Metaphysik: Von einem unabweislichen Bedürfnis der menschlichen Vernunft. Rémi Brague zu Ehren [1. Aufl.] 9783658315924, 9783658315931
Ein Leben lang leidet der Mensch an der nie zu überwindenden Endlichkeit seiner Vernunft, die ihn heftig mit Fragen bedr
323 36 58MB
German Pages XVI, 535 [526] Year 2020
Front Matter ....Pages I-XVI
Front Matter ....Pages 1-1
Die Unvermeidbarkeit der Metaphysik (Holm Tetens)....Pages 3-14
Von der kantischen ‚Kritik‘ zur ‚eigentlichen Metaphysik‘ – und darüber noch hinaus? (Rudolf Langthaler)....Pages 15-34
Front Matter ....Pages 35-35
Realismus als Herausforderung der Philosophie im Denken der Gegenwart (Inga Römer)....Pages 37-54
Front Matter ....Pages 55-55
Die Frage nach dem Ursprung als die Frage nach Gott (Martin Rhonheimer)....Pages 57-79
Szenische Metaphysik (Wolfram Hogrebe)....Pages 81-94
Die Verwindung der Metaphysik? (Harald Seubert)....Pages 95-112
Phänomenologie und Metaphysik (Angela Ales Bello)....Pages 113-124
Front Matter ....Pages 125-125
Metaphysik: Denken im Modus des Leidens (Helmut Holzhey)....Pages 127-140
An den Grenzen unseres Wissens: Zur Deutung der Beziehung zwischen Mensch und Gott aus dem Blickwinkel des Gebets (Norbert Hinske)....Pages 141-149
Metaphysik des Moralischen (Theo Kobusch)....Pages 151-171
Zur Metaphysik der Person (Berthold Wald)....Pages 173-195
Mensch und Gottmensch (Peter Ehlen)....Pages 197-209
Front Matter ....Pages 211-211
Das Gebet der Philosophen (Albrecht Dihle)....Pages 213-235
Plotins philosophische Mystik: Bestimmung einer Lebensform (Werner Beierwaltes)....Pages 237-249
Vom Verschwinden und Wiederauftauchen der antiken Auffassung der Philosophie (Pierre Hadot)....Pages 251-268
Front Matter ....Pages 269-269
‚Wiederkehr und Zukunft der Metaphysik‘: welcher Metaphysik? (Lorenz B. Puntel)....Pages 271-294
Die ‚reinen Vollkommenheiten‘ und die Postmoderne: eine philosophisch-theologische Betrachtung (Rocco Buttiglione)....Pages 295-305
Das Uneinholbare (Walter Schweidler)....Pages 307-325
Reditio incompleta in seipsum. Verwandlungen eines platonischen Axioms als Leitfaden einer künftigen Metaphysik (Richard Schenk)....Pages 327-339
Das Streben nach Erkenntnis und die ‚longue durée‘ metaphysischen Denkens (Andreas Speer)....Pages 341-353
Was ist Metaphysik in Vollendung? (Jens Halfwassen)....Pages 355-370
Front Matter ....Pages 371-371
Die Freiheit und das Gute (Wouter Goris)....Pages 373-390
Die Lehre von den Transzendentalien: ihre philosophiehistorische Krise und ihre bleibende Aktualität (Richard Schaeffler)....Pages 391-399
Sein als Gut (Rémi Brague)....Pages 401-419
Front Matter ....Pages 421-421
Das Ende in Vollendung als Anfang: Unabweisbar (Christoph Böhr)....Pages 423-453
Back Matter ....Pages 455-535
Recommend Papers
![Metaphysik: Von einem unabweislichen Bedürfnis der menschlichen Vernunft. Rémi Brague zu Ehren [1. Aufl.]
9783658315924, 9783658315931](https://ebin.pub/img/200x200/metaphysik-von-einem-unabweislichen-bedrfnis-der-menschlichen-vernunft-remi-brague-zu-ehren-1-aufl-9783658315924-9783658315931.jpg)
- Author / Uploaded
- Christoph Böhr
File loading please wait...
Citation preview
Das Bild vom Menschen und die Ordnung der Gesellschaft
Christoph Böhr Hrsg.
Metaphysik Von einem unabweislichen Bedürfnis der menschlichen Vernunft. Rémi Brague zu Ehren
Das Bild vom Menschen und die Ordnung der Gesellschaft Reihe herausgegeben von Christoph Böhr, Trier, Deutschland
Die Reihe Das Bild vom Menschen und die Ordnung der Gesellschaft will das Denken über den Zusammenhang von philosophischer Anthropologie und politischer Theorie neu beleben. Sie ist getragen von der Überzeugung, dass nur in der Zusammenschau beider Sichtweisen öffentliches Handeln sinnbestimmt zu begründen ist: Keine politische Theorie, der nicht eine philosophische Anthropologie beigesellt ist, wie umgekehrt gilt: Keine Anthropologie, die folgenlos bleibt für das Selbstverständnis von Politik. Zur Klärung dieses – heute weithin vergessenen – Zusammenhangs, wie er zwischen der Vergewisserung eines Menschenbildes und dem Entwurf einer Gesellschaftsordnung besteht, will die Schriftenreihe beitragen. Im Mittelpunkt stehen dabei soziale, ökonomische und politische Gestaltungsaufgaben. Öffentliches Handeln bestimmt sich über Ziele. Die jedoch lassen sich nur entwerfen, wenn das Leitbild sowohl für die Ordnung des Zusammenlebens als auch für die Beratschlagung der Gesellschaft in Sichtweite bleibt: im Maßstab eines Menschenbildes. Der Bestand einer Ordnung der Freiheit hängt davon ab, dass der zielbestimmte Sinn für den Zusammenhang, wie er zwischen der Anerkennung verbindlicher Regeln und der Bereitschaft zum selbstbestimmten Handeln besteht, immer wieder neu entdeckt und begründet wird. Die Reihe verfolgt mithin die Absicht, ein neues Selbstverständnis öffentlichen Handelns entwickeln zu helfen, das von der Frage nach den Zielen, auf die hin unsere Gesellschaft sich selbst versteht, ausgeht. Sie will die Reflexion der Theorie mit der Praxis der Deliberation verbinden, indem sie die Frage nach dem Handeln wieder im Zusammenhang mit dessen Zielbestimmung beantwortet.
Weitere Bände in der Reihe http://www.springer.com/series/12749
Christoph Böhr (Hrsg.)
Metaphysik Von einem unabweislichen Bedürfnis der menschlichen Vernunft. Rémi Brague zu Ehren
Hrsg. Christoph Böhr Trier, Deutschland
ISSN 2524-3632 (electronic) ISSN 2524-3624 Das Bild vom Menschen und die Ordnung der Gesellschaft ISBN 978-3-658-31592-4 ISBN 978-3-658-31593-1 (eBook) https://doi.org/10.1007/978-3-658-31593-1 Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen National bibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. © Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv lizenziert durch Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2020 Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Die Wiedergabe von allgemein beschreibenden Bezeichnungen, Marken, Unternehmensnamen etc. in diesem Werk bedeutet nicht, dass diese frei durch jedermann benutzt werden dürfen. Die Berechtigung zur Benutzung unterliegt, auch ohne gesonderten Hinweis hierzu, den Regeln des Markenrechts. Die Rechte des jeweiligen Zeicheninhabers sind zu beachten. Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben und Informa tionen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind. Weder der Verlag, noch die Autoren oder die Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen. Der Verlag bleibt im Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutionsadressen neutral. Springer VS ist ein Imprint der eingetragenen Gesellschaft Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH und ist ein Teil von Springer Nature. Die Anschrift der Gesellschaft ist: Abraham-Lincoln-Str. 46, 65189 Wiesbaden, Germany
Vorwort: Tatsächlich unabweislich? Eine Hinführung zur Fragestellung Christoph Böhr
Der Titel dieses Buches ist eine – nicht zu überlesende – Anspielung auf Immanuel Kants Redewendung von jenem Bedürfnis der praktischen Vernunft, das die Lehre von den Postulaten begründet, während jenes der reinen Vernunft lediglich zu Hypothesen führt. Da die in diesem Zusammenhang von Kant getroffenen Unterscheidungen nach Ansicht des Herausgebers von grundlegender und fortwirkender Bedeutung sind, soll die entsprechende Stelle, die sich in der Kritik der praktischen Vernunft findet, hier ausführlicher wiedergegeben werden: Es „ist ein Bedürfnis der reinen praktischen Vernunft, auf einer Pflicht gegründet, etwas (das höchste Gut) zum Gegenstande meines Willens zu machen, um es nach allen meinen Kräften zu befördern; wobei ich aber die Möglichkeit desselben, mithin auch die Bedingungen dazu, nämlich Gott, Freiheit und Unsterblichkeit voraussetzen muß, weil ich diese durch meine spekulative Vernunft nicht beweisen, obgleich auch nicht widerlegen kann. Diese Pflicht gründet sich auf einem, freilich von diesen letzteren Voraussetzungen ganz unabhängigen, für sich selbst apodiktisch gewissen, nämlich dem moralischen, Gesetze, und ist, so fern, keiner anderweitigen Unterstützung durch theoretische Meinung von der innern Beschaffenheit der Dinge, der geheimen Abzweckung der Weltordnung, oder eines ihr vorstehenden Regierers, bedürftig, um uns auf das vollkommenste zu unbedingt-gesetzmäßigen Handlungen zu verbinden. Aber der subjektive Effekt dieses Gesetzes, nämlich die ihm angemessene und durch dasselbe auch notwendige Gesinnung, das praktisch mögliche höchste Gut zu befördern, setzt doch wenigstens voraus, daß das letztere möglich sei, widrigenfalls es praktisch unmöglich wäre, dem Objekte eines Begriffes nachzustreben, welcher im Grunde leer und ohne Objekt wäre. Nun betreffen obige Postulate nur die physische oder metaphysische, mit einem Worte, in der Natur der Dinge liegenden Bedingungen der Möglichkeit des höchsten Gutshöchstes, aber nicht zum Behuf einer beliebigen spekulativen Absicht, sondern eines praktisch notwendigen Zwecks des reinen Vernunftwillens, der hier nicht wählt, sondern V
VI
Christoph Böhr
einem unnachlaßlichen Vernunftgebote gehorcht, welches seinen Grund, objektiv, in der Beschaffenheit der Dinge hat, so wie sie durch reine Vernunft allgemein beurteilt werden müssen, und gründet sich nicht etwa auf Neigung, die zum Behuf dessen, was wir aus bloß subjektiven Gründen wünschen, so fort die Mittel dazu als möglich, oder den Gegenstand wohl gar als wirklich, anzunehmen keineswegs berechtigt ist. Also ist dieses ein Bedürfnis in schlechterdings notwendiger Absicht, und rechtfertigt seine Voraussetzung nicht bloß als erlaubte Hypothese, sondern als Postulat in praktischer Absicht; und, zugestanden, daß das reine moralische Gesetz jedermann, als Gebot (nicht als Klugheitsregel,) unnachlaßlich verbinde, darf der Rechtschaffene wohl sagen: ich will, daß ein Gott, daß mein Dasein in dieser Welt, auch außer der Naturverknüpfung, noch ein Dasein in einer reinen Verstandeswelt, endlich auch daß meine Dauer endlos sei, ich beharre darauf und lasse mir diesen Glauben nicht nehmen; denn dieses ist das einzige, wo mein Interesse, weil ich von demselben nichts nachlassen darf, mein Urteil unvermeidlich beistimmt, ohne auf Vernünfteleien zu achten, so wenig ich auch darauf zu antworten oder ihnen scheinbarere entgegen zu stellen im Stande sein möchte.“1 Den Grundton dieser Darlegungen hatte Kant schon in der Vorrede zur ersten Auflage der Kritik der reinen Vernunft gleich im ersten Satz angeschlagen: Die menschliche Vernunft „hat das besondere Schicksal in einer Gattung ihrer Erkenntnisse: daß sie durch Fragen belästigt wird, die sie nicht abweisen kann, denn sie sind ihr durch die Natur der Vernunft selbst aufgegeben, die sie aber auch nicht beantworten kann, denn sie übersteigen alles Vermögen der menschlichen Vernunft.“2 Wichtig ist dabei, immer wieder festzuhalten, dass diese – von ihr nicht beantwortbaren – Fragen nicht aus einem vernunftfremden Zusammenhang erwachsen, sondern „durch die Natur der Vernunft selbst“ dem Menschen aufgegeben sind. Das heißt mit anderen Worten: Die Vernunft selbst ist es, die in eine Fragestellung hineinführt, die wiederum für sie selbst – als Vernunft – unbeantwortbar bleibt. Wie ist mit diesem – gleichermaßen unabweisbarem wie unbeantwortbarem – Bedürfnis der Vernunft umzugehen? Aus unterschiedlichen Blickwinkeln versuchen die Autoren dieses Bandes, sich dieser Frage zu nähern. Dabei wird eine Voraussetzung gemacht, die vielleicht nicht einfachhin als so selbstverständlich vorausgesetzt werden kann, wie es der Titel dieses Buches nahezulegen scheint: dass nämlich dieses genannte Bedürfnis der Vernunft tatsächlich unabweisbar ist, also durch die Zeiten hindurch gilt. 1 Immanuel Kant, Kritik der praktischen Vernunft, 1788, A 256 ff. Hervorhebungen im Original; in einer von Kant, ebd., A 257, gesetzten Fußnote weist dieser ausdrücklich darauf hin, dass es im dargestellten Sinn ein Bedürfnis nur gibt, wenn die Vernunft ihren Selbsterhalt bedenkt. 2 Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, 1781, A VII.
Vorwort: Tatsächlich unabweislich?
VII
Auf keine andere Frage ist der Herausgeber im Rahmen der Vorbereitungen zur Drucklegung dieses Buches so oft angesprochen worden wie auf diese – im Titel des Buches als selbstverständlich – vorausgesetzte Unterstellung: dass es nämlich, gestern wie heute, ein unabweisliches Bedürfnis des Menschen nach Metaphysik gibt. Ist dem tatsächlich so? Richten sich nicht vielmehr – vielleicht sogar immer mehr – Menschen im Leben ein, ohne dieses Bedürfnis als unabweislich wahrzunehmen? Meinerseits kann ich diese Frage nicht abschließend beantworten, vielleicht entzieht sie sich auch jedes Versuches einer schlussendlichen Beantwortung. Allerdings scheint mir, dass viele Menschen, die bei ersten Blick ganz offensichtlich kaum Anteil an diesem ‚unabweislichen‘ Bedürfnis haben, schon – bildlich gesprochen – bei einem leichten Wackeln des Flugzeuges Bedürfnisse entwickeln, die ihnen zuvor unbekannt schienen, will heißen: Wenn ihnen der Boden unter den Füßen zu entgleiten droht, suchen sie nach einem Halt, der in ihrer Erfahrungswelt – das Wort wird hier als Übersetzung des ‚mundus sensibilis‘ verstanden – nicht zu finden ist. Ein solches Argument lässt Kant allerdings nicht gelten. Deshalb betont er ja ausdrücklich: Es geht um ein Bedürfnis, das nicht vernunftfremd in bestimmten Lebenslagen, beispielsweise angesichts von Verunsicherung und Bedrohungsgefühlen, erwächst, sondern der Vernunft selbst entspringt – und das heißt nichts anderes: die gereinigte Vernunft, die allen Schein des Dogmatismus3 hinter sich gelassen hat und für die nach dieser Reinigung nicht mehr gilt, dass Not beten lehrt – diese gereinigte Vernunft findet aus sich heraus zu dem unabweislichen Bedürfnis nach Antwort auf Fragen, von denen sie selbst allzu gut weiß, dass diese ihr Leistungsvermögen übersteigen, die sie aber dennoch nicht aus der Welt zu schaffen vermag.4 Heute wird eine solche Feststellung, die der Vernunft unverbrüchlich auch dort die Treue hält, wo diese an ihre Grenzen stößt, gerne als weltfremde ‚Kopfgeburt‘ – als eine angeblich jeglicher Rationalität eigene Gefühlskälte, ja, als Herzlosigkeit – in Misskredit gebracht, weil sie doch – wiederum angeblich – Gefühlsbestimmungen des Handelns außer Acht lässt. Zweifellos ist der Mensch ein Sinneswesen – auch. Doch unabhängig von der Frage, ob klares Denken nicht eines klugen, beherrschten 3 Vgl. Kant, Kritik der praktischen Vernunft, A 238: Die „Postulate sind nicht theoretische Dogmata, sondern Voraussetzungen in notwendig praktischer Rücksicht, erweitern also zwar das spekulative Erkenntnis, geben aber den Ideen der spekulativen Vernunft im allgemeinen (vermittelst ihrer Beziehung aufs Praktische) objektive Realität, und berechtigen sie zu Begriffen, deren Möglichkeit auch nur zu behaupten sie sich sonst nicht anmaßen könnte.“ Hervorhebungen im Original. 4 Vgl. Burkhard Nonnenmacher, Vernunft und Glaube bei Kant, Tübingen 2018, S. 197: „Aufklärung bedeutet für Kant eben niemals nur vormals vermeintlich Gewisses für ungewiss zu erklären, sondern vielmehr selbständig denkend damit zu leben, dass wir uns unausweichlich fragen müssen, was gewusst werden kann, was nicht gewusst werden kann und was es heißt, dennoch systematisch zu denken.“ VII
VIII
Christoph Böhr
Umgangs mit Leidenschaften und Bestrebungen – jener passiones animae,5 die wir gemeinhin als Affekte bezeichnen, besser vielleicht noch als ‚Gefühle‘6 übersetzen – bedarf, lässt sich sagen: Dieser Einwand trifft Kants Gedankenführung in keiner Weise. Denn unabhängig von der Frage, ob Gefühle,7 Leidenschaften und Begierden – kantisch gesprochen: Neigungen – unser Leben und Denken8 möglicherweise mehr bestimmen als unsere Vernunft, bleibt diese doch – als ‚kritische‘, also geläuterte und sich ihrer Grenzen allzeit bewusste Vernunft9 – der immer alleinige, weil verlässlichere Ratgeber, weil nur sie einem Handeln nach Gründen die Schneise schlägt, und sie bleibt es zumal in allen Angelegenheiten, von denen wir empirisch keinerlei Kenntnis haben können, weil sie im ‚mundus sensibilis‘ gar nicht vorkommen, da sie dort keinen Platz haben. Vgl. dazu die verdienstvolle Aufsatzsammlung Passiones animae. Die ‚Leidenschaften der Seele‘ in der mittelalterlichen Theologie und Philosophie. Ein Handbuch, hg. v. Christian Schäfer u. Martin Thurner, Berlin 22013. 6 In diesem Sinne vgl. Alexander Brungs, Die ‚passiones animae‘. (S.th. I-II, qq. 22–48), in: Thomas von Aquin: Die ‚Summa theologiae‘. Werkinterpretationen, hg. v. Andreas Speer, Berlin 2005, S. 198–223, hier S. 198 f., Fußnote 1. 7 Man darf dabei nicht vergessen, dass für Kant das ‚moralische Gefühl‘ – die Verachtung alles dessen, was dem Sittengesetz widerstrebt – eine geradezu grundlegende Bedeutung hat; vgl. Dieter Henrich, Zu Kants Begriff der Philosophie. Eine Edition und eine Fragestellung, in: Kritik und Metaphysik. Studien. Heinz Heimsoeth zum achtzigsten Geburtstag, hg. v. Friedrich Kaulbach u. Joachim Ritter, Berlin 1966, S. 40–60, hier S. 53: Sittlichkeit reicht über alles hinaus, „was mit den Sinnen zu fassen und mit dem Verstand zu erklären“ ist. „Wenn wir uns ihrer vergewissern können, so nur durch eine unaufklärbare Teilhabe am Weltgrund selbst, – also durch eine intellektuelle Anschauung, die dem zugrunde liegt, was wir als ‚Gefühl‘ zu kennen glauben.“ 8 Vgl. Martin Thurner, Pathos und Mathesis. Mystische Theologie als Form ursprünglichen Philosophierens, in: Philosophie und Mystik – Theorie oder Lebensform?, hg. v. Johannes Schaber u. Martin Thurner, Freiburg u. München 2019, S. 232–251, hier S. 248: Einerseits „bedarf der Denken der emotionalen Erfahrung als seines Beweggrundes und darf diesen nicht vergessen oder verdrängen, andererseits muss dieser pathische Ursprung rational geformt werden, weil er in seiner Reinform für den Menschen nicht zu bewältigen ist. Wenn schon in der griechischen Wortprägung philosophia mit Philia und Sophia Affekt und Intellekt in eine Einheit gefügt sind, dann kommt damit unmittelbar zur Sprache, dass Philosophie ganz ursprünglich darin besteht.“ Hervorhebung im Original. 9 In diesem Sinne vgl. das Résumé bei Ferdinand Alquié, La conscience affective, 1979, dt. Das affektive Bewusstsein, hg. v. Jürgen Brankel, Wien 2004, S. 186: Was die Philosophie „uns wenigstens lehrt, ist, dass die Wissenschaft nicht Totalität ist und nicht als einzige das enthält, was der Mensch Wahrheit nennt. Die Metaphysik beweist es denjenigen, die den Weg der Metaphysik gehen. Das affektive Bewußtsein offenbart es jedem. Philosophie ist nicht affektives Bewußtsein. Aber sie bemüht sich, es nicht zum Schweigen zu verurteilen. Sie hört seine Stimme, weist seinem dunklen und evidenten, problematischen und unwiderlegbaren Wissen einen Platz zu.“ 5
Vorwort: Tatsächlich unabweislich?
IX
Vernünftig zu handeln heißt nicht mehr und nicht weniger, als nach – möglichst guten – Gründen zu handeln.10 Dieser praktischen Rationalität steht eine praktische Irrationalität gegenüber, die ein Handeln nach Gefühlen an die Stelle eines Handelns in der Befolgung guter Gründe setzt. Doch muss eine solche Handlungsbestimmung immer scheitern: Nur wer nach Gründen handelt, kann über die Beweggründe seines Handelns mit anderen nachvollziehbar sprechen. Intersubjektive Kommunikabilität und kritische Diskursivität sind nur möglich im Blick auf die Rationalität handlungsbestimmender Beweggründe. Zudem hat Nicholas Rescher ganz zu Recht darauf hingewiesen, dass die Frage ‚Weshalb rational sein?‘ unzweifelhaft und „klarerweise eine rationale Antwort“ verlangt.11 Und daran hat sich nichts geändert, mögen auch heute mehr Menschen als früher meinen, das Bedürfnis nach Antworten auf Fragen, die unserer Vernunft entspringen, aber nicht empirisch beantwortbar sind, abweisen zu können. Deshalb hat Kants Aussage eine ungeschmälerte Bedeutung auch in Zeiten des erklärten und gewollten Verzichts auf Metaphysik. Denn dieser Verzicht heutzutage wie ehedem ist eben nicht einem Fortschreiten der Vernunft oder gar der Einsicht in ihre Grenzen geschuldet, sondern der Vereinnahmung der Vernunft durch vernunftfremde Bestimmungen: ihrer Fremdbestimmung – ja Ersetzung – durch Vorurteile, Leidenschaften, Neigungen oder Meinungen. Aus dieser Haltung heraus – jenes Paradoxon zu umgehen, dass einerseits das Bedürfnis der Vernunft zwar von dieser nicht aus eigener Kraft beantwortet werden kann, seine Beantwortung aber andererseits mitnichten eine Außerkraftsetzung der Vernunft erlaubt – wird dann die Verführung nachvollziehbar, das Kind mit dem Bade auszuschütten und der Vernunft rundweg und grundsätzlich eine lebens- und handlungsleitende Kraft abzusprechen. Tatsächlich findet sich ja bei Philosophen beispielsweise der sogenannten Postmoderne, die Kants Postulate – Freiheit, Gott, Unsterblichkeit – als zwingendes Erfordernis vernünftigen Denkens nicht mehr hinzunehmen bereit sind, eine große Neigung, die menschliche Vernunft in Gänze zu verwerfen, weil diese – zumal bei Absehung der Lehre von den Postulaten – als zu schwach, zerbrechlich und trügerisch erscheint, um eine handlungsleitende und lebensgestaltende Aufgabe im Einzelfall wahrzunehmen.
10 Zu diesen Gründen zählen selbstverständlich nicht nur die des ‚Kopfes‘, sondern auch jene des ‚Herzens‘, über die Blaise Pascal, Über die Religion und über einige andere Gegenstände (Pensées), hg. v. Ewald Wasmuth, Heidelberg 1978, IV, Frgm. 277, S. 141, spricht. 11 Nicholas Rescher, Die Begründung von Rationalität: Warum der Vernunft folgen?, in: Ders., Rationalität, Wissenschaft und Praxis, Würzburg 2002, S. 9–23, hier S. 19. Hervorhebung im Original. IX
X
Christoph Böhr
Vermutlich kann man nichts in vergleichbarer Weise als die Signatur verschiedener Strömungen der Postmoderne bezeichnen wie eben diesen Abschied von der gleichermaßen starken wie schwachen ‚Vernunft‘ als jener Fähigkeit des Menschen, die sein Handeln an guten Gründen ausrichtet. Gianni Vattimos Entwurf eines ‚schwachen Denkens‘ ist einer der bemerkenswerten Versuche, die Vernunft angesichts ihrer Grenzen und Schwächen wenigstens als eine ‚schwache‘ zu retten. Helmut Holzhey hat diesen Versuch aufgenommen und fruchtbar gemacht, wenn er schreibt: Das ‚Geschick der Schwächung‘, wie Vattimo es zu beschreiben sucht, „koinzidiert mit der ‚antimetaphysischen Inspiration einer ‚postmetaphysischen Philosophie‘. … für die postmetaphysische Weltweisheit verliert das metaphysische Bedürfnis und mit ihm das Leiden der menschlichen Vernunft an der steten Zweifelhaftigkeit ihrer Erkenntnisse seine Bedeutung. Faktisch aber bleibt das Bedürfnis als Bekundung der condition humaine weiter virulent. Denn auch und gerade wenn transzendierende Vernunft vom metaphysischen Gott der Philosophen Abstand nimmt, ist die große Sinnfrage nicht verabschiedet.“12 Es bleibt also, wie es scheint, am Ende jenes Bedürfnis der menschlichen Vernunft, von dem hier die Rede ist, doch unabweislich – wenn auch im Wissen darum, dass es durch unsere Vernunft nicht erfüllt werden kann und, wie Holzhey zutreffend schreibt, zu einem Denken im Modus des Leidens – der Vernunft an sich selbst – führt. Abschließend ist ein mehrfacher Dank abzustatten: Zunächst ist der Hochschule Heiligenkreuz, allen voran ihrem Magnus Cancellarius, Abtpräses Dr. Maximilian Heim OCist, sowie ihrem Rektor, Professor P. Dr. Wolfgang Buchmüller OCist, zu danken für die überwältigende Gastfreundschaft, die sie allen Teilnehmern der Tagung, die den Anlass für diese Buchveröffentlichung gab, gewährt haben. Stattgefunden hat diese Tagung an der Hochschule Heiligenkreuz anlässlich seines 70. Geburtstages zu Ehren von Professor Dr. Rémi Brague, Paris, der selbst eine Honorarprofessur an dieser Hochschule begleitet und bereitwillig seine Mitwirkung beigesteuert hat. Zu danken ist schließlich dem Verlag Springer VS, Wiesbaden, namentlich dem für die Reihe, in der dieses Buch erscheint, zuständigen Cheflektor Frank Schindler sowie Herrn Daniel Hawig für die umsichtige Betreuung der Drucklegung dieses Buches. Ich danke Herrn Dr. René Kaufmann, Dresden, der mir bei der Bearbeitung der Manuskripte hilfreich zur Hand ging. Und nicht zuletzt danke ich allen, die diesem Buch einen Aufsatz beigesteuert haben. Ohne die Mühen und den Einsatz der Verfasser bliebe jedes – auch das vorliegende – Buch ungeschrieben. 12 Helmut Holzhey, Denken im Modus des Leidens, in: Ders., ‚Wir sehen jetzt durch einen Spiegel‘. Erfahrungen an den Grenzen philosophischen Denkens, Basel 2017, S. 143–156, hier S. 154. Hervorhebung im Original. Vgl. dazu auch den Beitrag von Helmut Holzhey, Metaphysik: Denken im Modus des Leidens, in diesem Band S. 127–141.
Vorwort: Tatsächlich unabweislich?
XI
Mir erscheint es sehr wichtig, dass gerade dieses Buch zu dieser Fragestellung unter Mitwirkung so zahlreicher sachkundiger Autoren, die einen gemeinsam geteilten Untersuchungsgegenstand aus ganz unterschiedlichen Sichtweisen beleuchten, geschrieben wurde. Denn das von Kant festgestellte Bedürfnis der Vernunft ist, wie mir scheint, tatsächlich unabweislich – damals wie heute und zukünftig. Im Blick auf den Versuch, jenes von Kant eindrucksvoll auf den Begriff gebrachte Paradoxon aufzulösen – dass nämlich einerseits das Bedürfnis der Vernunft zwar von dieser nicht aus eigener Kraft zufriedengestellt werden kann, andererseits aber diese Einsicht keineswegs das Fragen des Menschen zum Schweigen bringt – , wird die Verführung nachvollziehbar, das Kind mit dem Bade auszuschütten und der Vernunft rundweg und grundsätzlich eine tragfähige lebens- und handlungsleitende Kraft abzusprechen. Große Teile der Postmoderne sind von diesem Misstrauen, das auf den ersten Blick den Abschied von aller Vernunft durchaus zu rechtfertigen scheint, geprägt. Die Alternative zu ihrer Verabschiedung im Aufweis der Möglichkeit von Metaphysik auch angesichts einer stets nur endlichen Vernunft zeichnet dieses Buch, das damit die schon vor mehr als zwei Jahrzehnten erfolgte, nach wie vor dringliche Aufforderung von Rudolf Langthaler beherzigt, die leitenden Beweggründe metaphysischer Denkformen „in ihrer bleibenden philosophischen Relevanz zu vergegenwärtigen und so gegenüber generellen Metaphysikverdikten selbst noch einmal begründeterweise für Nachdenklichkeit … zu plädieren.“13 Der Rückzug in die Endlichkeit vermag das unabweisliche Bedürfnis der Vernunft, von dem Kant sprach, jedenfalls nicht zu stillen. Somit bleibt es bei der Frage, die Angela Ales Bello in diesem Band zeitlos zum Ausdruck bringt: „Warum stelle ich mir letzte und höchste Fragen, wenn ich mir doch meiner Endlichkeit bewusst bin?“14 Und vielleicht lautet die Antwort: Gerade weil ich mir meiner Endlichkeit bewusst bin, leide ich am Denken, das, wie ich sicher weiß, die Grenzen dieser Endlichkeit doch nie übersteigen kann, denke also zeitlebens im Modus des Leidens – mit der Folge, dass mich die letzten und höchsten Fragen umso mehr bedrängen. Insofern diese Bedrängnis den Charakter eines Widerfahrnisses hat, können wir uns ihm nicht entziehen, sondern müssen die Grenzen unseres Erkennens hin- und annehmen. Sie verursachen das Leiden am Denken – ein Leiden, das wie ein Stachel im Fleisch wirkt und uns ständig an die Sehnsucht nach Grenzüberwindung erinnert. Unter dieser Bedingung und in diesen – wie manch anderen – Grenzen vollzieht sich unser geistiges Leben. Transzendenz ereignet sich im 13 Rudolf Langthaler, Nachmetaphysisches Denken? Kritische Anfragen an Jürgen Habermas, Berlin 1997, S. 414. 14 Angela Ales Bello, Phänomenologie und Metaphysik. Überlegungen im Anschluss an Edmund Husserl und Edith Stein, in diesem Band, S. 113–127. XI
XII
Christoph Böhr
Milieu menschlicher Immanenz – und nie anders. Ich kenne kein schöneres Bild für diese conditio humana als jenes, dessen sich Kant in der Reflexion 1733 bedient: „Wenn wir die Natur als den Continent unserer Erkenntnisse ansehen, und unsere Vernunft in der Bestimmung der Grenzen derselben besteht, so können wir diese nicht anders erkennen, als sofern wir das, was die Grenzen ausmacht, den Ocean, der sie begrenzt, mit dazu nehmen, davon wir aber nur noch die Ufer erkennen, nämlich Gott und die andere Welt, die notwendig als Grenzen der Natur betrachtet werden, obzwar von ihnen unterschieden und für uns unbekannt.“15 Gewidmet ist dieses Buch Rémi Brague zum 70. Geburtstag: als Zeichen der Anerkennung und des Dankes für seine langjährigen maßgebenden Forschungen. Brague zählt zu den führenden Philosophen der Gegenwart. Sein Nachdenken über die künftige Gestalt von Metaphysik ist wegweisend – gerade angesichts unserer metaphysisch eher dürftigen Zeit. In vielen Büchern hat er sich dieser Denkaufgabe gewidmet. Die Fruchtbarkeit seines Denkens bezeugt nicht zuletzt dieser Band – als Dank für ein hoffentlich noch lange nicht abgeschlossenes Lebenswerk und als Zeichen der Verbundenheit mit einem klugen, vielseitigen und scharfsinnigen Philosophen unserer Tage. Trier, im Frühsommer 2020 Der Herausgeber
15 Immanuel Kant, Reflexion 1733, in: Reflexionen Kants zur kritischen Philosophie. Aus Kants handschriftlichen Aufzeichnungen, hg. v. Benno Erdmann, 1882 u. 1884, neu hg. v. Norbert Hinske, Stuttgart-Bad Cannstatt 1992, S. 508.
Inhalt
Vorwort des Herausgebers Tatsächlich unabweislich? Eine Hinführung zur Fragestellung . . . . . . . . . . . . . V Christoph Böhr 1
Von einem unabweislichen Bedürfnis der Vernunft
Die Unvermeidbarkeit der Metaphysik. Überlegungen zum kontroversen Charakter der Metaphysik . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Holm Tetens Von der kantischen ‚Kritik‘ zur ‚eigentlichen Metaphysik‘ – und darüber noch hinaus? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Rudolf Langthaler 2
Zum Problem des Realismus
Realismus als Herausforderung der Philosophie im Denken der Gegenwart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Inga Römer
XIII
XIV
3
Inhalt
Metaphysik: ihr Sitz im Leben
Die Frage nach dem Ursprung als die Frage nach Gott. Metaphysik im Schatten der Evolutionstheorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Martin Rhonheimer Szenische Metaphysik. Éric Weil und Rémi Brague . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Wolfram Hogrebe Die Verwindung der Metaphysik? Martin Heidegger und die Frage nach Sein und Nichts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Harald Seubert Phänomenologie und Metaphysik. Überlegungen im Anschluss an Edmund Husserl und Edith Stein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Angela Ales Bello 4
Praktische Metaphysik
Metaphysik: Denken im Modus des Leidens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Helmut Holzhey An den Grenzen unseres Wissens: Zur Deutung der Beziehung zwischen Mensch und Gott aus dem Blickwinkel des Gebets. Eine antike Quelle der christlichen und modernen Welt . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Norbert Hinske Metaphysik des Moralischen. Wollen im allgemeinsten Sinne . . . . . . . . . . . . . 151 Theo Kobusch Zur Metaphysik der Person . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Berthold Wald Mensch und Gottmensch. Simon L. Franks Philosophie des Wir . . . . . . . . . . 197 Peter Ehlen
Inhalt
5
XV
Metaphysik: geistige Übung als Lebensform
Das Gebet der Philosophen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Albrecht Dihle Plotins philosophische Mystik: Bestimmung einer Lebensform . . . . . . . . . . . . 237 Werner Beierwaltes Vom Verschwinden und Wiederauftauchen der antiken Auffassung der Philosophie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 Pierre Hadot 6
Grundzüge einer Metaphysik der Gegenwart
‚Wiederkehr und Zukunft der Metaphysik‘: welcher Metaphysik? . . . . . . . . . . 271 Lorenz B. Puntel Die ‚reinen Vollkommenheiten‘ und die Postmoderne: eine philosophisch-theologische Betrachtung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 Rocco Buttiglione Das Uneinholbare. Wege zu einer indirekten Metaphysik . . . . . . . . . . . . . . . . 307 Walter Schweidler Reditio incompleta in seipsum. Verwandlungen eines platonischen Axioms als Leitfaden einer künftigen Metaphysik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 Richard Schenk Das Streben nach Erkenntnis und die ‚longue durée‘ metaphysischen Denkens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 Andreas Speer Was ist Metaphysik in Vollendung? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 Jens Halfwassen
XV
XVI
7
Inhalt
Das Sein und das Gute
Die Freiheit und das Gute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 Wouter Goris Die Lehre von den Transzendentalien: ihre philosophiehistorische Krise und ihre bleibende Aktualität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 Richard Schaeffler Sein als Gut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401 Rémi Brague 8 Ontologische Erfahrung und metaphysisches Denken Das Ende in Vollendung als Anfang: Unabweisbar. Die ontologische Erfahrung als Quellgrund des metaphysischen Denkens . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 Christoph Böhr Erstveröffentlichungsnachweise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abkürzungsverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bibliographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Personenregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sachverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zu den Verfassern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
455 457 461 487 500 507
1 Von einem unabweislichen Bedürfnis der Vernunft
Die Unvermeidbarkeit der Metaphysik Überlegungen zum kontroversen Charakter der Metaphysik Holm Tetens
Metaphysik ist eine zentrale Disziplin der Philosophie. Aber es hat mit ihr eine eigentümliche Bewandtnis. Nicht wenige Philosophen träumen davon, die Metaphysik endlich loszuwerden. Die weit verbreitete Diagnose, wir lebten in einem nachmetaphysischen Zeitalter, ist in der Regel nicht als Kritik gemeint; im Gegenteil, manch einer glaubt, unserer kulturellen Epoche damit das beste philosophische Zeugnis ausstellen zu können. Es ist nicht besonders schwer nachzuvollziehen, warum Philosophen die Metaphysik immer wieder so negativ beurteilen. Denn an der Metaphysik und ihrer Geschichte fällt ein Merkmal besonders auf, und es ist nicht weit hergeholt, wird dieses Merkmal als problematisch beurteilt; jedenfalls ist das auf den ersten Blick nicht weit hergeholt. Die Metaphysik ist kontrovers pluralistisch, zum Teil sogar hochkontrovers. Sie ist es inhaltlich und auch auf jeder Metastufe. Es ist ja der Metaphysik eigentümlich, dass ihre Metatheorie selber ein gewichtiger Teil von ihr ist. Die Kontroversität beginnt schon damit, dass die Metaphysik eine ungeheure Vielfalt an Themen einschließt. Thematisch ist die Metaphysik, vorsichtig ausgedrückt, einigermaßen unübersichtlich. Was ist ein legitimer Gegenstand der Metaphysik, was nicht? Schon das ist strittig. Selbst wenn man sich über die Themenund Fragestellungen der Metaphysik einigen kann, so bricht jedoch spätestens bei der inhaltlichen Behandlung dieser Themen der Streit los. Obwohl Metaphysiker, wenn sie inhaltlich Metaphysik betreiben, argumentieren, kommt es selten vor, dass einer den anderen überzeugt. Jeder hält mehr oder weniger beharrlich an fundamentalen Grundsätzen seiner Metaphysik fest, trotz aller Einwände. Daher sieht es leicht so aus, als seien Metaphysiker durch die Bank weg dogmatisch und eigentümlich immun gegenüber Kritik. Der Verweis auf die kontroverse Pluralität der Metaphysik hat in der Geschichte der Philosophie immer wieder harsche, ja in nicht wenigen Fällen vernichtende Metaphysikkritik munitioniert. © Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv lizenziert durch Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2020 C. Böhr (Hrsg.), Metaphysik, Das Bild vom Menschen und die Ordnung der Gesellschaft, https://doi.org/10.1007/978-3-658-31593-1_1
3
4
Holm Tetens
Da man sich, technisch gesprochen, auf der inhaltlichen Objektstufe nicht einig ist, liegt es nahe, die inhaltliche Objektstufe zu verlassen und auf der Metastufe über Ziele und Methoden der Metaphysik nachzudenken. Aus der nicht aufzulösenden inhaltlichen Kontroverse auszusteigen, indem man auf die Metastufe aufsteigt, war jedoch praktisch nie ein Befreiungsschlag und nachhaltiger Durchbruch in der Metaphysik. Denn es misslang und misslingt mit schöner Regelmäßigkeit, die Metaphysik an Haupt und Gliedern so zu reformieren, dass die vorherrschende kontroverse Kakophonie schlussendlich doch einer Einstimmigkeit und inneren Stimmigkeit vernünftiger Einsichten und Erkenntnisse, gar einem stetigen Erkenntnisfortschritt gewichen wäre. Doch mit ebenso schöner Regelmäßigkeit misslingt es auch, die Metaphysik dann wenigstens erfolgreich zu überwinden und sie mit intellektuell bestem Gewissen ein für alle Mal ad acta zu legen. Deshalb drängt sich die übliche medizinische Metaphorik zur Beschreibung der Metaphysik geradezu auf: Die Metaphysik erscheint wie eine unheilbare intellektuelle Krankheit, bei der nicht nur alle Therapien nicht anschlagen wollen, sondern für die noch nicht einmal widerspruchsfreie und allgemein geteilte Diagnosen in Sicht sind. Wer mit Überlegungen zur Metaphysik so beginnt, wie hier begonnen wurde, der setzt sich dem Verdacht aus, er wolle den Versuch wagen, zum sovielten Male – nur der Herr hat sie gezählet – eine nun endlich wirksame Diagnose, Therapie und Reform der Metaphysik vorzuschlagen, und das, obwohl gerade schon darauf verwiesen wurde, dass die Dauerfolge von Diagnosen, Therapien und Reformen der Metaphysik am Ende nichts anderes gewesen ist als eine Dauerproduktion immer neuer Zankäpfel unter Metaphysikern. Wie kann jemand angesichts überragender Philosophen der Vergangenheit, die trotzdem der Metaphysik den Königsweg heraus aus Gezänk und Kontroverse nicht haben weisen können, noch auf die Idee kommen, gerade er hätte doch etwas wirklich Neues und Wirksames zur Diagnose, Therapie und Reform der Metaphysik beizusteuern? Die nachfolgenden Überlegungen haben nichts zur Therapie und Reform der Metaphysik beizusteuern und sollen auch nichts dazu beisteuern. Statt dessen soll nur erklärt werden, warum es im Wesentlichen in Ordnung ist, dass die Metaphysik so ist und sich in ihrer Geschichte so präsentiert, wie sie nun einmal ist und sie sich in ihrer wechselvollen Geschichte präsentiert hat. Natürlich werde ich dabei Behauptungen auf der Metastufe über die Metaphysik aufstellen, die kontrovers in der Metaphysik sind. Aber das muss niemanden stören, wie wir noch sehen werden. Es reicht, wenn man am Ende zugesteht, dass meine Metabehauptungen über die Metaphysik in dem Sinne funktionieren, als sie, sollten sie wahr sein, jedenfalls erklären können, warum die Metaphysik so ist, wie sie ist. Was den Leser daher erwartet, ist eine affirmative metaphilosophische Betrachtung der Metaphysik. Ich werde zwei metaphilosophische Annahmen vorschlagen.
Die Unvermeidbarkeit der Metaphysik
5
Mir scheinen das vernünftige Annahmen zu sein. Aus diesen Annahmen folgt aber gerade der durch und durch kontroverse Charakter der Metaphysik. Wenn die kontroverse Pluralität selber jedoch aus zwei vernünftigen Annahmen folgt, so überträgt sich die Vernünftigkeit der Annahmen ein Stück weit auf den Dauerstreit der Metaphysiker. Somit könnte man seinen Frieden mit der vermeintlich nur anstößigen Kontroversität der Metaphysik schließen.
1
Die thematische Leitfrage der Metaphysik
Wir beginnen mit einer einfachen Überlegung. Wir haben schon gesehen, dass die Metaphysik thematisch bis zur Unübersichtlichkeit vielgestaltig ist. Lässt sich das erklären? Nun, das lässt sich, so will mir scheinen, sehr einfach erklären. Man darf der Metaphysik nämlich durchaus eine Leitfrage unterstellen: Lässt sich und wie lässt sich die Wirklichkeit und die besondere Stellung des Menschen in ihr auf eine vernünftige Weise als ein selber vernünftig eingerichtetes Ganzes denken? Jede Antwort oder Teilantwort darauf zählt zur Metaphysik. Natürlich auch negative Antworten, die bestreiten, dass die Wirklichkeit ein vernünftiges Ganzes ist und deshalb auch als ein solches nicht vernünftig gedacht werden kann. Nicht wenige Metaphysiker beurteilen das, was wir die Wirklichkeit nennen, durchaus mehr oder weniger negativ. Der Metaphysik diese Leitfrage zu unterstellen, ist die erste der eben angekündigten metaphilosophischen Annahmen. Ich behaupte nicht, jeder Metaphysiker würde diese Frage als seine Leitfrage akzeptieren oder sein eigenes metaphysisches Denken als Antwortversuch auf diese Leitfrage wiedererkennen. Es reicht, wenn sich mit Hilfe dieser Leitfrage faktisch die unübersichtliche, ja fast verstörende Themenvielfalt der Metaphysik verständlich machen lässt. Das jedoch ist nicht schwer. Denn bei jedem überhaupt denkbaren Gegenstand lässt sich fragen: Müssen wir ihn zur Wirklichkeit hinzudenken, damit sie samt unserer Stellung in ihr sich als ein vernünftiges Ganzes denken lässt? Aber dürfen wir den betreffenden Gegenstand überhaupt in vernünftiger Weise zur Wirklichkeit hinzurechnen? Es ist zum Beispiel klar, dass wir fragen können, ob wir Gott als Schöpfer und Erlöser der Welt und der Menschen hinzudenken müssen, aber auch hinzudenken dürfen, damit die Trias aus Gott, Welt und Mensch als ein vernünftiges Ganzes gedacht werden kann. Gott ist, wenig überraschend, insofern ein legitimer Gegenstand der Metaphysik, und es sollte uns nicht wundern, dass der Gottesgedanke im Positiven wie im Negativen eine so wichtige Rolle in
6
Holm Tetens
der Geschichte der Metaphysik gespielt hat und, wenn man sich von der zeitgeistbedingten Hegemonie des Naturalismus nicht irre machen lässt, bis heute spielt. Aber nehmen wir einen metaphysisch erst einmal so wenig auffälligen Gegenstand wie Automobile. Selbst die könnte der Metaphysiker zum Gegenstand seines Nachdenkens machen, sicher nicht als Automobile, aber zum Beispiel als ein exemplarischer Fall für materielle Einzelobjekte oder auch als exemplarischer Fall materieller technischer Artefakte; denn es ist ja klar: die Frage nach der Vernünftigkeit der Welt ist frühestens dann beantwortet, wenn in der Beschreibung und Beurteilung der Wirklichkeit auch materielle Einzeldinge oder spezieller: technische Artefakte ihren legitimen Platz gefunden haben und sie in die metaphysische Analyse der Wirklichkeit miteinbezogen werden. Insofern kann man die Liste möglicher Gegenstände oder fundamentaler Arten von Gegenständen durchmustern, seien es Zahlen, Modalitäten, Raum und Zeit, Naturgesetze, abstrakte Gegenstände, Werte, Musik, Gemälde, der Tod, Krankheiten, Erdbeben, Einkommensunterschiede, Kriege – was auch immer man will – , immer kann und muss man letztlich fragen: Inwiefern sind die betreffenden Gegenstände Teil der Wirklichkeit, wie sind sie mit dem, was es sonst noch gibt, verknüpft und was tragen sie aufgrund ihrer Verknüpfung mit dem Rest zur Wirklichkeit bei? Und tragen sie etwas positiv zur Vernünftigkeit des Ganzen bei oder sind sie der Vernünftigkeit des Ganzen abträglich oder laufen ihr diametral zuwider? Die thematische Grenzenlosigkeit der Metaphysik ist so betrachtet kein Defizit, kein Manko. Sie liegt vielmehr in der Konsequenz der Leitfrage, die man der Metaphysik unterstellen kann und unterstellen sollte. Ich fasse meine Überlegungen in einem ersten Argument zusammen: 1. Metaphilosophische Annahme: Metaphysische Sätze sind Antworten und ihre Begründungen auf die Leitfrage ‚Lässt sich und wie lässt sich die Wirklichkeit und die besondere Stellung des Menschen in ihr auf eine vernünftige Weise als ein selber vernünftig eingerichtetes Ganzes denken?‘ 2. Prämisse: Diese Leitfrage der Metaphysik ist erst dann zureichend beantwortet, wenn für alle denkbaren Gegenstände oder zumindest alle fundamentalen Arten von Gegenständen geklärt ist, in welchem Sinne es sie tatsächlich gibt und, wenn es sie gibt, auf welche Weise sie zusammen mit anderen Gegenständen zur Einheit, gar zur vernünftigen Einheit der Wirklichkeit beitragen. 3. Konklusion: Also muss tendenziell jeder denkbare Gegenstand beziehungsweise zumindest jede fundamentale Art von denkbaren Gegenständen in der Metaphysik thematisiert werden; die Themenvielfalt der Metaphysik liegt in der inneren Logik ihrer Leitfrage und ist kein thematisch chaotischer Wildwuchs einer undisziplinierten Community von Metaphysikern.
Die Unvermeidbarkeit der Metaphysik
2
7
Wirklichkeitserschließung durch Metaphysik
Auf die Grundfrage der Metaphysik kann es niemals eine schnell und einfach begründete Antwort geben. Zuerst hat wohl jeder Metaphysiker eine intuitive Grundidee, welche grundlegenden Arten von Gegenständen es gibt und wie sie so miteinander zusammenhängen, dass sie Teil ein und derselben Wirklichkeit sind. So lautet etwa die Grundidee eines Naturalisten: Alles, was es gibt, superveniert über dem materiellen Geschehen, wie es von den Naturwissenschaften erfolgreich beschrieben und erklärt wird. Nach Franz von Kutschera hat ein theistischer Idealist die Grundidee: Die Wirklichkeit ist fundamental erkennbar und verständlich. Es gibt nur Gott und menschliche Subjekte sowie ihre geistigen Akte und deren Produkte. Die Entwicklung der Wirklichkeit geht im Ganzen in Richtung wertvollerer Zustände.1 Zwar glauben manche Metaphysiker für ihre metaphysische Grundidee einen Beweis aus unbezweifelbaren, notwendig wahren Prinzipien zu besitzen. Doch selbst solche Metaphysiker, die sich ihrer Sache ganz sicher sind, müssen trotzdem mit ihrer Grundidee überhaupt erst noch etwas Vernünftiges anfangen. Eine Grundidee ist ja nicht dazu da, ständig gebetsmühlenartig wiederholt zu werden. So erstarrte sie zur sterilen Formel. Eine metaphysische Grundidee behauptet etwas hoffentlich Interessantes und Wichtiges, ja Aufregendes über die grundlegenden Strukturen der Wirklichkeit. Eine metaphysische Grundidee muss ein wirklichkeitserschließendes Potenzial besitzen und muss sich darin bewähren. Diesen Prozess der Bewährung müssen wir genauer in den Blick nehmen. Jeder Metaphysiker weiß schon etwas von der Welt oder glaubt es zu wissen, wenn er beginnt nach dem Ganzen der Wirklichkeit zu fragen und ihn eine intuitive metaphysische Grundidee fasziniert und gefangen nimmt. Mit anderen Worten: Der Metaphysiker hat sehr viele andere Überzeugungen über die Welt und sich selbst, die er aus Gründen für wahr hält, die erst einmal mit seiner metaphysischen Grundidee nichts zu tun haben müssen oder zu tun zu haben scheinen. Es kann sich um alltägliche Wahrnehmungen, um mathematisch bewiesene Aussagen, um nach den Standards der empirischen Wissenschaften akzeptierte Aussagen, um analytisch wahre Aussagen, um für intuitiv wahr gehaltene Aussagen handeln, um nur die wichtigsten Fälle zu erwähnen. Nun unterstellen Aussagen generell zumindest implizit die Existenz bestimmter grundlegender Arten von Gegenständen und – oder – ihres Zusammenhangs. Und deshalb können die übrigen Überzeugungen entweder im Einklang mit der metaphysischen Grundidee stehen oder ihr wider1 Vgl. etwa Franz von Kutschera, Die Wege des Idealismus, Paderborn 2006, besonders S. 252-257.
8
Holm Tetens
sprechen. Nehmen wir an, die Aussagen W1,…,Wn beinhalten einen Teil des schon akzeptierten Weltwissens oder vermeintlichen Weltwissens eines Metaphysikers. Die Aussagen W1,…,Wn stehen im Einklang mit der metaphysischen Grundidee MG, wenn die Aussagen W1,…,Wn keine grundlegenden Arten von Gegenständen und Arten des Zusammenhangs zwischen ihnen implizit unterstellen, die MG oder unproblematischen Folgerungen aus MG widersprechen. Natürlich gilt das Prinzip vom ausgeschlossenen Widerspruch. Ein Metaphysiker wird sich daher darum bemühen, dass seine Metaphysik nicht seinen übrigen festen Überzeugungen widerspricht. Aber diese Widerspruchsfreiheit lässt sich auf zwei Weisen langfristig sichern. Zum einen kann ein Metaphysiker natürlich versuchen, eine metaphysische Grundidee aus dem, was er schon von der Wirklichkeit zu wissen glaubt, induktiv verallgemeinernd herzuleiten. Das entspricht etwa dem, was Peter F. Strawson als deskriptive Metaphysik bezeichnet.2 Aber genau genommen ist das problematisch. Der deskriptive Metaphysiker muss unterstellen, dass seine unübersehbar vielen Überzeugungen sich in ihren metaphysischen Unterstellungen nicht widersprechen. Das freilich ist nicht gesichert. Der Metaphysiker kann solchen Widersprüchen höchstens vorbauen, indem er sich auf bestimmte Klassen von Aussagen beschränkt, deren metaphysische Unterstellungen nachweislich miteinander kompatibel sind. Doch mit dieser Beschränkung hat ein Metaphysiker bereits begonnen, revisionäre Metaphysik im Sinne Strawsons zu betreiben, denn er muss dann behaupten, dass für die Frage, welche grundlegenden Arten von Gegenständen es gibt und wie sie miteinander zu einem Ganzen zusammenwirken, nur bestimmte Arten von Aussagen relevant sind, und diese Relevanzbehauptung ist bereits eine metaphysische Grundidee, die nicht mehr aus dem folgt, was der Metaphysiker sonst noch glaubt. Die Behauptung der Naturalisten, dass es nur die Erfahrungswelt gebe, wie sie erfolgreich durch die Naturwissenschaften beschrieben und erklärt werde, ist ein schönes Beispiel für eine solche revisionäre Metaphysik, die allerdings so tut, als halte sie sich nur an das, was wir vernünftiger Weise von der Welt und uns selbst glauben. Schon diese Überlegung spricht dafür, dass eine metaphysische Grundidee angemessen als eine apriorische Setzung gedeutet wird. In sie können zwar schon Vorwissen oder Vormeinungen von der Welt einfließen. Gleichwohl enthält eine metaphysische Grundidee immer eine Verallgemeinerung, die logisch und begrifflich über dieses Vorwissen oder die Vormeinungen deutlich hinausgeht. Die Grundidee einer Metaphysik als apriorische Setzung zu verstehen, dafür spricht noch etwas anderes. Wir haben ja bisher nur von den Überzeugungen ge2
Vgl. Peter F. Strawson, Analysis and Metaphysics. An Introduction to Philosophy, Oxford 1992.
Die Unvermeidbarkeit der Metaphysik
9
redet, die ein Metaphysiker aus Gründen, die von seiner metaphysischen Grundidee unabhängig sind, auch noch hat. Aber wir haben immer schon auch eine Vorstellung vom Zusammenhang der Sachverhalte. Und immer wieder verwerfen wir Aussagen als falsch, weil die Sachverhalte, die sie beschreiben, sich nicht in die Zusammenhänge einfügen lassen, von denen wir längst überzeugt sind oder die wir zumindest unterstellen. Genauso erschließen wir viele Aussagen als wahr, indem wir darauf verweisen, dass bestimmte Sachverhalte, die in der Welt der Fall sind, ohne einen weiteren Sachverhalt nicht den Zusammenhang bilden könnten, den Sachverhalte dieser Art nun einmal zusammen bilden. Wir können also festhalten, dass wir immer schon eine a priori gesetzte und unterstellte Idee vom Ganzen der Wirklichkeit brauchen, um gewisse Einzelheiten der Wirklichkeit zu erkennen. Und damit stellt sich heraus: Eine metaphysische Grundidee soll uns die grundlegenden Strukturen der Wirklichkeit erschließen. Es soll alles, was wir über die Wirklichkeit behaupten, verträglich sein mit den metaphysischen Behauptungen über die grundlegenden Arten von Gegenständen und ihren Zusammenhang mit dem Ganzen der Wirklichkeit. Freilich, auf dem Wege dorthin, wird es immer wieder logische Konflikte geben. Das bedeutet: Wir stoßen auf Aussagen, die wir bisher für wahr hielten, die aber grundlegende Arten von Gegenständen und deren Zusammenhang voraussetzen, die es nach der von uns schon akzeptierten metaphysischen Grundidee nicht gibt und geben darf. Wie lässt sich ein solcher Widerspruch aufheben? Man kann die metaphysische Grundidee unangetastet lassen und an ihrer Stelle eine der beteiligten anderen Aussagen revidieren. Seit Willard Van O. Quine3 wissen wir: Man kann an jeder Aussage festhalten, wenn man nur andere Aussagen im inferenziellen Netz unserer Überzeugungen revidiert. Diese Vorgehensweise ist jedenfalls logisch und erkenntnistheoretisch erst einmal unbedenklich und nicht per se schon unvernünftig. Man muss jedoch auch so vorgehen, wie Quine es vorschlägt, denn eine metaphysische Idee kann ihr Potenzial, uns richtige und wichtige Einzelheiten der Wirklichkeit zu erschließen und verständlich zu machen, nur zeigen, wenn man ihre Geltung voraussetzt. Dass dabei Konflikte auftreten, beweist ja nicht, dass die Grundidee falsch ist. Möglicherweise beweist der Konflikt, dass wir uns in Bezug auf gewisse Einzelheiten der Wirklichkeit bisher geirrt haben, und dieser Irrtum wird dann und nur dann aufgedeckt, wenn wir die metaphysische Grundidee gerade nicht aufgeben. Ob wir mit der metaphysischen Grundidee richtig liegen, kann sich nur längerfristig herausstellen. Wir müssen einer metaphysischen Grundidee über einen längeren Zeitraum eine Chance geben und an ihr auch im Konfliktfall festhalten. 3
Vgl. Willard Van O. Quine, Two dogmas of Empiricism, in: Willard Van O. Quine, From a logical Point of View. Nine Logico-Philosophical Essays, Cambridge, Mass. 21980.
10
Holm Tetens
Natürlich, irgendwann sollten die Konflikte abnehmen zwischen der metaphysischen Grundidee und dem, wovon wir sonst noch überzeugt sind. Wenn uns die Strategie, einen Widerspruch nicht der metaphysischen Grundidee, sondern anderen unserer Überzeugungen anzulasten, von einem Konflikt in den nächsten stürzt, dann wird unsere Bereitschaft wachsen, die metaphysische Grundidee doch zu opfern. Aber, wieviel Kredit man einer metaphysischen Grundidee trotz der Konflikte mit anderen unserer Überzeugungen einzuräumen bereit ist und wann einem Metaphysiker der Geduldsfaden reißt und er seine Metaphysik modifiziert oder zur Gänze aufgibt, dafür gibt es keine allgemeine und vernünftige Verfahrensregel. Das ist gerade ein wesentlicher Teil der erwähnten Einsicht Quines. Wenn wir unsere Überzeugungen unter Zugrundelegung einer metaphysischen Grundidee so bilden, dass wir beim Auftreten von Konflikten und Widersprüchen die Überzeugungen der metaphysischen Grundidee anpassen und nicht umgekehrt, dann machen wir mit Hilfe der metaphysischen Grundidee so etwas wie eine transzendentale Metaerfahrung. Wir erfahren, wie wir das Ganze der Wirklichkeit in der Perspektive einer metaphysischen Grundidee erfahren und denken können. Damit wird allmählich klar: Eine Metaphysik kann nicht definitiv widerlegt oder bewiesen werden. Eine Metaphysik kann sich für jemanden nur bewähren, indem er seine sonstigen Überzeugungen so bildet, dass er die dabei auftretenden logisch-begrifflichen Konflikte auflöst, ohne seine metaphysische Grundidee preiszugeben. Schließlich kann sich eine Metaphysik nicht kurzfristig bewähren, sondern nur über einen sehr langen Prozess. Ich fasse die Überlegungen in folgendem Argument zusammen: 1. Prämisse: Ohne eine metaphysische Grundidee vom Ganzen der Wirklichkeit, können wir viele wichtige Einzelheiten der Wirklichkeit gar nicht erkennen. 2. Prämisse: Eine Metaphysik macht jeweils eine mögliche Grundidee vom Ganzen der Wirklichkeit so explizit, dass sie sich beim Erkennen der Wirklichkeit bewähren kann. 3. Prämisse: Eine metaphysische Grundidee kann sich beim Erkennen der Wirklichkeit nur bewähren, wenn man für einen prinzipiell schwer zu begrenzenden Zeitraum auf alle sichtbar werdenden logischen Konflikte zwischen der Grundidee und anderen Überzeugungen mit einer Revision der letzteren antwortet und die metaphysische Grundidee unangetastet lässt. 4. Konklusion: Also argumentiert ein Metaphysiker nicht dogmatisch und immunisiert sich nicht gegen Kritik, wenn er trotz Gegeneinwänden bis auf weiteres an seiner metaphysischen Grundidee festhält.
Die Unvermeidbarkeit der Metaphysik
3
11
Selbstverantwortliche Erkenntnissubjekte
Wir kommen jetzt zu einem der heikelsten Probleme, die die Metaphysik aufwirft. Keine Antwort auf die metaphysische Leitfrage ist definitiv zu beweisen oder definitiv zu widerlegen. Zugleich können nicht alle metaphysischen Optionen wahr sein, denn die interessanten und wichtigen metaphysischen Auffassungen verhalten sich konträr zueinander. Ist es nicht überaus misslich, dass wir unter den verschiedenen Metaphysiken nicht die wahre identifizieren und erkennen? Ist es nicht sogar mehr als nur misslich, ist es nicht sogar bereits vernunftwidrig, dass es uns nicht möglich ist, die richtige Antwort auf die Frage nach der Vernünftigkeit der Welt im Ganzen zu kennen? Was soll daran vernünftig sein, dass wir uns gezwungen sehen, nach der Vernünftigkeit der Welt zu fragen, und dass wir trotzdem mit unseren Antwortversuchen jedes Mal nur Streit unter Metaphysikern provozieren? Aber überlegen wir etwas genauer. Wir verstehen uns, gerade wenn wir Metaphysik betreiben, als vernünftige Ich-Subjekte, ja, wir kommen gar nicht umhin, uns so zu begreifen. Als vernünftige Ich-Subjekte verstehen wir uns spontan niemals einfach als Erkenntnisautomaten, die die Welt richtig erkennen, weil die Welt den richtigen sensorischen Input liefert. Es passt die Vorstellung nicht zu unserem Selbstverständnis als vernünftige Erkenntnissubjekte, wir wären unbeschriebene Wachstafeln, in die die Welt kausal den richtigen Eindruck von sich selbst eindrückt, und schon würden wir die Welt erkennen, wie sie an und für sich ist. Als vernunftfähige Erkenntnissubjekte sind wir keine bloßen Objekte einseitiger kausaler Einwirkung der Welt auf uns, sondern eben frei und mitverantwortlich für das, was wir von der Welt und uns selbst erkennen. Das beginnt schon damit, dass wir es sind, die in der Metaphysik die Frage nach der Vernünftigkeit der Wirklichkeit stellen. Die Fragen, die wir an das, was ist, richten, stammen von uns. Wir sind für sie verantwortlich. Die Wirklichkeit verrät uns nicht, wie wir sie befragen sollen. Wenn wir die Wirklichkeit nicht ausdrücklich daraufhin befragen, ob sie sich als ein vernünftiges Ganzes denken lässt, werden wir niemals erkennen, wie es sich tatsächlich damit verhält. Aber unsere epistemische Freiheit und Verantwortung in metaphysischen Fragen reicht noch wesentlich tiefer. Wie wir schon im vorigen Abschnitt gesehen haben, können wir die Wirklichkeit als ein Ganzes erst erkennen und auf seine Vernünftigkeit hin beurteilen, wenn wir transzendentale Metaerfahrungen damit machen, wie gut und problemlos sich uns die Einzelheiten der Wirklichkeit mit Hilfe einer metaphysischen Grundidee vom Ganzen der Wirklichkeit erschließen. Diese metaphysische Grundidee müssen wir uns frei verantwortlich ausdenken und gewissermaßen für eine Erschließung der Wirklichkeit a priori investieren. Das erstreckt sich auch und gerade auf die Frage nach der Vernünftigkeit der Wirklichkeit.
12
Holm Tetens
Ständig stehen wir dabei tendenziell vor der folgenden Alternative: Entweder gehen wir von einem vernünftigen Ganzen der Wirklichkeit aus und schließen, dass dann X der Fall sein muss, weil ohne X die Wirklichkeit kein vernünftiges Ganzes wäre. Oder wir gehen von einen bestimmten Sachverhalt Y aus und schließen, dass wegen Y der Zusammenhang der Dinge insgesamt vernünftig beziehungsweise nicht vernünftig ist. Zum Beispiel geht ein Idealist wie Franz von Kutschera von dem metaphysischen Grundsatz aus, dass die Wirklichkeit vernünftig auf das Gute hin angelegt ist. Er schließt dann auf das Dasein Gottes, weil ohne Gott das, was es gibt, nicht vernünftig und gut sein könnte. Für den Naturalisten hingegen existiert Gott nicht, und daraus schließt der Naturalist, dass die Welt nur in Grenzen vernünftig und gut eingerichtet ist. Dieses Beispiel deutet auf etwas Bemerkenswertes hin: Wenn die Wirklichkeit im Ganzen vernünftig eingerichtet ist und wenn wir deshalb auch epistemisch vernunftbegabte selbstverantwortliche Ich-Subjekte sind, dann haben wir nur dann die Chance, dies auch in den Einzelheiten des Wirklichkeitsgeschehens zu erkennen, falls wir unsere Überzeugungen von der Wirklichkeit und uns selbst transzendental unter der metaphysischen Annahme bilden, dass die Wirklichkeit und unsere – epistemische – Stellung in ihr ein vernünftiges Ganzes sind. Hierin liegt mitnichten irgendeine fragwürdige epistemische Zirkularität. Aus unseren Überlegungen folgt selbstverständlich nicht, dass es nicht sein könnte, dass die Wirklichkeit im Ganzen nicht vernünftig eingerichtet ist. Auch negative Antworten auf die Leitfrage der Metaphysik lassen sich nicht definitiv widerlegen. Aber unsere Überlegungen zeigen, dass die metaphysische Annahme der Vernünftigkeit des Ganzen der Wirklichkeit einen besonderen Status hat. Man sollte der Unterstellung, dass die Welt doch vernünftig ist und wir das auf längere Sicht auch in den Einzelheiten erkennen und würdigen können, erst einmal Priorität einräumen. Das hängt unmittelbar damit zusammen, dass derjenige, der der Welt abspricht, vernünftig eingerichtet zu sein, immerhin in Anspruch nehmen muss, dass die Welt jedenfalls insoweit vernünftig eingerichtet ist, dass sich vernünftig erkennen lässt, dass sie im Ganzen nicht vernünftig genannt zu werden verdient. Man sollte also erst einmal unterstellen, dass die Welt vernünftig eingerichtet ist. Wenn man sich doch für das gegenteilige Urteil entscheidet, sollte man wirklich gute Gründe dafür ins Feld führen können. Wie wir gesehen haben, reichen kurzfristige und nur lokale Konflikte zwischen der transzendentalen Annahme, dass die Welt ein vernünftiges Ganzes ist, und unseren sonstigen Überzeugungen nicht aus, die transzendentale Annahme einer vernünftig eingerichteten Welt schon zu verwerfen. Insofern leben wir in einer bemerkenswerten metaphysischen Epoche. Für die meisten Philosophen kommt heutzutage nur die metaphysische Option des Naturalismus in Frage. Für den Naturalismus ist die Welt letztlich nicht vernünftig
Die Unvermeidbarkeit der Metaphysik
13
eingerichtet, denn die Wirklichkeit fällt nach naturalistischer Überzeugung mit der Erfahrungswelt zusammen, wie sie inhaltlich durch die Naturwissenschaften beschrieben und erklärt wird. Und es gilt dann die berühmte Feststellung des Physikers Steven Weinberg: „Je besser wir das Universum wissenschaftlich begreifen, desto sinnloser erscheint es uns.“4 Ich hatte schon die latente Halbherzigkeit der Metaphysiker erwähnt, die der Welt ihre Vernünftigkeit absprechen. Diese Halbherzigkeit ist auch dem Naturalismus zu eigen. Es kommt ja einem Wunder gleich, dass in der Welt zumindest so viel Vernunft waltet, dass wir erkennen können, dass die Welt im letzten nicht vernünftig ist. Mit dieser These muss jeder Naturalist leben. Aber er muss noch mit etwas anderem leben. Indem ein Naturalist sich seine Überzeugungen von der Welt transzendental bildet unter der metaphysischen Annahme, dass nur das zur Realität gehört, was die Wissenschaften mit empirischen Mitteln erfassen und erklären können, geht er das Risiko ein, die Einsicht in die Vernünftigkeit des Ganzen aus Welt und Mensch nicht in den Blick zu bekommen. Mit diesem Risiko, sich für die Vernünftigkeit der Welt epistemisch gewissermaßen blind zu machen, muss der Naturalist leben. Es liegt in seiner Verantwortung und Entscheidung als vernünftiges, sprich als auch in epistemischen Dingen letztlich freies Subjekt. Ich habe allerdings entschieden den Eindruck, dass die Naturalisten unserer Tage sich jedenfalls nicht darauf berufen können, wir könnten auf eine lange negative Metaerfahrung mit anderen vernunftoptimistischeren metaphysischen Optionen zurückblicken. Ist es wirklich so, dass zum Beispiel über einen langen Zeitraum die verschiedenen idealistischen Varianten einer Wirklichkeitserschließung permanent von einem Konflikt in den nächsten mit unseren sonstigen Überzeugungen gestürzt worden sind, so dass alle Spielarten idealistischer Metaphysik ihren Kredit und ihre Plausibilität längst und zu Recht verspielt haben? Ich habe meine größten Zweifel, dass das eine zutreffende Lesart der Metaphysikgeschichte und des Schicksals des Idealismus ist.5 Ich fasse meine Überlegungen in einem letzten Argument zusammen: 4 Zur Frage, inwiefern die Welt in naturalistischer Perspektive nicht als ein vernünftig eingerichtetes Ganzes erscheint, vgl. Holm Tetens, Gott als Antwort auf Fragen, die wir nicht loswerden. Zur programmatischen Idee einer rationalen Theologie, in: Gott denken. Zur Philosophie von Religion, hg. v. Christoph Böhr u. Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz, Wiesbaden 2018, S. 275-294, hier bes. S. 279. 5 Vittorio Hösle, Wahrheit und Geschichte. Studien zur Struktur der Philosophiegeschichte unter paradigmatischer Analyse der Entwicklung von Parmenides bis Platon, Stuttgart 1984, argumentiert mit guten Gründen dafür, dass in der Geschichte der Philosophie der Idealismus immer wieder zu Recht als Opponent zu Skeptizismus und Materialismus wiederaufersteht und Überzeugungskraft gewinnt.
14
Holm Tetens
1. Metaphilosophische Annahme: Wir sind um Vernunft bemühte und zur Vernunft fähige Wesen und als solche tragen wir eine freie Mitverantwortung auch in epistemischen Belangen. 2. Prämisse: Eine solche freie Mitverantwortung tragen wir nur dann, wenn es auch von unseren freien Entscheidungen für die Vernunft mit abhängt, was wir von der Wirklichkeit erkennen oder verfehlen. 3. Prämisse: Für die metaphysische Erkenntnis ist unser Spielraum aufgrund der Leitfrage der Metaphysik ein zweifacher: a. Je nach der zur Welterschließung gewählten metaphysischen Grundidee werden wir die Wirklichkeit anders erfahren. b. Wir können – und müssen – entscheiden, wieviel Kredit wir einer metaphysischen Grundidee einräumen trotz der logisch-begrifflichen Konflikte, die bei der Wirklichkeitserschließung unter Anleitung der betreffenden Grundidee auftreten, und ob wir daher weiter an ihr festhalten. 4. Konklusion: Also spricht es überhaupt nicht gegen die Vernünftigkeit unserer Stellung in der Welt, dass alle Antworten auf die metaphysische Leitfrage prinzipiell kontrovers bleiben. Ich komme zum Schluss. Die voranstehenden Überlegungen empfehlen eine Sicht auf die Metaphysik, in der die kontroverse Pluralität der Metaphysik kein Defizit, kein Manko ist, sondern etwas, das wir eigentlich erwarten sollten und auch gutheißen können, weil es die nahe liegende Konsequenz aus zwei vernünftigen Annahmen ist. Die erste Annahme besagt: Wir sind um Vernunft bemühte und zum vernünftigen Nachdenken befähigte Wesen und als solche sehen wir uns geradezu gezwungen zu fragen, ob und wie sich die Wirklichkeit und unsere Stellung in ihr als ein vernünftiges Ganzes denken lässt. Diese Frage kann man als die explizite oder implizit-geheime Leitfrage der Metaphysik auffassen. Die zweite Annahme besagt: Als um Vernunft bemühte und zur Vernunft befähigte Subjekte tragen wir eine freie Mitverantwortung für die Erkenntnis der Welt. Ich sehe keine ernsthaften Möglichkeiten, diese Annahmen ohne Selbstwiderspruch zu bestreiten. Akzeptieren wir beide Annahmen, sollten wir eigentlich bereit sein, unseren Frieden zu schließen mit der kontroversen Pluralität der Metaphysik und doch zugleich engagiert Metaphysik zu betreiben.
Von der kantischen ‚Kritik‘ zur ‚eigentlichen Metaphysik‘ – und darüber noch hinaus? Rudolf Langthaler Von der kantischen ‚Kritik‘ zur ‚eigentlichen Metaphysik‘
Walter Raberger zum 80. Geburtstag
Das mir zugewiesene Thema sei ein wenig präzisiert: Von der ‚Kritik‘ zur ‚eigentlichen Metaphysik‘ soll es heißen – zugleich soll der Titel noch im Sinne einer Anfrage erweitert werden: Von der ‚Kritik‘ zur vom späten Kant sogenannten „eigentlichen Metaphysik“1 – und darüber noch hinaus?2 Vom kritizistischen Programm, „um zum Glauben Platz zu bekommen“, bleibt demnach 1. – im Sinne der zu wahrenden Einheit von ‚Kritik und Metaphysik‘ – das Vorhaben der ‚eigentlichen‘ Metaphysik, ‚Glauben zu denken‘, noch zu unterscheiden, während – so meine zu begründen-
1 Immanuel Kant, Über die von der Königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin für das Jahr 1791 ausgesetzte Preisfrage: Welches sind die wirklichen Fortschritte, die die Metaphysik seit Leibnizens und Wolffs Zeiten in Deutschland gemacht hat?, A 55 – im Folgenden abgekürzt als Preisschrift – ; hier und im Folgenden werden Kants Druckschriften zitiert nach der von Wilhelm Weischedel herausgegebenen Ausgabe Werke in sechs Bänden, Darmstadt 1956–1964 u. ö., und zwar nach der dort fast immer vermerkten Paginierung der Originalausgaben: A bezeichnet die erste, B die zweite Auflage; werden Kant’s Gesammelte Schriften, hg. v. d. Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften, der Akademie der Wissenschaften zu Berlin und der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, Berlin 1900 ff. – im Folgenden Akademie Ausgabe genannt, abgekürzt als AA – zitiert, so bezeichnet die römische Ziffer die Bandnummer und die arabische Ziffer die Seitenzahl. 2 Für eine ausführliche Darstellung dieser Zusammenhänge sei es erlaubt, auf die beiden Bücher des Verfassers hinzuweisen: Rudolf Langthaler, Kant über den Glauben und die ‚Selbsterhaltung der Vernunft‘. Sein Weg von der ‚Kritik‘ zur ‚eigentlichen Metaphysik‘ – und darüber hinaus, Freiburg im Br. u. München 2018, sowie Ders., Geschichte, Ethik und Religion im Anschluss an Kant. Religionsphilosophische Perspektiven zwischen ‚skeptischer Hoffnungslosigkeit und dogmatischem Trotz‘, Berlin 2014. © Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv lizenziert durch Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2020 C. Böhr (Hrsg.), Metaphysik, Das Bild vom Menschen und die Ordnung der Gesellschaft, https://doi.org/10.1007/978-3-658-31593-1_2
15
16
Rudolf Langthaler
de Vermutung – die auf dem „Kritizismus der praktischen Vernunft gegründete wahre Religionslehre“3 darüber hinaus – grenzbedacht – und 2. auch notwendige Bezüge zu späten Gestalten eines von Kant sogenannten ‚reflektierenden Glaubens‘ eröffnet, die über den reinen ‚Vernunftglauben‘ – und dessen von Kant ausdrücklich benannten ‚theoretischen Mangel‘ – in gewisser Weise noch hinausweisen. Ausgegangen wird von Kants später Preisschrift aus dem Jahr 1791 über die wirklichen Fortschritte in der neueren Metaphysik. In dieser Preisschrift hat Kant „drei Stadien in der neueren Metaphysik“ unterschieden: „Dogmatism“ – „Skeptizism“ – „Kritizism der reinen Vernunft“.4 „Man kann die Fortschritte der Metaphysik in diesem Zeitraum – sc. seit der Leibniz-Wolffschen Epoche, RL – in drei Stadien einteilen: erstlich in das des theoretisch-dogmatischen Fortganges, zweitens in das des skeptischen Stillstandes, drittens in das der praktisch-dogmatischen Vollendung ihres Weges, und der Gelangung der Metaphysik zu ihrem Endzwecke.“5 Dem Stadium der rationalistischen ‚dogmatischen Metaphysik‘ und demjenigen des empiristisch orientierten ‚Skeptizism‘ folgt zuletzt das für Kants eigenes philosophisches Programm beanspruchte ‚dritte Stadium der neueren Metaphysik‘, das, jene beiden Stadien überwindend, näherhin ‚Kritik‘ und ‚eigentliche Metaphysik‘ umgreift. Letztere vollendet somit erst den über den ‚Dogmatismus‘ und ‚Skeptizismus‘ hinaus nötigen „dritten Schritt“, „der nur der gereiften und männlichen Urteilskraft zukommt“ und „nicht bloß Schranken, sondern die bestimmten Grenzen“ der Vernunft bestimmt,6 dergestalt jedoch die ‚kritische Transzendenz‘ auch erst begründet. In diesem dritten Stadium soll auch die in den beiden vorausliegenden Stadien zutage tretende zweifache Vermessenheit: der „Vernunft zu viel und zu wenig zuzutrauen“ überwunden und – gemäß den „unabweislichen Fragen“ der Vernunft7 – der ‚Endzweck der Metaphysik‘, ‚von der Erkenntnis des Sinnlichen zu der des Übersinnlichen durch die Vernunft fortzuschreiten‘, realisiert werden. 3 Immanuel Kant, Der Streit der Fakultäten, 1798, A 94. 4 Kant, Preisschrift, A 21. 5 Ebd., A 66. 6 Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, 1781, B 789. Hervorhebungen im Original. 7 Sie hat auch Jürgen Habermas, Metaphysik nach Kant, in: Ders., Nachmetaphysisches Denken. Philosophische Aufsätze, Frankfurt am M. 1988, S. 18-34, hier S. 22 f., anerkannt: „Dabei geht es um jene von Kant kanonisierten ‚unabweisbaren‘ Fragen, die gewissermaßen spontan entstehen und auf orientierende Antworten angelegt sind. Die Philosophie soll ein ‚bewusstes‘, durch reflexive Selbstverständigung erhelltes, in einem nicht-disziplinarischen Sinne ‚beherrschtes‘ Leben ermöglichen. Und in dieser Hinsicht stellt sich dem philosophischen Denken nach wie vor die Aufgabe, sich die Antworten der Tradition, nämlich das in den Hochkulturen entwickelte Heilswissen der Religionen und das Weltwissen der Kosmologien, im schmaler und schärfer gewordenen Licht-
Von der kantischen ‚Kritik‘ zur ‚eigentlichen Metaphysik‘
17
1 Kants Kampf gegen ‚Vermessenheit‘ als Zentralthema der Kritik und die ‚eigentliche Metaphysik‘ Wenn dies also im „künftigen System der Metaphysik“8 nach Kant zunächst einmal die Aufgabe der ‚Kritik‘ – die als „Metaphysik von der Metaphysik“ „eine gänzliche Veränderung der Denkungsart in diesem uns so innigst angelegenen Teile menschlicher Erkenntnisse“ hervorbringt9– voraussetzt, so impliziert dies vorrangig die Zurückweisung unterschiedlicher – ja sogar gegensätzlicher – ‚Erscheinungsformen‘ von ‚Vermessenheit‘ und ‚Schwärmerei‘, die sowohl in Gestalt eines religiösen wie auch eines atheistischen ‚Fundamentalismus‘ auftreten: „Das deutsche Wort vermessen ist ein gutes bedeutungsvolles Wort. Ein Urteil, bei welchem man das Längenmaß seiner Kräfte (des Verstandes) zu überschlagen vergisst, kann bisweilen sehr demütig klingen, und macht doch große Ansprüche, und ist doch sehr vermessen.“10 Kants kritisches – die „Täuschungen“ und „Erschleichungen“ der „natürlichen Vernunft“ überwindendes – Programm11 wendet sich in der Tat vorrangig gegen „Vermessenheiten“ aller Art, die sich in dem „unbegrenzten Vertrauen der Vernunft auf sich selbst zum grenzenlosen Misstrauen, und wiederum von diesem zu jenem ab[zu]springen“,12 manifestieren; allein dies bewahrt vor einer zweifachen Vermessenheit – sowohl im Gebiet der theoretischen als auch der praktischen Vernunft. Deren Überwindung sah Kant als eine unumgängliche, auf dem Weg ihrer ‚Selbsterkenntnis und -kritik‘ einzulösende Voraussetzung für kegel dessen anzueignen, was davon den Töchtern und Söhnen der Moderne mit guten Gründen noch einleuchten kann. Hinter dem Wortstreit, ob nach Kant ‚Metaphysik‘ noch möglich sei, verbirgt sich der Sache nach ein Streit über Bestand und Umfang jener alten Wahrheiten, die einer kritischen Aneignung fähig sind, aber auch um die Art und Weise der Transformation des Sinnes, der alte Wahrheiten im Falle einer kritischen Aneignung unterliegen müssen.“ 8 Kant, Kritik der reinen Vernunft, B XXXVI. 9 Immanuel Kant, Brief an Marcus Herz, in: AA X 269. 10 Immanuel Kant, Kritik der Urteilskraft, 1790, A 305. 11 Vgl. Immanuel Kant, Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können, 1783, im Folgenden abgekürzt als Prolegomena, A 190: „Die Kritik verhält sich zur gewöhnlichen Schulmetaphysik gerade wie Chemie zur Alchimie, oder wie Astronomie zur wahrsagenden Astrologie. Ich bin dafür gut, dass niemand, der die Grundsätze der Kritik auch nur in diesen Prolegomenen durchgedacht und gefasst hat, jemals wieder zu jener alten und sophistischen Scheinwissenschaft zurückkehren werde; vielmehr wird er mit einem gewissen Ergötzen auf eine Metaphysik hinaussehen, die nunmehr allerdings in seiner Gewalt ist, auch keiner vorbereitenden Entdeckungen mehr bedarf, und die zuerst der Vernunft dauernde Befriedigung verschaffen kann.“ 12 Kant, Preisschrift, A 21.
18
Rudolf Langthaler
eine künftige ‚kritische Metaphysik‘ an. „Eben deswegen ist Metaphysik auch die Vollendung aller Kultur der menschlichen Vernunft, die unentbehrlich ist“13 und vor welcher kein falscher ‚vernünftelnder‘ Schein bestehen kann. Dieses von Kant gelegentlich auch mit dem Bild der ‚Landvermessung‘ veranschaulichte Programm der Vernunftkritik, die sich auf das gesamte Feld der menschlichen Vernunft bezieht und auf deren umfassende „Gesetzgebung“14 abzielt, muss deshalb auf all ihren Gebieten einer vernunftwidrigen ‚Vermessenheit‘ und Borniertheit – also auch allen Gestalten eines ‚Dogmatismus‘ und bloßer Einäugigkeit – entschieden entgegen treten und auch Verwüstungen von der Art vermeiden, „welche eine gesetzlose spekulative Vernunft sonst ganz unfehlbar, in Moral sowohl als Religion, anrichten würde“15. Dies und die mit der – von Kant so genannten – ‚Geographie der menschlichen Vernunft‘ eng verknüpfte Frage, was es heißt, ‚sich im Denken zu orientieren‘, erfordert nicht zuletzt die genaue Abgrenzung von immer weiter verschiebbaren, das heißt stets relativierbaren Einschränkungen menschlicher Wissensansprüche und damit eine prinzipielle Grenzziehung epistemischer Ansprüche. Die Begrenzung der Wissensansprüche und die ‚Selbsterkenntnis der menschlichen Vernunft, ohne welches wir kein Augenmaß der Größe unserer Erkenntnis haben‘, geschieht, in einem ersten Schritt, nicht zuletzt in der Absicht, „um zum Glauben Platz zu bekommen“,16 die so eine unverzichtbare Schutzwehr der Religion darstellt. Dieses ‚Zum-Glauben-Platz-bekommen‘ setzt indes den kritischen Aufweis der widerspruchsfreien Denkbarkeit von Gott, Freiheit und Unsterblichkeit – dass sie keine innere Unmöglichkeit, keinen Widerspruch, enthalten17 – schon voraus. Die für den ordnungsgemäßen ‚praktisch-dogmatischen Überschritt zum Übersinnlichen‘ erforderlichen Grenzbestimmungen bleiben auf die grenzbegrifflich ausgewiesenen Resultate der Kritik rückverwiesen und setzen also die bekannte Einsicht voraus: „Vom Übersinnlichen ist, was das spekulative Vermögen der Ver-
13 Kant, Kritik der reinen Vernunft, B 878 f.; Hervorhebung im Original. 14 Ebd., B 868. 15 Ebd., B 877. 16 Ebd., B XXX; Hervorhebung im Original; hier und im Folgenden ist aus meiner Sicht in diesem Zitat das Wort ‚um‘ besonders zu betonen. 17 Immanuel Kant, Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, 1793, B 230 Anmerkung – im Folgenden abgekürzt als Religionsschrift – nannte dies auch das „Minimum der Erkenntnis (es ist möglich, daß ein Gott sei)“. Vgl. auch Immanuel Kant, Reflexion 6213, in: AA XVIII 499: „Was ist das Minimum der Theologie? Dass es wenigstens möglich sei, dass ein Gott ist, und dass keiner so viel wissen könne, um uns zu widerlegen, wenn wir ihn glauben“. Hervorhebungen im Original.
Von der kantischen ‚Kritik‘ zur ‚eigentlichen Metaphysik‘
19
nunft betrifft, kein Erkenntnis möglich (noumenorum non datur scientia).“18 Der sonach über den Aufweis der „Wirklichkeit der Freiheit“ – als dem Übersinnlichen „in uns“19 – in Aussicht genommene „praktisch-dogmatische Überschritt zum Übersinnlichen“20 setzt also zunächst diese kritisch reflektierte Grenzgängerschaft voraus. Es geht in dieser Selbstbegrenzung der Vernunft – im Aufweis der „Grenzen der reinen Vernunft“21 – um nichts anderes als um die allein dadurch ermöglichte ‚Selbsterhaltung der Vernunft‘, die in ihrem Orientierungs- und Selbstverständigungs-Bedürfnis eine andere Weise des ‚Überschritts zum Übersinnlichen‘ auf festem Boden verlangt und dafür einen verlässlichen „Wegweiser oder Kompass“22 in dem ‚mit dicker Nacht erfüllten Raume des Übersinnlichen‘ sucht. Darin manifestiert sich auch der Fortschritt in der neueren Metaphysik und die derart vollzogene kritische Erweiterung der Vernunfterkenntnis, die jedoch nicht als Entgrenzung missverstanden werden darf. In der Entfaltung jenes ‚dritten Stadiums‘ der Metaphysik hat Kant das schon in der Vorrede zur zweiten Auflage der Ersten Kritik angezeigte zweiteilige Programm ‚Kritik und Metaphysik‘ noch einmal näher bestätigt und expliziert, das den zunächst lediglich erkennbaren ‚negativen Nutzen‘ mit seinem Hinweis auf den durchaus auch ‚positiven Nutzen‘ der ‚Kritik‘ zu verbinden vermag. Schon hier wird dieser Doppelaspekt mit Verweis auf die notwendige Einheit einer ‚theoretischen Einschränkung‘ und der ‚praktischen Erweiterung der reinen Vernunft‘ benannt und in der Preisschrift sodann mit seiner Begründung beziehungsweise Entfaltung der „eigentlichen Metaphysik“23 eingelöst. Wenn die Metaphysik als ein ‚vollendetes Ganzes‘ – und nur so auch gemäß der früheren Leitidee eines ‚Systems der reinen Vernunft‘ – zu begreifen ist, so bleibt dabei aber der Sachverhalt zu beachten, dass ihr einerseits das kritische Geschäft der Transzendentalphilosophie vorgelagert ist: „Transzendentalphilosophie hat zu ihrem Zweck die Gründung einer Metaphysik, deren Zweck wiederum, als Endzweck der reinen Vernunft, dieser ihre Erweiterung von der Grenze des Sinnlichen zum Felde des Übersinnlichen beabsichtiget; welches
18 Kant, Preisschrift, A 55. 19 Ebd., A 106. Hervorhebung im Original. 20 Ebd., A 147; Vgl. ebd., A 148: „Allererst nachdem die moralischen Gesetze das Übersinnliche im Menschen, die Freiheit, deren Möglichkeit keine Vernunft erklären, ihre Realität aber in jenen praktisch-dogmatischen Lehren beweisen kann, entschleiert haben: so hat die Vernunft gerechten Anspruch auf Erkenntnis des Übersinnlichen, aber nur mit Einschränkung auf den Gebrauch in der letztern Rücksicht gemacht“. 21 Kant, Prolegomena, A 170. 22 Immanuel Kant, Was heisst: sich im Denken orientieren?, 1786, A 320. 23 Kant, Preisschrift, A 55.
20
Rudolf Langthaler
ein Überschritt ist, der, damit er nicht ein gefährlicher Sprung sei, indessen dass er doch auch nicht ein kontinuierlicher Fortgang in derselben Ordnung der Prinzipien ist, eine den Fortschritt hemmende Bedenklichkeit an der Grenze beider Gebiete notwendig macht“24. Es ist ein sehr bedenkenswerter Hinweis, den Kant in dieser späten Preisschrift auf die in diesem ‚Überschritt‘ beabsichtigte Erweiterung – offenbar in Anspielung auf eine berühmte Wendung Friedrich Heinrich Jacobis – macht. ‚Eigentliche Metaphysik‘ findet erst in dem – im „Faktum der reinen praktischen Vernunft“25 verankerten – ‚praktisch-dogmatischen Überschritt zum Übersinnlichen‘, der ‚praktisch-dogmatischen Metaphysik‘, ihren Abschluss und vermag erst so jenen Endzweck der ‚ganzen Metaphysik‘ als Wissenschaft einzulösen.26 Die sich ‚der Zeit nach‘ entwickelnde teleologisch-gestufte Verfassung der Vernunft zeigt sich auch in dem diesbezüglich interessanten Hinweis Kants, dass die Transzendentalphilosophie noch das Vorhof-Stadium der ‚eigentlichen Metaphysik‘ in ihrer ‚praktisch-dogmatischen Absicht‘ darstellt. Demgemäß bleibe die ‚Transzendentalphilosophie‘ mit der in ihr geleisteten ‚Kritik‘ – als dem ersten Teil dieses ‚dritten Stadiums der Metaphysik‘ – für sich genommen bloß die Voraussetzung der ‚eigentlichen Metaphysik‘ in ‚praktisch-dogmatischer Absicht‘. Dies besagt aber, dass die Kritik der reinen Vernunft als der ‚dritte und neueste Schritt‘ dieser neueren Metaphysik eben doch noch nicht die ‚eigentliche Metaphysik‘ selbst ist, zumal diese durch das Programm der ‚Kritik‘ – als Transzendentalphilosophie – allererst ihre kritische Fundierung erhält; innerhalb dieses ‚dritten Stadiums‘ thematisiere deshalb der ‚erste Teil‘ zunächst die unverzichtbaren Schritte hin zur Metaphysik, während der ‚zweite Teil‘ sodann erst „die Fortschritte der Metaphysik selber im Felde der reinen Vernunft vorstellig“ macht und sodann, gemäß dieser „Architektonik alles menschlichen Wissens“,27 die ‚eigentliche Metaphysik‘ erst auszuführen vermag. Dass die geschichtliche Entwicklung der neueren Metaphysik also gleichermaßen als eine systematische zu verstehen sei, spiegle sich infolgedessen jedoch nicht nur in der Abfolge dieser drei Stadien wider; die in dieser ‚natürlichen Gedankenfolge‘ 24 Ebd., A 43 f. 25 Immanuel Kant, Kritik der praktischen Vernunft, 1788, A 81. 26 Bernd Ludwig, Kants langer Weg zu einer Consequent-Kritischen Metaphysik, in: Über die Fortschritte der kritischen Metaphysik. Beiträge zu System und Architektonik der kritischen Philosophie, hg. v. Andree Hahmann u. Bernd Ludwig, Hamburg 2017, S. 79-118, hier S. 117, hebt mit Bezug auf den zitierten Passus hervor: „Die Kritik der dogmatischen Metaphysik erweist sich damit als eine zutiefst sittliche Aufgabe, als Ausdruck jenes Respekts gegenüber der gemeinen sittlichen Vernunft der ‚für uns achtungswürdigsten Menge‘ … , den Kant selbst seit der Zeit seiner intensiven Rousseau-Lektüre in sich verspürte“. 27 Kant, Kritik der reinen Vernunft, B 863.
Von der kantischen ‚Kritik‘ zur ‚eigentlichen Metaphysik‘
21
zutage tretende teleologische Struktur sei, so Kant, ebenso in den beiden Teilen dieses dritten Stadiums wiederzufinden. Kants Argumentation ist hier genau zu nehmen: „So viel ist in neuerer Zeit in der Transzendentalphilosophie geschehen, und hat geschehen müssen, ehe die Vernunft einen Schritt in der eigentlichen Metaphysik, ja, auch nur einen Schritt zu derselben hat tun können“:28 Von dem – alle gefährlichen Sprünge vermeidenden – Schritt ‚in‘ der ‚eigentlichen Metaphysik‘ wird also hier ausdrücklich der Schritt ‚zu derselben‘ in der zu einem System menschlicher Erkenntnis sich „bloß auswickelnden Vernunft“29 unterschieden; dafür sei gleichermaßen die von Kant auch andernorts betonte Entsprechung von Zeit- und natürlicher Gedankenfolge zu beachten, wonach auch die in diesen drei Stadien der neuzeitlichen Metaphysik zutage tretende „Zeitordnung in der Natur des menschlichen Erkenntnisvermögens gegründet“ ist30. Der in der Unterscheidung jener drei ‚Stadien‘ zutage tretende teleologische Charakter bleibt auch für die Stadien-Folge der Preisschrift zu beachten, worin auch Kants Ethikotheologie selbst ‚teleologisch‘ verankert ist. In dieser Zeitfolge der Stadien der Metaphysik werde eben sichtbar, „wie diese Metaphysik sich [in der Geschichte der Philosophie] nach und nach aus der menschlichen Vernunft hat entwickeln müssen“ und wie in der Folge „die Elemente derselben in der Kritik d. r. V. aufgestellt werden“.31 Näherhin umfasst das selbst innerhalb der ‚Geschichte der reinen Vernunft‘ verortete – beziehungsweise daraus hervorgegangene – dritte Stadium also Kants ‚Kritik‘ als ‚Metaphysik von der Metaphysik‘ sowie seine eigene, darauf begründete kritische ‚eigentliche Metaphysik‘; erst durch die Einheit beider Aspekte beziehungsweise Teile dieses dritten Stadiums – Kritik und eigentliche Metaphysik – ist folglich auch der ‚Grundsatz der Vernunft: ihre Selbsterhaltung‘ – ihre Bewahrung und auch ihre Realisierung – gewährleistet. Dabei erweist sich freilich, dass Kants – nicht zuletzt darauf abzielende – These, der zufolge „das Übersinnliche, worauf doch der Endzweck der Vernunft in der Metaphysik gerichtet ist, für die theoretische Erkenntnis eigentlich gar keinen Boden hat“32, noch präzisierungsbedürftig ist: Denn die theoretischen Vernunftideen 28 Kant, Preisschrift, A 55. 29 Kant, Kritik der reinen Vernunft, B 863. 30 Kant, Preisschrift, A 21. 31 So Immanuel Kant in einem Brief an Karl Morgenstern v. 14. August 1795, in: AA XII 36; vgl. auch Lose Blätter zu den Fortschritten zur Metaphysik, zitiert nach Immanuel Kant. Theoretische Philosophie. Texte und Kommentar, 3 Bde., hg. v. Georg Mohr, Frankfurt am M. 2004, Bd. 2, S. 285: In solcher „Zeitfolge“ auch die „natürliche Gedankenfolge“ sichtbar zu machen, ist nach Kant das unverzichtbare Thema einer „philosophierende[n] Geschichte der Philosophie“. 32 Kant, Preisschrift, A 16.
22
Rudolf Langthaler
bleiben als ‚Abschlussgedanken‘ in ihrer Berechtigung, und sogar als ‚notwendige Inhalte der Vernunft‘ ja vorausgesetzt und erfüllen so auch eine unverzichtbare kritisch-grenzbegriffliche Funktion – ungeachtet dessen, dass die Vernunft ein besonderes praktisches Interesse an diesen Ideen ‚Gott, Freiheit und Unsterblichkeit‘ nimmt, zumal sie sich eben nicht an einer „Theorie der Natur“ beziehungsweise am „Lauf der Welt“, sondern am „moralischen Lauf der Dinge“33 orientieren. Diese Themen der ‚metaphysica specialis‘ sind eben der Metaphysik ‚zweiter Teil‘, worin diese bekanntlich als – ‚praktisch immanent‘ gewordene – Vernunftpostulate entfaltet werden und so die Frage nach dem ‚Endzweck der Vernunft‘ und diejenige ihrer ‚Selbsterhaltung‘ so ihre Beantwortung findet. Derart wird also erst die in jener Vorrede zur Kritik der reinen Vernunft in Aussicht gestellte „nach Maßgabe der Kritik der reinen Vernunft abgefasste systematische Metaphysik“34 gemäß der „Architektonik alles menschlichen Wissens“35 realisiert und somit auch der formulierte „Endzweck der Metaphysik“, „von der Erkenntnis des Sinnlichen zu der des Übersinnlichen durch die Vernunft fortzuschreiten“.36 Die ‚transzendentalen Vernunftideen‘ als notwendige ‚Bedingungen unserer Vernunft‘ werden also erst durch den Bezug zur praktischen Vernunft Gegenstände des Glaubens und somit zu ‚Postulaten‘ fortbestimmt, sofern diese als unumgängliche Bedingungen des ‚höchsten Gutes‘ fungieren. ‚Kritik‘ wird dergestalt zur ‚praktischen Metaphysik‘.
2
Die Selbsterhaltung der Vernunft als ‚Fundament des Vernunftglaubens‘ und das ‚Stadium der Theologie‘: ‚Um zum Glauben Platz zu bekommen‘ und die Aufgabe: ‚Glauben denken‘
Was Kant in dieser – teleologisch angelegten – Vermittlung beziehungsweise des Aufstiegs zum ‚Endzweck der Metaphysik‘ bemerkenswerterweise aufweisen wollte, ist dies, dass der auf dem gesicherten ‚Boden der Vernunft‘ – fern jeder ‚Vernünftelei‘ – gesuchte ‚Überschritt zum Übersinnlichen‘ gleichwohl nicht kontinuierlich verlaufen kann, weil die als ‚Endzweck der Metaphysik‘ intendierte ‚Weisheitslehre‘ nur durch die gebotene Grundlegung und ‚Ordnung der Prinzipen‘ erfolgen kann und das Telos dieses ‚praktisch-dogmatischen Überschritts zum Übersinnlichen‘ 33 Immanuel Kant, Das Ende aller Dinge, 1793, A 498. 34 Kant, Kritik der reinen Vernunft, B XXX. 35 Ebd., B 863. 36 Kant, Preisschrift, A 10.
Von der kantischen ‚Kritik‘ zur ‚eigentlichen Metaphysik‘
23
darstellt. Für diesen „praktisch-dogmatischen Überschritt zum Übersinnlichen“ als den eigentlichen „Endzweck der Vernunft“ müsse es auch ein eigenes „Stadium der Metaphysik … geben“37. Kant stand dabei ein „den ganzen Zweck der Metaphysik [erst] erfüllende[s] Stadium“38 vor Augen. Er bezeichnete dieses Stadium, das zugleich – als „praktisch-dogmatische Erkenntnis“39 – als Vollendungsgestalt der Metaphysik anzusehen sei, bemerkenswerterweise ausdrücklich als „das der Theologie“40. Es ist in der Tat ein sehr denkwürdiger, weil in systematischer Hinsicht aufschlussreicher Sachverhalt, dass diese – genauer besehen – dem zweiten Teil des ‚dritten Stadiums‘ der Metaphysik – eben als ‚Theologie‘ – vorbehaltene ‚praktischdogmatische Vollendung ihres Weges‘ im Grunde nunmehr die späte Einlösung seiner frühen denkwürdigen programmatischen These darstellt, der zufolge – so Kant ausdrücklich41 – das ‚Fundament des Vernunftglaubens‘ auf die ‚Selbsterhaltung der Vernunft‘ abzielt, die auch mit jenem von Kant wiederholt sogenannten ‚Interesse der Vernunft an sich selbst‘ unzertrennlich verbunden ist. Diese als ‚Fundament des Vernunftglaubens‘ auszuweisende ‚Selbsterhaltung der Vernunft‘ wäre dann eben auch im Sinne einer Selbstentfaltung dieses Vernunftinteresses – das heißt seiner Realisierung – zu verstehen. Es ist lediglich eine besondere Akzentuierung der auch in diesem ‚dritten Stadium‘ der Metaphysik zutage tretenden ‚teleologischen Verfassung‘, dass auf dem darin beschrittenen Weg zum ‚Endzweck der Vernunft in der Metaphysik‘ sich die Verknüpfung der ‚selbstgemachten‘ Vernunftideen des „Übersinnlichen in uns, über uns und nach uns“42 in der Preisschrift gleichsam zu einer – von Kant sogenannten – inneren „Zweckverbindung“43 dieser ‚Vernunftideen‘ verdichtet und dergestalt auch eine „gewisse Organisation“44 erkennen lässt, in der genau jenes erwähnte ‚Interesse der Vernunft an sich selbst‘ – und somit an ihrer Selbsterhaltung – maßgebend ist, das ‚aus der Natur der allgemeinen Menschenvernunft‘ herrührt. Letztere steht so mit diesem Programm einer kritischen – von Kant sogenannten eigentlichen – Metaphysik in engstem Zusammenhang. Die Kennzeichnung dieser ‚eigentlichen Metaphysik‘ geht offenbar noch weiter als die vormalige Bestimmung des Verhältnisses von ‚Kritik‘ und ‚Metaphysik‘ und wirft 37 Ebd., A 104 f. 38 Ebd., A 110. 39 Ebd. 40 Ebd., A 67. 41 Immanuel Kant, Reflexion 2446, in: AA XVI 371. 42 Kant, Preisschrift, A 106. Hervorhebungen im Original. 43 Ebd., A 137. 44 Ebd., A 148.
24
Rudolf Langthaler
so auch auf Kants frühere Problemcharakterisierung ein neues Licht: „Die Philosophie der reinen Vernunft ist nun entweder Propädeutik (Vorübung), welche das Vermögen der Vernunft in Ansehung aller reinen Erkenntnis a priori untersucht, und heißt Kritik, oder zweitens das System der reinen Vernunft (Wissenschaft), die ganze … philosophische Erkenntnis aus reiner Vernunft im systematischen Zusammenhange, und heißt Metaphysik; wiewohl dieser Name auch der ganzen reinen Philosophie mit Inbegriff der Kritik gegeben werden kann“.45 Das ‚dritte Stadium‘ in dieser teleologischen Stadienkonzeption ist demnach der systematische Ort, an dem die von Kant sogenannte metaphysische Vernunftforschung – über das kritizistische Programm, ‚zum Glauben Platz zu bekommen‘, hinaus – die gesuchte Legitimation einer ‚praktisch-dogmatischen Metaphysik‘ durch die ihr aufgegebene Entfaltung der diesen ‚Vernunftglauben‘ auszeichnenden Binnenstruktur zu leisten hat. ‚Um zum Glauben Platz zu bekommen‘ bedeutet somit sowohl eine durch den ‚Gerichtshof der Vernunft‘ eröffnete kritische Begrenzung wie auch eine Legitimation von Glaubensansprüchen. Gemäß dieser Vernunftperspektive verfolgt auch Kants Aufweis der Verbindlichkeit der moralisch begründeten Hoffnung das Ziel, ‚um zum Glauben Platz zu bekommen‘, während das daran geknüpfte Programm der ‚eigentlichen Metaphysik‘, in differenzierter Weise ‚Glauben zu denken‘, die „praktisch-dogmatische Vollendung ihres Weges, und der Gelangung der Metaphysik zu ihrem Endzwecke“46 ist. Wenn die ‚eigentliche Metaphysik‘ in der teleologisch verfassten ‚Stadienlehre‘ ihren eigentlichen Ort sodann im zweiten Teil des dritten Stadiums und nach wie vor nichts anderes als ‚Gott, Freiheit und Unsterblichkeit‘ zum Gegenstand hat, dann ist die eigentliche Aufgabe der Metaphysik, ‚die als Wissenschaft wird auftreten können‘, um so in dieser teleologischen Absicht ‚zum Glauben Platz zu bekommen‘ und Glauben zu denken, eben der Aufweis und die Entfaltung dieser Themen als Glaubenssachen, worin sich ‚Vernunft selbst erhält‘, das heißt gewinnt und bewahrt. Die ‚Zukunft der Metaphysik‘ als ein ‚unabweisliches Bedürfnis der Vernunft‘ hängt nach Kant also an der Aufweisbarkeit der Verbindlichkeit des Vernunftglaubens als ‚Hoffnungsglaube‘, in dem sich der ‚Endzweck der Metaphysik‘ realisiert. Der Fortschritt zum ‚Endzweck der Metaphysik‘ vollzieht sich – im Sinne einer ‚allmählichen Entwicklung der menschlichen Vernunft‘ – innerhalb des dritten Stadiums in einer zunehmenden Differenzierung und Entfaltung des ‚Vernunftglaubens‘ als ‚Hoffnungsglaube‘ – das heißt innerhalb des Programms, Glauben zu denken. Der sich „aus Begriffen entwickelnden Vernunft“ entspricht so eine „sich in der
45 Kant, Kritik der reinen Vernunft, B 868. Hervorhebung im Original. 46 Kant, Preisschrift, A 66. Hervorhebung im Original.
Von der kantischen ‚Kritik‘ zur ‚eigentlichen Metaphysik‘
25
Zeit auswickelnde“ „Glaubensphilosophie“47. Das der ‚Vernunftkritik‘ aufgegebene Programm, ‚um zum Glauben Platz zu bekommen‘, und das der ‚eigentlichen Metaphysik‘ eigene Vorhaben, ‚Glauben zu denken‘, wären also in der Tat als eine Art – teleologisch verfasste – ‚Glaubensphilosophie‘ zu verstehen, die Kants Gesamtsystematik auf dem Weg von der ‚Kritik zur eigentlichen Metaphysik‘ und zur ‚Theologie‘ insgesamt betrifft. Demzufolge besagt jene Kennzeichnung der Theologie als ‚drittes Stadium‘ näherhin dies, dass dieser der ‚eigentlichen Metaphysik‘ zugedachte ‚praktischdogmatische Überschritt zum Übersinnlichen‘ vorrangig die Entfaltung dieses Hoffnungsglaubens erst leisten muss, für den die vorgängige ‚Kritik‘ zunächst doch lediglich ‚Platz bekommen‘ und darüber hinaus einen gangbaren Weg erst eröffnet hat. Vor dem Hintergrund der in Kants später Preisschrift dargelegten teleologischen Stadienkonzeption und des darin verorteten beziehungsweise legitimierten ‚praktisch-dogmatischen Überschritts zum Übersinnlichen‘ wird so nochmals deutlich, dass jenes in der Vorrede zur Kritik der reinen Vernunft kritizistisch begründete Vorhaben, ‚um zum Glauben Platz zu bekommen‘, doch erst den notwendigen ersten Schritt auf dem Weg zu der darin intendierten ‚Weisheitslehre‘ und jenem genannten ‚Endzweck der Vernunft in der Metaphysik‘, ‚vom Sinnlichen zum Übersinnlichen fortzuschreiten‘, darstellt, worauf die eigentliche Entfaltung dieses Vernunftglaubens als ‚Hoffnungsglaube‘ noch folgen muss. Das in Kants kritischem Geschäft intendierte Ziel, ein schiefes – weil vermessenes und somit auch der Weltstellung des Menschen unangemessenes – Verständnis des Glaubens zu überwinden und sodann ‚zum Glauben Platz zu bekommen‘, mündet zuletzt also in das religionsphilosophische Vorhaben ein, ‚Glauben zu denken‘: als Thema der ‚eigentlichen Metaphysik‘. Derart muss stufenweise nachgezeichnet werden, was die darin zutage tretende Eigenart, die – verborgene? – ‚teleologische Struktur‘ und den spezifischen Anspruch und Stellenwert der einzelnen Gestalten des Glaubens – nicht zuletzt des „Vernunftunglaubens“,48 der durch ein „überwiegendes – sic!, 47 Es scheint in der Tat nicht abwegig, „Kants Vernunftkritik (auch) als eine ‚Glaubensphilosophie‘ … “ zu verstehen, wie Axel Hutter, Vernunftglaube. Kants Votum im Streit um Vernunft und Glauben, in: Friedrich Heinrich Jacobi. Ein Wendepunkt der geistigen Bildung der Zeit, hg. v. Walter Jaeschke u. Birgit Sandkaulen, Hamburg 2004, S. 241-256, hier S. 246, bemerkt; vgl. auch ebd., S. 247: Es ist tatsächlich wichtig zu sehen, „dass Kants Satz über Wissen und Glauben keineswegs eine zu vernachlässigende Randglosse ist, sondern ganz im Gegenteil in das methodische Zentrum der Vernunftkritik verweist“. Dem entspricht das daran geknüpfte Programm, ‚Glauben zu denken‘, das heißt: seinen Anspruch zu ‚entwickeln‘. 48 Ihn hat Kant schon 1786 in seinem Aufsatz Was heißt: Sich im Denken orientieren?, A 328, als eine sich selbst widerstreitende „Maxime der Unabhängigkeit der Vernunft
26
Rudolf Langthaler
RL – praktisches Fürwahrhalten“ den „Zweifelglauben“49 und sein „Schwanken“ überwindet – ausmacht. So zeigt sich, welcher bedeutsame systematische Stellenwert von Kant dem Programm, ‚um zum Glauben Platz zu bekommen – als dasjenige der ‚Kritik‘, – und dem Programm, ‚Glauben zu denken‘ – als dasjenige der ‚eigentlichen Metaphysik‘, – in dieser sich ‚bloß auswickelnden – und darin sich selbst erhaltenden – Vernunft‘ beigemessen wird. Noch einmal sei betont: Die ‚Kritik‘ erfüllt als „Vorhof dieser eigentlichen Metaphysik“50 die – zwar in der ‚Analytik‘ und ‚Dialektik‘ eingelöste – Aufgabe, ‚für den Glauben Platz zu bekommen‘, während es dieser Konzeption zufolge der eigentlichen Metaphysik als dem zweiten Teil des dritten Stadiums, dem der Theologie, vorbehalten ist, auf diesem gesicherten Boden in einem ‚praktischdogmatischen Überschritt zum Übersinnlichen‘ sodann in ‚praktisch-dogmatischer Absicht‘, ‚Glauben zu denken‘. In dieser teleologischen Entfaltung findet demnach der früh von Kant so bezeichnete „Grundsatz der Vernunft: ihre Selbsterhaltung“51 seine Einlösung. Leitend ist nunmehr also die Idee einer ‚Teleologie‘ verschiedener, aufeinander folgender ‚Glaubensformen‘, in denen sich jene – von Kant sogenannte – ‚Selbsterhaltung der Vernunft‘ als das ‚Fundament des Vernunftglaubens‘ selbst zur Entfaltung bringt. Diese ‚Selbsterhaltung der Vernunft‘ wäre demnach nicht nur das ‚Fundament des Vernunftglaubens‘ – sie ‚realisiert‘ sich vielmehr selbst in diesen ‚teleologisch‘ gedachten Formen des Glaubens, worin sich also gewissermaßen eine ‚teleologia rationis humanae‘ manifestiert. Nur auf solche Weise ist auch die von ihrem eigenen Bedürfnis (Verzichttuung auf Vernunftglauben)“ charakterisiert. Diesen Vernunftunglauben kritisierte Kant, ebd., als einen „missliche(n) Zustand des menschlichen Gemüts, der – wenigstens, RL – den moralischen Gesetzen … alle Kraft der Triebfedern auf das Herz, mit der Zeit so gar ihnen selbst alle Autorität benimmt, und die Denkungsart veranlaßt, die man Freigeisterei nennt“. Als ein „aller Moralität widerstreitender Unglaube“ – Kant, Kritik der reinen Vernunft, B XXX – , der deshalb auf die von Kant andernorts so genannte „moralische Ungläubigkeit“ hinausläuft, erweist sich dieser ‚Vernunftunglaube‘ in Wahrheit jedoch selbst als ein ‚dogmatischer Unglaube‘ – als ein solcher, der ihm zufolge geradezu nihilistische Züge verrät. Dem den ‚Vernunftglauben‘ negierenden ‚Vernunftunglauben‘ korrespondiert – so Kant in der Einleitung zur Preisschrift nach Massgabe der dritten Handschrift, A 188 – eine „Verzweiflung“ – desperatio – „der Vernunft an sich selbst“ als ein „dogmatischer Skeptizismus“, dem eine an der ‚Selbsterhaltung der Vernunft‘ orientierte Hoffnung – spes – gegenübersteht, und weist so jenen ‚Vernunftglauben‘ als einen ‚Hoffnungsglauben‘ aus: Thema der ‚praktischen Metaphysik‘. 49 Kant, Kritik der Urteilskraft, B 464. 50 Kant, Preisschrift, A 11. 51 Immanuel Kant, Reflexion 1509, in: AA XV 823.
Von der kantischen ‚Kritik‘ zur ‚eigentlichen Metaphysik‘
27
in der ‚Geschichte der reinen Vernunft‘ zutage tretende – und für die Explikation dieser Idee der ‚teleologia rationis humanae‘ entscheidende – Verbindung einer „spekulativen Einschränkung der reinen Vernunft und praktischen Erweiterung derselben“52 in einer dem ‚Weltbegriff der Philosophie‘ genügenden, das heißt differenzierten Weise zu erreichen: „Die Philosophie (als Weisheitslehre) ist die Lehre von der Bestimmung des Menschen in Ansehung des aus seiner eigenen Vernunft hervorgehenden Endzwecks“.53 Ebendieser unauflösliche Bezug der teleologischen Entfaltung dieser Gestalten des Vernunftglaubens zum Thema der ‚Selbsterhaltung der Vernunft‘ bestätigt sich auch im Blick auf den späteren Kant. Wie bestimmend jene frühe programmatische Kennzeichnung der ‚Selbsterhaltung der Vernunft‘ als ‚Fundament des Vernunftglaubens‘ auch noch für den späteren Kant geblieben ist, zeigt auch ein Passus aus Kants Logik, wo er die Bezugnahme auf ‚Gott, Freiheit und Unsterblichkeit‘ als eine ‚subjektive Notwendigkeit‘ bezeichnete und als jenen casus extraordinarius rechtfertigte, „ohne welchen die praktische Vernunft sich nicht in Ansehung ihres notwendigen Zwecks erhalten – sic!, RL – kann, und es kommt ihr hier favor necessitatis zu statten in ihrem eigenen Urteil“.54 Und für diese Erhaltung der ‚praktischen Vernunft‘ ist die Kritik der ‚theoretisch-spekulativen Vernunft‘ freilich die unverzichtbare Bedingung, weil nur so das erforderliche „Verhältnis der Gleichheit“ gewährleistet ist, „worin Vernunft überhaupt zweckmäßig gebraucht werden kann“.55 In mehrfacher Hinsicht erweist sich die hier zutage tretende gestufte Argumentation Kants als aufschlussreich: Zeigt sich doch, dass jenes ‚dritte Stadium‘ sich nicht nur der ‚kritischen‘ Überwindung einer dogmatischen Metaphysik und ebenso eines antimetaphysisch-empiristischen Skeptizismus verdankt – beziehungsweise sich als solche versteht, „zwischen den beiden Klippen des Dogmatismus und Skeptizismus glücklich durchzukommen“56 – , sondern dass dieser gesuchte behutsame ‚Überschritt‘ notwendigerweise und allein auf der Basis einer – die rechte ‚Ordnung der Prinzipien‘ befolgenden – Begründung des „Primats der praktischen Vernunft in Verbindung mit der theoretischen“ erfolgen kann und auch nur dies einen „gefährlichen Sprung“57 vermeiden lässt. Allein dies eröffnet eine begründete Aussicht
52 Kant, Kritik der praktischen Vernunft, A 255. 53 Immanuel Kant, Reflexion 6360, in: AA XIII 689. 54 Immanuel Kant, Logik. Ein Handbuch zu Vorlesungen, 1800, A 103. 55 Kant, Kritik der praktischen Vernunft, A 255. Hervorhebung im Original. 56 Immanuel Kant, Reflexion 5645, in: AA XVIII 287. 57 Kant, Preisschrift, A 43.
28
Rudolf Langthaler
darauf, „die Metaphysik in einem zusammenhängenden Systeme“58 darzustellen, worin dem Vorhaben, ‚Glauben zu denken‘, nunmehr eine bedeutsame Rolle zukommt. Dieser der ‚eigentlichen Metaphysik‘ zugedachte ‚praktisch-dogmatische Überschritt zum Übersinnlichen‘ hätte demnach die vorrangige Aufgabe einer näheren Entfaltung des ‚Vernunftglaubens‘ selbst, für den die vorgängige ‚Kritik‘ zunächst lediglich ‚Platz bekommen‘ hat. In der gestuften Einlösung jenes metaphysischen Programms eines ‚praktischdogmatischen Überschritts zum Übersinnlichen‘ tritt demzufolge in der kantischen Konzeption des ‚Vernunftglaubens‘ eine bemerkenswerte ‚teleologische Binnenstruktur‘ zutage. Die Wendung: ‚das Wissen aufheben‘ zu müssen, ‚um zum Glauben Platz zu bekommen‘ lässt ohnedies eine ‚teleologische‘ Ausrichtung beziehungsweise ‚Nötigung‘ erkennen, sofern sich daran die im Stadium der ‚Theologie‘ zu leistende systematische Entfaltung jenes ‚Vernunftglaubens‘ knüpft, wofür die ‚Kritik‘ zunächst erst einmal ‚Platz bekommen‘ musste. Diese Wendung: Das ‚Wissen aufheben‘, ‚um zum Glauben Platz zu bekommen‘, macht jedenfalls diese ‚teleologische‘ Ausrichtung deutlich – auch im Sinne einer Zweckmäßigkeit, die den Verstand der Vernunft unterordnet, das heißt eine Reduktion der Vernunftansprüche auf die Ebene empirischer Wissenschaft verbieten muss. ‚Um zum Glauben Platz zu bekommen‘ – ebendies verweist auf die nach Kant mit dem ‚dritten Stadium‘ der Metaphysik erreichte ‚praktisch-dogmatische Vollendung ihres Weges‘ und bedeutet näherhin dies, dass jener Endzweck der Metaphysik nur über die Bestimmung des Endzwecks der praktischen Vernunft, des Endzwecks der Schöpfung und über die Frage nach Gott als dessen Ermöglichungsgrund ins Blickfeld treten kann. Es sind dies bekanntlich die Leitthemen der kantischen Ethikotheologie, die innerhalb des ‚dritten Stadiums‘ ihren systematischen Ort haben und in Kants später Preisschrift noch eine systematische Vertiefung beziehungsweise Weiterführung finden – nicht zuletzt in der schon genannten ‚Zweckverbindung der Vernunftideen‘. Dieser Ethikotheologie ist – auf dem Fundament der Kritik – der ‚Endzweck der Vernunft in der Metaphysik‘ vorbehalten, worin allein Vernunft ‚sich selbst erhält‘ und so zugleich die Einlösung des Vorhabens, Glauben zu denken, bedeutet. Es hat sich gezeigt: Zufolge der in diesen drei Stadien zutage tretenden ‚natürlichen Gedankenfolge‘ findet dieses ‚dritte Stadium‘ – in ihrem als zweiter Teil ausgewiesenen ‚eigentlichen Metaphysik‘ – erst in jener Weisheitslehre vom ‚höchsten Zwecke der menschlichen Vernunft‘ ihren Abschluss, die sie – in der Überwindung einer ‚Vermessenheit‘ sowohl im ‚theoretischen‘ als auch ‚praktischen Vernunftgebrauch‘ – dergestalt auszubilden vermag und so innerhalb des ‚Weltbegriffs 58 Immanuel Kant, Brief an Abraham Gotthelf Kästner v. 5. August [?] 1790, in: AA XIII 278.
Von der kantischen ‚Kritik‘ zur ‚eigentlichen Metaphysik‘
29
der Philosophie‘ den ‚praktisch-dogmatischen Überschritt zum Übersinnlichen‘ gewissermaßen ‚vollendet und krönt‘. Der ‚Weltbegriff der Philosophie‘ und die daran geknüpfte Weisheitslehre mit den darin leitenden Fragen finden in diesem ‚dritten Stadium der Metaphysik‘ innerhalb der kantischen Gesamtsystematik ihren Ort und ihre genauere und abschließende Entfaltung. In dieser immanenten Differenzierung erhält auch die kantische Unterscheidung zwischen Schul- und Weltbegriff der Philosophie ihre Begründung, die sowohl das Programm der ‚Kritik‘ als ‚Transzendentalphilosophie‘ als auch die ‚rationale Theologie‘ und ebenso die Ethikotheologie enthält.
3
Der ‚reflektierende Glaube‘ – ein Schritt über die ‚eigentliche Metaphysik‘ hinaus in der ‚auf dem Kritizism der praktischen Vernunft gegründeten wahren Religionslehre‘?
Die in dieser ‚Theologie‘ als dem ‚dritten Stadium der Metaphysik‘ rekonstruierbare teleologische Folge der ‚Glaubensgestalten‘ wäre demnach selbst als der kantische Versuch zu würdigen, die „Metaphysik um einen Schritt weiter“,59 ja diese sogar zur Vollendung zu bringen. In einem letzten Schritt, so meine abschließend – vermutungsweise – geäußerte These, mündet dieses Vorhaben jedoch in die vom späten Kant so bezeichnete „auf dem Kritizism der praktischen Vernunft gegründete wahre Religionslehre“60 ein. War die ‚Kritik‘ der ‚theoretischen Vernunft‘ in gewisser Weise noch eine Propädeutik der ‚eigentlichen Metaphysik‘ zu ihrem ‚Endzweck‘, so erweist sich der vom späten Kant so genannte ‚Kritizismus der praktischen Vernunft‘ mit der darin vollzogenen ‚Selbstbegrenzung der praktischen Vernunft‘ im Grunde lediglich als die unverzichtbare Vorbereitung für die ‚wahre Religionslehre‘ und ihre Frage ‚Was darf ich hoffen?‘ im eigentlichen Sinne.61 Die als ‚drittes Stadium‘ bezeichnete ‚Theologie‘ weist demzufolge, so meine Vermutung, selbst noch über sich hinaus und findet in dieser ‚wahren Religionslehre‘ ihre Aufhebung. In diesen
59 Kant, Prolegomena, A 193. Hervorhebung im Original. 60 Kant, Der Streit der Fakultäten, A 94. Hervorhebung im Original. 61 Schon die Kennzeichnung der, ebd., „auf dem Kritizism der praktischen Vernunft gegründeten wahren Religionslehre“ macht ja deutlich, dass die in der Kritik der praktischen Vernunft verankerte ‚Vernunftreligion‘ von der ‚wahren Religionslehre‘ noch unterschieden werden muss – ein Unterschied, der sich auch in der notwendigen Differenzierung des ‚Hoffnungsbegriffs‘ manifestiert.
30
Rudolf Langthaler
späteren Überlegungen Kants – in der Religionsschrift und im Streit der Fakultäten – werden so weitere Modifikationen und Differenzierungen sichtbar, die sich sodann – auch – als eine präzisierende Bestimmung beziehungsweise ebenso als Korrektur des von Kant selbst ausdrücklich angezeigten „theoretischen Mangels des reinen Vernunftglaubens“62 buchstabieren lassen und so auf die Gestalt des von Kant so bezeichneten „reflektierenden“ Glauben63 führen: „Die Vernunft im Bewusstsein ihres Unvermögens, ihrem moralischen Bedürfnis ein Genüge zu tun, dehnt sich bis zu überschwänglichen Ideen aus, die jenen Mangel ergänzen könnten, ohne sie doch als einen erweiterten Besitz sich zuzueignen. Sie bestreitet nicht die Möglichkeit oder Wirklichkeit der Gegenstände derselben, aber kann sie nur nicht in ihre Maximen zu denken und zu handeln aufnehmen. Sie rechnet sogar darauf, dass, wenn in dem unerforschlichen Felde des Übernatürlichen noch etwas mehr ist, als sie sich verständlich machen kann, was aber doch zur Ergänzung des moralischen Unvermögens notwendig wäre, dieses ihrem guten Willen auch unerkannt zu statten kommen werde, mit einem Glauben, den man den (über die Möglichkeit desselben) reflektierenden nennen könnte, weil der dogmatische, der sich als ein Wissen ankündigt, ihr unaufrichtig oder vermessen vorkommt“.64 Dieser ‚reflektierende Glaube‘ ist demnach von ‚historischen‘ und bloß ‚statutarischen Glaubenslehren‘65 klar unterschieden und wendet sich, eingedenk des „moralischen Unvermögens“ und im Sinn der durch die „hergebrachten frommen Lehren erleuchteten praktischen Vernunft“66, eben auch gegen die ‚Vermessenheit‘ praktischer Vernunftansprüche. In dieser – ausdrücklichen – Kennzeichnung des reflektierenden Glaubens – in der Religionsschrift67 – rückt also bemerkenswerterweise noch ein weiterer 62 Ebd., A XVIII. Hervorhebung im Original. 63 Kant, Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, B 63. Hervorhebung im Original. 64 Ebd. Hervorhebungen im Original. 65 Kant, Der Streit der Fakultäten, A 74. 66 Kant, Das Ende aller Dinge, 1794, A 516. 67 Darin zeigt sich in der Tat, wie Otfried Höffe, Einführung in Kants Religionsschrift, in: Immanuel Kant. Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, hg. v. Otfried Höffe, Berlin 2011, S. 1-28, hier S. 9, bemerkt: „Die Religionsschrift schließt sich … an die Moraltheologie der drei Kritiken nahtlos an und nimmt zugleich eine erhebliche Erweiterung vor“. Nach Höffes zutreffender Interpretation, ebd., S. 26, tritt derart die „Religion … mit einem größeren Eigengewicht auf. Erstens wird ihr die Möglichkeit einer nichtnatürlichen Einsicht, einer Offenbarung, eingeräumt. Zweitens werden von dieser Offenbarung anthropologische Einsichten erwartet, also Einsichten, die den Philosophen interessieren sollten. Damit erhält die Vernunft drittens eine Vorgabe, die sich auf eine Grenze beläuft: Sie kann die Einsichten, die der Vernunft vorgegeben werden, nicht aus sich hervorbringen. Sie vermag sie nur, viertens, zu re-konstruieren,
Von der kantischen ‚Kritik‘ zur ‚eigentlichen Metaphysik‘
31
Aspekt in den Vordergrund, der diesen ‚Vernunftglauben‘ als ‚Hoffnungsglauben‘ besonders akzentuiert und sich so auch für noch spätere religionsphilosophische Aspekte Kants als bedeutsam erweist – Problemperspektiven, die zuletzt auch in seiner Bezugnahme auf die in dem ‚Kritizism der praktischen Vernunft gegründeten wahren Religionslehre‘ im späten Streit der Fakultäten angezeigt sind. Dieser ‚reflektierende Glaube‘ bringt in durchaus behutsam-grenzbedachter Weise eine Bezugnahme auf für „spekulative Erkenntnis“ zwar „überschwenglich[e]“,68 aber auch – von Kant sogenannte – „moralisch transzendente Ideen“69 zur Sprache, die, wie es heißt, aus den an die ‚praktische Vernunft‘ anstoßenden Fragen resultieren70 und, in der Wirklichkeit der – in ihrem Grund ‚unerforschlichen‘ – Freiheit verankert, „unvermeidlich auf heilige Geheimnisse“71 führen. Dergestalt tritt also ein durch diesen ‚Kritizism der praktischen Vernunft‘ erst eröffneter ‚reflektierender Glaube‘ ins Blickfeld – und mit den durch ihn kritisch-grenzbegrifflich legitimierten ‚moralisch transzendenten Ideen‘ auch ein besonderer Aspekt der Frage ‚Was darf ich hoffen?‘. Wohl erst hier gewinnt Kants Frage ‚Was darf ich hoffen?‘ einen Sinngehalt, der in der ‚Dialektik der praktischen Vernunft‘ der Zweiten Kritik – in der Lehre vom ‚höchsten Gut‘ – doch lediglich berührt war. Denn das ‚Hoffen-Dürfen‘ des ‚reflektierenden Glaubens‘ wäre somit selbst im Hoffen-Sollen auf den ‚moralischen Endzweck‘ begründet – und ebendies entspricht auch dem wichtigen – jedoch häufig ignorierten – Sachverhalt, dass beziehungsweise weshalb der späte Kant die Beantwortung der Frage nach dem Hoffen-Dürfen weder der ‚Dialektik der reinen praktischen Vernunft‘ der Zweiten Kritik noch der ‚Ethikotheologie‘ der Dritten Kritik, sondern ausdrücklich erst der Religionsschrift zugeordnet hat – wie er in seinem Brief an Carl Friedrich Stäudlin vom Frühjahr 1793 ausdrücklich betonte72 im strengen Sinn des re-. Sie kann sie lediglich intellektuell einholen, nie überholen.“ Diese „Offenbarung“ bezieht sich indes nicht auf „historische Beweisgründe“ einer „außerwesentlichen“, „an sich zufälligen Glaubenslehre“, wie Kant jedoch gelegentlich – vgl. Kant, Der Streit der Fakultäten, A XVIII – missverständlicherweise betont. 68 Kant, Das Ende aller Dinge, A 507. 69 Kant, Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, B 63. 70 Auch in einem Entwurf der Vorrede zur Religionsschrift, in: AA XX 425 ff., Zweiter Entwurf, S. 433 ff., hier S. 440, ist davon die Rede: „Die Philosophie stößt im Fortgange der zu ihrem reinen Vernunftgeschäfte gehörenden Moral zuletzt unvermeidlich auf Ideen einer Religion überhaupt und kan sie nicht umgehen“. 71 Kant, Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, B 209. 72 Immanuel Kant, Brief an Carl Friedrich Stäudlin v. 4. Mai 1793, in: AA XI 429 f., hier S. 429: „Mein schon seit geraumer Zeit gemachter Plan der mir obliegenden Bearbeitung des Feldes der reinen Philosophie ging auf die Auflösung der drei Aufgaben: 1) Was kann ich wissen? (Metaphysik) 2) Was soll ich thun? (Moral) 3) Was darf ich hoffen?
32
Rudolf Langthaler
– und darauf zielt sodann auch die auf dem ‚Kritizismus der praktischen Vernunft gegründete Religionslehre‘ und der ihr entsprechende ‚reflektierende Glaube‘ im engeren Sinn. Dies eröffnet so, über den Anspruch des „Vernunftglaubens‘ hinaus,73 weitere religionsphilosophische Grenzgänge mit diesen ‚moralisch transzendenten Ideen‘ – freilich auch hier sich auf der Grenze haltend, das heißt ohne dabei einem ‚faulen Vertrauen auf eine erträumte Gnade‘ Vorschub zu leisten und ebenso die schiefe Vorstellung einer ‚verdienten Glückseligkeit‘ abwehrend. Freilich, jene zwar ‚von der Vernunft selbst geschaffenen‘ und grenzbegrifflich legitimierten ‚moralisch transzendenten Ideen‘ entziehen sich als solche ihrer Vereinnahmung durch ‚praktische‘ Vernunftansprüche und widerstehen gleichermaßen ihrer Eliminierung, zumal sie an solchen ‚Grenzen‘ der Vernunft selbst – sich ‚auf der Grenze haltend‘ – wie Kant sagt, vielmehr ‚viel zu denken geben‘ und diese ‚metaphysischen Gedanken‘ ‚tastend‘ über sich hinaus verweisen. Demnach werden diese ‚moralisch transzendenten Ideen‘ von Kant keineswegs einfachhin verabschiedet, sondern vielmehr als solche legitimiert, „die obzwar für das spekulative Erkenntnis überschwänglich, darum doch nicht in aller Beziehung für leer zu halten“ sind und „in praktischer Absicht uns von der gesetzgebenden Vernunft selbst an die Hand gegeben werden“,74 wie es in Kants spätem Aufsatz über Das (Religion); welcher zuletzt die vierte folgen sollte: Was ist der Mensch? (Anthropologie …) Mit beikommender Schrift: Religion innerhalb der Grenzen etc. habe – sc. ich, RL – die dritte Abtheilung meines Plans zu vollführen gesucht“. 73 Immanuel Kant, Entwurf eines Briefes an König Friedrich Wilhelm II. nach dem 12. Oktober 1794, in: AA XI 527 ff., hier S. 528 f.; in diesem Briefentwurf betonte Kant zu seiner Verteidigung, er habe gar keine „Würdigung“ einer „Offenbarungsreligion“ beabsichtigt, sondern lediglich eine solche der „Vernunftreligion“, „deren Priorität als oberste Bedingung aller wahren Religion, ihre Vollständigkeit und praktische Absicht (nämlich das, was uns zu tun obliegt), obgleich auch ihre Unvollständigkeit in theoretischer Hinsicht (woher das Böse entspringe, wie aus diesem der Übergang zum Guten, oder wie die Gewißheit, dass wir darin sind, möglich sey u. dgl.), mithin das Bedürfniß – sic!, RL – einer Offenbarungslehre nicht verhehlt wird, und die Vernunftreligion auf diese überhaupt, unbestimmt welche es sey (wo das Christenthum nur zum Beispiel als bloße Idee einer denkbaren Offenbarung angeführt wird), bezogen wird, weil, sage ich dieser Wert der Vernunftreligion deutlich zu machen Pflicht war.“ Auch hier wird also, ganz im Sinne der auf den ‚Kritizism der praktischen Vernunft gegründeten wahren Religionslehre‘, von der ‚Vernunftreligion‘ die ‚wahre Religion‘ noch unterschieden. Letztere weist demzufolge – auch mit jenen ‚moralisch transzendenten Ideen‘ – über das Programm der Religionsschrift noch hinaus: vgl. dazu Immanuel Kant, Vorredeentwürfe zur Religionsphilosophie. Zweiter Entwurf, in: AA XX 433 ff., hier S. 439: „In der gegenwärtigen Schrift wird das Ganze einer Religion überhaupt, so fern sie bloß aus der durch moralische Ideen geleiteten Vernunft entwickelt werden kann, vorgetragen“. 74 Kant, Das Ende aller Dinge, A 507.
Von der kantischen ‚Kritik‘ zur ‚eigentlichen Metaphysik‘
33
Ende aller Dinge ausdrücklich heißt; in dem darin zutage tretenden besonderen ‚Grenzbewusstsein‘ weisen sie genauer besehen also noch über den ‚Kritizism der praktischen Vernunft‘ hinaus auf die darin erst ‚gegründete wahre Religionslehre‘. Auch hier gilt es demzufolge, „nicht bloß Schranken, sondern die bestimmten Grenzen“75 zu ermitteln. So gewinnt eine über die Kritik der praktischen Vernunft noch hinausweisende ‚Selbstbegrenzung der praktischen Vernunft‘ eine orientierende Bedeutung, wie Kant besonders auch mit Verweis auf die religiösen Motive und Geheimnisse des ‚jüngsten Gerichts‘ sowie der ‚Genugtuung‘ und ‚Erwählung‘ deutlich macht. Hingewiesen sei – zuletzt – noch darauf, dass erst in der durch den ‚Kritizism der praktischen Vernunft‘ begründeten ‚wahren Religionslehre‘ und der darin maßgebenden Gestalt des moralischen Glaubens jene erwähnte Weisheitslehre ihren Abschluss findet, von der Kant noch spät – in einem Entwurf zum sogenannten Jachmann-Prospekt aus dem Jahr 1800 – gesprochen hat;76 auch hier bezog der schon unverkennbar gebrechliche Kant diese Weisheitslehre auf den ‚Endzweck der menschlichen Vernunft‘ – das heißt – so heißt es – : ‚auf das, wonach zu trachten das einzige Notwendige ist, was – sc. der Mensch, RL – sich schlechthin zum Ziele machen soll‘ – daran fügt er, gleichsam als Hinweis auf die notwendige ‚Selbstbegrenzung der Vernunft‘, zuletzt noch hinzu: ‚Natur und Gnade‘. Die nach Kant in der „menschlichen Vernunft“ verborgene „Anlage zur moralischen Religion“77 fände dergestalt – über die ‚eigentliche Metaphysik‘ hinaus – ihre sukzessive reflexive Entfaltung und Einlösung – bis hin zu dieser durch den „Kritizism der praktischen Vernunft gegründeten wahren Religionslehre“.78 Demgemäß vereinigt dieses „dritte Stadium“ der Metaphysik79 sowohl ‚Vernunftkritik‘ als auch ‚eigentliche Metaphysik‘ in sich – und weist zugleich behutsam-tastend darüber noch hinaus. Derart muss deshalb die eigentliche Entfaltung dieses – zunehmend reflexiv bestimmten – Vernunftglaubens – ‚Glauben denken‘ – in mehreren Schritten 75 Kant, Kritik der reinen Vernunft, B 789. Hervorhebungen im Original. 76 Zitiert nach Dieter Henrich, Zu Kants Begriff der Philosophie. Eine Edition und eine Fragestellung, in: Kritik und Metaphysik, hg. v. Friedrich Kaulbach u. Joachim Ritter, Berlin 1966, S. 40-60. 77 Kant, Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, B 160. 78 Die Sache ist freilich auch beim späten Kant nicht ganz eindeutig: Denn auch zufolge der Vorrede zum Streit der Fakultäten, A XVIII, besteht das „Wesentliche einer Religion … im Moralisch-Praktischen“ – bleibt dann für die später, ebd., A 94, so bestimmte auf dem „Kritizism der praktischen Vernunft gegründete wahre Religionslehre“ doch nur die, ebd., A XVIII, „an sich zufällige Glaubenslehre“, was „für außerwesentlich, darum aber doch nicht für unnötig und überflüssig angesehen wird“, und in den „moralisch transzendenten Ideen“ zur Sprache kommt? 79 Kant, Preisschrift, A 66 f.
34
Rudolf Langthaler
erfolgen, in denen dieser sich nicht nur in – auseinander entwickelten – Gestalten als Weisheitslehre realisiert, das heißt diese auch – in einer Stufenfolge – wiederum in einem teleologischen Zusammenhang verstehen lässt. Darin manifestiert sich die Differenzierung der selbstreflexiven Gestalten des Vernunftglaubens und der in eigentümlicher Weise sich steigernde reflexive Charakter derselben im Fortgang ihrer Entwicklung erweist sich so für die – wie Kant sagt – „Welt, darin wir leben (mundus noumenon)“80 als bestimmend und genügt erst so der vom späten Kant ausdrücklich geforderten „Befriedigung eines Vernunftbedürfnisses“.81 Dieses weist so über die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft in gewisser Weise – ‚grenzbegrifflich‘-behutsam – hinaus und relativiert so in gewisser Weise doch die kantische Auskunft, dass der Vernunftglaube, „wenn er praktisch ist, in jedem Glauben eigentlich die Religion ausmacht“.82 Es bleibt also die Frage, ob jenes „dritte Stadium“ der Metaphysik – „das der Theologie“ – zuletzt in jener „wahren Religionslehre“ aufgehoben wird, die so auch erst jenem „Bedürfnis einer Offenbarungslehre“83 entspricht? Dass dies als Anzeichen der zunehmenden Senilität Kants gelten müsse, gar als Ausdruck dafür, dass er der ehemaligen Gewissheit – „wer einmal Kritik gekostet hat, den ekelt auf immer alles dogmatische Gewäsche, womit er vorher aus Not vorlieb nahm, weil seine Vernunft etwas bedurfte und nichts Besseres zu ihrer Unterhaltung finden konnte“84 – untreu geworden sei, ist freilich zu bezweifeln …
80 Ebd., A 140 f.; im Unterschied zur ‚gegenständlichen‘ Welt, die wir forschend ‚erklären‘ wollen, geht es in dieser ‚Welt, darin wir leben‘, darum, diese und uns selbst auch zu ‚verstehen‘. In diesem Sinne darf wohl auch die Bemerkung von Robert Theis, ‚Es ist ein Gott‘. Kants Weg vom Wissen zum Glauben, in: Zum Grund des Seins. Metaphysik und Anthropologie nach dem Ende der Postmoderne – Remi Brague zu Ehren, hg. v. Christoph Böhr, Wiesbaden 2017, S. 163-188, hier S. 188, verstanden werden: „Gott lässt sich nicht erkennen, aber wir selber vermögen uns und die Welt ohne diesen Urgrund nicht zu verstehen. Mehr ist nicht möglich, mehr ist aber auch nicht nötig.“ 81 Kant, Streit der Fakultäten, A XIX. 82 Kant, Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, B 228. Kants kritische Unterscheidung zwischen „Schranken“ und „Grenzen“ der Vernunft gewinnt hier im Kontext des ‚praktischen Vernunftgebrauchs‘ einen durchaus präzisen Sinn. 83 Siehe dazu Anmerkung 73 in diesem Beitrag. 84 Kant, Prolegomena, A 190.
2 Zum Problem des Realismus
Realismus als Herausforderung der Philosophie im Denken der Gegenwart1 Inga Römer Realismus als Herausforderung der Philosophie …
Stellt man die Frage, ob sich besondere Tendenzen in den philosophischen Debatten seit der Jahrtausendwende beobachten lassen, so wird die Antwort unter anderem eine Entwicklung erwähnen müssen, die unter dem Schlagwort ‚Realismus‘ firmiert. Ein „Gespenst des Realismus“2, so formuliert der italienische Philosoph Maurizio Ferraris mit anspielungsreichem Pathos, ginge heute insofern um, als die Realisten immer mehr würden. Und in der Tat scheint dieser Trend inzwischen vom Weblog bis hin zur akademischen Philosophie sämtliche Ebenen erfasst zu haben. Weil es sich um eine Entwicklung handelt, die gerade erst im Entstehen begriffen ist, die eine ziemlich große Unübersichtlichkeit aufweist und deren Seriosität noch keineswegs als ausgemacht gelten darf, erscheint es nötig, zunächst die Frage zu stellen, womit wir es bei diesem Trend eigentlich zu tun haben. Der erste Teil des vorliegenden Aufsatzes geht daher der Frage nach: Was verbirgt sich dahinter, dass plötzlich jedermann ‚Realist‘ sein zu wollen scheint? Wofür ist der gegenwärtige ‚Realismus‘ gegebenenfalls ein Symptom? Der zweite Teil sucht dann in drei Schritten zu zeigen, dass, erstens, der einschlägigste Versuch einer Überwindung der sogenannten korrelationistischen Tradition bei Quentin Meillassoux nicht zu überzeugen vermag, zweitens, bei Immanuel Kant eine Differenzierung des Realitätsbegriffes gefunden werden kann, die, drittens, innerhalb der zeitgenössischen Phänomenologie so weiterentwickelt wird, dass sie Ressourcen enthalten könnte, um den in der aktuellen Realismus-Debatte sich meldenden Bedürfnissen durchaus zu entsprechen. Die leitende Hypothese ist dabei, dass der philosophisch bedeutsame Kern dieser Debatte letztlich in einer Renaissance des Problems der Metaphysik liegt. 1
Der vorliegende Aufsatz ist eine weiterentwickelte Fassung meines Habilitationsvortrags, der am 21. Oktober 2015 unter dem Titel ‚Realismus‘ – ein Symptom der Gegenwartsphilosophie an der Bergischen Universität Wuppertal vorgetragen wurde. 2 Maurizio Ferraris, Manifest des neuen Realismus, Frankfurt am M. 2014, S. 13. © Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv lizenziert durch Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2020 C. Böhr (Hrsg.), Metaphysik, Das Bild vom Menschen und die Ordnung der Gesellschaft, https://doi.org/10.1007/978-3-658-31593-1_3
37
38
1
Inga Römer
Wofür ist der gegenwärtige Trend des ‚Realismus‘ ein Symptom?
Die große Anzahl an Autoren, die sich zu Realisten erklären, sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir es bei diesem Trend keineswegs mit einer Schule, womöglich sogar noch nicht einmal mit einer eigentlichen ‚Bewegung‘ zu tun haben.3 Die Bedeutungen, die der Ausdruck ‚Realismus‘ in den einzelnen unter dieser Überschrift vorgetragenen Positionen annimmt, scheinen derart heterogen zu sein, dass man meinen kann, es mit kaum mehr als einer Homonymie zu tun zu haben. Ein skizzenhafter Überblick über die Hauptfiguren soll diese These der Heterogenität belegen. Innerhalb der ersten Generation der spekulativen Realisten, die sich im April 2007 während einer Tagung am Goldsmiths College der University of London zusammengeschlossen haben, vertritt der Gründervater Meillassoux einen von ihm so genannten nicht-metaphysischen spekulativen Materialismus des Hyper-Chaos, in dem nur noch der Satz vom Widerspruch, nicht aber der Satz vom Grund gültig sei und zu dessen Erörterung die Cantor’sche Mathematik des Transfiniten herangezogen werden könne. Iain Hamilton Grant wiederum schlägt eine an Schellings spekulative Physik anknüpfende Metaphysik der Natur vor, in deren Mittelpunkt eine durch Offenheit und Produktivität gekennzeichnete dynamische Kräfteontologie steht. Ray Brassier tritt seinerseits für eine eigentümliche Form des spekulativen Realismus als Nihilismus ein, in dem er in Anknüpfung an Friedrich Nietzsches Genealogie und Sigmund Freuds Todestrieb von einer ursprünglichen Sinnlosigkeit des Realen ausgeht, in das alles Bewusstsein samt seinen Sinnstiftungen und Zwecksetzungen zurückstrebe. Graham Harman wiederum schlägt eine objektorientierte Metaphysik vor, die in Anknüpfung an und Überbietung von Martin Heidegger eine eigenständige beziehungsreiche Objektwelt in den Mittelpunkt rückt. In Deutschland vertritt Markus Gabriel einen Realismus der Sinnfelder, dem zufolge es nicht die Welt, sondern nur unendliche viele, ineinander verschachtelte Sinnfelder gebe, in denen Existierendes erscheine, eine Position, die er inzwischen als ‚neutralen Realismus‘ bezeichnet, welcher die Realität weder naturalistisch noch diskursabhängig versteht. Markus Gabriel und Maurizio Ferraris wiederum haben sich gemeinsam zu den Begründern des von ihnen so genannten ‚Neuen Realismus‘ erklärt, obgleich Ferraris der Sache nach einen ganz anderen Typ von Realismus verfolgt als Gabriel. Ferraris, der ein Dissident der Bewegung des ‚schwachen Denkens‘ um Gianni Vattimo ist, tritt für einen ästhetischen Realis3 Ray Brassier wendet sich gegen die Rede von einer „Bewegung“ des „spekulativen Realismus“ und distanziert seine eigene Arbeit von einer solchen; vgl. das Interview unter http://www.kronos.org.pl/index.php?23151,896; letzter Abruf am 28. Mai 2014.
Realismus als Herausforderung der Philosophie …
39
mus ein, in dem Realität das sich in der Wahrnehmung und Sinnlichkeit meldende Widerständige meint. Markus Gabriel hat darüber hinaus eine Allianz mit dem analytischen Philosophen Paul Boghossian, der in kritischer Auseinandersetzung insbesondere mit dem Pragmatismus von Richard Rorty dafür argumentiert, dass der vermeintliche Relativist zumindest absolute Tatsachen der Befürwortung von Theorien beziehungsweise Perspektiven annehmen muss, um sich nicht selbst zu widersprechen, womit er schon ein minimaler Realist sei. In dem 2014 von Gabriel bei Suhrkamp herausgegebenen Band Der Neue Realismus finden sich außerdem unter anderem Beiträge von John Searle, der einen Realismus als erweiterten Naturalismus vertritt, von Manfred Frank, der in Anknüpfung an Johann Gottlieb Fichte und die romantische Tradition bei Jean-Paul Sartre einen spezifischen Typ des internen Realismus ausmacht, sowie von Jocelyn Benoist, der hier einen der Phänomenologie und Ludwig Wittgenstein nahe stehenden Kontextrealismus vertritt.4 Inzwischen sind weitere Stimmen hinzugekommen, wie etwa diejenigen von Hubert Dreyfus und Charles Taylor, die in einem gemeinsam verfassten Buch einen ‚pluralistischen robusten Realismus‘ zwischen relativistischem Subjektivismus und modernem Szientismus befürworten. Außerdem ist Anton Friedrich Koch zu erwähnen, der für einen hermeneutischen Realismus eintritt, in dem das Universum logisch von der Existenz intelligenter Wesen abhängt, diese Wesen jedoch selbst im Universum existieren.5 Und in der phänomenologischen Tradition ist die Stimme von Étienne Bimbenet hinzugekommen, der der Frage nachgeht, weshalb und wie der Mensch den natürlichen Relativismus seiner tierischen, milieubezogenen Existenz in einer ‚Erfindung des Realismus‘ hin zu einem Realismus der einen Welt überschritten hat.6 Angesichts dieses Feldes von Positionen kann sich ohne 4 Quentin Meillassoux, Après la finitude. Essai sur la nécessité de la contingence, Paris 2006; dt. Nach der Endlichkeit. Versuch über die Notwendigkeit der Kontingenz, Zürich u. Berlin 2008; Iain Hamilton Grant, Philosophies of Nature after Schelling, London u. New York 2008; Ray Brassier, Nihil Unbound. Enlightenment and Extinction, London u. New York 2007; Graham Harman, Guerilla Metaphysics. Phenomenology and the Carpentry of Things, Chicago 2005; Markus Gabriel, Warum es die Welt nicht gibt, Berlin 2013; Ders., Sinn und Existenz. Eine realistische Ontologie, Berlin 2016; Ders., Neutraler Realismus, in: Markus Gabriel. Neutraler Realismus, hg. v. Thomas Buchheim, Freiburg im Br. u. München 2016, S. 11-31; Ferraris, Manifest des neuen Realismus, a. a. O.; Ders., Estetica razionale, Mailand 1997; Paul Boghossian, Fear of Knowledge. Against Relativism and Constructivism, 2006; dt. Angst vor der Wahrheit. Ein Plädoyer gegen Relativismus und Konstruktivismus, Berlin 2013; Der Neue Realismus, hg. v. Markus Gabriel, Berlin 2014. 5 Hubert Dreyfus, Charles Taylor, Retrieving Realism, Cambridge, Mass. 2015; dt. Die Wiedergewinnung des Realismus, Berlin 2016; Anton Friedrich Koch, Hermeneutischer Realismus, Tübingen 2016. 6 Etienne Bimbenet, L’invention du réalisme, Paris 2015.
40
Inga Römer
Weiteres der Eindruck aufdrängen, dass der ‚Realismus‘ im Denken der Gegenwart allenfalls ein ‚Symptom für die vielbeklagte Orientierungslosigkeit‘ innerhalb der zeitgenössischen Philosophie ist. Auf ein Symptom der Orientierungslosigkeit lässt er sich jedoch nicht reduzieren, denn bei aller Heterogenität der Ansätze, scheinen sich doch zumindest der Tendenz nach zwei Gemeinsamkeiten zwischen den selbsternannten ‚Realisten‘ ausmachen zu lassen: ein vor allen Dingen den frühen Autoren gemeinsamer ‚Gegner‘ und einige gemeinsame, nicht rein philosophische ‚Motive‘, die die Suche nach einem zeitgemäßen ‚Realismus‘ bewegen. Der gemeinsame Gegner ist der von Meillassoux angegriffene sogenannte ‚Korrelationismus‘. Mit dem Ausdruck ‚Korrelationismus‘ bezeichnet Meillassoux die philosophische Tradition von Kant bis hin zur sprachanalytischen und zur phänomenologischen Philosophie. Ihre gemeinsame Hauptthese im Ausgang von Kants kopernikanischer Wende sei, dass „wir Zugang nur zu einer Korrelation von Denken und Sein haben, und nie gesondert zu einem der beiden Begriffe“.7 „Nach Kant und seit Kant entzweiten sich rivalisierende Philosophen nicht mehr so sehr über die Frage nach der wahrhaften Substantialität als vielmehr über die Frage, wer die Korrelation ursprünglicher denkt. Ist es der Denker der SubjektObjekt-Korrelation, jener der noetisch-noematischen Korrelation oder jener der Sprache-Referenz-Korrelation?“8 Seit Kant sei „das absolute Außen der vorkritischen Denker“ verloren, „[e]in Außen, das nicht relativ zu uns war, das sich seiner Gebung gegenüber indifferent gab, um das zu sein, was es ist, in sich selbst bestehend, ob wir es denken oder nicht“.9 Der Korrelationismus ist also insofern der gemeinsame Gegner der Realisten, als er aus ihrer Sicht die ‚Betrachtung der Realität selbst aufgebe‘ zugunsten einer Auseinandersetzung mit dem ‚bloßen Korrelat für uns‘. Es würde jedoch ‚zu kurz greifen‘, diesen so verstandenen gemeinsamen Gegner als einen ‚rein intellektuellen‘ Antagonisten zu verstehen. Die Realisten meinen nicht nur, dass der Korrelationismus eine unhaltbare philosophische Position darstellt, sondern sie sind auch der Auffassung, dass er in praktischer Hinsicht mit einer Reihe von fatalen Konsequenzen einhergeht. Aus diesen Konsequenzen ergeben sich für die Realisten wiederum intellektuelle Desiderate, die als ihre gemeinsamen Motive bei der Suche nach einem zeitgenössischen Realismus verstanden werden können. Folgende drei Motive erscheinen uns in dieser Hinsicht besonders einschlägig zu sein.
7 Meillassoux, Après la finitude, a. a. O., S. 18; dt. S. 18. 8 Ebd., S. 20; dt. S. 19. 9 Ebd., S. 22; dt. S. 21.
Realismus als Herausforderung der Philosophie …
41
In einer ersten praktischen Hinsicht, und das wird bei dem ästhetischen Realisten Ferraris besonders deutlich, sehen die Realisten in der korrelationistischen Tradition von Kant bis zur Postmoderne eine ‚sich selbst missverstehende Aufklärung‘, die aufgrund eines ‚Relativismus und Perspektivenpluralismus‘ letztlich nicht zur Befreiung, sondern vielmehr zum Gegenteil geführt habe. Die Auffassung, alles, was es gebe, sei relativ auf den bei Kant menschlichen, in der Postmoderne dann auf einen spezifisch kulturellen oder gar individuellen Standpunkt, habe in einen Pluralismus der Perspektiven geführt, der nicht der Befreiung der Einzelnen, sondern vielmehr ihrer Unterdrückung Vorschub geleistet habe. Wenn alles relativ auf einen Standpunkt ist und es keine absolute Wahrheit gibt, dann könne letztlich jeder beliebige Standpunkt zur ‚Wahrheit‘ erklärt werden. Eine derartige Philosophie könne weder dem Medienpopulismus eines Silvio Berlusconi, den fadenscheinigen Kriegsbegründungen eines George W. Bush jr. noch der ‚Fake News‘-Politik eines Donald J. Trump etwas entgegenhalten. Und sie versage angesichts der vermeintlichen Alternativlosigkeit in den Reaktionen auf die Finanzkrise, der uns unangenehm einholenden harten Realität der globalen ökologischen und ökonomischen Krisen sowie der wachsenden Flüchtlingsbewegungen, die der iranisch-deutsche Schriftsteller Navid Kermani jüngst als ‚Einbruch der Wirklichkeit‘ bezeichnet hat.10 Nicht die These einer unhintergehbaren Pluralität sei das geistige Rüstzeug zur Befreiung der Menschen, sondern vielmehr die Ausarbeitung eines Realismus, aufgrund dessen es möglich würde, den populistischen und manipulativen Verstellungen nicht lediglich andere Sichtweisen, denen im Machtgefüge dann strategisch mehr Gehör zu verschaffen wäre, sondern die Realität selbst entgegenzuhalten. In einer zweiten damit verbundenen praktischen Hinsicht, und das wiederum wird von Meillassoux auf besondere Weise zugespitzt, sehen die Realisten im philosophischen Verzicht auf die Erörterung ‚des Absoluten‘ die ‚Gefahr, den Diskurs über das Absolute ausschließlich der Religion zu überlassen‘. Wenn eine heute dominierende starke korrelationistische Philosophie selbst noch das vernünftige Denken als solches auf die Korrelation einschränke, dann nehme sie sich damit systematisch „das Recht auf die Kritik des Irrationalen“ und rechtfertige „den Anspruch des Glaubens im Allgemeinen, der alleinige Weg für einen möglichen Zugang zum Absoluten zu sein.“11 „Der Fideismus ist der andere Name des starken Korrelationismus.“12 Zwar könne man sich heute immer noch moralisch empören über die praktischen Konsequenzen bestimmter religiöser Überzeugungen, aber 10 Navid Kermani, Einbruch der Wirklichkeit. Auf dem Flüchtlingstreck durch Europa, München 2016. 11 Meillassoux, Après la finitude, a. a. O., S. 74 f.; dt. S. 67 f. 12 Ebd., S. 79; dt. S. 72.
42
Inga Römer
eine rationale Kritik habe man sich als starker Korrelationist selbst unmöglich gemacht, da alle Vernunft eben nur für uns, aber nicht an sich gelte. Insgesamt richtet sich die Stoßrichtung von Meillassoux’ Argument gegen eine von ihm dem Korrelationismus angelastete intellektuelle Hilflosigkeit gegenüber dem Wiedererstarken radikal religiöser Bewegungen. Ein drittes Motiv wird etwa bei dem Schellingianer Grant deutlich, zeigt sich jedoch auch bei Dreyfus, Taylor und Koch. Diverse Realisten sind der Auffassung, dass heute eine sich auf die Naturwissenschaften stützende positivistische Weltsicht dominiert, die zu einer szientistischen und naturalistisch-ideologischen Weltanschauung neigt. Will der Philosoph dem aber etwas entgegenhalten, so muss er doch in Bezug auf die Naturwissenschaften in irgendeiner Weise dialogfähig sein. Ein postmoderner Relativismus, für den es nur menschliche Sichtweisen gibt und für den die Rede von Realität prinzipiell unter Ideologieverdacht fällt, kommt aus der Sicht der Realisten hierfür nicht in Frage. Angesichts dieser drei Motive wiederum kann sich der Eindruck einstellen, der gegenwärtige Trend des ‚Realismus‘ sei womöglich in erster Linie ein ‚Symptom für ungelöste gesellschaftspolitische Herausforderungen‘, deren intellektuelle Hintergründe kurzerhand und auf zuweilen ziemlich fragwürdige Weise in eine große philosophische Tradition zurückprojiziert werden. Bei aller Skepsis gegenüber so manchen Vorschlägen aus der gegenwärtigen Realismus-Debatte möchte ich die Hypothese wagen, dass diese Debatte im Ganzen zumindest auch als ein ‚Symptom für eine bedenkenswerte Tendenz im Denken der Gegenwart‘ verstanden werden kann: Von philosophischem Interesse ist diese Debatte meines Erachtens dort, wo sich in ihr eine ‚Renaissance des Problems der Metaphysik‘ bemerkbar macht. Damit ließe sich diese Debatte zumindest in Teilen der aktuellen Suche nach einer Reformulierung des Problems der Metaphysik zuordnen. Nach Jahrzehnten, in denen die Ablehnung der Metaphysik im Ganzen dominierte, kennt die analytische Tradition heute die beiden Felder einer modallogisch orientierten ‚speculative metaphysics‘ und einer positivistisch geprägten ‚metaphysics of science‘. In der französischen Philosophiegeschichtsschreibung führte die kritische Auseinandersetzung mit Heideggers These, Metaphysik sei Ontotheologie, nicht nur zu einer Differenzierung verschiedener Gestalten ontotheologischer Metaphysik, sondern auch zur Suche nach nicht ontotheologischen Gestalten der Metaphysik, an die heute angeknüpft werden könnte. Und – wie uns in diesen Tagen besonders lebendig vor Augen steht – gibt es auch in der deutschsprachigen Philosophie systematisch ambitionierte Metaphysikhistoriker, wobei Heideggers These hier wohl weniger stark als heuristischer Leitfaden fungiert hat als in Frankreich. Nun gibt es aber auch eine Reihe von selbsternannten ‚Realisten‘, die den Begriff der Metaphysik durchaus affirmativ für sich in Anspruch nehmen, wenngleich nicht selten
Realismus als Herausforderung der Philosophie …
43
in einer weitestgehend unbestimmten Weise. Grant und Harman etwa sprechen von einer ‚Metaphysik der Natur‘ beziehungsweise einer ‚Metaphysik der Objekte‘. Meillassoux und Gabriel lehnen den Begriff der Metaphysik zwar ab, aber nur deshalb, weil sie Metaphysik als Ontotheologie – Meillassoux – beziehungsweise als Theorie von der einen Welt – Gabriel – verstehen. Meillassoux schreibt jedoch ausdrücklich, dass die metaphysischen Probleme eine Lösung zulassen, und Gabriel vertritt selbst eine pluralistische Ontologie, die sich durchaus als Transformation des Problems der ‚metaphysica generalis‘ verstehen ließe. In diesem ersten Teil habe ich zeigen wollen, inwiefern die aktuelle Realismus-Debatte in vierfacher Weise als ein Symptom verstanden werden kann: als ein Symptom für eine gewisse Orientierungslosigkeit, als ein Symptom für ein gesellschaftspolitisches Unbehagen mit einem konstatierten Relativismus, einem Wiedererstarken radikaler religiöser Bewegungen sowie mit einem zur Ideologie neigenden Naturalismus und als ein Symptom für eine Renaissance des Interesses am Problem der Metaphysik. Im nun folgenden zweiten Teil verlasse ich die Vogelperspektive, um mich im Ausgang von einer Auseinandersetzung mit Meillassoux der Frage nach inhaltlichen Perspektiven des Umgangs mit der Realismus-Debatte zuzuwenden. Am Ende werde ich auf das Problem der Metaphysik zurückkommen.
2
Auf der Suche nach der Realität jenseits des ‚Korrelationismus‘
Eine Hauptgefahr dieser neuen Strömung des Realismus besteht darin, nicht nur hinter die Einsichten der so genannten Postmoderne, sondern noch hinter diejenigen Kants schlichtweg zurückzufallen. Wie bereits herausgestellt ist der gemeinsame Gegner der Realisten der Korrelationismus von Kant bis zu Wittgenstein und Heidegger sowie ihren heutigen Fortführern. Diese große Überwindungsgeste ist jedoch bei den aktuellen Realisten nicht immer auch mit einer ernsthaften Auseinandersetzung mit jener verworfenen Tradition verknüpft. Meillassoux’ Buch Après la finitude. Essai sur la nécessité de la contingence zeichnet sich unter anderem dadurch vor anderen Ansätzen aus, dass es seinen Ausgangspunkt beim kritisierten Korrelationismus selbst nimmt und ihn ‚von innen heraus‘ zu überwinden sucht. Diese Überwindung von innen heraus beruht im Wesentlichen auf einem negativen und einem positiven Argument. Das negative Argument soll zeigen, weshalb der Korrelationismus sich in einen Widerspruch verwickelt; das positive Argument will aufweisen, dass der Korrelationist zu einem spekulativen Realisten werden muss, wenn er jenen Widerspruch vermeiden will. Die folgende Rekonstruktion
44
Inga Römer
und Erörterung dieser beiden Argumente wird von der Frage geleitet: Vermag Meillassoux überzeugend gegen den Korrelationismus zu argumentieren, und ist seine eigene Gegenthese hinreichend begründet? Meillassoux behauptet zunächst in einem ‚negativen‘ Argument gegen die Tradition des Korrelationismus, dass es ihr aus prinzipiellen Gründen unmöglich sei, einer vormenschlichen Realität – ‚l’ancestrale‘ – Rechnung zu tragen, die unsere Wissenschaften aber doch im Ausgang von uns heute zugänglichem Material – ‚l’archifossile‘ oder ‚matière-fossile‘ – erschließen zu können meinen.13 Der Korrelationist verwickele sich notwendig in einen Widerspruch, wenn er die Gegebenheit eines Seienden vor jeder Gegebenheit zu denken versuche.14 Durch den Aufweis dieses Selbstwiderspruches hält Meillassoux bereits im ersten Kapitel von Après la finitude sämtliche Korrelationismen für widerlegt. Wie überzeugend aber ist dieses Argument? Mit dem Meillassoux-Kritiker Peter Hallward lässt sich einwenden, dass „[t]here’s nothing to prevent a correlationist from thinking ancestral objects or worlds that are older than the thought that thinks them, or indeed older than thought itself“.15 Die Antworten von Kant, Edmund Husserl und Friedrich Wilhelm Joseph Schelling können zeigen, inwiefern das der Fall ist. Für Kant hält uns die zweite Analogie der Erfahrung dazu an, im Ausgang von etwas Gegebenem regressiv nach seinen Ursachen zu suchen, wobei diese Ursachensuche durchaus über diejenige Zeitspanne hinausreichen kann, in der Menschen existiert haben. Wie László Tengelyi herausgestellt hat, ist Husserls Lösung die „Idee einer rückwärts laufenden Konstitution“, durch die die in einem faktischen Ego verankerte transzendentale Subjektivität eine Welt ohne Subjekte „als Vergangenheit einer Welt mit solchen Subjekten“ zu denken vermag.16 Dies aber wiederum kommt Schellings in den Weltalter-Fragmenten formuliertem Gedanken nahe, dass die bewusstlose Natur als unsere Vergangenheit aufgefasst werden kann. Diesen regressiven beziehungsweise rückwärts laufenden Gang aber praktizieren tatsächlich die Wissenschaften selbst, wenn sie im Ausgang von heute gegebenem fossilen Material auf die Existenz einer Natur vor der Existenz von menschlichen Lebewesen zurückschließen. Die 13 Meillassoux, Après la finitude, a. a. O., S. 26; dt. S. 24. 14 Ebd., S. 32; dt. S. 29 f. 15 Peter Hallward, Anything is Possible: A Reading of Quentin Meillassoux’s After Finitude, in: The Speculative Turn. Continental Materialism and Realism, hg. v. Levi Bryant, Nick Srnicek u. Graham Harman, Melbourne 2011, S. 130-141, hier S. 137; vgl. auch S. 138. 16 László Tengelyi, Welt und Unendlichkeit. Zum Problem phänomenologischer Metaphysik, Freiburg im Br. u. München 2014, S. 211; Edmund Husserl, Transzendentaler Idealismus. Texte aus dem Nachlass (1908–1921), hg. v. Robin D. Rollinger u. Rochus Sowa, Dordrecht, Boston u. London 2003, S. 144, Anmerkung 2; zitiert von Tengelyi an der angegebenen Stelle.
Realismus als Herausforderung der Philosophie …
45
Gegebenheit einer Welt vor der Gegebenheit ist deshalb kein Widerspruch, weil sie ‚als Vergangenheit des aktuell Gegebenen‘ verstanden werden kann. Meillassoux’ ‚positives‘ Argument für seinen eigenen spekulativen Materialismus besteht darin, aus der Not des Korrelationisten eine Tugend zu machen, indem er die Faktizität nicht als Grenze unseres Denkens, sondern durch eine interne Überwindung des Korrelationismus als Prinzip des Absoluten und damit der Realität an sich selbst auffasst. Das Argument ist dieses: Dem Korrelationisten zufolge bestehe seine Faktizität darin, dass seine Existenz nicht notwendig ist, sondern er auch nicht sein könnte; die Möglichkeit seines eigenen Nichtseins könne aber nicht als bloßes Korrelat seines Denkens aufgefasst werden, weil es die Möglichkeit seines eigenen, denkenden Seins selbst betrifft; daraus folge, dass er die Möglichkeit seines eigenen Nichtseins nur denken kann, wenn er seine Faktizität hin zum Prinzip eines vom Denken unabhängigen An-sich verabsolutiere und die universale Kontingenz zur einzigen absoluten Notwendigkeit erkläre.17 Was in Meillassoux’ Argument geschieht, lässt sich meines Erachtens mithilfe eines phänomenologischen Begriffes reformulieren, den Tengelyi bei Husserl herausgearbeitet hat und als Grundpfeiler einer spezifisch phänomenologischen Metaphysik versteht: die bloß faktische Notwendigkeit der metaphysischen Urtatsache.18 Meillassoux’ Argument schließt aus der bloß faktischen Notwendigkeit des Vollzugscogitos, das solange notwendig ist wie es vollzugsmäßig existiert, auf das Prinzip der Faktualität und Grundlosigkeit des Absoluten an sich selbst. Er verwandelt ein Moment der metaphysischen Urtatsache des Vollzugscogitos, seine Nichtzurückführbarkeit auf einen Grund, in das Prinzip des Absoluten an sich. Diese spekulative Volte aber scheint zwei Momente der Faktizität miteinander zu vermengen: Von der Faktizität als ‚Unmöglichkeit‘, für die faktische Notwendigkeit des Vollzugscogitos einen Grund anzugeben, der sie absolut notwendig machen würde, wird darauf geschlossen, dass die Faktizität als Geworfenheit ein Geworfensein in einen ‚an sich selbst chaotischen und positiv durch Grundlosigkeit und Kontingenz gekennzeichneten Kosmos‘ bedeutet. Diese Schlussfolgerung ist aber keineswegs legitim. Als bloß faktisch notwendiges Ego bin ich vielmehr in etwas geworfen, in dem ich mich nicht auskenne und innerhalb dessen ich allererst eine Orientierung gewinnen muss, etwas, das mir überdies niemals abschließend gelingt; eine positive These, und sei es die des an sich bestehenden Hyperchaos, lässt sich über das, worein ich geworfen bin, gerade nicht formulieren. Der Gedanke, dass das, worein ich geworfen bin, auch so hätte sein können, dass es keine denkenden Wesen hervorgebracht hätte, bleibt immer ein Gedanke, mit Hilfe dessen ich das, in das ich geworfen bin, zu begreifen versuche; 17 Vgl. Meillassoux, Après la finitude, a. a. O., S. 83-94; dt. S. 76-86. 18 Vgl. Tengelyi, Welt und Unendlichkeit, a. a. O., S. 180-227.
46
Inga Römer
die Denkbarkeit dieses Gedankens hängt aber keineswegs davon ab, dass das, worein ich geworfen bin ‚an sich‘ durch Grundlosigkeit und Kontingenz gekennzeichnet ist. Meillassoux’ spekulative Volte aus der Korrelation hinaus scheint zu einer dogmatischen These über die subjektunabhängige Realität an sich zu führen.
3
Das Problem der Realität bei Kant und in der Phänomenologie
Wenn es aber zutreffen sollte, dass das derzeit wohl stärkste oder zumindest am wenigsten schwache Doppelargument für die notwendige Überwindung des Korrelationismus von innen heraus nicht zu überzeugen vermag, bleibt nur der Weg, ‚aus der Korrelation selbst heraus die Frage nach der Realität zu erörtern‘: Wie aber kann im Ausgang von der für uns nun einmal unhintergehbaren Perspektive Realität und genauer so etwas wie eine subjektunabhängige Realität verstanden werden? Im Ausgang von Kant, der von den gegenwärtigen Realisten als der Urvater des Korrelationismus verstanden wird, möchte ich nun zunächst drei verschiedene Fragen nach der Realität voneinander unterscheiden, die es bei der Erörterung der genannten Frage mindestens auseinanderzuhalten gilt: die Frage nach der ‚objektiven Realität von Begriffen‘, die Frage nach dem ‚Dasein beziehungsweise der Wirklichkeit von etwas Existierendem‘ und die Frage nach dem ‚Status des Dinges an sich‘. In einem zweiten Schritt möchte ich dann skizzieren, inwiefern die phänomenologische Tradition heute der Sache nach an diese drei kantischen Perspektiven anknüpft. Erstens, die Frage nach der ‚objektiven Realität von Begriffen‘ ist bei Kant die Frage danach, ob der ‚Gegenstand‘ dieses Begriffes ‚real möglich‘ ist. Objektive Realität hat ein Begriff nicht dann, wenn etwas wirklich Existierendes unter ihn fällt, sondern wenn er sich auf einen außer ihm liegenden Gegenstand beziehen lässt, wobei dieser Gegenstandsbezug durchaus ‚a priori‘ ermittelbar sein kann. Um diese objektive Realität eines Begriffs zu sichern, braucht es nach Kant die Anschauung, was in der Streitschrift gegen Johann August Eberhard folgendermaßen zusammengefasst wird: „daß keinem Begriffe seine objective Realität anders gesichert werden könne, als so fern er in einer ihm correspondierenden Anschauung (die für uns jederzeit sinnlich ist) dargestellt werden kann“.19 Ein Begriff zeigt für uns nur dann die reale Möglichkeit eines Gegenstandes an, wenn er mindestens 19 Immanuel Kant, Über eine Entdeckung, nach der alle neue Kritik der reinen Vernunft durch eine ältere entbehrlich gemacht werden soll, 1790, AA VIII 188 f.
Realismus als Herausforderung der Philosophie …
47
vermittelst der Schemata der reinen Verstandesbegriffe in den reinen Anschauungsformen von Raum und Zeit darstellbar ist. Anderenfalls bleibt er für uns leer und verweist höchstens auf eine bloß logische Möglichkeit. Zweitens, von dieser objektiven Realität der Begriffe im Sinne einer Realmöglichkeit von Gegenständen unterscheidet Kant das ‚Dasein oder die Wirklichkeit eines Existierenden‘. Die Kategorie des Daseins gehört zur vierten Kategorienklasse, deren Besonderheit darin besteht, den Gegenstand möglicher Erfahrung in seiner objektiven Beschaffenheit nicht näher zu bestimmen, sondern „nur das Verhältnis zum Erkenntnisvermögen aus[zu]drücken“.20 Für die Erkenntnis der „Wirklichkeit der Dinge“ aber, die Kant als Position oder Setzung versteht, ist ihm zufolge „Wahrnehmung, mithin Empfindung, deren man sich bewußt ist“, erforderlich.21 Der Kategorie der Wirklichkeit kann nur in Bezug auf Empfindung Bedeutung verliehen werden, denn, so Kants berühmte These“ „In dem bloßen Begriffe eines Dinges kann gar kein Charakter seines Daseins angetroffen werden.“22 An dieser Stelle hebt Kant ausdrücklich hervor, dass es sich nicht notwendig um unmittelbare Empfindung „von dem Gegenstande selbst, dessen Dasein erkannt werden soll“, handeln muss, „aber doch“ ein „Zusammenhang desselben mit irgend einer wirklichen Wahrnehmung, nach den Analogien der Erfahrung“ zu bestehen hat,23 wenn von der Wirklichkeit eines Existierenden die Rede sein soll. Ob ein wirklich existierender Gegenstand aber tatsächlich eine bestimmte sachhaltige Eigenschaft hat, kann gleichfalls lediglich durch Empfindung ausgemacht werden, was Kant bei der Schematisierung der Kategorie der Realität deutlich macht. Dort heißt es: „Realität ist im reinen Verstandesbegriffe das, was einer Empfindung überhaupt korrespondiert; dasjenige also, dessen Begriff an sich selbst ein Sein (in der Zeit) anzeigt.“24 An dritter Stelle schließlich steht die Frage nach dem Status des Dinges an sich, von dem Kant bekanntlich sagt, es sei unerkennbar. Dieser Begriff ist einer der umstrittensten der kritischen Philosophie und seine Deutung ist ebenso schwierig wie entscheidend für die Entwicklung der nachkantischen Philosophie. Wir müssen uns hier mit zwei Bemerkungen begnügen. Die erste betrifft das, was in der Kant-Forschung oft als ‚double aspect theory‘ bezeichnet wird. Man kann Kant so verstehen, dass er mit der Unterscheidung eines Gegenstandes möglicher Erfahrung von einem Ding an sich nicht zwei verschiedene Gegenstände meint, sondern 20 Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, 1781, A 219/B 266. 21 Ebd., A 225/B 272. Hervorhebungen im Original. 22 Ebd. Hervorhebung im Original. 23 Ebd. 24 Ebd., A 143/B 182.
48
Inga Römer
vielmehr ein und dasselbe Ding in zwei verschiedenen Hinsichten betrachtet: als Gegenstand einer möglichen Erfahrung und als Ding an sich selbst betrachtet, wobei wir bei letzterem im Sinne eines „Noumenon im negativen Verstande“ lediglich „von unserer Anschauungsart desselben abstrahieren“.25 Wir hätten es dann in unserer Erfahrung durchaus mit den Dingen selbst, aber in der Erscheinungsform möglicher Gegenstände unserer Erfahrung zu tun. Bei dieser Perspektive sind die Dinge an sich Abstraktionsfiguren unserer Erfahrungsgegenstände.26 Kant kennt jedoch auch einen Begriff des „Noumenon in positiver Bedeutung“, womit er „ein Objekt einer nichtsinnlichen Anschauung“ meint.27 Mit einer nichtsinnlichen Anschauung verweist er auf eine „intellektuelle, die aber nicht die unsrige ist“.28 Er räumt ein, es möge wohl „Verstandeswesen geben, auf welche unser sinnliches Anschauungsvermögen gar keine Beziehung hat,“29 das heißt, es könnte Dinge an sich selbst geben, die nicht Abstraktionsfiguren von Gegenständen der Erfahrung, sondern schlechthin beziehungslos auf uns und unser Anschauungsvermögen sind. Zweierlei also wird von Kant eingeräumt: Die Gegenstände unserer Erfahrung sind als Dinge an sich selbst betrachtet ‚anders‘ als sie von uns erkannt werden, und es könnte Dinge an sich selbst geben, die schlechthin ‚gar nicht‘ von uns erkannt werden können, auch nicht als Gegenstände der Erfahrung. Aus meiner Sicht können einige Entwicklungen der zeitgenössischen Phänomenologie so aufgefasst werden, dass sie an diese drei kantischen Perspektiven anknüpfen. Ich möchte nun nacheinander die drei gemeinten Entwicklungen benennen und bei jeder einzelnen erläutern, in welcher systematischen Verbindung sie meines Erachtens zu den drei kantischen Konzepten stehen. An erster Stelle sei auf zwei ‚Realismen‘ hingewiesen, die in der jüngeren Generation französischer Phänomenologen von Claude Romano und Jocelyn Benoist entwickelt wurden. Romano entwickelt in Anknüpfung an Heidegger das, was er eine ‚herméneutique événementiale‘, eine Ereignishermeneutik, nennt.30 Das Ereig25 Ebd., B 307. Hervorhebung im Original. 26 Dieser Aspekt ist jüngst von Lucy Allais hervorgehoben worden: vgl. Lucy Allais, Manifest Reality. Kant’s Idealism and his Realism, Oxford 2015. 27 Kant, Kritik der reinen Vernunft, B 307. Hervorhebung im Original. 28 Ebd. 29 Ebd., B 309. 30 Die Darstellung stützt sich auf die Zusammenfassung in Claude Romano, L’aventure temporelle. Trois essais pour introduire à l’herméneutique événementiale, Paris 2010. Bemerkenswert ist, dass auch Gabriel in Heideggers Denken nach der so genannten ‚Kehre‘ einen von Gabriel so genannten ‚realistischen Entwurf‘ erblickt. Ohne dass Gabriel auf Romano Bezug nimmt, visiert er damit der Sache nach eine ganz ähnliche Lesart des späten Heidegger an wie sein französischer Kollege. Allerdings wirft Gabriel
Realismus als Herausforderung der Philosophie …
49
nis sei etwas, das spontan, von sich aus geschehe und prinzipiell nicht antizipiert werden könne. Als solches verleihe es einerseits der Welt im Ganzen einen neuen Sinn und bringe andererseits die möglichen Modi des Antwortens – ‚événementiaux‘ – hervor, durch die das Subjekt – ‚l’advenant‘ – sich zum Ereignis und der durch es generierten Welt verhalten kann. Romano bezeichnet seine Ereignishermeneutik auch als einen „Holismus der Erfahrung“, der auf einen „deskriptiven Realismus“ führe.31 Weil die Rede von etwas Nicht-Realem, bloß Illusionärem überhaupt nur innerhalb eines ‚als Realität schon akzeptierten, holistischen Rahmens der Welt‘ sinnvoll sei, bedeute die Erfahrung von Realität nichts anderes, als dass sich das Erfahrene in den holistischen Rahmen der schon bekannten Welt einfügen lasse und innerhalb seiner beschrieben werden könne. Die ultimative Realität sei das Ereignis,32 die konkreten Erfahrungen der Realität aber seien Erfahrungen der Einschreibbarkeit des Erfahrenen in das schon Bekannte eines ereignishaft gestifteten Weltganzen. Jocelyn Benoist hat schon vor Romano mit der Ausarbeitung einer realistischen Philosophie begonnen, die Nähen zur phänomenologischen, aber auch zur wittgensteinianischen Tradition hat. Der Grundgedanke seines Realismus ist, dass wir ‚in‘ der Realität sind und uns nicht erst einen Zugang zu ihr verschaffen müssen. „‚Real‘ sei ‚das, was man hat‘ (ce que l’on a)“.33 Diese Realität, als das, was wir ‚haben‘, sei das, was wir schon akzeptiert und angeeignet haben. Sie ist ein ‚Kontext‘, den wir notwendig voraussetzen müssen, wenn wir uns intentional auf etwas beziehen. Als Bedingung der Möglichkeit der Intentionalität ist dieser Kontext des Realen allerdings nur in der Intentionalität und durch diese selbst zugänglich. Benoist spricht daher auch von einem „intentionalen Realismus“.34 Der von Romano und Benoist erörterte Rahmen oder Kontext des Verstehens aber kann als eine transformierende Weiterführung des ‚kantischen Begriffes der objektiven Realität von Begriffen‘ verstanden werden, die die reale Möglichkeit von etwas vorzeichnen. Auf der Ebene synthetischer Urteile ‚a priori‘ fungiert Heidegger trotz der bei diesem angelegten ‚realistischen Linie‘ vor, diese letztlich nicht durchgehalten zu haben, weil Heidegger an dem Gedanken, dass das Sein den Menschen brauche, stets festhielt; vgl. Markus Gabriel, Ist die Kehre ein realistischer Entwurf?, in: Suchen – Entwerfen – Stiften. Randgänge zum Entwurfsdenken Martin Heideggers, hg. v. David Espinet u. Toni Hildebrandt, Paderborn 2014, S. 87-106, hier S. 103. 31 Romano, L’aventure temporelle, a. a. O., S. 88, S. 111. 32 Ebd., S. 42: Das Ereignis sei „ … ‚realer‘ als alle Realität, ‚äußerlicher‘ als alle Exteriorität“. 33 Die Darstellung stützt sich auf die kleine Monographie Jocelyn Benoist, Éléments de philosophie réaliste. Réflexions sur ce que l’on a, Paris 2011. 34 Ebd., S. 53.
50
Inga Römer
die objektive Realität von Begriffen als Bedingung der Möglichkeit konkreter Gegenstandserfahrung. Die Realität eines Kontextes wird in jenen Konzeptionen zwar gerade nicht mehr als schlechthin ‚a priori‘ aufgefasst, sondern vielmehr als ereignishaft gestiftet oder durch die Praxis erwachsen. Die Realität von Begriffen bezieht sich damit spezifischer auf die ‚reale Möglichkeit und die damit verbundene Darstellbarkeit innerhalb unseres aktuellen, jedoch wandelbaren Kontextes des Verstehens‘. Zugleich fungiert dieser Kontext nicht nur als intellektuelle Vorbedingung für die Auffassung konkreter Gegenstände, sondern er geht selbst mit einer – in der Regel sogar ziemlich starken – Wirksamkeit für unser Leben einher, die zu durchbrechen keineswegs einfach ist. An dieser Stelle wird eine zweite Tendenz zeitgenössischer Phänomenologie bedeutsam, die jener ersten gegenübersteht und sich bei Marc Richir und Tengelyi beobachten lässt. Aus ihrer Perspektive hat jener holistische Rahmen beziehungsweise jener Kontext des schon Angeeigneten in einer bestimmten Hinsicht den Status dessen, was Richir eine ‚symbolische Institution‘ nennt, wenngleich letztere vielfältig und nicht holistisch verfasst ist und von Richir auch in einem anderen Gesamtzusammenhang entwickelt wird. Symbolische Institutionen sind verfestigte Sinnstrukturen, die aus vormals ‚spontanen Sinnbildungen‘ hervorgegangen sind. Diese spontanen Sinnbildungen dürfen allerdings nicht als eine unabhängige Urschicht verstanden werden, die dann in einer sekundären Schicht symbolischer Institutionen verfestigt und auch verstellt wird, sondern spontane Sinnbildungen kommen nur in den Zwischenräumen der symbolischen Institutionen und deren Reibungen mit dem Leben auf. Nach Tengelyi, der Richirs Konzeption weiterführt, sind unsere sämtlichen Erfahrungen zwar sprachlich und damit durch symbolische Institutionen vermittelt, bestehen in ihrem Kern jedoch gerade darin, dass jede Erfahrung von etwas immer auch eine Erfahrung ist, die wir so mit unseren hergebrachten Denkfiguren im Leben machen, dass wir zu deren Verschiebung gedrängt werden.35 Dieser Überschuss aber, der in der Erfahrung über die symbolischen Institutionen hinaus eine lebendige Sinnbildung aufkommen lässt, verweise durch diese Sinnbildungen auf das, was eigentlich ‚Realität‘ genannt werden könne. ‚Real im tieferen Sinne‘ sind hier ‚nicht‘ die symbolischen Institutionen, der Kontext oder das gestiftete Weltganze, sondern ‚das, was sich durch sie hindurch vermittelst der lebendigen Sinnbildungen in seiner Widerständigkeit meldet‘. In einem Gespräch hat Tengelyi mir gegenüber in dieser Hinsicht einmal den Ausdruck ‚subversiver Realismus ‘ gebraucht. In einem derartigen subversiven Realismus ist die Realität 35 Vgl. zu diesem Gedanken die Schlussfolgerungen in László Tengelyi, Erfahrung und Ausdruck. Phänomenologie im Umbruch bei Husserl und seinen Nachfolgern, Dordrecht 2007, S. 341-352.
Realismus als Herausforderung der Philosophie …
51
gerade nicht der etablierte Kontext, sondern das, was sich durch etablierte Kontexte hindurch meldet und diese unterbricht, unterwandert und verschiebt.36 Diese lebendige Sinnbildung aber kann als eine transformierende Weiterführung des ‚kantischen Begriffes des Daseins oder der Wirklichkeit‘ verstanden werden: Aus Sicht des Ansatzes von Richir und Tengelyi ist die nach Kant auf die Realität im Sinne der Existenz verweisende Empfindung nie ein bloßes Sinnesdatum, sondern immer schon mit einer spontanen Sinnbildung verknüpft, die zugleich den bisherigen Kontext symbolischer Institutionen neu ausrichtet; der spontan von sich aus in den Lücken der etablierten Kontexte auftauchende lebendige Sinn in seiner Widerständigkeit ist es, der anzeigt, was es ‚wirklich‘ und gerade nicht nur in unseren Begriffen gibt. Es handelt sich dabei aber um nichts Geringeres als um eine ‚Wirklichkeit, die die bisherige reale Möglichkeit übersteigt‘. Eine dritte Perspektive betrifft die Frage nach einer phänomenologischen Umarbeitung des kantischen Begriffes eines Dinges an sich selbst. Während Kant die logische Möglichkeit einer intellektuellen Anschauung von Dingen an sich selbst einräumt, hält Husserl diese Annahme für einen Widersinn. In den Ideen I führt er aus, dass es schlichtweg zum Wesen des Dinges gehöre, nur perspektivisch aufgefasst werden zu können, was auch für einen Gott nicht anders sein könne: „Prinzipiell“, so heißt es an jener berühmten Stelle der Ideen I, „bleibt immer ein Horizont bestimmbarer Unbestimmtheit, wir mögen in der Erfahrung noch so weit fortschreiten, noch so große Kontinuen aktueller Wahrnehmungen von demselben Dinge durchlaufen haben. Kein Gott kann daran etwas ändern“.37 Weil er den Gedanken eines nicht in Abschattungen gegebenen Dinges an sich für „widersinnig“ hält,38 ist ihm das uns in Abschattungen gegebene wirkliche Ding ‚zugleich‘ das Ding an sich selbst. Zur Bestimmung der Wirklichkeit des Dinges greift er jedoch noch einmal auf einen kantischen Begriff zurück, indem er ihn umdeutet: „Danach ist Wirklichkeit eines Dinges“, so schreibt Husserl, „eine ‚Idee‘ in Kant’schem Sinn, Korrelat der ‚Idee‘ eines ‚gewissen‘, aber im voraus nie vollbestimmten, vielmehr unendlich
36 Inzwischen wäre zu berücksichtigen, dass Benoist zwei weitere Bücher veröffentlicht hat, in denen er den Grundgedanken dieser zweiten Perspektive in einer spezifisch konturierten Weise in den Mittelpunkt zu rücken scheint – vgl. Le bruit du sensible, Paris 2013 – , während er im nächsten Buch – L’adresse du réel, Paris 2017 – beide, hier einander gegenübergestellten Perspektiven miteinander zu verknüpfen scheint. 37 Edmund Husserl, Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Erstes Buch: Allgemeine Einführung in die reine Phänomenologie, hg. v. Karl Schuhmann, Den Haag 1976, § 44, S. 92. 38 Ebd., § 43, S. 89 f.
52
Inga Römer
vieldeutigen Wahrnehmungsverlaufs, eines ins Unendliche erweiterungsfähigen“.39 Die Umdeutung besteht darin, dass die auf das Unendliche verweisende regulative Idee, die bei Kant als eine den Erfahrungsgang lediglich anleitende Vernunftidee fungiert, von Husserl zu einer konstitutiven Bestimmung des Einzeldinges selbst gemacht wird: Das Ding selbst ‚ist‘ ein unendliches Abschattungskontinuum. Die Frage ist, was das genau bedeutet. In Welt und Unendlichkeit hat Tengelyi zwei verschiedene Antworten Husserls voneinander unterschieden: Während Husserl in den Ideen I noch von der vollständigen Bestimmtheit des Dinges ausgehe, fände sich im letzten Paragraphen der Ideen II der Gedanke, dass Dinge ein „offenes Wesen“ hätten, welches immer wieder „neue Eigenschaften annehmen kann“,40 wobei etwa Kulturprädikate als anschauliche Beispiele fungieren können. Mit diesem letzten Gedanken aber wird die Offenheit der kantischen regulativen Idee in das Ding selbst hinein verlegt. Kants Begriff des Dinges an sich wird von Husserl also so transformiert, dass das ‚uns gegebene wirkliche Ding das Ding an sich selbst ist‘, verstanden allerdings als ein ‚unendliches Abschattungskontinuum mit einer seinem Wesen zugehörigen Offenheit‘. Nimmt man die drei hier herausgestellten Weiterführungen in den Blick, so lässt sich Folgendes zusammenfassend festhalten: Die objektive Realität im Sinne der realen Möglichkeit wird von einer Bedingung a priori zu einem wandelbaren Kontext, der eher dem Status eines, mit Michel Foucault gesprochen, historischen Aprioris nahekommt; die Realität im Sinne der Wirklichkeit aber vermag mittels lebendiger Sinnbildungen den jeweils aktuellen Kontext realer Möglichkeit zu durchbrechen und zu verschieben; die ontologische Grundlage dieser Macht des Wirklichen gegenüber dem Möglichen aber liegt in der Auffassung des Dinges an sich als einem unendlichen Abschattungskontinuum mit offenem Wesen, das in keinem System statischer Möglichkeiten im Vorhinein antizipiert werden kann.
39 Edmund Husserl, Logische Untersuchungen. Ergänzungsband: Erster Teil: Entwürfe zur Umarbeitung der VI. Logischen Untersuchung und zur Vorrede für die Neuauflage der Logischen Untersuchungen (Sommer 1913), hg. v. Ullrich Melle, Den Haag 2002, S. 197, zitiert in Tengelyi, Welt und Unendlichkeit, a. a. O., S. 313. 40 Edmund Husserl, Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Zweites Buch: Phänomenologische Untersuchungen zur Konstitution, hg. v. Marly Biemel, Den Haag 1952, S. 299, zitiert in Tengelyi, Welt und Unendlichkeit, a. a. O., S. 543.
Realismus als Herausforderung der Philosophie …
4
53
Ausblick: Der Begriff der ‚Realität‘ und das Problem der Metaphysik
Der hier eingeschlagene Weg, das Problem der ‚Realität‘ mit Kant und der Phänomenologie aus der ‚Korrelation‘ selbst heraus zu erörtern, hat durchaus Implikationen für die Erörterung des Problems der Metaphysik. Bereits Kant selbst ist keineswegs nur ein Kritiker der Metaphysik, sondern auch ihr Erneuerer unter kritischen Vorzeichen. Die ‚metaphysica generalis‘ des ‚ens qua ens‘ wird von ihm eingeschränkt auf eine bloße Ontologie der Gegenstände möglicher Erfahrung. Die so geartete Ontologie bezeichnet er in der Preisschrift über die Fortschritte der Metaphysik als „Teil der Metaphysik“, aber nur im Sinne einer „Propädeutik“, die „Vorhof der eigentlichen Metaphysik“ sei, weil sie selbst noch nicht das „Übersinnliche“ „berührt“.41 Während jedoch bei Kant jene Ontologie auf die Lehre von der objektiven Realität der Kategorien in ihrer Anwendung auf Raum und Zeit festgelegt bleibt, scheinen die skizzierten phänomenologischen Weiterführungen der Begriffe von objektiver Realität, Wirklichkeit und Ding an sich auf eine offene Ontologie hinzudeuten, in der wandelbare Kontexte von spontanen Sinnbildungen verschoben werden und dies vor dem Hintergrund einer Auffassung des Dinges als einem in seinem Wesen offenen unendlichen Abschattungskontinuum. Diese Perspektive vermag aber vielleicht durchaus auf zwei der drei diagnostizierten Bedürfnisse der zeitgenössischen Realisten zu antworten: Ein subversiver Realismus der Widerständigkeit spontaner Sinnbildungen birgt in sich ein kritisches Potential, um einem anti-aufklärerischen Relativismus entgegenzuwirken, und der Rahmen einer dynamischen Spannung zwischen reale Möglichkeiten stiftenden Kontexten und widerständiger Wirklichkeit scheint durchaus einer Wissenschaftsphilosophie Platz einräumen zu können, die sich im Dialog mit den Einzelwissenschaften entfaltet. Nimmt man aber weiterhin die kantische Architektonik zum Leitfaden, so wäre diese offene Ontologie der ‚Realität‘ eben nur der Vorhof zur Metaphysik, keineswegs aber bereits die Metaphysik selbst, insofern letztere es mit dem Übersinnlichen zu tun hat und von Kant selbst in die Tradition einer ‚metaphysica specialis‘ eingeordnet wird. Hier ließe sich die Frage stellen, ob Kants Denken und seine phänomenologischen Transformationen auch in Hinblick auf diese „eigentlich[e] Metaphysik“42 eine heute anschlussfähige Perspektive bieten könnten. Es ist vielleicht Emmanuel Levinas’ Rezeption des kantischen Gedankens einer reinen praktischen Vernunft, die hier eine interessante Weiterführung verspricht: Das ‚Jenseits des Seins‘ einer 41 Immanuel Kant, Preisschrift, 1804, A 11. 42 Ebd.
54
Inga Römer
reinen praktischen Vernunft bedeutet für Levinas, dass die mögliche Metaphysik in der ethischen Bedeutsamkeit zwischen den Menschen liegt.43
43 Vgl. Emmanuel Levinas, Le primat de la raison pure pratique, eingel. v. Inga Römer, in: Philosophie 142 (2019) S. 3-11; vgl. dazu von der Verfasserin Le raison pure pratique, au-delà de l’être. Levinas lecteur de Kant, in: ebd., S. 12-29.
3 Metaphysik: ihr Sitz im Leben
Die Frage nach dem Ursprung als die Frage nach Gott Metaphysik im Schatten der Evolutionstheorie Martin Rhonheimer
1
Religiöse Konflikte um die Evolutionstheorie
Religiöse Menschen fühlen sich durch das, was oft undifferenziert als ‚neodarwinistische‘ Evolutionstheorie bezeichnet wird, in ihrem Glauben verunsichert. Dabei sind nicht nur überzogene Ansprüche der Naturwissenschaft das Problem. Ebenso problematisch sind auch weit verbreitete, eher simple, ja philosophisch und theologisch ‚unaufgeklärte‘ und unreflektierte Gottesvorstellungen – und zwar auf allen Seiten. Aus diesem Grund landen beide Seiten in der Irrationalität: Die religiösen ‚kreationistischen‘ Gegner der Evolutionstheorie in einer Vorstellung von ‚Schöpfung‘, die zum Schutze ihres Glaubens jeglicher rationalen naturwissenschaftlichen Aufklärung geradezu verbissen ablehnend gegenüber steht; die naturwissenschaftlich gebildeten Kämpfer gegen Schöpfungs- und Gottesglauben in einer nicht weniger irrationalen Extrapolation naturwissenschaftlicher Erkenntnisse in Bereiche, für die ihre Wissenschaft ihrem eigenen Selbstverständnis gemäß gar nicht zuständig sein kann. Zustimmung zur modernen Evolutionslehre, so denken gläubige Menschen dann notgedrungen, wenn auch kurzschlüssig, hat notwendigerweise die Verabschiedung vom Glauben an ‚Gott‘, ‚Geist‘, ‚Freiheit‘ und so weiter zur Voraussetzung. Man muss dieser Sorge Verständnis entgegenbringen und zugestehen, dass die Vertreter dieser Sichtweise ein legitimes Anliegen vertreten: den Glauben an eine höhere Bestimmung des Menschen, seine Freiheit und seine Würde vor dem Würgegriff eines szientistischen Materialismus zu verteidigen. Dass sich auf diese Weise unter Gläubigen Wissenschaftsfeindlichkeit breit macht und generell gegenüber dem herrschenden Wissenschaftsbetrieb Skepsis genährt wird, ist bedauerlich und nicht ohne Gefahren.
© Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv lizenziert durch Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2020 C. Böhr (Hrsg.), Metaphysik, Das Bild vom Menschen und die Ordnung der Gesellschaft, https://doi.org/10.1007/978-3-658-31593-1_4
57
58
2
Martin Rhonheimer
Metaphysik als Vermittlungsinstanz zwischen Naturwissenschaft und Religion
Um dieser Gefahr zu begegnen und die angebliche Unvereinbarkeit von moderner Evolutionstheorie und Schöpfungsglauben zu widerlegen, versuchen sich Theologen oft darin, Naturwissenschaft und Theologie direkt miteinander ins Gespräch zu bringen – ohne philosophische Vermittlung. Insbesondere die klassische Metaphysik, ja die gesamte metaphysische Tradition, von der auch nicht wenige katholischen Theologen meinen, sie sei durch Immanuel Kant in ihren Grundfesten erschüttert und widerlegt worden, erfährt dabei gelinde gesagt eine stiefmütterliche Behandlung. Doch ebenso falsch wie der Versuch einer naturwissenschaftlichen Dekonstruktion der Theologie beziehungsweise des religiösen Glaubens an einen Schöpfergott ist das Ansinnen, dieser Dekonstruktion mit rein theologischen Mitteln, also ohne philosophisch-metaphysische Vermittlung begegnen zu wollen. In Wirklichkeit sind die Fragen, welche die Evolutionstheorie für Menschen aufwirft, die am Glauben an einen transzendenten Schöpfergott und an eine, von Materie zu unterscheidende, geistige Dimension der menschlichen Natur festhalten, genuin metaphysischer Natur. Es sind Fragen jener philosophischen Grunddisziplin, die aufgrund eines rein rationalen und damit auf ihre Weise wissenschaftlichen, also gerade nicht theologischen, an Offenbarungswahrheiten orientierten Grundlagendiskurses vorgeht und damit auch zur eigentlichen Instanz einer gegenüber aller Wissenschaft kritischen Vernunft wird. Die Metaphysik ist die gemeinsame Plattform, auf der sich sowohl Theologen wie auch Naturwissenschaftler jener Perspektive und Argumentationspraxis zu öffnen vermögen, die von jedem Denkenden geteilt werden kann. Metaphysik ist, im Unterschied zu den einzelnen Bereichen der Naturwissenschaften, jedermann zugänglich. Sie ist, aristotelisch gesprochen, keine ‚Partikularwissenschaft‘, sondern die allgemeine und grundlegende Wissenschaft, die nach den letzten Gründen des Seienden überhaupt fragt. Sie ist nach klassischer Auffassung, die durch die cartesianisch-idealistische Revolution erschüttert, von Kant ignoriert und schließlich liquidiert wurde, die disziplinierte Kontinuation unseres Alltagverstandes wie auch der zu diesem Verstand gehörige disziplinierte und reflektierte Gebrauch unserer Alltagssprache. Moderne Kritik der klassischen Metaphysik geht einher mit der Verachtung, ja Diskreditierung des ‚vorwissenschaftlichen‘ Alltagsverstandes. Diese Diskreditierung des ‚gesunden Menschenverstandes‘ begann mit René Descartes,
Die Frage nach dem Ursprung als die Frage nach Gott
59
wurde bei Kant zur systematischen Metaphysikkritik und bei Georg Wilhelm Friedrich Hegel schließlich zum Kennzeichen aller angeblich wahren Philosophie.1 Metaphysische Reflexion zwingt dazu, naturwissenschaftliche Alleinzuständigkeitsansprüche für kognitive Geltung zu hinterfragen, solche Ansprüche also nicht einfach, wie dies Naturwissenschaftler oft tun, dogmatisch vorauszusetzen, sondern erst einmal rational vor anderen Geltungsansprüchen zu rechtfertigen. Das zwingt Naturwissenschaftler auch, die impliziten metaphysischen Annahmen ihrer angeblich rein naturwissenschaftlich begründeten Positionen freizulegen. Der Zwang zur philosophischen Argumentation und metaphysischen Klärung kann hier Transparenz schaffen – falls der Wille besteht, sich darin zu engagieren.
3
Warum Kants Metaphysikkritik eine Fehlkonstruktion ist und ignoriert werden darf
Ist so verstandene Metaphysik jedoch nach Kant überhaupt noch möglich? Wer heute für Metaphysik in der klassischen, vorcartesianischen Tradition plädiert, sollte begründen, weshalb Kants Metaphysikkritik diese klassische Tradition der Metaphysik in keiner Weise trifft und er sie deshalb ignorieren darf. Das werde ich im Folgenden in gebotener Kürze und unvermeidlicher Unvollständigkeit tun. Kants Kritik der Metaphysik – seine ‚Kritik der reinen Vernunft‘ – ist ein faszinierender, genial konstruierter Versuch, aus den Sackgassen des, wie er ihn nannte, ‚dogmatischen‘ Rationalismus der deutschen Schulphilosophie und des auf den britischen Inseln blühenden skeptizistischen Empirismus herauszukommen, gleichzeitig aber auch eine gigantische Fehlleistung, weil sie ihr Ziel einer grundsätzlichen Metaphysikkritik gänzlich verfehlt. Wer heute in der klassischen Tradition Metaphysik betreibt, braucht sich durch Kants Kritik der Metaphysik in keiner Weise betroffen zu fühlen, weil sie das, was Metaphysik in klassischer Tradition immer war und auch heute noch ist, schlicht nicht trifft. Größe und Tragik Kants liegen darin, dass er die Brüchigkeit der Philosophie seiner Zeit zwar durchschaute, selbst jedoch ganz von ihren Voraussetzungen abhängig blieb. Er versuchte die beiden damals dominierenden Positionen, die einzigen, die er kannte, nämlich Rationalismus und – sensualistischen – Empirismus, 1 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Differenz des Fichteschen und Schellingschen Systems der Philosophie – ‚Differenzschrift‘ – , in: Ders., Jenaer Kritische Schriften, Bd. 1, Hamburg 1979, S. 21: „Der gesunde Menschenverstand kann es nicht fassen, wie das für ihn unmittelbar Gewisse für die Philosophie zugleich ein Nichts ist“.
60
Martin Rhonheimer
dadurch zu überwinden, dass er ihre Irrtümer miteinander verknüpfte; was aber an den beiden Positionen richtig war, warf er über Bord. Vom Rationalismus adaptierte Kant die Vorstellung, es gebe erfahrungsunabhängige, aus ‚reiner Vernunft‘ stammende, also apriorische Strukturen des Erkennens, verwarf aber dessen – durchaus aristotelische – Lehre von der grundlegenden Bedeutung der intellektuellen Intuition und damit die klassische Lehre von der Abstraktion, die er – im Unterschied zu dem schottischen Philosophen Thomas Reid, der von 1710 bis 17962 lebte – nur noch in ihrer Verfälschung durch John Locke3 als „empirische Allgemeinheit“ kannte, als die lediglich „willkürliche Steigerung der Gültigkeit, von der, welche in den meisten Fällen, zu der, die in allen gilt“, und die er deshalb zutiefst missverstand.4 Vom Empirismus wiederum, der alle Erkenntnis auf die Verarbeitung von Sinnesdaten reduzierte, übernahm Kant den Irrtum, dass die Sinne uns keinen Zugang zum realen Sein, insbesondere zur Erkenntnis von Substanz und Kausalität vermitteln können; wie auch die sensualistische These, es sei menschlicher Erkenntnis unmöglich, über das in der sinnlichen Anschauung Gegebene hinauszugehen. Gleichzeitig verwarf er aber die richtige – auf Aristoteles und die Scholastik zurückgehende – Ansicht der Empiristen, dass im Verstand nichts ist, was nicht zuvor in den Sinnen war: ‚nihil est in intellectu quod non prius fuerit in sensu‘. Hier blieb Kant mit seinem Apriorismus – sowohl auf der Ebene der transzendentalen Ästhetik wie auch der transzendentalen Logik – ganz und gar Rationalist. Kant – und das war das epochale Verhängnis – ließ sich unverständlicherweise durch einen argumentativen Lapsus David Humes täuschen. Wie Kant schrieb, „unterbrach“ Humes Argument den „dogmatischen Schlummer“ der rationalistischen Metaphysik, in der er gefangen war, und gab „seinen Untersuchungen im Felde der speculativen Philosophie eine ganz andere Richtung“.5 Welches war dieses Argument? Der Empirist Hume hatte erstaunlicherweise behauptet, man könne den Stoß einer Billardkugel auf eine andere Billardkugel, der diese in Bewegung setzt, nicht ‚sehen‘; die kausale Verknüpfung zwischen dem Aufprall der ersten und der nachfolgenden Bewegung der zweiten Billardkugel sei also, weil man nichts dergleichen ‚sehen‘ könne, gar kein Gegenstand sinnlicher Erfahrung; deshalb Thomas Reid, Essay on the Intellectual Powers of Man, 1785, in: Ders., Inquiry and Essays, hg. v. Ronald E. Beanblosson u. Keith Lerner, Indianapolis 1983, S. 245 f. 3 John Locke, An Essay Concerning Human Understanding, 1690, hg. v. Peter H. Nidditch, Oxford 1975, S. 159, II, § 9. 4 Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, 21787, B 4, AA III 29. 5 Vgl. Immanuel Kant, Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können, 1783, A 13, AA IV 260. 2
Die Frage nach dem Ursprung als die Frage nach Gott
61
könne auch der Verstand daraus nicht auf eine kausale Verknüpfung schließen, man könne – infolge des wiederholten Auftretens des Nacheinander der beiden Ereignisse, woran wir uns gewöhnen – an eine solche nur ‚glauben‘.6 Hume hat mit dieser Argumentation nicht nur Kant, sondern Generationen von Philosophen in die Irre geführt. Denn Stöße beziehungsweise Krafteinwirkungen zwischen Körpern – kinetische Energie – können naturgemäß gar nicht Gegenstand des Sehsinnes sein; was man ‚sehen‘ kann, sind Gestalten, Lichtintensitäten, Farben, auch Ortsveränderungen und deren Tempo relativ zu anderen sichtbaren Gegenständen. Hingegen sind Stöße beziehungsweise Krafteinwirkungen zwischen Körpern Gegenstand des ‚Tastsinnes‘ – und insofern sie akustisch wahrnehmbar sind, des Gehörs. „Der Trugschluss besteht darin, vom Sehsinn etwas zu verlangen, was er gar nicht wahrnehmen kann: kinetische Energie ist keine Farbe.“7 Wer einen Finger zwischen die Billardkugeln hält, so dass der Stoß auf den Finger wirkt, wird aber ‚spüren‘, was er selbstverständlich nicht ‚sehen‘ kann, dann aber auch sofort ‚verstehen‘, weshalb die zweite Kugel von der ersten in Bewegung gesetzt wird. Man braucht den Dachziegel, der einem auf den Kopf fällt, nicht zu ‚sehen‘, um ihn zu ‚spüren‘ und dadurch zu verstehen, dass hier eine Einwirkung stattfand und der verspürte Schmerz wohl eine Ursache in einem Gegenstand hat, der, ohne gesehen worden zu sein, dennoch real ist, und dass deshalb auch die ‚Verknüpfung‘ zwischen Aufprall und Schmerz real ist. Eine einzige solche Erfahrung genügt – es ist keine Verallgemeinerung einer Vielzahl solcher Sinneserfahrungen nötig – , und der Verstand hat – sofern man bei Verstand ist – die Ereignisabfolge als kausale Verknüpfung verstanden, hat also den Kausalzusammenhang aus der Sinneserfahrung ‚abstrahiert‘ und damit auch das Kausalitätsprinzip als ‚Gleichzeitigkeit‘ und ‚Notwendigkeit‘ der Verknüpfung von Ursache und Wirkung erfasst – denn Kausalität hat als solche nichts mit zeitlicher Abfolge zu tun, dies ist ein weiterer Fehler Humes; die Notwendigkeit der Verknüpfung hingegen besteht, und hier irrte Kant, nur in einer Richtung.8 6 David Hume, A Treatise of Human Nature, 1739, hg. v. David Fate Norton u. Mary J. Norton, Oxford 2000, 1.3.14, S. 110 ff., und An Abstract of a Book lately Published; Entitled ‚A Treatise of Human Nature‘, in: Ebd., S. 409 ff.; vgl. auch David Hume, An Enquiry Concerning Human Understanding, VII, 1, in: Ders., Enquiries Concerning the Human Understanding and Concerning the Principles of Morals, Nachdruck der Ausgabe v. 1777, hg. v. Lewis Amherst Selby-Bigge, Oxford 21902, 1972, S. 63 ff. 7 Vgl. Roger Verneaux, Critique de la Critique de la raison pure de Kant, Paris 1972, S. 75: „Le sophisme consiste à demander à la vue ce qu’elle ne peut pas percevoir: l’énergie cinétique n’est pas une couleur.“ 8 Eine Notwendigkeit der Verknüpfung zwischen Ursache und Wirkung besteht nur ex post, das heißt: Wenn die Wirkung eingetreten ist, hängt sie mit Notwendigkeit von
62
Martin Rhonheimer
Genau dieses verstandesmäßige Erfassen intelligibler Zusammenhänge und Strukturen ‚in‘ der Sinneserfahrung beziehungsweise in der sinnlichen Vorstellung und in mentalen Bildern, die Aristoteles ‚phantasmata‘ nannte, ist der Akt der Abstraktion – ‚aphairesis‘: jener Akt also, der von Kant als intellektuelle Intuition – oder ‚intellektuelle Anschauung‘ – erkenntnistheoretisch geächtet worden ist. Das von Aristoteles analysierte Zusammenspiel von Sinneserfahrung und intellektueller Intuition – von ‚phantasmata‘ und ‚nous‘ – ist der Ausgangspunkt aller Erkenntnis, aber auch aller Metaphysik und Wissenschaft. Deshalb sind Gegenstand unserer Erkenntnis nicht, wie Locke meinte, die von den Sinnen produzierten Ideen und Bilder; vermittels sinnlicher Vorstellungen gelangt der Intellekt vielmehr zu den Dingen selbst. Die Ideen sind nicht Gegenstand oder Ziel unseres Erkennens, sondern lediglich Mittel dazu. ‚Was‘ wir auf diese intentionale Weise erkennen, Gegenstand und Ziel des Erkennens also, ist die intelligible Wahrheit der Dinge. Das humesche Vorurteil, Notwendigkeit und Allgemeinheit von Erkenntnis könnten unmöglich über die Sinneserfahrung zugänglich werden, ist die bereits in der Vorrede von Kants Kritik der reinen Vernunft apodiktisch – sprich: dogmatisch – deklarierte, unbewiesene und falsche Grundprämisse der ganzen metaphysikkritischen Konstruktion, die Kant, in zirkulärer Weise, immer dann als Argument anführt, wenn er in seiner Beweisführung steckenbleibt – etwa in den Analogien der Erfahrung, der Schematismuslehre oder der transzendentalen Deduktion. Die Kritik der reinen Vernunft ist in Wahrheit ein komplex konstruierter Zirkelschluss, reine Tautologie, eine Petitio Principii, eine Form von Zirkularität, die dann im nachfolgenden deutschen Idealismus, insbesondere bei Hegel – etwa in der Vorrede zur Phänomenologie des Geistes – , zur Methode aller Wissenschaft schlechthin erklärt wird. Zusammen mit der Ablehnung der klassischen Abstraktionslehre, die eine Lehre der intellektuellen Intuition in das uns von den Sinnen gebotenen Erfahrungsmaterial ist, wurde der humesche Trugschluss zum Ursprung der kantischen epistemologischen Diskreditierung der Sinnlichkeit – „Anschauungen ohne Begriffe sind blind“9 – und seiner – zugegeben genialen – Konstruktion eines transzendentalen Idealismus, der auf der Grundlage der rationalistischen Lehre der angeborenen Ideen – apriorische Begriffe, die ohne sinnliche Anschauung ‚leer‘ sind10 – theoretische Erkenntnis auf die Naturwissenschaft beschränkt, die Fragen der Metaphysik jedoch – folgenreich – in die praktische Philosophie verbannt und uns damit der Ursache ab; das bedeutet aber nicht, dass sie, bevor sie eingetreten ist, auch mit Notwendigkeit hat eintreten müssen. 9 Kant, Kritik der reinen Vernunft, B 75, AA III 75. 10 Ebd.
Die Frage nach dem Ursprung als die Frage nach Gott
63
des wichtigsten Instrumentes beraubt hat, um zwischen Naturwissenschaft und religiösem Glauben beziehungsweise Theologie zu vermitteln. Kants – später verfasste – Kritik der Urteilskraft ist dafür ein schwacher Ersatz, aber auch ein Zeichen dafür, dass eine Lücke besteht und Kant sich dessen bewusst war. Kants Metaphysikkritik beruht in jeder Hinsicht auf falschen Voraussetzungen, die auch unserer Alltagserfahrung widersprechen. Kant war der methodische Realismus der vorcartesianischen Tradition als Methode der Metaphysik unbekannt. Deshalb verkannte er auch den Ausgangspunkt aller Metaphysik: die Sinneserfahrung. Er war und blieb Rationalist, Humes Billardkugeln verleiteten ihn jedoch dazu, den Grundfehler des Empirismus durch jenen des Rationalismus zu kompensieren – eine andere Möglichkeit, die Naturwissenschaft vor dem empiristischen Skeptizismus zu retten, sah er nicht. Es kann nicht erstaunen, dass Kant nie zu ‚erklären‘ vermochte, wie aus der Kombination von ‚blinder‘ sinnlicher Anschauung und ‚leeren‘ Begriffen, also einem empirisch inhaltslosen Apriori des Verstandes Erkenntnis zustande kommt. Kants Lösung bleibt ein reines, unbewiesenes Postulat. Er selbst meinte schließlich im Jahre 1790 im Streit mit seinem Kritiker Johann August Eberhard, auf welche Weise so „völlig heterogene Erkenntnisquellen“ wie Sinnlichkeit und Verstand in Verbindung treten und objektive Naturerkenntnis möglich machen können, „dieses konnten wir nicht (und das kann auch niemand) weiter erklären“.11 Kant übersah völlig, dass es so etwas wie leere Gedanken und Begriffe ebenso wenig geben kann wie leere Bilder; denn ebenso wie Bilder immer etwas darstellen, sind Gedanken immer ‚Gedanken von etwas‘ – oder sie sind nicht. Da hatte Aristoteles von Anfang an richtig gesehen: Der Intellekt ist von Natur aus eine ‚tabula rasa‘ und damit passiv, empfangend; zugleich ist er aber als aktiver Intellekt und reine Spontaneität wie ein Licht, das im sinnlich Erfahrenen und durch dieses, aber seiner eigenen geistigen Natur gemäß, das ‚eidos‘ der Dinge erfasst. Eine Metapher kann das veranschaulichen: Man denke sich einen dunklen Raum voller Gegenstände, die man hören, riechen, vielleicht in ihren Umrissen diffus erkennen kann … Und plötzlich erhellt eine Lichtquelle den Raum und man ‚sieht‘, obwohl sich nichts verändert hat und nichts dazugekommen ist. Das Licht ist das Analogon zum Intellekt: Er macht sichtbar, was für die Sinne immer schon da war, aber nur durch ihn ‚gesehen‘, das heißt: in seinem Wesen erkannt werden kann. Gemäß dieser auf Aristoteles zurückgehenden Auffassung besitzt der Intellekt eine Doppelnatur: Er ist einerseits ‚tabula rasa‘ – eine ‚leere Tafel‘, die keinerlei apriorische Denkstrukturen enthält und reine Rezeptivität ist – andererseits aber 11 Immanuel Kant, Über eine Entdeckung, nach der alle neue Critik der reinen Vernunft durch eine ältere entbehrlich gemacht werden soll, BA 124, AA VIII 250.
64
Martin Rhonheimer
auch Spontaneität, gleichsam ein Licht, das ‚in‘ den sinnlichen Vorstellungsbildern12 – den Aristotelischen ‚phantasmata‘ – und vermittelt durch sie – denn ‚die Seele denkt nie ohne Vorstellungsbilder‘13 – zum Erfassen des Wesens der Dinge gelangt, wie sie dann in Universalbegriffen zum Ausdruck gelangen. Das ‚Apriori‘ des Intellektes ist, aufgrund seiner Natur, einzig und allein seine Geistigkeit und damit seine Universalität. Denn das Universale, Allgemeine ‚existiert‘ nicht. Platon dachte, dass die Allgemeinbegriffe in einem separaten Reich der Ideen existieren. Doch gemäß aristotelischer Tradition gibt es in der Wirklichkeit – in der Natur – nur individuelle, konkrete Dinge. Alle Universalität und begriffliche Allgemeinheit stammen aus dem Verstand oder Intellekt. Berühmt ist das aus dem arabischen Aristotelismus – Avicenna und Averroes – stammende scholastische Prinzip: „Intellectus facit universalitatem in rebus“: Der Intellekt bewirkt das Allgemeine in den Dingen.14 Geistige Erkenntnis ist nicht einfach Abbild der wirklichen Dinge – solche Abbilder finden sich eher in den sinnlichen Vorstellungen – , sondern Repräsentation der Wirklichkeit gemäß der Natur des Intellektes. Klassischer erkenntnistheoretischer Realismus heißt: Wir erkennen tatsächlich die Wirklichkeit die Dinge nicht so wie sie ‚in sich‘ sind, sondern der Natur unseres geistigen Verstandes gemäß, was bedeutet: wir erkennen sie in einer viel tieferen Weise, als sie ‚in sich‘ sind, weil wir nämlich das Einzelne jeweils im Lichte der Allgemeinheit seines Wesens erfassen.15 Durch die ‚Rückwendung zu den Sinnesvorstellungen‘, die das sinnlich erfahrbare Einzelne zum Gegenstand haben, wird das allgemeine Wesen gleichsam im konkret sinnlich Erfahrbaren inkarniert und in der Konkretion dieses sinnlich Erfahrbaren geschaut. Rein ‚abstraktes‘ Denken ohne Sinnesvorstellungen ist unmöglich. So können wir Menschen keinen Kreis ‚denken‘, der nicht auch eine bestimmte ‚Liniendicke‘ und ‚Farbe‘ besitzt, weil unser Denken immer von Vorstellungen begleitet ist, unbeschadet der Tatsache, dass wir ganz unabhängig davon wissen, was das Wesen eines Kreises ist. Umgekehrt haben wir dann auch die Ver12 Aristoteles, De Anima, III, 7 431b 1: „Der Verstand erkennt die Wesensform – eidos – in den sinnlichen Vorstellungsbildern – en tois phantasmasin aei – .“ 13 Ebd., 431a 15. 14 Nachweise etwa bei den spätmittelalterlichen Antinominalisten Adam Burley, Walter Burley, Questions on the De anima of Aristotle, hg. v. Edward A. Synan, Leiden 1997, S. 106. Bei Thomas von Aquin finden wir – in seinem Frühwerk De ente et essentia, cap. 2: „Unde dicit Commentator in principio de anima quod intellectus est qui agit universalitatem in rebus. Hoc etiam Avicenna dicit in sua metaphysica.“ 15 Vgl. dazu ausführlicher Martin Rhonheimer, Homo sapiens: die Krone der Schöpfung. Herausforderungen der Evolutionstheorie und die Antwort der Philosophie, Wiesbaden 2016, S. 217-227.
Die Frage nach dem Ursprung als die Frage nach Gott
65
suchung, rein Geistiges uns vorzustellen und dafür Bilder heranzuziehen. Begriffe sind aber – auch hier irrte Hume – gerade keine Bilder, sondern eben Begriffe, auch wenn wir sie im konkreten Denken nicht von Vorstellungen zu trennen vermögen. Das hängt mit der leib-geistigen Einheit der menschlichen Natur zusammen; die geistige Seele ist eben die Form eines leiblichen Organismus und vollzieht ‚alle‘ ihre Funktionen in diesem und durch diesen. Aufgrund ihres methodischen Realismus eröffnet uns die klassische, vorcartesianische Metaphysik wegweisende Möglichkeiten der Vermittlung von Naturwissenschaft und Schöpfungsglauben. Beide, Naturwissenschaft und Metaphysik, sind, in allerdings verschiedener Weise, Erkenntnis des Seienden, sie stehen sich nicht als Konkurrenten auf dem Felde der Natur gegenüber, sondern kooperieren in einer Art, die Kant für unmöglich hielt. Das zeigt sich gerade im klassischen Begriff der Natur, wie er sich am prägnantesten bei Thomas von Aquin zeigt.
4
Thomas von Aquin: Natur als den Dingen eingegebene göttliche Kunst
Der Begriff der Natur wurde während der letzten Jahrzehnte durch eine Konzeption beschädigt, die sich vornimmt, nicht auf dem Weg der Metaphysik, sondern durch den Aufweis angeblicher naturwissenschaftlicher Erkenntnislücken eine Vermittlung zwischen Naturwissenschaft und Schöpfungsglauben zu leisten: ‚Intelligent Design‘. Intelligent Design versteht ‚Natur‘ beziehungsweise natürliche Prozesse und Strukturen in Analogie zu Artefakten, Kunstprodukten beziehungsweise Produkten einer höheren Intelligenz, die selbst nicht diesen Prozessen unterworfen ist, sie jedoch eingreifend mitgestaltet. Damit wird die Beziehung zwischen Kunst und Natur verkannt, ja auf den Kopf gestellt.16 Die klassischen Philosophen – auch Kant war dies noch durchaus geläufig – vertraten ja die exakt gegenteilige Ansicht: sie lehrten ‚ars imitatur naturam‘, Kunst und Technik imitieren die Natur. Jede menschliche Kunst oder Technik ist immer nur eine – schwache und unvollkommene – Nachahmung der Natur. Das Original ist die Natur und nicht die Kunst! Deshalb ist die Natur auch kein ‚Kunstwerk‘ Gottes und Gott weder Künstler, noch Ingenieur oder Techniker, sondern Schöpfer. Doch was ist Natur?
16 Für meine ausführliche Kritik an Kreationismus und ‚Intelligent Design‘ verweise ich auf Rhonheimer, Homo sapiens, a. a. O., Kap. 4, S. 93-124.
66
Martin Rhonheimer
Was Natur im Unterschied zur bloßen Kunst ist, wurde wohl am prägnantesten von Thomas formuliert. Für ihn ist Natur nicht analog zu einem menschlichen Kunstwerk oder Artefakt zu sehen, sondern als ein nach eigenen Gesetzen wirkendes, sich selbst organisierendes System sogenannter Zweitursachen, das für sein ‚Funktionieren‘ keines Eingreifens von außen mehr bedarf, als Ganzes jedoch vom Schöpfer beständig im Sein erhalten wird. Dieses System funktioniert so, ‚als ob‘ es intentional, also absichtlich und auf Grund der Kenntnis der Ziele, die durch einzelne Gesetzmäßigkeiten erreicht werden, wirken würde. In Wirklichkeit jedoch gibt es trotz Ordnung und Zweckmäßigkeit – Teleologie – innerhalb der ‚Natur‘ gerade keine Vernunft, keine Erkenntnis von Zielen und damit auch keine Intentionalität, also kein absichtliches Verfolgen von Zwecken. Was ist nun aber Natur im Unterschied zur Kunst? Die prägnanteste Formulierung liefert Thomas in seinem Kommentar zur Aristotelischen Physik. Hier bezeichnet er ‚Natur‘ als ‚ratio artis divinae rebus indita‘, was ich übersetze mit: „Die den Dingen eingegebene Kunstfertigkeit Gottes“. Wörtlich heißt es: „Die Natur ist nichts anderes als der den Dingen eingegebene Plan – ratio – einer Art Kunst – ratio cuiusdam artis – , nämlich der göttlichen, durch welche diese Dinge auf ein bestimmtes Ziel hingeordnet werden“. Natur ist also gemäß Thomas nicht ‚Produkt‘ göttlicher Kunst, kein Kunstwerk oder Artefakt, sondern die den geschaffenen Dingen eingegebene ‚ratio‘ dieser göttlichen Kunst, also gewissermaßen göttliche Kunstfertigkeit in den geschaffenen Dingen – ‚ars‘: Kunst, Geschicklichkeit, Fertigkeit, Gewandtheit, Geschick, auch: Kunstgriff. Thomas präzisiert mit einem Beispiel, was er damit meint: Es sei, „wie wenn ein Schiffsbauer dem Holz die Fähigkeit verleihen könnte, aus sich selbst die Gestalt eines Schiffes hervorzubringen.“17 17 Thomas von Aquin, In Octo libros Physicorum Aristotelis expositio, hg. v. Mariani Maggiolò, lib. 2, lectio 14, n. 8, Turin 1965: „ … natura nihil est aliud quam ratio cuiusdam artis, scilicet divinae, indita rebus, qua ipsae res moventur ad finem determinatum: sicut si artifex factor navis posset lignis tribuere, quod ex se ipsis moverentur ad navis formam inducendam“; näheres dazu in Martin Rhonheimer, Neodarwinistische Evolutionstheorie, Intelligent Design und die Frage nach dem Schöpfer. Aus einem Schreiben an Kardinal Christoph Schönborn, in: Imago Hominis 14 (2007) H. 1, S. 54 ff., abrufbar unter www. imabe.org/index.php?id=598; letzter Zugriff Januar 2019; vgl. dann auch Christoph Kardinal Schönborn, Fides, Ratio, Scientia. Zur Evolutionsdebatte, in: Schöpfung und Evolution. Eine Tagung mit Papst Benedikt XVI. in Castelgandolfo, hg. v. Stephan Otto Horn u. Siegfried Wiedenhofer, Augsburg 2007, S. 79-98, bes. S. 90 f.; Rolf Schönberger, Gott denken, in: Robert Spaemann, Der letzte Gottesbeweis. Mit einer Einführung in die großen Gottesbeweise und einem Kommentar zum Gottesbeweis Robert Spaemanns von Rolf Schönberger, München 2007, S. 91 f., sowie Ders., Abhängige Selbständigkeit. Metaphysische Reflexion über den Begriff der Schöpfung im Ausgang von Thomas von
Die Frage nach dem Ursprung als die Frage nach Gott
67
‚Natur‘ ist also im Unterschied zu ‚Kunst‘ – oder ‚Technik‘ – gerade ein intrinsisches Prinzip von Prozessen, Entwicklungen, Ursächlichkeiten. So fährt Thomas im Physikkommentar fort: „die Natur scheint sich nämlich in nichts anderem von der Kunst zu unterscheiden als dadurch, dass die Natur ein innerliches Prinzip ist, die Kunst hingegen ein äußerliches Prinzip. Falls nämlich die Kunst des Schiffsbaus dem Holz innerlich wäre, dann würden Schiffe auf natürliche Weise entstehen, so wie sie jetzt durch Kunst produziert werden.“18 Nicht Gott allein ist also eine Art Künstler, der die Natur nach einer ‚ratio‘, einem Plan geschaffen hat, sondern die Natur selbst ist Künstlerin, weil nämlich Gott ihr die ‚ratio‘ seiner Kunst und damit gleichsam ‚Kunstfertigkeit‘ eingegeben hat. Natur ist nicht einfach ein Hervorgebrachtes, sondern an Gottes Kunst und ihrer ‚ratio‘, ihrer inneren Logik und ihrem Plan, partizipierend, selbst ein Hervorbringendes, ein Prinzip des Werdens und Gestaltens. Auch Kant stand in seiner Kritik der Urteilskraft noch ganz in dieser klassischen Tradition, wenn er schrieb, man sage „von der Natur und ihrem Vermögen in organisierten Produkten bei weitem zu wenig, wenn man diese ein Analogon der Kunst nennt; denn da denkt man sich den Künstler (ein vernünftiges Wesen) außer ihr. Sie organisiert sich vielmehr selbst“.19 Wäre das Holz so beschaffen, dass es Schiffe hervorbringen könnte. bräuchte man beim Anblick von Schiffen nicht danach zu fragen, wer denn nun der Schiffsbauer sei, sondern man würde zu verstehen suchen, gemäß welchen Gesetzen sich aus Holz Schiffe entwickeln. Das wäre dann eine rein naturwissenschaftliche Frage. Ist sie beantwortet, ist alles verstanden, was wir zu wissen brauchen. Nach einem Schiffsbauer – analog zum ‚Watchmaker‘ – brauchen wir dann gerade nicht mehr zu suchen. Genau deshalb ahmt Kunst die Natur lediglich nach, kann sie aber nicht reproduzieren. Kunstprodukte tragen nicht die ‚ratio artis‘, die Kunstfertigkeit beziehungsweise die Vernunft, der sie entspringen in sich, sondern spiegeln nur den Plan wider, ‚dem gemäß‘ sie erzeugt worden sind. Sie sind nur Erzeugtes, selbst aber nicht Prinzip des Werdens und Erzeugens. Natur hingegen analog zu Kunstprodukten zu verstehen, bedeutet, das Wesen von Natur als ein System von Zweitursachen mit der intrinsischen Fähigkeit zur Aquin, in: Naturalisierung des Geistes? Beiträge zur gegenwärtigen Debatte um den Geist, hg. v. Kurt Appel, Hubert Philipp Weber, Rudolf Langthaler u. Sigrid Müller, Würzburg 2008, S. 171-201, bes. S. 187. 18 Thomas von Aquin, In Octo libros Physicorum Aristotelis expositio, a. a. O.: „ … nullo enim alio natura ab arte videtur differre, nisi quia natura est principium intrinsecum, et ars est principium extrinsecum. Si enim ars factiva navis esset intrinseca ligno, facta fuisset navis a natura, sicut modo fit ab arte.“ 19 Immanuel Kant, Kritik der Urteilskraft, B 292-293, AA V 374.
68
Martin Rhonheimer
Selbstorganisation zu verkennen. Das führt nicht nur zur Blockade gegenüber unermüdlichem naturwissenschaftlichen Weiterfragen – also zu Kants „fauler Vernunft“20; man verbaut sich damit auch die Möglichkeit, Naturwissenschaft mit der Idee der Schöpfung zu versöhnen. Die Natur wird auf diese Weise gleichsam unterschätzt und die Frage nach dem Schöpfer methodisch am falschen Ort gestellt.
5 Gott ist kein Lückenbüßer: Die zunehmende Dringlichkeit der Frage nach Gott durch wissenschaftlichen Fortschritt Zu erkennen, worin ‚Natur‘, ihre Potentialität und die Dynamik ihrer Prozesshaftigkeit besteht, ist Sache der Naturwissenschaft. Die moderne Evolutionsbiologie hat uns hier Dimensionen eröffnet, die zu früheren Zeiten undenkbar waren. Durch die Genetik und dann ganz besonders die Epigenetik sowie das Gesamt heutiger Molekularbiologie wissen wir, dass die Natur tatsächlich Wirkkräfte in sich birgt, die Evolution verstehbar machen. Vor allem lassen sie auch plausibel werden, wie aus einem nicht zielgerichtet ablaufenden Prozess Ordnung entstehen kann. Die Kombination von physikalischen Gesetzen, die – selbst der biologischen Evolution enthoben – aller Evolution zugrunde liegen und sie auf bestimmte Möglichkeiten festlegen, von epigenetischer Steuerung der Evolution des Genoms, umweltbedingten Zwängen und dem Mechanismus der natürlichen Selektion, der immer nur im Dienste des Überlebens beziehungsweise optimierter Anpassung wirkt und damit ein deutlich teleologisches Element enthält – die Kombination all dieser Elemente charakterisiert eine Logik der Evolution, bei der das Zufallsmoment lediglich erklärt, weshalb diese eines dermaßen langen Zeitraums bedurfte, es aber auch – wie vor Hunderten Millionen von Jahren im Kambrium – einzelne Etappen einer geradezu explosionsartigen Beschleunigung gab.21 Gottesbeweise werden immer wieder als Lückenbüßer dargestellt: Gott sei die Erklärung dafür, was auf natürliche beziehungsweise wissenschaftliche Weise keine Erklärung findet. Je mehr die Naturwissenschaft aber fortschreitet und diese Lücken, wie es immer wieder geschehen ist, nach und nach füllt, desto überflüssiger scheint dann auch Gott zu werden.
20 Immanuel Kant, Der einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration des Daseins Gottes, A 108-110, AA II 119 f. 21 Vgl. dazu Rhonheimer, Homo sapiens, a. a. O., S. 15-38.
Die Frage nach dem Ursprung als die Frage nach Gott
69
In Wirklichkeit verhält es sich gerade umgekehrt: Je mehr wir durch die Naturwissenschaft über die Strukturen der Natur und ihre intrinsische Fähigkeit zur Selbstorganisation wissen und je mehr wir sehen können, wie diese sinn- und zweckvolle Gebilde hervorbringt, die ja gerade auch von Biologen in der Sprache der Teleologie beschrieben werden, ja gar nicht anders beschrieben werden können, desto mehr drängt sich die Frage auf, woher dieses System ‚Natur‘ kommt. Genau das ist die metaphysische Frage. Wäre Natur Chaos und Sinnlosigkeit, würde sie also nicht so aussehen, ‚als ob‘ sie zweckmäßig geplant worden sei, und würden ihre Wirkkräfte nur Chaos hervorbringen, dann hätten wir gute Gründe, an der Existenz eines göttlichen Schöpfers zu zweifeln. Die Frage nach dem Ursprung, die metaphysische Frage, ergibt sich nicht aus der Unvollkommenheit oder den Defizienzen des Seienden und der Natur, aus dem naturwissenschaftlich Unerklärbaren, sondern gerade aus der Vollkommenheit und inneren Konsistenz dieser Natur. Je mehr uns die Naturwissenschaften ein erklärbares und intelligibles System ‚Natur‘ vor Augen führen, desto dringlicher stellt sich die Frage nach Gott als die Frage nach dem Ursprung. Gleichsam ‚evolutionsphilosophisch‘ gesprochen stehen wir heute vor der Tatsache eines nichtintentionalen, intelligenzlosen natürlichen Entwicklungsprozesses, der aber eine teleologisch strukturierte und als solche beschreibbare, sinnvolle und gesetzmäßige Ordnung schafft, eine Ordnung zudem, die überhaupt, wie gerade Biologen uns zeigen, nur in einer teleologischen Sprache adäquat und verständlich beschrieben werden kann. Teleologische Beschreibungen stehen mit mechanischwirkursächlichen Erklärungen nicht in Konkurrenz, besitzen vielmehr einen eigenen Erklärungswert; andernfalls wären solche Beschreibungen sinn- und bedeutungslos. Die Tatsache nämlich, dass ein natürlicher Prozess zu einem bestimmten Ziel führt und deshalb auch als zweckmäßig beschrieben werden kann, ist in Wirklichkeit ein Grund dafür, dass dieser Prozess überhaupt abläuft.22 Teleologie ist Bestandteil der Wirklichkeit des Seienden, und ihre Offensichtlichkeit ist, wie auch Kant zugeben muss, Motivation zur wissenschaftlichen Erforschung der Natur, auch wenn sie nicht selbst eine der Arten von Ursachen ist, nach der die Naturwissenschaft fragt, um Naturphänomene und -prozesse zu ‚erklären‘.23 22 David Braine, The Human Person. Animal and Spirit, Notre Dame, Ind. 1992, S. 230: „The form of a teleological explanation does not involve that some end is an efficient cause, but that some system is such that the fact that some development is conducive to a certain end is a reason for that development’s taking place.“ 23 Vgl. Kant, Kritik der Urteilskraft, B 268-270, 294-295, AA 359-361 sowie 375 f.; es scheint allerdings, dass Kant durchwegs ‚Teleologie‘ mit ‚Intentionalität‘ und damit mit ‚Absichtlichkeit‘ gleichsetzt; deshalb sind für ihn teleologische Erklärungen anthropomorphe Erklärungen, die in der Natur etwas suchen, was es nur beim menschlichen Handeln
70
Martin Rhonheimer
Die metaphysische Frage nach dem Ursprung wird deshalb durch die moderne Naturwissenschaft, auch durch die Evolutionstheorie keinesfalls überflüssig; sie wird sogar durch die Erkenntnis einer in sich stimmigen Naturordnung als Ergebnis und auch Triebkraft von Evolution verschärft zur Frage nach dem Ursprung von Natur und ihrer intrinsischen ‚Kunstfertigkeit‘, also ihrer Fähigkeit zur Selbstorganisation. Die Frage nach dem Ursprung von Natur ist aber die Frage nach der letzten Ursache des Seins, jener Ursache also, die selbst keine Ursache hat, die also auf Grund ihres Wesens ‚ist‘. Dieses Erste, das Ursprung von all dem ist, dessen Sein nicht sein Wesen ausmacht, nennen wir Gott. Die Metaphysik, die diese Frage stellt, war deshalb schon für Aristoteles die ‚Erste Philosophie‘ – wobei hier ‚Philosophie‘ für Wissenschaft generell steht – und wurde von ihm, weil sie zu Gott als der ersten, durch nichts verursachten Ursache führt, auch ‚theologia‘ genannt.
6
Richard Dawkins Unwahrscheinlichkeitsargument und seine Verkennung der metaphysischen Frage
Naturwissenschaftliche Gottesleugner wie Richard Dawkins erheben implizit die Naturwissenschaft zur ‚philosophia prima‘, zur ‚Ersten Philosophie‘. Da es für sie keine über die Naturwissenschaften hinausgehenden rationalen Fragen nach Gründen und Ursachen geben kann, wird die Naturwissenschaft selbst zur Metaphysik. Da sie sich dessen nicht bewusst sind, ja meinen, mit der Leugnung der Metphysik sei diese aus dem Horizont des menschlichen Wissens eliminiert, bedienen sie sich in intellektuell undisziplinierter Weise metaphysischer Argumente, ja missbrauchen die Naturwissenschaft zu metaphysischen Zwecken, wobei ihnen notgedrungen gravierende Fehler unterlaufen. So übernimmt Dawkins in einer zentralen Passage seines Buches The God Delusion24 unversehens und von ihm selbst unbemerkt – man könnte auch sagen: aus metaphysischer Ahnungslosigkeit – den Grundirrtum von Intelligent Design, Gott als eine bloß ‚übernatürliche‘, also nicht wirklich transzendente, sondern nur höhere und in der Ursachenkette letzte Superintelligenz zu verstehen. Dawkins gibt: Intentionalität als bewusstes Verfolgen von Zwecken. Hier ist Kant jedoch einem Irrtum unterlegen: Intentionalität ist lediglich eine bestimmte von Form von Teleologie – Handlungsteleologie – , sie ist mit ihr nicht gleichzusetzen. Deshalb sind teleologische Erklärungen auch keine intentionalen Erklärungen, die, wie Kant meint, irgendwelche mit mechanisch-kausalen Erklärungen in Konkurrenz stehenden Absichten in die Natur hineinzuinterpretieren versucht. 24 Richard Dawkins, The God Delusion, London 2006; dt. Der Gotteswahn, Berlin 2007.
Die Frage nach dem Ursprung als die Frage nach Gott
71
versucht dann mit einem zunächst verblüffenden Argument einen solchen Gott zu eliminieren beziehungsweise seine Existenz als extrem unwahrscheinlich nachzuweisen. Aufgrund der Annahme, mit ‚Gott‘ sei eine oberste, besonders eindrückliche und übermächtige in die Natur eingreifende und natürliche Prozesse erklärende Ursache zu verstehen, gelingt es ihm mühelos, diesen Gott mit einem rein logischen Argument erfolgreich aus dem Universum zu eliminieren. Dawkins Argument lautet: Wer aufgrund der extremen Unwahrscheinlichkeit, dass sich die gewaltige Komplexität des Universum rein zufällig so entwickelt hat, wie das der Fall ist – zu Ordnung, zum Menschen hin und so weiter – , auf die Existenz Gottes als Ursache einer so unwahrscheinlichen Entwicklung schließt, der merkt nicht, dass ein solches Wesen ‚Gott‘ ja noch ungleich komplexer sein müsste als das Universum selbst, dessen Existenz es erklären soll. Rein logisch sei deshalb die Existenz Gottes noch viel unwahrscheinlicher als all jene Komplexität, die angeblich durch ihn verursacht sein soll.25 Dawkins übersieht dabei, dass Gott hier selbst als Bestandteil des ‚Systems‘ jener Ursachen verstanden wird, dessen Wirkmechanismus durch seine Existenz erklärt werden soll. Er reduziert Gott einfach auf eine besonders wirkmächtige und damit auch besonders komplexe Naturursache höherer oder höchster Ordnung. Wäre dies der Fall, dann wäre dieser ‚Gott‘ gar nicht, was wir unter Gott als Schöpfer verstehen, sondern letztlich selbst Bestandteil der Natur, nämlich erste und oberste Naturkausalität. Wir hätten also nicht Gott bewiesen, sondern nur das Problem um eine Ebene zurückverschoben und müssten jetzt nach der Ursache von Gott fragen. Kurz: Die Frage nach Gott würde dem naturwissenschaftlichen Befund eine unnötige und unfruchtbare Komplikation hinzufügen. Doch ist in Wirklichkeit für den Begriff Gottes – so wie er in der christlichen Tradition verstanden wird – gerade wesentlich, dass Gott nicht Bestandteil des Systems von Naturursachen, sondern diesem transzendent und zudem nicht hochkomplex, sondern von größter Einfachheit ist. Wie Hans Kessler richtig bemerkt: „Wer nach Gott fragt, fragt – recht verstanden – nicht zurück nach einer ersten Ursache, also nach dem ersten Glied einer Kette von Ursachen, sondern er fragt nach dem Grund der ganzen Kette, also nach dem, was die Kette als Ganze begründet und trägt – und zwar in jedem ihrer Zustände“.26 Gott wirkt nicht ‚im‘ System und auch nicht ‚am‘ System. ‚Er hat das System erschaffen.‘ Robert Spaemann hat dafür eine treffende Metapher gefunden: Die Natur ist wie ein Film, der auf einer Leinwand abläuft, Gott ist der Projektor. „Die eigentliche Ursache des ganzen Geschehens, der Projektor, taucht natürlich im Film 25 Ebd., S. 147. 26 Hans Kessler, Evolution und Schöpfung in neuer Sicht, Kevelaer 2009, S. 100.
72
Martin Rhonheimer
selbst nicht auf. Er kommt in der Kette der innerfilmischen Ursachen beziehungsweise Antecendensbedingungen nicht vor. Aber er ist die wahre Ursache der ganzen Kette und aller ihrer Glieder. Schöpfung ist kein Ereignis, auf das wir im Studium der Geschichte des Kosmos einmal stoßen werden. ‚Schöpfung‘ bezeichnet das Verhältnis des ganzen Weltprozesses zu seinem außerweltlichen Ursprung, dem göttlichen Willen.“27 So wie der Projektor im Film nicht vorkommt, so kommt auch Gott in der Natur nicht vor; wie man einen Film genießen kann, ohne etwas über den Projektor zu wissen, kann man Naturwissenschaft betreiben und alle die Natur betreffenden Fragen zu beantworten suchen, ohne etwas über Gott zu wissen, ja ohne die Frage nach ihm überhaupt stellen zu müssen. Da Gott nicht das erste Glied in einer Kette von Naturursachen ist, sondern Ursache dessen, was wir Natur nennen, wächst auch mit der zunehmenden Komplexität auf der Ebene der natürlichen Ursachenreihen die Wahrscheinlichkeit und Plausibilität seiner Existenz. Denn genau das ist ja die Frage nach Gott: „Woher kommt das ‚System‘ natürlicher Ursachen als Ganzes?“ und nicht: „Worin besteht das erste und gleichsam oberste Glied der Kette dieser natürlichen Ursachen?“ Je komplexer und vollkommener das System ist, desto vernünftiger und dringlicher wird die Frage nach einer Ursache des Gesamtsystems.
7
Die Frage nach dem Ursprung des ‚Systems Natur‘ als die metaphysische Frage
Die Frage nach dem Ursprung wird auch, wie von theologischer Seite oft argumentiert wird, keineswegs durch den zufälligen, nicht zielgerichteten Charakter des Evolutionsprozesses provoziert: dann wäre Gott wieder ein Lückenbüßer. Die metaphysische Frage nach dem Ursprung entspringt einzig und allein dem Staunen über das ‚Ergebnis‘ dieses Prozesses: die beobachtbare, ja offensichtliche Existenz einer Naturordnung, mit mathematisch beschreibbaren Naturgesetzen und einer inneren Zweckmäßigkeit, die ja nun gerade von Biologen nicht nur nicht geleugnet wird, sondern zum Standardrepertoire wissenschaftlicher Beschreibungspraxis biologischer Phänomene gehört. So schreibt der Harvard-Zoologe Ernst Mayr, einer der Großen der modernen Evolutionsbiologie und selbst erklärter Atheist: „In der Biologie bedient man sich häufig einer teleologischen Sprache, um Feststellungen über die Funktion von Organen, über physiologische Vorgänge und Verhaltensweisen und Tätigkeiten von Arten und Individuen zu treffen. Diese 27 Spaemann, Der letzte Gottesbeweis, a. a. O., S. 10.
Die Frage nach dem Ursprung als die Frage nach Gott
73
Sprache ist durch die Worte ‚Funktion‘, ‚Zweck‘ und ‚Ziel‘ gekennzeichnet, ferner durch die Aussage, etwas existiere oder werde getan ‚um zu‘. Typisch teleologische Aussagen sind etwa: ‚Eine der Aufgaben der Nieren ist es, die Endprodukte des Proteinstoffwechsels auszuscheiden‘ oder: ‚Vögel ziehen in warme Gegenden, um den niedrigen Temperaturen und dem Futtermangel im Winter auszuweichen‘.“28 Warum beschreiben Biologen die Natur auf diese Weise? Sie tun es – und wir alle tun es – , weil andernfalls die Phänomene, in diesem Fall: die organischen Funktionen und tierisches Verhalten, keinen Sinn machen würden, die Phänomene in ihrer Funktionsweise zwar kausal-mechanisch erklärt, als Phänomene – sinnvoll strukturierte, wahrnehmbare Gegebenheiten – selbst jedoch unverständlich blieben. Es würde darauf hinauslaufen, verstehen zu wollen‚ wie etwas funktioniert‘, ohne das ‚Etwas, das funktioniert‘ im Auge zu behalten. Der Zweck würde sich sozusagen im Laufe der kausal-mechanischen Erklärung in Luft auflösen, und damit würde auch das zu erklärende Phänomen selbst verschwinden. Wir hätten erklärt, wie Leben funktioniert, wüssten aber nicht mehr, was ‚Leben‘ und was ‚Lebewesen‘ sind. Für die metaphysische Frage ist deshalb – vorausgesetzt, wir verstehen Natur im klassischen Sinne als System intrinsischer Selbstorganisation – die Tatsache der Evolution belanglos. Evolution beziehungsweise sich entwickelnde Natur ist ja selbst ‚Natur‘ und damit nur Teil und Geschichte einer Naturordnung, die uns zu jenem Staunen führt, das der Anfang aller Wissenschaft ist. Entscheidend ist das Ergebnis, und dieses ist – außer vielleicht auf quantenmechanischer Ebene – weder durch Zufälligkeit noch durch Ordnungslosigkeit geprägt, sondern durch Teleologie, die von Naturwissenschaftlern, die ihre Existenz nicht zu leugnen vermögen, in der Regel verschämt als ‚Teleonomie‘ bezeichnet wird. Die Frage nach dem Ursprung einer solchen teleologischen Ordnung, von ‚Natur‘ als ganzer also, stellt sich nicht als Frage der Naturwissenschaft – diese braucht sich mit solchen Fragen nicht zu beschäftigen, so wie man sich eben, um einen Film zu verstehen, nicht mit dem Projektor beschäftigen muss; sie stellt sich vielmehr als philosophische, metaphysische Frage: als die Frage nach dem Sein des Seienden und seiner letzten Ursache. Das ist die Pointe der klassischen sogenannten ‚Gottesbeweise‘, insbesondere der ‚Fünf Wege‘, wie sie Thomas kurz und prägnant vorgelegt hat.29 In seiner Kritik des sogenannten physiko-theologischen Gottesbeweises hat Kant genau diese Pointe verpasst. Er behauptet dort, wer aus Naturteleologie auf Gott schließt, gelange nur 28 Ernst Mayr, Teleologisch und teleonomisch: eine neue Analyse, in: Ders., Eine neue Philosophie der Biologie, München u. Zürich 1991, S. 51-86, S. 51. 29 Eine Einführung in die klassischen Gottesbeweise bietet Schönberger, Gott denken, a. a. O., S. 33-127; zu Thomas von Aquins ‚Fünf Wegen‘ vgl. ebd., S. 64-97.
74
Martin Rhonheimer
zu einem göttlichen ‚Werkmeister‘, einem kosmischen Demiurgen, aber nicht zu einem Schöpfer.30 Diesem Verdikt widerspricht Kant später selbst in seiner Kritik der Urteilskraft, wo er, wie bereits erwähnt, die Ansicht vertritt, ein organisches Naturwesen sei keine „bloße Maschine: denn die hat lediglich bewegende Kraft; sondern sie besitzt in sich bildende Kraft … Man sagt von der Natur und ihrem Vermögen in organisierten Produkten bei weitem zu wenig, wenn man diese ein Analogon der Kunst nennt; denn da denkt man sich den Künstler (ein vernünftiges Wesen) außer ihr. Sie organisiert sich vielmehr selbst.“31 Genau aus diesem Grund eben gelangt man durch die Erkenntnis von Naturteleologie nicht bloß zu einem göttlichen ‚Werkmeister‘ oder kosmischen Demiurgen, sondern zu einem Schöpfer. Kants Kritik des physiko-theologischen Gottesbeweises wird also durch das in seiner Kritik der Urteilskraft Gesagte widerlegt. Je mehr die Natur eben ‚Natur‘ ist – Fähigkeit zur Selbstorganisation – und Ordnung hervorzubringen vermag, desto mehr offenbart sie, mit Thomas gesprochen, eine ihr innewohnende ‚ratio artis‘ und drängt damit zur metaphysischen Frage, woher diese den Dingen innewohnende ‚Kunstfertigkeit‘ – ‚Natur‘ eben – komme. Von einem ‚Werkmeister‘ kann sie gerade nicht kommen, denn ein solcher ist nur imstande, Artefakte, aber nicht ‚Natur‘ zu erschaffen. Sie muss also von einer Ursache stammen, die zugleich Ursprung des Seins des Seienden und damit Ursprung der Natur ist, also diese den Dingen eingegebene göttliche ‚ratio artis‘ oder ‚Kunstfertigkeit‘ erschaffen hat. Für alle Gottesbeweise gilt: Gott wird als Ursache des Seins aufgewiesen, auch wenn man auf verschiedenen Wegen beziehungsweise von verschiedenen Ausgangspunkten her zu einem solchen Aufweis gelangt. „Die Wirkung Gottes ist nicht Einwirkung. Es müsste dann schon etwas geben, worauf Gott ‚einwirkt‘ … Es wird also nicht etwas in Bewegung gesetzt, sondern ins Sein erschaffen.“32 Auch als ‚erster unbewegter Beweger‘ ist Gott bei Thomas nicht mehr – wie noch im Achten Buch der Aristotelischen Physik – erstes Glied einer physikalischen Ursachenreihe, sondern Ursprung von Bewegung überhaupt, und das heißt: Ursprung der Materie, der Natur, des Seins. Gemäß der Ansicht des hl. Thomas von Aquin bräuchte das Universum einen solchen Gott selbst dann, wenn es zeitlich anfangslos wäre, also von Ewigkeit her existieren würde.33 ‚Geschaffensein‘ heißt nicht ‚einen zeitlichen Anfang haben‘, sondern ‚hinsichtlich des eigenen Seins von einer äußeren Ursache 30 Kant, Der einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration des Daseins Gottes, A 116, AA II 122 f. 31 Kant, Kritik der Urteilskraft, B 292-293, AA V 374. 32 Schönberger, Gott denken, a. a. O., S. 96. 33 Vgl. Thomas von Aquin, De aeternitate mundi contra murmurantes, in: Divi Thomae Aquinatis Opuscula Philosophica, hg. v. Raymund M. Spiazzi, Turin 1954, S. 105-108.
Die Frage nach dem Ursprung als die Frage nach Gott
75
abhängig sein‘, also nicht selbst das eigene Sein zu sein, sondern es empfangen zu haben. Die Alternative zum Geschaffensein ist das Nichtsein, das Nichts – oder aber das göttliche Sein.
8
Das Ethos der Naturwissenschaft und die Notwendigkeit der Metaphysik
Diese klassische Variante des teleologischen Gottesbeweises, die Kant gänzlich unbekannt war, gerät mit naturwissenschaftlicher Erklärungspraxis grundsätzlich nicht in Konflikt, da sie ja nur den Ursprung des Gesamtsystems ‚Natur‘ erklären will, nicht aber die innere Funktionsweise der Natur. Ihre dekadente Variante, das von Intelligent Design verwendete ‚argument from design‘ hingegen, versucht dort, wo die Naturwissenschaft nach natürlichen Ursachen zu suchen verpflichtet ist, übernatürliche Ursachen ins Spiel zu bringen. ‚Intelligent Design‘ stellt nicht die Frage nach dem Ursprung von ‚Natur‘ beziehungsweise nach dem Schöpfer, sondern mischt sich – aus theologischen Gründen – in die Naturwissenschaft ein, relativiert ihre Zuständigkeit und zerstört damit nicht zuletzt die Natur als Gottes Schöpfung – all dies paradoxerweise ‚zur größeren Ehre Gottes‘, in Wirklichkeit aber seine Größe mindernd. Das Weiterfragen nach den letzten Ursachen des Seienden als solchem, das auch Kant richtig als unausweichliches Schicksal der menschlichen Vernunft erkannt hat, ist das Fragen der Metaphysik. Metaphysik entspringt dem Staunen des Kindes und ist das Fragen des Kindes nach dem ‚Warum‘ von allem – aber ein durch Erfahrung gereiftes und geordnet vorgehendes, diszipliniertes Fragen. Die Behauptung Kants hingegen, metaphysisches Fragen der theoretischen Vernunft, die mit dem Anspruch auftritt, zu einem gesicherten Wissen zu gelangen, führe notwendig zu Aporien und „transzendentalem Schein“ und gleiche dem „kindischen Bestreben, nach Seifenblasen zu haschen, weil man Erscheinungen, die doch bloße Vorstellungen sind, für Sachen an sich selbst nahm“34, hängt von den oben dargestellten rationalistischen Voraussetzungen seiner Kritik ab und vermag wie gesagt den in der – Kant unbekannten – klassischen Metaphysiktradition verankerten Philosophen in keiner Weise zu beunruhigen. Metaphysik ist nicht das Geschäft einer rationalistisch verstandenen ‚reinen Vernunft‘, die dann durch den Hinweis auf ihre ‚Leerheit‘ und Inkompatibilität mit einer angeblich von Natur aus ‚blinden‘ Sinnlichkeit entthront wird. Sie entspringt vielmehr dem Fragen 34 Vgl. Kant, Prolegomena, a. a. O., A 69, AA IV 292.
76
Martin Rhonheimer
des normalen, in dieser Welt existierenden und mit ihr vertrauten leib-geistigen Subjekts nach den letzten Ursachen dessen, was ist. Ihr Ausgangspunkt ist auch nicht Gottfried Wilhelm Leibniz’ berühmte Frage „Warum ist überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts?“35 Das ist zwar eine durchaus metaphysische Frage und, wie Martin Heidegger, der sich in der klassischen Tradition auskannte, schrieb, die „Grundfrage“ der Metaphysik im Sinne der „weitesten“ und „tiefsten“ Frage, nicht aber die erste in der zeitlich-methodischen Abfolge des Fragens.36 Metaphysik beginnt, zumindest in der aristotelischen Tradition, mit dem staunenden ‚Konstatieren‘ dessen, was ist, und der dadurch provozierten Frage nach den letzten und tiefsten Ursachen alles Seienden. Metaphysik ist also letztlich Kontinuation des Common Sense, des Alltagsverstandes, und beruht auf dem kognitiven Urvertrauen gegenüber der Welt. Die Welt ist einfach ‚da‘, und wir sind ein Teil von ihr, sind in ihr; deshalb täuscht sie uns nicht und macht uns nichts vor, wir müssen auch nicht ihre Existenz oder die Existenz einer ‚Außenwelt‘ beweisen, weil es eine solche nicht gibt: Es gibt nur eine einzige Welt, zu der wir als erkennende Subjekte ebenfalls gehören. Die Dichotomie von ‚Innen‘ und ‚Außen‘, von ‚Erkennendem‘ und ‚Erkanntem‘, ist eine Konstruktion Descartes’37, mit deren Hilfe er die Metaphysik der Methode der Mathematik – der Suche nach axiomatischer Gewissheit – anzugleichen suchte. Der Fehler ist letztlich anthropologischer Natur, er beruht auf der Verkennung der leib-geistigen Einheit des Menschen und damit der eben ‚nicht‘ rein geistigen Natur menschlicher Subjektivität. Aufgrund seiner Leiblichkeit steht der Mensch der ‚Welt‘, der ‚Natur‘ nicht gegenüber, sondern ist ihr Teil. Das cartesische ‚Cogito‘ zerreißt diese Einheit und isoliert damit das erkennende Subjekt, als ‚rein geistiges‘ – kantisch gesprochen: als ‚reine Vernunft‘ – von der Welt und allen möglichen Gegenständen erfahrungsgebundener Erkenntnis. Doch ist die – geistige – Seele nicht das ‚Ich‘ oder das erkennende Subjekt – ‚anima mea non est ego‘38 – ; das Ich und damit auch das erkennende Subjekt ist immer die leib-seelisch, im Falle des Menschen also leib-geistig verfasste psycho-physische Einheit des Menschen, die menschliche Person.
35 Gottfried Wilhelm Leibniz, Principes de la Nature et de la Grace, fondés en raison, in: Ders., Die philosophischen Schriften, Bd. 6, hg. v. Carl Immanuel Gerhardt, 1885, Hildesheim 1965, S. 602: „Pourquoy il y a plustôt quelque chose que rien“. 36 Vgl. Martin Heidegger, Einführung in die Metaphysik, Tübingen 31966, S. 1 f. 37 Vgl. Braine, The Human Person, a. a. O., S. 42-68, S. 69-93. 38 Vgl. den Kommentar des hl. Thomas zum Ersten Korintherbrief: Thomas von Aquin, Super primam epistolam ad Corinthios lectura, cap. 15, lectio 2, Nr. 924, in: S. Thomae Aquinatis Super Epistolas S. Pauli Lectura, hg. v. Raphael Cai, Bd. 1, Turin 1953, S. 411.
Die Frage nach dem Ursprung als die Frage nach Gott
77
Auch wenn die Sinne uns täuschen können und uns manchmal tatsächlich täuschen, so sind solche Täuschungen wiederum durch Reflexion der Vernunft auf eigenes Erkennen erkennbar – darin gründet die Möglichkeit der Selbstdistanzierung der Vernunft von ihrer leiblichen Gebundenheit und damit auch alle Freiheit. Solches wurde bereits in der mittelalterlichen Scholastik diskutiert und gewusst. Descartes hat diesem Wissen durch den methodischen Zweifel und die Erhebung des ‚Cogito‘ zum Fundament allen Wissens entgegengearbeitet, ja er hat dieses Wissen um die psycho-physische Einheit der menschlichen Person verschüttet und damit den Mythos einer Vorstellung von Wissenschaft kreiert, die die Methode nicht an den Gegenstand anpasst, sondern den Gegenstand der Methode unterwirft und damit das erkennende, rein geistige Subjekt zum Herrn und Meister über die Wirklichkeit zu erheben sucht, deren Existenz als ‚Außenwelt‘ allerdings dann eines zusätzlichen und, wie sich gezeigt hat, unmöglichen Beweises bedarf. Als Naturwissenschaftler ist Descartes mit seiner Methode gescheitert – seine auf ihrer Grundlage konzipierte Physik war schlicht falsch und geriet durch den Sieg der Newtonschen Mechanik selbst in Frankreich in Vergessenheit. Der Mythos des Philosophen jedoch hat überlebt, ja wurde durch Kants offensichtliche Fehldeutung der kopernikanischen Wende und der Methode der modernen Physik im Allgemeinen noch durch einen weiteren Mythos ergänzt: den Mythos des Ursprungs aller Intelligibilität im erkennenden Subjekt – mit den Worten Kants: der angeblich seit Galileo Galilei vorherrschenden Einsicht, „dass die Vernunft nur das einsieht, was sie selbst nach ihrem Entwurfe hervorbringt“39, und sich deshalb der „Gegenstand (das Objekt der Sinne) nach der Beschaffenheit unseres Anschauungsvermögens“ richtet.40 Die kopernikanische Wende beruhte 39 Kant, Kritik der reinen Vernunft, Vorrede zur zweiten Auflage, B XIII, AA III 10. 40 Ebd., B XVII, AA III 12. – Der Cartesianer Kant erhob damit das ‚methodische Apriori‘ der Wissenschaft – jedes wissenschaftliche Herangehen an die empirische Realität geschieht mit theoretischen Vorannahmen, ist also ‚theoriegeladen‘, so Karl Popper – zur allgemeinen Erkenntnistheorie. Letztere hat die aller Wissenschaftsmethodologie ‚vorausliegende‘ Frage zu klären, wie ‚überhaupt‘ menschliches Erkennen der Wirklichkeit geschieht und woher ‚ursprünglich‘ unsere Verstandeskategorien beziehungsweise Begriffe wie ‚Ursächlichkeit‘, ‚Substanz‘ und so weiter kommen. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun: Aus der Tatsache, dass wir, um Naturwissenschaft zu betreiben, das Kausalitätsprinzip bereits kennen und anwenden müssen, es also ein methodisches Apriori darstellt, ohne dass wir überhaupt keine wissenschaftlichen Fragen stellen könnten, folgt nicht, dass dieses Prinzip selbst letztlich nicht aus der Erfahrung stammt und dass es deshalb ein gleichsam ‚absolutes‘ kognitives Apriori sein muss. Vgl. dazu das oben in Abschnitt 3 Gesagte. Diese – typisch cartesianische – Nichtdifferenzierung von allgemeiner Erkenntnistheorie und naturwissenschaftlicher Methodenlehre – oder ‚Logik der Forschung‘ – ist die letztlich entscheidende, weiter nicht begründete, ja nicht
78
Martin Rhonheimer
jedoch, ganz im Unterschied zu Kants Interpretation derselben, auf der – genau umgekehrten – Überzeugung der Intelligibilität eines von Gott geschaffenen Universums, dem, so Nikolaus Kopernikus, die Heliozentrik mehr entspreche als die bloß mathematisch-hypothetische Astronomie der ptolemäischen Tradition, der es nicht um Erkenntnis der wahren Struktur des Universums, sondern nur um ‚Wahrung der Phänomene‘ durch mathematische Denkmodelle – ‚Hypothesen‘ – ging, und das aus rein praktischen Gründen, wie etwa die Vorausberechnung einer Sonnenfinsternis oder – im islamischen Kulturkreis – die genaue Bestimmung der Gebetszeiten, wofür die geozentrische Perspektive genügte. Ihm hingegen, so erklärte Kopernikus im Vorwort seines Hauptwerkes, gehe es um die wissenschaftliche Erkenntnis „der Bewegungen der Weltmaschine, die um unseretwillen vom besten und genausten aller Werkmeister gebaut ist“41. Damit erweist sich Kopernikus als zutiefst christlich inspiriert. Denn die „christliche Theologie ging davon aus, dass es ein Geheimnis der Welt gibt, das entschleiert werden kann. Jedes Detail hat einen Sinn und eine Ordnung … Die westliche Wissenschaft entstand aber gerade aus der enthusiastischen Überzeugung, dass der menschliche Intellekt die Geheimnisse der Natur entschlüsseln kann?“42 Metaphysik ist das Geschäft des Common Sense, offen gegenüber Wissenschaft aller Art und diese zugleich rechtfertigend. Sich dem Alltagsverstand und der darauf gründenden Metaphysik zugunsten einer angeblich höheren oder aufgeklärteren wissenschaftlichen Rationalität zu versagen, hat nichts mit Wissenschaft gemein, sehr wohl aber mit einer existentiellen Entscheidung, die in den wenigsten Fällen argumentativ ausgewiesen oder rational begründet wird. Diese Entscheidung verbleibt im Hintergrund des wissenschaftlichen Diskurses, prägt diesen Diskurs aber, als latente Metaphysik, genau dann in entscheidender Weise, wenn sich Naturwissenschaftler mit Fragen über Mensch, Gott und die Welt als Ganzer zu beschäftigen beginnen. Dann können auch sie sich nicht der letztlich existentiellen Logik aller Metaphysik und Philosophie als jenes Grundlagendiskurses entziehen, indem immer auch unser Menschsein als Ganzes involviert ist. „Was für eine Philosophie man wähle, hängt sonach davon ab, was man für ein Mensch ist“, hat
einmal hinterfragte oder ausgewiesene Ausgangsprämisse von Kants Kritik der reinen Vernunft, aus der sich alle ihre Unstimmigkeiten ergeben. 41 Nikolaus Copernicus, Vorrede zu den Büchern der Umläufe, in: Ders., Das neue Weltbild. Drei Texte: Commentariolus. Brief gegen Werner. De revolutionibus, hg. v. Hans Günter Zekl, Hamburg 1990, S. 67-79, S. 73; vgl. auch Martin Rhonheimer, Christentum und säkularer Staat. Geschichte – Gegenwart – Zukunft, Freiburg im Br. 32014, S. 369 f. 42 Ulrike Ackermann, Eros der Freiheit. Plädoyer für eine radikale Aufklärung, Stuttgart 2008, S. 75.
Die Frage nach dem Ursprung als die Frage nach Gott
79
Johann Gottlieb Fichte geschrieben.43 Auch wenn der Weg der klassischen Metaphysik nicht einer bewussten Wahl entspringt, sondern dem natürlichen Gang des gesunden Menschenverstandes folgt, so ist zumindest die Entscheidung ‚gegen‘ sie eine Wahl. Sie entspringt dem gewollten, zur Methode erhobenen Zweifel, dem Misstrauen gegenüber einer Welt, zu der hin wir uns durch unsere Sinneserfahrung natürlicher- und spontanerweise öffnen, und damit einem Herrschaftswillen über das, was ist, der mit dem Ethos der Wissenschaft, die Wahrheitserkenntnis sucht, in Konflikt geraten kann. Sie ist deshalb nicht nur eine rein kognitive, sondern auch eine moralische Option.
43 Johann Gottlieb Fichte, Erste Einleitung in die Wissenschaftslehre, 1797, in: Fichtes Werke, hg. v. Immanuel Hermann Fichte, Bd. 1, 1845, Berlin 1971, S. 434.
Szenische Metaphysik Éric Weil und Rémi Brague Wolfram Hogrebe
1 Einleitung Éric Weil, der von 1904 bis 1977 lebte, Schüler von Ernst Cassirer, bei dem er 1928 in Hamburg mit einer Arbeit über Pietro Pomponazzi – der von 1462 bis 1525 lebte – promoviert wurde,1 legte 1950 ein Buch vor, das unter dem Titel Logique de la Philosophie in Paris erschien. Dieses Buch ist zweifellos sein Hauptwerk und bietet, um es salopp zu formulieren, einen mit Aristoteles gebremsten Immanuel Kant, wie ebenso einen mit Kant2 gebremsten Georg Wilhelm Friedrich Hegel3 und beides in Form einer Erzählung mit sich selbst. In dieses Buch gingen Weils Erfahrungen mit dem Nationalsozialismus mit ein, ohne dass sie erwähnt werden. Es ist von Anfang an das Erlebnis von Angst, ja Angst vor der Angst und Gewalt, die dieser großen Erzählung zugleich den Boden einer schweigenden Konfession unterbreitet, ohne die Vernunftnatur des Philosophen in den Abgrund zu ziehen. Pierre Aubenque nennt Weil den letzten Hegelianer und kontrastiert ihn mit der gesamten Palette der französischen Philosophie, mit dem Existentialismus eines Jean-Paul Sartre und Albert Camus, mit der Postmoderne von Jacques Derrida bis André Glucksmann, auch mit Emmanuel Levinas, um abschließend zu dem Befund zu kommen: „Es bleibt, daß Eric Weil das große Verdienst zukommt, der beredte, ja manchmal vehemente Anwalt der Vernunft in einer Zeit der Unvernunft – der Zeit des Nationalsozialismus, W.H. – gewesen zu sein – wer könnte ihm das vorwerfen? – , aber das auch in einer philosophischen 1 Éric Weil, Die Philosophie des Pietro Pomponazzi, in: Archiv für Geschichte der Philosophie 41 (1932) H. 1-2. 2 Éric Weil, Interprétations de Kant, Lille 1992. 3 Éric Weil, Hegel et l’Etat, Paris 1950; vgl. Paul Ricœur, Le conflit des interprétations, Paris 1969, S. 402. © Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv lizenziert durch Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2020 C. Böhr (Hrsg.), Metaphysik, Das Bild vom Menschen und die Ordnung der Gesellschaft, https://doi.org/10.1007/978-3-658-31593-1_5
81
82
Wolfram Hogrebe
Welt, die vielleicht mit guten Gründen an der Fähigkeit der Vernunft zweifelte, die Probleme zu lösen, die ihr einseitiger Gebrauch heraufbeschworen hatte.“4 Wer war nun Éric Weil?5 Er wurde 1904 in Parchim in Mecklenburg geboren und studierte von 1922 bis 1928 vor allem in Hamburg, aber auch in Berlin. In Hamburg hatte er intensiven Kontakt mit dem Kreis um Aby Warburg. 1933 musste er Deutschland verlassen, floh nach Paris und konnte hier 1938 seine Einbürgerung erreichen. 1940 wurde er – aus Selbstschutzgründen unter dem Namen Henri Dubois – zur Armee eingezogen, aber im selben Jahr bereits von deutschen Truppen gefangen genommen und blieb es bis Kriegsende. Ein Teil seiner Familie konnte vor den Nationalsozialisten fliehen, der größte Teil kam in Theresienstadt und Auschwitz ums Leben. Von 1939 bis Ende 1946 schrieb er, vor allem also während seiner Gefangenschaft im Stammlager XI B in Fallingbostel in den Jahren 1940 bis 1945, in dem er auch als Pianist auftrat,6 sein Hauptwerk Logique de la Philosophie.7 Während seiner Zeit an der Universität Hamburg studierte dort auch der fast gleichaltrige Joachim Ritter – 1903 bis 1977. Er war in frühen Jahren vorübergehend Marxist, wurde bereits 1925 von Cassirer mit einer Arbeit zu Nicolaus Cusanus – der von 1401 bis 1464 lebte – promoviert und habilitierte sich daselbst 1932 mit einer Arbeit über Augustinus. Da er in erster Ehe, seit 1927, mit Marie Johanna Einstein, gestorben 1928, einer Verwandten von Cassirer, verheiratet war und seine marxistischen Anfänge unvergessen blieben, kam Ritter bei der Partei
4 Pierre Aubenque, Eric Weil oder der letzte Hegelianer, in: Der französische Hegel, hg. v. Ulrich Johannes Schneider, Berlin 2007, S. 105-112, hier S. 112. 5 Eine ausführliche Biographie, der ich viele Angaben zu Weil entnommen habe, stammt von Gilbert Kirscher und findet sich auf der Homepage des Institut Éric Weil – Université Lille 3 – . 6 Nach Kirscher mit Verweis auf einen Brief von Henri Moysset an Anne Dubois vom 12. Februar 1941. 7 In der Biographie von Kirscher wird der 27. Dezember 1946 als Ende der Niederschrift von Logique de la Philosophie angegeben. – Den Titel einer Logik der Philosophie verwendet bekanntlich zum ersten Mal Emil Lask; vgl. Ders., Die Logik der Philosophie und die Kategorienlehre, in: Ders., Gesammelte Schriften, hg. v. Eugen Herrigel, Bd. 2, Tübingen 1923, S. 1-282; vgl. hierzu Peter Gaitsch, Einstellung und Sinn. Eric Weils Logik der Philosophie. Vorbegriff, Vorgeschichte, Relektüre, Wien 2013, S. 123 ff. Die systematische Verwandtschaft von Lask und Weil zeigt sich da, wo Lask den Subjektbegriff völlig entleert, um ihn gewissermaßen für die kognitive Gegenstandsempfängnis bereit zu machen; vgl. hierzu Uwe B. Glatz, Emil Lask. Philosophie im Verhältnis zu Weltanschauung, Leben und Erkenntnis, Würzburg 2001, S. 213 f.; um diese Entleerung aber noch kognitiv ‚abfangen‘ zu können, bemüht Weil seine ‚Einstellungen‘ als szenisches μεταξύ. Die Entleerung formuliert Weil, Logik, a. a. O., S. 417, übrigens noch pointierter als Lask: „das Individuum selbst denkt gar nicht.“
Szenische Metaphysik
83
als Privatdozent der Philosophie unter Druck.8 1939 hieß es in einem Bericht der NSDAP, er sei nicht nur in erster Ehe mit einer Jüdin verheiratet gewesen, sondern pflege auch ansonsten Kontakte mit jüdischen Kreisen und habe sich früher insbesondere durch den Juden Dr. Weil verschiedentlich vertreten lassen.9 Das war das Motiv für einige seiner nachmaligen durchaus unerheblichen opportunistischen Attitüden im sogenannten Dritten Reich. Er wollte seine akademische Existenz nicht aufs Spiel setzen. Ritter hatte in Hamburg also ersichtlich engeren Kontakt mit Weil. Nach 1945, seit 1948 Ordinarius in Münster, hat Ritter ihn mindestens zweimal, nämlich 1957 und 1958, zu Vorträgen nach Münster eingeladen und ihn in einem Exkurs zu seiner bedeutenden und einflussreichen Arbeit über Hegel und die französische Revolution von 1956 zustimmend und im Kontrast zu Karl Popper zitiert.10 Michael Landmann – 1913 bis 1984 – , Ordinarius für Philosophie an der Freien Universität zu Berlin, fragte bei Weil per Brief vom 19. Juni 1957 an, ob er sich vorstellen könnte, in Berlin eine Professur für Philosophie zu übernehmen. Mit Brief vom 28. Juni sagte Weil Landmann ab: Inzwischen sei er zu sehr mit Frankreich verwachsen. Am 6. Februar 1969 erhielt Weil auf Betreiben Ritters die Ehrenpromotion der philosophischen Fakultät der Universität Münster. Bei dem dazu üblichen Vortrag von Weil am Nachmittag dieses Tages im Fürstenberghaus war ich als Student anwesend. Draußen war es schon dunkel. In seinem frei gehaltenen und präzisen Vortrag über schwierige Fragen der aristotelischen Philosophie machte er auf mich mit seinem kolossalen pommerschen Schädel einen aufblitzenden, imposanten Eindruck. Als ich später, von Münster nach München und dann an die neugegründete Universität Düsseldorf wechselte, begegnete ich dort Gerard Dubrulle – 1946 bis 1996 – , der bei Weil in Lille studiert hatte und meinen überaus positiven Eindruck aus eigener Erfahrung bestätigte. Dubrulle hat dann 1977 über Gaston Bachelard in Düsseldorf promoviert, mit dessen Werk er durch Weil in Lille bekannt geworden war.11
8 Vgl. die biographische Skizze von Hans Jörg Sandkühler, Joachim Ritter: Über die Schwierigkeiten, 1933–1945 Philosoph zu sein, in: Philosophie im Nationalsozialismus, hg. v. Hans Jörg Sandkühler, Hamburg 2009, S. 219-252. 9 Ebd., S. 233. 10 Wiederabgedruckt bei Joachim Ritter, Metaphysik und Politik. Studien zu Aristoteles und Hegel, Frankfurt am M. 1969, S. 183 ff., hier: Exkurs III, S. 240.ff. 11 Gerard Dubrulle, Philosophie zwischen Tag und Nacht. Eine Studie zur Epistemologie Gaston Bachelards, Frankfurt am M. 1983.
84
Wolfram Hogrebe
Weil übernahm 1968 – die philosophischen Mandarine von Paris verwehrten ihm eine akademische Position ebendort – eine Professur an der Universität in Nizza. Hier starb er auch am 1. Februar 1977. Er hat sein großes Buch Logik der Philosophie also im Wesentlichen während seiner Kriegsgefangenschaft geschrieben.12 Solche Randbedingungen prägen natürlich auch die literarische Form eines Werkes. So gibt es hier kaum Anmerkungen, schon gar nicht in der Form gelehrter Auseinandersetzungen mit der Literatur, wie sie ansonsten gerade bei philosophischen Texten üblich sind und die Nähe einer Bibliothek bezeugen. Der Text ist vielmehr in der Form einer erinnerten großen Erzählung angelegt, die sich in ihrer facon d’être deutlich an Hegels Phänomenologie des Geistes anlehnt, aber in ihrer Struktur ebenso deutlich von ihr abweicht. Es gibt hier keine dialektische Selbstentfaltung des Begriffs, sondern in achtzehn Kapiteln eine sukzessive Exposition von Kategorien gewisser ‚Einstellungen‘, die das Vollbild des Selbstverständnisses der Philosophie zu präsentieren beanspruchen.
2 Orientierung In diesem Buch spricht die Philosophie also mit sich selbst und das Medium dieses Gesprächs ist ein Autor, der abwesend bleibt. Dieser methodische Kunstgriff macht die Lektüre nicht eben leicht. Man kann sie wie bei Hegel nur meistern, wenn man sich dem Prozess einer philosophischen Selbstvergewisserung lesend überlässt. Was dabei statthat, ist mit Kant ein begrifflicher Orientierungsversuch, ohne Karte, ohne Bilder, ohne Hilfestellung von außen. Die einzigen Anhaltspunkte dieser Selbstorientierung sind Einstellungen, unsere ‚les attitudes‘. Damit betritt Weil den Boden einer szenischen Metaphysik.13 Wenn man sich nach Modellen für eine solche Selbstorientierung umschaut, ist man gut beraten, Kants Text Was heißt sich im Denken orientieren? zu konsultieren. Kant mag eigentlich auch keine Bilder, jedenfalls nur dann, wenn es gilt, begriffliche Verhältnisse sinnfällig, das heißt: sie, wie er selber sagt, „zum Erfahrungsgebrauche
12 Wenn die Angaben von Kirscher korrekt sind, wurde die Niederschrift im August 1939 begonnen und Ende Dezember 1946 abgeschlossen. Andere Autoren behaupten, Weil habe dieses Buch trotz zurückreichender Vorarbeiten erst nach dem Krieg geschrieben – so etwa Patrick Schuchter, Eric Weil. Der Weg des Denkens in die Gegenwart und die Entscheidung für die Vernunft, Wien 2014, S. 14. 13 Vgl. dazu Wolfram Hogrebe, Riskante Lebensnähe. Die szenische Existenz des Menschen, Berlin 2009.
Szenische Metaphysik
85
tauglich zu machen.“14 Dazu gehört ganz einfach, dass unser orientierendes Bemühen sich tatsächlich zunächst ein Beispiel wählt, um gewissermaßen dingfest zu machen, wie ein Sich-Orientieren überhaupt starten und funktionieren kann. Tatsächlich so: Wir brauchen zunächst ein Faktum, zum Beispiel ‚die Sonne am Himmel‘, und dazu die zumindest gefühlsgegebene Unterscheidung zwischen ‚der rechten und der linken Hand‘, um uns dann effektiv orientieren zu können.15 Dieses primitive und durchaus leibgebundene Verfahren der Orientierung kann man nun per ‚Erweiterung‘, wie Kant sagt, auf andere Felder, auf geodätische, dann astronomische und sogar logische übertragen. Immer wird es darum gehen, beginnend mit Bekanntem, andere Dimensionen zu erschließen. Natürlich nimmt man dabei in Kauf, dass unsere Orientierungsbemühungen auch fehlschlagen können. Wir müssen dieses Risiko aber auf uns nehmen, denn eine andere Wahl haben wir nicht. Orientierung heißt immer ins Ungewisse peilen, aus Bekanntem das Unbekannte orten. So ist es unsinnig, eine komplette Faktenlage abzuwarten. Orientierung ist ohne Risiko nicht zu haben. Vernunft beweist sich darin, Ausgangsfakten projektiv zu ordnen. So wandert das Unbekannte als Problem in unsere rationalen Bemühungen hinein. Kants Skizze zur Eigenart unserer Orientierungen erinnert an das im 20. Jahrhundert von Donald Davidson vorgeschlagene Verfahren der Triangulation. Hier ist es auch nicht unnütz, daran zu erinnern, dass Davidson von 1942 bis 1945 im Dienste der US-Army – Navy – Piloten in Ortungspraktiken trainierte. Auch für Davidson müssen im einfachsten trigonometrischen Fall zwei Punkte bekannt sein, um einen entfernten dritten per Winkelmessung zu ermitteln. Davidson übertrug die Grundidee einer solchen durchaus bekannten Triangulation, gewissermaßen mit Kants Erweiterungslizenz, auf das semantische Dreieck.16 Wir brauchen immer zwei Personen, Sprecher und Hörer, die sich dann auf einen Gegenstand ihres Gesprächs einigen und gesprächsweise auf eben diesen beziehen können. So erscheint selbst unsere Intentionalität als bloßer Kunstausdruck für unsere elementare Fähigkeit, über beliebige Themen zu kommunizieren. Intendieren ist in diesem Sinne immer Triangulieren und damit intrinsisch ein sozialer, szenischer Akt.
14 Immanuel Kant, Was heißt sich im Denken orientieren?, in: Werke in zwölf Bänden, hg. v. Wilhelm Weischedel, Bd. 5, Frankfurt am M. 1968, S. 267. 15 Kant, Was heißt sich im Denken orientieren?, a. a. O., S. 269. 16 Donald Davidson, Rational Animals, in: Dialectica 36 (1982) S. 318-322; wiederabgedruckt in: Ders., Subjective, Intersubjective, Objective, Oxford 2001. Weitergehende Überlegungen zu dieser Figur bietet Jasper Liptow, Semantischer Externalismus und Triangulation, in: Zeitschrift für Philosophische Forschung 61 (2007) S. 35-54.
86
Wolfram Hogrebe
Das gilt erst recht, wenn wir unsere Orientierungsbemühungen von der geodätischen und dann semantischen Ebene in den politischen Raum erweitern, um uns gewissermaßen auf dem Boden einer politischen Geodäsie in der Weltgeschichte zu orientieren. Natürlich brauchen wir auch hier Fakten als Ausgangspunkte und zumindest ein Gefühl für elementare Distinktionen, um welthistorische Triangulationen zu versuchen. In diesem Sinne hat jedenfalls Hegel in seinem Werk immer wieder geschichtsphilosophische Diagnosen vorstellig gemacht. Das Generalfaktum, von dem bei ihm diese Prozeduren ausgehen, ist bei Hegel ostinat die Französische Revolution. Mit ihr verdampfen die Prinzipien bisheriger Legitimationstransfers: Legitimation durch Tradition und Legitimation durch soziale Stellung zählen nicht mehr. Ererbtes rechtfertigt nichts und damit auch nicht die Position im Kontext überkommener Privilegien. Was zählt, sind Begründung und Allgemeinheitsfähigkeit allein. Damit haben wir schon die Winkelgrößen, die wir für die Ausmessung politischer Ereignisse nach der Französischen Revolution benötigen. Der erste Interpret, der diese geschichtsphilosophische Triangulation, die sich bei Hegel in seinem Œuvre verstreut finden lässt, aufgegriffen und in ihrer Bedeutung erkannt hat, war der Philosoph Ritter. Aber es gab noch einen anderen Philosophen, der dieses Verfahren sogar auf sich selbst angewandt hat. Das Projekt einer Selbsttriangulation liegt einer Idee der Philosophie zugrunde, die Weil in seiner Logik der Philosophie vorgestellt hat. Und schließlich steht die Bemühung von Rémi Brague, sich einer Vergewisserung des Sinns von Europa zu stellen, im konzeptuellen Erbschaftsschatten von Weil.
3 Selbsttriangulation Auf den ersten Blick scheint es widersinnig zu sein, von einer ‚Selbsttriangulation‘ zu sprechen, da der Witz einer Triangulation ja gerade ihre kommunikative Einbettung ist. Aber Weil könnte mit der Tradition darauf verweisen, dass wir uns ja auch mit uns selbst verständigen müssen, sonst wäre es ja unmöglich, uns mit anderen ins Benehmen zu setzen. Unsere ungegenständliche Gegenstandsfähigkeit, die unserer szenischen Intentionalität zugrunde liegt, ist strukturell in triangulierenden Prozessen verankert. Wir waren schon szenisch verfasst, bevor wir uns sozial arrangierten. Die Logik der Philosophie von Weil beginnt aristotelisch: Menschen halten sich in der Welt, indem sie für sich Halt gewinnen. Und Halt gewinnen sie in einer Einstellung – griechisch ‚ἕξις‘, lateinisch ‚habitus‘, französisch ‚attitude‘ – , die sich im
Szenische Metaphysik
87
Diskurs bewährt und verwirklicht. Weil beginnt also nicht mit der Fiktion einer sinnlichen Gewissheit wie der Eingangs-Empirismus Hegels, sondern mit dem Format einer a limine soziomorphen, szenischen Weltstellung, die er aus der Hexis-Lehre des Aristoteles aufnimmt. Die grundlegenden Einstellungsformen nennt Weil, wieder ganz aristotelisch und kantianisch, Kategorien. Er orientiert sich bei Aristoteles an der Kategorie der Qualität, die auch die sachhaltigste ist, weil sie über ihre vieldeutige Offenheit für ein Mehr oder Minder beziehungsweise Ähnliches oder Unähnliches für nicht quantifizierbare Weltverhältnisse besser geeignet ist.17 Seinen Begriff der Haltung – ἕξις – entnimmt Weil offenbar der aristotelischen Metaphysik18 als szenisches Dazwischen oder Between: μεταξύ. Es möchte übrigens sein, dass hier auch Anregungen des französischen Philosophen – und Schülers von Victor Cousin – Félix Ravaisson-Mollien, der von 1813 bis 1900 lebte, mit eingeflossen sind. Dieser hatte schon 1838 in Paris ein Buch mit dem Titel De l’habitude vorgelegt.19 Ravaisson-Mollien war 1839 nach München gegangen, um dort Vorlesungen bei Friedrich Wilhelm Joseph Schelling zu hören. Auch dessen Echo sollte man bei Weil heraushören, wenn er die Bewährungsform unserer Haltungen, gerade auch der Haltung des Philosophen, in der Risikozone zwischen einer Vernunftoption und „der Angst vor dem Vernunftlosen in ihm“20 ansiedelt. In diesem Vernunftlosen gründet die Gewalt, gegen die unsere Vernunftnatur angeht, indem sie auf den absolut kohärenten Diskurs setzt. Aber auch für Weil ist es klar, dass Gewalt insofern eine Möglichkeit unserer Vernunftnatur selbst ist, die sich in brutaler Egozentrik auf Kosten unserer Konzilianzbegabung – Allgemeinheitsfähigkeit im Sinne Kants – austobt. Das in der Tat ist reiner Schelling seit seiner Freiheitsschrift von 1809. Weil präsentiert diesen originellen Neueinsatz seiner Logik der Philosophie aber nicht in der elaborierten Form eines Traktats, sondern in der offenen und szenischen Form einer metaphysischen Erzählung. Hier ist zweifellos der Stil der Phänomenologie des Geistes von Hegel sein Vorbild gewesen. Eine andere Form stand ihm ja seinerzeit, wie schon angemerkt, gar nicht zur Verfügung. Dadurch 17 Aristoteles, Categoriae, Kap. 8. 18 Aristoteles, Metaphysik, V, 20, 1022, 1022 a ff. Die Haltung wird hier als ein Vermittelndes – μεταξύ – eingeführt, zum Beispiel zwischen Halten und Gehaltenem. 19 Dt. Abhandlung über die Gewohnheit, Bonn 1954, in der Übersetzung von Gerhard Funke; dieser nennt die elementaren Formen der ‚Haltungen‘ oder ‚Einstellungen‘ nicht Kategorien, auch nicht Existenzialien wie Martin Heidegger, sondern ‚Hexiale‘; vgl. Ders., Art. Hexis (habitus), in: Historisches Wörterbuch der Philosophie, Bd. 3, Basel u. Stuttgart 1974, Sp. 1120–1123. 20 Eric Weil, Logik der Philosophie, Hildesheim 2010, S. 36, in der Übersetzung von Alexander Schnell.
88
Wolfram Hogrebe
bewahrte sein Text eine phänomenologische Offenheit, die zwar ebenso schwer zu lesen ist wie zugleich anregend zu wirken vermag. Von nicht zu unterschätzender Bedeutung für seine rezente Wirkungsgeschichte ist natürlich 2010 die deutsche Übersetzung der Logik durch Alexander Schnell gewesen. Merkwürdig dennoch, dass erst in den letzten fünf Jahren vor allem im deutschen Sprachraum die Logik Weils wieder größeres Interesse gefunden hat. Zuerst bei Yves Bizeul21, dann auch bei Peter Gaitsch22, Patrick Schuchter23, Philipp Wünschner, Frauke Kurbacher24 und anderen. Sie alle griffen Weil mit Blick auf eine fernere Theorie der Haltung phänomenologisch in zwischenmenschlichen Tableaus auf, die in deontologischen und auch konsequenzialistischen Konzeptionen der letzten zwanzig Jahre insbesondere in den anthropologischen Grundlagen der Ethik verloren gegangen waren. Weils Logik der Philosophie beginnt nach einer methodischen Einleitung mit der ‚Haltung der Wahrheit‘ und endet in der ‚Haltung der Weisheit‘. Jedes der achtzehn Kapitel zu Kategorien von Haltungen ist ein kleiner Roman des Phänotyps ‚Mensch‘, wie Gottfried Benn formulieren würde. Weisheit ist dabei kein Ziel, sondern begleitende Einstellung aller Einstellungen: „Weisheit ist also kein Wissen eines bestimmten Inhalts“,25 sondern Dokument unserer Vernunftnatur in ihrer Wahrheitsfähigkeit. Damit schließt sich der Kreis. In der Weisheit werden wir unserer Wahrheitsfähigkeit inne und sind es, „der Rest ist Schweigen.“26 Eine gewisse Achsenstellung nimmt in Weils Logik das neunte Kapitel ein, das der Einstellung der Bedingung – condition – gewidmet ist. Natürlich ist schon der Titel schwer verständlich. Was soll eine ‚Einstellung der Bedingung‘ überhaupt heißen? Hierzu gewinnt man nur einen Zugang, wenn man die Abhebung vom Göttlichen im vorhergehenden Kapitel hinzunimmt, um den Kontrast zu verdeutlichen. Die Einstellung der Bedingung ist im Prinzip nur die Favorisierung des Bedingten, wie es götterfrei und dennoch szenisch in Wirtschaft, Wissenschaft und Kunst zugänglich wird. Wenn die religiöse Einstellung hinter sich gelassen wird,
21 Gewalt, Moral und Politik bei Eric Weil, hg. v. Yves Bizeul, Hamburg 2006. 22 Peter Gaitsch, Eric Weils Logik der Philosophie, Wien 2013. 23 Schuchter, Eric Weil, a. a. O.; in einem Anhang seines Buches, S. 141-145, bietet Schuchter einen sehr nützlichen tabellarischen Überblick über die Logik an. 24 Philipp Wünschner, Eine aristotelische Theorie der Haltung. Hexis und Euexia in der Antike, Hamburg 2016; Was ist Haltung? Begriffsbestimmung, Positive Anschlüsse, hg. v. Frauke Kurbacher u. Philipp Wünschner, Würzburg 2017; Frauke Kurbacher, Zwischen Personen. Eine Philosophie der Haltung, Würzburg 2017. 25 Weil, Logik, a. a. O., S. 567. 26 Ebd., S. 571.
Szenische Metaphysik
89
erscheint die gesamte condition humaine nur als Zone messbarer Verhältnisse, die im Kapitalismus, Szientismus und Artistik unserer Zeit ausagiert werden. Der Kampf mit der Natur wird in der ‚Haltung der Bedingung‘ selbstreflexiv und zugleich selbstzerstörerisch: „Für den Menschen in der Einstellung der Bedingung gibt es … nur den Konflikt der Natur mit sich selbst“,27 und Dokumente dieses Konflikts sind Areale einer Selbstfesselung im Immerselben, das heißt in der Wiederholung in Arbeitsverhältnissen, Wissenschaft und Kunst von der politischen Romantik bis zum Surrealismus.28 Den Kampf mit der Natur, also letztlich mit sich selbst, entnimmt Weil Hegels Kapitel Herr und Knecht, nennt ihn darüber hinaus aber ein „transcendentale, das, weil es das letzte Faktum ist, sich nicht erklären läßt.“29 Das ist für ihn durchaus ungewöhnlich. In der Moderne verblasst der Sinnbezug der Einstellungen komplett, selbst unser Selbstverhältnis bleibt völlig entleert zurück. Schuchter hat das in seiner Interpretation Weils pointiert zusammengefasst: „Der Mensch in dieser Einstellung verhält sich zu sich selbst, indem er sich nicht zu sich selbst verhält.“30 Paradoxerweise ist erst in dieser Negativität der Weg zu Einstellungsentdeckung von Bewusstsein, Intelligenz, Persönlichkeit und Sinn frei. Die Moderne wird geboren aus einer anfänglichen Verneinung ihrer selbst. Darin besteht ihre Krisenanfälligkeit, die am Geburtsdrama ihres Eintritts in die Einstellung der Bedingtheiten immer noch leidet und leiden muss. Aber diese Negativität der modernen Einstellung in einem exklusiven Feld von Bedingtheiten ruft zugleich eine Einstellung des Unbedingten oder des Absoluten hervor. Das ist natürlich keine gegenständliche Einstellung, sondern fundiert quasi jede Vergegenständlichung als ihre untilgbare Voraussetzung und zwar so, dass dieses Fundierende nie Vordergrund werden kann. Das ist wieder die anonyme Kohärenz, auf die unsere Vernunftnatur und jeder Diskurs diskursiv einfach nur zugeht. Erst hier beginnt die Selbsttriangulation von Weil, von der oben schon die Rede war. Der Blick von Nirgendwo macht ein Einstellungsuniversum erst möglich, bleibt aber an jeder Stelle erhalten. Deshalb ist das Nichtwissen, das wir über Indikato27 Ebd., S. 274. 28 Ebd., S. 302, Anm. 27; ob hier Weil an Carl Schmitt gedacht hat, lässt sich nicht schlüssig belegen, obwohl er an dieser Stelle auch Joseph de Maistre erwähnt; vgl. Graeme Garrard, Joseph de Maistre and Carl Schmitt, in: Joseph de Maistre’s Life, Thought, and Influence, hg. v. Richard A. Lebrun, Montreal u. Kingston 2001, S. 220-240. Man beachte allerdings, dass Weil in seinem Eingangskapitel Wahrheit auch auf die Romantiker im kritischen Stil von Schmitt zu sprechen kommt; vgl. Weil, Logik, a. a. O., S. 127: „Für sie – sc. die Romantiker, WH – existieren alle Möglichkeiten. Sie können die Möglichkeiten gegeneinander ausspielen.“ 29 Weil, Logik, a. a. O., S. 274, Anm. 18. Hervorhebung im Original. 30 Schuchter, Eric Weil, a. a. O., S. 70.
90
Wolfram Hogrebe
ren der Haltungen aufzuhellen versuchen, untilgbar, nicht als Defizit, sondern als Voraussetzung unserer heuristischen Verfassung. In sie ist eine Tiefenangst – aus dem Leeren – allen Haltungen schon eingebaut, bevor sie uns zu okkasionellen Ängsten Veranlassung bietet. Die Selbstfraglichkeit des Menschen bleibt ihm über alle Facetten seiner Einstellungen erhalten, deshalb hört seine antwortlose Selbstbefragung nie auf. Das Mögliche ist nicht limitiert. Weil: „Der Mensch, der sich in der Welt orientieren will … , sieht nun ein, daß er gar nicht auf Fragen, die er nicht nicht stellen kann, bevor er nicht das Problem der Möglichkeit … gelöst hat, antworten kann.“31 Wir haben mithin keinen Grund, diese Tiefenangst zu beschönigen: sie kehrt an jeder Stelle unserer ungesättigten Haltungen wieder. Sie ist als Voraussetzung unserer elementaren Ungesättigtheit zugleich auf Dauer gestellt. Wir existieren gewissermaßen wie Variable, auch da und besonders da, wo wir uns unter überkommenen Konstanten zivilisiert eingerichtet haben. Genau das birgt das Risiko eines Rückfalls hinter ein erreichtes Niveau zivilisatorischer Prozesse, denn auch diese können selbstdestruktiv werden. „Das Denken“, schreibt Weil schon in der Einleitung, „muß somit schon ziemlich weit vorangeschritten sein, damit jemand erklären kann, daß er den Revolver zieht, sobald er nur das Wort ‚Zivilisation‘ hört.“32 Das genau ist Weils Situation im Deutschland der Nationalsozialisten gewesen und nicht nur seine. Gewalt tritt uns entgegen als Störung der großen, aber anonymen Kohärenz, und macht daher den Diskurs unmöglich. Die szenische Metaphysik Weils ist zugleich eine politische Metaphysik. Und diese ist bleibend auch ein Rahmen für ein europäisches Selbstverständnis.
4 Europa Eine stimulierende Übernahme von Weils Vokabular der ‚Haltungen‘ begegnet uns bei Brague. Zugleich bietet er vor allem eine überaus sensible geschichtsphilosophische Untermauerung von Weils szenischer Metaphysik. So verwendet er in seinem Buch Europa – seine Kultur, seine Barbarei. Exzentrische Identität
31 Weil, Logik, a. a. O., S. 69. Hervorhebung im Original. 32 Ebd., S. 90; vgl. hierzu ergänzend Gottfried Willems, „Frei um zivilisiert zu sein und zu sein“. Das Verhältnis von moderner Kunst und Zivilisationskritik im Licht von Gertrude Steins ‚Paris Frankreich‘, Erlangen u. Jena 1996.
Szenische Metaphysik
91
und römische Sekundarität33 seinen Achsenausdruck ‚l’attitude romaine‘, um eine kulturelle Haltung zu charakterisieren, die darauf abgestellt ist, sich das Überkommene verwandelnd anzueignen, „das Alte zu erneuern.“34 Römisch ist mithin von Anfang an eine kulturelle Renaissancefähigkeit. Denn: „Römisch ist die Erfahrung des Beginns als Wiederbeginn.“35 Dafür steht nicht nur der römische Ahnenkult, sondern auch das Anknüpfen an kulturelle Profile, die wie in Griechenland den Römern als ein Unbekanntes, aber für sie Bereicherndes entgegentraten. Dass Brague hier von einer römischen Haltung spricht, hat Gründe, auf die ich gleich noch zu sprechen komme. Zunächst einmal geht es ihm nur darum, dass wir es bei diesem Konstrukt nicht mit einer objektiven Tatsache im historischen Sinn zu tun haben, sondern um ein erschlossenes, aber belegbares, weil prägendes Sensibilitätsmuster, kurz: „um eine Gefühlseinstellung“.36 Brague greift hier also nicht explizit auf das Vokabular von Weil zurück, obwohl er es hätte tun können. Vielleicht war ihm sein geschichtsphilosophischer Versuch im Felde einer europäischen Selbstorientierung, ja einer Triangulation der europäischen Idee, zu historisch, um an das metaphysische Konzept Weils anzuschließen. Dennoch bewegten ihn offenbar die strukturellen Vorzüge des Vokabulars der Haltung, um diese Wahl zu treffen. In dieser Hinsicht kommt er mit Weil sachlich überein. Der aristotelische Begriff der Haltung – ἕξις – hat ja den Vorzug, dass er eine menschliche Disposition bezeichnet, die ebenso einen Bezug zur Vergangenheit – Ursprung – hat wie zur Zukunft – das Neue – , zugleich aber nur dann historisch existiert, wenn er sich in einem Gegenwärtigen stabilisiert hat. So bezeichnet auch der Terminus ‚Europa‘ nicht nur eine Herkunftssubstanz, ja eigentlich gar keine Substanz, sondern vielmehr eine Prozessform der Aneignung eines bereichernden oder korrigierenden Neuen im Licht von Überkommenem. Mit Brague: „Europäisierung ist eine innere Bewegung Europas, das heißt, sie ist die Bewegung, die Europa als solches ausmacht … Europa ist das Resultat der Europäisierung und nicht deren Ursache.“37 An dieser Stelle möchte sich Brague auch von Ritter absetzen, dem er unterstellt, dass er unter ‚Europäisierung‘ nur einen Kopiervorgang von schon Vorhandenem verstehe. Davon kann nur bedingt die Rede sein, wenn überhaupt. Auch Ritter nennt die Europäisierung „die Bewegung, in welcher sich ihre innere Universali33 Rémi Brague, Europa – seine Kultur, seine Barbarei. Exzentrische Identität und römische Sekundarität, hg. v. Christoph Böhr, Wiesbaden 22012. 34 Ebd., S. 45; der Ausdruck ‚Haltung‘ kommt in dem Text von Brague sehr häufig vor. 35 Ebd., S. 44. 36 Ebd., S. 47. 37 Ebd., S. 152.
92
Wolfram Hogrebe
tät zur äußeren Realität entfaltet.“38 Gewiss: die ‚innere Universalität‘ ist schon vorhanden, aber sie kann nicht kopiert, sondern immer nur aufs Neue realisiert werden. Denn die Universalität, das Allgemeine, ist natürlich immer schon vorhanden, sofern wir von einer Kultur des ‚homo sapiens‘ sprechen. Das ist Hegels Einsicht gewesen und es ist nicht zu sehen, wie man das Allgemeine – κάθολον – in kulturellen Prozessen entstehen lassen könnte, ohne es schon vorauszusetzen. Seiner ‚ratio essendi‘ nach ist der homo sapiens ‚a limine‘ katholisch, das heißt allgemeinheitsfähig, nicht jedoch seiner ‚ratio cognoscendi‘ nach. Das würde selbst Martin Luther nicht bestreiten, weil es keine Frage von Konfession ist. Das hat in unserer Zeit politisch 2015 wohl nur die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel verstanden, die, obschon in der defizitären Identität des Protestantismus aufgewachsen,39 im genannten Sinne ‚katholisch‘ agiert: das Gefängnis im Bahnhof Keleti pu in Budapest wurde nach Deutschland geöffnet. Genau das rechneten ihr verdumpfte Geister später zum Nachteil an. Der Hauptpunkt von Brague ist die ‚exzentrische Identität‘ Europas. Das besagt: Europas Identität existiert nur im Prozess einer Selbstfindung im Außenverhältnis. Hier wird Brague geradezu zum politischen Herold einer Offenheit, die historisch und auch gegenwärtig geradezu wörtlich eine Heraus-forderung war und ist: „Ich sage den Europäern daher: ‚Ihr existiert nicht!‘ Es gibt keine Europäer. Europa ist eine Kultur.“40 Und diese Kultur hat sich im Dreieck von Athen, Jerusalem und Rom trianguliert, um dann die Triangulation im Rahmen dieser Außenwinkel in andere Areale, also in den arabischen Raum – Mekka – , aber auch in den asiatischen bis zu Japan und China fortzusetzen. Dafür steht eine ‚l’attitude romaine‘, die gerade auch für eine politische Gegenwart Verpflichtung bleibt, die weiß, dass sie auch von einem Islam, wo immer er in eine produktive Berührung mit Europa eingetreten war, profitiert hat und profitieren kann, und umgekehrt auch dieser von den anderen. Wo bleibt bei Brague aber die Gewalt, von der Weil als Gegner der Vernunft des großen kohärenten Diskurses ausging? Sie kommt bei Brague in seinem geschichtsphilosophischen Dispositiv nur als Barbarei, das heißt nur in ihrer Übersetzung durch Schelling vor. Unter Barbarei versteht Brague auch eine ‚Haltung‘,
38 Joachim Ritter, Europäisierung als europäisches Problem, 1956, in: Ders., Metaphysik und Politik, a. a. O., S. 321-341. 39 Vgl. hierzu Brague, Europa, a. a. O., S. 28: Die „protestantische Welt – sc. hat – sich durch ihre Opposition zu der sogenannten ‚römischen‘ Kirche definiert.“ Das ist für die Perspektive einer ‚römischen Haltung‘ natürlich defizitär. Darunter leidet der Protestantismus bis heute. 40 Brague, Europa, a. a. O., S. 154.
Szenische Metaphysik
93
es ist für ihn die Form einer exkludierenden Selbstbehauptung, eine Attitüde der Selbstabschließung, mit Schelling also eine Form ausagierter Egozentrik. Zu Teilen sind wir in dieser ‚Haltung‘ natürlich alle befangen, wo immer wir unsere Stimme erheben und uns geltend machen. Aber sich selbst geltend machen genügt natürlich nicht, man muß, so Schelling, auch am Fremden in uns Anteil nehmen. Und damit tritt man erst in die ‚römische Haltung‘ ein. „Römisch ist in diesem Sinn jeder, der sich zwischen so etwas wie ‚Griechentum‘ und ‚Barbarentum‘ gestellt fühlt.“41 Ein architektonisches Sinnbild für diese Vermittlungshaltung ist, wie Brague im Anschluss an einen Hinweis von Beniamino Placido hervorhebt, das römische Aquädukt.42 So wird das Barbarische ein Teil von uns selbst, ein erkannter Teil, der es de facto immer schon war. So konnten schließlich sogar die Perser nostrifiziert und als von Perseus abstammend erklärt werden. Was Barbar war, wurden wir selbst. Das ist römisch. Was Brague allerdings doch als Feind dieser römischen Haltung betrachtet, ist das, was er einen „kämpferischen Laizismus“ nennt, einen militanten Atheismus also, der für das Rätsel der Geschichte und unserer Stellung im Kosmos unsensibel macht. Diese abgestumpfte Haltung, übrigens ein erklärtes Erziehungsziel der Philosophie in der DDR,43 steht einer ‚attitude romaine‘ strikt entgegen. Brague neigt hier allerdings der Hypothese zu, „daß dieser Laizismus einer Dialektik verpflichtet ist, die tendenziell zu seiner Selbstzerstörung führt.“44 Warum? Hier führt Brague einen Gedanken an, der ebenso schwierig wie nachdenkenswert ist. Er argumentiert so: Die säkulare Trennung des öffentlichen vom privaten Bereich hatte ja seinerzeit den Sinn, daß man so den privaten Bereich als schützendes Reservat des Religiösen deklarieren konnte. Damit, so Brague, ist indes die gleichzeitige Leugnung einer Präsenz des Göttlichen in einer einzigen Gestalt unverträglich.45 Das soll vermutlich besagen: Die Privatisierung des Göttlichen ist mit einem staatlichen Atheismus logisch unverträglich. Ist das zwingend? Vielleicht lässt sich das Argument auch so fassen: Man kann das κάθολον nicht privatisieren und zugleich seine Existenz leugnen. Denn dann wäre schon der Versuch seiner Privatisierung ein flagranter Widersinn.
41 Ebd., S. 49; vgl. zu dieser Figur einer Zweieinheit Wolfram Hogrebe, Duplex. Strukturen der Intelligibilität, Frankfurt am M. 2018. 42 Brague, Europa, a. a. O., S. 50 und Anm. 62. 43 So immer wieder triumphierend Reinhard Mocek – vor 1989 Professor für Philosophie an der Universität Halle – mündlich zum Verfasser. 44 Brague, Europa, a. a. O., S. 187. 45 Vgl. ebd., S. 188.
94
Wolfram Hogrebe
Dennoch befindet auch Brague am Ende und – gewissermaßen zum Trost – bündig: „Europa muß Ort der Trennung des Weltlichen und des Geistlichen bleiben – oder wieder werden; darüber hinaus Ort des Friedens zwischen den beiden Sphären.“46 Gleichwohl bleibt er skeptisch: „Ich weiß nicht, ob Europa eine Zukunft hat. Ich meine aber zu wissen, wie es sich eine solche verscherzen könnte.“47 Wie immer, die exzentrische Identität Europas hängt jedenfalls von diesen Fragen nicht ab. Seine Vitalität – Sichselbst im Anderen, das Andere in Sichselbst – hat die europäische Haltung längst bewiesen und genau dies hat auch die restliche Welt zumindest klandestin anerkannt, dafür steht auch die gegenwärtige Globalisierung ‚urbi et orbi‘. Es mag sein, dass Europa dereinst geographisch in einer militärischen Götterdämmerung untergeht. Allein: Das κάθολον kann nicht untergehen, weil es in nichts restlos inkorporierbar ist. Dieses platonische ‚Surplus‘, das uninterpretiert bleiben mag, obwohl wir es immer wieder zu interpretieren versuchen, werden wir jedenfalls nicht los, sofern wir überhaupt etwas loswerden können. Denn dieses Surplus bezeugt schon jede ‚Haltung‘ – τὸ μεταξύ – , ihre Existenz ist Beleg für den homo sapiens, unabhängig davon, was er daraus macht und wie immer er auch interpretiert. Dass in diesem Zuvorgekommenen unserer ‚Haltungen‘ gerade auch eine Verpflichtung zur Anerkennung des Fremden beschlossen ist, davon lebt die ‚l’attitude romaine‘. Und sie bleibt in einer szenischen Metaphysik philosophisch heimisch, aber da notwendig.
46 Ebd., S. 209. 47 Ebd.
Die Verwindung der Metaphysik? Martin Heidegger und die Frage nach Sein und Nichts Harald Seubert
1
Zwischen Logik und Urwissenschaft: Phänomenologie und Metaphysik in Heideggers Anfängen
Martin Heideggers Stellung zur Metaphysik ist von Anfang an von einer tiefen Zweideutigkeit geprägt: Metaphysik ist seinem Denken nach unhintergehbar, doch seine eigene Sache, als die sich schon früh die Seinsfrage herauskristallisiert, liegt jenseits der Wegmarken der Metaphysik. Dies hat zunächst genetische Gründe: Die Phänomenologie war mit Edmund Husserl als Erste Philosophie und als Erste Wissenschaft und zugleich als ‚strenge Wissenschaft‘ zu verstehen; sie war damit Zielbestimmung und Nachfolgedisziplin der Prima Philosophia, also Metaphysik.1 Dies zeigt sich umso deutlicher, als nach Husserls ‚Prinzip der Prinzipien‘ in der Erscheinung das Wesen der Sache selbst sichtbar wird, allerdings nur in den Grenzen, in denen es sich zeigt.2 Der Limes zwischen Wesen und Erscheinung wird damit gerade überschritten. Mit dem hohen Methoden- und Reflexionsbewusstsein der Phänomenologie war aber zugleich eine metakritische Stellung zu weiten Teilen der metaphysischen Überlieferung verbunden, erst recht, da Husserl weder ein ausgewiesener Kenner der metaphysischen noch der transzendentalphilosophischen Problemgeschichte war. Ihrem Selbstverständnis zufolge setzte die Phänomenologie die Metaphysik nicht einfach fort oder restituierte sie, wofür es unter den
1 Edmund Husserl, Erste Philosophie, I, 1923/1924, hg. v. Elisabeth Ströker, Hamburg 1992, S. 8 ff. 2 Edmund Husserl, Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie, Bd. 1, 1913, hg. v. Elisabeth Ströker, Hamburg 1992, § 24; zur grundsätzlichen Orientierung Alexander Schnell, Was ist Metaphysik, Frankfurt am M. 2019, S. 22 ff. © Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv lizenziert durch Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2020 C. Böhr (Hrsg.), Metaphysik, Das Bild vom Menschen und die Ordnung der Gesellschaft, https://doi.org/10.1007/978-3-658-31593-1_6
95
96
Harald Seubert
Zeitgenossen auch mannigfaltige Beispiele gibt.3 Sie firmierte vielmehr als deren Fundierung in einer phänomenologischen Urwissenschaft, so dass, im Sinn des frühen Realismus Husserls, ‚die Sache selbst‘ erst eigentlich zum Tragen kommt, im Sinn seiner späteren transzendentalen Wendung die ‚Eigenheitssphäre‘ der grundlegenden Besinnung im transzendentalen Subjekt fundamental freigelegt wird.4 Husserls phänomenologische Position hat mit der Wertelehre von Heinrich Rickert, Heideggers eigentlichem philosophischen Lehrer, den einen wesentlichen Grundzug gemeinsam, dass sie sich gegen die Auflösung von Geltung in Genealogien des Denkaktes wendet und damit den Psychologismus in die Schranken weist.5 Damit ergibt sich eine Konzeption Erster Philosophie, deren Verhältnis zur metaphysischen Überlieferung Heidegger zunehmend zum Problem werden sollte, zumal er, anders als Husserl, diese Überlieferung sich in ihrer ganzen Tiefe aneignen sollte. Mit der metaphysischen Fragestellung verbinden sich schon beim ganz frühen Heidegger drei Tendenzen: die Behauptung eines logischen und ontologischen Holismus einerseits, die Perzeption der dissoziierenden Tendenzen der Moderne, die diese Ganzheit bestreiten und doch nicht einfach antimodern traditionalistisch abgewehrt werden können, und die Suche nach einem Sinn von Sein andererseits, der aller Rede vom Seienden zugrunde liegt. Ist diese Seinsidee doch, wie Aristoteles’ Diktum vom ‚Pollachos legomenon‘ zeigt, das durchgehende analogische Band der Wissenschaften.6 Augenfällig ist es freilich, dass Heidegger in seinen Qualifikationsschriften nicht explizit von ‚Metaphysik‘ spricht und schon gar nicht die doxographischen Lehrgehalte der ‚Metaphysica generalis‘ oder der ‚Metaphysica specialis‘ erneuert, sondern die Problematik indirekt und im Horizont des logischen Reiches der reinen Geltung einkreist. Dass das axiomatische Reich des Geltenden die aristotelische Bestimmung der Metaphysik als Prinzip und Allheit des Seienden im Ganzen erfassen soll, deutet sich als das anspruchsvolle, anti-psychologistische Programm an.7 Weiterhin ist dabei schon prima facie unverkennbar, dass Heidegger die transzendentalphilosophische, auf die Subjektivitätsstruktur bezogene neuzeit-
3 Zu nennen wären nicht nur eher traditionelle Geister wie Peter Wust, sondern auch innovative Erneuerer der Metaphysik aus dem Geist der Phänomenologie wie Max Scheler oder Edith Stein. 4 Edmund Husserl, Cartesianische Meditationen. Eine Einleitung in die Phänomenologie, 1931/1950, hg. v. Elisabeth Ströker, Hamburg 1992, S. 66 ff. 5 Rudolph Boehm, Vom Gesichtspunkt der Phänomenologie. Husserl-Studien, Den Haag 1968, S. 12 ff. 6 Aristoteles, Metaphysik, 1028b33 ff. 7 Martin Heidegger, Frühe Schriften, Frankfurt am M. 22018, S. 49 ff.
Die Verwindung der Metaphysik?
97
liche Metaphysik mehrfach zurückweist und vielmehr das Gegebene der Welt als erscheinende ‚omnitudo realitatis‘ in den Blick nimmt.8 Kurz gesagt: Aristoteles und Thomas von Aquin, nicht aber Immanuel Kant stehen Pate. Zunehmend zeichnet sich dann in einem zweiten Schritt in den eigenständigen Vorlesungen des jungen Privatdozenten nach dem ersten Weltkrieg doch das Projekt einer ‚Metaphysik der Metaphysik‘ ab. Diese viel bekannte Formulierung aus Kants Brief an Marcus Herz begegnet freilich noch nicht programmatisch.9 Explizit wird Heidegger erst in der Phase nach Veröffentlichung seines Hauptwerkes Sein und Zeit auf diesen Anspruch Kants zurückkommen und ihn für einen kurzen Zeitraum seines Denkens in den Jahren 1929/30, die sich als besonders fruchtbar und produktiv erweisen sollten, einzulösen versuchen. Doch seine frühe Konzeption einer Ontologie, die zugleich die Faktizität des am-Leben-Seins in seiner Zeitlichkeit bezeichnet und die damit wesentliche Momente der ‚Fundamentalontologie‘ von Sein und Zeit präfiguriert,10 zielt auf eine urphänomenale Dimension der Seins‚erfahrung‘, die aller Metaphysik ihrerseits zugrunde liegt. Dieser Ansatz ermöglicht allererst den fundamentalontologischen Zugang, den Heidegger in Sein und Zeit formulieren wird. Der urwissenschaftliche Zugriff sucht den Lebenszusammenhang der metaphysischen Phänomene freizulegen. Er ist deshalb vor-kategorial11 bezogen auf Grundverhältnisse wie den Aufenthalt bei der Welt – Ethos – , die Abriegelung – Reluzenz – des Hier und Jetzt Gegebenen und die Ruinanz des in die Zeitlichkeit einbezogenen Seienden.12 In der Sache führt die Destruktion auf die Einsicht, dass Ontologie und Logik als theoretische Axiologien des Denkens auf die vortheoretische Urschicht bezogen und dadurch transformiert werden müssen: Die ‚Ontologie‘ verwandelt sich so zu einer Phänomenologie des sich selbst auslegenden und seine Lebensbewegung denkenden Daseins, die ‚Logik‘ verschiebt sich in eine Hermeneutik der Existenz, in der sich Dasein selbst ausspricht.13 Der Zusammenhang von Phänomenologie und Hermeneutik macht menschliches Dasein und in-der-Welt-sein als Erschließung 8 Ebd., S. 215 u. S. 280 ff. 9 Immanuel Kant, Brief an Marcus Herz v. 21. Februar 1772, in: AA XX 129. 10 Vgl. besonders Martin Heidegger, Ontologie (Hermeneutik der Faktizität), Frankfurt am M. 1988, S. 93 ff. 11 Beziehungsweise es ist eine eigene Kategorialität der Existenz zum Ansatz zu bringen; vgl. Barbara Merker, Selbsttäuschung und Selbsterkenntnis. Zu Heideggers Transformation der Phänomenologie Husserls, Frankfurt am M. 1988, S. 40 ff. 12 Martin Heidegger, Phänomenologische Interpretationen zu Aristoteles. Einführung in die phänomenologische Forschung, Frankfurt am M. 1994, S. 119 ff. 13 Dazu ausführlicher Harald Seubert, Heidegger – Ende der Philosophie und Sache des Denkens, Freiburg im Br. u. München 2019, S. 134 ff.
98
Harald Seubert
der Seinserfahrung deutlich, als ontologisches Grundmomentum, hinter das nicht noch einmal zurückzufragen ist:14 In den Kategorien der Existenz, die Heidegger bekanntlich auch Zeugnissen aus dem eschatologischen Zeitbewusstsein der frühen Christenheit von der gesetzten Mitte der Zeit, dem ‚ephapax‘ des Heilsgeschehens, ablas,15 wird eine radikale Geschichtlichkeit des Daseins artikuliert und auf dessen explizite Möglichkeit, sich nicht nur auf einzelnes Seiendes, sondern auf den Sinn von Sein auszurichten.
2
Fundamentalontologie und Seinsgeschichte: Zweifache Annäherung an die Frage der Metaphysik
2.1 Fundamentalontologische Annäherung Diese Vorspiele sind für Heideggers Rede von Metaphysik von kaum zu überschätzender Bedeutung. Wenn Heidegger von ‚der Metaphysik‘ spricht, nimmt sich der Metaphysikbegriff später, je länger je mehr, wie eine erratische Einheit aus, die sich in verschiedenen Ausprägungen artikuliert, ihnen aber zugrunde liegt. Der fundamentalontologische Ansatz von Sein und Zeit geht nachdrücklich davon aus, dass sich in metaphysischen Denkformen und Systematiken der Bezug des Daseins zu seinem ‚in-der-Welt-sein‘ eher indirekt dokumentiert. Erst die Interpretationsmethode einer ‚Destruktion‘ erschließt diesen Ursinn.16 Der primäre Charakter des ‚in-der-Welt-seins‘ und eines vortheoretischen Weltumgangs des Daseins ist in den Systematiken und Formationen der Metaphysik also selbst angelegt, aber nicht ausgesprochen. Die Kategorien des Daseins beziehungsweise der Existenz, wie Angst, Gewissen, Sorge und Zeitlichkeit, will Heidegger dezidiert nicht als existenzphilosophische oder existenzialistische Erkundungen verstanden wissen, sondern eben als Seinsideen, die dem Dasein in seinem in-der-Welt-sein aufgehen. 14 Vgl. u. a. Edmund Husserl, Die Konstitution der geistigen Welt. Text nach Husserliana Band IV, hg. v. Manfred Sommer, Hamburg 1984, und Ders., Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Allgemeine Einführung in die Philosophie, Hamburg 41980, S. 34 ff. Zur Hermeneutik der Konfrontation vgl. Bernhard Waldenfels, Indirekte Beschreibung, in: Heidegger und Husserl, in: Heidegger-Jahrbuch 6 (2012) S. 269 ff. 15 Vgl. Hebr 10, 10; Martin Heidegger, Einleitung in die Phänomenologie der Religion, Frankfurt am M. 1995, S. 48 ff., 203 ff. u. ö. 16 Seubert, Heidegger, a. a. O., S. 17 ff., und Otto Pöggeler, Heidegger und die hermeneutische Philosophie, Freiburg im Br. u. München 1983, S. 40 ff.
Die Verwindung der Metaphysik?
99
Jene Ideen selbst sind demnach das, was ‚der Metaphysik‘ zugrunde liegt, was sie aber selbst nicht bedacht hat. Artikulierte Metaphysik ist für Heidegger demnach die Grundlegung der ontischen Frage nach dem Seienden. Die ‚gigantomacheia tes ousias‘,17 jener ‚Gigantenkampf‘ um das Sein, auf den sich die von Heidegger auf der Titelseite zitierte Sophistes-Stelle Platons bezieht, kam in der Metaphysik selbst nicht zur Entfaltung. Daher erfordert die Grundfrage nach dem Sein einen Metaphysik selbst transzendierenden Zugang: Sie ist schlechterdings nicht zu ‚beantworten‘, sondern nur in ihrer Strittigkeit zu exponieren. Sein ist die verschwiegene, nicht eigens bedachte Tiefenschicht des in-der-Welt-seins. Es wäre allerdings verfehlt, darin eine Denkfigur zu sehen, wie sie im Zusammenhang dekonstruktivistischer, unter anderem an der Psychoanalyse geschulter Hermeneutiken entwickelt und vielfach in metaphysikkritischer Weise angewandt wurde, wonach es gelte, ‚das Verdrängte‘ der Metaphysik freizulegen.18 In dieses weitreichend sich auffächernde Feld, das Metaphysik gegen die Moderne exponiert19 und im weiten Sinn ‚metaphysikkritisch‘ genannt werden kann, ist Heidegger nicht einzubürgern. Fundamentalontologische Frage und metaphysische Systematik stehen in einem ungleich komplexeren und ambivalenten Verhältnis zueinander: metaphysisches Denken bietet allererst den Leitfaden, um in originärem Sinn das Wesen des Daseins als einen auf Welt und deshalb auf Sein selbst bezogenen Zusammenhang von Bekümmerung und Sorge zu erfassen.20 Wenn in Sein und Zeit der wohlbegründete Eindruck entstehen kann, es gebe einen Vorrang des pragmatischen Weltverhältnisses, des Umgangs des Daseins mit dem ihm verfügbaren Zeug, so ist dies nur der erste Schritt im Versuch den Weltcharakter des Daseins zu zeigen. In diesem Argumentationszusammenhang erweisen sich die Analysen von ‚Erschlossenheit‘ und ‚Verfallenheit‘ des Daseins, der Sterblichkeit und der Geschichtlichkeit als Annäherungen an den Seinssinn dieses Daseins, also an die Weise, wie es auf Sein und Welt bezogen ist. Die Fundamentalontologie soll die Weltnatur des Menschen erfassen, die ihrerseits Bedingung der Möglichkeit von Metaphysik ist.
17 Platon, Sophistes, 244 a, von Heidegger auf der Frontispizseite von Sein und Zeit zitiert. 18 Dies wäre beispielsweise bei Autoren wie Jacques Derrida, Gilles Deleuze, Jacques Lacan oder auch in religionswissenschaftlich marxistischer Sicht bei Klaus Heinrich zu konstatieren; vgl. dazu Johannes-Georg Schülein, Metaphysik und ihre Kritik bei Hegel und Derrida, Hamburg 2016, S. 309 ff. 19 Dazu noch immer sinnvoll Dieter Henrich, Was ist Metaphysik, was Moderne? Thesen gegen Jürgen Habermas, in: Merkur 20 (1986) H. 338, S. 495 ff. 20 Martin Heidegger, Sein und Zeit, Tübingen 192006, S. 209 ff.
100
Harald Seubert
Im Blick auf René Descartes wird die destruierende Annäherung an konkrete Ausprägungen der Metaphysik besonders exemplarisch deutlich gemacht: Descartes müsse ein Seinsverständnis verfehlen, weil er der ‚traditionell-metaphysischen‘ Interpretation des Wesens des Seienden als ‚Anwesenheit‘ – Präsenz beziehungsweise Parusie – und seiner gnoseologischen Erkennbarkeit als ‚Anschauung und Denken‘ unbefragt folge.21 Diese metaphysischen Vorentscheidungen bedingen, dass die Begründung des ‚Fundamentum inconcussum‘ im Ego cogito nicht die Seinsweise des Subjektes und in der ‚res extensa‘ nicht die Seinsweise der Natur der objektiven Welt erfassen könne.22 Der von Heidegger behauptete ontologische Mangel aller Metaphysik im Sinn der Ontologie wird in Sein und Zeit deshalb klar und deutlich markiert. In der tradierten Ontologie werde jeweils die Frage nach der Welt als Allheit des Seienden übersprungen, zugleich aber manifestiere sich in einzelnen metaphysischen Bestimmungen die ständige Wiederkehr dieses Überspringens. Metaphysik bleibe auf ‚Anwesenheit‘, Präsenz, Parusie bezogen. Dieser Zeit tilgende Präsenzcharakter verbinde sich damit, dass das ‚innerweltlich Seiende‘ zum eigentlichen Thema der Metaphysik wird. Dasein aber sprengt in seinem Doppelcharakter als ‚geworfener Entwurf‘ und in seiner zeitlichen Selbstauslegung in Gewissen und Schuld diese Innerweltlichkeit auf.23 Eine weitere, nur wenig beachtete, aber höchst bedeutsame Umzeichnung verbindet sich damit: Heidegger weist den metaphysischen Bestimmungen selbst den Charakter des ‚Vorstellens‘ zu, den Georg Wilhelm Friedrich Hegel etwa für Religion im Unterschied zum philosophischen Denken reserviert hatte.24 Denkend transzendiert das Dasein solche Vorstellungen. Es bezieht sich nicht mehr auf einzelne ontische Bestimmungen der Seinsidee und wird vielmehr auf seinen Weltbezug entgrenzt.
2.2
Das Konzept der Seinsgeschichte und die Seinsfrage
In den seinsgeschichtlichen Annäherungen an die Problematik der Metaphysik, die sich ab Mitte der dreißiger Jahre konkretisieren und allgemein unter dem Topos 21 Ebd., S. 96. 22 Ebd., S. 99 ff. 23 Ebd., S. 100. 24 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Religion, 1832, hg. v. Eva Moldenhauer u. Karl Markus Michel, Frankfurt am M. 1969, S. 12 ff.; dazu auch Michael Theunissen, Sein und Schein. Die kritische Funktion der Hegelschen Logik, Frankfurt am M. 1980, S. 301 ff. u. S. 381 ff.
Die Verwindung der Metaphysik?
101
der ‚Kehre‘ besprochen werden, geht Heidegger nicht mehr vom Weltbegriff aus, sondern vom Sein, das auch der Omnitudo realitatis zugrundeliegt: abgründig, doppeldeutig, als Erscheinung und sich-Entziehen. Der ontologische Holismus, wie er sich in Heideggers Frühzeit andeutete, formt sich in der Seinsgeschichte neu und vertieft aus. Heidegger unterscheidet in immer wieder neuen Anläufen zwischen dem ‚ersten Anfang‘, dem Anfang der Metaphysik und einem anderen Anfang des Denkens, der erst noch anstehe.25 Deshalb wird Metaphysik bekanntlich mit ‚Seinsvergessenheit‘ geradezu identifiziert.26 Die ‚gigantomacheia tes ousias‘ ist aus Heideggers Sicht in Sein und Zeit noch längst nicht hinreichend abgetragen worden. Obgleich es hier nicht möglich ist, Fragen der Konzeption von Heideggers Denkweg, der Kontinuitäten und der Umbrüche zu diskutieren27 – das Grundmotiv, dass es dem aller Metaphysik zugrundeliegenden Sein nachzudenken gelte, bleibt bestimmend: Während aber die Seinsfrage auf dem Weg der ‚Fundamentalontologie‘ aus der Struktur des menschlichen Daseins gewonnen werden sollte, erschließt sie sich nun aus der Struktur des Seins selbst. Systematisch zusammengesehen, ergibt sich eine elliptische Tektonik dieses Ansatzes mit zwei Brennpunkten, jenem des Daseins und jenem des Seins, auf das es bezogen ist. Diese Komplementarität erschließt erst den Blick auf Metaphysik im Ganzen. Sie dürfte Heidegger im Sinn gehabt haben, wenn er mit Parmenides darauf verwies, dass im Denken „Hinweg und Rückweg das Selbe“ seien,28 und wenn er sich so gegenüber jeder vulgarisierenden Periodisierung eines ‚Heidegger I‘ gegen einen ‚Heidegger II‘ verwahrte.29 Die immer wiederkehrenden Aussagen zu ‚der Metaphysik‘ auf dem seinsgeschichtlichen Denkweg variieren im Wesentlichen in einigen Grundaussagen: Metaphysik habe Seiendes in spezifische intentionale Bestimmungen gefasst. Sie habe aber das Sein selbst übergangen und sogar vergessen. Heideggers Ansatz unterscheidet sich ganz offensichtlich von jeder gängigen ‚Metaphysikkritik‘ 25 Martin Heidegger, Beiträge zur Philosophie. (Vom Ereignis), Frankfurt am M. 1989, S. 6-36. Dazu auch Harald Seubert, Zwischen erstem und anderem Anfang. Heideggers Auseinandersetzung mit Nietzsche und die Sache seines Denkens, Köln, Weimar u. Wien 2000, S. 1 ff. 26 Heidegger, Beiträge, a. a. O., S. 259 ff., u. Ders., Die Metaphysik als Geschichte des Seins, in: Heidegger, Nietzsche, Bd. 2, Pfullingen 51989, S. 399 ff. 27 Dazu in der Rückspiegelung der heutigen Forschung Seubert, Heidegger, a. a. O., S. 433 ff. 28 Klaus Held, Heraklit, Parmenides und der Anfang von Philosophie und Wissenschaft. Eine phänomenologische Besinnung, Berlin u. New York 1980, S. 55 ff. 29 So klassisch William Richardson, Heidegger: Through Phenomenology to Thought. Preface by Martin Heidegger. Fortieth Anniversary Edition, with New Writer’s Preface and Epilogue, New York 2003.
102
Harald Seubert
der Moderne, ob sie nun den Wegmarken des logischen Positivismus oder den Reduktionen auf vermeintliche Primärbereiche folgt, der Anthropologie oder der Politischen Ökonomie, von deren Fundament aus Metaphysik Projektionen beschreibt. Die Seinsvergessenheit ist nach Heidegger geradezu konstitutiv für die Metaphysik. Dabei vollzieht sich in der Seinsgeschichte eine Dynamik, die von einem ersten Vergessen zu immer weitergehender Seinsvergessenheit führt. Es ist nach Heidegger ein ‚Geschehen‘ und ‚Geschick‘, das nur bedingt in der Handhabe und Souveränität der einzelnen Denker liegt. Sein ‚wird‘ bei Platon ‚zur Idee‘, bei Aristoteles ‚zur Substanz‘‚ der Ousia – , bis sie bei Hegel zum ‚absoluten, in sich selbst vermittelten Begriff‘ und bei Friedrich Nietzsche zum in sich kreisenden ‚Willen zur Macht‘ wird, der den Sinn von Sein vollständig verdeckt. Die Begrifflichkeit löst sich zunehmend von den fundamentalontologischen ‚Kategorien der Existenz‘ und fügt ein enges Beziehungsgefüge von Grundworten in die Architektonik der Seinsgeschichte ein: Wahrheit, Unverborgenheit – a-letheia – , erweist sich als Lichtung des Verborgenen, als Aufdecken eines jeweiligen Sinnes von Sein. Sein hat an dem Entbergungszusammenhang von Wahrheit Anteil: Eben weil es sich in jeweiligen seinsgeschichtlichen Konstellationen nach bestimmten Hinsichten entbirgt und wieder verschließt. Auch Physis wird, gemäß dem Wort Heraklits: „physis kryptesthai philei“,30 zu einem Interpretament des Seins. Die bei Heidegger wiederholt begegnende Aussage, der „Name eines Denkers stehe für die Sache seines Denkens“31 macht deutlich, dass die jeweiligen Grundstellungen, in denen sich Metaphysik artikuliert, alles andere als kontingente eigene Denkleistungen sind, die auch anders hätten geschehen können. Auf dem Weg zwischen den verschiedenen Konstellationen soll vielmehr eine Art Nemesis walten, die dem Einzelnen nur wenig Gelegenheit zur Ausgestaltung lässt. Im Einzelnen legen die nachgelassenen Aufzeichnungen, vor allem in den Beiträgen zur Philosophie nahe, dass Heidegger von einem wechselseitigen Bedingungsverhältnis ausgeht:32 Metaphysik zehrt von dem verborgenen Grund der Seinsfrage. Im Lauf ihrer neuzeitlichen Entwicklungsgeschichte entfernt sie sich immer weiter von diesem Grund und nähert sich einer anfangsvergessenen Fixierung des Seienden auf die Produktionen neuzeitlicher Technik, des ‚Gestells‘, an. Doch mit dem
30 Heraklit, Fragmente 16, 32, u. 35, in: Fragmente der Vorsokratiker, 3 Bde., hg. v. Hermann Diels u. Walther Kranz, Berlin 71954, Bd. 1, S. 155, S. 159; dazu Martin Heidegger, Heraklit. Der Anfang des abendländischen Denkens, Frankfurt am M. 1979, S. 44 ff u. S. 124 ff. 31 Martin Heidegger, Nietzsche, Bd. 1, Pfullingen 51989, S. 9. 32 Heidegger, Beiträge zur Philosophie, a. a. O., S. 227 ff.; diese Nachweise und Verbindungen wären vielfach zu ergänzen, wie Seubert, Heidegger, a. a. O., S. 322 ff., zeigt.
Die Verwindung der Metaphysik?
103
Friedrich Hölderlin-Votum, dass wo Gefahr ist, auch das Rettende wachse,33 wird nach Heidegger gerade die in ihr Endstadium gelangte Metaphysik zur Anzeige des ‚selbst‘-Aufgehenden, der ‚Physis‘. Gerade in der Spätzeit einer Metaphysik des Willens zur Macht, in der die Ressourcen der Metaphysik weitgehend durchlaufen sind, kann sich daher ein Denken ausbilden, das, achtsam und bewahrend, das in der Metaphysik Ungedachte doch denkt.
3
Metaphysik und Seinserfahrung: Formationen diesseits der Metaphysikkritik
Der erratische Begriff ‚der Metaphysik‘ kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass Heidegger, vor allem in seinem Vorlesungswerk die verschiedenen metaphysischen Formationen auch im Einzelnen unterschied und, gründlicher als jeder andere Denker nach Hegel, deklinierte, freilich mit unterschiedlichen Graden von Genauigkeit. Auch in systematischer Hinsicht ist die jeweilige Kenntnis eines metaphysischen Horizontes von Bedeutung. In seinen Anfängen ist Heidegger mit der zeitgenössischen neukantianischen Philosophie, vor allem seines Lehrers Heinrich Rickert vertraut, erst später mit dem grundlegenden Neueinsatz der Husserlschen Phänomenologie. Zugleich ist die grundlegende Einsicht in die Aristotelische ontologische Frage nach der mannigfachen Bedeutung des Seienden und ihrem Zusammenhang, vermittelt über Franz Brentanos Dissertation,34 nach Heideggers Selbstaussage eine der Initiationen in die Philosophie gewesen. Thomas von Aquin und die nominalistische Kritik kommen hinzu. Dies war die Matrix, von der aus Heidegger in den vortheoretischen, eigentlich ontologischen Bereich ausgriff. In der Marburger Zeit erschließt er sich in zunehmendem Maß, neben dem singulären Rekurs auf die Kategorienlehre in Platons Sophistes,35 die neuzeitliche Subjektivitäts- und Transzendentalphilosophie, vor allem bei Descartes und Kant.36
33 Friedrich Hölderlin, Patmos Erste Fassung, in: Ders., Sämtliche Werke und Briefe, 1. Bd., hg. v. Michael Knaupp, München 1992, S. 447. 34 Franz Brentano, Von der mannigfachen Bedeutung des Seienden nach Aristoteles, Freiburg im Br. 1862, S. 7 ff. 35 Martin Heidegger, Platons ‚Sophistes‘. Marburger Vorlesung WS 1924/25, Frankfurt am M. 1992, vor allem S. 581 ff. 36 Dazu auch Martin Heidegger, Einleitung in die phänomenologische Forschung, Frankfurt am M. 1994, S. 130 ff. u. S. 270 ff.
104
Harald Seubert
Dies verbindet sich mit der weitergehenden Ausarbeitung des eigenen fundamentalontologischen Ansatzes und von dessen Temporalitätsstruktur.37 Erst in der Freiburger Periode seit 1929, auf dem Weg in die seinsgeschichtliche Konzeption, ist die sehr intensive Befassung mit der Metaphysik seit Hegel und Friedrich Wilhelm Joseph Schelling umfassend dokumentiert. Auch Platon, Aristoteles und Gottfried Wilhelm Leibniz kommen im Gesamtzusammenhang des seinsgeschichtlichen Blicks noch einmal zur Sprache. Der Fokus liegt aber auf der, nach Heideggers Überzeugung, letzten Form der abendländischen Metaphysik, Nietzsches Metaphysik des Willens zur Macht. Den Willen zur Macht interpretiert Heidegger als einen repetitiven Kreislauf, der einem technischen Maschinengang umfassender Reproduzierbarkeit und einer nihilistischen Itineration nahekommt. Heidegger teilte in späteren Jahren wohl gelegentlich mit, dass ihn Nietzsche beziehungsweise die intensive Beschäftigung mit dessen Denken ‚zerstört‘ habe.38 Man könnte darin einen Vorbehalt gegenüber einer Überidentifikation mit Nietzsche erkennen, gerichtet gegen einen prophetischen Gestus, der allzu sehr ‚mit dem Hammer‘ philosophiert und die Tektonik der Metaphysik zu früh verabschiedet. Ebenfalls werden in der Freiburger Zeit die metaphysischen Grundstellungen zunehmend im Licht eines Gegenhaltes interpretiert, den Heidegger immer stärker profiliert: nämlich der frühgriechischen, vor-metaphysischen Aussage über Wahrheit, aletheia bei Parmenides und Heraklit einerseits, der Dichtung – vor allem Hölderlins – andererseits. Dichtung ist für Heidegger ein regelrechtes Antidotum von Metaphysik. Wo sie, wie bei Hölderlin, ‚ins Offene‘ verweist, sagt und verschweigt sie zugleich den originären Seinsbezug. Dass dies immer auch der Bezug auf eine Welt sein wird, verdeutlicht Heidegger insbesondere in seinen späteren Arbeiten zur Kunst und insbesondere zur Dichtung. Die Grundstruktur schulmetaphysischer Bestimmungen: der ‚Existentia‘ und der ‚Essentia‘ bleibt ein Schlüssel, nach dem Heidegger metaphysische Konstellationen deutet. Auch das Instrumentarium der Leitfrage, die im Wesentlichen auf die Leitfrage der Metaphysik, die Bestimmung des Seins des Seienden, und der Grundfrage, die er bei Leibniz und Schelling identifiziert: „Warum ist Seiendes und nicht vielmehr Nichts?“, wiederholt sich.39 Die Beurteilung wird sich später ändern. 37 Siehe u. a. Martin Heidegger, Die Grundbegriffe der Metaphysik. Welt – Endlichkeit – Einsamkeit, Frankfurt am M. 21992, S. 15 ff.; siehe auch Ders., Die Grundprobleme der Phänomenologie, Frankfurt am M. 1975, S. 302 ff. 38 Nachweis bei Wolfgang Müller-Lauter, Heidegger und Nietzsche. Nietzsche-Interpretationen. 3, Berlin u. New York 1980, S. 17, mit weitergehenden Nachweisen, die dieses Diktum auf der Spur von Hans-Georg Gadamer und Otto Pöggeler verorten. 39 Martin Heidegger, Vom Wesen des Grundes, 1929, in: Ders., Wegmarken, Frankfurt am M. 1976, S. 123 ff.
Die Verwindung der Metaphysik?
105
Heidegger wird vielmehr betonen, dass die Metaphysik gar keine Grundfrage zu exponieren ermögliche. Erst einem Denken jenseits der Metaphysik erschließe sich die Verflechtung von Grund und Abgrund, in den das menschliche Dasein hineingehalten sei. Wenn man Heideggers Nachlass-Aufzeichnungen näher betrachtet, wird deutlich,40 dass ihn nicht nur die Frage, wie das unbedachte, vergessene Sein doch zu denken sei, beschäftigt. Mindestens ebenso blieb ihm das Verhältnis jenes ‚anderen Anfangs‘ zur Metaphysik fraglich: Der Rückgang und die ‚Auseinandersetzung‘, die Identifikation mit einer vergangenen metaphysischen Grundstellung und Trennung von ihr gleichermaßen erfordert, sind Voraussetzungen dafür, dass die Ressource des Seins ins Denken gebracht werden kann. Wo er Nähe und Ferne zur Metaphysik in einem eigenen Aufriss zu formulieren hatte, legte Heidegger selbst ein Entsprechungsverhältnis nahe zwischen der ‚Erinnerung‘ an die Metaphysik, ihre Wegbahnen und einzelnen Grundstellungen ‚und‘ dem Sprung, der alle Metaphysik hinter sich lässt. Wenn man aber noch Heideggers Notizen zur Selbstverständigung durchdenkt, etwa seine Selbstkommentare zu Sein und Zeit aus zehnjährigem Abstand, wird erkennbar, dass er zwischen beiden Aspekten durchaus schwankte.41 Der ‚Absprung‘ und das Vergessen werden wiederholt ins Spiel gebracht.42 Selbst von einer ‚Überwindung‘ ist auf Heideggers spätesten Denkwegen die Rede: aber eher in einem ‚Futurum perfectum‘, das dann greift, wenn in einer neuen Leichtigkeit Sein selbst erwogen wird. Die bevorzugte Wendung von der ‚Verwindung der Metaphysik‘ deutet demgegenüber an, dass der erste Anfang in den anderen ‚verwoben‘ oder ‚verschränkt‘ bleibt und dass das Denken nur ‚zwischen‘ Metaphysik und Seinsfrage Position gewinnen kann. Von Metaphysikkritik unterscheidet sich diese Position darin noch einmal elementar, dass es gerade nicht epistemologische, ökonomische oder realgeschichtliche Entwicklungen sind, an denen Heidegger seine Position zur Metaphysik orientiert und diese selbst radikal in Frage stellt. Dieser vordergründigen Lesart, die auf einer positivistischen Linie zwischen Ludwig Feuerbach und Rudolf Carnap wie selbstverständlich festgehalten wird,43 die eine ideologiekritische Positionierung 40 Vgl. hierzu nicht nur Martin Heidegger, Beiträge, a. a. O., sondern u. a. auch Ders., Besinnung, Frankfurt am M. 1997, S. 3 ff. u. S. 45 ff. 41 Dazu Martin Heidegger, Zu eigenen Veröffentlichungen, Frankfurt am M. 2017, S. 102 ff. und S. 230 ff.; vgl. dazu Seubert, Heidegger, a. a. O., S. 400 ff. 42 Martin Heidegger, Zur Sache des Denkens, Frankfurt am M. 2007, S. 3 ff. Die Belege wären durch die ‚Aufzeichnungen‘ – Schwarze Hefte – in deren philosophischem Kernbestand nach Ende des Zweiten Weltkriegs zu ergänzen. 43 Vgl. in kluger Abwägung von Heideggers eigenem Denkansatz und den Projektionen der Wirkung Emil Angehrn, Kritik der Metaphysik und der Technik. Heideggers Aus-
106
Harald Seubert
zur Metaphysik in Marxismus und Neomarxismus leitet, an der aber auch Philosophen der ‚unreduzierten und unreduzierbaren‘ Erfahrung wie Nietzsche oder Theodor W. Adorno Anteil haben, ist Heideggers Denken von seinem Ansatz her entgegengesetzt. Deshalb zielt auch jeder Versuch einer Situierung seiner ‚Sache des Denkens‘ in der Umgebung eines ‚schwachen Denkens‘,44 das die – vermeintlich letzten – Zielsetzungen und Gründe der Metaphysik in eine erfahrungshaft kontingente Nahoptik zurückbeziehe, an Heideggers sachlicher Position gänzlich vorbei. Vielmehr versucht Heidegger aus vortheoretischen Einsichten in den Zusammenhang von Philosophie und Leben in den Grund der Metaphysik einzudringen. Unverkennbar sind seine Ausarbeitungen im Umkreis der ‚Seinsfrage‘ teilweise auch Umzeichnungs- und Überbietungsversuche: So wenn Heidegger an die Stelle des Systems, in der Metaphysik der klassischen deutschen Philosophie, die ‚Fuge‘ setzt: Fluchtlinien und ‚Verfugungen‘ der Seinsfrage. Er betont dabei, dass die ‚Fuge‘, die gleichsam die Differenzen und Strukturen des Seinstopos selbst zeige, eine strengere Ausfigurierung zeige als das ‚System‘. Zugleich wird aber die Vorläufigkeit von Mitteilungen wie den Beiträgen betont. Sie seien „Richtscheit einer künftigen Ausgestaltung“.45 Dabei ergibt sich durchaus die Aporie, dass jene Denkform propositional angelegt sein soll und zugleich in eine aller propositionalen theoretischen Verfasstheit vorgelagerte Dimension führt. Man wird im Rückblick konstatieren können, dass Heidegger an der ‚künftigen Ausgestaltung‘ mehr oder weniger gescheitert ist. Die Hermetik der Heideggerschen Sprachform ist nur ein Teil der Problematik. Dass die Unmittelbarkeit der Seinserfahrung es in ihrem geradezu mystischen Evidenzcharakter letztlich eher verhindert, eine eigene Ergründungs- und Denkform auszubilden, wiegt schwerer. Dies ist auch der Grund dafür, dass es Heidegger nicht darum gehen kann, die Seinsfrage zu ‚beantworten‘,46 sondern sie zu ‚fragen‘, also als den ungefragten Grund der Metaphysik auszuweisen. Der Versuch, die Struktur der ‚ontologischen Differenz‘ in frühere Denkformen einzutragen, würde den zeitlichen Verlauf der Seinsgeschichte abzukürzen versueinandersetzung mit der ‚abendländischen Tradition‘, in: Heidegger-Handbuch. LebenWerk-Wirkung, hg. v. Dieter Thomä, Stuttgart u. Weimar 2005, S. 268 ff. 44 Dazu Gianni Vattimo, Jenseits vom Subjekt. Nietzsche, Heidegger und die Hermeneutik, hg. v. Peter Engelmann, Graz 1986, wobei diese Einbeziehung Heideggers in einen metaphysisch zurückhaltenden Strang der Postmoderne letztlich nicht überzeugen kann. 45 Heidegger, Beiträge, a. a. O., S. 1. 46 Dies gegen Rainer Enskat, Heideggers Weg zur Antwort auf die Seinsfrage und wie ihn Kant dabei begleiten kann, in: Neunzig Jahre ‚Sein und Zeit‘. Die fundamental-ontologische Frage nach dem Sinn von Sein, hg. v. Harald Seubert, Freiburg im Br. u. München 2019, S. 275-302.
Die Verwindung der Metaphysik?
107
chen.47 Bei aller Plausibilität, die dabei erreicht wird, überzeugt die Situierung innerhalb der Metaphysik nicht vollständig: Gelangte Heidegger doch in zunehmendem Maß zu der Überzeugung, dass erst am Ende, im Zeichen der ‚Not der Notlosigkeit‘, ‚ursprünglicher‘ und damit meinte er, in einem nicht nur philosophischen, sondern denkerischen Modus nach dem Sinn von Sein gefragt werden könne.48
4
Sein, Nichts und Welt als Formationen der Grundfrage
4.1
Der Status der Metaphysik
Die Modifikationen in Heideggers Blick auf Metaphysik können nichts daran ändern, dass im Sinn der weiter oben angedeuteten elliptischen Denkstruktur, Leit- und Grundmotive bestimmend bleiben. Damit nähert sich der Blick dem Kern von Heideggers metaphysischer Frage. Besonders deutlich bezeichnete er 1929 in seiner Freiburger Antrittsvorlesung Was ist Metaphysik? den Bezirk und zugleich die Grenze aller Metaphysik. Es ist nicht zufällig, dass diese exemplarische Äußerung zwischen dem fundamentalontologischen Ansatz von Sein und Zeit und der seinsgeschichtlichen Konzeption eine Mitte hält und Motive aus beiden Erwägungen aufnimmt. Erforscht werden solle und könne nur das Seiende – „sonst nichts“49, die Versicherung des ‚Eigensten‘ durch diese Begrenzung führte gerade zu dem Anderen, das ausgeschlossen werden sollte: eben dem ‚Nichts‘. In der Punktation dieser Frage unterscheidet Heidegger auffälligerweise nicht zwischen dem ‚metaphysischen‘ und dem ‚wissenschaftlichen‘ Menschen, zwischen denen er ansonsten vorläufige Trennlinien markiert.50 Die Andersheit des Nichts irritiert und erschüttert so und so das menschliche Weltverhältnis, tritt doch nicht nur der Bezug zu einzelnem Seienden, sondern zur Welt als ‚Omnitudo realitatis‘, zu der Allheit und Gesamtheit des Wirklichen in den Hintergrund. Heidegger schreibt seine Analyse der ‚Angst‘ aus Sein und Zeit phänomenologisch auf eine Grundstimmung hin weiter, in der nicht nur die Intentionalität des einzelnen Seienden, sondern auch der Bezug auf 47 Heidegger, Zur Sache des Denkens, a. a. O., S. 67 ff., wo der Zusammenhang des Endes der Seinsgeschichte mit der Nähe des anderen Anfangs sehr deutlich betont wird. 48 Ebd. 49 Martin Heidegger, Was ist Metaphysik, 1929, S. 105. 50 Ebd., S. 100 ff.; siehe auch Seubert, Heidegger, a. a. O., S. 110 ff. zu einer bereits früher fixierten Unterscheidung.
108
Harald Seubert
das Seiende im Ganzen selbst zurücktritt und das Weltverhältnis des Daseins gleichsam einem Abgrund ausgesetzt ist. Sein ist darin als das ‚Nichts‘ gegenüber allem Seienden enthüllt: „Nur auf dem Grunde der ursprünglichen Offenbarkeit des Nichts kann das Dasein des Menschen auf Seiendes zugehen und eingehen“.51 In einer ursprünglichen, metaphysisch aber nicht mehr reflektierbaren Offenbarkeit des Nichts gründen demnach im Sinne Heideggers die entscheidenden Wesenszüge des metaphysischen Charakters der Person: Selbstsein und Freiheit.52 Gemäß seiner Interpretation sind auch die Grundfrage der Metaphysik: ‚Warum ist Seiendes und nicht vielmehr Nichts?‘ und die mit ihr verbundene Grundstimmung des Daseins zum Nichts noch Teil der ‚metaphysischen Frage‘. Dieser Fragenkomplex umgreift dabei einerseits das Ganze der Metaphysik und sie bezieht zugleich das Dasein mit in die Fragebewegung ein. Eine ‚Metaphysik der Metaphysik‘, wie Heidegger sie zeitweise im Anschluss an Kants Programm vorgeschwebt haben mag, muss an der Einsicht festhalten, dass die Bezugnahme auf das Nichts derjenigen auf Seiendes und das Seiende im ganzen vorausgeht, dass sich diese Frage nach dem Nichts aber als die ur-ontologische Frage erweist. Auf diese Warumfrage findet sich eine Resonanz, wenn Heidegger den Satz der Identität, die Parmenideische Gleichsetzung von Denken und Sein zu einem GrundSatz des Denkens umzeichnet, der ein Satz im Sinn eines ‚Sprunges‘ sei, bezogen auf den „in sich schwingenden Bereich, durch den Mensch und Sein einander in ihrem Wesen erreichen, ihr Wesendes gewinnen, indem sie jene Bestimmungen verlieren, die ihnen die Metaphysik geliehen hat“.53 Im Licht der ‚Grundfrage der Metaphysik‘ und ihrem Verweis auf das Nichts gelangt Heidegger zu weitreichenden Aussagen: „Metaphysik ist das Grundgeschehen im Dasein. Sie ist das Dasein selbst“.54 Deshalb wird auch erklärt, dass Metaphysik sui generis sei. Sie ist deshalb nur aus der Immanenz metaphysischen Denkens und nicht nach dem Maßstab einer externen Epistemologie zu erfassen. Den Gedankengang der Freiburger Antrittsvorlesung hat Heidegger immer wieder erwogen und dabei verschiedentlich andere Akzente gesetzt. Es scheine „fast“, bemerkt er einmal in diesen Zusammenhängen, „als sei die Metaphysik durch die Art, wie sie das Seiende denkt, dahin gewiesen, ohne ihr Wissen die Schranke zu sein, die dem Menschen den anfänglichen Bezug des Seins zum Menschenwesen verwehrt“.55 Versuche, innerhalb ausgeprägter transzendenter Begriffsformen, wie dem Denken 51 Heidegger, Was ist Metaphysik, a. a. O., S. 114 f. 52 Ebd., S. 115. 53 Martin Heidegger, Bremer und Freiburger Vorträge, Frankfurt am M. 1994, S. 126. 54 Heidegger, Wegmarken, a. a. O., S. 122. 55 Heidegger, Einleitung zu ‚Was ist Metaphysik?‘, Frankfurt am M. 32004, S. 370.
Die Verwindung der Metaphysik?
109
des Einen im Neuplatonismus, die Struktur der ontologischen Differenz bereits anzusetzen, so dass Heideggers Anspruch, von Grund auf die Wahrheit des Seins gedacht zu haben, zu korrigieren wäre,56 verkennen doch die Radikalität, in der Heidegger jene Schranke verdeutlicht. Selbst in dem seins-transzendenten, Platons Vorzeichnung des ‚Epekeina tes ousias‘ folgenden neuplatonischen Einen – Hen57 – oder dem Absoluten des späten Johann Gottlieb Fichte, geht es um eine Differenz zwischen Principium und Principiatum, den Hervorgang der Allheit des Seienden. Die ‚Wahrheit des Seins‘ – und damit die grundlegende Struktur zwischen sich Zeigen und Verborgenheit, die es ‚denkender‘ zu denken gilt, weil sie nicht in das Begründungsgefüge der Metaphysik zu integrieren ist, bleibt aber unthematisch.
4.2 Heideggers Weltbegriff Den positiv unhintergehbaren Charakter von Metaphysik arbeitete Heidegger am Ende der zwanziger Jahre vor allem vor dem Brennpunkt des ‚Weltbegriffs‘ heraus,58 der nicht nur vom Schulbegriff der Philosophie zu unterscheiden ist, sondern den Heidegger, ausgehend von Kant, gerade nicht als ontische Verknüpfung und Substanzen-Koordination versteht. Der Kantische Weltbegriff eröffnet, wie Heidegger betont, selbst eine ontologische Struktur, der auf den höchsten Punkt der Vernunft führt,59 der die „Existenz des Menschen im geschichtlichen Miteinander“ begründet 60 und das „Ideal des göttlichen Menschen in uns“61 hervorbringt. Im Sinn dieses Weltbegriffs versteht Heidegger daher auch das ‚Wesen des Grundes‘, indem er in den produktiven Jahren nach Sein und Zeit und vor 1933 das Weltverhältnis des Menschen als Transzendenz versteht. Die Warumfrage: ‚Warum ist Seiendes und nicht vielmehr Nichts?‘ wird seinerzeit nicht in erster Linie auf den Vorrang des bestimmungslosen Nichts vor den ontologischen Klärungen bezogen, sondern als die Transzendenzbewegung des menschlichen Daseins zum Grund von Welt.
56 Werner Beierwaltes, Heideggers Rückgang zu den Griechen, in: Ders., Fußnoten zu Plato, Frankfurt am M. 2011, S. 345 ff. 57 Dazu Werner Beierwaltes, Denken des Einen. Studien zur neuplatonischen Philosophie und ihrer Wirkungsgeschichte, Frankfurt am M. 1985, S. 7 ff. 58 Martin Heidegger, Vom Wesen der menschlichen Freiheit. Einleitung in die Philosophie, Frankfurt am M. 1982, S. 115 ff., mit dem Topos der ‚Ausarbeitung der Leitfrage der Philosophie zur Grundfrage der Metaphysik‘. 59 Martin Heidegger, Kant und das Problem der Metaphysik, Frankfurt am M. 1991, S. 151 ff. 60 Ebd., S. 153. 61 Ebd., S. 154.
110
Harald Seubert
Heideggers eigener Leitsatz: „Das Wesen der Endlichkeit des Daseins enthüllt sich aber in der Transzendenz als der Freiheit zum Grunde“62 ist demnach noch als ein metaphysischer Satz angelegt.
5
Epilog
Dass Heideggers fundamentalontologischer Denkansatz keineswegs zwingend in eine Gegenpositionierung zu ‚der Metaphysik‘ hätte führen müssen, wird gerade in den Anläufen unmittelbar nach Sein und Zeit überdeutlich. Heidegger betonte im Umkreis des Kant-Buches und der Davoser Disputation mit Ernst Cassirer 1929, dass es in seinem Denken um eine einzige Frage gehe, die Frage nach dem Sein selbst. Im Licht der Seinsfrage kommt er auf ‚die Metaphysik‘ in ihren unterschiedlichen Formationen und Ausgestaltungen zurück. Dabei sind solche metaphysischen Konstellationen von besonderer Bedeutung, in denen sich das metaphysische Profil erstmals ausgeprägt zeigt, wie bei Platon und Aristoteles, oder in denen die metaphysische Begründungs- und Begriffsweise selbst reflexiv wird wie bei Hegel, Schelling oder Nietzsche. Heideggers Intuition, bezogen auf Metaphysik, ist darin treffend und nach wie vor unhintergehbar, dass er eine nicht-reduktionistische Konzeption des der Metaphysik Zugrundeliegenden, in ihr aber nicht Bedachten entwickelt. Philosophisch liegt dies in der Nähe von Kants Intention einer ‚Metaphysik der Metaphysik‘, aber auch von Husserls Situierung der Metaphysik als einer Urwissenschaft. Es ist gerade der Begriff von Welt, an dessen Leitfaden entlang Heidegger diese Konzeption einer ‚Metaphysik der Metaphysik‘ und der Annäherung an die Seinsfrage selbst entwickelt. Dabei besteht prima facie kein Grund, dies in einer Gegenstellung zur metaphysischen Überlieferung zu tun. Dies war Heidegger während einer kurzen Phase auch vollkommen klar, als er nach dem Abschluss von Sein und Zeit vertieft der Kantischen Transzendentalphilosophie nachging, die er, in Interpretation des Diktums aus Kants Brief an Marcus Herz, als eine Grundlegung der Metaphysik verstand, die die Endlichkeit des Daseins zugleich als konstitutiv für seine metaphysische Wesensnatur versteht. Bekanntlich geht Heidegger dabei in Interpretation primär der A-Auflage der Kritik der reinen Vernunft einer Spur in Heideggers Kant-Interpretation nach, die Zeit als reine Anschauung als Konstituens menschlicher Subjektivität erfasst.63 Zeitlichkeit durchdringt und bestimmt daher Metaphysik in einer, zu wenig beachteten, eminenten Weise: Sie sei das Grund62 Ebd., S. 175. 63 Heidegger, Kant und das Problem der Metaphysik, a. a. O., S. 25 ff.
Die Verwindung der Metaphysik?
111
geschehen im Dasein als solchem, nichts, was vom Menschen nur geschaffen wird in Systemen und Lehren.64 Diese Metaphysik werde in der Fundamentalontologie wiederholend zur Artikulation gebracht, so dass die zeitlose aristotelische Frage nach dem on he on, der Bedeutung des Seins des Seienden, in ihrer Unablösbarkeit von der Frage nach dem menschlichen Seinsgrund sichtbar werde.65 Im Zusammenhang der Davoser Disputation fügte Heidegger hinzu, „daß die Frage der Möglichkeit der Metaphysik eine Metaphysik des Daseins selbst fordert als Möglichkeit des Fundaments einer Frage der Metaphysik“.66 Indem Heidegger das seinsgeschichtlich zu Denkende so sehr vom Erbe metaphysischen Denkens trennte und sich auch von den Selbstreflexionen der Transzendentalphilosophie verabschiedete, in denen sich der metaphysische Bestand bricht, verlor er zunehmend den Bezugsrahmen seines Denkansatzes aus dem Blick. Der vortheoretisch phänomenologisch motivierte Fragezusammenhang nach der Verborgenheit und Unauflösbarkeit, dem änigmatischen Charakter im metaphysischen Denken bleibt Heideggers großer und nicht ersetzbarer Beitrag zum metaphysischen Weltgespräch. Er ist Teil einer ‚Metaphysik der Metaphysik‘, die zugleich Klärung erbringen kann über den metaphysischen Charakter der Person, die in ihrer Endlichkeit unendliche Fragen aufwirft. Doch keinerlei Notwendigkeit, ja nicht einmal eine Plausibilität besteht dafür, dass Heidegger seinen Denkansatz in die vehemente Gegenstellung zur Metaphysik bringt, so wie er dies schließlich tat. Mithin sind auch die Gegenstellungen zu dem ‚vormetaphysischen‘ griechischen Anfang des Denkens oder zu einem eminenten dichterischen Nennen des Seins, wie er es bei Hölderlin ausmacht, keinesfalls zwingend. Heidegger hat, in klarem Licht betrachtet, die Verborgenheiten besonders herausgearbeitet, die Spannung zwischen endlichem Denkenden und absoluter Implikation des Wahrseins. Bei allen vielfachen Einblicken, die er in das Wesen der Metaphysik geben kann, ist doch die Verfallsgeschichte, die Heidegger konstruiert, alles andere als zwingend. Seine tiefen-archäologischen Analysen können indes kontrafaktisch erhellen, wie das inkommensurable Wahrheitsgeschehen in den propositionalen Argumentationsstrukturen deutlich wird: als Lichtung und Verbergung, und wie die Evidenz von Kunst und Dichtung über die Propositionalität hinausgreift. Einzuwenden wäre auch, im Licht von Denkformen, die sich zeitweise bei Heidegger durchaus finden, dass Heidegger Identität und Differenz, aber auch die Korrelierung von Sein und Nichts allzu sehr vom klassischen Erbe der Transzendentalienlehre, von der Konvertierbarkeit des Seins, des Schönen und Wahren. 64 Ebd., S. 242. 65 Ebd., S. 288. 66 Ebd.
112
Harald Seubert
Dass Metaphysik noch immer den im letzten ahnend exponierbaren Ausgriff in das Ganze des Seins und seine Gründe bezeichnet, ein in sich gegliedertes ‚Synholon‘, in dem zudem Kunst und Leben konvergieren, sollte gerade unter Berücksichtigung heideggerscher Einsichten neu festgehalten werden. Denn wo die Irrlichter vermeintlich nachmetaphysischen Denkens verglimmen, bleibt Metaphysik doch die ‚gesuchte Wissenschaft‘, deren Konturen sich korrigieren und weiter präzisieren mögen: im Sinn des ewigen Aufrisses und seiner zeithaften Konkretisierungen.
Phänomenologie und Metaphysik Überlegungen im Anschluss an Edmund Husserl und Edith Stein Angela Ales Bello
In meinem Beitrag behandle ich zwei Themen, die miteinander verbunden sind und wechselseitig aufeinander verweisen: Das erste Thema betrifft eine kritische Bewertung der phänomenologischen Philosophie, so wie diese in dem Vorschlag ihres Gründers Edmund Husserl gestaltet und von seiner Schülerin Edith Stein weitergeführt wurde. Das zweite betrifft den Beitrag in dem besonderen Bereich dieses Denkens für die Begründung von Fragen, die wir als metaphysische Fragen definieren und die also die Konstitution und den Sinn des Menschen, der Natur und die letzte Rechtfertigung all dessen in einem Absoluten betreffen. Ich wähle Husserl und Stein für diese Reflexion, weil ich ihren phänomenologischen Ansatz als ‚klassisch‘ betrachte.
1
Die phänomenologische Theorese
Es ist sinnvoll, den Sinn des Adjektivs ‚klassisch‘ zu definieren, das ich zu dem Begriff der Phänomenologie hinzugefügt habe. Mit dem Gebrauch dieses Adjektivs beziehe ich mich auf zwei Perspektiven der Untersuchung: zum einen geht es um die innere Entwicklung der phänomenologischen Schule, zum anderen um das Verhältnis der Phänomenologie zu der Philosophie, die als ‚klassisch‘ bezeichnet wird, also um die wichtigste Denkströmung, die ausgehend von der im antiken Griechenland geborenen Spekulation die Geschichte der abendländischen Philosophie durchzieht. Daraus ergibt sich eine grundlegende Frage: Was für eine Art Philosophie ist die Phänomenologie? Die Geschichte derjenigen, die behaupten, dass sie diesen Denkstil teilen, zeigt, dass der Sinn der Philosophie selbst zur Debatte steht und für uns im Abendland hat schon diese Lehre – ein für alle Mal? – mit den griechischen © Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv lizenziert durch Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2020 C. Böhr (Hrsg.), Metaphysik, Das Bild vom Menschen und die Ordnung der Gesellschaft, https://doi.org/10.1007/978-3-658-31593-1_7
113
114
Angela Ales Bello
Denkern ihre Gestalt gewonnen. Es wird sich auch zeigen, dass diejenigen, die mit der Tradition brechen wollten, um die Fragen auf neue Weise anzugehen, sich am Ende doch immer mit der Vergangenheit auseinandersetzen mussten. Eine kritische Beurteilung der Phänomenologie betrifft daher nicht nur das, was sich innerhalb dieser Denkströmung abspielt und abgespielt hat, sondern eröffnet eine viel weitere Frage. Denn der Gründer dieser Schule hat selbst im gesamten Verlauf seiner Untersuchung dieses Problem in den Vordergrund gestellt. Die Untersuchung der ‚Phänomene‘ stellt zweifellos eine Neuheit im Vergleich zur Geschichte der abendländischen Philosophie dar; das gilt sowohl für Husserl als auch noch stärker für denjenigen, den er in einem ersten Moment als seinen Nachfolger betrachtete, nämlich Martin Heidegger. Sich an die Phänomene halten – Husserl – , sich an das Leben halten – Heidegger – , das waren die Schlüsselwörter dieser beiden Denker am Beginn ihrer Reflexion; während jedoch Husserl die Unzulänglichkeit und den Mangel an Radikalität der abendländischen Spekulation in dieser Hinsicht erfasst, sie jedoch trotz aller Kritik nicht zurückweist, führt Heidegger die Kritik an der vorhergehenden Spekulation bis zur letzten Konsequenz weiter und beschreitet mit dieser Haltung immer ausdrücklicher die Spuren von Friedrich Nietzsche. Aber führt dieser Nihilismus, der sich zwar noch nicht ausdrücklich im Denken Heideggers findet, aber auf den doch diese zweite Position hinauszulaufen scheint, nicht zur Verleugnung der Philosophie selbst? Und ist das wirklich eine Neuheit? Haben das nicht schon die Sophisten impliziert? Werden wir unausweichlich auf die griechische Philosophie zurückgeworfen, von der wir uns trotz aller Anstrengungen nicht befreien können, es sei denn, wir verzichten auf ‚die letzten und höchsten Fragen‘, wie Husserl es ausdrückte, und begnügen uns damit, kleine Wissensfelder zu bearbeiten, die trotz all ihrer Bedeutung doch immer begrenzt bleiben? Ist vielleicht das Bedürfnis, zu den letzten und höchsten Fragen vorzudringen, nur das Ergebnis einer großen Illusion? Wir müssen uns dann jedoch noch eine weitere Frage stellen: Wie kommen wir überhaupt dazu, uns mit solchen Fragen zu beschäftigten? Woher rührt dieses Bedürfnis? Was ist denn dieser Antrieb in uns? Ich habe von ‚uns‘ gesprochen, und vielleicht müssen wir gerade damit beginnen und uns an Heraklit halten, wenn er sagt: „Ich habe mich selbst erforscht.“1 Können wir von diesem Anfang absehen und uns unmittelbar in ein Meer von etwas stürzen, das wir nicht sind? Der frühe Heidegger bezeichnete das Leben als Dasein: Um das Leben zu begreifen, musste er auf das Thema der Existenz zurückgreifen, aber nicht auf die Existenz im allgemeinen, sondern auf eine Existenz, die geschichtlich im Hier und Jetzt verortet ist, das Dasein. 1 Heraklit, Frgm. 101, nach der Zählung von Hermann Diels und Walther Kranz.
Phänomenologie und Metaphysik
115
Ist es jedoch ausreichend, das Dasein von außen zu betrachten? Das war die Frage von Edith Stein.2 Müssen wir außen vor den Mauern des Schlosses bleiben? Franz Kafka meint, dass die Angst gerade dadurch entsteht, dass wir nicht eintreten können. Aber dennoch gibt es auch diejenigen, die gar nicht eintreten wollen und sich bewusst diesen Weg verstellen und dadurch gezwungen sind, sich sofort in das Meer des Seins zu stürzen, ohne dass sie dieses freilich nach diesem Sprung in seine Unermesslichkeit erkennen können. Das scheint mir bei Heidegger der Fall zu sein. Unabhängig von aller Metapher stellt sich jedoch die Frage: Können wir darauf verzichten, in uns selbst einzukehren, wenn wir uns selbst suchen? An dieser Stelle möchte ich ein Lob anstimmen auf die Analyse der Subjektivität, die die abendländische Philosophie durchzieht. Denn der Mensch ist das einzige Wesen, das in der Lage ist, sich selbst zu erkennen, das zugleich Subjekt und Objekt der Forschung sein kann, auch wenn dies ein Paradox zu sein scheint, wie Husserl feststellt.3 Akzeptieren wir also dieses Paradox und nutzen wir die Möglichkeiten, die es uns bietet: Beginnen wir also bei uns selbst, um aus uns selbst herauszugehen und bewusst in das Meer der Wirklichkeit einzutauchen, indem wir schrittweise begrenzte, aber sichere Bereiche dieser Wirklichkeit erobern. Andererseits können wir dem Abgrund nie entkommen, weder dem Abgrund, der in uns ist, um noch einmal den Spruch von Heraklit aufzugreifen, der in diesem Zusammenhang von Husserl zitiert wird,4 noch dem Abgrund, der um uns ist und dessen Erkenntnis uns dazu drängt, unsere Forschung in einem ständigen ‚immer wieder‘ kreisen zu lassen. Denn in einem unermesslichen physischen Universum sind wir klein, und so ist unerschöpflich, was wir mit unseren geistigen Fähigkeiten erkennen können, die uns eben auch dazu bringen, die physische Dimension zu verlassen, um in ein Reich des ‚Ganzen‘ einzutreten. Wenn wir das alles mit der Vernunft durchdringen wollen, sind wir also, um es in ‚klassischen‘ philosophischen Begriffen auszudrücken, zurückgeworfen auf die gnoseologischen Fragen – Wie erkenne ich? – , auf die anthropologischen Fragen – Kann ich durch die Erkenntnis meiner selbst entdecken, wie ich beschaffen bin?
Edith Stein, Martin Heideggers Existenzphilosophie, in: Dies., Endliches und ewiges Sein. Versuch eines Aufstiegs zum Sinn des Seins, hg. v. Andreas Uwe Müller, Freiburg im Br. 2 2013, S. 443 ff. 3 Edmund Husserl, Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie. Einleitung in die phänomenologische Philosophie, hg. v. Walther Biemel, Den Haag 1976, § 53. 4 Heraklit, Frgm. 45, nach der Zählung von Diels und Kranz: „Du gehst und findest die Grenzen der Seele nicht, auch wenn du alle Strassen abläufst: so tief ist der Logos, den sie bedingt.“ 2
116
Angela Ales Bello
– und auf die metaphysischen Fragen – Warum stelle ich mir letzte und höchste Fragen, wenn ich mir doch meiner Endlichkeit bewusst bin? – . Die klassische Phänomenologie, also die Phänomenologie Husserls, stellt sich diese Fragen mit einem interessanten neuen Ansatz. Stein folgt seinem Weg ein Stück weit, stellt sich jedoch in der Folge explizit der Herausforderung, sich mit der gesamten Geschichte der abendländischen Philosophie auseinanderzusetzen, und stellt fest, dass diese Fragen in der Vergangenheit angegangen worden sind und dass einige Antworten trotz aller unvermeidlichen, durch die Begrenztheit des menschlichen Wesens bedingten Bruchstückhaftigkeit überzeugend sind, weil sie den Sinn einiger Aspekte der Wirklichkeit erfassen. In diesem Fall bezeichnet der Begriff ‚klassisch‘ also den Rückgriff nicht nur auf die kritische, sondern auch auf die konstruktive Komponente des abendländischen Denkens, das stets zwischen einer kritischen und einer konstruktiven Haltung oszilliert, zwischen denen es kaum je zu einem Gleichgewicht kommt.
2
Wie ereignet sich Erkenntnis?
Ich bin der Auffassung, dass die Neuheit der Phänomenologie von Husserl – eine Neuheit, die Stein als erste bemerkt – in einer Untersuchung bestimmter Phänomene liegt, die sich auf unsere gelebte Erfahrung beziehen: Erlebnisse. In den Jahren 1884 und 1885 besuchte Husserl die Vorlesungen von Franz Brentano in Wien, und diese Begegnung des Mathematikers Husserl mit der Psychologie richtete sein Interesse auf das, was in der menschlichen Innerlichkeit geschieht; allerdings geht es nicht nur darum, psychische Phänomene zu analysieren, wie der Wiener Philosoph es tat, indem er sie im Hinblick auf ihre Beschaffenheit und Gesetzmäßigkeit untersuchte, sondern darum, eine Karte der menschlichen Erkenntnisstruktur zu entwerfen, indem Husserl das noch unerforschte Gebiet der Erlebnisse beschritt, allerdings nicht, ohne zuvor eine Wendung von einer rein an der Natur interessierten Haltung zu einer bewusst philosophischen Haltung vollzogen zu haben. Dieser Wechsel vollzieht sich bekanntermaßen durch die Epoché als Operation, die der Entdeckung des Wesens oder des Sinnes der Sachen vorausliegt, und zu diesen Sachen gehört durch eine Wendung vom Äußeren zum Inneren auch das, was wir erleben, unsere Erlebnisse. Wie schon Brentano im Rückgriff auf eine alte mittelalterliche Tradition über die psychischen Phänomene sagte, zeichnen sich die Erlebnisse durch die Intentionalität aus und stellen jeweils ein homogenes Ganzes im Hinblick auf ihre Beschaffenheit dar; daher können sie eingeteilt werden in Erlebnisse, die den Leib betreffen – zum
Phänomenologie und Metaphysik
117
Beispiel die Wahrnehmung, die durch die verschiedenen Sinneseindrücke taktiler, visueller, auditiver oder noch anderer Art vermittelt ist – , Erlebnisse, die die Psyche betreffen – sie bestehen aus den Impulsen und Spannungen und Reaktionen – und Erlebnisse, die den Geist betreffen – sie sind durch die spezifisch menschlichen Akte des Verstehens und Wollens gekennzeichnet. Das ermöglicht die Lösung eines doppelten Problems, des gnoseologischen wie des anthropologischen. Im Hinblick auf das gnoseologische Problem greift Husserl das kantische Thema des Transzendentalen wieder auf, das von der Wesensstruktur der Erlebnisse selbst gebildet wird, die sich auf das Ich in seiner Reinheit beziehen und sich jeweils im Inneren eines menschlichen Einzelwesens herausbilden. Ich erkenne die Freude des Anderen, so Stein, indem ich sie durch das Erlebnis der Einfühlung erfasse und indem ich ihn als mir ähnlich erkenne. Denn das Wesen der Freude ist uns zwar gemeinsam, aber dennoch kann ich nicht den Inhalt und die Schattierungen seiner Freude erleben, denn all das bleibt ganz und gar mit seiner Einzigartigkeit verbunden; ich kann mich ihm oder ihr zwar durch einen Akt der Sympathie nähern, die keine Empathie ist, um ihn oder sie besser zu verstehen, aber dennoch kann ich niemals seine oder ihre ‚Freude‘ erleben. Die transzendentale Struktur beschränkt sich aber nicht auf das, was wir hier in groben Zügen angedeutet haben, sondern öffnet sich auch Dimensionen, von denen wir kein Bewusstsein haben, die wir ‚unbewusst‘ erleben, sagt Husserl. Von den Ideen zu einer reinen Phänomenologie und einer phänomenologischen Philosophie, 1913,5 über die Analysen zur passiven Synthesis, 1925,6 gelangt man zu den Untersuchungen, die sich jetzt in dem Band Grenzprobleme der Phänomenologie7 aus dem Jahr 2014 finden, der Husserl-Texte aus den Jahren von 1908 bis 1937 über Themen wie eben das Unbewusste, den Instinkt, die Metaphysik und die Ethik zusammenfasst. Man kann also festhalten, dass sich diese tiefergehende Suche nicht erst seit den 1930er Jahren zeigt – auch wenn die bedeutendsten Texte aus diesen Jahren stammen – , sondern von Anbeginn in Husserls Untersuchungen präsent ist; ferner bewegt er sich aus dem Untergrund, wie Stein sagen würde, zu den intellektuellen Gipfeln der metaphysischen und der ethischen Fragen. Die Herausgeber des Bandes, Rochus Sowa und Thomas Vongehr, schreiben in ihrer
5 Edmund Husserl, Ideen zur einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie, hg. v. Karl Schumann, Den Haag 1976. 6 Edmund Husserl, Analysen zur passiven Synthesis. Aus Vorlesungen und Forschungsmanuskripten 1918–1926, hg. v. Margot Fleischer, Den Haag 1966. 7 Edmund Husserl, Grenzprobleme der Phänomenologie. Analysen des Unbewusstseins und der Instinkte. Metaphysik. Späte Ethik (1908–1937), hg. v. Rochus Sowa u. Thomas Vongehr, Dordrecht, Heidelberg, New York u. London 2014.
118
Angela Ales Bello
Einleitung, dass Husserl in diesen Texten den Bereich der Impulse und der Instinkte auch im Hinblick auf ethisch-religiöse8 Fragen neben dem Bereich der Vernunft stehen lässt, was ich anhand dieser Manuskripte, die ich teilweise im Archiv von Leuven gelesen hatte, in meiner kleinen Anthologie Husserl. Sul problema di Dio9 aus dem Jahr 1985 zu zeigen versucht habe.
3 Husserl und die ‚letzten und höchsten‘ Fragen Es wurde schon festgehalten, dass Husserl in Bezug auf die Person und ihre geistige Tätigkeit die ethisch-religiösen und metaphysischen Probleme als letzte und höchste bezeichnet. Der Begriff ‚Metaphysik‘ hat bei Husserl viele Bedeutungen: Wir beschränken uns hier auf die von ihm vorgeschlagene Unterscheidung zwischen einer „historisch degenerierten Metaphysik“ und einer „Metaphysik, die im Ursprung als erste Philosophie gegründet worden war“.10 Mit der ersten meint er eine Untersuchung, die auf einem Übermaß an Spekulation beruht, mit der zweiten meint er unter Rückgriff auf den aristotelischen Ausdruck den authentischen Geist der griechischen Philosophie. Dennoch ist der Bezugspunkt hier nicht unmittelbar Platon oder Aristoteles, sondern die Metaphysik von Gottfried Wilhelm Leibniz, und zwar insbesondere der Begriff der ‚Monade‘. Mein Ich als Monade „kann a priori nur welterfahrendes ego sein, indem es mit anderen seinesgleichen in Gemeinschaft ist, Glied einer von ihm aus orientiert gegebenen Monadengemeinschaft. Konsequentes Sich-ausweisen der objektiven Erfahrungswelt impliziert konsequentes Sich-ausweisen von anderen Monaden als seienden.“11 Das heißt, dass es nur eine objektive Welt gibt, die durch das bestimmt werden kann, was er als ‚transzendentale Metaphysik‘ bezeichnet, die darlegt, wie man vom Subjekt her die Verfasstheit einer objektiv existierenden Welt begreifen kann: Ich habe diese Haltung Husserls, die traditionell einander entgegenstehende Be-
8 Ebd., S. LXXXVII. 9 Angela Ales Bello, Husserl. Sul problema di Dio, Rom 1985. 10 Edmund Husserl, Cartesianische Meditationen und Pariser Vorträge, hg. v. Stephan Strasser, Den Haag 1963, S. 166. Hervorhebung im Original. 11 Ebd.
Phänomenologie und Metaphysik
119
griffe wie transzendentales Ich und objektive Existenz der Welt zusammenzufügen scheint, als „transzendentalen Realismus“12 bezeichnet. Auch wenn das eben Gesagte weiter ausgeführt werden müsste, was hier nicht geschehen kann, meint Husserl, so auf diesen Einwand mit Bezug auf die Phänomenologie wie folgt zu antworten: „Dazu sei sie im Ausgang von dem transzendetalen ego der phänomenologischen Reduktion und daran gebunden nicht mehr befähigt, sie verfalle, ohne es wahrhaben zu wollen, in einen transzendentalen Solipsismus … “.13 Da sich solche Argumente in der V. Cartesianischen Meditation finden, zeigt Husserl, dass gerade der Übergang zum Anderen durch seine leibliche Konsistenz das ist, was eine objektive existierende Welt sicherstellt, und dass diese Feststellung einen „transzendentalen“ Realismus14 begründen kann. Der neue, von Husserl vorgeschlagene metaphysische Blickwinkel wird von ihm als gültig betrachtet, weil es sich nicht um eine bloß an eine Tradition gebundene ‚metaphysische‘ Konstruktion handelt, sondern um eine aufgrund einer ‚Intuition‘ gerechtfertigte Position, denn es geht um Folgendes: „Den Sinn auslegen, den diese Welt für uns alle vor jedem Philosophieren hat und offenbar nur aus unserer Erfahrung hat, ein Sinn, der philosophisch enthüllt, aber nie geändert werden kann.“15 Auf dieser analytischen Linie, die danach strebt, den Sinn der existierenden Wirklichkeit zu betonen, in der wir uns vorfinden, und die Husserl, so könnten wir hinzufügen, als ‚Metaphysik‘ der immanenten Wirklichkeiten – Ich und Welt – bezeichnet, schreitet er zu einer Metaphysik der absoluten Transzendenz voran. In den Schriften Husserls habe ich sechs ‚Argumentationswege‘ bestimmt, die zu Gott führen: den ‚objektiven‘ Weg der Finalität, der an den fünften teleologischen Gottesbeweis von Thomas von Aquin erinnert, den subjektiven Weg, der von Augustinus und Anselm von Canterbury ausgeht, den intersubjektiven Weg, der eben auf den Spuren von Leibniz zur höchsten Monade führt, den Weg über die Hyletik, der ein weiterer teleologischer Weg ist, der von den Tiefendimensionen der Wirklichkeit ausgeht, die vor allen Reflexionen und Kategorien liegen, und das Vorhandensein einer Ordnung der Sachen aufzeigt, den Weg über die Ethik und
12 Angela Ales Bello, Il senso delle cose. Per un realismo trascendentale, Castelvecchi u. Rom 2014; engl. The Sense of Things. Toward a Phenomenological Realism, Dordrecht 2015. 13 Husserl, Cartesianische Meditationen, a. a. O., S. 174. 14 Ebd., § 42. 15 Ebd., S. 177.
120
Angela Ales Bello
vielleicht noch einen ‚mystischen‘ Weg, der die Gegenwart Gottes in der Innerlichkeit vertieft.16 Da ich in diesem Beitrag nicht all diese Wege nachzeichnen kann, verweile ich nur kurz bei dem Weg, der zur Übermonade führt, um in Übereinstimmung damit auf der Spur der metaphysischen monadischen Konstitution des Ich und der Welt fortzufahren. Wenn wir der Ausgangspunkt der Forschung sind und daher eine Art Absolutes ‚quoad nos‘ darstellen, so schreibt Husserl in einem Text von 1922: „Von diesem Absoluten muss dann der Weg führen zum letzten Absoluten in einem anderen Sinn, von diesem System ‚Substanzen‘ ‚im wahren Sinn‘ (als seienden, die kein konstituierendes Sein voraussetzen), ein Weg zur absoluten Substanz im letztem Sinn.“17 Weiter oben wurde schon gesagt, dass die Position Husserls nicht substanzialistisch ist. Der in diesem Text erscheinende Substanzbegriff ist wahrscheinlich einfach ein Rückgriff auf die Gewohnheit von Leibniz, die Monaden als Substanzen zu bezeichnen. Im Fortgang bezieht sich Husserl explizit auf die Übermonade als Endpunkt des intersubjektiven Weges zu Gott, und zwar besonders in einem anderen Text aus dem Jahr 1922 mit dem Titel Möglichkeit der Verschmelzung der Monaden. Möglichkeit einer (göttlichen) Übermonade.18 Es ist hier nicht möglich, auf die ethisch-religiösen Themen in Husserls Werk einzugehen, ich halte hier nur fest, dass die Behandlung ethischer Themen durch Husserl in einigen Fällen mit religiösen Themen verbunden ist und dass es auch, wie oben angedeutet, einen ethischen Weg gibt, der zu Gott führt. Husserl glaubt nicht, dass es ein blindes Schicksal gibt, sondern im Gegenteil, dass Gott die Welt erhält und sie auf absolute Werte hin ordnet, die die menschliche Freiheit und den menschlichen Willen anrufen, die wiederum von der Gnade unterstützt werden,
16 Angela Ales Bello, Edmund Husserl. Pensare Dio Credere in Dio, Padua 2005; engl. The Divine in Husserl and Other Explorations, Dordrecht 2009; span. Edmund Husserl. Pensar deus, creer Deus, Buenos Aires 2016; port. Edmund Husserl. Pensar Deus, Creer Deus, São Paulo 2016. 17 Edmund Husserl, Das transzendentale Alter Ego gegenüber der Transzendenz der fremden Subjektivität des Dinges. Absolute Monadologie als Erweiterung der transzendentalen Egologie. Absolute Weltinterpretation (Januar/Februar 1922), in: Ders., Zur Phänomenologie der Intersubjektivität II, hg. v. Iso Kern, Dordrecht 1973, S. 266. 18 Edmund Husserl, Möglichkeit der Verschmelzung der Monaden. Möglichkeit einer (göttlichen) Übermonade, 1922, Beilage XLI, in: Ders., Zur Phänomenologie der Intersubjektivität. Texte aus dem Nachlass. Zweiter Teil: 1921–1928, hg. v. Iso Kern, Dordrecht 1973, S. 300 ff.
Phänomenologie und Metaphysik
121
und daher glaubt er, dass es einen Gott gibt: „Der Glaube ist absolute und höchste Forderung.“19 Nicht von ungefähr handelt es sich um ein Manuskript, das nicht zur Veröffentlichung bestimmt war; hier verbindet sich die metaphysische Frage nach dem Absoluten mit der ethisch-religiösen Frage, und in diesem Fall geht Husserl nicht streng argumentativ vor, sondern legt eher seine tiefen und persönlichen Gedanken dar.
4
Edith Stein und die metaphysischen Fragen
Stein geht ohne Bruch von der phänomenologischen Analyse zu einer metaphysischen Determination über. Das Subjekt ist nicht nur reines Ich, psychisches und geistiges Ich, sondern auch ‚Substanz‘. Sein Getrennt-Sein lässt sich in seinem Bewusstsein ergreifen, und es unterscheidet sich von allem anderen, es kann nur sich selbst ‚Ich‘ nennen.20 Dennoch bewegt sich Stein auf phänomenologischem Boden, wenn sie die Themen der Intentionalität, der Zeitlichkeit, das Thema des spirituellen Lebens als geistigen Lebens und das Thema der Verbindung zwischen Innerlichkeit und Äußerlichkeit aufgreift.21 Das Gleiche geschieht im Hinblick auf das moralische Leben, in dem das andere Vermögen des Geistes auftaucht, nämlich der Wille. Auf diese Weise öffnen sich die Menschen der Außenwelt mit ihrer ganzen Person, die die Leiblichkeit, die Psyche – Gefallen und Missfallen – , die Gefühle – Liebe und Hass – und die Gemütsbewegung umfasst; alles läuft auf Seiten des Subjekts in der Bildung des Charakters zusammen, die auch an die der Individualität eigenen Merkmale gebunden bleibt. Die komplexe und vielschichtige Landschaft des innerlichen Lebens wird durch das Vorhandensein des Kerns ergänzt, der schon in den phänomenologischen Schriften Steins erscheint und von ihr jetzt als ‚Seele der Seele‘ definiert wird. Der Kern ist der Konvergenzpunkt des Menschen und der Ort seiner Öffnung auf die Transzendenz hin, die in den Anderen und in Gott besteht. 19 Edmund Husserl, Ms. Trans. A V 21: Ethisches Leben. Theologie – Wissenschaft, 1924–1927, in: Husserliana Dokumente, Bd. 3, S. 16; vgl. auch Edmund Husserl, Nr. 14: Rein wissenschaftliche, rein rationale Theologie (aus natürlichem Licht) und Theologie aus irrationalen Gründen (aus übernatürlichem Licht, Offenbarung). Allgemeines über ‚Begründung‘ von Urteilen. ‚Irrationale‘ Urteilsmotive. Absoluter Ruf, absolutes Sollen. Absolutes Gut, absolute Teleologie und die Idee Gottes, in: Ders., Grenzprobleme der Phänomenologie, a. a. O., S. 203. 20 Ebd., V, § 2. 21 Ebd., V, § 4, § 5, § 6.
122
Angela Ales Bello
Mit Hilfe von Thomas erweist sich der Geist immer mehr als Sitz der Operationen von Intellekt und Willen in ihrem Doppelaspekt von Erkenntnis und Moral. All das war von Husserl und Stein schon gesagt worden, aber hier gründet es sich auf ein metaphysisches Fundament. Im Blickwinkel dieser wieder neu aufgegriffenen Ontologie erfährt der Kern eine weitere Bestimmung auf der Spur der bereits in den ersten phänomenologischen Werken vollzogenen Untersuchungen.22 Was die Frage der Erkenntnis und des Beweises der Existenz Gottes betrifft, vertritt Stein eine besondere Haltung. Mehrmals wiederholt sie, dass die ‚Beweise‘ und ‚Demonstrationen‘ den Glauben nicht hervorbringen; sie bestätigen den Glauben, aber sie führen nicht zum Glauben. Der Gläubige, also derjenige, der schon einen als Erkenntnis Gottes verstandenen Glauben hat, lässt sich von den Beweisen leiten, der Nicht-Gläubige bleibt an ihren Grenzen stehen.23 Das bedeutet nicht, dass der Glaube etwas Irrationales wäre. Ganz im Gegenteil vertritt Stein, dass die ‚fides‘, die bis zu einer Annahme der Offenbarung gelangt, der natürlichen Vernunft in der Erkenntnis der Wahrheit nicht nur helfen kann, sondern sogar helfen muss, und in diesem Sinne wird die durch den Glauben erleuchtete Vernunft eine „übernatürliche Vernunft“. Diesen Ausdruck gebraucht sie nur bei einem Vergleich zwischen Husserl und Thomas,24 aber im letzten Sinne bleibt dieser Ausdruck stets präsent, denn er dient einerseits dazu, die Grenzen der menschlichen Vernunft abzustecken, andererseits aber auch dazu, die Möglichkeit einer Verstärkung eben dieser Vernunft durch den Glauben anzunehmen. Wenn hingegen die Philosophie zur Wahrheit gelangen will, dann muss sie die verschiedenen Quellen der Wahrheit kennen, und zu diesen zählt auch die Offenbarung, die auf die ‚fides‘ als natürliche Erkenntnis zurückgreifen muss, um angenommen zu werden. Diese wechselseitige Beziehung wird von Stein beibehalten, wenn sie in Endliches und ewiges Sein über die Bedeutung von ‚ewigem Sein‘ nachdenkt.25 Von zwei Texten der Bibel ausgehend stellt Stein fest, dass diese Texte weiter führen, als man mit einer intellektuellen Anstrengung kommen könnte. Es handelt sich um den Anfang des Johannes-Evangeliums „Im Anfang war der Logos“ und
22 Vgl. vor allem Edith Stein, Beiträge zur Begründung der Psychologie und Geisteswissenschaften, Freiburg im Br. 2010, sowie Dies., Der Aufbau der menschlichen Person, Freiburg im Br. 32015. 23 Stein, Endliches und ewiges Sein, a. a. O., S. 104. 24 Edith Stein, Husserls Phänomenologie und die Philosophie des hl. Thomas von Aquin, in: Dies., ‚Freiheit und Gnade‘ und weitere Beiträge zu Phänomenologie und Ontologie (1917–1923), hg. v. Beate Beckmann-Zöller u. Hans Rainer Sepp, Freiburg im Br. 2014. 25 Stein, Endliches und ewiges Sein, a. a. O., III, § 12.
Phänomenologie und Metaphysik
123
um den Abschnitt des Briefes von Paulus an die Kolosser, in dem es heißt: „Er ist vor aller Schöpfung, / in ihm hat alles Bestand.“26 Sie fügt hinzu, dass vielleicht die philosophische Bedeutung von ‚Logos‘, auf die wir verwiesen werden, dabei helfen kann, die theologische Bedeutung zu verstehen, und dass ihrerseits wiederum die offenbarte Wahrheit dabei helfen kann, die philosophischen Schwierigkeiten zu lösen. Sie fährt deshalb mit einer philosophischen Klärung der beiden Texte fort. Ihrer Meinung nach verweisen beide Texte auf ein dreifaltiges Gottesbild. Insbesondere hat ‚en arché en ho logos‘ diese Bedeutung: im ersten Seienden war der ‚Logos‘ – der Sinn oder das göttliche Wesen – bereits enthalten, im Vater war der Sohn, also der ‚Sinn‘ der ursprünglichen Aktualität; die Zeugung bedeutet also, dass das Wesen in die neue, personale Aktualität des Sohnes gesetzt wird, ohne dass dies eine Setzung außerhalb der ursprünglichen Aktualität des Vaters wäre. In dieser Unterscheidung zwischen dem wesentlichen Sein und dem aktuell-wirklichen Sein besteht jedoch das Risiko, diese beiden Aspekte im Denken voneinander zu trennen, und das ist nicht zulässig. Stein unterstreicht hier mit Nachdruck die Gültigkeit der Position von Thomas, der auf der Untrennbarkeit zwischen dem Wesen und dem aktuell-wirklichen Sein im ersten Seienden besteht, denn gerade das unterscheidet dieses Seiende von jedem anderen endlichen Sein, in dem diese Unterscheidung gemacht werden kann. Im Fortgang der Untersuchung stellt sie dann fest, dass das erste Seiende, weil es ja das Sein selbst als sein Wesen hat, unmöglich ohne das Sein gedacht werden kann, sondern dass man vielmehr fragen muss, worin denn die Konsistenz eines solchen ‚Denkens‘ bestünde. Denn wenn es möglich wäre, das wirklich auf erfüllende Weise zu denken – Stein gebraucht hier die Sprache in einem phänomenologischen Sinne und meint die völlige Erfüllung einer leeren Intention – , stünden wir vor einer tiefen Einsicht dessen, was Anselm als ‚Beweis‘ für die Existenz Gottes vorgeschlagen hat. Sie geht dieser Frage jedoch noch weiter nach und meint, dass wir, wenn es uns ‚wirklich‘ gelänge, die Koinzidenz zwischen Sein und Wesen zu erfassen, nicht vor einem ‚Beweis‘ stünden, also in logischer Hinsicht zu einer ‚Konklusion‘ oder Ableitung gelangt wären, sondern dass wir eine ‚Umformung des ursprünglichen Gedankens‘ in Bezug auf diese Koinzidenz vorgenommen hätten, dass wir ihn also überhaupt erst neu in Form gegossen hätten. Sie fügt hinzu: „Die Exaktheit dieser Formung wird nicht einmal von Thomas von Aquin bestritten, der bekanntermaßen den ontologischen Beweis abgelehnt hat.“27
26 Kol 1, 17. 27 Stein, Endliches und ewiges Sein, a. a. O., S. 149.
124
Angela Ales Bello
Auch Thomas behauptet schließlich, dass die Aussage ‚Gott existiert‘ selbstevident ist, aber eben nicht für uns, und weil wir eben gerade nicht dazu in der Lage sind, diese Evidenz wirklich zu erfassen, benötigen wir einen Beweis, der von den Wirkungen ausgeht. Auch auf diese Weise gelangen wir jedoch nicht zum Begreifen, und hier hat, so Stein, letztlich Augustinus recht, wenn er sagt: „Si comprehenderis non est Deus.“ Anselm bemüht sich um eine Umformung des ursprünglichen Gedankens, aber er scheitert, weil er nicht zu einem vollständigen Begreifen kommt. Der tiefere Grund des Scheiterns all dieser Beweise oder Wege, eine rückhaltlose Erfüllung zu erreichen, liegt in der unauflöslichen Spannung des menschlichen Geistes zwischen Endlichem und Unendlichem. Daraus ergibt sich für Stein auch das einzigartige Schicksal des ontologischen Gottesbeweises, dass er nämlich stets neue Gegner und Verfechter findet. Es ist also nicht möglich auf dem Weg der natürlichen Erkenntnis die Koinzidenz von Wesen und Existenz zu erfassen. Demjenigen, der Glaube hat, erscheint es unmöglich, dass diese Koinzidenz nicht besteht, aber wenn er versucht, sie intellektuell zu erfassen, ist er zum Scheitern verurteilt. Man kann sich Gott nur durch endliche Bilder annähern, mal vom Wesen her, mal vom Sein her. Es ist bekannt, dass Stein die Auffassung vertritt, dass dem Menschen im Einklang mit seinen als Geschöpf stets endlichen Möglichkeiten eine vollständige Gotteserkenntnis nur in der mystischen Erfahrung möglich ist, denn dort erhebt Gott die Seele zu sich und lässt sie intuitiv den Sinn aller Dinge erfassen, wie es die Heilige Theresa von Avila bezeugt hat.28 Daher erleuchtet die mystische Erfahrung die Selbsterkenntnis und ist von großem Nutzen für das Begreifen der anthropologischen Struktur sowie Gottes. Die metaphysischen Themen, die sich freilich auch unabhängig vom Glauben und von der mystischen Vision bearbeiten lassen, können durch diese besondere Art von ‚Erkenntnis‘ erleuchtet und leichter bearbeitet werden. Wie ich zu zeigen versuchte, vermeiden also die Philosophen, auf die ich mich beziehe, nicht die großen Fragen: Wer bin ich? Welches ist der Sinn der uns am nächsten liegenden sowie der letzten Wirklichkeit? In ihrer mehr oder weniger großen Nähe zu den klassischen und konstruktiven Positionen der Philosophiegeschichte und in Auseinandersetzung mit der Moderne – im Falle Husserls – oder mit der Antike und dem Mittelalter – wie bei Stein – zeigen sie durch einen ursprünglichen und überzeugenden Ansatz, dass diese Fragen unausweichlich sind und es möglich ist, eine gültige Antwort auf sie zu finden.
28 Edith Stein, Die Seelenburg, in: Dies., Endliches und ewiges Sein, a. a. O., S. 501-525.
4 Praktische Metaphysik
Metaphysik: Denken im Modus des Leidens1 Helmut Holzhey
Mein Zugang zur Frage nach der Zukunft der Metaphysik wird durch die kantische Vernunftkritik bestimmt. Das dürfte als solches kaum verwundern; überraschen könnte jedoch, dass ich bei dieser Orientierung an Kant metaphysisches Denken mit Leiden in Zusammenhang bringen will. Denn Kant kennt doch – wie es scheint – keinen Leidensmodus des Denkens, sondern fasst Denken ausdrücklich als Aktivität. Er unterscheidet das spontane, aus sich heraus – sua sponte – Vorstellungen erzeugende Denken von der rezeptiven sinnlichen Anschauung.2 Sprechen wir von Leiden im Denken, dann schreiben wir ihm aber ein Moment der Passivität und Rezeptivität oder Empfänglichkeit zu. Das ist zunächst einmal wenig plausibel. Allerdings weist der erste Satz der Kritik der reinen Vernunft auf ein Schicksal der menschlichen Vernunft hin und deutet damit etwas anderes an. Dieser erste Satz lautet: „Die menschliche Vernunft hat das besondere Schicksal in einer Gattung ihrer Erkenntnisse: dass sie durch Fragen belästigt wird, die sie nicht abweisen kann, denn sie sind ihr durch die Natur der Vernunft selbst aufgegeben, die sie aber auch nicht beantworten kann, denn sie übersteigen alles Vermögen der menschlichen Vernunft.“ Die belästigenden Fragen nach Gott, Freiheit und Unsterblichkeit geben einem, wie ich es nenne, metaphysischen Bedürfnis Ausdruck. Über die Genese eines Bedürfnisses der Vernunft in ihrem theoretischen Gebrauch äußert sich Kant in dem Aufsatz Was heißt: Sich im Denken orientieren von 1786. Und zwar so, dass sich die Vernunft „ihren Mangel“ bei der Beantwortung jener Fragen vergegenwärtigt 1 Der Beitrag bildet die überarbeitete und leicht ergänzte Fassung von Kap. IX Denken im Modus des Leidens meines Buches ‚Wir sehen jetzt durch einen Spiegel‘. Erfahrungen an den Grenzen philosophischen Denkens, Basel, 2017, S. 143-157. Mit freundlicher Genehmigung des Schwabe Verlags Basel. 2 KrV A 50 f. / B 74 f. © Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv lizenziert durch Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2020 C. Böhr (Hrsg.), Metaphysik, Das Bild vom Menschen und die Ordnung der Gesellschaft, https://doi.org/10.1007/978-3-658-31593-1_8
127
128
Helmut Holzhey
und „durch den Erkenntnistrieb“, der – so mein Kommentar – bei der Feststellung jenes Mangels nicht Halt macht, „das Gefühl des Bedürfnisses“ wirkt.3 Wir ertragen als Vernunftwesen die Einsicht in die Beschränktheit unserer Erkenntnis von ‚Übersinnlichem‘ nicht, ein gefühltes Bedürfnis nach solchem Übersinnlichen springt ein. Dieses Bedürfnis ist nicht nichts, es ist keine ‚bloße‘ Illusion, die so schnell wie möglich zu zerstören wäre. Kant spricht vielmehr diesem „Gefühl des Bedürfnisses“ die Leistung zu, das nach Erkenntnis des Übersinnlichen suchende Subjekt subjektiv zu orientieren. Im Raum der Metaphysik ist Orientierung nach Gegenständen nicht möglich, weil sich in ihm kein Anschauungsobjekt mehr findet, also nur Orientierung mit einem „subjektiven Mittel“, und das „ist kein anderes, als das Gefühl des der Vernunft eigenen Bedürfnisses“.4 In diesem Bedürfnis artikuliert sich – psychologisch gesprochen – ein Leiden: Leiden an der Aufdringlichkeit, mit der sich metaphysische Fragen stellen, und an der Vergeblichkeit der Bemühungen um ihre Beantwortung. Diese Vergeblichkeit tritt hervor, wenn wir etwas Gesichertes über ein Leben nach dem Tod wissen wollen, wenn wir Freiheit zu begründen oder Gottes Existenz zu beweisen suchen. Das Leiden daran kann sehr verschiedene Erscheinungsformen annehmen – vom Verdruss am Nachdenken bis zur existenziellen Verzweiflung. Doch: wer leidet hier? Nach meiner bisherigen Darstellung sind es Menschen, die sich mit metaphysischen Problemen beschäftigen. Verständlicherweise ist deren Leiden kein Zustand, in dem sie verharren möchten. Gibt es für dieses Leiden im Gebrauch unserer Vernunft, so die Frage, eine Therapie? Oder gibt es wenigstens Mittel, um zu einem hilfreichen Umgang damit zu gelangen? In der Weisheitsliteratur, aber auch im gewöhnlichen Leben wird nicht selten therapeutisch von einem Gewinn gesprochen, den man aus Leiden ziehen könne. Dann ginge es wohl auch für metaphysisches Denken um einen Gewinn, den sein Leiden bereithält. Doch worin bestände der? Darauf wollen meine Überlegungen am Schluss hinaus. Zunächst aber möchte ich allgemein zu jenem Gewinn etwas sagen, der im Lernen durch Leiden erzielt werden könnte – Lernen als Form praktischer und theoretischer Bewältigung von Leiden irgendeiner Gestalt.
3 Immanuel Kant, Was heißt: Sich im Denken orientieren, 1786, AA VIII 139. 4 Ebd., S. 136.
Metaphysik: Denken im Modus des Leidens
1
129
Durch Leiden lernen
Zum Ausgangspunkt nehme ich die Sentenz ‚Durch Leiden lernen‘ – πάθει μάθος – , die sich literarisch in der um 460 v. Chr. aufgeführten Tragödie Agamemnon von Aischylos findet.5 Sie besagt nicht so sehr, dass Leiden eine Einsicht vermittelt, als vielmehr, dass Leiden beim Betroffenen ein Nachdenken über sich selbst in Gang setzt, dass Leiden ein Lernen gewissermaßen am eigenen Leibe ist. Die Belehrung des Leidens betrifft die Existenz des leidenden Menschen als solche. Bei Aischylos heißt es weiter: Statt des Schlafs klopft uns ans Herz Angst, die Leid erinnert: Wider Willen selbst die Einsicht kommt. Das ist Gunst der Götter, hart sitzend Am heiligen Steuer. Für den Dichter bietet das Leiden die Chance, dass sich der wegen eines Frevels Leidende zu einem einsichtigen Menschen – sophron – wandelt, wenn er in dem und durch das Leiden zur Einsicht in die von ihm verletzte Ordnung gelangt und sich nun bemüht, sich dieser Ordnung wieder einzufügen. Das meint nicht, dass er nachträglich – gemäß dem Sprichwort ‚Durch Schaden wird man klug‘ – eine Lehre aus dem Schicksalsschlag zieht. Von dieser Sinnbestimmung menschlichen Leidens sind theoretische Erklärungen zu unterscheiden, die nicht dem Leiden selbst entspringen und also nicht durch Leiden ‚erlernt‘ werden. Solche Erklärungen des eigenen Leids können darin bestehen, dass dessen Ursache in einem von Gott oder den Göttern bestimmten Schicksal gesehen wird. Nachdenken über eigenes oder fremdes Leiden artikuliert sich sei es in mythisch-erzählender Form sei es philosophisch-rational. Sobald eine solche theoria auftaucht, ist sie auch schon umstritten. Gegen sie erhebt bereits Platon seine Stimme, indem er im Staat 6 dafür argumentiert, dass Gott nur Ursache des Guten sein kann, nicht des Schlechten. Schlechtes zu erleiden, das dürfe nur heißen, bestraft und durch die Strafe gefördert zu werden. Letzteres kann allerdings Unterschiedliches meinen, je nachdem ob der Betroffene selbst sein Leiden so zu verstehen lernt oder ob es als eine allgemeine Erklärung für Leiden daherkommt. Dass Leiden als Strafe aufzufassen sei, das ist bei aller Kritik bis in unsere Tage ein vertrautes Erklärungsmuster. Es findet sich neben anderen Begründungen, 5 Aischylos, Agamemnon, 176 ff. 6 Platon, Politeia, 379a ff.
130
Helmut Holzhey
mit denen Leiden verstehend zu bewältigen gesucht wird, auch in der Bibel – hier aber, insbesondere bei den israelitischen Propheten, verbunden mit dem Bußruf zur Umkehr. Durch Leiden zu lernen: das bedeutet im Alten Testament, dass sich das Volk Israel wie der Einzelne durch Opfer, Klage, Gebet wieder in die Nähe Gottes bringt und unter seinen Schutz stellt. Doch gibt es keine durchgreifende Erlösung: Insbesondere das Leiden des Unschuldigen führt diesen und sein Umfeld in eine bleibende Aporie. – Für das Neue Testament ist es der auf Gott vertrauende Glaube, mit dem allein Leiden bewältigt, mindestens besser ertragen werden kann. Dieser Glaube beinhaltet keine Erklärung oder Rechtfertigung des Leidens. Die Evangelien berichten, wie schwer leidende Menschen Jesus gläubig vertrauen und aufgrund ihres Glaubens geheilt werden. Dieser Glaube hat nicht den Charakter einer theoretischen Einstellung, er ist vielmehr Vertrauen, mit dem das eigene oder fremdes Leiden Gott anheimgestellt wird. Diese Form der Bewältigung menschlichen Leidens erhält dadurch eine ganz neue Dimension, die für die Freunde Jesu an dessen Kreuz sichtbar wird: Dem Mensch gewordenen Gott selbst ist das Leiden nicht fremd. Sie ‚lernen‘ in der Teilhabe an Jesu Leiden, dass ihrem Leiden und menschlichen Leiden überhaupt der Stachel gezogen ist: Es widerspricht nicht mehr der göttlichen Güte, es bleibt nicht mehr letztlich unverständlich, es wird für Christen sogar Bestandteil ihrer Nachfolge. Wieder ist es ein Lernen ‚am eigenen Leibe‘; Paulus beschreibt es im Zweiten Brief an die Korinther so: „In allem werden wir bedrängt, aber nicht in die Enge getrieben, … zu Boden geworfen, aber nicht vernichtet; allezeit tragen wir das Sterben Jesu am Leibe herum, damit auch das Leben Jesu an unsrem Leibe offenbar werde.“7 In eine Kurzformel gepresst: im Leiden glauben lernen, im Glauben leiden lernen. Dieses Lernen untersteht dem christlichen Paradox, wieder nach Paulus: „die Kraft erreicht ihre Vollendung in Schwachheit“.8 Radikal entgegengesetzt bietet Seneca, Zeitgenosse von Paulus, philosophisches Denken gegen das ‚schwer zu Tragende‘ auf: „Tragt es tapfer“, schreibt er. „Das ist es, worin ihr dem Gott überlegen seid: er steht außerhalb des Erleidens von Unglück, ihr über dem Erleiden.“9 Der Gott selbst rät, Schmerz, Tod und Schicksal zu verachten. Und schließlich ‚steht der Weg aus dem Leben offen‘, der Suizid. Seneca tritt dem Leiden mit philosophischen Argumenten entgegen, er zieht diese Argumente nicht aus der Erfahrung des Leidens. Er begegnet dem Leiden aber auch, formal verwandt mit Paulus, nicht mit bloßer Theorie, sondern mit ‚Lebenskunst‘, 7 2 Kor, 4, 8 ff. 8 Ebd., 12, 9. 9 Lucius Annaeus Seneca, Über die Vorsehung, VI, 6, in: Ders., Philosophische Schriften, Bd. 1, hg. v. Manfred Rosenbach, Darmstadt 1980, S. 39.
Metaphysik: Denken im Modus des Leidens
131
das heißt mit einem logosgemäßen Leben in der Haltung der apatheia, der Freiheit von allen Gemütsbewegungen. Die Versuche zur philosophisch-theoretischen Bewältigung des Leidens mündeten in die Theodizee der frühen Neuzeit, das heißt in eine Rechtfertigung Gottes angesichts der negativen Seiten seiner Schöpfung. Die dafür vorgebrachten Argumente überzeugten aber seit etwa der Mitte des 18. Jahrhunderts weniger und weniger. Kant kritisierte sie radikal und durchgängig. Am Schluss seines Nachweises, dass „alle philosophischen Versuche in der Theodizee“ misslingen müssen – von 1791 – , liefert er aber doch einen späten Beitrag zum Lernen durch Leiden. Er hebt nämlich von der für ihn philosophisch erledigten doktrinalen Theodizee den Vorgang einer authentischen Theodizee ab. Eine solche Theodizee hat für ihn darin ihr Charakteristikum, dass mit ihr nicht versucht wird, Gottes Willen und Handeln durch unsere menschliche Vernunft verständlich zu machen, sondern Gott selbst – wenn auch im Medium unserer Vernunft – als „der Ausleger seines durch die Schöpfung verkündigten Willens“ in Anspruch genommen wird.10 Hiob ist für Kant Zeuge dieser ‚authentischen‘ Rechtfertigung Gottes angesichts unverschuldeten Leidens. „Der Mensch wird gemahnt durch Schmerz auf seinem Lager“ – heißt es Hiob 33, 19. Welche Einsicht empfängt Hiob durch sein fast unerträgliches Leiden? Nur die, dass Gottes Wille und Wirken unerforschlich sind. Er überlässt damit das Verständnis göttlichen Wirkens allein Gott selbst – und bewahrt sich so seine Frömmigkeit. Er versteht Gott nicht, seine Vernunft ist bei der Suche nach Gründen für sein Leiden überfordert: „ich habe“, so bekennt er am Schluss, „im Unverstand geredet über Dinge, die zu wunderbar für mich und unbegreiflich sind“11 – das ist seine ‚Einsicht‘, kein bloßes Eingeständnis seines Unwissens, aber auch keine negative Theologie, überhaupt keine Theologie, sondern? In Kants Sicht ist Hiobs Bekenntnis, unverständig über den Ursprung und Grund seines Leidens geredet zu haben, Ausdruck einer ‚Haltung‘, nämlich Ausdruck von Aufrichtigkeit und Redlichkeit „in Bemerkung des Unvermögens unserer Vernunft“.12
10 Immanuel Kant, Über das Misslingen aller philosophischen Versuche in der Theodicee, 1791, AA VIII 264. 11 Hiob 42, 3. 12 Kant, Über das Misslingen aller philosophischen Versuche in der Theodicee, a. a. O., S. 267.
132
2
Helmut Holzhey
Leidendes Denken
Bisher stand Lernen durch Leiden im Fokus. Könnten Denken und Leiden aber nicht noch inniger verbunden sein, sodass von einem dem Denken immanenten Leiden statt bloß von einem dem Leiden immanenten Nachdenken beziehungsweise Lernen zu sprechen wäre? Nach Kant, ließe sich sagen, leidet die menschliche Vernunft daran, dass sie ohne Erfolg nach der Erkenntnis des Unbedingten oder Absoluten sucht und dabei abstürzt. Gedanklich-ideelle Arbeit mit metaphysischer Ausrichtung, kurz: metaphysisches Denken leidet an sich selbst. Fragen wir zunächst, worin – genauer betrachtet – dieses Leiden besteht. Offensichtlich macht die Rede von einem Leiden im Denken nur dann Sinn, wenn das Wort ‚Leiden‘ nicht bloß auf ein Übel oder Unglück hinweist. Der Bedeutungshorizont des Wortes ist auch ein viel weiterer. Der deutsche Sprachgebrauch kennt Leiden als Erleiden ‚von‘ etwas – zum Beispiel eines epileptischen Anfalls – und als Leiden ‚an‘ etwas – beispielsweise an den Folgen eines Unfalls – ; ersteres Leiden – Erleiden – hat häufig den Charakter eines Widerfahrnisses, letzteres Leiden erstreckt sich in der Zeit, wird bewusst wahrgenommen, veranlasst zu Nachdenken und kontrolliertem Umgang. Beide Weisen des Leidens gehören dem subjektiven Erleben zu, dem Erleben eines mir und dir Zustoßenden oder Zugestoßenen, und markieren keinen objektiven, gar messbaren und in der Folge therapeutisch angehbaren Tatbestand, wie wir ihn im Wort ‚Schmerz‘ ansprechen. ‚Leiden‘ steht in relativem Gegensatz zu aktivem Tun und Handeln. Zum Bedeutungsfeld des Wortes gehören dabei recht verschiedene Formen leidenden, das heißt – unscharf ausgedrückt – passiven, besser: pathischen Verhaltens zur Wirklichkeit. Bei der Empfindung beziehungsweise Wahrnehmung, bei Emotionen und Affekten ist Leiden im Spiel, nicht nur bei Unfällen, Krankheiten oder Unglück. Denn unsere Wahrnehmungen bauen auf Sinnes‚eindrücken‘ auf, wie wir sagen; und einen Wutanfall erleiden wir, eine Leidenschaft überkommt uns. Nehmen wir die sprachlichen Beobachtungen gesamthaft in den Blick, so fällt die semantische Nähe von ‚leiden‘ und ‚erfahren‘, insbesondere von ‚erleiden‘ und ‚erfahren‘, auf. Im Blick darauf, dass Leid immer unerwartet und ungewollt über den Menschen kommt, ihn als ganzen trifft und von ihm unvertretbar getragen werden muss, kann Leiderfahrung als ein ausgezeichneter Fall eines Widerfahrnisses bezeichnet werden. Machen wir nun auch so etwas wie eine pathische Erfahrung im Denken? Ich verwende für ein solches Widerfahrnis den Ausdruck Denkerfahrung. Eine solche ist bei Kant aktenkundig in seiner vorkritischen Schrift Träume eines Geistersehers, erläutert durch Träume der Metaphysik von 1766. Er erzählt hierin, wie er sich selbst, verlockt durch einen angeblichen empirischen Beweis der Existenz einer Geister-
Metaphysik: Denken im Modus des Leidens
133
welt, in einem metaphysischen ‚Blendwerk‘ verirrte. Seine vernunftgeführte Denkarbeit wird durch ein zweifaches Widerfahrnis erschüttert: das Widerfahrnis der Überwältigung durch das spekulative Interesse an möglicher, empirisch gestützter Einsicht in das Reich des Geistes und das Widerfahrnis, bei der Befriedigung dieses Interesses auf Abwege zu geraten. Diese Denkerfahrung lässt sich als ‚Leiden‘ des metaphysischen Denkens an sich selbst beschreiben. Denken zielt auf Wissen. Es stößt, wo es vollkommenes oder absolutes Wissen sucht, bei seinen eigenen letzten Zielsetzungen an, wird auf sich zurückgeworfen, macht mit sich eine Erfahrung. Diese Denkerfahrung erschließt weder auf direkte noch auf indirekte Weise das Gesuchte, kann also nicht als metaphysische Erfahrung des Absoluten beziehungsweise ontologische Erfahrung des Seins identifiziert werden. Sie führt nur auf die Einsicht, dass Denken von einem metaphysischen Bedürfnis getrieben wird. Das bedeutet aber nun nicht, dass sich Metaphysik nach dem Durchgang durch ihre auch radikale Kritik auf die Artikulation eines metaphysischen Bedürfnisses beschränken würde und müsste.13 Am Denken zu leiden ist nicht nur ‚unsere menschliche Bestimmung‘, sondern führt zu leidenschaftlicher, aber auch nie vollendbarer Denkarbeit, zum Beispiel an der ontologischen Differenz zwischen ‚habens esse‘ und ‚est esse‘,14 ohne je das Sein selbst erfassen zu können. Von der „Erfahrung des Denkens“ spricht auch Martin Heidegger, und das nicht nur poetisch.15 Denn in seiner Schrift Vom Wesen des Grundes von 1929 macht er eine philosophisch-metaphysische Denkerfahrung namhaft, wo er sich vor die Abgründigkeit metaphysischen Denkens gestellt findet. Mit der philosophischen Tradition geht er davon aus, dass Denken ein Gründen ist, ortet aber einen dreifachen Vollzug des Gründens: als Stiften, Bodennehmen und Begründen. In dieser dreifachen Gestalt tritt menschliches ‚Dasein‘ aus sich heraus und bekundet so seine Freiheit. Der Grund ‚entspringt‘ dieser endlichen Freiheit, er hat seinen ‚Ursprung‘ und in diesem Sinne seinen Grund in ihr. „Die Freiheit ist der Grund des Grundes. … Als dieser Grund aber ist die Freiheit der Ab-grund des Daseins.“ Gründen ist abgründig, weil es in grundloser Freiheit ‚gründet‘. „Das Aufbrechen des Abgrundes in der gründenden Transzendenz ist … die Urbewegung, die die Freiheit mit uns
13 Zu Kant vgl. in diesem Band den Beitrag von Rudolf Langthaler, Von der kantischen ‚Kritik‘ zur ‚eigentlichen Metaphysik‘ – und darüber noch hinaus?, in diesem Band S. 15–37. 14 So Christoph Böhr in seiner Besprechung meines Buches ‚Wir sehen jetzt durch einen Spiegel‘. Erfahrungen an den Grenzen des philosophischen Denkens, in: Forum Katholische Theologie 34 (2018) S. 72-74. 15 Vgl. Martin Heidegger, Aus der Erfahrung des Denkens, Pfullingen 81955.
134
Helmut Holzhey
selbst vollzieht“, indem sie den Menschen „in Möglichkeiten“ stellt, „die vor seiner endlichen Wahl, d. h, in seinem Schicksal, aufklaffen“.16 Anders Georg Wilhelm Friedrich Hegel: In dessen Phänomenologie des Geistes von 1807 gewinnt metaphysisches Denken, statt an seinem Versagen oder seiner Abgründigkeit unabänderlich zu leiden, ein positives Verhältnis zu seinem eigenen Leiden, indem es dieses in sich aufnimmt und so zu einer Antwort auf die es stimulierenden Fragen gelangt.
3
Vom Umgang mit dem an sich selbst leidenden metaphysischen Denken
3.1
Inklusion vs. Exklusion durch Philosophie
Wie legt Hegel die Therapie des an sich selbst leidenden metaphysischen Denkens an? Er zeigt, wie das Denken selbst in seinem Prozess der Selbstvergewisserung auf Leiden als seinen ‚Motor‘ angewiesen ist. Auf dem Weg zum wahren Wissen macht das ‚Bewusstsein‘ wiederholt die ‚Erfahrung‘, dass sich das auf einer ersten Stufe für sicher gehaltene Wissen bei näherer Reflexion von innen heraus zersetzt. So schon für die sinnliche Gewissheit, wie sie sich im Satz äußert: Hier vor mir liegt ein Bogen Papier. Das stimmt aber nicht mehr, sobald ich mich an einen anderen Ort begebe. Die sinnliche Gewissheit ist mit ihrer sprachlichen Fixierung in etwas anderes, nämlich in Wahrnehmung, übergegangen. Das Bewusstsein „leidet … Gewalt, sich die beschränkte Befriedigung zu verderben“, die es bei seinem ‚normalen‘ Wissen empfindet; es leidet diese Gewalt „von ihm selbst“, indem sich ihm das, was wahr schien, als unwahr erweist.17 Aus diesem Leiden entspringt ein Neues. Philosophie hat nicht nur Erfahrung zum Thema, sie ist nicht nur Wissenschaft von der ‚Erfahrung des Bewusstseins‘, sondern Philosophie besteht, ja wird überhaupt erst in diesem Denkprozess der Erfahrung – einem Prozess, der von Einsicht zu Einsicht durch die jeweilige Negation eines vorgeblichen Wissens systematisch vorangetrieben wird. Indem dieser Denkprozess alle Wissensbestände durchläuft, ist er gänzlich durch das Widerfahrnis geprägt, dass sich fortlaufend dasjenige, was eben noch für wahr galt, als unwahr erweist. In dieser Positivierung des an sich 16 Martin Heidegger, Vom Wesen des Grundes, 1929, Frankfurt am M. 81995, S. 53 f. 17 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Phänomenologie des Geistes, 1807, Einleitung, in: Werke in zwanzig Bänden, hg. v. Eva Moldenhauer u. Karl Markus Michel, Frankfurt am M. 1969–1971, Bd. 3, 1970, Einleitung, S. 74.
Metaphysik: Denken im Modus des Leidens
135
selbst leidenden Denkens wird das Leiden daran, immer erneut aus vermeintlichen Gewissheiten herausgerissen zu werden, zur Triebfeder des denkenden Fortgangs auf dem Weg des sich stetig vollendenden absoluten Sichwissens. Das Ziel wird erst im vollständigen Durchgang aller Stationen dieses Leidensweges erreicht, ja ist von diesem Durchgang nicht zu trennen. Für Hegel repräsentiert dieser Prozess „das Leben Gottes und das göttliche Erkennen“. Das ist keineswegs erbaulich gemeint, vielmehr gehören dieser Idee von Gott „der Ernst, der Schmerz, die Geduld und Arbeit des Negativen“ wesentlich zu.18 Radikal anders verfährt die positivistische Metaphysikkritik. Sie heilt das an seinem nicht zu befriedigenden metaphysischen Bedürfnis leidende Denken, indem sie ein Sinnkriterium anbietet, mit dem sich metaphysische Aussagen als sinnlos weil nicht sachhaltig entlarven lassen.19 In ähnlicher Tendenz hatte schon Friedrich Albert Lange in seiner Geschichte des Materialismus argumentiert, dass solchen Aussagen – beziehungsweise Ideen – „jede theoretische Geltung im Gebiet des auf die Außenwelt gerichteten Erkennens“ abgehe.20 Der gemeinsame psychische Ursprung in der Phantasie und derselbe atheoretische Status verbänden diese metaphysische ‚Begriffsdichtung‘ mit der eigentlichen Poesie und mit der Religion. Der letztere Gedanke bildet die Basis einer Therapie leidenden Denkens durch Auslagerung des Problems aus der logischen in die ästhetische Sphäre: Das metaphysische Phantasieren findet im Positivismus seinen Spielplatz in der Kunst, wo es – frei von der Verpflichtung zur Wahrheit bzw. zur Überprüfung der Wahrheit – bloß der ‚Erbauung‘ dient.
3.2
Lebensweisheit als Therapie
Das metaphysische Bedürfnis tritt im gewöhnlichen Leben meist in Grenzsituationen in der Form von Sinnfragen auf, in Situationen der Schuldverstrickung, der Angst, der Verzweiflung, des schweren körperlichen oder seelischen Leidens, des Sterbens und des Todes. Die ‚letzten‘ Fragen lassen Menschen – wie in der Philosophie die Vernunft – leiden, wenn sie keine befriedigende, das ‚gewöhnliche‘ Leiden mildernde Antwort finden. Allerdings wird sich so mancher beim Blick auf den von Hegels gezeichneten Leidensweg der völligen Selbstvergewisserung menschlichen 18 Ebd., Vorrede, S. 24. 19 Vgl. Rudolf Carnap, Scheinprobleme in der Philosophie. Das Fremdpsychische und der Realismusstreit, Berlin 1928, mit e. Nachwort v. Günther Patzig, Frankfurt am M. 1966. 20 Friedrich Albert Lange, Geschichte des Materialismus und Kritik seiner Bedeutung in der Gegenwart, Iserlohn 1866, S. 272.
136
Helmut Holzhey
Geistes fragen, ob die Negation es wirklich verdient, als Leiden angesprochen zu werden. Doch für den sich in jenen Grenzsituationen abspielenden Kampf mit der Sinnfrage steht das außer Frage. Gibt es für das hier zu statuierende Leiden an der Brüchigkeit aller philosophischen Antworten auf Lebensfragen eine Therapie? Die ‚Lebensweisheit‘ bietet dafür dies und jenes an. Man kann es mit Lessing halten: „Wenn Gott in seiner Rechten alle Wahrheit und in seiner Linken den einzigen immer regen Trieb nach Wahrheit, obschon mit dem Zusatze, mich immer und ewig zu irren, verschlossen hielte und spräche zu mir: wähle! Ich fiele ihm mit Demut in seine Linke und sagte: Vater gib! Die reine Wahrheit ist ja doch nur für dich allein!“21 Oder man versucht, ganz ähnlich, die Sinnfragen mitsamt ihren immer wieder hinterfragbaren Antworten prinzipiell als Ausdruck der Last des Menschseins hin- und anzunehmen – sich durch sie an die ontologische Verfassung menschlichen Lebens, ‚dass ich bin und zu sein habe‘ – wie Heidegger sagt – , erinnern zu lassen und sich dabei, wie Sisyphos bei Albert Camus, in ‚verschwiegener Freude‘ seinem Schicksal überlegen zu wissen. Aufs praktische Leben bezogen, könnte moderne ‚Lebenskunst‘ darüber hinaus das Angebot machen, die Sinnfragen selbst als Regulativ der eigenen Lebensführung einzusetzen, also aus dem Leiden an ihnen zu ‚lernen‘.
3.3
Ein im christlichen Glauben gestifteter Umgang
Der christliche Glaube impliziert nicht eigentlich Heilung von diesem geistigen Gebrechen, jedoch eine andere als die in- oder exkludierende, eine andere auch als die lebensweisheitliche Einstellung, vielmehr eine Einstellung, die Distanz zum metaphysischen Bedürfnis und der von ihm geplagten menschlichen Vernunft zulässt, ohne sich von ihm zu verabschieden. Zentraler Inhalt dieses Glaubens ist, dass Gott in Jesus Mensch geworden ist und das Menschsein bis zum schmählichen Tod am Kreuz durchlitten hat. Was könnte das für das Leiden im und am metaphysischen Denken bedeuten? Paulus setzt beim „Wort vom Kreuz“ – 1 Kor 1, 18 – an. Mit diesem wird höchst provozierend der gekreuzigte Jesus als der messianische Erlöser verkündigt. Und das ist sowohl für die Juden ein Ärgernis als auch für die nach Weisheit suchenden griechischen Heiden eine Torheit – 1 Kor 1, 23 – , eine inakzeptable Zumutung. Im Wort vom Kreuz ist aus philosophischer Sicht Gott nicht erkennbar – 1 Kor 1, 21 – . Den Versuch einer philosophischen Annäherung zu unternehmen, scheint nur töricht. Eine ‚Torheit zu sein‘, das dürfte meinen, dass 21 Gotthold Ephraim Lessing, Eine Duplik, in: Ders., Werke in drei Bänden, München 1972, Bd. 3, S. 149.
Metaphysik: Denken im Modus des Leidens
137
das Wort vom Kreuz widervernünftig ist, also von dem abweicht, was als Wissen oder gut begründete Überzeugung anerkannt ist. Eine Torheit – aphrosyne – wurde von der gesamten griechischen Philosophie negativ bewertet, Paulus gibt ihr als Erster auch eine positive Qualität. Aber das Positive der Torheit besteht für ihn nur darin, dass sie dem Wort vom Kreuz bleibend anhaftet, dass sie das Leben derjenigen prägt, die sich unter das Wort vom Kreuz stellen, dass sie nicht durch eine psychiatrische Behandlung oder durch bessere Einsicht zu überwinden ist. Das Wort vom Kreuz ist tatsächlich eine Torheit. Die Griechen – wir können auch sagen: die Philosophen – sehen das durchaus richtig: Ein gekreuzigter Gott ist für vernünftige Menschen nicht ernst zu nehmen. Nicht anders verhält es sich aber auch bei denjenigen, ‚die gerettet werden‘, den – erst später sich so nennenden – Christen. Es liegt da bei den einen wie den anderen kein Missverständnis vor, das man klären könnte. Die Differenz zwischen den Griechen beziehungsweise den Philosophen und den Christen besteht nur darin, dass sie sich zu dieser Torheit je anders verhalten. Die Philosophen grenzen sich von ihr ab, für sie macht das Wort vom gekreuzigten Gott keinen Sinn. Paulus hingegen sieht sich und die Christen, an die er schreibt, durch diese Torheit geradezu definiert und als Toren oder Narren von Gott erwählt, wie es 1 Kor 1, 27 heißt. Toren sind die Adressaten des Wortes vom Kreuz. Im gekreuzigten Christus kommt Gott zu dem, was töricht, schwach und verachtet, ja nichts ist ‚vor der Welt‘. So die Botschaft. Aber wie ist sie zu verstehen, fragen die Weltweisen, wenn sie selbst eine Torheit oder Narrheit ist? Sie ist als Torheit nur von Toren zu verstehen, antwortet Paulus. Also nach vernünftigen Maßstäben gar nicht zu verstehen? fragen die Weltweisen zurück. Das beraubt uns unserer Existenzgrundlage, sagen sie sich. Paulus bestätigt das: „Hat Gott nicht die Weisheit der Welt als Torheit entlarvt?“22 Indem Philosophen das Wort vom Kreuz als Torheit zurückweisen, statt es als Torheit anzunehmen, erweisen sie sich in dessen Licht selbst als Toren. Was geht sie dann das Wort vom Kreuz überhaupt noch an? Gegenüber dem Wort vom Kreuz sind philosophisch verschiedene Haltungen denkbar. Ich unterscheide drei: 1. Ich lasse das Wort vom Kreuz, der Gottessohn habe als Mensch schlimmste Qualen erlitten und sei am Kreuz hingerichtet worden, sei es als Absurdität sei es als Geheimnis des Glaubens gelten, ohne weiter nachzufragen. Ich bekenne mich so zu einer Glaubenshaltung, die mit dem Gebrauch der Vernunft nichts zu tun hat – Fideismus – .
22 1 Kor 1, 20.
138
Helmut Holzhey
2. Ich verwerfe das Wort vom Kreuz als mit meinem und generell mit einem vernünftig durchdachten Gottesverständnis nicht vereinbar und stelle mich so auf den Standpunkt des griechischen Weltweisen. 3. Ich nehme das Wort vom Kreuz ernst und frage mich, ob und wie die ins Transzendente ausgreifende Vernunft, statt dem metaphysischen Bedürfnis zu willfahren, dem Törichten und Schwachen an Gott23 das Wort lassen könnte – was unter anderem hieße, dass sie das denkend gesuchte Absolute oder Unbedingte nicht mehr mit Gott gleichsetzen dürfte.24 Als modernes Beispiel für den letzteren Versuch verdient das Konzept des ‚schwachen Denkens‘ – pensiero debole – nähere Betrachtung, das der italienische Philosoph Gianni Vattimo 1983 vorstellte. Seinem Grundgedanken nach geht das Konzept von einer Schwächung der Vernunft im Verlauf der abendländischen Geistesgeschichte aus. Diese Schwächung besteht darin, dass der menschlichen Vernunft zunehmend die Fähigkeit abgesprochen wird, ein einheitliches Bild der Welt liefern zu können, was heißt, dass man sich mit einem Pluralismus von gleichermaßen gültigen Standpunkten abfindet. ‚Schwaches Denken‘ stellt sich positiv zu diesem Prozess der Entkräftung der Vernunft, positiv insbesondere zum Abschied von der Annahme eines letzten Grundes der Dinge. Doch das allein brächte das ‚schwache Denken‘ noch nicht in einen Zusammenhang mit der von Paulus gemeinten Torheit der Weltweisheit. Dieser Zusammenhang ergibt sich erst damit, dass Vattimo den Prozess der Schwächung der Vernunft mit der Kenosis Gottes verbindet. Der christlichen Religionstradition liegt, schreibt Vattimo, „die Vorstellung von der Fleischwerdung Gottes zugrunde“, „die sie als kénõsis fasst, als Erniedrigung und, wie wir übersetzen würden, Schwächung“.25 Er bezieht sich dafür unter anderem auf Philipper 2, 6 f.: Christus Jesus „war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich – heauton ekenosen, semetipsum exinavivit – … “. Die Schwächung der Vernunft bedeutet – mit der Botschaft von der Menschwerdung Gottes in Beziehung gebracht – für Vattimo nichts anderes als Säkularisierung, und diese ist für Vattimo der Modus, „in dem sich … die kénõsis Gottes … verwirklicht“. So verstanden kann Säkularisierung „nicht mehr als Phänomen der Preisgabe der Religion gesehen werden, sondern als, und sei es auch
23 Ebd., 1, 25. 24 Vgl. Anselm von Canterbury, Proslogion, 3: „etwas, über das hinaus Größeres nicht gedacht werden kann … das bist Du, Herr, unser Gott“. 25 Gianni Vattimo, Jenseits der Interpretation. Die Bedeutung der Hermeneutik für die Philosophie, Frankfurt am M. 1997, S. 75. Hervorhebung im Original.
Metaphysik: Denken im Modus des Leidens
139
paradoxe, Verwirklichung ihrer tiefsten Berufung“26. Das ‚Geschick der Schwächung‘ der Vernunft ist Ausdruck der Fleischwerdung oder kénõsis Gottes. Es koinzidiert mit der ‚antimetaphysischen Inspiration‘ einer ‚postmetaphysischen Philosophie‘. Statt das Wort vom Kreuz mit der gängigen philosophischen Sicht als irrational abzutun, gibt ihm Vattimo mit seiner Übersetzung in die Sprache ‚schwachen Denkens‘ eine rational nachvollziehbare positive Deutung. Religiös beurteilt verliert das Wort vom Kreuz dabei allerdings sowohl seine Anstößigkeit wie seinen eigentlichen Gehalt, der besagt, dass sich Gott selbst im Tod Jesu Christi des schwachen und leidenden Menschen angenommen und uns so – sichtbar in der Auferstehung Jesu und seiner Erhöhung – von den Schrecken des Leidens befreit hat. Und für die postmetaphysische Weltweisheit verliert das metaphysische Bedürfnis und mit ihm das Leiden der menschlichen Vernunft an der steten Zweifelhaftigkeit ihrer Erkenntnisse seine Bedeutung. Faktisch bleibt das Bedürfnis als Bekundung der condition humaine jedoch weiter virulent. Was aber hat sich damit geändert, dass der Versuch der Beantwortung metaphysischer Fragen nun auf einen ‚schwachen‘ Gott statt auf den starken ‚Gott der Philosophen‘ Bezug nimmt? Die menschliche Vernunft sieht sich einem Gott gegenüber, dessen Existenz nicht mehr in einer übermenschlichen Denkanstrengung ausgewiesen werden muss, sondern mit einem Gott, der im Mensch gewordenen Logos spricht.27 Das Leiden der eo ipso dem höchsten beziehungsweise notwendigen Wesen nachdenkenden Vernunft bleibt unumgänglich. Aber in diesem Leiden wird eine Stimme, die leise Stimme eines ‚schwachen Gottes‘ hörbar. Das geschieht allerdings nur dann, wenn sich das aufs transzendente Absolute zielende philosophische Denken gegenüber dem Wort vom Kreuz zu seiner Torheit bekennt. In dieser Wendung öffnet sich der Philosoph für eine Antwort auf die metaphysischen Fragen, die nicht mehr aus dem Gebrauch seiner Vernunft resultiert. Das Bekenntnis meiner Torheit hat seinen Ort nicht im Hörsaal oder in Publikationen, auch nicht in einem Aufsatz wie diesem. An den genannten Orten trage ich, wenn ich denn mit ersten und letzten Fragen befasst bin, das metaphysische Bedürfnis aus als Bestandteil der ‚philosophischen Lebensform‘ des Weltweisen. Das Bekenntnis des Wortes vom Kreuz, zugleich Bekenntnis philosophischer Torheit, hat seinen Ort im Gottesdienst oder in der Liturgie mit ihren spezifischen rituellen Sprechhandlungen; es ist Bestandteil einer ‚liturgischen Lebensform‘, wie ich sagen möchte. Auch wenn ich bestreite, dass sich Ratio und Ritus ausschließen, kann es nicht angehen, die eine an der anderen Lebensform messen zu wollen. Wenn ich 26 Gianni Vattimo, Jenseits des Christentums. Gibt es eine Welt ohne Gott?, München u. Wien 2004, S. 38. Hervorhebung im Original. 27 Vgl. Joh 1, 14.
140
Helmut Holzhey
bete, philosophiere ich nicht, jedenfalls nicht im strengen Sinne von Philosophie; vice versa. Aber muss ich mich nicht für das eine oder das andere entscheiden? Viele tun und fordern das, meist im Sinne der Liquidierung von Religion, aber natürlich auch von der Seite der ‚Frommen‘ her durch Eingrenzung oder letztlich Geringschätzung der philosophischen Ratio für ein gottgemäßes heiliges Leben. Keine Frage: Aufklärung und Gegenaufklärung widersprechen sich. Doch die ‚philosophische‘ und die ‚liturgische‘ Lebensform sind in einem Leben verbindbar, ohne in ein sacrificium intellectus hineinzustolpern. Mein eigenes Bemühen geht dahin, vom metaphysischen Bedürfnis heimgesucht, dem liturgischen Leben Raum zu geben, um in ihm und durch es dem Leiden an der Endlichkeit menschlicher Vernunft seine Bitterkeit zu nehmen.
An den Grenzen unseres Wissens: Zur Deutung der Beziehung zwischen Mensch und Gott aus dem Blickwinkel des Gebets Eine antike Quelle der christlichen und modernen Welt Norbert Hinske An den Grenzen unseres Wissens
1
Das Problem der Selbsterkenntnis des Menschen im Spiegel der antiken Philosophie
Zu den ältesten überlieferten Sätzen der europäischen Philosophie gehört die Aufforderung: Erkenne dich selbst: γνῶθι sαυτόν. Die Ursprünge dieses Satzes liegen weithin im Dunkeln. Allem Vermuten nach geht er auf einen der sogenannten ‚Sieben Weisen‘ des siebenten und sechsten Jahrhunderts vor Christus zurück. Er hat die Menschen über die Zeitalter hinweg immer wieder in seinen Bann geschlagen. Noch das von Karl Philipp Moritz herausgegebene Magazin zur Erfahrungsseelenkunde – erschienen in den Jahren 1783 bis 1793, eine der Gründungsurkunden der modernen Psychologie1 – trägt in großen griechischen Buchstaben eben diesen Titel: ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ. Es ist nicht zuletzt dieses Programm der Selbsterkenntnis, das dem Fach Psychologie für viele bis heute seine Faszinationskraft verleiht. Wer sich auf den Versuch einläßt, sich selbst zu erkennen, stößt aber auch früher oder später auf die Frage, wie man das denn anstellen könne. So einfach die Aufforderung auf den ersten Blick auch scheinen mag – jeder Versuch einer Antwort führt in steiniges Gelände. Der Blick in den eigenen Personalsausweis reicht zur Selbsterkenntnis ja offenbar nicht aus. Auch diese Einsicht hat ihre lange Geschichte. „Es ist schwer, sich selbst zu erkennen“ – δύσκολον τὸ ἑαuτὸν γνῶναι – ist bei Diogenes Laertius2 im dritten nachchristlichen Jahrhundert als Karl Philipp Moritz, ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ oder Magazin zur Erfahrungsseelenkunde als ein Lesebuch für Gelehrte und Ungelehrte, hg. v. Karl Philipp Moritz, 10 Bde., 1783–1793, Nördlingen 1986. 2 Diogenes Laertius, Von dem Leben und den Meinungen berühmter Philosophen, I, 36. 1
© Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv lizenziert durch Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2020 C. Böhr (Hrsg.), Metaphysik, Das Bild vom Menschen und die Ordnung der Gesellschaft, https://doi.org/10.1007/978-3-658-31593-1_9
141
142
Norbert Hinske
einer der Sätze überliefert, die Thales von Milet zugeschrieben worden sind. Von Bias, einem anderen der ,Sieben Weisen‘, wird ähnliches berichtet.3 Ob es dabei primär um den Menschen als Individuum oder um den Menschen als Gattungswesen geht, bleibt offen. Einer der geistreichsten Antwortversuche findet sich bei den frühen Sokratikern, nämlich in den Erinnerungen an Sokrates, den Apomnemoneumata von Xenophon, und zwar im zweiten Kapitel des vierten Buches. In ihm geht es ganz ausdrücklich um die Frage, „an welchem Punkt man denn ansetzen müsse, um sich selbst zu erkennen“: περὶ πολλοῦ ποιητέον εἶναι τὸ ἑαυτὸν γιγνώσκειν, οὕτως ἴσθι ὁπόθεν δὲ χρὴ ἄρξασθαι ἐπισκοπεῖν ἑαυτόν.4 Der überraschende Grundgedanke des Sokrates ist: Ich erkenne mich selbst, wenn ich erkenne, was ich ganz fraglos für gut halte, oder anders formuliert: Ich erkenne mich selbst, und zwar offenbar zunächst mich selbst als Individuum, wenn ich erkenne, was ich mit letzter Entschiedenheit will, um was es mir in meinem Leben letzten Endes wirklich geht. Die Schlüsselfrage lautet: Welche Lebensabsichten kann ich nicht zur Disposition stellen, ohne mich damit zugleich selbst zur Disposition zu stellen? Der Mensch erkennt sich selbst, sobald und soweit er seine wahren Wünsche in den Blick bekommt, also dasjenige, was ihm nicht bloß als Mittel zum Zweck, als Mittel zu etwas anderem, sondern um seiner selbst willen wichtig ist. Die Beantwortung dieser Frage stellt sich jedoch im Verlauf des Gesprächs Schritt für Schritt als ein schwieriges, ja halsbrecherisches Unternehmen heraus. Das beginnt gleich bei der ersten, scheinbar ganz selbstverständlichen Antwort. Sie lautet: Ohne Frage gut ist Gesundheit. Das ist nun wahrlich eine zeitlose Antwort. ‚Hauptsache, man ist gesund‘, hat vermutlich jeder von uns schon irgendwann einmal gesagt. Sokrates aber weist seinen Gesprächspartner darauf hin, daß es in manchen Fällen paradoxerweise gerade die Gesundheit ist, die den Menschen in schlimme Dinge verwickelt, während ihn eine rechtzeitige Krankheit ‚zum Glück‘ davor bewahrt. Als Beispiel nennt Sokrates die „Teilnahme an einem verfehlten Feldzug oder an einer misslungenen Flottenexpedition“.5 Wenn nicht alles täuscht, ist das eine Anspielung auf die zweite Sizilische Expedition im Verlauf des Peloponnesischen Krieges, das Stalingrad Athens, das den Zeitgenossen damals noch in lebendiger Erinnerung gewesen ist. Sokrates bringt hier jedoch eine zeitlose Erfahrung zur Sprache. So mancher deutsche Soldat ist aus dem Kessel von Stalingrad nur aufgrund einer schweren Verwundung in letzter Minute ausgeflogen worden. Aber 3 Gnomologium Vaticanum, hg. v. Leo Sternbach, 1887–1889, neu hg. v. Otto Luschnat, Berlin 21963, S. 169, Nr. 445; vgl. auch ebd., S. 125, Nr. 321. 4 Xenophon, Erinnerungen an Sokrates, IV, 2, 30. 5 Ebd., IV, 2, 32.
An den Grenzen unseres Wissens
143
auch die Alltagserfahrung hält an dieser Stelle, wenn man nur nachdenkt, Beispiele genug bereit. Jemand hat ein Preisausschreiben gewonnen und ist dadurch in den Tod geflogen, solche und ähnliche Meldungen findet man in der Zeitung immer wieder. Natürlich ist Gesundheit ein hohes Gut und Krankheit eine Last, an der wir oft schwer zu tragen haben. Aufs Ganze gesehen aber handelt es sich bei der Gesundheit um etwas, was, wie Sokrates es ausdrückt, „manchmal von Nutzen und manchmal von Schaden ist“.6 Der Irrtum liegt nicht in dem Urteil als solchen, sondern in seiner unreflektierten Verallgemeinerung. Sokrates spricht denn auch nicht etwa – wie in der Folge die Stoa – von Adiaphoron – es macht keinen Unterschied; es ist gleichgültig – , sondern von ‚zweischneidig‘ – ἀμφίλογoν – , oder von ‚undurchschaubar‘ – ἄδηλoν – . Dieser zweite Begriff taucht auch bei Platon immer wieder auf;7 allem Vermuten nach handelt es sich bei ihm um ein genuines Sokratisches Erbe. Das Gesagte gilt nun aber nicht etwa nur für die Gesundheit. Es gilt genauso – um schon an dieser Stelle die Pointe des ganzen Gesprächs zur Hälfte vorwegzunehmen – für alle anderen Dinge, die wir im Alltag so fraglos für gut halten. Der zweite Lebensinhalt nämlich, den der Gesprächspartner für „unstrittig“ – ἀναμφισβητήτως8 – oder fraglos gut erklärt, ist das Wissen, insbesondere das Fachwissen. Auch hier bietet sich jedoch bei näherem Hinsehen das gleiche Bild. Sokrates verweist an diesem Punkt des Gesprächs zum Beispiel auf Daidalos, den sagenumwitterten Ingenieur der Antike – heute wäre er vermutlich Nobelpreisträger – , der gerade aufgrund seines Wissens erst seine Heimat und seine Freiheit und schließlich auch noch seinen Sohn verloren hat. Auch das gilt nicht etwa nur für die Lebensverhältnisse im antiken Griechenland. Man braucht an dieser Stelle nur an die Zeit nach 1945 zu erinnern, um zu bemerken, von welcher Zeitlosigkeit auch dieses zweite Beispiel ist. Als letzte mögliche Antwort bleibt dem Gesprächspartner des Sokrates schließlich nur der Hinweis auf das Glücklichsein – εὐδαιμονεῖν9 – : So etwas wie Glück scheint nun tatsächlich ein allen Anfechtungen und Zweifeln entzogener Lebensinhalt zu sein. Die auf den ersten Blick schier unverständliche Antwort des Sokrates aber lautet, und damit gelangt das Gespräch an seinen springenden Punkt: Ja, gewiss, das Glück, das ist ein Gut, das über allen Zweifel erhaben ist – aber freilich auch
6 Ebd., IV, 2, 32. 7 Vgl. Norbert Hinske, Der Sinn des Sokratischen Nichtwissens, in: Gymnasium 110 (2003) S. 319-332, hier S. 329. 8 Xenophon, Erinnerungen an Sokrates, IV, 2, 33. 9 Ebd., IV, 2, 34.
144
Norbert Hinske
nur dann, „wenn man es nicht aus zweifelhaften Gütern zusammensetzt“.10 Als Beispiele für solche zweifelhaften Lebensinhalte oder Lebensziele nennt Sokrates in der Folge Schönheit, Kraft, Vermögen sowie gesellschaftliches Ansehen und politischen Einfluss, also lauter Dinge, die wir zunächst einmal ganz unreflektiert mit dem Wort ‚Glück‘ assoziieren. Für alle diese Lebensinhalte aber gilt bei näherem Hinsehen eben das, was anfangs von der Gesundheit gesagt wurde: Sie sind ‚zweischneidige‘ Dinge, also etwas, was „manchmal von Nutzen und manchmal von Schaden ist“, wie es bei Xenophon wörtlich heißt.11 Beispiele dafür gibt es in der Geschichte wie in der Gegenwart genug. Viele Menschen, die man zunächst vielleicht beneidet hat, erregen am Ende nur noch unser Mitleid. Ein schönes Leben, so denken wir dann, sieht anders aus. Hinter den skizzierten Ausführungen des Sokrates steht eine grundlegende Einsicht – und sie macht die zweite Hälfte der Pointe aus: Auf der einen Seite ist Glück etwas, auf das jeder Mensch sozusagen mit Naturnotwendigkeit aus ist. Jeder möchte glücklich sein. Dieser Wunsch ist gewissermaßen das Apriori unseres Willens und daher von grundsätzlich anderer Art als alle konkreten, inhaltlich bestimmten Lebensziele, die wir uns im Laufe des Lebens setzen mögen. Um das festzustellen, bedarf es keiner kostspieligen empirischen Untersuchungen. Es ist eine Binsenweisheit. Auf der anderen Seite aber ist Glück ein völlig inhaltsleerer Begriff, den man so oder so mit Inhalt füllen muß. Für den in jüngster Zeit oft so gedankenlos gebrauchten Begriff ‚Gier‘ gilt übrigens das gleiche. Dass er glücklich werden will, steht für jeden Menschen stillschweigend fest. Auf welchem Wege er aber tatsächlich glücklich werden kann, erweist sich bei näherem Hinsehen als eine Aporie, an der keiner auf die Dauer vorbeikommt. So gesehen weiß niemand, was Glück ist.
2
Das Sokratische Nichtwissen und seine Konsequenzen für das Bittgebet
In unmittelbarem Anschluss an die skizzierten Überlegungen nimmt das Gespräch jedoch eine überraschende Wendung. Der Gesprächspartner des Sokrates zieht daraus nämlich den Schluss, unter solchen Umständen „wisse er nicht einmal, was er von den Göttern erbitten solle“: μηδ’ ὃ τι πρὸς τοὺς θεοὺς εὔχεσθαι χρὴ
10 Ebd. 11 Ebd., IV, 2, 32.
An den Grenzen unseres Wissens
145
εἰδέναι.12 Spätestens an dieser Stelle schlägt die Frage nach der Selbsterkenntnis des Menschen als Individuum um in die Frage nach der des Gattungswesens Mensch. Jetzt geht es um die grundsätzliche Frage nach der Situation des Menschen als Mensch, gestern wie heute. Die Frage lautet nun nicht mehr: Wie erkenne ich mich am Leitfaden meiner eigenen Glücksvorstellungen als dieses konkrete Individuum im Unterschied zu anderen? sondern: Wer ist der Mensch überhaupt? Das Gebet verrät nicht nur etwas über den einzelnen Menschen, es verrät auch etwas über die Verfasstheit des Menschen als Mensch. Bei dem Gesagten geht es nun aber nicht etwa um irgendeine Randbemerkung des analysierten Gesprächs. Es führt vielmehr mitten in das Zentrum des Sokratischen Denkens. Im ersten Buch der Memorabilien nämlich äußert sich Xenophon grundsätzlich zu dem Thema. Er schreibt: Sokrates „betete zu den Göttern einfach darum, sie möchten das Gute geben: εὔχετο δὲ πρὸς τοὺς θεοὺς ἁπλῶς τ’αγαθὰ διδόναι; „die Götter wüssten ja am besten, was im Einzelfall gut ist; diejenigen dagegen, die um Gold, Silber, politische Macht oder etwas anderes dieser Art beteten, die beteten seiner Meinung nach um nichts anderes, als wenn sie um ein Würfelspiel, eine Schlacht oder sonst etwas von demjenigen beteten, bei dem der Ausgang offenkundig unklar – τῶν φανερῶς ἀδήλων ὃπως ἀποβήσοιτο – sei“.13 Mit anderen Worten: Wer in solcher Weise betet, spielt Roulette. Vielleicht kommt der ursprüngliche Sinn des Sokratischen Nichtwissens nirgends deutlicher als in diesem kurzen Textstück zum Ausdruck. Erst beim zweiten Lesen aber bemerkt man, dass sich in ihm zugleich auch ein frappierendes Vertrauen artikuliert. Nichtwissen und Gottvertrauen gehen Hand in Hand. Wir wissen nicht, ob Sokrates der erste gewesen ist, der so gedacht hat. Die Situation, die er zur Sprache bringt, gehört ja seit eh und je zum Leben des Menschen. Zahlreiche Texte aber zeigen, dass sein Gedanke die Welt der Antike aufs nachhaltigste beeinflusst hat. Die Analyse aller dieser Texte böte Stoff genug für eine eigene Tagung.14 Im Gnomologium Vaticanum heißt es zum Beispiel über Aristipp: „Er sagte, es sei lächerlich, überhaupt – καθόλον – um etwas Gutes zu beten und von dem Gott etwas zu verlangen; denn auch die Ärzte gäben nicht dann etwas, wenn der Kranke um Essen oder Trinken bäte, sondern wenn sie den Eindruck hätten, es helfe.“15 Es ist nicht auszumachen, ob es sich hier um den bekannten Aristipp handelt,
12 Ebd., IV, 2, 36. 13 Ebd., I, 3, 2. 14 Zur Wirkungsgeschichte vgl. Olof Gigon, Kommentar zum ersten Buch von Xenophons Memorabilien, Basel 1953, S. 97 f. 15 Gnomologium Vaticanum, S. 16, Nr. 32.
146
Norbert Hinske
den Xenophon so wenig gemocht hat,16 oder um dessen Neffen oder um irgendeinen anderen Aristipp. Wenn es darum geht, die Gedankenwelt eines antiken Denkers zu rekonstruieren, ist das genannte Gnomologium eine lausige Quelle: Zahlreiche Aussprüche werden zugleich den verschiedensten Personen zugeschrieben. Wenn es sich dagegen darum handelt, die Breiten- und Langzeitwirkung bestimmter Gedanken abzuschätzen – die Handschrift der Sammlung stammt aus dem 14. Jahrhundert – , ist es von schier unschätzbarem Wert. Die skizzierte Fassung des Sokratischen Nichtwissens hat mehr als zwei Jahrtausende weitergewirkt und die christliche wie die moderne Welt bis hin zu Immanuel Kant beeinflusst. Es ist wohl kein Zufall, dass in dem berühmten Marmorfußboden des Doms von Siena nicht etwa Petrus, sondern Sokrates die Erdenpilger am Ende ihres Weges erwartet. Die Darstellung stammt aus dem 16. Jahrhundert. Von den antiken Quellen seien hier nur noch die Epistulae morales von Lucius Annaeus Seneca genannt. Sie variieren den Gedanken aus einer ganz anderen Perspektive. In einem dieser Briefe heißt es: „Taub zeige dich denen gegenüber, die du am meisten liebst. Sie meinen es gut und erbitten für dich schlechtes. Willst du glücklich sein, dann bete zu den Göttern, daß dir nichts von alledem widerfährt, was sie erflehen.“ „Surdum te amantissimis tuis praesta: bono animo mala precantur. Et si esse vis felix, deos ora, ne quid tibi ex his, quae optantur, eveniat“.17 Die Stoa hat aus dieser Situationsbeschreibung die vernünftige Folgerung gezogen, dass es nur das moralische Handeln und die Pflichterfüllung seien, die das glückliche Leben, die vita beata, und die tranquillitas amini ausmachten. Etwas anderes bleibe ja nicht. Wie sehr Seneca damit auch die christliche Welt geprägt hat, zeigt der Seneca christianus18 des Jesuiten Johann Baptist Schellenberg, der von 1586 bis 1645 lebte, eines der großen, immer wieder aufgelegten und übersetzten Erfolgsbücher des 17. Jahrhunderts. Das Werk ist in Wahrheit nichts anderes als eine wortgetreue Auswahl aus den philosophischen Schriften Senecas. Ob die ebenso unerbittliche wie radikale Antwort der Stoa das letzte Wort in dieser Sache ist, steht freilich auf einem anderen Blatt.
16 Vgl. Xenophon, Erinnerungen an Sokrates, II, 1, sowie III, 8. 17 Lucius Annaeus Seneca, Briefe an Lucilius, IV, 31, 2. 18 Seneca christianus. Das ist: Richt-Schnur eines Christlich-Tugendhafften Lebens, aus denen Episteln L. Annaei Senecae gezogen, um dessen Fürtrefflichkeit willen zum abermaligen Druck, auf vieles Verlangen, in Lateinisch- und Teutscher Sprach heraus gegeben, 11637, Frankfurt 1730.
An den Grenzen unseres Wissens
3
147
Die Anverwandlung des antiken Erbes im Christentum
Jesus hat sich immer wieder zum Gebet zurückgezogen. Für die Menschen in seiner näheren Umgebung war das offenbar so selbstverständlich nicht. Sie hatten nicht von ungefähr ihre Schwierigkeiten mit dem Beten. Denn die Sokratische Auffassung vom Gebet hat schwerlich an den Grenzen des damaligen Palästina haltgemacht und ihr Argument ist von entwaffnender Einfachheit. Im Alexanderreich wimmelte es ja von Wanderphilosophen unterschiedlichsten Couleurs. So kommt es, dass einer seiner Schüler zu Jesus sagt: „Herr, lehre uns, wie man betet“19: Kύριε, δίδαξον ἡμᾶς πρoσεύχεσθαι. Die Antwort Jesu ist das Vaterunser. Aus dem Blickwinkel des Bittgebets betrachtet ist es das Antigebet schlechthin. Es setzt allem gewohnten Bitten und Beten ein Ende. Denn wir sorgen uns ja, von schlimmen Notfällen abgesehen, gerade nicht um das Brot für heute, sondern um das Brot für morgen. Und wer könnte schon ernsthaft wollen, dass man mit ihm so umgeht, wie wir selber, zumindest in unserem Inneren, mit denen umgehen, die uns irgendwann einmal verletzt haben? Das Vaterunser überbietet alles, was die Antike zum Thema des Gebets gedacht hat. Aber es setzt die Antike als Problemhorizont voraus. Paulus bringt die Schwierigkeiten des Betens ganz ausdrücklich im Römerbrief zur Sprache. Er schreibt: „wir wissen nicht, was wir erbitten sollen, so wie man es soll“: καθὸ δεῖ οὐκ οἴδαμεν.20 Das könnte so auch bei Xenophon stehen. Klaus Haacker bemerkt dazu in seinem Handkommentar zum Römerbrief und zwar unter ausdrücklicher Bezugnahme auf die Memorabilien: „Damit greift er – sc. Paulus – ein Thema auf, das seit Sokrates von Griechen, Römern und Juden diskutiert wurde.“21 Für die weitere Wirkungsgeschichte wäre zum Beispiel der Brief von Aurelius Augustinus an Anicia Faltonia Proba zu nennen. Im Mittelalter hat Meister Eckhart die Probleme mit besonderer Schärfe zum Ausdruck gebracht. In seinem Kommentar zum Johannesevangelium schreibt er: „wer um dieses oder jenes bittet, weiß nicht, um was er bittet, weil er um einen schlechten Inhalt und in schlechter Form bittet“; „petens hoc aut hoc nescit, quid petat, quia malum et male“.22 Johannes XXII. hat diesen Satz im Jahr 1329 in seiner Bulle In agro dominico als irrig beziehungsweise häretisch verurteilt.23 Im Kontext 19 20 21 22 23
Lk 11, 1. Röm 8, 26. Klaus Haacker, Der Brief des Paulus an die Römer, Leipzig 1999, S. 166 f. Meister Eckhart, Die lateinischen Werke, Bd. 3, Stuttgart 1994, S. 533. Vgl. Meister Eckhart, Die lateinischen Werke, Bd. 5, Stuttgart 2006, S. 598: „Septimus articulus: Item quod ‚petens hoc aut hoc malum petit et male, quia negationem boni et negationem dei petit, et orat deum sibi negari‘ … “.
148
Norbert Hinske
der sokratischen Tradition aber ergibt der Satz, so überspitzt er auch formuliert sein mag, durchaus einen guten Sinn. Die Kirche hat den genannten Problemen in ihren großen Gebeten immer wieder Rechnung getragen. Sie atmen bewusst oder unbewusst den Geist des Sokratischen Nichtwissens. Das Kyrie beschränkt sich auf das bloße ‚eleison‘ und die Litanei auf Formeln wie ‚audi nos‘, ‚exaudi nos‘, ‚misere nobis‘ und ähnliche Bitten. Damit ist alles gesagt. Nach dem Zweiten Vaticanum sind an ihre Stelle häufig die Fürbitten getreten. Vor allem, wenn sie als sogenannte ‚pro-ut‘-Bitten formuliert werden, sind sie von dem Sokratischen Selbstverständnis des Menschen oft weit entfernt. Wer das Gebet aber zu volkspädagogischen oder gar politischen Zwecken missbraucht, verlässt den Raum des Gebets und beschädigt die religiöse Dimension des menschlichen Daseins. Beten heißt: sich Gott anvertrauen. Nur das sollen wir im Bittgebet lernen, sonst nichts. Um Missverständnissen vorzubeugen, sei hinzugefügt: Eine zweite, nicht weniger wichtige Säule des jüdischen und christlichen Glaubens ist das Almosengeben – ein heute törichterweise in Misskredit gebrachtes Wort. Aber Gebet und Almosengeben sind zwei ganz verschiedene Säulen, die man nicht miteinander verwechseln darf.
4 Kant und die Moderne Kant wird oft als Prototyp des neuzeitlichen Denkens gesehen. Aber auch bei ihm ist das Sokratische Verständnis des Gebets auf Schritt und Tritt präsent. Der so gern zitierte Satz seiner späten Religionsschrift: „Das Beten … ist ein abergläubischer Wahn“24 zeigt nur einmal mehr – selbst wenn die Weglassung durch Pünktchen angezeigt wird – , wie gründlich man die Auffassungen eines Autors auch durch korrekte Zitate auf den Kopf stellen kann. Dass Kant immer wieder von dem „Geist des Gebets“25 spricht, der unser Leben als ganzes bestimmen solle, wird dabei häufig mit Stillschweigen übergangen. Auch die Äußerungen Kants zum Gebet sind ohne einen Rückgriff auf die antiken Quellen nur halb zu verstehen. In einer frühen Reflexion heißt es bei Kant: „Socrates vom Gebeth“.26 Der Herausgeber Erich Adickes verweist dazu in der AkademieAusgabe ausdrücklich auf Xenophon Memorab., I, 3, 2, und zitiert die ganze Passage 24 Immanuel Kant, Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, 1793, 21794, B 302. Hervorhebung im Original. 25 Ebd. Hervorhebung im Original. 26 Reflexion 2189, AA XVI 265.
An den Grenzen unseres Wissens
149
im Original.27 Für Kant war das jedoch weit mehr als eine bald wieder vergessene Jugendlektüre. Die Beschäftigung mit Xenophons Erinnerungen an Sokrates zieht sich bei ihm vielmehr wie ein roter Faden fast durch sein ganzes Werk. Noch in seiner Grundlegung zur Metaphysik der Sitten aus dem Jahre 1785 kehrt das eingangs ausführlich erörterte Gespräch aus dem vierten Buch der Memorabilien in aller Breite wieder.28 Ähnliches gilt für Xenophons Äußerungen zum Problem des Betens. In Kants Vorlesung zur Moralphilosophie heißt es: „unsere Bedürfniß ist dem höchsten Wesen besser bekannt als uns. Der Wunsch der Creatur, er mag durch Worte ausgedrukt seyn oder nicht, ist Gott bekannt.“29 Eher an Senecas Epistulae morales dagegen erinnern Formulierungen wie: „ich würde selbst erschrekken, wenn Gott mir besondere Bitten gewähren möchte; denn ich könnte nicht wissen, ob ich mir nicht selbsten das gröste Unheil auf den Hals gewünscht hätte.“30 Auch Seneca nämlich war allem Anschein nach Kants ständiger Begleiter. Bei Kant wird das Sokratische Nichtwissen also wieder aus einer unmittelbaren Lektüre der antiken Quellen gespeist; ohne ihre Kenntnis bleiben viele seine Äußerungen unverstanden. Die Tiefe jenes Nichtwissens gegen alle ideologischen Verengungen offenzuhalten, zählt zu den wichtigsten Aufgaben der Gegenwart. Nur so geschieht Bildung. Wer den Bildungsbegriff dagegen stillschweigend auf bloße Berufsausbildung verkürzt, nimmt dem Menschen die Tiefendimension seiner Existenz und liefert ihn gleichermaßen den Ideologien wie der Werbung aus.
27 Ebd. 28 Vgl. Norbert Hinske, Glück und Pflicht. Überlegungen zu Xenophons ‚Erinnerungen an Sokrates‘ und ihre Wirkungsgeschichte im 18. Jahrhundert, in: Endlichkeit und Transzendenz. Perspektiven einer Grundbeziehung, hg. v. Jakub Siruvátka, Hamburg 2012, S. 13-23. 29 Immanuel Kant, Vorlesung zur Moralphilosophie, hg. v. Werner Stark, Berlin u. New York 2004, S. 143. 30 Ebd.
Metaphysik des Moralischen Wollen im allgemeinsten Sinne Theo Kobusch
1
Primat des Praktischen
Für das Schicksal der Metaphysik war es schlechthin bestimmend, dass sie schon in der Antike zweigeteilt wurde. Nachdem Aristoteles seine Metaphysik als eine Metaphysik der Natur entworfen hatte, entstand spätestens seit den Kirchenvätern, und zwar auf der griechischen Seite eher als bei Augustinus, der Typ einer Metaphysik des Willens beziehungsweise des Selbst. Während Aristoteles durch die Analyse der sinnlichen Substanz zuerst ihre inneren metaphysischen unselbständigen Prinzipien, schließlich auch die äußeren, immateriellen, selbständigen Prinzipien gewann, verdankt sich die Konstituierung der Metaphysik des Selbst einer Analyse des inneren Menschen. Aristoteles’ Metaphysik ist eine Lehre von einer objektiven Welt, die Metaphysik des Selbst ist eine Metaphysik des Subjekts. Diese Unterscheidung zweier Grundtypen der Metaphysik verdankt sich schon der Einsicht Wilhelm Diltheys, der in seiner frühen Arbeit Einleitung in die Geisteswissenschaften von 1883 die platonische und aristotelische Lehre als die Metaphysik der substantialen Formen oder als Kosmosmetaphysik oder auch als Metaphysik im Sinne der Vernunftwissenschaft zusammengefasst und davon die Metaphysik des Inneren, die Dilthey auch Metaphysik des Willens nennt, unterschieden hat.1 Die beiden Typen der Metaphysik, die sich gar nicht notwendig ausschließen, sind auch mit dem Blick auf die Philosophiegeschichte immer unterscheidbar. So wird man die Ontologie in der Aristoteleskommentierung der Spätantike, aber auch in der mittelalterlichen Aristotelesrezeption – bei Thomas von Aquin, Duns Scotus und anderen – weitgehend als Fortsetzung des aristotelischen Metaphysikansatzes ansehen müssen. Dagegen ist die Favorisierung des anderen Metaphysiktyps, 1
Wilhelm Dilthey, Einleitung in die Geisteswissenschaften, Göttingen 91990, S. 179, S. 192, S. 267.
© Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv lizenziert durch Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2020 C. Böhr (Hrsg.), Metaphysik, Das Bild vom Menschen und die Ordnung der Gesellschaft, https://doi.org/10.1007/978-3-658-31593-1_10
151
152
Theo Kobusch
der Metaphysik des inneren Menschen, nicht nur bei den meisten Kirchenvätern festzustellen, sondern vor allem auch im gesamten Neuplatonismus. Denn Plotins Metaphysik hat ja nicht nur deswegen eine herausragende Bedeutung, weil sie bestimmte Punkte an der aristotelischen Geistlehre, die er weitgehend übernimmt, kritisiert, sondern vor allem, weil sie eine Metaphysik des Subjekts ist. Seele, Geist und Eines sind vorrangig nicht objektiv vorgegebene Hypostasen, sondern Erfahrungsstufen der Seele. Die Seele ‚wird‘ Geist und schließlich auch Eines, wie zum Beispiel in Enneade VI 9 dargelegt ist. Das Werden, von dem da die Rede ist, ist nicht die substantielle Veränderung einer objektiv gegebenen Wesenheit, sondern die Selbstveränderung eines Subjekts, das die in ihm angelegten Fähigkeiten aktualisiert.2 Hier konnte Proklos mit seiner Lehre vom ‚Einen in uns‘ direkt anknüpfen. Allerdings auch die gesamte Mystik im Mittelalter von den Viktorinern angefangen, Meister Eckhart, Heinrich Seuse, Johannes Tauler bis hin zur französischen und protestantischen Mystik und in der Neuzeit bis zu Simone Weil. Die Mystik aller Jahrhunderte war immer die Metaphysik des inneren Menschen.3 Innerhalb dieser Innerlichkeitsmetaphysik entwickelt sich in der Spätantike, genauer gesagt bei den griechischen Kirchenvätern, eine Lehre, die für den Charakter der Metaphysik und auch für das neuzeitliche Denken im Ganzen von höchster Bedeutung ist. Das ist die Lehre vom Primat des Praktischen. Am deutlichsten tritt sie bei den Kappadoziern hervor, bei Gregor von Nyssa, seinem Bruder Basilius und Gregor von Nazianz. Ich habe das ausführlich in einem anderen Zusammenhang dargestellt und darf mich deswegen hier auf das Grundsätzliche beschränken.4 Im Hintergrund steht das Problem, wie sich eigentlich theoretische und praktische Erkenntnis zueinander verhalten. Es ist ein Problem, das ursprünglich schon im Platonismus, das heißt im Denken Platons selbst, angelegt ist. Denn auch schon bei Platon haben wir diese Konstellation des Denkens: Einerseits die Idee von der absoluten Transzendenz Gottes in der Politeia – die Schule gemacht hat – , andererseits den Grundgedanken von der ‚Verähnlichung mit Gott‘ im Theätet – der 2 Theo Kobusch, Metaphysik als Einswerdung. Zu Plotins Begründung einer neuen Metaphysik, in: Transzendenz. Zu einem Grundwort der klassischen Metaphysik, hg. v. Ludger Honnefelder u. Werner Schüßler, Paderborn, München, Wien u. Zürich 1992, S. 93-114. 3 Details bei Theo Kobusch, Mystik als Metaphysik des Inneren, in: Meister Eckhart und Augustinus, hg. v. Rudolf Kilian Weigand u. Regina Dorothea Schiewer, Stuttgart 2011, S. 17-36. 4 Theo Kobusch, Practical Knowledge in ‚Christian Philosophy‘: A New Way to God, in: Studia Patristica, Bd. LXXXIV: Papers presented at the seventeenth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 2015, hg. v. Marcus Vincent, Ilaria Ramelli, Giulio Maspero u. Monica Tobon, Bd. 10: Evagrius between Origen, the Cappadocians, and Neoplatonism, hg. v. Ilaria Ramelli, Löwen, Paris u. Bristol 2017, S. 157-164.
Metaphysik des Moralischen
153
ebenfalls in der Spätantike und darüber hinaus, in der christlichen und paganen Philosophie, omnipräsent ist. Wie soll das zusammengehen: Verähnlichung mit einem Unbekannten? Um diese widersprüchlich erscheinende Konstellation auflösen zu können, muss man sich vergegenwärtigen, was das Zentrum der Philosophie Platons ist und was auch immer zentral für alle Formen des Platonismus geblieben ist. Das ist die These, dass Gott aus theoretischer Sicht als ein transzendentes Wesen erscheint, das sich unserem Denken, auch dem intuitiven, und unserer Sprache entzieht, dass aber derselbe Gott aus praktischer Sicht, also durch das Sittliche, aufs Engste mit dem Menschen verbunden ist. Das bedeutet auch, dass Gott nach Platon und dem Platonismus zwar jenseits von Sein und Denken ist, aber nicht jenseits von Gut und Böse. Das Praktische wird ja an den Stellen im Werk Platons, wo von der ‚Homoiosis Theo‘ die Rede ist, deutlich herausgestellt. Evident ist das im Falle des ‚locus classicus‘: Theätet, 176b. Aber auch Politeia, 500c, drückt das aus, indem der im theoretischen Bereich mit einem pejorativen Beiklang belastete Begriff der ‚Imitation‘ nunmehr, praktisch gesehen, die intensivste Form der Verähnlichung mit Gott bezeichnet. Wenn noch andere markante Stellen seines Werkes mitberücksichtigt werden – Phaidon, 82a, Phaidros, 248a, Timaios, 90a-c – , kann es keinen Zweifel geben, dass Platon den praktischen Weg, das praktische Wissen, als die einzig gangbare Brücke zum Göttlichen im Sinne der Verähnlichung mit ihm verstanden hat. Platons Denken wird, wie bekannt ist, von den Kirchenvätern, besonders von den griechischen, rezipiert. Platon war, wie Franz Anton Staudenmaier, der große Kenner der christlichen Philosophie bemerkt, „bei den Lehrern der Kirche einheimisch wie ein lieber Gast“.5 Mit dem platonischen Denken wurde auch die problematische Konstellation von Theorie und Praxis übernommen. Bei den Kappadoziern wird diese platonische Spannung noch verschärft. Einerseits werden die maßlosen Ansprüche der aristotelisch verstandenen diskursiven Vernunft, die als Polypragmosyne, das heißt als neugierig erforschende, rein theoretische Vernunft das Wesen aller Dinge ergründen und so auch den letzten Grund alles Seienden erfassen zu können glaubte, in aller Deutlichkeit zurück gewiesen. Gregor nennt deswegen öfter das göttliche Wesen das ἀπολυπραγμόνητον, das der neugierigen Vernunft der aristotelischen Philosophie schlechterdings entzogen ist.6 5 Franz Anton Staudenmaier, Johannes Scotus Erigena und die Wissenschaft seiner Zeit, Erster Theil, Frankfurt am M. 1834, S. 388 f. 6 Gregorii Nysseni, De Vita Moysis, II, hg. v. Herbert Musurillo, Leiden 1964, [GNO, VII/I], S. 97,18 f.: ἀπολυπραγμόνητον εἴναι χρὴ τῶν ὑπὲρ κατάληψιν ὄντων τὴν κατανόησιν … ; Oratio catechetica, hg. v. Ekkehard Mühlenberg, Leiden 1996, [GNO, III/IV], S. 40,4; vgl. Gregorii Nysseni, De anima et resurrectione, hg. v. Andreas Spira, Leiden 2014, [GNO, III/III], S. 93, 8 f.: … ἀπολυπραγμόνητον τὸν λόγον τὸν περὶ τοῦ πῶς ἕκαστόν ἐστι, … ;
154
Theo Kobusch
Andererseits wird ein praktischer Weg zur Erkenntnis Gottes eröffnet, indem das Praktische, das heißt das Willensmäßige, die Freiheit, die Tugend, als die eigentliche Brücke zum Göttlichen angesehen wird. In diesem Lichte gesehen wird Gott zum ersten Mal überhaupt, nämlich bei Origenes als die Freiheit selbst – ingenita libertas – oder, wie bei Gregor von Nyssa, als die Tugend selbst erkannt. In dieser herausragenden Stellung des Praktischen ist womöglich ein typisches Merkmal des christlichen Platonismus zu sehen und dies auch im Unterschied zum – wenn ich so sagen darf – neuplatonischen Platonismus. Denn da ist das Praktische dem Theoretischen eindeutig untergeordnet. Sichtbar wird dieser Unterschied zwischen beiden Formen des Platonismus, wenn man sich vor Augen hält, wie beide es verstehen, dass der Mensch ‚Bild‘ Gottes ist. Die Neuplatoniker verstehen das ‚Eine in uns‘ als das Bild des transzendenten Einen, weil es wie dieses ‚unerkennbar‘ ist. Die Kirchenväter aber begreifen den Menschen als ‚Bild Gottes‘, weil er ein Freiheitswesen ist und mit Gott eine univok verstandene Freiheit gemeinsam hat. Was sich da in der Spätantike, speziell bei den griechischen Kirchenvätern vollzieht, ist nichts Geringeres als ein Paradigmenwechsel. Durch die Kritik an der Anmaßung der theoretischen Erkenntnis, das heißt am Anspruch der theoretischen Metaphysik, verliert die Theorie ihre Vormachtstellung und muss die Kompetenz für das Metaphysische an die praktische Erkenntnis abgeben. Etwas Analoges vollzieht sich in der Philosophie der Neuzeit. In Immanuel Kants Kritik der reinen Vernunft werden die unmäßigen Ansprüche der reinen theoretischen Vernunft zurückgewiesen. Die Anmaßung der theoretischen Vernunft besteht aber darin, über den Bereich der möglichen Erfahrung hinaus Erkenntnis haben zu wollen, wo sie doch nur jener Grundsätze sich bedienen darf, die bloß zur Erkenntnis der Gegenstände möglicher Erfahrung hinreichend sind. Kant hat diese notwendige Zurückweisung der Anmaßung der reinen theoretischen Vernunft als Bedingung für die Möglichkeit der praktischen Erkenntnis der Ideen Gott, Freiheit und Unsterblichkeit, das heißt für den praktischen Vernunftglauben angesehen. Denn andernfalls, wenn also die Grundsätze der spekulativen Vernunft auf solches angewandt würden, was nicht Gegenstand möglicher Erfahrung ist, würden die Ideen in bloße Erscheinung verwandelt, so dass eine praktische Erweiterung der reinen Vernunft, wie sie der Vernunftglaube darstellt, nicht möglich wäre.7
vgl. Gregorii Nysseni, [CE, II 1] [GNO, I], S. 255,1 f.: Καὶ ἂλλως δ᾽ ἂν τις ἀσφαλεὶς εἴναι φήσειεν ἀπολυπραγμόνητον ἐᾶν τὴν θείαν οὐσίαν ὡς ἀπόρρετον καὶ ἀνέπαφον λογισμοῖς ἀνθρωπίνοις; vgl. Gregorii Nysseni, [CE, II 105] [GNO, I], S. 257, 21 f.: … αὐτὴν δε τὴν οὐσίαν ὡς οὔτε διανοίᾳ τινὶ χωρητὴν οὔτε λόγῳ φραστὴν ἀπολυπραγμόνητον εἴασε, σιωπῇ τιμᾶσθαι … . 7 Vgl. Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, Vorrede zur zweiten Auflage.
Metaphysik des Moralischen
155
Dass Kant mit dieser Zurückweisung der Anmaßung der spekulativen Vernunft den aristotelischen Typ der Metaphysik kritisch treffen wollte, ist absolut sicher beweisbar. Denn er wirft ausdrücklich Aristoteles vor, ‚den himmelweiten Unterschied‘ zwischen dem reinen Vernunftvermögen und dem durch empirische Prinzipien geleiteten ‚nicht genug bemerkt‘ zu haben. Aristoteles hat vielmehr die Metaphysik nur „als eine zu höhern Stufen aufsteigende Physik“ angesehen und „in der Anmaßung derselben, die sogar aufs Übersinnliche hinausgeht, nichts Befremdliches und Unbegreifliches gefunden“.8 Die Kritik der praktischen Vernunft hat ein ganz anderes Anliegen. Sie will zeigen, dass es reine praktische Vernunft gibt, dass es den reinen Willen gibt und nicht nur den durch empirische Prinzipien bestimmten. Kant gebraucht auch in diesen Zusammenhang den Begriff der Anmaßung. Jetzt ist es die Anmaßung der empirisch bedingten Vernunft, alleine den Willen bestimmen zu wollen, die zurückgewiesen wird. „Die Kritik der praktischen Vernunft überhaupt hat also die Obliegenheit, die empirisch bedingte Vernunft von der Anmaßung abzuhalten, ausschließungsweise den Bestimmungsgrund des Willens allein abgeben zu wollen“.9 Ist aber dieser Aufweis erreicht, dass reine Vernunft den Willen bestimmt, dann können auch die praktischen Implikationen solcher Selbstbestimmung des Willens aufgewiesen werden. Diese Implikationen nennt Kant die Postulate. Sie sind das, was der praktische Vernunftglaube notwendig annehmen muss. Das Primat des Praktischen wird erkennbar. Und es wird zugleich durch Kant in den Rang eines Signums des neuzeitlichen Philosophierens erhoben, das als solches auch aufgegriffen wird. So hat Friedrich Heinrich Jacobi seine Philosophie der Innerlichkeit auch im Licht der Errungenschaften des kantischen Denkens durchdacht. Ausdrücklich erinnert Jacobi daran, dass Kant ‚zugleich mit mir‘, also er unabhängig von Kant und parallel zu ihm, die Anmaßung der spekulativen Vernunft, übersinnliche Wahrheiten demonstrieren und objektiv begründen zu wollen, zurück gewiesen habe.10 So bleibt für beide Denker nur der Weg des Praktischen. Wenn Jacobi sagt, dass „der Weg zur Erkenntnis des Uebersinnlichen ein praktischer, kein theoretischer, bloß wissenschaftlicher“ ist,11 könnte dieser Satz auch von Kant stammen. Auch 8 Immanuel Kant, Welches sind die wirklichen Fortschritte, die die Metaphysik seit Leibnitzens und Wolf ’s Zeiten in Deutschland gemacht hat?, AA XX 324. 9 Immanuel Kant, Kritik der praktischen Vernunft, Einleitung, AA VI 5. 10 Friedrich Heinrich Jacobi, Werke, hg. v. Klaus Hammacher u. Walter Jaeschke, Hamburg 1998 ff., Bd. 3: Schriften zum Streit um die göttlichen Dinge und ihre Offenbarung, hg. v. Walter Jaeschke, 2000, S. 73. 11 Jacobi, Werke, a. a. O., Bd. 4. 1: Kleine Schriften. 1. 1771–1783. Texte, S. XXV, SpBr. 220.
156
Theo Kobusch
Johann Gottlieb Fichtes und Martin Heideggers Lehre vom Primat des Praktischen knüpfen unmittelbar hier an.12 Die Metaphysik des Praktischen, die Kant unvergesslich ‚Metaphysik der Freiheit‘ oder ‚Metaphysik der Sitten‘ nennt, kommt aber zustande durch die absolute Universalisierung ihres Gegenstandes, der praktischen Prinzipien und Grundsätze.
2
Metaphysik der Sitten – universale Ethik
Kants praktische Philosophie ist im wesentlichen Willenslehre. Das geht nicht nur, aber besonders deutlich aus dem schwierigen Textstück in der Kritik der praktischen Vernunft über die ‚Kategorien der Freiheit‘ hervor. Die neuere Forschung über dieses Textstück hat gezeigt, dass die aus der theoretischen Philosophie übernommene Vorstellung von der ‚Erscheinung‘ der Handlung hier im Feld der praktischen Philosophie falsch ist und dass „es in allen Vorschriften der reinen praktischen Vernunft nur um die Willensbestimmung“,13 also um die Willensgesinnung beim Entschluss zu tun ist, nicht um die Naturbedingungen der äußerlichen Ausführung.14 In der Kritik der praktischen Vernunft wird zudem von der praktischen „objectiven Realität“ gesprochen, insofern, „als es nur auf das Wollen ankommt“.15 In diesem Sinne ist Kants praktische Philosophie eine Lehre von der praktischen Vernunft, das heißt vom Willen überhaupt, und dies wiederum besagt: von der Freiheit überhaupt, also „aller vernünftigen Wesen“, insofern sie von empirischen Bestimmungsgründen unabhängig sind und bloß eine Gesinnung nach Prinzipien haben.16 Ihr steht die Lehre von der Natur gegenüber.
12 Zu Johann Gottlieb Fichte und Martin Heidegger siehe Theo Kobusch, Selbstwerdung und Personalität, Tübingen 2018, S. 265 ff., S. 37 ff. 13 Kant, Kritik der praktischen Vernunft, AA V 66. Hervorhebung im Original. 14 Näheres bei Theo Kobusch, Die praktischen Elementarbegriffe als Modi der Willensbestimmung. Zu Kants Lehre von den ‚Kategorien der Freiheit‘, in: Die ‚Kategorien der Freiheit‘ in Kants praktischer Philosophie. Historisch-systematische Beiträge, hg. v. Stephan Zimmermann, Berlin u. New York 2016, S. 17-75. 15 Kant, Kritik der praktischen Vernunft, AA V 15. 16 Vgl. Immanuel Kant, Reflexion 7201, AA XIX 275 f.: „Es ist hier nun der Unterschied, daß da im theoretischen Erkentnis die Begriffe keine Bedeutung und die Grundsätze keinen Gebrauch als nur in Ansehung der Gegenstände [der] Erfahrung haben, im practischen dagegen viel weiter, nämlich auf alle vernünftige Wesen überhaupt gehen und von allen empirischen Bestimmungsgründen unabhängig, ja, wenn ihnen auch kein Gegenstand
Metaphysik des Moralischen
157
Durch diese Gegenüberstellung von Freiheit und Natur ist die kantische Philosophie zutiefst mit der mittelalterlichen verbunden, in der beide auch ontologisch als ‚esse morale‘ und ‚esse naturae‘ unterschieden wurden. Die kantische praktische Philosophie ist insofern die Lehre vom Moralischen, das Wort in seiner zweifachen Bedeutung genommen, nämlich im weiten, mittelalterlichen Sinne, nach dem es all das bezeichnen kann, was mit der Freiheit in irgendeiner Beziehung steht und was insofern das Gegenteil zum Physischen darstellt, und im engeren Sinne als das, was mit dem Sittengesetz oder der Autonomie des Willens vereinbar ist; sein Gegenbegriff ist bezeichnenderweise das Unmoralische oder das Unsittliche.17 In diesem allgemeinsten aller möglichen Gegenstände einer praktischen Philosophie liegt auch implizit der Anspruch des Universellen. Kant folgt in dieser Hinsicht den Spuren von Samuel von Pufendorf. Denn Pufendorf hat seine eigene Lehre von den ‚entia moralia‘ als ontologische Grundlage der ersten ‚universalen Ethik‘ angesehen, die bei ihm auch erstmals so genannt wird. Gegenüber der Tradition der aristotelischen Ethik, die Pufendorf als an die griechische Polis gebundene partikuläre Ethik begreift, erhebt Pufendorf den Anspruch, als „erster das Eis gebrochen“ und „aufgrund reiner Vernunft“ – ‚ex sola ratione‘ – das eine Prinzip erforscht zu haben, das „alle Völker, welche Religion sie auch haben, zulassen oder zu dessen Zulassung sie doch durch die Evidenz der Gründe gezwungen werden – ‚adigi‘ – könnten“.18 Dieses Prinzip ist der Fundamentalsatz, der sich allein aufgrund der Beobachtung der menschlichen Natur ergibt, nämlich der von der „universalen
der Erfahrung correspondirte, die bloße Denkungsart und Gesinnung nach Principien schon genug ist“. 17 Georg Friedrich Meier hat diesen mittelalterlichen Sinn des Wortes ‚moralisch‘ vor Augen: vgl. Georg Friedrich Meier, Metaphysik. Dritter Theil, ²1765, in: Christian Wolff, Gesammelte Werke, Bd. 108.3, Hildesheim, Zürich u. New York 2007, S. 391 f.: „Es wird dieses Wort – das heißt: das Sittliche; TK – in so unendlich vielen verschiedenen Fällen gebraucht, daß wir uns keinen bessern allgemeinen Begriff davon machen können, als wenn wir alles sittlich oder moralisch in weiterer Bedeutung nennen, was in einer näheren und merklichen Verbindung mit dem freyen Willen steht“; der mittelalterliche und der moderne Begriff des ‚Moralischen‘ werden durch den Kantianer Ludwig Heinrich von Jakob so unterschieden: vgl. Ludwig Heinrich von Jakob, Philosophische Sittenlehre, Halle 1794, § 190, S. 98 f.: „Alles, was von Freyheit abhängt, wird moralisch oder sittlich in weiterer Bedeutung genannt, und in diesem Sinne sind freye Handlungen mit sittlichen Handlungen einerley. In engerer Bedeutung aber heißen nur diejenigen Handlungen moralisch, welche durch die Freyheit nach dem Sittengesetz hervorgebracht sind, da hingegen diejenigen freyen Handlungen, welche dem Sittengesetz widersprechen, unsittlich oder unmoralisch genannt werden.“ 18 Samuel von Pufendorf, Eris Scandica, in: Gesammelte Werke, Bd. 5, Berlin 2002, S. 33; zum Erstheitsanspruch siehe ebd., S. 180.
158
Theo Kobusch
Sozialität“, die „absolut alle Menschen“ betrifft und den Gesetzen aller partikulären Sozietäten zugrunde liegt.19 In diesem Sinne sind die Fundamente des Naturrechts nach Pufendorfs ausdrücklicher Bemerkung von ihm deswegen gelegt worden, um alle Menschen, „insofern sie Menschen sind“,20 auf der Basis der Vernunft zu erreichen. Hält man sich diese selbstinterpretatorischen Bemerkungen vor Augen, kann es keinen Zweifel geben: Das Naturrecht in der pufendorfschen Form versteht sich selbst als die erste kultur- und religionsübergreifende universale Ethik, deren Anliegen durch die ‚philosophia practica universalis‘ fortgesetzt und schließlich durch die Metaphysik der Sitten Kants vollendet wird. Es ist kein Zufall, sondern eher ein Beleg, dass der Ausdruck ‚universale Ethik‘, durch den die Distanz zur partikulären aristotelischen Ethik gekennzeichnet wird, bei Pufendorf zum ersten Mal begegnet.21 Der frühe Kant hat denn auch diesen neuen Ansatz einer universalen Ethik als eine Eigentümlichkeit „unserer Zeiten“ herausgestellt.22 Wenn dagegen heutzutage namhafte Aristoteles- und Kant-Forscher den aristotelischen 19 Ebd., S. 64: „Ea porro socialitas, non in illis tantum terminatur, qui peculiari nobiscum societate juncti sunt, sed ad omnes omnino homines porrigitur. Et leges universalis istius socialitatis quarumvis particularium societatum leges antecedunt.“ Pufendorf charakterisiert öfter seinen ‚Fundamentalsatz‘ als einen, der auf ‚Beobachtung‘ – Pufendorf, Eris Scandica, a. a. O., S. 164 – beruht, das heißt auf Erfahrung. Abgelehnt wird damit zugleich Valentin Veltheims Ansicht, es sei ein apriorisches indemonstrables Prinzip vom Typ der ‚per se nota‘ – Pufendorf, Eris Scandica, a. a. O., S. 179. Zur Unterscheidung dieser beiden Arten von Prinzipien, den ‚principia per se nota‘ und den auf Erfahrung beruhenden Prinzipien siehe Theo Kobusch, Der Experte und der Künstler. Das Verhältnis zwischen Erfahrung und Vernunft in der spätscholastischen Philosophie und der neuzeitliche Wissensbegriff, in: Philosophisches Jahrbuch 90 (1983) S. 57-82. 20 Pufendorf, Eris Scandica, a. a. O., S. 133. Zur Formulierung „ad captum omnium hominum“ siehe auch Pufendorf, Eris Scandica, a. a. O., S. 282; vgl. auch ebd., S. 154: „Verum cum nobis jus naturae et gentium hoc fine tractetur, ut sit regula actionum et negotiorum inter omnes homines non qua Christiani, sed qua homines sunt“. 21 Samuel von Pufendorf, Brief an Thomasius v. 19. Juni 1688, in: Gesammelte Werke, Bd. 1: Briefwechsel, Berlin 1996, S. 194 f.: „Uber Aristotelis ethicam, und undecim nomina virtutum habe ich mich vielmal mit H. Weigelio zu Jena lustig gemachet. … Es befindet sich aber so wohl bey Aristotele, als allen Graecis, daß sie ihre democratias für die beste art von republiquen halten, und demnach auch ihre morale einrichten. … Denn damit könnte man selbiger morale auf einmahl die kehle abschneiden, als die nur particuliere ist, und auf gewiße formam civitatis eigentlich eingerichtet. Wir aber suchen ethicam universalem.“ Siehe auch Pufendorfs Brief an Pregitzer v. 29. Juli 1687, in: Ders., Briefwechsel, a. a. O., S. 164. 22 Immanuel Kant, Nachricht von der Einrichtung seiner Vorlesungen in dem Winterhalbenjahre von 1765–1766, AA II 312: „Diese Methode der sittlichen Untersuchung ist eine schöne Entdeckung unserer Zeiten und ist, wenn man sie in ihrem völligen Plane erwägt, den Alten gänzlich unbekannt gewesen.“
Metaphysik des Moralischen
159
und kantischen Ansatz in der praktischen Philosophie miteinander harmonisieren wollen, dann wird gerade dieses neue Selbstverständnis der universalen Ethik, das zum Verständnis der praktischen Philosophie Kants unverzichtbar ist, übersehen. Der Anspruch auf Universalisierung der Handlungsregeln ist denn folgerichtig auch im Rahmen der ‚philosophia practica universalis‘ erhoben worden.23 Die Universalität der Ethik Kants findet ihren deutlichsten Ausdruck in der Idee einer Metaphysik der Sitten. Das Genre der Metaphysik der Sitten erscheint als eine nochmalige Steigerung des Universalitätsgedankens, ja als das Äußerste der universalen Geltung des Sittlichen, insofern in ihm die Gültigkeit der sittlichen Gesetze für alle vernünftigen Wesen, Gott eingeschlossen, bedacht wird.24 Auch der englische Deismus und die Cambridge Platonists hatten in diesem Sinne die Mitberücksichtigung des Göttlichen als die Erweiterung der Universalität des Begriffs des Moralischen angesehen.25 Sie hatten sich in diesem Zusammenhang frontal gegen den theologischen Voluntarismus des Spätmittelalters gewandt. Die moralischen Inhalte von Gottes Willen abhängig zu machen bedeutet nach Thomas Chubb, den Ruin der Moralität und der Religion heraufzubeschwören.26 Deswegen 23 Siehe zum Beispiel Johann Christoph Gottsched, Erste Gründe der gesamten Weltweisheit, darinn alle philosophische Wissenschaften in ihrer natürlichen Verknüpfung abgehandelt werden. Zweiter, Praktischer Theil, 1762, § 12, in: Christian Wolff, Gesammelte Werke, Bd. 20.2, Hildesheim, Zürich u. New York 1983, S. 11: „Wir nennen diese Sittenlehre aber eine allgemeine, weil ihre Lehren sich in allen Altern, Geschlechtern, Ständen und Lebensarten der Menschen ohne Unterschied brauchen lassen. … Diese Allgemeinheit nun machet, daß diese Wissenschaft den Grund vor allen übrigen Theilen der practischen Philosophie in sich hält. Herr Bar. Wolff hat die Nothwendigkeit derselben zu allererst eingesehen, und schon 1703 in einer besonderen Dissertation, hier in Leipzig den ersten Entwurf dazu gemacht.“ 24 Siehe zum Beispiel Johann Christoph Hoffbauer, Anfangsgründe der Moralphilosophie und insbesondere der Sittenlehre nebst einer allgemeinen Geschichte derselben, Halle 1798, § 18, S. 11: „Die Wissenschaft der sittlichen Gesetze heißt die Moralphilosophie, insgleichen auch die praktische Philosophie. Sie wird die reine praktische Philosophie oder Metaphysik der Sitten genannt, in so fern sie diese in der Allgemeinheit betrachtet, in welcher sie für alle vernünftigen Wesen gültig sind.“ 25 Ralph Cudworth, The true intellectual System of the Universe, London 1743, S. 897: „ … it extending universally to all, even to that of the deity itself. … and therefore God himself cannot command, what is in its own nature unjust.“ 26 Ebd., S. 37 f.: „For if right and wrong, just and unjust, wisdom and folly, good and evil, have no foundation in nature, and if it depends upon the will of God what shall or shall not constitute each of these; then it must surely be allowed, that all these stand upon a very precarious bottom; because God may be constantly altering his will, and his determinations, with respect to them: that is, what God constitutes to be wise and good to day, he may constitute to be foolish evil to morrow, … so that we can never come to
160
Theo Kobusch
ist es notwendig, davon auszugehen, dass das Moralische, Gut und Böse, immer und überall, das heißt für endliche und unendliche Wesen dasselbe ist und dieselbe Bedeutung hat. Ähnlich denken Gottfried Wilhelm Leibniz, Hermann Samuel Reimarus und andere Aufklärer, schließlich auch die gesamte klassische deutsche Philosophie.27 Diese letzteren und ganz besonders Kant haben deutlich gemacht, dass das Moralische der absolute Standpunkt ist, der „Gesichtspunkt Gottes“,28 wie Fichte sagt, denn wir haben keinen anderen.29 Eine Metaphysik der Sitten ist – so gesehen – gewissermaßen die eigentliche, wahre universale Ethik. Sie beruht auf dem Grundsatz, dass ein Reich der Freiheit nur dann denkbar ist, wenn das Sittengesetz für alle freien Wesen, sowohl für die Glieder als Personen als auch für das Oberhaupt der Personen – wie die bedeutsame Unterscheidung in der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten lautet – , in gleicher Weise und in gleichem Sinne gültig ist. Nun könnte man sagen, das mag ja von der Konzeption der Metaphysik der Sitten in der Grundlegung her so sein, dass sie als die schlechthin universale Ethik gedacht sei, aber was die Ausführung in dem dann 1797 erschienenen Werk Metaphysik der Sitten angeht, so steckt da so viel Empirisches drin, dass doch gar nicht mehr von einer ‚Metaphysik‘ sinnvoll gesprochen werden kann. Kant ist sich dieses Problems durchaus bewusst. In der Tat scheinen Begriffe wie – um Beispiele aus der Rechtslehre zu nehmen – Geld, Ware, Kauf, Verkauf oder auch Buch ganz empirischer Art zu sein, so dass sie eigentlich in einer metaphysischen Rechtslehre keinen Platz finden dürften. Es ist aber der Anspruch der Metaphysik der Sitten, solche und ähnliche Begriffe „in lauter intellektuelle Verhältnisse“ auflösen zu können.30 ‚Intellektuelle Verhältnisse‘ bedeutet in unserem Zusammenhang natürlich ‚Willensverhältnisse‘
27 28
29
30
any certainty what is right and what is wrong, … because we have no certain principle to reason from, with respect to them, and consequently the foundation of morality, and all religion, must be destroyed.“ Vgl. Theo Kobusch, Die Grenzen der theoretischen Vernunft, in: Grenzen und Grenzüberschreitungen. XIX. Deutscher Kongress für Philosophie, hg. v. Werner Hogrebe u. Joachim Bromand, Berlin 2004, S. 237-256. Johann Gottlieb Fichte, Das System der Sittenlehre III, § 19, in: Gesamtausgabe, hg. v. Erich Fuchs, Hans Gliwitzky, Reinhard Lauth u. Peter K. Schneider, Bd. I, 5: Werke 1798–1799, hg. v. Hans Gliwitzky u. Reinhard Lauth, Stuttgart-Bad Cannstatt 1977, S. 230. Zur Kantischen These vom absoluten Standpunkt des Moralischen und der Kritik daran vgl. Theo Kobusch, Das Moralische: Der absolute Standpunkt. Kants Metaphysik der Sitten und ihre Herausforderung für das moderne Denken, in: Freiheit nach Kant: Tradition – Rezeption – Transformation – Aktualität, hg. v. Saša Josifović u. Jörg Noller, Leiden 2018, S. 54-93. Vgl. Immanuel Kant, Metaphysik der Sitten. Rechtslehre, AA VI 286.
Metaphysik des Moralischen
161
und zwar im Sinne des ‚allgemeinen‘ oder ‚gemeinsamen‘ Willens. Der aber ist, schon von seiner theologischen Herkunft her – die natürlich sowohl Jean-Jacques Rousseau wie auch Kant bekannt war – , notwendig ein Gegenstand der Metaphysik, der des Moralischen, wie sich von selbst versteht. Auch im Hinblick auf die Tugendlehre hat Kant durchaus den scheinbaren Eindruck ihres empirischen Charakters bedacht und entsprechend den Anspruch erhoben, „bis auf die Elemente der Metaphysik zurück zu gehen, ohne die keine Sicherheit und Reinigkeit, ja selbst nicht einmal bewegende Kraft in der Tugendlehre zu erwarten ist“.31 Man wird somit sagen können, dass die Metaphysik der Sitten eine allgemeine Willenslehre ist, oder noch deutlicher: die Lehre vom ‚allgemeinen Willen‘. Bedenkt man, was mit Pufendorfs universaler Ethik begann und durch die Philosophia Practica Universalis fortgesetzt wurde, so wird man sagen müssen, dass Kants Metaphysik der Sitten am – vorläufigen – Ende einer langen Entwicklung steht – die ja, auch vom Titel her, von Arthur Schopenhauer fortgesetzt wird – , in der der menschliche Wille und seine Äußerungen, ja sogar das Willensphänomen überhaupt, immer mehr in den Fokus einer der praktischen Philosophie immanenten, metaphysikähnlichen Disziplin geriet. Auch Georg Wilhelm Friedrich Hegels Rechtsphilosophie ist nach Ausweis von Zeitgenossen eine Art Fortführung der Metaphysik der Sitten.32
3
Metaphysik der Sitten – Univozität des Moralischen
Obwohl so die historische Bedeutung der kantischen Metaphysik in hellerem Licht erscheinen mag, ist doch noch ganz unklar, was sie inhaltlich besagt. Kant hat uns aber selbst den Weg zum Verständnis der Metaphysik der Sitten gewiesen. Die Metaphysik der Sitten untersucht im Unterschied zur allgemeinen praktischen Weltweisheit die „Idee und die Prinzipien eines möglichen reinen Willens“.33 Ein Ergebnis dieser Untersuchung ist, dass ein reiner, das heißt ein guter Wille allein jener Wille sein kann, der sich selbst ein Gesetz ist, das heißt dessen Maximen für eine allgemeine Gesetzgebung tauglich sind. Kant sieht es als die Aufgabe der 31 Immanuel Kant, Metaphysik der Sitten. Tugendlehre, Vorrede, AA VI 376. 32 Vgl. Conrad Johann Alexander Baumbach, Einleitung in das Naturrecht als eine volksthümliche Rechtsphilosophie besonders für Deutschlands bürgerliches Recht, Leipzig 1823, § 5, S. 15. 33 Immanuel Kant, Grundlegung der Metaphysik der Sitten, AA IV 390, Z. 34 f.
162
Theo Kobusch
Metaphysik an, zu prüfen, ob das für alle vernünftigen Wesen, also auch für den göttlichen Willen gilt. Will man aber die allgemeine Notwendigkeit des moralischen Gesetzes für alle vernünftigen Wesen und damit die innere Verbindung zwischen dem objektiven Gesetz und dem Begriff des Willens überhaupt durchschauen, so muss man, wie Kant an einer bedeutsamen Stelle der Grundlegung sagt, „einen Schritt hinaus thun“ zur Metaphysik der Sitten.34 Gemeint ist die Idee einer Metaphysik, deren Gegenstand nicht das Seiende als solches, sondern gewissermaßen das Wollen als solches, genauer gesagt: das reine Wollen als solches darstellt. Dieser Schritt in das Feld der Metaphysik der Sitten zeigt, was es mit dem Wollen eines Willens überhaupt, also mit dem menschlichen und göttlichen Wollen auf sich hat.35 Es kann nur als ein Wollen gedacht werden, das sich durch Vernunft, durch ein objektiv-praktisches Gesetz selbst bestimmt.36 Immer wieder ruft Kant in diesem Zusammenhang in Erinnerung, dass es hier um die Selbstbestimmung des Willens vernünftiger Wesen überhaupt geht. So muss zum Beispiel auch der objektive Grund der Selbstbestimmung, den Kant den „Zweck“ nennt, „für alle vernünftigen Wesen gleich gelten“.37 Dieser Zweck ist aber nichts anderes als die Person. Der Begriff der Person ist die Angel, um die sich die Welt des Moralischen dreht. Denn die Person hat absoluten Wert, und daran hängt der kategorische Imperativ. Wenn es sie nicht gäbe, wenn also aller Wert bedingter und somit zufälliger Natur wäre, „so könnte für die Vernunft überall kein oberstes praktisches Princip angetroffen werden“.38 Konsequenterweise ist der Begriff der Person in einer Formulierung des kategorischen Imperativs erhalten geblieben: „Handle so, daß du die Menschheit, sowohl in deiner Person, als in der Person eines jeden anderen, jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst.“39
34 Kant, Grundlegung der Metaphysik der Sitten, in: AA IV 426, Z. 28. 35 Reinhard Brandt, Kant als Metaphysiker, in: Der Begriff der Politik. Bedingungen und Gründe politischen Handelns, hg. v. Volker Gerhardt, Stuttgart 1990, S. 57-94, hier S. 84 f., hat das richtig erkannt. Nach seiner Interpretation bezeichnet der von Kant angezeigte „Schritt“ – Immanuel Kant, Grundlegung der Metaphysik der Sitten, AA IV 426, Z. 28 – den Übergang von der ‚Philosophia practica universalis‘ zur Metaphysik der Sitten. Und zwar bestehe dieser Schritt allein darin, dass der Begriff eines Willens von vernünftigen Wesen überhaupt gewonnen wird. 36 Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, AA IV 427, Z. 13-15. 37 Ebd., AA IV 427, Z. 24. 38 Ebd., AA IV 428, Z. 31-33. 39 Ebd., AA IV 429, Z. 10-12.
Metaphysik des Moralischen
163
Der absolute Wert der Person liegt nun nach Kant in ihrer inneren Freiheit, das heißt in ihrer Autonomie begründet. Ein schlechterdings guter Wille – mit dessen Idee die Grundlegung ja anhebt – , dessen Prinzip in dieser Welt ein kategorischer Imperativ sein muss, kann gar nicht anders denn als autonom gedacht werden.40 Der Gedanke der Autonomie des Willens beinhaltet nach Kant zweifelsohne auch, dass theologische Ansprüche zurück gewiesen werden.41 Wenn der Wille Gottes als die Ursache des Sittengesetzes angesehen und es durch den menschlichen Willen deswegen befolgt würde, weil Gott es befiehlt, liefe es auf eine Form der Heteronomie hinaus. Das Sittengesetz autonom zu befolgen bedeutet, den eigenen Willen der Bestimmung durch die reine Vernunft zu unterwerfen. Kant hat deswegen zwar die Religion als die „Erkenntnis aller unserer Pflichten als göttlicher Gebote“ definiert,42 aber nicht, weil sie Gottes Gebote sind, sind sie unsere Pflicht, sondern weil apriorische Gründe unserer Vernunft den Willen bestimmen. Der absolute Wert der Person, der in ihrer inneren Freiheit, in ihrer Autonomie, begründet liegt, hat aber auch die Bedeutung, dass er einen unendlichen Wert für jedes Bewusstsein darstellt. Das ist in der Kantforschung bezweifelt worden. Man hat versucht, die Person – nach kantischem Verständnis – ihres Charakters eines „metaphysisch objektiven Gutes“ zu entkleiden mit dem Hinweis darauf, dass sie „nur aus menschlicher Perspektive als höchstes Ziel“ erscheine und somit ihr absoluter Wert nur für ein menschliches Bewusstsein bestünde.43 Doch besagen die kantischen Texte genau das Gegenteil. Das moralische Gesetz, das in der Zweckformel seinen Ausdruck findet, gilt nämlich, freilich nicht in der Form eines Gebotes, auch für den göttlichen Willen. Somit gibt es auch für ihn einen Zweck an sich selbst. Kant erklärt denn auch unmissverständlich in der Kritik der praktischen Vernunft: „Diese Bedingung“ – nämlich ein vernünftiges Geschöpf nur dann als Mittel zu einem Zweck zu gebrauchen, wenn es zugleich auch als Zweck an sich selbst angesehen wird – „legen wir mit Recht sogar dem göttlichen Willen, in Ansehung der vernünftigen Wesen in der Welt, als seiner Geschöpfe, bei, indem sie auf der Persönlichkeit derselben beruht, dadurch allein sie Zwecke an sich selbst sind“.44 Die Person als moralisches Wesen hat den Charakter des ‚Endzwecks‘. Nur ein moralisches Wesen kann als Endzweck gedacht werden, niemals ein Naturding,
40 Ebd., AA IV 444. 41 Kant, Kritik der praktischen Vernunft, AA VI 25 f. 42 Immanuel Kant, Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, AA VI 158. 43 Christoph Horn, Die Menschheit als objektiver Zweck, in: Kants Ethik, hg. v. Dieter Sturma, Paderborn 2004, S. 195-212, hier: S. 211 f. 44 Immanuel Kant, Kritik der praktischen Vernunft, AA V 87, Z. 27-29.
164
Theo Kobusch
das heißt ein Zweck in der Natur.45 Die Person hat somit nicht nur für den menschlichen Willen den höchsten Wert, insofern sie im Modus der Achtung, das heißt durch die den endlichen Vernunftwesen eigene Art der Wertschätzung, erkannt wird, sondern auch für den göttlichen Willen. Die Person hat auch für ein göttliches Bewusstsein absoluten Wert. Das drückt auch ein Text der Grundlegung deutlich aus: „… und was, … den absoluten Werth des Menschen allein ausmacht, darnach muß er auch, von wem es auch sei, selbst vom höchsten Wesen beurtheilt werden“46. Die Person ist also, von welcher Perspektive auch immer betrachtet, ein höchster Wert, und dies, obwohl sie jederzeit ‚böse‘ werden kann, indem sie zum Beispiel sich ihrer ‚Persönlichkeit‘ im Selbstmord entäußert.47 Der Begriff der Person hat deswegen einen univoken Sinn. Darin liegt übrigens auch die eigentliche Bedeutung des berühmten Anfangssatzes der Grundlegung: „Es ist überall nichts in der Welt, ja überhaupt außer derselben zu denken möglich, was ohne Einschränkung für gut könnte gehalten werden, als allein ein guter Wille“!48 Die Voluntarisierung des eigentlich Guten und Schlechten ist schon den Stoikern zu verdanken, die das christliche Denken tief beeinflusst haben. Dass aber das Moralische auch ‚außerhalb‘ dieser Welt und damit in allen möglichen Welten Geltung hat, das ist, obwohl auch das schon von der Stoa grundgelegt ist,49 die Errungenschaft der neueren Zeit und besonders der Philosophie Kants.
45 Vgl. Immanuel Kant, Kritik der Urteilskraft, § 86, AA V 445: „Denn daß alsdann dieser nach der subjectiven Beschaffenheit unserer Vernunft, und selbst wie wir uns auch die Vernunft anderer Wesen nur immer denken mögen, kein anderer als der Mensch unter moralischen Gesetzen sein könne: kann a priori für uns als gewiß gelten; da hingegen die Zwecke der Natur in der physischen Ordnung a priori gar nicht können erkannt, vornehmlich, daß eine Natur ohne solche nicht existiren könne, auf keine Weise kann eingesehen werden.“ Ebd., § 87, AA V 448: „Nun ist, wenn man der letztern Ordnung nachgeht, es ein Grundsatz, dem selbst die gemeinste Menschenvernunft unmittelbar Beifall zu geben genöthigt ist: daß, wenn überall ein Endzweck, den die Vernunft a priori angeben muß, Statt finden soll, dieser kein anderer, als der Mensch (ein jedes vernünftige Weltwesen) unter moralischen Gesetzen sein könne.“ 46 Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, AA IV 439, Z. 22-24. 47 Vgl. Immanuel Kant, Metaphysik der Sitten. Tugendlehre, §6, AA VI 422. 48 Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, in: AA IV 439, Z. 22-24. 49 Zur stoischen Position siehe Theo Kobusch, Die Univozität des Moralischen: Zur Wirkung des Origenes in Deismus und Aufklärung, in: Origen and Origenism in the History of Western Thought. Papers of the 11th international Origen Congress, Aarhus University, 26-31 August 2013, hg. v. Anders-Christian Jacobsen, Löwen, Paris u. Bristol 2016, S. 2946.
Metaphysik des Moralischen
4
165
Metaphysik der Freiheit – Moralische Notwendigkeit
Die neuzeitliche Philosophie ist auch durch die Moralisierung der Modalbegriffe gekennzeichnet. Besondere Aufmerksamkeit verdient die Modalität der moralischen Notwendigkeit, ohne die die neuzeitliche Idee der Freiheit nicht verstanden werden kann. Sie ist durch die sogenannte ‚Zweite Scholastik‘ im Spanien des 17. Jahrhunderts entdeckt worden und zwar im Kontext der Diskussion um die Besonderheit der moralischen Modalitäten überhaupt, also um das, was das moralisch Mögliche und Unmögliche und Notwendige ist im Unterschied zum metaphysisch und physisch Möglichen/Unmöglichen und Notwendigen.50 Das metaphysisch Notwendige ist von der Art, dass sein Gegensatz nicht einmal von Gott de potentia absoluta verwirklicht werden kann, weil es selbst einen inneren Widerspruch impliziert. Das physisch Notwendige ist das, dessen Gegensatz nur durch ein Wunder, das heißt durch die göttliche Dispensierung eines Naturgesetzes, wirklich werden könnte. Notwendig in diesem Sinne ist zum Beispiel, dass das Feuer brennt. Die moralische Notwendigkeit meint nun jenes von unserem Willen abhängige Geschehen, dessen Gegensatz niemals eintritt und auch sinnvollerweise nicht erhofft – oder befürchtet – werden kann, obwohl es physisch möglich wäre. Gleichwohl lässt sie prinzipiell die Möglichkeit zum Gegenteil offen, wodurch sie besonders deutlich von der metaphysischen Notwendigkeit unterschieden ist.51 Diese Dreiteilung des Notwendigkeitsbegriffs ist im 17. Jahrhundert ein allgemeiner Topos.52 Die physische und die moralische Notwendigkeit sind prinzipiell suspendierbar und somit kontingent.53 Durch die moralische Notwendigkeit wird zusammenzudenken versucht, was metaphysisch oder logisch nicht möglich ist: nämlich Notwendigkeit und Kontingenz. Moralische Notwendigkeit ist eine Art der Gesetzmäßigkeit im Bereich des Kontingenten. In den Texten heißt es oft, dass die moralische Notwendigkeit die physische und metaphysische Kontingenz nicht 50 Zur Modalität der moralischen Notwendigkeit und zum Folgenden siehe die einschlägige Arbeit von Sven K. Knebel, Wille, Würfel und Wahrscheinlichkeit. Das System der moralischen Notwendigkeit in der Jesuitenscholastik 1550–1700, Hamburg 2000. 51 Ruiz de Montoya, Commentaria ac Disputationes in primam partem S. Thomae, Lyon 1630, S. 111a: „Nam ea quae simpliciter est necessitas, e diametro pugnat cum libertate, quoniam excludit omnino possibilitatem oppositi. Contra vero moralis necessitas relinquit absolute possibilitatem oppositi, proptereaque simpliciter libertatem custodit illaesam.“ 52 Die zahlreichen Belege für diesen Topos hat Knebel, Wille, Würfel und Wahrscheinlichkeit, a. a. O., S. 128 f., gesammelt und zitiert. 53 Ebd., S. 131.
166
Theo Kobusch
ausschließe.54 Moralisch notwendig in diesem Sinne ist das, was im Bereich des Gewollten immer der Fall ist, ohne dass deshalb sein Ausbleiben logisch, physisch oder metaphysisch unmöglich wäre. Das moralisch Notwendige ist somit das extrem Wahrscheinliche. „Die moralische Notwendigkeit im eigentlichen Sinne besteht darin, daß ein freies Vermögen so nach einer Seite hin geneigt wird, daß es sich nicht zum Gegenteil bestimmen kann“.55 Auch das ‚Unmögliche‘ kann so in dreifacher Weise differenziert werden. Das Unmögliche im metaphysischen Sinne ist das, was keine Möglichkeit zur Existenz, das heißt keine Eignung für die reale Existenz im Sinne der realen Möglichkeit hat. Physisch unmöglich ist das, was nicht in der Form eines Naturdings existieren kann, obwohl es eine metaphysische Existenz haben könnte. Moralisch unmöglich heißt das, was im moralischen Sinne nicht existieren kann. Es heißt auch das, was ‚sehr selten und nur unter großen Schwierigkeiten eintreten kann‘. Standardbeispiel für das moralisch Unmögliche in diesem Sinne ist, dass kein Mensch sein ganzes Leben hindurch ohne Schuld bleibt. Diese Unmöglichkeit beruht weder auf einem logischen Widerspruch noch auf einer physischen Repugnanz, sondern stellt ein Unmögliches sui generis dar. Es ist ein für den Willen Unmögliches. Später erscheint das moralisch Unmögliche in zweifacher Form, nämlich als das, was der Natur der Freiheit widerspricht, und was die unrechte Handlung beziehungsweise die Sünde ist.56 Von besonderer Bedeutung ist, dass die Konzeption der moralischen Notwendigkeit auf Gott übertragen wurde. Wir kennen alle die Auswirkung dieser Idee. Es ist der Leibnizsche Optimismus, der besagt, dass Gott moralisch zur Wahl des Besten genötigt ist. Er beruht auf der sogenannten Regel des Besseren, die ihrerseits ausdrückt, dass „Gott das will und auch immer tut, was im Hinblick auf das Universum schlechthin besser und vernünftiger ist“.57 Dass diese Übertragung der Idee von der moralischen Notwendigkeit auf Gott eine revolutionäre Neuerung darstellt, bezeugt uns ein Kritiker dieser Lehre, nämlich Piedro Hurtado de Mendoza, 54 Vgl. ebd., S. 129, S. 131. 55 Vgl. Silvestro Mauro, Opus Theologicum, T.1, Rom 1687, S. 173 a: „Necessitas moralis, proprie dicta consistit in hoc, ut potentia libera ita inclinetur ad unam partrm, ut non possit sine difficultate, conatu et excitatione omnium … suarum virium se determinare ad oppositum.“ 56 Vgl. Kobusch, Die praktischen Elementarbegriffe als Modi der Willensbestimmung, a. a. O., S. 64 ff. 57 Sie stammt von Ruiz de Montoya, zitiert bei Sven K. Knebel, Necessitas moralis ad optimum. Zum historischen Hintergrund der Wahl der besten aller möglichen Welten, in: Studia Leibnitiana 23 (1991) S. 3-24, hier S. 5.
Metaphysik des Moralischen
167
der in Salamanca Theologie lehrte. Er sagt: „Ich gestehe, daß ich vor dieser Zeit in keinem katholischen Scholastiker etwas von dieser moralischen Notwendigkeit gelesen oder gehört habe“.58 Diese Idee ist erstmals um 1630 herum von Diego Ruiz de Montoya und Diego Granado im Jesuitenkolleg in Sevilla entwickelt worden. Dass Gott nur das Gute wollen könne, hatte schon Platon mit guten Gründen dargelegt. Es geht dabei, wie Ruiz hervorhebt, um jenes von Gott unfehlbar gewollte Gute, das im Hinblick auf das Universum das schlechthin Beste ist. Maßstab dafür ist aber nicht der göttliche Wille selbst – von ihm wird gerade abgesehen – , sondern die den Objekten zukommende eigene und reale Vollkommenheit und ihr Verhältnis zum ganzen Universum, also die innere Kongruenz und Vernünftigkeit des Ganzen. Dieses Gute, was das Beste ist, muss Gott quasi wollen, obwohl er, absolut betrachtet, ganz frei bleibt. Es ist die mit der Freiheit verträgliche moralische Notwendigkeit.59 Das ist zugleich einer der wichtigsten Grundsätze, der in diesem Zusammenhang immer festgehalten wird und ausgestrahlt hat bis zu Leibniz: Die moralische Notwendigkeit hebt die absolute Freiheit nicht auf, ja, sie ist sogar die vollkommene Form der letzteren.60 Verträglich mit der Freiheit ist sie aber insofern, als sie im 58 P. Hurtado de Mendoza, Disputationes de Deo Homine, sive de Incarnatione Filii Dei, Antwerpen 1634, sec. VI, sub. 2, § 35, S. 19b: „Ego fateor ante haec tempora me in nullo Catholico Scholastico aut legisse, aut audiuisse hanc moralem necessitatem.“ 59 Ruiz de Montoya, Commentaria ac Disputationes in primam partem S. Thomae, a. a. O., S. 77a: „Deus semper atque infallibiliter vult illud bonum, quod in ordine ad universitatem rerum est simpliciter optimum …. Quamvis illius electio sit physice et absolute libera, nihilominus sit infallibilis et moraliter necessaria.“ Vgl. Diego Granado, Commentarii in primam partem Summae Theologicae S. Thomae, Pont-à-Mousson 21624, S. 430: „ … quod Deus velit optimum, licet non sit necessarium physice, sed potius absolute liberum … , moraliter tamen est necessarium … “. 60 Granado, Commentarii, a. a. O., S. 432: „ … necessitas moralis non aufert absolutam libertatem.“; vgl. Diego Ruiz de Montoya, Commentarii ac Disputationes ad quaestionem XXII et bonam partem quaestionis XXIII ex Prima parte S. Thomae, Lyon 1631, S. 99b: „Quarta – sc.: propositio – est, libertatem simpliciter, quae dicitur ‚libertas physica‘, manere multoties integram et solutam, licet moralis indifferentia seu libertas sublata sit per moralem necessitatem, … “; vgl. Jerónimo de Sousa, Futurorum contingentium polysophia, Paris 1680, S. 28: „ … manifeste apparet compossibilitas necessitatis moralis cum physica libertate.“; vgl. Samuel Clarke, A Discourse concerning the being and attributes of God, London 1738, S. 565: „Moral Necessity is evidently consistent with the most perfect Natural Liberty.“; vgl. Gottfried Wilhelm Leibniz, Streitschriften zwischen Leibniz und Clarke (1715–1716), Leibniz an Clarke, 5, § 7, in: Die philosophischen Schriften, hg. v. Carl Immanuel Gerhardt, Bd. VII, S. 390: „Et quant ‚a la Necessité morale, elle ne deroge point non plus à la liberté. Car lorsque le sage, et sur tout Dieu (le sage souverain) choisit le meilleur, il n’en est pas moins libre; au contraire, c’est la plus parfaite liberté, de
168
Theo Kobusch
Unterschied zur metaphysischen Notwendigkeit die Möglichkeit zum Gegenteil offenlässt.61 Und noch ein Element macht sie geradezu besonders freiheitstauglich, das ist die Selbstbestimmtheit, die darin liegt. Die moralische Notwendigkeit ist eine vom Willen sich selbst auferlegte. Eben darin gleichen sich sogar der göttliche und menschliche Wille.62 Das darin liegende Element der Selbstbestimmung macht diese Art der Notwendigkeit geradezu in besonderer Weise freiheitstauglich. Einer der wichtigsten Grundsätze, der in diesem Zusammenhang immer festgehalten wird, ist denn auch: Die moralische Notwendigkeit hebt die absolute Freiheit nicht auf, ja, sie ist sogar die vollkommene Form der letzteren, aber was durch die moralische Notwendigkeit aufgehoben wird, ist die Haltung der Indifferenz.63 Auch die zeitgenössische Kritik an der Lehre von der moralischen Notwendigkeit bestätigt diesen Gegensatz zur Indifferenz. Der springende Punkt in dieser Konzeption ist, dass Freiheit der Standpunkt einer bloßen Möglichkeit ist. Die Lehre von der moralischen Notwendigkeit aber versteht die Freiheit als den Willen zur Entscheidung. Ein gleichzeitiger, ähnlich ausgerichteter Versuch ist die 4. Meditation René Descartes᾿, in der – wie bei den Kirchenvätern – ‚allein‘ die Freiheit und nicht die Erkenntnis als der wahre Grund der Gottebenbildlichkeit bezeichnet wird. Es ist freilich nicht die Freiheit der Indifferenz, der untersten Stufe der Freiheit, die diese Gottähnlichkeit aufweisen könnte, sondern im Gegenteil jene Form der Freiheit, die die Indifferenz hinter sich lässt und einer ‚starken Neigung‘ – ‚magna
n’estre point empeché d’agir le mieux.“; Gottfried Wilhelm Leibniz, Essais de Théodicée, Causa Dei asserta per Justitiam ejus, § 21, in: Die philosophischen Schriften, hg. v. Carl Immanuel Gerhardt, Bd. VI, S. 441: „Necessitas excluditur Metaphysica, cuius oppositum est impossibile, seu implicat contradictionem; sed non Moralis, cuius oppositum est inconveniens. Etsi enim Deus non possit errare in eligendo, adeoque eligat semper quod est maxime conveniens, hoc tamen ejus libertati adeo non obstat, ut eam potius maxime perfectam reddat.“. Hervorhebungen im Original. 61 Ruiz de Montoya, Commentaria ac Disputationes in primam partem S. Thomae, a. a. O., S. 111a: „Nam ea quae simpliciter est necessitas, e diametro pugnat cum libertate, quoniam excludit omnino possibilitatem oppositi. Contra vero moralis necessitas relinquit absolute possibilitatem oppositi, proptereaque simpliciter libertatem custodit illaesam.“ 62 Vgl. Gaspar de Ribadeneira, Tractatus de voluntate Dei, Alcalá 1655, S. 401b: „ … Liberrime sibi Deus imponit necessitatem moralem.“; vgl. de Sousa, Futurorum contingentium polysophia, a. a. O., S. 336: „Respondeo necessitatem moralem maxime esse consentaneam libertati actus, quia est necessitas, quam sibimet ipsi libere imponit voluntas, et non ab alio accipit … “. 63 Ruiz de Montoya, Commentarii ac Disputationes ad quaestionem XXII, a. a. O., S. 99b: „Quarta – sc. Propositio – est, libertatem simpliciter, quae dicitur ‚libertas physica‘, manere multoties integram et solutam, licet moralis indifferentia seu libertas sublata sit per moralem necessitatem“.
Metaphysik des Moralischen
169
propensio‘ – des Willens folgt, hervorgerufen durch die evidente Erkenntnis des Grundes des Guten und Wahren. Das ist die höchste Stufe der Freiheit, nicht mehr die Qual der Wahl zu haben, sondern einer inneren Notwendigkeit zu folgen, die die spanische Scholastik die ‚moralische‘ nennt.64 Descartes aber, der auch schon das Prinzip der ‚necessitas ad optimum‘ formuliert hat, scheint beide Freiheitsbegriffe, den libertarischen Willkür- oder Indifferenzbegriff und die moralische Notwendigkeit, miteinander versöhnen zu wollen.65 Dass aber das Lehrstück von der moralischen Notwendigkeit nicht nur ein innerscholastischer Streitpunkt war, sondern ein Wesensbestandteil neuzeitlichen Philosophierens, ist aus der Wirkungsgeschichte zu entnehmen. Denn das Thema wird nicht nur bei Christian Wolff und in der Wolffschule, zum Beispiel breit bei Georg Friedrich Meier aufgenommen, sondern auch bei Kant und in der ‚Klassischen Deutschen Philosophie‘ sonst. Nach Kant liegt in dem moralischen Gesetz, das allen vernünftigen Wesen Verbindlichkeit auferlegt, der Charakter der moralischen Notwendigkeit. Allerdings ist „für Menschen und alle erschaffenen vernünftigen Wesen die moralische Nothwendigkeit Nötigung“, während sie für Gott als „Gesetz der Heiligkeit“ besteht, das heißt ohne Nötigung, weil der Wille des allervollkommensten Wesens das moralische Gesetz nicht „macht“, sondern ihm schon immer entspricht.66 Auch in der nachkantischen Ära ist es die moralische Notwendigkeit, die die wahre Freiheit, die göttliche wie die menschliche, als solche kennzeichnet. Nach Fichte ist es die Verwechslung der Freiheit mit Willkür, weswegen „man sich die moralische (nicht etwa physische) Nothwendigkeit, womit ein Gesetz der Freiheit gebieten soll, so schwer denken konnte.“ Wenn man nämlich Freiheit im Sinne der Willkür versteht – „ein Gedanke, dessen noch immer viele sich nicht erwehren können“ – , so ist damit freilich nicht die moralische Notwendigkeit kompatibel. 64 René Descartes, Meditationes de prima philosophia IV, in: Oeuvres de Descartes, hg. v. Charles Adam u. Paul Tannery, Bd. 7, S. 57. 65 René Descartes, Entretien avec Burman, hg. v. Hans W. Arndt, Hamburg 2013, S. 74: „quamvis enim Deus ad omnia indifferens sit, necessario tamen ita decrevit, quia necessario optimum voluit, quamvis sua voluntate id optimum fecerit; nec debent hic sejungi necessitas et indifferentia in Dei decretis, et quamvis maxime indifferenter egerit, simul tamen maxime necessario egit.“ 66 Vgl. Kant, Kritik der praktischen Vernunft, AA V 81 f., und bes. Reflexion 7089, AA XIX 246: „Gott macht nicht … die moralischen Gesetze, sondern sagt nur, daß sie die Bedingungen seines gütigen Willens seyn.“; Kant, Reflexion 7092, AA XIX 247: „Gott ist nicht durch seinen Willen der Auctor des moralischen Gesetzes, sondern der (göttliche) Wille ist das moralische Gesetz, nemlich das Urbild des vollkommensten Willens und auch das principium aller Bedingungen, unseren Willen einstimig mit dem seinigen zu determinieren … “.
170
Theo Kobusch
Aber Freiheit ist etwas von Willkür radikal Verschiedenes. Denn Freiheit ist die vom Zwang der Naturnotwendigkeit gänzlich befreite, spontane, praktische Selbstgesetzgebung der Vernunft. Fichte nennt das die „transcendentale Freiheit“, und von ihr ist vor allem dies zu sagen, dass sie, insofern sie praktisch ist, „jedem moralischen Wesen, folglich auch dem Unendlichen beizulegen [ist]“.67 Schließlich scheint auch Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, und zwar in seiner Freiheitsschrift, den Gedanken der moralischen Notwendigkeit aufgenommen zu haben. Wenn es darum geht, „das Verhältnis Gottes als moralischen Wesens“ zur Welt zu bestimmen, genügt es nicht, einfach auf die Freiheit zu verweisen, als ob er eine Entscheidung nach einer „Berathschlagung“ oder bei der „Wahl zwischen mehreren möglichen Welten getroffen hätte. Vielmehr ist die Schöpfung als eine Selbstoffenbarung zu denken, die mit „sittlicher Notwendigkeit“ erfolgt, und da die Freiheit das Wesen Gottes selbst ausmacht, kann man auch sagen: die mit metaphysischer Notwendigkeit erfolgt.68 Die moralische Notwendigkeit erweist sich so als ein Element der Univozität des Moralischen, insofern sie für den göttlichen wie für den menschlichen Willen gilt. Es war Fichte, der aus der kantischen Lehre die letzte Konsequenz zog. Wenn nämlich die recht verstandene Freiheit, die mit moralischer Notwendigkeit zusammenfällt, auch die göttliche Freiheit ist, dann ist gar kein Unterschied mehr zwischen der menschlichen und göttlichen Moralität erkennbar. Der moralische Standpunkt des Menschen ist der ‚Gesichtspunkt Gottes‘. Denn wie für den Menschen ist auch für Gott „jedes vernünftige Wesen absoluter und letzter Zweck“.69 Peter Strasser hat diesen Standpunkt für uns neu formuliert, indem er ihn mit der Idee des guten Lebens verbindet: „Denn die Idee des guten Lebens ist mit dem Gedanken der Nichtkontingenz des Guten notwendig mitgegeben. Das Gute ist gut in allen möglichen Welten, und das gute Leben wäre jenes, zu dem sich 67 Johann Gottlieb Fichte, Versuch einer Critik aller Offenbarung, 21793, § 2 II, in: Gesamtausgabe, a. a. O., Bd. I. 1, a. a. O., S. 147. Hervorhebungen im Original. Vgl. auch Johann Gottlieb Fichte, Versuch einer Critik aller Offenbarung, 11792, § 2, in: Gesamtausgabe, a. a. O., Bd. I. 1, a. a. O., S. 21, Anm.: „ … , sondern nur in einem solchen – sc. Wesen – , welches die Natur durchaus selbstthätig bestimmet; in welchem moralische Nothwendigkeit, und absolute physische Freiheit sich vereinigen. So ein Wesen nennen wir Gott“. Hervorhebung im Original. 68 Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, Philosophische Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit und die damit zusammenhängenden Gegenstände, in: Schellings Werke, Bd. 4: Schriften zur Philosophie der Freiheit (1804–1815), 1927, Neudr. München 1978, hg. v. Manfred Schröter, S. 289. 69 Fichte, Das System der Sittenlehre III, § 19, in: Gesamtausgabe, a. a. O., Bd. I, 5: Werke 1798–1799, hg. v. Hans Gliwitzky u. Reinhard Lauth, Stuttgart-Bad Cannstatt 1977, S. 230.
Metaphysik des Moralischen
171
in keiner möglichen Welt ein besseres denken ließe.“70 Die Nichtkontingenz des Moralischen, also seine Absolutheit, beinhaltet aber nicht nur seine bleibende und unveränderliche Identität angesichts vieler möglicher Welten, sondern auch seine prinzipielle Entzogenheit vor den Zugriffen menschlicher Willkür. Deswegen kann das Moralische nicht Gegenstand von Verträgen sein. „Es gibt keine morals by agreement“, so sagt Strasser gegen David Gauthier. Ja, zuletzt kann es überhaupt nicht als ein Produkt eines Willens, auch nicht des göttlichen, gedacht werden.71 Der Grundsatz von der Univozität des Moralischen selbst aber, den wir im englischen Deismus, bei den Cambridge Platonists, in der deutschen Aufklärung, bei Kant und in der gesamten klassischen deutschen Philosophie gefunden haben, macht uns bewusst, dass das Moralische, das heißt die Grundlagen desselben, was Gut und Böse ist, ein Absolutes ist, das für alle Vernunftwesen und in allen möglichen Welten Geltung hat und von keinem anderen Standpunkt aus relativierbar ist. Mit den Worten von Strasser gesagt: „Wir können uns keine Situation vorstellen, keine Welt am Abgrund, in der sich Auschwitz rechtfertigen ließe.“72
70 Peter Strasser, Gut in allen möglichen Welten. Der ethische Horizont, Paderborn, München, Wien u. Zürich 2004, S. 81. 71 Ebd., S. 49. 72 Ebd., S. 77.
Zur Metaphysik der Person Berthold Wald
In der Diskussion um den Begriff der Person gehen die Auffassungen nicht weniger auseinander, wie auf anderen Gebieten der Philosophie. Die Unterscheidung von klassischen und gegenwärtigen Persontheorien ist für eine grobe Orientierung auf dem Kampfplatz der Meinungen sicher hilfreich. So lassen sich aus begriffsgeschichtlicher Perspektive Abhängigkeiten, Übergänge und Veränderungen auf dem langen Weg in die Moderne leichter nachzeichnen. Das soll auch in groben Zügen geschehen. Ein solches Herangehen steht allerdings in der Gefahr, das schärfste Differenzkritierium zwischen allen Persontheorien zu verdecken. Dies ist in systematischer Perspektive die Unterscheidung des substanzontologischen Personbegriffs auf der einen Seite von allen anderen Personbegriffen auf der anderen Seite. Über alle Unterschiede hinweg besteht die wesentliche Differenz nicht zwischen klassischen und gegenwärtigen Theorien. Die eigentliche Differenz aller Persontheorien besteht vielmehr in der Opposition zu der einen von Anicius Manlius Severinus Boethius begründeten und von Thomas von Aquin weiter ausgeführten substanzontologischen Auffassung von Personalität.1 Zu deren Verständnis kommt es allerdings entscheidend darauf an, wie der Begriff der Substanz verstanden und ontologisch ins Spiel gebracht wird. Schon die in zeitlicher Nähe zu Thomas von Aquin entwickelten Persontheorien, die man folglich auch klassisch nennen könnte, verstehen das Sein von Personen zwar ontologisch, aber nicht substanz-ontologisch. Im Übergang von der Metaphysik zur Ontologie am Ende des 13. Jahrhunderts wird der aristotelische Grundgedanke einer durchgängigen Bestimmung jeder Substanz durch die ihr eigentümliche einzige Wesensform fallengelassen. Er wird ersetzt durch die Vorstellung einer Pluralität von Formen und Bestimmungen, aus deren ontologischen Differenzen 1 Vgl. dazu Berthold Wald, Substantialität und Personalität. Philosophie der Person im Mittelalter, Paderborn 2005. © Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv lizenziert durch Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2020 C. Böhr (Hrsg.), Metaphysik, Das Bild vom Menschen und die Ordnung der Gesellschaft, https://doi.org/10.1007/978-3-658-31593-1_11
173
174
Berthold Wald
sich die Substanz aufbaut. Die menschliche Person ist demzufolge ein Komplex aus unterscheidbaren Formbestimmungen des Körperseins, des Lebendigseins und der Geistausstattung samt den nichtwesentlichen Bestimmungen individueller Unterschiede – und das alles auf der Basis einer von allen formalen Bestimmungen ontologisch abgrenzbaren Materialität. Die damit initierte Veränderungsdynamik unseres Selbstverständnisses als Person dauert bis heute an. Die neuesten Theorien ‚fließender Personidentität‘ haben mehr mit der mittelalterlichen Umwandlung der Metaphysik zur Ontologie zu tun, als ihren Vertretern bewusst ist. Schon die übliche Klassifizierung neuzeitlicher Persontheorien als ‚bewußtseinstheoretisch‘ in der vermeintlichen Abkehr von der ontologischen Begründung menschlicher Personalität verleitet dazu, etwa bei John Locke eine nicht-ontologische oder ‚metaphysikfreie‘ Konzeption von Personalität zu unterstellen. Doch impliziert auch Lockes Definition der Person im direkten Rückgriff auf den Bewusstseinsbegriff eine metaphysische Theorie, die den Substanzbegriff durch eine Eigenschaftsontologie ersetzt. Diese eigenschaftsontologische Abkehr vom Substanzbegriff, von David Hume folgerichtig zu Ende gedacht, führt in die Auflösung jeglicher Bestimmtheit und Identität. Wenn es nur raum-zeitliche Bündel von Eigenschaften gibt und keine Substanzen, ist alles im Fluss. Identität ist dann immer fließende Identität als Abfolge wechselnder Zustände, die wesenlos ineinander übergehen, ohne Mitte und Ziel. Im Folgenden werde ich zunächst den von Thomas von Aquin explizierten Begriff menschlicher Personalität erläutern, den er im Ausgang von Boethius vertieft und gegen Einwände verteidigt hat. Man kann diesen Begriff insofern ‚klassisch‘ nennen, als sich die Persontheorien mit Beginn der Neuzeit indirekt oder direkt davon absetzen. Weil diese Theorien ihrerseits in der darauffolgenden Diskussion Referenzcharakter haben, könnte man sie ebenfalls als ‚klassisch‘ bezeichnen. Um Verwirrung zu vermeiden, werde ich diesen zweiten Hauptabschnitt meiner Darlegung ‚postklassische Persontheorien‘ nennen. Der dritte und letzte Abschnitt gilt den gegenwärtigen Persontheorien, die einige frappierende Implikationen der postklassischen Vorgängertheorien ans Licht bringen.
Zur Metaphysik der Person
175
1 Substanzontologische Definition von Personalität 1.1
Die Definition des Boethius
Die kleine Schrift Contra Euthychen et Nestorium2 ist als V. Traktat der Opuscula sacra in philosophischer Hinsicht die wichtigste Quelle des Mittelalters für die Formulierung des Personbegriffs. Sie markiert insbesondere im Bewusstsein der Theologen des 13. Jahrhunderts den Übergang von der bloßen Worterklärung zum Begriff in der Anwendung logischer und metaphysischer Kategorien auf das Sein der Person. Die Herleitung der Definition mit Hilfe logischer und semantischer Unterscheidungen kann hier unterbleiben. Deren Struktur und Gehalt ist so einsichtig und klar, dass jeder auf den ersten Blick denken wird, so muss es sein: Personen sind individuelle Substanzen von rationaler Natur: „persona est rationalis naturae individua substantia“. Das ist der Wortlaut eben jener berühmten Definition zu Beginn des 3. Kapitels im Rückgriff auf die zuvor eingegrenzten Bedeutungen von ‚natura‘ und ‚substantia‘.3 Dazu einige ergänzende Hinweise, die den logisch-metaphysischen Kontext der Definition erhellen sollen, zunächst zur Verwendung des Naturbegriffs. Person kann offensichtlich nur ausgesagt werden im Bereich von etwas, das eine entsprechende Naturbeschaffenheit hat. Die Frage ist dann aber, welche Natur, wenn nicht jede, und in welchem Sinn?4 Die definitorische Bezugnahme auf eine spezifische Natur hält Boethius für so offensichtlich, dass an ihr nicht zu zweifeln ist. Person kann nicht außerhalb von Natur ausgesagt werden, ob es sich um Menschen, reine Geistwesen oder die drei göttlichen Personen handelt. 5 Denn Seiendes ist nicht schon dadurch Person, dass es als Individuum existiert. Pflanzen und Tiere sind Individuen, aber keine Personen. Eine weitere ebenso wichtige Verstehensbedingung betrifft Die Schrift wird meist nicht unter ihrem Titel angegeben, sondern nach ihrem Inhalt De duabis naturis Christi benannt. Contra Eutychem et Nestorium wird als V. Opusculum zitiert auf der Basis der kritischen Ausgabe von Michael Elsässer, A. M. S. Boethius. Die theologischen Traktate, Hamburg 1988 – mit Kapitel- und Zeilenangabe. 3 Boethius, Opuscula sacra, V, 3; 4 f. 4 Ebd., V, 2; 1 ff.: „Sed de persona maxime dubitari potest, quaenam ei definitio possit aptari. Si enim omnis habet natura personam, indissolubilis nodus est, quaenam inter naturam personamque possit esse discretio; aut si non aequatur persona naturae, sed infra terminum spatiumque naturae persona subsistit, difficile dictu est ad quas usque naturas persona perveniat, id est quas naturas conveniat habere personam, quas a personae vocabulo segregari“. 5 Ebd., V, 2; 9 ff.: „Nam illud quidem manifestum est personae subiectam esse naturam nec praeter naturam personam posse praedicari“. 2
176
Berthold Wald
die Frage, wie zwei ontologisch unterscheidbare Sachverhalte, das Haben einer individuierten Natur – im Fall von Jesus Christus sogar von zwei Naturen – und das Sein als Person, seinsmäßig ein- und dasselbe Individuum sein können. Als unbezweifelbar gilt für Boethius, dass ‚Einessein‘ die Bedingung dafür ist, überhaupt etwas zu sein. „Was nicht ein Sein hat, kann auch überhaupt nicht sein.“6 Eine Substanz zu sein bedeutet demzufolge, Eines zu sein. Schließlich präzisiert Boethius den Substanzbegriff noch in einer weiteren Hinsicht im Hinblick auf die darin mitgedachte Subsistenz als Unmitteilbarkeit des je eigenen Seins. Substanz im Sinne von ‚essentia‘ – Wesen einer Art – ist mehreren Individuen mitteilbar, im Unterschied zu Substanz im Sinn von individueller Substanz. Als kategorialer Bezugspunkt aller Seinsbestimmungen impliziert das Individuum, sprich die ‚individua substantia‘, zwar Subsistenz, also Selbststand im eigenen Sein, im Unterschied zum Sein der ihr zukommenden Akzidenzien.7 In formeller Hinsicht jedoch kennzeichnet erst die Subsistenz der ‚individua substantia‘ die spezifische Seinsweise von Personen.8 Personalität kommt gegenüber bloßer Individualität durch den notwendigen Einschluss von Subsistenz und Inkommunikabilität eben jener Bedeutungsüberschuss zu, der den Ausdruck Person zum ‚nomen speciale‘ für eine besondere Art von ‚individua substantia‘ macht, wie Thomas von Aquin später ausführen wird. Auch wenn der Definition des Boethius in späteren Zeiten das Attribut ‚klassisch‘ zukommen sollte, ermangelte sie von Anfang an der allgemeinen Zustimmung. Die Kritik reicht von den hochmittelalterlichen Trinitätsspekulationen bis hin zu Martin Heideggers Sein und Zeit. Thomas war überzeugt von ihrer Richtigkeit, aber das so ziemlich als einziger. Er hat sie gleich mehrfach in ihrer Wahrheit und Universalität expliziert und Einwänden gegenüber verteidigt. Der Haupteinwand zu seiner Zeit bestreitet die Universalität der Definition: Sie mag für menschliche Personen gelten, aber sicher nicht für die drei göttlichen Personen. Sie kann vielleicht regionale Gültigkeit in der Christologie beanspruchen, für die sie entwickelt wurde, aber nicht in der Trinitätstheologie. Der Grund ihrer mangelnden Universalität wird gerade darin gesehen, dass Personen unter den Gattungsbegriff ‚Substanz‘ 6 V, 4; 36 ff.: „Quod enim non est unum, nec esse omnino potest; esse enim atque unum convertitur et quodcumque unum est est“. 7 Ebd., V, 3; 39 ff.: „Neque enim pensius subtiliusque intuenti idem videbitur esse subsistentia quod substantia». V, 3; 45 ff.: «Subsistit enim quod ipsum accidentibus, ut possit esse, non indiget. Substat autem id quod aliis accidentibus subiectum quoddam, ut esse valeant, subministrat; sub illis enim stat, dum subiectum est accidentibus“. 8 Boethius verweist dafür auf eine Besonderheit in der Semantik des griechischen Schlüsselworts ‚hypostasis‘, das im Unterschied zum lateinischen ‚persona‘ die unteilbare Subsistenz des Individuums mitbezeichnet; vgl. ebd., V, 3, 25 ff.
Zur Metaphysik der Person
177
fallen, was, so der Einwand, den relationalen Charakter von Personalität verdeckt. Denn Substanz impliziert ja Selbststand im Sein und also Unabhängigkeit vom Sein anderer. Dies scheint aber mit dem Glauben an die spezifische Personalität der drei göttlichen Personen unvereinbar. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind nicht für sich Person, sondern durch ihre jeweilige Beziehung zueinander als Person konstituiert. Auch außerhalb dieses theologischen Kontextes zielt der Haupteinwand gegen die Definition des Boethius auf den Substanzbegriff, wiederum weil, so das Argument, gerade die Kategorie der Substanz das Wesen menschlicher Personalität verdeckt. Damit wird auch die von den mittelalterlichen Kritikern zugestandene regionale Gültigkeit der Definition in Frage gestellt. Die Kritik an der Eignung des Substanzbegriffs ist allerdings sehr heterogen und nicht auf einen Nenner zu bringen. Sie reicht von der empiristischen Reduktion der Substanz auf ein eigenschaftsloses Suppositum empirisch gegebener Bestimmungen, über die skeptische Bestreitung eines solchen chimärischen Bezugspunkts empirischer Eigenschaften bis hin zu der von Max Scheler und Heidegger vertretenen Auffassung, wonach die Substanzkategorie als Dingkategorie völlig unangemessen sei, Personalität zu definieren. Der schon gegen den Seinsbegriff der Metaphysik erhobene Vorwurf der Verdinglichung soll hier erst Recht gelten für die von Boethius und Thomas von Aquin vertretene Bestimmung der Person als Substanz. Substantialität und Personalität schließen sich aus. Entweder ein X ist Substanz oder es ist Person, aber nicht beides zugleich, so die auch unter Anhängern des Personalismus verbreitete Ansicht.9
1.2
Explikation des Gehalts der Definition bei Thomas von Aquin
Schon Richard von St. Viktor hatte in seiner kritischen Analyse des boethianischen Personbegriffs dafür plädiert, den Substanzbegriff zu streichen und ‚individua substantia‘ durch ‚incommunicabilis existentia‘ zu ersetzen. Im Unterschied zur Wesensnatur sei das Sein der Person gerade nicht mitteilbar. Thomas hält diese Kritik an der Persondefinition des Boethius für ein Missverständnis, allerdings ein produktives. Eine sachlich angemessene Interpretation ohne Veränderung des definitorischen Gehalts ist möglich und zwar im Rückgriff auf den Begriff der Subsistenz, den bereits Boethius selbst zur Erläuterung seiner Definition verwendet. Boethius wird gewissermaßen mit Boethius erklärt, wie Thomas in der Regel mit Texten von Aristoteles verfährt. ‚Subsistenz‘ meint die auch im Begriff der ‚individua 9 Vgl. Wald, Substantialität und Personalität, a. a. O., S. 15 ff.
178
Berthold Wald
substantia‘ enthaltene Negation der Kommunikabilität. Die Person als ‚individua substantia rationalis naturae‘ subsistiert, insofern ihr Sein in sich selbst und nicht im Sein eines anderen Bestand hat: „inquantum non est in alio“. Person kann folglich auch ohne Preisgabe der Substantialitätsbedingung definiert werden als „distinctum vero incommunicabile“10 – als ein Seiendes, dessen Für-sich-sein unmitteilbar ist. Thomas erläutert darum den weniger deutlichen Ausdruck ‚individua substantia‘ durch die präzise Bestimmung „subsistens distinctum“:11 Person ist ein Seiendes, dem eine besondere Weise des Für-sich-seins zukommt aufgrund seiner Geistnatur. Darin sieht Thomas bei aller materialen Verschiedenheit die formal gleiche Kennzeichnung des Personseins überhaupt, ganz gleich, ob dabei von Gott oder vom Menschen die Rede ist. Das Wort ‚Person‘ ist ein ‚nomen speciale‘ für eine besondere Seinsverfassung, die allen Personen und also auch dem Menschen zukommt. Das geht bereits aus der besonderen Bezeichnungsweise – dem ‚modus significandi‘ – des Ausdrucks ‚Person‘ hervor. Er liegt zwischen der Bezeichnung durch den Eigennamen und der Bezeichnung des Individuums als ‚Mensch‘.12 Wie die Eigennamen, etwa Peter und Paul, bezeichnet ‚persona‘ ein Individuum, dies jedoch auf unbestimmte Weise. Und wie der Ausdruck Mensch – ‚homo‘ – bezeichnet ‚persona‘ das Individuum in der Vollständigkeit seines konkreten Seins – im Unterschied zu ‚humanitas‘ als ‚nomen abstractum‘ für die menschliche Natur. ‚Persona‘ bezeichnet daher unmittelbar das vollständige Sein einer Person. ‚Person‘ ist ein „nomen rei“,13 ein Name, der seit der Definition des Boethius alternativlos ist, wenn es darum geht, die Vollkommenheit und unvergleichliche Seinsfülle eines Individuums zu bezeichnen, die ihm durch seine naturgegebenen und im Selbstvollzug aktualisierten Seinsmöglichkeiten zukommt.14 Thomas weiß natürlich auch, dass es nicht auf das Wort ‚Person‘, sondern auf den Begriff ankommt.
10 Thomas von Aquin, Pot., 9, 4. 11 Ebd. 12 Ebd., 9, 2: „Individuum in genere substantiae speciale nomen sortitur … quia ipsius est proprie et vere per se agere“. 13 Ebd., 9, 2 ad 2: „Et propter hoc neque hypostasis neque persona est nomen intentionis, sicut singulare vel individuum, sed nomen rei tantum“. 14 Thomas von Aquin, 3 Sent., 6, 1, 1: „Individuum rationalis naturae quae est completissima et ubi stat tota intentio naturae habet quod significat completissimum ultima completione, postquam non est alia.“ Dazu bemerkt Brigitte Kible in ihrem Artikel Substanz und Person bei Thomas von Aquin, in: Philosophie und Religion. Jahrbuch des Forschungsinstituts für Philosophie Hannover, 1992/93, S. 119: „Für Thomas, der gewiß kein Freund überschwänglicher Formulierungen ist, ist diese Redundanz außergewöhnlich.“
Zur Metaphysik der Person
179
Die Sache war jedenfalls schon vor Ihrer Bezeichnung bekannt.15 Es ist aber das Verdienst des Boethius, dem Wort ‚Person‘ durch die Definition von Personalität eine universelle philosophische Bedeutung gegeben zu haben.16 Eine wesentliche Implikation dieser Universalisierung substantial begründeter Personalität liegt auf der Hand. Ihre Zuschreibung gilt unteilbar für alle Menschen, sofern sie Individuen sind von eben jener Art, der wesenhaft eine rationale Natur zukommt. Personen müssen zwar nicht notwendigerweise Menschen sein, denn das Menschsein gehört nicht notwendig zum Begriff der Person. Umgekehrt gilt aber mit Notwendigkeit: Das Personsein gehört zum Begriff des Menschen.17 Menschen sind Personen, weil sie Menschen sind, was eben heißt: Das Personsein kommt jedem Menschen durch sein Menschsein zu. Es ist das Menschsein in jedem von uns, worin die Würde begründet ist, Person zu sein. So kennen wir es von Immanuel Kant her.18 Doch Thomas hat diesen Gedanken lange vor Kant formuliert, wenn er die Würde der Person im Fall des Menschen anthropologisch begründet sieht in der Beschaffenheit der menschlichen Natur. Eben darum kann und muss gesagt werden: Jedes Individuum von rationaler Natur wird Person genannt.19 Die personale Würde, die allen Personen per se zukommt, kommt dem Menschen durch seine Existenzbedingungen zu.
15 Thomas von Aquin, Summa theologiae, I, 29, 3 ad 1:„Licet hoc nomen ‚personae‘ in Scriptura veteris vel novi Testamenti non inveniatur – sc. wie auch bei Aristoteles nicht – dictum de deo, tamen id quod nomen significat, multipliciter in sacra scriptura invenitur assertum de Deo quod est maxime per se ens et perfectissimum intelligens.“ 16 Vor Boethius diente das Nomen ‚persona‘ „ad significandum aliquos dignitatem habentes“: Thomas von Aquin, Summa theologiae, I, 29, 3 ad 2: hier lag aber bereits der Anknüpfungspunkt für die spätere Universalisierung: „quia magnae dignitatis est in rationali natura subsistere, omne individuum rationalis naturae dicitur persona.“ 17 Ebd., I, 29, 4: „Persona igitur in quacumque natura – sc. Rationalis – significat id quod est distinctum in natura illa: sicut in natura humana significat has carne set haec ossa et hanc animam, quae sunt principia individuantia hominem, quae quidam non sunt de significatione personae, sunt tamen de significatione personae humanae.“ 18 Immanuel Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, Zweiter Abschnitt, A 65, zufolge werden „vernünftige Wesen Personen genannt … , weil ihre Natur sie schon als Zwecke an sich selbst, d. i. als etwas, das nicht bloß als Mittel gebraucht werden darf, auszeichnet, mithin sofern alle Willkür einschränkt (und ein Gegenstand der Achtung ist)“; Hervorhebung im Original; vgl. dazu Albert Zimmermann, Zur Herkunft der Idee der Menschenwürde, in: Aufklärung durch Tradition, hg. v. Hermann Fechtrup, Friedbert Schulze u. Thomas Sternberg, Münster 1995, S. 74-86. 19 Thomas von Aquin, Summa. theologiae, I, 29, 3, ad 2: „Et quia magnae dignitatis est in rationali natura subsistere, omne individuum rationalis naturae dicitur persona.“
180
Berthold Wald
Zu fragen ist darum, worin genau diese besondere Würde besteht und welches die jeden Menschen kennzeichnenden Existenzbedingungen sind, die seine Personalität konstituieren. Es soll hier genügen, einige Stichpunkte zu nennen, die natürlich einer weiteren Vertiefung bedürfen. Zunächst zur Würde der Person, worin sie besteht und wie sie sich zeigt. Die Würde ist gebunden an den besonderen Selbststand als Person. Person ist ein ‚subsistens distinctum‘, etwas, dem das Für-sich-sein-können auf besondere Weise zukommt.20 Würde kommt der Person daher zuerst und grundlegend zu durch ihre Natur, die unter allen Naturen die größte Würde besitzt, und Würde kommt der Person zu durch sich selbst, durch den ‚modus existendi‘, also die Art ihres Seinsvollzugs.21 Die personale Würde des Menschen besteht also darin, durch sich selbst und um seiner selbst willen zu existieren, also nicht bloß etwas, sondern jemand zu sein, wie Robert Spaemann es formuliert hat.22 Thomas hat diesen Aspekt des ‚per se existere‘ auch so formuliert, dass wir uns darin unmittelbar wiedererkennen. Personen sind Wesen, die von Natur dazu befähigt sind, frei zu sein.23 Darunter versteht Thomas das Vermögen, über sich zu verfügen und sich zu seinen Akten selbst zu bestimmen. Doch Freiheit gibt erst, wo es Geist gibt, und Geist ist das Vermögen, sich in Beziehung zu setzen zu allem, was ist und dieses frei gewählte Bezogensein noch einmal in sich
20 Thomas von Aquin, Pot., 9, 4: „Persona divina significat subsistens distintinctum in natura divina, sicut persona humana significat subsistens distinctum in natura humana; et haec est formalis significatio tam personae divinae quam personae humanae.“ 21 Thomas von Aquin, Pot., 9, 3: „Natura autem, quam persona in sua significatione includit, est omnium naturarum dignissima, scilicet natura intellectualis secundum genus suum. Similiter etiam modus existendi quem importat persona est dignissimus, ut scilicet aliquid sit per se existens“. Daraus folgt die Sonderstellung der menschlichen Person: vgl. Thomas von Aquin, Summa theologiae, I, 29, 3: „Persona significat id quod est perfectissimum in tota natura“. 22 Vgl. Robert Spaemann, Personen. Versuche über den Unterschied von ‚etwas‘ und ‚jemand‘, Stuttgart 1996. 23 Thomas von Aquin, Summa theologiae, I, 29, 1: „Sed adhuc quodam specialiori et perfectiori modo invenitur particulare et individuum in substantiis rationalibus, quae habent dominium sui actus et non solum aguntur, sicut alia sed per se agunt.“ So auch Thomas von Aquin, Pot., 9, 1, ad 3: „Hoc autem quod est per se agere excellentiori modo convenit substantiis rationlis naturae quam aliis. Nam solae substantiae rationales habent dominium sui actus, ita quod in eis est agere et non agere; aliae vero substantiae magis aguntur quam agant. Et ideo conviniens fuit ut substantia individua trationalis naturae speciale nomen haberet.“
Zur Metaphysik der Person
181
zu reflektieren Auch das müsste nach der Seite des Erkennens und des Wollens weiter vertieft werden.24 Zusammenfassend kann im Blick auf die anthropologische Grundlegung menschlicher Personalität bei Thomas gesagt werden: Zum eigentümlichen Wesen menschlicher Personalität gehört, dass die für die personale Würde konstitutiven Merkmale des Selbststands und des Selbstseins der Person per se zukommen durch die menschliche Geistseele, die das Sein der Person konstituiert.25 Darum kann auch das Sein der Seele mit dem Sein der Person nur partiell identisch, aber nicht umfangsgleich sein, denn die Seele ist wohl substantiale Form des Menschen, aber keine vollständige Substanz. Gleiches gilt für das ‚Ich‘ oder das ‚Selbst‘.26 Ein ‚Ich‘ existiert weder substantial noch formal abtrennbar vom Sein des Menschen als individueller leiblicher Substanz. Die Begriffe ‚Mensch‘ und ‚Person‘ sind zwar nicht umfangsgleich, wohl aber als Bezeichnung des ganzen Seins einander zugeordnet, weshalb menschliches Leben als solches immer schon personales Leben ist. Die später am Leitfaden der Sprache gedachte Zusammensetzung führt in die Irre, wie wir noch sehen werden. Auch wenn die Bedeutungen der Worte ‚Mensch‘, ‚Person‘, ‚Selbst‘ verschieden sind: das Sein kommt der Person zu als eben dieser Mensch.27 Zwei wesentliche Aspekte müssen noch kurz benannt werden, um die Substantialität des menschlichen Personseins unverkürzt vor den Blick zu bekommen. Das erste ist das Folgende: Schon die Definition besagt ja, dass nur Individuen einer bestimmten Art Personen sein können. Individualität jedoch bedeutet Unterschiedenheit, und das nicht allein im Hinblick auf akzidentelle Eigenschaften, sondern auch im Hinblick auf die konstituierenden Seinsprinzipien. Konstitutiv für das Sein von Personen ist aber nicht die akzidentelle Verschiedenheit, sondern das substantielle Eigensein der Seele, die zwar der Art nach gemeinsam ist, aber numerisch nicht
24 Dazu hat Josef Pieper Grundlegendes gesagt in seiner Thomas-Interpretation Wahrheit der Dinge. Eine Untersuchung zur Anthropologie des Hochmittelalters, in: Werke in acht Bänden, hg. v. Berthold Wald, Bd. 5, Hamburg 1997, S. 99-179. 25 Thomas von Aquin, Summa theologiae, III, 2, 1 ad 2: „Ex anima et corpore constituitur in unoquoque nostrum duplex unitas: naturae, et personae. Naturae quidem sec. Quod anima unitur corpori, formaliter perficiens ipsum, ut ex duobus fiat una natura, sicut ex actu et potentia, vel materia et forma. Unitas vero personae constituitur ex eis inquantum est unus aliquis subsistens in carne et anima.“ 26 Thomas von Aquin, Super I Epistolam B. Pauli ad Corinthios lectura, 15, 2: „Anima autem cum sit pars corporis hominis, non est totus homo, et anima mea non est ego.“ 27 Thomas von Aquin, Summa teologiae, III, 2, 3: „Tantum hypostasis est cui attribuuntur operationes et proprietates naturae, et ea quae ad naturae rationem pertinent in concreto: dicimus enim quod hic homo ratiocinatur, et est risibilis, et est anima rationale. Et hac ratione hic homo dicitur esse suppositum.“
182
Berthold Wald
dieselbe sein kann.28 Die menschliche Geistseele ist per se individuell und wird nicht erst nachträglich dazu gemacht, gewissermaßen durch die dem menschlichen Individuum zukommenden Akzidentien.29 Das zweite, das es hinzuzufügen gilt, folgt unmittelbar daraus, dass die Geistseele erst in ihrer Verleiblichung das Sein der Person konstituiert. Die Seele ist ‚forma corporis‘, das heißt die von innen her das gesamte Sein prägende Form des Leibes.30 Als substantiale Form ist sie daher auch eine einzige, weshalb der Mensch in allen Hinsichten, in seiner Leiblichkeit, Sinnlichkeit und Geistigkeit, Person ist. Nicht etwas am Menschen ist Person, etwa sein Wille oder das ‚Selbst‘, sondern der ganze Mensch. Leiblichkeit und Sinnlichkeit des Menschen sind daher von vornherein personal geprägt und zwar bis hinein in die leibliche Differenz als Mann und Frau.
2
Postklassische Persontheorien: ontologischer Dualismus und Eigenschaftsontologie
Der grundlegende Wandel im Bereich postmetaphysischer Persontheorien hängt zusammen mit dem Wandel der Metaphysik zur Ontologie. Im Unterschied zur Metaphysik ist der Leitgedanke der Ontologie nicht die Substantialität des Seienden, sondern die im Sein des Seienden ontologisch unterscheidbaren Sachgehalte. Seinsanalyse ist daher Konstitutionsanalyse, weil nur so sichergestellt werden kann, dass unterscheidbaren Sachgehalten wie beispielsweise ‚Körperlichkeit‘, ‚Lebendigkeit‘, ‚Wahrnehmungsfähigkeit‘ auf seiten der erkannten Sache onto-logisch etwas objektiv Gegebenes entspricht. Für Duns Scotus kommt diesem sachlich Gegebenen ein ‚esse obiectivum‘ zu, das im Sein der Sache selbst begründet ist und nicht erst durch die Tätigkeit des erkennenden Verstandes hervorgebracht 28 Thomas von Aquin, Pot., 9, 2: „Individuum in genere substantiae speciale nomen sortitur: quia substantia ex propriis pricipiis individuatur, – et non ex aliquo extraneo – sicut accidens ex subiecto.“ Das war ja der Anlass für Thomas, gegen die averroistische Theorie der Einzigkeit des Geistes die Per-se-Individualität der Geistseele als Subjekt eigener Selbstvollzüge zu verteidigen. Es gilt darum beides: vgl. Thomas von Aquin, Summa theologiae, III, 2, 3: „Sicut accidentalis differentia facit alterum, ita differentia essentialis facit aliud“, und: ebd., I, 29, 2 ad 3: „Compositum ex ‚hac materia‘ et ex ‚hac forma‘ habet rationem hypostasis et personae: anima enim et caro et os sunt de ratione hominis, sed haec anima et haec caro et hos os sunt de ratione ‚huius hominis‘.“ 29 Thomas von Aquin, Pot., 9, 1 ad 3: „Sicut substantia individua proprium habet quod per se existat ita proprium habet quod per se agat.“ 30 Vgl. dazu Summa theologiae, I, 76: De unione animae ad corpus.
Zur Metaphysik der Person
183
wird, sofern dieser eine Sache in verschiedenen Hinsichten erfasst. Nicht bloß für die essentiellen Bestimmungen, ebenso für die Akzidentien und schließlich auch für die Materie ist eine sogenannte ‚entitas positiva‘ anzunehmen.31 Die ‚distinctio formalis a parte rei‘, die sogenannte Formaldistinktion vonseiten der erkannten Sache, ist das Grundprinzip dieser neuen Ontologie. Was vom menschlichen Verstand ‚clare et distincte‘ erfasst und unterschieden wird, muss auch einen eigenen Seinsstatus haben, wenn sachhaltige begriffliche Unterschiede nicht ‚leer‘, das heißt ohne Wirklichkeitsbezug bleiben sollen. Die Anwendung dieser Prinzipien führt bei René Descartes und später bei Locke zu einem neuen Verständnis von Personalität. Dabei steht der cartesianische Dualismus dem traditionellen Personbegriff noch insofern nahe, als Descartes an der Identität von Menschsein und Personsein festhalten will, während bei Locke die notwendige Identität von Mensch und Person explizit durch eine bloß kontingente Identität ersetzt wird.32
2.1 Descartes: Die menschliche Person als Einheit zweier Substanzen Für Descartes ist der Mensch die reale Einheit aus zwei Substanzen, die allerdings nicht nur begrifflich distinkt, sondern objektiv real voneinander verschieden sind.33 Diese Verschiedenheit beruht ganz im Sinne der scotistischen Formaldistinktion auf der primären Unterschiedenheit zweier Attribute des Menschen: dem Selbstbewusstsein und der körperlichen Ausdehnung. Als denkendes Wesen ist der Mensch ‚res cogitans‘, und als Körperwesen ist er ‚res extensa‘. Allerdings ist auch für Descartes zunächst einmal fraglich, woher wir die Gewissheit nehmen, dass den 31 Vgl. Berthold Wald, ‚Accidens est formaliter ens.‘ Duns Scotus on Inherence in his Quaestiones subtilissimae on Aristotle’s Metaphysics; in: Aristotle in Britain during the Middle Ages, hg. v. John Marenborn, Turnhout 1996, S. 177-193; dt. in: Wiener Jahrbuch für Philosophie 30 (1998) S. 59-70. 32 Vgl. Berthold Wald, Die Erfindung des Selbst. Johannes Duns Scotus – René Descartes – John Locke, in: Der Mensch und die Person, hg. v. Xavier Putallaz u. Bernard Schumacher, Darmstadt 2008, S. 121-132; frz. L’invention du Moi: Jean Duns Scot, René Descartes, John Locke, in: Diess., L’humain et la personne,hg. v. Xavier Putallaz u. Bernard Schumacher, Paris 2008, S. 195-216; poln. Wynaleziemie podmiotowosci. Jan Duns Szkot – Kartezjusz – John Locke, in: Wokol genezy czlowieka. Studia i rozprawy, hg. v. Piotr Stanislaw Mazur, Krakau 2013, S. 127-143. 33 Belege dafür finden sich in allen Hauptschriften von René Descartes – die Bandzählung folgt hier und im Folgenden der Ausgabe von Charles Adam u. Paul Tannery, Oeuvres de Descartes: vgl. dort Discours, Bd. 6, S. 32 f.; Meditationes, Bd. 7, S. 78; Principia, Bd. 11, S. 330.
184
Berthold Wald
begrifflich verschiedenen Attributen ‚Denken‘ und ‚Ausdehnung‘ auch eine vom Denken unabhängige Realität zukommt. Ein erster Weg zur Vergewisserung der Realität und Substantialität des Denkens ist der im zweiten Kapitel der Meditationes beschrittene Weg des methodischen Zweifels. Er führt zu der Einsicht in den Vorrang des Ich oder der denkenden Substanz vor allen andern Erkenntnisinhalten. Ich bin mir selbst in den Akten des Selbstbewusstseins auf andere Weise gegeben wie mein Körper, weil auch der Zweifel an meiner Existenz als ein Akt meines Selbstbewusstseins die Gewissheit meiner Existenz verbürgt. Nicht in gleicher Weise gesichert ist dagegen die Realität und Existenz der ausgedehnten Substanz meiner Körperlichkeit, weil mein Bewusstsein hierüber einer Täuschung unterliegen kann. Der methodische Zweifel sichert also nur die Gewissheit der geistigen Substanz und dies allerdings auch nur für die Dauer der Selbstreflexion. Die reflexiv gesicherte Substantialität des denkenden Ich ist daher außerhalb der Akte der Selbstreflexion keineswegs gewiss. „Denn vielleicht könnte es sogar geschehen, dass ich, wenn ich ganz aufhörte zu denken, alsbald auch aufhörte zu sein.“34 In diesem Stadium der Untersuchung ist es daher noch verfrüht, von der Gewissheit des Gedachten auf die Existenz des gedachten Sachverhalts zu schließen. Die oft unter Namen von Descartes zitierte Formel für die Selbstvergewisserung des Ich lautet darum auch nicht „cogito ergo sum“ sondern: „sum … quamdiu cogito“.35 Ein aus Sicht von Descartes tragfähiges Argument für die Substantialität von denkendem Ich und dem Sein des Körpers findet sich erst im dritten und sechsten Kapitel der Meditationes. Die Gewissheit der Existenz von Körper und Geist ist dort klarerweise nicht mehr erkenntnispsychologisch, sondern ontologisch begründet unter der Voraussetzung, dass alles, was ‚clare et distincte‘ als unterschieden erkannt ist, auch real unterschieden sein muss.36 Diese keineswegs selbstevidente Korrelation zwischen begrifflicher Unterschiedenheit und realer Unterschiedenheit wird in der sechsten Meditation damit begründet, dass das begrifflich Unterschiedene von Gott ohne Widerspruch auch als real existent hätte gesetzt werden können.37 Faktisch existiert zwar nur die Einheit von denkender und ausgedehnter Substanz als Einheit 34 Descartes, Meditationes, Bd. 7, S. 27. 35 Ebd.: „Ego sum, ego existo, certum est. Quamdiu autem? nempe quamdiu cogito; nam forte etiam fieri posset, si cessarem ab omni cogitatione, ut illico totus esse desinerim“. 36 Vgl. Descartes, Meditationes, Bd. 7, S. 13 – Synopsis 3 – : „daß alle die Dinge, die man klar und deutlich – clare et distincte – als verschiedene Substanzen begreift, wie das für Geist und Körper zutrifft, in der Tat substantiell verschiedene Dinge sind.“ 37 Vgl. ebd., Bd. 7, S. 77: „So genügt es, eine Sache – una res, i. e. Sachgehalt – ohne eine andere klar und deutlich – clare et distincte – einzusehen, um mir die Gewissheit zu geben, dass die eine von der anderen – sc. real – verschieden ist, da wenigstens Gott sie getrennt setzen kann.“
Zur Metaphysik der Person
185
von Geist und Körper im Sein des Menschen. Dennoch sind Ausgedehnt-sein und Denkend-sein real verschiedene Sachverhalte, wovon keiner des anderen bedarf, um existieren zu können. Eine denkende Substanz könnte auch ohne einen Körper existieren und darum real getrennt von einer ausgedehnten Substanz geschaffen sein. Hier sieht man deutlich den Einfluss und die Wirkung der scotistischen Formaldistinktion. Für die substantiale Verschiedenheit und objektive Realität der Erkenntnisinhalte ist nur ihre Trennbarkeit, aber nicht reale Getrenntheit erforderlich, die zumindest Gott ohne Widerspruch hätte bewirken können. So ist der Mensch zwar real die Einheit von zwei Substanzen. Doch es ist dies nur eine kontingente Einheit, sofern die eine Substanz nicht notwendig mit der anderen Substanz verbunden ist. Da ein echter Dualismus zweier Substanzen nur eine kontingente Einheit erlaubt, ist der Mensch zwar die von Gott gewollte Einheit der Substanzen Körper und Geist, die jedoch von sich her nur akzidentell auf einander bezogen sind. Descartes hatte jedenfalls Veranlassung seinem Schüler Henricus Regius in einem Brief dringend zu raten, bei jeder Gelegenheit öffentlich zu bekunden, „daß du glaubst, der Mensch sei ein wahres ens per se, nicht ein ens per akzidens, und der Geist sei real und substantiell mit dem Körper vereint.“38 Allerdings ist ein bloßes Versichern der realen Einheit kein tragfähiges Argument, wenn das vorausgesetzte Unterscheidungsprinzip der Formaldistinktion einer solchen Einheit per se die Begründung entzieht.
2.2 Locke: Differenz von Mensch und Person Wie Descartes beruft sich auch Locke für die Unterscheidung des Mentalen vom Körperlichen sowohl auf die Verschiedenheit der Sachgehalte – different ideas – wie auf den unterschiedlichen Gewissheitsgrad unserer Erkenntnisquellen und deren korrespondierender Objekte. „Denn während ich durch Sehen, Hören usw. erkenne, daß außer mir ein körperliches Wesen, das Objekt jener Wahrnehmung – sensation – , besteht, erkenne ich mit noch größerer Sicherheit, daß in mir ein geistiges Wesen ist, das sieht und hört.“39 Das Körperliche und das Geistige sind nicht bloß der erkannten Sache nach, sondern auch in ihrem Gewissheitsgrad nach objektiv verschieden. 38 Descartes, Bd. 3: Correspondance, S. 493; zitiert nach Dominik Perler, René Descartes, München ²2006, S. 213. Hervorhebungen im Original. 39 John Locke, Versuch über den menschlichen Verstand, Hamburg 1981, Bd. 1, S. 380; engl. An essay concerning human understanding, hg. v. Peter H. Nidditch, Oxford 1975, II, 23, § 15, S. 306. Hervorhebung von mir.
186
Berthold Wald
Sofern zwischen objektiv verschiedenen Sachgehalten kein definitorischer Zusammenhang besteht, bestreitet Locke die notwendige Identität zwischen dem Sein als Mensch und dem Sein als Person. Dann gibt es auch keinerlei Gewissheit darüber, ob eine bestimmte Person mit einem bestimmten Menschen nicht bloß faktisch identisch ist. Wir wissen nämlich nicht mit Bestimmtheit, was die substantielle Identität des Menschseins begründet, und folglich auch nicht, was ein personales Selbst mit diesem menschlichen Individuum verbindet. Erfahrungszugang haben wir nur in zwei unterschiedlichen Bereichen: Zum einen sind uns die Eigenschaften der Körperdinge durch Vermittlung der äußeren Sinne gegeben, während die zugrundeliegende Substanz als Träger dieser Eigenschaften lediglich hinzugedacht wird: „Unsere Idee der Substanz … ist nur etwas, ich weiß nicht was, das angenommen wird, um die Ideen, die wir Akzidentien nennen, zu tragen.“40 Zum anderen kennen wir mittels des inneren Sinns nur unsere eigenen Bewusstseinszustände. Locke definiert den Personbegriff dann in einer Weise, die auf den ersten Blick wie eine Präzisierung der frühmittelalterlichen Persondefinition des Boethius aussehen mag, tatsächlich aber eine grundsätzliche, erkenntnistheoretisch begründete Abkehr vom substanzontologischen Personbegriff impliziert. Der Ausdruck ‚Person‘ steht zwar für „a thinking intelligent Being, that has reason und reflection, and can consider it self as it self, the same thinking thing in different times and places.“41 Doch die an Boethius erinnernde Bezugnahme auf ein ‚intelligentes Wesen‘ beziehungsweise ein ‚denkendes Ding‘ impliziert bei Locke gerade keine Substanzannahme mehr, da das Sein der Person ausschließlich in der Bewusstheit bestehen soll, die untrennbar mit den Akten des Denkens verbunden ist: „only by that consciousness, which is inseparable from thinking“.42 Locke lässt den Substanzbegriff nicht einmal als Seinsprinzip des menschlichen Individuums gelten, geschweige denn im Hinblick auf die ontologische Grundlegung der Person. „Denn ‚dieselbe Substanz sein‘, ‚derselbe Mensch sein‘ und ‚dieselbe Person sein‘ sind drei ganz verschiedene Dinge, da Person, Mensch und Substanz Bezeichnungen für drei verschiedene Ideen sind.“43 Das Kriterium der Identität von Personen fällt so mit dem Kriterium der Selbstbewusstheit zusammen, sofern das Bewusstsein des je eigenen Selbst das Sein von Personen nicht bloß anzeigt, sondern unmittelbar konstituiert. „Personal identity consists not in the identity of
40 Ebd. 41 Locke, An essay concerning human understanding, a. a. O., II, 27, § 9; S. 335. 42 Ebd. 43 Locke, Versuch über den menschlichen Verstand, Bd. 1, S. 416; Ders., Essay, II, 27, § 7; S. 332. Hervorhebung im Original.
Zur Metaphysik der Person
187
substance, but … in the identity of consciousness.“44 „Denn wenn die Identität des Bewußtseins es bewirkt, daß jemand ein und derselbe ist, so beruht die Identität der Person offenbar allein hierauf.“45 Der Umfang des bewusstseinstheoretischen Personbegriffs ist damit enger und weiter zugleich als im substanzontologischen Begriff der Person des Mittelalters. Er ist enger, weil das Menschsein nicht schon das Selbstsein der Person impliziert. Nicht die menschliche Natur, auch nicht ein Bewusstseins‚vermögen‘, sondern allein die erinnerte wie antizipierte Abfolge bewusster ‚Akte‘ der Selbstwahrnehmung konstituiert das Sein der Person, die sich als sie selbst erfasst. Der schlafende Sokrates ist dann als Person nicht bloß verschieden vom wachenden Sokrates; er ist strenggenommen keine Person, solange er schläft. Der Umfang des bewusstseinstheoretischen Personbegriffs ist andererseits weiter, insofern alles, was ein Selbstbewusstsein hat, auch Person genannt werden kann, gleichgültig, wer oder was jetzt oder künftig als Inhaber dieses Bewusstseins auftreten mag: Tiere ebenso wie intelligente Maschinen. Der menschliche Leib ist für das Sein der Person nicht konstitutiv. Leiblichkeit ist darum nur eine Raum-Zeit-Stelle, an der sich eine Person erfährt. Von außen, aus der Beobachterperspektive, kann nicht einmal gesagt werden, ob mit diesem Leib eine Person gegeben ist, oder nur ein Automat, der das Verhalten einer Person simuliert.
3
Gegenwärtige Personkonzepte: reiner Moralbegriff und fließende Identität
Einige, nicht alle gegenwärtigen Persontheorien nehmen explizit Bezug auf die ‚Klassiker‘ der neuzeitlichen Persontheorien, sofern damit der substanzontologische Personbegriff aus dem Spiel ist und wir freie Bahn zu haben scheinen, Personalität zu definieren in Abhängigkeit von unseren Interessen.46 Ich werde mich auf zwei Positionen beschränken und eine dritte nur andeutungsweise skizzieren. 44 Locke, An essay concerning human understanding, II, 27, § 19; S. 342. Hervorhebung im Original. Vgl. auch Locke, Versuch über den menschlichen Verstand, Bd. 1, Kap. 27, S. 425: „Die Identität der Person erstreckt sich also nicht weiter als das Bewußtsein.“ Locke, An essay concerning human understanding, II, 27, § 14, S. 339. 45 Locke, Versuch über den menschlichen Verstand, Bd. 1, S. 421; Ders., An essay concerning human understanding, II, 27, § 10, S. 336. 46 Selbstverständlich gibt es auch moderne Weiterführungen des Personbegriffs auf der Linie von Thomas von Aquin, deren bedeutenste Karol Wojtyła vorgelegt hat: vgl. Karol Wojtyła, Person und Tat, Freiburg, Basel u. Wien 1982; ferner Ders., Betrachtungen über
188
3.1
Berthold Wald
Person als reiner Moralbegriff: eine Aktualisierung von Locke
In einem Artikel mit dem Titel Abortion and Infanticide47 hatte der amerikanische Philosoph Michael Tooley im Zusammenhang mit der in Amerika und Europa geführten Abtreibungsdiskussion den Versuch unternommen, auf der Basis des von Locke definierten Personbegriffs „eine vollständig liberale Position zur Abtreibung zu formulieren“.48 Die in Anlehnung an die Persontheorie John Lockes zu entscheidende Frage lautet für ihn: „Trifft es wirklich unzweifelhaft zu, dass neugeborene Babys Personen sind?“49 Das Wort ‚unzweifelhaft‘ ist im Text gesperrt gedruckt. Schon die Hervorhebung des möglichen Zweifels macht klar, dass es von dem vorausgesetzten Personbegriff abhängt, ob unsere gewöhnliche Auffassung, der zufolge Kinder und Neugeborene selbstverständlich Personen sind, gut begründet ist. Normalerweise sind wir ja bereit, eine bestimmte Voraussetzung als selbstverständlich zu akzeptieren, die jedoch „nicht vorteilhaft“50 für eine ‚liberale Position‘ sein kann. Diese Voraussetzung besteht in der „Tendenz, Ausdrücke wie ‚Person‘ und ‚menschliches Wesen‘ synonym zu gebrauchen“.51 Und wie wir bereits wissen, liefert die substanzontologische Auffassung menschlicher Personalität die stärkste Rechtfertigung für diesen Sprach- und Denkgebrauch. Nun kommt auch Tooley nicht darum herum anzuerkennen, dass Kinder vor ihrer Geburt erwiesenermaßen ebenso menschliche Wesen sind, wie Kinder nach ihrer Geburt, und dass Kinder sich von erwachsenen Menschen nur in ihrem Entwicklungsstadium, aber nicht in ihrem Menschsein unterscheiden. Die für Tooley entscheidende Frage ist jedoch, ob menschliche Embryonen und Kinder nach ihrer Geburt auch Personen sind. Was es zu klären gilt, ist folglich die Frage, wodurch das Wesen des Menschen, hg. v. Hanns-Gregor Nissing, München 2017, sowie Ders., Was ist der Mensch? Skizzen zur Anthropologie, hg. v. Hanns-Gregor Nissing, München 2011. 47 Michael Tooley, Abortion and Infanticide, in: Philosophy and Public Affairs 2.1 (1972) S. 37-65; dt. Abtreibung und Kindstötung, in: Um Leben und Tod. Moralische Probleme bei Abtreibung, künstlicher Befruchtung, Euthanasie und Selbstmord, hg. v. Anton Leist, Frankfurt am M. 1990, S. 157-195. Ein Buch Michael Tooleys mit demselben Titel folgte Oxford 1983. Entscheidend beigetragen zur Verbreitung dieser Ansichten hat jedoch erst Peter Singer, der sich in seinen wichtigsten Thesen – zum Speziesismus und Personbegriff, zum Verhältnis von Abtreibung und Kindstötung – ausdrücklich auf Tooley bezieht; vgl. Peter Singer, Praktische Ethik, Stuttgart 1984, S. 113 ff., S. 168-173. 48 Tooley, Abtreibung und Kindstötung, a. a. O., S. 157. 49 Ebd., S. 161. Hervorhebung im Original. 50 Ebd. 51 Ebd., S. 160.
Zur Metaphysik der Person
189
ist der Mensch Person? Diskussionsfähig sind für Tooley nur zwei Positionen, die zu gegensätzlichen Konsequenzen führen, und die sich unschwer als die klassische substanzontologische Persontheorie auf der einen und die von Locke begründete eigenschaftsontologische Persontheorie auf der anderen Seite unterscheiden lassen. Es hängt so von der vorausgesetzten Persontheorie ab, ob die unbedingte Geltung des Tötungsverbots prinzipiell für alle Menschen gleichermaßen gilt, oder aber, ob das Tötungsverbot Einschränkungen erlaubt mit weitreichenden Folgen. Die biologische Artgleichheit aller Menschen ist jedoch für Tooley nur dann ein Argument für die Unteilbarkeit der menschlichen Würde und des Rechts auf Leben, wenn eine reale Identität von Mensch und Person besteht. Unter dieser Voraussetzung kann es keinen Unterschied im Lebensrecht von menschlichen Föten, Neugeborenen und Erwachsenen geben. Und weil die Artgleichheit außer Zweifel steht, hängt eine konsistente Rechtfertigung der liberalen Interessenlage vor allem daran, die ontologische Verschiedenheit von Menschen und Personen zu behaupten. An dieser Stelle bringt Tooley den Personbegriff Lockes ins Spiel, der ‚different ideas‘ von Mensch und Person schon als hinreichend dafür ansieht, die Nichtidentität von Menschsein und Personsein zu behaupten. Beide Ausdrücke bedeuten ja in der Tat nicht ganz dasselbe. Daraus meint Tooley mit Locke schließen zu können, dass auch die Identitätsbedingungen für Menschsein und Personsein nicht dieselben sind. Die Identität als Mensch sei biologisch zu definieren durch die allgemeine Artzugehörigkeit, während die Identität als Person zu definieren sei durch das Vorhandensein bestimmter Eigenschaften. Die für die Zuschreibung von Personalität erforderlichen Eigenschaften sind wie schon bei Locke selbstbezogene Bewusstseinseindrücke – ein Selbst zu haben – und ein zukunftsorientiertes Selbstverhältnis – Wünsche zu haben – . Diese Eigenschaften werden jedoch erst einige Zeit nach der Geburt ausgebildet und sind an die Fähigkeit zur Selbstreflexion gebunden. Wo diese Eigenschaften nicht oder nicht hinreichend vorhanden sind, haben wir es zwar mit Menschen, aber nicht mit Personen zu tun. Embryonen, Kinder im ersten Lebensjahr, aber auch geistig Behinderte und Demenzkranke, sind dann keine Personen beziehungsweise sind es nicht mehr. Sie haben insofern auch kein uneingeschränktes Recht auf Leben, das Tooley nur Personen zugestehen will.52
52 Singer, Praktische Ethik, a. a. O., S. 134 f., hat diese Auffassung Tooleys noch radikalisiert, wenn er behauptet, dass in Abhängigkeit von den genannten personkonstitutiven Eigenschaften „manche Angehörigen anderer Gattungen … Personen – sc. sind – : manche Angehörigen unserer eigenen Gattung sind es nicht. … So scheint es, daß etwa die Tötung eines Schimpansen schlimmer ist als die Tötung eines schwer geistesgestörten Menschen, der keine Person ist.“
190
Berthold Wald
Dieser explizit im Anschluss an John Locke formulierte Personbegriff soll der Rechtfertigung dienen, „Quasipersonen“53, die gleichwohl Menschen sind, unter bestimmten Umständen töten zu dürfen, und zwar gleichermaßen dann, wenn ein überwiegendes – eigenes wie fremdes – Interesse an ihrem Tod besteht.54 Tooleys Vorschlag, den Ausdruck ‚Person‘ nicht ontologisch, sondern wegen seiner Nützlichkeit für die Rechtfertigung von Abtreibung und Euthanasie als „reinen Moralbegriff“55 zu verwenden, ist allerdings nur eine Frage der Etikettierung und philosophisch unerheblich. Philosophisch erheblich ist allein die Frage, ob der von Tooley für seine moralphilosophische Agenda wiederbelebte eigenschaftsontologische Personbegriff Lockes in sich konsistent ist oder nicht. Und daran gibt es erhebliche Zweifel, wie wir gleich sehen werden. Das bedeutet freilich nicht, dass die eigenschaftsontologische Persontheorie über den Bereich der philosophischen Kritik hinaus wirkungslos geblieben ist. So zielen im Bereich der so genannten ‚reproduktiven Gesundheit‘ einzelne Beschlüsse der Vereinten Nationen, der europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten darauf ab, die Unteilbarkeit der Menschenrechte an einschränkende Bedingungen zu knüpfen, um ein allgemeines Menschenrecht auf Abtreibung und Euthanasie zu begründen.56 Dies soll dadurch erreicht werden, dass zwischen ‚Personwürde‘ und ‚Menschenwürde‘ zu unterscheiden ist, um die Unteilbarkeit der Menschenrechte an den Personstatus zu binden. Die ‚Würde‘ der Person wird dann nicht mehr ungeteilt allen Menschen zukommen, sondern nur Menschen unter einer bestimmten Beschreibung, nämlich bei Vorliegen der erforderlichen Eigenschaften. Das Ziel ist klar: Künftig sollen Menschen nur dann unveräußerliche Recht haben, wenn sie Personen sind.57
53 Tooley, Abtreibung und Kindstötung, a. a. O., S. 192. 54 Unter dieser Voraussetzung wäre auch die experimentelle Manipulation – ohne therapeutischen Nutzen für die Betroffenen selbst – zu rechtfertigen, wenn sie an sozial isolierten Nicht-Personen im Interesse eines dringend erwünschten, aber sonst kaum erreichbaren medizinischen Fortschritts zur künftigen Behandlung von Personen vorgenommen wird. 55 Tooley, Abtreibung und Kindstötung, a. a. O., S. 159 ff. 56 Papst Johannes Paul II., Evangelium vitae, Enzyklika v. 25. März 1995, 50, sah in dieser Perversion der Menschenrechte die deutlichsten Anzeichen einer ‚Kultur des Todes‘. 57 Vgl. Berthold Wald, Menschenwürde und Menschenrechte. Unverzichtbarkeit und Tragweite naturrechtlicher Begründungen, in: Naturrecht und Kirche im säkularen Staat, hg. v. Hanns-Gregor Nissing, Wiesbaden 2016, S. 53-74.
Zur Metaphysik der Person
3.2
191
Person ohne Identität: eine Aktualisierung der Kritik an Locke
Abgesehen von dem offenkundig wahrheitsindifferenten Interesse, eine beliebige, für die liberale Agenda passende Begründung zu suchen, stellt sich aber doch die Frage, ob der für das liberale Projekt der Emanzipation vorteilhafte eigenschaftsontologische Personbegriff sich überhaupt als konsistent ausweisen lässt. Die Hauptschwierigkeit einer Ontologie, die an Stelle von Substanzen auf empirisch feststellbare Eigenschaften rekurriert, ergibt sich in der Frage der Identität. Diese Schwierigkeit ist immer dieselbe, ganz unabhängig davon, ob es sich dabei um materielle oder mentale Eigenschaften handelt: Damit wechselnde Eigenschaften die Eigenschaften von etwas Bestimmtem sein können, ist ein unveränderlicher Bezugspunkt vorausgesetzt. Andernfalls geht alles ineinander über, und nur der Wandlungsprozess selbst, aber nicht das darin sich Wandelnde hätte eine bestimmbare Substantialität. Eine bemerkenswerte Diskussion dieser Schwierigkeit findet sich bereits im platonischen Symposion und zwar sowohl mit Bezug auf eine – modern ausgedrückt – materialistische Prozessontologie, wie sie von Heraklit vertreten wurde, als auch mit Bezug auf immaterielle Bewusstseinsprozesse. Nicht bloß die Diskontinuität materieller Prozesse, sondern ebenso die Prozessuralität und Diskontinuität von introspektiv zugänglichen Vorstellungsinhalten lässt nirgends einen festen Bezugspunkt erkennen, der Halt und Orientierung verleihen könnte. Wir bemerken vielmehr, „daß auch die Erkenntnisse nicht nur teils entstehen, teils vergehen und wir nie dieselben sind in Bezug auf die Erkenntnisse, sondern daß auch jeder einzelnen Erkenntnis dasselbe begegnet“.58 Platon sieht auch bereits das Problem, in der erinnernden Vergegenwärtigung vergangener Bewusstseinsinhalte ein täuschungsfreies Kriterium für die Identität der Person zu besitzen, da vergangene Bewusstseinsakte als erinnerte nur innerhalb des gegenwärtigen Bewusstseinshorizontes gegeben sind und also auch vom gegenwärtigen Bewusstsein neu hervorgebracht sein können. In dem Fall wären es dann nur scheinbar dieselben Bewusstseinsakte der scheinbar selben Person, weil die Introspektion über kein Kriterium verfügt, erinnerte Gehalte des Bewusstseins von gegenwärtigen Bewusstseinsinhalten zu unterscheiden. 59
58 Platon, Symposion, 208 a 1 ff. 59 Ebd., 208 a 4 ff.: „Denn was man nachsinnen heißt, geht auf eine ausgegangene Erkenntnis. Vergessen nämlich ist das Ausgehen einer Erkenntnis. Nachsinnen aber bildet statt der abgegangenen eine Erinnerung ein und erhält so die Erkenntnis, daß sie scheint, dieselbe zu sein“ – auten dokei einai. Hervorhebung von mir.
192
Berthold Wald
In ähnlicher Weise hatte Hume gegen Lockes introspektiv gesicherte Gewissheit eines Selbst argumentiert und dabei auch den Substanzbegriff der Schulmetaphysik zu Recht als ‚uneinsichtige Chimäre‘ abgetan. I diesem Zusammenhang wird leicht übersehen, dass seine Kritik vor allem dem Subjektbegriff gilt, der sich bei Locke zwar hilfsweise noch auf ein unbestimmbares Suppositum stützt, die Identität der Person jedoch in die Kontinuität von Bewusstseinseindrücken verlegt und das menschliche Individuum lediglich als das Suppositum versteht, dem diese Eigenschaften zuzuschreiben sind. 60 Dieses auch Locke selbst uneinsichtige Supposition vergleicht Hume mit einer Theaterbühne, auf der allerlei zu sehen ist, mit Ausnahme eines ‚Selbst‘. Was Locke dafür hält, ist aber nichts weiter als ein durch die Erinnerung zusammengefügtes „Bündel oder eine Sammlung unterschiedener Wahrnehmungseindrücke“.61Darum hält Hume den Disput um die Identität der Person auf dieser Basis nur für einen philosophisch unergiebigen Streit um Worte, mit Ausnahme der Fiktion oder der Behauptung eines eingebildeten Prinzips der Verbindung unserer Wahrnehmungsinhalte.62 Darüber lohnt es sich zu streiten. Und dieser Streit ist inzwischen wieder voll entbrannt, zum Teil wiederum auf der Linie der von Hume vorgebrachten Kritik. Radikale Reduktionisten wie Derek Parfit vertreten die Auffassung, dass es nur zwei Sichtweisen gibt, zwischen denen man wählen kann: für die einen, die Anhänger von Descartes und Locke, gibt es so etwas wie ‚separat existierende Entitäten‘ – das ‚Ego‘ im ‚ego cogito‘ oder das ‚Selbst‘ im Fluss der Wahrnehmungen. Und für die anderen, die wie Parfit den Standpunkt des Materialismus vertreten, gibt es nichts, was von unseren Gehirnen, Körpern und Erfahrungen verschieden wäre. Diese zweite Auffassung
60 Vgl. Humes kritische Anmerkungen über „personal identity, which has become so great a question in philosophy“, in: Hume, A Treatise of Human Nature, I, 4, 6, S. 259; Ausgangspunkt seiner Kritik im 6. Abschnitt des Ersten Buches – Of personal identity – ist ein Selbstverständnis der Person im Sinne der von Descartes und Locke vertretenen subjektiven Gewissheit, ein Selbst zu sein: vgl. ebd., S. 251: „There are some philosophers, who imagine we are every moment intimately concious of what we call our SELF.“ Hervorhebung im Original. Hume hält dieser Auffassung entgegen, dass die Identität der Person grundsätzlich nicht über die Akte der Selbstreflexion zu begründen ist; vgl. ebd., I, 4, 3, S. 222: „Every quality being a distinct thing from another, may be conceiv’d to exist apart and may exist apart, not only from every other quality, but from that unintelligible chimera of a substance.“ 61 Ebd., S. 252: „nothing but a bundle or collection of different perceptions, which succeed each other with an inconceivable rapity, and are in a perpetual flux and movement.“ 62 Ebd., S. 262: „All the disputes concerning the identity of connected objects are merely verbal, except so far as the relation of parts give rise to some fiction or imaginary principle of union.“
Zur Metaphysik der Person
193
hält Parfit für zutreffend.63 Der Reduktionist räumt zwar ein, dass es zulässig sei, von Personen als Subjekt von Erfahrungen zu sprechen, bestreitet jedoch „that the subject of experiences is a separately existing entity, distinct from a brain and body, and a series of physical and mental events.“64 Wenn einerseits die Identität unserer Person nicht auf der Identität ihrer materiellen Zusammensetzung beruhen kann und andererseits solche chimärischen Entitäten wie das cartesianische ‚Ego‘ oder das Lockesche ‚Self‘ als Subjekt der Erfahrung nicht nachweisbar sind, dann sollten wir unsere diesbezüglichen Überzeugungen aufgeben und Personen wie ‚clubs‘ – so Hume – oder ‚political parties‘ – so Robert Nozick – betrachten.65 Für solche Dinge gibt es keine durchgehende Identität, sondern nur Relationen zwischen einzelnen Phasen – mit unterschiedlichen Mitgliedern. Jeweils heute dieselbe Partei oder dieselbe Person einer vergangenen Phase zu sein, heißt dann „to be that thing’s closest continuer … The present person whom we judge to be this past person is the present person who has the greatest continuity with this past person.“66 Erinnerung stellt nur den Bezug auf ihren unmittelbaren Vorgänger her und verleiht der Person auch nur eine psychologische Kontinuität, aber keine reale Identität; die Gesamtheit der Personenfolge hat also kein Bewusstsein ihrer selbst: „This bundle of elements is void of Self.“67Damit sind wir heute ziemlich genau da wieder angekommen, wo uns Platon und Hume in ihrer Kritik der materialistischen wie mentalistischen Prozessontologie abgesetzt haben.
63 Derek Parfit, Reasons and Persons, Oxford 1984, S. 273: „On one view, we are separately existing entities, distinct from our brains and bodies and our experiences, and entities whose existence must be all-or-nothing. The other view is the Reductionist View. And I claim that, of these, the second view is true.“ 64 Ebd., S. 223. 65 Ebd., S. 277, S. 477. 66 Ebd., S. 477. 67 Ebd., S. 502 – im letzten Abschnitt der Anhänge unter der Überschrift Buddha’s view. Damit endet das Buch! Das war allerdings schon Johann Gottlieb Fichtes Einsicht, wenn er den unendlichen Prozess der Selbstvergewisserung als Aufhebung aller Gewissheit um das eigene Selbst verstand; vgl. Johann Gottlieb Fichte, Versuch einer neuen Darstellung der Wissenschaftslehre, 1797, in: Fichtes Werke, hg. v. Immanuel Hermann Fichte, Neudr. Berlin 1971, Bd. 1, S. 526: „Wir werden sonach ins Unendliche fort für jedes Bewußtsein ein neues Bewußtsein bedürfen, dessen Objekt das erstere sei und sonach nie dazu kommen, ein wirkliches Bewußtsein annehmen zu können.“
194
3.3
Berthold Wald
Person als synthetisches Konstrukt mit fließender Identität: Cyborg und Gender
Kennzeichnend für den gegenwärtigen Diskurs über die Person ist eine Sichtweise der menschlichen Person, die auf die völlige Auflösung des Personbegriffs hinausläuft. Personen sind nichts irgendwie Gegebenes, weder substantial als leibhaftige Menschen noch reflexiv als davon ontologisch zu unterscheidende Subjekte. Personen sind nichts weiter als ein synthetisches Konstrukt mit fließender Identität. Davon soll zum Schluss noch kurz die Rede sein. Der Begründungskontext dieser Auffassung geht natürlich weit über die Frage nach dem Sein von Personen hinaus und reicht zurück bis in die frühe Phase der positivistischen Metaphysikkritik. Das Verbindende des Positivismus mit späteren Formen der Metaphysikkritik ist der Anti-Essentialismus, der heute vornehmlich in Gestalt des Konstruktivismus das Feld beherrscht. Ich zitiere Richard Rorty, der dem Konstruktivismus in der amerikanischen wie in der kontinentalen Philosophie zum Durchbruch verholfen hat. Rorty schreibt: „Autoren wie Goodman, Putnam und ich selbst – … – sc. denken, dass – es kein beschreibungsunabhängiges So-Sein der Welt, kein So-Sein unter keiner Beschreibung gibt.“68 Ludwig Wittgensteins Sprachspielmodell des Weltverstehens ist diesen Philosophen noch zu statisch und zu eng. Die Beschreibungsabhängigkeit unseres Wissens von der Wirklichkeit beruht für Rorty nicht allein auf vorgegebenen Sprachspielen, sondern auf der sozialen Konstruktion unserer Begriffe. Als sozial konstruiert gelten ihm nicht bloß die Beschreibungen der Welt, sondern auch die Tatsachen selbst. Ein solcher Tatsachenkonstruktivismus lässt definitiv keinen Raum mehr für die Beschreibungsabhängigkeit der Realität. Es gibt keine ‚Dinge an sich‘. Nicht bloß unserer Begriffe, sondern auch sogenannte ‚Tatsachen‘ wie Berge, Giraffen, der Heliozentrismus und selbstverständlich auch Personen, der menschliche Leib, Mann und Frau – alles das ist nicht bloß in seiner Bedeutung, sondern schon in der Wahrnehmung sozial konstruiert. Bezogen auf die Frage nach dem Sein von Personen lässt sich das in folgenden Punkten deutlich erkennen: in der Negation der Leiblichkeit als einer vorgegebenen Verfassung menschlicher Personalität, in der Negation der Geschlechterdifferenz von Mann und Frau, schließlich und beides zusammengenommen, in der Behauptung einer fließenden Identität.69 Ich beschränke mich auf die Negation der Leiblichkeit. 68 Richard Rorty, Wahrheit und Fortschritt, Frankfurt am M. 2000, S. 128. 69 Vgl. dazu Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz, Fließende Identität? Gender – eine Theorie auf dem Prüfstand, in: Dies., Frau – Männin – Menschin. Zwischen Feminismus und Gender, Kevelaer 2016, S. 168-200.
Zur Metaphysik der Person
195
Leib wird dabei auf Körper reduziert, der als kulturelles Artefakt zu unserer Verfügung steht, und die biologisch vorgegebene Sexualität wird auf ‚Gender‘ als frei wählbares soziales Geschlecht reduziert. Weil es gemäß dieser Auffassung keine natürlichen Körper gibt, ist es auch nicht widernatürlich, den menschlichen Körper zu verändern, etwa durch chirurgische und chemische Geschlechtsumwandlung wie auch mit Hilfe synthetischer Verfahren und einer darauf beruhenden Neuprogrammierung seiner Funktionen. Der dafür von feministischer Seite eingeführte Begriff Cyborg – das meint: Cyber-Organismus – mag einstweilen noch wenig Realität besitzen. Aber die damit verbundene Intention ist klar: sie zielt auf einen Transhumanismus, für den der natürliche Mensch lediglich das Material und die Vorstufe ist. Die Verbindung dieser Auffassungen zu den neuzeitlichen Persontheorien ist leicht zu sehen, am deutlichsten in der Auffassung des Körpers als veränderbarem kulturellem Artefakt. Schon für Descartes ist der menschliche Körper ein ausgedehntes Ding mit unterschiedlichen Funktionen. Der lebendige Körper ist nicht Leib, sondern Maschine, die durch die Natur programmiert ist und die heute durch den Menschen umprogrammiert werden soll. In diesem mechanistischen Paradigma sind alle späteren Entgrenzungen natürlicher Eigenschaften der menschlichen Person bereits angelegt. Die anti-essentialistische Behauptung einer fließenden Identität wiederum ist unschwer in Verbindung zu bringen mit der ontologischen Leerstelle einer lediglich bewusstseinstheoretisch oder eigenschaftsontologisch begründeten Personalität. Schon Platon hatte, wie erwähnt, den Finger auf diese Leerstelle gelegt. Und wo dies heute geschieht, steht die Kritik am Begriff personaler Identität in der Nachfolge von Hume. „Die Kehrseite der reflexiven Setzung – sc. des Subjekts – ist der mit ihr einhergehende ontologische Freiraum, der Begriff und Philosophie der Person wie ein Schatten folgt.“70 Die im Bemühen um eine Erneuerung der „Philosophie der Person“ festgestellte „semantische Lücke im Begriff der Person“71 ist jedoch vor allem eine ontologische Lücke, die anfällig macht für die Kritik des Reduktionismus. Es ist darum nicht mit ad hoc eingeführten, sich ergänzenden Perspektiven zur Wiedergewinnung eines umfassenden Verständnisses menschlicher Personalität getan.72 Was nottut, ist eine Rehabilitierung der unter den Bedingungen spätmittelalterlicher Metaphysik-Vergessenheit missdeuteten substanzontologischen Begründung menschlicher Personalität. 70 Dieter Sturma, Philosophie der Person. Die Selbstverhältnisse von Subjektivität und Moralität, Paderborn, München, Wien u. Zürich 1997, S. 56. 71 Ebd., S. 56. 72 Ebd., S. 359, These 47: „Die Identität der Person vollzieht sich in ontologischen, epistemologischen, epistemischen und moralischen Kontexten“.
Mensch und Gottmensch Simon L. Franks Philosophie des Wir Peter Ehlen
Der Inhalt des philosophische Systems Simon L. Franks lässt sich mit dem Begriff WIR zusammenfassen. Als Grundbegriff der Sozialphilosophie untersucht Frank das Wir in seinem Werk Die geistigen Grundlagen der Gesellschaft, veröffentlicht 1930 in Paris in russischer Sprache.1 Auch seine Werke zur Religionsphilosophie und zur Metaphysik – Das Unergründliche2 und Die Realität und der Mensch3 – , gleichfalls in der Emigration in Paris veröffentlicht, haben unter je anderer Rücksicht die Einheit des Wir zum Thema. Die Umbrüche des 20. Jahrhunderts bilden den Hintergrund der Reflexion Franks. Dazu gehört in erster Linie die unmittelbare Erfahrung der durch den Ersten Weltkrieg ermöglichten Revolution der Bolschewisten, weiter der darauf folgende Bürgerkrieg und die Hungersnot in Russland, die aufgezwungene Emigration und die Lebensgefahr des jüdisch-christlichen Philosophen im nationalsozialistischen Deutschland, schließlich die Flucht nach Frankreich und der Zweite Weltkrieg. Nach Kriegsende fand Frank Zuflucht in England, wo er 1950 starb. 1918 hatte Frank mit elf Gesinnungsfreunden eine erste Analyse der Katastrophe unternommen, die mit der Revolution über Russland hereingebrochen war. Ihr Titel De Profundis ging auf seinen Beitrag zurück. Frank knüpfte mit ihm nicht nur an die Klage des Psalmisten an; er enthielt für ihn auch die Verpflichtung, von der Tiefe her, ‚de profundis‘, zu erforschen, weshalb das Ziel der Revolutionäre, ein gerechtes menschliches Zusammenleben zu begründen, so nachhaltig verfehlt 1 Simon L. Frank, Die geistigen Grundlagen der Gesellschaft. Einführung in die Sozialphilosophie, Freiburg im Br. u. München 2002. 2 Simon L. Frank, Das Unergründliche. Ontologische Einführung in die Philosophie der Religion, Freiburg im Br. u. München 1995. 3 Simon L. Frank, Die Realität und der Mensch. Eine Metaphysik des menschlichen Seins, Freiburg im Br. u. München 2004. © Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv lizenziert durch Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2020 C. Böhr (Hrsg.), Metaphysik, Das Bild vom Menschen und die Ordnung der Gesellschaft, https://doi.org/10.1007/978-3-658-31593-1_12
197
198
Peter Ehlen
wurde. Die Philosophie, die ihrem Plan zugrunde lag, missachtete die Freiheit und rechtfertigte unter der Vorspiegelung geschichtlicher Notwendigkeit die Gewalt. Frank sah sich herausgefordert, diesen Irrglauben durch eine Philosophie der freien Verantwortung, die ihre Begründung im Sein des Menschen hat, zu überwinden. Die Auseinandersetzung mit Immanuel Kant und die fruchtbare Begegnung mit dem Neuplatonismus hatten ihn zu der Erkenntnis geführt, dass das „einzige Tor“, durch das wir das Sein erreichen, sich in unserem „unmittelbaren Selbstsein“ öffnet.4 Damit war die entscheidende Weichenstellung vollzogen. Schon René Descartes hatte auf der unumstößlichen Gewissheit des Selbstseins seine Philosophie aufgebaut. Mit seiner Auffassung vom Ich als einer Substanz hatte er sich jedoch den Zugang zum anderen Ich verbaut und der Neuzeit die philosophische Rechtfertigung des Individualismus geliefert. Gegenüber der von Descartes etablierten „Ich-Philosophie“ sei „entschieden und radikal eine ‚Wir-Philosophie‘“ zu begründen, schrieb Frank 1925.5 Diese Wir-Philosophie, so seine Forderung, müsse den „primär-ursprünglichen Charakter der Gemeinschaft und ihre unmittelbare ontologische Evidenz“ aufweisen. Zum philosophischen Grund, auf dem er dieses Projekt ausführte, gehörten die bahnbrechenden Einsichten Edmund Husserls. Dessen Untersuchungen zur Phänomenologie der inneren Erfahrung waren Meilensteine für Franks eigene philosophische Entwicklung. Kritische Sympathie erfuhren die Dialogphilosophie sowie Henri Bergsons Lebensphilosophie. Nicht zuletzt hat Martin Heideggers Werk Sein und Zeit Franks eigenes fundamentalontologisches Denken angeregt. Zugleich aber sah er in Heideggers Auffassung vom Verhältnis Welt – Gott die zentrale kritische Herausforderung an sein eigenes Denken. In dieser für jede Metaphysik entscheidenden Frage hat Frank, wie er mehrmals bekannte, nur einen wirklichen Lehrer gefunden: Nikolaus von Kues.
Der sozialphilosophische Aspekt des Wir-Seins Eine Gesellschaft – sei es eine Familie, eine Partei oder eine politische Union – ist, wie die phänomenologische Analyse zeigt, mehr als eine Ansammlung von Individuen. Sie ist eine Einheit. Doch was verbindet die Individuen zur Einheit? Ist es die bei der Gründung der Gesellschaft vereinbarte Satzung oder der sie bestätigende 4 Frank, Das Unergründliche, a. a. O., S. 334. 5 Simon L. Frank, ‚Ja‘ i ‚My‘, in: Festschrift für Peter B. Struve, Prag 1925; dt. ‚Ich‘ und ‚Wir‘. Zur Analyse der Gemeinschaft, in: Der Russische Gedanke. Internationale Zeitschrift für russische Philosophie, Literaturwissenschaft und Kultur 1 (1929/30) S. 49-62.
Mensch und Gottmensch
199
Vertragsabschluss? Sind die Individuen durch die Zusammenkünfte an einem bestimmten Versammlungsort zur Einheit verbunden? Zweifellos gehören die sichtbaren Organisationsformen zu einer Gesellschaft, aber sie sind nicht die Einheit ihrer Mitglieder. Besteht die Einheit im Geflecht der wechselseitigen Sympathien zwischen den Mitgliedern und in der Gleichartigkeit ihres Denkens? Auch hier gilt, dass ohne gemeinsame Gefühle und Bewusstseinsinhalte keine Gesellschaft bestehen kann; aber jedes Individuum besitzt sie je für sich; sie sind nicht die Einheit. Auch der Allgemeinbegriff ‚Partei‘, ‚Familie‘, ‚Ehe‘ und so weiter verbindet die Glieder nicht zu einer Einheit; er bezeichnet diese nur. Für Frank ist die Einheit einer Gesellschaft eine geistige Wirklichkeit. Er nennt sie die Einheit des ‚Wir‘. Nicht anders als die Organisationsformen hängt auch sie vom Willen ihrer Glieder ab. Sie kann nur solange bestehen, als diese den Sinn und Zweck ihrer Vereinigung, also ihr spezifisches ‚Wir‘, bejahen. Dazu gehört, dass sie einander in der Erreichung ihres Zwecks beistehen und bereit sind, dazu einander ein Mindestmaß an Vertrauen zu erweisen. Was für eine Ehe unmittelbar einleuchtet, gilt auch für eine Partei und eine politische Union. Auch sie können nur bestehen, solange ihre Mitglieder, ungeachtet aller gegenseitigen Rivalität, ihre Wir-Einheit wollen. Weil die psychische und die geistige Wirklichkeit des Menschen einander bedingen, würde das Absterben der wechselseitigen Sympathie auch die geistige Einheit des Wir aushöhlen und ihr letztlich den Boden entziehen. Jede menschliche Gesellschaft besitzt also zwei Seinsschichten, die sich durchdringen, aber wesentlich unterscheiden: Eine empirische und eine geistige Wirklichkeit.
Die geistige Seinsweise des Wir Gehen wir mit Frank noch einen Schritt weiter, um die geistige Seinsweise der WirEinheit zu verstehen. Frank knüpft an der erkenntnistheoretisch diskutierten Frage an, wie die Existenz eines fremden Bewusstseins bewiesen, wie also der Solipsismus überwunden werden kann, ohne das zu beweisende fremde Bewusstsein vorauszusetzen. Seine hier grundlegende Einsicht besagt, dass das lebendige personale Ich nicht mit dem Erkenntnissubjekt, das einem eigenschaftslosen Punkt gleicht, identisch ist. Würde das Ich auf das Erkenntnissubjekt reduziert, könnte ihm alles andere, auch das andere Bewusstsein, nur als Objekt begegnen. Tatsächlich aber verteidigt kein ernstzunehmender Denker den Solipsismus. Die Erkenntnis des fremden Ich muss folglich von anderer Art sein als die eines Objekts. Wichtiger ist Franks Überlegung, dass die wechselseitige Wahrnehmung zweier Bewusstseine nicht verstanden werden kann, wenn man den Solipsismus annimmt,
200
Peter Ehlen
also das eigene Ich für prinzipiell einzigartig hält. Denn daraus würde folgen, dass alles andere, auch der andere Mensch, ein Nicht-Ich ist. Wie ist diese offensichtlich irrige Annahme zu überwinden, ohne unausgesprochen vorauszusetzen, dass es doch fremdes Ichbewusstsein gibt? Nicht weiter hilft der Verweis auf die eigene Selbsterfahrung, durch die ich weiß, dass mein Gesicht ein Bewusstsein ausdrückt. Aus dieser Erfahrung würde gefolgert, dass auch das fremde menschliche Gesicht ein Bewusstsein ausdrücke. Diese Theorie des ‚Einfühlens‘ aber setzt das zu Beweisende – die Möglichkeit des fremden Ich – bereits voraus. Die petitio principii ist unvermeidlich. In einer wechselseitigen Wahrnehmung – so Franks Überlegung – begegne ich dem anderen Bewusstsein nicht von außen, wie einem Objekt. Vielmehr muss, um die petitio principii zu vermeiden, das andere Bewusstsein mir wie „ein ursprüngliches Urbild ‚von innen her‘ gegenwärtig“ sein.6 Franks folgenschwere These lautet: In der konkreten lebendigen Begegnung zweier Bewusstseine wird eine uranfängliche primäre Einheit zum Leben erweckt. Nur dank dieser ursprünglichen Einheit erfahren sie sich nicht als Objekte, sondern können sich als Ich und Du begegnen. Die Bedingung dafür ist also, dass mein lebendiges Ich auf ideale Weise schon auf das andere Ich bezogen ist, noch bevor ich dieses als Du erfahre. Diese „umgreifende geistige Einheit“ ist auch die Bedingung dafür, dass ich mich vom anderen Ich unterscheiden kann, ohne dass er für mich zum Gegenstand wird.7 Dem Sozialethiker Frank geht es darum, dem Kollektivismus, der durch die Entrechtung des Individuums das gesellschaftliche Leben pervertiert, philosophisch den Boden zu entziehen. Er kehrt jedoch das Verhältnis nicht einfach um. So wie der Kollektivismus verfehlt ist, der das Ich aus der Einheit des Wir hervorgehen lässt, dem es folglich auch untergeordnet bleibt, so ist auch der Individualismus verfehlt, der das Wir als Produkt des Ich ansieht. In Franks Sozialontologie wird das Gegenüber, in dem Ich und Du einander ausschließen, im Wir überwunden, ohne dass Ich und Du ihren Unterschied verlören. Vielmehr ist das Wir die Einheit des kategorial verschiedenen personalen Seins von Ich und Du, in der sich Ich und Du zugleich durchdringen. Diese Einheit gilt es zu verstehen. Das Ich ist, wie Frank ausführt, eine „ureigene Form des Seins“ und nicht aus einer anderen Form abzuleiten, doch es ist keine sich selbst genügende Substanz. Auch das Wir ist wie das Ich „eine primäre ontologische Wurzel unseres Seins“. Jede der beiden Instanzen setzt die andere voraus, so dass „das Ich anders denn als Glied des Wir undenkbar ist, ebenso wie das Wir nur als Einheit des Ich und Du
6 Frank, Die geistigen Grundlagen der Gesellschaft, a. a. O., S. 135. 7 Vgl. ebd., S. 133-135.
Mensch und Gottmensch
201
gedacht werden kann“.8 Darum steht das Wir nicht als ein eigenes Subjekt – etwa als ‚Volksgeist‘ – den Vielen gegenüber. Es ist ihnen immanent und „vereinigt sie von innen her“. Mit Franks Worten: „Das Ganze … ist in jedem seiner Teile anwesend“, so dass die Einheit des Wir als „die innere Grundlage des Lebens eines jeden Ich“ anzusehen ist.9 Aus dieser Überlegung ergibt sich als Konsequenz, dass „die Einzelheit, Gesondertheit, Selbständigkeit unseres persönlichen Seins nur eine relative ist; sie entsteht nicht nur aus der es umfassenden Einheit, sondern existiert auch allein in ihr“.10 Dieser Gedanke ist weiter zu erläutern, um klarzustellen, dass nicht doch das Kollektiv das Individuum aufsaugt.
All-Einheit und Unterschiedenheit Prinzipiell ist das Wir unbegrenzt. Die Wir-Einheit, die ein heiliger Franz von Assisi mit Bruder Sonne und Schwester Mond erlebte, war mehr als eine schwärmerischpoetische Zuschreibung. Weil Franz von Assisi in allem das Wirken desselben väterlichen göttlichen Ursprungs erlebte, konnte er sich auch mit jedem Geschöpf in brüderlicher Wir-Einheit verbunden wissen. In seinem religionsphilosophischen Werk untersucht Frank die metaphysische Voraussetzung dieser Erfahrung. Mein Abriss der Wir-Kategorie bliebe unvollständig, würde ich diesen Aspekt nicht wenigstens berühren. Franks weiterführende Frage lautet: Was geschieht, wenn zwei Menschen sich einander zuwenden und sich in der geistigen Einheit ‚Wir‘ verbunden wissen? Wie schon erwähnt, unterscheidet sich die Beziehung des Ich zum Du wesentlich von einem objektivierenden Erkenntnisakt. Bleibt im letzteren mein Erkenntnisblick auf das sich darbietende Äußere des Gegenstandes beschränkt, so berühre ich in der Zuwendung zum anderen als Du sein lebendiges Sein. Dieses Sein kann mir das andere Ich aber nur selbst zugänglich machen. Es selbst muss sich mir öffnen und sei es durch ein stummes Lächeln oder einen aufmerkenden Blick. Schon die empirische Entwicklungspsychologie zeigt, dass die Umarmung, mit der die Mutter dem Neugeborenen sagt ‚Du-bist‘, entscheidend dafür ist, dass im Kind das Potential zur Ich-Werdung sich entfaltet. Indem die Mutter sich dem Kind liebe-
8 Ebd., S. 137. 9 Ebd., S. 150. 10 Ebd., S. 138.
202
Peter Ehlen
voll zuwendet, teilt sie ihrem Kind etwas von ihrem Sein mit. Frank nennt diese Mitteilung, die sich nicht in Worten erschöpft, ‚Offenbarung‘. In der Einheit des Liebenden mit dem Geliebten erreicht die Teilnahme am Sein des anderen und so auch die geistige Einheit des Wir ihre Vollendung. Der Liebende weiß sich eins mit dem Geliebten; zugleich erkennt er ihn als ‚Anderen‘ und bejaht ihn in seiner unbedingten Andersartigkeit. Es geschieht die unbegreifliche ‚coincidentia oppositorum‘, die etwas völlig anderes ist als eine Summe von zweien oder mehreren. In der Einheit der Koinzidenz versteht sich das Ich in seiner „absolut einzigartigen Seinsweise … zugleich als Glied und Teilmoment eines mit ihm nach Seinsgehalt und Seinsweise identischen umfassenderen Ganzen“.11 Dieses „umfassendere Ganze“ zu verstehen, ist Franks nächster Schritt. Wenn Frank davon spricht, dass das „Ich bin“ „nur als abgeleitetes Teil-Moment der tieferen und ursprünglicheren Realitätsoffenbarung des ‚Wir-seins‘ anzusehen ist“,12 darf dieses Wir-sein, wie schon betont, nicht als Objekt möglicher Beobachtung und gegenständlichen Wissens missdeutet werden. In der geistigen Wirklichkeit des Wir, erläutert Frank, reiche ich in meinem Sein über mich hinaus; ich verstehe, dass ich, obwohl einzigartig, doch nicht absolut einsam bin; ich verstehe, „dass ich auch da bin, wo nicht ich selbst bin, dass mein eigenes Sein auf meiner Teilhabe am Sein gründet, das nicht meines ist, – nämlich, dass ich selbst bin im ‚Du-bist‘“.13 Mit einer in der philosophischen Literatur beispiellosen Einfühlsamkeit hat Frank in Das Unergründliche aufgewiesen, wie in einer wahrhaft tiefen Liebe der Liebende im Hinausgehen über sich selbst im Geliebten des absoluten Seins teilhaft werden kann. In der Seele des Geliebten offenbart sich ihm eine Realität, die über die Fragilität und Subjektivität des konkreten Menschen wesentlich hinausreicht, eine „Realität, die inneren Eigenwert und eigene Geltung besitzt“ und alles noch Unfertige hinter sich lässt. Der Liebende berührt in der Seele des geliebten Du den Urgrund des Seins. Frank nennt es das „Transzendieren nach außen“. Das individuelle Selbst kann aber auch im „Transzendieren nach innen“ des Absoluten inne werden. Indem die Seele der eigenen Fraglichkeit und Subjektivität bewusst wird und nach einem sinngebenden Grund des eigenen Seins verlangt, den ihm nur eine Realität geben kann, „die kraft ihrer Aktualität eine eigene, immanente Gültigkeit besitzt“.14 In beiden Weisen des „Transzendierens“ berührt die Seele, „gleichsam ihre Grenzen überschreitend, etwas anderes als sie selbst“, etwas absolut Fragloses, an sich Gültiges, schlechthin Objektives, das „Sein und Geltung an sich und aus 11 Frank, Das Unergründliche, a. a. O., S. 254. 12 Ebd., S. 257. 13 Ebd., S. 258. Hervorhebung im Original. 14 Ebd., S. 268.
Mensch und Gottmensch
203
sich“ besitzt.15 Der einfachere Weg das Absolute zu berühren ist jedoch, wie Frank betont, die Transzendenzerfahrung in der Liebe. So sehr dieses ‚Transzendieren‘ nur als ein völlig freier Akt geschehen kann, so ist er doch nicht beliebig. Franks philosophische Meisterschaft erweist sich darin, dass er zeigt, wie der Mensch, ohne nach einem sinngebenden Grund zu verlangen, sich selbst nicht verstehen kann. Die Realität, die in der Erfahrung des Grundes begegnet, hat keine Bestandteile, die sich inhaltlich bestimmen und begrifflich abgrenzen ließen. Schon wenn ich mir bewusst werde, dass ‚ich bin‘, ist dieses Bin-Sein kein Denk-Inhalt, den ich gegenständlich bestimmen könnte.16 Frank nennt es eine „Tatsache“, die außerhalb ihrer selbst keinen „Erkenntnisgrund“ hat, weil ihr Sein unmittelbar evident ist. Die Frage nach einem sie „begründenden“ logischen Grund ist deshalb abwegig. Es muss genügen und es genügt, „ihre ideale und sinnvolle Notwendigkeit“ zu sehen, mit anderen Worten: ihre selbstevidente Sinnerfülltheit.17 Die Unendlichkeit des Selbstseins ist freilich keine leere Unendlichkeit. Indem das Selbstsein – oder die Seele – sich öffnet und sich selbst transzendiert, dringt die Tiefe und Fülle des Seins in es ein und offenbart sich in ihm. Was dabei in der Seele „hervortritt“, ist „etwas anderes als sie selbst“, betont Frank gegen die pantheistische Fehldeutung der All-Einheit des Seins.18 Frank ist zu der Einsicht gelangt, die man seine philosophische Grundintuition nennen darf. Die Möglichkeit, sich selbst zu transzendieren, einem anderen sich selbst zu offenbaren und ihm das eigene Sein mitzuteilen, ist im Sein selbst begründet. Schöpfung ist wesentlich Mitteilung oder Offenbarung. Frank nennt den „Punkt“, an dem der göttliche Urgrund das Sein aus sich entlässt, wo die abgründige Ferne von Gott und Welt sich treffen und die „Schale“ ganz vom göttlichen Sein durchdrungen ist19, ‚Gottheit‘. Dieser „Punkt“ ist „die transzendentale Möglichkeitsbedingung der Seinsform ‚DU‘ “20. Ontologisch lautet die Formel so: „Die Ich-Du-Beziehung als Ich-Du-Sein manifestiert sich somit als die Urgestalt des Seins; sie erscheint uns so als Offenbarung – und zwar in ihrer Unergründlichkeit, jenseits jedes begrifflichen Erfassens“.21 15 16 17 18 19
Ebd., S. 272. Ebd., S. 277; S. 273. Ebd., S. 279-280. Hervorhebung im Original. Ebd., S. 172. Hervorhebung im Original. Ebd., S. 435. Dass in dieser Einheit sich ein überzeitlicher Prozess vollendet, macht Frank mit dem Verweis auf den ‚neuen Himmel‘ und die ‚neue Erde‘ aus dem Neuen Testament deutlich; vgl. Offenbarung des Johannes 21, 1. 20 Ebd., S. 367. Hervorhebung im Original. 21 Ebd., S. 249. Hervorhebung im Original.
204
Peter Ehlen
Die phänomenologische Analyse der menschlichen Wir-Einheit hat Frank nach ihrer metaphysischen Möglichkeitsbedingung fragen lassen. Die Antwort hat Frank im Sein gefunden. Das Sein ist lebendige Offenbarung und als solche in höchstem Sinne personal. Ist der Urgrund des Seins personaler Gott?
Gott und Mensch – eine Wir-Einheit? Die Antwort kann nur von der Erfahrung, nicht durch Begriffsanalyse, gegeben werden. Indem ich die Zuwendung der Gottheit als Mitteilung eines ‚Du bist‘ oder an mich gerichtetes ‚Sei!‘ erlebe, „indem sie sich mir als Du zu erkennen gibt“, ist die Gottheit „mein Gott“ oder „Gott mit mir“. „Nur als Du ist sie Gott“. Diese Mitteilung oder Offenbarung ist Ausdruck ihres schaffenden Wesens, nicht ein gelegentlicher Willensausdruck. So kann Frank sagen: „Die Gottheit ist ihrem eigensten Wesen nach immer ‚Gott mit uns‘ (Emmanuel)“.22 Indem Gott zum Menschen ‚Du‘ oder ‚Sei!‘ spricht, teilt er ihm etwas von seinem Sein mit und geht mit ihm eine Einheit ein. In welchem Sinne ist diese eine Wir-Einheit? Schon die bisherigen Ausführungen zur menschlichen Wir-Einheit haben gezeigt, dass sie weder als Vermischung noch als bloß numerische Summe gedacht werden darf. Es würde deshalb Franks Intention widersprechen, würde die Einheit Gott-Mensch pantheistisch gedacht, so dass das Absolute das menschliche Ich restlos in sich auflöst. Ganz verfehlt wäre auch, würde Gott als Glied einer mathematisch logischen Zweiheit gedeutet. Frank weiß sehr gut, dass die Metaphysik im Versuch, die Einheit des Absoluten mit dem Relativen zu denken, an die Grenze ihrer Möglichkeit gelangt. Weder als Einheit noch als Zweiheit kann sie widerspruchsfrei aufgelöst werden. Die Antinomie bleibt; sie ist nur in einer transrationalen Synthese in der Weise des cusanischen ‚wissenden Nichtwissens‘ auszudrücken.23 Um die Einheit, in der sich das Absolute und Relative gegenseitig durchdringen, mit ihrer unbedingten Verschiedenheit zugleich anzuzeigen, hat Frank den Begriff ‚antinomischer Monodualismus‘ geprägt. Die Wir-Einheit Gottes mit dem ganz anderen ist rational unsagbar, weil seine Verschiedenheit mit keinem Begriff logisch bestimmt werden kann. Mehrmals hat Frank daran erinnert, dass der lebendige Gott nicht anders als der sich mir in seiner Verborgenheit Zuwendende zu 22 Ebd., S. 364. Hervorhebung im Original. Frank knüpft mit dem Namen Immanuel an die Messiasverheißung des Alten und des Neuen Testamentes an: vgl. Jesaja 7, 14; Mt 1, 23. 23 Vgl. ebd., S. 392.
Mensch und Gottmensch
205
haben ist. Jedes Reden über Gott wie über einen inhaltlich bestimmen Gegenstand würde ihn zum Götzen machen. Darum ist lebendige Gott, den wir durch seine Selbstoffenbarung kennen, kein Objekt unseres Wissens, wohl können wir seine Anwesenheit verstehend erleben.24 Mit ‚verstehendem Erleben‘ gebrauche ich einen Begriff, der für Franks Erkenntnislehre zentral ist. Er nennt es auch ‚lebendiges Wissen‘. Selbst das Wir als geistige Einheit einer Partei, einer Freundschaft, einer Ehe und so weiter ist kein Gegenstand objektivierenden Wissens; nur, wer an ihrer Realität innerlich teilnimmt, ‚weiß‘, was sie ausmacht. Doch unterscheidet sich die Einheit, die Gott mit dem Menschen eingeht, von der menschlichen Ich-Du-Beziehung. Diese kann nicht entstehen, wenn das Ich die Zuwendung des anderen nicht aufmerkend erkennt und frei annimmt. Die Mitteilung, in der Gott mich als Du anspricht, sich als ‚mein Gott‘ offenbart, geht absolut von seiner Initiative aus. Meine Freiheit, sie anzunehmen, stammt von Gott, ohne dass sie deshalb determiniert wäre. Gott, welcher der absolute Urgrund von allem ist, ist der absolute Ursprung des Du. Als solcher schließt er das sich mir zuwendende Du in sich ein. Ohne dieses Du wäre er nicht Gott – und ich wäre nicht Ich. Frank kann sich deshalb das „in ehrfürchtigem Erzittern“ gesprochene Wort des Angelus Silesius aus dem Cherubinischen Wandersmann zu eigen machen: „Ich weiß, dass ohne mich Gott nicht ein Nu kann leben; werd’ ich zu nichts, er muss vor Not den Geist aufgeben“.25 Franks Aussage, dass das Ur-Du, das Gott ist, jede konkrete Du-Beziehung ermöglicht,26 kann verwundern. Selbstverständlich wird damit nicht behauptet, man müsse, um eine konkrete Du-Beziehung eingehen zu können, Gott als „die ‚Du-Form‘ schlechthin“ kennen und anerkennen. Es geht Frank bei seiner Überlegung um die ontologische Struktur. Als Phänomenologe ist er überzeugt, dass in jeder Du-Beziehung – selbst, wenn sie sich in einem freundlich aufmerkenden Blickwechsel in der Straßenbahn erschöpft – ein Lebensstrom zwischen den Menschen fließt. Die Selbstoffenbarung des eigenen Seins ist hier auf einen winzigen Ausschnitt beschränkt. Aber als geistige Seinsform ‚Wir‘ berührt auch diese Beziehung, ohne dass es gewusst wäre, den Urgrund des Seins.
24 Vgl. Frank, Die Realität und der Mensch, a. a. O., S. 76. Gott offenbart sich mir unmittelbar nur in der ungeteilten Einheit ‚Gott und ich‘. Philosophen wie Theologen sprechen in der Regel über Gott wie über eine dritte Person, wie über ein Er. Die apophatische Denkform schließt die Redeweise über Gott als Abwesenden nicht aus, betont aber ihre Beschränktheit. 25 Frank, Das Unergründliche, a. a. O., S. 364. 26 Ebd., S. 368.
206
Peter Ehlen
Es ist hier nicht der Ort, weiter auszuführen, wie Franks Sozialphilosophie, Erkenntnislehre, Ontologie und Religionsphilosophie ineinandergreifen. Das Anliegen seiner Sozialmetaphysik ist jedoch hinreichend deutlich geworden: Zu zeigen, dass im gesellschaftlichen Wir, „wenn auch unvollständig, inadäquat, aber dennoch aktuell“, das Absolute zur Erscheinung gelangt.27
Erfahrung des Unergründlichen Jede gesellschaftliche Verbundenheit und jede Kommunikation unter Menschen – sei sie auch ganz flüchtig oder utilitär oder sogar erzwungen – ist nur möglich, weil die Menschen im anderen ‚einen ihm gleichen‘ erkennen. Sie setzt ihre „ursprüngliche innere Zusammengehörigkeit“, die „intuitive Wahrnehmung einer sie umfassenden inneren Einheit“ voraus.28 Frank hat einige Lebensbereiche hervorgehoben, in denen die Menschen eindringlich erfahren können, dass ihr individuelles Ich-Sein mit der unergründlichen Tiefe des Seins vereint ist. An erster Stelle nennt Frank „die geistig-gemeinschaftliche Einheit der Familie“, aus der die menschliche Gesellschaft hervorwächst. Nicht zuletzt zeigt sich an ihrem Beispiel, dass die geistige Wir-Einheit eine höchst lebendige Realität ist. Als zweiten Lebensbereich, in dem wir die Unergründlichkeit des Seins „verstehend erleben“ können, nennt Frank die religiöse Feier. In ihrer „allgemeinen Natur“ ist Religiosität, phänomenologisch betrachtet, „nichts anderes … als das intuitive Gefühl der menschlichen Seele mit dem absoluten Prinzip und der absoluten EINHEIT verbunden zu sein“.29 Wer seine Seele für den Urgrund des Seins öffnet und verstehend erlebt, dass er mit ihm in überbegrifflicher Weise eins ist, ist religiös. Dieses, die Verschiedenheit der religiösen Äußerungen übergreifende Verständnis ist darin begründet, dass das geschaffene Sein das Andere Gottes oder Theophanie ist.30 Kraft der Anwesenheit des Schöpfers in der Schöpfung ist die geistige Einheit des Seins „in größerem oder geringerem Ausmaß“ in jedem Seinssbereich „als Ganzes … anwesend“,31 so dass die Gottheit in allen Dingen begegnen kann. In einem besonderen Sinn ist das gesellschaftliche Sein Theophanie, denn in ihm als ‚Ich-Du-Sein‘ gelangt die personale ‚Urgestalt‘ des Seins zur Erscheinung. 27 Frank, Die Realität und der Mensch, a. a. O., S. 206. 28 Frank, Die geistigen Grundlagen der Gesellschaft, a. a. O., S. 146. 29 Ebd., S. 148. Hervorhebung im Original. 30 Frank, Das Unergründliche, a. a. O., S. 433. 31 Frank, Die Realität und der Mensch, a. a. O., S. 186.
Mensch und Gottmensch
207
Für die Grundform von Religiosität ist darum das Bewusstsein kennzeichnend, „zu einem Ganzen zu gehören, das den Menschen nicht von außen umgibt, sondern innerlich vereint und ausfüllt“.32 Dieses ‚Ganze‘, so lässt sich im Sinne Franks sagen, ist die Anwesenheit des unergründlichen Urgrundes, der alles im Sein erhält. Frank hat das Bewusstsein dieser Anwesenheit als ‚sobornost‘ charakterisiert – in deutscher Übersetzung etwa: Gemeinschaftlichkeit – .33 Es ist keineswegs auf eine explizit religiöse Wir-Erfahrung beschränkt, wenngleich die religiöse Versammlung ein besonderer Ort ihrer Erfahrung ist. Zu den herausragenden Gelegenheiten, sich der „geheimnisvollen, unsere Persönlichkeit umgreifenden Tiefen des Seins“ bewusst zu werden, gehört, wie Frank andeutet, die gemeinsame Feier der Eucharistie; im profanen Leben sind es Augenblicke, in denen Menschen sich eines gemeinsam ertragenen Schicksals inne werden. In der menschlichen Vereinigung, die ihren Transzendenzbezug, das heißt ihre Gottmenschlichkeit, realisiert, also Ausdruck der ‚sobornost‘ ist, erkennt Frank die Grundform der ‚Kirche‘. Aus Franks Unterscheidung der rechtlich verfassten gesellschaftlichen Wirklichkeit und der ihr zugrunde liegenden und sie ermöglichenden gottmenschlichen Wir-Einheit folgt, dass zur ersten nur jene gehören, welche die von der historischen Gesellschaft aufgestellten Kriterien ihrer Mitgliedschaft erfüllen. Dagegen gehören zur Grundform ‚Kirche‘ alle, die mit dem Urgrund der Realität in der gottmenschlichen Wir-Einheit verbunden sind.34
Sollen, Sein und Freiheit In einem letzten Abschnitt soll – sehr verkürzt – das sittliche Sollen im Kontext von Franks Wir-Philosophie zur Sprache kommen. Schon die bisherigen Ausführungen zeigen, dass das Sollen seine Begründung im ‚gottmenschlichen‘ Sein des Menschen hat. Mit einem naturalistischen Fehlschluss hat die Bezugnahme auf das Sein nichts zu tun, vielmehr begründet gerade die Doppelnatur die den Menschen auszeichnende Spannung zwischen seiner begrenzten Natur und dem göttlichen Sein. Aus ihr resultiert die Bestimmung des Menschen, „sich ideell von seiner empirischen Natur loszusagen und sie, sich über sie erhebend, zu beurteilen 32 Frank, Die geistigen Grundlagen der Gesellschaft, a. a. O., S. 148. 33 Vgl. ebd., S. 140-154, sowie die Einleitung von Peter Ehlen, ebd., S. 25-26. 34 Frank, Die geistigen Grundlagen der Gesellschaft, a. a. O., S. 193 ff.; Franks Ausführungen zur ‚Kirche‘ und zu ihrer Abgrenzung von der ‚Welt‘ gehören zu den bedeutendsten und originellsten theologisch-philosophischen Aspekten seines Werkes.
208
Peter Ehlen
und zu bewerten“.35 Den Auftrag, seine empirisch gegebene Wirklichkeit zu transzendieren und sie der göttlichen zu öffnen, erfährt er als Gewissen. Entsprechend der Doppelnatur des Menschen kann auf zwei grundsätzlich verschiedene Weisen erfahren werden, dass das sittlich Gute gesollt ist. Wo die naturhafte Wirklichkeit das Leben beherrscht, fordert das Sittengesetz vom Menschen, ihm gleichsam von außen gegenübertretend, Gehorsam. Den fundamentalen Unterschied zu Kants Ethik markiert die Einsicht Franks, dass das sittlich Gute unzureichend verstanden ist, wenn man es prinzipiell als bewusste Erfüllung des Gesetzes begreift. Der aufmerksame Phänomenologe Frank erkennt, dass es auch ein völlig frei aus dem Inneren des Menschen hervorwachsendes sittliches Handeln gibt. In ihm geschieht das sittliche Handeln nicht durch Unterwerfung unter das Gesetz, „nicht als Befolgung nur des transzendenten Willens Gottes, sondern als konkretes Leben, als lebendiges substantielles Prinzip, das unserem Sein immanent ist“.36 Hier ist das sittliche Handeln Ausdruck von „Gottes Anwesenheit in uns und unseres Lebens in ihm“. Es hat das Gesetz hinter sich gelassen und geschieht nicht mehr aus Pflichtbewusstsein. Frank beschreibt den Unterschied so: „Soweit die wesentliche Gottmenschlichkeit des Menschen reicht, ist er Gottes Sohn, Teilnehmer am göttlichen Leben, Bewohner des Hauses Gottes; soweit sie abwesend ist, ist er nur Gottes Knecht und Diener, Ausführender seiner Gebote“.37 Es ist hier daran zu erinnern, dass das gott-menschliche Leben, weil eine ontologische Wirklichkeit, auch in Formen realisiert werden kann, die nicht ausdrücklich religiös sind. An welchem Maß ist das Gegebene zu messen und gegebenenfalls zu verändern? Franks vielleicht überraschende Antwort lautet: Die Vernunft erkennt bei allseitiger Berücksichtigung der Erfahrung, was dem Wesen des Menschen entspricht und folglich ‚ontologisch notwendig‘ ist. Frank hat dieses Prinzip mit der ‚teleologischen Gesetzmäßigkeit des organischen Lebens‘ erläutert, gegen die zu verstoßen, den Ruin einer organischen Kultur zur Folge hätte. Frank ist überzeugt, dass auch das soziale Leben, wie das organische, bestimmte Gesetzmäßigkeiten kennt, deren Missachtung die Gesellschaft wie auch das Individuum verkümmern lassen, deren Beachtung aber die Bedingung einer gedeihlichen Entwicklung ist. Frank hat mit dem Begriff ‚ontologische Notwendigkeit‘ ein Naturrecht zurückgewiesen, demzufolge das sittlich Gesollte von einer dem Menschen gegenüberstehenden Natur gleichsam abgelesen werden könnte. Ebenso ist die Annahme abgelehnt, die Vernunft könne aus sich selbst unveränderliche sittliche Normen 35 Frank, Die geistigen Grundlagen der Gesellschaft, a. a. O., S. 173. 36 Ebd., S. 184. Aus dem Neuen Testament erwähnt Frank den spontanen Liebesbeweis der reuigen Sünderin, der durch die Heiligkeit der Person Jesu geweckt wird. 37 Frank, Die geistigen Grundlagen der Gesellschaft, a. a. O., S. 185.
Mensch und Gottmensch
209
hervorbringen. Zurückgewiesen ist auch die Gesetzgebung durch einen göttlichen Gesetzgeber, der gleichsam positivistisch seine Gebote offenbart. Ursprung des sittlich Gesollten ist der auf seine Erfahrung verwiesene Mensch als Gottmensch.38 Frank misst damit der Freiheit und Verantwortung eine geradezu ungeheure Bedeutung zu. Er weiß freilich auch, dass das Bemühen, im Blick auf das Wesen des Menschen die richtige Entscheidung für das konkrete Handeln zu treffen, einer Gratwanderung „zwischen Gott und dunkler Natur“ gleicht, die auch „tragisch“ scheitern kann.39 Sein sozialphilosophisches Werk hat Frank mit einer Skizze der „grundlegenden normativen Prinzipien des gesellschaftlichen Lebens“ abgeschlossen. Das „höchste“ Prinzip ist der Dienst; ihm unter- und zugeordnet sind die Prinzipien der Solidarität und der Freiheit.40 Der Dienst gilt nicht der Gesellschaft oder irgendeinem Menschen. Er gilt allein der ‚Wahrheit‘. Die ‚Wahrheit‘ ist das Gottmenschentum, in dem das natürliche Wesen des Menschen mit der Anwesenheit Gottes untrennbar vereint ist. Das gesellschaftliche Leben muss dessen Ausdruck sein. Ohne den Vorrang des so verstandenen Dienstes, wäre es unmöglich, den Anspruch der Gesellschaft an den Einzelnen, sich dem Wohl des Ganzen zu unterwerfen und eigene Interessen zurückzustellen, mit dem Anspruch der Person zu versöhnen, sie sei ein unantastbarer Wert und müsse sich selbst bestimmen können. Solange beide Seiten sich als autonome Instanzen verstehen, bleibt der Egoismus das destruktive Lebensprinzip, den ein Kompromiss zwischen den antagonistischen Kräften nur vorübergehend mäßigen kann. Dagegen hat die Ontologie von Ich und Wir gezeigt, dass das Wir nicht ohne das Ich und das Ich nicht ohne das Wir existieren kann, dass Ich und Wir vielmehr einander durchdringen. Das hat zur Bedingung, dass beide sich nicht als absolut verstehen, sondern sich einer höheren Wirklichkeit unterordnen und ihre Existenz als Dienst begreifen. In der Mitte von Franks Philosophie steht der Mensch. Frank ist insofern ein Denker der Neuzeit. Doch das Sein des Menschen weist über sich hinaus. Er ist Gottmensch. Deshalb ist der Mensch die Quelle, aus der sein Wissen von Gott stammt. In der sorgfältigen phänomenologischen Analyse des menschlichen Selbsttranszendierens und in der Frage nach seiner Möglichkeitsbedingung besteht Franks Herausforderung an die Philosophie der Gegenwart.
38 Vgl. ebd., S. 183. 39 Ebd., S. 98; vgl. auch ebd., S. 217-219. 40 Ebd., S. 214; S. 219.
5 Metaphysik: geistige Übung als Lebensform
Das Gebet der Philosophen Albrecht Dihle
Die Entfaltung der christlichen Religion und ihr Siegeszug durch die Gesellschaft des Römerreiches vollzog sich in einer Atmosphäre, in der eine religiöse Praxis, θυσίαι καὶ εὐχαί, die sich in langer Tradition gebildet hatte, im Leben des Einzelnen wie der Gesellschaft eine dem modernen Menschen kaum noch nachvollziehbare Rolle spielte. Die überlieferten Riten kreuzten sich dabei mit denen neuer Kulte und der dazugehörigen Lehren und Vorstellungen, die teils aus dem Orient importiert, teils aus regionaler oder auch geheim gehaltener Überlieferung in weitere Bevölkerungskreise eingedrungen waren. Die Zauberpapyri etwa vermitteln einen Eindruck von dieser Buntheit religiöser Praktiken und Vorstellungen. Auch die in beträchtliche Breite wirkende Philosophie befasste sich mit Erscheinungen des religiösen Lebens und wollte in einer rational konzipierten und übermittelten Kunst der Lebensführung1 auch das aus rechter Einsicht erwachsende religiöse Verhalten lehren. Das betraf unter anderem Sinn und Wirkung des Gebetes.2 „Ein altes Gebet: Regne, lieber Zeus, regne auf die Felder und Fluren der Athener – entweder soll man gar nicht beten oder so naiv und ungeniert.“ Das ist eine Eintragung in des Kaisers Marcus sogenannte Selbstbetrachtungen.3 Diese Schrift4 ist voll von Gedanken über das Verhältnis des Menschen zur Gottheit, die sich der Verfasser aus der stoischen Lehrtradition vor Augen führt. Das Gebet kommt darin selten vor, und der Kaiser neigte wohl eher der ersten Alternative zu, die 1 Pierre Hadot, Qu’est-ce que 1a philosophie antique?, Paris 1995. 2 Emmanuel von Severus, Gebet I, in: Reallexikon für Antike und Christentum [im Folgenden abgek. als RAC], 8, 1972, Sp. 1134–1258, hier: Sp. 1147–1152. 3 Marcus Aurelius, Τὰ εἰς ἑαυτόν. Wege zu sich selbst, hg. v. Willy Theiler, Zürich 1951, 5, 7. 4 Die beste Einführung in die Gedankenwelt des Kaisers findet sich bei Pierre Hadot, La citadelle intérieure, Paris 1992. © Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv lizenziert durch Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2020 C. Böhr (Hrsg.), Metaphysik, Das Bild vom Menschen und die Ordnung der Gesellschaft, https://doi.org/10.1007/978-3-658-31593-1_13
213
214
Albrecht Dihle
das oben genannte Zitat anbietet. Beten passt nicht recht zum festen Vertrauen in die zugleich unabänderliche und segensreiche Weltordnung, in die Gemeinschaft aller in ihr lebenden Vernunftwesen, der Menschen und Götter,5 zum sicheren Gefühl, als Glied einem Kosmos zuzugehören, in dem jedes mit jedem auf die sinnvollste Weise verknüpft ist.6 So kann man alles, was einem zustößt, wie eine heilsame, von Asklepios verordnete Medizin entgegennehmen7 und sterben wie die reife Olive, die vom Baum fällt und diesem dankt, dass er sie getragen hat.8 Individuelle Bitten an die Gottheit sind unter dieser Voraussetzung überflüssig. Alles, was den Menschen zustößt und sie als σύνκλωσις, σύντευξις, τύχη bezeichnen, kommt von der Gottheit, und die Erfüllung menschlicher Sonderwünsche würde sich als schädlich erweisen.9 Nach philosophischer Meinung aber können Götter nicht schädigen.10 Wichtig für den Menschen ist es freilich, nie aus den Augen zu verlieren, dass auch der Frevler, der die Weltordnung missachtet11 und die Existenz der Götter verneint,12 als Vernunftwesen ein Verwandter ist und seine Rolle im Welttheater zu spielen hat.13 Deshalb schuldet man auch ihm Freundlichkeit und Hilfe.14 Sein Tun schädigt allein ihn selbst,15 seinen inneren Zustand. Das Göttliche, das als Vernunft jedem Menschen von Natur aus innewohnt und ihn zur bewussten Übereinstimmung mit der Weltordnung befähigt,16 und die Gottheit, die man an ihrem Wirken dankbar erkennt,17 werden im rechten Handeln geehrt,18 und die Menschen müssen dabei wissen, dass alles Unrechttun zugleich Unfrommheit ist.19 Marcus Aurelius, Τὰ εἰς ἑαυτόν. Wege zu sich selbst, 2, 12; 4, 23; 7, 53; 10, 21 u. a. Ebd., 7, 9; 7, 13; 8; 34; 11, 8; 12 ,5. Ebd., 5, 8. Ebd., 4, 48. Ebd., 3, 11a; 5, 28; 32; vgl. Maximos von Tyros, or. 5 ed. Koniaris; vgl. dazu George Leonidas Koniaris, On Maximus of Tyre, in: Classical Antiquity 1 (1982) S. 87-121. 10 Seneca, epist., 95, 49; Porphyrios, ad Marcellam, 23/24; Flavius Philostratos, Vita Apollonii, 1, 11. 11 M. Ant., 3, 13; 7, 22; 11, 8 u. ö.; vgl. Epiktet 6, 44, 4. 12 Marcus Aurelius, Τὰ εἰς ἑαυτόν. Wege zu sich selbst, 12, 28. 13 Ebd., 12, 36. 14 Ebd., 7, 24; 7, 70; 10, 4. 15 Ebd., 9, 1. 16 Ebd., 2, 12; 3, 12 u. ö.; vgl. Seneca, epist., 41, 2; Epiktet, 2, 8, 13; Diogenes Laertius, 7, 88. 17 Ebd., 12, 28. 18 Ebd., 12, 11. 19 Ebd., 9, 1; vgl. 11, 20. 5 6 7 8 9
Das Gebet der Philosophen
215
Ähnlich äußert sich auch der Platoniker Maximos von Tyros, Autor der einzigen aus dieser Zeit erhaltenen Abhandlung zu unserem Thema.20 Auch er betont, dass die Gottheit jedem das ihm Zukommende ohne Bitten gewähre. Gerade der Würdige braucht deshalb um nichts zu bitten. Würde die Gottheit aber das Gebet des Unwürdigen erhören, so veränderte sie damit die vorhandene, bestmögliche Weltordnung zum Schlechteren und zeigte sich selbst in Einsicht und Willen als veränderlich. Das anzunehmen aber ist unfromm. Dennoch hielten beide, der Stoiker und der Platoniker, Beten für gut und richtig. Ob die durch eine Vielzahl göttlicher Vernunftwesen garantierte Weltordnung für den Einzelnen in jeder Hinsicht Sorge trägt oder, wie die Platoniker lehrten, nur den Rahmen des Geschehens setzt, will Marcus, anders als andere Philosophen, nicht entscheiden. Aber dass diese Wesen mit uns zusammenleben, so sagt er, leugnen nur die Unfrommen, die sich deshalb an Opfer und Gebet, also den Handlungen der traditionellen Religion, nicht beteiligen.21 Zweierlei ist hier bemerkenswert. Einmal empfahlen fast alle Philosophien der Kaiserzeit ihren Anhängern, sich am religiösen Leben der Mitwelt, ‚κατὰ τοὺς νόμους‘, zu beteiligen. Das gilt für Epikureer,22 Stoiker23 und Platoniker24 gleichermaßen. Nur die Skeptiker wandten dagegen ein, dass sicheres Wissen, also auch das von der Existenz der Götter, unmöglich sei.25 Die Epikureer leugneten zwar jede Verbindung zwischen Menschen und Göttern, also auch göttliche Fürsorge, schlossen aber aus dem überall gehegten Götterglauben, dass Menschen ein angeborenes Wissen von der Existenz vollkommener Wesen innewohnt, denen Verehrung zu verweigern unmoralisch sei.26 Die Verehrung der Gottheit in traditionellen Formen war für den Philosophen unanstößig, denn man konnte im Bewusstsein von der Unvollkommenheit und Verschiedenheit menschlicher Einsicht die herkömmlichen Riten mit ganz verschiedenen Vorstellungen vom Wesen der Weltordnung, ihrer Herkunft und ihrer Garanten, verknüpfen. So ist zum Beispiel die sogenannte ‚theologia tripertita‘ ein Versuch, religiöse Praxis zu rechtfertigen, und dasselbe leistete die allegorische Er-
20 21 22 23 24 25 26
Maximos von Tyros, or. 5 – ed. Koniaris = 11 ed. Dübner. Marcus Aurelius, Τὰ εἰς ἑαυτόν. Wege zu sich selbst, 6, 44. fr. 387 Us. Stoicorum veterum fragmenta, 3, 608; Epiktet, 6, 44. Diogenes Laertius, 3, 83. Zum Beispiel S.E. M. 7, 401; 9, 61. fr. 169 Us.
216
Albrecht Dihle
klärung der Mythen und Kulte.27 Dabei spielte es keine Rolle, ob sich das religiöse Vertrauen in die Weltordnung auf einen Weltgott, eine unpersönliche Vorsehung oder auf viele göttliche Vernunftwesen richtete. Gelegentlich stand der Philosoph dem traditionellen Kult, an dem er sich beteiligte, freilich auch distanziert gegenüber. So forderte Seneca wie andere Stoiker die Einhaltung der religiösen Bräuche,28 allerdings ‚tamquam legibus iussa, non tamquam dis grata‘.29 Vor allem die philosophische Lehre von der Bedürfnislosigkeit der Götter gab Anlass zur Kritik an Opferpraxis und Gelübde als unwürdigem Tauschhandel. Schon Platon hatte darauf hingewiesen, dass man Verhaltensweisen des zwischenmenschlichen Verkehrs nicht auf das Verhältnis zur Gottheit übertragen dürfe.30 Der Philosoph musste die traditionelle Kult- und Gebetspraxis mit der Kosmologie seiner Schulrichtung in Einklang bringen. „Als Antoninus ist mir Rom Polis und Vaterland, als einem Menschen der Kosmos“ notiert der Kaiser.31 Am schwierigsten erwies sich das, wo man mit einer allumfassenden und zugleich denkbar besten und vernünftigen Vorbestimmung allen Geschehens rechnete wie in der Stoa. Dort galt auch das, was andere Philosophien als Zufall oder die Folge freier menschlicher Entscheidung definierten, als von der Heimarmene verordnet. Die Freiheit des Menschen besteht nach dieser Auffassung darin, dass seine Vernunft ihn zur Einsicht in die wohltätige Vorbestimmung befähigt und er darum alles, was ihm zu tun oder zu leiden auferlegt ist, in den eigenen Entschluss aufnehmen kann. Der Schlechte oder Unwissende hingegen sträubt sich gegen das ihm Bestimmte, dem er nichtsdestoweniger nicht entrinnt, und wird dadurch schlecht und unglücklich.32 Freiheit und Lebensglück des Menschen ergeben sich also nur aus der Beschaffenheit seines Bewusstseins und sind unabhängig von dem, was ihm von außen zustößt. Die Frage, in welchem Umfang die Gottheit sich um den einzelnen Menschen kümmert, verblasst hinter dem Wissen, dass dessen eigenes Ergehen fest in den für alle Wesen wohltätigen Weltplan eingefügt ist.33 Für die Herstellung seiner inneren Verfassung bleibt aber der Mensch selbst verantwort27 Zur ‚theologia tripertita‘ vgl. Godo Lieberg, Die ,theologia tripertita‘ in Forschung und Bezeugung, in: Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, I, 4, 1973, S. 63-115; zur allegorischen Erklärung vgl. Josephus Calas Joosen, Jan Hendrik Waszink, Art. Allegorese, in: RAC, 1, 1950, Sp. 283-293, und Jean Pépin, Mythe et allégorie, Paris 1958. 28 Seneca, epist., 14, 14 u. ö. 29 fr. 38. 30 Platon, Euthyphron, 14 B-C. 31 Marcus Aurelius, Τὰ εἰς ἑαυτόν. Wege zu sich selbst, 6, 44a. 32 Stoicorum veterum fragmenta, 1, 527. 33 M. Ant., 6, 44.
Das Gebet der Philosophen
217
lich.34 Die Vernunftbegabung, die den Menschen dazu befähigt, beschreibt der Kaiser, ähnlich wie schon vorher der Stoiker Epiktet35 in religiöser Terminologie. Es ist der Daimon, den die Gottheit jedem Menschen in die Seele gelegt hat, der ihn als Schützer und Ratgeber begleitet.36 „Sacer intra nos spiritus sedet, malorum bonorumque nostrorum observator et custos; hic prout a nobis tractatus est, ita nos ipse tractat“, heißt es bei Seneca.37 Ähnlich hatte sich schon der Gründer der Stoa geäußert.38 Selbst unter dieser Voraussetzung versuchte Seneca, dem Bittgebet einen Sinn zu geben.39 Der stoische Einwand gegen das Gebet lautet ja: Entweder ist etwas determiniert, dann geschieht es mit und ohne Gebet; oder es ist nicht vorherbestimmt, dann können die Götter auch durch Gebete nicht veranlasst werden, es herbeizuführen. Seneca erwidert darauf, dass Gebete nützen, ‚salva vi ac potestate fatorum‘. Gewisse Dinge nämlich haben die Götter in der Schwebe gelassen, und sie können durch Gebete zum Guten gewendet werden. Nur der Zusammenhang, der das Gebet einschließt, unterliegt der Heimarmene. Hier zog Seneca eine aristotelische Lehre heran: Alle durch menschliche Entscheidung verursachten Ereignisse sind ‚ἐνδεχόμενα καὶ ἄλλως ἔχειν‘. Sie fand auch in die Schicksalslehre der Platoniker Eingang. Alles, was nicht unmittelbar durch die Natur bewirkt wird, gehört zuweilen in die Kategorie des ‚πολλάκις oder ἐπὶ τὸ πολύ‘, nie aber des ‚ἀεί‘,40 kann also weder Gegenstand des Wissens sein noch vorausgesetzt werden. Näher bei der stoischen Tradition blieb Kaiser Marcus, wenn er notierte,41 man solle im Gebet die Hilfe der Götter gerade für das erbitten, was in der eigenen Macht stehe, indem man nämlich zum Beispiel nicht bittet, von einem lästigen Mitmenschen befreit zu werden, sondern darum, nicht den Wunsch zu hegen, von ihm befreit zu werden. Gerade für seinen inneren Zustand, für den 34 Marcus Aurelius, Τὰ εἰς ἑαυτόν. Wege zu sich selbst, 11,32; hierzu gehört auch die stoische Lehre von den zwei Verursachungen, die Chrysipp am Beispiel der Walze erläuterte: Damit eine Walze den Abhang hinunterrollt, bedarf es des Anstoßes von außen. Wie sie aber rollt, hängt von ihrer eigenen Beschaffenheit ab: Stoicorum veterum fragmenta, 2, 1000. 35 Epiktet, 1, 14, 12. 36 M. Ant., 3,5; 5, 27; vgl. Stoicorum veterum fragmenta, 2, 3219. 37 Seneca, epist., 41, 2. 38 Stoicorum veterum fragmenta, 1, 146. 39 Seneca, quaest. nat., 2, 37. 40 Aristoteles’ Auffassung von den ‚ἐνδεχόμενα καὶ ἄλλως ἔχειν‘, den undeterminierten Vorgängen, begegnet in ganz verschiedenem Kontext, zum Beispiel Ethica Eudemia, 1134 b 31; historia animalium, 731 b 25; ars rhetorica, 1402 b 21 f. 41 Marcus Aurelius, Τὰ εἰς ἑαυτόν. Wege zu sich selbst, 9, 40.
218
Albrecht Dihle
der Mensch allein verantwortlich ist, soll er zu dessen Verbesserung um göttliche Unterstützung bitten.42 Schon Sokrates hatte die Götter gebeten, sie möchten ihn innerlich schön machen, damit das, was er äußerlich sei und habe, mit seinem Innern in Einklang stünde.43 Poseidonios lehrte, dass der Weise bete, indem er die Gottheit einfach um das schlechthin Gute – und das ist für den Stoiker nur das καλόν, das sittlich Gute44 bittet.45 Platoniker und Peripatetiker vermochten das Bittgebet mit ihren Lehren über Schicksal und Freiheit leichter zu verbinden als die Stoiker. Der Peripatos kannte drei Arten der Verursachung, die auf derselben Ebene das Geschehen lenken: Die Weltordnung, den Zufall und die freie Entscheidung der Menschen. Diese Theorie, die Aristoteles’ Auffassung von der Undeterminiertheit des menschlichen Verhaltens bewahrt, ist am deutlichsten in der Schrift vom Schicksal des Alexander von Aphrodisias dargestellt.46 Eine echte Vorsehung gibt es danach nur im kosmischen Geschehen, worauf der Platoniker Attikos, ein Gegner der Verschmelzung platonischer und aristotelischer Lehren,47 tadelnd hinwies. Doch auch die Peripatetiker – mit wenigen Ausnahmen48 – sahen die Welt als von göttlichen Wesen gelenkt und interessierten sich darum für die Formen traditioneller Religion. Der Peripatetiker Kratipp unterschied zwischen der Weltordnung als ganzer und dem Wirken der Götter im Einzelnen,49 dort also, wo es nach peripatetischer Lehre keine Vorherbestimmung gibt. Reichlich bezeugt ist die Lehre der kaiserzeitlichen Platoniker von einer gestuften Vorsehung. Der Höchste Gott ist Hüter und Lenker der intelligiblen, überhimmlischen Welt, aus der die sinnlich wahrnehmbare Struktur, Leben und Bewusstsein erhält. In ihrer vernünftigen Ordnung gibt es keinen Widerspruch zwischen Freiheit und Notwendigkeit. In der Astralsphäre sorgen „die über den Himmel laufenden Götter“, die Sterne, für die vollkommene Ordnung der Ma42 Vgl. auch ebd., 9, 11. 43 Platon, Phaidros, 278 b-c. 44 Der Grundsatz, dass nur das sittlich Gute ein Gut sei – µόνoν τὸ κaλὸν ἀγαθὸν – ist stoisches Allgemeingut, vgl. zum Beispiel Stoicorum veterum fragmenta, 1, 188; 387. 45 fr. 40 E. K. 46 Zusammenfassend zu den Lehren über Vorbestimmung und Freiheit in der hellenistisch-kaiserzeitlichen Philosophie Albrecht Dihle, Freiheit und Schicksal in der hellenistischen Philosophie, in: Max-Planck-Gymnasium. Festschrift zum Jubiläum des ältesten Göttinger Gymnasiums, hg v. Henning Hennig, Detlef Johannsen, Jörg Ohlemacher u. Hans Christian Winters, Göttingen 1986, S. 175-183. 47 Attikos, fr. III Baudry. 48 Straton, fr. 32-35 ed. Wehrli. 49 Plutarch, Pomp., 75.
Das Gebet der Philosophen
219
terie, wodurch der Rahmen des Möglichen für die sublunare Welt gesetzt ist, in der die Menschen leben. Hier ist die Materie nur unvollkommen geordnet, wie es zum Beispiel das Handeln der Menschen aus irrationalen Impulsen und ihre Unfreiheit erweisen. Schon Platon hatte gelehrt, dass der Mensch vermöge seiner Vernunft zwar jederzeit zu freiem Handeln befähigt sei, dass er aber unlöslich an die Folgen seines Handelns gebunden bleibe und insofern einer Notwendigkeit unterliege.50 Die vielen Fehlhandlungen, die Menschen unter dem Einfluss ihres von der Vernunft nicht beherrschten Wesensteiles begehen, machen sie aber nicht nur unfrei. Sie verletzen auch die vernünftige Weltordnung. Diese fortgesetzt wiederherzustellen ist Aufgabe der Dämonen, der im sublunaren Bereich tätigen göttlichen Wesen. Das erleben die Menschen als Zufall oder als Vergeltung ihrer Taten und als Unterwerfung unter die Notwendigkeit.51 Die Lehre von diesem dreifach abgestuften Wirken der Gottheiten eröffnet der Freiheit des Menschen einen Spielraum und lässt individuelles Beten als sinnvoll erscheinen. Keine dieser drei Klassen göttlicher Wesen jedoch konnte man ohne weiteres mit den Göttern der traditionellen Religion identifizieren. Wohl deshalb führt ein platonisierender Text, eine schwer datierbare Pythagoras-Vita, die Götter auf einer zusätzlichen Stufe der Vorsehung ein.52 Vier Determinanten kennt auch die oben genannte Abhandlung des Maximos von Tyros, aber hier hätte es der stoisierenden Argumentation des Autors widersprochen, so auch das Bittgebet zu rechtfertigen. Er musste das Gebet auf andere Weise deuten. Fast alle in der langen Diskussion um Freiheit und Notwendigkeit ins Spiel gebrachten Determinanten zählt schließlich die personifizierte Philosophie in Boethius’ Consolatio auf.53 Diese Übersicht zeigt, dass man auch auf philosophisch-kosmologischer Grundlage bemüht war, dem Gebet, einer mit der überlieferten Religion fest verbundenen Handlung, den Platz im Leben zu erhalten. Das stärkste Argument zugunsten des Gebetes lieferte jedoch ein anderes Motiv. Das Bedürfnis, mit dem Numinosen zu kommunizieren, um an seiner Segenskraft teilzuhaben, ist Beweggrund aller religiösen Praxis. Jedoch darin, was solche Kommunikation bedeute, unterschieden sich die Meinungen auch in der Antike. Sie reichten von der Vorstellung, die numinose Macht durch Gebetsformeln, allein oder verbunden mit kultisch-magischem Handeln, herbeizurufen und zur hilfreichen Intervention zu veranlassen, bis zur spirituellen Erfahrung des Einswerdens mit der Gottheit. Die in der Kaiserzeit aufkommenden Heilslehren, 50 Platon, Politeia, 617 c-e. 51 Vgl. Dihle, Freiheit und Schicksal in der hellenistischen Philosophie, a. a. O. 52 Agatharchidea, hg. v. Otto Immisch, Heidelberg 1919. 53 Boethius, cons., 4, 6, 97.
220
Albrecht Dihle
in philosophischer Sprache expliziert, aber mit Offenbarungsanspruch vorgetragen, näherten sich bisweilen jenem magischen Verständnis der Verbindung zur Gottheit, das am krassesten in den Zauberpapyri zutage tritt. Andererseits aber gibt es aus der Kaiserzeit Zeugnisse auch dafür, dass man einfach nur das Glück einer Gemeinschaft mit der Gottheit erleben konnte, ohne dabei an Wunscherfüllung, Gebetszwang oder dergleichen zu denken und auch ohne den Rekurs auf mystische Versenkung. Plutarch, ein philosophisch gebildeter und zugleich im traditionellen Sinn frommer Mann, bedauert die Epikureer, weil ihre Lehre jede Verbindung zwischen Gott und Mensch ausschließt. So können sie die tiefe Freude nicht empfinden, die sich bei Götterfest und Kultmahl ganz von selbst einstellt, weil man sich dabei mit den Göttern vereint weiß.54 Hundert Jahre später berichtet Philostrat im Heroikos vom ganz alltäglich-selbstverständlichen Umgang, den Menschen und Heroen, Empfänger eines Grabkultes, miteinander pflegen,55 auch ohne dass es dabei jedes Mal um gute Gaben geht. ‚Caerimoniae et religiones‘ gibt es nicht aus Furcht, sondern einfach wegen der ‚coniunctio‘ zwischen Mensch und Gott, heißt es schon bei Cicero.56 Noch Macrobius sah in der Tischgemeinschaft zwischen Menschen und Göttern das wichtigste Kennzeichen der Goldenen Urzeit.57 Das philosophische Verständnis der Götterverehrung hat Seneca, vermutlich in Anlehnung an Poseidonios, aber in Übereinstimmung mit fast allen Schulphilosophien, kurz beschrieben.58 Man verehrt die Gottheit auf rechte Weise, wenn man ihr Wesen zu erkennen sucht und ihr im Wohltun nacheifert. Das kann, in Anlehnung an eine Formulierung im platonischen Theaitet, als ὁμοίωσις θεῷ oder stoisch als ἀκολουθεῖν τῷ θεῷ, ausgedrückt werden. Das Streben nach Erkenntnis der Gottheit, des höchsten Wesens, befreit als reine Vernunfttätigkeit den Menschen von der Bindung an seine Leiblichkeit und macht ihn derart der Gottheit ähnlicher, das Wohltun in der Nachahmung göttlichen Tuns lässt ihn die Gemeinschaft aller Vernunftwesen erfahren. Beides führt ihn in die Verbindung mit der Gottheit, die ihrerseits nichts bedarf, also auf Gaben der Menschen nicht angewiesen ist.59 Darin, dass das Gebet seinen Sinn als Gespräch mit der Gottheit erfülle, gipfelt denn auch die Darlegung in der oben genannten 5. Rede des Platonikers Maximos. 54 Plutarch, non posse suav., 1101E-1102D. 55 Dazu Albrecht Dihle, Theodorets Verteidigung des Kults der Märtyrer, in: Chartulae. Festschrift für Wolfgang Speyer, Münster 1998, S. 104-108; vgl. Libanios, orationes, 18, 39; 171 ff. 56 Marcus Tullius Cicero, de leg., 1, 43. 57 Macrobius, convivia primi diei Saturnaliorum, 1, 7, 19 ff. 58 Seneca, epist., 95 , 47-50. 59 Ebd., 95, 47 f. u. v. a.
Das Gebet der Philosophen
221
Gerade der Weise, die exemplarische Gestalt der philosophischen Paränese, befleißigt sich des Gebetes,60 weil bei ihm die Vernunft, unbehindert durch emotionale und andere, an der Materie orientierten Triebe; alle Lebensäußerungen bestimmt. Damit ist der Zustand des Weisen dem der Gottheit ganz ähnlich, so dass im Gebet eine Kommunikation von Gleich zu Gleich stattfindet.61 Alle in der Kaiserzeit maßgebenden Philosophien betrachteten den Wesenskern des Menschen als göttlich, sei es stoisch als Partikel des die Welt durchwaltenden Pneuma, des Trägers der Vernunft, sei es in platonischer Tradition als den wertvollsten unsterblichen Teil einer präexistenten Seele, dessen Heimat die intelligible Welt ist. Die Gottheit, zu der unter dieser Voraussetzung gebetet wurde, war darum, einerlei in welcher Gestalt man sie sich vorstellte, und unabhängig von dem Abstand, den man zu ihr verspürte, dem eigenen Innern verwandt. Hier liegt die wichtigste Voraussetzung für die philosophische Lehre vom Gebet als Kommunikation mit der Gottheit. Es wurde schon darauf hingewiesen, wie im religiösen Klima der Kaiserzeit auch Stoiker im Rahmen ihrer materialistischen Welterklärung dem Vertrauen in die Naturordnung in religiöser Sprache Ausdruck gaben. Die Konventionen dieser Sprache waren von der Praxis einer polytheistischen Religion geprägt. Nun rechneten auch die philosophischen Kosmologien mit der Existenz vieler göttlicher Wesen, die, trotz ihrer übermenschlichen Kraft und Einsicht, in derselben Welt- oder Seinsordnung wie die Menschen aufgehoben sind. So sprechen Seneca, Epiktet und Kaiser Marcus abwechselnd von Vorsehung, Natur, Gott, den Göttern oder dem Göttlichen, wenn sie ihre Geborgenheit in der Weltordnung zur Sprache bringen. Das erleichterte ein Festhalten an der traditionellen Religion und ihrer Praxis. Ihre Götter und Riten konnte man beibehalten, aber eben philosophisch, das heißt kosmologisch oder moralisch, deuten. Die Lehre der Platoniker war, wie oben gezeigt, in der Klassifizierung göttlicher Wesen besonders genau. Insbesondere die Vorstellung von einem höchsten, intelligiblen Gott, der in erhabener Ruhe oberhalb der Astralsphäre thront und das All bis hinunter in die Menschenwelt durch seine in strenger Hierarchie agierenden Diener und Boten regiert, war ein Modell, das sich sowohl den Gestalten der traditionellen Religion als auch den sozialen Erfahrungen in einer Weltmonarchie zuordnen ließ. Der Autor, der in der pseudo-aristotelischen Schrift vom Kosmos stoische, platonische und peripatetische Gedanken verbindet, hat das durch den Vergleich mit dem Großkönig der Perser
60 Maximos von Tyros, 61 ed. Koniaris. 61 Zur frühen Geschichte dieses Motivs vgl. Carl Werner Müller, Gleiches zu Gleichem: ein Prinzip frühgriechischen Denkens, Wiesbaden 1965.
222
Albrecht Dihle
exemplarisch ausgedrückt.62 Die Vorstellung von einem Weltgott verband man auch in der Weise mit den Göttergestalten beliebiger Religionen, dass man eine unter ihnen als Weltgott proklamierte und die übrigen als seine Erscheinungsformen verstand, an die sich in der Weite der Welt die Gebete der Völker und Menschen richten. Das entsprach den monotheistischen Tendenzen der Zeit und geschah außerhalb wie innerhalb der Philosophie. Das zeigt zum Beispiel einerseits der Isis-Hymnus auf einem Papyrus des 2. Jahrhunderts n.Chr., andererseits die Helios-Rede Kaiser Julians. Das Verfahren war durch die alte ‚interpretatio Graeca‘ exotischer Götter vorbereitet.63 In der Schule Platons, wo sich seit dem 3. Jahrhundert das philosophische Leben konzentrierte, suchte man das Verhältnis zwischen philosophischer Lebenskunst und religiöser Praxis besonders genau zu erfassen. Die einzelnen Vertreter des Neuplatonismus machten dabei in verschiedenem Umfang Gebrauch von Motiven, die sie in der Literatur der schon erwähnten Heilslehren fanden. Das gilt besonders für die sogenannten Chaldäischen Orakel64 aus dem 2. Jahrhundert n. Chr., die dem Menschen den Weg zur Erlösung in die Unsterblichkeit zeigen sollten. Sie operierten mit Motiven aus der Philosophie, beanspruchten aber die Autorität uralter orientalischer Weisheit und religiöser Offenbarung. Die orientalische Einkleidung entsprach der schon früh bei den Griechen gehegten Meinung vom hohen Alter der orientalischen Überlieferungen65 sowie der stoischen Lehre von dem durch spätere διαστροφή verlorenen natürlichen Wissen des Menschen von Gut und Böse.66 Dieses Wissen sollte die Philosophie als Kunst des rechten Lebens wiedergewinnen, und dazu gehört auch die Einsicht in das Wesen und Wirken der Gottheit, war doch die Philosophie „Lehre von den göttlichen·und menschlichen Dingen“. Gerade alte oder vermeintlich alte religiöse Traditionen des Orientes 62 Ps.-Aristoteles, de mundo, 398 a 5-b 22. 63 Isis-Hymnus, POxy. 1380. In der spätantiken Theologie, die mit platonischer Philosophie die alte Religion zu stützen suchte und dabei dem Sonnengott die Schlüsselrolle zuwies, gab es verschiedenste Spekulationen zum Verhältnis zwischen dem Weltgott und der Vielfalt göttlicher Wesen auf den einzelnen Stufen der Seinsordnung, so in Julians Rede auf den Sonnengott – zum Beispiel Julianus, or., 141D-142D; 152D-153D – . Zur Solartheologie im Westen vgl. Ekkehart Syska, Studien zur Theologie im ersten Buch der Saturnalien des Ambrosius Theodosius Macrobius, Stuttgart 1993, S. 189-209; zur frühen ‚interpretatio Graeca‘ fremder Gottheiten Walter Burkert, Herodot als Historiker fremder Religionen, in: Entretiens sur l’antiquite classique 35 (1988) S. 1-32. 64 Friedrich W. Cremer, Die Chaldäischen Orakel und Jamblich de mysteriis, Meisenheim am Glan 1969, S. 136-139. 65 Vgl. Aristoteles, Fr. 13; 35 ed. Rose. 66 Stoicorum veterum fragmenta, 3, 217; 220; 229a; 2, 473.
Das Gebet der Philosophen
223
genossen deshalb als Philosophien steigendes Ansehen.67 Die Theologie aber bildete in der philosophischen Systematik einen Teil der Physik, der Naturlehre, und so konnte sich die griechische Philosophie durch Übereinstimmungen mit der βάρβαρος φιλοσοφία bestätigt fühlen.68 Im 2. Jahrhundert nannte der pythagoreisierende Platoniker Numenios Platon einen „attisch sprechenden Moses“,69 und schon im frühen 3. Jahrhundert hatte Megasthenes geschrieben, es gebe keine kosmologische Lehre der griechischen Philosophie, die nicht auch bei indischen Brahmanen oder jüdischen Schriftgelehrten zu finden sei, was Clemens von Alexandrien im frühen 2. Jahrhundert zustimmend zitiert. Vor diesem Hintergrund wurde in der Schule Platons neben anderen Fragen der religiösen Praxis auch die nach dem Sinn des Gebetes wiederaufgenommen.70 Ob solche Erörterungen auch als Auseinandersetzung mit dem Christentum oder nur mit der steigenden Bedeutung religiöser Fragen für die innerphilosophische Diskussion zu erklären sind, kann man allenfalls im Einzelfall entscheiden. Der Kommentar des Proklos zu Platons Timaios71 aus der Mitte des 5. Jahrhunderts enthält eine kleine Abhandlung über das Gebet.72 Der Verfasser beginnt mit dem Referat der Gebetslehre des Porphyrios aus dem späten 3. Jahrhundert und
67 Zum Beispiel Claudius Aelianus, Varia Historia, 2, 31. 68 Zum Motiv der Belehrung durch alte exotische Weisheit vgl. Wolfgang Speyer, Art. Barbar, in: RAC, Supplement 1, 2001, Sp. 811-895 – , ursprünglich in: Journal of Ancient Civilizations 10 (1967) S. 251-290, hier S. 258 f.; Heinrich Dörrie, Der Platonismus in der Antike, Bd. 2, hg. v. Matthias Baltes, Stuttgart-Bad Cannstatt 1990, S. 166 ff.; Philostrat lässt seinen Helden Apollonios von Tyana mit indischen Brahmanen diskutieren, Plotin schloss sich dem Persienfeldzug Kaiser Gordians an, um mit indischen Weisen in Verbindung zu treten – vgl. Porphyrios, Plot. 3 – , und Porphyrios notierte, was Bar Daisan in Edessa von Gesandten aus dem Kushan-Reich über indische Überlieferungen gehört hatte – fr. 376 F Smith – . 69 Numenios, fr. 8 ed. des Places. 70 Hans P. Esser, Untersuchungen zu Gebet und Gottesverehrung der Neuplatoniker, Diss. Köln 1967; Clemens Zintzen, Die Wertung von Mystik und Magie in der neuplatonischen Philosophie, in: RMP 108 (1965) S. 71-100 – überarbeitet in Die Philosophie des Neuplatonismus, hg. v. Clemens Zintzen, Darmstadt 1977, S. 391 ff., dort: S. 417 ff. – über die Theurgie; wichtig ferner Peter Brown, The Rise and Function of the Holy Man in Late Antiquity, in: The Journal of Roman Studies 61 (1971) S. 80-101. Zu Vorstufen in der hohen Kaiserzeit Graham Anderson, Sage, Saint and Sophist, London 1994. 71 Proklos, in Ti., 1, 207 ff. 72 Dazu auch Proklos, Commentaire sur le Timée, hg. v. Andre J. Festugière, Bd. 2, Paris 1967, S. 27 ff.; zur Nachwirkung der Lehre des Proklos vom Gebet vgl. Werner Beierwaltes, Proklos, Frankfurt am M. 1979, S. 391 ff.
224
Albrecht Dihle
erläutert die eigene Meinung im Anschluss an die Lehre des Jamblich. Von diesem wiederum hat sich ein einschlägiger Exkurs in der Schrift De mysteriis73 erhalten. Im Porphyrios-Referat74 wird zunächst festgestellt, dass nur unter der Voraussetzung, dass man an die Fürsorge der Götter glaubt und mit den ἐνδεχόμενα καὶ ἄλλως εἶναι, also mit nicht durch die Weltordnung determinierten Vorgängen, rechnet, das Bittgebet einen Sinn hat. Für Leugner der Existenz der Götter oder auch nur ihrer Fürsorge sowie für Vertreter der Auffassung, dass alles göttliche Handeln einer Notwendigkeit unterliege, ist Beten widersinnig. Damit sind Skeptiker, Epikureer und Stoiker gemeint, auf deren Lehren man sich noch bezog, deren Schultraditionen aber meist schon abgestorben waren. Die aristotelische Konzeption der ἐνδεχόμενα καὶ ἄλλως ἔχειν war mit anderen peripatetischen Lehren in Teile der platonischen Lehrtradition übernommen worden, jedoch nicht ohne Widerspruch. So erklärt Porphyrios’ Lehrer Plotin, das Gebet könne den Lauf der Dinge nicht ändern,75 stimmt darin also gerade mit den Stoikern, zum Beispiel Hierokles im 2. Jahrhundert,76 überein. Porphyrios betrachtet das Gebet als eine Handlung, die das Leben der Menschen aufrichtet oder verbessert – ὰνορθοῦν – . Vor allem aber wird gerade der Weise beten, um die Verbindung – συναφή – zur Gottheit herzustellen und auf diese Weise Gleiches zu Gleichem bringen, denn der Weise ist bereits gottähnlich. Die um ἀρετή Bemühten, die philosophisch Lebenden, betrachten sich, wie es Platon ausgedrückt hatte, wie Soldaten auf der Wache, die ihren Posten nicht verlassen dürfen.77 Doch können sie, so Porphyrios, um Ablösung aus dieser unvollkommen-materiellen Welt beten,78 um als körperlose Seelen zu ihrem Vater, von dem sie getrennt sind, heimzukehren. Das bezieht sich auf die neuplatonische Lehre von der ἐπιστροφή. Wer nicht betet, ist wie ein vater- und mutterloses Kind, das nicht heimkehren kann oder will. Gerade hierfür beruft sich Porphyrios auf die βάρβαρος φιλοσοφία und ihre Lehre vom Gebet. Er tadelt dann die Chaldäischen Orakel, weil sie lehren, auch die ἀρετὴ θεῶν als Gott zu verehren, und damit um der ἀρετή willen die ἱερὰ
73 Iamblichos, Myst., 5, 26. 74 Proklos’ Referat der Gebetslehre des Porphyrios fehlt bei Porphyrius, Fragmenta, hg. v. Andrew Smith, Stuttgart u. Leipzig 1993. 75 Plotin, 3, 2, 8 u. ö. 76 Stobaios, 1, 3, 53. 77 Platon, Phaidon, 62 b-c; ein ähnliches Motiv bei dem Stoiker M. Ant., 10, 25. 78 Dieses Thema lag Porphyrios nahe, da er nach eigenem Bekunden sich mit Selbstmordabsichten getragen hatte; vgl. Porphyrios, Plot., 11.
Das Gebet der Philosophen
225
θρήσκεια vernachlässigen.79 Das richtet sich gegen die Hypostasierung göttlicher Eigenschaften als Gegenstand religiöser Verehrung, die für jene halbphilosophischen Texte typisch ist, aber schlecht zur Einhaltung traditioneller Götterverehrung passt, wie es in Plotins Schülerkreis trotz gelegentlicher Kritik des Meisters üblich war.80 Im Einklang mit dem zuvor Gesagten hebt Porphyrios hervor, dass es beim Gebet um die Vereinigung der Teile, als die sich die Menschen verstehen sollen, mit dem Ganzen gehe. Letztes Ziel der ἐπιστροφή aller Geistwesen ist ja das Eingehen in das allumfassende Eine. Alles rechte Beten entspringt dem Streben nach Vereinigung, auch die Bitte um σωματικὰ ἀγαθά, weil diese von der συνεκτικὴ δύναμις des einen Kosmos abhängen. Auch an anderen Stellen hat sich Porphyrios zum Gebet geäußert. So sieht er in sittlicher Reinheit die Voraussetzung des rechten Gebetes,81 beides aus der Tradition bekannte Gedanken. Die spirituelle Deutung des kultischen Verhaltens illustriert er am Beispiel des Erntedankopfers eines Bauern: Wie dieser von seinen Feldfrüchten opfert, so soll es der Philosoph mit seinen guten Gedanken tun, die eine göttliche Gabe sind.82 Das Dankgebet kommt auch Ad Marcellam 23-24 zur Sprache, verbunden mit dem alten Motiv, dass die Angleichung an Gott der beste Gottesdienst sei. Porphyrios’ Schrift De regressu animae, über längere Strecken durch Augustin bekannt, behandelte in Anknüpfung an die Chaldäischen Orakel auch den Sinn des die theurgische Handlung begleitenden Gebetes. Durch die Kulthandlung, von Kundigen ausgeübt, werden göttliche Wesen herbeigerufen und offenbaren übernatürliches Wissen.83 Von sich aus vermag der Mensch die Gottheit nicht zu erkennen und ist auf Rückschlüsse aus ihrem Wirken angewiesen.84 Porphyrios schreibt diesen Handlungen vor allem reinigende Wirkung zu, wodurch sie auf den eigentlichen, den geistigen Aufstieg der Seele und ihre Rückkehr zum Vater85 vorbereiten. Gereinigt wird so freilich nur der mit der Materie verknüpfte Teil
79 Die Hypostasierung oder Personifizierung göttlicher Eigenschaften begegnet in gnostischen, hermetischen und ähnlichen Heilslehren nicht selten, zum Beispiel Corp.Herm. 10, 23; Corp.Herm. Exc. 29 – Stobaios, 1, 5, 14 – ; Orac.Chald., 107, 11 P. 80 Porphyrios, Plot., 10. 81 Porphyrios, de abstinentia, 2, 45 f.; ad Marcellam, 11. 82 Porphyrios, de abstinentia, 2, 34. 83 Porphyrios, fr. 285 F Smith. 84 Porphyrios, de abstinentia, 3, 11; vgl. M. Ant., 12, 28. 85 Porphyrios, fr. 298 c F.
226
Albrecht Dihle
der Seele, nicht ihr νοῦς,86 und auch die sittliche Leistung reinigt.87 Dabei und bei dem daran anschließenden Aufstieg kann die Hilfe Gottes erbitten.88 Doch vermag das Gebet bei der Theurgie auch echten, magischen Zwang auszuüben,89 und dazu passen die von Augustin überlieferten Termini magia, goetia und theurgia.90 Proklos’ eigene Lehre vom Gebet an der angegebenen Stelle91 zieht die Parallele zur Ontologie noch deutlicher. Die Entfaltung des Seins im Vollzug der πρόοδος und die Wiedervereinigung aller Hypostasen mit dem allumfassenden Einen durch die ἐπιστροφή, als permanenter, Welt und Leben konstituierender Akt vorgestellt, erfolgt über viele Stufen der Hypostasierung. Auf jeder von ihnen ist das Göttliche anwesend, denn alles Seiende bleibt, wie sich Proklos ausdrückt, im höchsten Einen verwurzelt. Auf ihrer jeweiligen Stufe streben darum alle Wesen, sich mit dem nächsthöheren, das für sie die Gottheit repräsentiert und den Weg der Rückkehr anzeigt, zu vereinen. Dieses Streben nach συναφή durchzieht den ganzen sinnlich wahrnehmbaren und noetischen Kosmos, und in diesem Sinn zitiert Proklos Jamblichs Zeitgenossen Theodoros von Asine:92 Alle Wesen beten – mit Ausnahme des höchsten Einen, das alles Sein in sich zusammenfasst – °, indem sie die Vereinigung mit der nächsthöheren Hypostase suchen. Für den Menschen ist demzufolge Beten ein Weg der Seele, sich durch die Verbindung zu den ihr vorgeordneten Wesen aus den Bindungen der Materie stufenweise zu lösen, ihr ὄχημα, ihr materielles Kleid oder ,Fahrzeug‘, abzulegen und sich mit dem göttlichen νοῦς zu vereinigen. Ähnlich äußert sich Jamblich.93 Proklos entwirft dann eine nach verschiedenen Gesichtspunkten gegliederte Theorie des Gebets, und zwar im Hinblick auf seine Stufen,94 seine Begründungen95 und seine Arten.96 Die Stufenfolge beginnt bei der Erkenntnis der Gottheit, auf der zweiten folgt das Bemühen, sich durch sittliche Tadelsfreiheit der Gottheit anzupassen – οἰκείωσις – . Dann kommen als dritte die Verbindung – συναφή – zu ihr und als 86 Porphyrios, fr. 288 F / 290 b F. 87 Porphyrios, fr. 291 F. 88 Porphyrios, fr. 297 F. 89 Porphyrios, fr. 294 F. 90 Porphyrios, fr. 286 F. 91 Proklos, in Ti.,1, 209 ff. 92 Theodoros von Asine, test. 7 ed. Deuse; vgl. Plotin, 5 ,1, 6, 9. 93 Iamblichos, Myst., 5, 26. 94 Proklos, in Ti., 1, 211 ff. 95 Ebd., 213. 96 Ebd., 213 f.
Das Gebet der Philosophen
227
vierte die engste Annäherung – ἐμπέλασις – , und die letzte, die fünfte, bringt die Vereinigung mit der Gottheit. Die Gebete· richten sich auf das Wirken der Götter, sofern sie die Menschen zur ἐπιστροφή aufrufen und damit auf das Seelenheil des Beters, sie dienen als Symbol der ursprünglichen und als ἄρρητος ἕνωσις wiederzugewinnenden Einheit und verdeutlichen die Verwandtschaft der Seelen mit der Gottheit. Als sinnlich wahrnehmbare Zeichen erinnern sie die Seele an ihre vom Demiurgen geschenkte Gaben.97 Es gibt drei Arten der Gebete, ,demiurgische‘, etwa solche um Regen oder Wind, kathartische, etwa zur Abwehr von Seuchen, und Leben schaffende, etwa für das Gedeihen der Saaten. Auch muss man die Gebete nach den Betern unterscheiden, nämlich das philosophische Gebet, das Gebet bei der Theurgie und dasjenige gemäß der bürgerlichen Tradition, ferner nach seinem Inhalt: An erster Stelle das Gebet um die σωτηρία τῆς ψυχῆς, die Unsterblichkeit, sodann das um körperliche Gesundheit und das um äußere Güter. Schließlich gibt es noch die Einteilung nach den Gebetszeiten. In Proklos’ Einteilungsschema findet also neben der neuplatonischen Deutung des Betens auch das herkömmliche Gebet um gemeinschaftliches und individuelles Wohlergehen Platz, wofür die peripatetische Güterlehre herangezogen wird. Diese Klassifizierungen gehen gewiss auf Proklos, den großen Systematiker, selbst zurück. Jamblich, dessen Abhandlung 98 in einem anderen Zusammenhang steht, formuliert paränetischer, ist sich aber mit Proklos darin einig, dass das Gebet ein Mittel der ἐπιστροφή sei, der Zuwendung und Rückkehr zum Ursprung des Seins.99 Ganz in diesem Sinn sagt Jamblich an anderer Stelle, dass die noetischen Wesen, an die sich jedes rechte Gebet richtet, dieses nicht eigentlich erhören, dass sie vielmehr das erbetene Gute in sich haben und der Beter dessen durch die Vereinigung mit ihnen teilhaftig wird.100 Jamblich behandelt das Gebet101 im Zusammenhang der Theurgie, jener bei vielen späteren Neuplatonikern beliebten kultischen, an das Mysterienwesen anknüpfenden Methode, mit der Gottheit in Verbindung zu treten. Das Gebet, so Jamblich, kann dem theurgischen Akt vorausgehen, folgen oder ihn begleiten,
97 Zur Rolle des Demiurgen im nachplotinischen Platonismus vgl. Werner Deuse, Der Demiurg bei Porphyrios und Jamblich, in: Die Philosophie des Neuplatonismus, a. a. O., S. 238-278. 98 Iamblichos, Myst., 5,26. 99 Proklos, in Ti., 1, 210, 31 f. 100 Iamblichos, Myst., 1, 15. 101 Ebd., 5, 26.
228
Albrecht Dihle
erscheint also damit in der alten Rolle als Teil der Kulthandlung.102 Doch könne man es auch isoliert betrachten. Die Gottheit verteilt zwar ihre Gaben ohne Kult und Gebet, aber dieses dient der συναφή und der γνώρισις und sein Ziel ist die ἄρρητος ἕνωσις des Beters mit der Gottheit. Damit bringt es drei Segnungen: Erleuchtung, Gemeinschaft und Erfüllung der Seele mit göttlichem Feuer. Das Gebet stärkt den menschlichen νοῦς, erleichtert das Eindringen des göttlichen νοῦς in die Seele, gewöhnt den Menschen an den Glanz des göttlichen Lichtes, erweckt die Gottesliebe, unterdrückt die der Seele anhaftenden irdischen Elemente, verleiht Hoffnung und Glauben und macht Menschen zu Gesprächspartnern Gottes. Ähnlich wird die Wirkung des Betens in der Isidor-Vita des Damaskios beschrieben:103 Die Seele kommt zu sich selbst, indem sie sich aus der Bindung an den Körper löst, dann vereinigt sie sich mit dem göttlichen νοῦς und schließlich gelangt sie zu göttlicher, nicht mehr menschlicher Ruhe. Aber auch bei der Rückkehr aus der Ekstase kann das Gebet helfen.104 Proklos’ Lehre zeigt demnach die Systematisierung einer Gedankenreihe, die im wesentlichen auch bei Jamblich vorliegt. Die dabei eingehaltenen Stufenfolgen sind, vergleichbar dem Abriss der plotinischen Tugendlehre in Porphyrios’ Sentenzen,105 in Parallele zu einer Ontologie konzipiert, die eine Entfaltung des Seins aus dem höchsten Einen über viele Stufen des noetischen und des sichtbaren Kosmos lehrt. Die alte Frage, wie der Beter den Gott, zu dem er betet, auch kennen und seinen richtigen Namen wissen könne, suchen Porphyrios, Jamblich und ihre Nachfolger mit dem gleichfalls alten Motiv zu beantworten, dass die Götter selbst die Menschen das rechte und erfolgreiche Beten gelehrt haben. Sowohl im Referat des Proklos106 als auch in der an Porphyrios gerichteten Schrift De mysteriis behandelt Jamblich diese Lehre. Es sind ἄρρητα σύμβολα – von ἄσημα ὀνόματα spricht Porphyrios107 – die dem Menschen in die Seele gelegt wurden. Ihr Aussprechen vereint den Beter, der sich im Bewusstsein seiner Niedrigkeit nach dieser Vereinigung sehnt, mit der angebeteten Gottheit.108 Der göttliche νοῦς verbindet sich mit den λογία des Beters. 102 Zum Verhältnis zwischen Handlung und Wort im Kult vgl. Albert Henrichs, Dromena und Legomena: Zum rituellen Selbstverständnis der Griechen, in: Ansichten griechischer Rituale: Geburtstags-Symposium für Walter Burkert, hg. v. Fritz Graf, Stuttgart u. Leipzig 1998, S. 33-71. 103 Damaskios, vita Isidori, fr. 40 ed. Zintzen; vgl. Marinos von Neapolis, vita Procli, 21. 104 Damaskios, vita Isidori, fr. 208 ed. Zintzen. 105 Porphyrios, Sent., 32. 106 Proklos, in Ti., 1, 211, 1 ff. 107 Eusebius, praeparatio evangelica, 5, 10, 8. 108 Iamblichos, Myst., 1, 15.
Das Gebet der Philosophen
229
Schon Numenios hatte gelehrt, dass dem eigentlichen Gebet die Anrufung Gottes mit der Bitte um Offenbarung vorausgehen solle.109 Das entspricht der göttlichen Selbstoffenbarung, wie man sie zum Beispiel aus dem Corpus Hermeticum kennt und ist typisch für Heilslehren, die sich als neu präsentieren und dabei die alte Frage nach der richtigen Anrede des verkündigten Gottes beantworten müssen. Die geheimnisvollen, in der menschlichen Sprache nicht vorgesehenen Laute und Formeln gehören zur Theurgie, der rituellen Praxis, die im späteren Neuplatonismus eine nicht unbedeutende Rolle spielte. Es herrschte dabei die der Magie entlehnte Auffassung von einem Gebetszwang,110 den der Mensch durch gottgegebenes Wissen auszuüben vermag. Das bezogen die Neuplatoniker aus den erwähnten Heilslehren. So stand in den Chaldäischen Orakeln, die Porphyrios und vor allem Jamblich als Offenbarungstexte lasen, dass die Götter die Menschen das Beten lehrten und durch das Gebet herbeigerufen würden.111 Ein anderes Fragment112 bezeugt die Kombination der magisch verstandenen Kulthandlung mit dem fixierten Gebetstext. Der Einfluss chaldäischer, orphischer und hermetischer Texte im späteren Neuplatonismus113 zeigt sich auch in Berichten von der durch Gebet, mit oder ohne Kulthandlung, bewirkten Wunder. So vermögen in Alexandrien weilende indische Brahmanen,114 aber eben auch Philosophen,115 es regnen zu lassen oder Kranke zu heilen. Durch intellektuelle Anstrengung und rituelle Praxis erwerben sie übernatürliches Wissen,116 das sich sogar in ihrer Erscheinung ausdrückt.117 Die Gotteserkenntnis, die für Seneca in der Tradition hellenistischer Philosophie einer der beiden Teile rechter Gottesverehrung war, gründete sich demgegenüber auf das nur durch intellektuelles Bemühen erworbene Verständnis der göttlichen Weltordnung. Darum kann Seneca unter Berufung auf Aristoteles fordern, dass die Diskussion naturwissenschaftlicher Fragen in derselben ehrfurchtsvollen Haltung und Gesinnung erfolgen müsse, wie sie die Menschen bei Opfer und Gebet im Tempel zeigen.118
109 Numenios, fr. 11 ed. des Places. 110 Porphyrios: Eusebius, praeparatio evangelica, 8, 1-2; 9 ,1. 111 Orac.Chald. 222 ed. des Places. 112 Ebd., 224. 113 Marinos von Neapolis, vita Procli, 26. 114 Damaskios, vita Isidori, fr. 67 ed. Zintzen. 115 Ebd., fr. 69; 343; Marinos von Neapolis, vita Procli, 28; 31. 116 Marinos von Neapolis, vita Procli, 18-19. 117 Ebd., 23. 118 Seneca, quaest. nat., 7, 30, 1.
230
Albrecht Dihle
Plotin, der Begründer des Neuplatonismus, stand dieser von Seneca repräsentierten Tradition noch nahe. Chaldäische Orakel, gnostische, orphische oder hermetische Texte und ebenso die Theurgie wurden erst bei seinen Nachfolgern beliebt.119 Auch zur traditionellen Religion konnte er sich mit einer gewissen Reserve äußern, ebenso zur Astrologie.120 So verstand er auch das Gebet lediglich als Vorbereitung auf das philosophische, vom Erkenntnisstreben bestimmte Leben.121 Das war gut platonisch gedacht. Schon der Meister hatte gesagt, dass das Gespräch mit den Göttern zur Eudaimonie beitrüge,122 ein Zitat, das auch Proklos im oben besprochenen Abschnitt heranzieht. Dass göttliche Hilfe gerade für das eigene Bemühen um die Besserung des inneren Menschen vonnöten sei, entsprach auch stoischer Lehre, die Plotin nicht fremd war.123 Im vierten Traktat der vierten Enneade kommt Plotin wiederholt auf das Gebet zu sprechen.124 Bei den γοήτειαι, ἐπωιδαί und εὐχαί, worunter die mit Kulthandlungen verbundenen Gebete zu verstehen sind, schließt er weder die Wirkung auf die ἄλογος ψυχή aus noch die erfolgreiche Einwirkung auf Vorgänge innerhalb der Sinnenwelt, in der durch Sympathie jedes mit jedem verknüpft ist – auch dieses ein stoischer Gedanke.125 Aber zum Aufstieg der Seele, der aus dem Sichsehnen jedes Wesens nach der höheren Hypostase folgt und das geistige Beten bestimmt, trägt jenes innerweltliche, ,magische‘ Beten nichts bei. Anders als Porphyrios schreibt er ihm auch keine reinigende Wirkung zu. Das wahre Beten setzt ein Bei-sich-sein des Beters voraus, die Konzentration auf sein Inneres,126 und ist darum ein zur Erkenntnis leitender Akt. Die erkennende Schau der höheren Hypostase bedeutet dann die Angleichung an diese.127 Eben darin besteht die rechte Verehrung der Gottheit.128 Das Gebet zu den Sternen(göttern) wird von diesen nicht etwa erhört und mit einer vorsätzlichen Gewährung der Bitte beantwortet. Ihre Gaben verteilen sie mit und ohne Gebet, denn sie und der Beter sind Teile desselben Ganzen.129 Das schließt nicht aus, dass durch die ἄνω κίνησις der Seele des Beters sich zwischen 119 Porphyrios, Plot., 16. 120 Ebd., 10; 15. 121 Plotin, 5, 1, 6. 122 Platon, Nomoi, 716 D. 123 Porphyrios, Plot., 14. 124 Vor allem 40-44. 125 Vgl. M. Ant., 7,9. 126 Plotin, 5, 1, 6, 9-12; 4, 8, 1, 1. 127 Plotin, 5, 3, 8, 22; vgl. Porphyrios, Sent., 25. 128 Plotin, 3, 8, 1, 18. 129 Plotin, 4, 4, 41-42.
Das Gebet der Philosophen
231
ihm und den Göttern eine Harmonie einstellt. Auf diese Weise eröffnet das Gebet den Weg zur Erkenntnis, denn der Zustand der Seele wird durch die Verbindung zur Gottheit verändert.130 Es ist wohl deutlich geworden, dass die ausführlicheren Lehren vom Gebet, die sich bei Porphyrios, Jamblich und Proklos finden, zwar die plotinische Ontologie voraussetzen, sich jedoch von Plotins Gedankenwelt unterscheiden. Sie verstehen das Gebet als eine im engeren Sinn religiöse Handlung, die neben dem intellektuellen Bemühen eigene Bedeutung beansprucht. Plotin bleibt demgegenüber trotz seiner neuen Ontologie Vertreter einer philosophischen Frömmigkeit. Seine an Platon anknüpfende Lehre vom mystischen Evidenzerlebnis einer Vereinigung mit dem göttlichen νοῦς als Ziel des philosophischen Lebens131 bezieht sich auf einen Vorgang im Innern des Menschen und bedeutet die Sublimierung der schon älterer philosophischer Tradition geläufigen Vorstellung von einer spirituellen Kommunikation zwischen Mensch und Gott.132 Obgleich Plotin magische Wirkungen innerhalb der Sinnenwelt nicht ausschließt, misst er ihnen keine Bedeutung für den inneren Menschen zu, um dessen Aufstieg sein Denken kreist. In den erhaltenen Biographien gibt es reichlich Zeugnisse für die Frömmigkeit der späteren Neuplatoniker, die sich sowohl in ihrer Teilnahme an traditionellen öffentlichen und Mysterienkulten sowie in einer reichen Hymnendichtung133 ausdrückte. Auch von ihrem Beten und seiner Wirkung ist, wie oben gezeigt, gelegentlich die Rede. Allerdings scheint dieses Thema nicht im Zentrum ihrer Lehren gestanden zu haben. In Zusammenfassungen neuplatonischer Doktrin wie den Sentenzen des Porphyrios oder den Elementa Theologica des Proklos kommt es nicht zur Sprache, eher als Exkurs in exegetischen oder anderen Schriften. Das neuerliche Interesse an der Verknüpfung des Gebets mit kultischem Handeln tritt verständlicherweise dort besonders deutlich zutage, wo ein Zusammenhang mit dem von Kaiser Julian unternommenen Restitutionsversuch besteht, wie vermutlich im ,Katechismus‘ des Saloustios. Diese Schrift soll ein rechtes Verständnis traditioneller Kulte und Mythen vermitteln, sie mit einer Theologie versehen und so ihren Geltungsanspruch sichern. Auch Saloustios lehrt, dass Opfer und Gebet wie vieles andere von den Göttern erfunden oder eingerichtet wurden, um die Seelen vom Unrechttun abzuhalten.134 Sie bringen Vergebung der Fehltritte und gehören so, als Heilung von der κακία, 130 Plotin, 4, 4, 26, 1. 131 Vgl. dazu Pierre Hadot, Plotin ou Ja simplicite du regard, Paris 1997. 132 Plotin, 4, 8, 1, 1; vgl. Porphyrios, Plot., 23. 133 Vgl. Marinos von Neapolis, vita Procli, 1; 6; 18-19. 134 Saloustios, 12, 6.
232
Albrecht Dihle
dem im Sinn platonischer Ontologie als Folge zu großer Entfernung von den oberen Hypostasen bewirkten Seinsmangel, zur ἐπιστροφή.135 Auch blutige Opfer sind gerechtfertigt – Porphyrios hatte sich vehement gegen sie ausgesprochen – , denn zur Verbindung mit der lebenspendenden Gottheit bedarf es eines Lebewesens. Gebete ohne Opfer sind bloße λόγοι, mit Opfer aber λόγοι ἔμψυχοι.136 Gebete veranschaulichen das νοερόν, die heiligen Zeichen oder Symbole die unsagbaren Mächte, Pflanzen und Steine der Kultstätte die Materie, die Opfertiere die ἄλογος ζωή des Menschen.137 Welche Rolle der traditionelle Kult und die neuplatonische Theurgie im Leben Kaiser Julians spielten, ist wohlbekannt. Die umfassende Organisation der Kulte im Reich, zusammen mit der Einführung religiöser Unterweisung und karitativer Tätigkeit des Kultpersonals, war das Herzstück seines Programmes, wie es der 89. Brief ausführt. Auf das Gebet kommt er im 88. Brief zu sprechen. Es geht dort um die Frage der göttlichen Vergebung von Verfehlungen. Dabei wendet sich der Kaiser gegen die alte Konnotation des Wortes εὔχομαι: ‚einen Fluch aussprechen‘. Die Bedeutung des Wortes, das ursprünglich jede nachdrücklich getroffene Aussage bezeichnete, hatte sich im Laufe seiner Geschichte als ‚rühmen‘, ‚beteuern‘, ‚verfluchen‘, ‚ein Gelübde tun‘ oder eben ‚beten‘ realisiert. Oben wurde gezeigt, dass bei späten Neuplatonikern das Gebet nicht selten dem Zauberspruch gleichkam: Der Kaiser bemüht sich, die Bedeutung ‚beten‘ als die eigentliche darzutun, und zwar in diesem Zusammenhang als ‚Fürbitte tun‘. Die Fürbitte138 ist auch anderwärts im Neuplatonismus bezeugt.139 Die kultreligiösen Elemente, die sich in der Philosophie nach Plotin häufen, haben ihre Parallele in der steigenden Bedeutung, die der Kult, also die sinnlich erfahrbare Verbindung mit dem Numinosen, unter den Christen gewann. Während sich noch Lactanz dagegen wehrt, dass man etwa ein Kirchengebäude als heilig bezeichnet,140 wird dieser Sprachgebrauch seit Konstantin auf alles ausgedehnt, was mit dem Kult zusammenhängt. Die christliche Religion hatte sich zunächst auf dem Boden eines Judentums herausgebildet, das sich im Übergang von einer
135 Ebd., 14, 3. 136 Ebd., 16,2. 137 Ebd., 15,2. 138 Zur Geschichte des Fürbittegebetes vgl. Otto Michel, Gebet II (Fürbitte), in: RAC, 9, 1976, Sp. 1-36. 139 Marinos von Neapolis, vita Procli, 17; Damaskios, vita Isidori, fr. 186 ed. Zintzen. 140 Lactantius, divinae institutiones, 4, 13, 26.
Das Gebet der Philosophen
233
Kult- zu einer Buch- oder Schriftreligion befand.141 Die Kontinuität des religiösen Lebens beruhte fortan auf der Bewahrung heiliger Schriften und ihrer Auslegung für das Leben. Die Umwelt, in der sich die Kirche entfaltete und durchsetzte, war jedoch ganz und gar von kultreligiösen Traditionen bestimmt. Das begünstigte die Herausbildung der massiven christlichen Kultpraxis, die für viele Christen die schriftreligiöse Komponente ihres Glaubens in den Hintergrund treten ließ. Die Philosophie, die Kunst des rechten Lebens, hatte früh einen eigenen, von spekulativen Denken und ethischem Handeln gewiesenen Weg zur Gottheit gesucht142 und sich dabei vom überlieferten Kult entweder distanziert oder ihn als Symbol interpretiert.143 Seit dem späten 1. Jahrhundert bestand zudem philosophische Unterweisung im Wesentlichen in der Auslegung autoritativer Texte. Auch Plotin betrachtete sich nur als Exeget Platons.144 So lag ein Selbstverständnis der jüdischen und anfangs auch der christlichen Religion als einer Philosophie auf der Hand, was der Sprachgebrauch vielfach bezeugt.145 Die älteren philosophischen Reflexionen auf das Gebet ergaben sich aus kosmologischen Lehren und ließen dementsprechend den Kult beiseite. Sie rechneten darum weder mit der sinnlich erfahrbaren Gegenwart numinoser Macht und ihrer Beeinflussung durch menschliches Tun noch mit übernatürlicher, die Vernunft übersteigender Offenbarung. Es war aber schwierig, die Gottheit, wie die Philosophie sie verstehen lehrte, mit denselben Zügen auszustatten und sie in derselben Nähe zu suchen wie die Kultempfänger, zu denen die politische Gemeinde oder der Einzelne in den, Nöten des täglichen 141 Zur Transformation des frühen Christentums in eine Kultreligion vgl. Peri Terbuyken, Priesteramt und Opferkult bei Juden und Christen in der Spätantike, in: Chartulae, a. a. O., S. 271-284; ferner Peter Brown, The Cult of the Saints, Chicago 1981. 142 Vgl. Porphyrios, Plot., 23. 143 Aufschlussreich sind auch die Äußerungen Philostrats in der Biographie des Apollonios von Tyana; der Held erscheint als Anhänger traditioneller Kultfrömmigkeit, die er freilich durch pythagoreische Lehren wie die der Ablehnung blutiger Opfer läutert und sich dabei auf göttlicher Inspiration beruft – Flavius Philostratos, vita Apollonii, 11 u. ö. – . Herkömmliche Gebetspraxis versieht er mit philosophischen Begründungen, indem er unter Berufung auf die Gerechtigkeit der göttlichen Ordnung nur um das, was man verdient, zu beten lehrt – ebd. 4, 40 – oder um Bedürfnislosigkeit, die der Philosoph durch eigenes Bemühen erreichen soll – ebd. 1, 33 – . Wie Platon – siehe oben – lehnt er auch das Motiv des ‚do ut des‘ bei Opfer und Gebet ab: vgl. ebd., 1, 11. 144 Plotin, 5, 1, 8, 10. 145 Zur ausschließlichen Orientierung an autoritativen Schriften in Judentum, Christentum und griechischer Philosophie John F. Procopé, Greek Philosophy, Hermeneutics, and Alexandrian Understanding of the Old Testament, in: Hebrew Bible – Old Testament: The History of its Interpretation, Bd. 1: From the beginnings to the Middle Ages (until 1300), hg. v. Christian Brekelmans u. Menahem Haran, Göttingen 1996, S. 451-477.
234
Albrecht Dihle
Lebens ihre Zuflucht nahmen. Theologeme wie die ‚theologia tripertita‘ oder die philosophische Dämonenlehre waren aus dieser Sicht nur Notbehelfe, den Abstand zwischen den traditionellen Kultempfängern und der Gottheit der Philosophie zu überbrücken. Dass ein allmächtiger zugleich als naher Gott empfunden wird, wie es der 139. Psalm zum Ausdruck bringt, bildet in der Geschichte der Religionen wohl eher die Ausnahme. Das soziale und spirituelle Klima in spätantiker Zeit war der Sicherheit, sich in einem vernünftig geordneten Kosmos versorgt und aufgehoben zu wissen, alles andere als günstig. Die Hinwendung philosophisch Gebildeter zur kultischen Praxis und offenbartem Wissen – beides der Kontrolle des diskursiven Denkens letztlich entzogen – wirft ein Licht auf die religiöse Befindlichkeit und das neue Sicherheitsbedürfnis jener Gesellschaft. Gerade die Meinungen vom Sinn des Gebetes, die dabei zutage traten, lassen das deutlich werden. Ganz am Ausgang der Antike steht merkwürdigerweise noch einmal ein Versuch, das einfache Gebet ohne Rückgriff auf offenbartes Wissen, mystische Versenkung oder kultische Praxis philosophisch zu rechtfertigen. Das wichtigste Thema der Consolatio des Boethius ist das Problem, wie man sich das Verhältnis zwischen der unabänderlichen Weltordnung und der freien, Verantwortung begründenden Entscheidung des Menschen zu denken habe. Der Autor resümiert die vielen Lösungsversuche, die dieses Problem erlebt hat und zählt dabei auch die Kausalfaktoren auf, die man bisher vorbrachte.146 Dann gibt er seine eigene Antwort. Die Ewigkeit Gottes, so Boethius am Schluss der Schrift, ist nicht unbegrenzte, in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft eingeteilte Zeitlichkeit, sondern ewige Gegenwart, ein Gedanke, der plotinischer Herkunft ist147 und ähnlich im 11. Buch der Confessiones Augustins auftaucht. Darum sind in Gottes Wissen nicht nur alle kosmischen, mit auch dem Menschen erkennbarer Notwendigkeit ablaufenden Ereignisse gegenwärtig, sondern ebenso alle von veränderlichen menschlichen Entscheidungen gelenkten Handlungen sowie die Möglichkeiten, zwischen denen die Wahl bestand. Dem Menschen, der in der Zeitlichkeit lebt, sind die Ursachen der Handlungsabläufe allenfalls im Rückblick einsichtig. Seine im Blick auf die Zukunft gefällten Entscheidungen dagegen sind völlig frei. Darum verdient er göttliche Strafe oder Belohnung und kann seine Gebete an die Gottheit richten, um von ihr Hilfe zu erflehen,148 gerade im Hinblick auf die Verantwortung für seine Entscheidung.149 146 Boethius, cons., 4, 6, 97. 147 Porphyrios, Plot., 3, 7. 148 Boethius, cons., 5, 6, 123 ff., vor allem 127. 149 Dazu Henry Chadwick, Boethius. The Consolations of Music, Logig, Theology, and and Philosophy, Oxford 1981, S. 244-253; ob Boethius’ Abkehr von der mystisch-magischen
Das Gebet der Philosophen
235
Dieser Text gibt noch einmal Zeugnis von einer ganz aus philosophischer Reflexion gespeisten Frömmigkeit, wie man sie auch bei dem Kaiser Marcus findet und in der das Fazit aus jahrhundertelanger Bemühung um eine lehrbare Kunst des rechten Lebens gezogen wird. Aber schon im späten 2. Jahrhundert entsprach dieser Weg, den Menschen seiner Stellung in Welt und Zeit zu vergewissern, kaum noch den Bedürfnissen auch des gebildeten Teiles der antiken Gesellschaft.
Tendenz im späten Neuplatonismus mit der römischen Prägung seiner Philosophie zu tun hat, ist eine berechtigte Frage; für Macrobius erörtert sie Clemens Zintzen, Römisches und Neuplatonisches bei Macrobius, in: Politeia und Res Publica: Beiträge zum Verständnis von Politik, Recht und Staat in der Antike, hg. v. Peter Steinmetz, Wiesbaden 1969, S. 357-376.
Plotins philosophische Mystik1: Bestimmung einer Lebensform Werner Beierwaltes
‚Philosophische Mystik‘ könnte als ein Selbstwiderspruch erscheinen, sofern man mit ‚philosophisch‘ vernünftiges, begrifflich argumentierendes, begründendes Denken identifiziert, mit ‚Mystik‘ aber gerade dessen Aufhebung oder Negation. Es ist kaum zu bestreiten, dass unter den Definitionen von Mystik, die Alois Maria Haas ausgemacht hat, sich eine oder mehrere finden lassen, die sich mit dem Beiwort ‚philosophisch‘ nicht vertragen oder durch es gar irritiert fühlen müssten. Insofern stellt die Fügung ‚Philosophische Mystik‘ eine Herausforderung gegenüber dem Irrationalismusverdacht von Mystik überhaupt dar – ein Irrationalismusverdacht allerdings, der sich ganz auf Gefühl oder subjektivistische Emotion stellt, ohne deren Rechtfertigung im Begriff überhaupt zu erwägen oder zuzulassen. Ich möchte mich nun nicht auf eine neue Definition einlassen, sondern anhand eines, wie mir scheint, überzeugenden Paradigmas das sinnvolle Zusammengehören der beiden Aspekte – ‚philosophisch‘ und ‚mystisch‘ – erweisen. Im Gebrauch des Begriffs ‚Mystik‘ nutze ich einen Minimalkonsens, der in dem Eins-Werden des Menschen – seines Bewusstseins – mit einem göttlichen Prinzip besteht. Inwieweit dieser Vorgang in sich überzeugend oder gar als Zielvorstellung anziehend wirken kann, dies hängt an seiner Fundierung und Entfaltung.
1
Diese Thematik habe ich in meinem Buch Denken des Einen. Studien zur neuplatonischen Philosophie und ihrer Wirkungsgeschichte, Frankfurt am M. 1985, ausführlich und in anderer Form behandelt: vgl. vor allem die Kapitel All-Einheit – ebd., S. 38-72 – und Henosis-bei Plotin und in der mystischen Theologie des Christentums – ebd., S. 123-154 – . Die Texte Plotins zitiere ich nach der kritischen Ausgabe von Paul Henry u. Hans-Rudolf Schwyzer, 3 Bde., Paris, Brüssel u. Leiden 1951, 1959 u. 1973. Ein davon teilweise abweichender Text, zusammen mit einer deutschen Übersetzung, wurde von Richard Harder, Rudolf Beutler u. Willy Theiler in 5 Bänden bei Felix Meiner innerhalb der Philosophischen Bibliothek, Hamburg 1956–1967, veröffentlicht.
© Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv lizenziert durch Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2020 C. Böhr (Hrsg.), Metaphysik, Das Bild vom Menschen und die Ordnung der Gesellschaft, https://doi.org/10.1007/978-3-658-31593-1_14
237
238
Werner Beierwaltes
Als Paradigma einer derartigen Mystik, die nicht ohne den philosophischen Begriff – im aktiven Sinne – verstanden werden kann, wähle ich Plotin – meines Erachtens die reinste Ausformung dieser Denkungsart und der aus ihr resultierenden Lebensform. Viele Darstellungen der plotinischen Philosophie leiden darunter, dass sie den – ansonsten existentialistisch überstrapazierten – ‚Sitz im Leben‘ dieses Denkens verdrängen oder ihn erst ‚neben‘ und ‚außer‘ der sogenannten Hypostasenlehre beschreiben und so das Zentrum und das Ziel der plotinischen Philosophie notwendigerweise als ‚abstrakt‘ erscheinen lassen. ‚Konkretes‘ Denken aber hat, auch als, interpretierendes, die Konkretheit, das heißt: die innere Vermittlung seiner selbst oder eines anderen, fremden Denkens, zur Sprache zu bringen. Für Plotin heißt dies: das ‚mystische‘, also auf Einung mit einem göttlichen Prinzip zielende Moment seines Denkens ist als ein durch das Ganze hindurchgehender Impuls, als ein die Differenziertheit des Denkens insgesamt bestimmender und leitender Grund-Gedanke zu verstehen. Das ‚Mystische‘ – im Sinne des angedeuteten Minimalkonsenses – in Plotin ist daher nicht nur ein hinzukommendes Ende, die daraufgesetzte Spitze des ‚Systems‘, sondern dessen innerer Anfang, sein Beweggrund und seine zur Konzentration auffordernde Mitte. Als ein äußerer Hinweis darauf mag zunächst Plotins ‚letztes Wort‘ stehen, das uns in der Vita Plotini des Porphyrios – eines Plotin-Schülers – überliefert ist – ,2 als Imperativ, wie Paul Henry evident gemacht hat. Plotin spricht zu den sein Totenlager Umstehenden: „Versuchet, den Gott in Euch in das Göttliche im All hinaufzuführen!“ Dieses ‚letzte Wort‘ Plotins ist nicht eine feierliche, solipsistisch anmutende Ankündigung – wie es auch verstanden worden ist – , dass er, Plotin, nun in der Trennung von Leib und Geist – im Tode – das Göttliche in sich selbst mit dem Allgemein-Göttlichen zu vereinen suche, sondern vielmehr: es ist eine Anweisung zum Philosophieren, die als eine Kurzformel von Plotins gesamter philosophischer Bemühung verstanden werden sollte, durchaus eine authentische Beschreibung des ‚Motivs‘ von Plotins Philosophie. Sie macht auch den kommunikativen Charakter, den protreptischen, auf den Anderen hingewendeten Grundzug des plotinischen Denkens deutlich; sie ist Aufforderung zum Wagnis, das Göttliche in sich selbst philosophierend in das Göttliche schlechthin zu erheben. Diese Erhebung seiner selbst – des Denkens und der durch dieses bedingten Lebensform – impliziert das vorhin genannte ‚EinsWerden‘ oder die ‚Einung‘ mit dem Göttlichen oder dem Einen selbst. ‚Einung‘ ist jedoch als vollendendes Ziel der Erhebung kein bleibender Zustand, sondern ein glückhaftes Ereignis, ein zeitlos erscheinender Augenblick ‚in‘ der Zeit, der freilich nicht ohne Spur an dem Denkenden und eben dem dieses Ereignis Erfahrenden 2 Vita Plotini, 2, 26 f.
Plotins philosophische Mystik: Bestimmung einer Lebensform
239
vorübergeht. Dass es ein ‚glückhaftes‘ und auch relativ seltenes Ereignis ist, bezeugt wieder Porphyrios, der wohl glaubhaft berichtet: Plotin sei die Einung ‚vermöge seiner unsagbaren Kraft‘ während der Zeit, in der er – Porphyrios – bei Plotin gewesen sei – und dies heißt: in sechs Jahren – ‚vielleicht viermal‘ gelungen, ihm jedoch nur einmal.3 Er sagt dies in seinem achtundsechzigsten Jahr. Der sich in dem ‚letzten Wort‘ Plotins manifestierende und aus seinem eigenen Werk vielfach bezeugbare Grundzug seines Denkens geht – als Bewegung formuliert – aus dem Vielen ins Eine. Seine Philosophie ist in einem universalen und radikalen Sinne ‚Denken des Einen‘. Was aber ist dieses ‚Eine‘, auf das sich das Denken konzentrieren und dem es schließlich selbst gehören soll? Einem modernen Bewusstsein könnte diese Ziel-Setzung des Denkens fremd erscheinen, sofern sein Interesse gerade auf die Erkenntnis der Vielfalt der Phänomene gerichtet ist. Sein Interesse am Zusammenhang dieser erscheinenden Vielfalt jedoch, dokumentierbar etwa an der Suche moderner Physiker nach der ‚einen‘, die Differenziertheit der physikalischen Verhältnisse insgesamt erklärenden Welt-Formel, könnte einen Zugang zu dem Prinzip der alten Philosophie eröffnen. Im Zusammenhang mit Plotins ‚letztem Wort‘ war von dem ‚göttlichen Prinzip‘ die Rede: Prinzip als der ‚eine‘ Grund und Ursprung, der von ihm selbst her das ihm gegenüber Andere als Vieles sein lässt, identisch mit dem Göttlichen schlechthin oder dem – ersten – Gott. ‚Das Eine‘ nun ist der Name für eben dieses göttliche Prinzip, oder: das göttliche Prinzip ‚ist‘ das Eine, auf das das Denken sich konzentrieren und ihm schließlich selbst gehören soll. Dieser Satz klingt wie eine Definition, er erschöpft aber keineswegs das Wesen des Einen, ebenso wenig wie andere Sätze derselben Struktur. Das Eine – dies ist eine Voraussetzung des plotinischen Denkens – ist gerade nicht durch eine Definition zu fixieren, da es als universal begründender Grund über den Bereich hinaus ist, in dem Definitionen möglich und sinnvoll sind. Dadurch ist das Eine dem Denken nicht schlechterdings entrückt, sondern es wirkt als ständige Herausforderung des Denkens, es zu begreifen und zur Sprache zu bringen – selbst wenn es nur dessen Unbegreifbarkeit und Unaussprechbarkeit herauszustellen vermöchte. Dieses ständige durch das Eine Herausgefordertsein des Denkens erweist sich vor aller Reflexion auf die vielfältige ‚Erscheinungsweise‘ des Einen als die unbezweifelbare, intensivste ‚Wirklichkeit‘, die dem Bewusstsein zugänglich ist. Für griechisches Denken insgesamt und nicht minder für das plotinische, weist diese Erfahrung des Denkens selbst über sich hinaus auf den Grund eben dieser Erfahrung: Das herausfordernde Eine ist nicht nur eine Sache des Denkens oder ein ihm selbst immanentes Moment, sondern die in 3 Ebd., 23, 12-18.
240
Werner Beierwaltes
sich seiende Voraussetzung, der ontologische ‚Grund‘ des Denkens selbst, der aber nur durch das Denken und durch den in ihm selbst ermöglichten Selbst-Überstieg begreifbar ist. Der plotinische Imperativ zur ‚Anagogé‘ oder zum Aufstieg ist auch charakterisierbar als eine ‚Reduktion‘ im wörtlichen und nicht pejorativen Sinne: als Rückführung des Vielen, in dem das Denken sich selbst ursprünglich vorfindet, auf das Eine. Die Frage, was das Viele jeweils in seinem Wesen, in seinem Zustand oder in seiner Bewegtheit sei, ist letztlich jeweils und immer auf das Eine als den Grund des je einzelnen Vielen zurückzuführen. Erst die Erkenntnis der unterschiedlich sich auswirkenden Einheit des Einen macht das Viele als es selbst erklärbar. Rückführung des Vielen auf das Eine steht also gegen eine mögliche Fixierung des Einzelnen in sich, sie intendiert vielmehr den gegenseitigen Bezug des Vielen und damit auch schon die Konzentriertheit aller Bezüge in der umfassenden Einheit alles ‚jeweils‘ Einen – das heißt des Vielen – , sie zielt auf oder ‚ist‘ die Erkenntnis der konstituierenden und dadurch auch synthetisierenden – einenden – Kraft des Einen selbst ‚im‘ Vielen. Dieses wirkt in Allem – Vielen – , ist aber nur ein einzig Eines in ihm selbst. Denken dieses Einen kann als die neuplatonische Version dessen verstanden werden, was Aristoteles als Ziel der ‚Ersten Philosophie‘ behauptete und realisierte: „Das von alters her und auch jetzt und immer wieder Gesuchte und das, bei dem man immer in Ausweglosigkeit gerät: die Frage, was ist das Eine?“4 Diese Frage – das muss bewusst bleiben und noch differenzierter durchdacht werden – nach dem Einen oder nach dem Ersten als dem Einen, ist für Plotin alles andere als eine ‚abstrakte‘ Frage, es ist die Lebens-Frage schlechthin. Dies mit Recht sagen zu können, gründet in der gerade für neuplatonische Philosophie charakteristischen Tatsache, dass Lehre und Leben intensiv zusammengehören, dass also philosophische Reflexion, die die Wirklichkeit im ganzen als eine in sich differenzierte Erscheinungsform des Einen selbst im Blick hat, ihre Konsequenzen für die Lebensform haben muss: ‚Leben‘ des Einen5 ist nicht nur die Konsequenz, sondern der unmittelbare lebensweltliche Ausdruck des ‚Denkens‘ des Einen. Dieser Gedanke beruht auf einer für gegenwärtiges Bewusstsein vielleicht allzu optimistischen Überzeugung – was jedoch die Überzeugung der meisten griechischen Denker seit Platon gewesen ist – , dass das Richtige oder Wahre zu denken den Denkenden selbst verwandele, seine Lebensform von Grund auf bestimme. Für Plotins Philosophie und für die neuplatonische Philosophie insgesamt bedeutet dies: Das Eine zu denken macht den Denkenden selbst ‚eingestaltig‘, durch und in seinem 4 Vgl. Aristoteles, Metaphysik, 1028 b 2-4, als Frage nach dem Sein oder der ‚usia‘ formuliert. 5 Verstanden analog der aristotelischen Formulierung ‚Leben gemäß dem Geist‘ – Ethica Nichomachea, 1177 b 30 – als ein ‚Leben gemäß dem Einen‘.
Plotins philosophische Mystik: Bestimmung einer Lebensform
241
Denken und in seinem Sein in ihm selbst ‚einiger‘, führt ihn aus der Zerstreuung ins Viele in die höchstmögliche geistige Konzentration aufs eigentliche Zentrum. Dies aber ist auch die Voraussetzung einer in bestimmtem Sinne geordneten Lebensform: Das Eine, vermittelt durch seine vielfältigen Erscheinungen im Vielen, wird als Vermittlung seiner selbst zum Anfang und Ziel von Denken und Leben. Die Aneignung des Einen – die denkende und in der Lebensform, im Handeln sich manifestierende Aneignung – vollzieht sich als die zuvor genannte, nun universal zu verstehende ‚Rückführung‘ des Vielen ins Eine. Wenn man bedenkt, dass das Viele, also die uns zugängliche Wirklichkeit insgesamt, einer Selbst-Entfaltung oder Selbst-Differenzierung des Einen entstammt, dann ist ‚Rückführung‘ – die denkende ‚und‘ die individuell-lebensgeschichtliche – mit einer Umkehr eben dieses Entfaltungsprozesses identisch zu denken: Rückführung als eine verwandelnde Aufhebung des Vielen in den Einen Ursprung. Seinen Anfang macht das Sich-Anähnlichen an den Zielpunkt – der Einung mit dem Einen – in der Sinnlichkeit, das heißt: Rückführung und Umkehr ‚befreiten‘ den Menschen aus dem möglichen oder tatsächlichen Verstricktsein in seine Körperlichkeit und in die von dieser ausgehenden Begierde und Lust. ‚Tugend‘ ist der Modus dieses Sich-Befreiens, der Stand auch des freilich immer anfechtbaren Befreit-Seins. Dieser Prozess aber ist eng mit der Einheits-Bewegung des Denkens verbunden, beide steigern sich gegenseitig. Pointiert mit Plotin gesagt: „Tugend schreitet aufs Ziel hin fort, indem sie in der Seele mit Einsicht Gott zeigt; ohne wahrhafte Tugend ist die Rede von Gott allerdings nur ein leerer Name.“6 Plotin hat diese Einheit der logischen und ethischen Umkehrung des zuvor angedeuteten ontologischen Entfaltungsprozesses als ἀφαίρεσις bezeichnet und sie in den universal geltenden Imperativ gefasst: aphele panta – : „Tu alles weg.“7 ‚Alles‘ meint in ihm: ‚alles Viele oder Vielheitliche‘: Ἀφαίρεσις formuliert demnach Abkehr und Befreiung vom Vielen, Äußerlichen, dem Einen selbst ‚Fremden‘ und damit zugleich Umkehr ins ‚eigene Innere‘. Dies heißt freilich nicht einfach, das Viele zu ‚übergehen‘, es gleichgültig ‚liegenzulassen‘, sondern es ‚realistisch‘ in seiner Stellung zum Einen als dem absolut Nicht-Vielen zu erkennen und diese Erkenntnis für das Sein des Denkenden selbst ethisch zu realisieren. So verstandene, vom Vielen durch Erkenntnis und Tugend befreiende Abkehr und Umkehr ist keineswegs mit der immer wieder behaupteten und gescholtenen angeblichen ‚Weltverachtung‘ oder ‚Weltflucht‘ des Platonismus gleichzusetzen; sie gibt der Welt vielmehr den ihr zukommenden Stellenwert im Ganzen und versucht dadurch gerade ‚sie‘ – eben 6 II 9, 15, 38-40; hier und im Folgenden beziehen sich die römischen Ziffern auf Plotins Enneaden. 7 V 3, 17, 38.
242
Werner Beierwaltes
diese Welt – oder zumindest den Denkenden selbst ‚in‘ einem derartigen Begriff von Welt auf ein transzendentes Ziel hin zu verändern. „Die Erkenntnis der radikalen Kontingenz des ,Weltlichen‘ und ,Natürlichen‘, die Einsicht, daß dies kein Identifikationsobjekt sein ‚kann‘, gibt den nachhaltigen Impuls zum Überstieg auf den einen Grund von Wirklichkeit hin.“8 Abkehr und Umkehr vollziehen sich im Sinne einer nicht bloß formal funktionierenden, sondern auf die Sache des Denkens selbst gerichteten Dialektik als ein analysierendes und synthetisierendes Begreifen des Vielen, das ein jeweils Einzelnes ist, als Begreifen der vielfältigen Bezüge zwischen den Einzelnen – dem Einzel-Seienden – selbst. Dies kommt einer anfänglichen Entdeckung eines im welthaft oder phänomenal Wirklichen sich zeigenden ‚Einen‘ gleich. Subjekt dieser Erkenntnis-Bewegung auf das Eine ‚im‘ Vielen hin ist die denkende ‚Seele‘, die den Menschen als Prinzip seines leiblichen, emotionalen und begreifenden Seins zu einem Einzelnen und Ganzen bestimmt. Umkehr als ein Sich-Richten des Denkens auf das Eine aus dem Vielen heraus ist, wie zuvor schon angedeutet, zugleich Rückgang oder Rückwendung – ἐπιστροφή, Re-flexion – der Seele auf ‚sich selbst‘. So konzentriert sich die Seele in der Erkenntnis-Bewegung nicht nur auf das Begreifen des Einen im Phänomenal-Vielen, sondern – der Intention nach sogar primär – auf ‚sich selbst‘ als eine Seins-Form des Einen, die das in ihm Viele – das Gedachte, Erlebte, Erfahrene – zu einer Einheit und Ganzheit hin aufschließt und es dadurch zugleich verstehend zusammenhält. Rückgang der Seele in sich selbst, ihre Selbst-Reflexion, steht so – als ‚Einheit‘ im vielfältig Seienden ‚und‘ in ihr selbst entdeckende – im Dienste der Selbst-Erkenntnis oder Erkenntnis des eigenen Selbst – dies verstanden als die durch Denken und durch die von ihm geleitete Emotionalität ineinsfügende Kraft des Menschen, deren Aktivitäten sein bewusstes und möglicherweise glückendes Leben ausmachen. Als eine derartige Seinsform von Einheit ist das Selbst der Seele ermöglicht in dem sie begründenden ‚Geist‘. Vom Aspekt der ontologischen Entfaltung her ist dieser in einer intensiveren Weise Eines, als es die Seele selbst zu sein vermag, die durch Zeit als· ihren Lebensmodus immer an das Viele verwiesen bleibt. Das Höchstmaß der eigenen Einheit aber verdankt sie dem Wirken eben dieses Geistes, der über oder vor ihr und zugleich in ihr ‚ist‘, durch den in ihr auch der Ursprung jeglicher Form von Einheit, das Eine selbst, in modifizierter Form wirksam wird. Wenn also die Seele in der ἀφαίρεσις, in der Rückwendung auf sich selbst, in ihr selbst anfänglich etwas sucht, was im Vergleich zu einem in die Zeit verflochtenen, diskursiven Denken einfacher, einheitlicher, weil in sich selbst einiger, ist, etwas, was die das Denken durchweg bestimmende Differenz bereits in ein Minimum 8 Beierwaltes, Denken des Einen, a. a. O., S. 28.
Plotins philosophische Mystik: Bestimmung einer Lebensform
243
aufgehoben in sich ‚hat‘, dann findet sie in ihr selbst als eben dieses Gesuchte den ‚Geist‘. Sich selbst zu reflektieren, sein eigenes Selbst zu erkennen oder denkend zu finden, heißt also zugleich, sich selbst in seinem eigenen Grund zu sehen, auf diesen denkend zurückzugehen. Diesen Rückgang im Sinne einer Transformation der Seele in ihren eigenen Grund und in ihr eigentliches Selbst, als welches sich der Geist im Sinne des ihre eigene Einheit herstellenden und begründenden Grundes erweist, hat Plotin mit dem Terminus νοωϑῆναι – ‚Geist-Werden‘ – eigens bezeichnet.9 Erkenntnis des eigenen Selbst wird damit zu einer Form der ‚Anähnlichung‘ an den göttlichen Grund selbst ‚durch‘ die Vermittlung des Geistes ‚in‘ der Seele, ein begreifendes und zugleich lebensgeschichtliches Realisieren der ‚Spuren‘ des Einen im eigenen Denken. ‚Anähnlichung‘ an das göttliche Prinzip, eine zentrale Formel des platonischen Theaitetos,10 ist also im neuplatonischen Kontext nichts anderes als eine bewusst fortschreitende Intensivierung der inneren Einheit auf die absolute Einheit hin. Sie kommt als ἀφαίρεσις aus der Vielheit einer wachsenden Befreiung des Denkens von der in ihm selbst und in seinen Gegenständen immer noch wirkenden ‚Differenz‘ gleich. Ἀφαίρεσις, Anähnlichung an das göttliche Prinzip als das Eine selbst im Nachgehen der im Denken selbst vorfindlichen Spuren des Einen, ist demnach mit der ‚Ent-Differenzierung‘ des Denkens und des Seins des Denkenden selbst identisch. Der im Denken wie im Handeln zugleich ständig intendierte, bisweilen vielleicht auch glückhaft vollendete Stand dieser Ent-Differenzierung ist – dies sei im Vorgriff auf die weitere Entwicklung des Gedankens gesagt – die Einung oder ‚Henosis‘ mit dem Einen selbst. Wenn es die Voraussetzung der ontologischen Entfaltung des Einen selbst ist, dass in jeder Stufe oder in jeder Phase dieser Entfaltung Andersheit oder Differenz zunimmt, so liegt es in der Logik des Rückgangs, eben diese Differenz durch Bewusstmachen von deren Rückbezogenheit auf das Eine selbst immer mehr zum Verschwinden zu bringen, sie aufzuheben in eine höhere Form von Einheit. Das Bewusst-Werden des in uns, in der denkenden Seele, unbewusst wirkenden Geistes heißt demnach: die geringere Form von Differenz im Geiste gegenüber der Seele oder die im Geiste sich darstellende intensivere Form von Einheit zu erkennen. Bewusstmachen des in uns aktual, für uns selbst jedoch ‚unbewusst‘ wirkenden Geistes vollzieht eben diese intensivere Form von Einheit, die der Geist in sich ‚ist‘, als ‚unsere eigene‘ Einheit. Er ist, wie Plotin sagt, ‚unser‘ und ‚nicht unser‘ zugleich; dieses Nicht-unser-Sein des Geistes aber ist als ‚unseres‘ anzueignen. Die intensivere Form von Einheit, die der Geist selbst darstellt, besteht, wie sich zeigte, in der Reduktion der Differenz auf ein Minimum. Das Viele im Geiste ist 9 VI 7, 35, 4 f. 10 Platon, Theaitetos, 176 b.
244
Werner Beierwaltes
im Sinne Plotins zu verstehen als Fülle der ‚Ideen‘. Diese sind als seiende Sinngestalte ‚Gegenstand‘ des Denkens des Geistes. Die ‚Reduktion der Differenz auf ein Minimum‘ besteht nun darin, dass der ‚Gegenstand‘ des Denkens, die Idee als das intelligible Sein, mit dem Denken selbst identisch gedacht wird. Indem der Geist sein Sein in Gestalt der Ideen als seinen eigenen Gegenstand denkt, denkt er sie selbst. Sein als das Gedachte und Denken als der Vollzug dieses Gedachten ist ein und dasselbe: Sein ist Denken, indem es gedacht wird, Denken ist Sein, indem es sich selbst denkt. Geist-Werden und damit einiger mit sich selbst werden bedeutet für die ‚Seele‘, dass sie sich selbst einbringt in eben diese zeitlose Bewegtheit der Identität von Denken und Sein, die der seiende Grund für die zeitlichen Möglichkeiten der Seele ist. Differenz ist in diesem Vollzug des Seelen-Grundes derart aufgehoben, dass sie zwar noch als Doppelung von Denken und Sein auftritt, die je eigentümliche Differenz – im Sinne einer Wesensunterscheidung – sich jedoch einander derart ‚übergeben‘ hat, dass sich in beiden das Selbe spiegelt. Identität ist hier nicht zu einer leeren Tautologie zusammengeschnurrt, sondern ist als intensivste, das heißt als unwandelbare, zeitfreie Bewegung des Einen im Anderen zu verstehen: eine dynamische Identität. Als eine solche ist der Geist die intensivste Form von Einheit ‚in‘ der Vielheit oder Andersheit – ‚nach‘ dem Einen selbst. So wie der Geist als Grund der Seele diese im Prozesse ihrer Selbstvergewisserung auf sich selbst zog, so bewegt auch der die Einheit des Geistes bewirkend Grund – das ‚Eine selbst‘ – auf sich selbst hin. Die Anähnlichung an das göttlich Prinzip, das Einfach- oder Einig-mit-sich-selbst-Werden der Seele, steigert sich also dadurch, dass sie auch den Geist als eine Spur des Einen, als dessen Bild und Gleichnis, erkennt und sich dadurch selbst auf das Urbild des Bildes, auf den Ursprung der Spur, zurückbezieht. Rückgang durch den Geist ins Eine oder innerer Aufstieg in das Eine als den Grund von Seele ‚und‘ Geist muss also die erste Andersheit, die der Geist trotz seiner inneren Einheit gegenüber dem Einen selbst ist, denkend aufheben und sich dadurch dem Einen als dem Nicht-Anderen, dem jenseits oder über allem Anderen Seienden, angleichen oder mit ihm identisch werden. Das Eine denkt Plotin als schlechthin ‚vor‘ allem Anderen; wenn das Andere insgesamt bestimmt ist durch die allgemeinste Kategorie, ‚etwas‘ zu sein – also In-sich-Bestimmtes, von Anderem Abgegrenztes und zumindest im Bereich des Zeitlichen dadurch Endliches zu sein, dann ist das Eine auch ‚vor‘ dem Etwas; es ist die Ausgrenzung jeder Grenze und Bestimmtheit: ‚a-peiron‘, das Un-Endliche, dies jedoch nicht der Quantität oder ‚Größe‘, sondern, wie Plotin dies formuliert, seiner ‚unumfassbaren Mächtigkeit‘ nach.11 Es ist ebenso sehr frei von Form oder Gestalt: das Form- oder Gestalt-lose schlechthin – dies als Konsequenz des Nicht- oder Vor-dem-Etwas-Seins, als sol11 VI 9, 6, 10 f.
Plotins philosophische Mystik: Bestimmung einer Lebensform
245
ches aber nicht nur ‚absolut anders‘ als das Andere, sondern einfachhin Nichts: das Nichts des Anderen oder das Nichts von Allem. Daraus resultiert für Denken und Aussprechen des Einen, dass es nicht im eigentlichen Sinne, das heißt: so wie es in sich selbst ist, denkbar und sagbar ist – Denken und Sprache gehen immer auf ‚etwas‘ – , sondern dass es lediglich durch ‚Negation‘ ausgrenzbar ist: das Denken spricht ihm all das ab, was kategorial und durch Definition des je eigenen Etwas durchaus begrifflich fassbar und aussprechbar ist. Man würde Plotin und mit ihm anderes neuplatonisches Denken gründlich missverstehen, wollte man die Termini Nichts, Form- und Gestalt-los, Grenze-los – Un-Endlich – als Anzeichen der absoluten Leere des Einen verstehen. Im Sinne Plotins würde die Benennung des Einen als Gestalt, Form oder Etwas eine Einschränkung von dessen Wesen bedeuten. Die Bestimmung des Einen als Selbst-Ausschluss des Vielen im Sinne einer realen Vereinzelung und Differenzierung intendiert aber gerade den Gedanken, dass das Eine die Fülle all dessen ist, was als Einzelnes oder Differentes aus ihm entspringt: differenz-lose, allem Anderen gegenüber absolut transzendente Einheit, die eben dieses Andere in ihm als ‚Es Selbst‘, und das heißt nicht-differenziert, umfasst. Die so verstandene In-Differenz des Einen ist höher zu werten als die Differenz des Anderen, da sie dieses eben in der Form intensiverer Einheit in sich noch unausgefaltet ‚hat‘ und gerade dadurch, sofern die Entfaltung eine Differenzierung und Vereinzelung impliziert, Alles sein kann. In diesem Sinne kann das Eine zu Recht paradox ‚Alles und Nichts zugleich‘ genannt werden. Dieses in sich differenz-lose Eine ist Ziel des Denkens und der Anziehungspunkt von dessen eigener Umformung. Daher muss das Denken seine eigene, von Etwas, Form, Relation und Differenz bestimmte Struktur durch eine ‚Selbst-Entgrenzung‘ und ‚Ent-Differenzierung‘ aufzuheben versuchen. Nur so, letztlich also im Transzendieren seiner selbst, in seiner Selbst-Aufhebung, bereitet das Denken durch seine auf den Geist und auf das Eine in ihm inständig konzentrierte Reflexion die Möglichkeit vor, dass sich das Selbst der Seele – des Menschen – mit ihrem letzten und zugleich ersten Grund einige oder identifiziere. Das im Denken selbst vom Ursprung her ‚vorläufige‘ Bewegungsmoment dieses Auf- und Selbst-Überstiegs ist das in uns dem Einen Ähnliche, seine Spur, sein Bild im Denken, welches dessen Selbstentfaltung und Konzentration auf den Grund bedingt und voranbringt, sofern es im Rückgang des Denkens in sich selbst ‚realisiert‘ wird. Höchste Anstrengung des Denkens also, sich in immer intensivere Formen von Einheit einzuüben, hebt sich in den eigenen Ursprung auf, nimmt sich in ihn zurück, geht über in ihn, schlägt plötzlich um in das, was bisher sein ‚Gegenstand‘ war. Gegenständigkeit als eine Form der Differenz verschwindet, das Denkende selbst wird in der letzten Negation, der Negation seiner selbst, zum Einen selbst für einen zeitlosen, glückhaften Augenblick; das Gesehene ist im Sehen ganz dieses selbst oder der Sehende geht
246
Werner Beierwaltes
im Gesehenen auf – eine Form der ‚deificatio‘ des Menschen, in der er zum Licht des Einen selbst wird.12 Plotin beschreibt den Vorgang in seinen Enneaden mehrere Male, unter anderem so: Der Überschreitende wird „von der Woge des Geistes gleichsam fortgerissen und von ihrem Schwall hoch hinaufgehoben: da erblickt er es – das Eine – mit einem Schlage – im zeitlosen Augenblick, ἐξαίφνης – , er sieht nicht, wie, sondern das Schauen erfüllt seine Augen mit Licht und lässt durch das Licht nicht etwas Anderes sichtbar werden, sondern das Licht selber ist es, was er sieht. Denn in jener Schau war nicht das Gesehene für sich sein Licht, auch nicht das Denkende für sich und das Gedachte, sondern es ist ein einziger Glanz, der diese Dinge im Nachhinein gebiert und sie bei dem Schauenden sein lässt … “13 „Das Gesehene sieht der Sehende in jenem Augenblick – der Einung – nicht – die Rede ist freilich kühn – , unterscheidet es nicht, stellt es nicht als zweierlei vor, sondern er ist gleichsam ein Anderer geworden, nicht mehr er selbst und nicht sein eigen, ist einbezogen in die obere Welt und jenem Wesen – dem Einen – zugehörig, und so ist er Eines, indem er gleichsam Mittelpunkt mit Mittelpunkt – das heißt: den Mittelpunkt seiner Seele mit dem Mittelpunkt der ganzen Wirklichkeit, dem Einen selbst – zusammenfügt … “14 „Es ist nichts zwischen ihm, sie sind nicht mehr Zwei, sondern beide sind Eins; du kannst sie auch nicht mehr trennen, solange es oder er – das Eine – gegenwärtig ist“15. Den Vorgang, der zu diesem Identifikationsakt führt oder der mit ihm identisch ist, nennt Plotin ‚ekstasis‘.16 In meinem Buch Denken des Einen17 habe ich den plotinischen Gedanken der ‚ekstasis‘ so beschrieben: „Ekstasis ist einerseits das Resultat der bis zu ihrer Spitze hin geführten Reflexion, aktiver Überstieg des Denkens über sich selbst, Selbstaufgabe in den Bereich des nicht mehr Rationalen, endgültiges Einfach-Werden als Aufhebung jeder Zweiheit in sich und zu dem bisher noch Anderen hin, ἐπιβολή und ἐπςίδοσις αὑτοῦ: intuitives Sich-hin-Werfen ohne theoretischen Abstand, liebende Total-Hingabe an das Geliebte, insgesamt also ein Heraussteigen aus den gewohnten Denk- und Seinsbezügen in ein Ziel, das allerdings auch in den fernsten Aktivitäten von Denken und Handeln zumindest schon mittelbar im Blick war. Ekstasis bedeutet ebensosehr παραδοχή: unvermitteltes Aufnehmen des An-sich-Unmittelbaren, das vorbehalt- und hindernislose Sich-Öffnen dem Geschauten oder der Schau gegenüber, die ,auf die Seele zukommt‘, 12 VI 9, 9, 55-58. 13 VI 7, 36, 17-23. Hervorhebungen im Original. 14 VI 9, 10, 11 ff. 15 VI 7, 34, 13 f. 16 VI 9, 11, 23. 17 Beierwaltes, Denken des Einen, a. a. O., S. 141. Hervorhebungen im Original.
Plotins philosophische Mystik: Bestimmung einer Lebensform
247
ein überwältigt-, von dem Gott ,Ergriffen‘- und In-Besitzgenommen-Werden, ein Hingerissen- oder Entzückt-Sein. Ek-stasis wird in der Einung zur Stasis des Denkens; in ihr ist Eros als der ständige Impuls in der transzendendierenden Bewegung zu seinem endgültigen Ziel und damit zur Ruhe gekommen – in einen ‚Zustand‘ des Nicht-mehr-bewegt-Seins, des unverwandten Gerichtetseins auf das Eine oder des abstandlosen Zusammenseins – συνουσία – mit ihm. Der Differenz- und Relationslosigkeit, der ausdehnungslosen Punktualität und der zeitfreien Autarkie des Einen selbst entspricht diese durch Ekstasis erreichte, die Bewegung des Denkens stillstellende στάσις und ἡσυχία: Stand und Ruhe im Einen“. – Jenem, dem Einen selbst, zugehörig geworden zu sein, ist nicht identisch zu denken mit einer Aufhebung oder gar Vernichtung der Individualität oder des Selbst; vielmehr ist in der Ekstasis – in dem Akt der Identifikation – die Vollendung des Selbst, zumindest punktuell, im zeitlosen Augenblick erreicht; das Eine selbst erweist sich in der Einung als das wirklichste und in sich einigste Ziel dessen, was in den verschiedenen Formen von Einheit als das in ihnen vorläufige Prinzip von deren Einheit gesucht und gefunden worden ist. Henosis als ‚Akt‘ indessen ist kein in sich fixierter, endgültiger ‚Abschluss‘ einer Bewegung, sondern eine Erfahrung, die ‚immer wieder‘ – πάλιν18 – erstrebt und von neuem vollzogen werden muss, sobald die Seele aus der einenden Schau ‚herausgefallen‘ – ἐκπίπτειν – ist. Diese Wiederholung ist durch die Un-Endlichkeit oder Unbegrenztheit des Einen geradezu provoziert, sie ist diesem Grundzug des Prinzips durchaus angemessen. Eine Kontinuität der Schau – τὸ συνεχές … τῆς ϑέας:19 – in der Zeit als zeitlose suggeriert – erscheint allenfalls als möglich nach dem Tode. Wenn die Seele sich mit dem Einen eint, dann geht sie, wie Plotin sagt, ‚nicht in das Nicht-Seiende – im Sinne des Nicht-mehr-Seins – über‘; das Eine als das Nichts von Allem nimmt sie vielmehr in seine eigene höchste Wirklichkeit auf – παραδοχή – ; Übergang in das ‚Nichts‘ kommt damit einer Überführung der dem Denken immanenten vor-reflexiven Möglichkeit in dessen höchste Wirklichkeit gleich; so gelangt die Seele auf ihrem Weg ins Eine – so wiederum Plotin – „auch nicht zu einem Anderen – ihrer selbst – , sondern ‚zu sich selbst‘ – ‚ἥξει οὐκ εἰς ἄλλο, ᾀλλ᾽ εἰς ἑαυτήν‘ – , und so kann sie, da sie nicht in einem Anderen ist, nicht in einem Nichts (im Sinne der Privation, der Nicht-Wirklichkeit) sein, sondern – mit dem Einen zusammen – nur in sich selbst“.20 Henosis bedeutet damit für den Menschen punktuelle Erhebung vom Sein ins Über-Sein – ‚Gott-Werden‘, ‚Gott-Sein‘21 – , 18 19 20 21
VI 9, 11, 47. VI 9, 10, 2. VI 9, 11, 38-40. VI 9, 9, 58: „ϑεὸν γενόμενον, μᾶλλον δὲ ὄντα“.
248
Werner Beierwaltes
zugleich aber auch Selbst-Vollendung durch eigene Leistung ‚und‘ durch das Entgegenkommen des Einen im ‚Ergriffen- oder Hinausgerissen-Werden‘, ohne dass diese vom Einen ausgehende Bewegung unmittelbar mit dem christlichen Begriff der Gnade gleichgesetzt werden müsste. Eigens bemerken möchte ich noch, dass das Eine Plotins weder aus dem Bedenken des Weges zu ihm hin, noch aus dem Akt der Henosis als das abstrakt-leere, ‚bewegungslose‘ und dadurch undynamische, ‚kalte‘ ES vorgestellt werden kann – dies fällt nur einem wenig kenntnisreichen, pauschalisierenden Kontrastieren des angeblich apersonalen Absoluten der griechischen Philosophie zum personalen Gott des Christentums ein. Dem steht unter anderem entgegen, dass das erste Prinzip die Identität des Einen, des Guten und des Gottes darstellt, dass die Redeweise Plotins über diese Identität häufig zwischen neutralen und personalen Prädikaten changiert – αὐτό – αὐτός – , dass eben dieses göttliche Prinzip seine eigene Fülle entfaltet, an ihr ‚neidlos‘ teilgibt, dass es gerade aufgrund dieser von ihm ausgehenden Aktivität als ‚mild‘, ‚zugeneigt‘ und ‚zart‘ benannt werden kann;22 nur von daher erscheint es sinnvoll, dass das Eine auch ‚geliebt‘ wird „mit einem edlen Eros, wie eine Jungfrau den edlen Vater liebt“.23 Schließlich ist für Plotin die Umkehr in den Weg, der in der Einung mit dem Einen enden soll, auch durch die Odysseus-Metapher beschreibbar: die ‚Flucht des Einen‘ – mit sich selbst EinsGewordenen – ‚zum Einen‘24 ist – in dieser Metapher gesagt – identisch mit der Rückkehr in die Heimat: „Heimat ist uns dort, woher wir gekommen sind, und der Vater ist dort.“25 Diese zuletzt hier lediglich skizzierten Aspekte des Einen erweisen Plotin als einen Denker, der philosophische Reflexion im strengen Sinne mit einer von dieser her bestimmten religiösen Bewegtheit zu einer selbst-bewussten ‚pia philosophia‘ verbindet. Insofern Plotin das Eine oder Gute als das im höchsten Maße ‚Göttliche‘ denkt, ist die Befreiung zu ihm als dem „einzig im wahren Sinne freien“ – „μόνον
22 V 5, 12, 33 f.: ἤπιον, προσηές, ἁβρόν; vgl. auch VI 7, 23, 3 f.: „ἕλκον πρὸς αὑτὸ καὶ ἀνακαλούμενον ἐκ πάσης πλάνες, ἵνα πρὸς αὐτὸν ἀναπαύσαιτο“: das Gute – oder Eine – „zieht – sc. die Seele – zu sich hin und ruft sie aus aller Irrfahrt heraus, dass sie bei ihm ausruhe“; vgl. Augustinus, Confessiones, I, 1: „ … donec requiescat in te.“ Plotin VI 9, 8, 43 f. Zu beachten ist auch hier der Wechsel zwischen Neutrum und Maskulinum: πρὸς αὐτὸ – πρὸς αὐτὸν, den Henry und Schwyzer im Gegensatz zu Adolf Kirchhoff und Theiler beibehalten: Plotini Opera, Bd. 3, Paris, Brüssel u. Leiden 1973, S. 242, und Oxford 1982 – Editio minor – , S. 212 f. 23 VI 9, 9, 34. 24 VI 9, 11, 51. 25 I 6, 8, 21.
Plotins philosophische Mystik: Bestimmung einer Lebensform
249
τοῦτο ἀληϑείᾳ ἐλεύϑερον“,26 – und die Einung mit ihm der intensivst philosophische ‚und‘ religiöse Akt ‚zugleich‘. Philosophie ist demnach alles andere als eine bloß formale Übung oder Fertigkeit, nichts, was allein den Intellekt beträfe und formte; sie beansprucht vielmehr den Menschen als ganzen: in seiner Theorie-Fähigkeit ebenso sehr wie im selbstursprünglichen Entwerfen und Gestalten seine Handelns und in seiner bewussten und engagierten Bewegung auf sein höchstes Ziel hin, das ihn in sich einbezieht und doch immer übersteigt.
26 VI 8, 21, 31.
Vom Verschwinden und Wiederauftauchen der antiken Auffassung der Philosophie Pierre Hadot
Verschwinden und Wiederauftauchen der antiken Auffassung …
Wenn die antike Philosophie philosophischen Diskurs und Lebensform so eng miteinander verknüpfte, wie kommt es dann, dass die Philosophie heutzutage im gewöhnlichen Unterricht der Philosophiegeschichte vor allem als ein Diskurs dargestellt wird, der – ob als theoretisch-systematischer oder als kritischer Diskurs – jedenfalls keinen direkten Bezug zur Lebensart des Philosophen hat?
Christentum und Philosophie Der Grund für diese Transformation ist vor allem historischer Art und liegt im Aufkommen des Christentums beschlossen. Tatsächlich wurde das Christentum, wie wir bereits gesehen haben, sehr früh als eine Philosophie im antiken Sinne des Wortes dargestellt, das heißt, als eine Lebensform und Lebenswahl, die einen bestimmten Diskurs impliziert: die Lebenswahl gemäß Christus. In dieser christlichen Lebensweise und auch in dem christlichen Diskurs wurden viele Elemente der traditionellen griechisch-römischen Philosophie aufgesogen und integriert. Nach und nach ergab sich aber aus Gründen, die wir noch darlegen werden, insbesondere im Mittelalter innerhalb des Christentums eine Trennung zwischen Lebensweise und philosophischem Diskurs. Einige philosophische Lebensweisen, die für die verschiedenen Schulen der Antike typisch waren, wie etwa der Epikureismus, verschwanden völlig, andere wurden von der christlichen Lebensform aufgesogen, wie Stoizismus oder Platonismus. Auch wenn es stimmt, dass die mönchische Lebensform, die aus den antiken Philosophien die geistigen Übungen
© Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv lizenziert durch Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2020 C. Böhr (Hrsg.), Metaphysik, Das Bild vom Menschen und die Ordnung der Gesellschaft, https://doi.org/10.1007/978-3-658-31593-1_15
251
252
Pierre Hadot
integrierte, sich im Mittelalter häufig ‚Philosophie‘ nannte,1 so fand sie sich nun vom philosophischen Diskurs getrennt, mit dem sie zuvor verbunden war. Einzig die philosophischen Diskurse einiger antiker Schulen haben überlebt, vor allem die des Platonismus und des Aristotelismus; getrennt von den Lebensformen, von denen sie ausgegangen sind, besitzen sie aber nur noch den Stellenwert eines in theologischen Kontroversen anwendbaren bloßen begrifflichen Materials. Die in den Dienst der Theologie gestellte ‚Philosophie‘ war von nun an nicht mehr als ein theoretischer Diskurs, und von dem Zeitpunkt an, wo die moderne Philosophie im 17. und vor allem im 18. Jahrhundert ihre Autonomie erlangt, wird sie immer dazu tendieren, sich auf diesen Gesichtspunkt zu beschränken. Ich sage mit Absicht ‚wird sie dazu tendieren‘, denn tatsächlich, worauf wir noch zurückkommen müssen, sollte die ursprüngliche und authentische Auffassung der griechisch-römischen Philosophie niemals völlig in Vergessenheit geraten. Dank der Arbeiten von Juliusz Domański2 konnte ich die zu kurze und ungenaue Darstellung berichtigen, die ich von diesem ‚Theoretisierungs‘-Prozess der Philosophie in früheren Untersuchungen entworfen habe.3 Ich halte dieses Phänomen zwar weiterhin für eng verbunden mit den Beziehungen zwischen Philosophie und Christentum, in der Hauptsache mit denen, die in den mittelalterlichen Universitäten definiert wurden, muss aber einräumen, dass die Wiederentdeckung der Philosophie als Lebensform nicht so spät erfolgte, wie ich behauptet habe, sondern dass auch sie sich bereits in den mittelalterlichen Universitäten abzuzeichnen begann. Bei der Beschreibung dieser Wiederentdeckung der Philosophie als Lebensform hingegen muss man einige Differenzierungen und Präzisierungen vornehmen.
Die Philosophie als Dienerin der Theologie Im ausgehenden 16. Jahrhundert erklärt der Scholastiker Francisco Suárez in seinen Disputationes Metaphysicae, die einen beträchtlichen Einfluss auf viele Philosophen vom 17. bis zum 19. Jahrhundert ausüben werden: „In diesem Werk nehme ich die Rolle eines Philosophen an, wobei es mir sehr wohl im Geist gegenwärtig ist, daß Vgl. Pierre Hadot, Wege zur Weisheit oder Was lehrt uns die antike Philosophie?, Frankfurt am M. 1999, S. 275. 2 Juliusz Domański, La Philosophie, théorie ou manière de vivre? Les Controverses de l’Antiquité à la Renaissance, Fribourg 1996. 3 Pierre Hadot, Philosophie als Lebensform. Geistige Übungen in der Antike, Berlin 1991, S. 45 ff. u. S. 170-173. 1
Verschwinden und Wiederauftauchen der antiken Auffassung …
253
unsere Philosophie eine christliche Philosophie und die Dienerin der göttlichen Theologie sein muß.“4 Für Suárez ist eine ‚christliche‘ Philosophie eine Philosophie, die den Dogmen des Christentums nicht widerspricht und in dem Maße christlich ist, wie sie bei der Klärung theologischer Probleme zur Anwendung kommen kann. Das soll nicht heißen, dass diese Philosophie in den Lehren, die sie verkündet, spezifisch christlich ist. Ganz im Gegenteil handelt es sich im Wesentlichen um die aristotelische Philosophie, wie sie die Scholastik des 13. Jahrhunderts dem Christentum angeglichen und angepasst hat. Diese Vorstellung von der Philosophie als Dienerin oder gar Sklavin einer Theologie oder höheren Weisheit hat freilich eine lange Geschichte.5 Zu Beginn unserer Zeitrechnung findet man sie bei Philon von Alexandria, der ein allgemeines Schema der geistigen Erziehung und des geistigen Fortschritts entwarf.6 Die erste Stufe dabei war, nach dem Programm von Platons Politeia, das Studium einer Reihe von Fächern wie Geometrie, Musik, aber auch Grammatik und Rhetorik. In seinem Kommentar zum 1. Buch Mose – Genesis – setzt Philon diese Wissenschaften mit Hagar gleich, der ägyptischen Magd, mit der Abraham sich vor dem Bund mit seiner Gattin Sara, der Philosophie, vereinigen muss.7 Der Zyklus der von Philon vorgeschlagenen, zahlenmäßig nicht festgelegten Wissenschaften muss also als die Sklavin der Philosophie aufgefasst werden. Die Philosophie ihrerseits muss aber Francisco Suárez, Disputationes Metaphysicae, in: Opera omnia, Bd. 25, Paris 1861, unpaginiert: Ratio et discursus totius operis. Ad Lectorem: „Ita vero in hoc opere philosophum ago, ut semper tamen prae oculis habeam nostram philosophiam debere christianam esse, ac divinae Theologiae ministram.“ Den Hinweis verdanke ich Etienne Gilson, L’esprit de la philosophie médiévale, Paris 1944, S. 414, wo man im Appendix eine Textsammlung zum Begriff der christlichen Philosophie findet. A. d. Ü.: Die deutsche Übersetzung Der Geist der mittelalterlichen Philosophie, Wien 1950, enthält diesen Appendix nicht. 5 Zur Geschichte dieses Begriffs siehe: Bernardus Baudoux, Philosophia Ancilla Theologiae, in: Antonianum 12 (1937) S. 293-326; Etienne Gilson, Etudes de philosophie médiévale, Strasburg 1921, S. 30-50: La servante de la théologie; siehe auch die Anmerkungen von Andre Cantin in seiner Einleitung zu Pierre Damien, Lettre sur la Toute-Puissance divine, Paris 1972, S. 251, Anm. 3. 6 Vgl. Ilsetraut Hadot, Arts libéraux et philosophie dans la pensées antique: Contribution à l’histoire de l’éducation et de la culture dans l’Antiquité, Paris 2006, S. 282-287; Monique Alexandre, Einleitung zu Philon von Alexandria, De congressu eruditionis gratia, in: Œuvres de Philon d’Alexandrie, Bd. 16, Paris 1967, S. 27-96; dt. Werke, hg. v. Leopold Cohn, Isaak Heinemann, Maximilian Adler u. Willy T heiler, 7 Bde., Berlin 1909–1938, 1964, Bd. 6, S. 1-49; vgl. auch Harry Austryn Wolfson, Philo. Foundations of religious Philosophy in Judaism, Christianity and Islam, Cambridge, Mass. 1947, S. 156 f. 7 Philon von Alexandria, De congressu eruditionis gratia. Über das Zusammenleben der Allgemeinbildung wegen, in: Werke, a. a. O., Bd. 6, S. 1-49, § 11: 1. Buch Mose (Genesis), 16, 1-16; vgl. Hadot, Arts libéraux, a. a. O., S. 282. 4
254
Pierre Hadot
als die Sklavin der Weisheit angesehen werden, wobei die Weisheit oder wahre Philosophie für Philon das durch Moses offenbarte Wort Gottes ist.8 Die Kirchenväter, wie Clemens von Alexandria und vor allem Origenes, nehmen dieses von Philon festgesetzte Entsprechungsverhältnis zwischen dem Fächerkanon und der griechischen Philosophie einerseits, der griechischen und der mosaischen Philosophie andererseits wieder auf, wobei sie natürlich Moses’ Philosophie durch die Philosophie Christi ersetzen.9 Man muss sich aber vor Augen halten, dass die griechische Philosophie, von der hier die Rede ist, auf den philosophischen Diskurs reduziert ist. Das Christentum hatte sich selber, wie wir gesehen haben, als eine Philosophie, das heißt als eine Lebensform, als die einzig gültige Lebensform dargestellt. Gegenüber dieser christlichen Lebensform aber, die gelegentlich Nuancen der profanen Philosophie übernommen hat, blieben die philosophischen Diskurse der verschiedenen Schulen bestehen oder genauer: der philosophische Diskurs des Neuplatonismus. Ab dem 3. Jahrhundert n. Chr. ist nämlich der Neuplatonismus, eine Synthese aus Aristotelismus und Platonismus, die einzige überlebende Schule. Diesen neuplatonischen Philosophiediskurs benutzen die Kirchenväter im Anschluss an Clemens von Alexandria und Origenes, um ihre Theologie zu entwickeln. Unter diesem Gesichtspunkt ist die Philosophie seit der christlichen Antike also Dienerin der Theologie – eine Dienerin, die ihr Können einbringt, sich aber auch den Erfordernissen ihrer Herrin anpassen muss. So kommt es zu einer Kontamination. In der Dreifaltigkeit wird der Vater so manche Züge des ersten neuplatonischen Gottes tragen, der Sohn nach dem Modell des zweiten Gottes von Numenios oder des plotinischen Intellekts aufgefasst werden. Die Entwicklung der theologischen Kontroversen aber wird zur Vorstellung einer substanzgleichen Dreifaltigkeit führen. Aristotelische Logik und Ontologie, die der Neuplatonismus integrierte, liefern die für die Dogmen der Dreifaltigkeit und der Fleischwerdung unerlässlichen Begriffe, indem sie Natur, Wesen, Substanz und Hypostase zu unterscheiden erlauben. Und in der anderen Richtung wird als Wirkung der verfeinerten theologischen Diskussionen die aristotelische Ontologie verfeinert und präzisiert. Laut und Origenes stellen die freien Künste eine Propädeutik zur griechischen Philosophie dar, und die griechische Philosophie eine Propädeutik zur offenbarten 8 Philon von Alexandria, De congressu eruditionis gratia. Über das Zusammenleben der Allgemeinbildung wegen, a. a. O., § 79-80; vgl. Hadot, Arts libéraux, a. a. O., S. 284; Alexandre, Einleitung zu Philon von Alexandria, De congressu eruditionis gratia, a. a. O., S. 71 f. 9 Siehe die Texte von Clemens und von Origenes in: Alexandre, Einleitung zu Philon von Alexandria, De congressu eruditionis gratia, a. a. O., S. 83-97; und Hadot, Arts libéraux, a. a. O., S. 287 ff.
Verschwinden und Wiederauftauchen der antiken Auffassung …
255
Philosophie. Nach und nach aber verschmelzen die vorbereitenden Stufen miteinander. Wenn beispielsweise Aurelius Augustinus in seiner Schrift Vier Bücher über die Christliche Lehre die notwendigen profanen Kenntnisse für den christlichen Exegeten auflistet, stellt er die freien Künste wie Mathematik und Dialektik praktisch auf eine Stufe mit der Philosophie.10 Zu Beginn des Mittelalters stößt man wieder auf diese Gleichstellung, so in karolingischer Zeit bei Alkuin.11 Dank einiger am Ende der Antike von Boethius, Macrobius und Martianus Capella verfasster Übersetzungen von und Kommentare zu bekannten Werken von Platon, Aristoteles und Porphyrios wird vom 9. bis zum 12. Jahrhundert die griechische Philosophie wie zu Zeiten der Kirchenväter weiterhin in theologischen Diskussionen benutzt. Diese Werke dienen aber auch dazu, eine Vorstellung von der Welt zu entwickeln. Der Platonismus der Schule von Chartres ist ein sehr bekanntes Phänomen.12 In dieser Zeit sind in den Klosterschulen und Kathedralen die freien Künste Teil des Studienkanons.13 Ab dem 13. Jahrhundert üben zwei neue Gegebenheiten einen großen Einfluss auf die Entwicklung des Denkens im Mittelalter aus: das Auftauchen der Universitäten und die weite Verbreitung der Aristoteles-Übersetzungen. Das Phänomen der Konstituierung der Universitäten geht mit dem Aufschwung der Städte und dem Niedergang der Klosterschulen einher, die, wie Marie-Dominique Chenu sagt, „ohne Ehrgeiz, ohne Sorge für den kommenden Tag den jungen Mönch zur Bibellesung und zum heiligen Dienst anleiten“14. Die Universität, innerhalb des Gemeinwesens eine intellektuelle Zunft von Studenten und Lehrern und innerhalb der Kirche ein von der Autorität abhängiger Körper, organisiert einen Lehrgang, ein akademisches Jahr, Vorlesungen, Diskussionsübungen und Examina. Der Unterricht ist in zwei Fakultäten gegliedert: die Artistenfakultät, wo man im Prinzip die freien Künste unterrichtet, und die Theologische Fakultät. Ebenfalls im 13. Jahrhundert entdeckt man dank lateinischer Übersetzungen arabischer und griechischer Texte 10 Augustinus, De doctrina christiana. Vier Bücher über die Christliche Lehre, 40, 60: 2. Buch, in: Des Heiligen Kirchenvaters Aurelius Augustinus Ausgewählte praktische Schriften, Bd. 8, hg. v. Sigisbert Mitterer, München 1925. 11 Alkuin, Epistolae, Brief 280, in: Monumenta Germaniae Historica, Bd. 4: Epistolae Karolini aevi. 2, hg. v. Ernst Dümmler, Berlin 1895, Neudr. München 1978, S. 437, 27-31; vgl. Domański, La Philosophie, théorie ou manière de vivre?, a. a. O., Kap. 2. 12 Vgl. Edouard Jeauneau, ‚Lectio Philosophorum‘. Recherches sur l’ecole de Chartres, Amsterdam 1973. 13 Vgl. Philippe Delhaye, Enseignement et morale au XIIe siecle, Fribourg u. Paris 1988, S. 1-58. 14 Marie-Dominique Chenu, Das Werk des Hl. Thomas von Aquin, Heidelberg u. Graz 1960, S. 9.
256
Pierre Hadot
einen Großteil des Werkes von Aristoteles und seiner griechischen und arabischen Kommentatoren. Die Philosophie des Aristoteles, worunter wir nun seinen philosophischen Diskurs zu verstehen haben, spielt also in beiden Fakultäten eine entscheidende Rolle. Die Theologen benutzen die aristotelische Dialektik, aber auch seine Erkenntnislehre und seine Physik, die Form und Materie gegenüberstellt, um auf die Probleme zu antworten, welche die christlichen Dogmen der Vernunft stellen. In der Artisten-Fakultät wird der Unterricht in der Philosophie des Aristoteles, das heißt der Kommentar der dialektischen, ‚physikalischen‘ und ethischen Werke desjenigen, den man ‚den Philosophen‘ nannte, größtenteils den Unterricht in den freien Künsten ersetzen.15 Die Philosophie wird so mit dem Aristotelismus gleichgesetzt, und die Tätigkeit, das Metier des Philosophieprofessors besteht darin, Werke von Aristoteles zu kommentieren und deren Interpretationsprobleme zu lösen. Diese Philosophie (und auch Theologie) der Professoren und Kommentatoren hat man ‚Scholastik‘ genannt. An sich ist die Scholastik, wie bereits erwähnt16 nur die Erbin der philosophischen Methode, die sich am Ende der Antike großer Beliebtheit erfreute, so wie die Schulübungen der ‚lectio‘ und der ‚disputatio‘ nur die Unterrichts- und Übungsmethoden weiterführen, die in den antiken Schulen beliebt waren .17
Die Vernunftkünstler Ich entlehne den Ausdruck ‚Vernunftkünstler‘ von Kant, der mit dieser Formulierung die Philosophen bezeichnet, die sich nur für die reine Spekulation interessieren.18 Diese Vorstellung einer auf ihren begrifflichen Inhalt reduzierten Philosophie hat bis heute überlebt: Man trifft täglich in den Kursen der Universität wie in den Schulbüchern aller Niveaus auf sie. Man könnte sie als die klassische, schulische und universitäre Vorstellung der Philosophie bezeichnen. Bewusst oder unbewusst sind unsere Universitäten Erben der ‚Schule‘, das heißt der scholastischen Tradition. 15 Vgl. Domański, La Philosophie, théorie ou manière de vivre?, a. a. O., Kap. 2 – mit der detaillierten Bibliographie in Anm. 17 von Kap. 2. 16 Vgl. Hadot, Wege zur Weisheit oder Was lehrt uns die antike Philosophie?, a. a. O., S. 178. 17 Vgl. Pierre Hadot, La Préhistoire des genres littéraires philosophiques mediévaux dans l’Antiquite, in: Les Genres littéraires dans les sources théologiques et philosophiques médiévales, Actes du colloque international de Louvain-la-Neuve 1981, Louvain-la-Neuve 1982, S. 1-9. 18 Kant, Kritik der reinen Vernunft, B 867; Ders., Logik. Ein Handbuch zu Vorlesungen, A 24.
Verschwinden und Wiederauftauchen der antiken Auffassung …
257
Die ‚Schule‘ ist übrigens bis in unser 20. Jahrhundert hinein weiterhin lebendig, insofern von den Päpsten des 19. und 20. Jahrhunderts den katholischen Universitäten traditionell der Thomismus empfohlen wurde. Und man kann tatsächlich feststellen, dass die Verfechter der neuscholastischen oder thomistischen Philosophie wie im Mittelalter die Philosophie weiterhin als ein rein theoretisches Vorgehen ansehen. Von daher wurde beispielsweise in der um 1930 geführten Debatte über das Problem der Möglichkeit und der Bedeutung einer christlichen Philosophie das Problem der Philosophie als Lebensform meiner Kenntnis nach nie gestellt. Ein neuscholastischer Philosoph wie Etienne Gilson formulierte es in rein theoretischen Termini: Hat das Christentum neue Begriffe und eine neue Problematik in die philosophische Tradition eingeführt oder nicht?19 Mit der ihn auszeichnenden geistigen Klarheit erkannte er den Kern des Problems, als er schrieb: „Die günstigste philosophische Position hat nicht der Philosoph, sondern der Christ“, wobei die große Überlegenheit des Christentums darin bestehe, dass es keine „einfache, abstrakte Wahrheitserkenntnis“ war, „sondern eine für das Heil wirksame Methode“. Zwar war die Philosophie in der Antike zugleich Wissenschaft und Leben, wie Gilson feststellte, in den Augen des Christentums, einer Heilsbotschaft, stellte sie aber nicht mehr als reine Spekulation dar, während das Christentum eine Lehre ist, „die zugleich die Mittel zu ihrer eigenen praktischen Umsetzung beibrachte“.20 Deutlicher kann man nicht zeigen, dass die moderne Philosophie dahin gelangt ist, sich selber als eine theoretische Wissenschaft anzusehen, weil in der Perspektive des Christentums, das zugleich Lehre und Leben war, die existentielle Dimension der Philosophie keinen Sinn mehr hatte. Es gibt aber nicht nur die ‚Schule‘, das heißt die Tradition der scholastischen Theologie, es gibt auch die Schulen; zwar nicht die philosophischen Gemeinschaften der Antike, sondern die Universitäten, die ungeachtet ihrer verschiedenen Gründungsmotive und ihres unterschiedlichen Funktionierens das Erbe der mittelalterlichen Universität antraten. Und so wie in der Antike eine enge Wechselwirkung zwischen der gesellschaftlichen Struktur der philosophischen Einrichtungen und deren Vorstellung von Philosophie bestand, so gab es auch seit dem Mittelalter eine Art reziproke Kausalität zwischen der Struktur der universitären Einrichtungen und den Vorstellungen, die sie von der Natur der Philosophie hegten. Dies lässt sich auch an einem Text Hegels erkennen, den Miguel Abensour und Pierre-Jean Labarrière in ihrer hervorragenden Einführung zu Schopenhauers
19 Gilson, Der Geist der mittelalterlichen Philosophie, a. a. O., S. 1-45. 20 Ebd., S. 31.
258
Pierre Hadot
Pamphlet Über die Universitätsphilosophie zitieren.21 In diesem Text erinnert Hegel daran, dass die Philosophie nicht mehr „wie bei den Griechen als eine private Kunst exerziert wird, sondern … eine öffentliche, das Publikum berührende Existenz, vornehmlich oder allein im Staatsdienste, hat.“ Man erkennt sehr wohl den radikalen Gegensatz zwischen der antiken Philosophenschule, die sich an jedes Individuum richtet, um es in seiner ganzen Persönlichkeit zu transformieren, und der Universität, die zur Aufgabe hat, Diplome auszuteilen, die einem bestimmten objektivierbaren Wissensniveau entsprechen. Selbstverständlich kann Hegels Perspektive einer Universität im Dienst des Staates nicht verallgemeinert werden, man muss aber wohl einräumen, dass es eine Universität nur durch die Initiative einer höheren Autorität gibt, sei es die des Staates oder der verschiedenen katholischen, lutherischen, calvinistischen oder anglikanischen Religionsgemeinschaften. Die Universitätsphilosophie befindet sich also immer noch in der Lage, in der sie sich im Mittelalter befand, das heißt sie ist immer noch Dienerin, manchmal der Theologie – in den Universitäten, in denen die Philosophische Fakultät nur eine der Theologischen Fakultät untergeordnete Fakultät ist – , manchmal der Wissenschaft, immer aber der Notwendigkeiten der allgemeinen Unterrichtsorganisation oder heutzutage der wissenschaftlichen Forschung. Die Wahl der Professoren, der Fächer und der Examina unterliegt immer ‚objektiven‘ politischen oder finanziellen Kriterien, die leider zu häufig außerhalb der Philosophie liegen. Zudem führt die Universitätseinrichtung dazu, aus dem Philosophieprofessor einen Beamten zu machen, dessen ‚Geschäft‘ zu einem großen Teil darin besteht, andere Beamte auszubilden. Es geht nicht mehr wie in der Antike darum, Menschen zu Menschen zu bilden, sondern sie zu Gelehrten oder Professoren auszubilden, das heißt zu Spezialisten, Theoretikern, Bewahrern eines bestimmten mehr oder weniger esoterischen Wissens.22 Dieses Wissen setzt aber nicht mehr den Einsatz des ganzen Lebens voraus, wie es die antike Philosophie wollte. Jacques Bouveresse hat in Bezug auf Wittgensteins Ideen über die Laufbahn des Philosophieprofessors auf bewundernswerte Weise die Gefahr des ‚intellektuellen 21 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, in: Ders., Werke in 20 Bänden, hg. v. Eva Moldenhauer u. Karl Markus Michel, Bd. 7, Frankfurt am M. 1970, S. 21; zitiert von Miguel Abensour und Pierre-Jean Labarrière in ihrem Vorwort zur französischen Übersetzung von Arthur Schopenhauers Über die Universitätsphilosophie: Contre la philosophie universitaire, Paris 1994, S. 9; das ganze Vorwort ist bedeutend hinsichtlich der hier entwickelten Ideen. 22 Vgl. die Seiten, die Jacques Bouveresse in seinem Buch Poesie und Prosa: Wittgenstein über Wissenschaft, Ethik und Ästhetik, Berlin 1994, S. 73 ff., dem ,Geschäft‘ des Philosophieprofessors widmet.
Verschwinden und Wiederauftauchen der antiken Auffassung …
259
und moralischen Untergangs‘ analysiert, die dem Professor droht: „Man kann einen Menschen nicht mehr knechten, als indem man ihn dazu zwingt, aus Berufsgründen eine Meinung in Angelegenheiten zu haben, für die er zwangsläufig nicht berechtigt ist. Vom Standpunkt Wittgensteins aus geht es hier keineswegs um das ‚Wissen‘ des Philosophen, um seinen theoretischen Wissensbestand, sondern um den persönlichen Preis, den er für das zu zahlen hat, was er denken und sagen zu können glaubt. … Eine Philosophie (ist) … letztlich nichts anderes als der Ausdruck einer in bestimmter Hinsicht beispielhaften menschlichen Erfahrung.“23 Darüber hinaus haben die Dominanz des Idealismus über die ganze Universitätsphilosophie seit Hegel bis zum Aufkommen des Existentialismus, dann die Mode des Strukturalismus stark zur Verbreitung der Vorstellung beigetragen, dass es außer der theoretischen oder systematischen keine wahre Philosophie gebe. Dies scheinen mir die historischen Gründe zu sein, die dazu geführt haben, die Philosophie als reine Theorie aufzufassen.
Die Beständigkeit der Auffassung von der Philosophie als Lebensform Diese Transformation ist jedoch nicht so radikal, wie es scheinen könnte. In der Geschichte der abendländischen Philosophie lässt sich eine gewisse Beständigkeit, ein gewisses Überleben der antiken Auffassung feststellen. Einige Philosophen blieben vom Mittelalter bis in unsere Zeit der existentiellen und lebendigen Dimension der antiken Philosophie treu, manchmal innerhalb der Universitätseinrichtung selbst, häufiger in Gegenbewegungen und in Milieus, die ihr fremd sind, wie bestimmte religiöse oder profane Gemeinschaften, manche auch für sich allein. Weiter oben hatten wir gesagt, dass die Lehrer der Artisten-Fakultät das Werk eines Philosophen aus der Antike, nämlich des Aristoteles, fast vollständig lesen konnten dank der lateinischen Aristoteles-Übersetzungen aus dem Griechischen oder dem Arabischen. Dabei ist von großer Bedeutung, dass sie mit Hilfe dieser Texte wiederentdeckten, dass die Philosophie nicht nur ein Diskurs, sondern eine Lebensform ist.24 Diese Tatsache ist umso interessanter, als es sich um Aristoteles handelt, denjenigen Philosophen, der gemeinhin als reiner Theoretiker angesehen wurde. Seine Kommentatoren aber haben mit viel Scharfsinn erkannt, dass für den ‚Philosophen‘ das Wesentliche der Philosophie darin lag, sich dem Forscherleben 23 Ebd., S. 73 f. Hervorhebung im Original. 24 Vgl. Domański, La Philosophie, théorie ou manière de vivre?, a. a. O., Kap. 2 und Kap. 3.
260
Pierre Hadot
zu widmen, dem Leben der Kontemplation und vor allem in der Bemühung, sich dem göttlichen Intellekt anzugleichen. So sieht Boethius von Dacien im Anschluss an einige berühmte Behauptungen von Aristoteles am Ende des 10. Buches seiner Nikomachischen Ethik, dass der Zweck des Menschen und sein Glück darin besteht, gemäß dem höchsten Teil seines Wesens zu leben, das heißt gemäß seiner Intelligenz, welche die Wahrheit schauen soll.25 Ein solches Leben ist konform mit der Ordnung der Natur, die die niederen den höheren Mächten untergeordnet hat. Einzig der Philosoph, der sein Leben der spekulativen Erkenntnis der Wahrheit widmet, lebt also gemäß der Natur und führt zugleich ein köstliches Leben. Die Erklärung des Alberich von Reims ist ein Nachhall auf diesen Text: „Wenn man weiß, daß man ans Ende gelangt ist, bleibt einem nur noch, es zu genießen und Vergnügen daran zu finden. Dies nennt man die Weisheit; dieser Genuß, den man zu finden vermochte, kann um seiner selbst willen geliebt werden; darin liegt die Philosophie, hier muß man innehalten.“ 26
Bei Dante und bei Meister Eckhart lassen sich analoge Haltungen antreffen.27 Diese Denkströmung gewährt also, wie Juliusz Domański schreibt, „der Philosophie eine vollständige Autonomie, ohne sie für eine bloße Propädeutik der christlichen Lehre zu halten.“28 Im 14. Jahrhundert verwirft Francesco Petrarca die Idee einer theoretischen und deskriptiven Ethik, weil er feststellt, dass die Lektüre und Kommentierung von Aristoteles-Abhandlungen ihn nicht weitergebracht haben.29 Darum weigert er sich, die ‚Katheder‘-Professoren ‚Philosophen‘ zu nennen, und behält diesen Namen denen vor, die durch ihre Taten bestätigen, was sie unterrichten.30 In Bezug 25 Boethius von Dacien, De summa bono sive de vita philosophi, in: Martin Grabmann, Mittelalterliches Geistesleben. Abhandlungen. zur Geschichte der Scholastik und Mystik, Bd. 2, München 1936, Kap. 8: Die Opuscula De summo bono sive de vita philosophi und De somniis des Boethius von Dacien, S. 200-224. 26 Alberich von Reims, zitiert von Alain de Libera, Penser au Moyen Age, Paris 1991, S. 147; dt. Denken im Mittelalter, München 2003, S. 151. 27 Vgl. ebd., S. 317-347, v. a. S. 344-347. 28 Vgl. Domański, La Philosophie, théorie ou manière de vivre?, a. a. O., S. 70. 29 Francesco Petrarca, De sui ipsius et multorum ignorantia. Von seiner und vieler Leute Unwissenheit, in: Ders., Prose, hg. v. Guido Martellotti u. Pier Giorgio Ricci, Mailand 1955, S. 744. – A. d. Ü.: Diese Stelle ist nicht enthalten in der dt. Übersetzung in: Briefe und Gespräche, hg. v. Hermann Hefele, Jena 1910. – Zu allem Folgenden vgl. Domański, La Philosophie, théorie ou manière de vivre?, a. a. O., Kap. 4. 30 Francesco Petrarca, De vita solitaria, II, 7, § 1, in: Ders., Prose, a. a. O., S. 524 ff. Wie Domański anmerkt, Kap. 4, Anm. 5, geht der Ausdruck ‚Katheder-Philosophen‘ auf
Verschwinden und Wiederauftauchen der antiken Auffassung …
261
auf unseren Gegenstand gibt es bei ihm eine höchst bedeutsame Formulierung: „Wertvoller aber ist es, das Gute zu wollen als das Wahre zu erkunden“.31 Man findet die gleiche Haltung bei Erasmus, wenn er wiederholt behauptet, dass nur derjenige ein Philosoph sei, der auf philosophische Weise lebe, wie es Sokrates, der Kyniker Diogenes, Epiktet, aber auch Johannes der Täufer, Christus und die Apostel getan hätten.32 Dabei muss man präzisieren, dass Petrarca oder Erasmus, wenn sie vom philosophischen Leben sprechen, wie einige Kirchenväter und Mönche an ein christlich-philosophisches Leben denken. Wie wir gerade gesehen haben, räumen sie dabei ein, dass die heidnischen Philosophen ebenfalls das Ideal des Philosophen haben verwirklichen können. In der Renaissance wohnt man nicht nur einer Erneuerung, der Lehrmeinungen, sondern auch der konkreten Haltungen der antiken Philosophie bei: des Epikureismus, Stoizismus, Platonismus und Skeptizismus. In Montaignes Essais kann man beispielsweise sehen, wie sich der Philosoph bemüht, die verschiedenen von der antiken Philosophie vorgeschlagenen Lebensformen zu praktizieren: „Mein Handwerk und meine Kunst ist es zu leben!“33 Sein geistiger Weg führt ihn so von Senecas Stoizismus über den Skeptizismus zu Plutarchs Probabilismus, um schließlich und definitiv im Epikureismus zu enden: „‚Ich habe heute nichts getan.‘ – Wie, hast du nicht gelebt? Das aber ist nicht nur die wesentlichste, sondern auch die lobenswerteste deiner Tätigkeiten. … Recht zu leben – das sollte unser großes und leuchtendes Meisterwerk sein! … Es ist höchste, fast göttergleiche Vollendung, wenn man das eigene Sein auf rechte Weise zu genießen weiß.“34
Michel Foucault wollte die ‚Theoretisierung‘ der Philosophie mit Descartes und nicht im Mittelalter beginnen lassen. Wie ich schon anderenorts gesagt habe, stimme ich mit ihm überein, wenn er sagt: „Die griechische Philosophie … hat immer daran festgehalten, daß ein Subjekt keinen Zugang zur Wahrheit haben kann, wenn es
31 32 33 34
Seneca zurück: De brevitate vitae. Über die Kürze des Lebens, in: Ders., Dialoge VII-XII, Darmstadt 1969, X, 1. Francesco Petrarca, Von seiner und vieler Leute Unwissenheit, in: Briefe und Gespräche, a. a. O., S. 174 – De sui ipsius et multorum ignorantia, in: Ders., Prose, a. a. O., S. 746 f.: „Satius est autem bonum velle quam verum nosse.“ Erasmus von Rotterdam, Adagia, 2201 – 3, 3, 1 – , in: Opera omnia, Amsterdam 1969, Bd. 2, 5, S. 162, 25-166, 18; vgl. Domański, La Philosophie, théorie ou manière de vivre?, a. a. O., Kap. 4. Michel de Montaigne, Essais, II, 6, in: Ders., Essais. Erste moderne Gesamtübersetzung v. Hans Stilett, Frankfurt am M. 1998, S. 188. Ebd., III, 13, S. 560 u. S. 566.
262
Pierre Hadot
nicht zuvor eine gewisse Arbeit an sich geleistet hat, die es erst empfänglich macht für das Wissen der Wahrheit.“35 Hierzu wird es genügen, in Erinnerung zu rufen, was ich oben über Aristoteles und Porphyrios gesagt habe.36 Ich gehe aber nicht mit, wenn er hinzufügt, dass es laut Descartes „um zur Wahrheit zu gelangen, genügt, daß ich irgendein Subjekt bin, das sehen kann, was evident ist. An dem Punkt … wird Askese durch Evidenz ersetzt“. Ich bin davon überzeugt, dass Descartes, wenn er für eines seiner Werke den Titel Meditationen wählt, sehr gut weiß, dass das Wort in der Tradition der antiken und christlichen Spiritualität eine Übung der Seele bezeichnet. Jede Meditation ist in Wirklichkeit eine geistige Übung, das heißt eine Arbeit seiner selbst an sich selbst, die man vollendet haben muss, um zur nächsten Stufe zu gelangen. Wie der Schriftsteller und Philosoph Michel Butor sehr schön gezeigt hat, werden diese Übungen mit sehr viel literarischem Geschick vorgebracht.37 Wenn Descartes nämlich in der ersten Person Singular spricht, wenn er sogar das Feuer anführt, vor dem er sitzt, den Schlafrock, den er trägt, das Papier, das vor ihm liegt, und die Gefühle beschreibt, die er durchlebt, will er in der Tat, dass sein Leser die von ihm beschriebenen Stufen der inneren Entwicklung durchläuft: Anders gesagt, das in den Meditationen angewandte ‚Ich‘ ist in Wirklichkeit ein ‚Du‘, das sich an den Leser richtet. Wir stoßen hier auf die in der Antike so häufige Bewegung, mit der man vom individuellen Ich zu einem Ich übergeht, das auf die Ebene der Universalität erhoben ist. Jede Meditation behandelt nur ein Thema, so zum Beispiel den methodischen Zweifel in der ersten Meditation, die Entdeckung des Ich als denkende Wirklichkeit in der zweiten – und zwar, damit der Leser die in jeder Meditation praktizierte Übung sich zu eigen machen kann. Aristoteles hatte gesagt: „Es braucht Zeit, bis das, was wir lernen, Teil unserer Natur wird.“ Descartes seinerseits weiß ebenfalls, dass es einer langen ‚Meditation‘ bedarf, um das so erworbene neue Bewusstsein seiner selbst in das Gedächtnis eindringen zu lassen. Über den methodischen Zweifel sagt er: „So konnte ich … dennoch nicht umhin, diesem Gegenstande eine ganze Meditation zu widmen; und ich wünschte, die Leser widmeten der Betrachtung ihres Inhalts nicht bloß die kurze Zeit, die zu ihrer Lektüre erforderlich ist, sondern einige Monate oder wenigstens einige Wo-
35 Hubert L. Dreyfus, Paul Rabbinow, Michel Foucault. Jenseits von Strukturalismus und Hermeneutik, Frankfurt am M. 1987. Das Zitat entstammt dem Nachwort Foucaults über das Subjekt, ebd., S. 290 f. 36 Hadot, Wege zur Weisheit oder Was lehrt uns die antike Philosophie?, a. a. O. S. 110 u. S. 185. 37 Michel Butor, Der Gebrauch der Personalpronomen im Roman, in: Ders., Repertoire 2. Probleme des Romans, München 1965, S. 93-109, hier S. 105 ff. Hervorhebung im Original.
Verschwinden und Wiederauftauchen der antiken Auffassung …
263
chen, ehe sie an das übrige gingen.“38 Und über das Mittel, sich das Ich als denkende Wirklichkeit bewusst zu machen: „Der wahre aber und meiner Meinung nach einzige Weg zu diesem Ziel ist in meiner zweiten Meditation enthalten, aber er ist derart, daß man ihn nicht nur einmal, sondern oft und immer wieder begehen muß.“ Auch die dritte Meditation präsentiert sich in ihren ersten Zeilen als eine sehr platonische geistige Übung, da es darum geht, sich radikal von der·sinnlichen Erkenntnis zu trennen: „Ich will jetzt meine Augen schließen, meine Ohren verstopfen und alle meine Sinne ablenken, auch die Bilder der körperlichen Dinge sämtlich aus meinem Bewußtsein tilgen …; ich will mich nur mit mir selbst unterreden, tiefer in mich hineinblicken und so versuchen, mich mir selbst nach und nach bekannter und vertrauter zu machen.“39 Allgemeiner gesehen scheint mir die cartesianische Evidenz nicht jedem Subjekt zugänglich zu sein. Denn es ist unmöglich, die stoische Definition der adäquaten oder objektiven Vorstellung in den Zeilen der Abhandlung über die Methode, die das Gebot der Evidenz in Erinnerung rufen, zu übersehen: „Die erste (Regel) besagte, niemals eine Sache als wahr anzuerkennen, von der ich nicht evidentermaßen erkenne, daß sie wahr ist, das heißt Übereilung und Vorurteile sorgfältig zu vermeiden und über nichts zu urteilen, was sich meinem Denken nicht so klar und deutlich darstellte, daß ich keinen Anlaß hätte, daran zu zweifeln.“40 Genau dies ist die stoische Disziplin der Zustimmung, und wie im Stoizismus ist sie nicht jedem Geist auf gleiche Weise zugänglich, denn auch sie erfordert eine Askese und eine Anstrengung, die darin besteht, ‚Hast‘ – aproptosia, propeteia – zu vermeiden. Es wird nicht immer genügend beachtet, wie sehr die antike Auffassung von der Philosophie bei Descartes noch gegenwärtig ist, beispielsweise in den Briefen an Elisabeth von der Pfalz, die im Übrigen bis zu einem gewissen Grad Briefe eines Seelenleiters sind. Für Kant ist die antike Definition der Philosophie als ‚philosophia‘, Begehren, Liebe, Übung der Weisheit, immer noch gültig. Die Philosophie ist ‚Lehre und Übung der Weisheit (nicht bloß Wissenschaft)‘, sagt er und kennt den Abstand, der die Philosophie von der Weisheit trennt: „Der Mensch ist nicht im Besitz der Weisheit. Er strebt nur zu ihr und kann nur Liebe zu ihr haben, und das ist schon
38 René Descartes, Antworten auf die zweiten Einwände, in: Ders., Meditationen. Über die Grundlagen der Philosophie (mit den sämtlichen Einwänden und Erwiderungen), hg. v. Artur Buchenau, Hamburg 41915, 1972, S. 118 f. 39 Descartes, Dritte Meditation, in: ebd., S. 27. Hervorhebung im Original. 40 René Descartes, Discours de la méthode. Abhandlung über die Methode. Von der Methode des richtigen Vernunftgebrauchs und des wissenschaftlichen Forschens, hg. v. Lüder Gäbe, Hamburg 1960, 2. Teil, § 7.
264
Pierre Hadot
Verdienst genug.“41 Die Philosophie ist für den Menschen „Bestrebung zur Weisheit, die jederzeit unvollendet ist.“42 Das ganze technische Gebäude der kritischen Philosophie Kants hat nur Sinn in der Perspektive der Weisheit oder vielmehr des Weisen, denn Kant tendiert immer dahin, sich die Weisheit in der Gestalt des Weisen vorzustellen, einer idealen Norm, die von einem Menschen niemals verkörpert wird, aber nach welcher der Philosoph zu leben versucht. Kant nennt dieses Modell des Weisen auch die ‚Idee des Philosophen‘: „So wenig als ein wahrer Christ wirklich existiert, ebensowenig hat auch ein Philosoph in diesem Sinn ein Dasein. Sie sind beide Urbilder. … Es soll bloß zur Richtschnur dienen. Der Philosoph ist nur eine Idee. Vielleicht werden wir einen Blick auf ihn werfen und ihm in einigen Stücken nachfolgen können, aber nie werden wir ihn ganz erreichen.“43 Hier steht Kant in der Tradition des Sokrates aus dem Symposion, der sagt, das einzige, was er wisse, sei, nicht weise zu sein, noch nicht das Ideal des Weisen erreicht zu haben. Und dieser Sokratismus kündigt bereits den Søren Kierkegaards an, der sagt, dass er nur Christ sei, insofern er wisse, kein Christ zu sein: „Die Idee der Weisheit muß der Philosophie zugrunde liegen, so wie dem Christentum die Idee der Heiligkeit.“44 Kant benutzt im Übrigen den Ausdruck ‚Idee der Weisheit‘ ebenso wie den Ausdruck ‚Idee der Philosophie‘ oder ‚Idee des Philosophen‘, da die Weisheit als Ideal tatsächlich eben das Ideal ist, das der Philosoph verfolgt: „Einige Alte haben sich dem Urbilde eines wahren Philosophen genähert, Rousseau gleichfalls, allein sie haben es nicht erreicht. Vielleicht wird mancher glauben, dass wir die Lehre der Weisheit schon haben und sie nicht als eine bloße Idee ansehen dürften, indem wir so viele Bücher besitzen voll von Vorschriften, wie wir handeln sollen. Allein es sind diese meistens. tautologische Sätze und unerträglich anzuhörende Forderungen; denn sie zeigen uns keine Mittel, dazu zu gelangen.“45 Und Kant fährt fort, indem er auf die antike Philosophie hinweist: „Eine verborgene Idee der Philosophie hat in den Menschen lange gelegen. Sie haben sie aber teils nicht verstanden, teils als einen Beitrag zur Gelehrsamkeit angesehen. Nehmen wir die alten griechischen Philosophen wie Epikur, Zeno, Sokrates etc., so finden wir, daß die Bestimmung des Menschen und die Mittel, dazu zu gelangen, das Hauptobjekt ihrer Wissenschaft gewesen sind. Sie sind also der wahren Idee 41 Immanuel Kant, Kant’s Opus postumum, hg. v. Artur Buchenau, 2 Bde., Berlin u. Leipzig 1936 u. 1938, Bd. 1, S. 141: 1. Convolut, XL Bogen, 1. Seite. 42 Ebd., S. 6: l. Convolut, Umschlag, 3. Seite. 43 Immanuel Kant, Vorlesungen über Enzyklopädie und Logik, Bd. 1: Vorlesungen über Philosophische Enzyclopädie, hg. v. Gerhard Lehmann, Berlin 1961, S. 34. 44 Ebd. 45 Ebd.
Verschwinden und Wiederauftauchen der antiken Auffassung …
265
des Philosophen weit getreuer geblieben, als in den neueren Zeiten geschehen ist, wo man den Philosophen als einen Vernunftkünstler antrifft.“46 Und nachdem Kant die Lehre und vor allem das Leben von Sokrates, Epikur und Diogenes beschrieben hat, präzisiert er, dass man in der Antike von den Philosophen verlangte, so zu leben, wie sie lehren: „Wann willst Du anfangen, tugendhaft zu leben, sagte Plato zu einem alten Mann, der ihm erzählte, dass er die Vorlesungen über die Tugend anhörte. – Man muß doch nicht immer spekulieren, sondern auch einmal an die Ausübung denken. Allein heutzutage hält man den für einen Schwärmer, der so lebt wie er lehrt.“47 Solange auf dieser Erde der in seiner Lebensform und seiner Kenntnis vollkommene Weise nicht verwirklicht ist, wird es auch keine Philosophie geben: „Es gibt noch einen Lehrer im Ideal, der alle diese ansetzt, sie als Werkzeuge nutzt, um die wesentlichen Zwecke der menschlichen Vernunft zu befördern. Diesen allein müßten wir den Philosophen nennen“, aber den gibt es nach Kant „nirgend“.48 Die Philosophie im eigentlichen Sinne des Wortes existiert also noch nicht und wird vielleicht niemals existieren. Allein das Philosophieren ist möglich, das heißt eine von der Idee geleitete Übung der Vernunft, von der Idee, die man vom „Lehrer im Ideal“ hat.49 Es gibt tatsächlich zwei Ideen, zwei mögliche Vorstellungen von der Philosophie; die eine nennt Kant den Schulbegriff der Philosophie,50 die andere den ‚Welt‘-Begriff der Philosophie. In seinem Begriff von der Schule oder der Scholastik ist die Philosophie nur reine Spekulation, sie zielt nur darauf, systematisch zu sein, sie zielt nur auf die logische Vollkommenheit der Erkenntnis. Wer sich an den Schulbegriff der Philosophie hält, ist, wie Kant sagt,51 ein Vernunftkünstler, das heißt ein ‚Philodox‘, jener ‚Meinungsliebende‘, von dem Platon spricht,52 der sich für eine Vielzahl an schönen Dingen interessiert, ohne aber die Schönheit an sich zu sehen, für eine Vielzahl an gerechten Dingen, ohne aber die Gerechtigkeit an sich zu sehen. Was darauf hinausläuft zu sagen, dass er letztlich nicht vollkommen systematisch ist, weil er nicht die Einheit des universalen menschlichen Interesses sieht, das die Gesamtheit der philosophischen Anstrengung beseelt.53 Tatsächlich verbleibt für 46 Ebd., S. 34 f. 47 Ebd., S. 38. 48 Kant, Kritik der reinen Vernunft, B 867. 49 Ebd. 50 Ebd., B 866. 51 Ebd., B 867; Kant, Logik, A 24. 52 Platon, Politeia, 480a6. 53 Éric Weil, Problèmes kantiens, Paris 1990, S. 37, Anm. 17.
266
Pierre Hadot
Kant der Schulbegriff der Philosophie auf der Ebene der reinen Theorie. Allein der ‚Welt‘-Begriff der Philosophie bezieht die Perspektive des letzten Sinns der Philosophie ein und kann die Philosophie wirklich einen. Was ist der ‚Welt‘-Begriff der Philosophie? Kant spricht auch von einem ‚kosmischen‘ oder ‚weltbürgerlichen‘ Begriff.54 Der Ausdruck ist irreführend. Man muss ihn in den Kontext des 18. Jahrhunderts einordnen, dem Jahrhundert der Aufklärung. Das Wort ‚kosmisch‘ bezieht sich hier nicht auf die physikalische ‚Welt‘, sondern auf die menschliche Welt, das heißt auf den Menschen, der in der Welt der Menschen lebt. Der Gegensatz zwischen Philosophie der Schule und Philosophie der Welt bestand bereits vor Kant, so bei Johann Georg Sulzer – 1759 – , für den die ‚Weltweisheit‘ in der Erfahrung der Menschen und der daraus resultierenden Weisheit bestand.55 Diese Unterscheidung entsprach der allgemeinen Tendenz des Aufklärungszeitalters, die Philosophie aus dem geschlossenen und starren Kreis der Schule heraustreten zu lassen, um sie jedem Menschen zugänglich und nützlich zu machen. Wir müssen übrigens diese Charakterisierung der Philosophie im 18. Jahrhundert besonders hervorheben, die erneut dahin tendiert, philosophischen Diskurs und Art zu leben wie in der Antike miteinander zu vereinen. Die kantische Idee der kosmischen Philosophie geht allerdings tiefer als die Weltweisheit oder Popular-Philosophie, die sich im 18. Jahrhundert großer Beliebtheit erfreute, denn die ‚kosmische‘ Philosophie bezieht sich letztlich auf die im idealen Weisen verkörperte Weisheit. Was die Idee der Philo-Sophie – das heißt der Suche nach Weisheit – immer begründet hat, ist für Kant56 die Idee einer ‚kosmischen‘ Philosophie, eines ‚Weltbegriffs‘ der Philosophie – und nicht die Idee einer scholastischen Philosophie – , „vornehmlich wenn man ihn gleichsam personifizierte und in dem Ideal des Philosophen sich als ein Urbild vorstellte“. Das läuft darauf hinaus, dass man sie in der Gestalt des Weisen sah: „In solcher Bedeutung wäre es sehr ruhmredig, sich selbst einen Philosophen zu nennen und sich anzumaßen, dem Urbilde, das nur in der Idee liegt, gleichgekommen zu sein“. Dieser ideale Philosoph, dieser Weise, wäre der „Gesetzgeber der … Vernunft“, das heißt derjenige, der sich selber sein eigenes Gesetz gäbe, das Gesetz der Vernunft. Während der ideale Weise sich nirgendwo antreffen lässt, wird „die Idee aber seiner Gesetzgebung allenthalben 54 Kant, Logik, A 24 f.; zum kosmischen Begriff der Philosophie vgl. J. Ralph Lindgren, Kant’s Conceptus Cosmicus, in: Dialogue 1 (1963-64) S. 280-300. 55 Vgl. Helmut Holzhey, Der Philosoph für die Welt – eine Chimäre der deutschen Aufklärung, in: Esoterik und Exoterik der Philosophie. Beiträge zu Geschichte und Sinn philosophischer Selbstbestimmung, hg. v. Helmut Holzhey u. Walther Ch. Zimmerli, Basel u. Stuttgart 1977, S. 117 ff., hier S. 133; Holzhey zitiert Johann Georg Sulzer, Kurzer Begriff aller Wissenschaften und Theile der Gelehrsamkeit, Leipzig 21759, S. 185-188. 56 Kant, Kritik der reinen Vernunft, B 866.
Verschwinden und Wiederauftauchen der antiken Auffassung …
267
in jeder Menschenvernunft angetroffen“. Dies gibt zu verstehen, dass unsere Vernunft die Imperative, welche das menschliche Handeln führen, im Licht der Idee des idealen Weisen formuliert.57 Im kategorischen Imperativ „handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde“ verwirklicht und überwindet sich das Ich, indem es sich verallgemeinert.58 Der Imperativ muss also unbedingt sein – das heißt: Er darf sich nicht auf ein besonderes Interesse gründen, sondern muss im Gegenteil das Individuum veranlassen, nur im Hinblick auf das Universale zu handeln. Hier stoßen wir wieder auf eines der Grundthemen der Lebensform, die der antiken Philosophie eigen war. Der Leser wird sich gewiss fragen, warum Kant dieses von der Idee der Weisheit beherrschte philosophische Programm gerade ‚Begriff der kosmischen Philosophie‘ genannt hat. Vielleicht versteht man den Grund für diese Bezeichnung besser, wenn man folgende kantische Definition der Idee der kosmischen Philosophie liest: „Weltbegriff heißt hier derjenige, der das betrifft, was jedermann notwendig interessiert“59, das heißt, da die Welt – Kosmos – , von der hier die Rede ist, die menschliche Welt ist, das, was jedermann notwendig interessiert. Was jeden interessiert oder vielmehr was jeden interessieren sollte, ist hier eben nichts anderes als die Weisheit: Der normale, natürliche und alltägliche Zustand der Menschen sollte die Weisheit sein, den sie allerdings nie erreichen werden. Dies war eine der Grundideen der antiken Philosophie, und darum ist das, was jeden Menschen interessiert, nicht nur die Frage der kantischen Kritik ‚Was kann ich wissen?‘, sondern die Grundfragen der Philosophie sind vor allem die Fragen ‚Was soll ich tun?‘, ‚Was darf ich hoffen?‘ und ‚Was ist der Mensch?‘60 Diese Idee des Interesses, des Interesses der Vernunft, ist sehr wichtig, denn sie ist mit der Idee eines Primats der praktischen Vernunft im Verhältnis zur theoretischen Vernunft verbunden, weil, wie Kant sagt, „alles Interesse zuletzt praktisch ist, und selbst das der spekulativen Vernunft nur bedingt und im praktischen Gebrauche allein vollständig ist.“61 Kants Philosophie wendet sich in der Tat nur an diejenigen, die dieses praktische Interesse am moralisch Guten empfinden, die mit einem moralischen Gefühl ausgestattet sind, die auf einen höchsten Zweck setzen, auf ein höchstes Gut. Es ist bemerkenswert, dass in der Kritik der Urteilskraft dieses Interesse am moralisch 57 Weil, Problèmes kantiens, a. a. O., S. 34. Hervorhebung im Original. 58 Immanuel Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, BA 52. Hervorhebung im Original. 59 Kant, Kritik der reinen Vernunft, B 868 Anm. 60 Kant, Logik, A 25; Ders., Kritik der reinen Vernunft, B 833. 61 Immanuel Kant, Kritik der praktischen Vernunft, A 219.
268
Pierre Hadot
Guten und das moralische Gefühl als Voraussetzung des Interesses erscheinen, das man für die Schönheit der Natur empfinden kann: „Allein erstlich ist dieses unmittelbare Interesse am Schönen der Natur wirklich nicht gemein, sondern nur denen eigen, deren Denkungsart entweder zum Guten schon ausgebildet, oder dieser Ausbildung vorzüglich empfänglich ist“.62 Der theoretische Diskurs Kants ist also, von seiner Seite wie von Seiten derjenigen, an die er sich wendet, an eine Entscheidung gebunden, die einen Glaubensakt darstellt, der zur Wahl einer bestimmten Lebensform führt, die in letzter Analyse vom Vorbild des Weisen inspiriert ist. So wird deutlich, wie sehr Kant unter dem Einfluss der antiken Auffassung von der Philosophie stand. In der ‚Ethischen Asketik‘, die er am Ende seiner Metaphysik der Sitten vorschlägt, kann man übrigens eine Darlegung der Regeln zur Übung in der Tugend erkennen, ein Versuch, die epikureische Heiterkeit und die Anspannung der stoischen Pflicht miteinander zu versöhnen.63 Um die Geschichte der Rezeption der antiken Philosophie in der Philosophie vom Mittelalter bis heute in ihrer ganzen Reichweite zu beschreiben, bedürfte es eines dicken Bandes. Ich habe mich damit begnügt, einige Eckpfeiler abzustecken: Montaigne, Descartes und Kant. Andere Namen wären zu nennen, von so unterschiedlichen Denkern wie Jean-Jacques Rousseau, Shaftesbury64, Arthur Schopenhauer, Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau, Søren Kierkegaard, Karl Marx, Friedrich Nietzsche, William James, Henri Bergson, Ludwig Wittgenstein, Maurice Merleau-Ponty und weitere, die alle auf die eine oder andere Art vom Vorbild der antiken Philosophie beeinflusst sind und die Philosophie als eine konkrete und praktische Aktivität aufgefasst haben, als eine Transformation der Art zu leben oder die Welt wahrzunehmen.
62 Immanuel Kant, Kritik der Urteilskraft, § 42, B 170. 63 Immanuel Kant, Metaphysik der Sitten, II. Tugendlehre, II, § 53, A 176 f. 64 Vgl. die beiden handschriftlichen Hefte, die in den Shaftesbury Papers – Public Record Office, London – , enthalten sind: PRO 30/24/27/10, 1 u. 2; franz. Übersetzung: Shaftesbury, Exercices, hg. v. Laurent Jaffro, Paris 1993. Es handelt sich um geistige Übungen nach Epiktet und Marc Aurel; siehe auch Benjamin Rand, The Life, Unpublished Letters and Philosophical Regimen of Anthony, Earl of Shaftesbury, London u. New York 1900.
6 Grundzüge einer Metaphysik der Gegenwart
‚Wiederkehr und Zukunft der Metaphysik‘: welcher Metaphysik? Lorenz B. Puntel
0 Einleitung Sowohl der ursprüngliche Haupttitel ‚Wiederkehr der Metaphysik‘ als auch der endgültige Haupttitel ‚Die Zukunft der Metaphysik‘ dieser Tagung1 artikulieren eines der erstaunlichsten Phänomene auf der internationalen Ebene der Philosophie des 20. Jahrhunderts. Das Phänomen ereignete sich allmählich und grundsätzlich im Rahmen der analytischen Philosophie, jener Philosophie, deren Hauptrepräsentanten bis etwa Ende des II. Weltkrieges radikal und kämpferisch antimetaphysisch eingestellt waren. Heute ist ‚Metaphysik‘ ein wohletabliertes philosophisches Fach, das Gegenstand einer umfangreichen Literatur ist. Auf den ersten Blick erweckt diese Stellung der Metaphysik den Eindruck, es handele sich um ein bemerkenswertes, ja großartiges philosophisches Phänomen. Zwar wird man schwerlich bestreiten können, dass es in diesem Phänomen bemerkenswerte, ja großartige Aspekte gibt; aber das Phänomen der Wiederkehr der Metaphysik beziehungsweise der gegenwärtigen Metaphysik, als ein ganzes genommen, ist alles andere als bemerkenswert und großartig. Näher betrachtet, stellt es sich als eine Art buntes Sammelsurium von unterschiedlichen Fragestellungen, Ansätzen und Konzeptionen heraus, die sich unter dem Titel ‚Metaphysik‘ als philosophisch ausgeben. Die Verwendung des Ausdrucks ‚Metaphysik‘ ohne nähere Erläuterung beziehungsweise Präzisierung ist nicht vertretbar. Es herrscht in dieser Hinsicht in der heutigen Philosophie eine unerträgliche Unklarheit und Konfusion. Aus diesem Grund hatte sich der Verfasser vor einigen Jahren entschlossen, das Wort ‚Meta1 Die Zukunft der Metaphysik – von einem unabweislichen Bedürfnis der Vernunft. Philosophisch-Theologische Hochschule Benedikt XVI, Zisterzienser Stift Heiligenkreuz, Österreich, 5. bis 7. Oktober 2018. © Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv lizenziert durch Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2020 C. Böhr (Hrsg.), Metaphysik, Das Bild vom Menschen und die Ordnung der Gesellschaft, https://doi.org/10.1007/978-3-658-31593-1_16
271
272
Lorenz B. Puntel
physik‘ als Bezeichnung für die von ihm vertretene systematische Philosophie nicht zu verwenden; stattdessen wählte er die Bezeichnung ‚struktural-systematische Philosophie‘ – SSP – in Konsonanz mit dem Titel eines seiner Werke.2 In den letzten Jahren wurde ihm aber immer mehr bewusst, dass der Ausdruck ‚Metaphysik‘ nicht immer sinnvollerweise vermieden werden kann. Daher hat er beschlossen, den Ausdruck in gewissen Zusammenhängen zu verwenden, allerdings immer ausschließlich in strenger Verbindung mit dem den Ausdruck entscheidend erläuternden und präzisierenden Adjektiv ‚primordial/e‘: also als ‚Primordiale Metaphysik‘. Damit ist der zweite Teil des Titels des Vortrags erklärt: Die Antwort auf den als Frage verstandenen Haupttitel: ‚Wiederkehr beziehungsweise Zukunft der Metaphysik‘ lautet: ‚ … welcher Metaphysik?‘ Gemeint ist die primordiale Gestalt von Metaphysik. Diese Metaphysik hat es bis jetzt nicht explizit gegeben; daher kann man im Falle der hier darzustellenden Konzeption nur in einem uneigentlichen und ungewöhnlichen Sinne von ‚Wiederkehr beziehungsweise Zukunft der Metaphysik‘ sprechen. Der Sinn wäre: ‚Wiederkehr/Zukunft‘ im Sinne einer Neuentdeckung und Neuartikulation einer großen philosophischen Idee oder, genauer, einer umfassenden philosophischen Intuition, in Bezug auf welche man annehmen kann, dass sie der über zweitausendjährigen Geschichte der Verwendung des Wortes ‚Metaphysik‘ zugrunde lag und die bisher keine, zumindest keine adäquate, Ausarbeitung und Darstellung gefunden hat. Angesichts der immensen Weite und Komplexität dieses Themas ist dessen adäquate Behandlung im Rahmen eines Vortrags einfach undurchführbar. Der Verfasser muss sich daher auf einige allgemeine Hinweise beschränken, in vollem Bewusstsein der Gefahr, dass auch so seine Ausführungen nicht ganz oder kaum verstanden werden können. In seiner ursprünglichen Fassung bestand der Text aus zwei Hälften. In der ersten Hälfte wurden einige der wichtigsten in der Geschichte der Verwendung des Ausdrucks ‚Metaphysik‘ aufgetretenen Gestalten des Verständnisses dieses Terms in kritischer Absicht geschildert. Aber diese erste Hälfte wird hier vollständig ausgelassen. Der an dieser Thematik interessierte Leser sei auf die in der Fußnote 2 angeführten Bücher SuS und SuG des Verfassers verwiesen. Die zweite Hälfte war beziehungsweise ist streng systematisch orientiert: In ihr wird eine extrem schematische Charakterisierung einiger Grundzüge einer 2 Vgl. Lorenz B. Puntel, Struktur und Sein. Ein Theorierahmen für eine systematische Philosophie, Tübingen 2006; in dieser Abhandlung wird dieses Werk unter der Sigle SuS zitiert; vgl. auch das 2010 erschienene Buch des Verfassers Lorenz B. Puntel, Sein und Gott. Ein systematischer Ansatz in Auseinandersetzung mit M. Heidegger, É. Lévinas und J.-L. Marion, Tübingen 2010. Dieses Buch wird unter der Sigle SuG zitiert. Weitere Passagen in dieser Abhandlung sind entweder gänzlich oder teilweise einem dieser beiden Bücher entnommen.
‚Wiederkehr und Zukunft der Metaphysik‘: welcher Metaphysik?
273
Theorie der primordialen Metaphysik dargestellt. Eine stark gekürzte Fassung dieser ursprünglich konzipierten und ausgearbeiteten Hälfte wird hier abgedruckt. Sie gliedert sich in zwei Abschnitte. In Abschnitt 1 werden die Grundzüge des struktural-systematischen Theorierahmens dargestellt. Abschnitt 2 enthält eine konzise Präsentation der inhaltlichen Gestaltung und Ausführung des strukturalsystematischen Theorierahmens.
1
Grundzüge des struktural-systematischen Theorierahmens
In Teil 1 werden einige Grundzüge des Theorierahmens jener Philosophie dargestellt, die vom Verfasser unter dem Titel ‚struktural-systematische Philosophie – SSP – ‘ entwickelt wurde beziehungsweise wird. Es handelt sich um eine streng systematisch orientierte Philosophie. Für deren Bezeichnung wird aber nicht der deutsche Term ‚System‘ verwendet, und zwar wegen der immens negativen historischen Konnotationen, die diesem Wort anhaften. Die primordiale Metaphysik, wie sie hier vorgestellt und verwendet wird, versteht sich als Seinstheorie und besteht aus zwei ‚Teil‘-Theorien: der Theorie des Seins als solchen und der Theorie des Seins im Ganzen. Der Umstand, dass dieser Vortrag im Rahmen einer in der Philosophisch-theologischen Hochschule des Zisterzienser Stiftes Heiligenkreuz stattfindenden Tagung gehalten werden sollte, veranlasste den Autor, der Gottesthematik eine ausführlichere Behandlung als anderen Teilen und Themenstellungen der SSP zukommen zu lassen. Die SSP ist eine hochkomplexe Philosophie, die jeden Teil, jede Komponente und jedes Thema der Philosophie einer profunden Revision unterzieht und damit eine völlig neue theoretische philosophische Gesamtkonstellation schafft. Der Versuch, eine solche umfassende Konzeption im Rahmen eines beschränkten Vortrags überhaupt zu präsentieren, ist ohne Zweifel beinahe ein Ding der Unmöglichkeit. Der Verfasser wird wohl versuchen müssen, die beinahe Unmöglichkeit in etwas einigermaßen Sinnvolles zu verwandeln. Die SSP findet ihre Darstellung in fünf großen Schritten und damit auch in fünf Teilen. Sie artikulieren eine zunehmend bestimmtere Stufe der eingangs formulierten ‚Quasi‘-Definition der SSP. Die Teile oder Schritte 1 bis 4 werden hier mehr oder weniger nur in Stichworten dargestellt. Mehr erlaubt die zur Verfügung stehende Zeit nicht.
274
1.1
Lorenz B. Puntel
Systematik 1: Globalsystematik
Der erste Teil beziehungsweise Schritt besteht zuerst darin, eine Definition – oder, genauer, eine Quasi-Definition – der SSP zu artikulieren. Die hier vorgeschlagene ‚Quasi‘-Definition lautet: Die SSP – und damit auch die primordiale Metaphysik – ist die Theorie der universalen Strukturen des uneingeschränkten universe of discourse. Jedes Wort in dieser ‚Quasi‘-Definition zählt, weswegen es mit höchster Sorgfalt gewählt wurde. Der Ausdruck ‚universe of discourse‘ geht auf den Logiker August de Morgan zurück – Mitte des 19. Jahrhunderts.3 Die vollständige Erklärung dessen, was uneingeschränktes universe of discourse für die Philosophie meint, fällt mit der vollständigen Darstellung der strukturalsystematischen Philosophie zusammen. Die Formulierung ‚Uneingeschränktes universe of discourse‘ ist besonders aus zwei Gründen ganz adäquat: Zum einem ist sie weitgehend neutral, indem sie keine inhaltliche Angabe macht, da sie nur die Perspektive der uneingeschränkten Totalität artikuliert; zum anderen nennt sie explizit den discourse, und damit die Sprache, als eine wesentliche Dimension der Philosophie. Neben der ‚Quasi‘-Definition der SSP ist eine zweite globale Komponente dieser Philosophie zu nennen. Das ist die Idee des systematischen Theorierahmens. Rudolf Carnap hat den Ausdruck ‚linguistic framework – Sprachrahmen‘ in die Philosophie eingeführt;4 die SSP hat den Ausdruck und die dahinter stehende Idee grundsätzlich übernommen, ihn beziehungsweise sie aber durch Erweiterung beträchtlich korrigiert, mit dem Ergebnis, dass sie dann nicht mehr – oder nicht hauptsächlich – von Sprachrahmen, sondern von Theorierahmen spricht. Einfach und allgemein gesprochen, ist ein Theorierahmen das Gesamt der essentiellen Komponenten einer Theorie, jener Komponenten, die unabdingbare strukturale Bestandteile jeder, auch der kleinsten, theoretischen philosophischen Aussage und erst recht ganzer philosophischer Theorien sind. Welche das sind, ist eine entscheidende Frage. In jedem Fall müssen heute die drei folgenden Komponenten genannt werden: die sprachliche Komponente – Semantik – , die logische Komponente, die inhaltliche oder objektive oder, in der Terminologie der SSP, die ontologische/seinstheoretische Komponente – Logik, Semantik, Ontologie plus Seinstheorie. Für ‚Seinstheorie‘ wird in Unterscheidung zum Term ‚Ontologie‘ auch der Neologismus ‚Einailogie‘ eingeführt – aus dem Griechischen εἶναι: sein/Sein. Die große Aufgabe besteht darin, aus diesen Komponenten ein kohärentes, die Erfordernisse der Intelligibilität, Rigorosität und Sachangemessenheit erfüllendes 3 Vgl. dazu SuS, S. 39. 4 Vgl. dazu SuS, S. 39 f.
‚Wiederkehr und Zukunft der Metaphysik‘: welcher Metaphysik?
275
Ganzes zu entwickeln. Das ist eine formidable Aufgabe. Soweit der Verfasser sehen kann, wurde sie bisher kaum in angemessener Weise gesehen und noch weniger in Angriff genommen. Darin erblickt er eine der großen und weitreichende Konsequenzen in sich bergenden Schwächen der allermeisten philosophischen Richtungen der Gegenwart, ganz besonders derjenigen, die heute als die bedeutendsten angesehen werden. Warum soll der Philosoph die Idee des Theorierahmens annehmen und explizit machen? Die Antwort ist, grundsätzlich gesehen, ganz einfach: Weil in allem, was der Philosoph tut und sagt, ein von ihm hiermit vorausgesetzter Theorierahmen benutzt wird. Immer ist also ein semantischer, logischer und ontologischer plus seinstheoretischer Rahmen am Werk, ob der Philosoph sich dessen bewusst ist oder nicht, ob er dies explizit anerkennt oder nicht. Die Tragweite dieser simplen Feststellung kann man schwerlich überschätzen. Eine Grundthese der SSP besagt, dass es eine Pluralität von Theorierahmen faktisch gibt und dass es eine noch größere Pluralität geben kann. Der SSP-Theorierahmen versteht sich weder als der einzige und noch weniger als der absolute systematisch-philosophische Theorierahmen. Wohl erhebt er den Anspruch, der jedem anderen systematisch orientierten Theorierahmen in der gegenwärtigen Lage der Philosophie hinsichtlich Intelligibilität, Kohärenz und Sachadäquatheit überlegene Theorierahmen zu sein. Das ist eine immense und faszinierende Thematik, insbesondere hinsichtlich der Frage, wie das Verhältnis zwischen den verschiedenen vorhandenen und den als möglich nicht ausschließbaren philosophischen Theorierahmen zu denken ist. Hier kann darauf überhaupt nicht näher eingegangen werden. Eine weitere zentrale Komponente der Globalsystematik ist die philosophische Methode. Die SSP basiert auf einer sehr komplexen Methode. Sie kann als eine vollständig und adäquat entwickelte Netzwerkmethode verstanden werden. Diese Komplexität erklärt sich daher, dass die philosophische Theoriebildung zahlreiche und sehr verschiedenartige Aufgaben beinhaltet, für deren Bewältigung verschiedene Methoden angewandt werden müssen. In einer systematischen Hinsicht lässt sich diese ‚Vielfalt von Methoden‘ auf vier Methodenstufen reduzieren.
1.2
Systematik 2: Theoretizitätssystematik
In Teil oder Schritt 2, mit der Bezeichnung ‚Theoretizitätssystematik‘, werden essentielle Faktoren der Darstellungsdimension behandelt. Es sind dies: die Dimension der Theorie im engeren Sinn, die philosophische Sprache, die Dimension des Wissens – der Erkenntnis.
276
Lorenz B. Puntel
Viele, vielleicht die meisten heutigen Philosophen verwenden ausgiebig den Ausdruck – und Begriff – ‚Theorie‘. Weitgehend handelt es sich dabei aber nicht um einen klaren Begriff, sondern um ein Modewort. Wer die heutige Wissenschaftstheorie gründlich kennt, weiß, dass ‚Theorie‘ eine hochkontroverse und komplizierte Angelegenheit ist, bei deren Klärung die Meinungen oft weit auseinandergehen. Schon die Formulierung der ‚Quasi‘-Definition der SSP zeigt, dass im Zentrum dieser Philosophie die Sprache steht, allerdings nicht die sogenannte normale oder natürliche Sprache, sondern eine eigens entwickelte völlig transparente philosophische Sprache. Von entscheidender Bedeutung für die Thematik der SSP ist die Erarbeitung dieser völlig transparenten philosophischen Sprache mit ihrer speziellen Semantik und ihrer speziellen Ontologie plus Seinstheorie. Die von der SSP entwickelte und benutzte Sprache erkennt nur Sätze an, die nicht die SubjektPrädikat-Struktur haben, wie beispielsweise den Satz ‚Es regnet‘. Diese Sätze werden von der SSP Primsätze genannt und es wird angenommen, dass sie ein Expressum haben, das als Primproposition bezeichnet und als zentrales Element einer neuen Semantik und einer neuen Ontologie/Seinstheorie betrachtet wird. Der Grund für die Verwerfung von Sätzen mit der Subjekt-Prädikat-Struktur ist der Umstand, dass sie eine nicht akzeptierbare ontologische Implikation haben, nämlich die Substanzontologie, die nach den Grundsätzen der SSP als nicht intelligibel und als inkohärent gilt. Die dritte essenzielle Komponente der Dimension der Theoretizität ist die Dimension der Erkenntnis oder des Wissens. Diesbezüglich vertritt die SSP die absolut revolutionäre These von der Depotenzierung dieser Dimension. Die Dimension der Erkenntnis – des Wissens – hat eine nur geringe Bedeutung, ja eine nur marginale Bedeutung in der SSP. Der struktural-systematische Begriff der Erkenntnis beziehungsweise des Wissens unterscheidet sich grundlegend von dem allgemein üblichen und akzeptierten Begriff. Bekanntlich wurde dieser Begriff, der in der einen oder anderen Weise in der ganzen Tradition der Philosophie vertreten wurde, von Edmund Gettier genau definiert: Erkenntnis/Wissen ist nach seiner klassisch gewordenen Formulierung ‚justified true belief‘, ein Glaube oder eine Überzeugung, der/die wahr und gerechtfertigt ist. Die SSP lehnt diese Definition ab und ersetzt sie durch eine eigene.5 Ein anderer Faktor, der die Konzeption der SSP von jeder anderen philosophischen Konzeption unterscheidet, betrifft die Bedeutung und Tragweite ‚theoretischer Sätze‘. Die Philosophie besteht ausschließlich aus theoretischen Sätzen, das ist eine zentrale These der SSP. Aber was ist ein theoretischer Satz? Ludwig Wittgenstein hat in seinem Tractatus auf genial einfache und kurze Weise die Struktur theore5 Vgl. dazu SuS, Abschnitt 2.3.
‚Wiederkehr und Zukunft der Metaphysik‘: welcher Metaphysik?
277
tischer Sätze so artikuliert: „[D]ass es eine allgemeine Satzform gibt, wird dadurch bewiesen, dass es keinen Satz geben darf, dessen Form man nicht hätte voraussehen – das heißt konstruieren – können. Die allgemeine Form des [deklarativen] Satzes ist: es verhält sich so und so.“6 Ein theoretischer Satz ist ein Satz, dem der theoretische Operator „es verhält sich so, dass…“ (= ) vorangestellt wird, so dass sich die Form ‚ (ϕ)‘ ergibt. Beispiel: „es verhält sich so, dass [= ] die Erde sich um die Sonne dreht [= ϕ]“. Hier muss ein ganz bestimmter Aspekt hervorgehoben werden. Der kurz eingeführte und erläuterte theoretische Operator ist zu verstehen als ein uneingeschränkter Operator, was bedeutet, dass er durch keinerlei Faktoren limitiert wird. Solche Faktoren wären: Angewiesenheit an bestimmte Subjekte, bestimmte Situationen, bestimmte Zeiten, bestimmte psychologische und soziale Gegebenheiten und andere. Das liegt im Wesen einer genuinen Theorie. Es ist aber ein Faktum, dass theoretische Sätze, also Sätze, die durch den Operator bestimmt sind, in der heutigen philosophischen Literatur meistens, wenn nicht ausschließlich, durch allerlei Faktoren partikularisiert und damit eingeschränkt werden. Die entsprechenden theoretischen Sätze haben dann die Form p(ϕ), wobei der angehängte Index ‚p‘ ‚partikularisiert‘ meint. Die, philosophisch gesehen, wichtigste partikularisierte Form des theoretischen Operators betrifft den Bereich der Erkenntnis/des Wissens. Hier ist ein Phänomen zu nennen, das erstaunlicherweise kaum gesehen und noch weniger untersucht wurde. Die in der Neuzeit eingetretene Wende zum Subjekt findet ihre Artikulation in theoretischen Sätzen mit ‚eingeschränktem‘ theoretischem Operator. Wer Subjekt sagt, setzt von vornherein eine grundlegende Unterscheidung zwischen Subjekt und Objekt voraus. Beinahe alle philosophischen Richtungen in der Neuzeit und Gegenwart sind das Resultat der Artikulation der Subjekt-Objekt-Beziehung aus der Perspektive des Subjekts. Allgemein lässt sich sagen: Wenn eine Philosophie sich selbst charakterisiert, indem sie sich als echt philosophisch ausgibt und wenn dies in adäquater Weise geschieht, so formuliert diese Philosophie Sätze, die absolut uneingeschränkt sind. Wenn sie aber eigene Sätze äußert, die nicht durch einen uneingeschränkten theoretischen Operator strukturiert sind, dann kommt der Widerspruch zum Vorschein. Das ist ein Phänomen, das beinahe alle philosophischen Richtungen der Gegenwartsphilosophie betrifft. Es ist erstaunlich – oder auch nicht – , dass dieses Phänomen weder gesehen noch behandelt wird.
6
Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, 1921, in: Ders., Schriften 1, Frankfurt am M. 1969, 4.5.
278
1.3
Lorenz B. Puntel
Systematik 3: Struktursystematik
Teil oder Schritt 3 der SSP wird Struktursystematik genannt. Die Struktursystematik ist das Herzstück des SSP-Theorierahmens und damit auch der ganzen SSP. Die SSP geht vom mathematischen Begriff der Struktur aus, den sie aber dahingehend transformiert, dass sie ihn an die philosophische Zielsetzung und Gesamtthematik anpasst. In außerordentlich langen Ausführungen wird gezeigt, dass man drei Arten von philosophisch fundamentalen Strukturen annehmen muss. Es sind dies: die fundamentalen logischen Strukturen, die fundamentalen semantischen Strukturen und die fundamentalen ontologischen beziehungsweise seinstheoretischen Strukturen. Es ist schlechterdings unmöglich, im Rahmen dieses Vortrags darauf im Einzelnen einzugehen. Es sei hier aber ein extrem kurzer Hinweis auf den von der SSP vertretenen semantisch-ontologischen/seinstheoretischen Wahrheitsbegriff gegeben. Nach der SSP-Semantik drückt jeder wohl gebildete Primsatz eine Primproposition aus. Der Term ‚Proposition‘ hat nicht die Bedeutung von ‚Satz‘, wie dies oft in der Geschichte der Philosophie der Fall war und auch immer noch ist, sondern die Bedeutung eines Expressum eines Satzes. In diesem Sinne ist eine Primproposition eine nicht volldeterminierte Entität. Sie erhält den vollbestimmten Status erst durch den Begriff der Wahrheit. Dieser Begriff, dem die SSP eine enorme Bedeutung beimisst, bildet den höchsten und definitiven Bestimmtheitsstatus der Sprache, konkret der als wahr bezeichneten Primsätze. In aller Kürze kann die SSP-Auffassung so zusammengefasst werden: Ein Primsatz ist wahr dann und nur dann, wenn er eine wahre Primproposition ausdrückt und eine Primproposition ist wahr dann und nur dann, wenn sie identisch ist mit einer Primtatsache in der Welt beziehungsweise in der Seinsdimension.
2
Inhaltliche Gestaltung und Ausführung des struktural-systematischen Theorierahmens
Damit ist die Darstellung des systematischen Theorierahmens abgeschlossen. Was jetzt folgt ist die Anwendung des Theorierahmens auf die inhaltliche Dimension der Philosophie, zunächst in einem vierten Schritt oder Teil genannt Weltsystematik.
‚Wiederkehr und Zukunft der Metaphysik‘: welcher Metaphysik?
2.1
279
Systematik 4: Weltsystematik als ontologische Theorie der Welt und ihrer Bereiche
Die inhaltliche Dimension der SSP umfasst zwei Teile, den Teil oder das Kapitel 4 mit der Bezeichnung ‚Weltsystematik‘ und den Teil oder das Kapitel 5 mit der Bezeichnung ‚Gesamtsystematik‘. Weltsystematik ist in der Terminologie der SSP Ontologie als Theorie der – aller – Seienden, und Gesamtsystematik ist Seinstheorie/ Einailogie oder Theorie des Seins als solchen und im Ganzen. Diese Terminologie basiert auf der fundamentalen Distinktion zwischen Sein und Seiendem/en, einer Distinktion, die Martin Heidegger unangemessen ‚ontologische Differenz‘ nannte. An dieser Stelle ist vorerst zu bemerken, dass die SSP eine radikale Unterscheidung zwischen Welt und Sein macht. Als in den Teilen 1-3 vom uneingeschränkten universe of discourse die Rede war, wurde keine genaue explizite Unterscheidung zwischen folgenden Ausdrücken gemacht: Universum, Welt, Realität, Sein. Erst ab Teil 4 werden diese Ausdrücke nicht mehr als grundsätzlich äquivalent betrachtet. Das betrifft vor allem den Term ‚Welt‘, der vom Term ‚Sein‘ radikal unterschieden wird. Eine andere Unterscheidung, die für die weiteren Ausführungen eine wesentliche Rolle spielen wird, ist die zwischen ‚Sein‘ und ‚Existenz‘. Darauf soll später eingegangen werden. Die Weltsystematik als die Theorie über die Gesamtheit der Bereiche des/der Seienden kann hier nur stichwortartig erwähnt werden. In diesem Teil wurden im Buch SuS vorerst nur folgende Bereiche behandelt: die Naturwelt, die menschliche Welt – philosophische Anthropologie oder Philosophy of Mind, sittliches Handeln und sittliche Werte – , die ästhetische Welt, das Weltganze – die naturwissenschaftlich-philosophische Kosmologie – , das Phänomen und die Pluralität der Religionen, die Weltgeschichte.
2.2
Systematik 5: Gesamtsystematik als Theorie des Seins als solchen und im Ganzen – Einailogie –
Die Gesamtsystematik ist jene Dimension der SSP, die wohl als die Krönung dieser Philosophie bezeichnet werden kann und muss. Wenn man vom Wort ‚Metaphysik‘ hierfür Gebrauch machen will, so sollte man, wie schon eingangs vermerkt wurde, die Präzisierung ‚Primordiale Metaphysik‘ verwenden. Diesem Teil der SSP soll eine ausführlichere Darstellung gewidmet werden.
280
Lorenz B. Puntel
2.2.1 Sein und Existenz Als Erstes muss der Unterschied zwischen ‚Sein‘ und ‚Existenz‘ geklärt werden. Diese zwei großen Terme/Begriffe haben eine lange, sehr lange Geschichte. Manchmal wurden sie identifiziert, meistens aber wurden sie unterschieden. In der Gegenwart, in der Zeit der Wiederkehr der Metaphysik, spielen sie eine schlechterdings zentrale Rolle. Aber das ist keine brillante, nicht einmal eine eindrucksvolle Rolle; eher handelt es sich um ein Dokument des Scheiterns bei der Bewältigung der Aufgabe, die sich der Philosophie stellt, wenn diese versucht, die in ihrer Geschichte zumindest implizit und intuitiv mit den Termen/Begriffen ‚Sein/Seiendes‘ verbundene große Idee neu zu durchdenken. Nach Ansicht des Verfassers stellt das totale Fehlen einer Seinstheorie den größten Mangel der mainstream analytischen Ontologie/Metaphysik dar. Das zeigt sich besonders an einem falschen Doppelschritt, den diese Philosophie vollzieht. Der erste ist die konsequenzenreiche Entscheidung, ‚Sein‘ einfach auf ‚Existenz‘ zu reduzieren, was schon Willard Van Orman Quine getan hat: „Es war jüngst und ehedem in der Philosophie recht gebräuchlich, zwischen Sein als dem weitesten Begriff und Existenz als dem engeren zu unterscheiden. Diese Unterscheidung stammt nicht von mir; ich will mit ‚existiert‘ alles erfassen, was es gibt, und solcherart ist auch die Bedeutung des Quantors.“7 Der zweite Schritt besteht darin, dass viele analytische Philosophen auf der Basis oder im Rahmen einer solchen reinen Ontologie – im strengen Sinne einer Theorie der Seienden als Seienden – eine Theologie entwickeln, die dann die Gestalt einer Onto-Theo-logie annimmt. Damit verschwindet die Seinsdimension. Aus einer terminologischen und sachlichen Perspektive fasst die SSP ‚Existenz‘ als den Status der Elemente auf, die zu einem bestimmten Bereich von Seienden gehören; am besten könnte man diesen Bereich als den Bereich der aktuell Seienden charakterisieren – im Unterschied etwa zum Bereich der abstrakt Seienden und so weiter. Wie hier genauer zu verfahren wäre, ist eine terminologische und sachliche Frage. Aber diese These ist nur dann sinnvoll und zulässig, wenn sie genau verstanden wird, nämlich so, dass damit die Gesamtdimension der Seienden und die allerletzte Dimension des Seins nicht ignoriert oder gar ausgeschlossen werden. Diesen Grundfehler, der katastrophale Konsequenzen hat, begeht die SSP gerade nicht. Die heutige philosophische Situation, besonders im deutschsprachigen Raum, ist dadurch charakterisiert, dass die Reduktion von Sein auf Existenz im Rahmen einer sonderbaren und schnellen, allzu schnellen Mischung aus Elementen zweier großer falsch verstandener und nur oberflächlich rezipierter philosophischer Tradi7 Willard Van Orman Quine, Ontologische Relativität und andere Schriften, Stuttgart 1975, S. 139.
‚Wiederkehr und Zukunft der Metaphysik‘: welcher Metaphysik?
281
tionen stattfindet: der klassisch-deutschen Philosophie – besonders des deutschen Idealismus – und der analytischen Philosophie. Dazu sei ein Beispiel gebracht, das Bände spricht. Der deutsche Philosoph Markus Gabriel formuliert eine seiner in seinem Buch Sinn und Existenz. Eine realistische Ontologie8 vertretenen Hauptthesen folgendermaßen: „Eine der Hauptthesen der folgenden Abhandlung lautet … , dass Existenzaussagen immer lokal gebunden sind. Was existiert, kommt immer in einem Bereich vor, ohne dass es einen Bereich aller Bereiche – die Welt – geben kann, der zusätzlich zu allen anderen Existierenden auch noch existiert. So verstanden vertrete ich in diesem Buch einen meta-metaphysischen Nihilismus, das heißt die These, dass sich die Metaphysik buchstäblich mit gar nichts beschäftigt, dass es also weder einen Gegenstand noch einen Gegenstandsbereich gibt, auf den sich ihre unrestringierten Aussagen beziehen. … Das ist in vielem nicht weit von Kant entfernt, wobei er nicht so weit ging, die Existenz der Gegenstände der Metaphysik – die ‚Weltbegriffe‘: Gott, Welt, Seele – zu bestreiten, sondern sich darauf beschränkt zu bestreiten, dass wir solchen Begriffen entsprechende Gegenstände erkennen können. Die Metaphysik bezieht sich auf gar nichts, auch nicht indirekt oder sotto voce – auch nicht auf ‚das Ungegenständliche‘ oder ‚das Unaussprechliche‘. … Den meta-metaphysischen Nihilismus nenne ich auch die Keine-Welt-Anschauung, das heißt die Anschauung, dass es die Welt nicht gibt, dass sie nicht existiert.“9 Und diese zentrale These dient dann diesem Autor als Grundlage für den sensationellen und, man muss es wohl sagen, populistischen Titel eines seiner Bücher: Warum es die Welt nicht gibt.10 Es dürfte weniger Phänomene geben, die die heutige philosophische Lage so treffend charakterisieren, wie diese These und den Titel dieses Buches. Gabriels Behauptungen sind auf einem äußerst niedrigen philosophischen Niveau angesiedelt. Eine klare Distinktion zwischen Sein und Existenz ist nicht nur möglich, sondern unbedingt erforderlich. Wie schon ausgeführt, kann Existenz dann am besten als ein engerer Begriff als Sein verstanden werden: Existenz ist dann der Status einer bestimmten Art von Seienden, etwa der aktuell Seienden, in Kontradistinktion zu anderen Arten von Seienden, etwa abstrakten, idealen, möglichen und so weiter Seienden. Je nachdem, wie eng man die Terminologie festlegt, wäre es möglich, den Begriff der Existenz so zu gebrauchen, dass man sagen würde, dass nur die Elemente eines Bereichs Existenz haben, nicht aber der Bereich selbst und a fortiori nicht die Welt als die Totalität der Bereiche. Das ist es, was Gabriel tut. Aber ein solches Verfahren ist nur dann 8 Markus Gabriel, Sinn und Existenz. Eine realistische Ontologie, Frankfurt am M. 22017. 9 Ebd., S. 30 f. 10 Markus Gabriel, Warum es die Welt nicht gibt, Berlin 42018.
282
Lorenz B. Puntel
philosophisch sinnvoll und zulässig, wenn man damit den fundamentalen Fehler, den man bei Gabriel findet, nicht begeht. Das ist der Fehler, der darin besteht, dass man den Status der Bereiche und vor allem den Status der Totalität aller Bereiche völlig ignoriert, indem man nicht einmal die Frage danach stellt. Damit lässt man nicht nur den Zusammenhang zwischen den Elementen eines Bereichs, sondern auch den Gesamtzusammenhang zwischen allen Bereichen einfach ungefragt, unthematisiert stehen. Damit unterdrückt man fundamentale philosophische Fragen und Sachverhalte. Gabriels Position ist ein extremes Musterbeispiel dessen, was Heidegger die Seinsvergessenheit nannte. Gabriel übersieht einen absolut elementaren Sachverhalt, nämlich die Tatsache, dass der Zusammenhang der Elemente eines Bereichs und vor allem der Gesamtzusammenhang aller Bereiche nicht-Nichts, also seiend sind. Dieser Gesamtzusammenhang ist die Welt. Und er begeht den unverzeihlichen Fehler, den Ausdruck ‚es gibt‘ beziehungsweise ‚es gibt nicht‘ naiv als absolut synonym mit seinem absolut engen Begriff von Existenz zu verstehen und zu gebrauchen. Er ignoriert oder vergisst dabei vollständig die Seinsdimension: ‚Es gibt/ es gibt nicht‘ hat nämlich – auch und besonders – den Sinn von ‚es ist‘ beziehungsweise ‚es ist nicht‘. Gabriels Fehler ist umso gravierender, als er ihm im Titel eines Buches sozusagen eine überdimensionale Tragweite verleiht. Das ist Philosophie auf niedrigem, nämlich populistisch-sensationalistischem Niveau.
2.2.2 Aufweis der Seinsdimension Wenn man von der Geschichte der Philosophie absieht, indem man streng systematisch verfährt, so gibt es mehrere Möglichkeiten, die Seinsdimension zu erschließen.11 In aller Kürze sei hier nur ein streng systematisch orientierter Weg/ Ansatz dargelegt. Es ist der Weg/Ansatz, der auf den Begriff des Denkens oder des Geistes Bezug nimmt, wie dieser Begriff sich unmittelbar, das heißt bei der allerersten Betrachtung von Denken beziehungsweise Geist, zeigt. Man könnte diesen Ansatz dahingehend charakterisieren, dass man ihn als die Antwort auf eine Grundfrage versteht, die sich in philosophischer Hinsicht unmittelbar aufdrängt. Die Frage lautet: Was ist das Denken beziehungsweise der Geist? Eine philosophisch interessante, weil treffende Antwort darauf hat schon in der Antike Aristoteles in geradezu klassischer Weise gegeben, indem er die These aufstellte: ἡ ψυχὴ τὰ ὄντα πώς ἐστι πάντα – wörtliche Übersetzung: ‚Die Seele – der Geist – ist in gewisser Weise alle Seienden.‘12 In der lateinischen metaphysischen Tradition wurde daraus eine Art Axiom: ‚anima – 11 Vgl. dazu besonders SuG, Abschnitt 3.2.1. 12 Aristoteles, Περὶ ψυχῆς. De anima, Γ 431 b 21.
‚Wiederkehr und Zukunft der Metaphysik‘: welcher Metaphysik?
283
est – quodammodo omnia‘. Die ganze Tragweite dieser häufig angeführten These wurde aber in keiner Weise erfasst und noch weniger gewürdigt. Die Phrase ‚in gewisser Weise‘ kann man mit dem Begriff ‚intentional‘ deuten. Der Sinn der aristotelischen These könnte dann so wiedergegeben werden: ‚Der Geist ist intentional koextensiv mit der Gesamtheit der Seienden‘. Aristoteles spricht nur von ‚Seienden‘, nicht von ‚Sein‘. In dieser Hinsicht wäre die These des Aristoteles ein beredtes Zeugnis für die Richtigkeit der heideggerschen Interpretation und Kritik der Metaphysik, der zufolge diese nur das/die Seiende/n, nicht aber das Sein selbst bedacht hat. Aber man kann über Aristoteles hinausgehen und die Rede von ‚allen Seienden‘ oder von ‚der Totalität der Seienden‘ überwinden, indem man stattdessen vom Sein, und zwar vom Sein als solchem und im Ganzen spricht. Die intentionale Koextensivität des Geistes mit dem Sein als solchem und im Ganzen ist ein Grundkonstituens des menschlichen Geistes. Dieser Ansatz wird in der SSP schon durch die Formulierung der ‚Quasi‘-Definition der systematischen Philosophie artikuliert: Die SSP ist die Theorie der universalen Strukturen des uneingeschränkten universe of discourse. Wie schon gezeigt, ist die Seinsdimension nichts anderes als die präzise und adäquate Artikulation des uneingeschränkten universe of discourse. Dies lässt sich in aller Kürze so aufweisen: Das uneingeschränkte universe of discourse ist dadurch charakterisiert, dass es die allerletzte Dimension ist, die von jeder anderen Dimension – welcher Art auch immer: Begriffe, Sachen, Faktoren jeder Art … – , vorausgesetzt wird, die selbst aber keine ursprünglichere oder umfassendere Dimension voraussetzt. Auf die Frage, wie diese allerletzte, allerursprünglichste Dimension zu begreifen sei, gibt es eine absolut unbestreitbare Antwort: Diese allerletzte Dimension ist die Dimension des Seins. Warum? Weil ‚Sein‘ der einzige Begriff ist, der von allen anderen Begriffen – beziehungsweise Sachen beziehungsweise Faktoren welcher Art auch immer – vorausgesetzt wird, der aber selbst keinen anderen Begriff – oder Faktor jeder Art – voraussetzt. Diese Aussage ihrerseits lässt sich so begründen: Die minimalste, aber auch fundamentalste, ursprünglichste Bestimmung/Bestimmtheit von ‚Sein‘ lautet: ‚Sein‘ ist ‚nicht-Nichts‘. Das besagt, dass nur ‚Sein‘ grundsätzlich durch die Negation seiner eigenen Negation charakterisiert ist. Man mache die Probe aus Exempel. Man nehme einen anderen der ganz großen zentralen Begriffe der metaphysischen Tradition, etwa den ‚neu‘-platonischen oder plotinischen Begriff des Einen – τὸ ἕν –: Alles und jedes, welcher Art auch immer, ist in jedem Fall nicht-Nichts. Spricht man von dem Einen – τὸ ἕν – , vom Geist, vom Subjekt, von der Natur und so weiter und so fort, so setzt man unweigerlich immer schon voraus, dass es sich immer an erster Stelle um nicht-Nichts handelt. Aber diese Negation der radikalsten aller Negationen ist genau die elementarste, minimalste und fundamentalste ‚Definition‘ – wenn dieses Wort hier überhaupt sinnvoll ver-
284
Lorenz B. Puntel
wendet werden darf – von Seiendem – in einem relativen Sinne – beziehungsweise von Sein – in einem absoluten Sinne. Wollte jemand diese These bestreiten, so müsste er in der Lage sein, eine noch fundamentalere oder ursprünglichere Dimension zu nennen. Es ist nicht einzusehen, wie das möglich sein könnte.
2.2.3 Seiende/s, Seiendheit, Sein/sdimension Bis jetzt wurde fast ausschließlich die Distinktion von Sein und Seiendem/Seienden benutzt. Es handelt um die berühmte von Heidegger eingeführte ‚ontologische Differenz‘, eine Bezeichnung, die auf Heidegger selbst zurückgeht und die, wie schon oben vermerkt, sprachlich und begrifflich völlig inadäquat ist, da ‚ontologisch‘ nur die Sphäre der ὄ
![Von der Vernunft zum Wert: Die Grundlagen der ökonomischen Theorie von Karl Marx [1. Aufl.]
9783839428030](https://ebin.pub/img/200x200/von-der-vernunft-zum-wert-die-grundlagen-der-konomischen-theorie-von-karl-marx-1-aufl-9783839428030.jpg)

![Metaphysik der sittlichen Werte [[1. Aufl.].]](https://ebin.pub/img/200x200/metaphysik-der-sittlichen-werte-1-aufl.jpg)
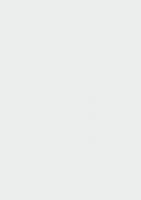
![Vernunft, Wissen, Glaube: Wege zu einem neuen Verständnis Immanuel Kants (Colloquium Metaphysicum) (German Edition) [1. Aufl. 2023]
3658406313, 9783658406318](https://ebin.pub/img/200x200/vernunft-wissen-glaube-wege-zu-einem-neuen-verstndnis-immanuel-kants-colloquium-metaphysicum-german-edition-1-aufl-2023-3658406313-9783658406318-b-1288884.jpg)
![Vernunft, Wissen, Glaube: Wege zu einem neuen Verständnis Immanuel Kants (Colloquium Metaphysicum) (German Edition) [1. Aufl. 2023]
3658406313, 9783658406318](https://ebin.pub/img/200x200/vernunft-wissen-glaube-wege-zu-einem-neuen-verstndnis-immanuel-kants-colloquium-metaphysicum-german-edition-1-aufl-2023-3658406313-9783658406318.jpg)
![Institution und Recht: Grazer Internationales Symposion zu Ehren von Ota Weinberger. Mit einem Vorwort von Werner Krawietz [1 ed.]
9783428477449, 9783428077441](https://ebin.pub/img/200x200/institution-und-recht-grazer-internationales-symposion-zu-ehren-von-ota-weinberger-mit-einem-vorwort-von-werner-krawietz-1nbsped-9783428477449-9783428077441.jpg)
![Die Europäische Union als Wertegemeinschaft: Forschungssymposium zu Ehren von Siegfried Magiera [1 ed.]
9783428541768, 9783428141760](https://ebin.pub/img/200x200/die-europische-union-als-wertegemeinschaft-forschungssymposium-zu-ehren-von-siegfried-magiera-1nbsped-9783428541768-9783428141760.jpg)
![Global Images: Eine Studie zur Praxis der Bilder. Mit einem Glossar zu Bildbegriffen [1. Aufl.]
9783839416877](https://ebin.pub/img/200x200/global-images-eine-studie-zur-praxis-der-bilder-mit-einem-glossar-zu-bildbegriffen-1-aufl-9783839416877.jpg)
