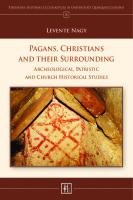Kirchengeschichtliche Studien: Alte Kirche, Russlanddeutsche und Oldenburg [1 ed.] 9783737016322, 9783847116325
141 64 10MB
German Pages [381] Year 2023
Recommend Papers
![Kirchengeschichtliche Studien: Alte Kirche, Russlanddeutsche und Oldenburg [1 ed.]
9783737016322, 9783847116325](https://ebin.pub/img/200x200/kirchengeschichtliche-studien-alte-kirche-russlanddeutsche-und-oldenburg-1nbsped-9783737016322-9783847116325.jpg)
- Author / Uploaded
- Ralph Hennings
File loading please wait...
Citation preview
Studien zur Kirchengeschichte Niedersachsens
Band 56
In Verbindung mit Ralph Hennings, Birgit Hoffmann, Inge Mager, Hans Otte und Mareike Rake herausgegeben von Thomas Kück
Ralph Hennings
Kirchengeschichtliche Studien: Alte Kirche, Russlanddeutsche und Oldenburg Mit einem Geleitwort von Bischof Thomas Adomeit Mit 17 Abbildungen
V&R unipress
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar. Gedruckt mit freundlicher Unterstützung der Gesellschaft für niedersächsische Kirchengeschichte, des Oldenburger Landesvereins und der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg. © 2023 Brill | V&R unipress, Robert-Bosch-Breite 10, D-37079 Göttingen, ein Imprint der Brill-Gruppe (Koninklijke Brill NV, Leiden, Niederlande; Brill USA Inc., Boston MA, USA; Brill Asia Pte Ltd, Singapore; Brill Deutschland GmbH, Paderborn, Deutschland; Brill Österreich GmbH, Wien, Österreich) Koninklijke Brill NV umfasst die Imprints Brill, Brill Nijhoff, Brill Schöningh, Brill Fink, Brill mentis, Brill Wageningen Academic, Vandenhoeck & Ruprecht, Böhlau und V&R unipress. Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages. Umschlagabbildung: © Ralph Hennings Vandenhoeck & Ruprecht Verlage | www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com ISSN 0938-5924 ISBN 978-3-7370-1632-2
Inhalt
Geleitwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Vorwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
Disputatio de origine animae (CPL 633,37), or the victory of creatianism in the fifth century . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43
Disputatio de origine animae (CPL 633,37) – Übersetzung . . . . . . . .
53
Hieronymus zum Bischofsamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73
Hieronymus zum Bischofsamt und seine Autorität in dieser Frage bei Luther, Melanchthon und Zwingli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87
Juden in zwei Osterpredigten Augustins . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107
Eusebius von Emesa und die Juden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125
„Wer selig werden will, muss glauben.“ Das athanasianische Glaubensbekenntnis – Geschichte und Bedeutung . . . . . . . . . . . . .
149
Carl Blum – Prediger der Rußlanddeutschen . . . . . . . . . . . . . . . .
175
Evangelische Pastoren und Lehrer in Russland während des 19. Jahrhunderts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
199
Die prägende Kraft der Predigtbücher für die Frömmigkeit der Russlanddeutschen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
223
6
Inhalt
Aus dem Tagebuch eines bekehrten russischen Rabbiners. Ein adversus-judaeos-Text aus der ev.-luth. Kirche in Rußland . . . . . .
243
Der Hl. Lambertus und die Lambertikirche in Oldenburg . . . . . . . . .
283
Die Lambertikirche als architektonisches Symbol . . . . . . . . . . . . .
307
Das Vestibül der Lambertikirche in Oldenburg. Rekonstruktion und Neukonzeption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
321
Theologie in der Ammergauischen Frülingslust . . . . . . . . . . . . . .
343
Die Reformationsjubiläen 1817 und 1917 in der Stadt Oldenburg . . . . .
353
Verzeichnis der Erstveröffentlichungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
379
Geleitwort
Der Bogen ist weit gespannt. Von der Alten Kirche des Hieronymus bis zur Frömmigkeit der Russlanddeutschen in der Gegenwart, von der Architektur der Lambertikirche in Oldenburg bis zur Theologie der Predigten in den Reformationsjubiläen von 1817 und 1917 gelingt es Ralph Hennings, Wissenschaft und Gemeindepraxis ins Gespräch zu bringen. Der vorliegenden Habilitationsschrift gingen viele Jahre pfarramtlicher Praxis sowie wissenschaftliche Forschung und Lehre voraus, stets verbunden mit einem kenntnisreichen Blick auf die Geschichte und Besonderheit der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg. Die Verzahnung von Wissenschaft, Forschung und Lehre mit gemeindlicher Praxis ist eine Kunst, die für alle Seiten einen großen Gewinn darstellt. Mit Freude und Dankbarkeit schaue ich auf die Veröffentlichung der vorliegenden Aufsätze und Forschungsbeiträge, die jede für sich einen Einblick in einen wichtigen Teil unseres kirchlichen Lebens und Glaubens eröffnen. Ralph Hennings ist in beiden Welten zuhause. Lebensnahe und lebendige Predigten, eine reflektierte und zugewandte Gemeindepraxis und wissenschaftliche Erkenntnisse und Diskussion werden gemeinsam durchdrungen und zueinander in Beziehung gesetzt – unabdingbar auf dem Weg zur zukünftigen Gestalt von Kirche. So bin ich guter Hoffnung, dass Predigt und Lehre, Forschung und Praxis, Wissenschaft und Glaubensalltag weiterhin so beziehungsreich gelebt und gepflegt werden, wie es die Beiträge dieser Schrift zum Ausdruck bringen. Der Bogen ist weit gespannt. Viel Freude und reiche Erkenntnisse im Lesen und Bedenken der hier vorliegenden Beiträge. Thomas Adomeit, Bischof
Vorwort
Die in diesem Band versammelten Texte sind im Lauf mehrerer Jahrzehnte entstanden. Im Jahre 2015 wurden sie der Universität Oldenburg für meine Habilitation im Fach Kirchengeschichte vorgelegt. Eine Veröffentlichung habe ich allerdings erst ins Auge gefasst, als ich von Thomas Kück dazu ermutigt wurde. Auf diese Weise ist der Band jetzt in den Studien zur Kirchengeschichte Niedersachsens erschienen. Literatur ist deshalb nur bis 2014 nachgetragen worden. Neue Ergebnisse der Forschung sind nicht berücksichtigt. Die benutzte Sekundärliteratur zu den einzelnen Texten ist jeweils am Ende angegeben. Die zitierten Quellen sind nur dann separat aufgeführt, wenn sie nicht den jeweils einschlägigen Quellenausgaben entnommen worden sind. In der folgenden Einleitung werden, nach einem allgemeinen Teil, Entstehung und Rezeption der einzelnen Texte ausführlicher beschrieben. Die vorliegende Veröffentlichung wurde jetzt ermöglicht durch Druckkostenzuschüsse des Oldenburger Landesvereins, der Gesellschaft für niedersächsische Kirchengeschichte und der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg. Zu danken habe ich darüber hinaus vor allem meiner Familie, die meine akademische Arbeit neben den Anforderungen des Pfarramtes immer unterstützt hat. Oldenburg, 15. Mai 2023
Einleitung
Wer ein Konvolut verschiedener Arbeiten zur Kirchengeschichte vorlegt, muss die Frage nach dem Bezugsrahmen beantworten, in dem diese Arbeiten entstanden sind und in dem sie durch Gegenstand, Fachwissenschaft und Zeitumstände stehen. Das könnte ich mit Schleiermachers augenzwinkernder Bemerkung tun: Die kirchengeschichtlichen Arbeiten eines jeden müssen teils aus seiner Neigung hervorgehen, teils durch die Gelegenheiten bestimmt werden, die sich ihm darbieten. Ein lebhaftes theologisches Interesse wird die erste den letzten zuwenden, oder für erstere auch die letztere herbeizuschaffen wissen1.
Die Frage reicht aber weiter. Sie fragt nach der konzeptionellen Einbettung der eigenen Arbeit. Da ich keine speziellen Arbeiten zur Geschichtstheorie vorlege, sondern Arbeiten, die Quellen unterschiedlicher Epochen und Provenienzen untersuchen, stellt sich die Frage nach der theoretischen Einbettung noch drängender: „Gibt es ein bestimmtes methodisches Konzept, das der Autor verwendet?“ Der Leser wird enttäuscht werden. Es gibt für meine Arbeiten nicht ein methodisches Konzept, sondern mehrere Arten, wie ich den Quellen begegne. Ich versuche sie unter verschiedenen Gesichtspunkten zu befragen und zum „Sprechen“ zu bringen. Die Wahl der jeweiligen Methodik verdankt sich den Eigenarten der Quellen und meiner Offenheit für verschiedene methodische Konzepte der Geschichtswissenschaft. Da das Konstatieren eines Theoriedefizits im historischen Meta-Diskurs inzwischen zu einem Topos2 geworden und für die Kirchengeschichte sogar zur
1 Friedrich Schleiermacher, Kurze Darstellung des theologischen Studiums zum Behuf einleitender Vorlesungen, 2. Aufl 1830, §194, in: Ders., Kritische Gesamtausgabe I. Abt. Bd. 6, Berlin 1998, 393,8–12. 2 Auf das topische dieser Kritik hat hingewiesen, Jakob Hort, Vergleichen, Verflechten, Verwirren. Vom Nutzen und Nachteil der Methodendiskussion in der wissenschaftlichen Praxis: ein Erfahrungsbericht, in: Agnes Arndt / Joachim C. Häberlen / Christiane Reinecke (Hg.), Vergleichen, Verflechten, Verwirren? Europäische Geschichtsschreibung zwischen Theorie und Praxis, Göttingen 2011, 319–341.
12
Einleitung
lexikalischen Gewissheit geronnen ist3, halte ich es für sinnvoll mit einigen Bemerkungen zur Theorie der Kirchengeschichte und ihrem derzeitigen Stand als Wissenschaft im Dreieck von Geschichtswissenschaft, Theologie und Kirche zu beginnen und erst danach einen Durchgang durch die vorgelegten Arbeiten folgen zu lassen. In der Vorstellung der einzelnen Arbeiten beschreibe ich ihre Fragestellungen, Gegenstände und die Aufnahme, die sie im Fachdiskurs gefunden haben.
Grundlegendes zur kirchengeschichtlichen Arbeit Bedingt durch Kürzungen an den Universitäten und durch einen scheinbaren Bedeutungsverlust der Theologie in der Folge des Bedeutungsverlustes der Kirchen, hat es um die Kirchengeschichte als akademisches Fach in den vergangenen Jahren in Deutschland eine intensive Debatte gegeben. Die grundlegenden Fragen in diesen Debatten sind allerdings nicht neu, sie haben sich bereits in der Aufklärungszeit, im Historismus, sowie in der Krise des Historismus herausgebildet. Es geht im Kern um die grundsätzliche Frage, ob Kirchengeschichte als eine historia sacra eine eigene Form der Geschichtswissenschaft darstellt4. Diese Frage wird im Protestantismus seit der Aufklärung klar mit „Nein“ beantwortet. Nach diesem kategorischen „Nein“ bleibt die Frage, ob es ein mit historischen Methoden feststellbares Handeln Gottes in der Geschichte gibt, das zu Erkennen die spezielle Aufgabe der Kirchengeschichte sei. Auch diese Frage ist letztlich zu verneinen, sie führt aber mitten hinein in die Bestimmung der Kirchengeschichte als akademischem Fach im Bezugsrahmen der drei schon genannten Größen Geschichtswissenschaft, Theologie und Kirche.
3 Vgl. Christoph Markschies, Kirchengeschichte / Kirchengeschichtsschreibung, in: RGG4 4 (2001) 1169–1179, hier 1177. 4 Vgl. den historischen Überblick über die Entwicklung der Kirchengeschichtsschreibung, den Markschies gibt (Anm. 3), 1170–1177. Die Loslösung der Geschichtswissenschaft von einem christlichen Geschichtsbild, die mit der Renaissance und der Reformation begann und sich in der Aufklärung durchsetzte, beschreiben Georg G. Iggers / Q. Edward Wang / Supriya Mukherjee, Geschichstkulturen. Weltgeschichte der Historiografie von 1750 bis heute, Göttingen 2013, 36–40.
Einleitung
13
Kirchengeschichte in Bezug zur allgemeinen Geschichtswissenschaft Dahinter steckt die oben gestellte Frage, ob die Kirchengeschichte – im Rahmen eines wie auch immer gearteten theologischen Konzepts – einen spezifischen, privilegierten Zugang zur Geschichte hat5. Wenn sie den nicht hat, kann, muss oder sollte sie dann überhaupt von der allgemeinen Geschichte unterschieden werden? Geht sie dann nicht in einer allgemeinen Religionsgeschichte oder einer modernen, Religion mit einbeziehenden Kulturgeschichte auf ? Oder gibt es einen Mittelweg, in dem wenigstens das Christentum (verstanden als Summe aller historisch fassbaren Erscheinungen des Christlichen und der Reaktionen darauf) als Spezialgebiet für die Kirchengeschichte reserviert bleibt, die dann folgerichtig aber auch als „Christentumsgeschichte“ bezeichnet werden sollte6? Mein akademischer Lehrer A. Martin Ritter resümierte demgegenüber skeptisch: Eine Trennung von Kirchen- und Profangeschichte [ist] unmöglich […] Der Prozeß historischer Erkenntnis kann nicht durch die Rede von „Gottes Geschichtshandeln“ abgekürzt werden. Vielmehr sind alle zu Gebote stehenden Methoden kritischer Geschichtswissenschaft, die in den letzten Jahrzehnten in einem interdisziplinären Dialog […] entwickelt [wurden], einzusetzen7.
Daraus ergibt sich für die Kirchengeschichte notwendigerweise eine Methodenvielfalt, die dem jeweiligen Stand der allgemeinen Geschichtswissenschaft entspricht. In der derzeitigen Situation der Geschichtswissenschaft führt das zu multiperspektivischen Ansätzen, die mit ihrer Variabilität der Tatsache Ausdruck geben, das Geschichte selbst nichts abgeschlossenes und starres ist, sondern etwas, das stets neu vergegenwärtigt werden kann, je nach dem welcher Zugang gewählt wird8. Eine allgemeingültige, abschließende Geschichtserzählung wird es nicht geben. Georg G. Iggers hat das mit dem Bild des „Dialoges“ beschrieben:
5 Vgl. Christoph Markschies, der einen eigenständigen Beitrag der Theologie zur allgemeinen Diskussion um Geschichte und Geschichtsdeutung fordert, lehnt aber „eine kirchengeschichtliche Sonderhermeneutik oder eine eigenständige Methodik der Kirchengeschichte“ ab. Markschies (Anm. 3), 1179. 6 Zu diesem an Trutz Rendtorff anknüpfenden Konzept vgl. Klaus Tanner (Hg.), Christentumstheorie. Geschichtsschreibung und Kulturdeutung, Trutz Rendtorff zum 24. 01. 2006 (Theologie, Kultur, Hermeneutik 9), Leipzig 2008. 7 A. Martin Ritter, Ist Dogmengeschichte Geschichte der Schriftauslegung? In: Stimuli. Exegese und ihre Hermeneutik in Antike und Christentum. Festschrift für Ernst Dassmann, hg. v. Georg Schöllgen, (JBAC.E 23), Münster 1996, 1–17, hier 3. Zu einem ähnlichen Schluss kommt Kurt Nowak, Wie theologisch ist die Kirchengeschichte? Über die Verbindung und die Differenz von Kirchengeschichtsschreibung und Theologie, in: ThLZ 122 (1997), 3–12, hier 11: „Die Kirchengeschichtsschreibung […] bewegt sich theologisch und geschichtstheoretisch auf einer Grenze, während sie methodisch ganz und gar zur Geschichtswissenschaft gehört“. 8 Vgl. Beverley Southgate, Postmodernism in History. Fear or Freedom?, London 2003, 164: „Such experimental multi-perspectival approaches enable historians, at least to some extent, to
14
Einleitung
Das Ziel der wissenschaftlichen Beschäftigung mit der Geschichte ist die Annäherung, wie partiell sie auch sein mag, an eine Vergangenheit, wie wirkliche Menschen sie erfahren und gemacht haben. Die Erforschung der Geschichte erscheint uns daher als ein fortdauernder Dialog9.
Zu diesem Dialog der Geschichtswissenschaft mit der Vergangenheit gehört die Dimension des Religiösen, des Christlichen und der Kirche unabdingbar dazu. Hier liegt das Fachgebiet der Kirchengeschichte.
Kirchengeschichte in Bezug zu den anderen Teildisziplinen der wissenschaftlichen Theologie Kirchengeschichte wird an den Universitäten Deutschland als Teilfach der konfessionellen Theologie gelehrt. Da Kirchenhistorikerinnen und Kirchenhistoriker aber nicht nur die Geschichte der Institution Kirche, oder der Ausprägungen des Christentums bearbeiten, sondern auch die Inhalte der jeweiligen Lehre zu verstehen suchen, überschneidet sich in der Dogmen-10 und Theologiegeschichte11 das Arbeitsfeld der Systematiker und der Kirchenhistoriker. Die Spannungen zwischen beiden entstehen an der Frage, wie die Quellen zu lesen sind. Wenn der Dialog zwischen diesen beiden theologischen Teildisziplinen gelingt, kann die Kirchengeschichte „in der verwickelten Wirkungsgeschichte mit den notwendigen Verschiebungen der Verstehenshorizonte […] mit ihrem historisch-kritischen, aber auch philologischen [Methoden-] Inventar zum theologisch relevanten Korrektiv systematischer Überlegungen“ werden12. Allein die Anwendung ihres historischen
9 10
11 12
show that he past is not something fixed, finally caught and preserved and presented in some divine equivalent of aspic“. Georg G. Iggers, Geschichtswissenschaft im 20. Jahrhundert. Ein kritischer Überblick im internationalen Zusammenhang, Göttingen 2007, hier 119. Eine aktuelle Ortsbestimmung der Dogmengeschichte in der Theologie nimmt Wolfram Kinzig vor. Wolfram Kinzig, Brauchen wir eine Dogmengeschichte als theologische Disziplin? in: Wolfram Kinzig / Volker Leppin / Günther Wartenberg (Hg.), Historiographie und Theologie. Kirchen- und Theologiegeschichte im Spannungsfeld von geschichtswissenschaftlicher Methode und theologischem Anspruch (Arbeiten zur Kirchen- und Theologiegeschichte 15), Leipzig 2004, 181–202. Zur Rolle der Theologiegeschichte in der Theologie vgl. Friederike Nüssel. Theologiegeschichte. Die geschichtliche Realisierung des Themas der Theologie, in: Kinzig u. a., Historiographie und Theologie (Anm. 10), 203–221. Thomas Böhm, Zwischen Skylla und Charybdis: Phänomenologische Skizzen zur Kirchengeschichte, in: Bernd Jaspert (Hg.), Kirchengeschichte als Wissenschaft, Münster 2013, 32–41, hier 37.
Einleitung
15
Methodeninventars enthebt die Kirchengeschichte allerdings nicht der Notwendigkeit selbst theologische Urteile zu fällen13.
Kirchengeschichte in Bezug zur Kirche Hier steht die Kirchengeschichte in einem anderen Verhältnis zu ihrem Gegenstand als die allgemeine Geschichtswissenschaft, weil sie selbst ein Teil ihres eigenen Gegenstands ist, denn sie ist ein Teil der Kirche. Das Verhältnis des Kirchenhistorikers zur Kirche ist nicht einfach eine Objekt-Subjekt-Beziehung, sondern ein dialektisches Ineinander beider Perspektiven. Martin Wallraff fasst diesen Problemkreis folgendermaßen: Der Kirchenhistoriker interagiert daher mit den Institutionen des Christentums (Institutionen hier wiederum in einem weit gefassten Sinn) derart, dass eine schlichte Unterteilung in Binnen- und Außenperspektive nicht angemessen scheint. Die „Kirche“ in „Kirchengeschichte“ ist Objekt und Subjekt zugleich. Wer das Fach treibt, hat – ob er will oder nicht – auch Teil an einer kirchlichen Selbstvergewisserung im Medium der Geschichte14.
Inwieweit die eigene kirchliche Verwurzelung der Kirchenhistorikerinnen und Kirchenhistoriker ihre Arbeit prägt ist, ist also stets kritisch zu hinterfragen. Aufgabe der Kirchengeschichte ist es in diesem Bezugsfeld, die Geschichte der Kirche kritisch zu prüfen und der Kirche daraufhin von ihrer eigenen Geschichte zu erzählen. Ob die Kirche die – vielleicht auch unbequemen – Erzählungen der Kirchenhistoriker übernimmt oder nicht, ist ein Rezeptionsgeschehen, das seinen eigenen Regeln gehorcht15. Als jüngeres Beispiel dafür kann der Streit um das Positionspapier der EKD zum Reformationsjubiläum 2017 „Rechtfertigung und Freiheit“16 dienen, das zwar unter Führung des Kirchenhistorikers Christoph Markschies geschrieben wurde, aber nach Auffassung seiner Kritiker zu wenig Einsichten der Reformationsgeschichte aufnimmt. Nach ihrer Auffassung erzählt die EKD eine unkritische und veraltete Version einer zentralen Epoche ihrer 13 Vgl. Ritter (Anm. 7), 3: „Zu einer theologischen Disziplin wird Kirchengeschichte nicht durch Ausgrenzung eines speziellen Gegenstandsbereiches, auch nicht durch eine spezielle Methodik, sondern allein durch das kritische theologische Urteil“. 14 Martin Wallraff, Kirchengeschichte im Spannungsfeld von Theologie und Kulturwissenschaft, in: VuF 54 (2009), S. 55–64, hier: 62. 15 Zu den verschiedenen Versuchen in der Nachkriegszeit die Position der Kirchengeschichte in der Theologie und ihre Beziehung zur Kirche zu verändern, vgl. Klaus Fitschen, „Kirchengeschichtsschreibung muß um das Wesen der Kirche wissen“. Selbstbesinnung und Selbstbegrenzung des Faches Kirchengeschichte nach 1945, in: Mitteilungen zur kirchlichen Zeitgeschichte 1/2007, 27–46. 16 Rechtfertigung und Freiheit. 500 Jahre Reformation 2017. Ein Grundlagentext des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Gütersloh 2014.
16
Einleitung
eigenen Geschichte. Dieses Vorgehen bezeichnen die beiden Historiker, die als Hauptkritiker hervorgetreten sind (Thomas Kaufmann, Professor für Kirchengeschichte in Göttingen und Heinz Schilling, em. Professor für Geschichte in Berlin) als „dogmatisch“17. In dieser Auseinandersetzung tritt ein Konflikt zu Tage, den Ulrich Körtner als fortwährende Aufgabe der Kirchengeschichtsschreibung beschrieben hat: Es „ist zwischen Kirchengeschichte als Erzählung der Kirche und Kirchengeschichte als kritischer Überprüfung derselben zu unterscheiden“18. Die vorliegenden Arbeiten überprüfen als wissenschaftliche Arbeiten kritisch die Geschichte der Kirche. Sie arbeiten dabei mit dem aktuellen Methodenrepertoire der Geschichtswissenschaft. Als kirchenhistorische Arbeiten kommen sie dabei manches Mal auch zu theologischen Urteilen. Im Moment ihrer Veröffentlichung gehen sie aber wiederum ein in die Erzählung von Kirchengeschichte als Erzählung der Kirche. Sie haben den Anspruch die Erzählung der Kirche zu verändern, Akzente zu verschieben und zu korrigieren. Das vermögen sie nur auf Grund ihrer methodisch reflektierten Arbeit an den Quellen19. Dabei sind historische Tatsachen oder Quellen zunächst einmal stumm, sie zum Sprechen zu bringen ist die Kunst der Historiker20, die sie zum einen in ihren Kontext einordnen und in diesem würdigen, zum anderen aber eine – zumindest perspektivisch – bis in die Gegenwart reichende Bedeutung des so Gewürdigten aufzeigen können. Dabei muss stets die historische Bedingtheit des eigenen Urteils bewusst sein. Die eigenen Fragestellungen an die Quellen werden nicht verleugnet, sondern offengelegt. Denn für die historische Erkenntnis gilt „man sieht etwas nur, und zwar ‚richtig‘, weil man es von einem Gesichtspunkt aus
17 In der Zeitung die „Welt“ vom 24. 5. 2014, http://www.welt.de/debatte/ kommentare/article 128354577/Die-EKD-hat-ein-ideologisches-Luther-Bild.html, abgerufen am 27. 8. 2014. 18 Ulrich H. J. Körtner, Historische und narrative Theologie. Zur theologischen Funktion der Kirchengeschichte, in: Reinhold Mokrosch, Helmut Merkel (Hg.) Humanismus und Reformation. Historische, theologische und pädagogische Beiträge zu deren Wechselwirkung (Arbeiten zur historischen und systematischen Theologie 3), Münster 2001, 185–200, hier: 195. 19 Gerade weil die Kirchengeschichte als wissenschaftliche Disziplin zur Theologie gehört, die stets unter Ideologieverdacht steht, ist es wichtig auf die Mahnung von Jakob Hort zu hören, der – ohne Bezug zur Kirchengeschichte – darauf hinweist, dass die Arbeit an den Quellen jeglicher Theoriebildung vorausgehen muss: Hort (Anm. 2), 321: „Wenn aber die praktische Forschung, das heißt die Arbeit an den Quellen, nicht mehr der Theoriebildung vorangeht, sondern die Anlage einer Arbeit und die Auswahl der Quellen an den Vorgaben eines theoretischen Konzepts oder an den dem Innovationspotential eines Arguments ausgerichtet wird, ist eine Verzerrung von Forschungsergebnissen vorprogrammiert“. 20 Vgl. Ulrich H. J. Körtner, Offene Fragen einer Geschichtstheorie, in: Ders. (Hg.), Geschichte und Vergangenheit. Rekonstruktion – Deutung – Fiktion, Neukirchen-Vluyn 2007, 1–12, hier 2: „Die vergangene Wirklichkeit erschließt sich nur im Wechselspiel zwischen Rekonstruktion und Interpretation“.
Einleitung
17
sieht“21. Die Kardinalfrage, die sich deshalb stellt ist die Frage: „Welche Perspektive lässt was sehen?“ Die Wahl der Perspektive, mit der auf die Quellen und ihre Kontexte geschaut wird, bestimmt das Ergebnis der historischen Forschung.
Interessen und Arbeitsweisen Bis auf eine Ausnahme sind alle hier vorgelegten Arbeiten reine Quellenstudien. Die Art der Quellen ist unterschiedlich, zum größten Teil sind es aber Texte unterschiedlicher Arten. Der Zeitraum der behandelten Quellen erstreckt sich von der Spätantike bis ins 20. Jahrhundert. In drei großen Bereichen habe ich historische Studien publiziert: in der Patristik, in der Migrationsgeschichte am Beispiel der Russlanddeutschen und in der Regional- und Lokalgeschichte.
Patristik Die Patristik ist der Bereich der Kirchengeschichte, der meine akademische Heimat ist22. Durch die Arbeit an der Geschichte der christlichen Spätantike bilden Patristiker notwendigerweise eine besondere Sensibilität Texten gegenüber aus, damit sind sie für Fragen offen, die der „linguistic turn“ ins allgemeine Bewusstsein der Geschichtswissenschaft gehoben hat. Da patristische Texte zumeist konstruierte Wirklichkeiten widerspiegeln, ist es in diesem Bereich der historischen Forschung immer notwendig, die Texte sehr sorgsam zu analysieren. Wie wird „Wirklichkeit“ repräsentiert, welche Lücken gibt es, worüber wird geschwiegen, wie werden die „Anderen“23 gezeichnet? All das sind Fragen der modernen Geschichtsschreibung, die in der Patristik schon früh gestellt wurden, weil die Quellen fast ausschließlich von solcher Art sind, dass sie ein ganz bestimmtes Bild ihrer Zeit und ihrer Wahrnehmung der Wirklichkeit zeigen wollen.
21 Ingolf U. Dalferth (Hg.), Wahrheit in Perspektiven. Probleme einer offenen Konstellation (Religion in philosophy and theology 14), Tübingen 2004, 11. 22 Vgl. meine Dissertation: Ralph Hennings, Der Briefwechsel zwischen Augustinus und Hieronymus und ihr Streit um den Kanon des Alten Testaments und die Auslegung von Gal. 2,11–14 (SVigChr 21), Leiden 1994. 23 Mein Blick auf die „Anderen“ ist vom deutschen Nachkriegsdiskurs über das Verhältnis zu den Juden geprägt. Zu den Juden als den exemplarischen „Anderen“ in der deutschen Geschichte bis zur Gegenwart vgl. Andrea Heuser, Vom Anderen zum Gegenüber. „Jüdischkeit“ in der deutschen Gegenwartsliteratur (Jüdische Moderne 11), Köln u. a. 2011. Zur Kategorie des „Anderen“ im Allgemeinen vgl. Thomas Bedorf, Andere. Eine Einführung in die Sozialphilosophie (Sozialphilosophische Studien 3), Bielefeld 2011.
18
Einleitung
Eine kritische Hermeneutik ist deshalb immer unumgänglich24. In allen meinen patristischen Arbeiten wird das deutlich. Der Dialogus de origine animae wird auf seine Funktion als dogmengeschichtlicher Lückenfüller hin untersucht, die kritischen Bemerkungen es Hieronymus zum Bischofsamt werden auf ihre Wirkungsgeschichte hin befragt und die Arbeiten zu den Predigten Augustins und des Eusebius von Emesa fragen nach dem Bild des „Anderen“, nach dem Bild, das die beiden ihren Gemeinden von den Juden vermitteln.
Eine besondere Migrationsgeschichte: Russlanddeutsche Die Notwendigkeit zur Beschäftigung mit der Geschichte der Russlanddeutschen ergab sich für mich als Gemeindepfarrer in Bösel, als Aussiedlerbeauftragter der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg und Mitglied der Konferenz Aussiedlerseelsorge in der EKD von 1993 bis 2003. Das Schicksal der Russlanddeutschen ist ein Teil der deutschen und der europäischen Migrationsgeschichte25. Zu dem Zeitpunkt, an dem Russlanddeutsche als „Spätaussiedler“ in die Bundesrepublik Deutschland kamen, gab es kaum kritische wissenschaftliche Arbeiten zur Geschichte und noch weniger zur religiösen Prägung der Russlanddeutschen. Meine, hier noch einmal zusammengestellten Arbeiten, sind inaugurale Forschungen in einem Forschungsgebiet, in dem die Quellenlage dünn und schwierig ist. Deshalb gibt es mehr sozialwissenschaftliche, bzw. praktisch-theologische als historische Studien in diesem Feld26. Ohne eine historische Einordnung blieben sozialwissenschaftliche Untersuchungen ohne geschichtliches „Fundament“. Sie konnten Befunde durch Befragungen erheben, aber die historischen Zusammenhänge, die hinter einzelnen Aussagen im Interview standen nicht erhellen. Für Methoden
24 Vgl. Elizabeth A. Clark, History, Theory, Text. Historians and the linguistic turn, Cambridge (Mass.) 2004, 169: „As a species of intellectual historian, scholars of late ancient Christianity occupy an advantageous position when considerations of theory are at issue. Given the rhetorical and ideological nature of their materials, these scholars may safely assume that their text lie in a largely unknown and dubious relation to the ‚reality‘ of the ancient Church, and should often be approached with a hermeneutic of suspicion and by reading against the grain“. 25 Vgl. Jochen Oltmer, Migration im 19. und 20. Jahrhundert (Enzyklopädie deutscher Geschichte 86), 2. Aufl. München 2013, Günter Kühn, Menschen in der Migration zwischen vertrauter und fremder Tradition. Unter besonderer Berücksichtigung der Situation in der Bundesrepublik Deutschland, Bielefeld 2013 und das Nachschlagewerk von Klaus Bade (Hg.): Enzyklopädie Migration in Europa. Vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart, 3. Aufl. Paderborn u. a. 2010. 26 Vgl. Christian Eyselein, Rußlanddeutsche Aussiedler verstehen. Praktisch-theologische Zugänge, Leipzig 2006 oder Stefanie Theis, Religiosität von Russlanddeutschen (Praktische Theologie heute 73), Stuttgart 2006.
Einleitung
19
der „oral history“27 eignen sich die Aussagen von Aussiedlern auch nur bedingt, denn Aussiedlerinnen und Aussiedler konnten oft ihre eigene Geschichte nicht erzählen28, zum einen verhinderte das die Opferscham, die sie von schlimmen Erfahrungen, Demütigungen, Lagerhaft und Folter schweigen ließ, zum anderen waren es aber auch die Ab- und Umbrüche in die die Zeitläufte diese Menschen gestürzt haben. All das hat die Kontinuitäten des Lebens der russlanddeutschen Familien zerstört, ihre Erzählzusammenhänge zerrissen und das Archivmaterial großflächig zerstört. Das hat die historische Arbeit besonders schwierig, aber auch besonders nötig und auch besonders reizvoll gemacht.
Regional- und Lokalgeschichte: Oldenburg Durch meinen Stellenwechsel an die St. Lamberti-Kirche, die Hauptkirche der Stadt und des Landes Oldenburg, sah ich mich unversehens mit zahlreichen Fragen zur Geschichte und zur Interpretation des Gebäudes konfrontiert. Viele Fragen waren trotz der prominenten Stellung der St. Lamberti- Kirche nicht, oder nur ungenügend bearbeitet worden. Auf diese Weise habe ich mich mit einer frühmittelalterlichen Quelle, der vita vetustissima des Lambertus auseinandergesetzt, eine Neu-Interpretation des Kirchengebäudes vorgelegt und Rechenschaft über die auf historischen Erkenntnissen fußende Neukonzeption der ehemaligen Eingangshalle abgelegt. Mein Interesse an der frühen Neuzeit kommt in der kleinen Studie über eine bibliophile Kostbarkeit des Oldenburger Landes zum Ausdruck, der „Ammergauischen Frülingslust“. Ich konnte zeigen, dass dies unter dem Gesichtspunkt der historischen Gartenkultur wieder veröffentliche Buch einen theologischmoralisierenden Hintergrund hat, der an der Grenze zum Frühpietismus steht, aber noch der altlutherischen Orthodoxie zugehört. Das herannahende 500jährige Reformationsjubiläum hat mich dazu veranlasst, nach den vorausgehenden Hundertjahrfeiern der Reformation in Oldenburg zu fragen. Die Quellenlage ist besonders spannend, weil sich alle Jubiläumspredigten von 1817 und 1917 erhalten haben und damit einen Einblick in die jeweilige kirchliche Situation eines gesamten Reichsterritoriums geben. Hier sind, über die vorliegende Arbeit zur Stadt Oldenburg hinaus, noch Schätze zu heben.
27 Vgl. Donald A. Ritchie (Hg.), The Oxford handbook of oral history, Oxford u. a. 2012. 28 Vgl. dazu jetzt die auf biographischen Interviews basierende Untersuchung von Gabriele Rosenthal / Viola Stephan / Niklas Radenbach, Brüchige Zugehörigkeiten. Wie sich Familien von „Russlanddeutschen“ ihre Geschichte erzählen, Frankfurt am Main u. a. 2011.
20
Einleitung
Kirchengeschichte neu erzählen Alle hier vorliegenden Arbeiten verdanken sich intensiver Arbeit an den Quellen bis hin zu ihrer Übersetzung und Kommentierung. Im Ergebnis erzählen sie Kirchengeschichte29. Mein Begriff von Kirche ist dabei nicht konfessionell festgelegt. Kirche liegt immer nur in konkurrierenden konfessionellen und theologischen Konzepten vor. Das ist eine Grundvoraussetzung kritischer Kirchengeschichtsschreibung30. In meinen Arbeiten wird das verschiedentlich deutlich. So unterscheiden sich zum Beispiel die Kirchenbegriffe des spätantiken Bischofs Eusebius von Emesa, des karolingischen Bischofs Lambertus, des Oldenburger Hofhistoriographen Johann Justus Winkelmann und der russlanddeutschen Pastoren erheblich. Sie nehmen aber alle für sich in Anspruch ein Teil der Kirche zu sein, sie alle rekurrieren auf das biblische Zeugnis und auf ein ihnen jeweils eigentümliches Verständnis des Christlichen. Der von Albrecht Beutel geprägte Begriff der „Inanspruchnahme des Christlichen“31 ist für diese Form der kirchengeschichtlichen Arbeit hilfreich, weil er ermöglicht „auch das Andere als Lebensgestalt einer authentischen Inanspruchnahme des Christlichen wahrzunehmen und anzuerkennen“32. So weitet die historische Arbeit die eigene Perspektive. Bei Weitem nicht alles in der Kirchengeschichte läuft auf die eigene Position zu. Vieles Erforschte steht sogar im Widerspruch zur eigenen Glaubensund Denktradition und ist dennoch eindeutig christlich und dennoch eindeutig ein Teil der Kirche und ihrer Geschichte. Erst diese Weite des Kirchenbegriffs als Grundlage der kirchenhistorischen Arbeit ermöglicht es, der Kirche relevante Geschichten über sich selbst erzählen. Denn was ist langweiliger als eine Geschichtsschreibung, die nur die eigene Position erklärt, verklärt oder gar zur einzig möglichen erhebt? Zur Verantwortung der Historiker gehört auch noch die weitergehende Frage: Für was werden meine Arbeitsergebnisse gebraucht werden? Welche Auswirkungen haben sie auf die Kirche oder auf die Wahrnehmung von Kirche33? Spätestens hier wird die Arbeit der Historiker politisch, wenn sie es 29 Zum Begriff des „Erzählens“ im Kontext der modernen Narratologie vgl. Jörg Schönert, Zum Status und zur disziplinären Reichweite von Narratologie, in: Vittoria Borsò / Christoph Kann (Hg.), Geschichtsdarstellung. Medien – Methoden – Strategien (Europäische Geschichtsdarstellungen 6), Köln u. a. 2004, 131–143. 30 Vgl. Albrecht Beutel, Vom Nutzen und Nachteil der Kirchengeschichte, Begriff und Funktion einer theologischen Kerndisziplin: Zeitschrift für Theologie und Kirche 94 (1997), 84–110, hier 86–89. 31 Beutel, Vom Nutzen und Nachteil (Anm. 30), 88: „Es scheint ratsam, Kirchengeschichte als die Geschichte der Inanspruchnahme des Christlichen zu verstehen“ (Hervorhebung im Original). 32 Beutel, Vom Nutzen und Nachteil (Anm. 30), 101. 33 Beutel, Vom Nutzen und Nachteil (Anm. 30), 100: „Der kritische Charakter der Kirchengeschichte hat sich nicht nur gegenüber ihrem Gegenstand zu bewähren – das allein wäre trivial –, sondern ebenso gegenüber dem Gebrauch, der jeweils davon gemacht wird“.
Einleitung
21
nicht schon vorher ist. Ist die Kirchengeschichtsschreibung dazu da, die Sieger eines historischen Prozesses zu feiern oder ist sie nicht mindestens ebenso dazu da, die Erinnerung an die Opfer historischer Prozesse aufrechtzuerhalten34, selbst wenn es kirchliche Akteure waren, die dafür gesorgt haben, dass es Opfer gab, zum Beispiel dadurch, dass sie die Anderen zu Ketzern erklärten?
Die Geschichte der „Anderen“ in den Blick nehmen In meinen Arbeiten spielt eines der großen Themen der deutschen Nachkriegstheologie, die Frage nach dem Verhältnis von Juden und Christen, eine wichtige Rolle. Besonders die Frage nach Nähe und Distanz zwischen Juden und Christen hat mich durchgängig interessiert. So sind die vorliegenden Arbeiten zu Eusebius von Emesa, zu Augustins Osterpredigten, aber auch die Untersuchung des Bekehrungsberichtes von Rudolf Gurland, der unter dem Titel „Aus dem Tagebuch eines bekehrten russischen Rabbiners“ veröffentlicht wurde, entstanden. Sie zeigen allesamt, dass eine gute Kenntnis des Judentums nicht unbedingt zu einem guten Miteinander von Juden und Christen führen muss. Kenntnisse der jüdischen Bibelauslegung werden von Christen gerne auch als Argument gegen Juden und gegen ihren Anspruch auf einen eigenen Weg zum Heil verwendet. Aus dem Interesse heraus, der Kirche in der Bundesrepublik die Geschichte der Frömmigkeit einer Gruppe von „Anderen“ – der Russlanddeutschen – zu erzählen, sind die Arbeiten zu Carl Blum, zum Verhältnis der Pastoren und Lehrer in Russland und die Studie zum Einfluss der Predigtbücher auf die Frömmigkeit der Russlanddeutschen entstanden. Sie bilden einen inhaltlichen Zusammenhang, der aufzeigt, unter welchen historischen, sozialen und räumlichen Bedingungen die Frömmigkeit der evangelischen Deutschen in Russland geprägt wurde. Als sie als Aussiedler in die Bundesrepublik zurückkehrten, fiel nicht nur ihre Kleidung und ihre Sprache auf, sondern auch die andere Frömmigkeit, die sie mitbrachten. Diese Frömmigkeit verstehbar zu machen, indem ich die historische Entwicklung und die Prägung durch bestimmte Theologen nachzeichne, ist ein Versuch zum gegenseitigem Verständnis beizutragen.
34 Johann Baptist Metz hat die Forderung erhoben, Kirchengeschichte prinzipiell als „memoria passionis“ zu betreiben. Das ist so einfach nicht einlösbar, weil damit andere wesentliche Faktoren der geschichtlichen Entwicklungen ausgeblendet werden. Aber es ist ein wichtiger korrigierender Impuls, der unbedingt bleibendes Gehör in der Kirchengeschichtsschreibung finden muss. Vgl. Johann Baptist Metz, Zukunft aus dem Gedächtnis des Leidens, in: Conc(D) 8 (1972), 399–407 und Ders. Memoria passionis. Ein provozierendes Gedächtnis in pluralistischer Gesellschaft, Freiburg u. a. 3. Aufl. 2006.
22
Einleitung
Wirkungs- und Mentalitätsgeschichte schreiben Mehrere der vorliegenden Arbeiten beschäftigen sich mit wirkungsgeschichtlichen Fragen35. Explizit in Hinblick auf die Wirkungsgeschichte hin untersucht wurde die Stellung des Hieronymus zum Bischofsamt. Sie fand, obwohl sie institutionen- und damit kirchenkritisch ist, Eingang in die wichtigste Sammlung des mittelalterlichen Kirchenrechtes und stand so den Reformatoren zur Verfügung, die mit Hilfe des Hieronymus ihre Position der Identität von Bischofsund Pfarramt stützen konnten. Die Frage der Prägung der spezifischen Frömmigkeit der russlanddeutschen Aussiedler ließ sich schließlich auf die Wirkung der Dauerlektüre bzw. des Dauerhörens bestimmter Predigtbücher zurückführen, die teilweise in Deutschland unbekannt waren, wie die von Carl Blum oder längst vergessen, wie die Predigten des württembergischen Pietisten Gottlob Immanuel Brastberger. In dieser Untersuchung kommt auch die Perspektive der „longe durée“ zur Geltung, die in der französischen Historikerschule der Annales36 entwickelt wurde. Die Frage nach der Frömmigkeitsgeschichte grenzt hier an die mentalitätsgeschichtliche Arbeitsweise, wie sie in diesem Zweig der Geschichtswissenschaft gerne betrieben wird.
Regional- oder Lokalgeschichte schreiben Regionalgeschichte wird oft als Stiefkind der „großen“ Geschichte betrachtet und manchmal auch so behandelt. Dagegen hat sich der Nestor der Oldenburgischen Kirchengeschichte, Rolf Schäfer bereits 1997 verwahrt und auf den wechselseitigen Zusammenhang von „großer“ und „kleiner“ Geschichte hingewiesen: Zu den Quellen gehören nicht nur die großkalibrigen Texte, die in der allgemeinen Kirchengeschichte Epoche machen, sondern auch das „Kleine“, […] dessen verständnisvolle, einfühlsame Interpretation […] hilft nicht nur der örtlichen, sondern auch der allgemeinen Kirchengeschichte weiter37.
35 Zur Wirkungsgeschichte als Methode vgl. Ulrich Luz, Wirkungsgeschichtliche Hermeneutik und kirchliche Auslegung der Schrift, in: Moisés Mayordomo (Hg.), Die prägende Kraft der Texte. Hermeneutik und Wirkungsgeschichte des Neuen Testaments (Stuttgarter Bibelstudien 199), Stuttgart 2005, 15–37. 36 Vgl. Peter Burke, Offene Geschichte. Die Schule der Annales, Berlin 1991. 37 Rolf Schäfer, Ortskirchengeschichte und allgemeine Kirchengeschichte. Gedanken zu einer oft verkannten Wechselbeziehung, in: Jahrbuch der Gesellschaft für Niedersächsische Kirchengeschichte 95 (1997) 385–389, hier 389.
Einleitung
23
Durch den „spatial turn“ in den Kulturwissenschaften38, der mit einiger Verzögerung auch die Kirchengeschichte erreicht hat, wurde in den letzten Jahren ein neues Verständnis für die Räume entwickelt, in denen historische Prozesse ablaufen. So werden Geschichtslandschaften sichtbar. Dafür eignet sich die Regionalgeschichte besonders gut39. In meinen Arbeiten zur Oldenburgischen Geschichte wird das deutlich. Bei der Suche nach der Verbindung zwischen Oldenburg und dem Hl. Lambertus, der der Oldenburger Stadtkirche ihren Namen gegeben hat, eröffnete sich ein epochen- und grenzüberschreitender Raum. Die gräfliche Familie der Oldenburger40 mit ihren verzweigten Linien und Beziehungen fungierte als Träger der Lambertus-Verehrung im hohen Mittelalter. Sie verknüpfte als Familie verschiedene geographische Räume miteinander, den Rhein-Maas-Raum und die nordwestdeutsche Tiefebene, in der die Herrschaft der Oldenburger zunächst noch gar nicht klar geographisch fixiert war. Ein raumübergreifendes, immaterielles Verbindungsglied bildete die Verehrung eines bestimmten Heiligen, sie führte schließlich zu einer Verfestigung an bestimmten Orten, dadurch, dass Kirchengebäude dem Heiligen geweiht wurden und diese zugleich zu Kristallisationspunkten sich räumlich fixierender Herrschaft wurden. Ganz kleinräumig ist meine Beschäftigung mit dem Gebäude der St. LambertiKirche in Oldenburg41. Dieses spezielle Gebäude ist ohne den Hintergrund einer aufklärerischen Frömmigkeit nicht zu verstehen. In einem komplizierten Umbauprozess, den ich von 2003 bis 2009 mit zu verantworten hatte, spielten viele historische Erkenntnisse eine Rolle. Die Ergebnisse der historischen Bauforschung, schriftliche und bildliche Quellen mussten ausgewertet werden, verschiedene und kontrastierende historische Schichten so mit einander verbunden werden, dass am Ende ein funktionierendes Gebäude entstand. Über einen Teil 38 Vgl. Doris Bachmann-Medick, Cultural Turns. Neuorientierungen in den Kulturwissenschaften, Reinbek bei Hamburg 2006, zum „spatial turn“ s. 284–290. 39 Riccardo Bavaj, Was bringt der „spatial turn“ der Regionalgeschichte? Ein Beitrag zur Methodendiskussion, in: Westfälische Forschungen 56 (2006), 457–484, hier 483: „Nicht zu Unrecht hat Karl-Georg Faber schon vor Jahrzehnten darauf hingewiesen, dass es gerade die auf kleinere und mittlere Räume fokussierte Erforschung von ‚Geschichtslandschaften‘ sei – ob man das Landes- oder Regionalgeschichte nennt, ist von untergeordneter Bedeutung –, die […] das geeignetste Experimentierfeld biete“. 40 Vgl. Gerd Steinwascher, Die Oldenburger. Die Geschichte einer europäischen Dynastie, Stuttgart 2. Aufl. 2012. 41 Für die Berechtigung der regionalen Kirchengeschichte bis hinunter zum einzelnen Gebäude tritt auch Klaus Fitschen ein. Klaus Fitschen, Wissen wie es war – Verstehen, wie es ist, in: Bernd Jaspert (Hg.), Kirchengeschichte als Wissenschaft, Münster 2013, 66–78, hier 73: „Deshalb ist auch die Territorialkirchengeschichte bzw. die Geschichte der jeweiligen Landeskirche zu pflegen und ihre Erforschung voranzutreiben. Dazu gehört dann auch die Geschichte der christlichen Kunst und Architektur, über die sich die Geschichte einer Kirche und eines Gemeinwesens anschaulich erschließen lassen“.
24
Einleitung
dieses Umbauprojektes habe ich schriftlich Rechenschaft gegeben, über die Neukonzeption des wenig mehr als 100 m2 großen Vestibüls der Kirche, ihrer ehemaligen klassizistischen Eingangshalle. In der Vorbereitung des Reformationsjubiläums 2017 habe ich den Blick zurück gerichtet und die Reformationsjubiläen 1817 und 1917 in Oldenburg untersucht. Hier zeigte sich die Verbindung der „großen“ mit der „kleinen“ Geschichte sehr deutlich. Die Stadt Oldenburg feiert die beiden Säkularfeiern im Zusammenhang mit den historischen, sozialen und kirchlichen Gegebenheiten der jeweiligen Zeit in Deutschland und Europa. Dennoch werden in Oldenburg, in einer viel weniger als heute von Medien bestimmten Wirklichkeit, 1817 und 1917 Jubiläen gefeiert, die für die Menschen in Oldenburg jeweils „das“ Reformationsjubiläum sind. Beide Hundertjahrfeiern prägen sich im Raum der Stadt und des Landes speziell aus, sie unterscheiden sich von den Jubiläumsfeiern anderer Orte und sind dennoch typisch für ihre jeweilige Zeit. Das Allgemeine und das Lokale verbinden sich und zeigen, dass Geschichte nicht ortlos sein kann.
Die Arbeiten im Einzelnen Die Arbeiten sind nach den drei Themengebieten geordnet. Den Anfang machen die patristischen Studien, danach folgen die Arbeiten zu Geschichte und Frömmigkeit der Russlanddeutschen, den Schluss bilden die regional- und lokalhistorischen Werke. Soweit nötig, sind die Arbeiten überarbeitet worden. Neue Erkenntnisse und Literatur wurden eingearbeitet. In der folgenden Vorstellung der Arbeiten wird auf ihre bisherige Rezeption bzw. auf die Entwicklung im jeweiligen Forschungsgebiet hingewiesen.
Zwei Arbeiten zur Disputatio de origine animarum Die Untersuchung und die Übersetzung der Disputatio de origine animarum sind entstanden, weil mir dieser Text in der handschriftlichen Überlieferung des Briefwechsels zwischen Augustinus und Hieronymus aufgefallen ist. Ich war von Anfang an fasziniert von der Leistung des Autors, eines spätantiken Kompilators, der mit hoher Kunstfertigkeit einen neuen Text aus Zitaten der beiden Kirchenväter zusammengesetzt hat. Die dogmengeschichtliche Bedeutung dieser in den Handschriften breit überlieferten, später völlig vergessenen spätantiken Kompilation ist groß. Dieser Text bildet eine wichtige Brücke in den spätantiken christlichen Auseinandersetzungen um die Entstehung der menschlichen Seele. Es konkurrierten im
Einleitung
25
Wesentlichen zwei Deutungsmodelle. Der Traduzianismus, lässt die Seele mit dem Samen übertragen werden und geht deshalb von einem einmaligen Schöpfungsakt der Seele im Paradies aus. Der Kreatianismus geht davon aus, dass jede Seele einzeln bei der Empfängnis von Gott neu geschaffen wird, Gott also bis auf den heutigen Tag mit dem Schöpfungsprozess beschäftigt ist. Augustinus, der die überragende antike Autorität des lateinischsprachigen Christentums war, hing zeitlebens eher dem Traduzianismus an. Hieronymus war ein leidenschaftlicher Verfechter des Kreatianismus. Augustinus und Hieronymus haben das Problem in ihrem Briefwechsel nicht gelöst. Aus verschiedenen Gründen sollte der Kreatianismus das großkirchlich bevorzugte Deutungsmuster werden. Aber im lateinischen Westen eine Entscheidung zu fällen, die bedeutet hätte, Augustinus unter die Irrlehrer zu zählen, war nicht so einfach möglich. In dieser Verlegenheit half die Disputatio aus. Sie fingierte einen Dialog zwischen Augustinus und Hieronymus an dessen Ende Augustinus vom Kreatianismus überzeugt war. Durch diesen Kunstgriff kann Augustinus ein rechtgläubiger Kirchenlehrer bleiben und der Traduzianismus als Häresie aus der Lehre der katholischen Kirche ausgeschieden werden. Die kreatianistische Vorstellung, dass Gott bei jeder Zeugung eines menschlichen Embryos eine neue Seele schafft, ist auf diese Weise bis heute geltende katholische Lehre geblieben und beeinflusst die Debatten um Abtreibung, PID, oder den Umgang mit embryonalen Zellmaterial. Auf Grund dieser weitreichenden Bedeutung des Themas gehört mein Aufsatz zur Disputatio in der vierten Auflage des Lexikons „Religion in Geschichte und Gegenwart“ sowohl im Artikel „Kreatianismus“42 als auch im Artikel „Traduzianismus“43 zu den wenigen zitierten Forschungsbeiträgen. Die hier vorgelegte komplette Übersetzung der disputatio soll dazu beitragen, den Text – und damit auch seine dogmengeschichtliche Bedeutung noch bekannter zu machen.
Zwei Arbeiten über die Stellung des Hieronymus zum Bischofsamt und seine Rezeption in der Reformationszeit Die Untersuchungen zur Haltung des Hieronymus zum Bischofsamt sind aus dem Interesse an der Ämterlehre entstanden. Hieronymus vertritt eine Mindermeinung in der Antike. Er geht davon aus, dass Presbyter (Priester) und Bischof identische Ämter sind. Das widerspricht der klassischen Trias der hierarchisch geordneten Ämter (Bischof, Presbyter, Diakon) in der Spätantike. Hieronymus führt allerdings zu seinen Lebzeiten keine kirchenpolitischen De42 Vgl. Ted Peters, Kreatianismus, in: RGG4 4 (2001), 1737–1738. 43 Vgl. Markus Mühling, Traduzianismus, in: RGG4 8 (2005), 530.
26
Einleitung
batten um die Ämterstruktur, die er mit biblischen Begründungen ablehnt. Erst über tausend Jahre später entfalten die Argumente des Hieronymus ihre Sprengkraft. In der Reformationszeit wird die Stellung des Hieronymus zu einem Argument in der Auseinandersetzung der Reformatoren mit der Ämterlehre der mittelalterlichen Kirche. Sie machen die Position des Hieronymus auf zweierlei Weise fruchtbar, zum einen als Argument gegen die Hierarchie und als Baustein einer evangelischen Amtsauffassung, die keinen Weiheunterschied zwischen Bischof und Pastor kennt. Die kritischen Äußerungen des Hieronymus zum Bischofsamt, die mein erster Aufsatz herausarbeitet, wurden in der Forschung zur Ämterlehre in der Alten Kirche und in der Klerikerkritik beachtet44. Die mit dem zweiten Aufsatz exemplarisch unternommene Erforschung der Wirkungsgeschichte patristischer Texte in der Reformationszeit ist ein noch lange nicht abgeschlossener Arbeitsbereich der Kirchengeschichte45. Die Zusammenarbeit zwischen Patristik und Reformationsgeschichte ist ein fruchtbarer Zweig der Kirchengeschichte, die einen wichtigen Beitrag zum Verständnis der konfessionellen Abgrenzung im Rückgriff auf einen gemeinsamen Traditionsbestand leistet. Die von mir beschriebene Wirkung der Behauptung der Einheit von Pfarr- und Bischofsamt hat darüber hinaus in den Diskursen um das evangelische Bischofsamt in den letzten Jahren ihre Wirkung entfaltet.
Die Juden in zwei Osterpredigten Augustins Aus der Fragestellung meiner Dissertation, die sich auch mit dem Umgang von Christen und Juden befasste, ist die Übersetzung und Untersuchung zweier unbekannter und bisher nicht ins Deutsche übersetzter Osterpredigten Augustins erwachsen. Welche Rolle spielen die Juden in der Verkündigung Augustins im Vergleich zu seinen exegetischen und dogmatischen Werken? In der ersten der beiden Osterpredigten, in der die Juden explizit als Thema der Predigt vorkommen, lässt sich zeigen, dass Augustinus gegenüber seiner Gemeinde eine 44 So z. B. Hanno Dockter, Klerikerkritik im antiken Christentum, Göttingen 2013. 45 Neben einigen Einzelstudien liegen das große Werk von Irena Backus, The reception of the church fathers in the west. From the Carolingians to the Maurists, 2 Bde. Leiden 1997 und die Kongressbände „Auctoritas Patrum“ vor: Leif Grane u. a. (Hg.), Auctoritas patrum. Zur Rezeption der Kirchenväter im 15. und 16. Jahrhundert, Mainz 1993 und Auctoritas patrum II. Neue Beiträge zur Rezeption der Kirchenväter im 15. und 16. Jahrhundert, Mainz 1998, sowie Günter Frank u. a. (Hg.), Die Patristik in der frühen Neuzeit. Die Relektüre der Kirchenväter in den Wissenschaften des 15. bis 18. Jahrhunderts (Melanchthon-Schriften der Stadt Bretten 10), Stuttgart-Bad Cannstatt 2006 und Silke-Petra Bergjan / Karla Pollmann (Hg.) Patristic tradition and intellectual paradigms in the 17th Century (Spätmittelalter, Humanismus, Reformation 52), Tübingen 2010.
Einleitung
27
differenzierte Haltung gegenüber den Juden einnimmt. Zum einen werden die Juden von Augustin für ihre „historische Schuld“ am Tod Jesu verurteilt und ihnen wird das „Israel-Sein“ abgesprochen, denn für Augustinus besteht das „wahre Israel“ jetzt in der Kirche aus Juden und Heiden. Allerdings hält Augustinus auch die Erinnerung daran wach, dass das Christentum sich dem Judentum verdankt und schärft seinen Hörern ein, das im Umgang mit den Juden nicht zu vergessen. Letztendlich resümiert er (unter Aufnahme von Mt 3,12), gäbe es unter allen Menschen unabhängig von ihrer Herkunft „Spreu“ und „Weizen“. Kriterium dafür, wer zur „Spreu“ und wer zum „Weizen“ gehöre, sei allein der Glaube an Christus und der stünde allen Menschen offen. In der zweiten Osterpredigt Augustins zeigt sich, dass das Thema der Haltung zu den Juden auch implizit in einer Predigt vorkommen kann und dann zu den wesentlichen textsteuernden Konzepten gehört. Beide Predigten haben zusätzlich zu den eigentlichen Predigttexten weitere, die Auslegung strukturierende Elemente. War es in der ersten Predigt der Text Mt 3,12, ist es in der zweiten Predigt die Zahl Zwei, die es Augustinus ermöglicht mit einem Schema der Steigerung vom ersten zum zweiten, bzw. der Überbietung des ersten durch das zweite zu arbeiten. In diesem Schema überbietet die „Gnade des Geistes“ das „Gesetz“. Das „Gesetz“ wird von Augustinus dem Judentum zugeordnet, die „Gnade des Geistes“ aber dem Christentum. So vermittelt er seiner Gemeinde in dieser Predigt, dass der „alte Bund“ hinfällig sei und nur der „neue Bund“ in Christus das Heil in sich birgt. Die beiden hier übersetzten Predigten sind noch nicht in dem großen Editionsprojekt der Predigten Augustins in deutscher Sprache enthalten46. Die Predigten Augustins sind zurzeit Gegenstand eines internationaler und interdiszi46 Vgl die Hubertus R. Drobner bisher ins Deutsche übersetzten, eingeleiteten und herausgegebenen Predigten Augustins: Predigten zum Buch Genesis (Sermones 1–5), (Patrologia 7), Frankfurt, a. M. [u. a.] 2000; Predigten zu Kirch- und Bischofsweihe (Sermones 336–340/A), (Patrologia 9), Frankfurt, a. M. [u. a.] 2003; Predigten zu den Büchern Exodus, Könige und Job (Sermones 6–12), (Patrologia 10), Frankfurt, a. M. [u. a.] 2003; Predigten zum Weihnachtsfest (Sermones 184–196), (Patrologia 11), Frankfurt, a. M. [u. a.] 2003; Predigten zum Buch der Sprüche und Jesus Sirach (Sermones 35–41), (Patrologia 13), Frankfurt, a. M. [u. a.] 2004; Predigten zum österlichen Triduum (Sermones 218–229/D), (Patrologia 16), Frankfurt, a. M. [u. a.] 2006; Predigten zum Markusevangelium (Sermones 94/A-97), (Patrologia 19), Frankfurt, a. M. [u. a.] 2007; Predigten zu Neujahr und Epiphanie (Sermones 196,A-204,A), (Patrologia 22), Frankfurt, a. M. [u. a.] 2010; Predigten zur Apostelgeschichte (Sermones 148– 150), (Patrologia 26), Frankfurt, a. M. [u. a.] 2012; Predigten zu den alttestamentlichen Propheten (Sermones 42–50), (Patrologia 29), Frankfurt, a. M. [u. a.] 2013 sowie die von Hubertus R. Drobner veröffentlichten Begleitbände: Augustinus von Hippo. Sermones ad populum. Überlieferung und Bestand, Bibliographie, Indices (Vigiliae Christianae. Supplements 49), Leiden [u. a.] 2000 und Augustinus von Hippo, Sermones ad populum. Überlieferung und Bestand, Bibliographie, Indices, Supplement 2000–2010, (Patrologia 25), Frankfurt, a. M. [u. a.] 2010.
28
Einleitung
plinären Forschungszusammenhangs. Insgesamt drei Tagungen mit dem Titel minsterium sermonis haben sich seit 2008 mit Augustins Predigten befasst bzw. beschäftigen sich noch mit diesem Thema47. Die beiden vor mir behandelten Osterpredigten sind dort noch nicht Gegenstand der Untersuchungen gewesen. Das Thema Augustinus und die Juden wurde hingegen bereits bei der ersten Tagung von Johannes von Oort behandelt, aber nicht durch eine Einzelstudie an ein oder zwei Predigten, wie hier, sondern in einem allgemeinen Überblick über Augustins Predigttätigkeit48. Es ist schade, dass der Berichtsband über den deutsch-polnischen Theologenkongress 2008 an der Universität Oldenburg, in dem mein Beitrag veröffentlicht werden sollte, nicht erschienen ist.
Eusebius von Emesa und die Juden Die Frage nach seiner Stellung zu den Juden richtet sich auch an Eusebius von Emesa, zwei Generationen vor Augustinus: Wie predigte ein Bischof zwischen 341 und 359 in einer Stadt, in der es eine größere jüdische Gemeinde gab und zu einer Zeit in der das Christentum erst dabei war sich als staatstragende Religion zu etablieren? Im Gegensatz zu vielen anderen christlichen Gruppierungen, die von vornherein das Alte Testament verwarfen, waren die christlichen Gruppen, aus denen die „orthodoxe“ Kirche hervorging, an einem Gespräch mit dem Judentum interessiert. Denn sie hielten an der Hebräischen Bibel als integralem Teil der Offenbarung fest und waren deshalb auf die exegetische Kompetenz jüdischer Gelehrten angewiesen. Es gab also Kontakte untereinander und einen Austausch über die gemeinsame Grundlage in der Hebräischen Bibel. Es lässt sich zeigen, dass der Bischof von Emesa (dem heutigen Homs) ein Kenner der jüdischen Bibelexegese ist, aber deswegen keinesfalls ein Philosemit. Er benutzt seine Kenntnisse ebenso zur Texterklärung wie zur Abgrenzung gegenüber dem Judentum. Das zeigt sich zum Beispiel bei den Themen „Ende der Prophetie in Israel“ und „Zerstörung Jerusalems“. Für die Haltung des Eusebius finden sich bei beiden Themen Erklärungen in der rabbinischen Literatur. Eusebius verwendet seine Kenntnisse sowohl in seinen nur fragmentarisch erhaltenen Bi-
47 Von zwei Tagungen liegen die Berichtsbände bereits vor, die dritte findet im Frühjahr 2015 auf Malta statt: Gert Partoens (Hg.), Ministerium sermonis. Philological, historical and theological studies on Augustine’s Sermones ad populum, (Instrumenta patristica et mediaevalia 53) Turnhout 2009 und Anthony Dupont (Hg.), Tractatio scripturarum. Philological, exegetical, rhetorical and theological studies on Augustine’s sermons. Ministerium Sermonis vol. II (Instrumenta patristica et mediaevalia 65), Turnhout 2012. 48 Johannes van Oort, Jews and Judaism in Augustine’s Sermones in: Partoens (Hg.), Ministerium sermonis (Anm 46), 243–266.
Einleitung
29
belkommentaren49, als auch in seinen Predigten. In den Predigten breitet er immerhin die innerjüdischen Erklärungen vor seiner Gemeinde aus, um ihr dann zu sagen, dass der wahre Grund für die Zerstörung Jerusalems ein anderer ist: nämlich die Tötung des Gottessohnes. Eusebius konzediert dabei sogar dem zeitgenössischen Judentum, dass es sich inzwischen intensiv um die Einhaltung der Tora bemühe, dass das im Laufe der Heilsgeschichte eine überholte, ja nutzlose Praxis sei, da nun – durch die konstantinische Wende – der Sieg des Christentums klar erwiesen sei50. Zum friedlichen, respektvollen Umgang der beiden Religionen miteinander wird das nicht beigetragen haben. Da im Großraum Antiochia zur Zeit des Eusebius viele selbstbewusste jüdische Gemeinden existierten, ermahnt er aber seine Gemeinde zur Besonnenheit. Die Christen sollen nicht provozieren. Die konstantinische Wende führte also nicht schnell zu einer einheitlichen christlichen Religion im Römischen Reich. Judentum und Heidentum blieben noch lange neben der erstarkenden Kirche bestehen und die Menschen mussten sich mit den verschiedenen Religionen auseinandersetzen. Das war aber nicht so einfach wie Robert E. Winn es noch 2011 für Eusebius beschreiben zu können meint51. Für Eusebius muss eine hoch entwickelte Dialektik zwischen intimer Kenntnis von jüdischer Bibelauslegung und jüdischer theologischer Debatten sowie einer sich scharf abgrenzenden christlichen Theologie konstatiert werden.
Das Athanasianum Das athanasianische Glaubensbekenntnis gehört zu den unbekannteren Bekenntnissen, obwohl es zu den „drei altkirchlichen Symbolen“ gehört, auf die sich ein Großteil der Geistlichen in den christlichen Kirchen verpflichten lassen. Es wird praktisch nie in Gottesdiensten verwendet, obwohl es zum kanonischen 49 Eine aufwendige Rekonstruktion des Genesis-Kommentars liegt jetzt vor. Dazu wurden armenische, syrische und griechische Überlieferungen zusammengeführt und mit einer französischen Übersetzung versehen: Françoise Petit / Lucas van Rompay / Jos J.S. Weitenberg (Hg.), Eusèbe d’Émèse. Commentaire de la Genese. Texte arménien de l’édition de Venise (1980), fragments grecs et syriaques avec traductions (Traditio Exegetica Graeca 15), Louvain 2011. 50 Zur konstantinischen Wende vgl. Klaus Martin Girardet, Die konstantinische Wende. Voraussetzungen und geistige Grundlagen der Religionspolitik Konstantins des Großen, Darmstadt 2006 und Hanns Christof Brennecke, Constantin und die Idee eines Imperium Christianum in: Friedrich Schweitzer (Hg.), Religion, Politik und Gewalt (Veröffentlichungen der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Theologie 29), Gütersloh 2006, 561–576. 51 Robert E. Winn, Eusebius of Emesa: Church and Theology in the Mid-Fourth Century Washington D.C. 2011, 253: „I have argued that Eusebius was advancing an ecclesiastical identity in his sermons and I have noted that he frequently did this by reminding his audience that Jews, pagans, and heretics were outside of the church.“
30
Einleitung
Bestand der Glaubensbekenntnisse gehört, die aus der Spätantike stammen und heute noch in der weltweiten Christenheit Gültigkeit haben. Obwohl das Bekenntnis mit dem Namen des großen Bischofs Athanasius von Alexandrien verbunden ist, stammt es nicht von ihm. Ob es eigentlich ein Glaubensbekenntnis ist oder doch eher ein Kompendium von bestimmten Lehrinhalten, muss zumindest gefragt werden. Sein Inhalt ist komplett von trinitätstheologischen und christologischen Fragen bestimmt. Dadurch lässt sich seine ungefähre Entstehungszeit (vor 540) bestimmen. Inhaltlich ist es im Bereich der Trinitätstheologie und Pneumatologie von Augustinus abhängig, in den christologischen Teilen spiegeln sich die Auseinandersetzung um Nestorius aus der ersten Hälfte des fünften Jahrhunderts wider. Das Athanasianum scheint eher eine Zusammenfassung des theologischen Lehrbestandes der Zeit um 540 in der westlichen, lateinischsprachigen Kirche zu sein als ein Glaubensbekenntnis für den individuellen oder gottesdienstlichen Gebrauch. Als eine Art Kompendium – vor allem für die Klerikerbildung – wurde es dann auch in der Folgezeit gebraucht. Vor allem die Karolinger führten es verpflichtend in die Klerikerausbildung ein. Es sollte als zweites Bekenntnis neben dem Apostolischen Glaubensbekenntnis von allen Klerikern auswendig gelernt und an jedem Sonntagmorgen rezitiert werden. Zu den schwierigen Wirkungen des Athanasianums gehört das Wörtchen filioque im trinitätstheologischen Teil. Um die Frage, ob der Heilige Geist von Gottvater oder von Gottvater und dem Sohn (filioque) ausgeht, gab es im Mittelalter scharfe Kontroversen zwischen Ost- und Westkirche. Im Westen hielt man diese Formulierung auf Grund des unter dem Namen des griechischen Kirchenvaters Athanasius weit verbreiteten Bekenntnisses für orthodox. Im Osten kannte und anerkannte man sie nicht. Dieser Konflikt war ein Baustein für die gegenseitige Verwerfung von 1054, dem großen Schisma zwischen Ost- und Westkirche. Seit dem ersten Erscheinen meines Beitrages haben sich Michael Kohlbacher52 und Volker Henning Drecoll53 mit dem Athanasianum beschäftigt. Ihre Ergebnisse bestätigen und ergänzen meine Arbeit zum Athanasianum, deshalb habe ich sie in die vorliegende Fassung eingearbeitet.
52 Michael Kohlbacher, Das Symbolum Athanasianum und die orientalische Bekenntnistradition. Formgeschichtliche Anmerkungen, in: M. Tamcke (Hg.), Syriaca II. Beiträge zum 3. deutschen Syrologen-Symposium in Vierzehnheiligen 2002 (Studien zur Orientalischen Kirchengeschichte 33), Münster 2004, 105–164. 53 Volker Henning Drecoll, Das Symbolum Quicumque als Kompilation augustinischer Tradition, in: ZAC 11 (2007), 30–56.
Einleitung
31
Carl Blum – Prediger der Russlanddeutschen Die Predigtbücher von Carl Blum kamen mit den russlanddeutschen Aussiedlern in die Bundesrepublik. Viele Pastorinnen und Pastoren, die mit Aussiedlern zu tun hatten, kannten den Autor nicht und waren von der Frömmigkeit seiner Predigten irritiert. Mir wurde die Frage gestellt, ob ich nicht versuchen könnte, die Biographie von Carl Blum zu erarbeiten und seine Predigten in ihren historischen Kontext einzuordnen. Das tut der vorliegende Artikel und ist damit bis heute die wissenschaftliche Referenz zu Carl Blum. Das Leben von Carl Blum lässt sich in den Kontext des deutschen Lebens im Baltikum und seine Theologie in die Nachgeschichte der Erlanger theologischen Schule einordnen. Seine Predigten sind durch die heilsgeschichtliche Theologie der Erlanger geprägt und gehören in den Kontext der lutherischen Erweckungsbewegung mit ihrem Zug zur Forderung der Bekehrung und der individuellen Heiligung. In seinen Predigten finden sich zudem viele Bezugnahmen auf die Lebenswelt der Deutschen in den – wie man damals sagte – „Kolonien“ an der Wolga und in Südrussland. Dem heilsgeschichtlichen Denken seiner theologischen Prägung entsprechend findet sich bei ihm ein ausgeprägter christlicher Antijudaismus. Zu Carl Blum gibt es keine neuere Literatur. Mein Beitrag ist bisher der Referenzstandard und wird in allen historischen Arbeiten zur Kirchengeschichte und zur Frömmigkeit der Russlanddeutschen rezipiert.
Evangelische Lehrer und Pastoren in Russland Die besondere Lage der Deutschen in den „Kolonien“ in Russland führte zu einer besonderen Situation, was die gottesdienstliche und seelsorgliche Versorgung durch Pastoren betraf. Die Gemeinden waren so groß und die Entfernungen so weit, dass mehr als eine pastorale Grundversorgung zumeist nicht geleistet werden konnte. Oft kam der Pastor nur wenige Male im Jahr in einen Ort, hielt Gottesdienst und inspizierte die Schule. In der übrigen Zeit des Jahres wurde aber auch in den kleinsten Siedlungen, wenn irgend möglich, Gottesdienst gefeiert. Die Küster/Lehrer übernahmen diesen Dienst, ebenso wie die meisten Beerdigungen und Taufen zusätzlich zu ihrem Amt als Lehrer. Schulen gab es deutlich mehr als Kirchen, bzw. Küster/Lehrer deutlich mehr als Pastoren. Die Organisation des Schulwesens war in den verschiedenen Gebieten Russlands, in denen Deutsche siedelten unterschiedlich. Am besten war das Schulwesen in Südrussland entwickelt. Wolhynien war die Region in der das Schulwesen am schlechtesten entwickelt war. In allen Gebieten der deutschen Siedlungen in Russland kämpften die Küster/Lehrer mit zu vollen Klassen, mit schlechter Bezahlung und unsicheren Arbeitsverhältnissen. Die „geistliche Schul-
32
Einleitung
aufsicht“ bemühte sich durchgängig um einen besser qualifizierten Lehrernachwuchs und um mehr Lehrer. Im Laufe des 19. Jahrhunderts lässt sich ein deutlicher Professionalisierungsschub feststellen. Im Zuge des beginnenden russischen Nationalismus wurde das Schulwesen auch in den deutschen Siedlungsgebieten russifiziert, das führte letztendlich zu einer bis dahin nicht gebräuchlichen ethnischen Selbstdefinition der Deutschen in Russland, die an ihrem eigenen „deutschen“ Kirchenschulwesen festhielten, bis die Revolution und die nachfolgende Zeit allen Formen der deutschen Selbstverwaltung und des Kirchenwesens ein Ende setzte. Die gleichzeitig mit meinem Aufsatz erschienene Habilitationsschrift von Wladimir Süss zum russlanddeutschen Schulwesen konnte nicht mehr berücksichtigt werden54, sie ist viel umfangreicher angelegt und zugleich mehr auf die organisatorischen Formen des Schulsystems konzentriert. Die Besonderheit der Rolle der Küster/Lehrer im russlanddeutschen Schul- und Kirchenwesen tritt bei Süss nicht so deutlich hervor.
Die prägende Kraft der Predigtbücher für die Frömmigkeit der Russlanddeutschen Die dritte Arbeit zur Geschichte der Russlanddeutschen ist in gewisser Weise die logische Fortsetzung der beiden vorausgegangenen. Carl Blums Predigtbücher sind die letzten einer Reihe von Predigtbüchern, die in Russland intensiv gelesen wurden. Dadurch, dass zumeist nicht die Pastoren den Gottesdienst vor Ort hielten, wurde im sonntäglichen Gottesdienst von den Küster/Lehrern eine gedruckte Predigt verlesen. Neben einigen anderen, waren vor allem die Predigtbücher von Gottlob Immanuel Brastberger, Ludwig Hofacker und Carl Blum in Russland verbreitet. Die am Ende des 19. Jahrhunderts gedruckten Predigtbücher waren zu Beginn des 20. Jahrhunderts weit verbreitet. Sie wurden von den frommen Russlanddeutschen mit in die Verbannung / Vertreibung hinter den Ural genommen, die ihre Volksgruppe in verschiedenen Wellen ereilte, bis schließlich 1941 alle Russlanddeutschen deportiert wurden. Damit reagierte der Sowjetstaat auf den Überfall Hitlers auf die Sowjetunion. Die geistliche Entwicklung der Deutschen in den neuen Siedlungsgebieten – vor allem in Sibirien und Kasachstan – blieb auf dem Stand dieser Predigtbücher stehen. Die Tradition der „geistlichen Selbstversorgung“ durch Küster/Lehrer oder Brüder, die die Berufung zum Predigtdienst annahmen, war in der Geschichte der Russland-
54 Wladimir Süss, Das Schulwesen der deutschen Minderheit in Russland von den ersten Ansiedlungen bis zur Revolution 1917 (Bildung und Erziehung Beiheft 13), Köln u. a. 2004.
Einleitung
33
deutschen schon angelegt. Eine besondere Prägung ihrer Frömmigkeit durch Pietismus und Erweckungsbewegung auch. Zu den Predigtbüchern, die bei den Russlanddeutschen in Gebrauch waren und ihrem prägenden Einfluss auf deren Frömmigkeit, sind keine neuen Arbeiten erschienen. Auch hier ist meine Arbeit bisher der Referenzstandard.
Aus dem Tagebuch eines bekehrten russischen Rabbiners. Ein adversus-judaeos-Text aus der ev.-luth. Kirche in Russland Ein besonderer Text ist der Bekehrungsbericht des Rabbiners Chaim (christlich: Rudolf) Gurland. In Russland war den Deutschen die freie Religionsausübung erlaubt. Sie durften aber keine orthodoxen Christen missionieren. Das, vor allem der Erweckungsbewegung innewohnende, Interesse an der Mission konnte auf diese Weise in Russland nicht ausgelebt werden. Einzige Betätigungsfelder für eine Mission in Russland selbst waren Muslime und Juden. Es gab aber keine organisierte Judenmission in den deutschen Kolonien in Russland. Der Missions-Erfolg war also gering. Die meisten Deutschen in Russland unterstützen lieber Missionsgesellschaften in Deutschland, die in Afrika oder Asien missionierten. Die Bekehrung eines ehemaligen Rabbiners zum Christentum und sein Werdegang bis zum lutherischen Pastor in Baltikum war eine publizistische Sensation. Rudolf Gurland beteiligte sich durch einen autobiographischen Text an der Verbreitung seiner Geschichte. In seiner Autobiographie gibt es einen Abschnitt, in dem Gurland seine Konfrontation mit seiner Synagogengemeinde beschreibt. Diese ein Jahr später zuerst veröffentlichte Beschreibung ist deshalb besonders, weil sie im hohen Maße authentisch zu sein scheint. Sie gibt die Situation einer Disputation mit einem Übertrittswilligen in einer Synagoge wieder. Die Argumente, die von der Synagogengemeinde vorgebracht werden lassen sich zu einem großen Teil als rabbinisch verifizieren. Rudolf Gurland scheint hier wenig geschönt zu haben. Die vorliegende Neuausgabe des Textes ist vor allem daran interessiert zu zeigen, dass Gurland, der als schon Bekehrter vor seine alte Gemeinde tritt, dennoch in der Lage ist, deren Argumente treu wieder zu geben. Das zeichnet diesen Text aus. Seine Funktion ist dennoch die eines adversus-judaeos Textes, denn der Bekehrungsbericht Gurlands fand in der Judenmission Verwendung und diente dort sowohl als „Erfolgsmeldung“ als auch als Material zur weiteren Bekehrung von Juden. In diesem Sinne wird die Lebensbeschreibung von Rudolf Gurland bis heute benutzt. Zahlreiche (vor allem englischsprachige) Internetseiten, die auf die Bekehrung vom Judentum zum Christentum zielen, verwenden eine gekürzte Form der Vita Rudolf Gurlands weiterhin als exemplarischen Bekehrungsbe-
34
Einleitung
richt55. Die Mühe, den komplexen Ablösungsprozess vom Judentum und die gelehrte Auseinandersetzung zwischen Synagogengemeinde und Konvertit wissenschaftlich zu untersuchen, hat sich bisher niemand gemacht.
Der Hl. Lambertus und die Lambertikirche in Oldenburg Den äußeren Anlass zur Beschäftigung mit dem Hl. Lambertus bot das 1300jährige Jubiläum seines Martyriums, das an der Oldenburger Lambertikirche ökumenisch begangen wurde. Wer ist Lambertus, was macht ihn zu einem Heiligen und wieso wurde ihm die Kirche in Oldenburg geweiht? Das waren die Leitfragen für diese Untersuchung, die tief in die Geschichte des frühen Mittelalters eintaucht. Es gibt wenig kritische Literatur zu diesem Thema. So musste die vita vetustissima als vorrangige Quelle ausgewertet werden. Sie zeigt Lambertus als Heiligen, der in der zugleich kriegerisch und christlich geprägten Schicht der fränkischen Adeligen aufgewachsen ist und deren Prinzipien und Denkweisen teilt. Als Bischof waren für ihn dennoch die adeligen Verhaltenscodices verbindlich. Fehde und Blutrache spielten auch in seinem Leben eine wichtige Rolle. Als er und sein Gefolge eines Tages angegriffen werden, wehren seine Neffen dieses Attentat ab, töten die Angreifer und geraten so in eine Blutrachesituation. Lambertus schützt sie zunächst. Erst als sie von der verfeindeten Familie auf dem Landgut des Lambertus (Leodium, später Lüttich) nächtens überfallen werden, verhindert Lambertus, dass die Spirale der Blutrache sich weiterdreht und verbietet seinen Männern – um Christi willen – die Gegenwehr. In diesem Überfall wird Lambertus im Gebet getötet. Sein Impuls zum Gewaltverzicht hat die Zeitgenossen als exemplarisches Christentum überzeugt. Er wird sofort als Heiliger verehrt. Nach kurzer Zeit wird sein Leichnam aus der Kathedrale in Maastricht nach Lüttich überführt und für den Heiligen dort eine Kirche errichtet. Der Kult des Lambertus wird im Adel des Rhein-Maas-Raumes über Jahrhunderte weitergetragen und erreicht schließlich durch die gräfliche Familie um 1200 Oldenburg. Sie gründen in Oldenburg eine Kirche für den von ihnen verehrten Heiligen und rekurrieren damit auf einen historischen lang zurückliegenden christlichen Kontext im Frankenreich. 55 Z. B. http://www.messianicgoodnews.org/rabbi-rudolf-hermann-gurland/ (abgerufen am 23. 10. 2014); http://www.ha-gefen.org.il/len/aalphabetic%20 presentation/c13764/63110.php (abgerufen am 23. 10. 2014); http://jewishroots.net/ library/testimonials/ rabbi_rudolf_%20 hermann_%20gurland_testimony.html (abgerufen am 23. 10. 2014); http://www.israelight.o rg.au/~israelig/?page_id=202 (abgerufen am 23. 10. 2014); http://www.man-na.com/Rabbi_ Rudolf_Hermann_ Gurland.htm (abgerufen am 23. 10. 2014); http://www.shalom.org.uk/lib rary/ RabbisWhoBelieved/RabbiRudolpHermannGurland.html (abgerufen am 23.10. 2014). Diese Liste ließe sich unschwer verlängern.
Einleitung
35
Die Geschichte des Lambertus ist in den späteren Viten ausgeschmückt und verändert worden. Dennoch ist ihre Urgestalt klar erkennbar und der Gewaltverzicht des Lambertus immer noch eine christliche Haltung, die Respekt abnötigt und vorbildlich ist. In der Rezension im Jahrbuch der Gesellschaft für niedersächsische Kirchengeschichte wurde sowohl die gründliche Quellenarbeit gelobt, wie die über Oldenburg hinausgehende Bedeutung dieses Aufsatzes betont56. Während die Rezension im Oldenburger Jahrbuch die Verbindung von Patroziniumsforschung und Baugeschichte hervorhob und es als beispielhaft ansah, dass sich eine Gemeinde auf diese mit ihrem Titularheiligen auseinandersetzt57.
Die Lambertikirche als architektonisches Symbol Die Baugeschichte der Lambertikirche in Oldenburg ist extrem kompliziert. Herzstück der heutigen Kirche ist eine klassizistische Rotunde. Sie wurde von dem Baumeister Winck und vom Herzog Peter Friedrich Ludwig konzipiert. Das Gebäude hat bereits mehrere Interpretationen erfahren, zuletzt eine stark politische. Durch die Auswertung der Quellen, die dem Baukonzept zu Grunde liegen, ergibt sich ein anderes Bild. Zum einen wirkt der Herzog viel stärker als bisher angenommen an der Konzeption des Baues mit. Er zeigt sich dabei als Kenner der Architekturtheoretiker der Renaissance und ihrer Vorstellungen von einem idealen Kirchengebäude. Der Vergleich mit (spät-)antiken Rundbauten zeigt, dass die Bau- und Gliederungsprinzipien der Lambertikirche sich problemlos christlich lesen lassen können. Dieser Kirchenbau gibt einer aufklärerischen Frömmigkeit Ausdruck, die durch den nachfolgenden Historismus und seine Form des Kirchenbaus diskreditiert wurde und deshalb heute noch vielen Menschen unzugänglich ist. Wie sehr die Rotunde der Lambertikirche dem Zeitgeschmack von 1795 entsprach und wie deutlich der Kontrast zur vorherigen spätgotischen Lambertikirche empfunden wurde zeigt ein Zitat aus der Einweihungspredigt. Superintendent Mutzenbecher spricht vom „neuen ungewohnten Anblick eines geschmackvollen Gebäudes, das, ohne durch Kunst überladen zu 56 Rezension von Udo Schulze, in: Jahrbuch der Gesellschaft für niedersächsische Kirchengeschichte 104 (2006),419–421: „Dabei wertet Hennings gründlich die erreichbaren Quellen aus und kommt immer wieder zu überzeugenden Ergebnissen, bei denen er die unterschiedlichen Interpretationen darstellt und mit angemessener Vorsicht beurteilt […] Alles in allem lohnt es sich auch für Nichtoldenburger dieses kleine kirchen- und kunstgeschichtliche Büchlein in die Hand zu nehmen und zu lesen“. 57 Rezension von Torben Koopmann, in Oldenburger Jahrbuch 107 (2007), 215: Das „Buch ist beispielgebend für andere Gemeinden um sich mit der lokalen Verehrung ihres Titelheiligen [zu] beschäftigen“.
36
Einleitung
sein, in seiner wahren, edlen Einfalt, jeden gefühlvollen Freund des Schönen entzückt“. Die Rezension im Oldenburger Jahrbuch hebt hervor, dass meine Interpretation gegenüber den vorhergehenden einen Neuansatz darstellt, der dem Gebäude und seiner komplexen Baugeschichte besser gerecht wird58.
Das Vestibül der Lambertikirche Dieser Text beschreibt die Neugestaltung eines einzigen Raums, die von 2003– 2009 im Zuge des Umbaus der Oldenburger Lambertikirche vorgenommen wurde. In diesem Raum überkreuzen sich mehrere historische Konzepte und moderne Raumanforderungen. Die Entwicklung des Konzepts für die Neugestaltung beruhte auf zu einem guten Teil auf historischen Forschungsergebnissen, die sich aus der Auswertung einer Vielzahl verschiedener Quellen ergeben haben. Das Wissen um die historischen Stücke, ihre Kontexte und Geschichte bildete den Ausgangspunkt für ein Raumkonzept, das sie jetzt in einen neuen Zusammenhang einfügt. Der spatial turn der Kulturwissenschaften kam hier im Zusammenspiel von moderner Architektur, historischer Raumsituation, historischen Ausstattungsstücken und theologischen Konzepten zu einer Anwendung, die sich seit 2009 in Oldenburg besichtigen lässt. Der hier vorliegende Text gibt Rechenschaft über die konzeptionelle Arbeit, die hinter dem für Stadtbewohner und Touristen inzwischen selbstverständlich gewordenen Raum steckt. In der Rezension im Oldenburger Jahrbuch wurde die konzeptionelle Arbeit für „den Umgang mit Stilkontrasten und Ausstattungsstücken“ gelobt59.
Theologie in der Ammergauischen Frülingslust Die Ammergauische Frülingslust des Oldenburgischen Hofhistoriographen Johann Justus Winkelmann (1620–1699) ist eine weitgehend unbekannte Naturschilderung der Barockzeit und zugleich ein Enkomium für den Oldenburger 58 Rezension von Wolfgang Henninger, in: Oldenburgisches Jahrbuch 108 (2008), 215: „Die Form der Lambertikirche darf aber nach Hennings nicht bloß als aufklärerisches, sondern als dezidiert theologisches Symbol […] interpretiert werden“. Das betont auch Jörgen Welp in seiner Rezension des 2011 erschienen Kirchenführers, Ralph Hennings / Torben Koopmann, St. Lamberti-Kirche in Oldenburg, Berlin [u. a.] 2011, indem die Interpretation der Lambertikirche weiter ausgeführt wurde. In: Oldenburger Jahrbuch 112 (2012), 205–206, hier 205: die Autoren haben „eine wirklich gelungene Darstellung dieses komplexen Gebäudes vorgelegt“. 59 Rezension von Wolfgang Henninger, in: Oldenburger Jahrbuch 112 (2012), 210–211, hier 211.
Einleitung
37
Grafen Anton Günther. In die Neuausgabe dieser Schrift wurden mehrere erläuternde Aufsätze aufgenommen, darunter dieser zur Theologie der Ammergauische Frülingslust. Winkelmann war Theologe und so schreibt er auch diesen Text mit einer erbaulichen Absicht. Die Ammergauische Frülingslust enthält ein klares theologisches Programm: Winkelmann geht es um Gotteserkenntnis aus der Natur, die neben der Gotteserkenntnis aus der Hl. Schrift möglich ist. Er versteht seine Ammergauische Frülingslust als ein augenöffnendes Buch, in dem er die Herrlichkeit Gottes aus der Natur erweist. Sein Werk lässt sich noch nicht der späteren Physikotheologie zuordnen, die versucht, die Existenz Gottes aus der Natur zu erweisen. Winkelmann setzt die Existenz Gottes noch als unbezweifelt voraus. In seiner Schrift weist er auf die Schönheit der, durch die göttliche Vorsehung (providentia) erhaltenen, Schöpfung hin. Er sieht den Zweck der Natur darin, den Menschen zu Gott zu rufen. Viele seiner Ansichten finden sich auch schon bei dem lutherischen Theologen Johann Gerhard. Winkelmann lässt sich damit in die altprotestantische Orthodoxie einordnen. Seine starke Betonung der Tugendlehre, die in der Ammergauische Frülingslust am Beispiel des Grafen Anton Günther exemplifiziert wird, lässt es aber auch zu, ihn in die Nähe des beginnenden lutherischen Pietismus zu rücken. Dass damit eine wichtige Lücke in der Erforschung der „Anton-Günther-Zeit“, also der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, in Oldenburg geschlossen wird, konstatiert die Rezension im Oldenburger Jahrbuch60.
Die Reformationsjubiläen 1817 und 1917 in Oldenburg Die nächste Jahrhundertfeier der Reformation wird bereits vorbereitet. Da ist es naheliegend, die vergangenen Säkularfeiern zu betrachten. Oldenburg ist in der glücklichen Lage, dass von den Reformationsjubiläen 1817 und 1917 umfangreiches Material vorliegt. Die beiden sehr unterschiedlichen Jubiläen lassen sich auch im historischen Rückblick in ihrem Charakter gut beschreiben. Beide fanden in unruhigen Zeiten statt. 1817 lagen die napoleonischen Kriege noch nicht lang zurück. Die restaurative Neugliederung Europas durch den Wiener Kongress begann zu greifen und das Thema der deutschen Einigung stand auf der Tagesordnung. Theologisch herrschte noch die Neologie. Sie gab dem Reformationsjubiläum eine theologische Ausrichtung auf das Thema der „Wiederherstellung“. Mit der in der Aufklärungszeit beliebten Lichtmetaphorik wird 60 Rezension von Torben Koopmann, in: Oldenburger Jahrbuch 113 (2013), 201–202, hier 202: „Hennings stellt […] das theologische Proprium Winkelmanns vor“ und hat „Bezüge zu zeitgenössischen Strömungen namentlich der lutherischen Orthodoxie […] verdeutlicht“. Er resümiert: Das ist ein „gewichtiger Bestandteil zur Erforschung der Kulturgeschichte der Anton-Günther-Zeit“.
38
Einleitung
die Reformation als Wiederherstellung der wahren Kirche verstanden oder als Licht beschrieben, das nach dem dunklen Mittelalter die Wahrheit des Evangeliums wieder an den Tag bringt. In Oldenburg zeigen die Predigten eine erstaunliche konfessionelle Weite und einen insgesamt entspannten Umgang mit der katholischen Kirche. 1917 fand das Reformationsjubiläum im Ersten Weltkrieg statt. Trotz der kriegsbedingten Einschränkungen wurde das Jubiläum in Deutschland flächendeckend gefeiert. Gerade deshalb, weil die ursprünglich geplanten zentralen Feiern in Wittenberg nicht stattfanden, wurde das Jubiläum regional und lokal intensiv vorbereitet und gefeiert. Es herrscht 1917 in ganz Deutschland und so auch in Oldenburg ein anderer Ton in den Jubiläumsfeierlichkeiten. Zum einen spielt der Krieg, eine Rolle, der schon viel zulange dauerte und immer mehr Opfer forderte, unter den Soldaten ebenso wie von der Zivilbevölkerung. Zum anderen war die Person Luthers viel stärker im Fokus und zwar in der am Ende des 19. Jahrhunderts schon einsetzenden Zuspitzung als „deutscher Luther“. Der Burgfriede zwischen evangelischen und katholischen Christen wurde auch in Bezug auf das Reformationsjubiläum eingehalten. Man versuchte – zumindest in Oldenburg – nicht sich auf Kosten der katholischen Glaubensgeschwister zu profilieren. Hier sorgte wahrscheinlich das gemeinsame Erleiden der Kriegsfolgen für eine neue Solidarität zwischen den Menschen. Beide Jubiläen haben auch in Oldenburg einen deutlich nationalen Charakter, vor allem das Jubiläum von 1917 begeht das Reformationsjubiläum im Wesentlichen als Lutherfeier und feiert in ihm einen deutschen Helden, der die im Krieg befindlichen Deutschen durch sein Vorbild stärkt. Der Rückblick auf die Reformationsjubiläen 1817 und 1917 lenkt den Blick nach vorn auf 2017. Für das bevorstehende Jubiläum muss eine andere Schwerpunktsetzung erfolgen. Die Fixierung auf Luther und der massive Nationalismus sollten einer internationalen, gesamtreformationsgeschichtlichen und ökumenischen Perspektive weichen.
Fazit Die hier vorgelegten Arbeiten entstammen drei unterschiedlichen Bereichen der Kirchengeschichte, der Patristik, der Migrationsgeschichte am Beispiel der Russlanddeutschen und der Regional- und Lokalgeschichte am Beispiel Oldenburgs. Dabei gibt es übergreifende Fragestellungen, wie zum Beispiel die Frage nach dem Verhältnis von Christen und Juden. Gemeinsam ist allen Arbeiten die intensive Beschäftigung mit den zu Grunde liegenden Quellen und deren eingehende Interpretation. Die methodischen Zugänge zum ausgewerteten Material variieren. Das Spektrum reicht von der kommentierenden Übersetzung bis zur
Einleitung
39
frömmigkeitsgeschichtlichen Langzeitanalyse. Manche Arbeiten sind inaugurale Forschungen zu Bereichen in denen es keine Vorgängeruntersuchungen gab, andere sind intensiv in den Forschungsdiskurs verwoben und beziehen dort klare Positionen.
Literatur Doris Bachmann-Medick, Cultural Turns. Neuorientierungen in den Kulturwissenschaften, Reinbek bei Hamburg 2006. Irena Backus, The reception of the church fathers in the west. From the Carolingians to the Maurists, 2 Bde. Leiden 1997. Klaus Bade (Hg.): Enzyklopädie Migration in Europa. Vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart, 3. Aufl. Paderborn u. a. 2010. Riccardo Bavaj, Was bringt der „spatial turn“ der Regionalgeschichte? Ein Beitrag zur Methodendiskussion, in: Westfälische Forschungen 56 (2006), 457–484. Thomas Bedorf, Andere. Eine Einführung in die Sozialphilosophie (Sozialphilosophische Studien 3), Bielefeld 2011. Silke-Petra Bergjan / Karla Pollmann (Hg.) Patristic tradition and intellectual paradigms in the 17th Century (Spätmittelalter, Humanismus, Reformation 52), Tübingen 2010. Albrecht Beutel, Vom Nutzen und Nachteil der Kirchengeschichte, Begriff und Funktion einer theologischen Kerndisziplin: Zeitschrift für Theologie und Kirche 94 (1997), 84–110. Thomas Böhm, Zwischen Skylla und Charybdis: Phänomenologische Skizzen zur Kirchengeschichte, in: Bernd Jaspert (Hg.), Kirchengeschichte als Wissenschaft, Münster 2013, 32–41. Hanns Christof Brennecke, Constantin und die Idee eines Imperium Christianum in: Friedrich Schweitzer (Hg.), Religion, Politik und Gewalt (Veröffentlichungen der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Theologie 29), Gütersloh 2006, 561–576. Peter Burke, Offene Geschichte. Die Schule der Annales, Berlin 1991. Elizabeth A. Clark, History, Theory, Text. Historians and the linguistic turn, Cambridge (Mass.) 2004. Ingolf U. Dalferth (Hg.), Wahrheit in Perspektiven. Probleme einer offenen Konstellation (Religion in philosophy and theology 14), Tübingen 2004. Hanno Dockter, Klerikerkritik im antiken Christentum, Göttingen 2013. Volker Henning Drecoll, Das Symbolum Quicumque als Kompilation augustinischer Tradition, in: ZAC 11 (2007), 30–56. Anthony Dupont (Hg.), Tractatio scripturarum. Philological, exegetical, rhetorical and theological studies on Augustine’s sermons. Ministerium Sermonis vol. II (Instrumenta patristica et mediaevalia 65), Turnhout 2012. Christian Eyselein, Rußlanddeutsche Aussiedler verstehen. Praktisch-theologische Zugänge, Leipzig 2006 oder Stefanie Theis, Religiosität von Russlanddeutschen (Praktische Theologie heute 73), Stuttgart 2006. Klaus Fitschen, Wissen wie es war – Verstehen, wie es ist, in: Bernd Jaspert (Hg.), Kirchengeschichte als Wissenschaft, Münster 2013, 66–78.
40
Einleitung
Günter Frank u. a. (Hg.), Die Patristik in der frühen Neuzeit. Die Relektüre der Kirchenväter in den Wissenschaften des 15. bis 18. Jahrhunderts (Melanchthon-Schriften der Stadt Bretten 10), Stuttgart-Bad Cannstatt 2006. Klaus Martin Girardet, Die konstantinische Wende. Voraussetzungen und geistige Grundlagen der Religionspolitik Konstantins des Großen, Darmstadt 2006. Leif Grane u. a. (Hg.), Auctoritas patrum. Zur Rezeption der Kirchenväter im 15. und 16. Jahrhundert, Mainz 1993. Ders. Auctoritas patrum II. Neue Beiträge zur Rezeption der Kirchenväter im 15. und 16. Jahrhundert, Mainz 1998. Andrea Heuser, Vom Anderen zum Gegenüber. „Jüdischkeit“ in der deutschen Gegenwartsliteratur (Jüdische Moderne 11), Köln u. a. 2011. Jakob Hort, Vergleichen, Verflechten, Verwirren. Vom Nutzen und Nachteil der Methodendiskussion in der wissenschaftlichen Praxis: ein Erfahrungsbericht, in: Agnes Arndt / Joachim C. Häberlen / Christiane Reinecke (Hg.), Vergleichen, Verflechten, Verwirren? Europäische Geschichtsschreibung zwischen Theorie und Praxis, Göttingen 2011, 319–341. Georg G. Iggers / Q. Edward Wang / Supriya Mukherjee, Geschichstkulturen. Weltgeschichte der Historiografie von 1750 bis heute, Göttingen 2013, 36–40. Wolfram Kinzig, Brauchen wir eine Dogmengeschichte als theologische Disziplin? in: Wolfram Kinzig / Volker Leppin / Günther Wartenberg (Hg.), Historiographie und Theologie. Kirchen- und Theologiegeschichte im Spannungsfeld von geschichtswissenschaftlicher Methode und theologischem Anspruch (Arbeiten zur Kirchen- und Theologiegeschichte 15), Leipzig 2004. Ulrich H. J. Körtner, Historische und narrative Theologie. Zur theologischen Funktion der Kirchengeschichte, in: Reinhold Mokrosch, Helmut Merkel (Hg.) Humanismus und Reformation. Historische, theologische und pädagogische Beiträge zu deren Wechselwirkung (Arbeiten zur historischen und systematischen Theologie 3), Münster 2001, 185–200. Ders., Offene Fragen einer Geschichtstheorie, in: Ders. (Hg.), Geschichte und Vergangenheit. Rekonstruktion – Deutung – Fiktion, Neukirchen-Vluyn 2007, 1–12. Michael Kohlbacher, Das Symbolum Athanasianum und die orientalische Bekenntnistradition. Formgeschichtliche Anmerkungen, in: M. Tamcke (Hg.), Syriaca II. Beiträge zum 3. deutschen Syrologen-Symposium in Vierzehnheiligen 2002 (Studien zur Orientalischen Kirchengeschichte 33), Münster 2004, 105–164. Günter Kühn, Menschen in der Migration zwischen vertrauter und fremder Tradition. Unter besonderer Berücksichtigung der Situation in der Bundesrepublik Deutschland, Bielefeld 2013. Ulrich Luz, Wirkungsgeschichtliche Hermeneutik und kirchliche Auslegung der Schrift, in: Moisés Mayordomo (Hg.), Die prägende Kraft der Texte. Hermeneutik und Wirkungsgeschichte des Neuen Testaments (Stuttgarter Bibelstudien 199), Stuttgart 2005, 15–37. Christoph Markschies, Kirchengeschichte / Kirchengeschichtsschreibung, in: RGG4 4 (2001) 1169–1179. Johann Baptist Metz, Zukunft aus dem Gedächtnis des Leidens, in: Conc(D) 8 (1972), 399– 407 und Ders. Memoria passionis. Ein provozierendes Gedächtnis in pluralistischer Gesellschaft, Freiburg u. a. 3. Aufl. 2006.
Einleitung
41
Markus Mühling, Traduzianismus, in: RGG4 8 (2005), 530. Kurt Nowak, Wie theologisch ist die Kirchengeschichte? Über die Verbindung und die Differenz von Kirchengeschichtsschreibung und Theologie, in: ThLZ 122 (1997), 3–12. Friederike Nüssel. Theologiegeschichte. Die geschichtliche Realisierung des Themas der Theologie, in: Kinzig u. a. (Hg.), Historiographie und Theologie, Leipzig 2004, 203–221. Jochen Oltmer, Migration im 19. und 20. Jahrhundert (Enzyklopädie deutscher Geschichte 86), 2. Aufl. München 2013. Gert Partoens (Hg.), Ministerium sermonis. Philological, historical and theological studies on Augustine’s Sermones ad populum, (Instrumenta patristica et mediaevalia 53) Turnhout 2009. Ted Peters, Kreatianismus, in: RGG4 4 (2001), 1737–1738. Françoise Petit / Lucas van Rompay / Jos J. S. Weitenberg (Hg.), Eusèbe d’Émèse. Commentaire de la Genese. Texte arménien de l’édition de Venise (1980), fragments grecs et syriaques avec traductions (Traditio Exegetica Graeca 15), Louvain 2011. Rechtfertigung und Freiheit. 500 Jahre Reformation 2017. Ein Grundlagentext des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Gütersloh 2014. Donald A. Ritchie (Hg.), The Oxford handbook of oral history, Oxford u. a. 2012. A. Martin Ritter, Ist Dogmengeschichte Geschichte der Schriftauslegung? In: Stimuli. Exegese und ihre Hermeneutik in Antike und Christentum. Festschrift für Ernst Dassmann, hg. v. Georg Schöllgen, (JBAC.E 23), Münster 1996, 1–17. Gabriele Rosenthal / Viola Stephan / Niklas Radenbach, Brüchige Zugehörigkeiten. Wie sich Familien von „Russlanddeutschen“ ihre Geschichte erzählen, Frankfurt am Main u. a. 2011. Rolf Schäfer, Ortskirchengeschichte und allgemeine Kirchengeschichte. Gedanken zu einer oft verkannten Wechselbeziehung, in: Jahrbuch der Gesellschaft für Niedersächsische Kirchengeschichte 95 (1997) 385–389. Friedrich Schleiermacher, Kurze Darstellung des theologischen Studiums zum Behuf einleitender Vorlesungen, 2. Aufl 1830, in: Ders., Kritische Gesamtausgabe I. Abt. Bd. 6, Berlin 1998. Jörg Schönert, Zum Status und zur disziplinären Reichweite von Narratologie, in: Vittoria Borsò / Christoph Kann (Hg.), Geschichtsdarstellung. Medien – Methoden – Strategien (Europäische Geschichtsdarstellungen 6), Köln u. a. 2004, 131–143. Beverley Southgate, Postmodernism in History. Fear or Freedom?, London 2003. Gerd Steinwascher, Die Oldenburger. Die Geschichte einer europäischen Dynastie, Stuttgart 2. Aufl. 2012. Wladimir Süss, Das Schulwesen der deutschen Minderheit in Russland von den ersten Ansiedlungen bis zur Revolution 1917 (Bildung und Erziehung Beiheft 13), Köln u. a. 2004. Klaus Tanner (Hg.), Christentumstheorie. Geschichtsschreibung und Kulturdeutung, Trutz Rendtorff zum 24. 01. 2006 (Theologie, Kultur, Hermeneutik 9), Leipzig 2008. Martin Wallraff, Kirchengeschichte im Spannungsfeld von Theologie und Kulturwissenschaft, in: VuF 54 (2009), S. 55–64. Robert E. Winn, Eusebius of Emesa: Church and Theology in the Mid-Fourth Century Washington D.C. 2011.
Disputatio de origine animae (CPL 633,37), or the victory of creatianism in the fifth century
Introduction The human soul is an enigmatical being and many scholars have attempted to solve its mysteries. A key to many puzzles seems to be the answer to the question of the origin of the soul. For this reason the Church Fathers also developed theories on this subject. They found three ways to explain the generation of body and soul1. The first to give an elaborate theory of the soul’s origin was Tertullian. As he wrote with a strong antignostic impact he did not stress the division between body and soul, but the junction between them. He developed the socalled traducianist theory which claimed both substances flesh and soul to be carried by the seed. Clement of Alexandria laid the foundations for the opposite position which claimed each soul to be individually created by God for an already moulded body. Origen modified this creatianist theory and taught the preexistence of all souls. His position was defended by his pupils Pamphilus and Didymus Blind2, but rejected by most of the ecclesiastical authors3. Both theories, creatianism and traducianism were advanced and modified in the following times. They found supporters in the Latin West as well as in the Greek East. For example creatianism was propagated by Lactancius4, the older Arnobius5, Ambrose of Milan6, Gregory of Nazianzus7, John Chrysostom8 and Theodoret9 whilst 1 For a general survey see: Heinrich Karpp, Probleme altchristlicher Anthropologie. Biblische Anthropologie und philosophische Psychologie bei den Kirchenvätern des dritten Jahrhunderts (Beiträge zur Förderung christlicher Theologie 44), Gütersloh 1950. 2 Heinrich Karpp, Probleme, 240. 3 E. g. Cyril of Jerusalem, Catechesis 4,18–20, PG 33, 477–481; Gregory of Nyssa, De anima et resurrectione dialogus, PG 45, 113B-C; 116C, Epiphanius of Salamis’ letter to John of Jerusalem (= Jerome, Ep. 51,4), CSEL 54, 400–403. 4 Lactancius, De opificio dei, vel de formatione hominum 17,1–19,6, CSEL 27, 55,7–61,9. 5 Arnobius, Adversus nationes II,14–62, CSEL 4, 59–98. 6 Ambrose’s position has been questioned cf. Heinrich Karpp, Probleme, 241f. An investigation of his various statements concerning the human soul shows a clear tendency to stress the division between body and soul, e. g. Exameron VI 6,39, CSEL 32,1 231,1–3 and VI 7,42–47,
44
Disputatio de origine animae (CPL 633,37) ), or the victory of creatianism
traducianism was supported by Pseudo-Athanasius10, Gregory of Nyssa11 and Apollinaris of Laodicea12. There was no dogmatic debate on this subject13 and both theories found supporters in every generation. The question was still undecided in the time of Augustine. Jerome espoused the creatianist side14. He emphasized the weight of a biblical reference which finally became a cornerstone for the creatianists: John 5,17 ‘My father is working still, and so I am working’. From this quotation he argued that up to now God is creating new souls15. Augustine on the other hand was unsatisfied with traducianism and searched to solve his major problem: how to combine the doctrine of original sin with the creatianistic theory16. In the Pelagian controversies the question of sin and how it was linked to the generation of man became a subject of close attention. Therefore Augustine wrote in 415 to Jerome17 (Ep. 166), knowing that he supported creatianism. But Jerome did not respond and finally died without answering Augustine’s letter. Augustine found no way of combining of creatianism with the doctrine of original sin. He never made a decision in favour of either of the theories18. In spite of this refusal, he was interpreted as a ‘traducianist’ by his enemies such as Julian of Eclanum and Annianus of Celeda19. And without any
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19
CSEl 32 233,15–238,4 or De Isaac vel anima 2,3–5, CSEL 32,1 643,16–645,6. In treating the story of Eve’s creation in his De paradiso Ambrose expresses himself even more clearly. The creation of Eve’s body with the help of Adam’s rib is distinguished from the creation of Eve’s soul which cannot be brought forth by the flesh. Adam does not see ‘soul from his soul’ but ‘bones from his bones and flesh from his flesh’ (cf. Gen 2,23). For Ambrose this is the way human beings are generated; De paradiso 11,50–51, CSEL 32,1 307,22–25. Gregory of Nazianzus, Oratio 38,11, PG 36,321C-323B. Chrysostom, Homilia in Genesim 13,2, PG 53, 106–107. Theodoret, Haereticarum fabularum compendium V,5, PG 83, 466B. (Ps.) Athanasius, Quaestiones ad Antiochenum q. 15 and 17, PG 28, 605–608. Gregory of Nyssa, De anima et resurrectione dialogus PG 45, 125B-C and De hominis opificio PG 44 234D-240B and 253B: ‘Τὸ γὰρ προκείμενον ἦν δεῖζαι τὴν σπερματικῆν τῆς συσθάσεως ἡμῶν αι᾿τίαν, μήτε ἀσόματον εἶναι ψυχὴν, μήτε ἄψυχον σῶμα’. Heinrich Karpp, Probleme, 240. This is Rufinus’ explicit statement as he is questioned on this topic. Rufinus, Apologia ad Anastasium 6, CCL 20, 27,13–16. Georg Grützmacher, Hieronymus, vol. 3, 260f., Berlin 1908, 2nd reimpression Aalen 1986. Jerome, Ep. 126,1 written to the african tribunus Marcellinus and his wife Anapsychia. Augustine knew this letter. Pier Franco Beatrice, Tradux peccati. Alle fonti dell dottrina agostiniana del peccato originale (SPMed 8), Mailand 1978, p. 99–104; 111; 140 etc. gives a survey of Augustine’s various statements. See also Robert J. O’Connell, The Origin of the Soul in St. Augustine’s Writings, New York 1987. Augustine, Ep. 166 Ad Hieronymum. Adolf von Harnack, Lehrbuch der Dogmengeschichte II, Freiburg i.Br. 18882 p. 134: ‘Der größte Theologe des Abendlandes, Augustin, hat zu keiner festen Ansicht über den Ursprung der Seele gelangen können’. Annianus of Celeda, Preface to his Latin translation of seven homilies of John Chrysostom, De laudibus S. Pauli Apostoli PG 50, 472; Julian of Eclanum in Augustine’s Contra Julianum
Disputatio de origine animae (CPL 633,37) ), or the victory of creatianism
45
deference to Augustine’s hesitations, creatianism became the leading theory in the Middle Ages20. Popes such as Leo IX (1049–54)21 and Benedict XII22 and the Fifth Council of the Lateran (1512–17)23 asserted creatianism as official doctrine and thus it remained in the Roman Catholic Church until today24.
Disputatio de origine animae I would like to draw attention to a largely neglected piece of patristic literature which might provide more evidence on the question of how creatianism became the scholastic doctrine of the human soul’s origin25. It is the anonymous Disputatio de origine animae as it is titled in the manuscripts. Although it is edited in Migne’s Patrologia Latina as Ep. 37 among the ‘Spuria et Dubia Hieronymi’26 and registered by Dekkers in his Clavis with the number 633,37, patristic discussion has nearly completely ignored it. After the Second World War the ‘Dispuatio’ is mentioned only twice, in 1946 in A. Michel’s article on traducianism in the Dictionaire de la théologie catholique27 and in 1992 by E. A. Clark in her excellent study on the Origenist controversy28. The only attempt to establish a date and to give clues to the authorship was made by H. von Schubert over ninety years ago in a codicological appendix to his book on the so-called Praedestinatus29. The text is a unity30, consisting of a prologue, a disputation between Augustine and Jerome as the main part, and an epilogue which is included in Jerome’s last
20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
(Opus imperfectum), CSEL 85/1 92,1f et al. Characteristic of Pelagian polemic against Augustine seems to be the combination of accusing him of still being a Manichean and at the same time a ‘traducianist’. Cf. Elizabeth A. Clark, The Origenist controversy, Princeton, 1992, 218. Heinrich Karpp, Probleme, 246 affirms in spite of Augustine’s undecisivness that his influence helped creatianism to a victory in the Middle Ages. Denzinger/Hünermann, Enchiridion symbolorum 37th ed., Freiburg/Breisgau 1991, No. 685. Denzinger/Hünermann, No. 1007. Denzinger/Hünermann, No. 1440. Catechism of the Catholic Church, No. 366. Elizabeth A. Clark, Origenist controversy, 243 has noticed the importance of the Disputatio as she remarks that it tries to fill a ‘hole’ Augustine has left, as he did not solve the problem of combining the doctrine of original sin with a theory of the origin of the soul. ‘The outstanding ‘hole’ in Augustine’s theory […] is made embarrassingly manifest in a piece preserved as Pseudo-Jerome, Epistle 37’. PL 30, 270–280. A. Michel, Traducianisme, DThC XV/1 (1946), 1354. Elizabeth A. Clark, Origenist controversy, 243. Hans von Schubert, Der sogenannte Praedestinatus. Ein Beitrag zur Geschichte des Pelagianismus (TU 24/IV), Leipzig 1903, Anhang über den Codex Augiensis CIX s.IX, p. 135–140. In some of the manuscripts the text is divided in two parts: prologue and disputaion are separated e. g. Wolfenbüttel Cod. Guelf 51. Gud lat 2o (s.xii); Oxford, Bodleian Library Raw-
46
Disputatio de origine animae (CPL 633,37) ), or the victory of creatianism
statement of the disputation. The main part – in which Augustine and Jerome dispute – is put together like a mosaic from several different writings of these two. In this feigned dialogue the question of the origin of the soul is discussed, especially the alternative between traducianism and creatianism. The dispute ends with a clear victory of Jerome and the creatianistic theory.
Prologue The author opens the prologue with an encomiastic paragraph in which he praises the splendour of knowledge and the prudence of his unnamed addressees. He himself seems to live on an island, as he says that his addressees deign to draw information from him being just a dribbling insular rill31. He pretends to be able to translate Greek into Latin, but a careful investigation shows that he only cites Origen twice and both quotations are taken from Rufinus’ Latin translations32. But the mere fact that he cites Origen without any hesitation is noteworthy. The subject of the origin of souls is so closely linked with those teachings of Origen which were regarded as heretical, that this quotation points to an early date of the Disputatio. Than follows a survey of the different opinions on the question of the origin of the soul. The creatianistic and traducianistic authors are listed. The author’s own comments show a tendency towards creatianism. For that reason he stresses the division between the sinful body and the eternal soul33. He even draws in the pagan figure Kleombrotus34, of whom it is said that he gained courage for his suicide from Plato’s Phaidon, where the immortality of the human soul is a major subject. Back to the christian tradition the author cites two of the most important quotations from the Holy Scripture as the foundations for creatianism and traducianism: John 5,17 and Gen. 46,26. First he quotes John 5,17 as the main scriptural proof for creatianism. With this quotation he claims to follow Victorinus of Pettau, Jerome and the majority of the catholic Christians. At this point he introduces Augustine – the problematic figure in his text. Gen. 46,26 is cited as an example for Augustine’s arguments in favour of traducianism. But the author of
31 32 33 34
linson C 279 (s.xii). In the manuscript 10.059 of the Bibl. Nac. in Madrid (s.xiv) the prologue is attributed to Cassiodorus. PL 30, 270A. Origen, De principiis I. Praef. 5 ed. Koetschau GCS 22, 13,7–11; and a passage from the Commentary to Paul’s Letter to Titus which is quoted in Rufinus’ translation of Pamphilus’ apology for Origen; Pamphilius, Apologia pro Origene IX, PG 17, 604B. PL 30, 271C. Kleombrotus Ambrakiota, a pupil of Socrates mentioned in Phaidon 59c and in Lucian, Philopat. 1, where the story of his suicide is told.
Disputatio de origine animae (CPL 633,37) ), or the victory of creatianism
47
the Disputatio supposes that Augustine follows creatianism and is ready to show this in his own writings if they were only read correctly. Therefore, he has to neglect Augustine’s scruples concerning the original sin and the punishment for children dying unchristened. This paragraph already shows the intention of the whole opus: Augustine has to be freed from the blame of being a ‘traducianist’. Therefore, in the dialogue he must be convinced of the superiority of creatianism. Traducianism is made a heresy, in accordance with some Pelagian arguments. In the following passage two other authorities are invoked, a bishop called Gaudiosus and Ambrose of Milan. Gaudiosus might give some clues towards an identification of the author, because the only bishop with this name known to us is Gaudiosus from Naples who died in the second half of the fifth century35. The author discussed his matter with Gaudiosus, but he gives no quotation or clear statement of his position. But Ambrose of Milan is quoted and strengthens the position of the creationists, whereas the author polemizes more and more against traducianism. He draws a parallel between traducianism and the older heresy of Photinianism, as both reject the creation of the soul36. Then it is attacked with an absurd argument from the story of Adam and Eve. As in the creation of Eve no conception took place, a traducianist would have to suppose that the soul was in the rib and torn into two pieces. In the following paragraphs he argues strongly for the uncorporeality of the soul, its divine creation and insufflation into the already existing body of the unborn. At the end of his argument our author has to dispute against a particular group of traducianists who assert that the soul comes from the woman and the body from the man. He sees the reason why this idea is popular, in the question of the conception of Jesus, where no man was involved. But he reacts very indignantly to this idea because it undermines the authority of the male sex. The introduction closes abruptly with an anathematization of those who do not believe that souls were daily created for single bodies by God, like the example of Adam the first man. This sentence was not formulated by the author. It is a quotation from a list of twelve anathemas, which forms the major part of the ‘libellus de fide’ of Pseudo-Rufinus37. This anathematization seems to be of great importance for our author; he uses it once again as third from the last statement in the disputation between Augustine and Jerome.
35 See ‘Gaudiosus 4’ in: André Mandouze, Prosopographie de l’Afrique chrétienne, Paris 1982, 528. 36 This is a difference to Pelagian polemic against traducianism, where often the parallel to Manichaeism is drawn. 37 Cf. Eligius Dekkers, Clavis Patrum Latinorum vol. 3, Steenbrügge 1961 2nd ed., Nr. 199. The author is unknown. The text in the version of the Collectio palatina is printed in ACO I/v 5,25f. In the manuscript tradition it is often connected with Marius Mercator’s Commonitorium. Both texts show a clear anti-Pelagian (and anti-Origenistic) attitude.
48
Disputatio de origine animae (CPL 633,37) ), or the victory of creatianism
Disputation The following disputation between Augustine and Jerome is compiled completely from their own writings. A list of the identified quotations would take too much space in this paper. It will be published in a planned translation with notes. To give an idea of how well the author knew his two Church Fathers, I add an analysis of a single statement made by Jerome in the disputation (see appendix). It is evident that the author in masterly fashion combines texts from different works of Jerome – and also of Augustine – to produce a coherent new text. He must have had an intimate knowledge of all the relevant texts and a library which supported him with the manuscripts. Altogether fourteen different works of Augustine and Jerome are used38. The structure of the disputation follows Augustine’s already mentioned Ep. 166 in which he asked Jerome for a convincing theory of creatianism. In the disputation Augustine therefore appears as the asking partner and Jerome as the teacher. He seems to accept Jerome’s position very quickly and without contradiction39. After that they search together for arguments to defend the creatianistic point of view. Then Augustine gets a chance to utter his hesitations concerning original sin and the destiny of little babies dying unchristened40. But Jerome gives only unsatisfying answers to these urgent questions. He refers to biblical passages and to the necessity of a common fight against heresy41. At the end of the dispute both agree in condemning traducianism42. The last statement is reserved for Jerome the winner of the disputation. But it is the author himself who gives his résumé under Jerome’s name. In this last paragraph it becomes clear that the author has done his work in response to a special request. He characterizes his task as follows: ‘See what I have done with God’s grace, I did what you wanted and what I could: Following the example of the first man and the word of the Saviour, I gave a reason for the soul, which is daily created and given to the already moulded body’43. With some satisfaction the author also gives an account on his own method to his addressees: ‘I restored their sentences from many of their works. Doing this I have made very accurate inquiries with careful attention to their specialities. Thus I have made them speak 38 The quoted works are Augustine’s De diversis quaestionibus, Letters 73, 82, 166, 190, 202A and Jerome’s Dial. c. Pelagianos, Comm. in Eccl., Comm. in Jonam, Comm. in Ev. Matth., Epp. 58, 115, 126 and 134. 39 PL 30, 275. 40 PL 30, 276–278. 41 PL 30, 278–279. 42 Augustine’s Ep. 190 to Optatus is quoted twice and Jerome repeats the anathematization already known to the reader of the dialogue. 43 PL 30, 279.
Disputatio de origine animae (CPL 633,37) ), or the victory of creatianism
49
like people being present.’ His veneration for the two Church Fathers finds its expression in the use of two metaphors. He compares them with the two anointed sons of Zech. 4,1444 and reuses his introductory metaphor. The author again compares himself with the little water of a dribbling liquid and Augustine and Jerome with the watering plenty of overflowing rivers.
Intention, date and authorship of the Disputatio The intention of the Disputatio is obvious. The author wants to make creatianism the winner of a dogmatic controversy. He is not an adherer of Augustine’s teaching concerning original sin, but he secures Augustine’s integrity against the Pelagian accusation of being a ‘traducianist’. Thus he is able to use Augustine’s authority for his creatianistic position. The literary genre of a dialogue or a disputation45 can be regarded as an adequate medium to present such a controversy. The person or group who asked the author for information on this controversy could in this way more easily digest the complicated matter of the discussion. The author had the opportunity to fill a literary lacuna, which was left open by Jerome’s missing answer to Augustine’s letter (Ep. 166)46. In the manuscript tradition the Disputatio therefore was sometimes incorporated in collections of the letters of Augustine and Jerome. But when was the Disputatio written? Some external dates can be assumed. The terminus post quem is the death of Augustine in 430. The general background is set by the Pelagian controversies. A possible terminus ante quem might be Ep. 6 of Anastasius II (496–8)47 the first official statement of the Roman Church in which traducianism is treated as a ‘new’ heresy48 which spread in Gaul. More information can be gleaned from the text itself. First the already mentioned frank quotation of Origen which is an indication of an early date, as Origen 44 PL 30, 280: ‘duos pinguedinis libros, Augustinum videlicet et Hieronymum assistentes’. The Vulgate has ‘duo filii olei’ in Zech. 4,14 but in Jerome’s Commentary the version ‘duo filii pinguedinis’ is given; Jerome, Comm. in Zech. I,4 l.235f (CCL 76). 45 For a distinction between the genre ‘dialogue’ and the subgenre ‘disputation’ see Bernd Heiner Voss, Der Dialog in der frühchristlichen Literatur (STA 9) München 1970, 349–352. 46 A parallel phenomenon in Jerome’s oeuvre is the refutation of Porphyry’s Against the Christians. Jerome often mentioned his intention of writing a suitable answer but he never fulfilled this announcement. Finally, the Rhetor Latinius Pacatus Drepanius filled the gap and wrote a treatise aganist Porphyry; cf. Pierre Courcelle, Les lettres grêcques en Occident, Paris 1948, 2nd ed., 211f. 47 Anastasius II, Ep. 6 ad universos episcopos per Gallias constitutos, in: Andreas Thiel, Epistolae romanorum pontificium genuinae, vol. 1, Braunsberg 1868, 634–637. Partially in: Denzinger/Hünermann, No.360–361. 48 Anastasius II, Ep. 6 3,6 and 5,8 Andreas Thiel, Epistolae, 635, 637.
50
Disputatio de origine animae (CPL 633,37) ), or the victory of creatianism
was considered more and more a heretic in the fifth century. Second the name of the bishop Gaudiosus, with whom the author had conversations on the question of the origin of the soul. Gaudiosus was bishop of Naples where his epitaph is preserved. A hagiographical text of the tenth century says that he was the former bishop of Abitina in the proconsular province and was expelled from North Africa by the Vandals49. He died about 45250. As the author speaks of him of ‘a martyr living in our times’51 it can be supposed that the Disputatio was written during his lifetime or shortly after his death. This would bring us to the middle of the fifth century. The question of the authorship has been fascinating ever since this anonymous tractate came into existence. Already in the ninth century Reginbert, a famous librarian of the monastery of Reichenau, attributed it to Paulus Orosius52 and in the 13th and 14th centuries two manuscripts claim Cassiodorus as the author of the prologue53. Both attributions are improbable. For a serious identification of a possible author four points have to be taken into consideration: 1) the metaphorical use of the terms island, water, river etc., 2) the mention of Gaudiosus, 3) access to a good library and 4) an anti-Augustinian attitude in the question of original sin. In the middle the fifth century there are just a few regions in the Latin West where all conditions are fulfilled. I would nominate only two places where the author could be found: Lerins and Rome. Further investigations 49 André Mandouze, Prosopographie 528. This information fits a story told by Victor of Vita of the bishop of Carthage, Quodvultdeus, banished by Genseric a. d. 440 together with a greater number of clerics. They sailed to Naples. Gaudiosus could have been one of the clerics who stayed at Naples. Victor of Vita, Historia persecutionis africanae provinciae I,15, CSEL 7, 8,3–10. 50 Cf. ‘Gaudiosus 1’ in: A Dictionary of Christian Biography, Literature, Sects and Doctrines ed. by W. Smith / H. Wace, vol. 1, London 1877, 614. 51 This is a conjecture of the printed text in PL 30, 272, where nostrisque temporibus unus martyr is given. Several manuscripts clearly read vivus, which makes more sense especially as the time of the Vandals and Visigoths was full of martyrs. The expression vivus martyr would again fit a supposed expulsion from Africa by Genseric. See also Hans von Schubert, Praedestinatus, 138. 52 Badische Landesbibliothek Karlsruhe Aug.Perg. XVIII (s.ix) and Aug.Perg. CIX (s.ix). The codex CIX is a famous collection of creeds written around 806. The date is given by Karl Preisendanz, Reginbert von der Reichenau. Aus Bibliothek und Skriptorium des Inselklosters, in: Neue Heidelberger Jahrbücher N. F. 1952/53, 25. A monography has been written on this manuscript: Karl Künstle, Eine Bibliothek der Symbole und theologischen Traktate zur Bekämpfung des Priscillianismus und westgotischen Arianismus aus dem VI. Jahrhundert, Mainz 1900 and Hans von Schubert, Praedestinatus, uses this codex as a main source for his work on the so-called Praedestinatus. The attribution of the Disputatio to Orosius exhibits Reginbert’s knowledge of the Fathers, but von Schubert has already demonstrated that it is highly improbable, op. cit., 136–138. 53 Paris, Bibl.nat.lat. 1889 (s.xiii) and Madrid, Bibl.nac. 10.049 (s.xiv): ‘Disputatione prologus de ratione animae Cassiodorus’. The attribution to Cassiodorus does not fit into the period assumed for the origin of the disputation and, whoever had the idea did not take into consideration the clamp formed by the prologue and the epilogue which guarantees the unity of the whole text.
Disputatio de origine animae (CPL 633,37) ), or the victory of creatianism
51
may bring more elucidation to this question. But even without solving the question of the authorship it can be assumed that the Disputatio has had an influence on the victory of creatianism as the official dogma of the Latin Church. It was very often copied – B. Lambert lists 101 manuscripts54 – partly because it was incorporated in some collections of the letters of Augustine and Jerome55, but it circulated also in other streams of the patristic heritage. The Disputatio seems to have found attentive readers. Its influence may be traced in the aforementioned letter of Anastasius56 and later on in several statements concerning the question of the origin of the human soul.
Appendix Example for the composing technique in the Disputatio (biblical citations in italics)
Dial. c. Pelagianos II,4 21–25
PL 30, 275C Jerome: Alienati sunt peccatores a vulva: erraverunt ac utero: locuti sunt falsa (Ps 57,4 LXX): statim ut nati sunt subjacuere peccato, in similitudinem praevaricationis Adae, qui est forma futuri (Rom 5,14).
Dial. c. Pelagianos II,4 35–39
Illud quoque quod in volumine Job scriptum est: Numquid mundus erit homo coram Deo, aut in operibus suis irreprehensibilis vir? Si adversus famulos suos non credit: et contra angelos suos pravum quid reperit: quanto magis in his qui habitant domos luteas (cf Job 4,17–19): e quibus et nos de eodem luto sumus?
Comm. in Jonam III,5 89–93
Nullus enim absque peccato, ne si unius quidem diei fuerit vita eius (cf Job 14,4f). Si enim stellae sunt mundae in conspectu Dei, quanto magis vermis et putredo (Job 25,5f); et hi qui peccato offendentis Adam tenentur obnoxii!
54 Bernard Lambert, Bibliotheca Hieronymiana manuscripta (IP 4), vol. 3a, The Hague 1970, 144–148. 55 The Disputatio is connected with different types of collection of the second part of the correspondence between Augustine and Jerome. A premilary survey gives Ralph Hennings, Der Briefwechsel zwischen Augustinus und Hieronymus und ihr Streit um den Kanon des Alten Testaments und die Auslegung von Gal. 2,11–14 (SVigChr 21), Leiden 1994, 362–383. 56 Anastasius II, Ep. 6, see note 47.
52
Disputatio de origine animae (CPL 633,37) ), or the victory of creatianism
Bibliography Pier Franco Beatrice, Tradux peccati. Alle fonti dell dottrina agostiniana del peccato originale (SPMed 8), Mailand 1978. Elizabeth A. Clark, The Origenist controversy, Princeton, 1992. Robert J. O’Connell, The Origin of the Soul in St. Augustine’s Writings, New York 1987. Eligius Dekkers, Clavis Patrum Latinorum vol. 3, Steenbrügge 19612. Georg Grützmacher, Hieronymus, vol. 3, 260f., Berlin 1908, 2nd reimpression Aalen 1986. Adolf von Harnack, Lehrbuch der Dogmengeschichte II, Freiburg i.Br. 18882. Ralph Hennings, Der Briefwechsel zwischen Augustinus und Hieronymus und ihr Streit um den Kanon des Alten Testaments und die Auslegung von Gal. 2,11–14 (SVigChr 21), Leiden 1994. Heinrich Karpp, Probleme altchristlicher Anthropologie. Biblische Anthropologie und philosophische Psychologie bei den Kirchenvätern des dritten Jahrhunderts (Beiträge zur Förderung christlicher Theologie 44), Gütersloh 1950. Karl Künstle, Eine Bibliothek der Symbole und theologischen Traktate zur Bekämpfung des Priscillianismus und westgotischen Arianismus aus dem VI. Jahrhundert, Mainz 1900. Bernard Lambert, Bibliotheca Hieronymiana manuscripta (IP 4), vol. 3a, The Hague 1970. André Mandouze, Prosopographie de l Afrique chrétienne, Paris 1982. A. Michel, Traducianisme, DThC XV/1 (1946), 1354. Karl Preisendanz, Reginbert von der Reichenau. Aus Bibliothek und Skriptorium des Inselklosters, in: Neue Heidelberger Jahrbücher N. F. 1952/5, 1–49. Hans von Schubert, Der sogenannte Praedestinatus. Ein Beitrag zur Geschichte des Pelagianismus (TU 24/IV), Leipzig 1903. W. Smith / H. Wace (Eds), A Dictionary of Christian Biography, Literature, Sects and Doctrines, vol. 1, London 1877. Andreas Thiel, Epistolae romanorum pontificium genuinae, vol. 1, Braunsberg 1868. Bernd Heiner Voss, Der Dialog in der frühchristlichen Literatur (STA 9) München 1970.
Disputatio de origine animae (CPL 633,37)1 – Übersetzung
Die Übersetzung2 dieses weitgehend unbekannten spätantiken Text ist eine späte Frucht des Heidelberger „Kirchenväterkolloquiums“. Im Wintersemester 1986/87 wurde dort der Briefwechsel zwischen Augustinus und Hieronymus gelesen. In der handschriftlichen Überlieferung dieses Briefwechsels markiert die „Disputatio“ häufig den Abschluss des zweiten Teils der Briefsammlung Inhaltlich füllt die „Disputatio“ eine Lücke in der Korrespondenz zwischen Augustinus und Hieronymus. Auf Augustins drängende Fragen zur Entstehung der Seele hat Hieronymus nicht mehr substantiell geantwortet. Diese Antwort holt die „Disputatio“ nach, indem sie aus verschiedenen Schriften der beiden ein Gespräch fingiert3. Dazu bedient sich der anonyme Autor einer großen Anzahl von Zitaten, die er akribisch genau zusammenfügt4. Diese Kompositionstechnik beherrscht der Autor meisterhaft. Inhaltlich trägt diese kleine Schrift dazu bei, das Problem der Entstehung der Seele im Rahmen der theologischen Diskussionen der Spätantike im Sinne des Kreatianismus zu entscheiden. Der Kreatianismus ist die Lehre von der Neuschöpfung jeder einzelnen Seele durch Gott zum Zeitpunkt ihrer Zeugung. Der Traduzianismus als konkurrierende Auffassung geht davon aus, dass die Seele zusammen mit dem menschlichen Samen übertragen wird. Augustinus kann trotz eines generellen Unbehagens am Traduzianismus einige Elemente dieser Vorstellung gut mit seiner Sünden- und Gnadenlehre vereinbaren. In der „Disputatio“ werden seine diesbezüglichen Einwände allerdings durch Texte des Hieronymus 1 Der Text ist ediert unter dem Titel De origine animarum. Dialogus sub nomine Hieronymi et Augustini als Ep. 37 unter den Spuria et Dubia Hieronymi in: PL 30 (1865), 270–280. Die Benennung als „Disputatio“ geht auf die handschriftliche Tradition zurück. 2 Diese Übersetzung wäre ohne die freundliche Hilfe von Prof. Dr. Hans Armin Gärtner nicht zu Stande gekommen. Dafür sei ihm an dieser Stelle herzlich gedankt. Alle Fehler und Ungenauigkeiten liegen allein in meiner Verantwortung. 3 Vgl. zur inhaltlichen Einordnung dieses Textes: Ralph Hennings, Disputatio de origine animae (CPL 633,27) or the victory of creatianism in the fifth century, in: StPatr 29 (1997), 260–268. 4 Im Dialogteil benutzt der Autor insgesamt 14 verschiedene Schriften, die in der Übersetzung jeweils am Ende des Zitats einzeln nachgewiesen werden.
54
Disputatio de origine animae (CPL 633,37) – Übersetzung
beiseite gewischt und so am Ende dem Kreatianismus zu einem glänzenden Sieg verholfen.
Disputatio de origene animae Einleitung I. Da bei euch der himmlischen Beredsamkeit reinster Quell ist und aller Wissenschaften Ströme sich ergießen und völlige Besonnenheit des Hauptes (auch) alle eure Glieder in festem Griff hält, wundere ich mich staunend – mit schreckstarrem Verstand – warum ihr geruht, die Tropfen eines Insel-Bächleins zu schöpfen, ihr glänzenden Strahlen, um dem schwachen Körper zu Hilfe zukommen. Lieber bringe ich also das, was ich aus griechischen Quellen entlehnt habe, für Dürstende herbei und leite der Lateiner allerklarste Flüssigkeiten in das Innerste eurer Herzen. II. Origenes also, der über die Seele kein eigenes Buch geschrieben hat, erwähnt die Seele in der Übersicht über die kirchliche Verkündigung und sagte folgendes: „Über die Frage jedoch, ob die Seele derart aus der Übertragung (ex traduce) durch den Samen herrührt, dass ihr Wesen oder ihre Substanz in dem materiellen Samen [d. h. in den Spermien, R.H.] selbst beschlossen läge, oder ob sie einen anderen Ursprung hat, und ob dieser Ursprung selbst geworden ist oder ungeworden; oder zumindest über die Frage, ob sie von außen in den Leib eingefügt wird oder nicht, darüber entscheidet die Verkündigung nicht mit hinreichender Deutlichkeit.5“ So schreibt er auch in dem Buch über den Brief an Titus, dort sagt er: „Wenn jemand nach dem Wesen der menschlichen Seele fragt, weil über sie die kirchliche Lehre weder überliefert, dass sie durch die Übertragung des Samens eingeführt wird, noch dass sie höher stehend und ehrenvoller als das Gefüge der Körper sie. Deswegen konnten viele nicht verstehen, das man anders über den Ursprung der Seele denken müsse und auch die, die anderes zu denken oder zu diskutieren schienen, werden von manchen verdächtigt, irgendetwas Neues einführen zu wollen“6. Das gleiche vertritt Origenes selbst in den zuvor erwähnten kleinen Werken, ähnlich sagen es aber auch Eusebius von Caesarea, der Märtyrer Pamphylius, Basilius, Gregor, Didymus und Rufinus in ihren Werken: Es seien alle Seelen von einer Substanz, unsterblich und vernunftbegabt, 5 Das Zitat stammt aus Rufins Übersetzung des Prooemiums von De principiis. Die deutsche Übersetzung folgt Herwig Görgemanns / Heinrich Karpp, Origenes, Vier Bücher von den Prinzipien, Darmstadt 1985, 93. 6 Es folgen einige Zitate aus Rufins Übersetzung des 1. Buches der Apologia pro Origine des Pamphilius, cap. IX, PG 17, 604B.
Disputatio de origine animae (CPL 633,37) – Übersetzung
55
mit freier Entscheidung und Willen, sie müssten auch gerichtet werden für das, was sie in diesem Leben getan haben. Sie seien dennoch von Gott erschaffen, der alles erschaffen und gegründet hat. Wann seien sie aber erschaffen worden, einst zugleich, oder jetzt für die einzelnen, die geboren werden7? Was, sagen sie, sind die Gefahren, wenn man eines von beiden annimmt? Athanasius, Hilarius und Ambrosius wird vorgeworfen [sie würden lehren, R.H.], dass den bereits im Mutterleib vorgebildeten und ausgeformten Körpern dann – zu diesem Zeitpunkt – Seelen erschaffen und in den schon geformten Körper eingepfropft werden8. III. Aber jene nun, die behaupten, dass die Seelen aus der Fortpflanzung kommen und dass sie zugleich mit den körperlichen Samen empfangen werden, zumal ja einige von ihnen zu bekräftigen pflegen, dass die Seele nichts anderes ist als die Einhauchung des Geistes Gottes, jene freilich, die Gott – wie man sagt – am Anfang der Weltschöpfung Adam eingehaucht habe. Sie vertreten die Ansicht, dass die Seele unmittelbar von göttlicher Substanz sei. Wie wird nicht enthüllt werden, dass sie dies gegen die Richtschnur der Schrift und gegen die Grundsätze der Frömmigkeit behaupten, dass es die Substanz Gottes ist, die sündigt, wenn eine Seele, die von der Substanz Gottes ist, sündigt und dass sie wegen der Sünde darüber hinaus auch noch der Strafe unterworfen werden muss. Aber sie sehen nicht, in welche Absurdität sie hineinlaufen: Es wäre dann nämlich notwendig, dass die Seele zugleich mit dem Körper stürbe und sterblich sei, wenn sie zugleich mit dem Körper empfangen, geformt oder geboren wird.9 IV. Dann weiter jene, das sind Apollonius, Tertullian, Pompeius, Arnobius, Laktanz und Apollinaris, die behaupten: Eine bestimmte Seele – nämlich diejenige, die als erste für Adam erschaffen wurde – sei von Gott nicht aus irgendwelchen Bestandteilen [d. h. also aus dem Nichts, R.H. ] geschaffen worden. Und aus Adam kämen die Seelen aller Menschen ins Sein. Und wie bei den Körpern ohne Zweifel eine Nachfolge bestünde, so würden sich auch die Seelen fortpflanzen (tradux). Auch sie zeigen nichts anderes, als dass die Seelen sterblich sind. So wie die übrigen Tiere aus einem einzigen Samen geboren werden, dementsprechend, glauben sie, sei es auch beim Menschen so, dass zugleich mit dem Körper – mit ein und demselben Samen – auch die Seele eingegossen werde. Was sagen wir dann von denen, die noch unfertig aus dem Mutterbauch abgegangen sind? Und von denen, die zuweilen auch verloren gehen, bevor die Samen von den sie natürlicherweise aufnehmenden Gefäßen empfangen worden sind? 7 Apol. pro Origene IX, PG 17, 607A. 8 Apol. pro Origene IX, PG 17, 605A. 9 Apol. pro Origene IX, PG 17, 605C-606A.
56
Disputatio de origine animae (CPL 633,37) – Übersetzung
Bei ihnen [sc. den Fehlgeburten, R.H.] wird zweifellos gefunden, dass auch jene Seelen, die zugleich mit den Samen hineingebracht wurden, auf natürliche Weise ausgelöscht und zugrundegegangen sind10. V. Ganz egal, ob die Seelen aus der Einhauchung Gottes stammen oder von einer abstammen, die zuerst geschaffen worden ist; es ist notwendigerweise so, dass sie zugleich mit den Körpern zu Grunde gehen, denn sie nehmen nach dem Verständnis jener auch mit den Körpern ihren Anfang. Entweder hat nämlich überhaupt an nichts von der vernunftbegabten und unsterblichen Seele das Anteil, was noch im Mutterleibe zugrundegegangen ist, und jene Lehre ist zurückgewiesen, die behauptet, dass sie die Seele – im Samen fortgepflanzt – zugleich mit den Körpern empfangen wird, oder wenn die Seele daran Anteil hat, besteht die Notwendigkeit zu bekennen, dass die Seele sterblich ist – was unser Glaube schlechterdings nicht gutheißt11. Von dem Herrn ist verkündet worden, dass die Seelen der Gestorbenen auch in der Unterwelt Gespräche führen; sowohl frohlockend Lazarus in den Sitzen der Seligen, als auch der reiche Mann brennend im Feuer. VI. Denn dass die Seelen unsterblich sind, davon sind nicht nur die göttlichen [Bücher], sondern auch die Bücher der Philosophen voll. Dass es so ist, hat Cleombrotius Ambraciota in Platons Buch im Gespräch mit Sokrates gelehrt: Der sein eigener Mörder zu sein sich nicht fürchtete und sich von der höchsten Mauer hinabstürzte, weil er meinte, dass es nach dem Tod kein Gericht gibt und glaubte, dass ohne Unterscheidung irgendwelcher Verdienste alle Seelen, nach dem Körper gleichermaßen in den Himmel kommen.12 Das haben die Philosophen lange für wahr gehalten und so hat die Weltweisen ein Nebel des Irrtums umhüllt, so dass sie meinten, es sei löblicher so wie der doctor homicida sich selbst zu töten, um nicht öffentlich getötet zu werden. So zog jedenfalls Cato – nach der nächtlichen Lektüre bei Lampenschein von Platons Buch, das die Unsterblichkeit der Seele lehrt – mit fester Hand das Schwert, entblößte die Brust und durchstieß sie einmal und noch einmal. VII. Gehen wir nun aber zurück zu jenen ganz bekannten Erörterungen weiterer Heiliger, die nicht im Schatten der waldigen Akademien verdeckt liegen, sondern von himmlischem Licht beschienen sind. Der selige Hieronymus also, der dem heiligen Märtyrer Victorinus [von Pettau] und auch den meisten Katholiken 10 Apol. pro Origene IX, PG 17, 606A-B. 11 Apol. pro Origene IX, PG 17, 606B-C. 12 Plato, Phaidon 59c. Cleombrotus aus Ambracia ist einer der Schüler des Sokrates. Von seinem Selbstmord wissen wir nur durch ein Epigramm des Callimachus. Dort wird erwähnt, dass er in den Tod sprang, nachdem er Platos Phaidon gelesen habe.
Disputatio de origine animae (CPL 633,37) – Übersetzung
57
gefolgt ist, hat gezeigt er glaube, dass die Seelen eher geschaffen als in Fortpflanzung entstünden, wie denn im Evangelium geschrieben steht: „Mein Vater wirkt täglich und ich wirke auch“ (Joh 5,17)13. Auch der heilige Augustinus hat, wie man erkennt, diese Meinung durch im Ganzen acht Bücher verteidigt. Aber da er die Erbsünde und die Strafe für die Kindlein, die ohne Taufe gestorben sind, darzustellen sich bemüht, stellt man fest, dass er stark zu der Meinung neigt, dass die Seele von Gott für Adam erschaffen wurde und von eben dieser alle Seelen der Menschen ihr Sein haben (und das verficht er) einerseits mit seinen eigenen Argumenten, andererseits mit Belegstellen aus den Schriften, wie jene eine ist: „Die Seelen, die mit Jakob nach Ägypten hineingekommen und seinen Schenkeln entsprossen sind“ (Gen 46,26 LXX). VIII. Der selige Bischof Gaudiosus14, ein äußerst tatkräftiger Arzt für Seelen und Körper, und lebendiger Märtyrer unserer Zeit, mit dem wir vertraute Gespräche geführt haben, hat dessen [Augustins] Behauptungen in einer ganzen Reihe seiner Predigten zustimmend benutzt. Aber der heilige Ambrosius15, den wir schon weiter oben als einen der apostolischen Männer erwähnt haben, hat gesagt: „Ich halte es für unehrenhaft, dass die Seelen zusammen mit den Körpern gezeugt werden. Das ist so, als ob eine Seele von einer [anderen] Seele geboren wird, und das entspricht nicht ihrem Selbst. Oder, wenn tatsächlich einzelne durch himmlische Macht erschaffen sind und aus ihnen die übrigen geboren wurden, könnten – scheinbar glaubhaft – aus der einen Seele Adams die übrigen geboren werden. Aber das trifft nicht zu, weil dies allein Gott zu tun möglich ist: Dass er etwas Einzigartiges hervorbringt – dies wird aber den Übrigen nicht eingeräumt. Dies ist im Fall des Erlösers so geheimnisvoll, dass es nicht bloß von den Heiden und Juden für unglaubhaft gehalten wird, sondern tatsächlich auch von solchen, die sich Christen nennen“. Denn die Photinianer haben diesen Glauben verworfen, sie glauben nicht, dass Gott sie [die Seele] hervorbringt. Denn, wenn zu dem Zeitpunkt, an dem der Körper befruchtet wird, auch die Seele aus der Seele gezeugt werden sollte, entnehmen wir der Geschichte der von Adam dargereichten Rippe, dass doch nicht Seele aus Seele geboren wird. Denn, wenn in der Rippe die Seele mit enthalten war, wurde sie dabei nicht geboren, sondern in Teile gerissen. Aber das steht nicht geschrieben. Der Prophet Sacharja sagt vielmehr unter anderem: „Der die Seele des Menschen in ihm bildet“ (Sach 12,1). Ohne von diesem abzuweichen sagt Jesaja: „So spricht der Herr, dein Gott, der dich gemacht und dich im Mutterleib gebildet hat“ (Jes 44,2). Wenn er also im Mutterleib gebildet wurde, wurde die Seele dem schon geformten Körper zugeteilt. 13 Das ist einer der Hauptbelegtexte für den Kreatianismus. 14 Es ist bisher nicht gelungen, den hier erwähnten Bischof Gaudiosus sicher zu identifizieren. 15 Das folgende Zitat lässt sich weder bei Ambrosius noch in seinen Pseudepigrapha nachweisen.
58
Disputatio de origine animae (CPL 633,37) – Übersetzung
Denn sie erfüllt alle Glieder des Körpers, wenn gesagt wird: „Im geformten Körper“. So wie Wasser, das ohne Gestalt ist, in ein Gefäß gegossen, dennoch geformt erscheint, so verhält es sich auch mit der Seele, da sie von Natur aus unkörperlich und einfach ist. Im geformten Körper belebt sie die einzelnen Glieder. Was auch Moses ganz eindeutig überliefert, indem er sagt: „Wenn einer eine schwangere Frau stößt und [die Leibesfrucht] abgeht, soll er Seele um Seele geben, wenn es geformt war, wenn es aber ungeformt war, soll mit Geld gesühnt werden“ (Ex 21,22–23). Damit wird bewiesen, dass die Seele dem Körper noch nicht vor der Formung einwohnt16. Darum, wenn sie dem schon geformten Körper gegeben wird, wird sie nicht während der Empfängnis des Körpers mit dem abfließenden Samen gezeugt. Denn, wenn mit dem Samen auch die Seele ihre Existenz aus einer anderen Seele hat, gehen viele Seelen täglich verloren mit irgendeinem Samenfluss, der keine Zeugung hervorbringt. IX. Aber, wenn wir auf die Anfänge zurückschauen, werden wir sehen, was wir befolgen müssen. Lasst uns die Erschaffung Adams bedenken, denn in Adam ist uns ein Beispiel gegeben, damit wir verstehen, dass der schon geformte Körper die Seele annimmt. Denn Gott hätte die Seele unter den Dreck der Erde mischen und so den Körper formen können. Aber das bringt den vernünftigen Zusammenhang ins Wanken, weil zuerst das Haus zusammengesetzt werden muss, und dann der Bewohner hineingeführt. Die Seele kann sicherlich, weil sie Geist ist, nicht im Trockenen wohnen, deshalb wird sie im Blut getragen. Wenn also die Umrisse des Körpers noch nicht zusammengefügt sind, wo wird die Seele bleiben? Ob sie draußen herumvagabundiert, bis sie hineingeschickt wird? Denn mit voller Berechtigung wird überliefert, dass der Vorgang der Übergabe so gestaltet wird, dass die Seele nicht müßig im Körper herumvagabundiert. Aber woher – sagen die, die anderes meinen – wird sie gegeben: Vom Mann? Oder von der Frau? Das trifft nicht zu, weil es in Adams Beispiel anders ist. Denn sie behaupten, dass vom Mann mit der Rippe auch die Seele gegeben ist. Wir haben gezeigt, dass das durch viele Begründungen entkräftet ist. Daher könnte es vielleicht so aussehen, als würde die Seele von der Frau gegeben, zu allermeist wegen des Heilandes, den wir ohne fleischliche Verbindung vom Heiligen Geist aus einer Frau geboren wissen. Wenn sie das für wahr halten, geben sie den Frauen zu viel; sie vertauschen die Autorität des Mannes mit der der Frau. Obwohl sie nämlich sagen, dass der Ursprung des Körpers genauso wie der der Seele vom Mann ist, stellen sie sich selbst auf den Kopf. Sie schreiben so das, was mehr ist – nämlich die 16 Dies ist für die Vertreter des Kreatianismus ein wichtiges Argument. Auch in der pseudoambrosianischen Altercatio contra eos qui animam non confitentur esse facturam aut ex traduce esse dicunt, PLS 1, 611–613, wird zwischen den angeführten Bibelstellen ausdrücklich festgestellt: „Vides ergo, figuratum in uterum animam accipere“.
Disputatio de origine animae (CPL 633,37) – Übersetzung
59
Seele – der Frau, was aber nun wirklich weniger ist, dem Mann zu – nämlich den Körper. Dabei ist sonnenklar, dass die von Gott im Beispiel gegebene Ordnung nicht geändert werden kann. Diejenigen, die sagen, dass die Seelen aus einer sich vermehren und nicht für die Körper nach dem Beispiel des ersten Menschen von Gott täglich erschaffen werden, die seien ausgestoßen17.
Dialog zwischen Augustinus und Hieronymus18 Augustinus: Heiliger Bruder Hieronymus, indem ich dich um Dinge um Rat frage, von denen ich nichts weiß, bitte ich Gott, dass es für uns fruchtbar sein möge. Denn obwohl du in fortgeschrittenerem Alter bist als ich – und ich bin doch schon ein alter Mann! – frage ich dennoch um Rat. Es scheint mir doch in keinem Alter zu spät zu sein, das Nötige zu lernen. Weil es sich gleichwohl für alte Männer mehr ziemt zu lehren als zu lernen, um so mehr ziemt es sich für sie dennoch zu lernen, als nicht zu wissen, was sie lehren sollen19. Hieronymus: Seliger Vater Augustinus20! ¦ Wenn es dir genehm ist, wollen wir auf dem Feld der Schriftauslegung spielerisch mit einander wetteifern, ohne uns gegenseitig zu verletzen21. ¦ Beurteile uns also nicht nach der Zahl der Jahre, denn Weisheit wird nicht den grauen Haaren zugerechnet, sondern graue Haare der Weisheit, wie die Schrift bezeugt: „Was die Ehrwürdigkeit eines grauhaarigen Menschen ausmacht, ist seine Klugheit“ (Weish 4,8)22. ¦ Ich sage dir: Messe den Glauben nicht nach der Zeit und halte mich nicht deshalb für besser, weil ich früher begonnen habe, im Heer Christi meinen Dienst zu leisten23. Augustinus: Lass dir also gefallen – ohne dass du dich davon belästigt fühlst – mir diesen Sachverhalt zu eröffnen und sorgfältig zu erklären: Die Frage der Seele beschäftigt viele Menschen und ich gestehe, unter ihnen zu sein. Über das, was ich ganz sicher von der Seele weiß, will ich nicht schweigen24.
17 Anathematismus Nr. 12 aus dem Libellus de fide Rufin des Syrers der Anathematismus wird zum Schluß des Dialoges von Hieronymus noch einmal wiederholt. 18 Wenn die Äußerung eines Dialogpartners vom Kompilator aus mehreren Zitaten zusammengesetzt wurde, ist das im Text durch ¦ als Trennzeichen gekennzeichnet. 19 Augustinus ad Hieronymum Ep. 166,1 CSEL 44, 545,7–546,6. 20 cf. Hieronymus ad Augustinum Ep. 115 CSEL 55, 396,18–397,1. 21 Hieronymus ad Augustinum Ep. 115 CSEL 55, 397,4–5. 22 Hieronymus ad Paulinum Ep. 58 CSEL 54, 527,9–528,2. 23 Hieronymus ad Paulinum Ep. 58 CSEL 54, 528,6–7. 24 Augustinus ad Hieronymum Ep. 166,2 CSEL 44, 548,10–13.
60
Disputatio de origine animae (CPL 633,37) – Übersetzung
Hieronymus: Du misst uns an deinen eigenen Tugenden und hebst unsere Kleinheit durch deine Größe hervor. Du nimmst in der Tischgesellschaft den Platz am Rand ein, damit dich der Hausherr durch seine Entscheidung weiter nach oben bringt25. ¦ Aber ich gebe zu, ich will, ich ziehe es vor, mich zu bemühen. Ich lehne es ab, ein Lehrer zu sein und verspreche, ein Mitgehender zu sein: Dem Bittenden wird gegeben, dem Klopfenden aufgetan und wer sucht, der findet (vgl. Mt 7,8). ¦ Lass uns auf Erden das Wissen erlernen, dass uns im Himmel bleibt26. Augustinus: Ich bin noch immer sicher, dass die Seele – ohne Gottes Schuld und ohne Gottes oder eigene Notwendigkeit, sondern durch eigenen Willen – in Sünde gefallen ist. Und sie kann nicht befreit werden von „diesem dem Tode verfallenen Körper“ weder durch Kraft des eigenen Willens – als ob die dafür ausreichte – noch durch den Tod des Körpers, sondern nur aus „Gottes Gnade durch Jesus Christus unseren Herrn“27. Hieronymus: Die Seele ist unsterblich, unsichtbar und unkörperlich – das sage ich im Vergleich zur dichteren Substanz unseres Körpers. Ich sage aber auch, jene wird zur beschlossenen Zeit bestraft werden und sie spürt die Strafe, weil sie ehemals einen Körper angenommen hat. Sie wird mit ihm bestraft werden, so wie sie mit ihm gesündigt hat28. Augustinus: Es wird gesagt, dass die menschliche Empfängnis so vor sich gehe, dass [der Fötus] in den ersten sechs Tagen Ähnlichkeit mit Milch hat, und in den folgenden neun Tagen in Blut umgewandelt wird. Hierauf wird er zwölf Tage verfestigt und in den folgenden 15 Tagen geformt bis zur vollkommenen Ausgestaltung aller Glieder, von da an wird er in der noch zur verbleibenden Zeit bis zur Geburt in der Größe vermehrt29. 25 Hieronymus ad Paulinum Ep. 58 CSEL 54, 527,4–6. 26 Hieronymus ad Paulinum Ep. 53,10 CSEL 54, 464,3–6. 27 Augustinus ad Hieronymum Ep. 166,5 CSEL 44, 535,9–14, unter Aufnahme von Röm 7,24, einer der zentralen Bibelstellen für Augustins Gnadenlehre. Hier zeigt sich der Zusammenhang zwischen Gnadenlehre und der Entstehung der Seele. Welcher Teil des Menschen ist erlösungsbedürftig und erlösungsfähig? Der „dem Tode verfallene Körper“ ist es nicht. Wenn die Seele erlöst werden muss und kann, möchte Augustinus wissen, wieso bereits die Seelen kleiner Kinder erlösungsbedürftig sind. Denn nach kreatianistischem Verständnis wurden deren Seelen von Gott direkt für den neugezeugten Fötus geschaffen und können daher bei der Geburt noch keine Tatsünde begangen haben. Weshalb sollten also die Neugeborenen der Erlösung – das heißt der Taufe – bedürfen, um ihrer Verdammnis zu entgehen? Innerhalb des Traduzianismus wäre dies Problem leichter zu lösen, dort „erben“ die Kinder die erlösungsbedürftige Seele von ihren Eltern, die seit Adam und Eva in der Kette der Erbsünde stehen. 28 Hieronymus, Commentarius in Evangelium Matthaei I zu Mt 10,28 CCL 77, 71,1701–1705. 29 Augustinus, De diversis quaestionibus, q.56 CSEL 44a, 95,4–10.
Disputatio de origine animae (CPL 633,37) – Übersetzung
61
Hieronymus: Also weißt du nicht den Weg, auf dem Geist und Seele in ein Kindlein hineingehen und kennst nicht die Mannigfaltigkeit der Knochen und Adern im Leib der Schwangeren, wie aus geringen Teilen der Körper des Menschen in diversen Gestalten und Gliedmaßen immer wieder anders hergestellt wird; und wie aus demselben Samen im Fleisch etwas weiches wird, in den Knochen etwas anderes hart wird, oder in den Adern etwas zuckt und etwas anderes gebunden30 wird in den Sehnen. So kannst du Gottes Werke nicht kennen, der alles geschaffen hat31. Augustinus: [Fragen] zur Menschwerdung (incarnatio) der Seele: Ob sie aus jener einen stammt, die dem ersten Menschen gegeben wurde? Werden so die übrigen hervorgebracht? Oder werden für jeden einzelnen auch jetzt noch neue Seelen gemacht? Oder werden schon irgendwo existierende [Seelen] entweder von Gott geschickt oder gleiten sie von selbst in die Körper32? ¦ Ich will wissen, welche dieser Meinungen ich wählen soll. Hieronymus: Ich erinnere mich an eure kleine Anfrage über die Natur der Seele, die allerdings eine der größten Fragen in der Kirche ist. Ob sie vom Himmel gefallen ist, wie der Philosoph Pythagoras, alle Platoniker und Origenes glauben? Ob sie von Gottes eigener Substanz ist, wie die Stoiker, Mani und die spanischen33 Häretiker des Priscillian vermuten? Ob die Seelen im Schatz Gottes aufbewahrt werden, seit sie vormals geschaffen wurden, worauf gewisse Kirchenleute – dummer Überredung folgend – ihr Vertrauen setzen? Oder ob sie täglich von Gott erschaffen werden, gemäß dem, was im Evangelium steht: „Mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke auch“ (Joh 5,17)? Oder in der Tat durch Weitergabe, wie Tertullian, Apollinaris und der größte Teil der westlichen Theologen meinen, dass so wie Körper aus Körper auch Seele aus Seele geboren wird, so dass sie [die Seele] ihre Existenz zu gleichen Bedingungen wie die Tiere hätte34? Augustinus: Dies denkst du ganz sicher: Dass Gott auch jetzt noch die einzelnen Seelen für die Gezeugten erschafft. Damit dieser Ansicht nicht entgegengehalten wird, dass Gott die gesamte Schöpfung in sechs Tagen endgültig abgeschlossen
30 Ich folge der Textform des CCL 72, 347, 102, dort steht ligetur statt duretur bei Migne. 31 Hieronymus, Commentarius in Ecclesiasten 11,5 CCL 72, 347,96–102. 32 Augustinus ad Hieronymum Ep. 166,7 CSEL 44, 556,1–5. Der durch den Strich abgetrennte Teil der Äußerung Augustins ist durch den Verfasser des Dialogs angefügt worden. 33 Ich folge der Textform in CSEL 56, 143,8 und lese hispana, statt des polemischen insana bei Migne. 34 Hieronymus ad Marcellinum et Anapsycham Ep. 126,1 CSEL 56, 143,4–16.
62
Disputatio de origine animae (CPL 633,37) – Übersetzung
habe, führst du ein Zeugnis aus dem Evangelium an: „Mein Vater wirkt bis heute“ (Joh 5,17)35. Hieronymus: Was gibt es denn für Zweideutigkeit in dem Gesagten, dass es Anlass gäbe verschiedene Deutungsmöglichkeiten einzuräumen36? ¦ Es steht fest und darüber gibt es keinen Streit37. Augustinus: Also bitte, lehre mich, was ich lehren soll! Lehre mich, an was ich mich halten soll! Und sag mir, wenn die einzelnen Seelen bis heute für die einzelnen gezeugten [Menschen] geschaffen werden, wodurch sündigen sie in den Neugeborenen, so dass sie des Sakramentes Christi bedürfen: der Vergebung der Sünden? Haben sie in Adam gesündigt, von dem das sündige Fleisch hervorgebracht wurde? Oder – wenn sie nicht sündigen – durch welche (Un-) Gerechtigkeit des Schöpfers werden sie so an fremde Schuld gebunden, dass sie von der Verdammnis ereilt werden, wenn ihnen nicht durch die Kirche Hilfe zu Teil wird, dadurch, dass ihnen die Gnade der Taufe zu Hilfe kommt? Nur deshalb weil sie mit durch Fortpflanzung hervorgebrachten sterblichen Gliedern vereinigt worden sind – obwohl es gar nicht in ihrer Macht liegt38? Hieronymus: „Verstoßen sind die Sünder vom Mutterschoße an, sie haben geirrt vom Mutterleibe an“ (Ps 58,4). Sobald sie geboren sind, sind sie der Sünde unterworfen, gleich der Übertretung Adams, der „die Gestalt des Zukünftigen ist“ (Röm 5,14)39 ¦ Das steht im Buch Hiob geschrieben: „Es ist doch kein Mensch vor Gott rein oder ein Mann in seinen Werken untadelig? Wenn er selbst seinen Dienern nicht glaubt und bei einem Engel Fehler findet, um wie viel mehr bei denen, die im Lehmhaus wohnen? (Hiob 4,17–19). Zu jenen gehören auch wir, die aus demselben Lehm gemacht sind40. ¦ Keiner ist ohne Sünde, auch wenn „sein Leben erst einen einzigen Tag währt“ (vgl. Hiob 14,5a (LXX)). Wenn selbst „die Sterne nicht rein sind in den Augen Gottes, wie viel mehr Wurm und Fäulnis“
35 Augustinus ad Hieronymum Ep. 166,8 CSEL 44, 557,12–558,1. 36 Hieronymus, Dialogus contra Pelagianos I,1 CCL 80, 6,4–6 Bei den Zitaten stellt der Autor des Dialoges seinen Text sowohl aus Äußerungen des Atticus (des katholischen d. h. rechtgläubigen Gesprächspartners) zusammen, als auch aus Sätzen, die bei Hieronymus Critobul, der Pelagianer spricht. Das erste Zitat aus dem Dialogus contra Pelagianos ist eine Äußerung von Atticus. Im Folgenden wird darauf hingewiesen, von welchem Gesprächspartner das jeweilige Zitat stammt. 37 Hieronymus, Dialogus contra Pelagianos I,2 CCL 80, 7,14–15 (Critobul). 38 Augustinus ad Hieronymum Ep. 166,10 CSEL 44, 560 7–15. 39 Hieronymus, Dialogus contra Pelagianos II,4 CCL 80, 57,22–25 (Atticus). 40 Hieronymus, Dialogus contra Pelagianos II,4 CCL 80, 58,35–39 (Atticus).
Disputatio de origine animae (CPL 633,37) – Übersetzung
63
(Hiob 25,6) und der, der unterworfen ist dem durch die Sünde beschädigten Adam41? Augustinus: Ich beschwöre dich, wie wird diese Ansicht verteidigt, nach der angenommen wird, dass die Seelen nicht alle aus jener einen des ersten Menschen gemacht werden, sondern wie jene eine für den Einen (Adam) so die einzelnen (Seelen) für die einzelnen (Menschen)? Was sonst gegen jene Ansicht gesagt wird, glaube ich, leicht zurückzuweisen zu können: So gibt es jenes Argument, von dem gewisse Leuten meinen, sie würden (damit) die (obige) Ansicht in die Enge treiben: Wie kann Gott alle seine Werke vollendet haben und am siebten Tag geruht haben, wenn er bis jetzt neue Seelen erschafft. Wenn wir jenen sagen, was du oben angegeben hast: „Mein Vater wirkt bis jetzt“ antworten sie „wirkt“ bedeutet bereits Vorhandenes zu verwalten, nicht Neues zu schaffen“42. Hieronymus: Wenn diese Bibelstelle von denen verwendet wird, die unerfahren sind, und Meditation, Erfahrung und Kenntnis der Heiligen Schriften nicht haben, scheint sie auf den ersten Blick deiner Ansicht zu schmeicheln. Aber durch weitere Untersuchung wird sie leicht erklärt, auch wenn du [diese] Zeugnisse mit anderen Zeugnissen der Schriften verglichen hast, damit es nicht so aussieht, als würde der heilige Geist sich je nach Beschaffenheit von Zeiten und Orten widersprechen, wie denn geschrieben steht: „Eine Tiefe ruft die andere mit der Stimme ihrer Wasserfälle“ (Ps 42,8). ¦ Ich verstehe, worauf deine Behauptung zielt: Aber darüber muss später diskutiert werden, damit wir nicht verschiedene Fragen vermischen und die Zuhörenden in einem unklaren Verständnis zurücklassen43. Augustinus: Es ist wahr, dass Gott ruhte vom Einrichten der Dinge, die noch nicht waren, es ist aber auch wahr, dass er nicht nur die Dinge verwaltet, die er gemacht hat, sondern er wirkt bis jetzt und erschafft auch etwas viele Male – nicht etwas, das noch nicht existiert, sondern etwas, das er schon einmal geschaffen hat. Also entgehen wir entweder so, oder wenn es beliebt auch auf andere Weise dem, was uns vorgeworfen wird, bezüglich der Ruhe Gottes von seinen Werken44, damit wir deshalb nicht glauben, dass bis jetzt neue Seelen erschaffen werden – nicht aus jener einen [sc. Adams, R.H.], sondern so wie für jenen eine. Denn auf das, was gesagt wird: „Warum macht er Seelen für die, von denen er weiß, dass sie schnell
41 42 43 44
Hieronymus, Commentarius in Jonam III, CCL 76, 406,89–93 (gekürzt). Augustinus ad Hieronymum Ep. 166,10+11 CSEL 44, 561,10–562,5. Hieronymus, Dialogus contra Pelagianos I,10 CCL 80, 12,2–5 (Atticus). Ich folge der Textform in CSEL 44 564,13 und lese operibus suis, statt operibus bei Migne.
64
Disputatio de origine animae (CPL 633,37) – Übersetzung
sterben werden?“ können wir antworten, dass so die Sünden der Eltern entweder erwiesen oder gegeißelt werden45. Hieronymus: Was ich darüber denke, habe ich nach meinem Wissen in den kleinen Werken gegen Rufinus geschrieben46, gegen das Buch, das er Anastasius – seligen Gedenkens –, dem Bischof der römischen Kirche gegeben hat47. In ihm bemüht er sich, in einem betrügerischen, dummen und tückischen Bekenntnis, sein Spiel mit der Einfältigkeit der Hörer zu treiben und spielt mit seinem Glauben, oder besser gesagt, mit seinem durchtriebenen Unglauben48. Augustinus: In deinem Buch gegen Rufinus hast du geschrieben, dass einige diese Lehre bemäkeln [d. h. den Kreatianismus, R.H.]: Es erscheine Gottes unwürdig, denen Seelen zu geben, die ehebrecherisch empfangen worden sind. Daraus versuchen sie mit Verdiensten für die Taten eines Lebens vor dem Fleisch den Beweis zu konstruieren, die Seelen könnten gerechterweise in das Gefängnis dieser Welt49 geführt werden. Dies regt mich nicht auf! Ich erwäge viele Argumente, mit denen diese Bekrittelung zurückgewiesen werden kann. Und was du selbst geantwortet hast: „Es ist beim Weizen nicht die Schuld des Saatguts, von dem man sagt, es sei im Diebstahl weggetragen, sondern es ist die Schuld dessen, der das Getreide gestohlen hat. Und die Erde soll auch nicht deshalb nicht in ihrem Schoß den Samen umhegen, weil der Sämann ihn mit unreiner Hand ausgestreut hat“50 – das ist ein äußerst elegantes Bild! Bevor ich dieses las, brachte mich dieser Vorwurf mit den ehebrecherischen Leibesfrüchten in dieser Frage nicht in die Klemme, da ich im Allgemeinen beobachte: Gott macht im Großen und Ganzen viel Gutes, sogar aus unseren schlechten und verkehrten Sünden. Die Erschaffung jedweder Lebewesen bewegt, wenn man sie mit Verstand und Frömmigkeit bedenkt, zu einem überschwänglichen Lob des Schöpfers, wie vielmehr die Erschaffung nicht nur irgendwelcher Lebewesen, sondern des Menschen! Wenn aber der Grund für die Erschaffung hinterfragt wird, kann kein Grund schneller oder besser in der Antwort genannt werden, als dass jedes Geschöpf Gottes gut ist. Und was ist würdiger, als dass der gute Gott Gutes schafft, was niemand kann außer Gott? Dieses und anderes, was ich kann und wie 45 Augustinus ad Hieronymum Ep. 166,12–13 CSEL 44, 564,7–565,3. 46 Anspielung auf die Apologia contra Rufinum II,8–10 CCL 79, 40,1–43,74; bzw. die Epistula adversus Rufinum (=Apol. c. Ruf. III) 28–30 CCL 79, 99,1–102,28. 47 Anspielung auf Rufin, Apologia ad Anastasium, 6 CCL 20, 27,1–14. 48 Hieronymus ad Marcellinum et Anapsycham Ep. 126,1 CSEL 56, 143,16–20. Am Ende des Zitats macht Hieronymus ein lateinisches Wortspiel mit den Worte fides und perfidia – also „Glauben“ und „Unredlichkeit“ – das sich so nicht im Deutschen wiedergeben lässt. 49 Ich folge dem bei Migne abgedruckten Text und lese mundi statt modi in CSEL 44 567,9. 50 Nahezu wörtliches Zitat Augustins aus Hieronymus, Epistula adversus Rufinum (=Apol. c. Ruf. III), 28.
Disputatio de origine animae (CPL 633,37) – Übersetzung
65
ich kann, sage ich gegen jene, die jene Überzeugung zu erschüttern versuchen, gemäß der geglaubt wird, dass die Seelen so wie für jenen einen [sc. Adam, R.H.], für jeden einzelnen erschaffen werden51. Hieronymus: Antonius, ein vorzüglicher Redner, dessen Lob Tullius laut verkündet, sagt, dass er viele beredte Männer gesehen hat, aber bisher keinen [wirklich] eloquenten. Also spiele mir nicht mit gelungenen Formulierungen der Rhetoren – statt deiner – durch die sie die Ohren der Unerfahrenen und Jungen zu betören pflegen. Sage stattdessen einfach, was du denkst!52 Augustinus: Glaube mir, wenn es um die Strafen für die kleinen Kinder geht, stecke ich wirklich in der Klemme. Ich finde ganz und gar nichts, was ich antworten soll. Ich rede nicht nur von den Strafen, die es nach diesem Leben durch die Verdammnis gibt, der sie notwendigerweise anheimfallen, wenn sie ohne das Sakrament der christlichen Gnade den Körper verlassen, sondern auch von den Strafen, in denen sie sich in diesem Leben – vor unseren Augen – zu unserem Schmerz wälzen. Wenn ich sie aufzählen wollte, fehlte mir eher die Zeit als die Beispiele: Sie siechen in Krankheiten dahin, werden von Schmerzen gequält, von Hunger und Durst gemartert, ihre Gliedmaßen werden verkrüppelt, sie werden ihrer Sinne beraubt und sie werden von unreinen Geistern heimgesucht. Es muss also erklärt werden, wieso jene Kinder ohne jede eigene üble Tat gerechterweise leiden müssen. Denn es ist nicht zulässig, zu sagen, dass es entweder ohne Gottes Wissen geschieht, oder dass er denen nicht widerstehen könnte, die es [den Kindern an-] tun, oder dass er jenes ungerechterweise tut oder zulässt53. Hieronymus: Du benutzt verschiedene Zeugnisse der Schriften in derselben Frage wie Verkleidungen im Theater, die ein und denselben Menschen in eine Vielzahl von Personen verwandeln und so Mars und Venus darstellen, so dass der, der zuerst grimmig und hart angegriffen hat, hinterher in weiblicher Weichheit zerschmilzt54. Augustinus: Wenn ich merke, dass du zornig bist, werde ich um nichts anderes als um Verzeihung bitten55.
51 Augustinus ad Hieronymum Ep. 166,15–16 CESL 44, 567,5–568,11. 52 Hieronymus, Dialogus contra Pelagianos III,17 CCL 80, 121 9–13 (Atticus). 53 Augustinus ad Hieronymum Ep. 166,16 CSEL 44, 568,11–569,7 (direkte Fortsetzung des vorausgehenden Augustin-Zitats). 54 Hieronymus, Dialogus contra Pelagianos III,12 CCL 80, 113,20–24 (Atticus). 55 Augustinus ad Hieronymum Ep. 73,9 CSEL 34/2, 276,6–7.
66
Disputatio de origine animae (CPL 633,37) – Übersetzung
Hieronymus: Ich bitte, dass du geduldig zuhörst. Wir streben nicht nach den Sieg über einen Gegner, sondern nach der Wahrheit, gegen die Lüge56. Augustinus: Wir sagen nun einmal, dass die unvernünftigen Tiere den höhergestellten Naturen berechtigt zum Gebrauch gegeben sind, selbst wenn diese mit Fehlern behaftet sind, wie wir es klar im Evangelium sehen (vgl. Mk 5,12–13), wo die Schweine den Dämonen zum verlangten Gebrauch überlassen werden – aber können wir das zu Recht auch über den Menschen sagen? Er ist tatsächlich ein Tier, aber vernunftbegabt, wenn auch sterblich. In seinen Gliedern ist eine vernunftbegabte Seele, die Strafen erleidet durch solch große Leiden. Gott ist gut, Gott ist gerecht, Gott ist allmächtig. Dies zu bezweifeln ist gänzlich wahnsinnig. Also muss die Ursache der vielen Übel, die kleinen Kindern zustoßen, als gerecht bezeichnet werden57. Denn, wenn Erwachsene solches erleiden, pflegen wir zu sagen, dass ihre Verdienste auf die Probe gestellt werden, wie bei Hiob, oder dass ihre Sünden bestraft werden, wie bei Herodes (vgl. Apg 12,23). Ausgehend von solchen Beispielen, bei denen Gott es offensichtlich wollte, bleibt es anheim gestellt Mutmaßungen anzustellen über andere Menschen, bei denen es unklar ist – aber das gilt bei Erwachsenen. Was aber sollen wir in Bezug auf die kleinen Kinder antworten, wenn in ihnen keine Sünden sind, die mit solch großen Strafen gesühnt werden müssten? Denn es gibt schlechterdings keine nachprüfbare Gerechtigkeit in ihrem Alter58. Hieronymus: Der Prediger [d. h. Kohelet] verwendet zuerst allen seinen Verstand auf die Suche nach Weisheit, aber dann bewegt er sich über die Grenzen des Erlaubten hinaus, indem er die Gründe und Ursachen erkennen will für solche Fragen: Warum werden Kindlein vom Dämon befallen? Warum gehen beim Schiffbruch gleichermaßen Gerechte und Ungläubige unter? Ob es ein Urteil Gottes ist, wenn sich dieser oder ein ähnlicher Fall ereignet? Und wenn es Zufall ist – wo ist die Vorsehung? Wenn es ein Urteil ist – wo ist Gottes Gerechtigkeit?59 Augustinus: Lehre also, was wir sagen und was wir denken sollen, damit sich bei uns die Einsicht festigt, dass die neuen Seelen einzeln für die einzelnen Körper geschaffen werden.60
56 Hieronymus, Dialogus contra Pelagianos I,22 CCL 80, 28,5–7 (Atticus). 57 Ich folge dem Text von CSEL 44, 568,15 und lese causa iusta statt causa bei Migne. 58 Augustinus ad Hieronymum Ep. 166,16 CSEL 44, 569,7–570,7 (wieder direkter Anschluss an das vorausgehende Zitat. 59 Hieronymus, Commentarius in Ecclesiasten 1,13 CCL 72, 259,302–308. 60 Augustinus ad Hieronymum Ep. 166,17 CSEL 44, 571,4–6 vgl. zum Inhalt auch Ep. 166,10 doce ergeo quaeso…).
Disputatio de origine animae (CPL 633,37) – Übersetzung
67
Hieronymus: Du scheinst mir leicht vergesslich zu sein und als ob nichts darüber gesagt worden wäre, gehst du zurück zu den (alten) Gesprächsfäden. Dies ist doch in einer langen Erörterung diskutiert worden!61 Augustinus: Ich frage nach dem Grund für die Verdammung der Kindlein. Denn wenn die einzelnen Seelen neu geschaffen werden für jeden einzelnen, sehe ich nicht, dass sie in diesem Alter irgendeine62 Sünde haben. Ich glaube nicht, dass irgendeine [Seele, R.H.] von Gott verdammt wird, von der er sieht, dass keine Sünde an ihr ist. Ob man vielleicht sagen muss, dass bei den Kindlein ausschließlich das Fleisch der Sünde gehört? Und könnte dann die Seele, die für jene tatsächlich neu geschaffen wird, indem sie gemäß den Geboten Gottes lebt – mit dem Beistand der Gnade Christi – für das eigene bezwungene und unterjochte Fleisch das Verdienst der Unvergänglichkeit erlangen63? Hieronymus64: Wir wollen uns bemühen, dass die allergefährlichste Häresie [sc. die pelagianische, R.H.] aus der Kirche entfernt wird, die immer Buße vortäuscht, damit sie die Möglichkeit hat in der Kirche zu lehren und damit sie nicht, wenn sie offen ans Licht kommt – nach draußen getrieben – umkommt65. Augustinus: Zu hinterfragen und zu begründen ist, weshalb die Seelen verdammt werden, die neu geschaffen wurden für die einzelnen zu Gebärenden, wenn sie als Kindlein ohne das Sakrament Christi [sc. die Taufe, R.H.] sterben. Dass sie verdammt werden, wenn sie in diesem Zustand den Körper verlassen, bezeugen die Heilige Schrift und die Heilige Kirche. Wenn von daher der Lehrsatz über die Erschaffung der neuen Seelen diesem allersichersten Glauben nicht widerspricht: so sei er auch meiner; wenn er aber dem widerspricht: so sei er auch nicht deiner. Ich will nicht, dass mir gesagt wird, ich müsse für diesen Lehrsatz als Argument anerkennen, das geschrieben steht: „Der den Geist im Inneren des Menschen geformt hat (finxit)“ (Sach 12,1). Es muss nach einem festen und unwiderlegbaren Argument gesucht werden, das uns nicht zwingt zu glauben, dass Gott irgendwelche Seelen ohne irgendeine Schuld verdammt. Denn entweder bedeutet creare (schaffen) das gleiche – oder vielleicht auch mehr? – als fingere (formen). 61 Hieronymus, Dialogus contra Pelagianos III,6 CCL 80, 104,1–3 (Atticus). 62 Ich folge der Textform in CSEL 44, 577,7 und lese ullum statt nullum bei Migne. 63 Augustinus ad Hieronymum Ep. 166,21–22 CSEL 44, 577,5–12. Augustins Äußerung klingt an dieser Stelle beinahe wie Pelagianismus, der es für möglich hält, dass Menschen sündlos leben können, wenn sie es wirklich schaffen, ihr „Fleisch zu bezwingen“. Das bringt den Kompilator des „Disputatio“ zu der folgenden scharfen Reaktion. 64 Der Kompilator des Dialogs legt an dieser Stelle Hieronymus Worte Augustins in den Mund! 65 Hieronymus ad Augustinum Ep. 134,1 CSEL 56, 262,7–10. Dieser Text wird von Augustinus selbst noch einmal zitiert in Augustinus ad Optatum Ep. 202a,3 CSEL 57, 303,24–304,3.
68
Disputatio de origine animae (CPL 633,37) – Übersetzung
Denn es steht ja geschrieben „Schaffe (crea) in mir ein reines Herz, Gott“ (Ps 51,12), es ist aber nicht plausibel, dass die Seele in dieser Bibelstelle sich wünscht, „gemacht“ (fieri) zu werden, bevor sie irgendwie existiert. So wie sie [die Seele] also als bereits existierende geschaffen wird (creatur) durch die Erneuerung der Gerechtigkeit, so wird sie als bereits existierende geformt (fingitur) durch die Bestätigung der Lehre. Auch das, was im Prediger (Kohelet) geschrieben steht: „Dann wird der Staub in Erde verwandelt, so wie er war und der Geist kehrt zurück zu Gott, der ihn geschaffen hat“ (Pred 12,7), bestätigt den Lehrsatz nicht, von dem wir wollen, dass es der unsere sei. Denn durch dieses [Zitat] werden mehr die gestützt, die glauben, dass alle Seelen aus einer stammen. Denn, sagen sie, wie der Staub in Erde verwandelt wird – so wie er vorher war – und dennoch das Fleisch, von dem das gesagt ist, nicht zu dem Menschen zurückkehrt aus dem heraus es sich fortgepflanzt hat, sondern zur Erde, aus der der erste Mensch gemacht worden war, so kehrt auch der Geist, der aus jenem66 Geist hervorgegangen ist, dennoch nicht zu ihm zurück, sondern zum Herrn, von dem er gegeben worden ist. Weil diese Belegstelle tatsächlich so klingt, als ob sie für diese Auffassung spräche – obwohl sie nicht gänzlich jener Meinung, die ich verteidigen will, entgegengesetzt zu sein scheint – habe ich geglaubt, dieses alles deiner Klugheit zu Bedenken zu geben, damit du nicht versuchst, mich durch Belegstellen von solcher Art aus diesen Schwierigkeiten zu befreien. Denn niemand kann durch Wünschen wahr machen, was nicht wahr ist. Wenn man es doch könnte, wünschte ich, dass dieser Lehrsatz wahr sei. So wie ich mir wünsche, dass er von dir in völliger Klarheit und unwiderlegbar verteidigt wird – wenn er denn wahr ist67. Hieronymus: Du hast Belegstellen angeführt, die nicht nur aus dem Zusammenhang der heiligen Schrift, sondern auch aus ihren eigenen Büchern herausgelöst sind68. ¦ „Es kehrt der Staub zu seiner Erde zurück, von der er genommen ist und der Geist kehrt zurück zu Gott, der ihn gegeben hat“ (Pred 12,7). Durch dieses [Schriftzitat] werden die genügend der Lächerlichkeit preisgegeben, die glauben, dass die Seelen mit den Körpern geschaffen werden – und zwar nicht von Gott, sondern aus den Körpern der Eltern. Denn wenn das Fleisch zur Erde zurückkehrt und der Geist zu dem zurückgeht, der ihn gegeben hat, ist sonnenklar, dass Gott Elternschaft für die Seelen hat, nicht die Menschen69.
66 67 68 69
Ich folge der Textform in CSEL 44, 581,15 und lese illius statt ipsius bei Migne. Augustinus ad Hieronymum Ep. 166,25–26 CSEL 44, 580,5–582,8. Hieronymus, Dialogus contra Pelagianos I,12 CCL 80, 14,16–18 (Atticus). Hieronymus, Commentarius in Ecclesiasten 12,7 CCL 72, 357,270–276.
Disputatio de origine animae (CPL 633,37) – Übersetzung
69
Augustinus: Über jene Ansicht, dass tatsächlich alle Seelen aus einer gemacht werden, will ich nur dann diskutieren, wenn es unbedingt nötig ist. Ich möchte aber – wenn die Ansicht, die wir jetzt behandeln, wahr ist –, dass sie so von dir verteidigt werde, dass es gar nicht mehr nötig ist, die erste Ansicht [sc. den Traduzianismus] überhaupt zu behandeln. Ich wünsche es mir so sehr, ich bitte, ich sehne es mit heißen Gebeten herbei und erwarte, dass Gott durch dich meine Unwissenheit in dieser Sache wegnimmt. Wenn jedoch – was nicht geschehen möge – ich dessen überhaupt nicht würdig bin, erbitte ich für mich Geduld von unserem Herrn70. Hieronymus: Gemäß dem seligen Apostel „soll ein jeder von seiner Ansicht ganz überzeugt sein“ (Röm 14,5). „Denn einer so, der andere aber so“ (1. Kor 7,7). Sicherlich ist alles, was man sagen kann und was ein erhabener Geist aus den Quellen der heiligen Schriften schöpfen kann, von dir dargestellt und diskutiert worden. Aber ich bitte dich verehrungswürdigen Menschen, dass du es für eine kurze Zeit erträgst, dass ich dein Genie lobe. Schließlich diskutieren wir unter uns um unserer Bildung willen. Aber die Neider, ganz besonders aber die Häretiker, werden, wenn sie Unterschiede zwischen unseren Lehrsätzen sehen, verleumdend über uns sagen, das rühre von einem alten Groll her. Mein Beschluss ist, dich zu lieben, zu stützen71, zu verehren, zu bewundern und deine Worte wie meine zu verteidigen72. Augustinus: Diejenigen, die fest behaupten, dass die Seelen (alle) aus einer hervorgehen, die Gott dem ersten Menschen gegeben hat und sagen, die Seelen werden deshalb von den Eltern übertragen, die behaupten in der Tat, wenn sie der Meinung Tertullians folgen, dass die Seelen nicht Geist, sondern Körpern sind und dass sie aus körperlichen Samen entstehen: Was könnte man perverseres sagen73? Hieronymus: Diejenigen, die sagen, dass die Seelen vorher existiert haben und nicht für die Körper – wenn sie gezeugt werden – nach dem Beispiel des ersten Menschen von Gott täglich geschaffen werden, die seien ausgestoßen74. 70 Augustinus ad Hieronymum Ep. 166,27–28 CSEL 44, 583,18–584,6. 71 Ich folge dem Text in CSEL 56, 262,5 und der bei Migne angegebenen Textvariante und lese suscipere statt suspicere. 72 Hieronymus ad Augustinum Ep. 134,1 CSEL 56, 261,12–262,2. Auch dieser Textabschnitt wird noch einmal von Augustinus zitiert, in: Augustinus ad Optatum Ep. 202a,3 CSEL 57, 303,13– 22. 73 Augustinus ad Optatum Ep. 190,14 CSEL 57, 148,13–17. 74 Anathematismus Nr. 12 aus dem Libellus de fide Rufin des Syrers, dieser Anathematismus ist zum Abschluss der Einleitung schon einmal zitiert worden.
70
Disputatio de origine animae (CPL 633,37) – Übersetzung
Augustinus: Wer leugnet denn, dass Gott nicht nur der Schöpfer und Verfertiger der einen, sondern aller Seelen ist, außer er steht ganz offensichtlich im Widerspruch zu Gottes eigenen Aussagen! Ohne jede Zweideutigkeit ist durch den Propheten gesagt worden: „Allen Atem habe ich gemacht“ (Jes 57,16), worunter er natürlich die Seelen verstanden haben wollte75. Hieronymus: Der Herr sagt im Evangelium: „Seht zu, dass ihr nicht einen von diesen Kleinen verachtet! Denn ich sage euch, dass ihre Engel ständig das Angesicht meines Vaters sehen, der im Himmel ist“ (Mt 18,10). Eine große Würde kommt den Seelen dadurch zu, dass eine jede seit ihrer Entstehung einen Engel zu ihrem Schutz bestimmt bekommen hat76. ¦ Es genüge uns der erwähnte schlichte Glaube77 ¦ und unsere Rede soll schließlich ein Ende finden78.
Epilog Siehe da, mit Gottes Hilfe habe ich, was du ungestüm gefordert hast – so gut allerdings wie ich es konnte – vollbracht: Ich habe das Wesen der Seele erläutert, die nach dem Beispiel des ersten Menschen und dem Wort des Erlösers, von Gott, dem Herrn, täglich geschaffen wird und dem bereits geformten Körper gegeben wird. Es mag sein, dass ich den ganzen Durchgang etwas kurz, wegen der Eile – wenn man so sagen will – eher mit Sprüngen als mit Schritten zum Ziel geführt habe. Und wegen der Dürftigkeit meines geringes Talentes habe ich ihn mit dem Beistand aller Lehrer der Kirche, besonders aber durch die Bücher der zwei Ölbäume79 – Augustinus und Hieronymus natürlich – die rechts und links des goldenen Leuchters stehen, gleichwie zwei Lichter des Himmels, mit Ziel der Klarheit, der Erkenntnis ans Herz gelegt. Aus ganz vielen ihrer kleinen Werke, die ich mit der ihnen angemessenen, geschickten Sorgfalt und scharfsinnigen Nachforschungen untersuchte, habe ich ihre Worte wiederhergestellt, und so sie abwechselnd miteinander sprechen lassen als ob sie gegenwärtig wären. Denn was ist wirklich wichtiger? Was ist wirklich wahrer? Was ist wirklich katholischer? Was ist heller als die Sonne und zur Belehrung aller besser geeignet? Oder was ist mit Gewissheit so sicher gegenüber Häretikern, die ihre Feindschaft gegen uns mit Leidenschaft austoben? Was ist wirklich untadelig? Ihr also, die ihr den 75 76 77 78
Augustinus ad Optatum Ep. 190,16 CSEL 57, 151,2–5. Hieronymus, Commentarius in Evangelium Matthaei III CCL 77, 159 558–560; 570–572. Hieronymus ad Damasum Ep. 15,4 CSEL 54, 66,11–12. Hieronymus, Dialogus contra Pelagianos III,19 CCL 80, 123,17, ebenso Hieronymus ad Fabiolam Ep. 64,21 CSEL 54, 613,6. 79 Wörtlich werden Augustinus und Hieronymus im Text als „Geölte“ bezeichnet, „Ölbäume“ nimmt hier den Sprachgebrauch der Lutherbibel auf. Vgl. zum Ganzen Sacharja 4,1–3.
Im Dialogteil benutzte Schriften
71
Lehren der katholischen Männer beharrlich folgt, werdet als ihre rechtmäßigen, aber auch eng befreundeten Erben erfunden. Ihr sollt Weiseren vorgezogen werden, weil ihr in der lateinischen Beredsamkeit stark seid. Und ihr sollt nicht mehr von tröpfelnder Flüssigkeit – wie ich es in der Einleitung zum Ausdruck gebracht habe –, sondern von in Fülle dahinwogenden Wassermassen bewässert werden und Überfluss haben in den Flüssen der Heiligen.
Im Dialogteil benutzte Schriften (in der Reihenfolge der ersten Zitierung mit Angabe der Häufigkeit) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11)
Augustinus ad Hieronymum Ep. 166 (15x) Hieronymus ad Augustinum Ep. 115 (1x) Hieronymus ad Paulinum Ep. 58 (3x) Hieronymus ad Paulinum Ep. 53 (1x) Hieronymus, Commentarius in Evangelium Matthaei (2x) Augustinus, De diversis quaestionibus (1x) Hieronymus, Commentarius in Ecclesiasten (2x) Hieronymus ad Marcellinum et Anapsycham Ep. 126 (2x) Hieronymus, Dialogus contra Pelagianos (Critobul 1x : Atticus 11x) Augustinus ad Hieronymum Ep. 73 (1x) Augustinus ad Optatum Ep. 202a (2x) (Im Dialog aber Hieronymus in den Mund gelegt) 12) Augustinus ad Optatum Ep. 190 (2x) 13) Rufin (der Syrer), Libellus des fide, Anathematismus 12 (1x) (Im Dialog Hieronymus in den Mund gelegt) 14) Hieronymus ad Damasum, Ep. 15 (1x)
Hieronymus zum Bischofsamt
Einleitung Wer mit den Augen des Hieronymus auf das Bischofsamt schaut, bleibt auf kritischer Distanz. Für den Heiligen aus Bethlehem ist die Vorstellung eines Lebens als Bischof ohne Reiz gewesen. Er liebte seine Selbstdarstellung als asketischer Gelehrter zu sehr. Sein sorgfältig gestaltetes Selbstbild war der alter Origenes, der fern ab vom Getriebe der Welt durch seine Schriften wirkt1. Seine Äußerungen zum Bischofsamt spiegeln diese Distanziertheit wieder2. Er schreibt kritisch und polemisch über das Amt und einzelne Bischöfe, aber nicht aus dem frustrierten Blickwinkel eines Presbyters, der keinen Aufstieg geschafft hat3. Seine Perspektive ist die des Bibelgelehrten, der als Mönch lebt. Obwohl seine Äußerungen zum Bischofsamt in der Forschung bekannt sind, konzentrieren sich die bisher vorliegenden Darstellungen aber meistens auf Einzelaspekte4. Hier soll in der gebotenen Kürze ein größerer Überblick versucht werden.
1 Vgl. Mark Vessey, Jerome’s Origen: The Making of a Christian Literary Persona, in: STPatr 28 (1993) 135–145. 2 Vgl. das Urteil von Eric G. Jay, From Presbyter-Bishops to Bishops and Presbyters, in: SecCen 1 (1981) 125–163. Jay führt am Ende seiner Darlegungen zur Entstehung des monarchischen Bischofsamtes Hieronymus als den Hauptzeugen für die Außenseiterposition an: „There were those who differed. Jerome […] This statement [die Gleichsetzung von Bischof und Presbyter] runs counter to the general assumption of Jerome’s time“. 3 Wie es zum Beispiel Aerius durch Epiphanius von Salamis vorgeworfen wird. In Panarion 75 und der Anakephaleiosis vermutet Epiphanius, Aerius kritisiere das Bischofsamt nur deshalb, weil er es nicht erreicht habe. Aerius hat offenbar auch die Gleichheit der Ämter behauptet und versucht, das durch die Gleichheit der Funktionen zu begründen; Epiphanius, Panarion 75, 3,3, GCS 37, 334,26–32. 4 In der Diskussion um die Ämter wurden einzelne Äußerungen des Hieronymus stets beachtet, aber nicht in den Kontext der übrigen Stellen eingebunden. Siehe z. B. bei Joseph Ysebaert, Die Amtsterminologie im Neuen Testament und in der Alten Kirche. Eine lexikographische Studie, Breda 1994, 168–170. Die einzige ausführlichere Untersuchung zum Bischofsamt bei Hiero-
74
Hieronymus zum Bischofsamt
Das Bischofsamt tritt in den Schriften des Hieronymus das erste Mal in der Altercatio Luciferani et Orthodoxi in den Blick5. Zum weiteren Gegenstand der Reflexion wird es dann im 386 entstanden Kommentar zum Titusbrief. Hieronymus entfaltet seine Konzeption im Anschluß an den Bischofsspiegel Tit 1,7–96. Bis zu seinem Lebensende kommt er immer wieder auf diese Auslegung zurück. Das Bild, das sich aus dem Tituskommentar gewinnen läßt, muß durch Zeugnisse aus anderen Schriften des Hieronymus ergänzt werden, in denen er auf dort nicht behandelte Aspekte eingeht. Die folgende Darstellung gliedert sich in zwei Teile. Zuerst werden die Anforderungen, die Hieronymus an das Bischofsamt stellt, behandelt, dann die Kritik, die er am Amt und den Amtsträgern übt.
Anforderungen an das Bischofsamt Hieronymus akzeptiert die bestehenden hierarchischen Verhältnisse in der Kirche, deshalb wird er nicht müde, das Bischofsamt mit 1.Tim 3,1 als καλόν ἔργον, bonum opus oder „hohe Aufgabe“ zu preisen7. Um die außergewöhnlich hohe Würde des Amtes deutlich zu machen, vergleicht er es mit Fürsten oder Königen. Sein schönster Vergleich findet sich im Anschluß an ein Ennius-Zitat, in dem ausgesagt wird, daß es dem gemeinen Mann wohl anstünde zu weinen, die Würde des Königtums aber gerade daran deutlich werde, daß es dem König nicht zukomme. Hieronymus bezieht diese Stelle auf das Bischofsamt:
nymus enthält der Abschnitt „L’Église hiérarchique“ bei Yvon Bodin, Saint Jérôme et l’Église, Paris 1966, 174–215. 5 Zur umstrittenen Datierung der Entstehung dieser Schrift s. Stefan Rebenich, Hieronymus und sein Kreis. Prosopographische und sozialgeschichtliche Untersuchungen (Historia Einzelschriften 72), Stuttgart 1992, 99f. 6 Zur Datierung siehe Pierre Nautin, La date des commentaires de Jérôme sur les épîtres pauliniennes, in: RHE 74 (1979) 5–12. Inwieweit der Tituskommentar des Hieronymus von Origenes abhängig ist, läßt sich nicht vollständig klären. Sicher ist, daß Hieronymus diesen Kommentar gekannt hat. Da nur noch wenige Fragmente existieren (zusammengestellt in PG 14, 1303–1306), läßt sich nicht klären, ob Hieronymus die berühmtgewordene Identifikation von Presbyter und Bischof aus dem Tituskommentar des Origenes übernommen hat. Dazu auch Adolf von Harnack, Der kirchengeschichtliche Ertrag der exegetischen Arbeit des Origenes 2. Teil, Anhang: Origenistisches Gut von kirchengeschichtlicher Bedeutung in den Kommentaren des Hieronymus zum Philemon-, Galater-, Epheser- und Titusbrief (TU 42/4), Berlin 1919, 167. 7 Z. B. Hieronymus, Comm. in Sophoniam III, CCL 76a, 699,225–700,229; Comm. in Ep. ad Titum, PL 26, 598; Adversus Iouinianum I,34, PL 23, 270; Ep. 14,8, CSEL 54, 56,6; Ep. 69,3, CSEL 54, 682,15; Ep. 69,8, CSEL 54, 694,17.
Hieronymus zum Bischofsamt
75
Wie der König so der Bischof, und mehr noch der Bischof als der König, jener nämlich steht Unwilligen vor, dieser aber Willigen; jener unterwirft durch Terror, dieser herrscht durch Dienst; jener beschützt Leiber, dieser rettet Seelen zum Leben8.
Damit korrespondiert ein zweites Bild, das den Bischof im Gegenüber zu seiner Gemeinde beschreibt. Hieronymus vergleicht ihn mit Eltern, die man ebenso wie den Bischof lieben soll. Damit fordert er nicht kindhafte Unterwürfigkeit der Gemeinde, sondern einen Bischof, der sich so verhält, daß er wie ein Vater geliebt werden kann9. Charakteristisch ist in diesem Zusammenhang die pointierte Beschreibung des Bischofsamtes als Aufgabe und Verpflichtung. Gedanken der Ehre oder gar des Verdienstes liegen ihm fern: „Bischof, Presbyter und Diakon, das sind keine Titel, die Verdienste bezeichnen, sondern Aufgaben“10. Ganz im Sinne der klassischen römischen Auffassung von den Amtstugenden, bezeichnet Hieronymus das Bischofsamt als opus nicht als honor. Als ein opus gibt es Gelegenheit, die dazu notwendigen Tugenden praktisch zu erproben11. Nur wenn Bischöfe die erforderlichen Amtstugenden haben und anwenden, dann ist Hieronymus bereit, sie „selig“ zu nennen12. Menschliche Schwächen lassen sich für ihn nicht mit dem Bischofsamt vereinen. Deshalb vertritt er die Auffassung, daß ein Bischof, der im Amt Fehler begeht, sich selbst das Amt entzieht13. Am Ende seines Lebens, in der Auseinandersetzung mit den Pela8 Hieronymus, Ep. 60,14, CSEL 54, 567,16ff: „prudenterque Ennius: ‚plebes‘ ait ‚in hoc regio antista loco: licet lacrimare plebi, regi honestate non licet‘. Ut regi sic episcopo, immo minus regi quam episcopo. Ille enim nolentibus praeest, hic volentibus; ille terrore subicit, hic servitute dominatur; ille corpora custodiat ad mortem, hic animas servat ad vitam“. 9 Hieronymus, Ep. 82,3, CSEL 55, 110,3: „nonne tua dilectio? amari enim debet parens, amari parens et episcopus, non timeri.“ Dieses Zitat gehört in den Kontext der Auseinandersetzung zwischen Hieronymus und Johannes von Jerusalem. Im Gegensatz zu Johannes stellt Hieronymus Theophilus von Alexandria als idealen Bischof dar, den man wie einen Vater lieben kann. 10 Hieronymus, Aduersus Iouinianum I,34, PL 23, 270: „episcopus et presbyrer et diaconus non sunt meritorum nomina, sed officiorum“. 11 Hieronymus, Aduersus Iouinianum I,34, PL 23, 270: „nec dicitur: si quis episcopatum desiderat, bonum desiderat gradum; sed bonum opus desiderat, quod in maiore ordine constitutus possit, si velit, occasionem exercendarum habere uirtutum“, vgl. auch Hieronymus, Comm. In Sophoniam III, CCL 76a, 699,225–200,229: „non enim dignitas et nomina dignitatum, sed opus dignitatis, et principes, et iudices, et prophetas, et sacerdotes saluare consueuit: qui episcopatum, inquit, desiderat, bonum opus desiderat“, so auch ebd. 662,224–236: „sed et nomina sacerdotum cum sacerdotibus qui frustra sibi applauderunt in episopali nomine, et in presbyterii dignitate, et non in opere“. 12 Hieronymus, Aduersus Iouinianum I,35, PL 23, 270: „cernis igitur quod episcopus, presbyter, et diaconus non ideo sint beati, quia episcopi, uel presbyteri sint, aut diaconi, sed si uirtutes habuerint nominum suorum et officiorum“. 13 Hieronymus, Comm. in Ep ad Titum, PL 26, 602: „sed uereor ne, quomodo regina austri ueniens a finibus terrae audire sapientiam salomonis, iudicatura est homines temporis sui; et uiri niniuitae, acta poenitentia ad praedicationem ionae, condemnabunt eos qui maiorem
76
Hieronymus zum Bischofsamt
gianern über die Möglichkeit eines sündlosen Lebens, wird Hieronymus dann aber bestreiten, daß es Bischöfe gibt, die über alle Amtstugenden verfügen. Diese sollen aber nicht wegen der fehlenden Amtstugenden verdammt, sondern auf Grund derer, die sie haben, gekrönt werden14. Die Amtstugenden eines Bischofs werden in einer Reihe ethischer Forderungen spezifiziert, die Hieronymus im Anschluß an die beiden neutestamentlichen Bischofsspiegel 1.Tim 3,1–7/Tit 1,7–9 entfaltet. a) Der Bischof soll Mann einer Frau sein (1.Tim 3,2/Tit 1,6+8). Hieronymus versteht diese Stellen als ein allgemeines Verbot der Wiederverheiratung15. In Ep. 69 wird ein Fall aus Spanien geschildert. Bischof Carterius war bereits vor seiner Taufe verheiratet, und ging danach eine neue Ehe ein16. Dieses Verhalten geißelt Hieronymus mit dem Verweis auf die angegebenen Stellen. Er schließt seine Ausführungen mit dem apodiktischen Satz: „iubentur monogami in clerum adlegi“17. Im Rahmen seiner rigiden Sexualmoral verschärft Hieronymus seine Auslegung von 1.Tim 3,2/Tit 1,6+8 noch und legt sie schließlich als Aufforderung zur generellen Enthaltsamkeit im Amt aus18. Er polemisiert gegen diejenigen, die diese Stellen als Anweisung verstehen, daß ein Bischof verheiratet sein müsse19. Völlig undenkbar ist es für ihn, daß ein Bischof mit seiner Frau Kinder im Amt zeugen könnte20.
14
15 16 17 18
19
iona saluatorem audire contempserunt: sic plurimi in populis episcopos iudicent, subtrahentes se ab ecclesiastico gradu, et ea quae episcopo non conueniunt exercentes; de quibus puto et ioannem ad caium scribere: charissime, fideliter facis quodcunque operaris in fratribus, et hoc peregrinis, qui testimonium dederunt dilectioni tuae coram ecclesia: quos optime facis, si praemiseris deo digne; pro nomine enim domini exierunt, nihil accipientes a gentilibus“. Der Gedanke der Amtsenthebung ist in der Folgezeit zu einem sensiblen Feld der Kirchenpolitik geworden. So verwundert es nicht, daß diese Äußerung des Hieronymus auch Eingang ins Decretum Gratians gefunden hat. Hieronymus, Dial. contra Pelagianos I,23, CCL 80, 30,39–43: „aut nullus, inquam, aut rarus est qui omnia habeat quae habere debet episcopus. et tamen si unum uel duo de catalogo uirtutum episcopi cuiquam defuerit, non statim iusti carebit uocabulo, nec ex eo damnabitur quod non habet, sed ex eo coronabitur quod possidet“. Hieronymus, Comm. in Ep. ad Titum, PL 26, 599. Zu diesem Fall und dem Zusammenhang mit der Streitschrift des Hieronymus gegen Vigilantius s. Stefan Rebenich, Hieronymus und sein Kreis (Anm. 5), 249. Hieronymus, Ep. 69,3 ad Oceanum, CSEL 54, 683,21f. Hieronymus, Comm. in Ep. ad Titum, PL 26, 603: „si autem episcopus et pudicus, quem graeci σώφρονα uocant: et latinus interpres uerbi ambiguitate deceptus, pro pudico, prudentem transtulit. si autem laicis imperatur ut propter orationem abstineant se ab uxorum coitu: quid de episcopo sentiendum est, qui quotidie pro suis populi que peccatis, illibatas deo oblaturus est uictimas?“ Vgl. dazu auch Ambrosiaster, Comm. in 1. Cor., CSEL 81/II, 74. Hieronymus, Contra Vigilantium II, PL 23, 355C-356A: „proh nefas! episcopos sui sceleris dicitur habere consortes: si tamen episcopi nominandi sunt, qui non ordinant diaconos, nisi prius uxores duxerint: nulli caelibi credentes pudicitiam, imo ostendentes quam sancte uiuant qui male de omnibus suspicantur: et nisi praegnantes uxores uiderint clericorum, infantes que de ulnis matrum uagientes, christi sacramenta non tribuant“.
Hieronymus zum Bischofsamt
77
b) Die Kinder des Bischofs müssen – wie sich aus der vorhergehenden Äußerung ergibt –, vor dem Amtsantritt geboren worden sein. In den Pastoralbriefen wird allerdings nur erwähnt, daß sie gehorsam sein sollen (1.Tim 3,4/Tit 1,6). Diese Vorschrift spiritualisiert Hieronymus und wendet sie in seiner Auslegung auf die „geistigen Kinder“ und die „praktischen Kinder“ an: die Gedanken und die Werke. Sie sollen gehorsam sein. Für Hieronymus muß also die Affektkontrolle eines Bischofs besonders perfekt sein21. Theologische Begründung dafür ist der Gedanke der Reinheit des von Priestern und Bischöfen darzubringenden Opfers22. c) Der Hinweis in den Bischofsspiegeln, daß der Bischof kein Säufer sein darf (1.Tim 3,3/Tit 1,7), wird von Hieronymus ebenfalls im asketischen Sinne verschärft. Der Bischof soll überhaupt keinen Wein trinken23 und auch nicht durch übergroßen Appetit auffallen24.
20 Hieronymus, Aduersus Iouinianum I,34, PL 23, 268D: „certe confiteris non posse esse episcopum, qui in episcopatu filios faciat“. Vgl. Peter Browns Charakterisierung dieser Passage in Aduersus Iouinianum: „Er [Hieronymus] behauptete weiter, daß Priester nur insofern heilig seien, als sie die Reinheit von Jungfrauen besäßen. Die verheirateten Geistlichen seien nur unerfahrene Rekruten in der Armee der Kirche, die man wegen zeitweiliger Knappheit an kampferprobten Veteranen des lebenslangen Zölibats eingeführt habe. Das war eine denkwürdige Formulierung des asketischen Standpunkts in seiner unangenehmsten und wirklichkeitsfremdesten Form“, Peter Brown, Die Keuschheit der Engel, München 1991, 384. 21 Hieronymus, Comm. in Ep. ad Titum, PL 26, 600: „si autem peccata filiorum iustum ab episcopatu prohibent, quanto magis unusquisque se considerans et sciens quia potentes potenter tormenta patientur retrahet se ab hoc non tam honore quam onere: et aliorum locum, qui magis digni sunt, non ambiet occupare! ad extremum hoc dicendum est in scripturis per filios λογισμοὺς, id est cogitationes, per filias uero πράξεις, id est opera, intelligi, et eum nunc praecipi debere episcopum fieri, qui et cogitationes et opera in sua habeat potestate, et uere credat in christo, et nulla subrepentium uitiorum labe maculetur“ und ebd. 604: „sit quoque episcopus et abstinens: non tantum (ut quidam putant) a libidine et ab uxoris amplexu, sed ab omnibus animi perturbationibus: ne ad iracundiam concitetur: ne illum tristitia deiiciat: ne terror exagitet, ne laetitia immoderata sustollat“. 22 Hieronymus, Ep. 64,5, CSEL 54, 593,2–9: „ego, si fecero, si dixero quippiam, quod reprehensione dignum est, de sanctis egredior et polluo uocabulum christi, in quo mihi blandior: quanto magis pontifex et episcopus, quem oportet esse sine crimine tantarum que uirtutum, ut semper moretur in sanctis et paratus sit uictimas offerre pro populo, sequester hominum et dei et carnes agni sacro ore conficiens, quia sanctum oleum christi dei sui super eum est!“ 23 Er begründet das mit dem Weinverbot für die Priester am Tempel in Jerusalem und für die Menschen, die das Nazarener-Gelübde abgelegt hatten. Hieronymus, Comm. in Ep. ad Titum, PL 26, 601: „miramur autem apostolum in episcopis siue presbyteris damnasse uinolentiam, cum in uetere quoque lege praeceptum sit, sacerdotes cum ingrediuntur templum ministrare deo, uinum omnino non bibere et: nazaraeum quandiu sanctam comam nutriat, et nihil contaminatum, nihil mortale conspiciat, et a uino abstinere, et ab uua passa, et a dilutiori quae solet ex uinaceis fieri, potione, omni que sicera, quae mentem ab integra sanitate peruertit“. Andere Ausleger wie z. B. Theodoret von Cyrus können es unter Hinweis auf 1.Tim 3,8 mit dem Verbot übermäßigen Weingenusses bewenden lassen; Theodoret von Cyrus, Interpretatio Epist I. ad Tim 3,3, PG 82, 805.
78
Hieronymus zum Bischofsamt
d) Der Bischof muß gastfreundlich sein (1.Tim 3,2/Tit 1,8). Gegenüber den Laien zeichnet ihn aus, daß er gegenüber allen gastfrei sein soll25. Hieronymus geht so weit, zu sagen: „episcopus nisi omnes receperit, inhumanus est“26. e) Der Bischof soll die Heilige Schrift kennen27, recht predigen und treu die Lehre bewahren (1.Tim 3,2/Tit 1,9)28. Hieronymus wendet sich hier scharf gegen Gegner des ununterbrochenen Bibelstudiums und betont, daß nur ein schriftgelehrter Bischof in der Lage ist, in der rechten Lehre zu ermahnen und die Widersprechenden zu überwinden. Darüberhinaus finden sich bei Hieronymus aber auch Anforderungen an den Bischof, die nicht auf die Pastoralbriefe zurückgehen. Die drei hier aufgeführten Beispiele tragen den Funktionen Rechnung, die das Bischofsamt im Lauf der Zeit erhalten hat. Hieronymus fordert, daß: f) der Bischof ein gerechter Richter sein soll29. Er soll ohne Ansehen der Person richten und in allen Fällen Gerechtigkeit walten lassen, g) der Bischof muß sich intensiv um die Armenfürsorge kümmern30, h) der Bischof soll geübt sein in der Ausübung der Binde- und Lösegewalt31. 24 Hieronymus, Comm. in Ep. ad Titum, PL 26, 602: „turpis quoque lucri appetitus ab eo qui episcopus futurus est, esse debet alienus“. 25 Hieronymus, Comm. in Ep. ad Titum, PL 26, 602: „ante omnia hospitalitas futuro episcopo denuntiatur. […] si enim omnes illud de euangelio audire desiderant: hospes fui, et suscepistis me: quanto magis episcopus, cuius domus omnium commune esse debet hospitium! laicus enim unum aut duos, aut paucos recipiens, implebit hospitalitatis officium“. 26 Hieronymus, Comm. in Ep. ad Titum, PL 26, 602. 27 Hieronymus, Comm. in Ep. ad Titum, PL 26, 604: „hic locus aduersus eos facit qui, inertiae se, et otio, et somno dantes, putant peccatum esse si scripturas legerint: et eos qui in lege domini meditantur die ac nocte, quasi garrulos inutiles que contemnunt: non animaduertentes apostolum post catalogum conuersationis episcopi, etiam doctrinam similiter praecepisse“. 28 Hieronymus, Comm. in Matth. IV CCL 77, 241,882–242,888: „pecunia ergo et argentum praedicatio euangelii est et sermo diuinus qui dari debuit nummulariis et trapezitis, id est uel ceteris doctoribus, quod fecerunt et apostoli per singulas prouincias presbiteros et episcopos ordinantes, uel cunctis credentibus qui possunt pecuniam duplicare et cum usuris reddere, ut quicquid sermone didicerant opere explerent“ und Ep. 53,3 ad Paulinum, CSEL 54, 447,9–14: „tito praecipit, ut inter ceteras uirtutes episcopi, quem breui sermone depinxit, scientiam quoque in eo eligat scripturarum: continentem eum, qui secundum doctrinam est, fidelem sermonem, ut potens sit et exhortari in doctrina sana et contradicentes reuincere“. 29 Hieronymus, Comm. in Ep. ad Titum, PL 26, 603 „iustus quoque et sanctus episcopus esse debet, ut iustitiam in populis quibus praeest exerceat, reddens unicuique quod meretur: nec accipiat personam in iudicio. […] inter laici autem et episcopi iustitiam hoc interest, quod laicus potest apparere iustus in paucis, episcopus uero in tot exercere iustitiam potest, quot et subditos habet“ und Comm. in Michaeam I,3, CCL 76, 463,210–215. 30 Hieronymus, Ep. 52,6 ad Nepotianum, CSEL 54, 425,13–15: „quid nos inserimus inter matrem et liberos? gloria episcopi est pauperum opibus prouidere, ignominia omnium sacerdotum est propriis studere diuitiis“. 31 Hieronymus, Comm. in Matth. III CCL 77, 142,84–99, hier 95–99: „quomodo ergo ibi leprosum sacerdos inmundum facit, sic et hic alligat uel soluit episcopus et presbiter non eos qui insontes
Hieronymus zum Bischofsamt
79
Die Ansprüche, die Hieronymus an das Bischofsamt erhebt sind hoch. Er erwartet einen gelehrten, asketischen und moralisch integeren Christen als Idealtyp des Bischofs. Seine Kritik am Bischofsamt, die im Folgenden dargestellt wird, läßt sich zu einem großen Teil als Kritik am Versagen gegenüber diesen hohen Ansprüchen verstehen.
Kritik am Bischofsamt Hieronymus stellt die Institution des monarchischen Bischofsamtes und die Ämtertrias Bischof, Presbyter, Diakon nicht in Frage, aber er übt auf verschiedenen Ebenen Kritik am Erscheinungsbild des Amtes. Dabei lassen sich drei Hauptlinien unterscheiden: Erstens die asketisch und monastisch motivierte Kritik, die sich vor allem an Prachtentfaltung und öffentlicher Geltung der Bischöfe entzündet. Zweitens die Kritik an einzelnen Amtsinhabern, die zum Teil auf persönliche Auseinandersetzungen zurückzuführen ist. Drittens die strukturelle Kritik am Bischofsamt, die Hieronymus durch die Gleichsetzung von Presbyter und Bischofsamt artikuliert.
Asketisch-monastische Kritik am Bischofsamt Hieronymus ist ein radikaler Vertreter asketisch-monastischer Ideale, deshalb kommt für ihn selbst kein Bischofsamt in Frage und deshalb nimmt er gegenüber diesem Amt auch grundsätzlich eine kritische Haltung ein. Er achtet die Mönchszelle höher als die Cathedra32. Die Einsamkeit des Mönches ist für ihn wertvoller als die Betriebsamkeit im Bischofsamt. Hieronymus folgt der klassisch-römischen Anschauung, in der die „Ruhe ohne jede feindselige Auseinandersetzung auf dem Land und in der Einsamkeit“33 gegenüber den Verpflichtungen eines öffentlichen Amtes gepriesen wird. So schreibt er an Paulinus, den späteren Bischof von Nola:
sunt uel noxii, sed pro officio suo, cum peccatorum audierit uarietates scit qui ligandus sit, qui soluendus“. 32 Hieronymus, Ep. 117,1, CSEL 55, 423,5–9: „cui ego: ‚optimam‘, inquam, ‚mihi iniungis prouinciam, ut alienus conciliem, quas filius frater que non potuit, quasi uero episcopalem cathedram teneam et non clausus cellula ac procul a turbis remotus uel praeterita plangam uitia uel uitare nitar praesentia‘“. 33 Hieronymus, Ep. 82,11 ad Theophilum, CSEL 55, 118,23–119,4: „ut quieti absque ullis simultatibus in agris et in solitudine uiueremus; ut pontifices Christi qui tamen rectam fidem praedicant, non dominorum metu, sed patrum honore veneremur; ut deferamus episcopis quasi episcopis, et non sub nomine alterius, alii quibus nolumus, servire cogamur“.
80
Hieronymus zum Bischofsamt
Wenn du das Amt eines Presbyters ausüben willst, wenn des Bischofsamtes Aufgabe oder Ehren dich stark anziehen, dann lebe in Städten und Burgen und schaffe durch das Heil andrer Gewinn für deine Seele. Wenn du aber sein willst, was du gesagt hast: ein Mönch – das heißt ein Einzelner –, was tust du dann in den Städten, die schlechterdings nicht die Behausungen der Einzelnen sind sondern der Vielen?34
Das Leben als Bischof ist mit den Idealen des Hieronymus von einer monastischen Existenz nicht vereinbar35. Aber ungeachtet seiner Vorstellungen ist das beginnende fünfte Jahrhundert die Zeit, in der mehr und mehr Mönche auf die Bischofsstühle berufen werden. Für Hieronymus ist es besonders erwähnenswert, wenn es einzelne schaffen, die monastische Existenz mit dem Bischofsamt zu verbinden. Sein Jugendfreund Heliodor, der Bischof von Altinum ist ein Beispiel für die gelungene Synthese. In ihm konnte sein Neffe Nepotianus zugleich den Mönch und den Bischof verehren36.
Kritik an der Amtsführung Hieronymus übt häufig Kritik an der Amtsführung von Bischöfen. Sie ergibt sich aus dem Versagen gegenüber seinen Anforderungen an das Amt. Dabei kann Hieronymus nur auf literarischem Wege Einfluß ausüben. Sein häufigstes Instrument ist der Hinweis auf die Gleichheit aller Christen und die Androhung des göttlichen Gerichts. Dabei betont er immer wieder, daß die Bischöfe Mitknechte, conservi37 und nicht Herren der Gemeinde seien38. Mahnend und tadelnd erhebt er den Finger gegen die: denen der Kamm schwillt ob des Bischofsamtes und die glauben, daß sie nicht der Haushalterschaft Christi sondern dem Imperium nacheifern sollen, sie sind nämlich
34 Hieronymus, Ep. 58,5 ad Paulinum, CSEL 54, 533,15–20: „si officium uis exercere presbyteri, si episcopatus te uel opus uel honos forte delectat, uiue in urbibus et castellis et aliorum salutem fac lucrum animae tuae. Sin autem cupis esse quod diceris, monachus, id est solus, quid facis in urbibus quae utique non sunt solorum habitacula sed multorum?“ 35 Vgl. z. B. die polemische Selbststilisierung gegenüber Augustinus in Hieronymus, Ep. 112,22 ad Augustinum CSEL 55, 393,7–10. 36 Hieronymus, Ep. 60,10 ad Heliodorum, CSEL 54, 559,7–8: „in uno atque eodem et imitabatur monachum et episcopum uenerabatur“. 37 Hieronymus, Comm. in Ep. ad Galatas II, PL 26, 406: „quae quidem et nos ad humilitatem prouocant, et supercilium decutiunt episcoporum, qui uelut in aliqua sublimi specula constituti, uix dignantur uidere mortales, et alloqui conseruos suos“ und Comm. in Ep. ad Titum, PL 26, 600: „sciat itaque episcopus et presbyter, sibi populum conseruum esse, non seruum“. 38 Hieronymus, Comm.in Eccl. 8,9, CCL 72, 318,144–146: „possumus hoc testimonio uti aduersus episcopos, qui acceperunt in ecclesia potestatem et scandalizant magis eos, quos docere et ad meliora debuerant incitare“.
Hieronymus zum Bischofsamt
81
nicht gleich etwas besseres, als die anderen, die nicht zum Bischof bestimmt worden sind39.
Gerade solche Amtsinhaber ermahnt Hieronymus immer wieder, sich nicht zu sicher zu fühlen im Besitz ihrer bischöflichen Würde. Ihnen droht die Verdammnis, wenn sie ihre Pflichten nicht erfüllen40. Das abschreckende Beispiel dafür ist Judas, der selbst des Apostolates verlustig ging. Das sollen sich Bischöfe und Priester eine Mahnung sein lassen und darauf achten, daß sie nicht das Priestersein verlieren41. Erbost ist Hieronymus, wenn Amtsträger oder auch Laien versuchen, mit dem Glauben Geschäfte zu machen. Gegen diese „Räuber auf dem Bischofsthron“ legt er Mt 21,22 (zusammen mit Mt 10,8) im geistlichen Sinne aus und versteht die Geschichte von der Tempelaustreibung als ein aktuelles Geschehen in der Kirche42: Täglich geht Jesus in den Tempel seines Vaters und vertreibt alle – sowohl Bischöfe, Presbyter, Diakone, als auch Laien und die ganze Menge aus seiner Kirche, auf Grund eines einzigen Verbrechens: weil sie verkaufen und verkaufen. Denn es steht geschrieben: Umsonst habt ihr’s empfangen, umsonst gebt es auch!
Die konkrete Frage einer Amtsenthebung diskutiert Hieronymus aber nicht. Zu groß sind die praktischen Schwierigkeiten. So stöhnt er nur resigniert darüber, wie „schwierig es ist, einen Bischof anzuklagen“43.
Strukturelle Kritik: Die Gleichsetzung von Bischof und Presbyter Der wirkmächtigste Beitrag des Hieronymus zur Lehre vom Amt des Bischofs ist seine Identifikation des Bischofsamtes mit dem Amt des Presbyters. Seine Kritik am Auseinandertreten der Ämter von Bischof und Presbyter hat aus heutiger
39 Hieronymus, Comm. in Ep. ad Titum, PL 26, 600: „deinde etiam illud est inferendum aduersum eos qui de episcopatu intumescunt, et putant se non dispensationem christi, sed imperium consecutos: quia non statim omnibus his meliores sint, quicunque episcopi non fuerint ordinati“. 40 Hieronymus, Comm. in Ep. ad Titum, PL 26, 603: „uere nunc est cernere quod praedictum est, in plerisque urbibus, episcopos, siue presbyteros, si laicos uiderint hospitales, amatores bonorum, inuidere, fremere, excommunicare, de ecclesia expellere, quasi non liceat facere quod episcopus non faciat: et tales esse laicos, damnatio sacerdotum sit“. 41 Hieronymus, Tractatus in Ps. 108, CCL 78, 212,116 im Anschluß an Ps 109,8: „et episcopatum eius accipiat alter […] si iudas apostolatum perdidit, custodiant se sacerdotes et episcopi, ut non et ipsi suum sacerdotium perdant“. 42 Hieronymus folgt hier Origenes, der in seinem Matthäuskommentar (GCS 40, 549,27; 552,29) bereits eine ähnliche Auslegung gegeben hat. 43 Hieronymus, Comm. in Ecclesiasten 8,9, CCL 72, 318,153–155: „difficilis est accusatio in episcopum Et si peccaverit, non creditur, et si convictus fuerit, non punitur“.
82
Hieronymus zum Bischofsamt
Sicht historische44, lexikographische45 und soziologische46 Argumente für sich. Hieronymus findet seine Position aber auf einem anderen Weg. Entscheidend sind für ihn Stellen im Neuen Testament, in denen die Begriffe Presbyter und Bischof nicht deutlich voneinander abgegrenzt werden. So wird in Apg 20,28 die Funktion der Presbyter zugleich als die von „Aufsehern“ (ἐπίσκοποι) beschrieben47. Ausgehend von solchen Beobachtungen behauptet Hieronymus erstens, daß in der urchristlichen Zeit Bischof und Presbyter das Gleiche gewesen seien: „idem est ergo presbyter qui et episcopus“48 und zweitens, daß die Presbyter die Kirche gemeinsam geleitet hätten, bis der Teufel den Spaltpilz in die Kirche eingeschmuggelt habe und es Parteiungen wie in Korinth gab49. Das Bischofsamt sei also nur eine Antwort auf die Zerteilungen der Kirche. Davor hätten die Presbyter gemeinsam die Funktionen ausgeübt, die dann von den Bischöfen wahrgenommen wurde. Dafür dient ihm die Kirche Alexandrias als Beispiel. Seine Darstellung der alexandrinischen Verhältnisse ist aber mit Sicherheit
44 Vgl. Ekkehard W. Stegemann / Wolfgang Stegemann, Urchristliche Sozialgeschichte. Die Anfänge im Judentum und die Christusgemeinden in der mediterranen Welt, Stuttgart 1995, 242. Die Autoren verweisen auf den Wandel vom Typus der paulinischen Gemeinden, in der die Leitungsfunktion eine „Rolle“ im Kontext charismatischer Gruppen zu haben scheint, hin zu der in den Pastoralbriefen erkennbaren Vorstellung vom Leiter der Gemeinde als Hausvater. Diese Funktion ist in den aber noch nicht hierarchisch in Presbyter und Episkopen differenziert. 45 Eine ausführliche Untersuchung, die die Synonymie von ἐπίσκοπος und πρεσβύτερος im Neuen Testament behandelt, findet sich bei Joseph Ysebaert, Amtsterminologie (Anm. 4), hier 60–73. 46 Dazu siehe Hans Dombois, Hierarchie. Grund und Grenze einer umstrittenen Struktur, Freiburg 1971, 70–72. 47 Hans von Campenhausen, Kirchliches Amt und geistliche Vollmacht in den ersten drei Jahrhunderten (BHTh 14), Tübingen 19632 168: „‚Älteste‘ […] haben, wie Lukas durchblicken läßt, zugleich die Bedeutung von ‚Bischöfen‘: denn zu ‚Aufsehern‘ hat sie der Geist in den Gemeinden gesetzt.“ Solche Beobachtungen hat Hieronymus auch gemacht; z. B. Comm. in Ep. ad Titum, PL 26, 597: „sed quia eosdem episcopos illo tempore quos et presbyteros appellabant: propterea indifferenter de episcopis quasi de presbyteris est locutus“ und etwas später „in actibus apostolorum scriptum est, quod cum uenisset apostolus miletum, miserit ephesum, et uocauerit presbyteros ecclesiae eiusdem, quibus postea inter caetera sit locutus: attendite uobis, et omni gregi, in quo uos spiritus sanctus posuit episcopos [Apg 20,28] pascere ecclesiam domini, quam acquisiuit per sanguinem suum. et hic diligentius obseruate, quomodo unius ciuitatis ephesi presbyteros uocans, postea eosdem episcopos dixerit“. Eine Testimoniensammlung findet sich in Ep. 146,1 ad Evangelum, CSEL 56, 308,8–309,20. 48 Hieronymus, Comm. in Ep. ad Titum, PL 26, 597: „sed nostram esse sententiam, episcopum et presbyterum unum esse“ und ebd. „haec propterea, ut ostenderemus apud ueteres eosdem fuisse presbyteros quos et episcopos“; weiterhin Hieronymus, Comm. in Aggaeum 2,12 CCL 76a, 734,306–308: „et ne casu hoc dixisse uideretur, ad titum quoque super presbyteris, quos et episcopos intellegi uult, ordinandis, eadem cautela seruatur“. 49 Hieronymus, Comm. in Ep. ad Titum, PL 26, 597: „idem est ergo presbyter qui et episcopus, et antequam diaboli instinctu studia in religione fierent, et diceretur in populis: ego sum pauli, ego apollo, ego autem cephae, communi presbyterorum concilio ecclesiae gubernabantur“.
Hieronymus zum Bischofsamt
83
tendenziös50. Hieronymus gibt an, daß die Kirche von Alexandria noch bis zur Zeit des Heraclas und Dionysius von einem Presbyterkollegium geleitet wurde, das jeweils einen aus diesem Kreis zum Bischof wählte51. Seine Darstellung ist von der Absicht bestimmt, zu belegen, daß in einem Patriarchat die Identität von Presbyter und Bischof historische Wirklichkeit war. Deshalb ist dieses Beispiel später immer wieder herangezogen worden, wenn die Identität von Bischofs- und Presbyteramt herausgestellt werden sollte52. Hieronymus betont immer wieder, daß die beiden Ämter ursprünglich identisch waren53. Bis auf die Ordination sind auch alle Aufgaben gleich54. Der Hauptgrund für die Einheit der beiden Ämter liegt für Hieronymus darin, daß Bischöfe und Presbyter zusammen die eine Priesterfamilie Christi bilden55, so wie Aaron und seine Söhne im alten Bund. Die Funktionen des Priesters, als Leiter der Eucharistie und als Inhaber der Binde- und Lösegewalt56 sind das Konstituum für das eine Amt der Kirche, das sich jetzt Bischöfe und Presbyter in der Leitung der Kirche teilen57: „Das, was Aaron und seine Söhne waren, das kennen wir als Bischof und Presbyter: ein Herr, ein Tempel, eins sei auch das Amt“.58
50 Eine ausführliche Darstellung der Regelungen zur Bischofsnachfolge in Alexandria bietet Joseph Ysebaert, Amtsterminologie (Anm. 4), 168–177. Dort findet sich eine Zusammenstellung anderer relevanter patristischer Zeugnisse. 51 Hieronymus, Ep. 146,1 ad Evangelum, CSEL 56, 310,8–10: „nam et Alexandriae a Marco euangelista usque Heraclam et Dionysium episcopos presbyteri semper unum de se electum et in excelsiori gradu conlocatum episcopum nominabant“. 52 Z. B. Martin Luther, Schmalkaldische Artikel X, zitiert nach BSELK 458,14f u. 25f. 53 Anders z. B. Theodoret von Cyrus, Interpretatio Epist I. ad Tim 3,3, PG 82, 604. Theodoret behauptet, Presbyter und Bischof hätte „in alter Zeit“ das gleiche bedeutet, aber die Funktion, die jetzt die Bischöfe ausüben, hätten damals die Apostel innegehabt. Vgl. auch dessen Interpretation in Ep. ad Phil. 1,2, PG 82, 560B. 54 Hieronymus, Ep. 146,1 ad Evangelum, CSEL 56, 310,12–13: „Quid enim facit excepta ordinatione episcopus, quod presbyter non faciat?“ 55 Das betont auch der sogenannte Ambrosiaster, Comm. in Ep. ad Tim. I, 3,8, CSEL 81/III, 267,18–23: „post episcopum tamen diaconis ordinationem subiecit. quare, nisi quia episcopi et presbyteri una ordinatio est? uterque enim sacerdos est, sed episcopus primus est, ut omnis episcopus presbyter sit, non tamen omnis presbyter episcopus. hic enim episcopus est, qui inter presbyteros primus est“. Vgl. auch Comm. in Ep. ad Efesios 4,11, CSEL 81/III, 99,11f. 56 Hieronymus, Comm. in Ecclesiasten 12,4, CCL 72, 354,170–174: „sequenti autem uersiculo, in eo quod ait: et consurget ad uocem uolucris, siue passeris, utemur in tempore, si quando uiderimus peccatorem ad uocem episcopi uel presbyteri per paenitentiam consurgentem“ und Comm. in Mattheum III, CCL 77, 142,95–99: „quomodo ergo ibi leprosum sacerdos inmundum facit, sic et hic alligat uel soluit episcopus et presbiter non eos qui insontes sunt uel noxii, sed pro officio suo, cum peccatorum audierit uarietates scit qui ligandus sit, qui soluendus“. 57 Hieronymus, Comm. in Ep. ad Titum, PL 26, 597 Presbyter und Bischöfe regieren gemeinsam die Kirche: „in commune debere ecclesiam regere“. Herrschaft teilen zu müssen könnte aber doch auch heißen, daß für Presbyter einfach dasselbe gilt, wie für Bischöfe; Hieronymus, Ep. 146,2 ad Evangelum, CSEL 56, 311,19f: „de presbyteris omnino reticetur, quia in episcopo et presbyteri continetur“.
84
Hieronymus zum Bischofsamt
Dieses eine Amt ist durch „die Wahrheit des Herren festgesetzt“; es ist eine dispositio dominica. Die Unterscheidung zwischen Bischof und Presbyter hat für Hieronymus demgegenüber eine andere Qualität. Er bezeichnet sie als bloße Gewohnheit59. Diese Unterscheidung zwischen kirchlicher Gewohnheit und göttlicher Anordnung findet aber erst in der Folgezeit großen Widerhall. Bei Hieronymus selbst bleibt sie merkwürdig folgenlos. In konkreten Vollzügen zeigt es sich, daß er die klassische Trias Bischof – Presbyter – Diakon akzeptiert und nicht beabsichtigt, dieses System zu verändern60. So auch im Fall des römischen Presbyters Evangelus, in dem Hieronymus seine Theorie der Einheit von Bischofs- und Presbyteramt anwenden könnte. Aber in Ep. 146 an Evangelus benutzt er seine Theorie nur dazu, die Positionen von Bischof und Presbyter gegenüber den Diakonen abzugrenzen61. Seiner These der Identität von Presbyter und Bischof ist aber dennoch eine große Wirkung beschieden gewesen. Die wesentlichen Stellen sind in den Diskussionen um die Ämter der Kirche immer wieder zitiert worden. Das Decretum Gratinans führt sie fast vollständig an und in der Reformation waren seine Gedanken eine wichtige Autorität für die Herausbildung der Lehre vom einen Amt62. Der Satz Melanchthons: „cum jure divino non sint diversi gradus episcopi et pastoris“63 wäre ohne die These des Hieronymus nicht denkbar gewesen.
58 Hieronymus, Ep. 52,7 ad Nepotianum, CSEL 54, 427,13–15: „quod aaron et filios eius, hoc episcopum et presbyteros nouerimus: unus dominus, unum templum, unum sit etiam ministerium“. 59 Hieronymus, Comm. in Ep. ad Titum, PL 26, 597: „sicut ergo presbyteri sciunt se ex ecclesiae consuetudine ei qui sibi praepositus fuerit, esse subiectos: ita episcopi nouerint se magis consuetudine, quam dispositionis dominicae ueritate, presbyteris esse maiores“. 60 Hieronymus, Comm. in Hieremiam I 12,5, CCL 74, 12,15f.; Comm. in Hieremiam IV 35,7, CCL 74, 202,5–7; Homilia in Matthaeum, CCL 78, 504,64; Ep. 108,28, CSEL 55, 347,18. 61 Die deutliche Unterscheidung zwischen Diakonen auf der einen und Presbytern und Bischöfen auf der anderen Seite, findet sich auch bei Johannes Chrysostomus und Ambrosiaster in der Auslegung von 1.Tim 3,8: Chrysostomus, In Ep. I. ad Tim. Hom. XI, PG 62, 553; Ambrosiaster Comm. in Ep. ad Tim. I, 3,8, CSEL 81/III, 267,18f (s. o. Anm. 55). Für die Textund Überlieferungsgeschichte der Titushomilien des Chrysostomus s. Blake Godall, The Homilies of St. John Chrysostom on the Letters of St. Paul to Titus and Philemon. Prolegomena to an Edition (UCP.CS 20), Berkeley u. a. 1979. 62 Zur Wirkungsgeschichte siehe Ralph Hennings, Hieronymus zum Bischofsamt und seine Autorität in dieser Frage bei Luther, Melanchthon und Zwingli, in: L.Grane / A.Schindler / M.Wriedt [Hg.], Auctoritas Patrum II, Mainz 1997, 83–101. 63 Philipp Melanchthon, Tractatus de potestate papae zitiert nach BSELK 490,37f.
Hieronymus zum Bischofsamt
85
Literatur Yvon Bodin, Saint Jérôme et l’Église, Paris 1966. Peter Brown, Die Keuschheit der Engel, München 1991. Hans von Campenhausen, Kirchliches Amt und geistliche Vollmacht in den ersten drei Jahrhunderten (BHTh 14), Tübingen 19632. Hans Dombois, Hierarchie. Grund und Grenze einer umstrittenen Struktur, Freiburg 1971. Blake Godall, The Homilies of St. John Chrysostom on the Letters of St. Paul to Titus and Philemon. Prolegomena to an Edition (UCP.CS 20), Berkeley u. a. 1979. Adolf von Harnack, Der kirchengeschichtliche Ertrag der exegetischen Arbeit des Origenes 2. Teil, Anhang: Origenistisches Gut von kirchengeschichtlicher Bedeutung in den Kommentaren des Hieronymus zum Philemon-, Galater-, Epheser- und Titusbrief (TU 42/4), Berlin 1919. Eric G. Jay, From Presbyter-Bishops to Bishops and Presbyters, in: SecCen 1 (1981) 125–163. Pierre Nautin, La date des commentaires de Jérôme sur les épîtres pauliniennes, in: RHE 74 (1979) 5–12. Stefan Rebenich, Hieronymus und sein Kreis. Prosopographische und sozialgeschichtliche Untersuchungen (Historia Einzelschriften 72), Stuttgart 1992. Ekkehard W. Stegemann / Wolfgang Stegemann, Urchristliche Sozialgeschichte. Die Anfänge im Judentum und die Christusgemeinden in der mediterranen Welt, Stuttgart 1995. Mark Vessey, Jerome’s Origen: The Making of a Christian Literary Persona, in: STPatr 28 (1993) 135–145. Joseph Ysebaert, Die Amtsterminologie im Neuen Testament und in der Alten Kirche. Eine lexikographische Studie, Breda 1994.
Hieronymus zum Bischofsamt und seine Autorität in dieser Frage bei Luther, Melanchthon und Zwingli
Hieronymus gehört zu den Kirchenvätern, die mit ihrem Werk entscheidenden Einfluß auf die Reformatoren ausgeübt haben. Bekannt und in der Forschung anerkannt ist vor allem der Einfluß des Exegeten Hieronymus, dessen Schriften im Gefolge des Humanismus Eingang in die reformatorische Arbeit an der Bibel gefunden haben. Hieronymus hat aber auch auf die Dogmatik der reformatorischen Kirchen eingewirkt. Ich möchte dies auf einem begrenzten Gebiet zeigen, der Lehre vom Amt des Bischofs bzw. des Pfarrers. Da es dazu keine auch nur einigermaßen befriedigende Darstellung der Position des Hieronymus gibt1, ist es notwendig, hier nicht nur den Rezeptionsprozess zu beleuchten, sondern vorher auch den Äußerungen des Hieronymus selbst Beachtung zu schenken.
Hieronymus zum Bischofsamt Für Hieronymus selbst ist ein Leben als Bischof nicht von Interesse gewesen. In sein Selbstkonzept als monastischer Gelehrter paßt kein öffentliches Amt. Seine Überlegungen zum Bischofsamt, die Gegenstand dieser Untersuchung sind, sind also nicht von eigener Praxis geprägt, aber auch nicht vom frustrierten Blickwinkel eines „Nur-Presbyters“. Das Bischofsamt selbst tritt in den Schriften des Hieronymus das erste Mal in seinem ca. 389 entstandenen Kommentar zum Titusbrief in den Blick2. Hiero1 Die einzige ausführlichere Untersuchung zu dem gesamten Themenbereich enthält der Abschnitt „L’Église hiérarchique“ bei Yvon Bodin, Saint Jérôme et l’Église, Paris 1966, 174–215. 2 Inwieweit der Tituskommentar des Hieronymus von Origenes abhängig ist, läßt sich nicht vollständig klären. Sicher ist, daß Hieronymus diesen Kommentar gekannt hat. Leider existieren vom Kommentar des Origenes nur wenige Fragmente, die in PG 14, 1303–1306 zusammengestellt sind. Ob Hieronymus die berühmtgewordene Identifikation von Presbyter und Bischof von Origenes übernommen hat, läßt sich aus dem vorhandenen Material nicht belegen. Dazu vgl. auch Adolf von Harnack, Der kirchengeschichtliche Ertrag der exegetischen Arbeit des Origenes 2. Teil, Anhang: Origenistisches Gut von kirchengeschichtlicher Bedeu-
88
Hieronymus zum Bischofsamt und seine Autorität in dieser Frage
nymus entfaltet seine Gedanken zum Bischofsamt im Anschluß an den Bischofsspiegel in Tit 1,7–9. Die hier entwickelten Gedanken erweisen sich bis zu seinem Lebensende als bestimmend. Das Bild, das sich aus dem Tituskommentar gewinnen läßt, muß aber ergänzt werden durch Zeugnisse aus anderen Schriften des Hieronymus, in denen er auf weitere Aspekte des Bischofsamtes eingeht. Dieses Material besteht neben den versprengten Zeugnissen in Kommentaren und Briefen aus drei Schriften, die aus konkreten Anlässen verfaßt worden sind. Zum einen ist es der Dialog „Gegen die Luciferaner“, zum anderen zwei Briefe, Ep. 69 und Ep. 1463, die jeweils Antworten auf Hieronymus gestellten Detailfragen sind.
Zum Bischofsamt im Allgemeinen Das generelle Bild, daß Hieronymus von diesem Amt entwirft ist bestimmt durch die Akzeptanz der bestehenden Verhältnisse. Hieronymus versucht an keiner Stelle, das monarchische Bischofsamt als solches in Frage zu stellen. Seine Kritik, die später detailliert betrachtet werden soll, erweist sich zwar als wirkmächtig, ist aber nicht von einem Impuls zur Veränderung getragen. Im Gegenteil, Hieronymus wird nicht müde, das Bischofsamt mit I Tim 3,1 als καλον ἔργον, bonum opus oder „hohe Aufgabe“ zu preisen4. Um die außergewöhnlich hohe Würde des Amtes deutlich zu machen, benutzt Hieronymus zuweilen den Vergleich mit dem Fürsten oder König, wobei er den Bischof nicht als Kirchenfürsten verstehen will. Für Bischöfe, die sich als principes ecclesiae gerieren, hegt er nur Verachtung. Sein schönster Vergleich des Bischofs mit einem König hat statt dessen mahnenden Charakter und enthält zugleich eine Beschreibung der qualitativen Unterschiede ihrer Ämter. Hieronymus zitiert eine Ennius-Stelle, die besagt, daß es dem gemeinen Mann wohl anstünde zu weinen, die Würde des Königtums aber
tung in den Kommentaren des Hieronymus zum Philemon-, Galater-, Epheser- und Titusbrief (TU 42/4), Berlin 1919, 167. 3 Die Datierung von Ep. 146 ist ungewiß. Mit Sicherheit kann nur ein terminus post quem gefunden werden. Der Brief ist nach seiner Übersiedlung nach Bethlehem 386 verfaßt worden, denn er setzt den Aufenthalt des Hieronymus in Rom 382–386 voraus. Heinz-Meinolf Stamm, Luthers Berufung auf die Vorstellungen des Hieronymus vom Bischofsamt, in: Martin Brecht (Hg.), Martin Luther und das Bischofsamt, Stuttgart 1990, 15–26: 15f. scheint davon auszugehen, daß Ep. 146 vor der Abfassung des Tituskommentars (389) entstanden ist und somit das erste Zeugnis für die Position des Hieronymus zum Bischofsamt ist. Mir scheint es plausibler, daß Ep. 146 nach dem Tituskommentar entstanden ist, in dem die allmähliche Entstehung seiner Auffassung zu beobachten ist. 4 Hieronymus, Comm. in Sophoniam III, CCL 76a, 699,225–700,229; Comm. in Ep. ad Titum, PL 26, 598; Aduersus Iouinianum I, 34, PL 23, 270; Ep. 14,8 CSEL 54, 56,6; Ep. 69,3 CSEL 54, 682,15; Ep. 69,8 CSEL 54, 694,17.
Hieronymus zum Bischofsamt und seine Autorität in dieser Frage
89
gerade daran deutlich werde, daß es dem König nicht zukomme. Im Anschluß daran sagt Hieronymus: Wie der König so der Bischof, und mehr noch der Bischof als der König, jener nämlich steht Unwilligen vor, dieser aber Willigen; jener unterwirft durch Terror, dieser herrscht durch Dienst; jener beschützt Leiber, dieser rettet Seelen zum Leben5.
Damit korrespondiert ein zweites Bild, das Hieronymus für die Beschreibung des Bischofs im Gegenüber zu seiner Gemeinde beschreibt. Er vergleicht ihn mit Eltern, die man ebenso wie den Bischof lieben soll. Damit fordert er aber nicht kindhafte Unterwürfigkeit, sondern einen Bischof, der idealerweise von seiner Gemeinde wie ein Vater geliebt wird6. Zu den weiteren allgemeinen Charakteristika des Bischofsamtes bei Hieronymus gehört die pointierte Beschreibung Amtes als Aufgabe und Verpflichtung. Gedanken der Ehre oder gar des Verdienstes liegen ihm fern: „Bischof, Presbyter und Diakon, das sind keine Titel, die Verdienste bezeichnen, sondern Aufgaben.“7 Auch die hohe Aufgabe, die das Bischofsamt darstellt, sollte niemanden dazu verleiten, zu glauben, es handele sich um eine Stufe der Karriereleiter, die man durch das Amt hinaufstiege. Ganz im Sinne der klassisch römischen Auffassung von den Amtstugenden, bezeichnet Hieronymus das Bischofsamt als opus (im Sinne von Werk nicht Aufgabe), weil es dazu Gelegenheit gibt, Tugenden praktisch zu erproben8. Nur wenn Bischöfe die für das Amt erforderlichen Tugenden haben und anwenden, dann ist Hieronymus bereit, sie „selig“ zu nennen, aber nicht etwa wegen der bloßen Tatsache der Amtsinhabe9. Weil er aber um die
5 Hieronymus, Ep. 60,14 CSEL 54, 567,14–568,3: „prudenterque Ennius: ‚plebes‘ ait ‚in hoc regio antista loco: licet lacrimare plebi, regi honestate non licet‘. Ut regi sic episcopo, immo minus regi quam episcopo. Ille enim nolentibus praeest, hic volentibus; ille terrore subicit, hic servitute dominatur; ille corpora custodiat ad mortem, hic animas servat ad vitam.“ 6 Hieronymus, Ep. 82,3 CSEL 55, 110,3: „nonne tua dilectio? amari enim debet parens, amari parens et episcopus, non timeri.“ Mit diesem Zitat beschreibt Hieronymus Theophilus von Alexandrien im Gegensatz zu Johannes von Jerusalem, mit dem er im Streit liegt, und stellt so Theophilus als idealen Bischof dar. 7 Hieronymus, Aduersus Iouinianum I,34 PL 23, 270: „episcopus et presbyter et diaconus non sunt meritorum nomina, sed officiorum.“ 8 Hieronymus, Aduersus Iouinianum I,34 PL 23, 270: „nec dicitur: si quis episcopatum desiderat, bonum desiderat gradum; sed bonum opus desiderat, quod in maiori ordine constitutus possit, si uelit, occasionem exercendarum habere uirtutum“ vgl. auch Hieronymus, Comm. in Sophoniam III CCL 76a, 699,225–700,229: „non enim dignitas et nomina dignitatum, sed opus dignitatis, et principes, et iudices, et prophetas, et sacerdotes saluare consueuit: qui episcopatum, inquit, desiderat, bonum opus desiderat“ so auch Comm. in Sophoniam I, CCL 76a, 662,234–236: „sed et nomina sacerdotum cum sacerdotibus qui frustra sibi applaudunt in episcopali nomine, et in presbyterii dignitate, et non in opere.“ 9 Hieronymus, Aduersus Iouinianum I,35 PL 23, 270: „cernis igitur quod episcopus, presbyter, et diaconus non ideo sint beati, quia episcopi, uel presbyteri sint, aut diaconi, sed si uirtutes habuerint nominum suorum et officiorum.“
90
Hieronymus zum Bischofsamt und seine Autorität in dieser Frage
Schwäche der condition humaine weiß, ist ihm der Gedanke nicht fremd, daß auch ein Bischof fehlen kann und sich selbst das Amt durch ungeziemendes Handeln entziehen kann10. Der Gedanke der Amtsenthebung ist in der Folgezeit zu einem sensiblen Feld der Kirchenpolitik geworden, so verwundert es nicht, daß diese Äußerung des Hieronymus auch Eingang ins Decretum Gratiani gefunden hat. Zu den Amtstugenden kommen noch eine Reihe weiterer ethischer Forderungen an die Inhaber des Amtes, die Hieronymus im Anschluß an die beiden neutestamentlichen Bischofsspiegel (1. Tim 3,1–7 / Tit 1,7–9) entfaltet, auf die hier nicht weiter eingegangen werden kann, obwohl Hieronymus auch auf diesem Gebiet eine gewisse Wirkungsgeschichte beschieden war.
Kritik am Bischofsamt Der wirkmächtigste Beitrag des Hieronymus zur Lehre vom Amt des Bischofs ist seine Identifikation des Bischofsamtes mit dem Amt des Presbyters. Hans Dombois hat in seiner Studie „Hierarchie – Grund und Grenze einer umstrittenen Struktur“ aus soziologischer Perspektive auf die Schwierigkeit der funktionalen Unterscheidung zwischen Bischofs- und Presybteramt hingewiesen. Vor allem dadurch, daß Bischof und Presbyter beide vollgültig die Eucharistiefeier leiten können, gerät die Grenze ihrer Ämter ins Fließen11. Die Ursache für die Durchsetzung des Bischofsamtes sieht Dombois im übergemeindlichen Leitungsamt, das die Bischöfe eingenommen haben12 und der damit verbundenen jurisdiktionellen Gewalt, die aber historisch gegenüber der Rolle des Gemeindeleiters später ist. Erst diese Funktion stabilisiert die Dreistufung der Ämter. Denn die Ordinationsgewalt, die das einzige liturgische Proprium des Bischofsamtes ist, wird zu selten ausgeübt, um bestimmend für das Amt zu sein13. 10 Hieronymus, Comm. in Ep ad Titum, PL 26, 602: „sed uereor ne, quomodo regina austri ueniens a finibus terrae audire sapientiam salomonis, iudicatura est homines temporis sui; et uiri niniuitae, acta poenitentia ad praedicationem ionae, condemnabunt eos qui maiorem iona saluatorem audire contempserunt: sic plurimi in populis episcopos iudicent, subtrahentes se ab ecclesiastico gradu, et ea quae episcopo non conueniunt exercentes; [Decretum Gratinani = DG, C.8.I.22] de quibus puto et ioannem ad caium scribere [3. Joh 5–7]: charissime, fideliter facis quodcunque operaris in fratribus, et hoc peregrinis, qui testimonium dederunt dilectioni tuae coram ecclesia: quos optime facis, si praemiseris deo digne; pro nomine enim domini exierunt, nihil accipientes a gentilibus.“ 11 Hans Dombois, Hierarchie. Grund und Grenze einer umstrittenen Struktur, Freiburg 1971, 70. 12 Hans Dombois, Hierarchie (Amn. 11), 72. 13 Hans Dombois, Hierarchie (Anm. 11), 71: „Einmal steht ihm die vom Mess-Vollzug her begründete Gleichwertigkeit von Bischof und Presbyter entgegen. Denn das proprium des Bischofs kommt ja nur einmalig in der Ordination, im übrigen aber nur in jurisdiktionellen
Hieronymus zum Bischofsamt und seine Autorität in dieser Frage
91
Die scheinbar so festgefügte Trias der drei ordines des höheren Klerus: Diakon, Presbyter, Bischof hat hier einen Riß, der letztendlich aus der Verschmelzung zweier Typen urchristlicher Gemeindeleitung resultiert. Das heidenchristliche Modell der von einem Bischof geleiteten Gemeinde, dem Diakone zugeordnet sind und das judenchristliche Modell eines Kollegiums von Presbytern, von denen einer den Vorsitz innehat, sind im Laufe der ersten Jahrhunderte zu einem dreistufigen hierarchischen Modell zusammengewachsenen14. Die Kritik des Hieronymus am Auseinandertreten der Ämter von Bischof und Presbyter hat also aus heutiger Sicht historische und soziologische Argumente für sich. Er findet seine Position aber auf einem anderen Weg. Auslöser sind für ihn Stellen im Neuen Testament, in denen die Begriffe Presbyter und Bischof nicht deutlich voneinander abgegrenzt werden. So beschreibt Paulus in Apg 20,28 die Funktion der Presbyter zugleich auch als „Aufseher“ (ἐπίσκοποι)15. Ausgehend von solchen Beobachtungen behauptet Hieronymus erstens, daß in der urchristlichen Zeit Bischof und Presbyter das Gleiche gewesen seien: „idem est ergo presbyter qui et episcopus“16 und zweitens, daß die Presbyter die Kirche gemeinsam geleitet hätten, bis der Teufel den Spaltpilz in die Kirche einge-
Kompetenzen, also im Bereich der hierarchia jurisdictionis zum Zuge. Sodann besteht von der Verschmelzung der beiden institutionellen Ursprungstraditionen der Kirche her ein unmittelbares Verhältnis zwischen Bischof und Diakon, denen der Presbyter gegenübersteht. Insofern ist die dreifache Stufenfolge nur im äußeren Bild gegeben. Jedoch hat sich dieses Dreierschema der traditionellen Ämter als ein grundlegendes Merkmal der bischöflichen Kirchen durchgesetzt. Die erwähnte Spannung in der geschichtlichen Basis hält dabei ebenso unveränderlich durch, wie sich Brüche in der Achse eines Grundrisses im sichtbaren Gebäude niemals ganz überbauen lassen.“ 14 Hans von Campenhausen, Kirchliches Amt und geistliche Vollmacht in den ersten drei Jahrhunderten (BHTh 14), Tübingen 19632, 84. 15 Hans von Campenhausen, Kirchliches Amt und geistliche Vollmacht (Anm. 14), 168: „‚Älteste‘ […] haben, wie Lukas durchblicken läßt, zugleich die Bedeutung von ‚Bischöfen‘: denn zu ‚Aufsehern‘ hat sie der Geist in den Gemeinden gesetzt.“ Solche Beobachtungen hat Hieronymus auch gemacht; z. B. Comm. in Ep. ad Titum, PL 26, 597: „ed quia eosdem episcopos illo tempore quos et presbyteros appellabant: propterea indifferenter de episcopis quasi de presbyteris est locutus“ und etwas später „in actibus apostolorum scriptum est, quod cum uenisset apostolus miletum, miserit ephesum, et uocauerit presbyteros ecclesiae eiusdem, quibus postea inter caetera sit locutus: attendite uobis, et omni gregi, in quo uos spiritus sanctus posuit episcopos [Apg 20,28] pascere ecclesiam domini, quam acquisiuit per sanguinem suum. et hic diligentius obseruate, quomodo unius ciuitatis ephesi presbyteros uocans, postea eosdem episcopos dixerit.“ 16 Hieronymus, Comm in Ep. ad Titum PL 26, 597 und ebd.: „sed nostram esse sententiam, episcopum et presbyterum unum esse“ und ebd.: „haec propterea, ut ostenderemus apud ueteres eosdem fuisse presbyteros quos et episcopos“; weiterhin Hieronymus, Comm. in Aggaeum 2,12 CCL 76a, 734,306–308: „et ne casu hoc dixisse uideretur, ad titum quoque super presbyteris, quos et episcopos intellegi uult, ordinandis, eadem cautela seruatur.“
92
Hieronymus zum Bischofsamt und seine Autorität in dieser Frage
schmuggelt habe und es Parteiungen gegeben hat, wie in Korinth17. Das Bischofsamt ist also nur eine Antwort auf die Zerteilungen der Kirche. Vorher übten die Presbyter gemeinsam die Funktionen aus, die jetzt von den Bischöfen wahrgenommen werden. Dafür ist die Kirche von Alexandria ein positives Beispiel. Hieronymus behauptet, daß sie noch bis zur Zeit des Heraclas und Dionysius von einem Presbyterkollegium regiert wurde18. Dieses Beispiel ist dann auch immer wieder herangezogen worden, wenn die Identität von Bischofs- und Presbyteramt herausgestellt werden sollte. Hieronymus selbst betont immer wieder die ursprüngliche Einheit beider Ämter. Für ihn bilden Bischöfe und Presbyter zusammen die eine Priesterfamilie Christi, so wie Aaron und seine Söhne die Priesterschaft des Alten Bundes darstellten19. Die Funktionen des Priesters, als Leiter der Eucharistie und als Inhaber der Binde- und Lösegewalt20 sind für Hieronymus das Konstituum für das eine Amt der Kirche, das sich jetzt Bischöfe und Presbyter in der Leitung der Kirche teilen müssen21. Das ist nicht etwa bereits eingedrungene lutherische Amtstheologie, Hieronymus spricht selbst von dem einen Amt: „Das, was Aaron und seine Söhne waren, daß kennen wir als Bischof und Presbyter: ein Herr, ein Tempel, eins sei auch das Amt.“22 Dieses eine Amt ist durch „die Wahrheit des Herren festgesetzt“, es ist eine dispositio dominica. Die Unterscheidung zwischen Bischof und Presbyter hat demgegenüber eine andere Qualität. Er bezeichnet sie nur als „Gewohnheit der Kirche“23. Diese Unterscheidung zwischen kirchlicher 17 Hieronymus, Comm. in Ep. ad Titum, PL 26, 597: „idem est ergo presbyter qui et episcopus, et antequam diaboli instinctu studia in religione fierent, et diceretur in populis: ego sum pauli, ego apollo, ego autem cephae, communi presbyterorum concilio ecclesiae gubernabantur.“ 18 Hieronymus, Ep. 146,1 ad Evangelum CSEL 56, 310,8–10: „nam et Alexandriae a Marco euangelista usque Heraclam et Dionysium episcopos presbyteri semper unum de se electum et in excelsiori gradu conlocatum episcopum nominabant.“ 19 Hieronymus, Ep. 52,7 ad Nepotianum CSEL 54, 427,9–15. 20 Hieronymus, Comm. in Ecclesiasten 12,4 CCL 72, 354,170–174: „sequenti autem uersiculo, in eo quod ait: et consurget ad uocem uolucris, siue passeris, utemur in tempore, si quando uiderimus peccatorem ad uocem episcopi uel presbyteri per paenitentiam consurgentem“ und Comm. in Mattheum III CCL 77, 142,95–99: „quomodo ergo ibi leprosum sacerdos inmundum facit, sic et hic alligat uel soluit episcopus et presbiter non eos qui insontes sunt uel noxii, sed pro officio suo, cum peccatorum audierit uarietates scit qui ligandus sit, qui soluendus.“ 21 Hieronymus, Comm. in Ep. ad Titum PL 26, 597 Presbyter und Bischöfe regieren gemeinsam die Kirche: „in commune debere ecclesiam regere“. Herrschaft teilen zu müssen kann aber auch heißen, daß für die Presbyter einfach dasselbe gilt, wie für die Bischöfe; Hieronymus, Ep. 146,2 CSEL 56, 311,19: „de presbyteris omnino reticetur, quia in episcopo et presbyteri continetur.“ 22 Hieronymus, Ep. 52,7 ad Nepotianum CSEL 54, 427,13–15: „quod aaron et filios eius, hoc episcopum et presbyteros nouerimus: unus dominus, unum templum, unum sit etiam ministerium.“ 23 Hieronymus, Comm. in Ep. ad Titum PL 26, 597: „sicut ergo presbyteri sciunt se ex ecclesiae consuetudine ei qui sibi praepositus fuerit, esse subiectos: ita episcopi nouerint se magis consuetudine, quam dispositionis dominicae ueritate, presbyteris esse maiores.“
Hieronymus zum Bischofsamt und seine Autorität in dieser Frage
93
Gewohnheit und göttlicher Anordnung findet in der Folgezeit großen Widerhall. Bei Hieronymus selbst bleibt sie merkwürdig folgenlos. In konkreten Vollzügen zeigt es sich, daß er die klassische Trias Bischof – Presbyter – Diakon akzeptiert und nicht beabsichtigt, dieses System zu verändern24. So auch in dem bekanntesten kirchenpolitischen Fall, indem er seine Theorie der Einheit von Bischofsund Presbyteramt einsetzt. In Ep. 146 an den römischen Presbyter Evangelus, benutzt er seine Theorie nur dazu, die Position des Presbyters gegenüber den Diakonen aufzuwerten, indem er die Presbyter in die Nähe des bischöflichen Ranges rückt. Es findet sich aber kein Gedanke daran, die Einheit von Bischofsund Presbyteramt im urchristlichen Sinne wiederherzustellen. Neben dieser bekannten These gibt es einige weniger beachteter Äußerungen des Hieronymus, in denen er das Bischofsamt kritisch beleuchtet. Zum einen folgt er dabei einer monastischen Linie der Polemik, die die Mönchszelle höher achtet als die bischöfliche Cathedra25. Dabei nimmt er wiederum eine klassischrömische Denkfigur auf, in der die „Ruhe ohne jede feindselige Auseinandersetzung auf dem Land und in der Einsamkeit“26 gegenüber den Verpflichtungen eines öffentlichen Amtes gepriesen wird. Zum anderen ist es die – zu einem guten Teil sicher berechtigte – Kritik an der Amtsführung der Bischöfe, die ihn veranlaßt sie ins Visier zu nehmen. Dabei betont Hieronymus, daß die Bischöfe Mitknechte, conservi27 und nicht Herren der Gemeinde seien. Mahnend und tadelnd erhebt er den Finger gegen die: denen der Kamm schwillt ob des Bischofsamtes und die glauben, daß sie nicht der Haushalterschaft Christi sondern dem Imperium nacheifern sollen, sie sind nämlich nicht gleich „was besseres“, als die anderen, die nicht zum Bischof bestimmt worden sind28. 24 Hieronymus, Comm in Hieremiam I 12,5 CCL 74, 12,15f.; Comm in Hieremiam IV 35,7 CCL 74, 202,5–7; Comm. in Ezechielem XI,34 CCL 75, 141; Homilia in Matthaeum, CCL 78, 504,64; Ep. 108,28 CSEL 55, 347,18. 25 Hieronymus, Ep. 117,1 CSEL 55, 423,5ff.: „cui ego: ‚optimam‘, inquam, ‚mihi iniungis prouinciam, ut alienus conciliem, quas filius frater que non potuit, quasi uero episcopalem cathedram teneam et non clausus cellula ac procul a turbis remotus uel praeterita plangam uitia uel uitare nitar praesentia.‘“ 26 Hieronymus, Ep. 82,11 ad Theophilum CSEL 55, 118,23: „ut quieti absque ullis simultatibus in agris et in solitudine uiueremus.“ 27 Hieronymus, Comm. in Ep. ad Galatas II, PL 26, 406: „quae quidem et nos ad humilitatem prouocant, et supercilium decutiunt episcoporum, qui uelut in aliqua sublimi specula constituti, uix dignantur uidere mortales, et alloqui conseruos suos“ und Comm. in Ep. ad Titum, PL 26, 600: „sciat itaque episcopus et presbyter, sibi populum conseruum esse, non seruum.“ 28 Hieronymus, Comm. in Ep. ad Titum, PL 26, 600: „deinde etiam illud est inferendum aduersum eos qui de episcopatu intumescunt, et putant se non dispensationem christi, sed imperium consecutos: quia non statim omnibus his meliores sint, quicunque episcopi non fuerint ordinati: et ex eo quod electi sunt, ipsi se magis existiment comprobatos [DG C.8.I.20a]: sed intelligant propterea quosdam a sacerdotio remotos, quia eos uitia liberorum impedierint.“
94
Hieronymus zum Bischofsamt und seine Autorität in dieser Frage
Gerade solche Amtsinhaber ermahnt Hieronymus immer wieder, sich nicht zu sicher zu fühlen im Besitz ihrer bischöflichen Würde. Wenn sie ihre Pflichten nicht erfüllen, so droht ihnen Hieronymus, dann müssen sie mit der Verdammnis rechnen29. Das abschreckende Beispiel dafür ist Judas, der des Apostelamtes verlustig ging. Das sollen sich Bischöfe und Priester eine Mahnung seien lassen und darauf achten, daß sie nicht selbst das Priestersein verlieren30. Insgesamt betrachtet paßt die Kritik in den Rahmen dessen, was sich beim Durchgang durch die Äußerungen zum Bischofsamt gezeigt hat. Neben der Hochschätzung des Amtes steht der ethische Anspruch an den Bischof zur rechten Amtsführung. Dieser Anspruch wird unterstützt durch den Hinweis auf Gottes Gericht und den möglichen Verlust des Amtes, wobei die konkrete Frage einer Amtsenthebung wohl wegen der praktischen Schwierigkeiten nicht in den Blick kommt, denn Hieronymus stöhnt „schwierig ist es einen Bischof anzuklagen“31, und das ist für ihn besonders bei offensichtlichem Amtsmißbrauch schwer zu ertragen.
Die Wirkungsgeschichte Ein entscheidender Faktor für die Rezeptionsgeschichte der Äußerungen des Hieronymus zum Bischofsamt ist ihre Aufnahme in das Decretum Gratiani. Die kritischen Anfragen des Hieronymus sind so im Hauptstrom der kirchlichen Überlieferung präsent geblieben. Gratian hat in seine Sammlung Zitate aus dem Titus-Kommentar und aus der Ep. 146 aufgenommen. Er zitiert gerade auch die Stellen, die das Bischofsamt kritisch beleuchten. Die kritischen Potentiale der Zitate aus den Schriften des Hieronymus werden zum Teil dadurch entschärft, daß Gratian sie zu Fragen anführt, die nicht unmittelbar zum Bereich des Bischofs- bzw. Presbyteramts gehören. So wird die nahezu vollständig zitierte Ep 146 in der Distinctio XCIII angeführt, die sich mit der Unterordnung der Ämter unter die jeweils höhere geistliche Rangstufe beschäftigt32. Ep. 146 dient hier zum Beleg für die Unterordnung der Diakone unter die Presbyter. Das Zitat 29 Hieronymus, Comm. in Ep. ad Titum, PL 26, 603: „uere nunc est cernere quod praedictum est, in plerisque urbibus, episcopos, siue presbyteros, si laicos uiderint hospitales, amatores bonorum, inuidere, fremere, excommunicare, de ecclesia expellere, quasi non liceat facere quod episcopus non faciat: et tales esse laicos, damnatio sacerdotum sit.“ 30 Hieronymus, Tractatus in Ps. 108 CCL 78, 212,116 im Anschluß an Ps 109,8: „et episcopatum eius accipiat alter […] si iudas apostolatum perdidit, custodiant se sacerdotes et episcopi, ut non et ipsi suum sacerdotium perdant.“ 31 Hieronymus, Comm. in Ecclesiasten 8,9 CCL 72, 318,153: „difficilis est accusatio in episcopum.“ 32 Decr. Grat. D.93.24; Hieronymus, Ep. 146 CSEL 56, 308,3–312,3 (Das Decretum wird in der Ausgabe Friedbergs zitiert).
Hieronymus zum Bischofsamt und seine Autorität in dieser Frage
95
Gratians aus dem Tituskommentar des Hieronymus hingegen ist beinahe im Sinne der von Hieronymus geforderten Identität von Bischofs- und Presbyteramt verwendet. Gratian konstatiert in der Überschrift zu diesem Zitat, daß Presbyter und Bischof ein und dasselbe sind und nur die Gewohnheit die Überordnung der Bischöfe begründet33. Durch die Einbettung in den Gesamtzusammenhang von Distinctio XCV wird aber deutlich, daß Gratian am Vorrang des Bischofs festhält, dem die Presbyter wie einem Vater gehorchen sollen34. Andere kritische Stellungnahmen zum Bischofsamt finden sich in Causa VIII, zur Frage der Regelung der Bischofsnachfolge, dort fehlt weder die Mahnung vor der stolzgeschwellten Bischofsbrust35, noch die allgemeine Warnung vor Würde und Bürde des Amtes36 und der schlechten Amtsführung37. Gratian damit die entscheidenden Stellen zusammengestellt, in denen Hieronymus die Identität von Bischofs- und Presbyteramt behauptet. Diese Zitate waren für die Reformatoren ein höchstwillkommenes Zeugnis eines der doctores ecclesiae, das ihre Kritik an der katholischen Ausformung der Ämterlehre an vielen Punkten untermauern konnte. Durch die HieronymusAusgabe des Erasmus von 1516, besaß man einen nach damaligen Maßstäben zuverlässigen Text, der neben dem Decretum Gratiani die Grundlage für die Rezeption bei den Reformatoren wurde. Auf diesem Wege hat Hieronymus eine Nachwirkung erfahren, die einen wichtigen Beitrag zur reformatorischen Theologie darstellt. Vor allem die ins Decretum Gratiani aufgenommenen Zitate wurden zu Standardbelegstellen für alle Reformatoren.
33 Decr. Grat. D.95.5a; 5b; Hieronymus, Comm. in Ep. ad Titum PL 26, 597. In der Überschrift heißt es: „Presbiter idem est qui et episcopus, ac sola consuetudine presbiteris epsicopi presunt.“ 34 Decr. Grat. D.95, Einleitung: „presbiteri pontificibus, tamquam filii parentibus, debent obedire“. Die scharfe Abgrenzung von Bischof und Presbyter in dem Sinne, daß nur den Bischof die „Fülle des Weihesakramentes auszeichnet“ hat erst das Vaticanum II in Lumen gentium Art. 21 u. 26 vorgenommen. Dort wird einzig in der Bischofsweihe „die Fülle des Weihesakraments übertragen“. Reinhard Staats verdanke ich den Hinweis, daß dieser Gedanke inzwischen sogar Eingang in die (lutherische) Amtslehre der schwedischen Kirche gefunden hat; Reinhard Staats, Von der Konfessionskirche zur Bischofskirche. Der schwedische Rapport „Das Bischofsamt“ aus patristischer Sicht, in: ThLZ 116 (1991) 321–338, hier 330. 35 Decr. Grat. C.8.I.20a; Hieronymus, Comm. in Ep. ad Titum PL 26, 600. 36 Decr. Grat. C.8.I.20b; Hieronymus, Comm. in Ep. ad Titum PL 26, 600. 37 Decr. Grat. C.8.I.22; Hieronymus, Comm. in Ep. ad Titum PL 26, 602.
96
Hieronymus zum Bischofsamt und seine Autorität in dieser Frage
Luther Luthers Stellung zum Bischofsamt ist Thema des 7. Int. Lutherforschungskongresses in Oslo 1988 gewesen. In den publizierten Beiträgen38 findet sich unter anderem auch ein Beitrag von Heinz-Meinolf Stamm über „Luthers Berufung auf die Vorstellungen des Hieronymus zum Bischofsamt“, der eine gewisse Einführung in das Thema bietet, aber noch ergänzt werden kann. Luther, der im Allgemeinen für Hieronymus nicht viele Sympathien hatte, beruft sich mehrmals auf die einschlägigen Stellen, in denen er sich zum Bischofsamt geäußert hat. Zuerst im Gefolge der Leipziger Disputation in der Schrift vom September 1519 Resolutio Lutheraniana super propositione sua decima tertis de potestate papae. Im dritten und letzten Teil dieser Schrift, führt Luther die Kirchenväter auf, die seine Argumentation stützen. Er leitet diesen Abschnitt mit der Bemerkung, ein, daß er aus der Heiligen Schrift schon genugsam bewiesen habe, daß der päpstliche Primatsanpruch unbegründet sei, aber „damit ich nicht einzig und allein mit Schriftworten um mich schmeiße, wollen wir schon auch von anderen Lehrsätze mit Begründungen hören“39. Als erstes führt Luther hier die Ep. 146 des Hieronymus an. Er zitiert sie zur Gänze, in der Textfassung des Decretum Gratiani40. Sein Schluß nach dem langen Zitat ist, daß Hieronymus der Häresie bezichtigt werden müßte, wenn die Päpste Recht damit hätten, daß der römische Bischofsstuhl – gemäß göttlichem Recht – allen anderen Bischofssitzen vorgezogen werden müsse. Und nicht nur Hieronymus, sondern auch die von ihm herangezogenen Paulus, Johannes und Lukas seien dann Häretiker. Um der Ironie noch eine weitere Spitze zu geben, meint Luther, da diese Äußerungen des Hieronymus ins Decretum Gratiani aufgenommen 38 Martin Brecht (Hg.), Martin Luther und das Bischofsamt, Stuttgart 1990. 39 Martin Luther, Resolutio Lutheraniana super propositione sua decima tertis de potestate papae, WA 2 227,30–31. 40 Wilhelm Maurer, Der junge Melanchthon zwischen Humanismus und Reformation, Göttingen 1969 Bd. II, 26 gibt an, daß die Hieronymus-Ausgabe des Erasmus sofort nach ihrem Erscheinen von Spalatin für die Kurfürstliche Schloßbibliothek angeschafft worden und damit auch den Universitätsprofessoren zugänglich war. Ulrich Bubenheimer, Martin Brecht und Christian Peters haben die komplizierte Geschichte der von Luther benutzten ErasmusAusgabe des Hieronymus inzwischen weiter aufklären können. In einer aus mehreren Provenienzen zusammengestellten Ausgabe, die sich heute im evangelischen Predigerseminar in Wittenberg befindet, sind die von Luther benutzen Bände. Er hat die Erasmus Ausgabe aus dem Nachlass Johannes Rhagius Aesticampianus benutzt, der am erst 31. 5. 1520 gestorben ist und seine Bücher einer Wittenberger Bibliothek vermacht hat. Dass Luther also 1519 die Ep. 146 in der Fassung des Decretum Gratiani zitiert hat, erklärt sich also auch über die Bibliotheksgeschichte. Martin Luther, Annotierungen zu den Werken des Hieronymus, hg. v. Martin Brecht und Christian Peters (Archiv zur Weimarer Ausgabe der Werke Luthers, Texte und Untersuchungen 8), Köln u. a. 2000. Diese Ausgabe von Luthers Anmerkungen zu den Werken des Hieronymus zeigt, dass Luther sich intensiv und durchaus differenziert mit dem Kirchenvater auseinandergesetzt hat.
Hieronymus zum Bischofsamt und seine Autorität in dieser Frage
97
worden seien, sei eigentlich jeder Gläubige von der römischen Kirche verpflichtet worden, die Kritik des Hieronymus für wahr zu halten41. Die „Altgläubigen“ können so von ihm mit den eigenen Waffen geschlagen werden. Luther führt als zweiten Beleg noch den Ausschnitt aus dem Titus-Kommentar des Hieronymus aus dem Decretum Gratiani an, und führt mit seiner Hilfe noch einmal den Beweis, daß die Position der Päpste gegen die Schrift und gegen die eigenen Dekrete steht42. Luthers Verwendung der Hieronymus-Zitate zielt also vor allem darauf, den päpstlichen Primat und seine Suprematieansprüche abzulehnen43. Er registriert und erwähnt auch die von Hieronymus vorgenommene Identifizierung von Bischof und Presbyter44, aber erst im Schlußsatz der ganzen Schrift gewinnt er daraus eine scharfe These, die die Gleichheit aller Amtsträger postuliert: „Also ist nach dem göttlichen Gesetz weder der Papst mehr als die Bischöfe, noch ein Bischof mehr als die Presbyter“45. Erst 1537, im Zuge von Luthers Vorbereitung der Schmalkaldischen Artikel, wird Hieronymus wieder ein wichtiger Kronzeuge gegen das Papsttum. Hieronymus wird hier von ihm als einer der doctores ecclesiae vorgestellt, dessen Wort gewichtig ist. Anhand mehrerer Stellen widerlegt Luther die mit Konstantinischen Schenkung verbundene Theorie der Suprematie des römischen Stuhls46. Dabei nimmt Luther hier auch den Gedanken auf, daß das Bischofsamt nur eine Reaktion auf die Spaltungen innerhalb der Kirche sei, wie er sagt „die Secten zu verhuten“47. In den Schmalkaldischen Artikeln gebraucht Luther zweimal das von Hieronymus herangezogene Beispiel der presbyterial regierten Kirche von Alexandria (Art. IV u. X)48. In Art. IV dient es Luther dazu zu zeigen, daß der Suprematieanspruch der Päpste wider das apostolische und urchristliche Vorbild ist. In Art. X dient dasselbe Beispiel als Beleg für die Rechtmäßigkeit der reformatorischen Praxis der Ordination durch Pastoren. Da in der Kirche von Alexandria kein Bischof war, müssen die Presbyter auch die Ordination vollzogen haben49.
41 42 43 44 45 46 47
Martin Luther, Resolutio (Anm. 39), 229,15–19. Martin Luther, Resolutio (Anm. 39), 230,3–5. Heinz-Meinolf Stamm, Luthers Berufung (Anm. 3), 15–17. Martin Luther, Resolutio (Anm. 39), 229,20–22; 230,9–11. Martin Luther, Resolutio (Anm. 39), 240,2–3. Heinz-Meinolf Stamm, Luthers Berufung (Anm. 3), 17–19. Martin Luther, Einer aus den hohen Artikeln des päpstlichen Glaubens, genannt Donatio Constantini, WA 50 84,34. 48 Martin Luther, Schmalkaldische Artikel, BSELK 430,26f; 458,25–27. 49 Für Luther gab es auch die Möglichkeit die Ordination durch Laien vollziehen zu lassen, vgl z. B. Martin Luther, Daß eine christliche Versammlung oder Gemeine Recht und Macht habe, alle Lere zu urtheilen und Lerer zu berufen, ein und abzusetzen, Grund und Ursach aus der Schrift (1523), WA 11, 411.
98
Hieronymus zum Bischofsamt und seine Autorität in dieser Frage
Sicherlich nicht ohne Zusammenhang mit der Vorbereitung der Schmalkadischen Artikel gibt Luther im folgenden Jahr die Ep. 146 ad Evangelum50 des Hieronymus, mit einem kurzen Vorwort versehen im Druck heraus51. Den Text entnimmt er wahrscheinlich der Erasmus-Ausgabe52; mit Sicherheit aber nicht dem Decretum Gratiani wie Otto Clemen behauptet hat53. Luther geht in seiner Vorrede darauf ein, daß dieser Brief mit seinen kritischen Thesen Teil des Kirchenrechts geworden sei. Da aber die Äußerungen des Hieronymus offensichtlich wirkungslos geblieben sind, schließt Luther, daß es mit seiner Autorität bei den „Altgläubigen“ nicht so weit her sein könne. Wenn er heute lebte, wäre Hieronymus wahrscheinlich zum Häretiker erklärt worden54. Die Hauptrichtung von Luthers Kritik, die er mit der Ep. 146 des Hieronymus untermauert, richtet sich gegen die päpstliche Hierarchie. Sie ist Menschen- bzw. Teufelswerk und widerspricht völlig dem von Hieronymus zu Recht betonten Grundsatz der Gleichheit aller Amtsträger55. Gegen Ende seines Lebens führt Luther ein letztes Mal Hieronymus gegen das Papsttum auf. In der 1545 erschienen Schrift „Wider das Papstthum zu Rom, vom Teufel gestiftet“56 insistiert er noch einmal auf der ursprünglichen Gleichheit der Apostelnachfolge im einheitlichen Bischofs- und Presbyteramt und lehnt die Suprematie Roms schärfstens ab: Denn er [der Papst] selbs wol weis, und ist so klar als die liebe Sonne aus allen Decreten der alten Concilien, aus allen Historien und Schrifften der heiligen Veter, Hieronymi, Augustini, Cypriani, […] Das der Römische Bischoff nicht mehr ist denn ein Bischoff gewest, und noch so sein sollte. Und S. Hieronymus thar frey heraus sagen: Alle Bischove sind gleich, allesampt der Apostel Stuel erben.
Luther macht immer wieder Gebrauch von den kritischen Äußerungen des Hieronymus zum Bischofsamt. Er verwendet sie vor allem zur Kritik der katholischen 50 Bei Luther wird der Empfänger dieses Briefes sowohl 1519 als auch 1538 mit Evagrius statt Evangelus angegeben. Diese Abänderung findet sich auch schon im Decretum Gratiani, während in den Handschriften durchgängig ad evangelum presbyterum (o.ä) zu finden ist Die Identifizierung des ansonsten unbekannten Presbyters Evangelus mit einem der Evagrii hat den – vielleicht gewünschten – Effekt das der Empfänger ein Bischof wäre. 51 Heinz-Meinolf Stamm, Luthers Berufung (Anm. 3), 20–21. 52 So auch schon Ernst Schäfer, Luther als Kirchenhistoriker, Gütersloh 1897, 94. 53 Gegen Otto Clemen, WA 50, 338. Luther folgt dem Text der Erasmus-Ausgabe. So hat er auch den letzten Satz von Ep 146, den das Gratianum ausläßt, mit den bei Erasmus umgestellten Schlußworten „vendicent in Ecclesia.“ 54 Martin Luther, Epistola Sancti Hieronymi ad Evagrium de potestatae papae cum praefatione Lutheri, WA 50 341,24f; 35f. 55 Martin Luther, Epistola Sancti Hieronymi (Anm. 54), 342,3–7: „Quare evidens est totam illam Hierarchiam Papalem esse doctrinas hominum seu daemoniorum verius, per hypocritas falsiloquos introductas. Omnes (inquit Sanctus Hieronymus) merito et sacerdotio sunt aequales, potentia divitiarum et paupertatis humilitas vel sublimiorem vel inferiorem Episcopum facit.“ 56 WA 54, 195–299.
Hieronymus zum Bischofsamt und seine Autorität in dieser Frage
99
Hierarchie und zur Ablehnung des Suprematieanspruchs des Papstes. Dabei bezieht er sich vor allem auf die Behauptung der Gleichheit aller Bischöfe. Die Identität von Bischofs- und Presbyteramt steht eher im Hintergrund. Der Reiz der Zitate aus den Schriften des Hieronymus scheint für Luther vor allem darin zu liegen, selbst aus dem verhaßten Kirchenrecht noch Material gegen die Päpste zu gewinnen und so den Gegner mit seinen eigenen Waffen schlagen zu können.
Melanchthon Melanchthon gilt als der „Traditionalist“ unter den Reformatoren. Seine Verwendung von Kirchenväterzitaten ist deshalb bereits häufiger untersucht worden57. Klärend ist Haendlers Beschreibung des Melanchthonschen Traditionalismus als Traditionskritik58, weil es das Ineinander von Schriftprinzip und Rezeption der schriftgemäßen Traditionen beschreibt. Die positive Aufnahme, die die Gedanken des Hieronymus zum Bischofsamt auch bei Melanchthon finden, läßt sich so verstehen als Rezeption einer schriftgemäßen Tradition. Der Verweis auf diesen Kirchenvater hat dabei eine doppelte Funktion, zum einen die Stützung der Argumentation gegenüber den „Altgläubigen“, zum andren die Absicherung im eigenen Lager59. Im Laufe seines Lebens hat Melanchthon seine Stellung zu Hieronymus verändert. Je mehr er sich dem Kreis der Humanisten entfremdet, desto deutlicher teilt er Luthers kritische Haltung gegenüber Hieronymus60. Während er noch 1519 den Theologiestudenten in Wittenberg die Lektüre des Erasmus als Her-
57 Die grundlegende Studie zur Auctoritas Patrum beim Melanchthon ist noch immer Peter (Pierre) Fraenkel, Testimonia Patrum. The Function of the Patristic Argument in the Theology of Philip Melanchthon (THR 46), Genf 1961. 58 Klaus Haendler, Wort und Glaube bei Melanchthon. Eine Untersuchung über die Voraussetzungen und Grundlagen des melanchthonischen Kirchenbegriffs (QFRG 37), Gütersloh 1968, 83: „Der melanchthonische ‚Traditionalismus‘ stellt sich also dar als Traditionskritik. Diese aber hebt nicht die Möglichkeit und Notwendigkeit von Traditionsbezogenheit auf, sondern schafft diese vielmehr als legitimes Hören auf das Zeugnis der Vergangenheit. Damit wird deutlich, daß das reformatorische Prinzip ‚Sola scriptura‘ für Melanchthon keineswegs in dem Sinne exklusiv ist, daß es das Hören auf die kirchliche Vergangenheit generell ausschließt. Vielmehr impliziert es diese.“ 59 Klaus Haendler, Wort und Glaube (Anm. 58), 83f. 60 Vgl. Eginhard P. Meijering, Melanchton and Patristic Thought. The doctrines of Christ and Grace, the Trinity and the Creation (SHCT 32), Leiden 1983, 73: „Melanchthon’s attitude towards Jerome was lukewarm […] In this he is closer to Luther than to Erasmus.“ oder Wilhelm Maurer, Melanchthon-Studien (SVRG 181), Gütersloh 1964, 73: „Im Gegensatz Luthers zu Hieronymus kündigen sich die Spannungen an, die zwischen dem Reformator und dem Humanismus erasmischer Prägung bestehen und in die Melanchthon hineingezogen wird, ohne sie je ganz überwinden zu können.“
100
Hieronymus zum Bischofsamt und seine Autorität in dieser Frage
ausgeber des Hieronymus empfiehlt61, macht sich schon in den Loci von 1521 ein anti-humanistischer, speziell anti-erasmischer Impuls bemerkbar62, der auch zu kritischen Äußerungen gegenüber Hieronymus führt. Dennoch findet sich in dem Abschnitt über die Amtsträger, der an die Frage der Abendmahlsteilnahme anknüpft, die von Hieronymus wohlbekannte Gleichsetzung von Bischof und Presbyter63 und wenig später sogar die Aussage, daß der erste (evangelische) Amtsträger eines Ortes der Bischof sei64. Der explizite Verweis auf Hieronymus in der Frage des Pastoren- und Bischofsamtes findet sich bei Melanchthon erst im Jahre 1537, dann aber an einer überaus wirkmächtigen Stelle: im Tractatus de potestatae papae. Diese kleine Schrift, die in das Korpus der Bekenntnisschriften vieler lutherischer Kirchen aufgenommen worden ist, enthält mehrere Verweise auf Hieronymus. Zum einen wird er in der Testimonienliste zusammen mit dem Konzil von Nicäa, Cyprian, Augustinus und Gregor d.Gr. aufgeführt, zum anderen am Ende des Traktats als Melanchthon noch einmal auf die Frage der Jurisdiktion der Bischöfe eingeht65. Die Vorbereitung Melanchthons für den Tractatus ist zeitgleich mit der Luthers für die Schmalkadischen Artikel. Es läßt sich beobachten, daß sämtliche Zitate bei Luther und Melanchthon aus der Ep. 146 des Hieronymus stammen, die Luther kurz danach noch einmal herausgegeben hat. Hier scheinen sich beide Reformatoren noch einmal besonders intensiv mit diesem Brief des Hieronymus auseinandergesetzt zu haben. Melanchthon benutzt im Tractatus die Hieronymus-Zitate zur Stützung verschiedener Argumentationslinien. Als erstes gebraucht er den Satz Si autoritas quaeritur, orbis major est urbe. So weist Melanchthon mit Hilfe der auctoritas des Hieronymus der Suprematieanspruch der Päpste zurück, den er für „falsch, 61 62 63 64
Melanchthon, Ep. 36, CR 1 71f. Vgl. Wilhelm Maurer, Der junge Melanchthon (Anm. 40), Bd. II 53f, 87f, 124, 315, 425. Melanchthon, Loci communes von 1521, StA II/1 157,2f. Melanchthon, Loci communes (Anm. 63), 159,29–34. Diese Äußerung erfolgt im Abschnitt De magistratibus. Dort grenzt Melanchthon die geistliche Gewalt von der weltlichen dadurch ab, daß er definiert, daß weder Magistrat noch Grundherr das Recht haben, bischöfliche Funktionen wahrzunehmen, noch ein Ortsbischof legislative Kompetenz. Für diese Auffassung beruft sich Melanchthon auf Jeremia 23; eine Bibelstelle, deren genauere Aufschlüsselung die Studienausgabe nicht für notwendig hielt. Melanchthon beruft sich auf Jeremia 23,1–4; Verse in denen ein „Wehe“ über die Könige Israels ausgerufen wird. Das ist zunächst unverständlich. Erst aus der Auslegungsgeschichte wird verständlich, wie Melanchthon dazu kommt, sich hier auf diese Bibelstelle zu berufen. Auch an dieser Stelle spielt Hieronymus eine wichtige Rolle. Er schreibt in seinem Jeremia-Kommentar daß die messianischen Hoffnungen, die auf den Königen Judas geruht haben, auf die principes ecclesiae übergegangen seien (Hieronymus, Comm. in Hieremiam IV,44,3–5 CCL 74, 214,6–215,7). Diesen Gedanken übernimmt auch Melanchthon. Er verweist nicht auf Hieronymus, aber aus seiner Verwendung von Jer 23,1–4 in diesem Kontext ergibt sich, daß ihm die Auslegung, die die Verse auf die geistlichen Hirten bezieht, nicht fremd ist. 65 Melanchthon, Tractatus de potestatae papae, BSELK 489.
Hieronymus zum Bischofsamt und seine Autorität in dieser Frage
101
ungottlich, tyrannisch und der christlichen Kirchen ganz schädlich“ hält66. Im zweiten Argumentationsgang geht es um Fragen der kirchlichen Jurisdiktion. Hier ist Hieronymus für Melanchthon Kronzeuge für die Gleichheit aller Amtsträger67. Die von den „Altgläubigen“ vorgenommene Unterscheidung zwischen Bischöfen und Presbytern ist nur auf Grund menschlicher Ordnungen erfolgt und hat keinen Grund in göttlichen Rechtssetzungen. Auf die bei Hieronymus zitierte Stelle Titus 1,5 weist Melanchthon noch einmal besonders hin. Auf diese Weise macht er deutlich, daß Hieronymus Autorität in dieser Frage aus seiner Übereinstimmung mit der Schrift gewinnt68. Die mit Hilfe der auctoritas des Hieronymus vollzogene Aufhebung der Unterscheidung zwischen der potestas der Bischöfe und Presbyter führt für Melanchthon auch zur Aufhebung des bischöflichen Ordinations(vor)rechts. So kann er guten Gewissens die Ordination durch Pastoren vertreten69. Denn das eine Amt, das kraft göttlicher Anordnung existiert, ist in seinen Funktionen unteilbar70. In der deutschen Übersetzung der Loci von 1558 schließlich, die von Justus Jonas angefertigt und von Melanchthon revidiert wurde, ist dann im Abschnitt „Vom Beruf der Prediger und Seelsorger“ noch einmal Hieronymus ausdrücklich erwähnt: Solches erinnert auch Hieronymus, das nach göttlichem Rechten nicht unterscheid sey zwischen Bischouen und andren Priestern, und sind seine wort angezogen im Decret. Distinctione xciii.71
Die Bedeutung des Hieronymus für das Amtsverständnis Melanchthons dürfte deutlich geworden sein. Mit Hilfe seiner auctoritas kann Melanchthon den Suprematieanspruch der Päpste zurückweisen und die Lehre vom einen Amt begründen, die für das lutherische Amtsverständnis eine solch zentrale Rolle spielt.
66 Melanchthon, Tractatus de potestatae papae, BSELK 471,18–472,1. 67 Melanchthon, Tractatus de potestatae papae, BSELK 489,40–43: „hanc potestatem iure divino communem esse omnibus, qui praesunt ecclesiis, sive vocentur pastores, sive presbyteri, sive episcopi.“ und 490,29–31: „Docet ergo Hieronymus humana auctoritate distinctos gradus esse episcopi et presbyteri seu pastoris.“ 68 Vgl. Peter Fraenkel, Testimonia Patrum (Anm. 57), 276: „In an nutshell we have here all those elements of Melanchthon’s view of the testimonia patrum that we have reviewed in the earlier chapters: the relative an dependent but positive position of the doctors of the Church; the need to believe them but at the same time to criticize them Biblically so that they can be believed (that is to say, that they can ‚help‘ by testifying to the absolute truth).“ 69 Melanchthon, Tractatus de potestatae papae, BSELK 490,37–40: „Sed cum jure divino non sint diversi gradus episcopi et pastoris, manifestum est ordinationem a pastore in sua ecclesia factam jure divino ratam esse.“ 70 Vgl. Klaus Haendler, Wort und Glaube (Anm. 58), 287. 71 Melanchthon, Heubtartikel Christlicher Lere im latin genandt, Loci Theologici, CR 22,524.
102
Hieronymus zum Bischofsamt und seine Autorität in dieser Frage
Zwingli Unter den drei herangezogenen Reformatoren ist Zwingli derjenige, der im Allgemeinen Hieronymus mit der größten Zuneigung begegnet. In der Wertschätzung für diesen Kirchenvater zeigt sich deutlich die Prägung, die Zwingli durch Erasmus und die schweizerischen Humanisten empfangen hat72. Wie Alfred Schindler in seinem Überblick zur Verwendung der Kirchenväter festgestellt hat, ist er der von Zwingli mit Abstand am häufigsten zitierte Kirchenvater73. Zwinglis Exemplar der erasmischen Ausgabe ist von ihm schon in Einsiedeln mit vielen Randglossen versehen worden und belegt, in welch großem Maße Hieronymus dem Reformator als Informationsquelle in biblisch-philologischen Fragen diente. Beim Thema des Bischofsamts74 werden die kritischen Anfragen des Hieronymus von Zwingli bereitwillig aufgenommen. Sie bieten ihm wie Luther und Melanchthon in der Diskussion mit den „Altgläubigen“ eine wertvolle Hilfe. Im Einzelnen läßt sich der Einfluß des Hieronymus in den Fragen des Bischofsamtes bei Zwingli an folgenden Punkten nachweisen: Zu allererst in der Gleichsetzung episcopus mit presbyter. Sie findet sich bereits als Randglosse in seiner Hieronymus-Ausgabe75 und scheint Zwingli so selbstverständlich geworden zu sein, daß er ohne besonderen Kommentar sich und andere Pfarrer als Bischöfe bezeichnen kann. Bereits im Brief an Erasmus Fabricius über die Vorgänge auf der 1. Zürcher Disputation 1522 stellt Zwingli die Zürcher Leutpriester als episcopi dem Konstanzer episcopus gegenüber76. In dieser Schrift liegt keine ausdrückliche Berufung auf Hieronymus vor. Von daher könnte man mit Alfred Schindler annehmen, daß für Zwingli ein Verweis auf die einschlägigen neutestamentlichen Stellen genügen könnte77. Es zeigt sich aber, daß Zwingli gerade an solchen Stellen auf die auctoritas des Hieronymus zurückgreift, an denen die Auffassung des Hieronymus mit den vom ihm ausge72 W. Peter Stephens, The Theology of Huldrych Zwingli, Oxford 1986, 11: „This point to the ambiguity in Zwingli’s relation to Erasmus. Whereas Luther and Erasmus sensed the sharp difference between their positions, Zwingli, for all his differences with Erasmus, sensed his kinship or continuity with him and others like him.“ 73 Alfred Schindler, Zwingli und die Kirchenväter (147. Neujahrsblatt zum Besten des Waisenhauses Zürich), Zürich 1984, 15. 74 Zum Amtsverständnis Zwinglis siehe jetzt die Untersuchung von Martin Hauser, Prophet und Bischof. Huldrych Zwinglis Amtsverständnis im Rahmen der Zürcher Reformation (ÖBFZPhTh 21), Freiburg 1994. 75 Martin Usteri, Initia Zwingli (2.), in ThStKr 59 (1886), 107. 76 Ulrich Zwingli, Epistola Huldrici Zvinglii ad Erasmum Fabricium de actis legationi ad Tigurinos missae diebus 7. 8. 9. aprilis 1522, CR 88, 144,18–145,2. 77 So Alfred Schindler, Zwingli und die Kirchenväter (Anm. 73), 54: „Die Berufung auf Hieronymus wäre auch entbehrlich, da der Bibeltext selbst, vor allem der Übergang von Titus 1,6 zu 1,7, aber auch die Verbindung mit 1. Tim 3,1ff ergibt, dass in der Terminologie dieser neutestamentlichen Briefe ein Bischof ein ‚uffseher oder pfarrer, kilcher oder lütpriester‘ ist.“
Hieronymus zum Bischofsamt und seine Autorität in dieser Frage
103
legten Schriftstellen zusammentrifft – oder anders gesagt, sachgemäße Auslegung ist. Der Rückgriff auf den Kirchenvater muß also noch eine andere Funktion haben, wenn wir es nicht nur als Ausweis der Gelehrsamkeit verstehen wollen. Die auctoritas des Hieronymus erweist sich gerade in der Übereinstimmung mit der Heiligen Schrift78. Er gehört zu den Zeugen, deren Ansehen und unangefochtene Stellung innerhalb der kirchlichen Überlieferung die Position der Reformatoren stärken. Deshalb verweist Zwingli, wie die anderen Reformatoren auch, gerade in der Frage des Bischofs- oder Pfarramts immer wieder auf Hieronymus79. So nimmt Zwingli im gleichen Jahr 1522 in „Eine freundliche Bitte und Ermahnung an die Eidgenossen“ ausdrücklich Bezug auf die Auffassung des Hieronymus vom Bischofsamt. Er führt ihn als Kronzeugen an, mit dem er in der Auslegung von I Tim 3,1ff übereinstimmt: „Hierinn lernend wir, das alle pfarrer bischoff sind. Der Meinung ouch ist der heilig Hieronymus.“80 Es wird deutlich, daß Zwingli Hieronymus für eine andere Beweisführung als Luther benutzt. Während dieser vor allem gegen die Stellung Roms argumentiert, bezieht Zwingli die Gleichsetzung von Bischof und Presbyter bei Hieronymus auf das Pfarramt und erklärt jeden einzelnen Pfarrer zum Bischof. Das wird Zwingli nicht müde zu wiederholen81. Hierin sind Zwingli und Melanchthon verwandt und damit haben sie eine bis heute im Protestantismus verbreitete Auffassung vom Pfarramt begründet82. Anders als Melanchthon und Luther, finden sich bei Zwingli weitere Einzelzüge des von Hieronymus vorgetragenen Bischofsbildes. So hat Zwingli ein offenes Ohr für die Bischofs- bzw. Pfarrerethik, die Hieronymus im Anschluß an Tit 1 und 1. Tim 3 entfaltet83. Dabei betont Zwingli wie Hieronymus den Charakter des Amtes als Aufgabe mit ihren Bürden, gegenüber einer überheblichen 78 Alfred Schindler, Zwingli und die Kirchenväter (Anm. 73), 48: „…als Luther im Prinzip keine andere Auffassung von den Kirchenvätern vertrat als Zwingli, also seinerseits kein Autoritätsund Traditionsargument ausserhalb der Schriftauslegung duldete.“ 79 Martin Hauser, Prophet und Bischof (Anm. 74), 211: „Hieronymus wird für Zwingli zum Kronzeugen der grundsätzlichen Gleichheit aller Geistlichen, welche die Presbyter-PriesterStufe erreicht haben.“ 80 Ulrich Zwingli, Eine freundliche Bitte und Ermahnung an die Eidgenossen CR 88 231,26f. 81 Stellen: Eine freundliche Bitte und Ermahnung an die Eidgenossen CR 88 240,3; Auslegungen und Gründe der Schlussreden CR 89 64,1ff; 267,3f; 278,30f; Der Hirt CR 90 5,4f; 52,22; Eine Antwort, Valentin Compar gegeben CR 91, 15113f; Von dem Predigtamt CR 91, 399,3.15.21f u.ö; Eine Epistel an die Gläubigen zu Eßlingen CR 92, 282,6. 82 Vgl. z. B. Peter Brunner, Beiträge zur Lehre von der Ordination unter Bezug auf die geltenden Ordinationsformulare, in: Peter Bläser u. a. (Hg.), Ordination und kirchliches Amt. Veröffentlichungen des Ökumenischen Arbeitskreises evangelischer und katholischer Theologen, Paderborn 1976, 72: „das Amt zu dem ordiniert wird, das ‚Bischofsamt‘ ist in dem Sinne von CA XXVII, das die Fülle der im Ministerium ecclesiasticum beschlossenen Funktionen umfaßt, ein Amt, das mit recht pastor seu episcopus genannt wird.“ 83 Darauf hat bereits hingewiesen: Martin Usteri, Initia Zwingli (Anm. 75), 107.
104
Hieronymus zum Bischofsamt und seine Autorität in dieser Frage
und anmaßenden Haltung die sich nur auf die Tatsache der Amtsinhabe beruft84. Dieser Amtsgedanke impliziert für Zwingli die Absetzbarkeit des Amtsträgers – also das Gegenteil des character indelebilis der katholischen Lehre85. Auch dafür beruft er sich auf Hieronymus, der in seiner Ep. 52 zumindest für Diakone noch eine regelrechte Amtsentlassung vorsah86 und auch sonst mit einer Möglichkeit rechnete, daß sich Amtsträger selbst das Amt entzogen. Als positives Bild für den rechten Amtsgebrauch des Bischofs/Pfarrers benutzt Zwingli ebenso wie Hieronymus die Metapher vom freundlichen Vater, dem alle Menschen gern gehorsam sind87.
Zusammenfassung Nach diesem Durchgang soll die Frage der Auctoritas des Hieronymus für die untersuchten Reformatoren noch einmal betrachtet werden. Sie setzt sich meines Erachtens aus fünf Elementen zusammen: 1) Hieronymus genießt Autorität in der Frage des Bischofsamtes, weil seine Position das Ergebnis von Schriftauslegung ist. Seine Autorität beruht auf der höchsten Autorität: der Heiligen Schrift88. 2) Hieronymus genießt Autorität auf Grund seiner exegetischen Kompetenz. Auch wenn diese nicht unumstritten ist, wird er auch an vielen anderen Punkten als Informationsquelle herangezogen. 3) Hieronymus genießt Autorität, weil seine Anschauungen konsistent sind. 4) Hieronymus genießt Autorität durch die Integration gerade seiner kritischen Äußerungen in die kirchliche Überlieferung (Decretum Gratiani). 84 Ulrich Zwingli, Supplicatio ad Hugonem episcopum Constaniensem 88 205,8f: „Adnotavimus etiam episcopi nomen officii esse, non insolentis supercilii“. Vgl. dazu folgende Schriften des Hieronymus, die Zwingli sämtlich bekannt waren: Comm. in Mattheum III CCL 77, 142,95– 99; Comm in Ep. ad Titum PL 26, 597 und Adv. Iouiniauum I,34, PL 23,270: „episcopus et presbyter et diaconus non sunt meritorum nomina, sed officiorum.“ 85 Auslegung des 61. Artikels CR 89 439,4–12 und De vera et falsa religione commentarius 20 CR 90 824,8–16: „Functio est, non dignitas episcopatus, hoc est verbi ministerium.“ 86 Hieronymus, Ep. 52 ad Nepotianum CSEL 54. Diese Ansicht des Hieronymus hat auch Eingang in das Decretum Gratiani gefunden: c.5 causa XII, quaestio 1. 87 Ulrich Zwingli, Auslegung des 34. Artikels CR 89,301,15–19: „Darnach heißt er sy ufsehen; das ist: Bischoff sin; dann bischof ist nüt anders dann ein wächter. Darnach söllend sy nit zwanglich sunder früntlich ir ampt verwalten und under sich nieman zwingen, sunder so vätterlich halten, das inen alle menschen selber willigklich gern gehorsam sind.“ Vgl. dazu Hieronymus, Ep. 82,3 CSEL 55, 110,3: „nonne tua dilectio? amari enim debet parens, amari parens et episcopus, non timeri.“ 88 Vgl. Peter Fraenkel, Testimonia Patrum (Anm. 57), 273f: „Luther […] combined a claim to the support of the Fathers with the assertion that they may be criticized by the Scriptures, whose teaching their own teaching continues.“
Hieronymus zum Bischofsamt und seine Autorität in dieser Frage
105
5) Hieronymus genießt Autorität, weil seine Thesen willkommene Hilfen in der Argumentation gegen die Altgläubigen sind89. Das Zusammentreffen dieser fünf Elemente macht seine Äußerungen zum Bischofs- und Presbyteramt so wertvoll für die drei untersuchten Reformatoren. Die deutliche Ablehnung, die Hieronymus an anderen Punkten erfährt, tritt gegenüber dem zurück und er erhält an diesem Punkt eine enorm große Resonanz. Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die kritischen Ansichten des Hieronymus vom Bischofsamt von ihm selbst ohne einen Impuls zur Veränderung der kirchlichen Strukturen entwickelt worden sind. Sie wurden im Decretum Gratiani aufbewahrt bis zu dem Zeitpunkt als das gesamte Gebäude der kirchlichen Hierarchie ins Wanken geriet. Erst in der Reformationszeit konnten seine Ideen wirkmächtig werden. Sie dienten zur Kritik der katholischen Hierarchie und haben Amtsauffassung der sich formenden reformatorischen Kirchen bis auf den heutigen Tag geprägt.
Literatur Peter Bläser u. a. (Hg.), Ordination und kirchliches Amt. Veröffentlichungen des Ökumenischen Arbeitskreises evangelischer und katholischer Theologen, Paderborn 1976. Yvon Bodin, Saint Jérôme et l’Église, Paris 1966. Martin Brecht (Hg.), Martin Luther und das Bischofsamt, Stuttgart 1990. Hans von Campenhausen, Kirchliches Amt und geistliche Vollmacht in den ersten drei Jahrhunderten (BHTh 14), Tübingen 1963. Hans Dombois, Hierarchie. Grund und Grenze einer umstrittenen Struktur, Freiburg 1971. Peter (Pierre) Fraenkel, Testimonia Patrum. The Function of the Patristic Argument in the Theology of Philip Melanchthon (THR 46), Genf 1961. Klaus Haendler, Wort und Glaube bei Melanchthon. Eine Untersuchung über die Voraussetzungen und Grundlagen des melanchthonischen Kirchenbegriffs (QFRG 37), Gütersloh 1968. Adolf von Harnack, Der kirchengeschichtliche Ertrag der exegetischen Arbeit des Origenes 2. Teil, Anhang: Origenistisches Gut von kirchengeschichtlicher Bedeutung in den Kommentaren des Hieronymus zum Philemon-, Galater-, Epheser- und Titusbrief (TU 42/4), Berlin 1919. Martin Hauser, Prophet und Bischof. Huldrych Zwinglis Amtsverständnis im Rahmen der Zürcher Reformation (ÖBFZPhTh 21), Freiburg 1994.
89 Vgl. Schindler, Zwingli und die Kirchenväter (Anm. 73), 44: „Damit kommen wir zum entscheidenden Punkt: Die Häufigkeit der Kirchenväterzitate bei Zwingli ist wesentlich abhängig vom Mass der Polemik und Apologetik“.
106
Hieronymus zum Bischofsamt und seine Autorität in dieser Frage
Martin Luther, Annotierungen zu den Werken des Hieronymus, hg. v. Martin Brecht und Christian Peters (Archiv zur Weimarer Ausgabe der Werke Luthers, Texte und Untersuchungen 8), Köln u. a. 2000. Wilhelm Maurer, Melanchthon-Studien (SVRG 181), Gütersloh 1964. Wilhelm Maurer, Der junge Melanchthon zwischen Humanismus und Reformation, Bd. II, Göttingen 1969. Eginhard P. Meijering, Melanchton and Patristic Thought. The doctrines of Christ and Grace, the Trinity and the Creation (SHCT 32), Leiden 1983. Ernst Schäfer, Luther als Kirchenhistoriker, Gütersloh 1897. Alfred Schindler, Zwingli und die Kirchenväter (147. Neujahrsblatt zum Besten des Waisenhauses Zürich), Zürich 1984. Reinhard Staats, Von der Konfessionskirche zur Bischofskirche. Der schwedische Rapport „Das Bischofsamt“ aus patristischer Sicht, in: ThLZ 116 (1991) 321–338. Heinz-Meinolf Stamm, Luthers Berufung auf die Vorstellungen des Hieronymus vom Bischofsamt, in: Martin Brecht (Hg.), Martin Luther und das Bischofsamt, Stuttgart 1990. W. Peter Stephens, The Theology of Huldrych Zwingli, Oxford 1986. Martin Usteri, Initia Zwingli (2.), in ThStKr 59 (1886).
Juden in zwei Osterpredigten1 Augustins
Augustins grundsätzliche Haltung zu den Juden ist in den letzten Jahrzehnten mehrfach beschrieben worden2. Seine Haltung zu den Juden speist sich nicht aus persönlicher Feindschaft, allgemeinem Ausgrenzungsdenken oder Vorformen des Rassenwahns3, sondern sehr klar aus theologischen und heilsgeschichtlichen Überlegungen4. Deshalb spielen Juden in verschiedenen Schriften Augustins eine Rolle. Sie werden heilsgeschichtlichen Kontexten erwähnt, oder bei der Frage nach dem Verhältnis von Neuem zu Altem Testament, oder bei dem typisch 1 Es handelt sich um: Sermo 229F (Morin, Guelferbitanus X) und Sermo 229M (Morin, Guelferbitanus XV). Diese beiden Predigten sind nicht in der Sammlung der Osterpredigten Augustins enthalten, die Hubertus Drobner vorgelegt hat. Hubertus R. Drobner (Hg.), Augustinus von Hippo. Predigten zum österlichen Triduum (Sermones 218–229 D), Einleitung, Text, Übersetzung und Anmerkungen (Patrologia 16), Frankfurt am Main u. a. 2006. Die Predigten Augustins erfreuen sich inzwischen einer stärkern Beachtung in der wissenschaftlichen Literatur. Zwei Tagungen zu den Predigten haben stattgefunden, die Ergebnisse liegen in zwei Bänden vor: Gert Partoens (Hg.), Ministerium sermonis. Philological, historical, and theological studies on Augustine’s Sermones ad populum (Instrumenta patristica et mediaevalia 53), Turnhout 2009 und Anthony Dupont (Hg.), Tractatio scripturarum. Philological, exegetical, rhetorical and theological studies on Augustine’s sermons (Ministerium Sermonis II = Instrumenta patristica et mediaevalia 65), Turnhout 2012. 2 Vgl. die Schriften von Bernhard Blumenkranz, Die Judenpredigt Augustins. Ein Beitrag zur Geschichte der jüdisch-christlichen Beziehungen in den ersten Jahrhunderten (Basler Beiträge zur Geschichtswissenschaft 25), Basel 1946, Bernhard Blumenkranz, Die Juden als Zeugen der Kirche, in: Theologische Zeitschrift 5 (1949), 396–398, Bernhard Blumenkranz, Augustin et les juifs – Augustin et le judaïsme, in Recherches Augustiniennes 1 (1958), 224–241. Die neuste Spezialuntersuchung zur Judenpredigt Augustins liegt vor von Wessel Hendrik ten Boom, Provocatie. Augustinus’ preek tegen de Joden, theologisch essay, Kampen 2006. Der neueste Gesamt-Überblick stammt von Thomas Raveaux, Augustin und die Juden, in: Volker Henning Drecoll (Hg.), Augustin Handbuch, Tübingen 2007, 212–218. 3 Vgl. Thomas Raveaux, Adversus Judaeos – Antisemitismus bei Augustinus? In: Signum Pietatis FS C. P. Mayer OSA, hg. v. Adolar Zumkeller, Würzburg 1989, 37–51. 4 Thomas Raveaux, Augustin und die Juden (Anm. 2), 217: „Insgesamt ergibt sich der Eindruck: Das Verhältnis von Augustin zu den Juden ist ganz überwiegend theologisch definiert. Es ist […] durch die grundsätzliche Überzeugung von der heilsgeschichtlichen Verknüpfung zwischen Christen und Juden bestimmt, wie sie in der besonderen Verbindung zwischen den beiden Testamenten deutlich wird.“
108
Juden in zwei Osterpredigten Augustins
augustinischen Thema von Gesetz und Gnade5. Aber auch Detailfragen kommen bei Augustinus vor wie zum Beispiel die Frage, ob Christen, die zuvor Juden waren, die Bestimmungen des jüdischen Zeremonialgesetzes einhalten dürfen6. Als Einleitung zu den beiden hier behandelten Osterpredigten beschränke ich mich im Folgenden auf vier charakteristische Zitate aus Augustins „Civitas Dei“. Ausgangspunkt für die heilsgeschichtlichen Überlegungen Augustins die unauflösliche Verbindung zwischen Altem und Neuem Testament. In beiden Teilen der christlichen Bibel wird von dem gleichen Gott geredet. Das Alte Testament ist dabei die prophetische Ankündigung (promissio) des Neuen. Die Erfüllung der Verheißung geschieht in Jesus Christus. Das wird im Neuen Testament beschrieben. Die besondere Rolle, die Augustinus den Juden in diesem Zusammenhang zuweist, ist ihre Funktion als eigene und unabhängige Träger der Überlieferung des Alten Testaments. Als solche werden sie in Augustins Augen zu unfreiwilligen Zeugen für die Wahrheit des Evangeliums. Ihre Zerstreuung in die Diaspora versteht Augustinus grundsätzlich als Strafe Gottes, wie wir später sehen werden. Aber diese Strafe hat ein einen positiven Nebeneffekt. Gott sorgt dafür, dass die Schriften des Alten Testaments überall verfügbar sind und ermöglicht damit stets den Beweis, dass das Christentum die Erfüllung dessen ist, was das Alte Testament bereits vorhergesagt hat. Diese ZeugenFunktion dient vor allem in apologetischen Debatten mit Heiden dazu, den christlichen Altersbeweis zu unterstützen. Von heidnischer Seite wurde den Christen immer wieder Verfälschung der biblischen Schriften vorgeworfen. Dem kann mit dem Hinweis auf die eigenständige Überlieferung der Hebräischen Bibel im Judentum widersprochen werden. So schreibt er in De civitate dei VII: Sodann wurde das hebräische Volk zu einer Art von einheitlichem Staat verbunden […] und in ihm ist […] all das, was seit der Ankunft Christi bis heute geschah und weiterhin geschieht, als Künftiges vorausgesagt worden. Und dieses Volk ist nachher, um seine Schriften zu bezeugen, in denen das ewige Heil in Christus als künftig vorausverkündet ist, unter die Heiden verstreut worden7.
Die weltweit verstreuten Juden als Träger der alttestamentlichen Überlieferung geben so den Beweis dafür, dass die Christen ihre Religion nicht „neu“ erfunden haben. Diese Funktion weist ihnen Augustinus übrigens ohne eine Spur von Zynismus zu. Die Christen haben aus der Zerstreuung des Volkes Israel in die Diaspora auf diese Weise einen Gewinn. Denn sie können sich jederzeit auf die 5 Zur Gnadenlehre vgl. Volker Henning Drecoll, Die Entstehung der Gnadenlehre Augustins (BHTh 109), Tübingen 1999. 6 Ralph Hennings, Der Briefwechsel zwischen Augustinus und Hieronymus und ihr Streit um den Kanon des Alten Testaments und die Auslegung von Gal 2,11–14 (SVigChr 21), Leiden 1994, 265–291. 7 Augustinus, De civitate dei, 7,32, in deutscher Übersetzung von Carl Johann Perl, Der Gottesstaat (lat./dt.), Bd. 1, Paderborn 1979, 479.
Juden in zwei Osterpredigten Augustins
109
außerhalb ihrer Gemeinschaft verlaufende Parallelüberlieferung des Alten Testaments wie auf einen Zeugen berufen. Die auch für Heiden offensichtlich erkennbare Gegnerschaft von Juden und Christen macht die jüdische Überlieferung der – von den Christen als Prophezeiungen auf Christus gelesenen – Texte des Alten Testaments für eine Zeugenschaft umso überzeugender8. Das beschreibt Augustinus in De civitate dei XVIII: Man trifft sie [die Juden] in der Tat überall an, und sie dienen uns durch ihre Schriften als Beweis, dass die Weissagungen über Christus nicht von uns nachträglich verfasst worden sind. […] Uns freilich genügen die Prophetien, die sich aus den Büchern unserer Gegner ergeben, die wir gerade wegen des Zeugnisses anerkennen, das sie uns ungewollt leisten. Sie besitzen ja diese Bücher und bewahren sie, zumal seitdem sie unter alle Völker verstreut sind, soweit immer die Kirche Christi sich erstreckt9.
Die Juden sind für Augustinus nicht in der Lage, den Sinn ihrer eigenen Schriften zu erfassen. Sie sind für die Wahrheit, die prophetisch auf Christus hinweist „blind“ (caecus). Das wiederholt Augustinus häufig. Diese „Blindheit“ der Juden ist letztendlich auch dafür verantwortlich, dass sie Jesus getötet haben. Die Juden tragen also die Schuld am Tode Jesu. Dafür haben sie von Gott die Strafe der Zerstreuung und Verbannung aus dem Heiligen Land erhalten. Ebenfalls in De civitate dei XVIII schreibt er: Die Juden aber, die ihn getötet haben und an ihn, dass er sterben und auferstehen musste, nicht glauben wollten, sind immer unheilvoller von den Römern mitgenommen und schließlich ganz und gar in ihrem Reich […] ausgetilgt und über die Länder verstreut worden10.
Sogar die Juden, die Zeitgenossen Augustins sind – und von daher unschuldig an dieser Tat ihrer Vorfahren sein müssen –, sind durch ihre Abstammung immer noch von dem Geschehenen betroffen. Augustinus wirft seinen Zeitgenossen in De civitate dei XX die Tötung Jesu vor: Reuen wird es nämlich an jenem Tage die Juden, auch die, die den Geist der Gnade und des Erbarmens empfangen haben werden, dass sie Christus in seinem Leiden verhöhnt haben […] Aber wie wir heute zu den Juden sagen: Ihr habt Christus getötet, obwohl es ihre Vorfahren taten, ebenso werden sie trauern, weil sie in gewissem Sinne etwas getan haben, was eigentlich die taten, aus deren Stamme sie sind11.
8 Zur Rolle der Juden als Zeugen für die Wahrheit des Christentums vgl. auch Ernst Bammel, Die Zeugen des Christentums, in: Herbert Frohnhofen [Hg.], Christlicher Antijudaismus und jüdischer Antipaganismus, Hamburg 1990, 170–180, wiederabgedruckt in: Ernst Bammel, Judaica et Paulina. Kleine Schriften II (WUNT 91), Tübingen 1997, 96–106. 9 Augustinus, De civitate dei, 18,46 (Anm. 7), 399, der Gedankengang wird am Ende von 18,47 noch einmal ausgeführt. 10 Augustinus, De civitate dei, 18,46 (Anm. 7), 399. 11 Augustinus, De civitate dei, 20,30 (Anm. 7), 637.
110
Juden in zwei Osterpredigten Augustins
Hier findet sich die Vorstellung einer über die Zeit hinweg reichenden Schuld der Juden als ethnisches Kollektiv. Augustinus gibt hier auch einen Einblick in die zeitgenössischen Auseinandersetzungen mit Juden. Ihnen wird – zumindest in christlicher Predigt und Liturgie vorgeworfen, Christus getötet zu haben. Diese Praxis erscheint heute äußerst fragwürdig. Die Vorstellungen von Schuld und ihrer Übertragbarkeit über die Generationen sind anders geworden, zum anderen ist die exegetische Erkenntnis gewachsen, dass die Schuld am Tode Jesu in jedem Falle die römische Besatzungsmacht zu tragen hat. Die Wiederzulassung des lateinischen Messformulars der römisch-katholischen Kirche, das in der Liturgie des Karfreitags auf ähnliche Weise Vorwürfe gegen die Juden erhebt, zeigt aber, dass der Umgang mit dem Volk Israel bis heute von solchen Elementen nicht frei ist.
Augustinus und die Juden in seiner pastoralen Arbeit Für einen Blick in die Praxis der pastoralen Arbeit Augustins sind neben seinen Briefen vor allem die zahlreichen erhaltenen Predigten von Interesse. Für die Frage nach der Haltung mit der Augustinus seiner Gemeinde gegenübertritt, wenn er in der Predigt etwas zu den Juden sagt, habe ich zwei Osterpredigten ausgewählt, die nicht direkt durch den Titel oder die zu Grunde liegenden Texte auf das Thema „Juden“ ausgerichtet sind, es aber dennoch streifen oder sogar in den Mittelpunkt stellen. Gemeinsam ist den Predigten auch, dass sie beide in einer prominenten Weißenburger Handschrift aus der zweiten Hälfte des neunten Jahrhunderts überliefert sind, die heute in der Wolfenbütteler HerzogAugust-Bibliothek aufbewahrt wird.
Augustinus und die Juden in der Osterpredigt Sermo CPL 229F (Guelf. X)12 Die erste der beiden ausgewählten Osterpredigten13, die zu den Juden Stellung nimmt, widmet sich sehr grundsätzlich diesem Thema. Allerdings eröffnet Augustinus die Predigt zunächst mit einmal mit der Frage nach Glauben und Sehen. Vermutlich schließt sich die Predigt an das Evangelium vom „ungläubigen 12 Zitiert nach Germanus Morin (Hg.) Sancti Augustini Sermones post Maurinos reperti (Miscellanea Agostiniana I), Rom 1930, 471–473. 13 Adalbert Kunzelmann, Die Chronologie der Sermones des Hl. Augustinus, in: Miscellanea Augustiniana II, Rom 1931, 477 u. 516 datiert die Predigt in die Zeit nach 418, vielleicht auf den Ostermontag 419.
Juden in zwei Osterpredigten Augustins
111
Thomas“ (Joh 20,24–29) an. Aber Augustinus nimmt im Verlauf der Predigt auf diese Geschichte wenig Bezug. Er entfaltet vielmehr als Hauptthema, dass der Glaube durch die Gnade Gottes zu Stande kommt. Dafür bietet sich ihm mit der Unterscheidung zwischen den Menschen, die den historischen Jesus zu erlebt haben und denen, die ihn nie mit eigenen Augen gesehen haben, eine erste Differenzierungsmöglichkeit und bildet damit eine der wenigen Brücken zum Evangelium vom „ungläubigen Thomas“. Eine weitere Differenzierung bietet sich ihm mit den Kriterien „Juden“ oder „Heiden“, also mit einer ethnischen Beschreibung der Menschen, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Augustinus kombiniert gleich am Anfang der Predigt beide Kriterien und stellt fest, dass zu denen, die Jesus gesehen haben und dennoch nicht glauben, vor allem die Juden gehören – andererseits stammen ganz prominente Personen der ersten Christenheit aus dem Volk Israel. Im Fortgang der Predigt werden eine Reihe weiterer Bibeltexte herangezogen, die als Subtexte den Gedankengang der Predigt steuern14. Zumeist spielt Augustinus nur auf die betreffenden Passagen an und setzt mit diesem Vorgehen eine anscheinend sehr bibelfeste Hörergemeinde voraus. Zum ersten Mal geschieht das bei einem Nebengedanken, der sich auf die Juden bezieht, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Augustinus erläutert seinen Hörern: Jesu Blut sei zwei Mal über sie gekommen, einmal gemäß der Selbstverfluchung aus Mt 27,25: „Sein Blut komme über uns und unsere Kinder“, die Augustinus unbekümmert als historische Tatsache ansieht, und einmal durch die erlösende Wirkung der Reinigung durch das Blut Jesu in Taufe und Abendmahl. Dann wird das Hauptthema der Predigt mit Hilfe eines weiteren nicht zitierten aber immer wieder alludierten Bibeltextes erläutert. Der diesen Strang der Predigt steuernde Text ist Mt 3,12: „Er hat seine Worfschaufel in der Hand; er wird seine Tenne fegen und seinen Weizen in die Scheune sammeln; aber die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer.“ Augustinus überträgt das jesuanische Bildwort auf die Frage des Glaubens. Der Glaube entscheidet darüber, wer „Weizen“ ist und wer „Spreu“. Entscheidendes Kriterium dafür ist weder, ob jemand Jesus mit eigenen Augen gesehen hat, noch seine ethnische Herkunft. Für die Frage, wer zum „Weizen“ gehört oder wer zur „Spreu“ gezählt wird, ist allein der Glaube an Jesus Christus ausschlaggebend: Betrachtet die Juden nicht so als ob sie Spreu auf jener Tenne wären, die jetzt ausgedroschen ist (vgl. Mt 3,12). Denn, meine Brüder, wenn wir (es recht) bedenken: aus den 14 Ähnliche Beobachtungen zu strukturierenden Elementen der Predigten Augustins hat Joost van Neer gemacht, Joost van Neer, Language and scripture as structuring principles of Augustine’s „Sermones“ 186 and 187, in: Augustiniana 63 (2013), 189–229.
112
Juden in zwei Osterpredigten Augustins
Juden stammen die Propheten, aus den Juden die Patriarchen, aus den Juden die Apostel, aus den Juden die Jungfrau Maria, die Christus geboren hat, aus den Juden stammt Paulus, der später glaubte und so viele tausend an einem Tag Getaufte (Apg 2,41), aus den Juden stammen unzählige Kirchen der Christen. Aber jenes Getreide wird schon in den Scheunen aufbewahrt – mit der Spreu spielt der Teufel. Juden sind Gläubige und Juden sind Ungläubige15.
Direkt daran schließt sich ein zweiter Gedankengang an, der von einem weiteren biblischen Text ausgeht. Auch in diesem Fall spielt Augustinus im Wesentlichen nur auf die Geschichte an, zitiert aber immerhin einzelne Sätze direkt. Es handelt sich um den Kampf Jakobs mit dem Engel am Jabbok: Gen 32,25b–30. In der Namensgleichheit des Volkes Israel mit seinem Stammvater Jakob, der nach dem Kampf mit dem Engel in „Israel“ umbenannt wird, liegt die erste Brücke zwischen der biblischen Geschichte und der Predigtaussage Augustins. Der zweite Vergleichspunkt liegt in der scheinbaren Unterlegenheit des Stärkeren. Scheinbar unterliegt der Engel Jakob, genauso ist Christus scheinbar von den Juden besiegt worden: Und er [der Engel] hat mit ihm gerungen, obwohl er ihm bei weitem an Kraft überlegen war, tat er so als ob er von ihm besiegt würde und Jakob hatte die Oberhand. So wurde auch der Herr Christus von den Juden besiegt: Sie hatten die Oberhand als sie ihn töteten16.
Auf diese Weise ist der Engel, der Jakob begegnet, für Augustinus eine persona Christi und ermöglicht so eine typologische Auslegung der Bibelstelle. In dieser Auslegung verschmelzen die Horizonte der Geschichte Israels und der Geschichte der Kirche so weit, dass am Ende der Name „Israel“ nicht mehr für Jakob oder für das Volk Israel reserviert bleibt, sondern am Ende nur noch für alle Gläubigen gilt, die an Jesus Christus glauben, gleichgültig ob aus dem Volk Israel oder aus den Heidenvölkern stammend: So groß wie die Auflegung des Namens ist der Segen: Israel wird übersetzt, wie ich schon sagte, mit „Gott sehend“: Name des einen, Auszeichnung für alle. Für alle aber: für die Gläubigen und Gesegneten, für die Juden und die Griechen.17
Dass das eine ernst gemeinte Übernahme der Israel-Bezeichnung – und damit eine klare Enteignung des Volkes Israel18 ist, macht Augustinus unmissverständlich klar, in dem er die Juden warnt und ermahnt, sie sollten sich nicht mit
15 16 17 18
Augustinus, Sermo 229F (Morin, Guelf. X), 472,15–21, Übersetzung R.H. Augustinus, Sermo 229F (Morin, Guelf. X), 472,25–27, Übersetzung R.H. Augustinus, Sermo 229F (Morin, Guelf. X), 473,3–5, Übersetzung R.H. Zum Begriff des „wahren Israel“ in der frühen Kirchengeschichte vgl. Marcel Simon, Verus Israel. Étude sur les relations entre chrétiens et juifs dans l’Empire Romain, Paris 1983 Nachdr. d. 2.Aufl. (Erstausgabe 1948).
Juden in zwei Osterpredigten Augustins
113
ihrer Abstammung und ihrer dadurch erworbenen Zugehörigkeit zum gesegneten Volk Israel brüsten: Die Juden sollen sich nicht hervortun und sagen: Siehe, dennoch ist Jakob unser Vater, er hat über einen Engel die Oberhand gewonnen und ist von dem Engel gesegnet worden. Wir sagen: Volk Israel, pass auf! Du bist nicht Israel! Du heißt so, aber du bist es nicht19.
Abstammung genügt nicht um zum „wahren“ Israel zu gehören. Das Kriterium dafür ist bei Augustinus allein der Glaube: „Wenn du an Christus glaubst, erkenne dich als gesegnet, wenn du Christus verneinst, erkenne dich als hinkend.“20 Mit dem Wort „hinkend“ wird auf den Schlag des Engels auf Jakobs Hüfte angespielt. Damit wurde der Kampf durch den Engel beendet und Jakob auf Dauer gezeichnet, trotz des ebenso vom Engel erhaltenen Segens. Die Begegnung mit dem Engel hatte also für Jakob einen doppelten Ausgang. Für Augustinus können die Juden sich nun durch die Entscheidung für oder gegen Christus quasi auf die eine oder die andere Seite des Engelskampfes stellen. Durch den Glauben an Christus werden sie „gesegnet“, durch den Unglauben bleiben sie „hinkend“. Auf dem Hintergrund dieser – für ihn als real eingeschätzten – Möglichkeit betont Augustinus offensiv und werbend die Bedeutung vieler Juden für die Frühzeit des Christentums. Wie er das bereits in der Mitte der Predigt getan hat, listet er am Ende noch einmal auf, welche entscheidenden Menschen für die Geschichte des Christentums aus dem Volk Israel stammen – und zwar Menschen, die den Auferstandenen gesehen haben und an ihn geglaubt haben. Aber, so schränkt Augustinus ein, das war und ist nicht die Masse des Volkes Israel. Damit kehrt er zum ersten steuernden Text zurück; zum Gleichniswort vom Dreschen und Worfeln aus Mt 3,12: Siehe, Israel ist gesegnet! Aber viele aus ihm [dem Volk Israel] hinken, wenige sind gesegnet […] Erkenne die wenigen Körner und wundere dich über den Haufen der Spreu, und siehe, was in die Scheune gehört, was ins Feuer. Und nun sollen sie hören – sie leben immer noch – sie sollen das Hinken beheben, sie sollen zum Segen kommen!21
Am Ende der Predigt steht damit ein ausdrücklicher Bekehrungsaufruf an die Juden. Es ist durchaus keine unfreundliche Aufforderung, die Augustinus damit ausspricht, aber die eindeutige Einladung durch Christus zum Segen, zum „wahren“ Israel, also der christlichen Kirche, zu kommen. Man fragt sich, ob Augustinus damit rechnet, dass Juden aus Hippo seiner Osterpredigt zuhören, oder ob das nur vor christlichen Ohren gesprochen worden ist. Wenn nur Christen in der Kirche waren, ist die Schlussformel der Predigt 19 Augustinus, Sermo 229F (Morin, Guelf. X), 473,12–14, Übersetzung R.H. 20 Augustinus, Sermo 229F (Morin, Guelf. X), 473,19–21, Übersetzung R.H. 21 Augustinus, Sermo 229F (Morin, Guelf. X), 473,26–27. 30–32, Übersetzung R.H.
114
Juden in zwei Osterpredigten Augustins
sicherlich eine Art Aufforderung an die Gemeinde mit dieser Botschaft zu den Juden der Stadt zu gehen. Zugleich sind die Christen in Hippo aber von Augustinus dafür sensibilisiert worden, wie tief die Christen im Volk Israel verwurzelt sind und welche Bedeutung Juden in der Geschichte des Christentums haben. Darüber hinaus bleibt die Frage, ob die Zuhörerinnen und Zuhörer das komplizierte Spiel mit den biblischen Anspielungen haben verstehen können, ohne dass die Texte zuvor gelesen worden waren.
Augustinus und die Juden in der Osterpredigt Sermo 229M (Guelf. XV)22 In dieser am Ostertag, dem 19. April 41223 in Hippo gehaltenen Predigt geht Augustinus – wie sonst am Freitag der Osterwoche24 – auf die Geschichte vom nachösterlichen Fischzug aus dem Johannesevangelium ein (Joh 21,1–13). In der Auslegung dieses Evangeliums erklärt er vor allem die Bedeutung der Zahl von 153 Fischen, die bei diesem Fischzug gefangen wurden. Diese Auslegung hat theologische Implikationen, die das Verhältnis von Christen und Juden berühren, auch wenn in dieser Predigt das Wort „Juden“ nur einmal und dann auch noch beiläufig vorkommt.25 In dieser Predigt ist das strukturierende Element die Zahl „Zwei“. Augustinus stellt die zwei in den Evangelien bezeugten Fischzüge einander gegenüber. Sie sind im Schema einer Steigerung angeordnet. Der zweite – nachösterliche – Fischzug überbietet den ersten Fischzug bei weitem. Augustinus versteht ihn als einen Hinweis auf das Himmelreich und charakterisiert das vor allem als eine ungetrübte Einheit im Glauben: „Aber im neuen Fischzug ist 22 Zitiert nach Germanus Morin (Hg.) Sancti Augustini Sermones post Maurinos reperti (Miscellanea Agostiniana I), Rom 1930, 488–491. 23 Adalbert Kunzelmann, Chronologie (Anm. 13), 481, datiert die Predigt wegen ihrer inhaltlichen Nähe zur 412 entstandenen Schrift „De spiritu et littera“ in dieses Jahr. 24 Augustinus, Sermo 248,4 zitiert nach Adalbert Kunzelmann, Chronologie (Anm. 13) 490, Anm. 5: Aliquod ergo signum vult iste numerus et anniversaria solemnitate sermonis huius commemorare vobis debeo, quod omni anno soletis audire. Daher erklärt sich auch der Anfang von Sermo 229F: „Eure Gnade kennt jene Zeugen aus den heiligen Evangelien der Auferstehung des Herren, die jährlich festlich gefeiert wird. So also erneuert die Lesung die Erinnerung, so erneuert die Auslegung der Lesung die Erinnerung, so also werden wir, mit der Hilfe des Herrn, verkündigen, was ihr jedes Jahr zu hören pflegt. Wenn so die Lesung eine Erneuerung des Gedächtnisses ist, die doch auch zu anderer Zeit im Evangelium gelesen werden kann, um wie viel mehr die Predigt, die nur dies eine Mal im Jahr gehört wird?“ Weitere erhaltene Predigten über die 153 Fische mit dieser Auslegung der Zahl sind die Sermones 249, 251, 259, Wilmart 13 und die Auslegung in den Tractatus in Iohannis Evangelium 122,8–9 (CCL 36), 673,1–675,43. 25 Augustinus, Sermo 229M (Morin, Guelf. XV), 490,25.
Juden in zwei Osterpredigten Augustins
115
perfekte Einheit.“26 „Dieser ist die heilige Kirche.“27 „Dies wird das Himmelreich sein: Kein Häretiker wird zanken, kein Schismatiker wird sich absondern, alle, die darin sind, werden in Frieden leben.“28 Zum zweiten Fischzug gehört die genaue Angabe der Zahl der Fische, die im Netz zappelten: 153. Dass das nicht die endgültige Zahl der Himmelsbewohner sein wird, ist schnell klar. Aber was könnte diese Zahl bedeuten, wenn der gesamte zweite Fischzug auf die Vollendung im Himmelreich hindeutet? Augustinus zerlegt sie in zwei Zahlen, aus denen nachher die Zahl 153 entsteht. Er benutzt die Zahlen „Zehn“ und „Sieben“. Diese zwei Zahlen ordnet er zwei theologischen Kategorien zu. Die „Zehn“ den Zehn Geboten, die „Sieben“ der „Gnade des Geistes“.29 In einem Paulus folgenden Gedankengang versteht er das Gesetz als eine unerfüllbare Forderung, die den Menschen zu einem Sünder macht, der sich selbst nicht befreien kann. Der Dekalog mit seinen unerfüllbaren Forderungen ist auf Grund der „Härte der Juden“ auf steinernen Tafeln geschrieben worden, während die Christen ein „Brief Gottes sind, der auf den fleischernen Tafeln des Herzens geschrieben“ (2. Kor 3,3) ist. Die zwei Größen, „Gesetz“ und „Gnade des Geistes“ stehen einander wiederum in einem heilsgeschichtlich überbietenden Sinne gegenüber. Mit dem Gesetz allein ist kein Weg zur Erlösung möglich – im Gegenteil – mit Paulus formuliert Augustinus: „Die Sünde nahm das Gesetz zum Anlass und betrog mich […] und dadurch tötete sie mich“ (vgl. Röm 7,7+11). Die Erlösung ist erst durch die Gabe des Geistes und seiner Gnade möglich. Der Geist ist bei Augustinus hier nicht der Geist Gottes im Allgemeinen, sondern explizit der bei der Taufe30 zugesprochene Geist: „Das ist der siebenfältige Geist, der über den Getauften angerufen wird.“31 Dieser Geist ist nötig, um mit dem Gesetz leben zu können. Nur wenn beides zusammenkommt, gibt es einen Weg in den Himmel: „Füge also „Sieben“ zu den „Zehn“ hinzu, wenn Du die Gerechtigkeit erfüllen willst. Wenn dir vom Gesetz befohlen wird, irgendetwas zu tun, bitte den Geist, dass er (dir) helfe.“32 Für Juden ist damit die Möglichkeit verbaut, einen Zugang zum Reich Gottes zu haben ohne Christen zu werden. Das bedeutet, dass der „alte Bund“ hinfällig ist und nur der „neue Bund in Christus“ einen Zugang zum Himmelreich eröffnet. Der Versuch, „die Gerechtigkeit zu erfüllen“, indem zum Beispiel ein frommer Jude das Gesetz hält, wird von Augustinus als eine unmögliche Möglichkeit verworfen. Nur mit der „Zehn“ kommt niemand in den Himmel. Es müssen die zwei Zahlen „Zehn“ und 26 27 28 29 30 31 32
Augustinus, Sermo 229M (Morin, Guelf. XV), 489,18, Übersetzung R.H. Augustinus, Sermo 229M (Morin, Guelf. XV), 489,19, Übersetzung R.H. Augustinus, Sermo 229M (Morin, Guelf. XV), 489,27–29, Übersetzung R.H. Augustinus, Sermo 229M (Morin, Guelf. XV), 490,11, Übersetzung R.H. Die Osterpredigt hat immer auch die an diesem Morgen Neugetauften im Blick. Augustinus, Sermo 229M (Morin, Guelf. XV), 490,22–23, Übersetzung R.H. Augustinus, Sermo 229M (Morin, Guelf. XV), 491,4–6 Übersetzung R.H.
116
Juden in zwei Osterpredigten Augustins
„Sieben“ zusammenkommen, damit sich die Zahl der Fülle, die Zahl der 153 Fische ergibt. Das erreicht Augustinus schließlich mit einem Rechentrick. Er addiert alle Zahlen bis Siebzehn mit sich selbst, also 1+2+3+4+5 … 1733. Das Ergebnis dieser Rechnung ist – auf wundersame Weise: 153! Damit ist die Auslegung der Fische im Netz des nachösterlichen Fischzuges auf eine theologische Basis gestellt, die sich stark paulinischen Konzepten verdankt und zugleich eine deutliche abgrenzende Funktion gegenüber dem Judentum hat. Der Weg zum Heil ist nur über Christus möglich. Das betonen beide Osterpredigten sehr deutlich, wenn auch auf sehr unterschiedlichen Wegen. Augustinus schließt dabei die Möglichkeit zum christlichen Glauben zu kommen für Juden nicht aus, er lädt sogar dazu ein. Aber dem Judentum selbst kann er – in dessen am Gesetz orientierter traditioneller Frömmigkeit – keinen eigenen Weg zum Heil mehr zugestehen. Nach seiner Auffassung müssten die Juden ihre „Blindheit“ ablegen und sich der Kirche zuwenden. Dann winkt ihnen die Gnade Gottes und sein himmlisches Reich ebenso wie den Heiden. Ihre besondere Abstammung und die besondere Geschichte Gottes mit seinem Volk schließen die Juden für Augustinus nicht vom Heil aus, eröffnen ihnen aber seit Ostern keinen eigenen Weg mehr dahin, der an Jesus Christus vorbeiführte.
Übersetzung Sermo 229F (Morin, Guelferbitanus X) 1. Die einen sahen die Auferstehung des Herrn, die anderen glaubten nicht, was [davon] berichtet wurde, ihnen wurde aber noch vom gegenwärtigen [dem auferstandenen] Herrn selbst der Vorwurf gemacht, dass sie denen nicht geglaubt haben, die [es] gesehen und berichtet haben. Welche Würdigung der Heiden und der lange danach Geborenen! Wie zeichnet Gott jene aus! Auf welche Weise füllt er die Kirche Christi? Die heiligen Apostel gingen mit dem Herren durchs Land, sie hörten das Wort der Wahrheit aus seinem Mund, sie sahen ihn den Tod erleiden, aber sie glaubten nicht, dass der Herr auferstanden sei. Wir aber, die lange danach geboren sind, haben seine körperliche Gegenwart niemals gesehen, haben kein Wort aus seinem fleischlichen Mund gehört, haben keines der von ihm gewirkten Wunder mit diesen Augen gesehen und dennoch glauben wir. Wir hören die Schriften derer, die damals nicht glauben wollten. Das Geschehen, das ihnen innerhalb kürzester Zeit berichtet worden war, glaubten sie nicht. Sie haben geschrieben, was wir lesen, was uns nützt und was wir glauben. Dass aber der Herr Jesus den Juden nicht erscheinen wollte, ist kein Urteil darüber, dass er sie nicht für würdig hielt, den Herrn Christus nach der Auferstehung zu sehen: Er zeigte sich den Seinen, nicht den Fremden. Aber indem sie 33 Augustinus, Sermo 229M (Morin, Guelf. XV), 491,7–28.
Juden in zwei Osterpredigten Augustins
117
den Seinen predigten, glaubten die Fremden – und die Fremde gewesen waren, wurden zu Seinen gemacht. Denn viele von denen – so lesen wir in der Apostelgeschichte – viele von denen, die den Herrn gekreuzigt hatten und die durch sein vergossenes Blut besudelt worden sind; viele von denen, die geschrieen hatten: „Sein Blut komme über uns und unsre Kinder“ (Mt 27,25), glaubten später der Verkündigung der Apostel. Sein Blut kam wiederum über sie: aber zum Abwaschen, nicht zum Untergang – über die einen zum Untergang, über die anderen zur Reinigung – gerecht über die zum Untergang, barmherzig über die zu Reinigenden. Und, haben etwa jetzt alle den Glauben? So wie damals selbst einige der Juden glaubten, einige nicht glaubten, so ist es auch jetzt bei den Heiden: es glauben einige, aber nicht alle. „Der Glaube ist nicht jedermanns Ding“ (2. Thess 3,2b). Diejenigen, die aber Glauben haben, die glauben aus Gnade. Sie bringen den Glauben nicht hervor, er ist Gottes Geschenk. Hat uns der Herr nun nicht deshalb erwählt, weil wir gut waren? Er erwählt nicht die Guten, sondern die er gut machen will. Wir waren alle im Schatten des Todes (Lk 1,79), und wurden alle in der Menge der Sünde gefesselt gehalten die von Adam gekommen ist. Wie vermag aus einer so verdorbenen Wurzel eine Frucht am dem Baum des Menschengeschlechts zu wachsen? Aber der die Verdorbenheit heilt, kommt ohne Verdorbenheit, und der kommt um von Sünden zu reinigen, kommt ohne Sünde. 2. Betrachtet die Juden nicht so als ob sie Spreu auf jener Tenne wären, die jetzt ausgedroschen ist (vgl. Mt 3,12). Denn, meine Brüder, wenn wir (es recht) bedenken: aus den Juden stammen die Propheten, aus den Juden die Patriarchen, aus den Juden die Apostel, aus den Juden die Jungfrau Maria, die Christus geboren hat, aus den Juden stammt Paulus, der später glaubte und so viele tausend an einem Tag Getaufte (Apg 2,41), aus den Juden stammen unzählige Kirchen der Christen. Aber jenes Getreide werden schon in den Scheunen aufbewahrt – mit der Spreu spielt der Teufel. Juden sind Gläubige und Juden sind Ungläubige. Wo werden sie zuerst verdammt? Beim ersten, beim Vater aller, bei Jakob selbst, der auch Israel genannt wird. Jakob heißt „Betrüger“, Israel heißt „Gott schauend“. Als er mit seinen Kindern zurückkehrte aus Mesopotamien, hat ein Engel mit ihm gerungen (Gen 32,25b–30) – dadurch die persona Christi im Voraus zeigend. Und er hat mit ihm gerungen, obwohl er ihm bei weitem an Kraft überlegen war, tat er so als ob er von ihm besiegt würde und Jakob hatte die Oberhand. So wurde auch der Herr Christus von den Juden besiegt: Sie hatten die Oberhand als sie ihn töteten. Mit großer Kraft ist er besiegt: Wo er besiegt ist, da besiegt er uns. Was heißt das: Wo er besiegt ist, da besiegt er uns? Weil er Blut vergoss, als er litt, dadurch hat er uns erlöst. Auf diese Weise, so steht es geschrieben, gewann Jakob die Oberhand über jenen. Und dennoch hat Jakob
118
Juden in zwei Osterpredigten Augustins
selbst, mit dem gerungen wurde, das Geheimnis erkannt. Es gewann ringend ein Mensch Oberhand über einen Engel, und als jener sagte: „Lass mich gehen“ (Gen 32,37a), sagte der, der die Oberhand hatte: „Ich lasse dich nicht gehen, wenn du mich nicht segnest“ (Gen 32, 27b). O welch großes Geheimnis! Es segnet der Besiegte, es leidet, der befreit, dann wird das alles ein Segen. „Wie heißt du?“ fragte jener. Er antwortete, „Jakob“. „Du wirst nicht mehr Jakob heißen“, sagte er, „sondern wirst Israel genannt werden“ (Gen 32,29). So groß wie die Auflegung des Namens ist der Segen: Israel wird übersetzt, wie ich schon sagte, mit „Gott sehend“: Name des einen, Auszeichnung für alle. Für alle aber: für die Gläubigen und Gesegneten, für die Juden und die Griechen. „Griechen“ nennt der Apostel alle [Heiden]Völker, weil unter den [Heiden]Völkern die griechische Sprache benutzt wird. „Herrlichkeit“ sagt er „und Ehre“ – das sind die Worte des Apostels – „Herrlichkeit und Ehre und Friede allen Menschen, die Gutes tun, den Juden zuerst und den Griechen, Ungnade und Zorn, Trübsal und Angst über alle Seelen, die Böses tun, den Juden zuerst und den Griechen“ (Röm 2,10.8a.9a). Den guten Juden Gutes, den schlechten Schlechtes, den guten Heiden Gutes, den schlechten Schlechtes. 3. Die Juden sollen sich nicht hervortun und sagen: Siehe, dennoch ist Jakob unser Vater, er hat über einen Engel die Oberhand gewonnen und ist von dem Engel gesegnet worden. Wir sagen: Volk Israel, pass auf! Du bist nicht Israel! Du heißt so, aber du bist es nicht. Der Name ist dir fälschlich gegeben, es bleibt Dir das Verbrechen. Nun sagt es [das Volk Israel] zu mir: Siehe Jakob ist mein Vater, siehe Israel ist mein Vater, siehe da ist der Name, wo ist das Verbrechen? Da lies, da finde dich! Denn da ist geschrieben: „Und er schlug Jakob auf die Breite der Hüfte, sie verkürzte sich und er hinkte.“ (Gen 32,26.31, nicht Vulgata) Jakob ist ein Mensch, sowohl gesegnet, als auch hinkend. In welchen gesegnet und in welchen hinkend? Wenn du an Christus glaubst, erkenne dich als gesegnet, wenn du Christus verneinst, erkenne dich als hinkend, denn du gehörst zu denen, von denen der Prophet sagt: „Und sie hinkten auf ihren Pfaden“ (Psalm 17,46b Vulg. / LXX)34. Woher stammten die heiligen Frauen, denen sich der auferstandene Herr als erste zeigte? Waren sie nicht Jüdinnen? Woher stammten die Apostel, die obwohl sie zunächst dem von den Frauen Berichteten nicht glaubten, doch später ihn selbst hörten und ihn als echt erkannten und fest am Meister hingen? Waren sie nicht Juden? Siehe, Israel ist gesegnet! Aber viele aus ihm [dem Volk Israel] hinken, wenige sind gesegnet. Denn das ist die Breite der Hüfte: die Masse des Volkes. Denn dort wird nicht gesagt: die Hüfte, sondern die Breite der Hüfte. Wo
34 Vgl. den inhaltlich und sprachlich parallelen Abschnitt in De civitate Dei XVI, 39 (Anm. 7), 188.
Juden in zwei Osterpredigten Augustins
119
die Breite der Hüfte ist, da ist ohne Zweifel die Menge des Volkes35. Und was ist daran außergewöhnlich? Erkenne die wenigen Körner und wundere dich über den Haufen der Spreu, und siehe, was in die Scheune gehört, was ins Feuer (vgl. Mt 3,12). Und nun sollen sie hören – sie leben immer noch – sie sollen das Hinken beheben, sie sollen zum Segen kommen!
Übersetzung Sermo 229 M (Morin, Guelferbitanus XV) 1. Geliebte, ihr kennt jene Lesungen aus den heiligen Evangelien, den Zeugen der Auferstehung des Herren, die jährlich festlich gefeiert wird. So also erneuert die Lesung die Erinnerung, so erneuert die Auslegung der Lesung die Erinnerung. Mit Gottes Hilfe werden wir also, dies verkündigen, was ihr jedes Jahr zu hören pflegt. Wenn so die Lesung eine Erneuerung des Gedächtnisses ist, die doch auch zu anderer Zeit im Evangelium gelesen werden kann, um wie viel mehr die Predigt, die nur dies eine Mal im Jahr gehört wird? Der Herr erscheint seinen Jüngern nach seiner Auferstehung am See Tiberias und trifft sie wie sie fischen, aber nichts fangen. Bei Nacht fischen sie und fangen nichts. Der Tag bricht an und sie fangen [etwas]. Weil sie [bei] Tag Christus sehen und auf das Wort des Herrn die Netze auswerfen, fangen sie [etwas]. Wir finden zwei Fischzüge, die von den Jüngern Christi ausgeführt werden, im Wort Christi [in den Evangelien]: Den ersten, als er sie erwählt und zu Aposteln macht, den zweiten eben nachdem er von den Toten auferstanden war. Vergleichen wir die beiden, wenn ihr dem zustimmt, und lasst uns aufmerksam darauf achten, was sie unterscheidet. Das wird uns zur Auferbauung unseres Glaubens dienen. Der erste [Fischzug] also, als der Herr die Fischer fand, die er bis dahin noch nicht gefunden hatte. Auch sie hatten in der ganzen Nacht nichts gefangen, sie hatten vergeblich gearbeitet. Er befahl, dass sie die Netze auswerfen sollten. Er sagte nicht: „Zur Rechten“. Er sagte nicht: „Zur Linken“, sondern er sagte: „Werft die Netzte aus“ (Lk 5,4). Sie warfen sie aus… und sie luden zwei Boote voll, so dass sie beinahe durch die Menge der Fische untergegangen wären, ferner war die Menge der Fische so groß, dass die Netze rissen (Lk 5,6). So verhielt es sich mit jenem Fischzug. Was ist nun mit diesem? Er sagte: „Werft die Netze auf der rechten Seite aus“ (Joh 21,6). Vor der Auferstehung warfen sie die Netzt nach allen Seiten aus. Nach der Auferstehung wird die rechte Seite ausgewählt. Ferner wurden beim ersten Fischzug die Boote [von der Last] hinunter gedrückt (Lk 5,7) und die Netze rissen. Bei diesem neuerlichen [Fischzug] nach der Auferstehung wurden weder das Schiff hinunter gedrückt, noch riss das Schleppnetz. Beim ersten Fischzug wird nichts über die Anzahl der Fische gesagt, bei diesem nach der Auferstehung 35 So formuliert Augustinus auch in De civitate Dei XVI, 39 (Anm. 7), 188.
120
Juden in zwei Osterpredigten Augustins
wird die Zahl der Fische präzise genannt. Verlassen wir also den ersten, um zum neuen zu kommen. Was habe ich gesagt? Lasst uns den ersten verlassen? Achtet auf die Netze! Netze des Wortes, Netze der Verkündigung. Achtet auf die Netze! Es sagt der Psalm: „Ich habe verkündigt und ich habe geredet, und sie sind über die Zahl vermehrt worden“ (Ps 40,6 Vulg.). Es ist klar, auf welche Weise das geschieht: Es wird das Evangelium verkündigt und die Christen werden über die Zahl vermehrt. Wenn sie alle gut lebten, würde das Schiff nicht hinunter gedrückt, wenn die Häresien und Schismata nicht teilten, würde das Netz nicht reißen. Warum gab es aber zwei Schiffe beim ersten Fischzug? Erinnert euch, Brüder, diese sind jene zwei Zäune: Vorhaut und Beschneidung, die in dem Eckstein [sc. Christus, Mt 21,42 par.] zusammenkommen und den Friedenskuss finden (vgl. Eph 2,14–17). Aber im neuen Fischzug ist perfekte Einheit, er ist recht, er hat nichts Linkes an sich [Wortspiel mit dexteram und sinistram]. Dies ist die heilige Kirche, die bloß aus Wenigen besteht, die unter vielen schlechten [Menschen] arbeiten. Diese wird jene bestimmte und präzise Zahl haben, in der kein einziger Sünder gefunden wird. Sie ist recht und hat nichts Linkes an sich. Und groß werden die Fische sein! Weil sie alle unsterblich sein werden, werden alle ohne Ende siegreich sein. Denn was ist größer als das, was kein Ende hat? Und durch die Rückbesinnung auf den Evangelisten erneuerst du deine Erinnerung an den ersten Fischzug. Hat er nicht hinzugesetzt: „und obwohl die Fische so groß waren, rissen die Netze nicht?“ (Joh 21,11 nicht Vulg.), als ob er sagen wollte, erinnert euch an den ersten Fischzug, bei dem die Netze gerissen sind? Dies wird das Himmelreich sein: Kein Häretiker wird zanken, kein Schismatiker wird sich absondern, alle, die darin sind, werden in Frieden leben. 2. Alle? Aber wie viele werden das sein? Werden es 153 sein? Gott bewahre! Gott bewahre uns davor, dass ich sage, dass sowohl in dem Volk, das hier vor mir steht, so wenige sind, als auch im kommenden Himmelreich, wo Tausende, unzählbar viele Tausende sein werden, die mit weißen Gewändern angetan sein werden, wie es Johannes gesehen hat. Er sagt: „aus allen Völkern und Sprachen kamen sie, eine Zahl, die niemand zählen konnte“ (Offb 7,9 nicht Vulg.). Was will er also mit jener Zahl [153]? Die einen belehre ich, die anderen ermahne ich. Die nicht hören, mögen lernen, die hören und ganz erfüllt sind, mögen es noch einmal bedenken, die es im Gedächtnis behalten, was sie gehört haben, werden durch mein Erinnern gefestigt! Das Verständnis dieser Zahl beginnt mit „Zehn“ und „Sieben“. Es ist ein Zeichen für alle Heiligen, für alle Gläubigen, für alle Gerechten im kommenden Himmelreich. „Zehn“ und „Sieben“: Die „Zehn“ wegen des Gesetzes, die „Sieben“ wegen der Gnade des Geistes. Erlege das Gesetz [ jemandem] auf – niemand tut es, niemand erfüllt es. Füge die Hilfe des Geistes dazu und es geschieht das, was geboten wurde, weil Gott Beistand leistet. Was sagt das Gesetz? „Du sollst nicht
Juden in zwei Osterpredigten Augustins
121
begehren“ (Ex 20,17; Röm 7,7). „Die Sünde nahm das Gebot zum Anlass und betrog mich“ (Röm 7,11 fast komplett Vulgata) sagte er „und dadurch tötete sie mich.“ Und „das Gesetz ist zwischenhineingekommen, damit das Fehlverhalten im Überfluss hervortritt“ (Röm 5,20). Füge den Geist hinzu: „Die Liebe ist des Gesetzes Erfüllung“ (Röm 13,10 nicht Vulg.). Aber woher kommt die Liebe? „Die Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist“ (Röm 5,5b Vulg.). Denn, wer liest, weiß, dass der Geist siebenfach zu preisen ist. Es höre aber, wer unaufmerksam liest, und besonders, wer nicht lesen kann. So preist Gott den Heiligen Geist durch den Propheten Jesaja: „Der Geist“ sagt er „der Weisheit und des Verstandes, des Rates und der Stärke, der Kenntnis und der Frömmigkeit, der Geist der Ehrfurcht vor Gott“ (Jes 11,2–3 i. A.). Das ist der siebenfältige Geist, der über den Getauften angerufen wird. Das Gesetz, das ist der Dekalog. Zehn Gebote, die auf Tafeln geschrieben waren, aber auf steinernen, wegen der Härte der Juden. Nachdem der Geist gegeben wurde, was sagt der Apostel da? „Ihr seid unser Brief geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinernen Tafeln, sondern auf den fleischernen Tafeln des Herzens“ (2. Kor 3,3 Vulg.). Nimm den Geist weg – und der Buchstabe tötet, denn er macht den Sünder zum Angeklagten, und befreit ihn nicht. Deswegen sagt der Apostel: „Es ist nicht so,“ sagt er „dass wir dazu hinreichend in der Lage sind, etwas selbst – sozusagen aus uns selbst – zu erkennen. Es ist vielmehr so, dass unser Geeignetsein von Gott kommt. Er versetzt uns in die Lage, Diener des neuen Bundes zu sein: Nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig“ (2. Kor 3,5–6 zumeist Vulg.). Füge also „Sieben“ zu den „Zehn“ hinzu, wenn Du die Gerechtigkeit erfüllen willst. Wenn dir vom Gesetz befohlen wird, irgendetwas zu tun, bitte den Geist, dass er [dir] helfe. 3. Wir haben die „Siebzehn“ gepriesen: Aber wie weit sind wir [noch] von 153 entfernt! Dennoch wissen viele, was ich sagen will. Die [es] wissen, mögen eine Pause einlegen. Wenn zwei auf einem Wege gehen, der eine schnell, der andere langsam, steht es in der Macht des Schnellen, dass sie zusammengehen, wenn er auf jenen wartet. Also ist der, der weiß, was ich sagen werde, schnell, er warte aber auf seinen langsamen Begleiter, so lange bis der darüber unterrichtet ist, was es mit der „Zehn“ und der „Sieben“ auf sich hat. Es ergeben sich 153, wenn die „Siebzehn“ so zusammengezählt werden, dass du bei eins anfängst und alle [Zahlen] addierst bis du zur siebzehn gekommen bist. Wenn du nun anfängst zu sagen: „Eins, Zwei, Drei, Vier“ und bis zur „Zehn“ kommst, wirst du in deiner Hand nichts anderes als „Zehn“ finden. Wenn du aber so zählst: „Eins plus Zwei sind es schon Drei. Plus Drei sind schon sechs. Plus Vier sind schon zehn. Plus Fünf sind schon fünfzehn. Plus Sechs sind schon
122
Juden in zwei Osterpredigten Augustins
Einundzwanzig. Plus Sieben sind schon Achtundzwanzig. Plus Acht sind schon Sechsunddreißig. Plus Neun sind schon Fünfundvierzig. Plus Zehn sind schon Fünfundfünfzig.“ Siehst Du? Wir sind schon nahe dran und haben die Hoffnung ans Ziel zu gelangen, weil wir uns so schnell nähern. Füge also Elf hinzu es werden Sechsundsechzig. Füge Zwölf hinzu und es werden Achtundsiebzig. Füge Dreizehn hinzu und es werden Einundneunzig. Füge Vierzehn hinzu und es werden Einhundertfünf. Und schon folgen die Langsamen den Schnellen. Füge also Fünfzehn hinzu und es werden Einhundertzwanzig. Füge Sechzehn hinzu und es werden Einhundertsechsunddreißig. Füge Siebzehn hinzu und es werden Einhundertdreiundfünfzig. Das sind alle, die zur „Siebzehn“ gelaufen sind, die das Gesetz Gottes tun, mit dem Beistand des Geistes Gottes.
Literatur Ernst Bammel, Die Zeugen des Christentums, in: Herbert Frohnhofen [Hg.], Christlicher Antijudaismus und jüdischer Antipaganismus, Hamburg 1990, 170–180, wiederabgedruckt in: Ernst Bammel, Judaica et Paulina. Kleine Schriften II (WUNT 91), Tübingen 1997, 96–106. Wessel Hendrik ten Boom, Provocatie. Augustinus’ preek tegen de Joden, theologisch essay, Kampen 2006. Bernhard Blumenkranz, Die Judenpredigt Augustins. Ein Beitrag zur Geschichte der jüdisch-christlichen Beziehungen in den ersten Jahrhunderten (Basler Beiträge zur Geschichtswissenschaft 25), Basel 1946. Ders., Die Juden als Zeugen der Kirche, in: Theologische Zeitschrift 5 (1949), 396–398. Ders., Augustin et les juifs – Augustin et le judaïsme, in Recherches Augustiniennes 1 (1958), 224–241. Volker Henning Drecoll, Die Entstehung der Gnadenlehre Augustins (BHTh 109), Tübingen 1999. Hubertus R. Drobner (Hg.), Augustinus von Hippo. Predigten zum österlichen Triduum (Sermones 218–229 D), Einleitung, Text, Übersetzung und Anmerkungen (Patrologia 16), Frankfurt am Main u. a. 2006. Anthony Dupont (Hg.), Tractatio scripturarum. Philological, exegetical, rhetorical and theological studies on Augustine’s sermons (Ministerium Sermonis II = Instrumenta patristica et mediaevalia 65), Turnhout 2012. Ralph Hennings, Der Briefwechsel zwischen Augustinus und Hieronymus und ihr Streit um den Kanon des Alten Testaments und die Auslegung von Gal 2,11–14 (SVigChr 21), Leiden 1994. Adalbert Kunzelmann, Die Chronologie der Sermones des Hl. Augustinus, in: Miscellanea Augustiniana II, Rom 1931. Joost van Neer, Language and scripture as structuring principles of Augustine’s „Sermones“ 186 and 187, in: Augustiniana 63 (2013), 189–22.
Literatur
123
Gert Partoens (Hg.), Ministerium sermonis. Philological, historical, and theological studies on Augustine’s Sermones ad populum (Instrumenta patristica et mediaevalia 53), Turnhout 2009. Thomas Raveaux, Augustin und die Juden, in: Volker Henning Drecoll (Hg.), Augustin Handbuch, Tübingen 2007, 212–218. Ders,, Adversus Judaeos – Antisemitismus bei Augustinus? In: Signum Pietatis FS C. P. Mayer OSA, hg. v. Adolar Zumkeller, Würzburg 1989, 37–51. Marcel Simon, Verus Israel. Étude sur les relations entre chrétiens et juifs dans l’Empire Romain, Paris 1983 Nachdr. d. 2.Aufl. (Erstausgabe 1948).
Eusebius von Emesa und die Juden
Einleitung Eusebius von Emesa (*ca. 300 in Edessa †ca. 359) ist in den letzten Jahren zunehmend zu einem Gegenstand des wissenschaftlichen Interesses geworden. Dazu hat vor allem die Edition neuer Texte aus seiner Feder beigetragen. Neben den lateinisch erhaltenen Predigten1, sind es in den letzten Jahren die fortschreitende Edition der Katenen und der Übersetzung ins Armenische gewesen, die der Forschung neue Impulse gegeben haben. Richard Hanson2 und Maurice Wiles3 haben daraufhin die Rolle des Eusebius von Emesa im arianischen Streit beleuchtet. Françoise Petit4, Adam Kamesar5, Lucas van Rompay6 und Robert Barend ter Haar Romeny7 haben sich intensiv mit den exegetischen Schriften des 1 Eusèbe d’Émèse, Discours conservés en latin, hg. v. Éloi Marie Buytaert (SSL 26+27), Louvain 1953 u. 1957. Nach dieser Ausgabe werden die lateinischen Predigten zitiert. Dabei werden die fortlaufenden Nummern der Predigten mit lateinischen Ziffern angegeben z. B.: hom. XI 1; Band, Seite und Zeile in Klammern z. B.: (I 222,2) oder (II 111,1). 2 Richard P.C. Hanson, The Search for the Christian Doctrine of God. The Arian Controversy 318–381, Edinburgh 1988, 387–398. 3 Maurice F. Wiles, The Theology of Eusebius of Emesa (StPatr 19), Leuven 1989, 267–280. 4 Françoise Petit (Hg.), Catenae Graeca in Genesim et in Exodum 1. Catena Sinaitica (CChrSG 2), Turnhout 1977; Dies.: Catenae Graeca in Genesim et in Exodum 2. Collection Coisliniana in Genesim (CChr.SG 15), Turnhout 1986; Dies.: La Chaîne sur la Genèse. Édition Intégrale (TEG 1–4), Leuven 1991–96; Dies.: Les fragments grecs d’Eusèbe d’Émèse et de Théodore de Mopsueste: l’apport de Procope de Gaza, in: Le Museon 104, 1991, 349–354. 5 Adam Kamesar, Jerome, Greek Scholarship, and the Hebrew Bible. A Study of the Quaestiones Hebraicae in Genesim, Oxford Classical Monographs, Oxford 1993. Kamesar setzt sich ständig mit der exegetischen Arbeit des Eusebius von Emesa auseinander. 6 Lucas van Rompay, Antiochene Biblical Interpretation: Greek and Syriac, in: The Book of Genesis in Jewish and Oriental Christian Interpretation. A Collection of Essays, ed. by Judith Frishman / Lucas van Rompay (TEG 5), Leuven 1997, 103–123. 7 Robert Barend ter Haar Romeny, A Syrian in Greek Dress. The Use of Greek, Hebrew, and Syriac Biblical Texts in Eusebius of Emesa’s Commentary on Genesis (TEG 6), Leuven 1997; und Ders., Eusebius of Emesa’s Commentary on Genesis and the Origins of the Antiochene School, in: The Book of Genesis in Jewish and Oriental Christian Interpretation (Anm. 6), 125–142.
126
Eusebius von Emesa und die Juden
Eusebius auseinandergesetzt, vor allem mit dem fragmentarisch erhaltenen Genesiskommentar. Dabei zeigt die neue Arbeit von ter Haar Romeny „A Syrian in Greek Dress“ in eindrucksvoller Weise, wie stark Eusebius an jüdischen exegtischen Traditionen interessiert ist. Er zieht allein in den bekannten Fragmenten seines Genesiskommentars 55 Mal hebräische Traditionen zur Erklärung des Bibeltextes heran8. Trotz dieser beeindruckenden Anzahl von ausdrücklichen Verweisen auf οἱ Ἑβραῖοι denen Eusebius seine Informationen verdankt, blieb die Stellung des Eusebius zu den Juden bisher in der Forschung unbeachtet. Das mag damit zusammenhängen, daß in den letzten Jahren vor allem philologisch an den Bibelkommentaren gearbeitet wurde. Um seine Stellung zu den Juden zu erkennen, ist es aber notwendig, alle erhaltenen Schriften heranzuziehen. Dabei zeigt sich, daß Eusebius sich in den exegetischen Schriften im engeren Sinne9 weitgehend der Stellungnahme enthält. Dort geht es ihm um die Erhellung des Sinnes der biblischen Texte. Aus dem Genesiskommentar läßt sich nicht erkennen, wie Eusebius sich zu den Juden verhält, von denen er seine exegetischen Informationen erhält. Darin unterscheidet er sich von anderen spätantiken Bibelauslegern, die ebenfalls die hebräische Bibel und ihre jüdischen Auslegungen kennen und benutzen. So läßt zum Beispiel Hieronymus in seinen bibelwissenschaftlichen Schriften keinen Zweifel an seinem Antijudaismus. Er schreibt zum Thema Sabbatruhe in der Auslegung von Gen 2,2 (LXX): „Und am sechsten Tag vollendete Gott seine Werke, die er gemacht hatte. Im Hebräischen steht ‚am siebenten Tag‘ statt ‚am sechsten Tag‘. Damit werden wir die Juden unter Druck setzen, die mit der Sabbatruhe prahlen“10, während Eusebius zum Thema Sabbatruhe in seiner Auslegung von Gen 3,21 nur vermerkt: „Juden sagen: Selbst wenn er am siebten Tage geruht hat, machte er etwas an ihm“ (nämlich die Kleidung für Adam und Eva). Beide Äußerungen lassen erkennen, daß es eine jüdisch-christliche Debatte um die Sabbatruhe gab11 auf die sich beide Autoren beziehen, aber der Unterschied im Ton ist unüberhörbar. Bei Hieronymus springt die polemische Verwendung seiner Kenntnisse sofort ins Auge. Das ist im Kommentar des Eusebius nur auf den zweiten oder dritten Blick zu erkennen. Erst in der „angewandten“ Exegese, den Predigten des Eusebius, wird deutlich, daß das exegetische Wissen, das er aus dem hebräischen Text oder von jüdischen
8 ter Haar Romeny, A Syrian in Grek Dress (Anm. 7), 51. 9 van Rompay, Antiochene Biblical Interpretation (Anm. 6), 107f. Er unterscheidet mit Geza Vermes zwischen „reiner“ und „angewandter“ Exegese. Die Kommentare zählen demnach zur „reinen“, die Predigten zur „angewandten“ Exegese. 10 Hieronymus, Quaestiones in Genesim 2,2, PL 23, 940A. Übersetzung R.H. 11 Vgl. bereits den Barnabasbrief, 15,1–8, hg. v. Klaus Wengst (SUC 2), 180–182.
Eusebius von Emesa und die Juden
127
Informanten hat, ihn keineswegs zu einem „Philosemiten“ macht12. Das zeigt sich bereits an den vielen antijüdischen Redewendungen, die in seine Predigten eingeflochten sind (siehe Anhang). Dabei scheint Eusebius von Emesa seinem Lehrer Eusebius von Caesarea zu folgen13, der sich ebenfalls intensiv um die Erklärung der Bibel mit Hilfe des hebräischen Textes und jüdischer Traditionen bemühte, aber auch kräftig gegen die Juden polemisieren konnte14. Auch die Haltung des Eusebius von Emesa zum Judentum war janusköpfig. Auf der einen Seite zieht er häufig den hebräischen Text des Alten Testaments und jüdische Auslegungstraditionen zur Bibelerklärung heran, auf der anderen Seite streitet er in seinen Predigten vehement gegen die Juden. Es soll eine eigene Schrift gegen die Juden des Eusebius von Emesa gegeben haben: Hieronymus erwähnt diese Schrift in De viribus illustribus15 und Ebedjesu nennt in seiner Notiz über Eusebius ebenfalls eine Schrift gegen die Juden16. Diese Schrift ist nicht erhalten. Seine ins Lateinische übersetzen und so bewahrten Predigten zeigen aber zur Genüge, in welche Richtung seine Schrift gegen die Juden gezielt haben muß.
12 Zum Begriff Philososemitismus siehe Wolfram Kinzig, Philosemitismus, in: ZKG 105 (1994), 202–228; 362–383. 13 Vgl. das Resümee von Hanson, The Search (Anm. 2), 398: „Any Origenist ideas he may have derived from his master, Eusebius of Caesarea, whose faithful disciple he is in most (but not in all) things, and not least in his careful attention to the text of scripture and in his knowledge of Hebrew. He is even more sober and cautious than Eusebius of Caesarea in using allegory.“ Zu Eusebius von Caesarea vgl. Eusebius, Christianity, and Judaism, ed. by Harold William Attridge / Ghei Hata (StPB 42), Leiden 1992 und Jörg Ulrich, Euseb von Caesarea und die Juden (PTS 49), Berlin 1999. 14 Vgl. die Beschreibung für das Vorgehen des Eusebius von Caesarea, die sich an diesem Punkt auf Eusebius von Emesa übertragen lässt; Michael J. Hollerich, Eusebius as a Polemical Interpreter of Scripture, in: Eusebius, Christianity and Judaism (Anm. 13), 589: „Here is the double commitment to scholarship and apologetics […] Eusebius was convinced that the events of history were the best demonstration of the truth of Christianity, if it could be shown, to the satisfaction of both Jews and Gentiles that the Hebrew Scriptures accurately foresaw the origin and spread of Christianity.“ 15 Hieronymus, De viris inlustribus, hg. v. Carl Albrecht Bernoulli (SQS 11), Freiburg 1895, Nachdr. Frankfurt 1968, Nr. 91: Eusebius Emesenus, elegantis et rhetorici ingenii innumerabilis et qui ad plausum populi pertineant confecit libros, magisque historiam secutus. Ab his qui declamare volunt, studiosissime legitur, e quibus vel praecipui sunt adversum Iudeos et gentes et Novatianos, et ad Galatas libri decem et in evangelii homiliae breves, sed plurimae. Floruit temporibus Constantii imperatoris, sub quo et mortuus Antiochiae sepultus est. 16 Zitat bei Éloi Marie Buytaert, L’Héritage littéraire d’Éusèbe d’Émèse (BMus 24), Louvain, 1949, 38.
128
Eusebius von Emesa und die Juden
Die Genese der Beziehungen des Eusebius zu den Juden Zur Kenntnis des Judentums hat schon die Herkunft des Eusebius von Emesa beigetragen. In Edessa, der Heimatstadt des Eusebius, haben über Jahrhunderte hinweg Juden und Christen in ihren unterschiedlichen Strömungen neben- und miteinander gelebt17. Das Christentum in Edessa verdankt seine Ursprünge einer starken jüdischen Gemeinde18. Im 2. und 3. Jahrhundert ist allerdings die Mehrheit der edessenischen Christen laut Drijvers – der hier Bauer folgt –, „gnostischen, semignostischen und enkratitischen Gruppierungen“ zuzurechnen, für die der Kontakt zum Judentum – vor allem wegen der Ablehnung des Alten Testaments – nur eine marginale Rolle spielte. Nur die christliche Gruppe, aus denen später die „orthodoxe“ Kirche Edessas hervorging, war an einem Gespräch mit dem Judentum interessiert. Sie hielten an der Hebräischen Bibel als integralem Teil der Offenbarung fest und waren deshalb auf die exegetische Kompetenz jüdischer Gelehrten angewiesen19. Aus dieser Gruppe stammten die Familie und die christlichen Lehrer des Eusebius. Ein späterer Zeuge für die Entwicklung in Edessa ist Ephraem
17 Hendrik Jan Willem Drijvers, Cults and Beliefs at Edessa (EPRO 82), Leiden 1980, 7: „Especially during the first centuries A.D. paganism, Judaism and Christianity in all their different forms coexisted side by side at Edessa sharing with each other a common culture and the means that culture provides to express various religious conceptions.“ Vielleicht ist die Herkunft aus Edessa auch der Grund für die anfängliche Ablehnung des Eusebius als Bischof in Emesa. Dort wurde er als Anhänger der Astrologie denunziert. In seiner Heimatstadt gab es starke astrologische Kulte. Vor allem der in Edessa gepflegte Kult von Azizos und Momimos scheint ebenfalls in Emesa bekannt gewesen zu sein, zumindest gibt es inschriftliche Belege für die Verwendung dieser Namen. Zu diesem Kult und seiner Verbreitung ebd., 146–174. Zur Bewertung der paganen Religiosität Edessas vgl. ebd., 176: „The strong appeal of astrology […] is attested by several sources“. 18 Hendrik Jan Willem Drijvers, Jews and Christians at Edessa, in: JJS 36 (1985), 88–102, hier 90: „local Christianity is labelled Jewish Christianity, since its first missionaries and adherents were Jews, who gave Edessene Christendom is typical semitic flavour and coleur locale untouched by hellenism.“ 19 Drijvers, Jews and Christians (Anm. 18), 96: „Second and third century Christianity at Edessa was dominated by Marcionits, Bardaisanites and adherents of an encratic form of Christian belief of which Tatian was an exponent … until the end of the third century C.E. the larger part of Edessene Christianity shows no substantial influence on the past of, or close contacts with, the Jewish section of the population with the exception of that small groups which was to become Edessa’s orthodox church in later times and was probably called after Palut. They were obliged to enter into discussion with the Jews because they retained the Jewish Bible as part of the whole revelation. But most of Edessa’s Christianity is clearly of pagan origins and consists in vast majority of semignostic, gnostic and encratite groups which show no great interest in the religion of their Jewish fellow-citizens, or clear traces of Jewish impact“ und ebd., 97: „It seems very likely that association with, and influence by, the Jewish population of Edessa increased together with the growing status of these Christians who were to become Edessa’s orthodox during the fourth century. During that period the Jewish impact on, and tensions with, at least that part of the Christians strengthened.“
Eusebius von Emesa und die Juden
129
der Syrer in dessen Schriften sich ebenfalls das spannungsreiche Zusammenleben von „orthodoxen“ Christen und Juden spiegelt20. Im weiteren Lebenslauf des Eusebius ist in den Jahren vor 330 Caesarea die nächste wesentliche Station. Als Schüler des Eusebius von Caesarea und des Patrophilus von Scythopolis hat er dort die Beziehungen zwischen Christen und Juden in der Metropole Palästinas kennengelernt21. In Caesarea benutzte er auch die Bibliothek und gewann wichtige Grundlagen für seine exegetische und homiletische Arbeit. Um 330 war Eusebius in Antiochia und gewann Einblicke in die zersplitterte konfessionelle Lage der Stadt. Um 333 reiste Eusebius nach Alexandria. Dort wurde er intensiv mit der alexandrinischen Theologie und Auslegungstechnik konfrontiert, die ihm bereits durch Eusebius von Caesarea nahegebracht worden war. Für seine Stellung zum Judentum hatte aber dann die Nachbarschaft seiner Bischofsstadt Emesa (heute Homs in Syrien) zu Antiochia die größte Bedeutung. Die dortige jüdische Gemeinde war groß und einflußreich. Aus den Schriften des Johannes Chrysostomus wissen wir, daß die Synagoge von Antiochia noch ein halbes Jahrhundert später große Anziehungskraft auf Christen hatte. Eusebius war gern gesehener Gast in Antiochia und einige seiner Predigten sind dort gehalten worden. Er mußte sich also mit der antiochenischen Situation auch in Bezug auf das Gegenüber von Juden und Christen auseinandersetzen. Seit ca. 341 ist Eusebius Nachfolger des Anatolius von Emesa, weil er es abgelehnt hatte als Gegenbischof Nachfolger des verbannten Athanasius in Alexandria zu werden. Stattdessen wurde er zum Bischof der Provinzstadt im Dunstkreis Antiochas. Wegen seiner Redekunst berühmt, wurde er nicht nur in Antiochia, sondern auch in Beirut und Jerusalem gebeten zu predigen. In Antiochia ist Eusebius um 359 gestorben, nachdem er noch Kaiser Konstantius auf einem Feldzug gegen die Perser begleitet hatte22.
20 Drijvers, Jews and Christians (Anm. 18), 101: „The simple existence of Jews and their synagogue, where even Christians attended the feasts and went to pray, was a real threat to Edessa’s orthodoxy, because it could neither exist without the Jews nor together with the Jews. The real debate of the early church was with the Jews and not with the Gentiles and of that debate Ephrem Syrus is a first-class witness.“ 21 Zu den christlich-jüdischen Beziehungen in Caesarea vgl. Ulrich, Euseb (Anm. 13), 10–27. Vgl. auch Günter Stemberger, Juden und Christen im Heiligen Land, München 1987, 218 über die rabbinische Schule von Caesarea. 22 Die Angaben zur Biographie des Eusebius verdanken sich im Wesentlichen dem Enkomium des Georgius von Laodicea, auf den sich die späteren Kirchenhistoriker berufen. Die biographischen Angaben folgen hier Buytarert, L’héritage (Anm. 16), 61–96.
130
Eusebius von Emesa und die Juden
Die Rolle der Juden in der Theologie des Eusebius Eusebius vertritt ein heilsgeschichtliches Modell, in dem es einen klaren Übergang der Erwählung von den Juden zur Kirche gibt23. Die Juden sind verworfen24. Das Volk Gottes sind jetzt ausschließlich die Christen. Mit Hilfe des Bildes von Hirte und Herde vollzieht Eusebius eine klare Scheidung. Juden und Christen können nicht zusammen geweidet werden: iam non erat possibile his, qui crediderant Christo, apud Iudaeam pasci25. Aufgrund des Verhaltens der Juden – hier ist für Eusebius die theologische Spitze des traditionellen Gottesmordvorwufes26 – mußten die Heidenchristen von ihnen getrennt werden. Er hält aber daran fest, daß Jesu Sendung ursprünglich die Rettung des Volkes Israel beinhaltete27. Eusebius scheint dabei terminologisch nicht zwischen Hebräern und Juden zu unterscheiden, wie es Eusebius von Caesarea mit einer heilgeschichtlichen Begründung tut28. Eusebius von Emesa benutzt beide Begriffe ohne erkennbare Differenzierung. Im Genesiskommentar bezeichnet er zum Beispiel jüdische Informanten sowohl als Ἑβραῖοι29 als auch als ι᾿ουδαῖοι30. In den lateinisch erhaltenen Predigten findet sich der Begriff hebraeus nur in alttestamentlichen Zitaten, ansonsten wird durchgängig judaeus verwendet31. Obwohl viele Juden in der apostolischen Zeit zum Glauben an Christus gekommen sind32, ist für Eusebius jetzt kein eigenständiges Judenchristentum mehr möglich. Die Strafe für die Verwerfung Christi trifft alle Juden33. Deshalb nimmt die Kirche keine Juden auf 34. Sie müssen, ebenso wie die Heiden, ihre „väterlichen Gebräuche“ – das heißt für sie das Zeremonialgesetz – aufgeben35. 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34
Eusebius, hom. XI 1 (I 256,6f.): Si igitur iuste eiecti sunt Iudaei, iuste vero nos vocati sumus. Eusebius, hom. XI 1 (I 256,3f.): Iudaei […] qui abiecti sunt. Eusebius, hom. XXIX 17 (II 228,22f.). Eusebius, hom. XVIII 35 (II 31,18f.): Et quem interfecerunt Iudaei et distraxerunt, istam adorant gentes dum pascuntur. Eusebius betont das ausdrücklich in hom. XI 22 (II 271,16). Dazu jetzt ausführlich: Ulrich, Euseb (Anm. 13) , 57–110. ter Haar Romeny, A Syrian in Greek Dress (Anm. 7) , 211, Fragment IX zu Gen 3,21. ter Haar Romeny, A Syrian in Greek Dress (Anm. 7), 352,5, Fragment XLIV zu Gen 25,31. Eine Ausnahme scheint die Übernahme der Bezeichnung „Philo, der Hebräer“ zu sein, ebd. 184,5, Fragment IV zu Gen 2,6. Diese ehrenhafte Verwendung des Begriffs „Hebräer“ überrnimmt Eusebius von Emesa von Eusebius von Caesarea. Vgl. dazu Ulrich, Euseb (Anm. 13), 66 u. 88– 100. Nicht einmal in der Predigt über Mose (hom. XII) wird dieser als Hebraeus bezeichnet. Eusebius, hom. XI,22 (I 271,23): ex Iudaeis multi fideles facti sunt. Eusebius, hom. XIV,4 (I 324,16f.): Iudaei vero non suscipiunt. Incredulitas illorum, nobis bonam salutem procuravit. Eusebius, hom. II,4 (I 46,26f.): Denique at Iudaeis ideo non patet ecclesia, quia non paenitent. Damit unterscheidet sich Eusebius von Emesa deutlich von der Haltung, die Ulrich für Eusebius von Caesarea herausgearbeitet hat; Euseb (Anm. 13), 45: „die Heilstat Gottes in
Eusebius von Emesa und die Juden
131
Für das heilsgeschichtliche Denken des Eusebius von Emesa spielen zwei nachbiblische Ereignisse eine große Rolle. Zum einen die Zerstörung des Tempels in Jerusalem und die Vertreibung der Juden in die Diaspora, zum anderen die konstantinische Wende, deren Zeitzeuge Eusebius ist. Dieser Sieg des Christentums hat in seiner Sicht Konsequenzen für Juden, Christen und Heiden. Die Vertreibung der Juden und die Zerstörung des Tempels stehen für Eusebius in einen klaren Kausalzusammenhang mit der Tötung Jesu, für die er den Juden die Schuld gibt. In drei Predigten beschäftigt er sich ausführlich mit der Rolle der Juden in der Heilsgeschichte und dem aktuellen Verhältnis von Christen und Juden.
Die Predigt über den Feigenbaum In der Predigt XI „Über den Feigenbaum“ setzt sich Eusebius mit der Frage nach der „Schuldfähigkeit“ der Juden auseinander. Er lehnt die allegorische Interpretation von Mt 21,18–21 ab, die andere ihm bekannte Auslegungen verwenden36. Diese Auslegungen verstehen den Feigenbaum als Sinnbild für die Stadt Jerusalem und damit pars pro toto für das Volk der Juden. Das eröffnet, ungewollt, die Möglichkeit die Schuld am Tod Jesu ihm selbst zuzuschieben. Denn so verstanden hätte Jesus die Juden verflucht, die nun nicht anders als dem göttlichen Fluch gemäß handeln konnten37. Um dieser Konsequenz der Allegorie auszuweichen, interpretiert Eusebius das Gleichnis ausdrücklich nicht allegorisch38. Die Verfluchung des Feigenbaumes gerät in seiner Interpretation zu einem
35 36
37 38
Christus, angekündigt in den heiligen Schriften der Juden, gilt seiner Überzeugung nach prinzipiell allen, Juden wie Heiden. Gerade wegen dieser theologischen Grundentscheidung ist es Euseb nun aber verwehrt, in den Fragen der ‚göttlichen Ökonomie des Guten‘ irgendwelchen exkludierenden Modellen das Wort zu reden.“ Eusebius, hom. XIX 34 (II 72,12–17). Eusebius setzt sich kritisch mit der ihm bekannten Auslegungstradition auseinander: hom. XI 4 (I 257,17–22): Sed veniamus ad ficum et hos sermones in alio differamus tempore. Multi enim sermones de fici ista arbore et dicti et scripti sunt, multis per conscriptionem scilicet patrum verbis; quaeque exponemus et, quae ipsi sentiamus, addemus, non ut in lite vincamus, sed ut interrogationem probemus et illa fuerint bona commune lucrum. Die Hochschätzung der Vorgänger nötigt ihn dann doch zu der Schlußbemerkung; Pr. XI 29 (I 275,19–21): Completus est igitur sermo de ficu, non cum contentione cum patribus, qui ante nos fuere, sed cum interrogatione fratris cum fratribus. Eusebius, hom. XI 7 (I 260,22f.): Ideo non suscipimus ficum esse Hierosolymam, ut non Iudaeos quidem excusemus, Dominum vero accusemus. Eusebius nimmt an dieser Stelle ausführlich zur allegorischen Auslegung Stellung. Diese Passage ist deshalb bereits mehrmals als Beweisstück für seine Zugehörigkeit zur älteren antiochenischen Schule verwendet worden (s. dazu unten Anm. 75). Er lehnt die Allegorie nicht kategorisch ab, empfiehlt aber eine sparsame Verwendung; Eusebius, hom. XI 4 (I 258,3–5): Siquidem allegoriae aures delectare consuerint (…) Sed non omnes allegorias ei-
132
Eusebius von Emesa und die Juden
Machterweis Jesu, der den Jüngern demonstrieren soll, daß Jesus seiner Passion nicht ausgeliefert wird, sondern Handelnder bleibt39. Seine Auslegung ist eingebettet in das heilsgeschichtliche Konzept der Verwerfung Israels. Die Juden sind voll schuldfähig. Es ist allein ihre Schlechtigkeit (maligna) die den Tod Jesu herbeiführt. Dabei hält Eusebius deutlich fest, daß hier nicht Gott gegen die Juden handelt. Im Gegenteil, er will ihr Heil, aber sie nehmen es nicht an: Sie verwerfen Jesus auf eigene Gefahr. Gott treibt sie nicht dazu an, er hindert sie aber auch nicht40. Er schließt seinen Gedankengang zur Auslegung des Gleichnisses mit folgendem Resümee ab: Er [Jesus] tat deshalb vor seiner Passion ein Zeichen an dem Feigenbaum, um zu zeigen, daß er nach eigenem Willen preisgegeben wurde und nach eigenem Willen ans Kreuz geschlagen wurde. Dadurch gab er den Jüngern Zuversicht, überführte die Juden und festigte unseren Glauben.41
Damit ist für Eusebius das „Recht so!“ begründet, das an den Stellen zu hören ist, an denen er die Zerstörung Jerusalems und die Zerstreuung der Juden als Konsequenz der Tötung Jesu beschreibt42. Der Untergang des Tempelkultes in
39
40
41 42
cimus, neque iterum omnes suscipimus. und hom. XI 5 (I 258,20f.): Non omnem ergo allegoriam eicimus neque omnem suscipimus, sed eam de qua dicta testatur. Der Abschnitt hom. XI 5 beschreibt seine Vorgehensweise im Detail. Eusebius bevorzugt „natürliche Lösungen“ für Auslegungsprobleme. Allegorie ist für ihn eine Ausflucht. In hom. XI 8 (I 261,9– 23) formuliert er dazu programmatische Sätze: sustinere naturalem per diligentiam solutionem (I 261,15f) und: Oportet sane patientiam habere et cum dictis descendere et vincula disparare. (1 261,22f.). Vgl. den Kommentar von Hanson, The Search (Anm. 2), 829: „Eusebius of Emesa in one of his discourses has a quite long passage about allegorizing. He allows that it cannot altogether be rejected but he is very cautious about its use … Had all ancient interpreters of the Bible followed this advice, subsequent generations would have been saved the necessity of reading a great deal of nonsense.“ Möglicherweise nimmt Eusebius von Emesa hier eine Bewegung auf, die sich bereits bei Eusebius von Caesarea abzeichnet. Bei diesem tritt die allegorische Auslegung im Laufe seines Schaffens immer mehr zugunsten des „wörtlichen“ oder „historischen“ Schriftsinns zurück. Vgl. dazu Ulrich, Euseb (wie Anm. 13), 186+191. Vgl. dazu Wiles, The Theology of Euseb (Anm. 3), 275: „The point of the non-allegorical cursing of the fig-tree was a demonstration to the disciples of his power, so that when his arrest and crucifixion came they would realise that it was something he was doing and not something being done to him.“ Eusebius, hom. XI 24 (I 272,21–26): Non quia Pater adversum Iudaeos agebat, sed pro gentibus erat. Non enim Pater occidit Filium, sed Iudaeorum maligna fervebat aviditas. Praedictum est, quia facient; sed non propter praeditionem fecerunt, sed quia facere habebant, praedictum est. Et Deus non impulit; Iudaei vero non sunt prohibiti. Eusebius, hom. XI 18 (I 269,12–15): Ideo ante passionem signum in fico fecit, ut ostenderet quia sponte traditur et sponte affigitur cruci. Ex hoc enim et discipulis fiduciam dedit et Iudaeos convicit et nobis fidem firmavit. Zum Beispiel in Pr. X 18 (I 250,9–19) des Eusebius von Emesa. Bei seinem Lehrer Eusebius von Caesarea ist der Tonfall, in dem diese Ereignisse kommentiert werden anders. Vgl. Ulrich, Euseb (Anm. 13), 139f., der daraufhinweist: „daß die eigenen Stellungnahmen Eusebs zu den die Juden ereilenden göttlichen Strafen keineswegs von Häme oder Schadenfreude gekenn-
Eusebius von Emesa und die Juden
133
Jerusalem bedeutet das definitive Ende der Gültigkeit des Zeremonialgesetzes und die Einführung des neuen Bundes43. Jetzt müssen die Juden ihre „väterlichen Gebräuche“ aufgeben, wenn sie Christen werden wollen. Das Halten des Zeremonialgesetzes ist nicht eine Quisquilie, sondern steht dem einzigen Weg zu Heil entgegen, deshalb ruft Eusebius den Juden (und Heiden) zu: „Laßt ab von den väterlichen [Gebräuchen] und glaubt dem Gekreuzigten!“44
Die Osterpredigten XVIII und XIX Daß dieser Ruf innerhalb des Judentums kaum Widerhall finden wird, hat Eusebius zumindest geahnt. Zu gut kennt er die jüdischen Erklärungsmodelle für die Diaspora. Dennoch will er die Hörer seiner beiden Osterpredigten XVIII und XIX davon überzeugen, daß das Judentum legitimerweise durch das Christentum abgelöst wurde. In der ersten Predigt benennt er deshalb alttestamentliche Zeugen für die Auferstehungshoffnung, um nachzuweisen, daß die Auferstehung Jesu Christi die Erfüllung der alttestamentlichen Prophezeiungen gewesen ist. Diese Predigt ist – zumindest auf der literarischen Ebene – ausdrücklich an die Juden gerichtet45. Deshalb disputiert Eusebius auch ausschließlich an Hand alttestamentlicher Stellen. Dabei finden sich interessante Parallelen zu seinen exegetischen Werken, denn er verwendet einige der exegetischen Erkenntnisse direkt in der Predigt. Darunter ist auch ein Hinweis, den er im Genesiskommentar explizit als jüdische Tradition kennzeichnet.
Die Opferung Isaaks: eine Verbindung zwischen Eusebius hom. XVIII 24 (II 23,15–17) und Fr. 36 ad Gen 22,12 aus dem Genesiskommentar Ein Reflex der exegetischen Arbeit des Eusebius liegt vor, wenn er in seiner Predigt über Abraham schreibt:
zeichnet sind, sondern von Mitleid und Trauer […] Das im selben Zusammenhang etwa von einem Johannes Chrysostomus bekannte und durchaus gehässig gemeinte ‚Recht so!‘ ist nämlich in den Texten Eusebs so eben nicht denkbar.“ Obwohl auch Eusebius von Caesarea die „anhaltend desolate Lage der Juden hinsichtlich ihrer heiligen Stätten bisweilen … als Strafe für die weiterhin fortdauernde Nichtannahme des Heils in Christus interpretiert oder aber als noch immer andauernde Strafe für den vor Generationen vollzogenen ‚Herrenmord‘“; ebd., 211. 43 Vgl. Ulrich, Euseb (Anm. 13), 205. 44 Eusebius, hom XIX 24 (II 72,12f.): Recedite a paternis et credite Crucifixo. 45 Eusebius, hom. XVIII 11 (II 14,1–3): Et si quidem ad Iudaeos sit sermo…
134
Eusebius von Emesa und die Juden
Es strahlt hervor deine Liebe, erkannt wird dein Glaube. Deine Taten, die du getan hast, werden eine Lehre sein für die, die nach dir sind. Man wird besingen, was du getan hast unter deinen zukünftigen Nachkommen46.
Das ist keine bloße Rhetorik zum Lobe Abrahams. Die Aussage „Deine Taten […] werden eine Lehre sein für die, die nach dir sind“ setzt exegetische Entscheidungen voraus, die sich in den erhaltenen Fragmenten des Genesiskommentars nachvollziehen lasen. Alle hier angeführten Texte sind bei ter Haar Romeny nachzulesen47. Der Abschnitt in der Predigt des Eusebius setzt voraus, daß in Gen 22,12 die Redewendung „nun weiß ich“ (Νῦν γὰρ ἔγνων, LXX) nicht in dem Sinne verstanden wird, daß Gott etwas für ihn Neues erfährt, denn das hieße, das Gott nicht allwissend ist. Eusebius versteht deshalb diese Stelle im Sinne von „nun hast du (uns) gezeigt“ (Νῦν ἔδειξας). Das erste Fragment in der Katene (Petit, Cat. 1267) erläutert diese Argumentation: Ἀντὶ τοῦ . Πῶς γὰρ ἀγνοεῖ αὐτὸς λέγων· Ἤδειν γὰρ ὅτι συντάξει Ἀβραὰμ τοῖς παισὶν αὐτοῦ τοῦ ϕυλάσσειν τὰς ἐντολὰς κυρίου; Ἀλλ᾿ ὥσπερ τὸ Ἵν᾿ ει᾿δῶ, δεικνύει μὲν ὡς βουλόμενον μαθεῖν. Βούλεται δὲ διδάξαι τοῦ θεοῦ τὸ ἀκριβές, οὕτω καὶ ἀπὸ τούτου γινώσκοντα τὸν θεόν, βούλεται δὲ ἡμᾶς διδάξαι, Νῦν ἔγνων λέγων, ἀπὸ τούτου γινώσκειν τὴν ει᾿ς θεὸν ἀγάπην.
Die Redewendung „nun weiß ich“ dient also dazu, die Liebe Abrahams zu Gott und seinen Geboten für andere sichtbar zu machen. Das nächste Fragment in der Katene (Petit Cat. 1268) legitimiert dieses Textverständnis mit dem Textbestand der „Hebräer“. Als Parallelstelle wird Gen 18,21 angeführt, denn dort wird ebenfalls das hebräische Verb =( עדיwissen, erkennen) benutzt und auch diese Stelle ließe sich so verstehen, als ob Gott etwas dazulernen könnte: Τουτέστι , ὡς ὁ Ἑβραῖος. Οὐ γὰρ ᾄγοιαν ει᾿σάγει θεοῦ, ἀλλὰ δίκης ἀκρίβειαν· ὡς τὸ Κατέβη ι᾿δεῖν εἶ κατὰ τὴν κραγὴν αὐτῶν συντελοῦνται.
Damit ist für Eusebius geklärt, daß die Septuaginta den Sinn des Textes nicht korrekt wiedergibt. Er versteht die Passage in Gen 22,12 – um der theologischen Implikationen willen – im Sinne von: „nun hast du (uns) gezeigt“ (Νῦν ἔδειξας) Die armenische Überlieferung des Kommentars gibt noch eine weiterführende Argumentation: Now the Syrian, instead of saying, „Now I have come to know“, says „Now you have made known“. He correctly says „Now you have made known“, in the sense of saying: „Now you have taught all mankind“. Now the Hebrew says: „I know that you fear God“. 46 Eusebius hom. XVIII 24 (II 23,15–17): Effulsit tua caritas, agnita est fides tua. Erunt ista, quae a te acta sunt, adhortatio eorum qui post futuri sunt te. Decantabitur id quod fecisti in progenies futuras. 47 ter Haar Romeny, A Syrian in Greek Dress (Anm. 7), 316–318.
Eusebius von Emesa und die Juden
135
Die hier angeführte syrische Textüberlieferung bestätigt für Eusebius sein Verständnis und bringt den Gedanken ins Spiel, daß Abraham an dieser Stelle alle Menschen belehrt. Diesen Gedanken nimmt Eusebius schließlich in hom. XVIII 24 wieder auf und schmückt ihn mit der ihm eigenen Rhetorik blumig aus: „Deine Taten [Abraham], die du getan hast, werden eine Lehre sein für die, die nach dir sind. Man wird besingen, was du getan hast unter deinen zukünftigen Nachkommen“.
Die Geburt von Isaak und Jakob: eine Verbindung zwischen Eusebius hom. XVIII 29 (II 27,2) und Fr. 44 ad Gen 25,31 aus dem Genesiskommentar Gegen den biblischen Bericht von der Geburt der Zwillingen Esau und Jakob ist Eusebius davon überzeugt, daß Jakob der Erstgeborene genannt werden muß, denn er ist nach einer jüdischen Auslegung derjenige, der zuerst im Mutterleib gebildet wurde. Die Katene überliefert ein Fragment, das nicht explizit Eusebius zugewiesen wird, aber mit der armenischen Überlieferung des Genesiskommentars übereinstimmt: „Die Juden sagen, daß Jakob der Erstgeborene ist, denn der erste, der im Mutterleib gebildet wird ist der zweite, der geboren wird“48. Diese Auslegung lässt sich auf jüdische Quellen zurückführen. Sie ist belegt in GenR 63,849 und bei Raschi zu Gen 25,2650. In hom. XVIII 29 verwendet Eusebius diese Auslegung en passant, ohne sie als jüdische Tradition kenntlich zu machen (II 27,2): Iacob autem electus ille et qui ante Esau factus est.
Joseph im Brunnen: eine Verbindung zwischen hom. XVIII 34 (II 31,8) und Fr. 57 ad Gen 37,21 aus dem Genesiskommentar In der Geschichte von Joseph im Brunnen gibt es in hom. XVIII 34 eine Entscheidung für eine Textform, die Eusebius im Genesiskommentar exegetisch begründet und dann in seiner Predigt weiterverwendet. Die armenische Übersetzung des Kommentars überliefert die exegetische Begründung: „When Reuben, he says, had heard that they had thrown Joseph into a cistern, he rescued him from his brothers and said: ‚Let us not hit him up to the soul.‘ The Syrian says: ‚Let us not kill him‘51“. Die syrische Übersetzung ist gefälliger als das umständlich ins 48 Eusebius, Fr. 44 (Petit, Cat. 1417) zitiert bei ter Haar Romeny, A Syrian in Greek Dress (Anm. 7), 351: „Οἱ Ἰουδαῖοί φασι πρωτότοκον εἶναι τὸν Ἰακώβ∙πρῶτος γὰρ ἐν κοιλίᾳ πλάττεται ὁ δεύτερος γεννώμενος“. 49 Bereshit Rabba 1–3 hg. v. Julius Theodor u. Chanoch Albeck, Berlin 1912–1929, Vol. II, 688. 50 Raschis Pentateuchkommentar, übers. v. S. Bamberger, Hamburg 1922, 68f. 51 Text und Übersetzung bei ter Haar Romeny, A Syrian in Greek Dress (Anm. 7), 389f.
136
Eusebius von Emesa und die Juden
Griechische gebrachte Hebräisch der Septuaginta „οὐ πατάξομεν αὐτὸν ει᾿ς ψυχήν“. In hom. XVIII 34 (II 31,8) heißt es deshalb bei Eusebius kurz und bündig: Non occidamus. Das entspricht der Textform des Syrischen und dem Inhalt der hebräischen Bibel und der Septuaginta. Hieronymus wird später versuchen die Wiedergabe des Hebräischen und Griechischen zu kombinieren und mit non interficiatis animam eius übersetzen.
Die Osterpredigt hom. XIX In der anschließenden, zweiten Osterpredigt (hom. XIX) geht Eusebius mit den Juden ins Gericht. Er versucht ihnen nachzuweisen, daß nur ihr Unglaube daran schuld sei, daß Jerusalem zerstört und sie zerstreut wurden. In dieser Predigt setzt er sich mit Erklärungsmodellen für die Katastrophe des Jahres 70 bzw. 135 n. Chr. auseinander, die er explizit als jüdische Erklärungen einführt52. Die Frage, ob es sich dabei um Erklärungsmodelle handelt, die innerhalb des zeitgenössischen Judentums bekannt waren, soll im Folgenden geklärt werden. Für Christen und für Juden lag es gleichermaßen nahe, das Ende des zweiten Tempels und die erneute Zerstreuung des Volkes durch einen Rückgriff auf alttestamentliche Denkfiguren zu erklären. Dazu werden vor allem prophetische Texte herangezogen, die die Ursache für den Untergang des ersten Tempels in der Schuld des Volkes Israel suchen. Christen versuchen dabei sehr schnell, eine Verbindung zur Verwerfung Jesu Christi durch die Juden herzustellen, während jüdische Erklärungen meistens die Schuld in der Vernachlässigung der Vorschriften der Tora suchen. Jüdische Erklärungen für den Untergang des Tempels R. Eliezer, ein Zeitgenosse der Zerstörung Jerusalems, bietet einen eindrücklichen Beleg für die Übernahme dieser Selbstanklage aus der prophetischen Tradition: Man fragte R. Eliezer: Waren die späteren Geschlechter [die zur Zeit des 2. Tempels] frömmer als die früheren [zur Zeit des 1. Tempels]? Er antwortete: Euer Zeuge, der Tempel, möge den Beweis liefern! Unsre Väter [zur Zeit des 1. Tempels] haben das [Dach-]Gebälk beseitigt, s. Jes 22,8: „Er hat die Decke Judas gelüftet“; aber wir haben die
52 Dazu vgl. Johann Maier, Jüdische Auseinandersetzung mit dem Christentum in der Antike (EdF 177), Darmstadt 1982, 190–195.
Eusebius von Emesa und die Juden
137
Wände zerschlagen [bis auf den Grund], s. Ps 137,7: „Die da riefen reißt nieder, reißt nieder, bis auf den Grund reißt sie nieder!“53
In den Augen des R. Eliezer sind die späteren Geschlechter, das heißt die Juden des ersten Jahrhunderts n. Chr., weniger fromm als die früheren Geschlechter, die durch ihr Verhalten immerhin die erste Zerstörung des Tempels und das babylonische Exil heraufbeschworen hatten. Den Charakter einer Selbstanklage haben auch die rabbinischen Erklärungen, die im Babylonischen Talmud zusammengestellt sind. Im Traktat Shabat werden acht Gründe für den Untergang Jerusalems aufgelistet54, die je in der Übertretung eines biblischen Gebotes bestehen (bShab 119b): 1) Nichtbeachtung des Sabbats 2) Unterlassen des Schema-Lesens 3) Abhalten der Schulkinder vom Unterricht 4) Fehlende Schamhaftigkeit 5) Nichtbeachtung der sozialen Ränge 6) Fehlen der gegenseitigen Zurechtweisung 7) Mißachtung der Schriftgelehrten (Propheten) 8) Fehlen von „Männern der Treue“ Eusebius von Emesa und seine Hörer müssen davon Kenntnis gehabt haben, daß es im Judentum vor allem solche Erklärungen für das Ende des Tempels und die Zerstreuung in die Diaspora gab, die die Schuld beim eigenen Volk suchten. Eusebius nutzt diese Situation in seiner Predigt dazu, die Juden selbst die Frage nach der Schuld vorbringen zu lassen. Er läßt sie fragen: „Welche anderen Sünden haben wir, daß wir ausgerechnet jetzt verstoßen worden sind?“55 Jüdische Erklärungsmodelle, mit denen diese Frage beantwortet wurde, fließen an dieser Stelle in die Predigt ein. Eusebius geht auf zwei Erklärungen ein, die im rabbinischen Judentum für die Zerstörung des Tempels gegeben werden: das Aufhören der Prophetie und jüdische Götzenverehrung. Beide Erklärungsmodelle entkräftet Eusebius allerdings am Ende der Predigt zu Gunsten seiner christlichen Deutung.
53 yYom 1,1 38c, Zitat bei Paul Billerbeck, Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch Vol. 1 München 81982, 946. 54 Vgl. Robert Goldenberg, Early Rabbinic Explanations of the Destruction of Jerusalem, in: JJS 33, 1982, 517–525. 55 Eusebius, hom. XIX 6 (II 49,8f): quia alia peccata habuimus, et ideo eiecti sumus nunc?
138
Eusebius von Emesa und die Juden
Jüdische Götzenverehrung als Grund für die Zerstörung des Tempels Diese Erklärung für den Untergang des Tempels findet sich als jüdische Selbstanklage im Babylonischen Talmud in San 64a und Yom 69b. Dort wird erklärt, daß Götzenverehrung die Ursache für Gottes Strafgericht über Israel gewesen sein soll. Der personifizierte „Genius des Götzendienstes“ wird dafür verantwortlich gemacht, daß es zur Zerstörung des Zweiten Tempels kommen konnte56. Eusebius kontert in seiner Predigt mit der Frage, quando non peccavit Israel? und bringt dann ausführliche Verweise auf die vielen Berichte über Götzenverehrung im Alten Testament57. Damit brandmarkt er die Juden als götzendienerisches Volk, was für eine christliche Gemeinde, die erst seit einer Generation von der Auseinandersetzung mit dem Zwang zum paganen „Götzenopfer“ befreit war, eine deutliche Diskreditierung der Juden ist. Das Ende der Prophetie als Grund für die Zerstörung des Tempels Das zweite Erklärungsmodell, das im Aufhören der Prophetie ein Zeichen für Gottes Zorn sieht, führt Eusebius wiederum als Frage der Juden ein: „Aber sie erkühnen sich zu sagen: Es hat den Anschein, daß wir deshalb, weil wir jetzt keine Propheten mehr haben, unter die Völkern zerstreut worden sind“.58 Dieser Erklärung setzt er eine Vielzahl alttestamentlicher Zeugnisse über Prophetie in der Zerstreuung – vor allem aus der babylonischen Gefangenschaft – entgegen59. Damit soll bewiesen werden, daß das Aufhören der Prophetie nicht in einem kausalen Zusammenhang mit der Diaspora stehen kann. Die Vorstellung, daß das Ende der Prophetie im Zusammenhang mit der Zerstörung des Tempels im Jahre 70 n. Chr. gestanden haben soll, mutet unhistorisch an, schließlich ist die Vorstellung, daß die Prophetie in Israel aufgehört habe, bereits in vorchristlicher Zeit verbreitet. In 1.Makk 9,27 heißt es: „Und in Israel war soviel Jammer, wie nicht gewesen ist seitdem man keine Propheten mehr gehabt hat“60. Auch Josephus stellt resigniert fest, daß es in Israel keine Propheten mehr gibt61. In der rabbinischen Theologie findet sich daneben die Vorstellung, daß es ein Fortwirken der Prophetie bis in die heutige Zeit gibt. Die Gabe der Prophetie soll 56 Heinz-Martin Döpp, Die Deutung der Zerstörung Jerusalems und des Zweiten Tempels im Jahre 70 in den ersten drei Jahrhunderten n. Chr. (TANZ 24), Tübingen 1998, hier: 179–182. 57 Eusebius, hom. XIX 7+8 (II 49,10–50,11). 58 Eusebius, hom. XIX,10 (II 51,1f): Sed ausi sunt dicere quia ideo nunc non habemus prophetas, quia inter gentes sparsi videmur. 59 Eusebius, hom. XIX 9+10 (II 50,12–52,8). 60 1. Makk 4,46; 14,41 drücken darüberhinaus die Hoffnung auf einen „rechten“ Propheten aus, den Gott für Israel erwecken soll. 61 Josephus, Contra Apionem I,41, Niese 9,9–10.
Eusebius von Emesa und die Juden
139
auf die Weisen übergegangen sein. So überliefert ExR 28 als Lehre des R. Jizcha: „Und nicht bloß alle Propheten haben vom Sinai her Prophetie empfangen, sondern auch von den Gelehrten, die in jeder Generation entstehen, hat jeder einzelne das Seine vom Sinai empfangen“62. Diese Auffassung hat sich aber nicht generell durchgesetzt. Auch in der rabbinschen Literatur ist das Fehlen bzw. die Verspottung der Propheten als Erklärung für den Untergang Jerusalems verstanden worden. So heißt es in der oben angeführten Liste (bShab 119b) der Gründe für die Zerstörung Jerusalems an siebter Stelle: Jerusalem ist nur deshalb zerstört worden, weil man da die Schriftgelehrten mißachtete, denn es heißt (2.Chr. 36,16): und sie verhöhnten die Boten des Herrn, verachteten seine Worte und spotteten seiner Propheten, bis der Grimm des Herrn so stieg, daß keine Heilung mehr möglich war.
Aber auch die explizite Verbindung zwischen dem Ende der Prophetie in Israel und der Zerstörung Jerusalems findet sich in der rabbinischen Literatur. Offenbar wurde dabei auf die älteren Texte keine Rücksicht genommen, die vom Ende der Prophetie schon vor der Zeitenwende sprechen. Im Babylonischen Talmud findet sich die Vorstellung, daß die Prophetie in Israel erst mit dem Ende des zweiten Tempels aufgehört hat. Dabei ist es das Interesse dieser Talmudpassage zu belegen, daß die Prophetie mit dem Untergang des Tempels nicht ganz aus Israel verschwunden, sondern auf Weise, Narren oder Kinder übergegangen ist: „R. Evdämi aus Hajpha sagte: Seit dem Tage, an dem der Tempel zerstört worden ist, ist die Prophetie den Propheten genommen und den Weisen gegeben worden“ (bBB 12a). und „R. Johanan sagte: Seit dem Tage, an dem der Tempel zerstört worden ist, ist die Prophetie den Propheten genommen und Narren und Kindern gegeben worden“ (bBB 12b). Hier ist das Ende der Prophetie in Israel direkt mit dem Ende des Tempels verknüpft. Diese Sicht ist im christlichen Bereich in das Arsenal der antijüdischen Polemik übernommen worden. So rechnet Origenes in seinem Matthäuskommentar das Fehlen der Propheten im Judentum zu den Zeichen dafür, daß Gott sich mit einem Scheidebrief vom jüdischen Volk getrennt hat: „Zeichen des Scheidebriefes [ist es …] ebenso, daß es keinen Propheten mehr gibt und daß sie sagen: wir sehen keine Zeichen mehr (Ps 73,9).“63 In diesem Sinne verwendet auch Eusebius von Emesa die im Judentum bekannte Verbindung zwischen dem Ende der Prophetie und den Katastrophen von 70 und 135 n.Chr. An Hand der rabbinischen Literatur läßt sich nachweisen, daß 62 Zitat bei Paul Billerbeck, Kommentar zum neuen Testament aus Talmud und Midrasch 4/1 München 71978, 450. 63 Origenes, Comm. in Mt. XIV 19 ad Mt 19,3–12. Die Übersetzung ist entnommen: Origenes, Der Kommentar zum Evangelium nach Mattäus II, eingel. übers. und mit Anmerkungen versehen von Hermann J. Vogt (BGL 30), Stuttgart 1990, 59.
140
Eusebius von Emesa und die Juden
es sich in den beiden angeführten Fällen wirklich um jüdische Erklärungsmodelle handelt, die in seiner Predigt verwendet werden. Selbst wenn Eusebius seinen Hörern damit nicht die gesamte Bandbreite der jüdischen Erklärungen für den Untergang des Tempels und die Zerstreuung des Volkes präsentiert, ist seine Osterpredigt ein deutliches Zeichen seiner intensiven Auseinandersetzung mit dem Judentum. Er mutet seinen christlichen Hörern damit zu, zunächst auf jüdische Erklärungen zu hören, bevor sie die sattsam bekannte christliche Begründung für die Zerstörung Jerusalems präsentiert bekommen. Vor dieser christlichen Schuldzuweisung an die Juden steht in der zweiten Osterpredigt noch ein Interludium, in dem Eusebius die Überlegenheit christlicher gegenüber jüdischen Märtyrern am Beispiel des Romanus-Martyriums in Antiochia herausstellt64. Dann kommt Eusebius zu dem Schluß, daß die zitierten jüdischen Erklärungsmodelle nicht stichhaltig sind. Die Zerstörung Jerusalems und die Zerstreuung des Volkes durch die Römer müssen seines Erachtens anders erklärt werden. Er tut das in einem fulminanten Angriff auf das zeitgenössische Judentum, bei dem sich zeigt, daß er dessen Gebräuche gut kennt. Er fragt die Juden, warum sie sich nicht bereits zur Zeit des Alten Testamentes des Götzendienstes enthalten und die Gebote beachtet hätten. Dabei gesteht Eusebius ihnen zu, daß sie sich jetzt sehr darum bemühen. Damit liegt er quer zu einer rabbinischen Argumentationslinie des Jerusalemer Talmud, der dem Volk bereits vor der zweiten Zerstörung des Tempels zugesteht: „Aber beim zweiten Mal [der zweiten Zerstörung, R.H.] erkennen wir ihnen an, daß sie der Tora gehorchen, die Gebote und Zehnten beachten und alle Arten guten Benehmens bei ihnen ist“65. 64 Das Martyrium des Romanus ist berichtet bei Eusebius von Caesarea, De Martyribus Palaestinae 2,1–5 GCS Eusebius II/2 909,5–35. Romanus war Diakon und Exorzist in Caesarea. Er erlitt das Martyrium in Antiochia während der diocletianischen Verfolgungen. Eusebius von Emesa erweitert den bei Eusebius von Caesarea erhalten Bericht wesentlich. Eusebius von Emesa berichtet, daß Romanus nach der Marter verbrannt werden sollte. Anläßlich des bevorstehenden Feuertodes fragten die Juden und andere „Ubi est horum Deus?“ und die Juden brachten als Gegengeschichte die drei Jünglinge im Feuerofen, die Gott vor dem Feuer bewahrt hatte. Bei Romanus wurde das Feuer schließlich durch göttliches Eingreifen gelöscht. Romanus konnte auf wunderbare Weise wieder sprechen, obwohl ihm die Zunge herausgeschnitten worden war und das zudem noch ohne Stottern (was er vorher getan hatte). Eusebius resümiert: hom. XIX 15 (II 55,23f.): Ergo cum producunt nobis Iudaei tres pueros, in uno tria proferimus und hom. XIX 16 (II 56,24f.): Habemus ergo et tertiam admirationem, et unus ecclesiae martyr iam aequatur tribus ex synagoga. Ob ihm andere Quellen als Eusebius von Caesarea zugänglich waren oder ob er den Bericht rhetorisch ausschmückt, damit er dazu taugt, über das Wunder der drei Jünglinge im Feuerofen zu triumphieren, ist nicht klar. Eusebius von Emesa weist durch seine Erweiterungen den Juden im Gegensatz zu Eusebius von Caesarea eine Mitschuld am Martyrium zu; vgl. dazu Ulrich, Euseb (Anm. 13), 54. Ein Motiv dafür ist die Märtyrerkonkurrenz zwischen Juden und Christen. Besonders in Antiochia, in dem die Makkabäergräber in einer besonderen Synagoge im Stadtteil Kerateion verehrt wurden, spielt die Konkurrenz um die „besten Märtyrer“ eine Rolle. 65 yYom 1,1 38c, Übersetzung bei Döpp, Die Deutung der Zerstörung Jerusalems (Anm. 56), 205.
Eusebius von Emesa und die Juden
141
Diese Argumentation läßt erkennen, daß es für die Rabbinen eigentlich unvorstellbar ist, daß die Juden bis zum Jahre 70 n. Chr. so viel Schuld auf sich geladen haben könnten, daß deswegen der Tempel zum zweiten Male zerstört werden mußte66. Für Eusebius hingegen ist die Schuld der Juden eindeutig geklärt. Bei ihm ist nur die Verwunderung darüber zu hören, daß das Judentum als Religion in der Diaspora fortbesteht und sogar aufblüht, obwohl diese furchtbare Strafe Gottes über sie gekommen ist: jetzt da ihr den Sabbat wie versprochen haltet, und das Gesetz lest und die Bücher der Propheten, die ihr getötet habt, als sie gegenwärtig waren, deren Bücher ihr aber durch purpurne Mäntel verehrt? Was ist der Grund dafür, daß einst, als ihr so viel Schlechtes getan habt, so viele Güter Gottes unter euch waren, der Geist bei euch wohnte und die Propheten bei euch waren? Aber jetzt wo ihr, wie gesagt, das Gesetz lest und befolgt, Feste und Sabbate einhaltet, euch von Speisen enthaltet, ohne Grund arbeitet und wacht, nächtens Psalmen rezitiert, und quer durch Städte und Länder Synagogen gründet und Schrein, Leuchter, Tisch und alles anfertigen wollt67, jetzt mehr als in eurem eigenen Land? Warum hattet ihr damals, als ihr all das Schlechte getan habt, so viele Propheten und Moses, den ihr steinigen wolltet und Aaron, dessen Macht ihr in Frage stelltet? Jetzt aber, wo ihr das Gesetz zu beachten scheint und all das tut, was zuvor bestimmt worden war, ist kein Prophet bei euch?68
Hier zeigt sich, wie die Kenntnis der Situation des zeitgenössischen Judentums von Eusebius antijüdisch genutzt werden kann. Eusebius kann nicht verstehen, welchen Sinn die Vorschriften der Tora nach der Zerstörung Jerusalems noch haben können. Er kann die Leistung des rabbinischen Judentums nicht würdigen, das die halachischen Vorschriften der Tora so interpretiert hat, daß sie ohne das kultische Zentrum des Tempels weiter vollzogen werden können. Eusebius verwendet jetzt auch das Fehlen der Prophetie im Judentum als christliches Argument gegen die Juden. Er verbindet das Aufhören der Prophetie mit dem Ende der Erwählung des Volkes Israel, ohne darauf Rücksicht zu nehmen daß das Ende der Prophetie bereits vor der Entstehung der neutestamentlichen Schriften beklagt worden war. Die Gedankenführung des Eusebius läuft schließlich 66 Vgl. Döpp, Die Deutung der Zerstörung Jerusalems (Anm. 56), 217. 67 Zur Ausstattung antiker Synagogen vgl. Hans-Peter Stähli, Antike Synagogenkunst, Stuttgart 1988. 68 Eusebius, hom. XIX 20 (II 60,13–23): nunc cum sabbatum custoditis ut pollicemini, et legem legitis et libros prophetarum, quos praesentes quidem interfecistis, libros autem eorum purpureis palliis honoratis? Quae causa est, ut tunc quidem tanta vobis facientibus mala, tanta fiebant in vobis Dei bona, et spiritus vobis aderat, et prophetae vobiscum erant; nunc autem cum legem legitis ut dicitis, et custoditis, et feriamini et sabbatum observatis, et ab escis vos abstinetis, sine causa laboratis et vigilatis, per noctem psalmos dicentes, et per civitates et nationes synagogas constituistis, et arcam et candelabra et mensas, et omnia vultis facere, nunc magis quam in terra vestra? Cur tunc, cum tanta mala faciebatis, tantos habebatis prophetas, et Moysen quem voluistis lapidare, et Aaron cui vim irrogastis; nunc autem, cum videmini custodire legem et omnia facere ut praedictum est, nullus vobiscum propheta est?
142
Eusebius von Emesa und die Juden
darauf hinaus, den Juden und seiner christlichen Hörerschaft nachzuweisen, daß die Schuld für die Zerstörung des Tempels einzig und allein in der Tötung des Gottessohnes zu suchen ist. Gott Vater erfüllt als Reaktion darauf die Vorhersagen Christi über den Untergang des Tempels. Die einzige – rhetorische – Frage, die Eusebius bleibt, ist: „Warum verstehen es die Juden nicht, daß sie wegen des Todes Jesu von Gott zerstreut worden sind?“ Die christliche Antwort darauf ist für Eusebius und seine Hörer, daß die Juden immer noch nicht verstanden haben, welche Bedeutung der Tod Jesu für sie hatte. Das Schicksal des Volkes gibt nach seiner Auffassung einen klaren Erweis der heils- oder unheilsgeschichtlichen Zusammenhänge: Wenn ihr aber als Übertreter des Gesetzes eine Stadt hattet, jetzt – wie gesagt – als Befolger des Gesetzes verstreut seid in den Städten, ist eure unentschuldbare Kühnheit gegen das Blut des Gerechten [sc. Christus, R.H.] offenbar.69
Damit ist die antijüdische Beweisführung der Osterpredigten abgeschlossen. Eusebius entwickelt keine weitergehende Perspektive. Er ruft weder zur verstärkten Mission unter Juden auf 70, noch fordert er seine christlichen Hörer zu judenfeindlichen Aktionen auf.
Eusebius und das Judentum seiner Zeit Für Eusebius von Emesa ist das Judentum seiner Zeit ein reales Gegenüber. Er gehört zu den christlichen Theologen, die aus exegtischem Interesse gerne den Rat von Juden einholen. Dennoch vertritt er eine Theologie, in der das Judentum eine heilsgeschichtlich überwundene Gruppe ist. Diese theologische Überzeugung trifft mit dem historischen Ereignis der „konstantinischen Wende“ zusammen, die Eusebius von Emesa miterlebt hat. Dieser Sieg des Christentums hat sein Lebensgefühl und seine Geschichtsauffassung geprägt. In der Beziehung zum Judentum ruft das eine eigentümliche Spannung hervor. Zwar sind die Kaiser Christen, aber deshalb ist nicht das ganze römische Reich christlich geworden. Die Juden bleiben zu Lebzeiten des Eusebius von Emesa eine machtvolle Gruppe, mit deren Präsenz er sich auseinandersetzen muß. Das zeigt sich unter anderem darin, daß Eusebius mehrmals seine Zuhörer davor warnt, eine Synagoge zu betreten und dort zu sagen „Jesus, der Gekreuzigte ist der Sohn Gottes“. Selbst in einem Dorf, in dem es nur drei oder vier Juden gibt, empfiehlt Eusebius, 69 Eusebius, hom. XIX 24 (II 64,9–12). 70 Eusebius von Emesa hat in den erhaltenen Schriften keine Perspektive auf die endgerichtliche Rettung „ganz Israels“ entwickelt, von der Paulus in Röm 11 spricht und die von Eusebius von Caesarea so verstanden wird, daß „ganz Israel“ nur den Teil der Juden meint, die an Christus glauben. Vgl. Ulrich, Euseb (Anm. 13), 207.
Eusebius von Emesa und die Juden
143
solche Aktionen zu unterlassen71. Das Judentum in Emesa, Antiochia und Umgebung war zur Zeit des Eusebius offenbar selbstbewußt genug, um sich gegen solche christlichen Provokationen zu wehren. Diese Situation steht in einer deutlichen Spannung zum Hochgefühl eines kirchlichen Sieges durch die „konstantinischen Wende“. Deshalb beeilt Eusebius sich, die Wohltaten des Sieges des Christentums sogar für Heiden und Juden herauszustellen: „die Heiden werden wegen Christus bereits züchtig und die Juden verehren die Bilder nicht wegen des Kreuzes“72. Ob es für Juden aber wirklich angenehmer gewesen ist, mit christlichen Kirchen an Stelle römischer Götterbilder konfrontiert zu werden, ist auf Grund ihrer rechtlichen Privilegien (religio licita) im römischen Reich zumindest fraglich. Trotz des christlichen Sieges sind die Juden durch ihr Festhalten an den Vorschriften der Tora ein Stachel im Fleisch des triumphierenden Christentums. Deshalb beklagt Eusebius noch in zwei anderen Predigten, daß es nicht möglich ist, in einer Synagoge ein Bekenntnis zu Jesus Christus abzulegen73. Angesichts dieser Situation bemüht er sich durch seine Predigten gegen die Juden zu beweisen, daß das Judentum heilsgeschichtlich eine bereits überwundene Größe ist. Dabei wird für ihn aber keineswegs das Alte Testament unwichtig. Im Gegenteil, das Alte Testament bildet mit seinen christlich gedeuteten Weissagungen ein Fundament der heilsgeschichtlichen Argumentation74. Für eine 71 Eusebius, hom. XIX 27 (II 66,26–67,5): Audeat quia ingredi synagogam. visus licet alicuius, et dicere: Iesus crucufixus Filius est Die. Sie exierit exinde, et hoc cum non sit ex Iudaeis, sed ex nobis; cum et leges vindicant et reges adorant, et cum ecclesia tenet! Si autem nunc non est sine periculo aliquem non Iudaeum ingredi in synagogam eorum, qui in captivitate habentur, et hoc in vico ubi tres aut quatuor colligungtur Iudaei, et dicere veritatem: quemadmodum Petrus ex Iudaeis Galilaeus? 72 Eusebius, hom. XIII,32 (I 315,5f): gentiles propter Iesum iam casti et Iudaei idola non colunt propter crucem. Vgl. dazu auch Timothy Davis Barnes, The Constantine Settlement, in: Eusebius, Christianity and Judaism (Anm. 13), 652, der auf den triumphalistischen Tonfall hinweist, mit dem Eusebius von Caesarea den Sieg über den Götzendienst preist. 73 Eusebius, hom. I 27 (I 30,22–31,3): quis ingressus est nunc in synagoga Iudaeorum, cum et imperator religiosus et pius et Deum colens et Christum adorans habetur et videtur christianus; cum tanta pars orbis praeventa iam est religiositate; cum serviunt Iudaei dispersi; cum omnis timor persecutionis vacat? Ingredere synagogam, si potes et dicito: Iesus resurrexit a mortuis. Adde ingredi, si exieris inde vivens. Cum ipsi adiuvant reges et iudices et multitudo tanta iam credens, nemo tamen audet ingredi synagogam. Und hom. XIV 26 (I 342,10f.): Numquidnam, in synagoga ingressi, praedicamus Christum? Utinam et ibi! 74 Eusebius, hom. XIX 23 (II 63,17–27). Um dem drohenden Verlust des Alten Testaments vorzubeugen, bedient Eusebius sich der Argumentationsfigur, daß die Juden ihre Hebräische Bibel falsch verstehen, weil sie die prophetischen Texte nicht als Voraussagen auf Christus lesen (sic!). Damit behält das Alte Testament seine Bedeutung für die Christen, die es „richtig“ lesen. In dieser Interpretation erweisen sich die Prophezeiungen als erfüllt, auch und gerade diejenigen, die gegen Israel gerichtet sind: Dicimus enim quia omnes promissiones Dei, quae per legem facta sunt et per prophetas, impletae sunt in adventu Domini Christi, et adhuc usque implentur. Hoc est honorare libros prophetarum, non purpureis palliis a foris, sed illum qui
144
Eusebius von Emesa und die Juden
sachgemäße Auslegung des Alten Testaments sind Philologie und Exegese von Nöten, wie sie sich im palästinisch-syrischen Raum in Abgrenzung zu Alexandria zu entwickeln beginnen75. Für diese Arbeit sind christliche Exegeten immer wieder auf die Juden, ihre Überlieferung der hebräischen Bibel und ihre exegetische Kompetenz angewiesen, oder wie es Eusebius sagt: Ihre Buchstaben, ihre prophetischen Bücher und unsere Mühe, die die Wahrheit sagt … Dies ist in jüdischer Sprache geschrieben, dies wird bei den Juden gelesen und in der Kirche anerkannt. Sie sind zu unserer Bibliothek geworden und wir nehmen auf, was es bei ihnen an Empfehlungen gab; ihre Buchstaben aber unsere Mühe, ihre Bücher und unser König76.
Damit ist der Umgang des Eusebius von Emesa mit den Juden und ihrem Wissen über das Alte Testament weitgehend beschrieben. Es deutet sich bei ihm ein positives Verständnis der Rolle der Juden an. Selbst in einem christlich gewordenen Imperium wird man nicht auf sie verzichten können, weil sie die Bibliothek der Christen bilden. Ihre Existenz und die von ihnen bewahrte hebräische Bibel sind der Altersbeweis der Christen. Damit werden sie in christlicher Perspektive zu Zeugen des Evangeliums – sogar wider ihren eigenen Willen77. Diesen Gedanken hat später Augustinus in sein Verständnis der Rolle der Juden eingefügt. Auch für den Bischof von Hippo sind die Juden wegen der von ihnen bewahrten hebräischen Bibel unfreiwillige Zeugen des Evangeliums. Deshalb intus praedicare agnoscere. Non est mentitus Moyses pro nobis: opus enim ipsum testimonium ei praestat. Non est mentitus Moyses adversus Israel: captivitas enim eorum et humiliatio testatur. Non sunt mentiti prophetae vocationem gentium praedicantes: vocati enim sunt, ut videtis. Non sunt mentiti prophetae, exitum et abiectionem Israel prophetantes. 75 Vgl. Sten Hidal, Exegesis in the Antiochene School, in: Hebrew Bible / Old Testament. The History if its Interpretation, Vol. 1, Antiquity, ed. by Magne Sæbø, Göttingen 1996, 545: „Eusebius of Emesa is somewhat older than both Diodore and Theodore of Mopsuestia (he lived 300–359), but does not belong in the proper meaning to the elder Antiochene school … The repeated quotations in the Antiochene commentaries from ‚the Hebrew‘ and ‚the Syrian‘ have one of their principal sources in Eusebius of Emesa. Eusebius was born at Edessa and mastered the Syriac language. In his commentary [sc. der armenisch erhaltene OktateuchKommentar, R.H.] there is a marked tendency towards the historical sense of the text. There seem to be connections between Eusebius and the Antiochene school, particularly Diodore, but the whole issue has to be investigated further.“ Vgl. auch L. van Rompay, The Christian Syriac Tradition of Interpretation, ebd., 628, der auf die Nähe zwischen Ephräm dem Syrer und Eusebius von Emesa hinweist. 76 Eusebius, hom. XIV 4 (I 325,1–9): Littera ipsorum, prophetiae ipsorum, libri; et nostra negotia quae dicit veritas … [erläutert an einem Beispiel aus Jes 53,7, R.H.] Haec iudaica voce sunt scripta, haec apud Iudaeos leguntur et in ecclesia cognoscuntur. facta sunt nobis bibliothecae et recepimus quae apud ipsos erant commendatio; litterae ipsorum sed negotia nostra, illis libris et nobis Rex. 77 Vgl. dazu Ernst Bammel, Die Zeugen des Christentums, in: Christlicher Antijudaismus und jüdischer Antipaganismus, hg. v. Herbert Frohnhofen, Hamburg 1990, 170–180, wiederabgedruckt in: Ernst Bammel, Judaica et Paulina. Kleine Schriften II, WUNT 91, Tübingen 1997, 96–106.
Eusebius von Emesa und die Juden
145
bezeichnet er die überall in der Welt lebenden Juden als testes evangelii. Daß Augustinus diesen Gedanken in Kenntnis der Predigten des Eusebius von Emesa entwickelt hätte, ist aber nicht zu belegen. Als Schlußwort bleibt nur hinzuzufügen, daß Eusebius von Emesa in seinen Predigten zeigt, daß er sich an den methodischen Grundsatz hält, daß man mit Juden nur streiten kann, wenn man sich auf die Schriften beruft, die sie ebenfalls als kanonisch anerkennen, also auf die hebräische Bibel: Wenn also ein Jude etwas zurückweist, das im Evangelium steht, muß aus dem Alten Testament argumentiert werden, wenn aber ein Häretiker das zurückweist, was im Alten Testament gesagt wird, wird eine Antwort aus dem Neuen Testament gegeben. Denn die Kirche nimmt beides an, sowohl das, im Alten, als auch das im Neuen Testament Geschriebene78.
In dieser methodischen Feststellung ist Eusebius von Emesa sich mit seinem Lehrer Eusebius von Caesarea einig, der in der Einleitung zur Demonstratio evangelica sagt: „Hinsichtlich dieser Fragen nun wollen wir die Entgegnung gegen sie (sc. die Juden) direkt aus ihren eigenen prophetischen Büchern ableiten“79. Dieses apologetische Interesse setzt Kenntnis des Alten Testaments und seiner jüdischen Auslegung voraus und ist immer wieder Auslöser für Kontakte zum Judentum gewesen. Eusebius von Emesa ist dafür ein gutes Beispiel aus der ersten Hälfte des vierten Jahrhunderts.
Anhang: Antijüdische Redewendungen in den Predigten des Eusebius von Emesa Im Vergleich zu Eusebius von Caesarea und Johannes Chrysostomus nimmt Eusebius von Emesa eine Mittelposition in der Polemik gegen Juden ein. Deutlicher als bei Eusebius von Caesarea werden die Juden moralisch diskreditiert, aber die Polemik ist bei weitem nicht so abfällig und geschmacklos wie bei Chrysostomus. Zu Eusebius von Caesarea vgl. J. Ulrich, Euseb von Caesarea und die Juden, PTS 49, Berlin 1999, 232. 235. 237 und vgl. zu Johannes Chrysostomus, Acht Reden gegen die Juden, eingel u. erl. v. R. Brändle, übers. v. V. JegherBucher, BGL 41, Stuttgart 1995. 78 Eusebius, hom. XVII 5 (I 373,16–21): Si igitur Iudaeus quis reprehendit quae sunt in evangelio posita, ex veteri testamento arguitur; si vero haereticus reprehenderit ea, quae in veteri testamento sunt dicta, de novo erit responsio. Ecclesia autem et quae in veteri testamento et quae in novo scripta sunt, utraque suscipit. 79 Vgl. Eusebius von Caesarea, Demonstratio evangelica II, prooem 2 übers.v. Ulrich, Euseb (Anm. 13), 223.
146
Eusebius von Emesa und die Juden
Aufgeregtheit der Juden – judaica alacritas I,19 (1 26,14) XXIX,5 (2 222,4) Eifer der Juden – iudaicum zelum I,24 (1 29,22) Unglaube der Juden – incredulitas Iudaeorum VIII,8 (1 201,17) VIII,14 (1 206,15.f) XI,12 (1 264,14) XI,25 (1 274,1–4) XIV,4 (1 324,15f.) XXIX,12 (2 225,14): „Incredulissimi enim Iudaei“ Bettlerische Juden – Iudaei mendici VIII,16 (1 207,22f.) Laster der Juden – Iudaeorum vitium IX,3 (1 217,21) Dreiste Juden – Iudaei, qui ausi sunt X,1 (1 238,13) X,18 (1 250,18) XIX,10 (2 51,1f.) XIX,18 (2 58,9) u. ö. XIX,24 (2 64,29) XIX,27 (2 66,22f.): „ausi sunt affigere cruci“ XXIX,10 (2 224,23) XXIX,16 (2 227,25): „Iudaeorum audacia“ Neid der Juden – livor Iudaeorum XI,11 (1 263,19f.) XI,14 (1 265,20f.) XI,15 (1 266,24) Gehässigkeit der Juden – invidia Iudaeorum XI,13 (1 265,2) XI,14 (1 266,23)
Eusebius von Emesa und die Juden
147
Gier der Juden – Iudaeorum aviditas XI,14 (1 272,22f.) Juden sind Skorpione XIII,35 (1 318,24f.) Juden sind Schlangenbrut XIII,35 (1 318,25f.) Untreue Juden – Iudaeorum infidelitas XIV,5 (1 32,12) Habsucht der Juden XV,5 (1 348,5–8) XVIII,34 (2 31,7f.): „Amatores autem pecuniam fuere et Iudaeorum patres, et Iudas consiliator corum“ (bezieht sich auf den Verkauf des Joseph durch die Brüder auf den Ratschlag des Juda hin) Unverschämte Juden – impudens est Israel (Israel bezieht sich dabei auf zeitgenössische Juden) XIX,24 (2 64,1f.)
Literatur Harold William Attridge / Ghei Hata (Eds.), Eusebius, Christianity, and Judaism (StPB 42), Leiden 1992. Ernst Bammel, Die Zeugen des Christentums, in: Christlicher Antijudaismus und jüdischer Antipaganismus, hg. v. Herbert Frohnhofen, Hamburg 1990, 170–180, wiederabgedruckt in: Ernst Bammel, Judaica et Paulina. Kleine Schriften II, WUNT 91, Tübingen 1997, 96–106. Éloi Marie Buytaert, L’Héritage littéraire d’Éusèbe d’Émèse (BMus 24), Louvain, 1949. Heinz-Martin Döpp, Die Deutung der Zerstörung Jerusalems und des Zweiten Tempels im Jahre 70 in den ersten drei Jahrhunderten n. Chr. (TANZ 24), Tübingen 1998. Hendrik Jan Willem Drijvers, Cults and Beliefs at Edessa (EPRO 82), Leiden 1980. Ders., Jews and Christians at Edessa, in: JJS 36 (1985), 88–102. Judith Frishman / Lucas van Rompay (Eds.), The Book of Genesis in Jewish and Oriental Christian Interpretation. A Collection of Essays (TEG 5), Leuven 1997. Robert Goldenberg, Early Rabbinic Explanations of the Destruction of Jerusalem, in: JJS 33, 1982.
148
Eusebius von Emesa und die Juden
Robert Barend ter Haar Romeny, A Syrian in Greek Dress. The Use of Greek, Hebrew, and Syriac Biblical Texts in Eusebius of Emesa’s Commentary on Genesis (TEG 6), Leuven 1997. Eusebius of Emesa’s Commentary on Genesis and the Origins of the Antiochene School, in: The Book of Genesis in Jewish and Oriental Christian Interpretation A Collection of Essays (TEG 5), Leuven 1997, 125–142. Richard P.C. Hanson, The Search for the Christian Doctrine of God. The Arian Controversy 318–381, Edinburgh 1988. Sten Hidal, Exegesis in the Antiochene School, in: Hebrew Bible / Old Testament. The History if its Interpretation, Vol. 1, Antiquity, ed. by Magne Sæbø, Göttingen 1996. Adam Kamesar, Jerome, Greek Scholarship, and the Hebrew Bible. A Study of the Quaestiones Hebraicae in Genesim, Oxford Classical Monographs, Oxford 1993. Wolfram Kinzig, Philosemitismus, in: ZKG 105 (1994), 202–228; 362–383. Johann Maier, Jüdische Auseinandersetzung mit dem Christentum in der Antike (EdF 177), Darmstadt 1982. Françoise Petit (Hg.), Catenae Graeca in Genesim et in Exodum 1. Catena Sinaitica (CChrSG 2), Turnhout 1977. Dies.: Catenae Graeca in Genesim et in Exodum 2. Collection Coisliniana in Genesim (CChr.SG 15), Turnhout 1986. Dies.: La Chaîne sur la Genèse. Édition Intégrale (TEG 1–4), Leuven 1991–96. Dies.: Les fragments grecs d’Eusèbe d’Émèse et de Théodore de Mopsueste: l’apport de Procope de Gaza, in: Le Museon 104, 1991, 349–354. Lucas van Rompay, Antiochene Biblical Interpretation: Greek and Syriac, in: The Book of Genesis in Jewish and Oriental Christian Interpretation. A Collection of Essays, ed. by Judith Frishman / Lucas van Rompay (TEG 5), Leuven 1997, 103–123. Hans-Peter Stähli, Antike Synagogenkunst, Stuttgart 1988. Günter Stemberger, Juden und Christen im Heiligen Land, München 1987. Jörg Ulrich, Euseb von Caesarea und die Juden (PTS 49), Berlin 1999. Maurice F. Wiles, The Theology of Eusebius of Emesa (StPatr 19), Leuven 1989.
„Wer selig werden will, muss glauben.“ Das athanasianische Glaubensbekenntnis – Geschichte und Bedeutung
In der heutigen Zeit ruft das sonntägliche Sprechen des apostolischen Glaubensbekenntnisses im Gottesdienst bei einigen Menschen zwiespältige Gefühle hervor. Sie fühlen sich eingeengt von einem alten Text, der nicht in allen Punkten dem entspricht, was sie selbst glauben. Aus diesem Unbehangen ist mit Unterstützung namhafter Theologen sogar eine Bewegung zur Schaffung neuer Glaubensbekenntnisse hervorgegangen1. Zugleich gibt es seit einigen Jahren eine Flut von Kommentaren zum Credo2. Gemeinsam ist diesen Veröffentlichungen, dass sie versuchen, eine Brücke vom „alten“ Text und seinen Inhalten zu den Lebenswirklichkeiten der Menschen zu schlagen, die diesen Text lernen und sprechen. Als Beispiel sei hier ein Abschnitt aus dem Klappentext zu Eugen Biser, Glaubensbekenntnis und Vaterunser, zitiert: Eine Neuinterpretation des Glaubens ist angesagt! Das heißt gewiss nicht, dass die Glaubensartikel mit neuen Inhalten versehen werden sollten, wohl aber, dass sie auf neue, dem gegenwärtigen Menschen einleuchtende Weise zur Sprache gebracht werden müssen, weil sich die wachsende Entfremdung, wenn überhaupt, nur so überbrücken lässt. Mit der stereotypen Wiederholung des „alten Wahren“ ist es nicht mehr getan. Vielmehr muss der Bann der Entfremdung gebrochen werden. Und das ist nur dann erreicht, wenn sich der Glaubende im Geglaubten wieder erkennt, wenn er sich von ihm in seiner Wesenstiefe angesprochen fühlt und wenn er in ihm die definitive Antwort auf seine Sinnfrage vernimmt3. 1 Jörg Zink, Das christliche Bekenntnis. Ein Vorschlag, Stuttgart 1996. 2 Wolfhart Pannenberg, Das Glaubensbekenntnis ausgelegt und verantwortet vor den Fragen der Gegenwart, 6. Aufl., Gütersloh 1995; Ulrich Kühn, Christlicher Glaube nach 2000 Jahren. Eine Auslegung des apostolischen Glaubensbekenntnisses, Leipzig 1999; Joseph Kardinal Ratzinger, Einführung in das Christentum. Vorlesungen über das apostolische Glaubensbekenntnis mit einem neuen einleitenden Essay, München 2000; Hans Küng, Credo. Das apostolische Glaubensbekenntnis – Zeitgenossen erklärt, 5. Aufl., München 1995; Norbert Scholl, Das Glaubensbekenntnis Satz für Satz erklärt, München 2000; Klaus Hofmeister / Lothar Bauerochse, Bekenntnis und Zeitgeist. Das christliche Glaubensbekenntnis neu befragt, Würzburg 1997; Theodor Schneider, Was wir glauben. Eine Auslegung des apostolischen Glaubensbekenntnisses, 4. Aufl., Düsseldorf 1991. 3 Klappentext zu Eugen Biser, Glaubensbekenntnis und Vaterunser, 2. Aufl., Düsseldorf 1994.
150
Das athanasianische Glaubensbekenntnis – Geschichte und Bedeutung
Diesem Text kann man nicht nur eine verkaufsfördernde Wirkung unterstellen, sondern auch einen Ausdruck der Stimmungslage im Umgang mit Texten, die den Glauben zu normieren scheinen. Und als solcher wird das apostolische Glaubensbekenntnis auch in den evangelischen Kirchen wahrgenommen, in denen eigentlich nur die Heilige Schrift bestimmende Norm (norma normans) sein soll. Ausgehend von diesem neuzeitlichen Unbehangen an festen Behauptungen über den Glauben ist das sog. athanasianische Glaubensbekenntnis ein Unding. Es ist ein Text, der mit großer Härte die Verbindung zwischen bestimmten zu glaubenden Sätzen und dem ewigem Heil formuliert, von mir im Titel für den heutigen Abend auf die Kurzformel gebracht „Wer selig werden will, muss glauben“. Diese Härte wurde in unserem Jahrhundert deutlich empfunden und so hat das Athanasianum seinen Platz in der Liturgie weitgehend verloren. Die Lutherischen Kirchen benutzen es nur noch selten in den Gottesdiensten am Trinitatisfest, die römisch-katholische Kirche hat es aus dem Brevier gestrichen, in dem es früher in der Prim am Sonntagmorgen seinen Platz hatte, nur die anglikanischen Kirchen benutzen es noch in den Morgengottesdiensten an einigen Festtagen.
Der Text des athanasianischen Glaubensbekenntnisses
Symbolum Athanasii4 contra Arianos scriptum
Bekenntnis des Athanasius5 gegen die Arianer geschrieben
(1) Quicunque vult salvus esse, ante omnia opus est, ut teneat catholicam fidem,
(1) Für den der selig werden will, ist es vor allem notwendig, den christlichen Glauben festzuhalten,
(2) quam nisi quisque integram inviolatamque servaverit, absque dubio in aeternum peribit.
(2) wenn jemand diesen nicht vollständig und unbeschädigt bewahrt, wird er ohne Zweifel in Ewigkeit verloren sein.
(3) Fides autem catholica haec est, ut unum (3) Dies ist aber der christliche Glaube, dass Deum in trinitate et trinitatem in unitate wir den einen Gott in Dreieinigkeit und die veneremur, Dreieinigkeit in Einheit verehren,
4 Lateinischer Text nach BSELK 28–30. Zur Textkritik vgl. John Norman Davidson Kelly, The Athanasian Creed, London 1964, 20–24. Nummerierung nach Denzinger/Vorgrimler. 5 Deutsche Übersetzung: Ralph Hennings. Die Übersetzung „christlich“ für catholicam entspricht der vorreformatorischen Übersetzung des apostolischen Glaubensbekenntnisses, die in den deutschen evangelischen Kirchen rezipiert wurde.
Das athanasianische Glaubensbekenntnis – Geschichte und Bedeutung
(4) neque confundentes personas, neque substantiam separantes.
151
(4) indem wir weder die Personen vermischen, noch die Substanz trennen.
(5) Alia est enim persona patris, alia filii, alia (5) Denn es ist eine andere Person des spiritus sancti: Vaters, eine andere des Sohnes, eine andere des Heiligen Geistes: (6) Sed patris et filii et spiritus sancti una est (6) Aber Vater, Sohn und Heiliger Geist sind eine Gottheit, haben gleiche Ehre und divinitas, aequalis gloria, coaeterna majestas. gleichewige Herrlichkeit. (7) Qualis pater, talis filius, talis et spiritus sanctus:
(7) Wie der Vater so der Sohn, so der heilige Geist:
(8) Increatus pater, increatus filius, increatus (8) Ungeschaffen ist der Vater, ungeschaffen spiritus sanctus. ist der Sohn, ungeschaffen ist der Heilige Geist. (9) Immensus pater, immensus filius, immensus spiritus sanctus.
(9) Unermesslich ist der Vater, unermesslich ist der Sohn, unermesslich der Heilige Geist.
(10) Aeternus pater, aeternus filiius, aeternus spiritus sanctus,
(10) Ewig ist der Vater, ewig ist der Sohn, ewig ist der Heilige Geist
(11) et tamen non tres aeterni, sed unus aeternus;
(11) und dennoch sind es nicht drei Ewige, sondern ein Ewiger,
(12) sicut non tres increati, nec tres immensi, (12) also nicht drei Ungeschaffene, nicht sed unus increatus et unus immensus. drei Unermessliche, sondern ein Ungeschaffener und ein Unermesslicher. (13) Similiter omnipotens pater, omnipotens (13) Ebenso ist der Vater allmächtig, der filius, omnipotens spritus sanctus, Sohn allmächtig und der Heilige Geist allmächtig, (14) et tamen non tres omnipotentes, sed unus omnipotens.
(14) und dennoch sind es nicht drei Allmächtige, sondern ein Allmächtiger.
(15) Ita Deus pater, Deus filius, Deus spiritus (15) So ist der Vater Gott, der Sohn ist Gott, sanctus, der Heilige Geist ist Gott, (16) et tamen non tres Dii, sed unus Deus.
(16) und dennoch sind es nicht drei Götter, sondern ein Gott.
(17) Ita Dominus pater, Dominus filius, Dominus spiritus sanctus,
(17) So ist der Vater der Herr, der Sohn der Herr und der Heilige Geist der Herr,
(18) et tamen non tres Domini, sed unus Dominus.
(18) und dennoch sind es nicht drei Herren, sondern ein Herr.
152
Das athanasianische Glaubensbekenntnis – Geschichte und Bedeutung
(19) Quia sicut singillatim unamquamque personam et Deum et Dominum confiteri christiana veritate compellimur,
(19) Weil wir einerseits von der christlichen Wahrheit gezwungen werden, jede einzelne Person als Gott und Herr zu bekennen,
(20) ita tres Deos et Dominum dicere catholica religione prohibemur.
(20) so verbietet uns andererseits die christliche Religion, von drei Göttern und Herren zu sprechen.
(21) Pater a nullo est factus,nec creatus, nec (21) Der Vater ist von niemandem genitus. geschaffen, weder geschaffen noch gezeugt. (22) Filius a patre solo est, non factus nec creatus, sed genitus.
(22) Der Sohn ist allein vom Vater, nicht gemacht, nicht geschaffen, sondern gezeugt.
(23) Spiritus sanctus a patre et filio, non factus nec creatus, nec genitus, sed procedens.
(23) Der Heilige Geist ist vom Vater und vom Sohn, nicht gemacht, nicht geschaffen, sondern hervorgehend.
(24) Unus ergo pater, non tres pateres, unus (24) Also ein Vater, nicht drei Väter; ein filius, non tres filii, unus spiritus sanctus, Sohn, nicht drei Söhne; ein Heiliger Geist, non tres spiritus sancti. nicht drei Heilige Geister. (25) Et in hac trinitate nihil prius aut posterius, nihil maius aut minus,
(25) Und in dieser Dreieinigkeit ist nichts früher oder später, nichts größer oder kleiner,
(26) sed totae tres personae coaeternae sibi sunt et coaequales:
(26) sondern alle drei Personen sind miteinander gleichewig und gleich beschaffen:
(27) Ita ut per omnia, sicut iam supra dictum (27) Sodass, wie schon oben gesagt ist, in est, et trinitas in unitate et unitas in trinitate allem sowohl die Dreieinigkeit in Einheit, als veneranda sit. auch die Einheit in Dreieinigkeit verehrt werden muss. (28) Qui vult ergo salvus esse, ita de trinitate (28) Wer also selig werden will, muss so über sentiat. die Dreieinigkeit denken. (29) Sed necessarium est ad aeternam salutem, ut incarnationem quoque Domini Jesu Christis fideliter credat.
(29) Aber es ist zum ewigen Heil notwendig, dass man auch die Menschwerdung des Herrn Jesus Christus verlässlich glaubt.
(30) Est ergo fides recta, ut credamus et (30) Der richtige Glaube ist, dass wir glauben confiteamur, quia Dominus noster Christus und bekennen, dass unser Herr Christus, Dei filius, et Deus pariter et homo est: Gottes Sohn, Gott und ebenso Mensch ist: (31) Deus est ex substantia patris ante saecula genitus, et homo est ex substantia matris in saecula natus.
(31) Er ist Gott, aus der Substanz des Vaters, vor der Zeit geboren und er ist Mensch aus der Substanz der Mutter in der Zeit geboren.
Das athanasianische Glaubensbekenntnis – Geschichte und Bedeutung
153
(32) Perfectus Deus, perfectus homo, ex anima rationabili et humana carne subsistens.
(32) Vollkommen Gott und vollkommen Mensch, bestehend aus vernunftbegabter Seele und menschlichem Fleisch.
(33) Aequalis patri secundum divintate, minor parte,secundum humanitatem.
(33) Dem Vater gleich gemäß der Gottheit, ihm gegenüber geringer gemäß der Menschheit.
(34) Qui licet Deus sit et homo, non duo tamen, sed unus est Chritus.
(34) Obwohl er Gott und Mensch ist, ist er dennoch nicht zwei, sondern ein Christus.
(35) Unus autem non conversione divinitatis (35) Er ist einer, nicht durch die in carne, sed adsumptione humanitatis in Verwandlung der Gottheit in Fleisch, Deo. sondern durch die Annahme der Menschheit in Gott (36) Unus omnino non confusione substantiae, sed unitate personae.
(36) Er ist einer, auf keinen Fall in Vermischung der Substanzen, sondern in der Einheit einer Person.
(37) Nam sicut anima rationabilis et caro unus est homo, ita Deus et homo unus est Christus.
(37) Denn so wie vernunftbegabte Seele und Fleisch ein Mensch sind, so ist Gott und Mensch ein Christus.
(38) Qui passus est pro salute nostra, descendit ad inferos, surrexit a mortuis,
(38) Der gelitten hat für unser Heil, hinuntergestiegen ist in die Unterwelt, auferstanden von den Toten,
(39) ascendit ad caelos, sedit ad dexteram patris, inde venturus judicare vivos et mortuos,
(39) aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten des Vaters, von dort wird er kommen zu richten die Lebenden und die Toten,
(40) ad cuius adventum omnes homines resurgere habent cum corporibus suis et reddituri sunt de factis propriis rationem:
(40) bei dessen Ankunft alle Menschen auferstehen müssen mit ihren Körpern und Rechenschaft geben müssen über ihre eigenen Taten.
(41) Et qui bona egerunt, ibunt in vitam aeternam, qui mala, in ignem aeternum.
(41) Und die Gutes getan haben, werden in das ewige Leben gehen, die Schlechtes getan haben, in das ewige Feuer.
(42) Haec est fides catholica, quam nisi quisque fideliter firmiterque crediderit, salvus ese non poterit.
(42) Das ist der christliche Glaube, wenn jemand den nicht verlässlich und fest glaubt, kann er nicht selig werden.
154
Das athanasianische Glaubensbekenntnis – Geschichte und Bedeutung
Kein Bekenntnis und nicht von Athanasius John Norman Davidson Kelly eröffnet seine bis heute maßgebliche Monographie über das Athanasianum mit den Worten: „Die beiden einzigen sicheren Fakten über das athanasianische Glaubensbekenntnis sind, dass es weder ein Glaubensbekenntnis ist, noch von Athanasius stammt“6. Damit ist ein Großteil der Forschungsproblematik um dieses Stück altkirchlicher Literatur umrissen. Es ist schon lange beobachtet worden, dass das so genannte athanasianische Glaubensbekenntnis im formalen Sinne kein Bekenntnis ist. Bereits Thomas von Aquin urteilt „Athanasius hat sein Manifest des Glaubens nicht in der Form eines Bekenntnisses verfasst, sondern in der Form einer dogmatischen Lehraussage“7. Dass der Bischof Athanasius von Alexandria nicht der Autor sein kann, wurde zum ersten Mal von Joachim Camerarius 1547 ausgesprochen. Camerarius war ein enger Freund von Philipp Melanchthon, lehrte in Wittenberg und wurde schließlich Professor für Griechisch in Tübingen. Hier veröffentlichte er eine Edition der griechischen Katechesen, in der er sich kritisch zur Autorschaft des Athanasius äußerte. Der darauf losbrechende Sturm der Entrüstung veranlasste ihn, in seiner lateinischen Übersetzung von 1563 diesen Passus zu entfernen8. Die spätere Forschung distanzierte sich dennoch von der Prämisse, dieses Bekenntnis müsse von dem berühmten Kirchenvater Athanasius stammen. Es konnte nachgewiesen werden, dass der Text des Athanasianums ohne Verfasserangabe in Schriften des 6. Jahrhunderts belegt ist und auf der Synode von Autun im Jahre 670 Athanasius zum ersten Mal als Autor dieses Textes genannt wird. Vor der ersten zaghaften Kritik an der Verfasserschaft des Athanasius war das Bekenntnis aber schon in Sammlungen der kanonischen Texte der Kirchen der Reformation aufgenommen worden. Als erste nimmt die anglikanische Kirche die drei altkirchlichen Bekenntnisse Apostolikum, Nicäno-Konstantinopolitanum und Athanasianum in ihre Ten Articles von 1536 auf. Im lutherischen Bereich beziehen sich die Confessio Augustana von 1530 und dann das Konkordienbuch von 1580 ausdrücklich auf die gleichen drei altkirchlichen Bekenntnisse. In der römisch-katholischen Kirche ist dieses Bekenntnis ebenfalls Teil der dogmatischen Grundlagen und hat dort durch seine Verwendung in zahlreichen Synoden auch kirchenrechtliche Relevanz. Damit gehört das Athanasianum zum 6 Kelly (Anm. 4), 1. In seiner Tübinger Antrittsvorlesung hat sich Volker Henning Drecoll mit dem Athanasianum auseinandergesetzt und noch stärker als bisher darauf hingewiesen, dass das Athanasianum eine Kompilation augustinischer Gedanken ist. Volker Henning Drecoll, Das Symbolum Quicumque als Kompilation augustinischer Tradition, in: ZAC 11 (2007), 30–56. 7 Thomas von Aquin, Summa theologiae 2/2 I,10,3. 8 Kelly, Athanasian Creed (Anm. 4), 3; Heinz Scheible, Camerarius, Joachim, in: RGG4 2 (1999), 43.
Das athanasianische Glaubensbekenntnis – Geschichte und Bedeutung
155
dogmatischen Kernbestand der großen westlichen Kirchen. Die Pfarrerinnen und Pfarrer werden in der Ordination darauf verpflichtet und es fand und findet Gebrauch in gottesdienstlichen Vollzügen.
Gattung Im Athanasianum lassen sich schnell zwei Teile unterscheiden, der erste handelt von der Trinität, der zweite von der Christologie9. Den Rahmen um die beiden Teile bilden drei Formeln, in denen der Zusammenhang zwischen dem (richtigen) Glauben und dem ewigen Leben konstituiert wird. 1. Am Beginn steht die Einleitungsformel „(v.1) Für den der selig werden will, ist es vor allen notwendig, den christlichen Glauben festzuhalten, wenn jemand diesen nicht vollständig und unbeschädigt bewahrt, wird er ohne Zweifel in Ewigkeit verloren sein“. 2. An der Nahtstelle zwischen Trinitätslehre und Christologie findet sich eine Überleitung, die beide Teile als heilsnotwendig kennzeichnet (vv.28+29) „Wer also selig werden will, muss so über die Dreieinigkeit denken. Aber es ist zum ewigen Heil notwendig, dass man auch die Menschwerdung des Herrn Jesus Christus verlässlich glaubt.“ 3. Am Schluss steht eine Zusammenfassung, die das ganze apodiktisch beschließt: „(v.42) Das ist der christliche Glaube, wenn jemand den nicht verlässlich und fest glaubt, kann er nicht selig werden“. Diese so genannten Verdammungsformeln bilden heute den anstößigsten Teil des Textes. Sie sind wahrscheinlich dafür verantwortlich, dass die westlichen Kirchen in denen das Athanasianum im gottesdienstlichen Gebrauch war, im Lauf des letzten Jahrhunderts davon Abschied genommen haben. Diese „starken Worte“ wollte man dem „modernen Zeitgeist“ nicht mehr zumuten. Dazu kommt, dass im Athanasianum auch eine Einleitungsformel fehlt wie sie aus den geläufigen Glaubensbekenntnissen bekannt ist, also etwa „Ich glaube“ oder „Wir glauben“. In den beiden Hauptteilen des Athanasianums finden sich auch sonst kaum Formulierungen, die wir aus dem Apostolikum oder dem Nicäno-Konstantinopolitanum kennen. Es ist im Gegensatz zu diesen beiden auch nicht dreigliedrig aufgebaut, sondern enthält nur zwei Teile. Der einzige Abschnitt, der auffällige Parallelen enthält ist vv.38+39(40). Hier liegt die Aufnahme einer
9 Diese Beobachtung hat zu der von Swainson und anderen vertretenen Hypothese geführt, das Athanasianum sei von Hinkmar von Reims im 8. Jahrhundert aus zwei Stücken kompiliert worden, Charles Anthony Swainson, The Nicene and Apostle’s Creed, London 1875.
156
Das athanasianische Glaubensbekenntnis – Geschichte und Bedeutung
traditionellen Formulierung vor, die sich so auch in den anderen beiden bekannteren Bekenntnissen findet. Im Rahmen der Vielzahl von altkirchlichen Glaubensbekenntnissen ist das Athanasianum allerdings kein Einzel- oder Sonderfall. Es gibt eine Vielzahl von Glaubensbekenntnissen, die zu den unterschiedlichsten Anlässen entstanden sind und unterschiedliche Verbindlichkeit und Verbreitung haben10. Darunter auch zahlreiche Glaubensbekenntnisse, die einzelnen Personen zugeordnet werden, etwa das „Glaubensbekenntnis des Damasus“ (fides Damasi) oder die „Glaubensregel“ (regula fidei) Gregors des Großen, und deshalb nicht mit „wir glauben beginnen“. Ebenso finden sich auch zweigliedrige Bekenntnisse, die einen trinitarischen und einen christologischen Teil miteinander verbinden11. Vor allem eine Gruppe von Bekenntnissen aus dem spanischen Raum hat ganz ähnliche Strukturen.12. Was das Athanasianum besonders macht ist, sein lehrhafter Charakter. Sowohl die insgesamt unpolemische Sprache, als auch die Ausführlichkeit der Ausführungen weisen darauf hin, dass das Bekenntnis nicht in der Hitze des Gefechts einer wie auch immer gearteten dogmatischen Kontroverse entstanden ist. Das oben zitierte Urteil Thomas von Aquins scheint dem Sachverhalt angemessen, selbst wenn Athanasius nicht der Autor ist: „Athanasius hat sein Manifest des Glaubens nicht in der Form eines Bekenntnisses verfasst, sondern in der Form einer dogmatischen Lehraussage“.
Stil Der Text des Athanasianums macht bereits beim ersten Lesen einen wohl abgewogenen und durchkomponierten Eindruck. Die Ausführlichkeit und das strenge Durchhalten der Dreiergruppen im ersten Teil, wie etwa vv.7–10, vermitteln beinahe den Eindruck eines doxologischen oder hymnischen Stils. Im Lateinischen ist der Text in einer rhythmischen Prosa verfasst, die diesen Eindruck noch verstärkt. Obwohl nicht dazu gedacht, trug es dazu bei, dass das 10 John Norman Davidson Kelly, Altchristliche Glaubensbekenntnisse, Göttingen 1972. 11 Kelly, Athanasian Creed (Anm. 4), 55. Vgl. Ders, Altchristliche Glaubensbekenntnisse, Göttingen 1972, Abschn. I u. III. In neuerer Zeit hat Michael Kohlbacher eine umfangreiche Sammlung von Bekenntnistexten aus dem östlichen Christentum vorgelegt, die einen Bezug zum Athanasianum aufweisen, ohne dass dadurch die Verfasserfrage geklärt würde. Michael Kohlbacher, Das Symbolum Athanasianum und die orientalische Bekenntnistradition. Formgeschichtliche Anmerkungen, in: M. Tamcke (Hg.), Syriaca II. Beiträge zum 3. deutschen Syrologen-Symposium in Vierzehnheiligen 2002 (Studien zur Orientalischen Kirchengeschichte 33), Münster 2004, 105–164. 12 Kelly, Athanasian Creed (Anm. 4), 54–59 hat daran seine These über den Ursprungsort des Athanasianums festgemacht.
Das athanasianische Glaubensbekenntnis – Geschichte und Bedeutung
157
Athanasianum in der Messe problemlos gesungen werden konnte. Die stilkritischen Untersuchungen zum Athanasianum zeigen, dass es in der Übergangsperiode von der älteren lateinischen Metrik mit ihrem quantitativen System zu einer akzentorientierten Rhythmik entstanden ist. Die einzelnen Verse berücksichtigen beide Systeme. Wie Kelly gezeigt hat, lässt sich der gesamte Text in beiden Systemen sinnvoll beschreiben13. Stilistisch fällt darüber hinaus die sehr formale Konstruktion der einzelnen Verse auf. Trotz der rhythmischen Prosa gibt es kaum Nähen zur Poesie. Vieles wirkt beinahe schulmeisterlich wie z. B. das „wie schon oben gesagt“ in v.27. Ansonsten sind es die aneinander gereihten Aussagesätze, die lehrhaft wirken. In vielem macht es den Eindruck, als ob theologische Debatten systematisiert werden und jetzt durch ihre formelhafte Zusammenstellung zum einen den „rechten Glauben“ festschreiben, zum anderen diese orthodoxe Lehre lern- und lehrbar machen. Das wirft auch Licht auf den möglichen Entstehungszeitraum.
Entstehung Durch die Überschrift, die in der jetzigen Fassung über dem Bekenntnis steht, wird der Eindruck erweckt, der Text stamme aus der Feder des Athanasius von Alexandrien (299?-2.5.373) und sei von ihm in der Auseinandersetzung mit den Arianern verfasst worden. Damit müsste der Text in der Mitte des vierten Jahrhunderts entstanden, Griechisch verfasst sein und auf die aktuellen Auseinandersetzungen Bezug nehmen. All das ist nicht der Fall. Der Text liegt in seinen älteren Handschriften ausschließlich in Latein vor. Griechische Übersetzungen gibt es erst aus dem 12. Jhdt, seitdem hat der Text im Bereich der orthodoxen Kirche eine eigene und eigentümliche Wirkungsgeschichte, auf die hier aber nicht eingegangen werden soll. Die sichersten Hinweise zur Entstehungszeit geben die ersten Zeugnisse des Textes in Handschriften und den Werken von anderen Autoren, die das Bekenntnis ganz oder teilweise zitieren. Der erste sichere Beleg ist eine Handschrift aus dem Kloster Zwiefalten. Dort wird das Athanasianum einer Sammlung von Predigten des Caesarius von Arles vorangestellt. Dazu gibt die, wahrscheinlich von Cäsarius selbst stammende Einleitung folgende Begründung: „Weil es notwendig und pflichtgemäß ist, dass alle Kleriker – und auch Laien – mit dem christlichen Glauben vertraut sein sollen, haben wir als erstes in dieses Buch geschrieben, wie die heiligen Väter jenen Glauben definiert haben“14. Caesarius 13 Kelly, Athanasian Creed (Anm. 4), 60–65. 14 Kelly, Athanasian Creed (Anm. 4), 36. Zitat aus dem Zwiefaltener Codex, Stuttgart, Theol.Philos. fol. 201.
158
Das athanasianische Glaubensbekenntnis – Geschichte und Bedeutung
war von 502 bis 542 Bischof von Arles. Er selbst hat die Sammlung seiner Predigten veranlasst und ist auch für das vorangestellte Bekenntnis verantwortlich. Diese Entdeckung von Germain Morin in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts hat die gesamte Debatte um den Ursprung des Athanasianums neu belebt15. Dass sich daraus aber kein terminus ante quem für die Entstehung des Athanasianums ergibt, hat Volker Henning Drecoll überzeugend nachgewiesen16. Der Text ist so stark von Augustinus und späteren Rezipienten augustinischer Theologie abhängig, dass man von einem Kompilator als Autor ausgehen muss. Als Entstehungsraum bietet sich der Bereich des lateinisch sprechenden Galliens an, dazu kommen noch Italien oder Spanien17. Darüber gibt es in der Forschung verschiedene Vermutungen, von denen aber bis jetzt keine zur herrschenden Meinung geworden ist. Nähere Aufschlüsse über die Entstehung gibt eine inhaltliche Einordnung in die trinitarischen, christologischen und pneumatologischen Debatten des 5./6. Jahrhunderts.
Trinitätslehre Hier zeigt sich vor allem im ersten Teil eine deutliche Abhängigkeit vom Gedankengut Augustins. Damit ergibt sich für die Frage der Datierung ein sicherer terminus post quem von 430, dem Jahr in dem Augustinus gestorben ist. Dass viele Formulierungen des Athanasianums eher formelhaft wirken und keine Reflexe der vielschichtigen Denkbewegungen Augustins erkennen lassen, erlaubt den Schluss, dass das Bekenntnis nicht allzu rasch nach dem Ableben Augustins verfasst wurde. In einer tabellarischen Übersicht sind einige Beispiele zusammengestellt, die einen schnellen Vergleich der entsprechenden Texte des Athanasianums und Zitaten aus verschiedenen Schriften Augustins erlauben18.
15 Germain Morin, L’origine du symbole d’Athanase: Témoinage inédit de S.Césaire d’Arles, RBen 44 (1932), 207–219. 16 Drecoll (Anm. 6). 17 Die in der älteren Forschung vertretene These einer Entstehung des Athanasianums in Nordafrika kann inzwischen ausgeschieden werden. 18 Drecoll (Anm. 6), 54–56 führt in seiner Textsynopse eine große Zahl weitere Belege für die kompilatorische Technik im Athanasianum an.
Das athanasianische Glaubensbekenntnis – Geschichte und Bedeutung
Athanasianum
159
Augustinus
(6) Sed patris et filii et spiritus sancti una est Trinitas est, sed una operatio, una maiestas, una aeternitas, una coaeternitas divinitas, aequalis gloria, coaeterna (De trin. 7,12) majestas. (13) Similiter omnipotens pater, omnipotens filius, omnipotens spritus sanctus,
Et omnipotens Pater, omnipotens filius, omnipotens filius, omnipotens spiritus sanctus:
(14) et tamen non tres omnipotentes, sed nec tamen tres dii, aut tres boni, aut tres unus omnipotens. (15) Ita Deus pater, Deus omnipotentes, sed unus Deus, bonus, filius, Deus spiritus sanctus, (16) et tamen omnipotens, ipsa trinitas (De trin. 1,8) non tres Dii, sed unus Deus. (17) Ita Dominus pater, Dominus filius, Dominus spiritus sanctus, et tamen non tres Domini, sed unus Dominus. (33) Aequalis patri secundum divintate, minor parte, secundum humanitatem.
Aequalem patri secundum divinitatem, minorem autem patre secundum carnem, hoc est secundum hominem (Ep. 137,12) Agnoscamus geminam substantiam Christi, divinam scilicet qua aequalis est patri, humanam qua minor est patri […] utrumque autem simul non duo sed unus est Christus […]
(34) Qui licet Deus sit et homo, non duo tamen, sed unus est Chritus.
Aequalem patri secundum divinitatem, minorem autem patre secundum carnem, hoc est secundum hominem (Ep. 137,12) Agnoscamus geminam substantiam Christi, divinam scilicet qua aequalis est patri, humanam qua minor est patri […] utrumque autem simul non duo sed unus est Christus […]
(37) Nam sicut anima rationabilis et caro unus est homo, ita Deus et homo unus est Christus.
Sicut enim unus est homo anima rationalis et caro, sic unus Christus Deus et homo (In Joh. Ev. tr. 78,3)
Christologie Der christologische Teil des Athanasianums erlaubt eine noch weitergehende Eingrenzung der Entstehungszeit. Für die Kenner der Debatten des 4. und 5. Jahrhunderts, um die rechte Lehre vom Wesen des Gottessohnes Jesus Christus, ergeben sich bereits beim ersten Lesen Hinweise auf den Diskussionsstand, den das Athanasianum erreicht. Man vermisst die berühmte christologische Formel
160
Das athanasianische Glaubensbekenntnis – Geschichte und Bedeutung
des Konzils von Chalcedon (451) vom Christus in einer Person (πρόσωπον) aber in zwei Naturen (φύσεις) die unvermischt, unverwandelt, ungetrennt und ungesondert erkannt werden19. Auch wenn das Athanasianum sachlich der Aussage des Konzils nicht widerspricht, lässt das Fehlen dieser auch im Westen bald bekannt gewordenen christologischen Formel darauf schließen, dass es vor 451 verfasst wurde. Dazu würde passen, dass in v.31.35+36 deutlich gegen nestorianische Tendenzen Stellung bezogen wird. Die Debatte zwischen Nestorius von Konstantinopel und Cyrill von Alexandrien bestimmte das Vorfeld des Konzils von 451. Die Äußerungen im v.37 des Athanasianums, die sich gegen den seit 377 als Irrlehrer verurteilten Apollinaris von Laodicea richtet, wirkt dagegen nicht so pointiert, sondern eher schulmäßig. Dass Christus Seele und Fleisch hatte, ist für den Verfasser des Athanasianums klar und wird eindeutig festgestellt, aber von einer aktuellen Debatte darüber ist dabei nichts zu spüren. Eine wichtige Entdeckung zur Beantwortung der Frage nach der Entstehung des Athanasianums wurde 1940 von José Madoz in einer Handschrift des 11./ 12. Jahrhunderts gemacht. Er fand einen trinitätstheologischen Traktat, der im Wesentlichen aus Exzerpten aus Werken Augustins besteht und den er auf Grund weiterer stilkritischer Analysen dem Vinzenz von Lérins20 zugeschrieben hat. Vinzenz lebte bis ca. 459 auf der Mittelmeerinsel Lérins (heute St. Honorat, vor Cannes gelegen). In dem ihm von Madoz zugeschriebenen Excerpta findet sich der christologische Teil des Athanasianums, zum Teil in wörtlichen Parallelen. Das hat zum einen die Vermutung nahegelegt, Vinzenz sei der Verfasser des Athanasianums, zum anderen die Frage aufgeworfen, welcher Text älter ist. Inzwischen hat sich die Meinung durchgesetzt, dass der Text des Vinzenz als Vorlage oder Ausgangsmaterial für die endgültige Formulierung des Athanasianums gewesen ist. Vinzenz von Lérins wird in der neueren Forschung nicht mehr als möglicher Verfasser des Bekenntnisses angesehen21.
Pneumatologie Ein entscheidendes Stück westlicher Pneumatologie hat im Athanasianum Platz gefunden. In v.23 wird festgestellt, dass der Heilige Geist nicht nur vom Vater ausgeht, sondern gleichermaßen aus dem Vater und dem Sohn. Diese Vorstellung ist später als westlicher Zusatz in das Bekenntnis von Nicäa-Konstantinopel 19 Übersetzung nach A. Martin Ritter, Alte Kirche (Kirchen- und Theologiegeschichte in Quellen 1), 2. Aufl., Neukirchen 1982, 221. 20 Klaus-Gunther Wesseling, Vinzenz von Lerin, in: BBKL 12 (1997) 1432–1436. 21 In der älteren Forschung vor allem von Hugo Koch, Vinzenz von Lérins und Marius Mercator, in: ThQ 81 (1899) und Vinzenz von Lérins und Gennadius. Ein Beitrag zur Literaturgeschichte des Semipelagianismus (TU 31,2), Leipzig 1907.
Das athanasianische Glaubensbekenntnis – Geschichte und Bedeutung
161
aufgenommen worden. Dort heißt es seit 1014, dass der Heilige Geist vom Vater und dem Sohn (lat. filioque) ausgeht. Das damit implizierte trinitarische Denken geht wiederum auf Augustinus zurück. Er versteht den Heiligen Geist vor allem als die wechselseitige Gemeinschaft der Liebe zwischen Vater und Sohn (De trin. XV 19,36f). Deshalb geht er auch vom Vater und dem Sohn hervor, wenn Augustin auch einräumt, dass er principaliter vom Vater ausgeht (De trin. XV 26,45.47). Diese Vorstellung findet sich bei westlichen Theologen durchgängig und ist sogar schon vor Augustin angelegt (vgl. die untenstehende Tabelle). Das filioque ist ein entscheidender Beleg dafür, dass das Athanasianum nicht im Osten entstanden sein kann, denn die östlichen Kirchen haben diese Vorstellung immer entschieden bekämpft. In der Wirkungsgeschichte des Athanasianums in den orthodoxen Kirchen des hohen und ausgehenden Mittelalters hat das zur Auslassung von v.23 geführt und dazu, dass man das derart gekürzte Bekenntnis als Beweis gegen die westliche Lehre benutzt hat, indem man sich auf die angebliche Verfasserschaft des Athanasius berief, um das filioque als „neu“ und westliche Irrlehre zurückzuweisen. Eine tabellarische Übersicht aus der Zeit der Entstehung des Athanasianums belegt, wie weit verbreitet die Einfügung des filioque bzw. der Gedanke des doppelten Ursprungs des Hl. Geistes aus Vater und Sohn war.
Das filioque in westlichen Texten des 4.–6. Jahrhunderts Athanasianum
Spiritus sanctus a patre et filio, non factus nec creatus, nec genitus, sed procedens (v.23)
Ambrosius (333/4–397)
Spiritus quoque sanctus, cum procedit a patre et filio (De spir. sanct. 1,120) Qui neque factus est, sicut omnia, nec creatus (De spir. sanct. 1,28)
Augustinus (354–430)
De filio spiritus sanctus procedere reperitur (De trin. 15,29) Iste autem spiritus utriusque, quoniam de utroque procedit (c. Maxim. II 23,3)
Faustus von Riez (ca. 405-ca. 490)
Ingenitus et ex utroque procedens personas indigitat (Ep. 3)
Fulgentius von Ruspe (ca. 465–532/33)
Pater a nullo genitus, filius a patre est genitus, spiritus sanctus a patre filioque procedens est (De trin. 2)
162
Das athanasianische Glaubensbekenntnis – Geschichte und Bedeutung
Zusammenfassung Damit bleiben als sichere Daten folgende Erkenntnisse: 1) Das Athanasianum ist im lateinischen Westen entstanden. 2) Seine Trinitätslehre und Pneumatologie ist von Augustinus abhängig. 3) Seine Christologie entspringt der Auseinandersetzung mit dem Nestorianismus und ist im Westen bei Vinzenz von Lérins bezeugt. 4) Eine Gruppe von Glaubensbekenntnissen aus im Westen und im Osten des römischen Reiches ist gleich strukturiert. 5) Das Athanasianum weist so viele Parallelen zu Schriften von Augustin oder von Augustin beeinflussten Schriftstellern auf, dass man von einer Kompilation sprechen kann. Diese Ergebnisse werden in der Forschung auf verschiedene Weise zusammengestellt, um zu einer Schlussfolgerung zu kommen, die eine präzise Zuschreibung zu einem Autor oder wenigstens die geographische Einordnung ermöglichen. An diesem Puzzlespiel beteilige ich mich nicht mit einem eigenen Vorschlag. Stattdessen gebe ich eine Einführung in den Inhalt und Wirkungsgeschichte des athanasianischen Bekenntnisses.
Inhalt Der Inhalt des athanasianischen Bekenntnisses ähnelt einem Kompendium trinitarische und christologischer Lehrsätze. Dabei zeigt eine nähere Betrachtung, dass das Athanasianum sehr konzise und äußerst präzise formuliert, selbst wenn manche Aussagen auf den ersten Blick etwas langatmig erscheinen. Zum Verständnis des Inhalts ist es notwendig, die Auseinandersetzungen zu kennen, die im Hintergrund der Formulierungen des Athanasianums stehen.
Trinität Wie oben beschrieben, entstand das Bekenntnis wahrscheinlich im fünften Jahrhundert. Die wesentlichen Kämpfe um die rechte Lehre von der Dreieinigkeit sind zu dieser Zeit abgeschlossen. Die Formulierungen des Bekenntnisses von Nicäa-Konstantinopel liegen fest, in der Folgezeit wird nur über ihre Interpretation gestritten. Die so genannte homöische22 Reichskirche23 etabliert sich in der 22 Winrich Löhr, Homöer in: RGG4 3 (2000), 1879–1882. 23 Hans Christof Brennecke, Studien zur Geschichte der Homöer (BHTh 73), Tübingen 1988.
Das athanasianische Glaubensbekenntnis – Geschichte und Bedeutung
163
Mitte des vierten Jahrhunderts und über ihre Grenzen hinaus nehmen zahlreiche gotische und germanische Stämme durch Ulfilas Mission diese Form des früher sog. „Arianismus“ an24. Diese Stämme gelangen im Lauf der so genannten Völkerwanderung im fünften Jahrhundert nach Gallien, Italien und Nordafrika und konfrontieren die dortigen „orthodoxen“ Christen mit ihrer Theologie. Dabei dient der sog. „germanische Arianismus“ oft mehr der ethnischen Abgrenzung als der theologischen Auseinandersetzung. Dogmatische Grundlage war das Bekenntnis von Seleukia/Rimini von 359 (4. Sirmiense). Die Homöer ordneten in der Nachfolge des Arius den Sohn dem Vater unter und diesen dem Heiligen Geist25. Obwohl sie dem Sohn das Prädikat „göttlich“ zugestanden und den orthodoxen Vorwurf, sie betrachteten den Sohn als ein Geschöpf zurückwiesen, ergab ihre Theologie im Endeffekt einen Tritheismus, in dem die drei göttlichen Wesen einander untergeordnet waren. Die orthodoxen Theologen wurden nicht müde, darauf hinzuweisen. In dieser Linie argumentiert auch das Athanasianum. Das Bekenntnis legt großen Wert auf die Einheit der Gottheit und die Gleichheit der drei Personen in der Trinität (v.3). Deshalb listet es in aller Ausführlichkeit auf, dass Vater, Sohn und Heiliger Geist in allen wesentlichen Eigenschaften gleich sind (vv.6–15). Besonders v.15 und die Reprise in v.20 sind eine Spitze gegen die „homöische“ Lehre, die von den Orthodoxen als Tritheismus aufgefasst wird. Auch die Aussage von v.25, dass nichts in der Dreieinigkeit früher oder später, größer oder kleiner ist und v.33 aus dem christologischen Teil, in dem festgehalten wird, dass der Sohn in Bezug auf seine Gottheit dem Vater gleich ist, sind antiarianisch, bzw. antihomöisch ausgerichtet. Von daher ist die Überschrift, die das Athanasianum in den lutherischen Bekenntnisschriften trägt „Bekenntnis des Athanasius gegen die Arianer geschrieben“ gar nicht falsch. Es richtet sich nur nicht gegen Arius und seine Gefolgsleute des vierten Jahrhunderts, sondern gegen die Fernwirkungen, die der Arianismus durch die christianisierten Goten und Germanen im lateinischen Westen des fünften und sechsten Jahrhunderts hatte26. Gegen die andere klassische Irrlehre in der Trinitätslehre, den Modalismus oder Sabellianismus, wird wesentlich weniger Energie aufgewendet, obwohl es im vierten Jahrhundert mit Markell von Ankyra, noch einmal einen scharfsinnigen Vertreter dieser Vorstellung gegeben hat, gemäß der sich der eine Gott in drei Formen zeigt. Diese Debatte erscheint dem Verfasser des Athanasianums nicht mehr aktuell zu sein. Eindeutig aber kurz wird in v.4+5 festgestellt, dass in der Dreieinigkeit die drei Personen klar zu unterscheiden sind. Terminologisch ist 24 Knut Schäferdiek, Germanenmission, in: RAC 10 (1978), 492–548. 25 Dazu vgl. Michael R. Barnes / Daniel. H. Williams, Arianism after Arius, Edinburgh 1993. 26 So schon Adolf von Harnack, Lehrbuch der Dogmengeschichte, 2. Aufl., Freiburg 1888, Bd. 2, 299.
164
Das athanasianische Glaubensbekenntnis – Geschichte und Bedeutung
dabei anzumerken, dass die Widergabe von οὐσία in v.4 mit substantia dem lateinischen Sprachgebrauch folgt, der seit Tertullian geprägt ist27. Damit ist die Diskussionslage skizziert, in der das Athanasianum argumentiert. Inhaltlich ist es völlig von Augustinus abhängig. Es lässt sich im ersten Teil geradezu als ein Kompendium augustinischer Trinitätslehre verstehen28. Als Beispiel sei nur eine kurze Passage aus Augustins monumentalem Werk über die Dreieinigkeit zitiert: Der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott, der heilige Geist ist Gott, und der Vater ist gut, der Sohn ist gut, der heilige Geist ist gut, und der Vater ist allmächtig, der Sohn ist allmächtig, der Heilige Geist ist allmächtig, dennoch gibt es nicht drei Götter, oder drei Gute, oder drei Allmächtige, sondern der Eine, ist Gott, gut und allmächtig: die Dreieinigkeit selbst29.
Zu den Spezifika der augustinischen Trinitätslehre gehört auch die schon erwähnte Lehre vom Hervorgang des Heiligen Geistes aus dem Vater und dem Sohn. Sie ist eingebettet in eine Passage des Athanasianums (vv.21–24), in der die Beziehungen zwischen den Personen der Trinität elaboriert und sehr abgewogen beschrieben werden. Innerhalb der Bekenntnisliteratur des Westens nimmt das Athanasianum in diesem Punkt eine absolute Ausnahmestellung ein30. Besonders die Betonung des Ungeschaffenseins des Vaters in v.21 erinnert eher an die Trinitätslehre der drei großen Kappadozier in der die Ungeschaffenheit (ἀγεννησία) eine große Rolle spielt31. Im Westen wird auf diesen dogmatischen Topos normalerweise weniger Wert gelegt und auch bei Augustinus findet er sich nur am Rande32.
Christologie In der Christologie liegt, wie schon erwähnt der Schwerpunkt auf der Auseinandersetzung mit der nestorianischen Lehre. Diese Auseinandersetzung spielte bereits in den letzten Lebensjahren Augustins im Westen des Reiches eine wichtige Rolle33, obwohl die Hauptprotagonisten – wie schon im arianischen
27 Vgl. Christopher Stead, Philosophie und Theologie 1. Die Zeit der Alten Kirche, Stuttgart 1990. 28 Kelly, Athanasian Creed (Anm. 4), 80: „Indeed, it can fairly be described as codified and condensed Augustinianism“. 29 Augustinus, De trinitate VIII,12. 30 Eine Parallele bietet erst das Bekenntnis der 1. Synode von Toledo, vgl. Kelly, Athanasian Creed (Anm. 4), 85. 31 Gregor von Nazianz, Oratio 25,16 u. ö. 32 Augustinus, Oratio 140,2 PL 38,773. 33 Vgl. z. B. Cassian, De incarnatione Domini contra Nestorium, CSEL 17, 235–391 (verf. 428/ 431). Einer der Presbyter aus Hippo, Leporius, soll an dieser Stelle seine irrige Auffassung korrigiert haben, Leporius, Libellus emendationis, PL 31, 1221–1230. Zu Leporius siehe auch
Das athanasianische Glaubensbekenntnis – Geschichte und Bedeutung
165
Streit – im Osten des Reiches lebten. Inhaltlich geht es um die Frage, wie die zwei Naturen in der einen Person Jesus Christus richtig ausgesagt werden können. Terminologisch ist hierbei wiederum eine Verschiebung zwischen Ost und West zu beobachten. Im Osten wird von zwei Naturen (δύο φύσεις) geredet, wenn es sich um die Menschen- und Gottesnatur geht. Und es wird von einer Person (πρόσωπον) bzw. einer Wesenheit (ὑπόστασις) gesprochen, wenn es sich um die in Christus vereinten Naturen handelt. Man sollte meinen, dass dementsprechend im Westen von zwei Naturen (duae naturae) die Rede sein müsste, das Athanasianum spricht aber an dieser Stelle (v.31) von zwei Wesenheiten (duae substantiae), was dem Griechischen δύο ὑπόστασεις entspricht. Die Übersetzung dieser entscheidenden Termini ist also genau gegenläufig. Damit folgt das Athanasianum einem lateinischen Sprachgebrauch, der zwar seit Tertullian etabliert ist, aber an dieser Stelle für Verwirrung sorgt34. Es ist ein typisches Beispiel für die Verständigungsschwierigkeiten zwischen Ost- und Westkirche seit dem dritten Jahrhundert. Sachlich entspricht das Athanasianum völlig der orthodoxen Lehre. Es hält fest, dass Christus eine doppelte Natur hat, aber dennoch nur eine Person ist. Das ist die Lösung, die das Konzil von Chalcedon 451 als orthodoxe Lehre dogmatisiert. Dieses Dogma von den zwei Naturen im einen Christus beendete den Streit um das rechte Verständnis der Einung im Gottessohn und führte zugleich zur Trennung der so genannten nonchalcedonensischen oder auch monophysitischen Kirchen von der Orthodoxie. In der dem Konzil vorausgehenden Debatte vertrat Nestorius, der Bischof von Konstantinopel die Position, dass die Einheit in Christus stärker betont werden muss, als der Unterschied der beiden Naturen in Christus. Daraus hat sich später der sog. Monophysitismus (d. h. Einnaturenlehre), entwickelt. Das Athanasianum entwickelt seine Gedanken zum Wesen des Gottessohnes in aller Ausführlichkeit entlang der orthodoxen Auffassung von den beiden Naturen im einen Christus. In vv.30–33 werden beide Naturen beschrieben und festgestellt, dass Christus „vollkommen Gott“ und „vollkommen Mensch“ ist (v.32). Damit jetzt aber die Unterscheidung zwischen Mensch und Gott nicht zu einer Teilung in Christus führt, wird in einem zweiten Argumentationsgang beschreiben, wie die Einheit der Naturen zustande kommt (vv.34–36). Die Betonung der Annahme der Menschheit durch Gott in v.35, dient wohl nicht der Abwehr eutychianischer Lehren, sondern entspricht in Verbindung mit v.32 dem Axiom des Cyrill von Alexandrien „dass nichts erlöst werden kann, was nicht angenommen worden ist“. Damit wird noch einmal festgehalten, dass Christus nicht nur gewissermaßen menschliches Fleisch als Trägersubstanz für die Gottheit zur Verfügung gestellt hat, den Eintrag Leporius 1, in: André Mandouze, Prosopograhie de l’Afrique chrétienne, Paris 1982, 634f. 34 Anders Leo d. Gr., er benutzt in seinem Tomus ad Flavianum natura nicht substantia.
166
Das athanasianische Glaubensbekenntnis – Geschichte und Bedeutung
sondern ein ganzer Mensch im Vollsinn des Wortes war. Dieser ganze Mensch ist in Christus eine Einheit mit der ganzen Gottheit, wie v.36 formuliert „in Einheit der Person“. Damit ist weitgehend die klassische Formulierung Cyrills von Alexandrien im Lateinischen wiedergegeben, die von einer Einung „gemäß der Wesenheit“ (ἕνωσις καθ᾽ ὑπόστασιν) spricht35. Der abschließende Vergleich der Einung der beiden Naturen in Christus mit der Einung von Seele und Fleisch im Menschen (v.37) ist ein viel gebrauchtes Bild in den christologischen Streitereien. Es kann sowohl von Anhängern der Zweinaturenlehre wie von Monophysiten verwendet werden. Im Athanasianum ist es sprachlich als Zusammenfassung gekennzeichnet (nam), mit der der Abschnitt über die Zweinaturenlehre abgeschlossen wird. Hier dient es als einprägsames Bild für die Einheit von zwei verschiedenen Teilen in einem Ganzen. Dass dieser Vergleich offen war für Interpretationen von nicht-orthodoxen Theologen hat seinen Gebrauch im fünften Jahrhundert im Westen noch nicht gehindert. Erst nachdem das Athanasianum die Frage nach dem Wesen des Gottessohnes geklärt hat, wird in aller Kürze die Heilsbedeutung seines Leiden, Sterbens und Auferstehen referiert. Dabei werden in vv.38–40 Formulierungen aufgenommen, die uns aus dem apostolischen Glaubensbekenntnis vertraut sind. Hier ist der Verfasser des Athanasianums offenbar nicht an einer klaren Stellungnahme in einem umstrittenen Bereich interessiert. Er greift ohne weiteres auf bekannte Formulierungen zurück. An einer Stelle verändert er sie aber in signifikanter Weise und vielleicht steckt darin doch noch eine Bezugnahme auf aktuelle Auseinandersetzungen der Entstehungszeit. In v.40 wird zusätzlich zu der vertrauten Formulierung, dass Jesus Christus wiederkommen wird „zu richten die Lebenden und die Toten“ (Apostolikum u. Nicäno-Constantinopolitanum), noch der biblische Gedanke des Gerichtes nach den Werken eingeführt36: dass „alle Menschen […] Rechenschaft geben müssen über ihre eigenen Taten“. Damit verlässt das Athanasianum an einer für den neuzeitlichen Leser unauffälligen Stelle die Themen Trinität und Christologie und macht einem kleinen Abstecher zur Gnadenlehre. Hier sind zu Recht semipelagianische Einflüsse vermutet worden.
35 2. Anathematismus Cyrills gegen Nestorius, zitiert bei A. Martin Ritter, Alte Kirche (Kirchenund Theologiegeschichte in Quellen 1), Neukirchen 1982, 2. Aufl., 219. 36 Die Auferstehung des Fleisches ist im Apostolikum enthalten. Die Formulierung in v.40 „dass alle Menschen auferstehen müssen mit ihren Körpern“ bringt demgegenüber nichts Neues.
Das athanasianische Glaubensbekenntnis – Geschichte und Bedeutung
167
Semipelagianische Einflüsse Das Athanasianum erweist sich in diesem sehr spezifischen Punkt als gänzlich unbeeinflusst von Augustinus, der doch sonst im Wesentlichen als der geistige Vater dieses Textes gelten kann. Das Bekenntnis hat eine völlig andere Vorstellung von der Gnade als Augustinus. Es ist an keiner Stelle überhaupt nur von Gnade die Rede. Auch Augustins Gedanken zur Rechtfertigung oder der Prädestination bleiben unberücksichtigt. Das zeigt sich in vv.40+41 und in den so genannten Verdammungsformeln. Vv.40+41 zeigen eine Gerichtsvorstellung, die – angelehnt an die Rede vom Weltgericht in Mt. 25 – mit einem reinen Gericht nach Werken rechnet. Die Bedeutung der Gnade und des Glaubens in den Fragen der Rechtfertigung der Sünder treten völlig in den Hintergrund. Eine derartige Gerichtsvorstellung betont die Eigenverantwortlichkeit des Menschen, unterstellt die Möglichkeit, das Heil aus eigener Kraft zu erlangen und bewirkt einen starken ethischen Impuls, der in den evangelischen Kirchen sehr schnell mit „Werkgerechtigkeit“ gleichgesetzt wird. Das sind Elemente einer Theologie, die sich nicht am Vorbild Augustins orientiert. In den Grundzügen entspricht sie viel eher den Vorstellungen von Rechtfertigung und Gnade, die Pelagius und seine Nachfolger vertreten. Wenn Sebastian Thier die Gnadenlehre des Pelagius im Kontext der Soteriologie so beschreibt: „Pelagius begreift den Heilserwerb des Menschen synergistisch als ein Anknüpfen an eine von Gott gesetzte Möglichkeit“37, dann ist damit die Möglichkeit, durch eigene Taten im Gericht zu bestehen, viel besser zu vereinbaren als mit Augustins pessimistischer Erbsündenlehre, die ein Bestehen des Menschen im Gericht zu einer unmöglichen Möglichkeit macht. Im gleichen Sinne betonen auch die erste und zweite der sog. Verdammungsformeln im Athanasianum die Willensfreiheit des Menschen. So heißt es in vv.1+28 ausdrücklich „wer selig werden will“. Das setzt eine Willensfreiheit des Menschen voraus, die die von Augustinus konzedierte bei weitem übersteigt. Die von Thier gegebene Beschreibung von Pelagius Überlegungen zur Gotteserkenntnis liefern auch hierfür einen plausiblen Hintergrund: Pelagius zeigt auf „dass die Vernunft des Menschen fähig ist, Gottes Wesen und Willen zu erkennen und hieraus für sich die Verpflichtung zum Gehorsam gegenüber Gott abzuleiten“38. Das ist im Rahmen augustinischer Erkenntnis- und Gnadenlehre nicht denkbar. Viel zu sehr ist für Augustinus die Erkenntnisfähigkeit des Menschen durch den Sündenfall beeinträchtigt. In den Verdammungsformeln und in dem Abschnitt über das Jüngste Gericht zeigt sich, dass der Verfasser des Athanasianums noch andere Lehrmeister hatte 37 Sebastian Thier, Kirche bei Pelagius (PTS 50) Berlin 1999, 118. 38 Ebenda, 67.
168
Das athanasianische Glaubensbekenntnis – Geschichte und Bedeutung
als nur Augustinus. Diese Gedanken stammen sehr wahrscheinlich aus semipelagianischen Zusammenhängen wie es sie zum Beispiel in Südgallien gab39. Sie haben auch Eingang gefunden in die „Normaltheologie“ des Mittelalters. Auch dort herrschte in der Rechtfertigungs- und Gnadenlehre eine Form von Semipelagianismus vor, die sich mit den Vorstellungen des Athanasianums zur Deckung bringen lässt.
Intention Am Ende der historischen Analyse soll der Versuch stehen, wenn schon nicht Autor und Entstehungsort zu benennen sind, doch wenigstens die Intention des Verfassers zu skizzieren. Das Athanasianum ist kein kämpferisches Bekenntnis, in dem dogmatische Spitzenpositionen durchgesetzt werden. Es erweist sich als ein Bekenntnistext, der die „Mainstream“-Theologie der lateinischen Mehrheitskirche um die Mitte des fünften Jahrhunderts formuliert. Es gibt klare Absagen an die „arianischen“ Germanen, an den Nestorianismus und an Augustins Gnadenlehre. Das geschieht ohne große Polemik. An keiner Stelle ist zu erkennen, dass sich der Autor in einem Streit ereifert. Insgesamt macht es den Eindruck eines Kompendiums. Dem entspricht auch der Stil des Athanasianums mit seinen wohl abgewogenen Formulierungen und der ruhigen rhythmischen Prosa. Es sind wohl vor allem die harten Verdammungsformeln, die für neuzeitliche Leser den Eindruck erzeugen, hier würden steile theologische Aussagen präsentiert. Es braucht wahrscheinlich eine historische Verstehenshilfe, um den Blick dafür zu öffnen, dass das Athanasianum im Grunde nichts anderes tut als die konventionelle Theologie einer bestimmte Epoche und Region zusammenzufassen. Das spiegelt sich auch in der Wirkungsgeschichte des Athanasianums wieder. Die folgenden Jahrhunderte haben dieses Bekenntnis vor allem als ein dogmatisches Kompendium genutzt. Das Vertrauen in seine Rechtgläubigkeit spiegelt sich dann in der mittelalterlichen Zuschreibung an den „Champion“ der nicänischen Orthodoxie, Athanasius wieder. Es dürfte aber, unabhängig von dem großen Namen, gerade die Kombination aus augustinischer Trinitätslehre, antinestorianischer Christologie und semipelagianischer Lehre von Gnade und Willensfreiheit gewesen sein, die das Athanasianum im frühen Mittelalter zu einem weithin akzeptierbaren Text machten. In Abwandlung eines Werbespruchs zu sagen, es sei damals „die zarteste Versuchung gewesen, seit es Bekenntnisse gab“, ist nur wenig übertrieben.
39 Kelly, Athanasian Creed (Anm. 4), 73.
Das athanasianische Glaubensbekenntnis – Geschichte und Bedeutung
169
Wirkung Die Rezeption des Athanasianums findet zuerst ohne den Namen des großen Kirchenvaters statt. Erst die Synode von Autun gibt um 670 das Bekenntnis unter diesem Namen wieder. Bis dahin finden sich Spuren der Wirkung des Athanasianums vor allem in Spanien. Dort formuliert der westgotische König Reccared gegenüber der 3. Synode von Toledo 589 seine Absage an den „Arianismus“ mit Worten aus dem Athanasianum. In der 4. Synode von Toledo, unter dem Vorsitz von Isidor von Sevilla, wird in den Kanones als erstes ein Bekenntnis überliefert, das in vielen Stücken dem Athanasianum ähnelt.40 Die Synode von Autun signalisiert 670 den Übergang in die merowingische Zeit. Für die fränkische Kirche wird jetzt festgeschrieben, dass die Kleriker das Athanasianum und das Apostolische Glaubensbekenntnis auswendig können müssen. Das ist im Zusammenhang mit den zahlreichen mittelalterlichen Versuchen zur Hebung des Bildungsstandes der Kleriker zu sehen. Zugleich wird das Athanasianum damit zu einem Herzstück der fränkischen Theologie: Im 1. Kanon wird festgelegt: Wenn ein Priester oder Diakon oder Kleriker das Bekenntnis, das die Apostel – inspiriert vom Heiligen Geist – überliefert haben und den Glauben des Heiligen Primas Athanasius nicht fehlerfrei wiedergeben kann, soll er vom Bischof getadelt werden41.
Das erklärt seine weite Verbreitung in der karolingischen Zeit. Die ersten noch erhaltenen Handschriften stammen aus dieser Epoche. Das älteste Manuskript stammt aus Bobbio, einer iroschottischen Klostergründung in Norditalien, die intensive Kontakte zum Bodenseeraum hatte. Dort taucht es dann in der sog. „Bibliothek der Symbole“ auf, einer umfangreichen Zusammenstellung von Glaubensbekenntnissen und anderen normativen Texten, persönlich geschrieben von Reginbert, dem gelehrten Bibliothekar der Reichenau. In dieser Epoche liegt auch der Beginn der liturgischen Verwendung des Athanasianums. In den „Capitula ecclesiastica“ des Haito, Bischofs von Basel und Ratgeber Karls d. Gr. findet sich die Vorschrift „Das Glaubensbekenntnis des Heiligen Athanasius soll von den Priestern gelernt und an jedem Sonntag zur ersten Stunde (d. h. zur Prim, dem ersten Stundengebet des Tages) auswendig rezitiert werden“42. Diese Praxis ist seit dem 12. Jahrhundert in der gesamten westlichen Kirche belegt und in der römisch-katholischen Kirche bis zum Jahr 1954 beibehalten worden. Auch dies 40 Kelly, Athanasian Creed (Anm. 4), 37–40. 41 MGH Legum sect. 3 Concilia. I 221,1–3: „Si quis presbyter aut diaconus aut clericus symbolum, quod sancto inspirante Spiritu apostoli tradiderunt et fidem sancti Athanasii presulis inreprehensibiliter non recensuerit, ab episcopo condempnatur“. 42 MGH Legum sect. 2 Capitula regnorum Francorum I 363,14f.: „ut fides sancti Athanasii a sacerdotibus discatur, et ex corde omni dominica ad horam primam recitetur“.
170
Das athanasianische Glaubensbekenntnis – Geschichte und Bedeutung
dient im Wesentlichen zur Bildung der Kleriker. Sie sollen mit einem Herzstück der Trinitätslehre und Christologie durch ständige Wiederholung vertraut sein. Es verwundert daher nicht, dass für die fränkischen Theologen das filioque ganz selbstverständlich als orthodoxe Lehre erscheint und sie im Laufe des 9. Jahrhunderts darangehen, seine Verwendung im Westen durchsetzen43. So berufen sich fränkische Mönche in einem Schreiben an Papst Leo III., der sich gegen die Verwendung des filioque sträubt, ausdrücklich auf das Athanasianum44 als Beleg für die doppelte Hervorbringung des Heiligen Geistes aus dem Vater und dem Sohn. Mit der allgemeinen Verwendung des filioque im Westen wird schließlich der Grundstein für einen massiven Streit mit der Ostkirche gelegt, der 1054 im Schisma eskaliert. Wie tief das Athanasianum in der karolingischen Zeit in den gottesdienstlichen Gebrauch vorgedrungen ist, zeigt seine Aufnahme in Psalmen-Handschriften, die im Allgemeinen für den liturgischen Gebrauch geschaffen worden sind. Ein kunstgeschichtlich hochbedeutsamer Codex, der das Athanasianum enthält, ist der sog. Utrecht-Psalter45. Auf fol. 90v dieser Handschrift steht direkt über dem Text des Athanasianums eine Zeichnung, die eine Konzilsversammlung zeigt. Das ist eine idealisierte Szene, die das Athanasianum durch diese Illustration in den Rang eines Synodalbekenntnisses erhebt. Es war anscheinend im neunten Jahrhundert nicht mehr vorstellbar, dass ein Text von solcher Bekanntheit und Bedeutung anders entstanden sein sollte als auf einem großen Konzil. Abgebildet sind 78 Konzilsväter, in der Mitte wird dem präsidierenden Bischof (Athanasius?) eine Stola umgelegt. Auf zwei Lesepulten liegen Bücher (mit Texten von Kirchenvätern?) am Boden sitzen sechs Schreiber mit ihrem Gerät46. Mit diesem Bild soll der kurze Ausblick in die Wirkungsgeschichte des Athanasianums abgeschlossen werden. Zum Schluss soll noch einmal das neuzeitliche Unbehagen an dem Athanasianum und verwandten Texten zur Sprache kommen.
43 Zum Filioque-Streit siehe jetzt Peter Gemeinhardt, Die Filioque-Kontroverse zwischen Ostund Westkirche im Frühmittelalter (AKG 82), Berlin 2002. 44 MGH Epistolarum tom. V. In dem berühmten Brief der fränkischen Mönche auf dem Ölberg, die in Streit mit ihren orthodoxen Nachbarn geraten sind, berufen sie sich gegenüber Papst Leo III. zum einen auf das Bekenntnis, das in der Pfalzkapelle zu Aachen verwendet wurde, und daher durch Kaiser Karl d.Gr. approbiert war (65,33f), auf eine Homilie und einen Dialog Gregors d.Gr. (65,35 u. 39) auf die Regula Benedicti (65,37) und auf das Glaubensbekenntnis des Athanasius (fidem Athanasii) (66,1). 45 Digitalisat verfügbar unter: https://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-2844 27&lan=en#page//11/51/45/11514575807329943918974580038627186786.jpg/mode/1up (abgerufen am 16. 4. 2023). 46 Zur Bildbeschreibung vgl. Der Utrecht Psalter. Kommentar von Koert van der Horts u. Jakobus H.A. Engelbregt OFM, übers.v. Johannes Rathofer, Graz 1984, 95.
Das athanasianische Glaubensbekenntnis – Geschichte und Bedeutung
171
Utrecht-Psalter fol. 90v
Ausblick: Das neuzeitliche Unbehagen Das neuzeitliche Unbehagen an den festgelegten Formulierungen der Bekenntnisse hat bereits Adolf von Harnack klar formuliert. Er sieht darin eine Erstarrung des Glaubens. Die Entwicklung von Glaubensgedanken, die uns selbst ein „halbdurchschautes Geheimnis“ bleiben, bis zu fest formulierten Sätzen mit Rechtscharakter ist für Harnack eine Verfallsbewegung, bei der die Lebendigkeit des Glaubens auf der Strecke bleibt: In dem Athanasianum als Symbol liegt die Umbiegung der Trinitätslehre als eines innerlich anzueignenden Glaubensdenkens zu einer kirchlichen Rechtsordnung vor, an deren Beobachtung die Seligkeit hängt. […] Es ist der Gang der Dinge, der sich in der Religionsgeschichte immer wiederholt: vom Glaubensgedanken zum philosophischtheologischen Lehrsatz, und vom Lehrsatz, der Erkenntnis verlangt zum Rechtssatz, der Gehorsam fordert […] Dabei wird naturgemäß die Formulierung immer wichtiger und das Bekenntnis mit dem Munde das Fundament der Kirche.47
Dazu passt es, dass Adolf von Harnack im sog. Apostolikumsstreit des ausgehenden 19. Jahrhunderts sich gegen eine starre Verwendung des apostolischen Glaubensbekenntnisses ausgesprochen hat, weil einige Sätze darin für „gebildete Christen“ anstößig sein müssen. Für ihn hat ein Bekenntnis nur dann seinen Sinn, wenn die traditionellen Inhalte stets aufs Neue kritisch angeeignet werden und in einer dementsprechenden Gestalt neu zur Geltung kommen können. 47 Adolf von Harnack, (Anm. 26), 301, Kursivierungen im Original gesperrt.
172
Das athanasianische Glaubensbekenntnis – Geschichte und Bedeutung
Diese Bewegung ist am Ende des letzten Jahrhunderts wieder aufgenommen worden mit der Suche nach „neuen“ Glaubensbekenntnissen, die scheinbar zeitgemäßer sind48. Das Unbehagen an den „alten“ Glaubensbekenntnissen und die Fremdheit die selbst Pfarrerinnen und Pfarrer gegenüber diesen Texten haben, hat Gerhard Ruhbach pointiert beschrieben: „Wie erratische Relikte einer fernen Vergangenheit ragen ja für viele Pfarrerinnen und Pfarrer die tradierten Bekenntnisschriften und dogmatischen Topoi in ihre Ordinationsverpflichtung hinein“49. Nach den Erfahrungen mit einem sich immer mehr beschleunigenden Verschleiß solcher Bekenntnistexte, stellt sich allerdings die Frage, ob so wirklich eine kritische Aneignung und jeweils gültige Neuformulierung des Glaubens stattfindet, oder ob einfach Texte verbraucht werden, die sich leichter verbrauchen lassen als ein Bekenntnis vom Schlage des Athanasianums. Es könnte sogar sein, dass Neuformulierungen von Bekenntnistexten in einer postmodernen und pluralen Gesellschaft neben ihrer schnellen Verfallszeit darunter leiden, dass sie keine über die Trägergruppe hinausgehende Gültigkeit beanspruchen können. Insofern ist bei einer vorfindlichen postdogmatischen evangelischen Kirche zu fragen, ob nicht gerade die Bekenntnis- und Lehrtexte der Alten Kirche und der Reformationszeit eine Art Minimalkonsens in dogmatischen Fragen darstellen. Sie sind ganz gewiss nicht norma normans, aber zumindest eine Art Appellationsinstanz. Dann würde sogar die ursprüngliche Intention des Athanasianums noch einmal zu ihrem Recht kommen, nämlich Trinitätslehre und Christologie zusammenzufassen, und lern- und lehrbar zu präsentieren. Dennoch bleibt die Frage bestehen, wie neuzeitliche Hörerinnen und Hörer mit den so genannten Verdammungsformeln umgehen können. Der Zusammenhang zwischen „selig werden wollen“ und „glauben müssen“ den das Athanasianum postuliert, stößt heute wohl deshalb auf solch großen Widerstand, weil der Glaubensbegriff damit auf das Fürwahrhalten von Lehrsätzen reduziert ist. Der dynamische und gnadenhafte Charakter des Glaubens an den dreieinigen Gott und insbesondere an Jesus Christus unseren Herrn und Bruder geht verloren, wenn es am Ende des Athanasianums einfach heißt: „Das ist der christliche Glaube, wenn jemand den nicht verlässlich und fest glaubt, kann er nicht selig werden.“
48 Jörg Zink u. a. (s. o. Anm. 1 u. 2). 49 Gerhard Ruhbach, Bekenntnisbildung und Bekenntnisbindung als theologisches Problem, in: Theo Sorg (Hg.), Credo heute. Predigthilfen zum Glaubensbekenntnis, Stuttgart 1975, 15–31, hier 19.
Das athanasianische Glaubensbekenntnis – Geschichte und Bedeutung
173
Abbildung Konzilsdarstellung aus dem Utrecht-Psalter fol. 90v. Der gesamte Paslter ist digital verfügbar über die Universitätsbibliothek Utrecht: https://dspace.library.uu.nl/handle/18 74/284427 (abgerufen am 16. 4. 2023).
Literatur Michael R. Barnes / Daniel. H. Williams, Arianism after Arius, Edinburgh 1993. Eugen Biser, Glaubensbekenntnis und Vaterunser, 2. Aufl., Düsseldorf 1994. Hans Christof Brennecke, Studien zur Geschichte der Homöer (BHTh 73), Tübingen 1988. Volker Henning Drecoll, Das Symbolum Quicumque als Kompilation augustinischer Tradition, in: ZAC 11 (2007), 30–56. Peter Gemeinhardt, Die Filioque-Kontroverse zwischen Ost- und Westkirche im Frühmittelalter (AKG 82), Berlin 2002. Adolf von Harnack, Lehrbuch der Dogmengeschichte, 2. Aufl., Freiburg 1888. Klaus Hofmeister / Lothar Bauerochse, Bekenntnis und Zeitgeist. Das christliche Glaubensbekenntnis neu befragt, Würzburg 1997. John Norman Davidson Kelly, The Athanasian Creed, London 1964. Ders.: Altchristliche Glaubensbekenntnisse, Göttingen 1972. Hugo Koch, Vinzenz von Lérins und Marius Mercator, in: ThQ 81 (1899). Ders., Vinzenz von Lérins und Gennadius. Ein Beitrag zur Literaturgeschichte des Semipelagianismus (TU 31,2), Leipzig 1907. Michael Kohlbacher, Das Symbolum Athanasianum und die orientalische Bekenntnistradition. Formgeschichtliche Anmerkungen, in: M. Tamcke (Hg.), Syriaca II. Beiträge zum 3. deutschen Syrologen-Symposium in Vierzehnheiligen 2002 (Studien zur Orientalischen Kirchengeschichte 33), Münster 2004, 105–164. Ulrich Kühn, Christlicher Glaube nach 2000 Jahren. Eine Auslegung des apostolischen Glaubensbekenntnisses, Leipzig 1999. Hans Küng, Credo. Das apostolische Glaubensbekenntnis – Zeitgenossen erklärt, 5. Aufl., München 1995. Winrich Löhr, Homöer in: RGG4 3 (2000), 1879–1882. André Mandouze, Prosopograhie de l’Afrique chrétienne, Paris 1982. Germain Morin, L’origine du symbole d’Athanase: Témoinage inédit de S.Césaire d’Arles, RBen 44 (1932), 207–219. Wolfhart Pannenberg, Das Glaubensbekenntnis ausgelegt und verantwortet vor den Fragen der Gegenwart, 6. Aufl., Gütersloh 1995. Joseph Kardinal Ratzinger, Einführung in das Christentum. Vorlesungen über das apostolische Glaubensbekenntnis mit einem neuen einleitenden Essay, München 2000. A. Martin Ritter, Alte Kirche (Kirchen- und Theologiegeschichte in Quellen 1), 2. Aufl., Neukirchen 1982. Gerhard Ruhbach, Bekenntnisbildung und Bekenntnisbindung als theologisches Problem, in: Theo Sorg (Hg.), Credo heute. Predigthilfen zum Glaubensbekenntnis, Stuttgart 1975, 15–31.
174
Das athanasianische Glaubensbekenntnis – Geschichte und Bedeutung
Knut Schäferdiek, Germanenmission, in: RAC 10 (1978), 492–548. Heinz Scheible, Camerarius, Joachim, in: RGG4 2 (1999), 43. Theodor Schneider, Was wir glauben. Eine Auslegung des apostolischen Glaubensbekenntnisses, 4. Aufl., Düsseldorf 1991. Norbert Scholl, Das Glaubensbekenntnis Satz für Satz erklärt, München 2000. Christopher Stead, Philosophie und Theologie 1. Die Zeit der Alten Kirche, Stuttgart 1990. Charles Anthony Swainson, The Nicene and Apostle’s Creed, London 1875. Sebastian Thier, Kirche bei Pelagius (PTS 50) Berlin 1999. Utrecht Psalter, Kommentar von Koert van der Horts u. Jakobus H.A. Engelbregt OFM, übers.v. Johannes Rathofer, Graz 1984. Klaus-Gunther Wesseling, Vinzenz von Lerin, in: BBKL 12 (1997) 1432–1436. Jörg Zink, Das christliche Bekenntnis. Ein Vorschlag, Stuttgart 1996.
Carl Blum – Prediger der Rußlanddeutschen
Einführung Carl Blum1 wäre ein unbekannter Pfarrer des 19. Jahrhunderts geblieben, wenn er nicht zwei Predigtsammlungen vorgelegt hätte, die sich bis heute unter den lutherischen Rußlanddeutschen größter Beliebtheit erfreuen und zu Zehntausenden nachgedruckt werden. Bei vielen gehört neben Bibel und Gesangbuch „der Blum“ zur häuslichen Andacht. Seine Predigten werden bis heute in den brüdergemeindlich geprägten Versammlungen in den GUS-Staaten oder in Deutschland als Lesepredigten für den sonntäglichen Gottesdienst gebraucht2. Blums Predigtbände haben nach dem Zweiten Weltkrieg die anderen Predigt- und Andachtsbücher nahezu vollständig verdrängt, die vorher unter den Rußlanddeutschen verbreitet waren3. Die inzwischen quasi-kanonische Stellung dieser Predigtbände zeigt sich darin, daß die Evangelisch-Lutherische Kirche in Rußland und den anderen Nachfolgestaaten der Sowjetunion lange genötigt war, neben den Texten der Lu1 Die Schreibung des Vornamens wechselt. In den älterne Lexika findet er sich zumeist als „Karl Blum“, während die Predigtbände als Verfasserangabe „Carl Blum“ tragen. Diese Form hat inzwischen auch Wikipedia übernommen. 2 Carl Blums Predigten gehören zu dem kleinen Schatz an religiöser Literatur, den Rußlanddeutsche durch Vertreibung, Krieg und Zwangsarbeit gerettet haben. Vgl. Hans-Christian Dietrich, in: Das Gute behaltet. Kirchen und religiöse Gemeinschaften in der Sowjetunion und ihren Nachfolgestaaten, Erlangen 1996, 86: „Christliches Leben war nur noch im Verborgenen […] möglich. Hier bewährte sich die Tradition der Erweckungsbewegung. Es waren ‚Brüder‘ und ‚Schwestern‘ der Gemeinschaften, die nicht nur bereit, sondern auch fähig waren, kleine Gruppen zur Andacht zu sammeln. Dieser und jene hatten auch die Bücher dazu bei der Vertreibung mitnehmen können: die Bibel, das wolgadeutsche Gesangbuch, das wolgadeutsche Gemeinschaftsliederbuch, die Predigtbände von Carl Blum, Brastberger, Hofacker“. Zur Verbreitung in den Staaten der ehemligen Sowjetunion vgl. Gerd Stricker, Religion in Rußland, Gütersloh 1993, 143, der die heutige lutherische Kirche unter den Rußlanddeutschen als „Brüdergemeinschaftswesen mit einem pastoral-kirchlichen Anstrich“ beschreibt. 3 Vgl. die umfassende Auflistung von gebräuchlichen Predigt- und Andachtsbüchern bei Johannes Schlundt, Die Gemeinschaftsbewegung unter der deutschen Bevölkerung in Rußland bzw. der UdSSR in Vergangenheit und Gegenwart, Steinau a. d. Straße, o. J., 10.
176
Carl Blum – Prediger der Rußlanddeutschen
therischen Perikopenordnung von 1977 die Perikopen anzugeben, die Blums Predigten zu Grunde liegen. Der Verfasser dieser Predigtbände ist trotz der großen Verbreitung seiner Bücher völlig unbeachtet geblieben. Nur wenige kennen seine Herkunft und zu seiner Stellung in der Theologiegeschichte des 19. Jahrhunderts gibt es bis jetzt keine Untersuchung. Diesem Mangel möchte die vorliegende Studie abhelfen.
Der Lebenslauf von Carl Blum im Überblick Carl Wilhelm Theodor Blum stammte aus dem Baltikum. Er wurde am 4. 5. 1841 in Garßen (Kurland) geboren4. Sein Vater, der Landmann Peter Blum starb bereits 1846. Carl Blum kam als Pflegekind in die Obhut von Pastor Gustav Gottlieb Grüner in Subbath. Dort wurde er von 1850–55 in der Neu-Subbathschen Stiftsschule und von 1855–57 im Haus von Pastor Grüner unterrichtet. 1857–60 besuchte er das Gymnasium in Mitau. Von 1860–65 studierte er Theologie an der Universität Dorpat. Von 1865–67 arbeitete er als Hauslehrer bei Pastor Karl Gideon Urban in Erwahlen. Während dieser Zeit bestand er die Konsistorialexamina beim kurländischen Konsistorium und absolvierte sein praktisches Jahr bei Pastor Urban, sowie seinem Pflegevater. Am 31. 12. 1867 wurde er in Riga zum Adjunkten des Propstes Georg Gustav Schilling zu Schwaneburg-Aahof in Livland ordiniert5. Am 10. 1. 1868 heiratete er die Tochter des Propstes, Marie Louise Schilling. Seinen Dienst als Pastor verbrachte er zum überwiegenden Teil in den deutschen Kolonien in Rußland. Er war vom Juni 1868 bis Juni 1872 Pastor in der Wolgakolonie Morgenthau im Gouvernement Samara. Während dieser Zeit wurde seine erste Abhandlung 1871 in Saratow gedruckt: „Fraget nach den vorigen Wegen, eine Predigt über Jer 6,16“. Von der Wolga wechselte Blum nach Südrußland und war von September 1872 bis November 1874 Pastor in der
4 Die biographischen Angaben verdanken sich, so weit nicht anders nachgewiesen, dem Eintrag bei Theodor Kallmeyer, Die evangelischen Kirchen und Prediger Kurlands, 21910 in: Deutsches Biographisches Archiv, hg. v. Bernhard Fabian (Mikrofiche Edition), München 1982. Die Informationen bei Joseph Schnurr (Bearb.), Die Kirchen und das religiöse Leben der Rußlanddeutschen (= Heimatbuch, Jahrbuch 1969–1972, der Deutschen aus Rußland), Stuttgart 1972 sind für Carl Blum unzuverlässig. Der Eintrag in der Liste der evangelischen Prediger (285) enthält mehrere offensichtliche Fehler. Leider sind auch die Angaben des neuen Nachschlagewerks von Amburger wenig weiterführend und überdies nicht zuverlässig. Erik Amburger, Die Pastoren der evangelischen Kirchen Rußlands vom Ende des 16. Jahrhunderts bis 1937, Lüneburg / Erlangen 1998. Die Angaben des biographischen Artikels zu Carl Blum stimmen nicht mit den Angaben zu den einzelnen Gemeinden überein. 5 Zur Charakterisierung von Propst Schilling siehe seine Eröffnungspredigt der Propstsynode in Sissegall am 30. 5. 1867, in: Mitteilungen für die evangelische Kirche in Rußland 23 = NF 14 (1867) 266–277.
Carl Blum – Prediger der Rußlanddeutschen
177
Kolonie Ludwigsthal im Gouvernement Jekaterinoslaw (Taurien)6. Am 20. 9. 1873 wurde dort sein Sohn Johannes Blum geboren. 1874 wurde Carl Blum als Pastor nach Dondangen in Kurland berufen. Er trat am 27. 11. 1874 sein Amt an und wurde am 29. 7. 1875 vom Generalsuperintendenten Lamberg7 eingeführt. Er blieb fünf Jahre in Dondangen, bis er wieder an die Wolga ging. Die Verbindung ins Baltikum blieb aber bestehen. Alle seine größeren Werke wurden dort verlegt: „Gnade um Gnade. Evangelienpredigten für das ganze Kirchenjahr“ in Mitau 18848; „Himmelan. Tägliche Morgen- und Abendandachten“ in Riga 1891; „Christus unser Leben. Epistelpredigten“, in Dorpat 18979. Vom Juni 1879 bis Oktober 1881 war er Pastor in der Kolonie Fresenthal im Gouvernement Samara und von Oktober 1881 an in seinem endgültigen Wirkungsort, der Kolonie Krasnojar an der Wiesenseite der Wolga10. Im Jahre 1889 wurde ihm das goldene Predigerbrustkreuz verliehen. Von 1898–1990 leistete sein Sohn Johannes das Probejahr beim Vater in Krasnojar11. Im Juni 1901 wurde Carl Blum Propst der Wiesenseiten-Präpositur. Sein Wirken an der Wolga endete 1905. Er starb am 10. 2. 1906 in Dorpat. Carl Blum gehört zu den zahlreichen baltischen Pfarrern, die ihren Dienst in den Kolonien in Rußland leisteten. Im Gegensatz zu den meisten von ihnen gelang es Carl Blum aber, mit den Kolonisten vertraut und, so weit möglich, einer der ihren zu werden12. Davon zeugt der andauernde Erfolg seiner Predigtbücher unter den Rußlanddeutschen bis auf den heutigen Tag. 6 Das Kirchspiel wurde 1864 gegründet und umfaßte 24 deutsche Gemeinden. Nach der Zählung von 1905 lebten hier ca. 6057 Deutsche, 6 Esten und 2 Letten; Angaben bei Schnurr (Anm. 4), 371. 7 Theodor Emil Lamberg (1815–1895) Generalsuperintendent und Vizepräsident (d. h. theologischer Leiter) des Kurländischen Konsistoriums von 1862–1887, Angaben nach: Deutschbaltisches Biographisches Lexikon, Lexikon 1710–1960, hg. v. Wilhelm Lenz, Köln 1970, 438f. 8 Carl Blum, Gnade um Gnade. Evangelienpredigten für das ganze Kirchenjahr, Nachdruck Kassel 41993. 9 Carl Blum, Christus unser Leben. Wolgadeutsche Predigten, Nachdruck Erlangen 31993. 10 Die Wolgakolonien wurden je nach dem auf welcher Seite der Wolga sie lagen, unterschieden nach „Bergseite“ (westlich der Wolga) und „Wiesenseite“ (östlich der Wolga). Bei Amburger (Anm. 4), wird angegeben, daß Carl Blum der erste Pfarrer der 1880 gegründeten Kirchengemeinde Krasnojar war. Bei Schnurr (Anm. 4), finden sich widersprüchliche Angaben, die vielleicht auf die Namensähnlichkeit zwischen Krasnojar und Krassnodar zurückzuführen sind; auf Seite 341 ist angegeben, daß Carl Blum von 1881–1905 Pastor in Krassnodar war, während er auf Seite 350 für die Zeit von 1871–1905 als Pastor von Krasnojar verzeichnet wird. 11 Angabe bei Schnurr (Anm. 4), 350. 12 Gerd Stricker, Deutsches Kirchenwesen in: Ders. (Hg.), Deutsche Geschichte im Osten Europas. Rußland, Berlin 1997, 324–418, hier 339: „Baltische Pastoren, seit 1832 in großer Zahl in die Kolonistendörfer entsandt, haben es dort selten lange ausgehalten, zu fremd war ihnen die Mentalität der Kolonisten.; meist blieben sie nur, bis sich in der baltischen Heimat eine Pfarrstelle für sie fand.“ Im Gegensatz dazu ging Carl Blum nach fünf Jahren Pfarramt im kurländischen Dondangen sogar wieder zurück an die Wolga! Zum nicht immer spannungsfreien Miteinander von Kolonisten und Pfarrern vgl. Regina Römhild, Die Macht des
178
Carl Blum – Prediger der Rußlanddeutschen
Einflüsse auf Carl Blum Von Carl Blum sind außer seinen Veröffentlichungen keine Selbstzeugnisse bekannt. Bei dem Versuch, seine Biographie über die oben genannten Stationen hinaus zu rekonstruieren, ist man darauf angewiesen, indirekte Zeugnisse heranzuziehen und diese mit seinen Predigten in Beziehung zu setzen. Das wird im Folgenden versucht. Zunächst sollen die Einflüsse auf Carl Blum in Schulzeit und Studium beschrieben werden.
Schulzeit in Subbath Den größten Teil seiner Kindheit verbrachte Carl Blum unter der Obhut seines Pflegevaters Pastor Gustav Gottlieb Grüner in Subbath. Dieser nahm das verwaiste Kind im Alter von fünf Jahren auf und sorgte für den Unterricht. Der Schul- und Privatunterricht13 in Subbath befähigte Carl Blum, das Gymnasium in Mitau zu besuchen. Von Pastor Grüner gibt es aus der betreffenden Zeit zwei Selbstzeugnisse. Den Aufsatz über die „Selbst-Communion der Geistlichen“14 von 1862 und den Bericht über „Das Missionsfest am 3. und 4. Septbr. 1863 in der Neu-Subbathschen Gemeinde in Kurland“15. Beide Schriften zeigen Grüner als lutherischen Pfarrer, der an den Bewegungen seiner Zeit Anteil nahm und versuchte, Kirche und Gemeinden zu einer vertieften Frömmigkeit zu bewegen. In diesem Sinne hat er seinen Ziehsohn vierzehn Jahre lang beeinflußt.
Die baltische Pfarrerschaft Carl Blum wuchs unter der Obhut von Gustav Gottlieb Grüner in einem Pfarrhaus auf. Die eigentümliche Atmosphäre eines baltischen Pfarrhauses in der Mitte des 19. Jhdts. hat seine Kindheit und Jugend geprägt. Die Stellung der Ethnischen: Grenzfall Rußlanddeutsche: Perspektiven einer politischen Anthropologie (Europäische Migrationsforschung 2), Frankfurt am Main u. a. 1998, 61f. 13 Diese Art des Privatunterrichts oder sogar einer kleinen Privatschule ist typisch für baltische Pfarrhäuser. Vgl. Wilhelm Lenz, Zur Verfassungs- und Sozialgeschichte der baltischen evangelisch-lutherischen Kirche 1710–1914, in: Reinhard Wittram (Hg.), Baltische Kirchengeschichte, Göttingen 1956, 110–129, hier 125: „So entwickelten sich in einzelnen Pastoraten kleine Privatschulen mit dem Charakter eines Progymnasiums“. 14 Gustav Gottlieb Grüner, Ist die Selbst-Communion der Geistlichen zulässig, in: Mitteilungen für die evangelische Kirche in Rußland 18 = NF 9 (1862), 417–435, siehe auch die Retractatio, 593f. 15 Gustav Gottlieb Grüner, Das Missionsfest am 3. und 4. Septbr. 1863 in der Neu-Subbathschen Gemeinde in Kurland, in: DZTK 6 (1864), 100–108.
Carl Blum – Prediger der Rußlanddeutschen
179
Pastoren im Baltikum war zu dieser Zeit nur mit der des Adels zu vergleichen, denn „die Geistlichkeit erhielt auf dem Lande ihren Lebensunterhalt im wesentlichen auf dieselbe Weise wie der grundbesitzende Adel.“16 Dazu kam, daß seit der Gründung der Universität Dorpat die Beziehungen zwischen Pfarrern, sog. Literaten und dem Adel noch vertrauter wurden, da es sich zumeist um Kommilitonen handelte17. So erkannten die adligen Gutsbesitzer meist die Familie des Pastors als gleichberechtigt an. Dabei orientierten sich die Formen des gesellschaftlichen Lebens an denen des Adels. Beide gesellschaftlichen Gruppen hatten neben Lebensgrundlage, universitärer Bildung und gesellschaftlichen Formen auch noch die starke Betonung der Familie gemeinsam. Im Baltikum hatte sich auf diese Weise bereits im 18. Jahrhundert ein Pastorenstand gebildet, in dem die Söhne den Beruf des Vaters ergriffen und Töchter anderer Pastoren heirateten – ein Verhaltensmuster, das Carl Blum übernommen hat. Er wuchs als Pflegekind in diese Familienstrukturen hinein, dann heiratete er die Tochter seines Mentors, des Propstes Schilling. Sein Sohn Johannes Blum wurde wiederum Pfarrer und heiratete 1899 Alice Grüner, die Tochter von Carl Blums Ziehvater aus Subbath18. Carl Blum entsprach damit in Bildungsgang, Familienleben und theologischer Prägung vollkommen dem Erscheinungsbild eines baltischen Pfarrers seiner Zeit.
Studium in Dorpat 1860–65 An der Universität Dorpat19 hatte sich zur Studienzeit von Carl Blum die Verbindung von Erweckungsbewegung20 und lutherischer Theologie durchgesetzt21, die so typisch für die Erlanger Schule ist22. Diesen Zusammenhang beschreibt Gottfried Horning folgendermaßen:
16 17 18 19
Lenz (Anm. 13), 115. Dazu Lenz (Anm. 13), 121–123. Amburger (Anm. 4), 264. Zur Universität Dorpat und ihrer theologischen Fakultät vgl.: Roderich von Engelhardt, Die deutsche Universität Dorpat in ihrer geistesgeschichtlichen Bedeutung (Schriften der deutschen Akademie 13), München 1933; Heinrich Seesemann, Die theologische Fakultät der Universität Dorpat 1802–1918, in: Reinhard Wittram (Hg.), Baltische Kirchengeschichte, Göttingen 1956, 206–219; Peter Hauptmann, Dorpat, in: TRE 9 (1982), 158–162. Zur Bedeutung der Universität Dorpat für die Pfarrerschaft der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Rußland in der Mitte des 19. Jahrhunderts vgl. Gerd Stricker, Rußland (Anm. 12), 352: „Wie mit einem unsichtbaren Band wurde diese Kirche umschlossen vom Lebensbund der in Dorpat ausgebildeten Pastoren“. 20 Zur Geschichte der Erweckungsbewegung vgl. Gustav Adolf Benrath, Erweckung / Erweckungsbewegungen I, in TRE 10 (1982), 205–220; Friedrich Wilhelm Kantzenbach, Die Erweckungsbewegung, Neuendettelsau 1957.
180
Carl Blum – Prediger der Rußlanddeutschen
Die Theologen der Erlanger Schule entdeckten, daß von dem Schleiermacherschen Erbe der Erfahrungstheologie und von dem persönlichen Erlebnis der Wiedergeburt her der gesamte Umfang der lutherischen Lehre gedeutet und angeeignet werden kann. Die persönliche Glaubenserfahrung gibt Anlaß zu einem tieferen Eindringen in die reformatorische Theologie Luthers23.
Carl Blum studierte von 1860–65 an der Universität Dorpat Theologie. An der theologischen Fakultät lehrten in diesen Jahren folgende Professoren24: Johann Heinrich Kurtz (1858–1870 Exegetik), Moritz von Engelhardt25 (1853–1881 Kirchengeschichte), Alexander von Oettingen26 (1853–1880 Dogmatik) Wilhelm Volck, (1861–1898 Semitische Sprachen)27, Arnold Christiani, (1852–1865 Praktische Theologie, in Theodosius Harnacks Abwesenheit28 seit 1855 zugleich Prediger der neugegründeten Dorpater Universitätsgemeinde). Bereits vor dem Studienbeginn von Carl Blum war die Fakultät durch konfessionelle lutherische Professoren geprägt. Den Höhepunkt dieser Ausrichtung erreichte sie aber erst mit der gleichzeitigen Berufung von Moritz von Engelhardt und Alexander von Oettingen im Jahre 185329. Damit dominierte der Einfluß der Erlanger Schule an der Fakultät während der gesamten Studienzeit Carl Blums. In seinen Predigten ist eine Fernwirkung der Konzepte dieser heilsgeschichtlichen Theologie noch deutlich festzustellen. Deshalb soll im Folgenden kurz ein Blick auf die Spezifika der Erlanger Schule geworfen werden. 21 Zur Geschichte der Wiederentdeckung der lutherischen Theologie vgl. Friedrich Wilhelm Kantzenbach, Gestalten und Typen des Neuluthertums, Gütersloh 1968 und Friedrich Wilhelm Winter, Die Erlanger Theologie und die Lutherforschung im 19. Jahrhundert (LKGG 16), Gütersloh 1995. 22 Vgl. Holsten Fagerberg, Luthertum II. Neuluthertum, in: RGG3 4 (1960), 536–540, hier 536: „Das Neuluthertum war ursprünglich eine Erweckungsbewegung […] Im Gegensatz zum ursprünglichen Luthertum ist das Neuluthertum eine ausgesprochene Erfahrungstheologie, die fordert, daß auch der wissenschaftlich arbeitende Theologe bekehrt sein soll“. 23 Gottfried Horning, Lehre und Bekenntnis im Protestantismus, in: HDThG III, 71–220, hier 182. 24 Vorlesungsverzeichnisse aus Blums Studienzeit finden sich z. B. für 1860 in: DZTK 2 (1860), 110 und 1863 in: DZTK 5 (1863), 157. 25 Zu Engelhardt siehe die Schilderungen seines Schülers Nathanael Bonwetsch in den Artikeln Gustav Moritz Constantin von Engelhardt, in: RE2 17 (1886), 770–776 und Gustav Moritz von Engelhardt, in: RE3 5 (1898), 374–379. 26 Zu Oettingen siehe Andreas Pawlas, Ein konservativer Fortschrittler. Das Wirken des baltischen Lutheraners Alexander von Oettingen, in: LM 31 (1993) Heft 2, 28–30. 27 Volck war vor seiner Berufung nach Dorpat Privatdozent in Erlangen. 28 Zu Theodosius Harnack vgl. Georg Merz, Theodosius Harnacks Bedeutung für die lutherische Kirche, in: Ders. Um Glauben und Leben nach Luthers Lehre, hg. von F.W.Kantzenbach (TB 15), München 1961, 200–209. 29 Alexander von Oettingen und Moritz von Engelhardt waren eng miteinander verbunden. Sie stammten beide aus dem einheimischen Landadel, haben gemeinsam die Krümmersche Schule in Werro besucht und waren miteinander verschwägert. Vgl. von Engelhardt (Anm. 19), 241f und 245. Beide haben von 1850–51 in Erlangen studiert.
Carl Blum – Prediger der Rußlanddeutschen
181
Die Rolle Erlanger Theologie im Baltikum Die heilsgeschichtliche Theologie Joh. Chr. Konrad von Hofmanns Die Theologie der sogenannten Erlanger Schule30 hat an der Universität Dorpat vor allem durch die überragende Wirkung Joh. Chr. Konrad von Hofmanns Bedeutung erlangt31. Drei seiner Schüler, Oettingen, Engelhardt und Volck32 dominierten die Fakultät in den Jahren, in denen Carl Blum dort studierte. Vor allem Volck erwies sich als getreuer Schüler Hofmanns. Er vollendete schließlich den monumentalen Kommentar zum Neuen Testament, den Hofmann als Torso hinterlassen hatte. Er war auch der Herausgeber des Briefwechsels zwischen Delitzsch und Hofmann33, in dem eine scharfe Auseinandersetzung zwischen „liberaler“ und „konfessioneller“ Theologie stattfand. Der zentrale Zugang zur Theologie ist bei Hofmann die Wiedergeburtserfahrung. Er erhebt sie zum Ausgangspunkt und zum methodischen Prinzip der Theologie34. Damit gewinnt das Subjekt eine ungeheuer wichtige Rolle. Bei Hofmann wird schließlich das Ich des Glaubenden zum Gegenstand der Theologie. Unmittelbarer Untersuchungsgegenstand für die christliche Theologie ist demzufolge die Glaubenserfahrung und das Gottesverhältnis des Christen: „Ich, der Christ, bin mir, dem Theologen, eigenster Stoff meiner Wissenschaft“35. Ein Abgleiten in totalen Subjektivismus wird nur dadurch verhindert, daß Hofmann behauptet, die Wiedergeburtserfahrung sei nur innerhalb der Existenz einer christlichen Kirche möglich36. Bedingt durch die starke Betonung der Rolle des Individuums vertritt Hofmann keinen starren Konfessionalismus in dem Sinne, daß er sich ausschließlich an den Bekenntnisschriften orientierte. Ebenso ist seine Bibelauslegung nicht durch eine strenge Lehre von der Verbalinspiration bestimmt, sondern dadurch, daß er die Bibel als Darstellung der Heilsgeschichte versteht. Das Fortleben dieser Gedanken bei den Dorpater Professoren zur Zeit 30 Dazu vgl. Karlmann Beyschlag, Die Erlanger Theologie (EKGB 67), Erlangen 1993 und Friedrich Wilhelm Kantzenbach, Die Erlanger Theologie, München 1960. 31 Zu Johann Christian Konrad von Hofmann siehe folgende Literatur: Karl Gerhard Steck, Johann Christian Konrad von Hofmann (1810–1877), in: Martin Greschat (Hg.), Theologen des Protestantismus im 19. und 20. Jahrhundert, Bd. 1, Stuttgart u. a. 1978, 99–112 und F.W. Kantzenbach, (Anm. 30), 179–208, hier 179: „Hofmann […] hat in erstaunlichem Maße die Theologen des 19. Jahrhunderts beeinflußt, die als seine Schüler oder Freunde das Verhältnis von Glaube und Geschichte im Sinne der ‚Heilsgeschichte‘ lösten“. 32 Beyschlag (Anm. 30), 141: „vor allem aber der Hofmann-Schüler Wilhelm Volck (gest. 1904) sicherte einen ähnlichen Kontakt zwischen Dorpat und Erlangen“. 33 Wilhelm Volck, Theologische Briefe der Professoren Delitzsch und von Hofmann, Leipzig 2 1894 (Erstausgabe Dorpat 1890). 34 Horning (Anm. 23), 182. 35 Zitat nach Horning (Anm. 23), 183. 36 Horning (Anm. 23), 183.
182
Carl Blum – Prediger der Rußlanddeutschen
Carl Blums zeigt sich zum Beispiel in Alexander von Oettingens programmatischem Eröffnungsartikel für die 1859 neugegründete „Dorpater Zeitschrift für Theologie und Kirche“. Oettingen betont deutlich die Notwendigkeit des persönlichen Glaubens für den Theologen: So ist denn auch das Object der theologischen Wissenschaft […] nämlich das Christentum als Religion des Heiles, wie es in Christo und seiner Versöhnungstat wurzelnd von dem Worte Gottes urkundlich bezeugt ist, wie es in der Kirche, in ihrem Leben und ihrer Lehre, als neuschöpferisches religiöses Princip eine Gestalt gewonnen und wie es im Herzen des einzelnen Gläubigen als persönlich erfahrene Heilsgnade wirksam ist. Dieses Object hat der Theologe wissenschaftlich […] zu erfassen und widerzuspiegeln. Und das wird er in dem Maaße mit Erfolg thun können, als ihm das geistliche Sensorium für die Aufnahme desselben, nämlich der Glaube lebendig ist, der Glaube, welcher selbst die Voraussetzung ist für die Liebe zum theologischen Object.37
Der persönliche Glaube, der nicht mit der volkskirchlichen Biographie identisch ist, spielt auch in den Predigten Blums eine entscheidende Rolle. Selbst wenn Blum in der Predigt nicht von sich selbst spricht, wird ausreichend deutlich, daß der persönliche Glaube sein wichtigster Zugang zu Theologie und Verkündigung ist. Weissagung und Erfüllung Die Wirkung der Theologie Hofmanns ist bei Carl Blum neben dem persönlichen Zugang zur Theologie vor allem in der heilsgeschichtlichen Konzeption von Weissagung und Erfüllung zu finden38. Deshalb sollen kurz die Besonderheiten dieser Denkweise bei Hofmann dargestellt werden. Das Schema von Weissagung und Erfüllung ist als exegetisches Verfahren seit der alten Kirche bekannt. Hofmann erweitert es aber universalgeschichtlich und macht es zur Basis von Exegese und Kirchengeschichtsschreibung. So versteht er die Bibel als eine Schilderung der Geschichte des Heils im Schema von „Weissagung und Erfüllung“, die ihre Mitte in Jesus Christus hat39. Das weitet er noch auf die Geschichte als Ganze aus, so daß nach Hofmann „Der wesentliche Inhalt der Geschichte mit der in der heiligen Schrift niedergelegten Weissagung und Erfüllung zusammenfalle“40. Es ergibt sich ein universalgeschichtlicher Dreischritt, in dem die 37 Alexander von Oettingen, Theologie und Kirche, in: DZTK 1 (1859), 1–45, hier 22–23. 38 Vgl. Uwe Swarat, Die heilsgeschichtliche Konzeption Johannes Chr. K. von Hofmanns, in: Helge Stadelmann (Hg.), Heilsgeschichte als Thema der Theologie, Basel und Wuppertal 2 1988, 211–239. 39 Johann Christian Konrad von Hofmann, Weissagung und Erfüllung im alten und neuen Testamente. Ein theologischer Versuch, Bd. 1 Nördlingen 1841, 58: „Jesus ist Schluß, aber auch Anfang der Geschichte: seine Erscheinung im Fleische ist der Anfang des Endes“. 40 von Hofmann (Anm. 39), 11.
Carl Blum – Prediger der Rußlanddeutschen
183
Geschichte in drei Bereiche aufgeteilt wird: erstens alttestamentliche Weissagungen, die in Christus erfüllt werden41, zweitens die Lebenszeit Christi, drittens Weissagungen im Neuen Testament, die sich bei der Wiederkunft Christi erfüllen werden. Die Stellung zum Judentum Dem Schema von Weissagung und Erfüllung ist eine antijüdische Pointe inhärent. Denn das Alte Testament hat keinen Wert in sich selbst, sondern ist nur Weissagung. Die Erwählung des Volkes Israel geht auf die Heiden über. Das illustriert das folgende Zitat aus dem von Wilhelm Volck bearbeiteten 10. Band von Hofmanns Bibelauslegung „Die heilige Schrift des neuen Testaments“: Die neutestamentliche Geschichte ist Geschichte der Erfüllung der auf der alttestamentlichen Weissagung beruhenden auf den Ausgang der Weltzeit gerichteten Hoffnung Israels, aber einer Erfüllung, durch welche die Stätte des erwarteten Heiles die außerisraelitische Völkerwelt geworden, während das jüdische Volk als solches in Folge seiner Abgeneigtheit und Feindseligkeit gegen die in seiner Mitte begonnene Verwirklichung desselben innerem und äußerem Unheil anheimfiel.42
Oder wie Hofmann selbst es noch kürzer sagt: „Das jüdische Volk im Ganzen verstockte sich und das Evangelium ging über zu den Heiden.“43 Damit ist aber das Volk Israel nicht endgültig aus der Heilsgeschichte entlassen. Es hat eine bleibende Bedeutung in der Weltgeschichte. Denn nach Röm 11,25f. soll das ganze Volk Israel nach der Bekehrung der Heiden gerettet werden. Deshalb spielen bei Hofmann die Juden immer wieder eine Rolle in den Vorstellungen vom Kommen des Gottesreiches: „wenn es eines Volkes bedarf, um Jesu Zukunft in Herrlichkeit vorzubereiten, wie einst seine Zukunft in Niedrigkeit, so ist das jüdische noch immer das hierzu berufene“44. Neben der Heidenmission als 41 von Hofmann (Anm. 39), 36: „Indem der Sohn Gottes aus einem unter vielen Völkern gekommen ist, sehen wir die Stellung Israels bestimmt, dessen Vorzug vor den übrigen dadurch zugleich ins Licht gestellt und auch abgethan wurde. Aller Fortgang der Geschichte dieses Volkes wurde damit für Fortschritt in der Geschichte des Heils erklärt, denn ihr Ergebnis war Bedingung der Geburt Jesu. Indem aber nun offenbar wird, auf wen jene Geschichte gemeint gewesen, hat sie somit ihre Endschaft erreicht“. 42 Johann Christian Konrad von Hofmann, Die heilige Schrift des neuen Testaments, 10. Teil, Die biblische Geschichte des neuen Testaments nach Manuskripten und Vorlesungen bearbeitet von Wilhelm Volck, Nördlingen 1883, 17. 43 von Hofmann (Anm. 39), Bd. 2, 211. 44 von Hofmann (Anm. 39), Bd. 1, 37. Vgl. auch Bd. 2, 211: „Doch schließt die neutestamentliche Geschichte vor dem Vollzuge der Scheidung, welche zwischen den an Jesus gläubigen und den auf einen anderen Christ wartenden Juden eintreten mußte, während hinwiederum die neutestamentliche Prophezeiung ihre Aussagen von des Herrn Jesu Wiederkehr mit Schilderungen einer Zeit anhebt, in welcher das heilige Volk bereits wieder in seinen eigenthümlichen Beruf eingetreten ist“.
184
Carl Blum – Prediger der Rußlanddeutschen
Aufgabe der Kirche bis zum Ende der Welt hat deshalb auch die Judenmission ihre Bedeutung, für die sich im auch Baltikum einige Kreise stark engagierten45. Die Rolle der Mission Weniger bekannt, aber für die Einordnung von Carl Blum ebenfalls von Interesse, ist die Tatsache, daß zwei seiner theologischen Lehrer, Alexander von Oettingen und Johann Heinrich Kurtz Beziehungen zur Hermannsburger Mission hatten. Das ist eine Ergänzung zu den Kontakten, die zwischen den baltischen Kirchen und der Leipziger Missionsanstalt bestanden, an die sie organisatorisch und finanziell angeschlossen waren. Von Oettingen findet sich 1860 – dem ersten Studienjahr Blums – ein begeisterter Bericht von einer Reise nach Hermannsburg in der Dorpater Zeitschrift für Theologie und Kirche46. Aus dem Jahr 1862 ist ein weiterer Reisebericht nach Hermannsburg erhalten. Dort berichtet der Dorpater Propst Willigerode ebenfalls enthusiastisch von seiner Fahrt47. Diese Begeisterung für die Mission trifft Carl Blum nicht unvorbereitet. Bereits in seiner Kindheit wurde ihm die Mission als wesentliche Aufgabe der Kirche nahegelegt. Das belegen die Äußerungen seines Pflegevaters Pastor Grüner aus Subbath im Bericht über das Missionsfest 1863: Die Kirche Christi ist als solche eine missionierende Kirche; verläugnet sie diesen wesentlichen Charakter, so verläugnet sie damit ihren Herren und vergißt seinen ausdrücklichen Befehl.48
Das entspricht der allgemeinen Begeisterung für die Mission in dieser Zeit. Sowohl im Baltikum wie auch in den anderen Bereichen der lutherischen Kirche in Rußland war ein starkes Engagement für die Mission verbreitet. Rückblickend berichtet ein Artikel aus dem Jahr 1884: Vor etwa dreißig Jahren ist die Heidenmission aus der Verborgenheit einzelner christlicher Kreise in das öffentliche Gemeindeleben hinausgetreten. Mit nicht geringer Anteilnahme werden Missionsfeste wie in den Städten so in den Landgemeinden der Ostseeprovinzen, in den Kolonien in Wolhynien, im südlichen Rußland und an der
45 Über die Judenmission wird in den Jahren zwischen 1865 und 1880 in der „Dorpater Zeitschrift für Theologie und Kirche“ und den „Mitteilungen für die Evangelische Kirche in Russland“ heftig debattiert. 46 Alexander von Oettingen, Ein Besuch in Hermannsburg, in: DZTK 2 (1860), 110–127. Oettingen beurteilt neben aller Begeisterung die Person von Ludwig Harms nicht uneingeschränkt positiv. Er hat ihn als zu streng und starr erlebt. 47 in: DZTK 4 (1862), 565–597. 48 Grüner (Anm. 14), 101.
Carl Blum – Prediger der Rußlanddeutschen
185
Wolga gefeiert […] Laut den Jahresberichten der betreffenden Gesellschaften empfing Leipzig im J.[ahre] 1881 von der lutherischen Kirche Rußlands 29.599 Mark49.
Diese Begeisterung für die Mission läßt sich mit der heilsgeschichtlichen Theologie der Erlanger Schule verbinden. Mission war in diesem theologischen Bezugsrahmen immer auch verstehbar als ein Engagement für die Vollendung des Reiches Gottes, die beginnen sollte, wenn das Evangelium bis an die Enden der Erde ausgebreitet war.
Carl Blums Predigten Nach den Einflüssen auf Carl Blum sollen nun seine Predigten selbst Gegenstand der Untersuchung sein. Zunächst erfolgt eine kurze formale Analyse, danach in zwei Abschnitten die inhaltliche Analyse. Dabei werden die Wirkung der Erlanger Theologie auf Carl Blum und seine Wirkung als Prediger der Bekehrung und der Heiligung untersucht.
Aufbau und Stil der Predigten Alle Predigten Carl Blums, sei es zu Evangelientexten oder Episteln, sind formal nach dem gleichen Schema aufgebaut. Auf den Kanzelgruß folgt die Verlesung des Predigttextes. Daran schließt sich die Einleitung an, in der das Thema der Predigt formuliert wird. Das Thema kann als Aussage oder als Frage an die Hörer gestaltet sein und ist in ein bis drei Abschnitte gegliedert. An die Themenstellung schließt sich ein darauf bezogenes Gebet an. Dann folgt die Entfaltung des Themas. Am Ende des letzten Abschnitts steht der Predigtschluß, der das Thema noch einmal bündelt. Öfter wird am Schluß ein passender Liedvers zitiert. Bei den Evangelienpredigten ist das Predigtlied angegeben, in beiden Bänden das Lied vor der Predigt. Diese Art des Predigtaufbaus hat Parallelen bei Ludwig Hofacker50 und Ludwig Harms51, die ihre 1857 bzw. 1868 veröffentlichten Predigten durchgehend nach dem gleichen Muster konzipierten. Damit knüpfen Blum, Hofacker und Harms an Traditionen der älteren pietistischen Predigten an, die ebenfalls einen vergleichbaren Aufbau haben. So hat der bei Blum im
49 G. C. Nöltingk, Russland, in: RE 132 (1884), 119–137, hier 131. Mitteilungen über die Höhe der Missionsbeiträge aus dem Baltikum finden sich regelmäßig in den „Mitteilungen und Nachrichten für die evangelische Kirche in Russland“. 50 Gerhard Schäfer, Ludwig Hofacker, in: TRE 15 (1986), 467–469. 51 Hugald Grafe, Ludwig Harms, in: TRE 14 (1985), 449–450.
186
Carl Blum – Prediger der Rußlanddeutschen
Vorwort zu „Gnade um Gnade“ erwähnte Immanuel Gottlob Brastberger52, seine 1758 veröffentlichen Evangelienpredigten nach dem gleichen Schema aufgebaut, nur – wie auch Ludwig Harms – regelmäßig ein Predigtschlußgebet angefügt. In der praktischen Theologie der Entstehungszeit der Predigten von Carl Blum galt dieses Schema bereits als altertümlich. Im Lehrbuch von Ernst Christian Achelis (1911) wird zum Beispiel die Einleitung vor die Textlesung gestellt, die Invocatio auf eine kurze Formel reduziert und die Erklärung des Bibeltextes der thematisch gegliederten Predigt als mindestens gleichwertig gegenüber gestellt53. Die zeitgleich mit Blum entstandenen Predigten des Rußlanddeutschen Samuel Keller sind bereits wesentlich einfacher konzipiert. Bei ihm schließt sich die Auslegung unmittelbar an die Textlesung an. Trotz einer gewissen Altertümlichkeit bedarf die Absicht der Predigten Blums, die Grundgedanken des Textes thematisch zu entfalten, keiner Rechtfertigung. Sie ist zeitlos. Die Gefahr, dieser Art zu predigen, – daß der Prediger jeden Text zu seinen Lieblingsthemen passend predigt – besteht dabei völlig unabhängig von formalen Kriterien54.
Carl Blum als Theologe der Erlanger Schule Das Schema von Weissagung und Erfüllung spielt auch in den Predigtbänden Carl Blums eine zentrale Rolle. Viele seiner Predigten sind vom heilsgeschichtlichen Denken geprägt. In den Predigtbüchern sind leider keine Predigten über alttestamentliche Texte veröffentlicht, bei denen dieses Auslegungsmuster sicherlich am besten zu studieren wäre55. Dennoch macht Blum – vor allem in den Evangelienpredigten – häufig von diesem Schema Gebrauch. Dabei besteht ein signifikanter Unterschied zwischen den Evangelien- und den Epistelpredigten. Gemäß dem Hofmannschen Dreischritt bezieht Blum sich in den Evangelienpredigten oft auf alttestamentliche Weissagungen, die in Christus als erfüllt gelten56, während er sich in den Epistelpredigten auf die Zukunft der Kirche 52 Vgl. Theodor Christlieb, Geschichte der christlichen Predigt, in: RE2 18 (1888), 466–653, hier 567. 53 Ernst Christian Achelis, Lehrbuch der Praktischen Theologie 2. Bd., Leipzig 1898, 223–269. 54 Vgl. Christlieb (Anm. 52), 614, der das für Ludwig Hofacker so beschreibt: „Mit großer Freiheit kann er sich dann und wann mehr nur an den Text anlehnen, ohne ihn genau ins Einzelne zu verfolgen […] Aber auch sonst fällt bei ihm aller Nachdruck auf die Anwendung, nicht auf die Textauslegung im Einzelnen“. Oder um es mit Hofackers eigenen Worten zu sagen: „Meine Sachen handeln stets um Buße und Glauben an den Herrn Jesum, daß er der einzige Weg zum Leben sei“. 55 Die erwähnte erste gedruckte Abhandlung Carl Blums: „Fraget nach den vorigen Wegen, eine Predigt über Jer 6,16“ war mir leider nicht zugänglich. 56 Carl Blum, Christus unser Leben, (Anm. 9) 183: „Auf diese Erlösung durch Christum weist das ganze Alte Testament hin mit allen seinen Einrichtungen“.
Carl Blum – Prediger der Rußlanddeutschen
187
bezieht, die in der Erwartung ihres Herren lebt. Ein Beispiel dafür, daß eine ganze Predigt auf dem Schema von Weissagung und Erfüllung aufgebaut sein kann, ist die Evangelienpredigt zu Estomihi: Sein Leiden und Sterben, sowie die Ursache seines Leidens und Sterbens, nämlich um unseretwillen, zu unserer Versöhnung, würden wir gar nicht verstehen, wenn Gott uns das alles nicht vorher durch die Propheten angezeigt und verkündigt hätte. Wie das Alte Testament überhaupt von Christus weissagt […] So wollen wir nun zur Stärkung unseres Glaubens einige dieser Weissagungen und ihre Erfüllung näher ansehen57.
Daneben dient ihm dieses Schema aber auch zur Auslegung einzelner Aspekte eines Predigttextes. In der Predigt zum Trinitatisfest über Joh 3,1–15 verweist Blum zur Illustration der „neuen Geburt“ auf Ez 36,25f als alttestamentliches Vorbild der christlichen Taufe. Dieser Hinweis geschieht in der Weise, daß die alttestamentliche Stelle aus Vorankündigung, eben als Verheißung, beschrieben wird, während das Neue Testament, beziehungsweise die christliche Praxis, die Erfüllung bringt: „Da ist die neue Geburt aus Wasser und Geist schon im Alten Testament verheißen, und in der christlichen Taufe ist diese Weissagung erfüllt.“58 Durch den Blick auf die alttestamentlichen Weissagungen gerät auch für Carl Blum die heilsgeschichtliche Rolle der Juden in den Blick. Zumeist ist nur die Rede von ihrem Abfall und der Zerstreuung als Strafe für die Verwerfung Jesu. Er schreibt in seiner fünften Fastenpredigt: Die Schreckenszeiten, von denen der Herr damals redete, sind schon längst über Israel gekommen. Die Heere der heidnischen Römer waren die Ruten, mit denen Gott sein abtrünniges Volk züchtigte und richtete59.
Oder in der Evangelienpredigt zu Judika: Die Steine, die sie gegen ihn aufhoben, sind auf die Juden selbst zurückgefallen und haben sie schwer getroffen […] Sie haben ihn verworfen, er aber hat sich aus den Heiden Völker gesammelt, die ihm Anbetung, Preis und Ehre bringen60.
Solche Polemik steht in der Tradition des christlichen Antijudaismus, wird aber in einer heilsgeschichtlichen Perspektive besonders wichtig, weil sich aus der Verwerfung des Volkes Israel die Erwählung der Kirche aus den Heidenvölkern herleitet. Der Auftrag zur Ausbreitung des Evangeliums bis an die Enden der Erde gibt dazu den zeitlichen Rahmen, denn erst nach der Erfüllung dieser 57 Carl Blum, Gnade um Gnade (Anm. 8), 152. 58 Carl Blum, Gnade um Gnade (Anm. 8), 366. Vgl. auch die Predigt am dritten Advent: „Aus der Erfüllung der Weissagungen jener Zeit sehen wir, daß Jesus der Heiland ist“ (Anm. 8), 28. 59 Carl Blum, Gnade um Gnade (Anm. 8), 244. 60 Carl Blum, Gnade um Gnade (Anm. 8), 240. Vgl. auch die antijüdischen Ausfälle in der Predigt zum 4. Sonntag nach Epiphanias, 113, oder der vierten Fastenpredigt, 231.
188
Carl Blum – Prediger der Rußlanddeutschen
Aufgabe, sollen sich die übrigen Juden zu Christus bekehren. Wie das Schema von Weissagung und Erfüllung mit der Rolle der Juden und der Bedeutung der Heidenmission verschränkt ist, führt Blums Evangelienpredigt am Epiphaniasfest deutlich vor Augen: An die Stelle des Volkes Israel sind wir nun getreten, wir Christen. Wir haben das Wort Gottes: das Alte Testament, das uns von Christus weissagt, und das neue Testament, das uns zeigt, wie in Jesus von Nazareth der verheißene Christus in die Welt gekommen ist. Wir Christen allein sind imstande, den Heiden den Weg zu Christus zu weisen, darum sollen wir nun auch dafür sorgen, daß das Evangelium von Christus den Heiden gepredigt werde61.
Das beste Beispiel für eine Predigt Carl Blums, die als Ganze aus der Perspektive der Verwerfung der Juden und der Erwählung der Heiden gestaltet worden ist, ist die Evangelienpredigt vom 2. Sonntag nach Trinitatis über das Gleichnis vom „Großen Abendmahl“ (Lk 14, 16–24). Hier setzt Blum die Juden mit den ursprünglich eingeladenen Gästen gleich, die die Einladung mißachten und schließlich verworfen werden. In seiner Perspektive sind die Christen die Eingeladenen von den Hecken und Zäunen, die Gott als der Gastgeber hereinnötigt62. Ihnen gehört das Heil, freilich nicht ohne Bedingung. Sie gelangen nur dann ins Reich Gottes, wenn sie sich ernsthaft bekehren. In der Predigt über das Gleichnis vom „Großen Abendmahl“ bringt Blum das Thema der Verwerfung der Juden und der Erwählung der Christen mit dem Thema „Mission“ in Beziehung. Es ist vorrangige Aufgabe der bekehrten Christen, zu missionieren, solange es noch „Gnadenzeit“ ist. Weil das Kommen des Reiches vom Erfolg der Mission abhängt, stehen für Blum auch die Aktivitäten in der Mission unter einer heilsgeschichtlichen Perspektive. Es soll allen Menschen das Evangelium verkündet werden, bis der Herr wiederkommt. In der Geschichte der Verbreitung des Christentums zeigt sich für Blum die Wahrheit des Glaubens „der die Welt überwunden hat“63. Daher nimmt die Mission in seinen Predigten großen Raum ein, obwohl es der lutherischen Kirche verboten war, Mission innerhalb Rußlands zu treiben. Dennoch ruft Blum immer wieder zur Heidenmission64 auf und betont ihre besondere Wichtigkeit. Die Dringlich61 Carl Blum, Gnade um Gnade (Anm. 8), 88. 62 Carl Blum, Gnade um Gnade (Anm. 8), 381: „Was tat denn nun Gott, als die Juden die Einladung zu seinem Reich verachteten? […] Die Juden hörten nicht auf diese Warnung. Darum wurden sie verworfen, und Gott erweckte sich Kinder aus den steinharten Herzen der Heiden. Den Juden wurde das Reich Gottes genommen und den Heiden gegeben“. 63 Carl Blum, Christus unser Leben (Anm. 9), 233: „wie Christus am Osterfest von den Todten auferstanden ist und über seine Feinde triumphiert hat, so hat auch der Christenglaube immer wieder den Sieg davon getragen über seine Feinde und Gegner, damit jedermann sehen könne, daß unser Glaube der Sieg ist, der die Welt überwunden hat“. 64 Die russischen Gemeinden unterstützten Missionsgesellschaften in Deutschland und dem Baltikum (s. o. unter S. 184). Die Ev.-luth. Kirche war zwar in Rußland anerkannt und der Zar
Carl Blum – Prediger der Rußlanddeutschen
189
keit seiner Aufforderungen unterstreicht er zum Beispiel dadurch, daß er sie in Analogie zur Weihnachtsbotschaft der Engel vorträgt: Es ist Gottes Wille, daß das Weihnachtslicht immer weiter leuchten soll, daß es auch den Völkern leuchten soll, die noch in Finsternis und Schatten des Todes sitzen. Wie soll das geschehen? Das soll durch die Mission geschehen. Wie Gott uns durch seinen Engel die Geburt des Heilandes verkündigen ließ, so soll die Mission der Engel sein, durch welchen auch den Heiden verkündigt werden soll, was Gott zu Weihnachten auch für sie gethan hat65.
Blum flicht in seine Predigten auch immer wieder Erlebnisse von Missionaren aus der Heidenmission ein, so zum Beispiel in der Evangelienpredigt am zweiten Pfingsttag, in der er gleich zwei Beispiele von Missionaren anführt, die den Text Joh 3,16 in ihrer Missionspredigt erfolgreich gebraucht hätten66. Die Judenmission spielt merkwürdigerweise in den Predigten Blums keine Rolle, obwohl sie im Baltikum zunächst heftig diskutiert und dann energisch gefördert wurde67. Sein heilsgeschichtliches Denken hätte erwarten lassen können, daß er sich für eine starke Missionstätigkeit unter Juden einsetzt. Denn nach Paulus wird sich Israel bekehren, wenn das Reich Gottes kommt (Röm 11,25f). Analog zum „Herbeizwingen“ des Reiches Gottes durch die angestrebte Vollendung der Weltmission, hätte demnach ein weiterer Schwerpunkt auf der Judenmission liegen können. Das Wirken Blums und anderer Prediger haben dazu geführt, daß 1884 – dem Jahr in dem „Gnade um Gnade“ veröffentlicht wurde – das kirchliche Leben in den Wolgakolonien mit folgenden drei Punkten resümiert werden konnte: „An kirchlichem Sinne fehlt es den Kolonisten nicht. Der Kirchenbesuch ist gut. Der Mission sind die Herzen erschlossen.“68 Insgesamt erweist sich Carl Blum als ein Schüler der theologischen Lehrer, die er an der Universität Dorpat kennengelernt hat. Seine Predigten sind durch und durch vom heilsgeschichtlichen Denken der Erlanger Theologie geprägt. Er
65 66 67
68
ihr formelles Oberhaupt, vgl. Gerd Stricker, Rußland (Anm. 12), 348–353, aber dennoch durfte sie nicht unter der umgebenden Bevölkerung missionierend tätig werden. Diese einschränkenden Vorschriften wurden vom Zaren auf Druck der russisch-orthodoxen Kirche erlassen. Carl Blum, Christus unser Leben (Anm. 9), 16. Carl Blum, Gnade um Gnade (Anm. 8), 354. Blum äußert sich in beiden Predigtbänden nahezu gleichlautend und ohne jeden Enthusiasmus zu der Tatsache, daß es Übertritte von Juden zum Christentum gibt. Carl Blum, Gnade um Gnade (Anm. 8), 381: „Einige wenige von ihnen [sc. den Juden] haben sich zu allen Zeiten bekehrt, damit erfüllt werde die Weissagung: Ein Rest wird sich bekehren, – aber die große Masse des Volks ist ausgeschlossen von dem Reich Christi, bis die Fülle der Heiden eingegangen sein wird“; und Carl Blum, Christus unser Leben (Anm. 9), 231: „Einige von ihnen haben sich zwar zu allen Zeiten bekehrt, damit die Weissagung in Erfüllung gehe, die da sagt, daß ein Rest von ihnen sich bekehren wird, aber Israel als Volk bleibt hart und verstockt, bis die Fülle der Heiden eingegangen sein wird“. Nöltingk (Anm. 49), 126.
190
Carl Blum – Prediger der Rußlanddeutschen
versteht das Alte Testament als Weissagung, die auf das Neue Testament oder auf die Kirche vorausweist. Die Weissagungen des Neuen Testamentes bezieht er auf die Praxis der Gemeinde, wie sich am Beispiel der Mission eindrucksvoll zeigen ließ. In der stärkeren Betonung der Heiligung in den Epistelpredigten, die im Folgenden untersucht wird, liegt ein weiteres Indiz für diese Wirkung des heilsgeschichtlichen Denkens der Erlanger Theologie. Auch die für Hofmann so typische Betonung des eigenen Glaubens als Ausgangspunkt aller Theologie hat seine Entsprechung bei Carl Blum, sie zeigt sich im erwecklichen Impetus der Predigten.
Carl Blum als Prediger der Bekehrung und Heiligung Carl Blum als Prediger der Bekehrung Der wesentliche Inhalt aller Predigten Carl Blums ist der einer Erweckungspredigt. Blum richtet sich an müde gewordene Christen, die in einer volkskirchlichen Situation aufgewachsen und geprägt worden sind und versucht, sie mit dem Ruf zur Buße und Bekehrung aufzurütteln. Blum weist in den Predigten regelmäßig auf die volkskirchliche Prägung seiner Predigthörer hin. Diese Situation kann er positiv beurteilen, als Ruf Gottes, der in Taufe, Unterricht, Konfirmation, Trauung, Beichte und Abendmahl immer wieder an die Gemeindeglieder ergeht69 – er kann aber auch polemisch und aufrüttelnd von einem bloßen Namenschristentum sprechen70, das für das Heil irrelevant ist71. In kaum einer Predigt fehlt deshalb der Ruf zur Bekehrung. Die Zuhörer sollen ernst machen mit ihrem Christentum und ihre Herzen Christus öffnen. Das Gegensatzpaar „tot“ und „lebendig“ spielt für die Veranschaulichung dieser Botschaft eine große Rolle: Wie durch den lebendigen Christus neues Leben in die tote Welt ausgegangen ist, so kann neues Leben in die tote Christenheit nur dann ausgehen, wenn wir uns selbst durch ihn zu neuem Leben erwecken lassen. Denn tote Christen können nur durch lebendige Christen vom geistlichen Tod erweckt werden72. 69 Carl Blum, Gnade um Gnade (Anm. 8), 135. 70 Carl Blum, Christus unser Leben (Anm. 9), 375 und ebenda 35: „Denn dadurch allein, daß du in einem christlichen Kirchenbuch verzeichnet stehst, bist du noch kein Christ, sondern dann erst, wenn Christus durch den heiligen Geist in dir wohnt und du mit allem Ernst darnach trachtest, ebenso gesinnt zu sein, wie Christus gesinnt war.“ 71 Carl Blum, Gnade um Gnade (Anm. 8), 413f, hier 414: „Mit dem äußeren Gottesdienst und einem ehrbaren Leben ist noch niemand selig geworden. Mehr, weit mehr verlangt der Herr. Er verlangt, wir sollen von neuem geboren, aus Gott geboren sein, wenn wir ins Himmelreich kommen wollen.“ 72 Carl Blum, Gnade um Gnade (Anm. 8), 279.
Carl Blum – Prediger der Rußlanddeutschen
191
Blum ist wie andere Prediger der Erweckungsbewegung von der Überzeugung durchdrungen, daß die Zeit der Gnade, in der Gott Umkehr zuläßt, zu Ende geht. Daher ruft er mit großem Ernst dazu auf, das „Heute“73 zu nutzen und die Gnadenzeit nicht verstreichen zu lassen74. „Denn wer nicht auf Gottes Bußruf hört, der verfällt dem Gericht. Das sagt uns das Wort Gottes, das predigt uns die Weltgeschichte“75. Als historisches Exempel für Gottes Gericht über Menschen, die nicht Buße tun, sieht Blum das Schicksal der Juden an. Die Zerstörung des Tempels und die Zerstreuung werden als Strafgericht für ihre Unbußfertigkeit verstanden. Hierin erweist sich die für Blum charakteristische Verbindung des heilsgeschichtlichen Denkens der Hofmannschen Theologie mit der Frömmigkeit der Erweckungsbewegung als Fortsetzung des christlichen Antijudaismus76. So schreibt Blum in seiner Evangelienpredigt am 10. Sonntag nach Trinitatis: Was half der äußere Gottesdienst und der herrliche Tempel? Was half es, daß sie ihn ehrten und ihm mit Hosiannagesang entgegen zogen? Das Volk ehrte ihn wohl mit seinen Lippen, aber ihr Herz blieb ferne von ihm. Darum mußten Gottes Gerichte über die Stadt hereinbrechen. […] Durch Gottes Gnade ließen sie sich nicht zur Buße leiten, darum wurden sie von Gottes Gerichten zermalmt. O, daß es doch mit uns, meine Lieben, anders wäre! 77
Der letzte Satz zeigt ein weiteres Charakteristikum der Predigt Carl Blums. Er bleibt nie bei einer bloß historischen Perspektive. Seine Predigt ist wie alle erwecklichen Predigten anthropologisch orientiert. Ako Harbeck hat das für Hofacker zutreffend beschrieben: „um den Menschen geht es, der Mensch wird ernstgenommen, angesprochen, umworben; sein Heil, seine Rettung, seine Erweckung oder Verstockung stehen auf dem Spiel“78. Die Ansprache an den Einzelnen ist in Blums Predigten immer wieder zu beobachten. Die Hörer sollen merken, daß es um ihre Sache, um ihr Heil geht; tua res agitur! Dazu redet er die Gemeinde auch direkt an: Wie steht’s denn mit dir, o Seele? Hast du diesen Tag [sc. der Bekehrung, R.H.] schon gehabt? Hast du dich von Herzen in Jesu Dienst begeben? 79 73 Vgl. auch Ludwig Hofacker, Predigten für alle Sonn-, Fest-, und Feiertage, Stuttgart 211857, 457: „Höret Seine Stimme, so lange es ‚heute‘ heißt, und laßt euch das nicht vom Taumel der Welt in die Ferne rücken.“ 74 Zum Beispiel, Carl Blum, Gnade um Gnade (Anm. 8), 252: „Jetzt aber ist noch die Zeit der Gnade und der Tag des Heils“. 75 Carl Blum, Gnade um Gnade (Anm. 8), 167. 76 Vgl. auch Carl Blum, Gnade um Gnade (Anm. 8), 226: „Jesus […] o, bewahre uns vor der Sünde Israels, daß wir doch nicht hören auf die Teufelsstimmen, die uns von dir abwendig machen wollen.“ 77 Carl Blum, Gnade um Gnade (Anm. 8), 446f, vgl. auch 229 239 243f 440 u. ö. 78 Hans-Jakob (Ako) Haarbeck, Erweckliche Predigt dargestellt an Ludwig Hofacker, Diss. theol. Göttingen 1958, 118f. 79 Carl Blum, Gnade um Gnade (Anm. 8) 402.
192
Carl Blum – Prediger der Rußlanddeutschen
Der Ernst des Rufes zur Umkehr kommt aus der Gewißheit des Gerichtes. Nur die Bekehrung kann vor dem Zorn Gottes und seinem Gericht bewahren. Anderenfalls drohen die „ewige Verzweiflung“ oder andere Bilder, die Blum für die Hölle gebraucht. An manchen Stellen nähert sich Blum einer radikalen Betonung der Bekehrung als einzigem Weg zum Heil80. An anderen Stellen kann er die Taufe als Beginn des neuen Lebens in Gott anerkennen81. Er schärft aber seiner Gemeinde ein, sich nicht auf die Tatsache des Getauftseins zu verlassen: „Denn die Taufe ist kein Zaubermittel und wird uns nichts helfen, wenn wir nicht in der Taufgnade bleiben“82. Im Extremfall kann er sogar Taufe und Bekehrung als aufeinanderfolgende Stufen im Glauben verstehen: Viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Die Berufenen, – das sind die, die getauft sind, die Gottes Wort hören und zum Abendmahl gehen: die den äußeren Gottesdienst mitmachen. Die Auserwählten, – das sind die, die nicht nur den äußeren Gottesdienst mitmachen, sondern glauben an das Evangelium von Jesus Christus und durch ihn eine neue Kreatur geworden sind83.
Der Weg der Bekehrung ist der Weg, auf dem der Mensch sich seiner Sünde bewußt wird und unter der Sündenlast stöhnend sich Christus anvertraut, der sich den Zerschlagenen gnädig nähert. Die Gnade Gottes gilt einzig und allein diesen zerknirschten Sündern, denn „wer sich nicht als Sünder vor Gott erkennt, der sucht auch nicht Gottes Gnade“84. Der nächste Schritt ist dann die Buße: „Es ist aber nicht genug, daß wir unsere Sünden erkennen; nicht genug, daß unser Herz geängstet und zerschlagen ist um unserer Sünden willen: der Herr verlangt, wir sollen Buße tun“85. Das Vertrauen zu Gottes Gnade soll der reuige Sünder nicht aus einem Gefühlsüberschwang, sondern aus Gottes Wort gewinnen86. Blum wird nicht müde, zu wiederholen, daß Gott die Sünden wegnehmen will – allein aus Gnaden. Hier zeigt er sich als eindeutiger Vertreter lutherischer Theologie. Die Betonung der Gnade zeigt sich auch schon im Titel der Evange-
80 Carl Blum, Christus unser Leben (Anm. 9), 359: „Die Sünde führt in den Tod hinein, die Bekehrung von der Sünde aber in’s Leben. Die Sünde führt an den Ort, wo Verzweiflung sein wird, die Bekehrung von der Sünde in den Himmel mit seiner unaussprechlichen Seligkeit und Herrlichkeit.“ 81 Carl Blum, Christus unser Leben (Anm. 9), 179: „In der Taufe fängt die neue Geburt, das neue Leben aus Gott an, denn die Taufe ist das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung durch den Heiligen Geist“, vgl. auch 345. 82 Carl Blum, Christus unser Leben (Anm. 9), 351 und 179. 83 Carl Blum, Gnade um Gnade (Anm. 8), 140. 84 Carl Blum, Gnade um Gnade (Anm. 8), 454. 85 Carl Blum, Gnade um Gnade (Anm. 8), 171. 86 Carl Blum, Christus unser Leben (Anm. 9), 136: „Du aber sollst diese Verheißung im Glauben in dein Herz fassen, und deinen Glauben nicht gründen auf deine Herzensgefühle und Empfindungen, sondern auf Gottes Wort und Zusage.“
Carl Blum – Prediger der Rußlanddeutschen
193
lienpredigten „Gnade um Gnade“, der uns als stehende Wendung in den Predigten immer wieder begegnet87. Carl Blum als Prediger der Heiligung Die Beschränkung der Predigt auf den Ruf zur Bekehrung und damit auf die Soteriologie ist ein typisches Kennzeichen der Erweckungspredigt88, spezifische Inhalte der einzelnen Predigttexte treten darüber völlig in den Hintergrund89. In den Epistelpredigten kommt zum Ruf zur Bekehrung noch der Anspruch der Heiligung dazu, mit dessen Hilfe die Konsequenzen von Buße und Bekehrung entfaltet werden. Bekehrte Christen müssen in ihrem Leben mit der Heiligung Ernst machen: Wir hoffen auf Gottes Gnade, aber wir machen keinen Ernst mit der Heiligung, und doch heißt es, „Ohne Heiligung wird niemand den Herrn schauen“90. Unter Heiligung verstehen wir das ernstliche Kämpfen gegen die Sünde und das Trachten nach dem, was gut, was heilig, was Gott wohlgefällig ist91.
Dazu führt Blum immer wieder Beispiele aus klassischen Tugendkatalogen an, wie Barmherzigkeit, Mäßigkeit, Keuschheit und Demut. So verlangt er zum Beispiel in seiner Predigt über das Gleichnis vom „barmherzigen Samariter“ von christlichen Eheleuten herzliche Liebe und Barmherzigkeit untereinander und von den Wirten und Hausleuten Barmherzigkeit gegen Kranke, Sieche und Krüppel92. Demgegenüber werden entsprechende Laster als Sünden gegeißelt. So gleicht die Predigt zum 9. Sonntag nach Trinitatis förmlich einem Beichtspiegel. Blum stellt die verschiedenen Laster zusammen und mahnt die Hörer, zu bedenken, daß sie mit diesen Verhaltensweisen nicht vor Gottes Gericht bestehen können. In dieser Predigt listet er folgende Laster auf: Trachten nach Reichtum und den Geiz93, Eitelkeit, Fleischeslust (Fressen und Saufen), Faulheit, Betrug
87 Zum Beispiel, Carl Blum, Gnade um Gnade (Anm. 8), 304. 88 Ako Harbeck, Erweckliche Predigt (Anm. 78), 124, stellt das auch bei den Predigten Hofackers fest und spricht von der „Beschränkung der Predigt Hofackers auf den christologisch-soteriologischen Bereich zu Lasten der spezifischen Textaussage.“ 89 S. o. unter S. 191. 90 Carl Blum, Christus unser Leben (Anm. 9), 88. 91 Carl Blum, Christus unser Leben (Anm. 9), 161. 92 Carl Blum, Gnade um Gnade (Anm. 8), 472. 93 Als Exempel sei hier nur der Text des Abschnitts über den Reichtum zur Gänze angeführt; Carl Blum, Gnade um Gnade (Anm. 8), 436f: „Wenn unser Sinnen und Trachten nur darauf geht, irdische Schätze zu sammeln, Geld auf Geld zu häufen im Dienst des Götzen ‚Mammon‘ – wie können wir da hoffen, vor Gott zu bestehen? Davor gerade warnt uns der Herr, indem er sagt: Sehet zu und hütet euch vor dem Geiz, denn niemand lebt davon, daß er viele Güter hat.“
194
Carl Blum – Prediger der Rußlanddeutschen
(vor allem im Handel), Wucherzinsen, eheliche Untreue, Ungeduld (Murren) im Leiden, Hochmut. Zornig wird Blum über den Mißbrauch von Festen und über die Müdigkeit des Gottesdienstbesuches. So stellt er sich bekehrte Christen nicht vor. Deshalb wettert er an Pfingsten über die Verweltlichung des Festes, die sich für ihn besonders kraß im Nacheinander von Gottesdienst und weltlichen Feiern zeigt: Das Pfingstfest ist für viele weiter nichts, als ein Fest weltlicher Freuden und Vergnügungen, – ein Fest, wo dem Fleisch und den sündlichen Lüsten und Begierden mehr noch als sonst gefrönt wird, – ein Fest, das freilich in der Kirche mit Singen und Beten um den Heiligen Geist angefangen, aber nicht selten mit Lärmen und Toben, mit Völlerei und Unzucht, im Dienste des Fürsten der Finsternis beschlossen wird.94
In seiner erwecklichen Ethik entsteht so ein deutlicher Gegensatz zwischen dem Leben der „Welt“ und dem Leben eines bekehrten Christen. In der Welt regieren die Sünde und der „Fürst der Finsternis“, dem die Christen nicht untertan sein sollen, deshalb sollen sie Ernst machen mit der Heiligung und das in ihrem Lebenswandel dokumentieren: Von Heiligung kann nur dann bei uns die Rede sein, wenn wir fest entschlossen sind, der Sünde den Abschied zu geben und in der Kraft des Heiligen Geistes ein neues, gottwohlgefälliges Leben zu führen95.
Zu den Kennzeichen des Gott wohlgefälligen Lebens gehört für Blum auch der Gehorsam gegenüber der Obrigkeit. Er erweist sich in diesem Punkt als ein getreuer Schüler von Paulus und Luther. Jede Obrigkeit – auf jeden Fall eine christliche – ist von Gott eingesetzt und deshalb muß ihr der notwendige Gehorsam geleistet werden96. Zur Zeit der jährlichen Rekrutenauslosung in Rußland im Spätherbst97 nimmt Blum in beiden Predigtbänden Bezug auf das Wort Jesu „Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist“. Angesichts der unter dem Abschiedsschmerz leidenden Familien appelliert er an den Gehorsam gegenüber der Ob-
94 Carl Blum, Gnade um Gnade (Anm. 8), 351. 95 Carl Blum, Christus unser Leben (Anm. 9), 162. 96 Carl Blum, Christus unser Leben (Anm. 9), 248: „Christen sehen in der Obrigkeit Gottes Dienerin, die von Gott verordnet ist.“ 97 Ursprünglich waren die deutschen Siedler in Rußland vom Wehrdienst befreit. Dieses Privileg bildete einen starken Anreiz zur Auswanderung nach Rußland. Vor allem christliche Gruppen, die den Kriegsdienst generell ablehnten, zogen deshalb nach Osten. Die 1874 schließlich doch eingeführte Wehrpflicht für die Kolonisten führte unter den frommen Rußlanddeutschen zu gegensätzlichen Reaktionen. Die lutherisch geprägten Christen verstanden den Wehrdienst als Gehorsam gegenüber der Obrigkeit, die freikirchlich geprägten Christen sahen hierin eine Einschränkung ihrer religiösen Überzeugungen, sodaß es zur Auswanderung von deutschen Siedlern aus Rußland kam. Vgl. dazu Römhild, Die Macht des Ethnischen (Anm. 12), 45: „die ab 1874 eingeführte Wehrdienstverpflichtung veranlaßt viele der religiös motivierten Einwanderer zur Flucht nach Amerika und Brasilien.“
Carl Blum – Prediger der Rußlanddeutschen
195
rigkeit und fordert, daß die Betroffenen ihre Gefühle hinter dem Gebot Christi zurückstellen: Murren wir nicht, wenn unsere Söhne auf den Befehl des Kaisers in den Soldatendienst treten müssen? Der Herr sagt besonders in dieser Zeit, wo wieder so mancher Sohn in den Militärdienst fort muß, – wo mancher Vater und manche Mutter sich von ihrem Sohn trennen müssen: Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Mag die Trennung noch so bitter sein, dennoch sollen wir auch im Herzen der Obrigkeit nicht widerstreben, wenn wir dem Worte Christi gehorsam sein und seine Verheißungen erben wollen98.
Hier erweist sich Blum als ein Bewahrer traditioneller Über- und Unterordnungsverhältnisse, die von ihm unmittelbar mit den Geboten Christi identifiziert werden. Seine Wahrnehmung von Menschen, die den Unterschichten zugeordnet werden müssen, richtet sich deshalb vor allem darauf, daß sie nicht gegen Gott oder gegen ihre Obrigkeit „murren“: Wie Kinder ihren Eltern unterthan sein sollen, wie Unterthanen ihrer Obrigkeit gehorchen sollen, so sollen auch Knechte und Mägde ihrem Herren unterthan und gehorsam sein, dann führen sie einen guten, christlichen Wandel99.
In der Epistelpredigt zum Sonntag Jubilate faßt Blum den guten Wandel, zu dem bekehrte Christen verpflichtet sind, schließlich in drei großen Punkten zusammen100. Die Grundpfeiler seiner Ethik sind: 1) daß wir uns enthalten von fleischlichen Lüsten, 2) daß wir untertan sind aller menschlichen Ordnung, 3) daß wir geduldig die Feindschaft der Welt tragen. Elemente dieser Ethik lassen sich bis heute bei vielen frommen Rußlanddeutschen finden. Sie bemühen sich, den fleischlichen Lüsten zu entsagen und haben ein Verhaltensrepertoire entwickelt, zu dem das Tragen von Kopftüchern, Verzicht auf Schmuck bei Männern und Frauen, eine strikte Sexualmoral, Alkoholabstinenz, Fernsehverzicht und weitere Konsumeinschränkungen gehören101. Zumeist halten sie sich an menschliche Ordnungen und stützen die jeweilige Regierung und – das ist für die Leidensgeschichte in der Sowjetunion das Entscheidende gewesen – sie haben die Feindschaft der Welt geduldig ertragen. Carl Blums Anweisung „Schweiget, leidet, duldet und befehlet eure Sache dem Gott der da recht richtet“102, liest sich im Rückblick auf das Schicksal der Rußlanddeutschen als prophetischer Satz.
98 Carl Blum, Gnade um Gnade (Anm. 8), 551, Predigt zum 23. Sonntag nach Trinitatis; und Carl Blum, Christus unser Leben (Anm. 9), 467, Predigt zum 22. Sonntag nach Trinitatis: „In der vorigen Woche ist die Recruten-Loosung gewesen…“. 99 Carl Blum, Christus unser Leben (Anm. 9), 249. 100 Carl Blum, Christus unser Leben (Anm. 9), 245. 101 Vgl. die Darstellungen bei Heike Pfister Heckmann, Sehnsucht Heimat? Die Rußlanddeutschen im niedersächsischen Landkreis Cloppenburg (Beiträge zur Volkskultur in Nordwestdeutschland 97), Münster u. a., 1998, 99.232.331f. 102 Carl Blum, Christus unser Leben (Anm. 9), 250.
196
Carl Blum – Prediger der Rußlanddeutschen
Aufnahme der Predigtbände bei den Zeitgenossen Zum Schluß dieser Untersuchung der Predigtbände Carl Blums sei noch ein Blick auf die Rezeption seiner Bücher bei den Zeitgenossen geworfen. In den „Mitteilungen und Nachrichten für die evangelische Kirche in Russland“ erschien 1885 eine Rezension der Evangelienpredigten verfaßt von J.Th. Helmsing103. Der Rezensent begrüßt das Werk Blums als eine „ungewöhnlich reiche Quelle der Kanzelberedsamkeit“ und lobt die „Lebendigkeit der Sprache“ und den „Wohllaut und die Abrundung des Ausdrucks“. Er bezeichnet Carl Blum als „den geborenen Volksredner“. Die inhaltliche Engführung wird bemerkt und von Helmsing positiv gewürdigt: „Inhalt der Predigten ist überall der Ruf zur Buße und zum Glauben“. Für die Nachgeborenen ist es aufschlußreich, zu sehen, daß Helmsing als Zeitgenosse Blums „praktische Anwendung auf die Colonialgemeinden“ lobt. Die ungebrochene Beliebtheit, der sich Blums Predigten unter den Rußlanddeutschen bis heute erfreuen, hängt sicher auch damit zusammen, daß er einen Ton trifft, der selbst nach mehr als hundert Jahren bei Rußlanddeutschen noch heimatliche Gefühle zu wecken vermag. Daß das von Blum auch beabsichtigt war, zeigt das Vorwort zur ersten Auflage der Evangelienpredigten. Darin betont er besonders, daß die Predigten auf die Verhältnisse in den Wolgakolonien zugeschnitten seien: „Der Verfasser ist bemüht gewesen […] unsere örtlichen Verhältnisse zu berücksichtigen“104. Carl Blums Buch „Himmelan“ mit Morgen- und Abendandachten wurde 1893 ebenfalls in den „Mitteilungen und Nachrichten“ besprochen105, aber schon damals war sich der Rezensent nicht sicher, ob sie weite Verbreitung erfahren würde. Dieses Urteil hat die Geschichte bestätigt. Blums über die Jahre erfolgreichstes Buch ist die Sammlung seiner Evangelienpredigten „Gnade um Gnade“, geblieben; selbst der Band mit den Epistelpredigten „Christus unser Leben“ hat nie eine solche Popularität erlangt. Heute sind die Predigten Carl Blums die Erbauungslektüre frommer Rußlanddeutscher. Sie haben nahezu alle anderen Predigtsammlungen oder Andachtsbücher verdrängt. Ihre Sprache, ihre Frömmigkeit, ihr Ruf zur Bekehrung und ihr heilsgeschichtliches Denken samt dem christlichen Antijudaismus prägen bis heute die Gedanken und Vorstellungen von vielen Menschen, die nach der Aussiedlung im heutigen Deutschland und den Kirchen der Bundesrepublik Fuß fassen wollen. Carl Blums Predigten sind dabei sicherlich eine Anfrage an die Praxis der zerbröckelnden Volkskirchen, zugleich stellen sie aber ein Stück der spezifisch rußlanddeutschen Heimat dar, die für Aussiedler heute weder geo103 Mitteilungen und Nachrichten für die evangelische Kirche in Rußland 41 = NF 18 (1885), 57– 58. 104 Carl Blum, Gnade um Gnade (Anm. 8), 5. 105 Mitteilungen und Nachrichten für die evangelische Kirche in Rußland 49 = NF 26 (1893), 47– 48.
Carl Blum – Prediger der Rußlanddeutschen
197
graphisch, noch ethnisch106, noch sprachlich bestimmbar ist. Diese Heimat wird in den vertrauten Liedern des Wolgadeutschen Gesangbuchs oder des „Geistlichen Liederschatzes“ gefunden und vor allem in Carl Blums Predigtbänden, die zumeist neben der Bibel und den erwähnten Gesangbüchern auf dem Tisch der älteren Aussiedlerfamilien liegen.
Quellen Carl Blum, Gnade um Gnade. Evangelienpredigten für das ganze Kirchenjahr, Nachdruck Kassel 41993. Ders., Christus unser Leben. Wolgadeutsche Predigten, Nachdruck Erlangen 31993. Mitteilungen für die evangelische Kirche in Rußland (eingesehen wurde das Exemplar der Universitätsbibliothek Leipzig).
Literatur Ernst Christian Achelis, Lehrbuch der Praktischen Theologie 2. Bd., Leipzig 1898. Erik Amburger, Die Pastoren der evangelischen Kirchen Rußlands vom Ende des 16. Jahrhunderts bis 1937, Lüneburg / Erlangen 1998. Gustav Adolf Benrath, Erweckung / Erweckungsbewegungen I, in TRE 10 (1982), 205–220. Karlmann Beyschlag, Die Erlanger Theologie (EKGB 67), Erlangen 1993. Nathanael Bonwetsch, Gustav Moritz Constantin von Engelhardt, in: RE2 17 (1886), 770–776. Ders., Gustav Moritz von Engelhardt, in: RE3 5 (1898), 374–379. Theodor Christlieb, Geschichte der christlichen Predigt, in: RE2 18 (1888), 466–653. Deutschbaltisches Biographisches Lexikon, Lexikon 1710–1960, hg. v. Wilhelm Lenz, Köln 1970. Hans-Christian Dietrich, in: Das Gute behaltet. Kirchen und religiöse Gemeinschaften in der Sowjetunion und ihren Nachfolgestaaten, Erlangen 1996. Roderich von Engelhardt, Die deutsche Universität Dorpat in ihrer geistesgeschichtlichen Bedeutung (Schriften der deutschen Akademie 13), München 1933. Holsten Fagerberg, Luthertum II. Neuluthertum, in: RGG3 4 (1960), 536–540. Hugald Grafe, Ludwig Harms, in: TRE 14 (1985), 449–450. Hans-Jakob (Ako) Haarbeck, Erweckliche Predigt dargestellt an Ludwig Hofacker, Diss. theol. Göttingen 1958. Peter Hauptmann, Dorpat, in: TRE 9 (1982), 158–162. Heike Pfister Heckmann, Sehnsucht Heimat? Die Rußlanddeutschen im niedersächsischen Landkreis Cloppenburg (Beiträge zur Volkskultur in Nordwestdeutschland 97), Münster u. a., 1998. 106 Zum gesamten Problembereich der „ethnischen“ Bestimmung der Rußlanddeutschen in Rußland, der Sowjetunion und in Deutschland vgl. Römhild, Die Macht des Ethnischen (Anm. 12).
198
Carl Blum – Prediger der Rußlanddeutschen
Ludwig Hofacker, Predigten für alle Sonn-, Fest-, und Feiertage, Stuttgart 185721. Johann Christian Konrad von Hofmann, Weissagung und Erfüllung im alten und neuen Testamente. Ein theologischer Versuch, Bd. 1 Nördlingen 1841. Ders., Die heilige Schrift des neuen Testaments, 10. Teil, Die biblische Geschichte des neuen Testaments nach Manuskripten und Vorlesungen bearbeitet von Wilhelm Volck, Nördlingen 1883. Gottfried Horning, Lehre und Bekenntnis im Protestantismus, in: HDThG III, 71–220. Theodor Kallmeyer, Die evangelischen Kirchen und Prediger Kurlands, 21910 in: Deutsches Biographisches Archiv, hg. v. Bernhard Fabian (Mikrofiche Edition), München 1982. Friedrich Wilhelm Kantzenbach, Die Erweckungsbewegung, Neuendettelsau 1957. Ders., Die Erlanger Theologie, München 1960. Ders., Gestalten und Typen des Neuluthertums, Gütersloh 1968. Wilhelm Lenz, Zur Verfassungs- und Sozialgeschichte der baltischen evangelisch-lutherischen Kirche 1710–1914, in: Reinhard Wittram (Hg.), Baltische Kirchengeschichte, Göttingen 1956, 110–129. Georg Merz, Theodosius Harnacks Bedeutung für die lutherische Kirche, in: Ders. Um Glauben und Leben nach Luthers Lehre, hg. von F.W.Kantzenbach (TB 15), München 1961, 200–209. G. C. Nöltingk, Russland, in: RE 132 (1884), 119–137. Alexander von Oettingen, Theologie und Kirche, in: DZTK 1 (1859), 1–45. Ders., Ein Besuch in Hermannsburg, in: DZTK 2 (1860), 110–127. Andreas Pawlas, Ein konservativer Fortschrittler. Das Wirken des baltischen Lutheraners Alexander von Oettingen, in: LM 31 (1993) Heft 2, 28–30. Regina Römhild, Die Macht des Ethnischen: Grenzfall Rußlanddeutsche: Perspektiven einer politischen Anthropologie (Europäische Migrationsforschung 2), Frankfurt am Main u. a. 1998. Gerhard Schäfer, Ludwig Hofacker, in: TRE 15 (1986), 467–469. Johannes Schlundt, Die Gemeinschaftsbewegung unter der deutschen Bevölkerung in Rußland bzw. der UdSSR in Vergangenheit und Gegenwart, Steinau a. d. Straße, o. J. Joseph Schnurr (Bearb.), Die Kirchen und das religiöse Leben der Rußlanddeutschen (= Heimatbuch, Jahrbuch 1969–1972, der Deutschen aus Rußland), Stuttgart 1972. Heinrich Seesemann, Die theologische Fakultät der Universität Dorpat 1802–1918, in: Reinhard Wittram (Hg.), Baltische Kirchengeschichte, Göttingen 1956, 206–219. Karl Gerhard Steck, Johann Christian Konrad von Hofmann (1810–1877), in: Martin Greschat (Hg.), Theologen des Protestantismus im 19. und 20. Jahrhundert, Bd. 1, Stuttgart u. a. 1978, 99–112. Gerd Stricker, Religion in Rußland, Gütersloh 1993. Ders. (Hg.), Deutsche Geschichte im Osten Europas. Rußland, Berlin 1997. Uwe Swarat, Die heilsgeschichtliche Konzeption Johannes Chr. K. von Hofmanns, in: Helge Stadelmann (Hg.), Heilsgeschichte als Thema der Theologie, Basel und Wuppertal 2 1988, 211–239. Wilhelm Volck, Theologische Briefe der Professoren Delitzsch und von Hofmann, Leipzig 2 1894 (Erstausgabe Dorpat 1890). Friedrich Wilhelm Winter, Die Erlanger Theologie und die Lutherforschung im 19. Jahrhundert (LKGG 16), Gütersloh 1995.
Evangelische Pastoren und Lehrer in Russland während des 19. Jahrhunderts
Vision und Verantwortung Vision und Verantwortung sind auch in der Geschichte der evangelisch-lutherischen Kirche in Russland treibende und tragende Kräfte gewesen. Die Gründung einer Kirche nach deutschem Vorbild entsprach der Wahrnehmung der Verantwortung für die vielen deutschen Siedler, die seit dem 18. Jahrhundert ins russische Reich eingewandert waren. Damit verband sich die Vision eines Lebens in einem Vielvölkerstaat, in dem die ethnische Zugehörigkeit nicht die alles entscheidende Rolle spielte. Ähnlich wie im Habsburger Reich, gab es im Zarenreich vor der Russifizierung im 19. Jahrhundert eine Periode der Toleranz gegenüber den zugewanderten Menschen. In dieser Phase ordnete sich das Leben der deutschen Kolonisten in Russland vorwiegend noch in den mitgebrachten Kategorien von Konfession1 und „Stand“. Ein verbindender Begriff des „Deutschseins“ hatte sich noch nicht gebildet. Wenn es Bindungen durch die Herkunft gab, waren es landsmannschaftliche Prinzipien. So hoben sich zum Beispiel die „Schwaben“, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts nach Südrussland eingewandert waren, schon sprachlich von den anderen Siedlern ab. Trotzdem bildete die Sprache, trotz unterschiedlicher Dialekten und Sprachformen, das einzige umfassende Ge-
1 Wilhelm Kahle, Zum Verhältnis von Kirche und Schule in den deutschen Siedlungen an der Wolga bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges, in: D. Dahlmann / R. Tuchtenhagen (Hg.), Zwischen Reform und Revolution. Die Deutschen an der Wolga 1860–1917 (Veröffentlichungen des Instituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa 4), Essen 1994, 224–243, hier 225: „Von Wichtigkeit war die Tatsache, dass alle Kolonie nach Konfessionen besiedelt wurden. Es gab das evangelische und das katholische Dorf“. Dabei gestaltete sich die konfessionelle Verteilung so: „in etwa 70–75 % Evangelische, während die anderen Katholiken waren. Unter den Evangelischen überwogen die lutherischen Siedler bei weitem die Reformierten“ (ebenda). Diese Zahlen gelten für das Wolgagebiet. Mit Einschränkungen sind sie auf die anderen Siedlungsgebiete zu übertragen. In Südrussland gab es neben Evangelischen und Katholischen einen größeren Anteil von freikirchlichen Gruppen.
200
Evangelische Pastoren und Lehrer in Russland während des 19. Jahrhunderts
meinsame der deutschen Siedler2. Im Laufe des 19. Jahrhunderts veränderte sich das Leben der Deutschen in Russland. Viele der Veränderungen wurden nicht von ihnen selbst initiiert. Die beginnende Industrialisierung, der Zustrom weiterer Deutscher nach Russland und die Russifizierung der Gesellschaft lagen außerhalb ihrer Einflußmöglichkeiten. Die Deutschen in Russland konnten hier nur reagieren und so gut wie möglich an den errungenen Fortschritten partizipieren. Zentral für diese Partizipationsmöglichkeiten war die Bildung der Russlanddeutschen. Dafür waren die Lehrer und Pastoren in Russland verantwortlich. Die wenigsten der Pastoren und Lehrer waren Visionäre. Sie erscheinen im Rückblick zum Teil als retardierende Kräfte, weil sie die traditionellen Prägungen der Russlanddeutschen aufrechterhielten, als sich die Verhältnisse grundlegend gewandelt hatten. Zum anderen sind gerade die Pastoren ein wichtiger Faktor der Modernisierung in den bäuerlichen Siedlungen der Kolonisten gewesen. Die universitär gebildeten Pastoren – von denen nur die allerwenigsten aus den Kolonien stammten – sorgten für neue Ideen. Fortschritte erreichten sie im Laufe des Jahrhunderts vor allem auf dem Gebiet der Volksbildung. Dafür waren sie allerdings durchgängig auf die Mitarbeit der Lehrer angewiesen, die „vor Ort“ waren und gegenüber den Gemeinden im Deutschen Reich in viel stärkerem Maße in pastorale Funktionen eingebunden waren. Damit sind bereits die Grundbedingungen beschrieben, die zu einem spannungsvollen Miteinander zwischen Vision und Verantwortung führen sollten.
Voraussetzungen Die deutschen Kolonisten brachten die Verbindung von Kirche und Schule, die im Deutschen Reich seit dem Westfälischen Frieden grundsätzlich festgelegt war, mit nach Russland. Die Schulaufsicht wurde von den Geistlichen ausgeübt. In der evangelischen Kirche war die Schulbildung nahezu ausschließlich auf die Konfirmation ausgerichtet. Dadurch waren Lehrer und Pastoren auf engste miteinander verbunden. Da aber die Pastoren in Russland so große Kirchspiele zu betreuen hatten, daß sie nur an wenigen Tagen im Jahr in den Filialgemeinden sein konnten, hatte der Lehrer vor Ort eine ungleich einflußreichere Position als der entfernte Pastor.
2 Zum gesamten Prozeß der Herausbildung einer ethnischen Identität der Russlanddeutschen vgl. Regina Römhild, Die Macht des Ethnischen. Grenzfall Russlanddeutsche. Perspektiven einer politischen Anthropologie (Europäische Migrationsforschung 2), Frankfurt am Main u. a. 1998, bes. 37–83. Vgl. auch Ute Richter-Eberl, Lutherisch, katholisch oder deutsch? Aspekte der kulturellen Identität der Deutschen an der Wolga, in: Dahlmann / Tuchtenhagen (Hg.), Zwischen Reform und Revolution (Anm. 1), 160–171.
Evangelische Pastoren und Lehrer in Russland während des 19. Jahrhunderts
201
Erschwerend für beide Berufsgruppen ist der das ganze Jahrhundert prägende Mangel an Stelleninhabern und Bewerbern3. In den Wolgakolonien stellte sich ein empfindlicher Mangel an Lehrern und Pastoren ein, als die erste Generation der deutschen Einwanderer ausgestorben war4. Unter den ersten Siedlern hatten sich noch einige gefunden, die als Lehrer fungieren konnten. Zum Teil hatten sie eine Ausbildung, zum Teil waren sie aber auch nur in der Lage, zu lesen und zu schreiben. Auf Grund dieser Fähigkeiten wurden sie zum Lehrer bestellt. Prominentes Beispiel ist Bernhard von Platen, der Dichter eines Auswanderungsepos, der über sich selbst schreibt: „Man hat aus mir Offizier / Ein Prozepter5 gemacht“6. Als die so gewonnenen Lehrer nicht mehr ihren Dienst tun konnten, stellte sich die Frage nach einer eigenen Lehrerausbildung in den deutschen Kolonien Russlands. Man konnte nicht darauf hoffen, daß Lehrer aus dem Mutterland zuwanderten und russische Lehrer waren in den deutschen Schulen ungeeignet. Das Kirchen- und Schulwesen der deutschen Kolonien in Russland wurde im Wesentlichen nach den Vorbildern in Deutschland organisiert. Die evangelischlutherische Kirche in Russland wurde durch das Gesetz von 1832 schließlich eine „Landeskirche“ nach dem Muster der evangelischen Kirchen im Deutschen Reich. Die Zaren seit Nikolaus I. waren auf diese Weise Oberhaupt der evangelischen Christen in Russland7, obwohl sie selbst orthodox blieben und zugleich de facto Oberhäupter der orthodoxen Kirche waren8. Auch die Schulen der Kolonisten orientierten sich von Anfang an den mitgebrachten Vorbildern. So waren die Schulen ebenfalls der „geistlichen Schulaufsicht“ unterstellt. Für die evangelische Kirche in Russland wurde 1838 gesetzlich festgelegt: „Die Schulen in unserer Mitte waren bisher, wie bekannt, Kirchenschulen und ihr Hauptzweck 3 Die baltischen Länder werden in diese Untersuchung nicht mit einbezogen. Sie gehörten zwar auch zum russischen Reich und damit auch zur evangelisch-lutherischen Kirche in Russland, bildeten aber eine völlig eigene Welt, die mit den Kolonien der Deutschen an der Wolga und in Südrussland nur wenig Kontakt hatte. Im Baltikum herrschte auch nicht so ein eklatanter Lehrer- und Pastorenmangel. 4 Gerd Stricker, Rußlanddeutsches Bildungswesen von den Anfängen bis 1941, in: Gerd Stricker (Hg.), Deutsche Geschichte im Osten Europas. Rußland, Berlin 1997, 420–478, hier 441. 5 Prozeptor = Praeceptor = Schulmeister. 6 Bernhard Ludwig von Platen, Reisebeschreibung der Kolonisten, in: Annelore Engel-Braunschmidt (Hg.), Siedlernot und Dorfidyll. Kanonische Texte der Rußlanddeutschen, Berlin u. Bonn 1993, 19. 7 Das „Summepiskopat“ des orthodoxen Zaren entsprach strukturell dem Summepiskopat der katholischen Könige in Bayern oder in Sachsen über die evangelisch-lutherischen Kirchen dieser Länder. 8 Die Zaren waren nicht formale Oberhäupter der russisch-orthodoxen Kirche. Seit Katharina II. übten sie aber ihre Herrschaft durch „Oberprokuratoren“ aus, die das Leitungsgremium der russisch-orthodoxen Kirche, den Hl. Synod, manipulierten. Patriarchen gab es zwischen 1700 und 1917 nicht. Vgl. Kurt Onasch, Grundzüge der russischen Kirchengeschichte (KIG 3 M/1) Göttingen 1967, 88–127.
202
Evangelische Pastoren und Lehrer in Russland während des 19. Jahrhunderts
laut dem Allerhöchst [d. h. vom Zaren] bestätigten Regeln für den Kirchen-Schulund Katechisations-Unterricht u.s.w. ist Unterricht der Jugend in der Religion, ihre Leitung ist an Ort und Stelle in die Hände des Pastors gelegt und die Oberaufsicht führt die geistliche Oberbehörde“9. Diese Festlegung entsprach den mitgebrachten Traditionen der Deutschen und im Wesentlichen auch ihren Erwartungen an Schule.
Deutsche Bildung in Stadt und Land Insgesamt ist ein starkes Bildungsgefälle zwischen den Deutschen in den Städten des russischen Reiches und in den Kolonistendörfern festzustellen. Dieser Unterschied ist durch die unterschiedlichen Lebenswelten zu erklären. In den Städten bildeten die Deutschen zumeist ein „selbstbewußtes Bildungsbürgertum und einen tüchtigen Mittelstand“10. Auf Grund dessen hatten sie ein ausgeprägtes Interesse an einer guten Schulbildung für ihre Kinder. So entstanden aus den Kirchenschulen in den Städten zum Teil große Schulkomplexe11. Wegen ihres guten Rufes wurden diese Schulen auch von russischen Kindern besucht, obwohl auch hier der Unterricht komplett in deutscher Sprache stattfand. Hervorzuheben sind hier die deutschen Schulen in St. Petersburg, Moskau und Odessa12. Für die Kolonien war die Lage grundlegend anders: In den deutschen Dörfern hingegen erwarteten die Kolonisten bis ins 19. Jahrhundert von ihrer Schule nicht viel mehr, als daß sie die Kinder auf Konfirmation und Firmung vorbereite, ihnen Lesen und Schreiben und etwas Rechnen beibringe und möglichst wenig koste13.
9 Mitteilungen und Nachrichten für die evangelische Kirche in Rußland 28 = N. F. 5 (1872), 276. Aus den verschiedentlich wiederholten Vorschriften, Erlassen und Gesetzen, die die Schulen betreffen, muss geschlossen werden, dass die sich Durchsetzung der Bestimmungen zum Teil erheblich verzögerte. Vgl. dazu das Urteil von Kahle, Zum Verhältnis von Kirche und Schule (Anm. 1), 227: „Wie in manchen Bereichen der russischen Geistes- und Kulturgeschichte, der Geschichte von Minderheiten auf russischem Boden, der Umsetzung von Einsichten in die Praxis lagen zwischen der Bestimmung, dem Wortlaut der Gesetzes und dem tatsächlichen Stand des Schulwesen erhebliche, langjährig bleibende Unterschiede […] Es ist deshalb nicht geboten, bestimmte Jahre zu Jahren völliger Änderung und neuer Durchbrüche zu stilisieren“. 10 Stricker, Rußland (Anm. 4), 431. 11 Zum Zeitpunkt des 200-Jahr-Jubiläums, 1910, umfasste die Schule der St. Petri Gemeinde in St. Petersburg „fünf verschiedene Schulen und 42 Klassen, 1667 Zöglinge und 69 Lehrer“, Wilhelm Kahle, Wege und Gestalt evangelisch-lutherischen Kirchentums. Vom Moskauer Reich bis zur Gegenwart, 2. Aufl., Erlangen 2002, 321. 12 Stricker, Rußland (Anm. 4), 422–431. 13 Stricker, Rußland (Anm. 4), 431. Zu den hier nicht behandelten katholischen Schulen vgl. Gerd Stricker, Die Schulen der Wolgadeutschen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.
Evangelische Pastoren und Lehrer in Russland während des 19. Jahrhunderts
203
Auf diese Weise bildeten die Kolonisten ein retardierendes Element in der Entwicklung der Schulbildung. Anstöße zur Weiterentwicklung und Verbesserung des Schulwesens gingen in den Kolonien zumeist von den Pastoren aus. Diese gegensätzliche Interessenlage trat im Laufe des 19. Jahrhunderts immer stärker an den Tag. Schließlich konnte 1904 die Situation für Südrussland so beschrieben werden: Die Pastoren waren für Bildung und Fortschritt, während die Gemeinden, die durchaus nicht so fortschrittlich gesinnt sind […] sondern durchschnittlich, wie echte Bauern, fast zu konservativ, zu sehr am Alten hängend, dem Pastor passiven Widerstand boten14.
Dennoch bedeutete die flächendeckende Versorgung mit Schulbildung in den deutschen Kolonien einen großen Vorsprung gegenüber der allgemeinen Bildungssituation in den ländlichen Gebieten Russlands. Unter der russischen Landbevölkerung herrschte überwiegend Analphabetismus15.
Die unterschiedliche Schulsituation an der Wolga, in Südrussland und in Wolhynien Die drei großen Siedlungsgebiete der Deutschen in Russland unterschieden sich im 19. Jahrhundert deutlich voneinander. Die Siedlungsgebiete an der Wolga waren der Bereich, in dem die Deutschen bereits am längsten lebten. Die erste Krise des Schulwesens setzte ein, als die Lehrer der Einwanderergeneration ausgestorben waren. Die Interessenskonflikte zwischen konservativer Dorfbevölkerung, fortschrittlicheren Geistlichen und unwilliger russischer Obrigkeit verhinderten eine effektive Struktur der Lehrerausbildung. Die 1840 durch die „Regeln über den Schul- und Katechismusunterricht in den Kolonien der Saratower ausländischen Aussiedler“16 eingeführte allgemeine Schulpflicht, verbesserte die Situation nicht wesentlich, denn dadurch nahm zunächst nur die Zahl der Schüler in den ohnehin überfüllten Klassen zu. Die „Kreisschulen“ in Grimm und Katharinenstadt lieferten wenig geeigneten Lehrernachwuchs. Erst nach der grundlegenden Reform von 1868 kam eine größere Anzahl gut ausgebildeter Lehrer in die Kolonistendörfer an der Wolga. Ein Versuch: Unter besonderer Berücksichtigung katholischer Anstalten, in Dahlmann / Tuchtenhagen (Hg.), Zwischen Reform und Revolution (Anm. 1), 244–266. 14 Zitiert bei Kahle, Wege (Anm. 11), 323. 15 Schulwesen an der Wolga, in: Lexikon zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen, Berlin 2002, 302: Trotz der immer wieder bemängelten Probleme „blieb die Schulausbildung in den deutschen Kolonien der der russischen Bevölkerung weit überlegen. Die russischen Dörfer waren bis Mitte des 18. Jahrhunderts nach wie vor von einer schulischen Erziehung ausgeschlossen“. Dazu vgl. auch Alfred Eisfeld, Die Russlanddeutschen, München 1992, 61–63. 16 Schulwesen an der Wolga, in: Lexikon (Anm. 15) 302.
204
Evangelische Pastoren und Lehrer in Russland während des 19. Jahrhunderts
Demgegenüber erwies sich Südrussland als modernere Region, weil hier die erst im Laufe des 19. Jahrhunderts vor allem aus Süddeutschland eingewanderten Deutschen von Anfang an ein deutlich höheres Interesse an einer qualifizierten Ausbildung ihrer Kinder zeigten17. Hier gab es bereits 1844 eine „Zentralschule“, die der Ausbildung von Lehrern diente18. In Wolhynien, dem dritten und jüngsten Siedlungsgebiet, dauerte der Zuwanderungsprozeß bis zum Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts. Die Schulsituation war auf Grund der andauernden Zuwanderung schwieriger als in den beiden anderen Gebieten. Lehrer waren noch seltener als in den übrigen Siedlungsgebieten und mußten bereits übervolle und dennoch weiter wachsende Klassen betreuen19.
Die pastorale Versorgung der deutschen Kolonien Anders als im Mutterland gehörte die Versorgung einer Kirchengemeinde durch einen Pastor nicht zur Normalität des Lebens der Deutschen in Russland. Zumeist waren die Gemeinden zu Kirchspielen zusammengefaßt, die sich einen Pastor teilten. In einem der Orte gab es ein Pfarrhaus, unter Umständen in mehreren Orten eine Kirche. In den kleineren Ortschaften waren Bet- und Schulhaus miteinander identisch. Am Sonntag wurde im Schulhaus der Gottesdienst gehalten. Unter Umständen gab es neben der Schule einen Glockenturm, der zum Gottesdienst rufen konnte. Der Pastor mußte im regelmäßigen Turnus seine Gemeinden besuchen und dabei unter Umständen erhebliche Strecken mit Pferd und Wagen zurücklegen. Amtshandlungen, die aufgeschoben werden konnten, wurden mit den Besuchen des Pastors verbunden. Beerdigungen und ein Großteil der Taufen mußten vom Lehrer, der zumeist auch als Küster und Kantor fungierte, vorgenommen werden. Durch den glücklichen Umstand, daß in der Mitte des 19. Jahrhunderts für die „Unterstützungskasse für Ev.-Luth. Gemeinden in Rußland“ eine genaue Aufstellung der Gemeinden angefertigt wurde, ist man in der Lage, sich ein präzises Bild von den äußeren Bedingungen der Tätigkeit eines evangelischen Pastors in 17 Zum Schulwesen in Südrussland vgl. den gesamten Abschnitt „Die Schulen der Kolonisten“ bei Detlef Brandes, Von den Zaren adoptiert. Die deutschen Kolonisten und die Balkansiedler in Neurussland und Bessarabien 1751–1914 (Schriften des Bundesinstituts für ostdeutsche Kultur und Geschichte 2), München 1993, 302–332. 18 Stricker, Rußland (Anm. 4), 430 u. 445. Die „Werner-Centralschule“ wurde 1844 in Sarata (Bessarabien) gegründet. Bereits vorher hatte Propst Feltnitzer in Odessa an die dortige Paulischule das sog. „Kleine Seminar“ angegliedert, aus dem zwischen 1832 und 1843 immerhin 40 Lehrer für die Kolonistendörfer im Schwarzmeergebiet hervorgegangen waren. 19 Kahle, Wege (Anm. 11), 324: „Am schlechtesten war die Schulsituation in den Siedlungen Wolhyniens, in denen die große Vermehrung der Ansiedler innerhalb weniger Jahrzehnte wie auch die Armut der Gemeinden es nicht zu einem geordneten Schulwesen kommen ließen“.
Evangelische Pastoren und Lehrer in Russland während des 19. Jahrhunderts
205
Russland zu machen. Wie die pastorale Versorgung eines Kirchspiels mit mehreren Orten, an denen Gottesdienst gehalten wurde, durch einen Pastor geregelt wurde, soll hier am Beispiel des südrussischen Kirchspiels Neu-Stuttgart-Berdjansk (gegr. 1865) gezeigt werden. Zum Kirchspiel gehörten sechs Ortschaften, die der Pastor alle zu Gottesdiensten und Amtshandlungen zu besuchen hatte. Aus dem Jahre 1867 gibt es eine Beschreibung der Gemeinde samt Filialorten, in der die Entfernungen vom Pastorat und die Besoldung des Pastors angegeben sind. Die Entfernungen vom Pastorat sind in Werst (= W.) angegeben (1 Werst = 1,067 km). Die Flächenangabe Dessät. ist die Abkürzung für Desjatine (1 Desjatine = 1,09 ha). Hinter dem Namen des Ortes ist jeweils die Zahl der evangelischen Christen angegeben: Kirchspiel Neu-Stuttgart-Berdjansk […] 1. Colonie Neu-Stuttgart, Lutheraner Pastorat und Bethaus.
100
2. Colonie Neu-Hoffnungsthal, Lutheraner 52 Entfernung vom Pastorat 8 W. 3. Colonie Rosenfeld, Lutheraner Entfernung vom Pastorat 10 W.
101
4. Colonie Neu-Hoffnung, Lutheraner Entfernung vom Pastorat 20 W.
50
5. Stadt Berdjansk, Lutheraner Bet- und Schulhaus. Entfernung vom Pastorat 35 W.
300
6. Stadt Nogaisk, Lutheraner
204
im Ganzen 807 Eingepfarrte Besoldung des Pastors: Gehalt 343 Rbl. von Berdjansk außerdem noch 150 Rbl., den Ertrag von 120 Dessät. Pfarrland oder stattdessen 400 Rbl., freie Wohnung und Heizung. Normirte Accidenzien: Taufe 30 Kop., Beerdigung 50 Kop., Confirmation und Trauung 1 Rbl. Der Pastor ist verpflichtet, zwölfmal jährlich nach Berdjansk zu fahren […] Viermal fährt er nach Nogaisk auf Kosten der Eingepfarrten dieses Ortes, zweimal nach Neu-Hoffnung; sonst hält er den Gottesdienst abwechselnd in Neu-Stuttgart, Rosenfeld und NeuHoffnungsthal20.
20 Ergänzungen der Materialien zur Geschichte und Statistik des Kirchen- und Schulwesens der Ev.-Luth. Gemeinden in Rußland, im Auftrage des Central-Comités der UnterstützungsKasse für Ev.-Luth. Gemeinden in Rußland, gesammelt und herausgegeben von E.H. Busch, 1. Bd., St. Petersburg 1867, 249–250.
206
Evangelische Pastoren und Lehrer in Russland während des 19. Jahrhunderts
Diese Beschreibung führt schnell vor Augen, daß der Pastor nur selten mehr als einmal im Monat in einer Gemeinde seines Kirchspiels war. Die Verhältnisse in Südrussland waren vergleichbar mit den übrigen deutschen Siedlungsgebieten. Auch an der Wolga gab es durchgängig zu wenige Pastoren für die Versorgung der immer weiter wachsenden Gemeinden. Die chronische Unterversorgung durch evangelische Pastoren zwang nicht nur zu einer großflächigen Versorgung der Gemeinden durch die Küster/Lehrer, sondern führt auch zur Zusammenarbeit über die Grenzen der verschiedenen evangelischen Denominationen hinweg. Katharinenstadt, als einer der Hauptorte unter den deutschen Siedlungen an der Wolga, hatte ursprünglich eine reformierte und eine lutherische Gemeinde, die sich aber durch den Einfluss von Superintendent D. Feßler zu einer lokalen Union zusammengeschlossen. Diese Union entsprang ebenso wie die Unionen in den evangelischen Landeskirchen Deutschlands nicht einer theologischen Vision, sondern der Wahrnehmung der Verantwortung für die Versorgung der Gemeinden in und um Katharinenstadt21. Deshalb wurde diese lokale Kirchenunion 1867 vor allem als praktischer Vorteil gefeiert. Denn die beiden Pastoren hatten bereits so viele Colonien zu versorgen, dass „der Katharinenstadtschen unirten Gesammtgemeinde der große Vortheil erwuchs, daß sie jeden dritten Sonntag, mitunter öfter, ihren Gottesdienst durch einen Prediger geleitet sehen konnte, während dies in den Filialen nur jeden fünften Sonntag geschehen kann.“22 An den Sonntagen, an denen kein Pastor da war, um den Gottesdienst zu leiten und eine selbst verfaßte Predigt zu halten, mußten die Lehrer den Gottesdienst leiten und eine Lesepredigt verlesen. Für die Pastoren bedeutete die Anzahl der Predigtstellen einen erheblichen Reiseaufwand. Sie mußten zu Pferde oder mit der Kutsche von Dorf zu Dorf fahren. Die Straßenverhältnisse und die Witterung bildeten dabei große Erschwernisse. Zudem verursachte die dauernde Reisetätigkeit erhebliche Kosten. Deshalb wird in den Berichten für die „Unterstützungskasse“ des Öfteren erwähnt, daß von den Gemeinden bei der Besoldung der Pastoren „ein entsprechendes Quantum an Hafer, Heu und Tabak […] als Ersatz der Kosten für Kutscher, Pferde und Wagen zur Bedienung des Kirchspiels“ bereitgestellt wird23. Die Anwesenheit eines Pastors in der Gemeinde war insgesamt eher die Ausnahme als die Regel. Deshalb gab es durchaus eine gewisse Konkurrenz der einzelnen Kolonien um die Anwesenheit der Pastoren. Das läßt sich an Festsetzungen wie der folgenden ablesen: „Sollten an einem Tag in einer Colonie 21 Alfred Adam, Unionen im Protestantismus I. Geschichtlich, in: RGG3 6 (1962), 1140–1144, hier 1141 trifft mit seinem Urteil auch die Situation an der Wolga: „Die Unionsschlüsse nach 1817 waren nicht von unmittelbar theologischen Erwägungen geleitet, sondern richteten sich nach der tatsächlichen Lage innerhalb der einzelnen Länder“. 22 Busch, Ergänzungen der Materialien (Anm. 20), 340. 23 Busch, Ergänzungen der Materialien (Anm. 20), 341.
Evangelische Pastoren und Lehrer in Russland während des 19. Jahrhunderts
207
mehr als 3 Paare zu trauen sein, so hat der Pastor sich in diese Colonie zu begeben“24. Ansonsten fuhren die Brautpaare ins Kirchdorf bzw. zum Pastorat. Der Pfarrermangel in den Kolonien wurde in der Mitte des 19. Jahrhunderts so drängend, daß sogar im Baltikum über eine Unterstützung der Gemeinden im Inneren des russischen Reiches nachgedacht wurde. Auf der Provinzialsynode der Pastoren in Livland wurde 1857 eindringlich dargestellt, wie schwierig die Situation in den Kolonien war: Der kirchliche Nothstand in den deutschen Colonie-Gemeinden in Rußland, die zu Zeiten aus Mangel an Predigern der Pflege und des Segens des geistlichen Amtes jahrelang entbehren müssen, rief auf der Synode der livländischen Prediger im J.[ahre] 1857 den Antrag hervor, daß durch Delegation von Prediger und Candidaten der Noth der Glaubensbrüder in Rußland abgeholfen werden möge25.
Dieser Antrag führte zu einer hart geführten Grundsatzdebatte, ob es möglich sei, Pastoren im „gesamtkirchlichen Interesse“ von ihrer Pfarrstelle zu entfernen und auf eine andere Stelle zu versetzen. Die Abstimmung ergab allerdings eine Entscheidung zugunsten des alten evangelischen Grundsatzes der Unversetzbarkeit der Pfarrer. So blieb es bei einem bloßen Appell, der Synode, die Gemeinden in den Kolonien zu unterstützen. Die Vision der Solidarität innerhalb der einen „Landeskirche“ in Russland scheiterte am evangelischen Gemeindeprinzip. So konnten die besser versorgten Gebiete im Baltikum die Kolonien im Inneren des Reiches bemitleiden, ohne Verantwortung übernehmen zu müssen.
Die Entwicklung des Schulwesens Für die Gemeinden in den deutschen Siedlungsgebieten ergab sich aus dem chronischen Pfarrermangel die Situation, daß sie für die Grundversorgung mit Gottesdiensten, Taufen und Beerdigungen auf den Lehrer angewiesen waren26. Diese Situation war in Russland viel stärker ausgeprägt als in Deutschland. Dort wurden zwar auch Küster mit Amtshandlungen beauftragt, die eigentlich zum Amtsbereich der Pastoren gehörten, aber das blieb weitgehend auf Ausnahmesituationen beschränkt, während es in den deutschen Siedlungsgebieten in Russland durchgängig die Regel war.
24 Busch, Ergänzungen der Materialien (Anm. 20), 347. 25 Mitteilungen und Nachrichten für die evangelische Geistlichkeit in Rußland 15 (1859), 201– 202. 26 Hugo Häfner, Der Küsterlehrer, in: Heimatkalender. Jahrbuch der Deutschen aus Bessarabien 42 (1991), 42–84, hier 43: „Ohne die Institution des Küsteramtes hätte ein kirchliches Leben in den evangelischen Kolonien nicht aufrecht erhalten werden können“.
208
Evangelische Pastoren und Lehrer in Russland während des 19. Jahrhunderts
Die eigentümliche Verbindung zwischen evangelischem Küsteramt und Schule, die sich in der hier verwendeten Bezeichnung „Küster/Lehrer“ widerspiegelt, entstammt der Reformationszeit. In der Leisninger Ordnung für die Visitatoren war bereits 1529 von dem „underpedagog“ die Rede, der das „custer ambt mit versorgen“ sollte27. Besonders der Katechismusunterricht der Jugend und der Kirchengesang wurden in den evangelischen Territorien an die Küster delegiert. Dabei behielten sich die Kirchenleitungen das Recht zur Prüfung vor, während die Einstellung eines Küsters Sache der Gemeinde war und nicht gegen das Votum des Ortspfarrers vorgenommen wurde. Zum Teil waren die Küster verpflichtet, bei Abwesenheit des Pfarrers in den Filialorten Lesegottesdienste abzuhalten28. Darüber hinaus waren sie auch für Nottaufen zuständig und wurden bei der Begleitung Sterbender bis hin zur Beerdigung beteiligt. Deshalb wurden in der brandenburgischen Visitationsordnung von 1573 Pfarrer und Küster von den bürgerlichen Lasten befreit, „weil sie jederzeit ihres Amtes zum Kindtaufen oder zu Kranken in Todesnöten gefordert werden“29. Durch die Anforderungen an den Küster als Lehrer und Vorsänger war ein gewisses Maß an Bildung eine Grundvoraussetzung für die Anstellung. Vor allem in den ländlichen Gebieten war es notorisch schwierig, geeignete Bewerber für dieses Amt zu finden. Selbst wenn die Gemeinde dazu verpflichtet war, ein Küsterhaus vorzuhalten, war die materielle Situation auch in Deutschland mehr als bescheiden30. Die Abhängigkeit von der Gemeinde und dem Ortspfarrer trug mit dazu bei, dass häufig Bewerber ohne die notwendigen Qualifikationen eingestellt wurden31. Die Klagen über diese beiden Mißstände bestimmen die Diskussion um Schule und Lehrer in Russland ebenso wie in Deutschland. Das in der kollektiven Erinnerung der Lehrer bis heute erhaltene Schreckgespenst der 27 Karl Nicol, Das Küsteramt in der evangelischen Kirche, Erlangen 19542, 8. 28 Nicol, Küsteramt (Anm. 27), 8: „In Filialorten hatte dieser außerdem den Pfarrer durch Abhaltung von Lesegottesdiensten zu vertreten; er übte das Lektorenamt aus“ (Hervorhebung im Original, R.H.). 29 Zitiert nach H. Merz, Küster, in: RE2 8 (1881), 306–308, hier 307. 30 Heinz-Elmar Tenorth, Lehrerberuf und Lehrerbildung, in: Handbuch der deutschen Bildungsgeschichte, Bd. 3, 1800–1870, München 1987, 258: „Die Klagen der Lehrer über ihre schlechten Verhältnisse mögen also die materielle Lage negativ verzeichnen, für die soziale Lage halten sie zu Recht Belastungen fest: Die Abhängigkeit von gemeindlichen Zahlungen, von der Zahl der Schüler und dem Schulgeld, die erheblichen Differenzen in der Ausstattung der Schulstellen zwischen östlichen und westlichen, ländlichen und städtischen Regionen, die Verschlechterung der Lebenssituation im Alter und die Unsicherheit für Witwen und Waisen. Diese Unsicherheiten, oder die Verzögerungen bei definitiver Anstellung, sind nicht zu bezweifeln, auch wenn der Status der Lehrer auf dem Lande relativ zur dortigen Bevölkerung keineswegs so schlecht war, wie es die Lehrerklage überliefert.“ 31 Nicol, Küsteramt (Anm. 27), 13: „Der vereinigte Küster- und Schuldienst wurde sehr lange Zeit hindurch auf dem Lande von nicht eigentlich vorgebildeten Bauern und Handwerkern geleistet, noch bis ins letzte Viertel des 18. Jahrhunderts und bis ins 19. Jahrhundert hinein, wenn der Betreffende überhaupt die nötigen Kenntnisse besaß“.
Evangelische Pastoren und Lehrer in Russland während des 19. Jahrhunderts
209
„geistlichen Schulaufsicht“ erweist sich bei genauer Betrachtung auch in Russland als eine staatliche Konstruktion. Seit 1802 hatte formal das zaristische „Ministerium für Volksaufklärung, Erziehung der Jugend und Verbreitung der Wissenschaften“ die Aufsicht über das gesamte Bildungswesen. Da der Staat in Russland noch weniger als im Deutschen Reich über die Ressourcen verfügte, ein flächendeckendes Bildungssystem zu organisieren, benutzten beide Länder die Kirchen als Schulträger und Schulaufseher32. Dennoch gab es einen staatlichen Bildungsanspruch33. In Russland wurden durch die Schulreform vom 28. 9. 1822 „die Ortsgeistlichen in den Rang von Schulinspektoren erhoben und die Lehrer als Kirchenbeamte der Geistlichkeit unterstellt“34. Dadurch wurde das Lehrerwahlrecht der Gemeinden eingeschränkt. Ein Lehrer konnte nicht gegen das Votum des Ortsgeistlichen durchgesetzt werden. Zugleich wurden dadurch Lehrer und Pastoren für eine lange Zeit aneinander gebunden. Diese eigentümliche Verbindung führte zum Teil zu guter Zusammenarbeit, zum Teil aber auch krassen Missverhältnissen zwischen Lehrern und Pastoren35. Seit der erwähnten Schulreform von 1840 gab es für die Deutschen in den Kolonien Schulpflicht. Sie setzte sich aber erst langsam überall durch. Das entsprach im Prinzip den Verhältnissen im Deutschen Reich. In Preußen besuchten 1816 erst 54,1 % der schulpflichtigen Kinder die Schule, 1846 waren es 78 %, 1864 85 % und 1871 86,3 %. Dem korrespondiert ein entsprechender Anteil der Analphabeten in der Bevölkerung. In Preußen waren es 1871 zwischen 1,9 % und 36,4 % der über 10-jährigen36. In den Wolgakolonien waren es 1862 18,2 % der Männer zwischen 15–30 Jahren. Bei den Männern zwischen 30–60 Jahren waren es 13,2 %37. Nach diesen Zahlen ist die Bildungsgeschichte der Deutschen in Russland strukturell vergleichbar mit der Lage im Mutterland. Das 19. Jahrhundert brachte eine Bildungsreform mit sich, in der die Grundbildung zu einem wirklichen Allge32 Gerd Friedrich, Schulsystem, in: Handbuch der deutschen Bildungsgeschichte Bd. 3, 1800– 1870, München 1987, 124: „Die Schulaufsichtsfunktionen wurden auf allen Verwaltungsebenen bis 1870 im allgemeinen durch Geistliche wahrgenommen; betrachtet man jedoch deren Rechtsstellung und Besoldung, ihre Titulaturen, die Verwaltung ihre Etats, ihre Amtssiegel, ihre Dienstanweisungen, so wird deutlich, daß sie nicht als Organe der Kirche, sondern als Beauftragte der weltlichen Staatsgewalt handelten“. 33 Friedrich, Schulsystem (Anm. 32), 130: „Die Stellung der Volksschulen im 19. Jahrhundert ist in allen deutschen Staaten gekennzeichnet durch den Gegensatz zwischen zentralistischem Führungsanspruch des Staates und seiner faktischen Führungsinkompetenz“. 34 Schulwesen an der Wolga, in: Lexikon (Anm. 15), 302. 35 Friedrich, Schulsystem (Anm. 32), 131: „das häufige Missverhältnis zwischen Volksschullehrer und Pfarrer wurde ein leidiges Thema der Volksschulrealität“. Für Russland lässt sich das gleiche sagen, wie das unten zitierte „Lied vom Küster Deis“ zeigt, das von einem Lehrer gedichtet wurde. Dort werden die treuen Küster/Lehrer den heuchlerischen und betrügerischen „Pfaffen“ gegenübergestellt, Kufeld, Küster Deis, s. u. (Anm. 38), 54. 36 Angaben nach Friedrich, Schulsystem (Anm. 32), 128. 37 Schulwesen an der Wolga, in: Lexikon (Anm. 15), 302.
210
Evangelische Pastoren und Lehrer in Russland während des 19. Jahrhunderts
meingut wurde. Auf dem Weg zu einer säkular definierten Schulbildung, waren die enge Verbindung zwischen Pastoren und Küster/Lehrern sowie die enge Koppelung von staatlich verordneter Schulpflicht und kirchlich definierten Bildungszielen eine Durchgangsstation. Diese Entwicklung vollzog sich sowohl in Deutschland wie in Russland. Die feststellbaren Unterschiede zum Mutterland und die spezifischen Probleme der Deutschen in Russland sind aus den dortigen geographischen, juristischen und administrativen Voraussetzungen erwachsen.
„Das Lied vom Küster Deis“ – Beschreibung eines wolgadeutschen Küsters Zum 150jährigen Jubiläum der Wolgakolonien hat der Lehrer David Kufeld ein langes Gedicht präsentiert38, das in 100 Strophen das Leben und das Amt eines Küster/Lehrers beschreibt39. Hier findet sich auch die Bezeichnung Küster/Lehrer in einem zeitgeschichtlichen Text. Kufelds Schilderung mutet beschaulich und romantisierend an. Aber neben den pittoresken Elementen findet sich eine zutreffende Schilderung dieser besonderen Existenzform in poetischer Sprache. Im vierten Abschnitt gibt Kufeld eine Beschreibung der vielfältigen Aufgaben, die dem Küster/Lehrer in einem Kolonistendorf übertragen wurden: Wenn ich nur beschreiben könnte Alle Ämter und Talente, Die der Küster Deis besaß, Aufsperr’n würde wohl mein werter Leser staunend Mund und Nas! Gibt’s ein Amt des Küsters schwerer? Deis war Küster, Kantor, Lehrer, Organist und Sekretär, Regent, Archivar und Felscher, Glockengeläut und noch mehr!…
Eine weitere Aufgabenbeschreibung gibt es am Ende des langen Gedichtes. Diese Beschreibung fällt weniger enkomiastisch aus. Sie ist als Rede der Küstersfrau konzipiert. Angesichts ihres kranken Mannes beugt sich die Frau über das Bett des 10jährigen Sohnes und prophezeit ihm eine mühsame Existenz in den Fußtapfen seines Vaters. Im Vordergrund der Rede der Küstersfrau steht die
38 David Kufeld, Das Lied vom Küster Deis, in: Engel-Braunschmidt (Hg.), Siedlernot und Dorfidyll (Anm. 6), 48–64. 39 Reinhold Keil, Ein Wort zum „Lied vom Küster Deis“, in: Heimatbuch der Deutschen aus Rußland 1982–1984, 22: „Man kann dieses Werk mit Fug und Recht als ein Versepos bezeichnen […] Der Autor […] David Kufeld, war viele Jahre als Lehrer im Bezirk Nowousensk an der Wolga tätig“.
Evangelische Pastoren und Lehrer in Russland während des 19. Jahrhunderts
211
materielle Armseligkeit der Lebensverhältnisse, die in keinem Verhältnis zum Umfang der Aufgaben steht. Die Last der Verantwortung, die auf einem Küster/ Lehrer ruhte, der sein Amt gewissenhaft wahrnahm, wird hier mehr als deutlich: Sollte jetzt dein Vater sterben, Schwindsucht hat er schon, Noch kein Hüttlein wirst du erben, Nichts, meiner armer Sohn. Treu dem Rufe deiner Väter Wirst du Küster hier, Wie du leiden wirst denn später Sing ich weinend dir. Küster-Lehrer wirst du werden, Kantor-Organist, Allen Menschen hier auf Erden Stets ein treuer Christ. Große Pflichten wirst du haben, Schüler ohne Zahl, Dann beginnt mit wilden Knaben Deine große Qual. Frei wird keine Stunde bleiben, Arbeit, Tag und Nacht: Lehren, Sänger üben, schreiben Über Menschenkraft! Und beerdigen und taufen, Teilen Freud und Leid, Auf den Gottesacker laufen In der schlecht’sten Zeit. Quält man dich gleich einem Knechte, Denk, mein Sohn, daran: Große Pflichten, keine Rechte Sind dir angetan…
Kufelds Beschreibung umfasst neben den Aufgaben, die Küster/Lehrer auch in den Territorien des Deutschen Reiches zu übernehmen hatten, den Hinweis auf die Funktionen der geistlichen Grundversorgung, die den Küster/Lehrern in Russland übertragen waren. „Beerdigen und taufen“ waren in den deutschen Kolonien in Russland reguläre Aufgaben der Küster. Durch die Präsenz vor Ort ergab sich auch eine seelsorgliche Funktion der Küster/Lehrer: „Teilen Freud und Leid“. Zu diesen Funktionen kamen noch die Aufgaben eines Kantors, Organisten, Schreibers und unter Umständen auch eines Arztes hinzu. Diese Ämtervielfalt verweist auf die zentrale Funktion des Küster/Lehrers in den deutschen
212
Evangelische Pastoren und Lehrer in Russland während des 19. Jahrhunderts
Kolonien in Russland. Zugleich zeigt es, daß die Kolonien im Wesentlichen bäuerliche Siedlungen waren, die kaum funktionelle Differenzierungen für die gemeinschaftlichen Aufgaben entwickelt hatten. In den Städten, sah die Situation anders aus. Hier gab es Ärzte und eine öffentliche Verwaltung. Die Küster/Lehrer waren hier „nur“ mit den Aufgaben eines Küsters, Kantors, Organisten, Lehrers und mit der pastoralen Versorgung bei Abwesenheit des Pastors betraut. Bis auf die pastoralen Funktionen entsprach das der Situation im Deutschen Reich. Die uns heute vertraute Differenzierung der Berufe ist ein Ergebnis der im 19. Jahrhundert begonnen Prozesse, die erst im 20. Jahrhundert zum Abschluss gekommen sind. In den deutschen Schulen im russischen Reich hat die kommunistische Machtübernahme für einen Abbruch dieses eigenständigen Prozesses der Berufsdifferenzierung in den deutschen Siedlungsgebieten gesorgt. Die letzten Küster/Lehrer wurden in den zwanziger Jahren von den Sowjets wegen „unzureichender Qualität“ oder wegen „Klerikalismus“ aus dem Schuldienst entfernt40.
Die gottesdienstlichen Funktionen der Küster/Lehrer Der von den Sowjets als Entlassungsgrund für Küster/Lehrer angeführte „Klerikalismus“ weist zurück auf die enge Verbindung zwischen Kirche und Schule im 19. Jahrhundert. Dabei läßt sich die Bedeutung der gottesdienstlichen Funktionen der Küster/Lehrer für das Leben eines deutschen Dorfes in Russland schwerlich überschätzen. Im Wertesystem der meisten Kolonisten waren es eben diese Anteile des Berufs, die einen Küster/Lehrer unentbehrlich machten. E. H. Busch urteilt zutreffend, wenn er 1867 schreibt: „Die Lehrer werden aber auch nicht sowohl des Unterrichtens halber angestellt, als vielmehr die Predigt am Sonntage vorzulesen und die Nothtaufen und Beerdigungen zu vollziehen“41. Für alle drei Siedlungsgebiete der Deutschen in Russland lässt sich die zentrale Bedeutung der Küster/Lehrer für die religiösen Bezüge der Kolonien im 19. Jahrhundert nachweisen. Für die Wolgakolonien läßt sich sagen: Jede, auch die kleinste Colonie hat ihre eigene Kirche, oder wenigstens ihr eigenes Schulhaus, in welchem der Pastor für die Bewohner dieses einen Dorfes Gottesdienst zu halten verpflichtet ist, so daß ein Prediger, dem 7 Colonien anvertraut sind, erst jeden siebenten Sonntag dazu kommt, in derselben Kirche und Gemeinde wieder Gottesdienst zu halten […] An den Sonntagen, da der Pastor selbst in seiner Gemeinde nicht sein kann, leitet der Schulmeister den Gottesdienst nach einer ihm dazu erteilten Form.
40 Stricker, Rußland (Anm. 4), 467. 41 Busch, Ergänzungen der Materialien (Anm. 20), 203.
Evangelische Pastoren und Lehrer in Russland während des 19. Jahrhunderts
213
Die gebräuchlichsten Predigtbücher sind zunächst der alte Brastberger, ferner Hofacker, Kapff, hie und da auch Ahlfeld und Huhn.42
Für Südrussland ist eine Schilderung aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts charakteristisch. Die Stadtgemeinde zu Jekaterinoslaw „bemühte sich schon seit 1846 zum Besitz eines eigenen Bethauses zu gelangen, in welchem von dem im benachbarten Josephsthal wohnenden Prediger öfter Gottesdienst gehalten und in Abwesenheit des Pastors von einem anzustellenden Schullehrer regelmäßig Sonntags eine Predigt vorgelesen werden sollte“43. Als das gelang, war für diesen Ort eine pastorale Grundversorgung gesichert. Eine weitere Schilderung aus der Verhältnisse in Bessarabien beschreibt die Situation, die durch die großen Kirchspiele und den Pastorenmangel in den ganzen deutschen Kolonien in Russland für das Jahrhundert typisch ist: Etwas Schweres ist es, daß der Pastor an jedem Sonntag nur einen Theil seiner Gemeinde versammelt sieht, weil er der Reihe nach an jedem Sonntage in einer andern Colonie seines Kirchspiels predigen muß. Hat er nun deren 4 oder 5 oder gar sechs, so ist er an jedem 4. oder 5. oder 6. Sonntage einmal zu Hause zur Predigt. Indeß wird der Gottesdienst sonn- und festtäglich in den Colonien, wo der Prediger nicht anwesend ist, vom Schullehrer nach einer besonderen Instruction versehen, wobei vorzugsweise das Predigtbuch von Hofacker gebraucht wird44.
In Wolhynien, dem jüngsten Siedlungsgebiet, ist die Situation grundsätzlich gleich, denn „den Predigern war es bei der großen Ausdehnung des Kirchspiels nur möglich, jedes Jahr auf einen oder einige Tage jede Colonie zu besuchen und die Lehrer, welche die Predigt zu verlesen, die Taufen und Beerdigungen zu verrichten hatten“45. Dazu paßt der Bericht über das Kirchspiel Schitomir, zu dem im Jahre 1867 bereits 59 Kolonien gehörten. Hier heißt es: „In den zahlreichen Colonien des Kirchspiels existiren nirgends Kirchen, sondern nur Schulhäuser, in denen Gottesdienst gehalten wird“46. In der Situation des ständigen Zuzugs von Deutschen nach Wolhynien „sucht jede Colonie bei ihrer Gründung sofort ein Schulhaus zu bauen, aber dieses ist meistens so klein, daß […] unmöglich die Kirchgänger auch nur zweier Gemeinden in demselben Platz finden. Somit wird die Wirksamkeit des Predigers
42 Materialien zur Geschichte und Statistik des Kirchen- und Schulwesens der Ev.-Luth. Gemeinden in Rußland, im Auftrage des Central-Comités der Unterstützungs-Kasse für Ev.Luth. Gemeinden in Rußland, gesammelt und herausgegeben von E.H. Busch, St. Petersburg 1862, 312–313. 43 Busch, Ergänzungen der Materialien (Anm. 20), 245. 44 Busch, Materialien (Anm. 42), 155. 45 Busch, Ergänzungen der Materialien (Anm. 20), 199. 46 Busch, Ergänzungen der Materialien (Anm. 20), 198.
214
Evangelische Pastoren und Lehrer in Russland während des 19. Jahrhunderts
zerstückelt durch fortwährendes Reisen und Predigen vor kleinen Versammlungen“47. Anders als in Deutschland war die gottesdienstliche Funktion der Küster/ Lehrer in der Lebenswirklichkeit der Kolonien prägend48. Ihre Funktionen als Lehrer und Erzieher traten demgegenüber im Bewußtsein der Kolonisten zurück. Erst im Laufe des 19. Jahrhunderts änderte sich das. Die Veränderungen gingen allerdings langsam vonstatten und wiesen große lokale Unterschiede auf. Parameter, an denen sich die Veränderungen ablesen lassen, sind die Schulwirklichkeit samt Lehrerbesoldung und Klassenstärken, sowie die Ausbildung der Lehrer und die Schulorganisation.
Lehrerbesoldung und Schulwirklichkeit Grundsätzlich waren die Einkommen der Lehrer, wie bereits dargestellt, gering. Die Gemeinden konnten das Gehalt für die Lehrer selbst festsetzen und hatten so eine Einsparmöglichkeit, die dazu führte, daß es eine hohe Fluktuation unter den Lehrern gab. Zum großen Teil bestand das Gehalt aus Naturallieferungen49. In den meisten Gemeinden, wurde im Sommer keine Schule gehalten. Deshalb waren die Lehrer gezwungen, sich in dieser Zeit anderweitig Geld zu verdienen, um das Gehalt aufzubessern. Noch 1872 wird die Situation an der Wolga so geschildert: Die Schulzeit ist eine kurze, denn nicht einmal die gesetzlich bestimmten 6 Monate können ganz auf den Unterricht verwendet werden; den halben, oft auch ganzen Oc47 Busch, Ergänzungen der Materialien (Anm. 18), 202. 48 Johannes Kufeld, Die Deutschen Kolonien an der Wolga, herausgegeben vom Historischen Forschungsverein der Deutschen aus Russland, Nürnberg 2000 (Das Manuskript wurde gegen 1911 abgeschlossen und scheint im Zusammenhang mit dem 150jährigen Jubiläum der Wolgakolonien entstanden zu sein.) Kufeld widmet den Küsterlehrern ein eigenes Kapitel und resümiert dort, 335: Dem Küsterlehrer „haben Gemeinde, Kirchengesetz, Tradition und zu verschiedenen Zeiten auch noch besondere Instruktionen nicht nur zum Vertreter des Geistlichen in dessen Abwesenheit beim Gottesdienst und den Amtshandlungen und zum Kirchenschreiber gemacht, auch der Schullehrerdienst ist ihm auferlegt worden, in den meisten Gemeinden war er früher auch Schulheizer und Schuldiener und Glöckner. Es war ihm eine ungeheure Arbeitslast aufgebürdet, er war ‚Mädchen für alles‘. Es ist nun von vornherein klar, dass er besonders in den Filialgemeinden, bei wochenlanger Abwesenheit des Pastors als Vertreter des letzteren mit der Zeit immer mehr und mehr an Bedeutung gewinnen musste je mehr die Kirchspiele an Ausdehnung wuchsen und je seltener die einzelnen Gemeinden den Pastor in ihrer Mitte zu sehen bekamen. Er war nicht nur Lehrer, Erzieher und Ratgeber, oft auch in medizinischen Angelegenheiten, also Arzt, sondern auch Pastor und Seelsorger, indem er nicht nur den Gottesdienst hielt, sondern auch taufte, beerdigte, die Kranken besuchte und mit ihnen betete.“ 49 In den Mitteilungen und Nachrichten für die evangelische Kirche in Rußland 28 = N. F. 5 (1872), 464 findet sich eine Aufstellung über die verschiedenen Lehrergehälter.
Evangelische Pastoren und Lehrer in Russland während des 19. Jahrhunderts
215
tober verlangen viele Eltern ihre Kinder noch zur Ernte, zum Strohfahren oder Tabaksbau, im März, wenn die Erde anfängt, ihr Winterkleid abzulegen und kahle Plätze sich zeigen, da fangen die Bänke an, sich zu leeren und die Dorf-Scholaren wandern mit der Hirtenschippe und dem Brodsack hinter den Schafen her, hinaus, froh dem Bakel und Schulstaub hinter sich zu haben. Den Sommer über, vom Frühjahr bis zum späten Herbst, braucht der Bauer auch seine Schulkinder zur Arbeit50.
Daß die Winterzeit, in der Schule gehalten wurde, für die Küster/Lehrer häufig kein Vergnügen war, belegt die folgende von Stricker überlieferte Schilderung aus Grimm an der Wolga eindrücklich: Das Schulhaus hat ein anständiges Äußeres, ist von beachtlicher Größe und besteht aus einem Saal mit 18 Fenstern an der Langseite. Ich fand darin 450 Lernende, darunter 100 Mädchen, im Alter von 7 bis 15 Jahren. Das war aber nur die Hälfte – die sog. Vormittagsschule. Die übrigen 450 Kinder kommen am Nachmittag zum Unterricht: Alle saßen auf sehr schmalen, dünnen und langen Brettern und Bänken und hielten ihre Bücher frei in den Händen, weil keine Tische vorhanden waren. Der Lehrer hatte einen Gehilfen, der sich mit den ABC-Schützen (etwa 100) mit halblauter Stimme […] beschäftigte, während der Lehrer das laute Lesen der Testamentsschüler abhörte. Die Antwort in den übrigen Lehrfächern wurden ständig in laut schallendem Chor gegeben. Am Fenster erblickte ich eine frische Weidenrute von einem halben Zoll Stärke und einem Arschin Länge. Die Kinder saßen sehr dicht gedrängt in von Schnee durchnäßten Oberkleidern und Schuhen. Fast allen stand der Schweiß auf dem Gesicht. Ungeachtet dessen, daß die Sonne am Morgen schien, konnte man im Saal kaum lesen – so dampfte es darin […] Man kann sich schon denken, daß unter solchen Verhältnissen von einem Unterricht im Sinne einer geistigen Entwicklung keine rede sein konnte. Alles beschränkte sich auf die strengste Einhaltung der Schuldisziplin, ohne welche es […] nicht möglich war, diese Masse von lebendigen Körpern in unbeweglicher Ordnung zu halten51.
Diese unglaublichen Unterrichtsverhältnisse waren nicht Ausnahme, sondern um 1870 die normalen Zustände in den deutschen Kolonien in Russland. Es waren in manchen Kolonien bis zu 1.000 Schulkinder, die von einem oder zwei Lehrern in viel zu kleinen Schulhäusern unterrichtet werden mussten52.
50 Bericht über die kirchlichen Zustände der Gegenwart und insbesondere der Wiesenseiter Präpositur, in: Mitteilungen und Nachrichten für die evangelische Kirche in Rußland 28 = N. F. 5 (1872), 529–543, hier 542. 51 Stricker, Rußland (Anm. 4), 439–440. 52 Vgl. die Angaben in Mitteilungen und Nachrichten für die evangelische Kirche in Rußland 28 = N. F. 5 (1872), 465, wo für drei Gemeinden eine Schülerzahl von über 1.000 Kindern angegeben wird. Die Schülerzahlen in Russland sind deutlich höher als in Deutschland, vgl.: Tenorth, Lehrerberuf (Anm. 27), 265: „Die Lehrer-Schüler-Relationen sinken in den niederen Schulen auch in den Städten kaum unter 1:50; sie erreichen aber in den ländlichen Regionen Bayerns, Preußens oder Österreichs auch durchaus höhere Werte, etwa 1:116 im Regierungsbezirk Oppeln (1843) oder 1:330 in der Bukowina nach 1830“.
216
Evangelische Pastoren und Lehrer in Russland während des 19. Jahrhunderts
Lehrerbildung und Schulorganisation Immer wieder gab es deshalb Klagen über den geringen Bildungsstand der Lehrer in den russlanddeutschen Kolonien. 1867 bilanziert E. H. Busch die Situation am Beispiel der Kolonien im Umkreis von Schitomir: Was die Schulen betrifft, so befinden sich diese […] auf einer recht niedrigen Stufe. Die Kinder lesen mit Mühe, ohne Ausdruck, geschrieben wird in wenigen Schulen, das Rechnen ist unbekannt, biblische Geschichte wird in keiner Schule getrieben, der Katechismus gelernt aber nicht erklärt. Daran ist hauptsächlich der Mangel an tüchtigen Lehrern Schuld. Dieselben sind im Allgemeinen eifrige Leute, entbehren aber jeder Bildung und waren früher entweder Feldarbeiter oder Handwerker. Tüchtige Lehrer sind schwer zu erlangen, noch schwerer aber zu fesseln, da die Gagen so sehr gering sind53.
In Deutschland war die Situation zu dieser Zeit bereits deutlich besser. Die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts ist in Deutschland gekennzeichnet durch die allmähliche Durchsetzung der seminaristischen Ausbildung der Lehrer54. In Russland wird in derselben Zeit versucht, die Bildung der Lehrer durch Ausbildung und Eingangsprüfungen zu verbessern. Im Wolgagebiet bildete sich deshalb in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Sitte heraus, dass die Küster/ Lehrer von der jährlich tagenden Synode der beiden Propsteien, zu denen ausschließlich die Pastoren gehörten, geprüft wurden55. Dieser zusätzlichen Arbeit unterziehen sich auch die Pastoren nicht gerne, wenn es andere Wege der Qualitätskontrolle gegeben hätte, wären sie wahrscheinlich beschritten worden. Diesen Eindruck vermittelt zumindest das Synodalprotokoll aus dem Jahre 1873: Die Prüfung der Schulamts-Aspiranten. Obgleich es verdrießlich ist, so viel kostbare Zeit einem so unerquicklichen Geschäfte widmen zu müssen, so hat sich doch die Synode dasselbe auferlegt, da es früher, in vorkommenden Fällen dem Propste allein oder einem einzelnen Pastor überlassen gewesen war, und übt es seit dem Jahre 1857 stehend alljährlich aus, in der Ueberzeugung, damit etwas Heilsames und Nothwendiges zu leisten56.
Aufschlußreich ist auch die Zusammenstellung der Prüfungsfächer. Prüfungsgegenstände waren 1858: 53 Busch, Ergänzungen der Materialien (Anm. 20), 203–204. 54 Tenorth, Lehrerberuf (Anm. 27), 256: „Noch um 1830 ist kaum die Hälfte der im Amt befindlichen Lehrer seminaristisch qualifiziert; Klagen über die Unfähigkeit der Lehrer und Lehramtsbewerber sind immer noch zu hören.“. 55 Einen historischen Abriß gibt der Artikel „Kurze Uebersicht der Verhandlungen der bisherigen Predigersynoden auf der Bergseite der Wolga in Betreff des evangelischen Kirchschulwesens des Propstbezirks“, in: Mitteilungen und Nachrichten für die evangelische Kirche in Rußland 28 = N. F. 5 (1872), 271–280. 56 Mitteilungen und Nachrichten für die evangelische Kirche in Rußland 29 = N. F. 6 (1873), 45.
Evangelische Pastoren und Lehrer in Russland während des 19. Jahrhunderts
1) 2) 3) 4) 5) 6)
217
Choralgesang nach Noten ausdrucksvolles Lesen eines Predigtabschnittes Biblische Geschichte nach dem Wortverstande Katechismus Orthographie Rechnen der 4 Species [Grundrechenarten]57
Die Reihenfolge ist wertend und gibt die Wichtigkeit der Fächer in den Augen der prüfenden Pastoren wieder. Dabei scheinen sich die Pastoren mit den Gemeinden einig zu sein, die die eigentlichen pädagogischen Fähigkeiten eines Küster/ Lehrers als nicht so wichtig einstuften. Die Betonung der gesanglichen Fähigkeiten und des Lesens der Predigt spiegeln die große Bedeutung des Küster/ Lehrers als Leiter des Gottesdienstes wieder. Die Ausbildung von Lehrer an der Zentralschule und die Prüfung durch die Propsteisynode und erwiesen sich auf die lange Sicht als nicht befriedigend. Der in Bildungsfragen besonders umtriebige Pastor Chr. Dsirne formulierte das Bedürfnis nach einer verbesserten Ausbildung der Lehrer 1867 deutlich: Ein Schullehrerseminar mit entsprechender zweckdienlicher Organisation, das ist unser Nothschrei schon seit Jahren, und noch immer will kein Helfer sich zeigen; denn wenn auch Pastoren hier und da, trotz überhäufter Amtsarbeiten, sich der Mühe der Schullehrerbildung unterzogen haben, so kann dadurch noch bei Weitem dem Nothstande nicht abgeholfen werden.
Dieser „Nothschrei“ von Pastor Dsirne wurde nicht erhört. Dagegen gelangte eine von den Pastoren an der Wolga ausgearbeitete und vom Moskauer Konsistorium bestätigte Neuordnung des Schulwesens 1868 in Geltung. Die „Schulund Küster-Schulmeister-Instruktion in den evangelischen Kolonien des Saratowschen und Samarischen Gouvernements“ beinhaltet eine Neuorientierung des Unterrichts und eine Abkehr von der sturen Paukerei der davor liegenden Periode. Die Unterrichtsfächer wurden vermehrt. Statt der Konzentration auf die Konfirmation stand jetzt ein anderes Motto über dem Unterricht: Die Kinder „für das Leben in den von Gott geordneten Hauptlebensgebieten: der Kirche, Familie und dem Staate christlich vorzubereiten“. Dafür sollen die folgenden Fächer unterrichtet werden:
57 Zusammengestellt nach dem Bericht über die Kreissynode auf der Bergseite der Wolga 31.8.– 2. 9. 1858 in Norka, in: Mitteilungen und Nachrichten für die evangelische Geistlichkeit in Rußland 15 (1859), 615.
218
Evangelische Pastoren und Lehrer in Russland während des 19. Jahrhunderts
1) Religion: a. biblische Geschichte und Bibellesen b. Gebete, Bibelsprüche und Kernlieder c. Katechismus 2) Lesen 3) Schreiben: Schön- und Rechtschreiben, wobei zu beachten ist, dass nicht nur die Deutsche, sondern auch die lateinische und russische Schrift den Kindern beigebracht werden soll und dass nicht ein Abschreiben von vorgelegten Vorschriften, sondern auch Aufschreiben eingeprägten Stoffes aus dem Gedächtnis und das Nachschreiben diktierter Sätze verlangt wird, 4) Rechnen: Kopf- und Tafelrechen 5) Gesang 6) mit dem Leseunterricht zu verbindender Sach- und Sprachunterricht58. Hier zeigten sich die Pastoren als treibende Kraft zu einer Verbesserung des Unterrichts in den deutschen Schulen, die ihrer Aufsicht unterstanden. Besondere Beachtung verdient die Öffnung für die russische Schrift, die den später einsetzenden Prozeß der Russifizierung durch die unten beschrieben Zemstvoschulen zu antizipieren scheint59. Eine weitere Modernisierung der Kirchenschulen wurde durch die von Geistlichen entwickelten Schulbücher erreicht. Ähnlich wie in Deutschland war die Ablösung von Bibel und Katechismus als Lese-, Lern- und Leselernbüchern ein wichtiger Schritt in der Entwicklung der Schule zu einer Bildungsanstalt, die nicht mehr nur auf die jeweiligen konfessionellen Bedürfnisse zugeschnitten war60. Im deutschen Reich „ging der entscheidende Impuls zwischen 1850 und 1860 von der Einführung des Lesebuchs in
58 Zu den Beratungen über die Instruktion vgl. das Synodalprotokoll der Bergseiter Präpositur vom 9–13. 10. 1866, in: Mitteilungen und Nachrichten für die evangelische Geistlichkeit in Rußland 23 (1867), 32–34. Der Text ist zitiert nach Kufeld, Kolonien (Anm. 48), 249. 59 Die Erfolge des Russischunterrichts an den deutschen Schulen blieben aber gering. Die Berichte der russischen Revisoren aus Südrussland aus den Jahren 1890/91 zeigen, „dass an den von ihnen besichtigten Kirchenschulen meist nur drei bis fünf Kinder die russische Sprache einigermaßen beherrschten. Ein Lehrer habe eingeräumt, dass zum Russisch-Unterricht, der meist nachmittags stattfinde, nur ein Zehntel der Schüler erscheine“. Zitiert nach Detlef Brandes, Zur „friedlichen Eroberung“ Südrusslands durch die deutschen Kolonisten, in: Die Deutschen in der UdSSR in Geschichte und Gegenwart. Ein internationaler Beitrag zur deutsch-sowjetischen Verständigung, hg. v. I. Fleischhauer / H. H. Jedig, Baden-Baden 1990, 135. 60 Bei den Kolonisten gab es langanhaltende Vorbehalte gegen die neuen Schulbücher. So schreibt Kufeld, Kolonien (Anm. 48), 252 noch um 1911: „Einmal war das Vorurteil der Kolonisten zu überwinden, die heute noch am liebsten alle weltlichen Lesebücher aus der Schule herauswerfen und wieder das Testament einführen würden“.
Evangelische Pastoren und Lehrer in Russland während des 19. Jahrhunderts
219
allen städtischen und ländlichen Schulen aus“61. In Russland war diese Entwicklung nur unwesentlich später zu beobachten. Das Problem der fehlenden gehobenen Schulbildung blieb aber weiterhin ungelöst. Vor allem an der Wolga bildeten sich daraufhin in den sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts zahlreiche Privatschulen. Sie erhoben zumeist ein so hohes Schulgeld, daß nur die Kinder begüterter Familien sie besuchen konnten. Trotzdem gab es 1886 bereits 28 solcher privaten Schulen62. In Südrussland war ihre Zahl geringer, dort gab es eine größere Anzahl an Zentralschulen, deren Abschlüsse zum Teil auch zum Besuch russischer höherer Bildungseinrichtungen berechtigten. Grundsätzlich standen aber die Zeichen der Zeit einer Weiterentwicklung der deutschen Bildungslandschaft in Russland entgegen. Die Vision einer eigenen deutschen Welt im russischen Reich versank im beginnenden russischen Nationalismus. Die unter Alexander II. begonnene Verwaltungsreform mit der Bildung von Landschaftsverbänden „Zemstvo“ und die aufkommende großrussische Propaganda, die in den Deutschen in Russland begann Ausländer zu sehen63, führten zur Aufhebung der deutschen Autonomie und Selbstverwaltung im Jahre 1871. Im Zusammenhang der Verwaltungsreform wurden in großem Stile russische Schulen gegründet. In den deutschen Kolonien sollten diese Zemstvoschulen die hergebrachten „Kirchenschulen“ verdrängen. Der Unterricht war staatlich bezahlt und so mussten die Schüler an den Zemstvoschulen kein Schulgeld aufbringen. Die Lehrer der staatlichen Schulen waren besser ausgebildet und bezahlt als an den deutschen Schulen. Zudem war das Fächerangebot in den staatlichen Schulen breiter und den Absolventen stand der Besuch weiterführender Schulen offen. Dennoch blieben die Kolonisten überwiegend dabei, ihre Kinder in die weiterhin überfüllte Kirchenschule zu schicken. Zentraler Grund dafür war, daß der Unterricht in den Zemstvoschulen auf Russisch stattfand. So ergab sich die Situation, daß an der Wolga 1893 neben 193 Kirchenschulen 64 staatliche Schulen existierten. An den staatlichen Schulen wurden aber nur 2200 Jungen unterrichtet, bei insgesamt 55.882 Schulkindern im
61 Friedrich, Schulsystem (Anm. 32), 141. 62 Stricker, Rußland (Anm. 4), 450. Eine Aufstellung und kurze Beschreibungen der privaten Schulen von Katharinenstadt und Saratov gibt Jean-François Bourret, Les Allemands de la Volga. Histoire culturelle d’une minorité 1763–1941, Lyon 1986, 191–194. 63 Das war vorher anders. Dostojewskis 1879/80 erschienener Roman „Die Brüder Karamasow“ zeichnet ein Bild der Deutschen in Russland, dass nicht allein von ethnischen Kriterien bestimmt ist. Dort wird ein Deutscher aus Deutschland von einem Deutschen aus Russland dadurch unterschieden, dass der Deutsche aus Deutschland von Aljoscha als „ausländischer Deutscher“ (inostrannyi nemec) bezeichnet wird. Diesen Hinweis verdanke ich Jean-François Bourret, Der Russisch-Unterricht im volgadeutschen Schulwesen bis zum ersten Weltkrieg, in: Fleischhauer / Jedig (Hg.), Die Deutschen in der UdSSR (Anm. 59), 153.
220
Evangelische Pastoren und Lehrer in Russland während des 19. Jahrhunderts
Einzugsgebiet64. Hier erwiesen sich die evangelischen Pastoren als massive Traditionalisten. Sie setzten alles daran, die herkömmliche – und von ihnen so oft beklagte – Struktur der deutschen Schule mit ihren Küster/Lehrern aufrechtzuerhalten. Dabei stand den Ortsgeistlichen stets das Recht zum Religionsunterricht an der Zemstvoschule zu. Religiöse Gründe können also nicht allein den Ausschlag für diese Haltung gegeben haben. Zumal Pastor Samuel Bonwetsch schon 1862 diese Entwicklung selbst gefordert hatte: „Die Volksschule, mit ihren notwendigen Kenntnissen für das Leben, muss unter staatliche Aufsicht gestellt werden und die Kirche behält allein, was ihr gehört: den Religionsunterricht“65. Was sich in dem letzten Viertel des 19. Jahrhunderts vollzog, ist der Übergang der Deutschen in Rußland von einer „protegierten und privilegierten Sonderstellung [… in] eine ethnische Außenseiterrolle, ganz im Sinne derjenigen [russischen Kräfte R.H.], die die Präsenz der Deutschen generell als ‚Deutschenherrschaft‘ im nationalistischen Interesse zuspitzen und überbewerten wollen“66. Als Folge begann eine ethnische Selbstdefinition der Russlanddeutschen, die ihnen vorher fremd war und jetzt dazu führte, daß man die „eigenen“ Traditionen und Institutionen an jeder nur möglichen Stelle verteidigte. So blieben die deutschen Kinder in den Kirchenschulen, bildeten die Zentralschulen weiter Küster/Lehrer aus und es wurde sogar im Jahre 1905 die Forderung nach einer eigenen Lehrerausbildungsstätte wieder laut67. Die Verantwortung für die Deutschen brachte Lehrer und Pastoren dazu, die an den mitgebrachten und in Russland weiterentwickelten Bildungseinrichtungen festzuhalten und so einen eigenen Beitrag zur Abgrenzung von der russischen Umwelt zu leisten. Die Vision eines multiethnischen Miteinanders passte nicht mehr in das ausgehende 19. und beginnende 20. Jahrhundert. Der europäische Nationalismus brachte die Deutschen in Russland in die Außenseiterposition, die ihnen späterhin zum Verhängnis werden sollte.
Quellen Ergänzungen der Materialien zur Geschichte und Statistik des Kirchen- und Schulwesens der Ev.-Luth. Gemeinden in Rußland, im Auftrage des Central-Comités der Unterstützungs-Kasse für Ev.-Luth. Gemeinden in Rußland, gesammelt und herausgegeben von E.H. Busch, 1. Bd., St. Petersburg 1867. Mitteilungen für die evangelische Kirche in Rußland (eingesehen wurde das Exemplar der Universitätsbibliothek Leipzig). 64 65 66 67
Stricker, Rußland (Anm. 4), 449. Zitiert bei Kufeld, Kolonien (Anm. 48), 247–248. Römhild, Macht des Ethnischen (Anm. 2), 83. Kufeld, Kolonien (Anm. 48), 255.
Evangelische Pastoren und Lehrer in Russland während des 19. Jahrhunderts
221
Literatur Alfred Adam, Unionen im Protestantismus, in: RGG3 6 (1962), 1140–1144. Detlef Brandes, Von den Zaren adoptiert. Die deutschen Kolonisten und die Balkansiedler in Neurussland und Bessarabien 1751–1914 (Schriften des Bundesinstituts für ostdeutsche Kultur und Geschichte 2), München 1993. Alfred Eisfeld, Die Russlanddeutschen, München 1992. Annelore Engel-Braunschmidt (Hg.), Siedlernot und Dorfidyll. Kanonische Texte der Rußlanddeutschen, Berlin u. Bonn 1993. I. Fleischhauer / H. H. Jedig (Hg.), Die Deutschen in der UdSSR in Geschichte und Gegenwart. Ein internationaler Beitrag zur deutsch-sowjetischen Verständigung, BadenBaden 1990. Hugo Häfner, Der Küsterlehrer, in: Heimatkalender. Jahrbuch der Deutschen aus Bessarabien 42 (1991), 42–84. Wilhelm Kahle, Zum Verhältnis von Kirche und Schule in den deutschen Siedlungen an der Wolga bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges, in: D. Dahlmann / R. Tuchtenhagen (Hg.), Zwischen Reform und Revolution. Die Deutschen an der Wolga 1860–1917 (Veröffentlichungen des Instituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa 4), Essen 1994, 224–243. Ders., Wege und Gestalt evangelisch-lutherischen Kirchentums. Vom Moskauer Reich bis zur Gegenwart, 2. Aufl., Erlangen 2002. Johannes Kufeld, Die Deutschen Kolonien an der Wolga, herausgegeben vom Historischen Forschungsverein der Deutschen aus Russland, Nürnberg 2000. Lexikon zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen, Berlin 2002. H. Merz, Küster, in: RE2 8 (1881), 306–308. Karl Nicol, Das Küsteramt in der evangelischen Kirche, Erlangen 19542. Kurt Onasch, Grundzüge der russischen Kirchengeschichte (KIG 3 M/1) Göttingen 1967. Ute Richter-Eberl, Lutherisch, katholisch oder deutsch? Aspekte der kulturellen Identität der Deutschen an der Wolga, in: D. Dahlmann / R. Tuchtenhagen (Hg.), Zwischen Reform und Revolution. Die Deutschen an der Wolga 1860–1917 (Veröffentlichungen des Instituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa 4), Essen 1994, 160–171. Regina Römhild, Die Macht des Ethnischen. Grenzfall Russlanddeutsche. Perspektiven einer politischen Anthropologie (Europäische Migrationsforschung 2), Frankfurt am Main u. a. 1998. Gerd Stricker, Die Schulen der Wolgadeutschen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Ein Versuch: Unter besonderer Berücksichtigung katholischer Anstalten, in Dahlmann / Tuchtenhagen (Hg.), Zwischen Reform und Revolution (Anm. 1), 244–266. Ders., Rußlanddeutsches Bildungswesen von den Anfängen bis 1941, in: Gerd Stricker (Hg.), Deutsche Geschichte im Osten Europas. Rußland, Berlin 1997, 420–478. Ders., (Hg.), Deutsche Geschichte im Osten Europas. Rußland, Berlin 1997. Karl-Ernst Jeismann / Christa Berg (Hg.), Handbuch der deutschen Bildungsgeschichte, Bd. 3, 1800–1870, München 1987.
Die prägende Kraft der Predigtbücher für die Frömmigkeit der Russlanddeutschen
Einleitung Russlanddeutsche sind seit 1989 in großen Zahlen in ihre „Urheimat“ nach Deutschland zurückgewandert. Sie brachten ihre eigene deutsch-russische Geschichte mit, die sie bis heute zu einer besonderen Migrantengruppe macht. Sie brachten aber auch eine eigene religiöse Prägung mit, die sich deutlich von der Prägung ihrer in Deutschland gebliebenen Mitchristen unterscheidet. Dafür ist nicht nur die kommunistische Unterdrückung des Christentums verantwortlich, die zu einem „Einfrieren“ von Theologie und Frömmigkeit auf dem Stand der zwanziger Jahre geführt hat. Als die heimgekehrten Russlanddeutschen in Deutschland in ihre konfessionellen Gruppen aufgenommen wurden, zeigte sich schnell, dass sie sich sowohl in den Freikirchen, wie in den evangelischen Landeskirchen nur schwer in die vorhandenen Gemeinden integrieren ließen. Ihre eigentümliche Frömmigkeit führt schnell zu Irritationen auf beiden Seiten. Das ist das Resultat einer tiefliegenden religiösen Prägung, die nur bedingt zum vorhandenen kirchlichen Spektrum in Deutschland passt. Die Frömmigkeitsformen der Russlanddeutschen sind in den verschiedenen Konfessionen relativ ähnlich. Sie zeichnen sich aus durch eigene „Brüderversammlungen“, durch die Predigt von Laien, („Brüdern am Wort“), dadurch, dass sie nur „bekehrte“ Christinnen und Christen in ihren Kreis aufnehmen und dadurch, dass sie zahlreiche Verhaltensregeln befolgen, die eine Abkehr von der Welt signalisieren, wie zum Beispiel, Verzicht auf Alkohol, Nikotin, Fernsehen, Theater, Kino, sowie besondere Kleidung und Haartracht für Männer und Frauen. Für den Kirchenhistoriker zeigen sich darin Nachwirkungen des europäischen Pietismus und der Erweckungsbewegung, selbst wenn die Betreffenden zum Beispiel im Jahre 1996 aus Mittelasien nach Deutschland gekommen sind. Die vorliegende Untersuchung geht der Frage nach, wie dieses Gedankengut und die beschriebenen Verhaltensweisen nach Russland gebracht wurden und wie sie sich dort in den weit verstreuten Siedlungen verbreiten konnten. Dazu
224
Die prägende Kraft der Predigtbücher für die Frömmigkeit der Russlanddeutschen
kann bereits auf einige gesicherte Ergebnisse der bisherigen Forschung zurückgegriffen werden. 1. Der Einfluss der Herrnhuter auf die deutschen Kolonisten an der Wolga. Durch ihre Siedlung in Sarepta (heute Teil des Stadtgebiets von Wolgograd) sorgte die Brüdergemeine dafür, dass die Kolonisten im 18. und frühen 19. Jahrhundert geistlich versorgt wurden1 und begründete damit eine pietistische Prägung der evangelischen Gemeinden an der Wolga. 2. Die erweckliche, separatistische oder chiliastische Prägung der Kolonisten aus Schwaben, die sich in den ersten beiden Vierteln des 19. Jahrhunderts in Südrussland ansiedelten2. 3. Die Ausbreitung der „Brüderversammlungen“ als einer Form erwecklicher Frömmigkeit in den traditionellen Siedlungsgebieten der Russlanddeutschen im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts3. 4. Der zu allen Zeiten eklatante Pfarrermangel in den deutschen Kolonien in Russland4 und die daraus resultierende Situation, dass die sonntägliche Predigt in den allermeisten Gemeinden eine Lesepredigt war, die ein Küster/ Lehrer vortrug5. 1 Wilhelm Kahle, Wege und Gestalt evangelisch-lutherischen Kirchentums vom Moskauer Reich bis zur Gegenwart, Erlangen 2002, 87: „ohne den Einfluß der Brüdergemeine hätte auf keinen Fall die gemeindliche Existenz der von ihrer Heimat aufgegebenen Evangelischen gehalten werden können. Wichtig ist aber vor allem auch gewesen, daß sich die Tätigkeit der Brüdergemeine nicht auf eine bloß einmalige Vermittlung beschränkte, vielmehr blieben die vermittelten Pfarrer mit dem Gesamtwerk der Brüdergemeine in ständiger Verbindung; sie empfingen von dort Anregungen und praktische Hilfen. Diese Hilfen wurden noch vermehrt durch wandernde Laienhelfer (zuerst 1777), die in den Gemeinden kleinere Gemeinschaften sammelten. Diese waren im Geist des Herrnhutischen Pietismus tätig.“ 2 Zusammengefasst bei Gerd Stricker, Die lutherische „Brüderbewegung“ in Russland als Echo des europäischen Pietismus, in: Forschungen zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen 9 (1999), 35–59, hier 38–39. 3 Beschrieben bei George J. Eisenach, Das religiöse Leben unter den Rußlanddeutschen in Rußland und Amerika, Nachdruck der Ausgabe von 1950, Groß Oesingen o.J., 72–92. 4 Gerd Stricker (Hg.), Rußland. Deutsche Geschichte im Osten Europas, Berlin 1997, 339: „Der Pfarrermangel kennzeichnete die Lage in den Kolonistendörfern bis zum Ersten Weltkrieg und erst recht in der Sowjetzeit“. 5 Gerd Stricker, Russland (Anm. 4), 340: „In dieser pastoralen Notlage … bildete sich ein besonderer Typus des Dorfschullehrers heraus – der des ‚Küsterlehrers‘, auch ‚Schulmeister‘ oder ‚Kantor‘ genannt. Er setzte sich in allen rußlanddeutschen Siedlungsgebieten durch. Der Küsterlehrer hielt nicht nur den Schulunterricht, sondern er hatte darüber hinaus in den zahlreichen Filialdörfern, wo es keine intensive pastorale Versorgung geben konnte, den Pfarrer zu vertreten. In Abwesenheit des Pastors leitetet der Lehrer den Gottesdienst, wo bei er allerdings keine eigene Predigt halten durfte, sondern Lesepredigten aus beliebten Predigtsammlungen vortrug.“ Zur Rolle der Küster/Lehrer im Miteinander und Gegenüber zu den Pastoren vgl. Ralph Hennings, In der Christusnachfolge: Evangelische Pastoren und Lehrer in Russland während des 19. Jahrhunderts, in: Vision und Verantwortung (FS Ilse MesebergHaubold), hg. v. B. Konz / U. Link-Wieczorek, Münster 2004, 216–235 (wiederabgedruckt in diesem Band, s. o.).
Die prägende Kraft der Predigtbücher für die Frömmigkeit der Russlanddeutschen
225
Auf welche Weise allerdings die Lesepredigten die Frömmigkeit der Russlanddeutschen beeinflusst haben, wurde bisher nicht beachtet. Die Frage, ob es nicht einen Zusammenhang von dem über Generationen hinweg Gehörten und den besonderen Ausprägungen der Frömmigkeit der Russlanddeutschen geben könnte, wurde bisher nicht gestellt. Dieser Frage widmet sich die vorliegende Untersuchung. Es soll gezeigt werden, dass der Inhalt der Lesepredigten einen wesentlichen Anteil an der tiefgreifenden Prägung der spezifisch russlanddeutschen Frömmigkeit hat. Dabei spielen die innerevangelischen Konfessionsgrenzen nur eine geringe Rolle. Die gemeinsame Wurzel im Pietismus und der Erweckungsbewegung sorgt dafür, dass viele Erscheinungsformen der russlanddeutschen Frömmigkeit sich ebenso in Freikirchen wie in lutherischen und reformierten Gemeinden finden.
Die prägende Kraft von Erbauungsliteratur Es gibt bis heute nur wenige Gesamtdarstellungen zur Rezeption religiöser Literatur in der Neuzeit. Die vorliegenden Arbeiten zur Geschichte der Erbauungsliteratur in Deutschland stammen vor allem aus dem ausgehenden 19. Jahrhundert6. Eine spezielle Geschichte der Rezeption von Postillen oder Predigtbüchern gibt es bis heute nicht einmal in Ansätzen. Die methodische Schwierigkeit liegt darin, dass bei weitem nicht alle Leser wiederum selbst zur Feder greifen, um über das Gelesene zu berichten. Dabei ist grundsätzlich unbestritten, dass die Postillen zusammen mit den Andachtsbüchern eine der wesentlichen Quellen der lang andauernden Prägungen evangelischer Frömmigkeit sind. Die Untersuchung widmet sich also der Mentalitätsgeschichte der Russlanddeutschen7. Die dabei untersuchten Phänomene verändern sich nur langfristig (longue durée), haben aber deutliche Auswirkungen auf das Verhalten der untersuchten Bevölkerungsgruppe. Um zu verwertbaren Belegen für die langfristig prägende Wirkung der Predigtbücher zu kommen, müssen vor allem indirekte Zeugnisse untersucht werden. Diese Zusammenhänge beschreibt Hermann Beck, in der Diktion des 19. Jahrhunderts: Wer da weiß, in welchem Maße die Gemeinden für die Privaterbauung nächst der heiligen Schrift, so auch freilich in ungebührlicher Weise – vor der heiligen Schrift der 6 Zum Beispiel: Hermann Beck, Die Erbauungsliteratur der evangelischen Kirche Deutschlands von Dr. M. Luther bis Martin Moller, Erlangen 1883 und Constantin Große, Die alten Tröster. Ein Wegweiser in die Erbauungsliteratur der evang.-luth. Kirche des 16. bis 18. Jahrhunderts, Hermannsburg 1900. 7 Ulrich Köpf, Mentalitätsgeschichte, in: RGG4 5 (2002), 1102–1103. Zur Methodologie vgl. auch: Sven Grosse, Zum Verhältnis von Mentalitäts- und Theologiegeschichtsschreibung, in: ZKG 105 (1994), 178–190.
226
Die prägende Kraft der Predigtbücher für die Frömmigkeit der Russlanddeutschen
Erbauungsbücher sich bedienen, wie dieselben als eisernes Inventar des Hauses von Geschlecht zu Geschlecht sich forterbend zugleich ein Stück Familien- und geistliche Tradition repräsentieren, wird uns beipflichten, wenn wir von solch naher Beziehung der Erbauungsliteratur zu dem geistlichen Leben unseres Volkes sprechen. Es steht wohl nicht vereinzelt da, was jener Pfarrer berichtet, daß eines seiner Gemeindeglieder, ein Landmann, erklärte, er vergleiche die Reden der Prediger immer mit den alten Büchern, die er zu Hause habe. Arnds wahres Christentum und Scrivers Seelenschatz, und wenn die Lehre, die er in der Kirche höre, mit diesen Bücher stimme, dann sei sie gut. So werden für den schlichten Christen diese Schriften zu einer Art geistlicher Autorität, zu einem Maßstab, welchen er an Glaubensgehalt und Schriftmäßigkeit der Predigt legt8.
Zum Ausweis der prägenden Wirkung von Predigtsammlungen dienen vor allem Zeugnisse von Dritten, die über die Lektüre bestimmter Schriften berichten. Ihre langandauernde Kraft erweist sich auch darin, dass die von Beck im Jahre 1883 beschriebenen Verhaltensweisen heute noch unter Russlanddeutschen üblich sind. In der privaten Andacht lesen viele die Predigten von Carl Blum, Brastberger oder anderen. Denn ähnlich wie in Becks Beispiel von dem Landmann, der die Predigt seines Pastors an den Büchern misst, die er zu Hause hat, messen viele der Russlanddeutschen die gegenwärtigen Predigten an ihren alten Predigtbüchern, die sie zu Hause haben. Dieses Verhalten, das so deutlich vom üblichen Verhalten der übrigen evangelischen Gemeindeglieder am Beginn des 21. Jahrhunderts abweicht, ist ein deutlicher Beleg für einen „Mentalitätsunterschied“ – zumindest zum Teil hervorgerufen durch die prägende Wirkung der jahrhundertelangen Lektüre von Predigtsammlungen in der besonderen Situation der Deutschen in Russland.
Predigtbücher im Protestantismus Russlands Im Protestantismus sind Predigtsammlungen, die eine fortlaufende Lektüre durch das Kirchenjahr erlauben, seit Luthers Kirchenpostille (1527) weit verbreitet. Luthers Predigtsammlung war „als Hilfsmittel für theologisch ungenügend vorgebildete Prediger, aber auch zum Vorlesen in der Familie“9 gedacht. Die Gattung der Postillen war bis zum Ende der altprotestantischen Orthodoxie in regem Gebrauch. Im Pietismus entstanden weniger neue Predigtsammlungen, denn jetzt traten zu 8 Beck, Erbauungsliteratur (Anm. 1), 5. 9 Alfred Niebergall, Die Geschichte der christlichen Predigt, in: Leiturgia 2 (1955), 181–352, hier 271. Mit Nachweisen auch bei Lutz Friedrichs, Postille, in: RGG4 6 (2003), 1514. Zur strukturellen Ähnlichkeit der Rezeptionsbedingungen von Predigtsammlungen im Katholizismus vgl. Franz M. Eybl, Gebrauchsfunktionen barocker Predigtliteratur. Studien zur katholischen Predigtsammlung am Beispiel lateinischer und deutscher Übersetzungen des Pierre de Besse (Wiener Arbeiten zur deutschen Literatur 10), Wien 1982.
Die prägende Kraft der Predigtbücher für die Frömmigkeit der Russlanddeutschen
227
diesen herkömmlichen Frömmigkeitsformen die „Collegia Pietatis“ hinzu, gemeinschaftliche Erbauungsstunden, die auf die Intensivierung der persönlichen Frömmigkeit zielten. Sie fanden zwar meist ohne Verwendung von „vorformulierten“ Predigten und Gebeten statt, zugleich erlebten aber Andachtsbücher eine neue Blüte10. Die Erweckungsbewegung führte schließlich zu einem neuen Aufschwung der Predigtsammlungen, die auch in der „Stund“, der typischen Erbauungsversammlung der schwäbischen Erweckung, Verwendung fanden. Über die private Lektüre hinaus, eröffnen Predigtsammlungen die Möglichkeit, einen Gottesdienst ohne Pastor zu feiern. Das ist in den evangelischen Territorien Deutschlands eher selten geschehen. Nur einige kleine Siedlungen, die keinen eigenen Prediger hatten, haben davon Gebrauch gemacht, und haben ihren Gottesdienst mit dem Verlesen einer gedruckten Predigt durch den Küster gefeiert11. Anders war die Situation in den deutschen Kolonien in Russland, in denen es chronisch zu wenige Pastoren gab. Hier war die Verlesung einer Predigt aus einer gedruckten Predigtsammlung der gottesdienstliche Normalfall. Die Gemeindechronik der 1823 lutherischen Gemeinde Grunau in Südrussland gibt eine lebhafte Schilderung dieses Zustandes in der Gründungsphase einer deutschen Siedlung: Waehrend dieser ganzen Zeit, vom Jahre 1823. bis zum Schlusse des 1825sten Jahres, hatte die Gemeine noch keinen eigenen Prediger; daher sich jede Dorfs-Gemeine, durch Gesang und Vorlesen von Predigten, in ihren Haeusern selbst erbaut12.
Bei der weiteren Konsolidierung einer deutschen Kolonie in Russland entstand dann regelmäßig der Wunsch nach einem eigenen Gebäude für den Gottesdienst. Ein eigener Pastor war meist außerhalb der Möglichkeiten, sowohl der Gemeinde als auch der Kirchenleitung. Es gab dafür weder genügend Kandidaten noch Finanzmittel, um solch abgelegene Pfarrstellen attraktiv zu machen. Aber ein Schulund Bethaus baute fast jede deutsche Siedlung in Russland früher oder später, wie hier ebenfalls am Beispiel einer südrussischen Gemeinde gezeigt werden soll: Die Gemeinde zu Jekaterinoslaw bemühte sich schon seit 1846 zum Besitz eines eigenen Bethauses zu gelangen, in welchem von dem im benachbarten Josephsthal wohnenden
10 Vgl. Alfred Niebergall, Predigt 1. Geschichte der Predigt, in: RGG3 5 (1961), 516–530, hier 523. 11 Karl Nicol, Das Küsteramt in der evangelischen Kirche, Erlangen 1954, 2. Aufl., 8: „In Filialorten hatte dieser außerdem den Pfarrer durch Abhaltung von Lesegottesdiensten zu vertreten; er übte das Lektorenamt aus“ Hervorhebung im Original. 12 Chronik der Evangelisch-Lutherischen Kirche und Gemeinde Grunau, im Jekatharinoslawschen Gouvernement und Alexandrowskischen Kreise. Angefertigt im Anfange des Jahres 1835 (wohl von Pastor Christian Eduard Holtfreter verfasst), abgedruckt in: Jakob Stach (Bearb.), Grunau und die Mariupoler Kolonien. Materialien zur Geschichte deutscher Siedlungen im Schwarzmeergebiet (Sammlung Georg Leibbrandt 7. Quellen und Materialien zur Erforschung des Deutschtums in Osteuropa), Leipzig 1942, 10.
228
Die prägende Kraft der Predigtbücher für die Frömmigkeit der Russlanddeutschen
Prediger öfter Gottesdienst gehalten und in Abwesenheit des Pastors von einem anzustellenden Schullehrer regelmäßig Sonntags eine Predigt vorgelesen werden sollte13.
Das Ziel der Gemeinde in Jekaterinoslaw beschreibt die gottesdienstliche Normalsituation der Deutschen Dörfer in Russland. Neben der gottesdienstlichen Verwendung wurden aber auch in Russland Predigtsammlungen und andere erbauliche Schriften weiterhin zur häuslichen und persönlichen Andacht benutzt. Damit zeigt sich, dass die Bedeutung dieser Literatur für die Prägung, den Erhalt und die Weitergabe einer spezifischen Frömmigkeit, die insgesamt pietistisch und erwecklich geprägt ist, unter den Deutschen in Russland auf Grund ihrer besonderen Situation ungleich höher ist als in Deutschland.
Welche Predigtbücher wirkten prägend in Russland? Es hätte durchaus sein können, dass sich unter den Deutschen in Russland eine Art religiösen Wildwuchses ausbreitete. Denn bis zum Jahre 1832 gab es keine evangelische Kirchenorganisation für die deutschen Kolonien in Russland. Die einzelnen Dörfer an der Wolga oder in Südrussland konnten in religiöser Hinsicht tun und lassen, was sie wollten14, solange sie nicht mit der russisch-orthodoxen Kirche in Konflikt gerieten. Das war 1763 eine der zentralen Zusicherungen im Manifest Katharinas der Großen gewesen. Die Kolonisten nutzen diese Freiheit im Prozess der Ansiedlung. Die Anlage der Siedlungen in Russland erfolgte nicht nach landsmannschaftlichen Prinzipien, sondern überwiegend unter konfessionellen Gesichtspunkten15. Im Ergebnis spiegelt sich dann die konfessionelle Lage der Herkunftsgebiete in Deutschland: Es gab überwiegend lutherische Siedlungen, ein knappes viertel katholische Dörfer und einige reformierte Ansiedlungen16. In den Siedlungen wurde meist sehr schnell der Wunsch nach einer Schule verwirklicht, der zugleich eine religiöse Grundversorgung sicherstellte, denn dort wurde am Sonntag Gottesdienst gefeiert und eine Predigt aus einer Predigtsammlung vorgelesen. Aber welche Predigtsammlungen wurden dazu benutzt? Von der Mitte des 18. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts liegen darüber keine verwertbaren Nachrichten vor. Erst dann geben Protokolle von Visitationsreisen 13 E.H. Busch, Ergänzungen der Materialien zur Geschichte und Statistik des Kirchen- und Schulwesens der Ev.-Luth. Gemeinden in Rußland. Im Auftrage des Central-Comités der Unterstützungs-Kasse für Ev.-Luth. Gemeinden in Rußland, 1. Bd., Der St. Petersburgische, der Moskausche und der Kurländische Consistorialbezirk, St. Petersburg / Leipzig 1867, 245. 14 Das Manifest Katharinas sichert den Siedlern „freie Ausübung der Religion nach ihren Satzungen und Gebräuchen“ zu, Zitat bei Gerd Stricker, Russland (Anm. 4), 51. 15 Vgl. Wilhelm Kahle, Wege und Gestalt (Anm. 1), 218. 16 Vgl. Gerd Stricker, Rußland (Anm. 4), 361.
Die prägende Kraft der Predigtbücher für die Frömmigkeit der Russlanddeutschen
229
und Kreissynoden sowie Berichte von Pastoren breiträumig Auskunft über die in Benutzung befindlichen Predigtbücher. Dabei stellt sich heraus, dass nicht etwa ein bunter Strauß unterschiedlichster Predigtbücher in den Siedlungen der Kolonisten vorgefunden wurde, sondern ein ziemlich einheitlicher Bestand. 1862 beschreibt Pastor Friedrich Dsirne (1835–1872)17 diesen Zustand für das Wolgagebiet: Die gebräuchlichsten Predigtbücher sind zunächst der alte Brastberger, ferner Hofacker, Kapff, hie und da auch Ahlfeld und Huhn.18
„Der alte Brastberger“ bildete den Grundbestand der Predigtbücher an der Wolga19 und ebenso auch in Südrussland. Sehr anschaulich schilderte das 1861 ein Bericht von Bischof Carl Christian Ullmann (1793–1871) aus St. Petersburg. Er schrieb über seine Visitationsreise in Südrussland. Er besuchte er die Kolonie Naslawtscha, die bis dato der Kirchenleitung völlig unbekannt war und fand im Schul- und Betzimmer der Gemeinde folgendes vor: Zwei Reihen Bänke, an der einen schmalen Wand eine Erhöhung mit gedecktem Tisch; auf demselben ein schwarzes Kreuz ohne Crucifix, zwei Leuchter mit groben gelben Wachslichten, Brastberger’s Predigten, nebst einem alten Predigtbuch ohne Titel, das praktische Handbuch der christlichen Lehre und Luther’s Katechismus.
Bei seiner Abreise wurde der Generalsuperintendent von der Gemeinde um neue Bücher gebeten. Exemplarisch lässt sich daran der Übergang vom „alten Brastberger“ zum nächsten prägenden Predigtbuch zeigen. Bischof Ullmann berichtete: Wegen Mangel an Kirchen- und Schulbüchern wurde ich gebeten, der Gemeinde zu besorgen: 8 Bibeln, 24 Gesangbücher, 10 Gebetbücher, 1 Exemplar Hofackers Predigten, 20 Katechismen und 20 ABCbücher20.
17 Angaben zu den Pastoren in Russland folgen Erik Amburger, Die Pastoren der evangelischen Kirchen Russlands vom Ende des 16. Jahrhunderts bis 1937, Lüneburg / Erlangen 1998. 18 Materialien zur Geschichte und Statistik des Kirchen- und Schulwesens der Ev.-Luth. Gemeinden in Rußland, im Auftrage des Central-Comités der Unterstützungs-Kasse für Ev.Luth. Gemeinden in Rußland, gesammelt und herausgegeben von E.H. Busch, St. Petersburg 1862, 313. 19 Das zeigen weitere Nachrichten aus der gleichen Zeit über den Bestand an Predigtbüchern im Wolgagebiet. Dabei bilden die „Bergseite“ (die westliche Seite) und die „Wiesenseite“ (die östliche Seite) jeweils einen Kirchenkreis. Aus beiden gibt es Belege für den Bestand an Predigtbüchern. Für die Bergseite wird 1871 berichtet: „Unter den Postillen, durch die Küsterschulmeister verlesen, kommen am häufigsten vor: Brastberger, Ludwig Hofacker, Gerok – und dann die Berkholz’sche Sammlung, Huhn, Ludwig Harms, Brandt, auch Löhe etc.“ in: Mitteilungen und Nachrichten für die evangelische Kirche in Rußland 28 = N. F. 5 (1872), 465. Für die Wiesenseite wird 1872 berichtet: „Die gewöhnlichsten, hier im Gebrauch befindlichen Postillen sind: die alte bewährte von Brastberger und die neueren von Hofacker, Gerock, Harms, Kapf (sic!), Brand, Goßner, Huhn und Müller“, in: Kirchliche Statistik der Trans-Wolga-Präpositur 1872 (Wiesenseite), in: Mitteilungen und Nachrichten für die evangelische Kirche in Rußland 30 = N. F. 7(1874), 236. 20 St. Petersburgisches Sonntagsblatt 4 (1861), 10.
230
Die prägende Kraft der Predigtbücher für die Frömmigkeit der Russlanddeutschen
Das eine Exemplar von Hofackers Predigten war nicht für den privaten Gebrauch bestimmt, sondern zum Vorlesen im sonntäglichen Gottesdienst. Die Gemeinde in Naslawtscha konnte also ab 1861 sonntäglich einen weiteren Jahreszyklus im Wechsel mit Brastbergers bekannten Predigten hören. In manchen Gemeinden wurden der „alte Brastberger“ und Hofacker neben einander gebraucht21, in manchen Gebieten setzt sich aber auch das Predigtbuch von Ludwig Hofacker als Standard durch, wie es sich für Bessarabien im Jahre 1862 zeigen lässt: Indeß wird der Gottesdienst sonn- und festtäglich in den Colonien, wo der Prediger nicht anwesend ist, vom Schullehrer nach einer besonderen Instruction versehen, wobei vorzugsweise das Predigtbuch von Hofacker gebraucht wird22.
Das galt zunächst für den Bereich der lutherischen Gemeinden, über die wir am meisten Informationen haben. Bei manchen Berichten über die Lage der Gemeinden in den Kolonien Russlands finden sich aber auch Hinweise auf freikirchliche Gemeinden: So wurde in einem polemisch gefärbten Bericht „Ueber die Secte der Hüpfer in den Colonien Süd-Rußlands“ nebenbei auch ein unpolemischer Blick auf die Mennoniten geworfen und mit Abscheu berichtet, dass Angehörige der „Hüpfer“ „Erbauungsbücher, welche von frommen Mennoniten gelesen werden, wie z. B. Joh. Arndts Wahres Christentum, Hofackers Predigten und Starcks Handbuch, öffentlich verbrannten“23. Hierin zeigt sich der in der Forschung immer wieder betonte überkonfessionelle Charakter der Erbauungsliteratur, zu der bei den Deutschen in Russland unbedingt die Predigtbücher gehören. Für das ausgehende 19. und beginnende 20. Jahrhundert lässt sich nun noch ein drittes Predigtbuch aufführen, dass die Reihe vom „alten Brastberger“ über Ludwig Hofacker weiter zu einem russlanddeutschen „Eigenprodukt“ führt. Das dritte massenhaft unter den Russlanddeutschen verbreitete Predigtbuch sind die Evangelienpredigten von Carl Blum, die 1884 unter dem Titel „Gnade um Gnade“ veröffentlicht wurden. Auch diese Predigtsammlung wurde nicht nur für die häusliche Andacht verwendet, sondern sehr schnell für die Lesepredigt im den öffentlichen Gottesdienst gebraucht. Das bezeugt Karl Cramer, der in Erinnerung
21 Wilhelm Kahle, Wege und Gestalt (Anm. 1), 223. 22 Materialien zur Geschichte und Statistik des Kirchen- und Schulwesens der Ev.-Luth. Gemeinden in Rußland, im Auftrage des Central-Comités der Unterstützungs-Kasse für Ev.Luth. Gemeinden in Rußland, gesammelt und herausgegeben von E.H. Busch, St. Petersburg 1862, 155. 23 E. H. Busch, Ergänzungen der Materialien zur Geschichte und Statistik des Kirchen- und Schulwesens der Ev. – Luth. Gemeinden in Rußland. Im Auftrage des Central-Comités der Unterstützungs-Kasse für Ev. – Luth. Gemeinden in Rußland, 1. Bd., Der St. Petersburgische, der Moskausche und der Kurländische Consistorialbezirk, St. Petersburg / Leipzig 1867, 258.
Die prägende Kraft der Predigtbücher für die Frömmigkeit der Russlanddeutschen
231
an seine Zeit von 1907–1909 als Pastor in Paulskoi24, in der Nähe von Katharinenstadt an der Wolga schreibt: In den vier Gemeinden (des Kirchspiels) wurde der Gottesdienst abwechselnd vom Pastor gehalten, in den drei anderen zugleich vom jeweiligen Schulmeister. Dieser verlas meist Predigten, die ein Wolgapastor namens Blum in schlichter Art geschrieben hatte25.
Damit sind die drei Predigtbücher zusammengestellt, die das religiöse Leben der Deutschen in Russland von 1763 bis zum Ende des zwanzigsten Jahrhunderts entscheidend mitgeprägt haben. Denn nach der Zerschlagung der Kirchenorganisation durch die Kommunisten in den zwanziger Jahren, nahmen die vertriebenen Deutschen ihre Predigtbücher mit. Sie gehörten zum kostbaren Bestand der geretteten christlichen Literatur und erfüllten selbst in der brutalen Unterdrückung in Sibirien und Mittelasien wieder ihre Funktion als Lesepredigt im sonntäglichen Gottesdienst. Ihre Theologie und ihre Rhetorik prägten in der Situation des völligen Pfarrermangels weiterhin die Predigten der „Brüder“ und sorgten so dafür, dass die typische Prägung der Frömmigkeit der Russlanddeutschen immer weiter vertieft wurde26.
Ein prägendes Trio: Brastberger, Hofacker, Blum Diese drei Predigtsammlungen sind – über den gesamten Zeitraum der deutschen Siedlung in Russland betrachtet – in besonderer Weise prägend gewesen. Sie lassen sich jeweils einer Epoche der Theologiegeschichte, bzw. ihrer Adaption an russlanddeutsche Verhältnisse, zuweisen.
Gottlob Immanuel Brastberger Für die Zeit des Pietismus steht Gottlob Immanuel Brastberger (10. 4. 1718 Sulz am Neckar – 13. 7. 1764 Nürtingen) mit seiner 1758 erschienen Sammlung von Evangelienpredigten „Evangelische Zeugnisse der Wahrheit zur Aufmunterung im wahren Christentum“. Brastbergers Predigten waren fünf Jahre gedruckt, als 24 Paulskoi wurde 1907 als Kirchspiel bei der Reorganisation von Katharinenstadt neu gebildet, vgl. Amburger (Anm. 17), 146 und zu Karl Cramer 287. 25 Karl Cramer, Das kirchliche Leben an der Wolga, in Joseph Schnurr (Bearb.) Die Kirchen und das religiöse Leben der Russlanddeutschen. Evangelischer Teil, Stuttgart 2. Aufl. 1978, 251. 26 Die einzige monographische Darstellung der Entstehung und das Leben der russlanddeutschen „Brüdergemeinden“, geht nicht auf die Langzeitwirkung der Predigtbücher ein; George J. Eisenach, Das religiöse Leben (Anm. 3), Er erwähnt allerdings unter den Erbauungsschriften, die von den „Brüdern“ gelesen wurden, auch Brastbergers und Hofackers Predigten, a. a. O., 88.
232
Die prägende Kraft der Predigtbücher für die Frömmigkeit der Russlanddeutschen
Katharina die Große ihr berühmtes Anwerbemanifest veröffentlichte. Seit 1763 machten sich Deutsche als Siedler auf den Weg nach Osten. Mit sich im Gepäck führten sie Brastbergers Predigten. Obwohl Brastberger gemeinhin nicht zu den bedeutenden Vertretern des Pietismus gezählt wird, hatten seine Predigtbände, allen voran die „Evangelischen Zeugnisse der Wahrheit“ einen unglaublichen publizistischen Erfolg. „Die ‚evangelischen Zeugnisse‘ erlebten mindestens 91 Auflagen und wurden im württembergischen Pietismus noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts als Erbauungsbuch benutzt“27, daneben gab es eine polnische und eine englische Übersetzung, die erst am Ende des 19., resp. Anfang des 20. Jahrhunderts auf den Markt kamen28 und damit von der ungebrochenen Beliebtheit dieses Buches zeugen. Martin Brecht charakterisiert die „Evangelischen Zeugnisse“ so: Innerhalb der Postillenliteratur fällt dieses Predigtbuch durch seine Schlichtheit und Schmucklosigkeit auf. Es kommt ohne Beispielgeschichten mit der einfachen Applikation des Textes aus. Man würde es schwerlich der großen Predigtliteratur zurechnen. Aber bis zum Ende des 19. Jahrhunderts sind 85 Auflagen bekannt, obwohl der Verfasser kein berühmter Mann war. Die Protestanten in Österreich und Südrussland zehrten davon. Brastberger muss den richtigen Ton getroffen haben29.
Der richtige Ton, den Brastberger getroffen hat, beinhaltet den Ruf zur Umkehr und zur Heiligung. Ein Christsein, dass sich allein auf das Getauftsein verlässt, ist ihm nicht genug: Als Beispiel sei hier seine Pfingstpredigt angeführt, in der er über die Wirkung der Salbung mit dem heiligen Geist predigt und damit seine Gemeinde wachrüttelt: Ihr müsset einsehen lernen, daß ihr dies hohe Gut von Natur nicht habt; ihr müsset einsehen lernen, daß ihr das, was ihr davon in der Taufe empfangen, wieder verschüttet habt, und daß ihr durch den Dienst der Sünde und des Satans in den allerelendesten Zustand geraten seyd. Das wird euch der Geist des Herrn aufdecken; Er wird euch 27 Martin H. Jung, Immanuel Gottlob Brastberger, in: RGG4 1 (1998), 1737. 28 Gottfried Mälzer, Die Werke der Württembergischen Pietisten des 17. und 18 Jahrhunderts. Verzeichnis der bis 1968 erschienen Literatur (BGP 1) Berlin u. a. 1972, 72–77. Ins Polnische übersetzt wurde Brastbergers Predigtbuch von O. Gerss, erschienen in Szillen (Ostpreußen) 1904. Eine englische Ausgabe erschien 1912 im St. Louis Concordia Publishing House, neu revidiert von W.H.T. Dau. 29 Martin Brecht, Der württembergische Pietismus, in: Ders. (Hg.), Geschichte des Pietismus Bd. 2, Göttingen 1995, 266. Das belegt auch eine ältere Darstellung des württembergischen Pietismus: W. Claus, Von Bastberger bis Hofacker. Bilder aus dem christlichen Leben Württembergs (Württembergische Väter 2), Calw u. a. 1888, 5: „Es wird unter den Zeugen der Wahrheit, welche Gott im vorigen Jahrhundert unserem württembergischen Vaterland schenkte, kaum einen geben, der unter dem Volk in so weiten Kreisen, und zwar nicht nur in den eigentlich gläubigen Kreisen, solchen Eingang gefunden und solche Frucht gebracht hat bis in unsere Tage, wie Immanuel Gottlob Brastberger, dessen Evangelien-Predigtbuch seit mehr als 100 Jahren in tausenden von Familien Jahr aus Jahr die sonntägliche Nahrung und Erbauung dargeboten hat“.
Die prägende Kraft der Predigtbücher für die Frömmigkeit der Russlanddeutschen
233
überzeugen von der Sünde, von der Gerechtigkeit und von dem Gericht; Er wird euch versichern, daß ihr in einem solchen Zustand mit Unflath überzogen und mithin nicht im Stande seyd, das reine Angesicht Gottes zu sehen: Denn ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen30.
Wie Martin Brecht treffend schreibt, geht es Brastberger „nicht um ‚bloßes Hirnwissen‘ und um ‚kraftloses Bekenntnis des Namens Christi‘“. Er legt Wert darauf, dass seine Hörer „das Evangelium auch mit einem heiligen Wandel zieren“31. Diese Botschaft kam an – auch in den deutschen Kolonien des russischen Reiches. Einzelne Gemeinden werden sie über hundert Jahre lang gehört haben. Ebenso lange haben sie Brastbergers vernunftkritische Mahnung gehört, die er am 12. Sonntag nach Trinitatis in klassisch lutherischer Manier formuliert: Das einzige Mittel, selig zu werden, ist der wahre und lebendige Glaube, der das Wort annimmt, die in demselben gegebenen Verheißungen demütig ergreift und nicht zweifelt […] Dawider aber erhebt sich die stolze Vernunft. Diese will nichts glauben, als was sie sieht […] Sie erregt in dem Herzen des Menschen tausenderlei Zweifel, die ihn abhalten sollen, das für wahr anzunehmen, was der treue und wahrhaftige Gott in seinem Wort bezeugt hat32.
Wenn man die Tiefenwirkung der jahrelangen Repetition dieser Predigten bedenkt, nimmt es nicht Wunder, dass die deutschen Kolonien in Russland gegen den Einfluss des Rationalismus in der Kirche weitgehend immun blieben. Dagegen war die erweckliche Predigt eines Ludwig Hofacker ziemlich problemlos anschlussfähig. Die pietistische Frömmigkeit Brastbergers bereitete geradezu den Boden für eine Neuformulierung in der Predigt Ludwig Hofackers33.
Ludwig Hofacker Für die Zeit der Erweckungsbewegung steht Ludwig Hofackers 1833 postum veröffentlichte Sammlung „Predigten für alle Sonn-, Fest- und Feiertage“. Hofackers Predigtbuch war im deutschsprachigen Raum die meistverkaufte Pre30 Gottlob Immanuel Brastberger, Evangelische Zeugnisse der Wahrheit, Nachdruck, GroßOesingen 1994, 513. 31 Martin Brecht (Anm. 29), 266. 32 Brastberger (Anm. 30), 686. 33 Wilhelm Kahle, Erweckung im Protestantismus Ostmittel- und Osteuropas sowie der asiatischen Teile des Russischen Reiches, in: Kirche im Osten 37 (1994), 11–34, hier 22, verweist darauf, dass die ersten Siedler an der Wolga noch keine erwecklichen Einflüsse aus Deutschland mitgenommen hatten. Das wäre auch 1763 noch nicht möglich gewesen. Aber sie hatten ihren „Brastberger“ im Gepäck und haben ihn über Jahre hinweg gehört und gelesen. Der Einfluss der Brüdergemeinde, der von ihrer Siedlung in Sarepta ausging und die wolgadeutschen Siedler mit einem gelebten Pietismus in Berührung brachte, kommt zur Wirkung der Lesepredigt verstärkend hinzu.
234
Die prägende Kraft der Predigtbücher für die Frömmigkeit der Russlanddeutschen
digtsammlung überhaupt. Die schwäbischen Auswanderer nach Russland brachten das Buch bald nach seinem Erscheinen mit, aber auch über andere Kontakte, die zwischen den Kolonien und dem Reich bestanden, wurden Exemplare von Hofackers Predigten nach Russland gebracht. Die ev.-luth. Kirche in Russland war in der Mitte des 19. Jahrhunderts durch ihre Universität Dorpat bereits so sehr neulutherisch geprägt, dass auch die Pastoren in den Kolonien keinerlei Probleme mit der Verwendung von Hofackers Buch als Grundlage für die Lesepredigten der Küster/Lehrer hatten. Hofackers Predigt führt die Hauptthemen des lutherischen Pietismus weiter, spitzt sie aber noch mehr zu34. Die Themen Buße, Bekehrung, und Wiedergeburt nehmen eine noch zentralere Stellung ein als bei Brastberger: Liebe Zuhörer! Wer nicht verloren gehen und ein Sklave des Argen bleiben will, der muß ein anderer Mensch werden. Ein neues Leben, neue Ansichten, neue Triebe, neue Bilder, neue Wünsche, eine andere Liebe muß in unser Herz; wir müssen wieder geboren werden: sonst können wir das Reich Gottes nicht sehen!35
Kategorisch unterscheidet er nicht nur zwischen Christen und Nicht-Christen, sondern vor allem zwischen Wiedergeborenen (Christen) und Nicht-Wiedergeborenen (Christen): „Das sind zwei Klassen unter den Menschen; es gibt geborene, aber dabei wiedergeborene, – und geborene aber noch nicht wiedergeborene“36. Sein Feindbild ist dabei der „Zeitgeist“, durch den Gottes Zorn verharmlost, sein Gericht relativiert und die Menschen von der Bekehrung abgehalten werden: Es hat aber jede Zeit ihre eigenen Versuchungen, also auch die unsrige […] Der Hauptcharakter unsers Zeitgeistes in dieser Beziehung ist leichtsinniger und hochmüthiger Unglaube. Unsere Zeit ist weit vorwärts geschritten in der Ausbildung des Verstandes; man ist in vielen Dingen erstaunlich kluge geworden; aber in Absicht auf das Göttliche ist der Ausspruch Pauli in unserer Zeit wahr geworden: „da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden.“37
Zeuge der Wiedergeburt ist die innere Erfahrung. Damit wird ein zentraler Punkt des Glaubens in die Innerlichkeit des Glaubenden verlagert. Die Reformatoren und die altprotestantische Orthodoxie haben diesen Schritt noch nicht vollzogen. Der Pietismus und vor allem die Erweckungsbewegung erweisen sich hierin als 34 Zu Hofacker vgl. Hans-Martin Kirn, Ludwig Hofacker 1798–1828. Reformatorische Predigt und Erweckungsbewegung, Metzingen 1999. Zu einem Vergleich mit amerikanischer Erweckungspredigt vgl. Klaus vom Orde, Die erweckliche Predigt im 19. Jahrhundert, in: Zeitschrift für Theologie und Gemeinde 3 (1998), 278–293. 35 Ludwig Hofacker, Predigten für alle Sonn-, Fest- und Feiertage nebst einigen Buß- und Bettagspredigten und Grabreden, Stuttgart 1867, Ausgabe letzter Hand, 28. Auflage, Predigt am zweiten Sonntag nach dem Erscheinungsfest, 156. 36 Hofacker, Predigt am siebenten Sonntag nach Trinitatis (Anm. 35), 560. 37 Hofacker, Predigt am zweiten Sonntag nach dem Erscheinungsfest (Anm. 35), 157.
Die prägende Kraft der Predigtbücher für die Frömmigkeit der Russlanddeutschen
235
ihrer Zeit gemäß. Sie nehmen die stärkere Betonung des Inneren des Menschen durch Aufklärung und Romantik ernst und wenden sie ins Religiöse. Deshalb antwortet Hofacker auf die selbst gestellte Frage „Wie sollen und können wir alle diese Versuchungen überwinden?“: Sie haben überwunden durch des Lammes Blut, durch die Kraft des Blutes Christi. Diese Kraft muß das Herz erfahren haben, es muß davon durchgangen und durchdrungen worden seyn; es muß im Genusse des versöhnenden und heiligenden Blutes Christi stehen; es muß wissen, aus lebendiger Erfahrung wissen, was an dem Spruche ist: das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht uns rein von aller Sünde!38
Allerdings lässt sich im Herzen39 des Menschen und in seiner Erfahrung kein fester Grund für eine Glaubensgewissheit finden, wie sie sich mit der Theologie Luthers verbindet. Um sich seines Glaubens zu vergewissern, muss der Glaubende sich ständig selbst skrupulös erforschen und ängstlich nach „Früchten des Glaubens“ Ausschau halten, die ihm bestätigen, noch im Stand der Gnade zu sein. Jenseits der Individualität und der Innerlichkeit wird Hofacker von einer drängenden Gewissheit beflügelt, dass das Ende dieser Welt nahe ist. Deshalb seine Dringlichkeit und sein Insistieren auf Bekehrung und Wiedergeburt: Immer näher rückt das Ende dieses Kampfes, immer näher rückt das Verderben der Feinde und der herrliche Lohn der Überwinder. Hier gilt kein Neutralseyn; wer nicht ganz bei Jesu ist, der ist wider Ihn; bei dem Siege, bei dem Austheilen der Beute wirst du nicht neutral seyn wollen: so sey es auch nicht im Kampfe! Ich bitte dich im Namen des Herrn: nimm dich zusammen, flehe Ihn an, daß Er dich nicht verloren gehen lasse, gib dich Ihm kindlich und lauter hin zum Eigenthum, und glaube, daß Er dem Aufrichtigen den Sieg gelingen lassen wird!40
Dass die Predigten Hofackers über Jahrzehnte hinweg zur Standardpredigt in russlanddeutschen Gemeinden werden könnten, hätte er sich selbst sicher nicht träumen lassen. 1869 – zu einer Zeit als Hofackers Predigtbuch sich bereits in Russland durchzusetzen begann, urteilte Albert Brömel skeptisch über die mögliche Rezeption der Predigten Hofackers: „Ueber zwei Jahre wird man Hofackers Predigten nicht unbeschädigt lesen können“41. Dass man das doch konnte, zeigt sich in Hofackers großem publizistischen Erfolg und seiner weiten Verbreitung – bis in die deutschen Kolonien Russlands. Allerdings hatten seine Predigten eine bestimmte Wirkung. Die ausgeprägte Betonung der Wiedergeburt, der Heiligung 38 Hofacker, Predigt am zweiten Sonntag nach dem Erscheinungsfest (Anm. 35), 159. 39 Eckhard Hagedorn, Vom armen zum großen Herzen. Anmerkungen zu den Predigten Ludwig Hofackers, in: Frömmigkeit unter den Bedingungen der Neuzeit (FS Gustav Adolf Benrath), hg. v. R. Braun / W.-F. Schäufele, Darmstadt / Kassel 2001, 237–248. 40 Hofacker, Predigt am vierten Sonntag nach Trinitatis (Anm. 35), 535. 41 Albert Brömel, Homiletische Charakterbilder Bd. 1, Leipzig 1869, 157, zitiert bei Kirn (Anm. 34), 81.
236
Die prägende Kraft der Predigtbücher für die Frömmigkeit der Russlanddeutschen
und das Bewusstsein der nahenden Endzeit machen Hofackers Predigten zu einer aufrüttelnden Lektüre. Sie stellen den Hörer ständig in die existentielle Entscheidungssituation für oder gegen Christus. Als Dauerlektüre fordern sie zu einer Form des entschiedenen Christentums auf, wie es in einer volkskirchlichen Gemeinde nicht einfach zu leben ist. Damit sind Hofackers Predigten kompatibel zur „brüderlichen“ Frömmigkeit innerhalb der lutherischen Kirche in Russland. Die „Brüder“ nahmen für sich in Anspruch, passend zu Hofackers Predigten, eine bessere Gerechtigkeit zu verwirklichen als die anderen Gemeindeglieder. Die anderen Gemeindeglieder werden dabei oft als „Gewohnheits“- oder „Namenchristen“ verunglimpft. Die Brüderversammlungen bestehen aus „Wiedergeborenen“ oder zumindest „Bekehrten“ und behaupten, das auch in ihrer Lebensführung ausweisen zu können42. Deshalb gehören zu ihren verbreiteten Regeln bestimmte Verhaltensweisen wie der Verzicht auf Alkohol und Nikotin, ein Verbot von Theater, Kino und Fernsehen und bestimmte Kleidungsvorschriften, wie der Verzicht auf Krawatten bei Männern und das Tragen von langen Röcken und Kopftüchern bei Frauen43. Auch hierin unterscheiden sich freikirchliche und „kirchliche Brüder“ der Russlanddeutschen nicht voneinander.
Carl Blum Für die Adaption der Gattung Predigtbuch an die russlanddeutschen Verhältnisse steht die von Carl Blum 1884 veröffentlichte Sammlung von Evangelienpredigten „Gnade um Gnade“. Carl Blum war lange Jahre Pastor in verschiedenen deutschen Kolonien in Russland und hat die Früchte aus seiner Amtszeit in zwei Predigtbänden veröffentlicht, von denen vor allem das Buch mit den Evangelienpredigten zu einem russlanddeutschen Bestseller geworden ist. Im Westen und im auch in seiner baltischen Heimat hat man von Blum und seinen Büchern
42 Wilhelm Kahle, Wege und Gestalt (Anm. 1), 227–228: „Will man die vielfältigen und oft ungeordneten Folgen dieser Erweckungen zusammenfassen, so ergeben sich folgende Grundanliegen: In den Kreisen nicht nur der Separierten, sondern auch der anderen evangelischen Gemeinden wurde die Forderung der Wiedergeburt erhoben, als deren Voraussetzung die Abkehr von der Welt. Dem entsprach die Forderung nach der Heiligung und der Erhaltung des neuen Lebens… Die oft rigorose Strenge führte vielfach zu einer Reglementierung des gesamten Lebens. Fröhlichkeit und Spiel waren verpönt. Bei Hochzeitsfeiern beschränkte man sich aufs Notwendigste.“ 43 Wilhelm Kahle, Erweckung (Anm. 33): 18: „Das große Thema der Heiligung, einer neuen Lebensordnung hat vielfältige Antworten erfahren, wobei das Rauchen, der Alkoholgenuß, das Volkslied, die dörfliche Sitte, der Besuch von Schaustellungen und Theatern, die Kleidung von Männern und Frauen zum Gegenstand heftiger Auseinandersetzungen und unterschiedlicher Entscheidungen werden konnten“.
Die prägende Kraft der Predigtbücher für die Frömmigkeit der Russlanddeutschen
237
kaum Notiz genommen44. Aber unter den Russlanddeutschen wurde „der Blum“ zum meistgelesenen Predigtbuch des zwanzigsten Jahrhunderts. Schließlich wurde seine Predigtsammlung im Westen nachgedruckt und nach Russland geschmuggelt, sowie von den im Westen lebenden Russlanddeutschen gelesen. Insgesamt erweist sich Carl Blum als ein Schüler der theologischen Lehrer, die er an der Universität Dorpat kennen gelernt hat. Seine Predigten sind durch und durch vom heilsgeschichtlichen Denken der Erlanger Theologie geprägt45. Auch die für den Erlanger Theologen Johann Christian Konrad von Hofmann so typische Betonung des eigenen Glaubens als Ausgangspunkt aller Theologie hat ihre Entsprechung bei Carl Blum, sie zeigt sich im erwecklichen Impetus der Predigten. Blum richtet sich an vermeintlich müde gewordene Christen, die in einer volkskirchlichen Situation aufgewachsen und geprägt worden sind. Er versucht sie mit dem Ruf zur Buße und Bekehrung aufzurütteln. Die volkskirchliche Prägung seiner Predigthörer kann Blum positiv beurteilen, als Ruf Gottes, der in Taufe, Unterricht, Konfirmation, Trauung, Beichte und Abendmahl immer wieder an die Gemeindeglieder ergeht46 – er kann aber auch polemisch und aufrüttelnd von einem bloßen Namenchristentum sprechen47, das für das Heil irrelevant ist48. In kaum einer Predigt fehlt deshalb der Ruf zur Bekehrung. Die Zuhörer sollen ernst machen mit ihrem Christentum und ihre Herzen Christus öffnen. Das Gegensatzpaar „tot“ und „lebendig“ spielt für die Veranschaulichung dieser Botschaft eine große Rolle: Wie durch den lebendigen Christus neues Leben in die tote Welt ausgegangen ist, so kann neues Leben in die tote Christenheit nur dann ausgehen, wenn wir uns selbst durch ihn zu neuem Leben erwecken lassen. Denn tote Christen können nur durch lebendige Christen vom geistlichen Tod erweckt werden49.
44 Die erste biographische Studie zu Carl Blum stammt aus dem Jahr 2000; Ralph Hennings, Carl Blum – Prediger der Russlanddeutschen, in: Zeitschrift für Kirchengeschichte 111 (2000), 70– 90 (wiederabgedruckt in diesem Band). 45 Ralph Hennings, Carl Blum (Anm. 44), 75–79. 46 Carl Blum, Gnade um Gnade. Evangelienpredigten für das ganze Kirchenjahr, Nachdruck Kassel, 4. Aufl. 1993, 135. 47 Carl Blum, Christus unser Leben. Wolgadeutsche Predigten, Nachdruck Erlangen 31993, 375 und ebenda 35: „Denn dadurch allein, daß du in einem christlichen Kirchenbuch verzeichnet stehst, bist du noch kein Christ, sondern dann erst, wenn Christus durch den heiligen Geist in dir wohnt und du mit allem Ernst darnach trachtest, ebenso gesinnt zu sein, wie Christus gesinnt war“. 48 Carl Blum, Gnade um Gnade (Anm. 46), 413f., hier 414: „Mit dem äußeren Gottesdienst und einem ehrbaren Leben ist noch niemand selig geworden. Mehr, weit mehr verlangt der Herr. Er verlangt, wir sollen von neuem geboren, aus Gott geboren sein, wenn wir ins Himmelreich kommen wollen“. 49 Carl Blum, Gnade um Gnade (Anm. 46), 279.
238
Die prägende Kraft der Predigtbücher für die Frömmigkeit der Russlanddeutschen
Blum ist wie andere Prediger der Erweckungsbewegung von der Überzeugung durchdrungen, dass die Zeit der Gnade, in der Gott Umkehr zulässt, zu Ende geht. Daher ruft er mit großem Ernst dazu auf, das „Heute“ zu nutzen und die Gnadenzeit nicht verstreichen zu lassen. Seine Predigt ist wie alle erwecklichen Predigten anthropologisch orientiert. Ako Harbeck hat das bereits für Hofacker zutreffend beschrieben: „um den Menschen geht es, der Mensch wird ernstgenommen, angesprochen, umworben; sein Heil, seine Rettung, seine Erweckung oder Verstockung stehen auf dem Spiel“50. Die Ansprache an den Einzelnen ist in Blums Predigten immer wieder zu beobachten. Die Hörer sollen merken, dass es um ihre Sache, um ihr Heil geht. Dazu redet er die Gemeinde auch direkt an: „Wie steht’s denn mit dir, o Seele? Hast du diesen Tag [sc. der Bekehrung, R.H.] schon gehabt? Hast du dich von Herzen in Jesu Dienst begeben?“51 Der Ernst des Rufes zur Umkehr kommt aus der Gewissheit des Gerichtes. Nur die Bekehrung kann vor dem Zorn Gottes und seinem Gericht bewahren. Anderenfalls drohen die „ewige Verzweiflung“ oder andere Bilder, die Blum für die Hölle gebraucht. An manchen Stellen nähert sich Blum einer radikalen Betonung der Bekehrung als einzigem Weg zum Heil52. An anderen Stellen kann er die Taufe als Beginn des neuen Lebens in Gott anerkennen53. Er schärft aber seiner Gemeinde ein, sich nicht auf die Tatsache des Getauftseins zu verlassen: „Denn die Taufe ist kein Zaubermittel und wird uns nichts helfen, wenn wir nicht in der Taufgnade bleiben“54. Im Extremfall kann er sogar Taufe und Bekehrung als aufeinanderfolgende Stufen im Glauben verstehen: Viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Die Berufenen, – das sind die, die getauft sind, die Gottes Wort hören und zum Abendmahl gehen: die den äußeren Gottesdienst mitmachen. Die Auserwählten, – das sind die, die nicht nur den äußeren Gottesdienst mitmachen, sondern glauben an das Evangelium von Jesus Christus und durch ihn eine neue Kreatur geworden sind55.
Der Weg der Bekehrung ist der Weg, auf dem der Mensch sich seiner Sünde bewusst wird und unter der Sündenlast stöhnend sich Christus anvertraut, der sich den Zerschlagenen gnädig nähert. Die Gnade Gottes gilt einzig und allein 50 Hans-Jakob (Ako) Haarbeck, Erweckliche Predigt dargestellt an Ludwig Hofacker, Diss. theol. Göttingen 1958, 118f. 51 Carl Blum, Gnade um Gnade (Anm. 46) , 402. 52 Carl Blum, Christus unser Leben (Anm. 47), 359: „Die Sünde führt in den Tod hinein, die Bekehrung von der Sünde aber in’s Leben. Die Sünde führt an den Ort, wo Verzweiflung sein wird, die Bekehrung von der Sünde in den Himmel mit seiner unaussprechlichen Seligkeit und Herrlichkeit“. 53 Carl Blum, Christus unser Leben (Anm. 47), 179: „In der Taufe fängt die neue Geburt, das neue Leben aus Gott an, denn die Taufe ist das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung durch den Heiligen Geist“, vgl. auch 345. 54 Carl Blum, Christus unser Leben (Anm. 47), 351 und 179. 55 Carl Blum, Gnade um Gnade (Anm. 46), 140.
Die prägende Kraft der Predigtbücher für die Frömmigkeit der Russlanddeutschen
239
diesen zerknirschten Sündern, denn „wer sich nicht als Sünder vor Gott erkennt, der sucht auch nicht Gottes Gnade“56. Der nächste Schritt ist dann die Buße: „Es ist aber nicht genug, dass wir unsere Sünden erkennen; nicht genug, dass unser Herz geängstet und zerschlagen ist um unserer Sünden willen: der Herr verlangt, wir sollen Buße tun“57. Das Vertrauen zu Gottes Gnade soll der reuige Sünder nicht aus einem Gefühlsüberschwang, sondern aus Gottes Wort gewinnen58. Blum wird nicht müde, zu wiederholen, dass Gott die Sünden wegnehmen will – allein aus Gnaden. Hier zeigt er sich als eindeutiger Vertreter lutherischer Theologie. Die Beschränkung der Predigt auf den Ruf zur Bekehrung und damit auf die Soteriologie ist hingegen ein typisches Kennzeichen der Erweckungspredigt59, spezifische Inhalte der einzelnen Predigttexte treten darüber in den Hintergrund. In Carl Blums Epistelpredigten kommt zum Ruf zur Bekehrung noch der Anspruch der Heiligung dazu, mit dessen Hilfe die Konsequenzen von Buße und Bekehrung entfaltet werden.
Zusammenfassung Im Zusammenklang mit Brastberger und Hofacker erweist sich Carl Blum als ein Vollender des, von den beiden erstgenannten, eingeschlagenen Weges. Seine Predigten führen die Traditionslinien aus dem älteren Pietismus und der württembergischen Erweckung weiter und fügen sie in den Kontext der russlanddeutschen Lebenswelt ein. Sein Leben als Pastor in den deutschen Kolonien Russlands stattete ihn mit der notwendigen Kenntnis der Mentalität seiner Gemeinden aus. Er sprach zu lutherischen Christen, die zwar volkskirchlich geprägt waren, zugleich aber durch die Lesepredigten, die sie ein Leben lang gehört hatten, auch für erweckliche Töne offen waren – sie wahrscheinlich sogar erwarteten. Denn auch Carl Blums Predigten wurden auf dem Hintergrund der vorher gemachten Erfahrung mit den Lesepredigten – also überwiegend den Predigten Brastbergers und Hofackers – gehört und beurteilt. Seine erweckliche Predigt und die heilgeschichtliche Ausrichtung der durch das Studium vermittelten Erlanger Theologie, passten in den Erwartungshorizont seiner Hörer und Hörerinnen. Das begründet den Erfolg seiner Predigtbände in den russland56 Carl Blum, Gnade um Gnade (Anm. 46), 454. 57 Carl Blum, Gnade um Gnade (Anm. 46), 171. 58 Carl Blum, Christus unser Leben (Anm. 47), 136: „Du aber sollst diese Verheißung im Glauben in dein Herz fassen, und deinen Glauben nicht gründen auf deine Herzensgefühle und Empfindungen, sondern auf Gottes Wort und Zusage“. 59 Ako Harbeck, Erweckliche Predigt (Anm. 50), 124, stellt das auch bei den Predigten Hofackers fest und spricht von der „Beschränkung der Predigt Hofackers auf den christologisch-soteriologischen Bereich zu Lasten der spezifischen Textaussage“.
240
Die prägende Kraft der Predigtbücher für die Frömmigkeit der Russlanddeutschen
deutschen Kolonien bereits vor der kommunistischen Unterdrückung des Christentums. Zugleich bauten seine Predigten eine Brücke von der „Amtskirche“ zu den in dieser Zeit schon vorhandenen „Brüdergemeinden“, in denen eine Frömmigkeit gelebt wurde, die den Maßstäben der Blumschen, Hofackerschen und Brastbergerschen Predigten entsprach60. Die Entstehung der Brüderbewegung in den lutherischen Kirchen entspringt geradezu der Kluft zwischen einem kirchlichen Leben, in dem die sonntägliche Lesepredigt den Höhepunkt markiert und dem Inhalt der vorgelesenen Predigten, die ein ganz anderes Ideal vor Augen hatten. Das erlebten die Gemeinden oft über Generationen hinweg. Gerd Stricker beschreibt diese Kluft zwischen dem „offiziellen“ Gemeindeleben und den im Lauf des 19. Jahrhunderts entstandenen „Brüderversammlungen“ zutreffend61, allerdings ohne zu berücksichtigen, dass die Predigt, die der Küster/Lehrer vorgelesen hatte, im Grunde das forderte, was schließlich die „Brüderversammlungen“ als Laienbewegung verwirklichten. Die „Brüderversammlungen“ der lutherischen Russlanddeutschen sind nicht nur ein Echo des Pietismus und der Erweckungsbewegung, sondern auch eine Frucht der Lesepredigten. Diese brüdergemeindliche Tradition führte nach der Zerschlagung der evangelischen Kirchenstruktur in Russland zu einem neuen geistlichen Leben im Untergrund. So resümiert Hans-Christian Dietrich beim Blick auf die Unterdrückungsgeschichte der kommunistischen Zeit: Christliches Leben war nur noch im Verborgenen […] möglich. Hier bewährte sich die Tradition der Erweckungsbewegung. Es waren „Brüder“ und „Schwestern“ der Gemeinschaften, die nicht nur bereit, sondern auch fähig waren, kleine Gruppen zur Andacht zu sammeln. Dieser und jene hatten auch die Bücher dazu bei der Vertreibung mitnehmen können: die Bibel, das wolgadeutsche Gesangbuch, das wolgadeutsche Gemeinschaftsliederbuch, die Predigtbände von Carl Blum, Brastberger, Hofacker62.
Quellen Carl Blum, Gnade um Gnade. Evangelienpredigten für das ganze Kirchenjahr, Nachdruck, Kassel 41993. Ders., Christus unser Leben. Wolgadeutsche Predigten, Nachdruck, Erlangen 31993. 60 Zum Miteinander oder Nebeneinander von Pastoren und „Brüdern“ vgl. Wilhelm Kahle, Wege und Gestalt (Anm. 1), 228–234. 61 Gerd Stricker, Die lutherische „Brüderbewegung“ (Anm. 2), 40: „In vielen Kolonistendörfern war außer dem Lesegottesdienst des Schulmeisters am Sonntag von geistlichem Leben wenig zu spüren. Fromme Siedler jedoch, deren geistliche Bedürfnisse über dieses Minimalangebot hinausgingen, gaben sich damit nicht zufrieden… Aus der ‚Stunde‘ entwickelte sich mit der Zeit die ‚Brüderversammlung‘“. 62 Hans-Christian Dietrich, in: Das Gute behaltet. Kirchen und religiöse Gemeinschaften in der Sowjetunion und ihren Nachfolgestaaten, Erlangen 1996, 86.
Die prägende Kraft der Predigtbücher für die Frömmigkeit der Russlanddeutschen
241
Gottlob Immanuel Brastberger, Evangelische Zeugnisse der Wahrheit, Nachdruck, GroßOesingen 1994. E.H. Busch, Materialien zur Geschichte und Statistik des Kirchen- und Schulwesens der Ev.-Luth. Gemeinden in Rußland, im Auftrage des Central-Comités der Unterstützungs-Kasse für Ev.-Luth. Gemeinden in Rußland, St. Petersburg 1862. Ders., Ergänzungen der Materialien zur Geschichte und Statistik des Kirchen- und Schulwesens der Ev.-Luth. Gemeinden in Rußland. Im Auftrage des Central-Comités der Unterstützungs-Kasse für Ev.-Luth. Gemeinden in Rußland, 1. Bd., Der St. Petersburgische, der Moskausche und der Kurländische Consistorialbezirk, St. Petersburg / Leipzig 1867. Ludwig Hofacker, Predigten für alle Sonn-, Fest- und Feiertage nebst einigen Buß- und Bettagspredigten und Grabreden, Ausgabe letzter Hand, 28. Auflage, Stuttgart 1867. Mitteilungen und Nachrichten für die evangelische Kirche in Rußland (eingesehen wurde das Exemplar der Universitätsbibliothek Leipzig).
Literatur Erik Amburger, Die Pastoren der evangelischen Kirchen Russlands vom Ende des 16. Jahrhunderts bis 1937, Lüneburg / Erlangen 1998. Hermann Beck, Die Erbauungsliteratur der evangelischen Kirche Deutschlands von Dr. M. Luther bis Martin Moller, Erlangen 1883. Martin Brecht, (Hg.), Geschichte des Pietismus Bd. 2, Göttingen 1995. W. Claus, Von Bastberger bis Hofacker. Bilder aus dem christlichen Leben Württembergs (Württembergische Väter 2), Calw u. a. 1888. Hans-Christian Dietrich u. a. (Hg,), Das Gute behaltet. Kirchen und religiöse Gemeinschaften in der Sowjetunion und ihren Nachfolgestaaten, Erlangen 1996. George J. Eisenach, Das religiöse Leben unter den Rußlanddeutschen in Rußland und Amerika, Nachdruck der Ausgabe von 1950, Groß Oesingen o.J. Franz M. Eybl, Gebrauchsfunktionen barocker Predigtliteratur. Studien zur katholischen Predigtsammlung am Beispiel lateinischer und deutscher Übersetzungen des Pierre de Besse (Wiener Arbeiten zur deutschen Literatur 10), Wien 1982. Lutz Friedrichs, Postille, in: RGG4 6 (2003), 1514. Constantin Große, Die alten Tröster. Ein Wegweiser in die Erbauungsliteratur der evang.luth. Kirche des 16. bis 18. Jahrhunderts, Hermannsburg 1900. Sven Grosse, Zum Verhältnis von Mentalitäts- und Theologiegeschichtsschreibung, in: ZKG 105 (1994),178–190. Hans-Jakob (Ako) Haarbeck, Erweckliche Predigt dargestellt an Ludwig Hofacker, Diss. theol. Göttingen 1958. Eckhard Hagedorn, Vom armen zum großen Herzen. Anmerkungen zu den Predigten Ludwig Hofackers, in: Frömmigkeit unter den Bedingungen der Neuzeit (FS Gustav Adolf Benrath), hg. v. R. Braun / W.-F. Schäufele, Darmstadt / Kassel 2001, 237–248. Ralph Hennings, Carl Blum – Prediger der Russlanddeutschen, in: Zeitschrift für Kirchengeschichte 111 (2000), 70–90.
242
Die prägende Kraft der Predigtbücher für die Frömmigkeit der Russlanddeutschen
Ders., In der Christusnachfolge: Evangelische Pastoren und Lehrer in Russland während des 19. Jahrhunderts, in: Vision und Verantwortung (FS Ilse Meseberg-Haubold), hg. v. B. Konz / U. Link-Wieczorek, Münster 2004, 216–235 (wiederabgedruckt in diesem Band). Martin H. Jung, Immanuel Gottlob Brastberger, in: RGG4 1 (1998), 1737. Wilhelm Kahle, Erweckung im Protestantismus Ostmittel- und Osteuropas sowie der asiatischen Teile des Russischen Reiches, in: Kirche im Osten 37 (1994), 11–34. Ders., Wege und Gestalt evangelisch-lutherischen Kirchentums vom Moskauer Reich bis zur Gegenwart, Erlangen 2002. Hans-Martin Kirn, Ludwig Hofacker 1798–1828. Reformatorische Predigt und Erweckungsbewegung, Metzingen 1999. Ulrich Köpf, Mentalitätsgeschichte, in: RGG4 5 (2002), 1102–1103. Gottfried Mälzer, Die Werke der Württembergischen Pietisten des 17. und 18 Jahrhunderts. Verzeichnis der bis 1968 erschienen Literatur (BGP 1) Berlin u. a. 1972. Karl Nicol, Das Küsteramt in der evangelischen Kirche, 2. Aufl., Erlangen 1954. Alfred Niebergall, Die Geschichte der christlichen Predigt, in: Leiturgia 2 (1955), 181–352. Ders., Predigt 1. Geschichte der Predigt, in: RGG3 5 (1961), 516–530. Klaus vom Orde, Die erweckliche Predigt im 19. Jahrhundert, in: Zeitschrift für Theologie und Gemeinde 3 (1998), 278–293. Joseph Schnurr (Bearb.) Die Kirchen und das religiöse Leben der Russlanddeutschen. Evangelischer Teil, 2.Aufl., Stuttgart 1978. Jakob Stach (Bearb.), Grunau und die Mariupoler Kolonien. Materialien zur Geschichte deutscher Siedlungen im Schwarzmeergebiet (Sammlung Georg Leibbrandt 7. Quellen und Materialien zur Erforschung des Deutschtums in Osteuropa), Leipzig 1942. Gerd Stricker (Hg.), Rußland. Deutsche Geschichte im Osten Europas, Berlin 1997. Ders., Die lutherische „Brüderbewegung“ in Russland als Echo des europäischen Pietismus, in: Forschungen zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen 9 (1999), 35–59.
Aus dem Tagebuch eines bekehrten russischen Rabbiners. Ein adversus-judaeos-Text aus der ev.-luth. Kirche in Rußland1
Mit diesem Text aus der Mitte des 19. Jahrhunderts öffnen sich Fenster in versunkene Welten. Zum einen gewährt er einen Einblick in die Welt des Ostjudentums, zum anderen zeigt er die Welt der lutherischen Kirche in Südrußland. Beide Welten begegnen sich in den im 19. Jahrhundert neugewonnenen Ländern des russischen Reiches. Schauplatz des Ereignisses, den der Text „Aus dem Tagebuch eines bekehrten russischen Rabbiners“ schildert, ist Kischinew in Bessarabien (heute in der rumänischen Namensform „Chisinau“ die Hauptstadt des unabhängigen Staates Moldawien). Die historische Landschaft Bessarabien liegt zwischen Dnjestr, Pruth und Donau. Nach dem Sieg über die Osmanen wurde dieses Gebiet im Frieden von Bukarest am 28. 5. 1812 Rußland zugeschlagen. Der Herrschaftswechsel führte zu einem verstärkten Zuzug von Juden nach Südrußland. Sie siedelten vor allem in den Städten und betrieben neben Handel und Geldwirtschaft viele Handwerksbetriebe. Durch die Versuche der russischen Regierung, die neugewonnenen Gebiete zu kolonisieren und landwirtschaftlich nutzbar zu machen, kamen im gleichen Zeitraum auch deutsche Siedler als Kolonisten nach Südrußland. Sie bildeten in den ausgedehnten Flächen eigene deutsche Kolonien2. Begegnungen mit der sich vergrößernden jüdischen Bevölkerung gab es nur in den Städten und durch Handelskontakte. Mit der berühmt-berüchtigten „Linie der hebräischen Ansässigkeit“ beschränkte Zar Nikolaus I. 1835 die Siedlungsfreiheit der Juden in Rußland auf die Gouvernements Kongreßpolens und 15 weiterer Gouvernements im Westen und Südwesten des Reiches, darunter auch Bessarabien3. In Bessarabien hatte sich die
1 Abkürzungen nach: Theologische Realenzyklopädie. Abkürzungsverzeichnis zusammengestellt von Siegfried Schwertner 2. Auflage, Berlin – New York 1994. 2 Detlef Brandes, Einwanderung und Entwicklung der Kolonien, in: Gerd Stricker (Hg.) Deutsche Geschichte im Osten Europas. Rußland, Berlin 1997, bes. 91–101. 3 Vgl. Kirche und Synagoge. Handbuch zur Geschichte von Christen und Juden, hg. v. K. H. Rengstorf / S. v. Kortzfleisch, Bd. 2, Stuttgart 1970, 648.
244
Aus dem Tagebuch eines bekehrten russischen Rabbiners
jüdische Bevölkerung von 1812 bis zur Volkszählung 1897 nahezu verzehnfacht4. Für Kischinew als Hauptstadt des Gebietes gilt diese Entwicklung verstärkt. Die Stadt hatte 1858 63.469 Einwohner, von denen ca 20 % Juden waren5. Die evangelische Gemeinde der Stadt hatte sich bis dahin nicht wesentlich vergrößert. Seit 1837 ist ein eigener lutherischer Divisionsprediger nachgewiesen6. Aus den evangelischen Angehörigen des russischen Militärs und aus Kaufleuten und Handwerkern war bereits 1827 eine Kirchengemeinde entstanden. Dazu gehörten nicht nur Deutsche, sondern auch Esten und Letten. 1858 gab es insgesamt 249 evangelische Christen in Kischinew. In der Umgebung hatten sich mehrere deutsche Kolonien gebildet, die vom lutherischen Divisionsprediger in Kischinew mitversorgt wurden. 1867 gehörten bereits 14 weitere Dörfer zur evangelischen Gemeinde. Damit lebten im Kirchspiel insgesamt 753 Evangelische. Die evangelische Kirche in Kischinew wurde bereits 1838 eingeweiht. Es gab ein Pastorat und ein Schulhaus. Der Divisionsprediger war zugleichder Gemeindepfarrer7. Diese Konstellation ist typisch für Gebiete Rußlands, in denen es keine eingesessene evangelische Bevölkerung gab, aber zahlreiche Angehörige des Militärs. So haben sich auch im fernen Osten des russischen Reiches aus Militärgemeinden normale Ortsgemeinden entwickelt. In Kischinew übte Rudolph Faltin das Amt des Divionspredigers und Ortspfarrers 46 Jahre lang aus. Er war von 1858 bis 1904 Pfarrer in Kischinew und von 1890 bis 1904 auch noch Propst des 1. Propsteibezirkes in Bessarabien. Die Entwicklung der Gemeinde in Kischinew bis in die Anfangsjahre Rudolph Faltins wird von E.H. Busch im Jahre 1867 wie folgt beschrieben: Nachdem im Jahre 1827 die evangelischen Bewohner Kischinews zu einem kirchlichen Gemeinde-Verbande zusammengetreten waren und einen Kirchenrath gewählt hatten, erhielt die junge Gemeinde im Jahre 1832 einen Platz zur Kirche (zum Kirchbau, R.H.) 4 Von ca. 20.000 Juden im Jahre 1812 vermehrte sich der jüdische Bevölkerungsteil bis zur Volkszählung 1897 auf 228.620 Menschen, vgl. Avram A. Baleanu, Bessarabien, in: Neues Lexikon des Judentums, Gütersloh 1992, 73. 5 Die jüdische Gemeinde in Kischinew wuchs im Zeitraum von 1847 bis 1867 von 10.509 auf 18.327 Mitglieder an, vgl. Jean Ancel, Kishinew, in: EJ 10 (1971), 1064. 6 Die lutherischen Pastoren in Kischinew waren: 1. Johann Samuel Hellwich 1837–1846 (1. 10. 1808 in Wenden (Livland), Pfr. in Klöstitz (Bessarabien 1831–1837). 2. Friedrich Gottfried Waldemar Croon 1846–1848 aus Livland, am 11. 7. 1848 auf einer Reise nach Tiflis an der Pest gestorben. 3. Johann Samuel Hellwich 1849–1856 gestorben am 1. 3. 1856 durch den Sturz aus einer Equipage. 4. Rudolph Faltin ab 1858–1904 (geb. 21. 5. 1829 in Riga gest. 1918 in Riga). Zu den Geistlichen vgl. Die Kirchen und das religiöse Leben der Russlanddeutschen. Evangelischer Teil, bearb v. Joseph Schnurr, Stuttgart 1978 2.Aufl. Zu Rudolf Faltin vgl. auch noch die Angaben bei Fr. Schrenk, Aus der Geschichte der Entstehung und Entwicklung der evangelisch-lutherischen Kolonien in den Gouvernements Bessarabien und Cherson speciell in kirchlicher Beziehung, Odessa 1901, 78–79. 7 E.H. Busch, Materialien zur Geschichte und Statistik des Kirchen- und Schulwesens der Ev.Luth. Gemeinden in Rußland, St. Petersburg 1862, 1176f.
Aus dem Tagebuch eines bekehrten russischen Rabbiners
245
angewiesen und von der Krone zum Bau des Gotteshauses die Summe von 20.000 Rubel. Die Kirche, zu welcher der Grundstein am 26. September 1834 gelegt war, wurde erst am 28. August 1838 eingeweiht, obgleich der Bau schon 1837 beendigt worden. Das Pastorat wurde in den Jahren 1859 bis 1861 erbaut8.
Trotz öffentlicher Präsenz mit Kirche, Pastorat und Schule bildeten die Lutheraner in Kischinew eine zahlenmäßig verschwindend kleine Minderheit. Die jüdische Gemeinde war demgegenüber, nach den Orthodoxen, die größte Religionsgruppe in der Stadt. Sie zählte um 1865 ca. 15.000 Menschen9. Bereits 1774 war eine jüdische Beerdigungsbruderschaft (Chewra Kaddischa) mit 144 Mitgliedern gegründet worden, obwohl Kischinew zu dieser Zeit noch eine wesentlich kleinere Ansiedlung war. Direkt nach dem Übergang in die russische Herrschaft wurde 1816 die erste Synagoge errichtet und 1838 eine weltliche jüdische Schule eingeweiht. Die Judenschaft Kischinews zeigte sich damit der „Haskala“, der jüdischen Aufklärungsbewegung gegenüber aufgeschlossen. Die chassidische Bewegung spielte dagegen keine große Rolle. Traurige Berühmtheit sollte die jüdische Bevölkerung Kischinews später erringen; 1903 wurde 47 Juden bei einem staatlich organisierten Pogrom getötet und mehrere Hundert verwundet oder verstümmelt10. Dieses Pogrom erregte internationale Aufmerksamkeit, und es gab zahlreiche Proteste und Hilfeleistungen aus dem Ausland. Dadurch ging der Name Kischinews in die Annalen der Judenverfolgungen ein.
Evangelische Judenmission in Rußland Evangelische Mission im russischen Reich war eine „unmögliche Möglichkeit“, denn die übermächtige orthodoxe Kirche verfolgte jede Missionsbemühung anderer Konfessionen mit Argwohn. Übertritte von der orthodoxen Kirche zu den in Rußland existierenden anderen christlichen Konfessionen waren strengstens verboten. Mission konnte sich daher für die evangelische Kirche innerhalb Rußlands nur auf „Heiden“ und Juden richten. Dafür waren neben dem am Anfang des 19. Jahrhunderts neu erwachten Missionsinteresse die staatlichen Vorgaben bestimmend. Unter Zar Alexander I. unternahm der Staat selbst Versuche zur Judenmission durch die Bildung einer „Gesellschaft der Israelitischen Christen“ und die Schaffung eines eigenen Ansiedlungsrayons in 8 E.H. Busch, Ergänzungen der Materialien zur Geschichte und Statistik des Kirchen- und Schulwesens der Ev.-Luth. Gemeinden in Rußland, St. Petersburg 1867, 1. Band, 218. 9 Die von Rudolph Faltin für 1865 angegebene Zahl von 35.000 Juden in Kischinew erscheint demgegenüber übertrieben. Rudolph Faltin, Der Herr sammelt die Seinen aus Israel, in: St. Petersburgisches Sonntagsblatt 8 (1865) 308. 10 M. Wischnitzer, Kischinew, in: EJ(D) 10 (1934), 21.
246
Aus dem Tagebuch eines bekehrten russischen Rabbiners
Südrußland. Dieses Unternehmen scheiterte aber kläglich11. 1817 erlaubte es Alexander I. allen christlichen Kirchen im russischen Reich, Juden aufzunehmen. Auf dieses Recht beriefen sich die evangelischen Judenmissionare, auch wenn in der Folgezeit Staat und Kirche stärkeren Druck auf Juden ausübten, um sie zum Übertritt in die orthodoxe Kirche zu bewegen. Für diese Konversion bedurfte es auch keiner weiteren Formalien, während die Aufnahme von Juden in die evangelische Kirche durch bürokratische Regeln zunehmend erschwert wurde. Der Übertritt von Juden in die evangelische Kirche wurde immer mehr zu einem langwierigen Verfahren12. Während die „Orthodoxe Kirche jede Missionstäthigkeit unter Nichtchristen als ein ihr ausschließlich im Lande zustehendes Recht betrachtet“13. Der Haltung von russischem Staat und orthodoxer Kirche gegenüber den Juden korrespondierte eine deutliche Verachtung auf Seiten der jüdischen Bevölkerung. Vor allem die ungebildeten Bauern waren Zielscheibe des jüdischen Spotts. Auf sie wurde in Rußland das Wort „Goi“ gemünzt, das in diesem Kontext den „slawischen, primitiven, analphabetischen Bauern“ bezeichnete, der zumeist orthodox war14. Die Begegnung mit den lutherischen oder katholischen Deutschen war demgegenüber etwas Anderes. In den Städten waren Deutsche vielfach Angehörige der Oberschicht und selbst auf dem Lande bemühten sich die Siedler als erstes darum, eine Schule für ihre Kinder einzurichten. Kontakte zwischen Deutschen und Juden in der Mitte des 19. Jahrhunderts in Südrußland fanden 11 Vgl. Semen Dubnow, History of the Jews in Russia and Poland, Bd. 1, Philadelphia 1916, 396– 400. 12 Vgl. Wilhelm Kahle, Wege und Gestalt evangelisch-lutherischen Kirchentums in Rußland vom Moskauer Reich bis zur Gegenwart, Erlangen 20022, 315–317. Als Beispiel sei nur der 1901 geregelte innerkirchliche Dienstweg angeführt: „Wenn der Propst, welchem insbesondere die Verantwortung für die gehörige Belehrung der Hebräer in den Lehren der evangelisch-lutherischen Confession obliegt, das Zeugnis des Predigers genügend findet, so unterlegt er darüber dem Consistorium und fügt sogleich das sowohl gedachte Zeugnis als auch seine eigene Meinung bei. Das Consistorium sucht nach Empfang einer solchen Vorstellung, unter Einsendung erwähnter Zeugnisse und seiner eigenen Meinung darüber bei dem Ministerium des Inneren oder auch je nach Erfordernis, bei den Oberdirigierenden des Civilressorts des Kaukasus um die Erlaubnis zur Taufe des Hebräers nach“ (a. a. O. 315–316). 13 J.F.A. de Le Roi, Die evangelische Christenheit und die Juden unter dem Gesichtspunkte der Mission geschichtlich betrachtet, 2. Bd., A. Zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts. Das europäische Festland während des 19. Jahrhunderts (Schriften des Institutum Judaicum in Berlin 9,2), Berlin 1891, 330. 14 Vgl. die Charakterisierung von Salcia Landmann in: Kirche und Synagoge (Anm. 3), 640: „Der Goi ist der Nichtjude niederer Stände, der Bauer, vor allem der slawische, primitive, analphabetische Bauer – denn andere Bauern kannte man ja im Osten nicht. Dieser Bauer war im vorgeschobenen Osten griechisch-orthodox. Folglich klingt diese konfessionelle Tatsache im Begriffe Goi mit. Man hat als Ostjude Mühe, einen Lutheraner als ‚Goi‘ zu bezeichnen […] Und da der Goi ungebildet war, der Jude aber bei aller Armut dennoch immer lesen und schreiben und sogar die Bibel und wenigstens auch die leichteren Kommentare im Urtext verstehen konnte, klingt im Worte Goi auch die Unbildung mit“.
Aus dem Tagebuch eines bekehrten russischen Rabbiners
247
deshalb durchweg in einer anderen Atmosphäre statt. Neben dem durchgängig vorhandenen christlichen Antijudaismus waren die speziellen Versuche zur Judenmission von einem starken Respekt vor den Juden, ihrer Religion und Geschichte getragen. Das ist ein Erbe der pietistischen Judenmission Deutschlands15. Sie hatte, vor allem angeregt durch englische und skandinavische Gesellschaften für die Judenmission, auch in Rußland ihre Wirkung. In der evangelisch-lutherischen Kirche Rußlands wuchs in der Mitte des 19. Jahrhunderts parallel zur erwecklichen Grundstimmung das Interesse an der Bekehrung der Juden. So ist in einem 1860 erschienen Aufruf zur Judenmission im St. Petersburgischen Sonntagsblatt neben dem Missionsinteresse ein deutliches Schuldeingeständnis von Christen gegenüber den Juden zu finden. Im Rückblick auf die Judenverfolgungen des Mittelalters und der frühen Neuzeit schreibt der anonym gebliebene Autor „Da liegt also eine große Schuld auf der Christenheit, die durch nichts abgetragen werden kann. Wollen wir aber gut machen, so viel gut zu machen ist, so müssen wir vor allem thun, was wir vermögen, daß die Juden unsere Brüder in Christo werden“. Gegenüber den Juden räumt der gleiche Autor dann auch noch ein, daß viele Christen die Gebote nicht beachten und „den Sonntag entheiligen, lügen, stehlen, betrügen und in Unzucht leben“16. Im Baltikum bildete sich bald darauf (1865) ein Verein für die Judenmission17, während die evangelische Kirche im übrigen Rußland ohne organisierte Judenmission blieb. Die Arbeit Rudolph Faltins in Kischinew ist eine Ausnahmeerscheinung für die evangelische Kirche in Rußland. Sie ist eher zufällig als geplant entstanden und ergab sich durch die Lage in Kischinew und durch die Sensibilität Faltins für diesen Bereich der Verkündigung18. Rudolf Gurland beschreibt im Rückblick, wie Rudolph Faltin zu der Arbeit in der Judenmission in Kischinew gekommen ist: Vor acht Jahren, als Herr Pastor Faltin hier sein Amt antrat, kamen Fälle vor, wo Israeliten sich bei ihm zum christlichen Unterricht meldeten. Die Sache war für diesen
15 Paul Gerhard Aring, Judenmission in: TRE 17 (1988), 325–330. Aring beschreibt das Ausgangsinteresse der evangelischen Judenmission bei Johann Christoph Wagenseil (1633–1705) so: „Daher sollte jedermann, vor allem die Obrigkeiten, alles tun, um die Juden durch das Vorbild eines gottgefälligen Lebens zum Glauben an Christus zu reizen. Dazu solle man versuchen, die Juden wirklich kennenzulernen, ihre Sprache zu sprechen, ihre Bücher zu studieren und vor allem junge Männer ausbilden, die den Juden in Liebe und Geduld den Weg zu Christus zeigen könnten.“ Vgl. dazu auch den Überblick von G.F. Heman, Missionen unter den Juden, in: RE2 10 (1882) 102–118, hier 112–113. 16 St. Petersburgisches Evangelisches Sonntagsblatt, 3 (1860), 286. 17 J.F.A. de le Roi, Die evangelische Christenheit und die Juden, Bd. 2 (Anm. 13), 332. 18 Vgl. die Einschätzung von G. C. Nöltingk, Auch ein Wort über unsere Mitarbeit an der Mission, in: Mittheilungen und Nachrichten für die evangelische Kirche in Rußland 38 = N. F. 15 (1882), 104: “Der Einfluß des sichtbaren Missionshauses in Kischinew geht, so glauben wir, nicht über das Weichbild der Stadt heraus.“
248
Aus dem Tagebuch eines bekehrten russischen Rabbiners
Mann nicht leicht. Er kannte wenig das jüdische Wesen, ihre Sitten und Eigenthümlichkeiten. Ihre Sprache war ihm fremd, ihre Denkweise unfaßlich, und die ganze Judenmission erschien ihm als ein fernliegendes Gebiet […] Er sandte anfangs die sich bei ihm anmeldenden Israeliten nach Jassy, woselbst ein Zweig der Britischen Judenmissions-Gesellschaft wirkte. Als sich aber die Fälle wiederholten, ging es dem Manne durchs Herz: ob er nicht diese Gelegenheit, die ihm Gott darbiete, auch selbst benutzen könnte und müßte19.
Aus diesen Anfängen entwickelte sich neben der späteren Tätigkeit des zur evangelischen Kirche übergetretenen Rabbiners Gurland auch die judenchristliche Bewegung um Josef Rabinowitsch, die in großer Nähe zu Rudolph Faltin entstand, aber doch eine völlig eigenständige Entwicklung nahm20.
Der Autor21 Autor des anonym publizierten Textes ist Rudolf Gurland. Er wurde 1831 in Wilna22, dem „litauischen Jerusalem“ als Chaim Gurland in eine Familie von Rabbinen hineingeboren23. Er besuchte die höhere Talmud-Tora-Schule in Wilna24 und von 1848–1851 die Rabbiner-Hochschule in Wolosin25. Bis 1853 war Gurland Hauslehrer bei seinem Onkel, dem Oberrabbiner von Lemberg. In Wilna wurde er am 8. 3. 1854 zum Rabbiner ordiniert26. Aus einem Brief an seinen Vetter Samuel am Tage der Ordination geht hervor, wie stark Gurland an seiner Befä-
19 Rudolf Gurland, Erstes Zeugnis des Pastors Gurland aus seinem evangelischen Amtsleben, in: Rudolf Gurland. Ein bekehrter Rabbiner, jetzt evangelischer Pastor (Schriften für Israel 4), Erlangen 1869, 45. Vgl. auch J.F.A. de le Roi, Die evangelische Christenheit und die Juden, Bd. 2 (Anm. 13), 340. 20 Kai Kjaer Hansen, Josef Rabinowitsch und die messianische Bewegung. Der Herzl des Judenchristentums, übersetzt von Niels-Peter Moritzen, hg. v. Evangelisch-Lutherischen Zentralverein für Zeugnis und Dienst unter Christen und Juden, Hannover 1990. 21 Die biographischen Angaben zu Rudolf Gurland stammen so weit nicht anders angegeben aus J.F.A. de le Roi, Die Evangelische Christenheit und die Juden, Bd. 2 (Anm. 13), 340–342. 22 Wilna war ein Zentrum der „Haskala“. Dort waren auch die Auseinandersetzungen um die neuen Ideen besonders heftig. Vgl. Semen Dubnow, History of the Jews in Russia and Poland, Bd. 2, Philadelphia 1918, 132. 23 Möglicherweise ist Rudolf Gurland mit dem jüdischen Gelehrten und nachmaligen Oberrabbiner von Odessa Chajm Jona Gurland (1843–1890) und dessen Bruder Jacob Gurland Rabbi von Poltava, verwandt. Beide besuchten wie Rudolf Gurland die Rabbinerschule in Wilna. 24 In zwei Welten. Rudolf Hermann Gurland. Ein Lebensbild. Mit einem Geleitwort von Martin Kähler, 2. Aufl. Dresden 1911, 18. Das benutzte Exemplar befindet sich im Besitz der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek. 25 In zwei Welten (Anm. 24), 33. 26 In zwei Welten (Anm. 24), 33–34.
Aus dem Tagebuch eines bekehrten russischen Rabbiners
249
higung zu diesem Amt zweifelte und welche Schwierigkeiten ihm die Autorität der Tradition im Judentum bereitete: Das Schlimmste aber ist, daß man bei uns nicht fragen darf; was der Vater geglaubt, muß blindlings geglaubt werden, auch wenn man noch so klar sieht, daß es falsch ist, sonst wird man ‚Berliner‘ genannt. Und ist der Verfolgung ausgesetzt27.
Die Familie sorgt danach zügig für die Verlobung Gurlands mit der Tochter des Rabbiners von Wilkomir28, dessen Amt er bereits nach kurzer Zeit, aufgrund des schlechten Gesundheitszustandes seines Schwiegervaters übernehmen mußte29. Im Januar 1855 geriet er in einen ernsten Konflikt mit seiner Gemeinde, was schließlich zu einem Verfahren vor dem Oberrabinnat in Wilna führte. Die Anstoß erregende Spitzenaussage Gurlands scheint gewesen zu sein, daß er den Talmud nicht als Gottes Wort anerkennt. In seinen Tagebuchaufzeichnungen über das Verfahren vor dem Oberrabinner schreibt er „Wenn ich auch den Talmud nicht als Gottes Wort anerkenne, so habe ich doch nie mit absichtlicher Tat gegen ihn gehandelt“30. Nachdem seine Gegner noch versucht hatten, ihn mit einem üblen Trick loszuwerden31, übte er sein Amt noch zwei weitere Jahre in Wilkomir aus, bis er freiwillig resignierte32. Nach sieben Jahren der Wanderschaft kam er nach Kischnew, wo er zum zweiten Mal heiratete33. Er bestritt seinen Lebensunterhalt vor allem durch Kalligraphie. In Kischinew begegnete er dem zwei Jahre älteren Rudolph Faltin, der ihn bat, ihm Hebräischunterricht zu erteilen34. Dabei wurde zunächst bewußt der Unterschied zwischen Christentum und Judentum vom Gespräch ausgeklammert. Es soll dann die Lektüre von Jes 53 gewesen sein, die Gurland dazu bewog, sich auf eine christliche Deutung alttestamentlicher prophetischer Texte einzulassen35. Nach einiger Zeit des Unterrichts
27 In zwei Welten (Anm. 24), 36. Mit „Berliner“ wurden die Anhänger der „Haskala“, der jüdischen Aufklärungsbewegung im traditionellen Ostjudentum bezeichnet. 28 In zwei Welten (Anm. 24), 45. 29 In zwei Welten (Anm. 24), 52. 30 In zwei Welten (Anm. 24), 58. 31 In zwei Welten (Anm. 24), 58–62. Gurland wurde ohne Paß aufgegriffen, damit konnte er nach geltendem Recht in Rußland zum Militärdienst gezwungen werden. Der Versuch scheiterte, da Gurlands Paß bei einem der Männer gefunden wurde, die ihn vor die Rekrutenkommission gebracht hatten. 32 In zwei Welten (Anm. 24), 64. 33 Von seiner ersten Frau wurde er geschieden. In Kischinew heiratete er eine bereits verwitwete Frau. 34 Zu Rudolph Faltin und seiner Arbeit in der Judenmission vgl. Wilhelm Kahle, Der Propst Rudolph Faltin und seine Arbeit an Israel in Kischinev, in: (Ders.) Symbiose und Spannung, Beiträge zur Geschichte des Protestantismus in den baltischen Ländern, im Innern des Russischen Reiches und der Sowjetunion, Erlangen 1991, 168–192, zuerst veröffentlicht in: Friede über Israel 5 (1964), 150–160. 35 In zwei Welten (Anm. 24), 73.
250
Aus dem Tagebuch eines bekehrten russischen Rabbiners
bei Rudolph Faltin wurden Rudolf Gurland und seine Frau am 26. 4. 1864 getauft36. Der Text, den Gurland ohne Namensnennung im Herbst 1864 im „Friedensboten für Israel“ und 1865 im St. Petersburgischen Sonntagsblatt veröffentlichte, geht auf die Auseinandersetzungen mit seiner jüdischen Gemeinde in Kischinew am 8. 3. 1864 zurück. Rudolf Faltin beschreibt die Situation so: Als sich mittlerweile auch die Nachricht unter den Juden hiesigen Ortes verbreitete, daß Herr G. sich taufen lassen wolle, wurde er darüber von den hiesigen Schriftgelehrten zur Verantwortung gezogen, in Folge dessen er eine Disputation am 8. März 1864 mit denselben hielt37.
Den Charakter einer Disputation gibt auch der vorliegende Text wieder. Es gibt zahlreiche Sprecherwechsel, zwei Hauptgesprächspartner und längere redenartige Passagen. Gurlands weiterer Lebensweg führte ihn direkt ans „Institutum Judaicum“ nach Berlin, wo er Theologie studierte. Vorteilhaft wirkte sich dabei seine Sprachkompetenz im Deutschen aus. Gurland sprach und schrieb perfekt Deutsch, die lingua franca der Gebildeten im russischen Reich. Nach dem zügigen Abschluß seiner Studien wurde Gurland am 30. 6. 1867 in Berlin vom Generalsuperintendenten Büchsel ordiniert, vom russischen Konsistorium noch einmal examiniert und mit seiner Einführung am 15. 10. 1867 Rudolph Faltin als Hilfsgeistlicher zur Seite gestellt38. Die erhoffte große Übertrittsbewegung zur lutherischen Kirche blieb aber aus. Stattdessen bildete sich am Ende des Jahrhunderts in Kischinew um Joseph D. Rabinowitsch eine judenchristliche Bewegung, die von den etablierten Kirchen unabhängig blieb und ihren ganz eigenen Weg suchte39. Sie war stark an der Auswanderung nach Erez Israel interessiert und dürfte in diesem Sinn sogar als Vorläufer des Zionismus betrachtet werden. Rudolph Faltin hatte mit Rabinowitsch und seiner Bewegung deutlich mehr Probleme als mit Rudolf Gurland, dessen Konversion schließlich zu einem lutherischen Pfarramt führte. 36 Angabe nach dem in Rußland gültigen Julianischen Kalender. So bei Rudolph Faltin, Der Herr sammelt die Seinen aus Israel, in: St. Petersburgisches Sonntagsblatt 8 (1865) 308: „Am 26. April, am Confirmationstage unserer Jugend wurde das liebe Ehepaar in die Gemeinschaft der christlichen Kirche durch die heilige Taufe aufgenommen“. In Gurlands Biographie, In zwei Welten (Anm. 24), 94, ist das Taufdatum hingegen nach dem Gregorianischen Kalender angegeben, wodurch sich der 8. 5. 1864 ergibt. Diese Datumsangabe findet sich auch bei W. Kahle, Propst Faltin (Anm. 34), 171. 37 R. Faltin, Der Herr sammelt die Seinen (Anm. 36), 308. 38 In zwei Welten (Anm. 24), 122–124. 39 Arnulf H. Baumann, Josef Rabinowitschs messianisches Judentum, in: Folker Siegert [Hg.], Grenzgänge. Menschen und Schicksale zwischen jüdischer, christlicher und deutscher Identität. Festschrift für Diethard Aschoff (Münsteraner Judaistische Studien 11), Münster 2002, 195–211.
Aus dem Tagebuch eines bekehrten russischen Rabbiners
251
Er wurde 1871 für die Judenmission im Baltikum übernommen, 1873 wurde er Adjunkt an der Trinitatiskirche in Mitau und schließlich 1876 dort pastor primarius. Dieses Amt übte Gurland bis zu seinem Ruhestand aus. Danach trat er wieder in den Dienst der Judenmission vor allem der „Mildmay-Mission“40 (London) und der amerkanisch-norwegischen Judenmission. Er verbrachte seine letzten Jahre in Odessa und mußte aus nächster Nähe das Pogrom in Kischinew 1903 miterleben41. Am 21. 5. 1905 starb Rudolf Gurland und wurde in Mitau beigesetzt42.
Der Text Der Text ist unter dem Titel „Aus dem Tagebuch eines bekehrten russischen Rabbiners“ sehr schnell nach der Taufe Gurlands in drei Folgen (Oktober, November, Dezember 1864) im „Friedensboten für Israel“, der Zeitschrift der Berliner Gesellschaft zur Beförderung des Christenthums unter den Juden erschienen43. Da diese Zeitschrift im Wesentlich nur in Kreisen der Judenmisssion gelesen wurde, aber doch ein großes Interesse an der Geschichte der Bekehrung eines Rabbiners unter den Deutschen im russischen Reich bestand, wurde sie 1865 noch einmal, ebenfalls in drei Folgen im „St. Petersburgischen Evangelischen Sonntagsblatt“ abgedruckt44. Diese kirchliche Zeitschrift hatte einen großen Leserkreis und war im ganzen russischen Reich verbreitet45. Das anhaltende Interesse an der Judenmission und an der ungewöhnlichen Bekehrungsgeschichte führte dazu, daß Gurlands Bericht 1869 ein weiteres Mal, diesmal wiederum in Deutschland nachgedruckt wurde. Zusammen mit einem 40 J.F.A. de le Roi, Die evangelische Christenheit und die Juden unter dem Gesichtspunkte der Mission geschichtlich betrachtet, 3. Bd., B. Großbritannien und die außereuropäischen Länder während des 19. Jahrhunderts (Schriften des Institutum Judaicum in Berlin 9,3), Berlin 1892, 296–394. 41 In zwei Welten (Anm. 24), 194–198. 42 In zwei Welten (Anm. 24), 215–218. 43 Der Friedensbote für Israel 2 (1864) 75–77; 83–85; 90–94. Das benutzte Exemplar des „Friedensboten“ befindet sich in der Bibliothek der Kirchenkanzlei der Evangelischen Kirche der Union in Berlin. 44 St. Petersburgisches Evangelisches Sonntagsblatt 8 (1865), 322–32;. 330–332; 356–360. Das benutzte Exemplar des St. Petersburgischen Evangelischen Sonntagsblattes befindet sich in der Bibliothek des Deutschen Instituts für Auslandsbeziehungen in Stuttgart. 45 Eine Übersicht aus dem Jahre 1863 weist 1300 verkaufte Exemplare nach, von denen nur 560 in St. Petersburg abgesetzt wurden. Die Mehrheit der Exemplare wurde in den übrigen Territorien des russischen Reiches gelesen; St. Petersburgisches Sonntagsblatt 6 (1863), 271. Bereits 1859 urteilten die „Mittheilungen und Nachrichten für die evangelische Geistlichkeit in Rußland“, 15 (1859), 67, über der publizistischen Erfolg des Sonntagsblattes: „Die bedeutende Abonnenten-Zahl ist gewiß ein Maßstab zur Beurtheilung wie zeitgemäß ein solches Unternehmen war“.
252
Aus dem Tagebuch eines bekehrten russischen Rabbiners
Bericht über seine Bekehrung und einem Bericht von Gurland über seine ersten Amtsjahre als evangelischer Pastor in Kischinew findet sich unser Text als vierter Band in der Reihe der „Schriften für Israel“46. Diese Schriftenreihe wurde von Pastor Carl Axenfeld herausgegeben, der seit 1861 Agent des Kölner Vereins für Israel geworden war. Axenfeld war als Kind getaufter Juden in Rußland geboren und hatte von daher Beziehungen zur Judenmission in Rußland47. Zur gleichen Zeit arbeitete aber auch der Kolporteur Max Rosenstrauch im rheinisch-westfälischen Verein für Judenmission, der in Kischinew von Rudolph Faltin und Rudolf Gurland unterrichtet worden war48. Der Text dieses Nachdrucks entstammt laut Angabe Axenfelds dem „Friedensboten für Israel“, wurde aber von dritter Hand verändert und hat von daher für die Neuausgabe des Textes keinen Wert. Die dritte Druckausgabe zeugt vielmehr von dem publizistischen Interesse an Gurlands Leben in Kreisen der Judenmission in Deutschland. Für diese Kreise bestimmt ist auch der vierte Abdruck, den Gurlands Schrift erlebte. Er erfolgte in Gurlands 1911 bereits in der 2. Auflage erschienen Biographie „In zwei Welten“49. Dort ist der Text von unbekannter Hand stark überarbeitet und in Teilen über das Buch zerstreut worden. Dieser Abdruck wurde deshalb ebenfalls nicht zur Texterstellung in der vorliegenden Neuausgabe herangezogen.
Gattung und Funktion Gurlands Text „Aus dem Tagebuch eines bekehrten russischen Rabbiners“ gehört zu der großen Menge von Bekehrungsberichten, die in den Missionsgesellschaften des 19. Jahrhunderts eine wichtige Funktion hatte. Sie verbanden literarische Authentizität und religiöse Biographie und sorgten so dafür, daß das an der Mission interessierte Publikum Anteil nehmen konnte am „Lauf des Evangeliums“ in den entferntesten Winkeln der Welt und unter den exotischsten Völkerschaften. Die Kategorien der Gattung „Bekehrungsberichte“ als Teil der religiösen Autobiographien sind spätestens seit Augustins „Bekenntnissen“ festgelegt. Der Autor muß die Leser vor allem Teil haben lassen an seinem geistlichen Innenleben. Innere Dialoge, Gebete und Gespräche der Seele mit Gott sind dabei wichtige Elemente. Schwierigkeiten, innere und äußere Kämpfe, sowie Selbst46 Das benutzte Exemplar befindet sich im Besitz der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena. 47 Paul Gerhard Aring, Christliche Judenmission. Ihre Geschichte und Problematik dargestellt am Beispiel des evangelischen Rheinlandes (Forschungen zum christlich-jüdischen Dialog 4), Neukirchen 1980, 140–148. 48 P.G. Aring, Judenmission (Anm. 47), 129–130. 49 In zwei Welten (Anm. 24) 79–92.
Aus dem Tagebuch eines bekehrten russischen Rabbiners
253
zweifel bilden retardierende Elemente, die die Spannung erhöhen, bevor es zum religiösen „Durchbruch“, der Bekehrung zu Jesus Christus kommt. Der von Rudolf Gurland aufgezeichnete Bericht von seiner Disputation in der Synagoge in Kischinew ist kein klassischer Bekehrungsbericht, weil die Disputation nach seiner Bekehrung erfolgte. Der „turning point“ für Gurlands Glauben an Jesus Christus war die wiederholte gemeinsame Lektüre von Jesaja 53 mit Rudolph Faltin. Da aber die Disputation in Kischinew noch vor Gurlands Taufe stattfand, gehört sie noch zu den äußeren Schwierigkeiten, die der Neubekehrte durchzustehen hatte. Die Erwartung aus den Kreisen der Judenmission an die literarische Wirkung seiner Nachschrift der Disputation wird in den „Schriften für Israel“ des rheinisch-westfälischen Vereins für die Judenmission klar formuliert, und zwar zunächst durch den Untertitel des Heftes „R. Gurland […] Ein Zeuge für die Gotteskraft des Evangeliums selig zu machen die Juden vornämlich“. Dann aber auch im Nachwort von Carl Axenfeld, in dem es heißt: „Möge auf dieser Schrift gleicher Segen ruhen wie auf den verwandten Schriften der Bekehrung Dr. Cappadose’s und Dr. da Costa’s, auf daß viele Juden und Christen den erkennen und preisen, der das Licht ist zu erleuchten die Heiden und die Herrlichkeit seines Volkes Israel!50“ Gurlands Text sollte also zum einen die Freunde der Judenmission in Deutschland oder durch das St. Petersburgische Sonntagsblatt auch in Rußland ihrer Sache gewiß machen – er diente gewissermaßen als „Erfolgsmeldung“ –, zum anderen sollte dieser Text in der Mission als Hilfsmittel zur Bekehrung weiterer Juden verwendet werden.
Die vorliegende Ausgabe Die Ausgabe folgt dem Text in der Ausgabe des „Friedensboten für Israel“ 1864, der bis auf orthographische Details unverändert im „St. Petersburgischen Sonntagsblatt“ 1865 nachgedruckt wurde. Die Orthographie des Originals wurde beibehalten, offensichtliche Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Eine Unterteilung in Kapitel ist um der besseren Übersicht willen vom Herausgeber vorgenommen worden. Anmerkungen des Herausgebers stehen im Text in 50 R. Gurland, ein bekehrter Rabbiner, jetzt evangelischer Pastor zu Kischinew in Südrußland (Schriften für Israel 4), Erlangen 1869, 61. Zu den angeführten Proselyten Abraham Cappadose und Isaac da Costa vgl. J.F.A. de le Roi, Die evangelische Christenheit und die Juden, Bd. 2 (Anm. 13), 298–304. Vgl. auch den Bekehrungsbericht „Wie die Portugiesischen Brüder Cappadose zu Amsterdam auf verschiedenen Wegen zu Christo kamen.“ Niedergeschrieben von dem einen noch lebenden Bruder, dem Arzt Dr. Cappadose, für Christen und Juden, aus dem Französischen übersetzt (Hauptverein für christliche Erbauungsschriften in den preußischen Staaten 81), Berlin 1883.
254
Aus dem Tagebuch eines bekehrten russischen Rabbiners
eckigen Klammern und in den Fußnoten. Fußnoten, die bereits im Original eingefügt sind, werden als solche gekennzeichnet. Die Bibelzitate im Text entsprechen zu einem Großteil der Luther-Übersetzung, sind aber nicht immer exakt zitiert. Gurland scheint den Text nicht mit einer Bibel auf dem Schreibtisch verfaßt zu haben, sondern zum Großteil aus dem Gedächtnis zu zitieren. Auf biblische Anspielungen und Zitate, die nicht im Text erklärt sind, wird in den Fußnoten hingewiesen. Bei abgekürzt angegebenen Bibelstellen wird in der Fußnote der volle Wortlaut der Stelle in der Fassung der Luther Übersetzung (Revision 1984) angegeben. Bei den rabbinischen Texten wird ebenso verfahren. Hier werden die entsprechenden Passagen aus der Talmudübersetzung von Lazarus Goldschmidt wiedergegeben. Zusätzlich werden Hinweise zur Person der angeführten Rabbinen angefügt. Zu großem Dank verpflichtet bin ich Dipl. Bibl. Gerd Witte (Oldenburg) für die Beschaffung entlegener Literatur und Prof Dr. Matthias Millard für seine Hilfe bei der Identifizierung schwieriger Zitate und Anspielungen aus dem Bereich der rabbinischen Literatur.
Aus dem Tagebuch eines bekehrten russischen Rabbiners 1.
Vorladung in die Synagoge und erstes Ausrufen des Banns
Den 8. März 1864 Abends 6 Uhr stürzten meine Hausgenossen, die ich bisher im Geheimen in der christlichen Religion unterrichtet hatte, zu mir in’s Haus. „Wir sind verrathen, ach, wir sind verloren“, schrieen sie beide in vollem Schrecken 5 aus, „Alles ist entdeckt, die ganze Stadt ist wider uns aufgebracht, sie wollen uns steinigen. Jacob und Chaim sind bei Herrn Z. eingesperrt und werden noch heute Abend öffentlich erklären müssen, warum sie mit uns in der Kirche beim Herrn Pastor gewesen sind; man vermuthet aber, daß Alles von Ihnen stammt, und Sie werden gewiß auch hingerufen werden“ – „Ich aber habe etwas zum Andenken 10 mitgebracht“, sprach Moses, indem er mir sein zerschlagenes Gesicht und seine Arme zeigte. „Das habe ich von meinem Onkel und Verwandten bekommen; ja, sie wollten mir noch mehr geben; allein ich achtete es billig, mich davon zu machen.“ – Bei dieser Gelegenheit erinnerte ich mich an die Worte des Proph. Sacharja 13,651 15 Kaum hatte der Letztere seine Worte ausgeredet, so wurde auch ich aufgefordert, vor der Versammlung der Juden zu erscheinen. Zuerst ging ich zum Herrn Pastor F.[Rudolph Faltin], der mein Lehrer und Vater im Herrn ist, welcher mich durch 51 Sacharja 13,6 „Und wenn man zu ihm sagen wird: Was sind das für Wunden auf deiner Brust?, wird er sagen: So wurde ich geschlagen im Hause derer, die mich lieben“.
Aus dem Tagebuch eines bekehrten russischen Rabbiners
255
Unterweisung und Gebet stärkte, und nachdem ich mich dem Herrn übergeben hatte, ging ich getrost hin. Den ganzen Tag war es sehr unfreundlich gewesen; besonders gegen Abend wehte ein sehr rauher Wind, ein kalter Regen strömte vom Himmel, mein Leib starrte von Kälte, in meinem Innern aber brannte ein unbegreifliches Feuer. Meine Seele durchkreuzten tausend verschiedene Gedanken, Freude, Schmerz, Entzückung und Wehmuth kämpften mit einander, bis dieser Kampf in einem Thränenstrome endigte. Das war ein schwerer Tag! Sacharja 14,6.7.52 Angelangt an der Thüre des Versammlungshauses trat ich mit dem Gebet ein: O Herr, sei in mir Schwachen mächtig53! – Im Vorzimmer hörte ich schon Geschrei und Zank, faßte mich aber und trat schnell ein. „Grüß’ Euch Gott, liebe Brüder!“ sagte ich zu der Versammlung. Aber anstatt mir zu antworten, schlugen sie die Augen nieder, und es trat eine lange Pause ein. Unterdessen fiel mein Auge auf die Beiden, die um ihres Glaubens willen als die ärgsten Verbrecher vor der Gemeinde standen. Endlich unterbrach ich die peinliche Stille und sprach: „Warum sieht es hier heute so sonderbar aus? Was haben diese Uebels gethan?“ Da entgegnete mir zuerst H.N. „Diese Dummköpfe leiden Ihretwegen, sie sagen, daß sie von Ihnen zum evangelischen Pastor und in die Kirche geführt worden seien.“ Die Anderen sagten zu mir: „Es ist gut, daß Sie gekommen sind, um diesen Gottlosen den Mund zu stopfen; denn sie wollen ihre Schuld auf Sie wälzen.“ – Zwei von meinen Freunden, die unter der Versammlung waren, entgegneten: „Es ist nicht wahr; es ist nicht werth, daß man Sie bemüht hat, wir wußten es vorher, daß diese lügen.“ Verzweiflungsvoll und mit wehmüthiger Trauer schauten diese fast Verurteilten auf mich: Zur Gemeinde gewandt sagte ich: „Warum glaubt Ihr diesen Unschuldigen nicht?“ N.N.: Weil wir eine alte Regel haben, nach der kein wahrer Jude Christ werden kann. Ich54: Ja, meine Lieben, diese Regel sollte aber umgekehrt lauten, nämlich: Ein wahrer Jude m u ß Christ werden. Mit innerer wehmüthiger Erregung riefen sie Alle: Ach Gott, s o i s t e s d o c h w a h r !! – Meine anwesenden Freunde, die auch bei meinen Worten staunten, versuchten doch die Gemeinde zu beruhigen und sprachen zu mir: Was für eine Sprache führen Sie heute? – Wir verstehen sie nicht!
52 Sacharja 14,6.7 „Zu der Zeit wird weder Kälte noch Frost noch Eis sein. Und es wird ein einziger Tag sein – er ist dem Herrn bekannt! –, es wird nicht Tag und Nacht sein, und auch um den Abend wird es licht sein“. 53 2. Kor 12,9 „Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig“. 54 Im Text sind alle Angaben über die Sprecher gesperrt gedruckt.
20
25
30
35
40
45
50
256
Aus dem Tagebuch eines bekehrten russischen Rabbiners
Ein anderer: Ich wußte schon lange Ihre Gesinnungen, nun aber möchte ich doch von Ihnen die Beweggründe zu diesem Unsinn hören; was veranlaßt Sie dazu? 55 Ich: Zu diesem Unsinn veranlaßte mich nur Gottes Wort. Sie: Was nennen sie denn Gottes Wort? Ich: Die Bibel, nämlich: das Alte und Neue Testament. Sie: Auch das Neue Testament nennen Sie Gottes Wort?! Ich: Allerdings. Wer an das Neue nicht glaubet, der kann auch an das Alte nicht 60 glauben; denn das Neue ruht auf dem Alten. Sie: O wehe uns, daß wir solches von Ihnen hören müssen! – O cherem! cherem*)55 schrieen Einige heftig und wollten ihre Kleider zerreißen: Er hat Gott gelästert!56 2.
Einladung zur Disputation
N.N.: Geduld! Zuerst wollen wir versuchen, ihn von seinem Irrthume zurück zu bringen. Vielleicht gelingt es uns, ihn und die ihm anhangenden Seelen zu retten. Ich: Deswegen bitte ich Euch, erlaubet mir, mich über meine Ansichten deutlicher auszusprechen, – oder saget mir, worin ich Eurer Meinung nach irre? N.N.: Bedarf es wohl noch einer näheren Erklärung? Anstatt des wahren, einigen Gottes Israels haben Sie den falschen heidnischen anerkannt. 70 Ich: Der Herzenskündiger ist mein Zeuge, daß ich nur die Wahrheit suche und ergreife, wenn ich den dreieinigen Gott anerkenne; denn auch unsere Eltern, Abraham, Isaak und Jakob haben nur diesem dreieinigen Gotte gedient. Ich werde nicht Heide, wie Ihr denkt, sondern erst recht ein wahrer Jude. Sie: Ein dreieiniger Gott! o bewahre! bewahre! 65
55 Anmerkung im Text: Cherem, d. h. eine Verbannung, daß niemand mit ihm in Berührung kommen darf, wie Josua 6,17–19. 56 Die Herleitung des in der Synagoge zum Ausrufen des Synagogenbanns verwendeten Rufes „Cherem“ allein aus der Bibelstelle Jos. 6,17ff ist nicht sehr überzeugend. Hier handelt es sich um den Kriegsbann, der im heiligen Krieg ausgerufen wird und durch den die Feinde und die Beute Gott geweiht werden. Der Ruf „Cherem“ bezeichnet den Synagogenbann, der auf biblische Verwendung von םרחals Bezeichnung einer Todesstrafe zurückzuführen ist, „die besonders bei Untreue gegenüber der Jahwe-Religion angewendet wird. Wenn diese Strafe ausgesprochen ist, ist jeder Loskauf ausgeschlossen (Lev 27,29). Der Schuldige ist Gott verfallen und muß als res exsecranda ausgerottet werden“ (C. Brekelmanns, in: THAT 1,638). Das zeigt auch schon die Übersetzung von םרחin der Septuaginta. Dort steht ανάθημα und zeigt damit die Nähe zum aussondernden Fluch aus der Gemeinschaft an. Im rabbinischen Judentum entwickelte sich der Ruf םרח/ Cherem zum Synagogenbann, mit dem ein Mitglied zur Besserung belegt werden konnte. Das Recht oder sogar die Pflicht, den Bann auszurufen, hatte jedes Gemeindemitglied (vgl. Strack/Billerbeck, Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch IV/1 293–333). Die Belegung mit dem םרח/ Cherem, der schweren Form des Bannes, hatte für den Betroffenen gravierende religiöse und soziale Folgen.
Aus dem Tagebuch eines bekehrten russischen Rabbiners
257
Ich: Liebe Brüder! Schon 2000 Jahre beinahe widerstrebt Israel der Wahrheit. Wir 75 sind in Finsterniß und glauben, daß wir das wahre Licht haben. –Was helfen uns Gesetz und Werke, wenn wir den wahren Glauben nicht haben, wenn wir unsern Messias, unsern Heiland verleugnen? Ja, was hilft uns unser Beten, Fasten und Weinen, wenn wir den Sohn Gottes verachten, verschmähen und verspotten, auf den Moses und alle Propheten geweissagt haben? Ach, wehe uns, wenn wir anstatt 80 Seiner den falschen schwärmerischen Messias der Talmudisten erwarten! Sie widersprechen nur sich selbst und können mit ihren Auslegungen nicht zurechtkommen, weil sie das rechte Ziel verfehlt haben. Sie: Weg damit! Solches wollen wir nicht hören! Ich: Das glaube Ich. Ja, es steht Euch frei; ich aber und meine Sinnesgenossen 85 wollen dem Herrn dienen. Her zu mir, wer dem Herrn angehört! (2. Mose 32,26). N.N.: Sie können Ihre Meinung weiter äußern. Lassen Sie uns hören, von wem Ihre vergifteten Ideen stammen, die uns mit Verderben drohen. Was haben Sie zuerst gegen den Talmud anzuführen? 3.
Frühe Zweifel am Judentum
Ich: Ich erkläre hiermit öffentlich, daß Talmud und Kabbala mich in Verzweiflung gebracht, oder richtiger gesagt, meine Verzweiflung vergrößert haben. Wer darin ernst und mit Nachdenken studirt, der kann sich überzeugen, wie selbstsüchtig, ehrgeizig und schwärmerisch diese Leute waren. Wie ernstlich haben sie sich bemüht, alle Stellen der heiligen Schrift, von welchen ein helles Licht auf den wahren Messias ausstrahlt, durch falsche Auslegungen zu verdunkeln! Gott gebe, daß Ihr aufmerksam zuhöret, damit meine schwachen Worte Euch zum Herzen dringen und Eure Augen geöffnet werden, in Gottes Wort die Wahrheit zu finden. „Bitte, wir wollen hören!“ sagten Einige. Ich: Soweit ich mich von meiner frühesten Jugend an erinnern kann, bin ich immer durch die empfindlichsten Zweifel gequält worden. Ich wollte gerne z. B. erfahren, Wann ist die Welt geschaffen? Wird sie ein Ende haben, und was wird sein, wenn sie vergangen ist? Wozu hat mich Gott geschaffen, und was soll ich hier auf Erden? Wird mit dem Tode mein Dasein aufhören oder giebt es ein Jenseits? – So klang es beständig in meinem Innern. Schon als Kind fragte ich einst meine älteste Schwester: „Sage mir, was ist Gott, wie sieht er aus, und wo ist er?“ Sie antwortete mir kurz: „Gott ist ein heiliger Geist, der im Himmel wohnt.“ Als ich sie aber quälte, diesen Geist mir genau auszumalen, lachte sie mich aus, und sagte endlich: „Ich kann Ihn dir nicht beschreiben, Gott ist Gott, das ist alles!“ „Du bist unwissend“, sagte ich zu ihr, „was soll ich mit dir sprechen, so du diese Frage nicht beantworten kannst?“ Gern wollte ich diesen lieben Gott, von dem ich so viel Schönes erzählen hörte, näher kennen lernen. Mein Vater, meinte ich, müßte als Rabbiner doch mit Ihm
90
95
100
105
110
258
115
120
125
130
135
140
145
Aus dem Tagebuch eines bekehrten russischen Rabbiners
näher bekannt sein. Allein aus Furcht (Euch allen ist ja bekannt, wie streng mein Vater mich erzogen hat), wagte ich nicht, ihn zu fragen, und äußerte lieber meine unklaren Fragen meiner Mutter, die sanftmüthig in ihrem Benehmen gegen mich war. Doch auch von ihr bekam ich fast dieselbe Antwort, als von meiner Schwester. Ich wollte mich auch diesmal nicht damit zufrieden geben. Als sie mir aber versicherte, daß mir das Alles aus der Bibel und Gemara klar werden würde, wurde ich ruhiger. Das müssen doch köstliche Bücher sein, dachte ich, da darin Alles zu finden ist, sogar den lieben Gott kann man endlich sehen, wenn man viel Kabbala57 gelernt hat, wie mir gesagt worden ist. Endlich kam die erwünschte Stunde, da mein Vater mit mir die Bibel zu übersetzen anfing. Kaum hatte ich die ersten zwei Verse des ersten Capitels Mosis gelesen, so fragte ich meinen Vater: „Wer hat dies Buch geschrieben?“ „Moses“ war die Antwort. – „Wie konnte er es gewußt haben?“ – „Gott hat es ihm gesagt“ – „Was ist Gott?“ fragte Ich: – „Gott ist ein heiliger Geist, der die Welt geschaffen hat.“ – „Kann denn ein Geist mit einem Menschen reden?“ – „Ja wohl“, war die Antwort, „wenn er nur will.“ – Hier aber ist gesagt, daß der Geist Gottes auf dem Wasser schwebte; wahrscheinlich ist der Geist nicht Gott selbst. Ich erinnere mich noch jetzt, wie sehr sich mein Vater, und besonders mein Großpapa, über meinen scharfen Verstand freuten, und als der Erstere nun mit seiner Erklärung mir nicht genügte, versuchte der Letztere seinen Scharfsinn und seine Kenntnis der talmudischen traditionellen Auslegungen anzuwenden; allein, wie gesagt, ich konnte diese unfaßbaren Luftgebäude nicht fassen. „Du bist noch zu dumm,“ sagte mir mein Vater endlich, „dies Alles zu verstehen.“ – Als ich bemerkte, daß ich meinen Eltern mit derartigen Fragen Freude machte, warf ich nun solche öfter auf, bis es mir mein Vater endlich streng verbot: „Mit solchen Fragen kommst du mir nicht mehr,“ sagte er, „hörst du Junge?!“ – „Er will jetzt schon alles wissen, was wir nicht einmal wissen können,“ sagte er zum Großpapa; „in der Gemara wirst du Alles finden.“ Schon hatte ich die Bibel einige Male mit fast allen Kommentaren durchgearbeitet; schon hatte ich einige Mesichthot58 vom Talmud Babli59 mit allen Erklärungen behalten; aber mein Zweifel war noch nicht gehoben. Viele Stellen in der Bibel waren mir ein Räthsel. Und je mehr ich meine Zweifel durch Talmud und Midrasch zu erledigen suchte, desto stärker regten sie sich: Ja, ich muß gestehen, daß ich mir, als ich in einem Alter von 22 Jahren Rabbiner wurde, trotz meiner Kenntnisse im Talmud Babli und Jerusalme60, Midrasch61 und Sohar62 nicht die 57 Jüdische Mystik, in der unter anderem die Schau Gottes angestrebt wird. 58 Ungewöhnliche Bezeichnung für einzelne Traktate, die Unterteilungen der sechs Ordnungen der Mischna darstellen. 59 Babylonischer Talmud. 60 Jerusalemer Talmud. 61 Hauptgattung der jüdischen Auslegungsliteratur.
Aus dem Tagebuch eines bekehrten russischen Rabbiners
259
kleinste Frage meiner Kindheit gewissenhaft zu beantworten im Stande war. Ich forschte nun auch in den neuesten jüdischen Büchern, glaubte bei den gerühmten Verfassern unserer Zeit die Wahrheit zu finden, aber leider auch hier habe ich anstatt Honig Gift geschmeckt. Fragen und Zweifel sind überall zu finden, aber keine genügende Antwort; denn diese wollen Alles verwerfen, was sie nicht begreifen können63. Ich habe keinen Trost gefunden und habe mich für den unglücklichsten aller Menschen gehalten. Ja, wie bedauernswerth war ich besonders, wenn die einzelnen Schafe meiner Heerde zu mir kamen, ein Jeglicher die Unruhe seiner Seele, die Plage seines Herzens mir darzulegen, und wenn Jemand mich auf mein Gewissen fragte, was ich von dem Talmud halte, was konnte ich ihm antworten?! Als ich dann bemerkte, daß das neue Geschlecht das Kind mit dem Bade ausschütten, nämlich: die heilige Schrift mit dem Talmud zugleich verwerfen wolle, habe ich deshalb in meinen Vorträgen erklärt, daß die Bibel mit dem Talmud keineswegs zu vergleichen sei, daß, wenn Jemand an dem letzteren zweifle, er doch an der ersteren festhalten solle. Daraus entstand die Empörung der Gemeinde in W. [Wilkomir R.H.] gegen mich, wie solches Euch bewußt ist64. Wie sehr heilig war und ist mir die Bibel, und wie habe ich mich bemüht, den Unterschied zwischen Bibel und Talmud zu erklären! Dennoch konnte ich es nicht so, daß jeder Gegner sich gefangen geben mußte, weil in der Bibel selbst auch mir alle messianischen Stellen noch dunkel waren. Ich hob meine Augen auf zu den Bergen: „Von wo kommt meine Hülfe? Siehe, meine Hülfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat!65“
62 Sefer ha-Zohar, Hauptschrift der Kabbala, der jüdischen Mystik. 63 Gurland grenzt sich hier von der „Haskala“, der jüdischen Aufklärungsbewegung seiner Zeit ab. Zur Haskala vgl. Jacob Katz, Aus dem Ghetto in die bürgerliche Gesellschaft. Jüdische Emanzipation 1770–1870, Frankfurt 1986, 140–178. Katz charakterisiert die Spannungen zwischen aufklärerischen Reformern und orthodoxen Frommen folgendermaßen (159): „Die Lossagung einer Minderheit der jüdischen Gesellschaft vom traditionellen Leben und – mehr noch – der Versuch, ihre Ansichten der gesamten jüdischen Gesellschaft aufzuzwingen, muß für diese verwirrend und empörend gewesen sein. Reichliches geschichtliches Beweismaterial verbürgt es, daß die Traditionalisten den Wandel in der jüdischen wie nichtjüdischen Gesellschaft in der Tat als katastrophal empfanden“. 64 Gurland hatte 1854 das Rabbineramt in Wilkomir von seinem Schwiegervater übernommen. Im Januar 1855 spitzte sich der Konflikt mit der Gemeinde soweit zu, daß er am 14. 1. 1855 vor den Oberrabbiner in Wilna zitiert wurde. Er übte trotz weiteren Anfeindungen sein Amt bis zum 24. 1. 1857 aus, als er es schließlich freiwillig niederlegte. In zwei Welten (Anm. 24), 55–65. 65 Ps 121,1+2. Diesen Psalm hatte Gurland auch bei seinem Abschied aus Wilkomir als Trost gelesen. Vgl. In zwei Welten (Anm. 24), 65.
150
155
160
165
170
260 4.
175
180
185
190
195
Aus dem Tagebuch eines bekehrten russischen Rabbiners
Welche Autorität hat der Talmud?
Ich: Ich will nicht sagen, daß der Talmud gar keinen Werth hat, daß keine Spur der Wahrheit darinnen vorhanden ist; nein, ich gestehe gern, in fast jeder Stelle seien mehr oder weniger helle Strahlen des Lichts zu bemerken, niemals aber das Licht selber. Ueberall tritt dem aufmerksamen Leser verhüllter oder offener das Sehnen und Streben nach Wahrheit entgegen, nirgends aber wird er die Wahrheit selbst finden. Wie wäre das auch möglich? Sollte sich Gott der Herr zur Offenbarung seiner Wahrheit s o l c h e r L e u t e als seiner Werkzeuge bedienen, die auf ihren eigenen Scharfsinn pochen, auf ihre Klugheit bauen, die maaßlosen Werth auf ihre eigene Lehre legen, vielmehr als auf Gottes Wort? Nimmermehr; hier gilt: „Ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen“66 . Und die Talmudisten halten sich in der That selbst für weise, denn sie wagen es, ihre Lehren denen des Wortes Gottes gleich, ja darüber zu stellen, denn in Berachot Fol. 4, Colon 2 heißt es: „Wer übertritt die Worte der S c h r i f t , ist ein O p f e r (chatas67) schuldig, wer aber übertritt die Worte der Weisen, ist des To d e s schuldig“; oder Chagiga Fol. 10 Colon 1 lesen wir: Raf 68 hat gesagt: „Wenn der Mensch aus dem Halachah, d. h. Tradition, zum Studium der heiligen Schrift übergeht, so hat er keinen Frieden mehr“69. Wie hoch die Talmudisten von sich halten, dafür liefert das auch einen deutlichen Beweis, wenn man liest, wie ein Talmudist dem Anderen die fabelhaftesten und außerordentlich zahlreichen Wunder nachrühmt. Auf ihr Wort stauten sich die Wasser der Flüsse, daß sie trockenen Fußes hindurch gehen konnten. Ihren Befehlen waren die Wolken des Himmels unterthan und ließen ihre Gewässer herabströmen. Ein Wink ihrer Hand, ein Wort ihres Mundes genügte und Schleusen des Himmels schlossen sich70. Sie waren die Herren des Todes: als Beweis lasse ich die Geschichte vom Kaiser Antonius und dem Rabbi hakodesch71 reden72. Sie stritten mit Gott und siegten, wie Bobemezic ruhmredig erzählt73. Dennoch stellten sie sich als Muster der Demuth, Wahrheit und Tugend auf. 66 1. Kor 1,19, in Aufnahme von Jes 29,14 (LXX). 67 ( )חטאהBiblisches Sündopfer z. B. Lev 6,18–23. 68 Rabbi Arikha, genannt „Rab“, gesprochen „Raw“, daher hier wohl die Schreibweise „Raf“. In den späteren Ausgaben des Textes zu „Rab“ korrigiert. 69 bChag 10a „Rabh sagte: Sobald jemand von der Halakah fortgeht, so gibt es für ihn keinen Frieden mehr“. 70 Die zahlreichen Wundergeschichten von Rabbinen, die es regnen ließen oder Regen stoppten, sind gesammelt in bTan 23a–25b. 71 Rabbi Jehuda ha-Nasi lebte am Anfang des 3. Jahrhunderts, Patriarch und Redaktor der Mischna. 72 Die Geschichte der Totenauferweckung durch R. Jehuda ha-Nasi ist überliefert in bAZ 10a. Seine guten Beziehungen zu den Römern drücken sich in einem ganzen Sagenkreis um „Antonius und den Rabbi“ aus. Die Erzählungen sind gesammelt bei S. Krauss, Antonius und der Rabbi, Wien 1910.
Aus dem Tagebuch eines bekehrten russischen Rabbiners
261
Urtheilt selbst danach, meine Lieben, ob ich zu viel sage, wenn ich behaupte, daß 200 der Talmud neben den Strahlen des Lichtes, die sich noch in ihm finden, viel, viel Lug, Trug und Unsinn enthalte, wie alle anderen Bücher, die von Menschen herrühren. Freudig erkenne ich aber zugleich, daß das Wort Gottes wahr, lauter und rein ist und bleiben wird, denn es ist das Wort des wahrhaftigen und ewigen Gottes: „Dein Wort ist die rechte Lehre, H e i l i g k e i t ist die Zierde deines 205 Hauses ewiglich:“ Ps 93,5. N.N.: Wir dürfen uns über die Ueberlieferungen unserer Rabbiner kein Urtheil anmaßen. Der weise Salomo sagt: „Wer sich auf sein Herz verläßt, der ist ein Narr“ (Sprüche 28,26) (vgl. auch Jer 17,974), Und darum sagt uns der weise Maimonides75: „All unser Wissen geht darauf hinaus, daß wir n i c h t wissen, 210 daher müssen wir uns bescheiden und blindlings den alten Vätern folgen.“76 5.
Gotteswort und Menschenwort
Ich: Aber ich finde keine Stelle in der Schrift, die euch verpflichtet, die Lehren der Väter als Gottes Wort anzusehen, und doch könnte man nur dann ein blindes Folgen verlangen, nur dann befehlen, die Vernunft gefangenzunehmen. Das 215 erkenne ich gern an, daß unsere Vernunft, so hoch sie gepriesen wird, doch nur sehr klein ist und wenig taugt, wenn wir sie als Maaßstab für überirdische, göttliche Dinge anlegen wollten. Ist sie doch so oft nicht im Stande, sich Erscheinungen der sichtbaren Welt zu erklären, oft die gewöhnlichsten nicht. Aber alles hat seine Grenzen. Wenn diese sogenannten Väter z. B. gesagt hätten: 2 x 2 = 5, 220 daß wir dann wie Papageien nachsprechen 2 x 2 = 5 und unsere Vernunft gefangen 73 bBM 59b Am Ende eines Streitgesprächs zwischen Rabbi Eli’ezer und anderen Rabbinen, wird geschildert, daß Gott, der auf Seiten Rabbi Eli’ezers eingegriffen habe, durch die Argumente Rabbi Jehoschuas besiegt wurde. Daraufhin heißt es: „Der Heilige, gepriesen sei er […] schmunzelte und sprach: meine Kinder haben mich besiegt, meine Kinder haben mich besiegt.“ Gurlands Ausdruck „Bobemezic“, ist nur in den ersten beiden Druckfassungen belegt. Die beiden späteren Ausgaben lesen den Namen des Talmudtraktates in der vertrauten Form „Baba Mezia“. Gurlands Wortwahl ermöglicht ein Wortspiel mit „Bobe-Mayse“, dem jiddischen Ausdruck für eine unglaubliche Geschichte. Er geht zurück auf die Jiddische Fassung des italienischen Romans „Bouvo d’Antona“. Als Titel wurde im Jiddischen „Bouve-Mayse“ gewählt, die sprachliche Nähe zu „Bobe-Mayse“ liegt auf der Hand. „Bobe-Mayse“ wurde jiddischer terminus technicus für eine „Großmuttergeschichte“ – im Deutschen vielleicht besser als „Ammenmärchen“ wiedergegeben. Dazu vgl. Art. Bobe-Mayse in: EJ 4 (1971), 1115. Dieses Wortspiel ist aber in einem hochdeutschen Kontext nicht mehr erkennbar. Deshalb wurde hier in den späteren Ausgaben konjiziert. 74 Jer 17,9 „Es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding, wer kann es ergründen?“ 75 Mose ben Maimon, geb. 30. 3. 1135 in Córdoba, gest. 13. 12. 1204 in Fostat bei Kairo. Einer der bedeutendsten rabbinischen Gelehrten und jüdischen Philosophen des Mittelalters. 76 Das Zitat konnte bisher nicht verifiziert werden. Es ist fraglich, ob Maimonides nach dem Gedanken einer docta ignorantia so unvermittelt einen Rückgriff auf die Tradition propagieren würde.
262
225
230
235
240
245
250
Aus dem Tagebuch eines bekehrten russischen Rabbiners
nehmen sollen unter diese Unvernunft der Talmudisten, das ist zu viel verlangt. Noch dazu wenn wir sehen, wie diese Weisen untereinander selbst im Widerspruche stehn. Beth Hillel sagt z. B. „mather“ d. h. es ist erlaubt, Beth Schamai sagt „Osser“ d. h. es ist verboten77, dennoch heißt es Ele woele divrei Elohim chaim78, d. h. dieses wie jenes sind dennoch Worte des lebendigen Gottes. So offenbarem Widerspruch kann ich mich nicht blindlings unterwerfen, noch viel weniger aber verlangen, daß Andere m e i n e Worte u n f e h l b a r anerkennen sollten. Bin ich nicht ein armer Mensch und kleben mir Irrthum und Fehler nicht täglich an? Das ist der richtige Platz, den man der Vernunft nach meiner Meinung einräumen darf, daß wir sie das Mittel und Werkzeug sein lassen, das göttliche Wort in uns aufzunehmen, wie das Auge das Werkzeug ist, durch das wir das Licht schauen. So wenig aber das Auge die Sonne selbst ist, so wenig ist die Vernunft die Wahrheit selbst, noch die Quelle, aus der die Wahrheit fließt, oder aus der wir Wahrheit schöpfen können. Nie dürfen wir uns also in göttlichen und übernatürlichen Dingen allein von der Vernunft leiten lassen. Trotzdem brauchen wir aber eine Quelle, aus der wir stets die lautere Wahrheit schöpfen können, einen Stein, an dem wir die Echtheit des Goldes probiren, denn nimmermehr kann es Gottes Wille sein, uns über die höchsten und wichtigsten Dinge, von denen Leben und Tod abhängt, im Unklaren und Ungewissen zu lassen. Und allerdings haben wir diese Quelle, die ewig lauter und helle fließt, das Wort, das feste Wort Gottes, wovon schon David sang (Ps 36,10): „Bei dir (Gott) ist die lebendige Quelle, und in deinem Lichte sehen wir das Licht.“ Zurück also, Geliebte, zurück zu diesem lauteren Borne, zurück zu Mose und den Propheten! Wir aber haben uns von diesem hellen Lichte gewandt und wandeln im Finstern, während die Heiden in hellen Haufen ihm entgegen jauchzen. Wir haben unsere Krone selbst uns vom Haupte gerissen, als wir unsern großen König, nach dem unsere Erzväter sich längst gesehnt, verwarfen und ihn den Heiden überantworteten. Die Heiden wandeln nun im Lichte und wir, das Volk der Wahl Gottes, schmachten im Todesschatten. Wollen wir denn nun noch ferne stehen und nicht in der Schrift
77 Die Schule Hillels (Beth Hillel) und die Schule Schammais (Beth Schamai) sind zwei unterschiedliche Auslegungstraditionen aus dem pharisäischen Judentum des 1. und 2. Jahrhunderts. Sie gehen auf die namengebenden Rabbinen Hillel und Schammai zurück. Die beiden Schulen unterscheiden sich dadurch, daß die Schule Hillels zumeist milder entscheidet als die strengere Schule Schammais. Die Schule Hillels hat sich im Wesentlichen durchgesetzt, trotzdem sind in der Mischna die widersprechenden Meinungen der jeweils anderen Schule aufgezeichnet worden. Das ist eines der wesentlichen Kennzeichen rabbinischer Literatur. Die Diskussion wird festgehalten und auch die unterlegenen Gesprächspartner werden in den Prozeß der Überlieferung aufgenommen. Anders in der christlichen Literatur der Antike. Die Schriften von „Ketzern“ werden vernichtet und können heute häufig nicht einmal mehr rekonstruiert werden. 78 Kursiviertes im Original in lateinischen Buchstaben.
Aus dem Tagebuch eines bekehrten russischen Rabbiners
263
forschen, daß die Todtengebeine wieder frischer Lebenssaft durchdringe, wie Hesekiel verheißt? (Hes 3779). N.N.: Sie sind ziemlich eingenommen von sich selbst, wenn Sie behaupten, jetzt den wahren Grund gefunden zu haben, während unsere großen Rabbiner alle in der Irre gegangen sein sollen. Verdenken Sie es uns nicht, wenn wir lieber dem Talmud als Ihnen glauben. Ist aber wirklich etwas in diesen heiligen Schriften dunkel und unverständlich, so geben uns ja unsere späteren Rabbiner Aufschluß darüber. Ich: Das Letzte ist eine Behauptung, der ich nicht beistimmen kann. Unter allen Commentaren, die ich bis heute kenne, finde ich keinen einzigen, der die vielen Widersprüche und Unklarheiten zu ordnen und in das rechte Licht zu setzen vermöchte. Viele solcher unerklärten Stellen aufzuführen, würde zu weitläufig sein, aber doch einige hier als Beispiele. Ueber 1. Mose 3,1 heißt es: „Und die Schlange war listig.“ Wohin zielt das? Es soll das Folgende, „Gott machte dem Adam und seinem Weibe Kleider aus Fellen, womit sie sich bedeckten“80 erklären. Die Schrift lehrt also hier, aus welcher Veranlassung die Schlange herbeigekommen sei, nämlich: „S i e s a h s i e n a c k e n d u n d e n t b r a n n t e d a h e r g e g e n s i e “81 – Oder 1. Mose 12,14: „Und als Abraham nach Aegypten kam.“ „Moses hätte schreiben sollen, als sie nach Aegypten kamen (Abraham und Sara), aber er will hiermit anzeigen, daß Abraham die Sara i n e i n e r K i s t e v e r b o r g e n h a t t e und daß die Aegypter, die diese Kiste öffneten, um den üblichen Zoll zu erheben, sie sahen82. Aehnliche Stellen gibt es noch viele. Diese und ähnliche Stellen sind es, die auf die schamloseste und anstößigste Weise commentiert sind, besonders von Rabbi Salomon Jarichi83, jenem großen Rabbiner, dessen Commentare noch heute für so heilig bei uns gehalten werden, daß man sie der heiligen Schrift gleich achtet; ja manche Prediger benutzen sie noch heute zu Texten und Belegstellen in ihren Predigten. Mein Gewissen verbietet mir das, denn ich weiß gewiß, daß eine Schrift, die voll von Widersprüchen 79 Ez 37,1–14. 80 Gen 3,21. 81 Raschis Pentateuchkommentar, übers. u. hg. v. Selig Bamberger, Hamburg 1922, 9: „3,1. Die Schlange war listiger, (Ber. rab.) wieso kommt dieser Abschnitt hierher, er hätte anschließen sollen, Er machte für den Menschen und seine Frau Röcke aus Fell und bekleidete sie; er lehrt dich jedoch, aus welchem Plan heraus die Schlange sie überfiel. Sie sah sie nackt und vor dem Auge aller dem Eheleben hingegeben, da wurde sie lüstern nach der Frau“. 82 Raschis Pentateuchkommentar, übers. u. hg. v. Selig Bamberger, Hamburg 1922, 31: „Als Abram nach Mizraim [hebräisch für Ägypten, R.H.] kam; er hätte sagen müssen, als sie nach Mizraim kamen; nur er lehrt, daß er sie in einem Behälter verbarg und jene dadurch, daß sie den Zoll verlangten, ihn öffneten und sie sahen (Ber. rab.)“. 83 Salomo ben Isaak, genannt Raschi geb. 1040 in Troyes, gest. 13. 7. 1107 in Troyes. Schöpfer des bedeutendsten Kommentarwerkes zur Hebräischen Bibel und zum Talmud.
255
260
265
270
275
264 280
285
290
295
300
305
310
Aus dem Tagebuch eines bekehrten russischen Rabbiners
und abgeschmackten schamlosen Erklärungen ist, nicht Gottes Wort sein kann. Ach, daß unser blindes Volk das doch erkennen möchte! Warum nehmen wir nicht Gottes Wort mit einem freien und einfältigen Herzen auf ? O, wir würden es besser verstehen, als mit vielen vielgerühmten Commentaren, die doch mehr verdunkeln als erklären, tausend Zweifel erregen und keinen einzigen heben. Aber leider sind wir von Jugend auf gewöhnt, diese Menschensatzungen als Gottes Wort anzusehen und wagen aus abergläubischer Furcht und unklarer Scheu nicht, über diese oder jene Bibelstelle nüchtern und ruhig vor Gott nachzudenken. N.N.: Aber Sie haben doch selbst gesagt, wir dürfen uns auf unseren Verstand nicht verlassen. Wie wagen Sie es jetzt, über unsere alten Väter abzuurtheilen? Ich: Nicht ohne Grund würden Sie mich der Anmaßung zeihen, wenn ich nach meinem Verstande mich unterstände, mich über die alten Väter mißbilligend und mißtrauisch zu äußern. Ich bin ein Mensch und als solcher dem Irrthume unterworfen. Doch ich habe einen bessern Prüfstein, als meine Vernunft, und der ist das wahre und wahrhaftige Wort Gottes, wie es der Herr seinen Knechten Mose und den Propheten geoffenbart hat, und ich meine, es ist eine heilige Pflicht für einen jeden Sohn Abrahams, Gottes Wort und Menschenwort84 zu unterscheiden. Menschenwort aber ist alles das, was nicht mit Gottes Wort übereinstimmt, oder mehr wissen will, als uns im Worte Gottes geoffenbaret ist, und jedes Wort, was sich für Gottes Wort ausgiebt, und ist es doch nicht, das sei verflucht85. Ein Gericht Gottes ist es für unser Volk, daß es sich so von blinden Leitern86 muß in die Irre führen lassen, denn der Herr spricht: „Ich will auch mit diesem Volke wunderlich umgehen, auf ’s Wunderlichste und Seltsamste, daß die Weisheit seiner Weisen untergehe und der Verstand seiner Klugen verblendet werde (Jes 29,14, vgl. auch Jer 9,22,23 und 8,7,8). N.N.: Diese Stellen müssen Sie auf sich und Ihre verderbliche Lehre beziehen und wohl beherzigen, daß mit welcherlei Augen man eine Schrift betrachtet, so sieht sie aus. Uns ist nichts heiliger als der Talmud. Ich: Ist Euch denn auch das heilig, was der Rabbi Bechai fabelt (Fol. 4.)?87 Er sagt, Gott habe eine Sünde begangen, weil der den Mond nicht so groß geschaffen, wie 84 Das ist eine typische Denkfigur der evangelischen Theologie und als solche dem rabbinischen Judentum fremd. Der Maßstab zur Beurteilung des Wahrheitsgehaltes von Texten ist durch die Tradition gegeben. 85 Vgl. Gal 1,8 „Aber auch wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein Evangelium predigen würde, das anders ist, als wir es euch gepredigt haben, der sei verflucht.“ 86 Vgl. Mt 15,14 „Laßt sie, sie sind blinde Blindenführer!“ und Röm 2,17–19 „Wenn du dich aber Jude nennst und verläßt dich aufs Gesetz und rühmst dich Gottes und kennst seinen Willen und prüfst, weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist, was das Beste zu tun sei, und maßt dir an, ein Leiter der Blinden zu sein, ein Licht derer, die in der Finsternis sind.“ 87 Weder der Rabbinenname noch die zitierte Quelle sind mit Sicherheit zu identifizieren. Unter Umständen geht die Anspielung auf R. Berachja zurück, der in BerR zu Gen 1,14 mit der
Aus dem Tagebuch eines bekehrten russischen Rabbiners
265
die Sonne, und es 1. Mose 1 doch heiße, Gott habe zwei große Lichter geschaffen. Und weil Gott an dem Monde gesündigt, so habe er Israel befohlen, für seine Sünde ein Versöhnopfer zu bringen88. Wir begnügen uns jetzt mit einem Gebete, welches wir alle Neumond beten, weil wir jetzt ohne Heiligtum und Leibrock sind. Ist das eine heilige Schrift, die Gott den Heiligen in Israel selbst zum Sünder 315 macht? Schmach über unser Volk, das sich so bethören läßt und das helle Licht nicht sehen mag, sich lieber ergötzt an der Finsternis, die Gott, der da sagt: Ich bin heilig,89 und vor dem sich die reinen Himmelsheere in Demuth bedecken, als Sünder kennzeichnet, ja ihn als G r u n d aller Sünde hinstellt, wie der Talmud lästert (Barachot Fol. 32 „Gott ist die Ursache aller Sünde“) und es aus Jer 14,6, 320 Mich 4,6 und Hes 36, 26.27 beweisen will90. N.N.: Nein! Das hätten wir doch nicht geglaubt, daß Sie so frech sein könnten, unsern heiligen Glauben so schonungslos zu brechen. Ihre Worte dringen wie feindliche Pfeile in unsere Herzen wie Salomo sagt (Spr. 26,22); aber Sie sind nicht der Erste, Israel hat solcher Verderber viele gehabt. Aber auch solcher Klugen 325 Äußerung erwähnt ist: „Nach R. Berachja im Namen des R. Simon sind Sonne und Mond zugleich zum Leuchten erschaffen worden, denn es heißt: ‚Sie sollen zu Lichtern sein‘, weshalb sie Gott an die Veste der Himmel stellte“. Die referierte rabbinische Diskussion hingegen stammt aus bHul 50b (s. u.). 88 bHul 60b „R. Schim’on b. Pazi wies auf einen Widerspruch hin: es heißt: Gott machte die zwei großen Leuchten [Gen 1,16], und dagegen heißt es: die große Leuchte etc. und die kleine Leuchte!? [dto.] Der Mond sprach vor dem heiligen, gepriesen sei er: Herr der Welt, ist es denn angängig, daß zwei Könige sich e i n e r Krone bedienen? Er erwiderte ihm: Geh hin und vermindere dich. Hierauf sprach er vor ihm: Herr der Welt, soll ich mich deshalb vermindern, weil ich vor dier eine richtige Sache gesprochen habe!? Er erwiderte ihm: So geh hin und herrsche bei Tag und Nacht. Er sprach: Was ist dies für ein Vorzug, was nützt eine Leuchte am Mittag!? Da sprach er zu ihm: Geh die Jisraeliten sollen nach dir Tage und Jahre berechnen. Er sprach: Die Jahreszeiten sind ja nicht ohne die Sonne zu berechnen!? So heißt es: sie sollen zu Zeichen, zu Zeitbestimmungen, zu Tagen und Jahren sein [Gen 1,14]. – Geh, nach dir sollen die Frommen benant werden: Jaqob der Kleine, Schemuel der Kleine, David der Kleine. Als der Heilige, gepriesen sei er, sah, daß ihn dies nicht beruhigte, sprach er: Bringet für mich ein Sühnopfer dar, weil ich den Mond verkleinert habe. Das ist es, was R. Schim’on b. Laqisch sagte: Womit ist der Ziegenbock des Neumondes anders [vgl. Num 28,15], daß es bei diesem heißt: für den Herrn? Der Heilige, gepriesen sei er, sprach: Dieser Bock soll mir Sühne schaffen dafür, daß ich den Mond verkleinert habe“. 89 Lev 19,2. 90 Die Aussage „Gott ist die Ursache aller Sünde“ findet sich nicht in bBer 32. Am Übergang von fol. 31b zu 32a findet sich eine Diskussion um die angegebenen Bibelstellen: „Ferner sagte R.Eleazar: Elijahu hat Worte gegen oben ausgestoßen, denn es heißt: und du hast ihr Herz rückwärts gewendet [1Kön 18,37]. R.Schemuel b. R. Jizchaq sagte: Woher, daß der Heilige, gepriesen sei er, zurückgetreten und Elijahu zugestimmt hat? – es heißt: und dem ich Böses getan habe [Mi 4,6]. Auch sagte R.Chama b. R. Chanina: Wenn nicht folgende drei Schriftverse, würden die Füße (der Feinde) Jisraels gewankt haben. Einer lautet: Dem ich Böses getan habe [Mi 4,6]. Einer lautet: Siehe, wie der Ton in der Hand des Töpfers, so seid ihr in meiner Hand, Haus Jisrael [Jer 18,6]. Und einer lautet: Ich entferne das steinerne Herz aus eurem Leibe und gebe euch ein fleischernes Herz [Ez 36,26]“.
266
Aus dem Tagebuch eines bekehrten russischen Rabbiners
Viele überlebt, wie Erter91, Ginsburg92, Lebensohn93 u. dgl. Israel bleibt dennoch seinem Glauben treu – die Spötter aber vergehen! 6.
Jesus ist der Messias Israels
Ich: Sie täuschen sich, liebe Brüder, wenn Sie meinen, daß ich Spott oder Scherz 330 treibe; ich begreife nicht, wie Sie denken können, daß man bei einer so ernsten Sache überhaupt seinen Scherz treiben könne. Ich meine, wir hätten vielmehr Ursache zu klagen und blutige Tränen zu weinen, wenn wir den elenden Zustand Israel betrachten. Israel ist ja so krank, daß es nicht mehr seine todtbringende Krankheit fühlt. – Wie muß das Herz eines wahren Israeliten bluten, wenn er 94 335 seine Brüder wie verirrte Schafe ohne Hirten in der Wüste zerstreut sieht, – wie tausend und aber tausend Seelen täglich in ihrem Unglauben verloren gehen95 – das ist doch wahrlich nicht zum Lachen. Und anstatt Sie auf mich die Worte Spr Salom 26,22 anwenden wollen96, können Sie Spr 18,1497 auf sich selbst anzu91 Izhak Erter (1792–1851), Satiriker aus Galizien, Er gehört zur „Haskala“, der innerjüdischen Variante der europäischen Aufklärung. Er prangerte überkommene Zustände an und kritisierte dabei Orthodoxe wie Chassidim gleichermaßen. Er forderte Reformen des Bildungssystems, die Pflege der hebräischen Sprache und den Übergang der jüdischen Bevölkerung Galiziens zur Landwirtschaft. Zu Erter vgl. B. Suler, Erter, Isaak in: EJ(D) 6 (1930), 734–735. 92 Christian David Ginsburg (1831–1914), im gleichen Jahr wie Rudolf Gurland in Warschau geborener Bibelwissenschaftler. Er trat im Alter von fünfzehn Jahren zum Christentum über (1846) und übersiedelte nach England. Er widmete sich ab 1855 intensiven Studien zum masoretischen Text der hebräischen Bibel. Vgl. A. Spanier, Ginsburg, Christian David, in: EJ(D) 7 (1931) 422–423. 93 Isaak Bär Levinsohn (1788–1860), war als Lehrer und Schriftsteller einer der wichtigsten Vorkämpfer der Haskala in Rußland. Er genoß die Protektion des Zaren und verfaßte neben lehrhaften Schriften und Angriffen auf die Chassidim auch eine Auseinandersetzung mit dem Christentum Achija Schiloni ha-Chose (Leipzig 1864). Vgl. M. E. Jernensky, Levinsohn, Isaak Baer, in: EJ(D) 10 (1934), 877–881 und Semen Dubnow, History of the Jews in Russia and Poland, Bd. 2, Philadelphia 1918, 125ff. 94 Dazu gibt es eine große Anzahl biblischer Stellen, die davon sprechen, daß Israel oder später dann auch die aus Juden und Heiden bestehende christliche Gemeinde sei „wie verirrte Schafe“, z. B. Jes 53,6 „Wir gingen alle in die Irre wie Schafe.“ Dieser Text spielte in den Bemühungen der pietistischen Judenmission stets eine zentrale Rolle. Es ist durchaus möglich, daß die Anspielung Gurlands auf Jes 53,6 zurückgeht. Es kämen aber auch neutestamentliche Stellen in Frage, wie z. B.: Mt 9,36 „Und als er [Jesus] das Volk sah, jammerte es ihn; denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben“; Mt 15,24 „Er [Jesus] antwortete aber und sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel“; 1Petr 2,25 „Denn ihr wart wie die irrenden Schafe; aber ihr seid nun bekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen.“ 95 Wichtiges Grundmotiv der pietistischen Missionsbemühungen: Rettung der „verlorenen Seelen“. 96 S. o. Z. 342. 97 Spr 18,14 „Wer ein mutiges Herz hat, weiß sich auch im Leiden zu halten; wenn aber der Mut daniederliegt, wer kann’s tragen?“
Aus dem Tagebuch eines bekehrten russischen Rabbiners
267
wenden versuchen. – Nein, meine Freunde, zu den von Ihnen genannten Kritikern bitte ich mich nicht zu zählen (1. Mose 49,5)98. Diese haben wirklich in ihren 340 Verfassungen99 den Glauben untergraben100. Wenn sie zwar wider den Talmud und den damit verbundenen Fanatismus ganz mit Recht gestritten haben, so muß man doch gestehen, daß sie durch die Art ihrer Angriffe den Grund des Glaubens erschüttert, dem Materialismus wie dem Rationalismus bei Vielen die Thür geöffnet haben, indem sie ihnen zwar den fanatischen talmudischen 345 Glauben nahmen, aber ihnen den wahren lebendigen Glauben nicht zu bringen vermochten101. Ihr wißt aber und müßt es mir gestehen, daß ich bisher nicht zu denen gehörte, die weder warm noch kalt sind102; vielmehr könnt Ihr selber meine Zeugen sein für meinen bisherigen Wandel unter euch, und daß ich selbst in meiner Unwissenheit das Christentum verachtet, indem ich glaubte, daß ich für 350 Gottes Wort eiferte, – bis der nach seiner großen Barmherzigkeit sich meiner erbarmt103 und die Decke Mosis von meinen Augen weggenommen hat104. Gelobt 98 Gen 49,5 „Die Brüder Simeon und Levi, ihre Schwerter sind mörderische Waffen.“ 99 D. h. Veröffentlichungen. 100 Gurland grenzt sich hier von den aufklärerischen Strömungen im Judentum seiner Zeit ab. Das korreliert einer kritischen Haltung gegenüber der Aufklärung, die sich im zeitgenössischen Protestantismus in der Erweckungsbewegung Bahn bricht. Sein christlicher Mentor Rudolph Faltin ist hier wahrscheinlich das Bindeglied. 101 Innerhalb des Judentums gab es auch in Rußland in der Mitte des 19. Jahrhunderts heftige Auseinandersetzungen zwischen Anhängern der „Haskala“ einerseits und dem Chassidismus sowie den orthodoxen Juden andererseits. Gurland grenzt sich von beiden Bewegungen ab und zeigt sich so als orthodoxer Theologe. Er teilt die religiöse Kritik an den aufklärerischen Bestrebungen der „Maskilim“ (den Vertretern der „Haskala“), die zum Teil ausgesprochen antireligiösen Charakter hatten. 102 Offb 3,15 „Ich kenne deine Werke, daß du weder kalt noch warm bist. Ach, daß du kalt oder warm wärest!“ 103 1 Petr 1,3 „Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat.“ 104 Dieses Bild ist für die Judenmission und das damit verbundene christliche Verständnis des Alten Testaments zentral. Es geht zurück auf die Schilderung der Wirkung der Theophanie auf Mose. Moses Gesicht strahlte so stark, daß er es im Kontakt mit dem Volk verhüllen mußte: Ex 34,33–35 „Und als er [Mose] dies alles mit ihnen geredet hatte, legte er eine Decke auf sein Angesicht. Und wenn er hineinging vor den Herrn, um mit ihm zu reden, tat er die Decke ab, bis er wieder herausging. Und wenn er herauskam und zu den Israeliten redete, was ihm geboten war, sahen die Israeliten, wie die Haut seines Angesichts glänzte. Dann tat er die Decke auf sein Angesicht, bis er wieder hineinging um mit ihm zu reden.“ Dieses Motiv nimmt Paulus wieder auf, und beschreibt seine Hoffnung auf eine Bekehrung Israels mit dem Bild der Decke, die von ihren Augen weggenommen wird: 2. Kor 3,12–16 „Weil wir nun solche Hoffnung haben, sind wir voll großer Zuversicht und tun nicht wie Mose, der eine Decke vor sein Angesicht hängte, damit die Israeliten nicht sehen konnten das Ende der Herrlichkeit, die aufhört. Aber ihre Sinne wurden verstockt. Denn bis auf den heutigen Tag bleibt diese Decke unaufgedeckt über dem Alten Testament, wenn sie es lesen, weil sie nur durch Christus abgetan wird. Aber bis auf den heutigen Tag, wenn Mose gelesen wird, hängt die Decke vor ihrem Herzen. Wenn aber Israel sich bekehrt zu dem Herrn, so wird die Decke abgetan.“
268
355
360
365
370
375
Aus dem Tagebuch eines bekehrten russischen Rabbiners
sei Gott, der mir meine blinden Augen geöffnet hat, meinen Erlöser und Messias in Seinem heiligen Worte mich hat finden lassen. Alle Stellen, die mir dunkel waren, sind mir jetzt klar geworden, denn siehe, der Morgenstern ist auch mir aufgegangen105. Ich breche also nicht, wie Ihr meinet, den Glauben, sondern ich will streiten für den wahren Glauben Israels, den Ihr selbst zu haben wünschet, der Euch aber fehlen wird, so lange Ihr Gotteswort von Menschenwort nicht unterscheidet. Nehmet nur den Stein des Anstoßes vom Wege der Gerechtigkeit weg106, und bittet Gott allein, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs im Ernst und in der Wahrheit, daß er Euch die Erkenntnis der einen Wahrheit in Seinem Worte schenken möge, so werdet Ihr Alle gewiß finden und sehen, was ich darin sah. Ich hoffe, daß Ihr mich nicht mißversteht und einseht, daß ich nur die Wahrheit und das Wohl Israels im Auge habe. Bei diesen Worten schien die Versammlung in großer Verlegenheit zu sein. Auf einigen Gesichtern zeigte sich ein tiefer Ernst, es war einige Minuten still; endlich sagte N.N. zu mir: Wir haben sehr viel Ursache zu klagen, daß wir ohne König, ohne Priester und ohne (Sanhedrin) Richter sind, sonst hätten Sie schon eine ernste Antwort erfahren, wie sie einem Verführer und Gotteslästerer gehört. Sie glauben uns fast besiegt zu haben, da man Ihnen nichts entgegnet? Nein, das sei ferne. Sie werden uns nicht auf die schwärmerischen Gedanken bringen, zu glauben, daß der verheißene Messias schon gekommen sei107; wir halten fest an dem talmudischen Glauben, daß er noch kommen wird. Wir bitten Sie daher, Ihre Rede abzubrechen, wir haben leider schon zu viel von Ihnen erfahren, was uns doch nicht zum Segen gereichen kann. Fest sind und bleiben die Worte unserer alten Rabbinen: „Jeder Gelehrte, der sich gegen ihre Worte widerspenstig zeigt, hat den Tod durch Erdrosseln zu erleiden.“108 Also, wenn es jemand wagte, ihre Auslegung zu be105 1 Petr 1,19 „Um so fester haben wir das prophetische Wort, und ihr tut gut daran, daß ihr darauf achtet als ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen.“ Offb 22,16 „Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch dies zu bezeugen für die Gemeinden. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der helle Morgenstern.“ 106 Kombination aus Spr 12,28 „Auf dem Weg der Gerechtigkeit ist Leben“ und Jes 57,14 „Räumt die Anstöße aus dem Weg“. 107 Messianische Bewegungen hat es auch innerhalb des Judentums gegeben. Für das osteuropäische Judentum ist vor allem die Bewegung, die von Sabbatai Zewi ausgelöst wurde, wichtig. 108 Anspielung auf Dt 17, 11 „An die Weisung, die sie dir geben, und an das Urteil, das sie dir sagen, sollst du dich halten, so daß du davon nicht abweichst weder zur Rechten noch zur Linken“. Für die rabbinische Auslegung ist mSan 11,1+2 zentral: „Folgende werden erdrosselt […] ein gegen die Entscheidung des (obersten) Gerichtshofes sich auflehnender Gelehrter“. Auf den Widerstand gegen rabbinische Anweisungen zielt mSan 11,3: „Die Auflehnung gegen die Worte der Schriftgelehrten ist eine schwerere Sünde als die gegen die Worte der Thora. Wer sagt: ‚es giebt keine Tephilinpflicht‘, um die Vorschriften der Thora zu
Aus dem Tagebuch eines bekehrten russischen Rabbiners
269
streiten, so ist er des Todes schuldig, wie unsere Chachamim109 von 5. Mose 17,11 beweisen: „Wenn er (nämlich der Chacham) von der rechten Hand sagt, sie sei die 380 linke, und von der linken, sie sei die rechte, so bist du (Israelit) bei Todesstrafe verpflichtet zu gehorchen.“110 Ein anderer: Wie können Sie täglich das Gebet dreimal beten, das da lautet111: „O daß die Verläumder keine Hoffnung haben, alle Bösewichter schnell vernichtet und alle muthwilligen Missethäter bald ausgerottet werden! Demüthige 385 du sie bald in unseren Tagen u.s.w.“112 wenn Sie selbst der Verführer, Verläumder und Verräther Israels sind?! 7.
Ungereimtheiten im Talmud
Ich: Hier bleibt der menschliche Verstand stehen, wenn man solches hört von Söhnen Abrahams, die sich für das auserwählte Volk halten. Ich muß mit David 390 klagen: „Wehe mir, daß ich ein Fremdling bin wie unter Mesech, ich muß wie unter den Hütten Kedars wohnen. Es wird meiner Seele b a n g e 113 zu wohnen bei denen, die den Frieden hassen. Ich spreche Frieden, sie aber sind zum Kriege bereit“ (Ps 120,5–7); und mit Jesaias 5,20ff.: „Wehe denen, die Böses gut und Gutes böse heißen, die aus Finsternis Licht, und aus Licht Finsternis machen 395
109 110
111 112
113
übertreten, ist nicht strafbar, wer aber sagt ‚es sind fünf Gehäuse nötig‘, um so den Worten der Schriftgelehrten etwas hinzuzufügen, ist schuldig“ zitiert nach Mischnajot. Die sechs Ordnungen der Mischna, IV Nesikin, übersetzt und erklärt von David Hoffmann, Basel 19863, 195–197. Der Mischnatraktat San 10 bzw 11 ist textkritisch schwierig, hier gibt es mehrere Textumstellungen und –ausfälle. Der gesamte Abschnitt mSan 11,3 ist nicht in der Neapolitaner Ausgabe zu finden. Dementsprechend schwierig ist die Diskussion im Talmud. In bSan 87a+88b wird der Fall des sich gegen den Gerichtsspruch auflehnenden Gelehrten aus mSan 11,1+3 besprochen und noch einmal der Unterschied zwischen der Auflehnung gegen die Tora und der Auflehung gegen die Auslegung der Schriftgelehrten eingeschärft. In bSan 99b begegnet dann auch noch die Gleichsetzung eines „Gottesleugners“ mit einem „der den Schriftgelehrten selbst verspottet“. Das ist der talmudische Hintergrund für Gurlands an dieser Stelle polemisch verkürzte Wiedergabe. Ehrentitel „Weise“. Anspielung auf Dt 17,10 „Du sollst tun nach dem, was sie dir sagen an der Stätte, die der Herr erwählen wird, und sollst es halten, daß du tust nach allem, was sie dich lehren werden“. In bSan 87a wird das durch die Auslegung von Rabbi Schim’on zugespitzt, der gehorsam gegenüber den Schriftgelehrten fordert egal, was sie gebieten: „Was sie dir sagen, von jener Stätte aus [Dt 17,10], auch irgend etwas“. Anmerkung im Text: Das ist einer von den 18 Segenssprüchen, welche drei Mal täglich in der Synagoge gebetet werden. Aus dem Achtzehnbittengebet: „Den Verleumdern sei keine Hoffnung, und alle Ruchlosen mögen im Augenblick untergehen, alle mögen sie rasch ausgerottet werden, und die Trotzigen schnell entwurzle, zerschmettre, wirf nieder und demütige sie schnell in unseren Tagen. Gelobt seist du, Ewiger, der du die Feinde zerbrichst und die Trotzigen demütigst“. Deutscher Text aus: Sidur Sefat emet, mit dt. Übersetzung von S. Bamberger, Basel 1978, 43. In der Lutherübersetzung „lang“.
270
400
405
410
415
420
Aus dem Tagebuch eines bekehrten russischen Rabbiners
u.s.w.“; und mit Jeremia: „Ich sehe und höre, daß sie nichts Rechtes lehren. Keiner ist, dem seine Bosheit leid wäre und spräche: Was mache ich doch? Sie laufen alle ihren Lauf, wie ein grimmiger Hengst im Streit. Mein Volk will das Recht des Herrn nicht wissen. Wie möget ihr doch sagen: Wir sind Weise, und haben Gottes Gesetz unter uns? Ist es doch eitel Lüge, was die Schriftgelehrten setzen; darum müssen solche Weise zu Schanden werden, erschrecken und gefangen werden; denn welche Weisheit ist in ihnen, da sie des Herrn Wort verworfen haben?“ (Jerem 8,6–9) Sind nicht diese und viele ähnliche Stellen der Propheten ein wahres Bild unserer Chachanim (Weisen)? Muß man nicht staunen, wenn man die Stellen hört, die Sie selbst aus dem Talmud angeführt haben, daß man es noch als Gottes Wort achtet, gar, wenn die sogenannten Chachanim mir heißen rechts links zu nennen, daß ich bei Todesstrafe verpflichtet sei, zu gehorchen? Wenn es durchaus gegen Gottes Wort ist, soll ich es doch annehmen? Dieselben haben nicht allein auf menschliche Urtheile über ihre Lehre die Todesstrafe gesetzt, sondern selbst Gottes Wort, die Bibel, fast verbannt, indem sie sagten: „Haltet fern eure Kinder von der Mikra“, d. h. Bibel. Daher kommt es, daß bei uns die hebräische Sprache so vergessen ist, daß wir unsere Kinder dieses göttlichen Schatzes berauben und statt dessen ihnen talmudische Spielzeuge reichen. Wir sehen jetzt die Folgen davon. Wenn der abhängige Knabe unabhängig wird und von der Gewalt des Fanatismus sich los macht, so wirft endlich der unterdrückte Geist die lästigen Zügel weg, verspottet den Talmud und Midrasch, und da er keinen Ersatz findet, so fällt er in die äußerste Verzweiflung. Was soll ein Kind denken, wenn es z. B. die Stelle in Barachot F. 7. liest: Gott betet täglich114, und hört den Beweis zu dieser Behauptung aus Jes 56,7 nehmen, da es heißt: „Ich will sie erfreuen in meinem Bethaus;“ und hört, Gottes Bethaus habe zu Salem gestanden, wie David sagt: „Zu Salem ist seine Hütte und seine Wohnung zu Zion?“115 Ber. Rab. F. 56116. Was muß ein Knabe denken, wenn ihm gesagt wird, Gott zieht beim täglichen Gebete Tephilim (Gebetsriemen) an, und erzählt wird, was in diesen göttlichen Tephilim geschrieben steht von Jes 62,3117? In 114 bBer 7a „R. Jochanan sagte im Namen R. Joses: Woher, daß der Heilige, gepriesen sei er, betet? – es heißt ich werde sie nach meinem heiligen Berge bringen und sie in m e i n e m Bethause erfreuen [Jes 56,7]. Es heißt nicht ‚i h r e m Bethause‘, sondern ‚m e i n e m Bethause‘ woraus zu entnehmen ist, daß der Heilige, gepriesen sei er, betet“. 115 Ps 76,3 „So entstand in Salem sein Zelt und seine Wohnung in Zion“. 116 BerR zu Gen 32,14 „Abraham nannte den Ort יראהs.hier und Gen 14,18, Schem nannte ihn Schalem ()שלם. Da sprach Gott: Wenn ich ihn יראהnenne, wie Abraham ihn nannte, so wird Schem, der Gerechte, darüber ungehalten sein, nenne ich ihn dagegen Schalem, so wird wieder Abraham der Gerechte, sich darüber beschweren, ich will ihn Jerusalem nennen, wie ihn beide genannt haben. [aus יראהund שלםzusammengesetzt]. R. Berachja sagte im Namen des R. Chelbo: Als der Ort noch Schalem hieß, hatte sich Gott daselbst eine Hütte gemacht, worin er Andacht verrichtete s. P 76,3“. 117 Jes 62,3 „Und du wirst sein eine schöne Krone in der Hand des Herrn und ein königlicher Reif in der Hand deines Gottes“.
Aus dem Tagebuch eines bekehrten russischen Rabbiners
271
Menachat F. 35, Col. 2 suchten die Rabbinen dies durch eine Stelle aus dem Gesetze zu begründen, nämlich durch 2. Mose 33, 23, wo es heißt: „Und wenn ich meine Hand von dir thue, wirst du mir hinten nach sehen“. Sie erzählen dazu, daß Gott, als er diese Worte gesprochen, den Knoten seiner Tephilim dem Moses selbst gezeigt habe118. Was soll man sagen, wenn Chagiga F. 5. steht: „Gott weinet jeden Tag, wenn er sich an die Zerstörung Jerusalems erinnert?119“ Er soll sogar einen besonderen Ort haben, der „Misstorim“120 heißt, dahin gehe er und weine um den Schmuck Israels, den die Völker von ihnen genommen haben etc. Baba Mezia F. 80 heißt es: Einst haben alle Engel und die ganze himmlische hohe Schule wider Gott disputirt; als aber keine Partei der andren weichen wollte, wandten sie sich an den Rabbi Chanina, der damals noch auf Erden lebte, daß er der Schiedsrichter sei. Er entschied (Gott zum Gefallen), daß Gott Recht habe121. Ferner: Unser Vater Abraham war der größte unter den Riesen. Er war so groß wie 74 Personen, trank so viel wie 74 Personen, und war so stark wie 74 Personen122. Eliaser, der Nämliche, der auch Og heißt, König von Basan123, war auch ein Riese, aber Abraham pflegte ihn auf seine flache Hand zu stellen, wenn er mit ihm reden wollte. Einmal geschah es, daß ihm ein Zahn aus dem Munde fiel, den nahm Abraham und machte sich ein Bett davon, in welchem er schlief.124
118 bMen 32b „Ich will meine Hand entfernen, und du wirst meine Rückseite schauen [Ex 33,32] R.Chana b. Bizna sagte im Namen R. Schimon des Frommen: Dies lehrt, daß der Heilige, gepriesen sei er, Mose den Knoten der Tephilin zeigte“. 119 bChag 5b „Und unaufhörlich (Tränen) tränen, ja in Tränen zerfließen soll mein Auge, weil die Herde des Herrn gefangen wurde [Jes 33,7] R. Eleazar sagte: Worauf deuten diese drei ‚Tränen‘? Einmal über die Zerstörung des ersten Tempels, einmal über die Zerstörung des zweiten Tempels und einmal über Jisrael, das aus seiner Stätte verbannt worden ist“. 120 Anmerkung im Text: Misstorim, d. h. das verborgenste, geheimste Gemach. Sie berufen sich auf Jer 13,17, wo es heißt: „Im Geheimen wird meine Seele weinen über eure Sünden;“ und wenn Gott sich auch den Engeln verbirgt, ist er doch den Rabbinen nicht verborgen geblieben, – das sagen sie – man höre und staune! 121 bBM86a[sic!] „Sie stritten sich dann im himmlischen Kollegium: wenn der Fleck dem weißen Haare voranging, so ist er unrein, wenn aber das weiße Haar dem Flecke voranging, so ist er rein. Ist dies zweifelhaft, so ist er, wie der Heilige, gepriesen sei er, sagte, rein, und wie das ganze Kollegium des Himmels sagte, unrein. Sie sprachen: Wer soll das entscheiden? – Rabbi b. Nachmani soll es entscheiden…“. 122 Legendarische Erzählung von der Stärke Abrahams, vgl. Louis Ginzberg, The Legends of the Jews, Bd. 1, Philadelphia 1909, 232. 123 Der König Og von Basan (oder Baschan) wird erwähnt in Num 21,33–35; Dtn 3,1–7; Jos 13,30. Jedesmal vom Sieg des Volkes Israel über Og von Basan erzählt. Laut Jos 13,12 gehörte der König Og zu den „Riesen“. 124 Das Zitat ist in sich nicht logisch, wie kann sich Abraham aus einem eigenen Zahn ein Bett machen?
425
430
435
440
272
445
450
455
460
465
Aus dem Tagebuch eines bekehrten russischen Rabbiners
Auch in den bekannten Geschichten von Aba und Levy, Barachot F. 18125, haben sie sich göttliche Macht zugeschrieben, wie wir es noch von keinem Propheten gehört haben. Gillen 69 wird von Assmodai (dem Obersten der Teufel) erzählt, daß er den König Salomo betrogen, verschlungen und ausgespieen habe an das Ende der Welt, und dort hätte der arme König trotz seiner Weisheit als Bettler eine Zeit lang wandeln müssen. Einige behaupten, daß Salomon nimmer zu seiner Regierung gekommen sei, und dann in seiner Armuth und in seinem Elend den Kohelet geschrieben habe, während Assmodai unterdessen in Salomos Gestalt den Thron Davids eingenommen, und als König Israels regiert und Salomo’s Frauen befehligt habe. Von demselben ist auch gesagt, daß er in der hohen himmlischen Schule mit allen heiligen Engeln studirte und eine gleiche Stimme habe126. Berachat F. 7. Gott selbst hat einmal von Rabbi Ismael dem Hohepriester127 verlangt, daß er den Segen über ihn spreche, was er auch gethan hat, und sein Segen sei Gott so angenehm gewesen, daß er mit dem Kopfe nickte, als wollte er dazu Amen sagen128. Wie weit diese Chachanim sich dann über das arme blinde Volk erhoben haben, zeigt uns ihre Lehre Pesachim F. 49, Col. 2. Rabbia Eliasar sagte: Es ist erlaubt, einen Amhaarez (Nichtgelehrten) die Nasenlöcher aufzureißen, sogar an einem Versöhnungstage, der auf den Sabbath fällt. Da sagen seine Schüler zu ihm: Rabbi, sage lieber, daß es erlaubt sei, ihn zu schlachten. Er antwortete, Dieses würde einen Segensspruch erfordern, der so nicht nötig ist129. Wo bleibt da das fünfte Gebot? Wo bleibt da das Gebot der Liebe? Nur Spott und Verachtung kennt der Talmud gegen den Nichtgelehrten, von dem er weiter sagt:
125 Anspielung auf eine talmudische Passage in bBer 18b, in der eine Geschichte eines Mannes erzählt wird, der zwei Totengeister auf einem Friedhof belauschte, denen es gelungen war, Gottes Ratschluß über die kommenden Naturkatastrophen in Erfahrung zu bringen. 126 Anspielung auf eine längere Passage mit Geschichten über König Salomo und den Teufel im talmudischen Traktat Gittin, bGit 68b[sic!]. 127 Rabbi Jischmael ben Elischa, aus priesterlicher Familie. Er gehört zur zweiten Generation der Tannaiten und gilt als Gegenspieler von Rabbi Aqiba. 128 bBer 7b „Es wird gelehrt: R. Jischmael b. Elischa erzählte: Einst trat ich in das Allerinnerste ein, um Spezereien zu räuchern und sah Ochteriel, Jah, den Herrn der Heerscharen, auf einem hohen und erhabenen Throne sitzen. Da sprach er zu mir: Jischmael, mein Sohn, segne mich! Ich sprach zu ihm: Möge es dein Wille sein, daß deine Barmherzigkeit deinen Zorn bezwinge, daß deine Barmherzigkeit sich über deine Eigenschaften [des Rechtes] wälze, daß du mit deine Kindern nach der Eigenschaft der Barmherzigkeit verfahrest und daß du ihretwegen innerhalb der Rechtslinie tretest. Da nickte er mir (mit seinem Haupte) Beifall zu. Dies lehrt uns, daß der Segen eines Gemeinen nicht gering in deinen Augen sei“. 129 bPes 49b „R. Eleazar sagte: Einen Mann aus dem gemeinen Volke darf man metzeln an einem Versöhnungstage, der auf einen Sabbath fällt. Seine Schüler sprachen zu ihm: Meister, sage doch: schlachten! Dieser erwiderte: Dies erfordert einen Segensspruch, jenes erfordert keinen Segensspruch“.
Aus dem Tagebuch eines bekehrten russischen Rabbiners
273
Es ist erlaubt einen Amhaarez zu zerreißen gleich einem Fisch130. Und wer wird denn eigentlich unter einem Amhaarez verstanden? – Amhaarez heißt der, der wohl die Bibel recht studirt hat – aber nicht Gemara (Talmud)131. Es ist ohne Ausnahme verboten, eines solchen Mannes Tochter zu heirathen; denn sie sei nicht besser, als ein Thier. – Mit einem solchen darf man nicht übernachten; denn er ist des Mordes verdächtig. Ferner: Ein Nichtgelehrter darf kein Fleisch essen; denn nach Levit XI, 46132 ist es nur dem erlaubt, der sich mit Erforschung des Geistes beschäftigt hat133. Ich erinnere mich noch jetzt, wie es mir in meiner Jugend bei diesen oder ähnlichen Stellen, wenn ich sie las, zu Muthe war. Tausend solcher Lehren findet man im Talmud, Midrasch und Agada, bei denen man nicht weiß, ob man lachen oder weinen soll. Wenn man noch einen Funken von Liebe zu seiner Nation und zu seinem Glauben hat, wenn man noch eine Spur von Gewissen im Herzen besitzt, wahrlich, da muß man bitter weinen. Wahrlich, da versteht man das Bild, welches der ewige Menschensohn Mt 23134 uns zeichnet von den Schriftgelehrten und Pharisäern, und versteht das Wehe, das er ausruft über diese Heuchler und Eigennützigen, über diese Hoffährtigen und Selbstgerechten. Ist es noch zu bewundern, daß Jesus, der die Wahrheit, die Sanftmuth, die Liebe und Barmherzigkeit ist, diesen Pharisäern ein Dorn im Auge war? Kann denn Feuer und Wasser in Gemeinschaft sein; oder Licht und Finsternis zusammen treffen? Wie es aber den Pharisäern erging, so geht es mehr oder weniger uns Allen, die wir von Jugend auf in den Lehren des Talmud fleißig unterrichtet sind, wir bringen die Früchte der Selbstüberhebung und des Unglaubens. Und dazu müssen Sie mir noch zugestehn, daß Sie alle die verschiedensten Gedanken über 130 bPes 49b „R. Schemuel b. Nachmani sagte im Namen R. Jochanans: Einen Mann aus dem gemeinen Volk darf man wie einen Fisch zerreißen. R. Schemuel b. Jizchaq sagte: Vom Rücken aus“. 131 Zum Bedeutungswandel von Am ha-Arez von der biblischen Zeit bis heute vgl. Heinz-Martin Döpp, Am ha-Arez, in: Neues Lexikon des Judentums, Gütersloh / München 1992, 31f. 132 Lev 11,46–47 „Das ist das Gesetz von den vierfüßigen Tieren und Vögeln und von allen Tieren, die sich regen im Wasser, und von allen Tieren, die auf der Erde kriechen, auf daß ihr unterscheidet, was unrein und rein ist und welches Tier man essen und welches man nicht essen darf“. 133 bPes 49b „Es wird gelehrt: Rabbi sagte: Ein Mann aus dem gemeinen Volke darf kein Fleisch essen, denn es heißt: das ist die Lehre inbetreff des Viehs und des Geflügels [Lev 11,46], wer sich mit der Tora [Lehre] befaßt, darf Fleisch von Vieh und Geflügel essen, wer sich mit der Tora nicht befaßt, darf kein Fleisch von Vieh und Geflügel essen“. 134 Mt 23,1–36. Ausführliche Scheltrede gegen die Schriftgelehrten und Pharisäer, in der mehrmals ein „Wehe“ über ihnen ausgerufen wird Mt 23,13. 15. 16. 23. 25. 27. 29. In dieser Ausführlichkeit ist die Rede Jesu, in der er sich mit den Schriftgelehrten und Pharisäern auseinandersetzt, eine redaktionelle Arbeit des Matthäus. Durch die in Kap 22,41–46 vorangestellte Frage „Was denkt ihr von dem Christus?“ wird die Übertragung und Aktualisierung dieses neutestamentlichen Textes in der Situation der Judenmission ermöglicht, da scheinbar die Frage immer noch dieselbe ist.
470
475
480
485
490
274
Aus dem Tagebuch eines bekehrten russischen Rabbiners
den Talmud haben, Niemand aber will die Wahrheit sagen. Blindheit ist Israel widerfahren, es schläft, es ist todt, Gott allein kann sich unserer erbarmen und Israel zu neuem Leben erwecken. 495 Die Versammlung wurde bei diesen Worten ungeduldig (wie es leider so oft sich zeigt, wenn man an Israel ein ernstes Wort richtet). Einige aber seufzten ernst und sagten: Leider, leider, es ist doch wahr! N.N.: Können Sie uns den Verlust ersetzen, wenn wir den Talmud verwerfen wollen, der doch Wahrheit und Gutes enthält? Wo sollen unsere Seelen Ruhe 500 finden, wenn wir die Lehre von der Auferstehung, von der Seligkeit und von dem zukünftigen Leben, und was uns sonst unsere alten Väter verkündigt haben, verachten? Wie viele kostbare Aussichten eröffnet uns der Talmud, welche die Bibel verschweigt, himmlische Erquickungen, wo das Gesetz und die Propheten nur irdischen Lohn oder irdische Strafe verkünden. Ich denke, es ist besser, wir 505 bleiben beim Alten. 8.
510
515
520
525
Christus und das Gesetz
Ich: Wie können wir uns einreden, daß wir auf die ewige Seligkeit Anspruch hätten, wenn wir das Gesetz Mosis nicht erfüllt haben? Es mag sich Jeder fragen, ob er das ganze Gesetz erfüllt hat? Nun aber ist es deutlich gesagt 5. Mose 27,26: „Verflucht sei der, der nicht a l l e Worte dieses Gesetzes erfüllen wird.“ Da haben wir doch nur die ewige Verdammniß zu erwarten, wenn wir die Gnade Gottes nicht annehmen wollen! Ist es Euch wirklich von ganzem Herzen darum zu thun, die Seligkeit zu erlangen, so leget alle eigensinnigen Gedanken fort, und forschet ernst in Gottes Wort, dann werdet Ihr Euren Erlöser, Euren Messias finden, der allein selig machen kann. Selig sind nur, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden135. Freilich auf unsere Gerechtigkeit können und sollen wir uns nicht verlassen, von der Jes 64,5 sagt: „Wir sind allesammt wie die Unreinen, und alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein unfläthiges Kleid.“ Und der fromme König David Psalm 14,3: „Es ist keiner, der Gutes sucht, nicht ein einziger.“ Und Daniel 9,7: „Du Herr bist gerecht, wir aber müssen uns schämen.“ Jesaias sagt, wenn er von der Zukunft Israels spricht 45,24: „Im Herrn allein habe ich Gerechtigkeit und Stärke.“ Von unserm Vater Abraham ist gesagt 1. Mose 15,6: „Er glaubte an den Herrn, und das rechnete Er ihm zur Gerechtigkeit.“ Aber nicht blos Abraham, sondern auch uns, wenn wir an den Jehova zidkenu136, der unsern Fluch137 getragen und für unsere Sünden am Stamm des 135 Mt 5,6. 136 D. h. Gott unsere Gerechtigkeit. Im Original in lateinischen Buchstaben. 137 Gal 3,13 „Christus aber hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes, da er zum Fluch wurde für uns“.
Aus dem Tagebuch eines bekehrten russischen Rabbiners
275
Kreuzes geblutet hat, glauben, wird seine Gerechtigkeit zugerechnet. Es ist kein anderer Weg zur Seligkeit, als dieser. Wir müssen den Weg wandeln, den Er selbst uns vorgeschrieben hat! Mühet euch nicht ab in eigenen Wegen! Die äußeren Ausbrüche der Sünde könnt Ihr vielleicht unterdrücken, die Sünde selbst aber kann durch nichts getilgt werden, als allein durch das Blut der Versöhnung138. Laßt euch mit diesem Blute besprengen139! Durch die Kraft Christi werdet Ihr vermögen, was Ihr aus eigener Kraft nimmer vermochtet, Gottes Kinder zu werden140! N.N.: Wer sagt es uns, daß dieser Christus der verheißene Messias sei? Darauf wurden die messianischen Stellen des alten Testaments aufgeschlagen; sie wollten dieselben durch falsche Auslegungen verkehren; aber bei dem 53. Cap. Jesaias blieben sie bankerott. N.N.: Hat Christus nicht das heilige Gesetz Gottes aufgehoben? Ich: Christus hat das Gesetz nicht aufgehoben, sondern v o l l k o m m e n gemacht, denn Er ist ja des Gesetzes Ende141. N.N.: Wieso denn? Ich: In einer Stunde läßt es sich nicht erklären, aber den Grund kann ich euch wohl sagen. Durch den Ungehorsam Eines Menschen, Adam, ist die Sünde in die Welt gekommen; und weil in ihm Alle gesündigt haben (womit auch die Talmudisten übereinstimmen), so ist der Tod zu allen Menschen hindurch gedrungen142. Die begangene Uebertretung des göttlichen Gesetzes erforderte nothwendig die Bestrafung des Menschen von Seiten Gottes. Weil nun aber Gott der Herr die ewige Liebe ist143, so wollte er nicht unsern Tod144, sondern offenbarte uns seine unendliche Barmherzigkeit. Darum sandte auch schon vor Zeiten seine Knechte, die Propheten, die uns zur Buße rufen sollten145, damit wir unsere Unwürdigkeit erkennen möchten und uns nach Erlösung sehnten146. Das ist auch 138 1 Petr 1,18–19 „Ihr wißt, daß ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väter Weise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes“. 139 1 Petr 1,2 „Die Gott, der Vater, ausersehen hat durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi“. 140 Joh 1,12. 141 Röm 10,4a „Denn Christus ist das Gesetzes Ende“. 142 Röm 5,12 „Deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben“. 143 1 Joh 4,16b „Gott ist die Liebe“. 144 Ez 33,11 „So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr: ich habe keinen Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern daß der Gottlose umkehre von seinem Wege und lebe“. 145 Apg 3,18–19 „Gott aber hat erfüllt, was er durch den Mund aller seiner Propheten zuvor verkündigt hat: daß sein Christus leiden sollte. So tut nun Buße und bekehrt euch, daß eure Sünden getilgt werden“. 146 Röm 8,23 „Wir […] sehnen uns nach der Kindschaft, der Erlösung unseres Leibes“.
530
535
540
545
550
276
555
560
565
570
Aus dem Tagebuch eines bekehrten russischen Rabbiners
der Zweck des Gesetzes, uns zur Erkenntnis der Sünde zu bringen147; dazu ist er auch nicht ferne geblieben mit seinen Heils- und Friedensgedanken, sondern hat uns schon im alten Testament auf unsern Erlöser hingezeigt durch Moses und alle Propheten, wie Ihr es eben gehört habt148. Als die Zeit endlich erfüllet ward149, sandte Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt, der in der Gestalt unseres Fleisches, jedoch ohne Sünden erschien150, damit Er sich Gott seinem Vater, als ein unbeflecktes Opfer151 für die Welt darstellte, und die Sünde Aller, die an ihn glauben, hinwegnähme152. Durch seinen Opfertod hat er uns ein ewig gültiges Verdienst erworben, nicht für sich; denn Er, der heilige Gott, bedurfte dessen nicht; aber in seiner unbegreiflichen Liebe rechnet er den Verdienst Jedem zu, und macht Jeden desselben theilhaftig, der im Glauben an Christum zu Gott kommt. Er ist das Ende des Gesetzes153 geworden, da Er allein es erfüllt hat154, und durch das Opfer, welches Er auf Golgatha dargebracht hat, wovon der Opferdienst des alten Testaments nur der Schatten und das Vorbild war155, hat er uns Vergebung der Sünden, Leben und Seligkeit erworben156. Deshalb findet nun Jeder, der von Herzen glaubt, daß Jesus von Nazareth der Messias und Heiland ist, bei Ihm Vergebung für alle seine Sünden; durch Ihn werden wir das auserwählte Geschlecht, das königliche Priesterthum, wie Gott uns beim Empfang der zehn Gebote durch Moses verheißen hat. Fröhlich und getrost kann nun eine solche Seele schon hier auf Erden wandeln, denn sie weiß, daß ihr Erlöser lebet157; noch fröhlicher aber kann auch eine solche sterben, wenn Jesus sie zu sich in die Herrlichkeit Gottes rufet. Auf sein Wort gestützet, hofft sie mit fester Zuversicht, daß sie einst dort sein werde, wo Er selbst ist. Eine solche Seele bittet nur eins, daß
147 Klassischer locus der lutherischen Theologie: Das Gesetz hat die Funktion einer lex accusans. 148 Bezieht sich auf das Lesen der messianischen Stellen des Alten Testaments, s. o. vgl. dazu auch Apg 3,21–26. 149 Gal 4,4 „Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan“. 150 Hebr 4,15 „Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht könnte mit leiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde“. 151 1 Petr 1,19 [Das Blut Christi ist das Blut] „eines unschuldigen und unbefleckten Lammes“. 152 Hebr 9,28a „So ist auch Christus einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen“. 153 Röm 10,4a, s. o. Z. 589. 154 Mt 5,17 „Ihr sollt nicht meinen, daß ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen; ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen“. 155 Das ist eine typologische Exegese der Opfervorschriften des Alten Testaments in der die Vorschriften des Gesetzes als Vorstufen des Neuen Testaments verstanden werden. Innerhalb des Neuen Testaments gibt es dafür im Hebräerbrief die ersten Belege, z. B. Hebr 10,1 „Denn das Gesetz hat nur einen Schatten von den zukünftigen Gütern, nicht das Wesen der Güter selbst“. 156 Hebr 9,26b „Nun aber am Ende der Welt, ist er ein für allemal erschienen, durch sein eigenes Opfer die Sünde aufzuheben“. 157 Hi 19,25a „Aber ich weiß, daß mein Erlöser lebt“.
Aus dem Tagebuch eines bekehrten russischen Rabbiners
277
unser liebster Jesus ihr nicht aus Verdienst, sondern allein aus Gnaden158 die 575 Erlösung zu Theil werden lasse, die er uns erworben hat. Wollt Ihr nun noch andere Mittel zur Seligkeit suchen, so bleibt Ihr ewig verloren; denn was kann es auch weiter sein, als neue Flicken auf ein altes Kleid, die Flicken müssen reißen und der Riß muß ärger werden159. Eins ist Noth160, daß Israel wieder ein Volk Gottes werde, daß sie an Jesum Christum glauben, der sie zu aller Zeit sammeln 580 will, wie eine Henne ihre Küchlein, um sie unter den Flügeln seiner Gnade zu schützen161. – Suchet Jesum und sein Licht, alles andere hilft Euch nicht!! 9.
Offizielle Verhängung des Synagogenbanns
Als sie das hörten, stürzten sie Alle von ihren Plätzen auf mich zu, schrieen, schimpften und verfluchten mich: – „Was zögern wir noch, diesen Gottlosen zu 585 verdammen?“ schrieen einige Stimmen, furchtbar wüthend. „O, daß wir noch so lange dieser Gotteslästerung zugehört haben! Verbannt muß er werden mit den Seinigen, dieser Feind Israels!“ Die Empörung war gewaltig, so daß ich fliehen mußte, ohne daß ich meine Mütze mitnehmen konnte. Zwei meiner Freunde eilten mit mir bis an die Thür meines Hauses; sie sagten mir, daß ich mich in Acht 590 nehmen sollte, künftig auf die Straße zu gehen. „Wir aber werden Sie besuchen,“ sagten sie zu mir, indem sie mir freundschaftlich die Hand drückten, „denn wir wollen durchaus zur Klarheit über das Christenthum kommen. Freilich werden wir auch Verfolgung leiden müssen, aber sind darauf gefaßt“162. Am zweiten Tage erfuhr ich, daß ein großer Bann über mich und meine Gesinnungsgenossen in 595 allen Synagogen ausgesprochen und der Bannbrief an den Straßenecken öffentlich angeklebt worden ist163.
158 Klassisches lutherisches Theologumenon: Die Erlösung geschieht allein aus Gnaden – sola gratia. 159 Mt 9,16 „Niemand flickt ein altes Kleid mit einem Lappen von neuem Tuch, denn der Lappen reißt doch wieder vom Kleid ab, und der Riß wird ärger“. 160 Lk 10,42a „Eins aber ist not“. 161 Mt 23,37 „Jerusalem […] wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel“. 162 Anmerkung des Redakteurs im Text: Von denen, welche den bekehrten Rabbiner nachher täglich besucht haben, sind drei in den Unterricht zu dem Pastor daselbst gekommen, von denen wir neulich durch einen Brief erfahren haben, daß einer schon vor drei Monaten seine Prüfung glänzend bestand, und hoffentlich schon zu Jesu Schäflein gezählt wird. – Die mit Thränen säen, werden mit Freuden erndten! [Ps 126,5]. 163 Zum Synagogenbann s. o. Anm. 56.
278
Aus dem Tagebuch eines bekehrten russischen Rabbiners
Analyse des dargestellten Gesprächsgangs Der Verlauf der Disputation zeigt, daß Gurland von seinen jüdischen Gesprächspartnern sehr ernst genommen wird und großen Raum erhält, seine Position darzulegen. Das erstmalige Ausrufen des Synagogenbanns führt erstaunlicherweise noch nicht zu einem Gesprächsabbruch. Im Kap. 2 (z.64–65) wird der Disputation die Chance eingeräumt, Gurland und seine Anhänger vom Übertritt zum Christentum abzuhalten. Es waren ja noch keine Fakten geschaffen. Weder Gurland noch ein anderer aus seinem Umkreis war bis zu diesem Zeitpunkt getauft. Gurland eröffnet den inhaltlichen Teil der Disputation mit einem biographischen Einstieg (Kap. 3). Dieser Weg sichert ihm die Aufmerksamkeit der Zuhörerschaft und hilft, frühzeitige Irritationen zu vermeiden. Der Abschnitt über die Autorität der Rabbinen (Kap. 4) beinhaltet Gedankengänge, die innerhalb des Judentums der Zeit noch verständlich sind. Eine explizit christliche Stellungnahme oder ein Bekehrungsversuch finden sich hier ebensowenig wie ein erkennbares Zitat aus dem neuen Testament. Es findet sich hier allerdings ein Gedanke, der Gurland bereits in seiner Rabbinatsgemeinde Wilkomir massive Schwierigkeiten eingetragen hat (z.160–165). Er unterscheidet zwischen Bibel und Talmud, indem er behauptet, daß die Autorität der Bibel über der des Talmud steht. Gurland stellt das in der Disputation als Versuch dar, auf diese Weise die Menschen in der Gemeinde zu halten, die sich die antitalmudische Haltung der jüdischen Aufklärer zu Eigen gemacht hatten. Der Rekurs auf die Bibel sollte den Exodus aus der traditionellen Gemeinde stoppen. In Wilkomir empörten sich die traditionellen Juden und sahen die Autorität der doppelten Tora verletzt. In Kischinew ruft sein in Kap. 4 ausgeführter Gedankengang eine ähnliche Reaktion hervor. Sein Disputationsgegner weigert sich, innerhalb der Tradition zu unterscheiden und beruft sich auf die rabbinische Überlieferung (z.207–211). Gurland entfaltet in Kap. 5 seine Gedanken dennoch weiter und führt eine typische Denkfigur der evangelischen Theologie in die Diskussion ein: die Unterscheidung zwischen „Gotteswort“ und „Menschenwort“ (z.297). Dieser Gedanke ist der rabbinischen Tradition fremd. Hier wird die Autorität der verschiedenen Texte nicht mit einer solchen Unterscheidung begründet. Deshalb reagiert der jüdische Gesprächspartner sofort mit einer Spitzenaussage „Uns ist nichts heiliger als der Talmud“ (z.308). Gurlands Gegenargumente verfangen nicht. Der jüdische Gesprächspartner zeigt sich enttäuscht von Gurland und vermag ihn nur noch in eine Reihe mit Vertretern der jüdischen Aufklärungsbewegung und Proselyten zu stellen (z.322–327). Trotzdem erhält Gurland den Raum, in Kap. 6 der Synagogengemeinde Jesus Christus als den Messias Israels zu präsentieren. Dieses ausführliche und eindeutige Bekenntnis zum Christentum ruft in der Versammlung Bestürzung hervor. Ihre Hoffnung, Gurland von einem
Aus dem Tagebuch eines bekehrten russischen Rabbiners
279
Übertritt abhalten zu können, ist zum Scheitern verurteilt. Deshalb fordert der jüdische Gesprächspartner Gurland auf, seine Rede abzubrechen. So etwas zu hören – und das auch noch aus dem Munde eines Rabbiners – sei der Gemeinde abträglich (z.374–376). Der Ärger über Gurlands Worte zeigt sich in dem Verweis auf die rabbinische Auslegung von Dt 17,10f. in der die Todesstrafe angedroht wird für den Fall, daß jemand die Auslegung der Rabbinen bestreitet. Die Einleitung der Erwiderung auf Gurland (z.368–370) enthält kaum verhüllte Drohungen. Daß es Gurland dennoch gelingt, das Gespräch fortzusetzen, liegt daran, daß er in ein Gespräch mit der angeführten Mischna-Stelle eintritt. Es folgt in Kap. 7 eine Zusammenstellung von Widersprüchen und unglaubwürdigen Stellen aus dem Talmud. Da es hier sehr lange keine Einwürfe des jüdischen Gesprächspartners gibt (z.389–497), läßt sich fragen, ob Gurland seine Stellensammlung wirklich in dieser Ausführlichkeit in der Synagoge von Kischinew präsentieren konnte, oder ob er die Belegstellen seiner Gesprächsnachschrift beigefügt hat, um sie für die Veröffentlichung bereitzustellen. Die Antwort des jüdischen Gesprächspartners eröffnet Gurland die Möglichkeit, zum Abschluß noch einen neuen christlichen Gedanken in der Synagoge zu äußern. Er stellt seinen Zuhörern in Kap. 8 Christus als das Ende des Gesetzes vor Augen (z.540). Dieser Gedankengang und die eingeschobene Lektüre wichtiger Stellen des Alten Testaments, die christlich messianisch gedeutet werden (z.535–537), ermöglichen Gurland eine kurze Predigt zum Schluß seiner Ausführungen. Er versucht, der Synagogengemeinde den liebevoll sich hingebenden Jesus vor Augen zu stellen, dessen Sühnopfer für die Gläubigen „Vergebung der Sünden, Leben und Seligkeit erworben hat“ (z.566). Sein Schlußsatz „Suchet Jesum und sein Licht, alles andere hilft Euch nicht!“ (z.582) reißt die Zuhörer von den Bänken. Voller Empörung wird er durch Verhängung des Bannes aus der Synagogengemeinde ausgeschlossen (z.594–597).
Relevante theologische Gedanken in Gurlands Bekehrungsprozeß Aus dem Bericht über die Disputation in der Synagoge von Kischinew lassen sich drei wesentliche Faktoren herauslösen, die für Gurlands Bekehrung zum Christentum konstitutive Bedeutung haben. Das sind erstens, die Unterscheidung Gotteswort und Menschenwort, zweitens die christologische Lesart des Alten Testaments (begonnen bei Jes. 53) und drittens das Verständnis von Christus als Erfüllung des Gesetzes. Diese drei Faktoren führen dazu, daß Gurland einen Weg aus seinen Zweifeln am Judentum seiner Zeit findet. Das paßt zu der Definition von Bekehrung, die Andrew Wingate in RGG4 gegeben hat:
280
Aus dem Tagebuch eines bekehrten russischen Rabbiners
Bekehrung ist ein Prozeß, der eine persönliche Entscheidung einschließt, die allein oder als Teil einer Gruppe gefällt wird, um dem Leben einen neuen Mittelpunkt zu geben, von dem man annimmt, daß er mehr Freiheit gewährt und der Wahrheit näher bringt. Dies schließt eine Veränderung des Selbstbildes mit ein und normalerweise den Anschluß an eine neue Gemeinschaft, die das Leben auf verschiedenen Ebenen beeinflußt – Körper, Herz, Geist und Seele – und zu spürbaren Veränderungen im Verhalten und in der religiösen Praxis führt164.
Gurland lernte durch den Kontakt zu Rudolph Faltin bestimmte evangelische Theologumena kennen und konnte sie auf seine eigene Situation anwenden. Dadurch war er in der Lage, zumindest teilweise die von ihm skizzierten theologischen Probleme seiner jüdischen religiösen Sozialisation zu lösen. Das damit verbundene Evidenzereignis dürfte für ihn der „turning point“ seiner Konversion gewesen sein. Auf die Frage: „Was begründet eine Konversion?“ dürfte im Falle Gurlands die Antwort Wingates passen „Schließlich ist es die entscheidende Frage, ob die neue Religion […] als befreiender und der Wahrheit angemessener angesehen wird, als die alte“165. Das konnte Gurland über das Christentum sagen. Seine Gesprächspartner in Kischinew sind diesen Weg nicht mitgegangen. Sie konnten mit ihrem Rabbiner sprechen „Ich denke, es ist besser, wir bleiben beim Alten“ (z.504–505). Entstanden ist auf diese Weise ein Text, der Zeugnis gibt vom Weg eines Menschen von der einen zu anderen Religion. Durch die in aller Schärfe vollzogene Abgrenzung vom Judentum ist der Bericht von der Disputation in der Synagoge zu Kischnew dabei zugleich auch zu einem christlichen adversus-judaeos-Text geworden.
Quellen E.H. Busch, Materialien zur Geschichte und Statistik des Kirchen- und Schulwesens der Ev.-Luth. Gemeinden in Rußland, St. Petersburg 1862. E.H. Busch, Ergänzungen der Materialien zur Geschichte und Statistik des Kirchen- und Schulwesens der Ev.-Luth. Gemeinden in Rußland, St. Petersburg 1867, 1. Band. Wie die Portugiesischen Brüder Cappadose zu Amsterdam auf verschiedenen Wegen zu Christo kamen. Niedergeschrieben von dem einen noch lebenden Bruder, dem Arzt Dr. Cappadose, für Christen und Juden, aus dem Französischen übersetzt (Hauptverein für christliche Erbauungsschriften in den preußischen Staaten 81), Berlin 1883. Der Friedensbote für Israel (Das benutzte Exemplar befindet sich in der Bibliothek der Kirchenkanzlei der Evangelischen Kirche der Union in Berlin).
164 Andrew Wingate, Bekehrung, VII. Missionswissenschaftlich, in: RGG4, 1 (1998), 1238–1239, hier 1238. 165 A. Wingate, Bekehrung (Anm. 164), 1239.
Aus dem Tagebuch eines bekehrten russischen Rabbiners
281
In zwei Welten. Rudolf Hermann Gurland. Ein Lebensbild. Mit einem Geleitwort von Martin Kähler, 2. Aufl. Dresden 1911 (Das benutzte Exemplar befindet sich im Besitz der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena). Rudolf Gurland, Erstes Zeugnis des Pastors Gurland aus seinem evangelischen Amtsleben, in: Rudolf Gurland. Ein bekehrter Rabbiner, jetzt evangelischer Pastor (Schriften für Israel 4), Erlangen 1869 (Das benutzte Exemplar befindet sich im Besitz der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena). St. Petersburgisches Evangelisches Sonntagsblatt (Das benutzte Exemplar befindet sich in der Bibliothek des Deutschen Instituts für Auslandsbeziehungen in Stuttgart).
Literatur Jean Ancel, Kishinew, in: EJ 10 (1971). Paul Gerhard Aring, Christliche Judenmission. Ihre Geschichte und Problematik dargestellt am Beispiel des evangelischen Rheinlandes (Forschungen zum christlich-jüdischen Dialog 4), Neukirchen 1980. Ders., Judenmission in: TRE 17 (1988), 325–330. Avram A. Baleanu, Bessarabien, in: Neues Lexikon des Judentums, Gütersloh 1992. Arnulf H. Baumann, Josef Rabinowitschs messianisches Judentum, in: Folker Siegert [Hg.], Grenzgänge. Menschen und Schicksale zwischen jüdischer, christlicher und deutscher Identität. Festschrift für Diethard Aschoff (Münsteraner Judaistische Studien 11), Münster 2002, 195–211. Semen Dubnow, History of the Jews in Russia and Poland, Bd. 1, Philadelphia 1916. Kai Kjaer Hansen, Josef Rabinowitsch und die messianische Bewegung. Der Herzl des Judenchristentums, übersetzt von Niels-Peter Moritzen, hg. v. Evangelisch-Lutherischen Zentralverein für Zeugnis und Dienst unter Christen und Juden, Hannover 1990. G.F. Heman, Missionen unter den Juden, in: RE2 10 (1882) 102–118. Wilhelm Kahle, Der Propst Rudolph Faltin und seine Arbeit an Israel in Kischinev, in: (Ders.) Symbiose und Spannung, Beiträge zur Geschichte des Protestantismus in den baltischen Ländern, im Innern des Russischen Reiches und der Sowjetunion, Erlangen 1991, 168–192, zuerst veröffentlicht in: Friede über Israel 5 (1964), 150–160. Ders., Wege und Gestalt evangelisch-lutherischen Kirchentums in Rußland vom Moskauer Reich bis zur Gegenwart, Erlangen 20022. Jacob Katz, Aus dem Ghetto in die bürgerliche Gesellschaft. Jüdische Emanzipation 1770– 1870, Frankfurt 1986. Kirche und Synagoge. Handbuch zur Geschichte von Christen und Juden, hg. v. K. H. Rengstorf / S. v. Kortzfleisch, Bd. 2, Stuttgart 1970. J.F.A. de Le Roi, Die evangelische Christenheit und die Juden unter dem Gesichtspunkte der Mission geschichtlich betrachtet, 2. Bd., A. Zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts. Das europäische Festland während des 19. Jahrhunderts (Schriften des Institutum Judaicum in Berlin 9,2), Berlin 1891. Ders., Die evangelische Christenheit und die Juden unter dem Gesichtspunkte der Mission geschichtlich betrachtet, 3. Bd., B. Großbritannien und die außereuropäischen Länder
282
Aus dem Tagebuch eines bekehrten russischen Rabbiners
während des 19. Jahrhunderts (Schriften des Institutum Judaicum in Berlin 9,3), Berlin 1892. G. C. Nöltingk, Auch ein Wort über unsere Mitarbeit an der Mission, in: Mittheilungen und Nachrichten für die evangelische Kirche in Rußland 38 = N. F. 15 (1882). Gerd Stricker (Hg.) Deutsche Geschichte im Osten Europas. Rußland, Berlin 1997. Andrew Wingate, Bekehrung, VII. Missionswissenschaftlich, in: RGG4, 1 (1998), 1238–1239. M. Wischnitzer, Kischinew, in: EJ(D) 10 (1934).
Der Hl. Lambertus und die Lambertikirche in Oldenburg
Einleitung Der Hl. Lambertus ist kein Heiliger, dessen Leben und Bedeutung bis heute noch jedem Schulkind bewusst wäre, wie etwa der Hl. Martin oder der Hl. Nikolaus. Der Hl. Lambertus hat aber für Oldenburg lokalgeschichtliche Bedeutung, da ihm die Hauptkirche der Stadt, die evangelisch-lutherische St. Lamberti-Kirche geweiht ist. Lambertus lebte im 7./8. Jahrhundert und sein Todestag wird traditionell mit dem 17. September 705 angegeben. Dieses Datum jährte sich 2005 zum 1300sten Mal. Die Lambertikirche in Oldenburg nahm das zum Anlass für einen „Lambertustag“, an dem in ökumenischer Verbundenheit des Namenspatrons der Kirche gedacht wird, denn Heilige werden auch in der evangelischen Kirche verehrt. Damit steht die evangelische Kirche in der Tradition der Alten Kirche und des Mittelalters. Heilige werden in der evangelischen Kirche allerdings nicht als Mittler zwischen Gott und den Menschen verehrt, zu ihnen wird nicht gebetet und sie werden auch nicht um ihre Fürbitte gebeten. Aber sie werden verehrt als Vorbilder des Glaubens. Sie stehen mit ihrem vorbildlichen Leben, mit ihren Taten und Worten vor uns in der langen Kette der Überlieferung des Glaubens. Deshalb gebührt ihnen Ehre. Das ist eine Entscheidung, die sich auf eine Seite der altkirchlichen und mittelalterlichen Heiligenverehrung festlegt und die andere damit verwirft. Die mittelalterliche Frömmigkeit kannte demgegenüber noch beide Seiten der Heiligenverehrung. Die Heiligen galten als „als Beispiele eines rechten Wandelns und als Bewirker eines heilen Lebens. Beides gehörte im Mittelalter zusammen. Die Balance allerdings, ob nun zuerst das Wunder oder die Vorbildlichkeit herauszustellen sei, war schwer zu halten“1. Der vorliegende Beitrag zum Hl. Lambertus und seiner Kirche in Oldenburg beschränkt sich auf eine historische Untersuchung zum Leben des Lambertus
1 Arnold Angenendt, Heilige und Reliquien. Die Geschichte ihres Kultes vom frühen Christentum bis zur Gegenwart, München 1994, 147.
284
Der Hl. Lambertus und die Lambertikirche in Oldenburg
und geht darüber hinaus noch der Frage nach, wann und in welchen Zusammenhängen die Lambertikirche in Oldenburg errichtet wurde.
Der Hl. Lambertus als frühmittelalterlicher Adelsheiliger Der Hl. Lambertus ist ein typischer fränkischer Adelsheiliger des 7./8. Jahrhunderts. Er entstammt einem christlichen adeligen Geschlecht des mittleren Maasgebietes. Dieser geographische Raum, heute zu Belgien und den Niederlanden gehörend, spielt für die fränkische und frühe karolingische Zeit eine zentrale Rolle in Europa. Ihm entstammen große Teile der führenden Geschlechter des Frankenreichs und auch die Familie der Karolinger, die im 8. Jahrhundert als fränkische Hausmeier den Übergang zum karolingischen Reich organisieren.
Das fränkische Reich Das fränkische Reich ist eine Gründung der Völkerwanderungszeit. Die Franken sind ein germanischer Stamm. Sie erobern im 5. Jahrhundert ausgehend von ihrem Stammland in Nordwestfrankreich fast das gesamte antike Gallien. Mit der Taufe Chlodwigs 498 wurde das fränkische Reich formal christlich. Es lebt aber in den eroberten Gebieten bereits eine romanische Bevölkerung, die aus der Vermischung der Römer mit den Galliern hervorgegangen ist und schon lange christianisiert war. Das fränkische Reich wird in seiner zweihundertjährigen Geschichte stets von Kämpfen innerhalb der adeligen fränkischen Führungsschicht erschüttert. Immer wieder kommt es dabei zu Teilungen des fränkischen Reiches. Im 8. Jahrhundert nimmt die Macht der Könige immer mehr ab. Die eigentliche Herrschaft liegt in der Hand des „Hausmeiers“ (Majordomus). Die Hausmeier führen Kriege, setzen Bischöfe und Grafen ein, während der König zu einer Repräsentationsfigur wird. 751 setzt der Hausmeier Pippin d.J. den letzten fränkischen König aus der Dynastie der Merowinger ab und wird Alleinherrscher. Er gehört bereits zum Geschlecht der Karolinger. Sein Sohn Karl der Große wird dann Herrscher des deutlich nach Osten vergrößerten karolingischen Imperiums.
Der Hl. Lambertus und die Lambertikirche in Oldenburg
285
Adelsheilige Adelsheilige sind eine besondere Erscheinung im fränkischen Reich. Nach der Bekehrung Chlodwigs zum katholischen2 Christentum wird das fränkische Reich einheitlich christlich. Es entsteht so Glaubenseinheit zwischen der eingesessenen romanischen Bevölkerung, ihren Bischöfen und den fränkischen Eroberern. Bischöfe und auch besonders verehrte „neue“ Heilige entstammen zunächst weiterhin aus den romanischen Eliten. Prominentes Beispiel aus der Frühzeit des Frankenreiches sind dafür der Hl. Martin und sein Biograph Gregor von Tours. Erst durch die iro-schottische Mission des 7. Jahrhunderts werden Angehörige der fränkischen Adelsgeschlechter in verstärktem Maße in die kirchlich-monastische Elite eingebunden. Besonders das Kloster Luxeuil dient als Ausbildungsstätte zahlreicher Bischöfe. Daneben entstammen auch dem neustrischen3 Königshof in Paris zahlreiche Klostergründer, Äbte und Bischöfe. Oft sind weltliche Ämter, späteres geistliches Leben sowie daraus resultierende Heiligkeit, direkt miteinander verbunden. In den fränkischen Heiligenviten „gewinnt man fast den Eindruck, als sei Adel eine Vorstufe der Heiligkeit“ und die „frühere politisch-herrschaftliche Funktion dieser Männer und Frauen wird in ihrer Vita regelmäßig hervorgehoben“4. Häufig gründen diese Adelsheiligen Klöster auf ihrem eigenen Besitz. Damit „festigen sie als Klostergründer, als Heilige, Äbte und Mönche zugleich den charismatischen Herrschaftsanspruch ihrer Familien“5. Dieser Typus des fränkischen Adelsheiligen stellt eine wesentliche Brücke zwischen der germanischen Kultur der Franken und der Kultur der romanischen Christen dar. Es entsteht der „für das Abendland konstitutiv gewordene Typus des Heiligen, der bei aller Askese doch mitten in der Welt steht“6. Dieser neue Typus eines Heiligen ermöglicht es den fränkischen adeligen Familien eine neue – und das heißt christliche – Legitimation ihrer Herrschaft zu finden. Die Heiligen aus den eigenen Reihen sind „Ausdruck und zugleich Festigung der inneren
2 Die Alternative wäre gewesen, dass die Franken sich zur homöischen – in der älteren Literatur „arianisch“ genannten Spielart des Christentums bekannt hätten, wie es zum Beispiel die Westgoten im benachbarten Spanien getan hatten, die dadurch in einen langandauernden Konflikt mir der katholischen, romanischen Bevölkerung gerieten. 3 Neustrien ist ein Teilgebiet des fränkischen Reiches mit dem Zentrum in Paris. Zu Neustrien gehört der romanisierte Westen des Reiches zwischen Schelde und Loire. Daneben gibt es noch zwei weitere Reichsteile, Austrien bestehend aus der Champagne, dem Maas- und Moselland mit der Hauptstadt Reims, sowie Burgund bestehend aus dem Loire- und Rhônegebiet mit der Hauptstadt Orleans. 4 Beide Zitate: Friedrich Prinz, Frühes Mönchtum im Frankenreich. Kultur und Gesellschaft in Gallien, den Rheinlanden und Bayern am Beispiel der monastischen Entwicklung (4. bis 8. Jahrhundert), München 2. Aufl. 1988, 491. 5 Prinz (Anm. 4), 491. 6 Prinz (Anm. 4), 492.
286
Der Hl. Lambertus und die Lambertikirche in Oldenburg
Verbindung des Adels mit dem neuen Gott und daher […] zugleich die neuen christlichen Garanten der alten Adelsherrschaft“7.
Die Lebensgeschichte des Lambertus Lambertus gehört zu diesem Typus der fränkischen Adelsheiligen. Er entstammt einem adeligen Geschlecht, wird Bischof, greift in das politische Geschehen ein und lebt zum Teil in einem Kloster. Am Ort seiner Grablege entsteht – nicht ein neues Kloster, sondern, Lüttich – eine neue Stadt. Über das Leben des Lambertus informieren uns insgesamt fünf Viten8. Diese Lebensbeschreibungen sind allesamt nicht zeitgenössisch. Und sie verfolgen alle das Interesse, ein heiligmäßiges Leben vor Augen zu stellen. Sie sind deshalb keine Biographien im modernen Sinne. Die älteste Vita ist zum Beispiel ein Text, der für die Rezitation am Gedenktag des Heiligen geschaffen wurde. Dennoch lassen sich einige Fakten aus diesen Quellen rekonstruieren. Die Familie des Lambertus stammt aus Maastricht, ist dort begütert und nimmt gräfliche Funktionen in der Region wahr9. Die Familie ist seit längerem christianisiert10. Der Vater des Lambertus wird bereits in der Kirche St. Pieter bei Maastricht beigesetzt11. Die Besetzung des Bischofsstuhles durch ein Familien7 Prinz (Anm. 4), 492. 8 Die Viten sind gesammelt herausgegeben worden von Bruno Krusch, (MGH Scrip. rer. Merov. 6), Hannover 1913, 299–432. An erster Stelle steht die anonyme Vita Landiberti episcopi Trajectensis vetustissima, deren handschriftliche Überlieferung bis ins 8. Jahrhundert zurückreicht. Des weiteren gehören dazu die aus der Zeit zwischen 920–924 stammende Vita Landiberti episcopi Trajectensis autore Stephano, die aus dem 10. Jahrhundert stammende Vita Landiberti episcopi Trajectensis autore Sigeberto und die zwischen 1142–1147 entstandene Vita Landiberti episcopi Trajectensis autore Nicolao, sowie ein langes biographisches Gedicht, das anonyme Carmen de sancto Landberto, dessen handschriftliche Überlieferung bis ins 10. Jahrhundert zurückreicht (MGH Poetae IV/1), München 1978, 141–159. 9 Jean-Louis Kupper, Saint Lambert: de l’histoire à la Légende, in: Revue d’histoire ecclésiastique 79 (1984), 5–49, hier 9. 10 Das ist zu dieser Zeit in dieser Gegend noch nicht selbstverständlich. Lambertus arbeitet selbst noch an der Mission des unmittelbar im Norden angrenzenden Toxandrien. Auch sein Nachfolger im Bischofsamt, der Hl. Hubertus widmet sich noch der Bekämpfung des Heidentums in Brabant und den Ardennen. Vgl. Satoshi Tada, The Creation of a religious Centre. Christianisation in the Diocese of Liège in the Carolingian Period, in: Journal of Ecclesiastical History 54 (2003), 209–227, hier 210: „Pagan practices were still rife among Christian lay people, and many priests had little knowledge of religious matters even though the conversion of this region was formally complete“. 11 Vita vetustissima 18 (Anm. 8), 371,9–372,4. Vgl. auch das Carmen de s. Landberto 425–427 (Anm. 8), 154. Zur Identifizierung der Kirche vgl. Matthias Werner, Der Lütticher Raum in frühkarolingischer Zeit. Untersuchungen zur Geschichte einer karolingischen Stammlandschaft, Göttingen 1980, 248–251.
Der Hl. Lambertus und die Lambertikirche in Oldenburg
287
mitglied ist – in der Perspektive der Familie – ihrem Rang und ihrer Bedeutung angemessen. Unter dieser Voraussetzung lässt sich die Ausbildung des Lambertus als eine frühzeitige Karriereplanung verstehen. Die älteste Vita berichtet, er sei auf Grund einer Entscheidung des Vaters bereits früh in der Heiligen Schrift – also auch in der lateinischen Sprache – unterrichtet worden. Ebenfalls auf väterliche Initiative geht die Entscheidung zurück, dass Lambertus zur weiteren Ausbildung dem Bischof von Maastricht-Tongern12, Theodoardus (669– 670)13 übergeben wird. Er sorgt für drei wichtige Bereiche der Erziehung eines für die geistliche Laufbahn vorgesehen jungen Adeligen: Lambertus wird unterwiesen in der christlichen Lehre (divinis dogmatibus) und in der klösterlichen Disziplin (monasticis disciplinis). Das geschieht durch Theodoardus. Da seine Erziehung im Bannkreis des Königshofes von Childerich II. stattfindet, kommt als drittes noch das weltlich-adelige Ausbildungsprogramm hinzu, nämlich der Unterricht in der Kunst der Kriegsführung14. Das entspricht dem Wesen der in dieser Zeit neu entstehenden „Kultur des adeligen Klerus“15. Lambertus wird in beiden Bereichen ausgebildet und entspricht damit vollkommen den Idealvorstellungen seiner Epoche. Sein Leben nimmt eine Wende, als sein Lehrer und Förderer Thoedoardus unter heute nicht mehr zu klärenden Umständen ermordet wird. Die Nachfolge ist nun zu regeln und das geschieht am Hof des Königs. Aus der Gemeinde wird Lambertus vorgeschlagen, einflussreiche Adelige des Hofstaates unterstützen die Kandidatur und der König ernennt ihn zum Bischof von Maastricht-Tongern. Damit ist Lambertus steil aufgestiegen und nimmt neben seinen bischöflichen Funktionen zugleich die Stellung eines einflussreichen Ratgebers am Hofe Childerichs II. ein. Die Wende in der politischen Großwetterlage nach der Ermordung Childerichs II. (675) kostet ihn sein Amt. Er wird abgesetzt und eine gegnerische Clique sorgt dafür, dass an seiner Stelle Pharamond in Maastricht Bischof wird16. Das lässt darauf schließen, dass Lambertus zu dieser Zeit noch auf der Seite der Gegner der Karolinger steht. Er und sein Netzwerk von Familienangehörigen, Freunden und Abhängigen gehören zunächst noch zur Partei des Hausmeiers Wulfoald, auf dessen Macht die Herrschaft Childerichs II. gegründet war. Die Familie des Lambertus scheint in den Machtkämpfen nach Childerichs II. Tod die Seite gewechselt zu haben. Damit hatten Lambertus und sein Familienverband aber auf die falsche Partei gesetzt. 12 Das Bistum geht auf die römische civitas Tungrorum zurück. Das an der Maas gelegene Maastricht hatte sich aber inzwischen zur Hauptstadt der Diözese entwickelt. 13 Zu Theodoardus vgl. Werner (Anm. 11), 236–241. 14 Vita vetustissima 3 (Anm. 8), 355,13–356,1. 15 Dieser Begriff ist von Jacques Le Goff geprägt worden: „culture aristocratique cléricale“, in: Ders.: Pour un autre moyen âge, Paris 1977, 232. 16 Kupper, Saint Lambert (Anm. 9), 16.
288
Der Hl. Lambertus und die Lambertikirche in Oldenburg
Wulfoald übernimmt unter dem neuen König Dagobert II. wieder die Macht als Hausmeier. Lambertus wird jetzt als Vertreter einer der feindlichen Gruppe betrachtet und abgesetzt. Lambertus wird immerhin nicht ermordet, aber er muss sich in ein Kloster zurückziehen. Er geht, von nur zwei Dienern (pueri) begleitet, in das Kloster Stablo (Stavelot). Der Abt des Klosters akzeptiert die Herrschaft des Königs Dagobert II., sodass Lambertus dort als sicher verwahrt gelten konnte. Sieben Jahre lang lebt er dort. In dieser Zeit lässt die Hagiographie ein erstes größeres Wunder geschehen. Während der Nachtruhe unterbricht Lambertus unabsichtlich das vorgeschriebene Schweigen. Daraufhin wird er im Dunklen vom Abt, ohne dass dieser weiß, wer der Übeltäter ist, fast unbekleidet zu einem Gang zum außerhalb des Klosters liegenden Kreuz verurteilt. Mitten im Winter verbringt Lambertus dort viele Stunden im eisigen Frost, bis sein Fehlen von den Mönchen bemerkt wird und man ihn schneebedeckt, aber wunderbarerweise nicht erfroren wiederfindet17. Die sieben Jahre Klosterhaft enden für Lambertus, als sich erneut die politische Situation verändert. Inzwischen hat Pippin II. als Hausmeier die Macht in Austrien übernommen. Es dauert aber noch zwei Jahre bis er 682/3 Pharamond ab- und Lambertus als Bischof in Maastricht wiedereinsetzt. Das mag damit zusammenhängen, dass die Familie des Lambertus zunächst auf der Seite des Konkurrenten Ebroin in die Auseinandersetzungen um die Macht im Staate eingegriffen hatte. Die Wiedereinsetzung des Lambertus könnte also ein Versuch Pippins II. sein, dessen einflussreiche Familie an sich zu binden und so die eigene Herrschaft in der für ihn sensiblen Region Maastricht zu sichern18. Da die Karolinger dort selbst zahlreiche Besitzungen haben, liegt ihnen die Besetzung dieses Bischofsstuhles besonders am Herzen. Nach seiner Wiedereinsetzung in Maastricht beteiligt sich Lambertus an der Christianisierung in der in Nordbrabant gelegenen Landschaft Toxandrien. Das passt in die Zeit nach 689, dem Sieg Pippins über die Friesen unter Radbod. Danach werden vermehrt Anstrengungen zur Christianisierung der neu eroberten Gebiete unternommen. Die Vita berichtet, dass Lambertus „viele Tempel und Götterbilder zerstört“19, aber nicht nur als Streiter Gottes auftritt, sondern auch dazu in der Lage ist, die Herzen der Menschen für das Christentum einzunehmen20. Eine indirekte Bezeugung der Bemühungen um die Christianisierung Toxandriens ergibt sich aus dem Kalendarium des Hl. Willibrord. Er ist der 17 18 19 20
Vita vetustissima 6 (Anm. 8), 358,10–361,2. Diese These vertritt Werner (Anm. 11), 262–266. Vita vetustissima 10 (Anm. 8), 363,13. Vita vetustissima 10 (Anm. 8), 363,15–364,8. Diese Angaben der Vita sind allerdings erkennbar nach einem ihrer literarischen Vorbilder, der Vita Eligii gefertigt, sodass ihre historische Glaubwürdigkeit sich in Grenzen hält, vgl. Werner, (Anm. 11), 266.
Der Hl. Lambertus und die Lambertikirche in Oldenburg
289
Anführer der angelsächsischen Missionare, die sich seit 690 in Absprache mit den Karolingern um die Christianisierung der Friesen kümmern. Für Willibrord wird 695 das Bistum Utrecht gegründet. In Toxandrien überschneiden sich die Einflusssphären von Maastricht und Utrecht. Das scheint aber nicht zu Konkurrenz, sondern zu einer Zusammenarbeit zu führen. Nachdem Lambertus ermordet wurde, nimmt ihn Willibrord als einen der ganz wenigen maasländischen Heiligen in seinem Kalender auf. Am 17. September trägt er dort das Gedächtnis an „sancti landberichti episcopi“ ein. Willibrord gedenkt bis zu seinem Tode viele Jahre lang an diesem Tage im Gebet des Hl. Lambertus und bittet ihn um seine Fürbitte bei Gott21. Weiteres aus dem Leben des Lambertus berichtet die Vita nicht. Sie preist zwar immer wieder die Tugenden des Lambertus, aber substantielle Beschreibungen von Taten oder Ereignissen gibt sie nur noch von der Passio, d. h. der Art und Weise wie Lambertus zu Tode gekommen ist und welche Ereignisse sich nach seinem Tode abgespielt haben. Dafür braucht die Vita 17 von 28 Kapiteln und zeigt so, wo ihr Hauptschwerpunkt liegt, nämlich im Nachweis des christlichen Sterbens und der Heiligkeit des so zu Tode Gekommenen. In der Fassung der ältesten Vita hat der gewaltsame Tod des Lambertus seine Ursache in einer reinen Familienfehde. Zwei Brüder, Gallus und Rivaldus, tauchen in Maastricht auf und provozieren Lambertus und andere Angehörige des Bischofsgefolges. Aus welchem Grunde sie das tun, überliefert die Vita nicht, wohl aber, dass der Streit zwischen den beiden und dem Familienclan des Lambertus eskaliert und zwar so weit, dass „Freunde“ des Bischofs die beiden im Streit erschlagen. Das wiederum kann deren Blutsverwandter Dodo, der ebenfalls einem einflussreichen Geschlecht aus dem Maasraum entstammt, nicht auf sich sitzen lassen. Blutrache ist für ihn – nach germanischem Verständnis – ein heiliges Gebot. Er sammelt aus seiner Privatmiliz Männer um sich und greift Lambertus und seine Leute nächtens auf seinem Besitz in Lüttich (Liege)22 an. Lambertus hat zunächst den (adeligen) Impuls, sich mit dem Schwert zu verteidigen, tut das aber um Christi willen nicht. Er beschließt bei sich selbst, dass es „für ihn besser sei, in Christus zu sterben, als sich auf die Feinde zu stürzen“23. Das passiert dann auch so. Die anwesenden Neffen des Lambertus, die augenscheinlich die Mörder der beiden Brüder Gallus und Rivaldus waren24, versuchen,
21 Da Lambertus schon wenige Jahre nach seinem Tod als Heiliger verehrt wurde, kann man davon ausgehen, dass Willibrord bis zu seinem eigenen Tod 739 zwanzig oder mehr Jahre den Hl. Lambertus verehrte. Zum Ganzen vgl. Werner (Anm. 11), 267–268. 22 Vita vetustissima 12 (Anm. 8), 366,1: „in villa iam dicta Leodio“. 23 Vita vetustissima 14 (Anm. 8), 368, 5–6. 24 Vita vetustissima 16 (Anm. 8), 370,2 Lambertus bezichtigt seine Neffen des Mordes: „rei et noxii in crimine necem fuistis“. Das bezieht sich mit großer Wahrscheinlichkeit auf die vorher
290
Der Hl. Lambertus und die Lambertikirche in Oldenburg
Lambertus doch zum Kampf zu überreden. Er aber überzeugt seine Neffen, dass das Martyrium um Christi willen dem Kampf vorzuziehen sei und hindert sie so am Waffengang. Am Ende finden und ermorden ihn die feindlichen Kämpfer in seinem Zimmer auf dem Boden liegend mit gekreuzten Armen tränenreich im Gebet versunken25. Die Frage der Datierung des Todes ist nicht restlos zu klären. Sicher ist der Tag, der 17. September, unsicher ist aber, in welchem Jahr Lambertus starb. Traditionell wird 705 als Todesjahr angenommen.
Vom Bischof zum Heiligen Lambertus wird erstaunlich schnell als Heiliger verehrt. Zu dieser Zeit gibt es noch kein offizielles Verfahren zur Kanonisierung von Heiligen. Wer Heiliger wurde, entschied die Verehrung, die ihm von den Gläubigen entgegengebracht wurde26. Wie bedeutend ein Heiliger wurde, hing davon ab, welche einflussreichen Kreise seinen Kult förderten. Träger der Verehrung bestimmter Heiliger konnten Mönche oder auch Kleriker sein, aber auch adelige Familienverbände oder Herrscherhäuser. In jedem Falle gehört zur Verehrung eines Heiligen dazu, dass mirakulöse Dinge nicht nur während seines Lebens, sondern auch darüber hinaus geschehen. So wird bei Sterben des Lambertus, von einem der Männer des Dodo, der auf dem Dach als Wache postiert ist, beobachtet, dass Engel seine Seele ins Paradies tragen. Danach wird der Leichnam des Lambertus zunächst per Schiff nach Maastricht transportiert und dort in der Kirche St. Peter neben seinem Vater beigesetzt. Bald geschehen Wunder am Grab und es entsteht ein Kult um den Heiligen. Die Schnelligkeit, mit der die Verehrung des Lambertus einsetzt, erklärt sich aber nicht allein durch die Wunder, die an seinem Grab geschehen. Lambertus muss bereits in seinem Leben und Sterben etwas verkörpert haben, das für andere vorbildlich, staunenswert und verehrungswürdig war. Wenn man sich allein auf den Text der Vita vetustissima verlässt, bieten sich gar nicht so viele Ansatzpunkte für eine intensive Verehrung des Lambertus. erwähnte Tötung der beiden Brüder und nicht auf irgendein anderes, uns unbekanntes Verbrechen der Neffen. 25 Vita vetustissima (17 Anm. 8) 370,9: „prostravit se terre, extensa bracchia in cruce, orationem fundens cum lacrimis. Et subito pervenerunt carnifices, ingressi sunt in domo interfecerunt in os gladii omnes quos ibidem invenerunt.“ 26 Die Macht einer solchen spontanen Verehrung durch die Gläubigen konnte auch im Jahre 2005 noch beobachtet werden. Beim Begräbnis von Papst Johannes Paul II. forderte die versammelte Menschenmenge auf dem Petersplatz immer wieder in rhythmischen Sprechchören „santo subito!“ („Sofort heilig!“, d. h. er soll sofort heiliggesprochen werden). Der neugewählte Papst Benedikt XVI. konnte sich diesem Ruf nach Anerkennung der Verehrung Johannes Pauls nicht entziehen und leitete wenige Wochen nach seinem Amtsantritt, unter Missachtung der üblichen 5-Jahres-Frist, das förmliche Seligsprechungsverfahren ein.
Der Hl. Lambertus und die Lambertikirche in Oldenburg
291
Seine Vita zeichnet sich nicht durch zahlreiche populäre Wunder oder Handlungen zugunsten des Volkes aus. Auch seine Missionserfolge begründen die Verehrung nicht, denn der Kult beginnt in Maastricht, respektive Lüttich, also in seinem Bistum, nicht in seinem Missionsgebiet. Es sind auch nicht die Toxandrier, die nach Lüttich pilgern und dort den Hl. Lambertus verehren, sondern die Menschen aus der Umgebung. Auffällig ist, dass sehr schnell adelige Familien wie z. B. die Karolinger dem Heiligen ihre Verehrung erweisen. Bereits neun Jahre nach dem Tod des Lambertus wird seine Heiligkeit bezeugt: Grimoald, der Sohn Pippins II. wird im April 714 erschlagen, „als er zum Gebet in die Kirche des Hl. Lambertus geht“27. 717/8 wird der Leichnam des Lambertus von seinem Nachfolger Hubertus nach Lüttich gebracht und dort eine Kirche über dem Grab errichtet, die Maria und Lambertus geweiht ist28. Der schnelle Beginn der Verehrung des Hl. Lambertus hat in der neueren Forschung immer wieder für Verwunderung gesorgt, zumal die älteste Vita doch ziemlich deutlich erkennen lässt, dass der Tod des Lambertus sich ausschließlich einer Familienfehde verdankt29. Dennoch ist hier der Schlüssel zum Verständnis der Verehrung zu suchen. Dass Lambertus sich selbst, seinen Neffen, sowie dem übrigen Gefolge verbot, sich mit Waffengewalt gegen Dodo und seine Männer zur Wehr zu setzen, muss seine Zeitgenossen und vor allem die Adeligen unter ihnen beeindruckt haben. In der Schilderung dieser Ereignisse formuliert die Vita, die literarisch sonst oft von der Vita des Hl. Eligius abhängig ist30, erkennbar eigenständig. Die Passagen, in denen Lambertus seine Neffen davon abhält, sich mit der Waffe in der Hand auf die Feinde zu stürzen, sind zudem mit passenden biblischen Anspielungen und Zitaten gespickt. Die in der Vita wiedergegebene Argumentation des Lambertus zielt darauf, dass es für das ewige Heil besser sei, das körperliche Leben aufzugeben, als durch noch mehr Blutvergießen Schuld auf sich zu laden. Der Dialog mit den Neffen gipfelt in der Aufforderung, Lambertus möge mit einer Art Gottesurteil ermitteln, was in dieser Situation der Wille Gottes ist. Sie fordern ihn auf: „Lies in den Büchern des Herren, deines Gottes 27 Liber historiae francorum 50, zitiert bei Matthias Zender, Räume und Schichten mittelalterlicher Heiligenverehrung in ihrer Bedeutung für die Volkskunde. Die Heiligen des mittleren Maaslandes und der Rheinlande in Kultgeschichte und Kultverbreitung, Köln, 2. Aufl. 1973, 27. 28 Eben dieses Doppelpatrozinium findet sich auch in Oldenburg. Auch hier ist die Lambertikirche ursprünglich Maria und Lambertus geweiht gewesen. Der etwas komplizierte Erklärungsversuch für das Doppelpatrozinium in Oldenburg durch einen Umweg über Düsseldorf, den Elfriede Heinemeyer vorschlägt, erübrigt sich. Elfriede Heinemeyer, Die Baugeschichte der St. Lambertikirche von den Anfängen bis zum Ende des 18. Jahrhunderts, in: Oldenburg und die Lambertikirche, hg. v. R. Dannemann / H. Schmidt / R. Rittner, Oldenburg, 1988, 63– 96, hier 67. 29 Kupper, Saint Lambert (Anm. 9), 18–19 in Übereinstimmung mit Werner, (Anm. 11), 272. 30 Krusch (Anm. 8), 310: „Vita [sc. vetustissima] igitur Landibertit magna ex parte verbis Vitae Eligii descripta est“.
292
Der Hl. Lambertus und die Lambertikirche in Oldenburg
[…] und wie der Herr es will, so geschehe es mit uns“31. Auf dieses Ansinnen antwortet Lambertus nach dem Öffnen seines Psalteriums mit einem umgeformten Zitat von Ps 31,24 (Ps 30,24 nach Vulgata-Zählung): „Denn der Herr fordert das Blut seiner Knechte“ und führt das Beispiel des Zacharias, der im Tempel erschlagen wurde, als Vorbild an. Nachdem er die beiden Neffen – wie schon erwähnt – auf ihre Schuld am Tod der beiden Brüder hingewiesen hat, bittet Lambertus alle seine Männer, auf seinen letzten Wunsch zu hören (also keine Gewalt zu üben), ihre Sünden Christus zu bekennen und ihn – so wie Lambertus es tut – zu lieben. Er schließt mit den Worten: „Ich muss nun sterben und werde mit Gott leben“32. Diese Haltung angesichts des Todes, sein Gottvertrauen und seine Durchsetzung des Verzichtes auf Gegengewalt müssen in der Welt des kriegerischen Adelsethos der Franken überraschend und überzeugend zugleich gewirkt haben. In der Verweigerung der Gegenwehr gelingt es Lambertus, die Spirale der Blutrache durch die Hingabe seines eigenen Lebens zu durchbrechen. Das zeichnet ihn als Heiligen aus und begründet seine Verehrung. Die älteste Vita leistet durch die dramatische Komposition des Stoffes ihren Beitrag zu der einsetzenden Verehrung des Lambertus33, selbst wenn die an sich wenig schmeichelhaften Tatsachen der Sippenfehde und der Verstrickung des Lambertus in weltliche Auseinandersetzungen hier noch sehr gut zu erkennen sind. Diese in der ersten Vita gut zu erkennenden Tatsachen befriedigen allerdings schon bald die gängigen Vorstellungen von Heiligkeit nicht mehr und so wird nach mehreren Vorläufern im 10. Jahrhundert in der von Sigbert verfassten Vita des Lambertus eine Episode eingefügt, die seinem Wirken eine neue Qualität gibt. Er wird nun in eine Reihe mit Johannes dem Täufer oder Elias gestellt34. Denn Lambertus soll, ähnlich wie Johannes der Täufer es bei Herodes tat, dem Hausmeier Pippin II. sein ehebrecherisches Verhältnis zu Alpaïs vorgeworfen haben35 und deshalb von deren Bruder Dodo ermordet worden sein. Diese Legende entbehrt vielleicht nicht eines wahren Kerns, lässt sich aber nicht weiter belegen. Eine nach germanischem Recht geschlossene Friedelehe ist in der Ari31 Vita vetustissima 15 (Anm. 8), 369, 9–11: „Tunc respondit unus ex nepotes eius Autlaecus: ‚Lege modo in voluminis domini Dei tui et perfice opus suum, quod coepisti feliciter; et ut Dominus vult, ita erit de nobis‘“. 32 Vita vetustissima 16 (Anm. 8), 370,8: „Me oportet dissolvi et cum Domino vivere“. 33 Die literarisch-dramatische Qualität der Erzählung vom Mord an Lambertus beschreibt auch Jean Louis Kupper, Liege au VIIIe siecle. Naissance d’une ville sanctuaire, in: L’évangélisation des régions entre Meuse et Moselle (Journées Lotharingiennes 10/1998), Luxembourg 2000, 355–364, hier 358: „Ce meutre collectif spectaculaire, digne des carnages du Nibelungenlied, est vraisemblablement l’accomplissement d’une Rache, d’une vendetta perpétrée par un très haut fonctionnaire de l’Etat franc, le domesticus Dodon.“ 34 Kupper, Saint Lambert (Anm. 9), 27–44. 35 Vita Landiberti episcopi Trajectensis auctore Sigeberto 16 (Anm. 8), 397,5–398,14.
Der Hl. Lambertus und die Lambertikirche in Oldenburg
293
stokratie des 8. Jahrhunderts gut bezeugt. Sie wird zu dieser Zeit auch noch kirchlich geduldet. Da die Legende von der Ermordung des Lambertus auf Grund des ehebrecherischen Verhältnisses von Pippin zu Alpaïs sich aber frühestens im 9. Jahrhundert nachweisen lässt, ist die Überlegung naheliegend, dass sie in einem zeitgenössischen Kontext entstanden ist. Das könnte zum Beispiel das Konkubinat Lothars II. gewesen sein, an dem mit Hilfe der Legende vom Hl. Lambertus von kirchlicher Seite Kritik geübt wird36. Auf jeden Fall stellt die Legende noch einmal mehr eine enge Beziehung zu den Karolingern heraus, die den Kult des Heiligen – der gewissermaßen in ihrer Nachbarschaft lebte – von Anfang an stark fördern37. Lüttich ist geradezu von karolingischem Familienbesitz umgeben. Die Verehrung des Hl. Lambertus liegt für die Karolinger aus zwei Gründen nahe. Zum einen durch die gemeinsame Herkunft aus dem hohen fränkischen Adel und zum anderen durch die doppelte geographische Nähe. Beide Familien sind im mittleren Maasland begütert und hier ist durch das Grab und der sich darum herum entwickelnden Stadt der Heilige weiterhin präsent. So sind die Karolinger gewissermaßen die „natürlichen“ Förderer des Lambertuskultes38. Durch die Verehrung des Hl. Lambertus sichern die Karolinger sich zudem die fortwährende Unterstützung der Familie des Lambertus, die weiterhin hohe Ämter im fränkischen und karolingischen Reich bekleidet.
Die Verehrung des Hl. Lambertus Die Verehrung des Hl. Lambertus verbreitet sich mit den Eroberungen der Karolinger weit nach Osten und Süden. Die Lambertusverehrung wird zu einer Zeit verbreitet, in der noch viele Kirchen von adeligen Stiftern gegründet werden. Trotz der Reformbemühungen der Kurie, ist das Eigenkirchenwesen gerade in den frisch missionierten Gebieten Deutschlands eine übliche Praxis. Die Lambertusverehrung weitet sich also auch deshalb so stark aus, weil die Träger der Verehrung in die Schicht der Kirchengründer gehören. Es lässt sich ganz allgemein feststellen, dass in allen Fällen außerhalb der Erzdiözese Köln und des Bistums Lüttich, in denen wir die Förderer des Lambertuskultes fest-
36 So vermutet Kupper, Saint Lambert (Anm. 9), 46. 37 Lüttich wird sehr bald Bischofssitz, Karl der Große feiert hier 770 Ostern und die von ihm bevorzugte Pfalz (königliche Burg) in Herstal liegt so nahe bei der Stadt, dass der Bischof von Lüttich nahezu als „Hofbischof“ fungieren konnte. Durchgängig lassen sich karolingische Privilegien für die Kirche der Maria und des Hl. Lambertus zu Lüttich belegen. Zu den insgesamt 12 Aufenthalten Karls des Großen in Herstal vgl. Werner (Anm. 11), 446. 38 Eine Karte bei Werner (Anm. 11), 444, illustriert das.
294
Der Hl. Lambertus und die Lambertikirche in Oldenburg
stellen können, es sich um Angehörige des hohen Adels handelt […] Lambertus ist Heiliger des Adels, nach Martin einer der ersten Standespatrone überhaupt39.
Eine der weiteren Ursachen, die dem Hl. Lambertus bis ins hohe Mittelalter die außerordentlich weitreichende Verehrung sichert, hängt ebenfalls mit der adeligen Trägergruppe zusammen. Die Angehörigen des hohen Adels kommen bis ins 12. Jahrhundert immer wieder bei Reichsgeschäften in das Maasgebiet40. Auf diese Weise vernetzen sich die Träger der Lambertusverehrung untereinander, geben Reliquien weiter und erleben in der Verehrung „ihres“ Heiligen ein verbindendes Element des Adels im Reich.
Die Weihe der Oldenburger Stadtkirche an den Hl. Lambertus Das erklärt, weshalb auch im 12./13. Jahrhundert die Verehrung des Hl. Lambertus immer noch so lebendig ist, dass ihm weiterhin neue Kirchen geweiht werden41. In der Stadt Oldenburg wird die Hauptkirche, analog zu Lüttich, „Maria und dem Hl. Lambertus“ geweiht. Der Bau der Kirche muss vor 1237 stattgefunden haben. Zu diesem Zeitpunkt ist erstmals ein „Stadtpfarrer“ (plebanus) von Oldenburg als Zeuge einer Urkunde belegt. Er wird Pfarrer der Lambertikirche gewesen sein42. Der Name „St. Lamberti-Kirche“ ist allerdings erst durch eine Urkunde aus dem Jahre 1309 verbürgt43. Bevor die Umstände dieser Kirchengründungen genauer untersucht werden können, muss aber zunächst die Erklärung in Betracht gezogen werden, in der oldenburgischen Chronistik gegeben wird. Es zeigt sich dabei, dass die Erklärungsversuche des späten Mittelalters nichts Stichhaltiges über die hochmittelalterliche Gründungsgeschichte der Lambertikirche aussagen.
39 Zender (Anm. 27), 29. 40 Zender (Anm. 27), 32. 41 Für den Niederrhein beschreibt Wilhelm Janssen die über lange Zeit stabile Verehrung bestimmter Heiliger, darunter auch der Hl. Lambertus: „ein fester Fundus landschaftlich verankerter Heiliger (etwa Petrus, Johannes Ev. und Bapt., Martin, Lambertus) […] konnte sich […] steter Hochachtung erfreuen“, in: Heinrich Janssen / Udo Grote (Hg.), Zwei Jahrtausende Geschichte der Kirche am Niederrrhein, Münster 1998, 112. 42 Oldenburgisches Urkundenbuch (= Oldb UB) I, Nr. 3–5. 43 Oldb UB IV, Nr. 915 Das Regest ist unbrauchbar. Eine gedruckte Fassung der Urkunde liegt vor bei Heinrich Reimers, Oldenburgische Papsturkunden, in: Oldenburger Jahrbuch 16 (1908) 1–177, hier 38f. Vgl. auch die Anmerkungen von Heinz-Joachim Schulze, Oldenburg in der Patrozinienforschung, in: Oldenburger Jahrbuch 62 (1963), 215–222, zur Lambertikirche 217–219.
Der Hl. Lambertus und die Lambertikirche in Oldenburg
295
Die Lambertus-Notiz des Heinrich Wolters Die Rasteder Chronik als bedeutendste Quelle für die Frühzeit des Oldenburger Grafenhauses vermerkt zur Gründung der Lambertikirche in Oldenburg nichts. Erst der aus Oldenburg stammende Chronist Heinrich Wolters44 fügt in der Mitte des 15. Jahrhunderts in die Rasteder Chronik eine Notiz ein, die etwas über die Wahl dieses Kirchenpatrons in Oldenburg aussagt. Wolters behauptet, dass die Wahl des Hl. Lambertus als Kirchenpatron deshalb erfolgt sei, weil der Stammvater der Oldenburger Grafen, Egilmar I., seine Abkunft auf den karolingischen Fürsten Dodo zurückführte. Also sei auch diese Kirchengründung noch als Sühneleistung der – inzwischen weit entfernten – Verwandten Dodos für die Ermordung des Hl. Lambertus anzusehen45. Diese Notiz in der Rasteder Chronik scheint aber eben nicht mit der Absicht verfasst worden zu sein, die Frage nach dem Grund für die Wahl dieses Kirchenpatrons zu klären. Heinrich Wolters Absicht liegt vielmehr darin, das Oldenburger Grafengeschlecht dynastisch aufzuwerten, indem er die Möglichkeit eröffnet, dass die Abstammung der Grafen sich auf ein prominentes fränkisches Adelsgeschlecht zurückführen lässt46. Da die Notiz über die Wahl des Hl. Lambertus als Kirchenpatron in den älteren Fassungen der Rasteder Chronik nicht vorliegt, kann nicht davon ausgegangen werden, dass diese gelehrte Verbindung von Kirchenpatrozinium und dynastischer Anknüpfung an fränkische Vorfahren der Oldenburger Grafen bereits im 13. Jahrhundert vorgenommen wurde. Das ist eine Leistung von Wolters, die 44 Vgl. Heinrich Schmidt, Wolters, Heinrich, in: Biographisches Handbuch zur Geschichte des Landes Oldenburg, Oldenburg 1992, 816–817. 45 Gedruckt liegt der Text nur vor bei Heinrich Meibom, Rerum Germanicarum, 3 Teile, Helmstedt 1688. Dort ist im 2. Teil die Fassung der Rasteder Chronik des Heinrich Wolters wiedergegeben: Heinrich Wolters, Chronicon Rastedense, 83–120. Die Notiz zur Wahl des Patrons für die Oldenburger Kirche findet sich auf 92: „Et Jadelee fuit mansio Comitum, Baronum et militum, et etiam habitatio potentum Frisonum habebatur, qui tempore Karoli M. cum eo Romam vicerunt, et sunt nobilitati, et ad Frisiam remisi. Quidam vero ob insignia meritorum in Francia traducti, Ducatus et Comitias adepti sunt, sicuti Dodo domesticus aulae regiae, tempore Pipini inubi ab istis partibus traductus, et Dux et Comes Ardennae est factus, qui sanctum olim refertur occidisse Lambertum, et ideo postea Comites Rustriae de quorum sanguine idem fuisse reperitur, in honore S. Lamberti in oppido Oldenburg Ammirorum [der Ammerländer] fundaverunt Ecclesiam, ut sic de natione sua perpetuum delerent opprobium, et ut divina cessaret ultio, saeviens in nonam generationem propter parricidium. Et istum S. Lambertus, a Dodo interfectum, venerabilis Humbertus Episcopus Trajecti superioris fecit canonizaru, et in Leodium villam traduxit. Alii etiam Frisones nobilis tempore Karoli M. cum militaribus hujus patriae antiquo nomine in Franciae retinuerunt“. Zur Überlieferung des Wolterschen Textes vgl. immer noch die Bemerkungen von Hermann Oncken, Zur Kritik der Oldenburgischen Geschichtsquellen im Mittelalter, (diss. phil.) Berlin 1891, 46–63. 46 Vgl. Zender (Anm. 27), 24: „Es zeigt sich dann im hohen und späten Mittelalter das unverkennbare Streben, die verwandtschaftlichen Beziehungen der Heiligen zu Fürstenhäusern, vor allen zu den Karolingern hervorzuheben oder die Verbindung zu Karl dem Großen überhaupt zu erfinden“.
296
Der Hl. Lambertus und die Lambertikirche in Oldenburg
wenig später der nächste Oldenburger Chronist Johannes Schiphower übernimmt. Voraussetzung dafür ist die Kenntnis der Vita des Hl. Lambertus, die in der Fassung der legenda aurea im Mittelalter weit verbreitet und für Wolters unschwer zugänglich war. Die Frage nach dem Grund für die ursprüngliche Wahl des Hl. Lambertus als Kirchenpatron in Oldenburg wird allerdings durch den Zusatz des Heinrich Wolters in der Rasteder Chronik nicht beantwortet47.
Das Motiv der Sühne für die Untat des Dodo Der von Wolters vorausgesetzte Gedanke, dass die Stiftung einer Kirche oder eines Klosters als Sühne für ein Verbrechen dienen könnte, entspricht im Prinzip der frühmittelalterlichen Bußpraxis, in der ein „Ausgleich“ für die begangenen Sünden gefordert und in Katalogen für Bußleistungen festgesetzt wurde.48 Allerdings wird in der ältesten Vita weder von einer offiziellen kirchlichen Buße, noch von einer weltlichen Verurteilung des Dodo und seiner Kämpfer berichtet. Nur in sehr allgemeinen Worten beschreibt die älteste Vita, dass Dodo „von der göttlichen Rache“ verfolgt wurde und sein Leben „elend und schlecht“ beendet hat49. Die Nicolaus-Vita des 12. Jahrhunderts spricht von Dodo als „ungläubig“ und von seiner Tat als einem „Gott verhassten Sakrileg“ und von der „ewigen Verdammnis“ in die Dodo auf Grund seiner Tat geraten wird50. Nicolaus spricht auch vom schnellen Tod Dodos als einer Strafe, die dieser erhalten hat, ohne allerdings eine bestrafende Instanz zu benennen51. Die Bestrafung des Dodo erscheint so in beiden Fassungen als eine rein göttliche Tat. Die Kirche konnte ihm keine Buße auflegen und auch die fränkischen Herrscher scheinen kein Interesse an einer Bestrafung des Dodo gehabt zu haben. Die Tat des Dodo muss im 8. Jahrhundert in den Verhaltensformen des fränkischen Adels akzeptabel gewesen sein. Der Gedanke einer Bußleistung für die lang zurückliegende Tat des Dodo lässt sich erst bei der Gründung des Klosters St. Lamprecht in der Obersteiermark fassen. Die Gründungslegende führt dort ebenfalls die beabsichtigte Sühne eines der Nachkommen des Dodo als Grund für die Wahl des Patroziniums an52. Da aber auch dieser Text erst spätmittelalterlich ist, lässt sich für die 47 In der Formulierung vorsichtiger, aber in der Sache gleich, urteilt Heinrich Schmidt, Kirche, Graf und Bürger im mittelalterlichen Oldenburg, in: Oldenburg und die Lambertikirche, hg. v. R. Dannemann / H. Schmidt / R. Rittner, Oldenburg 1988, 9–40 hier 14: „Ob der von Heinrich Wolters festgehaltene Erklärungsversuch des oldenburgischen Lambert-Patroziniums schon auf längerer Tradition beruhte, ist nicht auszumachen“. 48 Arnold Angenendt, Geschichte der Religiosität im Mittelalter, Darmstadt 1997, 630–639. 49 Vita vetustissima (Anm. 8) 23, 377,5–9. 50 Vita Landiberti episcopi Trajectensis auctore Nicolao (Anm. 8) 16, 424,37+425,1+3. 51 Vita Landiberti episcopi Trajectensis auctore Nicolao (Anm. 8) 16, 426,19–20. 52 Zender (Anm. 27), 33 u. 55.
Der Hl. Lambertus und die Lambertikirche in Oldenburg
297
Zeit der Kirchengründung in Oldenburg kein Motivzusammenhang konstruieren, mit dessen Hilfe die Gründung von Lamberti-Kirchen oder Klöstern auf den Gedanken der Sühneleistung für die Untat des Dodo zurückführen wäre. Welcher Grund bleibt dann übrig, der zur Wahl des Patroziniums in Oldenburg geführt haben mag? Doch wohl nur das übliche Verhalten adeliger Kirchenstifter, die durch die Wahl eines bestimmten Patroziniums ihrer speziellen Vorliebe Ausdruck geben. Darüber, dass für den Bau und damit sicher auch für die Wahl des Patroziniums die Familie der Grafen von Oldenburg verantwortlich gewesen ist, besteht in der Forschung ein einhelliger Konsens. Deshalb scheint es sinnvoll, in der Geschichte der gräflichen Familie nach Verbindungen zum Hl. Lambertus bzw. dessen Verehrung im Gebiet von Rhein und Maas zu suchen.
Drei Hypothesen zur Gründung der Lambertikirche und der Lambertusverehrung des Oldenburger Grafenhauses Die Familie der späteren Grafen von Oldenburg hat ihren Aufstieg zur Territorialherrschaft während der Herrschaft der Billunger als Markgrafen und Herzöge in Sachsen vollzogen. Die Billunger haben von 953 bis 1106 die Herrschaft in Sachsen inne. 1091 ist der erste Oldenburger Egilmar – zwar als Graf (comes), aber noch ohne Angabe eines von ihm beherrschten Territoriums – urkundlich erwähnt53. 1108 wird er gegen die jährliche Zahlung von 90 Bund Aalen in die Gebetsverbrüderung des Klosters Iburg aufgenommen. Jetzt wird er bezeichnet als „Graf, der in Sachsen und Friesland präsent und mächtig ist“54. Die Übergabe der Aale soll immer am 8. September an Boten des Klosters bei „Aldenburg“ erfolgen. Das ist die erste urkundliche Erwähnung von Oldenburg als Ort. Die „reichspolitische“ Hypothese 1149 belegt eine Urkunde den Grafen Christian I. „von Oldenburg“ im Umfeld des sächsischen Herzogs Heinrich d. Löwen. Die Welfen haben die Billunger abgelöst und sind in der Mitte des 12. Jahrhunderts das beherrschende Geschlecht in Sachsen55. Sie sind die Lehnsherren der Oldenburger Grafen, denen es bis zu dieser Zeit gelungen war, ein eigenes Territorium – in noch nicht geklärtem Umfang – in Besitz zu nehmen. Im mittelalterlichen Lehnswesen gehören sie als Grafen zu den Lehnsnehmern. Lehnsherr war zunächst der Herzog von Sachsen. 53 Oldb UB II, Nr. 15. 54 Oldb UB II, Nr. 17 Egilmarus comes in confino Saxoniae et Frisie potens et manens, dt. Übers. v. Heinrich Schmidt, in: Albrecht Eckhardt / Heinrich Schmidt, Geschichte des Landes Oldenburg, Oldenburg 1987, 112. 55 Hans-Walter Krumwiede, Kirchengeschichte Niedersachsens, Bd. 1, Göttingen 1995, 71–72.
298
Der Hl. Lambertus und die Lambertikirche in Oldenburg
Deshalb leistet Graf Christian I. (1148–1167) Heinrich dem Löwen Vasallendienste und zieht mit dem sächsischen Heeresaufgebot 1148 in den Feldzug gegen die Dithmarscher. 1155 ist er im sächsischen Aufgebot im Heer des Kaisers Friedrich I. Barbarossa in Italien anzutreffen. Im Gefolge des Kaisers befinden sich viele andere geistliche und weltliche Fürsten. Christian I. ist hier nachweislich mit Trägern der Lambertusverehrung zusammengetroffen, allen voran dem Bischof von Lüttich, Heinrich von Leez, der diesen und weitere Heerzüge Barbarossas begleitet56. Der Lütticher Bischof gehört zu den wichtigen Unterstützern Friedrichs I.57. Vermutlich hat die Lambertusverehrung in dieser Situation auch eine politische Dimension. Es gibt im Umkreis Kaiser Barbarossas zu dieser Zeit eine andere dokumentierte Verbindung zwischen Angehörigen des Hochadels, die den Hl. Lambertus verehren. Sie besteht zwischen dem Magdeburger Raum und Lüttich. Die Bischöfe Wichmann von Magdeburg und Udo von Naumburg sind Verehrer des Hl. Lambertus und sorgen sogar für eine Überführung von Reliquien aus Lüttich58. Auch sie finden sich gemeinsam mit dem Lütticher Bischof unter den Teilnehmern großer Feldzüge Friedrich Barbarossas59. Wichmann von Madgeburg gehört ebenso wie Graf Christian I. zu den sächsischen Unterstützern 56 Jan-Peter Stöckel, Reichsbischöfe und Reichsheerfahrt unter Friedrich I. Barbarossa, in: Kaiser Friedrich Barbarossa, Landesausbau – Aspekte seiner Politik – Wirkung, hg. v. E. Engel / B. Töpfer (Forschungen zur mittelalterlichen Geschichte 36), Weimar 1994, 63–79 hier: 64–65. 57 Zender, (Anm. 27), 24 weist auf die „Reichstreue der Bischöfe von Lüttich und Cambrai“ hin: „In jedem Falle ist die Reichstreue, wie auch die überaus enge Verbindung von Lüttich und Cambrai zum kaiserlichen Hofe Tatsache und in den uns interessierenden Fragen nicht ohne Folgen. Die Bischöfe stammen zum Teil aus dem Gefolge des Kaisers und halten sich als Bischöfe oft am Hof auf, wie auch die Kaiser häufig in der Diözese Lüttich verweilen. So hat Heinrich IV. bekanntlich seine letzte Zuflucht in Lüttich gefunden. Bis zur Beendigung des Investiturstreites, Anfang des 12. Jahrhunderts, dauerte dieser Zustand, um dann noch einmal in dem Lütticher Bischof Heinrich von Leez, dem Parteigänger Friedrich Barbarossas, und seinem Nachfolger Rudolf von Zähringen († 1191) eine späte Fortsetzung zu finden“. 58 Zender (Anm. 27), 32: „In der Magdeburger Gegend erweist sich der Erzbischof Wichmann, wie auch sein Verwandter, der Bischof Udo von Naumburg, der den Hl. Lambertus patronus suus nennt, als eifriger Propagator des Heiligen in jener Zeit. Bei diesen beiden Verehrern des Hl. Lambertus denken wir unwillkürlich an die Lütticher Bischöfe der gleichen Zeit, die ebenfalls zu Barbarossa standen und möchten vermuten, dass sich aus diesem Zusammenhang die Beziehungen der beiden mitteldeutschen Bischöfe zu Lambert erklären lassen. Bei Udo von Naumburg erfahren wir dann wenigstens auch einen der Gründe, die für die Ausbreitung des Lambertuskultes angeführt werden können. Udo stand in engen persönlichen Beziehungen zu Lüttich und hatte von dort Reliquien erhalten.“ Die Reliquientranslation fand bereits 1147/48 statt. Vgl. Zender (Anm. 27), 51. 59 Stöckel (Anm. 55), 64–65: Die Bischöfe von Lüttich, Magdeburg und Naumburg waren zusammen auf den Heerzügen in Italien 1158–1160 und 1161–1162, die Bischöfe von Lüttich und Naumburg auf dem Italienzug 1166–1168, am erstgenannten Italienzug beteiligte sich auch der Erzbischof von Bremen, der Kirchenherr in Oldenburg war.
Der Hl. Lambertus und die Lambertikirche in Oldenburg
299
Barbarossas und damit zugleich zur Opposition gegen den Herzog Heinrich den Löwen60. Es gibt also im Umkreis Kaiser Barbarossas die plausible Möglichkeit des Kontaktes zwischen dem Oldenburger Grafen und ausgewiesenen Trägern der Lambertusverehrung. Die Errichtung einer dem Hl. Lambertus geweihten Kirche in Oldenburg würde sich unschwer in diesen Kontext einfügen lassen. Der Bau der Lambertikirche in Oldenburg müsste dann zwischen 1155 und 1166 dem Beginn der sächsischen Verschwörung gegen Heinrich den Löwen erfolgt sein. Graf Christian I. vollzieht in dieser Zeit den offenen Bruch mit Heinrich dem Löwen. Zunächst zieht er 1164 noch mit dem Welfenherzog gegen die Wenden. Aber 1166 beteiligt er sich maßgeblich an der sächsischen Fürstenverschwörung gegen Heinrich den Löwen. Er zieht gegen Heinrich ins Feld, erobert die Burg Weyhe und verbündet sich mit den Bremern, die ebenfalls zu den Gegnern Heinrichs gehören. Heinrichs übermächtigen Truppen ist er allerdings nicht gewachsen und muss sich nach Oldenburg zurückziehen. Dort stirbt er 1167 während der Belagerung durch Heinrichs Truppen61. In den folgenden Jahren wird Oldenburg von welfischen Vögten verwaltet. Die Zeit bis zum Sturz Heinrichs des Löwen 1180 scheidet für die Erbauung der Lambertikirche definitiv aus. Die Heiratshypothese Das Gebiet der Grafen von Oldenburg fällt nach der 1180 erzwungenen Auflösung des Herzogtums Sachsen als ein Teil der Grafschaft Stade an das Hochstift Bremen. In dieser Situation scheinen die Oldenburger Grafen die Gunst der Stunde nutzen zu können. Sie sind von der übermächtigen Vorherrschaft der Welfen befreit. In dieser Situation gelingt ihnen das politische Kunststück, nicht zu Vasallen des Bremer Erzbischofs zu werden. Stattdessen werden sie in der Regierungszeit von Moritz I. (bis 1211), und seinen Söhnen Christian II. (1211– 1233) und Otto II. (1211–1252), zu einer Art anerkannter Nachbarn der Bremer Erzbischöfe. Das formal bestehende Lehnverhältnis wird anscheinend still-
60 Auf diese Verbindung zwischen der Lambertusverehrung und einer politischen Stellungnahme im 12. Jahrhundert hat bereits hingewiesen: Heinemeyer, Baugeschichte (Anm. 28), 66: „In der Folgezeit wird der Heilige [Lambertus] häufig als Patron solcher Kirchen genannt, die von adeligen Stiftern auf eigenem Grunde errichtet wurden, und im 12. Jahrhundert kam die Förderung seines Kultes einer politischen Aussage gleich. So waren z. B. Erzbischof Wichmann von Magdeburg und Bischof Udo von Naumburg an der Verbreitung wesentlich beteiligt und gehörten wie der Bischof von Lüttich zu den Parteigängern Kaiser Barbarossas im Kampf gegen Heinrich den Löwen“. 61 Gustav Rüthning, Oldenburgische Geschichte 1. Bd., Bremen 1911, 25–29.
300
Der Hl. Lambertus und die Lambertikirche in Oldenburg
schweigend aufgelöst, ohne dass stattdessen eine Belehnung auf Reichsebene erfolgt62. In diese Zeit ordnet eine bereits öfter vorgetragene Hypothese den Bau der Oldenburger Lambertikirche ein: Die Ehegattin eines der Oldenburger Grafen wird zur Erklärung herangezogen63. Vor allem Carl Wöbcken, Pfarrer in Sillenstede, sowie die Kunsthistorikerin Elfriede Heinemeyer haben diese These verbreitet64. Carl Wöbcken betrachtet auf Grund der urkundlich belegten Jahreszahl 1224 an einem der Pfeiler der Südseite des Gebäudes, Graf Moritz I. als Erbauer. Ausgangspunkt seiner Überlegung ist, dass die Zahl 1224 an einem Pfeiler erst angebracht worden sein kann, nachdem der – wie zu vermuten – erste einschiffige Bau durch Seitenschiffe erweitert wird, denn vorher gab es an der Außenseite der Kirche mit Sicherheit keine Pfeiler. Deshalb schlägt Wöbcken vor, davon auszugehen, dass vor der Erweiterung ein einschiffiger Kirchenbau besteht. Dessen Errichtung vermutet er in der Lebenszeit des Grafen Moritz I. (Graf von 1167–1211). Moritz I. ist verheiratet mit Salome aus dem niederrheinischen Adelsgeschlecht von (Are-) Wickrath65. Sie kommt aus einer Region und einer adeligen Familie, in der die Verehrung des Hl. Lambertus stark verbreitet ist. Vier ihrer Großonkel und zwei ihrer Brüder sind hohe Geistliche an Kirchen, in denen der Hl. Lambertus verehrt wird66. Lothar von Hochstaden, ein Bruder ihres Vaters wird 1192/3 von Kaiser Heinrich VI. zum Bischof von Lüttich ernannt67. Der andere Bruder ihres Vaters, Theoderich I. von Hochstaden erhält die Grafschaft Dalheim zu Lehen, sie umfasst das Gebiet zwischen Lüttich, Maastricht und 62 Vgl. Rüthning (Anm. 60), 29: „Die Grafschaft Oldenburg gehörte zu jenen neueren Staatenbildungen, die sich seit der Auflösung der alten fränkischen Grafschaftsverfassung entwickelten“. 63 So Schmidt, Kirche, Graf und Bürger im mittelalterlichen Oldenburg (Anm. 45), 12: „Zum heiligen Lambertus war das Oldenburger Grafenhaus möglicherweise über seine niederländischen Heiratsverbindungen, während der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts, in nähere Beziehung geraten“. 64 Carl Wöbcken, Lambertikirchen, Der Oldenburgische Hauskalender oder Hausfreund auf das Jahr 1958, Oldenburg 1957, 29–30. 65 Ute Bader, Geschichte der Grafen von Are bis zur Hochstadenschen Schenkung (1246) (Rheinisches Archiv 107), Bonn 1979. 66 Die vier Großonkel sind: Gerhard von Are, Propst des Bonner Münsters, das einen Altar dem Hl. Lambertus geweiht hatte, vgl. Bader (Anm. 64), 241–242 und Zender (Anm. 27), 42; Friedrich von Are, Bischof von Münster, dessen Dom ebenfalls einen Lambertusaltar hat, vgl. Bader (Anm. 64), 179 und Zender (Anm. 27), 51; Hugo von Are war Domdekan in Köln, an dessen Dom eine Kapelle dem Hl. Lambertus geweiht ist, vgl. Bader (Anm. 64), 179 und Zender (Anm. 27), 48; sowie Poppo von Are, Kanoniker im Stift Maria ad Gradus in Köln, das Reliquien des Hl. Lambertus besitzt, vgl. Bader (Anm. 64), 179 und Zender (Anm. 27), 48. Zwei Brüder der Salome von (Are-)Wickrath treten in das Stift in Xanten ein. Gerhard wird Propst, Hermann ist Kanoniker, vgl. Bader (Anm. 64), 177, das Stift hat einen seit 1083 belegten Altar für den Hl. Lambertus, vgl. Zender (Anm. 27), 59. 67 Er war vorher Nachfolger Gerhards von Are als Propst in Bonn, vgl. Bader (Anm. 64), 199–207.
Der Hl. Lambertus und die Lambertikirche in Oldenburg
301
Aachen am rechten Maasufer, das ebenfalls zu den Regionen zählt, in dem der Hl. Lambertus traditionell verehrt wird68. Dass Salome von Wickrath die Verehrung des ihr vertrauten Hl. Lambertus nach Oldenburg gebracht hat, ist durchaus plausibel. Wöbcken datiert deshalb auch die Stiftung von St. Lamberti in Aurich auf die Lebenszeit dieses gräflichen Paares und erklärt die bei dem spätmittelalterlichen Chronisten Johannes Schiphower vorgenommene Datierung für ein „Missverständnis“69. Dem stimmt auch die neuere Untersuchung von Moßig zu, der ebenfalls eine Gründung der Lambertikirche in Aurich „um das Jahr 1200 – vielleicht also noch im 12. Jahrhundert“ für „gegenwärtig sehr plausibel“ hält70. Die Heirat des Grafen Moritz I. mit Salome von (Are-)Wickrath bietet also eine gute Möglichkeit, die Weihe der Oldenburger Stadtkirche an den Hl. Lambertus zu erklären71. Einen möglichen Anlass zur Errichtung einer neuen Kirche in Oldenburg gibt das Ende des welfischen Intermezzos72, als es Graf Moritz nach 1181 wieder möglich ist, als Herrscher nach Oldenburg zurückzukehren. Dieses wichtige Ereignis könnte mit der Errichtung einer Stadtkirche verbunden worden sein. Die Spätdatierung Als letzte Möglichkeit zur Errichtung der Lambertikirche in Oldenburg ergibt sich die Variante einer Spätdatierung, die die Errichtung der Kirche in unmittelbare Nähe der urkundlichen Erwähnung des Stadtpfarrers in Oldenburg rückt. Die Oldenburger Grafen haben es zwischen 1181 und 1233 geschafft, zu Partnern des Bremer Erzbischofs aufzurücken. Bei der Vorbereitung des ersten Kreuzzuges gegen die Stedinger erscheinen die Oldenburger Grafen 1233 als direkte Partner des Bischofs beim Abschluss des Vertrages mit der Stadt Bremen. Ihre 68 Bader (Anm. 64), 286–288. 69 Johannes Schiphower, Chronicon Archi-Comitum Oldenburgensium, in: Heinrich Meibom, Rerum Germanicarum, 3 Teile, Helmstedt 1688, 151 (zum Jahr 1270): „His etiam temporibus Archi-Comes Johannes et eius filii, qui ante castrum habuerunt cappellam S. Nicolai Episcopi in honore Lamberti martyris parochiam statuerunt aliam in Aurickdorf vel in Auricke in partibus Frisiae aedificaverunt in Brockmerlande: quam Focko Uken traditorie a praedictis Archi-Comes accepit“; dazu vgl. Carl Wöbcken, (Anm. 63), 30. 70 Christian Moßig, Untersuchungen zur Geschichte des Auricherlandes im späten Mittelalter, in: Jahrbuch der Gesellschaft für bildende Kunst und vaterländische Altertümer zu Emden 62 (1982), 67–86 hier 84. 71 So ohne weitere Belege Heinrich Schmidt, Oldenburg in Mittelalter und früher Neuzeit, in: Geschichte der Stadt Oldenburg, Bd. 1, Oldenburg 1997, 33. Er schlägt vor: Dass die Grafen von Oldenburg Lambertus „zum Heiligen ihrer Kirche erwählten – möglicherweise auf Betreiben der aus niederrheinischem Adel stammenden Salome von Wickrath, Gemahlin Graf Moritz I.“. 72 Heinrich Schmidt, Oldenburg in Mittelalter (Anm. 70), 24.
302
Der Hl. Lambertus und die Lambertikirche in Oldenburg
Siegel umrahmen das Siegel des Bischofs, während die Ministerialen und Dienstmannen nur unterschreiben dürfen73. Der 1234 schließlich erfolgreiche (aus Sicht des Bischofs und der beteiligten Adeligen) zweite Kreuzzug gegen die Stedinger scheint diesen Zustand endgültig befestigt zu haben74. In der Vorbereitung und der Durchführung dieses Zuges gegen die Stedinger ist zum zweiten Mal ein direkter personaler Kontakt zwischen Adeligen aus dem niederländischflandrischen Raum und Oldenburg nachzuweisen. Nachdem beim ersten Zug gegen die Stedinger vor allem die Adeligen aus der direkten Umgebung Bremens teilgenommen haben, wird der zweite Kreuzzug überregional vorbereitet. Im Sommer 1233 beginnt die erneute Kreuzzugspredigt. Jetzt folgen dem päpstlichen Aufruf Adelige und Dienstleute aus den niederrheinischen Grafschaften Geldern und Kleve, aus der Grafschaft Holland und dem Herzogtum Brabant. Selbst aus der Grafschaft Flandern, die nicht zu den Territorien des Deutschen Reichs, sondern zu den Vasallen der französischen Krone zählte75.
Die Kreuzfahrer des zweiten Kreuzzuges sammeln sich in Bremen und brechen von da aus zur Schlacht auf, in der sie am 27. 5. 1234 die Stedinger Bauern vernichtend schlagen. Während der Vorbereitungen und der Durchführung des zweiten Zuges gegen die Stedinger sind Oldenburger Adelige und Angehörige des rheinisch-holländisch-flandrischen Adels ständig miteinander in Kontakt gekommen. Flandern, Holland und der Niederrhein bilden seit Jahrhunderten einen Raum, in dem der Hl. Lambertus intensiv verehrt wird – vor allem von den Angehörigen des Adels76. Hier wäre nun endgültig im überreichen Maß Gelegenheit für einen Kontakt zwischen den Grafen von Oldenburg und anderen Adelsfamilien gegeben, die den Hl. Lambertus als ihren Schutzheiligen in Anspruch nehmen. Die Schwierigkeit einer so späten Datierung der Errichtung der Lambertikirche liegt in der verbürgten Angabe der Jahreszahl 1224 am mittelalterlichen Kirchenbau. Die erste urkundliche Erwähnung des „Stadtpfarrers Johannes“ im Jahre 1237, widerspräche einem Kirchbau zu Ehren des Hl. Lambertus im Gefolge der Schlacht von Altenesch hingegen nicht.
73 Oldb UB II, Nr. 66. 74 Vgl. Rüthning (Anm. 60), 32–50. 75 Rolf Köhn, Die Teilnehmer an den Kreuzzügen gegen die Stedinger, in: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte 53 (1981), 139–206, hier 171. 76 S. o. die Karte der Ausbreitung der Lambertusverehrung von Zender (Anm. 27).
Der Hl. Lambertus und die Lambertikirche in Oldenburg
303
Zusammenfassung Es ergeben sich drei Hypothesen zur Errichtung der Lambertikirche in Oldenburg und ihrer Verknüpfung mit Ereignissen und Personen aus der Geschichte des Oldenburger Grafenhauses. 1. Graf Christian I. könnte seit 1155 durch seine Kontakte auf Reichsebene Zugang zur Verehrung des Hl. Lambertus gehabt haben. Seine Zugehörigkeit zur Opposition gegen Heinrich den Löwen rückt ihn in die Nähe der Unterstützer des Kaisers Friedrich Barabarossa, zu denen mehrere Verehrer des Hl. Lambertus gehörten. 2. Graf Moritz I. könnte durch seine Hochzeit mit Salome von (Are-) Wickrath in Kontakt mit dem am Niederrhein und dem Maasland intensiv verehrten Hl. Lambertus in Kontakt geraten sein. Seine Rückkehr nach Oldenburg um 1181 böte zudem einen Anlass zu einer Kirchenstiftung. Wenn die Gründung der Lambertikirche in Aurich ebenfalls um 1200 erfolgt ist, gäbe es zudem eine deutliche Parallele zur Gründung der Lambertikirche in Oldenburg durch Moritz I. und Salome. 3. Wenn die Lambertikirche nicht unter Moritz I. errichtet worden sein sollte, bleibt als zeitlich letzte Möglichkeit der Kreuzzug gegen die Stedinger 1234. Dort gibt es genügend Möglichkeiten für Kontakte zwischen Angehörigen des Oldenburger Grafenhauses und den zahlreichen Kreuzfahrern aus den Niederlanden, Flandern und vom Niederrhein, Gegenden, in denen die adeligen Familien traditionell Träger der Lambertusverehrung waren. Die Schlacht von Altenesch ergäbe auch einen Anlass zur Kirchengründung aus Dankbarkeit und Freude über den errungenen Sieg.
Weitere Zeugnisse für die Verehrung des Hl. Lambertus im Oldenburger Land Die weiteren vorhandenen Belege für die Verehrung des Hl. Lambertus im Oldenburgischen sind sehr unterschiedlicher Natur. Zunächst einmal gibt es heute eine weitere Lambertikirche in Eckwarden (Butjadingen). Die Geschichte dieser Kirche und ihres Patroziniums ist allerdings kompliziert. Bereits die Namensgebung der Kirche ist unsicher. H. Goens belegt aus dem Patrimonienbuch des 16. Jahrhunderts die Bezeichnung als Lambertikirche, eine Glocke des 15. Jahrhunderts bezeichnet aber den Hl. Martin als Kirchenpatron77. Nach archäologischen Erkenntnissen könnte ein erster Kirchbau bereits vor 1000 errichtet worden sein. Eine Notiz in der „Intscheder Agende“ berichtet, die Kirche in Eck77 Hermann Goens, Die Einziehung der Kirchengüter während der Reformationszeit im evangelischen Gebiete des Herzogtums Oldenburg, in: Oldenburger Jahrbuch 31 (1928), 7–116, hier 70.
304
Der Hl. Lambertus und die Lambertikirche in Oldenburg
warden sei von Graf Huno und damit im 11. Jahrhundert gegründet worden78. Der jetzige Bau stammt zum größten Teil aus dem 13. Jahrhundert79 und würde, wenn er damals dem Hl. Lambertus geweiht worden ist, in eine Reihe mit den beiden Lambertikirchen in Oldenburg und Aurich passen. Die Bau- und Patroziniumsgeschichte bleibt aber so unklar, dass eine Datierung im strengen Sinn ohne weitere Quellen nicht möglich erscheint. Des weiteren ist der Name „Lambert“ belegt für den Abt des Klosters Rastede von 1240–126080, der allerdings nicht aus Oldenburg, sondern aus dem Westfälischen stammt, so dass diese Namensgebung leider nicht auf die Verehrung des Hl. Lambertus im Oldenburgischen schließen lässt. Neben der Benennung der Oldenburger Stadtkirche nach dem Hl. Lambertus gibt es zwei weitere Zeugnisse für die Verehrung des Heiligen in der Stadt. In der Oldenburger Lambertikirche war der Hauptaltar der Mitpatronin Maria geweiht. Aber es hat zudem (auf diesem Altar?) eine Lambertus-Figur in der mittelalterlichen Kirche gegeben. Sie wird das letzte Mal am 19. April 1530 erwähnt, dort heißt es in einem Übergabeprotokoll verschiedener Gegenstände aus der Kirche: „Ock eyn belde van sunte Lamberde, unde dar ys ave de bischups staff unde swert“81. Auf Hochdeutsch: „Auch eine Figur von Sankt Lambertus, an der fehlen der Bischofsstab und das Schwert“. Lambertus war also den Oldenburgern durch eine Heiligenfigur gegenwärtig. Dass er für die Bewohner der Stadt eine große Bedeutung besaß zeigt auch das große Siegel der Stadt Oldenburg von 1366. Nach der Verleihung der Stadtrechte (1345) hat die Stadt Oldenburg den Patron der Hauptkirche als ihren Schutzheiligen übernommen.
Quellen Carmen de sancto Landberto (MGH Poetae IV/1), München 1978, 141–159. Hermann Lübbing (Hg.), Die Rasteder Chronik, Oldenburg 1976. Heinrich Meibom, Rerum Germanicarum, 3 Teile, Helmstedt 1688. Vita Landiberti episcopi Trajectensis vetustissima, Vita Landiberti episcopi Trajectensis autore Stephano, Vita Landiberti episcopi Trajectensis autore Sigeberto, Vita Landiberti episcopi Trajectensis autore Nicolao, hg. v. Bruno Krusch (MGH Scrip. rer. Merov. 6), Hannover 1913, 299–432.
78 Albrecht Graf Finck von Finckenstein, Die Geschichte Butjadingens und des Stadlandes bis 1514 (Oldenburger Studien 13), Oldenburg 1975, 112–113. 79 Georg Dehio, Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler. Bremen, Niedersachsen, Berlin 1992, 419. 80 Hermann Lübbing (Hg.), Die Rasteder Chronik, Oldenburg 1976, 34. 81 Oldb UB IV, 1319.
Der Hl. Lambertus und die Lambertikirche in Oldenburg
305
Literatur Arnold Angenendt, Heilige und Reliquien. Die Geschichte ihres Kultes vom frühen Christentum bis zur Gegenwart, München 1994. Ders., Geschichte der Religiosität im Mittelalter, Darmstadt 1997. Ute Bader, Geschichte der Grafen von Are bis zur Hochstadenschen Schenkung (1246) (Rheinisches Archiv 107), Bonn 1979. Georg Dehio, Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler. Bremen, Niedersachsen, Berlin 1992. Albrecht Eckhardt / Heinrich Schmidt, Geschichte des Landes Oldenburg, Oldenburg 1987. Albrecht Graf Finck von Finckenstein, Die Geschichte Butjadingens und des Stadlandes bis 1514 (Oldenburger Studien 13), Oldenburg 1975. Geschichte der Stadt Oldenburg, Bd. 1, Oldenburg 1997. Hermann Goens, Die Einziehung der Kirchengüter während der Reformationszeit im evangelischen Gebiete des Herzogtums Oldenburg, in: Oldenburger Jahrbuch 31 (1928), 7–116. Elfriede Heinemeyer, Die Baugeschichte der St. Lambertikirche von den Anfängen bis zum Ende des 18. Jahrhunderts, in: Oldenburg und die Lambertikirche, hg. v. R. Dannemann / H. Schmidt / R. Rittner, Oldenburg, 1988, 63–96. Heinrich Janssen / Udo Grote (Hg.), Zwei Jahrtausende Geschichte der Kirche am Niederrrhein, Münster 1998. Rolf Köhn, Die Teilnehmer an den Kreuzzügen gegen die Stedinger, in: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte 53 (1981), 139–206. Hans-Walter Krumwiede, Kirchengeschichte Niedersachsens, Bd. 1, Göttingen 1995. Jean-Louis Kupper, Saint Lambert: de l’histoire à la Légende, in: Revue d’histoire ecclésiastique 79 (1984), 5–49. Ders., Liege au VIIIe siecle. Naissance d’une ville sanctuaire, in: L’évangélisation des régions entre Meuse et Moselle (Journées Lotharingiennes 10/1998), Luxembourg 2000, 355–364. Jaques Le Goff, Pour un autre moyen âge, Paris 1977. Christian Moßig, Untersuchungen zur Geschichte des Auricherlandes im späten Mittelalter, in: Jahrbuch der Gesellschaft für bildende Kunst und vaterländische Altertümer zu Emden 62 (1982), 67–86. Hermann Oncken, Zur Kritik der Oldenburgischen Geschichtsquellen im Mittelalter, (diss. phil.) Berlin 1891. Friedrich Prinz, Frühes Mönchtum im Frankenreich. Kultur und Gesellschaft in Gallien, den Rheinlanden und Bayern am Beispiel der monastischen Entwicklung (4. bis 8. Jahrhundert), München 2. Aufl. 1988. Heinrich Reimers, Oldenburgische Papsturkunden, in: Oldenburger Jahrbuch 16 (1908) 1– 177. Gustav Rüthning, Oldenburgische Geschichte 1. Bd., Bremen 1911. Heinrich Schmidt, Kirche, Graf und Bürger im mittelalterlichen Oldenburg, in: Oldenburg und die Lambertikirche, hg. v. Ruth Dannemann / Heinrich Schmidt / Reinhard Rittner, Oldenburg 1988, 9–40.
306
Der Hl. Lambertus und die Lambertikirche in Oldenburg
Ders., Wolters, Heinrich, in: Biographisches Handbuch zur Geschichte des Landes Oldenburg, Oldenburg 1992, 816–817. Heinz-Joachim Schulze, Oldenburg in der Patrozinienforschung, in: Oldenburger Jahrbuch 62 (1963), 215–222. Jan-Peter Stöckel, Reichsbischöfe und Reichsheerfahrt unter Friedrich I. Barbarossa, in: Kaiser Friedrich Barbarossa, Landesausbau – Aspekte seiner Politik – Wirkung, hg. v. E. Engel / B. Töpfer (Forschungen zur mittelalterlichen Geschichte 36), Weimar 1994, 63–79. Satoshi Tada, The Creation of a religious Centre. Christianisation in the Diocese of Liège in the Carolingian Period, in: Journal of Ecclesiastical History 54 (2003), 209–227. Matthias Werner, Der Lütticher Raum in frühkarolingischer Zeit. Untersuchungen zur Geschichte einer karolingischen Stammlandschaft, Göttingen 1980. Carl Wöbcken, Lambertikirchen, Der Oldenburgische Hauskalender oder Hausfreund auf das Jahr 1958, Oldenburg 1957, 29–30. Matthias Zender, Räume und Schichten mittelalterlicher Heiligenverehrung in ihrer Bedeutung für die Volkskunde. Die Heiligen des mittleren Maaslandes und der Rheinlande in Kultgeschichte und Kultverbreitung, Köln, 2. Aufl. 1973.
Die Lambertikirche als architektonisches Symbol
Die Lambertikirche in Oldenburg erklärt sich einem heutigen Besucher nicht von alleine. Verwirrt von der neogotischen Außenhaut betritt man den Raum und staunt. „Völlig anders als wir erwartet haben“, das ist eine Äußerung, die häufig zu hören ist, wenn man mit Gästen die Lambertikirche zum ersten Mal betritt. Aber auch alteingesessene Oldenburger haben ihre Schwierigkeiten mit diesem Bau. Manch einer spöttelt über „den Tempel“1 oder „das Theater“2. Mit solchen Begriffen wird auf die klassizistische Gestaltung und die umlaufenden Emporen mit ihrem Blick auf den Altar angespielt. Hinter solchen Bemerkungen steht – unausgesprochen – das Idealbild eines lang gestreckten, mehrschiffigen Kirchenbaus. Die Lambertikirche mit ihrer Rotunde ist unerwartet – der Effekt wird noch verstärkt durch das jüngere Äußere –, sie passt nicht so recht ins landläufige Schema von einer Kirche. Wieso hat man absichtlich ein solches Gebäude an einer so prominenten Stelle errichtet und was soll es aussagen?
Der Herzog und der Umbau der Lambertikirche Die Baugeschichte der Lambertikirche bis zum Eingreifen des Herzogs Peter Friedrich Ludwig ist vergleichsweise unspektakulär. Der erste, romanische Kirchbau an dieser Stelle wurde im späten Mittelalter von einer dreischiffigen Hallenkirche abgelöst. Den Anstoß zum vollständigen Umbau gab der schlechte 1 Nach den Begriffen der Architekturtheoretiker der Renaissance ist die Verwendung dieses Wortes für eine Kirche völlig unproblematisch. Andrea Palladio verfasst seine Anleitungen zum Kirchenbau alle unter dem Überbegriff „Tempel“; Andrea Palladio, Die vier Bücher zur Architektur. Nach der Ausgabe Venedig 1570 I quattro libri dell’architettura aus dem Italienischen übertragen und hg. v. Andreas Beyer und Ulrich Schütte, Zürich 1983, 267–429. 2 Michael W. Brandt, Die Lambertikirche in Oldenburg – Protestantische Pfarrkirche, Monument fürstlicher Herrschaftslegitimation und dynastisches Denkmal, in: Das Land Oldenburg 95 (1997), 1–8, hier 3 zitiert einen Ausspruch von Heinrich Heine, der auf die Frage, ob er bereits in Oldenburg gewesen sei, reagiert: „Ich glaube ja, denn ich erinnere mich, dass ich die Kirche dort für ein Theater gehalten habe“.
308
Die Lambertikirche als architektonisches Symbol
Bauzustand der spätgotischen Kirche beim Regierungsantritt des Herzogs Peter Friedrich Ludwig. Der Umbau der Lambertikirche wurde der erste oldenburgische Auftrag an den damals noch in bischöflich-münsterschen Diensten stehenden Domkapitularwerkmeister Bernhard Winck, der in der folgenden Zeit die Baugeschichte der Stadt Oldenburg wesentlich mitbestimmt hat3. Er hat im Jahre 1790 seine Vorstellungen für den Umbau in einem Gutachten für das Oldenburgische Konsistorium dargelegt. Herzog Peter Friedrich Ludwig hat dazu eigenhändig „Bemerkungen“ verfasst, die von den Plänen Wincks zu dem Umbau der Lambertikirche führten, wie wir sie jetzt kennen4. Bernhard Winck hat in seinem Plan zunächst vorgeschlagen, nach dem Einschlagen der Gewölbe und des Abrisses des alten Dachstuhls, den Eingang auf die Ostseite zu verlagern, wie es dann auch geschah. Im Inneren will er einen ovalen Raum in die alten Außenmauern einbauen: Zur inwendigen Einrichtung der Kirche selbst, da für Gesicht und Gehör die runde Form die schicklichste ist, würde ich ein dem Cirkel sich näherndes Oval nehmen, dessen Umfang mit Arcaden eingeschlossenen untenher zugeschlossenen, mit Fenstern versehenen Oratorien, oben aber zu einer großen umlaufenden Gallerie diente […] so wäre wol die Hauptforderung einer tauglichen Reparation, die zugleich durch diesen Einbau eine edle Simplicität mit dem Nützlichen und Brauchbaren verbände, hierdurch erzielt5.
Dieser Entwurf Wincks findet grundsätzliche Zustimmung bei Konsistorium und Herzog, allerdings gibt es gewichtige Änderungswünsche. Bemängelt werden die verdächtig niedrig angesetzten Baukosten, die dann auch tatsächlich weit überschritten wurden6. Peter Friedrich Ludwig schreibt seine Änderungswünsche, Bedenken und Vorschläge in eigenhändigen Bemerkungen vom 17. 11. 1790 auf 7. Diese Bemer3 Elfriede Heinemeyer, Der Baumeister Joseph Bernhard Winck. Ein Vertreter des Frühklassizismus aus Münster, in: Ewald Gäßler (Hg.), Klassizismus. Baukunst in Oldenburg, Oldenburg 1991, 129–152. 4 Die Stellungnahmen sind inzwischen in den wichtigsten Teilen ediert: Torben Koopmann, Peter Friedrich Ludwig und das architektonische Konzept der Lambertikirche. Edition dreier Quellen zur Entstehung der klassizistischen Lambertikirche, in: Herzog Peter Friedrich Ludwig (1755–1829) zum 250. Geburtstag, hg. v. der Oldenburgischen Landschaft, Redaktion Jörgen Welp (Veröffentlichungen der Oldenburgischen Landschaft 11), Oldenburg 2006, 59–90. Ich danke Torben Koopmann herzlich für die frühe Einsichtnahme in sein Manuskript und das gemeinsame Quellenstudium im Niedersächsischen Landesarchiv Oldenburg (NLAO). 5 Bernhard Winck, Unmaßgebliches Gutachten über den baulichen Zustand der St. LambertiKirche zu Oldenburg und Vorschläge zum Umbau der selben, Oldenburg 1790 Mai 29, in: Koopmann, Peter Friedrich Ludwig (Anm. 4), 66. 6 Vgl. die polemische Darstellung der Streitigkeiten um die Finanzierung des Umbaus bei Hugo Harms, Ereignisse und Gestalten der Geschichte der evangelisch-lutherischen Kirche in Oldenburg 1520–1920, Oldenburg 1966, 154–156. 7 Bemerkungen Herzog Peter Friedrich Ludwigs über die Vorschläge J.B. Wincks, Oldenburg, 17. November 1790, in: Torben Koopmann, Peter Friedrich Ludwig (Anm. 4), 67–71.
Die Lambertikirche als architektonisches Symbol
309
kungen zeigen ihn als über das übliche Maß hinaus an architektonischen Detailfragen interessierten Herrscher. So hat ihn bereits einer seiner Hofräte, der literarisch interessierte Ludwig Starklof in seinen Erlebnissen und Bekenntnissen beschrieben: „Der Herzog tat sich viel darauf zugute, ein vorzüglicher Architekt zu sein, die Namen Vitruv und Palladio führte er gern im Munde“8. Starklof beleuchtet die Einflussnahme Peter Friedrich Ludwigs auf den Umbau der Kirche allerdings durchaus kritisch: Vor 20 Jahren war dem Herzog eingefallen, in Oldenburg eine alte Kirche neu zu bauen. Um das nach seiner Phantasie zu tun, hatte er den Kirchenfonds, auf den er kein Recht hatte, angegriffen und 50.000–60.000 Reichstaler verbaut, wobei er selbst den Oberbaumeister machte (weil er alles allein verstand)9.
In seinen Bemerkungen zu Bernhard Wincks ersten Plänen zeigt sich, dass Peter Friedrich Ludwig nicht nur die Namen Vitruv und Palladio im Munde führte, sondern ihre Lehrbücher der Architektur wirklich kannte und sich deshalb massiv für dort vertretene architektonische Vorstellungen engagiert. Er zitiert Vinvenzo Scamozzis 1615 erschienen Traktat über die Säulenordnungen10 und Andrea Palladios 1570 herausgegebenen „Vier Bücher zur Architektur“ Dabei bemängelt er zuerst ein Detail des Entwurfs, das uns heute nebensächlich vorkommt, damals aber mit viel Verve diskutiert wurde, nämlich das Längen-, Durchmesser- und Abstandsverhältnis der Säulen, die die Kuppel tragen. Peter Friedrich Ludwig empfindet die Säulen als zu lang im Verhältnis zum ihrem Durchmesser11. Darüber hinaus bemängelt er die geplante Verbindung von Kompositkapitellen mit ionischen Säulen, wegen der dadurch gegebenen Stilmi-
8 Ludwig Starklof, Erinnerungen. Theater – Erlebnisse – Reisen, hg. v. Harry Niemann, Oldenburg 1986, 102. 9 Ludwig Starklof, Erinnerungen (Anm. 8), 106–107. 10 Vincenzo Scamozzi, Dell’ idea dell architettura universale, Venedig 1615. Auch eine deutsche Druckfassung hätte z. B. vorgelegen in: Vincenzo Scamozzi, Klärliche Beschreibung der fünff Säulen-Ordnungen und der gantzen Baukunst aus dem sechsten und dritten Buche, aus dem Italiänischen, Nürnberg 1678. 11 Bemerkungen Herzog Peter Friedrich Ludwigs, in: Torben Koopmann, Peter Friedrich Ludwig (Anm. 4), 69: „Herr Winck läst die Kuppel […] durch 12 ionische Säulen tragen, welche zehn Models halten, da doch alle Lehrer in dieser Kunst, selbst Palladio und Scamozzi, nur 9 Model angeben“. Bei Scamozzi gibt es übrigens doch Säulen in dem Längen/Durchmesserverhältnis von 10:1, allerdings nur korinthische, bzw. „römische“ Säulen, Vincenzo Scamozzi, Dell’ idea dell architettura universale, Venedig 1615, Teil II, Buch 6, S. 6. Bernhard Winck verteidigt seine besonders schmalen Säulen für die Lambertikirche aber nicht mit dem Hinweis auf Scamozzi, oder andere Architekturtheoretiker, sondern mit der perspektivischen Verkürzung, mit der zu rechnen ist, wenn die Säulen erst in der Höhe der Emporenbrüstung beginnen. Bernhard Winck, Untertänigste Beantwortung auf die mir gnädigst vorgelegte Bemerkungen, Oldenburg Dezember 1790, in Torben Koopmann, Peter Friedrich Ludwig (Anm. 4), 75.
310
Die Lambertikirche als architektonisches Symbol
schung12 und das nur zweiteilige Gesimse, an dem seiner Meinung nach der Fries fehlt13. Der Herzog besteht gegenüber dem Baumeister darauf, sich strikt an die bei den Architekturtheoretikern gegebenen Anweisungen zu halten. Er verpflichtet Winck in seinen Bemerkungen darauf, eine corecte Ordnung zu nehmen14. Das ist die grundsätzlichste Bemerkung, die uns den Herzog zwar als Kenner der Materie, zugleich aber auch als relativ wenig eigenständig gegenüber den klassischen Vorbildern zeigt. Er besteht darauf, dass der Bau eine corecte Ordnung im Sinne der damaligen Architekturtheorie einhält. Diese Vorgabe wäre erfüllt, wenn die Säulen rein im ionischen Stil ausgeführt würden. Peter Friedrich Ludwig hat über die Einhaltung einer architekturtheoretischen Ordnung hinaus eine weitere präzise Vorstellung vom Umbau der Oldenburger Hauptkirche. Gegenüber Winck formuliert er seine grundsätzliche Bau-Idee: Er will kein Oval, sondern einen kreisförmigen Bau errichten: Dem Ganzen ein etwas besseres Ansehn zu geben, würde ich eine Rotunde vorschlagen, die unten in dem Quadrat der 4 Mauern auslief, oben aber eine Laterne träge, die dem Inneren Licht gebe15.
Peter Friedrich Ludwig will als Baukörper eine Rotunde, die in die stehengebliebenen Außenmauern der spätgotischen Kirche eingefügt wird und die von oben durch eine Öffnung mit Licht versorgt wird. Solch eine Laterne hatte Peter Friedrich Ludwig in dem 1790 gerade fertig gestellten Mausoleum auf dem Gertrudenkirchhof schon einmal erbauen lassen16. Auch dort hatte er durch die Gestaltung der Ecken des Dachstuhls die viereckige Grundform einem Kreis angenähert. Damit zeigt sich der erste unter seiner Ägide errichtete Bau auf dem Gertrudenkirchhof einmal mehr als Inkunabel der Bauvorstellungen Peter Friedrich Ludwigs. Im Mausoleum hat die Tradition der zentralen Memorialbauten einen präzisen Ausdruck gefunden. Dort war ursprünglich der Zugang 12 Peter Friedrich Ludwig, Bemerkungen, in: Torben Koopmann, Peter Friedrich Ludwig (Anm. 4), 69: „Die Capitäler der Säulen haben keine ionische, sondern composite Evoluten, welches zwahr kein eigentlicher Fehler, aber doch von keinem lauteren Geschmack zeigt“. 13 Peter Friedrich Ludwig, Bemerkungen, in: Torben Koopmann, Peter Friedrich Ludwig (Anm. 4), 69: „Das Gesimse ist ganz auser allen Verhältnissen und besteth nur nur aus 2 Theilen, nemlich Gebälke und Kransgesimse. Der Fries ist hie also ganz ausgelassen, welcher ohne Zweifel dem Dinge nun eigentlich Ansehn geben würde“. 14 Peter Friedrich Ludwig, Bemerkungen, in: Torben Koopmann, Peter Friedrich Ludwig (Anm. 4), 70: „Ich würde dagegen vorschlagen, eine bestimmte und corecte Ordnung zu nehmen“. 15 Peter Friedrich Ludwig, Bemerkungen, in: Torben Koopmann, Peter Friedrich Ludwig (Anm. 4), 70. 16 Jörg Deuter, Das herzogliche Mausoleum auf dem Oldenburger Gertrudenfriedhof (1786– 1790) und seine Baugeschichte, in: Ewald Gäßler (Hg.), Klassizismus. Baukunst in Oldenburg, Oldenburg 1991, 75–102.
Die Lambertikirche als architektonisches Symbol
311
zur Gruft in einer vertikalen Achse mit dem Oculus, durch den das gesamte Gebäude – wie das Pantheon in Rom – beleuchtet wird17.
Die Bedeutung des Rundbaus Die Festlegung des Herzogs auf einen Rundbau für die Lambertikirche ist eindeutig, ein Vorgängerbau steht schon in Oldenburg und es widerspricht niemand dem sich so eindeutig festlegenden Herzog. So wurde die Lambertikirche schließlich gebaut. Aber warum? Nur weil Peter Friedrich Ludwig die architektonischen Lehrbücher kannte und vielleicht auf seinen Reisen und Studienaufenthalten Rundbauten gesehen hatte? Er selbst liefert keine theoretische Begründung für die Forderung nach einem Rundbau. Vielleicht musste er das auch nicht, weil die Idee des Rundbaus bei den von ihm zur Kenntnis genommenen Architekturtheoretikern so eindeutig für die beste aller Möglichkeiten gehalten wurde, dass man dem nichts hinzufügen musste. Das trifft zumindest für den einflussreichsten Autor zu, Andrea Palladio. In seiner Abhandlung zur Architektur der Tempel gibt er Ratschläge zum Kirchenbau. Bereits im zweiten Kapitel äußert er sich über die Form der christlichen „Tempel“ und gibt sofort dem Rundbau den Vorzug: So suchen auch wir […] das Vollkommenste und Hervorragendste aus, um dem schicklichen Schmuck hinsichtlich der Tempelform zu genügen. Und weil dies die Kreisform ist, da sie von allen Formen einfach, gleichförmig, gleichmäßig, kräftig und umfassend ist, so machen wir unsere Tempel rund18.
Das ist ein auf die Form bezogenes Argument. Der Kreis ist unter den geometrischen Figuren die „vollkommenste“, weil er ohne Anfang und Ende und vollkommen symmetrisch ist. Zu diesem formalen Argument kommt bei Palladio dann noch ein theologisches Argument. Die Kreisform ist allein angemessen für Gott: „Die Kreisform ist bestens dazu geeignet, die Einheit, das unendliche Sein, die regelhafte Gleichförmigkeit und die Gerechtigkeit Gottes darzustellen“19. Diese Zusammenstellung von Kreisform und Eigenschaften Gottes ist hochbedeutsam für die Vorstellungswelt Peter Friedrich Ludwigs. Das ist neben seinen Bauvorlieben auch an seinem Wahlspruch abzulesen, der zuerst auf dem Entwurf einer Zivilverdienstmedaille zu belegen ist20. Er lautet: „Ein Gott, eine 17 18 19 20
Deuter, Das herzogliche Mausoleum (Anm. 16), 85. Andrea Palladio, Die vier Bücher zur Architektur (Anm. 1), 274. Andrea Palladio, Die vier Bücher zur Architektur (Anm. 1), 274. Friedhelm Beyreiß, Der Hausorden und die tragbaren Ehrenzeichen des Großherzogtums Oldenburg 1813–1918, Norderstedt 1997, 88f.
312
Die Lambertikirche als architektonisches Symbol
Wahrheit, ein Recht“. So wie die Kreisform einen Zusammenhang zwischen Gott, seiner „regelhaften Gleichförmigkeit“ und seiner Gerechtigkeit symbolisiert, fasst Peter Friedrich Ludwig diese drei zu einem Wahlspruch zusammen, der später auch auf seinem Denkmal eingraviert wurde, allerdings in veränderter Reihenfolge: „Ein Gott, ein Recht, eine Wahrheit“. In der ursprünglichen Reihenfolge wird aber das Einheitsdenken und die auch bei Palladio geknüpfte Verbindung zum Einheitssymbol schlechthin, dem Kreis, klarer. „Ein Gott, eine Wahrheit, ein Recht.“ Das Einheitsdenken ist nicht nur dem politischen, sondern auch dem theologischen Denken der Aufklärungszeit eigen21. Man bemüht sich um eine Überwindung der konfessionellen Streitigkeiten und sucht Beschreibungen Gottes, die auch philosophisch zu verstehen sind. Nach dem verheerenden dreißigjährigen Krieg, der eben auch ein Krieg zwischen den Konfessionen war, bemühte sich das Christentum, tragfähige Grundlagen herauszubilden, die transkonfessionelle Gültigkeit besaßen: Vernunft, Naturrecht und natürliche Religion22 sowie der Gedanke des Strebens nach, vor allem ethisch verstandener, Vervollkommnung23. Damit gelang es den aufklärerischen Theologen und Kirchenleitungen das gebildete Bürgertum anzusprechen und seiner Entkirchlichung entgegenzuwirken. In einem solcherart geprägten Christentum ist ein Kirchbau wie der Umbau der Lambertikirche zu einem Rundbau ein passender Ausdruck der Zeitströmung. Es entsteht – absichtlich – ein doppelt lesbarer Bau. Die Kreisform und das von oben einfallende Licht der Kuppel können im Sinne der aufklärerischen Philosophie gedeutet werden als ein 21 Albrecht Beutel, Aufklärung II. Theologisch-kirchlich, in: RGG4, I (1998), 941–948, hier 942. Claus Ritterhoff weist das für zwei Vertreter aufklärerischen Denkens in der unmittelbaren Nähe Herzog Peter Friedrich Ludwigs nach, den evangelischen Kanzleirat Anton von Halem und dem schließlich zum Katholizismus konvertierten Grafen Stolberg. Claus Ritterhoff, Friedrich Leopold Graf Stolberg und Gerhard Anton von Halem. Positionen fundamentalistischer und „aufgeklärter“ Religiosität um 1800, in: Reinhard Rittner (Hg.), Beiträge zur oldenburgischen Kirchengeschichte, Oldenburg 1993, 105–116, hier 115: „Beide warben für ihre Weltbilder, indem sie sie idealisierten, harmonisierten und zu geschlossenen, einheitlichen Räumen stilisierten. Verstand Halem Geschichte dabei im Prinzip als Verwirklichung eines allgemeinen, unvergänglichen Rechts, so stand Stolbergs Suche nach einer geschlossenen Welt mit ungeteilter Kirche und absoluter Wahrheit gegenüber. Einem Einheitsmythos hingen sie beide an“. 22 Vgl. z. B. die beinahe „klassische“ Formulierung Johann Gottfried Herders: „Lehrmeinungen trennen und erbittern, Religion vereint; denn in aller Menschen Herzen ist sie nur eine“, in seiner 1798 erschienenen Schrift „Von Religion, Lehrmeinungen und Gebräuchen“, in: Herders Werke, hg. v. Theodor Matthias, 3. Bd. Theologisches, Leipzig o. J., 365. 23 Vgl. zum Begriff der Vervollkommnung in der aufklärerischen Theologie Claus Ritterhoff, Friedrich Leopold Graf Stolberg und Gerhard Anton von Halem (Anm. 21), 109: „Umfassende Erziehung und Bildung als Voraussetzung sowie das religiös und geschichtsphilosophisch verankerte Vertrauen in die Macht der Vorsehung bürgten den Neologen dafür, dass der Prozess sittlicher Reifung, der Vervollkommnungsprozess der Menschheit letztlich gelingen würde“.
Die Lambertikirche als architektonisches Symbol
313
„perfekter“ Bau, in den das Licht der Vernunft einfällt und die Menschen zur sittlichen Vervollkommnung anregt. Die Lambertikirche kann aber auch als ein christliches Symbol verstanden werden, in dem das Licht ein Gottes- oder Christussymbol ist, die Kuppel ein Abbild der von Gott geschaffenen Welt und die zwölf Säulen die Repräsentation der zwölf Jünger in deren Kreis, sich die Gemeinde als Teil der universellen Kirche versammelt. Michael W. Brandt hat in seinen beiden Beiträgen zur Symbolik der Lambertikirche auf die politische Dimension des Rundbaus und auf die Funktion der Vorhalle als dynastisches Denkmal ausführlich hingewiesen24. Hier soll deshalb nur auf christliche Bedeutung und die lange Tradition der Zentral- und Kuppelbauten hingewiesen werden. Dass die Kreisform selbst bereits eine symbolische Beziehung zu Gott hat, ist mit Palladios Worten bereits gesagt worden. Ein Vorbild der Rotunde der Lambertikirche ist sicherlich „der“ antike Rundbau schlechthin, das Pantheon in Rom. Auch wenn die architektonischen Unterschiede beträchtlich sind, ist die symbolische Bedeutung beider Bauten nahezu identisch. Der bereits zitierte und von Peter Friedrich Ludwig studierte Architekturtheoretiker Palladio urteilt über das Pantheon: Man nannte es „auch deshalb Rotonda, da es – wie einige meinen – ein Abbild der Welt darstellt“25. „Rotunde“, italienisch „Rotonda“ ist in der Renaissance der volkstümliche Name für das Pantheon geworden26. Das heißt, allein die Verwendung des Begriffs „Rotunde“ im Umbauplan legt für die Lambertikirche die Verbindung zu diesem antiken Monumentalbau in Rom fest. Damit liegt auch die von Palladio beschriebene Bedeutung greifbar nahe. Es geht um nichts weniger als ein Abbild der von Gott geschaffenen Welt. Das trifft sich mit aufklärerischen Gedanken von der Einheit der Welt, einsehbar durch Vernunft und repräsentiert in den Naturgesetzen, zu denen auch die mathematischen gehören, also auch die geometrischen Formen Kreis und Quadrat, die Peter Friedrich Ludwig für den Umbau fordert27. Der Gedanke, dass ein Rundbau die Welt abbildet, ist aber nicht erst eine Erfindung der Aufklärung, des Klassizismus oder der Renaissance. Eine lange Tradition auch außerhalb des Christentums schreibt dies Rund- und Kuppelbauten zu28. Der biblische Ausgangspunkt für diese Vorstellung findet sich im 24 Michael W. Brandt, Die Lambertikirche in Oldenburg (Anm. 2) und ders., Die Lambertikirche – dynastisches Denkmal und Monument der Herrschaftslegitimation, in: Oldenburgische Landschaft (Hg.), Dem Wohle Oldenburgs gewidmet. Aspekte kulturellen und sozialen Wirkens des Hauses Oldenburg, Oldenburg 2004, 69–74. 25 Andrea Palladio, Die vier Bücher zur Architektur (Anm. 1), 358. 26 Andrea Palladio, Die vier Bücher zur Architektur (Anm. 1), 358: „Das Pantheon, das man heute die Rotonda nennt“. 27 S. o. (Anm. 15): „eine Rotunde … die unten in dem Quadrat … auslief“. 28 Vgl. die Studie von Baldwin Smith, The Dome. A Study in the History of Ideas, Princeton 1950.
314
Die Lambertikirche als architektonisches Symbol
Alten Testament beim Zelt29, das die Bundeslade während der Aufenthalte in der Zeit der Wüstenwanderung des Volkes Israel überwölbt (Ex 35,11)30. In der jüdischen und der frühchristlichen Exegese wird das Zelt, das tabernaculum, als ein Abbild der ganzen Welt verstanden. So schreibt der jüdische Historiker Flavius Josephus um 94. n. Chr.: „Diese Einteilung der Hütte sollte gleichsam das ganze Weltall darstellen“31. Und der christliche Theologe Origenes (185/6–253/4): „wie einige vor uns gesagt haben, ist das tabernaculum ein Abbild dieser Welt“32. Origenes fährt dann fort, die Säulen, die das tabernaculum tragen als Tugenden des individuellen Lebens zu deuten – ein Gedanke, der auch in der Zeit der Aufklärung willkommen gewesen wäre. Diese exegetische Vorstellung von der Abbildung der Welt in einem gewölbten Gebäude gewinnt auch im frühchristlichen Kirchenbau Bedeutung. Nach den baulich nicht festgelegten Hauskirchen der Urgemeinde und den frühen basilikalen Kirchentypen entwickelt sich eine Tradition des Rundbaus vor allem bei Memorialbauten. Der entscheidende Bau ist die Anlage des Heiligen Grabes in Jerusalem, das als Rundbau von einer Kuppel überwölbt wird33. Der Bericht des Bischofs Eusebius von Cäsarea (265–339/40) enthält eine Beschreibung des von Kaiser Konstantin in Auftrag gegebenen Baus. Der Abschnitt über den Baukörper, der sich direkt über dem heiligen Grab erhebt, lässt sofort an zwei zentrale Bauelemente der Lambertikirche denken. Eusebius beschreibt den zentralen Teil des großen Baukomplexes so: „Am oberen Ende der Basilika war eine Halbkugel, die Hauptsache des ganzen Baus hingestellt. Sie wurde von einem Kranz von zwölf Säulen getragen, gemäß der Zahl der Apostel des Heilands.“34 Der Rückblick auf die Geschichte des kuppelgewölbten Rundbaus und seiner Bedeutungszuschreibungen zeigt, dass der von Peter Friedrich Ludwig veranlasste Umbau der Lambertikirche zur Rotunde nicht nur eine Darstellung staatsphilosophischer Grundsätze ist35. Die Lambertikirche als Rundbau steht in einer klaren christlichen Tradition. Sie bildet die Welt ab. Im Zentrum steht Christus, symbolisch repräsentiert durch 29 Mit dem Zelt wird zugleich das All abgebildet, das Gott wie ein Zelt ausgespannt hat: „Er spannt den Himmel aus wie einen Schleier und breitet ihn aus wie ein Zelt, in dem man wohnt“ (Jes 40,22). 30 Die lateinische Überlieferung benutzt hier für Zelt das Wort tabernaculum, das in der Kirchenarchitektur schließlich zu einem Fachbegriff für einen überwölbten Aufbau über einem Altar geworden ist. Die Verwendung des Begriffs Tabernakel für den Aufbewahrungsort für die konsekrierten Hostien auf dem Hochalter in katholischen Kirchen leitet sich hingegen vom Wortfeld „Schrein“ ab, das das lateinische tabernaculum auch umfasst. 31 Flavius Josephus, Antiquitates III, 6,4. 32 Origenes, Homiliae in Exodum IX,4 (Sources chrétiennes 321), 294,2–4, Übersetzung R.H. 33 Jürgen Krüger, Die Grabeskirche zu Jerusalem. Geschichte-Gestalt-Bedeutung, Regensburg 2000, 55–59. Die Rekonstruktionszeichnung ist auf S.56 abgebildet. 34 Eusebius, Vita Constantini III,38 (GCS) 101,23–25, Übersetzung R.H. 35 Gegen Michael W. Brandt, Die Lambertikirche in Oldenburg (Anm. 2), 7–8.
Die Lambertikirche als architektonisches Symbol
315
das durch die Kuppel einfallende Licht. Die zwölf Säulen repräsentieren die zwölf Jünger Jesu und scharen sich um ihren Herrn und stellen damit einerseits die Kirche dar, andererseits stützen sie das Gewölbe des Himmels und bilden so die Verbindung zwischen der irdischen und der himmlischen Welt. Es ist also kein Zufall, dass die Kuppel der Lambertikirche, die mit ihrer Laterne schnell an das Pantheon als architektonisches Vorbild denken lässt, anders als dieses nicht auf 32 Säulen steht36. Die Anordnung der zwölf Säulen um die Mitte herum lässt eher an Darstellungen denken, in denen Christus in Kuppelbauten vom Kreis seiner Jünger umgeben ist. Ein prominentes Beispiel für eine solche Darstellung ist die Kuppel des um 400 n. Chr. errichteten Baptisteriums der Kathedrale von Ravenna37. Die Parallele zur Lambertikirche ist nicht im strengen Sinne architekturhistorisch, aber doch inhaltlich gegeben. In der Lambertikirche ist keine Christusdarstellung in der Mitte der Kuppel nötig, um Christus darzustellen, denn das Licht ist bereits ein Christussymbol, wie Jesus es im Johannesevangelium sagt: „Ich bin das Licht der Welt“ (Joh 8,12).
Der Herzog als bischöflicher Baumeister Das durch Peter Friedrich Ludwig entwickelte Bauprogramm für die Lambertikirche zielt eben nicht auf ein Denkmal, auch nicht auf einen „übersakralen Weihetempel“ und das Konzept ist auch nicht entstanden aus der „Vermengung der Wertbereiche von Religion, Geschichte und Politik“.38 Peter Friedrich Ludwig schafft einen Bau, der in der Tradition des christlichen Kirchenbaus steht, sich an klassizistischen Bauidealen orientiert und einer Stadtgemeinde als Gottesdienstraum dient. Die Lambertikirche ist nicht nur Hofkirche, sondern vor allem die Hauptkirche der Stadt – und damit auch des Oldenburger Landes. In erster Linie ist sie für den Gemeindegebrauch gedacht. Deshalb sorgt sich der Herzog 36 Damit verbietet sich für die Lambertikirche auch eine Bezugnahme auf eine Interpretation, die das Pantheon in Rom seit der Renaissance erfahren hat, nämlich als „Stätte des Geniekultes“, wie es Michael W. Brandt tut, Die Lambertikirche in Oldenburg (Anm. 2), 7. 37 Abbildungen finden sich z. B. in: Antonio Paolucci, Ravenna, Florenz 1971, 73 oder im Wikipedia-Artikel zur Kathedrale von Ravenna. 38 Gegen Michael W. Brandt, Die Lambertikirche in Oldenburg (Anm. 2), 7. Für das letztere beruft er sich auf eine Interpretation der Kunst des 19. Jahrhunderts die aus dem Jahre 1944 stammt, in dem es vielleicht wünschenswert erschien, dezidiert christliche Elemente aus der Kunst auszuschließen und zu fordern, dass das „Politische und Nationale dem Religiösen gleichgeordnet sei“. Das wäre bei der Verwendung des Brandt angeführten Zitates zu berücksichtigen. Brandt zitiert Hermann Beenken, Das 19. Jh. in der deutschen Kunst, Aufgaben und Gehalte, München 1944, 21: „Die Welten der Natur, der Bildung der Kunst, der Geschichte und damit verbunden die des Nationalen und des Politischen wachsen als eigene und dem Religiösen gleichgeordnete, zum Teil sich mit ihm vermengende Wertbereiche heran“.
316
Die Lambertikirche als architektonisches Symbol
bereits in seiner aller ersten Bemerkung zu den Winckschen Bauplänen um die Zahl die Sitzplätze für den Gottesdienst: Es wird nötig seyn, daß der anzufangende Bau einer Menge von 6 bis 700 Menschen einen anständigen Raum zu ihrer Versammlung gewehre und daß die Versammelten den Vortrag des Redners zu hören durch der [!] Disposition des Ortes nicht behindert werden39.
Peter Friedrich Ludwig bemüht sich auch um die Praktikabilität der Anordnung der Kanzel. Er verändert Wincks Plan und sorgt dafür, dass die Aufstellung der Kanzel so ausgeführt wird, wie sie heute ist. Dieses Interesse an der Aufstellung der Kanzel entspringt zum einen sicher dem unbefriedigenden Bauzustand in der alten Lambertikirche, in der ein Großteil der Gemeinde hinter dem Prediger sitzen musste, zugleich ist es aber auch ein Ausdruck für die typisch evangelische Betonung der Predigt als zentralem Element des Gottesdienstes. Der in St. Lamberti geschaffene Kanzelaltar gehört zu den typischen Elementen des evangelischen Kirchenbaus40. Seit dem – noch von Luther 1544 eingeweihten Bau der Schlosskirche zu Torgau – drückt er die Gleichberechtigung von Wort und Sakrament im evangelischen Gottesdienst aus41. In der Frage der Aufstellung des Kanzelaltars zeigt sich die Traditionsverhaftung Wincks und Peter Friedrich Ludwigs. Die kühne Idee Leonardo da Vincis zur Positionierung einer Kanzel in einer runden Kirche haben sie beide nicht übernommen. Er wollte die Kanzel aus akustischen und theologischen Gründen in die Mitte stellen. Dabei wäre das theologische Argument Leonardo da Vincis gerade in der evangelischen Kirche stichhaltig gewesen: es ist nötig, dass dieses Wort Gottes, das die Welt geschaffen hat und das Zentrum der gesamten Welt ausmacht, seinen Platz im Mittelpunkt der Kirche habe, die ja eine Darstellung der ganzen Welt sei42.
Dass die Vorstellung, die Kirche sei ein Abbild der ganzen Welt, gerade mit runden Kirchen nahezu unauflöslich verbunden ist, zeigt dieses Zitat noch einmal. Für die Lambertikirche, die also recht verstanden ein Abbild der Welt ist, ist nun zu fragen, wo der Herzog, der den Bau maßgeblich beeinflusste, seinen Platz sah. Der Herzog erhielt seinen Platz in einer Loge auf der ersten Empore, dem Altar und der Kanzel gegenüber. Das ist seit der karolingischen Zeit der traditionelle Platz der christlichen Herrscher. Die Loge des Herzogs war ein klar 39 Peter Friedrich Ludwig, Bemerkungen, in: Torben Koopmann, Peter Friedrich Ludwig (Anm. 4), 67. 40 Hierin stimme ich völlig überein mit Michael W. Brandt, Die Lambertikirche in Oldenburg (Anm. 2). 41 Dazu vgl. das Standardwerk von Hartmut Mai, Der evangelische Kanzelaltar. Geschichte und Bedeutung; Halle/Saale 1969. 42 Zitiert bei André Biéler, Kirchbau und Gottesdienst, Neukirchen 1965, 61.
Die Lambertikirche als architektonisches Symbol
317
abgegrenzter Bereich, der nur durch eine separate Treppe erreicht werden konnte. Ob sich also Peter Friedrich Ludwig durch diese Selbstpositionierung in der Kirche als „primus inter pares“ darstellen wollte, oder ob er nicht doch einen privilegierten Platz beanspruchte, sei zumindest zweifelnd angemerkt43. Ganz klar wird durch die Positionierung der Loge dem Altar und der Kanzel gegenüber, dass es für Peter Friedrich Ludwig auch wichtig war, das Gegenüber von Kirche und Landesherren zu betonen. Obwohl er der Bischof der lutherischen Kirche in Oldenburg war und mit seinem Kirchbau bischöflich handelte, saß er eben nicht über dem Altar. Und er saß auch nicht im Zentrum des Gebäudes. Auch das Licht, das am Morgen durch die Kuppel fiel, strahlte nicht den Herzog an, der im Osten saß, sondern den Kanzelaltar, der damals noch im Westen der Kirche stand44. Wenn überhaupt vom Herzog als einem „Gleichen“ im Zusammenhang mit der Symbolik der Lambertikirche die Rede sein kann, dann nur darin, dass er wie alle anderen von dem Licht, das durch die Kuppel fällt, erleuchtet wird und dass er sich wie die übrige Stadtgemeinde hier zum öffentlichen Gottesdienst einfindet. Diesen Aspekt der Gleichheit aller Gläubigen betont 1795 Esdras Mutzenbecher, der Superintendent der oldenburgischen Kirche in seiner Einweihungspredigt für die umgestaltete Lambertikirche: Hier fühlen wir uns alle, nicht als Mächtige oder Schwache, nicht als Obere oder Untergebene, nicht als Große oder Niedrige, nicht als Gelehrte oder Unwissende, sondern als Menschen, als Christen, als Kinder Gottes, als Bekenner Jesu, von ihm für die gleiche Seligkeit empfänglich gemacht!45
Zusammenfassung Die klassizistischen Bauformen, derer sich Peter Friedrich Ludwig als Bischof der Oldenburgischen Kirche und als architektonisch interessierter Herzog bedient, sind den Traditionen der Aufklärung verhaftet und bleiben deshalb mehrfach interpretierbar. Christlich gedeutet ist die Symbolik des Gebäudes eindeutig. Das Licht Gottes – und das ist Jesus Christus – scheint durch die Kuppel und wird von den Blumenbändern in der Kuppel weitergeleitet zu den 12 Säulen und den sie tragenden Pfeilern. In diesem Lichtraum sitzt die Gemeinde und feiert ihren Gottesdienst. Im Gottesdienst äußert sie ihre Dankbarkeit gegenüber Gott und
43 Gegen Michael W. Brandt, Die Lambertikirche in Oldenburg (Anm. 2), 7. 44 Durch den Umbau 1968–1971 ist die Kirche im Inneren um 180 Grad gedreht worden, so dass dieses Element der ursprünglichen Lichtsymbolik nicht mehr erlebt werden kann. 45 Esdras Mutzenbecher, Erste Predigt in der erneuerten Lambertus Kirche in Oldenburg am 3ten May 1795 gehalten, nebst dem vom P. Hollmann zu Anfang des Gottesdienstes vor dem Altar gesprochenen Gebete, Oldenburg 1795, 27–28.
318
Die Lambertikirche als architektonisches Symbol
übernimmt für sich selbst den Anspruch, als „Kinder des Lichtes zu leben“ (Eph. 5,8). Damit ist das theologische Konzept der Lambertikirche sehr gut einzuordnen in die Lichtsymbolik der aufklärerischen Theologie wie sie im Oldenburgischen zum Beispiel auch Johann Arnold Lauw, Pfarrer in Strückhausen in einer zeitgenössischen Predigt formuliert hat. Er forderte seine Gemeinde in Strückhausen auf, sie solle den Gottesdienst begehen: „1. mit seligem Dank gegen Gott für das hellere Licht des Evangeliums und 2. mit dem frommen Gelübde vor Gott, diesen Dank zu bestätigen und zu wandeln als Kinder Lichts“46. Darin sind die Elemente der Erleuchtung durch das Evangelium und des daraus folgenden verantwortlichen Handels aufgenommen. Beides sollen eine Predigt oder ein ganzer Gottesdienst bewirken. Das soll auch der Bau eines Gotteshauses unterstützen, im besten Fall bewirkt das die Kirche sogar ohne eine gesprochene Predigt, nur durch die Predigt des Gebäudes. Diese Absicht lässt sich im Umbau der Lambertikirche durch Peter Friedrich Ludwig erkennen. Das Gebäude sollte durch die „edle Simplicität“ von der der Baumeister Winck in seinen Plänen werbend sprach,47 und durch das von oben in die Rotunde fallende Licht auf die Besucher wirken. Nicht traurig oder niedergedrückt sollte der Gottesdienstbesucher sein, sondern dankbar für das Licht des Evangeliums und deshalb sein Leben auf die Säulen der Tugend bauen. Dieses Gefühl überwältigt zumindest den Superintendenten Mutzenbecher. Er behauptet, dass der: neue ungewohnte Anblick eines geschmackvollen Gebäudes, das, ohne durch Kunst überladen zu sein, in seiner wahren, edlen Einfalt, jeden gefühlvollen Freund des Schönen entzückt48.
Dabei ist das Entzücken nicht nur ästhetisch gemeint. Das Entzücken über den neuen Kirchenbau soll vielmehr ermuntern zur „gemeinschaftlichen Gottesverehrung“, zur „Beförderung der Erkenntnis und Tugend“, der „Erweckung der Andacht“ und zu einem „feierlichen Religionsbekenntnis“.49 Wenn das bis heute in uns geweckt wird, hat der als bischöflicher Baumeister wirkende Herzog Peter Friedrich Ludwig mit dem Umbau der Lambertikirche sein Ziel erreicht.
46 Johann Arnold Lauw, Predigt am 31. 10. 1817 abgedruckt bei Wolfgang Erich Müller, Aspekte der theologischen Spätaufklärung in Oldenburg, in: Reinhard Rittner (Hg.), Beiträge zur oldenburgischen Kirchengeschichte, Oldenburg 1993, 63–81, hier 75. 47 Johann Bernhard Winck, Unmaßgebliches Gutachten, in: Koopmann, Peter Friedrich Ludwig (Anm. 4), 66. 48 Mutzenbecher, Erste Predigt (Anm. 45), 9–10. 49 Mutzenbecher, Erste Predigt (Anm. 45), 13.
Die Lambertikirche als architektonisches Symbol
319
Quellen Johann Gottfried Herder, Von Religion, Lehrmeinungen und Gebräuchen, in: Herders Werke, hg. v. Theodor Matthias, 3. Bd. Theologisches, Leipzig o. J. Torben Koopmann, Peter Friedrich Ludwig und das architektonische Konzept der Lambertikirche. Edition dreier Quellen zur Entstehung der klassizistischen Lambertikirche, in: Herzog Peter Friedrich Ludwig (1755–1829) zum 250. Geburtstag, hg. v. der Oldenburgischen Landschaft, Redaktion Jörgen Welp (Veröffentlichungen der Oldenburgischen Landschaft 11), Oldenburg 2006, 59–90. Johann Arnold Lauw, Predigt am 31. 10. 1817 abgedruckt bei Wolfgang Erich Müller, Aspekte der theologischen Spätaufklärung in Oldenburg, in: Reinhard Rittner (Hg.), Beiträge zur oldenburgischen Kirchengeschichte, Oldenburg 1993, 63–81. Esdras Mutzenbecher, Erste Predigt in der erneuerten Lambertus Kirche in Oldenburg am 3ten May 1795 gehalten, nebst dem vom P. Hollmann zu Anfang des Gottesdienstes vor dem Altar gesprochenen Gebete, Oldenburg 1795. Andrea Palladio, Die vier Bücher zur Architektur. Nach der Ausgabe Venedig 1570 I quattro libri dell’architettura aus dem Italienischen übertragen und hg. v. Andreas Beyer und Ulrich Schütte, Zürich 1983. Vincenzo Scamozzi, Dell’ idea dell architettura universale, Venedig 1615.
Literatur Albrecht Beutel, Aufklärung II. Theologisch-kirchlich, in: RGG4, I (1998), 941–948. Friedhelm Beyreiß, Der Hausorden und die tragbaren Ehrenzeichen des Großherzogtums Oldenburg 1813–1918, Norderstedt 1997. André Biéler, Kirchbau und Gottesdienst, Neukirchen 1965. Michael W. Brandt, Die Lambertikirche in Oldenburg – Protestantische Pfarrkirche, Monument fürstlicher Herrschaftslegitimation und dynastisches Denkmal, in: Das Land Oldenburg 95 (1997), 1–8. Ders., Die Lambertikirche – dynastisches Denkmal und Monument der Herrschaftslegitimation, in: Oldenburgische Landschaft (Hg.), Dem Wohle Oldenburgs gewidmet. Aspekte kulturellen und sozialen Wirkens des Hauses Oldenburg, Oldenburg 2004, 69–74. Jörg Deuter, Das herzogliche Mausoleum auf dem Oldenburger Gertrudenfriedhof (1786– 1790) und seine Baugeschichte, in: Ewald Gäßler (Hg.), Klassizismus. Baukunst in Oldenburg, Oldenburg 1991, 75–102. Hugo Harms, Ereignisse und Gestalten der Geschichte der evangelisch-lutherischen Kirche in Oldenburg 1520–1920, Oldenburg 1966. Elfriede Heinemeyer, Der Baumeister Joseph Bernhard Winck. Ein Vertreter des Frühklassizismus aus Münster, in: Ewald Gäßler (Hg.), Klassizismus. Baukunst in Oldenburg, Oldenburg 1991, 129–152. Jürgen Krüger, Die Grabeskirche zu Jerusalem. Geschichte-Gestalt-Bedeutung, Regensburg 2000. Hartmut Mai, Der evangelische Kanzelaltar. Geschichte und Bedeutung; Halle/Saale 1969.
320
Die Lambertikirche als architektonisches Symbol
Claus Ritterhoff, Friedrich Leopold Graf Stolberg und Gerhard Anton von Halem. Positionen fundamentalistischer und „aufgeklärter“ Religiosität um 1800, in: Reinhard Rittner (Hg.), Beiträge zur oldenburgischen Kirchengeschichte, Oldenburg 1993, 105–116. Baldwin Smith, The Dome. A Study in the History of Ideas, Princeton 1950. Ludwig Starklof, Erinnerungen. Theater – Erlebnisse – Reisen, hg. v. Harry Niemann, Oldenburg 1986.
Das Vestibül der Lambertikirche in Oldenburg. Rekonstruktion und Neukonzeption
Die Lambertikirche in Oldenburg hat eine komplizierte Baugeschichte und bietet bis heute einen extremen Kontrast zwischen dem neugotischen Äußeren1, und dem klassizistischen Inneren der Kirche. Die neugotische Fassade überkleidet eine klassizistische Kirche, die selbst wiederum in den Außenmauern des spätgotischen Kirchenbaus steht. Zur klassizistischen Lambertikirche gehörte eine besondere Eingangssituation. Herzog Peter Friedrich Ludwig, der den Umbau der gotischen Kirche zu einer klassizistischen Rotunde konzipierte2, ließ auf den Trümmern des mittelalterlichen Altarraumes ein Vestibül errichten. Durch diese Eingangshalle betrat die Gemeinde seit 1795 die Rotunde, den eigentlichen Gottesdienstraum, dessen Altar im Rahmen der klassizistischen Neukonzeption im Westen aufgestellt worden war. Daran änderte sich auch durch die neugotische Ummantelung der Kirche nichts. Die Gemeinde betrat die Kirche, die nun optisch nach Osten ausgerichtet war, durch die neugotische Apsis und fand sich dennoch im Inneren im vertrauten Vestibül wieder. Erst die Drehung der Rotunde um 180° im Zuge des Umbaus der Kirche von 1968–1971 unter der Ägide des Architekten Prof. Dieter Oesterlen, führte zu einer Defunktionalisierung des Vestibüls. Es war nicht länger Eingangsraum, sondern ein Hinterraum, der von der Rotunde aus nur durch verschlungene Gänge aus zu erreichen war. Konsequenterweise wurde der Innenraum des Vestibüls einer neuen Nutzung zugeführt. Es entstand die „Lamberti-Kapelle“, ein zweiter Sakralraum mit einem Altar an der Stelle der 1 Zur Erforschung der Baugeschichte der neugotischen Ummantelung der Lambertikirche hat Ewald Gäßler maßgeblich beigetragen: Ewald Gäßler, Der Umbau der Lambertikirche im 19. Jahrhundert, in: Reinhard Rittner u. a. (Hrsg.), Oldenburg und die Lambertikirche, Oldenburg 1988, 97–124. 2 Zum Wirken Peter Friedrich Ludwigs beim Umbau der Lambertikirche vgl. Ralph Hennings, Die Lambertikirche als architektonisches Symbol und Torben Koopmann, Peter Friedrich Ludwig und das architektonische Konzept der Lambertikirche. Edition dreier Quellen zur Entstehung der klassizistischen Lambertikirche, in: Herzog Peter Friedrich Ludwig (1755– 1829) zum 250. Geburtstag, hg. v. der Oldenburgischen Landschaft, Redaktion Jörgen Welp (Veröffentlichungen der Oldenburgischen Landschaft 11), Oldenburg 2006, 45–91.
322
Das Vestibül der Lambertikirche in Oldenburg. Rekonstruktion und Neukonzeption
Grundriss der klassizistischen Lambertikirche
ehemaligen Tür zur Kirche. Aus diesem Raum wurden bis auf die Grabplatten von Graf Anton I. und seiner Frau Sophia und zwei Tafelbilder alle historischen Erinnerungsstücke entfernt, ebenso alle Bauteile, die den Zugang zur herzoglichen Loge und zum Heizungskeller ermöglichten. Alle hölzernen Türen und die gemauerten Nischen für die Kenotaphe wurden ebenfalls demontiert. Es entstand ein Raum, in dem die Bögen des klassizistischen Vestibüls in einem direkten Kontrast zum apsidalen Schluss des neugotischen Baukörpers standen. Für die jüngste Renovierung der Lambertikirche (2007–2009) unter der Leitung des Architekten Prof. Bernhard Hirche, war die weitgehende Wiederherstellung des klassizistischen Vestibüls eine der im Voraus feststehenden Bedingungen. Für eine Rekonstruktion und Neukonzeption waren dabei vier wesentliche Faktoren zu berücksichtigen. So mussten: 1. eine neue Wegeführung von den östlichen Eingangstüren in die Rotunde sichergestellt, 2. das Problem der kontrastierenden Bauphasen im Innenraum gelöst, 3. eine sinnvolle Wiederaufstellung der historischen Ausstattungsstücke ermöglicht und 4. eine Lösung für die Blickachse nach Osten gefunden werden.
Das Vestibül der Lambertikirche in Oldenburg. Rekonstruktion und Neukonzeption
323
Die Wegeführung Da im jetzigen Umbau die Rotunde nicht wieder nach Westen ausgerichtet wurde, blieb das Vestibül ein Raum, der von der Rotunde aus gesehen hinter dem Altar liegt. Für Menschen, die heute durch die beiden östlichen Türen die Kirche betreten, liegt das Vestibül hingegen auf ihrem Weg in die Kirche und lädt als erster Raum zum Verweilen ein.
Grundriss des neugestalteten Vestibüls
Um das zu erreichen, wurde zunächst eine neue Tür an der Stelle der alten Verbindungstür vom Vestibül zur Rotunde errichtet. Die klassizistische Supraporte mit ihrer Stuckatur wurde rekonstruiert, während die Tür eine modere Stahltür ist, wie sie auch in den übrigen Neubauteilen der Kirche Verwendung
324
Das Vestibül der Lambertikirche in Oldenburg. Rekonstruktion und Neukonzeption
findet. Um einen gut begehbaren Weg vom Vestibül in die Kirche zu ermöglichen, wurde die 1968–71 hinter dem Altar eingerichtete Sakristei wieder entfernt und der Aufgang zur Kanzel mit einer neuen Wendeltreppe ermöglicht. Besucher, die aus dem Vestibül kommen, werden von der runden Treppe nach rechts oder links gelenkt und betreten dann seitlich neben dem Altar die Rotunde. Der Raum neben der Kanzeltreppe wurde mit Vitrinen ausgestattet, die das historische Abendmahlsgerät der Lambertikirche zeigen. Im Vestibül selbst ergibt sich durch den Weg von den beiden östlichen Türen in die Rotunde eine Nord-Süd-Achse, die im westlichsten Bogensegment eine Durchgangslinie bildet, die nicht zur ursprünglichen Raumkonzeption gehört. Diese neue Querachse ermöglicht neben dem Zugang von außen in die Rotunde aber auch den Verkehr innerhalb des Gebäudes von der Nord- zur Süd-Seite. Um die direkte Konfrontation zwischen den Menschen, die diesen Weg benutzen und den im Vestibül aufgestellten Särgen zu verhindern, sind zwei Wandscheiben parallel zur Stirnwand des Vestibüls errichtet worden, die einen flüchtigen Blickkontakt gewähren und die Ahnung des dahinterliegenden Raumes ermöglichen, ohne dass die Särge dem Besucher zur Gänze sichtbar sind oder dass Besucher der Grablegen von Passanten gestört werden.
Die kontrastierenden Bauphasen Klassizismus und Neogotik im Vestibül Die neugotische Ummantelung der Lambertikirche (1885–1887) ließ das Innere der Kirche weitgehend unangetastet. Beim Vestibül mussten nur die die neue und alte Türanlage miteinander harmonisiert werden. Die neuen spitzbogigen Fenster blieben hinter den klassizistischen Türen weitgehend verborgen, sodass die Besucher beim Durchschreiten der Eingangstür einen kompletten Zeit- und Stil-Sprung machten, der sie von der Neugotik des ausgehenden 19. Jahrhunderts zurück in den Klassizismus des ausgehenden 18. Jahrhunderts brachte. Die Lambertikapelle des ausgehenden zwanzigsten Jahrhunderts kontrastierte jedoch die beiden Stilepochen direkt miteinander, indem sie die klassizistischen Bögen skelettiert in der neugotischen Ummantelung stehen ließ. Man sah durch die klassizistischen Rundbögen direkt auf die neugotischen Spitzbögen. Da bei der neuerlichen Umgestaltung des Vestibüls die klassizistischen Innentüren nicht wieder eingebaut werden konnten – das hätte die Wegeführung zu sehr behindert –, musste auf andere Weise eine Abmilderung des Stilkontrastes bewirkt werden. Dazu wurden jeweils der südliche und der nördliche Bogen der drei östlichen Bögen mit Leichtbauwänden geschlossen, die in Anlehnung an die beiden Wandflächen rechts und links der Durchgangstür zur Rotunde gestaltet
Das Vestibül der Lambertikirche in Oldenburg. Rekonstruktion und Neukonzeption
325
wurden. Der mittlere Bogen ist offengeblieben und gibt jetzt den Blick auf das mittelalterliche Kruzifix frei, das auf einem eingestellten Rahmenelement befestigt ist, das den Blick auf die dahinterliegenden Spitzbogenfenster verdeckt. Die beiden Konchen für die Kenotaphe tun ein Übriges, um auf den ersten Blick den Anschein eines klassizistischen Innenraums zu erzeugen. Wer das Vestibül betritt, sieht zunächst keine neugotischen Bauformen, erst wenn man sich den Grablegen nähert, werden die spitzbogigen Fenster der Ummantelung sichtbar. Auf diese Weise ist eine weitgehende Wiederherstellung eines klassizistischen Raumeindruckes gelungen, ohne die Ummantelung baulich angreifen zu müssen.
Die Wiederaufstellung der historischen Ausstattungsstücke Die Wiederaufstellung der historischen Ausstattungsstücke des Vestibüls war unter restauratorischer Perspektive ein zentrales Element der Rekonstruktion des historischen Raumes. Eine reine Rekonstruktion der Situation von 1795 verbot sich aber, weil im Laufe der Zeit mehrere wichtige Ausstattungsstücke dazugekommen sind. Ein ursprüngliches Ausstattungsstück, die Figur des „Ecce homo“ befindet sich seit 1937 in der Taufkapelle im Western der Lambertikirche, die heute als Eingangsraum dient. Leider ist es nicht gelungen, diese Figur wieder im Vestibül aufzustellen.
Die Kenotaphe An erster Stelle sind die beiden Kenotaphe zu nennen, die die Innenansicht des Vestibüls dominieren3. Peter Friedrich Ludwig hat sie konzipiert und die beiden überlebensgroßen Porträtbüsten 1793/4 in Rom für die Lambertikirche herstellen lassen. Die Büste Graf Anton Günthers schuf Luigi Acquisti, die Büste Herzog Friedrich Augusts wurde von Christopher Hewetson geschaffen. Diese Büsten stehen auf monumentalen Untergestellen aus Marmor, die ebenfalls in Italien angefertigt wurden. Nach der Umgestaltung des Vestibüls zur Lambertikapelle standen die je ca. 4½ Tonnen schweren Kenotaphe von 1968–1975 im Freien auf dem Oldenburger Gertrudenkirchhof. Die Kirchengemeinde weigerte sich, sie in ihren Räumen unterzubringen. Da sie rechtlich als Zubehör der gräflichen Grablege gelten, gehören sie zum Eigentum der herzoglichen Familie in der 3 Zur Entstehung der Kenotaphe vgl. Elfriede Heinemeyer, Die Baugeschichte der St. Lambertikirche von den Anfängen bis zum Ende des 18. Jahrhunderts, in: Reinhard Rittner u. a. (Hrsg.), Oldenburg und die Lambertikirche, Oldenburg 1988, 63–96 hier 88–92.
326
Das Vestibül der Lambertikirche in Oldenburg. Rekonstruktion und Neukonzeption
Lambertikirche. Deshalb wurden sie von der Kirchengemeinde im Jahre 1968 vor dem herzoglichen Mausoleum auf dem Gertrudenkirchhof abgestellt4. Nachdem die ersten witterungsbedingten Schäden an den Kenotaphen sichtbar wurden, musste die Kirchengemeinde sie auf Druck der Öffentlichkeit innerhalb des Kirchengebäudes unterbringen. Sie standen dann „sinnentleert“5 auf den Treppenabsätzen im 1. Stock der östlichen Treppenhäuser. Von dort wurden sie jetzt wieder heruntertransportiert und an ihren ursprünglichen Plätzen wieder aufgestellt.
Kenotaph für Herzog Friedrich August
Kenotaph für Graf Anton Günther
Für ihre sinnvolle Aufstellung war nicht nur der originale Standort entscheidend, sondern auch die Herrichtung neuer Konchen, in denen die Kenotaphe einen geschützten Standort finden konnten. Um hinter den Konchen nicht den Raum für die Aufstellung der Särge zu verbauen, konnten sie nicht wieder aus Stein 4 Torben Koopmann, Wo ist das Grab des Grafen Anton Günther? Anmerkungen zur Geschichte der Grablege des letzten Grafen von Oldenburg und Delmenhorst in der St. Lamberti-Kirche, in: Das Land Oldenburg. Mitteilungsblatt der Oldenburgischen Landschaft Nr. 113/114, 3./4. Quartal 2002, 5–15 hier 12f. 5 Heinemeyer, Baugeschichte (Anm. 3), 92.
Das Vestibül der Lambertikirche in Oldenburg. Rekonstruktion und Neukonzeption
327
gemauert werden. Es entstanden stählernen Konchen, die die Funktion der ursprünglich gemauerten Nischen übernahmen, ohne deren Platzanspruch zu haben. Zudem wurden die Kenotaphe um wenige Zentimeter weiter in den Raum geschoben, als sie es ursprünglich waren. Nur so konnten Rekonstruktion und Neukonzeption des Vestibüls an dieser zentralen Stelle miteinander verbunden werden.
Die Särge von Graf Anton Günther und seiner Frau Sophia Katharina Die Baumaßnahmen zum Einbau der klassizistischen Rotunde in die Mauern der gotischen Kirche führten unter anderem zur Zerstörung des Epitaphs für Graf Anton Günther6. In der Nacht vom 4./5. April 1791 stürzten die Gewölbe über dem Chorraum ein und begruben das prächtige Epitaph unter sich. Danach musste eine neue Ruhe- und Gedenkstätte für den Grafen errichtet werden, in die die unbeschädigten Särge Anton Günthers und seiner Frau einbezogen wurden7. Dazu bot sich der hinter dem Kenotaph für Anton Günther liegende Raum geradezu an. Erinnungsmal und Grablege waren auf diese Weise direkt miteinander verbunden. Diese Aufstellung der Särge wurde ergänzt durch Ausstattungsstücke, die den Abbruch der mittelalterlichen Kirche überstanden hatten. Aus der Beschreibung des Vestibüls im Inventarium der St. Lamberti-Kirche des Kirchenprovisors C. Harbers von 1829 wissen wir, dass es direkt hinter dem Kenotaph von Anton Günther, also zwischen den Särgen, eine kleine „Andachtsstätte“ gegeben hat. Dort wurde die Komposition des Epitaphs von Anton Günther rudimentär wiederholt, nämlich ein zentrales Kreuz mit Corpus und die kniende Figur Anton Günthers (samt den Fragmenten der liegenden Figur), nun allerdings ergänzt um die Figur des Moses als Kanzelträgers, der ebenfalls aus der alten Kirche gerettet werden konnte: In der mittelsten Vertiefung steht ein hölzernes Kreuz dessen Stamm 12 Fuß hoch und der Querbalken 6 Fuß lang ist. Daran befindet sich ein Christusbild mit natürlichen Haupt- und Barthaaren. Über demselben steht auf einem schrägen Brett INRI und unten am Stamm des Kreuzes auf einem hölzernen Felde das Lamm Gottes. Dieses Kreuz ist früher in der alten Kirche aufgestellt gewesen. An der westlichen Seite des
6 Torben Koopmann, Gott und den Nachkommen. Das Epitaph des Grafen Anton Günther in der Lambertikirche zu Oldenburg, in: Das Land Oldenburg. Mitteilungsblatt der Oldenburgischen Landschaft Nr. 110, 1. Quartal 2001, 3–12. Zu Anton Günthers Leben und Werk vgl. Hermann Lübbing, Graf Anton Günther von Oldenburg 1583–1667, Oldenburg 1967, zu seinem Wirken in der oldenburgischen Kirchengeschichte s. Rolf Schäfer u. a. (Hrsg), Oldenburgische Kirchengeschichte, Oldenburg 2005, 2.Aufl., 286–300. 7 Zur Geschichte der Grablege des Grafen Anton Günther s. Koopmann, Wo ist das Grab des Grafen Anton Günther? (Anm. 4).
328
Das Vestibül der Lambertikirche in Oldenburg. Rekonstruktion und Neukonzeption
Kreuzes steht eine alabasterne 5 Fuß hohe Statüe, Moses mit der Gesetzestafel in der Hand, vorstellend, welche früher in der alten Kirche als Kanephor gedient und die Kanzel auf ihrem Haupte getragen hat. Dieser zur Seite, östlich des Kreuzes, steht ebenfalls eine steinerne 5 Fuß hohe Statüe in betender Stellung, welche, verbunden mit dem auf dem Fußboden liegenden zerbrochenen Statüen und Engelsköpfen ein Epitaphium des Hochseligen Grafen Anton Günther, in der alten Kirche gebildet hat8.
Diese von Herzog Peter Friedrich Ludwig konzipierte Anlage der Grablege für Graf Anton Günther wurde durch die Schenkung von Kreuz, Kanzelfuß und Anton-Günther-Figuren an die großherzogliche Altertümersammlung im Jahre 1873 zum ersten Mal verändert. Die zweite große Veränderung kam mit der Aufstellung der Särge von Graf Anton I. und seiner Frau und eines dritten Sammelsarges im Jahre 1937. Damit standen fünf Särge relativ beengt hinter den Türen der nördlichen Seite des Vestibüls. Bei der 1968–69 erfolgten Umgestaltung des Vestibüls zur Lambertikapelle wurden alle fünf Särge in den ehemaligen Kohlenkeller der Kirche verbracht und dort eingemauert. Für die Rekonstruktion und Neukonzeption des Vestibüls spielte die Wiederaufstellung der Särge von Graf Anton Günther und seiner Frau eine zentrale Rolle. Graf Anton Günther ist bis heute in der Erinnerung der Oldenburger eine positive historische Figur. Das Vermauern seines vorher immer zugänglich gewesenen Sarges löste schon in den siebziger Jahren Proteste aus. Die Wiederaufstellung der Särge Anton Günthers und seiner Frau im Vestibül standen außer Frage. Die zinnernen Särge mussten dazu aufwendig restauriert werden und wurden dann wiederum hinter dem Kenotaph von Anton Günther aufgestellt. Erinnerungsmal und Grablege sollten wiederum eine Einheit bilden. Die Rückseite der stählernen Konche des Kenotaphs wurde nun zur linken Seitenwand der von der Ostseite zugänglichen Grabkammer, die erhaltene klassizistische Außenwand, an der von 1795 bis 1873 das Kruzifix hing, bildet nun die rechte Seite, 8 Inventarium der St. Lamberti Kirche zu Oldenburg 1829, S. 42f. Der zitierte Text verdankt sich der von Torben Koopmann dankenswerter Weise vorgenommenen Transkription des Inventariums. Für die Arbeit an der Rekonstruktion des klassizistischen Vestibüls war die Übertragung des Textes eine zentrale Quelle. Torben Koopmann (Übertragung), „Inventarium der St. Lamberti Kirche zu Oldenburg. Aufgenommen Anno 1829.“ Niedersächsisches Landearchiv, Standort Oldenburg, Best. 73 (Konsistorium Oldenburg) Nr. 9804a. Koopmann beschreibt das Archivstück und seine Transkription wie folgt: „Laut Eingangsvermerk auf der Titelseite ist das Inventarium am 29. Mai 1829 beim Konsistorium in Oldenburg eingegangen. Ein zweites Exemplar dieses Inventariums befindet sich im Archiv der ev.-luth. Kirchengemeinde Oldenburg. Dieses Exemplar weicht in der Seitenzählung von demjenigen im Staatsarchiv ab und besitzt zudem Nachträge und Ergänzungen. Auf dem Titelblatt des Inventariums im Archiv der Kirchengemeinde ist außerdem der Autor genannt: Kirchenprovisor C. Harbers. Die Zeichensetzung des Originals ist beibehalten worden.“ Bei dem im Text erwähnten Kreuz handelt es sich um das Kruzifix der ehemaligen Triumphkreuzgruppe, das jetzt im Osten des Vestibüls aufgestellt wurde, dazu s. u. Der Kanzelfuß befindet sich ebenso wie die Figuren Anton Günthers im Landesmuseum Oldenburg.
Das Vestibül der Lambertikirche in Oldenburg. Rekonstruktion und Neukonzeption
329
während im Westen die eingestellte Wandscheibe die Abschirmung zur neuen Wegeführung bildet. Auf diese Weise ist eine Grablege am historischen Ort wiederhergestellt worden, die sich bewusst am ursprünglichen Konzept orientiert, dies aber mit modernen Materialien tut und die heutigen Bedingungen im Vestibül berücksichtigt.
Die Grablege für Graf Anton Günther und seine Frau Sophia Katharina
An der Rückwand der Grablege sind zwei Schriftsteine in einem Metallgestell angebracht. Es handelt sich zum einen die vergrößerte Sandsteinkopie des Sterbetalers von Graf Anton Günther, die von 1972–2007 die Stelle bezeichnete, hinter der die Särge Graf Anton Günthers und seiner Frau im Heizungskeller der Kirche vermauert waren. Der kleinere, schwarze Stein ist das einzige Teil des Epitaphs von Graf Anton Günther, das in der Lambertikirche erhalten geblieben ist. Es ist der von Anton Günther schon zu Lebzeiten angebrachte Gedenkstein für seine Frau Sophia
330
Das Vestibül der Lambertikirche in Oldenburg. Rekonstruktion und Neukonzeption
Katharina9, er enthält neben ihrem Geburts- auch das Datum der Eheschließung, ließ aber von Anfang an keinen Platz für ein Sterbedatum.
Gedenkstein für Gräfin Sophia Katharina aus dem Epitaph für Graf Anton Günther
Die Särge des Grafen Christian von Haxthausen und seiner Frau Die repräsentativen Marmorsärge des Grafen Christian von Haxthausen (1690– 1740) und seiner Frau Margarethe, geb. von Juel (1702–1752)10 entstammen der in Oldenburg so genannten „Dänenzeit“, als die Grafschaft Oldenburg, zwischen dem Tod Graf Anton Günthers und dem Regierungsantritt Herzog Friedrich Augusts, von Dänemark aus regiert wurde. Christian von Haxthausen war dänischer Oberlanddrost in Oldenburg und zugleich ein Urenkel des Grafen Anton Günther. Sein Vater hatte eine Tochter des unehelichen Sohnes von Graf Anton Günther, Graf Anton I. von Aldenburg geheiratet. Die Grablege für Christian Graf von Haxthausen und seine Frau war in der Lambertikirche ursprünglich in der gräflich Wedelschen Gruft, in der schon seine Tante Wilhelmine Juliane Gräfin 9 Torben Koopmann, „Zum ewigen Gedächtnis…“, in: Nordwest-Heimat. Beilage der Nordwest-Zeitung, 20. 9. 2008, 1f. 10 Inger Gorny, Christian Haxthausen, in: Biographisches Handbuch zur Geschichte des Landes Oldenburg, Oldenburg 1992, 286–287.
Das Vestibül der Lambertikirche in Oldenburg. Rekonstruktion und Neukonzeption
331
von Wedel-Jarlsberg ebenfalls geb. von Aldenburg, ruhte. Als diese Gruft 1885 auf Grund von Fundamentierungsarbeiten für die neugotische Ummantelung der Kirche zerstört werden musste, kamen die Sarkophage aller namentragenden Angehörigen der Familie der Grafen von Wedel in die Familiengruft nach Loga (bei Leer). Die Sarkophage des Grafen von Haxthausen und seiner Frau blieben hingegen in der Lambertikirche und sind seitdem an verschiedenen Orten aufgestellt worden. Nach dem letzten Umbau standen sie im nordöstlichen Treppenhaus unter der Treppe. Im Rahmen der jetzigen Neukonzeption des Vestibüls, bot es sich an, die parallele Situation hinter dem Kenotaph von Herzog Friedrich August für diese Sarkophage zu nutzen. Die inhaltliche Verbindung zwischen Kenotaph und Grablege ist hier deutlich anders als bei Graf Anton Günther. Da aber im klassizistischen Vestibül hinter dem Kenotaph Friedrich Augusts keine Grablege war, sondern der Treppenaufgang zur herzoglichen Loge, gab es keine Argumente gegen eine solche Nutzung des vorhandenen Raumes hinter dem südlichen Kenotaph. Hier entstand jetzt ebenso eine Grablege wie auf der gegenüberliegenden Seite. Zur Grablege des Grafen von Haxthausen gehören auch noch zwei, von ursprünglich drei metallenen Gittern aus der Grablege in der Wedelschen Gruft. Leider fehlt ausgerechnet das Gitter mit dem Wappen Christian von Haxthausens. Das eine noch vorhandene Gitter vereint die Monogramme der Eheleute und das andere zeigt das Wappen der Familie von Juel. Ein Gitter steht jetzt als Begrenzung vor den Särgen, das andere hängt als Bekrönung an der Wand.
Grablege für Graf Christian von Haxthausen und seine Frau Margarethe
332
Das Vestibül der Lambertikirche in Oldenburg. Rekonstruktion und Neukonzeption
Historisch bilden die Särge des Grafen von Haxthausen und seiner Frau ein Bindeglied zwischen Graf Anton Günther und Herzog Friedrich August. Erzählen sie doch von den Nachkommen Graf Anton Günthers und der Pietät der dänischen Könige, die sie das Amt des Oberlanddrosten mit Abkömmlingen des Grafen Anton I. von Aldenburg bekleiden ließ.
Die Grabplatten von Graf Anton I. von Oldenburg und seiner Frau Seit 1969 hängen die schwarzen Grabplatten aus belgischem Marmor für Graf Anton I. von Oldenburg und seine Frau Sophia an der Westwand des Vestibüls.
Grabplatte für Graf Anton I. von Oldenburg Grabplatte für seine Frau, Gräfin Sophia von Oldenburg
Sie wurden bei der Neukonzeption des Vestibüls an Ort und Stelle belassen, da eine Zusammenführung der Grabplatten mit den Särgen des Grafen und seiner Frau nicht mehr möglich ist. Der Bau des Heizungskellers im Jahre 1937 zerstörte
Das Vestibül der Lambertikirche in Oldenburg. Rekonstruktion und Neukonzeption
333
die Anlage ihrer Gräber im ehemaligen Altarraum der mittelalterlichen Kirche11. Die Grabplatten wurden von den Särgen und Gebeinen getrennt. Die 1937 nach historischem Vorbild neu geschaffenen Särge sind bis 1969 neben den Särgen des Grafen Anton Günther und seiner im nördlichen Seitenraum des Vestibüls aufbewahrt worden, bevor sie alle zusammen in den Keller der Kirche kamen. Die Särge von Graf Anton I. und seiner Frau sind dort verblieben. Ihre Grabkammer ist jetzt durch eine Tür zugänglich. Mit den beiden Grabplatten für Graf Anton I. und seine Frau lässt sich die Generationenkette des Hauses Oldenburg noch zwei Generationen hinter Graf Anton Günther zurückverfolgen. Zugleich birgt das Vestibül mit diesen Grabplatten die Erinnerung an die Reformation im Oldenburger Land. Denn erst dadurch, dass Anton I. seine Brüder aus dem Regiment gedrängt hat, wurde ab 1530 die Reformation in Stadt und Land Oldenburg stabilisiert. Anton I. verhinderte allerdings bis zu seinem Tod, dass eine Kirchenordnung geschaffen und ein Superintendent eingesetzt wurde, was der evangelischen-lutherischen Kirche in Oldenburg einen verbindlichen rechtlichen Rahmen und eine geistliche Leitung gegeben hätte. Dieses Verhalten und die gleichzeitige Umwandlung kirchlicher Einkünfte in Staatseinnahmen, sorgten dafür, dass Anton I. im Urteil der Nachwelt keinen ungeteilten Beifall fand12.
Zwei Tafelbilder Durch glückliche Umstände ist die Lambertikirche im Besitz zweier großer Tafelgemälde, die auch schon in der Lambertikapelle gezeigt worden sind. Von daher gebot sich eine Einbeziehung der beiden Bilder in die Neukonzeption des Vestibüls. Es handelt sich zum einen um die Verklärung Christi von Johann Willinges13, zum anderen um eine zeitgenössische Rembrandt-Kopie. Der Maler Johann Willinges stammt aus Oldenburg, hat aber hauptsächlich in Lübeck gewirkt. Dort gehört er zu den Hauptvertretern des Manierismus. Sein Bild hat er wahrscheilich 1586 der Lambertikirche als Abschiedsgeschenk gestiftet, denn 11 Einen ausführlichen Bericht über die mit der Errichtung des Heizungskellers verbundenen Grabungen und Funde geben Karl Fissen und Walter Müller-Wulkow im Oldenburger Jahrbuch 1938, der dann mit einem Vortrag von Carl Wöbken zusammen als Sonderdruck 1939 noch einmal herausgegeben wurden ist. Karl Fissen / Walter Müller-Wulkow, Die Aufdeckung der Grabgewölbe des Oldenburgischen Grafenhauses und die übrigen in der Oldenburger Lambertikirche gemachten Funde, in: Oldenburger Jahrbuch 42 (1938), 41–61. 12 Zur historisch oft ungerechten Beurteilung des Grafen Anton I. vgl. die neuere Würdigung seines Wirkens durch Rolf Schäfer, in: Schäfer, Oldenburgische Kirchengeschichte (Anm. 6), 208–212 u. 228–231. 13 Elfriede Heinemeyer, Johann Willinges, in: Biographisches Handbuch zur Geschichte des Landes Oldenburg, Oldenburg 1992, 799–800.
334
Das Vestibül der Lambertikirche in Oldenburg. Rekonstruktion und Neukonzeption
Verklärung Christi von Johann Willinges (1586)
bereits 1587 ist er in Lübeck nachweisbar. Die Rückseite des Bildes samt der Künstlerinschrift hängt im Turmzimmer im Westen der Lambertikirche. Das zweite Bild zeigt die Kreuzabnahme Christi. Es ist eine Kopie des berühmten gleichnamigen Bildes von Rembrandt. Wahrscheinlich ist der 1633 entstandene Stich Rembrandts die direkte Vorlage gewesen, denn der Stich und seine Oldenburger Ausführung in Öl sind gegenüber dem im gleichen Jahr entstandenen Tafelbild Rembrandts (München, Alte Pinakothek) seitenverkehrt und zeigen in einigen Details deutliche Abweichungen14. Die Kopie in der Lambertikirche wurde wahrscheinlich noch im 17. Jahrhundert angefertigt. 14 Wolfgang Runge, Kirchen im Oldenburger Land, Bd. 3. Kirchenkreise Oldenburg 1 und 2, Oldenburg 1988, 46–47.
Das Vestibül der Lambertikirche in Oldenburg. Rekonstruktion und Neukonzeption
335
Kreuzabnahme (eine Rembrandt-Kopie)
Diese beiden Bilder fanden jetzt einen neuen Platz an den Wandscheiben, die die Grablege von den Durchgangswegen im westlichen Teil des Vestibüls trennen. Sie hängen jetzt gegenüber den Grabplatten von Graf Anton I. und seiner Frau und bilden mit ihnen zusammen eine Art kleinen Vorraums auf jeder Seite des Vestibüls.
336
Das Vestibül der Lambertikirche in Oldenburg. Rekonstruktion und Neukonzeption
Grabplatte und Tafelbild im Vorraum zum Vestibül (Nordseite)
Die Blickachse nach Osten Da die Lambertikirche nicht wieder im Inneren gedreht werden konnte, musste die Rekonstruktion und Neukonzeption des Vestibüls von der Tatsache ausgehen, dass der mittlere Eingang im Osten der Kirche nicht wieder geöffnet wurde. Die von Prof. Oesterlen 1969 geschickt eingepassten neogotisierenden Fenster im Scheitelpunkt des apsidalen Schlusses der Ummantelung blieben auf diese Weise erhalten. Sie störten aber den Eindruck des Betrachters erheblich, vor allem, wenn man von der Rotunde aus die Vorhalle betrat. Es fehlten dem Raum ein Abschluss und zugleich eine Ausrichtung nach Osten. Die Aufstellung eines markanten Kunstwerks wurde schon sehr früh als Lösung dieses Problems diskutiert. Gespräche mit dem niedersächsischen Landesmuseum ergaben die Möglichkeit einer leihweisen Präsentation des Kruzifixus der ehemaligen Triumphkreuzgruppe in der Blickachse nach Osten. Das Kreuz, das aus der zerstörten gotischen Kirche gerettet wurde, hängt jetzt wieder sehr nahe an dem Platz, an dem es Herzog Peter Friedrich Ludwig in seine Konzeption des Vestibüls eingepasst hatte. Zugleich bekam das Vestibül damit einen eindeutig christozentrischen Schlusspunkt.
Das Vestibül der Lambertikirche in Oldenburg. Rekonstruktion und Neukonzeption
337
Spätgotisches Kruzifix
Die Christusfigur in ihrer gotischen Expressivität weist sehr deutlich auf den Kreuzestod Christi hin. Dessen erlösende Wirkung war die Hoffnung aller, die in der Lambertikirche beerdigt worden sind. Durch die Christusfigur wird dem gesamten Kirchengebäude im Vestibül ein sinnvoller Abschluss gegeben. Obwohl das Kruzifix aus einer anderen Stilepoche stammt, macht es in seiner jetzigen Aufstellung deutlich, dass Rotunde und Vestibül nicht zwei verschiedene Teile eines Gebäudes sind. Sie werden durch das Kruzifix jetzt geistlich, also in ihrer Beziehung auf den gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus zusammengehalten15.
Rekonstruktion und Neukonzeption Erst die Einbindung der beschriebenen vier Faktoren ermöglichte die Rekonstruktion und Neukonzeption des Vestibüls. Sie war ein wesentliches Teilprojekt des 2009 abgeschlossenen Umbaus der Lambertikirche. 15 Zur christlichen Symbolik der Rotunde vgl. Ralph Hennings, Die Lambertikirche als architektonisches Symbol, in: Herzog Peter Friedrich Ludwig (Anm. 2), 45–58.
338
Das Vestibül der Lambertikirche in Oldenburg. Rekonstruktion und Neukonzeption
Zur Rekonstruktion kommen außer der Wiederaufstellung der Kenotaphe, der Wiedereinrichtung der gräflichen Grablege und der Ausblendung der neugotischen Ummantelung aus dem Innenraum des Vestibüls vor allem Entscheidungen zur Farbgebung hinzu. Aus dem Inventarium von 1829 war zu entnehmen, dass die Farbgebung der Wände Weiß bei blauer Hinterlegung der Stuckaturen war: „Die Decke des Vestibulums ist gegypst und mit Stuccaturarbeit verziert und, so wie die Wände, weiß. Da wo aber Stuccaturverzierung angebracht, ist die Fläche bläulich, damit sich die Verzierungen heraus heben“16. Diese Farbgebung wurde von den Restauratoren durch Farbschnitte belegt und davon ausgehend ein Vorschlag für eine blaue Hinterlegung der Stuckaturen gemacht. Diese wiederhergestellte Farbigkeit verleiht dem Vestibül einen ausgesprochen festlichen Charakter. Der Ursprung der Raumkonzeption im Klassizismus wird damit sehr deutlich hervorgehoben. Die Wiederherstellung der Supraporte beim Durchgang vom Vestibül in die Rotunde mit ihrer charakteristischen Stuckatur rundet die Rekonstruktion des Vestibüls ab. Die Rekonstruktion des Vestibüls hat aber auch Grenzen gefunden. So wurde ebenso wie in der Rotunde, der Fußboden der letzten Renovierung beibehalten. Im Vestibül wurden allerdings die schwarzen Vierecke, die zwischen den hellgrauen Achtecken lagen, entfernt und durch hellgraue Steine aus dem gleichen Material ersetzt. Der hellgraue Marmorboden ist jetzt in Rotunde und Vestibül durchgängig gleich. Das entspricht aber nicht dem Zustand von 1795 für den ein gröberes Material und eine dunklere Farbe belegt sind: „Der Fußboden ist vorn, hinten und an den Seiten mit braunen Flur- und Grausteinen in verschiedenen Gestalten, belegt“17. Das Bemühen des erneuten Umbaus der Lambertikirche war von dem Interesse geleitet, im Vestibül möglichst viele Elemente des klassizistischen Raumeindrucks zurück zu gewinnen. Da aber keine vollständige Rekonstruktion des Zustandes von 1795 möglich war, musste es eine Neukonzeption des Raumes unter den jetzigen Bedingungen geben. Zu dieser Neukonzeption gehören die Wegeführung durch die westlichen Bögen, die Wandscheiben zur Abtrennung der Grablegen sowie das Kruzifix mit seiner Rückwand in der Ostachse. Diese neuen Elemente binden das Vestibül in die Wegeführung innerhalb des Erdgeschosses der Lambertikirche wieder ein, obwohl ihr die ursprüngliche Funktion einer zentralen Eingangshalle nicht zurückgegeben werden konnte. Die ebenso ursprüngliche Funktion des Vestibüls als Grablege und als Raum zur dynastischen Repräsentation des Hauses Oldenburg ist auch in die Neu-
16 Inventarium der St. Lamberti Kirche (Anm. 7), 30. 17 Inventarium der St. Lamberti Kirche (Anm. 8), 30.
Das Vestibül der Lambertikirche in Oldenburg. Rekonstruktion und Neukonzeption
339
Wiederhergestellte Supraporte über der Tür zur Rotunde
konzeption eingeflossen18. Die beiden symmetrisch angeordneten Grablegen hinter den Kenotaphen werden der ursprünglichen Intention gerecht. Die Wiederherstellung der Grablege für Graf Anton Günther und seiner Frau hinter dem
18 Michael W. Brandt, Die Lambertikirche in Oldenburg – Protestantische Pfarrkirche, Monument fürstlicher Herrschaftslegitimation und dynastisches Denkmal, in: Das Land Oldenburg. Mitteilungsblatt der Oldenburgischen Landschaft Nr. 95, 2. Quartal 1997, 1–8, hier 4: Neben der Erinnerung an die zwei „großen oldenburgischen Fürsten“ sollte mit den Denkmälern in der Vorhalle aber auch ein dynastischer Gedanke verfolgt werden.
340
Das Vestibül der Lambertikirche in Oldenburg. Rekonstruktion und Neukonzeption
Kenotaph für Graf Anton Günther entspricht sogar exakt der Intention Herzog Peter Friedrich Ludwigs. Die im Laufe der Zeit neu hinzugekommenen Ausstattungsstücke des Vestibüls sind in der Neukonzeption zu einer umgreifenderen theologischen und historischen Perspektive auf die Lambertikirche und das Land und Haus Oldenburg verbunden worden. Das Kruzifix als ältestes Ausstattungsstück gibt dem gesamten Raum die Ausrichtung auf Christus und stellt damit die Kontinuität von der mittelalterlichen Kirche über Klassizismus und Historismus bis in die Gegenwart her. Auf Christus als ihren Herrn und Erlöser vertrauen die Christen aller Zeiten. Das Vertrauen auf Christus als Erlöser wird auf allen Grabmonumente ausgesagt, die jetzt im Vestibül versammelt sind: Die Grabplatten von Graf Anton I. und seiner Frau, die Särge von Graf Anton Günther und seiner Frau, die Särge von Graf Christian und seiner Frau. Selbst die beiden Gemälde sind christuszentriert: die Bilder von der Verklärung und der Kreuzabnahme zeigen wichtige Szenen aus dem Leben Jesu. Die einzigen Ausstattungsstücke, die nicht direkt eine Verbindung zum gekreuzigten und auferstanden Christus zeigen, sind die beiden großen Kenotaphe, die den Raum in der Querachse dominieren. Sie dienen der Repräsentation des Hauses Oldenburg in der älteren, gräflichen und der jüngeren, herzoglichen Linie. Die Position der Kenotaphe in der ehemaligen Eingangshalle erschöpft sich aber nicht in der dynastischen Repräsentation. Die Aufstellung der Kenotaphe im Übergangsbereich von weltlichen zum dezidiert gottesdienstlichen Raum gibt einen Hinweis auf die eigentümliche Stellung der Landesfürsten in den evangelischen Territorien bis zum Ende der Monarchie im deutschen Reiche im Jahre 1918. Die Landesherren waren zugleich Kirchenherren. Sie waren sowohl für die weltlichen wie die geistliche Belange ihrer Länder zuständig. Insofern war die Aufstellung der Kenotaphe für Graf Anton Günther und Herzog Friedrich August in der ehemaligen Eingangshalle ein korrekter Ausdruck ihrer verfassungsgemäßen Stellung19. Das gilt für die heutige Zeit nicht mehr, im Vestibül sind die Kenotaphe jetzt Erinnerungsstücke an die beiden Linien des Hauses Oldenburg, die das Land Oldenburg – und seit der Reformation die evangelisch-lutherische Kirche ihres Landes – regierten. Zusammen mit den Grabplatten des Grafen Anton I. und seiner Frau, sowie den Särgen des Grafen von Haxthausen und seiner Frau zeigen sie die Geschichte des Landes und seiner Kirche von der Reformation bis zum Beginn der Weimarer Republik. Sie ist bestimmt worden von der Familie Oldenburg20 und dem lutherischen Bekenntnis. Damit hat das rekonstruierte Vestibül der Lambertikirche eine Funktion, die weit über die eines Memorialraumes hinausgeht. Es zeigt die 19 Brandt, Die Lambertikirche (Anm. 18), 5. 20 Zur Familie der Oldenburger vgl. Gerd Steinwascher, Die Oldenburger. Geschichte einer europäischen Dynastie, Stuttgart 2. Aufl. 2012.
Das Vestibül der Lambertikirche in Oldenburg
341
historischen Verbindungen der Kirchen-, Stadt- und Landesgeschichte und das Vertrauen auf Jesus Christus als Glaubens- und Lebensgrundlage für die Menschen in Oldenburg.
Ansicht des rekonstruierten Vestibüls (Blick nach Osten)
Literatur Michael W. Brandt, Die Lambertikirche in Oldenburg – Protestantische Pfarrkirche, Monument fürstlicher Herrschaftslegitimation und dynastisches Denkmal, in: Das Land Oldenburg. Mitteilungsblatt der Oldenburgischen Landschaft Nr. 95, 2. Quartal 1997, 1–8. Ewald Gäßler, Der Umbau der Lambertikirche im 19. Jahrhundert, in: Reinhard Rittner u. a. (Hrsg.), Oldenburg und die Lambertikirche, Oldenburg 1988, 97–124. Karl Fissen / Walter Müller-Wulkow, Die Aufdeckung der Grabgewölbe des Oldenburgischen Grafenhauses und die übrigen in der Oldenburger Lambertikirche gemachten Funde, in: Oldenburger Jahrbuch 42 (1938), 41–61. Inger Gorny, Christian Haxthausen, in: Biographisches Handbuch zur Geschichte des Landes Oldenburg, Oldenburg 1992, 286–287. Elfriede Heinemeyer, Die Baugeschichte der St. Lambertikirche von den Anfängen bis zum Ende des 18. Jahrhunderts, in: Reinhard Rittner u. a. (Hrsg.), Oldenburg und die Lambertikirche, Oldenburg 1988, 63–96.
342
Das Vestibül der Lambertikirche in Oldenburg. Rekonstruktion und Neukonzeption
Dies., Johann Willinges, in: Biographisches Handbuch zur Geschichte des Landes Oldenburg, Oldenburg 1992, 799–800. Ralph Hennings, Die Lambertikirche als architektonisches Symbol, in: Herzog Peter Friedrich Ludwig (1755–1829) zum 250. Geburtstag, hg. v. der Oldenburgischen Landschaft, Redaktion Jörgen Welp (Veröffentlichungen der Oldenburgischen Landschaft 11), Oldenburg 2006, 45–58. Torben Koopmann, Gott und den Nachkommen. Das Epitaph des Grafen Anton Günther in der Lambertikirche zu Oldenburg, in: Das Land Oldenburg. Mitteilungsblatt der Oldenburgischen Landschaft Nr. 110, 1. Quartal 2001, 3–12. Ders., Wo ist das Grab des Grafen Anton Günther? Anmerkungen zur Geschichte der Grablege des letzten Grafen von Oldenburg und Delmenhorst in der St. LambertiKirche, in: Das Land Oldenburg. Mitteilungsblatt der Oldenburgischen Landschaft Nr. 113/114, 3./4. Quartal 2002, 5–15. Ders., Peter Friedrich Ludwig und das architektonische Konzept der Lambertikirche. Edition dreier Quellen zur Entstehung der klassizistischen Lambertikirche, in: Herzog Peter Friedrich Ludwig (1755–1829) zum 250. Geburtstag, hg. v. der Oldenburgischen Landschaft, Redaktion Jörgen Welp (Veröffentlichungen der Oldenburgischen Landschaft 11), Oldenburg 2006, 59–90. Hermann Lübbing, Graf Anton Günther von Oldenburg 1583–1667, Oldenburg 1967. Wolfgang Runge, Kirchen im Oldenburger Land, Bd. 3. Kirchenkreise Oldenburg 1 und 2, Oldenburg 1988. Rolf Schäfer u. a. (Hrsg), Oldenburgische Kirchengeschichte, 2.Aufl., Oldenburg 2005. Gerd Steinwascher, Die Oldenburger. Geschichte einer europäischen Dynastie, Stuttgart 2. Aufl. 2012.
Bildnachweis Alle Photos: Ralph Hennings Grundriss der klassizistischen Kirche: Die Bau- und Kunstdenkmäler des Herzogtums Oldenburg, Heft IV. Die Ämter Oldenburg, Delmenhorst, Elsfleth und Westerstede, Neudruck der Ausgabe 1907, Osnabrück 1976, 30. Grundriss des neugestalteten Vestibüls: Zeichnung von Prof. Dipl. Ing. arch. Bernhard Hirche.
Theologie in der Ammergauischen Frülingslust1
Die Ammergauische Frülingslust des Oldenburgischen Hofhistoriographen Johann Justus Winkelmann (1620–1699) ist nicht nur eine Naturschilderung der Barockzeit, sie enthält auch ein klares theologisches Programm. Das wird besonders in zwei Themenbereichen deutlich, zum einem in der Verbindung von Naturschilderung und Gotteserkenntnis und zum anderen im Lobpreis des Grafen Anton Günther als tugendhaften Herrschers. Dass Winkelmann mit der Frülingslust mehr beabsichtigt, als Naturschilderungen zur Ergötzung der Leserschaft zu geben, stellt er bereits in der Vorrede klar: Er verstecke seine ernsten Absichten in verschiedenen literarischen Verkleidungen; „hinter solche[n] liebliche[n] Larven“ stehe im Kern aber „erbauliche Lehre“ (Vorrede, iijv).
Gotteserkenntnis aus der Natur Dass Gott nicht nur aus der Bibel, sondern auch aus der Natur erkannt werden kann, steht schon in der Bibel. Im Römerbrief formuliert Paulus es klassisch: „Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken“ (Röm 1,20)2. In der Theologie tritt die Erkenntnis Gottes aus der Natur zumeist hinter der Erkenntnis Gottes durch sein Wort zurück. Im 17. Jahrhundert wurde allerdings die Theologie durch die sich formierenden Naturwissenschaften zu einer Neubestimmung 1 Beitrag zur Neuausgabe der Ammergauischen Frülingslust: Hans Just Winkelmann, Ammergauische Frülingslust. Nachdruck der Ausgabe Oldenburg 1656, hg. v. Eckhard Grunewald, Münster 2013. Die im Text in Klammern angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Seitenzahlen des Nachdrucks der Ammergauischen Frülingslust bzw. bei der unpaginierten Vorrede auf die Blattzahlen. 2 Diese Stelle aus dem Römerbrief steht Formulierungen in der Ammergauischen Frülingslust Pate: Aus der Schöpfung sollen die Menschen „die Almacht und Weisheit GOttes erkennen“ (118) oder „Sehe doch das allergeringste Gräßlein und Sämlein an / so wirstu gleichsam mit lebendigen Buchstaben die grose Weisheit / Kraft und Wirkung GOttes darauf / verborgener weise / gemahlet befinden.“ (180).
344
Theologie in der Ammergauischen Frülingslust
ihres Verhältnisses zur Natur gezwungen. Die Theologen der verschiedenen Konfessionen machten sich an eine Neubewertung der Natur als Quelle der Erkenntnis Gottes. Damit kam der „natürlichen Theologie“ in dieser Zeit eine besondere Rolle zu. Sie wurde im 17. und 18. Jahrhundert zum Teil zu einer regelrechten „Physikotheologie“ weiterentwickelt. Damit wollte man aus der Natur die Existenz Gottes beweisen und benutzte diese Art der Theologie als Argument gegen die Atheisten der Zeit3. Die Ammergauische Frülingslust ist noch keine Schrift, die der Physikotheologie im strengen Sinne zuzuordnen ist4, aber sie enthält bereits Elemente die damit übereinstimmen – so etwa das Pathos des Staunens und der Ergriffenheit angesichts der Größe der Schöpfung5. Winkelmann sieht sich aber nicht genötigt, die Existenz Gottes aus der Natur zu beweisen, wie es die Physikotheologen tun. Die Existenz Gottes kann er in der Ammergauischen Frülingslust noch als undiskutiert voraussetzen. Winkelmann versteht die Natur als eine von Gott geschaffene und durch die Vorsehung (providentia) erhaltene Schöpfung, und er sieht den Zweck der Natur darin, den Menschen zu Gott zu rufen. Viele seiner Ansichten finden sich bereits bei Johann Gerhard (1582–1637) in seinen Loci theologici, die von 1610–1622 erschienen6 und die wichtigste orthodoxe lutherische Dogmatik des 17. Jahrhunderts geworden sind. An einigen Stellen liegen in der Ammergauischen Frülingslust beinahe wörtliche, aber nicht gekennzeichnete Zitate aus Johann Gerhards Loci vor.
Gotteserkenntnis aus der Natur Die Erkenntnis Gottes durch das Betrachten seiner Schöpfung gehört zu den zentralen Themen der Ammergauischen Frülingslust. Bereits in der ausführlichen Titelformulierung wird darauf angespielt. Winkelmann gewinnt seinen Stoff nach eigenen Worten „aus dem grosen Naturbuch“. Speziell der Anblick des 3 Zum Gesamtzusammenhang siehe die Arbeiten von Hans-Martin Barth, Atheismus und Orthodoxie. Analysen und Modell christlicher Apologetik im 17. Jahrhundert (Forschungen zur systematischen und ökumenischen Theologie 26), Göttingen 1971; Udo Krolzik, Säkularisierung der Natur. Providentia-Dei-Lehre und Naturverständnis der Frühaufklärung, Neukirchen 1988; Paul Michel, Physikotheologie – Ursprünge, Leistung und Niedergang einer Denkform (Neujahrsblatt auf das Jahr 2008 hg. von der gelehrten Gesellschaft in Zürich), Zürich 2008. 4 Vgl. die folgende Definition von Udo Krolzik, Physikotheologie, in: RGG4 6 (2003), 1328–1330, hier 1329: „Die physikotheol. Arbeiten sind eine eigene Gattung theol. Lit. […] Sitz im Leben dieser Werke ist die kompendienhafte Vermittlung naturwiss. Erkenntnisse an das Bildungsbürgertum.“ Diese Kriterien erfüllt die Ammergauische Frülingslust nicht. 5 Barth (Anm. 3), 258–262. 6 Johann Gerhard, Loci theologici 9 Bde., hg. von Friedrich Frank. Leipzig 1885.
Theologie in der Ammergauischen Frülingslust
345
Himmels, dient ihm zur Gotteserkenntnis7. Gott hat den Himmel geschaffen und den Menschen mit dem aufrechten Gang begabt: damit er vor allen Dingen mit geflügeltem Vermögen und inbrünstigem herzlichem Anschauen die Höhe des Himmels / nach seinem alweisen Befehl / ansehen und darauf die Höhe / unaussprechliche / täglich vor Augenstehende grose Wunderwerke / Almacht / Weisheit / und Regirung des HErrn erkennen möchte“ (7, ähnlich 9, 10).
Damit bringt Winkelmann zur Sprache, dass die Schöpfung nicht am siebten Tag abgeschlossen wurde, sondern dass Gott – vor allem durch seine Vorsehung – die Welt bis heute erhält und regiert8. Gottes Wirken in der Welt verfolgt eine bestimmte Absicht, nämlich das Heil der Menschen. Sie sollen Gott durch seine Werke erkennen und sich zu ihm wenden. Für Winkelmann ist das der Sinn der Naturbetrachtung – und also auch seiner Naturschilderungen –, die den Lesern eine angeleitete, literarische Sicht auf die Welt ermöglichen sollen und damit auch auf die Hinwendung der Leser zu Gott abzielen: dahero auch GOtt der HErr / alles / was Er mit den Menschen handelt und fürnimt / es seyen Wolthaten oder Strafen / zu dem guten Endzweck thut / daß Er den von Ihm abgewendeten Menschen wieder zu ihm wende / kehre und locke (10).
Ganz grundsätzlich stellt Winkelmann fest: „Ja alles / was wir ansehen / ist eine Erinnerung unsers Schöpfers / dardurch rufet Er uns und will uns zu Sich ziehen.“ (19) Damit das so sein kann, ist eine bestimmte Sichtweise erforderlich. Winkelmann nennt das „Geistliche […] Anschauung“ (19). Ohne diese Sichtund Verstehensweise und ohne „heftige[s] Nachsinnen“ und ohne sich mit „dankbarem Herzen [zu] verwundern“ (19), bleiben die Dinge der Welt unverstanden und der Schöpfer hinter der Schöpfung unsichtbar. Um das zu verhindern, schreibt Winkelmann seine Ammergauische Frülingslust als ein augenöffnendes Buch, in dem er die Herrlichkeit Gottes aus der Natur erweist: „(darauf ich in dieser ganzen FrülingsLust mein Absehen gehabt) ins gesamt eine vorstellung der grosen Herrligkeit des grosen GOttes“ (256) zu geben.
7 Das tun auch andere Theologen dieser Zeit, vgl. Barth (Anm. 3), 260: „Besonders die Gestirne in ihrem stets gleichbleibenden Lauf sind ein mächtiger Hinweis auf Gott.“ 8 Auch Johann Gerhard lehrt, dass Gott die Welt nicht nur am Anfang geschaffen hat, sondern sie bis heute erhält und steuert: Porro non solum conservat Deus res creatas, sed etiam easdem gubernat. (Loc. theol. VI, cap. VII., Bd. 2, 27). Zur Vorsehung gehört die fortwährende Sorge Gottes um die Welt, die gubernatio. Johann Gerhard definiert das Verhältnis von providentia und gubernatio so: consistit providentia ἐν διοικήσει, in actuali ac temporali omnium rerum sustentatione ac gubernatione, qua Deus omnia sapienter, libere, potenter ac bene moderatur ac dirigit. (Loc. theol. VI, cap. V, Bd. 2, 26.)
346
Theologie in der Ammergauischen Frülingslust
Gott wirkt in der Natur durch sein Wort Gottes Wirken in der Natur geschieht für Winkelmann nicht einfach durch ein Fortwirken der von Gott am Anfang der Welt ins Leben gerufenen Kräfte, sondern unmittelbar durch Gottes Wort. Gleich zu Beginn der Ammergauischen Frülingslust erinnert er daran, durch welche Kraft der Himmel gestaltet ist: „Die Himlische Lichter / die Sterne / sind durchs Almächtige Wort GOttes an die Feste des Himmels gesetzet“ (11). Damit erweist sich Winkelmann wiederum als ein von lutherischer Theologie durchdrungener Schriftsteller. Auch Johann Gerhard hat deutlich darauf hingewiesen, dass die Naturkräfte nicht unabhängig vom Wort Gottes als der schöpferischen Kraft schlechthin zu denken sind. Die Natur existiert nicht einfach, sondern wird von Gott erhalten und regiert. Das tut Gott durch sein Wort: Zwei Aufgaben hat die göttliche Vorsehung in Bezug auf die (geschaffenen) Dinge: Bewahrung und Führung. Nicht aus sich und durch die eigenen Kräfte haben die geschaffenen Dinge Bestand, sondern Gott trägt alle Dinge durch die Kraft seines Wortes9.
Da die Menschen dies bisweilen aus Gewohnheit übersehen, weist Winkelmann zu Beginn der Frülingslust in der ersten „Tagzeit“ ausdrücklich darauf hin. Weil er die „Tagzeiten“ als Gliederungsprinzip für seine Schrift gebraucht, legt sich für ihn der Hinweis auf Sonne und Mond nahe, die nicht nur als Himmelskörper der Erde Tag und Nacht schenken, sondern zugleich Sinnbilder des Wirkens Gottes sind: Es sind viel und mancherley Wunderwerke GOttes in der Natur / welche der Mensch / weil er sie täglich für Augen siehet / wenig achtet. […] Unser unverdrossener und frühaufstehender Knecht und getreuer Diener / die Sonn / erinnert uns des überverständlichen und Ewigen Lichts / welches ist Christus und sein helleuchtendes Wort (13).
Das Wirken des Mondes wird von Winkelmann unter Anspielung auf Psalm 91,1 interpretiert: „Die stetsfleisige Magd / der Mond […] decket uns mit dem Schatten / gleich einem Bette / zu; Uns lehrend / unter dem Schatten des Höchsten zubleiben und zuwohnen.“ (17)
9 Gerhard: Loc. theol. VI, cap. VI, Bd. 2, S. 27: Duo autem sunt divinae providentiae circa res quasvis munia: Conservatio et gubernatio. Non ex se et suis viribus res creatae subsistent, sed portat Deus omnia verbo virtutis suae.
Theologie in der Ammergauischen Frülingslust
347
Gotteserkenntnis, Selbst- und Welterkenntnis Die theologische Verbindung zwischen dem Schöpferlob in den Naturschilderungen der Ammergauischen Frülingslust und den menschlichen Tugenden, wie sie sich vor allem in der Person Graf Anton Günthers vorbildlich darstellen, ist die Sünden- und Gnadenlehre10. Winkelmann folgt in seiner Schrift der reformatorischen Tradition, die die Schöpfung im einem status naturae purae sieht. Deshalb wird die Natur von Winkelmann als „unschuldig“ beschrieben, sie ist quasi noch im paradiesischen Urzustand. Der Mensch dagegen hat seine ursprüngliche Unschuld verloren, ist durch den Sündenfall verderbt (151). Das zeigt Winkelmann ausführlich am Beispiel der Tugenden der Tiere (120f.) und der Pflanzen (183f.), denen er eine Reihe von Untugenden des Menschen gegenüberstellt (121f.). Dieser Abschnitt gipfelt mit einem Ausspruch seines Lehrers Johann Balthasar Schupp (1610–1661)11, den Winkelmann als Gebet formuliert, in das die „falschen und lasterhaften Menschen“ (123) mit einstimmen sollen: „Domine da mihi, nosse te, nosse me, nosse mundum! HErr lehre mich / daß ich Dich / Mich und die Welt erkenne.“ Dieses Zitat bildet eine Klammer für die verschiedenen theologischen Anliegen, die Winkelmann mit seinem Werk verfolgt. Er will seine Kenntnis der Natur vermitteln, damit verbindet sich für ihn die Gotteserkenntnis. Für die Selbsterkenntnis als drittes Anliegen sorgen die Tugenden, allen voran die pietas oder „Gottseeligkeit“. Mit dem Grafen Anton Günther präsentiert Winkelmann ein Beispiel für tugendhaftes Leben und gibt seinen Lesern zugleich Gelegenheit zur Einsicht in die eigene Unvollkommenheit, die eigenen Schwächen und Sünden. Die Leser sollen also durch die Lektüre der Ammergauischen Frülingslust auf 10 Zur Verbindung von Gnaden- und Schöpfungslehre in der reformatorischen Theologie vgl. Krolzik (wie Anm. 3), S. 64. Es verwundert, dass in der Ammergauischen Frülingslust Jesus Christus nur eine untergeordnete Rolle spielt. Einen expliziten Verweis auf die Rolle Christi im Gnadengeschehen gibt Winkelmann erst auf Seite 254, wo er Christus als den Magnetstein (Kompass) bezeichnet, der für die sichere Überfahrt über das „Welt- Sünden- Angst- Meer“ in den „sicheren Hafen des grundlosen GnadenMeers“ sorgt. Mit dieser einen Metapher kommen dann allerdings gleich zwei der reformatorischen „solus“-Formeln zur Sprache: Das Heil geschieht sola gratia „allein aus Gnade“ und „allein durch Christus“: solus Christus. Dass Jesus Christus für das Heil der Menschen eine zentrale Bedeutung hat, betont Winkelmann in seinen kurz vor der Ammergauischen Frülingslust veröffentlichten Andachtsgemählden über den Evangelisten Matthæum (Oldenburg 1656), Einführung, 17. 11 Winkelmann erwähnt Schupp (Schuppius) in der Ammergauischen Frülingslust namentlich auf Seite 187. Johann Balthasar Schupp war Winkelmanns Lehrer an der Universität Marburg. Er verfasste zahlreiche geistliche Lieder und satirische Schriften. Schupp gilt als strenger Lutheraner und wird wegen seiner Betonung des christlichen Lebens auch als Vorläufer Speners bezeichnet. Vgl. Alexander Vial, Johann Balthasar Schuppius als Vorläufer Speners für unsere Zeit dargestellt, Mainz 1857. Zu Schupps Leben und Schriften vgl. auch Johann Lühmann, Johann Balthasar Schupp. Beiträge zu seiner Würdigung, Marburg 1907; dort auf Seite 86 wird das Zitat Winkelmanns als Schupps „quotidianum votum“ bezeichnet.
348
Theologie in der Ammergauischen Frülingslust
zwei Wegen zur Umkehr geführt werden, durch die Erkenntnis Gottes aus der Natur und durch die Selbsterkenntnis im Spiegel des tugendhaften Grafen.
Die Frülingslust – Lob des Grafen Anton Günther als eines vorbildlichen tugendhaften Herrschers In der Ammergauischen Frülingslust nimmt die Schilderung der Tugenden, vor allem der Tugenden des Grafen Anton Günther, einen breiten Raum ein. Die Verbindung zwischen der Herrschaft des von Gottes Gnaden regierenden Fürsten, den Tugenden und der Theologie bildet die pietas, die Frömmigkeit, oder wie Winkelmann sagt, die „Gottseeligkeit“. Bei Johann Gerhard ist die pietas die zentrale Tugend, sie ist gewissermaßen die „Seele“ aller anderen Tugenden: „Die Gottseligkeit ist das Haupt aller Tugenden – ja vielmehr die Seele aller Tugenden –, ohne sie sind die übrigen Tugenden unbeseelt, wie ein Kadaver“12. Deshalb hält Johann Gerhard an der Bedeutung der Frömmigkeit als zentraler Herrschertugend ausdrücklich gegen Machiavellis Principe fest, in dem dieser behauptet hatte, ein guter Fürst brauche gar keine echte Frömmigkeit, sondern es genüge die äußerliche Zurschaustellung von Frömmigkeit13. Die Sichtweise Johann Gerhards übernimmt Winkelmann bereits mit seiner ersten ausführlichen Beschreibung des gräflichen Einzuges (22–34). Dort geht die Tugend als Personifikation dem Zug voran, dann folgen die Personifikationen der einzelnen Tugenden. Die erste unter ihnen ist die „Gottseeligkeit“ (24, 47–51, 88), sie trägt ein Zepter mit eingravierten Versen, in denen Winkelmann die Gottesfurcht zur Grundlage der fürstlichen Herrschaft erklärt und damit explizit den Gedanken Johann Gerhards folgt: „Die Gottesfurcht erhält mit Ruhm / den Fürsten und sein Fürstenthum.“ (25) Bis in die Wortwahl hinein wird Johann Gerhards oben zitierte Formulierung von Winkelmann in der Rede wiederholt, in der sich die Tugend der „Gottseeligkeit“ selbst vorstellt: Ich bin aller Tugenden Mutter und Säugamme14 / eine Vermehrerinn der Liebe / Hofnung und Geduld; Ohne mich sind alle andere Tugenden nur ein Erbloses Bild / ja für ein faules / stinkendes Aas zuachten (48).
12 Gerhard: Loc. theol XXIV, sect. I, Bd. 6, 330: Pietas est ἀρχὴ τῶν ἀρητῶν, imo virtutum omnium anima, absque qua reliquae virtutes sunt inanime quoddam cadaver. 13 Gerhard: Loc. theol XXIV, sect. I, Bd. 6, 330: Ante omnia igitur requiritur, ut magistratus sit pius ac religiosus, timens Deum non hypocritice et ad externam duntaxat speciem, sed sincere et ex corde. Machiavellus quidem in lib. De princ. C. 18. praeter cetera venenata dogmata etiam hoc instillat principium aninmi, ‚non require in principe veram pietatem, sed sufficere illius quondam umbram et simulationem externam‘. 14 Dieser biblische Begriff wird in Winkelmanns Zeit in den Fürstenspiegeln verwendet. In Jesaja 49,23 heißt es in der Übersetzung Luthers von 1546: „Könige sollen deine Pfleger / und jre
Theologie in der Ammergauischen Frülingslust
349
Die Tugenden sind für Winkelmann wesentliche Kennzeichen der von Gott verliehenen Herrschaft der Fürsten. Wenn die Fürsten tugendhaft sind, wird ihre Herrschaft gewissermaßen von einem himmlischen Glanz umstrahlt. Die Fürstenherrschaft sieht Winkelmann grundsätzlich, in Übereinstimmung mit dem Hauptstrom der lutherischen Theologie, als Ausübung des von Gott gegebenen Auftrages an die „weltliche Obrigkeit“. In der Ammergauischen Frülingslust heißt es programmatisch: So sind jedoch vornemlich diejenige Fürsten warhafte irdische Götter und rechtwürdige Statthalter GOttes hochzuhalten und zuehren / welche gleich den Göttern / so viel sie höher als andere Menschen sind / soviel auch andere Menschen mit ihren Tugenden weit weit übertreffen (36)15.
Winkelmann zeichnet in seiner Schrift das Bild des Grafen Anton Günther als das eines tugendhaften Regenten par excellence. In der Ammergauischen Frülingslust findet sich damit ebenso wie in Winkelmanns Oldenburgischen Friedensund der benachbarten Oerter Kriegshandlungen (Oldenburg 1671) eine Darstellung des Grafen als tugendhaft-frommer Herrscher, so wie Anton Günther von der Mit- und Nachwelt gesehen werden will. Zu den Tugenden des Grafen zählt an erster Stelle die Gottesfurcht, wie auch sein Wahlspruch auxilium meum a domino – „Meine Hilfe kommt vom Herrn“ (Psalm 121,2) verdeutlicht, den Winkelmann bewusst an den Beginn seiner Schilderung setzt (4). Er verwendet ihn noch einmal in der allegorischen Schilderung eines Löwenkampfes (83)16. Dort siegt der die Tugenden verkörpernde Löwe im Kampf gegen die Todsünden, nachdem er einen Blick auf den abgekürzten Wahlspruch „A. M. A. D.“ geworfen Fürsten deine Seugammen sein“. Mit dieser Bibelstelle wird die Verpflichtung der Fürsten zu einem fürsorglichen Regiment ausgesprochen. Das dürfte völlig im Sinne der Herrschaftsausübung und -repräsentation Anton Günthers gewesen sein. In zeitlicher Nähe zu Winkelmann verwendet Philipp Jakob Spener in seiner Schrift Pia Desideria 1675 das Zitat im gleichen Sinne. Eine Verbindung zwischen Winkelmann und Spener ergibt sich durch Johann Georg Dorsche, der für Winkelmann ein Sendschreiben für dessen Andachtsgemählde (Anm. 10) verfasste und 1651–1653 Speners Lehrer an der Universität Straßburg war. Das Bildwort von der Säugamme verwendet Winkelmann in der Ammergauischen Frülingslust bereits auf Seite 3 und dann noch einmal an prominenter Stelle als zentrales Bildmotiv im Frontispiz seiner Oldenburgische Friedens- und der benachbarten Oerter Kriegshandlungen, die er im Auftrag Anton Günthers verfasst und 1671 veröffentlicht hat. Dort ist zwischen den versammelten Tugenden eine weibliche Figur abgebildet, aus deren Brüsten Muttermilch auf eine Karte der Grafschaft Oldenburg spritzt. 15 Den gleichen Gedankengang hat Winkelmann bereits in der Widmung an Graf Anton Günther in seinen Andachtsgemählden (Anm. 10) formuliert, Vorrede, S. V/VI: „Ja freylich sind Könige / Fürsten / Grafen und Herrn gleich den Göttern hochzuehren und werth zuhalten / weil sie in der Wahrheit anders nichts sind als irdische Götter, Statthalter des Allerhöchsten“. 16 Zum dritten Mal erwähnt Winkelmann Anton Günthers Wahlspruch auf Seite 200 zusammen mit dem Wahlspruch seiner Frau Sophia Catharina: spes mea Christus.
350
Theologie in der Ammergauischen Frülingslust
und sich so des göttlichen Beistandes versichert hat. Der daran anschließende Sieges-Choral wird von dem Kehrvers eingerahmt „dan Gottsfurcht- und Beständig seyn, / Besiegt die Welt und nimt den Himmel ein.“ (85 u. ö.). Auch hier steht die Gottesfurcht an der Spitze der Tugenden und wird zusammen mit der Beständigkeit als die zentrale Herrschertugend gepriesen. Im abschließenden „Ehrenlob“ des Grafen heißt es dann „Du liebest GOTT von Herzen / Dein Christenthum ist dir fürwar kein heuchlisch scherzen“ (88).
Gott sei Dank für einen Grafen, der den Frieden sucht Als herausragendes Merkmal der Herrschaft Anton Günthers nennt Winkelmann die umsichtige Politik des Grafen, die sein Land fast vollständig vor dem Schrecken des Dreißigjährigen Krieges bewahrt hat. Die Oldenburger sind Gott zu Dank verpflichtet für die gute Regentschaft Anton Günthers, vor allem für seine „fürtrefliche Klugheit und kluge Vorsichtigkeit“, mit der er das Land durch den „langwührigen und erschreklichen blutigen Krieg des deutschen Landes“ geführt hat (73). Der Dank an Gott dafür wird von Winkelmann stellvertretend für alle „vernünftige[n] Glieder“ des Landes ausgesprochen: Wir sagen dem „Allerhögsten GOtt von ganzer Seelen einhelliglich dafür Lob / Ehr und Dank (74). Zugleich bittet er: daß wir ja ins künftig unter dem Schirm des Höhesten17 und unter dem Christlichen Regiment unsers von GOtt fürgesetzten Hochlöblichen Grafens noch lange Jahr ein geruhiges und stilles Leben führen möchten in aller Gottseligkeit und Erbarkeit (75).
Hier zeigt sich Winkelmann als bibelorientierter Theologe; er nimmt die Aufforderung aus dem 1. Timotheusbrief 18 zum Vorbild und setzt sie auf die oldenburgischen Verhältnisse um.
Die alleinseligmachende Religion Zu den Garanten der gottgemäßen Herrschaft des Grafen Anton Günther gehört vor allem die Ausübung der richtigen Religion, wie es die (personifizierte) Tugend der Gottseligkeit in ihrer Rede formuliert:
17 Psalm 91,1. 18 1. Timotheus 2,1–2 (Luther-Übersetzung von 1546): „So ermane ich nu / das man fur allen Dingen zu erst thue / Bitte / Gebet / Furbit und Dancksagung / fur alle Menschen / fur die Könige und fur alle Obrigkeit / auff das wir ein gerüglich und stilles Leben füren mögen / in aller Gottseligkeit und erbarkeit.“
Theologie in der Ammergauischen Frülingslust
351
Du pflanzest die alleinseligmachende Religion in deinem Land / rein / lauter und unverfälscht fort / bestellest Kirchen und Schulen mit tüchtigen Gelahrten / ehrest und liebest Sie / und schaffest ihnen reichlichen Unterhalt. Das Gesetzbuch oder die H. Schrift ist die einige Richtschnur und Versicherung deines Regiments. Du hörest GOttes Wort andächtig und ofters. Daher wirstu auch hinwieder von GOtt und den Menschen geliebet (50).
Auch in der nachfolgenden Rede des Vertreters des Volkes, der im Namen aller Untertanen spricht, wird die „verkündigung der wahren Christlichen Religion“ allem anderen segensreichen Tun des Grafen vorangestellt (71) und ebenso wird am Schluss der Ammergauischen Frülingslust betont, im Oldenburger Land könne man dank Anton Günther „des Högsten GOttes Wort rein und unverfälscht predigen hören“ (276). Winkelmann erweist sich hierin wiederum als streng konfessioneller Theologe, der dem orthodoxen Luthertum seiner Zeit verpflichtet ist und andere Konfessionen und theologische Strömungen ablehnt. Seine Betonung der tugendhaften Lebensführung und ungeheuchelten Religionsausübung lassen es aber auch zu, Winkelmann bereits in das Umfeld des beginnenden Pietismus zu rücken. Die Frömmigkeitsstile des Grafen Anton Günther und seines Hofhistoriographen hatten also einiges gemeinsam.
Quellen Hans Just Winkelmann, Andachtsgemählde über den Evangelisten Matthæum, Oldenburg 1656. Ders., Ammergauische Frülingslust. Nachdruck der Ausgabe Oldenburg 1656, hg. v. Eckhard Grunewald, Münster 2013. Johann Gerhard, Loci theologici 9 Bde., hg. von Friedrich Frank. Leipzig 1885.
Literatur Hans-Martin Barth, Atheismus und Orthodoxie. Analysen und Modell christlicher Apologetik im 17. Jahrhundert (Forschungen zur systematischen und ökumenischen Theologie 26), Göttingen 1971. Udo Krolzik, Säkularisierung der Natur. Providentia-Dei-Lehre und Naturverständnis der Frühaufklärung, Neukirchen 1988. Johann Lühmann, Johann Balthasar Schupp. Beiträge zu seiner Würdigung, Marburg 1907. Paul Michel, Udo Krolzik, Physikotheologie, in: RGG4 6 (2003), 1328–1330. Ders., Physikotheologie – Ursprünge, Leistung und Niedergang einer Denkform (Neujahrsblatt auf das Jahr 2008 hg. von der gelehrten Gesellschaft in Zürich), Zürich 2008. Alexander Vial, Johann Balthasar Schuppius als Vorläufer Speners für unsere Zeit dargestellt, Mainz 1857.
Die Reformationsjubiläen 1817 und 1917 in der Stadt Oldenburg
Einleitung Jubiläumsfeiern sind nichts Harmloses. Weder im staatlichen, noch im kirchlichen Bereich. Sie sind Kristallisationspunkte des Selbstverständnisses der Feiernden und dienen dazu, das zum Zeitpunkt des Jubiläums gültige Selbstbild dem kollektiven Gedächtnis der Gesellschaft einzuprägen1. Die Reformationsjubiläen 1817 und 1917 in Oldenburg sind Feiern, die viel über das Selbstverständnis des (Groß-) Herzogtums und seiner evangelisch-lutherischen Kirche aussagen2. Im Rahmen dieser Veröffentlichung ist keine erschöpfende Beschreibung der beiden Jubiläen und der dazwischen liegenden Entwicklung möglich. Die Darstellung konzentriert sich vor allem auf einzelne Aspekte des Jubiläums von 1917, weil darüber – im Gegensatz zu 1817 – bisher noch keine Veröffentlichungen vorliegen3. Der Vergleich der beiden Reformationsjubiläen zeigt den Wandel der sich in Kirche, Staat und Gesellschaft vom frühen 19. bis um frühen 20. Jahrhundert vollzogen 1 Emil Brix / Hannes Steckl (Hg.), Der Kampf um das Gedächtnis. Öffentliche Gedenktage in Mitteleuropa, Wien 1997, 11: Gedenktage sind „bis in die Gegenwart wichtige Austragungsorte im Kampf um die Inhalte des kollektiven Gedächtnisses“. Am Beispiel Bayerns hat das für die kirchlichen Jubiläen aufgearbeitet Stefan Laube, Fest, Religion und Erinnerung. Konfessionelles Gedächtnis in Bayern von 1804 bis 1917 (Schriftenreihe zur bayerischen Landesgeschichte 118), München 1999. 2 Zu den deutschen Reformationspredigten von 1817 insgesamt vgl. Wichmann von Meding, Kirchenverbesserung. Die deutschen Reformationspredigten des Jahres 1817 (Unio et Confessio 11), Bielefeld 1986. 3 Die Feier des Reformationsjubiläums von 1817 in Oldenburg lohnte tiefergehende Analysen als sie hier geleistet werden können, zumal eine Reihe an Materialien dafür vorliegt: Die dritte Jubelfeyer der Reformation im J. 1817. d. 31. October im Herzogthum Oldenburg und der Herrschaft Jever, Oldenburg o. J.; Heinrich Iben, Wie unsere Väter die Reformation gefeiert haben. Ein Rückblick zur 400jährigen Gedächtnisfeier der Reformation im Herzogtum Oldenburg am 31. Oktober 1917, Oldenburg 1917 und Wolfgang Erich Müller (Hg.), Kirchenverbesserung in Oldenburg. Dokumente zum Reformationsjubiläum 1817 (Studien zur Kirchengeschichte Niedersachsens 28), Göttingen 1988. Zur Bewertung des Reformationsjubiläums 1817 s. Oldenburgische Kirchengeschichte, hrsg. von Rolf Schäfer in Gemeinschaft mit Joachim Kuropka / Reinhard Rittner/Heinrich Schmidt, 2. Aufl. Oldenburg 2003, 394–395.
354
Die Reformationsjubiläen 1817 und 1917 in der Stadt Oldenburg
hat. Der obrigkeitliche Staat und die aufklärerische Theologie dominieren das Jubiläum von 1817, während eine selbständiger gewordene Kirche und ein deutlicher Nationalismus das Jubiläum von 1917 auch in Oldenburg bestimmen.
Oldenburg 1817 Die Darstellung des Reformationsjubiläums 18174 beschränkt sich hier auf die Anordnung zur Durchführung des Festes und die zwei prominentesten Oldenburger Predigten, die des Generalsuperintendenten Anton Georg Hollmann und des Haupt-Pastors an der Hauptkirche St. Lamberti Georg Arnold Flor5. Diese beiden Predigten bedienen sich, wie die meisten im Oldenburger Land gehaltenen Festpredigten, einer in der Aufklärungszeit beliebten Lichtmetaphorik und einer Rhetorik der „Wiederherstellung“. Luther erscheint in diesen Predigten als ein Vorkämpfer für die Freiheit des Glaubens und für das Licht Gottes, das im „finsteren“ Mittelalter durch orthodoxe oder katholische Zutaten verdunkelt worden war. Luther stellt in der Perspektive der aufklärerischen Theologen die ursprüngliche Religion Jesu wieder her, die jetzt in der evangelischen Kirche praktiziert wird, aber noch nicht vollendet ist6.
4 Zu den Feiern der Reformationsjubiläen im 19. Jahrhundert insgesamt s. Dorothea Wendebourg, Die Reformationsjubiläen des 19. Jahrhunderts, in: ZThK 108 (2011), 270–335, für die vorausgehenden Jubiläen s. Thomas Kaufmann, Reformationsgedenken in der frühen Neuzeit. Bemerkungen zum 16. bis 18. Jahrhundert, in: ZThK 107 (2010), 285–324. 5 Das sind nur zwar nur zwei der insgesamt 59 noch erhaltenen Predigten aus dem Oldenburger Land, sie spiegeln aber den Charakter und die theologischen Schwerpunkte des Oldenburger Festes wider, zudem sind sie beide im Druck erschienen und haben so die größte Verbreitung erfahren; s. Wolfgang Erich Müller, Kirchenverbesserung in Oldenburg. Dokumente zum Reformationsjubiläum 1817 (Studien zur Kirchengeschichte Niedersachsen 28), Göttingen 1988, 7–10. Müller beschreibt dort seinen Fund der handschriftlich erhaltenen Predigten, die er leider nur zum Teil ediert hat. 6 Müller, Kirchenverbesserung (Anm. 3), 21 beschreibt das so: „Dieses Wiederherstellungsschema der reinen Religion Jesu von den unsachgemäßen orthodoxen und katholischen Erweiterungen durch den im göttlichen Auftrage wirkenden Luther mit einer Besinnung zur Verpflichtung der Gegenwärtigen durchzieht alle Predigten zum Reformationsjubiläum“. Von Meding sieht in dieser Metapher den Schlüsselbegriff für die Haltung der evangelischen Kirchen im Reformationsjubiläum 1817, von Meding, Kirchenverbesserung (Anm. 2), 151: „Das zahlenmäßig dominierende Reformationsverständnis war […] ‚die Wiederherstellung der Kirche‘ und […] ‚Kirchenreinigung‘“; von Meding (Anm. 2), 153: So aussagekräftig dieser Reformationsbegriff ist – schlechthin typisch ist für 1817 doch ein anderer, mit Abstand meistverwendeter. Es ist der geprägte Begriff der „Kirchenverbesserung“. „Wiederherstellung“, „Kirchenreinigung“ und „Kirchenverbesserung“ teilen als Leitbegriffe miteinander das Verständnis der Reformation als eines auf die Kirche bezogenen Vorgangs, der Auswirkungen auf die unmittelbare Gegenwart hat. Diesem Gedanken folgen auch die Oldenburger Predigten.
Die Reformationsjubiläen 1817 und 1917 in der Stadt Oldenburg
355
Die Anordnung für das Reformationsjubiläum 1817 Die Feier des Reformationsjubiläums erfolgte 1817 in Oldenburg auf herzogliche Anordnung hin7. Das Konsistorium verordnete am 17. September 1817 „mit Sr. Herzoglichen Durchlaucht höchster Genehmigung“, dass das Fest „wie andere große Festtage gefeiert“, dass es zwei Wochen vorher von allen Kanzeln angekündigt und dass es am Vorabend eingeläutet werden soll. Dabei soll am Vorabend und am Festtag „alles Gewerbe“ eingestellt und „keine öffentlichen Lustbarkeiten erlaubt“ sein, Schülerinnen und Schüler sollen auf das Fest vorbereitet werden, Kirchenmusik und Ausschmückung des Festes sollen je nach Vermögen der Gemeinde erfolgen8. Die Anordnung des Festes verweist auf den ökumenischen Kontext des Festes: „Die Jubelfeier erinnert zwar an eine Trennung von einer andern christlichen Gemeinschaft, kann und soll aber allen Verstoß gegen das Gebot ‚vertragt einander in der Liebe‘ vermeiden“9. Dieser Aufforderung zur Toleranz gegenüber anderen Konfessionen schließen sich die Reformationsfestpredigten allesamt an. Das passt zu der in Oldenburg zu dieser Zeit vorherrschenden aufklärerischen (neologischen) Theologie, wie sie exemplarisch in der Predigt Hollmanns zu Gehör kommen wird. Das Reformationsjubiläum 1817 steht in Oldenburg aber auch in einem aktuellen zeitgeschichtlich-politischen Kontext. Sowohl das nur wenige Jahre zurückliegende Ende der französischen Herrschaft und der damit verbundene Wiederantritt der Herrschaft des Oldenburger Herzogs Peter Friedrich Ludwig am 27. November 1813, wie auch das nur wenige Tage zurückliegende Eisenacher Wartburgfest am 18. Oktober 1817 finden Erwähnung in den beiden Oldenburger Reformationspredigten10.
7 Anordnung des hundertjährigen Dankfestes der Reformation, wieder abgedruckt in: Müller, Kirchenverbesserung (Anm. 3), 29–30. 8 Die Berichte über die Feiern samt der Beschreibung der einzelnen Ausschmückungen und der aufgeführten Kirchenmusik in den einzelnen Oldenburgischen Gemeinden liegen vor in: Oldenburgische Blätter Nr. 18, 273–288; Nr. 20, Sp. 305–320; Nr. 22 337–352; Nr. 24, Sp. 369–384; Nr. 20, Sp. 399–406 und in dem ergänzten Separatdruck: Die dritte Jubelfeyer der Reformation im J. 1817, d. 31. October im Herzogthum und der Erbherrschaft Jever, Oldenburg o. J. 9 Anordnung des hundertjährigen Dankfestes der Reformation, wieder abgedruckt in: Müller, Kirchenverbesserung (Anm. 3), 30. 10 Georg Arnold Flor, Reformationspredigt, zitiert nach Müller, Kirchenverbesserung (Anm. 3), 49: „Vor einigen Tagen feierten wir das Fest unserer bürgerlichen Freiheit“.
356
Die Reformationsjubiläen 1817 und 1917 in der Stadt Oldenburg
Georg Anton Hollmann, Predigt am dritten hundertjährigen Feste der Reformation Der Oldenburger Generalsuperintendent legte seiner Predigt den aufklärerischen Gedanken der Perfektibilität zu Grunde; zum fortschreitenden Erkennen der Wahrheit gehörte für ihn als entscheidender Schritt die Reformation11, denn: in der Reformation ist die Anlage zum Fortschreiten und fortgehenden Wachstum in Erkenntnis der Wahrheit, die uns im edelsten Sinn frei machen soll, so wie das Christentum überhaupt ein beständiges Streben nach Vollendung fordert12.
Hinderlich für das Streben nach Erkenntnis der Wahrheit war, nach dem Verständnis der aufgeklärten Theologie, der Zwang in Glaubensdingen. Dieser Glaubenszwang wurde als „Macht der Finsternis“ gekennzeichnet, vor dessen Hintergrund sich die befreiende Tat der Reformation ebenso leuchtend abhebt wie die alliierten Siege über Napoleon. Die französische Herrschaft wurde in Oldenburg als besonders bedrückend erlebt wurde, weil der Herzog ins Exil gehen musste und das Oldenburger Land seine territoriale Integrität verlor, es wurde in das „Département des Bouches du Weser“ eingegliedert, und wurde so ein direkter Teil Frankreichs13. Hollmann kann auf eigene leidvolle Erfahrungen zurückblicken14 und an ebensolche seiner Hörerinnen und Hörer appellieren, wenn er rhetorisch fragt: Wie würde uns sein, wenn wir, wie ehemals die Christen, gezwungen wären, einem ausländischen Kirchenfürsten blindlings zu gehorchen […] Erst vor wenigen Jahren ist uns auf Leipzigs Gefilden und bei Schönbund [i. e. Belle-Alliance / Waterloo, R.H.] die Befreiung von einer andern, immer drückender gewordenen Zwingherrschaft so blutig errungen! Und für die Erlösung vom Glaubenszwang, deren wir uns heute freuen – wie
11 Rainer Fuhrmann, Das Reformationsjubiläum 1817. Martin Luther und die Reformation im Urteil der protestantischen Festtagspredigt des Jahres 1817, Diss. Masch. Tübingen 1973, 49: „Dieses fortschrittsgläubige Geschichtsbild findet sich in vielen Predigten zum Reformationsjubiläum als Ausgangspunkt und Grundlage der Betrachtungen“ und 48: „Man war der Ansicht, daß Luther lediglich das Verdienst gebühre, mit der Reformation einen ersten Anstoß zu einem Prozeß gegeben zu haben, der sich in der Geschichte ständig weiterentwickelt“. 12 Georg Anton Hollmann, Predigt am dritten hundertjährigen Feste der Reformation, zitiert nach Müller, Kirchenverbesserung (Anm. 3), 44. 13 Albrecht Eckhardt / Heinrich Schmidt (Hg.), Geschichte des Landes Oldenburg, Oldenburg 1987, 286–293 und Helmut Stubbe-da Luz, „Franzosenzeit“ in Norddeutschland (1803–1814). Napoleons Hanseatische Departements, Bremen 2003. 14 Generalsuperintendent Hollmann wurde selbst von den Franzosen in Bremen als Geisel genommen, später wieder zur Ausübung seines Amtes nach Oldenburg entlassen, wurde aber weiter auf der Liste der Geiseln geführt und stand dort unter spezieller Aufsicht des Unterpräfekten, s. Schäfer, Oldenburgische Kirchengeschichte (Anm. 3), 391–393.
Die Reformationsjubiläen 1817 und 1917 in der Stadt Oldenburg
357
schwer, wie lange hat dafür gekämpft werden müssen. Wie lebendig muss es aus unserm Inneren sprechen: gelobt sei Gott, der uns errettet hat von der Macht der Finsternis!15
Dennoch gerät Hollmann nicht in eine konfessionelle Polemik, er predigt, wie in der Anordnung für das Reformationsfest empfohlen, die Liebe zu den Angehörigen anderer Konfessionen, obwohl er eine Kircheneinheit nicht für möglich und auch nicht für nötig hält: Wenn gleich ein Verein zur äußern Kirchengemeinschaft nicht als möglich, auch nicht als nötig erscheint […] Vertragt euch in der Liebe, das ist das heilige Gebot, dessen Beobachtung durch keine Verschiedenheit beschränkt werden darf, und befasst es nicht alle, die mit uns Kinder eines Vaters, Erlöste eines Herrn, Glieder eines Leibes, an welchem Christus das Haupt ist, Tempel eines Geistes, Erben einer himmlischen Seligkeit sein sollen?16
Die aufgeklärte Theologie Hollmanns erkennt also keinen qualitativen Unterschied zwischen den Christinnen und Christen durch die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Konfession. Der „Tempel“ von dem er spricht, ist für ihn „die Gesamtheit der Christen“, alle „die durch Jesum gläubig an Gott geworden, machen das Gebäude, den Tempel Gottes aus“17.
Georg Arnold Flor, Reformationspredigt Georg Arnold Flor, der Haupt-Pastor der Oldenburger Lambertikirche, predigt am Sonntag, dem 2. November 1817 ebenfalls zum Reformationsjubiläum. Flor schärft seinen Hörern ein, dass die Reformation sie dazu verpflichte „Liebe [zu] üben gegen jedermann“ (1. Thess 3,12). Unter „jedermann“ versteht Flor nicht nur die Angehörigen der eigenen Konfession oder Religion, sondern ausdrücklich auch Nichtchristen: „Betrachtet in jedem Menschen euren Bruder, er stehe auf der bürgerlichen Stufe über oder unter euch“. Flor glaubt aber nicht, dass die anderen Christen ebenso handeln, er grenzt sich polemisch von Positionen ab, die er der mittelalterlichen Kirche unterstellt und ruft seine Gemeinde auf: „Fliehet den unchristlichen Sektengeist, der sich früherhin durch Menschenhass, durch blutige Kriege, und durch flammende Scheiterhaufen kund machte“.
15 Georg Anton Hollmann, Predigt am dritten hundertjährigen Feste der Reformation, zitiert nach Müller, Kirchenverbesserung (Anm. 3), 43. 16 Georg Anton Hollmann, Predigt am dritten hundertjährigen Feste der Reformation, zitiert nach Müller, Kirchenverbesserung (Anm. 3), 45. 17 Georg Anton Hollmann, Predigt am dritten hundertjährigen Feste der Reformation, zitiert nach Müller, Kirchenverbesserung (Anm. 3), 39.
358
Die Reformationsjubiläen 1817 und 1917 in der Stadt Oldenburg
Typisch für die neologische Theologie ist die Betonung der entscheidenden Rolle der Tugend für das christliche Leben, deshalb predigt Flor: Als evangelische Christen habt ihr die höchste Verpflichtung, euch durch Tugenden, die nur allein den Weg zur Vollkommenheit, und dadurch zur Glückseligkeit bahnen, auszuzeichnen, denn ihr hofft nicht träge auf fremdes Verdienst, sondern wisst es, dass nur eigner, selbsterrungener Wert vor Gott, unserm Richter, würdig macht18
Vor lauter Eifer, seine Gemeinde auf den Weg der Tugend zu weisen, schießt Flor hier über das Ziel hinaus. Es unterläuft ihm eine Verdrehung von reformatorischen Grundeinsichten. Das Vertrauen auf die Rechtfertigung als opus alienum beschreibt er diffamierend als eine katholische Position (sie hoffen „träge auf fremdes Verdienst“), während er den evangelischen Weg als einen Weg des selbst errungenen Wertes vor Gott beschreibt, der Menschen auch ohne Gottes Gnadenhandeln würdig zu machen vermag19.
Resümee zum Reformationsjubiläum 1817 in Oldenburg Das Reformationsjubiläum 1817 in Oldenburg ist eine Feier, die das herzogliche Konsistorium strukturiert, das landesweit gefeiert und dokumentiert wird. Politisch ist es geprägt von der Freude über den Sieg über Napoleon und von der Freude über die wieder erlangte Eigenständigkeit Oldenburgs. Theologisch geprägt ist das Reformationsfest von der Neologie, die in Oldenburg derzeit weithin vorherrschend war. Durch diese theologische Ausrichtung ergibt sich ein erstaunlich weiter Blick auf die anderen Konfessionen und Religionen, und ein relativ gelassener Umgang mit der katholischen Kirche. Die konfessionelle Toleranz, die sich im Oldenburgischen auch im weiteren Verlauf des 19. Jahrhunderts ausbreitete, hat durch das Reformationsjubiläum keinen Schaden, eher noch einen weiteren Schub erfahren20.
18 Alle Zitate aus: Georg Arnold Flor, Reformationspredigt, zitiert nach Müller, Kirchenverbesserung (Anm. 3), 56–57. 19 Auf ähnliche Verdrehungen reformatorischer Theologie in den Reformationsfestpredigten von 1817 macht von Meding, Kirchenverbesserung (Anm. 2) mehrfach aufmerksam, z. B. 161–163. 20 Vgl. dazu die bei Müller, Kirchenverbesserung (Anm. 3), zitierten Auslassungen Hollmanns aus seinem Schriftsatz vom 28. 04.1817, in dem er sich über den Umgang mit den katholischen und reformierten Christen äußert (Müller 13–14) und die Predigt von Kaplan Achgelis in Vechta am Reformationstag 1817. In Vechta musste Achgelis sich als evangelischer Prediger in einem katholischen Umfeld artikulieren, tat das ohne scharfe Polemik und wurde durch das Mitfeiern der mehrheitlich katholischen Stadtbevölkerung belohnt (Müller 97–105).
Die Reformationsjubiläen 1817 und 1917 in der Stadt Oldenburg
359
Entwicklungen von 1817 bis 1917 Ohne Berücksichtigung der Entwicklungen zwischen 1817 und 1917 können die beiden Säkularfeiern der Reformation auch in dem kleinen Oldenburger Land nicht verglichen werden. Das 19. Jahrhundert mit seinen rasanten wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen hat auch in der evangelisch-lutherischen Kirche in Oldenburg seinen Widerhall gefunden. Die Oldenburger Kirchenordnung steht in direktem Zusammenhang mit der Revolution von 1848. Das Verhältnis zum Großherzog als Kirchenherrn hat sich dadurch deutlich verändert. Die aufklärerische Theologie hat ihr Deutungsmonopol aus dem Beginn des 19. Jahrhunderts im Laufe der Zeit verloren. In der Folge haben die innerevangelischen Auseinandersetzungen zwischen liberalen und neulutherischen Theologen in Oldenburg ihre Spuren hinterlassen, obwohl in Oldenburg durchweg eine tolerante und im wahren Sinne liberale Stimmung in der Kirche vorherrscht.21 Die Erweckungsbewegung spielt in der Oldenburger Kirche hingegen nur eine untergeordnete Rolle22, aber es gibt eine verstärkte Aktivität verschiedener kirchlicher Vereine und Bestrebungen zur Belebung des Gemeindelebens23. Dem Militarismus des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts kann sich das Oldenburger Land nicht entziehen. Die Kriegsbegeisterung ist hier 1914 genauso stark wie in anderen Teilen des Reiches. Deshalb wird am 5. August 1914 in der Oldenburger Lambertikirche auch ein außerordentlicher Bußtagsgottesdienst anlässlich des begonnen Ersten Weltkriegs gefeiert, bei dem Pastor Wilhelm Wilkens, einer der Reformationstagsprediger von 1917, über „Wenn Gott für uns ist, wer mag wider uns sein?“ (Röm 8,31) predigt24.
21 Vgl. Schäfer, Oldenburgische Kirchengeschichte (Anm. 3), 443–472 und Dietmar von Reeken, Kirchen im Umbruch zur Moderne. Milieubildungsprozesse im nordwestdeutschen Protestantismus 1849–1914 (Religiöse Kulturen der Moderne 9), Gütersloh 1999, 219. Von Reeken verweist darauf, dass in Oldenburg der Graben zwischen „liberalen“ und „positiven“ in der evangelischen Kirche nicht so tief war wie anderswo: „Von einer Trennung in zwei Religionen oder von Ekelschranken konnte in Oldenburg keineswegs die Rede sein“. Vgl. dazu auch Dietmar von Reeken, Protestantisches Milieu und „liberale Landeskirche“? Milieubildungsprozesse in Oldenburg 1849–1914, in: Olaf Blaschke/Frank-Michael Kuhlemann (Hg.), Religion im Kaiserreich. Milieus-Mentalitäten-Krisen (Religiöse Kulturen der Moderne 2), Gütersloh 1996, 290–315. 22 Vgl. Rolf Schäfer, Kirchen und Schulen im Landesteil Oldenburg im 19. und 20. Jahrhundert, in: Albrecht Eckhardt/Heinrich Schmidt (Hg.), Geschichte des Landes Oldenburg, Oldenburg 1987, 791–841. 23 Vgl. von Reeken, Kirchen im Umbruch (Anm. 21), 70–126. 24 Vgl. Schäfer, Oldenburgische Kirchengeschichte (Anm. 3), 643.
360
Die Reformationsjubiläen 1817 und 1917 in der Stadt Oldenburg
Die Oldenburger Kirchenordnung Die Oldenburger Kirchenordnung von 1849 und 1853 verschafft der evangelischlutherischen Landeskirche weitgehende Unabhängigkeit vom Landes- und Kirchenherren25. Im Kirchenverfassungsgesetz von 1849 kamen das Gemeindeprinzip und die Verselbständigung der Kirche vom Staat zur vollen Entfaltung, und an der grundsätzlichen presbyterial-synodalen Ordnung änderte sich auch durch die Revision von 1853 nur wenig. Die Gemeinden erhielten mit Gemeindeversammlung, Kirchenrat und Kirchenausschuss eigene Organe, das Pfarrerwahlrecht und das Recht zur weitgehenden Selbstverwaltung vor allem in Vermögensangelegenheiten […] Damit waren die Kirchengemeinden als selbständige und arbeitsfähige Körperschaften konstituiert und gleichzeitig von den Bürgergemeinen separiert26.
Das wachsende Bewusstsein für das eigene Wesen der Kirchengemeinden wird sich 1917 im ersten Oldenburger Gemeindetag darstellen, der unmittelbar vor dem Reformationsfest am 10. Oktober 1917 prominent begangen wird.
Lutherverehrung in Oldenburg am Ende des 19. Jahrhunderts Am Ende des 19. Jahrhunderts steigerte sich die Luther-Verehrung auch in Oldenburg. Als Beispiel möchte ich ein von den üblichen Jubiläumsjahren unabhängiges Geschehen anführen. 1876 wurde im Zuge des Anbaus eines Turmes an die zuvor turmlose klassizistische Lambertikirche in Oldenburg die Aufstellung einer monumentalen Figur in einer Turmnische diskutiert. Zur Diskussion stand die Frage, ob eine Christus- oder Lutherfigur für diese prominente Stelle gewählt werden solle. Der Bau des Turmes erfolgte seit 1873 mit den Mitteln einer bürgerlichen Stiftung und nicht wie in den Jahrhunderten zuvor auf Grund einer herrschaftlichen Bau-Initiative. Die Entscheidung für eine Lutherfigur wurde im Kirchenrat sogar gegen eine Stellungnahme des Großherzogs Nikolaus Friedrich Peter gefällt. Der Großherzog sprach sich deutlich gegen eine Statue Luthers aus, da dieses mit dem „Sinn des großen Reformators“ nicht vereinbar sei. Der Kirchenrat entschied sich dennoch für ein Lutherbildnis und vergab den Auftrag an den Oldenburger Bildhauer Bernhard Högl. Direktes Vorbild der Oldenburger 25 Von Reeken, Kirchen im Umbruch (Anm. 21), 31: „Auch nach der Revision von 1853 stand die oldenburgische Kirchenverfassung in der liberalen Tradition. Kaum irgendwo in Deutschland war eine Landeskirche zu diesem Zeitpunkt so frei und selbständig wie in Oldenburg.“ Vgl. dazu Rolf Schäfer, Das oldenburgische Kirchenverfassungsgesetz von 1849 und seine Revision 1853, in: 150 Jahre oldenburgische Kirchenverfassung, im Auftr. d. Oberkirchenrates in Verb. mit Günter Raschen hg. von Rolf Schäfer, Oldenburg 1999, 5–20. 26 Vgl. von Reeken, Kirchen im Umbruch (Anm. 21), 44.
Die Reformationsjubiläen 1817 und 1917 in der Stadt Oldenburg
361
Statue ist das von Ernst Rietschel entworfene Lutherdenkmal in Worms (1868). Dieser Vorgang bezeugt den deutlich gewachsenen Einfluss des Oldenburger Bürgertums gegenüber seinem Landesherrn und das gewachsene Selbstbewusstsein der Kirchengemeinde Oldenburg gegenüber ihrem Kirchenherrn. Zugleich zeigt sich, dass die Lutherverehrung ebenso wie die Bautätigkeit an der Oldenburger Hauptkirche eine bürgerliche Angelegenheit geworden ist. Diese Verschiebung zu Gunsten des Bürgertums und der Eigenständigkeit der Oldenburger Kirche bestimmt auch die Feier des Reformationsjubiläums 1917. Mit der Aufstellung der Luther- anstelle einer Christus-Figur an der Oldenburger Hauptkirche wird zugleich eine deutliche Betonung des konfessionell-lutherischen Elements durch die bürgerlichen und kirchlichen Kräfte deutlich.
Das Reformationsjubiläum 1917 in Oldenburg27 Bereits in der der Anordnung für das Fest unterscheiden sich die Jubiläen von 1817 und 1917 voneinander. Ordnete 1817 noch das Konsistorium „mit Sr. Herzoglichen Durchlaucht höchster Genehmigung“ das Fest an, beruft man sich 1917 auf das Schreiben des evangelischen Kirchenausschusses vom 1. Januar 191728 und der Oberkirchenrat ordnet mit Schreiben vom 24. März 1917 die weitere Vorbereitung und Durchführung der Feier in den Gemeinden an. Einen allgemeinen Feiertag anzuordnen lag nicht mehr im Machtbereich des Oberkirchenrates. Die Entwicklung vom Repräsentationsfest der deutschen lutherischen Fürsten hin zu einem bürgerlichen „deutsch-nationalen“ und dezidiert konfessionellen Fest ist auch in Oldenburg vollzogen worden29. Gestaltende Kraft des Reformationsjubiläums im Herzogtum Oldenburg ist ein Theologe aus der oldenburgischen Kirchenleitung: Heinrich Iben (1864–1947), seit 1910 zweites geistliches Mitglied des Oberkirchenrates30. 27 Zum Reformationsjubiläum 1917 in Oldenburg vgl. Schäfer, Oldenburgische Kirchengeschichte (Anm. 3), 646–649. Dort auch die Erwähnung des Vortrages von Friedrich Gogarten in der Kirchengemeinde Bant auf den hier nicht eingegangen wird. 28 Reformations-Ansprache an das deutsche evangelische Volk beim bevorstehenden Jahreswechsel, in: Allgemeines Kirchenblatt für das evangelische Deutschland 26 (1917), 1–2. 29 Vgl. dazu Johannes Burkhardt, Reformations- und Lutherfeiern. Die Verbürgerlichung der reformatorischen Jubiläumskultur, in: Dieter Düding / Peter Friedmann / Paul Münch (Hg.), Öffentliche Festkultur. Politische Feste in Deutschland von der Aufklärung bis zum ersten Weltkrieg, Reinbek b. Hamburg 1988, 212–236. 30 Es gab andere Männer in der Kirchenleitung, die Interesse an der Gestaltung des Reformationsjubiläums gehabt hätten, aber aus bestimmten Gründen nicht zum Zuge kamen. Der als Kirchenhistoriker ausgewiesene Dr. Heinrich Tilemann, wurde zwar schon am 20. Dezember 1916 zum ersten geistlichen Mitglied des Oberkirchenrats berufen, er trat sein Amt allerdings erst am 1. Mai 1917 an. Damit konnte er für die Vorbereitung des Reformationsjubiläums keine große Rolle mehr spielen und das obwohl er sich wissenschaftlich mit der Reforma-
362
Die Reformationsjubiläen 1817 und 1917 in der Stadt Oldenburg
Heinrich Iben stammt aus der oldenburgischen Kirche, kennt die Verhältnisse in der Region gut und ist in der Pfarrerschaft sowohl bei den konservativen wie den liberalen Theologen akzeptiert31. Er verfasst am 27. Januar 1917 für den Oberkirchenrat eine mehrseitige Programmschrift „Gedanken und Vorschläge zur Gedächtnisfeier der Reformation“32, mit der er die Weichen für die Gestaltung des Reformationsjubiläums in Oldenburg stellt. Bereits auf der ersten Seite dringt er darauf, dass es ein Reformations- und kein Lutherjubiläum sein soll: „Die Feier soll nicht Luther allein verherrlichen“. Das Jubiläum soll auch nicht der konfessionellen Polemik dienen: „Alle zeitgeschichtliche Polemik, die zu unnötigen Verletzungen führt, sollte zu Gunsten der aufbauenden Evangeliumskräfte zurücktreten“33. Iben beschreibt in seiner Programmschrift „den Stoff“, also die Themen, die er den Gemeinden für das Reformationsjubiläum an die Hand geben will (inklusive Literaturangaben) und er plant längere Vortrags- und Predigtreihen um der Fülle des Stoffs gerecht werden zu können. Iben bezeichnet am Schluss die Wiedereinführung des Reformationsfestes als gesetzlichen Feiertages als eine der wesentlichen Aufgaben für die Oldenburgische Kirche34. Ebenso möchte er gerne zum Reformationsfest ein neues Gesangbuch einführen. Diese beiden Pläne lassen sich allerdings nicht rechtzeitig verwirklichen35.
31 32 33 34
35
tionszeit beschäftigt hatte. Ebenso wenig griff der Präsident des Oberkirchenrats in die Vorbereitungen ein. Denn Präsident des Oldenburger Oberkirchenrats war traditionell ein Jurist. Von 1904 bis 1920 bekleidete der spätere Oldenburger Ministerpräsident Eugen von Finckh dieses Amt. Die theologische Arbeit überließ von Finckh den Theologen im Oberkirchenrat. Da D. Theodor Hansen als erstes theologisches Mitglied des Oberkirchenrates am 1. Mai 1917 in den Ruhstand trat, ergab es sich, dass Heinrich Iben die Vorbereitung des Reformationsfestes übernehmen musste. Vgl. Heinrich Höpken, Heinrich Iben, in: Biographisches Handbuch zur Geschichte des Landes Oldenburg, Oldenburg 1992, 342–343. Heinrich Iben, Gedanken und Vorschläge zur Gedächtnisfeier der Reformation, Manuskript im Niedersächsischen Landesarchiv Standort Oldenburg (NLAO) 250 A XI 25 I. Heinrich Iben, a. a. O. (Anm. 32). Der Reformationstag war seit 1854 in Oldenburg als Feiertag gesetzlich verankert, wurde aber 1908 vom Oldenburger Landtag bei einer Neufassung des Feiertagsgesetzes abgeschafft und trotz großer Proteste der Oldenburger Protestanten nicht wieder als staatlicher Feiertag eingeführt. 1912 hatte es, vom Evangelischen Bund organisiert, eine Sammlung von immerhin 30.000 Unterschriften für die Wiedereinführung des Reformationstages als gesetzlichen Feiertages gegeben, die aber nicht zum Erfolg führte. Die weiteren Auseinandersetzungen um das Reformationsfest in Oldenburg beschreibt Dietmar von Reeken, Kirchen im Umbruch (Anm. 21), 324–328. Nur die Kirchengemeinde Oldenburg gab einen eigenen Anhang zum Gesangbuch heraus, in dem reformatorische Lieder abgedruckt werden, die im damaligen Gesangbuch fehlten, Schäfer, Oldenburgische Kirchengeschichte (Anm. 3), 648.
Die Reformationsjubiläen 1817 und 1917 in der Stadt Oldenburg
363
Das „Ausschreiben“ des Oberkirchenrats zur Gestaltung der Feiern im Oldenburger Land Die von Heinrich Iben im Januar formulierten Gedanken bilden das Grundgerüst für das von ihm verfasste und von Präsidenten des Oberkirchenrates, dem Juristen Eugen von Finckh unterschriebene „Ausschreiben“ an die oldenburgischen Gemeinden vom 24. März 191736. Einleitend fordert darin der Oberkirchenrat die Gemeinden auf: „auf eine eindrucksvolle und erhebende Feier des 31. Oktober Bedacht zu nehmen und sie im kirchlichen und gottesdienstlichen Leben der Gemeinden würdig und nachdrücklich vorzubereiten“. In dem „Ausschreiben“ werden dann eine besondere Gottesdienstordnung für den 31. Oktober und eine Festschrift angekündigt. Die Gemeindekirchenräte werden darauf hingewiesen, dass sie für eine Information ihrer Gemeinden über die Geschichte der Reformation inklusive der lokalen Ereignisse sorgen sollen, dafür aber nicht den regulären Gottesdienst nutzen sollen, sondern „Nebengottesdienste, Gemeindeabende, Familienabende, Vortragsreihen mit Lichtbildern und Ähnliches“. Sicherlich sind vor allem die Pastoren angesprochen, wenn Iben schreibt: „Daß […] ein eindringendes Studium der Persönlichkeit Luthers und seines Werkes nötig ist, versteht sich von selbst“. Das Ausschreiben erwähnt weiter die Kinderlehre als Arbeitsfeld zur Behandlung der Reformationsgeschichte. Die Kreissynoden der Oldenburgischen Kirche werden vom Oberkirchenrat die Frage nach einer angemessenen Gestaltung des Reformationsjubiläums gestellt bekommen. Für die Kirchenmusik wird dem Ausschreiben die Broschüre „1917 und der deutsche evangelische Kirchengesang“37 beigelegt, die für Musik und Liturgie Verantwortlichen sollen daraus Anregungen für die Gestaltung der Gottesdienste entnehmen. Die Gemeinden sollen die Möglichkeiten der Publizistik nutzen: Gemeindebriefe, Flugblätter und Tagespresse. Um das Fest nachhaltig zu gestalten, sollen vorhandene und neue „Lutherfonds“ mit Geld bedacht werden, mit denen diakonische Aufgaben finanziert werden38. Schließlich sollen alle Predigten des Reformationsjubiläums dem Oberkirchenrat zur Archivierung zugesandt werden.
36 Die folgenden Zitate aus dem Manuskript des Ausschreibens des ev.-luth. Oberkirchenrates vom 24. 03. 1917, NLAO 250 A XI I. 37 Es handelt sich um folgende Broschüre, an der der später in Oldenburg referierende Julius Smend mitgearbeitet hat: 1917 und der deutsche evangelische Kirchengesang. Referate und Aussprache bei der Sitzung des Zentralausschusses in Eisenach am 5. Juli 1916. Zur Vorbereitung auf das Reformationsjubiläum in liturgischer und kirchenmusikalischer Hinsicht hg. v. d. Evangelischen Kirchengesangverein für Deutschland, Leipzig 1916. 38 Eine unvollständige Aufstellung der tatsächlich erfolgten Stiftungen findet sich im Oldenburgischen Kirchenblatt 23 (1917), 138, 142 u. 149.
364
Die Reformationsjubiläen 1817 und 1917 in der Stadt Oldenburg
Ein Hinweis auf die ökumenische Dimension des Festes und die besondere Lage in der Kriegszeit steht am Schluss des Ausschreibens: Ein besonderer Segen der Reformationsfeier würde darin liegen, dass bei aller Wahrung der evangelisch-lutherischen Eigenart doch das Oekumenische, das allgemein Christliche zum Bewusstsein käme. Die ernste Zeit, die zum gegenseitigen Tragen und Verstehen anleitet macht es allen zur Gewissenspflicht, von allem Feiern jede verletzende Haltung gegen andere Bekenntnisse fern zu halten.
Um seine Vorstellungen zum Reformationsjubiläum weiter zu verbreiten, nutzte Heinrich Iben die ihm vertrauten Kanäle für die innerkirchliche Diskussion. Zunächst veröffentlichte er einen Artikel im „Oldenburgischen Kirchenblatt“, dem „zentralen Organ der Oldenburgischen Kirche“39.
Heinrich Ibens Artikel vom 18. April 1917 im Oldenburgischen Kirchenblatt Dort gibt er am 18. April 1917 weitere Hinweise, wie er sich als kirchenleitender Theologe die Gestaltung des Reformationsgedächtnisses wünscht. Dafür bedient er sich jetzt der 1917 häufiger gebrauchten Differenzierung zwischen „innerem Fest“ und „äußerem Fest“. Diese Unterscheidung entsteht in den kirchlichen Verlautbarungen durch den kriegsbedingten Wegfall der zentralen Reformationsfeierlichkeiten. Daraufhin wird die „innere Feier“ immer mehr zu einem Thema der offiziellen Texte. Für den i n n e r e n Wert der Vierhundertjahrfeier wird es von der größten Bedeutung sein, daß wir sie nicht nur zu einer Lutherfeier gestalten, sondern zu einer Erinnerung an die Gottestat der Reformation […] Für den befriedigenden Verlauf der äußeren Feier, darf nicht außeracht gelassen werden, daß „die evangelische Kirche nicht vom Gegensatz gegen die katholische, sondern von ihren eigenen Werten lebt“40.
Iben betont noch einmal die Notwendigkeit sich bei der Feier des Reformationsfestes der antikatholischen Polemik zu enthalten. Anders als 1817 ist dafür nicht die Toleranz einer aufklärerischen Theologie der Hintergrund, sondern der „Burgfriede“ zwischen den Konfessionen während des Kriegs (s. u.). Iben äußert im „Ausschreiben“ und im Oldenburgischen Kirchenblatt seine Hoffnung auf ein bis zum Reformationsfest erreichtes Ende des Krieges. Für ihn kann das nur ein
39 Von Reeken, Kirchen im Umbruch (Anm. 21) zeichnet die innerkirchliche Publizistik in der Oldenburgischen Kirche von 1855 bis ins beginnende 20. Jahrhundert nach, 128–129, hier 129. 40 Heinrich Iben, Einige Winke für die Vierhundertjahrfeier der Reformation, in: Oldenburgisches Kirchenblatt 23 (1917), 43–44, hier 44 (Hervorhebungen im Original).
Die Reformationsjubiläen 1817 und 1917 in der Stadt Oldenburg
365
siegreicher Friedensschluss sein, zu dem dann die Glocken geläutet werden sollten41. Die Geschichte ging aber andere Wege…
Vorbereitungen der Kreissynoden und der evangelischen Vereine zum Reformationsfest Mit dem Ausschreiben und dem Artikel Heinrich Ibens im Oldenburgischen Kirchenblatt war der Startschuss für die aktive Vorbereitung des Reformationsjubiläums in der Oldenburgischen Kirche gegeben. In den verschiedenen Foren begannen jetzt intensive Gespräche über die konkreten Vorbereitungen. Die kirchlichen Vereine der Oldenburgischen Kirche begannen nach dem Impuls aus dem Oberkirchenrat umgehend mit der Beschäftigung mit dem bevorstehenden Reformationsjubiläum. Die verschiedenen Pfarrervereine42 und der Landesverein für Innere Mission beraten im Mai über das Jubiläum43. Im Juni beschäftigten sich alle sieben Kreissynoden der Oldenburgischen Kirche vorrangig mit der vom Oberkirchenrat gestellten Frage „Was kann geschehen, um die vierhundertjährige Gedächtnisfeier der Reformation in unseren Gemeinden wirksam zu gestalten?“44
41 Heinrich Iben, Einige Winke (Anm. 40): „Gott gebe nur, daß bis dahin der Krieg entweder das für uns günstige Ende gefunden hat oder doch zum sicheren Abschluß neigt. Das wäre eine Jubelfeier, wenn zum 31. Oktober Friedens- und Siegesgeläut sich zu gemeinsamem Klange mit den Gedächtnisklängen der Reformation vereinigen könnten!“ 42 Am 25. 4. 1917 tagte dazu der liberale „Evangelische Predigerverein“, Oldenburgisches Kirchenblatt 23 (1917), 46. Am 9. 5. 1917 tagte der konservative „Evangelisch-Lutherische Predigerverein“, Oldenburgisches Kirchenblatt 23 (1917), 53–54. Am 31. 5. 1917 tagte schließlich der Generalpredigerverein, dem alle Pastoren angehörten, Oldenburgisches Kirchenblatt 23 (1917), 59. Der Generalpredigerverein beschließt acht Thesen zur Reformationsjubelfeier, die im Wesentlichen dem Ausschreiben des Oberkirchenrates entsprechen. Die einleitende These nimmt explizit auf den Krieg Bezug: „Die Reformationsjubelfeier erhält durch die Zeit das Gepräge schweren Ernstes, um so mehr erhoffen wir von ihr inneren Stärkung“ Die Thesen des Generalpredigervereins sind veröffentlicht in: Oldenburgisches Kirchenblatt 23 (1917), 73–74. 43 Oldenburgisches Kirchenblatt 23 (1917), 65 u. 88. Das Reformationsjubiläum steht nicht auf der angekündigten Tagesordnung, aber Heinrich Iben hat in seinem Jahresbericht zum Reformationsjubiläum gesprochen. Daraufhin wurde die Herausgabe von zweier Schriften beschlossen. Verwirklicht wurde das Projekt von Emil Pleitner zur Oldenburgischen Reformationsgeschichte. 44 Die Kreissynoden tagen am 5. 6. 1917 Wildeshausen, 14. 6. 1917 Elsfleth, 15. 6. 1917 Delmenhorst, 19. 6. 1917 Oldenburg, 20. 6. 1917 Jever, 22. 6. 1917 Stad- und Butjadingerland, 27. 6. 1917 Varel, Angaben nach Oldenburgisches Kirchenblatt 23 (1917), 66–67.
366
Die Reformationsjubiläen 1817 und 1917 in der Stadt Oldenburg
Aufsätze zur lokalen Reformationsgeschichte im Oldenburger Sonntagsblatt Beginnend mit dem 14. Juli 1917 werden im Oldenburger Sonntagsblatt in loser Folge insgesamt zehn Artikel „Aus der oldenburgischen Reformationsgeschichte“ veröffentlicht. In der Anmerkung des Herausgebers, des Landespfarrers für Innere Mission, Pastor August Lindemann heißt es dazu: Unter dieser Ueberschrift werden wir eine Reihe kurzer Aufsätze bringen, die auf bemerkenswerte Ereignisse der oldenburgischen Reformationsgeschichte hinweisen. Wir hoffen auch dadurch mitzuarbeiten an einer würdigen Vorbereitung des vierten Jubelfestes der Reformation45.
Das Oldenburger Sonntagsblatt erschien wöchentlich mit einer Auflage von ca. 13.000 Exemplaren und erreichte so ca. 15–20 % der Oldenburger Gemeindeglieder46. Die Ausgabe zum Reformationsfest hat dann allerdings keinen Bezug zur Regionalgeschichte, sie wird eine reine „Luther-Nummer“. Sieben verschiedene Aspekte des Lebens und Wirkens Luther werden abgedruckt. Der Leitartikel „Zum Reformationsfest“ nimmt seinen Ausgang von der heroischen Figur Luthers und endet mit einem Vergleich zweier aktueller Kämpfe, die er ausmacht: zum einem den Kampf mit äußeren Feinden im Krieg zum anderen den „Geisteskampf um das Erbe der Reformation“47. Er warnt die Leserinnen und Leser dabei besonders vor den „Feinden in den eigenen Reihen: der Unglaube und die Gottlosigkeit auf der einen, der Stumpfsinn und die Gleichgültigkeit auf der anderen Seite“. Am Ende schließt er appellierend „Du liebes deutsch-evangelisches Volk: Halte, was du hast, daß niemand deine Krone nehme!“ Auch das Gedicht der Oldenburger Schriftstellerin Adelheid Etmer nimmt die Kampf-Metaphorik zur Würdigung der Reformation in Anspruch. Ihr Gedicht beginnt: Gott sei Dank, daß uns der Sieg Damals ward beschieden, Als der starke Glaubensheld Wandelte hinieden, Der von fremder Tyrannei Das Gewissen machte frei48.
45 Oldenburger Sonntagsblatt 64 (1917) 248. 46 Zur Entwicklung und Bedeutung des Oldenburger Sonntagesblattes und seines Herausgebers Pastor Lindemann, s. von Reeken, Kirchen im Umbruch (Anm. 21), 134–136. 47 Oldenburger Sonntagsblatt 64 (1917), 341–342, hier: 342. 48 Adelheid Etmer, Zur vierhundertjährigen Wiederkehr, in: Oldenburger Sonntagsblatt 64 (1917), 342.
Die Reformationsjubiläen 1817 und 1917 in der Stadt Oldenburg
367
Der Versuch Heinrich Ibens im Januar 1917 die Weichen für das Reformationsfest in Oldenburg so zu stellen, dass „nicht Luther allein verherrlicht“ werden und dass „alle zeitgeschichtliche Polemik zurücktreten“ soll, ist zumindest im Blick auf das auflagenstärkste Blatt der Oldenburger kirchlichen Presse gescheitert. Pastor Lindemann als Herausgeber bedient die zeittypischen Klischees vom deutschen Luther und vom Kampf gegen das Papsttum. Im Artikel über „Vornehme Bibelleser“ werden dann geradezu klischeehaft Bismarck, Hindenburg und Kaiser Wilhelm II. als Identifikationsfiguren eines evangelischen, bibelbezogenen Deutschtums präsentiert.
Oldenburger Veröffentlichungen Zum Reformationsjubiläum erscheinen zwei Oldenburger Veröffentlichungen49. Zum einen machte sich Heinrich Iben selbst an die Erarbeitung der angekündigten „Festschrift“ mit der Beschreibung der zurückliegenden Reformationsjubiläen im Oldenburger Land. Neben seinen sonstigen Amtsgeschäften gibt er das Buch „Wie unsere Väter das Gedächtnis der Reformation gefeiert haben“ heraus, in dem er vor allem auf das Material zum Reformationsjubiläum von 1817 wieder abdruckt50. Zu den breitenwirksamen Maßnahmen des Oldenburger Reformationsjubiläums gehört die Herausgabe eines von Emil Pleitner verfassten Buches zur Oldenburger Reformationsgeschichte. Pleitner unterrichtet am Oldenburger Lehrerseminar und hat mehrere landesgeschichtliche Bücher herausgegeben51. Seine Oldenburger Reformationsgeschichte ist allgemeinverständlich angelegt und bebildert. Sie umfasst alle Territorien des Oldenburger Landes und reicht bis über die Kirchenordnung von 1573, die Gegenreformation im Oldenburger Münsterland und die Geschichte Wildeshausens bis zum Reformationsjubiläum 1817 und schließt somit historisch an Heinrich Ibens Arbeit zum Jubiläum 1817 an. Pleitners Buch wird zum Selbstkostenpreis vom Landesverein für Innere Mission abgegeben und von den Gemeinden in hohen Stückzahlen abgenommen. Damit prägt Pleitner das populäre Bild von der Reformation im Oldenburger Land für die kommende Zeit. 49 Zu den zahlreichen übrigen Veröffentlichungen und Jubiläumsgaben zum Jubiläum 1917 s. Gottfried Maron, Luther 1917. Beobachtungen zur Literatur des 400. Reformationsjubiläums, in: ZKG 93 (1982), 177–221. 50 Heinrich Iben, Wie unsere Väter die Reformation gefeiert haben. Ein Rückblick zur 400jährigen Gedächtnisfeier der Reformation im Herzogtum Oldenburg am 31. Oktober 1917, Oldenburg 1917. Dabei verwendet Iben vor allem das Material, dass 1817 in dem Berichtsband „Die dritte Jubelfeier der Reformation im Jahre 1817“ zur Verfügung gestellt wurde. Iben lässt bei den Berichten von 1817 aus den einzelnen Gemeinden jeweils den ersten Absatz weg. 51 Darunter sind besonders zu erwähnen: Emil Pleitner, Oldenburg im 19. Jahrhundert, 2 Bde., Oldenburg 1899/1900 und Ders., Oldenburgisches Quellenbuch, Oldenburg 1904.
368
Die Reformationsjubiläen 1817 und 1917 in der Stadt Oldenburg
Der erste Oldenburgische Gemeindetag in Oldenburg 1917 Parallel zur Vorbereitung auf das Reformationsjubiläum wird in Oldenburg der erste Oldenburgische Gemeindetag vorbereitet, der nur drei Wochen vor dem Reformationstag stattfindet und eine große Resonanz findet. Die Initiative zu diesem Gemeindetag entspringt dem deutlichen Gefühl, dass vor allem die großstädtischen Gemeinden des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts eine andere Art des Gemeindelebens brauchen52. Die Debatte um die Gemeindereform erreichte Oldenburg über die „Konferenz für evangelische Gemeindearbeit“ (seit 1916 „Deutscher evangelischer Gemeindetag“) an deren Tagungen mehrere Oldenburger Vertreter teilnahmen. Vor allem in der „Freien Vereinigung“ dem Zusammenschluss der liberalen Oldenburger Pastoren wird darüber diskutiert53. Die Begründer der Konferenz der Berliner Pfarrer Dr. August Stock54 und der Gießener Praktische Theologe Martin Schian, werden beide zum Oldenburger Gemeindetag 1917 eingeladen und übernehmen die Hauptvorträge. Der Gemeindetag hat annähernd 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, darunter sowohl Pastoren, Kirchenälteste und weitere Gemeindeglieder. In den Diskussionen treffen durchaus unterschiedliche Positionen aufeinander. Dennoch wird die Veranstaltung als so fruchtbar erlebt, dass im Oktober des nächsten Jahres ein weiterer Gemeindetag stattfindet.
Vorträge und Predigten zur Vorbereitung auf das Reformationsjubiläum In der Stadt Oldenburg werden von der Kirchengemeinde sieben Vorträge organisiert, die zu verschiedenen Aspekten der Reformation Stellung nehmen55, sich aber im Wesentlichen auf die Person und die Wirkung Martin Luthers 52 Zum Oldenburger Gemeindetag s. von Reeken, Kirchen im Umbruch (Anm. 21), 49–51. 53 Vgl. z. B. das Referat „Wie werben wir für den Gemeindetag bei unseren Gemeinden“, das in der „Freien Vereinigung“ gehalten wurde und dann im Oldenburger Kirchenblatt 23 (1917), 199–122 abgedruckt wurde. 54 Zum Leben von August Stock s. Klaus Jürgens: Stock, Julius August, D., in: Horst-Rüdiger Jarck / Günter Scheel (Hg.): Braunschweigisches Biographisches Lexikon – 19. und 20. Jahrhundert., Hannover 1996, 595. 55 Für diese Vorträge, die im Wesentlichen von Pastor Wilkens organisiert wurden, wurde eine Mischung aus auswärtigen und Oldenburger Referenten gefunden. Es referierten am: 3. 10. 1917 Prof. Dr. Julius Smend (Münster) „Luther und Bach“; 18. 10. 1917 Prof. Dr. Karl Albrecht (Oldenburg) „Luther als Dichter“; 25. 10. 1917 Prof. em. Dr. Henry Thode (Karlsruhe) „Luther und die deutsche Kultur“; 7. 11. 1917 Generalsuperintendent Dr. Wilhelm Zöllner (Münster) „Die Losung der Reformation: Durch Wahrheit zur Freiheit“; 15. 11. 1917 Oberschulrat Emil Künoldt (Oldenburg) „Luther und die Schule“; 22. 11. 1917 Oberkirchenrat Lic. Dr. Heinrich Tilemann (Oldenburg) „Luther und der Staat“; 29. 11. 1917 Seminaroberlehrer Emil Pleitner (Oldenburg) „Die Reformation in Oldenburg“.
Die Reformationsjubiläen 1817 und 1917 in der Stadt Oldenburg
369
konzentrieren. Damit wird das bildungsbürgerliche Klientel in der Stadt bedient und zugleich können Oldenburger Theologen und Schulmänner ihre Beiträge zur Reformation einem breiteren Publikum präsentieren. Für die Lambertikirche arbeitet Heinrich Iben am Freitag, dem 7. September eine Liste von Predigttexten und -themen aus, durch die er die Gemeinde der Landeshauptstadt gottesdienstlich auf das Jubiläum vorbereiten will. Heinrich Iben nutzt hier seinen Gestaltungsspielraum um dafür zu sorgen, dass das Reformationsjubiläum nicht zu einer reinen Lutherfeier wird. Die Predigtthemen sind bis auf wenige Ausnahmen nicht auf die Person Luthers zugespitzt, sondern nehmen Themen der Reformation oder der reformatorischen Theologie auf. Dieser Predigtplan gilt für die neun Sonntage vor dem Reformationsfest56. Dabei fällt auf, dass die beiden Theologen im Oberkirchenrat von ihrem Kanzelrecht in der Lambertikirche nur sparsam Gebrauch machen. Heinrich Iben und Heinrich Tileman predigen in den neun Wochen vor dem Jubiläum je nur zweimal. Das eigentliche Reformationsfest überlassen sie den Gemeindepastoren.
Reformationsfestpredigten in der Lambertikirche Die oldenburgischen Gemeinden sollten am Ende des Jubiläums einen Bericht einreichen „in dem möglichst eingehend der Verlauf der Feier dargelegt und dem die am 31. Oktober gehaltene Predigt in Abschrift angelegt wird“57. Das ist tatsächlich geschehen. Heinrich Iben hat sämtliche im Oldenburger Land Predigten gesammelt, geordnet und mit eigener Hand überarbeitet, aber eine Publikation ist nicht erfolgt. Mit der Aktenübergabe vom Oberkirchenrat an das Staatsarchiv in Oldenburg sind alle Reformationstagspredigten von 1917 dorthin gelangt und liegen bis heute dort unter der Nummer 250 A XI 25 II in einem Aktenkonvolut zum Reformationsjubiläum. Hier soll – wie beim Jubiläum von 1817 – nur auf die zwei Predigten aus der Lambertikirche eingegangen werden. Pastor Wilhelm Wilkens Wilhelm Wilkens gehört zu den treibenden Kräften einer Erneuerung des Gemeindelebens in Oldenburg. Seine Predigt im Frühgottesdienst des Reformationstages 191758 geht wenig auf die aktuelle Lage der Kirche oder des Reiches ein. Einen Bezug zum Krieg stellt Wilkens nicht her. Seine Predigt ist darauf bedacht, 56 Pfarrarchiv der Kirchengemeinde Oldenburg Slg 2 Nr. 326. 57 Großherzoglich evangelisch-lutherischer Oberkirchenrat Oldenburg, Rundschreiben vom 24. 3. 1917, NLAO 250 A XI 25 I. 58 Predigt am Reformationsfest 1917 gehalten in der Lambertikirche zu Oldenburg (Frühgottesdienst) von Pastor Wilhelm Wilkens, NLAO 250 A XI 25 II. Daraus alle Zitate.
370
Die Reformationsjubiläen 1817 und 1917 in der Stadt Oldenburg
die Bedeutung der Gnade für Luther und bleibende Bedeutung Luthers herauszustellen. Wilkens stellt am Anfang der Predigt das Wirken Martin Luthers als Segen für die evangelische und die katholische Kirche und Luther als Vater der Kultur heraus. Er fordert seine Zuhörerinnen und Zuhörer auf, sie mögen sich den Segen klarmachen, den nicht nur die evangelische, sondern auch die katholische Kirche Luther verdankt. Mit Recht hat Kaulbach in seinem großen Wandgemälde59 Luther in die Mitte gestellt, die Bibel hoch erhoben, und um ihn herum Gelehrte, Künstler, Bahnbrecher der Kultur, alle zu ihm aufblickend als zu ihrem geistigen Vater.
Wilhelm von Kaulbach, Das Zeitalter der Reformation
59 Es handelt sich um ein monumentales Deckengemälde im großen Treppenhaus des Neuen Museums in Berlin. Der gesamte Zyklus zeigt sechs entscheidende Szenen der Weltgeschichte. Als sechstes und letztes Bild zeigt Kaulbach das „Zeitalter der Reformation“. Das Bild ist 1868 als Stich von Gustav Eilers vervielfältigt worden. Ein Exemplar dieses Stiches befindet sich noch heute im Besitz der Kirchengemeinde Oldenburg, Foto Ralph Hennings.
Die Reformationsjubiläen 1817 und 1917 in der Stadt Oldenburg
371
Im Schlussteil der Predigt stellt er die besondere Verbindung Luthers zu den Deutschen heraus. Wilkens behauptet, durchaus im Einklang mit dem Zeitgeist60: Martin Luther ist nicht von aller Welt verstanden worden. Wir Deutschen verstehen ihn, den tapferen Streiter, den Mann mit den blitzenden, tiefen Augen, wie er dasteht, die Faust auf die Bibel gelegt, lauter Entschlossenheit und Tatkraft in seiner Haltung, aber das Auge zum Himmel gerichtet, wo die Quellen seiner Kraft liegen, diesen starken Mann der doch so demütig und kindlichen Gemütes ist. So und nicht anders ist er, weil das Evangelium von der Herrlichkeit und Gnade Gottes sein Schatz geworden ist. Seinen lieben Deutschen hat er’s geschenkt in der deutschen Bibel, denn für meine Deutschen bin ich geboren, ihnen will ich dienen.
Haupt-Pastor Rudolf Schneider Im Hauptgottesdienst in der Lambertikirche predigt der 1. Pastor, Rudolf Schneider. Seine lange Predigt formuliert „Luthers Glauben“ als die zentrale Kraft der Reformation und ihrer Wirkung. Er stellt die direkte Verbindung zwischen Luthers Glauben und dem Verhalten in der Situation des Krieges her. Luthers Glaube ist demnach die Ursache der Pflichterfüllung, des Opfermutes, des Heldentums und der seligen Sterbens auf dem Schlachtfeld: Unsere Zeit bedürfte Glaubenskraft wie keine andere, Liebe, Opferfreudigkeit, Pflichttreue, Duldermut […] Die Schrecken des Krieges haben viel Liebeskraft offenbart, ausharrende Pflichttreue im prasselnden Trommelfeuer, einen Reichtum an gebender, bewahrender, pflegender Liebe, ein heldenhaftes Eintreten des einen für den anderen, ein aufopfern des eigenen Lebens, damit anderen geholfen werde. Mögen viele des tiefen Ursprungs, aus dem diese Bewegung kommt, sich nicht bewußt sein […] zuletzt geht sie doch aus von der heiligenden Gotteskraft des Evangeliums von Christo, von dem daraus geschöpften Glauben, der immer ein Vertrauen auf Gottes Gnade ist, Glaube an das Gute und Göttliche, Glaube an Sieg und Segen von oben. Groß ist das 60 Vgl. Hartmut Lehmann, „Er ist wir selber: der ewige Deutsche“ Zur lang anhaltenden Wirkung der Lutherdeutung von Heinrich von Treitschke, in: Ders., Luthergedächtnis 1817–2017 (Refo500 Academic Studies 8), Göttingen 2012, 126–137. Lehmann weist nach, dass Treitschkes 1883 veröffentlichtes Konstrukt eines „germanischen“ Luthers, eine weit reichende unheilvolle Wirkungsgeschichte hatte. In der Predigt von Wilhelm Wilkens werden die wesentlichen Verbindungen zwischen Luther und dem „Deutschtum“, die Treitschke hergestellt hatte, wiederaufgenommen. Damit ist Wilhelm Wilkens in den Hauptstrom der nationalistischen Lutherdeutung des Reformationsjubiläums von 1917 einzuordnen. Treitschke formulierte 1883 (Zitat nach Lehmann, 130): „Ein Ausländer mag wohl ratlos fragen, wie nur so wunderbare Gegensätze in einer Seele zusammenliegen mochten: diese Gewalt zermalmenden Zornes und diese Innigkeit frommen Glaubens, so hohe Weisheit und so kindliche Einfalt, so viel tiefsinnige Mystik und so viel Lebenslust, so ungeschlachte Grobheit und so zarte Herzensgüte […] Wir Deutschen finden in alledem kein Rätsel, wir sagen einfach: das ist Blut von unserm Blute. Aus den tiefen Augen dieses urwüchsigen deutschen Bauernsohnes blitzte der alte Heldenmut der Germanen, der die Welt nicht flieht, sondern sie zu beherrschen sucht durch die Macht des sittlichen Willens“.
372
Die Reformationsjubiläen 1817 und 1917 in der Stadt Oldenburg
Heldentum der Pflicht, das, um das Vaterland zu retten auch das Leben nicht zu teuer erachtet; groß das Heldentum der Liebe, das täglich, stündlich das eigene Leben läßt, um anderen zum Leben zu verhelfen, aber größer als beides ist es, wenn sterbend auf der Walstadt eine Menschenseele den Tod überwinden und still ergeben in Gottes Hand sich befehlen kann, weil sie im Glauben von Gottes Gnade Leben empfangen hat, das ewig ist. Das ist Luthers Glaube, dessen Leben Gottes Gnade ist61.
Resümee zum Reformationsjubiläum 1917 in Oldenburg Das Reformationsjubiläum in Oldenburg 1917 erweist sich als ein kirchliches Fest, das trotz des Krieges erstaunliche Energien freisetzte. Das Jubiläum, das 1917 entgegen der ursprünglichen Planungen ohne eine zentrale Feier für das Deutsche Reich auskommen musste, war deshalb wahrscheinlich stärker als das sonst geschehen wäre, in der Region verankert und hat dort zu verstärkten Aktivitäten auf verschiedenen Gebieten geführt. Oberkirchenrat Heinrich Iben erweist sich in Oldenburg als die treibende Kraft für die Organisation des Jubiläums. Seine Planungen beeinflussen die Ausgestaltungen der Feiern in den einzelnen Gemeinden. Davon ausgehend bemühen sich die verschiedenen kirchlichen Akteure: Gemeinden, Kirchenkreise und Vereine ein möglichst reichhaltiges und qualitätvolles Jubiläumsprogramm zusammenzustellen. In den Veröffentlichungen, Vorträgen, Diskussionen und Predigten zeigen sich dann typische theologische Entwicklungen der Zeit. Im Fokus der Aufmerksamkeit stehen in Oldenburg: Luther, seine Person und sein Wirken, die regionale Reformationsgeschichte, das besondere Verhältnis der Deutschen zu „ihrem Luther“ und die ethische Bedeutung Luthers und der Reformation für die Gegenwart. Mit seinem Anliegen, das Reformationsjubiläum nicht zu einer Lutherfeier werden zu lassen, konnte Iben sich nur dort durchsetzen, wo er selbst direkt gestalten konnte wie zum Beispiel bei den vorbereitenden Predigten in der Lambertikirche. Zwei Fragenkomplexe des Jubiläums 1917 sollen noch ausführlicher betrachtet werden, der „Burgfriede“ zwischen evangelischer und katholischer Kirche und die Aktivierung des Gemeindelebens, die sich in Oldenburg mit dem Gemeindetag verbindet.
61 Reformationsfestpredigt über Röm 1,16–17, gehalten in der Lambertikirche zu Oldenburg am 31. Oktober 1917 von Rudolf Schneider, Pfr., NLAO 250 A XI 25 II. Daraus das Zitat.
Die Reformationsjubiläen 1817 und 1917 in der Stadt Oldenburg
373
Hielt der „Burgfriede“ zwischen evangelisch und katholisch während des Jubiläums 1917? Der Krieg hat evangelische und katholische Christen auf eine besondere Weise zusammengebracht. Um die Kampfkraft der Deutschen im Krieg nicht zu schwächen, wurde bewusst auf Polemik zwischen den Konfessionen – und den politischen Parteien – verzichtet. So hatte Kaiser Wilhelm II. bereits am 1. August 1914 (dem Tag der deutschen Kriegserklärung an Russland) bei seiner Rede auf dem Balkon des Berliner Stadtschlosses erklärt: „Ich kenne keine Parteien und auch keine Konfessionen mehr“. Das ist der von den Zeitgenossen so genannte „Burgfriede“. Das entspricht der Intention des Oldenburger Oberkirchenrates der im Ausschreiben vom 24. März 1917 den schon zitierten Hinweis gibt, dass in schwerer Zeit trotz des lutherischen Profils das Gemeinsame der Konfessionen zu suchen ist62. Pastor Koch aus Elsfleth bestätigt bei der Frühjahrsversammlung des Oldenburgischen Generalpredigervereins die durch den Krieg geschehene Annäherung zwischen den Konfessionen63. Als eine Störung des „Burgfriedens“ von katholischer Seite aus ist bei den Vorbereitungen zum Reformationsjubiläum die Aufhebung des Jesuitengesetztes aus dem Jahre 1872 empfunden worden. Das drückt der Oldenburger Pastor Wilhelm Wilkens aus: Es wäre herrlich und dem Sinne eines Luther am wenigsten entgegen, wenn wir das 400jährige Gedächtnis der Reformation in vollem, aufrichtigen Frieden mit der römischen Kirche feiern dürften. Allein die Aufhebung des Jesuitengesetzes ist mitten in der Zeit des Burgfriedens durchgedrückt. Dieser zum Zweck der Bekämpfung der Evangelischen gegründete Kampforden, der eingeschworene Feind der evangel. Kirche, soll völlig ungehindert seine Tätigkeit entfalten dürfen64.
Letztendlich ist es aber gelungen, dass das Reformationsjubiläum, trotz der im Lauf des 19. Jahrhunderts deutlich verhärteten Fronten zwischen den Konfessionen, nicht zu einem Ärgernis für die katholischen Christen wurde65. Eine 62 Der Oberkirchenrat in Oldenburg hatte Kenntnis von dem Angebot Papst Benedikts XV. an die evangelischen Kirchen, dem Reformationsjubiläum gegenüber von Seiten der katholischen Kirche „Stillschweigen zu bewahren“, sofern die katholische Kirche im Zuge des Festes nicht angegriffen würde. Schreiben des Deutschen Evangelischen Kirchenausschusses an den großherzoglich evangelisch-lutherischen Oberkirchenrat vom 1. 5. 1918. NLAO 250 A XI 25 II. 63 August Koch, Gestaltung der Reformationsjubelfeier, in Oldenburgisches Kirchenblatt 23 (1917) 69–73: „Durch den Krieg ist nun eine starke Annäherung zwischen den Konfessionen herbeigeführt.“ 64 Wilhelm Wilkens, Was kann geschehen, um die vierhundertjährige Gedächtnisfeier der Reformation in unseren Gemeinden wirksam zu gestalten? in: Oldenburgisches Kirchenblatt 23 (1917), 85. 65 Erich Foerster, Die Stellung der evangelischen Kirche, in: Otto Baumgarten / Erich Foerster / Arnold Rademacher / Wilhelm Flitner (Hg.), Geistige und sittliche Wirkungen des Krieges in Deutschland (Veröffentlichungen der Carnegie-Stiftung für internationalen Friede. Abtlg.
374
Die Reformationsjubiläen 1817 und 1917 in der Stadt Oldenburg
weitergehende Perspektive auf die Ökumene ist aber nicht erkennbar. Die von Wilhelm Wilkens behaupteten Segnungen, die die katholische Kirche durch die Reformation empfangen habe, sind nicht durch katholische Äußerungen gedeckt, sondern letztlich nur Ausdruck eines kulturprotestantischen Überlegenheitsgefühls. Aktivierung der Gemeinden – der Oldenburger Gemeindetag Die zeitliche Nähe von Gemeindetag und Reformationsjubiläum in Oldenburg ist nicht zufällig. Die Strahlkraft des Jubiläums sollte der beabsichtigten Aktivierung der Gemeinden im Oldenburger Land helfen. Das hatte Wilhelm Wilkens in seiner Schluss-These auf der Oldenburger Kreissynode am 19. 6. 1917 formuliert: Die Jahrhundertfeier mag darum für die rechtlich verfasste Kirche eine Veranlassung sein, alle auf den Schutz, die Weckung, Vertiefung und Ausbreitung gerichteten Einzelbestrebungen […] kräftig zu unterstützen […] zu fördern und zu beleben66.
Eine rückblickende Beschreibung der Lage der evangelischen Kirche in der Kriegszeit nennt die Aktivierung der Kirchengemeinden wie sie sich auch im Oldenburger Gemeindetag zeigt, den wesentlichen Gewinn der Kriegszeit. Der liberale Frankfurter Theologe Erich Foerster schreibt 1927: Das wichtigste aber war, dass an diesen Aufgaben [d.i. Aufgaben, die durch den Krieg erwachsen sind, R.H.] die einzelnen Kirchengemeinden ihre Leistungsfähigkeit entdeckten und aus ihrem Schlummer aufwachten […] sie gewöhnten sich daran, viel tiefer in das praktische Leben, in wirtschaftliche, soziale, häusliche Dinge einzugreifen, und fanden neue Wege, nicht nur die Opferwilligkeit, sondern auch die Bereitschaft zu persönlichen Diensten zu steigern. Und diese Belebung der Gemeinden gelang wirklich überall da, wo sie geschickt und ausdauernd betrieben wurde. Das aktive Gemeinschaftsbewusstsein der evangelischen Kirchengemeinden ist währen des Krieges ganz erheblich gewachsen, die Laienschaft zur Teilnahme am Gemeindeleben viel williger und fleißiger, freilich auch selbstbewusster und kritischer geworden. Das erscheint mir als eine der erfreulichsten Wirkungen des Krieges67.
Für Volkswirtschaft und Geschichte. Wirtschafts- und Sozialgeschichte des Krieges. Deutsche Serie 6) Stuttgart-Berlin-Leipzig-New Haven 1927, 89–148, hier 130: „Der konfessionelle Friede ist […] durch das im Jahre 1917 gefeierte Reformationsjubiläum nicht ernsthaft gestört worden“. 66 Wilhelm Wilkens, Was kann geschehen, um die vierhundertjährige Gedächtnisfeier der Reformation in unseren Gemeinden wirksam zu gestalten? in: Oldenburgisches Kirchenblatt 23 (1917), 86. 67 Erich Foerster, Die Stellung der evangelischen Kirche (Anm. 65), 129.
Die Reformationsjubiläen 1817 und 1917 in der Stadt Oldenburg
375
Vergleich 1817–1917 Ökumene Bei beiden Reformationsjubiläen wird von kirchenleitender Seite darauf hingewiesen, dass das Fest nicht dazu genutzt werden soll, die katholischen Christen zu verärgern und die Reformation soll jeweils auch nicht nur durch Abgrenzung zur katholischen Kirche beschrieben werden. Trotz des nahezu gleichlautenden Impulses unterscheiden sich die beiden Jubiläumsfeiern in der Haltung zur katholischen Kirche. Während 1817 zwar keine Kircheneinheit, aber eine „brüderliche Vereinigung“ mir den katholischen Christen ins Auge gefasst werden konnte, ist davon 1917 nichts zu spüren. Es soll zwar der durch den Krieg entstandene Burgfriede zwischen den Konfessionen erhalten werden. Dieser Burgfriede ist aber eher ein Zweckbündnis als eine Liebesheirat. Neben dem Stillhalteabkommen zwischen den Großinstitutionen wird auf der individuellen und der Gemeindeebene aber durchaus positiv festgestellt, dass es eine verstärkte Gemeinsamkeit unter den Christen durch das gemeinsame Erleiden des Krieges gibt.
Die Rolle Luthers Während 1817 die Reformation als ein entscheidender Schritt zur Wiederherstellung der Religion Jesu gilt, aber mit ihr nur ein – wenn auch wichtiger – Schritt auf dem Weg zur Vollendung der Menschheit getan ist, steht 1917 die Persönlichkeit Luthers ganz anders im Vordergrund. Luther ist die überragende Figur des Jubiläums. Oft sind es so genannte Charakterbilder oder „Home-Storys“ die erzählt werden, um seine Persönlichkeit in den Vordergrund zu stellen. Die theologischen Anliegen der Reformation als Reformbewegung treten dahinter so weit zurück, dass die Frage nach der Kirchenreform zwar im Kontext des Jubiläums gestellt wird – zum Beispiel in der Frage der Aktivierung der Gemeinde – aber die Notwendigkeit einer Reform der evangelischen Kirche selbst kein Thema des Jubiläums ist. Stattdessen wird von der Persönlichkeit und dem Glauben Luthers direkt auf das ethische Handeln der Christen gezielt. In der Predigt Rudolf Schneiders wird das exemplarisch deutlich. Verkürzend zusammengefasst behauptet sie: „Es ist Luthers Glaube aus dem der Heldenmut im Krieg entsteht“. Das ist eine Art des theologischen Kurzschlusses, der strukturell in mehreren Predigten und Veröffentlichungen vorkommt. Das Leben und die Persönlichkeit Luthers werden nicht mit einem historischen Abstand betrachtet, sondern direkt auf die Gegenwart appliziert, als ob ein Mensch des 20. Jahrhunderts direkt an der persönlichen Glaubens- und Lebenserfahrung eines Menschen des 16. Jahrhunderts
376
Die Reformationsjubiläen 1817 und 1917 in der Stadt Oldenburg
partizipieren könne und daraus Glaubensmut und Handlungsanweisungen für seine Gegenwart entstünden.
Die nationale Dimension Im Gegensatz zum Jubiläum von 1817 hat das Reformationsjubiläum von 1917 eine eindeutig nationalistische Note. Zwar spielt auch 1817 der Zusammenhang von Reformationsjubiläum und den Befreiungskriegen gegen Napoleon eine Rolle, aber das ist 1917 weitaus drastischer. Luther als zentrale Figur des Jubiläums, wird für das Deutschtum vereinnahmt und eine Art „special relationship“ zwischen den damals lebenden Deutschen und Luther postuliert. 1817 war man auch in Oldenburg sicher, dass durch das Licht der Vernunft, das sich in der Reformation Bahn gebrochen hat, im Prinzip alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit geführt werden konnten. Dennoch war 1817 durchaus Stolz darauf zu spüren, dass mit der Reformation eine Freiheitsbewegung ihren Ausgang von Deutschland genommen hat. 1917 hat sich hingegen der exklusive Zugang der Deutschen zu Luther so sehr in den Vordergrund geschoben, dass sich fragen lässt, ob es in dieser Perspektive überhaupt denkbar war, dass Nicht-Deutsche Luther und mit ihm die Deutschen richtig verstehen. Wahrscheinlich reflektiert der exklusive Zugang zu Luther, der 1917 für die Deutschen reklamiert wird, die bedrängte Situation Deutschlands im Kriege. Deutschland erlebt sich im Weltkrieg isoliert und missverstanden. Da verspricht der Rekurs auf den historischen Heroen Martin Luther Halt und Stärkung. Denn bei Luther meint man sich des wechselseitigen Verstehens sicher sein zu können: Luther versteht seine Deutschen und (nur) seine Deutschen verstehen ihn. Dieser Zirkelschluss dient nicht einem tiefer gehenden Verständnis der Reformation. Er dient auch nicht einer kritischen Überprüfung des Zustandes Deutschlands an Hand der in der Reformation aufgekommenen Fragen. Durch den Rekurs auf den „deutschen“ Luther wird das Reformationsjubiläum 1917 in Deutschland vielmehr zu einer einsamen Form der Selbstvergewisserung.
Abbildung Gustav Eilers, Das Zeitalter der Reformation, Stich nach dem Gemälde von Wilhelm von Kaulbach, 1868, im Besitz der Kirchengemeinde Oldenburg, Foto Ralph Hennings.
Die Reformationsjubiläen 1817 und 1917 in der Stadt Oldenburg
377
Quellen 1917 und der deutsche evangelische Kirchengesang. Referate und Aussprache bei der Sitzung des Zentralausschusses in Eisenach am 5. Juli 1916. Zur Vorbereitung auf das Reformationsjubiläum in liturgischer und kirchenmusikalischer Hinsicht hg. v. d. Evangelischen Kirchengesangverein für Deutschland, Leipzig 1916. Ausschreibens des ev.-luth. Oberkirchenrates vom 24. 03. 1917, Niedersächsischen Landesarchiv Standort Oldenburg (=NLAO) 250 A XI I. Die dritte Jubelfeyer der Reformation im J. 1817. d. 31. October im Herzogthum Oldenburg und der Herrschaft Jever, Oldenburg o. J. Großherzoglich evangelisch-lutherischer Oberkirchenrat Oldenburg, Rundschreiben vom 24. 3. 1917, NLAO 250 A XI 25 I. Heinrich Iben, Wie unsere Väter die Reformation gefeiert haben. Ein Rückblick zur 400jährigen Gedächtnisfeier der Reformation im Herzogtum Oldenburg am 31. Oktober 1917, Oldenburg 1917. Ders., Einige Winke für die Vierhundertjahrfeier der Reformation, in: Oldenburgisches Kirchenblatt 23 (1917), 43–44. Ders., Gedanken und Vorschläge zur Gedächtnisfeier der Reformation, Manuskript (NLAO) 250 A XI 25 I. August Koch, Gestaltung der Reformationsjubelfeier, in Oldenburgisches Kirchenblatt 23 (1917) 69–73. Wolfgang Erich Müller (Hg.), Kirchenverbesserung in Oldenburg. Dokumente zum Reformationsjubiläum 1817 (Studien zur Kirchengeschichte Niedersachsens 28), Göttingen 1988. Emil Pleitner, Oldenburg im 19. Jahrhundert, 2 Bde., Oldenburg 1899/1900. Ders., Oldenburgisches Quellenbuch, Oldenburg 1904. Reformations-Ansprache an das deutsche evangelische Volk beim bevorstehenden Jahreswechsel, in: Allgemeines Kirchenblatt für das evangelische Deutschland 26 (1917), 1–2. Rudolf Schneider, Reformationsfestpredigt über Röm 1,16–17, gehalten in der Lambertikirche zu Oldenburg am 31. Oktober 1917, NLAO 250 A XI 25 II. Schreiben des Deutschen Evangelischen Kirchenausschusses an den großherzoglich evangelisch-lutherischen Oberkirchenrat vom 1. 5. 1918. NLAO 250 A XI 25 II. Wilhelm Wilkens, Was kann geschehen, um die vierhundertjährige Gedächtnisfeier der Reformation in unseren Gemeinden wirksam zu gestalten? in: Oldenburgisches Kirchenblatt 23 (1917), 85–86. Ders,. Predigt am Reformationsfest 1917 gehalten in der Lambertikirche zu Oldenburg (Frühgottesdienst), NLAO 250 A XI 25 II.
Literatur Emil Brix / Hannes Steckl (Hg.), Der Kampf um das Gedächtnis. Öffentliche Gedenktage in Mitteleuropa, Wien 1997. Johannes Burkhardt, Reformations- und Lutherfeiern. Die Verbürgerlichung der reformatorischen Jubiläumskultur, in: Dieter Düding / Peter Friedmann / Paul Münch (Hg.),
378
Die Reformationsjubiläen 1817 und 1917 in der Stadt Oldenburg
Öffentliche Festkultur. Politische Feste in Deutschland von der Aufklärung bis zum ersten Weltkrieg, Reinbek b. Hamburg 1988, 212–236. Albrecht Eckhardt / Heinrich Schmidt (Hg.), Geschichte des Landes Oldenburg, Oldenburg 1987. Erich Foerster, Die Stellung der evangelischen Kirche, in: Otto Baumgarten / Erich Foerster / Arnold Rademacher / Wilhelm Flitner (Hg.), Geistige und sittliche Wirkungen des Krieges in Deutschland (Veröffentlichungen der Carnegie-Stiftung für internationalen Friede. Abtlg. Für Volkswirtschaft und Geschichte. Wirtschafts- und Sozialgeschichte des Krieges. Deutsche Serie 6) Stuttgart u. a. 1927, 89–148. Rainer Fuhrmann, Das Reformationsjubiläum 1817. Martin Luther und die Reformation im Urteil der protestantischen Festtagspredigt des Jahres 1817, Diss. Masch. Tübingen 1973. Heinrich Höpken, Heinrich Iben, in: Biographisches Handbuch zur Geschichte des Landes Oldenburg, Oldenburg 1992, 342–343. Thomas Kaufmann, Reformationsgedenken in der frühen Neuzeit. Bemerkungen zum 16. bis 18. Jahrhundert, in: ZThK 107 (2010), 285–324. Stefan Laube, Fest, Religion und Erinnerung. Konfessionelles Gedächtnis in Bayern von 1804 bis 1917 (Schriftenreihe zur bayerischen Landesgeschichte 118), München 1999. Hartmut Lehmann, „Er ist wir selber: der ewige Deutsche“ Zur lang anhaltenden Wirkung der Lutherdeutung von Heinrich von Treitschke, in: Ders., Luthergedächtnis 1817–2017 (Refo500 Academic Studies 8), Göttingen 2012, 126–137. Gottfried Maron, Luther 1917. Beobachtungen zur Literatur des 400. Reformationsjubiläums, in: ZKG 93 (1982), 177–221. Wichmann von Meding, Kirchenverbesserung. Die deutschen Reformationspredigten des Jahres 1817 (Unio et Confessio 11), Bielefeld 1986. Dietmar von Reeken, Kirchen im Umbruch zur Moderne. Milieubildungsprozesse im nordwestdeutschen Protestantismus 1849–1914 (Religiöse Kulturen der Moderne 9), Gütersloh 1999. Rolf Schäfer, Das oldenburgische Kirchenverfassungsgesetz von 1849 und seine Revision 1853, in: 150 Jahre oldenburgische Kirchenverfassung, im Auftr. d. Oberkirchenrates in Verb. mit Günter Raschen hg. von Rolf Schäfer, Oldenburg 1999, 5–20. Rolf Schäfer u. a. (Hg.)., Oldenburgische Kirchengeschichte, 2. Aufl. Oldenburg 2003. Klaus Jürgens, Stock, Julius August, D., in: Horst-Rüdiger Jarck / Günter Scheel (Hg.): Braunschweigisches Biographisches Lexikon – 19. und 20. Jahrhundert., Hannover 1996, 595. Helmut Stubbe-da Luz, „Franzosenzeit“ in Norddeutschland (1803–1814). Napoleons Hanseatische Departements, Bremen 2003. Dorothea Wendebourg, Die Reformationsjubiläen des 19. Jahrhunderts, in: ZThK 108 (2011), 270–335.
Verzeichnis der Erstveröffentlichungen
Disputatio de origine animae (CPL 633,37) – or the victory of creatinanism in the fifth century, in: Studia Patristica XXIX, Leuven 1997, 260–268. Disputatio de origine animae (CPL 633,37) Übersetzung (bisher nur in Auszügen), in: Quaerite faciem eius semper. Studien zu den geistesgeschichtlichen Beziehungen zwischen Antike und Christentum. Dankesgabe für Albrecht Dihle zum 85. Geburtstag aus dem Heidelberger „Kirchenväterkolloquium“, hg. v. A. Jördens / H.A. Gärtner / H. Görgemanns / A.M. Ritter (Studien zur Kirchengeschichte 8), Hamburg 2008, 101–115. Hieronymus zum Bischofsamt, in: ZKG 108 (1997), 1–11. Hieronymus zum Bischofsamt und seine Autorität in dieser Frage bei Luther, Melanchthon und Zwingli, in: Auctoritas Patrum II, hg. v. Leif Grane / Alfred Schindler / Markus Wriedt, Mainz 1998, 85–104. Die Juden in zwei Osterpredigten Augustins. Sermo 229F (Morin, Guelferbitanus X) und Sermo 229 M (Morin, Guelferbitanus XV), bisher unveröffentlicht. Eusebius von Emesa und die Juden, in: ZAC 5 (2001), 240–260. „Wer selig werden will, muss glauben“: Geschichte und Bedeutung des athanasianischen Glaubensbekenntnisses, in: Ulrike Link-Wieczorek / Wolfgang Weiß (Hg.), In dubio pro deo? Anfragen an das Christentum. Eine Ringvorlesung des Instituts für Evangelische Theologie und Religionspädagogik der Universität Oldenburg im Sommersemester 2001 (Forum Religionsphilosophie 6), Münster 2004, 67–95. Carl Blum – Prediger der Russlanddeutschen, in: ZKG 110 (2000), 70–90. In der Christusnachfolge: Evangelische Pastoren und Lehrer in Russland während des 19. Jahrhunderts, in: Britta Konz / Ulrike Link-Wieczorek (Hg.), Vision und Verantwortung, Festschrift für Ilse Meseberg-Haubold (Theologie 63), Münster 2004, 216–235. Aus dem Tagebuch eines bekehrten russischen Rabbiners, in: Beiträge zur ostdeutschen Kirchengeschichte 6 (2005), 74–105. Die prägende Kraft der Predigtbücher für die Frömmigkeit der Russlanddeutschen, in: Freikirchenforschung 16 (2007), 66–83. Der Hl. Lambertus und die Lambertikirche in Oldenburg, in: Ralph Hennings / Melanie Luck von Claparède, Der Hl. Lambertus und die Lambertikirche in Oldenburg, Oldenburg, Lamberti-Verlag, o. J. (2005), 1–26. Die Lambertikirche als architektonisches Symbol, in: Oldenburgische Landschaft (Hg.): Herzog Peter Friedrich Ludwig (1755–1829) zum 250. Geburtstag (Veröffentlichungen der Oldenburgischen Landschaft 11) Oldenburg 2006, 45–58.
380
Verzeichnis der Erstveröffentlichungen
Das Vestibül der St. Lamberti-Kirche in Oldenburg. Rekonstruktion und Neukonzeption, in: Blickwechsel (FS Ewald Gäßler), Oldenburg 2010, 39–58. Theologie in der Ammergauischen Frülingslust, in: Johan Just Winkelmann, Ammergauische Frülingslust, Nachdruck der Ausgabe Oldenburg 1656, hg. v. Eckhard Grunwald, Münster 2013, 71–81. Die Reformationsjubiläen 1817 und 1917 in Oldenburg (Oldb.), in: KZG 26 (2013), 217–237.

![Alte Kirche [12 ed.]
9783788733131, 9783788733117](https://ebin.pub/img/200x200/alte-kirche-12nbsped-9783788733131-9783788733117.jpg)
![Sokrates und die alte Kirche [Reprint 2020 ed.]
9783112369302, 9783112369296](https://ebin.pub/img/200x200/sokrates-und-die-alte-kirche-reprint-2020nbsped-9783112369302-9783112369296.jpg)

![Zuhause fremd: Russlanddeutsche zwischen Russland und Deutschland [1. Aufl.]
9783839403082](https://ebin.pub/img/200x200/zuhause-fremd-russlanddeutsche-zwischen-russland-und-deutschland-1-aufl-9783839403082.jpg)

![Konstruktionen individueller und kollektiver Identität (II): Alter Orient, hellenistisches Judentum, römische Antike, Alte Kirche [1 ed.]
9783788732820, 9783788731052](https://ebin.pub/img/200x200/konstruktionen-individueller-und-kollektiver-identitt-ii-alter-orient-hellenistisches-judentum-rmische-antike-alte-kirche-1nbsped-9783788732820-9783788731052.jpg)