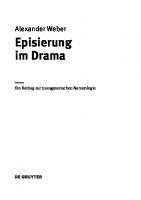Ein neugefundenes griechisches Drama [Reprint 2021 ed.] 9783112564226, 9783112564219
185 67 6MB
German Pages 26 [29] Year 1961
Recommend Papers
![Ein neugefundenes griechisches Drama [Reprint 2021 ed.]
9783112564226, 9783112564219](https://ebin.pub/img/200x200/ein-neugefundenes-griechisches-drama-reprint-2021nbsped-9783112564226-9783112564219.jpg)
- Author / Uploaded
- Friedrich Zucker
File loading please wait...
Citation preview
SITZUNGSBERICHTE D E R D E U T S C H E N A K A D E M I E DER WISSENSCHAFTEN ZU B E R L I N Klasse für Sprachen, Jahrgang
Literatur
und
Kunst
1960 • Nr. 5
FRIEDRICH
ZUCKER
EIN NEUGEFUNDENES GRIECHISCHES DRAMA
AKADEMIE-VERLAG • BERLIN I960
Vorgetragen und für die Sitzungsberichte angenommen in der Sitzung des Plenums am 24. März 1960 Ausgegeben am 28. 7. 1960
Alle Hechte vorbehalten Copyright 1960 by Akademie-Verlag GmbH, Berlin Erschienen im Akademie-Verlag GmbH, Berlin W 1, Leipziger Straße 3-4 Lizenz-Nr. 202 • 100/200/60 Satz und Druck: IV/2/U • VBB Werkdruck Gräfenhainichen • 1408 Bestellnummer: 2010/60/V/5 Preis: 1,50 DM Printed in Germany ES 7 M
EIN
NEUGEFUNDENES
GRIECHISCHES
DRAMA
Vor etwa 50 Jahren brachte ein im 5. J h . n. Chr. geschriebener Papyruscodex aus Ägypten zum ersten Mal große zusammenhängende Textstücke des Menander, die uns drei seiner Komödien im griechischen Original zugänglich machten. Im Herbst 1958 wurde zum ersten Mal in vollem Umfang das griechische Original eines seiner Dramen bekannt, aus einem im 4. J h . n. Chr. 1 geschriebenen Papyruscodex ebenfalls aus Ägypten. Dieser war von der Bibliotheca Bodmeriana in Genf angekauft worden; das Stück wurde von Victor Martin entziffert, bearbeitet und zu der angegebenen Zeit publiziert mit einem vollständigen Faksimile und mit einer französischen Ubersetzung, nach der eine deutsche und eine englische hergestellt sind. Die Komödie trägt den Titel Avoy.oÄoq, den man nicht ganz ausreichend mit 'Griesgram' übersetzt, weil dadurch die Menschenfeindlichkeit und Grobheit der Titelfigur nicht zum Ausdruck kommt. Öffentliche Aufführungen des Stückes haben bereits in mehreren Ländern stattgefunden. Da der Text im Papyrus viele Fehler, auch manche Lücken aufweist und die Erstausgabe, deren sehr großes Verdienst keineswegs geschmälert werden darf, in der Textherstellung, wie das bei einer Erstausgabe gar nicht anders sein kann, nicht immer das Richtige oder Wahrscheinliche getroffen hat, ist seit der Publikation eine Fülle von Verbesserungsvorschlägen unter internationaler Beteiligung gemacht worden, von denen viele unter 3
Nicht in der 1.Hälfte des 3. Jhs., wie Martin p. 9 meint; s . E . G.Turner, Bull: Inst. Class. Stud. Univ. London Nr. 6 (1959) 64.
3
einander übereinstimmen und so meist die Richtigkeit gewährleisten. 1 Im Papyrusbuch gehen dem Text des Stückes eine kurze Inhaltsangabe in Versen voraus, ein Personenverzeichnis mit Angabe des Namens des Hauptdarstellers sowie einige Angaben, die auf das amtliche Protokoll der Aufführung zurückgehen. Daraus erfahren wir, daß der Dyskolos am Lenäenfest, d. h. im J a n u a r / Februar eines Archontenjahres, das wir als 317/6 bestimmen können, also i. J . 316 aufgeführt wurde und den 1. Preis erhielt. Menanderwar damals 25 Jahre alt. Das Stück umfaßt 969 Verse und ist in 5 Akte eingeteilt. Der Spielplatz ist die kreisrunde Orchestra des Dionysostheaters in Athen, noch nicht die erhöhte Bühne. Um nun den mir zugemessenen Zeitraum möglichst nicht zu überschreiten, glaube ich in der Weise verfahren zu sollen, daß ich zunächst die Ausgangssituation ausführlich darlege. Auf dieser Grundlage wird man imstande sein zu folgen, wenn ich den Handlungsverlauf ganz knapp nach den Hauptpunkten zusammenfasse. Wenn ich dann die anschließende Gesamtwürdigung begründe, wird man eine Reihe von Einzelpersonen kennenlernen und so das Gerippe des Handlungsverlaufs in gewissem Ausmaß mit Fleisch und Blut bekleiden können, und auf diese Weise werden Wiederholungen vermieden. Der Schauplatz liegt im gebirgigen Norden Attikas an einer Grotte, mit Quelle, des Gottes Pan und der Nymphen 2 ; in der Mitte der Szene diese Grotte, 1. vom Zuschauer das Haus des Bauern Knemon, eben des Dyskolos, r. das seines Stiefsohnes Gorgias, eines armen Bauernburschen. In einem Prolog stellt der Gott die Grotte als ein Heiligtum der Bewohner von Phyle vor, wo Leute wohnen, die es verstehen, felsigem Boden Ertrag abzugewinnen. Den nächsten Nachbarn 1 2
4
Durch gütige Zusendungen bin ich mehreren Autoren zu größtem Dank verpflichtet. S. Literaturangaben am Ende. Die Inschriften der Grotte: W. Peek, M A I 67 (1942/51) 59ff.
der Grotte, den Bauern Knemon, stellt er als einen menschenfeindlichen Griesgram 1 vor, der von niemand etwas wissen will. Wegen seines unerträglichen Verhaltens hat ihn seine Frau verlassen und ist zu ihrem Sohn Gorgias aus früherer Ehe zurückgekehrt, der auf der anderen Seite der Grotte sein Haus hat. Bei dem Alten ist seine Tochter und eine alte Magd zurückgeblieben. Die Tochter hat Gott Pan, wie er selbst erklärt, unter seinen Schutz genommen wegen ihrer Unschuld und Frömmigkeit, und er hat es gefügt, daß der Sohn einer reichen städtischen Familie, Sostratos, der auf der Jagd in die Gegend gekommen war, des schönen Mädchens ansichtig wurde, als sie gerade den Nymphen des Heiligtums Kränze darbrachte, und sich in die fromme Spenderin verliebte. Den Handlungsverlauf, über dessen Voraussetzungen uns der Gott unterrichtet hat, werde ich jetzt, wie angekündigt, in knappster Fassung der einzelnen Stufen vorführen. Sostratos, der bereits vor Beginn des Spiels seinen Jäger mit einem Heiratsantrag zum Vater des Mädchens geschickt hatte, muß mit ansehen, wie der Abgesandte von dem Alten, der sich in grimmigen menschenfeindlichen Expektorationen ergeht, unter Beschimpfungen und Steinwürfen verfolgt wird, und er selbst wird nach wenigen Worten stehengelassen. So ist sein erster Versuch gescheitert, die Heiratseinwilligung zu erhalten. Aber dann kommt es unverhofft zu einem ihn beglückenden Zusammentreffen mit dem Mädchen, das von seiner Liebe nichts weiß: die alte Magd hat einen Wasserkrug beim Heraufziehen in den Hofbrunnen fallen lassen, die Tochter ist auf dem Weg, Wasser aus der Nymphenquelle zu schöpfen, er nimmt ihr den Krug ab und gibt ihn ihr gefüllt zurück. Das hat der Sklave ihres Halbbruders gesehen, und am Anfang des 2. Akts hat er den Vorfall bereits seinem Herrn mitgeteilt, der auf böse Absichten des feinen jungen 1
E s ist ohne weiteres verständlich, daß das Stück nach einer Angabe vor dem Text i m Altertum auch unter dem Titel Miaav&Qamog umlief.
5
Mannes aus der Stadt schließt. Dem eben auftretenden Sostratos macht Gorgias ernsthafte Vorhaltungen, die der von dem redlichsten Vorhaben erfüllte Sostratos zurückweist, und die lange Auseinandersetzung endet mit einem Freundschaftsbund. Bemüht, nunmehr auf einem andern Weg das ersehnte Heiratsziel zu erreichen, nimmt Sostratos, der feine Städter,, entschlossen den Rat seines neuen Freundes an, mit der Hacke schwere Feldarbeit zu leisten, um sich so dem unzugänglichen Alten angenehm zu machen. Im Kontrast zu der ausgedehnten ernsthaften Szene folgt eine heitere Dienerszene. Dienerschaft der Familie des Sostratos zieht auf, um mit einem Koch Vorbereitungen zu einem Opfer mit folgendem Opferschmaus in der Grotte zu treffen. Die Veranstaltung ist durch einen bösen Traum der Mutter des Sostratos veranlaßt, der ihr ihren Sohn durch Gott Pan zu schwerer Feldarbeit verurteilt zeigte. Die Lustigkeit setzt sich zunächst im 3. Akt fort. Über das Getriebe an der Grotte und die Opfersitten schlägt Knemon ein Zetergeschrei auf, und dann hat er Zusammenstöße mit dem Sklaven des Sostratos und dem Koch. Inzwischen ist die schwere Feldarbeit des Sostratos, wie wir ihn bei seinem Wiederauftreten in einem Selbstgespräch erzählen hören, vergeblich gewesen, da der Alte sich nicht hat blicken lassen. Somit ist auch der zweite Vorstoß zur Erreichung des Ziels mißglückt. Einer ruhigen Überlegung zwischen Sostratos und seinem mit den Vorbereitungen zum Opferschmaus beschäftigten Sklaven Getas folgt eine stürmische Szene zwischen Knemon und seiner alten Magd, der bei dem Versuch, den in den Hofbrunnen gefallenen Krug mit Hilfe einer Hacke herauszuholen, durch das Reißen des Stricks auch die Hacke hinuntergefallen ist. Der 4. Akt beginnt mit verzweifeltem Hilfegeschrei der alten Magd, da Knemon, der selbst in den Brunnen gestiegen war, hinabgestürzt ist. Sein Stiefsohn Gorgias und Sostratos machen sich an die Rettung. Während dieser Zeit läßt der Koch seiner Schadenfreude über den Unfall des groben Alten freien Lauf. 6
Dann erzählt Sostratos, wie ihn die Gegenwart der Tochter beseligt hat, die während der Rettungsmaßnahmen in Angst um ihren Vater neben ihm am Brunnenrand stand. Der Gerettete aber faßt entscheidende Entschlüsse unter dem Eindruck des Verhaltens seines Stiefsohns, von dem er nie das geringste hat wissen wollen und der ihn jetzt gerettet hat. Er adoptiert diesen, übergibt ihm sein Vermögen und beauftragt ihn, die Tochter zu verheiraten. Sofort verlobt Gorgias seine Halb- und jetzige Adoptivschwester in feierlicher Form mit Sostratos. Das Hauptziel der Handlung ist erreicht, sie erfährt aber noch Vervollständigung im 5. Akt. Zum Schluß des vierten erscheint Sostratos' Vater Kallippides. Im letzten Akt erreicht Sostratos in Auseinandersetzung mit seinem Vater dessen Zustimmung zu einer zweiten Verlobung, der seiner Tochter, der Schwester des Sostratos, mit Gorgias, der seinerseits sich zuerst aus übersteigertem Ehrgefühl sträubt, die reiche Heirat einzugehen. Die Doppelhochzeit wird für den folgenden Tag verkündet. Zum Schluß toben sich der Koch und der Sklave des Sostratos an dem hilflosen Alten aus, dem sie wegen der Grobheiten böse sind, die er ihnen angetan hat. Der neue Fund hat keines der komplizierten Intriguenstücke gebracht, wie wir es vielleicht eher von Menander erwarten konnten nach dem, was uns von römischen Bearbeitungen seiner Stücke und bestimmten zusammenhängenden Originalbruchstücken bekannt ist. Ein einfacher und äußerlich harmloser Handlungsverlauf, in dem alles unmittelbar ineinandergreift. Der Anfang des zweiten Aktes schließt direkt an das Ende des ersten an, die Anfänge des dritten und fünften setzen geradezu die letzten Szenen des zweiten und vierten fort, nur der vierte beginnt damit, daß eine Überraschung hereinplatzt, deren Voraussetzungen sich kurz vor dem Ende des dritten ereignen. Darin, daß das Handlungsziel im vierten Akt, genauer in dessen zweitem Teil erreicht wird, stimmt der Dyskolos mit der Haupthandlung der Epitrepontes überein. Der Verlauf an sich ist auf komische 7
Wirkung angelegt: nichts spaßhafter, als daß nach dem Krug und der Hacke der Hausherr selbst in den Hofbrunnen fällt, als er beides herausholen will. Ein einfacher Verlauf, aber, wie sogar schon aus der knappen Wiedergabe hervorgeht, durchweg von äußerer und innerer Belebtheit in Handlung und Dialog, im Kontrast ernsthaft-ruhiger und lärmender Szenen. Die Verkündung der Doppelhochzeit am Ende der Haupthandlung hält das uralte, traditionelle Motiv des Komödienschlusses wenigstens im Wort fest: Auszug zu Hochzeit und Schmaus. Die Schlußszene, die lärmende Quälerei des Alten durch den Koch und den Sklaven, ist ein Gegenstück zu der freilich in unvergleichbar niedrigerer Sphäre spielenden Verhöhnung des Kupplers am Schluß von Plautus' Persa 1 , dessen griechisches Original unbekannt ist wie dessen Dichter, der wahrscheinlich der mittleren Komödie angehörte. Für einen menandrischen Komödienschluß ist die Schlußszene des Dyskolos nahezu eine Überraschung — nahezu. Denn die ausgelassenen Schlußszenen des plautinischen Stichus 2 , dessen Original Menanders Komödie *AöeX(poi war, das erste Stück dieses Titels, hatte F . Leo Menander abgesprochen, jedoch Webster, Studies in Menander 141, hat sie mit Wahrscheinlichkeit dem Dichter zuerkannt. Eine unmittelbare Übereinstimmung zwischen dem Schluß des Dyskolos und dem des Stichus liegt in den Rezitativversmaßen mit Flötenbegleitung und darin, daß Getas den (die) Flötenspieler(in) anredet und im Stichus die zechenden Sklaven den Flötenspieler trinken lassen — wobei sie, während er trinkt, in Senaren reden. Walther Kraus, der im Rhein. Mus. 102 (1959) 154ff. diese Dinge erörtert, meint, die Schlußszene sei wohl das bedeutendste Neue, das der Dyskolos gebracht hat; das möchte ich dahingestellt sein lassen. Mit den zwei Schlußversen 968f., die als fr. 616 Kock bekannt waren und die Wilamowitz und, mit Vorbehalt, Körte den Epi1
8
Bemerkt von Martin p. 7.
2
Bemerkt von Martin p. 7.
trepontes zugewiesen hatten, stimmen fast wörtlich überein, wie E.Vogt feststellt 1 , die Schlußverse vonPoseidippos' 'AnoxXeto/uevrj, die E. Siegmann aus einem Heidelberger Papyrus publiziert hat. 2 Mit Recht bezeichnet Vogt die Verse als stereotypen Dramenschluß der Nea und stellt sie in Analogie zu stereotypen Tragödienschlüssen des Euripides. Statt des iambischen Trimeters treten in zwei Szenen andere Versmaße ein; einmal (708—783) der trochäische katalektische Tetrameter für die Verkündung der entscheidenden Entschlüsse des Knemon und die Verlobung des Sostratos, während vorher Knemon und Gorgias in iambischen Trimetern reden (691—782); der genaue Einsatz ist in einer Lücke verloren. Es ist wohl zweifellos, daß damit das Bedeutungsvolle, das FeierlichEndgültige hervorgehoben werden soll. Wenn Menander dagegen in der Perikeiromene die ausgedehnte Anfangsszene des zweiten Akts zwischen Moschion und seinem Sklaven Daos v. 77—163 mit den Drohungen und Forderungen des ersteren und dem Erkundungsgang und nachfolgenden Bericht des letzteren und in der Samia die komisch wilde Aufgeregtheit der Szene zwischen Demeas und Nikeratos v. 202 in denselben Tetrametern gehalten hat, so läßt er den Trochäus seinem ursprünglichen Wesen gemäß das Lebhafte und Erregte ausdrücken, auch das Heitere. Das Versmaß ist also bei Menander mit demselben Doppelcharakter verwendet, der uns bei Euripides infolge der überaus häufigen Verwendung im letzten Jahrzehnt seines Schaffens klar nachweisbar entgegentritt; einerseits für den feierlichen Ausdruck wichtiger Angelegenheiten, andererseits für lebhafte und erregte Auseinandersetzungen (Jos. Kanz, De tetrametro trochaico 25, Diss. Giessen 1913). 1
2
Ein stereotyper Dramenschluß der Nea. Rhein. Mus. 102 (1959) 192. Literarische griechische Texte der Heidelberger Papyrussammlung (1956) 6f. Siegmann erkannte auch die Übereinstimmung mit fr. 616 Kock.
9
Zum andern vollzieht sich die Verhöhnung des Knemon in iambischen katalektischen Tetrametern (880—958); Getas, der die letzten Worte von 958 gesprochen hat, setzt plötzlich mit Trimetern ein, den Sieg über den Alten verkündend und so zum Ende überleitend, dann von Sikon abgelöst (959—69). Das Versmaß steht in tieferem Rang, wie daraus hervorgeht, daß es im Agon der alten Komödie dem zum Unterliegen Bestimmten zugeteilt ist. In der seltenen akatalektischen Form erscheint das Versmaß in dem lustigen Rätselraten zwischen Kyllene und Satyrchor in Sophokles' Spürhunden 290—320. Beherrscht wird die Handlung durch die Gestalt des Dyskolos. Durch sein Wesen verhindert er die Erreichung des Handlungszieles bis in den vierten Akt, und zugleich ist er es, der es herbeiführt, freilich ungewollt, als Folge des Unfalls, den er sich durch seinen abweisenden Eigensinn zuzieht, und dessen Ausgang ihm die Entschlüsse abringt, durch die er den. anderen, Angehörigen und Fremden, deren lastendes Schicksal er bisher war, den Weg frei macht. Die Charakterkomödie im Sinn der komisch-extremen Gestaltung eines bestimmten Charaktertypus, ein Urerzeugnis der Volksposse, ist uns, um jetzt von der dorischen Posse und Komödie zu schweigen, aus der alten attischen Komödie des 5. Jhs. v. Chr. bekannt, und gerade der Typus des Griesgrämigen ist wenigstens in gewisser Weise vorgebildet durch eine i. J . 414 aufgeführte Komödie MovoTQonog — 'Der Einzelgänger' — des Dichters Phrynichos; die daraus wohl nicht vollständig erhaltene Selbstcharakteristik der Hauptperson (fr. 18 K.) führt nahe an den Dyskolos heran. Über 'die Behandlung des Typus in einem ebenfalls Dyskolos betitelten Stück eines Dichters der Mittleren Komödie, Mnesimachos, können wir nach dem einen erhaltenen Fragment (fr. 3 K.) — Anrede der Hauptperson an einen Neffen — nur sagen, daß der Geiz eine ihrer Eigenschaften war. Zur Ausbildung dessen, was wir bei Menander finden, hat, wie Wolfg. Schmid bald nach dem Erscheinen der Publikation eingehend 10
nachgewiesen hat 1 , eine ebenfalls aus dem 5. J h . stammende Gestalt beigetragen, die legendenhafte des Menschenhassers Timon, des /Madv&QConog, der wie der Dyskolos unter Mühsal seinen felsigen Acker bearbeitet und von niemand etwas wissen will. Menander hat das ihm durch die Tradition der Komödie gegebene Charakterstück in seinem Schaffen in verschiedener Weise ausgestaltet, wie sich wenigstens für einige von den Dramen zeigen läßt, die wir dieser Gruppe zuweisen können, soweit es die Titel erlauben. Wie der Dyskolos, als extremer Typus mit komischer Wirkung dargestellt, am Ende eine moralische Aufhöhung erfährt, so geschieht es mit dem Geizigen in dem wohl kaum als menandrisch zu bezweifelnden Original von Plautus' Aulularia, wenn Jachmanns Auffassung des Schlusses dieses Stückes das Richtige trifft. 2 Dagegen im Heautontimorumenos, den wir durch Terenz' Bearbeitung kennen, hat Menander einen ernsten Typus geschaffen, der von vornherein nur ernste Behandlung zuläßt, einen neuen, für die Zeit des Dichters höchst charakteristischen Typus, der sich aus der Wirkung der peripatetischen Philosophie erklärt, wenn auch die Ursprungsverwandtschaft mit Monotropos und Dyskolos zutage liegt, und jedenfalls typologisch ein Fall jener durchgehenden Spaltung der Charaktertypen der neuen Komödie gegeben ist, jener Spaltung in lächerliche und tadelnswerte einerseits und ernsthafte und lobenswerte andrerseits. Die Gegenüberstellung eines solchen 1 2
Rhein. Mus. 102 (1959) 157ff. Plautinisches und Attisches, 138. — Zwischen Dyskolos und Aulularia bestehen im Äußeren einige sehr nahe Beziehungen, vor allem einerseits Gott Pan als Protektor der unschuldigen und frommen Tochter des Knemon, in die er den reichen Sostratos sich verlieben läßt, andrerseits der Lar familiaris als Protektor der frommen Tochter des Euclio, den er im Interesse der Tochter einen Schatz finden läßt; anderes muß hier beiseite bleiben. Aber bis in neueste Zeit vorgebrachte Annahmen eines engen Verhältnisses beider Stücke auf Grund der^Dyskolosfragmente sind durch den vollständigen Dyskolos zunichte geworden. Siehe darüber V. Martin in der Ausgabe S. 7 A. 1. 11
gegensätzlichen Paares hat Menander in dem zweiten Drama mit dem Titel "Aöehpoi' durchgeführt, das uns wieder in Terenz' Bearbeitung vorliegt. Da wird das Erziehungsprinzip des Gewährenlassens, das der eine Bruder bis zum äußersten Extrem vertritt, an ihm selbst ad absurdum geführt, der andere mit seinem strengen Prinzip ist zwar am Vollzug dieses Geschehens beteiligt, aber er hat die Enttäuschung erleben müssen, daß der tugendhaft geglaubte Sohn sich als Taugenichts entpuppt. So ist ein gewisser Ausgleich bewerkstelligt. Vom Aeiaiöai/xcov darf allein auf Grund von fr. 97 mit Zuversicht gesagt werden, daß der Abergläubische gewiß mit vielen lächerlichen Einzelzügen an den Pranger gestellt wurde. Über den Ton des K6ka£ ist trotz der etwas umfangreicheren Fragmente kaum Genaueres zu sagen, noch weniger über den des Miaoyvvrjg, Menanders schönsten Stückes nach dem Urteil des Grammatikers Phrynichos, und vom WoiXav&Qconia in E N 1155 a 16 ss. F ü r Theophrast wichtig F . Dirlmeier, D. Oikeiosis — Lehre des Theophrast S. 72 (Philologus, Suppl. 30, H. 1).
20
LITERATURANGABEN Der Literaturzusammenstellung in der kritischen Textausgabe von H . J . Mette, Menandros Dyskolos, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht 1960, S. 3f. kann ich folgende Arbeiten hinzufügen: Menandro, Dyskolos ovvero sia il Selvatico, testo e traduzione a cura di Carlo Diano, nPOArQNEZ, collezione di studi e testi. Testi I, Padova, Editrice Antenore 1960. Carlo Diano, Note in margine al Dyscolos di Menandro, Padova 1959. Note in margine al D. di M. Revisioni ed aggiunte, Maia N. S. X I (1959) 326 ss. S. Eitrem, Textkritische Bemerkungen, Symbolae Osloenses, fase. 35 (1959) 130ff. (ab 131 zum Dyskolos). F . C. Görschen, Zu Menanders Dyskolos, Dioniso N. S. 22 (1959) 3ff. B. A. van Groningen, Nouvelles notes sur le Dyscolos de Ménandre, Mnemosyne S. I V voi. 12 (1959) 289 ss. G. Pascucci, K I N H T I A N (Men. Dysc. 462) Atene e Roma, N. S. 4 (1959) 102 ss. W. Peek, Zum Dyskolos des Menander, Wissenschaf ti. Zeitschr. d. Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg, Gesellsch.-Sprachw. V i l i (1959) 1201 ff. L. Strzelecki, De Dyscolo Plautina, Giorn, Ital. di filologia 12 (1959) 306ff. E . Vogt, Ein stereotyper Dramenschluß der Néa, Rhein. Mus. 102 (1959) 192. G. Zuntz, Notes on the Dyscolos, Mnem. S. IV vol. 12 (1959) 298 ss. Menander, Dyskolos. Griechisch und deutsch mit textkritischem Apparat und Erläuterungen herausgegeben von Max Treu. E r n s t Heimerau Verlag, München o. J . (Tusculum-Bücherei).
21
GEORGE
THOMSON
Forschungen zur altgriechischen Gesellschaft Band I: Frühgeschichte Griechenlands und der Ägäis Übersetzung aus dem Englischen Deutsohe Ausgabe besorgt von Erich Sommerfeld 1960. XIV, 661 Seiten - 85 Abbildungen - 11 Karten - 3 mehrfarbige Tafeln - 18 Tabellen gr. 8° - Ganzleinen DM 3 8 , -
In diesem Werk unternimmt es Thomson, Professor für Altertumswissenschaft an der Universität Birmingham, das Vermächtnis der Antike in marxistischer Sicht zu deuten. So untersucht er im I. Band seiner „Forschungen zur altgriechischen Gesellschaft" die Voraussetzungen, die zur Herausbildung der für Hellas typischen Form des Staates, zur Polis, führten. Ausgehend von Morgan und Engels werden an H a n d umfangreicher völkerkundlicher und archäologischer Quellen in lebendiger und leicht verständlicher Form die Entwicklung der Gentilgesellschaft im östlichen Mittelmeer erörtert und neben den Gemeinsamkeiten mit anderen primitiven Völkerschaften, wie Totemismus und Matriarchat, die Besonderheiten der griechischen Stämme hervorgehoben. Den Kern des Werkes bilden Untersuchungen über das Entstehen und die Rolle der Dichtkunst sowie über das griechische Epos mit seinem Höhepunkt, den homerischen Gesängen.
Bestellungen durch eine Buchhandlung
A K A D E M I E - V E R L A G
•
erbeten
B E R L I N
B I B L I O T H E C A CLASSICA O R I E N T A L I S Dokumentation der altertumswissenschaftlichen Literatur der Sowjetunion und der Länder der Volksdemokratie Im Auftrage des Instituts für griechisch-römische Altertumskunde bei der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin Herausgegeben von Prof. Dr. J O H A N N E S I B M S C H E R , Berlin Zweimonatlich ein Heft mit 64 Seiten im Format 21 x 29,7 cm - Bezugspreis je Heft DM 4 , -
Die Wissenschaft vom griechisch-römischen Altertum, einst auf einige Länder Europas begrenzt, hat sich im Laufe der Zeit in der ganzen Welt verbreitet; Tausende von Veröffentlichungen erscheinen alljährlich auf ihren verschiedenen Zweiggebieten, und es gibt kaum eine Nation, die an dieser Arbeit nicht teilnimmt. Die Bibliographie und die Dokumentation gewinnen daher.auch für die Altertumskunde zunehmend an Bedeutung. Den Völkern Ost- und Südost-Europas kommt hierbei eine besondere Rolle zu, ist doch für die meisten von ihnen das klassische Altertum nicht nur Bestandteil ihrer Kultur, sondern zugleich auch Bestandteil ihrer Geschichte. Sie haben deshalb eine Altertumsforschung eigenen Gepräges entwickelt, die vor allem im letzten Jahrzehnt an Gehalt und Umfang gewachsen ist. An ihren Ergebnissen kann heute auch der Mitforscher im Auslande nicht mehr vorübergehen. Einer solchen Aneignung stehen freilich mancherlei Schwierigkeiten entgegen, namentlich solche des sprachlichen Verständnisses. Diese Schwierigkeiten zu beseitigen, die Fachwissenschaftler an die altertumswissenschaftliche Arbeit jener Länder heranzuführen und mit ihren Ergebnissen bekanntzumachen, ist die Aufgabe dieser Zeitschrift, die auf Beschluß der damaligen Kommission für griechisch-römische Altertumskunde bei der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin vom 14. Januar 1955 ins Leben gerufen wurde. Die „Bibliotheca classica orientalis" verzeichnet Buchpublikationen und Zeitschriftenbeiträge, die der klassischen Altertumswissenschaft und ihren Grenzgebieten angehören. Sie veröffentlicht über diese Arbeiten Autorreferate, die in gedrängter Darstellung den Inhalt nach Leitgedanken und Hauptthesen wiedergeben. Bestellungen durch eine Buchhandlung erbeten
A K A D E M I E - V E R L A G
•
B E R L I N
KLIO Beiträge zur alten Geschichte I n Verbindung mit Prof. Dr. Izabella Biezunska-Malowist, Prof. Dr. Boris Gerov, Prof. Dr. Jänos H a r m a t t a , Prof. Dr. Johannes Irmscher, Prof. Dr. Dionis M. Pippidi und Prof. Dr. Antonin Salac herausgegeben von W E R N E R H A R T K E (In Arbeitsgemeinschaft mit der Dieterich'schen Verlagsbuchhandlung GmbH., Wiesbaden) I m Auftrage des Instituts f ü r griechisch-römische Altertumskunde bei der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin erscheint nach langjähriger Unterbrechung die Zeitschrift „ K L I O , Beiträge zur alten Geschichte" wieder. Die Zeitschrift stellt sich, wie in ihrer Vergangenheit, die Aufgabe, Erkenntnisse und neue Forschungsergebnisse aus der antiken Welt zu verbreiten und dabei in gleicher Weise die Althistorie und die Archäologie, die griechisch-römische Antike und den Alten Orient zu berücksichtigen. Aufbauend auf der Tradition der alten K L I O , steht sie zugleich aufgeschlossen allen Problemen der Gegenwart in der Altertumswissenschaft gegenüber. Durch Untersuchungen, Forschungsberichte, Miszellen und wissenschaftliche Nachrichten wird die K L I O der althistorischen Arbeit in vielfältiger Weise zu dienen suchen. Es erscheint jährlich ein Band mit ca. 320 Seiten Umfang und Abbildungen Format 16,7 x 24 cm - zum Preise von DM 30, AUSWAHL Imrje Salomo: Roland F. Willets: Molly Miller: Fritz R. Wüst: Günter Dunst: 1). M. Pippidi: Kazimierz Kumaniecki: Hans Drezler: Werner Hartke: Boris Gerov: Ladislav Widmann: Georgi Mihailov: Earel Swoboda: Kazimierz Majewski:
DEE
ERSTEN
BEITRÄGE:
Burgfrieden in Sillyon The Myth of Glaukos and the Cycle of Birth and Death The Earlier Persian Dates in Herodotus Laconica Ein neues chiisches Dekret aus Eos Zur Geschichte Histrias im 3./2. Jhd. v. u. Ztr. Ciceros Rede de haruspicum responso Zur Geschichte Kaiser Othos bei Tacitus und Plutarch Der retrospektive Stil des Tacitus als dialektisches Ausdruckmittel Zwei neugefundene Militärdiplome in Nordbulgarien Die Mission Plinius des Jüngeren in Bithynien Contributions de l'histoire de Thrace et de Mesie Die klassische Altertumswissenschaft im vorrevolutionären Rußland Die neuesten polnischen Forschungen über das Problem von Kontakten des westlichen Slawentums mit dem römischen Imperium
Bestellungen durch eine Buchhandlung A K A D E M I E - V E R L A G
•
erbeten B E R L I N
DAS ALTERTUM Im Auftrage der Sektion, für Altertumswissenschaft bei der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin Herausgegeben von Prof. Dr. J O H A N N E S I R M S C H E R , Berlin Die Zeitschrift erscheint vierteljährlich mit 64 Seiten - 17 x 24 cm - mit Abbildungen Bezugspreis je Heft DM 3 , -
Die Sektion für Altertumswissenschaft bei der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin stellt sich mit dieser Zeitschrift die Aufgabe, Erkenntnisse über die alten Kulturen um das Mittelmeer zu verbreiten. Dabei werden die griechisch-römische Antike und der Vordere Orient gleichermaßen berücksichtigt. „Das Altertum" wendet sich an alle, die sich für die antiken Kulturen interessieren und an den Ergebnissen der Altertumsforschung Anteil nehmen, an den Fachgelehrten, Lehrer, Studenten und an die zahlreichen Freunde des Altertums in anderen Berufen. Die Zeitschrift behandelt die gegenwärtigen Probleme der Altertumswissenschaft und zeigt die Lösungsversuche, an denen die Forschung heute arbeitet.
Bestellungen durch eine Buchhandlung erbeten
AK A D E M I E - VE R L A G
•
B E R L I N
PHILOLOGUS Zeitschrift
für das klassische
Altertum
Im Auftrage des Instituts für griechisch-römische Altertumskunde bei der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin Herausgegeben von F R I E D R I C H Z U C K E R , Nationalpreisträger, Jena, WOLFGANG S C H M I D T , Bonn, und O T T O L U S C H A T , Berlin In Arbeitsgemeinschaft mit der Dieterich'schen Verlagsbuchhandlung GmbH., Wiesbaden Erscheinungsweise halbjährlich mit einem Umfang von ca. 160 Seiten je Doppelheft, im Format 17 x 24 cm - Bezugspreis je Doppelheft DM 1 4 , -
Die Zeitschrift bringt Aufsätze und kleinere Beiträge aus den verschiedenen Gebieten der Wissenschaft vom griechisch-römischen Altertum unter besonderer Berücksichtigung der sprachlichen und literarischen Seite der Forschung. Es werden hiermit Veröffentlichungen fortgesetzt, die während des über hundertjährigen Bestehens (von 1846—1944, nach Kriegsende erschien ein Band im Jahre 1948) große Bedeutung für die Wissenschaft hatten. Zur Zeit liegt der 104. Band vor. Bestellungen
durch eine Buchhandlung
AK A D E M I E - V E R L A G
•
erbeten
B E R L I N

![Der Fürst und der Bürger: Ein Drama in drei Aufzügen [Reprint 2019 ed.]
9783111500331, 9783111134307](https://ebin.pub/img/200x200/der-frst-und-der-brger-ein-drama-in-drei-aufzgen-reprint-2019nbsped-9783111500331-9783111134307.jpg)
![Heinrich Waser: Ein Drama in fünf Aufzügen mit Gesängen [Reprint 2019 ed.]
9783111479453, 9783111112497](https://ebin.pub/img/200x200/heinrich-waser-ein-drama-in-fnf-aufzgen-mit-gesngen-reprint-2019nbsped-9783111479453-9783111112497.jpg)
![Der entfesselte Prometheus: Ein Drama [Reprint 2020 ed.]
9783112375709, 9783112375693](https://ebin.pub/img/200x200/der-entfesselte-prometheus-ein-drama-reprint-2020nbsped-9783112375709-9783112375693.jpg)
![Codrus: Ein neulateinisches Drama aus dem Jahre 1485 [Reprint 2018 ed.]
9783110834468, 9783110003574](https://ebin.pub/img/200x200/codrus-ein-neulateinisches-drama-aus-dem-jahre-1485-reprint-2018nbsped-9783110834468-9783110003574.jpg)
![Karl der Kühne, Herzog von Burgund: Ein Drama in fünf Akten [Reprint 2022 ed.]
9783112629383](https://ebin.pub/img/200x200/karl-der-khne-herzog-von-burgund-ein-drama-in-fnf-akten-reprint-2022nbsped-9783112629383.jpg)
![Schill: Ein Drama in fünf Akten [Reprint 2021 ed.]
9783112394045, 9783112394038](https://ebin.pub/img/200x200/schill-ein-drama-in-fnf-akten-reprint-2021nbsped-9783112394045-9783112394038.jpg)