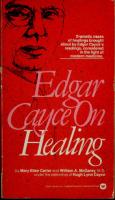Edgar Wind - Kunsthistoriker und Philosoph [Reprint 2015 ed.] 9783050075310
Edgar Wind (1900-1971) gehört zu jenem kleinen Kreis von Gelehrten um Aby Warburg, die große Kunsthistoriker und zugleic
253 78 49MB
German Pages 279 [280] Year 2015
Vorwort der Herausgeber
I BIOGRAPHISCHE ERINNERUNG
II ZUR KUNST
„Frisch weht der Wind“. Reynolds und das parodistische Porträt
Heroisierte Porträts? Edgar Wind und das englische Bildnis des 18. Jahrhunderts
Die Bildersprache Michelangelos. Edgar Winds Auslegung der Sixtinischen Decke
Pascal Griener: Edgar Wind und das Problem der Schule von Athen
Das Paradigma der Interpretation in Edgar Winds Die heidnischen Mysterien der Renaissance
Kunst als Kritik. Edgar Wind und das Symposium Art and Morals
Drei Ebenen von Platons Höhle: Wiederbegegnung mit Edgar Winds Art and Anarchy
III PHILOSOPHIE DER VERKÖRPERUNG
Kunst und Wissenschaft in Edgar Winds Philosophie der Verkörperung
Anhang: Edgar Winds Kurse in Chapel Hill und am Smith College
Falsche Skischwünge. Winds Kritik an Heidegger und Sartre / Anhang: Edgar Winds Kritik an Heidegger und Sartre und die Reaktionen
Zur Begründung der Kulturwissenschaft. Der Symbolbegriff bei Friedrich Theodor Vischer, Aby Warburg und Edgar Wind
IV DOKUMENTE
Metaphysik und Bilder. Ein Gespräch mit Pierre Hadot
Bild und Text
Die Autoren
Register
Recommend Papers
![Edgar Wind - Kunsthistoriker und Philosoph [Reprint 2015 ed.]
9783050075310](https://ebin.pub/img/200x200/edgar-wind-kunsthistoriker-und-philosoph-reprint-2015nbsped-9783050075310.jpg)
File loading please wait...
Citation preview
Edgar Wind Kunsthistoriker und Philosoph
Einstein Bücher
Edgar Wind Kunsthistoriker und Philosoph
Herausgegeben von Horst Bredekamp, Bernhard Buschendorf, Freia Härtung und John Michael Krois
Akademie Verlag
Titelabbildung: Detail aus Raffael „Schule von Athen" Redaktion: Freia Härtung
Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme Edgar Wind - Kunsthistoriker und Philosoph / hrsg. von Horst Bredekamp Berlin : Akad. Verl., 1998 (Einstein-Bücher) ISBN 3-05-003298-7
Gedruckt mit Unterstützung der Stiftung Preußische Seehandlung, Berlin
© Akademie Verlag GmbH, Berlin 1998 Der Akademie Verlag ist ein Unternehmen der R. Oldenbourg-Gruppe. Das eingesetzte Papier ist alterungsbeständig nach DIN/ISO 9706. Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form - durch Photokopie, Mikroverfilmung oder irgendein anderes Verfahren - reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden. Satz: Werksatz Schmidt & Schulz, Gräfenhainichen Druck und Bindung: Druckerei zu Altenburg Printed in the Federal Republic of Germany
Für Margaret Wind
Inhalt
Vorwort der Herausgeber
I
IX
BIOGRAPHISCHE ERINNERUNG James McConica: Edgar Winds Oxforder Jahre
II
3
Z U R KUNST Bruce Redford: „Frisch weht der Wind". Reynolds und das parodistische Porträt 13 Werner Busch: Heroisierte Porträts? Edgar Wind und das englische Bildnis des 18. Jahrhunderts 33 Elizabeth Sears: Die Bildersprache Michelangelos. Edgar Winds Auslegung der Sixtinischen Decke 49 Pascal Griener: Edgar Wind und das Problem der Schule von Athen
77
Michael Lailach: Das Paradigma der Interpretation in Edgar Winds Die heidnischen Mysterien der Renaissance 105 Christa Buschendorf: Kunst als Kritik. Edgar Wind und das Symposium Art and Morals 117 Philipp Fehl: Drei Ebenen von Piatons Höhle: Wiederbegegnung mit Edgar Winds Art and Anarchy 135
VIII III
Inhalt PHILOSOPHIE DER VERKÖRPERUNG John Michael Krois: Kunst und Wissenschaft in Edgar Winds Philosophie der Verkörperung / Anhang: Edgar Winds Kurse in Chapel Hill und am Smith College 181 Horst Bredekamp: Falsche Skischwünge. Winds Kritik an Heidegger und Sartre / Anhang: Edgar Winds Kritik an Heidegger und Sartre und die Reaktionen 207 Bernhard Buschendorf: Zur Begründung der Kulturwissenschaft. Der Symbolbegriff bei Friedrich Theodor Vischer, Aby Warburg und Edgar Wind 227
IV
DOKUMENTE Pierre Hadot: Metaphysik und Bilder. Ein Gespräch mit Pierre Hadot Edgar Wind: Bild und Text
Die Autoren Register
265
263
259
251
Vorwort der Herausgeber
Edgar Wind (1900-1971) gehörte zu jenem Kreis von Gelehrten der Kulturwissenschaftlichen Bibliothek Warburg, die große Kunsthistoriker oder bedeutende Philosophen waren. Er selbst war beides zugleich. Die im vorliegenden Band gesammelten Aufsätze gehen größtenteils auf ein Symposium zurück, welches das Einstein Forum in Potsdam dem Gelehrten im Februar 1996 gewidmet hatte. Die Beiträge zeichnen Winds intellektuellen Lebensweg und die Stationen seines Œuvres nach, beginnend mit seiner Anknüpfung an Warburgs Symboltheorie und der in der Habilitationsschrift (1934) formulierten Philosophie der Verkörperung, die seinen Bruch mit dem mainstream der akademischen Philosophie bezeichnet. Von Winds radikaler Ablehnung der Philosophie Heideggers und Jaspers' als einer der philosophischen Verdunklung, die in den Faschismus übergeht und die nach seiner Auffassung im Existentialismus wieder erscheint, ist selbst noch sein Hauptwerk von 1958, Heidnische Mysterien in der Renaissance, geprägt. Dem steht seine Bemühung gegenüber, die Zeichentheorie von Charles S. Peirce als erster deutscher Philosoph fruchtbar zu machen. Edgar Winds Studien zur englischen Kunst und Kultur des 18. Jahrhunderts, denen zwei Beiträge gewidmet sind, markieren sowohl die durch die Emigration alsbald gebotene Hinwendung zu neuen Forschungsfeldern, so etwa dem „Zitat" in der englischen Porträtmalerei, wie auch die Schwierigkeit, zwischen der noch im Hamburger Warburgkreis entwickelten theoretischen Grundlegung und der praktischen Behandlung des neuen Stoffes zu vermitteln. Winds Ausführungen zur modernen Kunst, dies zeigt ein weiterer Beitrag, geben Anlaß zu Reflexionen über Wahrheit und Unwahrheit in der modernen Einbildungskraft, also über das Dilemma des verlorenen Mythos, wie es in Kunst und Anarchie antizipiert ist. Aus dem Nachlaß werden erstmals die beiden unvollendet gebliebenen groß angelegten Studien über Michelangelos Sixtinische Decke und Raffaels Schule von Athen ausführlich erläutert und im Rahmen von Winds über dreißigjähriger Beschäftigung mit diesen Gegenständen im Kontext seines Werkes betrachtet. Schließlich zeigen die persönliche Erinnerung eines Weggefährten der Oxforder Jahre sowie eine Studie zu dem legendären, von Edgar Wind während der
X
Vorwort
McCarthy-Ära organisierten Symposium zur moralischen Dimension der Kunst nochmals das Zusammenspiel von Gelehrsamkeit und Verantwortung. Dokumente (u.a. Winds Heidegger- und Sartre-Kritik), ein Interview, das für Winds in den Heidnischen Mysterien angewandte Interpretationsprinzip plädiert, d. h. für die Rekonstruktion des geistigen Universums einer Epoche mithilfe von Kunstwerken, literarischen und philosophischen Textquellen, sowie ein Text Edgar Winds, der einen frühen Entwurf der Einleitung zu den Heidnischen Mysterien in der Renaissance präsentiert, bieten zusätzlich bislang unbekannte oder verschollene Materialien. Die Herausgeber hoffen, daß diese Texte mit den übrigen Beiträgen neues Licht auf einen „Klassiker" der Kunstgeschichte und einen bedeutenden Denker werfen, der vielleicht wie kein zweiter die Prägung Aby Warburgs mit der angelsächsischen Philosophie zu verbinden verstand. Wir danken an dieser Stelle allen, die am Zustandekommen des Buches mitgewirkt haben: den Autoren für die Überlassung ihrer Beiträge, der Stiftung Preußische Seehandlung, die die Veröffentlichung durch einen Druckkostenzuschuß gefördert hat, sowie Dr. Wolfgang Beyrodt, Kunstgeschichtliches Institut der Freien Universität Berlin, der bei der Beschaffung der Literatur behilflich war. Die Herausgeber
I BIOGRAPHISCHE ERINNERUNG
Edgar Winds Oxforder Jahre James
McConica
Edgar Wind erhielt die Professur für Kunstgeschichte in Oxford im Jahr 1955. Er war der erste Inhaber dieses Lehrstuhls, den er bis zu seiner Emeritierung 1967 innehatte, und blieb in Oxford bis zu seinem Tod 1971. Die Geschichte dieser Jahre möchte ich hier kurz behandeln: die Umstände, die ihn überhaupt nach Oxford führten, die Situation, die er vorfand, und die Leistungen, die er dort vollbrachte. Es ist eine bemerkenswerte und in mancher Hinsicht vielleicht sogar überraschende Geschichte. Aus den Gesprächen auf dieser Konferenz ist mir klar geworden, daß man vielleicht annehmen könnte, Oxford sei ein natürliches, empfängliches und anregendes Klima für die geistigen Interessen Edgar Winds gewesen. Tatsächlich aber läßt sich kaum eine Vorstellung denken, die stärker in die Irre führt, und so muß ich wenigstens versuchen, einen zusammenfassenden Bericht über das akademische Milieu zu geben, in das er damals geriet. Der Lehrstuhl für Kunstgeschichte wurde in der Fakultät für Neue Geschichte eingerichtet. Dies war fraglos seine natürliche Heimat, und eine andere Lösung wäre undenkbar gewesen. Dennoch offenbaren die Bezeichnung des Lehrstuhls und seine akademische Situierung bereits ein Problem. Edgar Wind war - wie ja auch dieses Symposium bestätigt - kein Kunsthistoriker im üblichen Sinn, oder er war dies vielmehr nur gelegentlich. Er war Kulturhistoriker von einer Art, wie sie dem akademischen Leben Englands, also auch dem Oxfords, völlig fremd war. Nur in den Zusammenkünften der Vertriebenen im Warburg Institute, um dessen Etablierung in England sich Wind so verdient gemacht hatte, waren seine Methoden und Schwerpunkte überhaupt bekannt. Dennoch war es unvermeidlich, daß er als „Kunsthistoriker" verstanden wurde. In Oxfords historischer Fakultät, die beherrscht war von den politischen und verfassungsrechtlichen Orientierungen, wie sie von Bischof Stubbs im 19. Jahrhundert so fest etabliert worden waren, wurden die arcana der Kulturgeschichte, sofern sie überhaupt zur Kenntnis genommen wurden, von vielen als fragwürdig, wenn nicht gar betrügerisch, zweifellos aber als exotisch betrachtet. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich absolvierte mein Grundstudium an dieser Fakultät von
4
I Biographische
Erinnerung
1951 bis 1954 und kehrte 1959 zum Promotionsstudium nach Oxford zurück. Obgleich ich an meiner aima mater in Kanada von einem Lehrer (selbst ein Absolvent von Oxford und früherer Rhodes-scholar) unterrichtet, ja inspiriert worden war, der sich selbst entschieden als „Kulturhistoriker" bezeichnete, war ich überrascht und zunächst tief enttäuscht darüber, daß eine solche Bezeichnung von meinen Tutoren in Oxford bestenfalls als Affektiertheit und schlimmstenfalls als Flucht vor ernster Wissenschaft betrachtet wurde. Einige Jahre später wurde ich von einer ranghohen Persönlichkeit der Universität nach meinen Interessen gefragt und als ich etwas schüchtern sagte, daß ich — wie ich glaubte - an „Ideengeschichte" interessiert sei, wurde mir die Antwort zuteil: „Ideen? - Ich hasse Ideen!" Die Oxforder Historiker jener Generation begeisterten sich in erster Linie für die Neuentdeckung des englischen Mittelalters, wie sie insbesondere unter der Ägide des damaligen Regius-Professors für Neue Geschichte, F. M. Powicke, betrieben wurde. Dies war keine Kleinigkeit und hatte einen tiefgreifenden und vorteilhaften Wandel im Studium mittelalterlicher Geschichte nicht nur in Oxford, sondern unter dem Einfluß der in Oxford ausgebildeten und an andere Universitäten berufenen Mediävisten in ganz Großbritannien zur Folge. Doch bewegte sich dieses Studium im großen und ganzen noch im vertrauten Rahmen der Institutionengeschichte - derjenigen von Kirche und Parlament - , die die Geschichtswissenschaft in Oxford bereits mehr als ein Jahrhundert lang bestimmt hatte. Natürlich gab es unter den Historikern, wie wir sehen werden, auch Ausnahmen, und sie spielten in der Geschichte, die ich nun erzählen werde, eine entscheidende Rolle. Wenn dies die Lage in Geschichte war, wie stand, es dann mit der Philosophie, der Edgar Wind seine zweite Prägung verdankte (wobei ich davon ausgehe, daß die klassische Tradition beiden Disziplinen gemein war)? Im Oxford der 50er Jahre gingen die intellektuellen Impulse in den Geisteswissenschaften zweifellos von der Philosophie aus. Und bei den Philosophen paarte sich das Mißtrauen der Historiker gegen alles, was auch nur entfernt nach teutonischer Ideen- oder Geistesgeschichte roch, mit einer noch tiefer verwurzelten Wertschätzung der empiristischen Tradition eines Locke oder Hume, die nun ironischerweiser durch eine deutsche Quelle, nämlich durch die begeisterte Rezeption der Philosophie Wittgensteins verstärkt wurde. Daher hatte man in Oxford so gut wie kein Interesse an der philosophischen Welt von Winds Lehrer Ernst Cassirer oder an anderen nachhegelianischen Ansätzen, aus denen die geistigen Wurzeln von Edgar Winds eigener Philosophie in erster Linie Nahrung zogen. Wie war es, so mögen Sie fragen, unter diesen Voraussetzungen möglich, daß Wind überhaupt nach Oxford kam. Seine Berufung ist dem Interesse und der Beharrlichkeit einer kleinen Schar einflußreicher dons zu verdanken, von denen einige - wie ich zu meiner Freude sagen kann - aus meinem College kamen. Winds philosophisches Interesse an David Hume hatte ihn 1929 nach London geführt, und aus diesem Besuch ging seine erste eingehende Analyse von Werken der bildenden Kunst hervor: Humanitätsidee und heroisiertes Porträt in der englischen
J. McConica:
Edgar Winds Oxforder Jahre
5
Kultur des 18. Jahrhunderts. Zumindest zwei der Gelehrten, die er damals kennenlernte, sollten für den weiteren Verlauf der Ereignisse wichtig werden: der Altphilologe Richard Livingstone und der Professor für mittelalterliche Geschichte Ernest Jacob. Livingstone wurde zwei Jahre später geadelt und sollte alsbald Präsident des Corpus Christi College in Oxford werden; Jacob hatte den ChicheleLehrstuhl für Neue Geschichte am All Souls College inne. Zusammen mit anderen englischen und deutschen Gelehrten nahmen sie im Jahr darauf an einer Vortragsreihe über England und die Antike der Kulturwissenschaftlichen Bibliothek Warburg in Hamburg teil. Beide Engländer waren beeindruckt von der Bibliothek mit ihrem Schwerpunkt auf dem interdisziplinären Charakter der Geisteswissenschaften, insbesondere aber vom betont kulturwissenschaftlichen Zugang zur Kunstgeschichte, wie er schon aus der Anordnung der Bücher hervorging. Als Wind im kritischen Jahr 1933 nach London zurückkehrte und die Verhandlungen aufnahm, die schließlich zum Transfer der Bibliothek nach London führten, holten Livingstone und Jacob ihn zu eingehenden Gesprächen nach Oxford. Damals machte er eine weitere entscheidende Bekanntschaft in der Person von Maurice Bowra vom Wadham College, einem Altphilologen mit beträchtlichem politischen Einfluß in der Universität, auf den viele der innovativen und folgenreichen Berufungen aus der Zeit unmittelbar nach dem zweiten Weltkrieg zurückgingen. Auch die Unterstützung durch den Mediävisten Ernest Jacob verdient Beachtung. Obwohl er vor seiner Rückkehr nach Oxford (wo er sein Studium begonnen hatte) einen Lehrstuhl in Manchester innehatte und daher mit der damals wichtigsten Schule der Institutionengeschichte identifiziert wurde, erstreckten sich Jacobs Forschungen zum Mittelalter auch auf andere Gebiete: die Geschichte des Konziliarismus und die italienische Renaissance. Die Italian Renaissance Studies, die er organisierte und 1960 herausgab, lassen sich als Versuch verstehen, das Werk verschiedener englischer Gelehrter von Rang auf diesem Gebiet zu versammeln und angemessen zu würdigen, darunter Denys Hay, Roberto Weiss, Nicolai Rubinstein, Daniel Bueno de Mesquita, Maurice Bowra, Cecil Grayson, Ε. H. Gombrich und auch Edgar Wind. 1954, im Jahr vor der endgültigen Einrichtung des Lehrstuhls, wurde Edgar Wind gebeten, die Chichele Lectures am All Souls College zu halten. Es handelt sich dabei um eine jährliche Reihe von Vorlesungen zu einem Thema, das vom College für diesen Anlaß ausgesucht wird. Winds Vorlesungen fanden im November statt und waren dem Thema „Art and Scholarship under Julius II" gewidmet. Sie waren offenbar ein öffentlicher Test seiner Eignung für die Berufung an eine Universität, an der lange Zeit tiefe Skepsis hinsichtlich der Respektabilität von Kunstgeschichte als akademisches Fach geherrscht hatte. Sie waren ein sensationeller Erfolg, und man kann mit Fug und Recht behaupten, daß die Einrichtung des Lehrstuhls mit Wind als erstem Inhaber von diesem Zeitpunkt an feststand. All Souls war aus vielen Gründen der richtige Ort für ein solches Experiment und inzwischen war die Schar von Edgar Winds dortigen Förderern gewachsen und
6
I Biographische
Erinnerung
umfaßte Namen wie Isaiah Berlin, Stuart Hampshire und John Foster, ein einflußreicher Anwalt, der in den Vereinigten Staaten entscheidende Vermittlungsdienste zugunsten der Bibliothek Warburg geleistet hatte. Ein anderer fellow am All Souls College war Charles Montieth, der spätere Leiter des Verlags Faber and Faber, mit dem Wind bereits seit 1953 im Gespräch über einen Publikationsvertrag für die Pagan Mysteries in the Renaissance stand. Schließlich und vor allem war an All Souls auch noch Jean Seznec, der Inhaber des Marshall Foch-Lehrstuhls für französische Literatur und vielleicht der einzige Oxforder Gelehrte, dessen Werk, repräsentiert durch La Survivance des dieux antiques, den Interessen Winds zumindest entfernt geistesverwandt war. Er wurde vom einzigen lebenden Zeugen, dem es zusteht, dies zu sagen, in einer liebenswürdigen Wendung als „der unentbehrliche Götterbote" bezeichnet. Nachdem die Berufung schließlich erfolgt war, blieb die Realität. Der Inhaber des neuen Lehrstuhls erhielt ein Büro gleich neben dem Ashmolean Museum mit seiner Library of Fine Art, die damals eine reine Museumsbibliothek war und deren bemerkenswerte Bestände dementsprechend benutzt zu werden pflegten. 1 Wind stürzte sich in die Aufgabe, eine völlig neue Bibliothek für das Studium der Ikonographie und eine große Sammlung von Dias und Photographien abendländischer Kunst aus der ganzen Welt zusammenzustellen. Diese Aufgaben waren nur die Spitze des Eisbergs - vielleicht eine besonders treffende Metapher im diesem Zusammenhang. Neben vielen anderen Dingen ließe sich etwa nennen: das Fehlen von College-Tutoren im Fach, der Mangel an Lehrpersonal und die ständigen finanziellen Probleme der Abteilung während seiner gesamten Amtszeit. Gleichzeitig bot ihm jedoch sein fellowship am Trinity College Heim und Rückhalt in Oxford, erwiesen sich doch seine fellows als besonders hilfreich, wenn es galt, die Schwierigkeiten des Lebens in einer akademischen Umgebung zu bewältigen, die sich von allem, was er bis dahin kennengelernt hatte, grundlegend unterschied. Trotz all dieser Widrigkeiten leistete er Erstaunliches. Er hatte das fertige Manuskript der Pagan Mysteries mitgebracht und setzte die Arbeit an seinem Werk über Michelangelo fort, das bei seinem Tod noch nicht vollendet war. Er veranstaltete Seminare gemeinsam mit John Sparrow („Einige Renaissance-Gedichte und ihre bildlichen Gegenstücke"), Stuart Hampshire (zwei Kurse über „Probleme der Ästhetik": „Kants Kritik der Urteilskraft" und „Hegel und nachhegelianische Theorien"), Humphrey Sutherland („Medaillen der Renaissance") und Austin Gill
1
Die Situation, der sich die vier Professoren für Kunst und Archäologie im Ashmolean Museum konfrontiert sahen, wird von Bernard Ashmole, dem 1954 neuernannten Lincoln Professor für Archäologie, in seiner Autobiographie beschrieben. Neben Wind und Ashmole handelte es sich um Christopher Hawkes (Europäische Archäologie) und Ian Richmond (Archäologie des Römischen Reichs). Gemeinsam verfaßten sie die umstrittene Denkschrift „Memorandum of the Four Professors". Siehe D o n n a Kurtz (ed.), Bernard Ashmole, an Autobiography 1894-1988 (Oxford 1994), S. 137-8.
J. McConica: Edgar Winds Oxforder Jahre
7
(„Manet und Mallarmé"). Wichtig ist ferner, daß er den Mediävisten Κ. B. McFarlane dabei unterstützte, seine entscheidende Entdeckung des Todesdatums von Sir John Kidwell auszuwerten, was zur Umdatierung von Memlings Donne-Triptychon führte. Es ist zu bezweifeln, daß McFarlanes Entdeckung ohne Edgar Winds Unterstützung und seinen großen internationalen Einfluß ausgewertet worden wäre, wenigstens nicht vom Entdecker selbst. Diese Arbeitsgemeinschaft ist auch als solche interessant. Zwar dürfte der nüchterne McFarlane in den Augen vieler der Inbegriff all dessen gewesen sein, was in der in Oxford herrschenden Geschichtsauffassung dem interdisziplinären Denken Edgar Winds entgegenstand, doch war er ein überaus gebildeter Mann mit einem ausgeprägten Interesse für Malerei. Indessen war beiden noch eine andere Eigenschaft gemein, die möglicherweise wichtiger war: ein untrügliches Auge für das verräterische Detail und die Fähigkeit, all seine Implikationen zu erfassen. Freilich waren es Edgar Winds öffentliche Vorlesungen, durch die sich sein Ruf in Oxford geradezu verklärte. Dieser Vorlesungen zu gedenken heißt, des Anbruchs einer völlig neuen Ära im geistigen Leben der Universität zu gedenken. Deren erste, im Herbsttrimester 1955, war dem Thema „Sir Joshua Reynolds: Gemälde und Diskurse" gewidmet. Ihr folgten im nächsten Trimester „Illustrationen zu Piaton" und im Trimester darauf „Die theologischen Quellen Michelangelos". Das nächste akademische Jahr begann mit „Leonardo da Vinci", gefolgt von einer Vorlesung über „Moderne Kunst" - die erste ihrer Art an der Universität - , und im Jahr darauf lautete das Thema „Die antiken Quellen Botticellis". Zwar fanden daneben auch Seminare und Übungen zu anderen oder verwandten Themen statt, doch kam Winds Begabung als genialer Lehrer am offenkundigsten in seinen Vorlesungen zur Geltung. Seine letzte Vorlesung im Sommertrimester 1967 behandelte „Raffaels Schule von Athen". Bereits ein Jahr nach seiner Berufung, im Herbsttrimester 1956, ging er dazu über, seine Vorlesungen zu wiederholen, da der Hörsaal im Ashmolean für den Andrang der Menge zu klein war. Nach einem vergeblichen Versuch, das Problem durch Verlegung der Vorlesung in die Taylorian Library zu lösen, las er ab Herbsttrimester 1957 regelmäßig im Playhouse Theatre, dem größten verfügbaren Raum, in dem die Projektion von Dias möglich war. Selbst dort mußten die Vorlesungen häufig wiederholt werden, und die Schlangen von Studenten, die die ganze Beaumont Street hinab anstanden, um bei Öffnung des Theaters einen Platz zu ergattern, wären heute nur bei einem Rockstar denkbar. Die Vorlesungen waren Darbietungen eines Virtuosen, in denen das projizierte Bild den Text lieferte und der Professor für Kunstgeschichte ohne Manuskript oder eine einzige Notiz seine Deutung entwickelte. Edgar Wind auf der Bühne im abgedunkelten Theater - nur vom reflektierenden Licht der Leinwand erleuchtet, wie er mit Hilfe des projizierten Pfeils aus dem Leuchtstab in seiner Hand das Bild analysiert - dies wird allen, die es erlebt haben, unauslöschlich im Gedächtnis bleiben. Die souveräne Beredsamkeit, das breite Spektrum von Gelehrsamkeit, die
8
I Biographische
Erinnerung
skrupulöse Beachtung des Details, die Fülle kultureller Anspielungen, der nie stockende Redefluß bei zuweilen langen und komplizierten Zitaten, all das kam zusammen, um die Zuhörer zu überwältigen und ihre Einbildungskraft und intellektuelle Neugierde zu erregen. Das war zweifellos Geschichte der abendländischen Kunst in Vollendung. Unausgesprochen war es auch eine Kritik nicht nur an der Form, in der Geschichte im allgemeinen gelehrt wurde, sondern - durch den Brückenschlag zwischen den Disziplinen - auch an der etablierten geisteswissenschaftlichen Fakultätsstruktur. Ich habe bei anderer Gelegenheit gesagt, daß Edgar Wind in jenen Jahren als eine prophetische Figur erschien, deren besonderes Genie uns ein intellektuelles Land der Verheißung wies, das er selbst nicht mehr erleben würde. Und ich wagte zu behaupten, daß er der Typus des gehörnten Moses sei, unbeugsam und gebieterisch, seine Stirn strahlend von der Schekina der eigenen Vision, und jederzeit bereit, mit den Zaudernden und Verstockten anzubinden. Unter ihnen, so muß gesagt werden, fanden sich ganz gewöhnliche, humanistisch ausgerichtete Kunsthistoriker, denen er zuweilen ein verwirrender, um nicht zu sagen alarmierender Bundesgenosse war. Zum Vermächtnis jener Jahre gehört als bedeutendstes Denkmal die Bibliothek, die er für das interdisziplinäre Studium der Kunstgeschichte und insbesondere das der Ikonographie schuf. Die Sammlung umfaßt zahlreiche seltene Ausgaben und andere Primärquellen, von denen einige unlängst (1994) in einer Ausstellung des Ashmolean Museum mit dem Titel „The Vitruvian Path" gezeigt wurden. Dazu zählen außerdem noch 33000 Photographien und 20000 Dias, die sich zur Zeit seiner Emeritierung im Besitz der Abteilung befanden. Eine vielleicht weniger greifbare, nichtsdestoweniger aber bedeutende Leistung war die 1961 ad hoc erfolgte Einrichtung der Abteilung und der Disziplin selbst. Es war dies das letztendliche Resultat eines langen und beharrlichen Bemühens um Dinge wie die nicht definierte Beziehung der vier Professoren für Archäologie und Kunst zum Ashmolean Museum und die Trennung der Bibliothek vom Museum - all das führte schließlich zu der allgemein akzeptierten Auffassung, daß das Museum als Lehrinstitution wie auch als Sammlung verstanden werden könne. Es sieht so aus, als könnten wir heute die Ernte all dieser Bemühungen erleben. Die Initiative der Universität Oxford, ein Zentrum für das Studium der Klassik einzurichten, das die Bestände des Ashmolean Museum mit den Bibliotheken und Sammlungen der Klassischen Philologie und der Kunstgeschichte vereint, gemahnt an die nur schwer definierbare Vision einer geisteswissenschaftlichen Fakultät', wie sie von Edgar Wind als natürliche Konsequenz seiner Methode und seines Werks verkündet wurde. Unterdessen bleibt die Wohnung in Belsyre Court, lichterfüllt und voller Bücher, der zwanglose Treffpunkt für nachfolgende Generationen von Wissenschaftlern aus aller Welt, die angezogen werden von der Kastellanin und vom Archiv des Werks von Edgar Wind. Sie finden hier, sorgfältig katalogisiert, seine Korrespondenz und andere persönliche Dokumente, unveröffentlichte Manu-
J. McConica: Edgar Winds Oxforder Jahre
9
skripte, eine Bibliographie seiner publizierten Schriften sowie eine Vielfalt verwandter Materialien. Ferner steht hier auch seine Privatbibliothek mit Schätzen wie dem von John Pine illustrierten Horaz (1733), Renaissance-Ausgaben der Werke von Pico, Ficino und Polizian, Emblembüchern, der illustrierten Ausgabe von Addisons „Dialogue on the Usefulness of Ancient Medals" von 1721 und dergleichen mehr. Hier ist die Schekina noch gegenwärtig: Hüterin eines seltenen Vermächtnisses und einer in die Zukunft weisenden Inspiration. Aus dem Englischen von Bernhard und Christa
Buschendorf
II Zur Kunst
„Frisch weht der Wind": Reynolds und das parodistische Porträt Bruce Redford
Mein Thema ist die Vielschichtigkeit der Anspielung in der britischen Kultur des 18. Jahrhunderts unter besonderer Berücksichtigung der Porträts von Sir Joshua Reynolds. Beginnen möchte ich aber im 20. Jahrhundert, und zwar mit einem bedeutenden Satiriker und Dramatiker, Alan Bennett nämlich, unlängst erschien von ihm The Madness of George III. Seine Karriere nahm ihren Anfang teils an der Universität, teils am Theater: als Edgar Wind Professor in Oxford war, hat Bennett dort an seinem Ph. D. gearbeitet und als Ko-Autor und Ko-Regisseur die [satirische Revue] Beyond the Fringe auf die Bühne gebracht. Bennett bezeichnete als Ausgangspunkt seiner Karriere eine Parodie auf die Rundfunkweihnachtsansprache der Königin, die er zu Beginn seines Studiums verfaßt hat. In einer seiner autobiographischen Skizzen illustriert Bennett diesen Doppelimpuls, die aristokratische Hochkultur zu verspotten und zu ehren, mit folgender Anekdote: „Geboren wurde und aufgewachsen bin ich in Leeds, wo mein Vater Fleischer war. Als Junge habe ich bisweilen mit dem Fahrrad Bestellungen an Kunden ausgeliefert, zu denen auch eine Mrs. Fletcher gehörte. Mrs. Fletcher hatte eine Tochter, Valerie, die woanders zur Schule und dann nach London ging, wo sie eine Stelle in einem Verlag bekam. In dem Verlag war sie erfolgreich, wurde Assistentin von einem der Direktoren, den sie, obwohl er viel älter war als sie, schließlich heiratete. Der Verlag war Faber and Faber, und der Direktor war T. S. Eliot. Deshalb habe ich einmal geglaubt, meine einzige Verbindung zur literarischen Welt würde darin bestehen, daß ich einst T. S. Eliots Schwiegermutter Fleisch geliefert hatte. Einige Jahre später, als mein Dad das Geschäft verkauft hatte, wir aber immer noch in Leeds wohnten, kam meine Mutter eines Tages nach Hause und erzählte: ,Ich bin heute auf der Straße Mrs. Fletcher in die Arme gelaufen. Sie war nicht in Begleitung von Mr. Fletcher; sie war in Begleitung eines anderen Mannes - groß, schon älter, von sehr distinguiertem Aussehen. Sie hat mich vorgestellt, und wir haben einander begrüßt.' Und erst viel später ist mir klar geworden, auch wenn es sich nicht um eine der denkwürdigsten Begegnungen in der abendländischen Literatur gehandelt hat, daß meine Mutter T. S. Eliot kennengelernt hatte. Ich versuchte, ihr die Bedeutung des großen Dichters zu erklären, aber ohne großen
14
II Zur Kunst
Erfolg, da Das Wüste Land in Mams Ordnung der Dinge keine überragende Rolle spielte. ,Die Sache ist die', sagte ich schließlich, ,er hat den Nobel-Preis gewonnen.' ,So', sagte sie mit jenem unfehlbaren Sinn für das Unwesentliche, der ein Vorrecht von Müttern ist, ,das wundert mich gar nicht. Es war ein schöner Mantel.' " 1 Diese Anekdote ist an sich schon eine formvollendete Vignette, die den Stimmen und Szenen in Das Wüste Land ironischen Tribut zollt, aber ich führe sie deshalb hier an, weil sie auf Bennetts spätere Bewertung ein Licht wirft: „Kunst kommt von Kunst", kommentiert er; „sie beginnt mit der Nachahmung, oft in Form der Parodie, und im Prozeß der Nachahmung der Stimmen anderer lernt man den Klang der eigenen Stimme kennen... Bei mir ist es nicht ganz so ausgegangen, denn die Kluft zwischen dem Provinziellen und dem Metropolitanen ist bestehen geblieben, T. S. Eliot und meine Mutter haben sich zwar die Hände geschüttelt, aber nicht für immer gereicht."2 Ich will ihn nicht zu weit treiben, den möglichen Vergleich zwischen Alan Bennett und Sir Joshua Reynolds, der in einer Provinzstadt aufgewachsen ist (wo er fast Apotheker geworden wäre), sich selbst als Parodist lancierte und dann eine Eliot ähnliche Position als Praktiker und Theoretiker der Kunst in der Großstadt anstrebte. Betonen möchte ich in diesen einleitenden Bemerkungen die Relevanz von Bennetts „Kunst kommt von Kunst" für ein Verständnis der kulturellen Praxis des 18. Jahrhunderts. Nahezu jeder bedeutende Autor der Zeit, gleich welchen Geschlechts, beginnt seine oder ihre Laufbahn als Parodist; man braucht, zum Beispiel, nur an The Rape of the Lock [Der Lockenraub] von Alexander Pope oder Love and Friendship [Liebe und Freundschaft] von Jane Austen zu denken. Doch für einen Künstler wie Reynolds hat „der Prozeß der Nachahmung der Stimmen anderer" nicht immer dazu geführt, „den Klang der eigenen Stimme" zu erkennen. In einer gedankenreichen Rezension von Hume and the Heroic Portrait zollt Ronald Paulson Edgar Winds bahnbrechenden Untersuchungen der englischen Kunst des 18. Jahrhunderts Tribut.3 „Wie diese Essays zeigen", schreibt Paulson, „war Wind die Quelle für fast alle unsere idées reçues über das Porträt und den Aufschwung der Historienmalerei im England des 18. Jahrhunderts." Paulson schilt sich selbst, weil er das Ausmaß seiner eigenen Abhängigkeit nicht verstanden und anerkannt hat, und schreibt abschließend, daß „die englische Kunstgeschichte seit 1930 ihren Horizont nicht sehr viel weiter" über Winds frühes Werk erweitert hat. Professor Paulsons Bewertung, die nun ein Jahrzehnt alt ist, hat nichts von ihrer Kraft und Relevanz eingebüßt: 1996 machen wir immer noch dankbar Gebrauch von Karten und Kompaß, die Edgar Wind uns geliefert hat. In dieser kurzen
1 Alan Bennett, Writing Home, London 1994, S. I X - X . 2 Ebenda, S. XII. 3 In: Eighteenth-Century Studies, 20 (1986-87), S. 4 7 2 ^ 7 5 .
Β. Redford:
Reynolds
und das parodistische
Porträt
15
Untersuchung werde ich mich nicht daran machen, wie Wind es getan hat, die Grenzen zu verrücken oder die idées reçues zu revidieren; statt dessen möchte ich zeigen, wie sehr ich ihm verpflichtet bin, indem ich zwei von Winds fundamentalen Einsichten in die englische Porträtkunst des 18. Jahrhunderts untersuche und erweitere. Sie betreffen die Laufbahn von Sir Joshua Reynolds, wie sie nicht nur in Hume and the Heroic Portrait analysiert wird, sondern auch in ,Borrowed Attitudes' in Reynolds and Hogarth und A Source for Reynolds's Parody of ,Th e School of Athens'. Die erste Einsicht bezieht sich auf einen von Reynolds bevorzugten Kunstgriff, um den großen Stil in der Porträtmalerei zu erzielen - was Wind in der Nachfolge von Horace Walpole „Zitat" nennt. Die bekanntesten Beispiele dieser Technik finden sich in Mrs. Siddons as the Tragic Muse mit der Evokation des Propheten Jesaja aus dem Deckengemälde der Sixtinischen Kapelle und Master Crewe as Henry VIII (Abb. 1) mit der Anspielung auf Holbein. Walpoles Verwendung des Wortes „Zitat" verbindet diese Praxis mit den Modi der Komposition und Rezeption, die eine ganze Periode zu definieren helfen. Wie Wind so gut gewußt hat, sind die verschwisterten Künste zutiefst miteinander verbunden, so daß man einen Reynolds zusammen mit einem Pope oder Händel betrachten kann - und es auch tun sollte. „Zitat" ist eine Folge der Lehre und der Praxis der Nachahmung. Im VI. Diskurs lobt Reynolds, was er den „wahren und freien Boden der Nachahmung" nennt, und er beschreibt ihn metaphorisch als „die Zufuhr von Glut, die dazu beiträgt, den Funken zu stärken"; Reynolds wendet dann seine Aufmerksamkeit „einer anderen Art von Nachahmung [zu]; wenn man einen besonderen Gedanken, eine Handlung, Haltung oder eine Figur borgt und sie in das eigene Werk verpflanzt: das wird entweder unter den Vorwurf des Plagiats fallen, oder gerechtfertigt sein und Empfehlung verdienen, je nachdem mit welchem Geschick es betrieben wird". Jene, die nicht mit dem, was Reynolds „Geschick" nennt, vorgehen, jene, die nicht ungestüm mit einem eklektischen Aufgebot an Vorbildern konkurrieren, werden als „eng, beschränkt, unfrei, unwissenschaftlich und unterwürfig" gebrandmarkt.4 Im selben Diskurs verwendet Reynolds viel Energie darauf, den Gedanken zu widerlegen, daß Nachahmung praktisch gleichbedeutend mit Plagiat sei, um einen starken Kontrast zwischen einem Künstler wie Rosso, der „etwas von dem Feuer entflammt wurde, welches die Werke eines Michelangelo belebt" und solch „sterilen" und „servilen" Imitatoren wie Romanelli und Jordaens herauszuarbeiten. Wie Wind jedoch klar macht, läßt sich Reynolds' eigene Praxis der Nachahmung, wie es sich in seiner anspielungsreichen Verwendung des Quellenmaterials manifestiert, nicht so leicht kategorisieren: die Skala reicht in der Tat von der „freien" Entlehnung (bei der die Quelle und ihre Umgestaltung offen ins Spiel gebracht werden) bis hin zur stummen, „versteckten" Entlehnung (die auch
4 Reynolds, Discourses
on Art, hrsg. von Robert R. Wark, New Haven und London 1975, S. 100-105.
16
II Zur Kunst
Master Cren-e als He,
„servil" oder selbst verstohlen genannt werden könnte). Wie reagieren wir, wenn - und ich zitiere hier aus ,Borrowed Attitudes' in Reynolds and Hogarth - „die Erkenntnis der Anspielung die Bewertung des Bildes nicht erheiht", wenn „der Einsatz [entlehnter Figuren] jenes Element des Paradoxen oder des Überraschen-
Β. Redford:
Reynolds
und das parodistische
Porträt
17
Abb. 2. Joshua Reynolds, Karikatur nach Raffaels Schule von Athen. Dublin, The National Gallery of Ireland
den verloren hat, das unabdingbar ist, wenn ein Zitat geistreich sein soll"? 5 Winds Untersuchungen sowohl der Macht als der Zweideutigkeit der Anspielung werfen für das Studium der Bilder Reynolds' ein grundsätzliches Problem auf; sie haben auch wichtige Auswirkungen auf unser Verständnis einer ganzen kulturellen Praxis. Die zweite Erkenntnis, deren Implikationen ich untersuchen möchte, steht in enger Beziehung zur ersten. In „A Source for Reynolds's Parody of The School of Athens" (Abb. 2) verbindet Wind seine Kommentare über die Entlehnungen mit Reynolds' Praxis der Karikatur in den Anfangsstadien seiner Laufbahn. „Der Apostel der Höflichkeit und Erhabenheit im Gebrauch klassischer Epitheta", schreibt Wind, „hat als Meister der Verspottung angefangen." 6 Meine eigene
5 Edgar Wind, Hume and the Heroic Portrait, hrsg. von Jaynie Anderson, Oxford 1986, S. 70: „Knowledge of the allusion does not increase appreciation of the picture ... [when] the use made of [borrowed figures] has lost that element of paradox or surprise which seems indispensable if a quotation is to be witty." 6 Ebenda, S. 78: „The apostle of courtesy and grandeur in the use of classical epithets began as a master of derision." Ellis Waterhouse hat Ähnliches im Sinn, wenn er bemerkt: „Es scheint außer-
18
II Zur Kunst
Untersuchung erwächst direkt aus dieser Beobachtung, welche die Doktrin und Praxis bildlicher Anspielung in einem spezifischen System des satirischen Possenspiels ansiedelt. Dabei lasse ich mich von folgenden Behauptungen leiten: erstens, daß Reynolds einen Stil heroischer Porträtkunst anstrebte, der, auf eine Weise, welche er nicht völlig bereit war einzugestehen, auf offener wie verborgener Anspielung beruhte; zweitens, daß die Wurzeln dieser heroischen Konzeption der Porträtkunst sich zu seinen römischen Karikaturen zurückverfolgen lassen; und drittens, daß Reynolds' Laufbahn als Porträtmaler von - um wieder aus den Discourses zu zitieren - „einem großzügigen Wettstreit", wie er es nennt, mit zeitgenössischen Künstlern gekennzeichnet war. Ich darf vielleicht an den ursprünglichen Kontext der Wendung „großzügiger Wettstreit" erinnern. Zu Beginn des Diskurses XIV, den Reynolds 1788 in der Royal Academy vorgetragen hat, unterscheidet er zwischen primären und sekundären Quellen der Inspiration: „Im Studium unserer Kunst ist wie im Studium aller Künste etwas das Ergebnis unserer eigenen Betrachtung der Natur; etwas aber, und das nicht in geringem Maße, die Auswirkung des Beispiels jener, die die gleiche Natur vor uns studiert und vor uns die gleiche Kunst mit Eifer und Erfolg gepflegt haben." Im weiteren Verlauf unterscheidet Reynolds zwischen „Beispielen aus dem fernen und verehrten Altertum" und näherliegenden Beispielen: „Es ist manchmal von Nutzen, wenn unsere Beispiele uns nahe sind und derart, daß sie Verehrung hervorrufen, die genügt, uns zu sorgfältiger Beobachtung anzuhalten, aber nicht so groß ist, als daß sie uns davon abhalten könnte, mit ihnen in so etwas wie einen großzügigen Wettstreit zu treten." 7 Diese Bemerkungen sind die Einleitung zu einem Tribut an Thomas Gainsborough, der gerade gestorben war und mit dem Reynolds „so etwas wie einen großzügigen Wettstreit" ausgetragen hatte. Die Komplimente für Gainsborough werden im selben Diskurs allerdings begleitet von der Abwertung Pompeo Batonis, dessen Ruf (so Reynolds) dazu bestimmt sei, der Vergessenheit anheimzufallen, und dessen irregeleiteten Methoden bedeuteten, daß „die Contenance" in seinen Porträts „nie gut ausgedrückt wurde, und, wie die Maler sagen, das Ganze nicht sehr gut zusammengesetzt war". 8 Ich bin der Uberzeugung, daß Reynolds Batoni mehr als allen anderen zeitgenössischen Porträtmalern verdankt, daß diese Dankesschuld nur selten zugegeben wurde und daß die Reaktionen auf das Werk von Reynolds' römischem Gegenspieler es uns erlauben, das trübe Terrain zu erforschen, welches ein „Zitat"
7 8
dem möglich, daß das Bild [die Parodie der Schule von Athen] als ein Schritt der sehr bewußten Selbstdisziplin gemalt wurde, mit deren Hilfe Reynolds sich selbst beibrachte, die Vorzüge Raffaels zu verstehen, und daß er dabei auf die Methode stieß, die für den Rest seines Lebens das offene Geheimnis seines Erfolges als Porträtist werden sollte." In: Ellis Waterhouse, Three Decades of British Art 1740-1770, Philadelphia 1965, S. 29. Reynolds, Discourses (wie Anm. 4), S. 247. Ebenda, S. 251.
Β. Redford:
Reynolds
und das parodistische
Porträt
19
von Aneignung, „großzügigen Wettstreit" von kleinlicher Konkurrenz trennt. Logische Folge dieser Behauptung ist, daß der Kontrast zwischen Reynolds und Gainsborough, den Wind so brillant analysiert hat, genau deswegen eingeräumt werden kann, weil er keine radikale Unzulänglichkeit oder Abhängigkeit impliziert; die damit einhergehende Herabsetzung Batonis läuft andererseits darauf hinaus, daß Reynolds ängstlich bemüht ist, seine künstlerischen Spuren zu verwischen. Vor Jahren hat Sir Ellis Waterhouse drei Bilder von Reynolds, gemalt Mitte der 50er Jahre des 18. Jahrhunderts, als „Übungen im Stile von Batoni" beschrieben; gleichzeitig gab Waterhouse zu verstehen, daß Reynolds sich Batonis Einfluß rasch entzogen habe.9 Ich bin im Gegenteil davon überzeugt, daß Batoni für Reynolds' Karriere von Einfluß und eine Herausforderung geblieben ist - so sehr, daß ein Großteil von Reynolds' Œuvre beschrieben werden könnte als Porträts einer „Grand Tour" in heimischen Gefilden. Mehrere biographische Fakten stehen in direktem Zusammenhang mit meinem Argument. Reynolds machte sich nach 1750 seine eigene Version der Grand Tour, in deren Verlauf er zwei Jahre in Rom verbrachte. Sein Mäzen Lord Edgcumbe „drängte" ihn „heftig", bei Pompeo Batoni zu studieren, doch Reynolds weigerte sich. So heißt es in der Biographie von Leslie und Taylor aus dem 19. Jahrhundert: „Nachdem er eine kurze Lehre bei einem durchschnittlichen englischen Maler [Thomas Hudson] gemacht hatte, war er nun zu klug, um sich in die Hände eines durchschnittlichen Ausländers zu begeben; und während seiner Zeit in Rom hat er hauptsächlich unter den Meistern Michelangelo und Raffael studiert."10 Eine Ironie liegt hier darin, daß Raffael auch der Lehrmeister Batonis war, der eine „unermüdliche und leidenschaftliche Studie" der Fresken im Vatikan betrieben und „ehrgeizige Kopien in Ol der Schule von Athen" angefertigt hatte.11 Eine weitere Ironie besteht darin, daß Reynolds, wie er im Diskurs XIV verrät, den Ateliermethoden von Batoni peinlich genaue Aufmerksamkeit schenkte. Außerdem hat Reynolds in den zwei Jahren in Rom Karikaturen jener milordi gemalt, die sich von Batoni porträtieren ließen. Doch war Reynolds' Einstellung zur Karikatur ebenso ambivalent wie seine Einstellung gegenüber Batoni. In seinen Memoirs of Sir Joshua Reynolds stellt James Northcote Überlegungen an über „einen seltsamen Umstand, der im Leben eines derart kultivierten Künstlers kaum zu glauben ist... daß er jemals zu irgendeiner Zeit Karikaturist gewesen sein sollte. Doch dies war tatsächlich der Fall während seines Aufenthalts in Rom, wo er mehrere Bilder jener Art gemalt hat; besonders eines, das eine Art Parodie von Raffaels Schule von Athen ist, mit etwa dreißig Personen, in denen die meisten englischen Gentlemen dargestellt werden, die damals in der Stadt waren..." North9 Ellis Waterhouse, Reynolds, London 1973, S. 17. Siehe auch Anthony M. Clark, Pompeo Batoni, hrsg. von Edgar Peters Bowron, Oxford 1985, S. 253, Kat.-Nr. 155. 10 Charles Robert Leslie und Tom Taylor, Life and Times of Sir Joshua Reynolds, London 1865, i. 48. 11 Batoni (wie Anm. 9), S. 24.
20
II Zur Kunst
cote fährt fort: „Aber ich habe es aus Sir Joshuas eigenem Munde gehört, daß zwar allgemein eingeräumt wurde, daß er Gegenstände dieser Art mit viel Ehre und Geist ausführte, es aber für absolut notwendig hielt, diese Praxis aufzugeben, da sie seinen Geschmack als Porträtmaler verderben müsse, dessen Pflicht es ist, allein danach zu trachten, die Vollkommenheiten jener zu entdecken, die er darstellen wolle." 12 Northcote läßt unerwähnt, was Wind zu Recht betont, daß nämlich diese römischen Karikaturen Reynolds' früheste Versuche der Nachahmung darstellen die ersten anspielungsreichen Umformungen von Pose, Komposition und Technik.13 Darüberhinaus liefert Reynolds selber einen sprechenden Hinweis auf die Verbindung zwischen heroischer und parodistischer Porträtmalerei, schreibt er doch im Diskurs VI „über Männer..., die zwar nicht zur exakten Nachahmung empfohlen werden können, die aber doch einen Künstler herausfordern, danach zu streben, mittels einer Art von Parodie deren Vorzüglichkeiten auf seine eigenen Darstellungen zu übertragen" (Hervorhebung von mir).14 Die Schule von Athen ist das erste der Bilder von Reynolds, bei denen, in Winds Worten, „der volle Genuß des Werkes eine Vertrautheit mit den Vorbildern voraussetzt; denn nur dann werden Anmut beziehungsweise Witz des Malers deutlich" 15 . Das Gemälde wird sich niemals vollkommen dechiffrieren lassen: wie ein vielschichtiges Gedicht oder ein Privatbrief aus dem 18. Jahrhundert, verschlüsselt es eine Reihe persönlicher Beziehungen, gemeinsamer Anspielungen und subtiler Bedeutungsschattierungen, die sich einer mehr als nur partiellen Rekonstruktion widersetzen. Wie aber Reynolds auf sein Original anspielt, wie er es adaptiert oder auch zerstört, liefert uns eine allgemeine Anleitung zur Entschlüsselung. Die bedeutendste Veränderung ist der Wechsel der architektonischen Szenerie von der Klassik zur Gotik. Mit seiner charakteristischen Vereinigung von Kürze und Präzision kommt Wind zum Kern der Sache: „Die Einführung von gotischen Bögen und Fialen in Raffaels klassischen Saal setzt nicht nur mit einem Streich die neoromanischen und neo-gotischen Stile der Lächerlichkeit aus, sondern erzeugt auch eine Atmosphäre der Verdunkelung, die für die Diskussion unter diesen kultivierten cognoscenti besonders geeignet ist." 16 „Verdunkelung" in der Tat: an die Stelle der strahlenden Statuen Apollos und Minervas sind verschattete Nischen getreten, und was sie enthalten, läßt sich unmöglich eindeutig klären. Winds Interpretation
12 James Northcote, Memoirs of Sir Joshua Reynolds, 13 Vgl. Katherine S. Balkan, Sir Joshua
Reynolds'
1817, S. 29. Theory
and Practice of Portraiture,
University
Microfilms International ( U M I ) 1973, S. 56. 14 Reynolds, Discourses (wie Anm. 4), S. 110. 15 Wind, Hume
(wie Anm. 5), S. 79: „ . . . t h e full enjoyment of the work presupposes an acquaintance
with the models; for only then does the painter's grace or wit become apparent..." 16 Ebenda, S. 77: „The insertion of Gothic arches and pinnacles into Raphael's classical hall not only ridicules with one stroke both the neo-Roman and the neo-Gothic tastes, but produces an atmosphere of obscurantism singularly suited for debate between these refined
cognoscenti."
Β. Redford: Reynolds und das parodistische Porträt
21
hat weitere Unterstützung durch neuere Arbeiten über die Aufzeichnungen von Lord Charlemont erfahren (der bei Reynolds an der Stelle von Pythagoras sitzt), der mit dem Wort „Goten" viele seiner Mittouristen auf der Grand Tour in Rom beschreibt.17 Die „gotische" Architektur gibt uns zu verstehen, daß das Bild, wenn auch in Auftrag gegeben von einem jungen Iren auf der Grand Tour (Joseph Henry, der den Platz einnimmt, den bei Raffael Diogenes innehat), den Wert des Unternehmens, das es dokumentiert, in Zweifel zieht. Diese Travestie von Raffaels Fresko ist eine Travestie jener, die aus der Bildungsreise eine Posse machen. Nirgendwo wird diese Botschaft deutlicher als in den Versionen der Gestalten Piatons und Aristoteles', die eingerahmt werden durch den zentralen gotischen Bogen. Wind hat darauf hingewiesen, daß Reynolds für die musikalische Gruppe im linken Vordergrund Belloris Erläuterungen zu Raffael zur Grundlage nahm und nicht Vasaris fehlerhaften Kommentar; es war nämlich Bellori, der die pythagoreische Tafel identifiziert hat, die Reynolds das musikalische Motiv lieferte. Ich möchte behaupten, daß Reynolds sich auch bei der Darstellung der beiden zentralen Gestalten bei Bellori bedient hat, um das Streben nach virtù der cognoscenti von eigenen Gnaden zu beschwören und satirisch darzustellen. Raffaels Piaton hält ein Exemplar des Timaios in der Hand und zeigt himmelwärts; und Bellori meint: „Questo Filosofo nel Timeo contempla la natura dell'Universo, e le cose naturali misteriosamente, come effetti, ed imagini delle divine."18 „Piaton" ist in Wirklichkeit Joseph Leeson, erster Earl of Milltown, ein fanatischer Sammler, Mäzen Batonis und Mitglied der „Society of Dilettanti". In einer gezierten Pose, die seinen Embonpoint noch betont, hält Leeson nicht den Timaios in der Hand, sondern ein Monokel - die ultimative Trivialisierung von Piatons kontemplativer Unternehmung. Die Gestalt des Aristoteles balanciert in Raffaels Fresko ein Exemplar der Ethik auf dem linken Oberschenkel und macht mit dem rechten Arm eine friedenstiftende Geste, wie bei Bellori zu lesen ist. Bellori fährt dann fort: „Ii quale atto conviene propriamente all'Etica, che quieta gl'affetti, e modra gl'animi umani con la proporzione della virtù." 19 Im Vergleich dazu ist Reynolds' Äquivalent für Aristoteles von der virtù nur in dem Sinne betroffen, als sie für ihn eine konkrete künstlerische Beute darstellt; er macht keine Geste der Befriedung, sondern des Erwerbs. Ähnliche satirische Züge speisen meiner Meinung nach jeden Aspekt des Bildes: Joseph Henry benutzt, zum Beispiel, einen Bücherstapel als bequeme Armstütze; und ebenso hat sich der Abakus des Euklid in eine Pastete verwandelt. An die
17 Cynthia O ' C o n n o r , „The Parody of The School of Athens: The Irish Connection", in: Bulletin of the Irish Georgian
Society, X X V I , 1983, S. 2 0 - 2 2 .
18 G. P. Bellori, Descrizzione
delle Imagini
dipinte da Rafaelle
d'Urbino
nelle Camere
del
Palazzo
Apostolico Vaticano, R o m 1695, S. 19. „Dieser Philosoph kontempliert geheimnisvoll im Timaios die Natur des Universums und der natürlichen Dinge als Wirkung und Ebenbild der Göttlichkeiten." 19 Ebenda, S. 19. „Diese Geste ziemt der Ethik im eigentlichen Sinne, welche die Gefühle besänftigt und die menschlichen Seelen durch die Größe der Tugend mäßigt."
II Zur Kunst
Conversation
Abb. 3. Joshua Reynolds, Picce: Milordi. Dublin, The National Gallerv of Ireland
Β. Redford:
Reynolds
und das parodistische
Porträt
23
Stelle von Raffaels Selbstbildnis hat Reynolds das tückisch blickende Gesicht von Thomas Patch gesetzt, ein Karikaturist im Zentrum des römischen Zirkels der Auslandsbriten. An der Pastete leckt ein kleiner schwarzweißer Spaniel, wie er in fast sämtlichen Karikaturen von Patch auftaucht. Reynolds' Schule von Athen steht in Verbindung zu mehreren kleinen Karikaturen, deren dargestellte Personen sie anscheinend als Pendants zu ihren Porträts von Batoni in Auftrag gegeben haben. Reynolds' satirisches conversation piece von vier gelehrten milordi (Abb. 3) zeigt das kinnlose Wunder Joseph Leeson den Jüngeren (der als ein Jünger des „Aristoteles" erscheint); neben ihm sitzt sein zukünftiger Schwager Joseph Henry („Diogenes"). Henry mit dem fliehenden Kinn glotzt erfolglos auf einen dicken Folioband mit der Aufschrift „Cloaca Maxima". Auf der anderen Seite der Leinwand posiert Lord Bruce selbstbewußt vor einem Säulenprospekt und zeigt eine unendlich lange geschwungene Wade. Zur selben Zeit ließen sich Leeson und Henry von Batoni malen. John Woodyeare, der auch zu dem Zirkel der Auslandsbriten gehörte, gab bei Reynolds ein Porträt in Auftrag, bei Batoni eines in einem anderen Stil. Woodyeares kretinöser Gesichtsausdruck ist ein Hohn auf seine kulturellen Interessen (Cello vorne, die Pyramide des Cestius hinten). Die Bilder von Reynolds und Batoni sind jedoch nicht nur durch die gemeinsamen Modelle verknüpft, sondern auch durch die Herkunft der Bildgattung, denn der eine parodiert, inter alia, eine spezifische Art des Porträts, die der andere perfektioniert hat. Ein direkter Abkömmling von Reynolds' römischen Karikaturen ist das Paat von Konversationsstücken, das für die Society of Dilettanti gemalt wurde und eine Gruppe Ehemaliger der Grand Tour darstellt. Reynolds wurde 1766 zum Mitglied gewählt und wohnte häufig den Sonntagstreffen der Gesellschaft bei, deren besonderes Ziel es war, das Erlebnis Italien erneut zu durchleben und gemeinsame Interessen an der Archäologie und Malerei zu erörtern.20 Die Gesellschaft gab 1777 ein Gruppenporträt in Auftrag, das sich als weltliches Diptychon beschreiben läßt. Das linke Bild zeigt sechs dilettanti, versammelt um Sir William Hamilton, der auf einen Folioband zeigt, welcher - nun nicht die Cloaca Maxima - , sondern seine Sammlung griechischer Vasen illustriert. (Abb. 4) In dem Pendant zu diesem Porträt ist in der Hand der stehenden Gestalt nicht ein Weinglas, sondern eine Gemme zu sehen. (Abb. 5) In beiden Konversationsstücken rücken die Posen, der Ausdruck und die Beschäftigungen der dilettanti die Bilder ins Reich des Burlesken ja ins Batonieske. Schräg hinter Sir William Hamilton steht John Taylor, der ein Damenstrumpfband in die Höhe hält (ein Detail, das dazu führte, daß das Bild nicht in Damengesellschaft gezeigt werden konnte). Ganz links im Bild befindet sich, bekleidet mit der Toga des Präsidenten, der bekannte Sammler Sir Watkin Williams Wynn, den Batoni zehn Jahre zuvor in Rom ein ähnlicher Gesellschaft in
20 Ausst. Kat. Reynolds, hrsg. von Nicholas Penny, London 1986, S. 281-282.
24
II Zur Kunst
Abb. 4 u. 5. Joshua Reynolds, Society of Dilettanti (2 Pendants). London, Society of Dilettanti
26
II Zur Kunst
einer ähnlichen Szenerie gemalt hatte. Die ausgeprägten Ähnlichkeiten in Komposition und Bildinhalt machen es in der Tat höchstwahrscheinlich, daß Batonis Bild, sein einziges ganzfiguriges Konverstationsstück für einen britischen Auftraggeber, als Vorbild für Reynolds diente, der viele Porträts für die Familie Williams-Wynn gemalt hat. Der Einfluß von Batoni und der batoniesken Formel läßt sich noch auf eine andere Weise eindrucksvoll bemessen; man braucht nur ein Porträt, das Reynolds vor seiner Romreise gemalt hat, dem Porträt gegenüberzustellen, mit dem er seinen Ruf begründete, als er sich sofort nach seiner Rückkehr aus Italien in London als Maler niederließ. Das Porträt von William Byron, datiert etwa 1749, kann bestenfalls als „stumpf" bezeichnet werden - ein Wort, das Andrew Wilton trefflich auf die Porträts von Reynolds' Lehrer Thomas Hudson gemünzt hat. 21 Die Komposition basiert in der Tat anscheinend eng auf Hudsons Admiral Sir Chaloner Ogle (ca. 1740). Der Porträtierte ist in nur angedeuteter plastischer Modellierung an die vordere Bildebene gerückt; seine Pose ist unbeweglich, sein Gesichtsausdruck ist starr. Das Farbschema ist düster, vor einem Waldhintergrund sind die Umrisse von Mantel und Hut kaum zu erkennen. Vier Jahre später malt Reynolds wieder einen Marineoffizier, Commodore Keppel, diesmal in einer ganz anderen Art und Weise. Keppel stürmt voran, als wäre er gerade erst an Land gegangen (seine Pose erinnert vage an den Apoll von Belvedere). (Abb. 6) Das Blau und Silber seiner Uniform werden von Himmel und Meer zurückgeworfen und intensiviert. Die Kolorierung, die auf Diagonalen beruhende Komposition, die dynamische Positur des Porträtierten innerhalb des Bildraumes: alle diese Elemente vereinen das Naturalistische mit dem Symbolischen und spielen darauf an, daß Keppel, in dem sich Natur und Kultur verbinden, die Seelandschaft, die sein definierendes Element ist, bewohnt und beherrscht. Bald nach Vollendung von Commodore Keppel suchte Reynolds Hilfe bei Batoni, um die Aura eines Porträts (Mr. Peter Ludlow) zu verstärken, dessen Komposition wiederum auf Van Dycks Lord Stafford zurückgeht. Von Batoni entlehnt Reynolds aber das charakteristischste Merkmal des Bildes, die Husarenuniform. Zwei der milordi, die in den römischen Karikaturen auftauchen, John Woodyeare und Lord Charlemont, hatten solche Uniformen getragen, die an ein Kostümfest erinnern; die sich daraus ergebende doppelte Assoziation (Kämpfer und Tänzer) will mit allen Mitteln die begehrte Aura des Renommisten, des posierenden Kraftkerls zeugen. Das „Renommier"-Porträt wird in Reynolds' Lieutenant-Colonel Tarleton fast ins Extrem getrieben. (Abb. 7) Wie das Porträt von Peter Ludlow lehnt es sich an ein älteres Vorbild an und prahlt mit dieser Beziehung, und an Batoni - eine Verbindung, die es allerdings negiert. Tarleton wird im Krieg in Amerika gezeigt; seine Pose basiert auf der berühmten Statue des Cincinnatus,
21 Andrew Wilton, The Swagger Portrait, London: Tate Gallery, 1992, S. 112.
Commodore
Abb. 6. Joshua Reynolds, Keppel (1744). L o n d o n , Maritime Museum
28
II Zur Kunst
Abb. 7. Joshua Reynolds, Lieutenant-Colonel Tarleton. London, National Gallery
Colonel
Abb. 8. Pompeo Batoni, William Gordon (1766). Fyvie Castle, Grampian, NT Scotland
„deren Abguß die Akademieschulen kennzeichnend schmückte". 22 Aber meiner Meinung nach ist es stärker beeinflußt von Batonis Colonel William Gordon. (Abb. 8) Gordon wird gezeigt, als würde er Rom in Besitz nehmen, und Rom wird nicht nur durch das Kolosseum im Hintergrund repräsentiert, sondern auch als allegorische weibliche Gestalt. Gordon, bekleidet in seinem militärischen Tartan, mit zurückgerolltem Strumpf, um Schnürstiefel anzudeuten, ergreift anmaßend sein Schwert und stellt den rechten Fuß mit Brio auf den Sockel der Statue. Beide Figuren, deren Pose und Kleidung zu engstem Vergleich einladen, werden in dynamischer Ungezwungenheit gezeigt, in einem Augenblick stolzer Eroberung Colonel Gordon im alten, Colonel Tarleton im neuen Rom. Viele andere Porträts von Reynolds laden zu ähnlichen Vergleichen ein und verweisen auf ähnliche Dankesschuld. Aber das einzige Beispiel offenen oder „großzügigen" Wetteiferns findet sich bei Reynolds in seinem Porträt von Mrs. 22 Reynolds (wie Anm. 20), S. 301; Francis Haskeil und Nicholas Penny, Taste and the New Haven und London 1981, S. 182-184.
Antique,
Β. Redford:
Reynolds
Abb. 9. Joshua Reynolds, Mrs Peter Beckford, Lady Lever Art Gallery. Port Sunlight (Merseyside County Council)
und das parodistische
Porträt
29
Abb. 10. Pompeo Batoni, Peter Beckford. Kopenhagen, Statens Museum for Kunst
Peter Beckford, das von ihrem Ehemann in Auftrag gegeben wurde als Pendant zu seinem eigenen Porträt von Batoni. (Abb. 9 und 10) Hier und nur hier erfüllt Reynolds dem Wortlaut nach sein Gebot, ausgesprochen im Diskurs IV, daß nämlich der Künstler „sich in einen Wettbewerb mit seinem Original begeben sollte, und sich bemühen sollte, was er für sein eigenes Werk übernimmt, zu verbessern. Eine solche Nachahmung ist soweit von der Unterwürfigkeit des Plagiats entfernt, daß es eine anhaltende Geistesübung ist, eine fortgesetzte Erfindung." 23 Batoni porträtiert sein Modell in einer Parkszenerie; Beckford ist reich gekleidet in Rosa und Silber, und er lehnt sich an das Piedestal einer Statue, die Roma Triumpbans darstellt. Das Piedestal schmückt ein Basrelief einer weinenden Frau, die als Darstellung der eroberten Provinz Dakien gilt. Dieses Relief, welches das ganze Jahrhundert über im Palazzo dei Conservatori ausgestellt war, war eine der gefeiertesten Plastiken auf dem Itinerar der Kunsttouristen der Grand Tour.24 23 Discourses (wie Anm. 4), S. 107. 24 Pompeo Batoni (wie Anm. 9), S. 302; Haskell und Penny, Taste (wie Anm. 22), S. 194.
30
II Zur Kunst
Noch in seinem kleinsten Detail reagiert Reynolds' Porträt auf sein Gegenstück, kommentiert es und versucht es zu übertreffen. Sujet des Bildes ist ein Opfer, das der Göttin der Heilkraft dargebracht wird. Die Komposition ist spiegelbildlich zu der Batonis: links eine starke Vertikale, die durch den Dreifuß, das Piedstal und die Statue der Hygeia geschaffen wird; im Zentrum Mrs. Beckford, die sich leicht vorneigt und so eine sanfte Diagonale bildet; rechts davon in einem kompositorisch dreieckig definierten Raum der Kopf und Oberkörper einer Dienstperson (entsprechend der Position des Hundes bei Batoni) und ein Stückchen Waldlandschaft. Mrs. Beckford ist in eine dem klassischen Stil entsprechende Robe gekleidet, deren Faltenwurf mit dem Kleid der Allegorie Dakiens in Batonis Porträt harmonisiert. Auch wenn man nicht wüßte, daß die Ehe der Beckfords ein spektakulärer Reinfall war, daß Mrs. Beckford von ihrem Liebhaber, William Beckford (dem Vetter ihres Ehemannes) veschmäht worden war und daß sie kränkelte, würden doch das drohende Licht und die in sich gekehrte, bedrängte und abgekehrte Miene der Porträtierten darauf hinweisen, daß etwas von Grund auf nicht stimmt. Ich möchte schließen mit einigen Worten über Edgar Winds Analyse von General Lord, Heath field, das für Wind den „Stil der heroischen Porträtmalerei" von Reynolds vollkommen exemplifiziert: Reynolds zeigt den General in einer besonderen Rolle, als Verteidiger von Gibraltar, mit dem Schlüssel zur Festung in der Hand, vor einem Hintergrund von Kanonen und Pulverrauch. Ein bedeutender Augenblick in der Karriere des Helden ist ausgewählt, um seine Entschlossenheit und Unbeugsamkeit zu schildern. Die heroische Lebenssicht wird ausgedrückt durch Embleme: den Schlüssel, die Kanone; vor allem durch die mit Pulverrauch gefüllte Landschaft, welche die rote Uniform des Generals zur Geltung bringt, an sich schon ein Emblem des Ranges. Die Gestalt steht allein, in dramatischer Beziehung zum Hintergrund... Darüber hinaus ist der General aus der Mitte gerückt; er steht rechts im Vordergrund, Protagonist eines Ereignisses, dessen Wesen betont wird durch seine kraftvolle Gebärde und die leichte Körperdrehung, die ein Zurückweichen der Diagonalen erzeugt.25
25 Wind, Hume (wie Anm. 5), S. 31 f: „Reynolds shows the General in a particular role, as defender of Gibraltar, with the key to the fortress in his hand, against a background of cannon and powdersmoke. A significant moment in the hero's career is chosen to convey his determination and inflexibility. The heroic view of life is expressed through emblems: the key; the cannon; above all, the landscape filled with powder-smoke, which sets off the General's red uniform, itself an emblem of his rank. The figure stands alone, in dramatic relationship to the background... In addition the subject is off-centre; he stands in the right foreground, protagonist of an event whose nature is emphasized by his forceful gesture and the slight turn of his body, which produces a diagonal recession."
Β. Redford: Reynolds und das parodistische Porträt
31
Winds Scharfsinn, Scharfblick und Eloquenz als Leser von Bildern unterstreichen in Vollkommenheit den Kontrast, um den sich „Hume und das heroische Porträt" dreht: „Gainsborough ist unschuldig aller gelehrten Anspielungen und jeglicher Schauspielerei; bei Reynolds sind die theatralische Geste und der metaphorische Ausdruck par excellence die Mittel, den heroischen Effekt zu erzielen." Bescheiden auf Winds Grundlagen aufbauend, habe ich hier eine Untersuchung der „gelehrten Anspielung" als Mittel zur Erlangung der „theatralischer Geste und [des] metaphorischen Ausdruck[s]" versucht. Abschließend möchte ich darauf hinweisen, daß Reynolds' heroische Porträtkunst ihre Abhängigkeit sowohl vor sich herträgt als auch verhüllt - daß in seinen Händen die anspielende Nachahmung viel komplexer und beunruhiger ist, als wir bisher einzuräumen bereit gewesen sind. Die Bestimmung dessen, was Robert Rosenblum „Reynolds' Dialog mit der Kunst seiner Zeitgenossen"26 genannt hat, ist ein Weg, diese Komplexität zu bemessen. Ziel einer solchen Untersuchung wäre letzten Endes, Reynolds einen Platz in der großen Kulturdebatte zwischen den Alten und den Modernen zuzuweisen - jener Debatte, die Jonathan Swift in seiner Battle of the Books [Die Bücherschlacht] beschreibt. Sie werden sich erinnern, daß Swift eine Konfrontation zwischen einer Spinne und einer Biene schildert. Die Spinne nennt die Biene „eine Landstreicherin ohne Haus noch Heimat", die einzig von „Raub" und „Freibeuterei" lebe. Die Biene entgegnet der Spinne, da sie „alles aus [sich selbst] herauszuziehen und verspinnen" könne, müsse sie wohl „eine recht ansehenliche Menge an Unflat und Gift" besitzen. Die Debatte wird zugunsten der Biene entschieden, die für die Seite der Alten und die Lehre von der Nachahmung steht; es ist die Biene, die „Honig und Wachs", „Süße und Licht" durch „langes Suchen, tiefes Nachdenken, wahre Urteilskraft" erzeugt.27 Die Herstellung von Honig und Wachs, das Studium der hybriden Spinnen-Bienen, ist ein Thema, das eines Edgar Wind selbst würdig ist. Aus dem Englischen von Bernd
Samland
26 Robert Rosenblum, in: Reynolds (wie Anm. 20), S. 45. 27 Jonathan Swift, Gulliver's Travels and other Writings, hrsg. von Louis A. Landa, Boston 1960, S. 366-368.
Heroisierte Porträts ? Edgar Wind und das englische Bildnis des 18. Jahrhunderts Werner Busch
Wissenschaftsgeschichte ist, wenn der zu behandelnde Gegenstand für den Werdegang eines Autors von unmittelbarer Wichtigkeit gewesen ist, nicht unproblematisch. Neben historischer Distanznahme ist Selbstreflexion gefordert. Bei der Einsicht darein, daß die Aneignung einer Denk- und Forschungstradition interessegeleitet ist, dürfte es sich um einen Allgemeinplatz handeln, doch können die Interessen sehr unterschiedlicher Natur sein. Wir erleben seit einigen Jahren eine Warburg-Renaissance ohnegleichen. Das nie in eine abschließende Form geronnene Warburgsche Konzept einer Kulturgeschichte wird mit großer Gelehrsamkeit rekonstruiert und mit zeitgleichen Modellen verglichen, um einem kulturgeschichtlichen Paradigma zuzuarbeiten, das der in die Krise geratenen Kunstgeschichte der Gegenwart neues Leben einzuhauchen verspricht. Eine derartige Reflexion macht entschieden Sinn. Daneben können wir eine Warburg-Philologie beobachten, die sich einem hemmungslosen Positivismus verschrieben hat: wir wissen inzwischen allen Ernstes, wo Warburg seine Ziege hat weiden lassen. Entschieden unangenehm jedoch ist eine dritte Spielart der Rezeption, die sich aus den Warburgschen Bruchstücken einer Konfession bedient und mit ihnen in postmoderner Beliebigkeit spielt. Das erinnert fatal an die Benjamin-Rezeption der sechziger und siebziger Jahre. In beiden Fällen ist die Verlockung insofern groß, als Benjamin wie Warburg in immer neuen Anläufen versucht haben, Schlüsselphänomene einer zu schaffenden Kulturtheorie in ungemeiner sprachlicher Verdichtung zu umkreisen. Komplexe, nicht selten paradoxe, aber darum um so mehr sich einprägende Begriffsschöpfungen gewannen, gelöst aus ihrem Kontext, ein Eigenleben, das sie zur Vernutzung geradezu prädestinierte. Kein kulturkritischer Essay mehr ohne Pathosformeln, Superlative europäischer Gebärdensprache oder auch Urworte leidenschaftlicher Gebärdensprache, Inversionen, soziale Gedächtsnisleistungen oder Denkräume der Besonnenheit. Und nun Edgar Wind, mehr als sechzig Jahre, nachdem er seine ersten wichtigen Aufsätze veröffentlicht hat. Wie wird seine sich abzeichnende Renaissance aussehen? Liest man Winds in „Times Literary Supplement" am 25. Juni 1971 erschienene vernichtende Rezension von Ernst H . Gombrichs „Intellectual Biography" War-
34
II Zur Kunst
burgs 1 , so ahnt man, daß es eine grundsätzliche Auseinandersetzung um das Warburgsche Erbe gegeben hat. Die Forschung wird nicht umhinkommen, sich diesem „clash" zu widmen, selbst wenn auch dies philologische Blüten treiben wird, denn erst das Messen der relativen Blicke auf Warburg aneinander dürfte einer kritischen Distanznahme aus heutiger Sicht dienen. Sie dürfte uns auch zeigen, an welchem Punkt und aus welchen Gründen die Warburgsche Kulturgeschichte primär zu reiner Geistesgeschichte geworden ist. Gerade der „philosophische" Wind könnte dem Verdacht ausgesetzt werden, hierfür zu einem Gutteil verantwortlich zu sein. Diese Konstruktion dürfte allerdings nur unter Ausschaltung des „politischen" Wind funktionieren oder, anders ausgedrückt: sie machte nur Sinn, wenn wir unterstellten, Wind ginge von einem bruchlosen Aufgehen des Kunstwerkes in zeitgenössischen abstrakten Denkgebäuden aus und thematisierte nicht die unauflösbare Spannung, ja sich auftuende Lücke zwischen Erfahrung und Theorie. Als Probe aufs Exempel bietet es sich in mehrfacher Hinsicht an, Winds frühen Aufsatz aus den „Vorträgen der Bibliothek Warburg" von 1931 über „Humanitätsidee und heroisiertes Porträt in der englischen Kultur des 18. Jahrhunderts" zu untersuchen.2 Zum einen ist dieser Aufsatz, auch nach der Meinung heutiger Kritik, der unmittelbare Reflex auf den prägenden Kontakt mit Warburg. Zum anderen hat Wind seine auch für das Folgende verbindliche methodische Position bereits weitgehend um 1930 erlangt. Des weiteren scheint der Aufsatz geeignet, auf die Diskrepanz hinzuweisen, die sich - jedenfalls nach unserer Meinung - zwischen Winds theoretischer Grundlegung und der praktischen Behandlung des englischen Porträts auftut. Sie zeigt sich gerade in der Frage der geistesgeschichtlichen Fundierung der Porträtkunst. Und schließlich erscheint es uns möglich, Winds Ergebnisse vor der Folie des heutigen Forschungsstandes zu kritisieren. So schwebt uns alles andere als Hagiographie vor - was unsere Bewunderung für die beneidenswerte Klarheit der Sprache, besonders bei der Darlegung philosophischer Zusammenhänge, und auch für die Brillanz zahlreicher Beobachtungen Winds nicht im geringsten mindert. Uberschrift und erster Satz von Winds großem Aufsatz sind Programm. Die Koppelung von „Humanitätsidee" und „heroisiertem Porträt" soll besagen, daß die jeweils gefaßte Humanitätsidee über die Beurteilung des heroisierten Porträts entscheidet. Und der erste Satz lautet noch direkter: „Es soll in diesem Vortrag versucht werden, die englische Porträtkunst des 18. Jahrhunderts in Zusammenhang zu bringen mit den zeitgenössischen philosophischen Anschauungen vom Wesen 1 Ernst H. Gombrich, Ab y Warburg. An Intellectual Biography, London 1970 (dt. 1981). 2 Edgar Wind, „Humanitätsidee und heroisiertes Porträt in der englischen Kultur des 18. Jahrhunderts", in: England und die Antike, Vorträge der Bibliothek Warburg 1930-31, Leipzig und Berlin 1932, S. 156-229 (engl, als: „Hume and the Heroic Portrait", in: Edgar Wind, Hume and the Heroic Portrait. Studies in Eighteenth-Century Imagery, hrsg. von Jaynie Anderson, Oxford 1986, S. 1-52).
35
W. Busch: Heroisierte Porträts?
und von der Würde des Menschen." 3 Durch Prüfung von Texten und Bilddokumenten will Wind einen Zusammenhang „wiederaufdecken", der den Engländern des 18. Jahrhunderts selbstverständlich war, nur uns historisch verschüttet ist. Diese Grundprämisse reflektiert er fortschreitend immer wieder, wie folgende paraphrasierten Zitate deutlich machen können: Wind sieht die Künstler in der Gestaltung direkt in den philosophischen Streit eingreifen, nimmt nicht etwa eine bloße Parallelität von Denken und Bildlichkeit an, allerdings auch nicht eine bloße Deckungsgleichheit, sondern eine zwischen ihnen herrschende Spannung, die für die Deutung wechselseitig fruchtbar zu machen sei. Besonders deutlich werde dies notwendig beim Porträt, denn neben der Wiedergabe einer individuellen Erscheinung müsse gleichzeitig der Künstler in der Gattung auch sein Bild vom Menschen zur Anschauung bringen.4 Das Bild vom Menschen, die Humanitätsidee, sieht Wind nun allerdings nach einem geradezu überhistorischen Gesetz, das bei ihm der Philosophiegeschichte und dem Einfluß Warburgs gleich viel verdankt, immer in polarer Ausprägung. Schon in seiner kunstphilosophischen Dissertation von 1922 ist in Auseinandersetzung mit Wölfflin und Riegl ohn' Unterlaß von Polaritäten die Rede: von haptisch-optisch, Fläche-Raum,Trennung-Verbindung, starrer Isolierung—lebendigem Verfließen und dann vor allem von Dingerscheinung und Ausdrucksgehalt.5 Unter Warburgs Einfluß wird dieses Polaritätsdenken entscheidend für Winds Symboltheorie, er stellt sie als von Warburg stammend, aber auch als für ihn verbindlich auf dem 4. Kongreß für Ästhetik 1930 vor.6 Im Symbol finden sich die gegensätzlichen Kräfte des Denkens einer Zeit zusammen. Dieses Symbolische kommt im Kunstwerk zur Anschauung. Im Kunstwerk verkörpern sich die polaren Ideen und treten ästhetisch hervor. Von Warburg nun lernt Wind, daß dieses sinnliche Erscheinen der verkörperten Ideen nicht als ein bloßer Ausgleich, als eine Aufhebung der Polarität zu denken ist, eine Lösung der Spannung, sondern im Gegenteil allein eine Aufhebung im Hegeischen Sinne darstellt, die Pole bleiben in einem labilen Gleichgewicht erhalten, Logik steht weiter gegen Mythos, Rationalität gegen Expression.7 Im Werk werden sie auf eine gemeinsame, dritte, Ebene gehoben, immer in der Gefahr, sich als Vorstellungen auch wieder zu isolieren. Die
3
Wind, Humanitätsidee
4
Ebenda, S. 160.
5
(wie Anm. 2), S. 156.
In Auszügen veröffentlicht als: „Zur Systematik der künstlerischen Probleme", in: Zeitschrift Ästhetik und allgemeine
Kunstwissenschaft
Buschendorf, „Einige Motive im Denken Edgar Winds", Nachwort, in: Edgar Wind, Mysterien in der Renaissance,
für
X V I I I , 1925, S. 438^-86, bes. S. 464ff.; siehe Bernhard Heidnische
Frankfurt/M. 1987, S. 3 9 6 - 4 1 5 ; diesem Beitrag verdankt das Folgende
manches. 6
Edgar Wind, „Warburgs Begriff der Kulturwissenschaft und seine Bedeutung für die Ästhetik", in: Vierter
Kongreß
für Ästhetik
Ästhetik und allgemeine 7
und allgemeine
Kunstwissenschaft
Kunstwissenschaft,
X X V , 1931, S. 1 6 3 - 1 7 9 .
Siehe Buschendorf (wie Anm. 5), S. 4 0 4 - 4 0 6 , 412.
Beilagenheft zur Zeitschrift
für
36
II Zur Kunst
kulturwissenschaftliche Aufgabe besteht nun darin, die Pole zu benennen, im Werk als angelegt zu erkennen und die Form ihrer Zusammenführung zu beschreiben auf der Basis der ästhetischen Wirksamkeit des Werkes. Bernhard Buschendorf hat zu Recht betont, daß an dieser Polarität Warburg grundsätzlich mehr das beunruhigende Ausdruckspotential des Werkes interessiert hat, Wind mehr der logische Pol, der im Werk verkörperte rationale Gedanke. 8 Für beide, Warburg und Wind, war es unerläßlich, den von Warburg sogenannten Denkraum der Besonnenheit zwischen Mensch und Objekt, Interpreten und Werk, durch einen Rekurs auf strenge Empirie zu schaffen, dazu mußte das Werk in seinen Denkbedingungen sorgfältig historisch rekonstruiert werden. Für Wind bedeutete dies primär die Rekonstruktion philosophischen Denkens. Er war davon überzeugt, daß nicht freigelegte Denkzusammenhänge auch die ästhetische Genießbarkeit des Werkes einschränkten, ebenso wie eine Uberfrachtung mit Textbezügen die Werkwirksamkeit verschleiert. Uber das rechte Maß an Bezugsstiftung habe ein Gefühl ästhetischer Angemessenheit zu entscheiden, so daß der Theorie nach im Endeffekt das Werk das letzte Wort hat. 9 Es ist zu fragen, ob Wind dies in der Praxis einlöst. Der Vorwurf, daß dies nicht erfolgt, ist ihm durchaus gemacht worden, etwa von Robert Klein in bezug auf „Pagan Mysteries": die Kunstwerke dienten nur als Schlüssel zur Rekonstruktion der Denkweisen der Renaissance. 10 Auch der „Humanitätsidee"-Aufsatz kann zu diesem Verdacht Anlaß geben, heißt es doch geradezu verräterisch: Da im Porträt notwendig der Begriff des Menschen anschaulich reflektiert würde, sei es für den „rückblickenden Betrachter möglich, den philosophischen Kampf, der um die begriffliche Bestimmung der Humanitätsidee ausgefochten würde, durch künstlerische Leistungen zu illustrieren". 11 Die Pole im englischen Denken der Zeit sieht Wind nun durch die skeptische und die heroische Lebensauffassung verkörpert. Als den skeptischen Philosophen par excellence schildert er David Hume, als den Propagandisten der heroischenthusiastischen Uberzeugung James Beattie und irritierenderweise auch Dr. J o h n son und ordnet sie Gainsborough respektive seinem großen Konkurrenten Reynolds zu, in deren Porträtkunst die jeweilige Auffassung zum Ausdruck gekommen sei. 12 Es folgt die Schilderung des Humeschen Skeptizismus, ein Glanzstück philosophiegeschichtlicher Darstellungsweise, dagegen bleibt die Vorstellung der Gegenseite seltsam blaß. Winds Sympathien sind eindeutig verteilt, der Humesche Empirismus steht ihm ausgesprochen nahe, heroische Verklärung aus En-
8 Ebenda, S. 406. 9 Wind, Mysterien
(wie Anm. 5), S. 27.
10 Robert Klein, Rezension von Edgar Wind, Pagan Mysteries in the Renaissance, London 1958, in: Zeitschrift für Kunstgeschichte 23, 1960, S. 284-86. 11 Wind, Humanitätsidee (wie Anm. 2), S. 160. 12 Ebenda, S. 157-159 et passim.
W. Busch: Heroisierte
Porträts?
37
thusiasmus ist ihm entschieden unangenehm. Dabei hat er in dem mittelmäßigen Dr. Beattie, den Reynolds in einem emblematisch aufgeladenen, heroischen und durchaus unglücklichen Porträt verewigt hat 1 3 , einen leichten Gegner. Mit Dr. Johnson verhält es sich anders, und hier wird man f ü r einen Moment psychologisieren müssen, nicht ohne zuvor allerdings Humes Überzeugungen, Wind folgend, dargestellt zu haben. Hume sieht sowohl Angst, die aus Aberglauben entsteht, wie auch Stolz, der sich auf Enthusiasmus gründet, als Resultat der Einbildungskraft. Von daher geht es ihm um skeptische Kontrolle der Einbildungskraft. Skepsis zersetzt Enthusiasmus und Aberglaube, ein mildes Gefühl der menschlichen Grenzen tritt an ihre Stelle, Hume hält es f ü r das „Natürliche" schlechthin, es scheint sehr dem Warburgschen Leitbegriff Sophrosyne zu ähneln. Diese natürliche Skepsis ist f ü r Hume per se moralisch. Jede theologische und übernatürliche Fundierung der Moral lehnt Hume ab, auch jede zwanghafte, etwa stoizistische oder asketische Selbstzensur, eine ruhige Form von „charity and benevolence", Güte und Mildherzigkeit, Toleranz und Humanität sind die Folge der Humeschen natürlichen Skepsis - w o z u sich der Stoiker mit seinem absoluten Selbstzwang nie versteigen könnte. 1 4 Aus dieser Grundüberzeugung nährt Hume sein Mißtrauen gegen jede Form von Heroismus, bzw. heroischer Lobpreisung, die überspannter Einbildungskraft entstamme. Lieber zuwenig als zuviel tun, ein mildes Gleichmaß erscheint als philosophisches Idealziel. Selbst das Sterben war für Hume in dieser seelischen Ausgleichslage geradezu entspannt auf sich zu nehmen. Keine Frage, Wind beschreibt die Grundzüge Humeschen Denkens, das ihm ganz offensichtlich selbst als Ideal vorschwebt, adäquat. Nur sollte schon hier darauf aufmerksam gemacht werden, daß diese Grundzüge, die Wind dann auch in der Kunst Gainsboroughs verköpert sieht, im englischen Denken der Zeit eine viel breitere Verankerung haben, die, um es gleich zu sagen, die Verbindung von Humeschem Denken mit Gainsboroughs Kunst gänzlich überflüssig macht. N u r zwei Hinweise: die Humeschen Begriffe „charity" und „benevolence" als die Zentralbegriffe einer milden Tugendlehre können uns den Weg weisen. Sie entstammen einem breiten Strang latitudinarischer Glaubensüberzeugung, in Hunderten von sogenannten „charity"-Predigten seit dem späteren 17. Jahrhundert verbreitet, seit den Bischöfen John Tillotson und Isaac Barrow, deren Predigten im 18. Jahrhundert immer wieder aufgelegt wurden, über Bischof Samuel Clarke bis hin zu Benjamin Hoadly, Bischof von Winchester und Freund Hogarths. 15 A u c h ein Teil der Bilder Hogarths, ja seine ganze Lebensauffassung, ist der „Christian benevolence"
13 Ausst. Kat. Reynolds, Nr. 87. 14 Wind, Humanitätsidee
hrsg. von Nicholas Penny, Royal Academy of Arts, London 1986, Kat.
(wie Anm. 2), S. 164. 15 Siehe Werner Busch, Das sentimentalische Bild. Die Krise der Kunst im 18. Jahrhundert Geburt der Moderne, München 1993, S. 24-34.
und die
38
II Zur Kunst
als einer ganz praktischen Mildtätigkeit verpflichtet. Dieser Auffassung ist der in England ohnehin ungewöhnliche Humesche Materialismus fremd. Einem ebenso breiten Strang folgt die Kritik am stoischen Heldenideal, schon bei Malebranche in den 1670er Jahren werden Cato und Brutus und mit ihnen aller Stoizismus als selbstüberheblicher Stolz verdammt, und Richard Steele, Addisons Partner in der Verbreitung Augusteischer Moral am Anfang des 18. Jahrhunderts, gab in seiner Abhandlung „Christian Hero", die es im 18. Jahrhundert immerhin auf zwanzig Auflagen gebracht hat, diesem Antistoizismus seinen sozialen Ort in einer pragmatischen, gänzlich unheroischen „middle-class"-Moral. Christliche, still wirkende Tugend wird dem antiken heroischen Heldenideal, das als bloßer eigensüchtiger Selbstzweck diffamiert wird, gegenübergestellt.16 Für beides brauchen wir David Hume also nicht, das tertium comparationes zu Gainsborough, von dem wir nicht einen direkten Hinweis auf Hume haben, scheint nicht zu greifen. Anders verhält es sich mit dem zum Humeschen Antipoden stilisierten Dr. Johnson. In der Tat, das Humesche Sterbeideal, das offensichtlich französisch-materialistischer Philosophietradition entstammt17, konnte ihm nur als blasphemisch vorkommen, zudem als gänzlich verlogen. Dr. Johnson, der Schöpfer des englischen Wörterbuches, der größte Sprachrationalist des 18. Jahrhunderts, wurde von extremen Angst- und Schuldanfällen heimgesucht, hatte panische Furcht vorm Sterben, malte sich die Schrecken nach dem Tode in aller Gräßlichkeit aus. Nur durch strenge Exerzitien einerseits, durch Trost im Freundeskreis andererseits, war es ihm möglich, eine prekäre Balance zu halten, immer vom Absturz bedroht, zugleich aber in die Lage versetzt, durch seinen verzweifelten Beherrschungsakt, dem Leben in seinem verhaßten Leib eine ungemeine sprachliche Klarheit, eine absolute gedankliche Logik und vor allem wahrhaftige Ehrlichkeit in allen Äußerungen auch und vor allem sich selbst gegenüber abzugewinnen, das geht bis zur Selbstentblößung.18 Wind weiß durchaus darum, aber er scheint es nicht wirklich würdigen zu wollen. Man kommt nicht umhin, um es noch einmal zu sagen, nach psychologischen Gründen für diese irritierende Zurückhaltung zu fragen. Wind, keine Frage, sieht seine Position durch Humes Ideal beschrieben. Doch wie ist das mit Warburg, dem großen Windschen Vorbild? Man begreift Winds vernichtende Kritik des Gombrichschen Buches nur, wenn man sie unter dieser Fragestellung betrachtet. Denn wogegen läuft er Sturm? Gegen Gombrichs Darstellung, Warburg sei sein Leben lang ein Umgetriebener gewesen, immer zwischen Rationalität und Irrationalität schwankend, jemand, der letztlich primär in intellektuellen Bruchstücken seiner Obsessionen Herr zu werden trachtete, in immer neuen Anläufen die gleichen 16 Ebenda und Richard Steele, The Christian Hero, hrsg. von Rae Blanchard, Oxford/London 1932. 17 John McManners, Death and the Enlightenment. Changing Attitudes to Death among Christians and Unbelievers in Eighteenth-Century France, Oxford/New York 1981. 18 Busch, Bild (wie Anm. 15), S. 411-Í18.
W. Busch: Heroisierte Porträts?
39
Fragen umkreisend, ohne im Endeffekt noch zu einer zusammenfassenden Antwort kommen zu können.19 Seine ungezählten Notizen, aus denen Gombrich zitiert, scheinen den Denkraum der Besonnenheit zu sprengen, der unvollendete, und nach Gombrichs Meinung wohl auch unvollendbare Bilderatlas spiegele nichts anderes. Wind hält dies für eine Diffamierung, sieht - und die Rezeption von Gombrichs Buch als Steinbruch für postmoderne Essayversatzstücke scheint ihm recht zu geben - die Gefahr, daß die disparaten Notizen als bloße Benjaminische Geistesblitze das zukünftige Bild von Warburg prägen und nicht etwa seine glasklaren, logisch vollständig beherrschten, ausformulierten Abhandlungen.20 Mit aller Macht sucht Wind am Ende seines Lebens Warburg für die Seite der Rationalität - und damit für seine Seite zu retten. Ganz offensichtlich sieht er in Gombrich den illegitimen Erben Warburgs, sich selbst als den eigentlich berechtigten Sachwalter. Und so will er von dem gleich nach Warburgs Tod 1929 entwickelten Bild Warburgs auch schon in seinem Aufsatz von 1930 nicht lassen. Dabei beschreibt er in Dr. Johnson, wie er wohl ahnt, wenn er dessen Zwangsneurosen einerseits mit Sympathie betrachtet, um ihn dann aber doch andererseits im „falschen" Lager zu situieren, exakt das Warburgsche Schicksal: wie Dr. Johnson verzweifelt gegen die Ängste ankämpfend, um sich immer wieder, auch nach Zusammenbrüchen, zur Sophrosyne durchzuringen und dies in Arbeiten von höchstem Scharfsinn sich selbst zu beweisen. Warburg gehört nicht zur Humeschen Seite, aber auch nicht zum sentimental-pathetischen Heroismus eines Dr. Beattie. Diese Art von Gefühligkeit haben Warburg wie Wind verachtet.21 Aber das Denken in Polaritäten geht eben nicht immer auf, denn auch Dr. Johnson gehört nicht zur Beattie-Seite eines unkontrollierten Enthusiasmus, sondern markiert durchaus eine eigene Position. Der Denkfehler scheint darin zu sehen zu sein, daß Wind, womöglich aus Betroffenheit, philosophische Überzeugung und menschliche Psyche nicht voneinander trennt. Doch nach diesem Ausflug in die Unwägbarkeiten zurück zu Winds Aufsatz. Nächste Frage muß sein, inwieweit Reynolds' Porträtkunst eine Verkörperung von Dr. Beatties schwachbrüstiger Heroismusphilosophie sein kann. Auch hier wird man Edgar Wind nicht folgen können. Doch muß man an dieser Stelle sehr differenziert argumentieren, denn zweifellos hat sich Reynolds einer heroisierenden Bildauffassung verschrieben und ebenso zweifelsfrei gab es eine ausgeprägte Polarität zwischen Gainsborough und Reynolds.
19 Gombrich, Warburg (wie Anm. 1), bes. „Introduction" und Kap. XVI, S. 307-324. 20 Edgar Wind, „Unfinished Business. Aby Warburg and his Work", in: Times Literary Supplement, 25. Juni 1971, S. 735f. (Rezension von Ernst H. Gombrich, Aby Warburg. An Intellectual Biography, London 1970), wieder abgedruckt unter dem Titel: „On a recent Biography of Warburg", in: Edgar Wind, The Eloquence of Symbols. Studies in Humanistic Art, hrsg. von Jaynie Anderson, Oxford 1983, S. 106-113. 21 Wind, Eloquence (wie Anm. 20), S. 110.
40
II Zur Kunst
Zum ersten Punkt: zu Reynolds heroisierender Porträtauffassung. Alle Untersuchungen zu Reynolds' Form der Nobilitierung des Porträts gehen zu Recht aus von Reynolds eigenen Bemerkungen zum „composite style" im vierten Akademiediskurs des Jahres 1771.22 Im Grunde genommen sind sie nicht sehr weitgehend und auch nicht besonders tiefschürfend. Nobilitierung im Porträt erfolge durch die Anlehnung an den „grand style" der Historienmalerei und die so sich einstellende Teilhabe an der „general idea" als dem höchsten Ziel der Kunst. Zu diesem Behufe sei das Kostüm zeitlos zu gestalten, seien kleinere Ungereimtheiten und Eigentümlichkeiten der Gesichtszüge zu unterdrücken, allerdings ohne zuviel an Ähnlichkeit aufzuopfern.23 Allein durch die Verwendung eines Begriffes unterscheidet sich Reynolds von der geläufigen Porträttheorie, und zu diesem Begriff gibt es verstreut über die Diskurse, wenn auch ohne expliziten Bezug zur Porträtmalerei, immer wieder Bemerkungen, die wichtigsten im 6. und 12. Diskurs, die ihre Konsequenzen für die Theorie, vor allem aber für die Reynoldssche Praxis haben: es ist der Begriff „borrowing" - Entlehnung.24 Der Porträtmaler soll Anleihen beim hohen Stil machen. Der Begriff gibt der klassischen Nachahmungstheorie einen besonderen Twist. Nicht generelle Nachahmung der klassischen Vorbilder in Stil, Haltung und Erfindung ist gemeint, sondern direktes Zitat einer einprägsamen Figuration, allerdings in Form von Anverwandlung an einen neuen Kontext. Ein derartiges Zitat sei nicht Plagiat, sondern im Gegenteil künstlerische Erfindung und zugleich, so können wir Reynolds ergänzen, Anknüpfung an, versuchter Einstieg in eine verbindliche Tradition. Reynolds denkt das Konzept sogar noch einen Schritt weiter, was dem an Warburg geschulten Wind besonders gut gefallen haben muß: er propagiert eine durch den neuen Kontext erfolgende gänzliche Bedeutungsinversion der gleichgebliebenen zitierten Figuration und führt dafür auch gleich ein Beispiel an, das Wind direkt zu seinem Aufsatz über die „Mänade unter dem Kreuz" geführt hat.25 Er besitze, schreibt Reynolds, eine Zeichnung von Baccio Bandinelli mit einer Kreuzabnahme, in der Bandinelli die Figuration einer rasenden Bacchantin, deren Typus in Reliefs, Kameen und Gemmen weit verbreitet sei, übertragen habe auf eine der verzweifelt klagenden Marien unter dem Kreuz.26 Zur Abrundung zitiert die Forschung zu Reynolds grundsätzlich - und auch Wind tut dies - noch Horace Walpoles 1771 formulierte Einschätzung von Reynolds Zitatpraxis, mit der er ihn vor dem Plagiatsvorwurf schützen wollte. Er
22 Sir Joshua Reynolds, Discourses on Art, hrsg. von Robert R. Wark, New Haven and London 3 1988, bes. S. 71 f. 23 Ebenda, S. 58-60, 69 f. 24 Ebenda, S. 106f., 215-217, 220-223. 25 Edgar Wind, „The Maenad under the Cross: I. Comments on an observation by Reynolds", in: Journal of the Warburg Institute I, 1937/38, S. 70f. 26 Reynolds, Discourses (wie Anm. 22), S. 221 f.
W. Busch: Heroisierte
Porträts?
41
betrachtet sie als besondere Form des Bildwitzes, der besonders dann entstehe, wenn die zitierte Figuration im neuen Kontext eine besondere Bedeutungsdiskrepanz zum ursprünglichen Sinnzusammenhang aufweise. Für denjenigen, der die Herkunft der Figuration realisiere, steigere sich im Vergleich von altem und neuem Sinn das ästhetische Vergnügen an der Neuverwendung. 27 Keine Frage, Walpoles Beobachtung steht in einem breiten Strom englischer Wahrnehmungs-, Wirkungsund schließlich Assoziationsästhetik, der sich schon in der ersten Hälfte des Jahrhunderts, von Addison bis Gerard, mit den psychologischen und ästhetischen Konsequenzen beim Vergleich von Vorbild und Nachbild beschäftigt hat. 28 Wind war nun wohl der Erste in der neueren Forschung, der zweierlei realisierte: 1. Neben Zitaten, die entschieden „sophisticated" sind und mit dem Kennertum und der Wahrnehmungskompetenz des Betrachters spielen, gibt es durchaus auch solche nach zweit- und drittrangigen Künstlern, deren Entdeckung Reynolds fürchten mußte. Was Wind wohl noch nicht wußte, was aber die neuere Forschung zu Reynolds in allem Detail ausgebreitet hat: auf der Akademieausstellung des Jahres 1775 stellte Nathaniel Hone ein schnell unterdrücktes Bild mit dem Titel „The Conjuror", „Der Zauberer", aus, das offensichtlich aufgrund von Insiderkenntnissen die wörtliche Herkunft zahlreicher Reynoldsscher Motive offenlegte und ihn dadurch in der Tat in den Augen der Öffentlichkeit als bloßen Plagiator dastehen ließ. 29 Allerdings ist auch dieses Zitatverfahren weniger ehrenrührig als es den Zeitgenossen und auch der neueren Forschung erscheinen mochte, denn Reynolds realisierte in ganz erstaunlichem Maße, geradezu mit historistischer Einsicht, den unüberbrückbaren und nicht wieder rückgängig zu machenden historischen Bruch, der seine Gegenwart von der klassischen Kunsttradition trennte. Niedergelegt hat er diese Gedanken in seinem 15. und letzten Diskurs aus dem Jahre 1790: „Im Verfolg dieser großen Kunst [gemeint: des hohen Stiles eines Michelangelo] muß eingestanden werden, daß wir unter größeren Schwierigkeiten arbeiten als die, die im Zeitalter ihrer Entdeckung geboren wurden und deren Sinn von Kindertagen an diesen Stil gewöhnt war; sie lernten ihn als Sprache, als ihre Muttersprache. Sie hatten keinen mäßigen Geschmack, um ihn überhaupt wieder verlernen zu können; sie brauchten keinen überzeugenden Diskurs, der sie zu einer günstigen Aufnahme dieses Stils überreden sollte [wie Reynolds es in seinen Diskursen in bezug auf die englische Kunstszene versuchte], keine tiefgründigen Nachforschungen nach seinen Prinzipien, um sie von den großen verborgenen Wahrheiten zu überzeugen, auf denen er gegründet ist. Wir [dagegen] sind ge-
27 Horace Walpole, Anecdotes of Painting, 3 Bde., London 1888, Bd. 1, S. XVII, Anm. 2; Werner Busch, Nachahmung als bürgerliches Kunstprinzip. Ikonographische Zitate bei Hogarth und in seiner Nachfolge (= Studien zur Kunstgeschichte Bd. 7), Hildesheim/New York 1977, S. 30-37. 28 Siehe Busch, Nachahmung (wie Anm. 27), S. 43—49. 29 Ausst. Kat. Reynolds (wie Anm. 13), Kat. Nr. 173 und John Newman, „Reynolds and Hone. The Conjuror Unmasked", in: ebenda, S. 344-354.
42
II Zur Kunst
zwungen, in diesen späteren Zeiten zu einer Art Grammatik oder Wörterbuch Zuflucht zu nehmen, als dem einzigen Weg, eine tote Sprache wiederzuerlangen. Sie haben ihn [den großen Stil] unbewußt, rein mechanisch gelernt und so viel besser als aufgrund von Regeln." 30 Aus dieser Perspektive gesehen ist auch das Zitat einer Formfindung eines unbedeutenderen Künstlers - und Reynolds zitiert beispielsweise Giovanni Battista Franco, Francesco Albani oder Francesco Romanelli 31 - nichtsdestotrotz die Evokation einer in allen Verästelungen gleich hohen, verlorenen Kulturtradition, einer Sprache, man kann durchaus im Sinne des 18. Jahrhunderts sagen: einer Ursprache der Kunst, die in der Gegenwart allenfalls noch zu rekonstruieren ist. Die Berufung auf sie dokumentiert ein Ethos und nicht eine Teilhabe. Soweit vom Warburgschen bzw. Windschen Wissenschaftsbegriff scheint diese Einsicht im übrigen nicht entfernt zu sein. Die zweite wichtige Beobachtung Winds besteht darin - und der Zusammenhang mit dem eben Ausgeführten ist nicht zu übersehen - , daß er den spielerischen Charakter von Reynolds' Rollenporträts realisiert, die u. a. angeregt wurden durch die inzwischen vor allem von Aileen Ribeiro untersuchte Maskeradenmode. 32 Das heißt, die Reynoldssche allegorische oder mythologische Einkleidung erhebt nicht oder nicht notwendig den Anspruch, die in der Rolle verkörperte Geltungsmacht auf den Rollenträger zu transferieren. Der ästhetische Gewinn resultiert wiederum primär aus der Realisierung der Anspielung, sie kann Kompliment sein, aber auch paradox bleiben, sie kann nur einen Zug des Vorbildes meinen, oder auch einfach eine Konvention aufrufen, sie kann aber auch vorrangig bildungsbürgerliches oder kunsthistorisches Spiel sein, bei dem nicht eine mythologische Figur in ihrer Bedeutung, sondern in ihrer Darstellungstradition aufgerufen wird, und sie kann schließlich im Bereich der privaten Anspielung verbleiben, d. h. etwa auf ein in der Rolle punktuell gespiegeltes, nur Eingeweihten bekanntes Ereignis aus dem Leben des oder häufiger der Dargestellten Bezug nehmen. „Vielleicht unterscheidet sich eben hierin", schreibt Wind, „diese einer bürgerlichen Kultur angehörige Form der Allegorie von denjenigen mythologischen Porträts, die, wie etwa in Frankreich, einer Hofkultur entspringen. Dort werden die antiken Mythologeme wirklich Symbole der Aneignung; die Gestalt verwandelt sich, indem sie sich verkleidet." 33 Sie erhebt, wie wir auch sagen können, Anspruch auf die Rolle. Winds Resümee zum englischen Rollenporträt lautet: „Noch immer wird die Person „als" etwas dargestellt, aber nicht mehr als die Verkörperung einer übernatürlichen Heroine oder Göttin, sondern lediglich als Beispiel einer Stimmung oder eines seelischen
30 Reynolds, Discourses (wie Anm. 22), S. 278. 31 Siehe Newman (wie Anm. 29), Fig. 84, 94, 102. 32 Aileen Ribeiro, The Dress Worn at Masquarad.es in England, 1730 to 1790, and Its Relation to Fancy Dress in Portraiture (= A Garland Series, Outstanding Thesis from the Courtauld Institute of Art), New York-London 1984; dies., Dress and Morality, London 1986. 33 Wind, Humanitätsidee (wie Anm. 2), S. 217.
W. Busch: Heroisierte Porträts?
43
Zustandes, der sich psychologisch unter einen Allgemeinbegriff bringen läßt." 3 4 So sehr also die Rolle weiterhin nobilitieren kann oder soll, ihre Form der Anwendung offenbart zugleich auch ein reflektiertes Verhältnis zur Adaption, d. h. paradoxerweise offenbart die Nobilitierung zugleich die individuellen Grenzen der dargestellten Person, ja sie kann so die Individualität, das Wesen der Person, womöglich deutlicher zum Vorschein bringen, als es eine minutiöse Nachahmung der Erscheinung der Person vermöchte. Und obwohl Wind dies zu ahnen scheint und zugleich auch feststellen muß, daß Reynolds' Porträts „bei allem Streben nach Heroisierung" einer „überladenen Pathetik fast niemals zum O p f e r " 3 5 fielen, bleibt er letztlich bei seiner Zuordnung des Künstlers zur Beattieschen Tradition eines enthusiastischen Heroismus. Diese offensichtliche Verkennung der Reynoldsschen Position, die, wie Wind entscheidend mitgeholfen hat zu begreifen, eben nicht mehr bruchlos in klassischer Theorie aufgeht, resultiert offenbar aus Winds Konstruktion einer absoluten Polarität zwischen Gainsborough und Reynolds, der wir uns jetzt zuwenden müssen. 36 Wind nimmt sie, um es vorab zu sagen, als „face value", für bare Münze, sieht nicht ihren topischen, kunsttheoretisch determinierten, ja modalen Charakter. So bleibt notwendig die punktuelle Nähe beider Künstler, aber auch der ostentative Charakter ihrer jeweiligen Positionsbeziehung, ihr Rollenspiel vor einer in antithetischen Denkvorstellungen befangenen Öffentlichkeit der Einsicht verstellt. Vor allem scheinen die Denkvorstellungen der Öffentlichkeit verkannt, sie mögen sich sehr in Grenzen in den auf einen gerippeartigen Kernbestand reduzierten philosophischen Überlegungen von Hume und Beattie spiegeln, aber was dann übrig bleibt, ist eigentlich nur eine Zuordnung Gainsboroughs zur Vernunft und von Reynolds zum Enthusiasmus. Das erinnert, ehrlich gesagt, mehr an die archetypische Polarität in Warburgs und Winds Denken oder an Nietzsche, als an eine präzise beschriebene historische Konstellation. Uber die Polarität von Gainsborough und Reynolds ist viel geschrieben worden, vor allem in der Folge von Winds Aufsatz; auf den Punkt gebracht, stellt sie sich etwa wie folgt dar. Gainsborough ist der Antiliterat, verschiedene Passagen seiner Briefe verkünden eine ausdrückliche Unbildung geradezu als Ethos; Reynolds ist der Literat, brilliert in seinen Texten mit humanistischen und kunsttheoretischen Lesefrüchten. Gainsborough umgibt sich mit Musikern, verbleibt ausdrücklich in einem höchst privaten Milieu; Reynolds liebt die Halböffentlichkeit des literarischen Clubs, umgibt sich mit Literaten, Dichtern, Theoretikern; Gainsborough verzichtet weitgehend auf eine zeichenhafte, auf den literarischen bzw. konventio-
34 Ebenda, S. 222. 35 Ebenda, S. 214. 36 Sie ist, besonders nach Wind, immer wieder Thema gewesen, siehe vor allem Homan Potterton, Reynolds and Gainsborough (= Themes and Painters in the National Gallery 2, 3), London 1976 und Busch, Bild (wie Anm. 15), S. 430-436.
44
II Zur Kunst
nellen Verweis rekurrierende Nobilitierung des Porträts, unterbietet in seinen fast ungegenständlichen und auch so gut wie nicht verkäuflichen Landschaften, die für ihn selbst besonders wichtig waren, noch den Rang des Porträts, geriert sich bewußt unklassisch. Reynolds' literarisch unterfütterter Nobilitierungsdrang zielt auf Klassizität auch im Porträt. Gainsborough, so die zeitgenössische Sprachregelung, gibt die Natur wieder, so wie sie ist, Reynolds so wie sie sein sollte.37 Spätestens hier wird die Topik offensichtlich. Sehr viel weniger Humesche und Beattiesche Denkmodelle scheinen sich dahinter abzuzeichnen, als vielmehr ein seit dem 16. Jahrhundert geläufiges kunsttheoretisches Klassifizierungsmodell.38 Nimmt man dieses Modell als eine angemessene Beschreibung für die historische Situation im englischen 18. Jahrhundert, so verkennt man seine Funktion. Es verdankt sich, sieht man einmal von seinen antik-philosophischen Ursprüngen ab, Vasaris Viten, in denen es seine Ausprägung in der Unterscheidung von venezianischer bzw. florentinisch/römischer Kunst fand; als Theorieversatzstück hat es seine Rolle bekanntlich über die Querelle bis zur Antithese Delacroix-Ingres im 19. Jahrhundert gespielt. Allerdings ist die je historische Ausprägung zu beschreiben. Grundsätzlich jedoch nutzt es die Antithese von Natur und Ideal, von Farbe und Linie und soll eine unakademische respektive eine akademische Grundausrichtung bezeichnen. Im Falle von Gainsborough und Reynolds reflektiert das Modell vor allem den unterschiedlichen Stellenwert der beiden vor der Öffentlichkeit, auch ihre, trotz Uberschneidung der Kreise, unterschiedliche Klientel. Ganz verkürzt gesagt: Gainsborough bediente den liberaleren Adel, die Intelligenz, das Handelsbürgertum und den Hof, Reynolds eher den konservativeren, traditionelleren Adel. Der König konnte Reynolds, den ersten Präsidenten seiner Akademie, nicht leiden, Gainsborough hat die Mitglieder der königlichen Familie bis in alle Verästelungen des Stammbaums hinein gemalt.39 Gainsborough, obwohl Mitglied der Akademie, stellte nach einiger Zeit seine Beteiligung an den jährlichen Akademieausstellungen ein, weil er sich bei der Hängung grundsätzlich benachteiligt sah. Vielleicht ist dieses Faktum ein guter Punkt, um von ihm aus die Differenzen zwischen Gainsborough und Reynolds aus heutiger Sicht, jenseits ihrer topischen Festschreibung, zu charakterisieren. Zum einen gilt es festzustellen, daß Gainsborough und Reynolds in einem fortwährenden Paragone miteinander begriffen waren. Auf eine Bildlösung des einen antwortete spätestens auf der nächsten Akademieausstellung der andere mit seiner Sicht der Dinge. Dabei kam ihnen die Markierung antithetischer Rollen vor der Öffentlichkeit durchaus zupaß; die Öffent-
37 Siehe bes. Reynolds' Nachruf auf Gainsborough; Reynolds, Discourses (wie Anm. 22), 14. Diskurs 1788, S. 2 5 2 - 2 5 5 . 38
Zu diesem rhetorischen Modell und seiner Geschichte seit der Antike jetzt: Werner Busch, „Klassizismus", in: Historisches
39 Ausst. Kat. Gainsborough
Wörterbuch
& Reynolds.
Buckingham Palace, London 1994.
der Rhetorik, Contrasts
Bd. 4, Tübingen 1998 (im Druck).
in Royal Patronage,
The Queen's Gallery,
W. Busch: Heroisierte
Porträts ?
45
lichkeit konnte zuordnen, was aus dem jeweiligen Camp vorgeschlagen wurde, war gespannt auf die Antwort des Konkurrenten. Dieser Paragone ist zweifellos Teil der Marktstrategie beider Künstler. Eine ähnliche Auseinandersetzung gab es auch zwischen Reynolds und Romney, und Lord Thurlows oft zitierte Bemerkung zu diesem Wettbewerb bezeichnet das Problem präzise: er sieht Reynolds und Romney die Stadt zwischen sich aufteilen, rechnet sich aber zur Romneyschen Fraktion. 40 Die Positionsbeziehung weckt das öffentliche Interesse, führt zur Fraktionierung, eröffnet eine Kunstdebatte, in der mit Theorieversatzstücken gut argumentieren ist. Eines allerdings gilt es zu bedenken: Dieser Diskurs ist ein akademischer, ist damit Reynolds' Diskurs. In seinem noblen Nachruf auf Gainsborough von 1788 läßt er bei aller Würdigung des Konkurrenten keinen Zweifel daran: Gainsborough ist bloßer Naturnachahmer, der venezianisch-flämisch-holländischen Tradition zuzurechnen, fern jeder klassischen, an der Historie orientierten Nobilitierung und insofern als begabter Einzelgänger zu schätzen, aber absolut kein Vorbild für die akademische Jugend, die sich von Anfang an dem Idiom der klassischen Tradition verschreiben soll, das Gainsborough verweigert habe. 41 Es ist wichtig zu realisieren, daß es für das, was Gainsborough wirklich tut, keine historisch-theoretische Sprachregelung gibt. Und so bezieht er die ihm gemäß der vorhandenen Sprachregelung zugewiesene Position, stilisiert seine gesamte Existenz auf sie hin, um sich ökonomisch zu behaupten, vor allem aber, um sich den Freiraum zu verschaffen, den er sich und seiner Kunst wünscht. Was nur in Grenzen gelingt, wie sein Stoßseufzer deutlich macht: „Ich bin krank vom Porträtmalen und wünsche mir so sehr, meine Viola da Gamba nehmen und einfach fortgehen zu können zu irgendeinem lieblichen Dorf, wo ich Landschaften malen und das mühsame Ende des Lebens in Ruhe und Leichtigkeit genießen kann. Aber diese feinen Ladies und ihr Teetrinken, ihre Tanzveranstaltungen, ihre Jagd nach dem Ehemann und dergleichen werden mir meine letzten zehn Jahre verleiden . . . " ,42 Dahinter verbirgt sich ein Ideal, was nur wenig mit Hume zu tun hat. Zwar plädiert auch Hume für eine mehr herabgestimmte, nicht von Ehrgeiz, sondern eher von Selbstbescheidung geleitete Tätigkeit, doch trifft dies nicht das Gainsboroughsche Idealziel des „rural retirement". Marcia Pointon hat nachgewiesen, wie eng Gainsboroughs Gedanken mit den von William Shenstone auf seinem Landsitz „The Leasowes" verwirklichten Vorstellungen eines kultivierten, bewußt der Stadt den Rücken kehrenden Lebens auf dem Lande zu tun hat: einem horazischen Ideal, das in einem abgeschirmten, natürlich gestalteten Raum, der die Realität des Ländlichen ausblendet, die eigene Sensibilität in Kunst und Dichtung und freundschaft-
40 John Romney, Memoirs of the Life and Works of George Romney ..., London 1830, S. 172. 41 Reynolds, Discourses (wie Anm. 22), S. 252 ff. 42 The Letters of Thomas Gainsborough, hrsg. von Mary Woodall, Bradford 1963, S. 115 (Brief an William Jackson aus Bath, o. D.).
46
II Zur Kunst
lichem Gespräch unter Gleichgesinnten zu pflegen weiß.43 Doch auch dieses Ideal, dem Gainsborough zweifellos anhing, kann zwar den „mood", den Ton seiner späten Porträts, sofern sie engen Freunden gewidmet waren, beschreiben und findet sein Äquivalent in einer melancholischen Natursehnsucht, allerdings eröffnet sich von hieraus noch nicht gänzlich der Zugang zu Gainsboroughs wirklich revolutionärer Kunstauffassung. Seine Klage über die falsche Hängung seiner Bilder auf den Akademieausstellungen verweist darauf, daß er die Rezeptionsbedingungen für seine besondere Art von Malerei nicht erfüllt sah. Nun ist auch dies topisch. In der zweiten Ausgabe seiner Viten von 1568 berichtet Vasari von der Notwendigkeit, vor Bildern Tizians den rechten Abstand einhalten zu müssen, da nur so die scheinbar ungeordneten Pinselstriche, die nahsichtig irritieren, sich zu farbiger, überzeugender Illusion zusammenschließen.44 Und auch Rembrandts berühmter Brief an den Sekretär des holländischen Statthalters Constantijn Huygens hebt sowohl auf die Bedingung des rechten Abstands, als auch der richtigen Beleuchtung seiner Bilder ab.45 Reynolds, im übrigen, ist viel zu gebildet, aber auch zu sehr praktischer Künstler, um nicht zu wissen, daß Tizian und Rembrandt, die Vertreter einer primär farbigen Malerei, eine für die Porträtmalerei unverzichtbare Dimension eröffnen: eben die der Illusionsstiftung durch farbige Malerei.46 Er selbst setzt dieses Wissen am offensichtlichsten nach seiner Reise auf den Kontinent 1781, die vor allem dem Studium Rubens' galt, in die malerische Praxis um und begegnet hier auch in seiner Lasurtechnik Gainsborough durchaus. Womit wir bei der entscheidenden Technikfrage angelangt wären, die hier allerdings nur in wenigen Stichworten charakterisiert werden kann. Gainsborough hat technisch vielfältig experimentiert, nur zwei Verfahren seien erwähnt.47 Beim Porträtmalen hat er den Raum verdunkelt und 43 Marcia R. Pointon, „Gainsborough and the Landscape of Retirement", in: Art History 2, 1979, S. 4 4 1 ^ 5 5 . 44 Giorgio Vasari, Le Vite de pik eccellenti pittori scultori e architettori, Florenz 1568, hrsg. von Paola Barocchi, Florenz 1987, Bd. VI, S. 154-174, bes. S. 166, Ζ. 30-31. David Rosand, Painting in Cinquecento Venice: Titian, Veronese, Tintoretto, New Haven and London, S. 11-33; John Gage, Kulturgeschichte der Farbe. Von der Antike his zur Gegenwart, Ravensburg 1994, Kap. „Die Farbe im Venedig des 16. Jahrhunderts", S. 137f. 45 The Rembrandt Documents, hrsg. von W. L. Strauss und M. van der Meulen, New York 1979, 1639/4. 46 Reynolds, Discourses (wie Anm. 22), S. 150; dies gilt besonders für Reynolds' Selbstbildnis als Akademiepräsident.· Werner Busch, „Hogarths und Reynolds' Porträts des Schauspielers Garrick", in: Zeitschrift für Kunstgeschichte 47, 1984, S. 96 f.; Ausst. Kat. Reynolds (wie Anm. 13), Kat. Nr. 116; Busch, Bild (wie Anm. 15), S. 389-391, 411. 47 Zu Gainsboroughs Technik: Ausst. Kat. The Earl and Countess Howe by Gainsborough: a bicentenary exhibition, hrsg. von Anne French, The Iveagh Bequest Kenwood, London 1988, bes. Viola Pemberton-Pigott, „The development of the portrait of Countess Howe", S. 37—43; Ausst. Kat. A Nest of Nightingales. Thomas Gainsborough, The Linley Sisters (= Paintings and their context II), Dulwich Picture Gallery, Lavenham 1988, bes. Helen Glanville, „Gainsborough as Artist and
W. Busch: Heroisierte
47
Porträts?
durch extrem verlängerte Pinsel einen ungewöhnlichen Abstand von der Staffelei genommen, einen Abstand, der in etwa seinem Abstand vom im Halbdunkel sitzenden Modell entsprach und auch den Abstand antizipierte, den der Betrachter vor dem fertigen Bild einnehmen sollte. Selbst wenn die Form der Verdunkelung auf Gottfried Schalckens in den Kiinstlerviten beschriebenes Verfahren zurückgehen sollte, das Wright of Derby etwa für seine „candlelight pictures" ab der Mitte der 60er Jahre nutzte, 48 so ist doch Gainsboroughs Absicht dabei eine andere. Im Halbdunkel werden die Züge des Modells nur verschwommen sichtbar, zugleich aber zeigen sie sich in ihrer Flächenwertigkeit und dabei durchaus naturrichtig. Ähnlichkeit entsteht so aus einem Grundgerüst, das auf die große Massenverteilung rekurriert und das kleine Detail ausblendet. Anders ausgedrückt: das Gesicht erscheint gleich als Phänomen. Der lange Pinsel bewirkt, daß auf der Leinwand in dünnflüssiger Malerei in fortschreitender Lasurarbeit ein Phänomenäquivalent entsteht. Das ist insofern von Bedeutung, als so der einzelne Strich nicht der nahsichtig erfaßten Form folgt, sondern gegenstandsunabhängig wird. Die Differenz von Sein und Erscheinen wird bewußt, damit der Tendenz nach der autonome künstlerische Akt. Dies erklärt auch, warum es bei Gainsborough einen durchgehenden gegenstandsübergreifenden Richtungsduktus der einzelnen Pinselstriche geben kann, er wird für sich wirkender Wert. Um eben diesen künstlerischen Akt geht es auch bei Gainsboroughs zweitem Verfahren; es betrifft die zeichnerische Erfindung. Gainsborough hat abends, nach des Tages Porträtarbeit, im Freundeskreis, möglichst bei Musik oder auch im Gespräch mit schwarzer Kreide Landschaft in Serie entworfen. Oder genauer gesagt: er hat Landschaftsstrukturen auf das Papier geworfen, denn auch hier, bei gänzlich reduziertem Landschaftsvokabular geht es primär um Massenverteilung. Es scheint so zu sein, daß dieses halbautomatische, allein von der momentanen Gestimmtheit geleitete Zeichnen sich letztlich von Alexander Cozens 1759 zuerst der Öffentlichkeit mitgeteiltem sogenannten „blot"-Verfahren herleitet, das ein ausdrücklich automatisches Strukturieren des Blattes mit Tintenflecken zur Gewinnung von Landschaftsvorwürfen propagiert. 49 In beiden Fällen - auf Differenzen soll hier nicht eingegangen werden - geht es um nachträgliche Auswertung, um die Hoffnung auf glückliche Bildfindungen unter den entworfenen Blättern, die
Artisan", S. 15-29; David Bomford, Ashok R o y and David Saunders, „Gainsborough's ,Dr Ralph Schömberg'", in: National
Gallery
Gockel, Landschaftsportraits
von
[London], Technical Bulletin 12, 1988, S. 4 4 - 5 7 ; Bettina
Thomas
Gainsborough,
unpubl. M. A. Hamburg 1991, bes.
S. 4 0 - 8 3 . 48 Benedict Nicolson, Joseph
Wright of Derby,
Painter of Light (= Studies in British Art. The Paul
Mellon Foundation of British Art), 2 Bde., L o n d o n - N e w Y o r k 1968, Bd. 1, S. 4 - 7 . 49 Zu Cozens: Kim Sloan, Alexander
and John Robert Cozens. The Poetry of Landscape,
and London 1986; Jean-Claude Lebensztejn, L'art de la tache. Introduction thode"
d'Alexander
Cozens,
N e w Haven
à la „Nouvelle
mé-
Epinal 1990; Busch, Bild (wie Anm. 15), S. 3 3 5 - 3 5 4 ; Vergleich mit
Gainsboroughs Zeichenpraxis, ebenda, S. 350, 3 7 5 - 3 7 9 .
48
II Zur Kunst
eine Vorstellung, nicht etwa eine verbindliche Vorlage für eine dann erst zu malende Landschaft liefern können. Es dürfte deutlich geworden sein, daß die beiden Gainsboroughschen Verfahren miteinander verwandt sind. Beiden geht es um eine dem Medium Bild in seiner Flächigkeit gerecht werdende Entwurfspraxis, die zweifellos den wahrnehmungspsychologischen Erkenntnissen der Zeit Rechnung trägt. Mehr noch: es geht bei dieser Medienbewußtheit um den vorsätzlichen Einbau eines Filters zwischen Naturauffassung und Naturwiedergabe, der dennoch „natürlich" ist, das eine Mal absolut dem Phänomen vertraut, das andere Mal absolut dem Gefühl, das eine Mal dem Objekt, das andere Mal dem Subjekt. Ob das etwas mit David Humes Empirievorstellung zu tun hat, mögen andere beurteilen. Es scheint eher auf naturwissenschaftlich geprägter Ästhetik zu basieren. Die Probe aufs Exempel müßte an Gainsboroughs Farbbehandlung erfolgen. Erste Versuche in dieser Richtung sehen etwa Joseph Priestleys Farbtheorie mit Gainsborough zusammen. 50 Als Resümee verbleibt uns festzuhalten, daß es für diese höchst modernen Verfahren in der Tat keine kunsttheoretischen Benennungen gab. Kunsttheorie verblieb idealistisch, und die genannten Verfahren sind explizit antiidealistisch, in Goetheschen Begriffen gesprochen: das Allgemeine geht nicht im Durchgang durch den Künstler aus dem Besonderen hervor, sondern Besonderes und Allgemeines fallen zusammen, und aus diesem Zusammenfall entsteht paradoxerweise die Autonomie der Kunst. Zugegeben, Edgar Wind ist zuletzt aus dem Blick geraten, aber das war durchaus Absicht, denn die Frage lautete: Welches Terrain hat Edgar Wind für die Erforschung der englischen Porträtkunst des 18. Jahrhundert erobert, was sehen wir aus heutiger Sicht anders und auch als zeitbedingt und wohin kann sich die Forschung heute, auf den Schultern von Wind stehend, womöglich weiterentwickeln. Die Windsche Polarität von Rationalität und Enthusiasmus, von Reynolds und Gainsborough, mag der Nachprüfung nicht standhalten, es galt, sie historisch zu differenzieren, besonders von der künstlerischen Praxis her, doch hat ihre Aufstellung andererseits Wind befähigt, das Reynoldssche Sinnstiftungsverfahren besonders beim Rollenporträt in neuer Weise zu durchschauen. Dem Gainsboroughschen Verfahren scheinen wir erst heute in Ansätzen gerecht werden zu können.
50 Gockel (wie Anm. 47); Joseph Priestley, History and Present State of Discoveries Light and Colours, 2 Bde., London 1772.
relating
to Vision,
Die Bildersprache Michelangelos. Edgar Winds Auslegung der Sixtinischen Decke Elizabeth Sears
„Seit etwa zwanzig Jahren beschäftige ich mich vor allem mit der Erforschung des Grenzgebietes zwischen Kunst- und Philosophiegeschichte. Es ist mein Ziel darzutun, daß bei der Erschaffung einiger der größten Kunstwerke der Verstand die Einbildungskraft nicht behindert, sondern beflügelt hat; und ich habe versucht, eine Methode der Bildinterpretation zu entwickeln, die zeigt, wie Ideen in Bilder übersetzt werden und Bilder auf Ideen beruhen." Edgar Wind schrieb diese Worte im Jahr 1950, in der Mitte seiner wissenschaftlichen Laufbahn, in einem Kontext, der nach autobiographischer Reflexion verlangte. Mit der Feststellung leitet Wind seinen Antrag auf ein Stipendium der Guggenheim Foundation ein, das ihm einen RomAufenthalt in der American Academy ermöglichte und ihm gestattete, seinen Forschungen über die Bildprogramme der italienischen Hoch-Renaissance nachzugehen.1 Mit dieser Äußerung datierte Wind den Anfang seiner wissenschaftlichen Methode auf die frühen 30er Jahre - Jahre, in denen er als Mitarbeiter der Kulturwissenschaftlichen Bibliothek Warburg (K. B. W.) in Hamburg mit seinen Kollegen daran arbeitete, das Erbe Aby Warburgs zu sichern. Wind mag dabei an seine erste größere Studie im „Grenzgebiet zwischen Kunst- und Philosophiegeschichte" gedacht haben - die Veröffentlichung eines 1930 in der K. B. W. gehaltenen Vortrags: „Humanitätsidee und heroisiertes Porträt in der englischen Kultur des 18. Jahrhunderts". Beim Studium der Gegensätze zwischen den Porträts von Gainsborough und Reynolds in Beziehung zum Denken David Humes, Samuel Johnsons, James Beatties und anderer, trug Wind eine Fülle von konkreten Beweisen für die Wechselwirkung zwischen Künstlern und Gelehrten in einem spezifischen Milieu der englischen Aufklärung zusammen und versuchte zu zeigen, „wie ein Künstler durch seine Gestaltung in einen philosophischen Streit eingreift". 2 1
2
Ich danke Frau Margaret Wind, daß sie mir über viele Jahre hinweg den Zugang zu Winds Manuskripten in O x f o r d gewährt und mir bei deren Interpretation mit Rat zur Seite gestanden hat. Bernhard Buschendorfs Forschungen in den Londoner Archiven haben mir meine Aufgabe erleichtert. Helmut Puff hat freundlicherweise eine Fassung dieses Artikels sorgfältig gelesen; Christa und Bernhard Buschendorf danke ich für die Überarbeitung der Ubersetzung. England und die Antike, Vorträge der Bibliothek Warburg 1930-1931, Leipzig und Berlin 1932, S. 159.
50
II Zur Kunst
1950 war Wind Professor für Kunst und Philosophie am Smith College.3 Der Weg von Hamburg nach Northampton war indes alles andere als geradlinig verlaufen. 1933 war er mit den Mitarbeitern der K. B. W. aus Nazi-Deutschland geflohen, nachdem er eine entscheidende Rolle bei den Verhandlungen über die Überführung der Bibliothek nach London gespielt hatte.4 Sechs produktive Jahre hat er in England verbracht, als Stellvertretender Direktor des Warburg Institute, Mitherausgeber des neugegründeten Journal of the Warburg Institute und Inhaber einer Ehrendozentur für Philosophie am University College, London. Im August 1939 begab er sich zu einem fünfmonatigen Aufenthalt in die Vereinigten Staaten, um während eines Urlaubssemesters am St. John's College, Annapolis, zu lehren. Im Monat darauf brach der Krieg aus, und man drängte ihn, in den Staaten zu bleiben und dort für das Institut zu arbeiten.5 Ohne feste institutionelle Bindung hielt er drei Jahre an amerikanischen Universitäten, in Museen und Bibliotheken Vorträge, die als „Darstellung der Methode, der das Warburg Institute verpflichtet war", gedacht waren.6 1942 nahm er eine Professur am kunstgeschichtlichen Institut der Universität Chicago an, eine konfliktträchtige Umgebung, die er gerne verließ, als ihm 1944 eine befristete William Allan Neilson Forschungsprofessur am Smith College angeboten wurde. In der Erwartung, daß die Rückkehr ans Warburg Institute unmittelbar bevorstünde, ging er mit seiner Frau Margaret Wind für ein Semester nach Massachusetts. Ein einwöchiges Treffen mit Fritz Saxl über die Zukunft des Instituts führte jedoch zu einem endgültigen Bruch, 7 und Wind blieb am Smith College. Die Forschungsprofessur wurde 3
Zu Winds Leben und Werk siehe Hugh Lloyd-Jones, „A Biographical Memoir", in: Edgar Wind, The Eloquence
of Symbols. Studies in Humanist Art, hrsg. von Jaynie Anderson, Oxford 1983; rev.
Ausg. 1993, S. xiii-xxxvi; Bernhard Buschendorf, „War ein sehr tüchtiges gegenseitiges Edgar Wind und Aby Warburg", in: Idea
Fördern:
(Jahrbuch der Hamburger Kunsthalle), IV, 1985,
S. 1 6 5 - 2 0 9 ; Claudie Balavoine, „Edgar Wind. Itinéraire d'un philosophe historien de l'art. Entretien avec Raymond Klibansky", in: Préfaces, Juni 1992, S. 2 8 - 3 2 ; Jaynie Anderson, Stichwort „Wind, Edgar" in: The Dictionary 4
of Art, London 1996.
Siehe Bernhard Buschendorf, „Auf dem Weg nach England: Edgar Wind und die Emigration der Bibliothek Warburg", in: Porträt aus Büchern: burg - 1933 - London,
5
Bibliothek
Warburg
und Warburg
Institute.
Ham-
hrsg. von Michael Diers, Hamburg 1993, S. 8 5 - 1 2 8 .
Das Telegramm der Western Union, das er am 21. Mai 1940 von „Saxl Bing Wittkower" erhielt, ist erhalten geblieben: „In the common interest advise you to stay in the States awaiting further developments if necessary also next winter."
6
Aus einem Bericht über Winds Aktivitäten in den Jahren 1 9 3 9 - 1 9 4 5 , der Fritz Saxl zugestellt, aber nicht ans Direktorium des Warburg Institute weitergeleitet wurde (Edgar Wind Archiv).
7
Es gab mehrere Gründe für dieses bedauerliche Zerwürfnis, u. a. die Verwaltung des Instituts und die Verteilung der finanziellen Mittel. A m stärksten beunruhigt war Wind von Saxls fortgesetzten Bemühungen, britische und amerikanische Wissenschaftler für die Arbeit an einer Enzyklopädie des Mittelalters und der Renaissance nach dem Vorbild von Pauly-Wissowas Realencyclopädie classischen Altertumswissenschaft
der
zu gewinnen. Wind war der Meinung, das Unternehmen stelle
eine „Flucht in die Konventionalität" dar (Brief vom 15. Juni 1945 an Gertrud Bing, Edgar Wind Archiv). Wie spannungsgeladen die Situation war, verdeutlicht ein früherer Brief Saxls an Wind
E. Sears: Die Bildersprache Michelangelos
51
von einem Semester auf vier Jahre verlängert, nach deren Ablauf Wind eine Professur auf Lebenszeit erhielt. Nach seiner Berufung auf den Lehrstuhl für Kunstgeschichte an der Universität Oxford kehrte Wind 1955 nach England zurück, doch in der Zeit davor - in den beschaulichen Jahren am Smith College, wo die Lehrverpflichtungen und Verwaltungsaufgaben keine schwere Last und die Ressourcen der Harvard University in Reichweite waren - kamen seine Forschungen voran. 1950 arbeitete Wind an der Fertigstellung mehrerer Bücher. Seine Studie Bellini's Feast of the Gods, 1948 von der Houghton Library an der Harvard University veröffentlicht, sollte der erste Band einer Trilogie über den venezianischen Humanismus sein.8 Außerdem bereitete Wind die Veröffentlichung der Colver Lectures über „The Humanism of Raphael" vor, 1948 an der Brown University gehalten, sowie die Publikation der Martin Classical Lectures über „Pagan Mysteries in the Renaissance", 1949 am Oberlin College gehalten.9 Wind arbeitete auch kontinuierlich an einem weiteren Buch, das er 1935, lange vor den eben erwähnten zu schreiben begonnen hatte: The Religious Symbolism of Michelangelo. Dies sollte eine Studie über Michelangelos Gesamtwerk sein, gesehen aus der Perspektive mystischer Theologie. Ein detailliertes, Ende der vierziger Jahre entstandenes Inhaltsverzeichnis zu diesem Band, liefert den Plan: neben einer Einführung „On the Nature of Symbols" sollte das Buch vier Teile umfassen: „Pagan and Christian Metaphors", „Symbols of Death", „The Theory of Love" und „The Theological Testament". Der längste Abschnitt sollte eine Analyse des „Mystical Program of the Sistine Ceiling" beinhalten. Im Laufe seines Lebens hat Wind eine Miszelle und vier Aufsätze über die Sixtinische Decke veröffentlicht. „The Ark of Noah: A Study in the Symbolism of Michelangelo" erschien 1950; 10 zwei Aufsätze waren schon zuvor, 1937 und 1947, veröffentlicht worden,11 und zwei sollten noch folgen, 1960 und 1966. 12 Nach (8. März 1944): „Of course I must first know what you think about [the encyclopedia] because the main work will be done when you are in power, not me..." (Edgar Wind Archiv). 8 Diese 1948 veröffentlichte Studie basiert auf einem Vortrag, der 1944 in der National Gallery of Art in Washington, D. C . gehalten wurde. Studien über die Hypnerotomachia
Polipbili
und
„Titian, Marcolini and Pietro Aretino" sollten folgen. 9
1955 abgeschlossen, wurde Pagan Mysteries in the Renaissance
1958 nach Winds Rückkehr nach
England in London von Faber & Faber veröffentlicht. Die Ubersetzung der revidierten Ausgabe (1968) von Christa Münstermann, Heidnische
Mysterien
in der Renaissance,
wurde 1981 vom
Suhrkamp Verlag veröffentlicht, mit einem N a c h w o r t von Bernhard Buschendorf. 10 In: Measure: A Critical Journal,
I, 1950, S. 4 1 1 - 4 2 1 .
11 „The Crucifixion of Haman", in: Journal
of the Warburg
Institute
I, 1937, S. 2 4 5 - 2 4 8 ; „Sante
Pagnini and Michelangelo: A Study of the Succession of Savonarola", in: Mélanges Henri Gazette des Beaux-Arts,
Focillon,
6. Serie, X X V I , 1944, publiziert 1947, S. 2 1 1 - 2 4 6 .
12 „Maccabean Histories in the Sistine Ceiling: A N o t e on Michelangelo's Use of the Malermi Bible", in: Italian Renaissance
Studies. A Tribute to the late Cecilia M. Ady, hrsg. von E. F. Jacob, London
1960, S. 3 1 2 - 3 2 7 ; „Michelangelo's Prophets and Sibyls", Aspects of Art Lecture 1960, in: The Proceedings of the British Academy,
LI, London 1965 [1966], S. 4 7 - 8 4 .
52
II Zur Kunst
seiner Emeritierung 1967 kehrte Wind zu diesem Projekt zurück und verfaßte, schon von Krankheit gezeichnet, zwei Kapitel einer Studie, die The Theological Sources of Michelangelo heißen sollte. Doch blieb dieses Buch ebenso wie die Studie über Raffael, die darauf folgen sollte, unvollendet. Eine umfassende Edition von Winds Schriften über die Werke Michelangelos ist derzeit in Vorbereitung.13 Ein Text, der nicht in diesen Band aufgenommen wird, ist der erste, den Wind über die Sixtinische Decke geschrieben hat, und der letzte, den er auf Deutsch verfassen sollte. Dieser Text, auf die Jahre 1935-36 zu datieren,14 ist in Winds Nachlaß in Oxford als 200seitiges Typoskript in zwei gebundenen Exemplaren mit dem Titel Die Bildersprache Michelangelos. Die Sixtinische Decke überliefert. Handschriftliche Korrekturen und Streichungen zeigen, daß der Text ihm alsbald überholt erschien; er begann fast unmittelbar darauf, Abschnitte umzuschreiben, und zwar auf Englisch.15 Dennoch bewahrte er den Urtext auf, der uns nunmehr ein einzigartiges Zeugnis seiner sich entwickelnden kunsthistorischen Methode liefert. Als Wind 1935 Die Bildersprache Michelangelos verfaßte, hatte er noch nicht seine bahnbrechenden Studien zur Renaissance-Theologie begonnen. Im Juli 1936 befand er sich in Rom und las Renaissancetexte; in einem Brief an Fritz Saxl schrieb er: „Die Pole meiner Existenz sind das Gerüst der Sixtina und das ,Istituto Biblico' der Jesuiten, wo ich die zeitgenössischen Bibelkommentare lese." 16 Aber 1935 stützte Wind sich hauptsächlich auf die Mittel der visuellen Analyse und eine genaue Lektüre der Bibel, wobei ihm sein Wissen um die Prinzipien der Exegese und seine Vertrautheit mit den einschlägigen Bildtraditionen zustatten kamen. 13 Die Ausgabe wird von der Verfasserin dieses Artikels besorgt; sie wird Winds veröffentlichte und unveröffentlichte Schriften über die Sixtinische Decke und andere Werke Michelangelos enthalten und bei Oxford University Press erscheinen. 14 Vgl. einen Brief von Wind an Gertrud Bing vom 4. September 1935 aus Roche's Hotel, Glengarriff, Co. Cork: „Ich habe das schreckliche Gefühl, daß der ,Geist Gottes' über mich gekommen ist; denn der ,Michelangelo' ist zu drei Vierteln fertig. Bitte sage Saxl nichts davon, denn vielleicht kann ich ihm bis zu seiner Rückkehr das Ganze - obwohl es Wahnsinn scheint - als Überraschung vorlegen" (Warburg Institute Archiv, I. C., 1934-36, I. 18). Tolnays erster Text über die Decke, veröffentlicht im März 1936 - „La volta della Cappella Sistina (Saggio d'interpretazione)", in: Bollettino d'arte, 29, 1935-36, S. 389—408 - ist der zeitlich letzte Verweis, zitiert gegen Ende der Studie (S. 136, 176, 178). Vgl. den Vermerk im Annual Report of the Warburg Institute für 1934-35 (S. 9): „A Study of the Religious Symbolism of Michelangelo is being completed by Dr. Wind." Wind hielt im Mai 1936 drei Vorträge über das Thema im Warburg Institute; der erste Vortrag wurde in der katholischen Zeitschrift The Tablet, 167,16. Mai 1936, auf S. 619 besprochen. 15 „The Crucifixion of Haman" (wie Anm. 11) ist eine Ubersetzung des Anfangskapitels und des ersten Anhangs des Textes. Siehe das als Anhang abgedruckte Inhaltsverzeichnis. 16 Warburg Institute Archiv, I. C., 1934-36, I. 18. Die Wirkung von Winds Gedanken blieb nicht lange aus. In einem Brief vom 3. Februar 1937 schrieb Cassirer aus Göteborg an Saxl: „Wie weit ist eigentlich die Publikation von Wind's Michelangelo-Studien gediehen? Ich bin sehr gespannt auf ihre Veröffentlichung. Aus Rom hörte ich von vielen Seiten, welch starken Eindruck seine Vorträge gemacht haben" (W. I. Α., I. C., 1937-38,1. 3; dieser Brief wurde von Rainer Nicolaysen entdeckt).
E. Sears: Die Bildersprache Michelangelos
53
Heute wird Wind bewundert - und kritisiert - wegen der außergewöhnlichen Gelehrsamkeit, die er zur Deutung der Decke herangezogen hat; aber in dieser wichtigen ersten Fassung beruhte seine Interpretation nicht auf der Kenntnis entlegener Renaissancetexte. Die Bildersprache Michelangelos, begonnen ein Jahr nach der Veröffentlichung von Das Experiment und die Metaphysik, hat etwas von der Gedrängtheit und Kargheit eines philosophischen Traktats. Im Gegensatz zur damaligen Forschung erprobt Wind hier die Hypothese, daß alle Teile der Decke in ein einheitliches Programm integriert waren, das sich um eine einzige Idee ordnete, d.h. daß sämtliche Details des Programms aus einem wohldefinierten theologischen Plan ableitbar sind und eine präzise, verifizierbare Bedeutung haben. An vielen seiner ursprünglichen Ideen hielt er in den folgenden Jahren fest, andere verwarf er. Bereits im Juni 1937 schrieb er an Saxl: „Im Prinzip war die erste Fassung schon richtig, in den Einzelheiten sehr vieles falsch."17 Bis Mitte der 40er Jahre war die Überarbeitung im wesentlichen abgeschlossen. Ziel des vorliegenden Aufsatzes ist es, Winds Reaktion auf sein eigenes Frühwerk zu untersuchen und dabei einen originellen Denker bei der Auseinandersetzung mit einer Reihe von komplexen Interpretationsproblemen zu beobachten. Die Bildersprache Michelangelos wird sich als eine bedeutsame Stufe der Entwicklung einer „Methode der Bildinterpretation" erweisen, „die zeigt, wie Ideen in Bilder übersetzt werden und Bilder auf Ideen beruhen".
Jeder Wissenschaftler, der sich auf das Studium der Sixtinischen Decke (Abb. 1) einläßt, muß sich mit der bisherigen umfangreichen Forschung auseinandersetzen: das gilt für die 30er Jahre ebenso wie für heute. Zu Zeiten Winds waren die Maßstäbe von den Größen des Fachs gesetzt worden: Justi und Steinmann, Thode, Wickhoff und Wölfflin. Wind trat in einen Dialog mit seinen geschätzten Vorgängern ein, deren Annahmen und Schlußfolgerungen er in Frage stellte.18 Die hier vollständig wiedergegebene Einleitung zur Bildersprache Michelangelos hat den Charakter eines Manifests. Der Bilderzyklus der Sixtinischen Decke ist ein Sinnbild des Harrens auf die Erlösung. Michelangelo verwarf den ursprünglichen Plan, die zwölf Apostel darzustellen, die die Heilswahrheit unmittelbar besitzen. Er setzte 17 Brief vom 27. Juni 1937, geschrieben in Breuil (Warburg Institute Archive, I. C., 1937-38,1.16). 18 Um 1950 machte sich Wind Gedanken über den von Justi, Steinmann und Klaczko vertretenen Ansatz: „The unity of the work did not, in their opinion, depend on the logic of a definable program, but on the force of the artistic imagination, which was a law unto itself" („Typology in Kugler's Handbook", unveröffentlicht).
E. Sears: Die Bildersprache Michelangelos
55
an ihre Stelle die Propheten und Sibyllen, die einer Welt, der der Heiland noch nicht erschienen ist, sein Kommen durch Gleichnisse verkünden. Auch die Vorfahren Christi, deren Namen und Bilder die Weissagungen der Propheten und Sibyllen begleiten, sind ein Sinnbild für das Kommen des Heilands. Und beide Reihen - Seher und Ahnen - sind, wie als Gegenspieler, der Schöpfungs- und Urgeschichte des Menschen zugeordnet, die durch den Sündenfall zur Austreibung aus dem Paradies, und durch den Frevel der Nachkommen Adams zur Sintflut und zur Schande Noahs führt. Die vier Eckbilder mit den Geschichten von Moses, Esther, David und Judith, nehmen die frohe Botschaft wieder auf und zeigen vier Beispiele wunderbarer Rettungen des auserwählten Volkes: Sinnbilder der Erlösung durch Christus. Dies alles hat man von jeher - bald mehr, bald weniger deutlich - empfunden. Aber gerade dieses unbestimmte Gefühl für das Ganze hat das Verständnis der Einzelheiten nicht gefördert. Man hat nicht erkannt, mit welcher unerbittlichen Folgerichtigkeit den Erzählungen und Sprüchen des Alten Testaments die Heilslehre der christlichen Kirche als geheimes Thema unterlegt worden ist. Die folgenden Studien suchen den Beweis zu erbringen, daß der Grundgedanke der Erlösungserwartung nicht nur den allgemeinen Plan des Programms bestimmt hat, sondern bis in die kleinsten, bisher unerklärbaren Einzelheiten hinein die Wahl der Themen und die räumliche Anordnung der Figuren und Bildfelder beherrscht. Daß von den sechzehn Propheten der Bibel gerade diese sieben, von den zehn oder zwölf Sibyllen, die die Uberlieferung im 16. Jahrhundert verzeichnet, gerade diese fünf ausgesucht worden sind, wird sich weder als Willkür noch als Zufall erweisen, sondern als bedingt durch die Beziehung ihrer Prophetien zu den Mittelbildern mit der Schöpfungsgeschichte, zu den Eckfeldern mit den „wunderbaren Rettungen", und zu den begleitenden Medaillons, deren Scenen erst durch diese neue Art der Betrachtung vollständig deutbar werden. Auch die Gebärden der Propheten und Sibyllen, deren Verständnis durch psychologische Betrachtungen mehr verwirrt als geklärt worden ist, erhalten eine eindeutig faßbare, in den Einzelzügen genau nachprüfbare Bedeutung, wenn man ihren Zusammenhang mit den Scenen der Medaillons und den Figuren der Lünetten erkennt, die sie wie ein durchlaufender Kommentar begleiten. Ja, diese Lünetten selbst, die seit den Zeiten Vasaris einer ikonographischen Einzeldeutung als weder fähig noch bedürftig erachtet wurden, lassen sich Stück für Stück als Teile eines einheitlichen Programms erklären. „Es scheint Mut dazu zu gehören, noch über diese Gemälde sich hören zu lassen." So schrieb Justi im Jahre 1900. „Daß nach vierhundert Jahren noch hineingeheimniste Ideen der Enträtselung harren sollten, dieser Glaube würde der Klarheit zu nahe treten, die man bei dem echten Kunstwerk vor-
56
II Zur Kunst aussetzt." 1 9 Aber Justi hat selbst, ohne sich darüber zu täuschen, den Gegenbeweis zu dieser Erklärung geliefert. Der spekulative Zug seiner eigenen und aller auf ihn folgenden Deutungen zeigt, daß die „Rätsel Michelangelos" heute noch ebenso ungelöst sind wie zu der Zeit, als Ludovico Dolce in seinen Dialogen den Aretino die boshaften Worte sprechen ließ: „Wenn Michelangelo will, daß seine Erfindungen nur von wenigen Gelehrten verstanden werden, so muß ich ihm seine Geheimnisse schon lassen, da ich nicht zu diesen wenigen gehöre." 2 0 Gelehrsamkeit ist allerdings das letzte, was zur Auflösung dieser Rätsel verlangt wird. Aus der Bibel und Dantes „Göttlicher Komödie" allein ist die Deutung vollständig zu gewinnen. Wer diese beiden Bücher liest, mit Michelangelos Bildern vor Augen, muß überwältigt werden von der fast monomanen Energie, mit der ein schlichter religiöser Grundgedanke sich durchsetzt gegen einen unvergleichlichen Reichtum der plastischen Einbildungskraft. Die Klarheit der Entscheidung, die nirgends zuläßt, daß die Bildphantasie sich beziehungsfrei äußert, scheint - Justi zum Trotz - gerade der Grund, daß diese Bilder so lange ein verwirrendes Geheimnis geblieben sind. „Le fond de tout grand génie", sagt Stendhal, „est toujours une bonne logique. Tel fut l'unique tort de Michelange." 2 1
Wind beginnt seine Überlegungen nicht, wie zu erwarten, mit den berühmten biblischen Geschichten des zentralen Gewölbes, sondern mit den Eckbildern, welche die vier Erlösungswunder darstellen. Die Kreuzigung Hamans zeigt die Hinrichtung „des Judenverfolgers Haman", der nicht, wie im Buch Esther, erhängt, sondern wie in Dantes Fegefeuer (xvii, 25-30) gekreuzigt wird. Im Programm der Sixtinischen Decke ist Hamans Tod eine Präfiguration des Opfertodes Christi, wie ungewöhnlich das auch sein mag: „daß Michelangelo sein Bild so verstanden wissen wollte, hat er durch die Anordnung an der Decke kenntlich gemacht" (S. 10). Denn dieser Szene gegenüber hat er die Aufrichtung der ehernen Schlange gesetzt, ein Vorbild der Kreuzigung, wie Christus selbst im Evangelium verkündet hat: „Und wie Moses in der Wüste eine Schlange erhöhet hat, also muß des Menschen Sohn erhöhet werden, auf daß alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben" (Johannes 3, 14-15). Diese Passage aus dem Neuen Testament ermöglichte es den christlichen Exegeten, im Alten Testament nach Präfigurationen des Kommens Christi und der Geburt der Kirche zu suchen.
19 Michelangelo.
Beiträge
zur Erklärung
der Werke und des Menschen,
Leipzig 1900. Wind betrach-
tete diesen Band als das „eingebungsreichste aller Michelangelo-Bücher" (S. 79); später nannte er Justi „perhaps the greatest of those who have celebrated Michelangelo as a brooding and unaccountable genius" („Typology in Kugler's Handbook", wie Anm. 18). 20 L'Aretino,
Venedig 1557.
21 Stendhal, Histoire de la Peinture en Italie, cliv („Vie de Michel-Ange").
E. Sears: Die Bildersprache Michelangelos
57
Und eben dieser Vers lieferte auch Wind den Schlüssel zur Dechiffrierung des Programms der Sixtinischen Decke.22 Der Leser von Winds Text sieht die vier Eckbilder mit den Augen des zeitgenössischen Betrachters - eine Gestalt, die selten explizit in Winds Analysen eingeführt wird: „So sah der Gläubige, wenn er den Blick zur Altarwand erhob, in der oberen rechten Ecke das Bild, das er gewohnt war, als Hinweis auf den Kreuzestod Christi zu deuten. Erwartete er aber ... auf der Gegenseite diesen Kreuzestod selbst dargestellt zu finden, so erlebte er eine erschreckend gewaltsame Peripetie... Als Vorahnung des versöhnenden Opfertodes erschien hier ... eine andere und dunklere Fassung des Worts, das noch der Erfüllung harrt" (S. 11). Wendet sich der Betrachter nun zur Eingangsseite, so vermag er mit Hilfe der so gewonnenen Erfahrung auch die verborgene Bedeutung der Szenen von David und Goliath und Judith und Holofernes zu entschlüsseln. Das Motiv der Enthauptung in diesen beiden Bildern des Triumphs über einen Feind deutet darauf hin, daß eine tiefere Entsprechung gemeint war, und diese Entsprechung erweist sich wiederum als typologisch. Während die beiden Eckbilder auf der Altarseite Präfigurationen der Erlösung und Auferstehung waren, waren diese Eckbilder - wie Wind zu beweisen sucht - Vorbilder der Höllenfahrt Christi und der Überwindung des Satan. Dies ist sein Ausgangspunkt für weiterreichende Folgerungen über den prophetischen Charakter des Programms: „Diese symbolische Bezeichnung und Verhüllung des Erlösungsgedankens, der vom Alttestamentarischen aus angedeutet, aber dann gleich wieder ins Alttestamentarische zurückgenommen wird, gibt dieser Bildersprache die Form einer geheimen Prophetie. Wer die gleichnishafte Absicht erkennt, wird die Transparenz des christlichen Sinngehalts bemerken. Wer nur den wörtlichen Sinn versteht, bleibt gleichsam eingefangen in einen streng alttestamentarischen Zyklus." (S- 16) Zur weiteren Bestätigung seiner typologischen Lesart der vier Eckbilder wendet Wind sich den Weissagungen der Propheten zu, die sich zwischen jedem Paar befinden: „Ihre Worte sind die entscheidende Probe für die Geltung der hier vorgeschlagenen Deutungen" (S. 16). Zacharias, der zwischen Judith und David dargestellt ist, hatte die Vision einer Satansvertreibung (3, 1-2); Jonas, zwischen Haman und der ehernen Schlange, ist selbst ein Vorbild des sterbenden und auferstehenden Christus (Matthäus 12, 39-41). Einen zusätzlichen Beweis liefern die bronzefarbenen Medaillons an den Enden der Kapelle. Die Jonas am nächsten befindlichen etwa zeigen das Opfer Abrahams und die Himmelfahrt des Elias, Präfigurationen des Opfertodes Christi bzw. der Himmelfahrt Christi. Hier hält Wind inne, 22 Wind brachte seine intellektuelle Erregung in einem Brief an Bing (wie Anm. 14) zum Ausdruck: „Denn ich habe jetzt die Wurzel des Ganzen gefunden: - eine religiöse Gnadenlehre, die sich auf das Gespräch Christi mit Nikodemus im Johannes-Evangelium gründet und deren zeitgenössisch literarischer Beleg in Michelangelos eigenen Gedichten vorliegt. Aus ihr erklärt sich jede Gebärde, jeder Zug, - und es treten unglaubliche Züge zutage."
58
II Zur Kunst
um seine Methode von der seiner Vorgänger abzusetzen. Bereits andere Kunsthistoriker hatten bemerkt, daß diese beiden Medaillons im Gegensatz zu den übrigen nicht gemäß der von Vasari in seinen Vite vorgenommenen Identifizierung Episoden aus dem Buch der Könige illustrieren, waren aber davon ausgegangen, daß nur diese beiden eine typologische Bedeutung hätten: „Die Durchbrechung des chronologischen Ordnungsprinzips sollte sich hier aus dem Wunsch Michelangelos herleiten, in den beiden Medaillons, die der Altarwand am nächsten waren, auf das Erlösungswunder hinzuweisen" (S. 22). Wind ist skeptisch gegenüber einer ahistorischen Erklärungsweise, die auf dem „Deus ex machina" der „plötzlichen Wünsche" eines Künstlers beruht (S. 22).23 Er geht vielmehr systematisch von der Annahme aus, daß dem Programm ein kohärentes System zugrunde liegt: „Nimmt man hinzu, daß der typologische Ansatz sich schon bei den Eckbildern als fruchtbar erwiesen hat, so erscheint die Forderung unabweislich, auch die Mittelbilder und Medaillons nach dem gleichen Prinzip zu untersuchen" (S. 23). Wind wendet sich nunmehr den narrativen Szenen im Gewölbe zu, deren Interpretation er freilich durch Herstellung eines prophetischen Kontextes vorbereitet: die „bloße Nebeneinanderstellung von Text und Bild" genügt für den Beweis, daß eine Verbindung zwischen den fünf kleineren Mittelbildern und den Propheten neben ihnen besteht. Es ist kein Zufall, daß Joel, neben der Schande Noahs, verkündete: „Wachet auf, ihr Trunkenen und weinet und heulet, alle Weinsäufer, um den Most..." Qoel 1, 5-12), oder daß Jeremias, neben der Trennung von licht und Finsternis, sagte: „So spricht der Herr: halte ich meinen Bund nicht mit Tag und Nacht..." (Jeremias 33, 25f.). Nur eine Paarung scheint sich dem nicht zu fügen. Die Verbindung zwischen Daniel 4, 10 und der benachbarten Szene ist, wie Wind einräumt, nicht offensichtlich. Das Konzept seiner Beweisführung offenbart kurz und bündig seine Methode: „Daß aber wirklich mit diesem Bilde des fünften Schöpfungstages, der Segnung der Tiere, das ,Erkennen Gottes' gemeint ist, wird sich überzeugend erst dann beweisen lassen, wenn wir die Scenen der zugehörigen Medaillons bestimmt haben, wenn die Gebärden der Persica und des Daniel gedeutet sind, und wenn erklärt ist, warum in den Lünetten unmittelbar unter der Figur des Daniel der Mann ein Schreiber ist und die Frau einen Faden abspult und warum die entsprechenden Figuren unter der Persica ... in tiefen Traum versunken sind" (S. 26 f.). Wind interpretiert die neun alttestamentarischen Szenen - die fünf kleineren und die vier größeren jeweils abwechselnd - im Lichte der christlichen Erlösung. Er beginnt seine Darstellung mit der Schande Noahs an der Eingangswand, die ein gutes Beispiel für seine Methode liefert. Diese Szene ist der herkömmliche Typus 23
„Wenn die chronologische Abfolge des Buches der Könige wirklich für die Anordnung der Medaillons bestimmend war, so kann sie nicht plötzlich bei mehreren Scenen durchbrochen sein. Wenn sich aber an einigen Scenen die typologische Deutung wirklich bewährt, so kann sie wieder nicht auf diese beschränkt bleiben" (S. 23).
E. Sears: Die Bildersprache
Michelangelos
59
zum Antitypus der Verspottung Christi in typologischen Zyklen wie der spätmittelalterlichen Biblia pauperum.24 Daß dies die von Michelangelo intendierte Bedeutung war, wird dadurch bewiesen, daß er die Delphische Sibylle - die Prophetin der Dornenkrönung Christi: „Vaticinatur de Christi coronatione" - der Schande Noahs gegenübergestellt hat (S. 29). Die benachbarten Medaillons bestätigen den Befund. Das über der Delphica zeigt die Ermordung Abners durch Joab - ein offensichtliches Sinnbild für den Judaskuß. Um den christlichen Gehalt des Medaillons über Joel, das den Todessturz Jorams zeigt, darzutun, bedarf es einer komplizierteren Beweisführung. Wind folgt dem Verfahren, das er im Falle der Kreuzigung Hamans und der Uberwindung des Holofernes angewandt hatte, und sucht ein Motiv, das auch in einer anderen Szene auftaucht, die als christliches Sinnbild traditionell festgelegt ist (S. 32). Ein Wagengespann erscheint an den beiden Enden des Zyklus, sowohl in diesem Medaillon wie in der Himmelfahrt des Elias: Auffahrt an der Altarseite (wo das Thema der Eckbilder Kreuzestod und Auferstehung ist), Absturz an der Eingangsseite (wo die Eckbilder Symbole des Siegs über den Satan sind). Im typologischen Denken bezeichnet der Fall Satans genau jene Szene, die dem Judaskuß folgt: „Die Häscher weichen vor Christus zurück." Wind kommt daher zu dem Schluß: „Die beiden Medaillons und das Mittelbild schließen sich jetzt zu einem Triptychon mit einheitlichem Thema zusammen" (S. 34). Gemeinsam bilden sie „die Auftakte der Passion", während die Knabenpaare, welche die Medaillons halten, zu Klagegestalten werden (vgl. Joel 1, 9-12). Ahnlich verfährt Wind bei der Analyse aller kleineren Mittelbilder, da diese von Propheten, Sibyllen und Medaillons flankiert sind, doch muß er sich einer anderen Deutungsstrategie bei der Interpretation der vier großen Felder bedienen. Ihre Stellung im größeren christologischen Verweisungszusammenhang ist hier von Bedeutung. Wenn die Schande Noahs auf die Verspottung Christi verweist und das Opfer Noahs auf die Kreuzigung, genauerhin auf den „Gläubigen Hauptmann mit den Frevlern vor dem Kreuz", dann ist es wahrscheinlich, daß die dazwischen gelegene Sintflut „der Schauplatz für die letzten Stadien der Passion" ist - „phantastisch wie es zunächst klingen mag." 25 Der Baum, der den Sündenfall von der Vertreibung aus dem Paradies trennt, wird damit zum Symbol des Kreuzes, an dem Christus zwischen den beiden Häschern gekreuzigt wurde. Die Erschaffung Evas - in der Mitte des Zyklus - ist ein häufig begegnender Typus für die Geburt der Kirche aus der Seite Christi. Hier wird die auf den Propheten, Sibyllen und
24 Wind benutzte die Tafeln der Biblia pauperum, humanae
hrsg. von H. Cornell, 1925 und des
Speculum
salvationis, hrsg. von J. Lutz und P. Perdrizet, 1 9 0 7 - 0 9 .
25 Die Vorsicht, mit der Wind diese Lesung einführt, erinnert daran, wie ungewöhnlich seine Ideen waren: „Der Leser, der bis hierher mit Zutrauen, wenn auch mit Zögern, gefolgt sein mag, wird bei dem nächsten Schritt die Empfindung haben, daß sein Glaubenswille auf eine etwas zu harte Probe gestellt wird" (S. 44).
60
II Zur Kunst
Medaillons basierende Beweisführung durch einen entscheidenden internen Beweis ergänzt: die Landschaft evoziert nicht das blühende Paradies, sondern die Schädelstätte Golgatha, wo aus der Seite Christi Blut und Wasser flössen. Überraschenderweise bemüht Wind an dieser Stelle zur Stützung seiner Argumentation den Formalisten Heinrich Wölfflin: „Selbst Beobachter, denen jede ikonologische Deutung fernlag, haben dieses Bild mit Worten beschrieben, die einen christlichen Passionsvorgang ahnen lassen: ,Adam liegt schlafend gegen einen Felsen, ganz gebrochen wie ein Leichnam mit vorfallender linker Schulter. Ein Pflock im Boden, an dem die Hand gewissermaßen aufgehängt ist, gibt noch weitere Verschiebungen in den Gelenken'" (S. 55).26 Die Erschaffung Adams verkündet die Auferstehung Christi. Der Schöpfungssegen ist ein Gleichnis für die Himmelfahrt Christi. Und die beiden letzten Szenen haben eine eschatologische Bedeutung: der Jüngste Tag wird evoziert durch die Segnung der Bäume und Pflanzen, vereinigt mit der Erschaffung der Gestirne („Der Hymnen auf dieses Bild", sagt Wind, „gibt es viele und schöne, der analytischen Studien wenige"; S. 70) - und die „Ausgießung des Heiligen Geistes" ist dargestellt in der Trennung von Licht und Finsternis. Alle zehn Medaillons werden als integrale Bestandteile des Gesamtentwurfs in einem christlichen Sinn gedeutet, der wiederum dem in den flankierenden Genesis-Szenen entdeckten korrespondiert. An diesem Punkt seiner Beweisführung hat Wind für sämtliche der vier Eckbilder, neun Mittelbilder und zehn Medaillons christliche Antitypen gefunden.27 Seine späteren Schriften zeigen genau, welche Aspekte seiner Deutung der drei alttestamentarischen Bildzyklen er befriedigend und welche er unzulänglich fand. Die Typologie blieb in den folgenden Jahren der Kern von Winds MichelangeloInterpretation. Wenn seine späteren Analysen der neun Mittelbilder im Detail auch beträchtlich davon abweichen, so verstand er die Szenen doch weiterhin als Vorbilder für das Kommen Christi, als Erlösungszeichen im Herzen eines kohärenten 26
Heinrich Wölfflin, Die klassische Kunst, München 1 8 9 9 , 1 . III. 2. Es ist bemerkenswert, daß Wind den Begriff „ikonologisch" - generell selten in seinen Schriften anzutreffen - im Kontext einer methodologischen Gegenüberstellung verwendet. Vgl. Martin Warnke, „On Heinrich Wölfflin", in: Representations geschichtliche
27 (1989); ders., „Sehgeschichte als Zeitgeschichte: Heinrich Wölfflins Kunst-
Grundbegriffe",
in: Merkur, Heft 5, 46. Jg., Mai 1992, N r . 518, S. 4 4 2 ^ 4 9 , hier:
S. 442: „In der Gegenbewegung gegen Wölfflin ist in der Kunstwissenschaft wohl überhaupt erst ein schärferes Bewußtsein von den geschichtlichen Dimensionen ästhetischer Formen zustande gekommen." 27
Im Kapitel „Religiöse Wiederholung" stellte Wind Betrachtungen über die Tatsache an, daß dieselben christlichen Antitypen in diesem Schema wiederholt begegnen: die „Höllenfahrt" wird zum Beispiel dreimal präfiguriert, und es gibt fünf verschiedene Zeichen für das Kreuz (die Arche Noah, den Baum des Paradieses, die eherne Schlange, die „Hinrichtung" Hamans und das Opfer Abrahams). In der ersten der vielen Definitionen der mystischen Logik, die er im Lauf der Jahre aufstellen sollte, schrieb er: „Es gehört zum Wesen dieser Denkweise, daß sie die Analogien zu häufen sucht, um möglichst viele verschiedene äußere ,Zeichen' für die Wahrheit der einen Heilslehre zu besitzen" (S. 75).
E. Sears: Die Bildersprache
Michelangelos
61
prophetischen Programms. Trotz aller Modifikationen seiner Interpretation hätte Wind am Ende seines Lebens wahrscheinlich seiner Schlußfolgerung von 1935 zugestimmt, „daß die Bilder außer ihrer wörtlichen, auch noch eine übertragene Bedeutung haben, die genau in der durch die räumliche Orientierung gegebenen Blickrichtung zur Entfaltung kommt" - eine Idee, die er zusammenfassend auf die Formel brachte: „1.) Der direkten räumlichen Orientierung (vom Eingang zum Altar hin) entspricht eine übertragene ikonographische Bedeutung (Passionsgeschichte). 2.) Der direkten ikonographischen Bedeutung (Schöpfungsgeschichte) entspricht eine übertragene räumliche Orientierung (vom Altar zum Eingang hin)." 28 In Winds 1950 veröffentlichtem Aufsatz „The Ark of Noah" gibt es viele Anklänge an seine frühen Schriften. Die Schande Noahs gilt noch immer als Präfiguration der Verspottung Christi; die Delphica ist die Prophetin der Dornenkrönung; Joel ist der Prophet, der ausruft: „Wachet auf, ihr Trunkenen." Doch jetzt findet die allegorische Lesart Unterstützung im exegetischen Erbe der Kirche. Die Schriften des Augustinus werden nun häufig herangezogen: „Die Pflanzung des Weinbergs durch Noah selbst, seine Berauschung durch dessen Frucht sowie Entblößung während des Schlafs und was sonst noch damals geschah und aufgeschrieben ward, alles ist von prophetischem Sinn erfüllt und mit Schleiern verdeckt." 29 Winds bildliche Analysen sind scharfsinniger als in der Bildersprache Michelangelos, und die Details werden in neuen Nuancierungen beschrieben. Das Weinfaß hinter dem schlafenden Noah - von humoristischer Ubergröße - wie auch der Krug und die Schale übernehmen allegorische Funktionen, sind sie doch „wrought with such extravagant overtones that they suggest the implements of a tragic ritual"; der Autor der Heidnischen Mysterien in der Renaissance findet in der Szenerie und dem dargestellten Zubehör auch Anspielungen auf die bacchischen Mysterien. Ähnliche Kontinuitäten der Interpretation lassen sich in Winds anschließender Behandlung der übrigen acht Erzählungen der Genesis entdecken wiewohl die typologische Deutung in allen Fällen mit leichterer Hand und systematisch weniger rigoros entwickelt wird. In „Adam and Eve", einem unveröffentlichten Text, der um 1950 verfaßt wurde, werden die mystischen Lesarten der drei zentralen Szenen durch analytische Beschreibungen ergänzt, in denen die theologischen Implikationen künstlerischer Entscheidungen erörtert werden. Konstrastierende Darstellungen der Erschaffung Adams und Evas - untersucht in Beziehung zum Denken von Augustinus und
28 So lautet Winds Lösung eines vieldiskutierten Problems: „Seit Wölfflin beobachtet hat, daß die räumliche Orientierung dieser Bilder, die auf einen vom Eingang herkommenden Beschauer rechnen, der Reihenfolge der Genesiserzählung zuwiderläuft, die am Altar beginnt und am Eingang aufhört, hat man viel über diesen Widerspruch nachgedacht" (S. 176). 29 „The Ark of Noah" (wie Anm. 10), S. 413, mit dem Zitat aus De civitate W. Thimme).
dei 16, 1 (Ubersetzung
62
II Zur Kunst
Pico della Mirandola - zeigen Adam als Vertreter des kontemplativen und Eva als Repräsentantin des aktiven Lebens; in Sündenfall und Vertreibung, wo die beiden die Urlaster superbia und luxuria verkörpern, übernimmt Adam dann aber, wie Wind bemerkt, die aktive Rolle und Eva die passive. In einem unveröffentlichten, um 1970 verfaßten Essay mit dem Titel „In the Beginning" bietet Wind eine Analyse der drei Szenen der Schöpfung, in die drei Jahrzehnte der Beschäftigung mit dem Thema eingegangen sind. Der Anfang der Welt wird noch immer als Verweis auf das Ende verstanden, und die Trennung von Licht und Finsternis wird eschatologisch als Präfiguration des Jüngsten Gerichts gedeutet. Doch ist es ihm nun ebenso wichtig darzutun, daß Michelangelo eine augustinische Deutung der Schöpfung bietet, daß in den drei Szenen die vier Elemente dargestellt werden, daß in diesen Szenen Gott bei der „Erschaffung", „Trennung" und „Ausschmückung" der Welt gezeigt wird, und daß sie die Trinität evozieren: die Welt wird vom Vater durch den Sohn und im Heiligen Geiste erschaffen. Überdies findet der Rhythmus der ersten Triade ein Echo in den nächsten beiden, was die neun Szenen zusammenbindet: „Once it is clearly understood that the first triptych, which depicts the fourfold God as elemental Creator reveals the Trinity in the PATERNAL mode, it will not be too difficult to recognize a FILIAL triad in the ,mysteries of Adam', and a triad of the PARACLETE in Noah's prophecies, centred in the image of the Great Flood, with the dove moving upon the face of the waters." 30 Wind gab allerdings die typologische Lesart der zehn Medaillons, die er in der Bildersprache Michelangelos vertreten hatte, völlig auf. Seine neue Deutung, die eine gänzlich anders geartete Grundlage für die Wahl der Szenen liefert, wurde durch eine verblüffende Entdeckung ermöglicht, die er Ende der 30er Jahre gemacht hatte und 1960 in „Maccabean Histories in the Sistine Ceiling" veröffentlichte: Als Michelangelo die Medaillons und andere Szenen der Decke entwarf, hatte er die groben Holzschnitte zu Rate gezogen, die die italienische Bibelübersetzung des Nicolas Malermi in den Ausgaben von 1490 und 1493 illustrierten. In Korrektur Vasaris konnte Wind nunmehr drei Szenen neu bestimmen, um deren Identifizierung er und seine Vorgänger gerungen hatten. So konnte er etwa zeigen, daß „Alexander vor dem Hohen Priester"31 - eine nichtbiblische Geschichte, die der 30 Jeremias und die Libyca übernehmen die Rolle von Tenebrae und Lux. Der Prophet sagt nun: „In tenebrosis collocavit me, quasi mortuos sempiternos" (Klagelieder 3, 6) - statt: „So spricht der Herr: halte ich meinen Bund nicht mit Tag und Nacht" (33, 25 f.); aber die Sibylle ruft immer noch aus: „Ecce veniet dies et illuminabit condensa tenebrarum." In Die Bildersprache Michelangelos dienten die Medaillons als Exempel der Verheißung der Ewigkeit: nun aber gemahnt Elias, auf der Seite der Dunkelheit, an den Tag des Zorns, während Abrahams Opfer, auf der Seite des Lichtes, ein Sinnbild der Erlösung ist. 31 Wind hatte bereits erkannt, daß die Szene auf einer Medaille, die nach dem Vorbild von Michelangelos Entwurf geschaffen und für Papst Paul III von Alessandro Cesati hergestellt worden war, Alexander knieend vor dem Hohen Priester zeigte (S. 57); groß muß sein Erstaunen gewesen sein, als er ebendiese nichtbiblische Geschichte an der Decke dargestellt fand.
E. Sears: Die Bildersprache
Michelangelos
63
Übersetzer ins Buch der Makkabäer eingefügt hatte - in der Mitte der Decke genau gegenüber einer Szene erschien, die nun als „Tod des Nicanor" erkennbar war (1. Makkabäer 7, 4 3 ^ 7 ) , mit dem Ergebnis, daß diese beiden Geschichten an den Seiten der Szene der Erschaffung Evas, die ein Vorbild der Geburt der Kirche ist, als Exempel der triumphierenden und der kämpfenden Kirche erkannt werden konnten. Die Einheit der Bildfolge - mit Szenen aus der Genesis, dem Buch der Könige und dem Buch der Makkabäer - beruhte offensichtlich nicht auf der biblischen Chronologie. Jedes Medaillon, so nimmt Wind an, stellte eines der Zehn Gebote dar, ob durch Befolgung oder Verletzung des Gebots, Anklage wegen der Verletzung oder Bestrafung dafür. Diese Lesart, ohne Vorläufer in der wissenschaftlichen Literatur, war seiner früheren Interpretation in mehrfacher Hinsicht überlegen, wie seine beiden unterschiedlichen Bemühungen um Rekonstruktion des „verlorenen Medaillons" erkennen lassen. 1935 suchte Wind eine Bibelepisode, die erstens „typologisch auf einen christlichen Vorgang hinweist, der sich nach dem Abschluß der Passion ereignet"; die zweitens „in Beziehung zur Uberwindung und Segnung des Tieres steht"; und die drittens „einen Vorgang darstellt, der auf das Land Persien Bezug hat". Er dachte „an die Heilung des blinden Tobias, ein Gleichnis für die Jünger von Emmaus" (S. 65 f.). 1960 hingegen konnte er eine Bestimmung vornehmen, die als solche eine Erklärung für die nachträgliche Unkenntlichmachung des Medaillons bot: Michelangelo hatte eine Szene gewählt, die das Gebot „Du sollst nicht ehebrechen" darstellte.32 Nach Winds Schema waren die zehn Gebote nicht wie in der Bibel angeordnet. Diese veränderte Anordnung war eine Folge des Gesamtplans: die Medaillons mußten sich thematisch auf die angrenzenden Szenen und Figuren beziehen. Wie er aber zu zeigen suchte, hatte ihre Plazierung in dem „mystischen" Schema dennoch eine „moralische" Logik. Die Medaillons waren in antithetischen Paaren gruppiert: es ist, um nur ein Beispiel zu nennen, bedeutungsvoll, daß das Sakrileg, die Besudelung des Heiligen (Heliodor), der Idolatrie (Baal), also der Anbetung des Weltlichen, gegenübersteht. In den Jahren nach der Vollendung der Bildersprache Michelangelos betonte Wind zunehmend die moralischen Aspekte des Programms. Auch die von den Kirchenvätern beschworene Zahlenallegorese - eine weitverbreitete Lektüre in der Renaissance - spielte eine größere Rolle als zuvor, und die Anzahl der Elemente in
32 Esther Gordon Dotson („An Augustinian Interpretation of Michelangelo's Sistine Ceiling", in: The Art Bulletin 61, 1979, S. 421) - zu jenen zählend, die Winds Hypothese akzeptiert haben - ist der Meinung, daß die fragliche Episode jene ist, in der Antiochus Prostituierte in den Tempel bringt (2. Makkabäer 6, 4). Winds These eines Zusammenhangs zwischen den Medaillons und den Geboten hat eine Kontroverse entfacht: siehe Charles Hope, „The Medallions on the Sistine Ceiling", in: Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, L, 1987, S. 200-204; und Rab Hatfield, „Trust in God: The Sources of Michelangelo's Frescoes on the Sistine Ceiling", in: Occasional Papers Published by Syracuse University, Florence, Italy 1, 1991, S. 1-23.
64
II Zur Kunst
einem Bildzyklus wurde nun als bedeutsam betrachtet. Während die beiden Paare von Eckbildern für Wind weiterhin primär die Funktion der Präfiguration des Opfertods Christi und der Überwindung Satans hatten, erklärte er nunmehr, daß ein jedes Paar auch den Gegensatz zwischen Besiegtem Laster und Siegreicher Tugend enthielt; 33 überdies gibt es in seinem Nachlaß Hinweise, daß er die vier Szenen inzwischen als Exempla der vier Kardinaltugenden betrachtete.34 Diese Entwicklung im Denken Winds wird besonders gut sichtbar an den nacheinander entstandenen Interpretationen der Vorfahren Christi. 1935 machte er sich daran, ein strenges theologisches Programm in diesem Bildzyklus zu entdecken, wo man keines vermutet hatte. Die Familienszenen in den sechzehn Lünetten und acht dreieckigen Stichkappen waren als „freie Phantasien" betrachtet worden, als „Genrebilder aus dem Florentinischen Volksleben". Justi hatte die Figuren sogar „namenlos" genannt, obgleich die vierzig in Matthäus 1 genannten Namen neben den Figuren eingetragen sind. Wind ging jedoch von einer anderen Prämisse aus: „Eine eindeutige Zuordnung von Namen und Figuren ist ohne Zweifel geplant gewesen; das geht schon daraus hervor, daß die Namenstafeln manchmal drei, manchmal zwei, in einigen Fällen sogar nur einen Namen tragen" (S. 87). Die Präsentation seiner Ergebnisse leitete er mit einer Reihe von Regeln ein, die er für die Zuordnung von Figuren und Namen ermittelt hatte, wie ζ. B.: „Wo Stichkappen über den Lünetten erscheinen, bezieht sich der erste Name immer auf die Stichkappe"; „Wo innerhalb der Lünetten zwei Generationen (Eltern und Kinder) dargestellt sind, bezieht sich ein Name auf die Eltern, ein zweiter auf die Generation der Kinder" (S. 88). 35 Sodann formulierte Wind seine These: „dies ist der geheime Sinn dieser Bilderreihe: daß in der Geschichte der Vorfahren Jesu seine eigene Lebensgeschichte präformiert erscheinen sollte" (S. 94). Dieser Gedanke war zugegebenermaßen schwer zu beweisen: „Wer dies einmal erkannt hat und die Lünetten im einzelnen zu erklären sucht, befindet sich genau in der Lage, die Gauß für seinen mathematischen Arbeitsprozeß als typisch sah: daß das Ergebnis klar ist und man sich nur den Kopf zerbricht, auf welchem Wege man dazu gelangen kann. Anders ausgedrückt: die erste Lesung dieser Lünetten, die Erschließung dessen,
33 „Judith and Holofernes - David and Goliath", unveröffentlicht, ca. 1950. 34 Einer Notiz im Edgar Wind Archiv zufolge. 35 Wind blieb in der Folge bei diesen Unterscheidungen, wandte sie aber weniger strikt an: „This semblance of a regular ,succession of generations' vanishes on a closer inspection of the names; for Michelangelo did not intend so many significant names to be lost on generations of children, who primarily sleep or eat, or worry their parents" („The Book of the Generation of Jesus Christ", unveröffentlicht, ca. 1950). In Die Bildersprache Michelangelos hatte Wind zwei weitere Anhaltspunkte durch die Beobachtung gewonnen, daß der Zyklus seinen Zick-Zack-Rhythmus an dem Punkt durchbricht, der mit der babylonischen Gefangenschaft korrespondiert, und daß dieser Bruch unterhalb der Sintflut stattfindet (vgl. „An den Wassern Babylons, da saßen wir und weinten"). Diese waren: 1.) Ein geschichtliches Schema liegt der Reihe zugrunde; 2.) Es besteht ein Zusammenhang zwischen den einzelnen Lünetten und den ihnen zugeordneten Mittelbildern (S. 92).
E. Sears: Die Bildersprache Michelangelos
65
was sie unmittelbar darstellen, ist viel schwerer als die zweite Lesung, der Nachweis ihrer übertragenen Bedeutung" (S. 94). Zu seiner „ersten Lesung" gelangte Wind, indem er die zwanzig Gruppen in den Liinetten zu identifizieren suchte. Er kam zu dem Schluß, daß acht davon historische Personen darstellen: Abraham etwa am Anfang des Zyklus, ist der biblische Abraham, der mit seinem Sohn gezeigt wird, welcher das Opferholz trägt. Doch die übrigen - in der Bibel lediglich durch ihre Namen bekannt - illustrieren Bibelsprüche. Die Lünette Aminadab zum Beispiel (in der eine Frau mit einem Schleier auf dem Schoß sich das Haar kämmt, während ein Mann vor sich hin starrt) evoziert aufgrund der Motivgleichheit den Vers: „Vergißt doch eine Jungfrau ihres Schmuckes nicht, noch eine Braut ihres Schleiers. Aber mein Volk vergißt mein ewiglich" (Jeremias 2, 32); die gegenüberliegende Lünette Naason (in der eine Frau in den Spiegel schaut und ein Mann über einem Text brütet) repräsentiert die Stelle: „Wir sehen's jetzt in einem Spiegel wie in einem dunkeln Wort" (1. Korinther 13, 12). Die eine separate Gruppe bildenden acht Stichkappen stellen die Seligsprechung der Armen dar, welche in verschiedenen Zuständen erscheinen: nackt, obdachlos und hungrig. Doch alle diese Szenen haben eine übertragende Bedeutung. Zur Stützung seiner „zweiten Lesung" bringt Wind jede Szene in Zusammenhang mit einer Episode aus dem Leben Christi. Die Lünetten Aminadab und Naason bilden den Auftakt, erstere „ein Aufruf der Erinnerung", letztere „ein Hinweis, die Reihe als Gleichnis aufzufassen" (S. 110). Nach ihnen entfaltet sich eine chronologische Sequenz, die mit Joachim und Anna (Jesse-David-Salomon) beginnt, sich über Johannes den Wüstenprediger (Salomon-Booz-Obeth), die Geburt zu Bethlehem (Roboam-Abias), die Schriftgelehrten des Herodes (AsaJosaphat-Joram) fortsetzt, bis zum geistlichen Wirken Christi und seiner Passion reicht und schließlich mit der Dornenkrönung-Kreuzigung (Jacob-Joseph) endet. Als Wind 1944 „Sante Pagnini and Michelangelo" abschloß, hatte er diese „zweite Lesung" aufgegeben.36 Doch die Einsichten, die er beim Versuch gewonnen hatte, die „erste Lesung" zu beweisen, lieferten die Grundlage für eine radikal neue Deutung des Zyklus. „Paradoxical though it may seem, these sharply realistic physiognomies are designed as purely mystical images. They do not illustrate the historical characters of the Bible, but the spiritual power of their names." 37 Die Lektüre 36 Wie oben, Anm. 11. Vgl. eine Fußnote in Winds Artikel „Charity: The Case History of a Pattern", in: Journal of the Warburg Institute I, 1937-38, S. 323: „In a forthcoming book on ,The Religious Symbolism of Michelangelo', I shall give a key for the interpretation of these names." In knapper Form unterbreitete Wind seine Gedanken in „Sante Pagnini and Michelangelo", S. 218-232, und explizierte sie systematisch in „The Book of the Generation of Jesus Christ" (wie Anm. 35). 37 „So paradox es auch scheinen mag, sind diese streng realistischen Physiognomien doch als rein mystische Sinnbilder gedacht. Sie schildern nicht die historischen Gestalten der Bibel, sondern die spirituelle Macht ihrer Namen." In: „The Book of the Generation of Jesus Christ". Das intellektuelle Milieu, in dem Wind arbeitete, dürfte seinen Sinn für die Bedeutung von Namen noch geschärft haben. In der Einleitung zu Kulturwissenschaftliche Bibliographie zum Nachleben der
66
II 2ur
Kunst
exegetischer Literatur hatte Wind eine jener überraschenden intellektuellen Wendungen ermöglicht, die so charakteristisch sind f ü r sein Werk. 3 8 Nachdem er in Kommentaren zu des Matthäus Stammbaum Christi (Matthäus 1 , 1 ) entdeckt hatte, daß sie moralische oder mystische Etymologien der vierzig hebräischen Namen lieferten, entwickelte er eine Vorstellung davon, wie Michelangelo diese abstrusen Ideen bildlich umgesetzt haben könnte. In Anlehnung an die in den zeitgenössischen Predigten über den Stammbaum beobachtete Praxis suchte er nach einer beglaubigten Etymologie, fand sie in einer Bibelstelle und bestimmte, welche ,kryptische' Tugend oder welches ,kryptische' Laster sie enthielt. Eine der Bedeutungen v o n Aminadab ist „mein Volk" (populus meus), eine Wendung, die in dem Verse begegnet, den er bereits der Lünette zugeordnet hatte; Naason bedeutet augurium aenigma oder serpens, wobei „aenigma" in der Stelle „wir sehen's jetzt in einem Spiegel wie in einem dunkeln Wort {in aenigmate)"39 vorkommt und „serpens" explizit auf die angrenzende Szene der ehernen Schlange verweist. 40 In der Bildersprache Michelangelos hatte Wind die Ansicht vertreten, daß die einander gegenüberliegenden Lünetten antithetische Paare bilden, „und immer geht ... das dunkle Bild dem lichten voran" (S. 108 f.). 1944 betrachtete er diese Antithesen nunmehr als Ausdruck moralischer Gegensätze: Die Lünette Aminadab, die die Laster Weltlich-
Antike (1934) nennt er neben Jacob Burckhardt Hermann Usener als einen der Vorväter der Warburgschen Kulturstudien und zitiert Useners Götternamen: Versuch einer Lehre von der religiösen Begriffsbildung (1896). Der erste Band des Journal of the Warburg Institute enthielt eine Miszelle von Fritz Saxl über „The Power of the Name?", die sich mit einem Porträt von „Mary" Tudor beschäftigt: „Anthropologists assume that there is a way leading from primitive totemic names to the theophoric names of higher civilizations" (S. 73); und E. Bikerman behandelte in seinem Beitrag „Anonymous Gods" Götter ohne Namen und paraphrasierte Orígenes, dessen Wiederaufleben in der Renaissance Wind später erforschte: „to call God ,the God of Abraham and Isaac and Jacob' was a very different thing from translating the Hebrew titles and saying ,the God of Laughter' (Isaac = Risus), since it is only in answer to the former invocation that God would hear and the demons obey" (S. 187). Siehe hierzu allgemein Roland Kany, Die religionsgeschichtliche Forschung an der Kulturwissenschaftlichen Bibliothek Warburg, Bamberg 1989. 38 Wind kultivierte ganz bewußt eine Methode, die mit Hypothesen arbeitet, wie er dargelegt hat in „Mantegna's Parnassus. A Reply to Some Recent Reflections", in: The Art Bulletin 31, 1949, S. 231: „...hypotheses are the most vital part in the logic of exploration, and no scientific discovery can be made without them. The historian who thinks he can say hypotheses non fingo is either deceived or he is barren. As Poincaré observed (Science et Hypothèse, IV, 9), the only vicious hypotheses are those which have hardened into customs and commonplaces and are hence mistaken for safe." 39 In nur einem einzigen weiteren Fall ist Wind auf den Vers gestoßen, der für seine spätere Interpretation entscheidend sein sollte: die historische Gestalt Booz („in quo est robur") blieb ein „abergläubischer Zimmermann" (Jesaja 44,14-18; Weisheit Salomos 13, 11-19). 40 In Die Bildersprache Michelangelos hatte sich Wind eines analogen Verfahrens bedient, als er anmerkte, daß das Wort Naason im Hebräischen „ehern" bedeutet (S. 131). Er hatte auch schon bemerkt, daß der „Wagen Aminadabs", auf den die sich schmückende Braut des Hohen Liedes (6,11) verweist, ein Vorbild des Mysteriums des Kreuzes war. Deshalb wird die Lünette mit der in der Nähe befindlichen Kreuzigung Hamans verknüpft (ebenda).
E. Sears: Die Bildersprache Michelangelos
67
keit und des Vergessens darstellt, geht der Naasons voran, die die Tugenden der frommen Betrachtung und der weisen Voraussicht ausdrückt - und so durch den gesamten Zyklus hindurch. Michelangelo hatte, laut Wind, eine Reihe rein visueller Gegensätze konstruiert, die die architektonischen Gegebenheiten nutzen sollten und keinerlei Parallelen in irgendeinem Text hatten, und somit dem Betrachter, der die genaue biblische Anspielung womöglich nicht errät, eine Art „Kürzel" bieten. „By studying them in pairs of opposites, it is possible to make them interpret each other, each side reversing the terms of the counterpart, and thus supply a coherent argument which can be tested with the help of the names." 4 1 Wind machte auf die Verbindung aufmerksam, die Bibelexegeten zwischen den vierzig Vorfahren Christi und der vierzigtägigen Fastenzeit, der Quadragesima, herstellen: „Michelangelo's paintings of the Genealogy are, therefore, a kind of penitential cycle illustrating the opposition of vices b y virtues, a Quadragesimale in the sense in which the title was used by Bernardino da Siena or Caracciolo for a volume of sermons containing precepts on fasting and self-effacement." 4 2 Ebenso w i e Wind in den zehn Medaillons die zehn Gebote gefunden hatte, entdeckte er im Verlauf seiner weiteren Forschungen in den acht Stichkappen die acht Seligpreisungen des neuen Gesetzes (Matthäus 5, 3-10). 1935 hatte er die acht Familien als Empfänger der „Verheißung an die A r m e n " betrachtet: die erste Stichkappe „Salmon" zeigt eine Frau, die ein Kleid für ein nacktes Kind zurechtschneidet; sie verkörperte daher die „Bekleidung der Nackten" (Matthäus 25, 36) und wurde „durch den Gebrauch der Schere" zugleich „zum Sinnbild der Beschneidung" (S. 118f.). Als diese Bibelverse für W i n d im Jahr 1950 Illustrationen eines Systems moralischer Gebote geworden waren, stellte diese barmherzige Frau hingegen die fünfte Seligpreisung dar: „Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen" (Matthäus 5, 7). Eine analoge Entwicklung läßt sich in Winds Denken über die Propheten und Sibyllen erkennen. Als Wind sich 1935 eingehend mit den jüdischen und nichtjüdischen Sehern beschäftigte, suchte er die Relevanz ihrer Prophezeiungen für die angrenzenden Szenen zu beweisen und zu zeigen, daß ihre Gebärden greifbare Bedeutung hatten. Einmal experimentierte er sogar mit dem Gedanken, daß die zwölf Figuren verschiedene prophetische Zustände ausdrückten. Da er, ausgehend von der Altarseite hin zur Eingangsseite, nach der Erschaffung Evas einen Wechsel bemerkte, erklärte
41 „Indem man sie als Gegensatzpaare liest, ist es möglich, sie sich wechselseitig deuten zu lassen, wobei sich jede Seite als Umkehrung des Gegenstücks erweist, und so einen zusammenhängenden Gedankengang zu unterbreiten, der sich mit Hilfe der Namen überprüfen läßt." In: „The Book of the Generation of Jesus Christ" (wie Anm. 35). 42 „Michelangelos Bilder der Genealogie sind deshalb eine Art Pönitenz-Zyklus, der den Widerstand der Tugenden gegen die Laster darstellt, ein Quadragesimale in jenem Sinne, in dem der Titel von Bernardino da Siena oder Caracciolo benutzt wurde für einen Band Predigten mit Geboten zum Fasten und zur Selbstbescheidung." Ebenda.
68
II Zur Kunst
er: „Von nun an sind es nicht mehr Grade der Vision, Stufen der Ergriffenheit durch Gott, sondern Grade der Verkündung, Stufen der Predigt gegen die Sünde, die in den Gebärden der Sibyllen und Propheten zum Ausdruck kommen" (S. 148). In „Michelangelo's Prophets and Sibyls" - der Veröffentlichung eines Vortrags, den er 1960 vor der British Academy gehalten hatte - brachte Wind seine Beobachtungen in eine methodische Ordnung und lieferte eine systematische Interpretation der Gebärden und des Gesichtsausdrucks der Figuren im Lichte der RenaissanceTheorien über Prophezeiung und prophetische Zustände. Die Propheten, so seine Auffassung, charakterisieren - im Verein mit den Putti hinter, den ignudi über und den Vorfahren unter ihnen - eine der sieben Gaben des Heiligen Geistes, die vom Propheten Jesaja genannt werden (11, 1-3). Die Sibyllen wiederum gemahnen an die fünf geistigen Gaben, die von Paulus genannt werden (1. Korinther 14, 26): Psalm, Lehre, Offenbarung, Zungenrede und Auslegung. Ferner stellen die zwölf als Gruppe zwar keine Illustration, wohl aber durch ihre Prophezeiungen eine Evokation der zwölf Glaubensartikel dar. Die Sixtinische Decke wird damit so etwas wie eine christliche summa, ein moralisches und prophetisches Programm, das vielfältige Hinweise auf den Renaissance-Katechismus enthält. In der Bildersprache Michelangelos sind also die Wurzeln seiner späteren Deutungen zu finden. Indem er Aufbau und Logik des Bildprogramms zu bestimmen suchte, erkannte Wind die Probleme, die ihn weiterhin interessieren sollten. Mittels Bildanalyse, unterstützt durch intime Bibelkenntnis und Beherrschung des typologischen Prinzips der Exegese, suchte er den Bildern die Preisgabe ihrer Geheimnisse abzuringen. Nur durch die Entdeckung der Regeln, denen Michelangelos Bildersprache gehorchte, konnte er die Rätsel des Programms lösen, ganz so, wie es der meditative Betrachter tun sollte. Wind suchte die Beweise für seine Deutungen gleichermaßen in kleinen Details wie in größeren Strukturen, fand Anhaltspunkte in Anomalien, achtete auf Symmetrien und Antithesen, Sequenzen und lineare Anordnungen, kontrapunktische Rhythmen und Bildanklänge. Wenn seine späteren Schriften über die Sixtinische Decke auch komplexer, gelehrter und rhetorisch eleganter sind, so sollte seine Methode doch konstant und auch weiterhin der Einsicht verpflichtet bleiben, daß die Bilder von kühner Metaphorik waren und Bedeutungen hatten, die über den Buchstabensinn hinausgehen. Während Wind die Früchte seiner immer extensiveren Lektüre der RenaissanceTheologie an den Fresken zum Tragen kommen ließ, dachte er auch zunehmend über die methodischen Probleme nach, die einer textgestützten Bilderklärung innewohnen. Er blieb bei seiner Verachtung für die schwerfälligen Interpretationen, welche ikonographische Studien oft hervorbrachten, und bei seiner Skepsis gegenüber den oberflächlichen Zuordnungen, die regelmäßig zwischen dem Inhalt von Texten und Bildern hergestellt werden. Er selbst suchte nicht nach Textpassagen, die möglicherweise durch Bilder illustriert wurden, sondern unternahm etwas viel Komplexeres: er benutzte Texte, um Gedankengänge aufzudecken, die in Bildern verkörpert sein mochten. Eine Passage aus einer unveröffentlichten methodischen
E. Sears: Die Bildersprache
Michelangelos
69
Erklärung, die ursprünglich als Einleitung zu Heidnische Mysterien in der Renaissance gedacht war, beschreibt sein Verfahren. Unless our reading takes us far away from the pictures, it will not lead us properly back to them.43 Iconography is nothing if not what Focillon regretfully called un détour. The divergences should be pursued, the convergences distrusted until they force themselves upon us against our expectation. In studying a philosophical text, we may find that a singularly bothersome series of arguments becomes suddenly lucid and transparent because we remember a picture which reflects it. When we have reached this point, that a picture helps us to place the right accents in a text, and a text to place the right accents in a picture, they will both acquire a new luminosity: and this is all we should aim for. But it is only when this experience begins to spread, when more texts and more pictures reinforce this sensation, that we may be allowed to trust it. Die gültige Lesart eines Bildprogramms entsteht nur allmählich, auf der Grundlage unablässiger Lektüre und ständiger kritischer Uberprüfung der gewonnenen Ergebnisse. Wind zufolge gibt es „one - and only one - test for the artistic relevance of an interpretation: it must heighten our perception of the object and thereby increase our aesthetic delight. If the object looks just as it looked before, except that a burdensome superstructure has been added, the interpretation is aesthetically useless, whatever historical or other merits it may have." 44
Das Studium komplexer Bildprogramme - Ansammlungen von Bildern, die durch ein übergreifendes Konzept miteinander verbunden sind - hatte für einen in Kunstgeschichte und Philosophie gleichermaßen versierten Gelehrten offenkundig seinen Reiz. Mit seiner epochemachenden Entschlüsselung der Fresken des Palazzo Schifanoia in Ferrara hatte Aby Warburg Wind ein Vorbild von entscheidender Bedeutung geliefert.45 Als Wind in den späten dreißiger Jahren an der Vollendung
43 Ubersetzung des ganzen Textes S. 2 5 9 - 2 6 2 in diesem Band. 44 Art and Anarchy (The Reith Lectures 1960, revised and enlarged), London 1963 (3. Aufl. 1985), S. 62. Hier zitiert nach Kunst und Anarchie, Frankfurt/M. 1979, S. 69: „Für die künstlerische Bedeutsamkeit einer Interpretation gibt es nur einen einzigen Prüfstein: sie muß unsere Wahrnehmung des Gegenstandes schärfen und dadurch unseren ästhetischen Genuß erhöhen. Wenn das Objekt hinterher genauso dasteht wie zuvor, nur durch einen lästigen Uberbau beschwert, so ist die Auslegung ästhetisch ohne Wert, so vermenschlicht sie in historischer oder anderer Hinsicht auch sein mag." 45
„Italienische Kunst und internationale Astrologie im Palazzo Schifanoja zu Ferrara" (1912), in: Gesammelte Schriften, II, Leipzig 1932, S. 459—481; wieder in Ausgewählte Schriften und Wiirdi-
70
II Zur Kunst
seiner Studie zur Sixtinischen Decke arbeitete, setzte er sich intensiv mit Problemen von Bildzyklen auseinander. Ein fünfzehnseitiger Brief, den er im Frühling 1937 aus Rom an Gertrud Bing schrieb und der eine Reise durch italienische Städte beschreibt, enthält eine verblüffende Zahl von Hinweisen auf dechiffrierte Bildprogramme.46 Zu eben dieser Zeit richtete er seine Aufmerksamkeit auch zum ersten Mal auf Raffaels Stanza della Segnatura. Von nun an betrachtete Wind das Phänomen künstlerischer Erfindung aus der Perspektive der Kulturgeschichte. Er unternahm es, die genauen Umstände, unter denen Bildprogramme entwickelt wurden, zu rekonstruieren, und versuchte, auf der Grundlage ihrer intellektuellen Prägung, zu bestimmen, wer außer den Künstlern, bei ihrer Erschaffung noch beteiligt gewesen sein könnte. In der zu Anfang zitierten Bewerbung um ein GuggenheimStipendium schrieb er: My first plans for a book on Raphael's School of Athens go back to the year 1938, when I discovered that it was possible to identify the humanist advisers who had assisted Raphael in composing the program of this painting. The idea of a „Concordance of Plato and Aristotle" had been set forth by Pico della Mirandola and was elaborated by his two nephews, Alberto Pio and Gianfrancesco Pico, who were counselors of Julius II at the time when the fresco was ordered. In the light of their writings as well as those of the elder Pico, supplemented by the works of the Roman Academy of which they were members, the painting revealed itself to be an eloquent illustration of arguments which occupied this circle of scholars.47
gungen, hrsg. v o n D i e t e r W u t t k e , B a d e n - B a d e n 1 9 7 9 , S. 1 7 3 - 1 9 8 . U b e r die historische Bedeutung v o n W a r b u r g s V o r t r a g , den „ m o m e n t in w h i c h the m o d e r n iconological m e t h o d c a m e into being", siehe W i l l i a m S. H e c k s c h e r , „The Genesis o f I c o n o l o g y " ( 1 9 6 4 ) , w i e d e r in seinem Band Art and Literature. Studies in Relationship, hrsg. v o n Egon V e r h e y e n , B a d e n - B a d e n 1 9 8 5 , S. 2 5 3 - 2 6 2 . 46
11. J u n i 1 9 3 7 ( W a r b u r g Institute A r c h i v , I. C , 1 9 3 7 - 3 8 , I. 16). In Rimini studierte W i n d den Skulpturenschmuck in San Francesco: „Ich glaube, ich habe das Programm des Tempio Malatestiano. Es ist, w i e nach P l e t h o n und W a r b u r g zu erwarten w a r , alles reinster Piatonismus. Ich brauche n u r noch etwas Philebus-Lektüre, u m ein paar Details aufzuklären. Vielleicht äußert Saxl inzwischen, w o h e r das beiliegende kosmologische Schema stammt. Sag' ihm übrigens zu seinem Trost, daß alles sehr viel mit Michelangelo zu tun hat: - siehe P r o p h e t e n u n d Sibyllen!" In F l o r e n z besuchte er das Baptisterium u n d erkannte, „daß Ghibertis B r o n z e t ü r e n t y p o l o g i s c h aufeinander bezogen sind, und z w a r so, daß die christliche Folge im umgekehrten
Sinn zu lesen ist w i e die alt-testamen-
tarische". Er hat „ f ü r die A u f s t e l l u n g der Sklaven in der ,Akademie', zusammen mit denen des L o u v r e ... einen R e k o n s t r u k t i o n s p l a n . . . , der eine ikonographische Auslegung zuläßt". W i n d hatte der englischen K u n s t des 18. J a h r h u n d e r t s den R ü c k e n gekehrt: „In Bologna habe ich u n e n d lich viel f ü r meine Engländer gelernt, u n d in Mantua, bei G i u l i o R o m a n o , auch." 47
In „Piatonic Justice, Designed b y Raphael", in: Journal
of the Warburg
Institute
I, 1 9 3 7 - 3 8 ,
S. 6 9 f f . sprach W i n d bereits v o n „the mind (or minds) w h i c h invented the ,School of A t h e n s ' " ; w i e d e r abgedruckt in Eloquence
(wie A n m . 3), S. 56 f.
E. Sears: Die Bildersprache Michelangelos
71
Gleichzeitig begann Wind, die Berater zu suchen, die Michelangelo beim Entwurf der Sixtinischen Decke herangezogen haben könnte. Im Juni 1937 war er auf der Spur des Dominikaners und Hebraisten Sante Pagnini, dessen Isagogae ad mysticos sacrae scripturae sensus libri XVII (Lyon 1536) wesentliche Hinweise geliefert hatten, um die Rätsel des Zyklus der Vorfahren Christi zu lösen.48 1947 veröffentlichte er eine Verteidigung seiner Idee in „Sante Pagnini and Michelangelo", wohl wissend, daß „the mere suggestion that such an adviser existed runs counter to an axiom of Michelangelo idolatry, to wit, that the brooding spirit of the master neither needed nor tolerated outside advice." 49 Wenn auch Wind sein Interesse an Pagnini nie verlor, führten ihn spätere Forschungen doch zu der in zwei Publikationen dargelegten Uberzeugung, daß das Programm der Sixtinischen Decke seinen Ursprung in dem Kreis augustinischer Gelehrter hatte, die sich in Rom in der Kirche Sant'Agostino um Egidio da Viterbo scharten.50 Um seine Gedanken zu untermauern, erforschte er minutiös die früheren Verbindungen des Künstlers zu Gelehrten und faßte seine Ergebnisse in dem um 1970 entstandenen, unveröffentlicht gebliebenen Text „Michelangelo's Progress among Theologians" zusammen. Die Dynamik des Gedankenaustauschs zwischen Künstlern, gebildeten Gönnern und gelehrten Beratern übte eine große Faszination auf Wind aus, der seine Aufgabe in der „Rekonstruktion des Gehalts vergangener Gespräche" sah.51 Er studierte viele solcher Beziehungen, von der zwischen Albrecht von Brandenburg und Grüne48 Brief vom 11. Juni 1937 (wie Anm. 46): „Das Einzige, womit ich nicht weitergekommen bin, ist die sog. Urkundenforschung. Uber Pagnini und Calcagnini ist hier nichts zu erfahren, als was ich schon weiß. Meine Hoffnung, Calcagninis Bibliothek in Ferrara oder Modena zu finden, schlug fehl. Nicht einmal sein Grab hat man in Ferrara stehen gelassen. - Die letzte Chance ist hier in Rom; aber auch da sind die Aussichten nicht viel versprechend. Pagninis Psalmenauslegung z. B., deren einziges gedrucktes Exemplar noch im 18. Jahrhdt. in der Casanatensis gesehen worden ist, ist inzwischen von dort verschwunden. Cantimori, der diesen ganzen Umkreis sehr gut kennt, behauptet fest und stark, Pagnini sei ein Ketzer geworden und zu den Reformierten übergetreten. Ich kann nicht den geringsten Beleg dafür finden, - obwohl es das Verschwinden seiner Schriften erklären würde." Zweieinhalb Wochen später klagt Wind in einem Brief an Saxl (wie Anm. 17) nochmals: „Es ist zu schade, daß Pagninis Manuskripte zerstört sind." 49 Wie Anm. 11, S. 232. 50 Egidios Name taucht bereits in einem gegen Ende der 40er Jahre erstellten Inhaltsverzeichnis auf, und Wind sollte auf seine Idee in „The Ark of Noah" (1950) und „Prophets and Sibyls" (1966) verweisen. Er studierte Egidios Manuskripte 1949/51 in Rom und nochmals 1968; im September 1948 schrieb er an W. S. Cook, Direktor des Institute of Fine Arts in New York: „In May I hope to go to Rome to verify a suspicion that some untapped sources relevant to my theories about the Sistine Chapel lie hidden in the Biblioteca Angelica" (Edgar Wind Archiv). Zu den neueren Vertretern der Auffassung, daß Egidio da Viterbo Michelangelos Berater war, gehören Esther Gordon Dotson (siehe Anm. 32, S. 250-255) und Malcolm Bull, „The Iconography of the Sistine Ceiling", in: The Burlington Magazine, 130, 1988, S. 605. 51 Pagan Mysteries in the Renaissance, London 1958, S. 15. (Dt. Ausgabe: Heidnische Mysterien in der Renaissance, Frankfurt/M. 1981, S. 26.)
72
II Zur
Kunst
wald 5 2 bis hin zu jener zwischen Shaftesbury und J o h n Closterman. 5 3 E s ist daher n u r konsequent, daß ihn der H o f v o n Mantua anzog, w o die gelehrte und gebieterische Gönnerin Isabella d ' E s t é - mit Hilfe ihres humanistischen Beraters Paride da C e r e sara - P r o g r a m m e für Künstler aufstellte, die mehr oder weniger glücklich und schöpferisch auf ihre Anweisungen reagierten: „Perugino . . . was out of his depth when he tried t o cope with one of her learned programs; but under precisely the same conditions M a n t e g n a p r o d u c e d t w o of his greatest works, as did also Correggio; while Costa's modest but conscientious talents proved quite adaptable to her wishes." 5 4 Auf der Grundlage dieser zahlreichen Studien sah sich W i n d in der Lage, umfassende Schlußfolgerungen über die Bedingungen zu ziehen, unter denen im Italien der Renaissance K u n s t w e r k e produziert w u r d e n - Bedingungen, die in eklatantem Gegensatz stehen z u r Situation in unserem nachromantischen Zeitalter, w o G ö n n e r u n d M ä z e n e sich in der Regel nicht mehr in den künstlerischen P r o z e ß einmischen u n d die F u r c h t herrscht, Wissen körine der Einbildungskraft schaden. 5 5 „In the Renaissance, no artist encountered his subject ,in the raw'. H e was provided -
or
provided himself - with a p r o g r a m m e , poetical o r liturgical o r philosophical or all three, w h i c h outlined the pictorial argument to be conveyed by the eloquence of his b r u s h . " 5 6 Freilich räumte W i n d durchaus ein, daß nicht alle gelehrten P r o g r a m m e
52 „Studies in Allegorical Portraiture - I", in: Journal of the Warburg Institute, I, 1937-38, S. 142ff.; wieder in: Eloquence (wie Anm. 3), „An Allegorical Portrait by Grunewald. Albrecht von Brandenburg as St. Erasmus", S. 58-76. 53 „Shaftesbury as a Patron of Art", in: Journal of the Warburg Institute, II, 1938-39, S. 185-188; erneut in: Hume and the Heroic Portrait, hrsg. von Jaynie Anderson, Oxford 1986, S. 64-68: „Er begriff den Künstler nicht als ein seiner eigenen Inspiration verpflichtetes Genie, sondern behandelte ihn als einen handwerklich Tätigen, der im sichtbaren Material das ausführt, was ihm der Philosoph als Ideen diktiert." 54 Bellini's Feast of the Gods, Cambridge, Mass. 1948, S. 3. 55 Vgl. Kunst und Anarchie (wie Anm. 44), IV. Kapitel („Die Furcht vor dem Wissen"), VI. Kapitel („Kunst und Wille"). 56 „In der Renaissance ging kein Künstler .unvermittelt' an sein Thema heran. Entweder bot sich ihm ein Programm, oder er schuf sich selber eins - ein poetisches, liturgisches oder philosophisches Programm, oder alle drei in einem, welches das bildnerische Argument umriß, das die Eloquenz seines Pinsels vermitteln sollte." In: „A Note on the Invention of the Programme", unveröffentlicht, entstanden 1950. Wind fuhr fort: „The invention and articulation of pictorial programmes belong to those marginal or hybrid activities of the imagination which are a source of irritation to aesthetic purists, being both relevant and extraneous to the artistic process. They are comparable, in this respect, to operatic libretti, which cannot be classified as either literary or musical works, but owe their existence to the indisputable phenomenon of,musical poetry' in a text. The presence or absence of this virtue in a libretto will support or damage the musical effect of the opera, though even the best libretto will not insure good music. It is significant, however, that in the process of composition, the sense of an affinity between text and music has proved to be a crucial creative phase with every composer." [Die Erfindung und Artikulation von Bildprogrammen gehört zu jenen Grenzleistungen oder gemischten Vollzügen der Einbildungskraft, die für ästhetische Puristen eine Quelle der Irritation sind, da sie für den künstlerischen Prozeß ebenso relevant wie ihm äußerlich sind. In dieser Hinsicht lassen sie sich mit Opernlibretti vergleichen, die sich weder als
E. Sears: Die Bildersprache
73
Michelangelos
gleichermaßen zur Umsetzung in Bilder geeignet waren, ebensowenig wie alle Künstler gleichermaßen befähigt waren, komplexe Gedanken bildlich umzusetzen: „It is clear that the quality of an argument for the purpose of painting is not identical with its intellectual merits, since it is quite possible to paint a trivial argument very well, or a profound idea very badly. In both these cases the attitude of the amateur is in the end the only sound one: he inclines in the one case to ignore the idea, and in the other to ignore the painting."57 Indem Wind Michelangelos Sixtinische Decke und Raffaels Stanza della Segnatura zu lebenslangen Studienobjekten erkor, wählte er Kunstwerke, die zu ihrer Zeit herausragend waren und in denen geistige Anforderungen und malerische Ansprüche wie er zu beweisen suchte - einander aufs trefflichste die Waage hielten. Es war eines von Winds Hauptanliegen, die Trugschlüsse jener Kunstästhetik zu entlarven, welche nach unbedingter - d. h. allen intellektuellen, moralischen, religiösen oder utilitaristischen Zwecken enthobener - künstlerischer Freiheit verlangt und ein Studium der Kunst fordert, das literarische, historische, biographische oder anekdotische Bezüge außer Acht läßt.58 Große Künstler, die sich durch Ideen inspirieren lassen, machen sich die Spannung zwischen Verstand und Einbildungskraft zunutze. In der Einleitung zur Bildersprache Michelangelos verweist Wind mit Nachdruck auf „die Klarheit der Entscheidung, die nirgends zuläßt, daß die Bildphantasie sich beziehungsfrei äußert..." Das Studium von Bildprogrammen hat Wind befähigt zu zeigen, „daß bei der Erschaffung einiger der größten Kunstwerke der Verstand die Einbildungskraft nicht behindert, sondern beflügelt hat". Ob den Bildern der Sixtinischen Decke überhaupt ein systematisches theologisches Programm unterliegt, in dem die alttestamentarischen Szenen geheime christliche Bedeutungen haben, und ob theologisch gebildete Ratgeber den Künstler dazu brachten, komplexe Ideen zu verkörpern - wie Wind und andere Kunsthistoriker nach ihm behauptet haben - ist noch immer umstritten. Winds Methode der Bildinterpretation, „die zeigt, wie Ideen in Bilder übersetzt werden und Bilder auf Ideen beruhen", ist indes eine bleibende Herausforderung für die Kunstwissenschaft. Aus dem Englischen von Bernd
Samland
literarische noch als musikalische Werke klassifizieren lassen, sondern ihr Dasein dem unbestreitbaren Phänomen ,musikalischer Poesie' in einem Text verdanken. Das Vorhanden- oder Nichtvorhandensein dieser Qualität in einem Libretto wird die musikalische Wirkung der O p e r steigern oder beeinträchtigen, auch wenn das beste Libretto keine Garantie für gute Musik ist. In jedem Fall ist es von Bedeutung, daß sich im Kompositionsprozeß der Sinn für die Affinität zwischen Text und Musik bei jedem Komponisten als entscheidendes schöpferisches Moment erweist.] 57 Siehe „Bild und T e x t " (wie Anm. 43), hier im Band S. 259. 58 Vgl. Winds unveröffentlichte Antrittsvorlesung über „The Fallacy of Pure A r t " , gehalten im Oktober 1957 in Oxford. Eine Zusammenfassung bei Lloyd-Jones (siehe Anm. 3), S. xxviiiff.
II Zur Kunst
74
A N H A N G : Inhaltsverzeichnis (1935-36)
DIE BILDERSPRACHE MICHELANGELOS. DIE SIXTINISCHE D E C K E
Einleitung HÖLLENFAHRT UND ERLÖSUNG (Die Eckfelder der Altar- und Eingangswand) 1. Die „Kreuzigung Hamans" 2. Judith - Maria; Holofernes - Satan 3. Die Worte Zacharias' und Jonas'
D I E PASSION IM S I N N B I L D D E R (Die Mittelbilder und Medaillons) 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
SCHÖPFUNGSGESCHICHTE
Die Worte Joels und der vier großen Propheten Die Bedrohung des Weinbergs Die Gegenwart Gottes Die Passionslandschaft Der Baum des Lebens und des Todes Die Fleischwerdung des Gebeins Die Uberwindung des Tiers Die Ausgießung des Lichts Der Jüngste Tag
D A S L E B E N J E S U IM G L E I C H N I S D E R V O R F A H R E N (Die Lünetten und Stichkappen) 13. 14. 15. 16. 17.
Der Stammbaum Christi Die Geschichte Israels; die Sprüche der Weisen Gesetzeseifer; Werke und Glaube Die Jugend des Heilands; das Erlösungswerk Die Verheißung an die Armen
G E H E I M N I S , PREDIGT, T R I U M P H D E R K I R C H E (Die Propheten und Sibyllen) 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
Versündigung und Entsühnungsgewißheit (Zacharias) Gerechtigkeit und Erbarmen; Gesetz und Gnade (Jonas) Das Mysterium des Lichts (Jeremias - Libyca) Das Erkennen Gottes (Persica - Daniel) Die Verwaltung des Sakraments (Hesekiel - Cumäa) Schöpfung und Sünde; die Wendung zur Predigt Die Genien der Dunkelheit und des Lichts
E. Sears: Die Bildersprache Michelangelos 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Das Werk der Bekehrung (Jesaja - Eritrea) Heilige Abwehr (Delphica - Joel) Das Schema der prophetischen Kräfte Prophet als,Gesetz'; Sibylle als ,Gnade' Der Doppelchor der Propheten und Sibyllen Der Chor der Begleitfiguren Die überwundenen Widersacher
Anhang I: Die rhythmische Gliederung Anhang II: Religiöse Wiederholung Anhang III: Das Weltreich der Sibyllen Anhang IV: Die Sibyllenzitate Anhang V: Haman und Christus
75
Edgar Wind und das Problem der Schule von Athen Pascal Griener *
Einführung E d g a r W i n d w i d m e t e m e h r als dreißig J a h r e einer U n t e r s u c h u n g , die z u einer bedeutenden Publikation führen sollte: z u d e r Studie ü b e r die Stanza tura Athen
della
( A b b . 1) u n d insbesondere das F r e s k o , das m a n gemeinhin die Schule
Segnavon
nennt. 1 D i e ersten E r g e b n i s s e erschienen 1 9 3 7 in k u r z e n gelehrten M a r g i n a -
lien. I m L a u f e der vierziger und fünfziger J a h r e w i d m e t e W i n d diesem T h e m a zahlreiche Vorträge, b e v o r er die endgültige F o r m u l i e r u n g seiner A n a l y s e n v o r bereiten k o n n t e - sie enthielten E x z e r p t e u n d i k o n o g r a p h i s c h e D o k u m e n t e , die geeignet schienen, eines der b e r ü h m t e s t e n dekorativen P r o g r a m m e der Renaissance z u erhellen. D o c h als er 1971 starb, hinterließ W i n d lediglich zahlreiche N o t i z e n und eine Anzahl v o n Skizzen für ein unvollendetes B u c h . E s ist klar, daß seine Tätig-
*
Diese Studie verdankt ihren Gehalt der entscheidenden Hilfe von Mrs Margaret Wind. Wir danken ihr sehr für ihre außerordentliche Geduld und Großzügigkeit. Bernhard Buschendorf hat freundlicherweise die Endfassung des Textes durchgesehen. 1 Die besten Arbeiten über Edgar Wind sind nach wie vor die von Bernhard Buschendorf, siehe Bernhard Buschendorf, „Enthusiasmus und Erinnerung in der Kunsttheorie Edgar Winds", in: Mnemosyne. Formen und Funktionen der kulturellen Erinnerung, hrsg. von Aleida Assmann, Dietrich Harth, Frankfurt/M. 1991 (2.Aufl. 1993) S. 319-334; Bernhard Buschendorf, „War ein sehr tüchtiges gegenseitiges Fördern. Edgar Wind und Aby Warburg", in: Idea (Jahrbuch der Hamburger Kunsthalle), IV, 1985, S. 165-209; ders., „Auf dem Weg nach England - Edgar Wind und die Emigration der Bibliothek Warburg", in: Porträt aus Büchern. Bibliothek Warburg und Warburg Institute - 1933 - London, hrsg. von Michael Diers, Hamburg 1993, S. 85-128; ders., „Einige Motive im Denken Edgar Winds", in: Edgar Wind, Heidnische Mysterien in der Renaissance, Frankfurt/M. 1984, S. 396-415; Hans Schlaffer, „Gelehrsamkeit. Über Edgar Wind", in: Akzente 2, 1982, S. 158-167; Silvia Ferretti, „Edgar Wind. Dalla filosofia alla storia", in: La Cultura X X I X , 1991, S. 346-357; Claudie Balavoine, „Edgar Wind. Itinéraire d'un philosophe historien de l'art. Entretient avec Raymond Klibansky", in: Préfaces, 1992, S. 28-32; Pierre Hadot, ebenda, S. 33-37; über das Leben von Edgar Wind siehe Hugh Lloyd-Jones, „A Biographical Memoir", in: Edgar Wind, The Eloquence of Symbols. Studies in Humanist Art, hrsg. von Jaynie Anderson, Oxford 1983; rev. Ausg. 1993, S. xiii-xxxvi.
78
II Zur Kunst
Abb. 1. Sicht der Stanza delle Segnatura von G. Niemann, 1883. In: Anton Springer, „Raffael's .Schule von Athen'", in: Die Graphischen Künste V 1883 S. 53-106
keit, vor allem an der Universität Oxford, ihn daran hinderte, sich ganz dieser Aufgabe zu widmen; aber andere, tiefere Gründe verschärften diese Schwierigkeit. Der Status der Untersuchung selbst war komplex genug. Die Schule von Athen war mehr als ein Forschungsgegenstand, sie war in mehrfacher Hinsicht ein Problem. Wind war ein Philosoph, der sich leidenschaftlich für Epistemologie interessierte: dieses Thema war für ihn der Test par excellence für seine methodologischen Überlegungen. Mehr noch, Die Schule von Athen sollte nicht weniger als ein Modell liefern, das alle anderen Untersuchungen über die Renaissance fördern und sein wissenschaftliches Ethos legitimieren konnte. Hie und da ist es leicht, den Schatten zu erkennen, den die Schule von Athen auf sein veröffentlichtes Werk wirft: außerhalb und als Referenz auf etwas Unvollendetes. Edgar Wind unterhielt eine komplexe Beziehung zum Schreiben. Bevor er mit der Niederschrift einer wichtigen Untersuchung begann, widmete er seinem Gegenstand zahlreiche Vorträge; er sprach freilich ohne Notizen und stützte sich lediglich auf eine Reihe sorgfältig geordneter Diapositive. Jede schriftliche Fixierung des Denkens erschien ihm kritisch, denn sie schien eine Neuformung der Ideen und Formulierungen nach sich zu ziehen.
P. Griener:
Edgar Wind und das Problem
der Schule von
Athen
79
In einem kurzen ersten Teil möchte ich die Umrisse des Problems skizzieren, das Edgar Wind von der gelehrten Tradition hinterlassen worden war. Dann werde ich versuchen, die Bedeutung der Schule von Athen für Edgar Wind zu rekonstituieren, und zwar als Gegenstand wie als Problem.
1. Die „Schule von Athen" als klassisches Interpretationsproblem: Vasari, Bellori Als allgemein anerkanntes und verehrtes Meisterwerk stellte die Schule von Athen den Betrachter sehr bald das Problem ihrer Bedeutung. Offensichtlich inszenierte das Fresko eine enzyklopädische Vision. Die Disputa veranschaulichte die theologische und die Schule von Athen die philosophische Erkenntnis; doch blieben das wahre Wesen und die Konturen dieser Inszenierung schwer zu entschlüsseln. Die Historiker suchten nach einem Programm des Zyklus, doch wurde dieses nie entdeckt. Raffael hinterließ keinerlei Zeugnis über die Zusammenhänge seines Werkes. Die erste substanzielle Aussage stammt von Vasari; seine Beschreibung, die sich teilweise auf eine mündliche und schon fragmentarische Tradition stützt und auf Stiche wie den von Agostino Veneziano (1524), scheint die Ikonographie der Disputa auf die der Schule von Athen zu projizieren (Abb. 2): in letzterer wird aus der Figur des Pythagoras die des Evangelisten Matthäus, und aus dem jungen neben ihm stehende Mann ein Johannes der Täufer. 2 In ihrer Unbeholfenheit bezeugte Vasaris Beschreibung jedoch eine fundamentale Wahrheit: um verstanden zu werden, entfaltet der Zyklus seinen Sinn kraft eines funktionstüchtigen Systems von Verweisen, Analogien und Gegensätzen. Vasaris Analyse selbst ist, obwohl falsch, ein authentischer Beleg für diese Funktion. Die erste systematische Interpretation des Zyklus ist ein Jahrhundert älter, und zum ersten Mal stammt sie von einem Gelehrten, der sich bemüht, einen verlorenen Sinn als verlorenen Text zu verstehen, den man wiederfinden muß. Bellori stellt diesen Sinn mit Hilfe eines rhetorischen Modells wieder her: „La Sapienza delle cose divine, ed umane, e la Virtù, nella quale consiste il bene, e la felicità di questa mortai vita per conseguire l'eterna." 3 Bei der Niederschrift seiner Beschrei-
2
Giorgio Vasari, Le Vite de'più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue, insino a' tempi nostri (1550), Hrsg. von Luciano Bellosi u. Aldo Rossi, Turin 1991, S. 616-620; Giorgio Vasari, Le Vite de' più eccellenti pittori scultori e architettori nelle redazioni del 1550 e 1568, hrsg. von Paola Barocchi u. Rosans Bettarini, Florenz 1987, Bd. IV, S. 167-173; Matthias Winner, „Disputa und Schule von Athen", in: Raffaello a Roma. Atti del Convegno 1983, R o m 1986, S. 2 9 - 4 5 ; ders., „II Giudizio di Vasari sulle prime tre Stanze di Raffaello in Vaticano", in: Ausst. Kat. Raffaello in Vaticano, Città del Vaticano, 1984-85, Mailand 1984, S. 179-193; ders., „Ekphrasis bei Vasari", in: Beschreibungskunst - Kunstbeschreibung, hrsg. von Gottfried Böhm u. Helmut Pfotenhauer, München 1995, S. 259-278.
3
Giovan Pietro Bellori, Descrizzione delle Imagini dipinte da Raffaelle d'Urbino Nelle Camere del
80
II Zur Kunst
Abb. 2. Agostino Veneziano, Gruppe des Heiligen Matthäus, nach der Schule von Athen von Raffael. Radierung, 1524
bung der Stanzen erfaßt Bellori die Grenzen der literarischen Beschreibung bildlicher Werke (Abb. 3). Poussin empfiehlt ihm, nicht nur das allgemeine Thema eines Gemäldes herauszuarbeiten, sondern es im Detail zu erfassen und alle seine Verknüpfungen zu übersetzen: den Ausdruck der Leidenschaften, der Gesichter, Gesten usw. Diese langweilige, lineare Ubersetzung widerstrebt ihm. Bellori entdeckt die Unmöglichkeit, die Bedeutung des Fresko in einem Text abzuwickeln: „Et è pessima cosa il ricorrere al'aiuto del proprio ingegno, l'aggiungere alle figure quei sensi e quelle passioni, che in esse non sono, con divertirle e disturbarle da gli originali." 4 Zwar bekennt er sich noch zu Ut pictura poesis, doch drückt seine
Palazzo Apostolico Vaticano, Rom 1695, S. 4 [Das Wissen um die göttlichen wie menschlichen Dinge ist die Tugend, in der das Gute liegt und die Glückseligkeit dieses sterblichen Lebens, um die Ewigkeit zu erlangen.]; zu dieser Frage siehe vor allem Oskar Bätschmann, „Giovan Pietro Belloris Bildbeschreibungen", in: Beschreibungskunst - Kunstbeschreibung (wie Anm. 2), S. 279-312. 4 Gian Pietro Bellori, Le vite de'pittori, scultori e architetti moderni, (1672) hrsg. von Evelina Borea, Einl. von Giovanni Previtali, Turin 1976, S. 8-9. [Und es ist eine sehr schlechte Sache, auf die Hilfe des eigenen Geistes zurückzugreifen und den Figuren einen Sinn und Leidenschaften zu unterstellen, die nicht in ihnen sind, um sie von den Originalen aus zu schmücken und zu entstellen.]
P. Griener: Edgar Wind und das Problem der Schule von Athen
81
U E B E R SIC Η Τ ALLER VON DEN BISHERIGEN AUSLECERN VORGESCHLAGENEN BENENNUNGEN EÜR DIE IN RAEEAELS „SCHULE VON ATHEN" ERSCHEINENDEN FIGUREN.
Abb. 3. Schema der verschiedenen Interpretationsschlüssel der Figuren in der Schule von Athen. In: Anton Springer, „Raffael's .Schule von Athen'", in: Die Graphischen Künste V 1883 S. 53ff.
Praxis eine Vorsicht aus, die auf dieses je ne sais quoi im Bild aufmerksam macht und jede Beschreibung in Frage stellt. Oskar Bätschmann hat zu Recht hervorgehoben, daß Jacob Burckhardt der erste sein wird, der die letzten Konsequenzen aus diesem Problem zieht: würde sich die Malerei darauf beschränken, die zuvor von einem Text festgelegten Inhalte zu illustrieren, so wäre sie für die entstehende Kunstgeschichte überflüssig.5 Im 19. Jahrhundert setzt sich eine neue Deutung der Schule von Athen durch, deren Historiograph Anton Springer war: eine historische Interpretation, die im Fresko die Darstellung von Helden der italienischen Renaissance sieht, freilich in Kostümen der Antike (Abb. 4). Eine solche Lesart neigt dazu, die Interpretation auf eine Analyse zu reduzieren, die der Lektüre eines Schlüsselromans gleicht: das Fresko illustriert dann den Text der Geschichte, den einer Kultur, die in ihrer synchronen Dimension veranschaulicht wird.6 5 Jacob Burckhardt, Der Cicerone, Basel 1855, Vorrede, S. VII: „Das Räsonnement des ,Cicerone' macht keinen Anspruch darauf, den tiefsten Gedanken, die Idee eines Kunstwerkes zu verfolgen und auszusprechen. Könnte man denselben überhaupt in Worten vollständig geben, so wäre die Kunst überflüssig, und das betreffende Werk hätte ungebaut, ungemeißelt, ungemalt bleiben dürfen." 6 Anton Springer, „Raffaels Schule von Athen", in: Die Graphischen Künste, V, 1883, S. 53-106; wahrscheinlich hat die Veröffentlichung der Kultur der Renaissance in Italien (1860) von Jacob
82
II Zur Kunst
DESCRIZIONE
DELLE
I M M A G I N I
DIPINTE
D A R A F F A E L L E D'URBIxNO
e nella Flrncfina alla Lungarx, „ . '·. C 0 Ν ^Alcuni Ragionamenti in onore ¿elle fue N e l Palazzo Vaticano,
f¡¡¡
OPERE, e della PITTURA, e SCULTURA ,
DI G i o : PIETRO
BELLORI
In cjuefli nuova eduione accrefcinra anche de"! VITA del mcdsfuno RAFFAELE Defcritta DA
G I O R G I O
V A S A R I .
IN R O M A , M D C C L I ,
Appicflò gli Eredi del r¡. Gio; Lorenzo Barbiellinc Stampatori , e Mcrcami di Libri a Fa&puno . COHLICETSJ.^iDE' SVTEBJORJ.
Abb. 4. Giovan Pietro Bellori, Descrizzione delle Imagini dipinte da Raffaelo d'Urbino del Palazzo Apostolico Vaticano, Rom: Boèmo, 1695, Titelseite
nelle
Camere
2. Edgar Wind und die „Schule von Athen" 1937 und 1938 erscheinen zum ersten Mal zwei kurze Studien von Edgar Wind, die der Stanza della Segnatura gewidmet sind.7 Die Hinwendung zu diesem Gegenstand war nicht rein zufällig, sondern durchaus systematisch. Denn 1937 ist
Burckhardt zu diesem Typus von Analyse beigetragen; siehe auch Ruskin, der am 8. September 1849 eine gleiche Interpretation der Hochzeit von Kana von Veronese (Louvre) plant: „the first distinct expression which fixed itself on one was that of the entire superiority of painting to literature as a test, expression, and record of human intellect, and of the enormously greater quantity of intellect which might be forced into a picture - and read there - compared with what might be expressed in words ... I felt that painting had never yet been understood as it is, an interpretation of Humanity." in: The Diaries of John Ruskin, hrsg. von Joan Evans u. John Howard Whitehouse, Oxford 1956-59, II, S. 437 (Besuch im Louvre, Paris, 8. September 1849). 7 Edgar Wind, „Platonic Justice, designed by Raphael", in: Journal of the Warburg Institute I, 1 (1937) S. 69-70; ders., „Homo Platonis", in: Journal of the Warburg Institute I, 3 (1938), S. 261, wo der so wichtige Begriff des ,wit' entwickelt wird; ders., „The four elements in Raphael's Stanza della Segnatura", in: Journal of the Warburg Institute II, 1 (1938), S. 75-79.
P. Griener: Edgar Wind und das Problem der Schule von Athen
83
das Jahr, in dem Wind darauf verzichtet, Schriften rein epistemologischen Charakters zu veröffentlichen. Die Analyse von Werken, insbesondere der Stanza della Segnatura, löst somit die theoretische Reflexion ab. Es ziemt sich daher, die Hauptzielrichtungen dieser Meditation zwischen 1922 und 1937 nachzuzeichnen, und dann zu verfolgen, wie die Analyse des Gegenstands die theoretische Reflexion ablöst.
2. a. Die Notwendigkeit einer Kunstwissenschaft Seit den Tagen der Grand Tour wurde die Stanza della Segnatura als absolutes ästhetisches Meisterwerk bewundert, auch wenn ihr Inhalt dunkel blieb. In der Zeit, als der junge Edgar Wind seine Studien begann, leugnete die herrschende formalistisch orientierte Kunstgeschichte sogar, daß es nötig sei, das Fresko zu verstehen, um es bewundern zu können. Dabei hatte Jacob Burckhardt beispielhaft gezeigt, daß ein Werk allein durch sein Verständnis als kulturelles Faktum gewürdigt werden kann. Die Kunstgeschichte, die er Wölfflin weitergab, war nach seinen eigenen Worten „eine Kunstgeschichte nach Aufgaben", das heißt nicht auf die Produktion eines fleischlosen, auf rein visuelle Wirkung abzielenden Genies gerichtet, sondern auf die Arbeit des Künstlers, der von seinen Auftraggebern eine Aufgabe übertragen bekommen hatte und diese mit Hilfe von Materialien und bindend auferlegten Arbeitsmethoden bildlich auszudrücken hatte. 8 Allerdings geriet zu Beginn der zwanziger Jahre unseres Jahrhunderts die von Burckhardt vorgeschlagene Methode wieder völlig in Vergessenheit. Mehr noch, die methodologische Reflexion schien in eine Sackgasse geraten zu sein. Bernard Berensons von Morellis Methoden inspirierte Praxis wurde bereits sehr bewundert; er versuchte jedoch nur einmal, diese Praxis zu kodifizieren, und zwar in einem enttäuschenden Essay unter dem Titel „Rudiments of connoisseurship". 9 Berenson war vorsichtig genug, seinem Essay den Untertitel „Fragment" zu geben. 10 Obwohl er niemals an einer Universität gelehrt hatte, schien sein Erfolg die Gültigkeit seiner Methode zu garantieren. Seine Rudiments richten sich auf eine einzige 8 Im ersten Aufsatz der Vorträge der Bibliothek Warburg erinnert Fritz Saxl an diese Schuld gegenüber Burckhardt, siehe F. Saxl, „Die Bibliothek Warburg und ihr Ziel", in: Vorträge der Bibliothek Warburg, I, 1921-22 S. 1-10, Zitat S. 1: „Warburgs Vorbild war Burckhardt." 9 Bernard Berenson, „Rudiments of connoisseurship", in: The Study and Criticism of Italian Art, Second Series, New York 1902, S. 111-148; hier S. 112: „As information, (...), the value of the document in art study depends on the question whether the work of art it deals with was executed (..;)." 10 Dieser Essay steht trotz seiner Anlehnung an Morelli der angelsächsischen Tradition näher, wie sie veranschaulicht wird durch Charles Lock Eastlake, Contributions to the Literature of the Fine Arts, Second Series, London 1870, S. 199-300, „How to observe"; siehe auch Fabius Pictor [Anthony Rich] in: The Handbook of Taste; or, How to observe Works of Art, especially Cartoons, Pictures, and Statues, 3. Aufl., London 1845.
84
II Zur Kunst
Aufgabe: die Identifizierung eines Kunstwerkes und seine Bewertung. Die Identifizierung stützt sich auf einen maßlosen Gebrauch der Schlußfolgerung. Berenson war sich der Notwendigkeit bewußt, ein konkretes Œuvre mit Hilfe eines rationellen Modells des künstlerischen Kontextes zu konstruieren, das Epochen, Schulen usw. miteinander verknüpft. Doch interessierte ihn keineswegs die Dynamik, die das konkrete Werk und das rationale Ganze, dem es konfrontiert ist, miteinander verbindet. Mehr noch, der Schlußpunkt der Analyse in Begriffen des Connoisseurship - die eindeutige Identifizierung der Spuren, die die Hand eines Künstlers belegen - , wird lediglich durch vagen Bezug auf die ästhetische Qualität eines Werkes erklärt, an der man einen Schöpfer erkennt. Für Berenson war die Geschichte nur dazu nütze, die Entstehungsbedingungen eines Werkes zu präzisieren und somit seine Echtheit zu erweisen. Er war sich wohl der Bedeutung bewußt, die eine künstlerische Theorie für das Verständnis der Produktion zeitgenössischer Werke besitzt - jenes Korpus von Zwängen und Gesetzen, denen der Künstler untersteht. Dennoch blieben die historischen Nachforschungen einer Priorität untergeordnet: der Identifizierung des konkreten Werkes. Ein formalistisches Herangehen machte die Anerkennung von „pattern" notwendig, die in den individuellen Werken vorhanden sind; was die kulturellen „pattern" betrifft, so wollte Berenson keines anerkennen: die Rudiments behaupten, ein Vertrag des 16. Jahrhunderts, der einen Künstler an einen Auftraggeber gebunden und nicht zur Ausführung eines Werkes geführt hätte, wäre von keinerlei Interesse für den Kunsthistoriker. 1919 ließ ein Essay Max Friedländers zum Thema Connoisseurship noch deutlicher die epistemologischen Aporien erkennen, in die der formalistische Zugang führte. Friedländer hatte nur sechs Semester auf den Bänken der Universität verbracht, bevor er sich dem Personal der Berliner Museen anschloß. Es scheint, als habe er versucht, dieses Ungenügen zu verbergen, indem er sich über jene Akademiker lustig machte, die vom Beweis ihrer Hypothesen besessen sind und sich in Bibliotheken, diesen „Friedhöfen der Geister", einschließen.11 Friedländer verwirft die Interpretation des Kunstwerkes, weil sie den ästhetischen Genuß zerstöre.12 Gemäß der gleichen Logik wird die Identifizierungsprozedur zu einem mystischen Ritual, das bei den großen Kunstkennern zwar unfehlbar, jedoch immer irrational sei. Wilhelm Waetzoldt faßt sehr schön dieses Scheitern jeder Rationalisierung zusammen: „Vorarbeit und Nacharbeit sind lehrbar und lernbar, das Erfassen der künstlerischen Persönlichkeit im Anblick des Werkes, das unmittelbare Erkennen ist nicht lehr- und lernbar, es ist Gnade."13 Es ist leichter, solche wissenschaftliche 11 Max J. Friedländer, Erinnerungen und Aufzeichnungen. Aus dem Nachlaß herausgegeben von Rudolf Heilbrunn, Mainz, Berlin 1967, S. 65. 12 Ebenda, S. 63 über seinen kurzen Aufenthalt in der Universität. 13 Wilhelm Waetzoldt, Rezension von Max J. Friedländer, Der Kunstkenner (1919), in: Kunstchronik, Nr. 42, 1. August 1919, S. 893-894. Waetzoldt war der Meinung, Connoisseurship müsse von der Universität anerkannt werden, und „Die Kunst ist wichtiger als die Methode der Kunstgeschichte".
P. Griener: Edgar Wind und das Problem der Schule von Athen
85
Haltung zu denunzieren, als sie zu widerlegen. In einer negativen Rezension des Werkes von Friedländer nimmt Hans Tietze eine völlig entgegengesetzte Position ein und geht so weit, der Ästhetik jedwede Bedeutung für den Kunsthistoriker abzusprechen. Der junge Edgar Wind ist damals nicht der einzige, der die Ansicht vertritt, das ästhetische Urteil genüge nicht, um eine wissenschaftliche Kunstgeschichte zu konstituieren, doch ist es seiner Ansicht nach mit der bloßen Einklammerung dieses Urteils ebenfalls nicht getan.14 Tietze allerdings formuliert einen Gedanken, der bei Edgar Wind eine außerordentliche Tragweite erhalten wird: für ihn sind die Methoden der anderen Wissenschaften geeignet, die Aporien zu lösen, auf die jede zeitgenössische Reflexion kunstgeschichtlicher Verfahren stößt.15 Friedländer und Berenson erwecken bei Edgar Wind das Gefühl, ihre Disziplin mache eine Krise durch, doch kein anderes Beispiel scheint ihn so sehr berührt zu haben wie das des berühmtesten Kunsthistorikers der Zeit: Heinrich Wölfflin. Im Gegensatz zu Friedländer genießt Wölfflin in Universitätskreisen eine beachtliche Autorität. 1915 werden seine Kunstgeschichtlichen Grundhegriffe als ein Triumph der Methode begrüßt.16 Der Einfluß von Wölfflin ist um so größer, als er die Illusion vermitteln konnte, Burckhardts Traum von einer Kunstgeschichte als Kulturgeschichte erfüllt zu haben. 1931 wird Edgar Wind seine Kritik gegenüber dem Älteren wie folgt zusammenfassen: Seinem Formalismus gelinge es ebenso wie demjenigen Riegls nur, eine komplette Sicht des künstlerischen Phänomens zu liefern, indem er Inhalt und Form trenne: „Der ikonographische Inhalt ist eben durchaus verschieden von dem künstlerischen; der (auf Erweckung bestimmter Vorstellungen gerichtete) Zweck, dem der erstere dient, ist ein äußerer gleich dem Gebrauchszwecke der kunstgewerblichen und architektonischen Werke, während der eigentliche Kunstzweck lediglich darauf gerichtet ist, die Dinge in Umriß und Farbe, in Ebene oder Raum derart darzustellen, daß sie das erlösende Wohlgefallen des Beschauers erregen."17 Indem er die Antithese zwischen Form und Inhalt betont, löst der formalistische Kunsthistoriker das Problem einer Kulturgeschichte der Kunst. Von ihrem Inhalt getrennt, können die Gegenstände einen homogenen Korpus vergleichbarer Elemente bilden und sich einer in rein ästhetischen Termini gehaltenen Periodisierung der Kunstgeschichte unterwerfen. Jeder Formtyp wird zur symbolischen Form hypostasiert, die eine Periode als Produkt eines Kunstwol-
14 Nach der Publikation von Der Kunstkenner
durch Max Friedländer 1919 antwortete Hans Tietze
mit seinem „Kunstkenner und Kunsthistoriker", in: Kunstchronik
N r . 2, 10, 1919 S. 2 1 - 2 3 ; ebenda
Replik Friedländers, S. 2 3 - 2 4 ; siehe die Diskussion in Edgar Wind, Aesthetiscber schaftlicher
Gegenstand.
Ein Beitrag zur Methodologie
der Kunstgeschichte,
und
kunstwissen-
Auszug aus der Inau-
gural-Dissertation, Universität Hamburg 1922, Hamburg 1924, S. 3. 15 Waetzoldt (wie Anm. 13). 16 Heinrich Wölfflin, Kunstgeschichtliche
Grundbegriffe,
München 1915; über Wölfflin, siehe das
unlängst erschiene Werk Relire Wölfflin, hrsg. von Matthias Waschek, Paris 1995. 17 Alois Riegl, Spätrömische
Kunstindustrie
(1901), 2. Aufl., Wien 1927, S. 229.
86
II Zur Kunst
lens charakterisiert - als autonomen schöpferischen Impuls, der einer Gesellschaft zu einer gegebenen Periode eigen ist. Für Wölfflin kann das Kunstwollen in jedem Gegenstand gelesen werden - ein unfehlbares Zeichen eines künstlerischen Volksgefühls in der geringsten seiner materiellen Produktionen. Kaum waren die Grundbegriffe erschienen, schrieb Wölfflin einen Artikel für die Kunstchronik, in dem er sein methodologisches Unternehmen legitimierte und darauf hinwies, daß Burckhardt dessen Dringlichkeit vorausgeahnt hatte. Er porträtierte seinen Lehrmeister, als dieser 1879 das Londoner Victoria and Albert Museum besichtigte, und schrieb darüber in einem Brief: „Schon Winckelmann hat die Kunstentwicklung als einen gesetzmäßigen Vorgang aufgefaßt, und es ist in gleichem Geiste gedacht, wenn Jacob Burckhardt auf der Höhe seines Lebens vor der unerschöpflichen Formenwelt der Sammlungen des Kensington-Museum sich Kraft und Muße wünscht, ,die lebendigen Gesetze der Form auf möglichst klare Formeln zu bringen'. (Brief London 2. August 1879)" 18 1933 ging Wölfflin sogar noch weiter. In der neuen Ausgabe der Grundbegriffe behauptete er, in den Papieren von Burckhardt eine Erklärung gelesen zu haben, die für seine formale Geschichte zu bürgen scheint, und nach der die Kunst ihr Eigenleben, ihre eigene Geschichte hat. Wölfflin fügte geschickt hinzu, er kenne nicht genau den Sinn dieser Erklärung, doch überrasche diese bei einem Historiker, der doch dafür berühmt sei, aus der Kunst einen integrierenden Bestandteil der Geschichte gemacht zu haben.19 Wölfflins Burckhardt scheint der Evidenz einer formalen Geschichte, die plötzlich von der Autonomie der Kunst legitimiert ist, ausgewichen zu sein. Ein solcher Taschenspielertrick konnte den jungen Edgar Wind kaum beeindrucken. Er nahm an einer Vorlesung Wölfflins teil, bevor er aufgab. In der Tat kann man seine Dissertation von 1922 als eine lange Widerlegung der Wölfflinschen Theorien lesen. Ihr Titel Aesthetischer und kunstwissenschaftlicher Gegenstand. Ein Beitrag zur Methodologie der Kunstgeschichte nennt klar ihr Programm. Diese Veröffentlichung war von nachhaltiger Wirkung, wenn auch auf Umwegen: 1924 und 1925 zogen einige veröffentlichte Auszüge kaum die Aufmerksamkeit auf sich.20 Allerdings benutzte sie Winds Doktorvater, Panofsky, in großem
18 Heinrich Wölfflin, „In eigener Sache", in: Kunstchronik, Nr. 20, 13. Februar 1920, S. 397-399; zu diesem Brief siehe auch Jacob Burckhardt, Briefe, hrsg. von Max Burckhardt, Basel 1969, VII, S. 43, Brief Nr. 816 an Max Alioth, London, 1. u. 2. August 1879; Wölfflin gab vor, ein unveröffentlichtes Dokument zu entdecken, doch dieser Brief war bereits bekannt, denn er war veröffentlicht worden in Jacob Burckhardt, Briefe an einen Architekten 1870-1889,2. Aufl., München 1913. 19 Wölfflin, „Epilog", in: Grundbegriffe (wie Anm. 16). 20 Wind, Aesthetischer und kunstwissenschaftlicher Gegenstand (wie Anm. 14); ders., „Zur Systematik der künstlerischen Probleme", in: Zeitschrift für Ästhetik und Allgemeine Kunstwissenschaft, XVIII, 1925, S. 438-486; ders., „Theory of Art versus Aesthetics", in: The Philosophical Review, X X X I V , 1925, S. 350-359; ders., „Contemporary German Philosophy", in: The Journal of Philosophy, X X I I , 1925, S. 477-493, S. 516-530.
87
P. Griener: Edgar Wind und das Problem der Schule von Athen
Maße in seinem Aufsatz Das Verhältnis der Kunstgeschichte zur Kunsttheorie von 1925.21 Wind versucht - gegen die Meinung der reinen Connoisseurs - nachzuweisen, daß die Analyse der Kunstwerke nicht die Frische der ästhetischen Empfindung zerstört. Die Ausübung von connoisseurship macht die Produktion analytischer Urteile gerade notwendig. Die ästhetische Kontemplation ist durch Fülle und Intensität gekennzeichnet, doch isoliert sie das Kunstwerk und verhindert jeden Vergleich. Die Anwendung eines Urteils zwingt den Betrachter, die Sphäre der ästhetischen Kontemplation zu transzendieren und Elemente zu erfassen, die mit anderen ähnlichen verglichen werden können.22 In einem tieferen Sinne versucht Wind an die Stelle einer Kunstgeschichte, die allein dem Sinneseindruck gewidmet ist, den das Kunstwerk auf den Betrachter macht, ein Herangehen an das Werk in Begriffen der Intentionalität zu setzen. Das Werk wird damit als Vehikel einer Botschaft betrachtet; das vorherrschende Merkmal des Werkes besteht dann in seiner Art und Weise, dies auszudrücken.23 Das Ergebnis des künstlerischen Schaffensprozesses - das Kunstwerk selbst - wird als rational erklärt, insofern das Werk durch jemand anderen rationalisierbar ist. Das Werk ergibt sich aus einer durch den Künstler getroffenen Wahl zwischen verschiedenen Optionen, im Rahmen von Zwängen, die durch sein Medium, seine Werkzeuge und seine Ausdrucksmittel diktiert sind; diese Zwänge ergeben sich aus erkennbaren Gesetzen, die Wind unter der Kategorie der Kunsttheorie subsumiert. Durch dieses Herangehen knüpft Wind an Burckhardts „Kunstgeschichte nach Aufgaben" an. Für Wind impliziert jede Aufgabe des Künstlers neue ästhetische Entscheidungen in den Grenzen eines komplexen Ensembles von Determinierungen. Doch in jener Epoche faßt Wind diese Gesetze noch in Begriffen, die dem Wölfflinischen Formalismus nahestehen: in Die klassische Kunst lobte Wölfflin Raffael für eine Virtuosität, die mit den Elementen des Raumes spiele (Abb. 5).24 Allerdings war für Wölfflin dieses Spiel Selbstzweck. Als er Raffaels Schule von Athen analysiert, ist Wölfflin von der Auf-
21 Erwin Panofsky, „Über das Verhältnis der Kunstgeschichte zur Kunsttheorie. Ein Beitrag zu der Erörterung über die Möglichkeit kunstwissenschaftler und Allgemeine Grundfragen
Kunstwissenschaft,
der Kunstwissenschaft,
Grundbegriffein:
Zeitschrift für
Ästhetik
XVIII, 1925, S. 1 2 9 - 1 6 1 ; erneut in Panofsky, Aufsätze
zu
hrsg. von H . Oberer u. E . Verheyen, Berlin 1964, S. 4 9 - 7 5 .
22 Max J. Friedländer war sich allerdings dessen bewußt, daß die Fülle der ästhetischen Erfahrung den Betrachter überflutet und ihn daran hindert, auf Grund des mangelnden Abstandes sein Urteil zu bilden: doch er lehnte es ab, aus dieser Tatsache Konsequenzen zu ziehen; siehe
Erinnerungen
(wie Anm. 11), S. 17: „Wenn der Maler die Natur 'schön' findet, das dies schon darin die Ursache, daß, was er erblickt, ihm unnachahmlich erscheint, da er sich vergeblich bemüht, die Vision zu realisieren. E r bewundert, was er wiederzugeben nicht vermag, steht vor einem Reichtum, den er nicht erschöpfen kann." 23 Wind, Theory of Art (wie Anm. 20), S. 358. 2 4 Heinrich Wölfflin, Die klassische Kunst. Eine Einführung 1914, S. 9 2 - 9 3 .
in die italienische Renaissance,
München
88
II Zur
Kunst
Abb. 5. Heinrich Wölfflin, Die klassische Kunst. Eine Einführung München 1914, S. 95
in die italienische
Renaissance,
teilung des Raums in zwei Bühnen frappiert: in der Bildmitte auf der oberen Plattform erhalten Piaton und Aristoteles einen zentralen Platz, während alle anderen weniger spekulativen Wissenschaften von Figuren dargestellt werden, die über die Treppen herunterströmen. Wölfflin bringt daraufhin die Meinung zum Ausdruck, der intellektuelle Inhalt des Freskos könne ohne Zweifel eine solche Aufteilung erklären - doch wird diese Hypothese als reine Uberinterpretation sofort beiseitegeschoben. Für Wind sind die vom Künstler getroffenen Entscheidungen Mittel, die auf einen Zweck gerichtet sind. In „Theory of Art versus Aesthetics" entwickelt er den Gedanken einer konkreten Kunstgeschichte, die als Verstehen der verschiedenen Wege definiert wird, die die Künstler finden, um künstlerische Probleme zu lösen; jeder Lösungstypus ist mit einem Stil in Verbindung zu bringen.
89
P. Griener: Edgar Wind und das Problem der Schule von Athen
2. b. Das Experiment und die Metaphysik Ende der zwanziger Jahre scheint Wind mit seinem ersten Abstecher in das Gebiet der Methodologie nicht zufrieden zu sein, denn er beginnt, seinen Horizont beachtlich zu erweitern. Er versucht, dem von Hans Tietze vorgezeichneten Weg zu folgen und die Funktionsweise der Wissenschaften unabhängig von ihrem jeweiligen Gegenstand zu untersuchen. Ein solcher Entschluß ist damals originell. In den zwanziger Jahren waren Werke - wie das von Wilhelm Dilthey (besonders die Geisteswissenschaft) - noch sehr geschätzt,25 in denen eine deutlichere Unterscheidung zwischen den reinen und den Humanwissenschaften getroffen wurde, gemäß einem Prinzip, das Vico bereits im 18. Jahrhundert formuliert hatte: dem der Homologie zwischen Objekt und Subjekt der Analyse auf dem Gebiet der Humanwissenschaften, was die Wirksamkeit der Erkenntnis als Erkenntnis des Gleichen garantiert.26 Da sie außerhalb des Menschen liegen, wären die Gegenstände der exakten Wissenschaften nicht wirklich für eine exakte Erkenntnis zugänglich. Man kann leicht verstehen, weshalb solche „Wahlverwandtschaften" Winds Mißtrauen erregten: sie erinnerten ihn zu deutlich an die „unmittelbare" Erkenntnis, die bei Friedländer vom Connoisseur am Ende einer emphatischen, aber unerklärbaren Erfahrung in Anspruch genommen wurde. Winds Habilitationsschrift nimmt eine diametral entgegengesetzte Stellung ein; denn hier wird die Rolle des Experiments bei der Konstitution einer wissenschaftlichen Vorstellung genauestens untersucht.27 Wind konzentriert seine Aufmerksamkeit auf die Schlußfolgerung, deren Bedeutung von der Analyse eines Berenson fast verdunkelt wird. Seine Analyse ist wohlbekannt; er faßt sie wie folgt zusammen: „jedes Experiment enthält und erprobt eine Hypothese über das Ganze." 28 Eine Hypothese ist bereits im Experiment enthalten, das deren Gültigkeit überprüfen soll - was eine unlösbare Antinomie ist: „an art-historian who from a given work draws an inference concerning the development of its author turns into an art-connoisseur who examines the reasons for attributing this work to this particular master: and for this purpose he must presuppose the knowledge of that master's development which he just wanted to infer."29 Folglich schlägt
25 Wilhelm Dilthey war eine wichtige Referenz auf Grund seiner Arbeiten über die Renaissance und die Reformation, erneut veröffentlicht 1921: Weltanschauung Renaissance
und
Reformation.
Abhandlungen
zur
Geschichte
und Analyse der
des Menschen
Philosophie
und
seit
Religion,
2. Aufl., Leipzig, Berlin 1921. 26 Sir Isaiah Berlin, Vico and Herder, 27 Edgar Wind, Das Experiment
London 1980.
und die Metaphysik.
Zur Auflösung
der kosmologischen
Antinomien
(= Beiträge zur Philosophie und ihrer Geschichte, Band 3), Tübingen 1934; siehe auch ders., „Can the Antinomies be restated?", in: Psyche,
X I V , 1934, S. 1 7 7 - 1 7 8 , und ders., „Some Points of
Contact between History and Natural Science", in: Philosophy and History. Ernst Cassirer, hrsg. von R. Klibansky u. H . J. Paton, Oxford 1936, S. 2 5 5 - 2 6 4 . 28 Wind, Experiment
(wie Anm. 27), Vorwort S. V i l i .
29 Wind, Some points (wie Anm. 27), hier S. 256.
Essays Presented
to
90
II Zur Kunst
Wind eine totalisierende Vorstellung von jedem durch das Experiment geprüften System vor; bei ihm wird die von Kant verworfene Metaphysik „die Lehre vom unbekannten Ganzen". 30 Das wissenschaftliche Experiment vollzieht sich zufolge seiner Schrift Das Experiment und die Metaphysik nicht im Äußerlichen: „The investigator intrudes into the process that he is investigating (...) A body is needed - however much the mind may ,interpret' - which transmits the signals that are to be interpreted."31 Eine solche Sicht gibt der Ästhetik im analytischen auf das Kunstwerk gerichteten Prozeß eine wesentliche, jedoch sorgfältig begrenzte Funktion zurück. Mehr noch, der Interpret eines Werkes muß sich selbst als den Ort denken, wo das Experiment seinen Platz findet. Wind zieht aus dieser Analyse wichtige Konsequenzen: in seinem Artikel „Contemporary German Philosophy" hält er fest, daß er nicht die Position einnimmt, das im Feld der Kunst gestellte Problem zu prüfen, sondern die Linien einer möglichen Methode zu skizzieren: „By analyzing the different kinds of arts, I could show how every one of them reconciles and, therefore, decides in an different way the conflict between the material of the real world out of which the artist forms his creation, and the laws of the ideal one, which determines the meaning of his work. And by analyzing the different styles in art, I could show how every epoch decides the antinomies of the artistic values."32 Wenn sich die epistemologischen Probleme, auf die die reinen Wissenschaften treffen, nicht grundlegend von jenen unterscheiden, auf die die Künstler stoßen, dann gestattet diese Homologie einem Gelehrten, die Entscheidung eines Künstlers nachzuvollziehen, indem er sein geistiges Rüstzeug rekonstruiert. Das Experimentierfeld des Künstlers verläuft zwischen den sichtbaren Formen und den unsichtbaren Gedanken. Eine solche intellektualisierte Konzeption der künstlerischen Arbeit muß dann nur noch in eine platonische Terminologie gekleidet werden (reale Welt; ideale Welt), um Edgar Winds Leistung als Historiker der Renaissance zu bestimmen.
2. c. Die Enzyklopädie von Aby Warburg Wind schloß gerade seine Habilitationsschrift an der Universität Hamburg ab, als er Aby Warburg begegnete. Der intensive Gedankenaustausch beider, der zwischen 1927 und 1929 stattfand, ist bereits untersucht worden. Ich möchte mich auf jene Aspekte dieses Austauschs konzentrieren, die am tiefsten die späteren, Raffael gewidmeten Untersuchungen prägten. Warburg hatte ein Institut errichtet, dessen Lesesaal in elliptischer Form den Ehrgeiz zum Ausdruck brachte, die verschie30 Wind, Experiment
(wie Anm. 27), S. VIII; ders., „Experiment and Metaphysics", in: Proceedings
the Sixth International
field Brightman, N e w Y o r k 1927, S. 2 1 7 - 2 2 4 ; ders., Antinomies
(wie Anm. 27).
31 Wind, Some points (wie Anm. 27), siehe ,Teil II. The Intrusion of the Observer', S. 258. 32 Wind, Contemporary
of
Congress of Philosophy at Harvard University 1926, hrsg. von Edgar Shef-
German
Philosophy (wie Anm. 20), hier S. 529.
P. Griener: Edgar Wind und das Problem der Schule von Athen
91
Abb. 6. Ansicht vom L e s e s a a l . , K . B . W , Hamburg
denen Bereiche des Wissens über den Menschen, unter dem Aspekt seiner symbolischen und kulturellen Praktiken, miteinander zu verbinden (Abb. 6). Warburgs wenige Veröffentlichungen, sowie die beeindruckende Masse seiner Aufzeichnungen bezogen sich auf bestimmte Kunstwerke oder boten allgemeine methodische Bemerkungen in aphoristischer Form. Warburg bewunderte sehr den philosophisch-systematischen Geist Winds. Kurz nach Warburgs Tod hielt der junge Gelehrte einen Vortrag, der in einer resümierenden Weise das Denken des Verstorbenen - gewissermaßen seine Theorie - darstellte: es war der Essay „Warburgs Begriff der Kulturwissenschaft und seine Bedeutung für die Ästhetik", der in der Festung selbst, in der „K.B.W." 1930 vorgetragen und ein Jahr später veröffentlicht wurde. 33 Warburgs Denken mußte sehr attraktiv sein für einen Philosophen, bei
33 Edgar Wind, „Warburgs Begriff der Kulturwissenschaft und seine Bedeutung für die Aesthetik",
in: Vierter Kongress für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft, Beilagenheft zur Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft, Bd. 25, 1931, S. 163-179.
92
II Zur Kunst
dem die Beziehung zwischen Ideen und Formen noch sehr intellektuell war - so auch für Cassirers Diktum „Auch in der Kunst waltet nicht nur eine bloße Mimesis, aber eine echte erzeugende Funktion" 34 - oder auch für Panofsky, der zur gleichen Zeit nachwies, daß die Denker aus Antike, Mittelalter und Renaissance trotz Piatons Verdammung der Kunst dessen Philosophie ihren Zwecken angepaßt und graduell dem Künstler gestattet hatten, nach seinem eigenen Geist jene Formen zu betrachten, die den Gegenständen der sichtbaren Realität vollkommen entsprechen.35 Edgar Wind seinerseits gab zu erkennen, daß er die verschiedenen Typen von Verbindungen zwischen Bild und Bedeutung, von denen Vischer gesprochen hatte, ergründen wollte. 36 Wenn Wind auch damals noch dazu neigte, Vischers Symbol-Verständnis allzu begrifflich zu fassen, so widmete er doch dem Problem der Verbindung von Bild und Bedeutung große Aufmerksamkeit.37 Das wichtigste Beispiel, das Vischer gab und das Wind in seinem Essay über Warburg zitierte, ist das des heiligen Sakraments.38 Als Wind wenige Jahre später, 1936, zum ersten Mal Rom besuchte, muß er sich an dieses Beispiel erinnert haben: In der Stanza della Segnatura wird in der Disputa die auf dem Altar glänzende Hostie inszeniert. Gegenüber in der Schule von Athen ist es das entkörperlichte mathematische Zeichen auf der Tafel mit der Darstellung der Tetractys (der heiligen Zahl vier). Die Stanza inszeniert die zwei Grenzen des Symbolismus nach Warburg. Winds Beziehung zu Warburg hat auch noch eine andere Bedeutung hinsichtlich seiner späteren Forschungen über die Schule von Athen. Sein 1931 veröffentlichter Essay über Warburg stellt, wie gesagt, den ersten systematischen Essay über War-
34 Ernst Cassirer, „Eidos und Eidolon", in: Vorträge der Bibliothek Warburg, II, 1922-23, S. 1-27, hier S. 27. 35 Erwin Panofsky, ,Idea'. Ein Beitrag zur Begriffsgeschichte der älteren Kunsttheorie, Leipzig 1924 (Studien der Bibliothek Warburg, 5). 36 Friedrich Theodor Vischer, „Das Symbol", in: Philosophische Aufsätze. Eduard Zeller zu seinem fünfzigjährigen Doctor-)ubiläum (1887), Berlin 1962, S. 153-193; hier S. 157: „Es ensteht die Aufgabe (...), Hauptarten der Verbindung zwischen Bild und Sinn auseinanderzuhalten." 37 Edgar Wind, „Warburg's Concept of Kulturwissenschaft", in: Eloquence (wie Anm. 1), S. 21-35, hier S. 27; siehe das dt. Original (wie Anm. 33), S. 170: „...mit dem Ausdruck .Bedeutung' fist] irgend ein Begriff [gemeint], gleichviel welchem Vorstellungskreise er entnommen sein mag ( . . . ) " . Vischer war sehr zurückhaltend, es widerstrebte ihm, dieses Wort zu benutzen, er sprach lieber von „Inhalt", was wesentlich neutraler ist (wie Anm. 36, hier S. 154): „etwas Zweites, Gedachtes (in unbestimmt weitem Sinne dieses Wortes [Hervorhebung von mir] der Kürze wegen heiße es vorerst nur allgemein Inhalt oder Sinn)." 38 Vischer, Das Symbol (wie Anm. 36); hier S. 158f.: „Ursprünglich lag nur vor: Brechen und Ausgiessen des Brods und Weins das Bild, Märtyrertod am Kreuze der Sinn, an den man denken soll; jetzt handelt es sich um Aneignung der Wirkung des Opfertodes, der Sündenvergebung, und hiermit fällt der Accent auf Essen und Trinken. Denn dies ist allerdings ein passendes Symbol für Aneignung, da Speise und Trank durch Essen und Trinken dem Körper wirklich ganz angeeignet, in dessen Saft und Blut verwandelt wird."
P. Griener: Edgar Wind und das Problem der Schule von Athen
93
burgs Konzept von Kulturwissenschaft dar.39 Später bezog sich Wind auf diesen Essay und erklärte: „I tried to put Warburg's basic ideas into a systematic order which I had learned from him in long conversations."40 Dies besagt, daß Warburgs Ideen als System vorgeführt werden, als System von Ideen, das dem Schüler im Laufe gelehrter Gespräche weitergegeben wurde, also nicht in schriftlicher, sondern in mündlicher Form. Die Aufgabe des Schülers besteht darin, diese freien und inspirierenden Dialoge in Form linearer Argumente schriftlich niederzulegen.41 Das war außerordentlich schwierig, denn das Denken Warburgs schien sich jeder linearen Synthese zu entziehen; jedes Bild, das in eine Geflecht von Beziehungen eingeordnet war, erforderte eine Methode, die der Dichte dieses Geflechts gerecht werden mußte. Es ist bezeichnend, daß Warburg erst verschiedene Modelle getestet hat, die eher als die Schrift diese Zusammenhänge treffend bezeichnen könnten: der berühmte Atlas, aber mehr noch die K.B.W, selbst. Warburg entschied persönlich über die Aufstellung seiner Bücher; Cassirer betonte, daß „es sich hier nicht um eine bloße Sammlung von Büchern, sondern um eine Sammlung von Problemen handle." 42 Warburgs wichtigstes Vermächtnis besteht doch in einem Raum, der versucht, eine enzyklopädische Repäsentation der vergangenen Kulturen zu geben.43 Edgar Wind war für diese Seite von Warburgs Erbe sehr aufgeschlossen: In einer 1935 verfaßten kurzen Einführung zum Gebrauch der Bibliothek ist der Begriff des Zugriffs („... a reference library, the readers having open access to the shelves"), sowie der der visual connection („To make interconnections easily visible") hervorgehoben.44 Und dieser Raum wird einer Gemeinschaft von Gelehr-
3 9 D e r Aufsatz von Erwin Panofsky, „Zum Problem der Beschreibung und Inhaltsdeutung von Werken der bildenden Kunst", in: Logos, 21, 1932, S. 1 0 3 - 1 1 9 , erscheint in der Tat erst ein Jahr später. 40 Buschendorf, War ein sehr tüchtiges gegenseitiges 41
Fördern
(wie Anm. 1), hier S. 183.
Siehe auch den Brief von Aby Warburg an Edgar Wind, Rom, Palace Hotel, 2 8 . 1 2 . 1 9 2 8 , (Warburg Institute Archiv, London): „Ich will das Jahr 1928 nicht in den Aktenschrank der Ewigkeit gelegt wissen, ohne Ihnen und Ihrer lieben Frau zu sagen, daß ich Ihren Eintritt in den engeren Kreis derer, für die K. B. W . ein wirkliches Lebenselement bedeutet, zu den wirklich guten Gaben eines Schicksals rechne, das es mit mir ernst meint."
42
Ernst Cassirer, „Der Begriff der symbolischen F o r m im Aufbau der Geisteswissenschaften", in: Vorträge der Bibliothek
Warburg,
1, 1 9 2 1 - 2 2 , S. 1 1 - 3 6 ; hier S . l l .
43 Sein Interesse für die Enzyklopädie fand rasch ein Echo, z. B. bei Adolph Goldschmidt, „Frühmittelalterliche illustrierte Enzyklopädien", in: Vorträge
der Bibliothek
Warburg,
III, 1923-1924,
S. 2 1 5 - 2 2 6 . 44 Edgar Wind, „The Warburg Institute Classification Scheme", in: The Library Association
Record,
II, 1935 S. 1 9 3 - 1 9 5 ; hier S. 193; über die Bibliothek von Warburg siehe René Drommert, „Aby Warburg und die kulturwissenschaftliche Bibliothek in der Heilwigstrasse", in: Aby M. „Ekstatische
Nymphe...
trauernder
Flußgott".
Porträt eines Gelehrten,
Brita Reimers, Hamburg 1995, S. 1 4 - 2 3 ; Tilmann von Stockhausen, Die Bibliothek
Warburg.
Architektur,
Einrichtung
und Organisation,
Warburg.
hrsg. von Robert Galitz u. kulturwissenschaftliche
Hamburg 1992; Salvatore Settis,
„Warburg continuatus. Descrizione di una biblioteca", in: Quaderni
Storici, n. s. 58, 1985, S. 5ff.
94
II Zur
Kunst
ten hinterlassen, die auf verschiedenen, doch voneinander abhängigen Gebieten arbeiten und in beständigem Dialog stehen. Das wichtigste Organ des Instituts nennt sich denn auch nicht Schriften, sondern Vorträge, als solle damit die mündliche Dimension des Austausche betont werden. Wir werden sehen, daß diese Unterscheidung, die von Edgar Wind erweitert wird, einen ebenso bedeutenden Platz in seinem Werk einnehmen wird wie die Idee der Enzyklopädie. Der Versuch über Warburg ist keine neutrale Synthese. Wind ergriff die Gelegenheit, seine eigene Position in einem Gelehrtenstreit zu definieren, so wie er es in „Contemporary German Philosophy" tat: „I wish to separate those thoughts and ideas which fulfill a productive function for the present generation (...) such a separation involves a specific standpoint". 45 Winds Arbeit in der Bibliothek Warburg gestattete ihm, die Bedingungen der wissenschaftlichen Erfahrung zu umschreiben. Die Enzyklopädie, die die Schule von Athen an Beispielen erläutern wird, wird für ihn zu einem Gegenstand besonderen Interesses - zum Anwendungsfeld der bereits in Das Experiment und die Metaphysik formulierten Hypothesen: „Within that specialized field of cultural history and psychology which is circumscribed by the 'Survival of the Classics', the Library endeavours to be encyclopaedic; i. e. it interconnects such seemingly independent subjects as the history of art, of science, of superstition, of literature, of religion, etc." 4 6 Der erste Entwurf des Essays über Warburg verrät, welcher Natur die Besorgnis Edgar Winds ist: Er enthält lange Absätze, in denen die formalistische Kunstgeschichte, die Ästhetik Wölfflins ständig widerlegt wird. In der Auseinandersetzung mit Wölfflin hat Wind entdeckt, daß eine rein ästhetische Analyse, die den symbolischen Inhalt eines visuellen Werkes vernachlässigt, zum Scheitern verurteilt ist. Doch Wind entdeckt auch, daß Warburg Werken von großer ästhetischer Qualität bewußt ausgewichen ist: „Weil an den Bruchstellen, die das schlechte Werk gewissermaßen vor dem guten voraus hatte, das Problem der Auseinandersetzung, mit dem der Künstler zu ringen hatte, deutlich wurde, - ein Problem, dessen komplizierte Struktur man angesichts eines großen Kunstwerkes viel schwerer bemerkt, weil hier der Künstler die Lösung so spielend bewältigt. [...] Wer nur von den großen Erscheinungen in der Kunst ausgeht, [...] an Lionardo, Raffael [...], wo die stärksten Gegensätze ihren höchsten Ausgleich gefunden haben, herantritt und sie ästhetisch genießt, d. h. in einer Stimmung, die selbst nur ein momentaner harmonischer Ausgleich von Gegensätzen ist, der wird glückliche Stunden verbringen,
45 Wind, Contemporary German Philosophy (wie Anm. 20), hier S. 477. 46 Wind, The Warburg Institute Classification Scheme (wie Anm. 44); dieses Element wird hervorgehoben von Cassirer in Der Begriff der symbolischen Formen (wie Anm. 42, hier S. 11): „Denn hier waren die Kunstgeschichte, die Religions- und Mythengeschichte, die Sprach- und Kulturgeschichte offenbar nicht nur nebeneinandergestellt, sondern sie waren aufeinander und auf einen gemeinsamen ideellen Mittelpunkt bezogen. / Diese Beziehung selbst scheint freilich auf den ersten Blick rein geschichtlicher Art zu sein: es ist das Problem vom Nachleben der Antike [...]"
P. Griener: Edgar Wind und das Problem der Schule von Athen
95
aber in die begriffliche Erkenntnis vom Wesen der Kunst, die ja die Aufgabe der Ästhetik ist, wird er nicht eindringen."47 Sich mit Raffael auseinanderzusetzen bedeutet für Wind auch, zu Werken zurückkehren, deren außerordentliche ästhetische Qualität nicht mehr als Hindernis, sondern als wesentlicher Bestandteil begriffen wird, dem die gesamte Analyse gerecht werden muß. Doch der stärkste Einfluß Warburgs auf Wind bemißt sich an dessen Vertiefung des Rapports zwischen der Ausdrucksweise des Bildes und jener von Texten. Dieser Einfluß wird nach und nach spürbar. 1936 reist Wind nach Rom und betrachtet die Fresken der Stanza della Segnatura zum ersten Mal. Zwei Jahre später ist er davon überzeugt, die Mittel zu deren Verständnis gefunden zu haben: In seinem Antrag für das Guggenheimstipendium erinnert er sich 1950: „My first plans for a book on Raphael's School of Athens go back to the year 1938, when I discovered that it was possible to identify the humanist advisers who had assisted Raphael in composing the program of this painting."48 Etwas weiter unten bezeichnet derselbe Text die Schule von Athen als „beredte Illustrierung" der Schriften Pico della Mirándolas und seiner beiden Neffen. Eine oberflächliche Lektüre des Antrags von 1950 könnte glauben machen, das Fresko Raffaels würde nur einen bereits existierenden philosophischen Text illustrieren. Zwei Indizien widerlegen diese Hypothese. Zum einen erfaßt Wind im Werk von Pico den in Vollendung auflebenden Versuch, ein enzyklopädisches System hervorzubringen, in dem sich das gesamte Wissen darstellt. Eben diese Enzyklopädie, die Warburg geduldig zu rekonstruieren versuchte, indem er die Bücher seiner Bibliothek neu ordnete, sieht Wind sowohl in der Schule von Athen und als im Werk Pico della Mirandola thematisiert. Die Aufgabe des Historikers besteht also nicht darin, das authentische „Text-Programm" eines Freskos wiederzufinden, sondern einen Subtext zu konstruieren, der geeignet ist, das Geheimnis des Freskos zu erhellen. Zum andern ist das Verhältnis zwischen Text und Fresko äußerst subtil: das Fresko entsteht nicht bloß nur nach dem philosophischen Text, sondern unterhält auch eine dialektische Beziehung zu ihm: es evoziert „a whole region of Renaissance Philosophy, practically unexplored", (Guggenheim, 1950) und spielt also eine aktive Rolle beim Aufbau des enzyklopädischen Wissens - im Rahmen der schon erwähnten „Einbildungskraft". Die Dialektik zwischen Verstand und Einbildungskraft ist also in ein offenbar ungewöhnliches Exemplum gekleidet. Wind wird gerade die Quelle des Programms neu definieren, um sorgfältig die Falle einer vereinfachenden Analyse des Text-Bild-Verhältnisses zu vermeiden. Wir sahen, daß die analytische Praxis eines Bellori viel dem Dogma des ut pictura poesis schuldete. Dieses Dogma, das Lessing bereits 1766 im Laokoon angeprangert hatte,
47 Wind, Warburgs Begriff (wie Anm. 33), hier S. 178f. 48 Edgar Wind, „Plan for Work", maschinengeschriebener Text, Bewerbungsunterlagen für das Guggenheim-Stipendium, 1950, Edgar Wind Archiv, Oxford.
96
II Zur Kunst
prägte weiterhin zahlreiche Texte der Kunstgeschichte. 49 Die meisten der großen dekorativen Renaissancezyklen wurden als Illustration schriftlich fixierter Programme betrachtet, von denen man allerdings fast jede Spur verloren hatte. Wind versuchte diese Frage mit Hilfe einer basalen Unterscheidung zu lösen. Er stellte nämlich fest, daß von solchen Programmen nichts erhalten ist, weil sie niemals existierten; die Unterscheidung besteht in der Annahme einer grundlegenden Differenz zwischen mündlichem und schriftlichem Diskurs. Sie begegnet uns sowohl in den Raffael gewidmeten Manuskripten, als auch in einem frühen Entwurf der Pagan Mysteries. Diese Unterscheidung gestattet es, das Problem der genauen Beziehung zwischen den Fresken und der Ordnung der Texte zu lösen: „Nur zweitrangige Künstler mit literarischen Ambitionen haben die eigenen Programme in schriftlicher Form verdoppelt. [...] Das einzige ausführlich beschriebene Programm im 15. Jahrhundert findet sich in dem Vertrag für ein Gemälde von Perugino, das sich als Mißerfolg erwies." 50 Durch das Wort, nicht durch die Schrift werden die großen Renaissancekünstler in das Wissen eingeführt. Raffael selbst gelangte zum „royal road to knowledge through learned dialogue". 51 Als hochentwickelte Form des Gebrauchs von Sprache bleibt das Gespräch das pädagogische Instrument par excellence der platonischen Philosophie: als nichtlineare Form des Diskurses bereitet er besser auf Umsetzung in die figurative Darstellung vor. Die Freiheit des Dialogs gestattet zwei Menschen, die verschiedensten Assoziationen zwischen Elementen der Erkenntnis - und besonders der enzyplopädischen Bezüge - zu erforschen; der Dialog ist eine Leistung, die immer aufs neue die Kompetenz des Gelehrten ins Spiel bringt. Die paradoxe Aufgabe des Historikers besteht darin, diese mündliche Dimension einer vergangenen Kultur zurückzugewinnen, „of recapturing the substance of past conversations" 52 , die per definitionem verschwunden ist. Diese Substanz sucht Wind in den humanistischen Epistolaria: der gedruckte Brief der Renaissance wird also als genauer Ersatz des gesprochenen Wortes interpretiert. Aus der Perspektive seiner eigenen Bedürfnisse schließt sich Wind voll einem humanistischen Topos an, nämlich der Auffassung des Briefs als sermo absentis in absentem: „In dieser Beziehung sind die epistolaria der Renaissance so beredt wie die des 18. Jahrhunderts." 53 Man muß diese Tatsache 49 Nikiaus Rudolf Schweizer, The Ut Pittura Poesis Controversy in Eighteenth Century England and Germany, Bern 1972; Hubertus Kohle, Ut Pictura poesis non erit: Denis Diderots Kunstbegriff, Hildesheim 1989; R. W . Lee, „Ut Pictura Poesis. The Humanistic Theory of Painting", in: The Art Bulletin, XXII, 1940, S. 197-269. 50 Edgar Wind, „Picture and Text", früher Entwurf einer Einführung in Pagan Mysteries in the Renaissance (1958), Edgar Wind Archiv, Oxford; im vorliegenden Band S. 259-262, hier S. 260. 51 Edgar Wind, Pagan Mysteries, London 1958, S. 14; dt. Ausgabe Mysterien (wie Anm. 1), S. 25: „[der Renaissancemaler benutzte] im gelehrten Dialog den Königsweg zum Wissen [...]" 52 Ebenda S. 15; bzw. S. 25 der dt. Ausgabe: „Der Prozeß der Rekonstruktion des Gehalts vergangener Gespräche ist notwendig komplizierter als die Gespräche selbst." 53 Edgar Wind, Picture and Text (wie Anm. 50), in diesem Band S. 261; Angelo Poliziano, Angeli Politiani, et aliorum virorum illustrium, Epistolarum libri duodecim, Basel 1522.
P. Griener: Edgar Wind und das Problem
der Schule von Athen
97
betonen: bei Wind selbst spielte das Mündliche eine fundamentale Rolle nicht mehr in der Schaffung, sondern in der Analyse des Kunstwerks. Man kennt die außerordentliche Popularität seiner Vorträge beim Publikum. Was weniger bekannt ist, ist die schmerzhafte Trennung, die bei ihm zwischen mündlichem und schriftlichem Ausdruck existiert. Er hielt seine Vorträge völlig frei und ohne irgendeine Notiz. In spielerischer Konzentration verknüpfte sein Geist und das Feuer seiner Worte die verschiedenen Elemente seiner Interpretation. Für Wind ist der Geist des Gelehrten sowohl in den exakten als auch in den Humanwissenschaften das eigentliche Laboratorium, wo das wissenschaftliche Experiment seinen Platz findet. Die mündliche Darlegung gestattet es, die Beziehungen zwischen den Ideen permanent neu zu knüpfen, ganz wie ein Spinnennetz, das ständig neu begonnen wird. Die Arbeit der Schrift dagegen ist gewissermaßen erstarrt; sie zwingt Wind eine ungeheuerliche Mühsal auf: „Lecturing and writing have become two entirely separate processes in my work, so that the preparation of these lectures for publication will begin only after I have delivered them."54 Das wichtige Zeugnis von Austin Gill läßt darüber keinen Zweifel: „there is nobility in keeping the mind free to formulate anew. Edgar [Wind] was concerned with links, finding them. An idea became dead for the one who discovered it when he writes it down. It was the exercise of the mind above all that preoccupied Edgar [Wind], not its codification."55 Als Wind 1937 und 1938 beginnt, seine ersten Essays über die Stanza della Segnatura zu veröffentlichen, ist in seinen Augen die Schule von Athen das vollkommene Modell des Gegenstandes der Kulturwissenschaft geworden.56 Das Bild thematisiert selbst die enzyklopädische Verknüpfung des Wissens, es liefert bereits eine Vorstellung davon. Raffael läßt seine Zeitgenossen an einer in der Antike belegten Szene teilnehmen; die Zivilisation der italienischen Renaissance bietet sich also in einem Theater dar, das sie sich gewählt hat - sie kann als Gestalt betrachtete werden, wo eine historische Wirklichkeit in einem vollständigen Synchronismus erfaßt wird. Außerdem zelebriert das Bild eine mündliche Uberlieferung des enzyklopädischen Wissens, bei dem der Dialog einen zentralen Platz einnimmt. 54 Raphael Papers, Edgar W i n d A r c h i v , O x f o r d , Schachtel 1 : 1 8 . Juni 1947, Brief v o n Ralph M. Blake, K o m i t e e der C o l v e r Lectures, B r o w n University, Rhodes Islands an Edgar Wind, w o r i n er eingeladen wird, eine Reihe v o n drei Vorlesungen über Die Schule von Athen zu halten. Er bittet u m das Manuskript der Vorlesungen; siehe den A n t w o r t b r i e f v o n Edgar W i n d an Ralph M. Blake
MO55 Siehe die wichtigen Aufzeichnungen v o n Margaret W i n d nach einem Essen mit Austin Gill, einem großen Freund Edgar Winds, O x f o r d , 24. M ä r z 1976: „ W e spoke about Edgar's extravagance with his learning, h o w he was so cavalier in the w a y he did not write d o w n what he knew. Austin claims there is nobility in keeping the mind free to formulate anew. Edgar was concerned with links, finding them. A n idea became dead f o r the o n e w h o discovered it when he writes it d o w n . It was the exercise of the mind above all that preoccupied Edgar, not its codification." Ich danke Frau Margaret W i n d f ü r die Freundlichkeit, mir dieses D o k u m e n t zur Verfügung zu stellen. 56 W i n d , The four elements (wie A n m . 7); ders., Platonic Justice (wie A n m . 7).
98
II Zur Kunst
Nachdem die Hypothese eines programmatischen Textes des Bildes verworfen ist, versucht Wind nachzuweisen, wie das von Inhalten gesättigte Renaissancebild diese Inhalte vor dem Zuschauer gemäß seiner eigenen Logik entfaltet. Auch in dieser Hinsicht schien ihm die Stanza della Segnatura ein ideales Modell für diese Funktion im 16. Jahrhundert zu liefern. Die zwei ersten Interpretationsversuche, die er dem Zyklus widmet, erscheinen im Journal of the Warburg Institute 1937 und 1938. Es lohnt sich zu betrachten, wie Wind die Dynamik begreift, die die Interpretation der Fresken der Stanza della Segnatura leitet. Das erste movens reizt den Zuschauer an, nach der Bedeutung dessen zu suchen, was er betrachtet - das Gemälde scheint auf den ersten Blick mehr zu sagen, als es zeigt. Die schrittweise Erschließung der Bedeutung erhöht und bringt den Verstehensprozeß in Gang. Die Kraft des Bildes liegt darin, daß sie Gedanken Gestalt gibt, sie ordnet und sich so dem Geist aufzwingt. Ein zweites movens entdeckt Wind in der Struktur selbst eines so dekorativen Programms wie dem der Stanza della Segnatura. Die Lesung der Wand- und Deckenfresken setzt im vorgegebenen Raum durch ein Spiel von Entsprechungen und Kontrasten alles miteinander in Beziehung. Die zwei dominierenden Darstellungen, die Disputa und die Schule von Athen, können nur in Bezug auf einander, in einem Hin und Her des Blicks, verstanden werden; die Verknüpfung ihrer Bedeutungen ist räumlich. Das dritte von Wind definierte movens bringt erneut die Entfaltung der Bedeutungen ins Spiel, wenn diese von der Analyse ausgeschöpft zu sein scheinen: Wind entleiht der romantischen Ästhetik genauer Jean Paul - den Begriff des Witzes und überträgt so die Bedeutung des gesamten Zyklus auf die Ebene der Ironie. 57 All diese Antriebskräfte halten die Dynamik einer Lesart ingang. Winds Analyse läßt die symbolischen Formen in fast strukturaler Weise funktionieren, eben weil der Gelehrte die vollkommene Kohärenz des Zyklus postuliert. Der Beweis dafür ist, daß er die heute allgemein akzeptierte Annahme verwirft, die Decke wäre partiell das Werk eines anderen - nach Winds Auffassung ist das Ganze von einem einzigen Mann gedacht und zeigt eine vollkommene Homogenität. Ein solches Herangehen ist metaphysisch in dem von Wind im Experiment und die Metaphysik definierten Sinn: es postuliert die Kohärenz einer Totalität, die es noch nicht kennt. Wie Bernhard Buschendorf zu Recht betont hat, verrät Edgar Wind hier einen Klassizismus (der fast wölfflinisch ist): ein großer Künstler ist der, der in seinem Werk die vollständigste Lösung der Spannungen seines Jahrhunderts anbietet. 58
57 Wind führt den Begriff des „Witzes" 1938 ein in Homo Piatonis (wie Anm. 56), S. 261; E. W. besaß Jean Paul's sämmtliche Werke in der 33-bändigen Reimer-Ausgabe (Berlin 1840—42); hier Bd. 18, Vorschule der Ästhetik, § 50: „Doppelzweig des bildlichen Witzes." - Ich fand in der Ausgabe in Winds Besitz bei Seite 214 ein Lesezeichen. 58 Siehe Buschendorf, Einige Motive im Denken Edgar Winds (wie A n m . l ) , S. 396-415.
P. Griener: Edgar Wind und das Problem der Schule von Athen
99
3. „Die Schule v o n A t h e n " als ethisches Modell des Gelehrten Die Studie über die Schule von Athen hatte in den Augen von Edgar Wind noch eine andere Dimension - und zwar eine rein ethische. Zwei Episoden veranschaulichen diese Tatsache bestens. Im Herbst 1942 wird Wind zum Professor für Kunstgeschichte an der Universität von Chicago ernannt. Zu diesem Zeitpunkt skizziert deren Präsident, Robert Maynard Hutchins, seine radikale Reform der Fakultäten und fordert die Professoren auf, die Grenzen zwischen ihren Disziplinen zu erkunden. Ein Sonderkomitee wird zu diesem Zwecke geschaffen, das Executive Committee on Social Thought. Wind schließt sich ihm mit Begeisterung an. 59 „My interest lay in giving monographic courses which would bring the student face to face with a few great objects and a few great men. I gave a course on Michelangelo, a course on Raphael, [...]." 6 0 Allerdings stößt der Gedanke auf heftigen Widerstand: sofort bildet sich ein Lager von Traditionalisten, dessen Mitglieder um die Integrität ihrer eigenen Disziplin fürchten. Geführt von einem Spezialisten für mittelalterliche Philosophie, Richard McKeon, versuchen sie sogar, das ganze Programm scheitern zu lassen.61 1943 unterbreitet Edgar Wind einen Forschungsplan, das Muster eines interdisziplinären Projektes, das er ,Encyclopaedic studies' nennt. Er lädt einen Kreis von Gelehrten - zumeist Freunde - ein, gemeinsam über die enzyklopädische Praxis zu reflektieren, die in verschiedenen Perioden der Geschichte zu beobachten war, und zwar unter dem Aspekt ihrer unterschiedlichen Sicht der Wissenszusammenhänge. Insbesondere das Studium der Renaissance müsse als Gegengift gegen die moderne Einteilung der Wissenschaften in Fächer wirken: „It is only with the excessive growth of departmentalism in scholarship that the courage to pursue the encyclopaedic ideal abated and the ideal itself became suspect and was finally discarded as „unscientific". (...) It is necessary to revive the knowledge of those intellectual procedures, too willingly abandoned in
59
„However, it was soon discovered that my method of approach was apt to cut through départemental boundaries, and before I knew it I was regarded as a dangerous man - ,a menace* was the official designation — and publicly branded an obscurantist." (Bericht von Edgar Wind an Fritz Saxl über die Jahre 1939-45, Warburg Institute Archiv, London, 1945; Kopie im Edgar Wind Archiv, Oxford; siehe The
University
of Chicago.
The Committee
on Social
Thought,
gleiches
Datum, eine Darstellung der Hauptthesen des Komitees 1942—43, Edgar Wind Archiv, Oxford. 60 Bericht an Fritz Saxl (wie Anm. 59), S. 4. 61 Siehe Fortune,
Dezember 1937, über die Universität von Chicago; dort wird die Kontroverse zwi-
schen Richard McKeon und Robert Maynard Hutchins beschrieben. Dabei schätzte Edgar Wind Richard McKeon 1931 als Gelehrten, siehe seinen Brief an E. Panofsky, 24. Oktober 1931 (Warburg Institute Archiv, London): „McKeon (Columbia) ist einer der Jungen', ein Schüler von Gilson, der mittelalterliche Philosophie liest, was ihn nicht gehindert hat, ein ausgezeichnetes Buch über Spinoza zu schreiben. E r ist von den jüngeren Leuten an der Columbia University sicher der interessanteste."
100
II Zur Kunst
recent years, which have produced encyclopaedic results in the past." 62 Der Enzyklopädismus liefert dem Gelehrten ein epistemologisches Modell, das in der Zusammenarbeit von Kollegen verschiedener Disziplinen seinen ethischen Niederschlag findet. Um diesem Streben mehr Nachdruck zu verleihen, unterbreitet Wind sein Projekt sogar den Herausgebern der Encyclopedia Britannica Mto bring out the importance of the interrelationships between all branches of knowledge and to emphasize the unity of learning and scholarship as a whole." 63 Insbesondere sollte eine monographische, historische Betrachtungsweise die Analyse des Zusammenhangs der Ideen in jedem System der Vergangenheit fördern. Wind selbst gedenkt, die Studien zum Enzyklopädismus der Renaissance zu übernehmen. Während dieser Zeit hält er viele Vorträge über die Schule von Athen von Raffael - als wolle er sich auf diese Aufgabe vorbereiten.64 Das Projekt wird nicht verwirklicht - die Fakultät der Humanwissenschaften, die überrumpelt war, rächt sich, indem sie Edgar Wind und seinen Kollegen Middeldorf zwingt, „a course on the Interpretation of Content" in der Kunst zu leiten, beziehungsweise den Parallelkurs, der „the Formal Interpretation of Art". 65 Eine solche Trennung zwischen Form und Inhalt kommt einem Verhöhnung der Arbeit Edgar Winds gleich; der Widerstand, auf den er im Komitee stößt, veranlaßt ihn schließlich dazu, Chicago zu verlassen und ans Smith College nach Northampton zu gehen. Daß diese Frage der Enzyklopädie in Winds Augen eine entscheidende Bedeutung hatte, ist offensichtlich; und seine Studie zum Raffael-Zyklus ist großenteils durch dieses Faktum zu erklären. Ein zweiter Konflikt, der Wind im Gegensatz zum Warburg Institute bringen wird, entsteht aus unvereinbaren Auffassungen der Enzyklopädie als warburgsches Projekt. Offiziell blieb Wind Mitglied des Warburg Institute, auch wenn die Kriegsereignisse ihn zwangen, in den USA zu bleiben. 1945 unternimmt Fritz Saxl, der damalige Direktor des Warburg, eine Geld-
62
Edgar Wind, Memorandum
on Encyclopaedic
Studies to be edited by the Committee on Social
Thought, [1943], Edgar Wind Archiv, S. 1. 63
Brief von John U . Nef, Executive Committee on Social Thought, Chicago, 19. Juli 1943, an William Benton, Vice-President Office, Faculty Exchange, S. 1 (Kopie, Edgar Wind Archiv, Oxford).
64 vgl. The 1943-44,
University
of Chicago.
Announcements.
The
College
and
the Divisions.
Sessions
of
Bd. X L I I I , 10. August 1943, Nr. 10, S. 147, n° 272: Edgar Wind, Vorlesung über „Raf-
fael" (Win T u Th 3 - 5 ) ; im darauffolgenden Jahr gibt Edgar Wind fünf Vorlesungen über die Beziehungen zwischen Kunst und Philosophie der Renaissance an der Universität Chicago, unter der Schirmherrschaft des Committee of Social Thought, Program Thought,
of Studies. The Committee
1 9 4 4 - 4 5 . The University of Chicago. Siehe auch The University of Chicago.
ments. The College and the Divisions. Sessions of 1944-45
on Social Announce-
Bd. X L I V , 15. Mai 1944, N r 8, S. 127,
n ° 2 7 2 A: E. W., Vorlesung über „Raphael and Michelangelo." (Spr Tu 3 and Th 3 - 5 ) (Edgar Wind Archiv, Oxford). 65 Supplementary chins-McKeon.
Report,
1944, to the University of Chicago,
betrifft die Auseinandersetzung Hut-
P. Griener: Edgar Wind und dasd Problem der Schule von Athen
101
beschaffungskampagne in den USA, um Mittel für ein großes Encyclopaedia-Projekt einzuwerben. Edgar Wind wird erst in letzter Minute von der Ankunft seines Kollegen informiert und kann ihm also nicht helfen; dabei hat Wind gute Beziehungen zu den amerikanischen Intellektuellenkreisen, da er selbst 1939/40 erfolgreich eine Unterstützungskampagne für das Institut initiiert hatte. Zu jener Zeit hatten die Library of Congress, die National Gallery of Art und die Dumbarton Oaks Research Library sogar offiziell die Mitglieder des Warburg Institute für die Dauer des Krieges eingeladen. Saxls Kampagne hat keinerlei Erfolg. Vor allem kann das Forschungsprojekt, für das er Gelder einwerben möchte, nicht die Zustimmung von Edgar Wind finden.66 Es geht darum, ein großes ikonographisches Lexikon zu erarbeiten, ein wissenschaftlich fundiertes Inventar, das in alphabetischer Ordnung die wichtigsten symbolischen Bilder des Abendlandes seit der Antike aufschlüsselt.67 Dieses Nachschlagewerk impliziert eine lexikographische Haltung gegenüber einem toten Material, das inventarisiert und denkbar willkürlich, nämlich alphabetisch konsultiert werden kann. Für Saxl genügt es, die Bildwerke der Vergangenheit zu inventarisieren, indem er ihren Ursprung nachzeichnet. Wind erklärt, daß er nicht daran denkt, das Projekt zu unterstützen, denn : „Being averse to the type of historical thinking which traces a motif à travers les âges and ends by becoming lost in the mazes of its own relativism".68 Für Wind ist die alphabetische Anordnung anorganisch, sie fragmentiert die Erkenntnis in Stücke von nur trügerischem Sinngehalt. Das Studium der Bilder ist nur in enzyklopädischem Zusammenhang zu erfassen, der niemals linear ist, sondern ihnen einen reichen mehrdeutigen Sinn gibt; die in der Schule von Athen verkörperten Symbole können nicht aus der Totalität losgelöst werden, der sie unterworfen sind. Man muß diese Funktionsweise nachspielen und durch Erfahrung selbst den Dialog zwischen den Wissenschaften in der modernen Welt neu lernen. - Der Bruch mit dem Warburg ist endgültig. Wind setzt seine Raffael-Forschung allein fort: die Schule von Athen wird für Wind die vollendetste Metapher seiner eigenen Ambition im warburgischen Sinne bleiben. Als er 1954 die Chichele Lectures im All Souls College gibt, räumt er diesem Thema eine quasi programmatische Bedeutung ein; vom Erfolg seiner Vorlesung hängt in der Tat die Schaffung eines Lehrstuhls für Kunstgeschichte an der Universität Oxford ab.
66 Siehe den Brief Edgar Winds an Gertrud Bing, Northampton-Massachusetts, 15. Juni 1945; Brief Edgar Winds an Edna Purdie, Chairman of the committee, Warburg Institute, Northampton Massachusetts, 11. Dezember 1945 (Edgar Wind Archiv, Oxford). 67 Siehe F. Saxl, „Illustrated Medieval Encyclopedias. 1. The Classical Heritage. 2. The Christian Transformation", in: Lectures,
I, S. 2 2 8 - 2 5 4 ; siehe den Brief von E.R. Curtius an Gertrud Bing,
Miirren, 28. August 1938, in: Kosmopolis tute. Briefe und andere
Dokumente,
der Wissenschaft.
E.R. Curtius
und das Warburg
Insti-
hrsg. von Dieter Wuttke, Baden-Baden 1989 (Saecula Spiritu-
alia 20), S. 1 3 0 - 1 3 1 . 68 Edgar Wind an Fritz Saxl (wie Anm. 59).
102
II Zur Kunst
Abb. 7. Illustrationen gewählt von Edgar Wind für j4ri and Anarchy, London: Faber & Faber, 1963, Kapitel IV (The Fear of Knowledge): Raffaels ,Schule von Athen'. (Edgar Wind Archiv, Oxford)
1963 schließlich wird die Schule von Athen als figura zum letzten Mal in einem von Edgar Wind publizierten Text abgebildet - in Art and Anarchy.69 Hier bietet das Fresko ein Beispiel, und zwar nicht mehr dem Gelehrten, sondern dem modernen Künstler: es trägt dazu bei, den Mythos vom romantischen Künstler, vom einsamen Genie zu zerstören, den kein Zwang - Auftrag, festes Programm, Bedingungen - entfremden könnte. 70 Wind ruft zu einem neuen Bündnis zwischen dem Inhaber des Wissens und dem Künstler des Bildes auf; die Schule von Athen bewies die vollkommene Ungezwungenheit eines Künstlers, der dennoch vor eine genaue Aufgabe gestellt worden war, der er sich unterwerfen mußte. (Abb. 7) Als Bewahrer eines Wissens hat der Künstler aktiven Anteil an dem Aufbau der wissenschaftlichen Vorstellung von Wirklichkeit; dieser Erfolg steht im Gegensatz zu Fami-
69 Edgar Wind, Art and Anarchy (The Reith Lectures 1960, revised and enlarged), London 1963, Kapitel IV (The Fear of Knowledge). 70 Uber die Merkmale dieses Mythos' und ihrer realen Entsprechung siehe das wichtige Werk von Oskar Bätschmann, Ausstellungskünstler. Kult und Karriere im modernen Kunstsystem, Köln 1997.
P. Griener: Edgar Wind und dasd Problem der Schule von Athen
103
Abb. 8. Illustration gewählt von Edgar Wind für Art and Anarchy: Paul Klee, Familiäres. (Copyright Mrs Jane Wade, New York)
liäres von Paul Klee, eine Zeichnung, die eine mikroskopische Kenntnis der Wirklichkeit verrät, jedoch in der Wissenschaft nur den Ausgangspunkt für eine von der Welt gelöste freie Phantasie findet. (Abb. 8) In der Geschichte der postwarburgschen Kultur haben also Edgar Wind und besonders die Figur der Schule von Athen, die er gezeichnet hat, eine wesentliche Rolle gespielt. Diese Figur löst gradweise das erste theoretische entscheidende Exposé über die Methode Warburgs ab; gegen eine diachronische Analyse, eine lineare Analyse des Lebens der Symbole, hat sie die synchronische Sicht eines jeder Epoche eigenen symbolischen Systems in Metaphern gefaßt, eines Systems, das als organische Ganzheit in der Tradition der romantischen Historiographie von Hegel über Ruskin zu Burckhardt gefaßt wird. Möglicherweise hat eine solche Sicht mitunter durch ein Zuviel an Systematik gesündigt; man kann aber sagen, daß Edgar Wind durch die Privilegierung der Funktionsweise, die synchronische Verknüpfung im Gegensatz zur diachronischen Dimension der Symbole, auf dem Gebiet der Ikonologie eine Wende bewirkte, die jener von Ferdinand de Saussure auf dem Gebiet der Linguistik vergleichbar ist.
Aus dem Französischen von Vincent von
Wroblewsky
Das Paradigma der Interpretation in Edgar Winds Die heidnischen Mysterien der Renaissance Michael Lailach
Die frühen philosophischen Arbeiten Edgar Winds stellen eine materialreiche Kritik natur- und kulturwissenschaftlicher Methodik dar (I).1 In den späteren Studien zur Kunst der Renaissance und des 18. Jahrhunderts tritt die pragmatisti sche Orientierung früherer Arbeiten jedoch so weit in den Hintergrund, daß die kunsthistorischen Texte Edgar Winds in die „Schule der Ikonologie" ein- und damit auch untergeordnet werden konnten.2 Die unterschiedlichen, oft kontroversen Standpunkte von Autoren wie zum Beispiel Aby Warburg, Ernst Panofsky und Edgar Wind scheinen darüber in Vergessenheit geraten zu sein. Im Gegensatz zu diesen Auffassungen soll im folgenden versucht werden, die methodischen Prämissen der berühmtesten Arbeit Winds: Pagan Mysteries in the Renaissance3 im Kontext seiner früheren Arbeiten zu beschreiben (II-III). Die sich daraus ergebenden kritischen Konsequenzen für die kunsthistorische Interpretation (IV) werden zum Schluß der in den Reith Lectures von 1963 demonstrierten kulturpessimistischen Haltung Winds entgegengestellt (V).
1 Vgl. v. a. Edgar Wind, „Warburgs Begriff der Kulturwissenschaft und seine Bedeutung für die Ästhetik", in: Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft, X X V , 1931, S. 163-179; ders., Das Experiment und die Metaphysik. Zur Auflösung der kosmologischen Antinomien, Tübingen 1934; ders., „Uber einige Berührungspunkte zwischen Naturwissenschaft und Geschichte", in: Wissenschaft - zum Verständnis eines Begriffes (= Arcus 2), Köln 1988, S. 3 4 - 3 9 (zuerst in englischer Sprache in der Festschrift für Ernst Cassirer 1936). 2 Eine differenzierte, jedoch auch einen „Schulzusammenhang" konstruierende Darstellung bei: Carlo Ginzburg, „Da A. Warburg a Ε. H. Gombrich. Note su un problema di metodo", in: Studi Medievali, serie III, VII, 1966, S. 1015-1065 (deutsche Ubersetzung in: ders., Spurensicherung. Uber verborgene Geschichte, Kunst und soziales Gedächtnis, München 1988). 3
Edgar Wind, Pagan Mysteries in the Renaissance, London 1958/1968. Im folgenden zitiert nach: ders., Heidnische Mysterien in der Renaissance, Frankfurt/M. 1987.
106
II Zur
Kunst
I. »... ein Experiment an eigner Person" In seiner Habilitationsschrift Das Experiment und die Metaphysik von 1934 entwickelte Edgar Wind eine pragmatistisch begründete Theorie des Experiments, in der das Experiment nicht als Kennzeichen einer wissenschaftlichen Revolution interpretiert, sondern als Verkörperung hypothetischer Annahmen argumentativ begründet wird. Die Formulierung des Titels läßt schon erkennen, daß Experiment und Metaphysik nicht im Widerspruch verstanden werden sollen, da jedes Experiment „eine Hypothese über das Ganze enthält und erprobt". 4 Dies gilt gleichermaßen für die Interpretation einer historischen Quelle: Wir müssen bestimmte primäre (axiomatische) Annahmen machen, welche uns dazu befähigen, Einzelbeobachtungen in systematischer Weise aufeinander zu beziehen, und wir müssen die Summe dieser Beobachtungen durch sekundäre (hypothetische) Annahmen ergänzen, die es uns ermöglichen, die Lücken auszufüllen. Wenn wir uns nun auf Grund eines solchen Systems an die Konstruktion eines Instrumentes oder die Exegese einer Quelle heranwagen, so wird das Ergebnis des Experiments (oder Erschließung einer Quelle) das vorgefaßte System entweder bestätigen oder widerlegen. [...] Eine solche Krisis ist aber immer ein Durchbruch zu neuen Erkenntnissen. 5 Experiment oder Quellenexegese sind folglich nicht nur als Modelle der Verifikation oder Falsifikation wissenschaftlicher Hypothesen zu verstehen. Sie führen zu einer Krisis der eigenen Annahmen und Sichtweisen und damit zur Festlegung neuer Überzeugungen. Dies ist auch das entscheidende Argument in Winds Programm der Kulturwissenschaft; einem Programm, dessen Handlungsrelevanz er am deutlichsten in der „Einleitung in die Kulturwissenschaftliche Bibliographie" der Bibliothek Warburg formulierte: Geschichte [...] vollzieht sich in Krisen, und ihre entscheidenden Ereignisse sind die „Pausen der Besinnung", denen das Wagnis der Handlung folgt. [...] In der Krisis der Entscheidung wirkt das erinnerte Symbol als Vorbild oder als Warnung, in der Pause des Zweifels als Ansporn oder Zügel. „Erinnerung" ist daher für den Historiker des Symbols das zentrale geschichtsphilosophische Problem [...]. 6 4 5 6
Wind, Experiment (wie Anm. 1), S. VIII. Ebenda, S. 14. Edgar Wind, „Einleitung" zu Kulturwissenschaftliche Bibliographie zum Nachleben der Antike. Erster Band: Die Erscheinungen des Jahres 1931. In Gemeinschaft mit Fachgenossen bearbeitet von Hans Meier, Richard Newald, Edgar Wind. Hrsg. von der Bibliothek Warburg. Leipzig - Berlin 1934, S. χ.
M. Lailach: Edgar Winds Die heidnischen Mysterien der Renaissance
107
Wind bezeichnete die Interpretation deswegen auch als „Experiment an eigener Person." 7 Dazu kann es aber nur kommen, weil Experiment und Quellenexegese die hypothetischen Annahmen des Wissenschaftlers instrumenteil beziehungsweise sprachlich oder bildlich verkörpern. In der Festschrift für Ernst Cassirer von 1936 charakterisierte Wind die experimentelle Prüfung naturwisschaftlicher Hypothesen und die historische Interpretation von Dokumenten oder Kunstwerken als „Störung". 8 Dies sollte nicht als hermeneutische Metapher verstanden werden, sondern als Ausdruck der pragmatischen Konsequenzen experimenteller oder dokumentarischer Interpretationen, die gleichermaßen sowohl die Vorstellung vom interpretierten Sachverhalt als auch die eigene Person betreffen. Der Gedanke einer Krisis persönlicher Uberzeugungen enthält damit das zentrale Argument Winds gegen die Behauptung eines geschichtlichen Determinismus. Folgerichtig spricht Wind auch vom „Spielraum der Gegenwart", einer Vorstellung, die er im dritten Kapitel seiner Habilitationsschrift in Anlehnung an Whitehead entwickelt. 9 Die Gegenwart ist kein eindeutiger Moment in einem linearen Zeitverlauf, sondern eine mehrdeutige Konfiguration in einer konfiguralen Zeitreihe, in welcher Gegenwart zu verstehen ist als das „[...] Auftauchen von Gestalten einer neuen Ordnung aus der zufälligen Konfiguration der Elemente der alten [...]." 10 Zeit ist folglich als Kontinuum gedacht, das sich aber erst im Prozeß zeitlicher Ordnungen konstituiert: Bei einer Periode kann man fragen: Wie lange besteht sie? Wie lange wird sie weiter bestehen? - und dieses „wie lange" läßt sich nur aus dem Bildungsgesetz, dem inneren Rhythmus der Periode entnehmen. 11 Anstelle von Bildungsgesetz kann man auch von Paradigma sprechen. 12 Die Frage: Wie lange besteht eine Epoche? ist also die Frage nach der Gültigkeit von Paradigmen. Die erweist sich zuerst im Experiment oder in der Quellenexegese, wobei die paradigmatischen Annahmen des Wissenschaftlers bestätigt oder widerlegt werden. So öffnet sich in der Prüfung historischer Hypothesen der Spielraum der Gegenwart, da Gestalten der alten Ordnung - Bilder und Texte - in die neue Ordnung des geschichtlichen Kontinuums gebracht werden. Damit steht Wind im 7 Ebenda. 8 Wind, Über einige Berührungspunkte (wie Anm. 1), S. 37. 9 Wind, Experiment (wie Anm. 1), S. 92ff. Vgl. auch Edgar Wind, „Mathematik und Sinnesempfindung. Materialien zu einer Whitehead-Kritik", in: Logos, XXI, 1929, S. 239-280, vor allem S. 276ff. 10 Wind, Experiment (wie Anm. 1), S. 103. 11 Ebenda, S. 106. 12 Vgl. zum Begriff „Paradigmenwechsel" und seiner wissenschaftstheoretischen Diskussion: Thomas Kuhn, Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen, Frankfurt/M. 19762 (zuerst Chicago 1962); Kritik und Erkenntnisfortschritt, hrsg. von Imre Lakatos und Alan Musgrave, Braunschweig 1974 (zuerst Cambridge 1970).
108
II Zur Kunst
Gegensatz zu einer Ideengeschichte, in der Epochengrenzen wie zum Beispiel die der „Renaissance" bestimmt wurden, ohne die Bedeutung der eigenen Interpretation für die Dauer und den Wandel einer Epoche zu erkennen. 13
II. ,Die heidnischen Mysterien der Renaisssance' Einen kunsthistorischen Text über „heidnische Mysterien der Renaissance" zu schreiben, scheint für die fünfziger Jahre noch ungewöhnlich. Um den Begriff genauer zu fassen, erklärte Wind deshalb im Anschluß an Festugière drei Bedeutungen des antiken Mysteriums: Ursprünglich kennzeichnet das Mysterium die rituelle Einweihung von Neophyten in eine durch das Schweigegebot charakterisierte Gemeinschaft der Geweihten, einem Ritus, wie ihn zum Beispiel die eleusinischen Mysterien verkörpern. Demgegenüber hat das Zitat der Mysteriensprache in literarischen Texten, wie zum Beispiel den platonischen Dialogen, keine rituelle, sondern figurative Bedeutung. Begriffe und Bilder der Mysterien verweisen auf die im philosophischen Gespräch entwickelte Fähigkeit, „auf rechte Art zu rasen". 14 Die Arkandisziplin wird gleichsam in eine Balance zwischen Reden und Schweigen verkehrt, dadurch, daß die Mysterien-Sprache zitiert, ihre änigmatische Form jedoch nicht aufgelöst wird. Im antiken Neuplatonismus erlangt die Rätselhaftigkeit der Mysteriensprache dann eine dritte, eine magische Bedeutung. Genau diese verschiedenen Momente heidnischer Mysterien kehren im christlichen Neuplatonismus der Renaissance wieder. Die antiken Texte von Plutarch, Porphyrios und Proklos wurden als Allegorien gelesen, wobei den Autoren eine philosophische List unterstellt wurde, derzufolge sie nur in dieser Form von dem im christlichen Sinne „Göttlichen" sprechen konnten. Das poetische Interesse war erst durch die allegorische Lesart legitimiert, die eine eigenartige Ästhetik des Bildrätsels, der Embleme und Hieroglyphen, formte. 15 Welche Form hat nun aber das Bild eines Mysteriums und worin unterscheidet es sich von anderen Bildern? In einem dem Vorsokratiker Anaxagoras zugeschriebenen Grundsatz: „Omnia in omnibus" benannte Wind die Eigenart heidnischer Mysterien in der Renaissance, die zu einem poetischen Synkretismus führte. 16 Das Phänomen des Synkretismus sieht Wind dort, wo die Vereinigung von Gegensätzen im Bild zu einer gegenseitigen Beeinflussung und Erhellung beiträgt, wie zum Beispiel die Koinzidenz des Bildes der Venus und des Bildes der christlichen mater dolorosa in einer Illustration des Romans Hypnerotomacbia Poliphili des 13 Vgl. zum Beispiel Erwin Panofsky, Renaissance and Renaissances in Western Art, Stockholm 1960, S. 1 - 4 1 . 14 Platon, Phaidros 244E. 15 Wind, Mysterien (wie Anm. 3), S. 1 1 - 2 7 . 16 Ebenda, S. 55, Anm. 21.
M. Lailach: Edgar Winds Die heidnischen Mysterien der Renaissance
109
späten 15. Jahrhunderts. 17 Die synkretistischen Phantasien entspringen dem Glauben an eine transzendente Einheit der Gegensätze heidnischer und christlicher Vorstellungen: Der antike Bildtypus konkretisiert ein christliches Dogma, das wiederum die Darstellung heidnischer Bilder ermöglichte, allerdings unter dem poetischen Schleier des Mysteriums. Ein synkretistisches Bild ist also im eigentlichen Sinn ein Symbolon: Sie sind niemals endlich im Sinne einer wörtlichen Aussage, die das Denken auf einen bestimmten Punkt fixieren würde; ebensowenig sind sie endlich im Sinne des mystischen Absoluten, in dem alle Bilder zergingen. Vielmehr halten sie das Denken dadurch, daß sie das Paradox einer „inhärenten Tranzendenz" vergegenwärtigen, in permanenter Schwebe; sie verweisen beständig auf mehr, als sie sagen. 18 Ist der poetische Synkretismus nun paradigmatisch für das von Wind vorgestellte Corpus von Texten und Bildern der Renaissance?
III. Das Paradigma der ,Heidnischen Mysterien in der Renaissance' Der Begriff des Paradigmas bezeichnet ursprünglich ein Bild, welches im ontologischen Sinn das Urbild seiner Abbilder ist. Piaton verwendete den Begriff als ein Modell im Kontext seiner Ideenlehre. Hier sind Paradigmen die Urbilder innerweltlich erscheinender und folglich erfahrbarer Dinge: sie werden als unveränderlich und damit die Abbilder konstituierend gedacht. Die Schwierigkeit, das Wesen eines Paradigmas zu erklären, zeigt sich jedoch im Politikos. Dort droht das Gespräch in dem Moment in einer Aporie zu enden, als das Paradigma selbst wieder nur paradigmatisch erläutert werden kann. Der Gast aus Elea führt, um eine Definition des Paradigmas zu geben, als Beispiel das Lesenlernen der Kinder an, die durch den Vergleich der Ähnlichkeit von Buchstaben die unbekannten Worte lesen lernen: Ein Paradigma ensteht dann, wenn ein und dieselbe Sache - etwas, das dasselbe ist - in verschiedenen Kontexten richtig vorgestellt und zusammengeführt und von jeder Sache und von beiden Sachen zusammen ein einziges wahres Urteil (δόξα) ermöglicht wird. 19
17 Francesco Colonna, Hypnerotomachia Poliphili, hrsg. von Giovanni Pozzi und Lucia Ciapponi, Padua 1980, Bd. 2, S. 369. Vgl. Wind, Mysterien (wie Anm. 3), S. 36. 18 Mysterien (wie Anm. 3), S. 237. 19 Piaton, Politikos 277d-278c, hier 278a.
110
II Zur Kunst
Ludwig Wittgenstein erklärte im Anschluß an Piaton das Paradigma als begriffskonstitutives Muster, das in der gemeinsamen Sprachpraxis ein Mittel der Darstellung ist; etwas, womit in einem Sprachspiel verglichen wird. Beispiel eines Paradigmas ist der Urmeter in Paris; dem einen Ding, von dem man nicht aussagen kann, es sei ein Meter lang, noch, es sei nicht ein Meter lang. Am Beispiel einer Farbe, dem nur vorgestellten „Ur-Sepia" in Paris, definierte Wittgenstein die Eigenart des Paradigmas: „Es ist in diesem Spiel nichts Dargestelltes, sondern Mittel der Darstellung." 20 Die Frage, ob ein Paradigma stabil genug sei, kann auch hier nur durch seinen Gebrauch als etwas, das verglichen wird, beantwortet werden. Da das Paradigma zur Beurteilung aller ähnlichen Situationen dient, ist es nicht an seine Einführungssituation gebunden, sondern wird situationsinvariant weiterverwendet. Paradigmen können daher verloren gehen, vergessen werden oder sich als unbrauchbar und nicht überzeugend erweisen.21 Liest man die Interpretation Winds als ein Sprachspiel, so erweist sich die Figur der Triade als Mittel der Darstellung. Das erscheint zunächst erstaunlich, weil Wind den poetischen Synkretismus als Charakteristikum der heidnischen Mysterien der Renaissance herausstellte. Im Unterschied dazu ist die Triade jedoch nicht nur kennzeichnend für den Gegenstand der Interpretation, sondern sie ist ihr Paradigma. Bilder und Texte, die in verschiedenen historischen Kontexten entstanden sind, können mittels der triadischen Figur beschrieben, verglichen und akzentuiert werden. 22 Die Triade ermöglicht damit im Sinne Piatons ein einziges wahres Urteil. So erklärt Wind das Bild der „drei Grazien" auf der Medaille des Pico della Mirandola als eine neuplatonische Triade, die die Liebe symbolisiere. Die Beobachtung einer gewissen Asymmetrie in der Darstellung und die Umschrift der Medaille „Pulchritudo - Amor - Voluptas" führt Wind zum Vergleich mit Ficinos Traktat über die Liebe, der ebenfalls triadische Argumente bei seiner Auslegung antiker neuplatonischer Texte gebraucht und zu asymmetrischen Triaden der Liebe gelangt. Das Bild der „drei Grazien" ist auch in symmetrischer Form bekannt, zum Beispiel in einem Fresko Correggios der „Camera di San Paolo" in Parma, wobei die drei nackten Frauen sich hier wie in einem Reigen die Hände reichen und eine in sich geschlossene Gruppe bilden. Wind vergleicht diese symmetrische Variante einer Triade mit einem Text Senecas (De beneficiis I, 3). In der „getanzten Dialektik" (Wind) der drei Frauen ist aus dieser Sicht die stoische Idee der Dankbarkeit
20 Ludwig Wittgenstein, „Philosophische Untersuchungen", § 50, in: Schriften, Bd. 1, hrsg. von G. E. M. Anscombe et al., Frankfurt/M. 1967. 21 Ebenda, §§ 55-57. 22 Vgl. das erst 1996 veröffentlichte Vorwort Winds zu den „Heidnischen Mysterien der Renaissance": „Wenn wir diesen Punkt erreicht haben, den Punkt, an dem ein Bild uns hilft, in einem Text die Akzente richtig zu setzen, und an dem ein Text uns hilft, in einem Bild die Akzente richtig zu setzen, dann gewinnen beide eine neue Leuchtkraft - und nach mehr sollten wir nicht streben" („Bild und Text", in diesem Band S. 259-262.)
M. Lailach: Edgar Winds Die heidnischen Mysterien der Renaissance
111
verkörpert: Erweisen, Erhalten und Erwidern von Wohltaten sind drei Formen des gleichen Gedankens.23 Die Triade ist ein stabiles und überzeugendes Paradigma der Interpretation Winds. Nachdem sie am Bild der „drei Grazien" und den Texten Ficinos einer gleichsam experimentellen Prüfung unterzogen wurde, gebraucht Wind sie weiterhin zur Beurteilung von Texten und Bildern. Die Triade ist nichts Dargestelltes, sondern Mittel der Darstellung. Daher können sowohl Picos Medaille und die Bilder Botticellis24 als auch die Darstellungen der heiligen Anna25 und Hegels notorische Triaden zusammengeführt und dargestellt werden. Die Ikonographie ist in dieser Hinsicht eine Methode, die die Stabilität des Paradigmas in verschiedenen Kontexten aufweist26 und zugleich das Vergessen des Paradigmas verhindert.
IV. „Ikonologie" als Methode Ikonologie ist ursprünglich der Name einer Anthologie von Sinnbildern abstrakter Begriffe, die Cesare Ripa im Jahr 1593 herausgab. Erwin Panofskys Studies in Iconology begründeten 1939 die Institutionalisierung einer Methode unter diesem Namen, deren Anfänge erst später auf Aby Warburg zurückgeführt wurden.27 Winds Pagan Mysteries in the Renaissance werden oft mit dieser Methode gleichgesetzt und damit in die Nachfolge Panofskys gestellt, ohne die Differenzen zwischen den Interpreten zu berücksichtigen. In einem Vortrag auf dem 4. Kongreß für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft 1930 stellte Edgar Wind den Begriff der Kulturwissenschaften von Aby Warburg in einen polemischen Gegensatz zu einer formalistischen Kunstgeschichte, die Wind exemplarisch in Heinrich Wölfflin verkörpert sah.28 In dem Versuch, eine Geschichte des Auges zu schreiben, habe Wölfflin die Geschichte auf die Entwicklung zwischen zwei Formkategorien reduziert, den sogenannten kunstgeschichtlichen Grundbegriffen.29 Gegen diese Reduktion künstlerischer Formen
23 Vgl. Wind, Mysterien (wie Anm. 3), S. 50 ff. 24 Ebenda, S. 135 ff. 25 Ebenda, S. 291. 26 Vgl. ebenda, S. 41, Anm. 5. 27 Erwin Panofsky, Studies in Iconology,
N e w Y o r k 1939 (die Nachweise im folgenden nach der
deutschen Ubersetzung: ders., Studien zur Ikonologie, Renaissance, Dictionary
Humanistische
Themen
in der Kunst
der
Köln 1980). Zur Begriffsgeschichte vgl. Jan Bialostocki, Stichwort „Iconography", in: of the History of Ideas, hrsg. von Philip P. Wiener, N e w Y o r k 1973, Bd. 2, S. 5 2 4 - 5 4 1 .
28 Wind, Warburgs Begriff (wie Anm. 1), S. 1 6 3 - 1 7 9 . 29
Heinrich Wölfflin, Kunstgeschichtliche neueren
Grundbegriffe.
Das Problem
Kunst, München 1915. Vgl. Edgar Wind, Art and Anarchy
der Stilentwicklung
vised and enlarged), London 1963, (zitiert im folgenden nach: ders., Kunst und Anarchie, f u r t / M . 1994, hier S. 2 3 - 5 5 ) .
in der
(The Reith Lectures 1960, reFrank-
112
II Zur Kunst
auf „Momente ohne Gefühlston" wendete Wind den Begriff einer Kulturwissenschaft „[...] als einen Begriff der Gesamtkultur, in der das Sehen eine notwendige Funktion erfüllt." 30 Das Programm Warburgs sei ein begrifflich geleiteter Erinnerungsvorgang, der im Kunstwerk eine Vermittlung historischer Erfahrungen sehe und diese Erfahrungen wieder zur Darstellung bringe - die Methode heiße Ikonologie.31 Damit ist die Methode benannt, jedoch nicht definiert. Die Erscheinung des „blinden Amor" in den heidnischen Mysterien der Renaissance gab Wind die Gelegenheit, eine subtile Kritik seines ehemaligen Lehrers Erwin Panofsky in das Bild des blinden Amors einzuschreiben. Panofsky hatte diesen Bildtypus in den Studies in Iconology aus der Sicht einer geschichtsphilosophischen Annahme gedeutet, derzufolge die Identität von Form und Inhalt mit der hegelianischen Figur der Identität von Identität und Nicht-Identität beschrieben wird. Wenn die Einheit von Inhalt und Form, so argumentierte Panofsky, in der antiken Kunst noch gegeben gewesen sei, kann der Weg mittelalterlicher Pseudometamorphosen der Bildtypen bis zu der Restitution von Form und Inhalt in der Renaissance verfolgt werden. Die Ikonographie der Bilder dient als methodisches Prinzip ihrer Anordnung, deren Entwicklung jedoch ikonologisch als Weltanschauung (Karl Mannheim) oder als symbolische Form (Ernst Cassirer) gedeutet wird.32 Wind behauptet demgegenüber keine geschichtliche Notwendigkeit der Entwicklung, sondern präsentiert das Bild des „blinden Amors" als Zentrum einer Konfiguration von Texten und Bildern, die durch das Paradigma der Triade strukturiert wird.33 Im 1937 veröffentlichten Aufsatz „Aenigma Termini. The Emblem of Erasmus of Rotterdam" 34 entwarf Wind um das Bild des Terminus eine eigenartige Konfiguration, die einerseits das unbestimmte Verhältnis von Bild und Text in der Renaissance, andererseits beispielhaft Winds Auffassung von „Gegenwart" illustriert. Als Erasmus das antike Bild des Grenzgottes Terminus, ein Geschenk Alexander Stewards aus dem Jahr 1509, zu seinem persönlichen Symbolon machte und der Kopie des Bildes auf seinem Siegelring die Worte „Cedo nulli" zufügte, erschien die Aussage noch eindeutig. Im Moment selbstbewußter Zuversicht interpretierte Erasmus das Bild durch Textzitate aus Gellius und Ovid - so zumindest die An30 W i n d , Warburgs Begriff (wie A n m . 1), S. 170. 31 Vgl. Ernst G o m b r i c h , „Die Krisis der Kulturgeschichte" (1967), in: ders., Die Krisis der Kulturgeschichte. Gedanken zum Wertproblem in den Geisteswissenschaften, Stuttgart 1 9 9 1 , S. 35-90. A m Beispiel Jacob Burckhardts k o m m t G o m b r i c h zu einer vergleichbaren Kritik formalisierter Geschichtsschreibung, ohne jedoch die Bedeutung der Erinnerung zu erkennen, vgl. insbesondere S. 86 ff. 32 Panofsky, Ikonologie
(wie A n m . 27), S. 49 ff., S. 163 ff.
33 Vgl. W i n d , Mysterien (wie A n m . 3), S. 6 8 - 9 8 . 34 Edgar W i n d , „Aenigma Termini. The Emblem of Erasmus of Rotterdam", in: Journal of the Warburg Institute I, 1937, S. 6 6 - 6 9 . Vgl. demgegenüber E r w i n Panofsky, „Erasmus and the Visual Arts", in: Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, X X X I I , 1969, S. 2 0 0 - 2 2 7 .
M. Lailach: Edgar Winds Die heidnischen
Mysterien
der Renaissance
113
nähme Winds. Die Gegner des Erasmus kritisierten das berühmt gewordene Symbolon jedoch als Zeichen des Hochmuts. Erasmus sah sich daher gezwungen, in einer Epistola apologetica im Jahr 1528 zu erwidern, es sei Terminus, der den kapitolinischen Göttern nicht habe weichen wollen und die Devise: „cedo nulli" als memento mori spreche. In seiner Verteidigung verwies Erasmus auf patristische Texte und Livius. In der Zwischenzeit, im Jahr 1519, hatte Erasmus zudem eine Medaille mit seinem Portrait von Quentin Massys anfertigen lassen, mit dem Revers-Bild des Terminus und zwei zugefügten Zeilen, die den Tod als Ende des Lebens ankündigen. Hier ist das Bild des Terminus gegenüber dem antiken Bild jedoch variiert: Auf einem quadratischen Grenzstein ist ein jugendlicher Kopf mit fliegenden Haaren dargestellt. Terminus verkörpert folglich zugleich den das Leben begrenzenden Tod und die Göttin Iuventas, die wie der Grenzgott den kapitolinischen Göttern nicht hatte weichen wollen. Das Emblem erscheint an dieser Stelle als Moment zwischen Zuversicht und Demut, in dem die Standhaftigkeit im Leben durch die Zuversicht des christlichen Glaubens an die „Aeternitas" begründet ist. Erasmus vollzog also buchstäblich ein „Experiment an eigner Person". Zudem wird hier - im Gegensatz zu den geschichtsphilosophischen Prämissen Panofskys das „Auftauchen von Gestalten einer neuen Ordnung aus der zufälligen Konfiguration der Elemente der alten" in der Konfiguration von Texten und Bildern verschiedener Zeiten um das antike Bild des Terminus anschaulich. Die Interpretationen Winds wie auch Warburgs gehen im wesentlichen auf die Bestimmung der jeweiligen geschichtlichen Gegenwart. In methodischer Hinsicht steht Wind allerdings im Widerspruch zu Warburg. In seiner Dissertation über Botticelli von 1893 versuchte Warburg eine „Untersuchung über die Vorstellungen von der Antike in der italienischen Frührenaissance."35 Irritiert von der scheinbar manieristischen, unnatürlichen Gestaltung der Haare und Kleider im Bild Botticellis, die der konventionellen Vorstellung über die Renaissance als Entdeckung der Welt und des Menschen widersprach, transponierte Warburg die philologisch-kritische Methode einer Polizian-Ausgabe von Carducci in seine Interpretation des Bildes.36 Da Carducci die Darstellung bewegten Lebens in Polizians Stanzen, die allgemein als Vorbild Botticellis angenommen wurden, als Zitat aus Ovid nachweisen konnte, schlußfolgerte Warburg, dieser literarisch vermittelte Einfluß der Antike bezeuge die poetische Vorstellung von der Antike in der Frührenaissance. Wenn Polizian der Ratgeber Botticellis gewesen war, kann die Darstellung der stilisiert erscheinenden Haare und Gewänder durch ihn auf Ovid zurückgeführt werden. Die Vorstellung von der Antike konnte dann von Warburg
35 Aby Warburg, Ausgewählte Schriften und Würdigungen, hrsg. von Dieter Wuttke, Baden-Baden 1992, S. 11-63. 36 G. Carducci, Le Stanze, L'Orfeo e le Rime di M. A. A. Poliziano, Florenz 1863.
114
II Zur Kunst
durch das Interesse an einem, gesteigerte äußere Bewegung verlangenden Vorbild charakterisiert werden. Indem Warburg in einer dichten Sammlung antiker und moderner Texte und Bilder, die nach dem Paradigma des „bewegten Beiwerks" ausgewählt wurden, den Stil als Ausdruck einer allgemeinen Vorstellung von der Antike untersuchte, steht er im Gegensatz zu Wind, der nicht den Stil eines Kunstwerkes, sondern das Verhältnis von Text und Bild als kulturwissenschaftliches Problem begriff. Gemeinsam ist ihnen nur die ideelle Voraussetzung: die Erinnerung des „Nachlebens der Antike." Im Widerstand gegen äußere Bedrohung formulierte Wind diesen methodischen Standpunkt als Gegenentwurf zur völkischen, anti-humanistischen Kulturkritik der 30er Jahre.37 Erinnerung wird damit zu einem polemischen Begriff, der gegen die Propagierung einer Immanenz der historischen Entwicklung den diskontinuierlichen, zufälligen und damit immer wieder veränderbaren Verlauf des geschichtlichen Kontinuums herausstellt: Erinnerung ist daher für den Historiker des Symbols das zentrale geschichtsphilosophische Problem: nicht nur weil sie selbst das Organ geschichtlicher Erkenntnis ist, sondern weil sie - in ihren Symbolen - gleichsam das Reservoir der Kräfte schafft, die sich in einer gegebenen Situation geschichtlich entladen [...] Unter diesem Gesichtspunkt gewinnt das Problem des Nachlebens der Antike die Bedeutung eines historischen Paradigmas [...] Aber es ist kein gleichgültiges, beliebiges Paradigma, das damit ausgesucht wird; sondern es ist insofern unersetzbar, als unser eignes Schicksal, das der Forschenden selbst, darin enthalten ist. Es ist gleichsam ein Experiment an eigener Person.38
V. Paradigmen der Moderne In Art and Anarchy erwähnte Edgar Wind beiläufig ein für den Salon gemaltes Bild Manets. Im Vergleich mit Mantegnas Kopenhagener Engelpietà, die Manet in dem erwähnten Bild kopierte, entlarvt Wind die moderne Darstellung als ausschließlich selbstreflexive und damit dissoziierte Kunst.39 Mit Hegel sei zu konstatieren, niemand beuge mehr vor diesem Bild sein Knie. Die Kritik moderner Kunst in den Reith Lectures von 1963 besteht aber nur vordergründig in einer Polemik gegen die Autonomie der Kunst in einem säkularisierten Zeitalter.40 Winds Kritik 37 38 39 40
Wind, Einleitung (wie Anm. 6), S. V. Ebenda, S. X. Wind, Kunst und Anarchie (wie Anm. 29), S. 121 ff. Vgl. einen der wenigen Aufsätze, in dem Wind sich zu zwei Vertretern moderner Kunst äußert: „Traditional Religion and Modern Art. Rouault and Matisse" (1953), in: ders., The Eloquence of Symbols. Studies in Humanist Art, Oxford 1983, S. 9 5 - 1 0 1 .
M. Lailach: Edgar Winds Die heidnischen Mysterien der Renaissance
115
richtet sich vielmehr gegen die Dissoziation künstlerischer Arbeit aus dem geschichtlichen Kontext und damit gegen einen Verlust von Erinnerung, die die Kunst noch immer zu verkörpern vermag. Es ist jedoch fraglich, ob diese Kritik sich nicht auch gegen den Interpreten selbst richtet. Aby Warburg wählte in einem posthum veröffentlichten Vortrag über die Moderne das „Déjeuner sur l'herbe" von Manet, den Inbegriff des „L'Art pour L'Art", um in einem „mindestens überflüssig scheinenden intellektuellem Beginnen" die „vorprägende Funktion heidnischer Elementargottheiten für die Entwicklung modernen Naturgefühls" zu erinnern. 41 Der Vergleich des „Déjeuner" mit einem antiken Sarkophag-Relief und einem Stich Marcantonio Raimondis des 16. Jahrhunderts, von dem Manet die formale Gestaltung der Naturgottheiten für die Anordnung seiner bürgerlichen Figuren kopierte, weist auf die Antike als den O r t ursprünglicher Formenprägungen zurück: Aus der kultisch zweckgebundenen Geste untergeordneter blitzfürchtiger Naturdämonen auf dem antiken Relief vollzieht sich über den italienischen Stich die Prägung freien Menschentums, das sich im Lichte selbstsicher empfindet. 42 Die Lösung aus dem Zwang der Zwecke, verkörpert in dem entscheidenden Moment der Wendung des Kopfes der Quellnymphe von den sich nähernden Göttern zum außenstehenden Betrachter, erscheint dem erinnernden Interpreten als wesentlicher Schritt in die Freiheit des modernen Menschen. Manets Bild verkörpert in der Interpretation Warburgs eine aufklärerische Anstrengung von Kunst und Philosophie: „Manet hat seinen Rousseau gelesen". Gerade in der Abwendung vom antiken Ursprung entdeckt Warburg das Nachleben der Antike - mit anderen Worten: „[...] der Streit um das Nachleben der Antike ist selbst ein Beweis dieses Nachlebens." 4 3 Winds Vorwurf einer selbstgewählten Randstellung moderner Kunst übergeht die geschichtlichen Bedingungen der Dissoziierung künstlerischer Darstellungsformen und schließt damit entgegen den eigenen methodischen Prämissen die „Gegenwart" gegen die geschichtliche Entwicklung ab. Die kulturpessimistische Hypothese wird zwar an Texten und Bildern der Moderne illustriert. Die Phänomene selbst werden aber nicht mehr mittels eines Paradigmas dargestellt:
41 Aby Warburg, „Manets Déjeuner sur l'herbe" (1929/37), in: Kosmopolis der Wissenschaft. Ernst Robert Curtius und das Warburg Institute. Briefe und andere Dokumente, hrsg. von Dieter Wuttke, Baden-Baden 1989, S. 257-273. 42 Ebenda, S. 263. 43 Wind, Einleitung (wie Anm. 6), S. X V I .
116
II Zur
Kunst
Die Unterscheidung in Begriffen ist über jedweden Verdacht zerstörerischer Spitzfindigkeit erhaben nur dort, wo sie auf jene Bergung der Phänomene in den Ideen, das Platonische τά φαινόμενα σώ ζειν es abgesehen hat. Durch ihre Vermittlerrolle leihen die Begriffe den Phänomenen Anteil am Sein der Ideen.44
44 Walter Benjamin, „Ursprung des deutschen Trauerspiels" (1928), in: Gesammelte von Rolf Tiedemann. Bd. I, 1, Frankfurt/M. 1980, S. 214.
Schriften,
hrsg.
Kunst als Kritik. Edgar Wind und das Symposium Art and Morals Christa Buschendorf
Im April 1953 fand an der renommierten Privatuniversität Smith College in Northampton, Massachusetts, ein Symposium zu dem Thema Art and Morals statt.1 Edgar Wind, der seit 1945 am Smith College Kunstwissenschaft und Philosophie lehrte, organisierte die Tagung. Es war ihm gelungen, einige herausragende amerikanische Intellektuelle und Künstler zu diesem Gedankenaustausch zusammenzubringen. Teilnehmer des Symposiums waren der Literaturkritiker Lionel Trilling (Columbia University), der Historiker George Boas (Johns Hopkins), die Kunstwissenschaftler Jacques Barzun (Columbia) und W. G. Constable (Kurator am Museum of Fine Arts, Boston), der Architekt Philip Johnson, der Maler Ben Shan, der Schriftsteller Allen Tate sowie die beiden damals auf der Höhe ihres Ruhms stehenden Lyriker Archibald MacLeish und W. H. Auden. Das Nachdenken über Kunst und Ethik war zu dieser Zeit keineswegs eine rein akademische Angelegenheit. Das Symposium widmete sich vielmehr einer durchaus aktuellen, ja brisanten Thematik. Bekanntlich erreichte der nach dem Senator Joseph McCarthy benannte innenpolitische Feldzug gegen Kommunisten zu Beginn der fünfziger Jahre seinen Höhepunkt. Mutmaßliche Mitglieder und Sympathisanten der Kommunistischen Partei wurden in Anhörungen vor Kongreßausschüssen zu ihrer und ihrer Freunde politischen Haltung vernommen.2 Nicht nur dezidiert linke, auch liberale Intellek-
1
Es handelt sich bei den Tagungsmaterialien, auf die ich im folgenden zurückgreife, um unpublizierte Abschriften der Reden und Podiumsdiskussionen des Symposiums. Die im Edgar Wind Archiv in Oxford liegenden Materialien wurden mir freundlicherweise von Margaret Wind zur Verfügung gestellt. Eine Edition der interessanten Dokumente wird von mir vorbereitet.
2
Einen informativen Bericht über die umfangreiche historische Forschung siehe in Ellen Schrecker, The Age of McCarthyism:
A Brief History with Documents,
Boston, N e w Y o r k 1994, S. 2 5 5 - 2 6 2 .
Von Schrecker stammt auch eine Studie über die Auswirkungen des McCarthyismus auf das intellektuelle Klima an den amerikanischen Universitäten: No Ivory Tower: McCarthyism
and the Uni-
versities, N e w York, Oxford 1986. Vgl. ferner die Untersuchung von Lionel S. Lewis, Cold War on Campus:
A Study of the Politics of Organizational
Control,
N e w Brunswick, Oxford 1988, die
einen Abschnitt über „Pressure on Smith College" enthält, S. 9 1 - 9 6 . Der Druck wird in diesem Fall
118
II Zur
Kunst
tuelle waren v o n politischen Verdächtigungen, Zensurmaßnahmen und Berufsverbot betroffen. In dieser zunehmend repressiven Atmosphäre, in der eine offene Kritik am McCarthyismus nicht ungefährlich war, kam der Frage nach der moralischen Dimension der Kunst eine höchst politische Bedeutung zu. 3 Im folgenden werde ich versuchen, die Hauptlinien der Diskussion am Smith College nachzuzeichnen. Bei aller Vielfalt der auf dem Symposium angesprochenen Aspekte des Themas kehren die Beiträge immer wieder zu der zentralen Frage zurück, die gleich in der ersten Rede von Archibald MacLeish aufgeworfen wurde: Besteht für den Künstler eine besondere Verpflichtung, sich in seiner Kunst f ü r die Werte des Gemeinwesens einzusetzen, wenn er sie in Gefahr sieht? Die beiden Lyriker MacLeish und Auden vertreten gegensätzliche Standpunkte in dieser Frage. Wind greift in den Disput ein, indem er zunächst die Differenz zwischen MacLeish und A u d e n pointiert, um dann von seinem eigenen Standpunkt aus die Möglichkeit einer Vermittlung zwischen beiden aufzuzeigen. Abschließend möchte ich darlegen, inwieweit Winds Position übereinstimmt mit Audens Poetologie, die dieser in einem unmittelbar nach dem Symposium verfaßten und Edgar Wind gewidmeten Gedicht formulierte.
I
Archibald MacLeish zum Festredner zu wählen, kam einer Entscheidung f ü r einen dezidiert politischen A u f t a k t gleich. MacLeish hatte sich in der Vergangenheit mehrfach f ü r die politische Verantwortung des Schriftstellers ausgesprochen ausgeübt von einer Alumna, die in einem an mehrere tausend Studentinnen verschickten Rundbrief vom Februar 1954 gegenüber fünf namentlich genannten Dozenten den Vorwurf der Mitgliedschaft in einer kommunistischen Organisation erhebt und überdies den Vorschlag macht, die Empfängerin des Briefs möge die dem College zugedachten Spenden zurückhalten, „until the Smith administration explains its educational policy to her personal satisfaction" (Lewis, Cold War, S. 92). Im Einvernehmen mit den zu Unrecht Beschuldigten wurde die Angelegenheit intern geregelt. Einen in der Öffentlichkeit verhandelten ,Fall' gab es am Smith College allerdings im Februar/März 1953, also gerade zur Zeit der Vorbereitung des Symposiums: In seiner Aussage vor dem Untersuchungsausschuß des Repräsentantenhauses für ,Unamerikanische Aktivitäten' bezichtigte Robert G. Davis, Professor für Englisch am Smith College, mehrere Fakultätsmitglieder der Mitgliedschaft in der kommunistischen Partei und wurde dafür vom Präsidenten des College öffentlich ( H a m p s h i r e Gazette, 27. Februar 1953) mit einem Lob bedacht, von dem sich wiederum eine Gruppe von Dozenten, u. a. Edgar Wind, in einer Erklärung ausdrücklich distanzierte (siehe Edgar Wind Archiv, „Art and Morals. Smith College 1953, II, ii, v: Unamerican activities Committee 1953"). 3 Entsprechend groß war das Interesse an der Veranstaltung: Dem Jahresbericht des College-Präsidenten zufolge wurden bei den Vorträgen und Diskussionen am 23. und 24. April stets zwischen 1100 und 1600 Zuhörer gezählt (President's Report, 1954, siehe Edgar Wind Archiv, „Art and Morals"). Ein Echo fand das Symposium auch in der überregionalen Presse: Am 10. Mai 1953 erschien in der New York Herald Tribune ein Artikel über die Tagung von der Kunstkritikerin Emily Genauer, die das hohe Niveau der Beiträge und die Ernsthaftigkeit der Auseinandersetzung hervorhebt.
Ch. Buschendorf: Kunst als Kritik
119
und seiner Auffassung durch ein aktives politisches Engagement Nachdruck verliehen.4 So war er etwa in den dreißiger Jahren hervorgetreten als Vorsitzender der anti-faschistischen Vereinigung League of American Writers, die sich vor allem gegen die im Spanischen Bürgerkrieg gipfelnde Politik des Franco-Regimes richtete. Daß er ein entschiedener Gegner des McCarthyismus war, zeigt etwa das 1952 erschienene Versdrama The Trojan Horse. MacLeishs Bearbeitung des antiken Stoffs ist als Parabel auf die zeitgenössische Situation zu lesen, als Warnung nämlich, daß die Amerikaner, wenn sie der Propaganda McCarthys erlägen, selbst zur Zerstörung der demokratischen Basis ihres Gemeinwesens beitrügen.5 Bekannt geworden war MacLeish vor allem durch einen Essay mit dem provozierenden Titel The Irresponsibles, in dem er 1940 an die amerikanischen Künstler appelliert hatte, die Freiheit vor dem Faschismus zu verteidigen.6 Seine Worte waren auf heftige Kritik gestoßen, an die er in seiner Rede am Smith College anknüpft. Kunst, so lautete der Vorwurf gegen MacLeish, sei in erster Linie sich selbst und nicht einer noch so guten Sache verpflichtet. Hier handle es sich, so erwidert MacLeish seinen Kritikern, um ein Mißverständnis. Damals wie heute stimme er nämlich mit seinen Kritikern darin überein, daß es weder dem Staat noch der Kirche noch auch sonstigen Macht- oder Interessengruppen gestattet sein dürfe, Künstlern Vorschriften über die Ausübung ihrer Kunst zu machen. Doch sei die Verpflichtung, von der er damals gesprochen habe, keineswegs von außen an die Kunst herangetragen. Vielmehr wohne sie der Kunst selbst inne. Und an eben diese Verpflichtung glaube er noch immer.
4
MacLeish (1892-1982), der Jura an der Universität Harvard studierte hatte, bekleidete mehrere Amter im öffentlichen Dienst und in der Politik. Von 1949 bis 1962 war er Boylston Professor of Rhetoric and Oratory an der Universität Harvard. Zuvor war er u. a. Bibliothekar an der Library of Congress (1939-1944), Vize-Außenminister (1944—1945), Leiter der amerikanischen Delegation der Londoner UN-Konferenz zur Gründung der Unesco (1945) sowie Leiter der amerikanischen Delegation der ersten Unesco-Konferenz (1946).
5
The Trojan Horse wurde im Januar 1952 vom Sender BBC als Hörspiel gesendet. Bezeichnend für das politische Klima ist, daß der Bostoner Verlag Houghton Mifflin Company das Versdrama 1952 nur in limitierter, nicht für den freien Verkauf bestimmter Auflage publizierte. Wie aus dem Schlußsatz des Begleitworts hervorgeht, wußte man sehr wohl, daß das Drama politischen Zündstoff enthielt: „If this play helps us to recognize a wooden horse when we see one it will have served an important purpose." MacLeish zitiert diesen Satz in einem Vorwort zu diesem Drama: MacLeish, Six Plays, Boston 1980. Zur Entstehungsgeschichte des Dramas siehe MacLeishs Erinnerungen in dem Interview-Band Archibald MacLeish: Reflections, hrsg. von Bernard A. Drabeck und Helen E. Ellis, Amherst 1986, S. 191 f. Zu MacLeishs kritischer Haltung gegenüber McCarthy siehe auch das Kapitel „Taking on McCarthy" in der Biographie von Scott Donaldson, Archibald MacLeish: An American Life, Boston 1992, S. 426—433, sowie vor allem die ausführliche Stellungsnahme MacLeishs in einem Brief vom 1. Januar 1953 in Letters of Archibald MacLeish 1907 to 1982, hrsg. von R. H. Winnick, Boston 1983, S. 363-367.
6
The Irresponsibles, New York 1940.
120
II Zur Kunst
Bevor MacLeish im einzelnen erläutert, was er unter dieser Verpflichtung versteht, nimmt er die Gelegenheit wahr, auf die aktuelle politische Situation einzugehen. Die Schärfe seiner Kritik verdankt sich einem rhetorischen Kunstgriff: Er prätendiert, eine rein fiktive Beschreibung der innenpolitischen Zustände geben zu wollen. Er beabsichtige mit diesem Szenario lediglich, auf potentielle - keineswegs auf faktische - Gefahren des politischen Klimas aufmerksam zu machen: „Bitte stellen Sie sich vor, die Mentalität, die anderen Völkern in anderen Ländern den Polizeistaat beschert hat, sei auch in der amerikanischen Öffentlichkeit aufgetreten und habe im Kongreß der Vereinigten Staaten sogar zu der Forderung geführt, der Staat solle seine Kontrolle auf Meinungs- und Glaubensfragen ausdehnen."7 MacLeish prangert in diesem vorgeblichen Gedankenspiel die herrschende Gesinnungsschnüffelei an, um mit offensichtlicher Ironie schließlich festzustellen: „Now it is obvious, of course, that nothing of this kind has happened or could happen in the United States." (6) Sollten wir nun aber, so fährt er insistierend fort, nur um unserer Fragestellung willen gleichwohl vom Faktum einer solchen inneren Bedrohung der Demokratie ausgehen, wie steht es dann um die Möglichkeiten des Dichters, auf diese Gefahr zu reagieren? Kann sich der Künstler etwa, indem er sich ausschließlich seiner Kunst widmet, vom Leben zurückziehen? Ein solcher Eskapismus ist für MacLeish nicht nur nicht akzeptabel. Ihm zufolge ist er nachgerade unmöglich. Denn der Dichter und MacLeish spricht von ihm durchgängig als Repräsentanten des Künstlers teilt die Erfahrung seiner Zeit, und der einzige Unterschied zu seinen Zeitgenossen ist, „daß er als Dichter, und gerade weil er ein Dichter ist, sich beständig dessen bewußt ist, was andere gelegentlich ignorieren, denn es ist eine wesentliche Eigenschaft des wahren Dichters, daß er sein Leben wachend zubringt, wer sonst auch immer im Leben schlafen mag." (7) Die conditio humana erweist sich als unhintergehbar: „Die Dichtkunst, ja jegliche Kunst, existiert nur innerhalb und dank der Bedingungen des Menschseins. Ihr unumstößliches Postulat ist der Mensch. Es genügt nicht, daß ein Dichter, ein Künstler, der Empfindung fähig ist, vielmehr muß er fähig sein, als Mensch zu fühlen."(15) Die Ausübung seiner Kunst entbindet den Künstler daher keineswegs von der Verpflichtung, seine Erfahrungen als Mensch zu empfinden und zu verstehen, im Gegenteil, „es ist gerade die Kunst selbst, die ihm sagen wird, was er empfinden sollte": „He is to feel as man." (16) Aufgrund dieser fraglosen Orientierung am Ideal der Humanität ist es denn auch nach MacLeish nicht nur möglich, sondern geradezu unausweichlich, in bestimm-
7
„The Muses' Sterner Laws", S. 6; die Reden sind separat paginiert und werden im folgenden unter dem Namen des Redners und der Seitenzahl angeführt. Der Titel ist ein Zitat aus dem Gedicht „The Grey Rock" von William Butler Yeats, an dem MacLeish seine Auffassung exemplifiziert. Es stammt aus dem Gedichtband Responsibilities (1914), vgl. The Collected Poems of W. B. Yeats, London 1955, S. 115-119. Eine überarbeitete Fassung dieses Vortrags erschien in The New Republic, July 13, 1953; aufgenommen in MacLeish, A Continuing Journey, Boston 1967.
Ch. Buschendorf:
Kunst als Kritik
121
ten historischen Situationen von einer umfassenden Verantwortung des Künstlers auszugehen. Denn - so appelliert er abschließend noch einmal eindringlich an seine Zuhörerschaft — „es gibt historische Situationen, in denen man auch die Konsequenzen dafür tragen muß, daß man wahrhaft als Mensch empfindet. Eine solche Situation ... ist diejenige, mit der die abendländische Zivilisation in den faschistischen Kriegen konfrontiert war und noch immer konfrontiert ist, nun da die faschistischen Kriege kommunistisch heißen und da die Waffen des Faschismus und Kommunismus nicht nur dem Angriff, sondern - Gott steh uns bei - der Verteidigung dienen." (17) II Das Publikum des Symposiums dürfte es nicht überrascht haben, daß W. H. Auden eine Gegenposition zu MacLeishs These von der Untrennbarkeit von Kunst und Leben vertrat und die Legitimität von dessen emphatischem Plädoyer für ein politisches Engagement in der Kunst entschieden in Zweifel zog. Zwar war Auden in den dreißiger Jahren als Autor politischer Dramen und als Mitglied eines Kreises britischer Linksintellektueller berühmt geworden. 8 Doch hatte der seit 1939 in N e w York lebende und zum Christentum konvertierte Schriftsteller von dieser engagierten Haltung nachdrücklich Abstand genommen. Vor allem aber war er nur allzu bekannt für seinen ironischen, spielerisch-distanzierten Umgang mit dem Wort. Als geistreicher Causeur zeigt er sich denn auch auf dem Symposium, wenn er etwa zu Beginn seiner Rede erklärt: „Das Interesse an der Beziehung zwischen Kunst (und dem Schönen) und Ethik, dem Wahren und Guten, verleitet Künstler wie Kritiker unweigerlich dazu, Unsinn zu reden." Und er versichert: „Im Verlauf der beiden nächsten Tage werden Sie zweifellos viel Unsinn zu hören bekommen, aber ich hoffe, daß es uns wenigstens gelingt, denselben einigermaßen unterhaltsam zu gestalten." 9 Im Gegensatz zu MacLeish geht Auden das Thema der Beziehung zwischen Kunst und Ethik von der Kunst her an. Er argumentiert für die Eigengesetzlichkeit, ja Mutwilligkeit der Kunst. Alles Banale, Repetitive und Normative - und somit alles Langweilige - sei mit Kunst unvereinbar. Die Einbildungskraft sei daher auch keineswegs mit der Instanz des Gewissens identisch. Denn während das Gewissen dem Gesetz, dem Allgemeinen, gehorche, sei die Einbildungskraft dem Einzelfall, dem Besonderen verpflichtet. Was er unter der daraus resultierenden ,frivolen' Haltung der Kunst versteht, demonstriert Auden an einem der berühmtesten Liebespaare der Weltliteratur: 8 Zum .britischen', politisch engagierten Auden siehe etwa Frederick Buell, W. H. Auden as a Social Poet, Ithaca, London 1973, sowie Samuel Hynes, The Auden Generation: Literature and Politics in the 1930's, London 1976. 9 Buell, Auden (wie Anm. 8), S. 1.
122
II Zur Kunst Let us take a question: Should a man commit adultery with another man's wife? Now, let us suppose the couple may visit Mrs. Imagination; and they say: „What shall we do?" Mrs. Imagination takes up a paper and says: „What is your name?" - „Tristan. Isolde." - Who is the husband? - „King Mark." Who is King Mark?' Tristan says: „My best friend." Then a further question to Isolde: „What did Tristan do?" - „Tristan killed the hero of my country." Then Mrs. Imagination says: „This is most interesting. You must commit adultery." If they look a little doubtful, Mrs. Imagination says: „Fine, here is a love potion, just to encourage this." And off they go. What they do not realize is that the moment they have left the office, Mrs. Imagination telephones to Melot to make the situation a little more difficult. (3)
Was dem Moralisten verdächtig sein muß, ist also nach Auden gerade die Stärke der Kunst. Sie unterwirft sich keiner äußeren Autorität; vielmehr gehorcht der Künstler ausschließlich seiner Muse. Hinsichtlich der politischen Funktion der Kunst gilt daher für Auden, daß jedes wahre Kunstwerk per se Zeugnis des freien Willens des Individuums sei: „and in an age in which the will to enforce the impersonal, the official, seems so strong, maybe that in itself has political importance."(ll) 1 0 Verglichen mit MacLeishs pathetischem Plädoyer für eine der Humanität verpflichtete Kunst mutet Audens Aussage über die Freiheit der Kunst wie ein Ausweichmanöver an. Diesen Vorwurf erhebt Wind denn auch ausdrücklich. Er frage sich, ob nicht drei Seelen in dieser einen Brust wohnten. Als Dichter und als Kritiker habe sich Auden so unmißverständlich und eindeutig über die Gefahren und Erfordernisse der Zeit geäußert, daß es kaum begreiflich sei, wie er nun, da er als „a didactic humorist" zu ihnen spreche, den Eindruck erwecken könne (wie Wind in Zuspitzung der geläufigen Redewendung treffend formuliert), „that he is beating about the burning bush". 11 Als Auden in der Schlußdiskussion gebeten wird, zu dieser Provokation Stellung zu nehmen, bezieht er sich zwar auf Winds bon mot, geht aber auf den Vorwurf des Eskapismus selbst nicht ein. Vielmehr erklärt er, seine Auffassung vom Wesen der Kunst stimme mit der von Wind vorgetragenen völlig überein. Um zu verstehen, inwiefern in Audens Replik seine Verteidigung enthalten ist, ist es notwendig, nunmehr etwas eingehender die Position Winds zu erörtern.
10 Über das Verhältnis des Dichters zur Politik vgl. Audens Essay „The Poet & the City", wo es heißt: „In our age, the mere making of a work of art is itself a political act. So long as artists exist, making what they please and think they ought to make ... they remind the Management of something managers need to be reminded of, namely, that the managed are people with faces, not anonymous numbers, that Homo Laborans is also Homo Ludens." In: Auden, The Dyer's Hand and other essays, New York 1962, S. 88. 11 Wind, S. 8 (wie Anm. 7).
Ch. Buschendorf:
Kunst als Kritik
123
III Wind radikalisiert das Problem, indem er in seiner Rede die grundsätzliche Frage aufwirft, wie denn Kunst im allgemeinen mit ihrem Material verfahre. Transformiert sie es lediglich? Wäre das der Fall, dann handelte es sich beim künstlerischen Schaffen um eine unschuldige, aber auch gänzlich irrelevante Tätigkeit. Wind zufolge trifft das Gegenteil zu: Mit der Transformation - so argumentiert er - geht immer auch eine Intensivierung des Dargestellten einher; aus diesem Grunde könne Kunst wirksam und sogar gefährlich werden; und aus eben diesem Grunde habe Piaton geglaubt, vor ihr warnen zu müssen. Das Spiel der Einbildungskraft entfaltet nach Piaton bekanntlich die höchst gefährliche Macht der Verwandlung und ist daher ernst zu nehmen - und zwar um so ernster je kunstvoller das Spiel gespielt wird, also je größer der Künstler ist. Die rigorosen Maßnahmen, die Piaton zur Bannung der von der Kunst ausgehenden großen Gefahr in seinem Staat vorsieht, mögen uns übertrieben erscheinen, und sie sind nur als Reaktion auf spezifische historische Bedingungen verständlich. Dennoch steckt - wie Wind betont - in der von Piaton konstatierten Spannung zwischen Kunst und Staat „eine überhistorische Einsicht", „eine Einsicht in einen Konflikt zweier Kräfte im Menschen". Und eben diesem Konflikt muß sich „der Mensch zu verschiedenen Zeiten in verschiedener Weise" stellen. Da Wind auf dem Symposium am Smith College nur in Anspielungen auf seine Rekonstruktion der Platonischen Kunstphilosophie zurückgreift, ziehe ich im folgenden zur Verdeutlichung seiner Position seinen Aufsatz „θείος Φόβος. Untersuchungen über die Platonische Kunstphilosophie" heran.12 Grundlage des theios phobos, jener ,heiligen Scheu' also, die Piaton der Kunst gegenüber empfindet, ist seine Lehre von den zwei im Widerstreit befindlichen Mächten der Seele, nämlich den dem Geist verpflichteten Vermögen und den ihm entgegengesetzten unbändigen Trieben. In dem Bestreben, einen Ausgleich zwischen ihnen zu schaffen, der allein den Zustand des Glücks garantieren kann, kommt nach Piaton der Kunst in der Erziehung eine bedeutende Rolle zu. Im Umgang mit den Künsten erfährt der Mensch Genüsse und Freuden; dabei wird er den der Kunst innewohnenden irrationalen Kräften ausgesetzt und lernt zugleich, mit der potentiellen Maßlosigkeit der Lust umzugehen. Die Kunsterfahrung kann somit ausgleichend wirken: Die Jungen konfrontiert sie mit den Abgründen der irrationalen Triebe und bringt ihnen auf diese Weise den theios phobos, die ,heilige Scheu', nahe; die Alten hingegen, deren Gemüt verhärtet ist, bringt sie dazu, sich erneut der Gefährdung durch die Irrationalität zu stellen, und ermöglicht ihnen
12 Edgar Wind, „θείος Φόβος. Untersuchungen über die Platonische Kunstphilosophie", in: Zeitschrift für Ästhetik und Allgemeine Kunstwissenschaft, XXVI, 1932, S. 349-373. Die soeben angeführten Stellen stammen aus diesem Aufsatz, S. 351.
124
II Zur Kunst
wieder die Teilhabe an der theia mania, dem ,heiligen Wahn'. Freilich kann es der Kunst nur dann gelingen, die „widerstreitenden Seelenkräfte zur Einheit zu verbinden", wenn sie maßvoll angewendet wird, d. h. wenn ihr anarchisches Potential nicht die Oberhand gewinnt. Was für das Individuum gilt, trifft auch für das Gemeinwesen zu: „Kunst und Staat [liegen] ihrem Wesen nach miteinander im Kampf ..., weil gerade jene Spannungen der Seelenkräfte im Menschen, die der Gesetzgeber zu überwinden und auszugleichen sucht, vom Künstler festgehalten und gesteigert werden." 13 Der Einsatz der Kunst birgt demnach immer ein Risiko. Die Höhe dieses Risikos hängt von zwei Faktoren ab: von der phantasiegestützten Wirkungsmacht der Kunst und von der Potenz ihres distanzschaffenden Spielcharakters. Die Uberbetonung eines der beiden Faktoren führt zu Verzerrungen. Produktionsästhetisch führt sie zu l'art engagé oder zu l'art pour l'art. Rezeptionsästhetisch führt sie zur Zensur oder zur Marginalisierung der Kunst. Wie Wind in Kunst und Anarchie darlegt, vernachlässigen alle diese Vereinseitigungen „die grundlegende Tatsache, daß die Kunst ein Spiel der Einbildungskraft ist, welche uns zu gleicher Zeit bindet und löst, uns am Dargestellten partizipieren läßt und es doch nur als ästhetischen Schein darstellt. Aus dieser doppelten Wurzel - Partizipation und Schein - zieht die Kunst ihre Macht, die Anschauung über das Gegebene hinaus zu erweitern . . . " I 4 Diese Einsicht bringt Wind auf dem Symposium zur Geltung, wenn er die Position Audens folgendermaßen erläutert: Auden habe mit seinen Zentralbegriffen von „Frivolität" und „Freiheit" den spielerischen Aspekt des Kunstschaffens so stark betont, daß man meinen könne, er spreche dem künstlerischen Tun jede Ernsthaftigkeit und somit auch jedes mit ihm verbundene Risiko ab. Wenn Auden allerdings von den möglichen Welten spreche, die durch künstlerische Phantasie evoziert würden, dann seien damit doch wohl nicht Welten gemeint, die von der wirklichen Welt völlig getrennt seien. Diese möglichen Welten lägen zwar jenseits der wirklichen, doch sei es nicht sinnvoll anzunehmen, daß es mögliche Welten gebe, die nicht auf irgendeine Weise mit der wirklichen Welt in Beziehung stünden und somit auch auf sie einwirkten. Und Wind fügt hinzu: „Ich für mein Teil muß gestehen, daß mich Audens Lyrik in vieler Hinsicht geprägt hat, und ich weiß daher, daß das, was er Frivolität nennt, möglicherweise etwas sehr Ernstes ist, das sehr wohl Risiken in sich birgt ,.." 1 5 Auden bestätigt Winds Interpretation, indem er versichert: „Das Wort ,Frivolität' sei mir gestattet, ich gebrauche es bewußt zur Bezeichnung einer Kunst, der ich leidenschaftlich verpflichtet bin und der ich mein Leben widme. Die Tatsache,
13 Ebenda, S. 358. 14 Wind, Art and Anarchy. Third Edition. With an Introduction by John Bayley, London 1985, S. 24 [meine Ubersetzung]. 15 Podiumsdiskussion, S. 3 (wie Anm. 1).
Ch. Buschendorf: Kunst als Kritik
125
daß ich das tue, bedeutet, daß ich sie leicht nehmen muß."16 Leidenschaft muß also nach Auden durch Distanznahme gezügelt werden. Der Gegensatz von göttlichem Wahn und göttlicher Furcht, von Irrationalität und Besonnenheit, der nach Piaton das Verhältnis zwischen Kunst und Staat sowie das zwischen Kunst und Individuum prägt, wird von Wind deutlicher als bei Piaton bereits im Kunstwerk selbst angesiedelt. Auch das einzelne Werk ist diesem Kunstbegriff zufolge Ausdruck der genannten gegensätzlichen Kräfte und hält dieselben, wenn es gelungen ist, in der Schwebe. Nach Wind ist freilich die im Kunstwerk waltende Vermittlung zwischen den Polen von Rationalität und Irrationalität nicht auf künstlerische Symbole beschränkt. In seiner Einleitung zu der vom Warburg Institute herausgegebenen Kulturwissenschaftlichen Bibliographie zum Nachleben der Antike erklärt er zum „Symbol als Gegenstand kulturwissenschaftlicher Forschung":17 „[Das] Symbol, das Spezifikum aller Kulturleistung, sei es nun religiöses oder staatliches, wissenschaftliches oder künstlerisches Symbol, lebt von der Schwingung zwischen diesen beiden Polen. Es ist Ausdruck einer seelischen Kraft ..." Je nach ihrer Entfernung vom seelischen Kraftzentrum nehmen Symbole einen eher magischen oder eher logischen Charakter an. Eine Betrachtung, die „die Spannung zwischen diesen beiden Polen in eine radikale Antithese verwandelt", die also „Begriff und Anschauung, Wort und Bild, Erkenntnis und Glauben voneinander trennt und sie alle aus ihrer Verbundenheit mit der sozialen Handlung herauslöst, [beruht] auf einer Abstraktion ..., die ihren Gegenstand seines symbolischen Gehalts und damit seiner funktionalen Bedeutung für die Gesamtkultur entkleidet". Das Symbol ist das Produkt eines Auseinandersetzungsprozesses und es „erschließt sich nur dem", der es als ein solches Auseinandersetzungsprodukt „historisch begreift und also auf die gegensätzlichen Kräfte und Energien zurückgeht, die sich in dieser Auseinandersetzung - bald hemmend, bald fördernd begegnen." Die „Wechselwirkung zwischen den verschiedenen Kulturfunktionen" bildet demnach „die selbstverständliche Voraussetzung" für eine solche Symbolforschung: „der symbolischen Betrachtungsweise gilt die gedankliche Leistung als unverständlich oder nur halb verstanden, solange sie nicht im Zusammenhang oder auch im Konflikt mit den Kräften gesehen wird, die sich in der Bildgestaltung und der religiösen oder sozialen Handlung äußern", und umgekehrt gilt ihr „die Bildgestaltung ... als unverständlich oder nur halb verstanden, wenn die religiösen und intellektuellen Bildungsinhalte, die sich in ihr verkörpern ... nicht in die Betrachtung mit einbezogen werden. ... Erst aus den Spannungen zwischen den verschiedenen Kulturfunktionen und dem jeweils zwischen ihnen gefundenen Ausgleich 16 Ebenda, S. 1.
17 Wind, „Einleitung" zu Kulturwissenschaftliche
Bibliographie
zum Nachleben
der Antike. Erster
Band: Die Erscheinungen des Jahres 1931. In Gemeinschaft mit Fachgenossen bearbeitet von Hans Meier, Richard Newald, Edgar Wind. Hrsg. v. d. Bibliothek Warburg. Leipzig - Berlin 1934 S. v-xvii.
126
II Zur Kunst
entsteht für sie überhaupt erst die Dynamik des geschichtlichen Fortgangs". 18 Kulturwissenschaftliche Forschungen, die sich an dieser Symboltheorie orientieren, sollten also exemplarisch verfahren und die zu erforschenden kulturellen Objektivationen in ihrer jeweiligen Wechselwirkung mit anderen Kulturfunktionen - seien sie ökonomischer, soziologischer, politischer, geistesgeschichtlicher oder eben ästhetischer Art - zu verstehen suchen.
IV Obgleich Auden sein Gedicht ,„The Truest Poetry is the Most Feigning' " Edgar Wind widmete19 und es ihm gegenüber ausdrücklich als „the result of our discussions" bezeichnete,20 hat die Forschung bislang versäumt, das Gedicht aus seinem Entstehungskontext heraus zu deuten. Eben dies soll im folgenden geschehen. Inhaltlich läßt sich das Gedicht in drei Abschnitte gliedern: Der erste, die drei Eingangsstrophen umfassende Abschnitt gibt eine Reihe von poetologischen Empfehlungen zur Abfassung von Liebeslyrik; der zweite aus der vierten Strophe bestehende Abschnitt erteilt dem Dichter einige Ratschläge zur angemessenen Reaktion auf politische Repression; der dritte Abschnitt behandelt schließlich das den ersten beiden zugrundeliegende Problem der Lüge, d. h. die Frage nach Dichtung und Wahrheit. Der programmatische Charakter des Gedichts kommt bereits in dem als Zitat kenntlich gemachten Titel zum Ausdruck: „The Truest Poetry Is the Most Feigning", oder wie es in der Schlegel-Tieck-Ubersetzung heißt: „die wahrste Poesie erdichtet am meisten".21 Die Zeile stammt aus der dritten Szene des dritten 18 Ebenda, S.viii-x. Vgl. Bernhard Buschendorf, N a c h w o r t zu Edgar Wind, Heidnische der Renaissance,
Mysterien
in
Frankfurt/M. 1981, S. 412f.
19 Anthony Hecht erläutert zu Beginn seiner Interpretation, daß die Widmung an Edgar Wind einem Kollegen Audens am Smith College gelte; in: The Hidden
Law: The Poetry ofW. H. Auden,
Cam-
bridge, London 1993, S. 416. In der Tat hatte Auden im Frühjahr 1953 eine Forschungsprofessur am Smith College inne; siehe Charles Osborne, W. H, Auden: don 1979, S. 242.
The Life of a Poet, N e w York, Lon-
Kennengelernt hatten sich die beiden Männer jedoch bereits im Mai 1952 auf
einer Konferenz in Paris; von den Begegnungen mit Auden in Paris berichtete Wind in Briefen an Margaret Wind (siehe Edgar Wind Archiv, „Auden and E. W . " ) . 20
Auden an Wind am Ende des Schreibens, das die erste Fassung des Gedichts enthält: „Dear Edgar, May I dedicate the enclosed to you, as it is the result of our discussions." (Copyright Nachlaßverwaltung W . H. Auden.) Der undatierte Brief wurde in Forio d'Ischia geschrieben, w o sich Auden im Sommer 1953 aufhielt. Auden sandte Wind eine überarbeitete Fassung im Herbst 1953 (siehe Edgar Wind Archiv, unter „Auden and E. W . " ) . Erstmals publiziert wurde das Gedicht in dem 1955 erschienenen Lyrikband Audens The Shield of Achilles.
Ich zitiere hier nach der nochmals
geringfügig überarbeiteten Fassung der Collected Poems, hrsg. von Edward Mendelson; London 1. Aufl. 1976; rev. Ausgabe 1991. 21
Hier zitiert nach Shakespeare's
Works / Shakespeares
Schücking, Bd. 6, Berlin, Darmstadt 1970, S. 268.
Werke. Englisch und Deutsch, hrsg. von L. L.
Ch. Buschendorf : Kunst als Kritik
127
Akts von Shakespeares As You Like It, einer Verführungsszene, in der der höfische Clown Touchstone die naive Audrey über das Wesen der Lyrik aufklärt. Die in der Uberschrift getroffene Feststellung, daß wir poetische Wahrheit am ehesten in der Maske des schönen Scheins finden, führt uns sogleich ins Zentrum des Arguments.22 Das Gedicht fingiert einen poetologischen Diskurs zwischen Meister und Schüler und beschränkt sich auf die Wiedergabe der Antwort des Meisters, der von seinem Schüler vorgängig offenbar gefragt wurde, ob und wie man Liebesgedichte schreiben solle: „By all means sing of love but, if you do, / Please make a rare old proper hullabaloo". Wenn also mit dieser Antwort in plauderndem Ton und in scherzhaft-ironischer Manier ein Dialog fortgesetzt wird, so trägt Auden der an anderer Stelle geäußerten Uberzeugung Rechnung, daß die der Literaturkritik gemäße Form das zwanglose Gespräch sei.23 Wie Anthony Hecht gezeigt hat, spielt Auden nicht nur auf Shakespeare, sondern auch auf Ovids Ars amatoria, nämlich auf Francis Wolfertons englische Ubersetzung der Ars amatoria von 1661 an. Ebenso wie Audens Gedicht ist auch diese Art of Love in „heroic couplets", also in paarweise gereimten jambischen Fünfhebern, gehalten. Und ebenso wie Auden sucht auch Wolferton den „sophisticated, scandalizing, and rather immoral tone" 24 Ovids zu imitieren. Der Gestus der mündlichen Rede und der despektierliche, freche Ton ist bei Auden freilich noch verstärkt. Inhaltlich beginnt das Gedicht mit der These, die Auden in den Mittelpunkt seines Vortrags am Smith College gestellt und mit dem Beispiel von Tristan und Isolde illustriert hatte: Die Phantasie - so hatte er behauptet - verbanne alles Banale,
22 Hecht behauptet, Auden habe im Titel Shakespeare falsch zitiert; die Stelle laute korrekt: „the truest poetry is the most faining" (fain = begierig). „What Auden has done, in altering the passage, is to narrow and confine Shakespeare's meanings. In declaring that ,the truest poetry is the most faining', Touchstone was saying that it was most expressive of desire." In: Hidden Law (wie Anm. 19), S. 417. Hecht bezieht sich auf die ursprüngliche Schreibweise, wie sie etwa in der OriginalSpelling Edition (William Shakespeare, The Complete Works. Original-Spelling Edition, hrsg. von Stanley Wells und Gary Taylor, Oxford 1986) nachzulesen ist. Wie von Auden zitiert findet sich die Stelle dagegen in der Standardausgabe The Oxford Shakespeare. The Complete Works of William Shakespeare, hrsg. von W. J. Craig, Oxford 1924. Im Kommentar der Arden Edition zu „the truest poetry is the most feigning" heißt es denn auch: „This touches on the many contemporary arguments as to whether poets are liars." In: As You Like It, hrsg. von Agnes Latham, London 1975, S. 80. In jedem Fall ist in Audens Gedicht der Aspekt der Täuschung (feigning) wichtiger als der des Begehrens (faining). 23 Vgl. die Einleitung zu Alan Ansen, The Table Talk of W. H. Auden, hrsg. von Nicholas Jenkins. Introduction by Richard Howard, Princeton 1990, S. xiii. 24 Hecht, The Hidden Law (wie Anm. 19), S. 418. Hecht führt einige Verse aus Francis Wolfertons The Art of Love von 1661 an, z. B: „A promise hurts you not; then promise much; / It makes those that are not rich seem to be such. / Your letter wins her, if she credits it; / Hope's a false goddess, yet for you most fit.
128
II Zur Kunst
Repetitive, also Langweilige; und so laute denn die erste Regel zur Abfassung von Liebesgedichten, der Dichter müsse von seinem Thema ein entsprechendes Aufheben machen: „By all means sing of love but, if you do, / Please make a rare old proper hullabaloo". Die zweite Strophe illustriert dieses Gebot exemplarisch an der alltäglichen Situation des Wartens auf die Geliebte. Was immer der gewöhnliche Sterbliche in dieser Situation Banales denken mag - etwa daß ihm eine Stunde wie zwei erscheint - , schreiben sollte er es nicht. Es gilt auszuschmücken oder - noch elaborierter — eine Anleihe am Mythos zu machen. Die auf diese Weise entstehenden „ingenious fibs", kunstvollen Flunkereien, machen Gedichte allererst zu dem, was sie sind. In den unmittelbar folgenden Zeilen geht Auden über den Gegensatz zwischen dem gewöhnlichen Menschen und dem Dichter hinaus: Er behauptet eine grundsätzliche Trennung zwischen Leben und Kunst: Then, should she leave you for some other guy, Or ruin you with debts, or go and die, No metaphor, remember, can express A real historical unhappiness; Your tears have value if they make us gay; O Happy Grief ! is all sad verse can say. Während das Ausmaß des banalen ,Unglücks', auf die Geliebte warten zu müssen, im Gedicht durch Übertreibung möglichst ins Interessante zu steigern sei, sollte das Ausmaß wahren Schmerzes im Gedicht nicht vermittelt werden, denn so lautet die Begründung - das kunstvolle sprachliche Gewand solle dem Leser einen die Trauer mildernden oder gar aufhebenden Genuß bieten. Auch in der dritten Strophe geht es um den Gegensatz von Sein und Schein und zwar im Hinblick auf die Beschreibung der Geliebten. Wie auch immer sie in Wirklichkeit beschaffen, d. h. mit welchen Fehlern oder Absonderlichkeiten sie von der Natur ausgestattet sein mag - „Yours may be old enough to be your mother, / Or have one leg that's shorter than the other" - , im Gedicht muß die Geliebte idealisiert werden. Und wieder kleidet Auden diese Erkenntnis in einen poetologischen Ratschlag, der auf die bei uns, den Lesern, zu erzielende Wirkung berechnet ist: „We cannot love your love till she take on, / Through you, the wonders of a paragon." Wie der Dichter ein solches „Wunder der Schöpfung" zu gestalten hat, demonstriert Auden, wenn er die Geliebte im folgenden Lobpreis in geradezu überbordender Bildlichkeit nach dem Muster eines Triumphzugs einer antiken Göttin beschreibt. Durch die Mittel der Häufung und Übertreibung konventioneller Embleme vermag Auden hier allerdings die Gattung zugleich zu parodieren und steigert auf diese Weise noch das Element der spielerischen Distanzierung:
Ch. Buschendorf:
Kunst als Kritik
129
We cannot love your love till she take on, Through you, the wonders of a paragon. Sing her triumphant passage to our land, The sun her footstool, the moon in her right hand, And seven planets blazing in her hair, Queen of the Night and Empress of the Air; Tell how her fleet by nine king swans is led, Wild geese write magic letters overhead And hippocampi follow in her wake With Amphisboene, gentle for her sake; Sing her descent on the exulting shore To bless the vines and put an end to war. Die letzte Zeile zeigt die triumphale Venus traditionsgemäß im Bunde mit dem weinspendenden Bacchus sowie als Besiegerin des Mars und schafft mit dieser Anspielung auf den Kriegsgott den Ubergang zum zweiten Abschnitt. In der vierten Strophe kommt Auden gewissermaßen zur Leitfrage des Symposiums: Welche Möglichkeiten hat der Dichter, auf politische Repression zu reagieren? In konsequenter Weiterführung seines Arguments lautet die Antwort Audens: Er verlege sich auf Verstellung. Der den Mächtigen verdächtige Dichter soll - so der zynische Rat - , um seine Haut zu retten aus dem Lobpreis der Geliebten eine panegyrische Ode auf den Herrscher machen. Zu diesem Zweck seien lediglich einige sprachliche Änderungen vorzunehmen, also etwa die Pronomina auszutauschen sowie die Semantik geschlechtsspezifisch zu modifizieren: If half-way through such praises of your dear, Riot and shooting fill the streets with fear, And overnight as in some terror dream Poets are suspect with the New Regime, Stick at your desk and hold your panic in, What you are writing may still save your skin: Re-sex the pronouns, add a few details, And, lo, a panegyric ode which hails (How is the Censor, bless his heart, to know?) The new pot-bellied Generalissimo. Some epithets, of course, like lily-breasted, Need modifying to say, lion-chested, A title Goddess of wry-necks and wrens To Great Reticulator of the fens ...25 25 Hecht kommentiert diese Stelle mit der Bemerkung: „There is a lot of androgynous fun going on here, which emphasizes the deceitful and feigning quality of poetry ..." Hidden Law (wie Anm. 19),
130
II Zur Kunst
Mit den letztgenannten Titeln scheint Auden ein Beispiel für die am Ende der ersten Strophe aufgestellte Behauptung geben zu wollen: „Good poets have a weakness for bad puns." Jedenfalls wird deutlich, daß Auden, der die Hyperbolik im Verlauf des Gedichts ohnehin zunehmend steigerte, den Scherz hier ins Absurde umschlagen läßt. Für Audens Argument ist diese Extremform der Übertreibung unerläßlich, da er wie in den folgenden Zeilen einzig und allein durch sie sicherstellen kann, daß die verstellte Rede des Dichters nur von beschränkten Köpfen für bare Münze genommen, von denjenigen aber, die reinen Herzens sind und einen klaren Verstand haben, durchschaut wird: „True hearts, clear heads will hear the note of glory / And put inverted commas round the story". Typisch für Auden ist der gegensteuernde Perspektivwechsel in der letzten Strophe. Der scherzhaft-burleske Ton schlägt in Ernst um, und aus den poetologischen Ratschlägen wird folgende gnomische Lehre gezogen: For given Man, by birth, by education, Imago Dei who forgot his station. The self-made creature who himself unmakes, The only creature ever made who fakes, With no more nature in his loving smile Than in his theories of a natural style, What but tall tales, the luck of verbal playing, Can trick his lying nature into saying That love, or truth in any serious sense, Like orthodoxy, is a reticence? 26
S. 421. Auf diese Strophe bezieht sich auch Alan Sinfield, der eine Kontroverse auslöste, als er in seiner Studie Literature, Politics and Culture in Postwar Britain, Oxford 1989, erklärte, „Auden founded a theory of poetry on the indirection he felt was required of homosexual men." (S. 67) Laurence Lerner weist diese Lesart zurück in dem Essay „Unwriting Literature", in: New Literary History, 1991, 22, S. 795-815, hier S. 801-803: „That Auden was a homosexual is well known, and it is perfectly possible, even likely, that some of his friends winked when they read his love poems ... But in doing this they were not reading the poems; they were noticing a rag of extraneous meaning that had got stuck onto them ..." Sinfield besteht auf der Legitimität seiner Deutung in dem Beitrag „.Reading Extraneously'. A Reply to Laurence Lerner", in: New Literary History, 1992, 23, S. 213f., auf den Lerner nochmals repliziert: „A Response to Alan Sinfield", in: New Literary History, 1992, 23, S. 214-216. 26 Vgl. hierzu einen Kommentar von Laurence Lerner: „But Auden also regards poetry as a search for truth, and so he has another paradox to explain: how can hanging around words enable you to say important things, how can a game lead to knowledge? This is discussed in the recent and very funny poem called The Truest Poetry is the Most Feigning. ... Alas that the last couplet of this brillant poem should be the flattest: but the argument is clear. Man is an utter liar by nature, and his plain speech is quite unreliable; but by imaginative lying he may stumble on a truth." Lerner, The Truest Poetry. An Essay on the Question What is Literature? London I960, S. 206f.
Ch. Buschendorf: Kunst als Kritik
131
Es geht um nichts weniger als um das lügnerische Wesen des Menschen, „the only creature ever made who fakes". Wenn dem Menschen etwas natürlich ist - so das Resümee - , dann die Verstellung. Daraus zu schließen, der Mensch sei gar nicht in der Lage, die Wahrheit zu sagen, wäre jedoch vorschnell, denn paradoxerweise sind es gerade die Lügengeschichten und Wortspiele, die ihn nach Auden zu einer wahren Aussage verleiten können, wie derjenigen, mit der das Gedicht in einer nochmaligen paradoxen Wendung endet, daß man nämlich über Liebe, Wahrheit und Glauben schweigen müsse. Trotz des moralisierenden Tons ist es Auden also nicht darum zu tun, den Menschen als notorischen Lügner zu diskreditieren. Unter Lüge versteht Auden vielmehr ein unausweichliches Moment der Sprache selbst, ihren realitätsverfälschenden Charakter: Das, was ist, ist objektiv, ist wahr. Indem etwas sprachlich verfaßt ist, unterscheidet es sich von dem, was ist, und ist in dem genannten Sinne nicht objektiv, nicht wahr. Und dennoch kann, wie das Gedicht versichert, auch im Lügengewand der Sprache, im schönen Schein der Kunst, Wahrheit aufscheinen. Der Wert der Kunst bemißt sich indessen keineswegs an ihrer Kraft, die Realität widerzuspiegeln. Vielmehr liegt er gerade in ihren unendlich vielen Möglichkeiten, das, was ist, zu überschreiten. Oder wie Auden in einem Essay schreibt: „... in der Dichtung sind Tatsachen wie Überzeugungen allesamt weder wahr noch falsch, sondern werden zu interessanten Möglichkeiten". 2 7 Das spielerische Erproben dieser interessanten Möglichkeiten eröffnet einen Zugang zu denjenigen Werten, die Auden auf dem Symposium mit den Begriffen „Frivolität" und „Freiheit" bezeichnet. Wenn somit nach Auden Poesie und Leben bzw. Dichtung und Wahrheit nur selten zur Deckung gelangen, so stellt sich erneut die von Wind in Anlehnung an Piaton gestellte Frage, ob das Spiel der Einbildungskraft ernstzunehmen ist, d. h. ob die Mimesis ein harmloses oder ein risikoreiches Spiel ist. Bekanntlich maß Auden dem Rollenspiel Zeit seines Lebens eine große Bedeutung zu. Christopher Isherwood macht in seiner Autobiographie die Experimentierfreudigkeit seines Freundes Auden am Wechsel von dessen Hüten fest: There was an opera hat - belonging to the period when he decided that poets ought to dress like bank directors ... There was a workman's cap, with a shiny black peak, which he bought while he was living in Berlin ... There was, and occasionally still is, a panama with a black ribbon - representing, I think, Weston's conception of himself as a lunatic clergyman; always a favourite role. 28
27 Auden, „Writing", in: The Dyer's Hand (wie Anm. 10), S. 19. 28 Christopher Isherwood, Lions and Shadows. An Education S. 188 f.
in the Twenties,
London 1938,
132
II Zur Kunst
Auden selbst äußert sich in The Age of Anxiety folgendermaßen über die Funktion des Rollenspiels: „Die Menschen sind notwendig Schauspieler, die nicht werden können, was sie nicht zuvor vorgegeben haben zu sein; und sie lassen sich einteilen nicht etwa in die Heuchler und die Wahrhaftigen, sondern in die Vernünftigen, die wissen, daß sie schauspielern, und die Verrückten, die es nicht wissen." 29 Oder wie Wind in Anlehnung an Piaton formuliert: „Durch Nachahmung werden wir, was wir sind ..." 3 0 Das Spiel der mimetischen Phantasie kann daher nicht unverbindlich sein: im Spiel stehen wir immer auch auf dem Spiel. An anderer Stelle geht Auden so weit zu behaupten, Spiel und Frivolität seien so wichtig, daß wir bereit sein sollten, sie mit unserem Leben zu verteidigen: „... unter den etwa halbdutzend Dingen, für die ein Ehrenmann, wenn nötig, bereit sein sollte zu sterben, ist das Recht zum Spiel, das Recht zur Frivolität, nicht das geringste." 31 Wie ernst die Kunst des Spiels zu nehmen ist, geht auch aus einer Passage in Art and Anarchy hervor, in der Wind seine eigene Position in Absetzung von l'art pour l'art wie auch von l'art engagé bestimmt. Obgleich ich den zentralen Satz dieses Abschnitts bereits angeführt habe, möchte ich Wind im folgenden noch einmal ausführlich im Original zu Wort kommen lassen: In the place of an art of disengagement, which rejoiced in its separation from ordinary life, we are now to have an art which completely involves us in real life - what in France is called art engagé. If I am sceptical about this doctrine, it is because it seems to me to make essentially the same mistake as the theory which it opposes. Both try to escape, in opposite directions, from the plain and fundamental fact that art is an exercise of the imagination, engaging and detaching us at the same time: it makes us participate in what it presents, and yet presents it as an aesthetic fiction. From that twofold root - participation and fiction - art draws its power to enlarge our vision by carrying us beyond the actual, and to deepen our experience by compassion; but it brings with it a pertinent oscillation between actual and vicarious experience. Art lives in this realm of ambiguity and suspense, and it is art only as long as the ambiguity is sustained. However, suspense is an awkward condition to live in, and we are persistently tempted to exchange it for
29 The Age of Anxiety. A Baroque Eclogue, Part Five. „The Masque", in Auden, Collected Longer Poems, London 1968, S. 333. Vgl. Hecht, der auf diese Stelle verweist und die große Bedeutung des Rollenspiels für Auden betont: „This ,adoption of roles,' whether by our own choice or at the behest of another, was a serious concern of Auden as a poet throughout his career ..." Hidden Law (wie Anm. 19), S. 6. 30 Wind, Kunst und Anarchie. Die Reith Lectures 1960. Durchgesehene Ausgabe mit den Zusätzen von 1968 und späteren Ergänzungen, Frankfurt/M. 1979, S. 11. 31 Auden, „The Poet & the City" (wie Anm. 10), S. 89.
Ch. Buschendorf:
Kunst als Kritik
133
some narrow but positive certainties; and yet we know very well that, as soon as the artistic imagination begins to work on us, we leave the safe shore for the open sea.32 Wollte man - so möchte ich abschließend zusammenfassen - die drei erörterten Standpunkte auf einer Skala ansiedeln, deren äußerste Gegensätze mit der Position des l'art engagé auf der einen Seite und der Position des l'art pour l'art auf der anderen Seite bezeichnet sind, so wären alle drei Positionen zwischen diesen Extremen zu situieren. Im Unterschied zu Vertretern der engagierten Kunst, redet MacLeish keineswegs einer propagandistischen Verwendung der Kunst das Wort; freilich steht er in der amerikanischen Tradition des Pragmatismus und betont daher das unausweichliche Verhaftetsein der Kunst im Leben und somit auch ihre per se soziale und politische Dimension. Auden hingegen unterstreicht die Eigengesetzlichkeit der künstlerischen Phantasie und die daraus resultierende Differenz der Kunst zum Leben. Anders jedoch als die Vertreter des l'art pour l'art hält er an der Lebensbedeutsamkeit des ästhetischen Spiels fest. Darin besteht die von ihm nachdrücklich betonte Ubereinstimmung mit der Position Winds. Was schließlich die Kunstauffassung Winds betrifft, so sind in ihr MacLeishs und Audens Position aufgehoben. Wie Auden geht auch Wind vom Spielcharakter der Kunst aus. Doch anders als dieser insistiert er auf der intensivierenden Wirkung des Mediums Kunst. In seinem Vortrag am Smith College führte Wind aus: „Die große Gefahr, die von der Kunst ausgeht, und zugleich ihre große Macht besteht darin, daß sie die Einbildungskraft bannt, die Erinnerung formt und dadurch Einfluß auf das Handeln nimmt." (7) Indem die Kunst das dem Leben entnommene Material transformiert, verdichtet und steigert sie es zugleich. Sie wirkt durch eben diese Intensivierung auf das Leben zurück und gewinnt allererst dadurch die von MacLeish geforderte lebenspraktische Relevanz. Oder wie Wind in dem Aufsatz „The Critical Nature of a Work of Art" schreibt: „In the interest of a living art it is essential to retain a sense of the risks involved in artistic expression; and this is to recognize the human force behind the aesthetic disguise."33 Damit kommt der Kunst ein kritisches Potential zu, das sie insbesondere in Zeiten staatlicher Repression zu einem geeigneten Mittel des Widerstands macht. Dieses kritische Potential der Kunst in grundlagentheoretischen Reflexionen herausgestellt zu haben, ist die eigentliche und in Zeiten des McCarthyismus politisch durchaus brisante Leistung des Symposiums.
32 Wind, Art and Anarchy (wie Anm. 14), S. 24. 33 Wind, „The Critical Nature of a Work of Art", in: Music and Criticism. A Symposium, hrsg. von R. F. French, Cambridge, Mass. 1948, S. 71.
Drei Ebenen von Piatons Höhle: Wiederbegegnung mit Edgar Winds
Art and Anarchy1 Philipp Fehl
Die umkämpften Künste Der Streit zwischen den Verfechtern der klassischen Tradition und jenen der neuen, „Modernen" läßt sich bis ins klassische Altertum selbst zurückverfolgen. Die Nachahmung eines als klassisch kanonisierten Vorbilds aus der Vergangenheit wird als Segen für die Kunst gepriesen oder als Fluch verabscheut, je nach dem Standpunkt des Betrachters, wie sensibel der jeweils neue moderne Künstler die Lehre des Vorbilds, das er nachahmt, zu nutzen weiß und wie gut er es gegenüber der Natur ausspielt. In dieser Kontroverse streben beide Seiten auf ein und dasselbe Ziel zu, die wahre Nachahmung und Darstellung der Natur in der Kunst. Es handelt sich um einen Methodenstreit. 2 Die Schlacht um das, was wir immer noch „Moderne Kunst" nennen, tobt seit etwa einhundertfünfzig Jahren. Sie unterscheidet sich radikal vom Konflikt zwischen der Antike und der Neuzeit, selbst wenn sie in ihren frühen Stadien einige Argumente aus der alten Kontroverse übernahm. Sie spricht die Sprache eines Krieges zwischen den Generationen und entzündet sich immer wieder von neuem an den Injurien, welche die verfeindeten Lager austauschen. Von Anfang an hat es sich um
1
Den Vortrag widme ich dem Andenken des Kunsthistorikers Julius Julier, der durch Jahre das Schloß Charlottenburg und seine Sammlungen verwaltete und betreute. Die Bilder Watteaus im Schlosse waren sein Glück und wurden im Gespräch mit ihm sein und unser Zugang zu unserem Wissen über die schönsten Aufgaben der Kunst. Ich grüße ihn in diesem für mich schmerzlichen Empfinden seines frühen Todes über das Grab hinweg, im Andenken an das „Embarquement pour Cythère", wo Kunst und Wahrheit sich die Hand reichen, Liebe und Witz die Segel hissen, und Trost uns lächelt, ohne zu lügen.
2
Eindrucksvolle Beispiele dafür aus der Literatur bei Karl Borinski, Die Antike in Poetik und
Kunst-
theorie, Leipzig 1 9 1 4 - 2 4 (Reprint Darmstadt 1965), Band I, S. 1 - 2 4 , Band II, S. 1 4 8 - 2 0 2 . Über die Zeugnisse der Kontroverse, wie sie sich in antiken Skulpturen zeigt, siehe Paul Zanker, Klassizistische Statuen:
Studien
zur Veränderung
des Kunstgeschmacks
in der römischen
Kaiserzeit,
Mainz
1974. U b e r die Kontroverse im politischen Denken siehe Joseph Cropsey, „Uber die Alten und die Modernen" in: Zur Diagnose der Moderne,
hrsg. von Heinrich Meier, München 1990, S. 2 1 1 - 2 4 6 .
136
II Zur Kunst
einen politischen Konflikt gehandelt. Es geht darin um moralische oder moralisierende Uberzeugungen über das Wesen des Menschen, die Freiheit der Künste, den Lauf der Geschichte und die Grundlagen einer guten und gerechten Gesellschaft. Erst in letzter Zeit ist es zu einem Waffenstillstand gekommen. Die Moderne Kunst hat Museumsreife erlangt und ist damit bloß eine weitere Epoche der Kunstgeschichte geworden. Moderne Künstler spielen sich immer noch als Militante auf, und „épater le bourgeois" ist immer noch ihr Ziel, aber wo finden sie diesen Bürger, den sie immer noch verblüffen können? Auf den Spielwiesen des neuen Mäzenatentums, wo cleverer Ankauf sich mit Prestige und Geld bezahlt macht und in den eleganten Museen, die die moderne Kunst kanonisieren, hat die Bourgeoisie längst schon die Künstler-Kritiker ausgetrickst, indem sie deren Protesten applaudiert. Der rebellierende Künstler kann an- und ausstellen, was er will: er ist zum gesellschaftlichen Konformisten geworden. Die Künstler wissen das und ärgern sich darüber. Wenn sie sich aus der Falle befreien können, in die sie aufgrund ihres Erfolges in einer Konsumgesellschaft getappt sind, werden sie es tun und Formen finden, sich aus der Umklammerung zu lösen, die ihre aufrichtigen Proteste in Wortgeklingel verwandelt. Dann wird der Krieg mit neuem Ingrimm aufflammen. Andernfalls wird die moderne Kunst keine Rolle mehr spielen in den tödlichen Kriegen politischen Engagements, die uns immer noch umgeben, und an ihre Stelle wird auf beiden Seiten der Front die reine Propaganda treten. Die Qual der Künstler, die in einem Umfeld stetig zunehmender Trivialisierung Werke von dauerndem Wert erschaffen möchten, in denen die höchsten Interessen ihres Lebens befragt, bekräftigt und vermittelt werden, ist nur ein beklagenswerter Aspekt jener Sprachverwirrung, in welcher der Krieg zwischen den immer wieder neuen Modernisten und ihren jeweils erneut selbsternannten konservativen Kritikern ausgetragen wird. In diesem Jahrhundert sind zwei Weltkriege und eine ganze Anzahl regionaler Konflikte mit einer fanatischen Unbarmherzigkeit ausgefochten worden, an denen die Künste, die gegensätzliche Utopien schilderten, mit ihrer eigenen Unbarmherzigkeit teilgenommen haben. Diktatoren, durchdrungen von revolutionärem Eifer, unterstützten die Argumente der Feinde der modernen Kunst und sorgten mit Zwang dafür, daß diese als absolute und staatstragende Wahrheiten akzeptiert wurden. Ihr Krieg gegen die Künstler wurde als Säuberung durchgeführt. Die Verfolgung moderner Künstler führte zur Zerstörung ihrer Karrieren und Werke, sie wurden verfemt, ins Exil und sogar in den Tod getrieben. Allein schon die Erinnerung an diese Märtyrer gebietet es, daß wir uns mit sorgenvollem Interesse den Zeugnissen der Auseinandersetzung, des tödlichen Kampfes zwischen militanten Modernen und ihren militanten Kritikern zuwenden. Die Künste sind traditionsgemäß Töchter des Friedens. Ihre Stimmen bieten uns Trost und spenden uns Segen. Jetzt aber stacheln sie nur allzu oft in ihrem Trachten nach sozialer Gerechtigkeit und Freiheit zur Rebellion auf, oder aber mit ebenso schriller Stimme im Namen von Recht und Ordnung zur Unterdrückung. Schon der
Ph. Fehl: Drei Ebenen von Piatons
Höhle
137
Kriegslärm formt oder vernichtet unsere Fähigkeit, als unabhängige Individuen auf Kunstwerke zu reagieren. Wir werden in den Dienst parteiischer Bewegungen gestellt, die über die Welt des schönen Scheins hinausreichen, in welcher die Künste ihren Zauber ausüben, und die von uns Treue und Gehorsam in einer Welt politischer oder kriegerischer Handlungen verlangen. Wenn wir den Kampf ignorieren, geht uns der Zugang zu Kunstwerken mit sozialem Anliegen verloren. Wenn wir uns ins Gefecht stürzen, begeben wir uns des Rechts, zwischen Kunst und Propaganda zu unterscheiden. In beiden Fällen hat das die Blindheit der Kritik zur Folge. Der Historiker, der keine Partei ergreift, übernimmt das Steuer und produziert Kataloge, auf den Markt zugeschnittene Chroniken mit lauter bunten Bildern. Bis vor kurzem war es den Freunden moderner Kunst möglich, in ihr eine klare und deutliche Kraft zur Förderung von Fortschritt, Freiheit und Gerechtigkeit für alle zu sehen. Es erhielt sich ein Mythos, der die offenen oder freien Formen der modernen Kunst mit dem Kampf um den Erhalt oder die Entwicklung der Demokratie auf der Welt verknüpfte und die mehr oder weniger realistische Darstellung der Natur sowie die Verwendung klassischer Stile in der Archtitektur mit dem Eintreten für den Faschismus und den ebenso diktatorischen Kommunismus verband. Bücher wie Art under a Dictatorship von Hellmut Lehmann-Haupt 3 und Siegfried Giedions unglaublich einflußreiches Space, Time and Architecture4 haben den Mythos artikuliert und gefördert, wie auch die wiederholten Wiederauflagen - mit umgekehrten Wertsignalen - der Nazi-Ausstellung „Entartete Kunst". 5 Was die Diktatoren ablehnten, war offenkundig gut für Freiheit und Fortschritt, was sie jedoch unterstützten, offensichtlich reaktionär. Das geduldige Studium der Zeugnisse hat den Mythos platzen lassen. Wie sich herausstellt, waren viele Modernisten frühe oder späte Anhänger des Faschismus, nicht nur als Opportunisten, sondern aus ganzem Herzen mit dem aufrichtigen revolutionären Engagement ihrer Kunst; und der frühe Kommunismus, der die moderne Kunst gefördert hatte, war ebenso blutdürstig und diktatorisch wie der späte Kommunismus, der aus seinen eigenen Gründen seine modernen Künstler verschlang.
Hellmut E. Lehmann-Haupt, Art under Dictatorship, New York 1954. Siegfried Giedion, Space, Time and Architecture: The Growth of a New Tradition (The Charles Eliot Norton Lectures for 1938-39), Cambridge, Mass. 1941 (viele Neuauflagen). Deutsche Ausgabe: Raum, Zeit, Architektur, Ravensburg 1965. 5 Siehe zum Beispiel Gerhard Fehl, „Die Moderne unterm Hakenkreuz" in: Faschistische Architektur, hrsg. von Hartmut Frank, Hamburg 1985, S. 88-122; Igor Golomstock, Totalitarian Art in the Soviet Union, the Third Reich, Fascist Italy and the People's Republic of China, London 1991; Nationalism in the Visual Arts (Studies in the Visual Arts, Band X X I X [1991]), hrsg. von Richard Etlin, Washington, D.C. 1991; Günter Metken, „Kunst zu Zeiten der Diktatur", in: Merkur, Heft 12, 50. Jg., Dez. 1996, Nr. 573, S. 1091-1102. Siehe auch Imagining Modern German Culture, 1889-1910, hrsg. von Françoise Forster-Hahn (Studies in the History of Art, 53 [Symposium papers / Center for Advanced Study in the Visual Arts; 31]), Washington, D.C. 1996.
3 4
138
II Zur Kunst
Wir stehen nun da mit den Trümmern des verlorenen Mythos, der uns so unbeschwert in die Reihen der Moderne einrücken ließ, aber wir wissen nicht so richtig, was wir mit ihnen anfangen sollen. Lange bevor der Mythos entlarvt wurde, hat Edgar Wind dieses Dilemma in seinem Buch, das er treffenderweise Art and Anarchy nannte, antizipiert.6 Er sah den Widerstreit von Alt und Neu im Kontext des problematischen Wesens der Künste überhaupt, ihr Versprechen und - da sie Maschinen unserer Phantasie in Bewegung setzen - ihre Gefahren für unsere Vernunft so gut wie unsere Werte. Nur wenn wir ein gewisses Maß an Klarheit über jene ursprüngliche Herausforderung an die jeweilige Tradition erreichen, können wir hoffen, Kunstliebhaber und verantwortungsbewußte Kritiker im Kampf zwischen der modernen Kunst und ihren Gegnern zu werden.
Piatons erste Höhle und die Verteidigung der Kunst Edgar Winds Argument führt uns zurück zu Piatons Höhle. Ich folge seinem Beispiel. Die Bilder, welche die Gefangenen an die Wand vor sich projiziert sehen, sind nur die Schatten wirklicher Gegenstände, doch das wissen sie nicht, und so verwechseln sie die Schatten mit der wirklichen Wahrheit. Die Projektion der Schatten auf die Wand funktioniert auf unheimliche Weise wie die Lichtbildvorführung in einem abgedunkelten Hörsaal für Kunstgeschichte, nur daß wir es schlechter machen als der Vorführer in Piatons Höhle. Er zeigt wirkliche Gegenstände, wir zeigen Schatten von Bildern, die von Bildern gemacht wurden, die selbst wiederum die Schatten der Schatten sind, die an der Wand der Höhle erscheinen. Und doch sind es diese armseligen Schatten von Schatten, in welchen die Liebhaber von Kunst und Poesie in voller Kenntnis der Beschränkung, welche die Höhle ihnen auferlegt, einen Anblick der Wahrheit, die hinter den Schatten liegt, zu erhaschen behaupten. Mit Hilfe von Bildern beleben wir unsere Phantasie. In der Nachfolge von Piatons Verbannung der Bilder und in Ehrfurcht vor dem Zweiten Gebot, das verbietet, sich ein Bild zu machen, achtete man darauf, daß der Betrachter das Bild eines Gegenstands nicht für den Gegenstand selbst hielt. Die Nachahmung war zwar bestrebt, lebendig und überzeugend zu sein, aber nicht zu täuschen - und wenn, dann nur bis zu einem gewissen Grade und im Scherz. Lebendigkeit sagte die Wahrheit im Spiel mit der Wahrheit. In seinem Bemühen, den Kult der Götter6
Edgar Wind, Art and Anarchy (The Reith Lectures 1960, revised and enlarged), London 1963. Deutsche Ausgabe: Kunst und Anarchie (Die Reith Lectures 1960, Durchgesehene Ausgabe mit den Zusätzen von 1968 und späteren Ergänzungen), Frankfurt/M. 1994. Zur Grundlage von Winds Argument siehe vor allem seinen Essay „On Plato's Philosophy of Art", in: Edgar Wind, The Eloquence of Symbols: Studies in Humanist Art, hrsg. von Jaynie Anderson, Oxford 1983 (durchgesehene Ausgabe 1992), S. 1-20.
Ph. Fehl: Drei Ebenen von Piatons Höhle
139
statuen gegen den Spott von Christen und Juden zu verteidigen, hat Julianus Apostata es so ausgedrückt: Wenn wir also auf die Statuen der Götter blicken, laßt sie uns nicht bloß für Steine und Holz halten; allerdings auch nicht für die Götter selbst. Wir sagen ja auch nicht, die Kaiserbilder seien ein Stück Holz oder Stein oder Erz, aber freilich auch nicht, sie seien die Kaiser in Person, sondern nur deren Abbilder. Wer demnach seinen Kaiser liebt, betrachtet mit Freude das Bild des Kaisers, wer sein Kind liebt, betrachtet mit Freude das Bild seines Kindes, wer seinen Vater liebt, das seines Vaters. Wer folglich Gott liebt, der blickt mit Freude auf die Statuen und Bilder der Götter, von frommer Scheu und zugleich Schauder vor diesen Göttern erfüllt, die, wiewohl selbst unsichtbar, auf ihn schauen.7 Die christliche Kirche übernahm dieses Argument von Julianus und untermauerte damit ihren eigenen Bilderkult, in dem die Abbildungen durch das, was sie darstellen, mehr als Bilder und doch nur Schatten der Wahrheit sind.8 Sie beschwören das Heilige, sind aber für sich genommen nur Gegenstände. Aber wenn ich ein Bild meines Vaters sehe, auch wenn es nur eine Photographie ist, die ihn als lebendigen Menschen zeigt - „so saß er, so ist er immer gegangen" - , ist es auch so, als ob ich ihn reden hören könnte und er mir voller Liebe weitergibt, was er über das Leben wußte und wie man es erträgt. Selbst Porträts von Fremden, von denen wir nichts weiter wissen, als daß sie längst tot sind, können uns auf ähnliche Art und Weise rühren; sie sprechen uns aus dem Jenseits auf die Weise an, wie sie auf ihren Bildern lebendig erscheinen. Die Verteidigung der Poesie, die auch eine Verteidigung der pictura ist, hat sich immer auf diesen Erinnerungsaspekte der Kunst berufen.9 Bilder können Abwesendes herbeirufen, sie können zeigen, was vor langer Zeit geschehen ist, was nie geschieht, was in der Zukunft geschehen wird, sie können das Unsichtbare sichtbar machen, sie können einen Charakter schildern und die Natur erkunden, sie können zur Tugend mahnen, sie können uns dazu führen, daß wir das Laster erkennen und verabscheuen, sie können uns
7
Kaiser Julian der Abtünnige. Die Briefe. Eingeleitet, übersetzt und erläutert von Lisette Goessler, Zürich und Stuttgart 1971, S. 132 ff. Siehe auch Philipp Fehl, The Classical Monument: on the Connection
between
Morality and Art in Greek
S. 6 0 - 6 2 ; Julius A . Elias, Plato's Defense Poetry from Homer
an Roman
Sculpture,
Reflections
N e w York 1972,
of Poetry, Albany, N . Y . 1984; Louise H . Pratt, Lying
to Pindar: Falsehood and Deception
and
in Archaic Greek Poetics, Ann Arbor 1993;
Niall Rudd, „Horace as a Moralist", in: Horace 2000. A Celebration,
hrsg. von Niall Rudd, London
1993, S. 64-81. 8
Siehe Jaroslav Pelikan, Imago Dei: The Byzantine Apology for Icons, N e w Haven, Conn. 1990.
9
Siehe vor allem Sir Philip Sidney, The Defence
of Poesie, London 1595. Zur Uberlieferung im klas-
sischen Altertum siehe Franciscus Junius the Younger, The Literature
of Classical Art, hrsg. von
Keith Aldrich, Philipp Fehl, Raina Fehl, Berkeley, Cal. 1992, Band I, X X I - X X V I .
140
II Zur
Kunst
trösten und entzücken, doch alles das selbstverständlich unter der Bedingung, daß ihre Wahrheit nur dann hervortritt, wenn wir erkennen, daß sie uns in der Maske der Fiktion vorgeführt wird. D a lebendige Bilder überzeugend sind, ist es in diesem Geben und Nehmen von Illusionen auch nötig, daß wir zu unterscheiden versuchen zwischen lügenhaften Illusionen, die uns unseres freien Willens berauben wollen, und Illusionen, die uns auf den Pfad zu Wahrheit und Tugend führen. „Wer die Malerei nicht schätzt, verschmäht die Wahrheit" sagt Philostratos der Altere in der Vorrede zu seinen Imagines/Eikones, „und versündigt sich auch am Kunstverständnis, das die Dichtung angeht; denn beide Künste wenden sich den Taten und Gestalten der Heroen zu; er hat auch kein Gefallen am Ebenmaß, durch das die Kunst auch am Logos teilhat." 10 Philostratos fordert Piaton spielerisch heraus. Er erkennt die Gültigkeit von Piatons Vorbehalten in seinen Beschreibungen oder, besser gesagt, in seinen Beschwörungen der Bilder, die er mit Worten zum Leben erweckt. Viele von ihnen ergreifen uns wie die Bilder, die Ovid mit Worten in seinen Metamorphosen malt. Es wird nicht von uns erwartet, daß wir an die Verwandlungen glauben, aber sie geschehen vor unseren Augen. Mitgefühl erfaßt uns, daß junge Liebende sterben müssen, und wir sind gerührt vor Dankbarkeit und Bewunderung, daß sie in Schönheit sterben und Blumen uns an sie erinnern; daß sie in ihren Denkmälern weiterleben, in der Schönheit des sich immer wieder von selbst erneuernden Lebens eines Gartens. Wenn Philostratos uns Eroten beim Spiel zeigt, die einander goldene, rote und gelbe Äpfel zuwerfen und auffangen, hält er den Knaben, der ihn bei seinem Besuch in der Galerie begleitet, in der die Bilder sind, die er uns zeigt, dazu an, den Duft dieser Äpfel zu riechen, „oder riechst du noch nichts?" Der Knabe läßt sich überzeugen, und er riecht den Duft. 11 Aber er kann die Äpfel selbstverständlich nur riechen, weil er sie sieht; müßte er mit geschlossenen Augen vor dem Bild stehen, würde er keinen Duft wahrnehmen. Es ist alles schöner Schein und doch eine Wahrheit. „Wer sich von der Kunst täuschen läßt," hat Gorgias gesagt, „ist weiser als jener, der sich nicht täuschen läßt 1 2 . „Täuschen", ja „Hinters Licht führen", nein. Wie schon oft in der Tradition der „Verteidigung der Poesie" gezeigt worden ist, benutzt auch Piaton selber lebensvolle Bilder, um seinen Dialogen Leben einzu-
10 Philostratos, Die Bilder,
hrsg., übersetzt und erläutert von O t t o Schönberger, München 1968,
S. 85. Siehe auch Philipp Fehl, Decorum
and Wit: The Poetry of Venetian
Painting,
Wien 1992,
S. 6 4 - 6 7 , 7 1 - 7 5 , 8 2 - 8 4 . 11
Philostratos, Die Bilder (wie Anm. 10), S. 99.
12 Bei zwei Gelegenheiten von Plutarch überliefert. Mor. 15 C - D und 348 G. Man siehe die Ubersetzung des gesamten Textes von Franciscus Junius. „Of Tragedies doth Gorgias also say very properly, that they are a kind of deceit, by which the deceived likewise is more just than he that doth not use such deceit; and the deceived likewise is wiser then he that is not deceived". Junius, ture (wie Anm. 9), Band I, S. 51.
Litera-
Ph. Fehl: Drei Ebenen von Piatons Höhle
141
hauchen, um zu lehren und um das Andenken an Sokrates zu feiern. Wer kann sein Bild des alten Kephalos zu Beginn von Der Staat vergessen, des liebenswürdigsten aller schönen alten Männer, gesittet, tugendhaft, fromm und mit freundlichem Lächeln? Sokrates begegnet ihm mit äußerster Achtung und sogar zärtlicher Liebe. Als das Streitgespräch des Buches „Was ist Gerechtigkeit?" so richtig anfängt, beteiligt sich der alte Mann nicht. Er geht hinaus, um ein Opfer darzubringen, und überläßt die anderen der Diskussion.13 Aber Piaton will, daß wir den ganzen Staat hindurch des Kephalos gedenken. Was Kephalos, der sozusagen vor dem Sündenfall lebt, von Natur aus tut, indem er seine äußerst feine Frömmigkeit ausübt, müssen wir wiedererlangen durch die Reaktion auf Sokrates' bohrende Fragen, die jeden Teilnehmer an dem Dialog prüfen und ihm darin seinen Platz zuweisen, von denen ein jeder so wie in einem Gemälde dargestellt wird, und uns zu wachsen hilft, während wir mitdenken, unsere eigenen Antworten ausprobieren und zuschauen, während wir zuhören. Wir dürfen nicht vergessen, daß der Dialog, die Szene seines Anfangs, mit der Andeutung eines Landschaftsgemäldes beginnt, als Sokrates und Glaukon auf dem Rückweg von Piräus sind. Das Bild des Kephalos aber ist ein liebevoll gemaltes Porträt, eingebettet in eine Genreszene. Es könnte sozusagen von Chardin stammen, oder auch, wenn wir seine Bilder mit den Augen Diderots sehen, von Greuze. Selbstverständlich wird Homer mit allen Ehren (ein weiteres Bild!) aus dem Staat hinausgeführt. Doch wollen wir nicht vergessen, daß Aristoteles ihn zurückbringt, geläutert zwar, denn er ist keine religiöse Autorität mehr, doch dafür in einer neuen und viel echter strahlenden Persona als Dichter.14 Dort, im Reich der Fiktion und der mit Worten gemalten Bilder, sagt er die Wahrheit, selbst wenn er schlummert. Rembrandts Gemälde mit dem vorsichtigen Titel „Aristoteles mit der Büste Homers" zeigt vielleicht den Augenblick, als Aristoteles, Piatons größter Schüler, sich zur Verteidigung Homers entschließt und im Hinblick darauf, sowohl kritisch wie beifällig, die Poetik zu schreiben und mit diesem Werk den Schönen Künsten eine Verfassung zu geben.15 Das Pantheon der Bilder in Piatons Höhle ist gefüllt mit Kunstwerken, die über sich selbst hinaus auf die Wahrheit verweisen, die wir kennen müssen, wenn wir die Kunst des gerechten und großmütigen Lebens beherrschen wollen. Darunter sind berühmte Meisterwerke, wie Raffaels „Disputa" und Michelangelos „Jüngstes Gericht", mit denen Generationen von Künstlern und Kunstliebhabern, solange
13 Platon, Politeia, I 328a-331d. 14 Vgl. vor allem Aristoteles, Poetik, 48a. 19-24, 55a. 22-34, 59a. 30-67, 60a. 5-11 und den Kommentar von Gerald F. Else, Aristotle's Poetics: the Argument, Leiden 1957. Zusätzliche bibliographische Hinweise bei Junius, Literature (wie Anm. 9), Band I, xxiii Anmerkungen 3—4. Homers Wahrheit bzw. Suche nach Wahrheit wird vom Standpunkt der Platonischen Dialoge lebendig dargestellt und untersucht von Seth Benardete, The Bow and the Lyre: A Platonic Reading of the Odyssee, Lanham, MD und London 1997. 15 Junius, Literature (wie Anm. 9), S. LIV-LV.
142
Π Zur Kunst
die akademische Tradition erhalten blieb, in das Verstehen des Erhabenen eingeführt worden sind. Aber dort sind auch viele Bilder, welche die Lebenswahrheit in Stilen darstellen, die weit vom Heroischen entfernt sind, aber doch lehrreich, geistreich und voller Witz oder reich an Tränen sind. Wie die Genres, die Gattungen der Literatur, haben sie alle ihre moralischen Stärken und werden im Leben ihrer Art geschützt durch die großen Gemälde und Skulpturen, welche die Bühne bereitet haben für unsere Begegnung mit dem Erhabenen mittels der Kunst. Die sogenannten „Kleinen Meister" sind keine Zwerge, sondern, gesehen durch ihren eigenen Geist, Schüler der großen Meister, denen sie Tribut zollen, indem sie vervollkommnen, was sie können, in dem Genre, das ihrem eigenen Genius entspricht.16 Es ist eine idyllische Welt, was die Kunst angeht, diese Erste Ebene von Piatons Höhle, reich an Fenstern, geschaffen von Bildern, die uns den Blick durch die Wände der Höhle gewähren, auch wenn wir in Wirklichkeit nicht aus der Höhle hinaus und hinein in die Welt gehen können, die dahinter liegt. Es gibt eine Grotte in der Höhle, wohl ziemlich an ihrem Rande, wo sich die Kunsthistoriker der Vergangenheit versammeln oder vorbeischauen und über die Kunst und deren Schicksal reden. Es sind fast alles Maler, die sich der Geschichte der Kunst zugewandt haben, um große Vorbilder besser zu verstehen und von ihnen zu lernen. Vasari hat einen Ehrenplatz inne und erinnert sich der Aussprüche Michelangelos; Carlo Ridolfi ist da und spricht von Tizian, Tintoretto und Paolo Veronese; und einer der Jüngsten unter den Alten ist Sir Joshua Reynolds, der immer noch eine neue Auflage seiner Discourses korrigiert, die seine Huldigung an Vasari und sein Geschenk an die Kunst des Denkens über die Kunst sind und der gerechte Unterschiede zum Nutzen der Nachwelt trifft, die sich kaum daran erinnert, davon Gebrauch zu machen.17 Gelegentlich schaut Alexander Pope vorbei und liest zu Vasaris Freude (Reynolds übersetzt für ihn) aus seinem Essay on Man und seinem Essay on Taste. Auch Pietro Aretino schließt sich der Gesellschaft der Großen an, obwohl die Inquisition nach seinem Tode alle seine Werke auf den Index der verbotenen Bücher gesetzt hat.18 Sie diskutieren mit ihm, vielleicht im Flüsterton, was wann und wo in Kunst und Literatur laut ausgesprochen werden darf. Das Skurrile wie das Würdige hat
16 Siehe Philipp Fehl, Sprezzatura by Apelles, Raphael,
and the Art of Painting Finely: Open-ended
Michelangelo,
Titian, Rembrandt,
Narration
in Paintings
and Ter Borch (The Ninth Gerson Lec-
ture), Groningen 1997, S. 34 ff. 17 Vgl. die bahnbrechenden Studien von Edgar Wind über Reynolds und die Künste in Britannien im 18. Jahrhundert, gesammelt in Hume
and the Heroic Portait: Studies in Eighteenth-Century
Ima-
gery, hrsg. von Jaynie Anderson, Oxford 1986. Zu Reynolds, siehe vor allem S. 19-99. 18 Siehe Mark Roskill, Dolce's „Aretino"
and Venetian
Art Theory of the Cinquecento,
1968; Luba Freedman, Titian's Portraits in the Lens of Aretino, 1 4 5 - 1 6 0 ; Fehl, Decorum
and Wit (wie Anm. 10), S. 152-197.
New York
College Park, Pa. 1995, S. 9 - 6 8 ,
Ph. Fehl: Drei Ebenen von Piatons Höhle
143
seinen Platz in der Welt der Imagination, die Wahrheit und Schicklichkeit zu entdecken trachtet, selbst negative Schicklichkeit, in der Behandlung von Gegenständen gemäß ihrem Rang in der Wertehierarchie. Manchmal wendet sich das Gespräch in der Grotte dem Lauf der Kunstgeschichte zu. Mit Ausnahme von Meinungsverschiedenheiten über den wahren Wert des einen oder anderen Künstlers herrscht am Tisch große Einmütigkeit. Es gibt nun einmal gewisse Fertigkeiten, die der Künstler braucht, um die Natur überzeugend darstellen zu können. Diese Fertigkeiten können erlernt werden - sie waren bereits in der Antike bekannt —, und sie können poetisch eingesetzt werden, um Herz und Seele des Betrachters zu bewegen. Zu ihrer Entwicklung bedarf es Generationen, und wie das Beispiel der Antike zeigt, können sie auch verlorengehen. Manchmal, worauf Vasari gerne aufmerksam macht, braucht es bloß eine Generation mangelnder Förderung, um eine blühende Kunst auf dem Höhepunkt ihrer Ausübung zu zerstören. So etwas ist praktisch in seiner eigenen Zeit passiert. Als Hadrian VI 1522 auf den kunstliebenden Leo X folgte, zeigte er kein Interesse für die Kunst. Er hielt sie wahrscheinlich für puren Luxus. Infolgedessen kehrten die Künstler Rom den Rücken, und es verschwanden die Fertigkeiten, von denen die Kunst lebt. Der Schaden wurde zwar unter Clemens VII behoben, aber die Erinnerung daran, daß plötzlich Wüste herrschte, wo einst die Kunst geblüht hatte, sorgte für Schrecken. 19 Eine berühmte Passage in der Naturgeschichte des Plinius berichtet, daß unter einem gewissen Kaiser die Kunst des Bronzegießens verschwand - cessavit ars - , und zeigt, daß so etwas auch schon in der Antike vorgekommen ist.20 Aufgemerkt, Mäzene! Die Künste brauchen zarte Pflege, zarte, aber urteilsstarke Pflege. Nicht nur der Mangel an Aufträgen, jähe Katastrophen und Kriege zerstören die Künste oder unterbrechen den Lauf ihres Fortschritts, der die Menschheit zivilisiert, sondern auch Luxus und Eitelkeit, zu der Künstler ebenso neigen wie ihre Gönner. In solchen Fällen ist die Kunst in Gefahr, ihre hohe Berufung zu verraten, sie verkauft ihr Können zugunsten pompöser Effekte, und sämtliche Verbote in der Bibel und bei Piaton sind gerechtfertigt. Ohne zu moralisieren haben Dichter und Künstler mit ihrem Können eine moralische Berufung, und die Ausbildung der Kunststudenten sollte das im Sinn behalten und der Jugend einprägen. Bei Vasari finden sich unendlich viele Anekdoten, die diese Lektion erteilen. Die Gründung von Akademien, deren Initiator Vasari war, ist ein Vorbeugemittel gegen den moralischen Verfall der Künste.21 19 G i o r g i o Vasari, Le Vite de'più eccelenti architetti, pittori et scultori italiani, da Cimabue insino a' tempi nostri, hrsg. v o n G . Milanesi, Florenz 1906, Band V , S. 527. Siehe auch Patricia Lee Rubin, Giorgio Vasari, Art and History, N e w Haven und L o n d o n 1995. 20 Plinius, Naturgeschichte, X X X I V . 19.52. Siehe auch Philipp Fehl, „Vasari and the Arch of Constantine", in: Istituto Nazionale di studi sul rinascimento, Giorgio Vasari tra decorazione ambientale e storiografia artistica, hrsg. v o n G i a n C a r l o Garafagnini, Florenz 1985, S. 2 7 - 4 4 . 21
Margaret u n d Rudolf W i t t k o w e r , The Divine Michelangelo: The Fiorentine Academy's Homage on His Death, 1564, L o n d o n 1964; Rubin, Giorgio Vasari (wie A n m . 19), S. 1 2 - 8 5 , 3 7 9 ^ 0 1 .
144
II Zur Kunst
An dieser Stelle nickt Reynolds nachdrücklich mit dem Kopf; er hat einen König zum Gönner seiner Royal Academy, die das Ziel hat, den Ruhm und die Tröstungen einer Kunst nach Britannien zurückzubringen, die es in Rubens und Van Dycks Tagen ausgezeichnet hatte - ein Ruhm, der ausgelöscht wurde in der Raserei und dem bitteren Ernst des Bürgerkriegs und in der absoluten Ablehnung, die die Puritaner für den Zauber der Bilder hegten.22 Ich kenne keine größere Huldigung Reynolds' und der Akademie als das Gemälde von Constable, „Reynolds' Kenotaph" (Abb. 1). Wir erblicken eine Landschaft in einem Park; es ist Herbst, die Bäume öffnen sich zu einer Lichtung, und dort, in der Mitte des Gemäldes, steht das einfache Kenotaph mit dem Wort Reynolds. Links und rechts davon bemerken wir jeweils eine Herme. Die eine zeigt die Büste Raffaels, die andere die Michelangelos. Ein Hirsch ist an diesen ruhigen Ort gekommen, er verharrt still und schaut uns an. Das Gemälde ist der Tribut des Landschaftsmalers an die Verteidigung der Historienmalerei und unser Wegweiser zu den befreienden Werken Michelangelos und Raffaels. Die Landschaftsmalerei, scheint das Bild zu sagen, verdankt ihren Sinn, ihre Berufung dem, was Reynolds in der Akademie gelehrt hat.23 Constable mußte verwandeln, was er gelernt hatte, um es seinem Genre anzupassen; er schuf etwas Neues, weil er zu lieben gelernt hatte, was alt und groß war; und das hatte er an dessen innerem Sinn und nicht nur an der Form erkannt. Ein solches Wissen um die Kunst wollte Reynolds in seinen
22 „Blake and Reynolds", in: Wind, Hume (wie Anm. 17); Philipp Fehl, „Poetry and the Entry of the Fine Arts into England: Ut pittura poesis", in: The Age of Milton, hrsg. von C. A. Patrides und Raymond B. Wadddington, Manchester 1980, S. 273-306. 23 Constables Bild zeigt ein Kenotaph zur Erinnerung an Reynolds, das Constables Freund Sir George Beaumont in seinem Park in Coleorton errichten ließ. Es trägt als Inschrift ein Gedicht von William Wordsworth, das im Namen von Beaumont eine Lobrede auf Reynolds spricht: „YE Lime-trees ranged before this hollowed Urn..." (The Complete Poetical Works of William Wordsworth, hrsg. von John Morley, London 1924, S. 405). In einem Brief aus Coleorton an seine Frau äußert sich Constable 1823 mit herzlichen Worten über das Kenotaph und das Gedicht. Siehe C. R. Leslie, Memoirs of the Life of John Constable, London 1912, S. 95. Die Hermen des Michelangelo und Raffael, die das Kenotaph auf Constables Gemälde einrahmen, befinden sich nur dort und sind vermutlich Constables Erfindung und zeugen von seiner besonderen Hochachtung für Reynolds' Discourses und seine Überzeugungskraft als Künstler. Siehe Basil Taylor, Constable. Paintings, Drawings and Watercolors, London 1975, S. 213. Constable machte im November 1823 eine erste Zeichnung des Kenotaphs. Er begann das Gemälde 1833 und vollendete es 1836. Siehe Graham Reynolds, The Later Paintings of John Constable, London 1984, S. 285-286. Graham Reynolds weist darauf hin, daß über dem Eingang zur Royal Academy im Somerset House sich eine Michelangelo-Büste von Joseph Wilton befand, eben jene Büste, die Sir Joshua Reynolds in sein Selbstbildnis aufnahm. Die Raffael-Büste, führt Reynolds aus, wurde wahrscheinlich aus Gründen der Balance in das Bild aufgenommen. (Sie geht auf die Raffael-Büste zurück, die Carlo Maratta für das Pantheon in Rom angefertigt hatte.) Wir dürfen hinzufügen, daß Constables „Balance" auch eine moralische ist und im Einklang steht mit dem Ort und dem Lob, denen Sir Joshua Reynolds in seinen Discourses Raum gewährte.
Ph. Fehl: Drei Ebenen von Piatons Höhle
A b b . 1. J o h n C o n s t a b l e , Tbc Cenotaph
to Reynolds'
Memory.
145
Coleorton
London, National Gallery
Discourses erläutern und dies lehrt auch Vasari über die Kunst, ihre Geschichte und ihre Gattungen, wenn wir ihn zu lesen lernen, nicht nur im Licht der Discourses, sondern auch im Lichte von Reynolds' Gemälden.
146
II Zur Kunst
Bisweilen empfangen die versammelten Kunstschriftsteller Gäste in ihrer Grotte. Einer der letzten Besucher war vielleicht Denis Diderot, der sie mit seinen Salons und dem Vortrag seines Essai sur la peinture erfreute. Für ihn, wie für die Maler, sind Poesie und Malerei eins, und er zieht Lehren aus den Bildern, die er im Geiste des Philostratos mit einer sinnlichen Lebendigkeit beschreibt, die seinem Genius eigen ist. Ich zitiere eine Passage aus dem Essai sur la peinture. Er spiegelt wie ein facettenreicher Diamant, der sich im Licht bewegt, das Licht, das in den Werken der großen Maler leuchtet. Diderot nimmt einen Standpunkt gegen die Moralisten ein, spricht aber für die höhere, die innere moralische Verpflichtung der Künste, das Herz ihrer gesellschaftlichen Gültigkeit, nicht nur in Piatons Höhle, sondern auch im Leben der Völker, der Staaten, denen sie, die Künste, dienen und in denen sie gedeihen: Ich bin nicht engherzig. Ich lese bisweilen meinen Petronius. Die Horazische Satire von ambubaiae [Sat. 1,2] gefällt mir mindestens ebensogut wie die anderen. Von den kleinen frechen Madrigalen Catulls kenne ich drei Viertel auswendig. Wenn ich mit meinen Freunden beim Picknick sitze und der Kopf vom Weißwein etwas erhitzt ist, zitiere ich ohne Erröten ein Epigramm von Ferrand. Ich verzeihe dem Dichter, dem Maler, dem Bildhauer und selbst dem Philosophen gern einen Augenblick der Hingerissenheit und Tollheit, aber ich wünsche nicht, daß man seinen Pinsel immer an dieser einen Stelle eintauche und den Zweck der Kunst ins Gegenteil verkehre. Einer der schönsten Verse Vergils, der zugleich eines der schönsten Prinzipien der nachahmenden Kunst enhält, ist dieser: Sunt lacrimae rerum, et mentem mortalia tangunt. [Für Unglück gibt es Tränen, und Menschliches rührt an die Herzen.] Man sollte über die Tür zu seinem Atelier die Worte schreiben: Unglückliche finden hier Augen, die sie beweinen.24 Diderots Zitat stammt vom Anfang der Aeneis (1.462). Aeneas und sein Freund Achates, beide unsichtbar gemacht von einer Wolke, mit der die Göttin Venus sie umhüllt hat, stehen als Kundschafter in Karthago vor dem neuerbauten Tempel der Juno. Dort sehen sie an den Toren die bildliche Darstellung der Schlacht um Troja und Trojas Zerstörung. Als Aeneas das Bild vom Tode des Priamus sieht, kann er seine Tränen nicht zurückhalten, fordert dann aber Achates auf, guten Mutes zu sein, denn ein Volk, das mit solchem Mitgefühl ein fremdes Leid schildern kann, werde sie und die Gruppe von Flüchtlingen, mit denen Aeneas gerade in Afrika
24 Denis Diderot, Essai sur la peinture, aus dem Salon von 1765, veröffentlicht zuerst 1766. Hier zitiert nach: Denis Diderot, „Versuch über die Malerei", in: Ästhetische Schriften, Band 1, herausgegeben und übersetzt von Friedrich Bassenge und Theodor Lücke, Berlin/Weimar und Frankfurt/M. 1968, S. 676. Siehe auch Jean Seznec, Essais sur Diderot et l'antiquité, Oxford 1957.
Ph. Fehl: Drei Ebenen von Piatons Höhle
147
gelandet ist, freundlich empfangen. Dann spricht er die Worte, die wir gerade gehört haben. In Diderots lebhaftem Lob werden diese Worte zu einem glänzenden Schild, der die humanisierende Macht und Mission der schönen Künste verkündet.
Die verwandelte Höhle Piatons: Die Höhle unter der Höhle Nach Diderots Besuch wurde es in der Grotte ziemlich still. Es kamen immer weniger Besucher. Einer der letzten Kunsthistoriker, die sie aufsuchten, um etwas zu lernen, war vielleicht Johann Dominicus Fiorillo, zu Beginn des 19. Jahrhunderts.25 Fiorillo, der in Göttingen lebte und wirkte, war der erste ordentliche Universitätsprofessor für Kunstgeschichte an einer Universität, und somit hat Göttingen die Ehre, Pionier in der Institutionalisierung der Profession gewesen zu sein. Aber Fiorillo war eigentlich zuerst und vor allem Maler, wenn auch nur wenige Bilder von ihm erhalten sind. Er hatte in Italien bei Pompeo Batoni Malerei studiert, und durch ihn fand er Zugang zu der Tradition, die durch die Kunsthistoriker-Maler und Akademiemitglieder repräsentiert wird, welche in der Grotte am Außenrand von Piatons Höhle versammelt sind. Fiorillo begann seine Laufbahn in Göttingen als Kustos der universitätseigenen hervorragenden Sammlung von Stichen und Drucken, die, wie die meisten vor dem 19. Jahrhundert angelegten Sammlungen, überwiegend aus Reproduktionen von Kunstwerken bestand. Sie bildeten die Grundlage seiner Lehre, zusammen mit einem Überblick, in Auswahl, über die gedruckten literarischen Quellen der Kunstgeschichte, das heißt, größtenteils die Bücher der Großen Alten, die wir in der von uns besuchten Grotte versammelt gesehen haben. Er beschreibt die Kunstwerke noch immer in der Tradition Vasaris; er glaubt, wenn auch nicht unkritisch, das, was die Großen Alten in ihren Werken berichten; er versetzt sich in den Geist der Künstlerlegenden, die sie erzählen; kurz, er setzt, so gut er kann, das von ihnen begonnene Werk fort und bringt es auf den neuesten Stand. Er ist ihr letzter Wortführer, aber sein Werk, das er bis zu seinem Tode im Jahr 1821 mit einer großen Gesamtschau der Geschichte der Künste in Europa vom Mittelalter bis zu seiner Zeit fortsetzte, wurde schon bald als angeblich unwissenschaftlich angegriffen, und zwar von jener entstehenden Kunstgeschichte, wie wir sie heute kennen. Man schalt ihn leichtgläubig, intolerant und ungenau und kreidete ihm ein mangelhaftes Studium der Quellen an.
25 Zur längst überfälligen Würdigung der Dominicus Fiorillo. Kunstgeschichte und Middeldorf Kosegarten, Göttingen 1997. siehe Werner Kaegi, Jacob Burckhardt, S. 681-685.
Leistungen Fiorillos als Kunsthistoriker siehe Johann die romantische Bewegung um 1800, hrsg. von Antje Uber Jacob Burckhardts Würdigung des Werks Fiorillos eine Biographie, Band VI, 2. Halbband, Basel 1977,
148
II Zur
Kunst
D i e g e s a m t e G e s c h i c h t e d e r K u n s t , s o s c h i e n es d e r n e u e n G e n e r a t i o n v o n H i s t o r i k e r n , n i c h t n u r d e r K u n s t , s o n d e r n der G e s c h i c h t e i n s g e s a m t , m ü s s e g a n z n e u i n A n g r i f f g e n o m m e n w e r d e n , u n d z w a r a u f einer w i s s e n s c h a f t l i c h o b j e k t i v e n u n d v o n G e f ü h l e n freien Grundlage.26 D i e neue L e h r e m a r s c h i e r t e n u n nach d e r M u s i k anderer T r o m m l e r in d e n K ü n s t e n . C a r l F r i e d r i c h v o n R u m o h r , d e r einst bei F i o r i l l o s t u d i e r t h a t t e , ü b e r s c h ü t t e t e ihn und seine M e t h o d e n i m N a m e n objektiver M a ß s t ä b e bei der Suche nach histor i s c h e r D e t e r m i n a t i o n u n d D e f i n i t i o n d e s S t i l w a n d e l s in d e r K u n s t m i t H o h n u n d Spott.27 Friedrich Schlegel w i e d e r u m veränderte das g e s a m t e Vokabular der moralis c h e n M a ß s t ä b e - in d e r P h i l o s o p h i e , d e r K u n s t u n d d e r S p r a c h e s e l b s t - , u m s i e in E i n k l a n g z u b r i n g e n mit e i n e m unerbittlichen W e g der V e r ä n d e r u n g in der Weltg e s c h i c h t e , i n d e r er d e n W i l l e n u n d d a s V e r s p r e c h e n d e r V o r s e h u n g a m W e r k e s a h . 2 8 B a l d s c h o n w u r d e a u f allen G e b i e t e n d e s S t u d i u m s m e n s c h l i c h e n S t r e b e n s d i e S z e n e f ü r h i s t o r i s c h e F o r s c h u n g e n d u r c h H e g e l s Philosophie
der
Geschichte
bestimmt, deren Schlußfolgerungen dann s o w o h l v o n den Parteigängern der sogenannten H e g e i s c h e n Rechten wie auch ihren T o d f e i n d e n (die t r o t z d e m dieselben Instrumente der dialektischen L o g i k benutzen), der H e g e i s c h e n „ L i n k e n " , adapt i e r t w u r d e n . 2 9 F i o r i l l o u n d d i e M e i s t e r , d i e er k o n s u l t i e r t h a t , d i e B e w o h n e r u n s e r e r G r o t t e , w e r d e n als v i e l l e i c h t i n t e r e s s a n t e S t u d i e n o b j e k t e b e t r a c h t e t , als Z e u g e n
26 Dies bleibt die vorherrschende Auffassung in Handbüchern über die Geschichte der Kunstgeschichte. Siehe, zum Beispiel, Udo Kultermann, Geschichte der Kunstgeschichte. Der Weg einer Wissenschaft, Frankfurt 2 1981, S. 161-164. Eine gerechte Beschreibung seines Werkes, die Fiorillo trotzdem noch in eine Art kunsthistorisches Niemandsland - „Am Ausgang der alten Zeit" - verbannt, findet sich bei Julius von Schlosser, Die Kunstliteratur, Wien 1924, S. 429-430. 27 Siehe Philipp Fehl, „Kunstgeschichte und die Sehnsucht nach der hohen Kunst: Winckelmann, Fiorillo und Leopoldo Cicognara", in: Johann Dominicus Fiorillo (wie Anm. 25), S. 45CM76. Zu Rumohrs Zielen als Kunsthistoriker siehe vor allem seine Italienische Forschungen, hrsg. von Julius von Schlosser, Frankfurt 1920. 28 Kultermann, Kunstgeschichte (wie Anm. 26), S. 147-149. Zur kritischen Reaktion siehe den grundlegenden Beitrag von Emil Staiger, Friedrich Schlegels Sieg über Schiller, Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Phil.hist. Klasse, Jahrgang 1981, (Bericht 3), Heidelberg 1982. Siehe auch Edgar Wind, Eloquence (wie Anm. 6), S. 15-16; ders., Kunst und Anarchie (wie Anm. 6), S. 18 f. 29 Über die Verbindung zwischen der Geschichtsphilosophie Hegels und den Ursprüngen einer modernen Kunstgeschichte in Deutschland, siehe Kultermann, Kunstgeschichte (wie Anm. 26), S. 164-174. Zur kritischen Diskussion über Hegels Einfluß siehe E. H. Gombrich, „Hegel und die Kunstgeschichte", in: Neue Rundschau, Nr. 2, 1977, S. 202-219; ders., Art History and the Social Sciences, Oxford 1976; ders., In Search of Cultural History, Oxford 1969. (dt. Ausgabe: Die Krise der Kulturgeschichte, Stuttgart 1983). Was Hegels Wirkung auf die Geisteswissenschaften und die Politik von heute angeht, siehe die inzwischen klassisch gewordenen kritischen Studien von Karl R. Popper, The Poverty of Historicism, London 1960 (dt. Ausgabe: Das Elend des Historizismus, Tübingen 1965) und The Open Society and its Enemies, London 1963. (dt. Ausgabe: Die offene Gesellschaft und ihre Feinde [2 Bde.], 71992). Siehe aber auch Reinhart Koselleck, „Vom Sinn und Unsinn der Geschichte", in: Merkur, Heft 4, 51. Jg., April 1997, Nr. 577, S. 319-334.
Ph. Fehl: Drei Ebenen von Piatons Höhle
149
der Zeit, in der sie gelebt haben, doch die Lehren ihrer historischen Werke an sich sind überholt. Sie haben in Zeiten gelebt und gewirkt, bevor die Gesetze der Geschichte und damit auch der Kunstgeschichte richtig begriffen worden sind, also in der sogenannten „Vorgeschichte der Kunstgeschichte". 30 Das Arbeitsgerät in der Lehre der Kunstgeschichte ist seit langem der Lichtbildprojektor; zwei Dias werden nebeneinander gezeigt. Die Suche nach Wahrheit in der Kunst besteht aus detaillierten Vergleichen, mit deren Hilfe die Grenzen und die Entwicklung von Stilepochen und Nationalstilen nachgewiesen werden. Jeder Stil gilt als Ausdruck einer eigenen kulturellen Zelle. Die ihm zugeordneten Kunstwerke sollen angeblich den Geist der Epoche ausdrücken, der die Schranken ihrer Vorstellungswelt bestimmt. Der freie Wille ist ein bloßes Symptom der zugrundeliegenden Bedingungen des Geistes eines Stils, der die Freiheit bestimmt. Auch die Philosophie wird somit durch die Zeit determiniert, obwohl sie wiederum auch die Motoren der Zeit antreiben kann mit einer Art von Bewußtsein, das dazu beiträgt, die Illusion des freien Willens zu schaffen. Wie die Kunstwerke einer gegebenen Epoche, wird auch sie als Symptom begriffen. Die Einteilung der Geschichte in autonome Epochen, die selbst wieder Teil des nicht rückgängig zu machenden Fließens der Zeit sind, hat auf den ersten Blick einen gewissen demokratischen Charme. Nichts und niemand wird beurteilt, doch jeder und jedes wird durch die immer feiner werdenden Definitionen der Stile betrachtet. In jeder stilistischen Einheit, die wir kennen, unterscheiden wir Untergruppen von Epochen: wir unterscheiden „früh", „mittel" und „spät". Allein „spät" ist unter diesen Einheiten von einem gewissen moralischen Nachteil belastet, weil es etwas Rückblickendes hat und dazu bestimmt ist, schon bald Platz zu machen für die frühe Phase des nächsten Stils, der in den Kulissen nur auf seinen Auftritt auf der Bühne der verfließenden Zeit wartet. Der neue Stil muß selbstverständlich im Lichte seiner eigenen Bedingungen beurteilt werden. Alle Urteile beziehen sich auf den jeweiligen Stil, und gut und schlecht besagen nur, wie gut ein bestimmtes Kunstwerk den Stilgesetzen entspricht, die ein Forscher für die fragliche Epoche aufgestellt hat. Neue Daten, neue scharfsinnige Methoden in der Kunst der Analyse von Kunstwerken erlauben dauernde Verfeinerungen und Neubewertungen in dem Maße, wie die Kunst selbst durch die Geschichte fortschreitet und auf ihren Leinwänden die Stile passieren sieht. 31
30 Siehe zum Beispiel Hans Sedlmayr, „Zu einer strengen Kunstwissenschaft", in: Kunstwissenschaftliche Forschungen, I, 1931, S. 7-23. Eine ausgewogene, wenn auch nicht ganz von Herablassung freie Bewertung („der brave Fiorillo") bei Julius von Schlosser, „Die Wiener Schule der Kunstgeschichte: Rückblick auf ein Säkulum deutscher Gelehrtenarbeit in Osterreich", in: Mitteilungen des österreichischen Instituts für Geschichtsforschung, Ergänzungsband XIII, Heft 2, 1934, S. 193 bis 210. 31 Ein beeindruckendes Ringen, auf die dieser Auffassung vom Fortschritt in der Geschichte der Kunst innewohnenden Probleme zu antworten, findet sich bei Paul Frankl, „Der Begriff der Gotik
150
II Zur
Kunst
A l s Alois Riegl eine eigenständige E p o c h e ausrief, die er „ s p ä t r ö m i s c h " nannte, u n d dieser ihr eigenes Kunstwollen32
zuschrieb, r ä u m t e er das letzte H i n d e r n i s für
eine völlig wertfreie K u n s t g e s c h i c h t e aus d e m W e g . D e r N i e d e r g a n g der K ü n s t e gegen E n d e des R ö m i s c h e n R e i c h e s war damit kein N i e d e r g a n g mehr, s o n d e r n ein Beweis für das d u r c h die Zeit fortschreitende
Kunstwollen.
Kein W u n d e r , daß es in der G r o t t e der G r o ß e n A l t e n der K u n s t g e s c h i c h t e s o still wurde. E s hatte keinen Sinn mehr, sie aufzusuchen, u m v o n ihnen zu lernen, wie man K u n s t h i s t o r i k e r w i r d u n d ist; sie lebten in der Renaissance u n d k o n n t e n ihrem Kunstwollen
e b e n s o w e n i g entrinnen wie w i r d e m unseren. D i s k u s s i o n e n mit
ihnen sind deshalb undenkbar. Andererseits lohnt es sich z u studieren, was die G r o ß e n A l t e n in ihrer Zeit gesagt und wie sie es gesagt haben; es kann zusätzliche Kenntnisse ü b e r
ihr Kunstwollen
liefern, ü b e r die spezifische
Struktur
ihrer
F r e m d h e i t . D e s h a l b schauen d o c h i m m e r wieder getarnte F o r s c h e r in der G r o t t e vorbei u n d messen die d o r t herrschende Temperatur. Falls die G r o ß e n A l t e n deren heimliche A n w e s e n h e i t ü b e r h a u p t bemerken, tun sie so, als o b sie diese ignorierten, schon u m ihren eigenen Seelenfrieden z u bewahren. V o r m e h r als fünfundsechzig J a h r e n hat der P h i l o s o p h L e o Strauss diese F o r m historischer F o r s c h u n g , die s c h o n damals die Regel in d e n „ h u m a n i t i e s " o d e r steswissenschaften
Gei-
war, wie sie vielsagend auf D e u t s c h heißen, als das Gefängnis der
und das allgemeine Problem des Stilbeginnes", in: Festschrift Heinrich Wölfßin. Beiträge zur Kunst- und Geistesgeschichte, München 1924, S. 107-125; ders., Die Entwicklungsphasen der neueren Baukunst, Leipzig 1914; ders., Das System der Kunstwissenschaft, Brünn 1938. Uber die philosophischen Voraussetzungen, auf denen die angeblichen Stilphasen in Kunst und Leben basieren, und deren Trugschlüsse, siehe Edgar Winds Einleitung zu Kulturwissenschaftliche Bibliographie zum Nachlehen der Antike. Erster Band: Die Erscheinungen des Jahres 1931. Hrsg. von Hans Meier, Richard Newald, Edgar Wind, Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg, Leipzig - Berlin 1934, S. V-XVII. Besonders zu beachten der Abschnitt „Kritik der Geistesgeschichte", S. V I I VIII. Zu einem konstruktiven neuen Ansatz in der Betrachtung der Geschichte der Kunst siehe E. H. Gombrich Art and Illusion: A Study in the Psychology of Pictorial Representation, London 1960; (dt. Ausgabe: Kunst und Illusion: Zur Psychologie in der bildlichen Darstellung, Köln 1967); ders., The Idea of Progress and their Impact on Art (The First Mary Duke Biddle Lecture, The Cooper Union School of Art and Architecture), New York 1971. Zur Geschichte der Debatte und Benedetto Croces Kampfansage an die damals neuen Methoden der Kunstgeschichte siehe Philipp Fehl, „On Virtue and Vice: Milton's Pandemonium and Bernini's Baldachin", in: W. Chandler Kirwin, Powers Matchless: The Pontificate of Urban VIII, the Baldachin and Gian Lorenzo Bemini, New York 1997, S. 235-252, 337-347, besonders S. 235 ff. 32 Siehe Hans Sedlmayr, „Die Quintessenz der Lehren Riegls", in: Alois Riegl, Gesammelte Aufsätze, hrsg. von Carl M. Swoboda, Augsburg und Wien 1928, S. X I I - X X X I V ; Otto Pacht, „Alois Riegl", in: Burlington Magazine, CV, 1963, S. 188-193 [„Art Historians and Art Critics" - VI]. Zu einer prägnanten Charakterisierung und Kritik des Konzepts „Kunstwollen" siehe Gombrich, Kunst und Illusion (wie Anm. 31 ), S. 35 ff. Zu einem neuerlichen Versuch der Rehabilitierung des Begriffes siehe Margaret Iversen, Alois Riegl's History and Theory, Cambridge, Mass. 1996. Zu Riegl siehe außerdem Wolfgang Kemp in: Altmeister moderner Kunstgeschichte, hrsg. von Heinrich Dilly, Berlin 1990, S. 37-60.
Ph. Fehl: Drei Ebenen von Piatons
Höhle
151
Zweiten Höhle Piatons bezeichnet.33 Er siedelte diese Höhle direkt unter der ersten Höhle an, die wir bereits besucht haben. In die zweite Höhle gelangt man mit einem Lift, der nur abwärts fährt, und wer je versuchen sollte, von dort wieder heraufzukommen, hat es teuflisch schwer. In dieser Höhle ist alles von der Uberzeugung gekennzeichnet, daß die an die Wände projizierten Bilder nur Bilder sind; es entspricht ihnen keinerlei Realität. Das Komitee der Historiker, das in dieser Höhle das Sagen hat, hat keinerlei Illusionen, es kennt nur Fakten und Daten, die in Reih und Glied stehen wie die spitzen Stacheln der Stacheldrahtzäune, welche die Grenzen zwischen den einzelnen Zeitzellen bilden. Grenzüberschreitungen sind unmöglich. Wenn jemand in dem großen, vom Komitee beherrschten Lager ein Fenster gefunden zu haben glaubt, durch das er aus der Höhle hinausblicken kann, zeigt er damit nur seine Illusion an. Je nachdem, in welcher Zelle er steckt, wird er entweder von der Illusionspolizei geholt, oder er wird sorgfältig als Musterbeispiel studiert, um das Illusionswollen seiner ureigenen Zelle auszumessen und aufzuzeichnen. Was ich darbiete, ist in der Tat ein Szenarium des schlimmsten Falles. Historiker und der kulturelle Relativismus haben mit ihren ausgedehnten, nie nachlassenden und bisweilen heroischen Erkundungen der weiten Fernen der Vergangenheit und der entlegenen Orte den Horizont unserer Erkenntnis über die Vielfalt, den Einfallsreichtum und die Tapferkeit ungeheuer erweitert, mit welchen Menschen in unterschiedlichen sozialen und kulturellen Umständen sich der universalen Situation des Menschen stellen und diese ertragen: nämlich mit der Gabe der Erinnerung in der Gegenwart und der Vorahnung des Todes in Würde zu leben. Die Begegnung mit dieser Vielfalt des Möglichen, kann uns, was die Toleranz angeht, in der Tat demütig und nachsichtiger machen, doch wenn es zur Diskussion über die Gültigkeit der Auffassung von Geschichte und Schicksal kommt, der wir soviel von diesen neuen Erkenntnissen verdanken, ist man weder demütig noch tolerant. Es herrscht in der zweiten Höhle ein absoluter Glaube an die historisch und national bedingte Relativität der Werte, in der jede Epoche oder Zivilisation, gleichermaßen nahe dem Gott der Zeit und des Ortes, zum Ton ihres eigenen Trommelschlags marschiert. Die Ursprünge der modernen Kunst und ihre Entwicklung sind bis heute dieser seltsamen Kunst der Historisierung der Geschichte verbunden, aber mehr noch als die Schöpfungen der Künstler selber, die fast dem Wesen künstlerischer Tätigkeit gemäß nach Dauer und Gültigkeit über die Zeit und den Raum ihrer sozialen Umwelt hinaus streben, spielen im Kampf um die moderne Kunst deren Verteidigung und und deren Musealisierung dabei eine 33 Heinrich Meier, Die Denkbewegung von Leo Strauss: Die Geschichte der Philosophie und die Intention des Philosophen, Stuttgart und Weimar 1993, S. 21-24, bes. S. 22, Anm. 2. Siehe auch Heribert Boeder, Das Vernunft-Gefüge der Moderne, Freiburg und München 1988; ders., „Die Dimension der Submoderne", Abhandlungen der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft, X L VI, 1995, S. 139-150.
152
II Zur Kunst
Rolle.34 Die Kunst ist durch und durch historisiert, und das allein, in einem Akademismus, der sich die Revolte als Vorbedingung zur Durchsetzung einverleibt, bedingt schon ihre weitere Entwicklung. Uber dem Eingang zum Gebäude der Sezession in Wien, der Ausstellungshalle, errichtet zur Förderung der Sache der neuen Kunst, der Kunst, die unsere Zeit zum Ausdruck bringt, stehen die Worte DER ZEIT IHRE KUNST DER KUNST IHRE FREIHEIT35 Der Satz weist in zwei Richtungen; er suggeriert eine Autonomie der Kunst, aber autonom ist auch das Zeitalter, die Epoche. In seiner Entschiedenheit hat der Slogan doch etwas seltsam Schwankendes. Die Zeit erkennt sich selbst im Bilde ihrer Kunst, und die Kunst ist frei solange sie dem Zug der Zeit entspricht, dem sie gleichsam das Siegel ihrer zeitbedingten Freiheit aufdrückt. Die siamesischen Zwillinge sind zu ihrem Glück gut aneinander angepaßt. Hören Sie die Worte eines frühen Förderers der Bewegung in Wien, des Kunsthistorikers Richard Muther, der in einer einst berühmten und wegen ihres scheinbaren Heldenmutes vielgelobten Geschichte der Malerei von der Renaissance bis zu seiner eigenen Zeit für die gute Sache kämpft. In der Auflage von 1926 erinnert er sich des ursprünglichen Plans seines Werkes von 1893. Die Kunst wandelt sich, aber der Kunsthistoriker trifft alle Vorkehrungen, daß seine Aussagen jederzeit gelten: Meine Geschichte der modernen Malerei 1893 ging von dem Gedanken aus: Alles was eklektisch eine schon vorhandene Kunst wiederholt, ist mehr oder weniger belanglos. Lebendig, soweit sie künstlerisch sind, bleiben lediglich Werke, die das Lebensblut ihrer eigenen Epoche durchpulst.36 34 Führend in diesem Bemühen und von anhaltendem Einfluß war das Museum of Modern Art in New York. Siehe, unter anderem, eine frühe didaktische Veröffentlichung des ersten Direktors Alfred Hamilton Barr, What is Modern Painting? New York 1943. 35 Das Gebäude von Josef Maria Olbrich (1867-1908) wurde 1898 errichtet. Über die Ziele der Sezession siehe Hermann Bahr, Sezession, Wien 1909, und sein Buch der Jugend, Wien 1909. Die architektonischen historisierenden Prämissen der deklarierten Modernität des Gebäudes basieren auf dem Werk und den Schriften von Olbrichs Lehrer Otto Wagner. Über diesen (samt einer Bibliographie) siehe den beredten biographischen Eintrag „Otto Wagner" von Dagobert Frey, Neue Österreichische Biographie, 1 8 1 5 - 1 9 1 8 , Band I, 1923, S. 168-179. Eine Studie des Milieus, in welchem Modernität in den Künsten als moralischer Triumph betrachtet wurde, findet sich in Imagining Modern German Culture (wie Anm. 5). Siehe vor allem Patricia G. Berman, „The Invention of History. Julius Meier-Graefe" und „German Modernism and the Genealogy of Genius", ebenda, S. 9 1 - 1 0 5 . Siehe auch Karen Lang, „Monumental Unease: Monuments and the Making of National Identity in Germany", ebenda, S. 275-300. 36 Richard Muther, Geschichte der Malerei, Berlin 5 1926, III, S. 390. Siehe auch Rotraut Schleinitz, Richard Muther - ein provokativer Kunstschriftsteller zur Zeit der Münchner Secession. Die Ge-
Ph. Fehl: Drei Ebenen von Piatons
Höhle
153
Seit Richard Muther sich ins Gefecht gestürzt hat, ist die Kunstgeschichte viel vorsichtiger geworden. Der Eklektizismus wird jetzt als lebenswichtiger Teil des Funktionssystems bestimmter Epochen anerkannt. So schreibt man ihn zum Beispiel dem „Manierismus" als Kennzeichen seines Stils zu. Aber das heißt auch nur, daß wir die Maschine, mit der Muther von Stil zu Stil und von Zeitalter zu Zeitalter fuhr, repariert haben und daß wir sie jetzt vorsichtiger fahren. Seine Begeisterung für das Lebensblut der Epochen ist geschwunden, die Straße ist dieselbe geblieben. Als Heinrich Wölfflin 1882 junger Student in Basel war, hat er selbstverständlich die Vorlesungen Jacob Burckhardts gehört. Es war der Burckhardt, der die Größe von Rubens entdeckt hatte, und dieser war für ihn ganz und gar nicht „barock", sondern vielmehr ein Sprößling der klassischen Kunst und, aufgrund seines assimilativen Eklektizismus, ein Lehrer sowie Vorbild der Würde und Freude einer Kunst, welche die Enge stilistischer Grenzen hinter sich läßt. 37 Kurz, Burckhardt sah Rubens so, wie Delacroix ihn gesehen hat. 38 Der junge Wölfflin war von Burckhardts Ansatz des Geschichtsstudiums tief enttäuscht. Ein Brief an einen Freund faßt seinen Eindruck summarisch zusammen: Da ist Jacob Burckhardt: eine Weltgeschichte hübsch erzählt, aber ohne metaphysischen Hintergrund. Das Prinzip: alles sagen wie es wirklich war. Kulturgeschichtliche Elemente zurückgedrängt. Diese Geschichte hat überhaupt keinen Zweck. Sie ist ein Schauspiel, ein Theater, wo alles bunt durcheinandergeht. Das ganze gewinnt erst Seele, wenn man nach einem Prinzip beobachtet hat. Die Weltgeschichte ist ohne Weltregierung nicht verständlich. Wilhelm von Humboldt. Dies ist der wissenschaftliche Standpunkt: die Gesetze der menschlichen Entwicklung. 39 Wölfflin, der bald schon Burckhardts erfolgreichster und engagiertester Schüler werden sollte, konnte auf seine frühe Bewertung nur als auf einen Ausdruck
schichte der Malerei im XIX. Jahrhundert
- Kunstgeschichte
oder Kampfgeschichte?
Hildesheim -
Zürich - N e w Y o r k 1993. Scheinbar im eklatanten Gegensatz zu dieser Aussage (und zum Schlachtruf der Sezession), und in der Dynamik ihrer Simplifizierung doch damit verbunden wie ein Spiegelbild, in dem rechts und links verkehrt sind, steht Adolf Hitlers Tadel der modernen Kunst, den er 1937 bei der Eröffnung des „Hauses der deutschen Kunst" verkündete: „In der Zeit liegt keine Kunst begründet, sondern nur in den Völkern". Zitiert bei Heinrich Dilly, Kunsthistoriker
1933-1945,
37 Siehe Kaegi (wie Anm. 25), VI, S. 6 9 5 - 7 1 3 . Siehe auch Ernst Maurer, Jacob Rubens,
Deutsche
München 1988, S. 43. Burckhardt
und
(Basler Studien zur Kunstgeschichte, hrsg. von Joseph Gantner, Bd. VII), Basel 1951.
38 Siehe George P. Mras, Eugène
Delacroix's
Theory of Art, Princeton, N.J. 1966, bes. S. 6 4 - 6 9 .
3 9 Walter Rehm, „Heinrich Wölfflin als Literaturhistoriker", in: Bayerische schaften, Sitzungsberichte,
Akademie
Historisch-philologische Klasse, Jg. 1960, Heft 9, S. 11.
der
Wissen-
154
II Zur Kunst
jugendlicher Übertreibung zurückgeblickt haben. Das ist sie auch; aber nichtsdestoweniger spricht ihre Beschreibung dessen, was die Geschichtsschreibung sein sollte, die Lehre von Wölfflins berühmten Buch Kunstgeschichtliche Grundbegriffe weit besser aus als das Buch selbst.40 Unter dem Einfluß von Burckhardts eindrucksvoller Zurückweisung von Verallgemeinerungen versagt sich Wölfflin am Ende seines Buches ebendiese, erwartet aber vom Leser, selbst diesen Schritt zu tun. Der Leser, wenn er denn beeindruckt ist von der Konstruktion des Werks, hat kaum eine andere Wahl.41
Piatons Dritte Höhle: Der Historismus nimmt sich selbst aufs Korn. Es war vielleicht nicht von allzu großer Bedeutung, wenn man sich von den Systembaumeistern beeindrucken ließ, solange sich in der Welt des Nachdenkens über die Geschichte auch weiterhin ein freier Marktplatz der Ideen behauptete. Man konnte sozusagen auf einen Einkaufsbummel nach Systemen gehen oder sie allesamt verschmähen, ohne daß es einen den Kopf kostete, aber seit Wörter wie Zeitenwende, die direkt aus dem Arsenal der handlichen Erklärungen für historischen Wandel des Historisten stammen, ins politische Leben eindringen und darauf drängen, daß wir unsere Treue zur neuen Zeit bekunden, zeigen sich die historisierenden Systeme nackt im vollen Elend ihrer Festlegung auf die Unausweichlichkeit des Wandels, die den Willen der Menschen nicht nur beugt, sondern ihn neu erschafft, damit er mit einer neuen strahlenden Flamme entbrenne - bis die nächste Zeitenwende ins Haus steht. Erst als die letzte Zeitenwende verkündet wurde und geistiger Dissens, wenn geäußert, als Verrat betrachtet wurde, tat sich der Boden der zweiten Höhle auf, aus der zu entkommen, wie Leo Strauss gezeigt hat, so unendlich schwierig ist, und es wurde die dritte Höhle geschaffen, in die nur allzu viele Historiker und Künstler wie auch Philosophen bereitwillig hinabstiegen, weil sie meinten, daß ihr Abstieg 40 Heinrich Wölfflin, Kunstgeschichtliche Grundbegriffe. Das Problem der Stilentwicklung in der neueren Kunst, München 1915. Uber Wölfflin siehe auch Nikolas Meier, in: Altmeister (wie Anm. 32), S. 63-79. 41 Die Verallgemeinerungen werden historisch untersucht von Meinhold Zurz, Heinrich Wölfflin: Biographie einer Kunsttheorie (Heidelberger Kunstgeschichtliche Abhandlungen, N. F., Bd. 14), Worms 1981. Einen bemerkenswert eloquenten Versuch, Wölfflins Kunsttheorie mit dem Glaubensbekenntnis eines Nationalsozialisten zu verbinden, liefert Wilhelm Pinder, „Architektur als Moral", in: Festschrift Heinrich Wölfflin zum siebzigsten Geburtstag, Dresden 1935, S. 145-151. Über Pinder siehe auch Marlite Halbertsma, in: Altmeister (wie Anm. 32), S. 235-248. Auch die von Halbertsma in ihrer Dissertation ans Licht gebrachten Fakten verdienen es, zur Kenntnis genommen zu werden: Wilhelm Pinder in de Duitse Kunstgeschiedenis, Groningen 1985 (dt. Ausgabe: Wilhelm Pinder und die Deutsche Kunstgeschichte, Worms 1992).
Ph. Fehl: Drei Ebenen von Piatons Höhle
155
der Aufstieg sei in ein neues Zeitalter der Freiheit und des moralischen Engagements.42 Ich biete Ihnen ein Beispiel, das für sich spricht, und lasse darauf eine sehr kurze Geschichte aus meinem eigenen Leben folgen, die sozusagen ein Bild malt, das auf Unaussprechliches verweist. Der Verfasser einer Dissertation an der Universität Köln, Das Dekadenzproblem bei Jacob Burckhardt, stellt 1929 (in leidenden und doch provokativen Worten) das dringende Bedürfnis der hereinbrechenden Zeit dar, sich selbst zu regenerieren, aus der Dekadenz und Verzweiflung zu Mannhaftigkeit und Größe sich zu erheben. Er sucht nach Tugend, und er wendet sich Burckhardt zu, der, wie wir an des jungen Wölfflins Kritik an ihm gesehen haben, nicht geneigt gewesen wäre, eine solche Dissertation zu unterstützen. In einer Zeit der Wende, die, in ungeheuren Krisen erschüttert, in bisher unbekanntem Ausmaß die Grundlagen der gesamten physischen und geistigen Existenz der europäischen Menschheit ins Wanken geraten sieht, da alles fließend geworden ist, alles labil und schwankend, durcheinandergerüttelt und zersprengt, da die Untergangsprophetie eines O. Spengler den Horizont der Zukunft mit den Gespenstern millionenfachen Todes bevölkert, da andrerseits ein neuer Geist auf einer breiten Front, von der Jugendbewegung bis in die höchsten Schichten der Kunst und Philosophie, sich anschickt, Wegbereiter eines neuen Geschlechts zu sein und im Anhauch und Frührot eines neuen Tages auf frischer Scholle eine neue Welt zu bauen, in einer solchen Zeit der großen Wandlungen und Entscheidungen rückt wieder, und wohl mehr denn je, in den Brennpunkt aller tieferen geschichtsphilosophischen Besinnung die Frage nach Wesen, Sinn und Wert dieses Lebens als eines geschichtlich gewordenen und zur Geschichte werdenden, nach seinem Woher und Wohin.« Ich möchte die Pein dieses jungen Mannes nicht schmälern, möchte aber neben sie die Pein eines anderen jungen Mannes stellen, der den Verlust seines Lehrers betrauerte, eines historisierenden Philosophen, der an einem für beide entscheidenden Punkt ihres Lebens aus Gründen, die tief verankert sind in den Bedingungen des lebenslangen Trachtens des Lehrers, die Erscheinungen zu analysieren, um ihre zugrundeliegende Form oder Struktur zu erkennen, einen Satz von sich gegeben hat, der den Glauben des jungen Mannes erschütterte, nicht nur den Glauben an seinen Lehrer, sondern auch den an das System, das dieser zu eleganter Vollkom42 Zu den Problemen der Philosophie im besonderen, wenn sie sich politisch engagiert, siehe „Appendix I: Die Insel der Wahrheit". 43 Paul Wilhelm Krüger, Das Dekadenzproblem bei Jacob Burckhardt, Phil. Diss. Universität Köln, Basel 1930, „Vorwort".
156
11 Zur Kunst
menheit entwickelt hatte. Ich bin diesem jungen Mann 1943 in einem Buchladen begegnet. Er war Flüchtling wie ich, hatte einen ruhelosen, intensiven Blick und stotterte, doch baute er sein Stottern in immer wieder neuen Willensakten zu sprechen in sein Gespräch ein. Karl Jaspers war sein Lehrer gewesen. Die Geschichte hat sich im November 1938 zugetragen. Der junge Mann war im Begriff, Heidelberg zu verlassen und nach Amerika zu fahren. „Für einen Juden war es nicht sicher, auf die Straße zu gehen", sagte er, „doch ich habe es riskiert. Ich konnte nicht abreisen, ohne mich von Jaspers zu verabschieden." Er wurde im Arbeitszimmer herzlich von Jaspers empfangen, als sie plötzlich eine starke Explosion hörten und durchs Fenster den roten Feuerschein sehen konnten. Sie blickten durchs Fenster hinaus: es war die große Synagoge, die gerade in Brand gesteckt worden war. „Sehen Sie", sagte Jaspers ins Schweigen hinein zu dem Studenten, „sehen Sie, das muß doch etwas bedeuten!" Die Bemerkung war für den Studenten niederschmetternd, obwohl sie gewiß als Trost für ihn gemeint war oder auch nur das Schweigen brechen sollte. Der Student floh das Haus, er konnte den Satz nie vergessen, und ebensowenig kann ich seinen Bericht vergessen. Jaspers hätte das Naheliegende sagen können: „So ein Verbrechen!" oder „Wie entsetzlich!" oder „Was für eine Schande!", aber er war, wie unschuldig auch immer, gefangen im Konzept der Zeitenwende. Der Student hat sein Studium der Philosophie danach nicht wieder aufgenommen; stattdessen hat er Mathematik studiert. Das war sauberer. Ich habe ihn danach zwei-dreimal gesehen, aber er führte ein Wanderleben, und ich weiß nicht, was aus ihm geworden ist.44 Eingeschlossen im Gefängnis von Piatons Dritter Höhle sind wir umtost vom Schlachtenlärm, und an den Wänden und auf dem Boden der Höhle sehen wir Blut fließen. Die Künste, sämtliche Künste stürzen sich mit ins Gefecht und treiben die großen Massen, Kombattanten wie Zivilisten, dazu an, bis zum Tode für Gott, die Reinheit der Rasse, fürs Vaterland, für den Atheismus, das Proletariat, die Demokratie und, getrieben von Professoren, für den Willen der Geschichte an sich zu kämpfen. 44
Ich möchte ausdrücklich betonen, daß ich diese Geschichte, die mich zutiefst bewegt hat, als ich sie hörte, und die mich noch immer bewegt, nicht erzähle, um die Erinnerung an die Redlichkeit und Ehre von Karl Jaspers zu verunglimpfen, die er in der Welt voller Lügen und Gewalt, welche ihn umgab und in der er zu arbeiten versuchte, an den Tag gelegt und bewiesen hat. Ich möchte nur die moralische Brüchigkeit des Vokabulars der Stilanalyse bei der Betrachtung der Geschichte (oder der Kunstgeschichte) zeigen, wenn die Geschichte über uns hereinbricht. Früh bemerkt wurde die Fehlbarkeit von Jaspers' System bei Wind, Kritik der Geistesgeschichte S. VIII. Jaspers' Vom Ursprung
und Ziel der Geschichte,
(wie Anm. 31),
(Zürich, 1949), bleibt ein beredtes und
bewegendes Zeugnis seines Kampfes, seine analytischen Fähigkeiten zu nutzen, um zeitlose moralische Werte mit dem historischen Determinismus zu versöhnen. Zur Komplexität seiner Geschichtsphilosophie siehe Seung-Kyun Paek, Geschichte zum Geschichtsdenken
und Geschichtlichkeit.
Eine
Untersuchung
in der Philosophie von Karl Jaspers (Phil. Diss., Fachbereich Philosophie,
Universität Tübingen), Tübingen 1975.
Ph. Fehl: Drei Ebenen von Piatons
Höhle
15 7
Das Gezeter und Geschrei über die Dekadenz der modernen Kunst, die, wie es heißt, mit den von ihr gepflegten Formen die Dekadenz des Zeitalters ausdrückt, ist deshalb so schrill und laut, weil es dabei um unsere Erlösung, die Errettung vorm Untergang geht. Es ist ein politischer Streit, denn die Zukunft des Staates ist bedroht. Als Antwort darauf erhebt sich ein ebenso lauter Lärm auf Seiten der Modernisten, die im Namen eines gesunden Proletariats, das der Welt eine große Zukunft verheißt, die „Bourgeoisie" als dekadent attackiert, wenn sie der modernen Kunst frönt, oder als dekadent und scheinheilig, wenn sie für die deutlich traditionellen Stile gegenständlicher Darstellung in den Künsten eintritt. Wir sehen somit Expressionisten und Realisten nicht nur gegeneinander antreten, sondern auch, wie sie mit der selben Rücksichtslosigkeit von Aktivisten in der Vorhut beider Seiten der Auseinandersetzung kämpfen, mit bloß oberflächlichen Anpassungen an die Kampfausrüstung ihres Stils, wie es eben gerade zur Flagge, unter der sie in die Schlacht ziehen, passen mag. Rücksichtslosigkeit wird in der dritten Höhle als Tugend aufgefaßt. Sie bezeugt das totale Engagement für das totale Engagement. Zu den Kampfteilnehmern gehören fraglos auch geniale Künstler, aber Ausdruck findet ihr Genie in einem gewissen Brutalitätskult, der in den Kriegen, in die sie ziehen, nicht nur seine Vollendung erfährt; allzuoft wird zu den Kriegen von der Kunst auch fortwährend angespornt, denn die engagierten Künstler verehren den Krieg. Als berühmte Beispiele nenne ich Gabriele D'Annunzio und Ezra Pound. Deren Bewunderer trennen gerne den für eine Sache engagierten Menschen von dem Dichter, dessen Werk, wie sie sagen, reine Vollkommenheit ist. Aber d'Annunzio und Pound hatten nur Verachtung für eine solche Verteidigung. Ihre Parteinahme und ihre Kunst sind voneinander nicht zu trennen.45 Auf Seiten der Linken ist es nicht viel anders, aber wie wir anfangs gesagt haben, hat die Linke in der Kunst wie in der Politik den moralischen Vorteil, daß sie jahrzehntelang von der Rechten grausam unterdrückt worden ist. Deshalb schockiert es uns immer noch, wenn wir mit der ihr eigenen Form von Unmenschlichkeit konfrontiert werden. Margarete Buber-Neumann berichtet in ihrem Buch Von Potsdam bis Moskau: Stationen eines Weges von der Grausamkeit des politischen Engagements des deutschen Dadaisten John Heartfield, dessen Werk so voller Wunderlichkeiten steckt, daß man meinen könnte, er konnte keiner Fliege etwas zuleide tun. Buber-
45 Unendlich ist die Literatur, welche die sklavische Bindung zwischen dem hemmungslosen, wenn nicht kriminellen Engagement beider Dichter im politischen Kampf wie im Krieg und der Triebkraft ihrer Poesie entweder demonstriert oder negiert. Zu D'Annunzio siehe besonders die grundlegende kritische Diskussion von Benedetto Croce in seiner Storia d'Italia del 1871 a 1915, (Scritti di Storia letteraria e politica XXII), Bari 3 1964, S. 247-299, bes., 247-265. Eine Einführung in die Probleme, die Pound moralisch empfindlichen Lesern seiner Poesie stellt, bietet Nemi D'Agostino, Ezra Pound (Biblioteca di Studi Americani no. 5), Rom 1960.
158
II Zur Kunst
Neumann zitiert wortwörtlich aus einem Zeitungsartikel, den Heartfield 1920 veröffentlicht hat, und sie ist immer noch fassungslos vor Entsetzen. Heartfield beschreibt ganz frank und frei die Politik, die er empfiehlt, um seine Künstlerkollegen für die Sache der Kommunisten zu gewinnen: Man wird dem Künstler den subjektiven Glauben an seine Eigenmächtigkeit zunächst am besten belassen. Ein wichtiges Mittel, diesen Glauben nicht zu zerstören (wodurch der Künstler sonst in die Opposition gedrängt und für die Sowjetmacht schädlich würde), ist öffentliche Anerkennung, Kritik an der Presse, usw., Hinzuziehung von Künstlern zu allerlei begrenzten Fragen, wo sie dann ruhig tonangebend sein können. Die Meinung, irgendeine Rolle zu spielen, ist von großer Bedeutung für das Wohlgefühl dieser Kreise, und die ist bei einiger Geschicklichkeit leicht zu erzielen ... Sollten [aber] einige wenige konsequente Anhänger des Kapitalismus konterrevolutionäre Propaganda treiben, so wird die Diktatur schon Mittel finden, um sie zu nützlicherem Tun zu bewegen ... 46 Im Anschluß daran berichtet Buber-Neumann vom Selbstmord einer Russin, Flüchtling aus dem bolschewikischen Rußland, die aus dem Fenster sprang und vor ihren Augen gestorben ist: Noch ganz unter dem Eindruck des furchtbaren Erlebnisses berichtete ich morgens meinen Genossen ... von der Tragödie der russischen Emigrantin. Man zeigte kein Mitgefühl, sondern erging sich in Phrasen über das Schicksal einer absterbenden Klasse, die nun mal auf dem ,Misthaufen der Geschichte' enden müsse.47
Verlust der Mitte und Edgar Wind. Man kann über den Kampf „für und gegen die moderne Kunst" nicht schreiben, ohne Hans Sedlmayr und seine Bücher Verlust der Mitte und Die Revolution der modernen Kunst4S zu erwähnen. Edgar Winds Kunst und Anarchie wird bisweilen mit Sedlmayrs Verlust der Mitte verglichen, weil Wind die abstrakte oder nichtgegenständliche Malerei abgelehnt hat. Aber darum geht es in seinem Buch gar nicht. Er mag, was die Leere abbildloser Leinwände angeht, recht gehabt haben oder nicht, aber wenn wir, um des Argumentes willen, annehmen wollen, daß er 46 Margarete Buber-Neumann, Von Potsdam nach Moskau. Stationen eines Weges, Frankfurt/M. 1990, S. 108. 47 Ebenda, S. 116. 48 Hans Sedlmayr, Verlust der Mitte. Die bildende Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts als Symptom und Symbol der Zeit, Salzburg 21950; ders., Die Revolution der modernen Kunst, Hamburg 1955.
Ph. Fehl: Drei Ebenen von Piatons Höhle
159
unrecht hatte, so hat er doch recht, wenn er sagt, daß Künstler, die sich auf den formalen Sinn versteifen und Inhalt als Besudelung der angeblichen Reinheit oder Unschuld ihrer Bilder betrachten, nichts Erinnernswertes zu sagen haben, wenn ihnen denn die Umsetzung ihrer Absicht in ein Kunstwerk gelingt. Als ich auf der Kunsthochschule war, und das ist schon lange her, haben wir solche Künstler „hochdumm" genannt. Winds Ablehnung der abstrakten Malerei, so falsch wir sie, wenn auch mit Vorbehalten, fanden, bleibt trotzdem noch, im Geiste seines Argumentes, eine Metapher für eine gewisse Praxis in der Kunst praktisch aller Epochen, die Kristallüster produziert, an die Decke hängt und sie dann Skulpturen nennt. Und sehen Sie bitte in mir keinen Feind von Kristallüstern. Ich habe dieses Beispiel absichtlich nur im metaphorischen Sinne benutzt. In Kunst und Anarchie steht, wie ich meine, sonst nichts weiter, was auch nur eine entfernte Ähnlichkeit mit der Absicht oder den Argumenten der beiden Bücher von Sedlmayr hat. Diese basieren auf streng traditionellen kunsthistorischen Stilanalysen, die Sedlmayr in einer seltsam geschickten Uberdrehung der Schraube Strukturanalyse nennt.49 Es ist ein historisierendes Werk par excellence und doch reich an Werturteilen und trostlosen Vorhersagen, worin es sehr Oswald Spenglers Untergang des Abendlandes gleicht.50 Seine Schlußfolgerungen beruhen auf den scheinbar unwiderlegbaren Beweismitteln des Lichtbildervergleichs. Es ist, als wäre Sedlmayr mit seiner wohlbewahrten Ausrüstung aus der relativierenden zweiten Höhle Piatons in die Dunkelheit der dritten hinabgestiegen.51 Bei seiner Ankunft dort bietet er einen interessanten Beweis für die Richtigkeit seiner Ana49 Siehe Hans Sedlmayr, „Zu einer strengen Kunstwissenschaft", in: Kunstwissenschaftliche schungen,
I, 1931, S. 7 - 2 3 , Wiederabdruck in Kunst und Wahrheit,
Begriff der „Strukturanalyse", in: Kritische Berichte
zur Kunstgeschichtlichen
S. 1 4 6 - 1 6 0 ; ders., „Die .Macchia' Bruegels", in: Jahrbuch
For-
Hamburg 1958; ders. zum Literatur,
der Kunsthistorischen
3—4, 1932,
Sammlungen
in
Wien, N . F . VIII, 1934, S. 137-159. Zu Sedlmayr siehe auch Norbert Schneider, in: Dilly, Altmeister (wie Anm. 31), S. 2 6 7 - 2 8 8 . 50 Oswald Spengler, Der
Untergang
1918; Band II, Welthistorische
des Abendlandes,
Perspektiven,
Band I, Gestalt und Wirklichkeit,
München
München 1922. (Engl. Ausgabe: The Decline
of the
West, N e w York, 1934). Sedlmayr erkennt zwar Spenglers Priorität an, findet ihn aber nicht rigoros genug in der Auswahl seines Materials. Während Spengler den Untergang des Abendlandes einem Altersprozeß zuschreibt, sieht Sedlmayr darin dagegen das Wirken einer Krankheit (engl. Ausgabe, S. 2, S. 212). 51
Einen vielleicht vergleichbaren Abstieg in die dritte Höhle im Bestreben, das praktisch anzuwenden, was er für unwiderlegbare Ergebnisse einer Wissenschaft hielt, hat der Rechtswissenschaftler und Gesellschaftskritiker Carl Schmitt unternommen, dessen Werk heute wieder viel studiert wird. Vergi. Mark Lilla, „The Enemy of Liberalism", in: The New
York Review of Books, X L I V ,
N r . 8 (15. Mai 1997), S. 3 8 - 4 4 . - Als er im Nürnberger Prozeßverfahren von einem amerikanischen Staatsanwalt verhört wurde, hielt Schmitt unerbittlich an seinen Uberzeugungen fest: „Dem Beschuldigten wird seine Schrift .Völkerrechtliche Großraumordnung', 4. Auflage, vorgehalten und folgender Satz auf Seite 63 vorgelesen. .Diese jüdischen Autoren haben natürlich die bisherige Raumtheorie so wenig geschaffen, wie sie irgend etwas anderes geschaffen haben. Sie waren doch auch hier ein wichtiges Ferment der Auflösung konkreter raumhaft bestimmter Ordnungen.',Wollen Sie
160
II Zur Kunst
lyse der Moderne. Sie deckt sich, so sagt er nicht ohne einen gewissen Spott in seiner nachfolgenden Studie Die Revolution der modernen Kunst, mit den Ergebnissen der Analyse eines bekannten Verfechters der modernen Kunst, Werner Hofmann. Ich zitiere Sedlmayr: Für die Erkenntnisse der Primärphänomene ist es gleichgültig, ob und in welchem Maße ihre Tendenzen den Schaffenden bewußt geworden sind. Die Ideologien der ,modernen Kunst' sind für den Prozeß, der mit innerer Folgerichtigkeit verläuft - und für sein Ergebnis unwichtig. Wichtig ist nur, daß die Künstler, bewußt oder unbewußt, so schaffen, als hätte ihnen ein Weltgeist eingegeben, dem Axiom gemäß zu schaffen. ... Werner Hofmann ist zu ganz ähnlichen Ergebnissen gekommen. Es bahnt sich also eine Ubereinstimmung in der Erkenntnis des Wesentlichen der modernen Kunst an, unabhängig von ihrer Bewertung. Und mehr ist nicht zu erwarten.52 Sedlmayr ist offensichtlich gar nicht der Gedanke gekommen, daß Hofmann und er deshalb zu den gleichen Ergebnissen gelangt sind, weil sie als praktizierende Historisten vorgingen, die es für selbstverständlich hielten, daß die gleiche Art von Analyse den gleichen „Zeitgeist" zeigt, der sich in den Kunstwerken ausdrückt, die sie untersucht haben.53 Wieder einmal reichen sich die Hegeische Linke und die Hegeische Rechte die Hände, bevor sie einander auf die Schädel hauen. Wind dagegen ist von jeder Art des Historismus weit entfernt, ob nun der linken oder der rechten Prägung. Wir sind nicht festgenagelt in unsere Zeit; im Gegenteil, sein Blick richtet sich auf die großen Werken der klassischen Kunsttradition, so daß wir Nutzen ziehen mögen aus der Erkenntnis ihres lebendigen und sogar verwirrenden Reichtums an Wahrhaftigkeit und Schönheit, ihrer Geistigkeit und bestreiten, daß das der reinste Goebbelsstil ist? Ja oder nein?' Antwort: ,Ich bestreite, daß das Goebbelsstil ist nach Inhalt und Form. Ich möchte betonen, den hochwissenschaftlichen Zusammenhang der Stelle zu beachten. Der Intention, der Methode und der Formulierung nach eine reine Diagnose.',Wollen Sie noch irgend etwas sagen?' A: ,Ich bin hier als was? Als Angeklagter?' F: ,Das wird sich noch herausstellen!' Α: ,Alles, was ich gesagt habe, insbesondere dieser Satz, ist nach Motiv und Intention wissenschaftlich gemeint, als wissenschaftliche These, die ich vor jedem wissenschaftlichen Kollegium der Welt zu vertreten wage.'" In: Robert Kempner, Das dritte Reich im Kreuzverhör, München und Esslingen 1969, S. 196. 52 Sedlmayr, Die Revolution (wie Anm. 47), S. 9. 53 Uber Werner Hofmanns Ansatz beim Studium der von Sedlmayr analysierten Periode, siehe Hofmanns Bruchlinien: Aufsätze zur Kunst des 19. Jahrhunderts, München 1976 und sein Buch Grundlagen der modernen Kunst, Stuttgart 1966. Eine indirekte Antwort auf Sedlmayr findet sich auch bei Hofmann, „Fragen der Strukturanalyse", in: Zeitschrift für Ästhetik und Allgemeine Kunstwissenschaft, XVII, Nr. 2, 1972, S. 143-169, sowie anläßlich Sedlmayrs Todes „Anstelle eines Nachrufs", in: Idea (Jahrbuch der Hamburger Kunsthalle), III, 1984, S. 7-17; nicht zu vergessen ders., „Zu einer Theorie der Kunstgeschichte", in: Zeitschrift für Kunstgeschichte, XIV, 1951, S. 118-123.
Ph. Fehl: Drei Ebenen von Piatons Höhle
161
ihrem Pathos, die weit über alle Worte hinausgehen. Es ist nicht so, daß er die moderne Kunst der alten anpassen möchte. Er will ihr, so weit es eben möglich ist, einen neuen Zugang zu dem gewähren, was wir eine höhere Bildung in den Künsten nennen dürfen. Und dann kann die Kunst in vielen Zungen reden.
Fluchtwege Winds Buch hat mir den Mut gegeben, meine eigenen Reflexionen vorzutragen, mein selbstgebasteltes Rüstzeug vorzuführen, die Ausrüstung aus Seilen, Stricken und Leitern, mit der wir, so Gott will, aus Piatons dritter Höhle hinausklettern und sogar die Grotte der ersten Höhle erklimmen können, wo die Großen Alten der Kunstgeschichte weilen und wir vielleicht zu Gesprächen mit ihnen eingeladen werden. Wir müssen lernen, ihre Sprache zu sprechen, doch das ist nicht sehr schwer, weil sie, wie Philostratos der Altere, dem wir zu Beginn der Diskussion begegnet sind, Zuflucht dazu nehmen, in Bildern zu sprechen. Eine Ekphrasis von hundert Wörtern ist tausendmal soviel wert wie tausend Wörter in einem Lexikon der Weltkunst. Wir dürfen die erlernte Toleranz ebensowenig über Bord werfen wie die große Erfahrung, die wir in den positivistischen Bemühungen des kunsthistorischen Lebens in der zweiten Höhle erworben haben. Dafür brauchen wir die Stricke und Seile, um nämlich das ganze Wissen zu transportieren, aber nur von den Großen Alten können wir lernen, daß wir in die weitesten Fernen nicht mit geschärfter objektiver Neugier schauen dürfen, sondern mit den Augen der Sehnsucht dorthin blicken müssen. So nämlich haben auch sie die Werke der Künstler des klassischen Altertums angeschaut und sie in ihren eigenen Werken zu neuem Leben erweckt. „Glücklich der Mensch, der fremde Größe fühlt", sagte Franz Grillparzer bei der Enthüllung der Mozartstatue in Salzburg. 54 Grillparzers Anteilnahme an Mozarts Größe erweckt auch unsere an seiner Größe und seiner Bescheidenheit. In diesem Sinne können wir Grillparzer ebenso nachfolgen wie den Großen Alten und den von ihnen gepriesenen Malern. Das wäre dann unsere Quelle humaner Bildung. An dieser Stelle erhebt das Wort „Bildungsbürgertum" sein häßliches Haupt und grinst uns an. Es ist direkt aus der dritten Höhle gekommen, um uns heimzusuchen. „Bildung" ist selbstverständlich keine auf die Bourgeoisie beschränkte Errungenschaft. Marxistische Künstler wie John Heartfield lehnen das ererbte Konzept der Bildung ab, um einen guten Eindruck auf das von ihnen angebetete Proletariat zu machen, und damit zerstören sie nicht nur die Künste und deren Würde, sondern auch ihre eigene Vorstellungskraft. 55 Diese Ablehnung ist eine 54 Franz Grillparzer, „Bei Gelegenheit der Enthüllung von Mozarts Standbild in Salzburg, September 1842", Sämmtlicbe Werke, I, Stuttgart 1872, S. 124. 55 Siehe Anm. 46.
162
II Zur Kunst
Form des Primitivismus. Ciceros Haupt muß wieder einmal fallen, weil er beredt und ein Verteidiger der humanistischen Bildung war. Heartfields berüchtigtes Pendant im Haß auf Bildung war bei den Nazis Hanns Johst, der einen seiner soldatischen Helden in seinem Stück Schlageter den gräßlichen Satz sagen läßt: „Wenn ich Kultur höre ... entsichere ich meinen Browning." 56 An sich ist es aber gar nicht so schwer, für „Bildung" oder „Herzensbildung" einzutreten, ob nun bürgerlicher oder anderer Art. Wir müssen nur unsere Scheu vor Wörtern ablegen, die einst schön, edel und erhebend waren und die wir kaum mehr zu gebrauchen wagen, weil sie in den Schlachten der dritten Höhle mißbraucht und entehrt worden sind. Wenn wir hinauswollen aus der Höhle, müssen wir ihren Bewohnern im Gedanken mit den berühmten Worten Alices aus Alice im Wunderland gegenübertreten, daß sie nichts weiter sind als ein Kartenspiel: „You are nothing but a pack of cards!" 57 Es gibt in dieser Welt nur sehr wenig Freiheit und Würde, aber die Phantasie, die Einbildungskraft ist immer noch frei, und die gerechte Behandlung der Künste und ihrer Geschichte ist es auch.
Es mag leichtsinnig erscheinen, ein Kinderbuch als Gegenmittel gegen so viele erdrückende Gelehrsamkeit zu empfehlen, die verantwortlich ist (wenn wir das Modell der zweiten Höhle von Leo Strauss akzeptieren) für die Bedingungen des Lebens und Lernens, denen wir entfliehen möchten. Aber Lewis Carroll war ein Mathematiker, der die Vernunft ebenso geliebt hat wie die Ordnung und die Weisheit, die der Sprache innewohnt, wenn sie mit Liebe zur Vernunft und Gerechtigkeit gebraucht und ihr mit derselben Liebe gelauscht wird. Er war auch von spielerischer Munterkeit und achtete das Kind Alice, dessen Gesprächen er sich mit der lächelnden und sehnsuchtsvollen Ernsthaftigkeit näherte, welche jene einsamen Erwachsenen auszeichnet, die sich zu der spielerischen Ernsthaftigkeit von Kindern hingezogen fühlen. Die Psychoanalyse, deren Zeit als eine der beharrlichsten und, für ihre Klienten, kostspieligsten Illusionen der zweiten Höhle nun abgelaufen ist, hat den Zauber von Lewis Carrolls Witz mit höhnischen Interpretationen überschüttet, indem sie das, was sie für die zugrundeliegende Motivation des Autors hält, entlarvt hat. Dieser Weg und andere vergleichbar simple Wege zum Verständnis eines Werks des Geistes machen es für manche immer noch schwer, auf Alices Abenteuer im Wunderland ohne Herablassung zu reagieren. In den Akademien meidet man das capriccio als Modus des Denkens, und zwar aus Angst, daß in seiner Gesellschaft 56 Hanns Johst, Schlageter, München 1933, S. 26 57 Lewis Carroll, Alice in Wonderland, in: The Complete Works of Lewis Carroll, The Modern Library, New York, o. D., S. 139. Die Illustration von John Tenniel dort S. 140.
Ph. Fehl: Drei Ebenen von Piatons Höhle
163
unsere Gelehrsamkeit lächerlich werden könnte, und wir mit ihr. Nicht ohne Grund gilt das Lachen als subversiv für unsere geltende Methodologie des Wissens. Vielleicht muß man eine gewisse Zeit in England gelebt haben, um mit Ernst und mit dankbarem Lächeln auf das befreiende Vergnügen von Carrolls geistreichem Witz reagieren zu können. Zu Edgar Winds fröhlichsten Werken gehören seine Studien zu den Quellen von Witz und moralischer Anmut englischer Künstler und Schriftsteller des 18. Jahrhunderts. Etwas von der Weisheit dieser „happy few" spiegelt sich in der Passage aus Alice im Wunderland, die ich zum Gebrauch bei unserer Flucht (die einzige, die uns jederzeit möglich ist) aus dem Gefängnis der von uns betriebenen Wissenschaften empfohlen habe: um der Wissenschaft selbst willen. Fluchten wie die von Alice sind das Ergebnis individueller Entscheidungen und Handlungen. Da ich Alices Abenteuer als Allegorie benutzt habe und mein Argument ein persönliches ist, fühle ich eine gewisse Verpflichtung, die Wahrheit des von mir gemalten allegorischen Bildes mit der faßlichen Wirklichkeit einer persönlichen Begegnung zu bekräftigen, welche mir bei meiner eigenen Entscheidung zur Flucht geholfen hat. Ich tue das mit der Bitte um Entschuldigung bei dem Helden meiner Geschichte dafür, daß ich sie überhaupt erzähle, und bei Ihnen, daß ich an Sie mit meinen Erinnerungen herantrete. Selbstverständlich kann ich nicht hoffen, die Anhänger der Argumente zu überzeugen, mit denen die Wände der zweiten und dritten Etage von Piatons Höhle beklebt sind, wenn ich mich auf ein poetisches Bild aus einem Kinderbuch und eine erschütternde Geschichte aus meinem Leben berufe. Ich kann nur wiederholen, daß ich die Argumente an den Wänden bei weitem nicht überzeugend finde. Ich male meine Bilder und erzähle meine Geschichten nur zum möglichen Nutzen jener, die, wie ich, ihren Weg finden wollen, indem sie in die Vergangenheit blicken, um zu sehen, welche Belehrung uns die Geschichte bieten kann, in der Form von exempla des Denkens und Verhaltens derer, die besser sind als wir und sich über die Täuschungen der Zeit erheben.
Die heitere Würde des Dr. Jellinek. Ich habe Dr. Jellinek 1939 kennengelernt, als wir beide als Flüchtlinge aus unserer Geburtsstadt Wien in einem kleinen Ort in der Tschechoslowakei lebten. Er war alt, vielleicht Anfang siebzig, und ich war sehr jung. Der deutsche Einmarsch hatte bereits stattgefunden, aber in unserem Ort gab es keine deutsche Garnison. Dafür war der Ort zu klein und zu unbedeutend, und wir führten für eine offensichtlich begrenzte Zeit ein verhältnismäßig normales Leben als vergessene Flüchtlinge. Wir sind uns zuerst rein zufällig begegnet, bei unseren Spaziergängen auf den zu einem Park umgewandelten Wallanlagen des Ortes, woraufhin wir uns dann täglich zu gemeinsamen Spaziergängen verabredeten. Er ging gesetzten Schritts,
164
II Zur Kunst
und ich ging unruhigen, ungeduldigen Schritts. Keine andere Menschenseele war weit und breit zu sehen. Wir fühlten uns durch unser gemeinsames Schicksal zueinander hingezogen und durch unseren Altersunterschied. Er war heiter, nachdenklich und steckte voller Erinnerungen, die er mit der Lust eines alten Rechtsanwalts am Geschichtenerzählen an mich weitergab. So lernte ich das Wien kennen, das er liebte und das ich nie kennengelernt hatte. Was für Schauspielerinnen es am Burgtheater seiner Zeit gegeben hatte! Eines Tages beglückwünschte ich Dr. Jellinek (dessen Vornamen ich nie erfahren habe) zu der Ruhe und Heiterkeit, die er mühelos inmitten unserer entsetzlichen Ungewißheiten bewahrte. Ich bewunderte seine äußerste Gelassenheit. „Es ist einfach", sagte er. „Bei meinem Alter ist das mein Geburtsrecht, und um das lasse ich mich nicht von denen [den Nazis] bringen. Ich bin Junggeselle und brauche mich weder um Frau noch Kind zu kümmern, und mein Bruder ist tot. Und dann", fügte er hinzu, wobei er auf seine Tasche zeigte, „lese ich täglich in meinem Tacitus. Das klärt den Kopf." Daraufhin machte ich ihm ein Kompliment über seine mühelose Beherrschung des Lateins. „Das ist gar nichts", sagte er, „mein Vater hat jeden Tag seines Lebens zur Erholung Horaz gelesen. Der konnte wirklich Latein." Wie ich später herausfand, war sein Vater ein berühmter Mann, der Begründer eines Systems des Vergleichenden Rechts, das vielleicht schon jenen Relativismus zur Schau trug, den Leo Strauss in seiner Allegorie von der zweiten Ebene von Piatons Höhle gekennzeichnet hat.58 Aber wenn dem so war, kann ich aus meiner Begegnung mit Dr. Jellinek nur schließen, daß es in den Wüsteneien der zweiten Höhle Oasen gab und mancherorts vielleicht auch noch gibt, deren Zauber vergleichbar ist mit der Grotte der Großen Alten der Kunstgeschichte in der ersten Höhle, in welcher die historisierende Suche nach dem individuellen Rang scheinbar gleichermaßen gültiger Maßstäbe menschlichen Verhaltens noch durch eine Latinität gemildert wurde, die bei ihrer Beschreibung aller Formen menschlichen Verhaltens ihre eigenen Unterscheidungen zwischen gut und schlecht und leidlich-verwirrt traf. War das Latein, besonders aber Tacitus, Dr. Jellineks Geheimwaffe in seinem Kampf gegen Hitler, so war es doch nicht seine einzige Waffe. Einige Tage später setzte er, fast schamhaft und doch mit heimlichem Stolz und Vergnügen unsere Unterhaltung fort und sagte: „Sehen Sie, ich habe auch Gift bei mir. Die werden mich niemals lebendig fassen und mich foltern und demütigen. Ich bin in Sicherheit." Ich sagte, was auf der Hand lag, daß ich mir wünschte, seinem Beispiel folgen zu können. „Aber nein", sagte er, „Sie sind jung und sollten versuchen, Ihre Chance wahrzunehmen, vielleicht gelingt es Ihnen, Ihr Leben zu retten und zu leben." Daraufhin sagte ich aus Loyalität ihm gegenüber, ja, ich sei auf eine gewisse Weise jung, wenn man nämlich vom Tag der Geburt zählte. Aber das Alter ließe
58 Vgl. den Artikel „Georg Jellinek" in: Neue Osterreichische
Biographie, VII, 1931, S. 36-52.
Ph. Fehl: Drei Ebenen von Piatons Höhle
165
sich auch nach rückwärts berechnen, vom voraussichtlichen Todestag, und in dieser Hinsicht seien wir beide wahrscheinlich mehr oder weniger gleich alt. Zum erstenmal im Leben war mir klar, daß die Zeit sich nicht nur vorwärts bewegt. „Das ist ein hübscher Gedanke", sagte er, ich glaube, geschmeichelt, „aber trotzdem sollten Sie versuchen zu fliehen. Gehen Sie nach England, wenn Sie können es ist, zivilisatorisch gesehen, noch immer das verläßlichste Land Europas." Das war, glaube ich, das letzte Mal, daß ich ihn gesehen habe. Ich kann nur hoffen, daß es ihm gelungen ist, so zu sterben, wie er es geplant hatte, als Römer. Dies war sein Weg, der Unerbittlichkeit der dritten Höhle zu entkommen, in welcher der Wortschwall der Rechthaberei erscholl, der Toleranz und Mitgefühl im Namen eines wissenschaftlich erlangten Prinzips ablehnte, nach dem entschieden wurde, wer sterben müsse und wer leben dürfe in der neuen Ordnung, die als Errettung der Welt verkündet wurde. Wie es sich ergab, hatte ich kurz nach meiner letzten Begegnung mit Dr. Jellinek die Chance, nach England zu fliehen. Nicht, daß ich damit seinem Rat gefolgt wäre; es war meine erste und einzige Chance zu entkommen. Aber sein Rat und wie er ihn in Worte gefaßt hat, sind mir stets in Erinnerung geblieben. Und dadurch bin ich schließlich auch dazu gebracht worden, mit verspielter Aufmerksamkeit Alice im Wunderland zu lesen und Exemplare des Buches zu kaufen und sie allen von mir geliebten Menschen zu schicken, als eine Art Talisman der Geistesfreiheit. Ich beende meine Hommage an Dr. Jellinek mit einer weiteren Flüchtlingsgeschichte. Sie umgibt das Andenken an diesen bemerkenswerten Mann sozusagen mit einem Schmuckrahmen und hilft mir somit dabei, die bange Lektion meiner Erinnerung an ihn weiterzugeben. Die Geschichte wurde mir von einer Freundin erzählt, die mein Alter ist und jene Tage miterlebt hat. Sie war noch Schülerin an einem jüdischen Gymnasium in Wien. Draußen beherrschten die Nazis die Stadt. Doch drinnen in der Schule ging der Unterricht weiter wie gewöhnlich. Eines Tages war ein Junge ziemlich schlecht in der mündlichen Ubersetzung aus dem Lateinischen. Der Lehrer machte ein trauriges Gesicht und fragte voll Verwunderung: „Wie können Sie sich auf das Leben vorbereiten ohne den Ablativus absolutus?" Nun gab sich der Lehrer wohl keiner Illusion hin, was die Nützlichkeit des Lateins in der zukünftigen vita activa seiner Schüler anging, selbst schon vor der Invasion Österreichs nicht, und vielleicht hat er auch schon vorher diesen kleinen Trick häufig angewandt und sein Treuebekenntnis zum Ablativus absolutus abgelegt. Aber für alle, die hören wollten, war sein weltfremdes Bekenntnis trotz allem lebensspendend. Der Ablativus absolutus öffnet uns die Augen für die Erfahrung des Lebens in einem Zeitmaßstab, der gleichzeitig die Zeit transzendiert. Er lädt uns ein zu begreifen, was vor langer Zeit geschehen ist oder auch noch geschehen mag in der Umarmung eines unabhängigen Satzteils und verankert es als Gegebenheit oder Hoffnung in einer Zeitspanne, die vom narrativen Teil des Satzes benannt wird. Die Einsicht einer einfachen Aussage wird durch den Blick zurück und den Blick nach vorn qualifiziert und mitbestimmt. Ein gewöhnliches Beispiel aus einem Schulbuch:
166
II Zur Kunst Perditis omnibus rebus virtus se sustenare potest. Ist alles auch verloren, kann Tugend doch sich erhalten.59
Mit den allerbesten Absichten bleibt die Ubersetzung doch unzulänglich. Das Lateinische zeigt an, daß die Handlung, in der alles verlorenging, hinter uns liegt. Aber die Tugend mit dem Verb im Präsens, das den Ablauf des Satzes bestimmt, bleibt in beherrschender Stellung. Das Schicksal, ob vergangen, gegenwärtig oder zukünftig, kann ihr nichts anhaben. Aber ob nun auf Latein oder auf Deutsch, der Satz ist ein passendes Epitaph für Dr. Jellinek. Er kann uns auch leiten, wenn wir versuchen, Ebene für Ebene aus Piatons Höhle hinauszuklettern.
Ein persönlicher Rat Mein Rat an junge Kunsthistoriker, von denen ich bei meinem Besuch in diesem Hause so viele begabte und liebenswürdige kennengelernt habe, ist ein bescheidener. Bei Ihrem Streben, die Vergangenheit mit der Gegenwart zu verbinden, denken Sie über den Ablativus absolutus nach. Seien Sie Amateure, Liebhaber der Kunst so gut wie auch deren Historiker, und reden und schreiben Sie wie ein Liebhaber der Kunst, so wie es die Liebe diktiert. Schreiben Sie Kunstgeschichtlicbe Gespräche in Briefen statt nur Kunstgeschichtliche Mitteilungen; und wenn Sie das, was Sie schreiben, nicht veröffentlichen können, schicken Sie Photokopien an Ihre Freunde. Außer diesen und unseren Rivalen liest doch sowieso kein Mensch mit Interesse das, was wir schreiben. Lassen Sie sich von Philostratos, Vasari, Pietro Aretino, Franciscus Junius und Diderot in der Kunst unterweisen, mit lebendiger Anteilnahme und einem nie stumpf werdenden Sinn für Tugend und Wahrheit über Kunst zu schreiben. Lachen Sie nach Herzenslust, denn Kunst ist ebenso witzig wie tief. Und, meine Freunde, lernen Sie zeichnen. Das schärft den Blick, belehrt das Herz und verschafft uns größeres Selbstvertrauen im Gespräch mit Künstlern wie mit Kunstwerken.
Moderne Künstler zur Hilfe: Eine letzte Huldigung. Es wäre müßig und vielleicht auch unangebracht zu erwarten, daß die Entwicklung der Künste, wie sie in der neueren Zeit Gestalt annimmt, durch Kunsthistoriker beeinflußt werden kann. Einen bedeutsamen Wandel können allein die Entscheidungen und die Werke der Künstler bewirken. Die Ursprünge der modernen Kunst sind tief verwurzelt in einer sehnsuchtsvollen und leidenschaftlichen Bejahung der Werke der großen Meister aus längst vergangenen Zeiten. In der Früh59 Charles L. Bennett, The Latin Grammar,
Boston, New York 1963 (1. Aufl. 1895), S. 149.
Ph. Fehl: Drei Ebenen von Piatons Höhle
167
zeit der Moderne haben einige moderne Künstler, vielleicht sogar ihre Mehrheit, sich bemüht und sich mit Erfolg bemüht, die große, befreiende und mitfühlende Vorstellungskraft am Leben zu erhalten und weiterzuentwickeln, die sie in den Werken der Meister fanden und von ihnen übernahmen, denen zu folgen sie sich entschieden hatten. Sie betrachteten sich als deren Jünger und Botschafter in einer Welt, die dem hohen Ernst ihres Trachtens gleichgültig und feindlich gesinnt war. Wenn sie ihrer Berufung treu bleiben wollten, so verurteilten sie sich praktisch zur gesellschaftlichen Isolation. Ich nenne zwei große Künstler, deren Vorbild diese moderne Entscheidung inspiriert hat: Delacroix und van Gogh. Der eine wählte Rubens und die Natur zu den Lehrern, denen er folgte, und der andere folgte Rembrandt, der Natur und eben auch Delacroix. Beide Künstler, an der Schwelle zur Moderne stehend und mit ihrem eigenen Blick auf die großen Meister, die sie mit Vorstellungskraft nachahmten, haben einen ungeheuren Beitrag zu unserem leidenschaftlichen Miterleben beim Verständnis der Werke von Rubens und Rembrandt geleistet, und zwar genau in jenem Bereich des Verstehens, wo Worte versagen und die Taten der Künstler sprechen. Um ein besserer Künstler zu werden, widmete sich Delacroix, wiederum in der Nachfolge Rubens', dem Studium der Kunstgeschichte. Wir nennen ihn einen „Romantiker" und weisen ihm damit seinen Platz in seiner Zeit zu. Aber über dem Eingang seines Pariser Ateliers (Abb. 2) ist bis zum heutigen Tage der Abguß eines berühmten Sarkophags der Musen zu sehen, den er dort angebracht hat und der sie im Glanz ihrer edlen Schönheit, Ungezwungenheit und Anmut zeigt (Abb. 3).60 Das war ein Gruß an die klassische Kunst und eine Mahnung, wenn er sein Atelier betrat, seinen künstlerischen Zielen treu zu bleiben. Was er in dem Vorbild und in der Ermunterung der Musen gesehen hat, zeigt als deutliches Beispiel ein rührendes kleines Gemälde, „Ovid unter den Skythen", in der Londoner Nationalgalerie (Abb. 4). Es feiert schon allein in der dargestellten Geschichte (die aus Ovids Tristia ex Ponto stammt) den humanisierenden Zauber der Musen, zum Leben erweckt in der Gestalt des verbannten Dichters, der in der Tiefe seiner Einsamkeit immer noch seine Gedichte schreibt. Die ungeschlachten Bewohner der Gegend nähern sich voll Scheu, und da sie die Schönheit des Dichters, wie er in schmerzlicher Hingabe seine Verse schreibt, rührt, bringen sie ihm Stutenmilch. Sie ist das beste, was sie ihm zu seinem Unterhalt geben können. Auch wenn sie seine Gedicht nicht lesen können, ist ihre Gabe, die ihr Mitgefühl zeigt, doch ihre Huldigung an den Dichter und die Musen, die ihn und sein Werk segnen, selbst in der Verbannung.61 60 Meine Freundin Claudia Echinger hat mich freundlicherweise daran erinnert, daß oberhalb der beiden Fenstern seitlich des großen Fensters über dem Abguß des Musensarkophags im Louvre sich zwei Abgüsse befinden, die die Arbeiten des Herkules zeigen. Es bedarf solcher Arbeiten, um die Voraussetzungen für den Frieden zu sichern, der den Musen zu tanzen erlaubt. In unserer Abb. 2 erkennen wir gerade noch (rechts), wie Herkules den Cacus erschlägt. 61 Siehe unseren Appendix II.
168
II Zur Kunst
A b b . 2. E u g e n e D e l a c r o i x ' Atelier. Paris, Place de F u r s t e m b c r g
A b b . 3. E u g è n e D e l a c r o i x ' Atelier. Detail ( P h o t o g r a p h i e : H e l m u t F ä r b e r u n d M a r g a r e t e H u b e r )
Ph. Fehl: Drei Ebenen von Piatons Höhle
Abb. 4. Eugene Delacroix, Ovid unter den Skythen.
169
London, National Gallery
Manche der modernen Künstler, die Delacroix, van Gogh und anderen in deren Achtung vor und Liebe zu den großen Meistern gefolgt sind, haben sich auch der Kunstgeschichte zugewandt als einer Quelle der Unterweisung in ihrer Kunst und gleichzeitig der Vervollkommnung der Humanität, die sie in ihren Werken feiern wollten. Die von ihnen dargestellten Gegenstände und die von ihnen verwendeten Formen stellten einen anderen Entscheidungsbereich als den jener Künstler dar, deren Werke sie studierten, aber ihr Gefühl der Besonderheit der künstlerischen Berufung und seiner Verantwortung, sein Mitgefühl und sein Feingefühl bei der Versenkung in die Natur und in die menschlichen Angelegenheiten blieben sich gleich. Und sie wiederum gaben dieses Wissen an ihre Schüler weiter. Es ist mir eine Ehre, einige dieser Künstler gekannt zu haben. Sie widmeten sich ihrem Werk und wählten, wie es die Notwendigkeit diktierte, die Obskurität als Preis, den es zu zahlen galt, um ihrem Werk nachzugehen, ohne sich dem Diktat der Moden zu unterwerfen. Mein erster Lehrer in der Kunstgeschichte war der Aquarellist Daniel Mendelowitz an der Stanford University. Das Malen und das Studium der Kunstgeschichte waren für ihn verwandte, ineinander greifende Gebiete, so wie es auch für die Bewohner der Grotte der Großen Alten in Piatons ursprünglicher Höhle galt. 62 War er aus diesem Grund kein moderner Künstler? Für so einen hielt er 62 Daniel Mendelowitz, History of American
Art, New York, 2 1970.
170
II Zur Kunst
sich, ohne darum viel Aufhebens zu machen. Seine Modernität wirkte in seinem Werk. Albert Bloch ist bekannt für die Werke, die er in seiner Münchener Zeit geschaffen und mit der Blauen Reiter-Gruppe ausgestellt hat. Als die Moderne in Mode kam, hatte er aber das Gefühl, seine eigene Modernität schützen zu müssen, und deshalb kehrte er nach Amerika zurück. Dort, an der University of Kansas, damals weit weg von Kunstmärkten, malte er weiter und entwickelte eine Kunstschule, in der er auch Kunstgeschichte lehrte, „die Kunstgeschichte eines Malers", wie er es nannte. Seine Vorlesungsnotizen sind, als ausgearbeitete Typoskripte, erhalten geblieben und harren noch der Veröffentlichung. Die Gemälde seiner Reifezeit sind in der großen Welt noch kaum bekannt, aber eine jüngst stattgefundene Ausstellung in München zeigt, was Modernität von den Anfängen seiner Karriere für ihn bedeutete, und wie er versucht hat, ihr Wesen zu erhalten und zu artikulieren (Abb. 5).63 Seine Einstellung zur Kunst und ihrer Geschichte haben sich nicht geändert. Die Welt der Kunst um ihn herum hat sich geändert. Als Künstler sah er keine Veranlassung, mit der Zeit zu gehen. Ich möchte abschließend das Selbstbildnis von Felix Nussbaum heranziehen, das keiner vergessen kann, der es je gesehen hat (Abb. 6).64 Wie das Bild zeigt, malt Nussbaum in völliger Einsamkeit und offenkundiger Verfolgung. Das Bild ist sein Abschied vom Leben, aber er huldigt damit auch seiner Kunst und legt ein Treuebekenntnis zur Wahrheit ab. Angesichts dieses Bildes verschwinden alle Unterscheidungen zwischen „modern" und „traditionell". Das Bild läßt sich datieren, aber sein Pathos und sein Schweigen sind zeitlos.65 Das ist es, was Künstler mit der Liebe zur Wahrheit zum Studium der Kunstgeschichte beitragen können. Kunsthistoriker ihrerseits können sich den Künstler 63 Ausst. Kat. Albert Bloch: ein amerikanischer Blauer Reiter, hrsg. von Annegret Hoberg und Henry Adams, Städtische Galerie im Lenbachhaus, München 1997; siehe auch Philipp Fehl, „Eine Begegnung mit Albert Bloch", in: Kontinuität, Identität: Festschrift für Wilfried Skreiner, hrsg. von Götz Pochat et al.; Wien 1992, S. 227-240. 64 Felix Nussbaum: Verfemte Kunst. Exilkunst - Widerstandskunst: Die 100 wichtigsten Werke, hrsg. von Eva Berger et al., Kulturgeschichtliches Museum Osnabrück 1990, S. 4 1 5 - 4 1 6 . 65 Auch möchte ich voller Achtung und Bewunderung an Gerhart Frankl erinnern, der im Exil in England durch das Studium der alten Meister einen neuen Stil schuf, der seiner großen Beschwörung des Leids und des Schreckens der Vernichtungslager angemessen war. Siehe Ausst. Kat. Gerhart Frankl. In memoriam, Neue Galerie am Johanneum, Graz, hrsg. von Wilfried Skreiner, London und Graz 1991. Ich erinnere mich mit derselben liebevollen Bewunderung an den tschechischen Bildhauer Karel Vogel, der einen Doktorgrad in Klassischer Archäologie erwarb, um sich besser der Ausübung seiner Kunst widmen zu können. Im Londoner Exil hat er Bildhauerei und Kunstgeschichte an der Cumberwell School of Arts gelehrt, wo er eine Gruppe treuer Schüler hinterlassen hat. Deren Werk hat zusammen mit seinem eigenen für einige Zeit einen Wandel in der sich wandelnden Szene der britischen Bildhauerei bewirkt. Mehr kann ein einzelner Künstler in mühevollen Zeiten für seine Kunst nicht tun; weniger aber dürfte er vielleicht auch nicht anstreben.
Ph. Fehl: Drei Ebenen von Piatons Höhle
171
A b b . 5. A l b e r t Bicicli, Blind Man (1942). D r . and M r s . N a t h a n G r e c n b a u m , K a n s a s C i t y , M i s s o u r i
dabei anschließen, die Zeugnisse der Vergangenheit auszuwerten, so daß die Künstler der großen Tradition in den kunsthistorischen Werken deutlicher sichtbar werden, nicht länger vernebelt von Legenden, Lügen und Mißverständnissen, die sich mit den Zeitaltern wie ein verdunkelnder Firnis (der auch dann noch bleibt, wenn die Bilder bis in den letzten Winkel gereinigt werden) auf sie gelegt haben und ihre innersten Anliegen verzerren.
172
II Zur Kunst
A b b . 6 . F e l i x N u s s b a u m , Selbstbildnis.
Kulturgcschichtlichcs Museum
Osnabrück
Vielleicht d a n n , in e i n e m golden Zeitalter d e r K ü n s t e , w e r d e n die K ü n s t e , wie s c h w i e r i g auch i m m e r die ä u ß e r e n U m s t ä n d e sein m ö g e n , befreit von E t i k e t t e n wie „ f o r t s c h r i t t l i c h " u n d „ r e a k t i o n ä r " , ganz allein für sich s p r e c h e n k ö n n e n , und für das W o r t „ m o d e r n " w i r d dann keine E n t s c h u l d i g u n g o d e r h i s t o r i s i e r e n d e E r k l ä r u n g m e h r n ö t i g sein.
Ph. Fehl: Drei Ebenen von Piatons Höhle
173
Ich glaube, das ist es, was Edgar Wind als Aufgabe für die Zukunft gemeint hat, als er vor langer Zeit Kunst und Anarchie schrieb. Er schrieb aus dem Gefühl der Verantwortung für die Kunst, denn er war Kunsthistoriker und Philosoph. Sein Werk fordert uns auf, nachdenklich zu werden, wenn wir über die Aufgaben der Kunst sprechen. Und eine ermutigende Herausforderung an uns bleibt auch die Tradition der Verteidigung der Kunst und deren moralische Verpflichtung zur Darstellung, Klärung und Erhellung, der Edgar Wind sein Lebenswerk als Gelehrter gewidmet hat.
Appendix I: Die Insel der Wahrheit In ihrer kalten Logik kann die Philosophie ebenso verführerisch, unnachgiebig, trügerisch bis zum Selbstbetrug und leidenschaftlich sein wie die Künste, wenn sie in die Politik geht. Der Fehlschlag von Piatons politischem Experiment in Syrakus zeigt das auf betrübliche Weise. Das aber hält die politischen Philosophen nicht zurück, sondern es spornt sie vielmehr noch an, Piaton zu übertrumpfen und die Tyrannen, mit denen zusammenzuarbeiten sie sich entschieden haben, noch besser kennenzulernen, in der heimlichen Hoffnung, sie entweder zu überlisten oder sie doch wenigstens so zu erziehen, daß sie sie für ihre eigenen Absichten einsetzen können. Es liegt etwas Kristallklares im Gang ihrer Argumente, der ihnen hilft, verzweifelte Situationen zu diagnostizieren, die dann selbstverständlich verzweifelte Gegenmaßnahmen erfordern. Leo Strauss' Modell der zweiten Höhle, von dem wir hier dankbaren Gebrauch gemacht haben, hat etwas von diesem absoluten Charakter bei der Definition ihrer Grenzen. Wenn die Philosophen sich nicht in die Angelegenheiten der Menschen einmischen, ist ihre Erkenntnis natürlich nutzlos, außer für ihre Kollegen, die anderen Philosophen, und außerdem unmoralisch. Aber das philosophische Engagement in der Politik, wenn nicht mit dem größten Takt und äußerster Vorsicht ausgeübt, lädt zu gegenseitiger Täuschung ein und führt vorzugsweise in die Katastrophe, das heißt, hinab in Piatons dritte Höhle. Edgar Wind hat sich mit diesem Dilemma in einem ansprechenden Essay befaßt, den er vielleicht auch deshalb unvollendet hinterließ, weil er sich nicht zu einer letzten Schlußfolgerung entscheiden wollte („Piatonic Tyranny and the Renaissance Fortuna. On Ficino's Reading of Laws, IV, 709A-712A", in seinem Buch Eloquence of Symbols, a. a. O., S. 86-93). Er verweist allerdings auf das bewegende Beispiel von Jacob Bernays' Erwägungen über politische Gerechtigkeit und politisches Verhalten in dessen Phokion und seine neuesten Beurtheiler. Ein Beitrag zur Geschichte der griechischen Philosophie und Politik, Berlin, 1881. Wind zitiert mit offensichtlicher Zustimmung Bernays' Charakterisierung von Piatons adligen Bundesgenossen in Syracus, die sich, in einem ausführlicheren Zitat als bei Wind geboten, folgendermaßen liest:
174
II Zur Kunst Je mehr daher die Sokratiker mit dem seit Alcibiades's Untergang unwiderruflich demokratischen Athen zerfielen, desto mehr richteten sie ihren Blick auf die Königshöfe im Westen und im Norden. Die kaum begreiflichen Hoffnungen, welche die blutigen Schöngeister auf dem sicilischen Thron, Vater und Sohn Dionysius, bei Piaton und seinen Freunden erregten, und die bitteren Enttäuschungen, welche in nur zu begreiflicher Weise, das übel angebrachte Vertrauen bestraften, brauchen hier nur in Erinnerung gebracht und nicht ausführlicher besprochen werden.
Bernays geht es darum, Phokions Ehre zu verteidigen, die von einigen seiner gelehrten Kollegen in Zweifel gezogen wurde, hielten sie doch Phokions Entscheidung, sich im Augenblick der Gefahr für sein Land lieber aus der Politik zurückzuziehen, als ein Unrecht auszuüben, für unpatriotisch und selbstsüchtig. Bernays spricht von edlem Egoismus (S. 34) und löst den Konflikt schließlich von seinem Standpunkt nicht als Philosoph, sondern als Historiker, der uns zeigt, daß Phokion aus politischen wie aus philosophischen Gründen gehandelt hat. Bernays' Überzeugung von Phokions moralischer Größe gerät nie ins Wanken. Er betrachtet dessen Handeln nicht nur von seinem eigenen (Bernays') Verständnis von Piatons Sozialphilosophie (und nicht dessen politischem Experiment), die besagt, „daß der Mensch lieber Unrecht leiden als Unrecht thun solle" (S. 45). Bernays rekonstruiert als Historiker den Spielraum politischer Entscheidungsmöglichkeiten, der sich Phokion als tugendhaftem Mann in äußerst kritischen Zeiten bot. Zu einer Zeit, als Piatons zweite Höhle (wie Leo Strauss sie beschreibt) sich bereits weit geöffnet hatte, orientiert Bernays seine Hoffnungen als Historiker immer noch im Einklang mit der Konstellation der Sterne (oder Schatten), die in Piatons ursprünglicher, erster Höhle wahrgenommen werden kann, über die Strauss mit so großer Sehnsucht schreibt. Bernays bewohnt die Grenze zwischen den beiden Höhlen, doch sein Wohnsitz wird durch eine feste Mauer moralischer Integrität geschützt. Dichter, die ironiebegabt sind, sind gelegentlich bessere Beobachter der Schattenseiten eines von Philosophen regierten Staates als die Philosophen selber. Das hat bereits Aristophanes in seinen Wolken gezeigt. Damit wurde eine lange Tradition begründet. Das folgende Beispiel stammt aus Ferdinand Raimunds Stück Der Diamant des Geisterkönigs, das 1824 in Wien uraufgeführt wurde. Zwei Reisende sind gerade im Ballon auf einer Insel gelandet, „in dem Land der Wahrheit und Sittenstrenge". Sie werden von Aladin, dem Ersten Höfling des Königs, empfangen und über die Sitten auf der Insel aufgeklärt: Aladin: Selten vergißt ein Frauenzimmer ihren Stolz. Wenn aber ein unwürdiges Betragen von einer den anderen zu Ohren kommt, so empört sich auch ihr Gefühl so sehr, daß sie in großen Tadel über die Unwürdige ausbrechen. Eduard: Ich danke dir für deine Auskunft und bedaure diese Unglücklichen; sie würden wahrscheinlich noch edlere Geschöpfe werden, wenn man ihren Handlungen weniger Zwang auflegen möchte.
175
Ph. Fehl: Drei Ebenen von Piatons Höhle
Aladin: Bedauern? Sprich dieses Wort nicht aus in Gegenwart meines Herrschers, bei dem ich dich jetzt melden werde. Im Lande der Wahrheit ist niemand zu bedauern, als der, den die Götter mit Blindheit geschlagen haben, den unbedingten Wert unserer Handlungen nicht einzusehen. (Ab in den Palast)"
Appendix II: Stutenmilch auf Delacroix' Ovid bei den Skythen (Abb. 4) Der Leser der Tristien des Ovid wird beim Anblick des Bildes leicht erkennen, daß Delacroix die Gedichte gut gekannt hat, aber er wird auch, wenn er nachliest, herausfinden, daß Delacroix keinen besonderen in den Gedichten geschilderten Augenblick gestaltet und ebensowenig Rücksicht auf Ovids eigene Personenbeschreibung oder sein Alter genommen hat. Ovid war fünfzig Jahre alt, als er in die Verbannung geschickt wurde. Bei Delacroix ist Ovid jung und schön, und sein Leid, das eines so jungen, unglücklichen Menschen, rührt die Skythen so, wie es uns rührt. Die Gabe der Stutenmilch, welche die Skythen dem Ovid darbringen, ist eine freie Erfindung von Delacroix. Das Geschenk ist der Höhepunkt des Bildes. Delacroix konnte sich bei seinem Publikum auf ein Allgemeinwissen über die skythischen Sitten verlassen. Aller Wahrscheinlichkeit war seine Quelle keine Primärquelle, sondern ein Bildungsroman, der schon lange in Frankreich und anderswo ein beliebtes Buch war, und zwar die Voyage du jeune Anacharsis en Grèce,67 Der „jeune Anacharsis" des Romans ist ein skythischer Prinz, der Griechenland im Goldenen Zeitalter bereist und dort den damaligen großen Menschen und Helden begegnet. Die Skythen werden von Barthélémy als ein edles, unverdorbenes Volk geschildert, das zwar ungebildet ist, aber, wie die fiktiven Reisen des Anarcharsis zeigen, der Zivilisation liebevollen Respekt erweist, die Griechenland zum Nutzen aller besaß. Barthélémy teilt uns mit, daß die Skythen Stutenmilch trinken und verweist uns auf Justinus, einen römischen Autor des 3. nachchristlichen Jahrhunderts (Epit. hist. II. 2 [8]), als seine Quelle. Aber Justinus, der in seinem ganzen Bericht über die Skythen hauptsächlich Freundliches und Bewunderndes über dieses Volk zu sagen hat, erzählt nicht mehr, als daß sie sich von Milch und Honig nähren, lacte et melle vescuntur. Trotzdem ist Barthélémy kein Lügner, er sucht nur die besondere pittoreske Note. Wenn wir die von ihm genannte Passage in einer alten Justinus-Ausgabe nachschlagen, etwa in der des berühmten Johann Georg Graevius, Leyden, 1683, finden wir, daß uns Graevius ziemlich kryptisch auf die Ilias,
66 Ferdinand Raimund, Der Diamant
des Geisterkönigs,
II. Akt, 10. Szene; in: Ferdinand
Raimunds
sämtliche Werke, hrsg. von Eduard Castle, Leipzig, o. J., S. 106. 67 Jean-Jacques Barthélémy, Voyage du jeune Anacharsis gelegt, z. B. Paris 1822; (dt. Ausgabe Reise des jüngeren
en Grèce, Anacharsis,
Paris 1788 und oftmals neuaufBerlin 1792-1793).
176
II Zur Kunst
13.6 verweist, und in Sachen Stutenmilch weitaus bedeutender auf Strabon, VII, 46, „[sie leben] nicht nur allgemein von Fleisch, sondern auch von Pferdefleisch, wie auch von Käse aus Stutenmilch, von frischer Stutenmilch, die, wenn sie auf besondere Weise zubereitet, von ihnen sehr geschätzt wird. Und deshalb nennt der Dichter [Homer] die Menschen in jenem Teil der Welt ,galactophagi' (oder Milchesser)". Nicht erwähnt wird in der Anmerkung von Graevius eine Stelle aus dem Herodot (IV.2), die von der barbarischen Sitte der Skythen erzählt, ihre Sklaven zu blenden, welche „die Stuten melken müssen, von denen sie trinken" („damit sie nicht die beste Milch stehlen", erklärt der Ubersetzer der Loeb-Ausgabe in einer Anmerkung (Band III, S. 197), und er beschreibt, wie schmerzhaft das Melken für die Stuten ist. Selbst wenn Barthélémy das alles gewußt hätte, hätte er weder diese Geschichte noch alle anderen barbarischen Taten geglaubt, ob sie nun von Herodot oder Strabon berichtet werden. Seine Skythen sind wie die des Justinus edle Wilde, denen keine Lüge über die Lippen kommt. Für Delacroix hat es gewiß gereicht, Ovid zu lesen, um von der Achtung und der Zuneigung gerührt zu sein, die die Skythen dem Dichter entgegenbrachten, wie Ovid es auch selber war. Er konnte ihre Darbringung von Geschenken noch sinnfälliger machen, indem er die Stutenmilch zum Geschenk machte, so daß zu sehen ist, wie sie ihre (von Barthélémy beschriebene Lieblingsspeise) mit dem verbannten Dichter teilten. Es ist eine simple Liebesgabe von einem naturnahen Volk, die nicht nur als Nahrung dargeboten wird, sondern auch als Tribut an die Schönheit und äußerste Einsamkeit des Dichters. Kritiker haben immer darauf hingewiesen und Delacroix hat kein Geheimnis daraus gemacht, daß dieses Gemälde, wenn auch mit Variationen, eines seiner Bilder für die Decke der Bibliothek im Pariser Palais Bourbon wiederholt (zu den Details siehe Lee Johnson, The Paintings of Eugène Delacroix, Band III, Text, Oxford, 1986, S. 150-152). Deshalb findet das Gemälde in Delacroix' umfangreichem Œuvre keine große Beachtung, zu Unrecht, wie ich meine, denn er hat sich nicht wiederholt, weil er alt war, sondern wandte sich 1859 voll Sehnsucht wieder seinem Werk der Liebe im Palais Bourbon (1834-1847) zu, das in der Gestalt des Orpheus die Tugend der Künste feiert, die mittels ihrer Reinheit den Beifall für die Schönheit wecken, Eintracht unter den Menschen schaffen und die Menschheit befreien. Sein „Ovid bei den Skythen" über dem 3. Pendentif der ersten Kuppel (La Poésie) in der Bibliothek zeigt Ovid in trauernder Abgeschiedenheit sitzen (fast wie ein römisches Bild eines Volkes in Gefangenschaft auf einer Münze oder in einem Relief), während sich eine skythische Familie ihm nähert; die Frau bietet ihm freundlich einen Becher Milch. Die Stute steht, fast wie zur Familie gehörig, hinter dem Gatten und Vater, der sie locker am Zügel hält. Im Kontext der Decke zeigt Ovids kummervolles Schicksal, welchen Preis es kostet, in widrigen Zeiten ein der Schönheit und den Musen geweihtes Leben zu leben. Mit der Wiederaufnahme dieses Thema in seinem Bild von 1859 unternimmt es Delacroix, in einem einzigen lyrischen Bild die epischen und moralischen Inter-
Ph. Fehl: Drei Ebenen von Piatons
Höhle
177
essen zu reflektieren, die schon seine Bilder im Palais Bourbon auszeichneten. Was dort, wo jedes Bild in dieser großartigen Konstruktion in Harmonie mit den anderen spricht, so bewegend sichtbar wird, sollte hier mit starker Unmittelbarkeit zu uns sprechen. Das Bild ist personenreicher, unter den Skythen sind mehr Frauen und Kinder, und die Schönheit Ovids, der mit seinen Pergamenten gezeigt wird - auf denen gewiß einige der Tristien geschrieben stehen - , wird genauso deutlich sichtbar wie die des Orpheus auf dem Hauptbild der Verherrlichung im Palais Bourbon. Die einfache Geschichte und die wilde Landschaft vor uns reichen aus, um uns zu rühren, unser Mitgefühl zu wecken und uns empfänglich zu machen für das, was die Poesie, die des Delacroix wie die des Ovid, für uns tun kann, wenn das Los des Dichters die Skythen derart rühren kann. Selbst die Stute, die noch alle Merkmale eines lebendigen, durch die Weiten galoppierenden Tieres hat, hält still, da sie gemolken wird. Das Gemälde zeigt uns einen Augenblick der Einsamkeit, doch auch der Erlösung in der Geschichte der Poesie. Mit seiner überzeugenden Darstellung erscheint Delacroix als ein moralischer Maler, der uns rührt, weil er selbst gerührt war, als er die Tristien las. Das Werk mag vielleicht treffend Delacroix' „Apotheose des Ovid" genannt werden, weil alles an und in ihm, geleitet von Delacroix' wohlüberlegter Kunst der Malerei, unendlich einfach ist und sich mit Worten nicht ausdrücken läßt. Aus dem Englischen
von Bernd
Samland
III Philosophie der Verkörperung
Kunst und Wissenschaft in Edgar Winds Philosophie der Verkörperung John Michael Krois
As for humanism, it appears to me to be an allied doctrine, in perfect harmony with pragmatism C. S. Peirce
1. Zur Einführung Edgar Winds philosophisches Hauptwerk, Das Experiment und die Metaphysik,1 scheint von einem „Fachphilosophen" zu stammen, von jemandem, dessen Interessen der Physik und der Kosmologie gelten und weit entfernt sind von Kunst oder Kulturtheorie, wie wir es von Edgar Wind erwarten würden. Doch dieses Werk verdankt seine allgemeine Ausrichtung gerade Winds Interesse an der Kunst. Die bildende Kunst macht etwas sichtbar, sie ist konkret, im Gegensatz zum Begriff. Sichtbarkeit ist für die Philosophie unwichtig. Die konkrete historische Wirklichkeit kommt in der Philosophie nicht vor; sie wird in ein vorgefertigtes begriffliches Schema eingepaßt oder der empirischen Forschung überlassen. Wind verwarf nicht das philosophische Interesse am Allgemeinen, er unterzog die von Kant geprägte Philosophie seiner Zeit aber einer tiefen Revision. Bei Wind steht nicht mehr der Begriff, das Bewußtsein, die Erkenntnis, das Verstehen und auch nicht die Welt oder das Sein im Mittelpunkt seiner philosophischen Untersuchungen, sondern, wie er es nannte: die „Verkörperung". Wir sehen Winds Begriff der „Verkörperung" und das Thema seines Buches beide von Blakes berühmtem Frontizpiz „The Ancient of Days" (Abb. 1) zu seiner „Europe, a Prophecy" illustriert. Das goldene Instrument in Blakes Bild wird bei der Erschaffung der Welt eingesetzt, aber es ensteht dabei ein Paradox: das Instrument setzt schon die Existenz der Welt voraus, weil es ein Teil (eine Verkörperung) von dieser ist. Die Wirksamkeit eines Instruments ensteht erst dadurch, daß es 1
Edgar Wind: Das Experiment und die Metaphysik. 7,ur Auflösung der kosmologischen Antinomien (= Beiträge zur Philosophie und ihrer Geschichte, Band 3), Tübingen 1934. Hiernach zitiert als EM.
182
III Philosophie der
Verkörperung
A b b . 1. W i l l i a m B l a k e : „ T h e A n c i e n t of D a v s " , F r o n t i s p i z z u „ l i u r o p c , a P r o p h e e v " ( 1 7 9 4 ) . Tate Gallery, L o n d o n
J. Krois: Kunst u. Wissenschaft in E. Winds Philosophie der Verkörperung
183
selbst ein Teil (eine Verkörperung) der Wirklichkeit ist. N u r so kann es zur Wirksamkeit gelangen. „Verkörperung" ist der Hauptbegriff in Edgar Winds Philosophie. Er bezeichnet zunächst das Resultat einer menschlichen Handlung, etwa die Herstellung eines Bildes, aber auch den Vorgang der Verkörperung im Allgemeinen. Diese zwei Auffassungen sind auch beide im Titel von Winds philosophischem Hauptwerk herauszuhören: „Das Experiment" (eine menschliche Handlung) und „die Metaphysik" (Theorie der Verkörperung im Allgemeinen). Bei Experimenten treffen Ideen und Dinge auf eine kontrollierbare Weise zusammen. Ein ideelles Maßsystem (z.B. das metrische) wird in einem Meßinstrument aus gewählten physikalischen Substanzen verkörpert. Dieses Instrument wird wiederum mit Teilen der Welt in einem Akt der Messung zusammengebracht. Die Regelmäßigkeiten, die wir mit Messungen feststellen wollen, setzen wir mithin schon beim Meßinstrument selbst voraus, denn dieses - so meinen wir - muß auch den Naturgesetzen gehorchen, die es entdecken helfen soll. Mit anderen Worten auch in der Naturwissenschaft gibt es den hermeneutischen Zirkel, aber als sich selbst korrigierenden methodischen Zirkel. Das Maßsystem haben zwar die Menschen erfunden (es gibt viele Maßsysteme), und auch die Geometrie ist historisch entstanden, aber Wissenschaft setzt eine Wirklichkeit voraus, der wir mit Hilfe eines Instruments immer näherkommen sollen und die eine Kontrollinstanz darstellt. Im Meßakt gibt es eine Art doppelte Verkörperung: (1.) von unserem Maßsystem und (2.) von den zu entdeckenden Gesetzmäßigkeiten. 2 Unsere Handlung erzwingt eine Antwort von der Wirklichkeit. Diese Wirklichkeit ist dem Gedanken heteronom: sie entzieht sich unserer Macht, auch während sie sich im Instrument zeigt. Deshalb bezeichnet Wind sie als „metaphysisch". Die Verkörperung im Instrument ist aber auch ein Symbolprozeß: die Anzeiger in Meßgeräten haben keine unmittelbare Bedeutung, aber ihre Bedeutung muß sich irgendwann in etwas Beobachtbarem verkörpern, wenn sie reale Bedeutung haben soll.3 Winds Heidnische Mysterien in der Renaissance und andere ikonologische Untersuchungen gehen auf die Inhalte von Kunstwerken ein. Für die ikonologische Analyse reichen die Mittel der formalistischen Kunstgeschichte und Kunstkennerschaft nicht aus. Warburg hat gezeigt, wie die Untersuchung literarischer Traditionen, wissenschaftlicher Vorstellungen und anderer Aspekte des sozialen Gedächtnisses in die Kunstgeschichte einbezogen werden müßte, um uns für die Inhalte von Kunstwerken empfänglich zu machen. Warburg aber stand der Philosophie fern bis er in Cassirers Symboltheorie eine systematische Grundlage für die Kulturwissenschaft als „Lehre vom bewegten Menschen" fand. 4 Im Gegensatz zu Warburg war Wind auch Philosoph. 2 Wind versteht den Forschungsprozeß als eine ständige Verkörperung und Erfassung von Gesetzmäßigkeiten, d. h. von Universalien. Siehe EM, S. 35. 3 Vgl EM, S. 31. 4 Brief von Aby Warburg an Ernst Cassirer, Kreuzlingen, 15.4.1924. Der Brief befindet sich in den „Cassirer Papers", Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Yale University.
184
III Philosophie der
Verkörperung
Die Ikonologie zeigt, daß Kunst Gedanken und nicht nur Gefühle und Formen transportieren kann. Gedanken müssen nicht in Kunstwerken verkörpert werden; die Philosophie kommt ohne Bilder aus. Aber kommt sie auch ohne Verkörperung aus? Rede, Schrift, alle Symbole verkörpern Sinn. Edgar Wind wollte dieser Verkörperung Rechnung tragen, aber um dies zu erreichen, mußte er mit (fast) der gesamten Philosophie seiner Zeit brechen. Bei der Entwicklung seiner Ideen wurde Edgar Wind vor allem durch seine Lektüre von Charles Peirce angeregt. Wind sagte später, es waren zwei Menschen, die ihn besonders beeinflußt hätten: Aby Warburg und Charles Peirce. 5 Niemand wird über die Erwähnung Warburgs überrascht sein, eher aber über die von Peirce (1839-1914). Überraschung ist auch angebracht, denn als Wind 1929 Das Experiment und die Metaphysik der Hamburger Fakultät vorlegte, war Peirces Philosophie kaum jemandem in Deutschland bekannt und der von Peirce begründete Pragmatismus im allgemeinen als Theorie des Nützens falsch verstanden. 6 Wind war der erste Philosoph in Europa, der Peirces Bedeutung erkannte. 7 Wind sagte zwar, daß er lediglich Peirces Methode in „How to make our ideas clear" folge, 8 aber es gibt bei Peirce keine Hinweise, wie man mit dieser Methode die Kantischen Antinomien auflösen kann - was die Hälfte von Winds Buch ausmacht. Wichtig für Wind war, daß es Peirce um Klarheit ging - im Gegensatz zu den „grüblerischen Deklamationen", die Wind in der Philosophie aufkommen sah, die „zu nebelhaft [sind] um auch falsch zu sein".9 Wichtig war für ihn aber auch, wie Peirce zur Klarheit gelangt. Statt nur von rein logischen oder psychologischen Denkmaßstäben auszugehen, macht Peirce die „denkbaren Wirkungen" von körperlichen Handlungen und Gegenständen zum Maßstab für die Klärung von Begriffen. 10 Der Pragmatismus war nicht nur für die Entwicklung von Edgar Winds Philosophie wichtig, sondern Wind griff auch selbst in diese Entwicklung des Prag-
5 Persönliche Mitteilung von Margaret Wind. Über die Beziehung Winds zu Warburg siehe Bernhard Buschendorf: „War ein sehr tüchtiges gegenseitiges Fördern·. Edgar Wind und Aby Warburg", in: Idea (Jahrbuch der Hamburger Kunsthalle), IV, 1985, S. 165-209. 6 Zu der Einstellung in Deutschland gegenüber dem Pragmatismus, siehe Hans Joas, Pragmatismus und Gesellschaftstheorie, Frankfurt/M 1992, S. 114-145: „Amerikanischer Pragmatismus und deutsches Denken. Zur Geschichte eines Mißverständnisses". 7 Die Peirce-Renaissance in Deutschland setzte im wesentlichen erst in den 1960er Jahren ein. 8 Siehe Wind: „Can the Antinomies be restated?" in: Psyche, XXV, 1934, S. 177-178, hier: S. 178. 9 EM, S. VI. 10 Siehe die sogenannte „pragmatische Maxime" in Peirces „How to Make our Ideas Clear" in: Writings of Charles S. Peirce. A Chronological Edition, Bd. 3: 1872-1878, Bloomington 1986, S. 257-276, hier: S. 266: „Consider what effects, which might conceivably have practical bearings, we conceive the object of our conception to have. Then, our conception of these effects is the whole of our conception of the object". (Uberlege, welche Wirkungen die denkbaren praktischen Bewandtnisse haben können, die wir dem Gegenstand unseres Begriffes zuschreiben. Dann besteht unser ganzer Begriff des Gegenstandes aus unserem Begriff dieser Wirkungen.)
J. Krois: Kunst u. Wissenschaft
in E. Winds Philosophie
der Verkörperung
185
matismus ein. Das oben angesprochene Bild von Blake, The Ancient of Days, stand als Frontispiz zu Sidney Hooks Buch The Metaphysics of Pragmatism (1927). Hook, einer der wichtigsten Denker um John Dewey, legte in seiner Schrift dar, was er „The Metaphysics of the Instrument" nannte. Diese erläuterte er anhand von Blakes Illustration: „Whatever else of frenzied fancy this picture may symbolize, it illustrates a profound metaphysical meaning. ... The golden compasses in Blake's picture already presupposes the existence of the world, otherwise their efficacy in intelligent construction would be a sheer impossibility".11 Hook sagt nicht, wie er auf dieses Bild von Blake gestoßen ist und auch nicht, wie die Idee seiner Metaphysik des Instruments entstand. Wind untersucht meines Wissens nirgends dieses Bild, aber es gibt gute Gründe, hier Winds Einfluß auf Hook zu sehen. Wind lernte Hook bald nach seiner Ankunft in Amerika im Jahr 1924 kennen.12 Wind trug seine Theorie der Verkörperung schon September 1926, also vor der Publikation von Hooks Buch, vor.13 Auch wenn Hooks und Winds Arbeiten als sich ergänzende Texte einzustufen sind, bietet Hook vor allem eine Klärung von John Deweys „instrumentalistischer" Philosophie,14 während Winds Schrift die zugrundeliegenden sachlichen Probleme thematisiert. Kant hat gezeigt, daß die Vernunft mit sich selbst in Widerspruch gerät, wenn sie versucht, etwas über die Wirklichkeit als Ganzes auszusagen. Sie kann z. B. gültige Argumente sowohl für die These geben, daß die Welt einen Anfang in der Zeit hat, als auch für die These, daß sie keinen hat. Solche Antinomien sind für die reine Vernunft deshalb unauflösbar, weil diese nur argumentieren kann. Aber die verkörperte Vernunft, die experimentell vorgeht, kann auf lange Sicht eine Beantwortung dieser Fragen erstreben, nicht bloß dadurch, daß wir uns der experimentellen Vernunft anvertrauen: Ergebnisse der konkreten Forschung zwingen uns praktisch, die Welt in der einen oder anderen Weise zu begreifen. Im experimentellen Gebrauch von Instrumenten werden auch Alternativen wie „euklidisch - nichteuklidisch, einfach - zusammengesetzt, determiniert - undeterminiert" entschieden. Instrumente verkörpern im experimentalen Gebrauch Fragen und sie teilen dank ihrer Verkörperung eine Antwort dem Experimentator mit.
Sidney H o o k , The Metaphysics Chicago/London 1927, S. 17. 12 A u s k u n f t v o n Margaret Wind. 11
of Pragmatism.
W i t h and Introductory W o r d by J o h n D e w e y ,
13 Siehe „Experiment and Metaphysics", in: Proceedings of the Sixth International sophy, hrsg. v o n E. S. Brightman, N e w Y o r k 1927, S. 2 1 7 - 2 2 4 .
Congress of Philo-
14 F ü r D e w e y ist selbst „Theorie" instrumental, weil sie eine Organisationsleistung darstellt oder was man heute eine „Komplexitätsreduktion" nennt. Vgl. D e w e y : Erfahrung und Natur, Frankfurt/M. 1995, S. 125: „Die Auffassung, daß kontemplatives D e n k e n das Ziel an sich sei, w a r zugleich eine Kompensation f ü r die Unfähigkeit, die V e r n u n f t in der Praxis wirksam w e r d e n zu lassen, wie auch ein Mittel, die Trennung sozialer Klassen aufrechtzuerhalten. Eine örtlich und zeitlich beschränkte politische Gemeinschaft historischer N a t u r w u r d e zu einer Metaphysik ewigdauernden Seins."
186
III Philosophie der
Verkörperung
2. Die Entwicklung von Edgar Winds Grundgedanken Peirce war der erste Denker, der die mechanistische (deterministische) Weltansicht durch eine neue ersetzte, in der absoluter Zufall zum gleichberechtigten Aspekt der Realität wurde, neben den Tatsachen und Gesetzen der Natur.15 Selbst die Naturgesetze entstanden in Peirces Philosophie aus Zufallsentwicklungen (infinitesimale Verletzungen von Gesetzen).16 Der andere große Entwurf einer Philosophie des Prozesses, der mit dem von Peirce oft verglichen wird, stammt von Alfred North Whitehead.17 Edgar Wind war ebenfalls der erste Philosoph in Deutschland, der Whiteheads extrem schwierige Philosophie rezipierte. Wind vereinte Ideen von Peirce und Whitehead in seiner Verkörperungstheorie und machte sie für Probleme der Kulturwissenschaft fruchtbar.18 Als Wind im Sommer 1920 19 sein Studium in Hamburg aufnahm, hatte er schon in seiner Heimatstadt Berlin 1918-1919 Philosophie bei Cassirer gehört 20 sowie im darauffolgenden Jahr in Freiburg bei Husserl und Heidegger. In seiner bei Cassirer und Panofsky entstandenen Dissertation „Ästhetischer und kunstwissenschaftlicher Gegenstand" (sie brachte ihm am 29. Juli 1922 die Promotion) versuchte er „Kategorien" der Kunstwissenschaft nach erkenntnistheoretischem Modell systematisch auszuarbeiten und in einer „Tafel" zu organisieren.21 Doch 1929, in seiner Habilitationsschrift, vertrat er eine andere, nicht mehr so formalistische oder Kantische Denkart. Winds Bruch mit dem mainstream der akademischen Philosophie fiel indessen anders aus als bei den meisten Denkern seiner Generation, für die die Phänomenologie oder die aus ihr hervorgegangene Existenzphilosophie richtungsweisend wurde. Keinen philosophischen Denkweg hat Wind so gänzlich abgelehnt,
15 Siehe dazu Ilya Prigogines „Vorwort" zu Charles S. Peirce: Naturordnung und Zeichenprozeß. Schriften über Semiotik und Naturphilosophie, hrsg. und eingeleitet von Helmut Pape, Frankfurt/M. 1991, S. 7-10. 16 Siehe Peirce: „Entwurf und Zufall", in: Peirce: Naturordnung (wie Anm. 15), S. 113-125, hier: S. 119. 17 Alfred North Whitehead und Charles Peirce werden oft in einem Atemzug als Schöpfer von „process philosophy" genannt. Whiteheads Schüler Charles Hartshorne, der mit Paul Weiss Herausgeber der ersten großen Ausgabe von Peirces Schriften war, hat diese Sichtweise verbreitet. Historisch richtiger wäre es, Whitehead mit William James zu nennen, der für Whitehead der Erfinder dieser Denkweise war. 18 Siehe Wind: „Mantegna's Parnassus. A Reply to some Recent Reflections", in: The Art Bulletin X X X I , 1949, S. 224-231, hier: S. 231, wo er wieder Peirce zitiert. Vgl. auch die zentrale Rolle von Peirce in Winds „Bild und Text" in diesem Band. S. 259-262. 19 Brief Edgar Winds an William Heckscher, 3. Nov. 1968, Edgar Wind Papers, Bodleian Library, Oxford University. Copyright Margaret Wind. 20 Hugh Lloyd-Jones, „A Biographical Memoir", in: Wind: The Eloquence of Symbols. Studies in Humanist Art, hrsg. von Jaynie Anderson, Oxford 1983, S. xiii-xxxvi, hier: S. xiv. 21 Siehe die aus Winds Dissertation hervorgegangene Publikation „Zur Systematik der künstlerischen Probleme", in: Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft, 18 1925, S. 438-486.
J. Krois: Kunst u. Wissenschaft in E. Winds Philosophie der Verkörperung
187
wie den v o n Heidegger, Jaspers und Sartre eingeschlagenen. 22 Diese Denker bewegten sich außerhalb der übrigen Welt der Wissenschaft, ja sie wollten mit dieser auch nicht in Berührung kommen. Wind nennt ihre Methode die Deklamation. 23 Auch wenn Husserls Arbeiten ihn nicht abstießen, so ist dennoch klar, daß er ihm nur geringe Tragweite zuerkannte. Husserls Methode, schrieb er, verwechsele einen ganz normalen Denkvorgang - Abstraktion - mit einer angeblichen Intuition von Wesen. 24 Davon abgesehen, ziele Husserls Phänomenologie auf den Aufbau einer reinen Wissenschaft v o n Wesenheiten - für die eine Beschäftigung mit der konkreten, historischen Welt nebensächlich w a r - und stand daher in scharfem Gegensatz zu Winds Denken. 2 5 In seinem Vortrag „Experiment and Metaphysics" auf dem 6. Weltkongreß der Philosophie im September 1926 an der Harvard University stellte Wind zum ersten Mal seine Verkörperungstheorie dar. 26 Wind kam schon im März 1924 nach N e w York, w o er zunächst an Schulen unterrichtete. Er lehrte dann 1925 bis 1927 Philosophie an der University of N o r t h Carolina in Chapel Hill. In den fast vier Jahren seines Amerikaaufenthaltes nahm er aktiv an den dortigen philosophischen Diskussionen teil und publizierte in Fachzeitschriften. 27 Gleich in seinem ersten Jahr, am 30. Dezember 1924, hielt er einen Vortrag „Theory of A r t versus Aesthetics" beim jährlichen Treffen der American Philosophical Association. 2 8 Bei diesem 22 Siehe Wind: „Jean-Paul Sartre. A French Heidegger", in: SCAN. Smith College Associated News, vol. XL, no. 31, March 5, 1946, S. 1, 2, 3, 4. In seinem später publizierten Leserbrief an diese Zeitung, mit dem Wind auf die Einwände seines Kollegen Vincent Guilloton reagiert, ist Winds Stellungnahme noch deutlicher. Siehe den Nachdruck der Texte in diesem Band, S. 219-226. 23 Siehe EM, S. Vf. Zum Ganzen, s. Horst Bredekamps Beitrag in diesem Band. (S. 207-218) 24 Siehe Wind: „Contemporary German Philosophy", in: The Journal of Philosophy, XXII, 1925, S. 477—493; 516-530, hier: S. 524-526. 25 Der Einfluß der Phänomenologie auf Wind war aber noch in seiner Dissertation, bzw. in der aus ihr hervorgehenden Schrift „Zur Systematik der künstlerischen Probleme" evident. 26 Wind sprach um 9.30 Uhr am 14. September, dem ersten Tag des Kongresses, wie auch Whitehead und C. I. Lewis. Siehe die Akten des Kongresses: Proceedings (wie Anm. 13), S. LXIV. 27 Neben den in der Wind Bibliographie („The Published Writings of Edgar Wind" in: Eloquence (wie Anm. 20), S. 115-130) erfaßten Publikationen aus seinen Jahren in Amerika, hat er außerdem folgende vier Rezensionen in dem Journal of Philosophy, der wichtigsten amerikanischen Fachzeitschrift für Philosophie, publiziert: (1) Max Ettlinger: Geschichte der Philosophie von der Romantik bis zur Gegenwart, in: XXI, 1924, S. 666-669; (2) Willy Nef: Die Philosophie Wilhelm Wundts, in: XXI, 1924, S. 498-502; (3) Raymond Schmidt (Hrsg.): Die Philosophie der Gegenwart in Selbstdarstellungen, Bd. 5, in: XXIII, 1926, S. 163-164; (4) H. H. Williams: The Evolution of Logic, in: XXIII, 1926, S. 524-525. 28 Siehe die Ankündigung von Winds Vortrag in The Journal of Philosophy, XXII, Nr. 1, 1925, S. 28. Winds Text erschien in The Philosophical Review, XXXIV, 1925, S. 350-359. Vgl. die Bemerkungen zu Winds Vortrag in Herbert Schneiders „The twenty-fourth annual meeting of the Eastern Division of the American Philosophy Association", in: The Journal of Philosophy, XXII, Nr. 2, 1925, S. 46.
188
III Philosophie
der
Verkörperung
Vortrag w u r d e W i n d d e m P u b l i k u m durch den N e w Y o r k e r Philosophen M o r r i s Raphael C o h e n vorgestellt. C o h e n hatte gerade im Jahr z u v o r 2 9 die erste Edition v o n Schriften Charles Peirces herausgegeben. Peirces A r b e i t e n w a r e n bis dahin (und lange danach) n u r w e n i g bekannt, W i n d w i r d w o h l v o n C o h e n den N a m e n Peirce z u m ersten Mal gehört haben. 3 0 A u f den jährlich im D e z e m b e r stattfindenden K o n f e r e n z e n der Philosophiegesellschaft w i r d es auch zu einer anderen wichtigen Begegnung g e k o m m e n sein. Beim Treffen im folgenden J a h r w u r d e ein S y m p o s i u m z u m T h e m a „Zeit" u n t e r der Leitung A l f r e d N o r t h W h i t e h e a d s abgehalten. 3 1 Whiteheads bedeutender V o r trag zu diesem Thema, „Time", den er 1 9 2 6 beim W e l t k o n g r e ß in H a r v a r d hielt, w u r d e v o n W i n d in seiner großen W h i t e h e a d - A b h a n d l u n g in der Zeitschrift L O G O S 1 9 3 2 kritisch untersucht. N e b e n W h i t e h e a d beeinflußte ein anderer H a r v a r d - P r o f e s s o r , Clarence Irving Lewis, die Entwicklung v o n W i n d s Philosophie. A u c h L e w i s w a r Teilnehmer am 6. W e l t k o n g r e s s f ü r Philosophie. Lewis' H a u p t w e r k Mind and the World Order erschien 1 9 2 9 , aber seine G r u n d i d e e n w a r e n schon 1 9 2 3 publiziert, u n d W i n d zitiert sie in seinem Buch. 3 2 Lewis' Grundgedanke betraf Kants Lehre v o m A p r i o r i . L e w i s behauptete, daß man diese Lehre vertreten k ö n n e und müsse, aber nicht als Lehre v o n festgelegten F o r m e n . Es gäbe w e d e r eine universale noch eine historische U b e r e i n s t i m m u n g über eine bestimmte F o r m des A p r i o r i . 3 3 K a n t hatte Recht,
29 Siehe Peirce: Chance, Love, and Logic, hrsg. von Morris R. Cohen, New York/London 1923. 30 Die Tatsache, daß Peirces Werk bis heute immer noch nicht richtig erschlossen ist, bzw. seine Texte in den 20er Jahren nur in raren Zeitschriften zugänglich waren, wird einem Forscher wie Wind kein Hindernis gewesen sein, sich damit zu beschäftigen. Ein Beispiel von Winds Werk als Sammler rarer Bücher ist durch den Ausstellungskatalog dokumentiert: Richard John and Monique Kornell: The Vitruvien Path. An Exhibition of Early Printed Books from the Library of the Department of the History of Art in the University of Oxford, The Ashmolean Museum, Oxford 1 September-31 December 1994, Oxford 1994. 31 Siehe „Notes and News", in: The Journal of Philosophy, XXII, Nr. 25, 1925, S. 672. Wind hat Whitehead vermutlich mehrfach persönlich gehört. Außer bei dem von Whitehead veranstalteten Symposium über „Time" anläßlich des Treffens der American Philosophical Association am 28.-30.12.1925 im Smith College in Northhampton, Massachusetts und bei dem Weltkongress für Philosophie, im September 1926 an der Harvard University, hatte Wind möglicherweise auch Whiteheads Vorträge über „Symbolism" gehört, die dieser 1926 an der University of Virginia hielt. Zu dieser Zeit lehrte Wind Philosophie an der University of North Carolina. Ralf Lachmann verdanke ich den Hinweis, daß Whiteheads Vorträge über „Symbolism" den Einfluß Susanne Langers zeigen, die damals bei Whitehead promovierte und sich in ihrer Dissertation immer wieder auf Cassirers Theorie der symbolischen Formen bezog. Hier hätte Wind eine eigenartige Situation erlebt: die Wirkung seines Hamburger Lehrers auf Whitehead in Virginia. 32 Wind zitiert Lewis' „The Pragmatic Element in Knowledge" in EM, S. 25 Anm. 1. 33 Siehe Lewis, „The Pragmatic Element in Knowledge", publiziert unter dem Titel „A Pragmatic Conception of the A Priori", in: Collected Papers of C. I. Lewis, hrsg. von John D. Goheen und John L. Mothershead, Jr., Stanford 1970, S. 231-239, hier: S. 239.
189
J. Krois: Kunst u. Wissenschaft in E. Winds Philosophie der Verkörperung
daß unsere begrifflichen Schemata der Wirklichkeit ihre Form vorschreiben, nur: diese Begriffe ändern sich historisch, wie Lewis sagt, „on pragmatic grounds when the expanding boundaries of experience reveal their infelicity as intellectual instruments".34 Dieser Gedanke von Lewis führte Wind zu seiner eigenen Revision der Kantischen Philosophie: die experimentelle Vernunft könne uns dazu zwingen, eine alte begriffliche Auffassung zu verwerfen, aber wir kommen dennoch nicht umhin, die Wirklichkeit überhaupt in irgendeinem begrifflichen Schema aufzufassen. Lewis entwickelte keine Theorie für die Änderungen im Apriori Begriffsschema. Er nannte seine Philosophie eine pragmatische Theorie des Begriffs.35 Wind sah, daß die „expanding boundaries of experience" das Phänomen der Verkörperung bedeuten. Winds Philosophie entstand in einem ganz anderen geistigen Klima,36 als er es bei seiner Rückkehr nach Deutschland vorfand. Dies war auch nicht ohne Bedeutung für die Bewertung von Das Experiment und die Metaphysik als Habilitationsschrift. Wind und sein Lehrer, Ernst Cassirer, waren in einem wichtigen Punkt divergenter Meinung, aber die anti-Kantische Tendenz der Arbeit im Allgemeinen nahm ihm der Dozent Albert Görland übel. Das Schlußgutachten der Windschen Habilitation zeigt, daß Görland mit Winds Ergebnissen nicht einverstanden war, aber daß Cassirer die Bedeutung dieser Bedenken durch eigenhändige Änderungen am ersten Entwurf des Protokolls abgeschwächt hat. (Leider werden Görlands Einwände nicht mitgeteilt.) In späteren Jahren wurden Winds und Cassirers Symbolbegriffe gleichgesetzt.37 Da beide hier unter dem Einfluß Warburgs standen, war der Versuch einer Gleich34 Ebenda, S. 239. 35 Lewis' Terminus ist „conceptual pragmatism". 36 Es ist hier nicht möglich auf die Bedeutung aller für Wind wichtigen Philosophen einzugehen, deren Werke ihm damals begegneten. Hierzu gehört aber sicherlich John Deweys Hauptwerk, Experience
and Nature
(1925). In Winds Aufsatz „Uber einige Berührungspunkte zwischen
Naturwissenschaft und Geschichte". [In: Wissenschaft - Zum Verständnis eines Begriffs,
hrsg. von
Hubert Markl u. a., Köln 1988, S. 3 4 - 3 9 . Winds Text erschien schon im Jahre 1936 in englischer Ubersetzung in der Ernst Cassirer Festschrift, Philosophy and History,
hrsg. von Raymond Kli-
bansky und H. J. Paton, Oxford (1936), S. 2 5 5 - 2 6 4 ] stellt er z . B . S. 37 fest, daß es in der Messung/Urkundendeutung immer eine ereignishafte „Intelligenzleistung" als „Weise des Verhaltens" gibt. Dies ist Winds Übersetzung und Anwendung von Deweys Begriff „creative intelligence". Die berühmte Auseinandersetzung zwischen John Dewey und George Santayana über Naturalismus und Metaphysik muß Wind mitbekommen haben, da Winds Aufsatz „Alfred C . Elsbach's Kant und Einstein", Journal
in: The Journal
of Philosophy, X X I V , 1927, S. 6 4 - 7 1 , in der gleichen Nummer des
of Philosophy im Anschluß an Deweys Antwort auf Santayana erschien. Vgl. John Dewey:
„Half-Hearted Naturalism", a.a.O., S. 5 7 - 6 4 . Auch die Nähe zwischen Dewey und Heidegger wird Winds Aufmerksamkeit auf ihn gelenkt haben. Siehe hierzu: Hubertus Breuer: „Sein und Zeit in Amerika. Eine klassische Schrift von J o h n Dewey erstmals auf deutsch", in: Frankfurter
Allge-
meine Zeitung, 7. Dezember 1995, N r . 285, S. 15. 37 Winds Reaktion darauf ist dokumentiert in seinem Leserbrief, „Mircrocosm & M e m o r y " , in: The Times Literary Supplement,
30 May 1958, S. 297.
190
III Philosophie
der
Verkörperung
setzung nicht g a n z abwegig: beide sahen kulturelle Symbolik i m P h ä n o m e n des körperlichen A u s d r u c k s begründet, 3 8 in d e n seelischen E r s c h e i n u n g e n i m Leib, in Gestik u n d A u s d r u c k s w e r t v o n hergestellten O b j e k t e n . E s gab aber einen Streitp u n k t . E r betraf nicht die Breite ihrer Auffassungen, sondern d e n Inhalt v o n S y m bolismen. W i n d zufolge sollten S y m b o l e in der theoretischen P h y s i k dann als „real" bezeichnet w e r d e n , w e n n sie sich in einem experimentum ließen, dessen A u s g a n g b e o b a c h t b a r ist.
39
crucis
verkörpern
C a s s i r e r verlangte diese B e o b a c h t b a r k e i t
nicht. 4 0 W a s w a r hierbei s o wichtig? E s ging u m m e h r als eine Feinheit in der T h e o r i e des S y m b o l s . C a s s i r e r w a r bei W i n d s Habilitation v o r allem gegenüber der F r a g e z u rückhaltend, o b w i r imstande sind, etwas ü b e r das Verhältnis auszusagen z w i s c h e n einem „ e x p e r i m e n t u m c r u c i s " , das eine physikalische T h e o r i e u m s t o ß e n kann, u n d d e m , was C a s s i r e r das „freie D e n k e n " nannte. 4 1 Cassirers persönliche Ä u ß e r u n g d a r ü b e r z u W i n d w a r : „In einem sehr geläuterten Sinne sind Sie d o c h eigentlich ein E m p i r i s t " . 4 2 D o c h „ E m p i r i s m u s " ist eine psychologisierende
Erkenntnistheorie.
W i n d hat eine S c h w ä c h e in K a n t s Philosophie nachgewiesen: das S y s t e m stand im „offenen Konflikt m i t der experimentellen M e t h o d e " . 4 3 Dies a n z u e r k e n n e n w a r nicht E m p i r i s m u s ; es w a r P r a g m a t i s m u s i m Sinne Peirces. 4 4 D e n n o c h schrieb C a s -
38 Siehe Wind: „Warburgs Begriff der Kulturwissenschaft und seine Bedeutung für die Ästhetik", in: Vierter Kongreß für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft, Beilagenheft zur Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft, 25, 1931, S. 163-179. Vgl. zum körperlichen Ausdruck Cassirer: Philosophie der symbolischen Formen. Teil 3: Phänomenologie der Erkenntnis. Berlin 1929, Teil 1, Kap. 1: Die Ausdrucksfunktion und das Leib-Seelen-Problem. 39 Siehe „Mircrocosm & Memory", in: Times Literary Supplement, 30 May 1958, S. 297. 40 Für Wind galt dies für die Natur- und Geisteswissenschaften gleichermaßen. Siehe „Humanitätsidee und heroisiertes Porträt in der englischen Kultur des 18. Jahrhunderts", in: England und die Antike, Vorträge der Bibliothek Warburg 1930-1931, Leipzig und Berlin 1932, S. 156-229, hier: S. 203: „Das eigentliche ,Experimentum crucis' für die These, daß der Gegensatz zwischen Reynolds und Gainsborough sich auf eine grundsätzlich verschiedene Einstellung zum Problem des gleichnishaft gesteigerten und dramatisch pointierten Ausdrucks zurückführen lasse, liegt im Schauspielerporträt". Leider ist der für Wind so wichtige Begriff „experimentum crucis" in der englischen Ubersetzung verlorengegangen. 41 Cassirers Gutachten (datiert vom 3. Nov. 1930) befindet sich in der Personalakte Winds, Nr. 375, im Staatsarchiv Hamburg. 42 Siehe Bernhard Buschendorf: „Auf dem Weg nach England - Edgar Wind und die Emigration der Bibliothek Warburg", in: Porträt aus Büchern, Bibliothek Warburg & Warburg Institute, Hamburg -1933 - London, hrsg. von Michael Diers, Hamburg 1993, 85-128, hier: S. 89. 43 EM, S. 41. Wind kritisiert die Kantsche Philosophie, aber sein Einwand betrifft jede nicht-pragmatische Philosophie. 44 Wind verlangte eine methodologische „Umgestaltung des Begriffs des Empirischen nach den Vorschriften der transzendentalen Methode" {EM, S. 42), so daß diese Methode einer transzendenten Kontrolle unterworfen wird. Der Forscher, sagt Wind, hegt einen Glauben an die „consistency" der Signale, die er von seinen Instrumenten erhält. Siehe Wind, Experiment and Metaphysics (wie Anm. 13), hier: S. 221; vgl. EM, S. 15.
J. Krois: Kunst u. Wissenschaft in E. Winds Philosophie der Verkörperung
191
sirer in einem Sondergutachten für die philosophische Fakultät, daß es Wind „gelingt, den Antinomien den Charakter der prinzipiellen Unentscheidbarkeit zu nehmen und [die] theoretische Möglichkeit ihrer experimentellen Entscheidbarkeit zu zeigen".45 Wind stand aber mit seiner Verkörperungstheorie in der damaligen deutschen Philosophie alleine da.46 Man kann sich kaum einen größeren Kontrast vorstellen als den zwischen Winds Vortrag beim Weltkongreß für Philosophie in Harvard und dem Vortrag des anderen deutschen Teilnehmers in seiner Sektion. Wind mag Bruno Bauchs Vortrag „Stellung und Beziehung von Sinnlichkeit und wissenschaftlichem Gegenstand" im Sinne gehabt haben, als er in Das Experiment und die Metaphysik feststellte: In Kants Aufbau der Erfahrung hat das Experiment überhaupt keinen Ort.*7 „Genau an derjenigen Stelle, an der für den Forscher die Erprobung eines Gedankens durch Experimente einsetzt, steht bei Kant die ,Realität der Empfindung', die [die] kategoriale Formung niemals erproben, sondern immer nur erdulden kann". 48 Wind erblickte im Einfluß Kants auch den Grund für die verhängnisvolle radikale Trennung von Naturwissenschaft und Geschichte. Kants radikale Trennung der streng-kausalen physischen und der freien moralischen Sphäre ließ keine methodische Verbindung von Naturwissenschaft und Geschichte zu. Ein Hauptanliegen von Winds Verkörperungstheorie war es, diese einander näher zu bringen.49 Als Das Experiment und die Metaphysik 1934 erschien, konnte Wind sich nicht mehr um dessen Rezeption kümmern; er war schon in England Deputy Director des Warburg Institutes. Das Werk, sagte er, David Hume zitierend „feil deadborn from the press".
3. Zur Bedeutung von Winds Philosophie. Wind hat seine Zielsetzung in Das Experiment und die Metaphysik einmal in einem Brief formuliert: „es ist die eigentliche Absicht meiner Arbeit, durch eine Analyse der gegenwärtigen Methode der Naturwissenschaften auf Folgerungen 45 Cassirers Sondergutachten (datiert vom 21. Dezember 1932) befindet sich in der Personalakte Winds (s. Anm. 41). 46 Heideggers Daseinsanalyse sollte eine fundamentale Ontologie ermöglichen und gerade nicht eine Kulturtheorie sein. Wind kannte Heidegger persönlich und war mit seiner Arbeit vertraut. Siehe dazu vor allem Winds Leserbrief an die Smith College Associated News, nachgedruckt in diesem Band. (S. 219ff.) 47 EM, Vorwort, S. VIII. 48 EM, S. VIII. Die Verkörperung von Urteilsformen findet im experimentellen Gebrauch und Verhalten von Instrumenten statt. Vgl. dazu Wind: EM, S. 3 9 - 4 4 . Diese Seiten waren wohl der Stein des Anstoßes für Cassirer. 49 Dies ist das Thema von Winds Aufsatz „Uber einige Berührungspunkte zwischen Naturwissenschaft und Geschichte" (wie Anm. 36).
192
III Philosophie der Verkörperung
(mit Bezug auf den Welt- und Freiheitsbegriff) hinzuweisen, die gerade für die Methode der Geisteswissenschaften von Wichtigkeit sind. Die scharfe Trennung von Natur- und Geisteswissenschaften war mitbedingt durch eine Auffassung von der Natur, wie sie die heutigen Naturforscher gar nicht mehr teilen, und wie sie die heutigen Geisteswissenschaftler nicht mehr als selbstverständlich hinnehmen dürfen". 5 0 Wind entwickelte seine Ideen über Verkörperung anhand von Betrachtungen über die Rolle des Instruments im Experiment, aber sie ist keineswegs darauf beschränkt. Die Weltvorstellung des Historikers findet eine Verkörperung im historischen Dokument; eine ästhetische Vision wird in Marmor, Bronze oder Malfarbe verkörpert. Die Menschen selbst sind Verkörperungen der physischen und historischen Prozesse, die sie erforschen. 51 Die Verkörperungstheorie der Erkenntnis stellt keine Lehre über die Beschaffenheit der Wirklichkeit auf, außer der, daß sie sich verkörpert. Es gibt demnach keine ideellen Beobachter: „Der Forscher ist in den Prozeß, den er erforscht, selbst eingeschaltet". 52 Anthropomorphismus war für Wind, wie für Peirce, eine Tatsache, mit der die Menschen leben müssen: „Die Angst vor dem ,Anthropomorphismus'" — schrieb Wind - „hat noch niemanden vor ihm bewahrt". 5 3 Auch Symbole sind immer schon in Medien verkörpert. Aber dies verstellt die Perspektive nicht; diese Verkörperung ermöglicht Perspektive. Nur die verkörperte Vernunft kann erkennen. Die traditionelle Lehre, wonach Wahrheit die „Ubereinstimmung" des Gedankens mit dem Gegenstand ist, ließ den Grund dieser „Ubereinstimmung" völlig im Dunkeln. Wind sah, daß wahre Sätze dadurch wahr gemacht werden, daß etwas sich verkörpert. Die „Übereinstimmung", falls sie stattfindet, ist dann von sekundärer Bedeutung und nur durch die Verkörperung begründet. Die Bestimmung des Gebrauchs von Instrumenten und das Antizipieren ihres Verhaltens führt zu Bestätigungen oder Widerlegungen; jede Aussage eines Historikers läßt sich als Voraussage interpretieren über den Zusammenhang eines Dokuments mit anderen, vielleicht noch nicht bekannten Dokumenten. All dies hat nichts mit einer einfachen sprachlichen Übereinstimmung zu tun. Es betrifft die komplexe, sich ändernde Konfiguration von physischen und historischen Prozessen, an denen der Forscher auch selbst beteiligt ist. 50 51 52 53
Brief Edgar Winds an Otto Siebeck, 6. März 1933, S. 1. Kopie im Besitz von Margaret Wind. EM, S. 33. Wind, Berührungspunkte (wie Anm. 36), S. 36. EM, S. 119. Vgl. Peirces „Lectures on Pragmatism", in: Collected Papers, hrsg. von Charles Hartshorne und Paul Weis, Cambridge, Mass. 1934, Band 5, § 47: .„Anthropomorphic' is what pretty much all conceptions are at bottom" ; vgl. auch Peirces Verteidigung von „Anthropomorphism" in seinem Brief an William James vom 23.07.1905, in: Collected Papers, Band 8, § 262: „As for humanism, it appears to me to be an allied doctrine, in perfect harmony with pragmatism, but not relating exactly to the same question. ... I prefer the word ,anthropomorphism' as expressive of the scientific opinion".
J. Krois: Kunst u. Wissenschaft in E. Winds Philosophie
der Verkörperung
193
4. Exkurs zu Whitehead und Peirce Die alte ontologische Metaphysik stellte sich die Welt als anwesend vor. Mittels der Lehre von der Ursächlichkeit erklärte sie diese Welt; erste Ursachen, die als Anfang und Grund der Welt gedacht wurden, sollten die Basis liefern. Für Winds Prozeßmetaphysik ist die Welt nicht anwesend, sie ist ein Prozeß der fortwährenden Verkörperung. Das Phänomen der Verkörperung bezeichnet Wind darum noch allgemeiner mit Whiteheads Terminus „Emergenz".54 Gewöhnlich denken wir uns die Zeit als endlose Reihe von Punkten und die Kausalität als ähnliche lineare Ordnung. Wind entwickelt in Das Experiment und die Metaphysik eine andere Zeitanschauung, die er als konfigural im Unterschied zur linearen Zeit bezeichnete.55 In ihr wird das „Jetzt" nicht mehr als Punkt in einer Kette begriffen,56 sondern als „Spielraum", in dem Ereignisse entstehen.57 Anstatt von der Zeitreihe zu sprechen, muß man Zeit als einen Aspekt der Emergenz denken, als „Auftauchen von Gestalten einer neuen Ordnung aus der zufälligen' Konfiguration der Elemente der alten".58 Zeit ist nicht von Raum zu trennen und beide nicht von dem Ereignis, das darin stattfindet.59 Wind spricht deshalb von einer „konfiguralen Periode" anstatt von einer linearen Zeitreihe. Diese Periode ist inhaltlich gedacht, als die Dauer eines Ereignisses und nicht als etwas, das auf die Welt als Ganzes bezogen ist.60 Die Unterscheidung zwischen linear und konfigural übernahm Wind von Peirce, seine Ideen über Zeit sind dagegen von Whitehead beeinflußt.61 Winds Auffassung bricht jedoch mit Whiteheads in einem wesentlichen Punkt. Wind konnte Whiteheads Ansicht nicht akzeptieren, daß die Zeit „von Periode zu Periode atomisch fortschreitet", darum spricht er von einer „konfiguralen Periode".62 Wind versucht 54 EM, § 29: „Konstanz und Emergenz". 55 56 57 58
EM, § 27: Linearer und konfiguraler Zeitablauf; vgl. § 30, S. 106. Siehe EM, S. 94: D e m Begriff des „Jetzt" haftet prinzipiell eine Mehrdeutigkeit an. Siehe EM, § 26: D e r „Spielraum" der Gegenwart. £Af, S. 103.
59 EM, § 30. In W i n d s Hamburger Vorlesung „Grundbegriffe der Geschichte und Kulturphilosophie" (Ts., S. 3) v o m W S 1932/33 verwendet er auch diese „linear/konfigurale" Unterscheidung, um eine Zeitauffassung zu charakterisieren, die Zufälle zuläßt im Vergleich zu einer, die sie nicht kennt. Er fügt hinzu: „Was der Physiker Zufall nennt, nennt der Historiker psychologisch: Freiheit". 60 EM, S. 106. 61 Peirce spricht v o n „the configuration of systems" als komplexe Zustände, vs. Veränderung durch kettenartige Abläufe. Siehe z . B . sein „Reply to the Necessitarians" in The Monist, 3, 1893, S. 526 bis 570. D o r t verteidigt Peirce seinen A n g r i f f ( T h e Monist, Januar 1891 und A p r i l 1 8 9 2 ) auf den Determinismus gegen Kritiker. Peirce kritisiert explizit Kants mechanische Auffassung in der Kritik der reinen Vernunft, A 1 9 9 / B 2 4 4 . 62 Siehe W i n d : „Mathematik und Sinnesempfindung. Materialien zu einer Whitehead-Kritik", in: Logos. Internationale Zeitschrift für Philosophie der Kultur, X X I , H e f t 3, 1932, S. 2 3 9 - 2 8 0 , hier: S. 278.
194
III Philosophie
der
Verkörperung
in Das Experiment und die Metaphysik, Whiteheads Begriff der Zeit eine lokale Kontinuität abzugewinnen. Winds Ausführungen zu diesem Punkt sind schwer verständlich, aber sie lassen sich deuten durch den Unterschied zwischen Peirces und Whiteheads Prozeßphilosophie. Peirce wollte seine ganze Philosophie „Synechismus" nennen: Philosophie der Kontinuität. Kontinuität ist für ihn neben Zufall und Notwendigkeit ein Aspekt eines jeden Phänomens. Für Whitehead dagegen betrifft Kontinuität nur Potentielles, während Tatsächlichkeit „unheilbar atomisch ist".63 Eines der Argumente, die Peirce für die Tatsächlichkeit der Kontinuität bringt, stützt sich auf das Phänomen der Erinnerung.64 Das kulturelle Phänomen der Erinnerung hatte für Wind eine so zentrale Bedeutung, daß er - unabhängig von den theoretischen Problemen - nicht bereit war, die Wirklichkeit von Kontinuität derart radikal einzuschränken. Hier fand er in Peirce wieder einen Gleichgesinnten.65 Verkörperung im metaphysischen Sinn bezeichnet die Realität, wie sie in jedem Moment entsteht. Anstatt die Reihe der Ereignisse auf einen Anfang in der Vergangenheit zurückzuführen, wird er zum Aspekt der Gegenwart. In dieser Philosophie ist das individuelle Ereignis, auch metaphysisch betrachtet, nicht bloß Negation oder Differenz, sondern das „Auftauchen von Gestalten einer neuen Ordnung aus der ,zufälligen' Konfiguration der Elemente der alten", also ein Beispiel von Kreativität (S. 103).66 Das Universum ist ein ständiger Prozeß der Schöpfung. „In der Emergenztheorie", sagt Wind, „macht das fortwährende Wunder innerhalb des Verlaufs das einmalige Wunder am Anfang und Ende überflüssig".67 Für diese Art Philosophie besteht Kants Problem der Versöhnung zwischen der streng determinierten, vorhandenen Welt und Freiheit nicht mehr.
63 Whitehead: Process and Reality. A n Essay on Cosmology, Gifford Lectures Delivered in the University of Edinburgh During the Session 1927-1928, corrected edition hrsg. von David Ray Griffin und Donald W . Sherburne, New York 1978, Chap. 2, Section 1, S. 61: „Continuity concerns what is potential; wheras actuality is incurably atomic". Vgl. S. 35: „the ultimate metaphysical truth is atomism". Wind konnte Whitehead in diesem Punkt nicht zustimmen. 64 Siehe Peirce: Collected Papers (wie Anm. 53) Bd. 4, § 641; vgl. Collected Papers, Bd. 1, § 167, sowie Collected Papers, Bd. 7, § 466. 65 Peirce hat die Diskontinuität der Zeit theoretisch in Erwägung gezogen und für möglich gehalten; siehe ζ. B. Collected Papers, Bd. 1, § 274. Whitehead und Peirce waren beide Mathematiker, aber Peirces Arbeiten als Wissenschaftshistoriker und experimenteller Psychologe überzeugte ihn von der Realität der zeitlichen Kontinuität. 66 Whitehead: „Time", in: Proceedings (wie Anm. 13), S. 5 9 - 6 4 , hier: S. 64: „there is not continuity of becoming, but there is a becoming of continuity". 67 EM, S. 108.
195
/ . Krois: Kunst u. Wissenschaft in E. Winds Philosophie der Verkörperung
5. Zum Bild des Menschen Der „heroische Mensch" war ein beliebtes Denkmotiv in der Philosophie der Renaissance.68 Der Mensch als einziges Wesen, das frei ist, sich zu verwandeln und alle „Stufen des Seins" zu durchqueren, kann über sich selbst hinauswachsen oder auch das Schlechteste werden.69 Wind geht auf dieses Thema im Laufe seiner Untersuchungen gelegentlich ein. Er verweist am Schluß von Art and Anarchy auf verwandte Beobachtungen von William James, der den Hauptunterschied zwischen Mensch und Tier im Willen sah: „Verringere sein Ubermaß, ernüchtere ihn, und du wirst ihn verderben".70 James dachte dabei an die Religion, an den Willen zum Glauben. Wind verband sich diese Gedanken mit der Kunst. In beiden Sphären findet die rationale Führung kaum einen Anhaltspunkt, die Leitung übernimmt das Gemüt und die Phantasie. Piatons Erkenntnis, daß die Phantasie gefährlich sein kann, nahm sich Wind früh zu Herzen. Die Gefahr besteht darin, daß Phantasie imstande ist, Rationalität außer Kraft zu setzen. Aber inwiefern ist das der Fall, können Phantasie und Rationalität nicht miteinander versöhnt werden? Das ist eine Frage der philosophischen Anthropologie. Wind benutzt den Terminus „philosophische Anthropologie" nicht, doch die Frage durchzieht alle seine Werke. Seine Ansichten darüber sind nicht in einem Traktat nachzulesen - sowenig wie bei Piaton. Statt Dialoge verfaßte Wind ikonologische Studien. Winds Menschenbild wird nicht in Argumenten entwickelt; es findet sich in konkreten Studien zur Kunst- und Kulturgeschichte, z. B. in seiner großen Abhandlung zum Menschenbildnis: „Humanitätsidee und heroisiertes Porträt in der englischen Kultur des 18. Jahrhunderts", oder, wie es im Englischen heißt, „Hume and the heroic portrait". Wind zeigt darin, wie in der britischen Philosophie und Malerei des 18. Jahrhunderts ein Streit um die Natur des Menschen ausgetragen wurde. Hume steht auf der Seite Gainsboroughs, d. h. für den ungekünstelten Menschen und gegen das heroisierte Porträt des Grand Manner. Der Mensch erscheint bei Gainsborough immer als Mensch, nie als Abgott oder heroische Figur. Dies geht bei Gainsborough so weit, daß selbst Schauspieler bei ihm nicht in Maske erscheinen. Für Wind ist dies das experimentum crucis seiner Interpretation Gainsboroughs:
68 Siehe hierzu Cassirers Nachruf auf Warburg, in: Hamburgische der Feier des Rektorwechsels
am 7. November
Universität.
Reden
gehalten
hei
1929, Hamburg 1929, S. 4 8 - 5 6 .
69 Diese Lehre findet sich schon in Carolus Bovillus' Schrift „De sapiente" von 1509; siehe Cassirer, Individuum
und Kosmos in der Philosophie
der Renaissance,
Leipzig/Berlin 1927 (= Studien der
Bibliothek Warburg, 10). Das Buch enthält eine Edition von diesem Werk, hrsg. von Raymond Klibansky. Eine auf die Zeitumstände gerichtete Darstellung von dem Verhältnis zwischen dem Bewunderungswürdigen und Schlechten findet sich in Wind, „The Criminal G o d " , in: Journal the Warburg
of
Institute I, 1938, S. 2 4 3 - 2 4 5 .
70 Wind, Kunst und Anarchie
(Die Reith Lectures 1960. Durchgesehene Ausgabe mit den Zusätzen
von 1968 und späteren Ergänzungen), Frankfurt/M. 1994, S. 100.
196
III Philosophie
der
Verkörperung
Gainsborough ist so gänzlich abgeneigt, den Menschen zu heroisieren, daß selbst Garrick und Mrs. Siddons als Privatpersonen erscheinen und nie als die von ihnen dargestellten Helden, während bei Reynolds selbst die Kleinkinder als junge Heroen mit Schwert auftreten. Der Mensch, der seine Grenzen versteht und diese nicht leugnet, ist für Hume der natürliche Mensch. Er ist kein Einzelgänger wie bei Rousseau, sondern eine gesellige Natur, wie es Hume selbst war. Winds Arbeit über das heroisierte Porträt griff der Humeforschung um ein halbes Jahrhundert vor. Statt in Hume den „Erkenntnistheoretiker" zu sehen, erblickte Wind den Grund für Humes „Skepticismus" in dessen Theorie der Grenzen des menschlichen Handelns und seiner Tugendlehre.71 Wind ignorierte nicht, wie die meisten Philosophen, daß Hume hauptsächlich Werke über Geschichte schrieb. Er sah, daß in Humes Moralphilosophie die Beherrschung der Emotionen und Gefühle (und Humes von Cicero stammende Tugendlehre) zu einer bestimmten politischen Philosophie führt. Das von Gainsboroughs Schüler Ramsey stammende Porträt Humes, so meint Wind, illustriert Humes Charakterisierung der moralischen Tugenden: einen Menschen „ohne Bedürfnis nach übernatürlichen Sanktionen, ohne Ubersteigerung seiner Geisteskräfte, in vollem Bewußtsein seiner natürlichen Grenzen", einen Menschen, der „ein bürgerlich nützliches und ästhetisch angenehmes Leben führte" 72 — die Besonnenheit in Person. Hume war Philosoph der Aufklärung, seine Skepsis machte ihn zum Gegner politischer Utopien. 73 Winds Hamburger Antrittsvorlesung „θείος Φόβος. Untersuchungen über die Platonische Kunstphilosophie" ergänzt die Abhandlung über Hume. In einem Brief vom Oktober 1933 schrieb Wind, daß der Titel des Vortrags „hauptsächlich für Philologen bestimmt" sei und daß er den Text erneut publizieren wolle - mit dem Titel „Die Stellung des Künstlers im Staate. Betrachtungen über Piatons Lehre der ,göttlichen Furcht'". Er beendet den Brief mit der Bemerkung: „Heute erscheint er [der Vortrag] mir so aktuell, dass ich ihn gern einem grösseren Leserkreis vorlegen würde". 74 Wie im Hume-Aufsatz geht es im PiatonVortrag um die Spannung zwischen der Phantasie und den durch sie verursachten Emotionen - Emotionen, die fähig sind, „Scham und sittliche Scheu" zu beseitigen.
71
Als Privatdozent der Philosophie in Hamburg umkreisten Winds Vorlesungen immer wieder Hume. E r lehrte dort u.a.: „Englische Philosophie des 18. Jahrhunderts", „David „Geschichte des Skepticismus". Siehe hierzu Buschendorf, Auf
dem
Hume",
Weg nach England
(wie
Anm. 42), S. 93. Auch nach seiner späteren Ubersiedlung nach Amerika lehrte Wind am Smith College immer wieder ein „Seminar in English Art of the Eighteenth Century". Siehe den Anhang II: „Edgar Winds Kurse am Smith College". (S. 2 0 2 - 2 0 5 ) 72 Wind, Humanitätsidee
(wie Anm. 40), S. 229.
73 Siehe hierzu auch die in Hume
and the Heroic Portrait. Studies in Eighteenth-Century
Imagery,
hrsg. von Jaynie Anderson, Oxford 1986, wiederabgedruckten Texte: „The Revolution of History Painting", S. 8 8 - 9 9 , hier: S. 95 Anm. 31 und „In Defence of Composite Portraits", S. 1 2 0 - 1 2 4 , hier: S. 124. 74
Brief Edgar Winds an O t t o Siebeck, 12. Oktober 1933. Kopie im Besitz von Margaret Wind.
J. Krois: Kunst u. Wissenschaft in E. Winds Philosophie der Verkörperung
197
Winds Essay „Piatonic Tyranny and the Renaissance Fortuna" von 1961 befaßt sich mit einem weiteren Aspekt des Problems, der an den Hume-Text erinnert. Nominal handelt es sich um das philologische Problem von Ficinos Deutung einer Stelle in Piatons Nomoi. Es geht aber um das, was Wind „the desperate hopes of Utopians" nennt: die verzweifelten Hoffnungen von utopischen Denkern.75 Piatons Fahrten nach Sirakus zum Tyrannen Dionysius sind ein Beispiel für die intellektuelle Versuchung, die Hoffnung in die Tyrannei zu setzen. Denn obwohl die Tyrannei für Piaton die schlechteste Staatsform war, ist sie dennoch die einzige, die den radikalen Schritt machen kann, den besten - ja idealen - Staat durch einen Gewaltakt hervorzubringen. Demokratie ist zwar besser als Tyrannei, aber sie kann diesen Gewaltakt nicht vollziehen. Winds indirekte Verbindung von Piaton und Machiavelli mittels Ficino, ließ Panofsky, für dessen Festschrift Wind den Essay schrieb, antworten, „although you were careful to reserve the epithet ,wicked' for the Florentine Platonists rather than to Plato himself it seems to me that, to use another colloquial phrase, ,a little bit rubs off on the grand old man himself".76 Wind sah in Piatons Versuch, einen Tyrannen zu beeinflussen, die Konsequenz eines falschen Heroismus des Denkens, wie Piaton es auch selbst einmal in Nomoi ausspricht (709-712): man brauche nur den richtigen Tyrannen und den richtigen Philosophen, um das Beste zu erreichen. Dieser Heroismus glaubt, sich des Sturmes in der Geschichte für die Verwirklichung einer großen Idee bedienen zu können. Enthusiasmus droht „das Moralische und Logische in uns [zu] ertöten". 77 Rationalität aber ist der Beginn der Zerstörung der Phantasie: „rationality about the hero", sagt Wind, „is the beginning of his destruction".78 Zur Rettung von beiden werden Rationalität und Phantasie in der Kultur getrennt. Wind war mit dieser Trennung nicht zufrieden.79 Daß Kunst Gedanken zum Ausdruck bringen und dabei Kunst bleiben kann, ist die Hauptprämisse von Winds ikonologischen Analysen. Diese Analysen zeigen die „Argumente" in Kunstwerken. Daß Wind sich so ausführlich mit den neuplatonischen Elementen in der Renaissancemalerei befaßte, rührte nicht daher, daß er deren Inhalte für „wahr" hielt, sondern daß die Gedankenwelt, die er darin fand, reich an „Argu-
75 Wind, „Piatonic Tyranny and the Renaissance Fortuna", in: Eloquence
(wie Anm. 20), S. 8 6 - 9 3 ,
hier: S. 92. 76 Brief Erwin Panofskys an Edgar Wind, 14. Febr. 1961, S. 2. Edgar Wind Papers, Bodleian Library, Oxford University. Copyright Margaret Wind. 77 Wind, „θείος Φόβος. Untersuchungen über die Platonische Kunstphilosophie", in: Zeitschrift Ästhetik und allgemeine
Kunstwissenschaft,
für
X X V I , 1932, S. 359. Es heißt dort: „je mehr die Kunst
das Ästhetische in uns seiner selbst willen entwickelt, desto mehr muß sie das Moralische und Logische in uns ertöten". 78
„In Defence of Composite Portraits", in: Hume
(wie Anm. 23), S. 124.
79 Whiteheads „Symbolism" Lectures enden mit der gleichen Behauptung, daß jede Gesellschaft sowohl phantasieartige Symbole als auch Rationalität benötigt.
198
III Philosophie
der
Verkörperung
menten" war.80 Solche Kunstwerke werden zu „Symbolen", die an Tiefe gewinnen, wenn ihr Argument verstanden wird, im Gegensatz zu bloßen Rätseln,81 die nur deshalb interessant sind, weil wir nicht wissen, was gemeint ist. Leonardos „letztes Abendmahl" stellt in Winds Lesart nicht bloß eine dramatische Szene dar: die vier Personengruppen versinnbildlichen die vier Arten der theologischen Interpretation: buchstäbliche, moralische, mystische und anagogische, und verbinden diese mit einer Darstellung der menschlichen Temperamenten.82 Wie kann Wind seine Deutungen beweisen? Er kann es nicht, denn die Einmaligkeit einer historischen Konfiguration läßt sich nach allen Seiten auslegen, aber nicht ableiten.83 Die Verkörperung der Kunstwerke in einer geschichtlichen Umgebung ermöglicht ihre Deutung: die nicht-künstlerischen Aspekte der Umgebung - die Wissenschaft, theologische und literarische Traditionen und die politischen Kräfte der Zeit geben Aufschluß über die Bedeutung von Bildern. In Kunst und Anarchie führt Wind vor, wie die „reine Kunst" durch ihre Isolation von der Welt an Kraft verliert - trotz aller Schrillheit der Formen. Am Schluß von Piatons Symposium stellt Sokrates die Forderung an den Dichter, er müsse sowohl Komödie als auch Tragödie dichten können; Wind stellt die noch schwierigere Forderung an den Künstler, daß er Argumente in sein Werk setzen solle. Aber wo soll er sie her bekommen? Das gelehrte Gespräch wird heutzutage um die Philosophie von heute gehen. Ich glaube nicht, daß Wind meinte, die Kunst transportiere heutzutage weniger Gedanken, sondern daß sie ganz andere verkörpere: private, tiefenpsychologische und rein ästhetische - im dem Sinne, daß Kunst sich selbst zum Thema macht. Gerade der von Wind so vehement verworfene Existentialimus findet in vielen modernen Kunstwerken seine Verkörperung. Stimmungen verdrängen die klassischen und biblischen Themen, und was übrig bleibt - mag es düster oder heiter sein - , ist nicht mehr geschichtlich;84 seine Bedeutung findet sich im augenblicklichen emotionalen und sinnlichen Reiz. So wird alles isoliert betrachtet, das Unmittelbare wird für das Konkrete genommen, auf Kosten der Erinnerung und der Antizipation. Winds Philosophie erlaubt nicht, sich der Illusion einer linearen Geschichte hinzugeben. Dennoch meinte er von der Antike, auch wenn sie uns kein allgemein verbindliches Vorbild mehr ist, 80 Wind betonte: er vertrat nicht selbst die Lehren, die er in Bildern fand; siehe Wind, Heidnische Mysterien in der Renaissance, Mit einem Nachwort von Bernhard Buschendorf, Ubersetzt von Christa Münstermann unter Mitarbeit von Bernhard Buschendorf und Gisela Hinrichs, Frankfurt/M. 1987, S. 27. 81 Siehe Wind: „Die Beredsamkeit der Symbole", in: Akzente, 29, 1982, S. 168-172, hier: S. 169. 82 Siehe „Three Talks on Leonardo da Vinci for the British Broadcasting Corporation", in: The Listener, 47, 1952, II: „The Last Supper". May 8, S. 747-748. 83 Zur Peirceschen Unterscheidung von konfigural und linear, siehe Wind: „Bild und Text", in diesem Band, S. 259-262. 84 Vgl. Hans Egon Holthusen, „Heimweh nach Geschichte: Postmoderne und Posthistoire in der Literatur der Gegenwart", in: Merkur, Heft 8, 38. Jg., August 1984, Nr. 430, S. 902-917.
199
J. Krois: Kunst u. Wissenschaft in E. Winds Philosophie der Verkörperung
daß wir ihr geschichtlich verhaftet bleiben.85 Das Wichtigste dabei ist die Tatsache der historischen Haftung selbst, so komplex diese Konfiguration sein mag. Der Geschichtsforscher greift auch in sein Material ein und „stört" es genauso, wie jeder Restaurator das Bild ändert, das er restauriert. Winds Kritik an Elsbachs „Einstein und Kant" hob einen anderen, hier relevanten Unterschied hervor: die Modernisierung von Kants Philosophie verlangt nicht, daß der Wissenschaftler die methodologische Antizipation aufgibt, sondern nur die rigide Vorstellung, daß die Wissenschaft der Wirklichkeit Gesetze vorschreiben kann.86 Auch der Historiker antizipiert, um die Quellen zu suchen, die seine Deutungen belegen können. In der Kunst gehen Erinnerung und Antizipation in der Phantasie zusammen. Winds Frage in Art and Anarchy war, ob es möglich ist, künstlerische Phantasie mit gedanklichem Inhalt zu füllen. Dies war für ihn kein bloß künstlerisches Problem, sondern ein kulturelles im breitesten Sinn. Der Neuplatonismus verlieh dem künstlerischen Schaffen die Berechtigung, die der Piatonismus ihm verweigerte.87 Der Schöpfer der Welt folgte nach Piaton den ewigen Vorbildern der Ideen, während für Plotin die Ideen selbst aus dem göttlichen Nous hervorgingen. Der Künstler wiederholte demnach mit dem Hervorbringen eines Werks den göttlichen Schöpfungsprozeß. Es ist natürlich, daß die Renaissance-Neuplatoniker mit dieser Philosophie Einfluß auf die Kunst ausüben konnten. Die moderne Philosophie von Descartes und Hobbes bis Hegel fand ihre Denkvorbilder in der Mechanik und Logik. Die Kunstphilosophie dieser Epoche gipfelte in Hegels Lehre vom „Ende der Kunst"; der Begriff löst das Bild ab. Es gibt gegenwärtig viele Zeugen für diese Ansicht. Vor wenigen Wochen sagte der Künstler Frank Stella: „Die italienische Malerei des 15. und 16., aber auch des 17. Jahrhunderts ist bisher unerreicht. ... Das 19., 20. und 21. Jahrhundert werden die Größe dieser dreihundert Jahre italienischer Malerei nie mehr erreichen. ... All die ... Errungenschaften der Moderne kommen nicht an das heran, was Botticelli mit einem Bild geschaffen hat". 88 Wind läßt uns in Art and Anarchy wissen, daß er kein Fatalist ist. Hegels Diktum vom Ende der Kunst entsprang der Selbstsicherheit eines geschlossenen philosophischen Systems. Winds eigene Philosophie eröffnete ihm die Perspektive eines unfertigen Kosmos, in dem Wille und Phantasie niemals vom Begriff abgelöst werden können und in dem auch Rationalität emergent ist. 85 Siehe Wind: „Einleitung" zu Kulturwissenschaftliche Erster Band: Die Erscheinungen
des Jahres
1931.
Bibliographie
zum Nachleben
der
Antike.
In Gemeinschaft mit Fachgenossen bearbeitet
von Hans Meier, Richard Newald, Edgar Wind. Hrsg. von der Bibliothek Warburg. Leipzig - Berlin 1934, S. v-xvii, hier: S. xi. 86 Wind, „Alfred C. Elsbach's Kant und Einstein",
in: The Journal of Philosophy, X X I V , 1927, S. 70.
87 Dies ist auch die These Cassirers in seinem am Warburg Institut gehaltenen Vortrag „Eidos und Eidolon. Das Problem des Schönen und der Kunst in Piatons Dialogen", in: Vorträge der thek Warburg
1922-1923,
Biblio-
N r . 2 , 1 9 2 4 , S. 1 - 2 7 .
88 Interview mit Frank Stella, in: Süddeutsche
Zeitung Magazin.
9. Februar 1996, S. 32—41, hier: S. 38.
200
III Philosophie
der
Verkörperung
ANHANG I: EDGAR WINDS KURSE AN THE UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA Quelle: The University of North Carolina. The Catalogue, Hill: The University of North Carolina Press, 1926.
1926-1927. Chapel
Courses in the Department of Philosophy. Professor WILLIAMS; Assistant Professor GREEN; Instructor WIND. A) Courses for Undergraduates - none Β) Courses for Graduates and Advanced Undergraduates 4. STUDIES IN GREEK PHILOSOHY. Open to Juniors, Seniors, and Graduates. The course is intended as a selective study of the works of the Greek philosophers, in which the student will become acquainted with the various classical doctrines as well as with their cultural background and their influence upon the following ages. The main stress will be laid upon the study of Plato and Aristotle, while an introductory survey will deal with the early Greek philosophers form Thaïes to Socrates. The course will end by tracing the influence of Plato and Aristotle through the Middle Ages up to the Renaissance. Five hours a week, winter quarter. Doctor Wind. 5. STUDIES IN MODERN PHILOSOPHY. Open to Juniors, Seniors, and Graduates. The course is a continuation of Philosophy 4 but may be taken independently. It will start with a demonstration of the philosophical legacy of the Middle Ages to the Renaissance, will then discuss the philosophical implications of the scientific revolution due to the introduction of the experimental method, and will finally trace the inter-dependencies of scientific and philosophical thought up to the 18th and 19th centuries. The main stress will here be laid on the philosophies of Enlightenment and Romanticism. The course will end with a discussion of the extent to which Contemporary Philosophy can be interpreted as an outgrowth of the ideas developed in the preceding periods. Five hours a week, spring quarter. Doctor Wind. 13. PHILOSOPHY OF SCIENCE. Open to Juniors, Seniors, and Graduates. The course is intended to demonstrate both the philosophical implications of science and the scientific relevance of philosophy. The methods of various sciences will be analyzed so as to exhibit their philosophical presuppositions; and the results of these sciences will be correlated so as to set forth the problems which they
J. Krois: Kunst u. Wissenschaft in E. Winds Philosophie der Verkörperung
201
present to philosophy. The course is mainly designed for students who, having studied at least one special science, wish to enlarge their scope as to the methodical possibilities of sience in general, or for those who, having had some general acquaintance with philosophy, wish to specify their understanding by a concrete application to science. Five hours a week, fall quarter. Doctor Wind. 20. ETHICS. Open to Juniors, Seniors, and Graduates. The course will deal with the problems of ethics in purely methodical terms. It will explain the possibility and the limitations of a science of values, will distinguish the method of judging ethical values from the methods applied to the corresponding problems in the fields of aesthetics and logic, and will end by discussing the relation of ethics to natural science and history. In studying the interdependence of all these fields, the student is meant to acquire a critical sense in dealing with ethical judgments and ethical theories. The material for the course will be supplied by a selective study of the most influential doctrines of ethics. Five hours a week, fall quarter. Doctor Wind. 30. PHILOSOPHY O F FINE ART (AESTHETICS). Open to Juniors, Seniors, and Graduates. The course is intended to supply the student with a method of approach to art, to train his eye in discriminating the particular qualities of style, and to make him acquainted with the fundamentals of aestetic theory. Instead of a text-book, each student will use a set of four hundred reproductions in print which will serve as material for comparative studies in the fields of architecture, sculpture, and painting. This material will be supplemented by demonstrations with lantern slides. Five hours a week, winter quarter. Doctor Wind. 31. PHILOSOPHY O F FINE ART (AESTHETICS). Open to Juniors, Seniors, and Graduates. This course is a continuation of Philosophy 30 but may be taken independently. The same method will be used, but it will be applied chiefly to the treatment of those specific problems of art which have formed the outstanding subject of arttheoretical literature. The main stress will, therefore, be laid on the analysis of arttheoretical writings, and the student will be trained to relate the various aesthetic doctrines to their general philosophical background as well as to the specific styles of art upon which they reflect. Five hours a week, spring quarter. Doctor Wind. C) Courses primarily for Graduates 104. PLATONISM AND ARISTOTELIANISM. Seminar course in Greek and Medieval Philosophy. Three hours a week, winter quarter. Doctor Wind.
202
III Philosophie der Verkörperung
105. ENLIGHTENMENT AND ROMANTICISM. Seminar course in the philosophy of the 18th and 19th centuries. Three hours a week, spring quarter. Doctor Wind. 113. THE PHILOSOPHICAL PRESUPPOSITIONS OF THE SCIENTIFIC METHOD. Seminar course. A study of the interdependence of philosophy and science, based mainly on readings from the works of Galileo, Kepler, Newton, Descartes, Leibnitz, and Kant, with special reference to the modern discussion of the Theory of Relativity. Three hours a week, fall quarter. Doctor Wind. 121. THE INDIVIDUAL AND THE STATE. Seminar course. A study of political theory, with special reference to the underlying metaphysics and psychology. Three hours a week, fall quarter. Doctor Wind.
ANHANG II: EDGAR WINDS KURSE AM SMITH COLLEGE Quelle: Smith College Catalogues. Lehrveranstaltungen in eckigen Klammern wurden in dem betreffenden Jahr nicht angeboten. Wind verbrachte das akademische Jahr 1950-1951 als Forschungsjahr in Italien. Smith College Bulletin, Catalogue Issue 1948-1949. A) Courses listed under „Art": 1) 42a: „Seminar in Dürer, Grünewald, and Holbein". 3 hours. For seniors by permission of the instructor. Page 78. 2) 42b: „Seminar in English Art of the Eighteenth Century. 3 hours. For seniors by permission of the instructor. Page 78. B) Courses listed under „Philosophy": 1) 36a: „Plato: a systematic and historical study of the chief dialogues". Prerequisite, 11 or 24. 3 hours. Page 128. 2) 36b: „The Platonic Tradition: a study of Neoplatonism, beginning with Plotinus and Proclus, leading to Marsilio Ficino and Pico della Mirandola, and ending with the Cambridge Platonists". Prerequisite, 36a. 3 hours. Page 128. 3) 36a: „Nineteenth-Century German Philosophy. 6 hours. Second Semester. Page 130. Smith College Bulletin, Catalogue Issue 1949-1950.
J. Krois: Kunst u. Wissenschaft in E. Winds Philosophie der Verkörperung
203
A) Courses listed under „Art": 1) 43a (42a): „Seminar in the Iconography of the Renaissance and Reformation". 3 hours. For seniors by permission of the instructor. M 8-10. Page 78. 2) 43b (42b): „Seminar in English Art of the Eighteenth Century. 3 hours. For seniors by permission of the instructor. M 8-10. Page 78. B) Courses listed under „Philosophy": 1) 36a: „Plato: a systematic and historical study of the chief dialogues". Prerequisites, 11 or 24 and at least three more hours in philosophy. 3 hours. M 4-6 Τ 4. Page 129. [2) 36b: „The Platonic Tradition: a study of Neoplatonism, beginning with Plotinus and Proclus, leading to Marsilio Ficino and Pico della Mirandola, and ending with the Cambridge Platonists". Prerequisite, 36a. 3 hours. Page 129.] 3) 37b: „Hegel and Hegelianism. A historical and critical study of Hegel, the man and his doctrines, his rivals, followers, and opponents". Prerequisite, 24. 3 hours. M 4-6 Τ 4. Page 129. 4) 45b (45a): „Kant: a study of the Critique of Pure Reason and readings from the Critique of Practical Reason, with consideration of their influence on later philosophy". For qualified students by permission of the instructor. 2 class hours, 3 hours. Page 130. Smith College Bulletin, Courses for 1951-1952.
Catalogue Issue 1950-1951 with Announcement of
A) Courses listed under „Art": 1) 43a: „Seminar in the Iconography of the Renaissance and Reformation". 3 hours. For seniors by permission of the instructor. M 8-10. Page 51. 2) 43b: „Seminar in English Art of the Eighteenth Century. 3 hours. For seniors by permission of the instructor. Page 51. B) Courses listed under „Philosophy": 1) 36a: „Plato: a systematic and historical study of the chief dialogues". Prerequisite, 11 or 24. 3 hours. Page 105. 2) 36b: „The Platonic Tradition: a study of Neoplatonism, beginning with Plotinus and Proclus, leading to Marsilio Ficino and Pico della Mirandola, and ending with the Cambridge Platonists". Prerequisite, 36a (35b). 3 hours. Page 105. [3) 37b: „Hegel and Hegelianism. A historical and critical study of Hegel, the man and his doctrines, his rivals, followers, and opponents". Prerequisite, 24. M 4 - 6 Τ 4. „Page 106.] 4) 45b: „Kant. A Study of the Critique of Pure Reason and readings from the Critique of Practical Reason, with consideration of their influence on later philosophy". For qualified students by permission of the instructor. Two class hours. Page 106.
204
III Philosophie
der
Smith College Bulletin, Courses for 1952-1953.
Verkörperung Catalogue Issue 1951—1952 with Announcement of
A) Courses listed under „Art": [1) 45a: „Seminar in English Art of the Eighteenth Century. M 8-10. For seniors by permission of the instructor. Page 52.] 2) 45b: „Seminar in the Iconography of the Renaissance and Reformation". M 8-10. For seniors by permission of the instructor. Page 52. B) Courses listed under „Philosophy": 1) 36a: „Plato. A systematic and historical study of the chief dialogues". Prerequisite, 11 or 24 and at least three more semester hours in philosophy. Τ 8-10. W 8. Page 107. 2) 36b: „The Platonic Tradition. A study of Neoplatonism, beginning with Plotinus and Proclus, leading to Marsilio Ficino and Pico della Mirandola, and ending with the Cambridge Platonists". Prerequisite, 36a. M 4 - 6 Τ 4. Page 107. 3) 37b: „Hegel and Hegelianism. A historical and critical study of Hegel, the man and his doctrines, his rivals, followers, and opponents". Open to a limited number of juniors and seniors. Prerequisite, 24. M 4 - 6 Τ 4. Page 107. [4) 45b: „Kant. A Study of the Critique of Pure Reason and readings from the Critique of Practical Reason, with consideration of their influence on later philosophy". For qualified students by permission of the instructor. Two class hours. Page 108.] Smith College Bulletin, Courses for 1953-1954.
Catalogue Issue 1952-1953 with Announcement of
A) Courses listed under „Art": [1) 45b: „Seminar in the Iconography of the Renaissance and Reformation". Alternates with 47b. For seniors by permission of the instructor. M 8-10. Page 51.] 2) 47b: „Seminar in English Art of the Eighteenth Century. Alternates with 45b. For seniors by permission of the instructor. M 8-10. Page 52. B) Courses listed under „Philosophy": 1) 36a: „Plato. A systematic and historical study of the chief dialogues". By permission of the instructor, for students who have had 11 or 24. Τ 8-10. W 8. Page 108. 2) 36b: „The Platonic Tradition. A study of Neoplatonism, beginning with Plotinus and Proclus, leading to Marsilio Ficino and Pico della Mirandola, and ending with the Cambridge Platonists". Prerequisite, 36a. M 4 - 6 Τ 4. Page 108. 3) 37b: „Hegel and Hegelianism. A historical and critical study of Hegel, the man and his doctrines, his rivals, followers, and opponents". Open to a limited
J. Krois: Kunst u. Wissenschaft in E. Winds Philosophie der Verkörperung
205
number of juniors and seniors. By permission of the instructor, for students who have had 24 or History 38a and b. M 4 - 6 Τ 4. Page 108. [4) 45b: „Kant. A Study of the Critique of Pure Reason and readings from the Critique of Practical Reason, with consideration of their influence on later philosophy". For qualified students by permission of the instructor. Two class hours. Page 108.] Smith College Bulletin, Courses for 1954-1955.
Catalogue Issue 1953-1954 with Announcement of
A) Courses listed under „Art": 1) 45b: „The Iconography of the Renaissance and Reformation". Alternates with 47b. For seniors by permission of the instructor. M 8-10. Page 53. [2) 47b: „Seminar in English Art of the Eighteenth Century. Alternates with 45b. For seniors by permission of the instructor. M 8-10. Page 53.] B) Courses listed under „Philosophy": 1) 36a: „Plato. A systematic and historical study of the chief dialogues". By permission of the instructor, for students who have had 11 or 24. Τ 8-10. W 8. Page 109. 2) 36b: „The Platonic Tradition. A study of Neoplatonism, beginning with Plotinus and Proclus, leading to Marsilio Ficino and Pico della Mirandola, and ending with the Cambridge Platonists". Prerequisite, 36a. M 4 - 6 Τ 4. Page 110. 3) 37b: „Hegel and Hegelianism. A historical and critical study of Hegel, the man and his doctrines, his rivals, followers, and opponents". Open to a limited number of juniors and seniors. By permission of the instructor, for students who have had 24 or History 38a and b. M 4 - 6 Τ 4. Page 110. [4) 45b: „Kant. A Study of the Critique of Pure Reason and readings from the Critique of Practical Reason, with consideration of their influence on later philosophy". For qualified students by permission of the instructor. Two class hours. Page 108.]
Falsche Skischwünge. Winds Kritik an Heidegger und Sartre Horst
Bredekamp
Die Habilitationsschrift
1958, als Edgar Winds Pagan Mysteries publiziert wurden, kam seine 1934 gedruckte Habilitationsschrift Das Experiment und die Metaphysik auf dem Titelblatt des Times Literary Supplement zu späten Ehren: „Es war Cassirer, der in Erinnerung rief, daß die Konzepte der Naturwissenschaften symbolische Repräsentationen darstellen, soweit sie nicht auf direkten Beobachtungen beruhen; und Edgar Wind betonte dasselbe in ,Das Experiment und die Metaphysik'. Es ist nicht überraschend, daß diese beiden Philosophen mit der Warburg-Gruppe zu deren Hamburger Zeit eng verbunden waren, denn ihr eigenes Denken ging in dieselbe Richtung" 1 . Schon eine Woche später erschien Winds knappe Antwort als Leserbrief: „Sir, die Erinnerung an ein anti-kantianisches Buch, das ich vor fünfundzwanzig Jahren unter dem unverdächtigen Titel ,Das Experiment und die Metaphysik' veröffentlichte, wurde unerwarteterweise im Titelblatt-Artikel vom 23. Mai besprochen. Die Ehre ist unverdient, weil das Buch totgeboren aus der Druckerpresse fiel. Eine der sehr wenigen Personen, die es lasen, war der verstorbene Ernst Cassirer; und mir tut leid, zu erwähnen, daß es den bewundernswerten Mann extrem ärgerlich machte. Im Namen seines Andenkens muß ich gegen die Unterstellung protestieren, daß wir dieselbe Sicht über die Natur der Symbole hatten. Meine These war, daß Symbole nur soweit,wirklich' sind als sie in einem experimentum crucis verkörpert werden können, dessen Ergebnis direkt beobachtbar ist - in seinen Augen ein bedauerliches Herabsinken in den ,Empirizismus' " 2. Angesichts dessen, daß in England kaum jemand die Habilitationsschrift kennen konnte, wirkt Winds Bericht zunächst wie eine neutrale Richtigstellung. Für die wenigen, die Das Experiment und die Metaphysik gelesen hatten, mußte sich aber eine zusätzliche Bedeutung aufdrängen. Denn die Kritik, daß sich Wind zu „empi-
1 „Microcosm and Macrocosm", in: The Times Literary Supplement, May 23, 1958, S. 1. 2 Edgar Wind, „Microcosm & Memory", in: The Times Literary Supplement, May 30, 1958, S. 297.
208
III Philosophie
der
Verkörperung
rizistisch" gebärdet habe, wirkt angesichts dessen beklemmend, daß er in seiner Habilitationsschrift dem „Idealismus" den Vorwurf gemacht hatte, sich im entscheidenden Moment mit der Welt des Wirklichen nicht eingelassen zu haben. In seiner Einleitung zur Habilitationsschrift definiert Wind zunächst als zeitgemäßen Auftrag der Philosophie, daß „man unerbittlich ankämpft" gegen den von Jaspers und Heidegger repräsentierten „Geist der Stunde, der an die Stelle der klärenden Analyse die grüblerische Deklaration setzen will" 3 . Dann aber wendet er sich gegen die Vertreter des „Idealismus": „Im Besitz und Genuß einer Weltanschauung, die sie durch eine glorreiche Tradition hinreichend gesichert glaubten, waren sie im kritischen Augenblick weder willens noch fähig, ihre logischen Verbindlichkeiten einzulösen. Zum Kampf gefordert, hatten sie die Wahl der Waffen. Aber sie zogen es vor, der Entwicklung, in die sie eingreifen sollten, von hoher Warte aus zuzusehen, durch Zeichen der Gunst den Feind zu umwerben, und sich in all ihrer Weisheit dem Wahn hinzugeben, sie könnten auch mit diesem Feind noch ihren Frieden machen. So sind sie besiegt worden, ohne gekämpft zu haben, und auch die Frucht ihrer Niederlage ging verloren. Denn da eine gedankliche Auseinandersetzung überhaupt nicht stattfand, ging von der kritischen Denkart als dem besten, das der Unterlegene zu hinterlassen hatte, nichts auf den Sieger über" 4. Diese Zeilen gehören zu den hellsichtigsten und auch beißendsten Abrechnungen mit den dominierenden Denkrichtungen der Philosophie in Deutschland. Aber während er seine Hauptgegner, Jaspers und Heidegger, die sich in den Zwanziger Jahren bei allen Unterschieden gemeinsam als Argonauten des Philosophierens über bislang unbekannte Tiefen empfanden, namentlich benennt, sagt er nicht, wen er bei den „Idealisten" im Auge hatte, die sich ihnen in ihren Höhenflügen nicht entschieden genug widersetzt hatten. Einer mündlich überlieferten Äußerung zufolge zielte Wind hierbei zuerst auf den Heidelberger Neukantianer Heinrich Rickert, der sich, obwohl er das Problem der werteorientierten Erkenntnis in den Vordergrund gestellt hatte,5 nicht aufzulehnen wagte, als in seinem Institut 1933 eine antisemitische Äußerung plakatiert worden war.6 Zweifellos hatte Wind bei den Vertretern des „Idealismus" aber eine größere Gruppe im Auge. Im Rückblick von 1953 beschrieb er sie mit Blick auf die Hamburger Universität als jene liberalen Professoren, die im „Moment der Gefahr" versagten. Als Bruno Snell sie im Frühjahr 1933 zum Widerstand zu bewegen
3 Edgar Wind, Das Experiment und die Metaphysik, Tübingen 1934, S. VI. 4 Ebenda. 5 Edgar Wind, „Contemporary German Philosophy", in: The Journal of Philosophy, XXII, 1925, S. 477-493, hier: S. 491 f. 6 Dieser Zusammenhang wurde auf der Podiumsdiskussion „Widerstand und Emigration - getrennte Welten" der Hamburger „Weiße Rose Konferenz" (25.-27.2.1991) von Raymond Klibansky berichtet, der ihn von Edgar Wind selbst erfahren hat (freundl. Mittig. von John Michael Krois).
H. Bredekamp:
Falsche Skischwünge
209
versuchte, hielten sie „diese Art des Vorgehens für eine leere Geste (...). Dieser Widerstand gelang nicht" 1 . Im weiteren Horizont von Winds Anklage stand vermutlich auch sein akademischer Lehrer, Ernst Cassirer. Auf den ersten Blick mag dies als kaum denkbar erscheinen, weil Wind in den Jahren 1929/30 Zeuge gewesen war, mit welcher Entschiedenheit sich Cassirer als Rektor der Hamburger Universität den nationalsozialistischen Studenten und Dozenten widersetzt hatte. Andererseits hat er sich darüber verwundert, daß dieser bereits im März 1933 emigrierte, 8 also noch bevor Snell seinen vergeblichen Widerstandsversuch unternahm. Möglicherweise hatte Wind, als er seine „Einleitung" im September 1933 verfasste, die Illusion, daß Snells Initiative mit der Unterstützung von Cassirers Persönlichkeit nicht derart ergebnislos geblieben wäre. Wie immer Cassirers frühe Emigration, die aus dem späteren Rückblick nur nochmals seine Hellsichtigkeit dokumentiert, aus der Perspektive des Spätsommers 1936 bewertet worden sein mag - es gab einen früheren Anlaß, der geeignet sein konnte, ihm den Vorwurf des Verharrens auf „hoher Warte" einzubringen: jenes legendäre Streitgespräch zwischen ihm und Heidegger, das 1929, im Jahr der Fertigstellung von Winds Habilitation, in der Höhe von Davos stattfand. Der Disput hatte Heidegger als Punktsieger hervorgehen lassen; nicht weil er besser getroffen hatte, sondern weil das ausgesucht höfliche Auftreten Cassirers der Qualität seiner Ausführungen keine angemessene Resonanz beim Publikum verschaffen konnte. Heidegger kommentierte das Ereignis in einem Brief an Elisabeth Blochmann damit, daß „Cassirer [...] in der Diskussion äußerst vornehm u. fast zu verbindlich [war]. So fand ich zu wenig Widerstand, was verhinderte, den Problemen die nötige Schärfe der Formulierung zu geben. Im Grunde waren die Fragen für eine öffentliche Erörterung viel zu schwierig. Wesentlich blieb nur, daß die Form und Führung der Diskussion durch das bloße Beispiel wirken konnte" 9 . Dies 7 Edgar Wind, Beitrag für die „Schluss-Sitzung" des „Kongresses für die Freiheit der Kultur", in: Wissenschaft und Freiheit. Internationale Tagung, Hamburg, 23.-26. Juli 1953, Berlin 1954, S. 280f. Vgl. Bernhard Buschendorf, „Auf dem Weg nach England - Edgar Wind und die Emigration der Bibliothek Warburg", in: Portrait aus Büchern. Bibliothek Warburg und Warburg Institute, Hamburg - 1933 - London, hrsg. von Michael Diers, Hamburg 1993, S. 85-128, hier: S. 95 f. 8 John Michael Krois, „Ernst Cassirer 1874-1945", in: Die Wissenschaftler Ernst Cassirer, Bruno Snell, Siegfried Landshut, Hamburg 1994, S. 9-40, hier: S. 27 f. 9 Martin Heidegger/Elisabeth Blochmann, Briefwechsel, hrsg. von Joachim W. Storck, Marbach 1989, Brief vom 12. 4. 1929, S. 30; vgl. Rüdiger Safranski, Ein Meister aus Deutschland. Heidegger und seine Zeit, München und Wien 1994, S. 222 f. Der Text der „Davoser Disputation" in der Niederschrift von O. F. Bollnow und Joachim Ritter ist abgedruckt in: Martin Heidegger, Kant und das Problem der Metaphysik, 4. Aufl., Frankfurt/M. 1973, S. 246-268. Vgl. zu dem Ereignis: Karlfried Gründer, „Cassirer und Heidegger in Davos 1929", in: Über Cassirers Philosophie der symbolischen Formen, hrsg. von Hans-Jürg Braun, Helmut Holzhey und Ernst Wolfgang Orth, Frankfurt/M. 1988, S. 290-302, sowie den fundamentalen Beitrag von John Michael Krois, „Why did Cassirer and Heidegger debate in Davos? Philosophy and Cultural Theory", in: New Perspectives on Ernst Cassirer, hrsg. von Cyrus Hamllin und John Michael Krois, New Haven 1998.
210
III Philosophie
der
Verkörperung
bestätigt der Bericht der Neuen Zürcher Zeitung: „Anstatt zwei Welten aufeinanderprallen zu sehen, genoß man höchstens das Schauspiel, wie ein sehr netter Mensch und ein sehr heftiger Mensch, der sich auch furchtbar Mühe gab, nett zu sein, Monologe redeten. Trotzdem taten alle Zuhörer sehr ergriffen und beglückwünschten sich gegenseitig dazu, dabei gewesen zu sein" 10 . Das Ereignis hat sich noch Jahrzehnte später in Jacob Taubes bösem Wort von Cassirer als dem „elegant parfümierten Vertreter [...] des protestantisch-jüdischen liberalen Konsensus" 11 niedergeschlagen. Es mag sich auch für Wind als der intellektuelle Sündenfall einer aufklärerischen Philosophie eingeprägt haben, die verloren hatte, weil ihr die Physis zum Angriff abhanden gekommen war. Eine Spur dieses Vorwurfes könnte noch fünf Jahrzehnte später nachgeschwungen haben, als Wind Cassirer in seiner Rezension von Gombrichs Warburg-Buch als „durchweg untadeligen Olympier" („always impeccably Olympian") und darin als einen Gegenpol zu Warburg beschrieb.12
Die „Kulturwissenschaftliche Bibliographie" Wie der Kampf zu führen gewesen wäre, hat Wind in seiner „Einleitung" zur Kulturwissenschaftlichen Bibliographie zum Nachleben der Antike von 1934 formuliert, die nach Drucklegung nicht mehr an den Buchhandel gegeben werden konnte.13 Der letzte Abschnitt „Humanismus und Gegenwart" enthält eine politische Begründung der Beschäftigung mit der Antike und dem Humanismus als einer Wappnung gegen alle Versuche, das Blut und den Boden an die Stelle der Antike setzen zu wollen: „So führt denn die scheinbar ,akademische' Frage nach der Bedeutung des Nachlebens antiker Elemente mitten hinein in den Kulturkampf unserer Tage, mitten hinein in den Streit um die Erhaltungs- und Wachstumsgesetze geschichtlicher Formen, in deren Bestimmung sich Historiker und Hygieniker den Rang ablaufen" 14 . Wie die Renzension im Völkischen Beobachter vom Januar 1935 ausweist, wurde die Botschaft verstanden: „Die gegen Deutschland, Italien und die ,Action française' gemachten Bemerkungen haben ihre deutliche antifaschistische Spitze und 10 Neue Zürcher
Zeitung, N r . 617, 1 0 . 4 . 1 9 2 9 (Zit. nach: Krois [wie Anm. 8], S. 25).
11 Jacob Taubes, Ad Carl Schmitt.
Cegenstrebige
Fügung,
Berlin 1987, S. 74. Vgl. auch den Auftritt,
mit dem der damalige Student Emmanuel Lévinas die Gesprächsführung Cassirers lächerlich machte (S. 75). 12 Edgar Wind, „On a Recent Biography of Warburg", in: ders., The Eloquence in Humanist
of Symbols.
13 Volker Breidecker, „Fragmente zu einer intellektuellen Kollektivbiographie", in: Erwin Beiträge des Symposions Hamburg 14
Studies
Art, hrsg. von Jaynie Anderson, Oxford 1983, S . 1 0 6 - 1 1 3 , hier: S. 110. Panofsky.
1992, Berlin 1994, S. 8 3 - 1 0 8 , hier: S. 85, Anm. 2.
Edgar Wind, „Einleitung", in: Kulturwissenschaftliche
Bibliographie
zum Nachleben
hrsg. v. d. Bibliothek Warburg, Bd. 1, Leipzig und Berlin 1934, S. I - X V I I , hier: S. X V .
der
Antike,
H. Bredekamp: Falsche Skischwünge
211
werden bei allen Glaubensgenossen bewunderndes Schmunzeln über den sauberen Herrn Wind auslösen. Wir aber sind sehend geworden und wissen, was wir davon denken sollen. Wir wollen nicht mehr diese jüdische und emigrantische Wissenschaft', die die Wissenschaft zum ,Betrieb' erniedrigt und sich von dem Geld des deutschen Volkes bereichert und es dafür wagt, dessen neue Lebensund Kulturauffassung offen und versteckt zu begeifern. Wir lehnen es ab, den Herren und Damen, denen es bei uns nicht mehr gefällt und die von ferne zischen, unsere Beachtung und unser Geld zu schenken" 15 . Nach dieser Reaktion wird Wind umso eher darin bestärkt worden sein, daß sein Pfeil getroffen hatte. Was immer er an Humanismusforschung seither verfaßte - programmatisch nennt er seine Aufsatzsammlung The Eloquence of Symbols im Untertitel Studies in Humanist Art - es war als Widerstand gegen alles Völkische zu verstehen, selbst wenn es sich scheinbar noch so weit von diesem Feld der Auseinandersetzung entfernt hatte.
Das experimentum crucis Wind ging es nicht um Humanismusforschung oder die Erkundung der Antikenrezeption allein, sondern um deren experimentelle Nutzung in einer Art philosophischem Zweifrontenkrieg, der sowohl gegen die Phantasmen des Nationalsozialismus wie auch gegen den in seiner Sicht zu verhaltenen Widerstand der „Idealisten" gerichtet war. Der Schlüssel für dieses Konzept liegt in seiner Habilitationsschrift: Das Experiment und die Metaphysik. Mit Blick auf die Erkenntnisse Poincarés und Einsteins resümiert Wind zunächst die neukantianische Kritik, daß Meßergebnisse nicht Tatsachen anzeigen, sondern deren Symbole, weil die Meßinstrumente, mit denen die Versuche veranstaltet werden, ihrerseits den Gegenstand der Untersuchung determinieren. Die Bedingungen der Instrumente aber seien nicht zu ermessen, sondern vorauszusetzen. Damit sei die Welt der Physiker nicht die der Tatsachen, sondern der Metaphysik. Das Mißtrauen des Physikers gegen die Metaphysik wird daher, so Winds ironischer Kommentar, „eine leichte Erschütterung erfahren, wenn er erkennt, daß gerade die Grundlage seines wissenschaftlichen Stolzes, das Meßinstrument, eines der schlagendsten Beispiele für ein metaphysisches Symbol ist" 1 6 . Im Kantischen Sinn war der Widerspruch dadurch einzuholen, daß diese Voraussetzungen, als Erzeugnisse des Bewußtseins, unhinterfragbare Wirklichkeit dar15 Martin Rasch, „Juden und Emigranten machen deutsche Wissenschaft", in: Völkischer Beobachter, Norddeutsche Ausgabe, Nr. 5 vom 5. Januar 1935, S. 5; hier zit. nach: Kosmopolis der Wissenschaft. E.R.Curtius und das Warburg Institute. Briefe und andere Dokumente, hrsg. von Dieter Wuttke, Baden-Baden 1989, S. 296-298, hier: S. 298. 16 Wind, Experiment (wie Anm. 3), S. 15.
212
III Philosophie
der
Verkörperung
stellten.17 Cassirer hatte diesen Gedanken zu seiner universalen Symboltheorie entfaltet. Wind dagegen, der sich am Pragmatismus Charles Sanders Peirce' orientierte,18 beharrte darauf, daß die zu Grunde liegenden Ideen „der Verkörperung fähig" sein müssen,19 daß also die menschlichen Sinne ein Korrektiv abzugeben hätten, das, wenn es denn als „anthropozentrisch" kritisiert würde, diesen Vorwurf aushalten solle.20 In dieser Argumentation entwickelt die Habilitationsschrift, was der Leserbrief an Times Literary Supplement von 1958 auf die knappe Formel eines Satzes bringt: „Meine These war, daß Symbole nur soweit,wirklich' sind als sie in einem experimentum crucis verkörpert werden können, dessen Ergebnis direkt beobachtbar ist". Mit dem Begriff des „experimentum crucis" nimmt Wind jene von Francis Bacon eingeführte Instanz des „Kreuz"- oder „Scheideweges" auf, die angesichts schwankender oder divergierender Theorien durch ein entscheidendes Experiment die gültige Richtung angibt.21 Ohne Frage hat Winds Rekurs auf Bacon den Sinn, einem in seiner umfassenden Gültigkeit abstrakten Symbolbegriff, der Mühe hat, unterhalb der Welt des Symbolischen das wiederzufinden, was symbolisiert wurde, das Konkrete und Nachvollziehbare in die Erinnerung zurückzurufen. Das Vorwort ist daher kein Zusatz, sondern eine Enthüllung der politischen Stoßrichtung dieses philosophischen Textes. Alle Suche nach dem Konkreten wird in Zukunft eine Metapher der Kritik an der philosophischen Verdunkelung sein, die Wind in den Faschismus übergehen sieht, und am widerstandsschwachen Idealismus, bei dem viel Licht, aber zu wenig Energie war.
Der französische Heidegger Winds Verwerfung der philosophischen Verdunkler und Uberblender hat in seiner 1946 publizierten Tirade gegen „Jean-Paul Sartre: a French Heidegger" eine unnachgiebige Steigerung erhalten. Im Oktober 1945 hatte Sartre in Paris seine Definition des Existentialismus formuliert, die ihn auch in den USA zu einer Berühmtheit machte. Im Rahmen einer Serie von Vorträgen gastierte er auch am 17 Ebenda, S. 43. 18 Vgl. Bernhard Buschendorf, „War ein sehr tüchtiges gegenseitiges
Fördern:
Edgar Wind und Aby
Warburg", in: Idea (Jahrbuch der Hamburger Kunsthalle), IV, 1985, S. 1 6 5 - 2 0 9 , hier: S. 167, 173 f. und John Michael Krois, „Kunst und Wissenschaft in Edgar Winds Philosophie der Verkörperung" im vorliegenden Band. 19 Wind, Experiment
(wie Anm. 3), S. 118 .
20 Ebenda, S. 119. 21
Francis Bacon, Nenes Organ der Wissenschaften
(Ubers.: Anton Theobald Brück), Darmstadt 1974
[1830], S. 163 ff. Buschendorf (wie Anm. 18), S. 173, verweist auf eine ähnliche Formulierung von Charles S. Peirce, in: Die Festlegung Pragmatizismus, S. 166 und 181.
einer Uberzeugung.
Schriften
zum Pragmatismus
und
hrsg. von Karl-Otto Apel, übers, von Gert Wattenberg, Frankfurt/M. 1976,
H. Bredekamp:
Falsche Skischwünge
213
Smith College, wo Wind zur selben Zeit Vorlesungen hielt. Für die zweiwöchig erscheinende Zeitschrift SCAN (The Smith College Associated News) verfasste er nach Sartres Auftritt einen nach Ton und Inhalt beispiellosen Artikel, der in seiner Schärfe von Winds Entsetzen zeugt, daß die Philosophie eines deutschen Nationalsozialisten nun in französischer Verkleidung die intellektuelle Welt zu beherrschen beginne.22 Wind beginnt seine Abrechnung bei Edmund Husserl, dessen „mystical power" er bereits in seiner Abhandlung zur zeitgenössischen deutschen Philosophie23 kritisiert hatte: „Ich fürchte, daß ich mit einigem Zorn über diesen Gegenstand schreiben werde, denn ich bin bereits zum zweiten mal Zeuge dieser Epidemie. Im Winter 1919, ein Jahr nach dem Ende des letzten Krieges, studierte ich an der Universität Freiburg im Breisgau, wo ich den Ausführungen Edmund Husserls lauschte, ein Philosoph, der für seine neue Methode höchsten Respekt genoß, den Gemeinplatz ins Obskure zu wenden. Er nannte sie Phänomenologie'". Nach diesem ironischen Einstieg wendet sich Wind dann mit jener abgründigen Abneigung gegen Heidegger, wie sie bisweilen zwischen Gelehrten wühlt, die sich noch aus Studienzeiten kennen und daher aus einem Fundus unverdeckter Schwächen schöpfen, die der spätere Ruhm überdeckt: „Husserl hatte einen Lehrling namens Heidegger. 1919 war er ein junger Tutor, der die Verdunkelungen des großen Professors in einem eigenen, virtuosen Stil zurückgab. Während Husserl eher wie ein Magier agierte, der über Geheimnisse verfügte, die er dem Pöbel nicht enthüllen konnte, versuchte Heidegger seine Studenten dadurch zu verwirren, daß er sie einschüchterte und ihnen im Gegenzug schmeichelte. Im Seminarraum plagte er sie mit hochfliegenden Phrasen, perfekt entlehnt von Stefan Georges Nachahmung von Mallarmé, aber an den Wochenenden begleitete er sie auf Skitouren, auf denen er sich als kerniger Bauer enthüllte, ein wenig die Maske einer oppressiven Dunkelheit lüftend, um sie mit umso größerem Effekt wieder aufzusetzen". Der Hinweis auf Heidegger als scheinheiliger Skiläufer, der am Wochenende eine körperliche Gemeinschaft vorspielt, die er im Seminar desto nachhaltiger düpiert, verblüfft. Sie könnte durch das kurz zuvor erschienene Sein und das Nichts motiviert gewesen sein, in dem Sartre eine kurze Philosophie des Skilaufens verfaßt hatte.24 Die Gedankenläufe von Sartre, Heidegger und Wind laufen hier für einen kurzen Moment durcheinander. Heidegger bewunderte diesen Passus,25 aber
22 Edgar Wind, „Jean-Paul Sartre: A French Heidegger", in: The Smith College Associated News, Tuesday, March 5, 1946, S. 1 - 4 (Anhang I). Für den Hinweis auf diesen Artikel wie auch für die weiteren, mit diesem Aufsatz in Verbindung stehenden Informationen sowie für die Erlaubnis, die Texte im Anhang zu drucken, ist Frau Margaret Wind herzlich zu danken. 23 Edgar Wind, Contemporary German Philosophy (wie Anm. 5), S. 516-530, hier: S. 526. 24 Jean-Paul Sartre, Das Sein und das Nichts, Reinbek bei Hamburg 1993, S. 884 f. 25 Safranski (wie Anm. 9), S. 402, mit Berufung auf einen nicht nachgewiesenen Bericht von Frédéric de Towarnicki.
214
III Philosophie der Verkörperung
dennoch hätte Wind in diesem einen Fall vermutlich zugestimmt. Sartres Theorie, daß die Berge je nach Skilaufstil unterschiedlich erlebt und begriffen werden, wird Wind ungeachtet seiner fundamentalen Kritik des Existenzialismus vermutlich akzeptiert haben, weil es hier um Handlungen ging, die sich authentisch in Wahrnehmungen niederschlugen. Heideggers Art der skilaufenden „Verkörperlichung" begriff er dagegen als einen besonders durchtriebenen Stil. Aus seiner Studienzeit erinnert sich Wind des Wechselspieles von sportlicher Naturnähe und intellektueller Entfernung, das auch die Teilnehmer des Davoser Gespräches beeindruckt und je nach Standpunkt abgestoßen oder eingenommen hatte. In dem bereits erwähnten Brief an Elisabeth Blochmann berichtet Heidegger, daß er, von seinen täglichen Skitouren zurückkommend, nachmittags mit dem Effekt in die Hotelgesellschaft eingebrochen war, wie um seinen Argumenten eine körperliche Unterstützung zu geben: „[...] noch den ganzen klingenden Schwung der weiten Abfahrten im Körper kamen wir dann immer abends in unserer Skiausrüstung mitten hinein in die Eleganz der abendlichen Toiletten. Diese unmittelbare Einheit von sachlich] forschender Arbeit u. völlig gelockertem und freudigem Skilauf war für die meisten der Dozenten u. Hörer etwas Unerhörtes" 2 6 . Berichte und Fotos, die den Gegensatz des Habitus zwischen dem auf dem Sofa ruhenden Cassirer und dem auf den Hängen wedelnden Heidegger betonten, 27 werden Wind bekannt gewesen sein, und in seiner Kritik des skilaufenden Freiburger Assistenten wird die Erinnerung an das Davoser Geschehen, das von den Zeitgenossen als ein Schlüsselereignis erachtet wurde, mitgeschwungen haben. Im Anschluß an seine Kritik des falschen Skiläufers betont Wind, daß Heideggers Parteinahme für die Nationalsozialisten kein äußerlicher Schritt, sondern eine logische Konsequenz seiner Philosophie gewesen sei, die Sartre nun beerbt habe, um die von Heidegger gestiftete Konfusion wegen der Übersetzungsprobleme noch zu verdoppeln. Die „satanischen Mächte", über welche Sartre verfüge, seien Produkte dieser Verwirrung. Man müsse sich klarmachen, daß seine Philosophie „Gift ist, und daß jene, die davon essen, sterben werden". Sartres Anschmiegung an Heidegger sei Produkt eines immer wieder zu beobachtenden Phänomens, daß die militärischen Sieger die geistigen Sklaven der Besiegten geworden wären. Daß Sartre offenbar in der Résistance mitgearbeitet hätte, mache seinen Sündenfall nur noch schlimmer. Denn wenn er ein Nazi wäre, könne man ihn angreifen. So aber sei er „Opfer und Agent der Konfusion". Auf Winds Artikel erschien ein Leserbrief von Vincent Guilloton, Professor für Französisch, der Sartre vom Vorwurf freizusprechen suchte, dieser sei ein Gefolgs-
26 Heidegger/Blochmann 27
(wie Anm. 9), S. 30; vgl. Safranski (wie Anm. 9), S. 222.
Gründer (wie Anm.9), S. 300; vgl. auch den Bericht von Ludwig Englert, der Heidegger charakterisiert als „dieser kleine braunschwarze Mann, dieser gute Skiläufer und Sportsmann, mit seiner energischen, unverrückbaren Miene" (ebenda, S. 299).
H. Bredekamp: Falsche Skischwünge
215
mann Heideggers. 28 Wind antwortete unversöhnlich, daß sich Sartre in seinem Vortrag ausdrücklich als Schüler Heideggers ausgegeben habe. Sartres Freiheitsbegriff laufe darauf hinaus, daß er sein Dasein im deutschen Gefangenenlager als Glück empfunden habe; da er aber keinesfalls als Kryptofaschist zu bezeichnen wäre, sei er schlimmer: ein Post-Kriegsgewinnler jener Konfusion, die nach jedem Krieg eintrete. 29 Winds erbarmungslose Kritik schlug über den Campus des Smith College hinaus Wellen. In der September/Oktober-Nummer der englischen Zeitschrift Polemic, die unter anderem auch George Orwells Analyse von Gullivers Reisen enthielt, erschien sein Artikel unter dem martialischen Titel: „Blood, Iron and Intuition" ein zweites Mal. 30 Dieser stammte jedoch nicht von ihm. In einem bitteren Brief an den Herausgeber vom 8.11.1946 wies er darauf hin, daß er einem Abdruck keinesfalls zugestimmt hätte, und schon gar nicht unter dem neuen Titel. Allein La France Libre sei an ihn mit der Bitte herangetreten, die gesamte Kontroverse in französischer Übersetzung publizieren zu können, und er habe dem zugestimmt, aber die Zeitschrift sei von ihrem Plan dann wieder abgerückt. Polemic möge daher in der folgenden Nummer darlegen, daß der Abdruck nicht autorisiert gewesen sei.31 Drei Tage später erhielt Wind ein bedauerndes Telegramm, 32 und am selben Tag ging ein Brief des Herausgebers ab, in dem er sich in aller Form entschuldigte. Ihm sei der Text von Freunden geschickt worden, denen er abnehmen konnte, daß sie ihn in Winds Namen geschrieben hätten; im übrigen habe er seine eigenen Befürchtungen gegenüber dem Existentialimus punktgenau getroffen. Ein Honorar, so peinlich sich dies ausnähme, sei für ihn vorgesehen. 33 Wind antwortete nicht, so daß der Herausgeber nochmals, und erneut vergeblich, im 21.2.1947 wegen Winds Bankverbindung anfragte. 34 Dieser Konflikt um die nicht autorisierte Fassung seines Artikels war mehr als eine beiläufige Episode. Er wird Wind vor allem aus dem Grund abgestoßen haben, daß der neue Titel einen Sprachduktus aufwies, der dem Vokabular seiner Feinde hätte entsprungen sein können. Er hatte die großen Worte Husserls, die mystagogischen Verdunkelungen Heideggers und dessen theatralische Naturnähe, die in seinen Augen eine Perversion seiner eigenen Suche nach „Verkörperlichung" sein mußten, denunziert, um nun selbst mit dem Pomp von „Blut und Eisen" verbunden zu werden. 28 Vincent Guilloton, „Letter to the Editor" (Anhang II). 29 Edgar Wind, „Letter to the Editor" (Anhang III). 30 Edgar Wind, „Blood, Iron and Intuition (Jean-Paul Sartre: a French Heidegger)", in: Polemic, Bd. V, 1946, S. 54-57. 31 Edgar Wind an Humphrey Slater, 8.11.1946 (Anhang IV). 32 Polemic an Edgar Wind (Anhang V). 33 Humphrey Slater an Edgar Wind, 11.11.1946 (Anhang VI). 34 Humphrey Slater an Edgar Wind, 21.2.1947 (Anhang VII).
216
III Philosophie der Verkörperung
Kritik der Mystagogen Winds Ausbruch gegen Heidegger und Sartre ist Episode geblieben. Aus diesem Grund ist der Text kaum wahrgenommen worden, und vor allem ist verborgen geblieben, daß Wind seine Kritik des Wechselspieles von Verdunkelung und Aufhellung über die folgenden Jahre auf einem anderen Gebiet weitergetrieben hat, das hierfür nicht unbedingt prädestiniert schien: den Pagan Mysteries. Weil dieses Buch sofort nach Erscheinen 1958 zum ikonologischen Klassiker aufstieg, wurde Winds erkenntniskritischer Antrieb mißachtet, und damit wurden die Heidnischen Mysterien zu einem der wohl am gründlichsten mißverstandenen Werke der Kunstgeschichte. In der Einleitung seines opus magnum kennzeichnet Wind die zuvor als HusserlHeideggersche Manie verachtete Kunst der rhetorischen Verhüllung als Instrument der neuplatonischen Mystagogen. Hierzu gehört zunächst die Sprache, auf die der Mensch, wie Pico della Mirandola ausführt, unabdingbar angewiesen ist, die aber niemals zum Wesen dessen dringen kann, was sie umschreibt: „[...] wir können es gleichsam nur umkreisen und versuchen, unsere Erfahrung von ihm in Sprache zu fassen, wobei wir unserem Ziel bald nahekommen, bald aufgrund der ihm innewohnenden Antinomien völlig zurückgeworfen werden [...]. Dennoch sprechen und schreiben wir" 3 5 . Alles Wesentliche ist daher nur in Andeutungen und Umhüllungen zu fassen; es muß, wie Egidio da Viterbo ausführt, Eingeweihten vorbehalten bleiben: „Wie es bei Dionysios heißt, kann uns der göttliche Strahl nur erreichen, wenn er in poetische Schleier gehüllt ist" 36 . Näher noch an das in Bezug auf Husserl und Heidegger beschriebene Wechselspiel kommt der Dialog des Neuplatonikers Celio Calcagnini mit seinem Neffen, der die Verhüllung und die Offenbarung gleichermaßen begründet. 37 Mit der Zusammenstellung dieser und weiterer Zitate rekonstruiert Wind dasselbe Verfahren in Bezug auf die neuplatonisch geschulten Mystagogen der Renaissance, das er zwölf Jahre zuvor Husserl und Heidegger zugeschrieben hatte. Zu Ende seines einleitenden Kapitels setzt sich Wind, was von allen Rezensenten des Werkes verkannt worden ist, entschieden von den Neuplatonikern ab: „Ich hoffe daher, nicht als Anhänger der Lehre der Mysterien, die ich im folgenden erläutere, mißverstanden zu werden. Den Grundsatz Pico della Mirándolas, daß Mysterien, die tief sein sollen, dunkel sein müßten, halte ich für [...] falsch [...]. Indessen kommt man an der wenn auch vielleicht unangenehmen Tatsache nicht vorbei, daß auf diesem unreinen Boden eine große Kunst blühte. Bei der Behandlung des 35 Pico della Mirandola, Enneaden VI, ix, 3-4, zit. nach der Ubers, in: Edgar Wind, Heidnische Mysterien in der Renaissance, Frankfurt/M. 1981, S. 20. 36 Egidio da Viterbo, In librum primum Sententiarum commentationes ad mentem Piatonis, zit. nach der Ubers, in: Wind, Mysterien (wie Anm. 35), S. 24f. 37 Celio Calcagnini, Opera aliquot, Basel 1544, S. 27, in: Wind, Mysterien (wie Anm. 35), S. 22.
H. Bredekamp:
Falsche Skischwünge
217
Gegenstandes werde ich mich um Klarheit bemühen, ein aus der Sicht der Renaissance-Mystagogen freilich fragwürdiges Ziel. Doch wird das Verständnis dieses verwirrenden Phänomens ebensowenig dadurch gefördert, daß man ihnen erliegt, wie dadurch, daß man ihre Existenz ignoriert"38. Wind setzte sich so intensiv mit dem Neuplatonismus auseinander, weil er diesen als einen außergewöhnlich gewitzten und damit ebenbürtigen Gegner ansah. Sein Interesse an der Kunst der Renaissance lag neben einem natürlichen Vergnügen an der Entschlüsselung von Bildrätseln vor allem darin, Obskurantismus in Klarheit zu überführen. Eine solche war aber nur zu erreichen, wenn den Verwirrungsstrategien der Neuplatoniker die konkrete Form des Kunstwerkes als Korrektiv und Ziel entgegengesetzt würde.
Formelkenntnis als experimentum
crucis
Der Schlüssel für Winds Beschäftigung mit dem Neuplatonismus liegt nicht an einem besonderen Faible für diese Philosophie, sondern darin, sie durch die kunsthistorische Formanalyse unnachgiebig überprüfen, kritisieren und erweitern zu können. Hierin besteht die Brücke zwischen der Habilitationsschrift und den Arbeiten zur Renaissance. Dieser Ubergang war von der Philosophie zur Kunst, aber auch in umgekehrter Richtung zu gehen. Wie sich der Neuplatonismus in der verkörperlichten Form zu bewahrheiten hatte, so war jede Interpretation sinnlos, die nicht die Formerkenntnis sensibilisierte. Die visuelle Evidenz, dies hat Wind in Kunst und Anarchie nochmals betont, ist das experimentum crucis der Hermeneutik: „Für die künstlerische Bedeutsamkeit einer Interpretation gibt es nur einen einzigen Prüfstein: sie muß unsere Wahrnehmung des Gegenstandes schärfen und dadurch unseren ästhetischen Genuß erhöhen. Wenn das Objekt hinterher genauso dasteht wie zuvor, nur durch den lästigen Uberbau beschwert, so ist die Auslegung ästhetisch ohne Wert, so vermenschlicht sie in historischer oder anderer Hinsicht auch sein mag" 39 . Winds Anspruch an eine aufklärerische Wissenschaft, den er 1934 in der Einleitung seiner Habilitationsschrift formulierte, wirkte in den Pagan Mysteries weiter. Er hatte sich zu intensiv mit den Wertproblemen von Max Webers Wissenschaft als Beruf auseinandergesetzt,40 als daß er die historische Exegese für die Tagespolitik hätte instrumentalisieren wollen. Vielmehr hat er, Webers These von der indirekten Wirkung gemäß, den aktuellen Bezug auch dort gesehen, wo sich die historische Forschung bewußt von der Gegenwart absetzt. Die letzten Sätze der
38 Ebenda, S. 27. 39 Edgar Wind, Kunst und Anarchie (Übers.: Gottfried Boehm), Frankfurt/M. 1979, S. 69; vgl. Buschendorf (wie Anm. 18), S. 175. 40 Wind, Contemporary German Philosophy (wie Anm. 5), S. 516 ff.
218
III Philosophie
der
Verkörperung
„Einleitung" von 1934 haben auch in dieser Hinsicht mottohafte Züge. Wenn die Wissenschaft, so Wind, „einmal grundsätzlich erkannt und ausgesprochen [hat], daß die Frage des Tages auch ihre eigene Frage ist und ihre eigene Lösung auf die Lösung des Tages zurückwirkt oder zurückwirken kann, so wird sie ihre eigenen Kräfte am besten dadurch schulen und den Forderungen der Stunde auch dienstbar machen, daß sie diese ohnehin wirksame und niemals wegzuleugnende Bindung in Gedanken wieder aufhebt und sie jedenfalls nicht durch einen gedanklichen Machtanspruch noch unnütz verstärkt und belastet. - Die Aktualität unseres Themas mögen wir daher, nachdem wir sie uns einmal in aller Schärfe bewußt gemacht haben, mit Vorbedacht wieder vergessen [...]" 41 . Diese Sätze könnten auch über Winds Hauptwerk, den Pagan Mysteries, stehen. Sein dort entfaltetes Interesse am Neuplatonismus hat durchaus Eigencharakter und ist durch ein authentisches Faszinosum geprägt. Der noch aus den zwanziger und dreißiger Jahren weiterwirkende Anspruch geht über diese autonome Zwiesprache mit der Kultur der Renaissance jedoch hinaus. In den neuplatonischen Mystagogen der Renaissance setzt sich Wind weiterhin auch mit jenen Philosophen seiner Zeit auseinander, die sich in seiner Wahrnehmung der Verdunkelung verschrieben haben. Sein übergreifendes Interesse am Neuplatonismus der Renaissance dient nicht einer panegyrischen Verdoppelung, sondern einer kritischen Aufhellung.42 Für Wind ist der Neuplatonismus als „kulturwissenschaftliches Paradigma" nicht Leitbild, sondern Stachel. Dies gibt seinen Schriften zur Kunst der Renaissance einen widerspenstigen Sinn. Er läßt nochmals verständlich werden, warum er im Jahr, in dem die Pagan Mysteries erschienen, an seine Habilitationsschrift erinnerte, die mit ihrer Theorie der Verkörperlichung als Antidotum gegen einen gefährlicheren Obskurantismus gemeint war.
41 42
Wind, Einleitung (wie A n m . 14), S. X V I I . Insofern sich W i n d hier v o m übrigen Umkreis der Warburg-Schule unterscheidet, ist meine Kritik neuplatonischer Deutungsweisen in diesem Punkt zu korrigieren (Horst Bredekamp, „Götterdämmerung des Neuplatonismus", in: Die Lesbarkeit der Kunst. Zur Geistes-Gegenwart der Ikonologie, hrsg. v o n A n d r e a s Beyer, Berlin 1992, S. 7 5 - 8 3 , hier: S. 76f.). Vgl. K a y E. Schiller, The Renaissance as Prototype and Remedy. The Transatlantic Development of German-Jewish Humanist Culture, Phil. Diss., Ms. Mss., The University of Chicago 1 9 9 6 , S. 1 6 7 f f . (Ersch. als Gelehrte Gegenwelten oder Über die Renaissance als Leitbild im 20. Jahrhundert, Frankfurt/M. 1999.)
H. Bredekamp: Falsche Skischwünge
219
ANHANG: EDGAR WINDS KRITIK A N H E I D E G G E R U N D SARTRE U N D DIE R E A K T I O N E N I Edgar Wind, Je an-Paul Sartre: A French Heidegger The best way to combat a disease is to study it. With characteristic clarity of mind, the French Department has done the College a great service by exposing it to the personality of Jean-Paul Sartre, whose notoriety as a counsellor of philosophic despair has some of the ugly traits of a fashionable epidemic. I fear that I shall write with some heat on this subject, for I am witnessing this epidemic for the second time. In the winter of 1919, one year after the end of the last war, I studied at the university of Freiburg im Breisgau, where I listened to the discourses of Edmund Husserl, a philosopher greatly respected for his new method of turning the commonplace into the obscure. He called it phenomenology, a word which had some pleasant associations with Hegel, but was to be a watchword against intellectual abuses. In fact, Husserl claimed to have rediscovered the value of pure intuition. An air of mystification pervaded his lectures and seminars, in which he told his disciples to contemplate with awe such phenomenal truths as that the color orange always lies between yellow and red, and that no color is ever seen without spatial extension. These were the models of a new kind of a priori proposition, to be discovered only by „painstaking researches", but capable of such wide expansion that ultimately even religious questions, concerning the nature of God and the destiny of man, could be answered by plain inspection; not to speak of self-evident propositions in ethics, among which I particularly remember one about war: that war is an evil thing in general, but perfectly justified if you feel that you have been attacked. Husserl had an apprentice by the name of Heidegger. In 1919 he was a young instructor, and echoed the obscurities of the great professor in a virulent style of his own. While Husserl acted very much like a wizard who knew secrets that he could not disclose to the vulgar, Heidegger tried to baffle his students by bullying and flattering them in turn. In the classroom, he teased them with high-flown phrases, preferably borrowed from Stefan George's imitation of Mallarmé, but for weekends he joined them on skiing parties where he revealed himself as a vigorous peasant, slyly lifting the mask of oppressive somberness, only to resume it with more effect. When I heard, some fifteen years later, that Heidegger had become a convinced fascist, it seemed to me a natural development. Contrary to many who „joined the party", he was predestined for it. A self-assertive disdain of reason, a wilful confusion of profundity with darkness, a playing on the sensibilities of his followers by caressing and threatening them in quick succession, all these were traits which
220
III Philosophie der Verkörperung
Heidegger had developed long before Hitler turned them to political use. It is considered virtuous by a metaphysical people to do violence to oneself and to others; and Heidegger's enormous success with his students, which reached hysterical proportions in later years, lay in his appeal to their instinctive beliefs. H e reassured that the reasonable is equivalent to the shallow, that the profound layers of existence are effectively laid bare by anguish, that a persistent threat of death is the only proper condition of living, and that one has no sense of reality unless one faces the void. There are traces of a perverted Protestantism in this doctrine, and some parts are literally lifted from Kierkegaard. Like the earlier quotations from the Germanized Mallarmé, they served the purposes of an oblique oratory, which ended by rejecting the. phenomenology of Husserl as far too diaphanous to suit the anguished, who need fear in order to know that they exist. Husserl was distressed by the apostasy of his pupil, but he had no excuse for being surprised. One kind of obscurantism breeds another. The apparently harmless vagaries of Husserl's phenomenology, to all intents a purely academic affair, created an atmosphere of mystification in which Heidegger could thoroughly exercise his metaphysical talents. The history of the „disappointed old man" is a good illustration that academic affairs are not harmless. Husserl had laid the eggs which were hatched by Heidegger. And now these self-same eggs are being served in a French style by M. Sartre. In his lecture, he appeared more urbane and was far more cerebral than Heidegger would consider permissible. To attack, as he did, l'esprit d'analyse with a series of purely analytic devices, seemed almost too facile a paradox. Only after the lecture, when he conversed with a smaller group, did he reveal the more somber implications of his doctrine. It transpired that there is a very minute distinction between Heidegger's philosophy and his own (for apparently this school of thought has now reached its own Alexandrianism). Whereas Heidegger holds that ,Nothing' is a more fundamental principle than ,Being', M. Sartre gives the primary place to ,Being' and argues that,Nothing' originates with man and condemns him (sic) to a state of liberty. At this point, Heidegger might have embraced his pupil, for in this they are both agreed: A man who senses his liberty as a state of „dereliction" has a genuine, „authentic" experience, whereas he who greets it with joy, has not. The dismissal of lucidity, of rationality, of any harmonious sense of existence as „unauthentic" is one of the most vicious pieces of sophistry which M. Sartre has taken over from Heidegger.
Heidegger in France The importation of Heidegger into France might be worth inquiring into. I can contribute one small episode. In 1930,1 made the acquaintance of an erudite young Frenchman, named Corbin, a librarian at the Bibliothèque Nationale. Being a
H. Bredekamp:
Falsche Skischwünge
221
French Protestant, he felt attracted to Heidegger, in whom he claimed to recognize a great Protestant force. Corbin's tastes were somewhat eccentric. Mr. Denis de Rougement asserts (I have to rely on his word for it) that Corbin has now joined the Greek Orthodox Church. At the time I knew him, he employed - or rather wasted - his leisure in an attempt to translate Heidegger into French. He wisely chose a short essay, entitled Was ist Metaphysik? (What is Metaphysics?) This happens to contain the famous sentence: „Das Nichts nichtet" (The Nothing nothings). I was interested in knowing how this would sound in French. Corbin was perfectly at ease and asked me in his best Socratic manner: „You say, the verb nichten does not exist in the German language?" - „That is right". - „But the verb vernichten is a good German verb?" - „Yes". - „Well, vernichten in French is anéantir, but néantir does not exist in French either. Hence, Le néant néantit is the exact French equivalent to Das Nichts nichtet." M. Sartre has exercised his ingenuity in a similar vein, extending it even to old Hegelian phrases. Hegel's An sich becomes I'En-soi, Hegel's Für sich becomes le Ρour-soi, and the union of both in Hegel's An und für sich appears as le Pour-soi dans l'En-soi. It is a pity that M. Sartre has apparently not yet adopted Jean Paul's An und für mich. The mystfying effect of such phrases is due to their remoteness from normal speech. Hegel is sufficiently mystifying in German, but in French the mystification is doubled. The same applies to Heidegger. M. Sartre owes some of his satanical powers to the use of language twice removed.
Why this revival? Why this revival in France of a philosophy that should have died with Hitler? Is the post-war mentality of the Germans of 1919 so congenial to the French avant-garde in 1946? And why should the international world of elegant letters become mesmerized by this glorification of fear? Whereever one opens a progressive weekly or monthly, whether in England or in America, the editor feels obliged to present his readers with Existentialism. In Horizon Mr. Ayer has made a valiant attempt to prove that M. Sartre's disdain of logic is illogical - as if M. Sartre cared. To fight such a poison, is it not sufficient to call it sillly. One must explain that it is a poison, and that those who eat from it shall die. It has frequently happened after a military victory, that the victors became spiritual slaves of the vanquished. The Dean of St. Paul's, in one of his gloomy moments, proclaimed that „nothing fails like success". M. Sartre would have us believe the opposite: Nothing succeeds like failure - a theorem on which Karl Jaspers who now presides over the University of Heidelberg, has based a successful phiolosophy of life. M. Sartre admires him greatly.
222
III Philosophie der Verkörperung
Let us not confuse the issue in our turn. It is a matter of record that Mr. Heidegger was an „authentic" member of the Nazi party. It is also a matter of record that M. Sartre proclaims Mr. Heidegger as his „authentic" model. It does not follow that Mr. Sartre is a Nazi, for history does not work in syllogisms. However, it does follow that M. Sartre, who is said to have worked in the French Resistance, is a victim and agent of confusion. The French are the most clear-minded men of letters, but the grave-diggers of Europe are still at work. (The Smith College Associated News, Tuesday, March 5,1946, pp. 2-4)
II Vincent Guilloton, Letter to the editor, 12. 3. 1946 Dear Editor, In fairness to M. Sartre who lectured recently at Smith under the auspices of the French Department, Dr. Wind's article in SCAN Tuesday, March 5, 1946, entitled Jean-Paul Sartre: a French Heidegger should not remain unanswered. It is not the purpose of this letter to take up in detail all the points in Dr. Wind's article. I just wish to point out that his strictures rest on a certain number of gratuitous assumptions. Assumption 1: Heidegger's conversion to Nazism derived ineluctable from his existentialist philosophy. „Post hoc, ergo propter hoc". In view of the fact that Heidegger, upon joining the Nazi party, became Rector of the University of Freiburg and inherited the lecture chair of his master Husserl, a Jew, whom he promptly expelled, is it not possible to assume that Heidegger was simply an ambitious and unscrupulous man acting more as a common opportunist than as an existentialist philosopher. Assumption 2: J. P. Sartre's and Heidegger's philosophies are identical. It is a matter of record that they are not. While Sartre and the French existentialists do acknowledge a debt to Heidegger, they are often at variance with him. Let me quote from an article entitled „Ideas in France: 1939 to 1949" which appeared in the January, 1946, number of the Review of Politics published by Notre-Dame University. This article was written by Prof. Henri Marrou of the Sorbonne, a Catholic who does not like „atheistic existentialism", but has this to say about Sartre and his friends: „a remarkable fact: all criticize bitterly their master Heidegger's doctrine of Sein-zum-Tode, of existence turned and, so to speak, pointed at death. All without exception give to their analyses, dark as they are, a virile conclusion directed toward life, energy, decision ... For Sartre, the end is an ethic of liberty." Assumption 3: Existentialist Heidegger having become a „convinced fascist" Sartre and the French existentialists are in danger of going the same way. Again it is a matter of record (Dr. Wind refers to the fact „en passant") that Sartre and his friends took an active part in the French Resistance against the Nazis, which prompts Prof. Marrou, himself an underground fighter, to pay them this
H. Bredekamp:
Falsche Skischwünge
223
homage in the same article: „These man have been able to demonstrate that they were able to transcribe in acts their nobility of soul." I submit therefore that labelling Jean-Paul Sartre a French Heidegger is, to say the least, misleading. Dr. Wind confesses to writing on the subject „with some heat", which may have led him to give SCAN readers not the real Sartre, but (apologies to Carlyle) a Sartre „resartus" a la Heidegger. Sincerly, Vincent Guilloton, Professor of French (The Smith College Associated News, Bd. XL, Nr. 33, 12. 3. 1946)
III Edgar Wind, Letter to the editor, 15. 3. 1946 To the editor: I have read Mr. Guilloton's apology for Sartre with regret. I fail to understand how a philosophy which is thoroughly evil in German can become any better by being translated into French, even assuming that it were proved, which it is not, that the French version tones down the worst aspects of the German doctrine. Mr. Guilloton claims that I have made a „gratuitous assumption" by saying that Heidegger's philosophy and his personal conduct are interrelated. Unfortunately, I speak from first-hand experience: I knew Heidegger personally, I know his philosophy. I congratulate Mr. Guilloton on being acquainted with neither; but his good fortune does not exactly qualify him for pronouncements on the connection, or lack of connection, between what Heidegger has written and what he has done. As for the relation of Sartre to Heidegger, I should like to remind Mr. Guilloton that at the meeting over which he presided, Sartre explicitly declared himself a disciple of Heidegger. Surely we have the right to accept his word. If Mr. Guilloton does not wish to believe that the difference between Sartre's and Heidegger's philosophy is confined to the minute point indicated in my article, I invite him to read Heidegger's Sein und Zeit, which is available. Without having read this book, he has again, I am afraid, no basis for dismissing my statement. Like most defenders of Sartre, Mr. Guilloton is unaware that the very term Existentialism is taken from Heidegger, nor is he perhaps informed of the vicious proportions which the cult of Heidegger has reached in France. Sartre himself stated that a complete French translation of Heidegger is now being made by Corbin. As against these danger-signals, little consolation may be gathered by Mr. Guilloton's quotations from an article by a French professor, published at Notre Dame, Indiana, who tries to make the best of an admittedly bad case. It is very fine to quote: „For Sartre, the end is an ethic of liberty", without telling us what that liberty is. We know what it is, for Sartre himself told us so, in the presence of Mr. Guilloton. Liberty is „a state of dereliction", and whoever greets it with joy is „unauthentic".
224
III Philosophie der Verkörperung
I was reluctant, in my article, to report the dreadful illustration by which Sartre tried to support his thesis; but as Mr. Guilloton claims that I am misrepresenting him, I am forced to retell the story. When Sartre was in a German prison camp, he and the other inmates, so he said, led well-adjusted lives and were fairly happy, for they had no decisions to make of their own. On regaining their liberty, they could no longer escape from decisions and promptly felt the full anguish of dereliction. On being questioned as to what he thought of those prisoners who greeted their liberation with joy, Sartre answered that their experience was „unauthentic"; they were deceived. And this is the doctrine which Mr. Guilloton would describe as an improvement over Heidegger. I assure the reader that Heidegger is no worse. I am sorry that in this „third gratuitous assumption" Mr. Guilloton claims that my article imputed a fascist tendency to Sartre and minimized his role in the Resistance Movement. Mr. Guilloton here commits the very fallacy against which I warned in my last paragraph, and I infer from this that he has missed the precise point of my argument. If Sartre were a crypto-fascist, there would be no problem, no confusion; but when a member of the Resistance talks Heidegger, we have every reason to be alarmed. And the confusion is spreading to America. The PartisanReview has announced that a forthcoming issue will contain samples from both Heidegger and Sartre. The Vogue of Existentialism is a typical post-war phenomenon, indicative of a social disease. Like warprofiteers who make business from disaster, there are also intellectual profiteers who thrive on confusion. The most charitable interpretation that I can place on Sartre's propaganda is that he is a victim of the very confusion which he spreads. I should like to repeat that we owe a great debt to the French Department. Edgar Wind (The Smith College Associated News, Bd. XL, 1946, 15. 3. 1946)
IV Edgar Wind an Humphrey Slater, Brief vom 8. 11. 1946 Humphrey Slater Esq. Polemic 5 Bathurst Street London, W2 Dear Sir: It was with considerable regret that, on seeing the October issue of Polemic, I found myself forced to send you the following cable: Astonished to receive September-October issue Polemic containing article by me reprinted without my permission and with unauthorized title of a kind I would never approve, and also several misprints and errors. Request that you withdraw title and make necessary explanations in text issue according to letter following.
H. Bredekamp:
Falsche Skischwünge
225
I am certain that you acted with the best of intentions, but I fail to understand how, never having communicated with me in the matter, you could assume that you were authorized to reprint the article and give it a new title without my consent, not to speak of the fact that it is customary to protect an author against misprints by letting him see the proofs of an article to be published under his name. I do not know whether you are aware that the article was printed some time ago in an American college paper, and that it was answered by a French professor whom I answered in turn. The debate amused some of my friends in England, and La France Libre asked for permission to print a French translation of the debate as a whole. This permission was granted both by my opponent and myself, but La France Libre decided on second thought to desist. No permission was either asked or given to reprint my article separatly or in any other journal but La France Libre or in any other language but French. I hope therefore that you will agree to insert the following statement in your next issue: Owing to a regrettable error, the article by Edgar Wind in our October issue was reprinted from an American college paper incorrectly and without the author's permission, and supplied with a title of wich the author disapproves. Yours very truly, Edgar Wind (Archiv Margaret Wind)
V Magazin Polemic an Edgar Wind, Telegramm vom 11.11.1946,21.46 Uhr most profound apologies manuscript was offered us unsolicited from genva difficulties posts telegraph resulted in inadequate check again sincerest regrets = Palemic [sic!]. (Archiv Margaret Wind)
VI Humphrey Slater an Edgar Wind, Brief vom 11.11.1946 Edgar Wind Esq. Smith College, Northampton, Mass. Dear Sir, It was with the utmost shame and distress that we received your cable about the article purporting to be by you in „Polemic" 5. What happened was that the manuscript in question was sent, unsolicited, to me by some friends in Geneva.
226
III Philosophie der Verkörperung
It had previously been offered to „Horizon" and I never had the slightest reason to doubt that you had not made it available for publication. I liked it immediately and believing that the craze for existentialism was a rapidly spreading danger I made the gross mistake of publishing it without waiting for a reply to my letter to you which asked you to let us know immediately if you objected. We heard nothing and assumed your consent. May I again express my most sincere regrets and assure you that an explanation will be made in the next „Polemic" (that is to say No. 7, N o . 6 is already printed.) I hope it is not impertinent of me to mention payment. O u r normal rate is 5 guineas a thousand words, which works out at nine guineas for your manuscript, but of course we would not suggest any sum less than that to which you are accustomed. Yours very sincerely, Humphrey Slater. (Archiv Margaret Wind)
VII Humphrey Slater an Edgar Wind, Brief vom 21. 2. 1947 Edgar Wind Esq. Smith College, Northampton, Mass. Dear Sir, I notice from our accounts that we have not yet paid any fee for our disreputable mistake in printing your article on existentialism. I should be most grateful if you would let us know what amount to send you. Perhaps you would let us know the name of your bank in America (we have to get special permission to make a sterling transfer) or alternatively, any account in England into which we might pay sterling? Again, please accept my apologies, Yours very sincerly, Humphrey Slater. (Archiv Margaret Wind)
Zur Begründung der Kulturwissenschaft Der Symbolbegriff bei Friedrich Theodor Vischer, Aby Warburg und Edgar Wind
Bernhard Buschendorf G r u n d l e g e n d für E d g a r W i n d s K o n z e p t v o n Kulturwissenschaft ist sein S y m b o l begriff, d e n n mit ihm sucht er den kulturwissenschaftlichen Gegenstand z u bestimmen. D a W i n d v o r allem an die S y m b o l t h e o r i e anknüpft, die der K u l t u r w i s s e n schaftler A b y W a r b u r g aus der S y m b o l t h e o r i e des Ästhetikers F r i e d r i c h T h e o d o r Vischer entwickelte, m ö c h t e ich im folgenden z u n ä c h s t diese beiden T h e o r i e n v e r gleichen. In A b s e t z u n g v o n ihnen w e r d e ich s o d a n n die wesentlichen M o m e n t e v o n W i n d s Symbolbegriff erörtern. Vischer ging es in der Symboltheorie, die er v o r allem in d e m späten e p o c h e m a c h e n d e n A u f s a t z „Das S y m b o l " explizierte, 1 u m eine a n t h r o p o l o g i s c h ausgerichtete, au fond
p s y c h o l o g i s c h e G r u n d l e g u n g der Ästhetik, mit der er sich ent-
schieden gegen konkurrierende B e g r ü n d u n g s v e r s u c h e der formalistischen Schule w a n d t e . 2 Vischer gibt zunächst eine allgemeine Definition des Symbolbegriffs. E r bestimmt das S y m b o l als äußerliche V e r k n ü p f u n g v o n Bild u n d B e d e u t u n g unter
1 Friedrich Theodor Vischer, „Das Symbol", in: Philosophische Aufsätze. Eduard Zeller zu seinem fünfzig-jährigert Doctor-Jubiläum gewidmet, Leipzig 1887, S.151-193 [wiederabgedruckt in: ders., Kritische Gänge 4, hrsg. von Robert Vischer, München 2 1922, 420-456]; vgl. ders., „Der Traum", in: Kritische Gänge 4, S. 459-488; vgl. dagegen Vischers frühe Symboltheorie in: ders., Ästhetik oder Wissenschaft des Schönen, hrsg. von Robert Vischer, München 2 1922, Tl. II, §§ 426ff. und 444 ff.; zur Revision seines frühen Symbolverständnisses siehe bereits: ders., „Kritik meiner Ästhetik", in: Kritische Gänge 4, S. 222-419, hier S. 314-325. 2 Die Vertreter der formalistischen Schule wie zum Beispiel Robert Zimmermann zielen auf eine dualistische Begründung der Ästhetik, denn sie machen neben dem Ausdrucksprinzip, auf dem der ästhetische Genuß der im Kunst- oder Naturschönen präsenten Gefühle und Stimmungen basiert, ein gleichursprüngliches Formprinzip geltend, das dem ästhetischen Genuß am Spiel der reinen Formen zugrunde liegt. Dagegen gibt der späte Friedrich Theodor Vischer eine monistische, nämlich ausschließlich ausdrucksästhetische Begründung der Ästhetik. Dabei beruft er sich auf seinen Sohn Robert, der Anfang der siebziger Jahre dargetan hatte, daß nicht nur der ästhetische Genuß der Gehalte von Kunst- und Naturschönem, sondern auch der des vermeintlich reinen Formenspiels in Wahrheit auf dem Ausdrucksprinzip, nämlich auf Einfühlung beruht; vgl. Robert Vischer, Über das optische Formgefühl. Ein Betrag zur Ästhetik, Leipzig 1873 [wiederabgedruckt in: ders., Drei Schriften zum ästhetischen Formproblem, Halle 1927, 1-44].
228
III Philosophie
der
Verkörperung
einem Vergleichspunkt, wobei er mit dem Wort Bild irgend einen anschaulich gegebenen Gegenstand meint und unter Bedeutung irgend einen begrifflich faßbaren Sinn versteht. Außerdem erklärt Vischer, die Verknüpfung von Bild und Bedeutung müsse unangemessen sein,3 was nichts anderes besagt, als daß die Bedeutung, auch wenn sie mehrere Sinnmomente enthält, gegenüber den vielen konkreten Eigenschaften des Bildes einfach und abstrakt sein muß. Diesen allgemeinen Symbolbegriff zerlegt Vischer sodann in drei besondere Formen. Er unterscheidet sie zum einen temporal-relational nach ihrem früheren oder späteren Auftauchen in der Entwicklungsgeschichte des Menschen, faßt sie mithin als drei Stufen. Zum anderen aber und vor allem differenziert er sie psychologischsystematisch nach der Art und Weise der Verbindung zwischen Bild und Bedeutung. Als erste behandelt Vischer die entwicklungsgeschichtlich vergleichsweise frühe Stufe der Symbolik, die er als die religiöse oder dunkel-unfreie Symbolform apostrophiert,4 und diskutiert als zweite die diametral entgegengesetzte, entwicklungsgeschichtlich relativ späte Stufe, die er die rationale oder helle und freie Symbolform nennt.5 In deutlicher Abgrenzung von beiden expliziert er schließlich die gesuchte ästhetische - von ihm auch als „vorbehaltende" bezeichnete - Stufe oder Form der Symbolik: Sie ist historisch und systematisch zwischen der religiösen und der rationalen gelegen, von beiden scharf geschieden und dadurch definiert, daß sie zwischen beiden vermittelt. In der frühen oder religiösen Form der Symbolik, in der das Bild der Sphäre des Unpersönlichen, die Bedeutung aber dem Gebiet des Heiligen entstammt, hat der Mensch noch eine so starke affektive Bindung an das Bild, daß er es mit der nur dunkel geahnten Bedeutung verwechselt und mit ihm unwillkürlich reale Handlungen, namentlich gottesdienstliche Akte vornimmt, indem er sich etwa dem - mit der Bedeutung identifizierten - Bild unterwirft oder es sich einzuverleiben trachtet. Als paganes Beispiel nennt Vischer den „Stier", der in der ägyptischen Religion „durch den Vergleichspunkt seiner Stärke und Zeugungskraft" als „Symbol der Urkraft" verstanden, dabei „aber mit dieser verwechselt" und infolgedessen kultisch verehrt wird.6 Als christliches Beispiel führt er das komplexe Symbol der Eucharistie an, in der der Gläubige sich das durch Christi Opfertod bewirkte Heil der Sündenvergebung durch Brot und Wein einzuverleiben sucht.7 3 Vgl. F. Th. Vischer, Das Symbol (wie Anm. 1), S. 423; zu Recht bemerkt Vischer, daß Unangemessenheit auch für Hegel ein zentrales Merkmal des Symbol ist. Zu dieser für das Symbol charakteristischen „Unangemessenheit von Idee und Gestalt" siehe die Definition der „symbolischen Kunstform" und den Abschnitt „Symbol überhaupt", in: Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Vorlesungen über die Ästhetik / , Werke in zwanzig Bänden, Bd. 13, Frankfurt/M. 1970, S. 107-109 (hier insb. S. 109) und S. 393-413 (hier insb. S. 396). 4 Vgl. Das Symbol (wie Anm. 1 ), S. 424-427. 5 Vgl. ebenda, S. 427-431. 6 Ebenda; vgl. auch Vischers Kritik meiner Ästhetik (wie Anm. 1), S. 317. 7 Das Symbol (wie Anm. 1), S. 424 f.
Β. Buschendorf:
Zur Begründung der Kulturwissenschaft
229
In der späten oder rationalen Symbolform ist die affektive Bindung des Menschen an das Bild bereits so gering, daß er es vollkommen frei und distanziert betrachten und somit Bild und Bedeutung in hellem Bewußtsein klar und deutlich unterscheiden kann. Markantes Beispiel dieser Form ist für Vischer die Allegorie, in der ein unpersönliches Bild mit einem klar umrissenen Sinn verknüpft ist oder eine Personifikation im Dienste eines Gedankens ersonnen wird.8 Ferner sieht Vischer die rationale Form der Symbolik in dem Verhältnis exemplifiziert, das der gebildete Europäer zu den in Kunst und Literatur tradierten Mythen der Antike und des Christentums hat. Der aufgeklärte, moderne Mensch glaubt an diese mythischen Gestalten nicht mehr. Er begreift sie vielmehr lediglich als Produkte der Einbildungskraft, denen er denn auch keine historische Wahrheit, sondern nur mehr eine „innere", „allgemein menschliche Wahrheit" 9 zuerkennt, indem er etwa Raffaels Sixtinische Madonna als Sinnbild „unaussprechlicher Himmelsfreude" versteht.10 Die mittlere oder ästhetische Form der Symbolik besteht in dem „leihende[n] Akt", in welchem der Mensch - unwillkürlich und dennoch frei - dem Unbeseelten seine „Seele und ihre Stimmungen unterleg[t]", n wobei er die rationale Einsicht in die Inadäquatheit dieses Aktes während desselben außer Kraft setzt oder, wie Vischer sagt, vorbehält. Mit der affektiven Bindung an das Bild ist demjenigen, der einen Gegenstand ästhetisch betrachtet, daher nur im Moment der Beseelung ernst. Wie in der religiösen gibt es also auch in der ästhetischen Form der Symbolik eine affektive Bindung an das Bild. Doch während sie beim religiös Gläubigen noch so stark ist, daß er Bild und Bedeutung nicht zu unterscheiden vermag und infolgedessen auf das affektiv besetzte Bild durch Verrichtung wirklicher namentlich kultischer - Handlungen unmittelbar reagieren muß, ist diese Bindung bei demjenigen, der in ästhetische Betrachtung versunken ist, durch das eigentlich schon vorhandene Wissen um die tatsächliche Unbeseeltheit des Bildes bereits so weit gemildert, daß er Bild und Bedeutung nur mehr im Moment der ästhetischen Betrachtung identifiziert und selbst im Falle äußerster Ergriffenheit nicht in reale Handlungen verfällt, sondern frei und besonnen in rein kontemplativer Haltung zu verharren vermag. In der Sprache zeigt sich, wie Vischer erläutert, die beseelende Leistung der ästhetischen Symbolik besonders sinnfällig in den rhetorischen Figuren wie etwa in der Metapher, und er führt exemplarisch umgangssprachliche Wendungen wie „der Morgen lächelt" oder „der Donner grollt" 12 sowie den Beginn des achten Gesangs aus Hermann und Dorothea an, wo Goethe bildmächtig „die
8 Vgl. ebenda, S. 453. 9 Ebenda, S. 428 f. 10 Ebenda, S. 429. 11 Ebenda, S. 432. 12 Ebenda, S. 433.
230
III Philosophie
der
Verkörperung
ahnungsvolle Beleuchtung" „der sinkenden Sonne" b e s c h w ö r t . 1 3 W i e Vischer erläutert, w e i ß natürlich ein jeder, daß es sich bei solchen v o m Dichter beschriebenen P h ä n o m e n e n an sich u m seelenlose, rein physikalische Ereignisse handelt. D e n n o c h w i r d sich der Leser, w i e Vischer betont, auf solche M e t a p h e r n gerne einlassen u n d sie als gelungene Täuschung gutheißen. D i e bereitwillig, w e n n auch unter V o r b e h a l t vollzogene seelische Handlung der Empathie begreift Vischer als basalen A k t des ästhetischen Bewußtseins u n d bezeichnet sie - im A n s c h l u ß an seinen S o h n R o b e r t - als Einfühlung. 1 4 Bei Vischer ist die polaritätstheoretische K o n z e p t i o n der gesamten Theorie und der zentralen Begriffe z w a r bereits in der triadischen S t r u k t u r angelegt, d o c h tritt sie erst allmählich zutage und w i r d noch nicht ausdrücklich als solche bezeichnet. Die religiöse u n d die rationale S y m b o l i k bilden zunächst einen k o n t r ä r e n Gegensatz, der durch die ästhetische S y m b o l i k vermittelt u n d erst dadurch z u einem polar-konträren Gegensatz w i r d . A l s polar-konträre Begriffe fungieren die religiöse und die rationale S y m b o l i k einerseits als G r e n z b e g r i f f e , denn die ästhetische F o r m der S y m b o l i k ist v o n ihnen scharf geschieden. Andererseits aber sind sie auch M o m e n t e der sie vermittelnden - u n d durch eben diese Vermittlungsleistung allererst definierten - ästhetischen S y m b o l f o r m . A b y W a r b u r g hat Vischers S y m b o l t h e o r i e immer wieder studiert. 1 5 Er teilt mit seinem G e w ä h r s m a n n die anthropologisch-psychologische Orientierung, folgt
13 Ebenda, S. 432; der hexametrische Eingang des achten, „Melpomene. Hermann und Dorothea" betitelten Gesangs lautet: „Also gingen die zwei entgegen der sinkenden Sonne, / Die in Wolken sich tief, gewitterdrohend, verhüllte, / Aus dem Schleier bald hier, bald dort mit glühenden Blicken / Strahlend über das Feld die ahnungsvolle Beleuchtung." [ H e r m a n n und Dorothea, Johann Wolfgang von Goethe, Werke (Hamburger Ausgabe), Bd. 2, München 9 1972, S. 437-514, hier S. 498. 14 Eine differenzierte Explikation des Einfühlungskonzepts gibt Vischer in dem Aufsatz „Das Symbol" (wie Anm. 1), S. 437-452. 15 Von Warburgs intensiver Beschäftigung mit Vischers Symbolkonzept zeugen vor allem die kunstphilosophischen Aphorismen, die er hauptsächlich von 1888 bis 1892 verfaßte, von 1894 bis 1905 ergänzte und 1896 mit dem Titel Grundlegende Bruchstücke zur Psychologie der Kunst versah. Unter beständigem Rückgriff auf Vischer beginnt Warburg diese Sammlung ausdruckskundlicher Reflexionen mit etwa dreißig Aphorismen zum Symbolbegriff, auf die er sich in der Folge immer wieder bezieht. Diese noch immer unpublizierte Aphorismensammlung befindet sich im Londoner Warburg Institute im Warburg-Archiv (III, Nr. 43-45); eine Veröffentlichung ist in Vorbereitung: Aby Warburg, Fragmente zur Ausdruckskunde, hrsg. von Bernhard Buschendorf und Claudia Naber, in: Gesammelte Schriften, hrsg. von. Horst Bredekamp, Michael Diers, Nicholas Mann, Martin Warnke, Berlin (vorausichlich 1999 ff.), 4. Abteilung Bd. IV; zu Warburgs Rückgriff auf Vischers Symbolkonzept siehe: Aby M. Warburg, „Bilder aus dem Gebiet der Pueblo-Indianer in Nord-Amerika", in: ders., Schlangenritual. Ein Reisebericht, Mit einem Nachwort von Ulrich Raulff, Berlin 1988, S. 9-59; ders, Gesammelte Schriften, hrsg. von der Bibliothek Warburg, Bd. I und II, Die Erneuerung der heidnischen Antike. Kulturwissenschaftliche Beiträge zur Geschichte der europäischen Renaissance. Mit einem Anhang unveröffentlichter Zusätze, hrsg. von Gertrud Bing, unter Mitarbeit von Fritz Rougemont, Leipzig, Berlin [Ndr. Nendeln (Liechtenstein) 1979] 1932, S. 5, 58, 158, 328, 534, 565 und 611 ff. An Forschung zu Warburgs Vischer-Bezug siehe:
231
Β. Buschendorf: Zur Begründung der Kulturwissenschaft
Vischers Vorstellung eines Ausgleichs zwischen irrationaler und rationaler Denkform, adaptiert daher auch die Unterscheidung zwischen drei besonderen Symbolformen sowie die Idee einer Ableitung der dritten aus den beiden ersten und übernimmt nicht zuletzt das Konzept der Einfühlung. Doch während es Vischer um eine Definition des Ästhetischen, also um eine Grundlegung der Ästhetik zu tun war, geht es Warburg in seiner Symboltheorie um die Bestimmung des kulturwissenschaftlichen Gegenstands und mittels dieser Bestimmung um die Formulierung eines kulturwissenschaftlichen Forschungsprogramms. Aufgrund dieses völlig anderen Erkenntnisinteresses muß Warburg an Vischers Theorie zwei entscheidende Modifikationen vornehmen. Erstens ersetzt er Vischers vergleichsweise moderaten Gegensatz von religiösem und rationalem Symbol durch den extremen Gegensatz von magisch-verknüpfendem und logisch-sonderndem Symbol und faßt damit den zu definierenden Begriff der Kultur so weit, daß er auf der irrationalen Seite noch die primitivsten Formen des Aberglaubens und auf der rationalen Seite noch die abstraktesten Formen der Wissenschaft enthält. Zweitens präzisiert Warburg den logischen Status des Gegensatzes. Während Vischer den Gegensatz von religiöser und rationaler Symbolik zunächst nur als konträren Gegensatz konzipiert und ihn erst anschließend durch die in der ästhetischen Symbolik erfolgende Vermittlung implizit als polar-konträr faßt, bestimmt Warburg den entsprechenden Gegensatz von magisch-verknüpfender und logisch-sondernder Symbolform von Anfang an ausdrücklich als polar-konträr und definiert damit Kultur als einen zwischen polar-konträren Extremen aufgespannten, verschiedenste Gebiete umfassenden und daher in sich höchst diskontinuierlich strukturierten Bereich. Zur Kultur im weiteren Sinne gehören folglich auch die sie begrenzenden Pole: Magie und Logik. D o c h haben diese extremen Gegensätze jeweils an sich selbst noch Momente ihres Gegenteils. Dem magischen-verknüpfenden Symbol eignet Edgar Wind, „Warburgs Begriff der Kulturwissenschaft und seine Bedeutung für die Ästhetik", in: Vierter Kongreß Ästhetik
für Ästhetik
und allgemeine
druckt in: Bildende lung, Probleme,
und allgemeine
Kunstwissenschaft,
Kunst als Zeichensystem
Kunstwissenschaft,
Beilagenheft zur Zeitschrift
für
25, 1931, S. 163-179, insb. S. 1 7 0 - 1 7 4 [wiederabge1. Ikonographie
und Ikonologie:
Theorien,
Entwick-
hrsg. von Ekkehard Kaemmerling, Köln 1979, S. 1 6 5 - 1 8 4 ; sowie in: Aby M. War-
burg. Ausgewählte
Schriften
und
Würdigungen,
hrsg. von Dieter Wuttke, Baden-Baden
2
1980,
S. 4 0 1 - 4 1 7 ] ; Fritz Saxl, „Die Ausdrucksgebärden der bildenden Kunst", in: Bericht über den X I I . Kongreß der Deutschen Gesellschaft für Psychologie in Hamburg vom 12.-16. April 1931, Jena 1932, S. 1 3 - 2 5 [wiederabgedruckt in: Wuttke (Hrsg.), Aby Warburg, Ernst H . Gombrich, Aby Warburg. Biography,
Eine intellektuelle
Biographie
4 1 9 - 4 2 5 , hier 421]; sowie
[Aby Warburg.
An
Intellectual
London 1971], übers, von Matthias Fienbork, Frankfurt/M. 1981, S. 9 9 - 1 0 2 ; Edgar
Wind, „Concerning Warburg's Theory of Symbols" [Wind-Nachlass (I, 3, vi)]; ders.,"Unfinished Business. Aby Warburg and his W o r k " , The Times Literary
Supplement,
June 25, 1971, S. 735 f.
[wiederabgedruckt und mit kleinen Ergänzungen aus Winds nachgelassenen Papieren versehen in: ders., The Eloquence
of Symbols. Studies in Humanist Art, hrsg. von Jaynie Anderson, mit einem
„Biographical Memoir" von Hugh Lloyd-Jones, Oxford 1983, S. 1 0 6 - 1 1 3 , hierS. 108)].
232
III Philosophie der
Verkörperung
ein Mindestmaß von Form oder Gestalt. Und im logisch-sondernden Symbol findet sich aufgrund der ihm innewohnenden, auf Verständnis zielenden Bedeutung ein wenn auch zumeist verschwindend geringer emotionaler Bezug. Zwischen beiden Extremen aber vermittelt die symbolisch-verknüpfende Symbolform, die die Gegenstände der Kultur im engeren Sinne konstituiert. Zu welchen Wertsphären sie auch immer gehören, ob sie also etwa der Astrologie, der Religion, der Philosophie, der Politik, dem Recht, der bildenden Kunst, der Literatur oder den Wissenschaften entstammen, die Gegenstände der Kultur werden von Warburg grundsätzlich als Ausgleichsprodukte einer symbolisch-verknüpfenden, zwischen Irrationalität und Rationalität vermittelnden Konstitutionsleistung begriffen. Nach Warburgs innerster, tief von humanistischem Geist geprägter Uberzeugung verdankt sich die Kultur des Abendlandes einer beständigen Rezeption des antiken Altertums, die gleichsam in Wellen höchst unterschiedlicher Art und Stärke verläuft und sich vor allem seit der Renaissance in so massiven Schüben fortsetzt, daß in der abendländischen Kultur seither jede Auseinandersetzung mit der Vergangenheit geradezu unausweichlich zu einer Auseinandersetzung mit dem antiken Erbe wird. Das Nachleben der Antike wurde daher für Warburg zum zentralen Problem, das ihn, wie er selbst zu sagen pflegte, lebenslänglich kommandierte. 16 Und indem Warburg mit seiner Symboltheorie den Gesamtbereich der Kultur als polar-konträr aufgespanntes Diskontinuum bestimmte und das kulturelle Einzelobjekt als Ausgleichsprodukt zwischen irrational bindenden und rational distanzierenden Kräften konzipierte, formulierte er das Problem des Nachlebens der Antike als Forschungsprogramm: Er verlieh ihm eine theoretische Basis und unterstellte es zugleich einem dezidiert psycho-historischen Erkenntnisinteresse. Die psychische Operation der Einfühlung, die Vischer als grundlegend für die ästhetische Symbolform ansah und somit ausschließlich für die Erschließung ästhetischer Gegenständen reservierte, betrachtet Warburg als basale Operation der symbolisch-verknüpfenden Symbolform und erachtet sie somit gegenüber allen Gegenständen der Kultur als adäquat. Einfühlung ist daher für Warburg das wichtigste Werkzeug kulturgeschichtlicher Arbeit. 17 Als Organ historischer Forschung kann sich Einfühlung freilich nicht mehr unmittelbar, sondern nur noch höchst 16 Zu Warburgs Forschungsprogramm zum Nachleben der Antike siehe vor allem die folgenden Arbeiten Fritz Saxls: „Rinascimento dell'antichità. Studien zu den Arbeiten A. Warburgs", in: Repertorium für Kunstwissenschaft, 43, 1922, S. 220-272; „Die Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg in H a m b u r g " , in: Forschungs-Institute. Ihre Geschichte, Organisation und Ziele, hrsg. von Ludolph Brauer, Albrecht Mendelssohn Bartholdy und Adolf Meyer, Bd. 2, Hamburg 1930, S. 355-358; „Warburgs Mnemosyne-Atlas" (1930) [alle wiederabgedruckt in: Wuttke (Hrsg.), Ab y M. Warburg (wie Anm.l5), S. 313-315, 331-334 und 347-399], 17 Theoretisch beschäftigte sich Warburg mit dem psychischen Akt der Einfühlung insbesondere in seiner Frühzeit; siehe hierzu die seiner Dissertation beigefügten „Vier Thesen" in: Gesammelte Schriften (wie Anm. 15), S. 58; vgl. auch Warburgs Grundlegende Bruchstücke (wie Anm. 15), S. 28, 29,51,174.
Β. Buschendorf: Zur Begründung der Kulturwissenschaft
233
mittelbar, nämlich auf dem Wege einer äußerst umständlichen, begrifflich geleiteten Erschließung ihrer Gegenstände vollziehen. Geleitet von seinem stark psychohistorischen Erkenntnisinteresse, machte Warburg von diesem Mittel denn auch intensiven Gebrauch. Durch Einfühlung versuchte er, in den kulturellen Manifestationen, die er erforschte, die seelischen Lagen der an ihrer Hervorbringung direkt oder indirekt Beteiligten zu erschließen, also gewissermaßen ihren seelischen Ort im weiten Spektrum zwischen rationaler Selbstbehauptung und triebhafter Selbstaufgabe auszumachen. Als Kunsthistoriker interessierte sich Warburg freilich nicht für alle Wertsphären in gleichem Maße, sondern konzentrierte sich in seiner kulturgeschichtlichen Arbeit vor allem auf die Welt der Bilder. In seinen frühen kunstphilosophischen Reflexionen ging es Warburg um eine ausdrucksästhetische Begründung des Bildbegriffs, bei der er sich stark an der Polaritätstheorie des Symbols orientierte. 18 Die wichtigsten Momente seines Begründungsansatzes suchte er schon im Titel hervorzuheben 19 , den er bezeichnenderweise denn auch mehrfach revidierte. Mit dem ursprünglich gewählten Titel Grundlegende Bruchstücke zu einer monistischen Kunstpsychologie unterstreicht Warburg die grundlagentheoretische Absicht seiner Kunstphilosophie und betont zugleich seine Uberzeugung von der Notwendigkeit ihrer Fundierung in einem einzigen, psychologischen Prinzip. Daß Warburg dabei immer schon das Ausdrucksprinzip, also eine ausdrucksästhetische Begründung des Bildbegriffs im Sinn hatte, verdeutlicht er durch eine spätere Version des Titels: Grundlegende Bruchstücke zu einer pragmatischen Ausdruckskunde. Durch den expliziten Hinweis auf den pragmatischen Charakter seines Ansatztes gibt er außerdem zu erkennen, daß er die Begründung des bildkünstlerischen Gegenstands handlungstheoretisch auszurichten und somit grundsätzlich auch der sozialen Dimension von Kunst Rechnung zu tragen gedenkt. 20 Mit dem seinen Reflexionen vorangestellten Motto „Du lebst und tust mir nichts" 21 betont Warburg, daß er das Bild - seiner ontologischen Struktur nach als Vermittlungs- oder Ausgleichsprodukt zweier basaler, gegensätzlich gerichteter Strebungen begreift. Die eine dieser antagonistischen Kräfte ist der formende oder vergegenständlichende Distanzierungswille, der gegenüber dem künstlerischen Objekt bereits dann zur Geltung kommt, wenn dessen bloß fiktiver und somit illu18 Grundlegende Bruchstücke (wie Anm. 15), I. Buch 1888-1892, insb. S. 1 - 1 2 ; zu Warburgs „Begriff des Bildes" siehe den gleichnamigen Abschnitt in Winds Aufsatz „Warburgs Begriff der Kulturwissenschaft und seine Bedeutung für die Ästhetik" (wie Anm. 15), S. 163-170. 19 Vgl. Warburgs Notizen auf dem Buchdeckel zum ersten Buch seiner Grundlegenden Bruchstücke (wie Anm. 15). 20 Vgl. ebenda; in anderen dort in Erwägung gezogenen Titeln begnügte sich Warburg damit, seine psychologische Ausrichtung und seine grundlagentheoretische Absicht zu betonen: Grundlegende Bruchstücke zu einer psychologischen Kunstphilosophie oder Grundlegende Bruchstücke zur Psychologie der Kunst. 21 Grundlegende Bruchstücke (wie Anm. 15), S. 13.
234
III Philosophie
der
Verkörperung
sionärer Charakter bewußt wird. Die Gegenkraft ist der Drang nach möglichst intensiver Vergegenwärtigung von Ausdruck und Leben. Warburg expliziert diese Doppelstruktur oder Widerspruchsspannung sowohl in produktions- als auch in rezeptionästhetischer Hinsicht. Produktionsästhetisch erklärt er: „Ein Kunstwerk, das einen dem menschlichen Leben entnommenen Gegenstand oder Vorgang, wie er erscheint, darzustellen versucht, ist immer ein Compromißproduct zwischen der Unfähigkeit des Künstlers, dem künstlerischen Gebilde wirkliche Lebendigkeit zu verleihen einerseits und dessen Fähigkeit andererseits die (Oberfläche der) Natur getreu nachzuahmen."22 Und in rezeptionsästhetischer Hinsicht konstatiert er: „Dieselbe Zweiheit herrscht in den Ansprüchen, die der Zuschauer an ein derartiges Kunstwerk stellt: Einerseits der Wunsch, die Nichtlebendigkeit des Kunstwerks als stillschweigende Voraussetzung fühlbar gemacht zu bekommen, andererseits der Wunsch, den völligen Schein des Lebens zu empfinden."23 Kurzum, Warburg verfährt polaritätstheoretisch, denn er begreift das Bild als Produkt eines psychischen Ausgleichs zwischen Ausdruck und Form. Wie aber läßt sich die spezifische Art und Weise, die besondere Gestalt dieses Ausgleichs im konkreten Einzelfall genau bestimmen? Für Warburg war dies ein Problem, das er in erster Linie rezeptions- oder traditionsgeschichtlich zu lösen suchte. Zum einen legte er dar, daß aus dem riesigen Schatz der in der Antike geprägten und der Nachwelt überlieferten Ausdrucksformen seit der Renaissance vornehmlich die Superlative der Gebärdensprache - wie etwa die Gebärden gieriger Verfolgung, brutaler Unterwerfung oder hemmungsloser Klage - ausgewählt, also gerade diejenigen Ausdrucksformen bevorzugt wurden, die als Verkörperungen von Leidenschaft oder Leid einen durchaus pathetischen Charakter haben und somit für die Darstellung des innerlich oder äußerlich bewegten, mimisch gesteigerten Lebens besonders geeignet sind. Zum anderen aber konnte Warburg zeigen, daß Form und Ausdrucksgehalt dieser Pathosformeln im Laufe des Uberlieferungsgeschehens immer wieder - und zudem häufig in höchst charakteristischer Weise - den besonderen Bedürfnissen ihrer jeweiligen Rezipienten angepaßt, also einer beständigen Transformation unterworfen wurden, die bis zu drastischer Umgestaltung der ursprünglichen Form oder zu völliger Inversion des ursprünglichen Ausdrucksgehalts führen konnte. Daß Warburg das Nachleben der Antike nach Maßgabe seines psychologisch ausgerichteten, polaritätstheoretisch präzisierten Symbolkonzepts erforschte, liegt in fast allen seinen Arbeiten klar und deutlich zu Tage. So untersuchte Warburg zum Beipiel bereits in seiner Dissertation Sandro Botticellis „Geburt der Venus" und „Frühling" die für die Renaissance charakteristische Anverwandlung antiker Ausdrucksmittel, denn er zeigte in dieser Schrift, daß „die Künstler des Quattro-
22 Ebenda. 23 Ebenda.
Β. Buschendorf:
Zur Begründung
der Kulturwissenschaft
235
cento [...] sich an antike Vorbilder anlehnten, wenn es sich um Darstellung äußerlich bewegten Beiwerks - der Gewandung und der Haare - handelte".24 Seinem Selbstverständnis zufolge erforschte er damit exemplarisch „den ästhetischen Akt der ,Einfühlung' in seinem Werden als stilbildende Macht".25 Typisch für diese ausdrucksästhetische Orientierung ist auch der Aufsatz „Dürer und die Antike". Warburg tut darin nämlich dar, daß der Nürnberger Künstler „die echt antiken Formeln gesteigerten körperlichen oder seelischen Ausdrucks", die in der zweiten Hälfte 15. Jahrhunderts in Oberitalien „in den Renaissancestil bewegter Lebensschilderung" eingegliedert worden waren, zunächst enthusiastisch übernahm, alsbald an „jenem barocken antikischen Bewegungsmanierismus [jedoch] keinen Gefallen mehr" fand.26 Bezeichnend für das psycho-historische Interesse Warburgs ist ferner seine Abhandlung „Francesco Sassettis letztwillige Verfügung", sucht er in dieser Arbeit doch darzulegen, daß die Frührenaissance die antiken Pathosformeln, von deren ausdruckssteigernder Kraft sie so ungeheuer fasziniert war, zunächst nur in der äußerst distanzierten Form der Grisaille vergegenwärtigte.27 Die Polaritätstheorie des Symbols leitete Warburg nicht zuletzt auch in seiner Abhandlung über „Heidnisch-antike Weissagung in Wort und Bild zu Luthers Zeiten", in der er die divergenten Rezeptionsformen antiker Astrologie bei Anhängern und Gegnern der Reformation, bei Humanisten sowie bei Philosophen und Künstlern der Renaissance untersuchte. Mit dieser Studie wollte Warburg erklärtermaßen dazu beitragen, die „tragische Geschichte der Denkfreiheit des modernen Europäers" zu erforschen, und ganz im Sinne seiner auf Interdisziplinarität zielenden Symboltheorie zugleich zeigen, wie sich „die kulturwissenschaftliche Methode" „durch Verknüpfung von Kunstgeschichte und Religionswissenschaft [...] verbessern" läßt.28 Wie Warburg zusammenfassend feststellt, vollzieht sich in der frühen Neuzeit ,,[d]ie Wiederbelebung der dämonischen Antike [...] durch eine Art polarer Funktion des einfühlenden Bildgedächtnisses. Wir sind im Zeitalter des Faust, wo sich der moderne Wissenschaftler - zwischen magischer Praktik und kosmologischer Mathematik - den Denkraum der Besonnenheit zwischen sich und dem Objekt zu erringen versuchte. Athen will eben immer wieder neu aus Alexandrien zurückerobert sein." 29 24 25 26
Gesammelte Schriften (wie A n m . 15), S. 1 - 6 0 und S. 3 0 7 - 3 2 8 , hier S. 5. Ebenda. Gesammelte Schriften (wie A n m . 15), S. 4 4 3 - 4 4 9 und 6 2 3 - 6 2 5 , hier S. 4 4 7 f . Warburgs einfühlungstheoretische Orientierung w i r d hier in seiner Deutung der zeitgenössischen Rezeption des antiken O r p h e u s m y t h o s auch terminologisch deutlich, denn er erklärt, „daß der Tod des Orpheus [...] ein wirklich im Geiste und nach den W o r t e n der heidnischen V o r z e i t leidenschaftlich und verständnisvoll nachgefühltes Erlebnis aus dem dunklen Mysterienspiel der Dionysischen Sage war." (ebenda, S. 446).
27
Gesammelte
Schriften
(wie A n m . 15), S. 1 2 7 - 1 5 8 und 3 5 3 - 3 6 5 , hier S. 157.
28 Ebenda, S. 535. 29 Gesammelte Schriften
(wie A n m . 15), S. 4 8 7 - 5 5 8 und 6 4 7 - 6 5 6 , hier S. 534.
236
III Philosophie
der
Verkörperung
Wind führte mit Warburg in dessen letzten beiden Lebensjahren intensive theoretische Gespräche, die immer wieder um Warburgs Symbolkonzept kreisten.30 Das Resultat dieser Gespräche faßte er nach Warburgs Tod in einem grundlegenden Aufsatz zusammen.31 Als Warburgs unmittelbarer Schüler und als theoretischer Kopf der Bibliothek Warburg versuchte er in den späten zwanziger und frühen dreißiger Jahren, Warburgs Symboltheorie zu präzisieren und weiterzuentwickeln. Die Ergebnisse seiner Überlegungen publizierte er freilich nur in knapper, stark programmatischer und daher notwendig verkürzter Form, nämlich in dem nur drei Seiten umfassenden Abschnitt „Das Symbol als Gegenstand kulturwissenschaftlicher Forschung" seiner „Einleitung" in die Kulturwissenschaftliche Bibliographie zum Nachleben der Antike?2 Daß er es dabei bewenden ließ, ist zum einen den Wirren der Emigration, zum anderen aber wohl auch der notwendigen Umorientierung geschuldet, die die Bibliothek Warburg nach der Emigration vornehmen mußte: Um sich in den angelsächsischen Kontext besser integrieren und mit der angelsächsischen Forschung kooperieren zu können, mußte das Warburg Institute seine grundsätzliche Kompatibilität mit deren Traditionen und Grundorientierungen herausstellen und daher eher seine positivistischen Stärken als seinen symboltheoretischen Grundansatz akzentuieren. Diese Akzentverschiebung zeigt sich auch in dem „Symbols in History" betitelten Abschnitt der englischen Fassung von Winds „Einleitung", wo er die Insistenz auf der grundlagentheoretischen Fundiertheit des Symbolbegriffs gegenüber der deutschen Fassung erheblich abschwächt.33 30 Nachdem Wind Warburg im Sommer 1927 bei einem Besuch in Hamburg kennenlernte, kehrte er Ende 1927 aus den Vereinigten Staaten, w o er seit 1924 gelebt und zuletzt als Philosophiedozent an der Universität von North Carolina (1925-1927) gelehrt hatte, nach Hamburg zurück, um 1928 wissenschaftlicher Assistent an der Bibliothek Warburg zu werden. Zu Winds intensivem Gedankenaustausch mit Warburg siehe: Bernhard Buschendorf, „War ein sehr tüchtiges gegenseitiges Fördern: Edgar Wind und A b y Warburg", in: Idea (Jahrbuch der Hamburger Kunsthalle), IV, 1985, S. 165-209, hier insb. S. 176-193 und S. 204-209, sowie ders., „Auf dem Weg nach England - Edgar Wind und die Emigration der Bibliothek Warburg", in: Porträt aus Büchern. Bibliothek Warburg & Warburg Institute Hamburg - 1933 - London, hrsg. von Michael Diers, Hamburg 1993, S. 85 bis 128, hier S. 89-91 und S. 120-121. Warburgs Begriff (wie Anm. 15); zu diesem Aufsatz erklärte Wind später: „In my paper of 1931, which was designed as an introduction to the Warburg Library in Hamburg, and delivered as a lecture to the Congress of Aesthetics that happened to meet in that library, I tried to put Warburg's basic ideas into a systematic order which I had learned from him in long coversations." [„Concerning Warburg's Theory of Symbols" (wie Anm. 15) S. 2]. 32 „Einleitung" in: Kulturwissenschaftliche Bibliographie zum Nachleben der Antike. Erster Band: Die Erscheinungen des Jahres 1931. In Gemeinschaft mit Fachgenossen bearbeitet von Hans Meier, Richard Newald und Edgar Wind, hrsg. von der Bibliothek Warburg, Leipzig und Berlin 1934, S. V - X V I I , hier S. VIII-XI [wiederabgedruckt in: Kosmopolis der Wissenschaft. E. R. Curtius und das Warburg Institute. Briefe 1928 bis 1953 und andere Dokumente, hrsg. von Dieter Wuttke, Baden-Baden 1989, S. 281-293, hier S. 284-287], 33 „Introduction", in: Bibliography on the Survival of the Classics, hrsg. vom Warburg Institute, London 1934, S. V-XII, hier S. VI-VIII. 31
Β. Buschendorf:
Zur Begründung
der Kulturwissenschaft
237
Die folgende Rekonstruktion von Winds Symbolkonzept stützt sich daher vor allem auf die äußerst fragmentarischen Notizen zu seiner letzten, im Wintersemester 1932/33 an der Universität Hamburg gehaltenen Vorlesung über „Grundbegriffe der Geschichte und Kulturphilosophie", in der er den Symbolbegriff ins Zentrum stellte.34 Wind hat Warburgs Symboltheorie in wesentlichen Stücken übernommen. Auch ihm geht es um die Bestimmung des kulturwissenschaftlichen Gegenstands und damit um die theoretische Fundierung des Forschungsprogramms zum Nachleben der Antike, dem er in der Nachfolge Warburgs zeitlebens verpflichtet blieb. Ferner teilt er Warburgs stark kulturanthropologisch-psychologische Grundorientierung. Vor allem aber übernimmt er die polar-konträre Konzeption und den generellen Aufbau der Symboltheorie, denn ähnlich wie Warburg und Vischer definiert er den Symbolbegriff zunächst allgemein, unterzieht ihn sodann einer zugleich systematisch und entwicklungsgeschichtlich begründeten Dreiteilung, gewinnt dadurch drei besondere Symbolbegriffe und expliziert den mittleren dieser Begriffe als den entscheidenden. Gleichzeitig modifiziert und präzisiert er freilich auch die zentralen Begriffe der Theorie, klärt ihren systematischen Zusammenhang und verdeutlicht ihre methodologischen Konsequenzen. Unter dem allgemeinen Begriff des Symbols versteht Wind jede Form des Verhaltens, in der eine seelische Kraft nicht in der Innerlichkeit oder bei sich selbst verharrt, sondern sich ausdrückt, indem sie sich an ein sinnlich faßbares Zeichen heftet. In diesem sinnlich manifestierten Ausdruck ist sie zwar nicht mehr sie selbst, sondern hat sich entäußert. Doch hat sie in dieser Entäußerung auch Form und Gestalt angenommen. Diese Gestalt appelliert ihrerseits wiederum an eine seelische Kraft, auf die sie zurückweist und durch die sie wieder verinnerlicht werden muß, um Leben und Bedeutung zu gewinnen. Wind definiert also das Symbol allgemein als polar-konträren Gegensatz von „absoluter Verinnerlichung" und „absoluter Entäußerung"35 und bestimmt damit den Begriff der Kultur als einen zwischen polar-konträren Extremen aufgespannten, in sich diskontinuierlich strukturierten Bereich: Gerade das Symbol, das Spezifikum aller Kulturleistung, - sei es nun religiöses oder staatliches, wissenschaftliches oder künstlerisches Symbol, — lebt von der Schwingung zwischen diesen beiden Polen. Es ist Ausdruck einer seelischen Kraft, und sofern es nicht mehr diese Kraft selbst ist, sondern deren Relikt, ist es ihr „entäußert". Aber gerade in dieser Entäußerung bleibt es Signal, Aufforderung für eine seelische Kraft, auf die es zurückweist und durch die es wieder lebendig und bedeutsam, kurz: - „verinnerlicht" werden
34 Grundbegriffe der Geschichte und Kulturphilosophie 35 Einleitung (wie Anm. 32), S. VIII.
[Wind-Nachlaß (1,2, ii)].
238
III Philosophie der
Verkörperung
muß. In diesem Auseinandersetzungsprozeß sind verschiedene Grade der „Verinnerlichung" und „Entäußerung" zu unterscheiden, und je nach ihrer Entfernung von dem seelischen Kraftzentrum nehmen die einzelnen Symbole verschiedene „seelische Orte" in der Umwelt des individuellen oder sozialen Organismus ein: Bald wirken sie wie ein magischer Zwang, auf den man handelnd reagieren muß, bald wie ein neutrales Begriffsgebilde, das zu analysierender Betrachtung anlockt. Nie aber darf die Spannung zwischen diesen beiden Polen in eine radikale Antithese verwandelt werden. Denn selbst das abstrakt gewordene Zeichen, das den höchsten Grad der Entäußerung darstellt, behält, sofern es überhaupt eine seelische Bedeutung hat und „verstanden" werden kann, eine wenn auch noch so gelockerte Beziehung zur Ausdrucksgestaltung bei. Und ebenso enthält auch der intensivste und daher am stärksten verinnerlichte Ausdruck, sofern er eben Ausdruck ist und „verstanden" werden kann, ein Minimum der Bezeichnung und damit der Entäußerung. 36 Indem er Ausdruck und Entäußerung gleichsetzt, nimmt Wind an der Symboltheorie Vischers und Warburgs eine entscheidende Modifikation vor, denn er faßt damit den Ausdrucksbegriff viel weiter als seine beiden Gewährsleute. Wie eingangs gezeigt, verstand Vischer unter Ausdruck einen beseelenden oder einfühlenden Akt des Ausgleichs zwischen rationaler und irrationaler Orientierung und betrachtete ihn ausschließlich als ästhetisches Prinzip. Warburg hingegen übertrug den Begriff auf alle Gegenstände der Kultur, sah sie also allesamt einem solchen Ausgleichsakt entspringen und ging daher davon aus, daß sie nur durch einen entsprechenden Akt der Einfühlung wieder verständlich gemacht werden können. Wind hält zwar am Gedanken der Umkehrbarkeit von Produktion und Rekonstruktion fest, doch versteht er unter Ausdruck die sinnliche Manifestation einer jeglichen inneren Kraft, auch wenn diese Kraft kaum noch Affekt- oder Gefühlsmomente enthalten sollte. Ausdruck ist für Wind somit jede Form, in der eine solche innere Energie in einer μετάβασις εις αλλο γένος nach außen tritt, sich entäußert und verkörpert. Diese inhaltliche Extensivierung des Ausdrucksbegriffs hat zur Folge, daß Wind in seinen kulturgeschichtlichen Forschungen von der dominant psycho-historischen Ausrichtung Warburgs abweicht und sich stärker ideengeschichtlich orientiert. 37 36 Ebenda, S. VHIf. 37 Winds allgemeine Fassung des Ausdrucksbegriffs als Entäußerung oder Verkörperung jedweder Art ist außerdem von eminenter methodologischer Bedeutung, denn er bezeugt damit, daß er in viel stärkerem Maße als Warburg an Fragen der empirischen Validierung interessiert ist. Die Uberzeugung, daß Verkörperung ein konstitutiver Bestandteil des Symbols sei, entspricht dem Grundsatz, daß Symbole einen Anspruch auf Geltung nur dann erheben können, wenn sie sich verkörpern und an der Realität erproben lassen. Diese Überzeugung entwickelte Wind während seines Amerika-Aufenthalts in Auseinandersetzung mit dem Pragmatismus oder kritischen Realis-
Β. Buschendorf:
Zur Begründung
der Kulturwissenschaft
239
Ebenso wie seine Vorgänger unterscheidet Wind, wie gesagt, drei besondere entwicklungsgeschichtliche Stufen oder symbolische Verhaltensweisen: eine frühe, magisch-rituelle Stufe, auf der das Verhalten des Menschen absoluter Verinnerlichung noch sehr nahe kommt, eine späte, rein begriffliche oder allegorische Stufe, auf der das Verhalten bis zur absoluten Entäußerung gelangt, und eine zeitlich und systematisch mittlere, im engeren Sinne symbolische Stufe oder Verhaltensweise, die die eigentlich kulturelle und somit die kulturwissenschaftlich im Grunde erst wirklich relevante ist. Wie Wind im Skript zu seiner Vorlesung über „Grundbegriffe der Geschichte und Kulturphilosophie" notiert, liegt „[das] [k]ulturphilosophische Problem [also] beim Übergang von [der] rituelle[n] zu[r] allegorische[n] Auffassung, [denn] von da [an ist] eigentlich erst von ,Symbol' zu sprechen!"38 Bei der Explikation der verschiedenen symbolischen Verhaltensweisen bedient sich Wind allerdings einer viel präziseren psychologischen Terminologie als Vischer und Warburg. Auf der frühen, magisch-rituellen Stufe, zu deren Erörterung Wind Beobachtungen aus der Psychologie der Tiere, des Kindes und der sogenannten Primitiven heranzieht, ist der Mensch in seinem Verhalten noch weitgehend affektbestimmt. Da er sich beständig in intensiver Erregung befindet, vermag er alles, was ihm begegnet, nur diffus, gewissermaßen nur als Reiz wahrzunehmen, auf den er besinnungslos, unmittelbar und geradezu zwanghaft reagieren muß. Nur zuweilen gelingt es ihm, die Erregungsintensität zu mildern, seine Reaktionen zu retardieren, vom bloßen Affekt gelöste Vorstellungen zu entwickeln und sie ein Stück weit zu differenzieren. Doch wird die Lage für ihn immer wieder sehr schnell prekär, denn die Diskrepanz zwischen Affekt und Vorstellung und ihre ansatzweise Differenzierung führen unweigerlich zu spannungsvoller Mehrdeutigkeit und lassen weitere Einbrüche des Neuen gewärtigen. Der sogenannte Primitive minimalisiert daher die Pausen der Besinnung, reduziert die entstandene Mehrdeutigkeit und Spannung und sucht sein Heil wieder im Sicherheit gewährenden Affekt, indem er die Symbole im Sinne des Affekts zu bloßen Signalen, also zu möglichst eindeutigen Handlungsvorschriften macht und ihnen gemäß in kultisch-ritueller Weise agiert. Oder wie es in Winds Notizen heißt: Sonderung der Sinnesgebiete aber erst auf höherer Stufe möglich. Kind handelt und empfindet aus Affekt. Aktionen bilden Einheit. Bewußtsein trennt erst.39 mus. Er legte sie seiner Habilitationsschrift Das Experiment und die Metaphysik. Zur Auflösung der kosmologischen Antinomien [Tübingen 1934] zugrunde und brachte sie später auf die Formel, „daß Symbole real nur insofern sind, als sie sich in einem experimentum crucis verkörpern lassen, dessen Ausgang direkt zu beobachten ist." [„Microcosm and M e m o r y " , The Times Literary Supplement, May, 30, 1958, S. 297]; siehe hierzu: Buschendorf, War ein sehr tüchtiges gegenseitiges Fördern (wie A n m . 30), S. 1 7 2 - 1 7 6 und S. 2 0 2 f. 38 Grundhegriffe 3 9 Ebenda, S. 9.
der Geschichte
und Kulturphilosophie
(wie A n m . 34), S. 13.
240
III Philosophie
der
Verkörperung
Satz: verbranntes Kind scheut Feuer: falsch! [...] Kind lernt erst, daß es gewisse Dinge gibt, die nicht brennen, nicht Schmerz verursachen, nicht um gekehrt; allmähliche Neutralisierung, Zähmung = Prozeß des Lernens (an Tieren experimentiert). - Triebleben differenziert noch durch Zeitpausen zwischen Affekt und Vorstellung. „Spannung" gibt es für den primitiven Menschen nicht.40 Zusammenhang mit der Erregungsseite! Zusammenhang mit magischem Verhalten. Signale, die der Primitive ,Omina' nennt. Sie beherrschen seine Verhaltungsweise. Man handelt unmittelbar, ohne sich über Entstehung klar zu werden. Form des Risikos (in der Handlung) sucht der Primitive auszuschalten. Der Primitive kennt schon die Pause der Besinnung, da er fürchtet, daß etwas entstehen könne (Zukunft!). Er sucht die Pause zu minimalisieren. Bestimmte Handlungsvorschriften. Symbol hat sofort und fast nur Signalcharakter. Da auch die Mehrdeutigkeit des Symbols im Sinne des Affekts minimalisiert.41 Die Symbole der magisch-rituellen Stufe entstehen also aus dem Affekt und können ihre handlungsorientierende Funktion nur erfüllen, wenn sie in starkem Maße an ihn gebunden bleiben. Sie lassen sich - ebenso wie später auch die im engeren Sinne kulturellen Symbole - vollgültig nur unter Berücksichtigung dieser ihrer Genese verstehen. Wer sie allerdings in dieser einzig angemessenen Form verstehen will, muß psychisch in der Lage sein, ihre spannungsvolle Mehrdeutigkeit, die aus der Diskrepanz zwischen Affekt- und Gegenstandsseite und ihrer fortschreitenden Differenzierung resultiert, wenn nicht dauerhaft, so doch zumindest längerfristig auszuhalten und zu ertragen. Genau das aber vermag der Primitive nicht. Er muß daher den Versuch, die von ihm geschaffenen Symbole wirklich verstehen zu wollen, nachgerade zu vermeiden trachten, wenn anders er der stabilisierenden Funktion nicht verlustig gehen will, die die Symbole - dank seiner affektiven Bindung an sie - als bloße Signale für ihn haben. Auf der späten, rein begrifflichen Stufe ist das Verhalten des Menschen dagegen nicht nur nicht mehr affektbestimmt, sondern völlig frei von jeder affektiven Färbung. Er steht der Welt nunmehr gänzlich neutral und distanziert gegenüber und sucht sie rational zu durchdringen. Die klar umrissenen Konzepte, die er dazu benötigt, gewinnt er dadurch, daß er die begriffliche Bedeutung des Symbols an ein lebloses und deswegen eindeutig bestimmbares Zeichen heftet. Oder anders gesagt, um die Gegenstände begrifflich erfassen und kontrollieren zu können, muß er sie isolieren, also aus ihrer Umgebung herauslösen, was in letzter Konsequenz ein
40 Ebenda, S . l l . 41 Ebenda, S. 16 f.
Β. Buschendorf: Zur Begründung der Kulturwissenschaft
241
völliges Absehen von ihrer Affektseite, eine radikale Tilgung der aus der Spannung zwischen Affekt- und Gegenstandsseite resultierenden Mehrdeutigkeit, also im Grunde eine Zerstörung ihres Symbolcharakters impliziert. Wie Wind hervorhebt, ist die Korrelation von emotionaler Indifferenz und begrifflicher Eindeutigkeit charakteristisch für das Verfahren der Naturwissenschaften und findet sich am markantesten in der Mathematik ausgeprägt: Genau wie in der Psychologie: zunächst keine Sonderung, das Gleiche: in der Wissenschaft (ζ. B. astrologische Wissenschaft ursprünglich direkt auf den Menschen bezogen (magisch-astrologisch), heute ohne besonders nahes Interesse // Frage nach Distanzierung, Isolierung. Hier das Problem: diese Symbolik (Sternbilder ζ. B.) hat Mehrdeutigkeit, Vibration. In der Methode der Distanz entwickelt sich das, was man in der Wissenschaft Isolierung nennt. Dadurch Symbolcharakter zerstört: es wird nur mit Zeichen gerechnet. Naturwissenschaft hat also ihr Wesentliches darin, daß sie Gegenstände sondert, Affektbetonung der Symbole auflöst und mit Zeichen rechnet. // Eindeutigkeit der Termini nur durch Sonderung gewonnen: in der Physik: das Phänomen wird „kontrolliert". Postulat der Isolierbarkeit an die Stelle des Postulats der Exaktheit gesetzt. // [...] Mit der Isolation des Gegenstandes aus der Umgebung zugleich Isolation des Betrachters. Das führt zur Ersetzbarkeit des Betrachters und des Phänomens. 42 Für den rationalisierenden Menschen gleichgültig, wie ich eine Gebärde ausführe, wenn ich mir nur die Bedeutung klarmache. (Letzte Konsequenz in der Mathematik, χ und y vertauschbar.) Ideal der Übersetzbarkeit von einem System ins andere. Die Signalreihen der Mathematik ( + . . . - ) haben keinen emotionalen Charakter. Selbst Bedeutungselemente geworden. 43 Während im magisch-rituellen Verhalten der Versuch, die Symbole unter dem Zwang des Affekts zu bloßen Signalen zu machen, nie restlos gelingt, so daß Eindeutigkeit immer nur erstrebt, doch nie ganz erreicht werden kann, entspringt Eindeutigkeit im rein begrifflichen Verhalten der völligen affektiven Indifferenz und gelingt vollständig. Psychologisch gesehen, ist allerdings der „Mathematiker im Gegensinn ebenso extrem wie der Magiker": 4 4 Beiden geht es um Vereindeutigung von Mehrdeutigkeit, also um Tilgung der polaren Spannung zwischen Affekt- und Gegenstandsseite und um Eliminierung des durch diese Spannung bedingten Deutungsspielraums, beide suchen die „Pause der Besinnung fast aus[zu]schalte[n]"
42 Ebenda, S. 30. 43 Ebenda, S. 16. 44 Ebenda.
242
III Philosophie der
Verkörperung
und beide heben die Anverwandelbarkeit oder „relative Ubertragbarkeit" von Symbolen und somit die Möglichkeit auf, „[das] Symbol durch das Medium der Erinnerung [zu] sehen". „[Der] Akt der Erinnerung fehlt beim Mathematiker und Magiker." 45 Der Eintritt in die entwicklungsgeschichtlich und systematisch mittlere Phase ist der Eintritt in die Kultur im engeren und eigentlichen Sinne. Einerseits bedeutet er Verzicht auf die im magisch-rituellen Verhalten garantierte Sicherheit und zugleich Befreiung vom Zwang elementarer Bindung, läßt sich der Mensch doch nun nicht mehr in erster Linie, geschweige denn ausschließlich, durch den Affekt bestimmen. Andererseits vollzieht sich diese Befreiung jedoch keineswegs - wie dies erst auf der späten, rein begrifflichen Stufe der Fall ist - in Form einer absoluten Entäußerung oder radikalen Tilgung des Affekts, denn zwar unterliegt der Affekt in der Kultur einer ständigen Transformation und Sublimierung, doch wird er in diesem Verwandlungs- und Verfeinerungsprozeß nie völlig aufgezehrt, sondern bleibt gewissermaßen als tragender Grund und Nährboden, aus dem sich die immer differenzierteren Formen des Geistes entwickeln, grundsätzlich erhalten. Der zivilisierte Mensch vollzieht in seinem symbolischen Verhalten ständig und stets auf neue Weise - einen Ausgleich zwischen dem affektiven und dem rationalen Pol des Symbols. Zu dieser wahrhaft kulturstiftende Vermittlungsleistung ist er allerdings nur in der Lage, weil er zuvor in einem langen und schmerzlichen Lernprozeß insbesondere die folgenden geistig-psychischen Fähigkeiten erworben hat: Er vermag in seinem symbolischen Verhalten die Vorstellung vom Affekt nunmehr nicht nur prinzipiell zu lösen, sondern die Unterscheidung zwischen beiden auch auf Dauer zu stellen. Er kann die polar-konträre Diskrepanz zwischen Affekt und Vorstellung und die sich daraus ergebende Mehrdeutigkeit permanent steigern, indem er sie in höchst verschiedene Sphären oder Ordnungen mit immer komplexeren Gebilden ausdifferenziert und damit das Diskontinuum Kultur hervorbringt. Er vermag an all ihren Ordnungen gleichzeitig zu partizipieren, sich von ihnen formen zu lassen und sie ihrerseits - im begrenzten Rahmen seiner jeweiligen Möglichkeiten - auch wiederum zu verändern. Vor allem ist er nämlich imstande, die vielfältigen Spannungen zwischen den diversen Ordnungen, die allesamt - wenn auch jeweils auf unterschiedliche Weise - zwischen Affektund Gegenstandsseite vermitteln, dauerhaft auszuhalten und zu ertragen. Freilich kann der zivilisierte Mensch diese Fähigkeiten nie als endgültig gesicherten Besitz betrachten. Vielmehr muß er sie immer wieder erproben und sich dabei stets aufs Neue bewähren, denn nur so vermag er der grundsätzlich nie völlig gebannten Gefahr eines krankhaften Rückfalls in elementare Bindung zu entgehen. Oder wie Wind notiert:
45
Ebenda.
Β. Buschendorf:
Zur Begründung
der Kulturwissenschaft
243
Kultur ist Spannung zwischen den gesonderten Ordnungen (Religion, Kunst etc.)· Wesentliches Element der Entwicklung: Durchbruch durch den primitiven Zustand. Neurose: Kulturkrankheit, Unvermögen zur Freiheit durch Spannung, Neurose - Zustand elementarer Bindung beibehalten. Loslösung der Vorstellung bedeutet Freiheit, Spannung. Abbau der Spannung durch Hypnose. Rausch (Baudelaire): Zurückführung auf primitiven Zustand: Affekt - nicht Vorstellungszustand. // 1) Krankheit durch Unvermögen zum Durchbruch. III) Spannungslosigkeit in großen Erregungen. II Darauf beruhend Symboltheorie. 46 Der ursprüngliche, dem Symbol im Moment seiner Entstehung verliehene Sinn geht mit zunehmender Loslösung der Vorstellung, mit wachsender Diskrepanz zwischen Affekt und Vorstellung, mit der daraus resultierenden Mehrdeutigkeit und den immer größer werdenden Auslegungsspielräumen stets in gewissen Maße unweigerlich verloren. Doch kann er, wie Wind darlegt, durch Auseinandersetzung prinzipiell wieder ermittelt, restituiert und zurückgewonnen, kurzum: - erinnert werden: Für Entstehung von Symbolen - Erregung im handelnden Sinne nötig. Ablösungsfunktion des Symbols: (spät. Entwicklung des Symbols ) - Gegensatz: unvermittelt in Erregung Schaffendes (Bild) und Betrachtendes (Zeichen). // [...] Mit Loslösung eigentlicher Sinn bis zu einem gewissen Grad verloren, aber wieder erweisbar: Problem der historischen Erinnerung. 47 Aber: unter welcher Bedingung entstehen Symbole? Symbole sind in verschiedenem Grad verständlich oder unverständlich. Eine Eigenschaft aus dem Ganzen, aus dem Gegenstand herausgelöst. Überall logisch willkürliches Element. Hier fast immer Allegorie genannt. (Obskures, Unverständliches). Frage nach der Entstehung wesentlich für das Verständnis der Symbole, (im Logischen bedeutungslos). 48 Gleichgültig ob die Auseinandersetzung oder Erinnerung im alltäglichen Leben, in der Rückbesinnung auf die Vergangenheit oder in den Sphären der Kunst, der Politik oder des Rechts geschieht, stets weist sie die drei folgenden, jeweils polarkonträr strukturierten Grundzüge auf: Erstens ist sie stets eine doppelte Operation, die zwei spannungsvoll aufeinander bezogene und unauflöslich miteinander verbundene Akte umfaßt: die emotionale Erschließung der affektiven Energie des Symbols und die kognitive Ermittlung seiner Bedeutung. Zweitens tendiert sie entweder mehr zur Verinnerlichung, also zu einer Betonung des Affekts, oder mehr 46 Ebenda, S . l l . 47 Ebenda, S. 13. 48 Ebenda, S. 15.
244
III Philosophie der
Verkörperung
zur Entäußerung, also zu einer Akzentuierung der Gegenstandsseite, so daß die einzelnen Symbole - je nach ihrer Distanz zum Affekt - die unterschiedlichsten Bedeutungen und Funktionen im Leben eines Individuums oder Gemeinwesens haben. Und drittens ist sie zugleich Wiederherstellung und Adaption, denn zum einen zielt sie auf Wiedergewinnung des ursprünglichen Sinns, zum anderen aber erfolgt sie stets von einem bestimmten Standpunkt aus, ist also - nicht anders als der ursprüngliche Akt der Symbolerzeugung - immer schon perspektivisch gebunden und damit jeweils in eigentümlicher Weise affektiv und kognitiv vororientiert, so daß die von ihr geleistete Restitution immer auch produktive Anverwandlung oder Übertragung des zu rettenden Sinns auf die eigene Situation ist. Dies läßt sich nach Wind zum Beispiel ,,[s]chon in der Sprache" beobachten, wo die „Zeichen mit ursprünglichem Emotionscharakter geladen" sind, „so daß jede Ubersetzung Verwandlung ist." 4 9 U m die sich zugleich als Restitution und schöpferische Anverwandlung vollziehende Auseinandersetzung als einzig angemessene Form kulturellen Verhaltens auszuzeichnen, grenzt Wind sie von zwei gleichermaßen fragwürdigen „Typen im Kulturverhalten" 50 ab: einem quasi-primitiven und einem rationalistischen Typus. Während ersterer die „Krise als das Entsetzliche" 51 ansieht und daher die mit Reflexion unweigerlich verbundene Verunsicherung unter allen Umständen zu vermeiden sucht, begegnet letzterer allen Symbolen gleichermaßen indifferent, beurteilt die Möglichkeit ihrer triftigen Deutung grundsätzlich skeptisch, stellt die mit der Ausschaltung aller Wertbeziehungen einhergehende Sinnkrise auf unbeschränkte Dauer und deklariert den permanenten „Zweifel als das einzig Menschliche" 52 . Gegenüber diesen beiden defizitären Formen ist nach Wind jedoch durchaus eine „Mittelstellung möglich! - [Sie ergibt sich aus dem] Zusammenhang mit dem Problem der Renaissance (Erinnerung!) [und besteht im] Akt des plötzlichen plötzlichen Zurückgehens auf die ursprüngliche Bedeutung. Der Doppelheit der Symbole liegt psychologisch das Problem der Renaissance zugrunde: Auseinandersetzung!" 53 Die Präzisierung und Systematisierung, die Wind an Warburgs Symbolkonzept vornimmt, besteht in der begrifflichen Zuschärfung der polar-konträr strukturierten Zentralterme und in der damit einhergehenden Verdeutlichung des inneren Zusammenhangs der gesamten Theorie. Insbesondere gelingt ihm dies bei der Bestimmung des im engeren Sinne symbolischen oder kulturstiftenden Verhaltens, also bei der Erörterung des Auseinandersetzungs- oder Erinnerungsbegriffs. Mit diesem Begriff schließt er zweifellos an Warburgs Begriff des symbolisch-verküpfenden Verhaltens und an dessen Mnemosyne-Konzept an, doch vermag Wind zu
49 Ebenda, S. 16. 50 Ebenda, S. 17. 51 Ebenda. 52 Ebenda. 53 Ebenda.
Β. Buschendorf:
Zur Begründung
der Kulturwissenschaft
245
zeigen, daß im Begriff der Auseinandersetzung oder Erinnerung verschiedene, in sich jeweils polar-konträr strukturierte Momente auszumachen sind und ein integrales Ganzes bilden. Die wichtigsten Aspekte eines Auseinandersetzungs- oder Erinnerungskonzepts seien daher hier noch einmal festgehalten: die Erkenntnis, daß die Diskrepanz zwischen Affekt- und Gegenstandsseite und die daraus resultierende Mehrdeutigkeit für kulturelle Symbole konstitutiv ist; der in der Formel „Freiheit durch Spannung" umrissene Gedanke, daß Auseinandersetzung auf der Fähigkeit beruht, die zunehmende Spannung zwischen den verschiedenen Ordnungen, die sich immer weiter ausdifferenzieren und dabei immer komplexer werden, dauerhaft auszuhalten und zu ertragen; die Erkenntnis, daß der urspüngliche Sinn des Symbols stets in gewissem Grade verloren geht, doch im Rückgriff auf seine Entstehung grundsätzlich wieder erinnert werden kann; die Beobachtung, daß im Rekurs auf den ursprünglichen Sinn die emotionale Erschließung seiner Affektseite und die kognitive Ermittlung seines Bedeutungsgehalts unauflöslich miteinander verschränkt sind; und nicht zuletzt die kapitale Einsicht, daß der Rückgang auf den verlorenen Sinn nicht nur Restitution, sondern stets auch schöpferische Anverwandlung bedeutet. Für den Kulturwissenschaftler ergeben sich aus der Polaritätstheorie des Symbols zum einen drei methodische Prinzipien; zum anderen folgt daraus die Warnung vor den methodischen Hauptfehlern der problemgeschichtlich orientierten Fachdisziplinen. Die methodischen Prinzipien sind folgende: erstens die kulturwissenschaftliche Grundvoraussetzung, daß die verschiedenen Funktionen oder Bereiche der Kultur wie Politik, Recht, Kunst, Religion usw. in Wechselwirkung stehen, und die daraus resultierende Forderung nach Einbettung der Forschungsgegenstände in die Gesamtkultur; zweitens die psychologisch gestützte kulturanthropologische Grundannahme, „daß die verschieden gerichteten Kräfte im Menschen nicht unabhängig von einander wirken, sondern selbst dort, wo sich ein Höchstmaß der Spannung zwischen ihnen entwickelt, durch eben diese Spannung noch aufeinander bezogen bleiben und niemals indifferent nebeneinander herlaufen;" 54 sowie der in dieser Annahme fundierte, handlungstheoretische Grundsatz, daß die Wechselwirkung zwischen den verschiedenen Kulturfunktionen stets durch die symbolischen Aktionen und Interaktionen der historischen Personen vermittelt ist; drittens die poietische Forderung nach Konzentration auf das Einzelobjekt, also die werkorientierte Maxime, daß sich das Einzelobjekt vollgültig nur verstehen läßt, wenn es symboltheoretisch als Auseinandersetzungsprodukt historisch begriffen, also im Rückgang auf die gegensätzlichen Kräfte erschlossen wird, „die sich in dieser Auseinandersetzung - bald hemmend, bald fördernd - begegnen." 55 : 54 Edgar Wind, „Humanitätsidee und heroisiertes Porträt in der englischen Kultur des 18. Jahrhunderts", in: England und die Antike, Vorträge der Bibliothek Warburg, 1930-1931, Leipzig und Berlin, S. 156-226, hier S. 159. 55 Wind, Einleitung (wie Anm. 32), S. IX.
246
III Philosophie der
Verkörperung
Denn der symbolischen Betrachtungsweise gilt die gedankliche Leistung als unverständlich oder nur halb verstanden, solange sie nicht im Zusammenhang oder auch im Konflikt mit den Kräften gesehen wird, die sich in der Bildnisgestaltung und der religiösen oder sozialen Handlung äußern. Die Bildgestaltung gilt ihr als unverständlich oder nur halb verstanden, wenn die reliösen und intellektuellen Bildungsinhalte, die sich in ihr verkörpern oder von denen sie sich loslöst, nicht in die Betrachtung miteinbezogen werden.56 Oder wie Wind in der Abhandlung „Humanitätsidee und heroisiertes Porträt in der englischen Kultur des 18. Jahrhunderts" erklärt: Ohne zu leugnen, daß der Sinn des Bildes sich primär an die Anschauung wendet, der Sinn des philosophischen Satzes primär an die begriffliche Uberlegung, wird man daher im Bilde doch mittelbar nach philosophischen Indizien und im philosophischen Satze mittelbar auch nach künstlerischen Konsequenzen suchen dürfen, um jede dieser beiden Gruppen von Dokumenten - im vollen Bewußtsein der zwischen ihnen herrschenden Spannung der Deutung der anderen dienstbar machen.57 Was die Warnung vor den Grundfehlern der fachdisziplinär beschränkten Forschung betrifft, so besteht nach Wind ihr erster und entscheidender methodischer Fehler in der völligen Isolierung der einzelnen Kulturfunktionen, entspringt also einer problemgeschichtlich orientierten Betrachtungsweise, die „Begriff und Anschauung, Wort und Bild, Erkenntnis und Glauben voneinander trennt und sie alle aus ihrer Verbundenheit mit der sozialen Handlung herauslöst".58 Im Kampf um ihre Autonomie orientieren sich die einzelnen Fachdisziplinen wie Literaturwissenschaft, Philosophie oder Kunstgeschichte an ideellen Grenzkonstruktionen, die keine Entsprechung in der historischen Wirklichkeit haben: Der Begriff der „reinen Form", die nur den Stil oder die Schreibweise und nicht das Sujet meint, der Begriff des „reinen Denkens", das sich ausschließlich begriffslogisch vollzieht und keinerlei Bezug zur Anschauung hat, oder der Begriff des „reinen Sehens", das nur die „optische Schicht" erfaßt und von allem Stofflichen absieht, all diese Begriffe konzipieren den historischen Gegenstand, der dargestellt, gedacht oder gesehen, und das heißt „in einem Auseinandersetzungsprozeß gestaltet wird", als etwas, das der Funktion des Gestaltens fremd und ihr „nur äußerlich zugeordnet bleibt." 59 Durch diese Abstraktion wird der „Gegenstand seines symbolischen Gehalts und damit seiner funktionalen Bedeutung für die Gesamtkultur entkleidet." 60 56 57 58 59 60
Ebenda, S. IXf.. Humanitätsidee (wie Anm. 54), S. 160. Ebenda, S. IX. Ebenda. Ebenda.
Β. Buschendorf: Z.ur Begründung der Kulturwissenschaft
247
Der zweite methodische Fehler ist der der Hypostasierung. Die problemgeschichtliche Forschung begeht ihn vor allem dann, wenn sie einen abstrakten Gegenstand wie etwa ein einzelnes philosophisches Problem oder ein einzelnes literarisches Motiv zum lebendigen Subjekt einer immanenten und kontinuierlich verlaufenden Entwicklung macht und das Gesetz seiner Veränderung dem Gang der Entwicklung selbst entnehmen zu können glaubt. Sie macht sich dieses Fehlers aber auch dann schuldig, wenn sie den Zusammenhang zwischen den verschiedenen Kulturfunktionen, den sie vorgängig durch Isolierung zerstörte, nachträglich durch Parallelisierung der diversen Entwicklungen und schließlich durch die Annahme eines alles bestimmenden Zeitgeistes, eines epochalen Lebensgefühls oder eines sonstigen Absolutums wiederherzustellen sucht. Der Theorie einer immanenten, kontinuierlich verlaufenden Entwicklung hält Wind entgegen, daß ein Gegenstand durch Isolation prinzipiell all seiner äußeren Spannungen beraubt würde und damit eben auch jede Fähigkeit verliere, sich zu entwickeln. Zudem verliefen historische Entwicklungen stets diskontinuierlich: „Gerade weil die geschichtlichen Ereignisse und Leistungen ihre symbolische Form dadurch gewinnen, daß sie aus grundlegenden Spannungen als vorübergehende Ausgleichsversuche hervorgehen, sind sie von einer eigentümlichen Sprunghaftigkeit."61 Gegen alle wissenschaftlichen Erklärungen, die auf ein hypostasiertes Absolutum rekurrieren, spricht nach Wind die prinzipielle Ungreifbarkeit reifizierter Abstrakta. Stets würde in Rückgriffen dieser Art versucht, das Bekannte aus dem Unbekannten zu erklären.62 Wind zufolge lassen sich auch größere geistige Zusammenhänge einer Zeit authentisch nur am Einzelobjekt erschließen. Dies sei freilich nur auf symboltheoretische Weise möglich: Der Forscher muß das Einzelobjekt als ein Auseinandersetzungsprodukt historisch begreifen, und das heißt, er muß in einem höchst umständlichen, quellengestützten Erinnerungsvorgang unter Einbeziehung von Dokumenten verschiedener Kulturgebiete auf die gegensätzlichen Kräfte zurückgehen, die in dieser Auseinandersetzung zusammentreffen. Als quellenkritisch gestützte Erinnerung vermag kulturhistorische Forschung die in symbolischer Auseinandersetzung stets angestrebte Restitution des verlore-
61 Ebenda, S. X . 62 Siehe hierzu Winds programmatische - 1957 in O x f o r d gehaltenen - Antrittsvorlesung „The Fallacy of Pure A r t " , in der er das u. a. von A. C . Bradley vertretene l'art pour l'art-Prinzip kritisiert und sich beiläufig mit Alois Riegls Versuch auseinandersetzt, die präzise Schattierungstechnik der spätrömischen Kunst mit der Negationslehre Augustine zu parallelisieren und beide auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen [vgl. hierzu Alois Riegl, Spätrömische Kunstindustrie, Wien 2 1927, S. 389-405]: „ B y thus reducing vision and thought to a common denominator which transcends them both, an identical impulse underlying their difference, he again commits the old fallacy of Schelling: he explains the known by the unknown. T o account for a connection between lateRoman art and Augustine's philosophy, he is not satisfied that Augustine looked at pictures, and looked at them in a particular way: in addition he assumes (to borrow Bradley's expression) a connection wholly underground." [Wind-Nachlaß, V, 21, 1],
248
III Philosophie
der
Verkörperung
nen Sinns zu optimieren und erfüllt damit ihre Wissenschaftsfunktion. Zugleich ist sie aber auch Anverwandlung und Übertragung des verlorenen Sinns auf die eigene Situation und erfüllt damit ihre Bildungsfunktion. In Winds Konzept von Kulturwissenschaft schließen sich Wissenschafts- und Bildungsfunktion nicht nur nicht aus, sondern bedingen und verstärken einander. Als „Organ, das es ermöglicht, an diese Dinge heranzukommen"63 eröffnet und verstetigt das subjektive Interesse den kritischen Erinnerungsvorgang. Und nur durch diesen wiederum ist historische Selbsterweiterung und die damit einhergehende Selbstformung möglich. Die im 19. Jahrhundert massiv einsetzende Modernisierung und die dadurch rapide beschleunigte Sonderung der einzelnen Kulturgebiete zeitigen, wie Wind betont, zwar in vieler Hinsicht durchaus posivite Folgen: die zunehmende kulturelle Randstellung des Künstlers führt zu äußerster Verfeinerung im Ästhetischen und erst durch immer engere Spezialisierung können die Wissenschaften ihre präzisen Begriffe, Theorien und Methoden entwickeln. Nach Winds kulturkritischer Diagnose führt dieser Entwicklungsprozeß aber auch zur „Entwurzelung": „Organe, mit denen man sich symbolisch auseinandersetzt mit der Umwelt - zerbrochen, das heißt die Welt als Ganzes zerbricht. Wenn Funktionen (Kunst = Wissenschaft) sich isolieren, zerbricht das Ganze".64 Mit ihrer radikalen Isolierung der Kulturgebiete trägt die problemgeschichtlich ausgerichtete Wissenschaft also zur zunehmenden Disintegration und Enthumanisierung der Kultur bei. Oder wie Wind sagt: „Isolierung den anderen Gebieten gegenüber hat zu ganz symbolarmen Begriffen geführt." 65 Diese Krise der Moderne sucht der symboltheoretisch orientierte Kulturwissenschaftler zu kompensieren, indem er die Tradition erinnert und das Sinnpotential der überlieferten Symbolwelten gegenwärtig hält, denn nur in beständiger Auseinandersetzung mit der Vergangenheit kann Selbstformung und humane Selbstbehauptung gelingen.
63 Wind, Grundbegriffe 64 Ebenda, S. 40. 65 Ebenda, S. 42.
(wie Anm. 34), S. 27.
IV Dokumente
Metaphysik und Bilder Ein Gespräch mit Pierre Hadot
Jeannie Carlier: Der Titel des bekanntesten Werkes von Edgar Wind, Heidnische Mysterien in der Renaissance, ist selbst ein wenig mysteriös. Können Sie ihn uns erklären? Pierre Hadot: In der Einleitung zu seinem Buch gibt Wind selbst die nötigen Erklärungen. Um den Begriff der „heidnischen Mysterien" genauer zu fassen, unterscheidet er im Anschluß an Festugière im Hinblick auf die Antike zwischen „mystères cultuels" und „mystères littéraires": Die kultischen Mysterien sind Riten, die in einer Gemeinschaft wirklich vollzogen werden und deren Teilnehmer, die „Mysten", zur Geheimhaltung und zum Schweigen verpflichtet sind (was in der Antike so strikt eingehalten wurde, daß man auch heute zum Beispiel noch nicht viel darüber weiß, was in Eleusis eigentlich vorging). Die „mystères littéraires" hingegen sind in gewisser Hinsicht viel weniger mysteriös, denn bei ihnen handelt es sich nicht um Zeremonien, sondern darum, daß ein den Mysterien entlehntes Vokabular in literarischen, vor allem aber in philosophischen Texten verwendet wird (so greift schon Piaton auf die in den eleusinischen Mysterien gebrauchte Redeweise zurück, und der Neuplatonismus benutzt die Sprache der Orphik und der chaldäischen Orakel). Aber die heidnischen literarischen Mysterien der Renaissance, wie Wind sie gesehen hat, gehen weit über eine einfache Entwendung des Vokabulars der Mysterienkulte hinaus: Edgar Wind untersucht in seinem Werk jene in der Renaissance aus der Antike, insbesondere aus der Spätantike übernommenen Lehren, die einen geheimen, mysteriösen Aspekt besitzen. Im alten Griechenland gab es eine Tradition, dergemäß es dem Philosophen zukam, einen verborgenen Sinn, eine ganze Philosophie oder geheime Metaphysik unter der Maske des Fremdartigen und Unverständlichen (wie in den orphischen Texten) oder gar des Monströsen und Skandalösen (wie in den Mythen Homers und Hesiods, wo Kronos seinen Vater kastriert und seine Kinder verschlingt) aufzufinden. Diese Tradition, nach der das Absurde oder Schreckliche ein Zeichen ist, das eine Suche nach dem tieferen, verborgenen Sinn auslösen soll, ist im antiken Griechenland fast so alt wie die Philosophie selbst. Bei den Stoikern erfährt sie eine bedeutende Entwicklung, doch erst am Ende der Antike gelangt sie mit den Neupiatoni-
252
IV
Dokumente
kern (und auch mit den Christen) zur vollen Blüte. Diese Tradition ist in der Renaissance wieder aufgenommen worden, wobei hier vor allem Marsilio Ficino, Pico della Mirandola, Nikolaus von Kues und später noch Giordano Bruno zu nennen sind, wenn wir uns auf die großen Namen beschränken wollen, und die Lehren dieser Tradition wurden ausdrücklich als „arcana", als Geheimnisse bezeichnet. J. C.: Das Buch Edgar Winds ist demnach vor allem ein philosophiegeschichtliches Werk? P. H.: Es ist viel mehr als nur das, und zwar in doppelter Hinsicht. Zunächst einmal stellt es ohne Zweifel einen bedeutenden Beitrag zur Ikonographie in der Tradition des Warburg Instituts dar. Der Grund dafür, daß dieses Buch eine derartige Berühmtheit erlangt hat (es hat vier englische Auflagen erlebt und ist ins Deutsche übersetzt worden), ist darin zu suchen, daß Wind in ihm Schlüssel zum Verständnis einiger der bedeutendsten Kunstwerke der Renaissance geliefert hat: zu Michelangelo, Leonardo da Vinci, Tizian, Raffael und vor allem zu den großen Gemälden Botticellis, dem Frühling und der Geburt der Venus, denen jeweils ein Kapitel gewidmet ist. J . C.: Aber gerade diese Art der Interpretation eines Kunstwerks ist ja sehr stark kritisiert worden. Wind behandelt ein großes Gemälde wie ein ideengeschichtliches Dokument, er verwertet den Frühling Botticellis und einen mittelmäßigen Kupferstich auf die gleiche Weise. In dem ganzen Buch wird nur ein einziges Mal die Farbigkeit eines Bildes angesprochen, und auch dann nur, um besser verstehen zu können, was es darstellt. Viele Kunsthistoriker halten die Reduzierung der Bedeutung eines Bildes auf „das, was es darstellt", für unzulässig. Für sie ist das Bild selbst, seine spezifische Organisation von Farben und Formen, viel wichtiger. P. H.: Diese Kritik scheint mir aus einem Mißverständnis und in gewissem Sinne auch aus einem Anachronismus hervorgegangen zu sein. Zunächst einmal ist festzuhalten, daß es sich bei den Heidnischen Mysterien in der Renaissance nicht in erster Linie um einen Beitrag zur Kunstgeschichte handelt. In diesem Buch wird die Kunst dazu benutzt, das geistige Universum einer Epoche zu rekonstruieren. Verfolgt man dieses Ziel, so ist es nicht nur möglich, sondern sogar zwingend geboten, alle Zeugnisse zu verwerten, deren man habhaft werden kann. Anthropologen oder Historiker kümmern sich schließlich nicht nur um Generäle und Könige, sondern widmen ihre Aufmerksamkeit auch dem einfachen Volk, das, wie sich herausstellt, sogar der interessantere Gegenstand ist. Ein Kunstwerk, das nicht aus der Hand eines großen Meisters hervorgegangen ist, vermag der Mentalität einer Epoche vielleicht darum um so eher zu entsprechen. Man muß alle zur Verfügung stehenden Dokumente auf die gleiche Weise behandeln. J . C.: Aber kann man nicht auch, diesmal aus der Perspektive der Kunstgeschichte, der Geschichte der großen Kunstwerke gesehen, sagen, daß man von dem Augenblick an, wo der Künstler bewußt einen tieferen Sinn verbirgt, man geradezu dazu verpflichtet ist, diesen zu suchen?
P. Hadot: Metaphysik und Bilder
253
P. H.: Ich glaube, daß man hier unterscheiden muß zwischen den offen allegorischen Bildern und den anderen, abgesehen von jenen, die allegorisch sind, ohne es einzugestehen. Vor allem besteht ein Unterschied zwischen den Epochen, und ich frage mich, ob nicht alle Bilder jener Zeit letzten Endes allegorisch sind ... Das meine ich, wenn ich von Anachronismus rede, man könnte es auch Ethnozentrismus nennen. Die Menschen der Renaissance waren für Allegorien empfänglicher als wir. Wir sind an die moderne Malerei gewöhnt, die nicht auf diese Weise funktioniert, doch deshalb dürfen wir einem Historiker nicht das Recht absprechen, die Menschen der Renaissancezeit, deren Kultur eine andere war und die einen anderen Zugang zur Malerei hatten, auch anders zu behandeln. Wind hat dieses Bedürfnis nach Allegorie bei den Malern der Renaissance sehr genau gesehen. Man muß sich halt darauf einstellen, daß diese Malerei allegorisch ist, das ist einfach die hier geltende Spielregel. Daraus erwächst ein Interpretationsprinzip: Nichts ist sinnlos; alles, was aus der Norm fällt, erfordert weitere Nachforschungen. Ich glaube, Winds Buch ist mehr eine Arbeit über die Allegorie als über die Malerei der Renaissance. Ich glaube auch, daß die Interpretation sich sogar auf den ästhetischen Genuß auswirkt, der dadurch gesteigert wird. Man ist nicht zufrieden, solange man nicht die Bedeutungen (oder wenigstens eine Bedeutung) entdeckt hat. Wenn man ein offensichtlich allegorisches Bild betrachtet und durch den Katalog des Museums nur erfährt, man habe bisher keine passende Erklärung gefunden, so findet man das Bild vielleicht ganz schön, hat aber doch das Gefühl, nicht auf seine Kosten gekommen zu sein, und das ist irritierend. Ich bin wie Edgar Wind der Meinung, daß das ungelöste Rätsel der Freude an der Kunst Abbruch tut, und ich bin jederzeit bereit, den letzten Satz des letzten Kapitels der Heidnischen Mysterien in der Renaissance zu unterschreiben: Ein großes Symbol ist das Gegenteil einer Sphinx, es gewinnt an Leben, wenn sein Rätsel gelöst ist. J . C.: Wind zeigt, auf welch außergewöhnlich subtile Weise die großen Maler der Renaissance über den zu ihrer Zeit allgemein bekannten Wortschatz ikonologischen Vokabulars hinausgehen: Sie bedienen sich des überkommenen Vokabulars, verleihen ihm aber neue, rätselhaftere Bedeutungen, indem sie Dinge zusammenbringen, die einander ausschließen würden, ginge es nach den geltenden Bedeutungsregeln. Das Ergebnis wirkt seltsam und fremdartig, manchmal sogar monströs ... P. H.: Es gibt bei Wind eine Tendenz, sich in diesem Zusammenhang besonders für das Außergewöhnliche oder gar Ungeheuerliche und Abstoßende zu interessieren (was er übrigens eigens begründet), und ich glaube, daß er damit recht hat. Für die Philosophen am Ausgang der Antike war das Skandalöse eine gegebene Tatsache: Die Legende gab es schon, sie hatten sie nicht erfunden, sie mußten sie allerdings erklären und gegen die sarkastischen Einwände der Christen verteidigen. Wie Edgar Wind aufzeigt, privilegierten die Menschen der Renaissance hingegen das Skandalöse und Paradoxe nicht nur ausdrücklich, sondern erfanden es sogar neu.
254
IV
Dokumente
J . C.: Das Selbstporträt Michelangelos als Geschundener? P. H.: Ja. Wind zufolge verweist dies auf die Geschichte des Marsyas, ein typisches Beispiel für eine abstoßende Szene, die eine mystische Bedeutung besitzt. In der hellenistischen Legende wird Marsyas, der Apollon herausgefordert hatte, bei lebendigem Leibe enthäutet. Indem er die Darstellungen dieses Ereignisses aus der Zeit der Renaissance zu Texten (vor allem von Dante und Michelangelo) und zu spätantiken Sarkophagen in Beziehung setzt, zeigt Wind, daß das Martyrium des Marsyas, ebenso wie die Prüfungen der Psyche und die Flagellationsszene auf Tizians Gemälde Heilige und profane Liebe, die Reinigung symbolisiert, die die Seele erleiden muß, bevor sie sich Gott zuwenden oder gar, vor allem im Tode, mit ihm vereinigen kann. Auf diesem Bild Tizians, das mit mehr Recht auch Himmlische und irdische Liebe genannt wird, sind zwei Frauen zu sehen, eine nackt, die andere bekleidet. Normalerweise würde man denken, die nackte Frau stehe für die irdische, niedrige Liebe, doch weit gefehlt! Paradoxerweise ist es genau umgekehrt, die Nackte stellt die himmlische Liebe dar (wobei Wind nicht der einzige war, der das gesehen hat): Die Nacktheit ist in Wirklichkeit ein Zeichen, sie ist keine Realität, sondern eine Allegorie. Wenn man aber nun erwarten wollte, daß die für die irdische Liebe stehende bekleidete Frau durch gemeine Wollust charakterisiert sein müsse, so läge man wieder falsch. Wie schon bei Plotin vorgezeichnet, ist es vielmehr so, daß beide, die irdische wie die himmlische Venus, „gut" oder „moralisch" sind, und der Gegensatz, um den es hier geht, ist der zwischen der kontemplativen Liebe und der fruchtbaren, erzeugenden Liebe. Das Paradoxe hat also nicht nur einen heuristischen Wert (indem es Fragen aufwirft und zu Untersuchungen anregt), es hat auch und vor allem einen echt metaphysischen Wert. Das eigentliche Thema des Buches von Edgar Wind über die „heidnischen Mysterien" scheint mir daher die Metaphysik des Heidentums in der Renaissance zu sein. J . C.: Aber die Künstler und Philosophen der Renaissance waren doch alle gute Christen, und einer von ihnen, Nikolaus von Kues, war sogar Kardinal. P. H.: Das hat sie nicht gehindert anzuerkennen, daß im Heidentum und sogar im Polytheismus eine gewisse Wahrheit liegt, und das ist von großer, von entscheidender Bedeutung: Genau das macht nämlich in der Renaissance die Problematik der Beziehungen zwischen Christentum und Heidentum aus. Die damaligen Platoniker waren aufrichtige Christen, aber sie waren der Uberzeugung, daß sie zwischen Christentum und Heidentum nicht zu wählen hatten. Sie glaubten an eine echte Kontinuität zwischen der heidnischen Tradition (vor allem der orphischen und „chaldäischen", wo sie überall Heilige Dreifaltigkeiten wiederfanden) und der christlichen Tradition. Sie stellten das Alte Testament der Heiden neben das Alte Testament der Juden. Selbst Savonarola, jene das fanatische Christentum repräsentierende Gestalt, war, wie sich beweisen läßt, Platoniker. Ficino, Pico und auch andere glaubten übrigens an eine innere Einheit der unterschiedlichen Religionen, die unter der Vielfalt verborgen liege. Mit den Worten des Cusaners: „Una
P. Hadot: Metaphysik und Bilder
255
religio in rituum varietate". Damit griff er, allerdings in einer Form, die seiner Metaphysik angemessener war, das Wort des Heiden Symmachus auf, mit dem dieser im 4. Jahrhundert vergeblich Ambrosius zu überzeugen suchte: „Es gibt mehr als einen Weg, sich einem so großen Mysterium zu nähern." Die letzten Kapitel von Winds Buch, die sich vor allem auf Nikolaus von Kues und Giordano Bruno stützen, lassen so etwas wie eine metaphysische Wahrheit des Heidentums erkennen, die man wohl folgendermaßen zusammenfassen kann: Gott ist verborgen, aber er bricht sich in einer Vielfalt von Bildern. Der Name Gottes ist unbekannt, aber eine Vielfalt von Namen zielt auf ihn ab, und eine Vielzahl von Mysterien gestattet den Menschen, sich ihm zu nähern. Die Weisheit ist daher wie ein Januskopf, der auf der einen Seite den unsichtbaren Gott als das Eine sieht und ihn auf der anderen in der Mannigfaltigkeit der sinnlichen Welt erschaut. Denn die Transzendenz, das Unzugängliche, läßt sich im Zusammenfallen der Gegensätze erfassen. Man muß das sich hauptsächlich auf Pico della Mirandola stützende Kapitel „Pan und Proteus" lesen, es ist Zentrum und Leitfaden eines Buches, das recht verschlungene Wege geht, denn in ihm zeigt Wind sehr deutlich auf, wie wichtig das neuplatonische Schema von der gegenseitigen Implikation der Teile des Ganzen ist. Es gilt, den in Proteus verborgenen Pan zu suchen (dessen griechischer Name „ganz", „alles" bedeutet), wobei Proteus für die sich ständig gegenseitig ineinander verwandelnden Teile des Ganzen steht. Wegen dieser universellen Metamorphose wohnt jeder Gestalt notwendigerweise auch ihr Gegenteil inne. In der orphischen Theologie sind alle Götter mehrdeutig oder vielschichtig, jede Gottheit partizipiert an den Eigenschaften der anderen. Für Giordano Bruno repräsentiert jede der drei Göttinnen in der Geschichte vom Urteil des Paris sowohl Macht als auch Weisheit und Schönheit, und sie unterscheiden sich nur hinsichtlich der jeweils prädominierenden, überwiegenden Eigenschaft. Daher rührt die Bedeutung, die zusammengesetzte, gemischte Formen in der Kunst der Renaissance erlangen, Formen, die die Gegensätze versöhnen und die mitunter sogar monströs sind: der Hermaphrodit, Janus, der ursprüngliche Mensch des Aristophanes, die fliegende Schildkröte, der junge Greis. J. C.: Mit der Koinzidenz der Gegensätze erklärt Wind die außergewöhnliche Ähnlichkeit zwischen Michelangelos Leda, einer Figur der Liebe, und der Nacht desselben Künstlers, einer Figur des Todes. P. H.: Ja. Dieser Vergleich ist keinesfalls willkürlich: Wind verweist auf eine Reihe von Texten und Darstellungen, wo Amor als Gott des Todes erscheint. Es gibt eine Logik der Prädominanz, die von der Logik des Widerspruchs verschieden ist und die in der Geschichte des Denkens eine wichtige Rolle spielt; ich bin an anderer Stelle den Spuren dieses Denkens von Anaxagoras bis Schelling gefolgt und habe sie, in Verfolgung dieses Weges, bei den Stoikern, natürlich bei den Neuplatonikern, bei Galen und anderen Medizinern wie auch bei Paracelsus gefunden. 1 1 Der Artikel Pierre Hadots über die Logik der Prädominanz ist erschienen in: Historisches Wörterbuch der Philosophie, Bd. 7, Basel 1989, Sp. 1225-1228, Stichwort „Praedominium".
256
IV
Dokumente
Alle Teile des Ganzen durchdringen sich gegenseitig derart, daß jedes Ding mehr oder weniger es selbst und zugleich etwas anderes ist (dies ist eine sehr starke metaphysische Fundierung der Allegorie, deren Wesen darin besteht, etwas anderes als das, was man sagt, zum Ausdruck zu bringen); innerhalb jeder realen Entität gibt es zwischen verschiedenen Kräften eine Art Kampf um die Vorherrschaft, der darüber entscheidet, welchen Charakter die Individualität annimmt. Jeder Teil ist das Ganze, aber auf seine eigene Weise. Für die Stoiker wird Zeus, indem er Zeus bleibt, zu Hera, zu Hephaistos, zu Feuer, Luft oder Wasser. Es gibt nur ein einziges Prinzip mit einer Vielfalt von Manifestationen. Die Neuplatoniker interpretieren dies auf eine nicht-materialistische Weise, und deshalb funktioniert dieses Schema dann auch gleich viel besser: Da es das Charakteristikum des Geistes ist, sich selbst innezuwohnen, wird nun die Vorstellung, alles sei in allem, völlig vernünftig. Ich glaube nicht, daß sich die Denker der Renaissance, die dieses Prinzip wiederaufnahmen, selbst für Heiden hielten, auch wenn, wie Wind sagt, das Denken Ficinos fast zwangsläufig darauf hinausläuft, es sei ein Irrtum, einen einzigen Gott zu verehren. Es ist von großer Bedeutung, daß in der Renaissance, zumindest in dem Umfeld der genannten Denker, jene metaphysische Vorstellung weiterlebte, die schon in der Schrift Plotins wider die Gnostiker ganz explizit zu finden war: Je mehr die Realität eine ist, desto mächtiger ist sie, und desto mehr verlangt es sie nach Manifestation oder, wie Nikolaus von Kues es nannte, nach Entfaltung (explicatio), das heißt, um so mehr hat sie den Drang, sich zu mannigfachen unterschiedlichen und sogar gegensätzlichen Formen (auch unterschiedlichen religiösen Formen) auseinanderzufalten. Eben das ist das zentrale Thema des Buches. J. C.: Eines der Beispiele für diese Lehre vom Zusammenfallen der Gegensätze muß bei Christen, die außerdem noch Platoniker sind, besonders überraschen: Bei Wind gibt es ein Kapitel mit der Uberschrift „Tugend versöhnt mit Lust". P. H.: Das ist von besonderem Interesse, denn damit wird etwas offenbar, was bei Plotin nur impliziert war. Plotin zögert nicht, der mystischen Extase die äußerste Lust, die höchste Freude zuzubilligen. Damit gesteht man aber ein, daß das Ziel des Menschen nicht nur in der Vereinigung mit Gott liegt, sondern auch in der Lust ... Wind hat damit einen wichtigen Punkt angesprochen, nämlich die Verbindung von Hedonismus und Mystik. Er macht darauf aufmerksam, daß der Epikureismus in der Frührenaissance eine Art von Rehabilitierung erfährt, besonders bei Ficino, der von Horaz die Devise „Laetus in praesens", „Glücklich in der Gegenwart" übernimmt. Eine erhabene und gewiß spirituelle Lust, aber doch eine Lust. Dies verliert sich in der Folgezeit nie völlig: Die Jansenisten sind im Grunde Hedonisten, denn das Ziel ist die Lust der Vereinigung mit Gott. Bei Pascal heißt es, Gott sei „dem Herzen fühlbar". J. C.: Da beginnt man davon zu träumen, wie wohl ein Christentum aussähe, das an den Gedanken Ficinos, Picos, Brunos und des Cusaners ausgerichtet wäre: ein weniger streng monotheistisches Christentum, mit mehr Toleranz gegenüber den anderen „Riten" ...
P. Hadot: Metaphysik und Bilder
257
P. H.: Ich war immer der Überzeugung, daß das Christentum heute ein ganz anderes Gesicht als das uns bekannte zeigen würde, wenn es den Weg genommen hätte, den ihm Menschen wie Clemens von Alexandrien oder auch Synesios, ein platonistischer Bischof des 5. Jahrhunderts, gewiesen haben. J . C.: Es wären uns einige Scheiterhaufen erspart geblieben ... P. H.: Zum Beispiel der des Giordano Bruno, der für diese Ideen gestorben ist. (1992)
Aus dem Französischen von Jürgen
Blasius.
Bild und Text1 Edgar Wind
Die erste und wichtigste Grundregel lautet, daß Bild und Text, wenn beide in ihrem eigenen Medium bedeutsam sind, meist nicht in eine Eins-zu-eins-Beziehung zueinander treten. Wo dies der Fall ist, sprechen wir von einer „buchstäblichen Illustration", die kein besonderes Problem aufwirft. Es ist allerdings bemerkenswert, wie wenige bedeutende heidnische Bilder der Renaissance sich der Gruppe der buchstäblichen Illustrationen zuordnen lassen. In ihrer Mehrheit sind sie das, was die Renaissance als poésie oder fantasie bezeichnete - Gestaltungen, die ersonnen wurden, um eine Idee zu vermitteln, die aber so angelegt waren, daß der Gedanke hierdurch malbar wurde. Es versteht sich, daß die Qualität eines Gedankens im Hinblick auf eine malerische Absicht nicht identisch ist mit seinem intellektuellen Rang, denn es ist durchaus möglich, einen trivialen Gedanken sehr gut zu malen oder einen tiefen Gedanken sehr schlecht. In beiden Fällen scheint die Haltung des Amateurs letztlich die einzig vernünftige zu sein: Er neigt dazu, im einen Falle von der Idee, im anderen vom Bild abzusehen. Wenn sich alle Renaissancekunst in diese beiden Gruppen einteilen ließe, wäre das Studium der Renaissance-Ikonographie ein unproblematisches Geschäft. Aber auffällig wenige „heidnische Erfindungen" der Renaissance gehören tatsächlich in eine dieser Gruppen. Im Gegenteil, wir stoßen in diesen Bildern auf eine außerordentliche Gabe zur Veranschaulichung von Ideen, eine Fähigkeit, die, recht besehen, weder dem Bereich des Diskurses noch dem der Wahrnehmung angehört, die vielmehr als ein spezifisches Vermögen der Phantasie zwischen beiden angesiedelt ist. Vielleicht läßt sich diese Fähigkeit am ehesten als eine Art Taktgefühl im Urteil darüber bezeichnen, welche Arten von Diskurs sich malen lassen und welche Formen von Malerei einen Diskurs auszudrücken vermögen. Meistens verbindet sich mit ihr das 1 Aus einem frühen Entwurf zu einer Einleitung für die erste Ausgabe von Pagan Mysteries in the Renaissance (1958), die aufgegeben und durch eine abschließende „Bemerkung zur Methode" ersetzt wurde. Vgl. die deutsche Ausgabe: Heidnische Mysterien in Renaissance, Frankfurt/M. 1981, S. 270-273. Copyright Margaret Wind.
260
IV
Dokumente
Bestreben, diese Möglichkeiten auch gründlich auszuloten. Wenn wir nicht einiges von dieser Fähigkeit wiedergewinnen, wird es unseren Interpretationsbemühungen immer an Richtung und Methode fehlen; und genau hier wird die Beschäftigung mit der Ikonographie der Renaissance riskant und bedeutsam. Heutzutage sind wir für diese Aufgabe besonders schlecht gerüstet, weil der Kult der reinen Wissenschaft und der Kult der reinen Sinnlichkeit - cette peinture décérebrée, wie Gide sie genannt hat, oder die misplaced concreteness im Sinne Whiteheads - gemeinsam dazu beigetragen haben, daß jenes Phantasievermögen zur Veranschaulichung eines Gedankengangs verkümmert ist. Dieser Sackgasse, die Gide in L'Enseignement de Poussin untersucht hat, versuchen die Kunst und die Rhetorik unserer Zeit auf verschlungenen Wegen zu entkommen. Der Künstler der Renaissance war insofern in einer günstigeren Lage, als er seine gedanklichen Leistungen nicht allein erbringen mußte. Seine Ideen zu einem Bild entstanden in der Beratung und oft im Ringen mit einem gebildeten Auftraggeber. Zu den Diskussionen, in denen diese Fragen erörtert und geregelt wurden, gibt es in der modernen Kunst kaum Parallelen, allenfalls im Bereich der Architektur, wo die Kunst, die Wünsche eines Auftraggebers herauszufinden und zu formen, nach wie vor als Teil des schöpferischen Prozesses gilt. Es ist für Auseinandersetzungen dieser Art bezeichnend, daß sie in ihren wichtigsten Phasen informell ablaufen. Wenn ihr Ergebnis in einem Vertrag feste Gestalt annimmt, werden die technischen Einzelheiten ausführlich niedergelegt, selten aber der Grund, warum man sich auf sie geeinigt hat. Auf diese Lücke stoßen wir in Verträgen aus der Renaissance mit ärgerlicher Regelmäßigkeit. Sie nennen die Anzahl der Figuren auf einem Grabmal oder einem Gemälde, gelegentlich erwähnen sie sogar deren Namen, aber nur in den seltensten Fällen enthalten sie Hinweise darauf, was die Figuren bedeuten. Und Briefe haben den unvermeidlichen Nachteil, daß sie nur dann geschrieben werden, wenn die Korrespondenten voneinander getrennt sind, während die entscheidenden Phasen des Gedankenaustauschs zwischen ihnen in die Zeiten fallen, in denen sie zusammen sind. Nur zweitrangige Künstler mit literarischen Ambitionen haben die eigenen Programme in schriftlicher Form verdoppelt. Vasari und Zucchi sind typische Beispiele. Das einzige ausführlich beschriebene Programm im 15. Jahrhundert findet sich in dem Vertrag für ein Gemälde von Perugino, das sich als Mißerfolg erwies. Man hat oft überrascht und enttäuscht festgestellt, daß für keines der großen Werke der Renaissance, weder für die Sixtinische Kapelle noch für die Stanza della Segnatura, weder für die Camera di San Paolo noch für Tizians Himmlische und irdische Liebe, ein schriftliches Programm überliefert ist. Daß die verfügbaren Dokumente sich so häufig weigern, unsere Frage zu beantworten, könnte indessen darauf hindeuten, daß diese Frage selbst falsch gestellt ist. Gesetzt den Fall, die Briefe aus jener Zeit sagten mehr über diese Programme, die Verträge wären ausführlicher und ein Humanist wie Poliziano hätte seine Kunst der ekphrasis wenigstens einmal an einem wirklich existierenden, statt an lauter imaginären Bildern geübt, dann würden wir diese Zeugnisse vermutlich als unsere
E. Wind: Bild und Text
261
„Texte" benutzen, würden die Bilder als ihre „buchstäbliche Illustration" lesen und auf diese Weise wieder in die Suche nach Eins-zu-eins-Beziehungen zurückfallen. Dies vereiteln nun aber die Dokumente selbst. Sie bilden (wenn ich diesen Ausdruck eines englischen Hofastronomen aus späterer Zeit aufgreifen darf) „eine Verschwörung, die uns daran hindert, etwas zu sehen, das nicht da ist". Sobald wir uns von der Vorstellung lösen, das beste Dokument zur Deutung eines Gemäldes sei eines, das dieses Bild in Wörtern verdoppelt, werden die Dokumente, die bisher die Antwort zu verweigern schienen, plötzlich sehr mitteilsam. Die gleichen Briefe, die die Bedeutung eines Bildprogramms nicht preisgeben, lassen uns doch die Personen identifizieren, die am Entwurf dieses Programms beteiligt waren; und es bedarf nur geringer Anstrengung, um herauszufinden, was diese Leute schrieben, was sie lasen, mit wem sie sich unterhielten etc. In dieser Beziehung sind die epistolaria der Renaissance so beredt wie die des 18. Jahrhunderts. Es gibt also eine Fülle von Indizien, die es erlauben, das intellektuelle Umfeld eines Malers zu rekonstruieren, und in der Regel ist es nicht sonderlich schwierig, zu bestimmen, welche antiken oder zeitgenössischen Texte eine gelehrte compositio angeregt haben. Wir brauchen diese Texte nur zu lesen, wie sie damals gelesen wurden. Aber wie wurden sie gelesen? Da liegt das Problem. Es ist ratsam, nicht mit dem Register zu beginnen. Diese Unart, die zum Kennzeichen des ikonographischen Betriebs geworden ist, reduziert die Lektüre eines Buches auf eine Lotterie, bei der man das eine oder andere Gedanken- oder Satzfragment hervorzieht und feststellt, daß es wunderbarerweise zu einem bestimmten Bild paßt. Beim Zusammensetzen solcher Bruchstücke erscheint das alte Spiel der Herstellung von Eins-zu-eins-Beziehungen in seiner lächerlichsten Gestalt, denn mit einer reichhaltigen, wohlerhaltenen Literatur wird hier umgegangen, als wäre sie nur in winzigen Papyrusfetzen auf uns gekommen. Je mehr wir uns auf die Literatur in ihrer Gänze einlassen, desto weniger werden wir dazu neigen, ihre Relevanz für die Malerei an der Oberfläche zu suchen. Die Auswahl der Zitate, die immer prekär ist, sollte man erst ganz zuletzt vornehmen. Nur wenn uns unsere Lektüre zunächst einmal weit wegführt von den Bildern, wird sie uns auch wieder zu ihnen zurückführen. Mehr als alles andere ist die Ikonographie das, was Focillon mit Bedauern un détour genannt hat. Divergenzen sollte man sorgfältig verfolgen und den Konvergenzen mißtrauen, bis sie sich uns gegen unsere Erwartung aufdrängen. Bei der Beschäftigung mit einem philosophischen Text kann es geschehen, daß ein besonders schwieriger Gedankengang plötzlich klar und einleuchtend wird, weil wir uns eines Bildes entsinnen, das ihn reflektiert. Wenn wir diesen Punkt erreicht haben, den Punkt, an dem ein Bild uns hilft, in einem Text die Akzente richtig zu setzen, und an dem ein Text uns hilft, in einem Bild die Akzente richtig zu setzen, dann gewinnen beide eine neue Leuchtkraft - und nach mehr sollten wir nicht streben. Aber erst wenn sich diese Erfahrung erweitert und vertieft, wenn weitere Texte und weitere Bilder den Eindruck verstärken, dürfen wir ihm trauen. Um diese Erfahrung zu vermitteln, bedarf es einer Beweisführung, die
262
IV
Dokumente
sich vom mathematischen Beweis radikal unterscheidet. An die Stelle einer linearen Logik, in der jeder Satz durch wohldefinierte Antezedenzien mit einem Komplex wohldefinierter Prämissen verknüpft ist, müssen wir eine konfigurative Logik setzen, die kontingente Argumente miteinander verbindet. Für derartige Untersuchungen kommt es, mit Charles S. Peirce zu sprechen, darauf an, daß unser Gedankengang „keine Kette bildet, die nicht stärker ist als ihr schwächstes Glied, sondern ein Tau, dessen Fasern noch so schwach sein mögen, wenn sie nur zahlreich genug und eng miteinander verknüpft sind". 2 Aus dem Englischen von Reinhard Kaiser
2
Charles S. Peirce, „Some Consequences of F o u r Incapacities", in: Collected Papers, hrsg. v. C. Hartshorne u. P. Weiss, Cambridge 1934, B d . V , S. 157; dt. „Einige Konsequenzen aus vier Unvermögen", in: C . S. Peirce, Schriften I, Frankfurt/M. 1967, S. 186.
Die Autoren
Horst Bredekamp, geb. 1947 in Kiel; Professor für mittlere und neuere Kunstgeschichte, Humboldt-Universität zu Berlin. Demnächst erscheint Das Urbild des modernen Staates. Thomas Hobbes' visuelle Strategien. Werner Busch, geb. 1944 in Prag; Professor für Kunstgeschichte, Freie Universität Berlin. Zuletzt erschien Landschaftsmalerei, 1997. Bernhard Buschendorf, geb. 1947; Privatdozent für Literaturwissenschaft an der Universität Heidelberg und lehrt am Institut für Literaturwissenschaft der Universität Karlsruhe (TH). Zahlreiche Veröffentlichungen zu Edgar Wind; demnächst erscheint „ Mit Piatons und Jacobis Musenpferden pflügenStudien zur Metaphysik in Jean Pauls Ästhetik und Dichtung. Christa Buschendorf, Professorin für Amerikanistik, Johann Wolfgang GoetheUniversität, Frankfurt/M. Ubersetzung u. a. von Edgar Winds Pagan Mysteries in the Renaissance (mit Bernhard Buschendorf und Gisela Heinrichs). In Vorbereitung: „ The High Priest of Pessimism ": Zur Rezeption Schopenhauers in den Vereinigten Staaten. Philipp Fehl, geb. 1920 in Wien; Professor em. für Kunstgeschichte, University of Illinois und verantwortlicher Herausgeber des Cicognara-Projektes, Vatikanischen Bibliothek. In Vorbereitung: Kunst und Menschlichkeit: Verschüttete Zugänge zu Bildthemen der Renaissance. Pascal Griener, geb. 1956; Professor für Kunstgeschichte, Universität Neuchâtel; Herausgeber von Edgar Winds Studien zur Schule von Athen. Zuletzt erschien die Monographie Hans Holbein (mit Oskar Bätschmann), 1997. Pierre Hadot, geb. 1922 in Paris; Professor em., Collège de France (Chaire d'histoire de la pensée hellenistique et romaine); auf Deutsch erschienen zuletzt Philosophie als Lebensform, 1991 und Die innere Burg - Anleitung zu einer Lektüre Marc Aurels, 1996.
264
Die Autoren
John Michael Krois, geb. 1943 in Cincinnati/Ohio; Privatdozent für Philosophie, Humboldt-Universität zu Berlin; verantwortlicher Herausgeber von Ernst Cassirer - Nachgelassene Manuskipte und Texte; (Hrsg.) Ernst Cassirer, Zur Metaphysik der symbolischen Formen, 1995. Michael Lailach, geb. 1969; Studium der Kunstgeschichte, Philosophie und Geschichte (M. A.); derzeit Stipendiat des Graduiertenkollegs „Die Renaissance in Italien und ihre europäische Rezeption" in Bonn; Promotion zu Mathias Holtzwarts Emblembuch Emblematum Tyrocinia. James McConica, FRHS, FRSC, Fellow am All Souls College, Oxford. Bruce Redford, University Professor, Boston University. Zuletzt erschien Venice and the Grand Tour, 1996; eine Studie über die Kulturgeschichte der „Society of Dilettanti" ist in Vorbereitung. Elizabeth Sears, Associate Professor für Kunstgeschichte, University of Michigan, Ann Arbor; Herausgeberin von Edgar Winds Studien zur Sixtinischen Decke.
Register
Addison, Joseph 9 , 3 8 , 4 1 Agostino Veneziano 79 Albani, Francesco 42 Albrecht von Brandenburg 71 Ambrosius, Hl. 255 Anaxagoras 56, 108, 255 Aretino, Pietro 56, 142,166 Aristophanes 174,255 Aristoteles 21, 70, 141, 200 Ashmole, Bernard 6 Anm. Auden, W. H. 117f., 121f., 124,126ff. Augustinus, HI. 61, 247 Anm. Austen, Jane 14 Bacon, Francis 212 Bandinelli, Baccio 40 Barrow, Isaac 37 Barthélémy, Jean-Jacques 175 f. Barzun, Jacques 117 Batoni, Pompeo 18f., 21, 23, 26, 28ff., 147 Bätschmann, Oskar 80 Anm., 81 Bauch, Bruno 191 Beattie, James 36 f., 3 9 , 4 3 f., 49 Beckford, Mrs. Peter 28 ff. Beckford, Peter 29 Beckford, William 30 Bellori, Giovan Pietro 21, 79f., 95 Benjamin,Walter 3 3 , 3 9 Bennett, Alan 13 f. Berenson, Bernard 83 ff., 89 Berlin, Sir Isaiah 6 Bernays, Jacob 173 f. Bing, Gertrud 50 Anm., 52 Anm., 57 Anm., 70 Blake, William 181,185 Bloch, Albert 170 Blochmann, Elisabeth 209, 214
Boas, George 117 Botticelli, Sandra 111, 113, 199,252 Bovillus, Caro lus 195 Anm. Bowra, Maurice 5 Bradley, A . C . 247 Anm. Bruce of Tottenham Lord 23 Bruno, Giordano 252, 255, 257 Brutus 38 Buber-Neumann, Margarete 157f. Bueno de Mesquita, Daniel 5 Burckhardt, Jacob 66 Anm., 81 ff., 85 ff., 103, 153 ff. Buschendorf, Bernhard 36, 98 Byron, William, 5th Lord 26 Calcagnini, Celio 71 Anm., 216 Carducci, Giosuè 113 Carroll, Lewis 162 f. Cassirer, Ernst 4, 52 Anm., 92f., 107, 112,183, 186, 188 Anm., 189ff., 199 Anm., 207, 209f., 212,214 Cato 38 Catull 146 Chardin, Jean-Baptiste Siméon 141 Charlemont, Lord 2 1 , 2 6 Cicero 162,196 Clarke, Samuel 37 Clemens von Alexandrien 257 Clemens VII. 143 Closterman, John 72 Cohen, Morris Raphael 188 Constable, John 144 Constable, W. G. 117 Corbin, Henry 220 f.,223 Correggio 72, 110 Costa, Lorenzo 72
266
Register
Cozens, Alexander 47 Croce, Benedetto 150 Anm., 157 Anm. D'Annunzio, Gabriele 56,157 Dante Alighieri 56, 254 Davis, Robert G. 118 Anm. Delacroix, Eugène 44, 153,167, 169, 175 ff. Descartes, René 199, 202 Dewey, John 185, 189 Anm. Diderot, Denis 141, 146 f., 166 Dilthey, Wilhelm 89 Diogenes 21 Dionysios Areopagita 216 Dionysius II. von Syrakus 197 Dolce, Ludovico 56 Dürer, Albrecht 202 Dyck, Anthonis van 26, 144 Edcumbe, Richard 1st Lord, 19 Egidio da Viterbo 71, 216 Einstein, Albert 199,211 Eliot, T.S. 13 f. Elsbach, Alfred C. 199 Englert, Ludwig 214 Anm. Erasmus von Rotterdam 112 f. Ettlinger, Max 187 Anm. Euklid 21 Festugière, André-Jean 108,251 Ficino, Marsilio 9, llOf., 197,202ff., 252,254, 256 Fiorillo, Johann Dominicus 147f. Focillon, Henri 261 Foster, John 6 Franco, Giovanni Battista 42 Frankl, Paul 149 Anm., 170 Anm. .Friedländer, Max 84f., 89 Gainsborough, Thomas 18 f., 31, 36 ff., 43 ff., 49, 190 Anm., 195 f. Galen 255 Galilei, Galileo 202 Garrick, David 196 Gellius, Aulus 112 George, Stefan 213,219 Gerard, Alexander 41 Gide, André 260 Giedion, Siegfried 137 Gill, Austin 6,97 Giulio Romano 70 Anm. Glaukon 141
Goethe, Johann Wolfgang 229 Gogh, Vincent van 167, 169 Gombrich, Sir Ernst H . 5, 33, 38f., 150 Anm., 210 Gordon, Colonel William 28 Gorgias 140 Görland, Albert 189 Graevius, Johann Georg 175 f. Grayson, Cecil 5 Greuze, Jean-Baptiste 141 Grillparzer, Franz 161 Guilloton, Vincent 214, 222 ff. Grünewald, Matthias 71,202 Hadrian VI. 143 Hamilton, Sir William 23 Hampshire, Stuart 6 Händel, Georg 15 Hartshorne, Charles 186 Anm. Hawkes, Christopher 6 Anm. Hay, Denys 5 Heartfield, John 157f., 161 f. Heathfield, Lord 30 Hecht, Anthony 126 Anm., 127, 129 Anm., 132 Anm. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 103, 111,114, 148, 199, 203 ff., 219, 221,228 Anm. Heidegger, Martin 186 f., 189 Anm., 191 Anm., 208 f., 212 ff., 219 ff., Henry, Joseph 21,23 Herodot 176 Hesiod 251 Hitler, Adolf 153 Anm., 221 Hoadly, Benjamin 37 Hobbes, Thomas 199 Hofmann, Werner 160 Hogarth, William 37 Holbein, Hans, der Jüngere 15,202 Homer 141,251 Hone, Nathaniel 41 Hook, Sidney 185 Horaz 9, 146,256 Hudson, Thomas 19, 26 Humboldt, Wilhelm von 153 Hume, David 4, 36ff., 43ff., 48f„ 191, 195ff. Husserl, Edmund 186f., 213, 215f., 219f„ 222 Hutchins, Robert Maynard 99 Huygens, Constantijn 46 Ingres, Jean-Auguste-Dominique 44
Register Isabella d'Esté 72 Isherwood, Christopher 131 Jacob, Ernest 5 James, William 186 Anm., 195 Jaspers, Karl 156, 187, 208, 221 Jean Paul 98 Johnson, Samuel 36 ff., 49 Johnson, Philip 117 Johst, Hanns 162 Jordaens, Jacob 15 Julianus Apostata 139 Julius II. 5,70 Junius, Franciscus 166 Justi, Carl 53, 55 f., 64 Justinus 175f. Kant, Immanuel 90, 181, 184,188ff., 194,199, 202 ff. Kephalos 141 Kepler, Johannes 202 Keppel, Commodore Augustus 26 Kierkegaard, Soren 220 Klee, Paul 103 Klein, Robert 36 Klibansky, Raymond 208 Anm. Langner, Susanne 188 Anm. Leeson, Joseph (der Jüngere) 23 Leeson, Joseph (später Earl of Milltown) 21 Lehmann-Haupt, Hellmut 137 Leibniz, Gottfried Wilhelm 202 L e o X . 143 Leonardo da Vinci 94, 198, 252 Lerner, Laurence 130 Anm. Leslie, Charles Robert 19 Lessing, Gotthold Ephraim 95 Lévinas, Emmanuel 210 Anm. Lewis, Clarence Irving 187 Anm., 188£. Livingstone, Richard 5 Livius 113 Locke, John 4 Ludlow, Peter 2 McCarthyJ o s e p h 117,119 McFarlane, K. B. 7 Machiavelli, Niccolò 197 McKeon, Richard 99 MacLeish, Archibald 117ff., 133 Malebranche, Nicole 38
267
Malermi, Nicolas 62 Mallarmé, Stéphane 213, 219f. Manet, Edouard 114 f. Mannheim, Karl 112 Mantegna, Andrea 72,114 Maratta, Carlo 144 Anm. Marrou, Henri 222 Massys, Quentin 113 Mendelowitz, Daniel 169 Michelangelo 15,19, 41, 52ff., 99,141 f., 144, 252,254 f. Middeldorf, Ulrich 100 Montieth, Charles 6 Morelli, Giovanni 83 Mozart, Wolfgang Amadeus 161 Muther, Richard 152 f. Nef, Willy 187 Anm. Newton, Isaac 202 Nikolaus von Kues 252, 254 ff. Northcote, James 19 f. Nussbaum, Felix 170 Ogle, Sir Chaloner 26 Olbrich, Josef Maria 152 Anm. Orwell, George 215 Ovid 112f„ 127, 140, 167, 175 ff. Panofsky, Erwin 86, 92, 105, 111 ff., 186,197 Paracelsus 255 Paride da Ceresara 72 Pascal, Blaise 256 Patch, Thomas 23 Paulson, Ronald 14 Peirce, Charles Sanders 181, 184, 186, 188,190, 192 ff., 212, 262 Perugino 72,96,260 Petronius 146 Philostratos der Ältere 140,146, 161, 166 Phokion 174 Pico della Mirandola, Giovanni 62, 70, 95,11 Of., 202 ff., 216, 252, 254 ff. Pinder, Wilhelm 154 Anm. Piaton 21, 70, 92, 108 ff., 123, 125,132, 138, 140f., 173f., 195, 197ff., 202ff., 251 Plethon 70 Anm. Plinius der Altere 143 Plotin 199,202 ff., 254, 256 Plutarch 108 Poincaré, Henri 211
268
Register
Pointon, Marcia 45 Polizian, Angelo 113,260 Pope, Alexander 14 f., 142 Porphyrios 108 Pound, Ezra 157 Poussin, Nicolas 80 Powicke, F. M. 4 Priestley, Joseph 48 Proklos 108, 202ff. Raffael 19ff., 23, 52, 77ff„ 141, 144, 229, 252 Raimondi, Marcantonio 115 Raimund, Ferdinand 174 Ramsey, Alan 196 Rembrandt van Rijn 4 6 , 1 4 1 , 1 6 7 Reynolds, Sir Joshua 7, 13ff., 36f., 39ff., 48f., 142, 144f., 190 Anm., 196 Ribeiro, Aileen 42 Richmond, Ian 6 Anm. Rickert, Heinrich 208 Ridolfi, Carlo 142 Riegl, Alois 35, 150, 247 Anm. Ripa, Cesare 111 Romanelli, Francesco 15, 42 Romney, George 45 Rosenblum, Robert 31 Rosso Fiorentino 15 Rougement, Denis de 221 Rousseau, Jean-Jacques 115, 196 Rubens, Peter Paul 46,144, 153, 167 Rubinstein, Nicolai 5 Rumohr, Carl Friedrich von 148 Ruskin, John 82 Anm., 103 Santayana, George 189 Anm. Sante Pagnini 71 Sartre,Jean-Paul 187, 212ff., 219ff. Saussure, Ferdinand de 103 Savonarola, Girolamo 254 Saxl, Fritz 50 ff., 70 Anm., 71 Anm., 83 Anm., lOOf.,232 Anm. Schalcken, Gottfried 47 Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph 247 Anm., 255 Schlegel, Friedrich 148 Schlosser, Julius von 149 Anm. Schmidt, Raymond 187 Anm. Schmitt, Carl 159 Anm. Sedlmayr, Hans 158ff. Seneca 110
Seznec, Jean 6 Shaftesbury, Third Earl of 72 Shakespeare, William 127 Shan, Ben 117 Shenstone, William 45 Siddons, Sarah 196 Sinfield, Alan 130 Anm. Slater, Humphrey 224 ff. Snell, Bruno 208f. Sokrates 1 4 1 , 1 9 8 , 2 0 0 Sparrow, John 6 Spengler, Oswald 155, 159 Springer, Anton 81 Steele, Richard 38 Steinmann, Ernst 53 Stella, Frank 199 Stendhal 56 Steward, Alexander 112 Strabon 176 Strauss, Leo 150, 154, 162, 164, 173f. Sutherland, Humphrey 6 Swift, Jonathan 31 Symmachus 255 Synesios 257 Tarleton, Lieut.-Colonel Bannastre 26 Tate, Allen 117 Taubes, Jacob 210 Taylor, John 23 Taylor, Tom 19 Thaies von Milet 200 Thode, Henry 53 Thurlow, Lord 45 Tietze, Hans 85, 89 Tillotson, John 37 Tintoretto 142 Tizian 46,142, 252, 254, 260 Trilling, Lionel 117 Usener, Hermann 66 Anm. Vasari, Giorgio 21, 44, 46, 55, 62, 79, 142f., 145, 147, 166, 260 Vergil 146 Veronese, Paolo 142 Vico, Giovanni Battista 89 Vischer, Friedrich Theodor 92, 227ff., 237ff. Vischer, Robert 227 Anm., 230 Vogel, Karel 170 Anm.
Register Waetzold, Wilhelm 84 Wagner, Otto 152 Anm. Walpole, Horace 15,40 f. Warburg, Aby 33ff., Ali., 49,69f., 90ff., 103, 105, 111 ff., 183f., 189,210,227, 230ff., 244 Waterhouse, Ellis 17 Anm., 19 Weber, Max 217 Weiss, Paul 186 Anm. Weiss, Roberto 5 Whitehead, Alfred North 107,186,187 Anm., 188, 193f., 197,260 Wickhoff, Franz 53 Williams, H. H. 187 Anm. Wilton, Andrew 26 Wilton, Joseph 144 Anm.
269
Winckelmann, Johann Joachim 86 Wittgenstein, Ludwig 4, 110 Wittkower, Rudolf 50 Anm. Wolferton, Francis 127 Wölfflin, Heinrich 35, 53, 60, 61 Anm., 83, 85 ff., 94, 111, 153 ff. Woodyeare, John 23 Wordsworth, William 144 Anm. Wright, Joseph, gen. Wright of Derby 47 Wynn, Sir Watkin Williams 23, 26 Yeats, William Butler 120 Anm. Zimmermann, Robert 227 Anm. Zucchi, Jacopo 260
Abbildungsnachweis
16, 17, Archiv Renate Prochno 22, 24, 25, Archiv des Verlages 27, Archiv Renate Prochno 28 (Abb. 7, 8), 29 (Abb. 9, 1), Archiv des Verlages 54, Edgar Wind Archiv 78, 80, 81, 82, 88, 91, Archiv des Autors 102, 103, Edgar Wind Archiv 145, London, National Gallery 168 (Abb. 2, 3) Archiv des Autors 169, London, National Gallery 171, Sammlung Dr. und Mrs. Nathan Greenbaum 172, Osnabrück, Kulturgeschichtliches Museum 182, Archiv des Autors




![Jacob Brucker (1696–1770): Philosoph und Historiker der europäischen Aufklärung [Reprint 2015 ed.]
9783050073590, 9783050030975](https://ebin.pub/img/200x200/jacob-brucker-16961770-philosoph-und-historiker-der-europischen-aufklrung-reprint-2015nbsped-9783050073590-9783050030975.jpg)