Oper im Schaufenster: Die Berliner Opernbühnen in den 1950er Jahren als Orte nationaler kultureller Repräsentation 9783205791522, 9783205787549, 9783486706666
125 25 4MB
German Pages [352] Year 2012
Recommend Papers

- Author / Uploaded
- Fabian Bien
File loading please wait...
Citation preview
Fabian Bien Oper im Schaufenster Die Berliner Opernbühnen in den 1950er-Jahren als Orte nationaler kultureller Repräsentation
Die Gesellschaft der Oper Musikkultur europäischer Metropolen im 19. und 20. Jahrhundert Band 9 Wissenschaftlicher Beirat und Herausgeber der Buchreihe: Philipp Ther, Universität Wien (geschäftsführend) Moritz Csáky, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien Heinz-Gerhard Haupt, Europäisches Hochschulinstitut Florenz und Universität Bielefeld Sven Oliver Müller, Universität Bielefeld Michael Walter, Universität Graz Michael Werner, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris
Fabian Bien
Oper im Schaufenster Die Berliner Opernbühnen in den 1950er-Jahren als Orte nationaler kultureller Repräsentation
Oldenbourg · Böhlau · 2011
Die Arbeit wurde von der Philosophischen Fakultät der Universität zu Köln als Dissertation angenommen.
Gedruckt mit der Unterstützung durch:
Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek : Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie ; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http ://dnb.d-nb.de abrufbar. ISBN 978-3-205-78754-9 (Böhlau Verlag) ISBN 978-3-486-70666-6 (Oldenbourg)
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, i nsbesondere die der Übersetzung, des Nachdruckes, der Entnahme von A bbildungen, der Funksendung, der Wiedergabe auf fotomechanischem oder ähnlichem Wege, der Wiedergabe im Internet und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. © 2011 by Böhlau Verlag Ges. m. b. H und Co. KG, Wien · Köln · Weimar http ://www.boehlau-verlag.com Gedruckt auf umweltfreundlichem, chlor- und säurefrei gebleichtem Papier Umschlaggestaltung: neuwirth+steinborn, www.nest.at Umschlagabbildung: Eröffnung der Deutschen Oper Berlin am 24. September 1961. Druck : Prime Rate Kft., 1047 Budapest
Inhaltsverzeichnis Vorwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
I. Eröffnungsfeiern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43
1. „Mittelpunkt für eine neue deutsche Opernkultur“ – Die Wiedereröffnung der Ost-Berliner Deutschen Staatsoper Unter den Linden am 4. September 1955. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 2. „Was das freie Deutschland an geistiger Substanz bietet“ – Die Eröffnung der West-Berliner Deutschen Oper in Charlottenburg am 24. September 1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 II. Vorstellungen von einer idealen deutschen Opernbühne . . . . . . . . .
1. Waffen des Staates – Deutsches Opernhaus und Preußische Staatsoper Unter den Linden im Nationalsozialismus . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Eine ideale deutsche Opernbühne – vier ideengeschichtliche Dimensionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a) Bildende Funktion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Schöner Schein. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c) Ursprungsmythologische Argumentationsfigur . . . . . . . . . . . . . d) Musterbühne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67 67 72 72 80 83 91
III. Kulturpolitische Konzepte – Deutsche Staatsoper und Städtische/ Deutsche Oper als ideale deutsche Opernbühnen . . . . . . . . . . . . .
1. Die Deutsche Staatsoper als ideale sozialistische deutsche Opernbühne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a) Neues Deutschland : „Zu den Aufgaben der Deutschen Staatsoper“ (1952). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Kulturpolitische und politische Bedingungen . . . . . . . . . . . . . . 2. Die kulturelle Gegenoffensive West-Berlins : Von der Städtischen Oper zur Deutschen Oper Berlin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96 97 97 103 119
6 Inhaltsverzeichnis
a) Politische Rahmenbedingungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 b) Vorstellungen der Intendanten von einer idealen deutschen Opernbühne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 IV. Architektur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Der Wiederaufbau der Deutschen Staatsoper Unter den Linden (1951–55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a) Die Lindenoper als Nationaltheater ? . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Der Plan einer neuen Staatsoper am Marx-Engels-Platz (1950). . c) Von der friderizianischen Kammeroper zum „repräsentativen Opernhaus der deutschen Hauptstadt“. . . . . . . . . . . . . . . . d) Die Lindenoper als fortschrittliches nationales Bauerbe . . . . . . e) Rezeption des Wiederaufbaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Der Neubau der Deutschen Oper in Charlottenburg (1951–61).. . a) Der Wettbewerb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Die architektonische Konzeption Fritz Bornemanns . . . . . . . . c) Rezeption des Neubaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136
. .
136
. .
136
. .
138
. .
144
. .
150
. .
159
. .
161
. .
161
. .
164
. .
172
V. Künstler – Der „Sängerkrieg“ und der Fall Erich Kleiber . . . . . . . . . .
177
1. „Eine neue Blütezeit der deutschen Opernkunst“ ?. . . . . . 2. Verbot der „Zweigleisigkeit“. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Eine deutsch-deutsche „Musik-Brücke“ ? . . . . . . . . . . . 4. „Primat des Politischen“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. „Kunst als Geschäft“ ?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. „Wenn Politik und Propaganda in ein Theater eindringen“ . 7. Nachspiel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .
177
. . . . . . .
184
. . . . . . .
186
. . . . . . .
190
. . . . . . .
192
. . . . . . .
193
. . . . . . .
197
VI. Aufführungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
199
1. Bildende Funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a) Richard Wagners Die Meistersinger von Nürnberg als Eröffnungspremiere der wieder aufgebauten Lindenoper 1955 . . . . b) Heinz Tietjen als Regisseur der Werke Wagners an der Städtischen Oper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c) Boris Blachers Preußisches Märchen an der Städtischen Oper 1952 ..
199 199 211 215
Inhaltsverzeichnis 7
2. Ursprungsmythologische Argumentationsfigur/Schöner Schein . . . . . a) Der Kampf gegen den Formalismus auf der Opernbühne : Brechts/Dessaus Das Verhör des Lukullus an der Staatsoper 1951. . . b) „Für eine deutsche Nationaloper !“ – Die Uraufführung von Jean Kurt Forests Der arme Konrad an der Staatsoper anlässlich des 10. Jahrestages der DDR 1959. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c) „Eine Schande für Berlin“ ? – Der Skandal um die deutsche szenische Erstaufführung von Arnold Schönbergs Moses und Aron an der Städtischen Oper 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Die Komische Oper als Musterbühne des Sozialistischen Realismus. . . VII. Publikum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
223 223
234
242 258 278
1. Ein Abonnement für die Städtische Oper 1955. . . . . . . . . . . . . . . 278 2. Westdeutsches Publikum in Staatsoper und Komischer Oper.. . . . . . 283 3. Ostdeutsches Publikum in der Städtischen Oper. . . . . . . . . . . . . . 286 4. „Bedürfnis aller Werktätigen“ ? – Die Einführung von Betriebsanrechten an der Komischen Oper 1953. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 Zusammenfassung und Ausblick.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
301
Anhang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
315
Quellen- und Literaturverzeichnis. . . . . . . . . . . . . . . 1. Quellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a) Archivalien.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Zeitungen und Zeitschriften . . . . . . . . . . . . . c) Zeitgenössische Literatur und gedruckte Quellen . 2. Literatur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
315
. . . . . . . . .
315
. . . . . . . . .
315
. . . . . . . . .
318
. . . . . . . . .
318
. . . . . . . . .
323
Abbildungsverzeichnis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 Personenregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345
für Barbara
Vorwort
„Il teatro e la vita non son la stessa cosa ; no … non son la stessa cosa !“ – Theater und Leben seien nicht das Gleiche, behauptet der Bajazzo zu Beginn von Ruggero Leoncavallos gleichnamiger Oper. Doch im Verlauf des Stückes muss der Protagonist leidvoll das Gegenteil erfahren, als seine Wandertruppe in Form eines ,Theaters auf dem Theater‘ unbeabsichtigt dessen persönliches Schicksal als Tragödie zur Aufführung bringt und damit Theater und Wirklichkeit ineinander übergehen. Zu Beginn von Leoncavallos Oper erläutert ein „Prolog“ die ästhetische Position des Werkes : „L’autore ha cercato […] pingervi uno squarcio di vita.“ Doch im gleichen Maße, wie sich in der Oper laut „Prolog“ das Theater als Abbild des wirklichen Lebens präsentiert, wird andersherum die Wirklichkeit theatralisch. – Seit Bestehen der Kunstform Oper haben sich Komponisten und Librettisten immer wieder dem Phänomen der Inszenierung von Wirklichkeit gewidmet, das die Geschichtswissenschaft erst allmählich für sich entdeckt. Die Studie versteht sich als Beitrag zu dieser Forschungsperspektive : Auch die Aufführungen der drei Berliner Opernbühnen in den 1950er-Jahren stellten ein ,Theater auf dem Theater‘ dar. Im Rahmen des geteilten Berlin als dem doppelten „Schaufenster der Systeme“, wie die Stadt von Zeitgenossen bezeichnet wurde, standen die Opernhäuser in besonderer Weise im ,Scheinwerferlicht‘ der Öffentlichkeit. Innerhalb der deutsch-deutschen System- und Kulturkonkurrenz bildeten sie wichtige politische Orte nationaler kultureller Repräsentation. Musiktheater im Berlin der 1950er-Jahre war ,Oper im Schaufenster‘. Dabei gehörten die an den Bühnen wirkenden Künstler, die Architektur der wieder aufgebauten beziehungsweise neu erbauten Häuser sowie das Publikum grundlegend mit zur kulturellen ,Inszenierung‘. An dieser Stelle sei allen gedankt, die dazu beitragen haben, dass ich jenes Berliner ,Theater auf dem Theater‘ mit der vorliegenden Studie gewissermaßen erneut zur ,Aufführung‘ bringen konnte. Besonderer Dank gilt meinem Doktorvater Hans-Peter Ullmann, der dem Thema von Anfang an eine große Offenheit entgegengebracht hat. Mit seinem sicheren Blick, seinen kritischen Impulsen und seiner außerordentlichen Zuverlässigkeit hat er das Entstehen
12 Vorwort
der Arbeit in idealer Weise begleitet. Dank gebührt meiner Zweitgutachterin Susanne Rode-Breymann, die aus musikwissenschaftlicher Perspektive wesentliche Anregungen beigesteuert und mir wiederholt die Gelegenheit gegeben hat, das Thema gewinnbringend in ihrem Doktorandenkolloquium zu diskutieren. Herzlich danke ich dem Cusanuswerk, das die Arbeit mit einem Graduiertenstipendium finanziell großzügig unterstützt und damit überhaupt erst möglich gemacht hat. Dem österreichischen Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung sowie der Philosopischen Fakultät der Universität zu Köln sei für Zuschüsse zu den Druckkosten der Arbeit gedankt. Bedanken möchte ich mich bei den Archivaren der Berliner Archive für ihre vielfältige Unterstützung bei der Quellenrecherche. Vor allem Ilse Kobán vom Archiv der Akademie der Künste und Axel Schröder vom Landesarchiv Berlin haben mit manchem guten Hinweis und unerwarteten „Fund“ weitergeholfen. Mit Dank schaue ich auf das faszinierende Interview zurück, das mir der Architekt der Deutschen Oper Fritz Bornemann im Oktober 2005, knapp eineinhalb Jahre vor seinem Tod, gewährte und das mir einmalige Einblicke in die Architekturdekade der 1950er in Berlin ermöglichte. Bedanken möchte ich mich bei den Freunden, die mich in Berlin bei meinen verschiedenen Forschungsaufenthalten immer wieder herzlich aufgenommen haben und deren Gastfreundschaft manchen langen Tag im Archiv kurzweilig enden ließ : Agnes und Jan Bäumer, Tina Bunyaprasit, Nils Clauss, Anatol Przytulski sowie Renate und Steffen Rudolph. Für anregende Gespräche über die Berliner Opernkultur sei besonders meinem Bruder Christian Bien, Steffi Buyken-Hölker und Benedikt Hölker, Tilman Gruhn, Michel Kofink, Sven Oliver Müller und Dietrich Steinbeck gedankt, für wichtige andere Gespräche und die Freundschaft Benjamin Seipel. Herzlicher Dank gilt Ulrike Burgi, Irmgard Schöning und meinen Eltern Brigitte und Günther Bien für die vielen Stunden kritischen Lektorats. Die Höhe- und Tiefpunkte, Wendungen und manche Dramatik bei der Entstehung der Arbeit hat niemand so intensiv miterlebt wie meine liebe Frau. Sie hat mir geholfen, immer das ,Finale‘ im Blick zu halten. Dafür bin ich ihr sehr dankbar. Köln, im August 2011
Fabian Bien
Einleitung
„Sprengt die Opernhäuser in die Luft !“1 Mit diesem Aufruf schockierte Pierre Boulez 1967 die kulturelle Öffentlichkeit in der Bundesrepublik. In einem Spiegel-Interview wandte sich der Komponist gegen den aus seiner Sicht verkrusteten deutschen Opernbetrieb. Für ihn waren die Musiktheaterbühnen mit ihrem Schwerpunkt auf den längst etablierten Werken durchweg von „bürgerlichem Durchschnittsgeschmack“2 geprägt. Boulez konnte mit seiner Kritik am Kulturbetrieb bei dem Philosophen und Musiksoziologen Theodor W. Adorno anknüpfen. Dieser hatte bereits 1955 im Rahmen des Darmstädter Gesprächs einen viel beachteten Vortrag gehalten, in dem er den deutschen Opernbühnen vorwarf, zu einem Teil der Kulturindustrie herabgesunken zu sein. Darin, dass sich in den Opernhäusern ein kulturell retrospektiv orientiertes Publikum von den immer gleichen Werken nur unterhalten lassen wolle, spiegele sich, so Adorno, ein ideologisches, weil falsches gesellschaftliches Bewusstsein. Adornos Kritik zielte auf die Opernkultur in beiden deutschen Staaten : „Die Lage der Oper ist nicht zu beneiden inmitten der verwalteten Menschheit, die, gleichviel unter welchem politischen System, sich nicht mehr um Befreiung, Ausbruch und Versöhnung kümmert […], sondern gegen den Laut der Humanität krampfhaft die Ohren verschließt, um es zufrieden, vergnügt und resigniert im Getriebe aushalten zu können.“3 Hinter der Kritik an der nach 1945 – in beiden Teilen Deutschlands – scheinbar problemlos ,auferstandenen‘ Kultur stand die Überzeugung, dass es nach den Gräueln des Nationalsozialismus in der Kunst kein unreflektiertes „Weiter so !“ geben dürfe, wenn diese ihren ethisch-moralischen Anspruch nicht verlieren solle. So mahnte Adorno, sich auf den ursprünglichen, aufklärerischen Charakter der Kunstform zu besinnen und – ob durch etablierte oder avancierte zeitgenössische Werke – Widerspruch gegen die bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse zu artikulieren. 1 „,Sprengt die Opernhäuser in die Luft !‘ Spiegel-Gespräch mit dem französischen Komponisten und Dirigenten Pierre Boulez“, in : Der Spiegel 21 (1967), Nr. 40, S. 166–174. 2 Ebd. 3 Theodor W. Adorno, „Theater, Oper, Bürgertum“, in : Egon Vietta (Hg.), Darmstädter Gespräch. Theater, Darmstadt 1955, S. 119–134, hier S. 133.
14 Einleitung
Tatsächlich war der kulturelle Wiederaufbau im Bereich der Oper und des Theaters nach den Verheerungen des Zweiten Weltkriegs überall in Deutschland energisch betrieben worden, was sich schon äußerlich in der Vielzahl neuer beziehungsweise wieder errichteter Theaterbauten spiegelt : Nachdem in den ersten Jahren nicht selten Aufführungen in Schulen, Universitätsaulen oder umgebauten Turnhallen hatten stattfinden müssen, wurden allein in der Bundesrepublik bis 1970 etwa 60 Theaterbauten errichtet.4 Die DDR wiederum konnte 1963 in einer hymnischen Darstellung des Musiklebens im ostdeutschen Staat sogar behaupten : „Im Vergleich mit anderen Ländern, Westdeutschland eingeschlossen, besitzt die Deutsche Demokratische Republik das dichteste Operntheater-Netz.“5 Was die DDR anbelangt, widersprach allerdings Adornos Vorwurf einer kulturellen Restauration auf dem Feld der Oper der Selbstdarstellung des sozialistischen deutschen Staates. In einer Musikgeschichte der DDR von 1980 etwa ist in diesem Zusammenhang über die 1950er-Jahre zu lesen, in den in jener Zeit entstandenen neuen Opern sei es zu einer „kritische[n] Auseinandersetzung mit der reaktionären Vergangenheit, vor allem der des Faschismus und seiner Wurzeln“ gekommen, wie darüber hinaus „zu Neuinterpretationen klassischer Sujets und Stoffe […] vom Standpunkt der neuen Gesellschaftsordnung“6 aus. Auch der Anspruch des realsozialistischen deutschen Staates, beim Publikum ein bildungsbürgerliches Kulturmonopol zu brechen, spricht gegen die These von der Restauration. In der Bundesrepublik hingegen scheint ein demonstrativer Bruch mit dem kulturellen System der nationalsozialistischen Vergangenheit, wie ihn die DDR für sich in Anspruch nahm, kaum auszumachen zu sein. Symptomatisch scheint dafür eine Äußerung der Wagner-Enkel Wieland und Wolfgang anlässlich der ersten Bayreuther Richard-Wagner-Festspiele nach dem Zweiten Weltkrieg 1951 zu sein. Im Programmheft forderten die beiden Leiter der Festspiele das Publikum auf : „Im Interesse einer reibungslosen Durchfüh4 Hannelore Schubert, Moderner Theaterbau. Internationale Situation, Dokumentation, Projekte, Bühnentechnik, Stuttgart/Bern 1971, S. 89. 5 Karl Laux (Hg.), Das Musikleben in der Deutschen Demokratischen Republik (1945–1959), Leipzig o. J. [1963], S. 113. 6 Musikgeschichte der Deutschen Demokratischen Republik 1945–1976. Von einem Autorenkollektiv unter der Leitung von Heinz Alfred Brockhaus und Konrad Niemann, Berlin 1980, S. 117.
Einleitung 15
rung der Festspiele bitten wir von Gesprächen und Debatten politischer Art auf dem Festspielhügel freundlichst Abstand nehmen zu wollen. Hier gilt’s der Kunst !“7 Eine kritische Reflexion über die politischen Implikationen des Komponisten und die Rolle der Festspiele im Nationalsozialismus und damit ein demonstrativer Bruch mit der NS-Vergangenheit der Wagner-Festspiele blieb im Bayreuth der frühen Bundesrepublik, so scheint es, aus. Was die Frage kultureller Restauration im Bereich der Oper in der frühen Bundesrepublik generell angeht, betonte allerdings Hans-Klaus Jungheinrich 1991 in seinem Überblick über Politische und gesellschaftliche Aspekte der Oper seit 1945, dass es in einem Punkt doch zu einem Wandel im Umgang mit der Kultur gegenüber der Zeit des Nationalsozialismus gekommen sei. Diesen Wandel jedoch sah er geradezu als selbstverständlich und kaum bemerkenswert an : „Daß es nach dem sogenannten Zusammenbruch nicht schlichtweg deutschtümelnd weitergehen konnte, war kaum umstritten.“8 Doch war ein solcher Wandel gemessen an der großen Bedeutung, welche die Oper in Deutschland für die Konstruktion einer nationalen Identität gespielt hatte, wirklich so unstrittig ? Die nationale Sinnstiftung bei der Kunstform Oper lässt sich bis ins frühe 19. Jahrhundert zurückverfolgen. Spätestens seit 1850 etablierte sich in diesem Zusammenhang in weiten gesellschaftlichen Kreisen eine gegenüber ausländischen kulturellen Einflüssen konfrontative und ausgrenzende Haltung, die auf der Vorstellung einer Überlegenheit der deutschen Kultur basierte. Zum negativen Gegenbild, bei dessen Konstruktion Richard Wagner eine entscheidende Rolle zukam, gerieten dabei vor allem Frankreich und die Juden. Ein solches Selbstverständnis kulminierte in der Zeit des „Dritten Reiches“, in der mit glanzvollen Opernaufführungen der Werke Mozarts und Beethovens, Webers, Richard Strauss’ und vor allem Richard Wagners dem Publikum die kulturelle Überlegenheit des deutschen Volkes sinnlich vor Augen geführt werden sollte. Die Kehrseite dieser nationalen kulturellen Repräsentation bildete die weitgehende Ausgrenzung der kulturellen Moderne. Vermeintlich ,undeutsche‘ Künstler wurden vom Kulturleben ausge7 Zitiert nach : Michael Karbaum, Studien zur Geschichte der Bayreuther Festspiele (1876–1976). Teil I : Textteil / Teil II : Dokumente und Anmerkungen, Regensburg 1976, S. 106. 8 Hans-Klaus Jungheinrich, „Politische und gesellschaftliche Aspekte der Oper seit 1945“, in : Udo Bermbach und Wulf Konold (Hg.), Der schöne Abglanz. Stationen der Operngeschichte, Berlin 1991, S. 243–262, hier S. 256.
16 Einleitung
schlossen und ihre Werke als ,entartet‘ verfemt, was vor allem Juden traf. Vor dem Hintergrund der langen Tradition deutscher kultureller Hybris wäre zu Jungheinrichs Einschätzung festzustellen, dass der Abschied von der bisherigen „Deutschtümelei“ keineswegs als selbstverständlich anzusehen ist. Für die Bayreuther Festspiele etwa ließe sich argumentieren, dass, wenn auch die WagnerEnkel ein unpolitisches Kunstverständnis gefordert hatten, die Entscheidung Wielands, die Sagen- und Mythenstoffe des Komponisten in seinen zeitlosabstrakten Inszenierungen aus dem bis dahin gültigen germanisch-nationalistischen Deutungsschema zu lösen, um sie stattdessen als gesamteuropäische, ja, allgemeinmenschlich gültige Geschichten zu deuten, einen erheblichen und keineswegs selbstverständlichen kulturellen Wandel bedeutet hat. Dieser wäre angesichts der zumindest anfänglichen erheblichen Widerstände von Teilen des Publikums gegen Wielands Ästhetik nur umso bemerkenswerter. Somit ist zu fragen, ob und inwiefern sich in der Bundesrepublik – und dasselbe ist für die DDR zu prüfen – auf dem Feld der Oper nach 1945 ein substanzieller Wandel in der nationalen kulturellen Selbstdarstellung ereignete, sodass die These vom restaurativen Charakter der Opernkultur in der ost- wie westdeutschen Nachkriegszeit zu modifizieren wäre. Die Beantwortung der Frage nach Restauration und Wandel im Bereich der Oper nach 1945 ist für die historische Forschung von Bedeutung. Die Kunstform Oper nämlich, die bis 1945 eine wichtige Rolle für die nationale Identitätsstiftung gespielt hatte, war auch in den Jahren nach dem „Dritten Reich“ gesellschaftlich von großer Relevanz. Bis die primär auf Konsum ausgerichtete Massenkultur, deren Aufstieg in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ihren Ausgang genommen hatte, um 1970 im Zusammenhang mit Fernsehen und Kino, Radio und Plattenspieler zur „Basiskultur der Gesellschaft“9 wurde – für die DDR galt das grundsätzlich genauso wie für die BRD10 – und bildungsbürgerliche Widerstände gegen diese Entwicklung abflauten, war die Oper von wichtiger, wenn auch wohl abneh 9 Kaspar Maase, Grenzenloses Vergnügen. Der Aufstieg der Massenkultur 1850–1970, Frankfurt/M. 1997, S. 13. 10 Zur Etablierung der Massenkultur in der DDR siehe etwa : Ebd., S. 259ff ; Uta G. Poiger, Jazz, Rock and Rebels. Cold War Politics and American Culture in a Divided Germany, Berkeley/Los Angeles/London 2000 ; Klaus Arnold und Christoph Classen (Hg.), Zwischen Pop und Propaganda. Radio in der DDR, Berlin 2004.
Einleitung 17
mender gesellschaftlicher Bedeutung. An den Aufführungen der großen Bühnen nahmen nicht selten die einflussreichsten politischen Vertreter des jeweiligen deutschen Staates teil ; hier partizipierten die Bildungseliten aus den jeweiligen Gemeinwesen.11 Durch die Beantwortung der Frage nach Restauration und Wandel in der Oper lassen sich somit wichtige Aussagen über das kulturelle Selbstverständnis des jeweiligen Staates nach den Jahren des Nationalsozialismus treffen. Fragt man nach kulturellem Wandel in der Oper im deutsch-deutschen Vergleich, rücken die drei Berliner Opernhäuser in den Blickpunkt : erstens die Deutsche Staatsoper, die ihren Spielbetrieb bereits kurz nach Kriegsende wieder aufnahm, allerdings nicht in ihrem Stammhaus Unter den Linden, das im Krieg zerstört worden war, sondern im Admiralspalast unweit des Bahnhofs Friedrichstraße ; zweitens die Städtische Oper, die im Nationalsozialismus den Namen Deutsches Opernhaus getragen hatte und die wegen der Kriegszerstörung ihres eigentlichen Domizils in der Charlottenburger Bismarckstraße nun im Theater des Westens spielte ; drittens die Komische Oper in der Behrenstraße unweit der Allee Unter den Linden, die Ende 1947 als drittes öffentlich subventioniertes Opernhaus gegründet wurde. Die Berliner Opernbühnen eignen sich aus drei Gründen in besonderer Weise als Untersuchungsgegenstand : zum einen, weil die Stadt eine lange und bedeutende Musiktheatertradition besaß, an die es nach 1945 anzuknüpfen galt ; zum anderen wegen der brisanten Vergangenheit von Staatsoper und Städtischer Oper als Hauptstadtbühnen des „Dritten Reiches“ ; schließlich auch deswegen, weil die Stadt während des Kalten Krieges für beide politischen Systeme von grundlegender symbolischer Bedeutung war.12 Berlin stand nicht nur im Mittelpunkt internationaler Aufmerksamkeit im globalen Rahmen des Systemkonflikts, sondern spielte auch innerhalb der 11 Holger Stunz, „Darsteller auf internationalen Bühnen : Festspiele als Repräsentationsobjekte bundesdeutscher Kulturpolitik“, in : Johannes Paulmann (Hg.), Auswärtige Repräsentationen. Deutsche Kulturdiplomatie nach 1945, Köln 2005, S. 63–84. – Zur Partizipation gesellschaftlicher Eliten an der Oper in Österreich siehe : Peter Stachel, „,Das Krönungsjuwel der österreichischen Freiheit‘. Die Wiedereröffnung der Wiener Staatsoper 1955 als Akt österreichischer Identitätspolitik“, in : Sven Oliver Müller und Jutta Toelle (Hg.), Bühnen der Politik. Die Oper in europäischen Gesellschaften im 19. und 20. Jahrhundert, Wien/München 2008, S. 90–107. 12 Michael Lemke (Hg.), Schaufenster der Systemkonkurrenz. Die Region Berlin-Brandenburg im Kalten Krieg, Köln 2006, S. 9–27.
18 Einleitung
deutsch-deutschen Konkurrenz eine zentrale Rolle, wobei beide Stadthälften symbolisch als „partes pro toto“13 für den jeweiligen deutschen Teilstaat fungierten. In diesem Zusammenhang wurde Berlin zu einem zweigeteilten ,Schaufenster‘ ausstaffiert, in dem zu Zwecken politischer Legitimation die Vorzüge des jeweiligen politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Systems sinnfällig gemacht werden sollten. Dies war überhaupt nur deswegen möglich, weil Berlin bis zum Mauerbau am 13. August 1961 den einzigen Ort darstellte, an dem die deutsch-deutsche Grenze noch prinzipiell offen war, sodass die konkurrierenden Angebote beider Teile des ,Schaufensters‘ begutachtet und miteinander verglichen werden konnten. Dabei kam den Opernbühnen der Stadt ein hoher Symbolwert zu. Staatlich subventioniert sollten sie als Orte nationaler kultureller Repräsentation einerseits innerhalb des eigenen Systems, andererseits aber auch beim jeweils anderen deutschen Teilstaat für den eigenen Staat und dessen Kulturverständnis werben. Die Berliner Opernbühnen befanden sich somit an einem Schnittpunkt zwischen innerer und äußerer nationaler kultureller Repräsentation und hatten somit eine wichtige politische Funktion. Der Begriff ,Repräsentation‘ wird dabei im Folgenden über seine heute allgemein gebräuchliche Bedeutung als „Vertretung eines Staates, einer öffentlichen Einrichtung o. Ä. auf gesellschaftlicher Ebene u. der damit verbundene Aufwand“14 hinaus in seinem früheren Sinn als „Aufführung, Darstellung oder Vorstellung eines Bühnenstücks“15 verstanden und damit der Theatralitätsaspekt betont. Das nämlich entspricht der zeitgenössischen Wahrnehmung Berlins als einem zweigeteilten ,Schaufenster‘ der Systeme. Die Stadt wird somit bildlich als eine ,Bühne‘ verstanden, auf der in der Art eines ‚Theaters auf dem Theater‘ Opernkultur ,repräsentiert‘ wurde. Ein solches Verständnis besitzt den Vorteil, den Fokus über die Aufführungen in den Opernhäusern hinaus auch auf die ,Szene‘ jenseits der Bühnenrampe richten zu können, womit die handelnden ,Akteure‘, also Kulturpolitiker, Künstler aber auch das Publikum, in den Blick kommen, 13 Ebd., S. 11. 14 Duden. Das große Fremdwörterbuch. Herkunft und Bedeutung der Fremdwörter, 2., neu bearbeitete und erweiterte Auflage, Mannheim u.a. 2000, S. 1158. 15 Niels Werber, Art. „Repräsentation/reräsentativ“, in : Karlheinz Barck u.a. (Hg.), Ästhetische Grundbegriffe. Historisches Wörterbuch in sieben Bänden, Bd. 5, Stuttgart und Weimar 2003, S. 264–290, hier S. 266.
Einleitung 19
und schließlich selbst die Architektur der Opernhäuser, gewissermaßen als die ,Bühnenbilder‘. Ein wichtiger Aspekt der sich ab 1948 abzeichnenden deutsch-deutschen Opernkonkurrenz war sicherlich, dem Publikum durch glanzvolle Bühnenbilder und luxuriöse Kostüme, berühmte Diven, teure Tenöre und eine imposante Opernarchitektur, kurzum durch ein quantitatives Übertrumpfen des Gegners, die Vorzüge und die Attraktivität des eigenen Systems zu verdeutlichen, was bisweilen zu heftigen kulturpolitischen Auseinandersetzungen führte. Doch über dieses rein quantitative „Höher, schneller, weiter“ hinaus sollten die Opernhäuser vor allem qualitativ das Kulturverständnis des jeweiligen Teilstaates repräsentieren. Dies betraf das Verhältnis zu der im Nationalsozialismus verfemten Kunst sowie damit verbunden die Ästhetik der Aufführungen, außerdem den Umgang mit den Exilanten und die Frage nach der Freiheit der Kunst ; darüber hinaus die Rolle und Charakterisierung des spezifisch Nationalen in der Kultur, die Frage der gesellschaftlichen Funktion der Opernhäuser und damit verbunden die gewünschte Sozialstruktur des Publikums sowie letztlich umfassend das Verhältnis von Kunst, Staat und Nation. Die Arbeit fragt somit in einem Vergleich nach der Art und Weise nationaler kultureller Repräsentation der Berliner Opernbühnen vor dem Hintergrund der nationalsozialistischen Vergangenheit einerseits und der Konkurrenz der beiden deutschen Staaten im Kalten Krieg andererseits. Inwiefern kam es gegenüber den Jahren vor 1945 zu Wandlungen, inwiefern bestand restaurative Kontinuität ? Die Arbeit trägt dem erweiterten Politikverständnis der neueren geschichtswissenschaftlichen Forschung Rechnung.16 Ausgehend von der Überlegung, dass das Feld der Politik, verstanden als Bereich der Ordnung gesellschaftlicher Beziehungen, nicht auf zentralistische Entscheidungsprozesse in Parlamenten, politischen Verbänden und intermediären Organisationen beschränkt ist, wurde die Definitionsgrenze zwischen dem Politischen und Unpolitischen erweitert. Politik offener als „Kommunikation“ zu deuten führte dazu, auch nichtsprachliche gesellschaftliche Interaktion wie Rituale, Zeremonien und 16 Ute Frevert und Heinz-Gerhard Haupt (Hg.), Neue Politikgeschichte. Perspektiven einer historischen Politikforschung, Frankfurt/M. 2005 ; Thomas Mergel, „Überlegungen zu einer Kulturgeschichte der Politik“, in : Geschichte und Gesellschaft 28 (2002), S. 574–606.
20 Einleitung
symbolische Praktiken in den Blick zu nehmen.17 Indem der Inszenierungsund Darstellungsaspekt18 von Politik zunehmend Beachtung fand, rückte die politische Selbstdarstellung in Form von Architektur, internationalen Festspielen, Kunstausstellungen und Sportwettkämpfen, aber auch von Städten etwa durch das Feiern von Festen in den Blickpunkt.19 In diesem Zusammenhang 17 Siehe etwa : Johannes Paulmann, Pomp und Politik. Monarchenbegegnungen in Europa zwischen Ancien Régime und Erstem Weltkrieg, Paderborn 2000 ; Andreas W. Daum, Kennedy in Berlin. Politik, Kultur und Emotionen im Kalten Krieg, Paderborn u.a. 2003 ; Frieder Günther, Heuss auf Reisen. Die auswärtige Repräsentation der Bundesrepublik durch den ersten Bundespräsidenten, Stuttgart 2006 ; Hans-Georg Soeffner und Dirk Tänzler (Hg.), Figurative Politik. Zur Performanz der Macht in der modernen Gesellschaft, Opladen 2002 ; Hans Vorländer (Hg.), Zur Ästhetik der Demokratie. Formen der politischen Selbstdarstellung, Stuttgart/München 2003 ; David I. Kertzer, Ritual, Politics, and Power, New Haven/London 1988 ; Murray Edelman, Politik als Ritual. Die symbolische Funktion staatlicher Institutionen und politischen Handelns, Frankfurt/M./ New York 1976 ; Rüdiger Voigt (Hg.), Politik der Symbole. Symbole der Politik, Opladen 1989 ; Jan Andres, Alexa Geisthövel und Matthias Schwengelbeck (Hg.), Die Sinnlichkeit der Macht. Herrschaft und Repräsentation seit der frühen Neuzeit, Frankfurt/M./New York 2005 ; Andreas Dörner, Politischer Mythos und symbolische Politik. Der Hermann-Mythos : zur Entstehung des Nationalbewußtseins der Deutschen, Reinbek 1996. 18 Jürgen Martschukat und Steffen Patzold (Hg.), Geschichtswissenschaft und „performative turn“. Ritual, Inszenierung und Performanz vom Mittelalter bis zur Neuzeit, Köln/Weimar/Wien 2003. Siehe auch : Josef Früchtl und Jörg Zimmermann (Hg.), Ästhetik der Inszenierung. Dimensionen eines künstlerischen, kulturellen und gesellschaftlichen Phänomens, Frankfurt/M. 2001 ; Herbert Willems und Martin Jurga (Hg.), Inszenierungsgesellschaft. Ein einführendes Handbuch, Opladen/Wiesbaden 1998. 19 Paulmann, Repräsentationen. – Zur Selbstdarstellung von Städten siehe : Christophe Charle und Daniel Roche (Hg.), Capitales culturelles – Capitales symboliques. Paris et les expériences européennes XVIII–XXe siècles, Paris 2002 ; Lemke, Schaufenster ; Ders., Hg., Konfrontation und Wettbewerb. Wissenschaft, Technik und Kultur im geteilten Berliner Alltag (1948–1968), Berlin 2008 ; Adelheid von Saldern (Hg.), Inszenierte Einigkeit. Herrschaftsrepräsentation in DDR-Städten, Stuttgart 2003 ; Dies. (Hg.), Inszenierter Stolz. Stadtrepräsentation in drei deutschen Gesellschaften (1935–1975), Stuttgart 2005 ; Monika Gibas, „,Die Republik, das sind wir !‘ – Das propagandistische ‚Gesamtkunstwerk‘ Zehnter Jahrestag der DDR als nachholendes Initiationsritual”, in : Dieter Vorsteher (Hg.), Parteiauftrag : Ein neues Deutschland. Bilder, Rituale und Symbole der frühen DDR. Buch zur Ausstellung des Deutschen Historischen Museums vom 13. Dezember 1996 bis 11. März 1997, München/Berlin 1996, S. 217–235 ; Dies. „,Deckt alle mit den Tisch der Republik‘. Regie und Dramaturgie des DDR-Dezenniums am 7. Oktober 1959“, in : Monika Gibas und Dirk Schindelbeck (Hg.), „Die Heimat hat sich schön gemacht…“. 1959 : Fallstudien zur deutsch-deutschen Propagandageschichte, Leipzig 1994, S. 49–68 ; Dies. u.a. (Hg.), Wiedergeburten. Zur Geschichte der runden Jahrestage der DDR, Leipzig 1999. Zur politischen Dimension von Architektur siehe : Peter Müller, Symbolsuche. Die Ost-Berliner Zentrumsplanung zwischen Repräsentation und Agitation, Berlin 2004 ; Ingeborg Flagge und Wolfgang Jean Stock (Hg.),
Einleitung 21
wurde der Fokus der Forschung schließlich auf die politische Dimension der Kunstform Oper gelegt.20 Für die Studie ist dabei zum einen Philipp Thers vergleichende Monografie In der Mitte der Gesellschaft über Opernhäuser in Dresden, Lemberg und Prag von Bedeutung. Ausgehend von Benedict Andersons Konzept der Nation als ‚Imagined community‘21 befasst sich die an der Schnittstelle zwischen Geschichts- und Musikwissenschaft befindliche Arbeit mit der Frage nach der Konstruktion nationaler Identität durch die Institution Oper.22 Zum anderen ist Michael P. Steinbergs Studie über die Salzburger Festspiele23 von besonderer Bedeutung, in welcher der Autor mit der Kategorie des „nationalistischen Weltbürgertums“ eine grundlegende mentalitätsgeschichtliche Kategorie deutscher und österreichischer Intellektueller beschrieben hat, die in der Arbeit aufgegriffen wird. Der Stand der Forschung zu den drei Berliner Opernhäusern nach 1945 ist als unzureichend zu bezeichnen. Was die Geschichte der drei Bühnen anbelangt, ist man weitgehend auf Überblicksdarstellungen angewiesen, die nicht selten ins Anekdotische abschweifen.24 Das ist erstaunlich angesichts der genannten Architektur und Demokratie. Bauen für die Politik von der amerikanischen Revolution bis zur Gegenwart, Stuttgart 1992 ; Olaf Asendorf, Wolfgang Voigt und Wilfried Wang (Hg.), Botschaften. 50 Jahre Auslandsbauten der Bundesrepublik Deutschland. Eine Ausstellung des Deutschen Architekturmuseums, Bonn 2000. Grundlegend für die politische Dimension von Opernarchitektur : Monika Steinhauser, Die Architektur der Pariser Oper. Studien zu ihrer Entstehungsgeschichte und ihrer architekturgeschichtlichen Stellung, München 1969. 20 Müller/Toelle, Bühnen. 21 Benedict Anderson, Imagined Communities. Reflections on the Origins and Spread of Nationalism, 2. Auflage, London 1990. 22 Philipp Ther, In der Mitte der Gesellschaft. Operntheater in Zentraleuropa 1815–1914, Wien/ München 2006. – Zur Konstruktion nationaler Identität durch Musik allgemein siehe : Celia Applegate und Pamela Potter (Hg.), Music and German National Identity, Chicago 2002 ; Hermann Danuser und Herfried Münkler (Hg.), Deutsche Meister – böse Geister ? Nationale Selbstfindung in der Musik, Schliengen 2001 ; Marion Demuth (Hg.), Das Deutsche in der Musik. Kolloquium im Rahmen der 5. Dresdner Tage der zeitgenössischen Musik vom 1.–10. Oktober 1991, Leipzig/Dresden 1997 ; Helmut Loos und Stefan Keym (Hg.), Nationale Musik im 20. Jahrhundert. Kompositorische und soziokulturelle Aspekte der Musikgeschichte zwischen Ost- und Westeuropa. Konferenzbericht Leipzig 2002, Leipzig 2004. 23 Michael P. Steinberg, Ursprung und Ideologie der Salzburger Festspiele 1890–1938, München 2000. 24 Georg Quander (Hg.), Apollini et musis. 250 Jahre Opernhaus Unter den Linden, Frankfurt/M. 1992 ; Sabine Vogt-Schneider, „Staatsoper Unter den Linden“ oder „Deutsche Staatsoper“ ? Ausein-
22 Einleitung
großen gesellschaftlichen Bedeutung der Oper. Allerdings liegt mit der Dissertation von Joy Haslam Calico eine wichtige Untersuchung zur kulturpolitischen Bedeutung der Staatsoper vor, an welche diese Arbeit anknüpfen kann. Darin untersucht die Autorin am Beispiel von Brechts/Dessaus 1951 uraufgeführter Oper Das Verhör/Die Verurteilung des Lukullus und Hanns Eislers abgebrochenem Faust-Projekt von 1952 die systeminternen Auseinandersetzungen um eine neue nationale Opernästhetik.25 Anhand dieser Beispiele arbeitet Calico heraus, dass die Oper von der Kulturpolitik der DDR für den politischen Kampf um nationale Einheit instrumentalisiert worden ist. Relevanz besitzt für die Arbeit des Weiteren Katrin Stöcks Beitrag zur Nationaloperndebatte in der DDR, indem ebenfalls die politische Funktionalisierung der Kunstform Oper herausgestellt wird. Stöck zeichnet den gescheiterten Versuch der ostdeutschen Kulandersetzungen um Kulturpolitik und Spielbetrieb in den Jahren zwischen 1945 und 1955, Berlin 1998 ; Walter Rösler, Manfred Haedler und Micaela von Marcard, Das „Zauberschloß“ Unter den Linden. Die Berliner Staatsoper. Geschichte und Geschichten von den Anfängen bis heute, Berlin 1997 ; Werner Otto, Die Lindenoper. Ein Streifzug durch ihre Geschichte, Berlin 1980. – Zur West-Berliner Oper siehe : Curt A. Roesler, „Das Deutsche Opernhaus Berlin 1934–1945“, in : Deutsche Oper Berlin. Beiträge zum Musiktheater 6 (Spielzeit 1986/87), S. 333–365 ; Werner Bollert, 50 Jahre Deutsche Oper Berlin, Berlin 1962 ; Horst Goerges, Deutsche Oper Berlin, Berlin 1964 ; Max W. Busch, Die Deutsche Oper Berlin. Das Haus in der Bismarckstraße und seine Vorgänger, Berlin 1986 ; Gisela Huwe (Hg.), Die Deutsche Oper Berlin, Berlin 1984 ; Detlef Meyer zu Heringdorf, Das Charlottenburger Opernhaus von 1912 bis 1961. Eine Dokumentation. Von der privat-gesellschaftlich geführten Bürgeroper bis zur subventionierten Berliner „Städtischen Oper“, 2 Bde., Phil. Diss., Berlin 1988. – Zur Komischen Oper siehe : Albert Kost (Hg.), Komische Oper Berlin, Berlin 1997 ; Rolf Hosfeld, Boris Kehrmann und Rainer Wörtmann, Komische Oper Berlin, Hamburg 2001. – Siehe außerdem : Dietrich Steinbeck, „Auf der Suche nach der verlorenen Identität. Oper zwischen Kriegsende und Währungsreform“, in : Der Bär von Berlin. Jahrbuch des Vereins für die Geschichte Berlins 52 (2003), S. 103–114 ; „…daß die Musik nicht ohne Wahrheit leben kann“. Theater in Berlin nach 1945 – Musiktheater, Berlin 2001. 25 Joy Haslam Calico, The politics of Opera in the German Democratic Republic 1945–1961, Ph.D. diss, Duke University 1999. ; Dies., „,Für eine deutsche Nationaloper‘ : Opera in the Discourses of Unification and Legitimation in the German Democratic Republic“, in : Celia Applegate und Pamela Potter (Hg.), Music and German National Identity, Chicago 2002, S. 190–204. – Zum Lukullus siehe auch : Klaus Angermann (Hg.), Paul Dessau – Von Geschichte gezeichnet. Symposion Paul Dessau Hamburg 1994, Hofheim 1995 ; Albrecht Dümling, „Zwischen Engagement und Formalismus. Zur west-östlichen Rezeption von Brechts/Dessaus zwei ‚Lukullus‘-Fassungen“, in : Hanns-Werner Heister und Dietrich Stern (Hg.), Musik 50er Jahre, Berlin 1980, S. 172–189 ; Lars Klingberg, „,Lukullus‘ im Jahr 1951“, in : Beiträge zur Musikwissenschaft 33 (1992), S. 188–206 ; Joachim Lucchesi (Hg.), Das Verhör in der Oper. Die Debatte um die Aufführung „Das Verhör des Lukullus“ von Bertolt Brecht und Paul Dessau, Berlin 1993.
Einleitung 23
turpolitik in den 1950er- und 1960er-Jahren nach, per Dekret das neue Genre einer sozialistischen deutschen Gegenwartsoper begründen zu wollen.26 Von Nutzen ist für die Arbeit – neben Studien zur Kultur im Berlin des Kalten Krieges allgemein27 – insbesondere eine Monografie von Elizabeth Janik, die sich mit der Etablierung zweier unterschiedlicher musikalischer Traditionen im Berlin des Kalten Krieges beschäftigt.28 Die Autorin geht jedoch leider nur knapp auf die Oper ein. Zwar schildert sie die Auseinandersetzungen an der Staatsoper um Lukullus, doch lässt sie die Städtische Oper weitgehend außer Acht und thematisiert die dortige Debatte um die Aufführung von Moses und Aron unverständlicherweise überhaupt nicht. Von Interesse ist für die Arbeit des Weiteren ein Aufsatz von Thomas S. Grey über die Rezeption von Richard Wagners Die Meistersinger von Nürnberg als deutsche Nationaloper, wurde doch auch die Berliner Lindenoper im Jahr 1955 gerade mit jenem Werk feierlich eröffnet.29 So verwundert es, dass Greys Analyse mit dem Jahr 1945 endet, ohne auch nur mit einem Wort auf die Rezeption des Werkes in der Zeit nach 1945 einzugehen.
26 Kathrin Stöck, „Die Nationaloperndebatte in der DDR der 1950er und 1960er Jahre als Ins trument zur Ausbildung einer sozialistischen deutschen Nationalkultur“, in : Helmut Loos und Stefan Keym (Hg.), Nationale Musik im 20. Jahrhundert. Kompositorische und soziokulturelle Aspekte der Musikgeschichte zwischen Ost- und Westeuropa. Konferenzbericht Leipzig 2002, Leipzig 2004, S. 521–539. 27 Christine Fischer-Defoy (Hg.), „Kunst, im Aufbau ein Stein“. Die Westberliner Kunst- und Musikhochschulen im Spannungsfeld der Nachkriegszeit, Berlin 2001 ; „…und die Vergangenheit sitzt immer mit am Tisch“. Dokumente zur Geschichte der Akademie der Künste (West) 1945/1954– 1993, herausgegeben von der Stiftung Archiv der Akademie der Künste. Ausgewählt und kommentiert von Christine Fischer-Defoy, Berlin 1997 ; „Zwischen Diskussion und Disziplin“. Dokumente zur Geschichte der Akademie der Künste (Ost) 1945/50–1993, herausgegeben von der Stiftung Archiv der Akademie der Künste. In Zusammenarbeit mit Inge Jens, ausgewählt und kommentiert von Ulrich Dietzel und Gudrun Geißel, Berlin 1997 ; Andrea Schiller, Die Theaterentwicklung in der sowjetischen Besatzungszone (SBZ), Frankfurt/M. 1988 ; Petra Stuber, Spielräume und Grenzen. Studien zum DDR-Theater, Berlin 1998 ; Christa Hasche, Traute Schölling und Joachim Fiebach (Hg.), Theater in der DDR, Berlin 1994 ; Wolfgang Schivelbusch, Vor dem Vorhang. Das geistige Berlin 1945–1948, München/Wien 1995. 28 Elizabeth Janik, Recomposing German music. Politics and musical tradition in Cold War Berlin, Leiden 2005. 29 Thomas S. Grey, „Die Meistersinger as National Opera (1868–1945)”, in : Applegate/Potter, Music, S. 78–104.
24 Einleitung
Was die Opernkultur im Berlin des Kalten Krieges angeht, sind darüber hinaus zwei Aufsätze von Michael Lemke von Relevanz. Der eine thematisiert den sogenannten „Sängerkrieg“30 Mitte der 1950er-Jahre, in dem es um den Kampf der Bühnen um die besten Sänger ging. Lemke kommt zu dem Ergebnis, dass der West-Berliner Senat mit seiner äußerst repressiven Strategie gegenüber der OstBerliner Bühnenkonkurrenz wesentlich zur Spaltung der Berliner Opernkultur beigetragen habe. Der andere befasst sich mit den systeminternen Auseinandersetzungen um eine Vertragsverlängerung Walter Felsensteins als Intendant der Komischen Oper in den Jahren 1957 und 1958, anhand derer die große politische Bedeutung des Künstlers für die kulturelle Repräsentation des ostdeutschen Staates deutlich wird.31 Wichtig sind für die Arbeit darüber hinaus theaterwissenschaftliche Studien zu Walter Felsensteins künstlerischem Konzept eines realistischen Musiktheaters.32 Während Carl Ebert mit seinem Wirken als Intendant der Städtischen Oper Berlin der Jahre 1931 bis 1933 und 1954 bis 1961 bislang überraschenderweise kaum von der theatergeschichtlichen Forschung berücksichtigt wurde33, gilt dies nicht für Heinz Tietjen, dessen Wirken in der Zeit des Nationalsozialismus in jüngster Zeit von den Historikern Hannes Heer und Boris von Haken einer außerordentlich kritischen Interpretation unterzogen worden ist.34 30 Michael Lemke, „Der ‚Sängerkrieg‘ in Berlin“, in : Lemke, Schaufenster, S. 269–295. 31 Ders., „Der ‚Fall‘ Felsenstein“, in : Michael Lemke (Hg.), Konfrontation und Wettbewerb. Wissenschaft, Technik und Kultur im geteilten Berliner Alltag (1948–1968), Berlin 2008, S. 209–231. 32 Robert Braunmüller, Oper als Drama. Das „realistische Musiktheater“ Walter Felsensteins, Tübingen 2002 ; Werner Hintze, Clemens Risi und Robert Sollich (Hg.), Realistisches Musiktheater. Walter Felsenstein : Geschichte, Erben, Gegenpositionen, Berlin 2008. 33 Dietrich Steinbeck, „,Geistiger Vater all unserer Bemühungen‘. Dem Regisseur Carl Ebert zum 115. Geburtstag“, in : Berlin in Geschichte und Gegenwart 21 (2002), S. 159–172 ; Peter Ebert, In this theatre of man’s life. The biography of Carl Ebert, Lewes 1999. – Siehe demgegenüber die Forschungsbeiträge zu Carl Eberts künstlerischem Wirken in der Türkei 1936–49 : Frithjof Trapp, „Eine Schule für Schauspiel- und Musiktheater in der Türkei“, in : Frithjof Trapp. u.a. (Hg.), Handbuch des deutschsprachigen Exiltheaters 1933–1945. Bd.1 : Verfolgung und Exil deutschsprachiger Theaterkünstler, München 1999, S. 365–375 ; Cornelia Maria ZimmermannKalyoncu, Deutsche Musiker in der Türkei im 20. Jahrhundert, Frankfurt/M. 1985, S. 87ff. 34 Hannes Heer und Boris von Haken : „Der Überläufer. Heinz Tietjen. Der Generalintendant der Preußischen Staatstheater im Dritten Reich“, in : Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 58 (2010), S. 28–53. – Siehe außerdem : Oliver Rathkolb, Führertreu und gottbegnadet. Künstlereliten im Dritten Reich, Wien 1991 ; Ulrich Teusch, „Gefährliches Doppelspiel. Der Theatermann Heinz
Einleitung 25
Was die Etablierung eines neuen, ‚werktätigen‘ Publikums in Oper und Theater aufseiten der DDR anbelangt, liefert Annette Schuhmann mit ihrer Arbeit aus dem Jahr 2006 zur Kulturarbeit im sozialistischen Betrieb, von wo aus der kollektive Theaterbesuch organisiert wurde, grundlegende Anregungen.35 Zum Wiederaufbau der Lindenoper liegt eine bislang nicht publizierte Magisterarbeit des Architekturhistorikers Uwe Schwartz vor.36 Während der Niederschrift der Arbeit hat, ausgelöst durch die anstehende Renovierung der Lindenoper, die Frage des Umgangs mit deren Architektur 2008 eine breite und heftige gesellschaftliche Debatte ausgelöst. Hintergrund ist, dass der ursprünglich von Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff für Friedrich II. errichtete und im Zweiten Weltkrieg schwer zerstörte Bau von der DDR in den Jahren 1951 bis 1955 keineswegs im Sinne des Denkmalschutzes wiederaufgebaut worden ist, sondern in weiten Teilen eine Neuschöpfung des Architekten Richard Paulick darstellt, dessen historisierender Stil am ehesten als frühklassizistisch zu bezeichnen ist. Die Debatte, bei welcher der wettbewerbsprämierte, in einer heutigen Architektursprache gestaltete Entwurf des Architekten Klaus Roth gegen eine Sanierung in der Formensprache Paulicks stand, wurde vom Berliner Senat schließlich zugunsten der letzteren entschieden. Die Positionen in der Debatte, in der nicht selten historische Sachverhalte verdreht wurden, sind in einem Sonderheft von Theater der Zeit mit dem Titel Sanieren oder Demolieren ? dokumentiert.37 Anders als die Architektur der Lindenoper wurde diejenige der Deutschen Oper Berlin von der Forschung bislang kaum beachtet. Lediglich Tietjen und seine Rolle in der NS-Zeit“, in : Neue Züricher Zeitung vom 02.04.2005. 35 Annette Schuhmann, Kulturarbeit im sozialistischen Betrieb. Gewerkschaftliche Erziehungspraxis in der SBZ/DDR 1946 bis 1970, Köln/Weimar/Wien 2006, S. 225–250. – Siehe dazu auch : Fabian Bien, „,Bedürfnis aller Werktätigen‘ ? – Zur Etablierung eines neuen Opernpublikums in der DDR am Beispiel der Ost-Berliner Komischen Oper in den 1950er Jahren“, in : Sven Oliver Müller u.a. (Hg.), Oper im Wandel der Gesellschaft. Kulturtransfers und Netzwerke des Musiktheaters im modernen Europa, Wien/München 2010, S. 57–68. 36 Uwe Schwartz, Der Wiederaufbau der Staatsoper Unter den Linden, Berlin, von Richard Paulick. Unveröffentlichte Magisterarbeit, Berlin 1999. In Form eines Sammelbandbeitrages liegen immerhin die wichtigsten Ergebnisse publiziert vor : Uwe Schwartz, „Der ‚rote Knobelsdorff‘. Richard Paulick und der Wiederaufbau der Staatsoper Unter den Linden“, in : Peter Müller und Peter Thöner (Hg.), Bauhaus-Tradition und DDR-Moderne. Der Architekt Richard Paulick, München 2006, S. 107–124. 37 Sanieren oder demolieren ? Berlins Opernalternative. Sonderausgabe Theater der Zeit, Juli 2008.
26 Einleitung
ein Sammelband hat bislang das Schaffen ihres Architekten Fritz Bornemann gewürdigt.38 Dessen Leistung sei es gewesen, so das Fazit von Susanne Schindler und Nikolaus Bernau, mit seinen Bauten einen „Ausdruck für die Demokratieund Kultursehnsucht“ der frühen BRD zu finden und dabei „durch Bescheidenheit einen Neuanfang zu suchen“.39 Betrachtet man die musikwissenschaftliche und historische Forschung zur musikalischen Hochkultur nach 1945 in der Bundesrepublik allgemein, stellt sich dieser Bereich als ein Hort der Restauration dar. Zwar werden hier manche Tendenzen der Modernisierung gesehen40, ansonsten aber, so die weitgehend einhellige Meinung, sei die musikalische Hochkultur vor allem von Restauration geprägt gewesen41 : Michael H. Kater betont, dass sich bei den Westdeutschen mithilfe der Konstruktion einer „Stunde null“ eine Schlussstrichmentalität etabliert habe, durch die eine kritische Aufarbeitung der Rolle der Musik im „Dritten Reich“ vereitelt worden sei. So seien die im Nationalsozialismus erfolgreichen Künstler auch in der Nachkriegszeit wieder in ihre alte Position eingerückt, womit der Schwerpunkt des Repertoires weiterhin auf dem tradierten klassisch-romantischen Repertoire gelegen habe. Überdies hätten sich dabei die alten kulturellen Feindbilder erhalten. Arnold Schönberg als Inbegriff der kulturellen Moderne etwa sei nach wie vor das Hauptangriffsziel rechter und traditionalistischer Kräfte geblieben.42 Die Einschätzung Katers wird geteilt 38 Susanne Schindler (Hg.), Inszenierte Moderne. Zur Architektur von Fritz Bornemann, Berlin 2003, darin : Markus Kilian, „Zurückhaltende Raumbildungen. Die Opern und Theater von Fritz Bornemann“, S. 48–65. 39 Susanne Schindler und Nikolaus Bernau, „Einleitung. Fritz Bornemann – ein Weg in die Moderne“, in : Schindler, Moderne, S. 8–9, hier S. 9. 40 Zu nennen ist in diesem Zusammenhang der Südwestfunk Baden-Baden unter Heinrich Strobel oder die avantgardistischen Plattformen in Donaueschingen und Darmstadt. Siehe dazu : Gesa Kordes, „Darmstadt, Postwar Experimentation, and the West German Search for a New Musical Identity“, in : Celia Applegate und Pamela Potter (Hg.), Music and German National Identity, Chicago 2002, S. 205–217 ; Gianmario Borio und Hermann Danuser (Hg.), Im Zenit der Moderne. Die internationalen Ferienkurse für Neue Musik Darmstadt 1946–1966, 4 Bd., Freiburg 1997. 41 Siehe zuletzt : Sven Oliver Müller, „Ein fehlender Neuanfang. Das bürgerliche Musikleben in der Bundesrepublik nach 1945“, in : Gunilla Budde, Eckart Conze und Cornelia Rauh (Hg.), Bürgertum nach dem bürgerlichen Zeitalter. Leitbilder und Praxis seit 1945, Göttingen 2010, S. 255–269. 42 Michael H. Kater, Komponisten im Nationalsozialismus. Acht Porträts, Berlin 2004, S. 349–376.
Einleitung 27
von Pamela Potter. In ihrer Studie zur deutschen Musikwissenschaft weist sie darauf hin, dass diese Disziplin in den Jahren nach 1945 in der BRD vor allem von ehemaligen Nationalsozialisten besetzt gewesen sei, die an ihren alten Vorstellungen weitgehend festgehalten hätten.43 Auch David Monod unterstreicht mit seiner Arbeit Settling Scores, in der er die Entnazifizierung der deutschen Musiker durch die amerikanischen Besatzungsbehörden untersucht hat, die Einschätzung vom restaurativen Charakter der bundesdeutschen Musikkultur. Monod kommt in seiner Arbeit zu dem Ergebnis, dass trotz mancher Erfolge der Entnazifizierung das eigentliche Anliegen der amerikanischen Besatzungsbehörden letztlich nicht erreicht werden konnte, nämlich die deutsche Vorstellung von der Überlegenheit der eigenen Kultur zu überwinden.44 Was schließlich die Bayreuther Festspiele als das international wichtigste Opernfestival der Bundesrepublik angeht, herrscht auch hier in der Forschung das Bild von der Restauration der Verhältnisse vor.45 Allerdings gibt es inzwischen eine differenzierende Position, die Wieland Wagners Bemühungen hervorhebt, den Komponisten gewissermaßen zu entgermanisieren.46 Die Frage, ob es sich bei der musikalischen Hochkultur in der frühen DDR um einen Bereich der Restauration oder des Wandels gehandelt habe, fällt in 43 Pamela M. Potter, Die deutscheste der Künste. Musikwissenschaft und Gesellschaft von der Weimarer Republik bis zum Ende des Dritten Reiches, Stuttgart 2000. 44 David Monod, Settling Scores. German Music, Denazification, and the Americans, 1945–1953, Chapel Hill/London 2005, S. 263. – Ein Kapitel aus Monods Arbeit befasst sich im Übrigen eigens mit der Situation in Berlin : Hier sei die Entnazifizierung aufgrund der interalliierten Konkurrenz gescheitert, innerhalb derer sich die Russen den Künstlern gegenüber außerordentlich nachgiebig gezeigt hätten, sodass der strenge Kurs der Westalliierten bei der Entnazifizierung keine Wirkung habe entfalten können. War ein Künstler etwa in den Westsektoren mit einem Auftrittsverbot belegt, konnte er im Osten seiner Kunst ungehindert nachgehen. Ebd., S. 68– 79. – Die These vom Fortbestehen der Vorstellung von der Überlegenheit der deutschen Kultur gegenüber der Massenkultur amerikanischer Provenienz in der BRD nach 1945 findet sich auch in : Albrecht Riethmüller, „Deutsche Leitkultur und neues Leitbild USA in der frühen Bundesrepublik“, in : Lars Koch (Hg.), Modernisierung als Amerikanisierung ? Entwicklungslinien der westdeutschen Kultur 1945–1960, Bielefeld 2007, S. 215–232. 45 Monod, Scores, S. 253ff ; Karbaum, Studien, S. 106 ; Sabine Henze-Döring, „Kulturelle Zentren in der amerikanischen Besatzungszone. Der Fall Bayreuth“, in : Gabriele Clemens (Hg.), Kulturpolitik im besetzten Deutschland 1945–1949, Stuttgart 1994, S. 39–54. 46 Ingrid Kapsamer, „Zu Wieland Wagners Ring-Inszenierungen 1951 und 1965“, in : Die Szene als Modell. Die Bühnenbildmodelle des Richard-Wagner-Museums und der Ring des Nibelungen in Bayreuth 1876–2000, München/Berlin 2006, S. 77–95.
28 Einleitung
der Forschung noch deutlicher zugunsten der Restauration aus : Verwiesen wird dabei auf die Formalismuskampagne zu Beginn der 50er-Jahre, bei der es nach dem Ende des „Dritten Reiches“ erneut zur Ausgrenzung der kulturellen Moderne gekommen und demgegenüber das klassische musikalische Erbe als Vorbild einer neuen sozialistischen Musikkultur kanonisiert worden sei.47 Im Gegensatz zum Aspekt der musikalischen Hochkultur erscheinen die 1950er-Jahre im Ganzen in der Bundesrepublik in der zeit- und kulturhistorischen Forschung der letzten 15 Jahre jedoch längst nicht mehr als ausschließlich restaurative Epoche. Galt die Dekade vor allem für die Generation von 1968 als eine Zeit des wieder aufgerichteten Obrigkeitsstaates, in der ehemalige Nationalsozialisten in Politik, Wirtschaft und Kultur problemlos rehabilitiert wurden, in welcher die nationalsozialistische Vergangenheit tabuisiert war und der kapitalistische Wohlstand des Wirtschaftswunders jegliche Kritik an den gesellschaftlichen Zuständen erlahmen ließ, hebt die Forschung heute gleichermaßen Aspekte des Wandels hervor.48 Zur Analyse von Wandel und Modernisierung 47 Daniel Zur Weihen, Komponieren in der DDR. Institutionen, Organisationen und die erste Komponistengeneration bis 1961. Analysen, Köln/Weimar/Wien 1999 ; David Gerard Tompkins, Composing the Party Line. Music and Politics in Poland and East Germany, 1948–1957, Ph.D. diss, Columbia University 2004 ; Lars Klingberg, „Politisch fest in unseren Händen“. Musikalische und musikwissenschaftliche Gesellschaften in der DDR. Dokumente und Analysen, Kassel 1997 ; Maren Köster, Musik-Zeit-Geschehen. Zu den Musikverhältnissen in der SBZ/DDR 1945–1952, Saarbrücken 2002 ; Matthias Tischer (Hg.) Musik in der DDR. Beiträge zu den Musikverhältnissen eines verschwundenen Staates, Berlin 2005 ; Michael Berg, Albrecht von Massow und Nina Noeske (Hg.), Zwischen Macht und Freiheit. Neue Musik in der DDR, Köln/Weimar/Wien 2004. – Siehe zur Kanonisierung des klassischen kulturellen Erbes und der Ausgrenzung der kulturellen Moderne in der DDR-Kulturpolitik allgemein : Lothar Ehrlich und Gunther Mai (Hg.), Weimarer Klassik in der Ära Ulbricht, Köln/Weimar/Wien 2000 ; Lothar Ehrlich und Gunther Mai (Hg.), Weimarer Klassik in der Ära Honecker, Köln/Weimar/Wien 2001. Bestätigt wird dieses Bild durch Arbeiten zu Literatur, Malerei und Architektur in der DDR : Manfred Jäger, Kultur und Politik in der DDR. Ein historischer Abriß, Köln 1994 ; Günter Feist, Eckhard Gillen und Beatrice Vierneisel (Hg.), Kunstdokumentation SBZ/DDR 1945–1990. Aufsätze, Berichte, Materialien, Köln 1996, darin vor allem : Rüdiger Thomas, „Staatskultur und Kulturnation. Anspruch und Illusion einer ‚sozialistischen deutschen Nationalkultur‘“, S. 16–41 ; Andreas Schätzke, Zwischen Bauhaus und Stalinallee. Architekturdiskussion im östlichen Deutschland 1945–1955, Braunschweig/Wiesbaden 1991 ; Werner Durth, Jörn Düwel und Niels Gutschow, Architektur und Städtebau der DDR. Band 1 : Ostkreuz. Personen, Pläne, Perspektiven. Band 2. : Aufbau. Städte, Themen, Dokumente, Frankfurt/M./New York 1998 ; Joachim Palutzki, Architektur in der DDR, Berlin 2000. 48 Axel Schildt und Arnold Sywottek (Hg.), Modernisierung im Wiederaufbau. Die westdeutsche
Einleitung 29
dienen die Kategorien „Amerikanisierung“49, womit die Übertragung amerikanischer politischer, ökonomischer und kultureller Modelle auf die Bundesrepublik gemeint ist, und „Westernisierung“, die Entstehung einer „gemeinsamen Werteordnung in den Gesellschaften des Nordatlantiks“.50 Bestätigung erhalten beide Modelle durch die Deutung der Entwicklung der Bundesrepublik als Ziel eines „langen Wegs nach Westen“51 (Heinrich August Winkler) und als „geglückte Demokratie“52 (Edgar Wolfrum). Befördert worden seien die bundesrepublikanischen Wandlungsprozesse demnach durch die Konstellation einer „dreifachen Zeitgeschichte“ (Hans Günter Hockerts), bei der die Westalliierten vor dem Hintergrund der NS-Vergangenheit und im Rahmen der Systemkonkurrenz besondere Anstrengungen unternommen hätten, die Westdeutschen von ihrem vermeintlich politisch-kulturellen Sonderweg wegzuführen. Während sich die Forschung zur Bundesrepublik auf der einen Seite mit Amerikanisierungsund Westernisierungsprozessen beschäftigt hat, gilt deren Aufmerksamkeit auf der anderen Seite inzwischen auch dem Beharrungsvermögen und dem Einfluss älterer ideengeschichtlicher Traditionslinien.53 Wegen der Gleichzeitigkeit von Aspekten der Kontinuität und Diskontinuität spricht der Literaturwissenschaftler Georg Bollenbeck somit treffend von den „janusköpfigen 50er Jahren“.54 Richtschnur für dessen einflussreiche Analyse von Restauration und Wandel in Gesellschaft der 50er Jahre, Bonn 1998. Siehe auch : Hanna Schissler (Hg.), The Miracle Years. A Cultural History of West Germany 1949 to 1968, Princeton 2001 ; Ulrich Herbert, Wandlungsprozesse in Westdeutschland. Belastung, Integration, Liberalisierung 1945–1980, Göttingen 2002, Werner Faulstich (Hg.), Die Kultur der 50er Jahre, Paderborn 2002. 49 Siehe dazu : Konrad Jarausch und Hannes Siegrist (Hg.), Amerikanisierung und Sowjetisierung in Deutschland 1945–1970, Frankfurt/M./New York 1997 ; Alexander Stephan und Jochen Vogt (Hg.), America on my mind. Zur Amerikanisierung der deutschen Kultur seit 1945, Paderborn 2006. 50 Anselm Doering-Manteuffel, Wie westlich sind die Deutschen ? Amerikanisierung und Westernisierung im 20. Jahrhundert, Göttingen 1996, S. 13. 51 Heinrich August Winkler, Der lange Weg nach Westen, 2 Bde., München 2000. 52 Edgar Wolfrum, Die geglückte Demokratie. Geschichte der Bundesrepublik Deutschland von ihren Anfängen bis zur Gegenwart, Stuttgart 2006. 53 Heinz Bude und Bernd Greiner (Hg.), Westbindungen. Amerika in der Bundesrepublik, Hamburg 1999 ; Lars Koch (Hg.), Modernisierung als Amerikanisierung ? Entwicklungslinien der westdeutschen Kultur 1945–1960, Bielefeld 2007. 54 Georg Bollenbeck und Gerhard Kaiser (Hg.), Die janusköpfigen 50er Jahre. Kulturelle Moderne und bildungsbürgerliche Semantik III, Wiesbaden 2000.
30 Einleitung
der Zeit nach 1945 ist die Frage der Durchsetzung der kulturellen Moderne, ob in der Spielart der avantgardistischen Hoch- oder der konsumistischen Massenkultur. Bollenbeck begreift den Niedergang kollektiver bildungsbürgerlicher Kunstvorstellungen und die im Gegenzug dazu zunehmende gesellschaftliche Bejahung der internationalen kulturellen Moderne als grundlegend für die Stabilität der Bundesrepublik.55 Den Gradmesser bildet für ihn die „Deemphatisierung des Volksbegriffes“ : Die Kunst habe demnach ihren Status als „symbolisch vergesellschaftende Macht“56 eingebüßt, sodass andere Nationen nach 1945 nicht mehr im Namen einer wie auch immer definierten deutschen Nationalkultur hätten herabgewürdigt werden können. Während Bollenbeck für die BRD ein „unaufgeregte[s] Ende“57 bildungsbürgerlicher Kunstvorstellungen konstatiert, wurde von der Forschung für die DDR der 1950er-Jahre – entgegen dem eigenen, innovativen Anspruch des sozialistischen Staates – deren Fortbestehen hervorgehoben. Thomas La Presti hat dies anhand der von der Kulturpolitik verhinderten Faustus-Oper von Hanns Eisler herausgearbeitet58 ; zwei weitere Beiträge zur Kultur in der DDR kommen zu demselben Ergebnis.59 Die Berliner Opernbühnen konkret unter der von Bollenbeck entworfenen Perspektive, nämlich der Frage nach dem Verhältnis zwischen bildungsbürgerlichen Kunstvorstellungen und kultureller Moderne zu untersuchen, ist von Gewinn für die historische Forschung, da die Oper bis 1945 grundlegend zu jener verhängnisvollen Vorstellung einer kulturellen Überlegenheit der Deutschen beigetragen hatte. So greift die Arbeit methodisch den Ansatz Bollenbecks auf, den dieser zunächst in seiner Studie Tradition, Avantgarde, Reaktion60 aus 55 Georg Bollenbeck und Gerhard Kaiser, „Einleitung“, in : ebd., S. 7–15, hier S. 8. 56 Ebd. 57 Ebd., S. 208. 58 Thomas La Presti, „Verhinderte Moderne : bildungsbürgerliche Semantik in der Debatte um Eislers Johann Faustus“, in : Georg Bollenbeck und Thomas La Presti (Hg.), Traditionsanspruch und Traditionsbruch. Die deutsche Kunst und ihre diktatorischen Sachwalter. Kulturelle Moderne und bildungsbürgerliche Semantik II, Wiesbaden 2002, S. 174–184. 59 Thomas La Presti, „Bildungsbürgerliche Kontinuitäten und diktatorische Praxis : Zur Kulturpolitik in der DDR der 50er Jahre“, in : Bollenbeck/Kaiser, 50er Jahre, S. 30–52 ; Gunter Schandera, „Zur Resistenz bildungsbürgerlicher Semantik in der DDR der fünfziger und sechziger Jahre“, in : Bollenbeck/La Presti, Traditionsanspruch, S. 161–173. 60 Georg Bollenbeck, Tradition, Avantgarde, Reaktion. Deutsche Kontroversen um die kulturelle Moderne 1880–1945, Frankfurt/M. 1995. Siehe auch : Wolfgang J. Mommsen, „Die Herausforde-
Einleitung 31
dem Jahre 1999 entwickelt und mit dem er an sein Buch Bildung und Kultur61 angeknüpft hat. Der Autor beschreibt darin als „bildungsbürgerliche Semantik“ drei langlebige, im späten 18. Jahrhundert entstandene Argumentationsfiguren des deutschen Bildungsbürgertums, die dem Diskurs um das Nationale in der Kunst zugrunde gelegen und deren Genese, Funktion und Charakter gekennzeichnet hätten62 : 1. Ursprungsmythologische Argumentationsfigur : „Kunst ist Ausdruck des Volkes, […] sie ist für das Volk da“63 und damit Garant für die Einheit der Nation. Diese Vorstellung gehe, so Bollenbeck, ganz wesentlich auf Johann Gottfried Herder zurück, von dem Ende des 18. Jahrhunderts die wirkungsmächtige Kategorie des Volkes als idealisierte Abstammungs-, Sprach- und Kulturgemeinschaft konstruiert worden sei. Herder habe mit seinem Volksbegriff nicht eine konkrete soziale Schicht in der Gegenwart gemeint, sondern eine normativ überhöhte, mythologisierte Gemeinschaft, die, wie Bollenbeck formuliert, „einen glücklichen vergangenen Zustand, eine gegenwärtige kulturelle Norm und eine zukünftige politische Hoffnung“64 impliziert habe. Angesichts der Erfahrung des deutschen politischen und religiösen Partikularismus im 18. und 19. Jahrhundert habe der Bezug zu der „vermeintliche[n] beständige[n] Ursprünglichkeit des Volkes“ eine „kompensatorische Rückversicherung“65 dargestellt. Die Vorstellung nationaler Identität im Medium der Nationalkultur, welche Herder in Volksliedern und in den Werken einzelner künstlerischer Genies verdichtet gesehen habe, sei dann um 1800 ins kollektive Gedächtnis des deutschen Bildungsbürgertums gelangt und bald auch auf die anderen Künste übertragen worden. Wenn auch der Nationalsozialismus in einem völkischen Sinne an dieses Konzept anknüpfen konnte, ist doch mit Bollenbeck zu betonen, dass es zunächst nicht auf eine deutsche kulturelle Überlegenheit und Ausgrenzung rung der bürgerlichen Kultur durch die künstlerische Avantgarde“, in : Ders., Bürgerliche Kultur und politische Ordnung. Künstler, Schriftsteller und Intellektuelle in der deutschen Geschichte 1830–1933, Frankfurt/M. 2002, S. 158–177. 61 Georg Bollenbeck, Bildung und Kultur. Glanz und Elend eines deutschen Deutungsmusters, Frank furt/M./Leipzig 1994. 62 Bollenbeck, Tradition, vor allem S. 50–98. 63 Ebd., S. 53. 64 Ebd., S. 58. 65 Ebd.
32 Einleitung
gegenüber der Kunst anderer Völker zielte und insofern nicht von einem „direkten Weg von Herder zu Hitler“66 gesprochen werden kann. Zwar brach ein solches genetisch-organisches Denken mit aufklärerisch-vernünftigen Vorstellungen von geschichtlich geprägten und somit wandelbaren kulturellen Identitäten, des Weiteren richtete es sich zugunsten der Idee verschiedener Nationen und dementsprechender „Nationalgeister“ gegen das Abstraktum Menschheit, und schließlich waren einem solchen Denken immer auch gleichzeitig Tendenzen zur Exklusion inhärent.67 Dennoch blieb es bis ins 19. Jahrhundert hinein mehrheitlich in einem liberalen Sinne auf die „Vorstellung einer allgemeinen Humanität und Menschenvernunft“68 bezogen. 2. Bildende Funktion : Kunst bildet das Individuum und die Nation.69 Bildung wird dabei in einem ethischen Sinne verstanden als etwas, das die Geschicke der Menschen zu bessern imstande ist. Diese Vorstellung geht, wie Bollenbeck erläutert, auf die europäische Aufklärung zurück, die Ethik und Moral aus den Zwängen kirchlicher Dogmen zu befreien versuchte ; ihre spezifisch deutsche Ausprägung habe diese Argumentationsfigur, so der Literaturwissenschaftler, in Friedrich Schillers wirkungsmächtigen Briefen Über die ästhetische Erziehung des Menschen (1795) erfahren, in denen der Dichter eine Überwindung der vermeintlichen Selbstentfremdung des von „Geschäftsgeist“ geprägten Menschen seiner Zeit durch Kunsterziehung in Aussicht gestellt habe. Bei Schillers Briefen handelt es sich demnach um das Konzept eines Weges hin zur politischen Freiheit durch Kunst, habe doch Schiller wie die Mehrheit der deutschen Intellektuellen in jenen Jahren eine Revolution wie in Frankreich aufgrund der abschreckenden Wirkung der dortigen terreur abgelehnt. Der Neuhumanismus schließlich habe den Anspruch der bildenden Funktion der Kunst im deutschen Bildungsbürgertum popularisiert und über die Literatur hinaus auch auf die anderen Künste übertragen. 3. Schöner Schein : „Kunst bietet sich als eine höhere Wirklichkeit des schönen Scheins dar, als eine autonome, zeitenthobene Welt der Freiheit und Sittlichkeit, 66 Ebd., S. 53. 67 Siehe dazu etwa : Dieter Langewiesche, Nation, Nationalismus, Nationalstaat in Deutschland und Europa, München 2000, S. 49ff. 68 Bollenbeck, Tradition, S. 57. 69 Ebd., S. 62ff.
Einleitung 33
der Schönheit und Wahrheit.“70 Seit dem späten 18. Jahrhundert habe im Wandel der ästhetischen Reflexion das „Kunstschöne“ (Georg Wilhelm Friedrich Hegel) eine normative Geltung erlangt. Für Schiller habe das Schöne, so Bollenbeck, notwendig in Bezug zu Wahrheit und Sittlichkeit gestanden71, sei es doch für ihn die Schönheit gewesen, durch die man „zu der Freyheit wandert“.72 Im Laufe des 19. Jahrhunderts sei dabei vom deutschen Bildungsbürgertum im Bereich der Literatur die Kunst der Weimarer Klassik zum ästhetischen Ideal erhoben worden. Mithilfe dieser drei Argumentationsfiguren gelingt es Bollenbeck, die Heftigkeit der deutschen Kontroversen um die kulturelle Moderne in den Jahren zwischen 1880 und 1945 zu erklären : Träger der deutschen Nationalkultur sei das sich im ausgehenden 18. Jahrhundert formierende Bildungsbürgertum gewesen, das seine gesellschaftliche Hegemonie angesichts der beschränkten politischen Partizipationsmöglichkeiten kompensatorisch im Bereich Kunst und Kultur zu verwirklichen gesucht hätte. So sei eine „einzigartig enge Koalition von sozialer, kultureller und nationaler Identität im Medium der Nationalkultur“73 entstanden. Mit dem Aufkommen der kulturellen Moderne im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts, die mit den traditionellen Vorstellungen von Genese, Funktion und Charakter der Nationalkultur gebrochen habe, spätestens dann in den 1920er- Jahren infolge von Inflation und Weltwirtschaftskrise habe das verunsicherte Bürgertum um seinen lange Zeit unangefochtenen hegemonialen Status gebangt. Angesichts dieser Situation sei die kulturelle Moderne in zunehmend weiten Kreisen als ‚undeutsch‘ oder ‚kosmopolitisch‘ abgelehnt und bekämpft worden. Auf diese Weise kann Bollenbeck verständlich machen, warum das „Dritte Reich“ für das Bildungsbürgertum als Retter der vermeintlich gefährdeten deutschen Kultur akzeptiert werden konnte. Die drei beschriebenen Argumentationsfiguren dienen als methodisch-strukturelle Basis der Untersuchung. Sie bilden – zuzüglich einer noch zu beschrei70 Ebd., S. 71. 71 Ebd., S. 74. 72 Friedrich Schiller, Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen, in : Schillers Werke. Nationalausgabe, Bd. 20 : Philosophische Schriften. Erster Teil, Weimar 1962, S. 312. 73 Georg Bollenbeck, „Die fünfziger Jahre und die Künste. Kontinuität und Diskontinuität“, in : Bollenbeck/Kaiser, 50er Jahre, S. 190–213, hier S. 201.
34 Einleitung
benden vierten – die Analysekategorien, unter denen die drei Berliner Opernbühnen historisch vergleichend untersucht werden. Jene Aspekte spielten auch im Zusammenhang mit der Idee einer idealen deutschen Opernbühne seit Ende des 18. Jahrhunderts eine grundlegende Rolle. Sie betrafen dabei, das ist wichtig, Oper wie Schauspiel gleichermaßen. So gehörte es – nachdem die Intellektuellen die Skepsis der Aufklärungszeit gegenüber der Kunstform überwunden hatten – erstens grundlegend zur Vorstellung von einer idealen Opernbühne, dass diese der sittlichen Bildung der Nation zu dienen habe. Dass diese Forderung meist konträr zum Publikum stand, das sich in der Oper lieber unterhalten als belehren lassen wollte, wozu sich diese Kunstform aufgrund der ‚sinnlichen‘ Ebene der Musik weit eher eignete als das Sprechtheater, hinderte die Intellektuellen jedoch nicht daran, diesen Anspruch immer wieder zu aktualisieren. Zweitens gehörte es entsprechend der von Bollenbeck beschriebenen ursprungsmythologischen Argumentationsfigur konstitutiv zu den Vorstellungen von einer nationalen Opernbühne, dass eine solche durch entsprechende Aufführungen die Etablierung eines spezifisch nationalen Repertoires fördere. Was drittens die Ästhetik der auf den Nationalbühnen zu spielenden Werke anbelangt, stand das Ideal des Kunstschönen bis zum letzten Viertel des 19. Jahrhunderts nicht infrage, wobei – analog zur Weimarer Klassik in der Literatur – als ästhetisches Ideal im Bereich der Musik die Vertreter der Wiener Klassik Haydn, Mozart und Beethoven galten. Den drei genannten Aspekten ist allerdings noch ein vierter hinzuzufügen, der die Vorstellungen von einer idealen deutschen Opernbühne ebenso grundlegend geprägt hat : die Forderung, dass ein solches Haus eine Musterbühne zu sein, dass es also optimale künstlerische und theatertechnische Aufführungen zu bieten habe. Dies betraf die Aspekte Gesang und Darstellungskunst sowie die Kostüme, das Bühnenbild und das Licht. Eine solche Optimierung wurde gefordert, um dem emphatischen, gleichsam religiösen Anspruch an die Kunst gerecht zu werden. Der Untersuchung liegen mit der ursprungsmythologischen Argumentationsfigur, der bildenden Funktion, dem schönen Schein und der Forderung nach einer Musterbühne somit vier Argumentationsfiguren zugrunde, welche die Geschichte der Idee einer idealen deutschen Opernbühne seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert bis 1945 geprägt haben. Im Vergleich wird analysiert, welche Rolle die vier Aspekte nach 1945 im Zusammenhang mit der jeweiligen nati-
Einleitung 35
onalen kulturellen Repräsentation der drei Berliner Opernbühnen gespielt haben. Über die künstlerischen Konzepte der Bühnen hinaus rücken zunächst die Aufführungen in den Blickpunkt : In besonderer Weise ist es auf der einen Seite von Interesse, wie mit dem Werk Richard Wagners umgegangen wurde, der für die nationalsozialistische Kulturpolitik von zentraler Bedeutung gewesen war. Auf der anderen Seite wird erörtert, wie die Bühnen mit der vom Nationalsozialismus ausgegrenzten kulturellen Moderne verfuhren. Für die Analyse haben sich dabei vor allem solche Aufführungen als geeignet erwiesen, über die in der Öffentlichkeit bis hin zum Skandal gestritten wurde. Die neuere musikwissenschaftliche Forschung hat ausgehend von Ansätzen der Politik- und Geschichtswissenschaft74 die gesellschaftlich wichtige Funktion von Aufführungsskandalen betont : Im Kunstskandal, so der Musikwissenschaftler Martin Eybl, würden „Konflikte […] zwischen Angehörigen verschiedener Gruppen ausgetragen. Inhalt der Auseinandersetzung sind Normen ; Skandale resultieren aus deren Verletzung. Und die Beschäftigung gibt Einblick in das Normengefüge, vor dessen Hintergrund der Skandal abläuft.“75 Aufführungsskandale fungieren somit als Seismografen gesellschaftlichen Dissenses. Gerade durch die kontroverse zeitgenössische Reflexion und Debatte kultureller Werte und Normen erschließt sich dem Historiker der zeitgenössische Gehalt von Opernaufführungen. Damit rückt in der Arbeit einer der heftigsten kulturpolitischen Skandale der frühen DDR in den Blickpunkt : die Auseinandersetzungen um die Uraufführung von Bertolt Brechts und Paul Dessaus Oper Das Verhör des Lukullus an der Staatsoper 1951. Gleichsam komplementär dazu wird der Versuch der SED, auf der 74 Manfred Schmitz, Theorie und Praxis des politischen Skandals, Frankfurt/M. 1981 ; Andrei S. Markovits und Mark Silverstein, (Hg.), The politics of scandal : power and process in liberal democracies, New York 1988 ; Rolf Ebbighaus und Sighard Neckel (Hg.), Anatomie des politischen Skandals, Frankfurt/M. 1989 ; Dirk Käsler u.a., Der politische Skandal. Zur symbolischen und dramaturgischen Qualität von Politik, Opladen 1991 ; Manfred J. Holler (Hg.), Scandal and its Theory, München 1999 ; John B. Thompson, Political scandal : power and visibility in the media age, Cambridge u.a. 2000 ; Karl Otto Hondrich, Enthüllung und Entrüstung. Eine Phänomenologie des politischen Skandals, Frankfurt/M. 2002. – Zum Skandal in der Kunst : Peter Zimmermann, „Die Kunst des Skandals“, in : Peter Zimmermann und Sabine Schaschl (Hg.), Skandal : Kunst, Wien 2000, S. 3–14 ; Martin Eybl (Hg.), Die Befreiung des Augenblicks : Schönbergs Skandalkonzerte 1907 und 1908. Eine Dokumentation, Wien/Köln/Weimar 2004. 75 Martin Eybl, „Neun Thesen zu einer Theorie des Skandals“, in : Österreichische Musikzeitschrift 57 (2002), Heft 11/12, S. 5–15, hier S. 8.
36 Einleitung
Bühne eine sozialistische deutsche Nationaloper zu etablieren, am Beispiel von Kurt Forests Oper Der arme Konrad untersucht, die anlässlich des zehnten Jahrestages der Gründung der DDR 1959 ihre Uraufführung erlebte. In Zusammenhang mit der Städtischen Oper wiederum liegt der Schwerpunkt außer auf der nicht unumstrittenen Uraufführung von Boris Blachers Preußischem Märchen 1952 auf der heftig skandalierten szenischen deutschen Erstaufführung von Arnold Schönbergs Oper Moses und Aron im Jahr 1959 und damit auf demjenigen Komponisten, der wie kein anderer im Nationalsozialismus zur Zielscheibe antisemitischer Kritik geworden war. Entsprechend der anfangs schon erläuterten Perspektive von den Berliner Opernhäusern als ‚Bühne‘, auf denen in der Art eines ‚Theaters auf dem Theater‘ Opernkultur ‚repräsentiert‘ wurde, widmet sich die Analyse des Weiteren der ‚Szene‘ jenseits der Bühnenbretter : Erörtert werden die Vorstellungen von einer idealen deutschen Opernbühne anhand der Architektur von Staatsoper und Deutscher Oper sowie der Feierlichkeiten bei deren Eröffnung. Darüber hinaus werden die Auseinandersetzungen um das Engagement der besten Künstler an den Berliner Opernbühnen erörtert, wobei insbesondere auf den Fall des berühmten Dirigenten Erich Kleiber fokussiert wird : Mit seinem Ziel, der zunehmenden deutsch-deutschen Teilung durch sein Wirken in beiden Stadthälften Berlins entgegenzuwirken, polarisierte Kleiber die deutsche Öffentlichkeit in der ersten Hälfte der 1950er-Jahre, selbst innerhalb der Systemgrenzen, wie kein anderer Künstler. Schließlich rückt in der Arbeit das Publikum als Akteur in den Mittelpunkt der Analyse und damit die Frage nach den kulturpolitischen Strategien, mit denen in Ost- beziehungsweise West-Berlin der jeweils als ideal angesehene Besucherstamm gewonnen werden konnte. Nicht nur beim Publikum, sondern auch bei den anderen Untersuchungsfeldern richtet sich die Analyse immer auch auf beziehungsgeschichtliche Aspekte : die Geschichte des einen Hauses ist nicht erklärbar ohne diejenige der jeweils anderen.76 Die ideengeschichtliche Entwicklung der Vorstellung von einer idealen deutschen Opernbühne in den Jahren nach 1945 anhand der nationalen kulturellen 76 Zum beziehungsgeschichtlichen Ansatz allgemein siehe : Christoph Kleßmann, „Verflechtung und Abgrenzung. Aspekte der geteilten und zusammengehörigen deutschen Nachkriegsgeschichte“, in : Aus Politik und Zeitgeschichte 29–30 (1993), S. 30–41.
Einleitung 37
Repräsentation der drei Berliner Opernbühnen zu erörtern und somit Ideengeschichte und Institutionengeschichte miteinander zu verbinden, hat den Vorteil, die entsprechenden Ideen jeweils konkret historisch-situativ verorten zu können. Damit wird einem Geschichtsverständnis Rechnung getragen, das sich, wie Ute Daniel formuliert hat, „stärker für die Komponente der historischen Bedeutung […] interessiert, ohne sie völlig außerhalb der historischen Menschen, ihrer sozialen Praktiken und ihrer Wahrnehmungsweisen anzusiedeln“.77 Das bedeutet auch, die kulturpolitischen Argumentationsweisen der DDR, wie etwa das emphatische Bekenntnis zum Humanismus in einer spezifisch sozialistischen Variante, ernst zu nehmen und sie nicht ex post aufgrund des Wissens um den Untergang des ostdeutschen Staates von vornherein als unglaubwürdig oder als falsche Propaganda abzutun. Der Untersuchungszeitraum umfasst mit Rückgriffen auf die kulturellen Anfänge nach dem Zweiten Weltkrieg die Jahre von 1948 bis 1961 : Zum einen fällt in das Jahr 1948 mit der westlichen Währungsreform, der Aufhebung der Zusammenarbeit der Alliierten Kommandantur und der Teilung der Stadtverordnetenversammlung das Ende der politischen und wirtschaftlichen Einheit der Stadt. Zum anderen spricht für 1948 als Beginn der Untersuchung, dass sich in diesem Jahr bei den Ost-Berliner Bühnen nach drei Jahren relativer künstlerischer Autonomie eine verstärkte politische Einflussnahme mit dem Ziel der Durchsetzung der ästhetischen Doktrin des Sozialistischen Realismus beobachten lässt. Schließlich bedeutet das Jahr 1948 auch für die West-Berliner Oper mit der Wiedereinsetzung des ehemaligen Intendanten der Preußischen Staatstheater Heinz Tietjen einen Einschnitt. Die Untersuchung 1961 enden zu lassen, rechtfertigen zwei Ereignisse : erstens die Eröffnung der Deutschen Oper Berlin im September des Jahres, wodurch die Aufbauphase der drei Bühnen rein äußerlich ihren Abschluss fand, sowie zweitens der Mauerbau, der eine verglei77 Ute Daniel, „Clio unter Kulturschock. Zu den aktuellen Debatten der Geschichtswissenschaft“, in : Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 48 (1997), S. 195–219 und 259–278, hier S. 204. – In diesem Zusammenhang sei angemerkt, dass Ute Daniel in ihrer Rezension von Bollenbecks Arbeit Tradition, Avantgarde, Reaktion kritisiert hat, dass der Autor die von ihm beschriebenen Argumentationsfiguren nicht in ausreichendem Maße konkret historisch-situativ verortet habe. Ute Daniel, „Geschichte schreiben nach der ‚kulturalistischen Wende‘“, in : Archiv für Sozialgeschichte 43 (2003), S. 576–599, hier S. 590–591.
38 Einleitung
chende Rezeption der im ‚Schaufenster‘ Berlin miteinander konkurrierenden Opernhäuser zumindest für das östliche Publikum bis 1989 verhindert hat. Der Arbeit liegt umfangreiches, bisher nicht erschlossenes Archivmaterial zugrunde. In Bezug auf ungedruckte Quellen78 bedient sich die Studie zunächst der Archive der Opernbühnen. Für die Staatsoper, deren Akten vor allem zur Ära Legal im Landesarchiv Berlin liegen, und die Komische Oper, die ihre Materialien aus der Intendanz Felsensteins der Akademie der Künste in Berlin überlassen hat, kann die Situation insgesamt als gut bezeichnet werden. Lediglich für die Städtische Oper sieht die Quellenbasis schlechter aus. Die Deutsche Oper erwies sich überdies als wenig hilfsbereit. Aus den bisweilen widersprüchlichen Angaben des Hauses ergab sich das Bild, dass das Archivmaterial zu den Jahren 1945 bis 1961 in Kellerräumen des in den 1930er-Jahren errichteten Verwaltungsgebäudes der Oper an der Richard-Wagner-Straße liegt. Mit der Begründung, die Räume seien einsturzgefährdet, wurde eine Einsichtnahme verweigert. Hier ist in Zukunft durch eine gewissenhafte Sichtung und angemessene Archivierung des Materials unbedingt Abhilfe zu schaffen. Durch die Parallelüberlieferung in den Verwaltungsakten des Senators für Volksbildung im Landesarchiv konnte diese Lücke jedoch geschlossen werden. Als gut ist die Quellenlage für den Ost-Berliner Magistrat zu bezeichnen, dem die Verwaltung der Komischen Oper oblag. Bei den für die Staatsoper zuständigen Behörden, zunächst dem Ministerium für Volksbildung, dann der Staatlichen Kommission für Kunstangelegenheiten und schließlich ab 1954 dem Ministerium für Kultur, ist die Quellensituation uneinheitlich. Während die umfangreichen Akten der ersten beiden Institutionen im Bundesarchiv für die Benutzung erschlossen sind und somit im Ganzen in die Analyse miteinbezogen werden konnten, stehen vom Bestand des Ministeriums für Kultur bislang erst Teile zu Forschungszwecken bereit. Von Relevanz waren für die Analyse des Wiederaufbaus der Lindenoper Akten aus dem Ministerium für Aufbau und der Bauakademie der DDR. Was die für die Ost-Berliner Opernbühnen zuständigen Parteistellen angeht, wurde über Protokolle des Politbüros hinaus Quellenmaterial der Abteilung 78 Die ungedruckten Quellen werden im Text durchgängig in der originalen Orthografie zitiert. Lediglich offensichtliche Schreibfehler wurden verbessert. Hervorhebungen von Wörtern in den Quellen, ob in Form von Unterstreichung oder Sperrung, sind im Text vereinheitlicht kursiv gedruckt.
Einleitung 39
Kultur des ZK der SED sowie des Büros von Alfred Kurella (Zentralkommitee der SED) berücksichtigt. Weitere für die Arbeit wichtige Quellenbestände stellen die von der Akademie der Künste aufbewahrten Nachlässe der Komponisten Boris Blacher und Jean Kurt Forest dar. Ebenfalls in die Analyse miteinbezogen wurden die Nachlässe der Opernintendanten Ernst Legal, Max Burghardt, Heinz Tietjen und Carl Ebert. Lediglich die umfangreichen Tagebücher Ernst Legals aus dessen Zeit als Intendant der Ost-Berliner Staatsoper, von denen detaillierte Einblicke in eine der wichtigsten Kulturinstitutionen der DDR zu erhoffen sind, konnten für die Arbeit nicht ausgewertet werden. Trotz der wiederholten Anfrage, Einsicht nehmen zu können, reagierten die Erben des Künstlers abschlägig.79 Zu Boris Blacher konnten außerdem die Handakten im Historischen Archiv der Berliner Universität der Künste ausgewertet werden. Die Umstände der deutschen szenischen Erstaufführung von Schönbergs Moses und Aron an der Städtischen Oper wurden darüber hinaus anhand der Akten des Historischen Archivs der Akademie der Künste in Berlin rekonstruiert. Für die Analyse des organisierten Theaterbesuchs in Ost-Berlin konnte auf bislang nicht genutztes Archivmaterial aus dem Bestand des Berliner Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes (FDGB) und der Magistratsakten im Landesarchiv Berlin zurückgegriffen werden. Was die gedruckten Quellen anbelangt, wurden zunächst die Programmhefte der Opernbühnen berücksichtigt. Allerdings ist die Quellenlage zu den drei Häusern nicht gleichermaßen gut : Während zu den Inszenierungen von Staatsoper und Komischer Oper eine Vielzahl an interpretierenden Texten vorliegt, sieht die Situation an der Städtischen Oper dürftig aus. Erst unter dem Intendanten Carl Ebert wurden ab der Spielzeit 1954/55 überhaupt regelmäßig Programmhefte eingeführt, die sich jedoch nicht selten mit einem Abdruck älterer, nicht auf die konkrete Inszenierung bezogener Texte begnügten. An zeitgenössischen Zeitschriften aus der DDR wurden mit Musik und Gesellschaft, Theater der Zeit und Deutsche 79 Begründet wurde die Absage nicht etwa mit der Sorge um unliebsame Enthüllungen über den Künstler, sondern mit einer in Aussicht gestellten eigenen Publikation. Eine solche allerdings ist bislang zum Nachteil der Forschung nicht erschienen. Zu Ernst Legal siehe allerdings : Christl Anft, Ernst Legal (1881–1955). Schauspieler, Regisseur, Theaterleiter. Ein bürgerlich-humanistischer Künstler im gesellschaftlichen und ästhetischen Strukturwandel der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, Berlin 1981.
40 Einleitung
Architektur die wichtigsten Organe in den Bereichen Musik, Theater und Architektur ausgewertet, dazu auf westlicher Seite für den Bereich Musik die Zeitschrift Melos und für die Theaterarchitektur Bauwelt sowie Bühnentechnische Rundschau. Von den ostdeutschen Tageszeitungen wurde in der Arbeit zunächst die Tägliche Rundschau als das Organ der Sowjetischen Militäradministration beziehungsweise der Sowjetischen Kontrollkommission (Einstellung des Blattes Ende Juni 1955) herangezogen, die für die sowjetische Medienpolitik und Propaganda eine zentrale Rolle spielte.80 Als direkter Ausdruck des jeweiligen kulturpolitischen Kurses der SED wurde des Weiteren das Parteiorgan Neues Deutschland benutzt.81 Zur Beantwortung der Frage nach Restauration und Neubeginn erschien es darüber hinaus ratsam, auf die National-Zeitung als Organ der 1948 gegründeten Nationaldemokratischen (Block-)Partei (NDPD) zurückzugreifen, die als ein Auffangbecken insbesondere für ehemalige Nationalsozialisten konzipiert war. Als das wichtigste Ost-Berliner Blatt wurde schließlich die Berliner Zeitung herangezogen, die als Organ der Ost-Berliner SED-Bezirksleitung fungierte, wenngleich sie sich als solches nicht eindeutig zu erkennen gab.82 Die Auswahl westlicher Zeitungen resultierte zum einen aus der Überlegung, einen repräsentativen Querschnitt sowohl West-Berliner als auch überregionaler Blätter zu verwenden, weil letztere hinsichtlich der Systemkonkurrenz tendenziell weniger stark parteiisch berichteten als die in deren Brennpunkt befindlichen Berliner Medien. Die andere Überlegung war, das Spektrum gesellschaftlicher Positionen abzudecken : So wurde für die Analyse von West-Berliner Zeitungen der amerikanisch lizenzierte Tagesspiegel herangezogen, der mit seinem entschiedenen Antikommunismus im Westen einen erheblichen Einfluss ausübte83, darüber hinaus die Berliner Morgenpost, Der Kurier und Der Telegraf. An überregionalen Blättern wurden auf konservativer Seite die Frankfurter Allgemeine Zeitung 80 Peter Strunk, Pressekontrolle und Propagandapolitik der Sowjetischen Militäradministration in Deutschland (SMAD). Der politische Kontrollapparat der SMAD und das Pressewesen im sowjetischen Besatzungsgebiet Deutschlands (1945–47). Phil. Diss., Berlin 1989 ; Ders., Zensur und Zensoren. Medienkontrolle und Propagandapolitik unter sowjetischer Besatzungsherrschaft in Deutschland, Berlin 1996, vor allem S. 36–62. 81 Ebd., S. 72ff. 82 Ebd., S. 85ff. 83 Christoph Marx, Reeducation und Machtpolitik. Die Neuordnung der Berliner Presselandschaft 1945–1947, Stuttgart 2001, S. 91ff.
Einleitung 41
sowie (zumindest für die Zeit ab 1953 unter dem Chefredakteur Hans Zehrer) Die Welt verwendet, des Weiteren die von der amerikanischen Besatzungsmacht herausgegebene einflussreiche Neue Zeitung (von September 1953 bis zu ihrer Einstellung Ende Januar 1955 bestand allerdings nur noch eine Berliner Ausgabe) sowie als linksliberales Blatt die Süddeutsche Zeitung. Darüber hinaus wurden die Pressespiegel der Opernhäuser und Kulturverwaltungen in die Analyse einbezogen, die sich jeweils, wie bei der Recherche deutlich wurde, nach Möglichkeit immer auch um die Dokumentation der Sichtweise des gegenüberliegenden Systems bemühten. Allerdings sei darauf hingewiesen, dass bei Weitem nicht zu allen Aufführungen Rezensionen aus beiden Systemen vorliegen, wurde die Opernkonkurrenz im anderen System doch nicht selten schlicht durch Nichtbeachtung gestraft. Im Zusammenhang mit der Analyse der gedruckten Quellen ist sich der Autor der besonderen Herausforderungen der Quellenkritik bewusst, waren doch die Medien selbst im Kalten Krieg nie objektive Berichterstatter, sondern immer selbst auch Akteure der Kulturkonkurrenz. Dies gilt in besonderem Maße für die politisch gelenkte Presse der DDR.84 Vorsicht ist jedoch nicht minder auch bei den westlichen Medien geboten, die durch ihren vehementen Antikommunismus mitunter nicht unwesentlich zur Verschärfung des Kalten Krieges in Berlin beitrugen.85 Was die für die Arbeit verwendeten publizierten Quellen angeht, sei insbesondere Joachim Lucchesis umfassende Dokumentation der Debatte um Brechts/ Dessaus Das Verhör des Lukullus86 sowie Elimar Schubbes87 Edition von Texten zur Kulturpolitik in der DDR genannt. Die Rekonstruktion der im ersten Kapitel thematisierten Eröffnungsfeiern erfolgte mithilfe der vom Autor selbst transkribierten Bänder der zeitgenössischen Radioübertragungen, die sich heute im Deutschen Rundfunkarchiv in Babelsberg beziehungsweise im rbb-Media-Archiv befinden. 84 Gunter Holzweißig, Die schärfste Waffe der Partei. Eine Mediengeschichte der DDR, Köln/Weimar/Wien 2002 ; Thomas Lindenberger (Hg.), Massenmedien im Kalten Krieg. Akteure, Bilder, Resonanzen, Köln/Weimar/Wien 2006. 85 Siehe dazu : Marx, Reeducation ; Susanne Grebner, Der Telegraf. Entstehung einer SPD-nahen Lizenzzeitung in Berlin 1946 bis 1950, Münster 2002. 86 Lucchesi, Verhör. 87 Elimar Schubbe (Hg.), Dokumente zur Kunst-, Literatur- und Kulturpolitik der SED, Stuttgart 1972.
42 Einleitung
Das erste Kapitel der Studie widmet sich den Eröffnungsfeiern der wieder aufgebauten beziehungsweise neu erbauten Berliner Opernhäuser. Es wird die nationale Bedeutung der Opernbühnen der geteilten Stadt in den 1950er-Jahren erläutert und dargestellt, wie sich die beiden Gemeinwesen bei diesen öffentlichkeitswirksamen Anlässen kulturell darstellten. Die beiden folgenden Kapitel befassen sich mit kulturellen Konzepten : Im zweiten Kapitel geht es in einem historischen Rückblick um die Vorstellungen von einer idealen deutschen Opernbühne, wobei auf die vier bereits genannten ideengeschichtlichen Dimensionen rekurriert wird. Wie diese Vorstellungen in den kulturpolitischen Konzepten von Deutscher Staatsoper und Städtischer/Deutscher Oper in den 1950er-Jahren aktualisiert wurden, ist Thema des dritten Kapitels, in dem außerdem die kulturpolitischen und politischen Rahmenbedingungen der entsprechenden Konzepte ausgeführt werden. Die Kapitel vier bis sieben behandeln sodann einzelne Felder kultureller Repräsentation : Das vierte Kapitel geht auf die Architektur von Staatsoper und Deutscher Oper ein und arbeitet deren politische Funktion innerhalb der nationalen kulturellen Selbstdarstellung der Bühnen heraus. Es wird gezeigt, wie sich in der Gestaltung der Bauwerke unterschiedliche Vorstellungen von einer idealen deutschen Opernbühne niederschlugen. Im Mittelpunkt des fünften Kapitels steht die kulturpolitische Auseinandersetzung um deutsch-deutsche Künstlerengagements, die am Beispiel des Dirigenten Erich Kleiber verdeutlicht wird. Anhand dieses Konflikts werden die unterschiedlichen Positionen zu der Frage nach der Einheit der deutschen Kultur im geteilten Deutschland beleuchtet. Das sechste Kapitel thematisiert sodann ausgewählte Inszenierungen der drei Opernbühnen und damit den Kern von deren kultureller Repräsentation. Im abschließenden siebten Kapitel wird der Fokus auf die Frage nach dem idealen Publikum der Opernhäuser in Ost- und West-Berlin gelegt und die Versuche erläutert, Publikum des jeweils anderen Systems für die eigenen Aufführungen zu gewinnen.
I. Eröffnungsfeiern
Da die Ensembles von Staatsoper und Städtischer Oper nach 1945 wegen der Kriegszerstörungen ihrer Stammhäuser jeweils Ausweichspielstätten hatten beziehen müssen, die hinsichtlich der theatertechnischen Bedingungen, der Größe aber auch des Komforts deutlich zu wünschen übrig ließen, stellte die Wiederherstellung beziehungsweise der Neubau der ursprünglichen Spielstätten ein zentrales Anliegen der Kulturverwaltungen dar. Dieses Bestreben wurde umso dringlicher, als die künstlerische Konkurrenz der Bühnen Ende der 1940er-Jahre im Rahmen des Systemkonflikts eine politische Dimension erhielt. So zeigen die Feierlichkeiten anlässlich der Wiedereröffnung der Ost-Berliner Lindenoper 1955 und der Einweihung der neu gebauten West-Berliner Deutschen Oper 1961 die große politisch-gesellschaftliche Bedeutung, welche den Berliner Opernbühnen im Rahmen des zweigeteilten ‚Schaufensters‘ Berlin beigemessen wurde. Beide Opernhäuser sollten als ideale nationale Opernbühnen jeweils Ostwie Westdeutschland im Ganzen kulturell vertreten. In diesem Zusammenhang wurden in Abgrenzung vom Nationalsozialismus einerseits und vom jeweiligen Gegenüber andererseits unterschiedliche Kulturvorstellungen repräsentiert.
1. „Mittelpunkt für eine neue deutsche Opernkultur“ – Die Wiedereröffnung der Ost-Berliner Deutschen Staatsoper Unter den Linden am 4. September 1955
Für die Festgäste, die sich am Vormittag des 4. September 1955 über die alte preußische Prachtstraße Unter den Linden der wiederaufgebauten Deutschen Staatsoper zu ihrer Eröffnung näherten, muss das traditionsreiche Gebäude einen imposanten Eindruck gemacht haben. An der ehemaligen Via triumphalis gelegen, stach es glanzvoll aus der Mehrzahl trostloser Ruinen hervor, die noch zehn Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges das Bild der östlichen Teilstadt prägten. So beschrieb die Süddeutsche Zeitung die Straße „zwischen dem Brandenburger Tor ohne Quadriga und dem kommunistischen Aufmarschplatz,
44 Eröffnungsfeiern
dem das Schloß hat weichen müssen“, als „ohne Leben. Ein einziger Neubau : die sowjetische Botschaft in Monumentalarchitektur. Sonst : eingeebnete Baulücken, einzelne stehengebliebene Häuser mit kahlen Brandmauern, zerfallene Palais ; nur Staatsbibliothek, Universität und Zeughaus von den Kriegsschäden geheilt. Das ist die Kulisse, vor der jetzt die Staatsoper Unter den Linden wiedererstanden ist.“88 „Die Linden“, wie die Straße bis heute oft genannt wird, waren eng verbunden mit dem machtpolitischen Aufstieg Berlins von der preußischen Residenz zur Hauptstadt des deutschen Nationalstaates. Angelegt nach dem Dreißigjährigen Krieg als einfacher Reiterweg vom Stadtschloss in Richtung des späteren Charlottenburg, entstand im Umfeld der zunehmend repräsentativ gestalteten Allee in den folgenden Jahrhunderten ein Ensemble von Gebäuden mit dem Ziel, die machtpolitische Bedeutung Preußens glänzend zum Ausdruck zu bringen : das barocke Zeughaus, das Kronprinzenpalais, das Alte Museum, der Berliner Dom, die Neue Wache, die Hedwigskathedrale, etwas weiter abgelegen der Gendarmenmarkt mit dem klassizistischen Schauspielhaus, dem Französischen und Deutschen Dom sowie das Brandenburger Tor.89 Zu den bedeutendsten Gebäuden entlang der Linden zählte darüber hinaus das Opernhaus mit seiner charakteristischen Fassade, einem aus sechs korinthischen Säulen gebildeten, von einem reliefierten Architrav übergiebelten Portikus. In den Jahren 1741–42 von dem Architekten Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff für Friedrich II. errichtet, hatte es vor allem deswegen Berühmtheit erlangt, weil es als eines der ersten deutschen Hoftheater frei stehend erbaut und nicht wie bis dahin üblich architektonisch in eine Schlossanlage eingegliedert worden war.90 Das historische Zentrum Berlins fiel im Zweiten Weltkrieg weitgehend den Bomben zum Opfer. Am 3. Februar 1945 versank auch die Staatsoper in Schutt und Asche. Sie hatte die von Albert Speer gestaltete monumentale 88 Gabriele Müller, „In rosa Glanz erstrahlt die neue Deutsche Staatsoper“, in : Süddeutsche Zeitung vom 13./14./15.08.1955. 89 Helmut Engel und Wolfgang Ribbe (Hg.), Via triumphalis. Geschichtslandschaft „Unter den Linden“ zwischen Friedrich-Denkmal und Schlossbrücke, Berlin 1997. – Aus essayistischer Sicht siehe : Günter de Bruyn, Unter den Linden, München 2002. 90 Hans Lange, Vom Tribunal zum Tempel. Zur Architektur und Geschichte deutscher Hoftheater zwischen Vormärz und Restauration, Marburg o. J. [1985], S. 203f.
„Mittelpunkt für eine neue deutsche Opernkultur“
45
Ost-West-Achse – Ausdruck des hypertrophen Plans einer „Welthauptstadt Germania“91 – gesäumt, in welche die Linden integriert worden waren. Für die DDR kam der Eröffnung der wiederaufgebauten Lindenoper, die es dem Ensemble der Staatsoper ermöglichte, die Ausweichspielstätte im Admiralspalast92 nahe des Bahnhofs Friedrichsstraße nach insgesamt zehn Jahren zu verlassen, eine hohe politisch-symbolische Bedeutung zu. In diesem Zusammenhang ließ sich bei einem berühmten Gebäude an einem prominentem Ort innerhalb der Berliner Stadtlandschaft die Leistungsfähigkeit des jungen sozialistischen Staates beim architektonischen Wiederaufbau demonstrieren und das „Auferstanden aus Ruinen“, wie es in der neuen Nationalhymne hieß, sinnlich erfahrbar machen. Darüber hinaus konnte sich die DDR generell als ein Kulturstaat präsentieren, der sich in vorbildlicher Weise der Pflege des im Sinne des Sozialismus als fortschrittlich interpretierten kulturellen Erbes annahm : nicht nur durch die Wiederherstellung des historischen Opernbaus sondern auch dadurch, dass auf diese Weise gute technische Bedingungen für die Aufführung von Opernwerken geschaffen wurden. Mit dieser Maßnahme wollte die DDR einerseits bei der eigenen Bevölkerung für ihr System werben, dessen politische Legitimität nicht erst seit dem Aufstand vom 17. Juni 1953 infrage stand, andererseits aber auch beim westdeutschen Teilstaat. In der Eröffnungsfestschrift war in einem Geleitwort von Ministerpräsident Otto Grotewohl zu lesen : „Zehn Jahre nach Zerstörung der früheren preußischen Staatsoper durch amerikanische Bomber, zehn Jahre nach der Befreiung vom Faschismus durch die Sowjetarmee haben die Werktätigen der Deutschen Demokratischen Republik unter großen Opfern und unter Zurückstellung mancher anderer Bauaufgaben die Staatsoper wiederhergestellt.“ Das Ergebnis, formulierte Grotewohl mit Blick auf den Nationalsozialismus, sei „der sichtbare Ausdruck jener Schöpferkraft, deren ein Volk fähig ist, wenn es von Ausbeutung und Unterdrückung befreit ist“.93 Der Wiederaufbau der Lindenoper als Teil des ‚Schaufensters‘ Ost-Berlin zielte vor 91 Hans J. Reichardt und Wolfgang Schäche, Von Berlin nach Germania. Über die Zerstörungen der „Reichshauptstadt“ durch Albert Speers Neugestaltungsplanungen, Berlin 1998. 92 Jost Lehne, Der Admiralspalast. Die Geschichte eines Berliner „Gebrauchs“-Theaters, Berlin 2006, S. 145ff. 93 Otto Grotewohl, „Ein Wort auf den Weg“, in : Deutsche Staatsoper Berlin. Zur Wiedereröffnung des Hauses Unter den Linden am 4. September, Berlin 1955, S. 5–6, hier S. 5.
46 Eröffnungsfeiern
allem gegen West-Berlin. Die westliche Teilstadt nämlich hatte 1955 kein mit dieser Oper vergleichbares Haus vorzuweisen. Zwar gab es beim Senat zu diesem Zeitpunkt Planungen für einen Neubau anstelle des im Zweiten Weltkrieg ebenfalls stark zerstörten Deutschen Opernhauses in der Charlottenburger Bismarckstraße, doch über dessen Finanzierung war noch keineswegs entschieden worden. Ein Ende der Interimszeit im wenig komfortablen Theater des Westens in der Kantstraße nahe dem Bahnhof Zoo ließ sich deshalb für das seit 1945 unter dem Namen Städtische Oper firmierende Ensemble nicht absehen. Auf ostdeutscher Seite wurde man im Zuge der Eröffnungsfeierlichkeiten 1955 nicht müde, immer wieder die gesamtnationale Bedeutung der Operneröffnung zu betonen. So äußerte sich Grotewohl zur Architektur der Lindenoper im Geleitwort : „In der Anknüpfung an die besten Traditionen der deutschen Baukunst drückt sich […] die Verpflichtung aus, Bewahrer der deutschen Kultur zu sein und unser kulturelles Erbe für ganz Deutschland zu pflegen“.94 Diese „nationale Aufgabe“ sei umso wichtiger, als – wie er mit Blick auf die USA meinte – „fremde, volksfeindliche Kräfte im Westen unseres Vaterlandes bemüht sind, die deutsche Kunst ihrer lebendigen Wurzeln zu berauben und heimatlos zu machen. Darum soll die Deutsche Staatsoper die Heimstatt und Wirkungsstätte aller großen und ernsthaften Künstler des Opernschaffens sein.“95 Kulturpolitisch stellte der Wiederaufbau der Lindenoper in der ersten Hälfte der 1950er-Jahre eines der wichtigsten, da über die Grenzen hinaus prestigeträchtigsten Bauprojekte für die DDR dar. Bedeutender als dieses Projekt war nur noch die Stalinallee, der monumentale sozialistische Boulevard zwischen Strausberger Platz und Frankfurter Tor. Die gesamtdeutsche Bedeutung der Staatsoper innerhalb des Wiederaufbaus von Berlin betonte etwa Maria Rentmeister, die stellvertretende Vorsitzende der Staatlichen Kommission für Kunstangelegenheiten, Vorläufer des späteren Kulturministeriums, am 25. Oktober 1952 im Neuen Deutschland : „Außer der Stalinallee gibt es ein großes Projekt des Aufbaus in Berlin, welches alle Berliner und ganz Deutschland interessiert – das ist der Wiederaufbau der Staatsoper Unter den Linden“. Denn deren Eröffnung bedeute „eine neue Etappe für die Entwicklung der deutschen Kunst. 94 Ebd. 95 Ebd.
„Mittelpunkt für eine neue deutsche Opernkultur“
47
Die Wiedererrichtung der Staatsoper Unter den Linden schafft den Mittelpunkt für eine neue deutsche Opernkultur in ganz Deutschland, und die Oper ist ein unerläßlicher Bestandteil der deutschen Nationalkultur.“96 Dementsprechend wurde die Lindenoper in offiziellen Publikationen immer wieder als deutsche „Nationaloper“ tituliert. Der leitende Architekt des Wiederaufbaus Richard Paulick etwa formulierte, der Wiederaufbau der Bühne habe das zentrale Ziel verfolgt, „auf der Grundlage des künstlerischen Erbes, das uns Knobelsdorff hinterlassen hat, eine Nationaloper zu errichten, die Eigentum des Volkes ist“.97 Um den Bau fertigstellen zu können, wobei vor allem im Inneren umfangreiche architektonische Umgestaltungen vorgenommen wurden, galt es immer wieder, unvorhergesehene logistische wie auch statische Hindernisse zu überwinden.98 Nach mehrfach verschobenem Eröffnungstermin konnte der Bau schließlich nach etwa drei Jahren der Öffentlichkeit übergeben werden. Hinter dem eigentlichen Opernhaus war dabei zusätzlich ein neues, durch einen Tunnel mit dem Knobelsdorffbau verbundenes Verwaltungsgebäude entstanden. Die Kosten für das gesamte Projekt, in dessen Verlauf es immer wieder zu Finanzierungsschwierigkeiten kam, welche die Bauleitung nur durch wiederholte Hinweise auf den drohenden Prestigeverlust beseitigen konnte, betrugen 66 Millionen DM (Ost), wobei 38 Millionen DM (Ost) auf das eigentliche Opernhaus entfielen.99 Schon Wochen vor der Eröffnung wurde die Staatsoper in ostdeutschen Publikationen geradezu hymnisch gepriesen. Von der „wohl mit Abstand gelungenste[n] bauliche[n] Theatererneuerung seit dem Kriege“100 und vom „schönsten Opern-
96 Mit dem Text reagierte Rentmeister auf Verzögerungen bei den Bauarbeiten. Maria Rentmeister, „Alle Kraft für den Wiederaufbau der Staatsoper“, in : Neues Deutschland vom 25.10.1952. 97 Richard Paulick, „Die Innenarchitektur der Deutschen Staatsoper“, in : Deutsche Architektur 2 (1953), S. 265–270, hier S. 266. 98 Nicht nur fehlten etwa die alten Baupläne, wodurch es zu Fehleinschätzungen der Statik und dadurch zu Verzögerungen kam. Auch durchkreuzten Materialengpässe wegen der parallelen Arbeiten an der Stalinallee den Baufortschritt. An der Staatsopernbaustelle wirkten durchschnittlich 800 Arbeiter im Zwei- bis Dreischichtenbetrieb, dazu weitere 80 Personen, die alleine mit der Herstellung der Skulpturen für das Äußere des Gebäudes befasst waren, wie dem Neuen Deutschland zu entnehmen ist. Waldemar Schmidt, „Der Enthusiasmus besiegte alle Hindernisse“, in : Neues Deutschland vom 06.09.1955. Siehe auch : Kurt Magritz, „Die Skulpturen der Staatsoper“, in : Tägliche Rundschau vom 24.12.1954. 99 Siehe Schwartz, Staatsoper, S. 53ff. 100 „Sinfonie in Rot-Weiß-Gold“, in : Berliner Zeitung vom 24.08.1955.
48 Eröffnungsfeiern
hause Deutschlands“101 schwärmte die Berliner Zeitung, von einem „der schönsten Opernhäuser der Welt“102 war sogar im Neuen Deutschland die Rede. Intendant Burghardt meinte, das Haus, welches schon vor seiner Zerstörung eine „Zierde unserer Stadt“ gewesen sei, erscheine nun sogar „glanzvoller und schöner denn je“.103 Die Festgäste, welche die neue Nationaloper, die auf dem Dach mit einer weithin sichtbaren schwarz-rot-goldenen Fahne104 geschmückt war, durch eines der drei Portale im Sockelgeschoss der Frontseite vorbei an einer Menge Schaulustiger betraten, gelangten in ein prachtvolles Inneres. Beim Gang durch das Gebäude waren verschiedenartig gestaltete Foyers zu bewundern, deren Wandverkleidungen aus Marmor oder farblich fein abgestimmten Seidentapeten bestanden. Beleuchtet wurden die Räume durch aufwendig gearbeitete Lüster. In den Fußböden waren feine Einlegearbeiten zu bestaunen. Die Aufgänge zu den Rängen flankierten marmorne Säulen mit antikisierenden vergoldeten Kapitellen, die Treppen säumten klassizistisch anmutende, geschmiedete Geländer. Festlich wirkte insbesondere der neu gestaltete Apollosaal auf der Höhe des ersten Ranges. Ursprünglich hatte er als königlicher Ballsaal gedient und sollte nun als großes Foyer für Opernaufführungen und als Ort von Staatsempfängen genutzt werden. Hier umgaben die Festgäste strenge korinthische Doppelsäulen mit vergoldeten Kapitellen, den Fußboden zierte ein großes ovales Mosaik mit verschiedenfarbigen Intarsien. Den architektonischen Höhepunkt aber bildete der Zuschauerraum mit 1450 Plätzen, der ebenfalls eine Neuschöpfung darstellte. Im DDR-Hörfunk Deutschlandsender, der mit seiner Programmgestaltung auf eine gesamtdeutsche Hörerschaft zielte105, gab der Sprecher seiner Bewunderung über die Schönheit des Raumes wortreich Ausdruck und artikulierte gleichzeitig damit die kulturpolitisch erwünschte Rezeption des Baues : „Ich lasse meine Blicke durch das weite Halbrund des Zuschauerraumes schweifen und entdecke immer wieder neue architektonische Schönheiten in dieser 101 „Die Deutsche Staatsoper eröffnet“, in : Berliner Zeitung vom 06.09.1955. 102 „Eröffnung der Deutschen Staatsoper am 4. September“, in : Neues Deutschland vom 11.08. 1955. 103 Max Burghardt, „Die Deutsche Staatsoper“, in : Neues Deutschland vom 04.09.1955. 104 Erst mit dem Flaggengesetz vom 1. Oktober 1959 war in der DDR das Emblem des Staatswappens, Hammer und Sichel, in die schwarz-rot-goldene Flagge eingefügt worden. 105 Klaus Arnold, Kalter Krieg im Äther. Der Deutschlandsender und die Westpropaganda der DDR, Münster/Hamburg/London 2002.
„Mittelpunkt für eine neue deutsche Opernkultur“
49
Farbensinfonie von Weiß, Rot und Gold. Dank, tiefer inniger Dank gebührt den Erbauern dieses Hauses. […] Hoch schwingen die hellen reich verzierten Brüstungen der drei Ränge über dem Parkett mit seinen rotgepolsterten und bequemen Stühlen im Rokokostil. Sie führen – gleichsam Stufen – den Blick nach oben zur Krönung des Raumes zum freischwingenden Opernhimmel mit dem meisterhaft gearbeiteten Lüster. Wahrlich, eine Glanzleistung architektonischer Gestaltung !“106 Genauso interessant wie die Betrachtung architektonischer Details mag für die Festgäste das Sehen und Gesehen werden gewesen sein. Zum Festakt erschienen war ostdeutsche wie auch internationale Prominenz aus Politik und Kultur. Blickte man im Saal umher, stach zunächst die Mittelloge des ersten Ranges ins Auge. Hier hatten unter anderem die Stellvertreter des Vorsitzenden des Ministerrates Walter Ulbricht, Willi Stoph, Lothar Bolz, Otto Nuschke und Paul Scholz Platz genommen. Darüber hinaus konnte man im Saal weitere Mitglieder des ZK der SED und der Regierung der DDR erblicken. Erschienen war außerdem das diplomatische Corps mit dem Botschaftsrat der UdSSR an der Spitze, des Weiteren eine Reihe bedeutender Künstler der DDR, darunter die Komponisten Paul Dessau und Max Butting, die Schriftsteller Bertolt Brecht und Arnold Zweig sowie der Intendant des Deutschen Theaters Wolfgang Langhoff. Michail Tschulaki, der Direktor des Moskauer Großen Akademischen Theaters, und der Komponist Tichon Chrennikow waren aus der UdSSR gekommen sowie weitere Musikwissenschaftler und Künstler vor allem aus den Ostblockländern. Zum Publikum zählten darüber hinaus 250 Nationalpreisträger, Helden der Arbeit sowie Aktivisten aus der DDR.107 Die ostdeutschen Berichte über die Eröffnungsfeier versäumten nicht, auch auf die Anwesenheit von Künstlern aus dem westlichen Ausland hinzuweisen, wie etwa des Schweizer Dirigenten Hermann Scherchen. Besondere Aufmerksamkeit galt überdies der Teilnahme von Gästen aus der Bundesrepublik. Aus München etwa hatte sich Generalintendant Rudolf Hartmann eingefunden, aus West-Berlin kamen der Direktor 106 „Staatsakt zur Eröffnung der wiederaufgebauten Staatsoper Unter den Linden am 4. September 1955.“ Deutsches Rundfunkarchiv Babelsberg DOK 497. 107 Zum Publikum der Staatsoperneröffnung siehe vor allem : „Neue Staatsoper öffnete ihre Pforten“, in : Tribüne [Ost-Berlin] vom 05.09.1955 ; „Festliche Eröffnung der neuen Staatsoper“, in : National-Zeitung vom 06.09.1955.
50 Eröffnungsfeiern
des Renaissance-Theaters Kurt Raeck und der Sänger Josef Metternich von der Städtischen Oper. Dass insgesamt ein nicht geringer Teil des Publikums aus der Bundesrepublik stammte, vermerkten aber auch die westdeutschen Berichte, die von „auffallend viele[n] westdeutsche[n] Nummernschilder[n]“ berichteten, welche „den weiten Platz zwischen Hedwigskathedrale und Universität“108 gefüllt hätten. In den westlichen Zeitungen wurde darüber hinaus nicht versäumt, auf die Unterschiede im Grad der Festlichkeit zwischen dem ost- und westdeutschen Publikum hinzuweisen. In Bezug auf die abendliche Festaufführung hieß es jedenfalls, dass man den „westliche[n] Gast am Smoking oder Frack“, „am Cocktailkleid von Ballerinenlänge“ oder dem „schulterfreien Abendkleid“ habe erkennen können, während die Garderobe beim östlichen Publikum bis hin zum „offenen karierten Hemd“ oder „Straßenkostüm“ gereicht habe.109 Das Sehen und Gesehen werden bei diesem „glanzvollste[n] gesamtdeutschen Kulturereignis dieses Jahres“, wie die Ost-Berliner National-Zeitung, das Presseorgan der Nationaldemokratischen (Block-)Partei der DDR, formulierte, wurde unterbrochen durch das Eintreffen Wilhelm Piecks in der großen Proszeniumsloge links von der Bühne. Die Festgesellschaft erhob sich und begrüßte den Staatspräsidenten der DDR, dessen Initiative der Wiederaufbau des Opernhauses wesentlich zu verdanken war, mit „minutenlangem Beifall“110, wie die National-Zeitung bemerkte ; dem Applaus allerdings schlossen sich die westlichen Gäste offenbar ostentativ nicht an, worauf wiederum die Frankfurter Allgemeine hinwies.111 Zu Beginn des Festaktes spielte die Staatskapelle, die auf der Bühne Platz genommen hatte, unter der Leitung des Generalmusikdirektors Franz Konwitschny feierlich die Nationalhymne der DDR. Daran schloss sich der Vortrag der Ouvertüre zu Carl Maria von Webers Oper Der Freischütz an, die 1821 in Berlin uraufgeführt worden war.112 Bevor der Ost-Berliner Oberbürgermeister 108 Sabina Lietzmann, „Gala-Abend Unter den Linden“, in : Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 06.09.1955 ; „Ost-Berlins mondänes Fest“, in : Die Welt vom 06.09.1955. 109 Sabina Lietzmann, „Gala-Abend Unter den Linden“, in : Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 06.09.1955. 110 „Festliche Eröffnung der neuen Staatsoper“, in : National-Zeitung vom 06.09.1955. 111 Sabina Lietzmann, „Gala-Abend Unter den Linden“, in : Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 06.09.1955. 112 Allerdings wurde der Freischütz nicht in der Lindenoper, sondern unweit davon im Schinkel-
„Mittelpunkt für eine neue deutsche Opernkultur“
51
Waldemar Schmidt symbolisch den Schlüssel des Hauses an den Intendanten überreichte und dieser in einer kurzen Ansprache dankte, betrat der Minister für Kultur der DDR Johannes R. Becher die mit einer schwarz-rot-goldenen Fahne geschmückte Bühne zur Festrede. Auch Becher betonte die gesamtdeutsche Bedeutung des Ereignisses : „Wir sind überzeugt, dass das ganze Deutschland es ist, das das Wiedererstehen der Deutschen Staatsoper als eine nationale Tat, als eine nationale Verpflichtung betrachtet“, wofür seiner Meinung nach auch die „Anwesenheit zahlreicher Vertreter aus Westdeutschland“ sprach. An den nationalen Stolz der deutschen Gäste appellierend, meinte er, die Deutsche Staatsoper böte „für ganz Deutschland außerordentliche Möglichkeiten, auf kulturellem Gebiet sich wieder Weltgeltung zu verschaffen.“113 Interessant ist, dass Bechers Rede grundlegende Aussagen zum Charakter und zur Funktion der Staatsoper im sozialistischen Staat enthielt, den der Minister als vorbildlichen Kulturstaat darstellte. In Abgrenzung von der nationalsozialistischen Diktatur betonte Becher – wohl zur Verwunderung manches westdeutschen Gastes – die Freiheit der Kunst an der neuen Opernbühne. Kein Künstler könne sich „nunmehr in die Ausrede flüchten, er sei von der Ungunst des politischen oder kulturellen Klimas verfolgt oder die Möglichkeit sei ihm vorenthalten, eine Stätte zu besitzen, um seinen Werken Gehör zu verschaffen.“ Was den Spielplan des Opernhauses angeht, präzisierte er dann allerdings auch, welchen Charakter die dort aufgeführten Werke haben sollten : „Solche Eroberer sind wir, dass wir in den Genien der Menschheit den Raum im Leben der Menschen gewinnen wollen, welcher allem Schönen, Guten, und Wahren gebührt und von dessen Besitz die Menschheit seit Jahrhunderten träumt.“ Die Auswahl der Werke sollte somit, das machen die Begriffe ‚gut‘ und ‚wahr‘ deutlich, ethisch-moralischen Kriterien folgen. So äußerte er in diesem Zusammenhang nicht ohne Pathos, die Staatsoper sei ein „Sieg des Friedens, […] ein menschlicher Triumph“. Mit dem Begriff ‚schön‘ wiederum – an anderer Stelle schen Schauspielhaus am „Platz der Akademie“, wie der Gendarmenmarkt in der DDR hieß, uraufgeführt. Dieser Theaterbau sollte noch bis in die 1980er -Jahre hinein Ruine bleiben. 113 Allen folgenden Zitaten aus der Eröffnungsfeier liegt die Transkription des Autors zugrunde, die vom Radiomitschnitt aus dem Rundfunkarchiv Babelsberg angefertigt wurde. „Staatsakt zur Eröffnung der wiederaufgebauten Staatsoper Unter den Linden am 4. September 1955.“ Deutsches Rundfunkarchiv Babelsberg DOK 497.
52 Eröffnungsfeiern
sprach er von den „schönen Künste[n]“ – kennzeichnete er das zukünftige Repertoire der Bühne in ästhetischer Hinsicht. Im Zusammenhang mit dem Spielplan kam Becher schließlich auf das Verhältnis von deutschen und ausländischen Werken innerhalb des Spielplans zu sprechen. Zwar legte er Wert auf die Weltoffenheit der Bühne : „Alle Völker sind eingeladen, hier in diesem Hause ihre Werke zur Aufführung gelangen zu lassen. Die ruhmreiche musikalische Tradition aller Völker ebenso wie ihr humanistisches Gegenwartsschaffen werden in unserem Hause eine Heimstätte finden“, wodurch die DDR einen „Beitrag zur internationalen Verständigung der Völker“ leisten und „aufs schönste und natürlichste dem Friedenswillen der Welt“ diene. Allerdings galt Bechers Präferenz dennoch unmissverständlich dem nationalen Repertoire. Von der Aufführung deutscher Werke versprach er sich einen grundlegenden Einfluss auf die Überwindung der politischen Teilung Deutschlands. Das Opernhaus sei dazu berufen, so der Minister, „in seinen künstlerischen Darbietungen […]‚ ‚die politische Unnatur unserer Zweigeteiltheit‘ mit zu überwinden und das, was alle Deutschen zusammenführt und zu einen geeignet ist, überzeugend in den Vordergrund zu rücken“. Dazu sprach sich der Minister dafür aus, in der DDR das Genre einer deutschen Nationaloper neu zu begründen, wobei die Lindenoper eine Schrittmacherfunktion übernehmen und die Bühne den „Grundstein zu einer neuen deutschen Nationaloper“ bilden sollte. „Solche patriotischen Kunstwerke müssen und werden geschaffen werden, da unser Vaterland als ein friedliches, wahrhaft demokratisches Deutschland auferstehen muß und auferstehen wird“, was vom Publikum mit lang anhaltendem Applaus quittiert wurde, wie der Radio-Mitschnitt des Deutschlandsenders dokumentiert. Was die künstlerischen Leistungen der Lindenoper anbelangte, erhoffte sich der Minister das höchste Niveau. Als ein „Kulturinstitut, das unsere Stadt vor allen anderen deutschen Städten hervorhebt“, habe das Opernhaus in gesamtnationalem Maßstab die Verpflichtung, „auf dem Gebiete des Musikschaffens beispielgebend voranzugehen“. Die Bühne dürfe sich nicht in einer „routinemäßigen Wiedergabe alter Opernstücke im Programm […] erschöpfen“. Schließlich kam Becher auf das Publikum der neuen Staatsoper zu sprechen. An dessen erwünschter Sozialstruktur ließ der Minister keinen Zweifel. Schon in seinem Beitrag zur Eröffnungsfestschrift konnte man lesen, dass er damit primär die „werktätige Bevölkerung“ meinte : „Der Wiederaufbau der Deutschen
„Mittelpunkt für eine neue deutsche Opernkultur“
53
Staatsoper – und das soll nie vergessen werden – ist ein Werk derjenigen Menschen, die früher wohl kaum Gelegenheit hatten, solch ein ‚hohes Haus‘ selber zu besuchen. Aber die Zeiten haben sich geändert. Und so wird es vor allem die werktätige Bevölkerung sein, welche künftighin die größte Besucherzahl der neuen Staatsoper darstellt. Wir heißen sie von ganzem Herzen willkommen. Die Deutsche Staatsoper wird ebenso zu ihrem Leben gehören und mit ihm verwachsen wie die Betriebe, die sie übernommen haben und die volkseigen geworden sind.“114 In seiner Festrede betonte er dann, dass die Staatsoper ein Ort kultureller Bildung des neuen Publikums sein möge : „Maß und Wert höchsten Künstlertums werden auf uns einwirken und […] zur Kunsterziehung der werktätigen Bevölkerung beitragen“. Die Arbeiter und Bauern des jungen sozialistischen deutschen Staates sollten an der Kultur des „klassischen Erbes“ partizipieren, von der sie bis 1945 ausgeschlossen worden seien.115 Der Festakt klang mit dem musikalischen Vortrag der Dritten Leonoren-Ouvertüre aus Ludwig van Beethovens Oper Fidelio aus. Staatsopernintendant Burghardt erläuterte später in seinen Lebenserinnerungen Ein Leben für die Staatsoper, dass es sich dabei um eine politische Entscheidung gehandelt habe. Auf die Zeit des Nationalsozialismus Bezug nehmend schrieb er, Fidelio sei „die heroische, humanistische, lebensbejahende und glückhafte Oper menschlicher Beziehungen, menschlicher Treue in Zeiten tyrannischer Unterdrückung, in Zeiten der Bedrohung edelster Empfindungen, der Bedrohung von Recht und Freiheit“.116 In den Wochen, die dem Festakt folgten, präsentierte die Staatsoper vier festliche Eröffnungspremieren, mit denen die Bühne der Wertschätzung der deutschen Nationalkultur Ausdruck verleihen wollte. Gespielt wurden als erste Premiere, am Abend des Eröffnungstages, Richard Wagners Die Meistersinger von Nürnberg. Des Weiteren standen Iphigenie in Aulis von Christoph Willibald Gluck, Don Giovanni von Mozart und Fidelio von Beethoven auf dem Programm. Zwei Aspekte mögen an dieser Auswahl überraschen : zum einen, dass mit Wagners Meistersingern eine Oper gegeben wurde, die wie keine andere 114 Johannes R. Becher, „Sieg des Friedens, menschlicher Triumph“, in: Deutsche Staatsoper Berlin. Zur Wiedereröffnung des Hauses Unter den Linden am 4. September, Berlin 1955, S. 9. 115 Bechers Rede ist in einer erweiterten Fassung abgedruckt in : „Grundstein zu einer deutschen Nationaloper“, in : Neues Deutschland vom 06.09.1955. 116 Max Burghardt, Ein Leben für die Staatsoper. AdK, Berlin, Burghardt-Archiv, Nr. 321, S. 131.
54 Eröffnungsfeiern
von Bedeutung für die nationalsozialistische Kulturpolitik gewesen war. Dass die sich als antifaschistisch verstehende DDR gerade dieses außerordentlich belastete Werk auswählte, noch dazu als Erstes und damit herausgehoben unter den vier Eröffnungspremieren, wird zu erklären sein. Zum anderen mag überraschen, dass unter den vier Werken keines der linksorientierten Opernreform der 1920er-Jahre vertreten war, als deren Inbegriff Bertolt Brechts und Kurt Weills Dreigroschenoper gelten kann. Diese wurde bei den Eröffnungsfeierlichkeiten nicht ein einziges Mal erwähnt. Auch das bedarf der Erklärung. Die Eröffnung der Lindenoper wurde in den westdeutschen Medien ausführlich thematisiert und kommentiert. Dabei stand der emphatischen ostdeutschen Selbstdarstellung eine weitgehend negative westdeutsche Fremdwahrnehmung gegenüber. Der Hauptkritikpunkt, der sich in fast allen westdeutschen Berichten117 fand, war – konträr zu Johannes R. Bechers Äußerungen – der Vorwurf fehlender künstlerischer Freiheit an der neuen Staatsoper. Heinz Kersten brachte dies im Tagesspiegel mit dem Begriff der „Kulturfassade“ auf den Punkt, hinter der es „doch keine echte künstlerische Freiheit geben“ werde und ohne die es „auch im modernsten Theaterbau schwerlich zu einer neuen Blüte der Staatsoper kommen“118 könne. Der Autor erinnerte in diesem Zusammenhang an die Absage des Dirigenten Erich Kleiber. Dieser hatte nach mehreren erfolgreichen Gastspielen an der Staatsoper seine Bereitschaft zur Übernahme des Amtes eines Generalmusikdirektors nur sechs Monate vor der Eröffnung des Hauses zurückgezogen. In einem offenen Brief an Intendant Burghardt hatte er als Grund für seine Entscheidung angegeben, er sei zu der Erkenntnis gekommen, dass „Politik und Propaganda vor der Türe dieses ‚Tempels‘ nicht Halt machen werden“.119 Auch verwies Kersten auf die politische Einflussnahme bei der Inszenierung von Michael Glinkas Ruslan und Ludmilla vom November 1950 : „Natürlich sind die Russen daran interessiert. Aber die Beckmesser aus Karlshorst sind nicht zufrieden. Nach zwei Vorstellungen wird die Neuinszenierung vom Spielplan abgesetzt. Ein Leitartikel 117 Siehe auch etwa : „Volkseigene Musen“, in : Der Tagesspiegel vom 12.08.1955. 118 Heinz Kersten, „Was geschah seit 1945 ?“, in : Der Tagesspiegel vom 04.09.1955. 119 LAB, C Rep. 167, Nr. 46. – Der Brief ist als Faksimile abgedruckt in Quander, Apollini, S. 225, ebenso wiedergegeben in : Ulrich Dibelius und Frank Schneider (Hg.), Neue Musik im geteilten Deutschland. Dokumente aus den fünfziger Jahren, Berlin 1993, S. 270.
„Mittelpunkt für eine neue deutsche Opernkultur“
55
in der ‚Täglichen Rundschau‘ ist schuld daran. Dort hatte sich der sagenhafte Herr Orlow, der immer dann aufzutreten pflegte, wenn den Sowjets etwas faul schien im Staate ‚DDR‘, der Staatsoper angenommen. Die ‚formalistische‘, an ‚mangelndem Optimismus‘ krankende ‚Ruslan‘-Premiere bot Anlaß zu der Forderung, die Intendanz müsse von den ‚immer noch herumsitzenden verschwommenen Mystizismen gereinigt‘ werden.“ Erst „in einer völlig banalen Inszenierung“ des Werkes ein halbes Jahr später durch den Intendanten Ernst Legal sei dann „dem ‚sozialistischen Realismus […] Genüge getan worden“. Genauso wie Legal hätten sich im März 1951 auch Bertolt Brecht und Paul Dessau nach der Uraufführung ihrer Oper Das Verhör des Lukullus dem politischen Diktat beugen müssen. „Pieck und Ulbricht in der Loge rührten keine Hand. Das entschied“, sodass das Werk erst nach Umarbeitungen ein halbes Jahr später wieder unter dem neuen Titel Die Verurteilung des Lukullus auf den Spielplan habe kommen dürfen. Doch waren aus westdeutscher Sicht nicht nur diese zurückliegenden Ereignisse Beleg für die fehlende Freiheit an der Staatsoper. Auch die Eröffnungsfeierlichkeiten hätten dafür Beispiele geboten. Der Berliner Kurier führte eine Szene im Rahmen des Festaktes an, bei der ein „sehr junge[r] und sehr eifrige[r] Mann im dunklen Anzug […] einem von den Berliner AP-Korrespondenten den Gebrauch der Kamera verwehrte und ihn der Einfachheit halber gleich mitkommen ließ“. Zwar sei der Korrespondent sogleich wieder entlassen worden, „aber der kleine Vorfall bewies doch immerhin, daß die Freiheitsfanfare in Beethovens III. Leonoren-Ouvertüre, mit welcher der Festakt ausklang, lediglich akademisch-musikalische Bedeutung“120 besessen habe. So werden die westdeutschen Journalisten ihren Rückweg kurz vor Mitternacht mit höchst gemischten Gefühlen angetreten haben, als sie, wie Sabine Lietzmann in der FAZ schilderte, „aus Scheinwerferflut und Zuschauermenge wieder in das Dunkel der ‚Linden‘ [eintauchten], die sich in Höhe Friedrichstraße, trüb beleuchtet und menschenleer, bis zum Brandenburger Tor erstre120 „Rechte Freude erst am Nachmittag“, in : Der Kurier vom 05.09.1955. An anderer Stelle war von den „aufmerksamen jungen Männern in den ‚unauffälligen‘ Streifenanzügen“ die Rede, die sich im Apollosaal „in einiger Entfernung postiert“ und „von der Höhe des Foyerumgangs auf die lässig plaudernde Prominenz“ hinabgeblickt hätten. Sabina Lietzmann, „Gala-Abend Unter den Linden“, in : Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 06.09.1955.
56 Eröffnungsfeiern
cken. Vor uns nur die Schlußlichter westlicher Autos und eine höfliche Volkspolizeikontrolle am Pariser Platz, die die festlich gekleideten Opernbesucher ohne Blick in den Kofferraum grüßend passieren ließen.“121 Als in West-Berlin sechs Jahre später, am 24. September 1961, in der Charlottenburger Bismarckstraße, welche die Fortsetzung der Linden über die Straße des 17. Juni hin nach Westen bildete, der Neubau der Deutschen Oper eröffnet wurde, war das Brandenburger Tor verschlossen. Nur sechs Wochen zuvor, am 13. August, hatte die DDR die Mauer errichtet und die Stadt dadurch unüberwindlich geteilt.
2. „Was das freie Deutschland an geistiger Substanz bietet“ – Die Eröffnung der West-Berliner Deutschen Oper in Charlottenburg am 24. September 1961
Am Vormittag des 24. September drängten sich viele West-Berliner122 entlang der Charlottenburger Bismarckstraße, um anlässlich der Eröffnung der neu erbauten Deutschen Oper der Ankunft der internationalen politischen und kulturellen Prominenz beizuwohnen. Die Plätze unmittelbar auf der gegenüberliegenden Straßenseite der Oper, von denen aus man die beste Sicht hatte, waren schwer umkämpft. Von hier aus war gut zu verfolgen, wie der neue Intendant Gustav Rudolf Sellner am Eingang die Festgäste empfing. Das Äußere des von dem Berliner Architekten Fritz Bornemann entworfenen Gebäudes, das im Rahmen dieser Szene gewissermaßen das ‚Bühnenbild‘ abgab, bot einen ungewohnten Anblick. Der Bau war als schlichter Kubus geformt worden. Antikisierende Säulen, Musenfiguren oder andere historistische Bauformen, wie man sie von Opernhäusern ansonsten gewohnt war und wie sie auch die Ost-Berliner Lindenoper enthielt, suchte man an dem Bau vergeblich. Während an den Seiten große Fensterfronten Einblicke ins Innere gewährten, bestand die Fassade zur Straße hin als fensterlos geschlossene Wand aus 88 großen quadratischen, mit 121 Ebd. 122 Die zahlenmäßige Einschätzung Stuckenschmidts, wonach die West-Berliner die Bismarckstraße „ zu Tausenden“ gefüllt hätten, ist möglicherweise übertrieben. Hans Heinz Stuckenschmidt, „,Giovanni‘ im neuen Haus“, in : Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 26.09.1961.
„Was das „Mittelpunkt freie Deutschland für einean neue geistiger deutsche Substanz Opernkultur“ bietet“
57
dicken Flusskieseln bestückten Waschbetonplatten. Einzig eine vor der Stirnseite postierte eine 20 Meter hohe abstrakte stählerne Skulptur des Bildhauers Hans Uhlmann, die sich einer Pflanze ähnlich vom Straßenniveau aus erhob, im mittleren Bereich gleichsam verknotete, um dann senkrecht in die Höhe auszuschlagen, lockerte die strenge Architektur auf. Der Bau war an der gleichen Stelle entstanden, an der 1912 im damals noch von Berlin unabhängigen Charlottenburg das Deutsche Opernhaus, ein monumentales vierrangiges Theater mit 2.300 Plätzen im klassizistischen Stil des Theaterarchitekten Heinrich Seeling, als bürgerliches Konkurrenzinstitut zur höfischen Lindenoper seine Eröffnung erlebt hatte.123 In der Nacht zum 23. November 1943 war das Opernhaus, seit 1939 genauso wie die Lindenoper Teil der nationalsozialistischen Ost-West-Achse, durch Bomben stark zerstört worden. Nach dem Ende des „Dritten Reiches“ als Städtische Oper im Theater des Westens wieder gegründet, war aus der bis dahin rein künstlerischen Konkurrenz der Bühne zur Staatsoper im Kontext des Kalten Krieges auch eine politische Konkurrenz geworden. Dem verdankte sich maßgeblich auch der Neubau in der Bismarckstraße. Wie die Deutsche Staatsoper Unter den Linden aus Sicht der DDR, sollte die nunmehr in Deutsche Oper Berlin umbenannte neue Bühne in Charlottenburg aus West-Berliner Sicht Deutschland im Ganzen kulturell repräsentieren. Da das finanzschwache West-Berlin den Bau nicht bezahlen konnte, wandte man sich an die Bundesregierung, die sich 1956 schließlich zur Übernahme der auf 18 Millionen DM bezifferten Kosten bereit erklärte.124 Mit einem Mehrbedarf von 9,5 Millionen DM konnte der Bau sechs Jahre später – Hamburg, Köln, Düsseldorf und Hannover hatten längst wieder eine Oper – vollendet werden, womit die ‚Schaufenster‘-Hälfte West-Berlin um eine architektonische Attraktion reicher war. Zur Eröffnung der Bühne waren aus Bonn Bundespräsident Heinrich Lübke, das diplomatische Corps mit dem amerikanischen und französischen Botschafter an der Spitze sowie die Vertreter des West-Berliner Senats gekommen.125 123 Irmhild Heckmann-von Wehren, Heinrich Seeling – Ein Theaterarchitekt des Historismus, München/Hamburg 1994, v.a. S. 72 und 224ff. 124 „Bornemann 1. Preisträger. Wettbewerb Deutsches Opernhaus entschieden“, in : Der Tagesspiegel vom 23.09.1955. 125 „Lübke eröffnet das Deutsche Opernhaus [sic] in Berlin“, in : Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 25.09.1961.
58 Eröffnungsfeiern
Zu sehen waren des Weiteren prominente Künstler aus der Bundesrepublik und anderen westeuropäischen Ländern, Komponisten und Dirigenten, Schauspieler, Schriftsteller, Maler und Bildhauer, dazu Rektoren und Professoren der Berliner Hochschulen126, darunter etwa auch der Direktor der West-Berliner Musikhochschule Boris Blacher. Um die Teilnahme westdeutscher Regierungsmitglieder an der Operneröffnung hatte es im Vorfeld Auseinandersetzungen mit dem West-Berliner Senat gegeben : Kurzfristig war die Teilnahme der Minister Heinrich von Brentano, Richard Stücklen, Paul Lücke, Werner Schwarz und Siegfried Balke sowie des Bundestagsvizepräsidenten Carlo Schmidt an der Feier abgesagt worden. Dies entsprach der Linie des Bundeskabinetts, das in seiner Sitzung am 20. September wegen des Mauerbaus festgestellt hatte, dass „besonders im Hinblick auf die schwierige Situation der Deutschen in der Zone jeder Eindruck von übertriebener Festlichkeit vermieden werden muss. Zurückhaltung erscheine geboten.“127 In einer scharfen Stellungnahme hatte daraufhin der Regierende Bürgermeister Willy Brandt die Absage der Minister als „politische Leisetreterei“128 verurteilt. So war am 24. September nur der Bundesminister für Gesamtdeutsche Fragen Ernst Lemmer anwesend. Umso herzlicher begrüßte man dafür in der Deutschen Oper den Luftbrückengeneral Lucius D. Clay, der von Präsident Kennedy nach dem Mauerbau als amerikanischer Sonderbeauftragter nach Berlin entsandt worden war. Betraten die Festgäste den Bau, erlebten sie im Inneren die Fortsetzung der schlichten Außenarchitektur. Auch hier war auf historisierende Bauformen oder sonstige Ornamente verzichtet worden. In den Foyers konnten großformatige zeitgenössische Plastiken von Henry Moore und Jean Arp, Fritz Wotruba, Kenneth Armitage und Henri Laurens sowie ein abstraktes Gemälde von Ernst Wilhelm Nay betrachtet werden, die dem Fest, wie der Tagesspiegel meinte, einen 126 Hans Heinz Stuckenschmidt, „,Giovanni‘ im neuen Haus“, in : Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 26.09.1961. 127 Die Kabinettsprotokolle der Bundesregierung, bearbeitet von Ulrich Enders und Jörg Filthaut, Bd. 14, 1961, München 2004, S. 255. Bereits am 18. September war es zu einem Gespräch zwischen dem Auswärtigen Amt und Vertretern der drei Westmächte gekommen, bei dem die britische Seite Bedenken gegen die ursprünglich beabsichtigte Teilnahme einer großen Zahl von Kabinettsmitgliedern artikuliert hatte. Siehe : ebd. S. 257. 128 „Lübke eröffnet das Deutsche Opernhaus [sic] in Berlin“, in : Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 25.09.1961.
„Was das „Mittelpunkt freie Deutschland für einean neue geistiger deutsche Substanz Opernkultur“ bietet“
59
„besonders modernistischen Akzent“129 verliehen. In der Eröffnungsfestschrift war zu lesen, bei der Auswahl der – indes nur geliehenen – Kunstwerke seien „internationale Maßstäbe“ angelegt und bei den Künstlern nur die „Größten ihres Metiers“ berücksichtigt worden, wie es für ein „internationales Institut“130 wie ein Opernhaus angemessen sei. Modern präsentierte sich auch der zweirangige Zuschauerraum mit seinem Fassungsvermögen von 1.920 Menschen. Die für ein Opernhaus typischen Logen fehlten, die Bestuhlung hatte der Architekt schlicht gehalten. Anstelle der traditionellen roten Plüschsessel fand man hier einfache mit gelbem Stoff bezogene „Sitzschalen“131 vor. Die Wände waren mit dunklem Holz vertäfelt. Statt des gewohnten Kronleuchters enthielt der Raum eine größere Anzahl tellerartiger Glaslampen, deren besondere Form einer guten Raumakustik dienlich sein sollte. Aufgrund der vorausgegangenen politischen Ereignisse war der Festakt, wie die FAZ charakterisierte, nicht von einer „elfenbeinernen Festlichkeit“, sondern glich vielmehr einer „Gedenkveranstaltung für die vom 13. August Betroffenen“.132 So betonte Willy Brandt in seiner Rede : „Wir haben den festlichen Rahmen bewusst schlicht gehalten, denn Prunk ziemt sich nicht in diesen Tagen.“133 Auch Heinrich Lübke äußerte sich zum zurückhaltend-festlichen Rahmen der Eröffnung. In die Freude über die Operneröffnung mische sich „ein tiefer Schmerz. Die Deutsche Oper Berlin sollte ja nicht nur der Bevölkerung des freien Teils dieser Stadt offen stehen. In ihr, das war und blieb unser Wunsch, sollte auch unseren Landsleuten aus Ost-Berlin und aus Mitteldeutschland die Begegnung mit dem sich frei entfaltenden kulturellen Geschehen der Gegenwart möglich sein und für sie eine große Aufgabe erfüllt sein. […] Es wäre deshalb sicher nicht verstanden worden, wenn man hier für die West-Berliner Bevölkerung Feiern veranstaltete, während die Bürger im Ostsektor trauernd abseits stehen müssen. So begnügen wir uns mit einer einfachen Übergabe der Schlüssel an den Inten129 Ebd. 130 Will Grohmann, „Die Gesellschaft der Musen“, in : Deutsche Oper Berlin. Zur festlichen Eröffnung des Hauses. September 1961, Berlin 1961, o. S. 131 „Berliner Prominenz ohne Plüsch und Pomp“, in : Die Welt vom 26.09.1961. 132 Siehe die Bildunterschrift in : Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 25.09.1961. 133 Allen weiteren Zitaten aus den beim Festakt gehaltenen Reden liegt die Transkription des Autors zugrunde, welche dieser vom Radiomitschnitt aus dem rbb-Archiv angefertigt hat. „Einweihung der Deutschen Oper am 24. September 1961“. rbb-Archiv Nr. 901445.
60 Eröffnungsfeiern
danten.“ Mit Rücksicht auf die politische Situation trugen der Bundespräsident wie auch Berlins Regierender Bürgermeister bei der abendlichen Festaufführung dann auch nur einen schlichten dunklen Anzug.134 Die demonstrative Zurückhaltung der Politiker hielt jedoch das Publikum nicht von der für solche Anlässe festlichen Selbstdarstellung ab. Bei der Opernaufführung am Abend sparten die Damen nicht mit großen Abendkleidern, während bei den Herren bis in die letzte Reihe des zweiten Ranges Frack und Smoking vorherrschten.135 Wie der Festakt bei der Lindenoper 1955 mit dem Auferstanden aus Ruinen begann, um die nationale Bedeutung des Ereignisses zu betonen, bildete 1961 das Deutschlandlied, gespielt vom Orchester der Deutschen Oper, den Auftakt der Feier. Wenn auch Ostdeutsche durch den Mauerbau von der Teilnahme an der Operneröffnung abgeschnitten waren, wurde der gesamtdeutsche Anspruch des Ereignisses dennoch nicht aufgegeben. Dazu führte Heinrich Lübke in seiner Rede aus : „Stellvertretend für unsere Landsleute in Ost-Berlin und der Zone begrüßen wir […] mit ganz besonderer Herzlichkeit Flüchtlinge in unserem Kreise, die sich in den letzten Wochen und Monaten gezwungen sahen, unter Gefahr für Leib und Leben ihre vertraute Umgebung, ihren Arbeitsplatz und Menschen zu verlassen, die ihnen lieb sind.“ In diesem Sinne erhoffte sich der Bundespräsident von der Operneröffnung „starke und nachhaltige Impulse für das Musikleben in ganz Deutschland“ und dass die „Strahlkraft Berlins […] mit dem Einzug der Deutschen Oper in ihr wiederaufgebautes Haus erneuert und verstärkt“ werde. In ihren Ansprachen äußerten sich Lübke und Brandt, Volksbildungssenator Joachim Tiburtius, der scheidende Intendant Carl Ebert und sein Nachfolger Sellner dann grundlegend zur gesellschaftlichen Funktion und zum Charakter der Deutschen Oper. Die programmatischen Aussagen der Politiker und Künstler richteten sich gleichzeitig auf die Zukunft der Bühne, wie sie auch ein Resümee der bisherigen künstlerischen Arbeit der Städtischen Oper seit 1945 waren. Durch einen Vergleich der 1961 in West-Berlin vorgetragenen Positionen mit denen 1955 in Ost-Berlin lassen sich Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der kulturellen Selbstdarstellung beider Systeme herausarbeiten : Interessant ist, dass 134 Günter Matthes, „Berliner bejubelten die gelungene Premiere“, in : Der Tagesspiegel vom 26. 09.1961. 135 Ebd. ; Hans Heinz Stuckenschmidt, „,Giovanni‘ im neuen Haus“, in : Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 26.09.1961.
„Was das freie Deutschland an geistiger Substanz bietet“
61
die Redner in West-Berlin – wie auch Johannes R. Becher 1955 im Zusammenhang mit der Eröffnung der Staatsoper – der Deutschen Oper eine grundlegende ethisch-moralische Dimension zuwiesen. Lübke betonte in seiner Ansprache, die Deutsche Oper habe eine „große erzieherische Aufgabe“. „Mit der Auswahl und der Interpretation der Werke, die sie ihren Besuchern vorstellt, soll sie dafür wirken, dass der Mensch seine Verantwortung und seine Gemeinschaftsverpflichtung erkennt, sich frei zu machen von jener verderblichen Ichsucht, die sich um die Not der anderen nicht kümmert. Wer wirklich im Denken und Handeln des anderen Last mitträgt, der wird auch Hilfe finden bei der Überwindung der eigenen Not.“ Diese ethische Maxime bezog er auf die politische Teilung Deutschlands : „Wie könnten wir zum Beispiel andere Völker dazu anhalten, sich für unser Recht auf Selbstbestimmung einzusetzen, wenn wir selbst nicht bei jeder sich bietenden Gelegenheit den Flüchtlingen und den Landsleuten in Ostberlin und der Zone zu Hilfe kommen ?“ Doch verstand Lübke unter der ethischen Dimension etwas anderes als der ostdeutsche Kulturminister. Während für Becher das Publikum an der Staatsoper durch die vermeintlich politischen Aussagen der dargebotenen Opern zur Parteinahme für den Sozialismus geführt werden sollte, meinte Lübke zunächst in einem unpolitischen Sinne eine individuelle moralische Veredelung des Einzelnen. „Kultur will von jedem Einzelnen erworben werden und ihm zu einer höheren Lebensauffassung verhelfen.“ Freilich sollte sich das Individuum, so sah es Lübke, dadurch gegenüber der politischen Gemeinschaft, in der es lebe, als nützlich erweisen. Den hohen Wert der Kultur, der sich für Lübke aus einem solchen Verständnis ergab, unterstrich er mit einer Aussage, die man in dieser Form im kapitalistischen westdeutschen System möglicherweise nicht vermuten würde : „Kultur ist nicht für Geld zu kaufen. Sie ist keine gängige Handelsware, deren Preis sich nach dem Verhältnis von Angebot und Nachfrage bemisst.“ Auch Willy Brandt betonte in seiner Rede den unpolitischen Charakter der Kunst : „Das Spannungsverhältnis zwischen Kunst und Politik scheint gerade am heutigen Tage und an diesem Ort für uns durchsichtig und lösbar. Mit der Freiheit für die Menschen, um die wir kämpfen, steht und fällt auch die Freiheit der Kunst.“ An anderer Stelle, in der Eröffnungsfestschrift, hatte der Regierende Bürgermeister erläutert, was er damit meinte, nämlich „nicht einen kulturellen Auftrag ins Politische zu verbiegen, sondern durch die reine“, und das hieß eine in Bezug auf den Inhalt der aufgeführten Werke
62 Eröffnungsfeiern
unpolitische „Darstellung seiner Kunst Beispiel und Maßstab dessen zu sein, was in Deutschland die Opernbühne bedeutet“.136 Schließlich unterstrich auch Volksbildungssenator Tiburtius die ethisch-moralische Funktion der Oper, wenn er Carl Ebert in einer Hommage mit Verweis auf Friedrich Schillers bekannten Schaubühne-Vortrag bescheinigte, in dessen Inszenierungen sei „die Schaubühne wirklich zur moralischen Anstalt geworden“. Wie Lübke grenzte sich auch Tiburtius von einer Politisierung der Oper ab, wobei er in seinem typisch launigen Vortragsstil Eberts Kunstauffassung als ideal und vorbildlich beschrieb : Manche von dessen Kollegen würden es für nötig halten, beim Se vuol ballare, Signor Continuo, der Arie des Figaro aus Mozarts gleichnamiger Oper, in welcher der Graf im übertragenen Sinne zum ‚Tanz‘ aufgefordert wird, „hinter der Fensterscheibe rotes Licht leuchten zu lassen, damit jeder begreift, hier geht’s um Revolution“, was im Publikum mit zustimmendem Gelächter quittiert wurde. Bei Ebert hingegen leuchte „das Licht auf dem Nerv der Musik, aus Bewegung, Vortrag und Ton. Das ist, glaube ich, musikalisch und der Oper gerechter und gerade auf dem Wege einer nicht verbogenen Kunst wachsen ja die großen sittlichen Kräfte, die Menschen tauglich machen, auch den Mächten der Finsternis zu widerstehen.“ Auch Tiburtius brachte sein Kunstverständnis in Beziehung zu den jüngsten politischen Ereignissen. Ebert habe mit seinem künstlerischen Wirken anderen Menschen gezeigt, „dass es sich lohnt, zusammenzustehen und uns zu verteidigen und sich selbst“. Carl Ebert nutzte seine Ansprache zu einer Reflexion über die Worte „Dem Großen, Wahren, Schönen“, die man, wie er ausführte, gewohnt gewesen sei, bei einem Theaterneubau so oder ähnlich in Stein gemeißelt über das Gebäude zu setzen. Ebert bezog sich damit letztlich auf denselben sprachlichen Zusammenhang, über den 1955 auch Johannes R. Becher reflektiert hatte, der 1955 vom „Schönen, Guten, Wahren“ gesprochen hatte. Ebert kritisierte den Verfall jener Begriffe in der Gegenwart, hätten sie doch in der Vergangenheit, womit er offensichtlich den Nationalsozialismus meinte, leider „oft einen anderen Sinn bekommen […]. Wir haben uns von diesen Worten weggewendet, und das ist schade. Wir sollen wieder zurückfinden zu ihnen, wir sollen das, was sie wirk136 Willy Brandt, [Grußwort], in : Deutsche Oper Berlin. Zur festlichen Eröffnung des Hauses. September 1961, Berlin 1961, o. S.
„Was das freie Deutschland an geistiger Substanz bietet“
63
lich im Tiefsten enthalten, uns ins Bewusstsein rufen, wir sollen wieder daran glauben, dass es ein Großes, ein Wahres und ein Schönes gibt. Und wir sollen deswegen daran glauben, an dieser Stelle um so mehr, weil dieses Haus diesen Dingen, diesen Symbolen gewidmet sein wird.“ Auch auf das Verhältnis des Theaters zur Politik allgemein kam Ebert zu sprechen. Der Intendant sagte, ihm sei im Ausland oftmals die Frage gestellt worden : „,Ja, dieses subventionierte Theater in Deutschland – abhängig von dem Votum des Parlaments oder der Parlamente –, ist da nicht Korruption und Neffenwirtschaft und ähnliches im Gange ? Kann man denn frei arbeiten ?‘“ Er habe, so der Intendant, „oft und oft Gelegenheit gehabt […], immer wieder zu betonen : diese Freiheit existiert ! Man gibt uns und man gab mir in so hohem Maße die künstlerische Freiheit, dass eines bei mir gewachsen ist, wie ich’s kaum ahnen und hoffen durfte : das Gefühl der persönlichen Verantwortung. Und die allein macht den […] schöpferischen Menschen.“ Nur auf der Grundlage künstlerischer Freiheit sei es möglich, das Wahre in der Kunst zu finden. Als Beispiel verwies er auf die deutsche szenische Erstaufführung von Arnold Schönbergs Moses und Aron im Jahr 1959 an der Städtischen Oper – ein Werk, das während des Nationalsozialismus zur ‚entarteten‘ Kunst gezählt worden und noch bei seiner West-Berliner Premiere 1959 bei Teilen des Publikums auf heftige Ablehnung gestoßen war. Ebert dankte seinem „direkten Vorgesetzten“, dem Volksbildungssenator Tiburtius, der „mit ungeheurem und nie ermüdendem Verständnis alle Wege mitbeschritten hat, auch dann, wenn sie ihm nicht richtig erschienen, auch dann, wenn sie ihm holprig erschienen, auch dann, wenn er sagt, es ist vielleicht nicht ganz angebracht, wenn ich sagte ‚ich muss, ich muss aus innerem Bedürfnis, aus innerem Glauben an eine Sache‘“. Nie habe Ebert von Tiburtius „auch nur den leisesten Widerstand oder gar eine Direktive erfahren“. Anders als an der Staatsoper 1955 war weder in Eberts noch in den anderen Ansprachen die Rede vom nationalkulturellen Erbe, das es an der Deutschen Oper zu retten gälte, wie es sich die DDR kulturpolitisch auf die Fahnen schrieb. Stattdessen betonte etwa Willy Brandt den kosmopolitischen Charakter der neuen West-Berliner Oper. Das Institut werde „seine Kraft ziehen aus dem, was das freie Deutschland an geistiger Substanz bietet. Es wird weltoffen sein, wie es dem Wesen der Kunst und dem Geist unserer Stadt entspricht.“ Was konkret das Repertoire des neuen Hauses anbelangte, fiel darunter alles, „was durch
64 Eröffnungsfeiern
zwei Jahrhunderte Berliner Operngeschichte als lebendige Tradition auf uns gekommen ist“137, wie Sellner in der Eröffnungsfestschrift formulierte. Nicht nur sollten „die Linien der repräsentativen […] Oper mit all ihren Wandlungen und Modifikationen“ berücksichtigt werden, womit er Gaspare Spontini und Giacomo Meyerbeer meinte, sondern auch eine volkstümliche Oper wie Carl Maria von Webers Freischütz. „Zur Geschichte der Oper in Berlin gehören seit der Uraufführung des ‚Wozzeck‘ in der Lindenoper und den avantgardistischen Dokumentationen des neuen Musiktheaters in der Krolloper in ganz starkem Maße auch die zeitgenössischen Werke.“ Sellner zielte somit auf einen Spielplan „zwischen Tradition und Zukunft“. Dem entsprach auch die Auswahl der Musikstücke, die das Orchester der Deutschen Oper beim Festakt vortrug : als Beleg der Verbundenheit mit der Tradition – wie auch 1955 an der Staatsoper – die Dritte Leonoren-Ouvertüre aus Ludwig van Beethovens Oper Fidelio, als Ausdruck des zeitgenössischen Schaffens der erste Satz aus Paul Hindemiths Symphonie Matthis der Maler („Engelskonzert“). Abends kamen die Gäste zur Festaufführung von Mozarts Don Giovanni in einer Neuinszenierung Carl Eberts erneut zusammen.138 Interessant ist, dass auch hierbei die nationale Bedeutung des Ereignisses symbolisch betont wurde. Bevor der Dirigent Ferenc Fricsay zur Ouvertüre anhob, trat Bundespräsident Lübke im ersten Rang an die Brüstung, woraufhin sich wie am Morgen alle Gäste zum Vortrag der Nationalhymne erhoben – eine politische Demonstration, welche die Zeit im Übrigen als „in Deutschland vor Opernaufführungen nicht üblich“139 bezeichnete. Das Eröffnungsprogramm der Deutschen Oper sah zusätzlich zum Don Giovanni, der vom Publikum mit lang anhaltendem Applaus gefeiert wurde, drei weitere festliche Eröffnungspremieren vor : Giuseppe Verdis Aida in einer Inszenierung des Wagner-Enkels Wieland, Glucks Orpheus und Eurydike sowie die Uraufführung von Giselher Klebes in der Zwölftontechnik komponierten Oper Alkmene. Anders als in Ost-Berlin, wo mit den vier Festpremieren der Hochachtung gegenüber dem nationalkulturellen Erbe Ausdruck verliehen werden sollte, 137 Gustav Rudolf Sellner, [Grußwort], in : ebd., o. S. 138 Im Fernsehen wurde am Abend des 24. September vom Sender Freies Berlin eine Aufzeichnung der Generalprobe ausgestrahlt. 139 Johannes Jacobi, „Eine neue deutsche Oper“, in : Die Zeit vom 29.09.1961.
„Was das freie Deutschland an geistiger Substanz bietet“
65
überschritt man in West-Berlin mit Aida nicht nur den nationalen Horizont, sondern zeigte sich mit der Aufführung von Klebes neuer Oper auch gegenüber der kulturellen Moderne als aufgeschlossen. Bedenkt man die Anwesenheit hoher politischer wie kultureller Prominenz, die nationale Symbolik, den materiellen Aufwand in der architektonischen Gestaltung und nicht zuletzt das große Interesse Schaulustiger bei der Eröffnung der Lindenoper wie der Deutschen Oper, wird deutlich, dass den Berliner Opernbühnen auf beiden Seiten der geteilten Stadt eine wichtige politisch-gesellschaftliche Bedeutung innerhalb der deutsch-deutschen System- und Kulturkonkurrenz beigemessen wurde. Dabei erschöpfte sich die kulturelle Repräsentation beider Gemeinwesen keineswegs darin, dass die jeweilige Gegenseite in quantitativer Hinsicht durch Pracht und Glanz der Opernkultur überboten werden sollte. Vielmehr dienten die Eröffnungsfeiern auch dazu, in qualitativer Hinsicht grundlegende Vorstellungen von einer idealen deutschen Opernbühne, nicht zuletzt in Abgrenzung vom jeweiligen Gegenüber, zu artikulieren und propagieren. Gemeinsam war beiden Seiten der ethisch-moralische Anspruch an die Aufführungen. Während damit jedoch im Osten in politischer Hinsicht eine Erziehung zum Sozialismus gemeint war, verstand man darunter im Westen die individuelle Versittlichung des Einzelnen, die nur vermittelt eine politische Dimension erhielt. Gemeinsam war darüber hinaus der Rekurs auf das „Schöne, Gute und Wahre“ durch Becher beziehungsweise auf das „Große, Wahre, Schöne“ durch Ebert. Während für Becher damit das Ideal des klassischen kulturellen Erbes gemeint war, an dem sich eine zeitgenössische Opernproduktion zu orientieren habe, bezog Ebert bewusst auch ein avantgardistisches Werk wie Schönbergs Moses und Aron in sein Verständnis mit ein. Hervorzuheben gilt in diesem Zusammenhang, dass gerade auch im Westen betont wurde, was für den antikapitalistischen Osten selbstverständlich schien, nämlich, dass die Kunst keine käufliche Ware sei. Beide Seiten unterschieden sich schließlich insofern, als in Ost-Berlin die Pflege des nationalen kulturellen Erbes in den Vordergrund der kulturpolitischen Bemühungen gerückt wurde, während man in West-Berlin den kosmopolitischen Charakter des neuen Opernhauses betonte.
66 Eröffnungsfeiern
Obwohl die Eröffnung von 1955 als auch jene von 1961 zeigen, dass man sich – wenn auch kaum offen ausgesprochen – von den Kunstvorstellungen des „Dritten Reiches“ und somit der nationalistischen Idee einer Suprematie der deutschen Kunst distanzierte, stellt sich doch die Frage, ob an den Berliner Opernbühnen nach 1945 nicht doch mehr Kontinuität zu Kunstvorstellungen der NS-Zeit bestand, als zugegeben wurde. Dass anlässlich der Staatsoperneröffnung gerade Richard Wagners durch den Nationalsozialismus so belastete Meistersinger, flankiert von einem emphatischen Bekenntnis zur deutschen Nationalkultur, gegeben wurden, noch dazu mit einer Propaganda gegen die kulturelle Überfremdung durch die USA, lässt am Selbstbild kultureller Weltoffenheit des ostdeutschen Staates zweifeln. Dieselben Zweifel sind jedoch auch im Zusammenhang mit West-Berlin angebracht, wo es nicht zuletzt etwa durch den Intendanten der Jahre 1948 bis 1961, Heinz Tietjen, personelle Kontinuität zum Nationalsozialismus in diesem wichtigen Amt gab. Überhaupt ist zu fragen, inwiefern die propagierten Kunstvorstellungen an den Berliner Opernbühnen tatsächlich eine Umsetzung fanden. Es wurde schon erläutert, dass der Westen am Beispiel von Brechts/Dessaus Verhör des Lukullus das in Ost-Berlin propagierte Selbstbild kultureller Freizügigkeit energisch bestritt. Möglicherweise hängt damit auch zusammen, dass bei der Eröffnungsfeier des Jahres 1955 Brechts/ Weills Dreigroschenoper nicht ein einziges Mal erwähnt wurde. Die Frage nach der Umsetzung der Kunstvorstellungen betrifft aber ebenso die West-Berliner Oper. Vor dem Hintergrund des virulenten Antikommunismus in der frühen Bundesrepublik und der Gefährdung bürgerlicher Rechte in den USA während der McCarthy-Ära140 ist zu fragen, ob es nicht auch in West-Berlin entgegen dem brusttönigen Bekenntnis zur Freiheit der Kunst faktisch zu Einschränkungen kam.
140 Siehe dazu etwa : David Caute, The Dancer Defects. The Struggle for Cultural Supremacy During the Cold War, Oxford 2003, S. 24ff.
II. Vorstellungen von einer idealen deutschen Opernbühne Politiker und Künstler artikulierten bei den Eröffnungsfeiern der Staatsoper Unter den Linden 1955 und der Deutschen Oper 1961 jeweils auf verschiedene Weise lange tradierte bildungsbürgerliche Vorstellungen vom Charakter einer idealen deutschen Opernbühne. Um die ideengeschichtliche Herkunft der am jeweiligen Opernhaus propagierten Kunstvorstellungen zu verdeutlichen, wird deren Genese im folgenden Kapitel bis zurück ins 18. Jahrhundert nachgezeichnet. Auf diese Weise soll deutlich werden, dass die von Georg Bollenbeck beschriebenen und in der Einleitung der Arbeit erläuterten nationalkulturellen Argumentationsfiguren bildende Funktion, schöner Schein und ursprungsmythologische Genese auch für die Idee einer idealen deutschen Opernbühne von grundlegender Bedeutung waren. Mit dem Anspruch von Musteraufführungen im Hinblick auf die szenische Umsetzung wird jenen drei ideengeschichtlichen Dimensionen darüber hinaus eine vierte, dem Performanzaspekt von Opernaufführungen geschuldete hinzugefügt. Historisch weit auszugreifen ist deswegen wichtig, weil sich die nach 1945 vollziehenden Wandlungen nationaler kultureller Repräsentation nur vor dem Hintergrund der langen Kontinuität bildungsbürgerlicher Kunstvorstellungen in ihrer ganzen Tragweite ermessen lassen. 1. Waffen des Staates – Deutsches Opernhaus und Preußische Staatsoper Unter den Linden im Nationalsozialismus
26 Jahre vor der Einweihung der West-Berliner Deutschen Oper ereignete sich am gleichen Ort im Vorgängerbau ebenfalls eine Operneröffnung. Nach einer umfangreichen architektonischen Umgestaltung durch den Architekten Paul Baumgarten wurde das Deutsche Opernhaus am 17. November 1935 feierlich wiedereröffnet. Als Ziel nannte Baumgarten nichts Geringeres, als aus dem Bau von 1912 die „repräsentative Reichsoper des deutschen Volkes“141 zu machen. 141 Paul Baumgarten, „Die bauliche Erneuerung des Deutschen Opernhauses“, in : Das Theater 16 (1935), S. 203–206, hier S. 203.
68
Vorstellungen von einer idealen deutschen Opernbühne
Als Festaufführung der dem Goebbelschen Ministerium für Volksaufklärung und Propaganda unterstellten Bühne erklangen in Anwesenheit Adolf Hitlers Die Meistersinger von Nürnberg von Richard Wagner in einer Neuinszenierung des Intendanten Wilhelm Rode mit Bühnenbildern von Benno von Arent. Die Aufführung dieses Werkes des „deutschesten aller deutschen Meister“142, wie der Dramaturg Karl Hermann Müller betonte, entsprach der künstlerischen Linie des Hauses im Nationalsozialismus, wonach im „Spielplan […] vor allem der deutsche Gedanke zum Ausdruck kommen“143 sollte. Die Aufführung der Werke Wagners war Bestandteil des Hauptanliegens der Bühne, nämlich die vermeintlich „werkgetreue Wiedergabe der Meisterwerke der deutschen Kunst“, worunter die Opern von Mozart, Weber, Beethoven, aber auch etwa die von Lortzing, Flotow und Humperdinck fielen. Dramaturg Müller wies dabei auf die politische Aufgabe der Opernbühne hin, wozu er Adolf Hitler zitierte, wonach sich die Künstler ihrer Aufgabe bewusst zu sein hätten, „die ihnen die Nation überträgt : die stolzeste Verteidigung des deutschen Volkes mit zu übernehmen durch die deutsche Kunst !“144 Selbst wenn am Deutschen Opernhaus wie an allen anderen Opernbühnen des „Dritten Reiches“ das etablierte klassischromantische europäische Repertoire mit Verdi, Rossini und Puccini weiter gepflegt wurde145, galt das Primat doch selbstverständlich den nationalen Werken. In einem pathetischen Vers, der die gleichsam religiöse Erhabenheit der Kunst verdeutlichen sollte, hieß es anlässlich der Festaufführung in der von der Bühne herausgegebenen Zeitschrift : „Das Volk bricht auf, aus Wirrnis und aus Wagen / zum heil’gen Tempel, welchen Kunst ihm baut. / Der Künstler aber darf die Leuchte tragen, / weil er im Sturm der Welt die Gottheit schaut.“146 Immer wieder wurde im Rahmen der Einweihung der Opernbühne auf die Notwendigkeit 142 Karl Hermann Müller, „Richard Wagner auf der Bühne des Deutschen Opernhauses“, in : Das Theater 16 (1935), S. 216–217, hier S. 216. 143 Wilhelm Rode, „Das Deutsche Opernhaus. Seine deutsche Mission“, in : Das Theater 16 (1935), S. 202. 144 Müller, „Wagner“, S. 216. 145 Henry Bair, „Die Lenkung der Berliner Opernhäuser“, in : Hanns-Werner Heister und HansGünter Klein (Hg.), Musik und Musikpolitik im faschistischen Deutschland, Frankfurt/M. 1984, S. 83–90, hier S. 87 ; Franz-Heinz Köhler, Die Struktur der Spielpläne deutschsprachiger Opernbühnen von 1896 bis 1966. Eine statistische Analyse, [Koblenz] 1968, S. 30ff. 146 Zitiert nach : Roesler, „Opernhaus“, S. 339.
Deutsches Opernhaus und Preußische Staatsoper im Nationalsozialismus
69
der Verbundenheit zwischen Künstler, Kunst und Volk hingewiesen. Als das Ideal galt wiederum Richard Wagner, dessen „beispiellose Volksverbundenheit und naturhafte Kraft“ sowie „gewaltige, unermeßliche und unbeschreibliche, nur erlebbare Fülle bodenständiger Werte […] sein Werk zum Besitztum eines ganzen Volkes gemacht hätten.“147 Den Zusammenhang zwischen Kunst und Volk betonte auch Joseph Goebbels bei einer wenige Tage vor der Eröffnungspremiere eigens für die beim Umbau der Oper beteiligten Arbeiter gegebenen Voraufführung der Meistersinger. Er sei, so der Propagandaminister, der Überzeugung, „daß eine Kunst, die vom Volk nicht mehr verstanden wird, überhaupt keine Existenzberechtigung“148 habe. Der Ideologie der Volksgemeinschaft entsprechend sollten im Nationalsozialismus, so Goebbels, „nicht nur die Begüterten, sondern gerade auch die Arbeiter, der Mittelstand und das Handwerk hier eine Stunde der Erholung und Erbauung finden“.149 Was das für die kulturelle Moderne der Weimarer Republik auf der Opernbühne bedeutete, hatte der den Nationalsozialisten gegenüber willfährige Intendant des Opernhauses Wilhelm Rode in seinem Aufsatz Opernführung im Dritten Reich in den Nationalsozialistischen Monatsheften bereits im Juli 1934 unmissverständlich ausgedrückt. Mit den „expressionistischen Regie- und Bühnenbild-Experimente[n]“ der 1920erJahre, die „heute als wildgewordenes Kunstgewerbe und größenwahnsinnige Gebrauchsgraphik entlarvt“ worden seien, und für die er „meistens jüdische, oder wenigstens […] liberalistisch-intellektuelle mit ‚Auffassung‘“150 verantwortlich machen zu müssen glaubte, habe der Nationalsozialismus zu Recht aufgeräumt. Statt dessen wurde am Deutschen Opernhaus im Nationalsozialismus der am Realismus des 19. Jahrhunderts orientierte pathetische Stil des 1936 zum „Reichsbühnenbildner“ ernannten Benno von Arent zum ästhetischen Ideal und Vorbild für andere deutsche Opernbühnen. Einflussreich wurde etwa 147 Müller, „Wagner“, S. 216. 148 „Arbeiter als erste Gäste im Deutschen Opernhaus“, in : Völkischer Beobachter vom 18.11.1935. 149 Faktisch änderte sich in der Zeit des Nationalsozialismus nur wenig an der Publikumsstruktur des Deutschen Opernhauses. Für neue Publikumsschichten war vor allem die 1934 gegründete „Volksoper“ im Theater des Westens zuständig. Bair, „Lenkung“, S. 86 ; Klaus Geitel, „Die Jahre der ‚Stullenoper‘. Das Theater des Westens zwischen 1933 und 1945“, in : 100 Jahre Theater des Westens 1896–1996, Berlin 1996, S. 155–184. 150 Wilhelm Rode, „Opernführung im Dritten Reich“ (1934), zitiert nach : Joseph Wulf, Musik im Dritten Reich. Eine Dokumentation, Gütersloh 1963, S. 277.
70
Vorstellungen von einer idealen deutschen Opernbühne
von Arents Gestaltung der Schlussszene der Meistersinger-Festaufführung 1935 mit einem szenischen Tableau, das an die Massenaufmärsche der Nürnberger Reichsparteitage erinnerte und das unmittelbar nach der Berliner Premiere von mehreren deutschen Bühnen nur leicht verändert nachgebaut wurde.151 Im Hinblick auf die Rolle der führenden deutschen Opernbühne konkurrierte das Deutsche Opernhaus mit der Preußischen Staatsoper Unter den Linden.152 Wie jenes Haus hatte die unter der persönlichen Obhut des preußischen Ministerpräsidenten Hermann Göring stehende Staatsoper den Anspruch, im Bereich der Oper für das nationalsozialistische Deutschland beispielgebend zu sein. So pries sich Göring im Geleitwort einer Geschichte der Staatsoper von 1937 vollmundig, es sei ihm zu verdanken, dass „aus dem einstigen Hoftheater, einer Schöpfung des Großen Königs [Friedrich der Große, FB], unter Wahrung von dessen ruhmreicher Tradition das Nationaltheater des Dritten Reiches“153 entstanden sei. Was die Funktion dieser Opernbühne im NS-Staat anbelangt, betonte der Dramaturg des Hauses Julius Kapp in demselben Buch – ganz ähnlich wie es am Deutschen Opernhaus geschah – die politisch-erzieherische Aufgabe, stelle doch das Theater eine „wertvolle Waffe des Staates“ dar. Kapp führte aus, die Lindenoper diene im NS-Staat nicht etwa „zur Unterhaltung, sondern auch zur inneren Erhebung und zum Nutzen der Nation“.154 Immer wieder betonte er den volkstümlichen Charakter der auf der Bühne der Staatsoper gespielten Werke. In diesen solle sich „das deutsche Wesen, die deutsche Seele offenbaren und sich in ihrer ganzen stammesmäßig bedingten Vielfalt widerspiegeln“.155 Schroff grenzte sich Kapp von der kulturellen Moderne ab, von welcher die Geschichte der Staatsoper in den Jahren der Weimarer Republik geprägt war. So sei die Bühne in jenen Jahren zur „Propaganda volksfremder zersetzender Erzeugnisse mißbraucht“ worden. Um demgegenüber die „unvergänglichen Meisterwerke der Oper in mustergültigen Aufführungen“ darbieten zu können, sei un151 Von Arents Meistersinger-Inszenierung etwa wurde unmittelbar nach der Berliner Premiere von mindestens drei deutschen Bühnen nur leicht verändert nachgebaut. Roesler, „Opernhaus“, S. 338. 152 Bair, „Lenkung“. 153 Hermann Göring, [Geleitwort], in : Julius Kapp, Geschichte der Staatsoper Berlin, Berlin 1937, o. S. 154 Kapp, Staatsoper, S. 197. 155 Ebd.
Deutsches Opernhaus und Preußische Staatsoper im Nationalsozialismus
71
ter der persönlichen Führung Görings mit dem „unkünstlerischen Star-System“ der Weimarer Republik, das für ihn lediglich Ausdruck von Kommerzstreben war, gebrochen und eine für eine solche Musterbühne angemessene „vorbildliche Ensemblekunst“156 geschaffen worden. Betrachtet man die Berliner Opernbühnen vor und nach 1945 miteinander im Vergleich, so wird deutlich, dass jeweils der Anspruch bestand, eine ideale deutsche Opernbühne zu sein. Ungeachtet der Distanzierung der Bühnen nach 1945 vom Nationalsozialismus fallen zwischen diesen und jenen hinsichtlich der propagierten Kulturvorstellungen verschiedentlich Gemeinsamkeiten auf. Dies gilt zunächst für die Betonung des nationalen Repertoires im Spielplan, die sich sowohl bei der Staatsoper der DDR als auch bei den Bühnen im Nationalsozialismus findet. Obwohl in der DDR anders als in der NS-Zeit nicht rassistisch argumentiert wurde und von einer Suprematie der deutschen Kultur nicht mehr die Rede war, ging es doch hier wie dort um eine volksverbundenvolkstümliche Kunst, der eine ‚volksfeindliche‘ beziehungsweise ‚volksfremde‘ negativ entgegengesetzt wurde. Als Bekenntnis zur Nationalkultur wurde dabei jeweils Richard Wagners Oper Die Meistersinger von Nürnberg zur Aufführung gebracht. Gemeinsamkeiten zwischen NS-Zeit und DDR bestehen darüber hinaus hinsichtlich des idealen Publikums : Ging es den Nationalsozialisten um eine soziale Öffnung der Bühnen für die anvisierte Volksgemeinschaft, zielte die DDR in ähnlicher Weise auf die Gesamtheit des Volkes im Arbeiter- und Bauern-Staat. In anderer Hinsicht liegt ebenfalls eine Parallele zwischen der NSZeit und der Ost-Berliner Staatsoper des Jahres 1955 vor. Jeweils argumentierten die Bühnen mit der politisch erzieherischen Funktion der Aufführungen, auch wenn es freilich in beiden politischen Systemen um unterschiedliche politische Zielsetzungen ging ; beide Male distanzierte man sich auf der Grundlage eines solchen politischen Kunstbegriffs von einem nur auf Unterhaltung abzielenden Verständnis von Kunst. In der Abgrenzung von einem der Unterhaltung dienenden Theater stimmte aber selbst die West-Berliner Deutsche Oper mit den Bühnen der Jahre vor 1945 überein, wenn man sich auch nun mit einem unpolitischen Kunstbegriff, wonach es um eine individuelle Veredelung beziehungsweise Versittlichung des 156 Ebd., S. 199.
72
Vorstellungen von einer idealen deutschen Opernbühne
Einzelnen durch Kunst gehe, dezidiert vom Nationalsozialismus abgrenzte. Jeweils schrieb man der Oper allgemein einen emphatischen Charakter zu, sei es, dass man die Kunstform mit geradezu religiösen Metaphern belegte oder dass man über sie vom „Schönen, Guten, Wahren“ beziehungsweise „Großen, Wahren, Schönen“ sprach. Hinter den genannten Gemeinsamkeiten in den Vorstellungen von einer idealen deutschen Opernbühne vor und nach 1945 stehen lange tradierte bildungsbürgerliche Vorstellungen von deutscher Nationalkultur, die bis ins 18. Jahrhundert hinein zurückreichen und welche die Vorstellungen von einer idealen deutschen Opernbühne prägten : Erstens sollte eine solche Opernbühne zur Erziehung beziehungsweise Bildung des Publikums beitragen ; zweitens sollten die dort gespielten Werke eine von der Gegenwart getrennte höhere Wirklichkeit wiedergeben, was sich mit dem Begriff des schönen Scheins sprachlich umreißen lässt. Drittens bestand das Ziel, auf einer idealen deutschen Opernbühne ein deutsches Repertoire zu etablieren, was auf die von Georg Bollenbeck als ursprungsmythologische Argumentationsfigur bezeichnete bildungsbürgerliche Kunstvorstellung zurückzuführen ist, wonach Kunst Ausdruck des Volkes sei und deshalb für das Volk da sei. Viertens galt es als Aufgabe eines vorbildlichen deutschen Opernhauses, in performativer Hinsicht eine Musterbühne zu sein.
2. Eine ideale deutsche Opernbühne – vier ideengeschichtliche Dimensionen a) Bildende Funktion
Die Vorstellung, dass eine ideale deutsche Opernbühne ein Ort der Bildung und nicht etwa der Unterhaltung sein sollte, geht bis auf das 18. Jahrhundert zurück. Sie hat ihren Ursprung in den Reformdiskussionen der Aufklärungszeit, die sich zunächst vor allem auf den Bereich des Schauspiels bezogen. In dieser Zeit versuchten Intellektuelle, die Bühne zu einer Stätte zu machen, in der die Nation gebessert und sittlich erzogen werden sollte.157 Zunächst richteten sich die Bemühungen auf die Wandertruppen mit ihrem extemporierten, oftmals 157 Hilde Haider-Pregler, Des sittlichen Bürgers Abendschule, Wien/München 1980.
Eine ideale deutsche Opernbühne – vier ideengeschichtliche D imensionen
73
um eine derb-komische Figur kreisenden Spiel, das einem literarisierten ernsten Theater weichen sollte. Allerdings zeigte sich, dass sich die Spielpläne der Wanderbühnen wegen deren ausschließlicher materieller Abhängigkeit von einem Publikum, das für sein Eintrittsgeld lieber unterhalten als belehrt werden wollte, kaum ändern ließen. So richteten die Aufklärer ihre Hoffnungen vor allem auf die unter der finanziellen Patronage der Fürsten befindlichen Hoftheater. Seit den 1770er-Jahren schienen sich ihre Forderungen nach der Bühne als „moralischer Anstalt“ (Friedrich Schiller) zu erfüllen, als die Fürsten überraschend damit begannen, die an ihren Hofbühnen bis dahin fest etablierten französischen Schauspiel- und italienischen Operntruppen zu entlassen, um stattdessen deutsche Ensembles in ihren Dienst zu nehmen. Unter dem neuen Namen „Nationaltheater“ öffneten sie die Hofbühnen nun über den Adel hinaus einem zahlenden bürgerlichen Publikum.158 Grund dafür war zum einen, dass die deutschen Truppen finanziell weitaus günstiger waren als die französischen beziehungsweise italienischen.159 Zum anderen aber hatte auch die Kameralistik den politischen Nutzen eines auf Versittlichung ausgerichteten Theaters für den reformabsolutistischen Staat erkannt.160 Als Erstes richtete Joseph II. im Jahr 1776 in Wien im Gebäude des Burgtheaters ein Nationaltheater ein.161 Dem folgten ebenfalls auf der Basis deutschsprachiger Ensembles Mannheim 1777 158 Roland Krebs, L’Idée de „Théâtre National“ dans l’Allemagne des Lumières. Théorie et réalisations, Wiesbaden 1985. 159 Hilde Haider-Pregler, „Die Wiener ‚Nationalschaubühne‘ (1776–1794) : Idee und Institution“, in : Roland Krebs und Jean-Marie Valentin (Hg.), Théâtre, nation et société en Allemagne au XVIIIe siècle, Nancy 1990, S. 167–192. Siehe auch : Reinhard Meyer, „Das Nationaltheater in Deutschland als höfisches Institut. Versuch einer Begriffs- und Funktionsbestimmung“, in : Roger Bauer und Jürgen Wertheimer (Hg.), Das Ende des Stegreifspiels – Die Geburt des Nationaltheaters. Ein Wendepunkt in der Geschichte des europäischen Dramas, München 1983, S. 124–152, vor allem S. 127. 160 Dies zeigen etwa die Schriften des Kameralisten Joseph von Sonnenfels, der einen großen Einfluss auf die Einrichtung der Wiener „Nationalschaubühne“ von 1776 hatte. Joseph von Sonnenfels, Briefe über die wienerische Schaubühne, herausgegeben von Hilde Haider-Pregler, Graz 1988. Zum Verhältnis von Kameralistik und Theater siehe : Wolfgang Martens, „Obrigkeitliche Sicht. Das Bühnenwesen in den Lehrbüchern der Polizey und Cameralistik des 18. Jahrhunderts“, in : Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur 6 (1981), S. 19–51. 161 Anders als das französische Schauspielensemble blieb hier das italienische Opernensemble bestehen, dem allerdings für einige Jahre ein deutsches Opernensemble zur Seite gestellt wurde.
74
Vorstellungen von einer idealen deutschen Opernbühne
und München 1778.162 In Berlin wurde das Hoftheater 1786 in ein Nationaltheater umgewandelt. Im Zentrum der Bemühungen der Aufklärungszeit stand zunächst das Schauspiel, galt doch die Oper nicht wenigen Intellektuellen als nicht reformfähig. Zurückzuführen war das maßgeblich auf die Schriften des einflussreichen Schriftstellers und Literaturtheoretikers Johann Christoph Gottsched, der nicht müde wurde, diese Kunstform aufgrund ihres mehr auf die Sinne als den Intellekt zielenden Charakters und die gegen alle Wahrscheinlichkeit verstoßenden Opernhandlungen mit ihrem Kulissenzauber zu kritisieren.163 Allerdings darf nicht übersehen werden, dass es im Kontext jener Theaterreformbestrebungen auch die ersten Versuche gab, eine ernste deutsche Oper zu schaffen, die den erzieherischen Ansprüchen gerecht wurde und als gleichwertig neben die italienische opera seria oder auch die französische Oper treten konnte.164 Zu nennen ist etwa Christoph Martin Wielands und Anton Schweitzers deutschsprachige Oper Alceste, die 1773 in Weimar mit großem Erfolg uraufgeführt und von den Zeitgenossen einhellig als Geburtsstunde der deutschen Oper begrüßt wurde.165 Als ernste deutsche Opern rezipierte das Publikum außerdem etwa die ursprünglich französischen Reformopern Christoph Willibald Glucks, denen sich Wieland und Schweizer stilistisch verpflichtet fühlten.166 Ungeachtet des Anspruches der Reformer spielte der Bildungsaspekt an den Nationaltheatern in der Theaterwirklichkeit allerdings nur eine untergeordnete 162 Siehe dazu : Katharina Meinel, Für Fürst und Vaterland. Begriff und Geschichte des Münchner Nationaltheaters im späten 18. Jahrhundert, München 2003. 163 Zur Opernkritik Gottscheds siehe : Joachim Birke, „Gottsched’s Opera Criticism and Its Literary Sources“, in : Acta Musicologica 43 (1960), S. 194–200 ; John D. Lindberg, „Gottsched gegen die Oper“, in : The German Quarterly 40 (1967), S. 673–683 ; Jörg Krämer, Deutschsprachiges Musiktheater im späten 18. Jahrhundert. Typologie, Dramaturgie und Anthropologie einer populären Gattung. 2 Teile, Tübingen 1998, 604–620. – Allerdings gab es auch Kritik an Gottscheds negativer Einschätzung der Oper. Siehe dazu : ebd., S. 620ff. 164 Bodo Plachta, Ein „Tyrann der Schaubühne“ ? Stationen und Positionen einer literatur- und kulturkritischen Debatte über Oper und Operntext im 18. Jahrhundert, Berlin 2003, S. 157ff. 165 Renate Schusky, Das deutsche Singspiel im 18. Jahrhundert. Quellen und Zeugnisse zur Ästhetik und Rezeption, Bonn 1980, S. 125. 166 Eine wichtige Rolle spielte bei der Stiftung einer nationalen Operntradition das Berliner Nationaltheater, an dem mehrere Werke Glucks in deutscher Übersetzung gegeben wurden. Christoph Henzel, „Zwischen Hofoper und Nationaltheater. Aspekte der Gluckrezeption in Berlin um 1800“, in : Archiv für Musikwissenschaft 50 (1993), S. 201–216.
Eine ideale deutsche Opernbühne – vier ideengeschichtliche D imensionen
75
Rolle, was nicht nur an der geringen Anzahl von zu diesem Zweck geeigneten Stücken, sondern auch an den Unterhaltungsbedürfnissen des Publikums lag.167 Faktisch stellten deshalb unterhaltende Opern und Singspiele den größten Teil des Repertoires der höfischen Nationaltheater dar.168 So war es letztlich nur folgerichtig, dass die Nationaltheater zu Beginn des 19. Jahrhunderts mehrheitlich wieder in Hoftheater umbenannt wurden, wie auch in Berlin, wo das Nationaltheater 1811 mit der Hofoper vereint wurde und fortan unter dem Namen Königliche Schauspiele firmierte. Die entscheidende Rolle dabei, dass der Oper wie dem Sprechtheater gleichermaßen eine sittlich bildende Funktion beigemessen wurde, kommt schließlich Richard Wagner zu. Im Rahmen der Revolution von 1848/49 gehörte er mit seinem Entwurf zur Organisation eines deutschen Nationaltheaters für das Königreich Sachsen169 zu denjenigen Künstlern und Intellektuellen, die sich erneut um eine Reform der Hoftheater bemühten, durch welche diese zu idealen nationalen Theatern gemacht werden sollten. Dabei kam es vor allem in Berlin zu einer intensiven Diskussion, deren einflussreichste Beiträge von dem Schauspieler und späteren Theaterleiter Eduard Devrient170 sowie von dem Literaten und Theaterkritiker Heinrich Theodor Rötscher171 stamm167 Ute Daniel, Hoftheater. Zur Geschichte des Theaters und der Höfe im 18. und 19. Jahrhundert, Stuttgart 1995, S. 143ff. 168 Reinhard Meyer, „Der Anteil des Singspiels und der Oper am Repertoire der deutschen Bühnen in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts“, in : Das deutsche Singspiel im 18. Jahrhundert. Colloquium der Arbeitsstelle 18. Jahrhundert Gesamthochschule Wuppertal, Universität Münster, Heidelberg 1981, S. 27–76. 169 Richard Wagner, Entwurf zur Organisation eines deutschen National-Theaters für das Königreich Sachsen, in : Sämtliche Schriften und Dichtungen. Volks-Ausgabe, Leipzig o. J. Bd. 2, S. 233– 273. (Die Gesamtausgabe der Schriften Wagners wird im Folgenden SSD abgekürzt). Die ursprüngliche Textfassung wurde für die Aufnahme in die gesammelten Schriften redigiert. Zur Urfassung der Schrift siehe Hans John, „Richard Wagners Schrift ‚Entwurf zur Organisation eines deutschen National-Theaters für das Königreich Sachsen‘ (1848)“, in : Michael Heinemann und Hans John (Hg.), Die Dresdner Oper im 19. Jahrhundert, Laaber 1995, S. 193–198. 170 Eduard Devrient, Das Nationaltheater des Neuen Deutschlands. Eine Reformschrift, Leipzig 1849. 171 Heinrich Theodor Rötscher, „Theater und dramatische Poesie in ihrem Verhältnisse zum Staate“, in : Carl von Rotteck und Carl Welcker (Hg.), Das Staats-Lexikon. Enzyklopädie der sämmtlichen Staatswissenschaften für alle Stände. Zwölfter Band, neue durchaus verbesserte und vermehrte Auflage, Altona 1848, S. 556–569. – Rötscher hatte seinen Text bereits 1843 für das liberale Rotteck-Welckersche Staats-Lexikon verfasst, dann aber noch einmal 1848 nach Berlin
76
Vorstellungen von einer idealen deutschen Opernbühne
ten.172 Zu den wichtigsten Forderungen jener Jahre gehörte es, die Bühnen aus der Zivilliste des Fürsten in die Verwaltung des Kultusministeriums zu überführen, um sie dadurch – öffentlich finanziert und somit finanziellen Zwängen entbunden – zu allgemeinen Bildungseinrichtungen zu machen. Das Besondere an Richard Wagners Schrift war dabei, dass sich der Komponist explizit um eine Aufwertung des Orchesters und der Oper innerhalb eines zukünftigen Nationaltheaters bemühte, hielt er doch die Musik in nicht geringerem Maße als das Schauspiel für geeignet, um Einfluss auf die Sitten zu nehmen.173 Mit seinem Konzept eines Gesamtkunstwerks174, das er nach dem Scheitern des Dresdner Mai-Aufstandes 1849, an dem er aufseiten der Revolutionäre aktiv teilgenommen hatte, im Schweizer Exil in den sogenannten Züricher Kunstschriften (1849–51) darlegte und in dem er der Oper eine grundlegend ethisch-bildende Funktion zuwies, knüpfte Wagner dann an die im Idealismus entwickelte Idee zweckfreier Bildung an.175 Bereits Friedrich Schiller hatte – im Gegensatz zu den Opern-kritischen Intellektuellen der Aufklärungszeit – in der Kunstform ein hohes Potenzial gesehen, um zum angestrebten Idealismus zu gelangen.176 Genau wie der Weimarer Dichter skizzierte Wagner ein dreistufiges geschickt im Rahmen der dortigen Überlegungen zur Einrichtung eines Nationaltheaters. Eine Auswertung der Reformvorschläge findet sich in : Wilhelm Klein, Der preußische Staat und das Theater im Jahre 1848. Ein Beitrag zur Geschichte der Nationaltheateridee, Berlin 1924, S. 53f. 172 Ebd. 173 Wagner, Entwurf, S. 269. 174 Siehe zu Wagners Konzept : Udo Bermbach, Der Wahn des Gesamtkunstwerks. Richard Wagners politisch-ästhetische Utopie, zweite, überarbeitete und erweiterte Auflage, Stuttgart/Weimar 2004. 175 Die Zusammenhänge zwischen Wagners Theaterkonzept und der Weimarer Klassik hat Dieter Borchmeyer herausgearbeitet. Dieter Borchmeyer, Das Theater Richard Wagners. Idee – Dichtung – Wirkung, Stuttgart 1982 ; Ders., Richard Wagner. Ahasvers Wandlungen, Frankfurt/M./ Leipzig 2002. 176 So schrieb Schiller am 29. Dezember 1797 an Goethe : „Ich hatte immer ein gewisses Vertrauen zur Oper, daß aus ihr wie aus den Chören des alten Bacchusfestes das Trauerspiel in einer edlern Gestalt sich loswickeln solle. In der Oper verläßt man wirklich die servile Naturnachahmung, und obgleich nur unter dem Namen der Indulgenz könnte sich auf diesem Wege das Ideale auf das Theater stehlen.“ Zitiert nach : Borchmeyer, Klassik, S. 377. – Auch Goethe reflektierte über einen möglichen Beitrag der Oper im Rahmen einer Reform des Theaters. Er selbst, der besonders die Werke Mozarts schätzte, verfasste ein, wenn auch fragmentarisch gebliebenes, Textbuch Der Zauberflöte zweiter Teil.
Eine ideale deutsche Opernbühne – vier ideengeschichtliche D imensionen
77
Geschichtsmodell. Ausgehend vom ästhetisch-gesellschaftlichen Ideal der antiken Poliswelt schilderte er die weitere Weltgeschichte als Verfallsprozess. Der negativen Gegenwart, die er einer grundlegenden Religions-, Gesellschafts- und Politikkritik unterzog, setzte er eine postrevolutionäre Zukunft entgegen, die von einer politisch befreiten Gesellschaft geprägt war. Wie für Schiller sollte für Wagner die zukünftige, mit sich selbst versöhnte Gesellschaft ihre geglückte Identität aus der ästhetischen Erfahrung von Kunst gewinnen. Analog zur Kritik der bestehenden Gesellschaft entfaltete er eine grundlegende Kritik an der Oper seiner Zeit, die für ihn lediglich ein luxuriöses Mittel zur Unterhaltung und Zerstreuung für adelige und begüterte bürgerliche Kreise war. Dagegen stellte er den Entwurf einer Vereinigung der einzelnen Künste zu einem theatralischen Gesamtkunstwerk, das sich auf der Grundlage allgemeinmenschlicher Werte in Form von Festspielen an die Gesamtheit der zukünftigen Gesellschaft richten sollte. Mit dieser gesellschaftlich-ästhetischen Zukunftskonzeption Wagners war seine in jener Zeit konzipierte Tetralogie Der Ring des Nibelungen eng verknüpft. Darin führte der Komponist in Form eines Mythos, ausgehend von einem geglückten, naturhaften Urzustand der Welt, den Verfall und schlussendlich Niedergang einer korrupten Gesellschaft vor. Den Ring plante der Komponist der postrevolutionären Gesellschaft in einem idealen Theater in Form von Festspielen vorzustellen. Wenn Wagner auch im Exil schließlich von der Hoffnung auf eine Revolution abrückte, die ja eigentlich die Voraussetzung für eine Aufführung des Ring des Nibelungen hatte bilden sollen, lassen sich von der ursprünglichen Festspielidee bis zu den 1876 mit der Tetralogie eröffneten Bayreuther Festspielen dennoch grundlegende Kontinuitäten ausmachen : Zu nennen ist der Gedanke eines aus dem Theateralltag herausgehobenen Bühnenfestes in Anlehnung an das antike griechische Theater wie das Ziel einer ethischsittlichen Bildung durch die Bühne.177 Der mit den Festspielen verbundene 177 Lore Lucas, Die Festspiel-Idee Richard Wagners, Regensburg 1973. – Eine Bezeichnung des Bayreuther Festspielhauses als deutsches „Nationaltheater“ lehnte Wagner ausdrücklich ab, war er doch enttäuscht vom Ausbleiben der Theaterreform, die das Scheitern der Revolution von 1848/49 vereitelt hatte. Um diese Bezeichnung tragen zu dürfen, hätte es für Wagner notwendig eines gesamtnationalen Interesses bedurft, was sich in der Finanzierung durch ein Parlament hätte niederschlagen müssen. Siehe dazu : Richard Wagner, Das Bühnenfestspiel-
78
Vorstellungen von einer idealen deutschen Opernbühne
Bildungsgedanke hat sich bis in die architektonische Gestaltung des Bayreuther Festspielhauses hinein niedergeschlagen, mit dem Wagner einen grundlegend neuen Typus von Theaterarchitektur schuf. Um den Bezug zur Kultur des antiken Griechenland baulich zu verdeutlichen, ging er über die seit dem Klassizismus im Theaterbau übliche Orientierung an antiker Tempelarchitektur im Äußeren, wofür als Beispiel Karl Friedrich Schinkels 1821 eröffnetes Berliner Schauspielhaus genannt sei, hinaus. So schuf er im Inneren anstelle des herkömmlichen Rang-/Logentheaters einen amphitheatralischen Zuschauerraum, bei dem das Parkett wie in einem griechischen Theater als Kreissegment konzentrisch und stark ansteigend auf die Bühne hin ausgerichtet wurde. Zum einen ließ sich durch eine solche Blickrichtung im Sinne des Bildungsgedankens die Aufmerksamkeit des Publikums weit besser als in einem Rang-/Logentheater, bei dem sich die Zuschauer an den Seiten regelrecht gegenübersaßen, auf das Bühnengeschehen konzentrieren. Zum anderen entsprach der Wegfall repräsentativer Logen aber auch der von Wagner angestrebten sozialen Gleichheit des Publikums.178 Einer inneren Sammlung des Auditoriums diente überdies die sparsame Ornamentierung des Zuschauerraums, die sich auf wenige antikisierende Elemente beschränkte. Das Äußere war sogar noch schlichter gehalten : Das Festspielhaus präsentierte sich, im 19. Jahrhundert für ein Opernhaus beispiellos, als weitgehend unverkleideter hölzerner, mit roten Ziegelsteinen ausgefüllter Fachwerkbau.179 Zwar entstand die große Mehrheit der um 1900 erbauten Theater weiterhin in der traditionellen Rang-/Logen-Form – nur Max Littmann orientierte sich mit Bauten wie dem Münchner Prinzregententheater
haus in Bayreuth. Nebst einem Berichte über die Grundsteinlegung desselben, in : SSD, Bd. 9, S. 322–344, hier S. 328. 178 Ebd., S. 341. 179 Lediglich die tektonisch entscheidenden Bauteile an den vier Seiten des Zuschauerraums waren massiv aus Stein im Neorenaissancestil ausgeführt, dabei allerdings ebenfalls mit schlichten roten Ziegelsteinen verklinkert. Heinrich Habel, Festspielhaus und Wahnfried. Geplante und ausgeführte Bauten Richard Wagners, München 1985, S. 392. – Erst zu den Festspielen des Jahres 1882 wurde der massive „Königsbau“ an der Frontseite angefügt. Ebd., S. 393. – Die angestrebte architektonische Schlichtheit des Festspielhauses verdeutlicht auch der handschriftliche Kommentar Wagners auf einem der Baupläne. Das Blatt zeigt die Fassade des Festspielhauses mit einem sich über die gesamte Fläche erstreckenden girlandenartigen Schmuck, den Wagner mit dem Satz kommentierte : „Die Ornamente fort !“ Zitiert nach : Ebd., S. 423.
Eine ideale deutsche Opernbühne – vier ideengeschichtliche D imensionen
79
Bayreuther Festspielhaus. Amphitheatralischer Zuschauerraum, noch ohne Bestuhlung (zeitgenössischer Holzschnitt)
am Bayreuther Festspielhaus180 –, jedoch war damit eine architektonische Form entstanden, die für den deutschen Theaterbau vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg von Bedeutung sein sollte. Erst mit Auflösung der Höfe 1918 wurden die Hoftheater in eine öffentliche Verwaltung überführt, sodass sie seitdem als Stadt-, Landes- beziehungsweise Staatstheater firmierten.181 In Berlin etwa kamen die ehemaligen Königlichen Schauspiele unter die Aufsicht des Ministeriums für Kunst, Wissenschaft und Volksbildung, womit die grundlegende Reformforderung von 1848/49 erfüllt wurde, nämlich die Bedingung zu schaffen, um die Bühne zu einem Ort allgemeiner Bildung zu machen. Allerdings wurde die alte Vorstellung einer allgemeinmenschlichen, zweckfreien Bildung in den Jahren der Weimarer Republik auch im Bereich der Oper zunehmend infrage gestellt. Auf der einen Seite löste sie die kulturelle Moderne durch einen politischen Kunstbegriff ab, wobei als Beispiel Brechts/Weills Dreigroschenoper (UA 1928) genannt werden kann, in 180 Siehe dazu : Bernd-Peter Schaul, Das Prinzregententheater in München und die Reform des Theaterbaus um 1900. Max Littmann als Theaterarchitekt, München 1987. 181 Siehe dazu : Günther Rühle, Theater in Deutschland 1887–1945. Seine Ereignisse – seine Menschen, Frankfurt/M. 2007, S. 356ff.
80
Vorstellungen von einer idealen deutschen Opernbühne
der ein linker politischer Standpunkt dezidiert zum Ausdruck kommt. Auf der anderen Seite eignete sich ein nationalistisches Bildungsbürgertum ein politisiertes Verständnis von Bildung im Theater an. Zu einem einflussreichen Stichwortgeber wurde in diesem Zusammenhang Julius Petersen.182 Noch während des Ersten Weltkrieges hatte der renommierte Germanist und Theaterwissenschaftler in einer Reihe von Vorträgen eine einflussreiche Geschichte des deutschen Theaters entfaltet, die wieder einmal in der Forderung nach Realisierung eines Nationaltheaters als einer idealen deutschen Bühne mündete.183 Auch für Petersen sollte das Theater der Bildung dienen und scharf von einer Unterhaltungsfunktion abgegrenzt sein. Allerdings reduzierte er die Bildungsfunktion, wobei die Oper mit eingeschlossen war, angesichts des Krieges in politischer Hinsicht darauf, die Einheit und Größe der Nation zu fördern ; von allgemeinmenschlichen Bildungsidealen war bei ihm nicht mehr die Rede. Von hier aus war der Weg zur Position des Nationalsozialismus eingeschlagen :184 Ob Inhalte von Opern in einem völkischen Sinne umgedeutet wurden oder ob sich die Bildungsfunktion im Gemeinschaft stiftenden Rezipieren der ‚großen‘ nationalen Werke erschöpfte – die Opernbühne wurde im Nationalsozialismus zur politisch-erzieherischen ‚Waffe des Staates‘, die gegen die als ‚kulturbolschewistisch‘185 geschmähte kulturelle Avantgarde ins Feld geführt wurde. b) Schöner Schein
Mit der im deutschen Bildungsbürgertum tradierten Vorstellung der bildenden Funktion der Kunst war der Anspruch eng verknüpft, dass diese Ausdruck des schönen Scheins sei und sich demnach, wie Georg Bollenbeck formuliert hat, als eine „höhere Wirklichkeit“ darstelle, „als eine autonome, zeitenthobene Welt
182 Petersen war im „Dritten Reich“ einer der führenden deutschen Germanisten und Theaterwissenschaftler. 183 Julius Petersen, Das deutsche Nationaltheater. Fünf Vorträge, gehalten im Februar und März 1917 im Freien deutschen Hochstift zu Frankfurt a. M., Leipzig/Berlin 1919. 184 Siehe dazu : Gaetano Biccari, „Zuflucht des Geistes ?“ Konservativ-revolutionäre, faschistische und nationalsozialistische Theaterdiskurse in Deutschland und Italien 1900–1944, Tübingen 2001. 185 Eckhard John, Musikbolschewismus. Die Politisierung der Musik in Deutschland 1918–1938, Stuttgart/Weimar 1994.
Eine ideale deutsche Opernbühne – vier ideengeschichtliche D imensionen
81
der Freiheit und Sittlichkeit, der Schönheit und Wahrheit“.186 Auch diese Argumentationsfigur prägte die Konzepte um eine ideale deutsche Opernbühne. Nicht erst mit den Meistersingern von Nürnberg erhob Richard Wagner den Anspruch, dass die Kunstform Oper in einem emphatischen, gleichsam religiösen Sinne eine „heil’ge Kunst“ sei.187 Bereits in den Züricher Kunstschriften entwickelte er die Vorstellung, dass die zukünftige, mit sich selbst versöhnte Gesellschaft ihre geglückte Identität aus der ästhetischen Erfahrung von schöner Kunst gewinnen sollte. Das Ziel der diesem Zustand vorausgehenden Revolution war für ihn, wie er in Die Kunst und die Revolution formulierte, „der starke und schöne Mensch“, wobei die Revolution dem Menschen die Stärke und „die Kunst die Schönheit“188 geben würde. Mit seiner Auratisierung der Bühne knüpfte er bei den Kunstkonzepten der Weimarer Klassik an. Schon Schiller hatte das Theater in einem idealen Sinne als eine autonome Sphäre des schönen Scheins aufgefasst, als einen gleichsam sakralen Ort, der von der kritisierten politisch-gesellschaftlichen Wirklichkeit zu trennen sei. Immer wieder hatte er dabei auf das Bild vom Theater als Tempel zurückgegriffen.189 Ob Wagner mit seiner Musik den selbst gestellten Ansprüchen von ästhetischer Schönheit genüge, blieb bei den Zeitgenossen umstritten. Zum prominentesten Kritiker des Komponisten wurde Eduard Hanslick, der sich selbst mit seiner Schrift Vom musikalisch Schönen (1854) um eine Theorie der Musikästhetik bemühte. Hanslick bemängelte an Wagners Musik die Auflösung überlieferter musikalischer Formen, eine unzureichende Melodiebildung sowie dessen die Grenzen der Tonalität strapazierende Harmonik.190 Wenn Wagners Musik aber 186 Bollenbeck, Tradition, S. 71. 187 Dieter Borchmeyer hat das Nürnberg aus Wagners Oper als Verwirklichung von Schillers ästhetischem Staat interpretiert. Dieter Borchmeyer, „Nürnberg als ästhetischer Staat. Die Meistersinger : Bild und Gegenbild der Geschichte“, in : Borchmeyer, Wagner, S. 235–275. 188 Wagner, Die Kunst und die Revolution, in : SSD, Bd. 3, S. 8–41, hier S. 32. 189 Der Vergleich des Theatersaals mit einem Tempel findet sich etwa in Schillers Prolog zu Wallensteins Lager, geschrieben anlässlich der Wiedereröffnung des Weimarer Theaterbaus 1798 : „Und sieh ! Er hat sich neu verjüngt, ihn hat / Die Kunst zum heitern Tempel ausgeschmückt, / Und ein harmonisch hoher Geist spricht uns / Aus dieser edlen Säulenordnung an, / und regt den Sinn zu festlichen Gefühlen.“ Zitiert nach : Borchmeyer, Klassik, S. 378. 190 Siehe etwa : Eduard Hanslick, „,Die Meistersinger‘ von Richard Wagner“, in : Attila Csampai und Dietmar Holland (Hg.), Richard Wagner. Die Meistersinger. Texte, Materialien, Kommentare, Reinbek bei Hamburg 1981, S. 217–227.
82
Vorstellungen von einer idealen deutschen Opernbühne
auch die zeitgenössischen Hörgewohnheiten nicht unerheblich herausforderte, ließen sich große Teile des Publikums dennoch auf dessen avancierte spätromantische Musiksprache ein. Dasselbe galt für die Herausforderungen, die Richard Strauss Oper Salome, die auf einem Text des englischen Dekadenz-Autors Oscar Wilde beruhte, mit sich brachte. Das Werk sorgte bei der Uraufführung 1905 für einen erheblichen Skandal, was zum einen an dem „Tanz der sieben Schleier“ lag, welcher die bestehenden Vorstellungen von Sittlichkeit erschütterte, zum anderen an einer extrem dissonanzreichen, sich häufig an der Grenze zur Atonalität bewegenden Musik. Zu einer ungleich größeren Herausforderung wurden für das Publikum avantgardistische Werke, die nach dem Wegfall der Zensur in der Weimarer Republik auf die Opernbühnen kamen und mit denen die Künstler angesichts des zunehmend ästhetisch als hohl empfundenen konsensuellen Kunstnationalismus nach neuen künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten suchten. Dabei avancierte Berlin zum wichtigsten Zentrum der kulturellen Moderne im Bereich der Oper. Hier gelangte an der Staatsoper Unter den Linden 1925 etwa Alban Bergs atonale Oper Wozzeck (1925) zur heftig umstrittenen Uraufführung. Mit der Kroll-Oper, einer zweiten Spielstätte der Staatsoper, gegenüber dem Reichstag am Platz der Republik, bestand unter der Leitung von Otto Klemperer und Ernst Legal in den Jahren 1927 bis 1931 ein Institut, dem ausdrücklich eine Avantgardekonzeption zugrunde lag.191 Hier wurden nicht nur die etablierten Werke des Repertoires ohne überkommene szenische Gewohnheiten auf die Bühne gebracht, sondern es wurde auch dem zeitgenössischen Musiktheater ein angemessener Platz im Spielplan eingeräumt. So konnte man an der Kroll-Oper etwa Zeitopern wie Neues vom Tage von Paul Hindemith im Jahr 1929 als Uraufführung oder Ernst Kreneks Sensationserfolg Jonny spielt auf (UA 1927, Leipzig) erleben. Beiden Werken war gemeinsam, dass hier an die Stelle einer idealisierten Gegenwelt die satirisch überzeichnete Schilderung der zeitgenössischen Lebenswirklichkeit trat. Während bei Hindemith etwa eine Protagonistin in fleischfarbenem Trikot in der Badewanne sitzend die Vorzüge 191 Zur Kroll-Oper siehe : Hans Curjel, Experiment Krolloper 1927–1931, München 1975 ; Hans J. Reichhardt, …bei Kroll 1844 bis 1957. Etablissement – Ausstellungen – Theater – Konzerte – Oper – Reichstag – Gartenlokal. Eine Ausstellung des Landesarchivs Berlin, 14. Juni bis 31. Oktober 1988, Berlin 1988.
Eine ideale deutsche Opernbühne – vier ideengeschichtliche D imensionen
83
der Warmwasserversorgung in Form einer Arie pries, fuhr bei Krenek spektakulär eine Eisenbahn über die Bühne. Im Schlussbild verwandelte sich die großformatige Bahnhofsuhr in eine Weltkugel, auf welcher der schwarze Geiger Jonny stehend unter Schlagerklängen, die man als amerikanischen Jazz verstand, vom Anbruch einer neuen Zeit kündete. Des Weiteren brachte die Kroll-Oper 1930 einen Schönberg-Abend mit dessen atonalen Einaktern Erwartung und Die glückliche Hand zur Aufführung ; diese Werke wiederum brachen aufgrund ihrer dissonanten Klangsprache mit überkommenen Vorstellungen von ästhetischer Schönheit. Die hier als Beispiele genannten Werke wurden von weiten Teilen des Bildungsbürgertums heftig angegriffen, sodass der Nationalsozialismus von vielen als Retter der längst nicht mehr konsensuellen bildungsbürgerlichen Kunstvorstellungen akzeptiert werden konnte.192 c) Ursprungsmythologische Argumentationsfigur
Die lange tradierte bildungsbürgerliche Argumentationsfigur, die Kunst sei Ausdruck des Volkes und für das Volk da, prägte ebenfalls die Vorstellung von einer idealen deutschen Opernbühne. Demnach sollten sich die Teilnehmer einer Opernaufführung als nationale Gemeinschaft wahrnehmen. Bereits Friedrich Schiller hatte 1784 in seinem Schaubühne-Vortrag formuliert : „Wenn wir es erlebten, eine Nationalbühne zu haben, so würden wir auch eine Nation.“193 Allerdings ging es dem Dichter dabei noch nicht darum, durch das Theater auf eine politisch geeinte Nation hinzuwirken. Wenn man sich Ende des 18. Jahrhunderts als Mitglied einer einheitlichen deutschen Nation verstand, bezog sich 192 Für die nationalsozialistischen Musikideologen stand fest, dass die zu schaffende zeitgenössische „Volksoper“ nicht etwa auf zeitgeschichtlichen Stoffen basieren sollte sondern – ein Reflex auf den schönen Schein – hinsichtlich der Stoffwahl von einer Distanz zur Gegenwart geprägt zu sein hatte. Als Beispiel für eine solche Volksoper sei Ottmar Gersters 1941 in Düsseldorf uraufgeführte Oper Die Hexe von Passau genannt, der eine kaum als avantgardistisch zu bezeichnende gemäßigt moderne Klangsprache zugrunde lag. Siehe dazu : Michael Walter, „Volksgemeinschaft in der Oper. Ottmar Gersters Hexe von Passau“, in : Michael Walter, Hitler in der Oper. Deutsches Musikleben 1919–1945, Stuttgart/Weimar 1995, S. 263–277. 193 Friedrich Schiller, Was kann eine gute stehende Schaubühne eigentlich wirken ?, in : Schillers Werke. Nationalausgabe, Bd. 20 : Philosophische Schriften. Erster Teil, Weimar 1961, S. 87– 100, hier S. 99. Siehe dazu auch : Jörg Echternkamp, Der Aufstieg des deutschen Nationalismus, Frankfurt/M./New York 1998, S. 126ff.
84
Vorstellungen von einer idealen deutschen Opernbühne
dies auf die Kultur. Politisch war man mit der staatlichen Vielfalt im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation durchaus zufrieden.194 Während es im Bereich des Sprechtheaters bereits in den 1740er-Jahren zu Bemühungen um ein nationales Repertoire kam195, fielen vergleichbare Bestrebungen im Bereich der Oper aufgrund der Skepsis der Aufklärer gegenüber der Kunstform erst in die 1770er-Jahre. Zu nennen ist etwa mit Anton Kleins und Ignaz Holzbauers Günther von Schwarzburg als Eröffnungspremiere des neuen Mannheimer „Kurfürstlichen Hof- und Nationaltheaters“ 1777 der Versuch, eine deutsche Oper nicht mit einem mythischen, sondern einem spezifisch nationalen Stoff zu prägen. Von einem breiten Publikum wurde im Bereich der Oper allerdings erst der 1821 in Berlin uraufgeführte Freischütz von Carl Maria von Weber als deutsche Nationaloper rezipiert. Mit seinem volkstümlichen Charakter entsprach das Werk der vor allem von Johann Gottfried Herder propagierten und bei deutschen Intellektuellen zunehmend verbreiteten, geradezu mythisch überhöhten Vorstellung vom Zusammenhang zwischen Künstler, Volk und Nation. Nicht nur basiert die Handlung des Freischütz auf einer Volkssage196 ; auch in die Musik sind, etwa mit dem „Jungfernkranz“ oder dem „Jägerchor“, volksliedhafte Abschnitte miteinbezogen. So wurde das Werk von den Zeitgenossen als Ausdruck deutschen Nationalgeistes interpretiert. Dies ist allerdings insofern erstaunlich, als Webers Singspiel mit seinem für diese Gattung typischen Wech194 Dieter Langewiesche hat in diesem Zusammenhang von einem „föderativen Nationalbewusstsein“ gesprochen. Langewiesche, Nation, S. 84. – Dass eine einheitliche nationale Kultur nicht gleichzeitig auf einen politischen Nationalstaat zielte, verdeutlicht auch die vielzitierte Bemerkung Gotthold Ephraim Lessings in seiner Hamburgischen Dramaturgie anlässlich des Scheiterns des Projektes eines Hamburger Nationaltheaters : „Ueber den gutherzigen Einfall, den Deutschen ein Nationaltheater zu schaffen, da wir Deutsche noch keine Nation sind ! Ich rede nicht von der politischen Verfassung, sondern blos von dem sittlichen Charakter. Fast sollte man sagen, dieser sey : keinen eigenen haben zu wollen.“ Gotthold Ephraim Lessing, Hamburgische Dramaturgie, in : Sämtliche Schriften, Bd. 9, herausgegeben von Karl Lachmann, 3. durchges. u. verm. Aufl., Leipzig/Berlin 1886–1924, S. 213. 195 Zu nennen ist in diesem Zusammenhang vor allem Johann Christoph Gottscheds sechsbändige Sammlung Deutsche Schaubühne (1741–45). 196 Die Quelle Webers und seines Librettisten Friedrich Kind bildete August Apels und Friedrich Launs Gespensterbuch von 1810. – Auch der Freischütz mit seinem märchenhaften Sujet war der sittlichen Bildung verpflichtet. Im Kampf des Guten gegen das Böse, in dessen Verlauf sich die Hauptfigur Max mit dem Teufel einlässt, siegt am Ende der „Himmel“ und wird Max die Möglichkeit zu einer moralisch-sittlichen Besserung eingeräumt.
Eine ideale deutsche Opernbühne – vier ideengeschichtliche D imensionen
85
sel zwischen gesungenen und gesprochenen Passagen stilistisch nicht so sehr von einem vermeintlichen deutschen Geist geprägt als vielmehr dem Modell der französischen opéra comique verpflichtet war.197 Auch spielte die Handlung der Oper, worauf Ther hingewiesen hat, keineswegs in einer typisch deutschen, sondern mit dem westlichen Böhmen in einer ausgesprochen tschechisch geprägten Gegend.198 Schließlich fehlten dem Werk selbst explizite Appelle an das Nationalgefühl, wie man sie in späteren europäischen Nationalopern findet.199 Dass der Freischütz als Nationaloper rezipiert wurde, hing auch mit der Biografie Carl Maria von Webers zusammen, der infolge seiner Männerchor-Vertonungen der nationalistischen Lyrik Theodor Körners während der Befreiungskriege, allen voran Lützows wilde Jagd, eng mit der deutschen Nationalbewegung identifiziert wurde. Dass allerdings der ansonsten eher unpolitische Komponist das Ziel verfolgt haben soll, mit seinem Freischütz die Übermacht der italienischen Oper zugunsten der nationalen zu bekämpfen, ist eine verzerrte Sicht späterer Generationen.200 Die neuere Forschung entwirft demgegenüber ein anderes Bild von Weber : Wenn der Komponist auch im Sinne seiner Zeit von der Existenz nationaler Eigenarten in der Musik überzeugt war, hatte das doch für ihn nichts mit einer Abwertung oder Ausgrenzung nicht-deutscher Kultur zu tun.201 Tatsächlich war Webers Verhältnis zur italienischen Oper weitgehend positiv : So 197 Darauf hat bereits Carl Dahlhaus verwiesen und betont, dass der „national-deutsche Ton“ des Freischütz, der von grundlegender Bedeutung für die Rezeption des Werkes als Nationaloper war, nur eine Variante eines umfassenden Interesses Webers für ethnisches musikalisches Kolorit bildete, das sich in seinem Schaffen in spanischen, polnischen, russischen, arabischen oder auch chinesischen Assoziationen niederschlug. Carl Dahlhaus, Die Musik des 19. Jahrhunderts, Laaber 1980, S. 56. – Grundsätzlich stellte Dahlhaus zur Kategorie des Nationalen in der Musik des 19. Jahrhunderts fest, dass diese „weniger ein musikalischer Substanz-, als ein politischer und sozialpsychologischer Funktionsbegriff“ sei, sodass die Rezeption eines Werkes als Ausdruck nationalen Wesens immer auch von der partiell außermusikalischen Rezeptionsbereitschaft abhängig gewesen sei. Ebd., S. 180. Siehe dazu auch : Wulf Konold, „Nationale Bewegungen und Nationalopern im 19. Jahrhundert. Versuch einer Definition, was eine Nationaloper ausmacht“, in : Udo Bermbach und Wulf Konold (Hg.), Der schöne Abglanz. Stationen der Operngeschichte, Berlin 1991, S. 111–128. 198 Ther, Mitte, S. 124. 199 Siehe dazu : Konold, „Nationalopern“. 200 Ein solches unhistorisches Bild findet sich etwa in : Ludwig Schiedermair, Die deutsche Oper. Grundzüge ihres Werdens und Wesens, Leipzig 1930, S. 207. 201 Ther, Mitte, S. 122.
86
Vorstellungen von einer idealen deutschen Opernbühne
kooperierte er etwa mit seinem Dresdner Kollegen Francesco Morlacchi, dem Leiter des italienischen Operndepartements, auf vielfache Weise.202 Auch die vermeintliche Gegnerschaft zwischen Weber und dem Berliner Hofkapellmeister, dem gebürtigen Italiener Gaspare Spontini, zur Zeit der Freischütz-Uraufführung ist eine Rückprojektion.203 Generell führt über die ursprungsmythologische Argumentationsfigur kein direkter Weg zum Nationalsozialismus. Diese zielte nicht von Anfang an auf eine nationale kulturelle Suprematie der Deutschen, selbst wenn in einem solchen Denken die Möglichkeit einer Abgrenzung gegen Ausländisches angelegt war.204 Was sich allerdings im Laufe des 19. Jahrhunderts zeigte, war das Paradox, dass die Deutschen gerade aufgrund ihrer allgemeinmenschlichen Ideale begannen, sich anderen Nationen überlegen zu fühlen, ein Sachverhalt, den Michael P. Steinberg mit dem Oxymoron „nationalistisches Weltbürgertum“205 umschrieben hat. Deutlich wird dies wiederum vor allem bei Richard Wagner, der nicht nur wesentlich zu einer Verklärung Webers als Begründer einer nationalen Operntradition beigetragen, sondern sich mit seinem Schaffen selbst nachhaltig um eine Fortführung dieses Anliegens bemüht hat.206 In den Züricher Kunstschriften vertrat Wagner die Auffassung, dass die Deutschen seiner Zeit als Einzige in der Lage seien, jene hohen allgemeinmenschlichen Werte zu artikulieren, wie er sie selbst im Übrigen in seinem Ring des Nibelungen pro202 Streitigkeiten zwischen Weber und Morlacchi waren eher selten. Eberhard Kremtz, „Das ‚deutsche Operndepartement‘ des Dresdner Hoftheaters“, in : Michael Heinemann und Hans John (Hg.), Die Dresdner Oper im 19. Jahrhundert, Laaber 1995, S. 107–112, hier S. 110 ; Anno Mungen, „Morlacchi, Weber und die Dresdner Oper“, in : ebd., S. 85–105, hier S. 92f. 203 Wolfgang Michael Wagner, Carl Maria von Weber und die deutsche Nationaloper, Mainz 1994, S. 150. 204 Bollenbeck, Tradition, S. 53f. – In dem schon erwähnten Konzept Heinrich Theodor Rötschers für ein Berliner Nationaltheater etwa gilt – wenn er sich mit seinen Ausführungen auch nur auf das Schauspiel und nicht die Oper bezog – die Anerkennung gleichermaßen dem nationalen Repertoire mit Lessing, Goethe und Schiller wie einem spanischen, französischen oder englischen. Für Rötscher hatte der Spielplan einer idealen nationalen Theaterbühne deswegen in einem egalitär-liberalen Sinne die Werke verschiedener Nationen in gleicher Weise zu berücksichtigen. Rötscher, „Theater“, S. 569. 205 Steinberg, Ursprung, S. 89ff. 206 Schon während seines Wirkens als Dresdner Hofkapellmeister in den Jahren 1843 bis 1849 waren mit Tannhäuser und Lohengrin Werke entstanden, die an den Freischütz als Nationaloper anknüpfen sollten. Ther, Mitte, S. 127ff.
Eine ideale deutsche Opernbühne – vier ideengeschichtliche D imensionen
87
pagierte. Aus diesem Grund glaubte er, die deutsche Kunst derjenigen anderer Nationen überordnen zu dürfen. So unterzog er die italienische und französische Oper in Oper und Drama einer heftigen Kritik, warf ihr Seichtigkeit, eine rein unterhaltende Funktion und einen letztlich kommerziellen Charakter vor. Die Komposition der Meistersinger von Nürnberg war dann von einer erneuten intensiven Beschäftigung mit der Frage nach der deutschen Identität begleitet.207 Auch dabei zeigte sich Wagner als nationalistischer Weltbürger. In der Artikelserie Deutsche Kunst und deutsche Politik (1867) stellte er den von ihm beschworenen deutschen Geist durch die vermeintlich verderblichen Einflüsse einer französischen Zivilisation als in seiner Existenz gefährdet dar. Für Wagner standen sich beide Länder kulturell unversöhnlich gegenüber : auf der einen Seite eine auf Unterhaltung zielende, materialisierte französische, auf der anderen Seite die deutsche Kultur – hier bezog sich Wagner wieder ganz auf die Weimarer Klassik – mit ihrem Streben nach Idealität und Zweckfreiheit. Als seinen eigenen Beitrag zugunsten des deutschen Geistes begriff Wagner seine Meistersinger. Darin wird in der Schlussansprache des Hans Sachs vor den negativen kulturellen Einflüssen des Auslandes gewarnt : „Habt acht ! Uns dräuen üble Streich‘ : / zerfällt erst deutsches Volk und Reich, / in falscher wälscher Majestät / kein Fürst bald mehr sein Volk versteht, / und welschen Dunst mit welschem Tand / sie pflanzen uns in deutsches Land ; / was deutsch und echt, wüßt’ keiner mehr, / lebt’s nicht in deutscher Meister Ehr.“208 Das Pochen auf eine Reinheit der nationalen Kultur in Abgrenzung von vermeintlich schlechten, ausländischen Einflüssen zeigt, dass die ursprungsmythologische Argumentationsfigur ihren egalitär-liberalen, von der Vorstellung einer Gleichwertigkeit der Nationalkulturen ausgehenden Charakter eingebüßt hat. Die Botschaft 207 Hannu Salmi, „Die Herrlichkeit des deutschen Namens…“. Die schriftstellerische und politische Tätigkeit Richard Wagners als Gestalter nationaler Identität während der staatlichen Vereinigung Deutschlands, Turku 1993 ; Stefanie Hein, Richard Wagners Kunstprogramm im nationalkulturellen Kontext. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte des 19. Jahrhunderts, Würzburg 2006, vor allem S. 139–188. 208 Dieter Borchmeyer hat auf die frappierenden textlichen Gemeinsamkeiten zwischen Wagners Meistersingern und Friedrich Schillers Gedichtfragment Deutsche Größe hingewiesen und aufgezeigt, dass sich bereits in Letzterem die Vorstellung einer Überlegenheit der deutschen Kultur gerade aufgrund der allgemeinmenschlichen Werte andeutet. Borchmeyer, Klassik, S. 57–61.
88
Vorstellungen von einer idealen deutschen Opernbühne
von der Abgrenzung der deutschen Kultur gegenüber ausländischen Einflüssen wurde von den Zeitgenossen unmittelbar verstanden und die Meistersinger als neue deutsche Nationaloper stürmisch gefeiert.209 Auch die Architektur des Bayreuther Festspielhauses konnotierte Wagner im Übrigen national. Für ihn war die dem Bildungsgedanken geschuldete amphitheatralische Anordnung des Theatersaales Ausdruck des deutschen Geistes, sodass er die neue Theaterarchitektur gegen eine vermeintlich nur Unterhaltungszwecken dienende Bauweise der italienischen beziehungsweise französischen Rang-/Logentheater abgrenzen zu müssen glaubte.210 Im Kaiserreich avancierte der Komponist zu einer der zentralen nationalen Identifikationsfiguren. Für das deutsche Bildungsbürgertum war Wagner – genau wie der in nationalen Festen gefeierte Schiller211 – Ausweis deutscher Größe gegenüber dem ‚Erzfeind‘ Frankreich. Eines der leidenschaftlichsten Bekenntnisse zu Wagners Werk legte in diesem Sinne während des Ersten Weltkrieges Thomas Mann ab. In seinen Betrachtungen eines Unpolitischen (1918) pries er Wagner als Inbegriff des deutschen Geistes und spielte ihn mit der inzwischen im Bildungsbürgertum verbreiteten Dichotomie Kultur versus Zivilisation gegen das verhasste Frankreich aus.212 So wie 1870 Wagner den Einmarsch der deutschen Truppen in Paris verstand jetzt Thomas Mann den Krieg als Bündnis zwischen deutschem Militär und deutscher Kultur zur Rettung des gefährdeten deutschen Geistes.213 209 Thomas S. Grey, „Selbstbehauptung oder Fremdmissbrauch ? Zur Rezeptionsgeschichte von Wagners ‚Meistersingern‘“, in : Danuser/Münkler, Meister, S. 303–325, vor allem S. 310 ; Thomas S. Grey, „Die Meistersinger as National Opera (1868–1945)”, in : Applegate/Potter, Music, S. 78–104. 210 Wagner, Bühnenfestspielhaus, S. 335. 211 Rainer Noltenius, „Die Nation und Schiller“, in : Helmut Scheuer (Hg.), Dichter und ihre Nation, Frankfurt/M. 1993, S. 151–175. 212 Thomas Mann, Betrachtungen eines Unpolitischen, Berlin 1918. Zur Dichotomie von Kultur und Zivilisation siehe Bollenbeck, Bildung, S. 268ff. 213 Bereits in seinem Versuch über das Theater (1907) hatte Thomas Mann den Deutschen „eine Ehrfurcht vor dem Theater“ attestiert, „wie keine andere Nation sie kennt. Was dem übrigen Europa eine gesellige Zerstreuung ist, ist uns zum mindesten ein Bildungsfaktor.“ Für Mann konnte ein Text wie Schillers Schaubühne-Vortrag nur in Deutschland entstehen, und „nur bei uns konnte ‚Bayreuth‘ konzipiert und verwirklicht werden“. Thomas Mann, Versuch über das Theater, in : Essays, Bd. 1 : Frühlingssturm 1893–1918, herausgegeben von Hermann Kurzke und Stephan Stachorski, Frankfurt/M. 1993, S. 53–93, hier S. 79–80.
Eine ideale deutsche Opernbühne – vier ideengeschichtliche D imensionen
89
Eine besonders verhängnisvolle Wirkung entfaltete schließlich Wagners Antisemitismus im Rahmen der Vorstellung deutscher kultureller Suprematie. In seinem antisemitischen Pamphlet Das Judentum in der Musik (1850) sprach Wagner den Juden die Fähigkeit zu wahrer Kunstproduktion ab und unterstellte ihnen eine auf Kommerz abzielende Verschwörung gegen das europäische Kulturleben.214 1869 publizierte er sein Pamphlet erneut, das gegenüber der ersten Fassung sogar noch signifikante Verschärfungen enthielt.215 Neu war etwa, dass Wagner nun erstmals eine gewaltsame Ausweisung der Juden aus Deutschland erwog. Mit der zweiten Veröffentlichung seiner Schrift avancierte Wagner zu einem Vorläufer und Motor des um 1879 ausbrechenden modernen Antisemitismus in Deutschland, dem es um eine Zurückdrängung der verfassungsmäßig garantierten Gleichberechtigung der Juden ging.216 Als Multiplikatoren von Wagners Antisemitismus erwiesen sich zunächst die 1878 gegründeten Bayreuther Blätter.217 Vor allem in den 1920er-Jahren wurde der Antisemitismus zu einer argumentativen Waffe, um gegen die verhasste kulturelle Moderne zu polemisieren. Im Bereich der Oper gerieten, wie schon erwähnt, insbesondere die Aufführungen der Berliner Kroll-Oper ins Kreuzfeuer einer nationalistisch ausgerichteten Kritik. Im Namen der deutschen Nationalkultur wurden die Aufführungen der Bühne als ‚undeutsch‘, ‚kosmopolitisch‘, ‚kulturbolschewistisch‘ oder mit antisemitischen Argumenten verunglimpft, wobei Arnold Schönberg den Hauptangriffspunkt der antisemitischen Modernekritik bildete. Dass die Kroll-Oper – offiziell mit der Begründung der knappen Finanzen infolge der Weltwirtschaftskrise – 1931 geschlossen wurde, kam vielen Nationalkonservativen daher mehr als gelegen. 214 Jens Malte Fischer, Richard Wagners „Das Judentum in der Musik“. Eine kritische Dokumentation als Beitrag zur Geschichte des Antisemitismus, Frankfurt/M./Leipzig 2000. 215 Jens Malte Fischer bezeichnete die zweite Publikation der Schrift aufgrund ihrer inhaltlichen Verschärfungen als den „eigentliche[n] ,Sündenfall‘“ Wagners. Jens Malte Fischer, „Richard Wagners ‚Das Judentum in der Musik‘. Entstehung – Kontext – Wirkung“, in : Dieter Borchmeyer, Ami Maayani und Susanne Vill (Hg.), Richard Wagner und die Juden, Stuttgart/Weimar 2000, S. 35–52, hier S. 42. 216 Fischer, Dokumentation, S. 91. 217 Annette Hein, „Es ist viel ‚Hitler‘ in Wagner“. Rassismus und antisemitische Deutschtumsideologie in den „Bayreuther Blättern“ (1878–1938), Tübingen 1986 ; Winfried Schüler, Der Bayreuther Kreis von seiner Entstehung bis zum Ausgang der wilhelminischen Ära. Wagnerkult und Kulturreform im Geiste völkischer Weltanschauung, Münster 1971.
90
Vorstellungen von einer idealen deutschen Opernbühne
Während sich Berlin in den 20er-Jahren zu einem wenn auch umstrittenen Zentrum der kulturellen Moderne entwickelte, bildeten die Bayreuther Festspiele im Gegensatz dazu einen Hort des völkischen Nationalismus und Antisemitismus.218 Maßgeblichen Anteil daran hatte Houston Stewart Chamberlain, als Ehemann der Wagner-Tochter Eva eng mit dem Haus Wagner verbunden. Mit seinen Grundlagen des 19. Jahrhunderts (1899) wurde Chamberlain zum einflussreichsten Rassentheoretiker seiner Zeit. Seit Oktober 1923 stand das Haus Wagner in engem Kontakt mit Adolf Hitler. Bei den ersten Festspielen nach dem Ersten Weltkrieg 1924 rissen die Meistersinger das Publikum zu einer kollektiven nationalen Begeisterung hin, sodass am Schluss gemeinsam das Deutschlandlied angestimmt wurde.219 Mit der Machtübertragung 1933 setzten die Nationalsozialisten die ideengeschichtlich bereits lange etablierte kulturelle Ausgrenzung in die Wirklichkeit um. Werke vor allem von jüdischen Künstlern wurden als ‚entartet‘ verfemt ; dem Regime unliebsame Sänger und Orchestermusiker, Komponisten, Dirigenten und Intendanten wurden, so sie nicht selbst von ihren Positionen zurücktraten, diffamiert und aus den deutschen Opernhäusern vertrieben.220 218 Brigitte Hamann, Winifred Wagner oder Hitlers Bayreuth, München 2002. 219 Aus Angst vor einem Ausbleiben von Spenden jüdischer Wagnerianer sah sich der Leiter der Festspiele, Siegfried Wagner – selbst ein Antisemit –, gezwungen, mäßigend einzugreifen. Um mögliche Geldgeber durch das Singen des Deutschlandliedes nicht zu reizen, ließ auf Handzetteln verbreiten : „Ich bitte alles noch so gut gemeinte Singen zu unterlassen, hier gilts der Kunst !“ Sein äußerst halbherziger Verweis auf den unpolitischen Bildungsbegriff macht allerdings deutlich, dass es um diesen inzwischen schlecht bestellt war. Zitiert nach : Brigitte Hamann, Die Familie Wagner, Reinbek bei Hamburg 2005, S. 103. 220 Siehe dazu : Hannes Heer, Jürgen Kesting und Peter Schmidt, Verstummte Stimmen. Die Vertreibung der „Juden“ aus der Oper 1933 bis 1945, Berlin 2008. – Dass sich in der Zeit des Nationalsozialismus entgegen der Selbstdarstellung des Regimes bisweilen dennoch eine „gemäßigte“ Moderne halten konnte, wie bisweilen etwa an der Berliner Staatsoper, wo Heinz Tietjen und sein Bühnenbildner Emil Preetorius an ihrem auf die 1920er-Jahre zurückgehenden Konzept eins „stilisierten Naturalismus“ festhalten konnten, wo Werner Egks Peer Gynt uraufgeführt wurde und wo selbst einzelne jüdische Künstler toleriert wurden, sollte nicht dazu verleiten, die Auswirkungen des Regimes auf die Entwicklung der Kultur zu relativieren. Die Gründe für die genannten Ausnahmen sind zum einen in der Absicht zu sehen, auch erstklassige, aber aus Sicht des Regimes ideologisch zweifelhafte Künstler für den Nationalsozialismus zu gewinnen, des Weiteren in dem Bestreben, nach außen hin liberal zu erscheinen, schließlich im polykratischen Charakter der NSHerrschaft. Zu letzterem Aspekt siehe das Kapitel „Die Vermählung einer idealen Politik mit einer realen Kunst. Oper und Musikpolitik im Dritten Reich“ in : Walter, Hitler, S. 213–262.
Eine ideale deutsche Opernbühne – vier ideengeschichtliche D imensionen
91
d) Musterbühne
Schließlich gehörte die Forderung nach musterhaften Aufführungen zu den Vorstellungen von einer idealen nationalen Opernbühne. Nicht nur die Auswahl der an einer solchen Bühne gespielten Werke sollte repräsentativ für die übrigen Bühnen in Deutschland sein, auch die künstlerische und theatertechnische Qualität der Darbietungen hatte vorbildlich zu sein. Zu den ersten Bemühungen kam es dabei wiederum zunächst im Bereich des Schauspiels. Für das 18. Jahrhundert ist Conrad Eckhofs 1753 gegründete Schauspieler-Akademie innerhalb der Schönemannschen Truppe zu nennen. Auch im Rahmen der Gründung des Hamburger Nationaltheaters 1767 war geplant gewesen, eine Theatralische Akademie zur Hebung des schauspielerischen Niveaus zu gründen, waren doch die deutschen Schauspieler den französischen Hoftheatertruppen qualitativ weit unterlegen. Allerdings wurde das Vorhaben nicht umgesetzt.221 In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts dann stach Carl Immermann (1834–37) mit seiner Düsseldorfer Musterbühne hervor. Forderungen nach einer Optimierung von Theater- und Opernaufführungen waren auch grundlegender Bestandteil der Nationaltheaterkonzepte im Kontext der Revolution von 1848/49. Gefordert wurde die Angliederung eigens einzurichtender Theaterschulen an die Nationaltheater222, die mit ihren Aufführungen in vorbildlicher Weise zur Hebung des Publikumsgeschmacks beitragen sollten. Zur Verbesserung der Qualität sollte des Weiteren die Zahl der Spieltage an den Nationalbühnen verringert223 beziehungsweise ein jährlich aufzuführendes Stammrepertoire an Modellaufführungen224 begründet werden. Auch Wagner, der sich Zeit seines Lebens über die unzureichende Qualität der Aufführungen an den deutschen Hof- und Stadttheatern beklagte, machte in seinem Nationaltheaterentwurf für Dresden detaillierte Vorschläge, um die Aufführungsqualität zu verbessern. Er plädierte für die Einrichtung einer Theaterschule, für die Senkung der Aufführungstage und sprach sich
221 Erika Fischer-Lichte, Kurze Geschichte des deutschen Theaters, Tübingen/Basel 1993, S. 110. 222 Rötscher, „Theater“, S. 568 ; Devrient, Nationaltheater, S. 68ff. 223 Ebd., S. 57. 224 Ebd., S. 51.
92
Vorstellungen von einer idealen deutschen Opernbühne
darüber hinaus zur Verbesserung der Opernaufführungen für die Gründung eines musikalischen Instituts aus.225 Nach dem Willen Wagners sollten dann die Bayreuther Festspiele die erhofften Musteraufführungen bringen. Aus Probenberichten des Jahres 1876 ist überliefert, wie sich der Komponist, während er bei seinem Ring des Nibelungen Regie führte, um einen neuen Darstellungsstil als Pendant zur psychologisch differenzierten Charakterisierung der Figuren in seiner Musik bemühte. Der Komponist gehörte in Deutschland zu den Ersten, welche die szenische Darstellung, die sich in der Oper bis dahin weitgehend in standardisierten Gesten erschöpft hatte, einer umfassenden Regiekonzeption unterwarfen.226 Was die Dekorationen der ersten Bayreuther Festspiele anbelangt, war Wagner mit dem Resultat jedoch außerordentlich unzufrieden. Statt des angestrebten szenischen Idealismus musste er sich mit einem am Historismus des Meininger Hoftheaters orientierten Ergebnis begnügen.227 Eine Loslösung von einem solchen Realismus brachten für die Werke des Komponisten erst die vom Jugendstil beeinflussten, gemäßigt stilisierten Bühnenbilder Alfred Rollers in Wien der Jahre 1897 bis 1907. Überhaupt markiert die Zusammenarbeit Rollers mit Gustav Mahler als Hofoperndirektor in Wien eine weitere Station auf dem Weg zu einer Professionalisierung der Opernregie. Mahler strebte nach dramaturgischer Logik sowie Natürlichkeit von Gestik und Mimik der Darsteller.228 Bis zur Abstraktion drang schließlich Adolphe Appia mit seinen Bühnenbildentwürfen für die Werke Richard Wagners vor, an die Wieland Wagner ab 1951 stilistisch anknüpfte. Die wesentlichen Anregungen für die Regie und das Bühnenbild in der Oper gingen im 20. Jahrhundert dann vom Schauspiel aus. Zu nennen ist etwa das 225 Wagner, National-Theater, S. 250ff. 226 Martina Srocke, Richard Wagner als Regisseur, Phil. Diss., Berlin 1984, S. 36ff. 227 Zitiert nach : Oswald Georg Bauer, „Reinster Idealismus und unzulängliche Realisierung. Die wiedergefundenen Entwürfe von Josef Hoffmann zum Ring des Nibelungen der ersten Bayreuther Festspiele 1876“, in : Die Szene als Modell. Die Bühnenbildmodelle des RichardWagner-Museums und der „Ring des Nibelungen“ in Bayreuth 1876–2000, München/Berlin 2006, S. 17–36, hier S. 18. 228 Von Gustav Mahler ist das künstlerische Credo überliefert : „Was ihr Theaterleute eure Tradition nennt, ist nichts als eure Bequemlichkeit und Schlamperei.“ Zitiert nach : Nora Eckert, Von der Oper zum Musikdrama, Wegbereiter und Regisseure, Berlin 1995, S. 15.
Eine ideale deutsche Opernbühne – vier ideengeschichtliche D imensionen
93
psychologisierte Einfühlungstheater von Konstantin Sergejewitsch Stanislawski, der 1919 ein Opernstudio zur darstellerischen Ausbildung von Opernsängern einrichtete, Wsewolod E. Meyerhold sowie Max Reinhardt.229 Carl Ebert, dessen erste Intendanz an der Berliner Städtischen Oper in die Jahre 1931–33 fiel, erhielt bei Reinhardt Schauspielunterricht. Als Generalintendant des Hessischen Landestheaters in Darmstadt 1927–31 sowie dann in Berlin war er einer der maßgeblichen Erneuerer der szenischen Darstellung in der Oper.230 Zu erinnern ist etwa an seine viel beachteten Berliner Verdi-Inszenierungen von Macbeth und Maskenball, Wagners Der Fliegende Holländer und an die Uraufführung von Kurt Weills Die Bürgschaft.231 Die im Rahmen einer Reform der Oper einflussreichste Bühne bis 1933 stellte schließlich die Kroll-Oper dar, an der etwa der Schauspielregisseur Jürgen Fehling mit Wagners Fliegendem Holländer eine aufsehenerregende Inszenierung schuf, die in einer charakteristischen Mischung aus Realismus und abstraktem Theater bestand.232 Der Nationalsozialismus bereitete avancierter Opernregie und modernem Bühnenbild ein Ende. Zum ästhetischen Ideal und Vorbild für deutsche Opernaufführungen wurde stattdessen nun der naturalistisch-pathetische Stil des schon genannten „Reichsbühnenbildners“ Benno von Arent erhoben. Allerdings konnte ein Regisseur wie Heinz Tietjen zusammen mit Emil Preetorius an der Berliner Lindenoper sowie bei den Bayreuther Festspielen zumindest einen an den Reformen der 1920er-Jahre orientierten ‚stilisierten Naturalismus‘ fortführen.233 Zusammengefasst ergibt sich, dass es zu den von Künstlern und Intellektuellen artikulierten ideengeschichtlichen Konstanten im Zusammenhang mit einer idealen deutschen Opernbühne – von der nicht selten als Nationaltheater die 229 Ebd., S. 14ff. 230 Hermann Kaiser, Modernes Theater in Darmstadt 1910–1933. Ein Beitrag zur Stilgeschichte des deutschen Theaters zu Beginn des 20. Jahrhunderts, Darmstadt 1955 ; Steinbeck, „,Vater‘“. 231 Siehe dazu : Diana Diskin, „Schlachtfeld Berlin : Carl Ebert und die Uraufführung von Kurt Weills Die Bürgschaft“, in : Nils Grosch (Hg.), Aspekte des modernen Musiktheaters in der Weimarer Republik, Münster u.a. 2004, S. 225–265. 232 Eckert, Oper, S. 30. 233 Nora Eckert, Der Ring des Nibelungen und seine Inszenierungen von 1976 bis 2001, Hamburg 2001, S. 178.
94
Vorstellungen von einer idealen deutschen Opernbühne
Rede war – bis 1945 erstens gehörte, dass eine solche der sittlichen Bildung der Nation dienen solle. Mit diesem Anspruch, der spätestens ab 1848/49 gleichermaßen für Oper wie Schauspiel galt, war verbunden, dass die Bühnen dem Gesetz des Marktes von Angebot und Nachfrage enthoben zu sein hatten, das als Ursache für das kritisierte Unterhaltungstheater angesehen wurde. In enger Verbindung mit dem Anspruch sittlicher Bildung stand zweitens das Ideal ästhetischer Schönheit des auf der Bühne Dargebotenen. Drittens schrieben Künstler und Intellektuelle einer idealen deutschen Opernbühne die Aufgabe zu, ein nationales Repertoire zu pflegen, durch dessen Rezeption sich die Deutschen als nationale Gemeinschaft erkennen sollten. Eine grundlegende Rolle spielte in diesem Zusammenhang die maßgeblich von Johann Gottfried Herder popularisierte ursprungsmythologische Argumentationsfigur, wonach die Kategorien Kunst, Volk und Nation in einem konstitutiven Zusammenhang standen. Viertens sollte eine ideale deutsche Opernbühne für andere Opernhäuser die Rolle einer Musterbühne übernehmen, nicht nur bei der Auswahl der gespielten Werke, sondern auch hinsichtlich ihrer performativen Qualität. Im Laufe der Zeit veränderte sich die konkrete inhaltliche Ausfüllung der genannten ideengeschichtlichen Aspekte. Der Bildungsbegriff, der aus der europäischen Aufklärung stammte, wurde im Idealismus erheblich mit Anspruch aufgeladen und fortan als zweckfrei interpretiert. Gründete er sich bis ins frühe 20. Jahrhundert hinein dabei auf allgemeinmenschliche Werte, koppelten nationalistische Theaterkonzepte in der Weimarer Republik diesen vom europäischen Humanismusdiskurs ab. An dessen Stelle trat ein politisches Bildungsverständnis, an das schließlich der Nationalsozialismus anknüpfte. Auch die inhaltliche Füllung der ursprungsmythologischen Argumentationsfigur verschob sich im Laufe der Zeit. Wurde sie zunächst mehrheitlich egalitär-liberal im Sinne einer Gleichwertigkeit der verschiedenen Nationalkulturen verstanden, änderte sich dies spätestens um 1850, als sich im deutschen Bildungsbürgertum die Vorstellung einer Überlegenheit der deutschen Kultur gegenüber derjenigen anderer Nationen und Völker abzuzeichnen begann. Diese Vorstellung verband sich seit Ende der 1870er-Jahre mit dem aufkommenden modernen Antisemitismus. Paradoxerweise blieb das deutsche kulturelle Selbstverständnis dabei zunächst jedoch weiterhin allgemeinmenschlichen, weltbürgerlichen Werten verpflichtet.
Eine ideale deutsche Opernbühne – vier ideengeschichtliche D imensionen
95
Die ersten grundlegenden Impulse zu einer Professionalisierung von Opernregie und Bühnenbild, wodurch die Aufführungen einer idealen deutschen Opernbühne zu einem Muster für andere Bühnen werden sollten, brachte Richard Wagner mit den Bayreuther Festspielen 1876. Im 20. Jahrhundert dann gingen die wesentlichen Impulse in diesem Zusammenhang vom Schauspiel (Stanislawski, Meyerhold, Reinhardt) aus. Mit dem Wegfall der Zensur in der Weimarer Republik kamen verstärkt Werke der kulturellen Moderne auf die Spielpläne der Opernhäuser und Theater, die mit der „bildungsbürgerlichen Semantik“ (Bollenbeck) brachen. Diese Werke wurden von nationalkonservativen Kreisen als ‚undeutsch‘ oder ‚kosmopolitisch‘, ‚kulturbolschewistisch‘ oder mit antisemitischen Argumenten verfemt, wobei der Nationalsozialismus in Aussicht stellte, die vermeintliche Kluft zwischen Kunst und Volk zu schließen. Infolge der Machtübertragung auf die Nationalsozialisten 1933 wurde die Ausgrenzung der kulturellen Moderne in die Tat umgesetzt.
III. Kulturpolitische Konzepte – Deutsche Staatsoper und Städtische/Deutsche Oper als ideale deutsche Opernbühnen
Im diesem Kapitel wird erläutert, welche Rolle die vier beschriebenen ideengeschichtlichen Dimensionen einer idealen deutschen Opernbühne in den kulturpolitischen Konzepten der beiden ‚großen‘ Berliner Bühnen, der Staatsoper und der Städtischen/Deutschen Oper, nach 1945 gespielt haben. Im Zusammenhang mit der Staatsoper wird auf das im Dezember 1952 im Neuen Deutschland publizierte detaillierte Grundsatzprogramm „Zu den Aufgaben der Deutschen Staatsoper“ eingegangen und dieses in den politisch-gesellschaftlichen Kontext eingeordnet : erstens die Bedingungen sowjetischer Kulturpolitik, zweitens die Aneignung bildungsbürgerlicher Kunstvorstellungen durch die Arbeiterbewegung, drittens die Deutschlandpolitik der SED und viertens die besondere Bedeutung Ost-Berlins als Hauptstadt der DDR. Für die West-Berliner Oper liegt, dem westdeutschen Anspruch der Freiheit der Kunst entsprechend, kein vergleichbares, inhaltlich verbindliches kulturpolitisches Dokument vor. In diesem Zusammenhang wird jedoch der Plan des West-Berliner Senats erläutert, in Charlottenburg einen Opernneubau als ideale deutsche Opernbühne in Konkurrenz zur Staatsoper zu errichten. Dieses kulturpolitische Vorhaben wird in das Bestreben der West-Berliner Teilstadt eingebettet, den Status als (west-) deutsche Hauptstadt wiederzuerlangen. Darüber hinaus stehen die individuellen Vorstellungen der Intendanten jener Jahre, Heinz Tietjen und Carl Ebert, von einer idealen deutschen Opernbühne im Mittelpunkt, die das Opernhaus jeweils weit stärker individuell prägten als etwa Max Burghardt an der kulturpolitisch gelenkten Staatsoper.
Die Deutsche Staatsoper als ideale sozialistische deutsche Opernbühne
97
1. Die Deutsche Staatsoper als ideale sozialistische deutsche Opernbühne a) Neues Deutschland : „Zu den Aufgaben der Deutschen Staatsoper“ (1952)
In seiner Grundsatzrede über „Die gegenwärtige Lage und die neuen Aufgaben der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands“ auf der II. Parteikonferenz im Juli 1952, bei welcher der „planmäßige Aufbau des Sozialismus“ in der DDR beschlossen wurde, wandte sich Walter Ulbricht auch dem Feld der Kultur zu : „Auf dem Gebiete der Oper und des Schauspiels gilt es, das Niveau noch weiter zu erhöhen“, forderte der Generalsekretär des Zentralkomitees. Vor allem aber sei die Ost-Berliner Staatsoper „zur führenden Oper in Deutschland zu machen“.234 Ulbrichts Appell nahm das Politbüro der SED als das einflussreichste Gremium der Staatspartei am 4. November 1952 auf und beauftragte das Parteiorgan Neues Deutschland, „Stellung zu nehmen zu den Aufgaben der Staatsoper und zu den bisherigen Versäumnissen in der Arbeit“.235 Das Blatt kam der Aufforderung nach, indem es sechs Wochen später, am 19. Dezember, ein ganzseitiges Grundsatzprogramm mit dem Titel „Zu den Aufgaben der Deutschen Staatsoper“ publizierte. Das Fehlen einer Autorenangabe wies darauf hin, dass es sich bei dem Leitartikel um die allgemeine und verbindliche Meinung der Partei handelte. Dementsprechend hatten die darin enthaltenen Aussagen für die Opernbühne grundsätzliche Verbindlichkeit. So prägten sie die kulturelle Selbstdarstellung bei der Wiedereröffnung der Lindenoper 1955 und hatten, da sie nicht widerrufen wurden, für die Staatsoper während der gesamten 1950er-Jahre Bestand. Interessant ist an dem Text, dass darin Positionen artikuliert werden, die aus der Geschichte der Idee einer idealen deutschen Opernbühne gut bekannt sind. Erstens wird im Grundsatzprogramm „Zu den Aufgaben der Deutschen Staatsoper“ der Anspruch formuliert, dass die Bühne zur Bildung der Nation beizutragen habe. Ziel der Aufführungen der Staatsoper sollte es sein, den 234 Referat Walter Ulbrichts auf der II. Parteikonferenz der SED. Zitiert nach : Schubbe, Dokumente, S. 239–240, hier S. 240. 235 Protokoll der Sitzung des Politbüros des Zentralkomitees vom 04.11.1952. BArch, DY 30/ IV 2/2/ 243, Bl. 715.
98
Kulturpolitische Konzepte
„fortschrittlichen und humanistischen Ideengehalt“ der entsprechenden Werke „herauszuarbeiten“.236 Damit war jener ethisch-moralische Aspekt gemeint, den auch Johannes R. Becher in seiner Festrede 1955 betonen sollte. Freilich wurde darunter, dies sei noch einmal betont, nicht mehr eine zweckfreie und unpolitische Selbstveredelung des Subjekts im Sinne des Idealismus verstanden, sondern es sollte im Gegenteil in einem politisch-funktionalen Sinne darum gehen, „die Kräfte für den Aufbau des Sozialismus [zu] verstärken“.237 Auch für die DDR stand dabei das klassische kulturelle Erbe, zu dem die Epoche der Klassik im engeren Sinne wie die des bürgerlichen 19. Jahrhunderts im weiteren Sinne zählte, im Mittelpunkt des Interesses ; dem ostdeutschen Staat ging es ebenfalls um die Pflege der „großen musikalischen Traditionen der […] klassischen Oper“238, denen eine grundlegend sittliche Dimension zugemessen wurde. Wenn sich die Schwerpunkte des Repertoires zwischen dem Nationalsozialismus und dem sozialistischen deutschen Staat damit zwar letztlich weitgehend deckten, unterschieden sich beide Systeme doch insofern fundamental, als die DDR argumentativ wieder an den in Deutschland ideengeschichtlich lange Zeit prägenden Humanismusdiskurs anknüpfte, der von der NS-Kulturpolitik bestritten worden war. Zweitens erfuhr die ursprungsmythologische Argumentationsfigur in dem Text eine Aktualisierung, ging die Kulturpolitik des sozialistischen deutschen Staates doch weiterhin von einem konstitutiven Zusammenhang zwischen Volk, Künstler und Nation aus. Demnach gehörte die Oper für die DDR „als untrennbarer Bestandteil zur Nationalkultur eines Volkes. In ihrer Einheit von Dichtung, Musik, Schauspiel, Tanz und Bühnenbild war diese Kunstgattung in der Periode der Herausbildung der Nationen gleichsam ein Kristallisationspunkt des künstlerischen Lebens der Nation.“239 Einerseits bedeutete dies, wie es im Neuen Deutschland hieß, dass die Staatsoper im sozialistischen Staat nicht mehr nur eine „Angelegenheit begüterter Kreise“ sein dürfe. Im Gegenteil müssten die „Bestrebungen dahin[gehen], allen Werktätigen die Möglichkeit zu geben, unser 236 „Zu den Aufgaben der Deutschen Staatsoper“, in : Neues Deutschland vom 19.12.1952. Zitiert nach : Schubbe, Dokumente, S. 259–264, hier S. 260. 237 Ebd. 238 Ebd. 239 Ebd., S. 259.
Die Deutsche Staatsoper als ideale sozialistische deutsche Opernbühne
99
musikalisches und kulturelles Erbe kennenzulernen […] und dafür zu sorgen, daß breitesten Kreisen […] diese Aufführungen zugänglich gemacht werden.“240 Dass die bürgerliche Kultur im Arbeiter- und Bauern-Staat eine neue Trägerschicht erhalten sollte, war vor dem Hintergrund, dass diese Kultur seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert nie exklusiv für die bestehende Sozialformation des Bürgertums, sondern immer als Teilnahmeangebot für alle konzipiert war, aus Sicht der DDR nur folgerichtig.241 Andererseits aber richtete sich die Bühne über ein ostdeutsches Publikum hinaus explizit auch an die Westdeutschen. In diesem Zusammenhang wies die DDR der Kunstform angesichts der politischen Teilung Deutschlands wieder die alte Funktion zu, national Einheit stiftend zu wirken. Innerhalb des „Kampf[es] um den Bestand der deutschen Nation“ und für eine Wiedervereinigung sah man somit die „Schaffung einer zentralen führenden Institution der deutschen Opernkunst [als] eine geschichtliche Notwendigkeit“ an.242 So ließ der Text keinen Zweifel daran, dass die Werke der deutschen Nationalkultur, wobei Gluck und Mozart, Wagner, Weber und Lortzing genannt wurden, im Spielplan einen größeren Stellenwert erhalten sollten als diejenigen anderer Nationen, nicht weil diesen etwa eine geringere künstlerische Qualität eingeräumt worden wäre als den deutschen. Doch konnte sich das Publikum aus Sicht der DDR nur durch die Rezeption der eigenen nationalkulturellen Werke als nationale Gemeinschaft verstehen und auf diese Weise der erhoffte Beitrag zur Überwindung der politischen Teilung Deutschlands geleistet werden. Erst an zweiter Stelle kamen somit im Repertoire die „unvergänglichen Werke der russischen, italienischen, polnischen, tschechischen und französi240 Ebd., S. 260. 241 Schandera, „Resistenz“, S. 165. Zur Inanspruchnahme der bürgerlichen Kultur durch die Arbeiterbewegung in der DDR siehe auch : Maase, Vergnügen, S. 259ff. 242 „Zu den Aufgaben der Deutschen Staatsoper“, zitiert nach : Schubbe, Dokumente, S. 259. – In der im Januar 1954 publizierten „Programmerklärung“ des neugegründeten Ministeriums für Kultur bezog sich Johannes R. Becher dann etwa auch explizit auf Schillers Schaubühne-Vortrag : „Wenn wir es erlebten, eine Nationalbühne zu haben, so würden wir auch eine Nation.“ Dieses von Schiller und anderen geforderte deutsche Nationaltheater habe, so der Minister, „Weltruf“ besessen, sodass seine „Wiedergeburt“ als kulturpolitisches Ziel genannt wurde. Johannes R. Becher, „Programmerklärung zur Verteidigung der Einheit der deutschen Kultur“, in : Sinn und Form 6 (1954), S. 279–321, hier S. 298 und 320. Die Aneignung der Schillerschen Ideen durch die DDR findet sich auch in : Joachim Tenschert, „Die Schaubühne – moralische Anstalt“, in : Theater der Zeit 10 (1955), Heft 8, S. 1–6.
100
Kulturpolitische Konzepte
schen Meister“. Unter diesen wiederum maß man der russischen Nationaloper die größte Bedeutung zu. Die „Meisterwerke“ Glinkas und Mussorgskis, RimskiKorsakows, Tschaikowskis und Borodins seien von einem „tiefen humanistischen und patriotischen“ Gehalt erfüllt, sie hätten erstmals in der Geschichte dieser Kunstform das Volk als „aktiv handelndes patriotisches Element auf die Bühne“ gebracht und, ihre Musik stütze sich – auch hier das ursprungsmythologische Argument – „auf den unerschöpflichen Quell des russischen Volksliedes“. So hätte der „russische Realismus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die höchste Stufe des vorsozialistischen Realismus überhaupt dargestellt“.243 Aufgrund ihrer besonderen Qualitäten komme diesen Opern eine Vorbildfunktion auch für eine neu zu schaffende sozialistische deutsche Nationaloper zu, bei deren Etablierung die Staatsoper die führende Rolle spielen sollte. Becher sprach in diesem Zusammenhang 1955 von der Staatsoper als „Grundstein einer deutschen Nationaloper“. Wenn es im Neuen Deutschland somit hieß, die Staatsoper müsse „im patriotischen Geist […] erziehen“244, erhielt die bildende Funktion eine zusätzliche Dimension : Nicht nur durch die Inhalte der Werke sollte politisch erzogen werden, sondern auch durch das Gemeinschaft stiftende gemeinsame Rezipieren der Werke der Nationalkultur. Dieser Gedanke war, wie schon erläutert, auch von der nationalsozialistischen Kulturpolitik vehement vertreten worden. Allerdings unterschied sich die DDR insofern von jener, als es hier nicht um einen aggressiv-militaristischen Nationalismus ging. Stattdessen wurden Patriotismus und Humanismusdiskurs in der DDR argumentativ eng miteinander verbunden, da man sich doch von einem unter sozialistischen Vorzeichen vereinigten Deutschland auch ein moralisch besseres versprach.245 Eine grundlegende Gemeinsamkeit mit dem Nationalsozialismus bestand aber doch. Zwar wurde die ursprungsmythologische Argumentationsfigur in der DDR nicht etwa rassistisch interpretiert und nicht in den Dienst eines aggressiven Nationalismus gestellt wie im „Dritten Reich“, aber es ging damit im sozialistischen Staat wie vor 1945 explizit eine kulturelle Abgrenzung einher, die grundlegender Bestandteil des Konzepts der Staatsoper als vorbildliches nationales Theater war. 243 „Zu den Aufgaben der Deutschen Staatsoper“, zitiert nach : Schubbe, Dokumente, S. 260–261. 244 Ebd., S. 260. 245 Zu den Unterschieden zwischen NS-Regime und DDR in diesem Zusammenhang siehe : Bollenbeck/La Presti, Traditionsanspruch, S. 10.
Die Deutsche Staatsoper als ideale sozialistische deutsche Opernbühne
101
Diese betraf erneut die kulturelle Moderne. Wenn man sich 1952 im Neuen Deutschland – wie auch Johannes R. Becher 1955 bei der Eröffnungsfeier – auch als weltoffen und liberal darstellte und betonte, den Künstlern in der DDR stünden „alle Möglichkeiten für die freie Entfaltung ihrer Kräfte offen“, während sich im Westen die „Lage der Kulturschaffenden von Tag zu Tag verschlechtert[e]“246, wurden doch die Grenzen der Freigiebigkeit im sozialistischen Staat unmissverständlich benannt. Diese aber entlarvten den Anspruch kultureller Liberalität als bloßes Lippenbekenntnis. Mit denselben Begriffen nämlich, mit denen der Nationalsozialismus die kulturelle Moderne ausgegrenzt hatte, argumentierte nun auch die DDR. So hieß es, die westliche Moderne sei „volksfeindlich und antinational“ und von einem „heimatlosen Kosmopolitismus“247 geprägt ; „formalistische Experimente“ in der Kunst, die zur „Auflösung und Zerstörung der Traditionen in unserem musikalischen Schaffen“248 beitragen würden, müssten aus dem Spielplan der Bühne verdammt werden. Das vom Nationalsozialismus vorgetragene Argument der Zerstörung der Tradition galt nun auch für Paul Dessaus und Bertolt Brechts Das Verhör des Lukullus. Die Oper war im März 1951 an der Staatsoper uraufgeführt und nach nur einer Vorstellung auf Weisung des Volksbildungsministeriums vom Spielplan abgesetzt worden. Erst nach einer Überarbeitung, deren Ergebnis freilich in der SED immer noch umstritten war, konnte das Werk im Oktober desselben Jahres unter dem neuen Titel Die Verurteilung des Lukullus wieder auf die Bühne gelangen. Vor diesem Hintergrund wundert es kaum, dass Brechts/Weills Dreigroschenoper, Inbegriff einer linksorientierten Opernreform der 1920er-Jahre, für die Staatsoper im sozialistischen deutschen Staat keine Rolle spielte. Im Zusammenhang mit der Ablehnung der kulturellen Moderne aktualisierte die DDR auch die dritte Dimension aus der Geschichte der Idee einer idealen deutschen Opernbühne : den ästhetischen Anspruch auf Schönheit. Über die Oper von Brecht und Dessau heißt es abwertend : „Da gibt es keine Geigen. Dieses edelste aller Instrumente, das in der Lage ist, herrliche Klangbilder hervorzurufen, fehlt völlig. Es gibt keine Oboen und Klarinetten, dafür aber ein 246 „Zu den Aufgaben der Deutschen Staatsoper“, zitiert nach : Schubbe, Dokumente, S. 264. 247 Ebd., S. 262. 248 Ebd., S. 261.
102
Kulturpolitische Konzepte
mit Reißnägeln versehenes Klavier und vor allem neun Schlagwerke, unter denen sich große und kleine Trommeln und Metallplatten befinden, die mit Steinen bearbeitet werden. Diese Tatsache könnte als bloße Äußerlichkeit erscheinen, aber in Wirklichkeit ist sie der Ausdruck dafür, daß der Komponist Paul Dessau die Rolle der Melodie und der Harmonie in der Musik unterschätzt, ja sogar mißachtet, denn diese Unterdrückung des Melodischen entspringt einer bewußten Einstellung der Formalisten.“249 Wenn auch der Begriff ‚Schönheit‘ als Kategorie für die an der Staatsoper aufgeführten Werke im Text nicht explizit genannt wird, ging es doch genau darum.250 Es war dies das „Schöne, Gute und Wahre“, von dem Becher 1955 sprechen sollte. Schließlich erfuhr die vierte ideengeschichtliche Dimension einer idealen deutschen Opernbühne 1952 im Neuen Deutschland eine Aktualisierung. Der Staatsoper war aufgetragen, durch die künstlerische Qualität ihrer Aufführungen die Funktion einer Musterbühne zu übernehmen. Das Haus sollte die „erste Opernbühne Deutschlands“251 sein – nicht nur im Rahmen der DDR, sondern Gesamtdeutschlands. Dabei zeigte sich der sozialistische Staat bei der Finanzierung der Bühne, die zur Jahreswende 1949/50 aus der Obhut der Volksbildungsabteilung des städtischen Magistrats in die Verantwortung des neuen staatlichen Volksbildungsministeriums übergeben worden war, außerordentlich generös. Der Bühne würden, hieß es, „alle Mittel“ zur Verfügung gestellt, und ihre Mitglieder könnten „bei ihrer Arbeit immer auf die Unterstützung der Regierung der DDR rechnen [sic]“.252 Der inzwischen begonnene kostspielige Wiederaufbau der zerstörten Lindenoper bestätigte dies. Um den Anspruch einer Musterbühne einlösen zu können, wurde die „Notwendigkeit eines festen Ensembles“253 betont. Des Weiteren benannte das Neue Deutschland auch Idealvorstellungen über die visuelle ästhetische Gestaltung der 249 Ebd. 250 In einem Dokument des Kulturministeriums von 1955 über die neue Lindenoper heißt es in Bezug auf den Aspekt der Schönheit, es sei die Aufgabe der Bühne, die „Werktätigen […] mit den großen musikalischen Werken der Nation, aber auch der gesamten Menschheit vertraut zu machen und ihnen diese Werke in ihrem humanistischen Gehalt und ihrer Schönheit zu erschließen“. Vorlage vom 15.02.1955. LAB, C Rep. 167, Nr. 432. 251 „Zu den Aufgaben der Deutschen Staatsoper“, zitiert nach : Schubbe, Dokumente, S. 264. 252 Ebd. 253 Ebd.
Die Deutsche Staatsoper als ideale sozialistische deutsche Opernbühne
103
Aufführungen : Gefordert waren Bühnenbilder von „strahlender Helligkeit“ als „Sinnbilder des Optimismus“.254 Abgelehnt wurden hingegen künstlerische Umsetzungen wie die damalige Staatsopern-Inszenierung des Fidelio, bei welcher über weite Strecken der Aufführung auf der Bühne „ein unerträgliches Dunkel“ herrsche, „das den Zuschauer ermüdet, die Sänger zur Verhaltenheit zwingt und sie ihre künstlerischen Fähigkeiten nicht voll zum Ausdruck bringen lässt“. Auch würden die Darsteller nur „schablonenhaft und steif“ agieren und nicht wie gewünscht in einer „realistischen“ Art und Weise. Zwar sei die Kunstform Oper in darstellerischer Hinsicht etwas anderes als das Schauspiel, doch dürfe „das schauspielerische Element“ bei einer Aufführung nicht „in so starkem Maße in den Hintergrund treten […], wie das bei einem großen Teil der Inszenierungen der Deutschen Staatsoper gegenwärtig der Fall ist“.255 Als Ursache dafür wurde angesehen, dass den Aufführungen der Bühne bislang keine „kollektiv erarbeitete wissenschaftlich begründete, künstlerisch einwandfreie Regiekonzeption zugrunde“256 lägen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die vier tradierten ideengeschichtlichen Dimensionen einer idealen nationalen Opernbühne auch für die Staatsoper im sozialistischen deutschen Staat eine zentrale Rolle spielten : Erneut wurde der Bühne eine bildende Funktion zugewiesen, allerdings in einem verengten Verständnis von Humanismus im Sinne einer politischen Erziehung zum Sozialismus ; des Weiteren erfuhr die ursprungsmythologische Argumentationsfigur eine Aktualisierung, und war der ästhetische Aspekt der Schönheit der Kunst wiederum von zentraler Bedeutung, sodass die kulturelle Moderne in diesem Zusammenhang erneut als ‚volksfremd‘, ‚antinational‘ und ‚kosmopolitisch‘ ausgegrenzt wurde. Schließlich sollte die Staatsoper auch in der DDR in performativer Hinsicht eine Musterbühne sein. b) Kulturpolitische und politische Bedingungen
Die Kontinuität jener vier ideengeschichtlichen Dimensionen einer idealen deutschen Opernbühne ist im Kontext von vier zentralen kulturpolitischen und 254 Ebd., S. 263. 255 Ebd. 256 Ebd., S. 262.
104
Kulturpolitische Konzepte
politischen Bedingungen zu sehen, die im Folgenden erläutert werden. Als erste wichtige Bedingung ist die sowjetische Kulturpolitik zu nennen. Dass diese von grundlegender Bedeutung für das kulturpolitische Konzept der Staatsoper war, zeigt die Tatsache, dass das Neue Deutschland im Grundsatzprogramm „Zu den Aufgaben der Deutschen Staatsoper“ seine Kritik an Brechts/Dessaus LukullusOper mit einem Artikel aus der Prawda vom 28. Januar 1936 untermauerte. Unter dem Titel Chaos statt Musik hatte das sowjetische Parteiorgan als Stimme der offiziellen Kulturpolitik der KPdSU Dimitri Schostakowitschs Oper Lady Macbeth von Mzensk einer vernichtenden Kritik unterzogen.257 Von „Kakophonie“, einem bisweilen „wahnwitzigen Rhythmus“, musikalischem „Lärm“ und sogar „‚linke[r]‘ Entartung“ war in jenem Bericht die Rede, den das SED-Organ anführte. „Diese absichtlich ‚verdrehte‘ Musik ist so beschaffen, daß in ihr nichts mehr an die klassische Opernmusik erinnert und sie mit sinfonischen Klängen, mit der einfachen allgemeinverständlichen Sprache der Musik nichts mehr gemein hat. Das ist eine Musik, die nach dem gleichen Prinzip der Negierung der Oper aufgebaut ist, nach dem die ‚linke‘ Kunst überhaupt im Theater die Einfachheit, den Realismus, die Verständlichkeit der Gestalt, den nationalen Klang des Wortes negiert …“258 Die Prawda-Kritik an Schostakowitschs Oper war Ausdruck ausgreifender politischer Verfolgung der verschiedenen Felder des künstlerischen Lebens unter Stalin seit 1932, die dem Ziel dienten, die Künste in zunehmendem Maße für die politischen Ziele der KPdSU zu funktionalisieren.259 In den Bereichen Literatur und Bildende Kunst, Architektur, Musik und Theater wurden die bestehenden Künstlerorganisationen aufgelöst und durch zentrale, besser kontrollierbare Dachverbände ersetzt. Darüber hinaus kam es zur Propagierung des Sozialistischen Realismus als verbindliche künstlerische Leitlinie. Vorreiter war der neugegründete Schriftstellerverband. In dessen Statut, verabschiedet nach dem 257 Siehe dazu : Marco Frei, „Chaos statt Musik“. Dmitri Schostakowitsch, die Prawda-Kampagne von 1936 bis 1938 und der Sozialistische Realismus, Saarbrücken 2006, vor allem S. 71ff. ; Sheila Fitzpatrick, The Cultural Front. Power and Culture in the revolutionary Russia, Ithaca 1992, S. 183ff. 258 Zitiert nach : „Zu den Aufgaben der Deutschen Staatsoper“, in : Neues Deutschland vom 19.12.1952. 259 Siehe dazu : Gabriele Gorzka (Hg.), Kultur im Stalinismus. Sowjetische Kultur und Kunst der 1930er bis 1950er Jahre, Temmen 1994 ; Fitzpatrick, Front.
Die Deutsche Staatsoper als ideale sozialistische deutsche Opernbühne
105
1. Allunionskongress vom August 1934, fand sich die entscheidende Definition : „Der sozialistische Realismus, der die Hauptmethode der sowjetischen schönen Literatur und Literaturkritik darstellt, fordert vom Künstler wahrheitsgetreue, historisch konkrete Darstellung der Wirklichkeit in ihrer revolutionären Entwicklung. Wahrheitstreue und historische Konkretheit muß mit den Aufgaben der ideologischen Umgestaltung und Erziehung der Werktätigen im Geiste des Sozialismus verbunden werden.“260 Die Funktionalisierung der Kunst zu einem Mittel der politischen Erziehung im Sinne der Parteiideologie, hier zunächst für den Bereich der Literatur formuliert, wurde bald auch für die anderen Künste verbindlich. Dass dabei letztlich bis zu einem gewissen Grad uneindeutig und undefiniert blieb, was konkret unter Sozialistischem Realismus zu verstehen sei, machte den Begriff als kulturpolitische Waffe zur Reglementierung der Künste nur umso wirkungsvoller. Das künstlerische Ideal im Sinne der neuen kulturpolitischen Doktrin bestand in einer verstärkten Bezugnahme auf das klassische kulturelle Erbe, welches für Optimismus stand, positive Helden aufzuweisen hatte und dadurch für Humanismus zu bürgen schien. Dabei sollten die Kunstwerke für die breite Masse der Bevölkerung eingängig und leicht rezipierbar sein. Mit einer sich über zwei Jahre erstreckenden Pressekampagne in der Prawda, die mit jener vernichtenden Kritik an Schostakowitschs Lady Macbeth 1936 anhob, wurde der Sozialistische Realismus verstärkt propagiert. ‚-Ismen‘ aller Art wie Naturalismus, Expressionismus, Impressionismus, Konstruktivismus, Symbolismus oder Futurismus, letztlich die gesamte kulturelle Moderne, wurden von der Warte des Sozialistischen Realismus aus abgelehnt. Die genannten Kunstrichtungen, die fortan pauschal mit dem Negativbegriff ‚Formalismus‘ belegt wurden, galten als westlich-dekadent und Ausdruck eines kulturellen Verfalls. Die bisweilen schwere Verständlichkeit jener Kunst legte man als Mangel an Volkstümlichkeit aus, so dass vermeintlich formalistische Kunst als ‚volksfremd‘ oder ‚volksfeindlich‘ bezeichnet wurde. In der Musik galten im Bereich der Harmonik übermäßiger Dissonanzengebrauch, in der Melodik fehlende Sangbarkeit sowie eine Dominanz des Schlagwerks als Negativmerkmale. Auf dem Feld der Oper wurde Iwan Dserschinskis Der stille Don (UA 1935) zum 260 Zitiert nach : Jäger, Kultur, S. 41.
106
Kulturpolitische Konzepte
Vorbild für einen „sowjetischen Klassizismus“261 erhoben, wie ihn sich Stalin wünschte.262 Nachdem der Zweite Weltkrieg eine relative Lockerung des restriktiven kulturpolitischen Kurses gebracht hatte, zog die KPdSU die Zügel im Kontext des beginnenden Kalten Krieges wieder an. Ab 1946 erließ das Zentralkomitee eine Reihe von Resolutionen, in denen der Sozialistische Realismus erneut als verbindlich propagiert und gegen die kulturelle Moderne abgegrenzt wurde. Eine maßgebliche Rolle kam im Rahmen dieser Kampagne dem ZK-Mitglied Andrej Shdanow zu. In einer Rede über Fragen der sowjetischen Musikkultur auf einer ZK-Sitzung im Januar 1948 interpretierte er die UdSSR vor dem Hintergrund des System- und Kulturkonfliktes als „wahre Beschützerin der Musikkultur der ganzen Menschheit […] gegen den bürgerlichen Verfall und Niedergang der Kultur“.263 Aus Shdanows Referat erwuchs wieder eine Resolution gegen eine Oper : Am 10. Februar 1948 verabschiedete das ZK einen Beschluss über Wano Muradelis Die große Freundschaft (UA 1947). Der Text zählte zunächst vermeintliche kompositorische Mängel und Fehler im Geschichtsbild der Oper auf, verwies dann auf den Prawda-Artikel gegen Lady Macbeth, um sich schließlich grundsätzlich mit Nennung konkreter Komponistennamen wie Schostakowitsch, Sergei Prokofjew oder Aram Chatschaturjan gegen formalistische Tendenzen in der zeitgenössischen Musik zu wenden.264 Anders als in den 1930er-Jahren blieb die Doktrin des Sozialistischen Realismus nach 1945 nicht mehr auf die Sowjetunion beschränkt. Im Zusammenhang mit der Aufteilung der Welt in zwei Machtblöcke übernahmen auch die übrigen Länder des östlichen Machtbereichs die Shdanowsche Position. In der DDR stellte der Entschluss Der Kampf gegen den Formalismus in Kunst und Literatur, für eine fortschrittliche deutsche Kultur, gefasst auf der Fünften Tagung des ZK der SED vom März 1951, den entscheidenden Schritt auf diesem Weg 261 Stalin in einem Gespräch mit dem Dirigenten Samossud, zitiert nach : Boris Schwarz, Musik und Musikleben in der Sowjetunion 1917 bis zur Gegenwart, Wilhelmshaven 1982, S. 239. 262 Zur Musikkultur im Stalinismus siehe : Dorothea Redepenning, Geschichte der russischen und der sowjetischen Musik. Band 2 : Das 20. Jahrhundert, Laaber 2008, S. 299ff ; Fred K. Prieberg, Musik in der Sowjetunion, Köln 1965, Schwarz, Musik. 263 Andrej A. Shdanow, „Fragen der sowjetischen Musikkultur“, zitiert nach : Schneider/Dibelius, Musik, S. 48–51, hier S. 50f. 264 Redepenning, Geschichte, S. 492ff.
Die Deutsche Staatsoper als ideale sozialistische deutsche Opernbühne
107
dar.265 In dem Dokument, welches die vermeintlichen Fehlentwicklungen in den verschiedenen Künsten geißelte, hieß es : „Formalismus und Dekadenz in der Musik zeigen sich in der Zerstörung wahrer Gefühlswerte, im Mangel an humanem Gefühlsinhalt, an verzweifelter Untergangsstimmung, die in weltflüchtiger Mystik, verzerrter Harmonik und verkümmerter Melodie zum Ausdruck kommt.“266 Der Entschluss brachte die kulturelle Dimension stets in Verbindung mit dem allgemeinen politischen Kontext des Kalten Krieges. So war darin etwa zu lesen, das „Kulturleben in Westdeutschland und Westberlin“ habe „durch den verderblichen Einfluß des amerikanischen Monopolkapitalismus einen katastrophalen Tiefstand erreicht“, während von den „kulturellen Erfolgen“267 der DDR die Rede war, wo allerdings der Formalismus ebenfalls als noch nicht völlig überwunden angesehen wurde und wo überdies durch die schädlichen westlichen Einflüsse die ständige Gefahr eines kulturellen Rückschlags drohe. In den Jahren 1950 bis 1952 war in der DDR über die Doktrin des Sozialistischen Realismus hinaus auch die sowjetische Organisationsstruktur in Form neuer, zentralisierter Künstlerverbände übernommen worden.268 Im Kontext dieser Zentralisierung ist auch die Zuordnung der Staatsoper zum Volksbildungsministerium am Jahresbeginn 1950 zu sehen.269 Mitte 1951 nahm dann die bei den Künstlern gefürchtete Staatliche Kommission für Kunstangelegenheiten (Stakuko) ihre Arbeit auf. Sie sollte die zu einem Mittel des politischen Kampfes funktionalisierten Künste und Kulturinstitutionen im Sinne des Sozi265 Siehe dazu : Tompkins, Party Line, S. 55ff ; Sylvia Börner, Die Kunstdebatten 1945 bis 1955 in Ostdeutschland als Faktoren ästhetischer Theoriebildungsprozesse, Frankfurt/M./Bern/New York 1993, S. 111ff ; Günter Erbe, Die verfemte Moderne. Die Auseinandersetzungen mit dem „Modernismus“ in Kulturpolitik, Literaturwissenschaft und Literatur der DDR, Opladen 1993, S. 55ff. 266 Zitiert nach : Zur Weihen, Komponieren, S. 61. 267 „Der Kampf gegen den Formalismus in Kunst und Literatur, für eine fortschrittliche deutsche Kultur.“ Zitiert nach : Schubbe, Dokumente, S. 178–186, hier S. 179. 268 Zur Umwandlung der Organisationsstruktur im Bereich der Musik siehe : Zur Weihen, Komponieren ; Klingberg, Gesellschaften. 269 Ein der Kulturkommission des ZK der SED vorgelegter Bericht belegt eindrücklich die Versuche, die Bühne auf die Linie der SED auszurichten. „Bericht zur Situation an der Deutschen Staatsoper“ [undatiert, zwischen Mitte 1950 und Mitte 1952]. BArch, DY 30/ IV 2/9.06/ 287, Bl. 79–87.
108
Kulturpolitische Konzepte
alistischen Realismus anleiten. Die bisweilen harschen Eingriffe der Stakuko in das kulturelle Leben der DDR in Form von Zensur und Verboten besiegelten die Freiheit der Kunst, die in der sowjetisch besetzten Zone nach 1945 zunächst noch weitgehend gegeben war. Vergleichsweise spät, 1954, erhielt die Staatsoper dann mit dem SED-Funktionär Max Burghardt einen parteikonformen Intendanten, mit dessen Hilfe sich die kulturpolitische Linie grundsätzlich durchsetzen ließ. Burghardt war seit 1930 Mitglied der KPD gewesen und von den Nationalsozialisten von 1935 bis 1941 wegen seiner politischen Haltung inhaftiert worden. Seit 1954 hatte er den Status eines Kandidaten des ZK inne ; 1959 wurde er Mitglied des ZK der SED.270 Wenn auch das kulturelle Leben der DDR im Kontext des Kalten Krieges von der SED und damit „von oben“ auf die Prinzipien der shdanowschen Kulturpolitik ausgerichtet wurde, lassen sich die im ostdeutschen Staat fortan propagierten kulturellen Vorstellungen doch keineswegs erschöpfend erklären, begreift man sie nur als Nachahmung des sowjetischen Vorbildes. Thomas La Presti hat darauf hingewiesen, dass die im Formalismus-Beschluss von 1951 vorgebrachten „Vorbehalte gegenüber der modernen Kunst […] vielschichtiger und […] noch traditionsgesättigter“ seien, „als sie vielleicht zunächst erscheinen“.271 Das gleiche gilt für das Grundsatzprogramm für die Ost-Berliner Staatsoper von 1952. Da die Sowjetunion ihren Bündnisländern überdies das Anknüpfen an deren jeweilige nationalkulturelle Traditionen explizit zugestand, konnten in der DDR ältere deutsche Kulturvorstellungen ohne Schwierigkeiten fortgeführt werden. So blieb die Ost-Berliner Opernkultur in dieser Hinsicht eine weitgehend deutsche Angelegenheit. Zwar gab es Reisen von Delegationen der Ost-Berliner Opernbühnen in die UdSSR und wurde in DDR-Zeitschriften zu Lernzwecken oftmals über die Arbeit sowjetischer Künstler berichtet.272 Aber schon die Verpflichtung russischer Regisseure für Inszenierungen an den Ost-Berliner Opern war die Ausnahme.273 Eine spezifische Sowjetisierung lässt sich in diesem Zu270 Hugo Fetting, Max Burghardt, Berlin 1965. 271 La Presti, „Kontinuitäten“, S. 31. 272 Ein Beispiel dafür ist : Boris Pokrowski, „Die Arbeit des Großen Theaters der UdSSR an der Oper ‚Aida‘“, in : Neues Deutschland vom 23.11.1952. 273 Für die Inszenierung von Chowanstschina an der Staatsoper 1958 wurde etwa der russische Regisseur Hinko Leskowsek verpflichtet.
Die Deutsche Staatsoper als ideale sozialistische deutsche Opernbühne
109
sammenhang kaum ausmachen. Zwar erhielten die bekannten russischen Opern des 19. Jahrhunderts einen festen Platz im Repertoire der Staatsoper.274 Diese waren allerdings auch in Westdeutschland durchaus geschätzt. Selbst die WestBerliner Städtische Oper spielte in der Spielzeit 1957/58 Mussorgskis Boris Godunow.275 Gegen eine Sowjetisierung spricht schließlich vor allem, dass es während der gesamten 1950er-Jahre weder an der Staatsoper noch an der Komischen Oper – und das trotz der expliziten Aufforderung der Stakuko276 – auch nur eine einzige Inszenierung einer neueren sowjetischen Oper gab.277 Da die Staatsoper in den 1950er-Jahren deutsche bildungsbürgerliche Kulturvorstellungen weitgehend fortführen konnte, stellt sich die Frage nach der Aneignung jener Traditionen durch die deutsche Arbeiterbewegung als eine zweite wichtige Rahmenbedingung für das Konzept einer idealen Opernbühne für den sozialistischen deutschen Staat. Thomas La Presti hat überzeugend herausgearbeitet, dass die erläuterten bildungsbürgerlichen Kunstvorstellungen „den Weg in die Arbeiterbewegung angetreten haben und dort weiter tradiert worden sind“.278 Er belegte dies anhand grundlegender Ästhetikdebatten, die in der Arbeiterbewegung seit Ende des 19. Jahrhunderts geführt wurden. Eine dieser Kunstdiskussionen, die einen „Selbstverständigungs- und Selbstvergewisserungsprozess über das Verhältnis zur bürgerlichen Kunst und Kultur“279 274 Noch unter der Intendanz Ernst Legals waren dies Pique Dame von Tschaikowski und Die Zarenbraut von Rimski-Korsakow (beide 1948), Mussorgskis Boris Godunow (1949), Ruslan und Ludmilla von Glinka (1950/1951) und Eugen Onegin von Tschaikowski (1951 und 1955), unter der Intendanz Max Burghardts dann Fürst Igor von Borodin (1957), Chowanstschina von Mussorgski (1958) und noch einmal Boris Godunow (1961). 275 Zu den Gemeinsamkeiten zwischen der russischen und deutschen Musiktradition siehe auch : Janik, Recomposing, S. 88ff. 276 Die Staatliche Kommission für Kunstangelegenheiten empfahl etwa explizit die Aufführung der sowjetischen Oper Der stille Don von Iwan Dsershinski. BArch, DR 1/6112, Bl. 711. 277 Als Beispiel einer neueren Nationaloper aus dem Ostblock gelangte lediglich Krútňawa (UA 1949) von Eugen Suchoň im Jahr 1958 auf die Bühne der Staatsoper. 278 La Presti, „Kontinuitäten”, S. 31. 279 Ebd., S. 37. Zur Schiller-Debatte siehe auch : Gisela Jonas (Hg.), Schiller-Debatte 1905. Dokumente zur Literaturtheorie und Literaturkritik der revolutionären deutschen Sozialdemokratie, [Ost-]Berlin 1988. – Schon in Friedrich Engels Abhandlung Zur Wohnungsfrage war nachzulesen, dass die Arbeiterbewegung die Verpflichtung besitze, „dasjenige, was aus der geschichtlich überkommenen Bildung – Wissenschaft, Kunst, Umgangsformen usw. – wirklich wert ist, erhalten zu werden, nicht nur erhalten, sondern aus einem Monopol der herrschenden Klasse
110
Kulturpolitische Konzepte
bedeutete, brachte etwa der 100. Todestag von Friedrich Schiller im Jahr 1905. Gemeinsam war allen Beiträgen jener Schiller-Debatte, ob sie von Clara Zetkin oder Franz Mehring, Karl Kautsky oder Kurt Eisner stammten, der Anspruch, dass anstelle des nicht mehr progressiv eingestellten Bürgertums nunmehr die Arbeiterbewegung Anspruch auf das Erbe Schillers erheben dürfe. Unabhängig von der Interpretation des Weimarer Dichters im Einzelnen wurde dabei jeweils bildungsbürgerlich argumentiert. Man rühmte – dies bisweilen schon in Abgrenzung vom Naturalismus eines Gerhart Hauptmann und damit von einem der Väter der kulturellen Moderne – Schillers emphatischen Kunstbegriff und die ästhetische Schönheit seiner Werke. Clara Zetkin, welche die „geistige[n] und sittliche[n] Kräfte“ der Weimarer Klassik beschwor, meinte : „Die geschichtliche Entwicklung hat das deutsche Proletariat […] zum Erben […] der hehren weltbürgerlichen Ideale der klassischen Literatur gemacht.“280 Doch nicht nur die bildende Funktion der Kunst und die ästhetische Dimension der Schönheit spielten in der Aneignung der bürgerlichen Kultur durch die Arbeiterbewegung eine Rolle. Auch die ursprungsmythologische Argumentationsfigur wurde aufgegriffen. Das macht die berühmte Ansprache des Sozialdemokraten und späteren Reichspräsidenten Friedrich Ebert anlässlich der Eröffnung der verfassunggebenden Nationalversammlung am 6. Februar 1919 in Weimar deutlich. Darin forderte der Politiker, um eine Lösung der gesellschaftlichen Probleme herbeizuführen, zur Besinnung auf den „Geist von Weimar, den Geist der großen Philosophen und Dichter“ auf. Georg Bollenbeck formulierte in diesem Zusammenhang, „mit der Absage an den zusammengebrochenen Machtstaat“ sei die „Reaktivierung älterer liberaler wie bildungsbürgerlicher Traditionen einher[gegangen]“.281 Hinter Eberts Beschwörung der Weimarer Klassik habe wesentlich die Vorstellung von der integrativen Funktion der Nationalkultur gestanden. Die Bezugnahme auf das nationalkulturelle Erbe findet sich während der Zeit des Nationalsozialismus auch bei den deutschen Exilanten in der Sowjetunion wieder. Beim schon erwähnten 1. Allunionskongress der Sowjetschriftsteller, in in ein Gemeingut der ganzen Gesellschaft verwandelt und weiter fortgebildet werde“. Zitiert nach : Ehrlich/Mai, Ulbricht, S.8f. 280 Zitiert nach : La Presti, „Kontinuitäten“, S. 40. 281 Bollenbeck, Tradition, S. 196.
Die Deutsche Staatsoper als ideale sozialistische deutsche Opernbühne
111
dessen Statut sich die Definition des Sozialistischen Realismus fand, formulierte Johannes R. Becher in einer Rede, es sei künftig „die Sache der klassischen deutschen Kultur […], das edle Erbe der Jahrhunderte endgültig denen [zu] übergeben, die die Zukunft in ihren Händen tragen, den deutschen Arbeitern“.282 Angesichts der radikalen Ablehnung des nationalsozialistischen deutschen Staates war dem nationalkulturellen Erbe aus Sicht der Exilanten für die Zukunft die Funktion zugedacht, die moralische Grundlage eines besseren Deutschland zu bilden. In der Gegenwart, so La Presti, habe die „bildungsbürgerliche Kunstsemantik den deutschen Exilliteraten die Möglichkeit gegeben, die nationale Identität über ‚Kultur‘ herzustellen“, wovon „ähnlich wie zu Zeiten, als es noch keinen einheitlichen deutschen Staat gab, Gebrauch gemacht“283 worden sei, so La Presti. Erhebliche Bedeutung bei der Vermittlung der bürgerlichen Kultur an die Arbeiterbewegung kam dem marxistischen Literaturwissenschaftler Georg Lukács zu. Mit seinen seit Mitte der 1930er-Jahre entstandenen Schriften trug der meist deutsch schreibende Ungar wesentlich zur Legitimation der deutschen Klassik und des deutschen Realismus des 19. und frühen 20. Jahrhunderts als gesellschaftlich fortschrittliche Kunst bei. In jenen Werken sah er die objektiven gesellschaftlichen Entwicklungstendenzen gespiegelt, denen er in einem geschichtsphilosophischen Sinne einen zunehmenden Fortschritt unterstellte. Dem positiven ‚realistischen‘ Erbe, das aufgrund seiner Eigenschaften eine Funktion im Kampf gegen den Faschismus übernehmen konnte, stellte Lukács die kulturelle Moderne als negativ gegenüber, bedeutete sie für ihn doch nur eine Zerstörung des gewünschten Realismus. Auch warf ihr der Literaturwissenschaftler vor, wegen ihrer bisweilen erheblichen Komplexität den Kontakt zum Volk und damit die Möglichkeit, politisch zu wirken, zugunsten der Isolation eingebüßt zu haben. Lukács’ Position, der sich etwa auch Johannes R. Becher anschloss, war unter den deutschen Exilanten in der UdSSR außerordentlich einflussreich.284 Den282 Hans-Jürgen Schmitt und Godehard Schramm (Hg.), Sozialistische Realismuskonzeptionen. Dokumente zum I. Allunionskongreß der Sowjetschriftsteller, Frankfurt/M. 1976, S. 256. 283 La Presti, „Kontinuitäten”, S. 47. 284 Siehe dazu : Caroline Gallée, Georg Lukács. Seine Stellung und Bedeutung im literarischen Leben der SBZ/DDR 1945–1985, Tübingen 1996.
112
Kulturpolitische Konzepte
noch gab es auch abweichende Meinungen. In der Expressionismus-Debatte von 1937, die durch Alfred Kurellas These ausgelöst wurde, die konsequente Befolgung des Geistes, aus dem die künstlerische Stilrichtung des Expressionismus entstanden sei, führe in den Faschismus, sprachen sich der Komponist Hanns Eisler und der Philosoph Ernst Bloch gegen eine undifferenzierte Ablehnung der gesamten kulturellen Moderne aus. Noch in Moskau trafen sich am 25. September 1944 in Wilhelm Piecks Zimmer im Hotel Lux deutsche Künstler, darunter auch Johannes R. Becher, um über einen kulturellen Wiederaufbau nach dem Ende des Nationalsozialismus zu beraten. Die Zusammenkunft war deswegen von Bedeutung, weil hierbei Maxim Vallentin ein Referat über die Rolle des Theaters im zukünftigen Deutschland hielt, das Petra Stuber als „grundlegend für das Theater in der sowjetisch besetzten Zone und der späteren DDR“285 bezeichnet hat. Auch bei Vallentin ist von der Notwendigkeit einer Verbindung zwischen Künstler und Volk die Rede und von der bildenden Funktion der Kunst : „Der Kommunist – der beste Verfechter der nationalen Interessen seines Volkes. Das heißt angewandt auf die Kunst : Kunst ist Volksgut ! und der beste Sammler, Hüter, Verteidiger und Mehrer des Volksgutes, Kunst, ist der Kommunist, der sich auch so dem Volk verbindet und das Volk dem Kommunismus. Die Anwendung dieser Einstellung auf das Theater würde bedeuten : Kampf für das Deutsche National-Theater !“ Als Ziel nannte Vallentin, „die besten Geisteswerte zu mobilisieren zur Umbildung der deutschen Volksseele“.286 Mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges war dann die Stunde für die Weimarer Klassik gekommen. Sie konnte als eine der wenigen weitgehend nicht belasteten kulturellen Traditionen in Deutschland als Ansatzpunkt für einen Neubeginn, als Symbol der weiterhin existierenden gesamtdeutschen Kulturnation und als ein Garant humanistischer Kontinuität über die Jahre der nationalsozialistischen Barbarei hinaus gelten.287 Zur Durchsetzung einer moralischen Erneuerung und als Garant nationaler Einheit fühlte sich der „Kulturbund zur demokratischen Erneuerung Deutschlands“, der 1945 zunächst in der SBZ lizenziert worden war, mit seinem zur intellektuellen Schlüsselfigur jener Jahre avancierenden Präsidenten Johannes 285 Stuber, Spielräume, S. 12. 286 Zitiert nach : ebd., S. 13. 287 Ehrlich/Mai, Ulbricht, S. 16.
Die Deutsche Staatsoper als ideale sozialistische deutsche Opernbühne
113
R. Becher berufen.288 Wenn der Kulturbund auch langfristig das Ziel verfolgte, das marxistisch-leninistische Kulturverständnis im Sinne der aus dem Moskauer Exil nach Deutschland zurückgekehrten „Gruppe Ulbricht“289 durchzusetzen, definierte sich die Vereinigung zunächst jedoch bewusst als überparteilich, ging es doch in der SBZ in jenen ersten Jahren darum, auch bürgerliche Intellektuelle für das breite Bündnis einer „Volksfront“ zu gewinnen.290 Dabei zeigten sich die sowjetischen Kulturfunktionäre als außerordentlich freigiebige Förderer der deutschen Kultur. In den ersten Jahren nach 1945 waren sie darüber hinaus liberal eingestellt sowie der Moderne gegenüber aufgeschlossen. Das beruhte, darauf hat Wolfgang Schivelbusch hingewiesen, nicht so sehr auf politischer Berechnung, sondern entsprach den ureigenen Überzeugungen jener Kulturoffiziere. Bei diesen handelte es sich um die „Kinder der alten Bildungs- und Großbourgeoisie“.291 Der typische sowjetische Kulturoffizier war demnach zwischen 1900 und 1910 in Petersburg geboren, hatte zunächst die deutsche Reformschule, eine traditionelle Eliteschule des Petersburger Bildungsbürgertums, besucht und dann an einer der von dem liberalen Volkskommissar Anatoli Lunatscharski geförderten Bildungsinstitutionen studiert. Als für diese Angehörigen der Intelligenz Ende der 1920er-Jahre der Eintritt ins Kulturleben anstand, machte die Kulturrevolution durch alles einen Strich. Mit dem Wiederaufbau des deutschen Kulturlebens begannen die Sowjets unmittelbar nach dem Ende der Kampfhandlungen. Nun konnten die sowjetischen Kulturoffiziere ihre alten kulturellen Ideale ungehindert umsetzen.292 288 Jens-Fietje Dwars, Abgrund des Widerspruchs. Das Leben des Johannes R. Becher, Berlin 1998, S. 500ff. 289 Im Juni 1945 äußerte Walter Ulbricht über die Erziehung der Jugend, zunächst müssten ihnen die Augen für die Rolle des Militarismus und die Lügen der Nationalsozialisten geöffnet werden. „Dann muß man anfangen, sie mit deutscher Literatur, mit Heine, Goethe, Schiller usw. vertraut zu machen. Nicht mit Marx und Engels anfangen ! Das werden sie nicht verstehen.“ Zitiert nach : Wolfram Schlenker, Das „Kulturelle Erbe“ in der DDR. Gesellschaftliche Entwicklung und Kulturpolitik 1945–1965, Stuttgart 1977, S. 67. 290 Siehe dazu : Jens Wehner, Kulturpolitik und Volksfront. Ein Beitrag zur Geschichte der Sowjetischen Besatzungszone Deutschlands 1945–1949. 2 Bde., Frankfurt/M. 1992 ; Magdalena Heider, Politik – Kultur – Kulturbund. Zur Gründungs- und Frühgeschichte des Kulturbundes zur demokratischen Erneuerung Deutschlands 1945–1954 in der SBZ/DDR, Köln 1993. 291 Schivelbusch, Vorhang, S. 59. 292 Zum kulturpolitischen Einfluss der sowjetischen Besatzungsmacht im Nachkriegsdeutsch-
114
Kulturpolitische Konzepte
In Berlin berief der sowjetische Stadtkommandant Nikolai Bersarin bereits sechs Tage nach Unterzeichnung der deutschen Kapitulation deutsche Künstler zu einer ersten Besprechung. Am 24. Juni ernannte dann die neu gegründete sogenannte Kammer der Kunstschaffenden Ernst Legal, der als politisch unbelastet galt, zum Intendanten der Staatsoper.293 Von 1928 bis 1930 hatte er die der Moderne verpflichtete Berliner Kroll-Oper geleitet ; die Jahre des Nationalsozialismus verbrachte er als Schauspieler und Regisseur in Deutschland ; zwischen 1938 und 1944 gehörte er zum Ensemble des Schiller-Theaters in Berlin. Seine Berufung an die Spitze der Staatsoper bedeutete ein Anknüpfen an die kulturelle Moderne der 1920er-Jahre. Legal versammelte die verbliebenen Ensemblemitglieder der Staatsoper im Admiralspalast. Bereits am 23. August 1945 konnte das Interimstheater, das den Krieg nur wenig beschädigt überstanden hatte, mit einem Festkonzert eröffnet werden. Nur zwei Wochen später, am 11. September, ging mit Glucks Orpheus und Eurydike die erste Opernpremiere über die Bühne. Auch dieses Werk war Ausdruck des Neuanfangs im Zeichen der Klassik. Ernst Legal versprach sich, wie er in der Täglichen Rundschau, dem Presseorgan der sowjetischen Militäradministration, unter der Überschrift Die deutsche Oper vor neuen Zielen erläuterte, von dieser Reformoper Glucks, eines der „maßgebende[n] Begründer der Opernkunst“, nach der Zeit des Nationalsozialismus eine moralische Erneuerung. So wie dieser im 18. Jahrhundert in seiner Kunst auf „Unwesentliches“, „Schnörkelhaftes“ und „snobistische Züge“ verzichtet habe, sollten nach dem Ende der nationalsozialistischen Diktatur in der Staatsoper wieder „lautere Menschlichkeit“ und „geistige Disziplin“294 Einzug halten. Die Erneuerung der Oper im Geiste der Klassik hatte sich für Legal nicht etwa gegen die kulturelle Moderne zu vollziehen. Klassik und Moderne standen für ihn in einer gemeinsamen Linie, richteten sich doch beide Epochen gegen ein Verständnis der Kunstform als der Unterhaltung dienende „Prunkoland : Anne Hartmann und Wolfram Eggeling, Sowjetische Präsenz im kulturellen Leben der SBZ und frühen DDR 1945–1953, Berlin 1998 ; David Pike, The Politics of Culture in SovietOccupied Germany, 1945–1949, Stanford 1992 ; Gerd Dietrich, Politik und Kultur in der Sowjetischen Besatzungszone Deutschlands (SBZ) 1945–1949, Frankfurt/M. 1993, Norman M. Naimark, Die Russen in Deutschland. Die sowjetische Besatzungszone 1945 bis 1949, Berlin 1997, S. 501ff. 293 Siehe dazu : Anft, Legal, S. 305. 294 Ernst Legal, „Die deutsche Oper vor neuen Zielen“, in : Tägliche Rundschau vom 24.08.1945.
Die Deutsche Staatsoper als ideale sozialistische deutsche Opernbühne
115
per“. Es stand für ihn außer Frage, dass in der zukünftigen Staatsoper, wie schon in der Kroll-Oper der Weimarer Republik, die Werke der im Nationalsozialismus verfemten Komponisten Strawinsky, Hindemith und auch Schönberg im Spielplan vertreten sein mussten. Hindemith und Schönberg waren für ihn ein selbstverständlicher Teil der deutschen Nationalkultur. Dementsprechend umfasste sein Spielplan über die etablierten deutschen und internationalen Werke des 18. und 19. Jahrhunderts hinaus auch das zeitgenössische Schaffen. Am 22. Mai 1948 etwa brachte er Hindemiths Mathis der Maler als Berliner Erstaufführung heraus und damit jenes Werk, dessen Uraufführung an der Berliner Staatsoper 1934 von den Nationalsozialsozialisten verhindert worden war. Am 17. März 1951 erklang in der Staatsoper dann die Uraufführung von Dessaus und Brechts Das Verhör des Lukullus. Noch im Sommer 1952, als die kulturelle Moderne in der DDR bereits wieder kulturpolitisch ausgegrenzt wurde, konnte Legal im Ost-Berliner Nachtexpress stolz feststellen : „Unser Repertoire gibt heute einen Querschnitt durch die Geschichte der Weltoper von Gluck bis Dessau.“295 Als dritte wichtige Bedingung für das Grundsatzprogramm von 1952 muss die Deutschlandpolitik der DDR angesehen werden. Der sozialistische deutsche Staat interpretierte den strikten Westbindungskurs der Bundesregierung unter Konrad Adenauer, von diesem selbst nur als kurzfristiges Aufschieben einer deutschen Wiedervereinigung unter westlichen Vorzeichen verstanden, als Beleg dafür, dass Bonn in Wirklichkeit an der deutschen Einheit nicht interessiert sei. Auf die zunehmende westdeutsche Integration ins westliche Bündnissystem mit Montanunion, Europäischer Verteidigungsgemeinschaft (EVG) und schließlich mit den Pariser Verträgen von 1954 reagierte die DDR mit der Propagierung der Wiederherstellung eines deutschen Nationalstaates, auch wenn sie selbst faktisch die politische Spaltung vorantrieb. Zu nennen ist etwa die Initiative „Deutsche an einen Tisch“ von Regierung und Volkskammer 1951 oder der vom ostdeutschen Staat unterstützte Vereinigungsvorschlag der Sowjetunion („Stalin-Note“) aus dem Jahr 1952. Dem nationalkulturellen Erbe kam dabei, ausgehend von der ursprungsmythologischen Argumentationsfigur, die Aufgabe zu, integrativ für eine deutsche 295 Zitiert nach : Anft, Legal, S. 377.
116
Kulturpolitische Konzepte
Einheit zu wirken. Für einen wiedervereinigten sozialistischen deutschen Nationalstaat sollten im Westen zunächst bürgerliche Intellektuelle gewonnen werden, die als fortschrittlich im Sinne des Sozialismus angesehen wurden. Dabei setzte man wesentlich auch auf den in der deutschen Bildungselite verbreiteten Antiamerikanismus.296 Auf dem III. Parteitag der SED im Juli 1950 etwa hieß es, die westdeutschen Intellektuellen sollten durch ein Bekenntnis zur DDR „zeigen, daß sie nicht gewillt sind, die kulturelle Einheit Deutschlands zu zerreißen und das große deutsche Kulturerbe vernichten zu lassen“.297 Allerdings drohte ein gesellschaftlicher Elitentausch, den ein rascher Aufbau des Sozialismus mit sich bringen musste, auf die bürgerlichen westdeutschen Intellektuellen abschreckend zu wirken, was wiederum einer Wiedervereinigung unter sozialistischen Vorzeichen zuwiderlaufen würde. Der Historiker Gunther Mai hat die Schwankungen, die sich aus jenem „Zielkonflikt zwischen Eigenstaatlichkeit und nationaler Einheit“298 für die Kulturpolitik der DDR ergaben, anschaulich nachgezeichnet. Demnach folgten auf Phasen mit verstärkten Bündnisangeboten an bürgerliche Kreise, die verbunden waren mit einer relativen Liberalisierung und einer gesamtdeutschen Ausrichtung der Kulturpolitik, Phasen der Abschottung gegenüber dem Westen und einer rigorosen Unterwerfung der ostdeutschen Intellektuellen unter die kulturpolitische Linie der Partei. Nur auf diese Weise, argumentierte man dann, sei der Sozialismus zu verwirklichen, und es wurde eine mögliche Wiedervereinigung in diesem Zusammenhang zumindest für eine gewisse Zeit für aufgeschoben erklärt.299 Wenn die Kulturpolitik der DDR im Zusammenhang mit der Staatsoper auch die kulturelle Moderne als westlich dekadent ausgrenzte, hielt sie sich mit Affek296 Gunther Mai, „Staatsgründungsprozeß und nationale Frage als konstitutive Elemente der Kulturpolitik der SED“, in : Ehrlich/Mai, Ulbricht, S. 33–60, hier. S. 37f. 297 Zitiert nach : ebd., S. 40. 298 Ebd., S. 34. Grundlegend zur Deutschlandpolitik der SED : Michael Lemke, Einheit oder Sozialismus ? Die Deutschlandpolitik der SED 1949–1961, Köln 2001. 299 Erschwert wurde die Situation für die SED durch die wiederholten deutschlandpolitischen Kurswechsel der Sowjetunion. Als die DDR beispielsweise fürchten musste, dass sich die UdSSR mit der „Stalin-Note“ über den ostdeutschen Staat hinweg mit der Bundesrepublik arrangierte, setzte Ulbricht schon aus Gründen der Konsolidierung der eigenen Macht entgegen der Einheitspropaganda faktisch auf die Zementierung der Eigenstaatlichkeit. Siehe dazu : Mai, „Staatsgründungsprozeß“, S. 42.
Die Deutsche Staatsoper als ideale sozialistische deutsche Opernbühne
117
ten gegen das ‚bürgerliche‘ Publikum im Westen in den 1950er-Jahren weitgehend zurück. So bildete ein Werbeplakat die Ausnahme, mit dem 1953 für das Wiederaufbauprojekt Lindenoper geworben werden sollte und auf dem – die alte Kritik an einem lediglich der Unterhaltung dienenden Theater nunmehr harsch gegen den Westen wendend – zu lesen war, die Staatsoper werde in Zukunft „nicht mehr dem Amüsement reicher Nichtstuer, sondern der Erholung und Erbauung der Werktätigen“300 dienen. Kulturpolitisch stand bis Ende der 1950erJahre die national integrative Funktion der Staatsoper klar im Vordergrund. Wenn das Neue Deutschland der Staatsoper im Dezember 1952 die Rolle der führenden Opernbühne zuwies, hing das als vierte Bedingung auch mit der besonderen politischen Bedeutung Ost-Berlins als Hauptstadt der DDR und der Konkurrenzlage zu West-Berlin zusammen.301 Dementsprechend war OstBerlin nicht nur Sitz der meisten DDR-Ministerien und wichtigsten Verwaltungsstellen von Staat und Partei. Die Teilstadt wurde auch zu einem kulturellen ‚Schaufenster‘ des ostdeutschen Staates ausgebaut. Dabei kam der Architektur eine herausgehobene Bedeutung zu, ließen sich doch dadurch die Leistungen des Staates eindrucksvoll veranschaulichen. Wichtig war in diesem Zusammenhang vor allem die schon genannte Stalinallee, der monumentale sozialistische Boulevard zwischen Strausberger Platz und Frankfurter Tor, bei dem die Doktrin des Sozialistischen Realismus in Ost-Berlin erstmals auf die Architektur übertragen wurde. Mit dem Bauensemble war die Absicht verbunden, einen eindrucksvollen Gegensatz zu dem am Bauhaus der 1920er-Jahre orientierten Funktionalismus der gleichzeitig in West-Berlin entstandenen Architektur zu schaffen. Von Bedeutung war aber auch der Wiederaufbau historisch bedeutender Gebäude, wobei dem von Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff Unter den Linden errichteten Opernhaus, wie schon erläutert, ein besonderer Stellenwert eingeräumt wurde. Der architektonische Glanz Ost-Berlins beschränkte sich allerdings weitgehend auf die Hauptstraßen. Abseits von ihnen stieß man auf 300 Zitiert nach : Theater in Berlin nach 1945 – Musiktheater, S. 11. 301 Bernd Wilczek (Hg.), Berlin. Hauptstadt der DDR 1949–1989. Utopie und Realität, BadenBaden 1989 ; Jürgen Rostock, „Ost-Berlin als Hauptstadt der DDR“, in : Werner Süß und Ralf Rytlewski (Hg.), Berlin. Die Hauptstadt. Vergangenheit und Zukunft einer europäischen Metropole, Bonn 1999 ; Manfred Rexin, „Ost-Berlin als DDR-Hauptstadt“, in : Deutschland Archiv 21 (1989), S. 644–655.
118
Kulturpolitische Konzepte
verfallende Bausubstanz und zunehmend verwahrlosende Straßen und Plätze. Über die Architektur hinaus bildeten die Museen auf der Museumsinsel im historischen Zentrum einen wichtigen Magneten. Schließlich sollten auch die OstBerliner Theater vorbildliche Leistungen vollbringen. Im Bereich des Sprechtheaters übte insbesondere das Berliner Ensemble im Theater am Schiffbauerdamm, an dem Bertolt Brechts Werke in einer vom Dichter autorisierten Form gegeben wurden, eine besondere Anziehung auf West- wie Ostdeutsche aus. Von den beiden Musiktheaterbühnen entwickelte sich im Laufe der 1950er-Jahre letztlich entgegen dem geschilderten kulturpolitischen Anspruch – auch aufgrund des großen Zulaufs westlichen Publikums – nicht die Staatsoper, sondern die Komische Oper zur führenden Opernbühne der DDR.
2. Die kulturelle Gegenoffensive West-Berlins : Von der Städtischen Oper zur Deutschen Oper Berlin a) Politische Rahmenbedingungen
Beim West-Berliner Senat verfolgte man den fortschreitenden Wiederaufbau der Lindenoper in der ersten Hälfte der 1950er-Jahre nicht ohne Sorge, da man fürchtete, dass von dieser Bühne eine erhebliche Anziehungskraft auf die Bevölkerung der eigenen Teilstadt ausgehen könnte. Aus diesem Grund erhielt die Frage eines Neubaus einer Oper anstelle des im Krieg zerstörten Charlottenburger Opernhauses ab 1955 eine erhöhte Priorität. Beim Senat hieß es : „Inzwischen ist der beschleunigte Wiederaufbau des Hauses in der Bismarckstraße auch zu einer politischen Frage geworden, weil das im Sowjetsektor gelegene Gebäude der alten Preußischen Staatsoper unter Verwendung sehr bedeutender materieller Mittel wieder hergerichtet worden ist und am 3. [sic] September 1955 in repräsentativer Form eröffnet werden soll. Mit der pomphaften Wiedereröffnung der Staatsoper soll ein besonders starker Trumpf der sowjetzonalen Kulturpolitik ausgespielt werden ; insbesondere soll die Staatsoper auch ein Anziehungspunkt für die Westberliner Bevölkerung werden, der ein im äußeren Aufwand auch nur annähernd gleichwertiges Opernhaus nicht zur Verfügung steht.“ Der Charlottenburger Opernneubau sollte, genau wie die Staatsoper aus Sicht der DDR, Deutschland kulturell im Ganzen vertreten, weswegen sogar
Die kulturelle Gegenoffensive West-Berlins : Von der Städtischen Oper zur Deutschen Oper Berlin
119
emphatisch von einem ‚Nationaltheater‘ die Rede war : „Es erscheint dringend geboten, den Wiederaufbau eines repräsentativen Operngebäudes in WestBerlin beschleunigt durchzuführen, das im Sinne der Regierungserklärung des regierenden Bürgermeisters den Charakter und die Bedeutung eines deutschen Nationaltheaters aufweist und als solches auch die kunstliebende Bevölkerung des Sowjetsektors und der Sowjetzone anzuziehen vermag.“302 Das Charlottenburger Opernbauprojekt war Ausdruck einer groß angelegten Offensive des West-Berliner Senats gegen das konkurrierende Ost-Berlin, die letztlich darauf zielte, die Stadt wieder zur Hauptstadt eines unter dem Vorzeichen des westlichen Teilstaates wiedervereinigten Deutschland zu machen. Von diesem Ziel aber war West-Berlin zu Beginn der 1950er-Jahre weit entfernt. Nicht nur lag die aufgrund ihrer Insellage finanzschwache westliche Teilstadt beim Wiederaufbau weit hinter den anderen großen westdeutschen Städten zurück, sondern sie war noch nicht einmal politisch als gleichberechtigtes 12. Bundesland in den westdeutschen Staat inkorporiert worden, wenn auch bis 1955 eine enge wirtschaftliche, rechtliche und politische Angliederung an die BRD erfolgte.303 Die volle politische Eingliederung in den westdeutschen Staat war an alliierten Vorbehalten gescheitert wie auch an der Regierung Adenauer, die wenig Interesse an der alten Reichshauptstadt zeigte, der gegenüber ein nicht unerhebliches Maß an Misstrauen wegen ihrer preußischen Tradition bestand. In dieser Situation konnte es aus West-Berliner Sicht schon als Erfolg gelten, dass auf eigenes Drängen in die Erklärung der Bundesregierung vom 5. Mai 1955 über die Hilfeleistungen für die Stadt die Worte „als der vorgesehenen Hauptstadt eines freien, wiedervereinigten Deutschlands“304 eingefügt wurden. Um dieses Ziel zu erreichen, sah es der Regierende Bürgermeister Otto Suhr (SPD) als wichtigste Aufgabe an, die westliche Teilstadt vor allem kulturell attraktiv zu machen. In seiner Regierungserklärung vom 3. Februar formulierte er, Berlin müsse sich, „schon heute als das geistige, künstlerische und wissenschaftliche, kulturelle Zentrum Deutschlands beweisen“. Zum einen dürfe es sich 302 Senatsbeschluss Nr. 774/55 vom 11. Juli 1955. LAB, B. Rep. 014, Nr. 2468. 303 Siehe dazu : Wolfgang Ribbe, Berlin 1945–2000. Grundzüge der Stadtgeschichte, Berlin 2002, S. 84ff. 304 Zitiert nach : Georg Kotowski und Hans J. Reichhardt, Berlin als Hauptstadt im Nachkriegsdeutschland und Land Berlin 1945–1985, Berlin/New York 1987, S. 109.
120
Kulturpolitische Konzepte
„von den Städten des Westens nicht den Rang ablaufen lassen“, zum anderen aber müsse „der in der letzten Zeit deutlich erkennbaren Kulturoffensive des Ostens“ begegnet werden. Wichtig war dem Regierenden Bürgermeister dabei insbesondere, dass die westliche Teilstadt international attraktiv werden würde : „Gerade im Zusammenhang mit der außenpolitischen Entwicklung wird es notwendig sein, Berlin als Kulturzentrum so hochqualifiziert zu entwickeln, daß es seine Anziehungskraft auf die Gäste des Westens und die freiheitlich gesonnenen Menschen im Osten ausübt.“305 So forderte Suhr – außer einem großen Investitions-, Verkehrs- und Wohnungsbauprogramm – den Ausbau der Freien Universität, den Bau einer neuen Philharmonie, die Wiederherstellung des Schlosses Charlottenburg sowie der Deutschlandhalle. Ein wichtiger Bestandteil der kulturellen Offensive war für Suhr darüber hinaus der Neubau eines repräsentativen Opernhauses. „Wenn heute mit den Mitteln der sogenannten DDR die Oper Unter den Linden wiederaufgebaut wird, ist zu erwägen, ob es nicht eine gesamtdeutsche Verpflichtung ist, die Charlottenburger Oper als ein deutsches Nationaltheater wieder zu errichten. In den zuständigen Senatsverwaltungen sind bereits Vorbereitungen getroffen, um dafür die Finanzierung durch westdeutsche Quellen zu erschließen, damit über dem Theaterbau die sozial dringendere Pflicht der Wiedererrichtung von Schulen und Wohnhäusern nicht hintan gesetzt wird.“306 Dass die Bundesregierung die kulturelle Offensive schließlich durch die Finanzierung des „Langfristigen Aufbauplans für Berlin“ unterstützte und damit auch die Kosten für den Bau der Oper übernahm, führte paradoxerweise vom eigentlichen Ziel des West-Berliner Senats weg. Die Bundesregierung nämlich erwarb dafür im Gegenzug von der westlichen Teilstadt die Unterstützung ihrer außenpolitischen Linie, die im Mai 1955 in die Pariser Verträge mündete und dem westdeutschen Teilstaat die weitgehende Souveränität brachte. Dies allerdings bedeutete faktisch eine Zementierung der deutschen Teilung und damit gerade die Verhinderung von Berlin als Hauptstadt eines vereinigten Deutschland.307 305 Otto Suhr, „Wirtschaftlicher Aufschwung, soziale Sicherheit, geistige Ausstrahlungskraft (Richtlinien der Regierungspolitik)“, in : Otto Suhr, Eine Auswahl aus Reden und Schriften, Tübingen 1967, S. 385–399, hier S. 393. 306 Ebd. 307 Siehe dazu : Kotowski/Reichhardt, Berlin, S. 108.
Die kulturelle Gegenoffensive West-Berlins : Von der Städtischen Oper zur Deutschen Oper Berlin
121
Am 20.12.1960 entschloss sich der Senat, das West-Berliner Opernhaus mit der Eröffnung des Neubaus 1961 von Städtische Oper in Deutsche Oper Berlin umzubenennen. Begründet wurde dies damit, dass der Opernbühne die Aufgabe zugedacht sei, „nicht nur die Tradition einer kommunalen Opernbühne“ fortzusetzen, „sondern darüber hinaus […] die Funktionen einer repräsentativen Staatsbühne, die den Charakter eines deutschen Nationaltheaters trägt“308, zu erfüllen. Nicht zu dem Namen Deutsches Opernhaus zurückzukehren, den die Bühne von 1912 bis 1925 und – nach einer Zeit als Städtische Oper – während der Zeit des Nationalsozialismus getragen hatte, begründete Volksbildungssenator Joachim Tiburtius damit, dass mit jenem Namen „wenig angenehme Erinnerungen verknüpft“ seien. „Das Deutsche Opernhaus stand während des nationalsozialistischen Regimes unter der Rechtsträgerschaft des damaligen Reichsministeriums für Volksaufklärung und Propaganda und erreichte unter dem damaligen Intendanten einen künstlerischen Tiefstand, der es nahe legt, dem neuen Hause eine andere Bezeichnung zu geben.“309 Was Suhrs Plan eines Kulturzentrums West-Berlin als Wegbereiter einer deutschen politischen Hauptstadt von 1955 anbelangt, ist wichtig, dass der Regierende Bürgermeister dabei an keiner Stelle ursprungsmythologisch argumentierte, wie es in der DDR üblich war. Die Kunst hatte für ihn lediglich die Funktion, Menschen aus Ost- und Westdeutschland anzuziehen und die westliche Teilstadt damit in Konkurrenz zum ostdeutschen Staat und insbesondere zu Ost-Berlin attraktiv zu machen. Überhaupt äußerte sich Suhr an keiner Stelle inhaltlich konkret zu dem Charakter der beschworenen zukünftigen Nationaloper, wie die DDR das im Zusammenhang mit der Staatsoper tat. Dies entsprach der im Grundgesetz garantierten Freiheit der Kunst. Möglicherweise hat der Terminus ‚Nationaltheater‘ für den Regierenden Bürgermeister auch nicht mehr als eine Werbefunktion impliziert, um durch Bonn die Finanzierung des Bauprojektes zu erwirken, das Berlin aus eigener Kraft nicht realisieren konnte. Das bedeutet jedoch nicht, dass die für die Geschicke der Bühne verantwortlichen Künstler, die Intendanten der Jahre 1948 bis 1961 Heinz Tietjen und Carl Ebert, nicht jeweils konkrete inhaltliche Vorstellungen von einer idealen nationalen Opernbühne hatten. 308 Senatsbeschluss 2196/60 vom 20.12.1960. LAB, B Rep. Nr. 014, Nr. 2186. 309 Ebd.
122
Kulturpolitische Konzepte
b) Vorstellungen der Intendanten von einer idealen deutschen Opernbühne
Heinz Tietjen stand bei seinem Amtsantritt an der Städtischen Oper 1948 die große Bedeutung des West-Berliner Opernhauses angesichts der beginnenden Teilung der Stadt klar vor Augen. Im Dezember 1948 schrieb er an seinen Freund, den Bühnenbildner Emil Preetorius : „Wir stehen in Berlin im Brennpunkt des Weltgeschehens, und was in der Kunst hier Positives geschieht, öffnet die Tore in das Ausland ; das merke ich jetzt schon an den Angeboten, die ich bekomme.“310 Allerdings ist es schwierig, die Vorstellungen Tietjens von einer idealen deutschen Opernbühne zu rekonstruieren. Der Künstler, welcher der Städtischen Oper bis 1954 vorstand, war als Intendant Zeit seines Lebens nämlich außerordentlich öffentlichkeitsscheu. Die Fähigkeit, gleichzeitig „allgegenwärtig und doch unsichtbar“311 zu sein, hatte ihm früh das Bonmot eingebracht : „Hat Tietjen wirklich gelebt ?“312 Dementsprechend rar sind grundlegende programmatische Äußerungen Tietjens über das Theater. Stationen von Tietjens rasantem künstlerischem Aufstieg bildeten die Ernennung zum Leiter der Berliner Städtischen Oper 1925, zwei Jahre später die Übernahme der Generalintendanz aller Preußischen Staatstheater sowie 1931 zusätzlich die Berufung zum künstlerischen Leiter der Bayreuther Festspiele durch Winifred Wagner. Damit war der als SPD-nah geltende Tietjen zu Beginn der 1930er-Jahre der wohl einflussreichste Theatermann Deutschlands. Nicht nur aufgrund seiner Doppelbegabung als Regisseur und Dirigent der Werke Richard Wagners und Richard Strauss’, sondern auch seines großen diplomatischen Geschicks konnte der Künstler, der aus Sicht der Nationalsozialisten eigentlich ein Exponent des verhassten Weimarer „Systems“ war, seine Machtfülle während des „Dritten Reiches“ beibehalten. Geschickt gelang es ihm, die aus dem polykratischen Charakter des NS-Regimes resultierende Rivalität zwischen
310 Brief Tietjens an Emil Preetorius vom 29.12.1948. AdK, Berlin, Tietjen-Archiv, Nr. 226. 311 Ulrich Teusch, „Gefährliches Doppelspiel. Der Theatermann Heinz Tietjen und seine Rolle in der NS-Zeit“, in : Neue Züricher Zeitung vom 02.04.2005. 312 Micaela von Marcard : „Hat Tietjen wirklich gelebt ?“, in : Vivace. Journal der Staatsoper Unter den Linden. Heft 20/21 und 22/23 (1998), S. 20–22 und 32–33.
Die kulturelle Gegenoffensive West-Berlins : Von der Städtischen Oper zur Deutschen Oper Berlin
123
Goebbels und Göring für seine Belange zu nutzen.313 Tietjen war in der Doppelfunktion als künstlerischer Leiter der Bayreuther Festspiele und Intendant der Berliner Staatsoper Unter den Linden, die er zu einer engen künstlerischen Verbindung beider Bühnen nutzte, außerordentlich erfolgreich, sodass die Wagner-Pflege an beiden Bühnen im „Dritten Reich“ zumindest musikalisch auf einem bis dahin nicht erreichten Niveau stand.314 Trotz der Schwierigkeit für die historische Forschung, Tietjens Rolle in der NS-Zeit aufgrund der genannten Charaktereigenschaft zu bestimmen, schält sich doch allmählich ein klares Bild heraus. Oliver Rathkolb hat darauf hingewiesen, dass der Intendant, wenn er sich auch nicht demonstrativ als Nationalsozialist geriert habe und überdies auch nicht Mitglied der Partei war, die Staatsoper dennoch „im Sinne der Erfolgszurechenbarkeit für das NS-Regime“315 geführt habe. Mit seinem Einsatz für eine gemäßigte kulturelle Moderne wie 1934 im Fall Hindemith habe er Liberalität demonstriert und somit für die Nationalsozialisten wertvolle Propaganda geleistet. Jüngst haben die Historiker Hannes Heer und Boris von Haken überzeugend herausgearbeitet, dass Tietjen aus persönlichem Machtstreben heraus zum politischen Opportunisten geworden sei, wobei er wissentlich auch die Vertreibung jüdischer Künstler in Kauf genommen habe.316 Das Ende des NS-Regimes schien Tietjens Karriere zunächst keinen Abbruch zu tun. Vom ersten sowjetischen Stadtkommandanten Nikolai Bersarin war er kurz nach Ende des Krieges zum Intendanten aller Berliner Operntheater berufen worden. Doch musste er, als Nationalsozialist denunziert, das Amt noch im Juni 1945 wieder niederlegen, womit seine Intendantenkarriere ein vorläufiges Ende fand.317 In den Verhandlungen vor der deutschen Entnazifizierungskommission wirkten sich für ihn vor allem seine Ernennung zum Preußischen Staatsrat und ein Betriebsappell vom 30. Januar 1936 anlässlich des dritten Jahrestages der 313 Ulrich Teusch, „Gefährliches Doppelspiel. Der Theatermann Heinz Tietjen und seine Rolle in der NS-Zeit“, in : Neue Züricher Zeitung vom 02.04.2005. 314 Jens Malte Fischer, „Wagner-Interpretation im Dritten Reich. Musik und Szene zwischen Politisierung und Kunstanspruch“, in : Saul Friedländer und Jörg Rüsen (Hg.), Richard Wagner im Dritten Reich. Ein Schloss Elmau-Symposion, München 2000, S. 142–164, S. 154. 315 Rathkolb, Führertreu, S. 89. 316 Heer/von Haken : „Überläufer“. 317 Siehe dazu : Janik, Recomposing, S. 102.
124
Kulturpolitische Konzepte
Reichskanzlerschaft Hitlers als belastend aus. In jener Ansprache hatte er seinen Stolz darüber geäußert, als Intendant der Staatstheater „erster Adjutant“ Görings zu sein, und die Machtübertragung auf die Nationalsozialisten als richtungsweisend „für die Deutschen Theater und die Deutsche Kunst“ bezeichnet, da „heute […] das gesamte Theaterwesen auf freundschaftliche Basis gebracht“318 sei. Tietjen verfolgte die Verteidigungsstrategie, seinen Einsatz für jüdische Ensemblemitglieder wie den Dirigenten Leo Blech hervorzuheben und sich selbst darüber hinaus als Mitglied des Widerstandskreises um den preußischen Finanzminister Johannes Popitz darzustellen.319 Erst im April 1947 erlangte Tietjen die Entlastung durch die deutsche Kommission, die allerdings einer Bestätigung durch die Alliierten bedurfte. Diese jedoch blieb aus.320 Erst als im Juni 1948 die Sowjets ihre Beteiligung an der Alliierten Kommandantur aufkündigten und in der SBZ 1948 die Entnazifizierung eingestellt wurde, machte die britische Militärregierung den Weg frei für eine erneute Berufung des erfahrenen Intendanten an das zu dieser Zeit künstlerisch und in Folge der Berlin-Blockade finanziell angeschlagene Charlottenburger Opernhauses.321 Der Fall Tietjen wurde in den östlichen beziehungsweise westlichen Medien höchst unterschiedlich aufgenommen. Während in der westlichen Presse die Entlastung der deutschen Spruchkammer zunächst noch als Beleg für eine zunehmende Renazifizierung in Deutschland kritisiert wurde, verschwand eine derartige Sichtweise ab 1948 weitgehend, sodass dessen Rehabilitierung ausgehend von einem unpolitischen Kunstbegriff, wonach der politisch belastete Mensch Tietjen vom unpolitischen Künstler Tietjen zu trennen sei, nunmehr begrüßt wurde.322 In der SBZ/DDR hingegen beschuldigte man den Intendanten wegen seiner nationalsozialistischen Vergangenheit schwer, allerdings ohne einzugestehen, dass dem Künstler in den Jahren 1947 und 1948 auch von Bühnen in der SBZ Beschäftigungsange-
318 Von Marcard : „Tietjen“, S. 20. 319 Hannes Heer und Boris von Haken haben das von der Staatsoper selbst lange vertretende Bild von Tietjen als Helfer der Juden und vom Widerstandskämpfer als beschönigend zurückgewiesen. Heer/von Haken, „Überläufer“, S. 43ff. 320 Monod, Scores, S. 76f. – Siehe dazu auch : Heer/von Haken, „Überläufer“, S 45ff. 321 Zunächst erhielt Tietjen nicht offiziell den Titel „Intendant“, sondern wirkte unter der Bezeichnung „künstlerischer Leiter“. Ebd., S. 48ff. 322 Siehe dazu : Janik, Recomposing, S. 145f.
Die kulturelle Gegenoffensive West-Berlins : Von der Städtischen Oper zur Deutschen Oper Berlin
125
bote unterbreitet worden waren.323 In jedem Fall sind aus den Jahren nach 1945 keine pronationalsozialistischen Äußerungen Tietjens überliefert. Ob dies jedoch auf einen Wandel seiner inneren Überzeugungen zurückzuführen ist oder nur Ausdruck von Opportunismus war, muss hier offen bleiben.324 Ein grundlegendes programmatisches Konzept Tietjens zur Städtischen Oper gibt es nicht. Allerdings lässt sich etwas über seine Vorstellungen von einem idealen Repertoire sagen. Zu Beginn seiner Intendanz bekundete Tietjen, neben der Pflege der klassischen Oper auch der im Nationalsozialismus verfemten zeitgenössischen Oper einen breiten Raum einräumen zu wollen. Noch die Ankündigungen für die Spielzeit 1951/52 sahen die Aufführung mehrerer Werke der kulturellen Moderne vor : Anvisiert war eine Inszenierung von Strawinskys The Rake’s Progress, Schönbergs Moses und Aron und Alban Bergs Wozzeck, darüber hinaus sollte Rolf Liebermanns nach 1945 komponierte Oper Leonore 40/45 gegeben werden. In der Praxis allerdings blieb von den ehrgeizigen Plänen nichts übrig, sodass sich der Eindruck aufdrängt, als seien jene von Tietjen nur aus opportunistischen Gründen mit dem Ziel geäußert worden, sich im Deutschland der Nachkriegszeit als der kulturellen Moderne gegenüber aufgeschlossen zu zeigen. Zwei Jahre später nämlich musste der Musikwissenschaftler und Musikjournalist Hans Heinz Stuckenschmidt konstatieren, dass keines jener Vorhaben umgesetzt worden sei. Von der angekündigten Vielseitigkeit in Form einer Mischung aus Tradition und Moderne sei nichts zu spüren. Stattdessen würden nur die längst etablierten Werke Strauss’, Verdis und Wagners vorherrschen. Nicht dass Stuckenschmidt etwa deren Präsenz im Repertoire kritisierte, doch fehlte ihm die Berücksichtigung des zeitgenössischen Schaffens. „Intendant Tietjen, der es als seine vornehmste Pflicht bezeichnete, die Moderne zu fördern, hat in drei Jahren nur eine wichtige Uraufführung gebracht : Boris Blachers ‚Preußisches Märchen‘. Und auch darum musste gekämpft werden.“325 Zusammen323 Ebd., S. 145. 324 Dasselbe gilt freilich auch für alle anderen an den drei Opernbühnen beschäftigten Künstler, die bereits im Nationalsozialismus an den Berliner Bühnen wirkten : Im Januar 1946 waren etwa noch über 50% der Mitglieder von Staatsoper und Städtischer Oper ehemalige Parteimitglieder. Janik, Recomposing, S. 131. 325 Hans Heinz Stuckenschmidt, „Probleme der Städtischen Oper“, in : Die Neue Zeitung vom 03. 05.1953.
126
Kulturpolitische Konzepte
fassend kam Stuckenschmidt zu dem Urteil, Tietjen fehle es an einer „übergeordneten Idee in der Spielplangestaltung“. Der Intendant selbst, der seit 1951 wegen Etatüberziehungen im Abgeordnetenhaus stark in der Kritik stand326, argumentierte im Gegenzug mit den ihm neuerdings auferlegten finanziellen Zwängen, die es ihm unmöglich machten, den eigentlich von ihm geplanten idealen Spielplan zu verwirklichen. Dieselben Kritikpunkte wie Stuckenschmidt brachte auch Werner Oehlmann vom Tagesspiegel gegen Tietjen vor, der überdies einem Teil der gespielten Werke wie der Strauß-Operette Wiener Blut, Gounods Margarethe, d’Alberts Tiefland, Humperdincks Hänsel und Gretel oder auch Franz von Suppés Boccaccio einen Mangel an „geistiger Bedeutung“327 vorwarf. Aus der Sicht Oehlmanns konnte die Städtische Oper hinsichtlich der künstlerischen Qualität nur mit Mühe mit den Opernbühnen in Hamburg und München Schritt halten. Diese Feststellung führte den Kritiker zu einer grundlegenden Reflexion über Sinn und Funktion einer staatlich subventionierten Opernbühne. Interessant ist, dass Oehlmann dabei das alte ideengeschichtliche Gegensatzpaar von Bildungs- und Unterhaltungstheater aufgriff : Er fragte sich mit Blick auf Tietjens Werkauswahl, ob „das künstlerische Ziel eines bloßen Unterhaltungstheaters den hohen Zuschuß aus öffentlichen Mitteln, den das Unternehmen trotz aller willigen Anpassung an den vermeintlichen Geschmack der ‚breiten Massen‘“328 benötige, rechtfertige. Den aufwendigen „dekorativen Illusionismus“ in den Inszenierungen der Städtischen Oper verurteilte der Journalist in einer Weise, die an die Kritik Ernst Legals – dessen Spielplan Oehlmann im Übrigen weit höher schätzte als denjenigen Tietjens329 – an einer nur dem ‚Prunk‘ dienenden Oper erinnerte : „Es geht nicht an, daß wir Sklaven eines szenischen Materialismus werden, der die geistige Bewegungsfreiheit einengt. […] Nicht der Luxus der Ausstattung, nicht der längst abgenutzte Komfort von Drehbühne und Scheinwerfern bestimmen die Qualität einer Aufführung, sondern die Klarheit der Idee, die hinter der Inszenierung steht.“330 326 Meyer zu Heringdorf, Opernhaus, S. 84ff. 327 Werner Oehlmann, „Aktuelle Aufgaben des Musiktheaters. Zur Situation der Städtischen Oper“, in : Der Tagesspiegel vom 03.02.1952. 328 Ebd. 329 Werner Oehlmann, „Die Krise der Städtischen Oper“, in : Der Tagesspiegel vom 09.07.1952. 330 Werner Oehlmann, „Aktuelle Aufgaben des Musiktheaters. Zur Situation der Städtischen
Die kulturelle Gegenoffensive West-Berlins : Von der Städtischen Oper zur Deutschen Oper Berlin
127
Für Stuckenschmidt wiederum, der als Apologet der musikalischen Avantgarde von Zwölftontechnik, Serialismus und elektronischer Musik einer elitären Kunstkonzeption anhing, gingen die Probleme von Tietjens Opernleitung noch weiter. Mit seiner Spielplangestaltung habe der Intendant „die Gunst der geschmackbildenden Elemente verloren“, dabei jedoch nicht einmal die des „breiten Publikums“ gewonnen. Wie sein Kollege Oehlmann kam Stuckenschmidt zu dem Urteil : „Das Institut, das seiner phantastisch hohen Subvention und der politischen Bedeutung Berlins entsprechend das erste Deutschlands sein müßte, steht hinter anderen zurück.“331 Der Kritiker ging so weit, Tietjens Fähigkeiten als Intendant infrage zu stellen : „Die Unklarheit, die die Persönlichkeit Tietjens umgibt, seine Taktik, geistigen Entscheidungen auszuweichen, macht es unmöglich, dem Intendanten das Vertrauen zu bewahren, das dem Künstler Tietjen bereitwillig geschenkt wird.“332 Tietjens Öffentlichkeitsscheu, die für seine Karriere während des Nationalsozialismus von Vorteil war, gereichte ihm im Berlin der Nachkriegszeit zum Nachteil. Ende April 1953 kündigte Tietjen seinen Rücktritt vom Intendantenposten an, den er Ende Januar 1954 vollzog. Nicht nur die Kritik an seinem Spielplan, die Einengung seines finanziellen Handlungsspielraums, das trotz einer ökonomischen Reorganisation der Städtischen Oper333 fortbestehende Misstrauen von Teilen des Abgeordnetenhauses, sondern auch juristische Auseinandersetzungen mit Künstlern der Städtischen Oper wie mit dem Dirigenten Ferenc Fricsay machten die Amtsausübung aus seiner Sicht unmöglich.334 Anders als Heinz Tietjen hat sich Carl Ebert, der jenem mit Beginn der Spielzeit 1954/55 als Intendant der Städtischen Oper nachfolgte, grundlegend programmatisch zur Frage einer idealen nationalen Opernbühne geäußert. Aus verschiedenen Phasen seines künstlerischen Wirkens stammen Zeugnisse einer Oper“, in : Der Tagesspiegel vom 03.02.1952. Siehe auch die Kritik Oehlmanns an Tietjen in : Werner Oehlmann, „Der Dramaturg der Städtischen Oper“, in : Der Tagesspiegel vom 27.07.1952 ; Werner Oehlmann, „Was wird aus der Städtischen Oper ?“, in : Der Tagesspiegel vom 09.05.1953. 331 Hans Heinz Stuckenschmidt, „Probleme der Städtischen Oper“, in : Die Neue Zeitung vom 03.05.1953. 332 Werner Oehlmann, „Die Krise der Städtischen Oper“, in : Der Tagesspiegel vom 09.07.1952. 333 „Reorganisation der Städtischen Oper“, in : Der Tagesspiegel vom 07.09.1951. 334 Meyer zu Heringdorf, Opernhaus, S. 87f.
128
Kulturpolitische Konzepte
intensiven Beschäftigung mit diesem Thema, so bereits aus der Zeit als Intendant des Hessischen Landestheaters in Darmstadt Ende der 1920er-Jahre. In dieser Funktion war er im Dezember 1929 nach Mannheim eingeladen worden, wo er eine Grundsatzrede mit dem Titel „Für Freiheit der Kunst !“335 hielt. Anlass war eine Protestkundgebung der dortigen Freien Volksbühne gegen die drohende Schließung des traditionsreichen und durch Schillers Wirken berühmten Mannheimer Nationaltheaters. Angesichts der Weltwirtschaftskrise hatte sich der Bürgerausschuss der Stadt nicht auf eine Fortführung der Subventionierung der Bühne mit den Gattungen Oper, Operette und Schauspiel einigen können, weshalb zum Ablauf der Spielzeit das Ende des Spielbetriebs drohte.336 Ebert sprach sich in seiner Rede eindrücklich für den Erhalt der Bühne in der bestehenden Form aus und entwarf zugleich seine Idealvorstellung von einem deutschen Theater. Auch bei ihm finden sich lange tradierte Ideen wieder. Im Ganzen zeigte er sich dabei durchaus als Vertreter eines nationalistischen Weltbürgertums, wie es Michael Steinberg charakterisiert hat. Für den Intendanten stand mit dem Mannheimer Nationaltheater symbolisch das ganze Prinzip des „deutschen gemeinnützige[n] Theater[s]“337 auf dem Spiel, dem er eine „in der ganzen Welt einzigartige Bedeutung“ beimaß. Dessen Überlegenheit gegenüber den Theaterkulturen anderer Völker und Nationen zeichnete sich für Ebert dadurch aus, dass es in einem weltbürgerlichen Sinne ein „Verwalter des großen literarischen Erbes der Nation und der Welt“ war, wobei er mit dem Begriff ‚literarisch‘ auch die Oper meinte. Ziel des deutschen Theaters sei in einem kosmopolitischen Sinne immer der „Kampf um die geistige Weiterentwicklung der Menschheit auf eine höhere Ebene“ gewesen, womit Ebert den Bildungsaspekt ins Spiel brachte. Dabei ließ er es sich nicht nehmen, an der Stätte von Schillers einstigem Wirken an dessen Begriff vom Theater als „moralische Anstalt“ zu erinnern. Auch für Ebert war es selbstverständlich, dass der Bildungsaspekt nur durch eine Unabhängigkeit der Bühne von wirtschaftlichen Zwängen in Form staatlicher Trägerschaft verwirklicht werden konnte. Darüber hinaus mahnte 335 Carl Ebert, „Für Freiheit der Kunst !“ (07.12.1929), in : AdK, Berlin, Ebert-Archiv, Nr. 2567. 336 Siehe dazu : Herbert Meyer, Das Nationaltheater Mannheim 1929–1979, Mannheim 1979, S. 31f. 337 Dieses und alle weiteren Zitate aus Eberts Mannheimer Rede zitiert nach : Carl Ebert, „Für Freiheit der Kunst !“ (07.12.1929), in : AdK, Berlin, Ebert-Archiv, Nr. 2567.
Die kulturelle Gegenoffensive West-Berlins : Von der Städtischen Oper zur Deutschen Oper Berlin
129
er die Freiheit der Kunst an, die gegenwärtig in Mannheim verloren zu gehen drohe, wie er angesichts der Versuche einer „politische[n] Infizierung“ des Nationaltheaters von verschiedenen Seiten befürchtete. Demgegenüber gab er den aus seiner Sicht unpolitischen Charakter der Kunst zu bedenken, da diese doch „keiner Partei zugehört“. Den nationalkonservativen Kritikern beispielsweise hielt er vor, dass sie, indem sie unter dem Stichwort „Verwesungs-Erscheinungen des heutigen Theaters“ Künstler wie Brecht, Krenek oder Hindemith bekämpften, „ihren Schiller wieder nicht verstanden“ hätten. Tatsächlich nämlich würden die genannten Exponenten der kulturellen Moderne, statt kulturelle Werte zu zerstören einen Beitrag zu einer geistigen „Regeneration“ im Sinne des Bildungsgedankens leisten. Darüber hinaus sei deren Schaffen, womit Ebert eine weitere altbekannte ideengeschichtliche Dimension ansprach, ästhetisch schön, was selbst dann gelte, wenn dies erst von späteren Generationen erkannt werde. Die ursprungsmythologische Argumentationsfigur spielte in Eberts Rede hingegen keine prägnante Rolle. Zwar sprach er von einer „Verankerung“ des Theaters in der „Gesamtheit des Volkes“, doch in keinem Fall argumentierte er etwa in einem völkischen Sinne. Keinesfalls hatte das Theater für Ebert die Funktion, einen Beitrag zur Formierung der Nation beziehungsweise der Volksgemeinschaft zu leisten. Das Mannheimer Nationaltheater konnte letzten Endes 1929 vor einer Schließung bewahrt werden. Mit der Machtübertragung auf die Nationalsozialisten 1933 allerdings setzte dann doch jene ‚politische Infizierung‘ der Kunst ein, vor der Ebert in seiner Mannheimer Rede gewarnt hatte. Er selbst, der durch seine Inszenierungen in Darmstadt, dann aber auch in Berlin ab 1931 als Intendant der Städtischen Oper als einer der profiliertesten Erneuerer des Musiktheaters galt, zog daraufhin seine Konsequenzen. Als das Opernhaus am 11. März durch eine SA-Abteilung des „Kampfbundes für deutsche Kultur“ besetzt wurde und ihn Göring zu einer Mitarbeit an einer Neuorganisation der Berliner Opernbühnen im nationalsozialistischen Sinne aufforderte, trat er den Weg ins Exil an. Für Ebert, der im nationalsozialistischen Deutschland auf die Liste der „Musik-Bolschewisten“338 gesetzt worden war, taten die Jahre im Ausland seiner Kariere keinen Abbruch. Ebert wirkte nicht nur als Opernregisseur in 338 Die Liste ist abgedruckt in : John, Musikbolschewismus, S. 360f.
130
Kulturpolitische Konzepte
Florenz. Er stand in Basel und Zürich selbst als Schauspieler auf der Bühne und leitete bis 1936 die „Deutsche Operntemporada“ am Teatro Colón in Buenos Aires. Zusammen mit Fritz Busch baute er auch als künstlerischer Direktor das international erfolgreiche Opernfestival im englischen Glyndebourne auf. Im Exil hielt Ebert an seinen in Mannheim geäußerten Auffassungen von einem idealen nationalen Theater fest, wie sein Wirken für den türkischen Staat ab 1936 belegt, für den er eine Opern- und Schauspielschule als Grundlage eines türkischen Nationaltheaters einrichtete.339 1945 kehrte Carl Ebert erstmals wieder nach Deutschland zurück. Von der britischen Kontrollkommission hatte er den Auftrag bekommen, einen Bericht über die Theater- und Orchestersituation zu erstellen. In der Rückschau schilderte er in einem Vortrag an der Freien Universität 1957, wie ihm in jener Situation die bildende Dimension der Kultur noch klarer als bisher geworden sei : „Mir wurde jetzt erst völlig bewußt, welche Bedeutung die Kunst und besonders die Musik für die Erhaltung und Regeneration der seelischen Kräfte eines Volkes haben konnte […].“340 In einer Pressemeldung vom 16. November 1953 gab dann Volksbildungssenator Tiburtius die erneute Berufung Eberts, der inzwischen die amerikanische Staatsbürgerschaft angenommen hatte, zum Intendanten der Städtischen Oper bekannt. Die Nachricht verdeutlicht das Bestreben, an die Kultur der Weimarer Republik anzuknüpfen. Tiburtius wies auf Eberts Berliner Intendanz der 339 In einem siebenseitigen Gutachten skizzierte Ebert im April 1936 die anstehenden Aufgaben. Wie in Mannheim 1929 formulierte er, die Bühne müsse zu einer „,moralische[n] Anstalt‘ im Sinne der Bildung und Förderung der ethischen Anschauungen und Kräfte“ werden, wobei eine staatliche Subventionierung des Theaters die bisherige privatwirtschaftliche Organisationsform ablösen sollte. Carl Ebert., „Gutachten über die Errichtung von Theaterschulen mit dem Ziele des Aufbaus einer NATIONALEN TÜRKISCHEN OPERN- UND SCHAUSPIELBÜHNE“ (April 1936). AdK, Berlin, Ebert-Archiv, Nr. 327. – Ebert hatte mit seinem Wirken in der Türkei künstlerisch nachhaltigen Erfolg, was sich in einer Vielzahl von Schauspiel- und Operninszenierungen bis 1947 niederschlug. Siehe dazu : Trapp, „Schule“ ; ZimmmermannKalyoncu, Musiker, S. 87ff. 340 Carl Ebert, Vortrag über das Wesen der Oper, gehalten an der Freien Universität Berlin. AdK, Berlin, Ebert-Archiv, Nr. 254. Der Text ist nicht datiert. Aufgrund der inhaltlichen Gemeinsamkeiten handelt es sich mit großer Wahrscheinlichkeit jedoch um den am 10.05.1957 im Kurier besprochenen Vortrag Eberts. Siehe : „Eberts musiktheatralische Sendung“, in : Der Kurier vom 10.05.1957.
Die kulturelle Gegenoffensive West-Berlins : Von der Städtischen Oper zur Deutschen Oper Berlin
131
Jahre 1931–33 mit ihren „ungewoehnlichen kuenstlerischen erfolgen“ hin und erinnerte daran, dass der Künstler „durch politischen willkuerakt von seinem berliner posten entfernt“ worden sei. In der Emigration habe er „durch seine vielfaeltige kuenstlerische taetigkeit in den westeuropaeischen laendern sowie in nord- und suedamerika entscheidendes fuer die weltgeltung der deutschen opernkunst geleistet.“341 Auch Eberts zweiter Berliner Intendanz lag die kosmopolitische Auffassung vom Theater als „Aufstellung und Deutung ewig gültiger Menschheitsfragen“342 zugrunde, wie er 1957 formulierte. Weiterhin vertrat er einen unpolitischen Kunstbegriff, womit er in Gegensatz zum politisierten Humanismusverständnis der DDR stand. Als Negativbeispiel einer politisierten Aufführungspraxis führte er eine Schweizer Fidelio-Inszenierung an, in der „die Gefangenen streikende Fabrikarbeiter“ gewesen seien, „PIZARROS Wachen als SS-Truppen und PIZZARO selber natürlich als Hitler“ agiert hätten. So wie er sich gegen einen solchen „,Avantgardismus von vorgestern‘“ wandte, „der sich modern wähnt, wenn er Beethovens ‚Fidelio‘ in einen SS-Staat Kogonscher Fixierung transponieren läßt“343, lehnte er allgemein eine „,Moderne à tout prix‘“ und den „Selbsthaß und die Selbstquälerei der Kafka-Epigonen“344 ab. Allerdings hat Ebert die kulturelle Moderne als West-Berliner Intendant keineswegs generell zurückgewiesen, sondern intensiv gefördert. So brachte er an der Städtischen Oper nicht nur etwa Hans Werner Henzes König Hirsch und Hindemiths Mathis der Maler heraus, sondern vor allem auch die deutsche Erstaufführung von Schönbergs Oper Moses und Aron, auf die in der Arbeit noch eingegangen wird. Doch musste auch das zeitgenössische Schaffen aus seiner Sicht grundsätzlich den tradierten bildungsbürgerlichen Kunstvorstellungen des „Große[n], Wahre[n], Schöne[n]“, wie er bei der Eröffnung der Deutschen Oper formulierte, verpflichtet bleiben. Ebert ging davon aus, dass, wenn solche zeitgenössischen Werke auch in ihrer 341 Pressemeldung von Volksbildungssenator Tiburtius anlässlich der Berufung Eberts zum Intendanten der Städtischen Oper vom 16.11.1953. LAB, C Rep. 014, Nr. 2123. 342 Carl Ebert, Vortrag über das Wesen der Oper, gehalten an der Freien Universität Berlin. AdK, Berlin, Ebert-Archiv, Nr. 254. 343 Ebd. 344 „Eberts musiktheatralische Sendung“, in : Der Kurier vom 10.05.1957. – Als Beispiel für eine Kafka-Oper kann Gottfried von Einems Der Prozeß genannt werden.
132
Kulturpolitische Konzepte
Entstehungszeit nicht selten umstritten seien, doch erst die Einschätzung der aus historischem Abstand urteilenden Nachwelt von Relevanz sei, ob diese unter die drei hehren Begriffe fielen.345 Ebert, der schon die Darmstädter Bühne346 zu einer Musterbühne gemacht hatte, beabsichtigte dasselbe auch mit dem West-Berliner Opernhaus. Ihm ging es darum, in den Inszenierungen die aus seiner Sicht „besten Eigenschaften der Kunstauffassung und Kunstübung im deutschen Theater“ zu retten, ihre „Strenge, ihre Sauberkeit, und ihr unbedingtes Streben nach dem Wesentlichen“. Von Eberts nationalistischem Weltbürgertum früherer Tage blieb in Berlin nach 1945 kaum etwas übrig. Zwar lobte der Intendant in seinem Vortrag 1957 weiterhin den „Nährboden“ der öffentlichen Subventionierung des Theaters in Westdeutschland, auf dem sich die Kunst besser als in anderen Ländern entfalten könne. Auch äußerte er sich weiterhin kritisch zu der „nur unterhaltenden oder der Zerstreuung dienenden Funktion [des Theaters, FB] in anderen Ländern“. Allerdings lehnte er die Vorstellung einer „Minderbewertung der geistigen Kräfte und Strömungen anderer Völker“ ausdrücklich ab. Auch wollte er die Vorteile des westdeutschen kulturellen Systems „nicht in einem überheblichen Sinne“ verstanden wissen, sondern sah darin vielmehr eine Verpflichtung, „zu lernen und dankbar bescheiden zu sein“.347 In einem Punkt unterscheiden sich Eberts Kunstauffassungen in der Zeit seiner zweiten Berliner Intendanz jedoch klar von seinen früheren. Während er in seiner Mannheimer Rede 1929 noch das Volksbühnensystem als vorbildlich gelobt hatte, da dadurch über die bereits affizierten bürgerlichen Kreise hinaus eine möglichst große Zahl an Menschen mit dem Theater in Verbindung gebracht werde, argumentierte er nun weitaus konservativer. So äußerte er zu Beginn seiner Intendanz 1954, sich mit seiner künstlerischen Arbeit primär an den „gebildete[n] und bildungshungrige[n] Mittelstand“ wenden zu wollen, „der das deutsche Theater in seinen besten Zeiten getragen“348 habe. Damit war un345 Siehe dazu auch die in Kapitel VI wiedergebene Argumentation Eberts im Zusammenhang mit dem Skandal um Moses und Aron. 346 Steinbeck, „,Vater‘“, S. 164. 347 Carl Ebert, Vortrag über das Wesen der Oper, gehalten an der Freien Universität Berlin. AdK, Berlin, Ebert-Archiv, Nr. 254. 348 „Carl Eberts Programm“, in : Der Tagesspiegel vom 16.01.1954.
Die kulturelle Gegenoffensive West-Berlins : Von der Städtischen Oper zur Deutschen Oper Berlin
133
missverständlich, auch wenn er den Begriff vermied, ein bürgerliches Publikum gemeint.349 Zwar sollte auch ein interessiertes Arbeiterpublikum, selbst das aus der DDR, für das zukünftige West-Berliner „Nationaltheater“ gewonnen werden, aber die Zielgruppe stellten doch insbesondere die bereits Gebildeten dar. Damit positionierte sich Ebert in direktem Gegensatz zur DDR mit ihrem kulturpolitischen Anspruch, die Opernbühnen vor allem einem ‚werktätigen‘ Publikum zu öffnen. Betrachtet man die kulturpolitischen Konzepte der beiden ‚großen‘ Berliner Opernbühnen in den 1950er-Jahren im Vergleich, ergibt sich, dass ihnen im Kontext der deutsch-deutschen Kulturkonkurrenz jeweils die Rolle zugedacht war, Deutschland als ideale nationale Opernbühne kulturell im Ganzen zu vertreten. Auch wenn dabei die kulturpolitisch gelenkte Staatsoper von den Vorgaben der UdSSR abhängig war, wirkten hier – vermittelt über die Arbeiterbewegung – alte bildungsbürgerliche Kunstvorstellungen fort, da die Sowjetunion selbst im Stalinismus ihren Bündnisländern ein Anknüpfen an deren nationalkulturelle Traditionen explizit zugestand. So findet sich in dem im Neuen Deutschland Ende 1952 publizierten Grundsatzprogramm für die Staatsoper die Vorstellung wieder, dass die Aufführungen des Opernhauses grundlegend eine Bildungsfunktion besäßen. Bildung wurde dabei in einem politischen Sinne als Erziehung zum Sozialismus verstanden, wobei der vom Nationalsozialismus geleugnete Humanismusdiskurs argumentativ wieder aufgegriffen wurde. Außerdem argumentierte das Neue Deutschland ursprungsmythologisch, versprach man sich doch – passend zur Deutschlandpolitik, welche sich die Überwindung der deutschen Teilung auf die Fahnen schrieb – von den Aufführungen deutscher Werke eine national einigende Wirkung. Demnach richteten sich die Vorstellungen der Bühne nicht nur an die Gesamtheit des Volkes im Arbeiter- und Bauern-Staat, sondern darüber hinaus auch an die Bevölkerung Westdeutschlands. Schließlich findet sich der ästhetische Anspruch auf Schönheit der in der 349 Die Vermeidung des Begriffes ‚Bürgertum‘ zugunsten des Terminus ‚Mittelstand‘ ist typisch für die frühe Bundesrepublik. Siehe dazu : Hannes Siegrist, „Ende der Bürgerlichkeit ? Die Kategorien ‚Bürgertum‘ und ‚Bürgerlichkeit‘ in der westdeutschen Gesellschaft und Geschichtswissenschaft der Nachkriegsperiode“, in : Geschichte und Gesellschaft 20 (1994), S. 549–583, hier S. 557.
134
Kulturpolitische Konzepte
Staatsoper gegebenen Werke im Grundsatzprogramm von 1952 wieder. Nachdem die Sowjetunion in den ersten Nachkriegsjahren die Freiheit der Kultur weitgehend garantiert hatte, sodass die Staatsoper unter dem Intendanten Ernst Legal an die kulturelle Moderne der Weimarer Republik anknüpfen konnte, änderte sich der kulturpolitische Kurs im Kontext des beginnenden Kalten Krieges. Ausgehend von den Resolutionen Shdanows wurde die kulturelle Moderne nun wieder, ähnlich wie im Nationalsozialismus, als ‚volksfremd‘ ausgegrenzt. In West-Berlin war die Entscheidung für den – von der Bundesregierung finanzierten – Neubau eines Opernhauses anstelle des kriegszerstörten Charlottenburger Baues im Jahr 1955 Ausdruck einer großangelegten, gegen die DDR mit ihrer Hauptstadt Ost-Berlin gerichteten kulturellen Offensive des Senats. Diese zielte letztlich darauf, den verlorenen Status als Hauptstadt Deutschlands wiederzuerlangen. Der Freiheit der Kunst entsprechend gab es für die Intendanten hinsichtlich des Spielplans keine bindenden Vorgaben. So prägten diese die Geschichte der Städtischen Oper jeweils höchst individuell. Die Rückkehr Heinz Tietjens, einer der einflussreichsten Künstlerpersönlichkeiten im Bereich der Oper in der Zeit des Nationalsozialismus, auf den Intendantenposten der künstlerisch angeschlagenen Städtischen Oper 1948 war Resultat der Beendigung der Entnazifizierung im Kontext des Kalten Krieges. Von Tietjen sind aus der Nachkriegszeit keine pronationalsozialistischen Äußerungen überliefert. Allerdings zeigt sein weitgehend risikoloser Spielplan als Intendant nach 1945, dass sein anfänglich geäußertes Bekenntnis zu den Werken der kulturellen Moderne kaum inneren Überzeugungen entsprach. Demgegenüber war für seinen Nachfolger Carl Ebert die Förderung der Moderne ein glaubwürdig verfolgtes Ziel. Dabei zeigte sich Ebert auch in seinen Äußerungen als ein Exponent alter bildungsbürgerlicher Kunstvorstellungen. Seiner Auffassung nach diente eine ideale deutsche Opernbühne dem Zweck, zur Bildung in einem allgemeinmenschlich-unpolitischen Sinne beizutragen, womit er sich im Gegensatz zum politisierten Kunstverständnis der DDR befand. Darüber hinaus mussten Opern für ihn – ganz in Übereinstimmung mit den offiziellen Kunstvorstellungen im ostdeutschen Staat – dem Anspruch ästhetischer Schönheit genügen. Anders als dort jedoch konnten für ihn selbst avancierte Werke der kulturellen Moderne schön – sowie selbstverständlich auch ethisch bildend – sein. Ein Unterschied zwischen Ebert und der offiziellen ostdeutschen Kunstauffassung war
Die kulturelle Gegenoffensive West-Berlins : Von der Städtischen Oper zur Deutschen Oper Berlin
135
schließlich, dass die ursprungsmythologische Argumentationsfigur für den Intendanten anders als dort nur eine untergeordnete Rolle spielte. Zwar ging auch Ebert von der Existenz verschiedener Nationalkulturen aus und es finden sich in seinem Denken auch Reste eines nationalistischen Weltbürgertums. Aber er setzte ursprungsmythologisches Denken nicht ein, um damit ausländische Kultur oder eine vermeintlich ‚volksfremde‘ Kunst herabzumindern.
IV. Architektur
Der Architektur der wieder aufgebauten Staatsoper Unter den Linden und der neu errichteten Charlottenburger Deutschen Oper kommt innerhalb der nationalen kulturellen Repräsentation im Kontext der deutsch-deutschen Systemkonkurrenz eine wichtige Rolle zu. Die beiden Berliner Gemeinwesen wollten mit ihren großzügigen Opernbauten demonstrieren, dass ihnen die Kunstform Oper innerhalb des kulturellen Wiederaufbaus der Stadt von besonderer Bedeutung war. Jedoch verhalten sich Staatsoper und Deutsche Oper wie „Bau und Gegenbau“350 und lassen die unterschiedlichen Vorstellungen von einer idealen deutschen Opernbühne architektonisch sichtbar werden. Während das Knobelsdorffsche Opernhaus – vor allem im Inneren grundlegend umgestaltet – von der DDR zum Vorbild für einen zeitgenössischen deutschen Theaterbau stilisiert wurde, der sich im Sinne des Sozialistischen Realismus an spezifisch nationalen Traditionen orientierte, entwarf der Architekt Fritz Bornemann die Deutsche Oper im westlichen, an Konzepten der Moderne orientierten Internationalen Stil. Die Architektur der beiden Opernhäuser bildete im Rahmen des zweigeteilten ‚Schaufensters‘ Berlin auf dem Gebiet der Opernkultur gewissermaßen die ‚Kulisse‘ für die Selbstdarstellung der Künstler auf der Bühne sowie jenseits davon, aber auch für diejenige des Publikums.
1. Der Wiederaufbau der Deutschen Staatsoper Unter den Linden (1951–55) a) Die Lindenoper als Nationaltheater ?
Eng verbunden mit den kulturpolitischen Forderungen, die das Neue Deutschland im Grundsatzprogramm für die Staatsoper 1952 festschrieb, war der Wiederaufbau der im Zweiten Weltkrieg zerstörten Lindenoper. In jenem Dokument 350 Martin Warnke, „Bau und Gegenbau“, in : Hermann Hipp und Ernst Seidl (Hg.), Architektur als politische Kultur. Philosophia practica, Berlin 1996, S. 11–18.
Der Wiederaufbau der Deutschen Staatsoper Unter den Linden (1951–55)
137
hieß es, die an das Opernhaus gestellten Forderungen seien umso dringlicher, als ab „Anfang des Jahres 1954 die Aufführungen in der bis dahin neu aufgebauten Staatsoper Unter den Linden stattfinden werden“.351 Auch wenn es schließlich bis zur Eröffnung der Bühne eineinhalb Jahre länger dauern sollte als geplant, war doch das Ziel klar : Die Lindenoper sollte auch baulich dem Anspruch genügen, ein ideales deutsches Opernhaus zu sein. Als kulturpolitische Richtung der Baumaßnahme nannte der leitende Architekt des Wiederaufbaus Richard Paulick, „auf der Grundlage des künstlerischen Erbes, das uns [Georg Wenzeslaus von] Knobelsdorff hinterlassen hat, eine Nationaloper zu errichten, die Eigentum des Volkes ist“.352 Aus der 1742 eröffneten Oper des preußischen Hofes allerdings die Opernbühne für die ganze deutsche Nation zu machen, stellte ein fast nicht zu lösendes Problem dar, war doch die Opernkultur unter Friedrich II. aus der Sicht der marxistisch-leninistischen Theorie denkbar negativ besetzt. Dementsprechend bemerkte Paulick auch kritisch, in jener Zeit seien in der Lindenoper „Pathos und Frivolität antikisch bekränzt“ und „die Sirenen noch den wahren Musen“353 vorgezogen worden, womit er die alte Kritik an einer nur der Unterhaltung dienenden Oper aktualisierte. Nach dem Zweck, luxuriöser Schauplatz für einen dekadenten Adel zu sein, habe sich auch die bauliche Gliederung des Opernhauses gerichtet : Während der Apollosaal der Ort von Redouten gewesen sei, hätten die Aufführungen im Theatersaal dazu gedient, das „Gepränge“ der Bälle „durch Musik, Gesang und vor allem Ballett, durch die Dekorationstechnik mit Wasserkünsten und Feuerwerken ins Triumphale und kaum Faßbare“354 zu steigern. So hätten sich, wie Paulick bemängelte, „die friderizianischen Musen […] nicht um die Pflege einer nationalen Musikkultur“ und das „Ringen um ein deutsches Theater, [um] eine deutsche Oper“ bemüht. Dieses Versäumnis lasse sich auch an der Architektur ablesen : Von Friedrich II. sei verfügt worden, den Zuschauerraum im „komfortablen und eleganten fran-
351 „Zu den Aufgaben der Deutschen Staatsoper“, in : Neues Deutschland vom 19.12.1952. 352 Paulick, „Innenarchitektur“ (1953), S. 266. 353 Richard Paulick, „Zum Wiederaufbau der Deutschen Staatsoper“, in : Deutsche Staatsoper Berlin. Zur Wiedereröffnung des Hauses Unter den Linden am 4. September 1955, Berlin 1955, S. 79–92, hier S. 79. 354 Ebd., S. 80.
138
Architektur
zösischen Stil“355 auszustatten. Doch nicht nur der ursprünglich französische Stil des Theatersaales war ein Problem für die DDR. Dem kulturpolitischen Anspruch, aus der Lindenoper eine Nationaloper zu machen, stand vor allem im Wege, dass der Bau schlichtweg zu klein war, hatte ihn Friedrich II. doch nur als Kammeroper für den preußischen Hof erbauen lassen. Trotz verschiedener, bisweilen grundlegender Umbauten seit der Öffnung des Theaters für ein bürgerliches Publikum im Jahr 1789, die darauf zielten, im Opernhaus mehr Platz zu schaffen, war das Raumproblem letztlich nie gelöst worden.356 Man mag sich fragen, wie die Lindenoper als antinationale, der Unterhaltung des dekadenten Adels dienende Kammeroper einem Abriss durch den sozialistischen Staat entkommen konnte, war doch 1950 auch das unweit gelegene, keineswegs irreparabel beschädigte Stadtschloss der Hohenzollern aus ideologischen Gründen kurzerhand gesprengt worden.357 Betrachtet man das Ergebnis des Wiederaufbaus der Lindenoper, so wird deutlich, dass es sich dabei keineswegs um die Rekonstruktion eines früheren Zustandes im Sinne heutiger Vorstellungen von Denkmalpflege handelte. Stattdessen wurde das Gebäude in seinem Äußeren wie auch vor allem im Inneren architektonisch grundlegend um- und neu gestaltet. In dem baulichen Ergebnis, mit dem die DDR ihre Vorstellungen von einer idealen deutschen Opernbühne auch architektonisch und damit sinnlich anschaulich repräsentierte, kamen lange tradierte Kunstvorstellungen zum Ausdruck. b) Der Plan einer neuen Staatsoper am Marx-Engels-Platz (1950)
Die ersten konkreten Pläne für einen Wiederaufbau der zerstörten Lindenoper sahen vor, das Gebäude nicht mehr als Opernhaus zu nutzen. Im August 1949 wurde erwogen, den Knobelsdorffbau zu einem Konzertsaal umzugestalten.358 Ein Jahr später dann beabsichtigte das Ministerium für Aufbau, in dem Ge355 Richard Paulick, „Die künstlerischen Probleme des Wiederaufbaus der Deutschen Staatsoper Unter den Linden“, in : Deutsche Architektur 1 (1952), S. 30–39, hier S. 32. 356 Zur Umwandlung der Lindenoper in ein öffentliches Hoftheater siehe : Lange, Tribunal, S. 110ff. 357 Bernd Maether, Die Vernichtung des Berliner Stadtschlosses. Eine Dokumentation, Berlin 2000. 358 Berliner Zeitung vom 07.10.1949.
Der Wiederaufbau der Deutschen Staatsoper Unter den Linden (1951–55)
139
bäude ein Musik-Konservatorium einzurichten. Mit dessen Planung wurde der gerade erst aus seinem langjährigen Exil in Schanghai zurückgekehrte Architekt Richard Paulick beauftragt. Dass der Knobelsdorffbau nicht weiter als Opernhaus verwendet werden sollte, lag an den schon genannten beengten Raumverhältnissen. So war seit August 1950 geplant, für die Staatsoper einen großen Neubau zu errichten und damit einen bereits im 19. Jahrhundert artikulierten Wunsch Wirklichkeit werden zu lassen.359 Obgleich das Projekt nicht verwirklicht wurde, ist es im Zusammenhang mit der Frage nach nationaler kultureller Repräsentation dennoch interessant, da es den zentralen Stellenwert der Opernkultur für den jungen sozialistischen deutschen Staat demonstriert. Der Neubauplan war verbunden mit der Übernahme des Sozialistischen Realismus auf dem Gebiet der Architektur im Anschluss an den III. Parteitag der SED im Juli 1950. Mit diesem grundlegenden Kurswechsel grenzte sich die DDR schroff von der sich seit 1945 in West- wie Ostdeutschland etablierenden architektonischen Moderne ab, die auf Konzepte der 1910er- und 1920er-Jahre zurückging. Diese unter Bezeichnungen wie Neues Bauen oder Internationaler Stil firmierende Architektur hatte mit der an der Klassik orientierten Formensprache des Historismus gebrochen, an dessen Stelle ein primär an funktionalen Gesichtspunkten orientiertes Bauideal trat. Von der DDR-Kulturpolitik wurde eine derartige Architekturauffassung – parallel zur Kritik an der kulturellen Moderne im Bereich der Musik – als ‚kosmopolitisch‘, ‚internationalistisch‘, ‚amerikanisch‘ und ‚volksfremd‘ diffamiert. Stattdessen strebte der junge sozialistische Staat in der Baukunst nach einer „schöpferischen Anwen359 Zu den Plänen einer neuen Staatsoper am Marx-Engels-Platz siehe auch : Schwartz, Staatsoper, S. 103ff. – Zu Klagen über die Enge der Lindenoper war es schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gekommen. Selbst das Hinzufügen eines vierten Ranges bei der Wiederherstellung des niedergebrannten Opernhauses durch Carl Ferdinand Langhans 1843, das gegen den Widerstand der einen Neubau fordernden bürgerlichen Öffentlichkeit durchgeführt worden war, konnte das Problem nicht lösen. Immerhin stellte der Monarch Friedrich Wilhelm IV. in der Kabinettsordre vom 21.08.1843 in Aussicht, in späterer Zeit ein „allen Anforderungen der Zeit entsprechendes und bei der immer wachsenden Bevölkerung auch umfangreiches Theater […] erbauen zu lassen“. Zitiert nach : Lange, Tribunal, S. 122. – Auch Kaiser Wilhelms II. hatte noch 1910 den Plan, durch ein gewaltiges neues Königliches Opernhaus dem Platzproblem Abhilfe zu schaffen. Waltraud Strey, Wettbewerb für den Neubau eines Königlichen Opernhauses in Berlin für Wilhelm II., Berlin 1981.
140
Architektur
dung des nationalen Kulturerbes“. Zum Vorbild einer nationalen Architektur, die als „schön im Sinne des Volksempfindens“360 definiert wurde, erhob man den Klassizismus der Jahre um 1800, wobei vor allem das Werk Karl Friedrich Schinkels in den Mittelpunkt des Interesses rückte.361 Die Forderungen an eine sozialistische deutsche Architektur waren verbunden mit einem neuen Ideal des Städtebaus. An die Stelle des Prinzips der funktional gegliederten und aufgelockerten Stadt, das auf dem vierten Kongress der CIAM (Congrès Internationaux d’Architecture Moderne) 1933 als Charta von Athen verabschiedet worden war, trat in der DDR das neue Leitbild einer kompakten, von monumentalen Bauten gekrönten Stadt nach dem Muster der seit 1935 durchgeführten Neugestaltung Moskaus. Die architekturpolitische Übernahme des Sozialistischen Realismus wurde in den am 27. Juni 1950 von der Regierung verabschiedeten Sechzehn Grundsätzen des Städtebaus festgeschrieben.362 Was deren Umsetzung anbelangt, fiel das Hauptaugenmerk auf den Wiederaufbau Berlins als Hauptstadt eines in Zukunft wiedervereinigten Deutschland. Schon in seiner Rede auf dem III. Parteitag hatte Walter Ulbricht gefordert, Berlin müsse „schöner […] denn je“363 erstehen. Dabei sollte das Zentrum der Stadt, vom Brandenburger Tor bis zur Stalinallee, „sein charakteristisches Bild durch monumentale Gebäude und eine architektonische Komposition erhalten, die der Bedeutung der Hauptstadt Deutschlands gerecht“364 würde. Noch während des Parteitages kam es zur Gründung eines aus Vertretern des Aufbauministeriums und des Magistrats gebildeten „Planungsausschusses Berlin“365, der sich vor allem um die Gestaltung eines zentralen Aufmarschplatzes bemühte, wie er dann auch im sechsten der Sechzehn Grundsätze gefordert wurde : „Das Zentrum ist der politische Mittel360 Zitiert nach : Durth/Düwel/Gutshow, Aufbau, S. 64. 361 Simone Hain, „,Zweckmäßigkeit, Schönheit und Idee‘. Zur Schinkelrezeption in der frühen DDR und den Plänen zum Wiederaufbau der Bauakademie“, in : Frank Augustin (Hg.), Mythos Bauakademie : die Schinkelsche Bauakademie und ihre Bedeutung für die Mitte Berlins, Berlin 1997, S. 159–179. 362 Durth/Düwel/Gutschow, Ostkreuz, S. 162ff. 363 Durth/Düwel/Gutschow, Aufbau, S. 214. 364 Zitiert nach : ebd., S. 64. 365 Der „Planungsausschuss“ wurde schon bald in „Planungsgruppe Berlin“ umbenannt. Siehe dazu : ebd., S. 65.
Der Wiederaufbau der Deutschen Staatsoper Unter den Linden (1951–55)
141
punkt für das Leben seiner Bevölkerung. […] Auf den Plätzen im Stadtzentrum finden die politischen Demonstrationen, die Aufmärsche und die Volksfeiern an Festtagen statt.“366 Als Ort des zentralen Aufmarschplatzes, der als symbolisches Zentrum Deutschlands vorgesehen war, wurde nach dem Willen Walter Ulbrichts der Lustgarten vor dem Alten Museum Schinkels bestimmt. Geplant war, diesen durch Abriss des kriegsbeschädigten Stadtschlosses auf 82.000 Quadratmeter zu vergrößern, sodass er bei Demonstrationen 330.000 Menschen fassen konnte.367 Der maßgebliche Entwurf für die Gestaltung des Platzes, erstellt bereits am 27. Juli 1950, stammte von Helmut Hennig, dem Leiter der Magistratsabteilung öffentliche Bauten. Er zeigt einen Aufmarschplatz, der sich vom Alten Museum im Norden über das Areal des abgerissenen Schlosses erstreckt. Anstelle des Schlosses war eine Tribüne und ein dahinter gelegenes riesiges Zentralgebäude als Versammlungshalle konzipiert. Den südlichen Abschluss des Platzes sollte die neue Staatsoper bilden. Dem sechsten der Grundsätze entsprechend, wonach im Zentrum der Stadt „die wichtigsten politischen, administrativen und kulturellen Stätten“ zu liegen hatten, erhielt die Oper somit den Stellenwert eines der wichtigsten kulturellen Gebäude Deutschlands überhaupt. Mit der großen kulturpolitischen Bedeutung der neuen Staatsoper korrespondierten deren im Entwurf angedeutete monumentale Ausmaße : Die Front maß in etwa die Breite des auf der anderen Schmalseite des Platzes gelegenen Alten Museums ; der Länge nach übertraf sie die alte Lindenoper um mehr als die Hälfte.368 Eine Schnittzeichnung lässt überdies die Höhe erahnen, nach welcher der Bühnenturm bis über den Kuppelansatz des Berliner Doms hinausreichen sollte.369 Was die äußere Form anbelangt, suggeriert die Zeichnung Hennigs mit einer angedeuteten Freitreppe und Säulen eine klassizistische Fassade. Nachdem Walter Ulbricht bereits am 5. August 1950 der Gestaltung des geplanten Aufmarschplatzes einschließlich des Schlossabrisses zugestimmt
366 Zitiert nach : Durth/Düwel/Gutschow, Ostkreuz, S. 173. 367 Müller, Symbolsuche, S. 38. 368 Siehe den Grundriss in : Durth/Düwel/Gutschow, Aufbau, S. 215. – Ein von Paulicks Hand stammender Plan vom August 1950 enthält demgegenüber einen leicht veränderten Grundriss des zukünftigen Opernhauses. Abgedruckt in : ebd., S. 219. 369 Die Schnittzeichnung ist abgebildet in : ebd., S. 221.
142
Architektur
hatte, bestätigte das Politbüro diesen „Plan des Neuaufbaus von Berlin“370 am 15. August. Während für die neue Staatsoper am Marx-Engels-Platz, wie das Areal genannt wurde, eine monumentale Gestalt angedacht war, bot der Plan, die alte Lindenoper als Konservatorium wieder aufzubauen, die Möglichkeit, diese auf ihre ursprüngliche friderizianische Größe zurückzuführen. Im Jahr 1910 nämlich war dem Opernhaus, das bis dahin die ursprüngliche schlichte Form eines Rechtecks besessen hatte, ein großer Bühnenturm aufgesetzt worden, der sich in seiner unverkleidet-nüchternen Erscheinung deutlich von der historischen Bausubstanz abhob. Da sich aber auch durch diesen Zusatz die Ansprüche an eine zeitgemäße Bühnentechnik nicht erfüllen ließen, hatte der Architekt Eduard Fürstenau in den Jahren 1926–28 darüber hinaus – nun dekorativ verkleidet im Stile Knobelsdorffs – zwei Seitenbühnen angefügt, wodurch das Opernhaus seinen – bis heute bestehenden – kreuzförmigen Grundriss erhielt.371 Hatte Fürstenaus Umbau schon in den 1920er-Jahren zu heftigen Protesten geführt, bot sich im Rahmen des Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg die Möglichkeit, diese Veränderungen wieder rückgängig zu machen. In diesem Sinne forderte das Berliner Amt für Denkmalpflege des Magistrats im November 1949 : „Da dieses Bauwerk weltbekannt und von einem derartigen künstlerischen Wert ist, muß angestrebt werden, auf jeden Fall das Opernhaus in seiner ursprünglichen großen, reinen, klaren Form […] wiederherzustellen.“372 Tatsächlich wurde Anfang 1950 bereits der Bühnenturm abgetragen, sodass der Bau auf den Stadtmodellen des zukünftigen Berlin aus jener Zeit immer mit dem ursprünglichen, einheitlich durchgehenden Dach dargestellt ist.373 Im März 1951 herrschte Einigkeit zwischen dem Volksbildungsministerium und dem designierten Präsidenten der Bauakademie Kurt Liebknecht über den Wiederaufbau der ehemaligen Oper als Konservatorium.374 Dass mit den Ar370 Wiedergegeben in : ebd., S. 220–221. 371 Zum Umbau durch Eduard Fürstenau siehe : Schwartz, Staatsoper, S. 19ff. 372 Amt für Denkmalpflege an Magistrats-Direktor Kurt Starck vom 05.11.1949. Zitiert nach : ebd, S. 27. 373 Siehe etwa das Stadtmodell vom August 1950, abgebildet in Durth/Düwel/Gutschow, Ostkreuz, S. 180. 374 BArch, DH 2/20081.
Der Wiederaufbau der Deutschen Staatsoper Unter den Linden (1951–55)
143
Entwurf zur Neugestaltung des vergrößerten Lustgartens als zentraler Aufmarschplatz Berlins mit Demonstrantenzug (Zeichnung von Helmut Hennig, 27. Juli 1950). Unten links das Alte Museum von Schinkel, darüber der Berliner Dom. Im Mittelpunkt des Bildes Zuschauertribünen mit dem dahinter gelegenen, geplanten Zentralen Gebäude. Oben rechts die neue Staatsoper mit Freitreppe, Säulen und Bühnenturm.
beiten daran einstweilen noch nicht begonnen wurde, lag nur daran, dass der zuständige Architekt Richard Paulick, der bereits Pläne vorgelegt hatte, mit einer anderen, zunächst dringenderen Aufgabe beschäftigt war : dem Bau einer Sporthalle für die am 3. August 1951 beginnenden Weltjugendfestspiele.375 Gleichzeitig stockten aber auch die Planungen der neuen Staatsoper am MarxEngels-Platz. Dass man hier nicht weiterkam, hatte vor allem zwei Gründe : Zum einen enthielt der von der Regierung am 23. August 1950 bestätigte Aufbaubeschluss eine solche Vielzahl an Bauprojekten, dass deren zeitnahe Umsetzung schlechterdings nicht zu bewältigen war. Des Weiteren fehlte es trotz des beschworenen Vorbildes der nationalen Bautraditionen schlicht an konkreten architektonischen Vorstellungen darüber, wie eine zukünftige sozialistische Architektur konkret auszusehen habe.376 375 Schwartz, Staatsoper, S. 31. 376 Müller, Symbolsuche, S. 39.
144
Architektur
c) Von der friderizianischen Kammeroper zum „repräsentativen Opernhaus der deutschen Hauptstadt“
Die bisherigen Planungen wurden hinfällig, als nach einem Treffen des Dirigenten Erich Kleiber mit Mitgliedern der DDR-Staatsführung am 17. Juni 1951 beschlossen wurde, statt eines neuen Opernhauses am Marx-Engels-Platz nun doch den Knobelsdorffbau als Opernhaus wiederaufzubauen.377 Der berühmte Dirigent, welcher der Bühne bereits in den 1920ern als Generalmusikdirektor vorgestanden und in dieser Position Ruhm erlangt hatte, stellte im Gegenzug für den Wiederaufbau der Lindenoper in Aussicht, an seine alte Wirkungsstätte zurückzukehren, wovon sich die DDR einen kulturpolitischen Triumph ersten Ranges versprach. In der Berliner Zeitung war am 27. Juni 1951 über das Treffen zu lesen, zwischen Erich Kleiber und den Regierungsvertretern sei „völlige Übereinstimmung darüber erzielt [worden], daß die Lindenoper unter Wahrung der Knobelsdorffschen Architektur so wiederhergestellt werden soll, wie sie vor den Umbauten unter der Hitlerdiktatur und den Zerstörungen durch den Bombenkrieg bestand.“378 Kleiber wünschte sich somit im Inneren die Rekonstruktion des Zustandes wieder, den die Bühne in den Jahren 1928 bis 1941 besessen und den er selbst bei seinem ersten Wirken in Berlin erlebt hatte. Demnach sollte die Gestaltung Carl Ferdinand Langhans d. J. von 1843 wiederhergestellt werden. Langhans hatte, nachdem das Opernhaus bei einer Ballettaufführung mit Feuerwerk bis auf die Außenmauern abgebrannt war, den Bau auf Beschluss König Friedrich Wilhelms IV. wiederaufgebaut. Während dabei das Äußere weitgehend unverändert wiederhergestellt worden war, wurde die ursprüngliche Dekoration des Theatersaals aus dem 18. Jahrhundert nicht rekonstruiert. Vielmehr erstand das Innere nach dem Plan des Architekten in völlig neuer dekorativer und formaler Gestaltung.379 Eine einschneidende Änderung war, dass an die Stelle der ursprünglich drei Ränge vier traten, wodurch 377 Zur Entscheidung für den Wiederaufbau der Staatsoper siehe auch : Schwartz, Staatsoper, S. 34ff. 378 Erich Kleiber bei Präsident Pieck, in : Berliner Zeitung vom 27. Juni 1951. Bereits am 24. Juni vollzog die Regierung der DDR den Wiederaufbaubeschluss formell nach. 379 Zum Wiederaufbau der Lindenoper durch Carl Ferdinand Langhans siehe : Lange, Tribunal, S. 115–143.
Der Wiederaufbau der Deutschen Staatsoper Unter den Linden (1951–55)
145
Zuschauerraum der Lindenoper mit vier Rängen (Fassung von Carl Ferdinand Langhans, Eröffnung 1843).
der Saal nun erheblich mehr Zuschauer fassen konnte. Die Fassung von Langhans war dann wiederum von den Nationalsozialisten 1941 durch Einbau einer „Führerloge“ abgeändert worden.380 Ungeachtet der Zusagen der Regierungsvertreter an Kleiber wurde dessen Wunschfassung jedoch, das sei hier bereits vorweggenommen, nicht verwirklicht. Mit der Durchführung des Wiederaufbaus beauftragte das Ministerium für Aufbau die seit Anfang 1951 bestehende Deutsche Bauakademie.381 Diese übergab das Projekt an Richard Paulick, der bereits mit dem Konservatoriums-Plan betraut worden war.382 Paulick gehörte als Leiter der Meisterwerkstatt III der 380 Umgebaut wurde durch den Architekten Erich Meffert 1941 außerdem der Apollosaal. Schwartz, Staatsoper, S. 22ff. 381 Die offizielle Eröffnung der Bauakademie, die sich als Neugründung der traditionsreichen Berliner Bauakademie von 1799 verstand, erfolgte erst am 8. Dezember 1951. Durth/Düwel/ Gutschow, Aufbau, S. 115ff. 382 Aktenvermerk von Kurt Liebknecht vom 28.06.1951. BArch, DH 1/39022. – Zur Biografie des früheren Hans Poelzig-Schülers Richard Paulick siehe : Peter Müller und Peter Thöner
146
Architektur
Bauakademie neben Hermann Henselmann und Hanns Hopp zu den einflussreichsten Architekten der jungen DDR. Wissenschaftliche Unterstützung erhielt er durch den Kunsthistoriker Willy Kurth, Professor für Kunstgeschichte an der Humboldt-Universität und seit 1946 Direktor der Staatlichen Schlösser und Gärten Potsdam-Sanssouci. In einem Zeitungsartikel erläuterte Paulick am 5. Juli 1951 seine Pläne für den Wiederaufbau, mit denen er Kleibers Vorstellungen durchweg entsprach : „Ich beabsichtige […], das herrliche Bauwerk Knobelsdorfs [sic] in seiner unverfälschten ursprünglichen Gestalt zu neuem Leben zu erwecken. Alle stilwidrigen sogenannten Verbesserungen, die im Laufe der Zeit das Haus verunstaltet haben, werden beseitigt, so auch der Bühnenturm, der aus der wilhelminischen Zeit stammt und die klassische Ebenmäßigkeit der Formen zuschanden machte.“383 Demnach wollte Paulick das Gebäude wie zuvor bei dem Konservatoriumsplan zumindest ohne einen Bühnenturm wiederherstellen, wenn auch die Seitenbühnen bleiben sollten. Was die Zahl der Sitzplätze anbelangt, waren „unverändert 1700“384 vorgesehen, womit also die Fassung von Langhans gemeint war. Zur Überwachung des Bauprojektes wurde am 15. August 1951 eine Baukommission unter der Leitung des Vorsitzenden der Staatlichen Kommission für Kunstangelegenheiten Helmut Holtzhauer eingerichtet, der unter anderem die Opernintendanten Ernst Legal und Walter Felsenstein sowie als Vertreter der Bauakademie der designierte Leiter Kurt Liebknecht und sein Stellvertreter Edmund Collein angehörten. In der konstituierenden Sitzung nannte Holtzhauer in Anwesenheit Paulicks und Kurths dann die mit dem Wiederaufbau385 verbundene entscheidende kulturpolitische Aufgabe : Es gehe darum, „unter weitgehender Wahrung der künstlerischen Ideen von Knobelsdorff die Staatsoper Unter den Linden wieder aufzubauen und dabei die Bedürfnisse des repräsentativen Opernhauses der Hauptstadt Deutschlands zu berücksichtigen“.386 Ge(Hg.), Bauhaus-Tradition und DDR-Moderne. Der Architekt Richard Paulick, München 2006, vor allem S. 11–22. 383 Zitiert nach : Otto, Lindenoper, S. 286. 384 Ebd. 385 Zum Wiederaufbau siehe auch : Schwartz, Staatsoper, S. 36ff ; Schwartz, „,Knobelsdorff‘“, S. 113ff ; Haspel/Schmitz, „Staatsoper“, S. 14–19. 386 Protokoll der konstituierenden Sitzung der Baukommission am 15. August 1951. BArch, DH 2/20019.
Der Wiederaufbau der Deutschen Staatsoper Unter den Linden (1951–55)
147
nau diese Bedürfnisse aber durchkreuzten die ursprünglichen Pläne Paulicks. So wurde schon in der konstituierenden Sitzung der Baukommission entgegen dem Standpunkt des Architekten festgelegt, die aus den 1920er-Jahren stammenden Seitenbühnen beizubehalten und darüber hinaus sogar erneut einen Bühnenturm hinzuzufügen. Nur so nämlich seien aufwendige Inszenierungen möglich, welche der Admiralspalast als Ausweichspielstätte mit seinen beschränkten räumlichen Gegebenheiten und seiner unzureichenden technischen Ausstattung nicht zulasse. Immerhin sollte der neue Bühnenturm, so wurde entschieden, gegenüber dem gerade erst abgetragenen acht Meter niedriger und – anders als sein Vorgänger – stilistisch der Knobelsdorffschen Architektur angepasst sein. Was die Innengestaltung betraf, blieb es zunächst bei der von Kleiber geforderten Rekonstruktion des Langhansschen Zuschauerraums. Allerdings enthält das Sitzungsprotokoll eine folgenreiche Bemerkung, die schließlich grundlegende Änderungen nach sich ziehen sollte : Es sei auf „durchgängige gute Sicht […] Rücksicht zu nehmen“. Diese Forderung bedeutete doch letztlich gewissermaßen die Quadratur des Kreises, da gerade die Form des Rang-/Logentheaters einer guten Sicht für das gesamte Publikum bekanntlich zuwiderläuft. In seinem 1. Vorprojekt, das Richard Paulick der Baukommission am 27. September 1951 präsentierte, kritisierte er zunächst in erstaunlicher Offenheit die mit dem Wiederaufbau verbundenen kulturpolitischen Zielsetzungen : „Die vom Ministerrat gestellte Aufgabe : Die Oper im Stile Knobelsdorff’scher Tradition wiederherzustellen, und sie zum repräsentativen Deutschen Opernhaus zu machen, birgt einen unlösbaren Widerspruch in sich selbst. […] Man muß sich dessen bewußt sein, daß dieses Opernhaus als höfische Kammeroper gebaut wurde und höhere Ansprüche nur erfüllt werden können unter teilweiser oder gänzlicher Zerstörung des Knobelsdorffschen Baues.“387 Eine Wiederherstellung ohne Bühnenturm aber sei nur unter zwei Bedingungen möglich : Entweder habe in den Inszenierungen der neuen Lindenoper an die Stelle umfangreicher „Bühnenbauten plastischer Art“ die Verwendung von „Lichteffekten“ und „Projektionen“ zu treten388 oder die Lindenoper werde der Ort für 387 Richard Paulick, Erläuterungsbericht zum Vorprojekt für den Wiederaufbau der Deutschen Staatsoper Unter den Linden in Berlin. BArch, DH 2/20081. 388 Möglicherweise bezog er sich dabei bereits auf die entsprechenden inszenatorischen Neuerungen Wieland Wagners, die dieser im gerade zurückliegenden Sommer in seinen Inszenierungen
148
Architektur
Aufführungen weniger aufwendiger „Spiel- und Kammeropern“ sein. Die große Oper müsse dann „in einem neu zu errichtenden Bau anderswo – etwa dem vorgesehenen Standort am Marx-Engels-Platz – ein Heim“ finden. Doch war dieser Plan ja gerade erst verworfen worden. So stellte Paulick bedauernd fest, dass die auf die 1920er-Jahre zurückgehende „Verunstaltung des Knobelsdorffschen Baues“ beim anstehenden Wiederaufbau lediglich reduziert werden könne. Sich den Vorgaben der Baukommission fügend, hatte er dann auch bereits einen im Stile Knobelsdorffs verkleideten Bühnenturm entworfen. Darüber hinaus enthielt sein Entwurf im Inneren nun entscheidende Neuerungen. Diese betrafen das Sichtproblem im Zuschauerraum. So schlug Paulick entgegen den bisherigen Vorgaben vor, an die Stelle des Langhansschen Theatersaals mit vier Rängen zur ursprünglichen Dreirangigkeit Knobelsdorffs zurückzukehren. Indem die Ränge in größerem Abstand als bisher zueinander angeordnet wurden, ließen sich die hintereinander gelegenen Sitzreihen stärker in die Höhe staffeln, sodass selbst von den hinteren Plätzen aus eine ausreichend gute Sicht bestand. Auch sollte der Saal nun nicht mehr im vermeintlich „kalten und unpersönlichen“389 Stil Langhans’ dekoriert werden. Allerdings lehnte der Architekt überraschenderweise genauso auch die ursprüngliche Fassung von 1742 ab, da deren Form ebenfalls „bekanntlich große Mängel in der Sicht auf[ge]wiesen“ habe. Da die ursprüngliche Gestaltung einschließlich der Dekoration auch wegen der unzureichenden Quellenlage nicht zu rekonstruieren war, wählte Paulick einen anderen Weg : Es sollte ein dreirangiger Saal mit einer an das 18. Jahrhundert angelehnten Dekoration gebaut werden. Zu diesem Zweck seien von der Bauakademie bereits „die Details der Schlösser Rheinsberg, Charlottenburg und Sanssouci studiert [worden], um den Raumcharakter Knobelsdorffs, Nahls und Hoppenhaupts [als damals beteiligten Dekorateuren, FB] stilistisch zu treffen“.390 Da die Diskussion um diesen völlig neuen Zuschauerraum in der Baukommission nur aus der subjektiv gefärbten Sicht des von Ring und Parsifal bei den Bayreuther Festspielen erstmals erprobt hatte. Doch war dessen Ästhetik von der DDR als Ausdruck des Formalismus heftig abgelehnt worden, sodass dieser Weg für die Deutsche Staatsoper nicht infrage kam. Siehe dazu : Braunmüller, Oper, S. 59. 389 Richard Paulick, Erläuterungsbericht zum Vorprojekt für den Wiederaufbau der Deutschen Staatsoper Unter den Linden in Berlin. BArch, DH 2/20081. 390 Ebd.
Der Wiederaufbau der Deutschen Staatsoper Unter den Linden (1951–55)
149
Architekt Richard Paulick (rechts) mit dem Kunsthistoriker Willy Kurth (links) vor dem Modell der zukünftigen Staatsoper. Der Bühnenturm ist gegenüber dem der 1920er-Jahre verkürzt und im Stil der Knobelsdorffschen Fassade dekoriert (wohl 1952).
150
Architektur
Protokollanten Richard Paulick überliefert ist, lässt sich nicht sagen, wie heftig die Einwände dagegen ausfielen. Liebknecht muss auf Kleibers Forderung nach Rekonstruktion des Langhansschen Zuschauerraumes verwiesen haben, was allerdings angesichts der zu erwartenden funktionalen Verbesserungen, die durch eine Dreirangigkeit zu erhoffen waren, nicht verfing.391 Felsenstein meinte, dass man gegenwärtig sensibler für die „Reinheit der Formen und des Stils“ sei, sodass „wenn außen, dann auch innen nach Knobelsdorff gebaut werden müsste“.392 Zwar enthielt das 1. Vorprojekt noch keine Zeichnungen des neuen Zuschauerraums, dennoch war am Ende der Sitzung die grundlegende Entscheidung gegen die Fassung von Langhans gefallen. Entwurfszeichnungen des Zuschauerraums enthielt dann das 2. Vorprojekt, das Paulick der Baukommission am 15. Februar 1952 vorlegte und schließlich am 25. März 1952 vom ZK der SED bewilligt wurde.393 d) Die Lindenoper als fortschrittliches nationales Bauerbe
Den Ausschlag für die Bewilligung von Paulicks Entwurf wird gegeben haben, dass der Architekt diesen mit einer marxistisch-leninistischen Argumentation legitimierte.394 Paulick interpretierte den Bau als Ausdruck des fortschrittlichen nationalen Bauerbes im Sinne des Sozialismus, indem er Knobelsdorff als Frühklassizisten deutete, der sich mit seiner Architektur gegen das rückschrittliche Rokoko gestellt habe. Bereits in der Sitzung der Baukommission am 27. September 1951 hatte der Kunsthistoriker Kurth die Außenarchitektur der Oper in der Weise interpretiert, dass er auf die „revolutionäre Tat des Knobelsdorff391 Erich Kleiber selbst kritisierte die Entscheidung gegen die Langhans-Fassung erwartungsgemäß heftig. In einem Brief an den Intendanten der Staatsoper Ernst Legal schrieb er : „Dass man […] das Bühnenhaus wieder erniedrigt, vor allem den immerhin historischen, wenn auch nicht von Knobelsdorff für das damalige Berlin gedachten IV. Rang den Berlinern wegnimmt (die Hochburg der Verständigen !), halte ich für grausam !“ Brief Kleibers an Ernst Legal vom 18.11.1951. LAB, C Rep. 167, Nr. 46. 392 Protokoll der Sitzung der Baukommission vom 27.09.1951. BArch, DH 2/20081. 393 Noch am 28. November 1951 hatte Holtzhauer den Architekten in einem Brief eindringlich vor „eigenmächtigen Veränderungen“ gegenüber dem Vorkriegszustand gewarnt und eine „eingehende Aussprache“ verlangt. Ebd. 394 Siehe dazu auch : Schwartz, Staatsoper, S. 98ff.
Der Wiederaufbau der Deutschen Staatsoper Unter den Linden (1951–55)
151
Modell des neuen, klassizistischen Zuschauerraums der Staatsoper mit drei Rängen aus dem Jahr 1953. Links die großformatige Proszeniumsloge.
schen Stiles“ hinwies, „vom Rokoko zu der schlichten Form des Rechteckes und des Kubus überzugehen“. Diese Interpretation Knobelsdorffs wurde nun von Paulick als leitend auch für die Innengestaltung erklärt : Der Zuschauerraum sei „in seiner Gesamtkonzeption, den Details, Profilen und der Farbgebung im klassizistischen Stil Knobelsdorffs“395 zu gestalten. Tatsächlich lässt sich die Interpretation Knobelsdorffs als Frühklassizist architekturhistorisch nicht halten, wird doch der Stil des Baumeisters bis heute übereinstimmend dem „friderizianischen Rokoko“ zugeordnet.396 Zwar besaß Paulicks Deutung für die antikisierend-schlicht anmutende Außenarchitektur eine gewisse Plausibilität, weist der Bau hier doch scheinbar klassizistische Merkmale auf. Das Innere aber mit seinen ursprünglichen, primär von den Ron395 Erläuterungsbericht zum 2. Vorprojekt für den Wiederaufbau der Deutschen Staatsoper Unter den Linden. BArch, DH 2/20019. 396 Siehe etwa : Tilo Eggeling, Studien zum friderizianischen Rokoko. Georg Wenceslaus von Knobelsdorff als Entwerfer von Innendekorationen, Berlin 1980.
152
Architektur
caille geprägten Dekorationen war, wie die wenigen erhaltenen Zeichnungen Knobelsdorffs zeigen397, eindeutig dem Rokoko zugeordnet. Gerade die nicht auflösbare Spannung zwischen der gegensätzlichen Innen- und Außengestaltung aber, für die das Opernhaus als beispielhaft gelten kann, ist charakteristisch für jenen preußischen Regionalstil.398 Um die Interpretation Knobelsdorffs als Frühklassizist zu untermauern, bediente sich Paulick eines argumentativen Tricks. Er unterstellte einen – den historischen Tatsachen widersprechenden – Gegensatz zwischen den ästhetischen Positionen Knobelsdorffs und denen seines königlichen Auftraggebers : hier der Anhänger des rückständigen Rokoko, dort der Vertreter des fortschrittlichen Klassizismus. Demzufolge glaubte sich Paulick berechtigt, den Zuschauerraum nun so zu gestalten, wie ihn „Knobelsdorff nach unserer gewonnenen Auffassung durch das intensive Studium seiner Bauten […] gestaltet hätte, wenn nicht Friedrich II. durch persönliches Eingreifen bzw. Kabinettsorder die ursprünglichen [klassizistischen, FB] Absichten Knobelsdorff’s verhindert hätte“.399 Welchen grundlegenden Unterschied die neue, Knobelsdorff angeblich besser entsprechende Klassizismus-Fassung gegenüber der tatsächlichen von 1742 bedeutete, wird den meisten Mitgliedern der Baukommission nicht bewusst gewesen sein, da das Original nur durch wenige Skizzen überliefert und kaum bekannt war. In der Vielzahl von Texten, mit denen Richard Paulick den Wiederaufbau der Lindenoper kommentierte, erweiterte er die Interpretation Knobelsdorffs als Ausdruck des fortschrittlichen Nationalerbes zu einem umfassenden Bild, in dem er den Baumeister geradezu zum Schöpfer einer nationalen Opernarchitektur stilisierte. Interessant ist, dass dieses Bild grundlegend von den vier erläuterten ideengeschichtlichen Dimensionen einer idealen deutschen Opernbühne geprägt war. Paulick interpretierte die Lindenoper als Ausdruck der „Opposition des aufsteigenden Bürgertums gegen das ausschweifende Leben der absoluten Fürsten“.400 Im Opernhaus würden sich die in jener Zeit einsetzenden Bemü397 Ebd., S. 87ff. 398 Ebd., S. 20. 399 Erläuterungsbericht zum 2. Vorprojekt für den Wiederaufbau der Deutschen Staatsoper Unter den Linden. BArch, DH 2/20019. 400 Paulick, „Probleme“ ; S. 32.
Der Wiederaufbau der Deutschen Staatsoper Unter den Linden (1951–55)
153
hungen auf dem Feld der Musik widerspiegeln, die Oper „aus der servilen Rolle zu befreien, zu der die absolutistische Hofgesellschaft sie herabgewürdigt hatte“. Knobelsdorffs Bau sei „nicht mehr höfisches Anhängsel, ist nicht mehr Unterhaltung der großen Salons“. Stattdessen sei es darum gegangen, der Kunstform einen „tieferen Inhalt“ zu geben und dadurch die „Bedeutung des Kastratensängers, des Tänzers, der Primadonna, die Selbstzweck geworden waren, […] zu brechen“401, womit Paulick auf die Bestrebungen der Aufklärung anspielte, die Bühne zu einem Ort der Bildung zu machen. Deutlich werde diese neue, selbstbewusste Haltung etwa daran, dass sich das Opernhaus als „freistehender, selbständiger Bau“402 präsentiere, wodurch die Distanz zum Hof schon allein räumlich sichtbar werde. Dass Knobelsdorff mit seiner fortschrittlichen Haltung zum „Schöpfer des deutschen Frühklassizismus“403 geworden sei, indem er sich als erster deutscher Architekt vom dekorativ überladenen Rokoko zugunsten einer schlicht-antikisierenden Formensprache abgewandt habe, belegte für Paulick der Portikus der Frontseite. Durch diesen habe das Opernhaus die klassizistische Form eines „Tempel[s] des Apoll und der Musen“404 angenommen, lange bevor Karl Friedrich Schinkel diese Absicht in seinem berühmten Berliner Schauspielhaus umgesetzt habe. Paulick, alle am Wiederaufbau Beteiligten so401 Ebd. 402 Paulick, „Probleme“, S. 30. – Tatsächlich ergab sich die herausgehobene Position des Opernhauses erst aus einer Änderung der ursprünglichen Konzeption des „Forum Fridericianum“. Zunächst nämlich hatte das Gebäude zusammen mit einem Zwilling für die Akademie der Wissenschaften jeweils den räumlichen Abschluss einer riesigen Flügelanlage bilden sollen, die als Residenz des Königs geplant war. Erst durch die in der Nachbarschaft des Opernhauses tatsächlich verwirklichten kleiner dimensionierten Gebäude wie das Palais des Prinzen Heinrich (die heutige Humboldt-Universität), die Hedwigskathedrale und die Königliche Bibliothek erhielt die Oper ihren architektonisch herausgehobenen Status. Siehe dazu : Lange, Tribunal, S. 105. 403 Paulick, „Probleme“, S. 31. 404 Ebd., S. 30. – Die Charakterisierung der Lindenoper als klassizistischer Musentempel stammte nicht originär von Paulick. Schon seit Ende des 19. Jahrhunderts war diese bildungsbürgerliche Kunstvorstellungen spiegelnde Interpretation wiederholt vorgetragen worden. Siehe dazu : Lange, Tribunal, S. 205. Auch die Deutung Knobelsdorffs als Klassizist war älteren Ursprungs : Bereits 1928 glaubte der Architekt Eduard Fürstenau in Knobelsdorff aufgrund der „klare[n], schlichte[n] Gliederung“ des Opernhauses den „Schöpfer des Klassizismus“ sehen zu dürfen. Eduard Fürstenau, „Das Opernhaus im Laufe der Zeiten“, in : Julius Kapp (Hg.), 185 Jahre Staatsoper. Festschrift zur Wiedereröffnung des Opernhauses Unter den Linden am 28. April 1928, Berlin 1928, S. 119–168, hier S. 126.
154
Architektur
wie die ostdeutsche Presse generell wurden nicht müde, von den ästhetischen Schönheiten der neuen Lindenoper zu schwärmen. Intendant Max Burghardt etwa bezeichnete den Bau in Anlehnung an Walter Ulbrichts Rede auf dem III. Parteitag als „glanzvoller und schöner denn je“.405 Knobelsdorffs Architektur sei, so Paulick, vor allem von der Renaissancearchitektur Andrea Palladios sowie von den englischen Neo-Palladianisten seiner Zeit inspiriert worden. Als direktes Vorbild für den Portikus der Lindenoper habe Palladios berühmte Villa Rotonda gedient.406 Wenn die Tempel- beziehungsweise Klassizismus-These auch eine gewisse Plausibilität zu haben scheint, lässt sie sich doch architekturhistorisch nicht halten. So hat der Architekturwissenschaftler Hans Lange betont, dass der Portikus der Lindenoper gerade „nicht primär das ganze Bauwerk und seine Bestimmung“ adele, wie es für den Klassizismus charakteristisch sei. Stattdessen handele es sich lediglich um ein dem „spröden Kastenbau“ appliziertes „Zitat“, dem die Funktion zukomme, den „kostbaren Rahmen des erlauchten Stifternamens der Weiheinschrift über dem der königlichen Majestät vorbehaltenen Hauptportal“407 zu bilden, die lautete : „FRIDERICUS REX APOLLINI ET MUSIS“. In der Lindenoper die erste Verwirklichung eines Musentempels zu sehen, kann nur als Anachronismus gedeutet werden. Das Gleiche gilt für den Bühnenturm, der in seiner stilistisch nunmehr dem Rest des Gebäudes angepassten Dekoration aussieht, als habe Knobelsdorff selbst ihn entworfen. Tatsächlich begannen sich derartige Aufbauten erst allmählich im Laufe des 19. Jahrhunderts durchzusetzen und existierten Mitte des 18. Jahrhunderts noch nicht. Hatte Paulick in dem Bühnenturm zunächst eine Verschandelung der ursprünglichen Form gesehen, die sich selbst durch eine stilistische Angleichung nur teilweise beheben ließ, glaubte er diesen jetzt sogar als eine für den Klassizismus charakteristische „Bekrönung“ feiern 405 Max Burghardt : „Die Deutsche Staatsoper“, in : Neues Deutschland vom 04.09.1955. – Siehe zur ‚Schönheit‘ der Staatsoper auch die im I. Kapitel der Arbeit wiedergegebenen Äußerungen. 406 Paulick konnte in diesem Zusammenhang einen Entwurf Knobelsdorffs anführen, auf dem alle vier Seiten des Opernhauses ähnlich der Villa Rotonda mit einem Portikus versehen waren. Paulick, „Wiederaufbau“, S. 81/86. – Die neuere architekturhistorische Forschung hat statt dessen als direkte Vorlage für das Opernhaus inzwischen Colen Campbells Stichwerk Vitruvius Britannicus or the British architect von 1731 ausmachen können. Siehe dazu : Schwartz, Staatsoper, S. 14. 407 Lange, Tribunal, S. 106. Dort finden sich weitere Argumente gegen die Tempel-These.
Der Wiederaufbau der Deutschen Staatsoper Unter den Linden (1951–55)
155
zu dürfen, deren Vorbild er wiederum in der baulichen Überhöhung der Villa Rotonda erblickte. Der „Weg des Weiterbildens und Weiterkomponierens der Knobelsdorffschen Form“408, zu der sich Paulick berechtigt sah, da doch Friedrich II. seinen Baumeister teilweise an dessen klassizistischen Intentionen gehindert habe, hatte vor allem für den Zuschauerraum Folgen. Dessen Ergebnis stellt eine völlige Neuschöpfung Richard Paulicks dar. Da der preußische König diesen wichtigsten Raum des Opernhauses entgegen Knobelsdorff im „komfortablen und eleganten französischen Stil“409 ausgestaltet haben wollte, sei dieser ohne das Zutun des Baumeisters und „im Gegensatz zum maßvollen Äußeren […] von Nahl und Hoppenhaupt unorganisch und in schwülstiger Weise überdekoriert“410 worden. So glaubte Paulick, Knobelsdorff nachträglich zu seinem Recht zu verhelfen, indem er den Zuschauerraum in dem von diesem angeblich intendierten klassizistischen Stil dekorierte. Dazu wurden, wie der Architekturhistoriker Uwe Schwartz detailliert nachgewiesen hat, im Zuschauerraum wie in den anderen Räumen vor allem Elemente des Marmor- und des Parolesaals aus dem von Knobelsdorff 1745–47 erbauten Potsdamer Schloss Sanssouci kopiert. Für Paulick waren dies die einzigen Innenräume, die den „wahren Geist“411 Knobelsdorffs ohne vermeintliche Rokokoverfälschungen widerspiegelten. Dementsprechend hatte beispielsweise die Deckengestaltung des Zuschauerraumes ihr Vorbild in der Kuppel des Marmorsaals.412 Wenn sich die Dekoration im neuen Zuschauerraum nach dem Willen Paulicks auch betont schlicht ausnehmen sollte, lag ihr dennoch zusammen mit der traditionellen Farbgestaltung Weiß, Rot und Gold die Absicht zu Grunde, beim Publikum eine „festlich-intime Wirkung“413 zu evozieren. Der Zuschauerraum war dabei nur der Höhepunkt einer von der Eingangshalle über Garderoben und Foyers gesteigerten Festlich408 Paulick, „Probleme“, S. 37. 409 Ebd., S. 32. 410 Richard Paulick, „Über die Innenarchitektur der Deutschen Staatsoper Berlin“, in : Deutsche Architektur 4 (1955), S. 436–445, hier S. 439. – Dasselbe meinte Paulick im Übrigen von der Fassung Langhans d. J., die sich „schon bedenklich auf den überladenen wilhelminischen Stil“ zubewegt habe. Paulick, „Probleme“, S. 33. 411 Ebd., S. 39. 412 Schwartz, „,Knobelsdorff‘“, S. 119. 413 Paulick, „Wiederaufbau“, S. 92.
156
Architektur
keit. Allerdings war diese nicht etwa glamouröser Selbstzweck, sondern diente dem Ziel, das Publikum in eine „gehobene Stimmung“414 zu versetzen und „zur Sammlung [zu] zwingen“.415 Wenn Paulick auch in keinem seiner Texte explizit auf Richard Wagners Bayreuther Reformtheater als Vorbild verwies, bestanden doch zwischen dem Wiederaufbaukonzept der Lindenoper und jenem gewisse Parallelen : Wie Wagner lehnte Paulick zugunsten der Bildungsfunktion einen übertriebenen, nur der Zerstreuung des Publikums dienenden Prunk ab. So gab es hinsichtlich der Anordnung der Sitzplätze in Bezug auf die Bühne durchaus Gemeinsamkeiten. Wenn Paulick für die Lindenoper auch nicht auf eine amphitheatralische Sitzordnung zurückgriff, war er dennoch um eine Verbesserung der Sichtverhältnisse des Rangtheaters bemüht. Die erhebliche vertikale Staffelung der Sitze innerhalb der von Paulick konzipierten drei Ränge der Lindenoper erinnert zumindest an die stark ansteigenden Sitzreihen des Bayreuther Festspielhauses. Des Weiteren verzichtete Paulick auch auf ein in viele Logen gegliedertes Proszenium, wie es sich in Langhans Theatersaal gefunden hatte. Vom Proszenium aus nämlich hatte man nur eine schlechte Sicht gehabt. Schließlich führte Paulick die drei Ränge, ebenfalls zur Verbesserung des Sichtwinkels, auch bewusst nicht bis an die Bühne heran.416 Selbst wenn Paulick beim Wiederaufbau der Lindenoper nicht an das Bayreuther Reformtheater gedacht haben mag : Hier wie dort ging es darum, die Aufmerksamkeit des Publikums zugunsten des Theaters als eines Ortes der Bildung auf das Bühnengeschehen hin zu konzentrieren. Um die neue sozialistische Staatsoper zu einer Repräsentation der gesamten Nation zu machen, verzichtete Paulick darüber hinaus auch darauf, im Fond des 414 Paulick, „Innenarchitektur“ (1955), S. 437. 415 Ebd., S. 438. 416 Paulick stellte stolz fest, dass „mit Ausnahme weniger Plätze auf den äußersten Rangenden eine gute Sicht gewährleistet ist“. Paulick, „Wiederaufbau“, S. 91. – Sucht man für das Verhältnis von Zuschauerraum und Bühne, wie es in der neuen Lindenoper gestaltet war, im Theaterbau ein Pendant, findet man dies in den Rangtheatern, die Max Littmann im Anschluss an seine an Wagner anknüpfenden Amphitheater baute. In diesen scheinbar traditionellen Theaterbauten, zu denen etwa die im Zweiten Weltkrieg nicht zerstörte ehemalige Stuttgarter Hofoper (1911) gehörte, versuchte er, die Vorteile des Amphitheaters so weit als möglich auf die Form des Rangtheaters zu übertragen, was ihn zu ähnlichen Lösungen führte wie Paulick. Schaul, Prinzregententheater, 109ff.
Der Wiederaufbau der Deutschen Staatsoper Unter den Linden (1951–55)
157
ersten Ranges Logen einzurichten, hätten diese doch der neuen Gesellschaftsordnung nicht mehr entsprochen. Auch mit dieser Entscheidung lag er auf einer Linie mit dem Bayreuther Festspielhaus. Allerdings fanden sich in der Staatsoper dann doch Ausnahmen, welche den Anspruch sozialer Gleichheit im Arbeiterund Bauern-Staat letztlich konterkarierten. Ohne Unterteilung in Logen nämlich lief nur der zweite und dritte Rang durch. Im ersten Rang hingegen ließ Paulick die aus dem Nationalsozialismus stammende „Führerloge“ bestehen, auch wenn er deren Monumentalität deutlich zurücknahm. Auch im Proszenium fügte Paulick insgesamt zwei Logen ein, die nun aber tatsächlich riesig dimensioniert waren und sich über die Höhe von zwei Rängen erstreckten. Sie fungierten als Präsidenten- und Regierungslogen.417 Optisch herausgehoben wurden die beiden Proszeniumslogen nicht nur durch ihre überdimensionale Größe, sondern auch durch die – allerdings dezente – Verwendung des Staatswappens Hammer und Zirkel, das auf deren Brüstungen angebracht war. Über den Eingangstüren der beiden Logen befand sich darüber hinaus jeweils ein vergoldetes Stuckrelief mit Abbildungen von Demonstrationszügen, die an der Lindenoper vorbei über die Straße Unter den Linden zum Marx-Engels-Platz zogen.418 Was die übrigen vom Publikum begehbaren Räume der Staatsoper anbelangt, wurden auch diese von Paulick völlig neu erschlossen und dekoriert, sollten sie doch gegenüber den früheren Gestaltungen mehr Platz erhalten und repräsentativer wirken. Dazu erweiterte Paulick das Kellergeschoss mithilfe eines Durchbruchs durch die seitlichen Fundamente um zwei 40m lange Garderobenhallen. Einen ehemaligen Aufenthaltsraum im Zentrum des Untergeschosses, die sogenannte „Konditorei“, vergrößerte er darüber hinaus auf das Doppelte. Alle Räume wurden historisierend ornamentiert, wobei es der Architekt allerdings im Gegensatz zum Zuschauerraum mit dem Klassizismus nicht immer genau nahm, sodass hier bisweilen doch das ‚rückschrittliche‘ Rokoko und Barock anklangen. Als Hauptfoyer wurde der Apollosaal konzipiert, der auch für Staatsempfänge genutzt werden sollte. Wie der Theatersaal erhielt dieser Raum nicht seine ursprüngliche Gestalt von 1742 wieder, sondern wurde völlig neu im klas417 Allerdings waren die Proszeniumslogen nur „für festliche Anlässe und Kundgebungen“ vorgesehen, wie Paulick in seinem 2. Vorprojekt schrieb. Für den sonstigen Theaterbesuch von Vertretern der Politik sollte die Mittelloge des ersten Ranges Verwendung finden. 418 Schwartz, Staatsoper, S. 98.
158
Architektur
sizistischen Stil gestaltet. Auch hier gaben Marmor- und Parolesaal aus Schloss Sanssouci die architektonischen Vorbilder ab. Aus ersterem kopierte Paulick das ovale Fußbodenmosaik exakt im Maßstab 1 :1, aus Letzterem übernahm er das Motiv der korinthischen Doppelsäulen.419 Einer geräumigeren Gestaltung der Lindenoper sowie bestmöglichen technischen Bedingungen diente schließlich die Auslagerung aller Magazin-, Verwaltungs- und Probenräume in einen an der linken Rückseite des Opernhauses gelegenen Neubau. Das in einem historisierenden Stil entworfene Gebäude wurde durch einen Tunnel mit dem Opernhaus verbunden. Die technischen Möglichkeiten, die sich daraus für die künstlerische Arbeit ergaben, pries Paulick als geradezu einzigartig : „Wohl kaum ein anderes Theater bisher“420 habe solche guten Bedingungen besessen. Diese entsprachen den hohen kulturpolitischen Anforderungen an die Qualität der zukünftigen Staatsopern-Aufführungen, welche der Bühne doch den Status einer Musterbühne des sozialistischen Staates einbringen sollten. Der kulturpolitischen Vorgabe entsprechend, die fortschrittlichen nationalen Bautraditionen zu pflegen, wurde der Gegensatz zwischen fortschrittlichem Klassizismus und rückschrittlichem Rokoko im Zusammenhang mit der Staatsoper auch zu einem Gegensatz zwischen nationaler und nicht-nationaler Kunst stilisiert. Demnach war vom „Rokoko des französischen Stils“421 die Rede, gegen den die spezifisch deutsche Architektur Knobelsdorffs abgegrenzt wurde. Dabei ging Paulick so weit, die Lindenoper zum Stiftungsbau einer nationalen Opern architektur zu erheben und zu einem Vorbild für den Theaterbau im sozialistischen deutschen Staat. Dagegen distanzierte man sich von der zeitgenössischen Theaterarchitektur in der Bundesrepublik, die man – ursprungsmythologisch argumentierend – als formalistisch-volksfremd kritisierte, da sie nicht an die klassischen nationalen Bautraditionen anknüpfe. Als Negativbeispiel dienten etwa die Entwürfe zum Neubau des kriegszerstörten Mannheimer Nationaltheaters, die von Hans Hopp 1954 in der DDR-Zeitschrift Deutsche Architektur einer grundlegenden Kritik unterzogen wurden. Hopp missfiel, dass allen Entwürfen, ob demjenigen von Ludwig Mies van der Rohe, Hans Scharoun oder Otto Ernst 419 Ebd., S. 116, 83ff. 420 Paulick, „Wiederaufbau“, S. 92. 421 Paulick, „Innenarchitektur“ (1953), S. 265.
Der Wiederaufbau der Deutschen Staatsoper Unter den Linden (1951–55)
159
Schweizer dieselbe Konstruktionsform zugrunde liegen würde : die eines Industriebaus. Im Rückgriff auf die alte bildungsbürgerliche Vorstellung vom gleichsam sakralen Charakter der Kunst meinte der Autor : „Der Besucher, der zu einem besonderen Erlebnis ins Theater geht, zu einem Erlebnis, das seinen Alltag erhöht, sieht nur einen Industriebau vor sich, wie er ihn täglich an seiner Arbeitsstätte erlebt. Die Architektur eines Theaters hingegen sollte ihn auf das Erlebnis des Abends vorbereiten.“ In den genannten Theaterentwürfen würden die „reichen Erfahrungen der Menschheit in der Architektur“, als deren Gipfelpunkt er die Klassik ansah, verleugnet. So seien die Mannheimer Entwürfe Ausdruck einer „Barbarisierung der Architektur“ und eines „Verlustes an Werten“.422 Da die ursprüngliche lateinische Giebelinschrift der Lindenoper angesichts des Wiederaufbaus als eine „Nationaloper“ für den sozialistischen deutschen Staat zu einem Anachronismus geworden war, ist es nicht verwunderlich, dass diese vor der Eröffnung im März 1955 gegen die Lettern „DEUTSCHE STAATSOPER“ ausgetauscht wurde.423 Diese Maßnahme allerdings sollte Erich Kleiber wenig später zum Anlass für seinen endgültigen Rückzug von der Lindenoper nehmen. e) Rezeption des Wiederaufbaus
Während die wiederaufgebaute Lindenoper auf ostdeutscher Seite hymnisch gefeiert wurde, war die Rezeption des Baus in der westdeutschen Presse demgegenüber überwiegend negativ.424 Doch gab es auch hier mehr Lob, als an422 Hanns Hopp, „Die Entwürfe zum Nationaltheater in Mannheim“, in : Deutsche Architektur 3 (1954), S. 212–215, hier S. 215. Dass kein vergleichbarer Text zum Wettbewerb für den Neubau der Städtischen Oper von 1953 vorliegt, mag mit dem zu jener Zeit aus Sicht der DDR noch geringeren Symbolwert dieses Opernhauses gegenüber dem traditionsreichen Mannheimer Nationaltheater zu tun haben. Bereits 1954, also noch vor dem Beschluss zu einem Opernneubau in Charlottenburg, kam es im ostdeutschen Staat zu einem erneuten architekturpolitischen Kurswechsel. Orientiert an der Sowjetunion lautete die Devise ab jetzt „besser, billiger und schneller bauen“, womit auch im Osten grundlegende Prinzipien der westlichen Architekturmoderne Einzug erhielten. 423 Wohl von Intendant Max Burghardt existieren drei allerdings verworfene Alternativvorschläge für eine neue Giebelinschrift : „RES PUBLICa – Apollini et Musis“, „Was Fridericus den Musen gewidmet, / hat das deutsche Volk wieder aufgebaut“ und „Anno 1742 Fridericus Rex Apolloni [sic] et musis / Anno 1955 refecit populo“ [sic]. LAB, C Rep. 167, Nr. 46. 424 Zur Rezeption siehe auch : Simone Hain, „Richard Paulicks Wiederaufbau des Forum Frideri-
160
Architektur
gesichts der Polarisierung im Kalten Krieg zu erwarten gewesen wäre. Die Außenarchitektur etwa wurde übereinstimmend positiv gewertet. Selbst im sonst gegenüber dem Osten besonders kritischen Tagesspiegel war die Rede von einer „geschmackvolle[n] Wiederherstellung des ursprünglich tempel- und palastartigen Aussehens“.425 Gelobt wurde darüber hinaus bisweilen sogar die Innenarchitektur der Oper. Die Welt bezeichnete den Zuschauerraum als „gelungensten Raum des neuerbauten Hauses“, der mit seinen drei Rängen als harmonisch proportioniert und auch mit „seine[r] farbliche[n] Abstimmung auf Rosa, Elfenbein und Gold“426 als angenehm empfunden wurde. Bei den positiven Urteilen mag indes eine Rolle gespielt haben, dass nicht jedem Journalisten bewusst gewesen sein wird, wie groß der Unterschied zwischen der historischen Innenarchitektur von 1742 und der Fassung des Jahres 1955 war und dass vor allem der Zuschauerraum eine Neuschöpfung Paulicks war427, obgleich dieser den Sachverhalt nie bestritten hatte.428 Insgesamt aber dominierte im Westen die Meinung, dass die Innendekoration der Oper ‚falsch‘ und der Bau überhaupt von einer materiellen Maßlosigkeit geprägt sei. Die FAZ kritisierte, dass das Gebäude „Unmassen an Geldern und Arbeitsstunden verschlungen“429 habe. Im Tagesspiegel war zu lesen, im Inneren herrsche ein „Mangel an Stil bei der Verwendung des Kunstmarmors zu falschem Prunk und im phantasielosen Rokoko-Dekor“.430 Die Süddeutsche Zeitung wiederum konstatierte : „Bestürzend wirkt fast der Prunk in allen Necianum“, in : Sanieren, S. 22–28, hier 27f. 425 Heinz Kersten, „Was geschah seit 1945 ?“, in : Der Tagesspiegel vom 04.09.1955. 426 „Ost-Berlins mondänes Fest“, in : Die Welt vom 06.09.1955. Auch die FAZ äußerte anerkennend, das Innere wirke „durch die gelungene Verbindung alter Stilgrenzen mit modernen Materialverarbeitungsverfahren […] geschmackvoll und zweckentsprechend.“ Egon Strohm, „Knobelsdorff redivivus“, in : Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 21.02.1955. 427 Sogar ein Fachmann wie der Architekt der Deutschen Oper Fritz Bornemann hielt, wie ein Text von 1958 belegt, den Wiederaufbau der Lindenoper für angemessen im Sinne der Denkmalpflege. Fritz Bornemann, „Gedanken zum Wiederaufbau des Deutschen Opernhauses Berlin“, in : Bühnentechnische Rundschau 52 (1958), Heft 3, S. 10–11, hier S. 10. 428 Selbst in einer westdeutschen Fachzeitschrift wie der Bühnentechnischen Rundschau gestand Paulick offen ein, dass es sich beim Zuschauerraum der Lindenoper des Jahres 1955 um eine Neuschöpfung handele. Richard Paulick, „Der Wiederaufbau der Deutschen Staatsoper Berlin“, in : Bühnentechnische Rundschau 45 (1955), Heft 5, S. 11–13, hier S. 11. 429 Egon Strohm, „Knobelsdorff redivivus“, in : Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 21.02.1955. 430 Heinz Kersten, „Was geschah seit 1945 ?“, in : Der Tagesspiegel vom 04.09.1955.
Der Neubau der Deutschen Oper in Charlottenburg (1951–61)
161
benräumen. […] Paßt all das in die Gegenwart, paßt es vor allem in den Arbeiter- und Bauernstaat ?“431 Kritisiert wurde besonders das neue Verwaltungsgebäude, von dem sich die FAZ „beinahe schokiert“ [sic] zeigte : Ein Beobachter habe gemeint, „man müsse sich Filzpantoffeln anziehen, sonst hätte man ein schlechtes Gewissen, in den Räumen hin und her zu gehen. Er habe das Gefühl gehabt, sich nicht in einer nüchternen Intendantur und Arbeitsräumen, sondern in den Fuggersälen von Augsburg zu befinden. Die Probenräume für das Ballett sind fast prunkvoll ausgestattet, und die Umkleideräume für die Tänzer und die Garderoben der Solisten gleichen Boudoirs. […] Der Raum des Intendanten ist mit einem Luxus ausgestattet, den sich kaum ein Ministerpräsident leisten würde.“ Von diesem Prunk, so wurde vermutet, versprächen sich die „Kulturstellen des Sowjetsektors […] nicht nur, dass Künstler […] von der Atmosphäre des Opernhauses und von der Sorge des Staates um die Künstler tief beeindruckt sind. […] Bei den Ausländern, die die Verhältnisse Berlins nicht genau kennen“, solle der Eindruck erweckt werden : „,Was wollt ihr eigentlich. In Berlin haben es die Menschen doch sehr gut !‘ Sie sollen das arme West-Berlin vergessen, das nicht weiß, wie es die inzwischen unmoderne Städtische Oper renovieren und wie es einen Kredit dafür erlangen kann.“432 Nicht ohne Häme registrierte somit der West-Berliner Kurier bereits 1959 erste Verfallserscheinungen an der neuen Lindenoper : „Obwohl sie erst vor drei [sic] Jahren wiedereröffnet wurde, bröckelt bereits der Putz von der Fassade.“433
2. Der Neubau der Deutschen Oper in Charlottenburg (1951–61) a) Der Wettbewerb
Im Mai 1955 widmete sich das Darmstädter Gespräch, eines der einflussreichsten Diskussionsforen der jungen Bundesrepublik, dem Thema Theater. Es wurde begleitet von einer umfangreichen Ausstellung zur Geschichte des Theaterbaus. 431 Gabriele Müller, „In rosa Glanz erstrahlt die neue Deutsche Staatsoper“, in : Süddeutsche Zeitung vom 13./14./15.08.1955. 432 Christian am Ende, „Ein Opernhaus für 55 Millionen Ostmark“, in : Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 15.01.1955. 433 Foto mit Kommentar in : Der Kurier vom 26.03.1959.
162
Architektur
Sie wurde mit einem Vortrag des Architekten Werner Kallmorgen eröffnet, der stellvertretend für seine Kollegen grundlegende Probleme des gegenwärtigen Theaterbaus in Westdeutschland artikulierte. Für Kallmorgen waren die seinerzeitigen Schwierigkeiten eine Spätfolge der Jahre nach dem Ersten Weltkrieg. Als die Höfe 1918 aufgelöst worden seien, hätten die Bürger die ehemaligen Hoftheatergebäude und die damit überkommenen Repräsentationsformen einfach übernommen, ohne sich über eine der Demokratie angemessene neue Formensprache klar zu werden. Durch die Zerstörung vieler alter Theater im Zweiten Weltkrieg sei eine Lösung dieses Problems nun drängend geworden : „Es ist tragisch, daß die demokratische Gesellschaft sich noch nicht soweit selbstverständlich empfindet, daß sie die ihr gemäße Repräsentation prägen konnte.“434 Zwar bestehe über eine an der architektonischen Moderne orientierte Gestaltung Konsens. So sollten die neuen Theater „mit Recht nicht Säulen mehr tragen und nicht mit neun Musen geschmückt sein, die heute mit einer preisgekrönten Damenriege verwechselt werden könnten“. Wie die neuen Gebäude aber stattdessen formal und hinsichtlich einer dekorativen Gestaltung auszusehen hätten, sei unter den Architekten keineswegs geklärt : „Bei uns ‚stimmt‘ nichts mehr, alles muß neu erarbeitet werden, wir kommen nicht darum herum.“ Eine besondere Schwierigkeit ergebe sich dadurch, dass die neuen Theater „auch noch einfach wirken“ müssten „und dabei ‚festlich‘. Und das ist das Allerschwerste an der Sache : keiner weiß, wie die neue Festlichkeit aussehen muß. […] Chrom statt korinthischer Säule tut es freilich nicht.“435 Interessant ist an Kallmorgens Äußerungen, dass eine festliche Dekoration in den bundesrepublikanischen Theaterbauten der Nachkriegszeit entgegen dem Vorwurf der DDR, wie ihn Hans Hopp im Zusammenhang mit den Mannheimer Theaterentwürfen vorgebracht hatte, sehr wohl eine Rolle spielte. Allerdings herrschte keine Einigkeit darüber, wie diese Festlichkeit architektonisch zu gestalten sei. Die von Kallmorgen beschriebenen Schwierigkeiten, eine angemessene Theaterbauform und eine neue Art festlicher Dekoration zu finden, beschäftigten auch die Jury und die beteiligten Architekten des zweistufigen Wettbewerbs zum Neubau des Opernhauses in Charlottenburg. Man war sich einig, dass 434 Vietta, Gespräch, S. 22. 435 Ebd., S. 23.
Der Neubau der Deutschen Oper in Charlottenburg (1951–61)
163
das stark kriegsbeschädigte Deutsche Opernhaus von Heinrich Seeling aus dem Jahr 1912 nicht wiederhergestellt werden sollte, da die monumental-repräsentative Architektur der wilhelminischen Zeit nach 1945 allgemein wenig geschätzt wurde. So war es bereits 1951 zu ersten Gesprächen über einen Neubau gekommen, wollte man doch die baulich unzureichende Interimsspielstätte in der Charlottenburger Kantstraße möglichst schnell verlassen. Als in Ost-Berlin der Wiederaufbau der Lindenoper sichtbar voranschritt, wurde das Projekt drängender, sodass der Senator für Bau- und Wohnungswesen 1953 einen Ideenwettbewerb ausschrieb, dessen sieben beste Beiträge man zu einer zweiten Wettbewerbsstufe einladen wollte.436 Dass der Kreis der Teilnehmer in diesem Wettbewerb auf ausländische Architekten ausgedehnt wurde, was in den 1950er-Jahren durchaus noch nicht üblich war, und mit André Sonrel ein international bekannter französischer Bühnentechniker in die Jury berufen wurde, zeigt, dass das Projekt ehrgeizig angelegt war.437 Dennoch blieben Beiträge der berühmtesten westlichen Architekten der Zeit, wie etwa von Ludwig Mies van der Rohe oder auch von Hans Scharoun, die viel beachtete Entwürfe für die Theater von Mannheim beziehungsweise Kassel vorgelegt hatten, aus. Der Grund dafür waren die eng gefassten Wettbewerbsvorgaben, welche die Gestaltungsfreiheit der Architekten stark einengten438 : Aus Kostengründen war beschlossen worden, das weitgehend erhaltene Bühnenhaus einschließlich des Bühnenturms, auf den man wie bei der Ost-Berliner Staatsoper nicht verzichten wollte, in den Neubau zu integrieren.439 Somit war von den Architekten nur die Planung des Zuschauerhauses gefordert. Dessen Anlage und Ausdehnung jedoch waren ebenfalls festgelegt, sowohl in Richtung Bühne, deren Maße und Portalgröße aus dem Seelingschen Deutschen Opernhaus übernommen werden mussten, als auch zur anderen Seite hin, wo die mehrspurige Bismarckstraße verlief. 436 K. H. Wuthe, „Das Opernhaus an der Bismarckstraße“, in : Deutsche Oper Berlin. Zur feierlichen Eröffnung des Hauses. September 1961, Berlin 1961. 437 Werner Harting, „Gedanken zum Wettbewerb des ‚Deutschen Opernhauses‘ in Berlin“, in : Bauwelt 44 (1953), S. 621–622. 438 Siehe dazu : Will Grohmann, „Opernhaus-Wettbewerb“, in : Die Neue Zeitung vom 11.10.53. 439 Werner Harting hatte in der Zeitschrift Bauwelt die einschränkenden Vorgaben des Wettbewerbs scharf kritisiert und im Kontext der inszenatorischen Neuerungen Wieland Wagners für den Verzicht auf einen Bühnenturm plädiert. Harting, „Gedanken“, S. 621f.
164
Architektur
Der erste Preis der zweiten Wettbewerbsstufe ging 1955 schließlich an den Berliner Architekten Fritz Bornemann, dessen Entwurf dann auch baulich umgesetzt wurde. Wenn Bausenator Rolf Schwedler bei der öffentlichen Bekanntgabe der Planungsergebnisse lobend feststellte, „daß der Entwurf des Preisträgers in künstlerischer und technischer Hinsicht dem entspräche, was man bei einem solchen Neubau erwarte“440, war sich die Jury jedoch intern einig, dass „das Gesamtergebnis des Wettbewerbes enttäuschend“441 sei. Allerdings könne der Entwurf Bornemanns als „den anderen Arbeiten wesentlich überlegen“ angesehen werden. In der schriftlichen Begründung würdigte das Preisgericht vor allem dessen Funktionalität und Schlichtheit : „Die Gruppierung der Baumassen und die äußere Gestaltung des Zuschauerraumes sind klar und einfach.“442 Auch wurde hervorgehoben, dass der Verfasser „mit einem viel geringeren Bauvolumen als alle anderen Wettbewerbsteilnehmer“ auskomme. Lediglich was die Festlichkeit anging, war man nicht recht zufrieden. Allerdings, hieß es in der Begründung, könne „eine evtl. geforderte festlichere Wirkung […] des Zuschauerraums […] ohne besondere Schwierigkeiten durchgeführt werden.“443 b) Die architektonische Konzeption Fritz Bornemanns
Fritz Bornemann schuf ein Gebäude ohne antikisierende Säulen, Musenfiguren, Freitreppe oder andere historisierende architektonische Elemente, wie man sie von älteren Opernbauten gewohnt war und wie sie sowohl die Ost-Berliner Staatsoper als auch noch der Charlottenburger Vorgängerbau enthalten hatten. Bornemanns Bau bestand aus einem schlichten Kubus, der sich zu den Seiten hin durch große Fensterfronten öffnete, während er gegen die Bismarckstraße durch eine 70 Meter lange und 14 Meter hohe Wand hermetisch abgeschlossen war. Dieser Wand ließ er 88 quadratische, mit großen Flusskieseln bestückte Waschbetonplatten applizieren. Als eigentlicher Schmuck dieser außerordentlich schlichten Fassade diente einzig eine dem Bau vorangestellte 20 Meter hohe 440 „Bornemann 1. Preisträger“, in : Der Tagesspiegel vom 23.09.1955. 441 Niederschrift über die Sitzung des Preisgerichts am 22. September 1955. LAB, B Rep. 014, Nr. 2468. 442 Rolf Schmalor (Hg.), Theater und Konzerthäuser. Architektur-Wettbewerbe, Stuttgart 1960, S. 80. 443 Ebd.
Der Neubau der Deutschen Oper in Charlottenburg (1951–61)
165
abstrakte stählerne „Kunst am Bau“-Skulptur des Bildhauers Hans Uhlmann. Die Skulptur, die sich einer Pflanze ähnlich vom Straßenniveau aus erhob, verknotete sich gleichsam im mittleren Bereich, um dann senkrecht in die Höhe auszuschlagen. Den Eingang zur Oper platzierte Bornemann, ohne ihn baulich hervorzuheben, unterhalb der einige Meter nach vorne auskragenden Fassadenwand. Indem der Architekt die konstruktive Machart eines Baus bewusst kenntlich machte – die Gebäudeseiten etwa lassen das Betongerüst deutlich sichtbar werden – zeigte er sich als typischer Vertreter jenes Funktionalismus, mit dem in Westdeutschland nach 1945 an die Moderne-Konzepte der 1910er- und 1920er-Jahre angeknüpft wurde.444 Bornemanns Oper stand damit in einer Linie mit dem westdeutschen Vorzeigebau der 1950er-Jahre, Egon Eiermanns und Sep Rufs deutschem Pavillon für die Weltausstellung in Brüssel 1958. Mit dessen offen und leicht erscheinender Glas-Stahl-Konstruktion hatten die beiden Architekten bewusst einen Kontrast zu jener monumental-steinernen Ästhetik gesucht, von welcher die Bauten Albert Speers für die Pariser Weltausstellung 1937 geprägt waren.445 Genau wie Eiermann und Ruf ging es auch Bornemann darum, einen „Ausdruck für die Demokratie- und Kultursehnsucht“ der frühen BRD zu finden und nach den Jahren des Nationalsozialismus „durch Bescheidenheit einen Neuanfang zu suchen“446, wie die Architekturhistoriker Susanne Schindler und Nikolaus Bernau formuliert haben. Dass Bornemann das alte Charlottenburger Deutsche Opernhaus, in welches durch den Umbau Paul Baumgartens von 1935 „das Helle, Glänzende, ja mitunter sogar AufwendigLuxuriöse seinen Einzug“447 gehalten hatte, wie ein Chronist des Opernhauses später formulierte, aus eigener Anschauung kannte, bedeutete für ihn eine zusätzliche Verpflichtung : Von jener äußerlichen Festlichkeit des Nationalsozialismus wollte sich der Architekt mit seinem Bau distanzieren.448 444 Ulrich Conrads, „Die Deutsche Oper Berlin“, in : Bauwelt 52 (1961), S. 1285–1289, hier S. 1286. 445 Paul Sigel, „Der inszenierte Staat. Zur Geschichte der deutschen Pavillons auf Weltausstellungen“, in : Asendorf/Voigt/Wang, Botschaften, S. 50–59. 446 Schindler, Moderne, S. 9. 447 Bollert, Oper, S. 8. Baumgarten selbst hatte es als seine Aufgabe bezeichnet, den Zuschauerraum „festlicher zu gestalten“. Paul Baumgarten, „Der Umbau des Deutschen Opernhauses in Charlottenburg“, in : Zentralblatt der Bauverwaltung 56 (1936), S. 45–52, hier S. 46. 448 Noch im hohen Alter bezeichnete es der Architekt als seine Überzeugung, dass man das „He-
166
Architektur
Allerdings wendete sich diese neue Art architektonischer Repräsentation nicht nur gegen den Nationalsozialismus, sondern auch gegen die DDR, deren Sozialistischer Realismus im Westen allgemein als Fortsetzung der Monumentalität des „Dritten Reiches“ empfunden wurde. Ihren prägnantesten Ausdruck fand der Wettbewerb der beiden konkurrierenden deutschen Architektursprachen der 1950er-Jahre in den Berliner städtebaulichen Großprojekten Stalinallee und Hansaviertel. Als Antwort auf jenes östliche ‚Schaufenster‘-Projekt zwischen Strausberger Platz und Frankfurter Allee entstand im Westen am Rande des Tiergartens mit dem neuen Hansaviertel eine Siedlung, mit der an die städtebaulichen Prinzipien der Charta von Athen angeknüpft wurde. Im Gegensatz zur östlichen Orientierung an nationalen Traditionen galt hier der Internationale Stil als leitend. Eingeladen wurden neben deutschen Architekten die renommierten Vertreter Westeuropas und Amerikas, wodurch „dem westlichen Ausland […] die Rückkehr Deutschlands unter die der Moderne verpflichteten zivilisierten Kulturnationen“449 demonstriert werden sollte. Die Ergebnisse dieses Vorzeigeprojekts wurden im Rahmen der Internationalen Bauausstellung (Interbau) 1957 der Öffentlichkeit präsentiert. Zwar war Fritz Bornemann nicht mit einem architektonischen Beitrag an der Interbau beteiligt.450 Allerdings hatte er jedoch bereits 195254 ein „Schlüsselwerk der West-Berliner wie auch der westdeutschen Nachkriegsarchitektur“451 im Internationalen Stil geschaffen : die Amerika-Gedenkbibliothek. Der von den USA finanzierte Bau war ebenfalls Ausdruck der kulturellen Konkurrenz zwischen den beiden deutschen Staaten. Am südlichen Ende der Friedrichstraße gelegen sollte er mit seinem weithin sichtbaren Schriftzug „Gedenkbibliothek“ den Ost-Berlinern am anderen Ende der Straße als Denkmal freiheitlicher westlicher Kultur bei Nacht entgegenleuchten. Auch in anderem Zusammenhang war Bornemann, der im roische“, von welchem die Zeit des Nationalsozialismus ästhetisch geprägt gewesen sei, „von der Oper wegnehmen musste“. Mitschnitt eines Interviews des Autors mit Fritz Bornemann vom 22.10.2005. 449 Gabi Dolff-Bonekämper und Franziska Schmidt, Das Hansaviertel – Internationale Nachkriegsmoderne in Berlin, Berlin 1999, S. 40. 450 Statt Bornemanns Entwurf für einen Berlin-Pavillon wurde derjenige Hermann Fehlings gebaut. Schindler, Moderne, S. 149. 451 Eva von Engelberg-Dočkal, „Bornemanns Bibliotheken in Berlin und Bonn“, in : Schindler, Moderne, S. 27–47, hier S. 27.
Der Neubau der Deutschen Oper in Charlottenburg (1951–61)
167
Hinblick auf die NS-Zeit als politisch unbelastet gelten konnte, eng mit der Systemkonkurrenz verflochten.452 Seit 1950 gestaltete er für die United States Information Agency (USIA) Ausstellungen wie Wir bauen ein besseres Leben (1952), Atom (1954) oder Farmlive USA (1960), mit denen in Deutschland und anderen Ländern Europas für den American Way of life geworben werden sollte. Somit war auch Fritz Bornemanns neue Charlottenburger Oper ein „Gegenbau“ zum Sozialistischen Realismus.453 Wie löste Bornemann schließlich innenarchitektonisch die von Kallmorgen benannten Theaterbauprobleme in seinem Opernhaus ? Welche Rolle spielte die Bildungsfunktion in seiner Konzeption ? Wie setzte er die von der Jury geforderte Festlichkeit um ? Schließlich : Wie gab er der demokratischen Staatsform architektonisch Ausdruck ? Bornemann griff in seinem Zuschauerraum die Sitzordnung des Bayreuther Festspielhauses auf.454 Die Plätze im Parkett gestaltete er stark ansteigend und richtete sie konzentrisch auf die Bühne hin aus. Um 1.900 Zuschauer im Saal unterbringen zu können, entwarf er zwei Ränge. Zwar ordnete er diese um das Parkett herum an.455 Doch hatte deren Form mit den herkömmlichen Rangtheatern nichts gemein. Die Rangplätze nämlich wurden genau wie diejenigen im Parkett strikt auf die Bühne hin ausgerichtet. Bornemann begründete diese Entscheidung mit dem Unterschied in der kulturellen Praxis des Theaterbesuchs zwischen Gegenwart und Vergangenheit : „Früher im Barock saß bei hellerleuchtetem Zuschauerraum die festliche höfische Gesellschaft während des Spiels, aber auch während der vielen langen Pausen. In einer ganz anderen Situation befinden wir uns heute. Der Zuschauerraum ist verdunkelt, das Spiel auf der 452 Susanne Schindler, „Bornemann über Bornemann. Über die Eitelkeit der Bescheidenheit“, in : Schindler, Moderne, S. 11–24, hier S. 19. 453 Bei der Entscheidung der Jury für den Architekten scheint keine amerikanische Einflussnahme bestanden zu haben Der Bevollmächtigte der BRD in Berlin sprach in einem Brief an das Bundeskanzleramt vom 25.03.1955 davon, dass die „amerikanische Dienststelle in Berlin […] lediglich dem Senat von Berlin gegenüber den Neubau eines Opernhauses als wünschenswert bezeichnet“ hätte, „weil [auch] im Ostberliner Raum ein neues Opernhaus“ entstünde. BArch, B 136/2385. 454 Kilian, „Raumbildungen“, S. 56. 455 In diesem Sinne hatte auch schon Max Littmann in seinem amphitheatralischen Schillertheater in Berlin einen Rang mit konzentrisch auf die Bühne ausgerichteten Sitzplätzen hinzugefügt.
168
Architektur
Bühne oder Vorbühne wird […] zum konzentrierten optischen Erleben.“456 Da das Publikum die Pausen gegenwärtig in den Foyers verbringe, sei es nicht mehr sinnvoll, wie im Barock einen „festlich dekorierten Raum mit rundherumlaufenden Rängen oder umlaufenden Logen“457 zu entwerfen. Indem es Bornemann als das „Wesentlichste“ seiner Konzeption bezeichnete, „im Sinne unserer Zeit die geistige Resonanz zur Oper herbeizuführen“458 und sich damit von einem auf Unterhaltung zielenden Verständnis von Opernkultur distanzierte, präsentierte auch er sich letztlich als Exponent der Bildungsfunktion der Kunst. Zugunsten der Kommunikation zwischen Zuschauer und Bühne richtete er nicht nur alle Plätze zur Bühne hin aus, sondern vermied auch bewusst, „durch emotionelle Reize, durch zu viele Details und durch die Verwendung vieler Materialien und Farben die Konzentration auf die Handlung zu gefährden“.459 Indem Bornemann seine Theaterarchitektur funktionalistisch als dienende Hülle auffasste, entsprach er der Position Richard Wagners, dem es beim Bayreuther Festspielhaus ja ebenfalls um Funktionalismus gegangen war.460 Die Gemeinsamkeiten beider Bauten erstrecken sich bis in die Konstruktion hinein : Ist beim Festspielhaus das funktionale Holzgerüst des Fachwerks außen unverkleidet sichtbar, ist es bei der Deutschen Oper die Betonkonstruktion. Wie verhielt es sich in diesem Zusammenhang mit der Frage der Festlichkeit ? Bornemann äußerte dazu im Sinne Kallmorgens : „Unter dem Begriff ‚Festlichkeit‘ des Theaterraumes sei nicht der Pseudoglanz einer Formensprache verstanden, die Vergangenes imitieren oder Elemente früherer Stile in unsere Zeit transportieren will.“461 Seiner Auffassung nach hatte sich die Festlichkeit vielmehr aus dem Geschehen auf der Bühne selbst zu ergeben, sollte der „Glanz
456 Bornemann, „Gedanken“, S. 11. 457 Ebd. 458 Fritz Bornemann, „Opernraum und Kommunikation“, in : Deutsche Oper Berlin. Zur festlichen Eröffnung des Hauses. September 1961, Berlin 1961, o. S. 459 Ebd. 460 Zeitweise war sogar geplant, das Prinzip des verdeckten Orchestergrabens des Bayreuther Festspielhauses, durch welchen ebenfalls eine Ablenkung des Publikums vom Bühnengeschehen verhindert werden sollte, in modifizierter Weise zu übernehmen. Josef Hausen, „Ein Haus für schöne Stimmen“, in : Der Tagesspiegel vom 20.12.1957. 461 Bornemann, „Opernraum“.
Der Neubau der Deutschen Oper in Charlottenburg (1951–61)
169
Amphitheatralischer Zuschauerraum der Deutschen Oper. Eröffnungspremiere am 24. September 1961, in der Mitte des ersten Ranges Bundespräsident Heinrich Lübke und der Regierende Bürgermeister Willy Brandt.
170
Architektur
einer Aufführung den Raum festlich beherrschen“.462 Der Saalarchitektur kam dabei lediglich die Funktion zu, diesen Glanz in den Aufführungspausen nicht abbrechen zu lassen. Dem Zuschauerraum gab er deswegen nicht die im Theaterbau übliche Farbkombination Weiß-Rot-Gold, wie sie etwa noch Paulick bei der Lindenoper verwendet hatte, sondern eine dunkle Verkleidung aus afrikanischem Cebrano-Holz. Dieses war während der Aufführung kaum wahrnehmbar, in den Pausen aber konnte es durch Lichtreflexe den gewünschten festlichen Glanz hervorrufen. Damit die Darbietungen der zukünftigen West-Berliner Musterbühne die gewünschte festliche Wirkung entfalten konnten, erhielt die Bühne des neuen Opernhauses eine an modernsten Standards ausgerichtete technische Ausstattung.463 Zielte schon Bornemanns Anordnung der Sitzplätze zur Bühne hin darauf, das gesellschaftliche Sehen-und-Gesehen-Werden zugunsten der Bildungsfunktion in den Hintergrund treten zu lassen, übertrug er diese Absicht sogar auf die beiden übereinander gelegenen Foyers. Dabei war das zunächst gar nicht intendiert. Zwar hatte der Architekt diese Pausenräume schon in seiner ursprünglichen Planung als Orte der „Besinnung“ auf das Erlebte vorgesehen, doch genauso war daran gedacht, dass hier die „Erscheinung des festlich gekleideten Besuchers“464 und somit der gesellschaftliche Aspekt in ausreichendem Maße zur Geltung kommen sollte. In der Schlussphase der Bauarbeiten jedoch entschied sich Bornemann dafür, selbst die Foyers nicht mehr als Orte gesellschaftlicher Kommunikation zu gestalten : Von dem Kunsthistoriker Will Grohmann beraten, platzierte er in den beiden Hallen zeitgenössische Kunstwerke. Es handelte sich um insgesamt fünf große abstrakte Skulpturen von Jean Arp, Fritz Wotruba, Kenneth Armitage, Henry Moore und Henri Laurens sowie ein Wandbild von Ernst Wilhelm Nay. Die beiden Foyers wurden nun bewusst dunkel gehalten, um die eigens beleuchteten Kunstwerke optisch hervorzuheben. In der Eröffnungsfestschrift erläuterte Grohmann, es sollten dadurch „Blickpunkte“ geschaffen werden, „damit das Interesse des Opernbesuchers außerhalb des Zuschauerraumes auf etwas konzentriert wird, was ihn davor bewahrt, nur 462 Ebd. 463 Siehe dazu : Walther Unruh, „Die Bühnentechnik in der Deutschen Oper Berlin“, in : Bauwelt 28 (1961), S. 805–807. 464 Bornemann, „Gedanken“, S. 11.
Der Neubau der Deutschen Oper in Charlottenburg (1951–61)
171
sich selbst und seinen Nächsten zu sehen, prominierender [sic] Gast einer großen ‚Party‘ zu sein“.465 Auch in den Foyers also erhielt die bildende Funktion der Kunst Vorrang vor einer unterhaltenden. In seiner Schlichtheit und Funktionalität hebt sich Bornemanns Opernhaus von der Vielzahl neuer westdeutscher Theaterbauten der „Happy Fifties“ ab, in denen es scheint, als sei es, wie Wolfgang Pehnt formuliert hat, „mehr auf die Inszenierung des Publikums als die der Schauspieler [bzw. Opernsänger, FB] angekommen“.466 Ein Telegramm des ansonsten der Moderne gegenüber aufgeschlossenen designierten Intendanten der Deutschen Oper Gustav Rudolf Sellner an Volksbildungssenator Tiburtius vom 11. Februar 1961 belegt, als wie radikal Bornemanns Opernhaus von Zeitgenossen bisweilen erlebt wurde. Sellner kritisierte harsch, er empfinde den Bau als „GRABKAMMER DER OPER“ und merkte an, dass Bornemanns Architektur „DEN GESELLSCHAFTLICHEN ASPEKT VON DEM DER BAU EINER OPER AUF HERVORRAGENDE WEISE BESTIMMT SEIN MUSS VOELLIG UNBERUECKSICHTIGT LAESST“.467 Aber gerade um eine neue Bestimmung der gesellschaftlichen Funktion der Oper ging es Bornemann. Dazu konnte sich der Architekt auf Theodor W. Adorno beziehen. Der Philosoph und Musiksoziologe hatte beim schon erwähnten Darmstädter Gespräch 1955 einen intensiv diskutierten Vortrag zum Thema „Theater, Oper, Bürgertum“ gehalten. In teilweise bissiger Ironie hatte er darin den Opernbetrieb als Teil der auf Unterhaltung zielenden Kulturindustrie und den Verlust der aufklärerischen Potenziale des Musiktheaters kritisiert. Bornemann wiederum bezog sich zur Begründung seiner architektonischen Konzeption auf Adornos Reflexion über den auf Schiller zurückgehenden Begriff des „Scheins“. Demnach wollte Bornemann mit seinem Bau dazu beitragen, die Oper „,als ein ganz vom Schein beherrschtes Kunstphänomen‘ (Adorno) zu überwinden“. Dazu lehnte er die am Klassizismus orientierte, ehemals als „schön“ empfundene Formensprache, wie sie im Theaterbau bis 1945 üblich war, für die Gegenwart als nur ästhetisch überkommen und hohl ab zugunsten einer Ästhetik, die 465 Bei den Kunstwerken handelte es sich überwiegend um Leihgaben, war doch der Etat des Neubaus erschöpft. Grohmann, „Gesellschaft“. 466 Wolfgang Pehnt, Deutsche Architektur seit 1900, Ludwigsburg/München 2005, S. 298–309, hier S. 308. 467 Telegramm Sellners an Tiburtius vom 11.02.1961. LAB, B Rep. 014, Nr. 1143.
172
Architektur
in aufklärerischer Absicht dazu beitrage, die auf der Bühne gespielten Werke mit ihrem ethischen Gehalt in den Mittelpunkt zu rücken. Bornemann verzichtete im Zusammenhang mit seiner amphitheatralischen Anordnung der Sitzplätze auf Logen. Auch damit entsprach die neue Berliner Oper dem Wagnerschen Reformtheater, dessen Zuschauerraum sich als Repräsentationsform für die Demokratie hervorragend eignete. Regierungslogen, wie sie in der neuen Lindenoper vorkamen, gab es hier nicht. Zwar wurde während der Bauzeit eine flexibel ein- und ausbaubare Staatsloge für wichtige Anlässe erwogen, doch gab man diese Idee am Ende auf.468 Bundespräsident Lübke nahm bei der Eröffnung der Deutschen Oper in der ersten Reihe des ersten Ranges Platz, ohne dass diese Position in irgendeiner Weise baulich hervorgehoben worden wäre. Mit dem generellen Verzicht auf Logen, der Offenheit signalisierte, wollte der Architekt möglicherweise auch der zu erwartenden ostdeutschen Kritik begegnen, die Deutsche Oper wende sich nur an ein wohlhabendes Bürgertum. c) Rezeption des Neubaus
Bornemanns Opernhaus wurde im Westen verschieden beurteilt.469 Interessant sind vor allem die kritischen Stimmen. Kritisiert wurde das Gebäude etwa wegen seiner „allzu streng[en] – allzu nüchtern[en]“470 Architektursprache. Vor allem aber löste die ungewohnte Gestaltung der Fassade Unmut aus, die so gar nicht den herrschenden ästhetischen Vorstellungen von einem Musentempel entsprach und die nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch in der Bauverwaltung heftige Diskussionen auslöste. Schon das Preisgericht hatte die Notwendigkeit „einer sehr sorgfältigen künstlerischen Durchbildung“471 der zur Straße hin geschlossenen Fassade angemahnt, deren Notwendigkeit man 468 Anna Teut, „Allzu streng – allzu nüchtern“, in : Die Welt vom 30.12.1957. 469 Eine ostdeutsche schriftliche Rezeption zu dem nur wenige Wochen nach dem Mauerbau eröffneten Opernhaus hat sich leider nicht finden lassen. 470 Anna Teut, „Allzu streng – allzu nüchtern“, in : Die Welt vom 30.12.1957. 471 Schmalor, Theater, S. 80. Tatsächlich hatte Bornemann schon in seinen ersten Entwürfen geplant, die Fassade mit einem Relief zu versehen, wie eine Skizze des Architekten von 1955 andeutet. Diese ist abgedruckt in : ebd., S. 82.
Der Neubau der Deutschen Oper in Charlottenburg (1951–61)
173
aber aus Lärmschutzgründen grundsätzlich bejahte. Als diese dann aber im Juli 1959 mit Flusskieselplatten verkleidet wurde, erhoben sich in der Öffentlichkeit kritische Stimmen. Der Präsident des Abgeordnetenhauses Willy Henneberg (SPD) stellte in der Sitzung des Abgeordnetenhauses vom 7. Juli 1959, allerdings außerhalb der Tagesordnung, besorgt fest, dass „nach seiner Auffassung die Neugestaltung der Fassade des Opernhauses kaum die Billigung der Berliner Bevölkerung finden wird“.472 Der zu einer Stellungnahme aufgeforderte Bausenator verwies demgegenüber auf einen noch ausstehenden Wettbewerb, in dem über die künstlerische Gestaltung durch „Metallreliefs oder Drahtplastiken“473 entschieden werden sollte. Allerdings beruhigten sich die Gemüter nach Installation der aus dem Wettbewerb siegreich hervorgegangenen Plastik Uhlmanns nicht, die selbst in der Senatsverwaltung heftig umstritten war474, sondern die Kritik nahm im Gegenteil noch zu. In einem Boulevard-Blatt wurde deren Kunstcharakter bestritten und sogar von einer Verschwendung von Steuergeldern gesprochen.475 Auch wurde auf den ‚Volksmund‘ verwiesen, der Spitznamen wie „hochkant gestellte Dorfstraße“476 oder „Klagemauer“477 für die Fassade und „Schaschlikspieß“478 für Uhlmanns Plastik geprägt habe.479 Bei diesen Kommentaren blieb es jedoch nicht. Uhlmann wurde nach eigenen Aussagen mit Schmähbriefen und anonymen Anrufen belästigt.480 Auch die Kunstwerke im Inneren der Oper führten zu Kritik. Hellmut Kotschenreuther schrieb in der Berliner Morgenpost : „Was die Gäste über die Plastiken in den beiden Fo472 LAB, B Rep. 014, Nr. 2472. 473 Ebd. 474 Im Landesarchiv haben sich keine Akten zu dem Wettbewerb erhalten, an dem neben Uhlmann die Bildhauer Bernhard Heiliger, Karl Hartung und Erich F. Reuter teilnahmen. Im Unterschied zu Uhlmann entwarfen die drei anderen Künstler Objekte, die direkt an der Wand angebracht waren. Siehe dazu : Stefanie Endlich, „Stählernes Ausrufungszeichen für reinen Klang. Uhlmanns Skulptur für Bornemanns Oper“, in : Schindler, Moderne, S. 68–71, hier S. 69. 475 „…und der Laie wundert sich“, in : BZ vom 06.09.1961. 476 „Marterstühle hinter Kopfsteinpflaster“, in : Der Kurier vom 16.07.1959. 477 „,Berlin hat Mut zum künstlerischen Wagnis‘“, in : Der Kurier vom 25.09.1961. 478 „…und der Laie wundert sich“, in : BZ vom 06.09.1961. 479 Stefanie Endlich vermutet hinter dem vermeintlichen Volksmund die Erfindungen von Journalisten. Endlich, „Ausrufungszeichen“, S. 70. 480 Heinz Ohff, „Der stählerne Stein des Anstoßes“, in : Der Tagesspiegel vom 21.10.1961.
174
Architektur
yers sagten, habe ich zwar gehört, wage es aber nicht mitzuteilen. Es ist nicht druckfähig.“481 Ob diese Äußerungen auch von nationalsozialistischem Vokabular geprägt waren, muss offen bleiben. In jedem Fall aber zeigt die Art der Ablehnung der architektonischen Moderne im Jahr 1961 einen grundlegenden Unterschied gegenüber derjenigen in den kulturellen Auseinandersetzungen der Weimarer Republik : Anders als dort wurde nun nicht mehr – zumindest nicht mehr offen – ursprungsmythologisch oder politisch argumentiert. Begriffe wie ‚volksfremd‘ oder ‚entartet‘ fehlten in der gesellschaftlichen Diskussion genauso wie die frühere Diffamierung der Moderne als ‚kulturbolschewistisch‘. Zu offensichtlich unterschied sich doch die abstrakte Kunst im Westen vom sowjetisch verordneten Sozialistischen Realismus im östlichen Teil Berlins, als dass ein solches Schlagwort noch hätte verfangen können. Mag hinter vorgehaltener Hand auch noch nationalsozialistisch argumentiert worden sein, beschränkte sich zumindest die öffentliche Kritik auf unpolitische und damit letztlich harmlose Bemerkungen.482 So wies etwa Kotschenreuther, welcher der Moderne gegenüber in seinen Zeitungsberichten bisweilen sehr kritisch eingestellt war, seine Leser in der Berliner Morgenpost lediglich ironisch-harmlos darauf hin, dass „die hohen vasenähnlichen Gebilde in den Foyers […] keine modernen Plastiken“ seien, „sondern Aschenbecher“.483 Kaum als bissig zu bezeichnen ist auch eine Karikatur zu Uhlmanns Plastik an anderer Stelle. Darauf ist ein Polizist abgebildet, der einen Mann, der auf dem Dach des Opernhauses stehend seinen Mantel am Kunstwerk aufhängt, in Berliner Dialekt mit den Worten ermahnt : „Det is keen Jadrobenstända“.484 Resümiert man, was sich unter einer vergleichenden Perspektive über den Wiederaufbau der Lindenoper und den Neubau der Deutschen Oper sagen lässt, ergibt sich, dass sich beide Projekte wie Bau und Gegenbau zueinander verhal481 Hellmut Kotschenreuther, „Das ist unsere Oper !“, in : Berliner Morgenpost vom 26.09.1961. Siehe auch : „Was uns an der neuen Oper nicht gefällt. Vor allem die Plastiken werden heftig kritisiert“, in : Welt am Sonntag vom 01.10.1961. 482 Möglicherweise spiegelt sich in einer Titulierung der Fassade als „Klagemauer“ doch antisemitisches Gedankengut, ebenso wie sich in der Bezeichnung der Uhlmann-Plastik als „Schaschlikspieß“ vielleicht Reste einer ausländerfeindlichen Argumentationsweise manifestieren. 483 Hellmut Kotschenreuther, „Das ist unsere Oper !“, in : Berliner Morgenpost vom 26.09.1961. 484 Berliner Morgenpost vom 24.09.1961.
Der Neubau der Deutschen Oper in Charlottenburg (1951–61)
175
ten. Die Entscheidung des West-Berliner Senats für den Bau der West-Berliner Oper war eine Reaktion auf die Eröffnung der wiederhergestellten Ost-Berliner Bühne, befürchtete man doch, dass von dieser eine erhebliche Attraktivität auch auf ein westliches Publikum ausgehen würde. Beide Bühnen wurden als Orte nationaler kultureller Repräsentation konzipiert. Dabei waren sie im Hinblick auf die sich in der Architektur niederschlagenden Kulturvorstellungen gegensätzlich und doch aufeinander bezogen. Trotz aller Unterschiede gibt es zunächst eine entscheidende Gemeinsamkeit : In der Architektur beider Bauten schlug sich die Ansicht nieder, dass eine Opernbühne der Bildung und nicht etwa nur der Unterhaltung dienen sollte. Beide Gebäude aktualisierten damit tradierte Vorstellungen von einer idealen deutschen Opernbühne. In der Lindenoper zeigte sich dies in der grundlegenden architektonischen Umgestaltung des Knobelsdorffbaus mit dem Ziel, daraus einen klassizistischen Musentempel zu machen, in der Deutschen Oper durch das explizite Anknüpfen an das Modell des Bayreuther Festspielhauses sowie durch die Foyers, welche zugunsten einer Rezeption zeitgenössischer Kunstwerke dezent abgestimmt wurden. Gegensätzlich verhalten sich beide Bauten dann aber in Bezug auf das Verständnis von ästhetischer Schönheit in der Architektur. Während Richard Paulick bei der Lindenoper im Osten im Kontext der kulturpolitisch verordneten Ausrichtung auf die nationalen Bautraditionen an den ästhetischen Idealen des Klassizismus festhielt, verwarf Fritz Bornemann diese bei der Deutschen Oper, wobei er sich an dem im Westen populären Internationalen Stil orientierte. Architektonische Elemente wie antikisierende Säulen und Portikus, Musenfiguren und Freitreppe, die auch im Nationalsozialismus noch als vorbildlich galten, lehnte er bei der Deutschen Oper als ästhetisch hohl ab. Stattdessen entwarf er eine an den architektonischen Reformkonzepten der 1910er- und 1920er-Jahre orientierte primär funktionale Architektur, die dem Zweck diente, das Bühnengeschehen in den Mittelpunkt des Opernbesuches zu rücken. Ein weiterer wesentlicher Unterschied besteht zwischen beiden Bauten in der Frage einer spezifisch nationalen Konnotation. Während die Architektur der Lindenoper von der DDR zum Stiftungsbau einer nationalen Opernarchitektur stilisiert wurde, brach man an der Deutschen Oper trotz des Anknüpfens an Wagners ursprünglich als national interpretiertes Opernhaus-Modell mit einer solchen Identitätsstiftung. Dies ergibt einen frappierenden Befund : Während Fritz Bornemann die von Richard
176
Architektur
Wagner her deutsch konnotierte Amphitheaterform in seinem Charlottenburger Opernhaus mit den architektonischen Mitteln der westlichen Moderne internationalisierte, geschah beim Opernhaus Unter den Linden exakt das Gegenteil : Dieses stilistisch eigentlich italienischen, französischen und englischen Vorbildern verpflichtete Rang-/Logentheater wurde von Richard Paulick nationalisiert. Beide Opernhäuser zielten als „Nationaltheater“ auf ein gesamtdeutsches Publikum. Entsprechend der Ideologie im Arbeiter- und Bauern-Staat verzichtete Paulick bei der Lindenoper weitgehend auf eine Gliederung der Ränge in Logen, die eine gesellschaftliche Hierarchie hätten ausdrücken können. Allerdings gab es Ausnahmen : Nicht nur behielt man für die Staats- und Parteispitze die ehemalige „Führerloge“ in der Mitte des ersten Ranges bei, wenn auch in einer weniger monumentalen Form, sondern es wurden sogar zwei großformatige Proszeniumslogen neu geschaffen, deren Bedeutung eine entsprechende politische Ikonografie noch unterstrich. In der Deutschen Oper hingegen verzichtete Fritz Bornemann komplett auf Logen, womit der ‚bürgerliche‘ Westen gesellschaftliche Offenheit demonstrieren konnte. In der westdeutschen Presse erntete die architektonische Gestaltung beider Opernhäuser neben Lob auch deutliche Kritik. Während der Tenor bei der Staatsoper 1955 war, dass diese – zumal im Hinblick auf die Verhältnisse im Arbeiter- und Bauern-Staat – zu prunkvoll gestaltet sei, monierte man im Gegenteil dazu 1961 an der Deutschen Oper den Mangel an Festlichkeit und Pracht. Kritisiert wurden darüber hinaus die zeitgenössischen abstrakten Skulpturen, sowohl diejenige Uhlmanns vor der Fassade als auch diejenigen in den Foyers. Allerdings bleibt festzuhalten, dass diese Kritik, verglichen mit der Kritik an der kulturellen Moderne in den Jahren der Weimarer Republik und der Zeit des Nationalsozialismus, harmlos blieb. Offene politische Verunglimpfungen der Künstler oder Schmähungen auf der Grundlage der ursprungsmythologischen Argumentationsfigur blieben bei der Deutschen Oper aus.
V. Künstler – Der „Sängerkrieg“ und der Fall Erich Kleiber
Nicht nur mit ihrem Wirken auf der Opernbühne und im Orchestergraben trugen Künstler im Berlin des Kalten Krieges zur kulturellen Repräsentation des jeweiligen politischen Systems bei, sondern darüber hinaus auch in größerem Rahmen auf der ‚Bühne‘ des zweigeteilten ‚Schaufensters‘ Berlin. In diesem Zusammenhang entbrannte zwischen Ost- und West-Berlin in der ersten Hälfte der 1950er-Jahre ein regelrechter Kampf um die besten Künstler, in welchen die jeweiligen Kulturbehörden aktiv eingriffen. Heftig umstritten waren vor allem künstlerische Doppelengagements an Opernbühnen in beiden Teilen der Stadt. Damit verbunden war zum einen die Frage nach der Einheit der deutschen Kultur, zum anderen nach dem Verhältnis von Kunst und Politik beziehungsweise nach der Freiheit der Kunst überhaupt. Ausgetragen wurde der von den Zeitgenossen als „Sängerkrieg“ bezeichnete Konflikt in den Medien. Dabei fungierten die Künstler nicht ausschließlich als Objekte der Berichterstattung, sondern sie machten sich die Presse für ihre eigene Selbstdarstellung bisweilen aktiv zunutze und versuchten, politische Entscheidungen zu beeinflussen. Der umstrittenste Akteur des „Sängerkrieges“ war der Dirigent Erich Kleiber, der versuchte, mit seinem künstlerischen Wirken an der Ost-Berliner Staatsoper einer Teilung der deutschen Kultur entgegenzuwirken.
1. „Eine neue Blütezeit der deutschen Opernkunst“ ?
„Nach mehr als sechzehnjähriger Abwesenheit dirigierte Erich Kleiber am Sonntagabend [dem 18. Juni 1951] zum erstenmal wieder in der Berliner Staatsoper. Er leitete eine hervorragend gelungene Aufführung des ‚Rosenkavalier‘ von Richard Strauss und schenkte damit der deutschen Hauptstadt einen glanzvollen Abend. Präsident Wilhelm Pieck, der amtierende Ministerpräsident Walter Ulbricht, Volksbildungsminister Paul Wandel, Vertreter des Diplomatischen Korps und viele führende Persönlichkeiten des politischen und kulturellen Lebens
178
Künstler – Der „Sängerkrieg“ und der Fall Erich Kleiber
waren zugegen. […] Der Beifall für Erich Kleiber wuchs von Akt zu Akt und steigerte sich am Schluß zu Ovationen. Er zeigte dem großen Dirigenten, daß er sich an seiner ehemaligen Wirkungsstätte, die er vor 1933 zu einem Operninstitut von Weltrang entwickelt hat, zu Hause fühlen darf.“485 In der DDR-Presse, wie hier im Neuen Deutschland, wurde die Rückkehr Erich Kleibers ans Pult der Staatskapelle im Jahr 1951 emphatisch gefeiert. Kleiber, einer der renommiertesten deutschen Dirigenten seiner Zeit486, hatte sich als Generalmusikdirektor der Berliner Lindenoper in den 20er-Jahren mit einem breiten Repertoire einen hervorragenden Ruf erworben und als Dirigent von Uraufführungen wie derjenigen von Alban Bergs Wozzeck 1925 einen Namen gemacht. Drangsaliert durch das nationalsozialistische Regime war er Anfang 1935 von seinem Amt zurückgetreten, ins Exil gegangen und hatte zwischen 1937 und 1949 am Teatro Colón in Buenos Aires, aber auch in anderen Ländern Südamerikas gewirkt.487 Maßgeblichen Anteil an der Rückkehr Kleibers an die Staatsoper nach dem Zweiten Weltkrieg hatte deren Intendant Ernst Legal488, der sich – genau wie die Ost-Berliner Kulturbehörden – von dem Dirigenten „eine neue Blütezeit der deutschen Opernkunst in der Staatsoper Berlin“489 erhoffte. Nicht nur sollte durch eine erneute feste Bindung des Dirigenten an das Opernhaus ein hohes künstlerisches Niveau der Bühne sichergestellt werden, sondern man hoffte auch, dass Kleiber durch sein internationales Renommee weitere hervorragende Künstler, Orchestermusiker und Sänger anzog. Dies war vor allem deswegen wichtig, weil der Staatsoper seit der zweiten Hälfte des Jahres 1948 ein Exodus ihrer renommiertesten Künstler an Bühnen und Orchester des Westens drohte. Infolge der Währungsreform in den drei 485 Karl Schönewolf, „Stürmischer Beifall für Erich Kleiber“, in : Neues Deutschland vom 19.06. 1951. 486 Kurt Blaukopf, Große Dirigenten, Teufen 1953, S. 96ff. 487 Zu Kleibers Exilzeit siehe : Fritz Pohle, Musiker-Emigration in Lateinamerika. Ein vorläufiger Überblick, in : Hanns-Werner Heister, Claudia Maurer Zenck und Peter Petersen (Hg.), Musik im Exil, Frankfurt/M. 1993, S. 338–353, vor allem S. 340f ; Duilio Abelardo Dobrin, Erich Kleiber. The Argentine Experience (1926–1949), Muncie/Indiana 1981. 488 Dies belegt eine größere Anzahl von Briefen zwischen beiden Künstlern im Landesarchiv Berlin. LAB, C Rep. 167, Nr. 46. 489 „Betr. : Vorschlag für die Verleihung des Nationalpreises 1. Klasse an Prof. Erich Kleiber“ vom 15.07.1952. BArch, DR 1/213, Bl. 77.
„Eine neue Blütezeit der deutschen Opernkunst“ ?
179
Westzonen im Juni 1948, in welche auch die Berliner Westsektoren einbezogen worden waren, hatte die ostdeutsche Währung bald erheblich an Wert verloren.490 An den in West-Berlin lizenzierten Wechselstuben tauschte man schon im März 1949 eine Westmark gegen etwa fünf DM (Ost).491 Dies war für die in West-Berlin wohnenden Mitglieder der Staatsoper insofern problematisch, als deren Gehälter beziehungsweise Gagen – von den Sängern waren dies noch in der Spielzeit 1951/52 ganze 80% des Ensembles492 – dadurch massiv entwertet wurden.493 Die meisten der in West-Berlin lebenden Mitglieder waren dadurch in erhebliche finanzielle Schwierigkeiten geraten. So herrschte an der Staatsoper bereits Anfang 1949 eine „recht verzweifelt[e]“494 Stimmung, wie Ernst Legal dem Magistrat in einem seiner Monatsberichte klagen musste. Ein großer Teil der betroffenen Sänger und Orchestermusiker drohte dem Intendanten wegen der finanziellen Probleme unumwunden mit dem Weggang an eine westdeutsche Bühne, sollte sich ihre materielle Situation an der Staatsoper nicht verbessern. Zu befürchten waren für den Intendanten insbesondere Abwanderungen an die direkte künstlerische Opernkonkurrenz in West-Berlin, wo man nur zu gerne bereit war, die hochqualifizierten Künstler aufzunehmen. Zu einem Eklat kam es bei der Staatskapelle, als der Dirigent Hermann Abendroth im Oktober 1949 in einer Probe mit dem Orchester eine Wiederholung des einstudierten Programms verlangte und sich einige Musiker mit der Begründung, sie seien das schlecht bezahlteste Orchester von Berlin, weigerten weiterzuspielen.495 Bis zum Herbst 1949 waren aus der Staatskapelle 16 Musiker abgewandert496, zum Ende der Spielzeit 1949/50 kündigten weitere 23 Musiker ihr Vertragsverhältnis.497 490 Zu den Auseinandersetzungen um die Ausdehnung der Währungsreform auf West-Berlin siehe : Ribbe, Berlin, S. 71ff. 491 Erika M. Hoerning, „Der alltägliche Kalte Krieg in Berlin 1948 bis 1961“, in : BIOS. Zeitschrift für Biographieforschung und Oral History 6 (Sonderheft 1993), S. 73–93, hier S. 83. 492 Bericht zur Situation an der Deutschen Staatsoper. BArch, DY 30/ IV 2/9.06/ 287, Bl. 79–87, hier Bl. 84. 493 Der Anteil West-Berliner Mitglieder an der Komischen Oper lag Anfang der 1950er-Jahre insgesamt ebenfalls bei etwa 80%. Siehe : Lemke, „,Sängerkrieg‘“, S. 271. 494 Ernst Legal, 40. Monatsbericht (vom 10.02.1949). LAB, C Rep. 167, Nr. 30. 495 Ernst Legal, 47. Monatsbericht (vom 12.11.1949). Ebd. 496 Brief Legals an das ZK der SED vom 22.09.1949. Ebd. 497 Ernst Legal, 4. Monatsbericht (vom 13.05.1950). Ebd.
180
Künstler – Der „Sängerkrieg“ und der Fall Erich Kleiber
Ein besonderer Prestigeverlust drohte der Staatsoper durch den Verlust namhafter Sängerinnen und Sänger. Immer wieder machte Legal gegenüber den Kulturbehörden seinem Ärger über Abwerbungen durch die konkurrierende West-Berliner Städtische Oper Luft : „Der künstlerische Leiter des Instituts, Heinz Tietjen, hat die sich ihm bietende günstige Gelegenheit weidlich ausgenutzt und einen grossen Teil unserer wichtigsten Gesangskräfte mit leichter Mühe fest an sein Haus binden können.“498 Wiederholt forderte Legal die zuständigen Ost-Berliner Stellen zum Einschreiten gegen die „WestmarkVormachtstellung“499 der Städtischen Oper auf, indem er vor dem drohenden künstlerischen Herabsinken seines Hauses auf „Stadttheaterhöhe“500 warnte. Wenn es auch ab März 1949 zu ersten Ausgleichszahlungen durch den Magistrat kam501, reichten diese doch bei Weitem nicht aus, um alle in West-Berlin lebenden Künstler an der Staatsoper zu halten.502 Allerdings fiel die Abwanderung im Bereich der Solisten insgesamt weniger dramatisch aus, als zunächst befürchtet worden war. Dies hing mit der den Künstlern bewussten Tatsache zusammen, dass ein Engagement an der Staatsoper gerade im Ausland nach wie vor als ein Ausweis künstlerischer Qualität verstanden wurde.503 Doch ließen sich immer weniger Sänger auf feste Jahresverträge ein. Oftmals blieben diese letztlich nur deswegen mit der Bühne verbunden, weil ihnen Legal die Gelegenheit gab, gleichzeitig an westlichen Opernhäusern Westmark zu verdienen.504 Attraktiv war der Westen Deutschlands für die Sänger aber nicht nur 498 Ernst Legal, 45. Monatsbericht (vom 22.07.1949). Ebd. 499 Brief Legals an Hauptabteilungsleiter Volkmann im Ministerium für Volksbildung vom 23.09.1950. LAB, C Rep. 167, Nr. 23. 500 Ernst Legal, 43. Monatsbericht (vom 16.05.1949). LAB, C Rep. 167, Nr. 30. 501 Ebd. 502 An die West-Berliner Städtische Oper wechselte etwa die Sängerin Margarete Klose. 503 Siehe dazu : Ernst Legal, 16. Monatsbericht (vom 15.05.1951). LAB, C Rep. 167, Nr. 30. 504 Brief Legals an Volkmann vom 23.09.1950. LAB, C Rep. 167, Nr. 23. – Darunter fielen die Sänger Erich Witte, Josef Metternich, Irma Beilke, Christel Goltz und Elisabeth Grümmer. Brief Legals an das ZK der SED vom 22.09.1949. LAB, C Rep. 167, Nr. 30. – Auch an der Komischen Oper kam es zur Abwanderung von Künstlern in den Westen. Deren Zahl blieb allerdings insgesamt geringer als bei der Staatsoper, was insbesondere auf die jeweils enge persönliche Bindung des Intendanten Walter Felsenstein zu seinen Ensemblemitgliedern im Rahmen der künstlerischen Arbeit zurückzuführen ist. Siehe die Liste der aus der Komischen Oper ausgeschiedenen Künstler vom 14.04.1953. BArch, DY 30/ IV 2/2.026, Bl. 44–46. – Auch konnte sich Felsenstein, anders als Legal im Jahr 1952 an der Staatsoper, stets erfolgreich
„Eine neue Blütezeit der deutschen Opernkunst“ ?
181
wegen der Westmark-Gagen, sondern auch, weil es von hier aus viel leichter als von der DDR aus möglich war, internationale Reisevisa zu bekommen, welche die unabdingbare Voraussetzung für eine internationale Künstlerkarriere bildeten. In der DDR hingegen konnten noch nicht einmal die für Auftritte in Westdeutschland notwendigen Interzonenpässe problemlos erlangt werden, ganz zu schweigen von den permanenten Behinderungen der Künstler bei Kontrollen an den Sektorengrenzen.505 So verwundert es kaum, dass die ostdeutschen Kulturpolitiker auch mit ihren seit 1952 verstärkt betriebenen Bemühungen, westdeutsche beziehungsweise West-Berliner Sängerinnen und Sänger von Staats- wie Komischer Oper zu einer Übersiedlung in die DDR zu bewegen, keinen Erfolg hatten, zumal selbst die beiden Intendanten, Ernst Legal und Walter Felsenstein, – sehr zum Unmut der SED-Funktionäre – ihren Wohnsitz in West-Berlin beließen. Wenn die „Kulturschlacht“506, wie es Legal formulierte, um die besten Sänger gegen den Westen und insbesondere gegen West-Berlin gewonnen werden sollte, war es letztlich unabdingbar, den dort lebenden Künstlern zumindest einen Teil ihrer Gage in Westmark auszubezahlen. So finanzierte die Staatliche Kommission für Kunstangelegenheiten 1951 inzwischen meist 25% der Gagen von Westdeutschen an Staats- wie Komischer Oper in Westmark. Allerdings verfuhr die Behörde dabei äußerst restriktiv und mahnte den Opernbühnen gegenüber immer wieder dieselbe zurückhaltende Einstellung bei Vertragsverhandlungen an. Dies hing zum einen mit den knappen Staatsfinanzen zusammen507, zum anderen damit, dass man nicht noch zusätzlich Begehrlichkeiten bei den in festen Vertragsverhältnissen stehenden ostdeutschen Künstlern wecken wollte. Überdies war es aus Sicht der SED-Funktionäre ärgerlich, dass sich die teuer bezahlten Künstler aus dem Westen trotz der erheblichen finanziellen Zuwendungen einer politisch-ideologischen Einflussnahme, sei es vonseiten gegen die von Partei- und Magistratsfunktionären geforderte Entlassung von West-Berliner Mitgliedern im Bereich der Technik zur Wehr setzen. 505 Siehe dazu : Allmeroth, Betrifft Abwanderung der Kollegen nach dem Westen (16.03.1953). BArch, DY 30/ IV 2/9.06/ 287, Bl. 111/112. 506 Brief Legals an Volkmann vom 23.09.1950. LAB, C Rep. 167, Nr. 23. 507 Siehe etwa den Brief der Staatlichen Kommission für Kunstangelegenheiten an Legal vom 30.07.1952. BArch, DR 1/6080, Bl. 13.
182
Künstler – Der „Sängerkrieg“ und der Fall Erich Kleiber
der Betriebsgewerkschaftsleitung oder der Betriebsorganisation der SED, ausnahmslos verweigerten.508 Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung kam der DDR die Rückkehr Erich Kleibers an das Pult der Staatskapelle kulturpolitisch außerordentlich gelegen. Dementsprechend wurde der Dirigent während seines Gastspieles 1951 stark umworben. Den Höhepunkt bildete die schon erwähnte Einladung Kleibers am Morgen des 19. Juni 1951 in den Festsaal von Schloss Niederschönhausen, dem Amtssitz von Wilhelm Pieck, bei der die DDR-Führung dem Dirigenten im Gegenzug für dessen enge künstlerische Bindung an die Staatsoper den Wiederaufbau des zerstörten Hauses Unter den Linden zusagte.509 Neben dem Staatspräsidenten waren dort Ernst Legal, der Präsident der Deutschen Bauakademie Kurt Liebknecht sowie führende DDR-Politiker zugegen, darunter Walter Ulbricht, Aufbauminister Bolz und Volksbildungsminister Wandel. In einem Brief an seine Frau beschrieb Kleiber das Zusammentreffen : „Am Sonntag wurde ich, vom Staatssekretär des Präsidenten abgeholt (mit Polizei vor dem Auto ! ! Brother !), ins Schloß zu Herrn Pieck gebracht, dort war Legal, verschiedene Baumeister, der Vize-Präsident Ulbricht, und da bekamen wir Sandwiches, Erdbeeren und eine Erdbeer-Bowle (am Vormittag 11 Uhr !). Herr Pieck ist ganz natürlich, wie der Vorstand eines Kegel-Clubs – schwer begeistert von mir, er sagte : ‚Wenn wir vielleicht damit rechnen dürften, daß Sie uns die neuerstandene ‚Lindenoper‘ einweihen würden‘ – ich sagte : ‚Nicht vielleicht, sondern,
508 Bericht zur Situation an der Deutschen Staatsoper (o. D. [aber spätestens Ende der Spielzeit 1951/1952]). BArch, DY 30/ IV 2/9.06/ 287, Bl. 84. – Noch ein Bericht über die politischideologische Situation an der Komischen Oper aus dem Jahre 1958 stellt ohne Illusionen fest : „Die Solisten, von denen auch einige im Demokratischen Sektor wohnen, hören uns bei Gesprächen wohl zu, sie bestätigen uns auch, daß die Kulturpolitik unserer Regierung richtig ist, insbesondere was die Behandlung der Intelligenz betrifft. Sie erkennen an, daß man bei uns künstlerisch arbeiten kann, und ein Teil von ihnen wirkt drei- bis viermal jährlich auch bei Veranstaltungen in den Betrieben, bei der Nationalen Volksarmee, bei den Jugendweihen, in Krankenhäusern und Schulen oder bei Aufbauvorstellungen unentgeldlich [sic] mit. Es geht aber bei wenigen in die Tiefe, denn sie haben wenig Zeit, sich über ihre künstlerische Arbeit hinaus mit unseren Problemen zu beschäftigen.“ Ebd., Bl. 64. 509 Einer umfangreichen propagandistischen Verwertung dieser Zusammenkunft stand ein im Protokoll Piecks vermerkter Umstand entgegen : „Es war vergessen worden – Photographen zu bestellen.“ BArch, NY 4036/681, Bl. 11.
„Eine neue Blütezeit der deutschen Opernkunst“ ?
183
wenn Sie sie wieder so aufbauen, wie sie war, ganz bestimmt.‘“510 Ungeachtet der Ironie Kleibers über den staatsmännischen Pomp bei seinem Empfang ließ sich der Dirigent offensichtlich von der Zielstrebigkeit der kulturpolitischen Bemühungen der DDR-Führung überzeugen. Offensichtlich herrschte gegenseitige Sympathie, wie aus Piecks Protokoll des Treffens hervorgeht : „Kleiber spricht sehr frei, macht guten Eindruck.“511 Dass es Kleiber mit der Rückkehr an die Staatsoper, der er sich durch sein künstlerisches Wirken in den 1920erund 1930er-Jahren emotional eng verbunden fühlte, ernst war, zeigt auch, dass sich der Künstler trotz insgesamt dreier gescheiterter Versuche seit 1949, von den DDR-Behörden ein Einreisevisum zu erhalten, nicht von seinem Vorhaben abbringen ließ. Wie wichtig dem Dirigenten die Rückkehr an die Staatsoper war, zeigt ein Brief Kleibers an Legal vom 23. Dezember 1950 : „Ich schreibe diese Zeilen nicht ohne Bitterkeit : ich habe jetzt dreimal mit allen Kräften versucht, nach Berlin zu kommen und endlich das Orchester zu dirigieren, zu dem ich mich doch noch gehörend betrachte. Vergangenes Jahr habe ich Weihnachten damit verbracht, allein in Prag auf ein längst versprochenes Visum zu warten. Diesmal haben sie mir so freundlich am 6. Dezember angekündigt, dass die Visa bereits nach Wien abgegangen sind. Ich habe bis heute jeden Tag anrufen lassen und selbst angerufen, bis ich schon den Eindruck hatte, lästig zu sein ! Ich habe gebeten, auf meine Kosten zu telephonieren, was abgelehnt wurde. Es tut mir im Herzen weh, wieder vergebens versucht zu haben, mit ‚meinem‘ alten Orchester Kontakt zu gewinnen, ich weiß nicht, was da vielleicht für ‚Hindernisse‘ vorlagen, die man doch eigentlich offen aussprechen sollte.“512 Bis 1951 hatte der Dirigent Engagementangebote aus Baden-Baden, München und Stuttgart und vor allem auch eine Einladung Heinz Tietjens von der Städtischen Oper Berlin abgelehnt513, da er es sich in den Kopf gesetzt habe „zum ersten Mal in Deutschland unter allen Umständen die Staatskapelle in Berlin zu dirigieren“.514
510 Zitiert nach : John Russell, Erich Kleiber, München 1958, S. 247–248. 511 BArch, NY 4036/681, Bl. 12. 512 Brief Kleibers an Legal vom 28.12.1950. LAB, C Rep. 167, Nr. 46. 513 Siehe : Brief Ruth Kleibers an Legal vom 10.02.1950. Ebd. 514 Brief Kleibers an Legal vom 28.05.1950. Ebd.
184
Künstler – Der „Sängerkrieg“ und der Fall Erich Kleiber
2. Verbot der „Zweigleisigkeit“
Aus West-Berliner Sicht stellte sich die Lage der Staatsoper völlig anders da. Hier bekam man von den Sorgen der Ost-Berliner Bühne um den Bestand des Ensembles kaum etwas mit. So herrschte auf West-Berliner Seite Anfang der 1950er-Jahre von der Staatsoper das Bild eines glanzvollen kulturellen Aushängeschildes des ostdeutschen Staates vor, dem unbegrenzte finanzielle Mittel zur Verfügung standen, um die besten Künstler zu engagieren. Tatsächlich hatten die Aufführungen der Staatsoper unter Ernst Legal bald nach 1945 unbestritten wieder eine hervorragende künstlerische Qualität erreicht, während die Städtische Oper nach beträchtlichen Anlaufschwierigkeiten unter ihrem ersten Intendanten Michael Bohnen erst mit dessen Nachfolger Heinz Tietjen ab 1948 allmählich an künstlerischem Niveau gewann. Von West-Berlinern zahlreich besucht, stellte die Staatsoper somit für das West-Berliner Opernhaus eine massive kulturelle Konkurrenz dar. Provokant war der Ost-Berliner kulturelle Glanz vor allem angesichts der drückenden Auswirkungen der Blockade der drei WestSektoren von 1948/49, deren Folgen sich ab 1950 mit über 300.000 Arbeitslosen und einer erheblichen sozialen Armut abzeichneten.515 Doch selbst wenn sich die westliche Teilstadt angesichts der großen wirtschaftlichen Probleme zu Beginn der Dekade etwa den Wiederaufbau des zerstörten Charlottenburger Opernhauses nicht leisten konnte, war die Städtische Oper doch im Vergleich mit anderen großen Bühnen Westdeutschlands eines der am höchsten subventionierten Häuser, die es nach der administrativen Teilung der Stadt finanziell mit der Staatsoper doch durchaus aufnehmen konnte.516 Bedenkt man jedenfalls die finanziellen Probleme der Staatsoper in jenen Jahren, resultierte die auf dem Feld der Kultur Anfang der 1950er-Jahre einsetzende massive Abgrenzungspolitik des West-Berliner Senats gegenüber Ost-Berlin nicht unwesentlich aus einer Überschätzung und damit Fehlwahrnehmung der tatsächlichen pekuniären Situation der Gegenseite.517 Letztlich trug die West-Berliner 515 Siehe dazu Ribbe, Berlin, S. 77ff. und 97ff. 516 Die Städtische Oper erhielt etwa in der Spielzeit 1951/52 insgesamt 4,87 Mio. DM. Zu den Subventionen des West-Berliner Opernhauses siehe : Werner Oehlmann, „Was wird aus der Städtischen Oper ?“, in : Der Tagesspiegel vom 09.05.1953. 517 Zum Phänomen der wechselseitigen Fehlwahrnehmung und der daraus resultierenden
Verbot der „Zweigleisigkeit“
185
Stadtregierung mit ihrem Vorgehen, wie Michael Lemke aufgezeigt hat, maßgeblich zur „Entfesselung und Eskalation des ‚kalten Kulturkrieges‘ um das Berliner Musiktheater“518 bei. Dem Leiter des West-Berliner Schillertheaters Boleslaw Barlog etwa wurde 1951 untersagt, seine Ost-Berliner Intendantenkollegen zur Eröffnung des fertig gestellten Sprechtheaterbaus in Charlottenburg einzuladen, was die ostdeutsche Zeitschrift Theater der Zeit dazu veranlasste, Proteste der Betroffenen zu publizieren : Ernst Legal gab seiner „trauernden Verwunderung“ Ausdruck, „die mich immer ergreift, wenn ich Deutsche gegen Deutsche auftreten sehe“. Für ihn zählte nur eine „deutsche Kulturarbeit, die keine Sektorenund Zonengrenzen kennt“.519 Im Juni 1951 verbot die Volksbildungsverwaltung ein West-Berliner Konzert mit Musik von Rudolf Wagner-Régeny, weil der Komponist in Ost-Berlin lehrte. Im Herbst desselben Jahres suspendierte man vorübergehend den Konzertmeister der Philharmoniker Siegfried Borries wegen eines Gastspiels mit den Dresdner Philharmonikern in Westdeutschland.520 Den entscheidenden Schritt kultureller Abgrenzung aber bildete das Verbot der sogenannten „Zweigleisigkeit“521 unter dem neuen Volksbildungssenator Joachim Tiburtius (CDU) im Herbst 1951. Bis dahin hatten Doppelbeschäftigungen von Künstlern an öffentlich finanzierten Kulturinstitutionen in beiden Teilen Berlins mehr die Regel als die Ausnahme gebildet.522 Dies jedoch wollte die Volksbildungsverwaltung nicht länger hinnehmen. So durften Künstler und Kunstpädagogen, die bei einer dem Senat unterstellten kulturellen Institution engagiert waren, fortan nicht mehr gleichzeitig in Ost-Berlin wirken, sah man doch darin einen nicht zu duldenden Beitrag zur Entfaltung von kulturellem Glanz in dem kommunistischen System. Die neue Regelung galt nicht für längerfristige Engagements, doch waren bestehende Verträge zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu lösen.523 Dieser Schritt war im Vorfeld intern umstritten „reaktiven Mechanik“ im Kalten Krieg siehe : Wilfried Loth, Die Teilung der Welt, 1941–1955, erweiterte Neuausgabe, München 2000. 518 Lemke, „,Sängerkrieg‘“, S. 270. 519 „Monteure am Eisernen Vorhang. Zu einer politischen Maßnahme der Westberliner Kulturfunktionäre“, in : Theater der Zeit 6 (1951), Heft 16, S. 23–26, hier S. 23. 520 Janik, Recomposing, S. 239ff. 521 „Tiburtius gegen ‚Zweigleisigkeit‘“, in : Der Kurier vom 13.11.1951. 522 Lemke, „,Sängerkrieg‘“, S. 273. 523 Werner Oehlmann, „Wieder ‚Philharmonische Konzerte‘“, in : Der Tagesspiegel vom 14.11.1951.
186
Künstler – Der „Sängerkrieg“ und der Fall Erich Kleiber
gewesen. Als der Volksbildungsausschuss des Abgeordnetenhauses bereits im September 1950 für einen solchen harten Kurs votierte, erinnerte man in der Volksbildungsverwaltung noch daran, dass „wir für die kulturelle Spaltung Berlins ebenso wenig tun wollen, wie wir für die politische getan haben. Eine generelle Verfügung […] würde aber diese Spaltung hervorrufen“.524 Auch wurde zu bedenken gegeben, dass die Gefahr bestand, dem Osten durch eine solche Vorgehensweise renommierte Künstler in die Arme zu treiben und der Spielbetrieb der Städtischen Oper dadurch möglicherweise nicht ohne Einschränkungen aufrechtzuerhalten wäre. Es wurde auch eingewandt, dass dann Probleme drohen könnten, wenn die westdeutschen Bundesländer nicht auf einen solchen harten Kurs mit einschwenkten. Dann nämlich würde es, was eine eminente Blamage West-Berlins bedeuten würde, zwischen dem Bundesgebiet und OstBerlin zu den kritisierten Doppelengagements kommen. Allen Einwänden zum Trotz glaubte sich der Volksbildungssenator Ende 1951 zu dem neuen konfrontativen kulturpolitischen Kurs genötigt.525 Anfang 1952 wurden in der Volksbildungsverwaltung entsprechende Richtlinien ausgearbeitet. Nun hatten alle vom Senat bezahlten Künstler und Kunstpädagogen im Fall von vertraglichen Verpflichtungen mit dem Osten die Behörde um Zustimmung zu ersuchen. Zwar wurde in den neuen Richtlinien festgestellt, dass es ein „gesamtdeutsches Anliegen“ sei, „die Einheit Deutschlands grundsätzlich aufrechtzuerhalten“526 – aber eben nur grundsätzlich. Faktisch zielten die Richtlinien auf das Gegenteil.
3. Eine deutsch-deutsche „Musik-Brücke“ ?
Das Verbot der „Zweigleisigkeit“ traf als einen der prominentesten Künstler Erich Kleiber. Der Dirigent hatte geplant, sein zweites Gastspiel an der Staatsoper im Juni 1952 mit einem Auftritt bei den West-Berliner Philharmonikern 524 Hauptamt Kunst an Stadtrat May vom 13.09.1950. LAB, B Rep. 014, Nr. 348. 525 Noch im Dezember 1951 trat der Leiter der West-Berliner Hochschule für Musik Werner Egk aus Protest gegen den neuen kulturpolitischen Kurs von seinem Amt zurück. Fischer-Defoy, „,Kunst‘“, S. 272ff. 526 Richtlinien zur Doppelbeschäftigung von Künstlern in beiden Teilen Berlins vom 25.01.1952. LAB, B Rep. 014, Nr. 348. Siehe dazu : Lemke, „,Sängerkrieg‘“, vor allem S. 279.
Eine deutsch-deutsche „Musik-Brücke“ ?
187
zu verbinden. Doch wurde ihm vom Direktor dieses Orchesters Eduard Lucas mit Verweis auf die neue kulturpolitische Linie in West-Berlin unmissverständlich klar gemacht, dass er sich für eine der beiden Institutionen zu entscheiden habe. Wenn ihm dies nicht möglich sei, „müssen wir zu unserem größten Bedauern auf die mit Ihnen vereinbarte Leitung des Konzertes […] mit unserem Orchester verzichten“.527 Kleiber sagte daraufhin in einem offenen Brief an Lucas seinen Auftritt mit den Philharmonikern ab.528 Darin reagierte der Dirigent auf den Vorwurf von Lucas, dass die ostdeutschen Kulturinstitutionen einer „gelenkten politisch-ideologischen Kunstrichtung“ verpflichtet seien, und verwies auf seine künstlerische Unabhängigkeit : „Ich habe mich niemals und von Niemandem in der Ausübung meines Berufes politisch lenken lassen.“529 Auch sei er in keiner „,Richtung‘ hin ‚politisch-ideologisch‘ eingestellt, sondern […] nur Musiker“. Kleiber verwies in diesem Zusammenhang auf seinen Weggang von der nationalsozialistischen Staatsoper im Jahre 1935 : Es sei „fast grotesk, dass ich Ihnen heute dieselben Worte schreiben muss, die ich 1935 an Herrn Göring […] gerichtet habe : ‚Die Musik ist für alle da, wie die Sonne und die Luft‘, – und ‚ich musiziere überall dort, wo ich Freiheit in der Wahl meiner Programme habe, und die Bedingungen für eine ernste Kunstübung (Disziplin und Qualität) vorfinde‘.“ Die für sein künstlerisches Wirken notwendige Bedingung, die Freiheit der Kunst, glaubte er in Ost-Berlin vorzufinden. Wenn sich Kleiber allerdings als ein unpolitischer Künstler darstellte, betrieb er doch selbst faktisch Politik, als er die alte Vorstellung von der einigenden Wirkung der deutschen Kultur beschwor. Als seine Aufgabe nämlich betrachtete er es, wie er an Lucas schrieb, mit seinem künstlerischen Wirken in Berlin „zwischen West und Ost eine Musik-Brücke“ zu schlagen.530 Im Gegensatz zu West-Berlin werde dieses Ziel, wie er lobend hervorhob, von der Leitung der Staatsoper begrüßt. 527 Brief des Direktors des Berliner Philharmonischen Orchesters Eduard Lucas an Kleiber vom 06.11.1951. LAB, C Rep. 167, Nr. 46. Zur Episode um den Auftritt Kleibers bei den Berliner Philharmonikern siehe auch : Vogt-Schneider, „,Staatsoper‘“, S. 92f ; Russell, Kleiber, S. 251f. 528 Die Bemerkung Michael Lemkes, Kleiber habe ab Juni 1951 sowohl an der West-Berliner Städtischen Oper als auch an der Staatsoper dirigiert, entspricht nicht den Tatsachen. Kleiber ist nie an der Städtischen Oper aufgetreten. Lemke, „Sängerkrieg“, S. 289. Siehe dazu die Dokumentation : Meyer zu Heringdorf, Opernhaus. 529 Brief von Kleiber an Lucas, Weihnachten 1951. LAB, C Rep. 167, Nr. 46. 530 Ebd.
188
Künstler – Der „Sängerkrieg“ und der Fall Erich Kleiber
Mit seiner Beschwörung der Einheit stiftenden Wirkung der deutschen Kultur lag Kleiber auf einer Linie mit der Deutschland- und Kulturpolitik der SED in der ersten Hälfte der 1950er-Jahre. Mit dieser Position wiederum konnte sich auch Ernst Legal – trotz aller kulturpolitischen Differenzen mit der SEDKulturbürokratie in der täglichen Arbeit als Intendant – identifizieren. In seinen publizistischen Äußerungen jener Jahre ist immer wieder die ursprungsmythologische Argumentationsfigur zu finden. Auch für Legal bewahrte nur die Erhaltung der „Einheit und Einheitlichkeit der deutschen Landschaften, deren so beglückend verschiedenartig sprudelnde Quellen das deutsche Geistesleben speisen“, vor „geistiger Einschränkung und Verarmung“.531 Neben der ‚Quelle‘ findet sich bei Legal auch die Naturmetapher der ‚Wurzel‘ : Die deutsche Kultur, die für Legal universalistisch ausgerichtet war, müsse „aus einer einzigen Wurzel erblühen“.532 In Bezug auf die deutsche Teilung meinte er, es sei ein „grosser tragischer Irrtum, annehmen zu wollen, dass sich aus einer so gearteten Erscheinung Teile herausbrechen ließen, ohne dass die Gefahr eines Nachlassens der geistigen Kräfte […] hervorgerufen würde“.533 Dem Intendanten gelang es, angesichts der die Staatsoper gefährdenden neuen kulturpolitischen Linie WestBerlins ein Vier-Augen-Gespräch mit dem ihm seit Langem bekannten Volksbildungssenator Tiburtius zu arrangieren.534 Seine damit verbundenen Hoffnungen auf einen kulturpolitischen Kurswechsel wurden allerdings enttäuscht. Die Episode um Kleibers Absage bei den West-Berliner Philharmonikern führte zu einer weiteren Annäherung des Dirigenten an die Staatsoper. Sein zweites, insgesamt zweiwöchiges Gastspiel im Juni 1952 wurde in der ostdeutschen Presse erneut enthusiastisch gefeiert.535 Bei Verhandlungen über Kleibers 531 Text (ohne Überschrift) vom 02.03.1948 für den Sonntag. LAB, C Rep. 167, Nr. 9. 532 Text (ohne Überschrift) vom 25.09.1951. Ebd. 533 Ebd. 534 Siehe dazu : Ernst Legal, 24. Monatsbericht (vom 14.02.1952), LAB, C Rep. 167, Nr. 30. Nähere Hinweise zu diesem Gespräch enthalten möglicherweise die Tagebücher Ernst Legals im Archiv der Akademie der Künste in Berlin. 535 Siehe etwa : „Professor Erich Kleiber bei der Probe“, in : Neues Deutschland vom 01.06.1952 ; Karl Schönewolf, „Professor Kleiber dirigierte den ‚Don Giovanni‘“, in : Neues Deutschland vom 04.06.1952 ; Karl Schönewolf, „Ein Beethoven-Erlebnis in der Deutschen Staatsoper“, in : Neues Deutschland vom 11.06.1952 ; „Begeisterung für Erich Kleiber“, in : Neues Deutschland vom 18.06.1952 ; Leo Berg, „Auf Wiedersehen, Erich Kleiber !“, in : Berliner Zeitung vom 19.06.1952.
Verbot der „Zweigleisigkeit“
189
zukünftiges Verhältnis zur Staatsoper stimmte Volksbildungsminister Wandel den Bedingungen des Dirigenten weitestgehend zu. Nicht nur sollte das Orchester auf 142 Mitglieder aufgestockt und finanziell besser gestellt werden als bisher, wie es im vertraulich eingestuften Protokoll heißt. Auch signalisierte man ihm, dass für das Engagement von Solisten aus Westdeutschland „das größte Interesse besteht“.536 Schließlich fanden selbst Kleibers Spielplanvorschläge zur Eröffnung der Lindenoper Zustimmung. Dies ist insofern bemerkenswert, als offensichtlich sogar eine Inszenierung von Alban Bergs Wozzeck anlässlich des 30. Jahrestages der Uraufführung mit Kleiber am Pult auf Akzeptanz stieß. Dass man sich in der Hochphase der Formalismus-Kampagne selbst auf dieses avancierte Werk der musikalischen Moderne einließ, zeigt, welche große Bedeutung eine Verpflichtung Kleibers für die Kulturpolitik des ostdeutschen Staates besaß. Tatsächlich war die Gefahr einer Abwanderung der besten Sänger keineswegs gebannt. So musste Kleiber fortan auf Elfride Trötschel, eine der renommiertesten Sopranistinnen des Ensembles, die bei seinem ersten Rosenkavalier-Gastspiel die Rolle der Sophie verkörpert hatte, verzichten. Sie war Anfang 1952 von Tietjen an die Städtische Oper engagiert worden.537 Wie zuvor Ernst Legal versuchte Kleiber in West-Berlin, eine Lockerung des konfrontativen kulturpolitischen Kurses zu bewirken, wozu er sich – allerdings ohne Erfolg – mit Carl Ebert besprach.538 Auch die Schwerpunktsetzung auf das deutsche Repertoire bei den Eröffnungspremieren der wiederaufgebauten Lindenoper geht auf Kleiber zurück. In einem Brief an Max Burghardt forderte er 1954 enthusiastisch : „Was die ersten neu-zu-schaffenden Auffuehrungen im Linden-Haus betrifft, so stehe ich unbedingt auf dem Standpunkt, dass die neu erstandene deutsche Staatsoper unter allen Umständen mit Werken der vier großen deutschen Klassiker – Beethoven, Gluck, Mozart, Wagner – eroeffnet werden muss. Das müssen die ersten Meister sein, die dort erklingen.“539 Kleiber schloss mit der Versiche536 „Niederschrift über die Abschlussbesprechung mit Herrn Minister Wandel und Herrn Prof. Kleiber am 16. Juni 1952 über das künftige Vertragsverhältnis Kleibers zur Staatsoper“. BArch, DR 1/213, Bl. 67–69, hier Bl. 68. 537 In einem Brief Kleibers an Legal vom 18.04.52 heißt es : „Dass die Trötschel dem ‚Zug‘ nach Westen gefolgt ist, ist ein schwerer Schlag.“ LAB, C Rep. 167, Nr. 46. 538 Bruce Rothwell, „Sängerkrieg – nicht um musikalische Themen“, in : Münchener Merkur vom 25.01.1955. 539 Brief Kleibers an Max Burghardt vom 30.07.1954. LAB, C Rep. 167, Nr. 46.
190
Künstler – Der „Sängerkrieg“ und der Fall Erich Kleiber
rung : „Moegen Sie der Ausfuehrlichkeit dieses Schreibens entnehmen, dass ich mithelfen will, das neuerstehende Linden-Haus (dem meine große Liebe seit Langem gehört) wirklich zu einer Deutschen STAATSOper zu machen.“540
4. „Primat des Politischen“
In West-Berlin hielt man die DDR-Kulturpolitik mit ihrer Rede von der Unteilbarkeit der deutschen Kultur nur für eine „Schaunummer“, innerhalb derer Erich Kleiber das „Paradepferd“541 abgebe, wie der Tagesspiegel bissig kommentierte. Beim Senat war man der Ansicht, dass der Ost-Berliner Kulturbetrieb in Wirklichkeit nur die Funktion einer „Kulturfassade“ habe, mit der die unmenschlichen Praktiken des Systems verschleiert werden sollten und von der man sich abzugrenzen habe. Die Vorstellung von der Unteilbarkeit der deutschen Kultur verlor in diesem Zusammenhang in West-Berlin an Bedeutung. Gleichzeitig allerdings begann die Volksbildungsverwaltung ein Verhältnis zwischen Künstler und Politik zu propagieren, das man gerade am Osten kritisierte. Nun vertrat man die Auffassung, „nur wenn sie sich eine zeitlang dem Primat des Politischen“ beuge, habe „die Kunst Aussicht, später wieder allein nach ihrem eigenen Gesetz leben zu können“.542 Zwar waren mit dem Primat der Politik nicht etwa Eingriffe in die Spielpläne gemeint, wie sie im Osten vorkamen. Allerdings bedeutete auch die Einmischung in die Auswahl der Künstler durch die Politik eine erhebliche Einschränkung der Freiheit der Kunst. Die Berechtigung dazu sah man in den Versäumnissen gegenüber der nationalsozialistischen Diktatur. Ausgehend von der gängigen Gleichsetzung von Nationalsozialismus und Kommunismus sprach sich Intendant Carl Ebert Ende 1954 gegen die „‚politische Narrenfreiheit‘“ und „‚achselzuckende Neutralität‘“ aus, die „schon 1933 einen großen Teil der deutschen Intelligenz so falsch geführt“543 habe. In Bezug auf Kleibers Haltung meinte der West-Berliner Tag unter der Überschrift „Wenn Musiker unpolitisch sein wollen“ fordernd, der Mut, den der Dirigent 540 Ebd. 541 „Der wunderbare Vertrag“, in : Der Tagesspiegel vom 04.01.1955. 542 Vermerk von Wallner-Basté vom 26.12.1952. Zitiert nach : Lemke, „,Sängerkrieg‘“, S. 278. 543 „Forderungen und Versäumnisse“, in : Der Tagesspiegel vom 13.11.1954.
„Primat des Politischen“
191
1935 Göring entgegengebracht habe, sei nun „durchaus auch vor Stalin am Platze“.544 Dass durch das Verbot der „Zweigleisigkeit“ aber zumindest in einer Hinsicht selbst in West-Berlin die künstlerische Freiheit eingeschränkt wurde, blendete man im Westen aus. Genau auf diesen blinden Fleck, „von Freiheit [zu] reden, und mit Verboten [zu] handeln“545, konnte die DDR mit Recht verweisen. Die West-Berliner Position wog umso schwerer, als man sich damit beharrlich gegen die westdeutschen Bundesländer stellte, die sich aus Zweifel an der Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz nicht zur Übernahme der WestBerliner Richtlinien bewegen ließen. Der Kunstausschuss der Kultusministerkonferenz kam überein, es solle „alles vermieden werden, was den Eindruck erwecken kann, daß Westdeutschland sein Interesse an Ostdeutschland verloren habe, und das der Regierung der DDR zum Vorwand dienen könnte, ihrerseits entsprechend zu argumentieren“.546 Auch der westdeutsche Bühnenverein ließ sich trotz vehementer West-Berliner Überzeugungsarbeit nicht von deren rigidem Kurs einnehmen. Zwar kam sein Verwaltungsrat 1954 überein, den Mitgliedsbühnen zu empfehlen, nach den Berliner Richtlinien zu handeln. Doch war dies nur eine unverbindliche Empfehlung, die ohne Auswirkung blieb, wie man in West-Berlin zerknirscht zur Kenntnis nehmen musste.547 Wegen der starren Haltung geriet West-Berlin in diesem Punkt zunehmend in die Isolation und musste erleben, was von Anfang an befürchtet worden war : In Westdeutschland engagierte Künstler gastierten problemlos gleichzeitig an der Staatsoper.548 544 „Der Fall Erich Kleiber. Wenn Musiker unpolitisch sein wollen“, in : Der Tag vom 04.03.1953. 545 „Von Freiheit reden und mit Verboten handeln. Künstler-Boykott in Westberlin“, in : Neues Deutschland vom 07.01.1955. 546 Zitiert nach : Lemke, „,Sängerkrieg‘“, S. 282. 547 Der Antrag des Verwaltungsrates des Bühnenvereins zur Übernahme der West-Berliner Richtlinien wurde nur deswegen nicht abgelehnt, „a) weil der Beschluß wegen des Begriffes Empfehlung als völlig unverbindlich angesehen wurde, b) aus Höflichkeit gegen den Antragsteller, c) um die lästige Sache loszuwerden“. Vermerk Wallner-Basté vom 28.05.1954. AdK, Berlin, Tietjen-Archiv, Nr. 618 (Mappe : Senat für Volksbildung Intendantenwechsel). 548 Auch bei einer Konferenz mit Vertretern großer Opernbühnen im Dezember 1954 scheiterte West-Berlin mit der Forderung nach Übernahme seiner Richtlinien. Die westdeutschen Kollegen wiesen die Vertreter der Städtischen Oper darauf hin, dass „die in Frage kommenden Künstler [bei der Frage von Gastspielen, FB] zumeist vertragliche Urlaubsansprüche geltend
192
Künstler – Der „Sängerkrieg“ und der Fall Erich Kleiber
5. „Kunst als Geschäft“ ?
Um die Jahreswende 1954/1955 erreichten die Auseinandersetzungen um das Verbot der Zweigleisigkeit, die in der Presse mittlerweile unter dem Begriff „Sängerkrieg“ firmierten, ihren Höhepunkt. Ins Zentrum rückten die Fälle der Sängerin Margarete Klose und des Sängers Josef Herrmann. Beide waren an der Städtischen Oper engagiert, hatten dann aber Ende 1954 einen Vertrag für die Lindenoper abgeschlossen, die im folgenden Jahr eröffnet werden sollte. Klose wie Herrmann wurde daraufhin von der West-Berliner Volksbildungsabteilung das Recht abgesprochen, weiter an der Städtischen Oper aufzutreten. Wenn auch Klose ihre Entscheidung für Ost-Berlin mit künstlerischen Gründen rechtfertigte, nämlich der Zusammenarbeit mit Erich Kleiber549, reduzierten die meisten West-Berliner Medien deren Entscheidung – genauso wie diejenige Josef Herrmanns, der später bei der Eröffnungspremiere der Lindenoper die Rolle des Hans Sachs in den Meistersingern übernehmen sollte – ausschließlich auf finanzielle Motive.550 Mit der Kritik an der „Kunst als Geschäft“551 kam der im Bildungsbürgertum lange tradierte Vorwurf gegen eine rein von finanziellen Interessen geprägte Kunst zu neuen Ehren. Kloses Verpflichtung an die Staatsoper sei ein „Vergehen gegen die Kunst“, die doch eigentlich unabhängig von Ökonomischen „einen reinen und erhabenen Bereich unserer Welt zu repräsentieren“ habe, hieß es in der Berliner Morgenpost. Nicht dass man den Erwerbssinn von Künstlern generell infrage stellte, doch müssten diesem, wie es hieß, in der gegenwärtigen Situation Grenzen gesetzt werden, „die der menschliche Anstand und letzten Endes auch politische Rücksichten gebieten“.552 In der westlichen Presse kursierten wilde Gerüchte um die angeblich immens hohe Gage Klomachen können, über deren Verwertung sie ohne Befragung ihrer Intendanz verfügen können“. Vermerk von Werckshagen vom 06.12.1954. LAB, B Rep. 014, Nr. 349. 549 Der wunderbare Vertrag“, in : Der Tagesspiegel vom 04.01.1955 550 Ebd. ; „Kunst als Geschäft“, in : Berliner Morgenpost vom 06.01.1955 ; Joachim Tiburtius, „Der Berliner Sängerkrieg“, in : Welt am Sonntag vom 23.01.1955. – Außerhalb von Berlin sah man die Motive für Kloses beziehungsweise Herrmanns Entscheidung differenzierter, wie ein Artikel in der Welt zeigt. Walter Busse, „Wenn sie ‚drüben‘ singen oder spielen“, in : Die Welt vom 11.01.1955. 551 „Kunst als Geschäft“, in : Berliner Morgenpost vom 06.01.1955. 552 Ebd.
„Wenn Politik und Propaganda in ein Theater eindringen“
193
ses in Ost-Berlin. Um diese zu entkräften, berief der Intendant der Staatsoper Burghardt in Ost-Berlin eine Pressekonferenz ein, schon allein deswegen, um unter den übrigen Sängern des Ensembles nicht Begehrlichkeiten zu wecken, die letztlich nicht zu finanzieren waren.553 Die West-Berliner BZ argumentierte in der Frage der Gagen, wenn dies auch eine Ausnahme darstellte, sogar rassistisch, indem sie die Worte „Bin nur ein Nigger, zieh durch die Welt – singe für money, tanze für Geld“ aus Paul Abrahams Operette Blume von Hawaii zitierte, um dann zu fragen : „Wo ist da eigentlich der Unterschied zwischen dem Nigger und den Opernsängern ?“554
6. „Wenn Politik und Propaganda in ein Theater eindringen“
Dass auch an der Staatsoper die Freiheit der Kunst nicht gewährleistet war, wie sich Kleiber dies zunächst erhofft hatte, dämmerte dem Dirigenten spätestens im Sommer 1952. Infolge des Beschlusses der 2. Parteikonferenz der SED vom Juli 1952, den Sozialismus planmäßig aufzubauen, was einen Sowjetisierungsschub bedeutete, war über Ernst Legals Kopf hinweg rund 240 West-Berliner Staatsopernangehörigen aus dem Bereich der Technik gekündigt worden. Ernüchtert musste der Intendant feststellen, dass die Regierung des ostdeutschen Staates entgegen der vielfachen offiziellen gegenteiligen Beteuerungen ebenfalls auf eine Teilung der deutschen Kultur hinarbeitete. Auch die Erfahrungen im Zusammenhang mit Ruslan und Ludmilla und dem Verhör des Lukullus bestärkten ihn in der Einsicht, dass ihm an seiner Bühne die künstlerische Freiheit nicht mehr gewährt wurde. Er trat verbittert von seinem Amt zurück.555 Die Ereignisse hinterließen auch bei Kleiber tiefe Spuren. In einem mit bemerkenswerter Offenheit formulierten Brief an Ministerpräsident Grotewohl vom Januar 1953 gab der Dirigent, er hatte mittlerweile sein drittes Gastspiel in der DDR absolviert, seinen „schweren Zweifeln“ an der Übernahme des 553 Brief Burghardts an Abusch vom 23.09.1957. BArch, DR 1/18199. Immerhin widersprach auch der West-Berliner Kurier den Gerüchten um die angeblich immens hohen Gagen. Kurt Westphal, „Die andere Seite : Allein um Gagen geht es nicht“, in : Der Kurier vom 14.01.1955. 554 Zitiert nach : Lemke, „,Sängerkrieg‘“, S. 290. 555 Siehe zum Rücktritt Legals auch : Anft, Legal, S. 372f.
194
Künstler – Der „Sängerkrieg“ und der Fall Erich Kleiber
Generalmusikdirektorenamtes Ausdruck : „Ich habe im Jahre 1935 Berlin und damit eine Lebensstellung verlassen, weil ich die traurige Gewissheit hatte, dass hier Politik und Partei-Propaganda einen solchen Einfluss auf die künstlerische Arbeit gewonnen hatten, dass diese lediglich zur Dienerin wurde. Was mich seinerzeit aus Berlin vertrieben hat, tauchte nun wie ein Gespenst wieder vor mir auf, als ich die Zusammenhänge und Vorfälle kennenlernte, die zum Rücktritt Legals führten. Ich muss mich mit dem Inhalt des [Rücktritts-]Schreibens Legals vom 31. August 1952 völlig einverstanden erklären, vor allem in der Befürchtung, dass, wenn Politik und Propaganda in ein Theater eindringen, dieses eben aufhört ein Kunstinstitut zu sein. Vorfälle wie sie sich in der letzten Zeit der Ära Legal ereigneten (abgesehen von den grausamen Kündigungen, die ohne Wissen und Willen des Intendanten ausgesprochen wurden), dass dem künstlerischen Leiter Vorhaltungen gemacht, ja sogar Verbote ausgesprochen wurden, die mit den künstlerischen Werten der beanstandeten Werke in gar keiner Beziehung standen, wären auch für mich unerträglich. Dazu kommt, dass ich auf meiner Reise durch die DDR Zustände finden musste, die mich sehr nachdenklich stimmten : wie könnte ich (der dank Ihrer Gastfreundschaft in einem gewissen Luxus leben durfte) von allen meinen anderen Mitarbeitern die nötige starke Konzentration zur künstlerischen Arbeit fordern und erhalten, wenn manche dieser Mitarbeiter mit schwersten sozialen und materiellen Sorgen zu kämpfen haben, und viele in der ständigen Angst leben, von heute auf morgen von ihrem Posten aus irgendwelchen kunstfremden Gründen enthoben zu werden ?“556 Kleiber legte sich in seinem Brief an Grotewohl bezüglich einer festen Bindung an die Staatsoper wohl bewusst nicht endgültig fest und hielt sich so die Möglichkeit eines Rückzuges offen. Allerdings beteuerte er, wie er dem Ministerpräsidenten schrieb, weiterhin sein Bestreben, „nach besten Kräften die ‚Musikbrücke‘ [zu] halten“.557 Als Heinz Tietjen den Dirigenten, den er durch die gemeinsame künstlerische Arbeit an Wagners Rings in Rom nach 1945 gut kannte, nach Legals Rücktritt ein weiteres Mal um ein Engagement an der Städtischen Oper ersuchte, sagte dieser erneut ab.558 Kleiber 556 Brief Kleibers an Grotewohl vom 12.01.1953. BArch, NY 4090/544, Bl. 48/51. 557 Ebd. 558 Telegramm Tietjens an Kleiber vom 06.09.1952. LAB, B Rep. 014, Nr. 2260.
„Wenn Politik und Propaganda in ein Theater eindringen“
195
konzentrierte sich weiterhin auf die Staatsoper ; auch 1954 und 1955 kehrte er zu ausgedehnten Gastspielen ans Pult der Staatskapelle zurück. Dennoch war das Verhältnis zwischen dem Dirigenten und der östlichen Kulturadministration seit Legals Demission erschüttert. Letzten Endes fehlte nur noch ein Auslöser für Kleibers Entschluss, von seinem zukünftigen Posten an der Staatsoper zurückzutreten. Diesen erblickte der Dirigent in der Entfernung der gerade erst restaurierten Giebelinschrift „ F R I D E R I C U S R E X A P O L L I N I E T M U S I S “ von der wiederaufgebauten Lindenoper. In einem offenen Brief, der in allen großen westdeutschen Zeitungen abgedruckt wurde, wandte er sich am 16. März 1955 an Staatsopernintendant Burghardt. Darin erläuterte er, dass die Abnahme der Inschrift für ihn einen Bruch mit der ursprünglichen Zusage der DDR-Führung darstelle, das Gebäude genauso wiederaufzubauen, „wie es 1743 der ‚Alte Fritz‘ durch seinen Baumeister Knobelsdorff dem deutschen Volke geschenkt hat.“559 Für den Dirigenten war „dieser Vorfall -- nebst anderen […] Vorkommnissen der letzten Zeit -- ein trauriges aber sicheres Symptom, dass -- wie im Jahre 1934 -- Politik und Propaganda vor der Türe dieses ‚Tempels‘ nicht Halt machen werden. Früher oder später müsste ich dann doch ein zweitesmal Abschied nehmen von dem Hause, nach dem ich mich 20 Jahre lang gesehnt habe. Dieselbe oder eine andere ‚Stelle‘, die den wilden Befehl gab, die Inschrift ‚binnen zwei Stunden‘ zu entfernen, wird sich nicht abhalten lassen, in meinen Wirkungskreis einzudringen, und mit Anweisungen oder Richtlinien meine bisher völlig unbeeinflusste Kunstübung zu stören.“560 Burghardt antwortete Kleiber am 21. März ebenso mit einem offenen Brief. Darin warf er Kleiber vor, genau diejenigen Interessen verraten zu haben, für die er sich seit seinem ersten Ost-Berliner Gastspiel eingesetzt habe und sprach 559 LAB, C Rep. 167, Nr. 46. – Zwei Wochen später richtete Kleiber einen weiteren, nun persönlichen Brief an Burghardt, in dem er seinen Entschluss noch einmal bekräftigte. Dabei erwähnte er eine nicht näher beschriebene „Dresdner Angelegenheit“, die ihm „schon sehr viel zu denken gegeben“ und ihm „wochenlang wie ein Gespenst vor Augen“ gestanden habe. Ebd. – Möglicherweise handelte es sich bei der „Dresdner Angelegenheit“ um die Aufforderung zum Entfernen von großformatigen Politikerbildern aus dem Zuschauerraum während einer Probe. Siehe dazu den Ausschnitt aus den Basler Nachrichten im Pressespiegel der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 22.03.1955. 560 LAB, C Rep. 167, Nr. 46.
196
Künstler – Der „Sängerkrieg“ und der Fall Erich Kleiber
von seinem Rücktritt als einer „die gesamtdeutschen Kulturverbindungen schädigenden Handlung“.561 Die Abnahme der Inschrift verteidigte er, indem er deren lateinische Lettern als Ausdruck einer überkommenen, antinationalen Haltung deutete. An deren Stelle sei nun ein neuer, nationaler Geist in dem wiederaufgebauten Haus eingekehrt. Man müsse „verstehen, dass diese Menschen“ in der DDR „ihr Werk im Sinne der Vereinigung unseres Vaterlandes nicht dem alten Fritzen, sondern dem deutschen Volke widmen wollen und darum diesen grossen Kunsttempel als eine Angelegenheit des gesamten Volkes und nicht einer Dynastie ansehen“.562 In diesem Sinne wurden noch vor der Wiedereröffnung der Bühne anstelle der alten Giebelinschrift die neuen Lettern „ D E U T S C H E S T A A T S O P E R “ angebracht.563 Der Rücktritt Kleibers wurde indes innerhalb der DDR teilweise sogar begrüßt. In einem Leserbrief an die Redaktion der Täglichen Rundschau heißt es kritisch : „Wir brauchen das kapitalistisch verseuchte Künstlervolk à la Kleiber nicht. […] Die Arbeiter sollen sparen, mit jedem Pfennig, jedem Gramm und jeder Minute, aber einige Leute besonders beim Theater treiben ein großes Possenspiel und verschwenden tausende Mark.“564 Wenig bekannt ist heute, dass der West-Berliner Volksbildungssenator Tiburtius kurz nach Kleibers Rückzug von der Staatsoper bei dem Dirigenten erneut durch eine Gesandtschaft in Erfahrung bringen ließ, ob jener nicht nunmehr zu einem Engagement an der Städtischen Oper oder den Philharmonikern bereit sei – es war inzwischen der dritte Versuch West-Berlins in dieser Richtung. Doch auch dieses Mal wies Kleiber das Angebot ab und nutzte die Gelegenheit zu einer scharfen öffentlichen Erklärung und Abrechnung mit der West-Berliner Kulturverwaltung : „Ich werde in West-Berlin den Taktstock nicht heben, solange die jetzigen Kulturbehörden dort am Ruder sind, denn diese haben sich, als ich eine Musikbrücke zwischen Ost und West schlagen wollte, kleinlich sowie chauvinistisch und feindlich gezeigt. Mein Fall ist für jede politische Propaganda – ganz gleich welcher Richtung – ungeeignet und unverwendbar, denn 561 Ebd. Der Brief ist abgedruckt in : Dibelius/Schneider, Musik, S. 305f. 562 Ebd. 563 Die ursprüngliche Inschrift wurde erst in den 1980er-Jahren im Kontext eines veränderten Erbeverständnisses der DDR wieder am Gebäude angebracht. 564 Brief von Peter Klein an die Redaktion der Täglichen Rundschau vom 23.03.1955. Ebd.
Nachspiel
197
ich werde mir wie bisher von niemandem Vorschriften machen lassen, wo ich dirigieren darf und wo nicht.“565 Mit Kleibers doppelter Berliner Absage 1955 war der Höhepunkt der Berliner Auseinandersetzungen um die Doppelbeschäftigung von Künstlern überschritten. Nicht dass es bis zum Mauerbau nicht immer wieder zu Streitfällen über Sängerbesetzungen und Abwerbungen gekommen wäre. Doch begann die WestBerliner Kulturverwaltung nun nach alternativen Konzepten zu suchen. Begünstigt wurde die kulturpolitische „Tendenzwende“566 zum einen durch die allmählich eintretende Besserung der wirtschaftlichen und sozialen Lage der westlichen Teilstadt, wofür nicht zuletzt erhebliche Bonner Subventionen verantwortlich waren567, in deren Kontext auch der Bau der Deutschen Oper finanziert wurde. Zum anderen hing die kulturpolitische Neuausrichtung mit der zwischenzeitlich internationalen Entspannung im Kontext der Genfer Gipfelkonferenz und der geplanten Moskaureise Adenauers zusammen. Anstelle eines rein konfrontativen Denkens trat auf West-Berliner Seite zunehmend der Gedanke des Wettbewerbs. Der Intendant der Städtischen Oper Carl Ebert etwa gab die Parole aus : „Meine Waffe sind gute Vorstellungen.“568 Spätestens Ende der 1950er-Jahre hatte die Bühne in künstlerischer Hinsicht mit der Staatsoper gleichgezogen.
7. Nachspiel
Erich Kleiber starb unerwartet früh am 27. Januar 1956 in Zürich. Möglicherweise trugen dazu auch die Kränkungen im Zusammenhang mit der Berufung zum Generalmusikdirektor der wiederaufgebauten Lindenoper bei. Kleibers Biograf John Russel jedenfalls verknüpft dessen Tod mit den Berliner Ereignissen : „Es gibt Schläge, von denen sich niemand erholen kann, und dies war ein solcher.“569 565 „Erich Kleiber kommt nicht nach Westberlin“, in : Der Tagesspiegel vom 20.03.1955. 566 Siehe dazu : Lemke, „,Sängerkrieg‘“, S. 292ff. 567 Ribbe, Berlin, S. 97ff. 568 Elisabeth Mahlke, „Wieviel [sic] Tenöre braucht die Oper ? Intendant Ebert über Ensemblebildung und Spielplan“, in : Der Tagesspiegel vom 11.02.1955. 569 Russel, Kleiber, S. 265.
198
Künstler – Der „Sängerkrieg“ und der Fall Erich Kleiber
Im Osten und Westen Deutschlands wurde der Fall Kleiber nach dessen Tod jeweils unterschiedlich interpretiert. Max Burghardt zeichnete noch in seinen Memoiren 1973 von Kleiber das Bild eines heimatlosen entwurzelten Menschen. Indem er von der „völlige[n] Bindungslosigkeit“570 des Dirigenten an Land und Gesellschaft sprach, bemühte er noch einmal die lange tradierte Kunstvorstellung eines konstitutiven Zusammenhangs zwischen Künstler, Kunst und Volk. Wenig geschmackvoll bezog er darauf auch den frühen Tod Kleibers : „Wie er [Kleiber, FB] seinen wirklichen Freunden in der Heimat Unverständnis, ja Feindseligkeit entgegenbrachte, so glaubte er, jetzt in der [Züricher] Fremde das zu finden, was er hier abgewiesen hatte.“ Die Ruhe, die der Resignierte in der Schweiz hätte erlangen wollen, habe er dann „schneller, als er glaubte“571 gefunden : im Tod. In der DDR galt es schließlich als ausgemacht, dass sich Kleiber 1955 nur deswegen von der Staatsoper zurückgezogen habe, weil er von westlichen Stellen manipuliert worden sei – angesichts seines wiederholten Pochens auf seine geistige und künstlerische Unabhängigkeit eine zynische Unterstellung.572 In West-Berlin hingegen taugte der Fall, nachdem der Ärger über Kleibers dreifache Zurückweisung der West-Berliner Teilstadt abgeklungen war573, einseitig als Beleg für die mangelnde Freiheitlichkeit des ostdeutschen Systems. Dass aber auch der West-Berliner Senat gegenüber dem Dirigenten die Freiheit der Kunst eingeschränkt hatte, wurde bei dieser Sichtweise geflissentlich übersehen.574 570 Max Burghardt, Ich war nicht nur Schauspieler, Berlin 1973, S. 364f. 571 Ebd. 572 Der langjährige Dramaturg der Staatsoper Werner Otto formulierte, die „abrupte Trennung“ des Dirigenten von der Lindenoper habe „mehr jenen westlichen Gruppierungen, die an Kleibers Tätigkeit an der führenden Opernbühne der DDR desinteressiert waren, als seinem eigenen Willen“ entsprochen. Werner Otto, Lindenoper, S. 296. – In einem Brief an Johannes R. Becher mutmaßte Max Burghardt, Kleibers Absage habe in Zusammenhang mit einer USATournee des Dirigenten gestanden, welche dieser für den verstorbenen Wilhelm Furtwängler übernommen habe. LAB, C Rep. 167, 432. 573 Joachim Tiburtius äußerte am 06.04.1955, er wolle zwar den Streit mit Herrn Kleiber nicht fortsetzen, „empfinde es aber als traurig, daß ein großer Musiker erst in dem Augenblick Anlaß zur Trennung von diesem System [der DDR] findet, in dem Gewalttaten ihn selber berühren und nicht aus Erkenntnis der Grundsätze“. Zitiert nach : Lemke, „Sängerkrieg“, S. 290. 574 Eine derart einseitige Interpretation findet sich sogar noch in der nach der deutschen Wiedervereinigung von Ulrich Dibelius und Frank Schneider herausgegebenen, um Aufklärung bemühten Dokumentation zur Geschichte der deutschen Musik im Kalten Krieg. Dibelius/ Schneider, Musik, S. 319.
VI. Aufführungen Im Zentrum der nationalen kulturellen Repräsentation der Berliner Opernbühnen standen die Aufführungen. Durch die Auswahl der gespielten Werke, deren Interpretation und die Art ihrer Inszenierung wurde dem Publikum das jeweilige Kulturverständnis sinnlich vermittelt. Von Interesse ist zum einen, wie in Ost- und West-Berlin mit den Werken Richard Wagners verfahren wurde, der nach 1945 durch seine zentrale Bedeutung für die Kulturpolitik des Nationalsozialismus umstritten war. Zum anderen ist interessant, wie an den Bühnen mit der kulturellen Moderne umgegangen wurde, die im „Dritten Reich“ ausgegrenzt worden war. Es wird zu untersuchen sein, inwiefern sich in den Aufführungen die vier erläuterten ideengeschichtlichen Dimensionen von einer idealen Opernbühne niedergeschlagen haben. Diese vier Dimensionen gliedern das folgende Kapitel in die Abschnitte bildende Funktion, ursprungsmythologische Argumentationsfigur, schöner Schein und Musterbühne. Dabei wird der zweite und dritte Aspekt zusammen behandelt, weil sich beide Gesichtspunkte in der Analyse nicht sinnvoll voneinander trennen lassen. Für die Analyse sind vor allem solche Aufführungen geeignet, über die in der Öffentlichkeit bis zum Skandal gestritten wurde. Gerade durch die zeitgenössische Reflexion und Diskussion kulturelle Werte und Normen erschließt sich dem Historiker der zeitgenössische Gehalt der Aufführungen. Dass die Komische Oper in diesem Kapitel lediglich unter dem Aspekt Musterbühne thematisiert wird, hängt an diesem Umstand, denn es fehlen an diesem Haus große Auseinandersetzungen um einzelne Aufführungen, wie sie an Staatsoper und Städtischer Oper zu finden sind.
1. Bildende Funktion a) Richard Wagners Die Meistersinger von Nürnberg als Eröffnungspremiere der wieder aufgebauten Lindenoper 1955
Die für die kulturelle Selbstdarstellung der DDR wichtigste Premiere der OstBerliner Staatsoper in den 1950er-Jahren bildete Richard Wagners Oper Die
200
Aufführungen
Meistersinger von Nürnberg, mit der die wieder aufgebaute Lindenoper am 4. September 1955 feierlich eröffnet wurde. Keine andere Aufführung stand derart im Mittelpunkt medialer Aufmerksamkeit wie diese. Die Inszenierung hatte Intendant Max Burghardt besorgt, das Bühnenbild stammte von Ludwig Sievert, und die Leitung der Staatskapelle lag in Händen Franz Konwitschnys, der nach Erich Kleibers Rückzug zum neuen Generalmusikdirektor der Staatsoper ernannt worden war. In den ostdeutschen, politisch gelenkten Zeitungsberichten wurde die Aufführung erwartungsgemäß gefeiert : Von einer „glanzvolle[n] erste[n] Vorstellung“575 war in der Berliner Zeitung die Rede, von „Größe und Würde“576 in Theater der Zeit, und im Neuen Deutschland wurde geschwärmt, dass die drei genannten Künstler „die gesamten szenischen und musikalischen Kräfte sich in einem Maße auf die große Apotheose des Schlußbildes hin entwickeln ließen, wie man dies bisher kaum jemals erlebte.“577 Lob erntete nicht nur die musikalische Seite der Aufführung, wobei neben den Sängern vor allem die Leistung Konwitschnys, der als einer „der besten Operndirigenten der Gegenwart“578 bezeichnet wurde, Zustimmung fand, sondern auch das naturalistisch gestaltete Bühnenbild, das Musik und Gesellschaft als „MeistersingerNürnberg aus vorbildlicher malerischer Anschauung“579 charakterisierte. Es entspräche, wie das Neue Deutschland vermerkte, „in seiner Darstellung des traulichen alten Nürnberg, in der weiten sommerlich-luftigen und frohen Gestaltung der Festwiese dem Gehalt von Werk und Inszenierung sehr gut.“580 Sievert ließ die Schlussszene vor einem großen gemalten Stadtprospekt des alten Nürnberg spielen, vor dem er den Chor auf verschieden hohen Podesten postiert hatte, umgeben von Fahnen mit Emblemen der verschiedenen Zünfte. Kritisiert wurde allerdings in den ostdeutschen Medien die Regie von Max Burghardt, was angesichts der großen kulturpolitischen Bedeutung der Eröffnungsinszenierung für den ostdeutschen Staat durchaus verwundert. Während es in der Berliner 575 J. Weinert, „Opern-Auftakt Unter den Linden“, in : Berliner Zeitung vom 05.09.1955. 576 Heinz Hofmann, „,Die Meistersinger von Nürnberg‘ von Richard Wagner“, in : Theater der Zeit 10 (1955), Heft 11, S. 50–54, hier S. 50. 577 H. Schell, „,Ehrt eure deutschen Meister !‘“, in : Neues Deutschland vom 06.09.1955. 578 Ernst Krause, „,Die Weihe des Hauses‘“, in : Musik und Gesellschaft 10 (1955), S. 306–310, hier S. 307. 579 Ebd., S. 308. 580 H. Schell, „,Ehrt eure deutschen Meister !‘“, in : Neues Deutschland vom 06.09.1955.
Bildende Funktion
201
Zeitung anerkennend hieß, in seiner Inszenierung sei „unter der Decke des Traditionellen mehr Neues“ zu finden gewesen, „als die meisten erwartet hatten“, wie etwa beim Darstellerensemble der Meister, denen „alles Schematische, wie man es bisher gewohnt war“581, genommen worden sei, äußerte sich Theater der Zeit, gerade was die Personenregie anging, kritisch : „Burghardt arbeitete mehr in großzügiger Holzschnitt-Manier die Zeit- und Wesensbestimmung der Dichtung heraus, ohne allen Charakteren genaue Positions- und Funktionsmerkmale zu geben. So wirkte das heitere, lebens- und beziehungsvolle Spiel bisweilen allzu vordergründig in Handlung und Gegenhandlung, schienen nicht alle der singenden Darsteller davon überzeugt, daß innerhalb der Konzeption des Gesamtcharakters jeder seinen logisch begründeten und genau umgrenzten Einzelcharakter durchführen muß.“582 Dennoch war der übereinstimmende Tenor in der ostdeutschen Presse, die Aufführung habe „dem Haus Unter den Linden den Weg zu neuer Weltgeltung“ gewiesen. Es sei deutlich geworden, „daß der Mut und Aufbauwille, der an dieser Stelle in den vergangenen Jahren gewaltet hat, nicht vergebens war, und daß unsere Hoffnungen für die Zukunft unserer Deutschen Staatsoper sehr berechtigt sind“.583 Mit der festlichen Aufführung der Meistersinger sollte nicht nur ein Beweis der künstlerischen und technischen Leistungsfähigkeit der Staatsoper geliefert, sondern auch in Abgrenzung von der Bundesrepublik ein Beispiel für das Kulturverständnis des sozialistischen deutschen Staates gegeben werden. Dabei hatte man mit den Meistersingern allerdings ein durch seine jüngste Rezeptionsgeschichte schwer belastetes Werk ausgewählt. Keine andere Oper war für die Kulturpolitik der Nationalsozialisten von vergleichbar großer Bedeutung gewesen wie diese. Dass das Werk bei der feierlichen Eröffnung des umgebauten Deutschen Opernhauses 1935 gegeben worden war, ist schon erwähnt worden. Auch als Eröffnungspremiere der nach der ersten Zerstörung im Zweiten Weltkrieg wiederaufgebauten Lindenoper 1942 erklang die Oper. Darüber hinaus hatte eine Aufführung der Meistersinger in Anwesenheit Hitlers den Abschluss des sogenannten „Tages von Potsdam“ 1933 gebildet. Schließlich hatte 581 J. Weinert, „Opern-Auftakt Unter den Linden“, in : Berliner Zeitung vom 05.09.1955. 582 Hofmann, „,Meistersinger‘“, S. 52. 583 H. Schell, „,Ehrt eure deutschen Meister !‘“, in : Neues Deutschland vom 06.09.1955.
202
Aufführungen
das Werk als Festoper der Nürnberger Reichsparteitage gedient.584 Wie ist es zu erklären, dass in der DDR, für die das Selbstverständnis als antifaschistischer Staat konstitutiv war, gerade die rezeptionsgeschichtlich so belasteten Meistersinger als Eröffnungspremiere der wiederaufgebauten Lindenoper ausgewählt wurden ? Blickt man auf die Wagner-Rezeption seit 1945 in der SBZ/DDR, wird deutlich, dass der Komponist hier zunächst außerordentlich stark diskreditiert war. Ihm haftete, wie es Eckart Kröplin formuliert hat, der „Ruch faschistoider Geistesart“ an, sodass „eine ‚Entnazifizierung‘ […] fast unmöglich“585 schien. Verbreitet war das pointierte Diktum des einflussreichen Theaterkritikers Herbert Ihering von Wagner als dem „Opiumschmuggler des Nationalsozialismus“586, dessen Werke „das Gift der Großmannssucht“ enthalten würden, welches Kleinbürger zu Welterlösern narkotisiere. Auch der einflussreiche, in der DDR lebende Komponist Hanns Eisler etwa lehnte Wagner wegen seines Nationalismus und Antisemitismus ab. 1950 etwa riet er, „von weiteren Aufführungen [der Werke Wagners, FB] für einige Zeit ab[zu]sehen“.587 Allerdings gab es auch schon früh den Versuch einer positiven Neubewertung Wagners. In der Täglichen Rundschau sprach sich Gustav Leuteritz 1946 anlässlich des ersten Berliner Wagner-Konzertes nach dem Krieg in der Städtischen Oper für ein neues Verständnis des Komponisten aus, wobei er an dessen aktive Teilnahme an der Revolution von 1848/49 aufseiten der Dresdner Aufständischen erinnerte.588 Einen Schub in der positiven Neubewertung brachte vor allem dann das Jahr 1953, in das sowohl Wagners 140. Geburtstag als auch sein 70. Todestag fielen. Wenn es zu diesen Anlässen, anders als bei anderen 584 Siehe dazu : Grey, „Meistersinger”, S. 78–104 ; Hans Rudolf Vaget, „Wagner-Kult und nationalsozialistische Herrschaft. Hitler, Wagner, Thomas Mann und die ,nationale Erhebung‘“, in : Saul Friedländer und Jörg Rüsen (Hg.), Richard Wagner im Dritten Reich. Ein Schloss ElmauSymposion, München 2000, S. 264–282. 585 Eckart Kröplin, „Aufhaltsame Ankunft und ahnungsvoller Abschied. Der Ring in der DDR“, in : wagnerspectrum 1/2006, Würzburg 2006, S. 63–110, hier S. 64. – Zur Wagner-Rezeption in der DDR siehe inzwischen auch : Matthias Duncker, Richard-Wagner-Rezeption in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) und der Deutschen Demokratischen Republik (DDR), Hamburg 2009. 586 Herbert Ihering, Berliner Dramaturgie, Berlin 1947, S. 37. 587 Hanns Eisler, Musik und Politik. Schriften 1948–1962, Leipzig 1982, S. 88. 588 Gustav Leuteritz, „Richard Wagner im Zwielicht“, in : Tägliche Rundschau vom 10.10.1946.
Bildende Funktion
203
Komponisten, keine große staatliche Ehrung gab und das publizistische Echo der beiden Jubiläen im Vergleich mit anderen in der DDR begangenen Feiern verhältnismäßig schwach ausfiel, kam es doch in der Presse zu vermehrten Anstrengungen, den Komponisten zu rehabilitieren. Die National-Zeitung forderte etwa : „Wagner gehört uns – kämpfen wir um ihn !“589 Zwar gestand das Blatt ein, dass der Nationalsozialismus „an gewisse objektive Voraussetzungen bei Wagner“ habe anknüpfen können, so an dessen „stellenweise zutage tretenden Hang zur Deutschtümelei“, „sein falsches Verhalten gegenüber jüdischen Mitbürgern und sein Eintreten für Gobineaus Rassenanschauung, [des Weiteren] an eine gewisse rauschhafte und monumental-schauspielerische Wirkung seiner Kunst und an ähnliches mehr.“ Doch betonte das Blatt, dass der Kunst Wagners auch eine humanistische und damit bildende Dimension innewohne. Die „hohe ethisch-erzieherische, echt humanistische Absicht dieser Kunst“ sei von den Nationalsozialisten bewusst unterschlagen worden. Wagner habe „durch seine Kunst weder die Menschen zu Massenschlächtern erziehen, noch für die Massengräber reif machen“ wollen, „in die der Nationalsozialismus das deutsche Volk mit seinem räuberischen Rassenwahn […] gestürzt hat. […] Im Gegenteil, Wagners ganzer Kampf galt der Verhütung solcher Verbrechen.“590 Um Wagner wieder aufzuwerten, war es hilfreich, auf sowjetische Interpretationen des Komponisten zurückzugreifen, wobei vor allem ein Artikel von Roman Gruber in der Großen Sowjet-Enzyklopädie einflussreich werden sollte.591 Gruber hatte das Bild eines doppelten Wagner entworfen, der sich vom Revolutionär von 1848/49 schließlich zum Reaktionär entwickelt habe : „Der Republikaner 589 Hartmut Meinard, „Wagner gehört uns – kämpfen wir um ihn !“ (Teil 1 und 2), in : NationalZeitung vom 06. und 09.06.1953. 590 Hartmut Meinard, „Wagner gehört uns – kämpfen wir um ihn !“ (Teil 1), in : National-Zeitung vom 06.06.1953. Siehe auch die Darstellung von Wagners Teilnahme am Dresdner Maiaufstand von 1849 in der Berliner Zeitung : Joachim Schulz, „Der rebellische Hofkapellmeister“, in : Berliner Zeitung vom 22.05.1953. 591 Roman I. Gruber, „Richard Wagner. Zur Wiederkehr seines Geburtstages (22. Mai 1813). Aus der Großen Sowjet-Enzyklopädie, Band 6“, in : National-Zeitung vom 22.05.1953. Siehe auch : Igor Boelza, „Richard Wagner im russischen Musikleben“, in : Die Neue Gesellschaft. Populärwissenschaftliche und kulturpolitische Monatsschrift der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft 4 (1951), S. 865–870 und 976–978. Die russischen Autoren konnten sich auf den früheren Volkskommissar Anatoli Lunatscharski berufen, der bereits in den 1930er-Jahren das Bild vom zweifachen Wagner entworfen hatte. Siehe dazu : Kröplin, „Ankunft“, S. 68.
204
Aufführungen
verwandelte sich in einen Monarchisten, der Anhänger Feuerbachs in einen Ergebenen der reaktionären Philosophie Schopenhauers und Nietzsches, in einen Verfechter der reaktionären Rassentheorie Gobineaus.“ Dennoch kam Gruber zu dem Schluss, Wagner nehme in der Musikgeschichte „bei all seinen Widersprüchen einen hervorragenden Platz ein.“ So müsse es darum gehen, sich die „wertvollen Errungenschaften seines Musikschaffens […] zu erhalten und sich kritisch zu eigen zu machen“.592 Das Doppelbild von Wagner als Revolutionär wie Reaktionär setzte sich in der frühen DDR schließlich durch.593 Wenn demzufolge von den nach 1848/49 entstandenen Werken des Komponisten nicht nur dessen Tetralogie Der Ring des Nibelungen, sondern auch Tristan und Isolde sowie das Alterswerk Parsifal als gesellschaftlich passiv abgelehnt wurden, galt dies allerdings nicht für die Meistersinger von Nürnberg. Diese Oper wurde von der Kritik weitestgehend ausgenommen und als humanistisch im sozialistischen Sinne dem nationalkulturellen Erbe zugerechnet. Das Ansehen der Oper stieg in der SBZ/DDR in dem Maße, in dem man sich auf das nationale kulturelle Erbe als ein Mittel gegen die deutsche Teilung besann. Schon 1948 hatte Gustav Leuteritz den Komponisten in seinem Aufsatz Wagner und die deutsche Einigung anlässlich der hundertsten Wiederkehr des Revolutionsjahres im Ost-Berliner Aufbau als einen Künstler gedeutet, der sich mit seiner Teilnahme an der Revolution für einen deutschen Nationalstaat eingesetzt habe, von dem er sich die Verwirklichung einer gerechteren Gesellschaftsordnung versprochen habe. In jener Zeit sei es Wagner um „den neuen Menschen, den von Privilegien und Vorrechten befreiten klassenlosen Staat und das in einer Republik geeinte Deutschland“594 gegangen, wobei sein Werk „der Idee edler, hilfsbereiter Menschlichkeit zutiefst 592 Roman I. Gruber, „Richard Wagner. Zur Wiederkehr seines Geburtstages (22. Mai 1813). Aus der Großen Sowjet-Enzyklopädie, Band 6“, in : National-Zeitung vom 22.05.1953. 593 Beispiele für das Doppelbild Wagners als Revolutionär wie Reaktionär finden sich etwa in : Georg Knepler, „Zu Richard Wagners 70. Todestag“, in : Neues Deutschland vom 13.02.1953 ; „Wagnerpflege statt Wagnerkult“, in : Berliner Zeitung vom 13.02.1953 ; Carl Friedrichs, „In Wahrheit siegte doch immer das Leben“, in : National-Zeitung vom 13.02.1953 ; Hans Mayer, „Richard Wagners geistige Entwicklung“, in : Sinn und Form 6 (1954), S. 111–162, vor allem S. 118. 594 Gustav Leuteritz, „Wagner und die deutsche Einigung“, in : Aufbau 4 (1948), S. 675–682, hier S. 678.
Bildende Funktion
205
verpflichtet“ gewesen sei.595 So habe Wagner in diesem Sinne noch in den Meistersingern „zwanzig Jahre nach der Revolution, im Jahre 1868 mit der Festwiese […] eine weitgefaßte Vision echter deutscher Demokratie entworfen“.596 Selbst der gegenüber Wagner sonst so distanzierte Hanns Eisler nahm die Meistersinger von seiner Kritik weitgehend aus. Bei einem von der Ost-Berliner Deutschen Akademie der Künste 1952 veranstalteten Kolloquium nannte er das Werk eine der „glücklichsten Kompositionen Wagners“.597 Wenn Eisler auch bemängelte, dass darin mit dem Ritter Stolzing das „Prinzip des Neuen, der neuen Zeit merkwürdigerweise in der Figur des Junkertums“ liege, hob er dennoch hervor, dass das Werk „plebejische Elemente in sich“ berge. Auch lasse sich „das Geniale der prachtvollen Partitur […] nicht von der Hand weisen“.598 Bertolt Brecht, der ebenfalls am Kolloquium teilnahm, hielt demgegenüber jedoch an seinem negativen Urteil fest. Er meinte, „man sollte in unserer Epoche jetzt so wenig wie nur möglich Wagner spielen. Wagner ist ja im Bewußtsein der Deutschen als eine nationale Figur, als ein Dichter und Musiker verkörpert. Man sollte ihn darum weniger spielen, weil wir von ihm nur Störungen der Bewußtseinsbildung zu erwarten haben. Wir müssen das Nationalbewußtsein sehr stark auf andere Weise entwickeln, bis man endlich zu Wagner kommen kann. Ich halte seine nationalen Züge für vollkommen flach und unbrauchbar.“599 Brecht konnte sich mit seiner Position jedoch nicht durchsetzen. So wurden gerade die Meistersinger von der DDR als Mittel zur nationalen Identitätsstiftung in Dienst genommen. In diesem Zusammenhang wurde die lange tradierte ursprungsmythologische Argumentationsfigur erneut aktualisiert : Durch die Rezeption der nationalkulturellen Meistersinger sollten sich die Deutschen als nationale Gemeinschaft erkennen und so die Unhaltbarkeit der politischen Teilung begreifen. Dass eine Erziehung zu solchem Patriotismus in der frühen DDR als Bestandteil der bildenden Dimension der Kunst verstanden wurde, 595 Ebd., S. 675. 596 Ebd., S. 676. 597 Eisler, Musik und Politik 1948–1962, S. 240, 241. 598 Ebd. 599 Ebd., S. 243. Das Protokoll der Sitzung enthält daraufhin den Vermerk : „Herr Prof. Eisler schließt sich nicht der Meinung von Herrn Brecht an, indem er [Brecht, FB] für die Unterdrückung der Opern Wagners plädiert.“
206
Aufführungen
ist anhand des Grundsatzprogramms für die Staatsoper von 1952 bereits erläutert worden. Aus Sicht der SBZ/DDR galt eine nationale Einigung unter sozialistischen Vorzeichen als Bedingung für eine moralisch bessere deutsche Gesellschaft. Am 19. Dezember 1948 kam es an der Berliner Staatsoper unter der Intendanz Ernst Legals zur ersten Meistersinger-Inszenierung in der SBZ und damit zum Bruch eines „Tabu[s]“600. Zwar waren von den Werken Wagners in Berlin nach 1945 zuvor schon Der fliegende Holländer und Tristan und Isolde 1947 an der Staatsoper sowie Die Walküre 1948 an der Städtischen Oper gegeben worden, doch besaßen diese Werke keine annähernd so große kulturpolitische Brisanz wie die Meistersinger. So sah sich das Neue Deutschland in seiner Rezension der Premiere dazu veranlasst klarzustellen : „Nürnberg und Wagner wurden von den Nazis mißbraucht“.601 Als entscheidendes Argument für die Aufführung der Oper sah das SED-Organ den konstitutiven Zusammenhang zwischen Künstler, Kunstwerk und Volk an : Die Grundidee, „von dem Revolutionär der 48er Jahre entworfen“, sei „heute aktueller denn je : die Kunst dem Volk, das Richter sein soll über das Schaffen der Künstler. Das Lied, aus den Quellen des Volkstums gespeist, überwindet den Formalismus, in dem die Fachgilde der Meistersinger erstarrt. Es ist nach 80 Jahren auf anderer Ebene wieder die Forderung der Stunde.“602 In der Neuen Zeitung, die in der amerikanischen Besatzungszone erschien, kommentierte Hans Heinz Stuckenschmidt den Entschluss zur Aufführung der Meistersinger dagegen außerordentlich kritisch. Sein Vorwurf zielte gegen die aus seiner Sicht nationalistische Schlusspassage : „Nichts gegen das Werk. Es ist in vielen Dingen von unvergänglicher Schönheit und Meisterschaft. Aber die pathetischen Ansprachen auf der Festwiese wollen uns nicht mehr eingehen ; wir ertragen die Tiraden gegen ‚welschen Tand‘ nur sehr ungern.“603 Die Vorstellung von der Einheit stiftenden Funktion der deutschen Kultur bildete dann auch das Hauptmotiv für die Wahl der Meistersinger als Eröff600 Werner P. Seiferth, „Wagner-Pflege in der DDR“, in : Richard-Wagner-Blätter 13 (1989), S. 89–113, hier S. 93. 601 Carl Friedrich, „Berliner Weihnachtspremieren“, in : Neues Deutschland vom 21.12.1948. 602 Ebd. 603 Hans Heinz Stuckenschmidt, „Meistersinger in der Staatsoper“, in : Die Neue Zeitung vom 21. 12.1948.
Bildende Funktion
207
nungspremiere der Berliner Lindenoper 1955.604 Ursprünglich war geplant gewesen, aus diesem Anlass Beethovens Fidelio zu geben.605 Am 15. März 1955 jedoch hatte das Politbüro der SED aufgrund der aktuellen deutschlandpolitischen Entwicklungen beschlossen, „mit Professor Kleiber zu verhandeln, ob nicht zur Abendaufführung anstatt ‚Fidelio‘ die Oper ‚Die Meistersinger von Nürnberg‘ aufgeführt werden kann“.606 Erst am 27. Februar 1955 hatte der Bundestag in Bonn die Pariser Verträge ratifiziert, welche der BRD eine weitgehende politische Souveränität und den Beitritt zur Nato brachten. Obwohl daraufhin die DDR in den neu gegründeten Warschauer Pakt aufgenommen wurde, sodass dadurch faktisch die beiderseitige Blockintegration abgeschlossen und die deutsche Teilung zementiert wurde, hielt die SED dennoch offiziell an ihrer Einheitspropaganda fest. Nach dem Rückzug Kleibers vom 16. März 1955 ließ sich der alternative Premierenwunsch des Politbüros problemlos verwirklichen.607 Der parteikonforme Staatsopernintendant Max Burghardt begründete im Neuen Deutschland die Entscheidung mit den Worten : „Wir waren der Meinung, daß diese echte nationale Volksoper am besten ausdrückt, was die Herzen aller Deutschen heute bewegt : die Einheit unseres Vaterlandes und der Sieg des Neuen im Herzen der Menschen.“608 In einer bruchlosen Gleichsetzung des historischen Hans Sachs mit der Opernfigur Wagners führte Burghardt aus, dass im Nürnberg des 16. Jahrhunderts „der Traum von einem deutschen Nationalstaat, der in den Jahren vor der Niederlage der Bauern in Deutschland geträumt wurde, in weite Ferne gerückt“ gewesen sei und sich stattdessen ein „weiterer Verfall“ angekündigt habe. Genauso sei, „als Richard Wagner die ‚Meistersinger‘ schuf, […] die deutsche Einheit, für die der junge Wagner 1849 in Dres604 Die kulturpolitische Bedeutung Wagners für die auf nationale Einigung setzende Deutschlandpolitik der SED spiegelt sich außerdem auch in den Dessauer „Richard-Wagner-Festwochen“ der Jahre 1953 bis 1963 wider, die – vom ostdeutschen Staat finanziell massiv unterstützt – zu einer Art DDR-Bayreuth gemacht werden sollten. Siehe dazu : Kröplin, „Ankunft“, S. 76ff. 605 Siehe dazu : „Die Deutsche Staatsoper vor großen Aufgaben“, in : Tägliche Rundschau vom 08.04.1954. 606 Protokoll der Sitzung des Politbüros vom 15.03.1955. BArch, DY 30/ J IV 2/2/ 411, S. 5. 607 Siehe zum Beschluss des Politbüros auch : Max Burghardt. Ein Leben für die Staatsoper. AdK, Berlin, Burghardt-Archiv, Nr. 321, S. 90. 608 Max Burghardt, „Die Deutsche Staatsoper“, in : Neues Deutschland vom 04.09.1955.
208
Aufführungen
den auf die Barrikaden ging, noch immer nicht erkämpft“ gewesen. Damit war für Burghardt der Bezug des Werkes zur gegenwärtigen politischen Situation klar : „Heute, da wir mit den ‚Meistersingern‘ die Deutsche Staatsoper wieder eröffnen, haben wir die staatliche Einheit verloren, sie ist uns wiederum als Ziel unseres politischen Kampfes gestellt.“ Er zog daraus den Schluss, dass es „von doppelt großer Bedeutung“ sei, „die Einheit der deutschen Kultur, ‚die heil’ge deutsche Kunst‘, gemeinsam festzuhalten.“609 Im Programmheft ging Burghardt dann ausführlich auf den engen Zusammenhang zwischen Künstler, Kunstwerk und Volk ein, der sich auch in den Meistersingern spiegele : Der Komponist habe „aus eigener bitterer Erfahrung gegen formale, mechanische Kunstbetriebsamkeit für eine aus dem pulsierenden Leben sich immer neu bildende Kunst“ gekämpft, dabei jedoch nicht „der Schrankenlosigkeit eines sich wild gebärdenden Künstlertums Tür und Tor geöffnet. […] Willkür und Regellosigkeit sind ebenso kunstfeindlich wie Dogmen und Tabulaturen. Gesetze sind in der Kunst wie im Leben notwendig. Sie erhalten und schützen das Erreichte, sie geben dem Ungestümen, Revolutionären Maß und Form. Sie ordnen und lassen reifen.“610 Um den Bezug der Kunst zum Leben nicht zu verlieren, sei es notwendig, deren Stimmigkeit immer wieder vom Volk beurteilen zu lassen. In diesem Sinne rate Hans Sachs in Wagners Oper dem Stolzing : „Dem Volke wollt ihr behagen, / nun dächt’ ich, läg’ es nah, / ihr ließt es selbst euch sagen, / ob das ihm zur Lust geschah. / Daß Volk und Kunst gleich blüh’ und wachs’, / bestellt ihr so, mein’ ich, Hans Sachs !“611 Allerdings versäumte Burghardt in seinem Text nicht, auch auf die Kehrseite der national-integrativen Funktion der der deutschen Kultur hinzuweisen : die Abgrenzung gegen eine ‚volksfeindliche‘ Kunst. So gälten Wagners Bemühungen gegen „formale, mechanische Kunstbetriebsamkeit“ und sein „leidenschaftlicher Kampf gegen die Beckmesser seiner Zeit“ gleichermaßen auch für die DDR. Für den Intendanten waren die 609 Ebd. 610 Max Burghardt [Vorwort] in : Programmheft Die Meistersinger von Nürnberg (Deutsche Staatsoper Berlin, 1955), o. S. 611 Ebd. – Auch der Literaturwissenschaftler Hans Mayer bezeichnete die Meistersinger in seinem Programmheftbeitrag als von „Deutschheit und echter Volkstümlichkeit“ geprägt und rückte das Werk hinsichtlich seiner kompositorischen wie dichterischen Qualitäten in die Nähe der Weimarer Klassik. Hans Mayer, „Richard Wagners ‚Meistersinger‘ in ihrer und in unserer Zeit“, in : ebd., o. S.
Bildende Funktion
209
Gefahren eines „welschen Dunst mit welschem Tand“612, die nach den Worten Hans Sachs drohten, auch gegenwärtig von unverminderter Aktualität. Was im Horizont von Wagners Oper auf negative kulturelle Einflüsse Frankreichs gemünzt war, bezog Burghardt angesichts des Kalten Krieges auf die vermeintliche Gefahr einer Überfremdung der deutschen Kunst durch eine Amerikanisierung. In diesem Sinne hatten die Schlussworte aus den Meistersingern aus Burghardts Sicht auch für die DDR eine grundlegende Bedeutung : „Ehrt eure deutschen Meister, / dann bannt ihr gute Geister ! / Und gebt ihr ihrem Wirken Gunst, / zerging’ in Dunst / das heil’ge röm’sche Reich, / uns bliebe gleich / die heil’ge deutsche Kunst !“613 Der national-affirmative Gestus von Hans Sachs’ Schlussansprache hat sich bis in die sängerische Gestaltung der Rolle 1955 durch Josef Herrmann niedergeschlagen, der jenen Abschnitt betont pathetisch vortrug, wie der Radiomitschnitt der Aufführung belegt.614 Betätigt wird dieser Eindruck durch den Aufführungsbericht von Sabina Lietzmann in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung : „An die Rampe tretend sang Josef Herrmann als Hans Sachs, das von Konwitschny kompakt und lautstark geführte Orchester übertönend, nachdrücklich und deutlich artikuliert seine Botschaft von der ‚Heil’gen deutschen Kunst‘ ins Parkett, fortissimo, und das ‚Habt acht ! Uns drohen üble Streich’ !‘ von aktualisierender Beschwörungskraft.“615 Bedenken gegen ein derartiges Pathos äußerte innerhalb der ostdeutschen Presse lediglich Ernst Krause in Musik und Gesellschaft : „Herrmann sollte den Fehler vermeiden, bei der Schlussansprache gewisse Worte nationalen Selbstbewußtseins übertrieben zu betonen.“ Allerdings stellte er jene Worte nicht etwa grundsätzlich infrage, sondern im Gegenteil : „Je unabsichtlicher hier die Akzente gesetzt werden, desto stärker sprechen sie uns an.“616 612 Auf die Worte aus Hans Sachs Schlussansprache ging Burghardt in seinem Beitrag für das Neue Deutschland ein. Max Burghardt, „Die Deutsche Staatsoper“, in : Neues Deutschland vom 04.09.1955. 613 Siehe dazu : Burghardt, [Vorwort]. 614 Deutsches Rundfunkarchiv Babelsberg, Archivnummer 1920193. 615 Sabina Lietzmann, „Gala-Abend Unter den Linden“, in : Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 06.09.1955. 616 Ernst Krause, „,Die Weihe des Hauses‘“, in : Musik und Gesellschaft 10 (1955), S. 306–310, hier S. 309.
210
Aufführungen
Wagners Meistersinger wurden somit in der DDR 1955 vorbehaltlos in das nationale kulturelle Erbe integriert, das bei der Eröffnung des Hauses Unter den Linden 1955 zusätzlich mit drei weiteren Festpremieren repräsentiert wurde : Iphigenie in Aulis von Christoph Willibald Gluck, Don Giovanni von Mozart und Fidelio von Beethoven. In der zweiten Hälfte der 1950er-Jahre blieb es an der Staatsoper, was Wagners Œuvre angeht, nicht bei der Aufführung der Meistersinger. In der Zwischenzeit war die anfängliche Zurückhaltung gegenüber dem Komponisten so weit geschwunden, dass 1956 selbst Tristan und Isolde wieder gegeben wurde. 1956 bis 1957 gelangte dann sogar der Ring des Nibelungen in einer Neuinszenierung auf die Bühne der Lindenoper. Dennoch verstummte die Kritik gegenüber dem Komponisten in der DDR nie ganz. Heinz Bär stieß mit seinem Aufsatz Wahllose Wagnerei im Juli 1958 in Theater der Zeit eine heftige Diskussion über Wagner an, die über mehrere Ausgaben hinweg in einer Vielzahl von Leserbriefen und Artikeln geführt wurde.617 Umstritten war dabei insbesondere die Aufführung von Wagners Lohengrin in der Lindenoper, die am 25. Juni jenes Jahres ihre Premiere erlebt hatte. Erika Wilde forderte in ihrer Rezension der Inszenierung in Theater der Zeit erneut, Wagners Werke von den Spielplänen der DDR zu verdammen, seien diese doch ideologisch nicht annehmbar.618 Die Auseinandersetzung um Wagner hatte vor allem deswegen Brisanz, weil die SED inzwischen eine neue Etappe in der „sozialistischen Kulturrevolution“ der DDR ausgerufen hatte. Bei der Kulturkonferenz des ZK der SED im Oktober 1957 waren die Intellektuellen wieder einmal zur Anerkennung der führenden Rolle der Partei gezwungen worden, und es wurde in diesem Zusammenhang das politische Ziel erneuert, jegliche Einflüsse bürgerlicher Ideologie zu bekämpfen. So stellte Heinz Bär, einer der entschiedensten Kritiker des Komponisten, in der Wagner-Diskussion fest, dessen Werk sei nicht in Einklang zu bringen „mit den Zielen unserer Kulturrevolution“.619 Die Debatte wurde schließlich jedenfalls vom Herausgeber der Zeitschrift Fritz Erpenbeck Anfang 1959 abgebrochen, indem dieser feststellte, „das Werk Wagner[s], das 617 Heinz Bär, „Wahllose Wagnerei“, in : Theater der Zeit 13 (1958), Heft 7, S. 20–22. Zur Wagner-Kontroverse siehe auch : Calico, Politics, S. 302ff. 618 Erika Wilde, „Der mystische Gral deutscher Kunst. ‚Lohengrin‘ von Richard Wagner in der Staatsoper Berlin“, in : Theater der Zeit 13 (1958), Heft 8, S. 35–36. 619 Bär, „Wagnerei“, S. 21.
Bildende Funktion
211
Werk eines genialen deutschen Musikers“, gehöre „trotz aller Meinungsverschiedenheiten […] zu unserem Kulturerbe. Also ist es zu pflegen.“620 Letztlich hatte die Debatte keine unmittelbaren Auswirkungen auf den Umgang mit Wagner an der Staatsoper in den 1950er-Jahren ; an der Komischen Oper wurde bis zum Mauerbau überhaupt keine Oper von Wagner zur Aufführung gebracht. Um noch einmal auf die Eröffnungspremiere des Jahres 1955 zurückzukommen : Während die Meistersinger-Inszenierung in der ostdeutschen Presse, wie erläutert wurde, bis auf die Regie Max Burghardts gefeiert wurde, erfuhr die Aufführung in den westdeutschen Medien eine weitaus kühlere Aufnahme. Zwar stieß deren musikalische Seite überwiegend auf positive Resonanz, doch hieß es auch : „Daß Konwitschny ein zweiter Kleiber sei, wird uns […] niemand einreden können.“621 Vor allem die Regie war Anlass zur Kritik. Wenn der Kurier dieser immerhin noch attestierte, sie habe den „Glanz und die wohlige Sicherheit der bewährten Tradition“ besessen, monierte die Frankfurter Allgemeine, sie sei „konventionell und sonderbar phantasielos“ gewesen, „vor allem in den Massenszenen“.622 Auch das Bühnenbild habe „nur einen Teil der Poesie, die sich aus dem Altstadtzauber Nürnbergs mühelos hätte destillieren lassen“623, heraufbeschworen. Die FAZ zog sogar ästhetische Parallelen zwischen der Schlussszene auf der Festwiese und den Aufmärschen auf dem MarxEngels-Platz unweit der Oper. Dahinter stand der Vorwurf einer politischen Indienstnahme der Kunst durch den sozialistischen Staat.624 b) Heinz Tietjen als Regisseur der Werke Wagners an der Städtischen Oper
Dass das Werk Wagners nach 1945 stark diskreditiert war, wurde vor allem für Heinz Tietjen zum Problem, da dieser während des „Dritten Reiches“ als künst620 Zitiert nach : Schlenker, „Erbe“, S. 178. 621 „Rechte Freude erst am Nachmittag“, in : Der Kurier vom 05.09.1955. 622 Sabina Lietzmann, „Gala-Abend Unter den Linden“, in : Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 06.09.1955. Eine ähnliche Einschätzung siehe : „Ost-Berlins mondänes Fest“, in : Die Welt vom 06.09.1955. 623 „Rechte Freude erst am Nachmittag“, in : Der Kurier vom 05.09.1955. 624 Sabina Lietzmann, „Gala-Abend Unter den Linden“, in : Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 06.09.1955.
212
Aufführungen
lerischer Leiter der Bayreuther Festspiele und Intendant der Preußischen Staatstheater die Wagner-Rezeption im nationalsozialistischen Deutschland entscheidend geprägt hatte. So fühlte sich Tietjen nach dem Ende des NS-Regimes dazu veranlasst, sein zurückliegendes künstlerisches Wirken im rechten Licht erscheinen zu lassen. Tietjen scheint seinen Standpunkt, mit dem er sich dann vor der Entnazifizierungskommission verteidigen sollte625, früh festgelegt zu haben. Auf einem Manuskript, das jene Position enthält, steht der handschriftliche Vermerk, es sei „unmittelbar nach dem Zusammenbruch“626 Deutschlands verfasst. In jenem Text stellte er sich als unpolitischer Künstler dar, der nur dem ‚ewigen‘ Werk Wagners habe dienen wollen. So heißt es darin, es habe „nach 1933 niemals ein ‚teutsches‘ Bayreuth in nationalistischem Sinne, und nach 1933 niemals ein Hitler-Bayreuth bei der Deutung des Kunstwerkes auf dem Festspielhügel gegeben“. Es sei immer nur sein Bestreben gewesen, „aus jahrzehntelangem Wissen um das Werk, in absolutester Werktreue und unbeeinflusst von irgendwelchen politischen Ereignissen, ausschließlich dem künstlerischen Willen des Dichter-Komponisten nahe zu kommen.“ Diese Linie sei ihm deswegen möglich gewesen, weil es niemand gewagt habe, ihm „in Bayreuth in irgend etwas hineinzureden. Selbst die Gesamtleiterin der Bayreuther Festspiele, Frau Winifred Wagner, hat mir in allen künstlerischen Angelegenheiten vollste künstlerische Freiheit gelassen.“627 Bedenkt man Tietjens Rehabilitierung im Jahr 1948, ging seine Argumentationsstrategie zumindest langfristig auf. Als Intendant der Städtischen Oper brachte er zwischen 1949 bis 1954 zusammen mit dem Bühnenbildner Emil Preetorius, mit dem er seit den 1930er-Jahren zusammengearbeitet hatte, den größten Teil des Wagnerschen Œuvres zur Aufführung : Tannhäuser (1949), Tristan und Isolde (1950), Der Fliegende Holländer (1952), Der Ring des Nibelungen (1950-53) und als letzte Oper auch Die Meistersinger von Nürnberg (1954). Es ist in diesem Kontext keine einzige pronationalsozialistische Äußerung Tietjens überliefert. Allerdings sahen der Regisseur und sein Bühnenbildner offensichtlich auch keinerlei Notwendigkeit, ihre Auffassung von Wagner grundlegend zu überdenken. Einwände wie derjenige Thomas Manns, es sei „viel ‚Hitler‘ in 625 Siehe dazu : Selbstaussage Tietjens vor der Entnazifizierungskommission am 05.06.1946. AdK, Berlin, Tietjen-Archiv, Nr. 370. 626 Zitiert nach : Karbaum, Studien, S. 112. 627 Ebd.
Bildende Funktion
213
Wagner“628, in seinem berühmten Brief an Preetorius vom 6. Dezember 1949, galten für sie nicht. Aus verschiedenen Briefen Tietjens geht hervor, dass er seine künstlerische Arbeit nach 1945 als bruchloses Anknüpfen an sein Wirken in Bayreuth vor 1945 begriff.629 Für ihn waren Wagners Dramen, wie er am 13. Juni 1946 an seinen Bühnenbildner schrieb, Ausdruck allgemeinmenschlicher – keineswegs spezifisch nationaler – Werte und Konflikte, gehe es darin doch in einem kosmopolitischen Sinne um die „Darstellung der ewig widerstreitenden Mächte im Herzen der Menschen“.630 Die Position der DDR, wonach von der Kunst Wagners eine nationale Einheit stiftende Wirkung ausgehe, ist von Tietjen nach 1945 nicht überliefert. Interessanterweise war er aber gleichzeitig in der frühen Bundesrepublik offensichtlich Vertreter eines nationalistischen Weltbürgertums, wie es der Historiker Michael Steinberg charakterisiert hat. In einem Brief an den Stadtrat für Volksbildung Walter May (SPD) vom 23. Mai 1950 plädierte Tietjen mit dem Argument für die Aufführung der Werke Mozarts, Wagners und Richard Strauss’, dass diese „für die deutsche Kunst die ganze Welt erobert“ hätten „und heute wieder mehr als je die Vormachtstellung für Deutschland und für Berlin einnehmen“.631 Was Tietjens Selbstdarstellung nach 1945 als unpolitischer Künstler anging, konnte er sich zu Gute halten, dass er sich in seinen zusammen mit Preetorius während des „Dritten Reiches“ realisierten Inszenierungen stilistisch nie dem kulturpolitisch verordneten pathetisch-nationalistischen Naturalismus des „Reichsbühnenbildners“ Benno von Arent unterworfen habe, der überdies nie selbst in Bayreuth gewirkt hat. Tietjen und Preetorius konnten vielmehr auch im Nationalsozialismus einen zumindest gemäßigt modernen „stilisierte[n] Naturalismus“632 umsetzen, der eine Tendenz hin zu einer expressionistischen symbolisch-abstrahierenden Bildsprache hatte. Um nun in seinen Inszenierungen an der Städtischen Oper ab 1948 den aus seiner Sicht zeitlosen Gehalt der 628 Brief Thomas Manns an Emil Preetorius vom 06.12.1949, zitiert nach : Hans Rudolf Vaget, Im Schatten Wagners. Thomas Mann über Richard Wagner. Texte und Zeugnisse 1895–1955, Frankfurt/M. 1999, S. 101–205, hier S. 204. 629 Siehe dazu : Briefe Tietjens an Preetorius vom 13.06.1946, 07.09.1946 und 09.05.1947. AdK, Berlin, Tietjen-Archiv, Nr. 226. 630 Brief Tietjens an Preetorius vom 13.06.1946. Ebd. 631 Brief Tietjens an Walter May vom 23.05.1950. Ebd., Nr. 630. 632 Eckert, Ring, S. 178.
214
Aufführungen
Werke Wagners herauszuarbeiten, wollte Tietjen, wie dem Briefwechsel mit Preetorius zu entnehmen ist, das Bühnenbild – über das bisherige Maß hinaus – noch weiter stilisieren. Interessant ist dies insofern, als er damit eine Ästhetik ins Auge fasste, die dann Wieland Wagner in seinen Inszenierungen in ‚Neu-Bayreuth‘ ab 1951 umsetzte. So schrieb Tietjen 1946 an Preetorius in Bezug auf die geplante Tannhäuser-Inszenierung : „Unser Versuch zielt darauf, die Inscenierung, das Bühnenbild und die Kostüme von Wagner’s Werk aus der überkommenen Sphäre des Historismus und Naturalismus herauszulösen und vorzudringen zu seiner Kernsubstanz, dem musikdramatischen Geschehen. Damit soll zugleich der vielstimmige Einwand gegen Wagner entkräftet werden, daß mit jenem gehäuften Ausstattungsstil das Werk Wagner’s stehe und falle.“633 Auch für das Bühnenbild zur Götterdämmerung forderte er von seinem Bühnenbildner eine weitestgehende Stilisierung : „Weg von allem Dekorationsplunder, und sei er noch so künstlerisch, so wie wir es in Bayreuth schufen, aber auch weg von unserem damaligen Bayreuth zu noch viel grösserer Einfachheit auf der Bühne. Alles, was Wagner dekorativ sich dachte, bitte in Ihren Entwürfen nur angedeutet […]. Ich stelle alle meine Inscenierungen nur noch auf das Drama und den Menschen im dramatischen Verlauf der Musik“.634 Wenn die künstlerische Umsetzung des Rings in West-Berlin dann auch konventioneller geriet als in der Korrespondenz mit Preetorius angedacht, ist Nora Eckerts Einschätzung doch zu einseitig, die jene Produktion in ihrer Arbeit über die Aufführungsgeschichte der Tetralogie lediglich als ein „mit der Dürftigkeit der Zeit zusammengeflicktes Remake“ und als einen dritten „Aufguß ihrer Bayreuther und Berliner ‚Ring‘Konzeption von 1933“635 bezeichnete. Unabhängig von den Unzulänglichkeiten der Bühnentechnik und den räumlichen Einschränkungen im Theater des Westens kann im West-Berliner Ring der Jahre 1950 bis 1953 demgegenüber durchaus von einer Weiterentwicklung von Tietjens und Preetorius Stil der 1930er- und 1940er-Jahre gesprochen werden. Dass beide Künstler nicht „mehr […] zu bieten“ gehabt und „schon gar nichts dazugelernt“636 hätten, wie Eckert schrieb, ist jedenfalls eine zu undifferenzierte Sicht. 633 Brief Tietjens an Preetorius vom 13.06.1946. AdK, Berlin, Tietjen-Archiv, Nr. 226. 634 Brief Tietjens an Preetorius vom 02.02.1949. Ebd., Nr. 227. 635 Eckert, Ring, S. 178. 636 Ebd.
Bildende Funktion
215
Im Vergleich zu Wieland Wagners schon erwähnten archaisch-symbolisch verdichteten Bayreuther Inszenierungen ab 1951 allerdings wirkten die Deutungen von Tietjen und Preetorius stilistisch dennoch zunehmend veraltet. Für den Intendanten muss das schmerzlich gewesen sein, hatte er doch, nachdem er seine Ambitionen auf eine Rückkehr nach Bayreuth mit der Ernennung der beiden Wagner-Enkel als neue Leiter der Festspiele aufgeben musste637, den ehrgeizigen Anspruch gehabt, die West-Berliner Städtische Oper zu einem ‚besseren‘ Bayreuth zu machen.638 Der Stil Wieland Wagners schlug sich Ende der 1950er-Jahre auch an der Städtischen Oper nieder. Carl Ebert nämlich lud keinen anderen als den Wagner-Enkel Wieland selbst nach Berlin ein, der 1959 Wagners Tristan und Isolde inszenieren sollte, womit eine enge künstlerische Zusammenarbeit zwischen dem Leiter der Bayreuther Festspiele und dem Opernhaus begann. Tietjens und Preetorius Inszenierungen jedoch hielt Ebert in den Jahren seiner Intendanz weiterhin im Spielplan. c) Boris Blachers Preußisches Märchen an der Städtischen Oper 1952
Ungeachtet der ‚ewigen‘, allgemeinmenschlichen, aber unpolitischen Werte, die Heinz Tietjen in Richard Werken Wagners verwirklicht sah – dass Carl Ebert über die bildende Funktion der Kunst prinzipiell gleich dachte wie jener, wurde schon erläutert – stellt sich die Frage, ob in den 1950er-Jahren nicht doch, zumindest im Zusammenhang mit zeitgenössischen Werken, ein dezidiert politischer Kunst- beziehungsweise Bildungsbegriff auf der Bühne der Städtischen Oper Einzug hielt. Kam es vielleicht in der West-Berliner Oper zu einer konkreten künstlerischen Auseinandersetzung mit gegenwärtigen politischen Pro637 Zu Tietjens Ambitionen auf ein neuerliches künstlerisches Wirken in Bayreuth nach 1945 siehe : Henze-Döring, „Zentren“, S. 47ff. – Dass Wieland Wagner mit der Leitung der Bayreuther Festspiele betraut wurde, erschien Tietjen angesichts von dessen besonderer Begünstigung durch Adolf Hitler als besondere Ungerechtigkeit. Siehe etwa den Brief Tietjens an Preetorius vom 20.04.1949. AdK, Berlin, Tietjen-Archiv, Nr. 227. 638 Aus verschiedenen Briefen Tietjens geht hervor, wie sehr er seine künstlerische Arbeit an der West-Berliner Städtischen Oper nunmehr als Gegenentwurf zu den Bayreuther Festspielen begriff : In einem Brief vom 11.08.1953 etwa bezeichnete Tietjen seinen West-Berliner Ring in Abgrenzung von Wielands Bayreuther Inszenierung als „Contra-Ring“. Ebd.
216
Aufführungen
blemen oder etwa mit der unmittelbaren Vergangenheit des Nationalsozialismus ? Am 23. September 1952 hatte an der Städtischen Oper Boris Blachers Preußisches Märchen seine Uraufführung, die auf Carl Zuckmayers Schauspiel Der Hauptmann von Köpenick. Ein deutsches Märchen von 1930 basierte, jener berühmten schonungslosen Abrechnung mit preußischem Untertanengeist und Militarismus. So ist zu fragen, ob Blacher mit seiner Oper – anders als etwa der letztlich allzu harmlose Erfolgsfilm Der Hauptmann von Köpenick von 1956 mit Heinz Rühmann in der Hauptrolle – einen gesellschaftskritischen Kommentar über deutschen Militarismus angesichts der damals aktuellen Debatte um eine deutsche Wiederbewaffnung intendiert habe. Dass dies so sei, war jedenfalls der Eindruck der West-Berliner FDP. Bei einer Versammlung der Partei im Stadtteil Neukölln regte sich erheblicher Unmut über Blachers neueste Oper, wie der Tagesspiegel am 17. Februar 1953 zu berichten wusste.639 Dabei wandte sich der Abgeordnete Hermann Fischer entschieden gegen die Absicht, dieses Werk als Gastspiel der Bühne in Paris zu zeigen. Es müsse, kolportierte die Zeitung den Politiker, „von den zuständigen Senatsdienststellen so viel Fingerspitzengefühl“ verlangt werden, „daß sie nicht zu einem Zeitpunkt, in dem um die Verteidigung Europas gerungen werde, im Ausland ‚preußische Grenadiere als Hampelmänner‘“ zeigten. Die gerade in Verhandlung befindlichen Pläne einer Europäischen Verteidigungsgemeinschaft (EVG) machten es aus Sicht des FDP-Politikers unmöglich, die Oper als Gastspiel in Paris aufzuführen. Auch aus einem anderen Grund war er gegen das Werk : Es habe sich herumgesprochen, dass der Komponist in der Partitur des Preußischen Märchens „ursprünglich eine Verhöhnung des Deutschlandliedes vorgesehen“ habe. Die Partitur solle nur deswegen geändert worden sein, weil sich die Musiker geweigert hätten, das Werk „in dieser Form zu spielen“. Diese Tatsache müsse ausreichen, um den „dissonanten Neutöner“ Blacher vom zukünftigen Amt als Leiter der West-Berliner Musikhochschule wieder zu entfernen.640 Die West-Berliner Zeitung Der Abend befragte daraufhin verschiedene Persönlichkeiten des Kulturlebens nach ihrer Auffassung zu Blachers 639 „Kulturelle Nachrichten. Berliner Freie Demokratische Partei gegen das ‚Preußische Märchen‘“, in : Der Tagesspiegel vom 17.02.1953. 640 Ebd.
Bildende Funktion
217
Werk. „Ja und Nein prallen hart aufeinander“, resümierte das Blatt. Während sich etwa Jean Neurohr, der Direktor des Französischen Instituts in Berlin für ein solches Gastspiel aussprach, weil es für die Pariser, welche „die Deutschen vielfach für humorlos halten“, eine große Überraschung bedeuten würde, „die Berliner Ironie kennenzulernen“641, sprach sich der Schauspieler und Regisseur Hans Stüwe gegen eine Aufführung in Frankreich aus. Er befürchtete politische Missverständnisse, da er bezweifelte, dass die Ironie Blachers richtig verstanden werden würde. War Blachers Oper somit tatsächlich von einer derart heftigen politischen Sprengkraft, wie es die Neuköllner FDP behauptet hatte ?642 Boris Blacher, der von 1922 bis zu seinem Tod 1975 in Berlin lebte, avancierte in den Jahren nach 1945 zum einflussreichsten (West-)Berliner Komponisten, sodass sogar von einer „Ära Blacher im Nachkriegs-Berlin“643 gesprochen werden kann. Der als Sohn eines baltischen Bankiers in China und Sibirien aufgewachsene Komponist hatte zwar mit seiner dem Neoklassizismus zuzuschreibenden Concertanten Musik, die 1937 mit großem Erfolg von den Berliner Philharmonikern uraufgeführt worden war, bereits während des „Dritten Reiches“ einige Bekanntheit erlangt ; sein Name war nach 1945 aber zunächst noch nicht so geläufig, als dass dieser „mit dem NS-Regime unweigerlich identifiziert“644 worden wäre, wie Dietmar Schenk den Komponisten im Berliner Musikleben verortet hat. Überdies habe Blachers innere Emigration, die aufgrund der nationalsozialistischen Klassifizierung als „Vierteljude“ und „Neutöner“ stets prekär geblieben sei, „nichts Fragwürdiges an sich“ gehabt. Nach 1945 erhoffte sich Blacher, der politisch deutlich links stand645 und, was im West-Berlin des beginnenden Kalten Krieges nicht selbstverständlich war, in Kontakt mit Bertolt Brecht und anderen Kommunisten aus Ost-Berlin stand, einen Wandel der kulturellen Verhältnisse. So artikulierte er 1949 in einem Briefentwurf an William Glock seine 641 „ MÄRCHEN – zu ernst genommen ?“, in : Der Abend vom 18.02.1952. 642 Aus welchem Grund das Pariser Gastspiel mit dem Preußischen Märchen letztlich nicht zustande kam, konnte leider nicht ermittelt werden. 643 Zitiert nach : Dietmar Schenk, „Boris Blacher im Berliner Musikleben der Nachkriegszeit“, in : Heribert Henrich (Hg.), Boris Blacher, Hofheim 2003, S. 89–104, hier S. 89. 644 Ebd., S. 94. 645 Ebd., S. 99.
218
Aufführungen
Enttäuschung über die kulturelle Restauration in West-Berlin : „Berlin is not more interesting us at all. The musical life is now quite normal with Furtwängler playing Brahms + Bruckner in the same way as nothing happened in the past. All the hopes that something has changed since 45 are gone.”646 Wenn sich Blachers Versuche, die kulturellen Verhältnisse in Berlin durch sein kompositorisches Schaffen zu ändern, wegen der stilistischen Vielgestaltigkeit seines Œuvre auch kaum auf einen Nenner bringen lassen, lässt sich doch sagen, dass ein zentraler Aspekt seiner zahlreichen Werke für das Musiktheater war, darin auf gegenwärtige gesellschaftliche Probleme kritisch Bezug zu nehmen.647 In den Kammeropern Die Flut (1946), die 1948 auch an der Städtischen Oper gespielt wurde, und Die Nachtschwalbe (1947) knüpfte er, wie Martin Willenbrink herausgearbeitet hat648, an das Genre der Zeitoper der 1920er-Jahre an. Jene Form von Musiktheater, die sich hinsichtlich ihrer Inhalte durchaus provokativ einer unbedingten gesellschaftlichen, politischen sowie technologischen Aktualität verschrieben hatte, brach bewusst mit der Vorstellung der Kunst als Ausdruck des schönen Scheins, zeigte sich bisweilen sozialkritisch und nahm musikalisch Einflüsse zeitgenössischer Unterhaltungsmusik vor allem amerikanischer Provenienz auf. Blacher verband mit seinem Anknüpfen an dieses Genre die Kritik an den herrschenden gesellschaftlichen Zuständen im Nachkriegsdeutschland. An die Stelle eines überkommenen idealistischen Kunstverständnisses mit seinem Anspruch auf überzeitliche Geltung und eine Betonung vermeintlich ‚ewiger Werte‘ der Kunst traten bei ihm „Opern mit einkomponiertem Verfallsdatum“649, die auf die konkrete gesellschaftliche und politische Situation bezogen waren. Allerdings blieb der Komponist gegen646 Zitiert nach : ebd., S. 102. – In Berlin hatte Blacher ab 1945 zunächst an dem der musikalischen Moderne verpflichteten Internationalen Musikinstitut in Zehlendorf mitgearbeitet, dann ab 1948 an der Hochschule für Musik gewirkt, zu deren Direktor er 1953 ernannt wurde. Dieses Amt übte er bis 1970 aus. 647 Die deutlichste politische Botschaft Blachers enthält sein kompositorischer Beitrag für die deutsch-deutsche Gemeinschaftskomposition Jüdische Chronik. Siehe dazu : Joy H. Calico, „Jüdische Chronik : The Third Space of Commemoration between East and West Germany“, in : The Musical Quarterly 88 (2005), S. 95–122. 648 Martin Willenbrink, „Opern mit einkomponiertem Verfallsdatum. Der Zeitopern-Komponist Boris Blacher“, in : Heribert Henrich (Hg.), Boris Blacher 1903–1975. Dokumente zu Leben und Werk, Berlin 1993, S. 27–37. 649 Ebd., S. 30.
Bildende Funktion
219
über der gesellschaftlichen Wirksamkeit seiner Werke skeptisch. Jedenfalls hielt Bertolt Brecht in seinem Arbeitsjournal unter dem 19. April 1950 über einen Besuch bei Blacher in dessen Wohnung fest, dass sich jener über die Zukunft der Oper pessimistisch geäußert habe : „seit 1912 (rosenkavalier) hat keine oper mehr (auch kein größeres musikstück mehr) fuß gefaßt. das publikum kommt aus mit den älteren werken.“650 Das dem Preußischen Märchen zugrunde liegende Schauspiel von Carl Zuckmayer geht zurück auf die wahre Geschichte des Schusters Wilhelm Voigt. Dieser hatte 1906 zusammen mit zwei Trupps von Gardesoldaten, die ihm wegen seiner falschen Hauptmannsuniform Gehorsam leisteten, das Rathaus der Stadt Köpenick vor den Toren Berlins besetzt, den Bürgermeister verhaften lassen und die Stadtkasse beschlagnahmt. War es allerdings Zuckmayer mit seinem Theaterstück darum gegangen, den preußischen Untertanengeist ironisch aufs Korn zu nehmen, hatte Blachers Oper eine andere Stoßrichtung. Sein Librettist Heinz von Cramer hob an dem Stoff, wie Heribert Henrich formuliert hat, „weniger das Thema der Autoritätsgläubigkeit hervor, als daß er die Köpenickiade dazu nutzte, – in bewußter Anlehnung an Heinrich Manns Untertan – die Gefährlichkeit des zu unkontrollierter Macht gelangenden Kleinbürgers zu demonstrieren“.651 Wenn auch direkte Anspielungen auf den Nationalsozialismus fehlten und das kritische Potenzial insofern begrenzt blieb652, war das Werk doch „in dieser Akzentuierung ungeachtet seines wilhelminischen Gewandes in stärkerem Maße auf das ‚Dritte Reich‘ bezogen, als dem Publikum so kurz nach dessen Untergang lieb sein konnte“.653 Anders als Zuckmayer entwarfen Blacher und von Cramer die Titelfigur nicht etwa als charakterlich liebenswürdig, sondern als unsicher und passiv. Die Rolle des Hauptmanns zum Beispiel nimmt
650 Brecht selbst erwiderte nach eigener Aussage, er habe versucht „zu argumentieren, daß diese eben die alte funktion der oper besser erfüllen und eine neue funktion nicht gefunden worden ist. die opern des revolutionären systems (DON JUAN, ZAUBERFLÖTE, FIGARO, FIDELIO) waren aufrührerisch ; es gibt keine anstrengung der oper in solcher richtung.“ Zitiert nach : ebd., S. 34. 651 Heribert Henrich (Hg.), Boris Blacher 1903–1975. Dokumente zu Leben und Werk, Berlin 1993, S. 105. 652 Schenk, „Blacher“, S. 100. 653 Henrich, Dokumente, S. 105f.
220
Aufführungen
der Schuster erst beim „Ausbruch einer Art reaktionärer Massenpsychose“654 an. Auch die Verhaftung des Bürgermeisters weckt nicht etwa Sympathien für den Hauptmann, wenn dieser als Motiv für seine Tat den Hass auf die zu große Liberalität des Stadtoberhauptes nennt.655 Ursprünglich hatte Blacher das Werk für die Ost-Berliner Komische Oper vorgesehen, wo es am 28. Februar 1951 erstmals auf die Bühne hätte kommen sollen.656 Wahrscheinlich wegen der zu befürchtenden kulturpolitischen Probleme angesichts der heraufziehenden Formalismus-Kampagne jedoch verzichtete Felsenstein auf die Inszenierung an seinem Haus, sodass sich für die Städtische Oper die Gelegenheit zur Uraufführung bot. Hier jedoch lehnten Tietjen, Generalmusikdirektor Ferenc Fricsay und der Dramaturg Julius Kapp, den Tietjen noch aus seiner Zeit bei der Preußischen Staatsoper vor 1945 kannte, das Werk zunächst ab, wie das Protokoll einer Regiesitzung im Opernhaus vom 7. April 1952 belegt.657 Aus Sicht der Städtischen Oper sollte das Werk, das für das Programm der Berliner Festwochen vorgesehen war, „als eine sehr lustige Satire“ und nicht – wie es in der vorliegenden Fassung wirke – „als eine Persiflage“658 erscheinen. Eine Abänderung der Oper in diesem Sinne allerdings musste zu einem erheblichen Verlust an sozialkritischer Substanz führen. Heribert Henrich hat herausgearbeitet, dass der Komponist sein Werk vor der Uraufführung in einer Art Selbstzensur an entscheidenden Stellen ‚entschärft‘ hat.659 Auch wenn sich die einzelnen Schritte der Umarbeitung nicht mehr im Detail rekonstruieren lassen, kann doch davon ausgegangen werden, dass der Komponist die Änderungen als Reaktion auf die Ablehnung des Werkes durch die Städtische Oper vornahm, wollte er sein Werk doch noch zur Aufführung kommen lassen.660 Damit dieses 654 Ebd., S. 105. 655 Ebd. 656 Vermerk der Senatsverwaltung für Volksbildung vom 20.03.1951. LAB, B Rep. 014, Nr. 1301. Siehe auch den Hinweis auf die geplante Uraufführung in : Karl Schönewolf, „Schöpferische Verwandlung. Zur Erneuerung des Operntheaters“, in : Theater der Zeit 5 (1950), Heft 11, S. 13–14, hier S. 13. 657 Protokoll der Regiesitzung vom 07.04.1952. AdK, Berlin, Tietjen-Archiv, Nr. 624. 658 Brief Paproths an Tietjen vom 11.08.1952. AdK, Berlin, Tietjen-Archiv, Nr. 618. 659 Henrich, Dokumente, S. 106f. 660 In den Quellen im Tietjen-Archiv ist von einer „erste[n] Fassung“ des Werkes die Rede,
Bildende Funktion
221
wie gewünscht als „sehr lustige Satire“ wirke, wurde dessen gesellschaftskritische Dimension, die von Blacher ja eigentlich intendiert gewesen war, unterdrückt. Geändert wurden mehrere Textstellen661 : Hatte etwa der Chor der Schreiber im Rathaus in Anspielung auf den Nationalsozialismus ursprünglich „Der Deutsche fürchtet Gott und sonst nichts auf der Welt“ gesungen, hieß es in der überarbeiteten Fassung nur noch harmlos : „Der wirklich brave Mann denkt an sich selbst zuletzt“. Aus den Worten des Schusters „Kampf dem Bürgermeister : Sturm auf das Rathaus, Säuberung des Bezirks, Reinigung der Stadt, Ehrenrettung der Provinz, Ruhmesblatt des Landes, unser Blut fürs Reich, für eine deutsche Welt mit einem deutschen Gott“ milderte er die letzte Parole ab, sodass es nunmehr nur noch hieß : „für eine neue Welt“. Entschärft wurde an einer entscheidenden Stelle auch die Musik. Um den Auftritt des Bürgermeisters musikalisch vorzubereiten, hatte Blacher in der ersten Fassung der Partitur über mehrere Takte hinweg in der Tuba mit Ironie das Deutschlandlied zitiert. Es handelte sich dabei um jenen Passus, der später von der Berliner FDP kritisiert werden sollte. Im Jahre 1974 erläuterte der Komponist, dass ihm der Dirigent der Uraufführung Artur Rother im Vorfeld der Premiere geraten habe, auf die entsprechende Stelle zu verzichten.662 Um beim Publikum alle Zweifel an der politischen Unbedenklichkeit des Werkes auszuräumen, fügte die Städtische Oper im Programmheft eine entsprevon der eine überarbeitete zweite Version abgegrenzt wird. Brief Paproths an Tietjen vom 06.08.1952, in : AdK, Berlin, Tietjen-Archiv, Nr. 618. – Es liegt nahe, in jener ersten Fassung den von Henrich beschriebenen „ursprünglichen Zustand“ der Oper zu sehen, der sich in den Autographen von Partitur und Klavierauszug sowie einer ersten, nur als Leihmaterial verbreiteten Auflage des Klavierauszugs niedergeschlagen hat. Siehe dazu : Henrich, Dokumente, S. 106. 661 Siehe dazu : ebd. 662 Siehe dazu : ebd. – Im Historischen Archiv der Universität der Künste in Berlin befindet sich in den Handakten Blachers eine von Artur Rother unterzeichnete Bestätigung in diesem Sinne vom 18. Februar 1953 : „Die Behauptung, daß das Orchester der Städtischen Oper in den Orchesterproben zu Blachers ‚Preußischem Märchen‘ gegen die Verwendung des Deutschlandliedes protestiert habe, entbehrt jeder Grundlage : lange, ehe das Studium des Werkes begann, hatte der Komponist nämlich schon die fragliche Stelle eliminiert, so daß sie in keiner einzigen Probe gespielt wurde, also auch nicht abgelehnt werden konnte.“ Universität der Künste Berlin, Universitätsarchiv, Bestand 11, 11 (Handakten Boris Blacher). – Unklar ist, ob Blacher das musikalische Zitat des Deutschlandliedes bereits für die ursprünglich vorgesehene Uraufführung des Werkes an der Ost-Berliner Komischen Oper geplant hatte.
222
Aufführungen
chende Interpretation bei : In seinem Beitrag reflektierte der Regisseur Ludwig Berger über den Unterschied zwischen Ironie und Karikatur, wobei er das Werk ersterer zurechnete. Während er das künstlerische Mittel der Karikatur als negativ kennzeichnete, da auf diese Weise doch der „Gegenstand, den man sich gewählt“ habe, „mit bösem Auge“ gebrandmarkt werde, hob er davon das Mittel der Ironie positiv ab, weil dieser „Herz und selbst Liebe zu dem Gegenstand“ innewohne, „den man belächelt“. So sei der Hauptmann weder „ein Betrüger noch ein Gauner“, und sein Streich sei nur die letztlich harmlose Folge eines Alkoholrausches. „Man ist ihm am Ende ebenso wenig böse, wie Wilhelm II. dem Original-Hauptmann war, als er mitten im ersten Weltkrieg im Hauptquartier zu Luxemburg plötzlich erfuhr, daß der echte, historische ‚Hauptmann von Köpenick‘ dort sein Asyl habe und ihn sich vorstellen ließ, um ihn persönlich kennenzulernen.“ Schließlich kam Berger auf die Frage der Militarismuskritik in dem Werk zu sprechen. Auch dabei wiegelte der Regisseur ab : „Selbst in einer Zeit des ausgesprochenen Militarismus galt die Sage von den Schildbürgern nicht als Majestätsbeleidigung der Nation. Blachers dumm-dreister Hauptmann mit seinem blinden Glauben an die Uniform ist ein Schildbürger, und das Städtchen um ihn herum atmet den gleichen Geist einer liebenswürdigen Ironie, wie wir ihn auf den Kompositionen Spitzwegs finden.“663 Indem Berger das Werk in die Nähe des Biedermeier rückte, war dessen ursprünglicher gesellschaftskritischer Anspruch endgültig dahin. Einer solchen Sicht leistete schließlich der Komponist sogar selbst durch einen kurzen Text im Programmheft Vorschub, in dem er zu seiner Musik schrieb, diese stehe „bedingungslos auf Seiten Piccinnis, der Buffonisten, Rossinis und Offenbachs – also auf der Seite der leichten Muse. […] Das musikalische Material ist ein bunter Strauß von Märschen, Polkas, Walzern, Galopps, die nicht durch Hinzufügung von falschen Tönen zu zänkischen Grotesken werden, sondern mit ihren Toniken und Dominanten liebenswürdige Geschöpfe bleiben sollen.“664 Der Oper widerfuhr damit letztlich dasselbe Schicksal wie dem schon genannten Film Der Hauptmann von Köpenick mit Heinz Rühmann. Auch hier 663 Ludwig Berger, „Ironie und Karikatur“, in : Programmheft der Berliner Festwochen, Preußisches Märchen (1952), o. S. 664 Boris Blacher, in : Programmheft der Berliner Festwochen, Preußisches Märchen (1952), o. S.
Ursprungsmythologische Argumentationsfigur/Schöner Schein
223
hatte der Regisseur Helmut Käutner, gedrängt vom Produzenten, auf die ursprünglich von ihm geplanten kritischen Anspielungen auf das politische System der Bundesrepublik verzichten müssen665, sodass der Film, wie Irmela Schneider formuliert hat, dem „zeitspezifische[n] Bedürfnis“ folgte, „politische Situationen auf ihre menschliche Dimension zu verkürzen“.666 In den westdeutschen Kritiken zur Uraufführung des Preußischen Märchens, das am 23. September 1952 vom Publikum begeistert aufgenommen wurde, war an keiner Stelle von einem Bezug des Werkes zur jüngsten deutschen Vergangenheit zu lesen. Sabina Lietzmann brachte in ihrem Bericht für die Frankfurter Allgemeine die Reaktion des Publikums auf den Punkt, als sie schrieb, in Blachers Werk werde „mit dem Spießbürgertum der Jahrhundertwende ins Gericht gegangen, mit soviel liebenswürdiger Ironie, daß sich niemand im Publikum verletzt zu fühlen schien, sondern durchweg das hellste Entzücken herrschte.“667
2. Ursprungsmythologische Argumentationsfigur/Schöner Schein a) Der Kampf gegen den Formalismus auf der Opernbühne : Brechts/ Dessaus Das Verhör des Lukullus an der Staatsoper 1951
„Die lange voraus umstrittene, von Gerüchten umschwirrte Premiere der Staatsoper im Sowjetsektor wurde Ereginis : ‚Das Verhör des Lukullus‘, Oper von Paul Dessau, Text von Bertolt Brecht. Bis zuletzt war es ungewiß, ob sie stattfinden würde. Man berichtete von Einwänden und drohendem Verbot der Aufführung. […] Der öffentliche Kartenverkauf für die Premiere wurde zuerst hinausgezögert, endlich unterblieb er ganz. Die Uraufführung blieb einem geladenen Publikum vorbehalten, dem Sowjetzonen-‚Präsident‘ Pieck in der Mittelloge präsidierte. Wer war dieses Publikum ? Man sprach von FDJ-Gruppen, die angewiesen seien, die Aufführung zu stören. Aber es ließ nicht viel böse Absicht 665 Irmela Schneider, „Literatur und Film : Der Hauptmann von Köpenick (1956)“, in : Werner Faulstich und Helmut Korte (Hg.), Fischer Filmgeschichte. Band 3 : Auf der Suche nach Werten 1945–1960, Frankfurt/M. 1990, S. 271–298, hier S. 288. 666 Ebd., S. 292. 667 Sabina Lietzmann, „Berliner Jahrhundertwende – heiter ironisch. Blacher-Cramers ‚Preußisches Märchen‘ in Berlin uraufgeführt“, in : Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 07.10.1952.
224
Aufführungen
merken. Saßen etwa ganz andere Leute im Theater, als man hineindirigieren wollte ? Hatten die Geladenen ihre Karten an Interessierte weitergegeben ? Die da waren, ergaben sich dem Eindruck des Abends. […] Die Aufführung […] war ein starker Eindruck. Anfängliche Pfiffe opponierender Gruppen, schwächliche Ansätze einer organisierten Demonstration, verstummten bald. Der Beifall steigerte sich am Ende zu begeisterter Zustimmung. Eine zweite Aufführung wird nicht stattfinden ; das Stück ist vom Spielplan abgesetzt.“668 Nicht ohne Genugtuung berichteten westdeutsche Zeitungen wie der Tagesspiegel, dass die Uraufführung von Bertolt Brechts und Paul Dessaus Oper Das Verhör des Lukullus am 17. März 1951 in der Ost-Berliner Staatsoper zu einem Erfolg geriet ; die Aufführung wurde als Triumph über die Einschränkungen der Kunstfreiheit im ostdeutschen System gefeiert. Die Premiere der Oper über den antiken römischen Feldherrn Lukullus, der sich nach seinem Tod im Jenseits vor einem Schöffengericht für seine Taten verantworten muss, war gleichzeitig die vorerst letzte Aufführung. Nur neun Stunden vor dem Beginn hatte die SED bei ihrer Fünften Tagung des Zentralkomitees nach dem III. Parteitag den folgenschweren kulturpolitischen Beschluss Kampf gegen den Formalismus in Kunst und Literatur gefasst und dabei Brechts/ Dessaus Oper als Negativbeispiel formalistischer Kunst angeführt. Schon zuvor war vom Ministerium für Volksbildung auf Veranlassung des Zentralkomitees verfügt worden, dass das Werk über eine erste, nicht öffentliche Aufführung hinaus nicht im Spielplan der Staatsoper verbleiben sollte.669 Interessant ist, dass der kulturpolitischen Ablehnung des Werkes zwei altbekannte Argumente aus der Geschichte der Idee von einer idealen nationalen Opernbühne zugrunde 668 Werner Oehlmann, „Hinter verschlossenen Türen. Brecht-Dessaus ‚Verhör des Lukullus‘ in der Staatsoper, in : Der Tagesspiegel vom 20.03.1951. Zitiert nach : Lucchesi, Verhör, S. 325– 326. 669 Protokoll Nr. 52 der Sitzung des Sekretariats des ZK am 12.03.1952. Zitiert nach : ebd., S. 82f. – Die einzelnen Schritte, die zum Verbot des Werkes führten – ein widersprüchlicher Prozess, bei dem es mehrfach zu Kompetenzunklarheiten zwischen Staat- und Parteistellen kam –, lassen sich anhand der vorzüglichen Quellen-Dokumentation von Joachim Lucchesi gut nachvollziehen. Lucchesi, Verhör. – Siehe auch : Klingberg, „,Lukullus‘“ ; Gerhard Müller, „Zeitgeschichtliche Aspekte der ‚Lukullus-Debatte‘“, in : Klaus Angermann (Hg.), Paul Dessau – Von Geschichte gezeichnet. Symposion Paul Dessau Hamburg 1994, Hofheim 1995, S. 144–151 ; Calico, Politics.
Ursprungsmythologische Argumentationsfigur/Schöner Schein
225
liegen : zum einen der Vorwurf, dass dem Werk der vermeintlich notwendige ‚volkstümliche‘ Charakter fehle, womit die ursprungsmythologische Argumentationsfigur aktualisiert wurde, sowie zum anderen damit verbunden der Vorwurf eines Mangels an ästhetischer Schönheit. In seinem Referat auf jener Fünften Tagung des ZK erläuterte SED-Kultursekretär Hans Lauter, was aus Sicht der Partei unter Formalismus zu verstehen sei : „Das wichtigste Merkmal des Formalismus besteht darin, daß unter dem Vorwand, etwas ‚vollkommen Neues‘ zu entwickeln, ohne an die vorhandenen Traditionen anzuknüpfen, der Widerspruch mit dem klassischen Kulturerbe vollzogen wird, und das führt zur Entwurzelung der nationalen Kultur, das führt zur Zerstörung des Nationalbewußtseins, fördert den Kosmopolitismus und bedeutet damit eine direkte Unterstützung der Kriegspolitik des amerikanischen Imperialismus. Für den Formalismus ist weiter kennzeichnend die Abkehr von der Volkstümlichkeit der Kunst, das Verlassen des Prinzips, daß die Kunst Dienst am Volke sein muß.“670 Damit argumentierte Hans Lauter ursprungsmythologisch. Auch aus Sicht der SED war das Schicksal der deutschen Nation, die sie von der ‚kosmopolitischen‘ USA bedroht sah, von der Existenz einer ‚volkstümlichen‘ Kunst und Kultur abhängig. Demnach musste Kunst, wenn sie als gelungen gelten sollte, für ein breites Publikum leicht rezipierbar sein. Als Bedingung dafür aber galt, dass die Kunst ästhetisch schön zu sein hatte, womit Lauter die zweite ideengeschichtliche Dimension aktualisierte. Da diese Bedingung im Falle des Lukullus als nicht gegeben angesehen wurde, stellte Lauter die Oper als Ausdruck eines ‚volksfremden‘ Kosmopolitismus dar : „Ich muß schon sagen, und ich spreche es ganz offen aus, daß diese Musik […] einem direkt Ohrenschmerzen bereitet : viel Schlagzeuge, disharmonische Töne, man weiß nicht, wo man eine Melodie suchen soll.“671 Zusammenfassend fragte Lauter in seinem Referat rhetorisch : „Kann eine solche disharmonische Musik unsere Menschen mit dem fortschrittlichen Geist erfüllen, mit dem Willen, sich für den Aufbau, für den Kampf um den Frieden und die Einheit Deutschlands einzusetzen ?“672 670 Stenografische Niederschrift über die Fünfte Tagung des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Zitiert nach : Lucchesi, Verhör, S. 127–177, hier S. 135. 671 Ebd., S. 157. 672 Ebd., S. 158.
226
Aufführungen
Der Vorwurf mangelnder Volkstümlichkeit und damit mangelnder Schönheit war auch einer der zentralen Streitpunkte im Rahmen einer vom Ministerium für Volksbildung veranlassten Diskussion über Brechts und Dessaus Werk am 13. März, wenige Tage vor der ersten und zunächst einzigen Aufführung. Wenn dieses Gespräch auch insofern nicht ergebnisoffen geführt wurde, als dass das Verbot des Werkes zu diesem Zeitpunkt bereits beschlossen war, ist es doch lohnend, die verschiedenen Positionen, die in Protokollen überliefert sind, nachzuvollziehen. Wie schon im oben zitierten Referat Hans Lauters traf auch in der Diskussion die Kritik vor allem Dessaus Musik, während Brechts Text kaum beanstandet wurde. Nathan Notowicz, Professor für Musikwissenschaft an der Ost-Berliner Deutschen Hochschule für Musik, monierte, dass Dessau „mit musikalischen Mitteln der Destruktion arbeitet“.673 Auch Ernst Hermann Meyer, Professor für Musiksoziologie an der Humboldt-Universität, äußerte ganz ähnlich : „Ich glaube, daß Dessau in dieser Musik nicht mit den richtigen Mitteln arbeitet, sondern mit den Mitteln der Negation. Mit Septimen-Parallelen, mit scharfen, ätzenden Blasinstrument-Akkorden ist eine Charakterisierung des Häßlichen gegeben. Die Melodie blüht auf lange Strecken nicht auf […].“674 Meyer forderte stattdessen eine Kunst, in der „Kraftbewußtsein und die Zuversicht […] nicht fehlen. Auch das Volkstümliche darf nicht fehlen.“675 Auch Rudi Raupach, Sektorenleiter für Kultur im FDJ-Zentralrat, glaubte nicht, „daß die Oper auf unserem gesunden Kulturerbe aufgebaut ist, daß sie nicht fördert, was wir Jugendlichen suchen : eine enge Verbindung mit der Volkstümlichkeit.“676 Ein Vertreter der IG-Eisenbahn schließlich formulierte unumwunden, die Musik des Lukullus entspreche „nicht unserem Geschmack, denn wir Deutschen lieben ja harmonische Musik“.677 Angesichts der massiven Kritik gegen Dessaus Musik mahnte der Filmemacher Wolfgang Schleif an, nicht „wieder ab[zu]rutschen in diese wohlklingende Volksmusik“, womit er sich offensichtlich auf die Zeit des Nationalsozialismus bezog. Auch Intendant Ernst Legal sprach sich für die Musik aus. Er erinnerte daran, daß 673 Ebd., S. 91. 674 Ebd., S. 85. 675 Ebd., S. 86. 676 Ebd., S. 93. 677 Ebd., S. 87.
Ursprungsmythologische Argumentationsfigur/Schöner Schein
227
„viele von den später anerkannten und geschätzten Werken zunächst ausgepfiffen wurden“678, und forderte – genau wie der bei der Diskussion anwesende Dirigent der Aufführung Hermann Scherchen – zur Geduld mit der Oper auf, allerdings ohne zu wissen, dass es wegen des bereits beschlossenen Verbotes dafür schon zu spät war. Der Formalismus-Vorwurf auf dem Feld der Musik, dessen prominentestes Opfer Das Verhör des Lukullus wurde, traf generell vor allem die sogenannte Zweite Wiener Schule um Arnold Schönberg, Alban Berg und Anton Webern sowie deren künstlerische Erben, die sich in Westdeutschland maßgeblich im Rahmen der Internationalen Ferienkurse für Neue Musik in Darmstadt formierten.679 Als eines der einflussreichsten Dokumente in diesem Zusammenhang kann der Vortrag Realismus – die Lebensfrage der deutschen Musik gelten, den der bereits zitierte Ernst Hermann Meyer anlässlich der Gründung des Verbandes deutscher Komponisten und Musikwissenschaftler 1951 hielt. Darin bezeichnete Meyer die von Schönberg entwickelte Zwölftonmusik als „Revolte gegen die Volksmusik“ ; sie stelle eine „Negierung all der positiven Inhaltswerte“ dar, welche „die Klassik von Bach bis Brahms“ bereitgehalten habe. Zwar attestierte Meyer der Neuen Wiener Schule positiv, „vom Abscheu gegen das reaktionäre Philistertum und von Grauen vor den Zuständen unter dem Imperialismus erfüllt“ gewesen zu sein. Doch kritisierte er, wie das der Nationalsozialismus getan hatte, als von einer ‚volksfremden‘ Kunst die Rede war, den vermeintlich „unvolkstümlich[en]“680 Charakter von Schönbergs Musik.681 Neben Arnold Schönberg traf der Formalismus-Vorwurf vor allem den Komponisten Igor Strawinsky. Auf ihn spielte auch die offizielle Stellungnahme des Neuen Deutschland zur Uraufführung von Das Verhör des Lukullus an. Dabei grenzte sich das Blatt von der Rezension der Oper im West-Berliner Tagesspie678 Ebd., S. 88. 679 Siehe dazu vor allem : Inge Kovács, „Die Ferienkurse als Schauplatz der Ost-West-Konfrontation“, in : Gianmario Borio und Hermann Danuser (Hg.), Im Zenit der Moderne. Die Internationalen Ferienkurse für Neue Musik Darmstadt 1946–1966. Bd. 1, Freiburg 1997, S. 116–139. 680 Ernst H. Meyer, „Realismus – die Lebensfrage der deutschen Musik“, in : Musik und Gesellschaft 1 (1951), S. 38–43, hier S. 38. 681 Joy Haslam Calico geht davon aus, dass in der Lukullus-Debatte zumindest unterschwellig auch Antisemitismus eine Rolle gespielt habe. Allerdings kann sie dies nicht mit Quellen belegen. Calico, Politics, S. 313.
228
Aufführungen
gel ab, in dem Werner Oehlmann lobend formuliert hatte : „Dessau musiziert mit den Fragmenten der abendländischen Musik, die Strawinsky noch übrig gelassen hat. Intakt, kontinuierlich ist nur der unablässig trommelnde Rhythmus. Aus ihm erheben sich Fetzen von Melodie, konzentrierte, kurze Formeln, die Emphase oder Leid, Marsch oder Signal, Ruf oder Lied bedeuten.“682 Anerkennend hieß es weiter : „Aber es glückt Dessau, das Zerbrochene auf eine rätselhafte Weise zur Einheit zu bringen. Das Überlaute attackiert den Hörer, durch Schallverstärker maßlos gesteigert, und das Leiseste, Zarteste versetzt ihm den Atem ; die Musik schildert ebenso in quälender, lärmender Grellheit die ödeste innere Leere, wie sie in äußerster Verhaltenheit die abgründige Tiefe menschlichen Leides aufnimmt.“683 Für Oehlmann bewies die Musik Dessaus ihre Qualität, so lässt sich interpretieren, gerade darin, dass sie überkommene Vorstellungen von ästhetischer Schönheit in der Musik nicht einfach wiederholte, sondern indem sich in ihr Reste einer einstmals als schön geltenden Musik zu einer neuen, ästhetisch gelungenen Einheit zusammenfügten. Oehlmanns Satz von den „Fragmenten der abendländischen Musik“ zitierte nun das Neue Deutschland und fuhr fort : „Igor Strawinsky, ein in den USA lebender Kosmopolit, ist ein fanatischer Zerstörer der europäischen Musiktradition. Als Häuptling der formalistischen Schule bestreitet er, daß die Musik einen anderen ‚Inhalt‘ als rhythmische Spielereien haben könnte. Wer einem solchen ‚Vorbild‘ folgt, vernichtet die eigene Begabung. Dessau beraubt sich auf diese Weise selbst der Möglichkeit, die Massen durch seine Kompositionen zum Kampf gegen einen neuen Eroberungskrieg zu begeistern. […] Es ist nicht recht begreiflich, warum die Deutsche Staatsoper diese Oper einstudiert hat. […] Offensichtlich orientiert sich die Intendanz […] weniger auf [sic] die weiten fortschrittlichen Kreise unseres Volkes als vielmehr auf eine kleine Minderheit stagnierender Intellektueller.“684 Brechts/Dessaus Das Verhör des Lukullus war nicht das einzige Werk, das zu Beginn der 1950er-Jahre an der Ost-Berliner Staatsoper dem Vorwurf man682 Werner Oehlmann, „Hinter verschlossenen Türen. Brecht-Dessaus ‚Verhör des Lukullus‘ in der Staatsoper.“ Zitiert nach : Lucchesi, Verhör, S. 325–326, hier S. 326. 683 Ebd. 684 Heinz Lüdecke, „,Das Verhör des Lukullus‘. Ein mißlungenes Experiment in der Deutschen Staatsoper.“ Zitiert nach : ebd., S. 329–331, hier S. 330.
Ursprungsmythologische Argumentationsfigur/Schöner Schein
229
gelnder Volkstümlichkeit und Schönheit ausgesetzt war. Schon zuvor hatte die Bühne anlässlich von Paul Schmidtmanns Inszenierung von Michael Glinkas Ruslan und Ludmilla in der Täglichen Rundschau heftige Kritik geerntet. In dem Blatt stand am 19. November 1950 zu lesen, die Aufführung dieses Werkes „des großen russischen Komponisten“ trage den „Stempel der Dekadenz und Zersetzung“ und sei aufgrund ihres dunklen Bühnenbildes und der weitgehend „formalistischen Dekorationen“ von der „verfallenden und degenerierenden Kultur des Westens“685 geprägt. Von seiner Kritik an der Aufführung ging der Text zu einem Generalangriff auf Ernst Legal über : „Die Leitung der Berliner Staatsoper ist von der Öffentlichkeit bereits mehrfach warnend darauf hingewiesen worden, daß sie ihre Einstellung zum Zuschauer revidieren und mit dem volksfremden Stil ihrer Inszenierungen Schluß machen muß.“ Da die Intendanz jedoch offensichtlich nicht geneigt sei, „diesen Forderungen Gehör zu schenken“ und ihren „kunst- und volksfremden Kurs fort[setze]“, werde es Zeit, „sich mit der Berliner Staatsoper zu beschäftigen und dort Ordnung zu schaffen. Es muß Schluß gemacht werden mit der Herrschaft der Schatten auf der Bühne der Berliner Staatsoper, mit der Verhöhnung der Zuschauer, der Sänger und der Orchestermitglieder durch eine Handvoll talentloser Mystiker und Formalisten, die sich in die Leitung eingeschlichen haben.“686 Aufgrund der Kritik nahm Legal die Inszenierung schließlich vom Spielplan. Erst am 20. Mai 1951 gelangte das Werk in einer neuen, den Maximen der Kulturpolitik entsprechenden Inszenierung des Intendanten selbst wieder auf die Bühne. Über diesen Fall hinaus ist eine andere als formalistisch kritisierte Aufführung an der Staatsoper zu nennen : Am 14. März 1951 hatte die Dresdner Staatsoper mit Carl Orffs 1949 uraufgeführter Antigonae im Ost-Berliner Admiralspalast gastiert und war daraufhin vom Neuen Deutschland heftig kritisiert worden.687 Das ist vor allem deshalb bemerkenswert, weil Orff nicht nur 1949 für seine Oper Die Kluge – als erster Komponist überhaupt – einen der hoch dotierten Nationalpreise der DDR erhalten hatte, sondern weil auch dessen Antigonae noch bei der Dresdner
685 N. Orlow [Pseudonym], „Das Reich der Schatten auf der Bühne“, in : Tägliche Rundschau vom 19.11.1955. Zitiert nach : ebd., S. 47–50, hier S. 47. 686 Ebd., S. 49. 687 Siehe dazu : Köster, Musik-Zeit-Geschehen, S. 73ff.
230
Aufführungen
Premiere im Neuen Deutschland wegen ihres „hohe[n] sittliche[n] Gehalt[s]“688 gefeiert worden war. In Berlin nun wurde die Oper von dem Partei-Organ wegen ihrer vermeintlich „nervtötende[n], fast dreistündige[n] Monotonie“ gerügt und es hieß, dass Antigonae aufgrund der dissonanten musikalischen Gestaltung ein „zutiefst asoziales Werk“689 sei.690 Dass Brechts/Dessaus Lukullus schließlich doch noch an der Staatsoper gespielt werden konnte, hatte vor allem zwei Gründe : Zum einen gab es selbst innerhalb der SED einflussreiche Befürworter der beiden Künstler, wie den Staatspräsidenten Wilhelm Pieck. Er nahm bald nach dem Verbot des Werkes mit Textdichter und Komponist Kontakt auf, um eine Überarbeitung von Text und Musik der Oper zu erwirken.691 Zum anderen zeigten die westdeutschen und internationalen Rezensionen, dass das Verbot der Oper dem Ansehen nicht nur der Bühne, sondern darüber hinaus der gesamten DDR erheblich geschadet hatte. Schon allein deshalb empfahl sich nachträglich ein konziliantes Verhalten gegenüber Brechts/Dessaus Werk. Somit konnte die Oper nach einer Überarbeitung, bei der im Wesentlichen einige – neu vertonte – Textpassagen hinzugefügt wurden, die den Unterschied zwischen negativem Angriffs- und erlaubtem Verteidigungskrieg deutlicher herausstellen sollten als in der ersten Fassung, am 12. Oktober 1951 unter dem neuen Titel Die Verurteilung des Lukullus erneut auf die Bühne der Staatsoper gelangen.692 Dennoch blieb der durch diese nach688 Zitiert nach : ebd., S. 74. 689 Zitiert nach : ebd., S. 74–75. 690 Was den Formalismus-Vorwurf in der DDR im Bereich der Oper angeht, ist auch die – im Vergleich mit Brechts/Dessaus Lukullus nicht weniger heftige – Debatte um Hanns Eislers Johann Faustus-Projekt im Jahr 1953 zu nennen. Siehe dazu : Thomas La Presti, „Moderne“ ; Hans Bunge, Die Debatte um Hanns Eislers „Johann Faustus”. Eine Dokumentation, Berlin 1991 ; Peter Schweinhardt (Hg.), Hanns Eislers „Johann Faustus“. 50 Jahre nach Erscheinen des Operntexts 1952. Symposion, Wiesbaden 2005. 691 Paul Dessau selbst berichtete von dem selbstkritischen Ausspruch Wilhelm Piecks in Bezug auf Das Verhör des Lukullus : „Genossen, was ist, wenn wir uns hier irren ?“ Zitiert nach : Lucchesi, Verhör, S. 19. 692 Allerdings riss die Kritik an der Oper in der DDR trotz deren Überarbeitung nicht ab, was sich darin zeigt, dass das Werk noch im Grundsatzprogramm für die Staatsoper von 1952 als Negativbeispiel für eine formalistische Kunst herhalten musste. – Zu den Unterschieden in den Fassungen der Oper siehe : Calico, Politics, S. 92ff ; Daniela Reinhold, „Die Verurteilung des Lukullus. Synopse der Fassungen“, in : Paul Dessau 1894–1979. Dokumente zu Leben und Werk, zusammengestellt und kommentiert von Daniela Reinhold, Berlin 1994, S. 199–208.
Ursprungsmythologische Argumentationsfigur/Schöner Schein
231
trägliche Liberalisierung erhoffte Imagegewinn für die DDR aus. Es verschlechterte sich das Ansehen des ostdeutschen Staates im Westen sogar noch. Nicht nur, dass sich die westdeutschen Medien trotz der Wiederzulassung der Oper nicht von ihrem grundsätzlich negativen Bild, was die Freiheitlichkeit in der DDR anging, beeinflussen ließen ; auch nahm das Ansehen Bertolt Brechts im Westen Schaden, der bis zur Uraufführung im März 1951 durchaus noch eine Werbefunktion für den sozialistischen Staat besessen hatte. War der Autor in der BRD angesichts des Aufführungsverbotes noch wegen seiner kritischen Distanz zur staatlich verordneten Kunstpolitik gelobt worden, galt er im Oktober 1951 vielen nur noch als „Parteidichter“, dessen Einwilligung in eine Neufassung der Oper als verachtenswerter Kniefall vor einer totalitären Kulturpolitik interpretiert wurde.693 Dass Brecht und Dessau mit ihrem Werk im Übrigen gerade auch die gegenwärtige Politik der Remilitarisierung in der Bundesrepublik hatten kritisieren wollen, wurde von den westdeutschen Journalisten durch die Brille eines unpolitischen Kunstbegriffes gar nicht wahrgenommen. So forderte etwa Kurt Westphal in der westdeutschen Zeitschrift Melos nach der Uraufführung der Erstfassung : „Wir verzichten in unserem Bericht auf jegliche politische Betrachtung und würdigen das Werk nur von der künstlerischen Seite her.“694 Dennoch entwickelte sich Brechts/Dessaus Lukullus in der überarbeiteten Fassung – bei Inszenierungen des Werkes in Westdeutschland wie etwa bei der Frankfurter Erstaufführung bevorzugte man die Urfassung – schließlich zu einer Art Paradestück der Staatsoper. Bis zum Ende der DDR kam es dort zu insgesamt drei weiteren Inszenierungen des Werkes (1960, 1965 und 1983). Begünstigt wurde dies dadurch, dass sich mit dem Tod Brechts 1956 die kulturpolitischen Zweifel an dem Dichter in der DDR auflösten, der fortan widerspruchslos verehrt wurde. Vor allem geriet die SED mit ihrer rigorosen Ablehnung der kulturellen Moderne spätestens seit der zweiten Hälfte der 1950er-Jahre im eigenen Land zunehmend in die Defensive. Infolgedessen war bereits 1954 die von den Künstlern gefürchtete Staatliche Kommission für Kunstangelegenheiten aufgelöst und an ihrer Stelle das verhältnismäßig liberale Ministerium für Kultur unter der Leitung Johannes R. Bechers eingerichtet worden. Der Umschwung 693 Dümling, „Engagement“ ; Lucchesi, Verhör, S. 23. 694 Zitiert nach : ebd., S. 114.
232
Aufführungen
auf dem Gebiet der Musik zeigte sich auch in einem Vortrag, den Hanns Eisler 1954 zum Gedenken an Schönberg aus Anlass seines 80. Geburtstages in der Ost-Berliner Akademie der Künste hielt.695 Wenn sich Eisler für seine Bemühungen um eine Rehabilitierung Schönbergs wieder einmal heftige Kritik gefallen lassen musste696, war dies doch langfristig der Ausgangspunkt für ein Umdenken. Die Akademie der Künste etwa gab 1955 eine Erklärung heraus, in der gefordert wurde, „Kenntnis einiger wesentlicher Werke Schönbergs durch hochwertige Aufführungen zu vermitteln und dadurch die Diskussion am lebendigen Beispiel zu fördern, ohne sie jedoch durch ein präjudizierendes Urteil zu beeinflussen“.697 In der zweiten Hälfte der 1950er-Jahre mehrten sich dann die Stimmen, die dafür plädierten, Schönberg doch als – wenn auch problematischen – Teil des nationalkulturellen Erbes zu deuten.698 Angesichts dieser Entspannung war es dem Intendanten der Staatsoper Max Burghardt sogar möglich, Alban Bergs atonale Oper Wozzeck aus Anlass des 30. Jahrestages der Uraufführung im Dezember 1955 auf die Bühne des gerade erst eröffneten Hauses Unter den Linden zu bringen. Allerdings war auch diese Aufführung, deren Initiative noch auf Erich Kleiber zurückging, welcher selbst die Uraufführung dirigiert hatte, kulturpolitisch heftig umstritten.699 In seinem Manuskript Ein Leben für die Staatsoper berichtete Burghardt davon, wie sich „mit Näherkommen der Premiere […] bestimmte amtliche Stellen reserviert, ja abratend“ verhalten hätten, „während überängstliche Kritiker und Musikfachleute nicht einmal im Programmheft schreiben wollten“.700 Unterstützung fand Burg695 Hanns Eisler, „Arnold Schönberg“, in : Eisler, Musik und Politik 1948–1962, S. 320–329. Berühmt wurde Eislers Ausspruch über Schönberg : „Verfall und Niedergang des Bürgertums : gewiß. Aber welch eine Abendröte !“ Ebd., S. 320. 696 Siehe etwa : Karl Laux, „,Die moderne Musik ist tot‘. In Amerika und anderswo – in der DDR feiert sie fröhliche Urständ“, in : Musik und Gesellschaft 5 (1955), S. 212–214 ; Marcel Rubin, „Was bedeutet uns Schönberg ? Eine Antwort an Hanns Eisler“, in : Musik und Gesellschaft 5 (1955), S. 274–275. 697 „Zur Schönberg-Diskussion“, in : Musik und Gesellschaft 5 (1955), S. 362–363, hier S. 362f. 698 Siehe dazu : Janik, Recomposing, S. 25 ; Lars Klingberg, „Die Debatte um Eisler und die Zwölftontechnik in der DDR in den 1960er Jahren“, in : Matthias Tischer (Hg.) Musik in der DDR. Beiträge zu den Musikverhältnissen eines verschwundenen Staates, Berlin 2005, S. 39–61. 699 Siehe etwa : Marcel Rubin, „Alban Berg und die Zukunft der Schönberg-Schule“, in : Musik und Gesellschaft 5 (1955), S. 384–386. 700 Max Burghardt, Ein Leben für die Staatsoper. AdK, Berlin, Burghardt-Archiv, Nr. 321, S. 148.
Ursprungsmythologische Argumentationsfigur/Schöner Schein
233
hardt indes bei der Ost-Berliner Akademie der Künste, die dem Intendanten auf seine Anfrage hin eine positive Stellungnahme zu dem Werk zukommen ließ. Interessant ist in diesem Zusammenhang ein Brief Paul Dessaus an den Leiter der Musiksektion der Akademie Max Butting, in dem jener die zustimmende Position der Akademie konzipierte. In diesem Brief empfahl Dessau, das Werk als volkstümlich wie auch als ästhetisch schön zu charakterisieren : Dessau riet Butting, in der Stellungnahme an die Staatsoper zwar zu erwähnen, dass die Oper atonal sei. Um jedoch dem kulturpolitisch notwendigen Kriterium der Volkstümlichkeit Genüge zu tun, empfahl er – angesichts der expressionistischen Musik Bergs wohl nicht ohne Ironie – in jedem Fall auch zu betonen, dass sich Berg in seiner Musik vielfach auf das nationale musikalische Erbe und die deutsche Volksmusik bezogen habe. Er möge herausstellen, dass Berg „in diesem Werk viele der alten Formen wie besonders die der Variation, der Passacaglia und der Invention u.a.“ benutzt habe, und er solle betonen, „dass die Oper ‚Wozzeck‘ voller schöner Melodien ist ! Dass Volkstümliches (im Büchner-Text) von Berg zwar selbstständig verarbeitet, aber ehrfurchtsvoll gewahrt wurde ! Ich erinnere an ‚Jäger aus Kurpfalz‘, an das Wiegenlied, an die Militärmusik, und besonders an das herrliche Vorspiel zum letzten Bild, das in seiner Schönheit sobald nicht erreicht werden wird im zeitgenössischen Schaffen.“701 Dass Bergs Wozzeck, der in der ostdeutschen Presse bereits im Herbst 1954 angekündigt worden war702, tatsächlich im Dezember 1955 an der Staatsoper gespielt werden konnte, hing jedoch auch mit dem bei einer Absage für die DDR zu befürchtenden internationalen Ansehensverlust zusammen. Diese Sorge formulierte Max Burghardt gegenüber Staatssekretär Opitz aus der Präsidialkanzlei : „Nach dem Weggang Kleibers wurde die ‚Wozzeck‘-Aufführung vom [westdeutschen, FB] Gegner bei uns totgesagt. Die Zeitungen schrieben, es wäre bei uns verboten worden etc., gleichzeitig wurde es aber an den grossen Bühnen in Wien, Hamburg, Düsseldorf, Dortmund, Salzburg, Wuppertal, Hannover usw. gespielt. Noch dieser Tage hieß es in den westdeutschen Zeitungen, dass das Stück nach der ersten Aufführung 701 Brief Paul Dessaus an Max Butting vom 31.01.1955, in : AdK, Berlin, AdK-O, Nr. 477, Bl. 213. Siehe auch den Dankesbrief Burghardts an Butting vom 16.02.1955 in : LAB, C Rep. 167, Nr. 432. 702 „Von altem zu neuem Ruhm der Staatsoper. Intendant Max Burghardt über die Pläne der neuen Lindenoper“, in : Tägliche Rundschau vom 22.10.1954.
234
Aufführungen
bestimmt wieder vom Spielplan verschwinden würde usw. Ich wurde in Hamburg und in Wien gefragt, ob ich das Werk wirklich spielen ‚dürfe‘. Aus diesen Gründen halte ich die Aufführung nicht nur für eine künstlerische, sondern auch für eine politische Angelegenheit, zumal wir den Ideengehalt des Werkes klar und unzweideutig realistisch herausgearbeitet haben.“703 Während Alban Berg durch die – vom Publikum positiv aufgenommene – DDR-Erstaufführung des Wozzeck vergleichsweise früh ins nationalkulturelle Erbe integriert wurde, dauerte dies bei Arnold Schönberg weitaus länger, wie im Zusammenhang mit der West-Berliner Aufführung von Moses und Aron im Jahr 1959 noch erläutert werden wird. b) „Für eine deutsche Nationaloper !“ – Die Uraufführung von Jean Kurt Forests Der arme Konrad an der Staatsoper anlässlich des zehnten Jahrestages der DDR 1959
Nach der Debatte um Brechts/Dessaus Lukullus, die auf die ostdeutschen Komponisten verunsichernd wirkte, ging es der DDR darum, verbindliche Richtlinien zur Komposition von Opern zu schaffen. So druckte das Neue Deutschland am 1. November 1952, sechs Wochen bevor das Grundsatzprogramm für die Staatsoper erschien, mit dem Titel „Für eine deutsche Nationaloper !“ einen weiteren wichtigen kulturpolitischen Text zur Rolle der Oper im sozialistischen deutschen Staat.704 Die anvisierte sozialistische deutsche Nationaloper hatte, das machte das Neue Deutschland deutlich, eine politische Funktion. Ihre Aufgabe sollte es sein, „das Kraftgefühl des deutschen Volkes zu stärken und einen historisch begründeten Enthusiasmus für den Kampf um Frieden, Einheit, Demokratie und Sozialismus zu wecken“.705 Der Kunstform Oper wurde für diese Aufgabe eine besondere Bedeutung zugemessen, erhoffte man sich doch von der „innigen Verschmelzung von Musik und Handlung“ einer Oper „eine außerordentlich tiefe Wirkung auf das menschliche Bewußtsein“. Somit hatten die zukünftigen Nationalopern „alle patriotischen Saiten in der Seele des deutschen Volkes zum Klingen“ zu bringen und eine „edle leidenschaftliche Begeisterung 703 Brief Max Burghardts an Opitz vom 12.12.1955, in : LAB, C Rep. 167, Nr. 432. 704 „Für eine deutsche Nationaloper !“, in : Neues Deutschland vom 01.11.1952. Zur Interpretation des Textes siehe auch : Stöck, „Nationaloperndebatte“, vor allem S. 525ff. 705 „Für eine deutsche Nationaloper !“, in : Neues Deutschland vom 01.11.1952.
Ursprungsmythologische Argumentationsfigur/Schöner Schein
235
für den Kampf um die friedliche Vereinigung des deutschen Vaterlandes“ zu wecken. Zu diesem Zweck hatte eine Nationaloper aus Sicht der SED-Kulturpolitik zwei Bedingungen zu erfüllen : Zum einen bedurfte sie bestimmter Stoffe, zum anderen einer bestimmten musikalischen Gestaltung. Die Stoffe der Nationalopern hatten sich aus der deutschen Geschichte zu speisen, die sich aus der Perspektive des Marxismus-Leninismus in fortschrittliche und rückschrittliche „Triebkräfte“ teilte. Als Themen wurden „Ereignisse wie der deutsche Bauernkrieg, der Befreiungskrieg von 1813, die Revolution von 1848, der Widerstand gegen den Faschismus, Gestalten wie Ulrich von Hutten, Thomas Münzer, Michael Geismaier, York van Wartenburg und Ferdinand Schill, Friedrich Engels im Badischen Aufstand“706 vorgeschlagen. Weiterhin wurden als Beispiele genannt : das Leben von Walther von der Vogelweide oder Tilman Riemenschneider, Albrecht Dürer oder Balthasar Neumann, Andreas Schlüter, Mozart oder Goethe. Abgesehen von Ansätzen bei Albert Lortzing und Carl Maria von Weber sei es aber bislang lediglich einem einzigen deutschen Komponisten gelungen, aus der Verarbeitung der nationalen Geschichte einen überzeugenden Opernstoff zu schaffen, nämlich Richard Wagner mit seinen Meistersingern von Nürnberg. Was die musikalische Gestaltung der zukünftigen Nationalopern anbelangte, aktualisierte die SED-Kulturpolitik ein weiteres Mal die Vorstellung eines konstitutiven Zusammenhangs zwischen Künstler, Kunstwerk und Nation : Indem in solchen Werken „aus den Empfindungen des deutschen Volkes“707 geschöpft werde, sollten sich die Deutschen beim gemeinsamen Rezipieren als eine natio nale Gemeinschaft verstehen, damit auf diese Weise ein Beitrag zur Überwindung der deutschen Teilung geleistet werde. Die Komponisten der DDR könnten dazu bereits an verschiedene gelungene nationale Vorbilder anknüpfen, so zum Beispiel an Glucks Orpheus und Eurydike, Mozarts Zauberflöte, Webers Freischütz, Beethovens Fidelio oder eben Wagners Meistersinger. Drei von diesen Werken erklangen dann 1955 wirklich zur Eröffnung der Ost-Berliner Lindenoper. Bei der musikalischen Gestaltung der zukünftigen Nationalopern sollten die Traditionen des klassischen Erbes mit denen des Volksliedes verbunden wer706 Ebd. 707 Ebd.
236
Aufführungen
den, verbürgte doch vor allem das Letztere die notwendige Verbindung zwischen Künstler und Volk. Als Vorbild nannte das Neue Deutschland Russland. Ursprungsmythologisch argumentierend hieß es : „Keine Oper der Welt hat in Stoff und Musik eine so tiefe und lebendige Beziehung zu den Kräften des Volkes und den nationalen Traditionen“708 wie die russische, wobei die Werke Glinkas, Borodins und Mussorgskis als Beispiele genannt wurden. Die Idee einer auf nationalen kulturellen Traditionen basierenden zukünftigen deutschen Nationaloper, wie sie im eben erläuterten Text des Neuen Deutschland von 1952 entfaltet wurde, war keineswegs einfach nur eine Übernahme des sowjetischen Modells. Bereits im Mai 1948 hatte die „Zweite Internationale Tagung der Komponisten und Musikkritiker“ in Prag ein maßgeblich von Hanns Eisler verfasstes einflussreiches Manifest verabschiedet, das sich in ähnlicher Weise positionierte. Jener Text ging von der Diagnose einer grundlegenden Krise der zeitgenössischen Musik in den Ländern Europas aus, welche aus einer Auseinanderentwicklung der Musik in zwei entgegengesetzte Richtungen, auf der einen Seite eine „ernste“ Musik, auf der anderen Seite die Unterhaltungsmusik, resultiere. Während sich die erstere „immer komplizierter, konstruierter, individualistischer und subjektiver“ gestalte und deswegen immer weniger Hörer finde, entwickele sich die letztere, die ein „Objekt der monopolisierten Kulturindustrie“ sei, „immer flacher, nivellierter, standardisierter“.709 Beiden Richtungen warf das Manifest das Negieren nationaler musikalischer Eigenarten und somit einen falschen „Kosmopolitismus“ vor, wobei die Lösung des Problems in einem Wiederanknüpfen an die nationalen Charakteristika der Kultur des jeweiligen Landes gesehen wurde. Es ist das Verdienst der Musikwissenschaftlerin Maren Köster darauf hingewiesen zu haben, dass das Eislersche Manifest nicht einfach undifferenziert als früher Ausdruck einer Unterordnung unter die rigide, an Shdanow orientierte SED-Kulturpolitik zu werten ist. So war es im beginnenden Kalten Krieg auf westdeutscher Seite interpretiert worden, was in Theodor W. Adornos bekanntem Aufsatz Die gegängelte Musik (1948)710 seinen prägnantes708 Ebd. 709 Hanns Eisler, „Manifest“, in : Ders., Musik und Politik. Schriften 1924–1948, Leipzig 1973, 26ff. 710 Theodor W. Adorno, „Die gegängelte Musik“, in : Theodor W. Adorno, Gesammelte Schriften, Bd. 14, Frankfurt/M. 1973, S. 51–66.
Ursprungsmythologische Argumentationsfigur/Schöner Schein
237
ten Ausdruck gefunden hatte. Stattdessen müsse, wie Köster betont, von einer Eigenständigkeit der Eislerschen Position gegenüber derjenigen der SED ausgegangen werden. „Unabhängig von der sowjetischen Kampagne gegen die moderne Musik brachten die Emigranten, die aus den USA und den westeuropäischen Ländern zurückkehrten, ihre eigenen Positionen zu den Schwierigkeiten zeitgemäßer musikalischer Produktion in die Musik-Diskussion mit.“711 Der Befund der Musikwissenschaftlerin bestätigt, was bereits im Zusammenhang mit dem Grundsatzprogramm für die Staatsoper ausgeführt wurde, dass in die Kulturpolitik der SED tradierte bildungsbürgerliche Kunstvorstellungen eingingen, welche sich die Arbeiterbewegung längst angeeignet hatte. Um das Ziel einer sozialistischen deutschen Nationaloper in der DDR Wirklichkeit werden zu lassen, empfahl das Neue Deutschland 1952 die „Organisierung einer planmäßigen und kollektiven Zusammenarbeit zwischen Komponist, Schriftsteller und Wissenschaftler“.712 Eine Kooperation dieser Art kam jedoch nie zustande. Lediglich der Verband der Komponisten und Musikwissenschaftler veranstaltete eine Tagung zum Thema Oper713 und richtete eine entsprechende Kommission ein.714 In jedem Fall blieben die kompositorischen Resultate solcher Nationalopern in den folgenden Jahren weit hinter den ehrgeizigen Ansprüchen zurück.715 Noch 1955 musste Musik und Gesellschaft feststellen, dass man „kaum einen Schritt weitergekommen sei“.716 Wenn auch einige in Arbeit befindliche Kompositionsprojekte genannt werden konnten, musste doch eingestanden werden, dass die meisten schon allein wegen ihrer Stoffe nicht als Nationaloper taugten. Selbst die Einrichtung eines „dramaturgischen Büros“ beim Komponistenverband, das zu einer Verbesserung der Libretti beitragen sollte, hatte keine erkennbaren Auswirkungen. Den Hauptgrund dafür, 711 Köster, Musik-Zeit-Geschehen, S. 48. Eislers Position wurde in ihren Grundzügen etwa auch von dem Literaturwissenschaftler Hans Mayer geteilt. Siehe dazu : Kovács, „Ferienkurse“, S. 121ff. 712 „Für eine deutsche Nationaloper !“, in : Neues Deutschland vom 01.11.1952. 713 „Der dornige Weg zu unserem Ziel : Die deutsche Nationaloper“, in : Musik und Gesellschaft 5 (1955), S. 84–86, hier S. 84. 714 „Aus der Arbeit unserer Kommissionen und Sektionen : Erste Tagung der Kommission ‚Oper‘“, in : Musik und Gesellschaft 3 (1953), S. 149f. 715 Siehe dazu : Stöck, „Nationaloperndebatte“, S. 528ff. 716 „Der dornige Weg“, S. 84.
238
Aufführungen
dass es mit dem Genre Nationaloper nicht recht vorankam, sahen verschiedene Autoren in Musik und Gesellschaft jedoch in den Opernintendanten, die sich aus Mangel an Risikobereitschaft davor scheuten, neue Werke aufzuführen.717 In der DDR waren in den Jahren 1954 bis 1956 lediglich fünf Uraufführungen zu verzeichnen, allesamt nur an kleineren oder mittleren, nicht aber an den großen Opernbühnen. So sprach der Komponistenverband noch 1957 vom „Sorgenkind Oper“.718 Den Vorwurf, sich unzureichend für die sozialistische deutsche Nationaloper einzusetzen, musste sich vor allem die Ost-Berliner Staatsoper gefallen lassen, hatte Johannes R. Becher doch bei der Eröffnungsfeier 1955 die Bühne als „Grundstein“719 zu einem solchen Genre bezeichnet. Allerdings hatte schon die Berliner Zeitung in ihrem Bericht über die Einweihung kritisiert : Zur Eröffnung [der Lindenoper, FB] erklang noch nicht einmal eine neue Ouvertüre.“720 Wahrscheinlich schreckten die Verantwortlichen an der Staatsoper aufgrund der Erfahrung des Verbots von Brechts/Dessaus Lukullus vor weiteren Uraufführungen zurück. Zwischen 1951 und 1959 jedenfalls ist an der Bühne keine einzige Erst- oder Uraufführung eines neuen Werkes aus der DDR zu verzeichnen. Erst anlässlich des zehnten Jahrestages der Gründung der DDR kam es am 4. Oktober 1959 mit Jean Kurt Forests Der arme Konrad wieder zur Uraufführung einer zeitgenössischen Oper. Innerhalb der Jubiläumsfeierlichkeiten, die von der SED massiv zu Propagandazwecken721 genutzt wurden, spielte die Kunst eine wichtige Rolle. An die Künstler erging der Aufruf : „Gestaltet den 10. Geburtstag unserer Republik durch neue literarische Werke, durch neue Schöpfungen der Musik und der bildenden Kunst, durch neue Filme und Massenlieder, durch meisterhafte Aufführungen neuer und alter Werke, durch Ausstellungen und
717 Siehe dazu : Fritz Reuter, „Zur Frage der deutschen Nationaloper“, in : Musik und Gesellschaft 5 (1955), S. 156–157 ; Ottmar Gerster, „Um die deutsche Nationaloper (1956)“, in : Stephan Stompor (Hg.), Komponisten der DDR und ihre Opern, 2. Teil : Textbeiträge zu einzelnen Werken, Berlin 1979, S. 22ff. 718 „Sorgenkind Oper. Zur Fachtagung des VDK in Berlin“, in : Musik und Gesellschaft 7 (1957), S. 135–136. 719 „Grundstein zu einer deutschen Nationaloper“, in : Neues Deutschland vom 06.09.1955. 720 J. Weinert, „Opern-Auftakt Unter den Linden“, in : Berliner Zeitung vom 05.09.1955. 721 Gibas, „,Republik‘. Siehe auch : Gibas, „,Tisch der Republik‘“ ; Gibas, Wiedergeburten.
Ursprungsmythologische Argumentationsfigur/Schöner Schein
239
Feste der Volkskunst zu einem großen Feiertag unserer Nationalkultur !“722 Die Premiere von Der arme Konrad war in das Festival Berliner Festtage integriert worden, das – als Gegenveranstaltung zu den seit 1951 im Westen der Stadt veranstalteten Festwochen – „die sozialistische Kultur in ihrer gesamten Breite und Vielfalt […] unseren Werktätigen näherbringen“723 sollte. Mit Jean Kurt Forest (1909–1975), von 1951 bis 1955 Chefdirigent am Deutschen Fernsehfunk und danach als freischaffender Komponist tätig, hatte man einen Künstler ausgewählt, der sich durch über 200 Massenlieder, Kantaten auf Stalin (1949), Lenin (1952) und Marx (1953)724 sowie durch mehrere größere Orchesterwerke einen Namen gemacht hatte. Vergleicht man das zwischen 1955 und 1957 entstandene künstlerische Resultat von Forests Der arme Konrad mit den erläuterten kulturpolitischen Leitlinien zur Komposition einer sozialistischen deutschen Nationaloper von 1952, wird deutlich, dass der Komponist diese in den wesentlichen Punkten umzusetzen versucht hat : Den geforderten nationalen Stoff fand Forest in dem gleichnamigen Schauspiel des Arztes und kommunistischen Schriftstellers Friedrich Wolf (1888–1953) aus dem Jahr 1923. Das Stück schildert den gescheiterten Aufstand der Bauern gegen den württembergischen Herzog Ulrich von 1514, getarnt unter dem Deckmantel des traditionellen Fastnachtsspiels „Das Narrengericht“. Wenn der Aufstand auch scheitert und der Held des Stückes, der Bauer Konz, am Ende untergeht, widerruft er doch die „große Sach“ der Bauern nicht. Er stirbt in der Hoffnung : „Einmal wird sie wiederkommen…“725 So wie das Narrenspiel als ‚Theater auf dem Theater‘ im Stück die Funktion erfüllt, bei den Bauern eine gemeinsame revolutionäre Identität zu stiften, dient das Stück als Gesamtes dazu, eine solche beim Opernpublikum herzustellen. Dementsprechend haben die letzten Worte des Bauern Konz auf der Bühne die Funktion, dem Opernpublikum die geschichtliche Bedeutung der DDR mit ihrem Anspruch ins Bewusstsein zu rufen, Vollenderin der Arbeiterbewegung zu sein. Darüber hinaus weist bereits die erste Szene der Oper auf die gesamt722 Zitiert nach : Gibas, „Gesamtkunstwerk“, S. 225. 723 „Berliner Festtage 1959“, in : Neues Deutschland vom 03.10.1959. 724 Die Kantate Karl Marx hat gelebt und gelehrt stieß allerdings auf Kritik vonseiten der Staatlichen Kommission für Kunstangelegenheiten. Siehe : Köster, Musik-Zeit-Geschehen, S. 83. 725 Siehe das Libretto der Oper in : AdK, Berlin, Forest-Archiv, Nr. 514, S. 41.
240
Aufführungen
deutsche Bedeutung des Bauernaufstandes hin : Das Gespräch zwischen den Bauern Andres und Fidi, mit dem die Handlung beginnt, wird unterbrochen vom Erschallen der sogenannten „Kuh“, der Posaune als Erkennungszeichen der „Konrad“-Bewegung. Daraufhin singt Andres : „Die Kuh wird brüllen, und ganz Deutschland, Fidi, und ganz Deutschland wird’s hören !“726 In einer dem Libretto beigefügten Interpretation des Werkes, die wahrscheinlich von Forest selbst stammt, heißt es zu dieser Stelle, Andres wachse „in seiner Begeisterung für die große Sache, die ganz Deutschland erfassen wird, und – wie wir heute feststellen können – erfaßt hat über sich selbst hinaus – prophetisch, ein Moses der plebejisch-bäuerlichen Bewegung.“727 Um der Handlung Authentizität zu verleihen, behielt Forest in dem mithilfe des Wolf-Biografen Walther Pollatschek verfassten Libretto den schwäbischen Dialekt, den bereits das Schauspiel enthalten hatte, durchgängig bei.728 Nicht nur die Stoffwahl entsprach den Leitlinien von 1952 sondern auch die musikalische Gestaltung.729 Formal erinnert das in einer erweiterten Tonalität gestaltete Werk mit dem – zeitweilig verschleierten – Wechsel zwischen rezitativischen Passagen einerseits, in denen die Handlung vorangetrieben wird, und Arien, Duetten oder Ensembles andererseits, die demgegenüber eine ritardierende Wirkung haben, an die überlieferte Form der Nummernoper. Zur Gestaltung der verschiedenen Nummern bezog Forest mehrere Volkslieder in die Partitur mit ein wie etwa In stiller Nacht, zur ersten Wacht (3. Bild) beziehungsweise integrierte alte musikalische Weisen wie einen Satz des Komponisten Michael Praetorius (3. Bild) oder sogar eine pentatonische Melodie aus der Zeit um 1200 (Steckentanz der jungen Bauern, 5. Bild). Formal wird die Partitur darüber hinaus durch einige musikalische Leitmotive gegliedert, welche den Gegensatz zwischen der positiv besetzten Welt der Bauern (Konrad-Motiv 726 Ebd., S. 2. 727 Ebd. (Interpretation), S. 2. 728 Darüber hinaus fügte Forest in das Libretto Gedichte verschiedener Epochen in teilweise abgewandelter Form hinzu, wie etwa Johannes R. Bechers Tränen des Vaterlandes (2. Bild) oder ein Gedicht Martin Luthers (3. Bild). 729 Günter Rimkus, „Der arme Konrad“, in : Programmheft Der arme Konrad (Deutsche Staatsoper Berlin, 1959) ; Günter Altmann, „Die neue Oper im Musikunterricht. Eine Einführung in Jean Kurt Forests Oper ‚Der arme Konrad‘“, in : Musik in der Schule 13 (1962), S. 61–70 und S. 75.
Ursprungsmythologische Argumentationsfigur/Schöner Schein
241
und Sensenlied) und der negativ charakterisierten Welt Herzog Ulrichs verdeutlichen sollen. Um die „krankhafte, dekadente Atmosphäre“, wie Günter Rimkus im Programmheft schrieb, im Umfeld des Herzogs darzustellen, griff Forest auf die Zwölftontechnik der westlichen musikalischen Avantgarde zurück.730 Der antinationalen Haltung des Herzogs entspricht damit, so lässt sich interpretieren, die vermeintlich ‚volksfremde‘ Stilistik der Dodekaphonie.731 In der DDR-Presse wurde die Uraufführung unterschiedlich bewertet.732 Zwar lobte man das Werk allenthalben als wichtigen Beitrag zur angestrebten Nationaloper : Im Neuen Deutschland hieß es anerkennend, durch Forests Komposition habe „die Entwicklung des zeitgenössischen Opernschaffens der DDR eine neue Stufe erreicht“.733 Musik und Gesellschaft sprach von einer „wesentliche[n] Station auf unserem Wege zu einer neuen sozialistischen Nationaloper“734, und die National-Zeitung davon, dass das Werk ein Erfolg sei, der „uns auf dem Wege zur Nationaloper weiterhelfen“735 werde. Lob fanden auch die Leistungen der Sänger. Die Staatsoper hatte die stattliche Anzahl von 19 männlichen und vier weiblichen Solopartien zum Großteil mit ersten Kräften besetzt. Doch wurde in den Besprechungen auch deutliche Kritik an der Oper geübt. Mängel sah man vor allem in den dramaturgischen Qualitäten des Werkes : „Die übermäßige Gliederung in fünf Akte mit zehn Bildern ist für die Gesamtwirkung wenig günstig“, und „die dramaturgische Konzeption der einzelnen Bilder kann nicht durchweg als glücklich bezeichnet werden“, urteilte das Neue Deutschland ; Musik und Gesellschaft riet dem Komponisten, „das arg wuchernde Episodische“ im inhaltlichen Aufbau des Werkes „hier und da noch zu beschneiden“.736 Über730 Siehe die Analyse in : ebd., S. 67. 731 Forest konnte sich bei dem kompositorischen Verfahren, eine Negativfigur in der Oper mit dem Mittel der Zwölftontechnik zu charakterisieren, auf sowjetische Werke beziehen. Siehe dazu : Sigrid Neef und Hermann Neef, Deutsche Oper im 20. Jahrhundert. DDR 1949–1989, Berlin u.a. 1992, S. 21. 732 In der westdeutschen Presse wurde das Werk nicht besprochen. Immerhin brachte am 06.10.1959 zumindest Die Welt einen Hinweis auf die Uraufführung des Werkes. 733 Horst Seeger, „Der Bauernkrieg in Musik“, in : Neues Deutschland vom 06.10.1959. 734 Ernst Krause, „,Der arme Konrad‘. Oper nach Friedrich Wolf von Jean Kurt Forest“, in : Musik und Gesellschaft 9 (1959), S. 653–645, hier S. 645. 735 „Geschichte, die uns angeht. Forests ‚Der arme Konrad‘ in der Deutschen Staatsoper“, in : National-Zeitung vom 08.10.1959. 736 Krause, „,Konrad‘“, S. 643.
242
Aufführungen
haupt sorge die Musik nur in einigen Passagen für eine zwingende dramaturgische Gestaltung. Wurde zwar die Szene des Narrengerichts in diesem Punkt gelobt, galt das nicht auch für die anderen Teile. Von einem „zerbröckelt[en]“737 musikalischen Satz war die Rede und davon, dass ungeachtet der lobenswerten Bemühungen um Volkstümlichkeit „plastischere, tragfähigere Themen, mehr charaktervolle musikalische Einfälle und vielleicht auch eine umfangreichere Einbeziehung großer Chorwirkungen“738 dem Werk gut getan hätten. Kritik erntete schließlich auch die Regie von Erich-Alexander Winds. Manche Figuren kämen „recht hölzern-pathetisch“ daher, sodass die Inszenierung den Forderungen eines „modernen, realistischen Musiktheaters“739 nicht habe gerecht werden können. Angesichts des 1952 im Grundsatzprogramm für die Staatsoper formulierten kulturpolitischen Anspruchs, dass das Haus eine Musterbühne des deutschen Musiktheaters sein solle, war das wenig schmeichelhaft. Der arme Konrad brachte es an der Staatsoper auf insgesamt immerhin zwölf Aufführungen740, konnte sich jedoch nicht langfristig im Spielplan der Bühne halten. Damit erging es dem Stück genau wie den anderen kompositorischen Bestrebungen, eine sozialistische deutsche Nationaloper zu schaffen.741 Wenn das Werk auch 1960 in Meiningen, 1962 in Stralsund und 1975 in Schwerin zur Aufführung kam, konnte es sich letztlich nicht fest in den Opernspielplänen der DDR etablieren. c) „Eine Schande für Berlin“ ? – Der Skandal um die deutsche szenische Erstaufführung von Arnold Schönbergs Moses und Aron an der Städtischen Oper 1959
Größer hätte der Gegensatz zwischen den beiden am 4. Oktober 1959 an der Staatsoper und der Städtischen Oper gespielten Premieren nicht ausfallen können. Während in Ost-Berlin als Beitrag zur erhofften sozialistischen deutschen 737 Ebd. 738 Horst Seeger, „Der Bauernkrieg in Musik“, in : Neues Deutschland vom 06.10.1959. 739 Karl Schönewolf, „,Der arme Konrad‘. Uraufführung von Jean Kurt Forests Oper in der Deutschen Staatsoper“, in : Berliner Zeitung vom 08.10.1959. 740 Neef/Neef, Oper, S. 139. 741 Siehe dazu auch : Calico, Politics, S. 306ff.
Ursprungsmythologische Argumentationsfigur/Schöner Schein
243
Nationaloper und in Abgrenzung zur vermeintlich dekadenten westlichen kulturellen Moderne Jean Kurt Forests Der arme Konrad seine Uraufführung erlebte, kam zur gleichen Zeit im West-Berliner Opernhaus im Rahmen der Festwochen ein Werk auf die Bühne, das inzwischen zum Inbegriff westlicher kultureller Avantgarde avanciert war : Arnold Schönbergs in der Zwölftontechnik komponierte Oper Moses und Aron. Diese Aufführung hatte Brisanz : Es war das erste Mal, dass dieses Werk Schönbergs, der in der Zeit des Nationalsozialismus wie kaum ein anderer Komponist antisemitisch angefeindet worden war, auf einer deutschen Opernbühne szenisch gespielt wurde, noch dazu vor den Augen eines internationalen Publikums im Rahmen der West-Berliner Festwochen. Die Aufführung geriet zu einem der heftigsten Opernskandale in der Bundesrepublik seit 1945, bei dem kulturelle Werte und Normen von Befürwortern und Gegnern von Schönbergs Werk schroff aufeinander prallten. In der Welt beschrieb Heinz Joachim die Ereignisse : „Gegendemonstrationen von einer Stärke und Ausdauer, wie man sie auch in Berlin noch nicht erlebt hat, ereigneten sich nach der ersten deutschen Bühnenaufführung von Schönbergs ‚Moses und Aron‘ in der Städtischen Oper. Nahezu zwanzig Minuten tobte nach Schluss der Vorstellung der Kampf der Meinungen. […] Scherchen [der Dirigent, FB] war […] der Hauptgegner der Demonstranten bei der Aufführung – neben dem Intendanten, Professor Carl Ebert, den Sprechchöre zur Abdankung aufforderten. Schon vor Beginn der Vorstellung, als dem Dirigenten beim Erscheinen am Pult wie üblich applaudiert wurde, rief jemand : ‚Bestellter Beifall !‘ Während der Pause waren die Demonstranten offenbar ‚scharf‘ gemacht worden. Wie auf Verabredung suchten sie die Weiterführung der Vorstellung zu vertrampeln. Pfiffe, Buh-Rufe und Getrampel von mehr als einhundert Premierenteilnehmern ertönten, als die Lichter im Zuschauerraum eingezogen wurden und der Dirigent das Zeichen zum Wiederbeginn geben wollte. Natürlich brach nun demonstrativer Beifall los, der die Gegner erst recht erhitzte. Sie verstiegen sich bis zu dem Ausruf ‚Eine Schande für Berlin‘ und gaben erst Ruhe, als Scherchen sie in einer Ansprache aufgefordert hatte, mit ihren Kundgebungen doch wenigstens bis zum Schluß zu warten. Die Vorstellung konnte weitergehen […].“742 742 Heinz Joachim : „Arnold Schönbergs Triumph über Pfiffe und Proteste“, in : Die Welt vom 06. 10.1959.
244
Aufführungen
Worin die Ursachen für die ablehnende Haltung der Skandalierer lagen, darüber räsonierten schon die Rezensenten der Aufführung. Hans Heinz Stuckenschmidt schrieb in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung : „Antimodernisten ? Neonazis ? Feinde Scherchens ? Wer weiß.“743 Erwin Kroll fragte in der Neuen Zeitschrift für Musik : „Wollte man sich gegen Schönbergs Musik wehren ? War es Scherchen, dessen Forderungen an Chor, Orchester und Solisten als zu grausam empfunden wurden ? War man empört über die – angeblich – zu hohen Kosten, die die Aufführung verursacht hatte ? Oder spielten hier politische und rassische Motive mit ?“744 Deutlichere Worte fand Karl Heinz Ruppel in der Süddeutschen Zeitung : „Wem galten denn die Radauszenen in der Berliner Kantstraße ? Einem jüdischen Komponisten, den das Naziregime zwang, seine Heimat Europa zu verlassen ; einem Dirigenten, dem dasselbe Regime den Taktstock aus der Hand geschlagen hat – Hermann Scherchen ; und nicht zuletzt einem Intendanten, dem es das Recht abgesprochen hatte, ein deutsches Theater zu leiten – Carl Ebert. Der trübe politische Hintergrund, vor dem die religiöse Bekenntnisoper Schönbergs erscheint, sollte selbst bei denjenigen, die Gegner seiner Musik sind, so viel Anstand erwecken, daß sie gerade bei diesem Werk nicht gegen den Komponisten und seine Helfer randalieren. Niemandem ist es verwehrt, die Kunst Schönbergs abzulehnen. Gegen sie zu demonstrieren, sollten sich aber nur diejenigen unterfangen, die frei von jedem Verdacht sind, auf dem Vehikel des künstlerischen Protests einer neuen Goebbels-Propaganda Vorschub zu leisten. […] Denn aus den an die Nichtjuden Scherchen und Ebert gerichteten Rufen : ‚Scherchen raus !‘ und ‚Ebert raus !‘ hörte man immer das ‚Juden raus !‘, das nicht nur eine Schande für Berlin, sondern für ganz Deutschland war.“745 Für die DDR schließlich waren die Motive der Moses-Gegner offensichtlich. Demnach handelte es sich um eine „von faschistischen Kreisen“ inszenierte „antisemitische Hetze“.746 743 Hans Heinz Stuckenschmidt, „Triumph mit Störversuchen“, in : Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 06.10.1959. 744 Erwin Kroll, „Berliner Festwochen 1959. Arnold Schönbergs ‚Moses und Aron‘“, in : Neue Zeitschrift für Musik 120 (1959), S. 567–569. 745 Karl Heinz Ruppel, „,Eine Schande für Berlin‘“, in : Süddeutsche Zeitung vom 08.10.1959. 746 Die Berliner Zeitung führte dabei Hanns Eisler an, der an der Aufführung teilgenommen und danach gegenüber dem ADN-Korrespondenten erklärt hatte, der Skandal sei eine „bestellte faschistische, antisemitische Provokation gewesen“. „Antisemitische Hetze in Westberlin“, in : Berliner Zeitung vom 06.10.1959.
Ursprungsmythologische Argumentationsfigur/Schöner Schein
245
Dass von verschiedenen westdeutschen Rezensenten überhaupt antisemitische Beweggründe bei den Aufführungsgegnern vermutet wurden, war durchaus nicht selbstverständlich und hing damit zusammen, dass die Aufführung in eine Zeit fiel, in der das Problem des Antisemitismus nach Jahren eines weitgehenden gesellschaftlichen Beschweigens der nationalsozialistischen Vergangenheit erst allmählich ins öffentliche Bewusstsein trat. Nicht nur der „Ulmer Einsatzgruppenprozess“ von 1958, auch verschiedene Justiz- und andere Skandale führten dazu, dass von den Medien verstärkt nach der Rolle dieses bis dahin tabuisierten Themas gefragt wurde.747 Welche Motive also lagen den Gegnern der Moses und Aron-Aufführung zugrunde ? Inwiefern handelte es sich um eine rein ästhetische Ablehnung, sodass sich die Kritik etwa auf den Vorwurf mangelnder Schönheit des Werkes beschränkte ? Inwieweit spielte darüber hinaus Antisemitismus bei dem Skandal eine Rolle, basierend auf einer rassistischen Variante der ursprungsmythologischen Argumentationsfigur ? Moses und Aron war das Resultat einer Zusammenarbeit zwischen der Städtischen Oper und der West-Berliner Akademie der Künste, die ausdrücklich vom West-Berliner Kultursenator Joachim Tiburtius (CDU) unterstützt wurde.748 Die Idee zu der Aufführung kam von der Akademie, die es sich – im Gegensatz zur Akademie in der DDR – zum Ziel gesetzt hatte, „die Wirkung Schönbergs weiter von der Stadt ausgehen“ zu lassen, „in der er in seiner besten Zeit Leiter einer Kompositionsklasse der Preußischen Akademie der Künste war“, wie Akademie-Generalsekretär Herbert von Buttlar am 10. August 1957 an Intendant Carl Ebert schrieb. Auf einer Pressekonferenz erläuterten die Veranstalter 1959 dann öffentlich, dass die Aufführung einen Beitrag zu einer „Wiedergutmachung“ des Schönberg angetanen „Unrechts“749 in der Zeit des 747 Werner Bergmann, Antisemitismus in öffentlichen Konflikten. Kollektives Lernen in der politischen Kultur der Bundesrepublik 1949–1989, Frankfurt/M./New York 1997, S. 190ff. – Den vorläufigen Höhepunkt jener Entwicklung bildete die antisemitische „Schmierwelle“ in der Bundesrepublik der Jahre 1959/60. Werner Bergmann, „Die antisemitische Schmierwelle 1959/1960“, in : Werner Bergmann und Rainer Erb (Hg.), Antisemitismus in der politischen Kultur nach 1945, Opladen 1990, S. 253–275. 748 Brief von Tiburtius an Carl Ebert (undatiert, wahrscheinlich vom Juli 1957), in : AdK, Berlin, AdK-W, Nr. 788. 749 „Konzept für Dr. v. Buttlar f.d. Pressekonferenz bei Prof. Ebert (Städtische Oper) am 12.3.59“, in : ebd.
246
Aufführungen
Nationalsozialismus leisten solle. Die Biografie des Komponisten war eng mit Berlin verbunden. Hier war Schönberg Professor für Komposition an der Preußischen Akademie der Künste gewesen, bis ihn die Nationalsozialisten 1933 seines Amtes enthoben hatten, woraufhin er in die USA emigrierte.750 Konkret sollte die West-Berliner Moses-Aufführung das Vorhaben der Akademie unterstützen, Schönbergs künstlerischen Nachlass aus dessen Exil in Los Angeles, wo er bis zu seinem Tod 1951 gelebt hatte, nach Berlin zu holen. Zu diesem Zweck stand man in engem Kontakt mit Gertrud Schönberg, der Witwe des Komponisten, die an einem Verkauf des Nachlasses an West-Berlin Interesse zeigte.751 1957 hatte die Akademie in diesem Zusammenhang den Musikwissenschaftler und Schönberg-Schüler Josef Rufer für mehrere Monate in die USA entsandt, wo dieser den Nachlass sichtete, ordnete und ein Werkverzeichnis erstellte, das 1959 unter dem Titel Das Werk Arnold Schönbergs erschien.752 Dass man in Berlin gerade Moses und Aron zur Aufführung bringen wollte und nicht etwa ein anderes Musiktheaterwerk Schönbergs, hing nicht nur damit zusammen, dass die Komposition in den Jahren 1930–32 in Berlin entstanden war. Es sollte auf diese Weise auch die Aufmerksamkeit der Musikwelt auf die weitgehend unbekannten Werke aus Schönbergs Nachlass gerichtet werden. Schönberg nämlich hatte von der auf drei Akte angelegten Oper Moses und Aron nur die ersten beiden vertont, sodass das Werk zu seinen Lebzeiten nie zur Aufführung gekommen war. Auch hoffte die Städtische Oper, mit der anspruchsvollen Aufführung von Moses und Aron ihre inzwischen große künstlerische Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen zu können.753 Bis zur WestBerliner Aufführung nämlich hatte nur eine einzige Bühne, die Züricher Oper, gewagt, das Fragment szenisch aufzuführen, dem aufgrund seiner immensen musikalischen Anforderungen an Sänger und Instrumentalisten der Nimbus der Unspielbarkeit anhaftete. Schließlich hing die Entscheidung für Moses und Aron aber vor allem damit zusammen, dass das Werk seit der ersten konzertanten 750 Siehe dazu : Michael H. Kater, „Arnold Schönberg“, in : Kater, Komponisten S. 243ff. 751 Siehe dazu : „…und die Vergangenheit“, S. 223ff. 752 Josef Rufer, Das Werk Arnold Schönbergs, Kassel 1959. 753 In einem Brief an Gertrud Schönberg vom 08.09.1959 äußerte von Buttlar : „Ich habe die feste Zuversicht, das Märchen von der Unspielbarkeit dieses Werkes hier in Berlin zu zerstreuen.“ AdK, Berlin, AdK-W, Nr. 788.
Ursprungsmythologische Argumentationsfigur/Schöner Schein
247
Aufführung des Tanzes um das goldene Kalb aus dem 2. Akt am 2. Juli 1951 im Rahmen der Internationalen Ferienkurse für Neue Musik in Darmstadt einen hohen Symbolwert besaß. Jene umjubelte Aufführung nämlich markiert den Zeitpunkt des breiten Durchbruchs Schönbergs und der Zwölftontechnik innerhalb der Darmstädter Avantgarde, sodass das Werk seitdem als Inbegriff westlich-musikalischer Moderne galt.754 Dabei war Moses und Aron nicht etwa der erste Schritt einer Hinwendung zur kulturellen Moderne nach der Zeit des Nationalsozialismus an der Städtischen Oper. Die entscheidenden Impulse gingen dabei, wie bereits erläutert wurde, jedoch nicht so sehr von Heinz Tietjen aus, wenn unter dessen Intendanz auch Blachers Preußisches Märchen, Rolf Liebermanns Leonore 40/45 (1953) und Gottfried von Einems Der Prozeß (1953) zur Aufführung kamen, sondern von Carl Ebert. Dieser brachte 1956 den Doktor Faust des im „Dritten Reich“ verfemten Ferrucio Busoni auf die Bühne, danach im Jahr 1956 Hans Werner Henzes beim Publikum heftig umstrittene Oper König Hirsch, 1957 eine Zweitfassung der während seiner ersten Intendanz uraufgeführten Bürgschaft von Kurt Weill, 1959 Hindemiths Mathis der Maler und schließlich 1960 Alban Bergs Wozzeck. Den Initiatoren der Moses und Aron-Aufführung ging es explizit darum, Schönberg als deutschen Komponisten zu rehabilitieren. So erinnerte etwa Josef Rufer in seiner Rede auf Arnold Schönberg, die er 1957 in der West-Berliner Akademie der Künste hielt, daran, dass man dem Komponisten in Deutschland schon 1931 „das Recht abzusprechen begann, sich einen deutschen Musiker zu nennen“.755 Rufer zitierte ein, wie er sagte „erschütterndes Dokument“ Schönbergs mit der Überschrift „Nationale Musik“. Darin hatte sich der Komponist angesichts der von Rufer beschriebenen Kritik nationalkonservativer Kreise gerechtfertigt, indem er die musikalischen Einflüsse Bachs und Mozarts, Beethovens, Wagners und Brahms auf sein Schaffen detailliert aufschlüsselte. Wenn Schönberg in West-Berlin wieder in die deutsche Kultur integriert wurde, so geschah das, dies gilt es hervorzuheben, nach den Erfahrungen mit dem Nationalsozialismus nicht auf der Grundlage einer wie auch immer definierten nationalen Abstammungsgemeinschaft. Anstelle eines genetischen Prinzips – wie es 754 Siehe dazu vor allem : Gianmario Borio, „Zwölftonmusik im Prozeß ihrer Rezeption“, in : Borio/Danuser, Zenit (Bd. 1), S. 171–212, hier S. 171. 755 Josef Rufer, „Rede auf Arnold Schönberg“, in : Melos 24 (1957), S. 345–349, hier S. 347.
248
Aufführungen
in der DDR weiterhin propagiert wurde, wenn auch nicht in einer rassistischen Variante – trat die Vorstellung einer gesellschaftlich bedingten kulturellen Prägung als Bedingung der Zugehörigkeit zur Nation. Um Schönberg als deutschen Komponisten zu rehabilitieren, interpretierte man überdies Moses und Aron, dem die alttestamentarische Schilderung des Auszugs der Israeliten aus Ägypten zugrunde liegt, nicht als spezifisch jüdisches, sondern als kosmopolitisches Thema. Hermann Scherchen schrieb in einem Brief an den Regisseur der Aufführung Gustav Rudolf Sellner : „Schönberg macht mit diesem Werk den Versuch, das jüdische Problem zu einem allgemein Menschlichen umzugestalten : Moses, dessen Zunge gelähmt ist, besitzt den Gedanken, vermag ihn aber nicht mitzuteilen ; Aron, der alles mitzuteilen vermag (selbst den Gedanken !), hat nur den Mund dazu […], weiss aber nichts. Der Verrat am Gedanken, – das ist eigentlich das Thema des Werkes.“756 Dass die Oper durchaus auch als Niederschlag der Identitätskrise Schönbergs angesichts zunehmender antisemitischer Anfeindungen in den Jahren vor 1933757 zu verstehen ist, in deren Folge sich der Komponist dem Zionismus zugewandt und sich selbst immer weniger als deutscher denn als jüdischer Komponist gefühlt hatte, spielte im Rahmen der West-Berliner Aufführung keine Rolle.758 Nachdem die Initiatoren der Moses-Aufführung zunächst geplant hatten, das Werk schon 1958 im Rahmen der Festwochen zur Aufführung zu bringen, stellten sich die organisatorischen, technischen und finanziellen Schwierigkeiten als 756 Brief Hermann Scherchens an Gustav Rudolf Sellner vom 21.10.1958, in : AdK, Berlin, AdKW, Nr. 788. 757 Martina Sichardt, „Deutsche Kunst – jüdische Identität. Arnold Schönbergs Oper ‚Moses und Aron‘“, in : Hermann Danuser und Herfried Münkler (Hg.), Deutsche Meister – böse Geister ? Nationale Selbstfindung in der Musik, Schliengen 2001, S. 367–383. Siehe auch : Michael Mäckelmann, Arnold Schönberg und das Judentum. Der Komponist und sein religiöses, nationales und politisches Selbstverständnis nach 1921, Hamburg 1984. Zur Rolle des Antisemitismus in Schönbergs Biografie siehe : Harald Waitzbauer, „Arnold Schönberg und das Mattsee-Ereignis. Sommerfrischen-Antisemitismus in Österreich und Salzburg“, in : Arnold Schönberg und sein Gott, Wien 2003, S. 14–26. 758 Als Ausdruck allgemeinmenschlicher Themen wurde die Aufführung auch in der Presse rezipiert. Als Beispiel sei Stuckenschmidt angeführt, für den die Oper „schöpferische Auseinandersetzung mit den letzten Dingen“ war, mit „Geist und Ungeist, Leben und Tod, Liebe und Haß, Erfolg und Schiffbruch des Menschen“. Hans Heinz Stuckenschmidt, „Triumph mit Störversuchen“, in : Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 06.10.1959.
Ursprungsmythologische Argumentationsfigur/Schöner Schein
249
so groß heraus, dass das Projekt auf das folgende Jahr verschoben werden musste. Da der Opernetat allein nicht ausreichte, um die Aufführung zu ermöglichen, wurde die Bühne von den Festwochen und der Akademie der Künste finanziell maßgeblich unterstützt. Große Widerstände kamen indes auch vom Chor und dessen musikalischen Leitern Hermann Lüddecke und Ernst Senff. So musste sich die Intendanz aufgrund der vermeintlichen Unspielbarkeit des Werkes zwischenzeitlich sogar mit einem Protestschreiben der Chorgewerkschaft auseinandersetzen.759 Die Einwände konnten jedoch entkräftet werden, indem Teile der Chorpartitur durch den zusätzlich engagierten RIAS-Kammerchor auf Band vorproduziert und während der Aufführung eingespielt wurden. Nicht nur ließen sich auf diese Weise die musikalischen Schwierigkeiten in den Griff bekommen ; es konnte somit auch das Problem der – gemessen an der von Schönberg geforderten außerordentlich großen Anzahl von Choristen – eigentlich zu klein dimensionierten Bühne im Theater des Westen gelöst werden. Die stärksten Widerstände im Vorfeld der Aufführung aber kamen von der Musikpublizistik und einem Teil der West-Berliner Journalisten. Als Hauptsprachrohr der Schönbergkritik in den 1950er-Jahren im Westen kann der Dirigent, Komponist und Publizist Alois Melichar (1896–1976) gelten, der seiner vehement ablehnenden Position in wortgewaltigen und einflussreichen Büchern wie Die Überwindung des Modernismus (1954), Musik in der Zwangsjacke (1958) und Schönberg und die Folgen (1960) Ausdruck verlieh.760 Auf Melichar bezog sich nicht nur etwa der in der Bundesrepublik angesehene Musikwissenschaftler Hans Joachim Moser, der während des Nationalsozialismus zu den profiliertesten antisemitischen Vertretern seines Faches gezählt hatte und sich nach 1945 als Leiter des West-Berliner Städtischen Konservatoriums kaum von seinen alten Ansichten distanzierte.761 759 Vermerk über eine Besprechung zwischen von Buttlar, Carl Ebert und Horst Goerges am 17.12.1958, in : AdK, Berlin, AdK-W, Nr. 788. 760 Alois Melichar, Die Überwindung des Modernismus. Konkrete Antwort an einen abstrakten Kritiker, Frankfurt/M. 1954 ; Alois Melichar, Musik in der Zwangsjacke. Die deutsche Musik zwischen Orff und Schönberg, Wien 1958 ; Alois Melichar, Schönberg und die Folgen. Eine notwendige kulturpolitische Auseinandersetzung, o. O. 1960. – Zu Melichars Position siehe auch : Manuel Gervink, Arnold Schönberg und seine Zeit, Laaber 2000, S. 332ff. 761 Hans Joachim Moser, Die Musik der deutschen Stämme, Wien/Stuttgart 1957, S. 903. – Zu Mosers Rolle innerhalb der Musikwissenschaft nach 1945 siehe : Potter, Musikwissenschaft, S. 312f.
250
Aufführungen
Auch der Redakteur Walter Abendroth etwa verwies in der Zeit lobend auf Melichar.762 Selbst in der ostdeutschen Zeitschrift Musik und Gesellschaft fand Melichar Zustimmung.763 Schließlich führte, auch das zeigt dessen Einfluss, sogar der Generalsekretär der West-Berliner Akademie der Künste von Buttlar bei den Auseinandersetzungen im Vorfeld der West-Berliner Moses-Premiere Melichar explizit als Beispiel für die zeitgenössische Kritik an Schönberg an.764 Ausgangspunkt von Melichars Thesen, die im Folgenden zusammenfassend erläutert werden, war die Feststellung einer „besorgniserregend weit fortgeschrittene[n] Demolierung“765 des Kunstlebens, wobei er der Musik Arnold Schönbergs als derjenigen des „Anführers“ der Neuen Musik die zentrale Rolle zuwies. Gegen Schönberg gewendet findet sich bei Melichar nicht nur Kritik an der vermeintlich fehlenden versittlichenden Wirkung von dessen Kunst und der Vorwurf eines Mangels an ästhetischer Schönheit in seiner Musik, sondern auch die ursprungsmythologische Argumentationsfigur. So warf Melichar der Oper Moses und Aron zum einen einen unsittlichen Inhalt vor. Dazu bezog er sich auf die Szene mit dem Tanz um das goldene Kalb, in der Schönberg ein „Blutopfer“ an vier nackten Jungfrauen und eine „erotische Orgie“766 konzipiert hatte. In dieser Szene, so Melichar, seien Schönberg „die schlimmsten Entgleisungen sprachlicher und handlungsmäßiger Natur“767 passiert, sodass er das gesamte Werk als eine „Orgie der Geschmacklosigkeiten“768 bezeichnete. Was sodann den Mangel an ästhetischer Schönheit angeht, äußerte sich Melichar auf eine Art und Weise, die derjenigen der DDR gegenüber der musikalischen Moderne an Heftigkeit in nichts nachsteht. Bei Moses und Aron sprach er drastisch von einem „unaufhörliche[n] Simultangebrüll singender, schreiender, sprechender, sprechsingender Solostimmen, in welches flüsternde, schmetternde, heulende Männerchöre und konvulsivisch aufkreischende, gellende, zischende Frauenchöre 762 Walter Abendroth, „Die Krise der Neuen Musik. Eine Polemik zur höchst notwendigen Aufklärung eines vertrackten Sachverhaltes“, in : Die Zeit vom 14.11.1958. 763 Karl Laux, „,Moderne Musik‘“, S. 212. 764 „Konzept für Dr. v. Buttlar f.d. Pressekonferenz bei Prof. Ebert (Städtische Oper) am 12.3.59“, in : AdK, Berlin, AdK-W, Nr. 788. 765 Melichar, Zwangsjacke, S. 8. 766 Arnold Schönberg, Moses und Aron. Oper in drei Akten. Textbuch, Mainz u.a. 1957, S. 24/25. 767 Melichar, Zwangsjacke, S. 162. 768 Ebd., S. 163.
Ursprungsmythologische Argumentationsfigur/Schöner Schein
251
ihre Tonklumpen, -brocken und -scherben werfen, dazu der grässlich dicke, wie ein Lindwurm sich dahinwälzende ‚Harmonie‘-Satz des zu einer gigantischen Lärmartillerie verwandelten Riesenorchesters, das fast pausenlos und gleichzeitig aus allen Rohren seine Breitseiten abschießt, im Grunde aber nur eine mit den kompliziertesten Mitteln hergestellte höchst primitive Musik exekutiert“.769 Die ursprungsmythologische Argumentationsfigur schließlich kam zum Tragen, wenn Melichar, ausgehend von der Existenz verschiedener Nationalkulturen, Schönbergs Musik die Tendenz zu einer „Einheitsweltkunst“770 vorwarf, da ihr spezifisch nationale Charakteristika fehlen würden. In diesem Zusammenhang gab er der Vermutung Ausdruck, dass die Kritik an dem Komponisten bisher nur wegen der „generellen Subordinationsfreudigkeit“ der Deutschen „so zahm, lau und ängstlich“ geführt werde, da man sich doch „nach 1945 auch auf dem Gebiet der Künste […] bedingungslos dem […] amerikanischen Diktat des Abstraktionismus unterworfen“771 habe. Allerdings fehlen in Melichars Büchern offene antisemitische Äußerungen. Der Autor selbst wollte seine Kritik sogar explizit als rein ästhetische verstanden wissen und distanzierte sich ausdrücklich vom Antisemitismus.772 Dennoch lassen sich bei Melichar zumindest implizit antisemitische Töne finden, etwa wenn er den Verfechtern der musikalischen Moderne eine Verschwörung gegen den etablierten Musikbetrieb unterstellte, was nur zu deutlich an den nationalsozialistischen Vorwurf einer Verschwörung des Judentums gegen die deutsche Kultur erinnert. Indem er darüber hinaus sogar von einer „Brunnenvergiftung“773 der aus seiner Sicht unpolitischen Kunstform Musik durch die Anhänger der Neuen Musik sprach, benutzte Melichar sogar explizit antisemitisches Vokabular. Schließlich lässt sich auch ein anderes Argument Melichars antisemitisch deuten : Der Autor bezeichnete die Dode769 Ebd., S. 172–173. 770 Melichar, Schönberg, S. 26. 771 Ebd. 772 Ebd., S. 6 ; Melichar, Zwangsjacke, S. 59. – Während des „Dritten Reiches“ hatte Melichar allerdings Musik für NS-Propagandafilme geschrieben. Siehe dazu : Fred K. Prieberg, Handbuch Deutsche Musiker 1933–1945, CD-Rom Version 1.2–3/2005, Auprès des Zombry 2004, S. 4546–4551. 773 Melichar, Schönberg, S. 5. – Der aus dem Mittelalter stammende Topos der Brunnenvergiftung stellte für lange Zeit den wirkungsmächtigsten antisemitischen Vorwurf überhaupt dar. Werner Bergmann, Geschichte des Antisemitismus, München 2002, S. 11f.
252
Aufführungen
kaphonie Schönbergs als „naturwidriges und geistfeindliches Pseudosystem“774 und bezog sich ausdrücklich auf Wilhelm Furtwänglers Diktum von der „biologisch minderwertigen“775 Zwölftonmusik. Aber wie schon gesagt wurde, argumentierte Melichar an keiner Stelle offen antisemitisch. Dies war nach 1945 in der Bundesrepublik gesellschaftlich nicht mehr vertretbar.776 Im Vergleich zur Schönberg-Kritik in der Zeit des Nationalsozialismus fehlt es Melichars Pamphleten deswegen, trotz der bisweilen drastischen Sprache, entscheidend an Schärfe. Wenn eine offene antisemitische Argumentation auch in den Berliner Presseartikeln im Vorfeld der West-Berliner Moses-Aufführung nicht zu finden ist, enthalten diese doch das gesamte argumentative Arsenal Melichars gegen Schönberg. Hellmut Kotschenreuther etwa, der das Moses-Projekt grundlegend ablehnte, kritisierte am 4. Januar 1958 in der Berliner Morgenpost nicht nur die aus seiner Sicht zu hohen Kosten der Aufführung, des Weiteren die Belastung für den laufenden Spielbetrieb durch zu viele Proben und ebenso die sich aus dem Fragmentcharakter des Werkes ergebenden Probleme für eine Aufführung. Er fragte auch : „Kennen die Verantwortlichen das Textbuch dieser Oper, dessen geschmackliche, sprachliche und dramaturgische Fehlleistungen das Maß des Statthaften bei weitem überschreiten ?“777, womit er auf die vermeintlich fehlende versittlichende Wirkung der Oper anspielte. Bereits 1956 hatte sich Kotschenreuther in der Publikation Musikstadt Berlin zwischen Krieg und Frieden, die einen Überblick über das nach 1945 wiedererstandene Musikleben zu geben beabsichtigte, grundlegend gegen Schönberg und die Zwölftonmethode geäußert. Jeder auf dieser Kompositionstechnik basierenden Musik warf er einen „dürren Intellektualismus“ vor und bezeichnete sie als „trocken, langweilig, phantasielos“ und „ideologisch ausgekühlt“778. Wie Melichar unterstellte er eine 774 Melichar, Zwangsjacke, S. 59. 775 Ebd., S. 140. Die Äußerung Furtwänglers findet sich in : Wilhelm Furtwängler, Gespräche über Musik, Zürich 1948, S. 24. 776 Bergmann, Antisemitismus in öffentlichen Konflikten, S. 188. 777 Hellmut Kotschenreuther, „Soll unsere Oper ‚Moses und Aron‘ aufführen ?“, in : Berliner Morgenpost vom 05.01.1958. 778 Hellmut Kotschenreuther, „Reaktion, Restauration oder Revision ?“, in : Harald Kunz (Hg.), Musikstadt Berlin zwischen Krieg und Frieden. Musikalische Bilanz einer Viermächtestadt, Berlin 1956, S. 187–210, hier S. 192.
Ursprungsmythologische Argumentationsfigur/Schöner Schein
253
Verschwörung der Vertreter der musikalischen Moderne gegen das etablierte deutsche Musikleben : „Die [musikalischen, FB] Revoluzzer haben es verstanden, in die Schlüsselstellungen einzusickern. Auf diese Weise sind sie in den Besitz einer Machtposition gekommen.“779 Neben Kotschenreuther äußerte sich in derselben Publikation auch der Journalist Kurt Westphal grundlegend gegen Schönberg, indem er ähnlich wie zuvor Furtwängler der Zwölftontechnik insgesamt wahre schöpferische Möglichkeiten absprach, was er mit der mangelnden Zustimmung des Publikums begründete : „Das Berliner Publikum verschließt sich keiner neuen Musik, die Zeugnis echter schöpferischer Potenz ist.“780 Der Widerstand gegen das Moses und Aron-Projekt vonseiten West-Berliner Journalisten gipfelte schließlich in einer von Oper und Akademie der Künste gemeinsam abgehaltenen Pressekonferenz am 12. März 1959. Dabei hätten sich die Veranstalter, wie von Buttlar berichtete, „gegen die anbellende Meute der Presse zu wehren“781 gehabt. „Die Herren Kroll, Westphal und Kotschenreuther, insbesondere die beiden letzteren“ hätten „mit unbeschreiblichen Argumenten“ versucht, das Projekt „mies[zu]machen“782, bevor die Premiere überhaupt stattgefunden habe. Carl Ebert verteidigte vom Podium her das Werk und die möglichen Rezeptionsschwierigkeiten, indem er als Beispiel den zweiten Teil von Goethes Faust anführte, der, vom Publikum zunächst weitgehend abgelehnt, gegenwärtig sogar als „stärker“ als der erste angesehen werde. Wie Ernst Legal im Jahr 1951 bei der Diskussion über die bevorstehende Lukullus-Premiere bat nun Carl Ebert um Geduld.783 Die Städtische Oper erneuerte damit die Position, die sie bereits angesichts der vehementen Ablehnung von Hans Werner Henzes Oper König Hirsch 1956 durch Teile des Publikums eingenommen hatte :784 In verschiedenen Programmhefttexten hatte die Bühne angesichts des Unmuts 779 Ebd. 780 Kurt Westphal, „Das Publikum und die Neue Musik“, in : ebd., S. 174–187, hier S. 186. Siehe auch : Kurt Westphal, „Tradition und Fortschritt in der Neuen Musik“, in : Musikerziehung. Zeitschrift zur Erneuerung der Musikpflege 6 (1952), S. 72–78. 781 Protokoll der Pressekonferenz vom 12.03.1959, in : AdK, Berlin, Ebert-Archiv, Nr. 344. 782 Ebd. 783 Ebd. – Siehe auch : Carl Ebert, „Die Aufgabe, auch Geburtshelfer problematischer Werke zu sein“, in : Der Kurier vom 11.03.1959. 784 Siehe dazu : Hans Werner Henze, Reiselieder mit böhmischen Quinten. Autobiographische Mitteilungen 1926–1995, Frankfurt/M. 1996. S. 175f.
254
Aufführungen
mancher Zuschauer die Entscheidung für das unbequeme Werk Henzes verteidigt. Der Dramaturg Horst Goerges etwa hatte an die bildende Funktion des Theaters erinnert und betont, dass ein städtisches Opernhaus die Subventionen aus öffentlicher Hand nicht nur zum Zwecke „angenehme[r] Zerstreuung“ erhalte ; ein „Kulturtheater“ diene „nicht nur der ‚Unterhaltung‘“. Zwar stünde es, so Goerges, jedem Zuschauer frei, „Werke, zu denen er trotz intensiver Bemühung keine Beziehung findet, für sich abzulehnen“, doch hinge davon nicht deren „tiefer begründete Existenzberechtigung und Qualitätsbestimmung ab“. Der Dramaturg hatte daraus geschlossen, dass ein „repräsentatives Kulturinstitut derartige Werke [z. Bsp. König Hirsch, FB] zur Diskussion stellen“ müsse, „selbst wenn sie vielleicht rätselhaft erscheinen und dem unvorbereiteten Zuhörer nicht sofort eingängig sind.“785 Mit dieser Position verhielt sich die Städtische Oper gegenüber der kulturellen Moderne entgegengesetzt zur ostdeutschen Kulturpolitik : Während eine Oper aus Sicht der DDR nur durch die unmittelbarere positive Bewertung des Publikums überhaupt als große Kunst legitimiert wurde, bemaß sich der Wert eines Kunstwerks an der Städtischen Oper unabhängig von der Zustimmung durch die Rezipienten. Unmittelbar vor der Premiere von Moses und Aron schließlich scheint der Grad aggressiver Ablehnung des Werkes bei Einzelnen derart hoch gewesen zu sein, dass es offensichtlich selbst zur Androhung von Gewalt kam : Mehrere Zeitungen jedenfalls berichteten, dass Hermann Scherchen einige Tage vor der Premiere einen anonymen Anruf erhalten haben soll mit der Drohung, man werde ihm die Chemikalie Vitriol in die Augen spritzen, wenn er es wage, die Aufführung zu dirigieren.786 Glücklicherweise blieb es in diesem Fall bei der bloßen Androhung von Gewalt. In der Nacht unmittelbar vor der Premiere aber zerstachen Unbekannte die Autoreifen seines Wagens.787 785 Horst Goerges, „Bemerkungen über Publikum, Spielplan und Abonnement“, in : Programmhefte der Städtischen Oper Berlin, Spielzeit 1957/58, S. 61–64, hier S. 62 und 64. Siehe auch zwei weitere Beiträge in den Programmheften derselben Spielzeit : Manfred Klee, „Jugend und Oper“, S. 31–34 ; Gerth-Wolfgang Baruch, „Die Galerie lebt“, S. 76–78. 786 Heinz Joachim : „Arnold Schönbergs Triumph über Pfiffe und Proteste“, in : Die Welt vom 06.10.1959 ; Karl Heinz Ruppel, „Pfiffe in der Berliner Oper“, in : Süddeutsche Zeitung vom 06.10.1959 ; Karl Rehberg, „Schönbergs Bekenntnisoper“, in : Der Telegraf vom 06.10.1959. 787 Siehe etwa : Heinz Joachim : „Arnold Schönbergs Triumph über Pfiffe und Proteste“, in : Die Welt vom 06.10.1959.
Ursprungsmythologische Argumentationsfigur/Schöner Schein
255
Ob bei den Gegnern der Moses und Aron-Aufführung im Zuschauerraum schließlich Antisemitismus eine Rolle gespielt hat oder ob sich die Kritik auf ästhetische Aspekte beschränkte, lässt sich im Einzelnen nicht mehr klären. Ansätze liefert sicher der schon erläuterte westdeutsche Schönberg-kritische Diskurs der Nachkriegszeit als ‚veröffentlichte Meinung‘. Lediglich die von der DDR unterstellte inszenierte „antisemitische Hetze“ kann wohl ausgeschlossen werden ; für sie gibt es jedenfalls keinerlei Belege. Hinweise aber, dass auch Antisemitismus eine Rolle gespielt hat, liefern indes Leserbriefe. Im Berliner Tagesspiegel setzte sich der Journalist Walter Karsch nach der Premiere mit Zuschriften von Lesern zu dem Skandal auseinander. Ein Teil der Leserbriefe belege deutlich, stellte Karsch fest, dass aufseiten des Publikums auch Antisemitismus eine Rolle gespielt habe : „Daß sich der antisemitische Pöbel (der natürlich behauptet, nicht antisemitisch zu sein) […] mit selbstverständlich anonymen, von persönlichen Beschimpfungen strotzenden Zuschriften beteiligt [hat], sei für diejenigen angemerkt, die bestreiten, daß zu den Motiven einiger der Pfeifer vom vergangenen Sonntag auch antisemitische zu zählen sind.“788 Doch wurden diese Zuschriften wegen der fehlenden Autorenangabe, wie es üblich war, nicht abgedruckt. Allerdings zeigen zumindest zwei abgedruckte Äußerungen antisemitische Ressentiments. In dem einen der beiden Briefe wurde zwar bestritten, dass der Tumult nach der Premiere einen „erkennbar antijüdischen Charakter“ besessen habe. Dann aber hieß es, dass „Darbietungen wie in gewisser Hinsicht das Schönbergsche Werk […] tatsächlich ungewollt dazu beitragen“ könnten, einer antijüdischen Stimmung vermehrten Raum zu schaffen. Wäre heute ein Bühnenwerk eine deutschvölkische Demonstration, die Öffentlichkeit würde diese entschieden ablehnen. Ist es aber wirklich notwendig, von der Bühne her mit einer Art von alljüdischer Demonstration aufzuwarten ?“ Auch der andere Leserbrief spiegelt antisemitische Vorbehalte. Darin heißt es : „Der Gedanke liegt […] nah, daß es sich bei der Aufführung doch mehr oder minder um eine Repräsentation ausschließlicher jüdischer Religiosität und Nationalität handelt. Man stelle sich vor, wie eine Dichtung, die mit ähnlicher Emphase etwa die geistesgeschichtliche Führung des deutschen Volkes verkünden wollte, bei einer 788 Walther Karsch, „Der Leser zu Schönbergs ‚Moses und Aron‘. Versuch eines Zwiegesprächs“, in : Der Tagesspiegel vom 11.10.1959.
256
Aufführungen
Aufführung in Tel Aviv vom dortigen Publikum empfangen würde.“ – Darauf antwortete der Journalist Walther Karsch : „Die Frage, wie ein betont propagandistisches Stück heute in Tel Aviv aufgenommen würde, verstehe ich nicht ganz. Schließlich haben, wenn man so fragt, die Deutschen den Juden Böses getan, nicht aber die Juden den Deutschen.“789 Wohl nicht zuletzt wegen der Sorge, Antisemitismus vorgeworfen zu bekommen, bemühten sich schließlich selbst die anfangs ablehnenden Journalisten in ihren Rezensionen um eine auffällig moderate Haltung. Hellmut Kotschenreuther etwa gestand nun immerhin ein, Moses und Aron sei „bei allen Einwänden : Ein Werk von hohem Ethos“.790 Begünstigt wurde ein solches Urteil dadurch, dass die umstrittene Szene mit dem Tanz um das goldene Kalb in der Choreografie von Dore Hoyer durch Stilisierung gewissermaßen ‚entschärft‘ worden war. So musste auch Kurt Westphal feststellen : „Wer […] die Berliner Premiere in Erwartung einer Sensation besuchte, der dürfte enttäuscht gewesen sein. Alles, was von der Orgie um das goldene Kalb, von Lust- oder Ritualmord in der Vorstellung vieler Köpfe schwirrte, verlor in Sellners streng zeremonieller und fast geometrischer Spielführung jeden Beigeschmack des Lüsternen.“791 So wurde die Aufführung bei der Presse letztlich einhellig gefeiert und für die Bühne zu einem Triumph.792 Nicht nur waren die sechs angesetzten Aufführungen am Ende ausverkauft.793 Die Bühne wurde mit dieser Produktion auch im Jahr 1960 zu Gastspielen nach Wien und Paris sowie im Jahr darauf an die Mailänder Scala eingeladen, was mithilfe erheblicher finanzieller Zuwendungen der Kulturabteilung des Auswärtigen Amtes verwirklicht werden konnte. Um die Finanzierung durch Bonn zu erwirken, argumentierte man beim West-Berliner Senat mit den besonderen Möglichkeiten solcher Gastspiele, die Leistungen der 789 Ebd. 790 Hellmut Kotschenreuther, „Bei allen Einwänden : Ein Werk von hohem Ethos“, in : Berliner Morgenpost vom 06.10.1959. 791 Kurt Westphal, „Gedanken-Oper – streng zeremoniell und fast geometrisch“, in : Der Kurier vom 05.10.1959. 792 Siehe etwa : Werner Ohlmann, Arnold Schönbergs Berliner Triumph, in : Der Tagesspiegel, Nr. 4278 ; Hans Heinz Stuckenschmidt, „Triumph mit Störversuchen“, in : Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 06.10.1959 ; Heinz Joachim : „Arnold Schönbergs Triumph über Pfiffe und Proteste“, in : Die Welt vom 06.10.1959. 793 Gertrud Pliquett, „Jetzt pfiff keiner mehr“, in : Berliner Morgenpost vom 18.10.1959.
Ursprungsmythologische Argumentationsfigur/Schöner Schein
257
Städtischen Oper „international sichtbar zu machen, die hier schon auf Grund der Insellage Berlins nur eine begrenzte Ausstrahlung erreichen“794 könnten. Eine herausgehobene Bedeutung kam dem Gastspiel in Paris zu. Hier war die Städtische Oper zur Eröffnung einer „Saison Berlinoise“ des internationalen Festivals „Théâtre des Nations“ eingeladen worden. Diese prominente Einladung wurde besonders deswegen als kulturpolitisch wichtig angesehen, weil hier die DDR mit dem Berliner Ensemble und der Komischen Oper in den vergangenen Jahren große Erfolge gefeiert hatte. Erst 1959 war der Felsenstein-Bühne der Preis für die beste Aufführung und damit die wichtigste der dort vergebenen Auszeichnungen zuerkannt worden.795 Dem Senat stand die Bedeutung eines Gastspiels in der französischen Hauptstadt umso deutlicher vor Augen, als „dem Vernehmen nach […] die französische Regierungsstelle die Weisung gegeben haben [soll], für die diesjährigen Pariser Festspiele keine Ost-Berliner Bühne einzuladen“.796 So wollte man diese Chance keineswegs vertun. Das Gastspiel an der Seine mit 350 Mitwirkenden und drei ausverkauften Moses-Aufführungen hatte schließlich einen außerordentlich großen Erfolg : Die Städtische Oper erhielt den begehrten Preis für die beste Aufführung, womit man die Komische Oper ablöste, die freilich in jenem Jahr nicht an dem Pariser Festival teilgenommen hatte.797 Letzten Endes entwickelte sich die zunächst heftig skandalisierte Moses und Aron-Produktion des West-Berliner Opernhauses zu einem beispiellosen Erfolg. Die Inszenierung stand bis Mitte der 1970er-Jahre auf dem Spielplan der Bühne. Auch in Rom 1966, Osaka 1970 und Zagreb 1971 sowie bei drei weiteren internationalen Gastspielen konnte das Werk gezeigt werden.798 Nicht nur trug die Städtische Oper dadurch wesentlich dazu bei, mit Moses und Aron eines der Hauptwerke des im „Dritten Reich“ verfemten Arnold Schönberg international bekannt zu machen. Sie demonstrierte damit 794 Senatsbeschluss 2377/61 vom 21.02.1961, in : LAB, B Rep. 014, Nr. 2276. 795 Die Städtische Oper, die 1959 ebenfalls in Paris gastierte, konnte immerhin den Preis für die beste Sängerin erobern : Lisa della Casa wurde für ihren Auftritt in Ariadne auf Naxos geehrt. „Berliner Oper ausgezeichnet“, in : B.Z. vom 20.07.59. 796 Ebd. 797 „Lorbeer für die Oper. Pariser Auszeichnungen“, in : Berliner Morgenpost vom 09.07.1961. 798 Siehe dazu die Übersicht des Wiener Arnold Schönberg Center. URL : http ://www.schoenberg.at/6_archiv/music/works/no_op/compositions_Moses_performances.htm (Stand 22.12. 2008).
258
Aufführungen
auch anschaulich ein gegenüber dem Nationalsozialismus grundlegend gewandeltes westdeutsches kulturelles Selbstverständnis. In der DDR hingegen kam es erst im Jahr 1975 im Zuge einer allmählichen Aussöhnung mit Schönberg an der Dresdner Staatsoper zu einer ersten Aufführung des Werkes.799 Die OstBerliner Staatsoper spielte das Werk sogar erst 1987. Der Erwerb des Schönberg-Nachlasses durch die West-Berliner Akademie allerdings scheiterte trotz des großen Erfolges mit Moses und Aron, hatte sich doch unter den Mitgliedern der Akademie keine einheitliche Position zu dieser Frage herausbilden können. Aufgrund der halbherzigen Haltung Berlins entschloss sich die Witwe des Komponisten dazu, den Nachlass in den USA zu behalten und ihn der University of South California in Los Angeles zu übergeben, wo 1977 ein Schönberg-Institut eröffnet wurde.800
3. Die Komische Oper als Musterbühne des Sozialistischen Realismus
In einem Brief an den Minister für Kultur Johannes R. Becher vom 18. Oktober 1954 machte der Intendant der Ost-Berliner Komischen Oper Walter Felsen799 Matthias Herrmann, Arnold Schönberg in Dresden, Dresden 2001, S. 91ff. – Zur kulturpolitischen Aussöhnung mit Schönberg in der DDR allgemein siehe : Wesley Blomster, „The Reception of Arnold Schoenberg in the German Democratic Republic“, in : Perspectives of New Music 21 (1982/1983), S. 114–137 ; Frank Schneider, „Von Gestern auf Heute : Die Wiener Schule im Schaffen von Komponisten der DDR“, in : Rudolf Stephan und Sigrid Wiesmann (Hg.), Bericht über den 2. Kongreß der Internationalen Schönberg-Gesellschaft. Die Wiener Schule in der Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts, Wien 1986, S. 122–129. – Noch in der zweiten Hälfte der 1950er-Jahre hatte Eberhard Rebling in Musik und Gesellschaft über die szenische Uraufführung von Moses und Aron in Zürich kritisch geschrieben : „,Moses und Aron‘ ist trotz aller Lauterkeit der Absichten Schönbergs das künstlerische Zeugnis einer ausweglosen, weil rückwärts gerichteten Haltung, das ein Opernpublikum, das sich einem neuen Leben zuwendet, wohl kaum mehr in seinem Innersten berühren können wird.“ Eberhard Rebling, „Arnold Schönbergs Lebensbekenntnis. Gedanken zu seiner Oper ‚Moses und Aron‘“, in : Musik und Gesellschaft 7 (1957), S. 462–467, hier S. 467. 800 Siehe dazu : Fischer-Defoy, „Vergangenheit“, S. 601. – Nachdem die University of South California aufgrund von Streitigkeiten mit den Schönberg-Erben 1995 beschlossen hatte, den Nachlass zum Jahr 1998 aufzugeben, verhandelten diese erneut mit der inzwischen vereinigten Berliner Akademie. Wegen des neuerlichen Zögerns allerdings fiel die Entscheidung im Dezember 1996 schließlich zugunsten der Stadt Wien. Siehe dazu : ebd.
Die Komische Oper als Musterbühne des Sozialistischen Realismus
259
stein seinem Ärger Luft : Den Stein des Anstoßes bildete für ihn die zurückliegende feierliche Einführung Max Burghardts in das Amt des Intendanten der Staatsoper, bei der Staatssekretär Apelt in seiner Rede einige für den Künstler nicht akzeptable Äußerungen gemacht hatte. Apelt hatte gesagt : „,Die Deutsche Staatsoper, die seit ihrem Beginn an der Spitze aller deutschen Musiktheater steht, hat in unserer gegenwärtigen Zeit für die Weiter- und Höherentwicklung der deutschen Kultur eine ganz besondere Bedeutung.‘ […] ‚Im Ringen um den Realismus auf der Opernbühne wird die Deutsche Staatsoper […] die Stätte sein, an der die begonnene Auseinandersetzung über das Musiktheater aus der Theorie in die künstlerische Praxis geführt wird. Sie muss sich an die Spitze der Auseinandersetzung stellen, den anderen Theatern Orientierung geben und ihnen helfen, sich von Routine und Schablone zu befreien, um zu einer lebendigen und wahrhaftigen Gestaltung auf der Opernbühne zu gelangen.‘“801 Felsenstein kritisierte, dass Apelt mit seiner Aussage, die Staatsoper spiele bei der Erneuerung der Oper im sozialistischen deutschen Staat die entscheidende Rolle, einen Anspruch formuliert habe, der nach Meinung des Intendanten vielmehr der von ihm selbst geleiteten Bühne zukomme. Für Felsenstein bildete die Komische Oper die Musterbühne des Musiktheaters in der DDR. „Jeder“, schrieb der Intendant, „dem der Fortschritt des deutschen Musiktheaters wirklich am Herzen liegt, weiss, dass die Deutsche Staatsoper – wie auch immer man ihren Beginn datieren mag – leider noch niemals an der Spitze aller deutschen Musiktheater stand. […] Die Komische Oper war und ist zur Zeit das einzige Theater, das anderen Opernbühnen eine Orientierung zu geben vermag, und das ein Beispiel dafür gibt, wie man sich von Routine und Schablone befreien kann und zu einer lebendigen und wahrhaftigen Gestaltung auf der Opernbühne gelangen kann.“ Felsenstein fuhr fort, der Minister wisse zwar, „wie weit vom angestrebten und erreichbaren Ziel entfernt“ er die Ergebnisse seiner bisherigen Bemühungen um das Musiktheater betrachte. „Aber das ändert nichts daran, dass ich mich diesen Bemühungen seit sieben Jahren aufopfere, dass ich besser wie [sic] jeder Andere beurteilen kann, wie es mit dem Ringen um den Realismus auf der Opernbühne vorläufig wirklich bestellt ist, und dass ich mich nicht behindern lassen darf, die 801 Brief Walter Felsensteins an Johannes R. Becher vom 18.10.1954, in : LAB, C Rep. 167, Nr. 432.
260
Aufführungen
Erkenntnisse meiner mehr als dreissigjährigen Arbeit so fruchtbar wie nur möglich für das Entstehen eines wahrhaftigen deutschen Musiktheaters im Rahmen der deutschen Volkskultur einzusetzen.“802 Wie lässt sich in den 1950er-Jahren das Verhältnis zwischen Komischer Oper und Staatsoper als den systeminternen Konkurrentinnen charakterisieren ? Welche der beiden Bühnen war tatsächlich die Musterbühne des Musiktheaters in der DDR ? Die Komische Oper in der Behrenstraße unweit der Linden im Gebäude des ehemaligen Metropol-Theaters war am 23. Dezember 1947 als drittes städtisch subventioniertes Opernhaus Berlins neben Staatsoper und Städtischer Oper mit Johann Strauß’ Operette Die Fledermaus eröffnet worden, nachdem dem Intendanten von der kunstliebenden sowjetischen Militäradministration erst im Juni jenen Jahres die entsprechende Lizenz überreicht worden war.803 In den 1920er- und 1930er-Jahren hatte Felsenstein seine Laufbahn als Spielleiter an die Schauspiel- und Opernbühnen in Basel, Freiburg, Köln und Frankfurt geführt. 1936 war er unter Bezugnahme auf seine „nichtarische“ Ehe aus der Reichstheaterkammer ausgeschlossen worden. Nach Felsensteins Wirken am Stadttheater Zürich 1938 bis 1940 konnte er durch die Hilfe Heinrich Georges bis zur Schließung aller Theater 1944 als Spielleiter ans Berliner Schillertheater wechseln.804 Schon im Programmheft der Eröffnungspremiere der Komischen Oper 1947 hatte Felsenstein die Grundsätze seiner geplanten Opernreform formuliert.805 Mit den Aufführungen an seinem Haus, so war dort zu lesen, verfolge er das Ziel einer „gleichmäßigen Betonung beider Teile des Wortes Musik-Theater. Denn Musik, die nicht aus dem dargestellten Vorgang wächst, hat nichts mit Theater zu tun, und eine Darstellung, die sich nicht präzis und künstlerisch gültig mit Musik identifiziert, sollte besser auf Musik verzichten. Der dramatische Einfall schafft die Situation, in der die Musik unentbehrlich und der Gesang zur einzig möglichen Aussage des Darstellers wird.“806 Felsensteins Ziel als Regisseur war 802 Ebd. 803 Siehe dazu : Werner Rackwitz, „Die Wiedergeburt der Komischen Oper in Berlin“, in : Albert Kost (Hg.), Die Komische Oper, Berlin 1997, S. 50–66. – Rackwitz weist darauf hin, dass die Notwendigkeit eines dritten Berliner Opernhauses von der Öffentlichkeit zunächst durchaus angezweifelt wurde. Ebd., S. 64f. 804 Götz Friedrich, Walter Felsenstein. Weg und Werk, Berlin 1961, S. 18–23. 805 Siehe dazu : Braunmüller, Oper. 806 Walter Felsenstein, „Zum Beginn. Aus dem Programmheft der Eröffnungspremiere der
Die Komische Oper als Musterbühne des Sozialistischen Realismus
261
es, die qualitativen Standards der Personenführung aus dem Bereich des Schauspiels auf die Oper zu übertragen. Indem es ihm dabei um ein psychologisch glaubhaft gespieltes Einfühlungstheater ging, stand er in diametralem Gegensatz zu Bertolt Brechts Konzept eines epischen Theaters, das von den ästhetischen Kategorien Verfremdung und Distanz bestimmt war.807 Felsenstein wurde in den 22 Jahren seiner Intendanz an der Komischen Oper nicht müde, sich vehement gegen den Schlendrian, so ein von ihm häufig benutzter Ausdruck, zu wenden, bei dem der Bereich der szenischen Darstellung einer Opernaufführung mehr oder weniger ungeplant und somit letztlich der schauspielerischen Kreativität des jeweiligen Sängers überlassen war. Damit verbunden kritisierte er eine Aufführungspraxis, bei welcher die Musik nur als ein von der dramatischen Situation unabhängiges, rein dekoratives und damit nur Unterhaltungszwecken dienendes Beiwerk angesehen werde. „Gesang als Einlage und als nur klangliche Produktion einer Stimme ist eine Degradation des Theaters und die mehr oder weniger unverbindliche instrumentale Begleitung eines durchaus selbständigen szenischen Vorgangs ein Mißbrauch wertvoller Musik.“808 Für das Repertoire der Komischen Oper stellte Felsenstein die „kostbarsten Werke des klassischen heiteren Musiktheaters“809 in Aussicht. Dabei legte er Wert darauf, dass es in diesem Zusammenhang keineswegs nur um bloße Unterhaltung gehe. Vielmehr sei es das Bestreben der Komischen Oper „abseits vom belanglosen Amüsement“, aber auch „abseits vom unpopulären Experiment […] Freude [zu] bereiten“. Dialektisch formulierte er in diesem Zusammenhang : „nur der bedeutende Spaß, ernst genommen“, führe „zur unvergänglichen Heiterkeit“.810 Mit der Wahl des Namens Komische Oper bezog sich Felsenstein zum einen auf das Genre der französischen opéra comique, das sich im 19. Jahrhundert sowohl thematisch aufgrund seiner primär heiteren Themen als auch stilistisch Komischen Oper am 23. Dezember 1947“, in : Walter Felsenstein, Schriften. Zum Musiktheater, Berlin 1976, S. 21–22, hier S. 22. 807 Siehe dazu : Braunmüller, Oper ; Hintze/Risi/Sollich, Musiktheater. 808 Felsenstein, „Beginn“, S. 22. 809 Walter Felsenstein, „Rede aus Anlaß der Lizenzüberreichung (1947)“, in : Walter Felsenstein, Schriften. Zum Musiktheater, Berlin 1976, S. 19–21, hier S. 20. 810 Ebd., S. 22.
262
Aufführungen
mit seinen gesprochenen statt gesungenen Zwischendialogen vom Typ der grande opéra abgrenzte. Zum anderen bezog er sich auf das gleichnamige Berliner Opernunternehmen der Jahre 1905 bis 1911 an der Weidendammer Brücke unter der Intendanz Hans Gregors. Bereits dem Schauspielregisseur Gregor war es an seiner Komischen Oper um eine Reform des Musiktheaters gegangen, durch welche der pompös-repräsentative Darstellungsstil der Hofoper Unter den Linden überwunden werden sollte.811 Mit der Entscheidung für den Namen Komische Oper erhob Felsenstein somit den Anspruch, konzeptuell ein Gegengewicht zur ‚großen‘ Staatsoper zu bilden. Während die ersten Inszenierungen Felsensteins – neben der Fledermaus handelte es sich um Orffs Die Kluge und Jacques Offenbachs Orpheus in der Unterwelt – in der Presse noch umstritten waren, da unabhängig von der viel beachteten Qualität des Theatralischen das Orchester der Komischen Oper noch einige kaum zu überhörende Schwächen besaß, wurde der hohe Rang der Bühne doch zunehmend anerkannt. Spätestens mit der von Otto Klemperer musikalisch geleiteten Premiere von Bizets Carmen am 4. Januar 1949, die einen beispiellosen Erfolg brachte, konnte die Komische Oper als etabliert gelten.812 Mit dem Erfolg wurde Felsensteins Bühne für die Kulturpolitik der neu gegründeten DDR zunehmend interessant. Nicht nur versprach sich die SED von der Komischen Oper, die gerade für West-Berliner und westdeutsches Publikum immer mehr zu einer kulturellen Attraktion avancierte, eine Werbung für den jungen ostdeutschen Staat. Da es zwischen Felsensteins Theaterkonzept und dem Ideal des Sozialistischen Realismus erhebliche Schnittmengen813 gab, hoffte man schließlich auch, den Intendanten und seine Inszenierungen an der Komischen Oper zum Vorbild einer sozialistischen Opernregie erheben zu können. Felsenstein entsprach den neuen kulturpolitischen Idealen nicht nur dadurch, dass er erstens kritiklos am klassischen kulturellen Erbe festhielt, des Weiteren von der Existenz positiver Helden als Identifikationsangeboten auf der Bühne ausging und überdies naturalistisch gestaltete Bühnenbilder gegenüber stilisierten oder sogar abstrakten bevorzugte, sondern es ging ihm mit seinen 811 Fritz Jacobsohn, Hans Gregors Komische Oper : 1905–1911, Berlin o. J. [1911]. 812 Siehe dazu : Braunmüller, Oper, S. 58. 813 Ebd. S. 54ff.
Die Komische Oper als Musterbühne des Sozialistischen Realismus
263
Inszenierungen auch darum, die Kunstform Oper über ein gebildetes Publikum hinaus einem bis dahin theaterfernen zu erschließen. Des Weiteren war auch Felsenstein der kulturellen Moderne gegenüber in mancher Hinsicht skeptisch eingestellt. Tatsächlich sollte an seiner Bühne erst 1967 mit Siegfried Matthus’ Der letzte Schuß erstmals ein Werk eines ostdeutschen Komponisten uraufgeführt werden. Vereinbar war Felsenstein mit der Kulturpolitik der jungen DDR aber vor allem wegen der grundlegenden Gemeinsamkeiten zwischen seinem Ideal eines Einfühlungstheaters und dem in jenen Jahren zum kulturpolitischen Vorbild erhobenen Realismus des russischen Schauspielers, Regisseurs und Theaterreformers Konstantin Sergejewitsch Stanislawski. Dessen ästhetische Positionen wurden spätestens mit der sogenannten Stanislawski-Konferenz des Jahres 1953 für die Bühnen des ostdeutschen Staates verbindlich.814 Abgesehen von der im Neuen Deutschland 1950 im Vorfeld der FormalismusKampagne artikulierten Kritik an der Inszenierung von Darius Milhauds Der arme Matrose, die daraufhin nach nur acht Vorstellungen vom Spielplan genommen wurde, blieb die Komische Oper von offenen kulturpolitischen Angriffen, wie sie die Staatsoper in der Ära Legal traf, verschont.815 Im Gegenteil erhielt Felsenstein im Laufe der 1950er-Jahre für sein künstlerisches Wirken sogar insgesamt vier der begehrten Nationalpreise.816 Bereits zu Beginn der 1950er-Jahre setzte, von der SED-Kulturpolitik wie der Bühne gleichermaßen vorangetrieben, die Stilisierung der Komischen Oper zur Musterbühne des Sozialistischen Realismus ein, wobei Felsensteins Theaterkonzept bald mit dem griffigen Terminus realistisches Musiktheater belegt wurde. Den Ausgangspunkt bildete ein ausführlicher Beitrag von Karl Schönewolf mit dem Titel Schöpferische Verwandlung – Zur Erneuerung des Operntheaters im Novemberheft 1950 von Theater der Zeit, einem Text, der das öffentliche Bild von Felsenstein und seiner Bühne entscheidend prägte.817 Schönewolf lobte die „beispielhafte Arbeit“ des Intendanten, welcher dem Haus in den knapp drei Jahren seines Bestehens ein charakteristisches Gepräge zu geben vermocht habe, „das diese 814 Siehe dazu : Stuber, Spielräume, S. 265ff. 815 Karl Schönewolf, „Ein ungleiches Opernzweigespann. ‚Gianni Schicchi‘ und ‚Der arme Matrose‘ in der Komischen Oper“ in : Neues Deutschland vom 24.10.1950. 816 Felsenstein, Pflicht, S. 357f. 817 Braunmüller, Oper, S. 58.
264
Aufführungen
Musikbühne grundsätzlich von jeder anderen unterscheidet“.818 In seinen Inszenierungen entreiße der Regisseur längst bekannte Werke dem „Schlendrian, dem ‚Gewohnheitsunfug‘“ ; er fege „den Staub davon, durchleuchtet sie bis auf den Kern und stellt ihre Realität, ihre wahren, menschlichen Beziehungen wieder her“. Dabei ruhe Felsenstein im Vorfeld seiner pro Spielzeit nur zwei oder drei Neuinszenierungen nicht eher, als „bis er für die Charaktere des Spiels die geeigneten Persönlichkeiten gefunden habe. In seinen Aufführungen entstehe der Eindruck, daß jedem Sänger seine Partie ‚auf den Leib geschrieben‘ wurde“. Mit seiner Arbeit gehe es dem Regisseur, der sich „mit der neu werdenden demokratischen Republik verbunden fühlt“, darum, ein Musiktheater zu schaffen, das den gewandelten gesellschaftlichen Verhältnissen entspreche. „Ein Operntheater, das einen ‚Vergnügungsbetrieb‘ nach [den Bedürfnissen, FB] einer besitzenden Oberschicht einrichtet, die allenfalls während der letzten Akte in den gemieteten Logen erscheint, damit die Damen ihre Toiletten zeigen und sich nebenbei an den Arien berühmter Sänger, an Ballett- und Ausstattungsprunk ergötzen können, wie es in kapitalistischen Ländern heute noch geschieht, hat bei uns keine Existenzberechtigung mehr.“819 Der Anspruch, eine Musterbühne des sozialistischen deutschen Staates zu sein, findet sich auch in einer von der Komischen Oper selbst aus Anlass ihres fünfjährigen Bestehens 1953 herausgegebenen Dokumentation. Der entsprechende Text, der wiederum aus der Feder von Karl Schönewolf stammte, ist deswegen interessant, weil die Komische Oper darin als Erbin einer langen Geschichte opernreformatorischer Bestrebungen in Deutschland interpretiert wurde. Explizit nahm Schönewolf auf Richard Wagners Entwurf zur Organisation eines deutschen Nationaltheaters zu Dresden aus dem Jahr 1849 Bezug. In jener Schrift habe der Komponist Schillers Thesen vom Theater „,als moralische[r] Anstalt‘“ aufgegriffen, als er „,die vollste und regste Teilnahme der gesamten Nation an einer künstlerischen Anstalt‘“ gefordert habe, „,welche im Verein mit allen Künsten ihren Zweck in der Veredelung des Geschmackes und der Sitten erkennt‘“, wie Schönewolf den Komponisten zitierte. Wagners Anspruch, eine Opernaufführung so zu gestalten, dass „,die Teilnahme des Publikums eine tä818 Karl Schönewolf, „Verwandlung“, S. 13. 819 Ebd.
Die Komische Oper als Musterbühne des Sozialistischen Realismus
265
tige, energische, – nicht schlaffe und oberflächlich genußsüchtige‘“820 sei, galt nach Meinung des Autors auch für die Komische Oper. Wenn hier zwar auch nicht Wagners Vorschlag, zur Verbesserung der Aufführungsqualität die Anzahl der Spieltage zu senken, umgesetzt wurde, konnte sich die Felsenstein-Bühne doch, wie Schönewolf lobend ausführte, aufgrund der im Vergleich mit anderen Häusern erheblich geringeren Anzahl an Premieren pro Spielzeit und damit verbunden erheblich verlängerten Probezeiträumen weitaus gründlicher, als es anderswo der Fall sei, auf die jeweiligen Inszenierungen vorbereiten. Auf diese Weise sei die Komische Oper in der Lage, Vorstellungen zu erarbeiten, „die in Wort, Ton und Bewegung, in Musik, Szene und Bild, dem Inhalt entsprechend, annähernd vollkommen übereinstimmen und damit die lebendigste Darstellung der im Kunstwerk enthaltenen Wirklichkeit erreichen“ oder, wie er mit Wagner formulierte, „,den Stempel möglichster Vollendung an sich tragen‘“.821 Als weitere Stationen einer Opernreform im Bereich der szenischen Darstellung nannte Schönewolf neben Gregors Komischer Oper die Inszenierungen der 1920er-Jahre von Carl Ebert822 wie die Inszenierungen von Regisseuren wie Josef Gielen, Georg Hartmann, Günther Rennert und Oskar Fritz Schuh. Die Reformbestrebungen der Krolloper jedoch, die allzu offensichtlich der kulturellen Moderne zuzurechnen waren, überging Schönewolf in diesem Zusammenhang geflissentlich. Der Anspruch der Komischen Oper, Musterbühne des sozialistischen deutschen Staates zu sein, musste zu Problemen mit der Staatsoper führen, zumal das Neue Deutschland diese Rolle im Grundsatzprogramm „Zu den Aufgaben der Deutschen Staatsoper“ Ende 1952 gerade dieser Bühne zugewiesen hatte. So verwundert es nicht, dass es angesichts dieser systeminternen Kulturkonkurrenz immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen beiden Opernbühnen kam. Dabei wurde zwischen der staatlich verwalteten Staatsoper und der städtischen 820 Karl Schönewolf, „Fünf Jahre ‚Komische Oper‘“, in : Komische Oper 1947–1952 [Dokumentation], Berlin o. J. [1952], S. 2–12, hier S. 2. 821 Ebd., S. 6/9. 822 Felsenstein selbst sprach von Carl Ebert im Zusammenhang mit dessen opernreformatorischen Bemühungen in den 1920er-Jahren als dem „Vater all unserer Bemühungen“. Steinbeck, „,Vater‘“, S. 159. – Carl Ebert war 1952, als die Dokumentation aus Anlass des fünfjährigen Bestehens der Komischen Oper erschien, noch nicht wieder nach Berlin zurückgekehrt.
266
Aufführungen
Komischen Oper über die Höhe der jeweils zulässigen Sängergagen oder über das Abwerben von Künstlern gestritten.823 Aber auch das jeweilige künstlerische Profil der Bühnen stand im Mittelpunkt von Streitigkeiten, wie der anfangs zitierte Brief Felsensteins an Johannes R. Becher deutlich macht. Angesichts des zunehmenden Erfolgs der Komischen Oper kam die Staatsoper unter Druck, ihre künstlerische Ausrichtung zu überdenken. So heißt es in einem Brief der Leitung der Staatsoper an die Staatliche Kommission für Kunstangelegenheiten : „Für die Staatsoper steht fest, daß sie ihrem Charakter nach einen anderen Stil Musiktheater entwickelt, als die durch die Individualität und subjektive Auffassung des Kollegen Felsenstein entwickelte Komische Oper.“824 Da die besonderen Leistungen des Hauses in der Behrenstraße gerade im Bereich der szenischen Darstellung lagen, blieb für die Staatsoper zu eigenen Profilierung nur die Ebene der Musik : „In einem erstrangigen Operninstitut wie der Staatsoper müßten die Impulse einer Aufführung erstrangig vom Kapellmeister, vom Pult also, und der Ausdeutung der Partitur in werktreuer Auffassung des Komponisten ausgehen.“ So sei es die Aufgabe der Bühne, „eine Oper im Sinne des Komponisten [und] in gesanglicher Vollendung auf die Bühne zu stellen“825, womit ein Anspruch formuliert wurde, den man hoffte, in Zukunft durch eine Verpflichtung des Dirigenten Erich Kleiber als Generalmusikdirektor einlösen zu können. Ungeachtet der Bemühungen der Staatsoper um ein eigenes künstlerisches Profil avancierte die Komische Oper noch in der ersten Hälfte der 1950er-Jahre zur führenden Opernbühne der DDR. Den Zeitpunkt dieses Durchbruchs markiert eine gemeinsam vom Ministerium für Kultur, der Akademie der Künste, dem Komponisten- und dem Schriftstellerverband veranstaltete „Erste deutsche Musiktheater-Konferenz“, die vom 23.–25. März 1954 in Berlin stattfand. Ziel dieser Konferenz war es, ähnlich wie ein Jahr zuvor bei der StanislawskiKonferenz im Bereich des Schauspiels, die Prinzipien des russischen Realismus
823 Siehe etwa den Brief Felsensteins an die Staatliche Kommission für Kunstangelegenheiten (Kurt Bork) vom 26.03.1952, in : BArch, DR 1/18167 ; Brief des stellvertretenden Intendanten der Staatsoper Allmeroth an die Staatliche Kommission für Kunstangelegenheiten (Kurt Bork) vom 01.07.1953, in : BArch, DR 1/18158. 824 Brief Allmeroths an Bork vom 01.07.1953, in : BArch, DR 1/18158, S. 2. 825 Ebd.
Die Komische Oper als Musterbühne des Sozialistischen Realismus
267
auch auf die Oper zu übertragen.826 Gleichzeitig mit der Konferenz erschien Grigori Kristis ins Deutsche übersetztes Buch Stanislawskis Weg zur Oper827 und eine aufwendig gestaltete Dokumentation der Komischen Oper über die eigene künstlerische Arbeit.828 In den Berichten über die Musiktheater-Konferenz stilisierten die Zeitschriften Musik und Gesellschaft und Theater der Zeit Walter Felsenstein zum uneingeschränkten Vorbild für Opernregie im sozialistischen deutschen Staat. Dabei wurde sein Theaterkonzept in Gegensatz zum „‚oratorischen Inszenierungsstil‘“829 gebracht, den Wieland Wagner in Bayreuth praktizierte und der für die DDR verworfen wurde. Als Anschauungsmaterial dienten den an der Musiktheater-Konferenz teilnehmenden Intendanten, Regisseuren und Dirigenten Aufführungen an der Staatsoper wie an der Komischen Oper. Im Admiralspalast wurde eine Inszenierung von Daniel François Esprit Aubers 1829 uraufgeführter Oper Die Stumme von Portici gezeigt, die in Musik und Gesellschaft schon bei ihrer Premiere in Ungnade gefallen war. Der Dramaturg der Bühne Hermann Neef hatte mit dem Ziel, die revolutionäre Tendenz des Stückes stärker zu betonen – aus Sicht des Blattes eine unzulässige Aktualisierung –, grundlegende Eingriffe in die Werkstruktur vorgenommen, wobei auf der Bühne am Ende sogar eine rote Fahne geschwenkt wurde.830 An der Komischen Oper hingegen wurde den Kongressteilnehmern mit Verdis Falstaff und Mozarts Zauberflöte von der Presse weithin gefeierte Inszenierungen Felsensteins gezeigt. Nach der Premiere der Zauberflöte am 25. Februar 1954 hatte das Neue Deutschland geschwärmt, der Regisseur habe dieses „Gipfelwerk Mozartscher Opernkunst bis in die Einzelheiten in seiner wahren Bedeutung 826 Braunmüller, Oper, S. 69f. – Zum Zusammenhang zwischen Felsensteins und Stanislawskis Theaterkonzeptionen siehe : Jens Roselt, „Eros und Intellekt. Stanislawski, Felsenstein und die Wahrheit des Theaters“, in : Hintze/Risi/Sollich, Musiktheater, S. 18–31. 827 Grigorij V. Kristi, Stanislawskis Weg zur Oper, Berlin 1954. 828 Die Komische Oper Berlin 1947–1954, Berlin 1954. 829 Stephan Stompor, „Auf dem Weg zu einem deutschen Musiktheater“, in : Musik und Gesellschaft 4 (1954), S. 183–185, hier S. 184. Zur Kritik an Wieland Wagners Neu-Bayreuther Inszenierungsstil siehe auch : Stephan Stompor, „Wahrheitstreue und lebendige Gestaltung auf unseren Opern- und Operettenbühnen“, in : Musik und Gesellschaft 4 (1954) S. 122–126, hier S. 123. 830 Eberhard Rebling, „Aubers ‚Stumme von Portici‘ in der Staatsoper Berlin“, in : Musik und Gesellschaft 4 (1954), S. 29–30. – Zur Missbilligung der Inszenierung durch Eberhard Rebling siehe : Braunmüller, Oper, S. 67f.
268
Aufführungen
ebenso werkgetreu wie neuartig vor unseren Ohren und Augen erstehen“ lassen. Nach dem „schablonisierten Darstellungsstil“ der Hoftheater und einer „neusachlich-seelenlose[n]“ Inszenierung an der Krolloper sei diese Aufführung nun „ein hervorragendes Beispiel realistischer Operngestaltung, trotz verschiedener Einwände gegenüber bestimmten Details“ und damit „für alle deutschen Opernbühnen richtungweisend“.831 Felsenstein verkörperte mit seinen vermeintlich ‚werkgetreuen‘ Inszenierungen das an überlieferten bürgerlich-idealistischen Kunstvorstellungen orientierte Aufführungsideal der DDR. Dabei waren visuelle Bezüge zur Gegenwart, selbst wenn sie eine erwünschte politische Aussage enthielten, verpönt. Schon 1951 hatte Karl Schönewolf in Theater der Zeit derartigen Aktualisierungen eine Absage erteilt : Zur Frage, wie ein zeitgenössisches Werk angemessen zu gestalten wäre, schrieb er : „Sollen nun Aktivisten, Traktoristen, Belegschaften der MAS und VEB Arien und Liebesduette singen ? Das wäre ein verfälschender Widerspruch, eine Veräußerlichung und ein Verkennen der gesellschaftlichen Wahrheit. Das Erleben des heutigen Menschen, in welchem Gewande es auch sei, das Musik in sich trägt und verträgt, in einer sinnfälligen, gleichnishaften Handlung zu gestalten, wäre die Aufgabe der Gemeinschaftsarbeit von Dichter und Komponist.“832 In dem Maße, in dem die Komische Oper 1954 kulturpolitisch auf den Schild gehoben wurde, nahm das Ansehen der Staatsoper ab. Maria Rentmeister von der Staatlichen Kommission für Kulturangelegenheiten fühlte sich im April des Jahres veranlasst, die Bühne wegen Nachlässigkeiten bei den Vorstellungen erheblich zu kritisieren : „Während der Aufführung ‚Così fan tutte‘, die ich etwa vor drei Wochen ansah, […] konnte ich mindestens 5 Fälle beobachten, die sich nicht gehörten. Während einer Zwischenpause flog der Vorhang soweit zurück oder wurde aus irgend welchen Gründen soweit zurückgeschlagen – ich konnte das vom 1. Rang aus nicht genau sehen –, daß man das Hin- und Herrennen auf der Bühne sah und die Leute im Parkett noch über anderes amüsiert waren. 831 H. Schell, „Noch mehr – er ist Mensch !“, in : Neues Deutschland vom 03.03.1954. – Die Inszenierung der Zauberflöte wurde 1958 von Felsensteins Schüler Götz Friedrich als Musteraufführung detailliert schriftlich dokumentiert. Götz Friedrich, Die Zauberflöte in der Inszenierung Walter Felsensteins an der Komischen Oper 1954, Berlin 1958. 832 Karl Schönewolf, „Oper und Gesellschaft II. Widersprüche im Zusammenhang“, in : Theater der Zeit 6 (1951), Heft 7, S. 16–18, hier S. 18.
Die Komische Oper als Musterbühne des Sozialistischen Realismus
269
In zwei Vorstellungen, die eine war ‚Jenufa‘ und die andere weiß ich nicht mehr genau, waren Dekorationsstücke unfertig. Sie paßten nicht zusammen und man fürchtete jeden Moment, daß sie herunterfallen.“833 Die Unzulänglichkeiten an der Staatsoper waren umso beunruhigender, als bereits für Mai 1954 mit Mozarts Don Giovanni und Così fan tutte ein erstes großes Gastspiel der Bühne in der französischen Hauptstadt anstand.834 Doch wenn dieses auch nach einer ausgiebigen Probenphase schließlich zum Erfolg gebracht werden konnte835, war es dennoch vor allem die Komische Oper, die in den nächsten Jahren international Ruhm ernten konnte. Nach Gastauftritten in Budapest 1952, in Prag 1956 und sogar in Wiesbaden 1957 hatte Felsenstein dann in Paris den größten Erfolg, wo er 1957 sowie 1959 im Rahmen des schon erwähnten Festivals „Théâtre des Nations“ verschiedene Aufführungen seiner Bühne zeigen konnte. Bei seinem zweiten Pariser Gastspiel erhielt er, wie schon erwähnt wurde, für die Inszenierungen von Jacques Offenbachs Hoffmanns Erzählungen sowie Benjamin Brittens Albert Hering den begehrten Großen Preis des „Cercle international de la jeune critique“. Als Reaktion auf das künstlerische Profil und den großen Erfolg der Komischen Oper öffnete sich die Staatsoper unter Intendant Max Burghardt dann sogar, wenn auch nur in moderater Weise, dem Neu-Bayreuther Stil Wieland Wagners. Als Beispiel dafür sei Erich Wittes Inszenierung von Wagners Ring-Tetralogie 1956/57 genannt.836 Wenn sich Walter Felsenstein auch in der Öffentlichkeit weitgehend loyal gegenüber der DDR verhielt und nur in seltenen Fällen ansatzweise Kritik übte, wie etwa an einem übertriebenen Bürokratismus837, war er doch ‚hinter den Kulissen‘ für die Kulturbehörden ein höchst unbequemer Künstler. Nicht nur, 833 Brief der Staatlichen Kommission für Kunstangelegenheiten (Maria Rentmeister) an Allmeroth vom 29.04.1954, in : BArch, DR 1/18159. 834 Felsenstein selbst riet aus künstlerischen Gründen von dem Gastspiel der Staatsoper in Paris ab. „Betr. : Gastspiel der Deutschen Staatsoper in Paris“ vom 12.04.1954, in : Ebd. 835 Siehe dazu : Ernst Krause, „Aus dem Musikleben. Deutsch-französischer Musikaustausch. Die Berliner Staatsoper in Paris“, in : Musik und Gesellschaft 9 (1954), S. 273–274. Weder im Landes- noch Bundesarchiv haben sich Quellen erhalten, anhand derer sich die Modalitäten des Gastspiels rekonstruieren lassen könnten. 836 Siehe dazu : Eckert, Ring, S. 209ff. 837 Ein Beispiel dafür ist seine Rede anlässlich der Gorki-Feier im Theater am Schiffbauerdamm 1953. Walter Felsenstein, „Rede zur Gorki-Feier (1953)“, in : Felsenstein, Schriften, S. 422– 426.
270
Aufführungen
dass er in West-Berlin wohnen blieb, nicht Mitglied der SED wurde, einen aufwendigen Lebensstil pflegte838, nur unzureichend mit den Kulturbehörden zusammenarbeitete und gegen den Willen der Partei an seinem West-Berliner Mitarbeiterstamm festhielt839, stellte eine Herausforderung dar. Unbequem war Felsenstein aber vor allem wegen seiner Kompromisslosigkeit in künstlerischen Fragen. Er beharrte darauf, über die Anzahl der von ihm verantworteten Inszenierungen pro Spielzeit selbst zu entscheiden. Aufgrund seiner beispiellosen Genauigkeit in der künstlerischen Arbeit, die zu einer bis dahin kaum gekannten zeitlichen Ausdehnung der Probenphasen führte, kam es dazu, dass es in einer Spielzeit oft nur eine einzige neue Felsenstein-Inszenierung zu sehen gab. So geschah es zum Unmut der städtischen Kulturverwaltung sogar, dass zwischen der Premiere von Leoš Janáčeks Das schlaue Füchslein am 30. Mai 1956 und der darauf folgenden Produktion von Verdis Othello, die am 25. Januar 1958 anlief, ganze 20 Monate ohne eine neue Felsenstein-Inszenierung lagen. Für die Kulturbürokratie war dies angesichts der Funktion des Künstlers als kulturpolitisches Aushängeschild viel zu wenig. Dazu kam noch, dass, weil der Intendant nicht wie andere Opernhäuser mit Zweitbesetzungen arbeitete, bei Erkrankung einzelner Sänger ganze Aufführungen verschoben werden mussten oder sogar entfielen. Schließlich führten die hohen künstlerischen Ansprüche immer wieder auch zum Überschreiten der für eine Inszenierung veranschlagten Kosten. Die guten Arbeitsbedingungen ließen Felsensteins Regiekollegen bisweilen vor Neid erblassen. Als Carl Ebert 1959 von der Presse wegen „verschlampte[r] 838 In einer „Parteiinformation der 6. Grenzbrigade“ vom 16.05.1961 über die Zustände auf der Insel Hiddensee heißt es, es herrsche „eine äusserst schlechte Stimmung über die Handlungsweise des Prof. Felsenstein, Intendant der Komischen Oper Berlin. Obwohl es Schwierigkeiten in der Beschaffung von Baumaterialien gibt, liess sich Prof. Felsenstein in Kloster auf Hiddensee einen Eselstall aus Mahagoniholz bauen. Die Bevölkerung diskutiert so darüber, dass man auf die Junker schimpft, weil sie ihre Pferdeställe auskacheln liessen, während andererseits die Landarbeiter in Elendshütten lebten. Heute im Arbeiter- und Bauernstaat, kann sich die Intelligenz noch grössere Dinge erlauben, indem sie aus hochwertigem Edelholz einen Eselstall baut.“ Kommando der Deutschen Grenzpolizei/Politische Verwaltung (Breitfeld) an das ZK der SED, Abteilung Sicherheit (Krüger) vom 23.05.1961. BArch, DY 30/ IV 2/2.026/ 70, Bl. 32. 839 Zu Beginn des Jahres 1958 wohnten von den insgesamt 700 Betriebsangehörigen der Komischen Oper 234 in Westdeutschland oder West-Berlin. Brief Felsensteins an Johanna Blecha vom 12.02.1958. LAB, C Rep. 121, Nr. 430, S. 3.
Die Komische Oper als Musterbühne des Sozialistischen Realismus
271
Vorstellungen“ kritisiert wurde, gab er zu Bedenken, sein Kollege Felsenstein könne es sich – anders als er – erlauben, „in einem solchen Fall das Theater zu[zumachen]“.840 Die Ost-Berliner Kulturbehörden jedoch trieben die Gepflogenheiten der Komischen Oper nicht selten an den Rand der Verzweiflung. Jeweils bei einer anstehenden Verlängerung von Felsensteins privilegiertem Einzelvertrag versuchte man – allerdings vergeblich –, den Intendanten durch eine Änderung der Vertragsbedingungen einer besseren Kontrollierbarkeit zu unterwerfen. So war es auch nach der Kulturkonferenz vom Oktober 1957.841 Die von jener Konferenz initiierte Überprüfung der Ost-Berliner Kulturinstitutionen kam zu dem Schluss, dass der Vertrag Felsensteins „dahingehend zu verändern“ sei, dass, wie es im typisch bürokratischen Jargon der SED hieß, dessen „künstlerische Produktion nach kulturpolitischen Gesichtspunkten als gesichert betrachtet werden kann“.842 Da der Vertrag des Intendanten zum Sommer 1958 auslief, sah man die Gelegenheit dazu als günstig an. Jedoch zogen sich die Verhandlungen mit der Kulturbehörde des Magistrats zunächst hin, ohne dass eine Einigung in Sicht kam. Dies lag daran, dass Felsenstein, sobald er in dem zukünftigen Vertragsverhältnis eine Verschlechterung seiner Arbeitsbedingungen witterte, unumwunden mit seinem Rücktritt drohte. Genauso wie Felsenstein mangelte es aber auch der Gegenseite, den Vertretern des Magistrats, an der nötigen Kompromissbereitschaft. Nicht nur die mit den Verhandlungen betraute Stadträtin Johanna Blecha war der Meinung, man müsse „schlußmachen damit, daß Felsenstein unter Denkmalschutz steht“. Auch für ihn dürfe es „keine Ausnahmen geben“.843 Selbst Oberbürgermeister Friedrich Ebert war eher bereit, den Intendanten fallen zu lassen, als dessen Forderungen nachzugeben. Um den durch einen Bruch mit Felsenstein drohenden erheblichen kulturpolitischen Prestigeverlust für die DDR abzuwenden, griff das Ministerium für Kultur ein. In einem Brief an Friedrich Ebert vom 3. März 1958 kritisierte 840 Carl Ebert, Protokoll der Pressekonferenz vom 12.03.1959. AdK, Berlin, Ebert-Archiv, Nr. 344. 841 Zu den Auseinandersetzungen zwischen Felsenstein und der SED-Kulturbürokratie um die Vertragsverlängerung 1957/58 siehe : Lemke, „Felsenstein“. 842 Bericht über die kulturpolitische Konzeption der Berliner Theater (o. D. und Autorenangabe [1958]). LAB, C Rep. 112, S. 11. 843 Brief von Alexander Abusch an Friedrich Ebert vom 03.03.1958. LAB, C Rep. 430.
272
Aufführungen
Alexander Abusch, Mitglied des ZK und zu diesem Zeitpunkt Staatssekretär im Ministerium für Kultur, Stadträtin Johanna Blecha wegen ihres aus seiner Sicht unangemessenen Tones bei den Verhandlungen scharf. Er habe, schrieb Abusch, „der Genossin Blecha gesagt, daß ein Brief vom 30.12.1957 an Felsenstein, in dem sie ihm einfach kalt die Auflösung seines Vertrages wegen Ablauf der [Verhandlungs-]Frist“ zur Kenntnis gegeben habe, „ohne auch nur eine freundliche Redewendung zu gebrauchen und einen Neujahrsgruß anzufügen, nicht die Art und Weise ist, wie man mit solchen Künstlern brieflich verkehrt. Ich habe ihr gesagt, man müsse die Durchsetzung prinzipieller Forderungen mit der größten Konzilianz und der Versicherung der Hochschätzung verbinden.“ Abusch betonte gegenüber Friedrich Ebert, dass er im höchsten Auftrag handele. Er sei von Walter Ulbricht persönlich beauftragt, „zu verhindern, daß Felsenstein von der Komischen Oper weggeht. Genosse Ulbricht hat mir vor einigen Wochen noch einmal gesagt, als ich ihn über Schwierigkeiten mit Felsenstein informierte, daß wir dies nicht nur als eine ‚Berliner Angelegenheit‘ behandeln sollen“.844 Das Schreckgespenst des Ministeriums für Kultur, eine Abwerbung Felsensteins durch eine Bühne im Westen, war dabei nicht unbegründet. In einem vertraulichen Brief vom 17. Januar 1958 etwa stellte dem Künstler kein anderer als Carl Ebert in Aussicht, ihn für den Fall eines Wegganges „als nächsten Mitarbeiter gewinnen“845 zu wollen. Dass schließlich doch noch eine Übereinkunft zwischen Felsenstein und dem Magistrat erzielt werden konnte, lag daran, dass dem Intendanten im neuen Vertrag wieder dieselben außergewöhnlich guten Arbeitsbedingungen zugestanden wurden wie bisher schon. Der Künstler selbst war sich bewusst, dass er in der Bundesrepublik oder in seinem Heimatland Österreich zumindest in materieller Hinsicht keine besseren Konditionen für seine künstlerische Arbeit erhalten konnte als in der DDR. Gleichzeitig jedoch stand ihm klar vor Augen, dass die ihm gewährten Privilegien nur durch eine gewisse Distanz zum Regime möglich waren. Nur auf diese 844 Ebd. 845 Brief Carl Eberts an Walter Felsenstein vom 17.01.1958. AdK, Berlin, Ebert-Archiv, Nr. 696. – Dass Felsenstein dieses Angebot durchaus ernst nahm, belegt sein Schreiben an Ebert vom 09.02.1961, in dem er sich auf den Brief des West-Berliner Intendanten von „vor etwa zweieinhalb bis drei Jahren“ bezog, den er damals ausdrücklich nicht habe beantworten sollen, den er aber „nie vergessen“ habe. Ebd.
Die Komische Oper als Musterbühne des Sozialistischen Realismus
273
Weise konnte er immer wieder glaubhaft mit seinem Weggang drohen, was für den ostdeutschen Staat einem kulturpolitischen Desaster gleichgekommen wäre. Felsenstein hat das Paradoxe dieser Situation in einem posthum veröffentlichten Interview selbst ausgesprochen : „Als Sozialist bin ich zutiefst traurig, daß es die Komische Oper nicht geben würde, wenn ich Parteigenosse und DDR-Bürger wäre.“846 So blieb Walter Felsenstein für die Kulturpolitik des ostdeutschen Staates stets eine ambivalente Figur. Alfred Kurella, der Leiter der Kulturkommission des Politbüros des ZK, brachte dies auf den Punkt, als er anlässlich eines Gastspiels der Komischen Oper in Moskau 1960 den DDR-Botschafter in der UdSSR über die Rolle des Künstlers aufklären zu müssen glaubte : „Felsenstein hat etwas von jenen Söhnen der Familie, die, wenn sie zu Besuch sind, einen großartigen Eindruck hinterlassen und den Eltern Lob und Glückwünsche für die so wohlgeratenen und wohlerzogenen Kinder eintragen, die aber zu Hause die größten Sorgenkinder, oder besser gesagt, einfach unausstehlich sind.“847 Die Erläuterungen zu den Aufführungen an den Berliner Opernbühnen in den 1950er-Jahren ergeben zunächst, dass diesen in Ost und West eine grundlegend bildende Funktion beigemessen wurde. Für den Osten wurde das beispielhaft anhand der Eröffnungspremiere der wieder aufgebauten Lindenoper 1955 gezeigt. Die Aufführung von Richard Wagners Die Meistersinger von Nürnberg stellte die für die kulturelle Selbstdarstellung der DDR wichtigste Premiere der Bühne in jener Dekade dar. Es wurde erläutert, wie die Oper des Komponisten, der nach 1945 in der SBZ/DDR wegen seiner großen kulturpolitischen Bedeutung für das nationalsozialistische System zunächst stark diskreditiert war, aufgrund ihres aus Sicht der DDR humanistischen und damit ethisch bildenden Gehaltes im sozialistischen deutschen Staat schließlich in das nationalkulturelle Erbe integriert wurde. Auf der Grundlage des Doppelbildes von Wagner als Revolutionär wie Reaktionär, welches sich zudem auch in sowjetischen Texten über den Komponisten fand, ließ sich zumindest ein Teil von Wagners Schaffen für den Sozialismus retten. Gerade in den Meistersingern schien sich die demo846 Ilse Kobán (Hg.), Walter Felsenstein. Theater. Gespräche – Briefe – Dokumente, Berlin 1991, S. 43. 847 Brief Alfred Kurellas an den Botschafter der DDR in der UdSSR Rudolf Dölling vom 14.01.1960. BArch, DY 30/ IV 2/2.026/ 70, Bl. 24–25, hier Bl. 24.
274
Aufführungen
kratische Gesinnung Wagners und sein Bekenntnis zu einem deutschen Nationalstaat im Zusammenhang mit der Revolution von 1848/49 zu spiegeln. Im Zusammenhang mit der SED-Propaganda, die deutsche Teilung überwinden zu wollen, erhielt das Werk für die DDR kulturpolitische Bedeutung : Von einer gesamtdeutschen Rezeption der Meistersinger versprach sich das Politbüro der SED eine nationale Einheit stiftende Wirkung, sodass die Oper als Eröffnungspremiere der Lindenoper ausgewählt wurde. Dass mit den Meistersingern zu Patriotismus erzogen werden sollte, hatte aus Sicht der DDR eine ethische Dimension, versprach man sich doch von einer nationalen Vereinigung unter sozialistischen Vorzeichen ein moralisch besseres Deutschland. Auch in West-Berlin kamen die Opern Richard Wagners unter dem Intendanten Heinz Tietjen bald wieder zu Ehren. Tietjen deutete die Werke des Komponisten im Gegensatz zur DDR jedoch nicht politisch, sondern begriff sie als Ausdruck ‚ewiger‘, allgemeinmenschlicher Werte und Konflikte, wohl auch in der Absicht, um sich dadurch gegenüber der Entnazifizierungskommission exkulpieren zu können. Dass die West-Berliner Opernbühne im Sinne eines politischen Kunst- beziehungsweise Bildungsbegriffes auch ein Ort der Auseinandersetzung konkreter gegenwärtiger gesellschaftlicher Fragen und Probleme gewesen wäre, lässt sich für die 1950er-Jahre nicht feststellen. Dies wurde anhand eines zeitgenössischen Werkes, der Uraufführung von Boris Blachers Oper Preußisches Märchen (1952), beispielhaft ausgeführt. Zwar hatte Blacher mit seinem auf Carl Zuckmayers Hauptmann von Köpenick basierenden Werk ursprünglich einen gesellschaftskritisch-politischen Anspruch verbunden. Allerdings nahm er diesen noch vor der Uraufführung in einer Art Selbstzensur wieder weitgehend zurück, da die Verantwortlichen der Städtischen Oper das Stück nur als harmlos-heitere Komödie bereit waren aufzuführen. Der konstitutive Zusammenhang zwischen Künstler, Kunstwerk und Nation, die ursprungsmythologische Argumentationsfigur, der sich aus Sicht der ostdeutschen Kulturpolitik in Wagners Meistersingern vorbildlich ausdrückte, wurde Anfang der 1950er-Jahre im Kontext der Formalismus-Kampagne gegen die kulturelle Moderne gewendet, deren Werken vorgeworfen wurde, dass es ihnen an ‚Volkstümlichkeit‘ fehle. Zum prominentesten Opfer der Kampagne wurde Brechts/Dessaus Oper Das Verhör des Lukullus, die nach nur einer Aufführung im März 1951 verboten wurde. Begründet wurde der Vorwurf fehlender
Die Komische Oper als Musterbühne des Sozialistischen Realismus
275
Volkstümlichkeit damit, dass die Oper für das Publikum schwer rezipierbar sei. Dies wiederum wurde auf einen Mangel an ästhetischer Schönheit der Musik Dessaus zurückgeführt. Man warf der Lukullus-Partitur vor, ihr fehle eine eingängige Melodik, eine tonale Harmonik sowie – angesichts des umfangreichen Einsatzes von Schlagwerk – eine Instrumentation, die sich am symphonischorchestralen Klang des 19. Jahrhunderts orientierte. Nicht zuletzt wegen des Verlustes an internationalem Ansehen, den das Verbot der Oper für die DDR bedeutet hatte, wurde Brecht und Dessau eine Überarbeitung des Werkes gestattet, sodass es ein halbes Jahr später unter dem neuen Namen Die Verurteilung des Lukullus wieder auf die Bühne kommen konnte. Wenn die Bedingung der Volkstümlichkeit und der ästhetischen Schönheit für die auf den Opernbühnen der DDR gespielten Werke auch in der zweiten Hälfte der 1950er-Jahre grundsätzlich verbindlich blieb, lockerte sich der kulturpolitische Kurs gegenüber der kulturellen Moderne doch insoweit, als Ende 1955 an der Ost-Berliner Staatsoper sogar Alban Bergs Wozzeck als DDR-Erstaufführung gespielt werden konnte, wenngleich auch diese Aufführung kulturpolitisch umstritten blieb. Das Ideal einer zeitgenössischen Oper blieb aus Sicht der DDR die sozialistische deutsche Nationaloper, deren Prinzipien Ende 1952 im Neuen Deutschland verbindlich festgelegt wurden. Konstitutiv war für das Genre der Nationaloper die Wahl nationaler Stoffe, wie sie der Marxismus-Leninismus verstand, sowie eine musikalische Gestaltung, die entsprechend der ursprungmythologischen Argumentationsfigur an die nationale kulturelle Tradition anknüpfte. Der doppelten politischen Zielsetzung einer solchen Nationaloper, für den Sozialismus zu mobilisieren und einen Beitrag zur Überwindung der deutschen Teilung zu leisten, wollte auch die Staatsoper mit der Uraufführung von Jean Kurst Forests Bauernkriegsoper Der arme Konrad dienen, die – als erstes zeitgenössisches Werk überhaupt nach Brechts/Dessaus Lukullus an diesem Haus – zum zehnten Jahrestag der DDR-Gründung 1959 zur Uraufführung kam. Obwohl die ostdeutsche Presse die künstlerischen Leistungen der Mitwirkenden lobte, fand die Oper bei ihr nur bedingt Anerkennung. Kritisiert wurden musikalische, vor allem aber dramaturgische Schwächen. Letztlich ging es dem Werk wie allen anderen Versuchen im Zusammenhang mit der anvisierten sozialistischen Nationaloper : Es konnte sich nicht im Spielplan durchsetzen. An der Städtischen Oper hingegen verloren, was die Aufführungen angeht, sowohl die ursprungs-
276
Aufführungen
mythologische Argumentationsfigur als auch traditionelle Vorstellungen von ästhetischer Schönheit in der Musik an Bedeutung, wie anhand des Skandals wegen der szenischen deutschen Erstaufführung von Arnold Schönbergs Moses und Aron 1959 erläutert wurde. Im Vorfeld der Aufführung, durch die Schönberg vonseiten des Opernhauses sowie der Akademie der Künste nach den Jahren der Ächtung durch den Nationalsozialismus wieder als deutscher Komponist rehabilitiert werden sollte, war von Kritikern aus Musikpublizistik und Journalismus nicht nur das vermeintliche Fehlen eines sittlichen Gehaltes des Werkes beanstandet worden, sondern auch ein Mangel an musikalischer Schönheit. Auch ein ursprungsmythologisches Denken spielte eine Rolle. Allerdings, und das ist entscheidend, wurde, selbst wenn sich Reste einer antisemitischen Einstellung finden lassen, anders als im Nationalsozialismus nicht mehr offen antisemitisch gegen Schönberg und seine Oper polemisiert. Das war in der Bundesrepublik gesellschaftlich nicht mehr vertretbar. Sofern es antisemitische Äußerungen etwa in Leserbriefen gab, wurden sie einfach nicht gedruckt. Damit verlor der Schönberg-kritische Diskurs entscheidend an Schärfe. Die Städtische Oper empfahl dem Publikum vielmehr Geduld hinsichtlich der kulturellen Moderne. Die Bedeutung eines zeitgenössischen, aufgrund seiner neuartigen ästhetischen Ausdrucksmittel dem Publikum noch nicht vertrauten Werkes ermaß sich für die Bühne jedenfalls nicht am Grad spontanen Gefallens beziehungsweise an einer Art von ‚Volkstümlichkeit‘, wie sie für die DDR relevant war. Der Vorwurf mangelnder Sittlichkeit der Oper, der sich vor allem gegen die Orgien-Szene des Tanzes um das goldene Kalb richtete, wurde durch eine nüchtern abstrakte Inszenierung entkräftet. Ob sich die anfänglichen Kritiker durch die Aufführung somit schließlich doch von Schönbergs Oper überzeugen ließen oder ob sie nur Sorge hatten, selbst mit dem Vorwurf, antisemitisch zu sein, belegt zu werden, lässt sich heute nicht mehr klären. Jedenfalls entwickelten sich die Aufführungen dieses Werkes an der Städtischen Oper, die grundlegend mit der kulturellen Repräsentation des Nationalsozialismus brachen, letztendlich zu einem immensen Erfolg für die Bühne, was verschiedene Einladungen zu internationalen Gastspielen belegen. Den Status einer Musterbühne errang unter den Berliner Opernbühnen in den 1950er-Jahren die Komische Oper, wenn gleichzeitig auch die musikalische Qualität an der Staatsoper hoch blieb und die Städtische Oper mit Inszenie-
Die Komische Oper als Musterbühne des Sozialistischen Realismus
277
rungen Carl Eberts oder einer Aufführung wie Moses und Aron glänzen konnte. Mit einer im Bereich der Oper nur selten erlebten Genauigkeit und Akribie übertrug Walter Felsenstein in seinen raren Inszenierungen die Standards der Personenführung aus dem Bereich des Schauspiels auf die Oper, womit er Forderungen umsetzte, die bereits im 19. Jahrhundert von Richard Wagner artikuliert worden waren. Dabei bestanden zwischen dem realistischen Musiktheater Felsensteins und dem in der DDR kulturpolitisch verordneten Sozialistischen Realismus erhebliche Schnittmengen, insbesondere entsprach Felsenstein mit seinem Einfühlungstheater dem in jenen Jahren zum Vorbild erhobenen Realismus des russischen Theaterreformers Stanislawski. Spätestens im Zusammenhang mit der „Ersten deutschen Musiktheater-Konferenz“ im März 1954 wurde Felsenstein zum Vorbild für Opernregie im sozialistischen deutschen Staat erklärt, wohl auch deshalb, weil sich der Künstler nach außen hin gegenüber der DDR weitgehend loyal verhielt. Dennoch blieb das Verhältnis zwischen Felsenstein und der für ihn zuständigen Kulturbehörde beim Ost-Berliner Magistrat, die immer wieder auf eine engere Kontrolle des intern unbequemen Künstlers drang, gespannt. Ein Weggang Felsensteins, der für die DDR einen Prestigeverlust erster Güte bedeutet hätte, konnte nur durch Eingreifen der obersten Parteiebene verhindert werden.
VII. Publikum
Auch das Publikum in den Aufführungen der drei Berliner Opernhäuser war Ausdruck der nationalen kulturellen Repräsentation der beiden deutschen Staaten. Mit verschiedenen Strategien und unterschiedlichem Erfolg bemühte man sich in Ost- und West-Berlin um die Etablierung eines idealen Besucherstammes. Dabei setzte die Städtische Oper, indem vor allem bildungsbürgerliche Kreise angezogen werden sollten, auf Kontinuität. Im Osten hingegen zielte man auf Diskontinuität. Hier bestand der ehrgeizige Anspruch, an die Stelle eines bürgerlichen ein aus Arbeitern bestehendes Publikum zu etablieren. Über Zuschauer aus dem eigenen System hinaus wurde jedoch immer auch beim Gegenüber um Publikum geworben. Damit sollten die kulturellen Leistungen und Werte des jeweiligen Staates herausgestellt und der gesamtdeutsche Anspruch des Kulturverständnisses verdeutlicht werden.
1. Ein Abonnement für die Städtische Oper 1955
Unmittelbar nach seiner Berufung zum Intendanten der Städtischen Oper Ende 1953 setzte sich Carl Ebert beim West-Berliner Senat für die Einführung eines reinen Opernabonnements ein, das es bis dahin seit 1945 nicht gegeben hatte. Ebert wollte dadurch den „gebildete[n] und bildungshungrige[n] Mittelstand“ enger an die Städtische Oper binden, habe dieser doch das „das deutsche Theater in seinen besten Zeiten getragen“.848 Durch einen regelmäßigen Opernbesuch sollten die bildungsbürgerlichen Kreise der Stadt „an der gesamten künstlerischen Arbeit fortlaufend Anteil […] nehmen“.849 Der Tagesspiegel begrüßte die Initiative eines Opernabonnements, das in der West-Berliner Kulturverwaltung zwar verschiedentlich diskutiert, im Gegensatz zu den meisten anderen west848 „Carl Eberts Programm“, in : Der Tagesspiegel vom 16.01.1954. 849 Vermerk betreffend Abonnement der Städtischen Oper und Freien Volksbühne vom 07.01. 1954. LAB, B Rep. 014, Nr. 2140, S. 1.
Ein Abonnement für die Städtische Oper 1955
279
deutschen Städten aber aufgrund der finanziellen Unwägbarkeiten verworfen worden war.850 In dieser Zeitung konnte man lesen : „Das Bewußtsein, etwa jeden vierten Dienstag oder Mittwoch mit gleichgesinnten Kunstfreunden am gleichen Orte zusammenzutreffen, die Ueberzeugung, den ‚Stamm‘ eines künstlerischen Unternehmens mitzubilden und für sein Schicksal mitverantwortlich zu sein – man unterschätze die Bedeutung dieser psychologischen Momente nicht.“851 Die Einführung des Abonnements hing schließlich auch mit der bevorstehenden Eröffnung der wiederaufgebauten Lindenoper zusammen, hoffte man doch, durch diese Maßnahme der gefürchteten Sogwirkung auf das westliche Publikum entgegenwirken zu können.852 Mit der Einführung eines reinen Opernabonnements war eine erhebliche Änderung des bestehenden organisierten Theaterbesuchs verbunden : Da man den finanziell lukrativsten Teil der bisherigen Karteneinnahmen, den Kassenverkauf, der 1955 nur knapp 33 % aller Plätze853 betrug, zugunsten des Abonnements nicht einschränken wollte, musste der Freien Volksbühne ein Teil ihres bisherigen Kartenkontingents entzogen werden. Die Freie Volksbühne war als eine Besucherorganisation 1890 in Berlin mit dem Ziel gegründet worden, Arbeitern durch erheblich reduzierte Eintrittspreise den Besuch von Theater und Oper zu ermöglichen. Zudem wurden umfangreiche Bildungsveranstaltungen angeboten.854 Nach der „Gleichschaltung“ in der Zeit des Nationalsozialismus war die Organisation in Berlin im Kontext des Kalten Krieges zweifach, im Osten und im Westen, neu gegründet worden. Bis 1954 hatte die West-Berliner Freie Volksbühne die einzige Möglichkeit für organisierte Theaterbesuche an der Städtischen Oper dargestellt. Abend für Abend nahm sie einen erheblichen 850 Werckshagen und Lange zur Einführung eines Opernabonnements am 29.04.1954. Ebd. 851 Elisabeth Mahlke, „Parkett Reihe 7, Platz 12. Wann kommt das Abonnement in der Städtischen Oper ?“, in : Der Tagesspiegel vom 25.04.1954. 852 Vermerk betreffend Abonnement der Staatsoper vom 12.06.1954 (Wallner-Basté). LAB, B Rep. 014, Nr. 2140. 853 Gutachten des Rechnungshofes vom 20. Juni 1955 über Organisation und Wirtschaftlichkeit der Städtischen Oper. LAB, B Rep. 014, Nr. 1634, S. 91. 854 Zur Geschichte der Berliner Volksbühnenbewegung siehe Dietger Pforte (Hg.), Freie Volksbühne Berlin 1890–1990. Beiträge zur Geschichte der Volksbühnenbewegung in Berlin, Berlin 1990 ; aus ostdeutscher Sicht siehe : Heinrich Braunlich, Die Volksbühne. Theater und Politik in der deutschen Volksbühnenbewegung, Berlin 1976.
280
Publikum
Prozentsatz aller verfügbaren Karten ab, 1954 im Durchschnitt etwa 46% aller 1510 Sitzplätze.855 Diese Karten kosteten die Volksbühnenmitglieder jeweils nur drei DM (West), was einer Reduzierung des Kassenpreises um 62% entsprach.856 Der beim Opernhaus pro Karte entstehende Fehlbetrag wurde durch einen Zuschuss des Senats ausgeglichen. Dass der Volksbühne ein Teil ihres Kartenkontingents bei der Städtischen Oper entzogen werden sollte, bedeutete jedoch nicht, dass finanziell schlecht gestellten Arbeitern ihr bisheriges Anrecht auf den Opernbesuch zugunsten bürgerlicher Zuschauer weggenommen werden sollte. Es war allgemein bekannt, dass sich die Mitglieder der Freien Volksbühne nach 1945 keineswegs mehr überwiegend aus Arbeitern rekrutierten. Eine Berufsstatistik der Volksbühne aus dem Jahre 1953 macht deutlich, dass 43,9% Verwaltungsangestellte in nicht leitender Stellung, 28,5% sonstige Angestellte, 10,4% Selbstständige und nur 14,2% Arbeiter die Karten nutzten.857 So argumentierte die Volksbühne auch gar nicht gegen das Opernabonnement. Sie gestand das mittlerweile bürgerliche Profil ihrer Organisation offen ein, indem sie darauf hinwies, dass gegenwärtig der „frühere, vielfach verarmte Mittelstand keine geringe Rolle“858 spiele. Dementsprechend erkannte sie den Wunsch eines Teils ihrer Mitglieder als berechtigt an, gegen einen erhöhten Betrag ausschließlich Opernaufführungen sehen zu wollen859, konnte sie selbst doch ihren Mitgliedern pro Saison lediglich zwei Opernabende anbieten. Der größere Anteil der jeweiligen „Mieten“ hingegen galt dem Schauspiel. Auch gab es für die Volksbühne genügend Bewerber, die aufgrund der beschränkten Subventionsmöglichkeiten des Senats bisher nicht 855 Gutachten des Rechnungshofes vom 20. Juni 1955 über Organisation und Wirtschaftlichkeit der Städtischen Oper. LAB, B Rep. 014, Nr. 1634, S. 95. 856 Ebd. 857 1953 waren 23,9% der Volksbühnenmitglieder Hausfrauen bzw. Menschen ohne eigenes Einkommen. Pfortge, Volksbühne, S. 128. Vermerk betreffend Abonnement und Volksbühne vom 06.03.1954. LAB, B Rep. 014, Nr. 2140. 858 „Abonnementspläne der Städtischen Oper. Carl Ebert – ihr neuer Leiter“, in : Blätter der Freien Volksbühne 7 (1954), Heft 4, S. 19–21, hier S. 21. 859 „Abonnementspläne der staatlichen Theater aufgeschoben“, in : Blätter der Freien Volksbühne 7 (1954), Heft 6, S. 10. Konkret betrug die von der Oper an die Volksbühne abgegebene Anzahl an Karten im Rechnungsjahr 1954 insgesamt 191.000. Gutachten des Rechnungshofes vom 20. Juni 1955 über Organisation und Wirtschaftlichkeit der Städtischen Oper, S. 89. LAB, B Rep. 014, Nr. 1634.
Ein Abonnement für die Städtische Oper 1955
281
als Mitglieder hatten aufgenommen werden können und die bei Kündigungen aufgrund von Wechseln ins Opernabonnement nun die Chance hatten nachzurücken. Im Ganzen aber bezweifelte die Besucherorganisation den Erfolg des Abonnements. Da es „die meisten Mitglieder […] schon schwer genug haben, ihren Volksbühnenbeitrag regelmäßig aufzubringen“, glaubte man, dass wohl nur „ein paar hundert Mitglieder“ zum Abonnement abwandern würden. Wie viele Mitglieder der Volksbühne es aber auch immer sein würden, die in ein Opernabonnement wechseln würden : Aufgrund der inzwischen bürgerlich geprägten Mitgliederstruktur der Organisation sei es in jedem Fall ein verständiges Publikum.860 Dies freilich sah man bei der Städtischen Oper anders, wo man sich von der Volksbühne wegen deren wiederholter Forderung nach einem stärker unterhaltenden Opernspielplan so unabhängig wie möglich machen wollte. Im Interesse ihrer Mitlieder hatte die Besucherorganisation etwa für die Spielzeit 1950/51 gefordert, die Oper möge von 180 Vorstellungen 60 als Operettenabende geben, was von der Bühne abgelehnt wurde.861 Von Nachteil war das bestehende System aus Sicht der Städtischen Oper aber vor allem deswegen, weil die Bindung der ca. 85.000 Mitglieder der Besucherorganisation862 an das Haus in der Kantstraße vergleichsweise locker blieb. Die Mitglieder nämlich erhielten mit einer (gemischten) Volksbühnenmiete pro Spielzeit nur zwei Vorstellungen in der Oper. Genau das Gegenteil aber wollte Carl Ebert : Ihm schwebte ein Publikum vor, das durch einen häufigen Besuch eng mit der künstlerischen Entwicklung seines Hauses verbunden war. Der Senat seinerseits ging davon aus, dass ein nicht unerheblicher Teil der Volksbühnenmitglieder finanziell gar nicht bedürftig sei und sich die Zugehörigkeit zur Besucherorganisation lediglich daraus erkläre, dass keine andere Möglichkeit zum verbilligten Opernbesuch bestehe.863 Unklar blieb allerdings, wie hoch das Kontingent an Abonnements veranschlagt werden sollte, die ihre 860 „Abonnementspläne der Städtischen Oper. Carl Ebert – ihr neuer Leiter“, in : Blätter der Freien Volksbühne 7 (1954), Heft 4, S. 19–21, hier S. 21. 861 Gutachten des Rechnungshofes vom 20. Juni 1955. LAB, B Rep. 014, Nr. 1634, S. 93. 862 Dies war der Mitgliederstand der Freien Volksbühne in der Spielzeit 1954/55. Ebd., S. 92. 863 Vermerk betreffend Abonnement und Volksbühne vom 06.03.1954. LAB, B Rep. 014, Nr. 2140, S. 1.
282
Publikum
Besitzer erheblich teurer zu stehen kommen würden als die Mieten bei der Volksbühne. Während Carl Ebert aufgrund seiner Erfahrungen aus der Zeit der Weimarer Republik vom Erfolg der Maßnahme überzeugt war und an die damals hohe Zahl von 18.000 Abonnenten erinnerte, waren andere vorsichtiger. Sie verwiesen darauf, dass in West-Berlin seinerzeit nur 400.000 Lohn- und Gehaltsempfänger mit einem monatlichen Bruttoeinkommen von über 300 DM864 beziehungsweise 33.000 mit einem Einkommen von über 700 DM lebten.865 Auch waren in der westlichen Teilstadt 1954 noch 144.000 Menschen arbeitslos.866 Das Abonnement startete 1955 schließlich mit einem Kontingent von 4160 Plätzen, was einem abendlichen Anteil von knapp 11 % des Publikums entsprach.867 Verglichen mit der Zahl der Abonnenten gegen Ende der Weimarer Republik waren das viel weniger Plätze, doch waren diese von Anfang an ausgebucht. Hunderte von Bewerbern um die niedrigsten Preisstufen mussten abgewiesen werden.868 Ein Abonnement umfasste zehn Aufführungen, die gegenüber dem Kassenpreis um 20% ermäßigt waren. Damit lagen die Abo-Preise, die sich von zwei bis zehn DM (West) pro Aufführung staffelten, im Durchschnitt um 100% über den Preisen der Volksbühne. Wenn sich genauere Angaben zur sozialen Zusammensetzung der Abonnenten auch nicht erhalten haben, muss doch davon ausgegangen werden, dass es aufgrund dieser verhältnismäßig hohen Preise überwiegend finanziell besser gestellte Personenkreise gewesen sein
864 Vermerk betreffend Abonnement der Städtischen Oper und Freie Volksbühne vom 07.01.1954. Ebd, S. 1. 865 Carl Werckshagen und Lange zur Einführung eines Opernabonnements vom 29.04.1954. Ebd., S. 3. – Was die schlechte Einkommenssituation in West-Berlin angeht, sei angemerkt, dass der Volksbildungssenator noch 1959 den Vorschlag ablehnte, angesichts der stark angestiegenen Kosten für den Neubau des Opernhauses in Charlottenburg einen Förderverein zu gründen. Er begründete dies damit, dass es anders als in einer Stadt wie München in West-Berlin keine ausreichend große Anzahl finanzkräftiger Mäzene gebe. Brief des Senators für Volksbildung an den Verlag Bote und Bock vom September 1959. LAB, B Rep. 014, Nr. 1142. 866 Karl C. Thalheim, „Berlins wirtschaftliche Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg“, in : Heimatchronik Berlin, Köln 1962, S. 763–866, hier S. 838. 867 Gutachten des Rechnungshofes vom 20. Juni 1955. LAB, B Rep. 014, Nr. 1634, S. 97. 868 Ebd.
Westdeutsches Publikum in Staatsoper und Komischer Oper
283
müssen, die sich ein Abonnement leisten konnten.869 Für finanziell schlechter Situierte war das Abonnement kaum erschwinglich.
2. Westdeutsches Publikum in Staatsoper und Komischer Oper
Ungeachtet der zunehmenden politischen und wirtschaftlichen Abgrenzung Ost-Berlins vom Westteil der Stadt war die kulturpolitische Linie der DDR bis 1961 dennoch durchgängig davon geprägt, West-Berliner und Westdeutsche als Publikum für die Aufführungen in den östlichen Theatern und Opernhäusern zu gewinnen. Den Werbeversuchen traten in West-Berlin seit 1948 der Tagesspiegel870 und der Senat871 mit Boykottaufrufen entgegen. Aufgrund dieser Aufrufe und infolge der allgemeinen Polarisierung des Kalten Krieges vor allem in den Jahren 1948 bis 1951 sank der Anteil westlicher Zuschauer in den Ost-Berliner Opernhäusern erheblich ab.872 Staatsopernintendant Ernst Legal stellte in seinem Monatsbericht zum Mai 1951 an das Volksbildungsministerium einen erheblichen Einnahmenrückgang fest, der aus dem „nunmehr fast vollständigen Ausbleiben des Westpublikums“873 resultiere.874 Ebenso war an der Komischen Oper der Anteil westlichen Publikums zunächst stark rückläufig und sank 1951 innerhalb von sechs Monaten von 40% auf 20%.875 Doch stellte sich der Schwund von Westbesuchern als nur vorübergehend heraus. Bereits im 869 Wie viele Volksbühnemitglieder tatsächlich ins Abonnement der Städtischen Oper überwechselten, konnte im Rahmen der Arbeit nicht ermittelt werden. 870 Am 07. Dezember 1948 rief der Tagesspiegel zum Boykott von „Ankündigungen, Anzeigen und Besprechungen der nicht privaten Theater, Unterhaltungsstätten, Buchproduktionen und so weiter“ auf. „An unsere Leser“, in : Der Tagesspiegel vom 07.12.1948. 871 Siehe dazu die Ausführungen im V. Kapitel. 872 Der Anteil an West-Berlinern in den Aufführungen von Staatsoper und Komischer Oper (ab Ende 1947) wird zunächst nach 1945 wegen der mehrheitlich bürgerlichen Prägung der in den westlichen Sektoren gelegenen Bezirke mehr als die Hälfte betragen haben. 873 Ernst Legal, 17. Monatsbericht (28. Juni 1951). LAB, C Rep. 167, Nr. 7. 874 Legal musste sich als entschiedener Vertreter der Vorstellung von der Einheit der deutschen Kultur auch über die aus seiner Sicht kontraproduktive Aufkündigung der Teilnahme an einem West-Berliner Veranstaltungskalender vonseiten des Ostens beklagen. Ernst Legal, 20. Monatsbericht (11. Oktober 1951). Ebd. 875 „Rückgang des Theaterbesuchs im Sowjetsektor“, in : Der Tagesspiegel vom 15.09.1951.
284
Publikum
April 1952 musste Heinz Tietjen zu seinem Leidwesen die Teilnahme einer großen Anzahl von West-Berlinern an einer Aufführung von Wagners Fliegendem Holländer in der Staatsoper hinnehmen, pikanterweise nur einen Tag vor der für den 26. April 1952 vorgesehenen Premiere desselben Werkes in der Städtischen Oper. Tietjen klagte, die Folge sei „publikumsmaessig – eine ausserordentlich traurige“. Die aus Sicht des Intendanten „mehr als mittelmaessige Staatsoperaufführung“ sei „von Westpublikum – ich hatte jemand hingeschickt, der sehr viele Westberliner erkannte – sehr stark besucht [worden] --- und unsere Premiere war beschaemend leer ! !“876 In der zweiten Hälfte der 1950er-Jahre aber entspannte sich die Situation erheblich. So sah man in einer Zauberflöte-Aufführung der Komischen Oper im Februar 1957 einen begeistert applaudierenden Carl Ebert, was noch in der Hochphase des „Sängerkrieges“ 1954/55 unmöglich gewesen wäre.877 Letztlich blieben die Ost-Berliner Opernbühnen somit bis 1961 Orte einer deutsch-deutschen Verflechtung.878 Zur Attraktivität der Ost-Berliner Opernbühnen trugen die für das Westpublikum bis 1961 außerordentlich niedrigen Kartenpreise im freien Verkauf erheblich bei : 1953 kosteten die teuersten Karten in Staatsoper wie Komischer Oper, die vom West- wie vom Ostpublikum gleichermaßen in östlicher Währung zu entrichten waren, im freien Verkauf gerade einmal 15 DM (Ost).879 Legt man einen Wechselkurs von 1 :5 zugrunde, betrug der Preis für die besten Karten im Osten für Westpublikum gerade einmal etwa ein Viertel der teuersten Plätze 876 Brief Tietjens an Wallner-Basté vom 13.05.1952. LAB, B Rep. 014, Nr. 2120. 877 In Götz Friedrichs Vorstellungsbericht über die Aufführung vom 08.02.1957 heißt es : „Carl Ebert applaudierte ca. 15 Vorhänge lang. Lag das nur daran, daß er in der Mitte der 3. Reihe war und nicht hinaus konnte ? Es sah nicht so aus.“ AdK, Berlin, Felsenstein-Archiv, Nr. 831 (1). – Im Jahr 1960 konnte sogar Felsensteins Inszenierung von Giovanni Paisiellos Barbier von Sevilla bei den westdeutschen Schwetzinger Festspielen im Rahmen eines Gastspiels der Komischen Oper Premiere feiern. Darüber hinaus kam es noch wenige Monate vor dem Mauerbau zu Gesprächen über das Theater zwischen Felsenstein und dem westdeutschen Theaterkritiker Siegfried Melchinger, die in einer gemeinsamen Publikation mit dem Titel Musiktheater mündeten. Walter Felsenstein und Siegfried Melchinger, Musiktheater, Bremen 1961. 878 Diese Verflechtung blieb erhalten, obwohl die DDR mit der Auflösung der östlichen Volksbühnenorganisation gegen Ende der Spielzeit 1953/54, worauf in Kapitel VII.4 eingegangen wird, knapp 6.000 West-Berliner Mitglieder verlor. Es gelang nicht, diese in das neu geschaffene Anrechtssystem mit einzubeziehen. LAB, C Rep. 120, Nr. 2383, Bl. 64. 879 Attraktiv war für West-Berliner darüber hinaus auch ein Ost-Berliner Abonnement, das den Kartenpreis noch einmal um 20–25% senken konnte.
Westdeutsches Publikum in Staatsoper und Komischer Oper
285
in der Städtischen Oper (12,50 DM [West]). Angesichts dieser Niedrigpreise verwundert es nicht, dass mancher westliche Gast den Opernbesuch im Osten mit einem ausgiebigen Besuch des Opernrestaurants krönte. Die Rechnung war dann ebenfalls in Ostmark zu bezahlen. In einem Bericht der West-Berliner Senatskanzlei über die Staatsoper vom Juli 1957 heißt es, das gastronomische Personal der Oper beklage sich offen darüber, dass „die Westberliner 5 bis 6 Schachteln Konfekt, 10 bis 12 Brötchen und mehrere Flaschen Wein, also weit über das, was sie in der Oper verzehren können, kaufen. Auch Angehörige der westlichen Besatzungstruppen fallen unangenehm dadurch auf, daß sie nur in die Oper gehen, um dort gut essen und trinken zu können.“880 Doch waren die Ost-Berliner Opernbühnen, in deren Aufführungen – abgesehen von den begleitenden Programmheften und etwa einer Inszenierung wie der schon erläuterten Stummen von Portici an der Staatsoper – auf eindeutige politische Botschaften im Sinne des Sozialismus weitgehend verzichtet wurde, für das West-Publikum auch künstlerisch höchst attraktiv. Die Staatsoper überzeugte trotz des Weggangs einer Reihe hochqualifizierter Künstler mit einem beachtlichen musikalischen Niveau, das vor allem in der ersten Hälfte der 1950er-Jahre die Städtische Oper immer wieder in den Schatten stellte, wie die geschilderte Episode um die Holländer-Aufführung deutlich macht. Attraktiv war darüber hinaus aber vor allem die Komische Oper mit ihrem Aushängeschild Walter Felsenstein. Dessen Haus avancierte zusammen mit dem von Bertolt Brecht gegründeten Berliner Ensemble im Theater am Schiffbauerdamm zu der von West-Berlinern am stärksten frequentierten Ost-Berliner Bühne. Wenn auch keine detaillierten Statistiken über den Anteil an West-Publikum in der Komischen Oper existieren, kann doch für die zweite Hälfte der 1950erJahre von durchschnittlich mindestens 15–20% ausgegangen werden.881 Für die West-Berliner Kulturpolitik stellte sich der hohe Anteil westlichen Publikums in der Komischen Oper besonders während der West-Berliner Festwochen, die 880 „Aus der Deutschen Staatsoper, Berlin : Besetzung und militärische Uebungen. Bericht vom Juli 1957.“ LAB, B Rep. 002, Nr. 2151. 881 Walter Felsenstein, „[An den Magistrat von Groß-Berlin/Stadtrat]“ (16.04.1957), in : Walter Felsenstein, Die Pflicht, die Wahrheit zu finden. Briefe und Schriften eines Theatermannes. Aus Materialien des Felsenstein-Archivs der Stiftung Archiv der Akademie der Künste BerlinBrandenburg. Hg. Ilse Kobán, Frankfurt/M. 1997, S. 273–275, hier S. 274.
286
Publikum
ja eigentlich der Präsentation der eigenen Kultur dienen sollten, als peinlich dar. Dann parkten vor der Komischen Oper „fast ausschließlich westberliner, amerikanische und bundesrepublikanische Wagen“882, wie die Stuttgarter Nachrichten anlässlich einer Aufführung von Leoš Janáčeks Das schlaue Füchslein 1956 zu berichten wussten. Selbst als die DDR die Bewegungsfreiheit von Westdeutschen auf ihrem Gebiet ab 1960 erheblich einschränkte, war davon die Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen explizit ausgenommen.883 Das ehrgeizige Vorhaben allerdings, westliches Publikum durch den Besuch der Ost-Berliner Opernhäuser im Sinne des Sozialismus zu beeinflussen, gelang nicht. Angesichts der hohen Kosten, die jährlich für die Opernbühnen aufzuwenden waren, ließ diese Tatsache manchen SED-Funktionär skeptisch werden. Bei der Berliner SED-Bezirksleitung stellte man 1957 nüchtern fest, es seien vor allem „die Spießer, die in unsere Theater aus Westberlin kommen. Sie unterliegen sofort den Schwankungen, wie die Westpresse heult, und der Theaterbesuch hat ihr Vertrauen zur DDR nicht gestärkt.“884 Statt durch ihre Theaterbesuche im Osten „gegen die Feinde der Kultur in Westberlin aufsässig“ zu werden, hätten sie die günstigen Eintrittspreise nur „gegenüber der DDR anmaßend“885 gemacht. Desillusioniert sah man den einzigen Sinn des Westpublikums somit lediglich im Rückfluss von Ostmark.
3. Ostdeutsches Publikum in der Städtischen Oper
Auch die West-Berliner Kulturpolitik bemühte sich bis 1961 um die Teilnahme von Ostdeutschen an den Aufführungen der Städtischen Oper. Dem standen jedoch – zusätzlich zu den östlichen Behinderungen beim Übertritt nach WestBerlin – die hohen Eintrittspreise entgegen. Mit der Einbeziehung West-Ber882 Kurt Honolka, Festwochen-Brief aus Berlin : „Totenhaus-Dialoge und Opern-Ausgrabungen“, in : Stuttgarter Nachrichten vom 01.10.1956, zitiert nach : Ilse Kobán (Hg.), „Das Schlaue Füchslein“ von Leoš Janáček. „Und doch ist in der Musik nur eine Wahrheit“. Zu Walter Felsensteins Inszenierung an der Komischen Oper Berlin (1956), Anif/Salzburg 1997, S. 193. 883 Ribbe, Berlin, S. 121. 884 Brief des Sekretariats Wengels (SED-Bezirksleitung Groß-Berlin) an die Stellvertreterin des Oberbürgermeisters, Johanna Blecha, vom 12.04.1957. LAB, C Rep. 120, Nr. 2383. 885 Ebd.
Ostdeutsches Publikum in der Städtischen Oper
287
lins in die Währungsreform der Westsektoren 1948 hatte die Ostmark rasch an Wert verloren. Bis zum Sommer 1952 konnte dies an der Städtischen Oper dadurch ausgeglichen werden, dass es den Ostbesuchern gestattet wurde, den Kassenpreis in DM (Ost) zu entrichten. Da der West-Berliner Senat jedoch Anfang der 1950er-Jahre nicht mehr in der Lage war, die damit verbundenen hohen Subventionen an die Oper aufzubringen, erhöhten sich die Preise für Ost-Berliner ab den Festwochen 1952 wesentlich : Nun erhielten Ostdeutsche die Opernkarten an der Kasse nur noch für den halben Preis in DM (West). Bei dem üblichen Wechselkurs von 1 :5 entsprach dies nun fast dem 2½-fachen Betrag in DM (Ost). Beispielweise hatten Ostdeutsche im Jahr 1955 für eine Eintrittskarte in einer mittleren Kategorie in der Städtischen Oper (2. Rang, Reihe 1) zu ursprünglich fünf DM (West) nun ganze 11,25 DM (Ost) aufzuwenden. Für diesen Betrag ließ sich jedoch bereits beinahe ein Sitzplatz in der zweitbesten Kategorie der Staatsoper erwerben (12 DM [Ost], Parkett Reihe 7–12). Mit einem Abonnement reduzierte sich der Eintritt in den Ostberliner Bühnen darüber hinaus noch einmal um 20–50%. Mit diesen Preisen konnte die Städtische Oper bei Weitem nicht konkurrieren. So sank der Anteil der Ostbesucher an den Kassenkäufen des Opernhauses erheblich ab und betrug 1957 nur noch 4,3%.886 Den zahlenmäßig bedeutsameren Anteil stellten somit diejenigen Ostbesucher dar, welche die Städtische Oper als Mitglieder der Freien Volksbühne zu erheblich reduzierten Preisen besuchten.887 1955 kamen von den ca. 85.000 Mitgliedern der Freien Volksbühne etwa 25.000 aus dem Osten. Konkret gingen im Jahr 1954 von den insgesamt 191.400 an die Besucherorganisation vergebenen Karten 45.800 an Ost-Berliner, was einem Anteil von 23,9% entsprach.888 Betrachtet man den aus der Summe von Kassenverkauf und Volksbühnenkarten resultierenden Gesamtanteil von Ostbesuchern an den Aufführungen der Städtischen Oper, lag dieser Mitte der 1950er-Jahre bei nicht mehr als 12%.889 Somit war nicht nur der Prozentsatz erheblich niedriger als 886 Brief von Tiburtius an den Bundesminister für Gesamtdeutsche Fragen vom 06.11.57. LAB, B Rep. 002, Nr. 2161. 887 In der Spielzeit 1954/55 betrug der Eintrittspreis für eine Opernaufführung für Ostmitglieder der Freien Volksbühne vier DM (Ost). Blätter der Freien Volksbühne 7 (1954), Heft 6, S. 8. 888 Gutachten des Rechnungshofes vom 20. Juni 1955. LAB, B Rep. 014, Nr. 1634, S. 92f. 889 Zu dieser Zahl kommt man durch eine Addition der östlichen Volksbühnenmitglieder (für
288
Publikum
derjenige von West-Berlinern allein in der Komischen Oper, sondern er sank auch zunehmend, selbst was die Ostmitglieder der Freien Volksbühne anging. Um den Anteil der Ostbesucher wieder zu steigern, mussten die Eintrittspreise im freien Verkauf erheblich gesenkt werden. Dazu bedurfte es allerdings höherer Subventionen als bisher.890 So bemühte sich der Senat ausgehend von der Regierungserklärung des Regierenden Bürgermeisters Otto Suhr vom 3. Februar 1955 um eine westdeutsche finanzielle Unterstützung der Ostdeutschen für Kulturveranstaltungen in West-Berlin. Von einer zusätzlichen Reduzierung der Eintrittspreise versprach man sich eine „starke politische und psychologische Wirkung“891 auf den Osten. Am 15. September 1957 traten dann unter der Bezeichnung „Gesamtberliner Kulturplan“ einschneidende Änderungen in Kraft : Finanziert durch die Bundesregierung erhielten Ostdeutsche Eintrittskarten nicht nur für Opern-, sondern auch Theateraufführungen, Konzerte, Museen und selbst für den Zoo im Verhältnis 1 :1, sodass sie den Westmarkpreis in östlicher Währung entrichten konnten.892 Dies bedeutete eine Reduzierung um insgesamt 80% des Westmarkpreises. Durch diese Maßnahme erhöhte sich in der Städtischen Oper der Anteil östlicher Kartenkäufer allein an der Tages- und Abendkasse auf immerhin etwa 12% im Jahr 1960.893 Dazu kam ein Zuwachs an Mitgliedern bei der Freien Volksbühne. Die Besucherorganisation konnte, ebenfalls finanziert durch die Bundesregierung, zur Spielzeit 1957/58 weitere 6.000 Ostdeutsche aufnehmen, die ihre Karten ebenfalls für den Betrag das Rechnungsjahr 1954 sind dies die genannten 23,9% von einem Volksbühnenanteil von 46,1% an der Gesamtheit der Zuschauer bei 1510 Plätzen) mit den Ostbesuchern aus dem Freien Kartenverkauf der Städtischen Oper (5% von 32,9% an der Gesamtheit der Zuschauer bei 1510 Plätzen). Siehe dazu die Zahlen in : ebd., S. 91–92. 890 Die Anzahl der am Abonnement der Städtischen Oper teilnehmenden Ost-Berliner war nicht signifikant hoch. 891 Maßnahmen zur Förderung des Gesamtberliner Kulturlebens (o. D., aber vor 1957). LAB, B Rep. 002, Acc. 1636, Nr. 2161. 892 In den Umfang der Vergünstigungen des „Gesamtberliner Kulturplans“ wurde schließlich sogar das Kino miteinbezogen. Siehe dazu : Michael Lemke, „Die Kino-Konkurrenz im geteilten Berlin 1949–1961“, in : Heiner Timmermann (Hg.), Das war die DDR. DDRForschung im Fadenkreuz von Herrschaft, Außenbeziehungen, Kultur und Souveränität, Münster 2004, S. 635–676, vor allem S. 656–664. 893 Brief von Tiburtius an das Bundesministerium für Gesamtdeutsche Fragen vom 04.01.1962, in : LAB, B Rep. 002, Nr. 2162.
„Bedürfnis aller Werktätigen“ ? – Die Einführung von B etriebsanrechten an der Komischen Oper 1953 289
1 :1 in DM (Ost) erhielten.894 Stieg deren Anteil 1957 damit vorübergehend auf 30.000895, konnte die Zahl bis zum Mauerbau trotz der durch die DDR zunehmend eingeschränkten Bewegungsfreiheit der Ostdeutschen immerhin auf 25.000 gehalten werden.896 Wenn der durch den „Gesamtberliner Kulturplan“ zu verzeichnende Zuwachs an ostdeutschem Publikum aus Sicht des West-Berliner Senats noch höher hätte sein sollen, zeigte die Maßnahme dennoch wie erwartet im Osten eine erhebliche psychologische Wirkung, wie noch erläutert wird.
4. „Bedürfnis aller Werktätigen“ ? – Die Einführung von Betriebsanrechten an der Komischen Oper 1953
Am 28. März 1953 berief die Abteilung Kunst und kulturelle Massenarbeit des Ost-Berliner Magistrats eine Pressekonferenz ein, in der die Neugestaltung des organisierten Theaterbesuchs für die staatlichen Bühnen Ost-Berlins angekündigt wurde : „Auf der II. Parteikonferenz der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands [vom 9. bis 12. Juli 1952, FB] wurde der historische Beschluss gefasst, in der Deutschen Demokratischen Republik planmäßig mit dem Aufbau des Sozialismus zu beginnen. Dieser Beschluss […] weist auch der Kunst eine neue, gewaltige Aufgabe zu. Sie muss eine aktive Rolle spielen bei der Veränderung des Bewusstseins unserer Werktätigen.“ Das Ziel sei es, „die Kreise der Interessierten in den Betrieben ständig zu erweitern und schließlich den Besuch einer Theateraufführung zum echten Bedürfnis aller Werktätigen werden zu lassen.“897 Setzte man, wie erläutert wurde, in West-Berlin beim Publikum auf bildungsbürgerliche Kontinuität, ging es in Ost-Berlin um Diskontinuität. Anstelle eines bürgerlich geprägten Publikums sollte hier ein aus Arbeitern – oder, wie es im Sprachgebrauch hieß, ‚Werktätigen‘ – bestehendes etabliert werden. In 894 Blätter der Freien Volksbühne 12 (1958), Heft 2, S. 50–51. 895 Blätter der Freien Volksbühne 11 (1957), Heft 2, S. 39. 896 „Freie Volksbühne nach dem 13. August“, in : Blätter der Freien Volksbühne 15 (1961), Heft 2, S. 34–35. 897 Magistrat von Groß-Berlin, Pressekonferenz zur Neuorganisation des Theaterbesuches für alle Berliner Theater vom 21.03.1953. LAB, C Rep. 120, Nr. 2383, Bl. 47.
290
Publikum
die Neugestaltung des Theaterwesens in der östlichen Teilstadt wurden nicht nur die Sprechtheaterbühnen, das Deutsche Theater, die Kammerspiele, das Berliner Ensemble, das Metropol-Theater und das Maxim-Gorki-Theater miteinbezogen, sondern auch die beiden Opernbühnen : die Deutsche Staatsoper und die Komische Oper. Besonders die Felsenstein-Bühne bemühte sich intensiv um das kulturpolitische Ziel, ein neues, nichtbürgerliches Publikum zu erreichen. In einer Ansprache an sein Ensemble 1949 etwa äußerte Felsenstein, sein Haus habe sich nicht so sehr um den „Beifall des vorgebildeten Publikums und der Sachverständigen“ als vielmehr um die „Ganzheit des werktätigen Volkes“898 zu bemühen. Felsenstein stand mit dieser Auffassung in direktem Gegensatz zu der Position, die Carl Ebert ab 1954 in West-Berlin vertrat. Während sich dieser gerade an die Gebildeten wenden wollte, strebte Felsenstein ein Publikum an, das bislang noch nicht mit der Oper vertraut war. Diese Auffassung Felsensteins stellte nicht etwa ein der einsetzenden Stalinisierung geschuldetes Lippenbekenntnis dar, sondern war konstitutiv für sein Theaterverständnis und eng verbunden mit dem von ihm propagierten Konzept des realistischen Musiktheaters. Damit versuchte der Intendant und Regisseur während der Aufführung im Theatersaal einen Zustand zu erreichen, den er immer wieder mit dem Begriff Theatererlebnis bezeichnete. Darunter verstand er das Ergebnis einer geglückten Interaktion zwischen Bühne und Publikum : Die innere Anteilnahme der Zuschauer einerseits und ein psychologisch glaubhaft gespieltes Bühnengeschehen andererseits sollten sich wechselseitig zu einem Theatererlebnis verstärken.899 Was die Bereitschaft eines ‚werktätigen‘ Publikums zu einem solchen Erlebnis anbelangte, nahm Felsenstein – ungeachtet der komplexen visuellen wie auditiven Anforderungen einer Opernaufführung – zunächst eine höchst optimistische Haltung ein. Die Bereitschaft zum Theatererlebnis und „somit auch das Bedürfnis danach sind den Menschen angeboren“900, äußerte er 1951 bei einer Diskussion der Ost-Berliner Volksbühne. 898 Walter Felsenstein, „Über das neue Publikum. Aus einer Ansprache an das Ensemble (1949)“, in : Walter Felsenstein, Schriften. Zum Musiktheater, Berlin 1976, S. 30. 899 Siehe etwa : Felsenstein, „Ansprache anlässlich einer Besucherkonferenz (1953)“, in : ebd, S. 60–63, hier S. 60. 900 Felsenstein, „Ist das Musiktheater eine Angelegenheit des Volkes ? Referat zur Einleitung einer Diskussion der Volksbühne Berlin (1951)“, in : ebd., S. 41–47, hier S. 41.
„Bedürfnis aller Werktätigen“ ? – Die Einführung von B etriebsanrechten an der Komischen Oper 1953
291
Im Folgenden wird gefragt, ob es an der Komischen Oper in den 1950erJahren gelang, den Opernbesuch „zum echten Bedürfnis aller Werktätigen“ werden zu lassen, wie es in der eingangs erwähnten Pressekonferenz hieß. Die Felsenstein-Bühne kann in diesem Zusammenhang als Beispiel untersucht werden, da sich das Haus bereits in der ersten Hälfte der Dekade den Rang des unumstrittenen Vorbilds für eine sozialistische Opernregie und der kulturpolitisch wichtigsten Musiktheaterbühne der DDR, auch gegenüber der Staatsoper, erworben hatte. Wenn die Etablierung eines ‚werktätigen‘ Publikums an einer Opernbühne im sozialistischen deutschen Staat in den 1950er-Jahren erreicht worden ist, dann an der Komischen Oper, oder anders gewendet : Wenn es hier nicht funktioniert hat, so auch nicht an anderen Opernhäusern in der DDR. Den entscheidenden Schritt auf dem Weg, ein nichtbürgerliches Publikum zu gewinnen, stellte in der DDR die Auflösung der ostdeutschen Volksbühnenorganisation zum Sommer 1953 zugunsten eines neuen Abonnementsystems dar. Anfang dieses Jahres war es auf einer Delegiertenversammlung der Volksbühne nach dem üblichen Prozedere von Kritik und Selbstkritik zur Selbstauflösung der Besucherorganisation gekommen. Man hatte beklagt, dass die Volksbühne mit der politischen Entwicklung nicht Schritt gehalten habe, der Anteil an Arbeitern unter den Mitgliedern zu gering geblieben und überhaupt eine separate Besucherorganisation für Arbeiter im sozialistischen Staat überflüssig sei.901 An die Stelle der Volksbühne mit ihren überwiegend individuellen Abonnements trat praktisch in der gesamten DDR ein System kollektiver Betriebsanrechte, das vom ostdeutschen Freien Deutschen Gewerkschaftsbund (FDGB) organisiert wurde. Die Einheitsgewerkschaft erhoffte sich von dieser Organisationsform des Theater- und Opernbesuches eine bessere ideologische Beeinflussbarkeit des Publikums, als dies zur Zeit der Volksbühne möglich war. Die Besucherorganisation hatte für den FDGB im Bereich der Massenkultur eine erhebliche Konkurrenz dargestellt, die nun massiv unterdrückt wurde.902 Für die Ost-Berliner Theater richtete man zu Koordinationszwecken eine Anrechtszentrale ein, da hier insgesamt sieben staatliche Bühnen in das neue System einbezogen werden mussten. Mit der Anrechtszentrale hatten eigens gewählte Kulturfunktionäre 901 Siehe dazu : Schuhmann, Kulturarbeit, S. 239. 902 Ebd., S. 238.
292
Publikum
aus den Betrieben Anrechtsverträge über fünf oder zehn Vorstellungen pro Arbeiter abzuschließen, wobei jeweils mehrere oder sogar alle der sieben Bühnen berücksichtigt wurden. Über die Abschlüsse hinaus hatten die Kulturfunktionäre die bis dahin von der Volksbühne vorgenommene Bildungsarbeit in ihrem Betrieb fortzuführen und den Kontakt zu den Bühnen zu pflegen. Das neue System, mit dessen Werbung im April 1953 begonnen wurde, kam aus verschiedenen Gründen zunächst nur schleppend in Gang. Eine erste Ursache war der Aufstand vom 17. Juni, der vorübergehend zu einem vollständigen Erliegen der Anrechtsabschlüsse führte. Eine weitere Ursache lag darin, dass die Bühnen dem neuen System von Anfang an wenig Gegenliebe entgegenbrachten. Zwar garantierten ihnen die Betriebsanrechte eine gewisse finanzielle Sicherheit. Doch mehr als von diesen Anrechten, die ja immer mehrere oder sogar alle OstBerliner staatlichen Bühnen berücksichtigten, versprachen sie sich von sogenannten Besucherheften. Diese Hefte, die individuell mit einzelnen Zuschauern abzuschließen waren, umfassten ausschließlich Aufführungen an ihrem eigenen Haus, sodass sie damit innerhalb der Ost-Berliner Theaterlandschaft erst einmal die eigene Position stärken konnten. Dadurch allerdings traten die Bühnen in Widerspruch nicht nur zu den Zielen der Anrechtszentrale, sondern auch zu denen der Kulturfunktionäre in den Betrieben. Als der Werbeleiter der Komischen Oper bei einem Rundfunkgespräch das Besucherheft seines Hauses anpries, widersprachen ihm die anwesenden Betriebsvertreter harsch. Sie machten ihm deutlich, dass sie von diesen Heften nichts wissen wollten, da es ihre Aufgabe sei, für den kollektiven Anrechtsbesuch zu sorgen.903 Dass das neue System zunächst nicht griff, hing schließlich auch mit den Eintrittspreisen zusammen. Diese lagen mit 40% Ermäßigung gegenüber den Kassenpreisen, finanziert zu gleichen Teilen von den Bühnen und dem Magistrat904, dennoch 65% über denen der Volksbühne.905 So betrug die Zahl der Abschlüsse noch Anfang August 1953 zur Beunruhigung des FDGB gerade einmal 18.500.906 Erst als die neuen Betriebsanrechte auf Beschluss des Ministerrates noch einmal preislich gesenkt
903 LAB, C Rep. 120, Nr. 2383, Bl. 64. 904 Pressekonferenz zur Neuorganisation des Theaters. Ebd., Bl. 48. 905 Ebd., Bl. 44. 906 Ebd., Bl. 56.
„Bedürfnis aller Werktätigen“ ? – Die Einführung von B etriebsanrechten an der Komischen Oper 1953 293
wurden907 und der FDGB eine breit angelegte Werbekampagne unter dem Motto „Die Tore der Theater sind für Dich weit geöffnet“908 startete, erhöhten sich die Abschlusszahlen wesentlich. So konnten Ende 1953, allerdings für die längst angelaufene Spielzeit, schließlich ca. 58.000 Betriebsanrechte verzeichnet werden.909 Selbstkritisch musste man jedoch feststellen, dass der Anteil der Arbeiter unter den Betriebsanrechtlern – Ziel der Kampagne waren vor allem Industriearbeiter – noch viel zu gering war. Zwar konnte dieser gesteigert werden, aber er lag immer noch erst bei etwa 40%. Bei der Mehrzahl der Anrechtsbesitzer hingegen, die in den Aufführungen der Komischen Oper 1954 insgesamt etwa 35%910 ausmachten, handelte es sich statt dessen um Angestellte.911 Das neue Anrechtssystem bot in den 1950er-Jahren ständig Anlass zu Kritik. Vor allem in den politisch verhältnismäßig liberalen Jahren 1954 bis 1956 wurde diese in ostdeutschen Magazinen wie Theater der Zeit immer wieder unverhohlen artikuliert. Die Kritik betraf etwa die bürokratische Starrheit des Systems : Für die Anrechtsinhaber war es unpraktisch, den Aufführungstag nicht frei wählen zu können. Dies stellte gerade für Arbeiter mit wechselnden Schichten ein Problem dar.912 Für die Bühnen wiederum war es nachteilig, dass sie kaum direkten Kontakt zu ihrem neuen Publikum aufnehmen konnten, lief doch fast alles über die koordinierende Anrechtszentrale.913 Zwar wurden an den Bühnen, so auch an der Komischen Oper, sogenannte „Besucherräte“ gegründet, die den Kontakt zwischen der Intendanz und den neuen Besuchern herstellen sollten ; doch waren diese auf die Kooperation mit den Gewerkschaftsfunktionären in den Betrieben angewiesen.
907 Horst Oswald, Erfahrungsaustausch kollektiver Theaterbesuch vom 30.07.1954. LAB, C Rep. 910 (2), Nr. 8251. 908 Siehe die Broschüre in : LAB, C Rep. 120, Nr. 2383, Bl. 57. 909 Bericht über den Stand des kollektiven Theaterbesuchs vom 03.12.1953. LAB, C Rep. 910 (2), Nr. 8251. 910 Siehe die Besucher-Statistiken der Komischen Oper aus dem Jahr 1954. LAB, C Rep. 121, Nr. 291. 911 Konkret wurden 23.200 Arbeiter gezählt. Sekretariatsvorlage FDGB, Abteilung Kultur und Schulung vom 05.12.1953. LAB, C Rep. 910 (2), Nr. 8251. 912 Heinz Hofmann, „Theaterbesuch zu billig ? Wir sprachen mit Verwaltungsdirektoren und Werbeleitern“, in : Theater der Zeit 11 (1956), Heft 8, S. 37–40, hier S. 39. 913 Ebd., S. 38–39.
294
Publikum
Genau hier lag der größte Schwachpunkt des Systems. Es zeigte sich nämlich, dass die Gewerkschaftsfunktionäre, die nur selten bereits in Diensten der Volksbühne gestanden hatten, mit der ihnen anvertrauten Aufgabe häufig überfordert waren. Theater der Zeit etwa klagte : „Die Kulturfunktionäre sind meist ‚Verlegenheitslösungen‘. Selten ist ein solcher, meist übermäßig strapazierter Mensch in der Lage, in einer echten kulturpolitischen Diskussion mitzureden. So verschanzt er sich hinter seiner – meist tatsächlich bestehenden – Überbelastung, und die Gewerkschaften tun nichts, um hier die richtigen Leute auf die richtige Stelle zu setzen.“914 Die Kulturfunktionäre beschränkten sich in vielen Fällen schlicht darauf, ihr Soll gegenüber den vom FDGB geforderten Abschlusszahlen zu erfüllen und hatten dann Mühe, die abgenommenen Karten im Betrieb loszuwerden. Die einzige Lösung bestand dann bisweilen darin, dass sie, wie Theater der Zeit kritisierte, die Arbeiter „,zum Kulturdienst abkommandiert[en]‘“.915 Eine inhaltliche Bildungsarbeit aber blieb in den meisten Fällen aus. So zeigten sich schon bald die negativen Folgen der Entscheidung, nämlich diejenigen, die bis 1953 für die Volksbühne eine erfolgreiche Bildungsarbeit geleistet hatten, nicht in das neue Anrechtssystem miteinbezogen zu haben.916 An der unzureichenden Arbeit der Kulturfunktionäre lag es auch, dass die an der Komischen Oper durch den Besucherrat organisierten Bildungsveranstaltungen nur mangelhaft besucht wurden : Eine Aussprache mit dem VEB Garbaty im April 1955 etwa besuchten nur zehn Teilnehmer, eine ähnliche Veranstaltung für das Kabelwerk Oberspree sogar nur acht. Lediglich eine Veranstaltung für das Werk für Fernmeldewesen hatte 300 Besucher. Allerdings war diese große Teilnehmerzahl auf die Anwesenheit von Rentnern und Bewohnern eines Altersheims zurückzuführen und entsprach somit nicht der eigentlich erwünschten Klientel.917 Aufgrund solcher Erfahrungen forderte der Werbeleiter der Komischen Oper im Zusammenhang mit den Kulturfunktionären eine „Erziehung der Erzieher“918 – doch ohne Erfolg. Der FDGB stellte sich einfach 914 Ebd., S. 39–40. 915 Ebd., S. 39. 916 Siehe dazu : Schuhmann, Kulturarbeit, S. 240f. 917 Werner Thalheim, „Theater – Betriebe – Gewerkschaften“, in : Theater der Zeit 10 (1955), Heft 10, S. 44–46. 918 Ebd., S. 45.
„Bedürfnis aller Werktätigen“ ? – Die Einführung von B etriebsanrechten an der Komischen Oper 1953 295
stur. Die Empörung über die Einheitsgewerkschaft war bei der Komischen Oper so groß, dass der Verwaltungsdirektor des Hauses öffentlich forderte, die „Festung des [Berliner] Bezirksvorstandes des FDGB ein[zu]rennen“.919 Das Interesse der Arbeiter war jedoch nicht nur an den Bildungsveranstaltungen gering, sondern vor allem auch an den Aufführungen : Häufig blieben bezahlte Plätze der Komischen Oper einfach leer – sehr zum Leidwesen vieler Operninteressierter, die wegen der Anrechtsbelegung im freien Verkauf keine Karten mehr bekommen hatten. Eine Chance bestand für sie dennoch : Nicht selten nämlich verkauften Anrechtsinhaber ihre Karte am Eingang der Komischen Oper gewinnbringend weiter.920 Kritik kam jedoch auch von den Kulturfunktionären. Sie bemängelten an der Komischen Oper die vergleichsweise niedrige Zahl an Premieren pro Spielzeit. Dadurch war es ihnen kaum möglich, den Arbeitern in ihren Betrieben immer wieder neue Stücke zu präsentieren, was die Attraktivität der Anrechte schmälerte : „Was kann ich anbieten ? Immer dieselben Werke, und die will mir keiner mehr abnehmen“921, klagte ein Kulturfunktionär 1956 in einem Brief an Felsenstein. Abschreckend wirkte für die Anrechtler darüber hinaus auch die verhältnismäßig häufige Verschiebung von Aufführungen an der Komischen Oper. Allein in der Spielzeit 1958/59 wurden dort 12 Verlegungen gezählt, wovon 5.717 Anrechtler aus 897 Betrieben betroffen waren.922
919 „Was Besucher wünschen“. Öffentliche Aussprache des Berliner Theateraktivs am 22. Juni 1955 in der „Möwe“. LAB, C Rep. 910 (2), Nr. 8251. 920 Walter Felsenstein, „[Theateranrecht] (1959)“, in : Felsenstein, Pflicht, S. 275–277, hier S. 277. 921 Riederichs Einschätzung hinsichtlich der Repertoirepräferenzen eines ‚werktätigen‘ Publikums lautete : „Herr Intendant, die Mehrzahl aller Werktätigen, die angespannt arbeiten muß, will keine Problematik im Theater. Sie will Werke, die sie unterhalten und möglichst Opern, die sie kennen. Ich weiss ihre Gegenargumente, verstehe sie auch. Aber nur ein ganz kleiner Kreis ist aufgeschlossen und musikalisch so interessiert, Ihnen zu folgen. Die Masse ist es nicht !“ Brief von Konrad Riederich an Walter Felsenstein vom 09.05.1956. AdK, Berlin, FelsensteinArchiv, Nr. 2549. – Zur Kritik an den häufigen Spielplanänderungen der Komischen Oper siehe auch : Brief von Eberhard Nicolai an Walter Felsenstein vom 04.03.1961. Ebd. 922 Ministerium für Finanzen, Abteilung Kontrolle und Revision, Finanzrevision Groß-Berlin : „Revisionsprotokoll“ über die Anrechtszentrale vom 02.09.59. LAB, C Rep. 120, Nr. 2383, Bl. 120–124, hier Bl. 123.
296
Publikum
Die Bühnen kritisierten schließlich auch die inzwischen außerordentlich niedrigen Anrechtspreise. Durch finanzielle Zuschüsse aus den Betriebsgewerkschaftskassen und den Direktorenfonds, die über die grundsätzlich 50%ige Ermäßigung hinaus gewährt wurden, waren diese auf bisweilen nur noch 25% des Kassenpreises gesunken.923 Die Folge sei, hieß es in Theater der Zeit, dass die Anrechtsbesitzer „in den Erfrischungsräumen […] der Theater meist ein Mehrfaches des Betrages, den sie für das Kunsterlebnis entrichteten“924, verzehrten. Nicht wenige Kritiker forderten deswegen eine Abschaffung des unbeliebten Anrechtssystems. Doch dies war kulturpolitisch nicht durchzusetzen. Bei der Berliner Bezirksleitung des FDGB hieß es dazu 1956 : „Das Theaterbedürfnis unserer Werktätigen ist noch nicht in dem erforderlichen Maß vorhanden, um den Theaterbesuch nach Auflösen des zentralen Anrechts in der gleichen ständig steigenden Linie fortzusetzen. Die Auflösung würde ein [sic] Rückgang der Besucherzahlen zur Folge haben.“925 Diese Blöße wollte sich der FDGB gegenüber dem Westen jedoch auf keinen Fall geben, sodass die Einheitsgewerkschaft am gegenwärtigen System festhalten zu müssen glaubte. Schlimmer noch : Bei einer Abschaffung des Anrechtssystems war zu befürchten, dass man dann „dem Kartenverkauf an Westberliner überhaupt keinen Einhalt mehr bieten“926 könne. Selbst ein Kompromiss in Form einer Erhöhung der Anrechtspreise schien dem FDGB kulturpolitisch nicht möglich. Zu sehr drohten die im Osten bekannten West-Berliner Verhandlungen über den „Gesamtberliner Kulturplan“ und die Aufnahme von weiteren 6.000 Ost-Berlinern in die Freie Volksbühne die West-Berliner Konkurrenz zu stärken. Der Leiter der Kulturabteilung des FDGB-Bundesvorstandes Egon Rentzsch formulierte : „So erstrebenswert es ist zu erreichen, daß eines Tages das Theaterbedürfnis der Arbeiterklasse und aller 923 Hofmann, „Theaterbesuch“, S. 39. 924 Ebd. 925 Sekretariatsvorlage Abteilung Kulturelle Massenarbeit vom 14.02.1956. LAB, C Rep. 910 (2), Nr. 8251. – Bereits 1955 war eine Erhöhung der Anrechtspreise vonseiten der Abteilung Kultur der Berliner SED-Bezirksleitung und dem Berliner FDGB-Bezirksvorstand wegen der kulturellen Konkurrenz West-Berlins zurückgewiesen worden. Brief Kurt Borks (Hauptamt Darstellende Kunst im Ministerium für Kultur) an Kulturminister Becher vom 07.02.1955. BArch, DR 1/18253. 926 Brief von Johanna Blecha an Oberbürgermeister Ebert vom 17.02.1960. LAB, C Rep. 101, Nr. 1726.
„Bedürfnis aller Werktätigen“ ? – Die Einführung von B etriebsanrechten an der Komischen Oper 1953 297
Werktätigen so groß ist, daß sie bereit sind, den vollen Kassenpreis zu zahlen, so notwendig erscheint mir im gegenwärtigen Zeitpunkt die unbedingte Einhaltung der Errungenschaft des verbilligten Theaterbesuchs ; ganz zu schweigen davon, daß wir in einem Deutschland leben, das aus zwei Staaten besteht und in Westdeutschland und Westberlin noch Volksbühnenorganisationen existieren.“927 Somit blieb dem FDGB, um nach Westen hin kulturpolitisch erfolgreich dazustehen, keine andere Wahl, als das problematische System fortzusetzen. Immerhin konnten zu Beginn der Spielzeit 1955/56 etwa 77.000 Betriebsanrechte verzeichnet werden.928 Aufgrund der Vorstellungsberichte, die sich Walter Felsenstein durch seine künstlerischen Mitarbeiter über den Verlauf jeder Aufführung an seinem Haus anfertigen ließ, können Aussagen über das Verhalten des neuen Publikums in der Komischen Oper getroffen werden. In diesen Berichten sind die Reaktionen der Zuschauer teilweise außerordentlich genau festgehalten. Immer wieder machten sich die Verfasser Luft über das Anrechtspublikum, bei dem sich das von Felsenstein erhoffte Theatererlebnis nicht einstellte. Über die Zuschauer der Aufführung von Janáčeks Das schlaue Füchslein vom 24. April 1959 etwa heißt 927 Brief von Egon Rentzsch an Kurt Bork vom 07.11.1956. BArch, DR 1/18253. Siehe auch die Sekretariatsvorlage der Abteilung Kulturelle Massenarbeit beim Magistrat vom 14.02.1956 : „Es ist […] nicht günstig, in der augenblicklichen Situation eine Veränderung der Ermäßigungen [der Betriebsanrechte, FB] vorzunehmen. Die gute künstlerische Arbeit unserer Bühnen und die starke Ausstrahlung nach West-Berlin sowie die immer weitere nationale und internationale Anerkennung unserer Theater liegt dem Frontstadtstrategen, dem ‚Kultursenator‘ Tiburtius schwer im Magen. Der Westberliner Senat beschäftigt sich zur Zeit mit der Frage, den Bewohnern des demokratischen Sektors die Möglichkeit zu geben, die Westberliner Theater im Verhältnis 1 : 1 zu besuchen. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, in verstärktem Maße die politisch-ideologische Arbeit in den Betrieben zu verbessern, durch die Bildung von Theaterzirkeln, regelmäßige Aussprachen über die Theaterstücke und Aufführungen gemeinsam mit den Theatern in den Betrieben, das Abwandern in die Theater nach Westberlin zu verhindern.“ LAB, C Rep. 910 (2), Nr. 8251. 928 Sekretariatsvorlage Abt. Kulturelle Massenarbeit vom 14.02.1956. Ebd. Gleichzeitig war jedoch die Zahl der Aufführungen pro Anrecht zur Spielzeit 1955/56 von zehn auf acht gesenkt worden. – Allerdings sagt die Zahl 77.000 nichts über die tatsächliche Höhe des Arbeiteranteils aus. In einem Exposé an das Kulturministerium über die „Verbesserung der kulturpolitischen Massenarbeit der Gewerkschaften in den Betrieben mit Hilfe der Berliner Theater“ von Horst Kanzler vom 28.6.1958 heißt es : „Es sind meist die Verwaltungsangestellten, die sich aus eigenem Antrieb ein Besucheranrecht und damit die Preisermäßigung sichern.“ BArch, DR 1/18253.
298
Publikum
es drastisch : „Ich möchte wissen, was das für ein Publikum war (Beschränkter Kartenverkauf ). Ausverkauft war es nicht. Herr Enders [in der Doppelrolle als Dackel und Schulmeister, FB] war der einzige, der im 5. Bild Reaktionen holen konnte. Der Tod des Füchsleins ergab außer einigen Ausrufen des Bedauerns Anlaß zur Unterhaltung und Gelächter. Nach der Pause kamen Leute aus der 8. Reihe nicht wieder. Der Schluß schien überhaupt niemand [sic] verständlich geworden zu sein, denn sie erhoben sich erst, nachdem gänzlich hell gemacht wurde. Zwischenapplaus kam gar nicht […], der Schlussapplaus schleppte sich eine Weile hin, angeführt von einigen, denen die Aufführung gefallen haben musste.“929 Im Rahmen einer Diskussion in der Ost-Berliner Akademie der Künste 1959 übte Felsenstein vernichtende Kritik am Anrechtssystem. Der Intendant fragte : „Ist jener Weg der richtige, daß möglichst viele Leute da unten [im Zuschauerraum, FB] sitzen ? Ich müßte das sehr in Frage stellen nach den Erfahrungen der letzten Jahre. […] So wie es bisher war, geht es nicht mehr weiter. Ich fühle mich in meiner künstlerischen Produktion zur Impotenz verurteilt, wenn ich gezwungen bin, vor Zuschauern zu spielen, von denen nur ein kleiner Teil die Absicht hat, an dem Erlebnis teilzunehmen. Der Prozentsatz derer, die zum Theaterbesuch überredet werden, wird größer.“930 Wirklich gelungene Aufführungen seien, wie Felsenstein erläuterte, nur möglich, wenn der Anrechtsanteil nicht höher als 30% liege. „Dieselbe gute Vorstellung ist dort, wo das ermäßigte Anrecht den Prozentsatz fünfzig bis sechzig erreicht, gelähmt. […] So geht es nicht ! Es entsteht eine Qualitätsnivellierung ! Es wird nichts Außergewöhnliches mehr geboten. […] Das Theaterbedürfnis beträgt bei uns unter zehn Prozent und noch darunter. Nicht der Theaterbesuch, sondern das Theaterbedürfnis.“931 Doch der Intendant hatte mit seinem Protest keinen Erfolg : Das Anrechtssystem bestand weiter. Felsenstein jedenfalls musste angesichts der enttäuschenden Entwicklung seinen anfänglichen Optimismus über das neue Publikum revidieren : Ein „angeborenes“ Opernbedürfnis jedenfalls, wie er anfangs geglaubt hatte, ließ sich bei den ‚Werktätigen‘ der DDR nicht ausmachen. 929 Vorstellungsbericht vom 24.04.1959. AdK, Berlin, Felsenstein-Archiv, Nr. 1558. 930 Walter Felsenstein, „[Theateranrecht] (1959)“, in : Felsenstein, Pflicht, S. 275–277, hier S. 276. 931 Ebd., S. 276–277.
„Bedürfnis aller Werktätigen“ ? – Die Einführung von B etriebsanrechten an der Komischen Oper 1953 299
Die Ausführungen haben gezeigt, dass die Berliner Opernbühnen in den 1950er-Jahren hinsichtlich des Publikums Orte einer erheblichen deutschdeutschen Verflechtung blieben. Westlichen Boykottaufrufen zum Trotz suchten Westdeutsche – nach einem Einbruch in den Jahren 1948 bis 1951 – die Ost-Berliner Opernbühnen Abend für Abend zahlreich auf, genauso wie Ostdeutsche allen Behinderungen beim Übertritt in die Westsektoren zum Trotz die Städtische Oper besuchten. Dabei konnten die Ost-Berliner Bühnen durchschnittlich jeweils einen höheren Anteil westlichen Publikums verbuchen als es die Städtische Oper im Hinblick auf das ostdeutsche Publikum konnte. Dies hing nicht nur damit zusammen, dass die Eintrittspreise von Staatsoper und Komischer Oper aufgrund des Wechselkurses für Westdeutsche außerordentlich günstig waren, sondern auch mit der Qualität der Darbietungen. Vor allem die musterhaften Aufführungen Walter Felsensteins entwickelten sich zu einem Publikumsmagneten für westliches Publikum, sodass deren Zahl in der zweiten Hälfte der 1950er-Jahre durchschnittlich mindestens bei 15–20 % lag. Die Städtische Oper hingegen war für viele Ostdeutsche trotz der für sie vom Senat gewährten Subventionen bis 1957 schlicht zu teuer. Die Situation änderte sich erst ab 1957 durch den von der Bundesregierung finanzierten „Gesamtberliner Kulturplan“. Nicht nur konnten durch diese Maßnahme Ostdeutsche Eintrittskarten für West-Berliner Kulturveranstaltungen zum Wechselkurs von 1 :1 erwerben, sondern es konnte auch die Freie Volksbühne 6.000 neue Ostdeutsche als Mitglieder aufnehmen, sodass sich der Anteil östlichen Publikums in der Städtischen Oper bis zum Mauerbau erheblich vergrößerte. Was die Vorstellungen von einem idealen Publikumsstamm aus dem eigenen System anbelangt, setzte die Städtische Oper unter der Intendanz Carl Eberts mit der Einführung eines reinen Opernabonnements ab 1955 auf bildungsbürgerliche Kontinuität. In der DDR hingegen bestand ab 1953 das ehrgeizige kulturpolitische Ziel, den Opernbesuch zum „echten Bedürfnis aller Werktätigen“ werden zu lassen. Dazu trat an die Stelle der Besucherorganisation der Volksbühne, die aufgelöst wurde, ein neues System mit gemischten Anrechten für bis zu sieben Ost-Berliner Theater, von dem man sich versprach, dass es mehr Arbeiter, vor allem aus dem Bereich der Industrie, erfassen würde. Insbesondere für die künstlerische Arbeit Walter Felsensteins bildete die Etablierung eines ‚werktätigen‘ Publikums ein zentrales Anliegen. Dennoch wurde das Ziel
300
Publikum
in den 1950er-Jahren an der Komischen Oper nicht erreicht. Die Ursachen lagen zum einen im starren Bürokratismus des Anrechtssystems, des Weiteren in der mangelhaften Bildungsarbeit der Gewerkschaftsfunktionäre und schließlich im Erfolgsdruck, der aus der kulturellen und ökonomischen Konkurrenz durch West-Berlin insbesondere infolge des „Gesamtberliner Kulturplans“ resultierte. Statt die Probleme des Anrechtssystems zu reflektieren und zu korrigieren, setzte man in der DDR kulturpolitisch ausschließlich auf hohe Abschlussquoten mit Außenwirkung – Theaterbedürfnis hin oder her.
Zusammenfassung und Ausblick
„Bis zu den Augusttagen des Jahres 1961 entfaltete sich zwischen den drei Berliner Opernhäusern eine fruchtbare Konkurrenz, die wie eine Neuerweckung der Blüte und Vielfalt des Berliner Opernlebens Ende der zwanziger Jahre erschien“932, charakterisierte Götz Friedrich, Regisseur und Schüler Walter Felsensteins, die Berliner Opernkultur bis zum Mauerbau rückblickend. Friedrichs Einschätzung der Opernkultur jener Jahre ist insofern zutreffend, als sich die Zeit bis zum 13. August 1961 für das Opern liebende Publikum geradezu wie ein Eldorado ausnahm, bei dem Abend für Abend – so es trotz der Behinderungen an den Sektorengrenzen möglich war – zwischen Aufführungen an drei qualitativ erstklassigen Opernhäusern gewählt werden konnte. Allerdings sollte dieser Umstand nicht zur Verklärung führen und das Spezifikum der Opernkonkurrenz jener Jahre verdecken : Über einen rein künstlerischen Wettbewerb, wie er in den 1920er-Jahren vorlag, hinaus handelte es sich im Berlin des Kalten Krieges um eine politische Konkurrenz der Bühnen. Die Opernhäuser bildeten, wie anhand der Eröffnungsfeiern von Lindenoper und Deutscher Oper gezeigt wurde, innerhalb der deutsch-deutschen Kulturkonkurrenz des Kalten Krieges wichtige politische Foren nationaler kultureller Repräsentation, in denen divergierende Werte, Normen und Kulturvorstellungen zum Ausdruck kamen. Dabei wurde der Wettbewerb der drei Bühnen vor allem in der ersten Hälfte der 1950er-Jahre konfrontativ geführt, sodass es immer wieder zu erheblichen Spannungen und Auseinandersetzungen kam. Als wichtigstes Ergebnis der Untersuchung gilt es festzuhalten, dass es im Rahmen dieser Kulturkonkurrenz an der West-Berliner Städtischen Oper in den 1950er-Jahren zu einem erheblichen Wandel nationaler kultureller Repräsentation kam. An dieser Bühne büßte die für die bildungsbürgerliche Kunstsemantik bis 1945 konstitutive Vorstellung von der vergesellschaftenden Funktion deutscher Nationalkultur, die sich spätestens im Nationalsozialismus unheilvoll ausgewirkt 932 Götz Friedrich, „Walter Felsenstein“ ; in : Lothar Gall (Hg.), Die großen Deutschen unserer Epoche, Frechen 2002, S. 310–324, hier S. 312.
302
Zusammenfassung und Ausblick
hatte, indem sie in einer rassistischen Variante gegen die kulturelle Moderne und ihre Vertreter gerichtet worden war, ihre Relevanz ein. Damit muss die gängige These vom restaurativen Charakter der Opernkultur für die BRD der 1950erJahre, was die Städtische Oper angeht, modifiziert werden. Wenn an der WestBerliner Oper der Nachkriegszeit auch Ressentiments gegen die moderne, primär auf Konsum ausgerichtete Massenkultur wohl bestehen blieben, bedeutete doch die Öffnung gegenüber der hochkulturellen Moderne im Spielplan einen grundlegenden Aspekt von Diskontinuität in der nationalen kulturellen Repräsentation. In der Arbeit konnte das beispielhaft an der deutschen szenischen Uraufführung von Arnold Schönbergs Opernfragment Moses und Aron 1959 erläutert werden. Ziel der Initiatoren war es, mit der Aufführung zur Rehabilitierung des Komponisten beizutragen, dessen Leben und künstlerisches Wirken bis 1933 eng mit der Stadt Berlin verknüpft war. Wenn Schönberg nun wieder als deutscher Komponist verstanden wurde, argumentierte man in diesem Zusammenhang doch nicht mehr ursprungsmythologisch im Sinne einer Abstammungsgemeinschaft, sondern betonte, dass die Zugehörigkeit des Komponisten zur deutschen Kultur das Ergebnis kultureller Prägung sei. Die Verdienste der Städtischen Oper sowie damit verbunden der West-Berliner Akademie der Künste um die Rehabilitierung Schönbergs durch die Aufführung von Moses und Aron sind umso höher einzuschätzen, als in diesem Zusammenhang erhebliche öffentliche Widerstände überwunden werden mussten, die vonseiten eines Teils der Presse bereits im Vorfeld einsetzten und am Abend der Premiere in einem der heftigsten westdeutschen Opernskandale der 1950er-Jahre kulminierten. Kritisiert wurde an dem Werk neben den vermeintlich fehlenden bildenden Qualitäten vor allem die in der Zwölftontechnik komponierte Musik, der ein Mangel an ästhetischer Schönheit vorgeworfen wurde. Allerdings muss festgehalten werden, dass die Kritik an Schönberg in den 1950er-Jahren viel von der Schärfe einbüßte, welche diejenige der 1920erund 1930er-Jahre gekennzeichnet hatte, wurde doch nun im Unterschied dazu – zumindest nicht mehr offen – antisemitisch argumentiert. Dennoch kann, auch wenn die Inszenierung von Moses und Aron letztendlich zu einem großen Erfolg des Opernhauses avancierte, angesichts des Premierenskandals nicht von einem „unaufgeregte[n] Ende der bildungsbürgerlichen Kunstsemantik“933 gesprochen 933 Bollenbeck/Kaiser, 50er Jahre, S. 208.
Zusammenfassung und Ausblick
303
werden, wie es Bollenbeck für die bundesrepublikanischen 1950er-Jahre verallgemeinernd konstatiert hat. Eine Öffnung des West-Berliner Opernhauses hin zur kulturellen Moderne konnte in der Arbeit des Weiteren im Zusammenhang mit der Architektur des Charlottenburger Neubaus aufgezeigt werden. Zwar griff der Architekt Fritz Bornemann bei der Deutschen Oper formal das Modell des von Richard Wagner konzipierten Bayreuther Festspielhauses auf, indem er dessen amphitheatralische Sitzordnung und die primär funktionalen Zwecken dienende Schlichtheit übernahm. Allerdings entwarf er seinen Bau im westlichen Internationalen Stil. An keiner Stelle war etwa von einer spezifisch deutschen Architektur die Rede, wie man sie bei Wagner bezüglich seines Festspielhauses findet. Dass die überlieferte Vorstellung von der Einheit der deutschen Kultur in West-Berlin an Bedeutung verlor, haben schließlich auch die Ausführungen über den sogenannten „Sängerkrieg“ gezeigt : Das vom West-Berliner Senat verfügte Verbot ost-westlicher Doppelengagements ab Herbst 1951 vertiefte die Teilung der Stadt nachhaltig. Eines der prominentesten Opfer wurde der Dirigent Erich Kleiber mit seinem politischen Anspruch, im Sinne der Einheit der deutschen Kultur in beiden Teilen Berlins wirken zu wollen. Dass die West-Berliner Oper in den 1950er-Jahren von der Forschung bislang noch nicht unter der Frage nach der Konstruktion einer nationalen Gemeinschaft untersucht worden ist, mag somit selbst für das Ergebnis der Arbeit sprechen : die schwindende Bedeutung der Einheit stiftenden Funktion der Kunstform in der Bundesrepublik. Infolge dessen nämlich verlor die Oper – umgekehrt proportional zum Aufstieg der Massenkultur – gesellschaftlich an Bedeutung, sodass die einstmals große Relevanz jener vergesellschaftenden Funktion allmählich aus dem kollektiven Bewusstsein und damit auch aus demjenigen der historischen Forschung verschwand. Mit dem Bedeutungsverlust der Vorstellung von der national vergemeinschaftenden Wirkung der deutschen Kultur in der kulturellen Selbstdarstellung der Städtischen Oper ging die Rückkehr zu westlichen Werten einher. Zwar lässt sich bei Heinz Tietjen noch jene Haltung beobachten, die Michael Steinberg als nationalistisches Weltbürgertum charakterisiert hat, also jene Denkfigur, wonach sich die Deutschen als einzige Nation überhaupt in der Lage sahen, allgemeinmenschlich bildende Werte zu vertreten, sodass sie glaubten, sich anderen
304
Zusammenfassung und Ausblick
Nationen gegenüberüberlegen fühlen zu dürfen. Auch wenn seine Haltung nach 1945 zu einem guten Teil nur einer Anpassung an die neuen politischen Gegebenheiten geschuldet und damit Opportunismus gewesen sein mag, sind jedenfalls pronationalsozialistische Äußerungen von ihm nicht überliefert. Im Falle des Remigranten Carl Ebert hingegen war das Anknüpfen an allgemeinmenschlich-ethische Werte ein glaubhaftes Anliegen. Schon in den 1920er-Jahren hatte er in der Bühne – in Oper wie im Schauspiel gleichermaßen – eine „moralische Anstalt“ gesehen. War Ebert dabei zunächst selbst ein Exponent jenes nationalistischen Weltbürgertums gewesen, blieb von dieser Position nach 1945 kaum mehr etwas übrig. Bei Carl Ebert kann somit von einer Westernisierung gesprochen werden. Muss somit die These von der musikalischen Hochkultur der Bundesrepublik in den 1950er-Jahren als einem Hort der Restauration für die Städtische Oper modifiziert werden, müssen auch die Grenzen des Wandels in der nationalen kulturellen Repräsentation der Bühne genannt werden : Eine kritische Reflexion der Rolle der Oper in der NS-Zeit und derjenigen des Deutschen Opernhauses im Besonderen blieb in den Jahren nach 1945 aus. Stattdessen etablierte sich bald wieder der unpolitische Bildungsbegriff der Jahre vor 1933, der suggerierte, dass nur eine von der Politik getrennte Kunst rein sei. Zwar war dieser nicht zwangsläufig ein Ausdruck von Verdrängung der politischen Verstrickungen der Kunst in der Zeit des Nationalsozialismus. So galt die Trennung von Politik und Kunst etwa für Carl Ebert bereits vor 1933 als Bedingung für die moralische Integrität der Letzteren. Bei Heinz Tietjen allerdings scheint der unpolitische Kunstbegriff vor allem der Verdrängung gedient zu haben. So ist es bezeichnend, dass unter Tietjens Intendanz Boris Blachers Preußisches Märchen erst nach einem Akt der Selbstzensur zur Uraufführung 1952 angenommen wurde, bei dem die Oper ihr ursprüngliches gesellschaftskritisches Potenzial weitgehend einbüßte. Hatte Blacher dem Publikum ursprünglich einen Spiegel vorhalten und ironisch-bissig die politische Verführbarkeit der Deutschen im Nationalsozialismus anprangern wollen, stellte sich die Geschichte vom Hauptmann von Köpenick in der überarbeiteten Fassung, wie von den Verantwortlichen der Oper gewünscht, nur mehr als politisch harmlose Komödie dar. Wenn somit an der Städtischen Oper in den 1950er-Jahren zwar die Freiheit der Kunst propagiert wurde, beschränkte sich diese doch faktisch auf die Artikulation unpoliti-
Zusammenfassung und Ausblick
305
scher, vermeintlich ewig-menschlicher Werte. In einem Punkt kam es darüber hinaus sogar explizit zur Einschränkung der Freiheit der Kunst, wodurch die unablässige Selbstdarstellung des Westens als des Horts der Freiheit gegenüber einem totalitären Osten Lügen gestraft wurde : beim Verbot deutsch-deutscher Doppelengagements durch den West-Berliner Senat, das es Erich Kleiber aber auch anderen Künstlern unmöglich machte, in West-Berlin zu konzertieren. Für Ost-Berlin konnte das bisherige Bild der Forschung von der restaurativen Kontinuität der bildungsbürgerlichen Semantik in den 1950er-Jahren bestätigt werden. Hier blieb die Bedeutung der ursprungsmythologischen Argumentationsfigur im Zusammenhang mit der eine Wiedervereinigung propagierenden Deutschlandpolitik der SED bestehen : Der Staatsoper war, wie anhand des 1952 im Neuen Deutschland abgedruckten Grundsatzprogramms erläutert wurde, die kulturpolitische Funktion zugedacht, durch die Aufführung Einheit stiftender nationaler Werke den Deutschen die Unhaltbarkeit der politischen Teilung vor Augen zu führen. In der Arbeit wurde das zum einen anhand der Eröffnungspremiere der Lindenoper 1955 mit Richard Wagners Meistersingern herausgearbeitet. War der Komponist nach 1945 in der SBZ/DDR wegen seiner großen Bedeutung für die NS-Kulturpolitik zunächst stark diskreditiert gewesen, ließ er sich doch mithilfe des Doppelbildes vom Revolutionär wie Reaktionär spätestens in der ersten Hälfte der 1950er-Jahre offiziell wieder in das nationalkulturelle Erbe integrieren. Dabei wurden die Meistersinger als Ausdruck von Wagners demokratischer Einstellung sowie als Bekenntnis zu einem deutschen Nationalstaat und damit als humanistisch bildend im sozialistischen Sinne gedeutet. Dass der gesellschaftliche Fortschritt in dem Werk ausgerechnet von einem Adeligen, dem Ritter Walter von Stolzing, verkörpert wurde, überging man dabei geflissentlich. Die Entscheidung für die Meistersinger als Eröffnungspremiere der Lindenoper 1955, die zu der für die nationale kulturelle Repräsentation wichtigsten Aufführung der Bühne in den 1950er-Jahren wurde, fällte schließlich das Politbüro der SED als höchstes Gremium der Staatspartei. Dass die Kulturpolitik der SED den Aufführungen der Staatsoper eine national einigende Funktion zuschrieb, konnte außerdem anhand der Uraufführung von Jean Kurt Forests Oper Der arme Konrad 1959 gezeigt werden, die aus Anlass des zehnten Jahrestages der Gründung der DDR 1959 erklang. Das Werk sollte einen Beitrag zur Etablierung des von der SED erhofften Genres einer
306
Zusammenfassung und Ausblick
sozialistischen deutschen Nationaloper leisten. Doch obwohl die Oper mit ihrer Bauernkriegsthematik und mit der Einbeziehung deutscher Volkslieder den kulturpolitischen Forderungen an eine solche Nationaloper entsprach, wonach einer solchen ein nationaler Stoff und eine vermeintlich spezifisch deutsche Musik zugrunde liegen mussten, konnte sich das Werk nicht dauerhaft im Spielplan der Bühne etablieren. Grund dafür waren nicht zuletzt allzu offensichtliche dramaturgische, wohl auch kompositorische Schwächen. Die vergesellschaftende Funktion deutscher Nationalkultur beschwor die DDR im Gegensatz zu West-Berlin auch im Falle Erich Kleibers. Der Dirigent, der bereits in den 1920er-Jahren als Generalmusikdirektor der Lindenoper Berühmtheit erlangt hatte, bevor er während des Nationalsozialismus ins Exil gegangen war, sollte Anfang der 1950er-Jahre nach dem Willen der SEDKulturpolitik erneut fest an die Staatsoper gebunden werden, nicht zuletzt, um mit dessen erhoffter Magnetwirkung dem Abwanderungstrend von Künstlern der Staatsoper an Bühnen des Westen entgegenzuwirken. Dieser Trend hatte sich seit 1948 in dem Maße verstärkt, in dem das östliche und westliche Währungsniveau auseinanderklafften. Der SED kam bei ihren Bemühungen um den Dirigenten zwei Dinge entgegen : zum einen, dass Kleiber selbst viel an einer Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte gelegen war, die ihm zudem außerordentlich generös entgegentrat und ihm sogar den Wiederaufbau der zerstörten Lindenoper zusicherte, zum anderen die restriktive Kulturpolitik des West-Berliner Senats. Die Tatsache, dass die West-Berliner Philharmoniker eine Zusammenarbeit mit Kleiber wegen des Verbotes ost-westlicher Doppelengagements verweigerten, ließ bei ihm die Überzeugung wachsen, dass nur die DDR wirklich an der Einheit der deutschen Kultur interessiert war, die er im Übrigen durch ein gesamtdeutsches künstlerisches Wirken selbst zu fördern gedachte. Somit konnte die DDR mit Kleiber Politik machen. Spätestens jedoch nach der Entlassung der West-Berliner Staatsopernmitglieder aus dem Bereich Technik im Sommer 1952, die Ernst Legal – selbst ein überzeugter Vertreter der Vorstellung von der Einheit der deutschen Kultur – zum Rücktritt von seinem Intendantenposten bewegten, musste Kleiber begreifen, dass ihn sein Bild von der DDR getrogen hatte und auch der ostdeutsche Staat die deutsch-deutsche Teilung vertiefte. So zog sich Kleiber im März 1955 endgültig von der Staatsoper zurück.
Zusammenfassung und Ausblick
307
Schließlich war auch der Wiederaufbau der Lindenoper, dem nach der Stalinallee kulturpolitisch wichtigsten Bauprojekt der DDR in Ost-Berlin in den 1950er-Jahren, von einer massiven gesamtdeutschen Propaganda begleitet. Es wurde in der Arbeit dargestellt, wie die Fokussierung auf das nationale Erbe in diesem Fall skurrile Blüten trieb : Nachdem der ursprüngliche Plan, eine große neue Staatsoper am Marx-Engels-Platz zu errichten, durch die Zusage an Erich Kleiber 1951, die Lindenoper wieder aufzubauen, hinfällig geworden war, galt es, die klein dimensionierte ehemalige Hofoper zu dem repräsentativen Opernhaus des sozialistischen deutschen Staates zu machen. Ausgangspunkt war, dass ihr Erbauer Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff nicht – wie bis heute eigentlich üblich – als Vertreter des friderizianischen Rokoko, sondern als ein Exponent des aufgeklärten Frühklassizismus gedeutet wurde. In diesem Sinne entwarf der Architekt des Wiederaufbaus Richard Paulick im Innern eine komplett neue Raumaufteilung und Dekoration, bei der er sich stilistisch eng an denjenigen Sälen Knobelsdorffs aus dem Potsdamer Schloss Sanssouci orientierte, die am ehesten dem Bild eines Frühklassizisten entsprachen. Zu diesem grundlegenden Eingriff in die bauliche Gestaltung glaubte sich Paulick dadurch berechtigt, dass er – entgegen den historischen Tatsachen – von einem grundlegenden Gegensatz in den Architekturauffassungen Knobelsdorffs und seines königlichen Auftraggebers ausging. Knobelsdorffs Opernarchitektur, die stilistisch eigentlich englischen beziehungsweise italienischen Vorbildern verpflichtet gewesen war, wurde in diesem Zusammenhang, was einen Anachronismus darstellt, als spezifisch deutsch umgedeutet und zum Stiftungsbau einer spezifisch nationalen Opernarchitektur erhoben. Zwar distanzierte sich der ostdeutsche Staat in der nationalen Selbstdarstellung der Staatsoper von der Vorstellung einer Überlegenheit der deutschen Kultur, womit er sich vom Kulturverständnis der NS-Zeit abgrenzte ; doch wurde die kulturelle Moderne an der Bühne wie schon im Nationalsozialismus ausgegrenzt, was anhand von Brechts/Dessaus Lukullus erläutert wurde : Wegen seiner dissonanten Tonsprache, die gängigen Vorstellungen von ästhetischer Schönheit widersprach, wurde das Werk als ‚volksfremd‘ und ‚antinational‘ verunglimpft. Ein Anknüpfen an die politisch linksorientierte Opernreform der 1920er-Jahre jedenfalls, deren Inbegriff Bertolt Brechts und Kurt Weills Dreigroschenoper darstellte, fand somit nicht statt. Allerdings kam Brechts/Dessaus Oper in einer
308
Zusammenfassung und Ausblick
überarbeiteten Fassung unter dem Titel Die Verurteilung des Lukullus schließlich doch noch auf den Spielplan, schon allein deshalb, um den durch das Aufführungsverbot ausgelösten internationalen Prestigeverlust für den ostdeutschen Staat wieder zu beheben. Seit Mitte der 1950er-Jahre befand sich die DDR allerdings mit ihrer abgrenzenden Haltung gegenüber der kulturellen Moderne auf dem Rückzug, sodass Ende 1955 sogar Alban Bergs atonale Oper Wozzeck gegeben werde konnte. Wenn den Anlass zur Verfemung der kulturellen Moderne auch die sowjetische Kulturpolitik bildete, lässt sich doch im Zusammenhang mit der Staatsoper kaum von einer Sowjetisierung sprechen. Vielmehr ließen sich im Kontext der Stalinisierung, in der die UdSSR ihren Bündnisländern ein Anknüpfen an deren nationalkulturelle Traditionen explizit zugestand, ältere deutsche ideengeschichtliche Traditionen fortführen. Diese fanden über die Aneignung der Arbeiterbewegung Eingang in den sozialistischen deutschen Staat. Einen Bruch mit der Vergangenheit strebte die DDR im Zusammenhang mit dem Versuch an, in der Oper an die Stelle eines bürgerlichen ein ‚werktätiges‘ Publikum treten zu lassen. Vor dem Hintergrund, dass das nationalkulturelle Erbe seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert zumindest ideell nie exklusiv für die bestehende Sozialformation des Bürgertums, sondern immer als Teilnahmeangebot für die gesamte Nation konzipiert war, sah sich der Arbeiter- und Bauern-Staat als legitimer Erbe der bürgerlichen Kultur. Am Beispiel der Komischen Oper konnte allerdings gezeigt werden, dass die DDR mit diesem ehrgeizigen Anspruch scheiterte. Zwar bildete die Etablierung eines ‚werktätigen‘ Publikums ein grundlegendes Anliegen für deren Intendanten Walter Felsenstein, das eng mit dessen Opernreformkonzept eines realistischen Musiktheaters verknüpft war. Dass der Anspruch jedoch nicht eingelöst werden konnte, hatte seine Gründe erstens im Bürokratismus des Anrechtssystems, zweitens in der mangelhaften Bildungsarbeit der Gewerkschaftsfunktionäre und drittens in der kulturellen und ökonomischen Konkurrenz mit West-Berlin insbesondere infolge des „Gesamtberliner Kulturplans“ von 1957, die dazu führte, dass der mit der Organisation betraute FDGB sein Ziel ausschließlich in hohen Abonnentenzahlen statt einer fundierten Bildungsarbeit sah. Wenn Felsenstein mit seinen Inszenierungen an der Komischen Oper von der SED spätestens Mitte der 1950er-Jahre zum Vorbild für Opernregie im sozialistischen deutschen Staat
Zusammenfassung und Ausblick
309
erhoben wurde, sodass seine Bühne der Staatsoper den Rang als Musterbühne streitig machen konnte, lag das nicht in erster Linie am Erfolg des Hauses beim ‚werktätigen‘ Publikum – und das, obwohl es nicht unwesentliche ästhetische Schnittmengen zwischen dem Konzept des realistischen Musiktheaters und der Doktrin des Sozialistischen Realismus gab. Es lag vielmehr daran, dass das westliche Publikum die Komische Oper sehr schätzte und das Haus Abend für Abend zu einem erheblichen Teil füllte. Die beispiellos guten Probenbedingungen, welche der Komischen Oper gewährt wurden, waren dabei innerhalb der SED keineswegs unumstritten und wurden bei jeder Verhandlung über eine Vertragsverlängerung mit Felsenstein zum Streitpunkt. Dass der Intendant seine Position jedes Mal behaupten konnte, hatte seinen Grund darin, dass der nach außen hin der DDR gegenüber weitgehend loyale Künstler stets glaubhaft mit seinem Weggang drohte, was für die DDR einen nicht hinnehmbaren kulturellen Prestigeverlust bedeutet hätte. Die für das Publikum so fruchtbare Konkurrenz zwischen den drei Berliner Opernbühnen endete abrupt durch den Bau der Berliner Mauer vom 13. August 1961, durch den eine wechselseitige Rezeption der Opernbühnen in beiden Teilen der Stadt unmöglich wurde.934 Der Mauerbau führte vor allem für die Ost-Berliner Opernhäuser zu erheblichen Problemen, was wesentlich auch mit den Reaktionen auf den Mauerbau in West-Berlin zusammenhing. Zum einen nämlich wurde in West-Berlin die Lohnausgleichskasse für die westöstlichen Grenzgänger, also diejenigen Berliner, deren Wohnort und Arbeitsstätte nicht im gleichen Teil der Stadt lag, aufgelöst. Dies hatte zur Folge, dass den an den Opernbühnen Ost-Berlins arbeitenden West-Berlinern der durch das Währungsgefälle niedrige Ost-DM-Lohn nicht mehr wie bisher durch jene Einrichtung aufgebessert wurde. Schon dies minderte die Bereitschaft, weiterhin im Osten zu arbeiten. Zum anderen wurde vonseiten des West-Berliner Senats zusammen mit Teilen der Presse auf die an den Ost-Berliner Bühnen arbeitenden Grenzgänger ein starker moralischer Druck ausgeübt, sich von ihren Arbeitsverhältnissen im kommunistischen System zu lösen. Vor allem für die Staatsoper wurde dies zum Problem, als der allergrößte Teil der immer noch 934 Die Ausführungen über die Auswirkungen des Mauerbaus auf die Berliner Opernkultur sind folgender Studie entnommen : Ursula Volkmann, Berliner Opernleben zu Zeiten des Mauerbaus. Unveröffentlichte Magisterarbeit, Berlin o. J.
310
Zusammenfassung und Ausblick
rund 200 West-Berliner Mitglieder aus dem Solistenensemble, Chor, Ballett, Orchester und Vorstand den Vertrag zur Spielzeit 1961/62 außerterminlich löste. De facto vor die Wahl gestellt, in den Osten zu ziehen oder die Mitarbeit an der Staatsoper aufzukündigen, entschied sich nur ein geringer Anteil für erstere Möglichkeit. Für alle anderen einen kurzfristigen Ersatz zu finden und die Spielzeit wie vorgesehen bereits am 20. August 1961 eröffnen zu können, um damit nach außen hin den Eindruck eines weitgehend reibungslosen Fortgangs der künstlerischen Arbeit zu erwecken, war nur möglich, indem zahlreiche Musiker aus anderen Orchestern Ost-Berlins sowie der übrigen DDR – zum Nachteil der Qualität jener Klangkörper – in die Staatskapelle integriert wurden. Studenten der Musikhochschulen wurde bereits vor dem Ablegen ihres Examens ein Praktikanten-Jahr an der Staatsoper gewährt, und Musiker und Sänger aus den sozialistischen Nachbarländern Ungarn, Bulgarien und Tschechoslowakei wurden der Not gehorchend eingeladen. Stellte für jene Künstler die Aufnahme in die Staatsoper eine unverhoffte Karrierechance dar, blieb all dies doch nicht ohne Auswirkungen auf das Niveau der Bühne. Zwar konnte ein kontinuierlicher Spielplan aufrechterhalten werden, doch traten an die Stelle personalintensiver Opern für einige Jahre weitgehend weniger aufwendige Kammeropern. Darüber hinaus war ein Einbruch bei der musikalischen Qualität zumindest in den ersten Jahren nicht zu überhören. An die Stelle der systemübergreifenden Opernkonkurrenz trat mit dem 13. August 1961 eine verschärfte systeminterne Konkurrenz zwischen Staatsoper und Komischer Oper, die wie schon vor 1961 eindeutig zugunsten von Felsensteins Bühne entschieden wurde. Während die Staatsoper auf den allergrößten Teil ihrer West-Berliner Mitglieder verzichten musste, gelang es dem Intendanten der Komischen Oper mit seiner kompromisslosen Haltung, die wie ein Damoklesschwert über dem Fortbestand des Hauses schwebte, den größten Teil seiner West-Berliner Mitarbeiter halten zu können. Dass sich insgesamt über hundert West-Berliner Mitglieder trotz Beibehaltung ihres Wohnsitzes im Westen und damit trotz tagtäglicher Behinderungen beim Übertritt in den östlichen Sektor der Stadt für einen Verbleib an der Komischen Oper entschieden, lag nicht nur an der Aura Felsensteins, sondern auch daran, dass das Ministerium für Kultur für jene West-Berliner ausreichend Devisen bereithielt. So konnte die Bühne mit zweiwöchiger Verspätung die Spielzeit eröffnen und die künstlerische
Zusammenfassung und Ausblick
311
Arbeit an dieser Musterbühne des deutschen sozialistischen Staates reibungslos weitergehen. An der Staatsoper hingegen trat Max Burghardt im Sommer 1962 enttäuscht von seinem Amt zurück, sah er doch seine Bühne zu Recht vom Kulturministerium gegenüber der Komischen Oper als benachteiligt an. Felsenstein übrigens zog Mitte der 1960er-Jahre dann doch von West-Berlin in den Ostteil der Stadt, womit die jahrelangen Bemühungen der DDR ihr Ziel erreichten. Auf der anderen Seite der Mauer blieben bei der Deutschen Oper Einschränkungen in der Spielplangestaltung aus. Anders als in Ost-Berlin, wo durch den Wegfall westlichen Publikums auch die Auslastung der Opernhäuser erheblich sank, konnte der Betrieb im neuen Opernhaus – finanziell maßgeblich von der Bundesregierung subventioniert – reibungslos und ohne Publikumsverluste beginnen. Erst zwei Jahre später gab es, zumindest für die West-Berliner, wieder die Möglichkeit, auch die östliche ‚Schaufenster‘-Hälfte zu begutachten. Durch das Passierscheinabkommen vom 17. Dezember 1963 konnten diese erstmals wieder an Aufführungen der Ost-Berliner Opernbühnen teilnehmen. Im Rahmen der Studie konnte nicht geklärt werden, inwiefern sich die gewonnenen Ergebnisse auf die übrigen Opernbühnen des jeweiligen Systems übertragen und somit verallgemeinern lassen. Zweifel an einer Verallgemeinerung sind jedoch angebracht. Was etwa das Verhältnis gegenüber der kulturellen Moderne, aber auch die Versuche der Etablierung einer sozialistischen deutschen Nationaloper bei der Staatsoper angeht – für die Komische Oper gilt dasselbe –, scheint sich das permanente helle ‚Scheinwerferlicht‘ des ‚Schaufensters‘ insbesondere nach den negativen Erfahrungen mit Brechts/Dessaus Lukullus dahingehend ausgewirkt zu haben, dass man sich im Vergleich mit anderen Bühnen der DDR überdurchschnittlich vorsichtig verhielt, wollte man doch nicht erneut einen das Prestige schädigenden Skandal erregen. Die Städtische Oper wiederum war durch ihre exponierte Lage im ‚Schaufenster‘ westlicher Kultur der Moderne gegenüber möglicherweise in stärkerem Maße aufgeschlossen, als es die anderen westdeutschen Opernbühnen waren. Anknüpfend an die Ergebnisse der Arbeit wäre es interessant zu fragen, inwiefern die deutsch-deutsche Kulturkonkurrenz die Entwicklung der Berliner Opernbühnen in den Jahrzehnten nach dem Mauerbau geprägt hat. Zumindest die ostdeutsche Opernkultur war im Westen in den Jahren der deutsch-deutschen Teilung prinzipiell immer zu rezipieren, ob durch Teilnahme an Auffüh-
312
Zusammenfassung und Ausblick
rungen der Ost-Berliner Bühnen, durch Auftritte einzelner ostdeutscher Künstler beziehungsweise Bühnengastspiele im Westen oder schließlich sogar durch das Fernsehen. Dass etwa in West-Berlin 1981 kein anderer als Götz Friedrich, der die DDR 1972 verlassen hatte, zum Intendanten der Deutschen Oper ernannt wurde, resultierte nicht nur aus künstlerischen Überlegungen, sondern stellte auch einen politischen Schachzug innerhalb der deutsch-deutschen Kulturkonkurrenz dar. Von Gewinn wäre es für die Forschung darüber hinaus, nach den Auswirkungen des deutschlandpolitischen Kurswechsels der SED auf die kulturelle Selbstdarstellung im Bereich der Opernkultur zu fragen. Welche Rolle spielte die ursprungsmythologische Argumentationsfigur, als die DDR in den 1960erJahren begann, sich von der Vorstellung einer einheitlichen Staats- und Kulturnation zu verabschieden ? Fest steht, dass etwa der Begriff „Nationaloper“ in den 1960er-Jahren in dem Maße im Sprachgebrauch verlorenging, in dem die Werke jenes kulturpolitisch anvisierten Genres aus den Spielplänen der Bühnen verschwanden. An die Stelle des Terminus „Nationaloper“ rückte nun zunehmend der allgemeinere Terminus „Gegenwartsoper“.935 Zu fragen wäre darüber hinaus nach der Rolle der kulturellen Moderne in den Spielplänen der Ost-Berliner Bühnen im Schatten der Mauer. Dass sich Brechts/Dessaus Verurteilung des Lukullus schließlich zu einem Paradestück der Staatsoper entwickelte, wurde schon erwähnt. Inwiefern regten sich kulturpolitische Widerstände, als sich die Bühne seit den 1960er-Jahren vor allem mit den Inszenierungen von Ruth Berghaus, der es als Regisseurin insbesondere um die Übertragung von Brechts Konzept des Epischen Theater auf die Oper ging, ästhetisch neu ausrichtete ? Welche Rolle spielte wiederum die kulturelle Moderne an der Komischen Oper seit den 1960er-Jahren ? Bezüglich der Deutschen Oper wäre die Rolle der Bühne im Rahmen der Studentenunruhen 1967/68 von Interesse. Die Tatsache, dass Benno Ohnesorg am 2. Juni 1967 bei einer Demonstration gegen den Schah von Persien vor der Deutschen Oper im Vorfeld einer Galaaufführung von Mozarts Die Zauberflöte erschossen wurde, ist vielleicht nicht ohne symbolische Bedeutung.936 Zu un935 Stöck, „Nationaloperndebatte“, S. 535. 936 Siehe dazu inzwischen : Sven Oliver Müller, „,An Interesting Eastern Potentate‘ ? Staatsauf-
Zusammenfassung und Ausblick
313
tersuchen wäre, ob es in der Folgezeit der Studentenunruhen zu einer sozialen Öffnung des Opernhauses kam. In diesem Kontext wäre der Fokus zudem auf die Auseinandersetzungen um die Etablierung eines politisierten Bildungsbegriffs in den Aufführungen seit den 1960er-Jahren zu legen.937 Eine Sprengung der Opernhäuser freilich, wie sie Pierre Boulez 1967 im Spiegel gefordert hatte, ist von den Bilderstürmern der 1968er Jahre nie umgesetzt worden und heute auch nicht mehr zu befürchten. Selbst Inszenierungen des für seine Provokationen bekannten Hans Neuenfels werden heute von konservativer Seite mit dem Argument der Freiheit der Kunst verteidigt. Dies wurde deutlich am Berliner Idomeneo-Skandal vom September 2006, bei dem die Angst vor einer Sprengung eines Opernhauses in anderer Hinsicht auf groteske Weise wiederauflebte : Die Intendantin der Deutschen Oper Berlin Kirsten Harms hatte wegen der möglichen Gefahr islamistischer Anschläge auf ihr Opernhaus die drei Jahre alte Neuenfels-Inszenierung von Mozarts Idomeneo vom Spielplan abgesetzt. Der von ihr befürchtete Stein des Anstoßes war die Schlussszene der religionskritischen Inszenierung, in der die Titelfigur die abgeschlagenen Häupter von Poseidon, Buddha, Jesus und Mohammed auf die Bühne bringt. Künstler und hochrangige Politiker aller Parteien beanstandeten die Entscheidung von Harms als einen nicht hinzunehmenden Akt von Selbstzensur und forderten eine Wiederansetzung des Werkes. So kam die Inszenierung, von einem internationalen Medieninteresse begleitet, unter großen Sicherheitsvorkehrungen am 18. Dezember 2006 wieder auf den Spielplan. Wenn es den Befürwortern der Aufführung im Skandal um „unsere Vorstellungen von Offenheit, Toleranz und Freiheit“938 beziehungsweise um das „Theater als moralische Anstalt eines aufgeklärten westlichen Geistes“939 ging, wird deutlich, dass die Oper in Deutschland ihre einstige Funktion, zur Konstruktion einer nationalen Gemeinschaft beizutragen, zugunsten einer europäischen Identitätsstiftung verloren hat. führungen für den Schah von Persien in Berlin – 1873 und 1967“, in : Müller (u.a.), Oper, S. 277–300. 937 Siehe zu diesem Aspekt allgemein : Jungheinrich, „Aspekte“. 938 „Das ist verrückt“, in : zeit.de (26.09.2006). URL : http ://www.zeit.de/online/2006/39/Idomeneo (Stand 02.09.2007). 939 Manuel Brug, „Deutsche Oper setzt Mozart-Stück“ ab, in : welt.de (25.09.2006). URL : http :// www.welt.de/kultur/article155469/Deutsche_Oper_setzt_Mozart-Stueck_ab.html (Stand 02. 09.2007).
Anhang
Quellen- und Literaturverzeichnis 1. Quellen a) Archivalien
Landesarchiv Berlin (LAB)
Deutsche Staatsoper (C Rep. 167) Nr. 1, 5, 6, 7, 9,11, 14, 22, 24, 26, 30, 31, 36, 37, 44, 45, 46, 432. Grundorganisation der SED – Staatsoper (C Rep. 904–093) Nr. 12. Magistrat von Berlin, Oberbürgermeister (C Rep. 101) Nr. 1726, 1871. Magistrat von Berlin, Abteilung Volksbildung (C Rep. 120) Nr. 103, 1639, 1906, 1964, 2383, 3316. Magistrat von Berlin, Abteilung Kultur (C Rep. 121) Nr. 112, 243, 291, 337, 430, 607, 893. Magistrat von Berlin, Chefarchitekt (C Rep. 110–01) Nr. 7, 22, 73,78. Freier Deutscher Gewerkschaftsbund (FDGB), Bezirksorganisation Berlin (C Rep. 910 [2]) Nr. 8251. Der Regierende Bürgermeister/Senatskanzlei (B Rep. 002) 758, 1470–1474, 2151–2152, 2642, 3160, 3283, 3435, 3526, 5497, 8835, 9098, 11487, 11537/1–2, Acc. 1636, Nr. 2160–2162/2070, Acc. 2186, Nr. 36/52/53, Acc. 1703, Nr. 2218–2219. Senatsverwaltung für Wissenschaft und Forschung (B Rep. 014) Nr. 207, 245, 262, 348–349, 597, 1139–1143, 1250–1252, 1301, 1375, 1394–1395,
316
Anhang
1399, 1635, 1653, 2121–2124, 2132–2133, 2168, 2139–2140, 2172, 2186, 2252, 2254, 2260, 2274–2277, 2467–2477, 2502, 2519, 3097, 3148, 3183.
Bundesarchiv (BArch)
Protokolle des Politbüros des ZK der SED [SAPMO] DY 30/ IV 2/2/ 241, 243 ; DY 30/ J IV 2/2/ 411, 413, 417, 440. Abteilung Kultur des ZK der SED [SAPMO] DY 30/ IV 2/9.06/ 194 ; DY 30/ IV 2/9.06/ 287. Zentralkommitee der SED, Büro Alfred Kurella [SAPMO] DY 30/ IV 2/2.026/70. Staatliche Kommission für Kunstangelegenheiten / Ministerium für Kultur (DR 1) Nr. 213, 6080–6082, 6112, 6117, 8321, 18007, 18253, 18158, 18059, 18060. 18199, 18167, 18253, 18117. Ministerium für Aufbau (DH 1) Nr. 39022, 43636, 43722, 43849, 44234, 44329, 44476. Bauakademie der DDR (DH 2) Nr. 20019, 20081, 20241. Nachlass Otto Grotewohl (NY 4090) Nr. 544, 534, 205. Nachlass Wilhelm Pieck (NY 4036) Nr. 681.
Archiv der Akademie der Künste (AdK, Berlin)
Nachlass Ernst Legal Nr. 417, 1456, 3155-3156, 3304, 3329, 3389-3390, 3391, 3387-3389, 3395-3397, 3398-3399, 3401, 3412. Nachlass Max Burghardt Nr. 5, 89, 279, 286, 293, 296, 299, 321, 355, 384, 414, 417-419, 415, 420-435, 437, 439, 444, 446, 449, 458-463, 462.
Quellen- und Literaturverzeichnis
317
Nachlass Walter Felsenstein Nr. 39, 63, 65, 77, 79, 95, 97, 99, 101-102, 119-121, 556, 720, 751, 758, 760, 774, 798, 808, 831 (1), 984, 972, 1488, 1544, 1558, 1951, 2541-2545, 2549, 2709, 2759, 2764-2765, 2768, 3047, 3050, 3053, 3191, 3248, 3383, 3403, 3411, 3416, 3419, 3434, 3439, 3456, 3810, 3820, 3901, 4417, 4459, 4671, 4768-4769, 4939, 4999, 5004, 52605262, 5405. Nachlass Heinz Tietjen Nr. 13, 28-29, 77, 82, 226-227, 269, 263, 265, 309, 311, 364, 366, 370, 382, 478, 513, 520, 586, 618, 621, 624, 625-630, 639, 642, 716, 718, 721. Nachlass Carl Ebert Nr. 239-240, 245-246, 248, 249, 252, 254-255, 257, 274, 308, 326-328, 340, 343-344, 341, 346, 348, 350, 400, 454, 593-596, 696, 721, 809, 894, 1056, 1076, 1087, 1091, 1097, 1015, 1217, 1234, 1250, 1303, 1308, 1311, 1334, 1370, 1384, 1402, 1406, 1498, 1518, 1556, 1723, 1828, 2459, 2504, 2507, 2567, 2943, 2594. Nachlass Boris Blacher Nr. 349, 278. Nachlass Jean Kurt Forest Nr., 44, 74, 98, 460-461, 511, 513-514, 558, 563, 567.
Historisches Archiv der Akademie der Künste
AdK-O 477, AdK-W 126, AdK-W 127-7, AdK-W 163-2, AdK-W 788.
Historisches Archiv der Universität der Künste Berlin
Handakten Boris Blacher (Bestand 11) Nr. 11.
Deutsches Rundfunkarchiv Babelsberg
„Staatsakt zur Eröffnung der wiederaufgebauten Staatsoper Unter den Linden am 4. September 1955“ (DOK 497).
318
Anhang
rbb-Archiv
„Einweihung der Deutschen Oper am 24. September 1961” (Nr. 901445). b) Zeitungen und Zeitschriften
Bauwelt Berliner Morgenpost Berliner Zeitung Bühnentechnische Rundschau Deutsche Architektur Frankfurter Allgemeine Zeitung Der Kurier Melos Musik und Gesellschaft National-Zeitung Neues Deutschland Die Neue Zeitung Süddeutsche Zeitung Tägliche Rundschau Der Tagesspiegel Der Telegraf Theater der Zeit c) Zeitgenössische Literatur und gedruckte Quellen
„Abonnementspläne der Städtischen Oper. Carl Ebert – ihr neuer Leiter“, in : Blätter der Freien Volksbühne 7 (1954), Heft 4, S. 19–21. Theodor W. Adorno, „Die gegängelte Musik“, in : Theodor W. Adorno, Gesammelte Schriften, Bd. 14, Frankfurt/M. 1973, S. 51–66. Ders., „Theater, Oper, Bürgertum“, in : Egon Vietta (Hg.), Darmstädter Gespräch. Theater, Darmstadt 1955, S. 119–134. Günter Altmann, „Die neue Oper im Musikunterricht. Eine Einführung in Jean Kurt Forests Oper ‚Der arme Konrad‘“, in : Musik in der Schule 13 (1962), S. 61–70 und 75. „Aus der Arbeit unserer Kommissionen und Sektionen : Erste Tagung der Kommission ‚Oper‘“, in : Musik und Gesellschaft 3 (1953). Heinz Bär, „Wahllose Wagnerei“, in : Theater der Zeit 13 (1958), Heft 7, S. 20–22. Gerth-Wolfgang Baruch, „Die Galerie lebt“, in : Programmhefte der Städtischen Oper Berlin, Spielzeit 1957/58, S. 76–78.
Quellen- und Literaturverzeichnis
319
Paul Baumgarten, „Der Umbau des Deutschen Opernhauses in Charlottenburg“, in : Zentralblatt der Bauverwaltung 56 (1936), S. 45–52. Ders., „Die bauliche Erneuerung des Deutschen Opernhauses“, in : Das Theater 16 (1935), S. 203–206. Johannes R. Becher, „Programmerklärung zur Verteidigung der Einheit der deutschen Kultur“, in : Sinn und Form 6 (1954), S. 279–321. Ludwig Berger, „Ironie und Karikatur“, in : Programmheft der Berliner Festwochen, Preußisches Märchen (1952), o. S. Kurt Blaukopf, Große Dirigenten, Teufen 1953. Igor Boelza, „Richard Wagner im russischen Musikleben“, in : Die Neue Gesellschaft. Populärwissenschaftliche und kulturpolitische Monatsschrift der Gesellschaft für DeutschSowjetische Freundschaft 4 (1951), S. 865–870 und 976–978. Fritz Bornemann, „Gedanken zum Wiederaufbau des Deutschen Opernhauses Berlin“, in : Bühnentechnische Rundschau 52 (1958), Heft 3, S. 10–11. Ders., „Opernraum und Kommunikation“, in : Deutsche Oper Berlin. Zur festlichen Eröffnung des Hauses. September 1961, Berlin 1961, o. S. Willy Brandt, [Grußwort], in : Deutsche Oper Berlin. Zur festlichen Eröffnung des Hauses. September 1961, Berlin 1961, o. S. Max Burghardt, Ich war nicht nur Schauspieler, Berlin 1973. Ders., [Vorwort], in : Programmheft Die Meistersinger von Nürnberg (Deutsche Staatsoper Berlin 1955), o. S. Ulrich Conrads, „Die Deutsche Oper Berlin“, in : Bauwelt 52 (1961), S. 1285–1289. Deutsche Staatsoper Unter den Linden. Zur Wiedereröffnung des Hauses Unter den Linden am 4. September 1955, Berlin 1955. Eduard Devrient, Das Nationaltheater des Neuen Deutschlands. Eine Reformschrift, Leipzig 1849. „Der dornige Weg zu unserem Ziel : Die deutsche Nationaloper“, in : Musik und Gesellschaft 5 (1955), S. 84–86. Ulrich Dibelius und Frank Schneider (Hg.), Neue Musik im geteilten Deutschland. Dokumente aus den fünfziger Jahren, Berlin 1993. Hanns Eisler, Musik und Politik. Schriften 1924–1948, Leipzig 1973. Ders., Musik und Politik. Schriften 1948–1962, Leipzig 1982. Walter Felsenstein, „Zum Beginn. Aus dem Programmheft der Eröffnungspremiere der Komischen Oper am 23. Dezember 1947“, in : Walter Felsenstein, Schriften. Zum Musiktheater, Berlin 1976, S. 21–22. Ders., „Rede aus Anlaß der Lizenzüberreichung (1947)“, in : Walter Felsenstein, Schriften. Zum Musiktheater, Berlin 1976, S. 19–21. Ders., „Über das neue Publikum. Aus einer Ansprache an das Ensemble (1949)“, in : Walter Felsenstein, Schriften. Zum Musiktheater, Berlin 1976, S. 30.
320
Anhang
Ders., „[An den Magistrat von Groß-Berlin/Stadtrat]“ (16.04.1957), in : Walter Felsenstein, Die Pflicht, die Wahrheit zu finden. Briefe und Schriften eines Theatermannes. Aus Materialien des Felsenstein-Archivs der Stiftung Archiv der Akademie der Künste BerlinBrandenburg. Hg. Ilse Kobán, Frankfurt/M. 1997, S. 273–275. Ders. und Siegfried Melchinger, Musiktheater, Bremen 1961. Eduard Fürstenau, „Das Opernhaus im Laufe der Zeiten“, in : Julius Kapp (Hg.), 185 Jahre Staatsoper. Festschrift zur Wiedereröffnung des Opernhauses Unter den Linden am 28. April 1928, Berlin 1928, S. 119–168. Götz Friedrich, Die Zauberflöte in der Inszenierung Walter Felsensteins an der Komischen Oper 1954, Berlin 1958. Wilhelm Furtwängler, Gespräche über Musik, Zürich 1948. Ottmar Gerster, „Um die deutsche Nationaloper (1956)“, in : Stephan Stompor (Hg.), Komponisten der DDR und ihre Opern, 2. Teil : Textbeiträge zu einzelnen Werken, Berlin 1979. Horst Goerges, „Bemerkungen über Publikum, Spielplan und Abonnement“, in : Programmhefte der Städtischen Oper Berlin, Spielzeit 1957/58, S. 61–64. Hermann Göring, [Geleitwort], in : Julius Kapp, Geschichte der Staatsoper Berlin, Berlin 1937, o. S. Will Grohmann, „Die Gesellschaft der Musen“, in : Deutsche Oper Berlin. Zur festlichen Eröffnung des Hauses. September 1961, o. S. Otto Grotewohl, „Ein Wort auf den Weg“, in : Deutsche Staatsoper Unter den Linden. Zur Wiedereröffnung des Hauses Unter den Linden am 4. September 1955, Berlin 1955, S. 5–6. Werner Harting, „Gedanken zum Wettbewerb des ‚Deutschen Opernhauses‘ in Berlin“, in : Bauwelt 44 (1953), S. 621–622. Heinz Hofmann, „Theaterbesuch zu billig ? Wir sprachen mit Verwaltungsdirektoren und Werbeleitern“, in : Theater der Zeit 11 (1956), Heft 8, S. 37–40. Hanns Hopp, „Die Entwürfe zum Nationaltheater in Mannheim“, in : Deutsche Architektur 3 (1954), S. 212–215. Herbert Ihering, Berliner Dramaturgie, Berlin 1947. Die Kabinettsprotokolle der Bundesregierung, bearbeitet von Ulrich Enders und Jörg Filthaut, Bd. 14, 1961, München 2004. Manfred Klee, „Jugend und Oper“, in : Programmhefte der Städtischen Oper Berlin, Spielzeit 1957/58, S. 31–34. Ilse Kobán (Hg.), Walter Felsenstein. Theater. Gespräche – Briefe – Dokumente, Berlin 1991. Die Komische Oper Berlin 1947–1954, Berlin 1954. Hellmut Kotschenreuther, „Reaktion, Restauration oder Revision ?“, in : Harald Kunz (Hg.), Musikstadt Berlin zwischen Krieg und Frieden. Musikalische Bilanz einer Viermächtestadt, Berlin 1956, S. 187–210.
Quellen- und Literaturverzeichnis
321
Ernst Krause, „Aus dem Musikleben. Deutsch-französischer Musikaustausch. Die Berliner Staatsoper in Paris“, in : Musik und Gesellschaft 9 (1954), S. 273–274. Grigorij V. Kristi, Stanislawskis Weg zur Oper, Berlin 1954. Karl Laux (Hg.), Das Musikleben in der Deutschen Demokratischen Republik (1945–1959), Leipzig o. J. [1963]. Ders., „‚Die moderne Musik ist tot‘. In Amerika und anderswo – in der DDR feiert sie fröhliche Urständ“, in : Musik und Gesellschaft 5 (1955), S. 212–214. Gotthold Ephraim Lessing, Hamburgische Dramaturgie, in : Sämtliche Schriften, Bd., 9, herausgegeben von Karl Lachmann, 3. durchges. u. verm. Aufl., Leipzig/Berlin 1886–1924. Gustav Leuteritz, „Wagner und die deutsche Einigung“, in : Aufbau 4 (1948), S. 675– 682. Joachim Lucchesi (Hg.), Das Verhör in der Oper. Die Debatte um die Aufführung „Das Verhör des Lukullus“ von Bertolt Brecht und Paul Dessau, Berlin 1993. Thomas Mann, Betrachtungen eines Unpolitischen, Berlin 1918. Ders., Versuch über das Theater, in : Essays, Bd. 1 : Frühlingssturm 1893–1918, herausgegeben von Hermann Kurzke und Stephan Stachorski, Frankfurt/M. 1993, S. 53–93. Hans Mayer, „Richard Wagners geistige Entwicklung“, in : Sinn und Form 6 (1954), S. 111–162. Ders., „Richard Wagners ‚Meistersinger‘ in ihrer und in unserer Zeit“, in : Programmheft Die Meistersinger von Nürnberg (Deutsche Staatsoper Berlin 1955), o. S. Alois Melichar, Die Überwindung des Modernismus. Konkrete Antwort an einen abstrakten Kritiker, Frankfurt/M. 1954. Ders., Musik in der Zwangsjacke. Die deutsche Musik zwischen Orff und Schönberg, Wien 1958. Ders., Schönberg und die Folgen. Eine notwendige kulturpolitische Auseinandersetzung, o. O. 1960. Ernst H. Meyer, „Realismus – die Lebensfrage der deutschen Musik“, in : Musik und Gesellschaft 1 (1951), S. 38–43. „Monteure am Eisernen Vorhang. Zu einer politischen Maßnahme der Westberliner Kulturfunktionäre“, in : Theater der Zeit 6 (1951), Heft 16, S. 23–26. Hans Joachim Moser, Die Musik der deutschen Stämme, Wien/Stuttgart 1957. Karl Hermann Müller, „Richard Wagner auf der Bühne des Deutschen Opernhauses“, in : Das Theater 16 (1935), S. 216–217. Richard Paulick, „Die künstlerischen Probleme des Wiederaufbaus der Deutschen Staatsoper Unter den Linden“, in : Deutsche Architektur 1 (1952), S. 30–39. Ders., „Die Innenarchitektur der Deutschen Staatsoper“, in : Deutsche Architektur 2 (1953), S. 265–270. Ders., „Zum Wiederaufbau der Deutschen Staatsoper“, in : Deutsche Staatsoper Berlin.
322
Anhang
Zur Wiedereröffnung des Hauses Unter den Linden am 4. September 1955, Berlin 1955, S. 79–92. Ders., „Der Wiederaufbau der Deutschen Staatsoper Berlin“, in : Bühnentechnische Rundschau 45 (1955), Heft 5, S. 11–13. Ders., „Über die Innenarchitektur der Deutschen Staatsoper Berlin“, in : Deutsche Architektur 4 (1955), S. 436–445. Julius Petersen, Das deutsche Nationaltheater. Fünf Vorträge, gehalten im Februar und März 1917 im Freien deutschen Hochstift zu Frankfurt a. M., Leipzig/Berlin 1919. Programmheft Die Meistersinger von Nürnberg (Deutsche Staatsoper Berlin, 1955). Fritz Reuter, „Zur Frage der deutschen Nationaloper“, in : Musik und Gesellschaft 5 (1955), S. 156–157. Günter Rimkus, „Der arme Konrad“, in : Programmheft Der arme Konrad (Deutsche Staatsoper Berlin, 1959). Wilhelm Rode, „Das Deutsche Opernhaus. Seine deutsche Mission“, in : Das Theater 16 (1935), S. 202. Heinrich Theodor Rötscher, „Theater und dramatische Poesie in ihrem Verhältnisse zum Staate“, in : Carl von Rotteck und Carl Welcker (Hg.), Das Staats-Lexikon. Enzyklopädie der sämmtlichen Staatswissenschaften für alle Stände. Zwölfter Band, neue durchaus verbesserte und vermehrte Auflage, Altona 1848, S. 556–569. Marcel Rubin, „Was bedeutet uns Schönberg ? Eine Antwort an Hanns Eisler“, in : Musik und Gesellschaft 5 (1955), S. 274–275. Ders., „Alban Berg und die Zukunft der Schönberg-Schule“, in : Musik und Gesellschaft 5 (1955), S. 384–386. Josef Rufer, Das Werk Arnold Schönbergs, Kassel 1959. Ders., „Rede auf Arnold Schönberg“, in : Melos 24 (1957), S. 345–349. Ludwig Schiedermair, Die deutsche Oper. Grundzüge ihres Werdens und Wesens, Leipzig 1930. Friedrich Schiller, Werke. Nationalausgabe, Weimar/Berlin 1943ff. Rolf Schmalor (Hg.), Theater und Konzerthäuser. Architektur-Wettbewerbe, Stuttgart 1960. Hans-Jürgen Schmitt und Godehard Schramm (Hg.), Sozialistische Realismuskonzeptionen. Dokumente zum I. Allunionskongreß der Sowjetschriftsteller, Frankfurt/M. 1976. Gustav Rudolf Sellner, [Grußwort], in : Deutsche Oper Berlin. Zur festlichen Eröffnung des Hauses. September 1961, Berlin 1961, o. S. Arnold Schönberg, Moses und Aron. Oper in drei Akten. Textbuch, Mainz u.a. 1957. Karl Schönewolf, „Schöpferische Verwandlung. Zur Erneuerung des Operntheaters“, in : Theater der Zeit 5 (1950), Heft 11, S. 13–14. Ders., „Oper und Gesellschaft II. Widersprüche im Zusammenhang“, in : Theater der Zeit 6 (1951), Heft 7, S. 16–18.
Quellen- und Literaturverzeichnis
323
Ders., „Fünf Jahre ‚Komische Oper‘“, in : Komische Oper 1947–1952 [Dokumentation], Berlin o. J. [1952], S. 2–12. Elimar Schubbe (Hg.), Dokumente zur Kunst-, Literatur- und Kulturpolitik der SED, Stuttgart 1972, S. 239–240. „Sorgenkind Oper. Zur Fachtagung des VDK in Berlin“, in : Musik und Gesellschaft 7 (1957), S. 135–136. Stenographische Berichte des Abgeordnetenhauses von Berlin, 1.–4. Wahlperiode, Berlin 1951ff. Stephan Stompor, „Auf dem Weg zu einem deutschen Musiktheater“, in : Musik und Gesellschaft 4 (1954), S. 183–185. Ders., „Wahrheitstreue und lebendige Gestaltung auf unseren Opern- und Operettenbühnen“, in : Musik und Gesellschaft 4 (1954) S. 122–126. Otto Suhr, „Wirtschaftlicher Aufschwung, soziale Sicherheit, geistige Ausstrahlungskraft (Richtlinien der Regierungspolitik)“, in : Otto Suhr, Eine Auswahl aus Reden und Schriften, Tübingen 1967, S. 385–399. Joachim Tenschert, „Die Schaubühne – moralische Anstalt“, in : Theater der Zeit 10 (1955), Heft 8, S. 1–6. Werner Thalheim, „Theater – Betriebe – Gewerkschaften“, in : Theater der Zeit 10 (1955), Heft 10, S. 44–46. Walther Unruh, „Die Bühnentechnik in der Deutschen Oper Berlin“, in : Bauwelt 28 (1961), S. 805–807. Hans Rudolf Vaget (Hg.), Im Schatten Wagners. Thomas Mann über Richard Wagner. Texte und Zeugnisse 1895–1955, Frankfurt/M. 1999. Richard Wagner, Sämtliche Schriften und Dichtungen. Volks-Ausgabe, 16 Bände, Leipzig o. J. Kurt Westphal, „Das Publikum und die Neue Musik“, in : Harald Kunz (Hg.), Musik stadt Berlin zwischen Krieg und Frieden. Musikalische Bilanz einer Viermächtestadt, Berlin 1956, S. 174–187. Ders, „Tradition und Fortschritt in der Neuen Musik“, in : Musikerziehung. Zeitschrift zur Erneuerung der Musikpflege 6 (1952), S. 72–78. Erika Wilde, „Der mystische Gral deutscher Kunst. ‚Lohengrin‘ von Richard Wagner in der Staatsoper Berlin“, in : Theater der Zeit 13 (1958), Heft 8, S. 35–36. K. H. Wuthe, „Das Opernhaus an der Bismarckstraße“, in : Deutsche Oper Berlin. Zur feierlichen Eröffnung des Hauses. September 1961, Berlin 1961. 2. Literatur Benedict Anderson, Imagined Communities. Reflections on the Origins and Spread of Nationalism, 2. Auflage, London 1990.
324
Anhang
Jan Andres, Alexa Geisthövel und Matthias Schwengelbeck (Hg.), Die Sinnlichkeit der Macht. Herrschaft und Repräsentation seit der frühen Neuzeit, Frankfurt/M./New York 2005. Christl Anft, Ernst Legal (1881–1955). Schauspieler, Regisseur, Theaterleiter. Ein bürgerlich-humanistischer Künstler im gesellschaftlichen und ästhetischen Strukturwandel der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, Berlin 1981. Klaus Angermann (Hg.), Paul Dessau – Von Geschichte gezeichnet. Symposion Paul Dessau Hamburg 1994, Hofheim 1995. Celia Applegate und Pamela Potter (Hg.), Music and German National Identity, Chicago 2002. Klaus Arnold, Kalter Krieg im Äther. Der Deutschlandsender und die Westpropaganda der DDR, Münster/Hamburg/London 2002. Ders. und Christoph Classen (Hg.), Zwischen Pop und Propaganda. Radio in der DDR, Berlin 2004. Olaf Asendorf, Wolfgang Voigt und Wilfried Wang (Hg.), Botschaften. 50 Jahre Auslandsbauten der Bundesrepublik Deutschland. Eine Ausstellung des Deutschen Architekturmuseums, Bonn 2000. Henry Bair, „Die Lenkung der Berliner Opernhäuser“, in : Hanns-Werner Heister und Hans-Günter Klein (Hg.), Musik und Musikpolitik im faschistischen Deutschland, Frankfurt/M. 1984, S. 83–90. Oswald Georg Bauer, „Reinster Idealismus und unzulängliche Realisierung. Die wiedergefundenen Entwürfe von Josef Hoffmann zum Ring des Nibelungen der ersten Bayreuther Festspiele 1876“, in : Die Szene als Modell. Die Bühnenbildmodelle des RichardWagner-Museums und der „Ring des Nibelungen“ in Bayreuth 1876–2000, München/ Berlin 2006, S. 17–36. Ruth Bereson, The Operatic State. Cultural Policy and the Opera House, London/New York 2002. Michael Berg, Albrecht von Massow und Nina Noeske (Hg.), Zwischen Macht und Freiheit. Neue Musik in der DDR, Köln/Weimar/Wien 2004. Werner Bergmann, „Die antisemitische Schmierwelle 1959/1960“, in : Werner Bergmann und Rainer Erb (Hg.), Antisemitismus in der politischen Kultur nach 1945, Opladen 1990, S. 253–275. Ders., Antisemitismus in öffentlichen Konflikten. Kollektives Lernen in der politischen Kultur der Bundesrepublik 1949–1989, Frankfurt/M./New York 1997. Ders., Geschichte des Antisemitismus, München 2002. Udo Bermbach, Der Wahn des Gesamtkunstwerks. Richard Wagners politisch-ästhetische Utopie, zweite, überarbeitete und erweiterte Auflage, Stuttgart/Weimar 2004. Ders. (Hg.), Oper im 20. Jahrhundert. Entwicklungstendenzen und Komponisten, Stuttgart/Weimar 2000.
Quellen- und Literaturverzeichnis
325
Ders., „Das ästhetische Motiv in Wagners Antisemitismus. ‚Das Judentum in der Musik‘ im Kontext der Züricher Kunstschriften“, in : Dieter Borchmeyer, Ami Maayani und Susanne Vill (Hg.), Richard Wagner und die Juden, Stuttgart/Weimar 2000, S. 55–76. Gaetano Biccari, „Zuflucht des Geistes ?“ Konservativ-revolutionäre, faschistische und nationalsozialistische Theaterdiskurse in Deutschland und Italien 1900–1944, Tübingen 2001. Fabian Bien, „‚Bedürfnis aller Werktätigen‘ ? – Zur Etablierung eines neuen Opernpublikums in der DDR am Beispiel der Ost-Berliner Komischen Oper in den 1950er Jahren“, in : Sven Oliver Müller u.a. (Hg.), Oper im Wandel der Gesellschaft. Kulturtransfers und Netzwerke des Musiktheaters im modernen Europa, Wien/München 2010, S. 57–68. Joachim Birke, „Gottsched’s Opera Criticism and Its Literary Sources“, in : Acta Musicologica 43 (1960), S. 194–200. Wesley Blomster, „The Reception of Arnold Schoenberg in the German Democratic Republic“, in : Perspectives of New Music 21 (1982/1983), S. 114–137. Sylvia Börner, Die Kunstdebatten 1945 bis 1955 in Ostdeutschland als Faktoren ästhetischer Theoriebildungsprozesse, Frankfurt/M./Bern/New York 1993. Georg Bollenbeck, Tradition, Avantgarde, Reaktion. Deutsche Kontroversen um die kulturelle Moderne 1880–1945, Frankfurt/M. 1995. Ders., Bildung und Kultur. Glanz und Elend eines deutschen Deutungsmusters, Frank furt/M./Leipzig 1994. Ders., „Die fünfziger Jahre und die Künste. Kontinuität und Diskontinuität“, in : Georg Bollenbeck und Gerhard Kaiser (Hg.), Die janusköpfigen 50er Jahre. Kulturelle Moderne und bildungsbürgerliche Semantik III, Wiesbaden 2000, S. 190–213. Ders. und Gerhard Kaiser (Hg.), Die janusköpfigen 50er Jahre. Kulturelle Moderne und bildungsbürgerliche Semantik III, Wiesbaden 2000. Werner Bollert, 50 Jahre Deutsche Oper Berlin, Berlin 1962. Dieter Borchmeyer, Das Theater Richard Wagners. Idee – Dichtung – Wirkung, Stuttgart 1982. Ders., Weimarer Klassik. Portrait einer Epoche, aktualisierte Neuausgabe, Weinheim 1998. Ders., Richard Wagner. Ahasvers Wandlungen, Frankfurt/M./Leipzig 2002. Ders., Ami Maayani und Susanne Vill (Hg.), Richard Wagner und die Juden, Stuttgart/ Weimar 2000. Gianmario Borio und Hermann Danuser (Hg.), Im Zenit der Moderne. Die internationalen Ferienkurse für Neue Musik Darmstadt 1946–1966, 4 Bd., Freiburg 1997. Gianmario Borio, „Zwölftonmusik im Prozeß ihrer Rezeption“, in : Gianmario Borio und Hermann Danuser (Hg.), Im Zenit der Moderne. Die internationalen Ferienkurse für Neue Musik Darmstadt 1946–1966, Bd. 1, Freiburg 1997, S. 171–212. Detlef Brandenburg, „Wahn und Welt. Politische Aspekte der Rezeption von Wagners Ring des Nibelungen in der Bundesrepublik Deutschland nach 1945“, in : wagnerspectrum 1/2006, Würzburg 2006, S. 11–61.
326
Anhang
Heinrich Braunlich, Die Volksbühne. Theater und Politik in der deutschen Volksbühnenbewegung, Berlin 1976. Robert Braunmüller, Oper als Drama. Das „realistische Musiktheater“ Walter Felsenstein, Tübingen 2002. Günter de Bruyn, Unter den Linden, München 2002. Heinz Bude und Bernd Greiner (Hg.), Westbindungen. Amerika in der Bundesrepublik, Hamburg 1999. Hans Bunge, Die Debatte um Hanns Eislers „Johann Faustus”. Eine Dokumentation, Berlin 1991. Max W. Busch, Die Deutsche Oper Berlin. Das Haus in der Bismarckstraße und seine Vorgänger, Berlin 1986. Joy Haslam Calico, The politics of Opera in the German Democratic Republic 1945–1961, Ph.D. diss., Duke University 1999. Dies., „‚Für eine deutsche Nationaloper‘ : Opera in the Discourses of Unification and Legitimation in the German Democratic Republic“, in : Celia Applegate und Pamela Potter (Hg.), Music and German National Identity, Chicago 2002, S. 190–204. Dies., „Jüdische Chronik : The Third Space of Commemoration between East and West Germany“, in : The Musical Quarterly 88 (2005), S. 95–122. David Caute, The Dancer Defects. The Struggle for Cultural Supremacy During the Cold War, Oxford 2003. Christophe Charle und Daniel Roche (Hg.), Capitales culturelles – Capitales symboliques. Paris et les expériences européennes XVIII–XXe siècles, Paris 2002. Attila Csampai und Dietmar Holland (Hg.), Richard Wagner. Die Meistersinger von Nürnberg. Texte, Materialien, Kommentare, Reinbek bei Hamburg 1987. Hans Curjel, Experiment Krolloper 1927–1931, München 1975. Carl Dahlhaus, Die Musik des 19. Jahrhunderts, Laaber 1980. Ute Daniel, Hoftheater. Zur Geschichte des Theaters und der Höfe im 18. und 19. Jahrhundert, Stuttgart 1995. Dies., „Clio unter Kulturschock. Zu den aktuellen Debatten der Geschichtswissenschaft“, in : Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 48 (1997), S. 195–219 und 259–278. Dies., „Geschichte schreiben nach der ‚kulturalistischen Wende‘“, in : Archiv für Sozialgeschichte 43 (2003), S. 576–599, hier S. 590–591. Hermann Danuser und Herfried Münkler (Hg.), Deutsche Meister – böse Geister ? Nationale Selbstfindung in der Musik, Schliengen 2001. Das „Dritte Reich“ und die Musik, Berlin 2006. Andreas W. Daum, Kennedy in Berlin. Politik, Kultur und Emotionen im Kalten Krieg, Paderborn u.a. 2003. Marion Demuth (Hg.), Das Deutsche in der Musik. Kolloquium im Rahmen der 5. Dresdner Tage der zeitgenössischen Musik vom 1.–10. Oktober 1991, Leipzig/Dresden 1997.
Quellen- und Literaturverzeichnis
327
Gerd Dietrich, Politik und Kultur in der Sowjetischen Besatzungszone Deutschlands (SBZ) 1945–1949, Frankfurt/M. 1993. Diana Diskin, „Schlachtfeld Berlin : Carl Ebert und die Uraufführung von Kurt Weills Die Bürgschaft“, in : Nils Grosch (Hg.), Aspekte des modernen Musiktheaters in der Weimarer Republik, Münster u.a. 2004, S. 225–265. Duilio Abelardo Dobrin, Erich Kleiber. The Argentine Experience (1926–1949), Muncie/ Indiana 1981. Anselm Doering-Manteuffel, Wie westlich sind die Deutschen ? Amerikanisierung und Westernisierung im 20. Jahrhundert, Göttingen 1996. Andreas Dörner, Politischer Mythos und symbolische Politik. Der Hermann-Mythos : zur Entstehung des Nationalbewußtseins der Deutschen, Reinbek 1996. Gabi Dolff-Bonekämper und Franziska Schmidt, Das Hansaviertel – Internationale Nachkriegsmoderne in Berlin, Berlin 1999. Dreißig Jahre Deutsche Oper Berlin 1961–1991. Beiträge zum Musiktheater 10, Berlin 1991. Duden. Das große Fremdwörterbuch. Herkunft und Bedeutung der Fremdwörter, 2., neu bearbeitete und erweiterte Auflage, Mannheim u.a. 2000. Albrecht Dümling, „Zwischen Engagement und Formalismus. Zur west-östlichen Rezeption von Brecht-Dessaus zwei ‚Lukullus‘-Fassungen“, in : Hanns-Werner Heister und Dietrich Stern (Hg.), Musik 50er Jahre, Berlin 1980, S. 172–189. Matthias Duncker, Richard-Wagner-Rezeption in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) und der Deutschen Demokratischen Republik (DDR), Hamburg 2009. Werner Durth, Jörn Düwel und Niels Gutschow, Architektur und Städtebau der DDR. Bd. 1 : Ostkreuz. Personen, Pläne, Perspektiven ; Bd. 2 : Aufbau. Städte, Themen, Dokumente, Frankfurt/M./New York 1998/1999. Jens-Fietje Dwars, Abgrund des Widerspruchs. Das Leben des Johannes R. Becher, Berlin 1998. Rolf Ebbighaus und Sighard Neckel (Hg.), Anatomie des politischen Skandals, Frank furt/M. 1989. Peter Ebert, In this theatre of man’s life. The biography of Carl Ebert, Lewes 1999. Jörg Echternkamp, Der Aufstieg des deutschen Nationalismus, Frankfurt/M./New York 1998. Nora Eckert, Der Ring des Nibelungen und seine Inszenierungen von 1976 bis 2001, Hamburg 2001. Dies., Von der Oper zum Musikdrama, Wegbereiter und Regisseure, Berlin 1995. Murray Edelman, Politik als Ritual. Die symbolische Funktion staatlicher Institutionen und politischen Handelns, Frankfurt/M./New York 1976. Tilo Eggeling, Studien zum friderizianischen Rokoko. Georg Wenceslaus von Knobelsdorff als Entwerfer von Innendekorationen, Berlin 1980.
328
Anhang
Lothar Ehrlich und Gunther Mai (Hg.), Weimarer Klassik in der Ära Ulbricht, Köln/ Weimar/Wien 2000. Dies., (Hg.), Weimarer Klassik in der Ära Honecker, Köln/Weimar/Wien 2001. Stefanie Endlich, „Stählernes Ausrufungszeichen für reinen Klang. Uhlmanns Skulptur für Bornemanns Oper“, in : Susanne Schindler (Hg.), Inszenierte Moderne. Zur Architektur von Fritz Bornemann, Berlin 2003, S. 68–71. Helmut Engel und Wolfgang Ribbe (Hg.), Via triumphalis. Geschichtslandschaft „Unter den Linden“ zwischen Friedrich-Denkmal und Schlossbrücke, Berlin 1997. Eva von Engelberg-Dočkal, „Bornemanns Bibliotheken in Berlin und Bonn“, in : Susanne Schindler (Hg.), Inszenierte Moderne. Zur Architektur von Fritz Bornemann, Berlin 2003, S. 27–47. Günter Erbe, Die verfemte Moderne. Die Auseinandersetzungen mit dem „Modernismus“ in Kulturpolitik, Literaturwissenschaft und Literatur der DDR, Opladen 1993. Martin Eybl (Hg.), Die Befreiung des Augenblicks : Schönbergs Skandalkonzerte 1907 und 1908. Eine Dokumentation, Wien/Köln/Weimar 2004. Ders., „Neun Thesen zu einer Theorie des Skandals“, in : Österreichische Musikzeitschrift 57 (2002), Heft 11/12, S. 5–15. Werner Faulstich (Hg.), Die Kultur der 50er Jahre, Paderborn 2002. Günter Feist, Eckhard Gillen und Beatrice Vierneisel (Hg.), Kunstdokumentation SBZ/ DDR 1945–1990. Aufsätze, Berichte, Materialien, Köln 1996. Hugo Fetting, Max Burghardt, Berlin 1965. Jens Malte Fischer, Richard Wagners ‚Das Judentum in der Musik‘. Eine kritische Dokumentation als Beitrag zur Geschichte des Antisemitismus, Frankfurt/M./Leipzig 2000. Ders., „Wagner-Interpretation im Dritten Reich. Musik und Szene zwischen Politisierung und Kunstanspruch“, in : Saul Friedländer und Jörg Rüsen (Hg.), Richard Wagner im Dritten Reich. Ein Schloss Elmau-Symposion, München 2000, S. 142–164. Ders., „Richard Wagners „Das Judentum in der Musik“. Entstehung – Kontext – Wirkung“, in : Dieter Borchmeyer, Ami Maayani und Susanne Vill (Hg.), Richard Wagner und die Juden, Stuttgart/Weimar 2000, S. 35–52. Christine Fischer-Defoy (Hg.), „Kunst, im Aufbau ein Stein“. Die Westberliner Kunst- und Musikhochschulen im Spannungsfeld der Nachkriegszeit, Berlin 2001. Erika Fischer-Lichte, Kurze Geschichte des deutschen Theaters, Tübingen/Basel 1993. Sheila Fitzpatrick, The Cultural Front. Power and Culture in the revolutionary Russia, Ithaca 1992. Ingeborg Flagge und Wolfgang Jean Stock (Hg.), Architektur und Demokratie. Bauen für die Politik von der amerikanischen Revolution bis zur Gegenwart, Stuttgart 1992. Marco Frei, „Chaos statt Musik“. Dmitri Schostakowitsch, die Prawda-Kampagne von 1936 bis 1938 und der Sozialistische Realismus, Saarbrücken 2006.
Quellen- und Literaturverzeichnis
329
Ute Frevert und Heinz-Gerhard Haupt (Hg.), Neue Politikgeschichte. Perspektiven einer historischen Politikforschung, Frankfurt/M. 2005. Ruth Freydank, Theater in Berlin. Von den Anfängen bis 1945, Berlin 1988. Saul Friedländer und Jörg Rüsen (Hg.), Richard Wagner im Dritten Reich. Ein Schloss Elmau-Symposion, München 2000. Götz Friedrich, Walter Felsenstein. Weg und Werk, Berlin 1961. Ders., „Walter Felsenstein“ ; in : Lothar Gall (Hg.), Die großen Deutschen unserer Epoche, Frechen 2002, S. 310–324. Josef Früchtl und Jörg Zimmermann (Hg.), Ästhetik der Inszenierung. Dimensionen eines künstlerischen, kulturellen und gesellschaftlichen Phänomens, Frankfurt/M. 2001. Ingo Fulfs, Musiktheater im Nationalsozialismus, Marburg 1995. Caroline Gallée, Georg Lukács. Seine Stellung und Bedeutung im literarischen Leben der SBZ/DDR 1945–1985, Tübingen 1996. Klaus Geitel, „Die Jahre der ‚Stullenoper‘. Das Theater des Westens zwischen 1933 und 1945“, in : 100 Jahre Theater des Westens 1896–1996, Berlin 1996. Manuel Gervink, Arnold Schönberg und seine Zeit, Laaber 2000. Monika Gibas, „‚Deckt alle mit den Tisch der Republik‘. Regie und Dramaturgie des DDR-Dezenniums am 7. Oktober 1959“, in : Monika Gibas und Dirk Schindelbeck (Hg.), „Die Heimat hat sich schön gemacht…“. 1959 : Fallstudien zur deutsch-deutschen Propagandageschichte, Leipzig 1994, S. 49–68. Dies., „‚Die Republik, das sind wir !‘. Das propagandistische ‚Gesamtkunstwerk‘ Zehnter Jahrestag der DDR als nachholendes Initiationsritual“, in : Dieter Vorsteher (Hg.), Parteiauftrag : Ein neues Deutschland. Bilder, Rituale und Symbole der frühen DDR. Buch zur Ausstellung des Deutschen Historischen Museums vom 13. Dezember 1996 bis 11. März 1997, München/Berlin 1997, S. 217–235. Dies. u.a. (Hg.), Wiedergeburten. Zur Geschichte der runden Jahrestage der DDR, Leipzig 1999. Horst Goerges, Deutsche Oper Berlin, Berlin 1964. Gabriele Gorzka (Hg.), Kultur im Stalinismus. Sowjetische Kultur und Kunst der 1930er bis 1950er Jahre, Temmen 1994. Susanne Grebner, Der Telegraf. Entstehung einer SPD-nahen Lizenzzeitung in Berlin 1946 bis 1950, Münster 2002. Thomas S. Grey, „Die Meistersinger as National Opera (1868–1945)”, in : Celia Applegate und Pamela Potter (Hg.), Music and German National Identity, Chicago 2002, S. 78–104. Ders., „Selbstbehauptung oder Fremdmissbrauch ? Zur Rezeptionsgeschichte von Wagners ‚Meistersingern‘“, in : Hermann Danuser und Herfried Münkler (Hg.), Deutsche Meister – böse Geister ? Nationale Selbstfindung in der Musik, Schliengen 2001, S. 303– 325.
330
Anhang
Frieder Günther, Heuss auf Reisen. Die auswärtige Repräsentation der Bundesrepublik durch den ersten Bundespräsidenten, Stuttgart 2006. Heinrich Habel, Festspielhaus und Wahnfried. Geplante und ausgeführte Bauten Richard Wagners, München 1985. Hilde Haider-Pregler, Des sittlichen Bürgers Abendschule, Wien/München 1980. Dies., „Die Wiener ‚Nationalschaubühne‘ (1776–1794) : Idee und Institution“, in : Roland Krebs und Jean-Marie Valentin (Hg.), Théâtre, nation et société en Allemagne au XVIIIe siècle, Nancy 1990, S. 167–192. Simone Hain, „‚Zweckmäßigkeit, Schönheit und Idee‘. Zur Schinkelrezeption in der frühen DDR und den Plänen zum Wiederaufbau der Bauakademie“, in : Frank Augustin (Hg.), Mythos Bauakademie : die Schinkelsche Bauakademie und ihre Bedeutung für die Mitte Berlins, Berlin 1997, S. 159–179. Dies., „Richard Paulicks Wiederaufbau des Forum Fridericianum“, in : Sanieren oder demolieren ? Berlins Opernalternative. Sonderausgabe Theater der Zeit, Juli 2008, S. 22–28. Brigitte Hamann, Winifred Wagner oder Hitlers Bayreuth, München 2002. Dies., Die Familie Wagner, Reinbek bei Hamburg 2005. Anne Hartmann und Wolfram Eggeling, Sowjetische Präsenz im kulturellen Leben der SBZ und frühen DDR 1945–1953, Berlin 1998. Christa Hasche, Traute Schölling und Joachim Fiebach (Hg.), Theater in der DDR, Berlin 1994. Jörg Haspel und Frank Schmitz, „Die Staatsoper. Denkmalwerte und Denkmalpflege“, in : Sanieren oder demolieren ? Berlins Opernalternative. Sonderausgabe Theater der Zeit, Juli 2008, S. 14–19. Heinz-Gerhard Haupt und Jürgen Kocka (Hg.), Geschichte und Vergleich. Ansätze und Ergebnisse international vergleichender Geschichtsschreibung, Frankfurt/M. 1996. Irmhild Heckmann-von Wehren, Heinrich Seeling – Ein Theaterarchitekt des Historismus, München/Hamburg 1994. Hannes Heer, Jürgen Kesting und Peter Schmidt, Verstummte Stimmen. Die Vertreibung der „Juden“ aus der Oper 1933 bis 1945, Berlin 2008. Hannes Heer und Boris von Haken : „Der Überläufer. Heinz Tietjen. Der Generalintendant der Preußischen Staatstheater im Dritten Reich“, in : Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 58 (2010), S. 28–53. Magdalena Heider, Politik – Kultur – Kulturbund. Zur Gründungs- und Frühgeschichte des Kulturbundes zur demokratischen Erneuerung Deutschlands 1945–1954 in der SBZ/ DDR, Köln 1993. Annette Hein, „Es ist viel ‚Hitler‘ in Wagner“. Rassismus und antisemitische Deutschtumsideologie in den „Bayreuther Blättern“ (1878–1938), Tübingen 1986. Stefanie Hein, Richard Wagners Kunstprogramm im nationalkulturellen Kontext. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte des 19. Jahrhunderts, Würzburg 2006.
Quellen- und Literaturverzeichnis
331
Michael Heinemann und Hans John (Hg.), Die Dresdener Oper im 19. Jahrhundert, Laaber 1995. Heribert Henrich (Hg.), Boris Blacher 1903–1975. Dokumente zu Leben und Werk, Berlin 1993. Hans Werner Henze, Reiselieder mit böhmischen Quinten. Autobiographische Mitteilungen 1926–1995, Frankfurt/M. 1996. Sabine Henze-Döring, „Kulturelle Zentren in der amerikanischen Besatzungszone. Der Fall Bayreuth“, in : Gabriele Clemens (Hg.), Kulturpolitik im besetzten Deutschland 1945–1949, Stuttgart 1994, S. 39–54. Christoph Henzel, „Zwischen Hofoper und Nationaltheater. Aspekte der Gluckrezeption in Berlin um 1800“, in : Archiv für Musikwissenschaft 50 (1993), S. 201–216. Ulrich Herbert, Wandlungsprozesse in Westdeutschland. Belastung, Integration, Liberalisierung 1945–1980, Göttingen 2002. Matthias Herrmann und Hanns-Werner Heister (Hg.), Dresden und die avancierte Musik im 20. Jahrhundert, Laaber 1999. Matthias Herrmann, Arnold Schönberg in Dresden, Dresden 2001. Manfred Hettling und Bernd Ulrich (Hg.), Bürgertum nach 1945, Hamburg 2005. Werner Hintze, Clemens Risi und Robert Sollich (Hg.), Realistisches Musiktheater. Walter Felsenstein : Geschichte, Erben, Gegenpositionen, Berlin 2008. Erika M. Hoerning, „Der alltägliche Kalte Krieg in Berlin 1948 bis 1961“, in : BIOS. Zeitschrift für Biographieforschung und Oral History 6 (Sonderheft 1993), S. 73–93. Manfred J. Holler (Hg.), Scandal and its Theory, München 1999. Gunter Holzweißig, Die schärfste Waffe der Partei. Eine Mediengeschichte der DDR, Köln/ Weimar/Wien 2002. Karl Otto Hondrich, Enthüllung und Entrüstung. Eine Phänomenologie des politischen Skandals, Frankfurt/M. 2002. Rolf Hosfeld, Boris Kehrmann und Rainer Wörtmann, Komische Oper Berlin, Hamburg 2001. Gisela Huwe (Hg.), Die Deutsche Oper Berlin, Berlin 1984. Fritz Jacobsohn, Hans Gregors Komische Oper : 1905–1911, Berlin o. J. [1911]. Manfred Jäger, Kultur und Politik in der DDR. Ein historischer Abriß, Köln 1994. Elizabeth Janik, Recomposing German music. Politics and musical tradition in Cold War Berlin, Leiden 2005. Konrad Jarausch und Hannes Siegrist (Hg.), Amerikanisierung und Sowjetisierung in Deutschland 1945–1970, Frankfurt/M./New York 1997. Eckhard John, Musikbolschewismus. Die Politisierung der Musik in Deutschland 1918– 1938, Stuttgart/Weimar 1994. Hans John, „Richard Wagners Schrift ‚Entwurf zur Organisation eines deutschen Natio-
332
Anhang
nal-Theaters für das Königreich Sachsen‘ (1848)“, in : Michael Heinemann und Hans John (Hg.), Die Dresdner Oper im 19. Jahrhundert, Laaber 1995, S. 193–198. Gisela Jonas (Hg.), Schiller-Debatte 1905. Dokumente zur Literaturtheorie und Literaturkritik der revolutionären deutschen Sozialdemokratie, [Ost-]Berlin 1988. Hans-Klaus Jungheinrich, „Politische und gesellschaftliche Aspekte der Oper seit 1945“, in : Udo Bermbach und Wulf Konold (Hg.), Der schöne Abglanz. Stationen der Operngeschichte, Berlin 1991, S. 243–262. Hartmut Kaelble, Der historische Vergleich. Eine Einführung zum 19. und 20. Jahrhundert, Frankfurt/M./New York 1999. Dirk Käsler u.a., Der politische Skandal. Zur symbolischen und dramaturgischen Qualität von Politik, Opladen 1991. Hermann Kaiser, Modernes Theater in Darmstadt 1910–1933. Ein Beitrag zur Stilgeschichte des deutschen Theaters zu Beginn des 20. Jahrhunderts, Darmstadt 1955. Ingrid Kapsamer, „Zu Wieland Wagners Ring-Inszenierungen 1951 und 1965“, in : Die Szene als Modell. Die Bühnenbildmodelle des Richard-Wagner-Museums und der Ring des Nibelungen in Bayreuth 1876–2000, München/Berlin 2006, S. 77–95. Michael Karbaum, Studien zur Geschichte der Bayreuther Festspiele (1876–1976). Teil I : Textteil / Teil II : Dokumente und Anmerkungen, Regensburg 1976. Michael H. Kater, Die missbrauchte Muse. Musiker im Dritten Reich, München/Wien 1998. Ders. Komponisten im Nationalsozialismus. Acht Porträts, Berlin 2004. Ders. und Albrecht Riethmüller (Hg.), Music and Nazism. Art under Tyranny 1933–1945, Laaber 2003. David I. Kertzer, Ritual, Politics, and Power, New Haven/London 1988. Markus Kilian, „Zurückhaltende Raumbildungen. Die Opern und Theater von Fritz Bornemann“, in : Susanne Schindler (Hg.), Inszenierte Moderne. Zur Architektur von Fritz Bornemann, Berlin 2003, S. 48–65. Wilhelm Klein, Der preußische Staat und das Theater im Jahre 1848. Ein Beitrag zur Geschichte der Nationaltheateridee, Berlin 1924. Christoph Kleßmann, „Verflechtung und Abgrenzung. Aspekte der geteilten und zusammengehörigen deutschen Nachkriegsgeschichte“, in : Aus Politik und Zeitgeschichte 29–30 (1993), S. 30–41. Lars Klingberg, „Politisch fest in unseren Händen“. Musikalische und musikwissenschaftliche Gesellschaften in der DDR. Dokumente und Analysen, Kassel 1997. Ders., „‚Lukullus‘ im Jahr 1951“, in : Beiträge zur Musikwissenschaft 33 (1992), S. 188– 206. Ders., „Die Debatte um Eisler und die Zwölftontechnik in der DDR in den 1960er Jahren“, in : Matthias Tischer (Hg.) Musik in der DDR. Beiträge zu den Musikverhältnissen eines verschwundenen Staates, Berlin 2005, S. 39–61.
Quellen- und Literaturverzeichnis
333
Ilse Kobán (Hg.), „Das Schlaue Füchslein“ von Leoš Janáček. „Und doch ist in der Musik nur eine Wahrheit“. Zu Walter Felsensteins Inszenierung an der Komischen Oper Berlin (1956), Anif/Salzburg 1997. Lars Koch (Hg.), Modernisierung als Amerikanisierung ? Entwicklungslinien der westdeutschen Kultur 1945–1960, Bielefeld 2007. Tilo Köhler, Unser die Straße – Unser der Sieg. Die Stalinallee, Berlin 1993. Franz-Heinz Köhler, Die Struktur der Spielpläne deutschsprachiger Opernbühnen von 1896 bis 1966. Eine statistische Analyse, o. O. [Koblenz] 1968. Maren Köster, Musik-Zeit-Geschehen. Zu den Musikverhältnissen in der SBZ/DDR 1945– 1952, Saarbrücken 2002. Wulf Konold, „Nationale Bewegungen und Nationalopern im 19. Jahrhundert. Versuch einer Definition, was eine Nationaloper ausmacht“, in : Udo Bermbach und Wulf Konold (Hg.), Der schöne Abglanz. Stationen der Operngeschichte, Berlin 1991, S. 111–128. Gesa Kordes, „Darmstadt, Postwar Experimentation, and the West German Search for a New Musical Identity“, in : Celia Applegate und Pamela Potter (Hg.), Music and German National Identity, Chicago 2002, S. 205–217. Albert Kost (Hg.), Komische Oper Berlin, Berlin 1997. Georg Kotowski und Hans J. Reichhardt, Berlin als Hauptstadt im Nachkriegsdeutschland und Land Berlin 1945–1985, Berlin/New York 1987. Inge Kovács, „Die Ferienkurse als Schauplatz der Ost-West-Konfrontation“, in : Gianmario Borio und Hermann Danuser (Hg.), Im Zenit der Moderne. Die internationalen Ferienkurse für Neue Musik Darmstadt 1946–1966, Bd. 1, Freiburg 1997, S. 116–139. Jörg Krämer, Deutschsprachiges Musiktheater im späten 18. Jahrhundert. Typologie, Dramaturgie und Anthropologie einer populären Gattung. 2 Teile, Tübingen 1998. Roland Krebs, L’Idée de „Théâtre National“ dans l’Allemagne des Lumières. Théorie et réalisations, Wiesbaden 1985. Eberhard Kremtz, „Das ‚deutsche Operndepartement‘ des Dresdner Hoftheaters“, in : Michael Heinemann und Hans John (Hg.), Die Dresdner Oper im 19. Jahrhundert, Laaber 1995, S. 107–112. Eckart Kröplin, „Aufhaltsame Ankunft und ahnungsvoller Abschied. Der Ring in der DDR“, in : wagnerspectrum 1/2006, Würzburg 2006, S. 63–110. Brian Ladd, The Ghosts of Berlin. Confronting German History in the urban landscape, Chicago/London 1997. Hans Lange, Vom Tribunal zum Tempel. Zur Architektur und Geschichte deutscher Hoftheater zwischen Vormärz und Restauration, Marburg o. J. [1985]. Dieter Langewiesche, Nation, Nationalismus, Nationalstaat in Deutschland und Europa, München 2000. Thomas La Presti, „Verhinderte Moderne : bildungsbürgerliche Semantik in der Debatte
334
Anhang
um Eislers Johann Faustus“, in : Georg Bollenbeck und Thomas La Presti (Hg.), Traditionsanspruch und Traditionsbruch. Die deutsche Kunst und ihre diktatorischen Sachwalter. Kulturelle Moderne und bildungsbürgerliche Semantik II, Wiesbaden 2002, S. 174–184. Ders., „Bildungsbürgerliche Kontinuitäten und diktatorische Praxis : Zur Kulturpolitik in der DDR der 50er Jahre“, in : Georg Bollenbeck und Gerhard Kaiser (Hg.), Die janusköpfigen 50er Jahre. Kulturelle Moderne und bildungsbürgerliche Semantik III, Wiesbaden 2000, S. 30–52. Michael Lemke, Einheit oder Sozialismus ? Die Deutschlandpolitik der SED 1949–1961, Köln 2001. Ders. (Hg.), Schaufenster der Systemkonkurrenz. Die Region Berlin-Brandenburg im Kalten Krieg, Köln 2006, S. 9–27. Ders, „Der ‚Sängerkrieg‘ in Berlin“, in : Michael Lemke (Hg.), Schaufenster der Systemkonkurrenz. Die Region Berlin-Brandenburg im Kalten Krieg, Köln 2006, S. 269–295. Ders., „Die Kino-Konkurrenz im geteilten Berlin 1949–1961“, in : Heiner Timmermann (Hg.), Das war die DDR. DDR-Forschung im Fadenkreuz von Herrschaft, Außenbeziehungen, Kultur und Souveränität, Münster 2004, S. 635–676. Ders. (Hg.), Konfrontation und Wettbewerb. Wissenschaft, Technik und Kultur im geteilten Berliner Alltag (1948–1968), Berlin 2008, S. 209–231. Ders., „Der ‚Fall‘ Felsenstein“, in : Michael Lemke (Hg.), Konfrontation und Wettbewerb. Wissenschaft, Technik und Kultur im geteilten Berliner Alltag (1948–1968), Berlin 2008, S. 209–231. Jost Lehne, Der Admiralspalast. Die Geschichte eines Berliner „Gebrauchs“-Theaters, Berlin 2006. John D. Lindberg, „Gottsched gegen die Oper“, in : The German Quarterly 40 (1967), S. 673–683. Thomas Lindenberger (Hg.), Massenmedien im Kalten Krieg. Akteure, Bilder, Resonanzen, Köln/Weimar/Wien 2006. Helmut Loos und Stefan Keym (Hg.), Nationale Musik im 20. Jahrhundert. Kompositorische und soziokulturelle Aspekte der Musikgeschichte zwischen Ost- und Westeuropa. Konferenzbericht Leipzig 2002, Leipzig 2004. Wilfried Loth, Die Teilung der Welt, 1941–1955, erweiterte Neuausgabe, München 2000. Lore Lucas, Die Festspiel-Idee Richard Wagners, Regensburg 1973. Kaspar Maase, Grenzenloses Vergnügen. Der Aufstieg der Massenkultur 1850–1970, Frankfurt/M. 1997. Michael Mäckelmann, Arnold Schönberg und das Judentum. Der Komponist und sein religiöses, nationales und politisches Selbstverständnis nach 1921, Hamburg 1984. Bernd Maether, Die Vernichtung des Berliner Stadtschlosses. Eine Dokumentation, Berlin 2000. Gunther Mai, „Staatsgründungsprozeß und nationale Frage als konstitutive Elemente
Quellen- und Literaturverzeichnis
335
der Kulturpolitik der SED“, in : Lothar Ehrlich und Gunther Mai (Hg.), Weimarer Klassik in der Ära Ulbricht, Köln/Weimar/Wien 2000, S. 33–60. Micaela von Marcard : „Hat Tietjen wirklich gelebt ?“, in : Vivace. Journal der Staatsoper Unter den Linden. Heft 20/21 und 22/23 (1998), S. 20–22 und 32–33. Andrei S. Markovits und Mark Silverstein, (Hg.), The politics of scandal : power and process in liberal democracies, New York 1988. Wolfgang Martens, „Obrigkeitliche Sicht. Das Bühnenwesen in den Lehrbüchern der Polizey und Cameralistik des 18. Jahrhunderts“, in : Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur 6 (1981), S. 19–51. Jürgen Martschukat und Steffen Patzold (Hg.), Geschichtswissenschaft und „performative turn“. Ritual, Inszenierung und Performanz vom Mittelalter bis zur Neuzeit, Köln/Weimar/Wien 2003. Christoph Marx, Reeducation und Machtpolitik. Die Neuordnung der Berliner Presselandschaft 1945–1947, Stuttgart 2001. Katharina Meinel, Für Fürst und Vaterland. Begriff und Geschichte des Münchner Nationaltheaters im späten 18. Jahrhundert, München 2003. Thomas Mergel, „Überlegungen zu einer Kulturgeschichte der Politik“, in : Geschichte und Gesellschaft 28 (2002), S. 574–606. Detlef Meyer zu Heringdorf, Das Charlottenburger Opernhaus von 1912 bis 1961. Eine Dokumentation. Von der privat-gesellschaftlich geführten Bürgeroper bis zur subventionierten Berliner „Städtischen Oper“, 2 Bde., Phil. Diss., Berlin 1988. Herbert Meyer, Das Nationaltheater Mannheim 1929–1979, Mannheim 1979. Reinhard Meyer, „Der Anteil des Singspiels und der Oper am Repertoire der deutschen Bühnen in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts“, in : Das deutsche Singspiel im 18. Jahrhundert. Colloquium der Arbeitsstelle 18. Jahrhundert Gesamthochschule Wuppertal, Universität Münster, Heidelberg 1981, S. 27–76. Ders., „Das Nationaltheater in Deutschland als höfisches Institut. Versuch einer Begriffs- und Funktionsbestimmung“, in : Roger Bauer und Jürgen Wertheimer (Hg.), Das Ende des Stegreifspiels – Die Geburt des Nationaltheaters. Ein Wendepunkt in der Geschichte des europäischen Dramas, München 1983, S. 124–152. Wolfgang J. Mommsen, „Die Herausforderung der bürgerlichen Kultur durch die künstlerische Avantgarde“, in : Ders., Bürgerliche Kultur und politische Ordnung. Künstler, Schriftsteller und Intellektuelle in der deutschen Geschichte 1830–1933, Frankfurt/M. 2002, S. 158–177. David Monod, Settling Scores. German Music, Denazification, and the Americans, 1945– 1953, Chapel Hill/London 2005. Gerhard Müller, „Zeitgeschichtliche Aspekte der ‚Lukullus-Debatte‘“, in : Klaus Angermann (Hg.), Paul Dessau – Von Geschichte gezeichnet. Symposion Paul Dessau Hamburg 1994, Hofheim 1995, S. 144–151.
336
Anhang
Peter Müller, Symbolsuche. Die Ost-Berliner Zentrumsplanung zwischen Repräsentation und Agitation, Berlin 2004. Sven Oliver Müller und Jutta Toelle (Hg.), Bühnen der Politik. Die Oper in europäischen Gesellschaften im 19. und 20. Jahrhundert, Wien/München 2008. Sven Oliver Müller u.a. (Hg.), Oper im Wandel der Gesellschaft. Kulturtransfers und Netzwerke des Musiktheaters im modernen Europa, Wien/München 2010. Ders., „,An Interesting Eastern Potentate‘ ? Staatsaufführungen für den Schah von Persien in Berlin – 1873 und 1967“, in : Sven Oliver Müller u.a. (Hg.), Oper im Wandel der Gesellschaft. Kulturtransfers und Netzwerke des Musiktheaters im modernen Europa, Wien/München 2010, S. 277–300. Ders., „Ein fehlender Neuanfang. Das bürgerliche Musikleben in der Bundesrepublik nach 1945“, in : Gunilla Budde, Eckart Conze und Cornelia Rauh (Hg.), Bürgertum nach dem bürgerlichen Zeitalter. Leitbilder und Praxis seit 1945, Göttingen 2010, S. 255–269. Anno Mungen, „Morlacchi, Weber und die Dresdner Oper“, in : Michael Heinemann und Hans John (Hg.), Die Dresdener Oper im 19. Jahrhundert, Laaber 1995, S. 85–105. Musikgeschichte der Deutschen Demokratischen Republik 1945–1976. Von einem Autorenkollektiv unter der Leitung von Heinz Alfred Brockhaus und Konrad Niemann, Berlin 1980. Norman M. Naimark, Die Russen in Deutschland. Die sowjetische Besatzungszone 1945 bis 1949, Berlin 1997. Sigrid Neef und Hermann Neef, Deutsche Oper im 20. Jahrhundert. DDR 1949–1989, Berlin u.a. 1992. Herbert Nicolaus und Alexander Obeth, Die Stalinallee. Geschichte einer deutschen Straße, Berlin 1997. Rainer Noltenius, „Die Nation und Schiller“, in : Helmut Scheuer (Hg.), Dichter und ihre Nation, Frankfurt/M. 1993, S. 151–175. Werner Otto, Die Lindenoper. Ein Streifzug durch ihre Geschichte, Berlin 1980. Joachim Palutzki, Architektur in der DDR, Berlin 2000. Johannes Paulmann (Hg.), Auswärtige Repräsentationen. Deutsche Kulturdiplomatie nach 1945, Köln 2005. Ders., Pomp und Politik. Monarchenbegegnungen in Europa zwischen Ancien Régime und Erstem Weltkrieg, Paderborn 2000. Wolfgang Pehnt, Deutsche Architektur seit 1900, Ludwigsburg/München 2005. Frank-Manuel Peter, Das Berliner Hansaviertel und die Interbau 1957, Erfurt 2007. Dietger Pforte (Hg.), Freie Volksbühne Berlin 1890–1990. Beiträge zur Geschichte der Volksbühnenbewegung in Berlin, Berlin 1990. David Pike, The Politics of Culture in Soviet-Occupied Germany, 1945–1949, Stanford 1992.
Quellen- und Literaturverzeichnis
337
Bodo Plachta, Ein „Tyrann der Schaubühne“ ? Stationen und Positionen einer literatur- und kulturkritischen Debatte über Oper und Operntext im 18. Jahrhundert, Berlin 2003. Fritz Pohle, „Musiker-Emigration in Lateinamerika. Ein vorläufiger Überblick“, in : Hanns-Werner Heister, Claudia Maurer Zenck und Peter Petersen (Hg.), Musik im Exil, Frankfurt/M. 1993, S. 338–353. Uta G. Poiger, Jazz, Rock and Rebels. Cold War Politics and American Culture in a Divided Germany, Berkeley/Los Angeles/London 2000. Reiner Pommerin, Von Berlin nach Bonn. Die Alliierten, die Deutschen und die Hauptstadtfrage nach 1945, Köln/Wien 1989. Pamela M. Potter, Die deutscheste der Künste. Musikwissenschaft und Gesellschaft von der Weimarer Republik bis zum Ende des Dritten Reiches, Stuttgart 2000. Dies., „Musical Life in Berlin from Weimar to Hitler“, in : Michael H. Kater und Albrecht Riethmüller (Hg.), Music and Nazism. Art under Tyranny 1933–1945, Laaber 2003, S. 90–101. Fred K. Prieberg, Musik in der Sowjetunion, Köln 1965. Ders., Musik im NS-Staat, Frankfurt/M. 1982. Ders.,, Handbuch Deutsche Musiker 1933–1945, CD-Rom Version 1.2–3/2005, Auprès des Zombry 2004. Hermann G. Pundt, Schinkels Berlin, Frankfurt/M./Berlin/Wien 1981. Georg Quander (Hg.), Apollini et musis. 250 Jahre Opernhaus Unter den Linden, Frankfurt/M. 1992. Werner Rackwitz, „Die Wiedergeburt der Komischen Oper in Berlin“, in : Albert Kost (Hg.), Die Komische Oper, Berlin 1997, S. 50–66. Wolfgang Rathert und Giselher Schubert (Hg.), Musikkultur in der Weimarer Republik, Mainz 2001. Oliver Rathkolb, Führertreu und gottbegnadet. Künstlereliten im Dritten Reich, Wien 1991. Dorothea Redepenning, Geschichte der russischen und der sowjetischen Musik. Band 2 : Das 20. Jahrhundert, 2 Teilbände, Laaber 2008. Hans J. Reichhardt, …bei Kroll 1844 bis 1957. Etablissement – Ausstellungen – Theater – Konzerte – Oper – Reichstag – Gartenlokal. Eine Ausstellung des Landesarchivs Berlin, 14. Juni bis 31. Oktober 1988, Berlin 1988. Hans J. Reichardt und Wolfgang Schäche, Von Berlin nach Germania. Über die Zerstörungen der „Reichshauptstadt“ durch Albert Speers Neugestaltungsplanungen, Berlin 1998. Daniela Reinhold, „Die Verurteilung des Lukullus. Synopse der Fassungen“, in : Paul Dessau 1894–1979. Dokumente zu Leben und Werk, zusammengestellt und kommentiert von Daniela Reinhold, Berlin 1994, S. 199–208. Manfred Rexin, „Ost-Berlin als DDR-Hauptstadt“, in : Deutschland Archiv 21 (1989), S. 644–655.
338
Anhang
Wolfgang Ribbe, Berlin 1945–2000. Grundzüge der Stadtgeschichte, Berlin 2002. Albrecht Riethmüller, „Deutsche Leitkultur und neues Leitbild USA in der frühen Bundesrepublik“, in : Lars Koch (Hg.), Modernisierung als Amerikanisierung ? Entwicklungslinien der westdeutschen Kultur 1945–1960, Bielefeld 2007, S. 215–232. Curt A. Roesler, „Das Deutsche Opernhaus Berlin 1934–1945“, in : Deutsche Oper Berlin. Beiträge zum Musiktheater 6 (Spielzeit 1986/87), S. 333–365. Jürgen Rostock, „Ost-Berlin als Hauptstadt der DDR“, in : Werner Süß und Ralf Rytlewski (Hg.), Berlin. Die Hauptstadt. Vergangenheit und Zukunft einer europäischen Metropole, Bonn 1999. Jens Roselt, „Eros und Intellekt. Stanislawski, Felsenstein und die Wahrheit des Theaters“, in : Werner Hintze, Clemens Risi und Robert Sollich (Hg.), Realistisches Musiktheater. Walter Felsenstein : Geschichte, Erben, Gegenpositionen, Berlin 2008, S. 18–31. Walter Rösler, Manfred Haedler und Micaela von Marcard, Das „Zauberschloß“ Unter den Linden. Die Berliner Staatsoper. Geschichte und Geschichten von den Anfängen bis heute, Berlin 1997. Günther Rühle, Theater in Deutschland 1887–1945. Seine Ereignisse – seine Menschen, Frankfurt/M. 2007. John Russell, Erich Kleiber, München 1958. Adelheid von Saldern (Hg.), Inszenierte Einigkeit. Herrschaftsrepräsentation in DDRStädten, Stuttgart 2003. Dies. (Hg.), Inszenierter Stolz. Stadtrepräsentation in drei deutschen Gesellschaften (1935– 1975), Stuttgart 2005. Hannu Salmi, „Die Herrlichkeit des deutschen Namens…“. Die schriftstellerische und politische Tätigkeit Richard Wagners als Gestalter nationaler Identität während der staatlichen Vereinigung Deutschlands, Turku 1993. Sanieren oder demolieren ? Berlins Opernalternative. Sonderausgabe Theater der Zeit, Juli 2008. Andreas Schätzke, Zwischen Bauhaus und Stalinallee. Architekturdiskussion im östlichen Deutschland 1945–1955, Braunschweig/Wiesbaden 1991. Gunter Schandera, „Zur Resistenz bildungsbürgerlicher Semantik in der DDR der fünfziger und sechziger Jahre“, in : Georg Bollenbeck und Thomas La Presti (Hg.), Traditionsanspruch und Traditionsbruch. Die deutsche Kunst und ihre diktatorischen Sachwalter. Kulturelle Moderne und bildungsbürgerliche Semantik II, Wiesbaden 2002, S. 161–173. Bernd-Peter Schaul, Das Prinzregententheater in München und die Reform des Theaterbaus um 1900. Max Littmann als Theaterarchitekt, München 1987. Dietmar Schenk, „Boris Blacher im Berliner Musikleben der Nachkriegszeit“, in : Heribert Henrich (Hg.), Boris Blacher, Hofheim 2003, S. 89–104. Axel Schildt und Arnold Sywottek (Hg.), Modernisierung im Wiederaufbau. Die westdeutsche Gesellschaft der 50er Jahre, Bonn 1998.
Quellen- und Literaturverzeichnis
339
Andrea Schiller, Die Theaterentwicklung in der sowjetischen Besatzungszone (SBZ), Frank furt/M. 1988. Susanne Schindler (Hg.), Inszenierte Moderne. Zur Architektur von Fritz Bornemann, Berlin 2003. Dies., „Bornemann über Bornemann. Über die Eitelkeit der Bescheidenheit“, in : Susanne Schindler (Hg.), Inszenierte Moderne. Zur Architektur von Fritz Bornemann, Berlin 2003, S. 10–24. Dies. und Nikolaus Bernau, „Einleitung. Fritz Bornemann – ein Weg in die Moderne“, in : Susanne Schindler (Hg.), Inszenierte Moderne. Zur Architektur von Fritz Bornemann, Berlin 2003, S. 8–9. Hanna Schissler (Hg.), The Miracle Years. A Cultural History of West Germany 1949 to 1968, Princeton 2001. Wolfgang Schivelbusch, Vor dem Vorhang. Das geistige Berlin 1945–1948, München/ Wien 1995. Wolfram Schlenker, Das „Kulturelle Erbe“ in der DDR. Gesellschaftliche Entwicklung und Kulturpolitik 1945–1965, Stuttgart 1977. Robert Schlesinger, Gott sei mit unserem Führer. Der Opernbetrieb im deutschen Faschismus, Wien 1997. Manfred Schmitz, Theorie und Praxis des politischen Skandals, Frankfurt/M. 1981. Frank Schneider, „Von Gestern auf Heute : Die Wiener Schule im Schaffen von Komponisten der DDR“, in : Rudolf Stephan und Sigrid Wiesmann (Hg.), Bericht über den 2. Kongreß der Internationalen Schönberg-Gesellschaft. Die Wiener Schule in der Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts, Wien 1986, S. 122–129. Irmela Schneider, „Literatur und Film : Der Hauptmann von Köpenick (1956)“, in : Werner Faulstich und Helmut Korte (Hg.), Fischer Filmgeschichte. Band 3 : Auf der Such nach Werten 1945–1960, Frankfurt/M. 1990, S. 271–298. Joseph von Sonnenfels, Briefe über die wienerische Schaubühne, herausgegeben von Hilde Haider-Pregler, Graz 1988. Hannelore Schubert, Moderner Theaterbau. Internationale Situation, Dokumentation, Projekte, Bühnentechnik, Stuttgart/Bern 1971. Winfried Schüler, Der Bayreuther Kreis von seiner Entstehung bis zum Ausgang der wilhelminischen Ära. Wagnerkult und Kulturreform im Geiste völkischer Weltanschauung, Münster 1971. Annette Schuhmann, Kulturarbeit im sozialistischen Betrieb. Gewerkschaftliche Erziehungspraxis in der SBZ/DDR 1946 bis 1970, Köln/Weimar/Wien 2006. Renate Schusky, Das deutsche Singspiel im 18. Jahrhundert. Quellen und Zeugnisse zur Ästhetik und Rezeption, Bonn 1980. Uwe Schwartz, „Der ‚rote Knobelsdorff‘. Richard Paulick und der Wiederaufbau der Staatsoper Unter den Linden“, in : Peter Müller und Peter Thöner (Hg.), Bauhaus-
340
Anhang
Tradition und DDR-Moderne. Der Architekt Richard Paulick, München 2006, S. 107– 124. Ders., Der Wiederaufbau der Staatsoper Unter den Linden, Berlin, von Richard Paulick. Unveröffentlichte Magisterarbeit, Berlin 1999. Boris Schwarz, Musik und Musikleben in der Sowjetunion 1917 bis zur Gegenwart, Wilhelmshaven 1982. Peter Schweinhardt (Hg.), Hanns Eislers „Johann Faustus“. 50 Jahre nach Erscheinen des Operntexts 1952. Symposion, Wiesbaden 2005. Werner P. Seiferth, „Wagner-Pflege in der DDR“, in : Richard-Wagner-Blätter 13 (1989), S. 89–113. Martina Sichardt, „Deutsche Kunst – jüdische Identität. Arnold Schönbergs Oper ‚Moses und Aron‘“, in : Hermann Danuser und Herfried Münkler (Hg.), Deutsche Meister – böse Geister ? Nationale Selbstfindung in der Musik, Schliengen 2001, S. 367–383. Hannes Siegrist, „Ende der Bürgerlichkeit ? Die Kategorien ‚Bürgertum‘ und ‚Bürgerlichkeit‘ in der westdeutschen Gesellschaft und Geschichtswissenschaft der Nachkriegsperiode“, in : Geschichte und Gesellschaft 20 (1994), S. 549–583. Paul Sigel, „Der inszenierte Staat. Zur Geschichte der deutschen Pavillons auf Weltausstellungen“, in : Olaf Asendorf, Wolfgang Voigt und Wilfried Wang (Hg.), Botschaften. 50 Jahre Auslandsbauten der Bundesrepublik Deutschland. Eine Ausstellung des Deutschen Architekturmuseums, Bonn 2000, S. 50–59. Hans-Georg Soeffner und Dirk Tänzler (Hg.), Figurative Politik. Zur Performanz der Macht in der modernen Gesellschaft, Opladen 2002. Brunhilde Sonntag, Hans-Werner Boresch und Detlef Gojowy (Hg.) „Die dunkle Last“. Musik und Nationalsozialismus, Köln 1999. Martina Srocke, Richard Wagner als Regisseur, Phil. Diss., Berlin 1984. Peter Stachel, „‚Das Krönungsjuwel der österreichischen Freiheit‘. Die Wiedereröffnung der Wiener Staatsoper 1955 als Akt österreichischer Identitätspolitik“, in : Sven Oliver Müller und Jutta Toelle (Hg.), Bühnen der Politik. Die Oper in europäischen Gesellschaften im 19. und 20. Jahrhundert, Wien/München 2008, S. 90–107. Dietrich Steinbeck, „‚Geistiger Vater all unserer Bemühungen‘. Dem Regisseur Carl Ebert zum 115. Geburtstag“, in : Berlin in Geschichte und Gegenwart 21 (2002), S. 159–172. Ders., „Auf der Suche nach der verlorenen Identität. Oper zwischen Kriegsende und Währungsreform“, in : Der Bär von Berlin. Jahrbuch des Vereins für die Geschichte Berlins 52 (2003), S. 103–114. Michael P. Steinberg, Ursprung und Ideologie der Salzburger Festspiele 1890–1938, München 2000. Monika Steinhauser, Die Architektur der Pariser Oper. Studien zu ihrer Entstehungsgeschichte und ihrer architekturgeschichtlichen Stellung, München 1969.
Quellen- und Literaturverzeichnis
341
Alexander Stephan und Jochen Vogt (Hg.), America on my mind. Zur Amerikanisierung der deutschen Kultur seit 1945, Paderborn 2006. Kathrin Stöck, „Die Nationaloperndebatte in der DDR der 1950er und 1960er Jahre als Instrument zur Ausbildung einer sozialistischen deutschen Nationalkultur“, in : Helmut Loos und Stefan Keym (Hg.), Nationale Musik im 20. Jahrhundert. Kompositorische und soziokulturelle Aspekte der Musikgeschichte zwischen Ost- und Westeuropa. Konferenzbericht Leipzig 2002, Leipzig 2004, S. 521–539. Waltraud Strey, Wettbewerb für den Neubau eines Königlichen Opernhauses in Berlin für Wilhelm II., Berlin 1981. Peter Strunk, Pressekontrolle und Propagandapolitik der Sowjetischen Militäradministration in Deutschland (SMAD). Der politische Kontrollapparat der SMAD und das Pressewesen im sowjetischen Besatzungsgebiet Deutschlands (1945–47). Phil. Diss., Berlin 1989. Ders., Zensur und Zensoren. Medienkontrolle und Propagandapolitik unter sowjetischer Besatzungsherrschaft in Deutschland, Berlin 1996. Petra Stuber, Spielräume und Grenzen. Studien zum DDR-Theater, Berlin 1998. Holger Stunz, „Darsteller auf internationalen Bühnen : Festspiele als Repräsentationsobjekte bundesdeutscher Kulturpolitik“, in : Johannes Paulmann (Hg.), Auswärtige Repräsentationen. Deutsche Kulturdiplomatie nach 1945, Köln 2005, S. 63–84. Karl C. Thalheim, „Berlins wirtschaftliche Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg“, in : Heimatchronik Berlin, Köln 1962, S. 763–866. Theater in Berlin nach 1945 – Musiktheater, Berlin 2001. Philipp Ther, In der Mitte der Gesellschaft. Operntheater in Zentraleuropa 1815–1914, Wien/München 2006. Rüdiger Thomas, „Staatskultur und Kulturnation. Anspruch und Illusion einer ‚sozialistischen deutschen Nationalkultur‘“, in ; Günter Feist, Eckhard Gillen und Beatrice Vierneisel (Hg.), Kunstdokumentation SBZ/DDR 1945–1990. Aufsätze, Berichte, Materialien, Köln 1996, S. 16–41. Matthias Tischer (Hg.) Musik in der DDR. Beiträge zu den Musikverhältnissen eines verschwundenen Staates, Berlin 2005. David Gerard Tompkins, Composing the Party Line. Music and Politics in Poland and East Germany, 1948–1957, Ph.D. diss., Columbia University 2004. John B. Thompson, Political scandal : power and visibility in the media age, Cambridge u.a. 2000. Frithjof Trapp, „Eine Schule für Schauspiel- und Musiktheater in der Türkei“, in : Frithjof Trapp. u.a. (Hg.), Handbuch des deutschsprachigen Exiltheaters 1933–1945. Bd.1 : Verfolgung und Exil deutschsprachiger Theaterkünstler, München 1999, S. 365–375. „… und die Vergangenheit sitzt immer mit am Tisch“. Dokumente zur Geschichte der Akademie der Künste (West) 1945/1954–1993, herausgegeben von der Stiftung Archiv der
342
Anhang
Akademie der Künste. Ausgewählt und kommentiert von Christine Fischer-Defoy, Berlin 1997. Hans Rudolf Vaget, „Wagner-Kult und nationalsozialistische Herrschaft. Hitler, Wagner, Thomas Mann und die ‚nationale Erhebung‘“, in : Saul Friedländer und Jörg Rüsen (Hg.), Richard Wagner im Dritten Reich. Ein Schloss Elmau-Symposion, München 2000, S. 264–282. Nicholas Vaszonyi (Hg.), Richard Wagner’s „Meistersinger“. Performance, History, Representation, Rochester 2003. Sabine Vogt-Schneider, „Staatsoper Unter den Linden“ oder „Deutsche Staatsoper“ ? Auseinandersetzungen um Kulturpolitik und Spielbetrieb in den Jahren zwischen 1945 und 1955, Berlin 1998. Rüdiger Voigt (Hg.), Politik der Symbole. Symbole der Politik, Opladen 1989. Ursula Volkmann, Berliner Opernleben zu Zeiten des Mauerbaus. Unveröffentlichte Magisterarbeit, Berlin o. J. Hans Vorländer (Hg.), Zur Ästhetik der Demokratie. Formen der politischen Selbstdarstellung, Stuttgart/München 2003. Wolfgang Michael Wagner, Carl Maria von Weber und die deutsche Nationaloper, Mainz 1994. Michael Walter, Hitler in der Oper. Deutsches Musikleben 1919–1945, Stuttgart/Weimar 1995. Harald Waitzbauer, „Arnold Schönberg und das Mattsee-Ereignis. Sommerfrischen-Antisemitismus in Österreich und Salzburg“, in : Arnold Schönberg und sein Gott, Wien 2003, S. 14–26. Martin Warnke, „Bau und Gegenbau“, in : Hermann Hipp und Ernst Seidl (Hg.), Architektur als politische Kultur. Philosophia practica, Berlin 1996, S. 11–18. Jens Wehner, Kulturpolitik und Volksfront. Ein Beitrag zur Geschichte der Sowjetischen Besatzungszone Deutschlands 1945–1949. 2 Bde., Frankfurt/M. 1992. Niels Werber, Art. „Repräsentation/reräsentativ“, in : Karlheinz Barck u.a. (Hg.), Ästhetische Grundbegriffe. Historisches Wörterbuch in sieben Bänden, Bd. 5, Stuttgart und Weimar 2003, S. 264–290. Bernd Wilczek (Hg.), Berlin. Hauptstadt der DDR 1949–1989. Utopie und Realität, Baden-Baden 1989. Herbert Willems und Martin Jurga (Hg.), Inszenierungsgesellschaft. Ein einführendes Handbuch, Opladen/Wiesbaden 1998. Martin Willenbrink, „Opern mit einkomponiertem Verfallsdatum. Der ZeitopernKomponist Boris Blacher“, in : Heribert Henrich (Hg.), Boris Blacher 1903–1975. Dokumente zu Leben und Werk, Berlin 1993, S. 27–37. Heinrich August Winkler, Der lange Weg nach Westen, 2 Bde., München 2000.
Quellen- und Literaturverzeichnis
343
Edgar Wolfrum, Die geglückte Demokratie. Geschichte der Bundesrepublik Deutschland von ihren Anfängen bis zur Gegenwart, Stuttgart 2006. Joseph Wulf, Musik im Dritten Reich. Eine Dokumentation, Gütersloh 1963. Peter Zimmermann, „Die Kunst des Skandals“, in : Peter Zimmermann und Sabine Schaschl (Hg.), Skandal : Kunst, Wien 2000, S. 3–14. Cornelia Maria Zimmermann-Kalyoncu, Deutsche Musiker in der Türkei im 20. Jahrhundert, Frankfurt/M. 1985. Daniel Zur Weihen, Komponieren in der DDR. Institutionen, Organisationen und die erste Komponistengeneration bis 1961. Analysen, Köln/Weimar/Wien 1999. „Zwischen Diskussion und Disziplin“. Dokumente zur Geschichte der Akademie der Künste (Ost) 1945/50–1993, herausgegeben von der Stiftung Archiv der Akademie der Künste. In Zusammenarbeit mit Inge Jens, ausgewählt und kommentiert von Ulrich Dietzel und Gudrun Geißel, Berlin 1997.
Abbildungsverzeichnis
Cover : LAB, F Rep. 290, Nr. 77777 (Horst Siegmann). Abbildung 1 : Tafel 4, aus : „Sechs architektonische Pläne zu dem Bühnenfestspielhause“, in : Richard Wagner, Sämtliche Schriften und Dichtungen. VolksAusgabe, Bd. 9., o. S. Abbildung 2 : Privatarchiv Jörn Düwel. Abbildung 3 : Archiv der Deutschen Staatsoper Berlin. Abbildung 4 : Deutsche Architektur 1 (1952), S. 30. Abbildung 5 : Deutsche Architektur 2 (1953), S. 267. Abbildung 6 : Harry Croner : Zuschauerraum der Deutschen Oper Berlin, Feierliche Eröffnung 24.9.1961 (Stiftung Stadtmuseum Berlin).
Personenregister
Abendroth, Hermann 179 Abendroth, Walter 250 Abraham, Paul 193 Abusch, Alexander 272 Adenauer, Konrad 115, 119, 197 Adorno, Theodor W. 13–14, 171, 236 Albert, Eugen d’ 126 Appia, Adolphe 92 Arent, Benno von 68–70, 93, 213 Armitage, Kenneth 58, 170 Arp, Jean (Hans) 58, 170 Auber, Daniel François Esprit 267 Bach, Johann Sebastian 227, 247 Bär, Heinz 210 Balke, Siegfried 58 Barlog, Boleslaw 185 Baumgarten, Paul 67, 165 Becher, Johannes R. 51–54, 61–62, 65, 98–102, 111–113, 198, 231, 238, 240, 258, 266 Beethoven, Ludwig van 15, 34, 53, 55, 64, 68, 131, 189, 207, 210, 235, 247 Beilke, Irma 180 Berg, Alban 82, 125, 178, 189, 227, 232–234, 247, 275, 308 Berger, Ludwig 222 Berghaus, Ruth 312 Bersarin, Nikolai 114, 123 Bizet, Georges 262 Blacher, Boris 36, 39, 58, 125, 215–223, 247, 274, 304 Blech, Leo 124 Blecha, Johanna 271–272 Bloch, Ernst 112 Bohnen, Michael 184 Bolz, Lothar 49, 182 Bornemann, Fritz 12, 26, 56, 136, 160, 164– 168, 170–172, 175–176, 303 Borodin, Alexander 100, 109, 236 Borries, Siegfried 185
Boulez, Pierre 13, 313 Brahms, Johannes 218, 227, 247 Brandt, Willy 58–61, 63, 169 Brecht, Bertolt 22, 35, 41, 49, 54–55, 66, 79, 101, 104, 115, 118, 129, 205, 217, 219, 223–224, 226, 228, 230–231, 234, 238, 261, 274–275, 285, 307, 311–312 Brentano, Heinrich von 58 Britten, Benjamin 269 Bruckner, Anton 218 Burghardt, Max 39, 48, 53–54, 96, 108–109, 154, 159, 189, 193, 195, 198, 200–201, 207–209, 211, 232–233, 259, 269, 311 Busch, Fritz 130 Busoni, Ferrucio 247 Butting, Max 49, 233 Buttlar, Herbert von 245–246, 250, 253 Casa, Lisa della 257 Chatschaturjan, Aram 106 Chamberlain, Houston Stewart 90 Chrennikow, Tichon 49 Clay, Lucius D. 58 Collein, Edmund 146 Cramer, Heinz von 219 Dessau, Paul 22, 35, 41, 49, 55, 66, 101–102, 104, 115, 223–224, 226, 228, 230–231, 233–234, 238, 274–275, 307, 311–312 Devrient, Eduard 75 Dserschinski, Iwan 105 Ebert, Carl 24, 39, 60, 62–65, 93, 96, 121, 127–135, 189–190, 197, 215, 243–245, 247, 253, 265, 270, 272, 276, 278, 281–282, 284, 290, 299, 304 Ebert, Friedrich (Oberbürgermeister von OstBerlin) 271–272 Ebert, Friedrich (Reichspräsident) 110 Eckhof, Conrad 91
346
Personenregister
Egk, Werner 90 Eiermann, Egon 165 Einem, Gottfried von 247 Eisler, Hanns 22, 30, 112, 202, 205, 230, 232, 236–237, 244 Eisner, Kurt 110 Enders, Werner 298 Engels, Friedrich 109, 113, 235 Erpenbeck, Fritz 210 Fehling, Jürgen 93 Felsenstein, Walter 24, 38, 146, 150, 180–181, 220, 257–268, 270–273, 277, 284–285, 290, 295, 297–299, 301, 308–311 Feuerbach, Ludwig 204 Fischer, Hermann 216 Flotow, Friedrich von 68 Forest, Jean Kurt 36, 39, 238–241, 243, 275, 305 Fricsay, Ferenc 64, 127, 220 Friedrich, Götz 268, 284, 301, 312 Friedrich Wilhelm IV. 139, 144 Friedrich II. 25, 44, 70, 137–138, 152, 155, 195 Fürstenau, Eduard 142, 153 Furtwängler, Wilhelm 198, 218, 252–253 George, Heinrich 260 Gerster, Ottmar 83 Gielen, Josef 265 Glinka, Michael 54, 100, 109, 229, 236 Gluck, Christoph Willibald 53, 64, 74, 99, 114–115, 189, 210, 235 Gobineau, Arthur de 203–204 Goebbels, Joseph 68–69, 123, 244 Goerges, Horst 254 Göring, Hermann 70–71, 123–124, 129, 187, 191 Goethe, Johann Wolfgang von 76, 86, 113, 235, 253 Goltz, Christel 180 Gottsched, Johann Christoph 74, 84 Gounod, Charles 126 Gregor, Hans 262, 265 Grohmann, Will 170 Grotewohl, Otto 45-46, 193–194 Gruber, Roman 203
Grümmer, Elisabeth 180 Hanslick, Eduard 81 Harms, Kirsten 313 Harting, Werner 163 Hartmann, Georg 265 Hartmann, Rudolf 49 Hauptmann, Gerhart 110 Haydn, Joseph 34 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 33 Heine, Heinrich 113 Henneberg, Willy 173 Hennig, Helmut 141, 143 Henselmann, Hermann 146 Henze, Hans Werner 131, 247, 253–254 Herder, Johann Gottfried 31–32, 84, 94 Herrmann, Josef 192, 209 Hindemith, Paul 64, 82, 115, 123, 129, 131, 247 Hitler, Adolf 32, 68, 90, 124, 131, 201, 212, 215 Holzbauer, Ignaz 84 Holtzhauer, Helmut 146 Hopp, Hanns 146, 158, 162 Hoyer, Dore 256 Humperdinck, Engelbert 68, 126 Ihering, Herbert 202 Immermann, Carl 91 Janáček, Leoš 270, 286, 297 Joachim, Heinz 243 Joseph II. 73 Käutner, Helmut 223 Kallmorgen, Werner 162, 167–168 Kapp, Julius 70, 220 Karsch, Walter 255–256 Kautsky, Karl 110 Kennedy, John F. 58 Kersten, Heinz 54 Klebe, Giselher 64–65 Kleiber, Erich 36, 42, 54, 144–147, 150, 159, 177–178, 182–183, 186–190, 192–198, 200, 206, 211, 232–233, 266, 303, 305–307
Klein, Anton 84 Klemperer, Otto 82 Klose, Margarete 192 Knobelsdorff, Georg Wenzeslaus von 25, 44, 47, 117, 136–139, 142, 144, 146–147, 150–155, 158, 175, 195, 307 Konwitschny, Franz 50, 200, 209, 211 Kotschenreuther, Hellmut 173–174, 252–253, 256 Krause, Ernst 209 Krenek, Ernst 82–83, 129 Kristi, Grigori 267 Kroll, Erwin 244, 253 Kurella, Alfred 112, 273 Kurth, Willy 146, 149–150 Langhans, Carl Ferdinand 139, 144–148, 150, 155–156 Langhoff, Wolfgang 49 Laurens, Henri 58, 170 Lauter, Hans 225–226 Legal, Ernst 38–39, 55, 82, 109, 114–115, 126, 134, 146, 150, 178–185, 188–189, 193–195, 206, 226, 229, 253, 263, 283, 306 Lemmer, Ernst 58 Leskowsek, Hinko 108 Lessing, Gotthold, Ephraim 86 Leuteritz, Gustav 202, 204 Liebermann, Rolf 125, 247 Liebknecht, Kurt 142, 146, 150, 182 Lietzmann, Sabine 55, 209, 223 Littmann, Max 78, 156, 167 Lortzing, Albert 68, 99, 235 Lucas, Eduard 187 Lübke, Heinrich 57, 59–62, 64, 169, 172 Lücke, Paul 58 Lüddecke, Hermann 249 Lukács, Georg 111 Lunatscharski, Anatoli 113, 203 Mahler, Gustav 92 Mann, Heinrich 219 Mann, Thomas 88, 212 Marx, Karl 113 Matthus, Siegfried 263
Personenregister
347
May, Walter 213 Mayer, Hans 208 Mehring, Franz 110 Meffert, Erich 145 Melchinger, Siegfried 284 Melichar, Alois 249–252 Metternich, Josef 50, 180 Meyer, Ernst Hermann 226–227 Meyerbeer, Giacomo 64 Meyerhold, Wsewolod E. 93, 95 Mies van der Rohe, Ludwig 158, 163 Milhaud, Darius 263 Moore, Henry 58, 170 Morlacchi, Francesco 86 Moser, Hans Joachim 249 Mozart, Wolfgang Amadeus 15, 34, 53, 62, 64, 68, 76, 99, 189, 210, 213, 235, 247, 267, 269, 312–313 Müller, Karl Hermann 68 Muradeli, Wano 106 Mussorgski, Modest 100, 109, 236 Nahl, Johann August 148, 155 Nay, Ernst Wilhelm 58, 170 Neef, Hermann 267 Neuenfels, Hans 313 Neurohr, Jean 217 Nietzsche, Friedrich 204 Notowicz, Nathan 226 Nuschke, Otto 49 Oehlmann, Werner 126, 228 Offenbach, Jacques 222, 262, 269 Ohnesorg, Benno 312 Orff, Carl 229, 262 Otto, Werner 198 Paisiello, Giovanni 284 Palladio, Andrea 154 Paulick, Richard 25, 47, 137, 139, 141, 143, 145–158, 160, 170, 175–176, 307 Petersen, Julius 80 Piccinni, Niccolò 222 Pieck, Wilhelm 50, 55, 112, 177, 182–183, 223, 230
348
Personenregister
Pokrowski, Boris 108 Pollatschek, Walther 240 Popitz, Johannes 124 Praetorius, Michael 240 Preetorius, Emil 90, 93, 122, 212–215 Prokofjew, Sergej 106 Puccini, Giacomo 68 Raeck, Kurt 50 Raupach, Rudi 226 Reinhardt, Max 93, 95 Rennert, Günther 265 Rentmeister, Maria 46, 47, 268 Rentzsch, Egon 296 Rimkus, Günter 241 Rimski-Korsakow, Nikolai 100 Rode, Wilhelm 68–69 Rötscher, Heinrich Theodor 75, 86 Roller, Alfred 92 Rossini, Gioachino 68, 222 Rother, Artur 221 Rühmann, Heinz 216, 222 Ruf, Sep 165 Rufer, Josef 246–247 Ruppel, Karl Heinz 244 Scharoun, Hans 158, 163 Scherchen, Hermann 49, 227, 243–244, 248, 254 Schiller, Friedrich 32–33, 62, 73, 76–77, 81, 83, 86–88, 99, 110, 113, 128–129, 171, 264 Schinkel, Karl Friedrich 78, 140–141, 143, 153 Schleif, Wolfgang 226 Schmidtmann, Paul 229 Schmidt, Carlo 58 Schmidt, Waldemar 50 Schönberg, Arnold 26, 36, 39, 63, 65, 83, 89, 115, 125, 131, 227, 232, 234, 243–253, 255, 257–258, 276, 302 Schönberg, Gertrud 246, 258 Schönewolf, Karl 263–265, 268 Scholz, Paul 49 Schopenhauer, Arthur 204 Schostakowitsch, Dimitri 104–106 Schuh, Oskar Fritz 265 Schwarz, Werner 58
Schweitzer, Anton 74 Schweizer, Otto Ernst 158 Schwedler, Rolf 164 Shdanow, Andrej 106, 108, 134, 236 Seeling, Heinrich 57, 163 Sellner, Gustav Rudolf 56, 60, 64, 171, 248, 256 Senff, Ernst 249 Sievert, Ludwig 200 Sonnenfels, Joseph von 73 Sonrel, André 163 Speer, Albert 44 Spontini, Gaspare 64, 86 Stalin, Josef 104, 106, 191 Stanislawski, Konstantin Sergejewitsch 93, 95, 263, 266–267, 277 Stoph, Willi 49 Strauß, Johann 126 Strauss, Richard 15, 82, 122, 125, 177, 213 Strawinsky, Igor 115, 125, 227–228 Stuckenschmidt, Hans Heinz 56, 125–127, 206, 244, 248 Stücklen, Richard 58 Stüwe, Hans 217 Suchoň, Eugen 109 Suhr, Otto 119–121, 288 Suppé, Franz von 126 Tiburtius, Joachim 60, 62–63, 121, 130, 171, 185, 188, 196, 198, 245, 297 Tietjen, Heinz 24, 37, 39, 66, 90, 93, 96, 121– 127, 134, 180, 183–184, 189, 194, 211–215, 220–221, 247, 274, 284, 303–304 Trötschel, Elfride 189 Tschaikowski, Pjotr Iljitsch 100, 109 Tschulaki, Michail 49 Uhlmann, Hans 57, 165, 173–174, 176 Ulbricht, Walter 49, 55, 97, 113, 116, 140–141, 154, 177, 182, 272 Vallentin, Maxim 112 Verdi, Giuseppe 64, 68, 93, 125, 267, 270 Wagner, Eva 90 Wagner, Richard 15, 23, 35, 53, 66, 68–69, 71,
75–78, 81, 86–89, 91–93, 95, 99, 122–123, 125, 156, 168, 175–176, 189, 194, 199, 202–215, 235, 247, 264–265, 269, 273–274, 277, 284, 303, 305 Wagner, Siegfried 90 Wagner, Wieland 14, 16, 27, 64, 92, 147, 163, 214–215, 267, 269 Wagner, Winifred 122, 212 Wagner, Wolfgang 14 Wagner-Régeny, Rudolf 185 Wandel, Paul 177, 182, 189 Weber, Carl Maria von 15, 50, 64, 68, 84–86, 99, 235 Webern, Anton 227 Weill, Kurt 54, 66, 79, 93, 101, 247, 307
Personenregister
Westphal, Kurt 231, 253, 256 Wieland, Christoph Martin 74 Wilde, Erika 210 Wilde, Oscar 82 Wilhelm II. 139, 222 Winds, Erich-Alexander 242 Witte, Erich 180, 269 Wolf, Friedrich 239 Wotruba, Fritz 58, 170 Zehrer, Hans 41 Zetkin, Clara 110 Zuckmayer, Carl 216, 219, 274 Zweig, Arnold 49
349
Die Gesellschaft Der Oper. Musikkultur eurOpäischer MetrOpOlen iM 19. unD 20. JahrhunDert her ausGeGeben vOn philipp ther
bD. 1
philipp ther in Der Mitte Der Gesellschaft Operntheater in Zentr aleurOpa 1815–1914 2006. 465 s. br. 148 X 210 MM. isbn 978-3-7029-0541-5 [a], 978-3-486-57941-3 [D]
bD. 2
sven Oliver MÜller, Jutta tOelle (hG.) bÜhnen Der pOlitik Die Oper in eurOpäischen Gesellschaften iM 19. unD 20. JahrhunDert 2008. 225 s. br. 148 X 210 MM. isbn 978-3-7029-0562-0 [a], 978-3-486-58570 -4 [D]
bD. 3
peter stachel , philipp ther (hG.) Wie eurOpäisch ist Die Oper? Die Geschichte Des Musik theaters als ZuGanG Zu einer kulturellen tOpOGr aphie eurOpas 2009. 226 s. br. 148 X 210 MM. isbn 978-3-205-77804-2 [a], 978-3-486-58800 -2 [D]
bD. 4
Jutta tOelle bÜhne Der staDt Mail anD unD Das teatrO all a scal a ZWischen risOrGiMentO unD fin De siÈcle 2009. 212 s. br. 148 X 210 MM. isbn 978-3-205-77935-3 [a], 978-3-486-58958-0 [D]
böhlau verlag, wiesingerstrasse 1, a-1010 wien, t: + 43 1 330 24 27-0 [email protected], www.boehlau-verlag.com
Die Gesellschaft Der Oper. Musikkultur eurOpäischer MetrOpOlen iM 19. unD 20. JahrhunDert her ausGeGeben vOn philipp ther
bD. 5
sven Oliver MÜller, philipp ther, Jutta tOelle, Gesa Zur nieDen (hG.) Oper iM WanDel Der Gesellschaft kulturtr ansfers unD netZWerke Des Musik theaters iM MODernen eurOpa 2010. 331 s. br. 148 X 210 MM. isbn 978-3-205-78491-3 [a], 978-3-486-59236-8 [D]
bD. 6
Gesa Zur nieDen vOM Gr anD spectacle Zur Great seasOn Das pariser théâtre Du châtelet als r auM Musik alischer prODuk tiOn unD reZeptiOn (1862–1914) 2010. 432 s. 32 s/ W-abb. br. 148 X 210 MM. isbn 978-3-205-78504-0 [a], 978-3-486-59238-2 [D]
bD. 7
sar ah Zalfen sta ats-Opern? Der WanDel vOn sta atlichkeit unD Die Opernkrisen in berlin, lOnDOn unD paris aM enDe Des 20. JahrhunDerts 2011. 458 s. br. 148 X 210 MM. 978-3-205-78650 -4 [a], 978-3-486-70397-9 [D]
bD. 8
GerharD brunner, sar ah Zalfen (hG.) Werk treue Was ist Werk, Was treue? 2011. 224 s. 9 nOtenbeispiele. br. 148 X 210 MM. isbn 978-3-205-78747-1 [a], 978-3-486-70667-3 [D]
bD. 9
fabian bien Oper iM schaufenster Die berliner OpernbÜhnen in Den 1950er-Jahren als Orte natiOnaler kultureller repr äsentatiOn 2011. 349 s. 6 s/ W-abb. br. 148 X 210 MM. isbn 978-3-205-78754-9 [a], 978-3-486-70666-6 [D]
böhlau verlag, wiesingerstrasse 1, a-1010 wien, t: + 43 1 330 24 27-0 [email protected], www.boehlau-verlag.com



![Nachkriegsgefüge: Europa und die Kunst in den späten 1940er und den 1950er Jahren [1 ed.]
9783412529253, 9783412529239](https://ebin.pub/img/200x200/nachkriegsgefge-europa-und-die-kunst-in-den-spten-1940er-und-den-1950er-jahren-1nbsped-9783412529253-9783412529239.jpg)
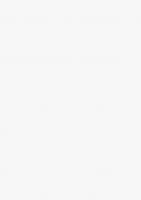



![Hochschulreformen: Eine unendliche Geschichte seit den 1950er Jahren [1 ed.]
9783428554249, 9783428154241](https://ebin.pub/img/200x200/hochschulreformen-eine-unendliche-geschichte-seit-den-1950er-jahren-1nbsped-9783428554249-9783428154241.jpg)
