Medienwechsel und Selbstreferenz: Christian Weise und die literarische Epistemologie des späten 17. Jahrhunderts [Reprint 2011 ed.] 9783110943771, 9783484350939
Careful analysis of school dramas and poetological texts by Christian Weise (1642-1708) reveals the crisis of emblematic
177 96 47MB
German Pages 246 [248] Year 2003
1. Vorbemerkung
2. »Hier hat ein kluger Platz zwey Spiegel auffgestellt«: ›Klugheit‹ als Beziehung von Selbst- und Fremdreferenz
3. Medienwechsel, Zeichenwechsel, Affektwechsel
4. »In der Freude selbst keine Freude empfinden«: Zur Logik literarischer Selbstreferenzunterbrechung
4.1. Von der ›similitudo‹ zur ›conclusio‹: Tautologie – Empirie – Erklärung
4.2. Rahmung und Verzeitlichung als semantische Strategien der Selbstreferenzunterbrechung: Zur zyklischen Kohärenz der Dramentrilogie in Christian Weisens Zittauischem Theatrum [...] (1683)
4.3. »Was etlicher massen verdecket wird / das wird nicht alsofort gäntzlich abgethan«: Hierarchisierung und Temporalisierung semiotischer Beziehungen
Literaturverzeichnis
Personenregister
Recommend Papers
![Medienwechsel und Selbstreferenz: Christian Weise und die literarische Epistemologie des späten 17. Jahrhunderts [Reprint 2011 ed.]
9783110943771, 9783484350939](https://ebin.pub/img/200x200/medienwechsel-und-selbstreferenz-christian-weise-und-die-literarische-epistemologie-des-spten-17-jahrhunderts-reprint-2011nbsped-9783110943771-9783484350939.jpg)
- Author / Uploaded
- Claus-Michael Ort
File loading please wait...
Citation preview
STUDIEN UND TEXTE ZUR SOZIALGESCHICHTE DER LITERATUR
Herausgegeben von Wolfgang Frühwald, Georg Jäger, Dieter Langewiesche, Alberto Martino, Rainer Wohlfeil
Band 93
Claus-Michael Ort
Medienwechsel und Selbstreferenz Christian Weise und die literarische Epistemologie des späten 17. Jahrhunderts
Max Niemeyer Verlag Tübingen 2003
Redaktion des Bandes: Georg Jäger
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar. ISBN 3-484-35093-8
ISSN 0174-4410
© Max Niemeyer Verlag GmbH, Tübingen 2003 h tip ://ww w. n iemeyer. de Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Printed in Germany. Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier. Satz: Johanna Boy, Brennberg Druck: Memminger MedienCentrum, Memmingen Einband: Buchbinderei Geiger, Ammerbuch
Inhalt
1. Vorbemerkung 2. »Hier hat ein kluger Platz zwey Spiegel auffgestellt«: >Klugheit< als Beziehung von Selbst- und Fremdreferenz 9 2.1. Das Tableau der Zeichen 9 2.2. Bühne, Spiegel, Malerei: Zur Repräsentation von Ähnlichkeit und Differenz 19 2.3. Destruktion des >Sinnbildes< und Konstruktion von Differenz: Weises Betrübte und wiederum vergnügte Nachbars Kinder (1699).. 29 3. Medienwechsel, Zeichenwechsel, Affektwechsel 3.1. Theater und Lektüre: Zur Wirkungsparadoxie des Weiseschen Schuldramas 3.2. Medienwechsel als Erfolgsgarant: >Privatberedsamkeit< 3.3. Mischung, Wechsel, Unterbrechung und die Paradoxien des >Geschmacks< 3.4. theatralische Gedichte< - >musikalische Quacksalbere Der Zusammenhang von >PoesieMusik< und >Medizin
similitudo< zur >conclusioExempel< und >Regel< - >Rezitativ< und >ArieKlugheit< und >MoralWahnsinn< Rollenwechsel und soziale Differenzierung 193 Literaturverzeichnis
213
Personenregister
237
VI
1. Vorbemerkung*
Die ambivalente Einschätzung, die dem umfangreichen dramatischen CEuvre des Rhetorikprofessors und Zittauer Schulrektors Christian Weise (1642-1708) entgegengebracht wird, verdankt sich einer implizit wertenden literaturgeschichtlichen Periodisierung: Reduziert sich den einen der Wert seiner Dramen im wesentlichen auf ihre Funktion als Gebrauchstexte des protestantischen Schultheaters, so werten ihn andere vorschnell zum frühen Aufklärer auf, dessen Prosadramen gegen Opitz' Regelpoetik verstoßen, die Ständeklausel relativieren, sich nicht zuletzt durch ihre gattungsübergreifende Verwendung komischer Figuren vom barocken Trauerspiel der Schlesier abheben und damit einen ästhetischen Mehrwert repräsentieren, der nicht auf die praktische Funktion der Dramen reduziert werden könne. So wird insbesondere Weises Trauer-Spiel Von dem Neapolitanischen Haupt-Rebellen Masaniello (1682) von seinem trilogischen Aufführungs- und Publikationszusammenhang isoliert, scheint als Einzelwerk aber um so mehr Deutungsprobleme aufzuwerfen.1 Hochbewertung und Vereinzelung zum >autonomen< Werk setzen einander voraus - eine Untersuchung der semantischen Strategien des Masaniello im Kontext von Weises Aufführungstrilogie und im Rahmen seiner Poetologie scheint dagegen den literaturgeschichtlichen Wert des Masaniello zugunsten einer vermeintlich literatursoziologischen Signifikanz des Textes zu mindern und dessen Interpretationshorizont auf die engere Gattungsgeschichte des Schuldramas einzuengen. Die vorliegenden Studien zu Dramen und zur Dramenpoetik von Christian Weise entziehen sich dieser falschen Alternative und favorisieren statt dessen eine Perspektive, aus der die Frage, ob Weise eher als Frühaufklärer und als früher Vertreter autonomisierter Literatur (Wich 1962) oder noch als Barockautor und als Vertreter einer heteronomen, schulrhetorisch instrumentalisierten Zweckliteratur einzustufen sei (Zeller 1980), an Bedeutung verliert. Sie gehen vielmehr von veränderten historischen und theoretischen Voraussetzung aus und versuchen, diskurs- und mediengeschichtliche Argumentationsangebote zu nutzen, ohne deshalb auf ein >close-reading< der
Hervorhebungen stammen - wenn nicht anders vermerkt - von mir. Kursivierte Titel verweisen auf das Literaturverzeichnis. Vgl. etwa das dunkle Resümee von Luserke 2000, S. 173: »Weises Stück hat in den vergangenen Jahrzehnten nur eine einzige Inszenierung erfahren. Das zeigt, daß der Masaniello kein aktuelles Drama ist, vielmehr handelt es sich um ein geschichtliches Stück, das ebenso ein Geschichtsstück ist. Insofern muß man stets aufs neue nach seinem Stellenwert in der Literaturgeschichte fragen.«
untersuchten Texte verzichten zu wollen.2 Textanalytische und (im weitesten Sinn) sozialgeschichtliche Hypothesenbildung können nur dann in ein wechselseitiges Steigerungs- oder zumindest Anregungsverhältnis gesetzt werden, wenn deren jeweilige Informations- und Komplexitäts->Überschüsse< nicht voreilig beschnitten werden, sondern das Auflösungsvermögen der Beobachtung erhöhen. Zum einen legen es die langfristig beobachtbaren sprach-, diskurs- und mediengeschichtlichen Veränderungen der Frühen Neuzeit nahe, die Phase des Wandels von der älteren zur neueren Literatur als einen Zeitraum des Übergangs zu definieren, der etwa dreihundert Jahre zwischen dem 15. und dem 18. Jahrhundert umfaßt. 3 Michel Foucaults Annahme eines >epistemischen Bruchs< zwischen dem Ähnlichkeits-Wissen des 16. Jahrhunderts und dem klassifizierenden Differenz-Wissen des 17. und 18. Jahrhunderts läßt die »Geschichte der Ähnlichkeit« im 17. Jahrhundert als Geschichte ihrer sukzessiven Einschränkung erscheinen (Foucault 1974, S. 27), die diese MakroPeriode ebenso prägt wie die Evolution der Printmedien seit Gutenberg: [...] an den Verwendungen von Handschrift, Druck und Theater läßt sich sehr gut erkennen, wie bewußt Entscheidungen für das einzelne Medium getroffen wurden und wie geschickt man sich diesen Medien anzupassen wußte, so daß sie umgekehrt nicht ohne konstitutiven Einfluß auf die Texte und im weiteren auf die Entwicklung der Literatur dieser Jahrhunderte waren. (Roioff 2000, S. 485)
Daß langfristiger semiotischer und medientechnischer Wandel seit dem späten 17. Jahrhundert stärker konvergieren, läßt sich - so die Hypothese - schließlich an Funktionskrisen der Literatur ablesen, denen auch das Weisesche Schultheater und -drama ausgesetzt ist. Zum anderen gehen die folgenden Untersuchungen von einer theoretischen Voraussetzung aus, die sich bei der Rekonstruktion semiotischer Strukturen von Literatur wird bewähren müssen. Wenn nämlich aus systemtheoretischer und soziologischer Perspektive gelten soll, daß »in der Systemdifferenzierung [...] der Prozeß der Systembildung reflexiv auf sich selbst angewandt [wird]« und »Systemdifferenzierung [...] somit die Außengrenzen nach innen [staffelt]« (Schwanitz 1990b, S. 107), dann schlagen sich solche Differenzierungsprozesse zugleich in gesellschaftlichen Selbstbeschreibungen nieder, die die ansteigende Komplexität im Verhältnis von Teilsystemen und ihren Umwelten reflexiv begleiten und verarbeiten. Sozialgeschichtlich orientierte Ansätze der Literaturwissenschaft haben unter diesen theoretischen Bedingungen versucht, den funktionalen Beitrag der Literatur
Die Arbeit wurde unter dem Titel »Schule der Affekte. Studien zu den Dramen Christian Weises« 1999 von der Philosophischen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel als Habilitationsschrift angenommen. Für Unterstützung und Anregungen danke ich Marianne Wünsch und Albert Meier sowie Georg Jäger, Jörg Joost, Joachim Linder, Dieter Pfau und Petra Kallweit. Womit ich dem >Berliner Modell der Mittleren Deutschen Literatur< folge (vgl. Caemmerer/ Delabar/Jungmayr/Kiesant 2000 und Roioff 2000).
zu solchen Prozessen zu bestimmen und literarischen Wandel und sozialen Wandel aufeinander zu beziehen.4 Da insbesondere die Wissenssoziologie Niklas Luhmanns die Frage nach der Beziehung von >Gesellschaftsstruktur und Semantik< - »nach einer Korrelation oder Kovariation von Wissensbeständen und gesellschaftlichen Strukturen« (Luhmann 1980a, S. 15) - interdisziplinär anschließbar elaboriert hat, ist dieses Theorieangebot mit unterschiedlichen Akzentuierungen genutzt worden, um die >Ausdifferenzierung< eines eigenständigen gesellschaftlichen Handlungsbereiches >Literatur< mit spezifischen Subsystemen und Handlungsrollen ab 1750 im synchronischen Schnitt und diachronisch zu modellieren (Schmidt 1989, Fuchs 1993, Eibl 1995, Plumpe 1995).5 Dabei überwiegen Versuche, die erstens eher synchroniser! und zweitens eher literatursoziologisch verfahren: Sie skizzieren >Literatur< als Sozialsystem zwar soziologisch differenziert, unterlassen es aber, den komplexen Wandelsprozeß zu beschreiben, der zu diesem >modernen< Systemzustand von Literatur geführt hat. So ist Stöckmann (2001) zuzustimmen, wenn er diagnostiziert, daß von »systemtheoretischer Seite [...] dieser um 1750 durchgreifende evolutionäre take off mitsamt seinen Folgeproblemen - man denke an die Originalitäts- und Innovationszwänge literarischer Kommunikation [...]- umfassend dargestellt worden [ist]« und sodann kritisch fortfährt: unübersehbar ist allerdings auch, daß die einschlägigen literaturwissenschaftlichen Applikationen der Systemtheorie in so erheblichen [sie] Maße von der Suggestionskraft des Neuen und Inkommensurablen getragen werden, daß die Literaturgeschichte des 18. Jahrhunderts [...] als Geschichte eines epochalen, in seiner >Emergenz< allerdings eigentümlich kontext- und voraussetzungslosen Ereignisses erzählbar wurde, [...]. (Stöckmann 2001, S. 367)
Darüber hinaus erschöpfen sich die Bemühungen, diese Untersuchungsrichtung für eine textbezogene Literaturgeschichte offen zu halten, allzuoft in systemtheoretischer >Hermeneutik< oder beschränken sich - mit Ausnahme älterer gattungssoziologischer Konzeptionen (z.B. Voßkamp 1977) - auf punktuelle Zurechnungen von literarischen Texten auf soziale Funktionen. Als Desiderat einer Sozialgeschichte der Literatur scheint demgegenüber auf, sowohl den Wandel literarischer Wissenskonstruktionen als auch den Wandel der sozialorganisatorischen Umstände dieser Konstruktionen
Was auf die mehrbändigen >Sozialgeschichten der Literatur^ wie etwa die von Rolf Grimminger begründete, nur bedingt zutrifft, obwohl auch für solche Projekte inzwischen gelten müßte, was Pfau 1993, S. 45 für die Literatursoziologie konstatiert: »Nicht der Bezug auf >GesellschaftWissenMittleren Literatur - zwischen 1650 und 1750 - dominieren im Rahmen einer alteuropäischen »poetologischen Semantik« (Stöckmann 2001) Rhetorik und Affekttheorien nach wie vor das anthropologische, zeichen- und erkenntnistheoretische Basiswissen. Sind Prozesse des sozialen Wandels in der Frühen Neuzeit als Bündel von Stratifizierungs-, Differenzierungs- und Re-Integrationsprozessen zu beschreiben und zugleich mit einem Reflexivwerden langfristig konstanten, gesellschaftlichen Wissens verknüpft, dann kann es als Indikator für gesellschaftlichen Wandel gelten, wenn Eigenschaften, Funktionen und Wirkungen von Literatur nicht nur in externen Reflexionsdiskursen, wie etwa demjenigen der philosophischen Ästhetik im 18. Jahrhundert, sondern auch in der Literatur selbst reflektiert werden, sie sich also angesichts gestiegener gesellschaftlicher Kontingenz und Komplexität ihrer Grenzen und Funktionen zu versichern sucht. Zu prüfen wäre dann etwa, ob und auf welche Weise sich Literatur selbst als Zeichensystem und in ihrer technischen Verfaßtheit in Speicher- und Verbreitungsmedien (Buch, Theater) thematisiert. Darüber hinaus liegt es nahe, Selbstreferenz auch als abstrakte semantische Struktur zu verstehen, ihr Problempotential aufzuspüren und insbesondere das Verhältnis von Tautologie, Paradoxie und Zirkularität zu untersuchen. Wenn diese Begriffe im folgenden gelegentlich als gleichrangig behandelt werden, dann ist dabei an einen Zusammenhang gedacht, den Gerhard Plumpe und Niklas Luhmann wie folgt beschreiben: Die tautologische Formulierung ist paradox, da sie mit einer Differenz operiert, die keine ist. Um die [...] Kommunikation nicht zu blockieren, ist es daher notwendig, das Paradoxe dieser Tautologie aufzulösen und ergiebigere, anschlußfähigere Selbstbeschreibungen anzufertigen. (Plumpe 1990, S. 73). Enttautologisierungen sind Entparadoxierungen, [wobei] Paradoxien [...] nicht auf einen (zu vermeidenden) circulus vitiosus zurückzuführen [sind], sondern solche Zirkel [...] mißlungene Formen der Entparadoxierung [sind]. (Luhmann 1987, S. 170)
Paradoxien können demnach latent bleiben, also zu Tautologien entschärft oder in Zirkel aufgelöst werden, wobei sich letztere entweder zu paradoxer Selbstbezüglichkeit
Vgl. pauschal Bachelard 1974, Canguilhem 1979, Foucault 1973 und 1974 oder auch das Konzept einer >Denkgeschichte< sensu Titzmann 1991b, S. 425-428, die die »epistemologischen Basisprämissen« von »Diskursen« rekonstruiert (S. 408).
ODieser Satz ist falschRealität< selbst - vermitteln. Solche Konstruktionen halten ferner Unterscheidungssemantiken bereit, die die gesellschaftlichen Realitätskonstruktionen tragen. Deren Funktionsfähigkeit ist jedoch nur gewährleistet, wenn der jeweilige >blinde Fleck< von Unterscheidungen oder Leitdifferenzen (wie z.B. >gut< und >bösegesund< und >krankrecht< und >unrechtschön< und >häßlich< usf.) ausgeblendet, also die Einheit der Unterscheidung nicht oder jedenfalls nicht permanent thematisiert wird: Alles Wissen ist [...] letztlich Paradoxiemanagement, und dies in der Weise, daß man eine Unterscheidung vorschlägt, deren Einheit nicht thematisiert wird, weil dies das Beobachten in die Form einer Paradoxie bringen, also blockieren würde. (Luhmann 1995, S. 173).
Manifestieren sich nun innerhalb eines Diskurses verstärkt semantische Strategien der Enttautologisierung oder Entparadoxierung einschließlich ihrer zirkulären Varianten, dann deutet dies auf ein Problempotential hin, das je diskursspezifische Unterscheidungen aufgestaut haben. Im Falle des Diskurses über Affekte - sei er literarisch oder nicht-literarisch, also z.B. medizinisch, rhetorisch oder poetologisch verfaßt - kann dies bedeuten, daß die Thematisierung der Einheit einer moralischen Unterscheidung von Affekten durch andere konkurrierende Unterscheidungen (medizinische, ästhetische, soziale) erzwungen wird und die Gefahr einer Selbstblockade dieses Diskurses mit der Beeinträchtigung seiner Unterscheidungsfähigkeit steigt. Oder um ein anderes Beispiel zu geben: Eine binäre und antinomische Unterscheidung, wie die horazische und Weisesche von >Lust< und >Nutz< wird dann zur Paradoxie, wenn ihre oppositionellen Glieder als simultan gleichrangig gedacht werden, die Unterscheidung also damit eigentlich außer Kraft gesetzt wird. Diese Art einer - latent selbstreferentiellen - Blockade der Unterscheidung als (paradoxe) Einheit ist zum einen dadurch zu durchbrechen, daß sie rekursiv hierarchisiert wird, also etwa unter >Nutzen< selbst wieder >Lust< und >Nutzen< subsumiert werden, was Luhmann den >Wiedereintritt der Unterscheidung in das Unterschiedene< nennt, so daß die Einheit der Unterscheidung sichtbar, aber durch Ebenendifferenzierung entparadoxiert wird. (>re-entryParadoxieauflösung< durch Unter-
>Diskurs< wird im lockeren Anschluß an Foucault 1973 verstanden als »ein System des Denkens und Argumentierens, das von einer Textmenge abstrahiert ist und das erstens durch einen Redegegenstand, zweitens durch Regularitäten der Rede, drittens durch interdiskursive Relationen zu anderen Diskursen charakterisiert ist. [...]. Ein Diskurs ist [...] ein System, das die Produktion von Wissen regelt« (Titzmann 1991b, S. 406, S. 407).
Scheidung von Beobachtungsebenen S. 374). Zum anderen können die Glieder des Widerspruchs aber auch temporalisiert d.h. nacheinander aktualisiert werden, so daß sie nur innerhalb einer diachronen Serie koexistieren. Beide semantischen Strategien machen Anschlußkommunikationen und Anschlußunterscheidungen wahrscheinlicher und Selbstreferenz in ihrer Unterbrechung zugleich als solche sichtbar (Junge 1993). Der daran ablesbare Bedarf an Unterbrechung paradoxer (tautologischer, zirkulärer) Selbstreferenz indiziert allerdings ferner, daß die jeweiligen Unterscheidungen im Rahmen alternativer Unterscheidungen zur Disposition stehen. Unterscheidungen, die im Kontext gleichwahrscheinlicher Alternativen kontingent werden, büßen ihre soziale Funktionsfähigkeit ein: Wenn Literatur sowohl als >Lust< oder >Nutz< als auch als >schön< oder >häßlich< bewertet werden kann, hat sie nicht nur die gestiegene Komplexität verdoppelter Wahlmöglichkeiten zu verarbeiten, sondern auch intrinsisch zu vermitteln, welche der Optionen erfolgreich sein soll - ein Problem, dem die Schuldramen Weises in besonders hohem Maße ausgesetzt sind.8 Strukturen der logischen Selbstbezüglichkeit können nun ihrerseits ästhetisch genutzt oder verschleiert werden, wobei letzteres eher an nicht-literarischen Diskursen zu beobachten ist. Tugendlehren haben kein Interesse daran, ihre Lehrbarkeit und Wirkung durch evidente Selbstbezüglichkeit zu beeinträchtigen, die die >blinden Flecke< ihrer Unterscheidungen expliziert und diese damit relativiert. Eine Komödie kann jedoch genau dies tun und damit indirekt als Medium der Selbstreferenzunterbrechung fungieren, da hier die Einheit literaturfremder Unterscheidungen thematisiert werden kann, ohne daß deren Funktion dadurch beeinträchtigt würde. Daß solche semantischen Strukturen indessen keineswegs erst um 1750 als Indiz einer sozial zusehends >autonomisierten< Literatur auftreten,9 führt die Notwendigkeit einer weniger kurzatmigen und normativen Rekonstruktion der Geschichte literarischer Selbstreferenzunterbrechung in der Frühen Neuzeit vor Augen. Ohne eine Geschichte der Selbstreferentialität in der >Mittleren Literatur< zwischen 15. und 18. Jahrhundert
Niklas Luhmann unterscheidet in diesem Sinn >Speicher-< und >Verbreitungsmedien< von >ErfolgsmedienKunstsystems< in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts auf eine »Startformel« und eine »Abschlußformel« und den Wechsel von Selbstbeschreibungen bezieht (S. 66): »Im Jahre 1767 schrieb Heinrich Wilhelm von Gerstenberg: >Poesie ist das Werk des GeniesPoesie ist PoesieGelegenheitsrede< geschrieben (bzw. diktiert) und dann - nicht zuletzt aufgrund langer Unterbrechungen im Zittauer Schulbetrieb - zusehends zur gedruckten >WiedergebrauchsredeAutor< verbunden, der den spezifischen Aufführungskontext seiner Dramen verloren hat, dennoch unvermindert weiterschreibt und die Zwecke seines Schreibens und Publizierens veränderten Bedingungen anzupassen versucht. Beabsichtigt ist weder eine vollständige Monographie zu Christian Weises Dramen noch die erschöpfende Analyse einzelner Texte, sondern vielmehr eine mikroanalytische Lektüre exemplarischer Dramen Weises (mit einem Seitenblick auf Johann Sebastian Mitternacht) und seiner gattungs- und affekttheoretischen
10
Luhmanns Konzept des gesellschaftlichen Wissens als >Paradoxiemanagement< weist Parallelen zur Konzeption von >ProblemProblemlösung< und semantisch-logischem >Widerspruch< auf, wie es Titzmann 1991b, S. 431-434 im Rahmen eines Modells des literarischen Wandels entwickelt; die Parallelen ergeben sich aus der Ablösung der Kausalerklärung durch funktionalistische Denkfiguren in der Systemtheorie, vgl. Baecker 2000, insbesondere S. 219-222. Zur >Selbstreferenz in systemtheoretischer und semiotischer Sicht< siehe im Überblick Nöth 2000 und mit Blick auf den Wandel gesellschaftlicher Selbstbeschreibungen Kneer 2003. - Die Geschichte literarischer >Selbstreferenzunterbrechung< impliziert eine Komplementärgeschichte literarischer Paradoxie und Zirkularität, die an die »Serien der Paradoxa< in der Logik des Sinns von Deleuze 1993 kritisch anknüpfen könnte.
Poetologie, die einzeltextspezifische und korpusspezifische Befunde auf abstrakte Problemkonstellationen zu beziehen erlaubt. Auf einen gesonderten Forschungsbericht zu Weises Schultheater und seine Dramen kann dabei verzichtet werden, da umfängliche Forschungsliteratur jeweils ad hoc in den Anmerkungen diskutiert wird. Angestrebt ist, spezifische Gesichtspunkte am Textkorpus so zu konkretisieren, daß theoretische Vorgaben heuristisch genutzt werden können, ohne den >Überschuß< an Textbeobachtungen von vornherein zu beschneiden. Diese Beobachtungen unterlaufen dabei die Grenzen der Einzelwerke im Korpusbezug und beziehen die Dramen Weises exemplarisch auf sowohl ältere als auch jüngere Diskurskontexte, so daß ihre spezifische Verankerung im literarischen und poetologischen Problemhorizont deutlich wird. Die an ihnen nachweisbaren Schnittpunkte von Mediengeschichte, Schulrhetorik und Affektpoetologie und die semantischen Strategien der Selbstreferenzunterbrechung verdanken sich allerdings, wie zu zeigen sein wird, langfristig anhaltenden Dispositionen. Im Anschluß an diskursgeschichtliche und wissenssoziologische Thesen von Foucault und Luhmann gewinnt so eine semiotische und zugleich medienhistorische Problemkonstellation Kontur, die nicht nur das Schultheater im letzten Drittel des 17. Jahrhunderts auszeichnet: Auf welche Weise nämlich die didaktischen Wirkungsansprüche und rhetorischen Erkenntnismittel dramatischer Literatur zwischen Klugheit und Moral neu verhandelt werden, erweist sich für das beginnende Ende des Zeitraumes der >mittleren Literatur< - also für den sukzessiven Übergang vom Barock zur Aufklärung - als spezifisch.
2. »Hier hat ein kluger Platz zwey Spiegel auffgestellt«: >Klugheit< als Beziehung von Selbst- und Fremdreferenz
2.1. Das Tableau der Zeichen Christian Weise hat seinem Dramensammelband Freymüthiger und höfflicher Redner/das ist / ausführliche Gedancken von der Pronunciation und Action, Was ein getreuer Informator darbey rathen und helffen kann / Bey Gelegenheit Gewisser Schau-Spiele allen Liebhabern zur Nachricht gründlich und deutlich entworffen (1693) ein unsigniertes Titelkupfer vorangestellt (Abbildung siehe S. 10).' Zwanzig Alexandriner in Paarreimen kommentieren es im Anschluß an das Titelblatt (SW XII/2, S. 391): Erklärung des Kupffer-Blats:
5
10
15
20
Hier hat ein kluger Platz zwey Spiegel auffgestellt / In einem bildet sich die cuRiöSe Welt / Die spielet allerseits mit Tritten und Figuren / Mit schöner Eitelkeit / mit stoltzen Posituren / Und was man eusserlich gut oder böse macht / Das wird gut oder böß im Spiegel beygebracht. Gesetzt / wir wollen diß gar gerne besser sehen: So muß das Ebenbild in der Gestalt geschehen. Gleich wie ein Mahler thut: Der richtet allemal Die Kunst in der Copie nach dem ORIGINAL. Der andre Spiegel führt uns tieffer ins Gewissen / Daß wir die Fehler selbst an uns erkennen müssen. Weil er den Übel-Stand an unserem Leibe zeigt / Den mancher Feind verlacht / den mancher Freund verschweigt. In jenem lernen wir fromm und gedultig werden / In diesem bessern wir die Freyheit in Geberden. Man sieht / was möglich ist / man schickt sich in die Welt / Man mercket an sich selbst / was ändern wolgefällt. Und solches müssen wir von diesem Spiegel sprechen: Will jemand klüger seyn / so mag er ihn zerbrechen.2
Für die Reproduktion aus dem Freymüthigen und höfflichen Redner (Signatur Pg.l2°57) danke ich dem Leiter der Abteilung Altbestand in der Christian-Weise-Bibliothek Zittau, Herrn Dipl.-Bibl. (FH) Uwe Kahl. Nach einer längeren Vorrede (SW XII/2, S. 392-455) folgen die Dramen Die Merckwürdige Begebenheit von Naboths Weinberge und der gestürzten Jesabel (aufgeführt 1685), Der Fall des Französischen Marschalls von Biron (aufgeführt 1687) und Der politische Quacksalber (aufgeführt 1684).
Sowohl Untersuchungen zu Weises Dramen und seiner Schulbühne (z.B. Haxel 1932, S. 61, Eggert 1935, S. 111, 355, Zeller 1980, S. 69-70) als auch jüngere Arbeiten zur Diskurs- und Mediengeschichte von Rhetorik, theatralischer Actio und Affektsemiotik (Geitner 1992, S. 97-100 und im Anschluß daran Göttert 1998, S. 241f.) weisen diesem Frontispiz und seiner >Erklärung< einen beinahe emblematischen Aussagewert als >mise en abyme< zu, der sowohl die Weisesche Bühne und ihre Wirkungsabsichten als auch die Medien >kluger< Fremd- und Selbstwahrnehmung betrifft. 3 Es liegt deshalb nahe, die vereinzelten Interpretationen des Titelkupfers in der Forschungsliteratur an der Komplexität seiner Bild-Text-Beziehungen zu messen. Die Bemerkungen von Haxel (1932) im Abschnitt >Kupferstiche und Text< (S. 57-63) seiner Studie zu den Lustspielen Weises beschränken sich auf Zitate aus der Erklärung, obwohl er Bildbeigaben in Büchern für lesekundiges Publikum durchaus einen Bedeutungsüberschuß - eher Verdunkelungs- denn Illustrationsoder Erklärungsfunktion (S. 57) - attestiert. Seine Zuordnung der jeweiligen Text>Erklärungen< zu den beiden abgebildeten Spiegeln bleibt darüber hinaus uneindeutig. Daß das Kupfer die zweigeteilte Kulissenbühne des Weiseschen Schultheaters abzubilden scheint, wie sie u. a. aus Regieanweisungen rekonstruiert werden kann,4 entgeht Haxel (S. 61) jedoch nicht und wird insbesondere von Eggert (1935) betont (S. llOf.). Mehr als eine grobe Ähnlichkeit der dargestellten Raumstaffelung mit dem aus einer Vorbühne und einer durch Vorhang abschließbaren Mittel- und Hinterbühne bestehenden Bühnenraum Weises vermag indes auch Eggert nicht zu konstatieren: Ob der im Bild sichtbare, geraffte Vorhang die Grenze zwischen Bühne und tiefer gelegenem Zuschauerraum - zwischen drei Darstellern und fünf Zuschauern - markiert oder als >Mittelgardine< die Hinter- und Mittelbühne mit drei Akteuren von der tiefer liegenden Vorderbühne mit fünf Akteuren abtrennt, ob die Treppe links also auf den Zuschauer- oder bereits auf den Bühnenbereich führt und die drei Stühle somit synekdochisch den Zuschauerraum bezeichnen oder Requisiten der Vorderbühne darstellen: wo also die Grenze zwischen Zeichen und Welt genau verläuft, läßt das Kupfer offen. Eggert unterscheidet beide Deutungsmöglichkeiten zwar präzis, interpretiert ihre Beziehung selbst aber nicht mehr, sondern räumt lediglich den begrenzten theatergeschichtlichen Dokumentcharakter des Titelkupfers ein (S. 111: »Man sieht, wie schwierig es ist, selbst von einem so ins einzelne gehen-
Eggert 1935 schließt seine Untersuchung zu Weises Bühne mit den Versen 17-20 der >Erklärung< des Titelkupfers (S. 355); ihres ikonischen wie theoretischen Kontextes beraubt scheinen sie - wie eine subscriptio - die von Eggert postulierte, überzeitliche Signifikanz von Weises Leben und Werk zu reflektieren: »In solchem Sinne wird >Weise und seine BühneSpiegel der Zeit - Spiegel der WeltSpiegel der Welt< und der >Spiegel der Selbsterkenntnis< (»Klugheit [...] als angewandte Psychologie«, S. 69), »beide lehrhaften Spiegel-Effekte müssen zusammenkommen, die Kenntnis der eigenen Person muß sich mit der Erfahrung in der Beurteilung anderer verbinden« (S. 70).5 Im diachronisch und synchronisch erweiterten Kontext seiner >Geschichte der Stimme< von der Antike bis zum 20. Jahrhundert verdeutlicht Göttert (1998) mit Verweis auf Geitner (1993) anhand des Titelkupfers, daß Weises Rhetoriklehre als Einübung sozialer Rollen und angemessener actio und pronunciatio auch das »Selbststudium« (S. 241) vor dem Spiegel einschließe. Wie Götterts Zitat aus dem Freymüthigen Redner belegt, diene solches Selbststudium der Ausbildung einer >freymüthigen< Beredsamkeit des Leibes, die über die Reproduktion bloßer Regelhaftigkeit hinausgehe: »Denn ein Redner soll freymüthig / ungezwungen / und also zu sagen ein Dollmetscher seines Hertzens / und nicht ein Papagey von fremden oder ausstudirten Worten seyn.« (SW XII/2, S. 407). Auf Weises >Erklärung< des Kupfers geht Göttert allerdings nicht ein, sondern vertraut auf die selbstexplikative Evidenz des reproduzierten Kupferstichs (Göttert 1998, S. 242). - Auch Geitner (1993) zieht in ihrem Exkurs zur Bedeutung der eloquentia corporis und der Actio-Lehre für die neuzeitlichen Bildungs- und Interaktionsideale< (S. 80-106) Weises Freymüthigen Redner und sein Konzept einer »comödiantischen Erziehung« (Geitner 1993, S. 94-106, hier 94) heran und deutet ihn als Beispiel für die langfristige Bearbeitung des seit Cicero und Quintilian bekannten Dilemmas aus innerer >Affekt-Natur< und äußerlicher >Affektation< ihres Ausdrucks: Als Voraussetzung erfolgreicher Kommunikation der motus animi gilt die rhetorische Regelhaftigkeit ihres Ausdrucks, welche wiederum die Authentizität der Gemütsbewegungen verfehle, letztere nur zu simulieren erlaube (S. 91f.).6 Die latent paradoxe Selbstblockade, >freymüthige< Rede und >Besserung< der »Freyheit in Geberden« (Erklärung, V. 16) einüben und regulieren zu wollen, werde durch eine physiognomische Selbstbeobachtung aufgehoben, die der kleinere, am linken Bühnenrand angebrachte Spiegel ermögliche (V. 11: »Der andre Spiegel führt uns tieffer ins Gewissen / [...]«) und die - wie Geitner mit Die Ungenauigkeit von Zellers alles andere als >kluger< Bildbetrachtung treibt seltsame Blüten: Zeller entgeht nicht nur, daß die von ihm als >Schauspieler< bezeichnete, höfisch ausstaffierte Figur rechts vorne nicht alleine und nicht auf gleicher Ebene vor dem Spiegel steht, sondern auch, daß sie gar nicht in den Spiegel blickt: »In dem einen Spiegel [...] erblickt der Schauspieler nicht sich selbst, sondern mehrere fremde Personen« (S. 69). Er erblickt sich selbst in der Tat nicht, aber nur deshalb, weil er den Blick abwendet; sähe er in den Spiegel, wie Zeller behauptet, sähe er wiederum keine >fremden PersonenAnthropomorphisierung< des sozialen Rollenspiels und seiner Befreiung von göttlicher Determination gewichen: Die Theater-Analogie, so kann im Anschluß an Geitner resümiert werden, stellt ihre Semantik von Fremdkontrolle auf Selbstkontrolle um.8 Daß Geitner aus den beiden letzten Versen der Erklärung (V. 19/20: »Und solches müssen wir von diesem Spiegel [dem links positionierten, CMO] sprechen: Will jemand klüger seyn / so mag er ihn zerbrechen.«) zu dem einseitigen Schluß gelangt, dieser allein sei »der eigentlich wichtige« (S. 97), wirkt vor diesem Hintergrund allerdings nicht recht plausibel, zumal sie die Verse 5 bis 10, die insbesondere ab Vers 7 den Übergang vom rechten zum linken Spiegel argumentativ vorbereiten, nicht nur nicht zitiert, sondern vollständig aus ihrer Interpretation ausblendet. Selbstbeobachtung (im Spiegel links) und kollektive Selbst- und Fremdbeobachtung (im Spiegel rechts), so ist zunächst festzuhalten, bedingen einander und bilden erst gemeinsam das Tableau visueller Beobachtungsrichtungen, welches die affektrhetorischen und poetologischen Aussagen des Freymüthlgen Redners - seiner Vorrede und seiner Dramen - versinnbildlicht.9 Aus den auf den linken Spiegel bezogenen
Vgl. Geitner S. 97-98; sie verweist außerdem auf eine der Vorredner-Figuren in Weises 1683 aufgeführter Dramatisierung Jo. Barclaji Gedichte von der Sizilianischen Argenis; vgl. ebd. (SW l, S. 383): »[Hiero.J [...] In dem ein jedweder [...] / auf das Leben selbst und auf die Jahre des Männlichen Alters / das ist / auf die grosse Comoedie zu dencken gewohnet ist.« - Die invers verlaufende Analogie liegt dem »Sprüchwort [...] COMOEDIA EST VITAE HUMANAE SPECULUM« zugrunde (Vorrede zu Lust und Nutz der Spielenden Jugend [...], 1690, SW VIII, S. 423; nochmals zitiert in der Vorrede zur Komödie Ungleich und Gleich gepaarte Liebes-Alliance, 1708, SW XV, S. 320): Das Leben ist (wie) eine Komödie, die Komödie ist (wie) ein Spiegel des Lebens. Wobei aber, so ist anzumerken, die Doppelrolle der Figuren rechts vorne als Zuschauer und Akteure durchaus dem alten >Theater-Sinnbild< entspricht, wie es Alewyn 1959 charakterisiert: »Von Gott, dem absoluten Spieler, zu Gott dem absoluten Zuschauer, führt die Achse durch eine Stufenfolge von Wirklichkeiten. In Ihrer Mitte aber steht der Mensch, auch seinerseits Zuschauer zugleich und Schauspieler in dem Großen Welttheater des Barock« (S. 70). Geitners Formulierung, der Betrachter des linken Spiegels stehe »hier nicht außerhalb, nicht jenseits des Spiegels und der Spiegelung, wie es beim >WeltKlugheit< bedarf beider Spiegel, nur wer sich zu Recht oder Unrecht noch >klüger< wähnt, mag auf den linken Spiegel verzichten und das Medium der Selbsterkenntnis >zerbrechenklugem< ikonischen und sprachlichen Tableau scheint jedenfalls eine Lektüre angemessen, die die Komplexität der dargestellten Beziehungen zwischen Beobachtung und Selbstbeobachtung - die mehrfache Überlagerung der Positionen von Zuschauer und Betrachter einerseits und Darsteller und Wahrnehmungsobjekten andererseits - nicht vorschnell reduziert. Unterhalb des Feldes der Titelkartusche »Der Freymüthige und höffliche Redner« schließt sich der symmetrisch geraffte Vorhang an, dessen Status als bühneninterne Binnen- oder als Außengrenze (wie schon von Eggert beklagt) nicht definitv zu bestimmen ist. Darunter bieten sich dem zentralperspektivisch und erhöht - in göttlich-königlicher Position - situierten externen Betrachter (Ebene 0) mehrere interne, horizontal und vertikal gestaffelte Auftrittsebenen und Raumzonen dar. Bildintern etabliert wird die hierarchisch höchste, externe Beobachterposition des Zuschauers, Bildbetrachters und Lesers durch die jeweils über den beiden Spiegeln befindlichen Motti, deren Schriftzüge nicht der dargestellten Bühnenwirklichkeit angehören, sich also nicht als Beschriftung der Kulissenwände erweisen.10 Davon zu unterscheiden ist weiterhin die am tiefsten gelegene Ebene l, die vom unteren Rand des Kupfers abgeschnitten wird und durch eine Treppe links unten auf Ebene 2 führt, deren Status als noch interne aber tiefer liegende Vorderbühne oder als bühnenexterner Zuschauerraum unbestimmt bleibt. Auf ihr koexistieren sowohl die Zuschauerpositionen der drei nebeneinander gestellten, leeren Stühle links als auch eine konvex zum Betrachter angeordnete Gruppe von fünf stehenden Figuren, die diesem - mit Ausnahme der im Profil sichtbaren zweiten Gestalt von rechts - den Rücken zukehren." Vier Figuren - das linke Paar aus Mann und Frau, die Frau des
verwechselt sie doch den virtuellen Bildhorizont der Spiegel mit den Auftrittsebenen der vertikal gestaffelten Bühne und die je unterschiedliche räumliche Distanz zwischen Spiegel und Betrachter mit deren Ein- oder Mehrzahl. 10 Die inscriptiones setzen beide Bildteile im Sinne von V. 7 der Erklärung in ein Steigerungsverhältnis. Die rechte inscriptio (»Ich sehe es gerne besser«) verweist auf die linke, die >besseres Sehen< konstatiert: »Ich sehe es besser.« " Weises Dramen überschreiten variantenreich die Grenzen zwischen verschiedenen Spielebenen und verleiben sich Außengrenzen als Binnengrenzen ein, so etwa im 1696 gedruckten Lustspiel Vom verfolgten Lateiner. Der erfolglos intrigierende Kirchschreiber Pomponius ergreift im vorletzten Auftritt des letzten Aktes die Flucht in die Zuschauerrolle: »>Doch potz tausend sie kommen mir schon auff den Hals / ich werde mir einen bequemen Platz suchen müssen.< - (Er springt herunter und setzt sich vor das Theatrum auffein Stühlchen.)« (SW XIII, S. 303).
14
zweiten Paares sowie eine einzeln stehende männliche Figur rechts blicken auf die erhöhte (Mittel-)Bühne (Ebene 3): Die drei mittleren Figuren spiegeln sich bis zum Oberkörper in einem gerahmten Spiegel, den ihnen ein diabolischer, bocksbeiniger Satyr mit Blickkontakt zu Ebene 2 vorhält. Eine höfisch gekleidete männliche Gestalt ohne Blickkontakt zu Ebene 2 deutet kommentierend - gleichsam rahmend - auf das Spiegelbild. Eine zweite, ähnlich gekleidete männliche Figur links wendet dieser den Rücken zu und betrachtet ihre eigene Physiognomie in einem in Kopfhöhe an der ersten Seitenkulisse angebrachten, kleineren Spiegel. Die schließlich hinter der Spiegelebene zentralperspektivisch zum Bühnenprospekt ansteigende, leere, von weiteren drei mit Bäumen bemalten Kulissenpaaren begrenzte Bühnenfläche (Ebene 4) endet im Bereich des Fluchtpunktes, auf den auch die beiden mittig herabhängenden Kordeln des Vorhangs verweisen. Als signifikant erweisen sich die Differenzen in den Beziehungen zwischen Betrachter(n) und Spiegelbild, wobei den drei höfisch-aristokratisch kostümierten Degenträgern - dem Selbstbeobachter, dem Kommentator des Spiegels rechts und der zweiten Gestalt von rechts in der Figurengruppe unten - besondere Bedeutung zukommt: Während die solitäre Selbstbeobachtung keiner sozialen Kontrolle innerhalb der Spielebene 3 unterliegt und vollständig auf der Bühne >agiert< wird, überschreitet die Bespiegelung der Figurengruppe rechts die Grenze zwischen Ebene 3 und Ebene 2, Akteure und Zuschauer befinden sich auf verschiedenen Niveaus. Die Figurengruppe bekommt den Spiegel vorgehalten, ohne deshalb zur direkten Selbstwahrnehmung verpflichtet zu sein. Aus größerer räumlicher Distanz kann sie der Selbstbespiegelung visuell ausweichen und etwa die actio der Figuren beobachten, die ihr den Spiegel vorstellen bzw. ihn kommentieren, oder auch das Spiegelbild des je anderen betrachten. Daß potentiell auch der links stattfindende Akt der Selbstbeobachtung noch im Gesichtfeld der Figurengruppe liegt, verdeutlicht der dritte der drei >Kavaliere< in der Figurengruppe, dessen Blickrichtung - wie die der beiden ähnlich gekleideten Figuren auf Ebene 3 - quer zu derjenigen der anderen Figuren verläuft. Er wird zwar gespiegelt, verweigert aber als einziger in der Gruppe auf Ebene 2 explizit den Blick in den (oder zumindest in Richtung auf den) Spiegel und wendet sich sowohl dem linken Teil der Bühne einschließlich des Selbstbeobachters, als auch den links neben ihm stehenden Personen zu. Er weicht so der Selbstreferenz seiner Spiegelung durch die Beobachtung fremder Selbstbeobachtung auf den Ebenen 2 und 3 aus und stellt zugleich visuell die Verbindung zwischen den beiden Spiegeln als Medien der Beobachtung und Selbstbeobachtung her. Festzuhalten ist darüber hinaus auch ein wesentlicher Unterschied der beiden Spiegel-Rezipientenrollen: Der rechte größere Spiegel wird nämlich von zwei Figuren aktiv >vorgestellt< - gehalten und vorgezeigt -, so daß sich dessen Raumposition der Verfügung durch Figuren der Ebene 2 entzieht. Sie bleiben ihrem Gespiegelt-Werden mithin mehr oder weniger ausgeliefert, solange sie auf Ebene 2 stehen. Im Gegensatz dazu erfordert die Selbstwahrnehmung links aktive Teilnahme und Mobilität des Rezipienten. Ihm wird kein Spiegel vorgehalten, sondern er hat sich vielmehr aktiv in die Nähe des seitlich befestigten, kleinen Spiegels begeben, aus der er sich auch wieder entfernen kann.
15
Die Erklärung baut auf diesen verbildlichten Rezeptionshaltungen auf: Der rechte Spiegel »bildet« die äußerliche, »cuRiöse Welt« (V. 2), die ihrerseits schon mit Metaphern des Theaters und des Rollenspiels charakterisiert wird (V. 3: »spielet [...] mit Tritten und Figuren«; V. 3: »Eitelkeit«, »stoltze[n] posiTURen«; V. 5: »was man eusserlich gut oder böse macht«). Der Spiegel reproduziert unmittelbar äußerlich die ständische Distinktion und soziale Mimesis von >gut< und >böse< (V. 6-7) des geselligen Rollenspiels. Der Blick auf die leere Hinterbühne wird der Figurengruppe auf Ebene 2 durch den Spiegel verstellt, der sie auf die Bühne hochspiegelt und von der Zuschauerrolle in eine virtuelle Akteursrolle transponiert. Das Bühnen-Spiegelbild repräsentiert jedoch nur die Theatralik der vorgeordneten sozialen Bühne der >curiösen Welt< selbst. Der Rollenambivalenz der zugleich rezipierenden und im Spiegel agierenden Figuren auf Ebene 2 entspricht darüber hinaus der im späten 17. Jahrhundert feststellbare Bedeutungswandel des seit Beginn des 18. Jahrhunderts im Deutschen zusehends inflationär gebrauchten Wortes >curieuskurioscuriosus< (>sorgsamwißbegierigneugierigcurieux< von einer Eigenschaft des Erkenntnissubjektes auf Merkmale des >merkwürdigen< Erkenntnis- und Wahrnehmungsobjektes selbst.12 Das Titelkupfer und seine >Erklärung< vollziehen insofern eine Engführung beider Bedeutungen, als hier die >curiöse Welt< vor dem Spiegel, also die >wißbegierigen< und >schaulustigen< Betrachter, und ihr >begehrter< Gegenstand, also die im Spiegelbild auf sich selbst zurückverwiesenen Wahrnehmungssubjekte, zusammenfallen. Die Bedeutungskomponente der >Gier< und >Begierde< konnotiert darüber hinaus die gefährliche und verführerische Kehrseite visueller (Selbst-)Wahrnehmung und (Selbst-)Erkenntnis,13 die sich ebenfalls an Weises Titelkupfer ablesen läßt und die der Ikonographie des >Spiegels< langfristig innewohnt.14 Nicht umsonst ordnet die 12 13
14
Dazu ausführlich Frühsorge 1974, S. 193-205, hier insbesondere S. 193f., neuerdings Kenny 1998. »Im Aspekt der Begierde vollzieht sich die Bedeutungsvertiefung im 17. Jahrhundert. Kuriosität als Gier in der Anhäufung des schon Erkannten wandelt sich zur Neu-Gier auf das, was überhaupt erst der Erfahrung und Erkenntnis bedarf. Neugier, ihrem Wesen entsprechend bevorzugt als >Augengier< und >Augenlust< dargestellt, wird der zentrale Bedeutungsgehalt der >CuriositätCurieusen< [...], das sich [...] etwa um die Mitte des 17. Jahrhunderts ausbildet. [...]; an der Wende des 17. zum 18. Jahrhundert [...] [wird] >curieus< mit >galant< und >politisch< zur Trias der beliebtesten Modewörter der Zeit [...].« (Frühsorge 1974, S. 194). Schon Ovids Narcissus-Geschichte (Metamorphosen, 3. Buch, 339-510, v.a. ab 153) schildert die tödliche Gefahr der Selbstliebe und einer Selbstwahrnehmung, die sich zu spät als solche erkennt, und Seneca warnt in seinen Naturales quaestiones (I.Buch, 17,1-10) vor dem Mißbrauch des Instruments der Selbsterkenntnis (17,4: »Inventa sunt specula, ut homo ipse se nosset«; 17,10: »iam speculum ornatus tantum causa adhibetur? Nulli non vitio necessarium factum est.«). - Zum ikonographischen Bildinventar vgl. nur Cesare Ripa, dessen Nova Iconologia (1618) die Personifikation der prudenza in einen Handspiegel blicken läßt (Ripa 1992, S. 368) oder im Überblick das LCI, 4. Bd., Sp. 188-190, besonders 189; ähnliche Beispiele für die prudentia- und vanitas-Bedeutung des >Spiegels< bieten Emblematik (vgl. Henkel/Schöne 1996, Sp. 970, 1346-1351, 1553, 1627-1628) und bildende
16
Erklärung dem rechten Spiegel die Begriffe »schöne[r] Eitelkeit«, »stoltz[en]Lernen< von Frömmigkeit und Geduld (V.15) zu, korreliert ihn also einerseits mit vanitas und superbia und funktionalisiert ihn andererseits um so mehr als Medium der Übung von Frömmigkeit und Tugend. Nicht umsonst wird der Spiegel ferner von einer ebenso heidnisch wie christlich-diabolisch deutbaren Bocksgestalt gehalten, die sowohl die Satyr-Ikonographie15 abruft als auch auf Weises folgende Vorrede bezogen werden kann: Diese mündet in eine exemplarische Disputation der These eines Respondenten (»COMOEDIAE NON SUNT IMPROBANDAE«, SW XII/2, S. 436-455, hier S. 436), zu deren Widerlegung der Opponent (»Q[uod] scatet mendaciis, illud est improbandum, / Comoediae scatent mendaciis E[rgo] /Comoediae sunt improbandae.«, ebd.) aus den Predigten des Kirchenvaters Chrysostomus zitiert: »Minorem probo clarissimis SS. Patrum testimoniis. Chrysostomus Homil. XXI. Ad Antioch. Spectacula vocat POMPAM SATANAE.« (ebd., S. 445). Der Respondent führt alle geläufigen Gegenargumente einschließlich der Luthers ins Feld und nimmt die spectacula als >unschuldige< adiaphora (>Mitteldinge Die von Weise in der Vorrede zitierte Tischrede Martin Luthers (SW XII/2, S. 432-434), die die Frage eines Schulmeisters, ob es Christen gestattet sei, antike (>heidnischeSpiegels< der >curiösen Welt< zu unterstreichen: Zum Ändern, daß in Comödien fein künstlich erdichtet, abgemalet und fürgestellet werden solche Personen, dadurch die Leute unterrichtet, und ein Jglicher seines Amts und Standes erinnert und vermahnet werde, was einem Knecht, Herrn, Junggesellen und Alten gebühre, wol anstehe und was er thun soll, ja, es wird darinnen fürgehalten und für die Augen gestellet aller Dignitäten Grad, Aemter und Gebühre, wie sich ein Jglicher in seinem Stande halten soll im äußerlichen Wandel, wie in einem Spiegel. (Luther 1912, S. 43l).17
15
16
17
Kunst reichlich (Baltrusaitis 1986); die Geschichte der Selbstreferentialität der Malerei kennt Abbildungen von >Spiegeln< (Stoichita 1998, S. 209-223) auch als Verselbständigung der Parerga (Derrida 1978, S. 44-94, Stoichita 1998, S. 32-45) und im Zusammenhang der Paragon-Thematik (Sykora 1996). Die Pan- und Satyr-Emblematik unterstreicht die ambivalente Stellung des Menschen zwischen tierischer Natur und anerziehbarer Kultur und warnt vor Verführbarkeit, Geilheit und Ausschweifung; vgl. im Überblick Henkel/Schöne 1996, Sp. 1832-1836. Vgl. die Argumentation in Elmenhorsts Apologie der Oper (Dramatologia AntiquaHodierna, 1688): »Adiaphora aber/ [...] heissen diejenige Dinge / worvon die H. Schrift keinen deutlichen Befehl giebet / welche Sie nicht gebeut / auch nicht verbeut;« (Vorrede unpaginiert, S. 1; auch S. 4-8) und: »daß ihr [der Opern, CMO] Endziel nicht sey / eine blosse Augen-Lust« (Vorrede S. 6) oder S. 104: »[...] wie nun nicht folget: Um des Mißbrauchs willen der Gabe GOTTES / des Mahlens oder Bildhauens / muß man den Gebrauch solcher Künste im menschlichen Leben und ihren guten Ergötzungen auffheben.« Zeller 1980 führt anläßlich des Titelkupfers zum Freymüthigen [...] Redner die »Spiegelmetapher vom Drama als einem >speculum vitaewiderzuspiegeln< habe. >UnterrichtungVermahnung< und >Erinnerung< sind jedoch nicht nur an das >GuteBöse< geknüpft - sei es im Medium eines >wahren< (Spiegel-)Bildes der Welt, sei es in idealisierender oder negativ verzeichnender Verfälschung. Der gesellschaftliche Nutzen oder Schaden des Darstellungsmediums hängt also nach Luther weitgehend von seinem richtigen Gebrauch ab und verdankt sich nicht den intrinsischen - verzerrenden, idealisierenden - und im Normalfall des >SpiegelsSpiegels< zum Ausdruck kommende Ambivalenz visueller und theatralischer Medien der spielerischen Welt- und Selbsterkenntnis (>Spiegel der Weltvitae humanae speculumSchulkomödien< gar der Grund für die langjährige Unterbrechung des regelmäßigen Schultheaterbetriebes in Zittau zwischen 1689 und 1701 und erneut ab 1705 bis zum Tod Weises im Jahre 1708 zu erblicken ist (wie Eggert 1935, S. 282-287 vermutet), mag dahingestellt bleiben, in seinen poetologischen Vorreden zu den Druckausgaben seiner Dramen schlagen sich solche Vorbehalte aber zweifellos nieder; die simulierte Disputation im Freymüthigen
18
19
auf den sich Opitz in seiner Vorrede An den Leser zu L. Annaei Senecae Trojanerinnen; Deutsch gegeben durch Märt. Opitium (1625) beruft: »Dann eine Tragedie / wie Epictetus sol gesagt haben / ist nichts anders als ein Spiegel derer / die in allem jhrem thun vnd lassen auff das blosse Glück fussen« (Opitz 1625, S. 430). Im Kontext von Weises Argumentation zur Komödie erscheint jedoch der Bezug auf Luther als näherliegend und aussagekräftiger. Luther betont die Nützlichkeit der Komödien für den Lateinunterricht (Luther 1912, S. 431) und daß sie durch ihre Welt-Darstellung »zum Ehestand locken und von Hurerey abziehen« können (S. 432). So im Streit anläßlich der Hamburger Operngründung 1678 (vgl. von pietistischer Seite Reiser 1681 und die Gegenposition von Elmenhorst 1688 sowie im Überblick Flemming 1933, S. 12-18 und Jaacks 1997, S. 80-92); die Vorbehalte gegen theatralische Medien fokussieren besonders die Oper und die Komödie (z.B. Vockerodt 1697) und werden von anhaltenden poetologischen Anstrengungen ihrer Verteidiger begleitet (vgl. etwa die Kieler Schutzschrift für die Oper von Bertuch 1696, die von Ch. F. Hunold veröffentlichten Leipziger Poetik-Vorlesungen [1695-97] des Pastors und Kirchenlieddichters Erdmann Neumeister [Hunold 1706a] sowie Hunold 1706b, Barthold Feinds Gedancken von der Opera (in Feind 1708, S. 74-114; vgl. Marigold 1994) oder noch 1726ff. den Disput zwischen dem Hamburger Komponisten und Musiktheoretiker Johann Mattheson und dem Göttinger Gymnasialprofessor Joachim Meier über die protestantische Kirchenkantate, vgl. dazu Heidrich 1995). Zum Verhältnis des Pietismus zur deutschen Barock-Oper siehe Lindberg 1973, zur Hamburger Oper am Gänsemarkt schon Haufe 1964/1994, S. 7-26 und über den Halleschen Pietismus Martens 1989, zu Vockerodt ebd., S. 192-199.
18
Redner dient folglich nicht nur als rhetorisches Exempel, sondern auch der Vermittlung und Einübung inhaltlicher Argumente, die die pädagogische Nützlichkeit des Theaters und besonders der Komödien zu beweisen versuchen.
2.2. Bühne, Spiegel, Malerei: Zur Repräsentation von Ähnlichkeit und Differenz Weises Titelkupfer und seine Erklärung, die den >Spiegel auf der Bühne< wörtlich nehmen, spitzen die der Bildlichkeit vom >Spiegel< innewohnenden Paradoxien zu und explizieren dabei Gebrauchs- und Wirkungsbedingungen von Bildmedien, die nicht nur lehrreichen Außenzwecken dienen, sondern auch zu verführerischen Selbstzwecken werden können. Die Relation von Bild und Text verkompliziert nicht nur die Beziehung zwischen den beiden abgebildeten und im Gedicht thematisierten Spiegeln - also die Differenzen von kollektiver >Fremd-< und solitärer >Selbstwahrnehmung< (V. 5: »äußerlich« versus V. 12: »die Fehler selbst an uns erkennen«) -, sondern kreuzt sie auch mit der Differenz von >Dargestelltem/Gespiegeltem< und >Darstellung/Spiegelbildguten< oder >bösen< Verhaltensweisen >beibringt< (V. 6), unterscheidet Vers 8 zunächst »Ebenbild« und »Gestalt«; Vers 9 überträgt diese Unterscheidung sodann auf den Bereich der >Malerei< und führt so - nach Bühne und Spiegel - ein weiteres visuelles Medium ein. »Gleich wie ein Mahler thut« (V. 9), werden schließlich in V. 10 »Copie« und »Original« unterschieden und in Beziehung gesetzt. Durch den Vergleich wird zudem das Verhältnis der Unterscheidungen von >SpiegelungSpiegelbild< und >MalereiGemälde< problematisiert, die den Differenzen von »Ebenbild«/»Gestalt« einerseits und von »Copie«/»Original« andererseits zugrunde liegen. Was sich mit dem normativen Gestus einer Regel (»muß«, V. 8) rhetorisch inszeniert und die Last der >Erklärung< dem uneigentlichen Bedeutungsbereich der >Malerei< (»Gleich wie«) aufbürdet, erweist sich auf den zweiten Blick als uneindeutig, wenn nicht gar dunkel, in jedem Fall aber als interpretationsbedürftig. Eine Mikroanalyse des >besseren Sehens< der gespiegelten >curiösen Welt< einschließlich des Vers 8 erläuternden Bildbereichs der >Malerei< (V. 9f.) bietet sich an. Die argumentative Abfolge von »Gesetzt« in der Bedeutung von >wenn< (V. 7), »So« (V. 8) und »Gleich wie« (V. 9) zeichnet sich durch eine doppelte Beziehbarkeit des Partikels »so« aus; dieser läßt sich entweder in der Bedeutung >dann< nach rückwärts oder als eigentliche Komponente des zusammen mit Vers 9 »Gleich wie« gebildeten Vergleichs nach vorwärts beziehen und koppelt auf diese Weise Schluß- und Vergleichslogik aneinander, verschränkt also zwei verschiedene Modi der Verknüpfung von Differenz und Identität, nämlich einerseits das fortschreitende, auf Unterscheidung von Voraussetzung und Folgerung beruhende >wenn - dann< und andererseits das auf partieller Ähnlichkeit des Differenten beruhende >so - wieEbenbild< in der >Gestalt geschehen muß, um besser zu sehen, auf welche Weise der >WeltUrGestaltenEbenbilder
geschehen< dann >sich manifestieren^ >realisiert< oder >agiert werden< bedeutet. Um >besser< sehen zu können, wie die Gestalt im >Ebenbilde geschieht·«, sich also im Spiegelbild realisiert, muß sich umgekehrt auch das >Ebenbild< in der >Ur-Gestalt< manifestieren, d.h. das Bild in der Gestalt, die es abbildet, erkannt werden können. Invers zum Prozeß der Spiegelung bzw. Abbildung (von der >Gestalt< zum >EbenbildEbenbild< zur >GestaltGestalt< ebenbürtig - als >Ebenbild< - rezipiert, so daß die Beobachtung des Bildes und die Selbstbeobachtung des Abgebildeten zusammenfallen, was jedoch die Unterscheidung von >Ebenbild< und >Gestalt< unterläuft und einem sinnvollen Vergleich beider die Grundlage entzieht, oder es wird ein zweiter Beobachter hinzugezogen, der die Beobachtungsrichtung wechselt und Spiegelbild und >Gestalt< einer anderen Person abwechselnd und nacheinander betrachtet. Der männlichen Figur auf Ebene 2, deren Blickrichtung quer zu derjenigen der Figurengruppe verläuft, kommt in diesem Zusammenhang besondere Bedeutung zu: Sie fungiert als Beobachter von Selbstbeobachtung auf Ebene 2 und 3, und ihre Position erlaubt einen Vergleich von Spiegelbildern und Originalgestalten. Daß ein solcher Vergleich im >SpiegelMalerei< abrufen und die oben angedeutete Beziehung von >Ebenbild< und >Gestalt< mit der >Tätigkeit< eines Malers vergleichen, der »allemal / Die Kunst in der Copie nach dem Original [richtet].«20 Daß eine Unterscheidung von >Original< und Bild im Falle der Malkunst sinnvoll scheint, da deren Produkte im Unterschied zu virtuellen Spiegelbildern unabhängig vom Gegenstand der Abbildung existieren und semiotische Autonomie besitzen können, die den Erkenntniswert eines Vergleichs zwischen Vorlage und Bild erhöhen, wird durch die Formulierungen von Vers 10 indes offenkundig wieder zurückgenommen.
20
Die wechselseitige Metaphorisierung von >Malerei< und >Spiegel< blickt seit Platon (siehe Politeia, u.a. X. Buch, 596-599, 601-605; Platon o.J., S. 102-103, S. 367-373 und S. 376384) auf eine lange, hier nicht näher darzustellende Tradition zurück, in der sich Platons Abwertung der >illusionärenunwahren< Bilder und Künste und deren Aufwertung zum Mittel der Erkenntnis in Aristoteles' Mimesis-Konzeption langfristig gegenüberstehen; vgl. Deleuze 1993, S. 311-340 und Cacciari 1994, zur literarischen >Dekonstruktion< (neu-)platonischer Bild-, Spiegel- und Höhlen-Semantik in der spanischen Mystik des 16. Jahrhunderts (Teresa von Avila u.a.) siehe Teuber 1996. Die - indirekt auch an Weises Titelkupfer ablesbare - frühneuzeitliche Säkularisierung der theologischen Topik des >Sehens< und der >Seele als Spiegel Gottes< und >Gottes als Spiegel der Seele< (z.B. bei Jacob Böhme, Das umgewandte Auge, [...] Von der Seelen und ihrer Bildniß, [...], 1620) erfaßt auch die >SpiegelKlugheit< (Frühsorge 1974, S. 59-123 oder am Beispiel des Frontispizes von Hobbes' >Leviathan< 1651: Bredekamp 1999).
20
Das Postulat, der Maler >richte allemal die Kunst in der Copie nach dem Original·, bleibt ambig: Werden die Tätigkeit des Malers (»wie der Mahler thut«, V. 9) und die Tendenz zur Annäherung von >Kopie< und >Original< als Äquivalente verstanden - Malerei als >Kopieren< der Welt, als bloße >Kunst in der Kopie< - , dann informiert der Satz über die zugrundeliegende semantische Äquivalenz von Maler und Kopist und verschleiert zugleich eine Tautologie: Die selbständige adverbiale Bestimmung »in der Copie« erweist sich in dieser Lesart nämlich als redundant und kann ohne Bedeutungsverlust entbehrt werden (>der Maler richtet allemal die Kunst nach dem Original·). - Eine zweite, nicht redundante Lesart versteht unter »Kunst in der Copie« dagegen ein komplexes Akkusativobjekt, in welchem die adverbiale Bestimmung strikt an das Objekt >Kunst< gebunden bleibt und somit nicht Malerei insgesamt, sondern nur einen Spezialfall von Malkunst, nämlich die Kunst des Kopisten, bezeichnet. Nur seine >Kopierkunst< richtet >ein Maler - in der Rolle des >Kopisten< - >allemal< nach dem >Originak Diese Lesart favorisiert - so bleibt erstens festzuhalten - genau die Tätigkeit, bei der ein Bildkünstler die flüchtige illusionistische Mimesis des (zumindest seitenverkehrten) Spiegelbildes zu erreichen oder sogar zu übertreffen und in ein dauerhaftes und situationsunabhängiges Artefakt zu überführen vermag, >SpiegelMalereiOriginal< nicht die >WeltWelt< und >Zeichen< wird zur Beziehung zwischen Zeichen, das >Original< ist selbst nur ein semiotisches Objekt, das >Originalität< nur relativ zu seiner Kopie, nicht aber bezüglich des eigentlich Dargestellten für sich reklamieren kann. Beide Lesarten lassen sich wiederum mit dem Bild des Titelkupfers in Beziehung setzen, das auf Ebene 2 ebenfalls nicht deutlich zwischen >Außen-Welt< der Zuschauer und semiotischer >Innen-Welt< der Bühnenakteure unterscheidet. Die dargestellte Welt, die >curiöse Welt< der Ständegesellschaft, ist selbst eine immer schon zeichenhafte, bedeutungstragende, deren mimetische >Ebenbilder< damit zu >Kopien< zweiten Grades werden, zu Zeichen einer Welt, deren eigentliches >Ur-Bild< sich entzieht. Externer Weltbezug verflüchtigt sich in der Vervielfältigung immanenter Beziehungen zwischen Zeichen. Der uneigentlichen Rede von der Malerei, dem was >der Maler tut< (V. 9 und 10), obliegt die bildhafte >Erklärung< der vorausgehenden normativen Setzung (V. 7f.); diese Funktion erfüllt sie auf komplexe Weise, und zwar derart, daß sie zunächst zwischen tautologischer Bedeutungsreduktion und sinnhafter Information zu oszillieren scheint und schließlich ihre Bedeutung auf zwei alternativen Lesarten aufbaut, deren Kontingenz von der Logik ihrer Verknüpfung jedoch eingeschränkt wird. Daß
21
Vives' De ratione dlcendi (1532) verwendet >Tafel< und >Spiegel< noch als äquivalente Vergleiche für das Theater: »In theatris ad publicam exhilarationem exprimebatur hominum vita, velut tabella quadam, vel specula; quae res vehementer delectat propter imitationem, sicut Aristoteles ait in arte poetica [...]« (Vives 1993, S. 220). Zur >SpiegelTheaterKopieOriginal< richte, eine implizite Tautologie auftritt, die semantisch das reproduziert, wovon sie handelt (>KopieSpiegel< zu äußerlich >Gespiegeltem< (vgl. V. 5f.) abbildet, und daß diese Tautologie ferner gerade durch ihren Zeichen-Überschuß (die adverbiale Bestimmung »in Copie«) auf eine zweite Lesart des Satzes hinweist, in der die adverbiale Bestimmung Informationsgehalt zurückgewinnt und zwischen Prädikat (>die Kunst des Kopierens nach dem Original richtender Maler< als Repräsentant der Malkunst) eine Differenz aufbaut, erscheint alles andere als zufällig: Es führt vielmehr modellhaft und in arguter Verdichtung vor Augen, wie aus Selbstreferenz Fremdreferenz, aus größtmöglicher Ähnlichkeit Differenz zu gewinnen ist und weist situationsabhängigen >Spiegelungen< Merkmale situationsunabhängiger >Bilder< zu.22 Zweckloser Zeichenüberschuß - die Selbstbezüglichkeit funktionsloser Zeichen - erhält damit eine gerade für nicht-tautologische Bedeutungskonstitution unverzichtbare Funktion, die allerdings ihrerseits >Spiegel< und >gemaltes Bild< semantisch wieder annähert. >Spiegel< werden eigenständigen, d.h. von der Präsenz des Originals unabhängigen >Bildern< ähnlicher, die sich ihrerseits als >Kopien< ihrer >Originale< der mimetischen Qualität von >Spiegeln< nähern. 23 Die sprachliche Vermittlung des uneigentlichen Bedeutungskomplexes >Malerei< und seine interne Beziehung zwischen >Kopie< und >Original< folgt damit, so ist weiterhin zu folgern, einer Logik der Repräsentation, die homolog sowohl auf die eigentlich gemeinten Relationen von >Ebenbild< und >Gestalt< innerhalb des >SpiegelErklärungserklärendem< Titelkupfer selbst übertragen werden kann. 24 Das uneigentliche >Ebenbild< muß in
22
23
24
Was die >klassische Darstellung< des 17. Jahrhunderts laut Marin 1994, S. 384 in der Tat auszeichnet: »Im Unterschied zu jenen dem Auge [...] als Grenzfall der Repräsentation begegnenden >VerdoppelungenRe-< der Repräsentation sich zwischen Verdoppelung und Substitution abarbeiten [...].« Die Konfrontation der Bedeutungskomplexe >Malerei< und >Spiegelbild< im Vergleich des Gedichts vermittelt die (platonisch) perhorreszierte Autonomie des >falschen< Illusionsmediums mit seiner gleichwohl (aristotelisch) behaupteten Erkenntnisfunktion als mimetischem Medium der Wahrheit und balanciert beide Positionen gegeneinander aus. Die Unterscheidung und Rekombination beider Semantiken führt zu einem >klugen< Ergebnis, das die Gefahren der Bildmedien und ihren Nutzen generell betrifft. Das Bild-Text-Syntagma aus Titelkupfer und Erklärung sowie Argumentation und Bildlichkeit des Gedichtes weisen wesentliche Merkmale von >acutezza< auf, wie elliptische Verdichtung, Zweideutigkeit, implizite Antithetik und ein komparatives, analogisierendes - >metaphorisches< - Verfahren (vgl. zur Unterscheidung von >acuto< und >arguto< Battistini 1992 und Kapp 1992 sowie zu lakonischer >brevitas< und >argutia< als Merkmalen des Hofstiles Kühlmann 1982, S. 220-243). Daß >acutezza< wesentlich auf metaphorischen Verfahren beruht, die »in unähnlichen Dingen die Ähnlichkeit [finden]«, zeigt Lange 1968, S. 78-99 (hier S. 78) am Beispiel von Gracian, Pellegrini und Tesauro. Weises
22
hohem Maß jeweils an die eigentliche >Gestalt< gebunden bleiben und zugleich - wie im Falle der Mal- oder Kopierkunst - sinnvoll mit ihr verglichen werden können, also semiotischen Eigen- oder Mehrwert repräsentieren. In der Beziehung zwischen dem ikonischem Tableau des Kupfers selbst und seiner syntagmatisch wie logisch nachgeordneten >Erklärung< garantiert schon allein der Wechsel vom Bild- in das Textmedium einen je irreduziblen Bedeutungsüberschuß, der allerdings durch diejenigen gemeinsamen Bedeutungskomponenten begrenzt wird, die sich ihrerseits als >abbildend< und redundant erweisen, insofern sie sowohl ikonisch als auch verbal bezeichnet werden. Die implizite Adressatenrolle von Kupfer und Erklärung definiert sich insbesondere durch die Möglichkeit, Explanandum und Explanans, also (ikonisches) >Original< und (sprachliches) >Bild< sukzessive zu vergleichen. Die im Titelkupfer und im Gedicht thematisierten Varianten von Selbstbeobachtung als Selbstbespiegelung - so ist festzuhalten - entgehen der latenten Paradoxie, Merkmale des nachahmenden, aber heteronom flüchtigen Spiegelbildes mit solchen des materiell autonomen, dauerhaften Gemäldes zu verbinden, dadurch, daß sie den dargestellten passiven Selbstbezug mit Fremdreferenz anreichern und ihn in aktive Fremdbeobachtung überführen. Ein letzter Blick auf die im Titelkupfer inszenierten visuellen Wahrnehmungsrichtungen und das >erklärende< Gedicht soll dies belegen. Die männliche Figur (Ebene 2), deren >Seitenblick< von der Blickrichtung der sich spiegelnden Figurengruppe abweicht, nimmt, wie oben konstatiert, eine Betrachterposition ein, die nicht nur abwechselnd Selbstspiegelung und Fremdbeobachtung erlaubt, sondern deren Fremdbeobachtung wiederum sowohl die Beobachtung fremder Selbstbeobachtung auf Ebene 3 als auch einen abgleichenden Blick von den gespiegelten >Ebenbildern< der Figuren neben ihr auf deren >reale Gestaltem ermöglicht. Sie verweigert (zumindest temporär) die Selbstwahrnehmung, unterbricht deren leere Selbstreferenz und nähert sich insofern der hierarchisch höchsten Position des Lesers und Bildbetrachters (Ebene 0) an, die sich durch die Dynamik des sukzessiven Wechsels der Blickrichtungen auszeichnet. Damit büßt die Selbstspiegelung ihre Funktion als Metapher für Selbsterkenntnis, wie sie dem linken Spiegel und seinem Betrachter zugeordnet wird, insofern ein, als sie nur im Gesamttableau des Sehens und nur als zugleich fremdbeobachtete und unterbrochene Bedeutung gewinnt. 25
25
Titelkupfer und seine >Erklärung< bedienen sich dieser Verfahren, um schließlich erneut >Unähnlichkeit< in der >ÄhnIichkeit< zu akzentuieren. - Schon Martin Kempes Unvorgreiffliches Bedencken / Über die Schrifften derer bekantesten POETEN hochdeutscher Sprache [...] (1681) attestiert Weises »Satyrische[n] Schrifften«, daß sie, »wen sie was gelten sollten / nur von tieffsinnigen und weitsehenden INGENIIS ersonnen werden« (S. 377 [64]). Barner 1970 zählt neben Jacob Masen, Harsdörffer, Morhof, Birken u.a. Weise zu den Vermittlern der spanischen und italienischen argutia-Mode in Deutschland (S. 44); siehe dazu auch Alt 1995, S. 318 und S. 343 sowie Neukirchen 1999, S. 87-119, S. 120-126 und S. 166-169. Daß der Prozeß der >klugen Besserung< Selbst- und Fremdbezug in argute und wergnügliche< Beziehungen setzt, formuliert Weise in der Vorrede zu den Neuen Proben von der vertrauten Redens-Kunst [...] (1700): »[...] in Tugend-Lehren / als in den Politischen
23
Das in Vers 7 für den rechten größeren Spiegel angestrebte >bessere< und so ist zu ergänzen: auch >bessernde< Sehen ist jedoch nicht nur an die Unterbrechung der Selbstbeobachtung sondern auch an die relative Dauerhaftigkeit der >guten< (nachahmenswerten) oder >bösen< (abschreckenden, warnenden) Bilder gebunden (V. 5f.; V. 9). Ohne erkennbare und v.a. dauerhaft repräsentierbare, temporale und semiotische Differenz zwischen >Ebenbildern< und >Gestalten< scheint der pädagogische Nutzen der Bilder >guter< oder >böser< Zustände gefährdet, bleiben sie >äußerliche< (V. 5) und potentiell >verführerischeEbenbilderEitelkeit< ihres Gegenstandes vervielfältigen. Die syntagmatische späte Position des Verses, in dem der lehrhafte Zweck des größeren Spiegels postuliert wird, illustriert dies ebenso wie die Unterbrechung der Thematisierung des jeweiligen Spiegels durch die Thematisierung des je anderen: Nachdem in den Versen 7 bis 10 die impliziten Bedingungen des >besseren Sehens< und in den Versen 11 bis 14 der kleinere linke Spiegel erläutert worden ist, kehrt Vers 15 zum größeren Spiegel zurück (»In jenem lernen wir fromm und gedultig werden/«) und behauptet - ohne weitere Plausibilisierungsversuche - dessen >Geduld< und >Frömmigkeit< fördernde Wirkung. Selbstreferenzunterbrechung wird dabei im syntaktischen Vollzug manifest: Erst nach der >Erklärung< des »andren Spiegelfs]« kommt die >bessernde< Funktion des ersten Spiegels (»In jenem [...]«) und unmittelbar danach diejenige des zweiten (»In diesem [...]«) zur Sprache. Ohne Entschlüsselung der nicht zuletzt durch die syntaktische Durchkreuzung und wechselseitige Unterbrechung der >jenerdieserkluge< Spiel der Spiegelungen und Blickrichtungen einläßt, es konsequent auf die >Erklärung< des nachfolgenden Gedichtes bezieht und den Bedeutungs- und Zeichenüberschuß beider konkurrierenden, einander verdoppelnden und zugleich wechselseitig mit Bedeutung aufladenden >Texte< ausschöpft, findet nachträglich Argumente für dieses Postulat. Vor diesem Hintergrund klären sich auch die Position und die Funktion des >anderenOriginals< (Ebene 2), im zweiten Fall aus hinreichender Distanz (Ebene 0) - die Möglichkeit bietet, >Ebenbild< und >Gestalt< gleichzeitig wahrzunehmen und zu vergleichen. Weder der Quer-Betrachter auf Ebene 2 noch der hierarchisch
Anschlägen / darinne sich manch scharfsinniger Kopf wohl vergnügen kan / indem einer nach dem ändern sein schönes oder sein heßliches Ebenbild unter einer frembden Person betrachten / und den gantzen Verlauff zu seiner klugen Besserung ansehen mag« (SW XII/2, S. 456).
24
höchste Außenbetrachter auf Ebene 0 hat ansonsten diese Möglichkeit: Ersterem gelingt beides bezüglich des ersten Spiegels nur im zeitlichen Nacheinander durch Wechsel der Blickrichtung vom Spiegel zur Nebenperson und zurück, da er selbst der gespiegelten Figurengruppe angehört. Im Blickfeld des letzteren befinden sich zwar die Figurengruppe und die Spiegelbilder der drei mittleren Figuren; da jedoch die je abgewandten Gesichter bzw. die abgewandte Gesichtshälfte der im Profil sichtbaren männlichen Figur zurückgespiegelt werden, entsprechen aus der Perspektive des >rückwärtigen< Betrachters die für ihn sichtbaren >Gestalten< ihren gespiegelten >Ebenbildern< nicht. Daß die aus nächster Nähe stattfindende und solitäre Selbstbeobachtung im zweiten Spiegel ihrerseits auf der Bühne (Ebene 3) >agiertAkteure< auf die Bühne (Ebene 3) hochgespiegelten Figurengruppe bis zum polaren Gegenpol der auf Ebene 3 >real< agierenden Figuren erstreckt. Spiegel-Vorzeiger und -Halter bestimmen zumindest fakultativ die >Reichweite< des ersten Spiegelbildes, was die Standesperson ganz links - nicht durch Halten des zweiten Spiegels sondern durch das >Agieren< vor ihm - ebenfalls vermag. Im Unterschied zu den auf Ebene 2 stehenden Objekten der Spiegelung liegt es - wie gesagt - im aktiven und freiwilligen Ermessen des Selbstbetrachters auf der Bühne, ob und wie nahe er dem ortsfesten kleinen Spiegel zu kommen beabsichtigt. Seine actio determiniert zeitlich und semiotisch sein >Ebenbild< und auch die wechselnde >Gestalt< des >Ur-Bildeseinsame< und von Fremdbeobachtung und sozialer Kontrolle unabgelenkte Studium seiner selbst - in gesteigerter aber zugleich aktiv herbeigeführter Selbstreferentialität - »führt uns« laut Vers 11 bis 12 »tieffer ins Gewissen / Daß wir die Fehler selbst an uns erkennen müssen«. Von unmittelbarer sozialer Kontrolle und sozialen Erwartungen befreite Selbstbeobachtung ohne visuelle Ausweichmöglichkeit verpflichtet also zu schonungsloser Selbsterkenntnis, die gerade den >Übelstand< »an unserem Leibe zeigt« (V. 13), der im Prozeß der sozialen Selbstbespiegelung, der gegenseitigen >HöflichkeitsFreiheit< wieder zurück, bindet die kurzfristig freigesetzte Selbstbezüglichkeit erneut an das Netz von Fremdbeobachtung der sozialen >Welt< (»man schickt sich in die Welt«) und verschränkt Selbst- und Fremdbeobachtung derart eng, daß der zweite Spiegel ebenso zum Medium der
25
>Welt-< und Fremderkenntnis wird wie der erste, und - so ist zu ergänzen - dieser indirekt auch zum Medium der Selbsterkenntnis (V. 18: »Man merckt an sich selbst / was ändern wolgefällt.«).26 Die Unverzichtbarkeit des zweiten Spiegels, die die beiden letzten Verse des Gedichtes indirekt behaupten (V. 20: »Will jemand klüger seyn / so mag er ihn zerbrechen«) verdankt sich erstens der mit Unterbrechung der leeren Selbstbeobachtung erreichten Verschränkung von Selbstbezug (»an sich selbst«) und Fremdbezug (»was ändern«) und zweitens - genau deshalb - auch dem ersten Spiegel, der sowohl im Text als auch im Bild als Medium der guten wie bösen, >curiösen Welt< fungiert. Die beiden Spiegel stehen - auch dies wird hierbei deutlich - nicht in der Beziehung einer kontingenten Alternative, sondern sind durch das Nacheinander der Phasen visueller actio miteinander korreliert. Der erste Spiegel erweist sich als Voraussetzung der Funktion des zweiten und reichert ihn erst eigentlich mit Fremdreferenz an, was auch von der syntagmatischen Abfolge der Spiegel im Gedicht unterstrichen wird. Ihre Beziehung entspricht derselben Logik, die auch die beiden, an die adverbiale Bestimmung »in der Copie« geknüpften Lesarten verbindet: Keine von beiden ist entbehrlich, nur beide zusammen konstituieren den Sinn des Vergleiches von Spiegelung und Malerei. Ebenso sind beide Spiegel als Medien der Welt- und Selbsterkenntnis auf dem »klugefn] Platz« (V. 1) zwar zu unterscheiden, was durch ihre rechtwinklig gegeneinander versetzte Anordnung und ihr unterschiedliches Format noch betont wird, aber keinesfalls voneinander zu isolieren. Wer die >Klugheit< der Aufstellung der Spiegel allerdings übertrifft oder zu übertreffen glaubt, also noch »klüger seyn [will]«, der mag das Medium der Selbsterkenntnis >zerbrechenkluge< Verknüpfung von Fremd- und Selbstreferenz, die beide Spiegel auf verschiedene Weise leisten - oder ist in Zukunft zu einer noch >klügeren< Aufstellung fähig. Die Mehrdeutigkeit der Formulierungen des letzten Verses läßt diese - positive - Lesart ebenso zu, wie die beiden negativen, die den Verzicht auf den Spiegel entweder mit einem von vornherein getroffenen Verdikt gegen die >Augenlust< der Bildmedien oder mit Selbsttäuschung über den Stand der bereits erreichten >Klugheit< motivieren. Wer ihnen Nützlichkeit abspricht oder sich zumindest des zweiten, kleineren Spiegels entledigt, verzichtet auf dessen Verbindung von Selbst- und Welt-Bezug und durchbricht damit das Beziehungstableau aus Selbst- und Fremdreferenz. Er behielte nur den rechten, mit der Bühne parallelisierten, theatralischem Spiegel und setzte sich damit um so mehr den Gefahren des > äußerlichen Weltepistemischen Bruch< zwischen dem Ähnlichkeits-Wissen des 16. Jahrhunderts und der hierarchisierenden, klassischen Mathesis< des 17. Jahrhunderts zu belegen (Foucault 1974). Zumindest den heuristischen Wert dieser These könnte die literaturgeschichtliche Barockforschung ohne Schaden abschöpfen.27 Wird Foucault zufolge eine »Geschichte der Ähnlichkeit« (Foucault 1974, S. 27) im 17. Jahrhundert zur Geschichte ihrer Einschränkung, zur Geschichte der »Bedingungen«, unter denen »das klassische Denken Beziehungen der Ähnlichkeit oder der Äquivalenz zwischen den Dingen [hat] reflektieren können« (ebd.), dann handelt es sich »nicht mehr um die Frage der Ähnlichkeit, sondern um die der Identitäten und der Unterschiede« (Foucault 1974, S. 82). Die »gleichzeitig unbegrenzte und geschlossene, volle und tautologische Welt der Ähnlichkeit findet sich dissoziiert und wie in ihrer Mitte geöffnet« (vgl. ebd., S. 82-107, hier S. 91) - geöffnet für Zeichen, die repräsentieren und zugleich diese Repräsentation ihrerseits repräsentieren (S. 98): »Vom klassischen Zeitalter an ist das Zeichen die Repräsentativität der Repräsentation« (S. 99).28 Ein Blick auf Foucaults Analyse von Velazquez' El Cuadro de la Familia [Las Meninas] (1656) mag abkürzend verdeutlichen, was gemeint ist (Foucault 1974, S. 31-45, 372-377): Wenn das Gemälde die klassische Repräsentation repräsentiert (S. 45), die nicht mehr nur auf Ähnlichkeiten, sondern auf >Tableaus< (mathesis und Taxonomie) beruht, indem es das >Sujet< zum Verschwinden bringt, das die Repräsentation begründet (ebd.) und das Königspaar nur mehr als zentrales Spiegelbild an der Rückwand des Ateliers abbildet, dann geht das Frontispiz des Freymüthigen und höfflichen Redners noch einen Schritt weiter.29 Das Zentrum des Bildes und Bühnenraumes ist leer, auch die >Sujets< der beiden
27
28
29
Vgl. die entsprechenden Vorschläge und Anwendungsbeispiele von Scholz 1991 und Alt 1995, S. 134-140; eine Notwendigkeit, die theoretischen Voraussetzungen >archäologischer< Diskursgeschichte (Foucault 1973) unbesehen zu übernehmen, ergibt sich daraus nicht. Ohne expliziten Bezug auf Foucault präzisiert Titzmann 1991a, S. 76-78 den Wandel der Repräsentation im 17. Jahrhundert zeichentheoretisch: »Der theologische und politische Diskurs erlauben nur eine vorgegebene und begrenzte Menge möglicher Signifikanten, und die unbegrenzte Menge von Realien und Individuen muß auf sie hin interpretiert werden. Die Welt präsentiert sich als ein enormer Signifikantenüberschuß und als [...] redundante Nachricht: Demzufolge müssen jeweils sehr viele Elemente, wenn sie denn Zeichen sein sollen, dasselbe bedeuten [...]. [...]. Wenn viele verschiedene Sachverhalte Signifikanten derselben Signifikate sein müssen, muß [...] von ihrer Individualität abstrahiert werden: Das System erfordert die Zusammenfassung von Individuen zu Typen« (S. 77). - Die Grenzen der Analogisierung sind erreicht, die Hierarchisierung des Wissens wird unvermeidlich, Zu El Cuadro de la Familia vgl. nur Alpers 1985, Hart Nibbrig 1987, S. 75-83, Stoichita 1998, S. 278-286 und resümierend Zaunschirm 1993, zum Verhältnis von Bild, Spiegel und Bühne insbesondere Harlizius-Klück 1995, S. 73-98.
27
dezentrierten Spiegelungen sind in das Tableau integriert und selbst zum Gegenstand der Betrachtung geworden. Die Spiegel spiegeln kein äußeres - göttliches, königliches - Sinnzentrum, keine zentralperspektivische Betrachterposition mehr ins Bild hinein: endlich davon »befreit [...] kann die Repräsentation sich als reine Repräsentation geben« (Foucault 1974, S. 45) - und, so wäre für das Titelkupfer zu ergänzen, das Feld vorläufig abstecken, das sich zwischen dem ausgeblendeten transzendenten und einem noch nicht elaborierten innerseelischen Sinnhorizont - zwischen Gott und Individuum, Theologie und Psychologie - erstreckt. Vor diesem Hintergrund bedürfen die von Geitner konstatierten Unterschiede zwischen dem Titelkupfer des Freymüthtgen [...] Redners und dem auf >Ähnlichkeit< basierenden »alten theatrum-mundi-Paradigma« mit Gott als dem »obersten Spielleiter« (Geitner 1992, S. 98) weitergehender Präzisierung. Nur wenn sich Ähnlichkeitssemiotik in die bloße Selbstbezüglichkeit höfischer (Selbst-)Repräsentation zurückzieht und zugleich die Grenzen zwischen Bühne einerseits und dem königlichen Zuschauer und Akteur andererseits verschwimmen, wie es Neumeister (1978) für die >Fiestas< von Pedro Calderon de la Barca ausführt, wird »die Selbstdarstellung des Herrscherpaares, in der sich ursprünglich das Gemeinwesen als Ganzes wiedererkennen sollte, [...], am Ende des 17. Jahrhunderts endgültig zu einer narzistischen [sie] Selbstbespiegelung fast ohne Außenbezug« (S. 282), zur >solipsistischen Selbstfeiertheatrum-mundi-Paradigma< (sensu Alewyn 1959), wie es etwa durch Calderons >auto sacramental alegoricoE1 gran theatro del mundo< (EA 1655) repräsentiert wird (vgl. Reichenberger 1981, allgemein Link 1981, zum Jesuitentheater Rädle 1981, zu Lope de Vega und Tirso de Molina Nitsch 2000), schon nicht mehr demjenigen der >Ähnlichkeit< im Sinne Foucaults, da es auf unterbrochener Ähnlichkeit beruht, die eine sichtbare, von Fremd- oder Außenbezügen unterscheidbare Selbstreferenz voraussetzt. Jede rekursive Rückkehr, jedes >»re-entry< der Unterscheidung in das durch sie Unterschiedene« (Luhmann 1997, S, 50) - Spiel im Spiel, Bild im Bild, Spiegel im Bild usf. - unterbricht die Selbstbezüglichkeit eines ins tautologische Extrem gesteigerten Ähnlichkeitsparadigmas, simuliert die Beobachtung der Beobachtung< intern und ermöglicht ein rekursives Beobachten der jeweiligen >blinden Flecke< der Beobachtungsebenen (vgl. theoretisch Junge 1993, zur Selbstreferenz des Dramas Schwanitz 1990a, S. 99-129, besonders S. 110-119).
28
der Rollen von Akteur und Rezipient, der Bereiche der Repräsentation und des Repräsentierten darstellbar. Die Bildlichkeit des >Spiegels< scheint hierfür besonders geeignet, da sie Ähnlichkeit und Selbstreferentialität zu verknüpfen erlaubt. Eine hierarchisierende Einbettung von Selbstwahrnehmung und -bespiegelung in ein Tableau geschachtelter aber unterscheidbarer Wahrnehmungshorizonte entzerrt - >enttautologisiert< - Selbstbezüglichkeit rekursiv und überführt sie in die Differenz von Selbst- und Fremdwahrnehmung, die sich im Nacheinander der Blickrichtungen realisiert und in der Selbstbezüglichkeit nur als unterbrochene sichtbar wird. Aus einer derart veränderten Beziehung von Selbstreferentialität und Ähnlichkeit indes auf eine >Krise< der Repräsentation im 17. Jahrhundert zu schließen, als deren >Überwindung< diese veränderte Beziehung zugleich interpretiert wird, entlarvt diese >Krise< als einen vielsträngigen und weniger emphatischen Wandel: Die Analyse des Wandels der semiotischen Strukturen und sozialen Funktionen von Selbstreferentialität in unterschiedlichen Medien steht zwar noch aus, müßte aber zeigen können, in welcher Form sich Ähnlichkeit zu ihrem Gegenteil in Beziehung setzt und im 17. Jahrhundert vor dem Hintergrund einer veränderten Relation von Fremd- und Selbstbezüglichkeit umfunktioniert wird.32
2.3. Destruktion des >Sinnbildes< und Konstruktion von Differenz: Weises Betrübte und wiederum vergnügte Nachbars Kinder (1699) Ein spätes Schauspiel von Weise mag den Übergang vom Ähnlichkeitsparadigma zur multimedial entfalteten Differenz von Selbst- und Fremdbezüglichkeit und ihre drameninterne Reflexion vor Augen führen. Im dritten Aufzug der zweiten >Handlung< der 1699 aufgeführten und 1700 im Druck erschienen Auffmunterung Schöner Gemüther / Wie solche In einem kurtzen Schau-Spiel von betrübten und wiederum vergnügten Nachbars Kindern / den I I . Augusti 1699. Mit lauter Personen von guter Extraction Modest und ohn alle Possen versuchet worden (SW XV, S. 1-89) schleicht sich Robert, der Sohn des alten Patriziers Dietrich, bei dem mit Dietrich verfeindeten Nachbarn Barnabas, dessen Sohn Philipp jedoch mit Robert befreundet ist, in »verstellter Kleidung als ein Mahler« ein (SW XV, S. 37), der sich »lange in Italien herumgeschraubt« habe (S. 38). Barnabas erteilt ihm den Auftrag, als Probe seines Könnens »etliche Zimmer« (ebd.) auszumalen, und postuliert das >Schöne< als intrinsischen Erfolgsgaranten der Kunst, der sich nicht nur bei Liebhabern des >Schönen< (»es giebt immer Leute, die was schönes sehen wollen«, ebd.), sondern
32
Derartige Fragestellungen bezeichnen darüber hinaus ein Desiderat, in welchem sich Komponenten von Foucaults Diskursgeschichte mit wissenssoziologischen Erkenntnisinteressen vereinbaren lassen und welches etwa im lockeren Anschluß an Luhmanns wissenssoziologische Studien zum Verhältnis von >GeseIIschaftsstruktur und Semantik< behoben werden könnte (zur Konzeption vgl. Luhmann 1980a und 1995).
29
auch gegen diejenigen, »die gerne was schönes verachten wollen«, ebd.), durchsetze: »Was recht schön ist / das lobt sich selber / [...]« (ebd.). Der des Malens vollständig unkundige, in Barnabas' Tochter Ottilia verliebte Robert fürchtet indessen, seiner Gefühlslage widersprechend, »eine Begebenheit von der scharfsinnigen und glückseligen Liebe vorstellen [zu] müssen« (S. 39), wartet aber auf Anweisungen des Hausherrn. Als vermeintlicher Maler sieht sich Robert inzwischen Versuchen ausgesetzt, für die gegen ihn gerichteten Intrigen seines Konkurrenten bei Ottilia instrumentalisiert zu werden. Er verweigert seine Mitwirkung am geplanten Possenspiel mit dem Hinweis auf seine Profession als Maler, der »zwar offt ein THEATRUM gemahlet / aber die Kurtzweil auff demselben [...] mehrentheils ändern überlassen« habe (S. 47), und weist die Zumutung zurück, Unwahrheiten über sich selbst - den angeblich verreisten Robert - zu verbreiten. Sein Kontrahent versucht dagegen, den (falschen) Maler auf die >Unwahrheit< der Künste zu verpflichten: »Die Mahler und die Poeten haben ihr Privilegium vor sich / sie mahlen Löwen mit Flügeln und mit gedoppelten Schwäntzen / und dessentwegen werden sie doch nicht aus der Christenheit gestossen« (ebd.). Festzuhalten ist vorerst: Robert spielt eine Rolle, innerhalb derer er sich im fingierten Medienwechsel zur Malerei den Fiktionen einer zweiten, eingelagerten Rollenzuschreibung entziehen kann und >Wahrheit< im Rahmen seiner Rolle als falscher Maler vertreten kann. Der Verweis auf die heraldisch legitimierten >Unwahrheiten< der Maler verfängt bei ihm nicht, die Analogie zur Lüge im sozialen Rollenspiel wird ihrerseits als falsch erkannt. Im Rahmen des >Spiels im Spiel< wird es somit möglich, >Wahrheit< gegen das geforderte falsche Spiel im Spiel im Spiel zu postulieren, die als relative aber nur innerhalb der Referenzrahmen der Spielebenen und ihrer begrenzten Geltungsbereiche denk- und kommunizierbar ist und mindestens zweier sich überlagernder Rollenkontexte mit konkurrierenden Wahrheitsmedien bedarf (Malerei und Sprache bzw. Poesie, Theater und Intrige). Daß Robert innerhalb seiner >unwahren< Maler-Rolle nur deshalb auf selten der >Wahrheit< steht, weil sich die >Unwahrheit< gegen ihn selbst richtet, funktionalisiert sie zwar auf die >Klugheit< des >Politicusrichtige< Unterscheidung von >Lüge< und >Wahrheit< im sozialen Rollenspiel einerseits, die von >Wahrheit< und >Unwahrheit< der Künste andererseits nicht. Der moralische Wert der >Wahrheit< wird von ihren sozialen >Gelegenheiten< nicht beeinträchtigt. Die schon im Titel des Dramas zitierte und von Barnabas erneut ins Spiel gebrachte Kategorie des >Schönen< setzt sich, so ist ferner zu folgern, zu den Differenzen von >gutböse< und >wahrfalsch< in Beziehung, die die oben zitierten Textstellen explizit oder implizit (»Christenheit«, S. 47) etablieren. Dabei kristallisiert sich als argumentativ intrikate Aufgabe heraus, >Wahrheit< zu relativieren oder besser: an soziale Funktionen und >kluge< Gelegenheiten zu koppeln, ohne die Abgrenzung zum >Falschen< aufzugeben und ohne diesem, das seinerseits mit der moralischen Unbedenklichkeit von künstlerischer >Unwahrheit< (am >falschen< Beispiel der Heraldik) argumentiert, eine Bindung an das christlich-moralisch >Gute< einzuräumen. In dieser Aufgabe zeigt sich das Grundproblem der Weiseschen >Oratorie< und Rhetorik-Lehre am Ende des 17. Jahrhunderts: Der >schöne Schein< der Künste und
30
des Spiels steht im Dienste einer je situativ relativen >Wahrheitkluge< Techniken der Verstellung und der Beredsamkeit verflüchtigt, ohne daß der latent paradoxe Anspruch aufgegeben würde, sie dennoch auf Moral und Tugend-Zwecke zu verpflichten. Das >Schöne< in den Künsten, das laut Barnabas von vornherein kommunikativen >Erfolg< verbuchen kann, mag >unwahr< und >wahr< umfassen; die moralische Unterscheidung von >gut< und >böse< wird ihm jedoch nicht subsumiert, sondern bleibt ihr gleichrangiger Widerpart. Was in den Künsten >gut< ist - auch da, wo sie >unwahr< sind -, wird außerhalb ihrer nach wie vor zur >LügeErfolg< des >Schönen< gleichwohl für die Unterscheidung von >gut< und >böse< genutzt werden kann, bleibt als Problem bestehen, an dem sich die Schuldramen Weises und seine Poetologie permanent abarbeiten. Deutlich wird diese Problemkonstellation in den Nachbars Kindern schon allein daran, daß das Schauspiel selbst im Vorbericht als ein »Gespräch-Spiel« (S. 6) definiert wird, das der Jugend »lustige und nützliche Übungen« (S. 8) biete, die andere Formen der Schulung von Beredsamkeit und sozialer Kompetenz ergänzen: »da hingegen bey abgewechselten Gesprächen ein Blick in die Politische Welt gethan wird / daß also die AciERENden in der cONTlNUlRLlCHen Abwechselung besser Lust behalten / und etwas nothwendiges erkennen müssen« (S. 6). Auch der genitivus objectivus des Titels - »Auffmunterung Schöner Gemüther / wie solche in einem kurtzen Schau-Spiel [...] versuchet worden« (S. 1) - meint nicht oder zumindest nicht primär die Zuschauer oder Leser des Stückes (»in einem [...] Schau-Spiel«), sondern sowohl die >Agierenden< als auch die dargestellten Figuren, also die »betrübten und wiederum vergnügten Nachbars Kinder[n]« und deren Eltern selbst (ebd.). Was für das Schauspiel und seine Affektwirkung auf Akteure und potentiell auch die Zuschauer gilt (Vorbericht, S. 7), gilt nachweislich für die Figuren des Spiels: Auch sie werden durch Rollenspiel und >Unwahrheit< (der wahrheitswidrig gemeldete Tod Roberts in der dritten Handlung, S. 61-83) >aufgemuntertgute< Affektwirkungen auf die Mehrzahl der Figuren, erstere - bei Erfolg - nur auf den Intriganten selbst. Das im neunten Aufzug der zweiten Handlung stattfindende Gespräch zwischen Robert und seinem Auftraggeber Barnabas (S. 48-51) gewinnt vor diesem Hintergrund an Bedeutung. Kontrovers diskutiert werden die Freiheit der >Invention< im Kontrast zur Regelgebundenheit der Zeichen und Bedeutungen und die Erweiterung des Zeicheninventars von >Sinnbildernfreier< künstlerischer Gestaltung gipfelt. Roberts nächstes Argument entschärft die implizite Paradoxie dieses >Auftrages< und enthüllt, innerhalb welcher unausgesprochen engen Grenzen Barnabas Robert Freiheit zu gewähren beabsichtigt. Robert schlägt Barnabas folgendes Sujet vor: Mein Patron gedencke doch / wenn ich die Wände mit sauern Gurcken bemahlte / wenn ich ein grünes Eichhörnchen und einen blauen Fuchs dazu setzte /ja wenn ich Tannenzapfen gar vergolden wollte / würden die Leute mit mir im Hause zu frieden seyn? (S. 49-50).
Barnabas' Antwort reduziert die ursprüngliche Alternative auf die nun deutlich eingeschränkten Wahlmöglichkeiten einer Auftragskunst, als deren einziger Erfolgsmaßstab der Patron selbst fungiert: BARNABAS. Wenn ich das haben wolte / so ließ ich einen Gurcken-Mahler kommen / in meiner Stube müssen Sinnbilder seyn. ROBERT. Die Sinnbilder finden allemahl nicht gar zu grosse Liebhaber. BARNABAS. Gnung / daß der Herr im Hause von solchen Sachen einen vEstirn machet. Was gedenckt er zu mahlen? (S. 50).
Die von Barnabas bevorzugte, im weitesten Sinn auf Ähnlichkeiten und Analogien beruhende >Sinnbild-< oder Emblem-Kunst, deren Beliebtheit und Erfolg Robert bezweifelt,34 wird durch Roberts phantasiertes Sujet ad absurdum geführt: Ein derart >autonomisiertes< weil von dekodierbaren Bedeutungen abgekoppeltes und folglich auch von den Zwecken der Erkenntnis und der moralischen Besserung befreites Bild kombinierte zwar noch Rudimente des emblematischen Zeicheninventars, desemantisierte sie jedoch durch kontrafaktische Farbgebung und ihre Syntagmatik zum
33
34
Barnabas' rätselhaft widersprüchliche und uneigentliche Rede vom >losen Fischen als >Lehrmeister< des vermeintlich in Italien ausgebildeten Malers, der diesem vorauseilenden Gehorsam gegenüber seinem >Patron< empfiehlt, kann - zugegeben spekulativ - als Anspielung auf das historische Exempel des Fischers und Aufrührers Tommaso Aniello motiviert werden, das Weise in seinem Trauer-Spiel Von dem Neapolitanischen HauptRebellen Masaniello (aufgeführt 1682; SW I, S. 153-373) verarbeitet hat: »Hier trotzt ein Fischer seinen Herren« (1. Tenorist, S. 160). Der >lose Fischer< als >Lehrmeister< vertritt dann metonymisch Weises Schuldrama [...] Masaniello, dessen >Nachredner< das »unglückselige« Ende des >rasenden< Rebellen als »glückseliges Ende« des »SchauSpiel[es]« interpretiert (SW I, S. 373) und daraus >Lehren< für die »Politische Klugheit« der Herrschenden ableitet (S. 372). Die Kritik des Patrons Barnabas an Roberts >trotzigem< Widerstand gegen die ihm gnädig eingeräumten Freiheiten und die Gleichsetzung seines >Lehrmeisters< mit einem >losen Fischer< warnte somit indirekt vor einer einseitigen - Freiheitsspielräume vorauseilend leugnenden - Schlußfolgerung aus der >Tragödie< des Rebellen Masaniello. Benjamin 1978, S. 155-167 betont gar einen Zusammenhang von >AllegorieMortifikation< und >Melancholie< (vgl. S. 161: »Wird der Gegenstand unterm Blick der Melancholie allegorisch, [...], bleibt er als toter, doch in Ewigkeit gesicherter zurück«); zu diesem Zusammenhang bei Benjamin vgl. auch Steiner 1992.
32
leeren (>totengut< und >böse, von >Tugend< und >LasterGurcke< noch >TannenzapfenFichtenzapfen< (u.a. als Zeichen der Weisheit Sp.255-257), >Eichhörnchen< (Sp.490-493, u.a. als Zeichen der Selbsthilfe und der Klugheit) sowie >Fuchs< (Sp.454-458, u.a. in Bedeutungskontexten der Klugheit und des Mißtrauens). Zumindest auf der Ebene einzelner Bedeutungskomponenten läßt sich der Bildidee eine minimale Ausdrucksbeziehung zu Roberts individueller Zwangslage als falscher Maler nicht absprechen, ohne daß damit ihre Existenzberechtigung als >Sinnbild< gesichert wäre; nicht die Ausdrucks- sondern allein die Besserungsfunktion vermag dies zu leisten, wie schon Vives (1532) für die allegorischen >ApoIogi< betont: »Apologi conficta exempla sunt in usum vitae, qui ad suadendam virtutem, ad dissuadendum vitium, [...] sunt reperti, alioqui vani sunt, et superflui, quippe non narrantur propter se ipsos, sed propter exemplum quod nos sumamus« (Vives 1993, S. 215).
33
Die Aktivierung des Betrachters und Lesers zu eigener Auffüllung der leeren Farbflächen und zur (ikonischen) Konkretisation von >Tugend< und >Laster< dynamisiert und temporalisiert die Erfolgskriterien des >Sinnbildesweiß< und >schwarzgut< und >böseÄhnlichkeit< und >Wahrheit< zugunsten einer auf Differenz basierenden >KlugheitBedenkzeit< von einem Tag. Zwar reagiert dieser auf diese letzte aufschiebende Anweisung des Hausherrn (»diesen Tag noch Bedenck-Zeit«, ebd., Z. 6) innerhalb seiner (falschen) Rolle (»Meinem Patron zu dienen«, Z. 8); zwar hat sich außerdem der von Barnabas gewährte >künstlerische< Handlungsspielraum als stillschweigend vorausgesetzte Bindung an das Sinnbild-Paradigma und folglich als eingeschränkter entpuppt. Am Ende kann jedoch dem Patron das Gewähren von >Bedenkzeit< selbst als >Klugheit< ausgelegt werden, zumal von neuem offen bleibt, auf welche Weise und zu welchem Zweck Robert nun seinerseits seine Bedenkzeit >klug< nutzen sollte - um das vorgeschlagene Sujet beizubehalten oder zu verändern, ganz zu verwerfen, um ein neues zu finden, den Auftrag zurückzugeben oder gar, um endlich aus seiner Malerrolle zu schlüpfen.36 Noch bleibt unklar, was sich für wen in welcher Rolle am Ende als >klug< herausstellen wird, nicht aber die Erkenntnisfunktion >falscher< Bildsujets oder - auf den Ausgang der Nachbars Kinder bezogen - die heilsame Affektwirkung >klug< eingesetzten >falschen SpielsLeuchter< im Spiel im Spiel die >Sonne< bedeuten soll: »Ihr [...] mit dem Leuchter / ihr möchtet wol weggehen / es sol itzo Nacht seyn. [...]. Als wenn man in der Nacht keine Leuchter bedürffe? [...]. Euer Licht sol aber den Son-
34
im Vorbericht die - sowohl was den dramatischen >discours< als auch die erzählbare >histoire< angeht - wenig komplexen Nachbars Kinder als »kleines Meister-Stück« (S. 7, Z. 33) bewertet. Er begründet dies zwar vordergründig mit pragmatischen Zwängen: Da das Stück für eine Aufführungssituation geschrieben worden sei, in der nur besonders wenige und >gleichartige< Akteure zur Verfügung standen, sei er »genöthiget worden / keinen grossen Unterscheid in den Personen zu machen / darinne sonst bey THEATRALischen Auffzügen / die meiste GRACE bestehen soll« (ebd., Z. 29-32), und insbesondere auf die Differenz schaffende, illusionsbrechende und kommentierende >lustige Person< des >Pickelherings< zu verzichten (S. 7f.). Die eigentliche Leistung liegt aber darin, in einem kurzen, gattungssystematisch und sozial, d.h. hinsichtlich des ständischen decorums in der Tat entdifferenzierten - weder tragischen noch komischen - Schauspiel mit homogenem Figureninventar 38 ohne Fallhöhe gleichwohl eine Fülle interner Referenzen zu etablieren und in ihnen die verbleibenden Basisdifferenzen mit begrenzten Mitteln um so schärfer zu profilieren: Semiotische (>wahrfalschschönhäßlichtugendhaftlasterhaftSpiel< und >Schein< an deren affekttherapeutische Funktion gekoppelt: >Betrübnis< wird zu >Vergnügennicht-wahrhaftiger< Darstellung (>grünes Eichhörnchen^ >blauer Fuchsgoldener Zapfenwahrhaftig< nach der Natur zu malendes, dafür
38
39
nenschein bedeuten. [...]. So wil ich nun der Monde werden« (S. 343). Der >Leuchter< als Metapher für >Sonnenlicht< wird umdefiniert zur Metonymie für aufzuhellende nächtliche Dunkelheit, Similarität weicht Kontiguität, die Bedeutungs- der Gebrauchsfunktion. Drei benachbarte Bürgersfamilien - davon zwei Vater-Sohn-Dyaden - sowie ein Fremder und immerhin wenigstens ein erfolglos intrigierender, fürstlicher Bedienter. - Da Weise das Stück, wie Haxel 1932 betont, in der langen Aufführungspause des Zittauer Schultheaters »eigens für seine >TischpurschenSinnbildkunst< als »des Hertzens getreue Dolmetscherin« mittels »einer schicklichen Gleichniß« vgl. den vierten Teil von Harsdörffers Gespraechspielen (S. 210-235, hier S. 220).
35
aber nicht-emblematisches Bedeutungselement hinzu (>saure Gurkeausgemaltes< Gegenbeispiel realisierbar, das auf die Argumentation gegen erweiterte Kreationsspielräume bezogen bleibt, unterläuft aber immerhin die konventionalisierte Speicher- und Erinnerungsfunktion der Sinnbilder.40 Daß Robert die Rekombination vorgegebener Bedeutungskomponenten zu ihrer Desemantisierung nutzt, ordnet sich außerdem in einen längerfristigen, semiotischen Zusammenhang ein, in dem einerseits eine spielerisch entfesselte >ars combinatoria< die Dominanz der >Ähnlichkeit< reduziert und die Vielfalt der Welt wie der Zeichen auf generative Kombinationsregeln zurückzuführen versucht, das Ähnlichkeitsprinzip andererseits aber nach wie vor die Tropentheorie (Rieger 1997, S. 63f.) und eine räumlich (etwa theateranalog) organisierte, auf fixen Zuordnungen mentaler >imagines< auf bestimmte >topoiloci< beruhende Mnemonik prägt (Keller 1979, S. 201; Draaisma 1999, S. 33-56).41 Daß außerdem Schriftlichkeit und insbesondere das Speichermedium >Buchdruck< - die überschießende Kontingenz der Kombinatorik von Lettern - die Probleme der Ordnung des Wissens, seiner Hervorbringung, Speicherung und Erinnerung, im Medium >Buch< zu lösen beansprucht, zugleich aber auch erheblich verschärft, deuten Rieger (1997, S. 72-75, 100-102) und schon Keller (1979) hypothetisch an. Würde »die Schrift als konkurrierendes Paradigma« der >memoria< »ernstgenommen«, dann veränderte auch der vorausgesetzte platonische Erinnerungsraum als »Raum des >inneren AugesPoetik< von Emblem und Sinnbild im Dienst von >Moralphilosophie und Erbauung< vgl. Höpel 1987, S. 107-223; zu emblematischen (>zweigliedrigenBild< und >Spiel< betont. Eine ins Einzelne gehende Diskussion der Abgrenzung von >Emblem< bzw. >Sinnbild< einerseits und >Allegorie< und >Symbol< andererseits ist hier nicht erforderlich, vgl. aber zur Allegorie Wiedemann 1979, Hillen 1979 sowie zu Symbol, Allegorie und Emblem Schöne 31993, S. 30-34, zu Emblem und Allegorie Bormann 1979. - Weimar 1990 interpretiert die barocke Metapher gar als »Akt[e] sprachlich-praktischer Christologie« (S. 470), da »Übertragung [...] das Schema der Inkarnation, Vereinigung das Schema der Menschwerdung« sei (ebd.). Daß derartige Prämissen von auf Ähnlichkeit beruhender Repräsentation nicht nur für die Literatur gelten - zur religiösen Zahlenallegorese der Musik im 17. Jahrhundert siehe Gravenhorst 1995 - und im dezidiert christlichen Kontext auch sehr viel länger ungetrübt überleben, steht - trotz der >Krise der Allegorie um 1700< (Alt 1995, S. 306-348) - außer Zweifel (vgl. etwa nur die allegorischen Considerationes Morales Ad Scenam Accommodatae im Theatrum Affectuum Humanorum [...], 1717, des Jesuiten Franciscus Lang). Siehe v.a. Zeller 1974, S. 157-183 zu Harsdörffers >ars combinatoria< als >ars inventiva< und >memorativa< sowie zum >SpielFünffachem Denckring der Teutsche Sprache< aus den Mathematischen Erquickstunden< (1651) ebd. S. 166-168; Harsdörffers >nicht-mimetische Kunstauffassung< thematisiert Battafarano 1994b, S. 108-116 mit Blick auf die Gespraechspiele; vgl. auch generell Dotzler 1996, S. 179-202 und Rieger 1997, S. 100-126. Den Zusammenhang von Lexikalik, Kombinatorik und Enzyklopädik bei Athanasius Kircher skizziert Schmidt-Biggemann 1983, S. 155-211.
36
Wurde so gezeigt, wie eng mnemotechnische Verfahren im 16. und 17. Jahrhundert an inventorisch-kreative Akte gebunden sind, die den Raum des Inneren konstituieren sollen, so ist damit eine Modifikation der Frage nach ihrem möglichen Funktionsverlust denkbar: >Reagieren< die mnemonischen Künste mit der komplexer werdenden Gestaltung eines artistisch-psychologischen Bereichs nicht auch auf den technisch möglich gewordenen Speicher der Druckschrift? Denn die kreativ-poietische Aktivität ihres >Speichers< verlangt ein neuartig vielfältiges Experimentieren mit der Beweglichkeit von Lettern< als Trägern von Sinn, aber auch als [...] sinnlich-figuralen Materien. (S. 211). Zu vermuten ist jedenfalls, daß das >Theatrum mundiTheater< als »Sinnbild der Welt« (Alewyn 1959, S. 54), und eine Strukturanalogie von >Drama< und >EmblematikSpiel< und >Bild< (Schöne 31993, S. 208-231; S. 229: »Theatrum emblematicum«) einen spezifische >ÄhnlichkeitsÄhnlichkeit< als semantischem Basisprinzip zu sprechen (vgl. etwa Dubois/Edeline u.a. 1974, S. 176-194 zu Metapher und Vergleich), will genaue Unterscheidungen verschiedener Typen von Bildlichkeit keineswegs einebnen, sondern appelliert lediglich an deren unterschiedlich weitreichende Gemeinsamkeiten. Die Bedenken von Schöne gegen Benjamins unscharfen Allegorie-Begriff sind insofern zu teilen (vgl. Benjamin 1978, S. 138-167 zu >Allegorie und Trauerspiel· und kritisch Schöne 31993, S. 253-265; dazu auch Steinhagen 1979, Garber 1987, Schings 1988 und Alt 1995, S. 141-150). Schönes >idealtypisches< Verständnis emblematischer Strukturen ist selbst ähnlicher Kritik unterzogen worden (Sulzer 1992, S. 32-40), die allerdings den heuristischen Wert einer von Varianten abstrahierten Idealtypik übersieht. Zu prüfen wäre, wie sich hierzu das von Deleuze 1995 im Anschluß an Leibniz übergeneralisierte Prinzip der »ins Unendliche gehenden Falte« als einer »operative[n] Funktion« verhält (S. 11, S. 61-67), die alle Diskurse und Medien des Barock durchzieht, und inwieweit diese >Funktion< die Unterbrechung von Ähnlichkeit und Selbstbezug durch Differenz akzentuiert (zur >Allegorie< im Anschluß an Benjamin vgl. ebd., S. 204-209). Prägnante Beispiele hierfür enthält der vierte Teil von Harsdörffers Gespraechspielen (1644), in dem der Zusammenhang von >Spiel< und >Spiegelung< auf eine das Ähnlichkeitsparadigma durchbrechende, genuin schriftliche Weise hergestellt und anläßlich der Erklärung eines >Sinnbildes< (S. 20) der »Letterwechsel / Auf vorhergehendes Sinnbild. / Gespraechspiel. / versetzet Gespraechspiegel« (S. 23) vollzogen wird. Semantische Ähnlichkeiten und Differenzen zwischen >Spiel< und >Spiegel< reduzieren sich zunächst also auf die pure Differenz der Signifikanten; zum >Letterwechsel< nach Art der Kabbala siehe auch ebd., S. 226-232 und das ebenfalls meta-semiotische Beispiel aus dem Bereich visueller Erkenntnissemantik »Sinnbild / [...] Bündnis« (S. 226).
37
3. Medienwechsel, Zeichenwechsel, Affektwechsel
3.1. Theater und Lektüre: Zur Wirkungsparadoxie des Weiseschen Schuldramas Der im Titelkupfer des Freymüthigen [...] Redners und in seiner Erklärung eröffnete >kluge (Schau-)Platz< des Redners inszeniert mit Hilfe zweier Spiegel auf der mittleren Bühne (Ebene 3) zwei visuelle Rezeptionshaltungen, die sich zeichenhaft auf den medialen Ort des Redners und die mediengeschichtliche Position der Druckeditionen von Weises Dramen beziehen lassen. Während der im Gedicht als erster thematisierte, große Spiegel allein schon durch seine Position parallel zur Bildflache der Bühne und die Art und Weise, wie er der Figurengruppe auf Ebene 2 präsentiert wird, das Theater selbst, seine >Schauspiele< als gemeinsam rezipierte Repräsentationen des »grosse[n] Schau-Platz[es] der Welt« (Feind 1708, S. 77f.) vertritt, entspricht die Wahrnehmung des zweiten kleineren Spiegels links durch eine dem Bühnengeschehen abgewandte Einzelperson aus nächster Nähe eher der Rezeptionshaltung des Lesens, der einsamen, selbstreflexiven Lektüre, die von den Zwängen sozialer Kontrolle und Rückkopplung zunächst befreit scheint (»Freyheit in Geberden«, V. 16). Die Beziehung der beiden abgebildeten Spiegel repräsentiert also bildintern nicht nur die Beziehung von Theater und Text, sondern auch die textinterne von Schauspielen und Vorrede und überträgt den komplexen Nexus von Bild und Text, von Frontispiz und Erklärung modellhaft auf die im Bild indirekt bezeichneten medienspezifischen Rezeptionsweisen.1 Daß - wie gezeigt - der linke Spiegel den rechten einerseits voraussetzt andererseits aber auch dessen Funktion teilweise übernimmt, bedeutet nun im übertragenen Sinn, daß eine bloß individuelle Lektüre die Wirkung der gedruckten und in Weises Rhetoriklehre eingebetteten Trauerspiele und Komödien des Freymüthigen [...] Redners - insofern sie von Aufführungskontexten entkoppelt bleiben - sozial nicht mehr zu kontrollieren und zu beeinflussen erlaubt, Erfolg also kontingent wird. Dies beschreibt in der Tat ein von Weise mehrfach thematisiertes, spezifisches Problem seiner Dramenproduktion und Bühnenarbeit.
Die ikonische und verbale Rhetorik von Kupfer und Erklärung legt eine Übertragung von Vers 20 auf das Buch des Freymüthigen und höfflichen Redners selbst nahe: Wer >klüger sein willkluge OratorieRezipientenDie dänische Amazonin Svanhvita, welche den unglücklichen König Regnerum in Schweden erlöset< (vgl. Fulda 1883, S. XXIX); zu Zahl und Herkunft der z.T. namentlich überlieferten Akteure seiner Schulaufführungen vgl. Hörn 1966, S. 162-182 sowie die Besetzungslisten des Regnerus (1684), des >Grafen Olivarez< (1685) und der Boßhafften und verstockten Prinzessin Ulvilda aus Dennemarck (1685) in SW II, S. 635-636, 639-641 und 643-644 oder das Programm zum Curiositäten Krähmer, 1686, SW XIII, S. 313-314. Die Doppelrolle als Akteure und Adressaten der auf der Vorbühne (Ebene 2) befindlichen Figurengruppe im Frontispiz erweist sich als implizit funktionalisierbar. Die Position des Bild-Betrachters (Ebene 0) entspricht nämlich insofern derjenigen des Zuschauers einer Schulaufführung, als diese auf einer Meta-Ebene vorführt, wie ihre Primäradressaten, die Schüler selbst, die jeweilige Dramenhandlung >agierenErfolg< bei den Besuchern der Aufführungen führt Weise nämlich nicht nur auf intrinsische Qualitäten seiner Stücke, sondern auch auf die affektive Bindung der Zuschauer an ihre agierenden Verwandten oder Freunde zurück, so daß sich die Rezeptionssituation im Theater in individuelle nonverbale Kommunikationsdyaden aufzulösen scheint: Die Personen waren bekandt l und weil man entweder auff einen Sohn oder sonst auff einen Freund warten muste / der endlich zu guter Vergnügung heraus kam / so kunte die Zeit nicht lang werden. Doch sollten andere Leute an die Stelle treten l so würde sich der Unterscheid leicht weisen / und der APPLAUSUS möchte was sparsamer heraus kommen. (Christian Weisens Lust und Nutz der Spielenden Jugend bestehend in zwey Schau- und Lust-Spielen [...] /Nebenst Einer ausführlichen Vorrede /Darinnen von der Intention dergleichen Spiele deutlich und aus dem Fundamente gehandelt wird. Vorrede. 1690, SW VIII, S. 423)
Auch schon 1683 wünscht Weise in der Vorrede (SW I, S. 599-601) zu seinem Dramenband Christian Weises Zittauisches THEATRUM wie solches Anno MDLXXXIl. Praesentiret worden / [...] (1683) für Schauspiele, die »vor kurtzer Zeit auf einer dunckelen Bühne / bey schwachen Lichtern« präsentiert worden sind und nun »auch an dem hellen Tage-Lichte gesehen werden« wollen, d.h. im Druck erschienen sind, »nochmahls dieselben Zuschauer / derer Anwesenheit auch die geringen Erfindungen kostbar gemacht hat« (S. 599) und befürchtet, »daß die Liebe gegen die INTERESSIRENDEN Anverwandten kräftiger gewesen ist / als die Sache« (ebd., S. 599f.). Die damit implizierte Abwertung der Dramen selbst scheint jedoch um so mehr dazu herauszufordern, deren Erfolg auch in Wiederaufführungen oder als Lesedramen unter Beweis zu stellen. Eine solche Generalisierung der Wirkungen von Weises Dramen erfordert die Abstraktion vom spezifischen pragmatischen Kontext der Schulaufführungen und bedeutet eine Erweiterung des Rezipientenkreises durch spätere Wiederaufführungen mit anderen Akteuren und anderem Publikum oder durch ihre printmediale Verbreitung, sei es in Einzelveröffentlichungen oder - häufiger - durch ihre Publikation in Sammelbänden wie dem Freymüthigen und Höfflichen Redner von 1693.
Zur >Dramaturgie der Schulcomödie< vgl. auch Zeller 1980, S. 19-24, zur Überlagerung der »literarisch-theaterästhetischefn] Rezeptionskette von Autor - Schauspieler - Publikum« und der »schulisch-pädagogische[n] [...] von Lehrer - Schüler - Eltern/bzw. Schulherrn« (S. 22) insbesondere das Schaubild (S. 23). Die Probleme, die der Medienwechsel zum Buchdruck in sich birgt und deren Reflexion durch Weise thematisiert Zeller nicht. - Die Grundzüge des >poetischen Schulbetriebes< an den protestantischen Schulen (Schulactus, Schuldrama, Deklamation) skizziert Paulsen 31919, S. 361-368.
41
Damit gewinnt eine grundlegende Problemkonstellation Kontur, die Weise in seinen unterschiedlich umfangreichen Vorreden zu den späteren Druckausgaben seiner Schuldramen wiederholt reflektiert. Zugleich integriert er auf diese Weise seine Dramen in einen Diskurs, der das Problem des fehlenden vergangenen Aufführungskontextes argumentativ bearbeitet und die Publikation der Dramen rechtfertigt. Die folgende Zitatauswahl mag die Variationsbreite von Weises Argumentation jeweils im Zusammenhang illustrieren: Ferner habe ich etwas gemercket / warum sich meine CoMOEDien nicht so gut im Buche lesen /als auff der Bühne FRAESENTiren lassen. Denn es sind viel Personen / welche nicht den hochdeutschen ACCENT, wie er im Buche stehet / behalten dürffen / sondern sie müssen sich nach dem DIALECTO richten / der bey uns auch unter GALANten Leuten in acht genommen wird. Wo sie das nicht thun / so kommen die meisten Sprüchwörter und andere scharfsinnige Reden gar todt und gezwungen heraus. (Christian Weisens Lust und Nutz der Spielenden Jugend bestehend in zwey Schau- und Lust-Spielen [...] /Nebenst Einer ausführlichen Vorrede /Darinnen von der Intention dergleichen Spiele deutlich und aus dem Fundamente gehandelt wird. Vorrede. 1690, SW VIII, S. 423). Drum habe ich auch keine Bedencken getragen / nochmals etliche Stücke dem geneigten Liebhaber zu COMMUNiciren. Und ob ich wohl weiß / daß man sie an wenig Orten nachspielen möchte; Denn ich würde selbst Noth haben / wenn ich sie vor itzo noch einmal pRAESENTiren solte / nachdem die vorigen Personen weggezogen sind; Und ich würde lieber was Neues machen l das meinen itzigen Untergebenen anständig wäre: Doch wird der STYLUS vielleicht so beschaffen seyn / daß man sich an dem blassen Lesen etlicher massen vergnügen möchte. (Freymüthiger und höfflicher Redner. Vorrede. 1693. SW XII/2, S. 431-432). Ich habe es in meinen Comödien erfahren / da gab ich keinem etwas zu AGiren / darinn ich nicht alles nach der Person ihrem NATUREL eingerichtet hatte: Doch wenn ich nur die Personen hätte verwechseln sollen / die sonst ihre Partheyen alle vor sich selbst gar ungezwungen REPRAESENTiRten / so würde man den Unterscheid und den Mangel sehr gespürt haben. Ich stehe auch in Sorgen / wo mir jemand meine Sachen nachspielt l der nicht eben solche Leute beysammen hat / so wird es ihm gehen / wie dem besten Capellmeister / der ein fremdes Stück / das auf andere Sänger gesetzet ist / nachmachen will, (ebd., S. 403-404). Ich habe es geschehen lassen / daß die Herren Verleger ein gantzes Dutzent von meinen THEATRAlischen Stücken zusammen bringen. Denn ob ich zwar diese zehn Jahre an solche Dinge nicht viel gedacht habe / so bin ich doch wohl zufrieden / daß ein Liebhaber meine vormahligen CONCEPTS zu lesen bekömmt. Absonderlich darum / weil ich in der That selbst verspüret habe / was vor ein köstlicher Nutz auch aus solchen Schrifften zu fliessen pfleget. Und wenn ich curiösen Gemüthern zu Gefallen / bey dieser Gelegenheit gedachten Nutzen etwas deutlicher ausführen sollte l [...]. (Neue Proben/von der vertrauten/Redens-Kunst/Das ist: drey Theatralische Stücke/ [...]. Welche vormahls auf/dem Zittauischen Schau-Platz gesehen worden. Nu aber nützlich und vergnügt zu lesen seyn. Nebst einer Vorrede von der also genannten PRUDENTIA SERMONIS SECRETI. [...]. Geneigter Leser. 1700, SW XII/2, S. 456). [...] / ich habe nochmals vor der klugen Welt ein Zeugniß ablegen wollen / daß ich meine Gedancken von so vielen Jahren her noch nicht verändert habe. [...]. [...]. [...]. Sonst habe ich mich mit der PUBLICATION vielmal zurückegehalten l denn ich habe nicht einmal den
42
vierdten Theil davon in Druck kommen lassen / der Personen sind durchgehende sehr viel / und weil ich mich nach eines jedweden NATURELL, das ist / nach seiner PRONUNCIATION, nach seiner Figur / und nach seiner ungezwungenen AFFECTE gerichtet habe / so weiß ich selber nicht / wer vor ändern die Haupt-Person heissen sollte. Ja ich muß gestehen / daß ich mir kein Stück von vorigen Jahren wieder auf/zuführen getraue. Wie ein CapellMeister / der sich in der COMPOSITION nach seinen INSTRUMENTALSTEN und VOCALISTEN genau gerichtet hat / bey erfolgter MUTATION, wenn er auch bessere Leute vor sich hätte / gleichwol mit den vorigen Stücken schlechte SATISFACTION geben möchte. (Christian Weisens Curieuser Körbelmacher/ Wie solcher auffdem Zittauischen Theatro den 26.Octobr.MDCCH. von Etlichen Studirenden praesentiret worden / Anietzo aus gewissen Ursachen herausgegeben. Geneigter Leser. 1705, SW XV, S. 101-102). Nur in dem Stücke bin ich [...] anderswo unglücklich gewesen / daß die Personen zur gewöhnlichen PRONUNCIATION nicht sind angeführet worden. Ich habe die Zeit meines Lebens nur eine Comödie von den Meinigen / auff einem frembden THEATRO gesehen / doch ich lieff davon / ehe der letzte ACTUS sollte vorgestellet werden. Ach es ist unmöglich / daß der ACCENT, der DIALECTUS, und andere Kleinigkeiten lebendig heraus kommen / wenn nicht ein jedweder seine PARTIE mit einer freymüthigen Gelassenheit auszuführen weiß / wie man solches im gemeinen Leben gewohnet ist. ([...] ungleich und gleich gepaarte Liebes-Alliance, wie solche Vor einigen Jahren In einem Lust-Spiele vorgestellet worden /Nunmehr mit einer Ausführlichen Vorrede heraus gegeben. An den geneigten Leser. 1708, SW XV, S. 323). Daß die Comödien bey der Jugend ihren sonderlichen Nutzen haben / das ist ausgemacht. Voraus wenn es zur lebendigen ORATORIE kommen soll. Denn es liegt nicht allein das meiste von der ACTION und PRONUNCIATION daran / [...]. Gestalt ich eben aus diesen Ursachen gar gerne bekenne / daß ich keine Comödie vor mich selbst auff das Papier hinschreiben kan l wenn ich den Worten nichts frembdes und EXTRAVAGANTES mit einmischen will. Da hingegen im DiCTiren die lebendige PRONUNCIATION sich niemals verbergen darff. (ebd., S. 319).
Aus Weises pädagogisch und rhetorisch begründeter Forderung nach einer lebendigen Oratorie< und natürlichem »FAMILIÄREN PRONUNCIATION« (Lust und Nutz [...], Vorrede. 1690, SW VIII, S. 423) resultieren also weitere gravierende Probleme mit der Realisation seiner Dramen, die - sei es durch wiederholte Aufführung, sei es durch eine Verbreitung als Buch - von den Umständen der Situation der Erstaufführung abstrahiert. Wo sich »das Spiel nach den Personen« zu richten hat und nicht »die Personen nach dem Spiele« (ebd., S. 42l),6 erscheinen Wiederaufführungen als unangemessen, die die ursprünglichen Adressaten der Stücke notwendig verfehlen und deshalb die Wirkung schmälern (vgl. auch Lust und Nutz [...], Vorrede. SW VIII, S. 421). Daß Weise durchaus Spielraum zugesteht, innerhalb dessen die Stücke an wechselnde Aufführungsbedingungen angepaßt werden können, ändert daran nichts grundlegend, wie das Beispiel der 1700 in den Neuen Proben von der vertrauten
»Hiermit war mein gröstes Kunststücke / daß ich die Kunst verbergen / [...] kunte« (Lust und Nutz [...], Vorrede, 1690, SW VIII, S. 421), was den Funktionswandel zur Wiedergebrauchsrede erschwert und zugleich das damit verknüpfte Wertungsdilemma verdeutlicht.
43
Redens-Kunst [...] erschienenen Druckfassung der Misculance von der alsogenannten TRAGOEDIE und COMOEDIE In der Vorstellung Einer Historie oder einer Fabel vom König Wentzel / [...] (1686) illustriert: Ob auch wohl die Sache dergestalt eingerichtet ist / daß sie nirgend besser als auff einen Zittauischen THEATRO kann PRAESENTIRET werden; so dürffte doch nur hin und wieder was weniges ausgelassen werden; damit würden sich auch die Zuschauer anderswo daran vergnügen können, (ebd., Innhalt, SW III, S. 5).7
Um den Zielkonflikt zu beheben, der zwischen der postulierten sozialen Relevanz der erzieherischen Wirkungsabsichten der Schuldramen einerseits und der konstatierten (und zugleich befürchteten) Eingrenzung der Wirkung auf ihre Adressaten, nämlich die jeweils in standesgemäßer Rollenbesetzung agierenden Schüler des Zittauer Gymnasiums andererseits besteht, bleibt Weise gleichwohl nur der Wechsel des Mediums vom Theater zum Buch. Die selektive und später meist verzögerte Drucklegung der Dramen, insbesondere der Komödien, und ihre nach wie vor ambivalent beurteilte Lektürewirkung erweisen sich offenkundig als das kleinere Übel. Wenn ihr intendierter >Nutzen< in begleitenden Vorreden theoretisch erläutert und begründet wird, dann mögen sie auch im >bloßen Lesen< immerhin >vergnügliche< und >nützliche< Wirkungen erzielen, die - so ist festzuhalten - höher bewertet werden, als diejenigen von Wiederaufführungen, aber deutlich niedriger als die Wirkungen, die die Dramen in der individuellen Besetzung erreichen, für die sie geschrieben worden sind.8 Der damit entschärften latenten Paradoxie einer als gesellschaftlich >nützlich< definierten, aber zugleich nur einmalig und hoch individuell realisierbaren Gelegenheitsrede, deren enge Koppelung an ihre Erst-Akteure als Garant ihrer kalkulierbaren Wirkung und zugleich als Grund für die massive Einschränkung ihres zeitlichen und gesellschaftlichen Wirkungsbereichs fungiert, liegt darüber hinaus ein nicht auf Weise begrenztes Problem im Übergang vom 17. zum 18. Jahrhundert zugrunde. Es betrifft die Anforderung an rhetorische, affekttheoretische und affekttherapeutische Diskurse, ihre erhoffte >bessernde< Wirkung sozial zu generalisieren, dauerhaft abzusichern und dafür die adäquaten Speicher- und Verbreitungsmedien zu finden - Medien zumal, die die freigesetzten und >natürlichen< Wirkungen noch an reproduzierbare Regeln - >freimütig< und >höflich< - zu binden erlauben.
Ähnlich auch die Nachbemerkung zur Druckfassung (1690) von Der Tochter-Mord. Welchen Jephtha unter dem Vorwande eines Opfers begangen hat / [...] (1679), wo er die hochdeutsch gesetzten Reden der Bauern dem Dialekt desjenigen überläßt, »der es zu AGIREN Lust hat« (SW IV, S. 197) oder die Inhaltsangabe des im Freymüthigen und höfflichen Redner 1693 veröffentlichten Schauspiels Der Fall des Französischen Marschalls von Biron (1687), in der er einräumt, daß er in die >ernsthafftige Materie allerhand Kurtzweil< mit >einmischen< mußte, »welches man doch gar leicht auslassen könnte« (SW III, S. 184); vgl. auch Eggert 1935, S. 294-295. Nur wenn die Drucklegung noch unter dem Eindruck der Aufführung oder jedenfalls in zeitlicher Nähe zu ihr erfolgt, scheint Weise - wie im Falle der Vorrede zum Einzeldruck (1682) von Das Ebenbild eines gehorsamen Glaubens / welches ABRAHAM In der vermeinten
44
Daß diese Problemkonstellation zumindest implizit auch dem Titelkupfer zum Freymüthigen und höfflichen Redner und seiner Erklärung eingeschrieben ist, wird vor dem Hintergrund von Abschnitt 2.1. und 2.2. um so deutlicher. Die visuellen und verbalen Strategien ihrer Beziehung etablieren, wie gezeigt, im Tableau der Spiegel eine Form der >KlugheitPoliticus< eine dynamische wechselseitige Koppelung von Selbst- an Fremdbeobachtung nahelegt und dabei zwei visuelle Aktions- und Rezeptionsmodi aneinander bindet: den >höflichen< und >äußerlichem, sozialen Modus des Theaters und einen >freimütigenLesens< aufweist - repräsentiert durch den linken Spiegel. Die Freiheit, wechselnde >Gebärden< in diesen Spiegel hineinzuspiegeln und in diesem wahrzunehmen (»Freyheit in Geberden«, V. 16), markiert für den >Akteur< und Betrachter - und im übertragenen Sinn: für den Leser - einen doppelten Freiraum für mögliche actiones und für ihre Deutung (»Man sieht / was möglich ist«, V. 17). Als Selbstreflexionsmedium bedarf dieser Spiegel jedoch der Koppelung an den >curieusen Welt-Spiegel< rechts, der zugleich das wirkungsorientierte Aufführungs- und Erfolgs-Medium des Theaters vertritt und den Spielraum der >Re-Flexionen< sozial begrenzt. Damit weisen Titelkupfer und Erklärung einen Bedeutungsüberschuß auf, der über den rhetorischen Lehrzweck der Buchpublikation des Redners hinausgeht und sich einem Tableau visuell kodierter >Klugheit< verdankt, das implizit mediengeschichtliche wie poetologische Signifikanz für sich reklamieren kann. Buch und Theater, Lesen einerseits und dessen Nutzanwendung im Agieren oder Zuschauen andererseits - sei es auf dem Theater, sei es im >Welt-Theater< selbst -, erweisen sich gleichermaßen als unverzichtbare Mittel einer >klugen< Weltund Selbsterkenntnis, in der die Fremdreferenz der Mimesis - einer auf gesteigerter Ähnlichkeit und Natürlichkeit beruhenden Zeichenhaftigkeit - von der Selbstreferenz der autonomen Zeichen selbst unterbrochen wird und umgekehrt. Indirekt wird dies auch an den Reflexionsanstrengungen Weises deutlich, die die Umstellung vom Aufführungs- und Präsenzmedium >Theater< auf die Bedingungen des Buchdrucks und des Lesens begleiten. Das Bild-Text-Syntagma aus Titelkupfer und Erklärung führt in diesem Zusammenhang durch seine visuellen und semantischen Strategien arguter Bedeutungskonstitution - durch seine ikonische und textuelle >Theatralik< und >eloquentia interna< - einen Grad an Leser- und Betrachteraktivierung vor, der die actio des Lesers zwischen oratorisch-dramatischem Agieren und passiver Rezeption ansiedelt.
Opferung seines Isaacs beständig erwiesen /[...] (1680) - »dem Liebhaber die blasse Lust im Lesen [zu] überlassen« (SW IV, S. 207). Bei größerer zeitlicher Distanz zum sozialen Kontext der Aufführung scheint der pädagogisch-rhetorische Legitimationsdruck auf die Publikation zuzunehmen und deren Wirkung zugleich um so zweifelhafter zu sein.
45
3.2. Medienwechsel als Erfolgsgarant: >Privatberedsamkeit< Insofern der Aufführungskontext der Schauspiele durch den schriftlichen Kontext des rhetorischen Diskurses ersetzt wird, der ihre Rezeption steuert, weist er ihnen zusätzliche Bedeutung als lehrhafte Exempel zu, die die Postulate der >klugen< Oratorie und >galanten pronunciation und >actio< illustrieren und zugleich realisieren: Die pragmatisch nicht (mehr) einlösbare Wirkung der Rhetorik wird also ersatzweise auf die je nachfolgenden Dramen verschoben und damit semiotisch beglaubigt. Dies weicht schon allein in den quantitativen Proportionen von der früheren Praxis Weises vor seinem Rektorat am Zittauer Gymnasium ab: Hatte er in ein Complimenten- und Chrien-Lehrbuch wie den 1084 Seiten umfassenden Politischen Redner von 1677 als exemplarisches Lesedrama die Complimenür-Comödie von 140 Seiten (Weise 1683, S. 294-434)9 eingefügt, so haben sich die Gewichte nun deutlich zugunsten der Schauspiele verschoben. Noch können sie indessen nicht für sich allein stehen, sind also nicht aus ihrem schulrhetorischen Diskurskontext entlassen. Wie nicht nur der Freymüthige und höffliche Redner vor Augen führt, erweisen sich die abgedruckten Dramen dabei jedoch längst als die eigentlich dominante Textsorte, deren formale Unterordnung unter die rahmenden, rhetorischen Übungs- und Lernziele kaum darüber hinwegtäuschen kann, daß diese die Dramen allenfalls noch einleiten und poetologisch kommentieren, ansonsten aber zu Parerga geworden sind. Wenn derjenige Diskurskontext, der die Schauspiele erst überhaupt zu bedeutungstragenden Exempeln macht, »bey Gelegenheit gewisser Schau-Spiele« (wie es im Titel des Freymüthigen Redners signifikant vage heißt) selbst zu deren >Beiwerk< absinkt, dann schiebt sich in der Tat die literarische >Gelegenheit< vor die pädagogischen Zwecke, dann werden >Vergnügen< und >köstlicher Nutz< zum eigentlichen, didaktisch legitimierbaren Ziel, und die Horazischen Funktionen des >prodesse< und des >delectare< kommen annähernd zur Deckung.10 Wie außerdem das Beispiel rhetorischer Affekt->Pathologien< und medienspezifischer Affektenlehren, die nicht nur sprachliche sondern auch musikalische oder ikonische Mittel betreffen, zeigt, bedürfen die Affekt-Taxonomien des 17. Jahrhunderts dringend des Umwegs über poetische, dramatische, musikalische oder bildliche Medien, um die zusehends offe-
9
10
»Wenn ich auch die gantze COMOEDIE betrachte / so stehet sie mehr deßwegen da / daß sie sol gelesen / als daß sie sol AGiret werden.« Vorrede zu Lust und Nutz, der Spielenden Jugend bestehend in zwey Schau- und Lust-Spielen [...], 1690, SW VIII, S. 418). Der Satz Weises kann als nachträgliche Kritik daran gelesen werden, daß gerade die ComplimenürComödie bereits im Jahre ihres Erstdrucks auf der Görlitzer Schulbühne und auch später noch mehrfach zur Aufführung gelangt ist (vgl. Gajek 1994, S. 324). Horaz unterscheidet drei mögliche Leistungen von Dichtkunst: »aut prodesse volunt aut delectare poetae aut simul et iucunda et idonea dicere vitae« (Quintus Horatius Flaccus, Epistula ad Pisones de Arte Poetica [1972], Z. 333f. [S. 24]); vgl. jüngst Hinrichs 1999, S. 232, zur Beziehung von Poetik und Rhetorik S. 226-232, Dyck 1991 und für Weises >Lust-und-NutzAdsessor IV< nur, den Wert jeglicher physiognomischen Diagnostik in Zweifel zu ziehen: Aus einer bösen PHYSIOGNOMI kan nicht eben / und gewiß ein böses Leben geschlossen werden. Denn welchem Gelehrten ist nicht bekandt / was vor eine böse PHYSIOGNOMI SOCRATES gehabt? (ebd.) Auch die >Conscientia Chirurgi< bezeichnet die Tat des Barbiers als »tyrannisch« (S. 112, 113), worin allerdings kaum ein Indiz für Kritik am Absolutismus zu erblicken ist, solange dessen >Obrigkeit< in Gestalt des Gerichts positiv bewertet wird. Zur antiabsolutistischen Tendenz des Protestantismus vgl. aber Kaiser 1972, S. 89-104 und Mitternachts Drama >PoIitica Dramatica. Das ist Die Edle Regiments-Kunst In der Form oder Gestalt einer Comoedien / [...]< (1667).
99
Daß der »Entleibte« gar »arm gewesen / und man wohl weiß / daß faule Bettler zum öfftern Strassenraub ausüben / [...]«, der Chirurgus demnach »vielen Todschlägen und Mordthaten zuvor gekommen« sei (ebd.), wird schließlich vom Praeses selbst als abduktiver Fehlschluß entlarvt: »A posse ad esse non valet consequentia« (S. 143)n - daß Armut ein verbreitetes Mordmotiv sei, heiße umgekehrt nicht, daß »alle armen Leute Mörder wären« (ebd.). Auch die Bitte der Kinder des Angeklagten um Gnade für den Vater (S. 133, S. 145-148), damit er sie »noch weiter versorgen und erziehen könne« (S. 133), bleibt unerfüllt. Angesichts des pädagogischen Versagens der Eltern des Opfers kann es nicht verwundern, wenn am Ende auch dem Barbier und Chirurg als >schlechtem< Vater keine >Barmherzigkeit< (S. 145) widerfährt und er seiner Familie durch die angekündigte Enthauptung (S. 147) entrissen wird. Die von Verelendung und Verwahrlosung bedrohten Kinder werden vom Praeses auf >Gott< vertröstet, der »Vaterstelle« vertrete (S. 148) und dabei wiederum von >Vormündern< und >Anverwandten< ersetzt werde (ebd.). Erneut wird die Möglichkeit, aus Verfehlungen zu lernen und innerweltlich zu büßen, verweigert; das Strafexempel richtet sich nur an die Mitwelt, nicht den zu bestrafenden Sünder selbst: Denn »Gottes gerechtes Gerichte pflegt zwar eine Zeitlang verborgen zu liegen / aber endlich außzubrechen und an den Tag zu kommen« (Philosophus sextus, S. 149). Nicht nur das Gerichtsverfahren gegen den Chirurgen und seine Verteidigungsgründe, sondern auch die forensische Bilanz des Dramas insgesamt fällt - zumal für ein Schuldrama - desaströs aus und entbehrt nicht epistemologischer >TragikHeilungGewußten< entlarvt, also die auf Fehlschlüssen beruhenden Prognosen zukünftigen kriminellen Verhaltens, physiognomische Diagnosen des inneren Affektzustandes und seine anschließende moralische Bewertung oder das kanonisierte Wissen einer Medizin, die sich darin erschöpft, die in Büchern tradierten Kenntnisse immer von neuem zirkulär zu bestätigen. Auch der Versuch, die Selbstreferentialität des Wissens >empirisch< zu durchbrechen, scheitert und fällt in leere semiotische Selbstbezüglichkeit zurück. Aus der Beobachtung der Bewegungen des menschlichen Herzens durch Autopsie folgt weder eine neue Therapie für die Heilung körperlicher wie affektiver >HerzbeschwerungenFäßchenBewegung< des >Herzens< ebenso wie vor seiner >Verstocktheit< kapitulieren. Auch die Mittel der Rhetorik versagen bei dieser Aufgabe; weder Eltern noch >Praeceptoren< vermögen es, die Gemütsneigung des Ariophilus positiv zu beeinflussen. Aus den Erfahrungen
12
Zum Begriff der >Abduktion< siehe unten die Abschnitte 4.1.2. und 4.1.3.
100
des Lebens selbst zu >lernen< und aus Strafe >klug< zu werden, scheint schließlich angesichts der Destruktivität dieser Erfahrungen keine ernsthaft zur erwägende Alternative. Ein Bedarf an pädagogischer und therapeutischer Intervention bleibt also nach wie vor bestehen, die Mittel zur Befriedigung dieses Bedarfs werden jedoch nachhaltig desavouiert.13 Daß der Unglückselige Soldat nicht die Methoden der Schulrhetorik, der Medizin, der Affekterkenntnis und -therapie für ihren Mißerfolg sondern dafür ausschließlich die nicht besserungsfähigen Adressaten der Erziehung selbst verantwortlich macht und keinen anderen Ausweg sieht, als sie zu verurteilen und zu tilgen, bleibt indessen nicht nur angesichts des argumentativen Aufwandes des Dramas vordergründig, käme es doch einem - aufwendig inszenierten, dadurch aber nur unzureichend kaschierten - Eingeständnis vollständigen Scheiterns der Institution gleich, dem das Schultheater selbst seine Existenz verdankt. Das Drama widerlegt dieses vermeintliche Ergebnis implizit auch schon deshalb, weil es zum einen das epistemologische Scheitern einer Pädagogik vorführt, die nur diejenigen erreicht, die ihrer letztlich kaum bedürfen, und zum anderen die >Opfer< dieses Scheiterns - durchaus im Sinne der aristotelischen Katharsis - zu abschreckenden (der Chirurg) und mitleiderregenden (Ariophilus) Exempeln erhebt, die die didaktische Selbstblockade aufzuheben in der Lage sind.14 Was es im Falle des experimentierenden Arztes noch verwirft, nämlich die >Opferung< des Ariophilus für einen vermeintlich >guten< Zweck, das praktiziert es mit dem Alibi einer >abschreckenden< Verurteilung des Chirurgen selbst. Es bedarf selbst der theatralischen >AutopsieCuriosiätHeilPädagogik< Mitternachts vgl. ebd., S. 237-251). »Die Tragödie ist Nachahmung einer [...] Handlung [...] [...), die Jammer [>
Strafen< und >Schrecken< sowie die >Parallele< zwischen >Tragödie< und >Hinrichtung< arbeitet für das 18. Jahrhundert Zelle 1984 heraus, der auf Lessings Ablösung des >Schreckens< durch die >Furcht< und den Wandel im ästhetischen und juristischen Diskurs des 18. Jahrhunderts hinweist (S. 102).
101
unterstreichen die »grosse Müh und Arbeit« (S. 149) und die affektdiagnostischen (»erkundigen«) und affektsemiotischen Anforderungen an den Autor, dessen Stücke als lehrhafte >exercitii dramatici< erfolgreich wirken sollen: [...] in einem solchen EXERCITIO muß der Erfinder desselben alle HUMORS derer Personen / und ihre ADFECTUS oder Gemüthsneig- oder Bewegunge erkundigen / und mit bequehmen Worten abbilden. Weil nun so viel und mancherley Personen aufgeführet werden / ist unschwehr zu ermässen / daß er auch mancherley und wieder einander lauffende ADFECTUS beschreiben müsse / welches ohne viel Nachsinnen nicht geschehen kan. (S. 149).
Was weder medizinisch-chirurgischen Experimenten noch rhetorischen Persuasionsversuchen gelingt, nämlich die >Bewegungen des >Herzens< zu erfassen und das bewegte Gemüt zu beeinflussen, und was die unmittelbar disziplinierende Moraldidaxe ihrerseits am »verstopfeten« >Herzen< des in Gegenwart des Lehrers >stille sitzendem Schülers (S. 88) ebenso vergeblich versucht, das mutet sich die dramatische Literatur zu: >Erkundigung< der >Gemüthsbewegunge< in lehrhafter und >bessernder< Absicht (Prologus, S. 20: »erbar / erbaulich und Christlich«) mittels - wie es in der Vorrede An den wohlgeneigten Leser heißt - »unterschiedliche[r] Abbildungen der Gemüter / gleich wie in den Spiegeln unterschiedliche Leibesgestalten / vorgebildet« (S. II). 15 Die pädagogische Leerstelle, die der Ausgang des Unglücklichen Soldaten hinterläßt, wird somit von den »Theatralibus actionibus« (ebd.) selbst besetzt, die den Mittelweg zwischen den beiden Extremen des >FäßchenTreuen Ekhard< (S. 87-88), das dem ratlosen Musophilus die erfolglose Erziehung seines Sohnes erklärt und das Versagen der Schule entschuldigt, zeigt zugleich den Zielkonflikt jeder unmittelbar intervenierenden Pädagogik und Affektmanipulation auf: Die Bewegung des Gemüts bildet zwar die Voraussetzung seiner >Öffnung< und Zugänglichkeit, zu starke Bewegung mindert jedoch seine Beeinflußbarkeit ebenso, wie eine massive Disziplinierung, die es zwar >still-legeverstockeÖffnung< >verstopfeAdsessor< erinnert an einen Maler in päpstlichen Diensten, der »aus CURIOSITÄT einen gecreuzigten Menschen recht künstlich und natureul ab zu mahlen / seinen Gesellen überredet / daß er sich an ein Creuz henken lassen / und hernach denselben / [...] / mit einem Messer erstochen / damit er den todten und erblaßten Leichnam desto besser abbilden könte / [...]« (S. 118). Die illusionär gesteigerte Natürlichkeit der Kunst - das tödliche ikonische Experiment - erweist sich (nicht nur im Falle des Bildgegenstandes der Kreuzigung Christi) als ähnlich blasphemisch, wie sein chirurgisches Gegenstück, beruhen doch beide auf einer künstlichen Destruktion der Natur. Erneut zeigt sich, daß ein übersteigertes semiotisches Ähnlichkeitsparadigma genauso der Restriktion bedarf wie dasjenige der klassifizierenden und >sezierenden< Analyse.
102
tralischen >Vorstellung< bietet sich als Lösung an. Er vermeidet beide Extreme und moderiert die Dynamik des Wechsel verschiedener Affekte auf einem mittleren Bewegungsniveau zwischen entdifferenzierender Vermischung und unversöhnlicher Kontrastierung, zwischen befreiender und lustvoll bewegter, affektiver Erfahrung und einengender statisch-deduzierender Belehrung. Nur eine gelungene dynamische Balance (>delectaredocere< und des >movere< ist moralpädagogisch >nützlichLust< und expliziter >Nutzprodessenutzlosepischeunterhaltsamen< Wechsel, sondern beide auch noch mit Zwischenauftritten des Narren Morio verbindet und zweitens der Kontrast zwischen den belehrenden, kommentierenden, ankündigenden und zusammenfassenden Redeakten von >PhilosophiArgumentatoresAdmonitor< und Personifikationen auf der einen Seite und der Greuelszene der Vivisektion auf der anderen besonders kraß ausfällt. Daß, wie Sorg 1980 (S. 89-90) anmerkt, der Schul-Praeceptor selbst nicht als Figur auftritt, belegt vor diesem Hintergrund alles andere als seine gottähnliche, auf Absenz gegründete »Omnipotenz« (S. 90), sondern eher das Gegenteil und verweist darauf, daß jener nur indirekt und vermittelt - und das heißt auch: im Medium der Literatur und des Theaters - erfolgreich wirksam werden kann. 17 Ohne Medium, das die leere Selbstbezüglichkeit der pädagogischen Bemühungen und ihres moralischen Inhalts unterbricht und ihrer - von der Dramenhandlung deutlich genug vorgeführten - Wirkungslosigkeit entgegentritt, vermag >Schule< nichts. Die Tragödie des Unglückseligen Soldaten und vorwitzigen Barbirers als >Tragödie< scheiternder Pädagogik und Moraldidaxe wird so zur impliziten Selbstrechtfertigung desjenigen Mediums, das als einziges einen Ausweg aus den aufgebauten Dilemmata verspricht: Schuldrama und Schultheater selbst. Wenn der Praeceptor in der Figur des Ekhard einen >treuen< Repräsentanten findet, dessen >Experiment< mit dem Fäßchen den Vater des mißratenen Sohnes seinerseits 16
17
Eine solche >Kreuzung< von Rhetorik und Poetik führt zur Unterscheidung eines >prodesse< zweiter Ordnung und zum >Wiedereintritt< der Unterscheidung von >prodesse< und >delectare< in das Unterschiedene: Eigentlich >nützlich< weil wirksam ist nur die Verbindung von >delectaremovere< und >docere< (im Sinne von Quintilian 31995: »tria sunt item, quae praestare debeat orator, ut doceat, moveat, delectat«, Institutionis Oratoriae. Liber V, 2, S. 300). - Zur Poetologie Mitternachts vgl. Sorg 1980, S. 287-303, zu ihrem Verhältnis zur Aristotelischen und Horazischen Poetik S. 288-292; sein Befund im Anschluß an die Vorrede zum Trauer-Spiel, zwischen »Dichtung und Wirklichkeit bleib[e] immer die anerkannte Schulwissenschaft quasi dazwischengeschaltet« (S. 292), wäre allerdings zu modifizieren: Zwischen Schulwissenschaft und Wirklichkeit sind vielmehr die Medien Drama und Theater zwischengeschaltet. Im Widerspruch dazu konstatiert Sorg allerdings später, daß dem »Gelehrten« mit dem Vordringen des barocken Theaters Gefahr drohe, »der Praeceptor von der omnipotenten Autorität [...] zur Lustspielfigur« absinke (S. 311), ohne diesen Widerspruch zum Anlaß einer genaueren Analyse des Soldaten zu nehmen.
103
über die Schwierigkeiten der Pädagogik aufklären will, und wenn ferner das >real< vorgeführte Exempel insofern Merkmale des Theaters selbst teilt, als es sich an einen Zuschauer richtet, der - wie die agierenden Schüler - selbst zur Mitwirkung aufgefordert ist, dann gewinnt dies nicht nur Aussagekraft für das Verhältnis von Theater und Schule, sondern signalisiert auch eine semiotische Selbsteinordnung dieses Mediums: Als Modellversuch positioniert sich Ekhards Demonstration zwischen analoger Repräsentation - das Faß als Herz oder Gemüt und der Wein als die zu vermittelnde >Lehreempirische< Experiment des Barbiers. 4.1.2 >Exempel< und >Regel< - >Rezitativ< und >Arieactiones theatrales< und die damit verknüpften Affekterfahrungen - scheint ex negativo eine Dramenpoetik auf, die über die spezifischen Anforderungen des Schultheaters hinausführt und dessen exemplarische pädagogische und affektrhetorische Problemdisposition sich, zumal angesichts der um 1700 zunehmenden Verbreitung des Buchdruckes und des Lesens, als längerfristig wirksam erweist. Dies wird u. a. am erneuten Aufschwung und an der affekttherapeutischen Funktionsüberlastung der Aufführungsmedien im 18. Jahrhundert und ihrem Anspruch deutlich, die Repräsentationen von Affekten und ihren Wirkungen der Wirkung dieser Repräsentationen anzunähern. Um einen Ausweg aus den bis in das 18. Jahrhundert reichenden tautologischen und zirkulären Strukturen des Diskurses über Affekte - ihre Erklärung, Beeinflußung und Besserung - zufinden,scheint sich also Literatur - und insbesondere die dramatische - als Medium der Selbstreferenzunterbrechung anzubieten. Die diskursgeschichtliche Position von Mitternachts Trauer-Spiel führt dies insofern vor Augen, als sich weder die in postulatorischer Selbstbezüglichkeit verharrende, rhetorisch fundierte Pädagogik noch eine medizinisch >fortschrittliche< (>curiösekluge< Medien der Fremd- und Selbsterkenntnis und der Affekttherapie erweisen - erstere nicht mehr, letztere noch nicht. Daß sich das zirkuläre Verhältnis von äußeren Wirkungen und inneren Ursachen als Problem herausstellt, das im Übergang von Repräsentationen per Ähnlichkeit und Analogie zu solchen, die auf indexikalischen Zeichen, körperlichen, affektiven
104
oder sozialen (etwa verbalen) Symptomen beruhen, auftritt, belegen die impliziten Widersprüche und Veränderungen frühaufklärerischer >Kardiodiagnostik< (zu Thomasius siehe Geitner 1992, S. 124-148 und S. 163-167)18 ebenso, wie das erkenntnistheoretische Problembewußtsein, das J. G. Leutmann (21724) in seinem >Anhang< zu den Temperamenten unter Beweis stellt. Nachdem er seine humoralpathologischen Voraussetzungen um physiologische und anatomische erweitert hat und den »Antrieb des Hertzens und der Lunge«, die »Vasa«, das »Geblüthe« und »Lympha«, »Serum« und »Nerven-Safft« (§ 72, S. 149-150) zu »consideriren« (S. 149) vorschlägt, stellt er sich die Frage, [...] ob man das TEMPERAMENT aus Betrachtung dieser Ursachen suchen, oder ob man aus Erkäntniß des TEMPERAMENTS auf diese Umstände einen richtigen Schluß machen könne. [...]. Wenn man alle diese angezeigte Ursachen vorher erkennen und wissen könte, so wäre wohl leicht zu urtheilen, was vor ein TEMPERAMENT daraus fliessen müste; Allein da dieses nicht leicht möglich, indem sie meistentheils verdeckt und also unserer Erkäntniß verborgen, so sind sie nur darum nöthig zu wissen, damit, wenn ein TEMPERAMENT genennet wird, man alsobald auff diese Ursachen Schlüssen, und also die innerliche Beschaffenheit eine Menschen wissen möge. [...]. Es sind also die TEMPERAMENTE nicht aus denen CAUSIS und Ursachen zu erforschen, sondern aus denen EFFECTIBUS und Würckungen zu erkennen. Und wenn man etliche Anzeigungen eines TEMPERAMENTES hat, so kan man die ändern Würckungen solches TEMPERAMENTES, und dannenhero auch die INCLINATIONES und NATURELL eines jeden Menschen vollständig JUDICIREN. (ebd., § 73 - § 75, S. 150-151).
Gerade weil sich das Verfahren des Mitternachtschen Chirurgen verbietet und als wenig hilfreich erwiesen hat, die innerliche Beschaffenheit eines Menschern also >verdeckt< und >verborgen< bleibt, ist nicht aus ihr (gesichert) auf die psychischen Folgen zu schließen, sondern umgekehrt (und weniger gesichert) von den äußeren Anzeichen der Temperamente auf diese selbst und von diesen auf deren vorausgesetzte, innere Ursachen. Nicht die Autopsie des Inneren, der physischen Herzbewegungen, erklärt die affektiven Bewegungen, sondern aus den Gemütsbewegungen wird vielmehr auf die inneren, organischen Ursachen geschlossen - der Erkenntniszirkel bleibt unaufgelöst. Die Erkenntnis der Affekte und Temperamente selbst bleibt nach wie vor latent tautologisch und in zirkulären Zuordnungen von Bezeichnendem und Bezeichnetem verfangen (solches gilt auch für B. Feinds säftemedizinische Produktionspoetik, vgl. dazu Abschnitt 3.3.). Daß unter solchen logischen und empirischen Bedingungen die Produktion neuen Wissens - die Entdeckung »unbekannter Wahrheiten« (Tschirnhaus 21695, S. 48) -
18
Geitner, S. 127, Fußnote 71 führt den Begriff auf Christoph August Heumanns >Prudentia cardiodiagnostica< zurück und bezieht ihn ohne Nachweis auf Christian Thomasius' »Kunst / anderer Menschen Gemüther zu erkennen« (Kurtzer Entwurf/der Politischen Klugheit /[...], 1710, S. 101); vgl. ähnlich auch schon den Entwurf einer »Wissenschaft, Das Verborgene des Herzens anderer Menschen auch wider ihren Willen aus der täglichen Konversation zu erkennen« von Thomasius 1692, S. 68.
105
ganz allgemein auf Schwierigkeiten stößt, wird ebensowenig verwundern wie die erkenntnistheoretischen Anstrengungen, derartige Zirkel zu vermeiden und in der Erkenntnis des >Wahren< und der Unterscheidung des >Falschen< nicht bei einer bloßen Bestätigung des schon Gewußten stehen zu bleiben. So empfiehlt z. B. die Medicina Menüs, sive Artis Inveniendi Praecepta Generalia [...] (21695) des mit Christian Weise befreundeten Philosophen und Naturforschers Ehrenfried Walther von Tschirnhaus, [...] einen zwischen den Wegen aller bisherigen Philosophen geichsam die Mitte haltenden Weg [einzuschlagen]. Von ihnen waren einige der Meinung, daß alle Erkenntnis a priori allein durch Vernunftgründe abzuleiten sein: die übrigen glaubten vielmehr, daß dies a posteriori durch die Erfahrung geschehen müsse. Es ist nämlich meine Ansicht, daß man zwar zunächst a posteriori beginnen soll, daß dann aber beim Fortschreiten alles nur a priori abzuleiten und das einzelne überall durch evidente Erfahrungen zu bestätigen ist; und daß dies so lange fortgesetzt werden muß, bis wir wiederum zu den ersten Erfahrungen, die wir am Anfang herangezogen hatten, durch die Ordnung selbst geleitet, zurückkehren und so der ganze Kreis der Philosophie ohne Zirkel (nämlich den, den die Logiker mißbilligen) vollendet ist. (S. 282).
Begleitet wird dies von der Bemühung, der >Vernunft< und der Erkenntnis der >Wahrheit< ein affektives und ethisches Substrat zu verschaffen, das sie dauerhaft intrinsisch absichert und nicht nur mit >privatpolitischer Klugheit< und den vordergründigen Zwecken prudentistischer Sozialtechnik motiviert.19 Im Bereich der auf Affekterkenntnis angewiesenen >Klugheitslehren< korrespondiert damit ein Plausibilisierungsversuch ihrer Methodik, der sich auf die Selbstbezüglichkeit des Gegenstandsbereichs zurückzieht und auf extrapolierbare Selbsterkenntnis baut: Christian Thomasius' »Kunst / anderer Menschen Gemüther zu erkennen« (Thomasius 1710, S. 101) »bestehet« nämlich »aus einer einzigen Regel«: Je weiter du in Erkenntniß deiner eigenen Thorheit kommen bist / iemehr wirst du anderer Leute Klugheit und Thorheit ohne alle andere Regeln erkennen; und ieweniger du dich Selbsten kennest / ieweniger werden dir auch tausend Regeln / wie man andere erkennen solle / helffen.
19
Vgl. etwa Tschirnhaus' utilitaristische und eudämonistische Argumentation, für die Dauerhaftes Glück< nur daraus entstehen kann, seinen »Geist auszubilden, [...], um hierdurch das wahrhaft Nützliche von dem, was so lediglich zu sein scheint, sicher zu unterscheiden.« Genau dadurch erfährt man »die höchste und reinste Ergötzung von allen, die auf natürliche Weise auf Menschen in diesem Leben, [...], Anwendung finden können, nämlich die, die aus der Gewinnung der Wahrheit erwächst und der, f...], niemals eine andere gleichgestellt werden darf.« Die »Größe dieses Genusses«, wenn »neue Entdeckungen« gemacht »oder Theoreme, die einzigartige Wahrheiten in sich schließen und sehr nützlich sind« (S. 57), bestätigt werden, fungiert geradezu als verkapptes Wahrheitskriterium, die Aussicht auf >höchste Ergötzung< als Movens der Wahrheitsfindung. Wie die normative Formulierung (»niemals [...]«) zeigt, trennt diese Art der >Ergötzung< nur ein schmaler Grat von der bloßen >CuriositätKlugheit< erweist sich einmal mehr als ein Prozeß des >Zirkulierens< zwischen Selbst- und Fremdreferenz, der ihre nach wie vor zirkuläre Verschränkung mit der Dynamik der je wechselnden Perspektiven überspielt und sowohl Selbstreferenz als auch Fremdreferenz permanent und wechselseitig unterbricht. Beide - so ist aus der Akzentverschiebung in Thomasius' Argumentation zu folgern - bleiben wechselseitig auf einander verwiesen. Extrapolieren, Abstrahieren, Generalisieren, Re-Spezifizieren ermöglichen es, so scheint es zumindest, Selbst- und Fremderkenntnis mit Wissensgewinn so aufeinander zu beziehen, daß Exempel und Regel nicht mehr in tautologischer Relation stehen und dieser Relation explanativer Wert zukommt. Thomasius reflektiert das Problem im zweiten Kapitel Von der Klugheit / Rath zu geben seines Kurtzen Entwurffs der Politischen Klugheit [...] (1710, S. 21-40) insbesondere in den § 19 bis § 28 (S. 29-33), wobei der Gang seiner Argumentation zusätzliche Aussagekraft für die zugrundeliegenden Dilemmata gewinnt. Daß zur »Erlernung der Klugheit« (S. 29) >Exempel< unverzichtbar sind und sie, »so ferne sie zum Grunde dieser Lehre und zu Erlangung der Erfahrenheit dienen« (S. 30), idealiter >wahr< zu sein haben, steht für Thomasius ebenso fest, wie die didaktische und affektive Unzulänglichkeit solcher »wahren Historien« (ebd.). Daraus zieht er die einzig mögliche Konsequenz: Aber zu besserer Erleuterung der Reguln und zu Übung der Lernenden ist nicht schädlich / sondern zu weilen nützlich / wenn man ihnen auch erdichtete CASUS oder Exempel vorleget. [...]. Denn die die erdichteten Exempel sind hierbey nicht gäntzlich zu verwerffen / und wie bey FUrtragung der Lehre von Tugenden und Lastern die Fabeln nicht ohne Nutzen seyn; Also haben ihrer viele nicht ohne Ruhm die Regeln der Klugheit unter den Fabeln ihren Zuhörern beygebracht. Ein Lernender wird dadurch offt zur Auffmercksamkeit ermuntert l und schärffet seinen Verstand damit / wie denn in QUINTILIANI und SENECAE CONTROVERSIEN die meisten / wo nicht alle Exempel erdichtet seyn. (S. 30).
107
Das Verhältnis der >Exempel< zu den >RegelnExempel< umgekehrt »nach der Regel ein [zu] richten«, also die »Anführung durch Regeln« (S. 31), garantiert im Gegensatz zum inversen Weg höhere >SicherheitExempel< sind hingegen »betrüglich« (ebd.), so daß Thomasius nach wenigen Zeilen zu dem genau konträren Schluß gelangt: [...] es wird eine Lehre viel besser erläutert l wenn man das Exempel aus der Regel l als wenn man die Regel aus dem Exempel ziehet. Die Exempel beweisen nichts; dahero können auch die aus dem Exempel gezogenen Regeln einen Lernenden nicht zum Beyfall bewegen; zumahl da die Exempel l aus denen man Regeln ziehet / nicht solche CONNEXION haben können / als die Regeln / welche mit Exempeln erläutert werden. (S. 31).
Einerseits scheint der Aufmerksamkeit erregende Wert anschaulich >erdichteter Exempel< Voraussetzung für eine erfolgreiche Vermittlung der >Regelnbeweisen< fiktive - >betrügliche< - Beispiele nichts und >Regelnconnexion< transportiert werden, haben ohne diese kaum Bestand bzw. können ohne sie kaum vermittelt werden, >bewegen< also auch >nicht zum Beifalk Abgesehen davon entgehen beide auf >Exempel< angewiesenen >Methoden< den Gefahren nicht, die von deren semiotischem Überschuß und ästhetischem Eigenwert auszugehen scheinen.20 Der Widerspruch ist nicht auflösbar, zumal - wie die weitere Argumentation von Thomasius zeigt - gerade in »öffentlichen Lectionen / da sich allerhand Zuhörer einfinden« (S. 32), der kommunikative Erfolg im Unterschied zu »auserlesenen Zuhörern / die ihr gehöriges Alter schon haben« (S. 32), sehr viel ungesicherter erscheint, so daß auf eine Ableitung der >Regeln< aus den >Exempeln< nicht verzichtet werden kann. >Beiderlei Methoden< abwechselnd nacheinander zu 20
Weshalb Heidegger (Mythoscopia [...], 1698) auch Romanen jegliche belehrende, durch Abschreckung bessernde Exempel-Funktion abspricht: »Wann man in den ROMANEN Exempel sihet eifersichtiger / zornmüthiger / leichtsinniger / [...] Leuthe / die ihren AFFECTEN den Zaum schiessen lassen / [...] / stärcken sich ohne Zweifel auch solche Passionen bey dem Leser« (S. 113). - Zur Rhetorik und Logik des >Exempels< in der Lyrik um 1700 vgl. Petrus 1996, S. 162-170.
108
praktizieren, scheint schließlich der einzige Weg zu sein, den Thomasius nahelegt, ohne ihn explizit weiter auszuführen. Das Dilemma ist außerdem bereits aus Weises Poetologie und ihren decorum-Problemen bekannt: Je größer die Zahl unterschiedlicher Adressaten ist, die eine Klugheitslehre, eine Schuloratorie oder ein Schuldrama als literarisches >Exempel< zu erreichen beansprucht, desto weniger scheint die >Lust< entbehrlich, die von den heterogenen Signifikanten der >RegelLust< stellt den Erfolg der Signifikate, also der lehrhaften >Regeln< auch affektiv sicher. Darüber hinaus wird aber aus den oben gegebenen Beispielen deutlich, inwiefern das schon vor 1700 und nicht nur von Weise erkannte - von diesem aber >medientheoretisch< zugespitzte - wirkungsästhetische und rhetorische Problem, das den kommunikativen Erfolg der Affekten-, Oratorien- und Klugheitslehren zu beeinträchtigen scheint, mit den zeitgleich virulenten epistemologischen und empirischen Grenzen dieser Diskursformation zusammenhängt. Martus 2002 zeigt anläßlich von Gottscheds Konzeption von >GründlichkeitSchuldrama< spricht. Zur Konjunktur des Masaniello-Stoffes in Drama und Oper des 18. Jahrhunderts siehe Rudolph 1968.
113
4.1.3. B. Feinds Libretto Masagniello Furioso (1706) und die Funktion der Gleichnisse Auf der Basis der zitierten poetologisehen Aussagen zur >Erklärung< des Rezitativs durch die Arie ergibt sich zunächst hypothetisch, daß in dieser die >actiones< und die sie begleitenden Sprechakte des Rezitativs auf ihre affektive Basis bezogen werden, die diese >actiones< verursacht, als affektiv motiviert erscheinen läßt und somit >erklärtMoraleAllegorieExempel< und >RegelWut< der Fischer gegen den Adel und Masaniellos >wütende< Handlungsanweisung an den >Banditen-General· Perrone im Rezitativ wird von dessen nachfolgender Arie (»Wenn die Geduld zu hart verletzet, wird sie zum Wüten angehetzet«, S. 138-140) auf eine >Wenn-dannWüten< ausbricht und sich zu diesem Zweck des Gleichnisses vom »beherzten Leu« (S. 139) bedient. In der Fiktion der dargestellten Welt handelt es sich dabei also um den oben als >induktiv< bezeichneten Weg vorn konkreten Handeln zur nachträglich aus diesem abgeleiteten >Regelmäßigkeit< - vom Rezitativ zur Folgerung Perrones, die ex post jene >Wenn-dannWüten< nachliefert. Die Begründung simuliert folglich eine Deduzierbarkeit des konkreten Affektzustandes Masaniellos und der Fischer im Rezitativ aus der zuvor induktiv gefolgerten Gesetzmäßigkeit. Der Versuch, dies in die Form eines Syllogismus zu zwingen, offenbart jedoch die Grenzen einer >Erklärung< der >WutGeduld verletzt< ist (Zustand A), dann erfolgt ein >Ausbruch von Wut< (Zustand B). - Allgemeine Gesetzmäßigkeit (Arie). Masaniello und die Fischer befinden sich in Zustand A. Conclusio: Masaniello und die Fischer >wüten< (Zustand B) (Rezitativ).
Um die >Wut< als Explanandum auf diese Weise aus dem Explanans, welches aus der Annahme einer allgemeinen Gesetzmäßigkeit (I) und konkreten Antecedensbedingungen (II) besteht,26 erschließen und damit >erklären< zu können, müßten
26
Die syllogistische Grundstruktur der deduktiven Gesetzeserklärung resümiert Stegmiiller 1974, S. 82-90: »Zu erklären ist ein spezielles Vorkommnis [...]. Es werde Explanandum genannt. [...] [es] müssen zunächst gewisse Bedingungen angegeben werden, die vorher oder gleichzeitig realisiert waren. [Antecedensbedingungen]. Ferner müssen gewisse Gesetzmäßigkeiten [...] formuliert werden. Die Erklärung besteht darin, den Satz [...], der das zu erklärende Phänomen beschreibt, aus diesen beiden Klassen von Sätzen, [...], logisch abzuleiten« (S. 82).
Merkmale des Zustandes A an Masaniello und den Fischern allerdings unabhängig von B, d.h. zeitlich vor Beginn von Zustand B festgestellt werden können, was innerhalb der mit B einsetzenden Dramen hand lung nicht möglich ist. A darf also selbst nicht erst ex post aus B gefolgert oder anläßlich von B postuliert werden. Der Schlußverlauf scheint folglich eher einer nachträglich verallgemeinernden Abduktion zu entsprechen, in der (II) und (III) die Positionen vertauschen und ein allenfalls mögliches Motiv für B, nämlich der Zustand A, seinerseits als eindeutig ableitbares Explanandum ausgegeben wird. A als - unter der Prämisse von (I) - immerhin denkbare >Erklärung< von B wird also mit Hilfe von B selbst >erklärtGeduld verletztx ist (Zustand A), dann erfolgt ein >Ausbruch von Wut< (Zustand B). - Allgemeine Gesetzmäßigkeit (Arie). (II) Masaniello und die Fischer befinden sich in Zustand B (Rezitativ). (III) Conclusio: Masaniello und die Fischer befinden sich in Zustand A.27 Der im Rezitativ Masaniello und den Fischern attribuierte Zustand der >Wut< ist nun vom Explanandum selbst zur Antecedensbedingung und damit zum scheinbaren Explanans von Zustand A geworden, der doch ursprünglich zur >Erklärung< von B beitragen sollte. Daß eine mögliche >Erklärung< von B derart selbst mit B >erklärt< wird, entlarvt die zweite Schlußfolgerung als verallgemeinernden Umkehrschluß: Dieser verschleiert, daß aus B als Antecedensbedingung - dem Affekt der >Wut< - nicht auf genau nur eine Ursache (A) geschlossen werden kann: >Wenn A gilt, dann Bwenn B, dann AerklärtRegel< (>wenn A, dann BAbduktion< und zu seiner Abgrenzung von >Induktion< und >Deduktion< vgl. Peirce 1983, S. 89-98, v.a. S. 94-96, der >Abduktion< als »mögliche Erklärung« einer »überraschenden Tatsache«, als >Verallgemeinerung< einer >Erfahrung< definiert (S. 95). Eine zeichentheoretische und logische Vertiefung ist an dieser Stelle verzichtbar; zu vermuten ist aber auf der Basis von Quintilians (31995) Unterscheidung von Syllogismus und >epichirema< bzw. >enthymema< als rhetorischen Schlußfolgerungen, deren Prämissen nur auf Wahrscheinlichkeit beruhen (»syllogismi rhetorici« oder »inperfecti«, V 10, 3, S. 548), daß der oben angedeuteten zirkulären Verknüpfung deduktiver und abduktiver Elemente selbst der Status eines Epicheirems zukommt (vgl. ebd., V 14, S. 651-665 und insbesondere die Beispiele in V 14, 24-26, S. 660-663). Da Rezitative oft aus Sprechakten verschiedener Figuren bestehen, ist jeweils genau zu beachten, wessen Affektzustände im Rezitativ jeweils zum Ausdruck kommen und von wem welche Zustände dann jeweils in der folgenden Arie thematisiert werden. So kündigt z.B. Perrones letzter, ungehörter und zur Arie überleitender Sprechakt im Rezitativ (S. 138: »Ich weiß, daß du mit Recht erzürnet bist.«) zwar eine >Erklärung< des >Zornes< Masaniellos an, die diesen >Zorn< und die daraus resultierende Rebellion zu rechtfertigen vorgibt, signalisiert darüber hinaus aber bereits die Urteils- und Definitionsmacht des zwischen den Fronten stehenden, >machiavellistischen< Banditenführers, der den >rasenden< Masaniello am Ende töten wird (S. 280: »Vier masquierte Personen mit dem Perrone
115
implizite >Erklärungswenn A, dann B< - von vornherein als bekannte und gültige behandelt werden - eigentlich also gar nichts zu folgern, zu erschließen und zu >erklären< ist. Das >Exempel< der neapolitanischen Fischer-Rebellion belegt die aus ihm gezogene >Lehre< des ausgleichenden Affektausbruchs, der wiederum von dieser >Lehre< erklärt wird. Im Anschluß daran durchbricht dann allerdings ein Gleichnis (Feind 1706, S. 139-140) den explanativen Nexus zwischen Rezitativ und Arie und markiert überdies einen internen Bruch innerhalb der Arie, so daß sich erneut die Frage nach dem Verhältnis von >Exempel< (>picturaRegel< (>subscriptioLöwen< >erklärt< nun im Gegensatz zum ersten Satz der Arie nicht einmal mehr zum Schein den von Perrone selbst als >berechtig< anerkannten >Zorn< Masaniellos in der Situation des Rezitativs und ist auch keine bildliche Umformulierung der vorangehenden >Regel< von der >verletzten Gedukk Diese motiviert den Ausbruch der >Wut< nach dem zu langen >Käfig< der >GeduldStreit< und >Grimm< eines >Beherzten< und Wilden gegen denjenigen, der ihn in den >Käfig< sperren, disziplinieren will. Wer zu lange unterdrückt ist, wird ebenso wütend wie der wilde >Löwe< vor seiner (erneuten) Unterdrückung - in beiden Fällen, so vemittelt die Arie, sind gefährliche Affektausbrüche zu erwarten. Die eigentliche Bedeutung des Gleichnisses liegt also, soll es nicht als prophylaktische >Kasuistik< gelten, in der Zukunft der dargestellten Welt und ist als Warnung vor den freigesetzten und nur mehr schwer zu bändigenden Affekten zu verstehen - oder, in Kenntnis des weiteren Schicksals Masaniellos, als prospektive Aussage Perrones.29 Sie motiviert allenfalls den Ausgang des Dramas
29
erschießen ihn«). Perrone selbst erweist sich als kaum affektdominiert, als bestechlich (S. 193) und in seinem Verhalten offenbar auch nicht erklärungsbedürftig. Auch schon in Weises Trauerspiel von dem Neapolitanischen Haupt-Rebellen Masaniello (1682; SW I) wird die >Regel< von der überbeanspruchten >Geduld< beiläufig formuliert, allerdings von Vertretern der Obrigkeit und des Adels, die ihr gleichwohl ständeübergreifende Gültigkeit zubilligen, siehe dazu 4.2.1.
116
und das Ende des Masaniello >furioso< und ist zunächst - an dieser frühen syntagmatischen Stelle - als Anreiz anzusehen, die fehlende Bedeutung des Gleichnisses im weiteren Verlauf der Handlung zu suchen.30 >Similitudo< siegt zwar über >conclusioemblematischen< Beziehung von Rezitativ und Arie bestätigt sich somit auch und gerade dann, wenn die poetologisch von Neumeister, Hunold oder Feind postulierte, affektive und rationale Generalisierungs-, Erklärungs- und Motivierungsfunktion der Arie wörtlich genommen und überprüft wird. Nur dann zeigt sich nämlich, daß und auf welche Weise das poetologisch Behauptete offenbar nicht mit dem in der Oper Realisierten zusammenstimmt, daß sich also die - allerdings durch das Löwen-Gleichnis selbst schon bedrohte - semiotische Statik des >Emblems< gegen eine pseudo-explanative Dynamik durchsetzt, die Handeln aus Affekten erklären möchte und doch nur immer wieder Affekte aus Handlungen erschließen und durch Handlungen repräsentieren kann. Obwohl die Arie als >sententia generalis< »desjenigen / was vorher geredt ist / oder noch geredt werden soll« (Neumeister in Hunold 1706a, S. 408), verstanden wird, macht »die Application im Consequente [...] auf das / was im Recitatif gesagt worden« ist, die in Aussicht gestellte »neue Lehre« eher unwahrscheinlich (Feind 1708, S. 95) oder allenfalls am intern vorausweisenden Gleichnis sichtbar. Deutlich wird daran aber auch die Funktion dieser poetologischen Bestimmung von Arie und Rezitativ selbst. Deren syntagmatische Relation, ihre wechselnde Folge und gegenseitige >UnterbrechungAntecedente< und >Consequente< (Feind 1708, S. 95) im schlußlogischen Sinne zwar verfehlen, aber immerhin einen - noch ungenügenden - Ausweg aus der zirkulären Selbstbestätigung und implizit tautologischen Repräsentation der guten und der bösen Affekte durch Personifikation und Allegorese versprechen. Solange >Empirie< ebenso versagt wie >Logik< scheint immerhin Verzeitlichung eine Möglichkeit zu bieten, die Selbstbezüglichkeit immer schon bekannter, somit weder vermeidbarer noch besserungsfähiger Affektzustände sukzessive zu unterbrechen. Aus der isolierten, pseudo-emblematisehen Dyade aus Rezitativ und nachfolgender Arie läßt sich diese Folgerung, wie gezeigt, freilich nicht untermauern, so daß ein Blick auf wenigstens zwei andere Textstellen aus Feinds Masagniello-Libretto naheliegt. Angesichts des Löwen-Gleichnisses bietet es sich an, die Beziehung von Rezitatv und Arie anhand der in der Tat über das Gleichnis hinaus erklärungsbedürftigen >Raserei< Masaniellos zu überprüfen, um dann im
30
Daß das Gleichnis seine >Regel< zumindest im zweiten Teil sehr viel vorsichtiger formuliert und die vom >Löwen< ausgehende tödliche Gefahr nur für wahrscheinlich, jedenfalls aber für möglich hält (»oft«), unterstreicht diese Funktion zusätzlich.
117
nächsten Abschnitt einen vergleichenden Blick zurück auf Weises vierundzwanzig Jahre älteres Trauer-Spiel von dem Neapolitanischen Haupt-Rebellen Masaniello (1682) zu werfen. Im Fünfzehenden Auftritt der dritten Handlung bestreitet Masaniello ein von Streichern begleitetes und mit »Masaniello rasend« überschriebenes Accompagnato (722. Accompagnement e Recitativo, Feind 1706, S. 275-278): Verzagte Räuber! Schämt euch! Bückt euch, werft euch zur Erden, [...], hier ist ein Held, ich soll noch König werden! Ihr feigen Neapolitaner, pfui, ihr habt Herzen, pfui, ihr habt Herzen als die Weiber, [...], pfui, schämt euch, [...], fort, bückt euch, zögert nur nicht lang, sonst straf ich euch mit Ruten, Dolch und Strang! So recht, bin ich nicht alles in dem Staat? Ein Richter, Obrist, mutiger Soldatf Packt ein, packt ein, zur See, zur See, zu Schiff, zu Schiff! Seid auf meinen Wink parat, bringt Zuber, Eimer, Angel her, Werft's Netz aus, laßt den Köder hangen, wir werden große Fische fangen. Was werden wir für Beute fangen! Halt, nehmt die Segel ein, Knecht, rudere nicht mehr, hier soll mein Schiff vor Anker liegen. (Wiederholungen sind z.T. durch >[...]< ersetzt, CMO.)
Es folgt die letzte Arie Masaniellos (123. Aria con Violini Unisoni e Hautbois, S. 279-280): Ich eile nicht mehr zu Schiffe, zu Schiffe, [...], sonst muß ich ertrinken und sinken, [...]. Das Ungestüm treibet mich hin und her, hin und her, [...]. O Himmel, ich fahre zur Tiefe, ich fahre zur Tiefe!
Der Auftritt schließt mit einem weiteren, nur mit Basso continue begleiteten Rezitativ von Masaniello und Perrone (124. Recitativo, S. 280), in dessen Verlauf Masaniello von vier »masquierten Personen mit dem Perrone« (ebd.) erschossen wird: Masaniello. Ist dies mein Lohn? O ihr Verräter! Perrone. Die Schüsse haben nicht gefehlt, da liegt der Übeltäter zu eines jeden Spott entseelt. Ich geh und mache dies zur Stund dem Herzog und dem Adel kund.
Masaniello, dem seit dem zweiten Auftritt der dritten Handlung keine Arie (88. Aria) und seit dem neunten Auftritt kein Rezitativ (707. Recitativo) mehr zugedacht ist, erscheint im ersten Rezitativ seines letzten Auftritts als ein inzwischen Gewandelter, >RasenderErklärung< in der folgenden Arie - der letzten, todesnahen Selbstaussage Masaniellos - bedürfte. Das Rezitativ beginnt mit einer absolutistischen Machtphantasie (»bin ich nicht alles in dem Staat«), die die Opposition >männlicher, mutiger Held - versus - feige Weiber< mit einer vertikalen Raumachse (»bückt euch«, »zur Erde«) kreuzt und dann übergangslos den Bedeutungsbereich der Seefahrt (horizontale Bewegungsrichtung) und des Fischens abruft, der Masaniellos Vergangenheit repräsentiert und auf der vertikalen Achse >große Fische< und reiche >Beute< verspricht. »Hier soll mein Schiff vor Anker liegen« bezeichnet schließlich nicht nur das Ende des Rezitativs, sondern auch den Umschlag der Schiffssemantik von einem - unter den Prämissen der Rede eines Wahnsinnigen - durchaus wörtlich zu nehmenden Bedeutungskomplex zu einem uneigentlich bildlichen, der das >ankernde Lebensschiff< und das Ende seiner >Fahrt< konnotiert. Die Arie führt die Schiffssemantik fort und funktionalisiert sie doppelt, nämlich sowohl als Bedeutung wörtlicher aber >wahnsinniger< Rede als auch als bildliche Bedeutung einer zugleich situationsadäquaten, >vernünftigen< Rede. Die Angst vor Schiffbruch und Ertrinken verbleibt zwar im nautischen Bildbereich, bezeichnet aber die todesnahe und gefährliche, >reale< Situation Masaniellos. Ähnliches gilt für das vom >Ungestüm< verursachte >Hin-und-Her-TreibenRasen< selbst, werden auf diese Weise in der Arie zwar nicht motiviert oder >erklärt< aber auf bildhafte Weise thematisiert. Die (uneigentliche) Schiffsbewegung bei stürmischer See (horizontal: >hin und herHimmel< appelliert und vermeintlich in die >Tiefe< fährt, also >Erlösung< und >Wahnsinn< und >Verdammnis< kontrastiert werden. Damit motiviert Masaniellos Selbstaussage zwar seinen im Rezitativ dokumentierten >Wahnsinn< nicht, überführt aber die inkohärente Rede des >Rasenden< in sinnhaft-bildliche Gleichnisrede, gewinnt der Schiffs- und Fischer-Semantik also emblematische Kohärenz ab. Masaniellos >Raserei< bleibt >unerklärtRasendenRaste< dort allerdings der >Wilde< angesichts seiner bevorstehenden Bändigung, so tötet Perrone nun Masaniello gerade wegen der tyrannischen Entartung seiner Herrschaft.31 Die (Be-)Deutungsmacht der >Gleichnisse< scheint ungebrochen und
31
Im Gegensatz zu Weises Masaniello -Trauerspiel, in dem der Rebell, wie in den historischen Quellen, immerhin von >Edelleuten< erschossen wird (V/22; SW I, S. 364); Bauer-Roesch 1997, S. 159-169 sieht darin einen »eigenen Beitrag des Librettisten zur MasagnielloHistoriographie«, da Feind durch den »Verrat innerhalb der Verschwörergruppe [...] Masagniello [...] von Grund auf [desavouiert] und [...] seinem Handeln den letzten Anschein von Legitimität [entzieht]« (S. 168, Fußnote 48), sie übersieht dabei aber, daß Perrone seinerseits vom Adel bestochen worden ist. Unstrittig ist zumindest, daß sich Inhalt und
119
manifestiert sich erneut in einer Arie, die über ihre religöse Konnotation (>Himmel< versus >TiefeRaserei< Masaniellos retrospektiv nicht >erklärtrasende< Tyrannis oder tyrannische >Raserei< legitimiert. Auch die Schiffssemantik und der mit ihr korrelierte Bereich des Fischens verbindet retro- und prospektive Blickrichtung und verklammert mittels ihrer >similitudo< die Vorgeschichte Masaniellos als Fischer mit seinem Ende als Masaniello >furiosoSchiff< vor >Anker< liegt und der nun >zur Tiefe fährtWütenden< über die Kohärenz des Schiffsgleichnisses und seine indirekte similitudo mit der Situation Masaniellos in die situationsadäquate, >vernünftige< Rede dessen zurückführt, der am Ende seinen Verrätern und Mördern gegenübersteht (»Ist dies mein Lohn? O ihr Verräter!«).32 Aus Inkohärenz mittels gleichnishafter Zusatzbedeutungen Kohärenz herzustellen und damit die sprachlichen Indizien von Masaniellos >Raserei< nicht zu tilgen, aber doch zu reduzieren, verhält sich konträr zum Verfahren Weises im Trauer-Spiel von dem Neapolitanischen Haupt-Rebellen Masaniello (1682; gedruckt in [...] Ziltauisches Theatrum [...], 1683; SW I, S. 153-373). Dieser Kontrast wird sich vor dem Hintergrund des oben angedeuteten Zusammenhanges von >conclusio< und >similitudo< als interpretierbar erweisen.
4.2. Rahmung und Verzeitlichung als semantische Strategien der Selbstreferenzunterbrechung: Zur zyklischen Kohärenz der Dramentrilogie in Christian Weisens Zittauischem Theatrum [...] (1683) Weises 1683 in »in Verlegung Johann Christoph Miethens« unter dem Titel [...] Zittauisches Theatrum [...] von Michael Hartmann gedruckter (siehe die Reproduktion von Titelblatt und Frontispiz mit der inscriptio »Der Jugend Zeitvertreib« u.a. in SW I, zwischen S. 152 und 153) und in Zittau erschienener Dramensammelband enthält nach Widmung und Vorrede (SW I, S. 599-601) drei Dramen in der Reihenfolge ihrer
32
Aufführungszeitpunkt der Oper signifikant auf die 1706 eskalierende >Rebellion< der Hamburger Bürger gegen die Ratsherrschaft beziehen lassen und als Parteinahme Feinds für den Rat und als Warnung vor Pöbelherrschaft erscheinen (Bauer-Roesch 1997, S. 169); vgl. ähnlich Marigold 1984, S. 478 und Jaacks 1997, S. 94-96. Bauer-Roesch 1997, S. 167-168 sieht in der ahnungsvollen »Untergangsvision« der »in düsterem d-moll stehenden« Arie Masaniellos (S. 168) das »letzte Aufflackern ungetrübten Bewußtseins«, ohne auf die Schiffs-Semantik und ihrer Verschiebung vom >Wahnsinn< zum >Gleichnis< einzugehen.
120
Aufführung zur Fastnacht 1682 sowie eine Zwischenbemerkung an den Geliebten Leser zwischen dem ersten und dem zweiten Drama (SW I, S. 602-603). Nach dem Ersten Lust-Spiel/Von Jacobs doppelter Heyrath am 10.2.1682 und dem Masaniello am 11.2. werden auf der Zittauer Rathausbühne am 12.2.1682 zuerst >Die beschützte Unschuld< (1674) - ein Seitenstück zur triumphierenden Keuschheit< (1668) aus der Zeit vor seinem Zittauer Rektorat - und dann in einer Parodie eines neuen Peter Sqvenzes von lautern ABSURDIS COMICIS (Titelblatt des Zittauischen Theatrums [...], 1683, SW XI, vor S. 250) das Lustige Nachspiel [...] von Tobias und der Schwalbe) gegeben.33 Die bereits 1674 veröffentlichte >Beschützte Unschuld< (siehe Fulda 1883, S. XIX-XX und Kaiser 1972, S. 149-150) ist im Zittauischen Theatrum nicht mehr abgedruckt, so daß die drei Spieltage im Februar 1682 dem Leser der 1683 publizierten und 1699 neu aufgelegten Druckfassung als eine Trilogie präsentiert werden, deren Komposition, wie zu zeigen sein wird, keineswegs nur dem Zweck dient, die zurückliegenden Aufführungen zu dokumentieren (zur Druckgeschichte SW I, S. 617-619). 4.2.1. Gleichnisse und Narren: Das Trauer-Spiel von dem Neapolitanischen Haupt-Rebellen Masaniello (1682) Wie bei Feind wird auch bei Weise der >Wahnsinn< Masaniellos nach einer Auftrittspause zwischen dem zwölften Auftritt der vierten Handlung (S. 321) und dem vierzehnten Auftritt der fünften Handlung (S. 352: »Masaniello rasend«) durch den >Rasenden< selbst abrupt dokumentiert, zuvor aber durch Aussagen anderer Figuren mehrfach angedeutet. Da »des Volckes General zum Narren wird« (V/2, S. 331) kursieren überdies Gerüchte eines Giftanschlages, der »nicht dem Hertzen das Leben / sondern dem Kopffe den Verstand nehmen sollte« (V/2, S. 332).34 Damit scheint der Ausbruch der >Raserei< nicht nur spekulativ mit einer Intrige des Vize-Königs von Neapel Rhoderigo d'Arco und rudimentär säftemedizinisch >erklärtWasserstaatsklug< und nützlich instrumentalisiert zu werden - »weil der rasende Hund in sein Verderben dahin rennet« (V/2, S. 332) und man »mit einem rasenden zu thun« habe, »der sich selbst in dem Netze verstricken soll« (V/12, S. 351). Daß »ein rasender Mensch die Freyheit hat / die gantze Stadt zu verwüsten« (V/11, S. 349) ist, wie Rhoderigo einräumt, »bißhero [...] mit ziemlicher Gedult vertragen« worden (V/12, S. 350), ist es doch als Folge der mangelnden >Klugheit< des Fürsten in Kauf zu nehmen gewesen. Da nun aber »die Narrheit eines einzigen Bubens den Fehler unserer Klugheit wieder gut« gemacht hat (ebd.), Neapel durch Masaniellos Rebellion die alten Zoll- und Steuer Privilegien Kaiser Karls V. (1/14, S. 188; III/6, S. 261) zurückerhalten hat, erweist sich >Geduld< mit der Tyrannei Masaniellos nur mehr so lange als >klugWahnsinn< selbst zu ihrem Ende und zu Masaniellos Untergang beiträgt. Die schon vorher von Donato, dem >Secretarius des ReichsRegeI< von der überbeanspruchten >Geduld< des >Volkes< (1/8, S. 178: »Und wenn ein armer Mann sechs Pfennige des Tages weniger hat / als er verzehren soll / so wird er ungeduldig l biß die Ungedult zu einer Raserey hinaus schlaget«) wiederholt nun Herzog Carlo und wendet sie zugleich auf seinen eigenen Stand an: >Raserei< bewirkt >Raserei< (V/12, S. 350: »Wir haben viel gelitten: Doch wer uns mehr Gedult abfedert / der zwinget uns zur Raserey«). Daß der >Wahnsinn< Masaniellos also mehrfach von beobachtenden, retrospektiv berichtenden Figuren kommentiert, ja spekulativ auch >erklärt< und von seinen Gegnern durchaus als sinnhaft interpretiert wird, mindert dessen Ereignishaftigkeit und domestiziert ihn von Anfang an diskursiv. So werden auch noch nach dem ersten Auftritt des manifest >rasenden< Masaniello figurenspezifische Beobachterperspektiven etabliert, die das Gesehene durch die Erzählung von bereits vergangenen Geschichten seiner >Narrheit< abstützen und deuten (vgl. V/20, S. 360: »Ach was vor eine COMOEDIE haben wir in der Kirche gehabt! Nun ist der Herr MASANIELLO gantz rasende geworden.«). In diesem Rahmen lassen sich Masaniellos >wahnsinnige< Äußerungen und Kommunikationsprobleme jedoch ab V/14 (S. 352-359) um so krasser inszenieren und syntagmatisch elaborieren - im Kontrast zu Feinds umgehender Überführung der >Raserei< in die Kohärenz eines Gleichnisses. Kommunikation wird durch lautliche Ähnlichkeiten erschwert (V/14, S. 353: Masaniello versteht »Pestilenz« statt »Excellenz«), die Unterscheidung von Alter und Ego und der eigenen hierarchischen Position ist beeinträchtigt (V/15, S. 355: »Hier sind wir als unterthänige Diener. das Sternzeichen >Wassermann< - dem Fischer (!) und Apostel Petrus zugeordnet - sowie der Mond bezeichnen dabei den Phlegmatiker und seine >lunarekaltefeuchte< und >wässerige< Natur, die noch Leutmann 21724 als »gutartig / langsam / einfältig / schwach an Kräften des Leibes und Gemüthes / barmherzig / niederträchtig / furchtsam / traurig / nicht allzu reinlich« beschreibt (S. 14; zur »planetarischen Eintheilung« siehe ebd., S. 12-14). Die pseudo-medizinischen Spekulationen von Anaclerio und Leonisse scheinen Masaniello somit als >geborenen< Phlegmatiker zu diagnostizieren, der >blutig< entartet und am Ende damit bestraft wird, das vergossene Blut zeichenhaft (>Rotwein< und >Giftsanguinisch< vergiftet wird. - Die Parallele zu Petrus dem Fischer und Apostel zieht Anaclerio übrigens schon in 1/2, S. 165.
122
MASANIELLO. Wem bin ich unterthänig?«; ähnlich V/18, S. 359), Masaniello hebt eigene Anordnungen auf (V/16, S. 356) und widerspricht sich selbst (V/15, S. 355), manipuliert die soziale Hierarchie durch die Ernennung des Trommlers zum Fürsten (V/15, S. 355), »schlaget närrisch« selbst die Trommel (V/14, S. 354), hält sich für den Papst (V/16, S. 356) und fordert den Viz-König auf, sich >hencken< zu lassen (V/14, S. 353), um am Ende aus der Rolle als >Oberster< zu fallen und sich von seinem Amt zu distanzieren (V/19, S. 359: »Ich habe nichts mit dem Ampte zu schaffen / der Vice-Roy ist euer Herr«). Aus >Wahnsinn< scheint punktuell >Vernunft< hervorzudämmern, die allerdings von der Klimax seines >Rasens< gefolgt wird (ebd.). Erst die Festsetzung Masaniellos durch Angehörige seiner eigenen Truppe und die >wohltätige Verwahrung< des verdienten >Kranken< in einem Kloster (V/19, S. 360, V/21, S. 361) befreien ihn von seiner Rolle als Befehlshaber und Herrscher über die Stadt und lassen ihn als geheilt erscheinen (V/21, S. 361: »ich bin gantz vernünfftig worden«). Auch im Moment des Sterbens scheint ihn - wie bei Feind - der wiedergewonnene klare Verstand gegenüber seinen adeligen Mördern nicht zu verlassen (V/22, S. 364: »O ihr Verräther und Undanckbaren Leute!«)!1 Während bei Feind Masaniellos Wahnsinn als letzte Extremfolge einer zu lange geübten Affektdisziplinierung (>Geduldunklugen< Regiments und nachträglich >kluger< geduldiger Intervention. Der latente Widerspruch in Feinds Libretto, daß der Bandit Perrone nicht nur zum Sprachrohr der Affektregel, sondern auch noch als bestochener Verräter zum Instrument des Adels wird, damit aber zugleich ein Geschehen vollendet, das höherer, gleichnishaft überhöhter Providenz gehorcht, mildert sich bei Weise ab und wird zur >Klugheit< lernfähiger Herrschender moderiert.36 Zwischen die göttliche Providenz und den eigennützigen Verbrecher Perrone, der als ihr unentbehrlicher Erfüllungsgehilfe zunächst Masaniello, dann dem Adel dient und so zum Werkzeug ausgleichender Gerechtigkeit und Affektbalance wird, siedelt Weise die >Klugheit< der Herrschenden selbst an. Der Vize-König, seine Beamten, Kardinal Philomarini
36
Daß sich bei Feind Perrone im Rahmen der beigefügten adelsinternen Liebesintrige bestechen läßt und nur so gegen Masaniello eingenommen wird (Feind 1706, 11/13, Nr.78, S. 193), führt einmal mehr die Absenz vorausschauender >Klugheit< vor Augen, die die Handelnden im Masagniello furioso an den Tag legen: Sie folgen ihren >privatpolitischen< Interessen, eine für das Gemeinwohl >kluge< Lösung des Konfliktes ergibt sich daraus wie von selbst, d.h. durch - ersatzweise und indirekt angedeutet - höhere Fügung (vgl. den gefangenen Don Antonio, der genau darüber mit dem »Verhängnis sonder Recht« [11/12, Nr.75, S. 180], mit dem »Himmel« und den »Sternen« hadert und die Rolle Perrones als »Missetäter, [...] Bösewicht, Bandit, Verräter« beklagt, S. 181-182). Die zu Anfang in einer Arie des Duca d'Arcos geäußerte >Klugheit< bleibt jedenfalls ebenso apodiktisch (1/2, Nr.8, S. 45-46: »Gesetze sind des Volkes Seele, [...]. Ein Kluger sinnet auf Befehle, die Freiheit und den bösen Willen des Volks zu mäßigen und zu stillen«), wie Aloysias affektive (stoische) Selbstgesetzgebung (II/7, Nr.62, S. 158: »ich will mir ein Gesetze geben«).
123
und die Mehrheit der Aristokratie verstehen es, die erkannten Zusammenhänge zwischen >Geduld< und Affektausbruch in >kluges< Handeln umzusetzen, also Dauer und Ende der eigenen >Geduld< mit Masaniellos Rebellion und >Raserei< selbst zu bestimmen und sich nicht dem eigenen, natürlichen aber unkalkulierbaren Affekthaushalt zu überlassen. Die Diskussion zwischen den >Edelleuten< Angelo und Laudato, die später zu den Mördern Masaniellos gehören werden, verdeutlicht weitere Unterschiede zu Feind: ANGELO. Wer kan davor / wenn VESUVIUS mit seine Flammen ein Adeliches Schloß verderbet hat? Wer kan uns [...] beschuldigen / wenn die Flamme des allgemeinen Auffstandes unser Glücke ziemlich versengen soll? LAUDATO. Es ist ein schlechter Trost; der VESUVIUS kan durch Menschliche Gewalt nicht eingeschlossen werden: Doch ein Auffstand solle billich durch unsere Klugheit seyn hintertrieben worden. [...] unser Hochmuth bringet uns in das Unglück. (IV/6, S. 305)
Adelige Selbstdiagnose (»unser Hochmuth«) in der Konversation und die Destruktion einer >similitudotrostreich< erkannt wird, ist bei Feind später der monologisch selbstsicheren Fremddiagnose durch den >machiavellistischen< Räuber gewichen. Die in beiden Texten am Exempel Masaniellos formulierte >Regel< von der überbeanspruchten >Geduld< behält zwar ihre Gültigkeit, die Folgerungen, die aus ihr jeweils gezogen werden, unterscheiden sich jedoch. Während bei Feind Perrone diese >Regel< sowohl in ihrer eigentlichen als auch in ihrer uneigentlich-gleichnishaften Fassung (Gleichnis vom >Löwenklugen< Selbsterkenntnis. Darüber hinaus unterscheidet sich der Stellenwert der Gleichnisrede: Daß diese bei Feind ihre argumentative Funktion behält, verdankt sich dabei nur vordergründig ihrer vermeintlich größeren Angemessenheit. Perrones Löwengleichnis besetzt zwar wie der Vulkanausbruch das semantische Feld von der (natürlichen) >Eruption< und ihrer >UnterdrückungLöwen< doch weniger vergeblich an, als sie es im Falle des Vesuvs sein müßten. Vergleich und Verglichenes stehen sich offenbar im Gleichnis vom wütenden Löwen< semantisch näher - Masaniello und der >beherzte Leu< treffen sich im Affekt des >Zorns< - als im Falle des unbelebten, selbst affektfreien Vulkans. Ein Vergleich der Gleichnisse zeigt jedoch, daß beide je unterschiedliche Größen in Verbindung setzen, ihre semantischen Strukturen also doch minimal aber signifikant differieren. Weises (bzw. Angelos) Bild vom Vulkanausbruch steht nämlich nicht für die individuellen Affektzustände vieler Einzelner, v.a. aber Masaniellos, die mit einem synekdochisch wütenden Löwen verglichen werden können, sondern für die Gewalt des allgemeinen Aufstandest Angelo vergleicht also ein gesellschaftliches mit einem natürlichen Ereignis, deren gemeinsames tertium comparationis in der Gewalt der >Eruption< selbst liegt, während Feind (bzw. sein Perrone) Mensch und Tier mittels des tertium comparationis eines gemeinsamen Affektes vergleicht.
124
Masaniello ist als singulärer Held, was Perrones erfolgreicher Mordanschlag aber auch sein Tod bei Weise belegen, wie der >beherzte< aber wütende >Löwe< besiegbar, nicht aber die >Raserei< seiner Affekte. Angesichts dessen erscheint Angelos Bild durchaus als angemessen und eine hinreichende Ähnlichkeit zwischen Vergleich und Verglichenem gesichert. Als plausibles tertium comparationis von >Vulkanausbruch< und allgemeinem Aufstand< fungieren die in beiden Fällen unkontrollierbaren und anonymen (physikalischen bzw. affektiven) Bewegungsenergien.37 Wie Laudato selbst einräumt, scheint auch der standesspezifische Affekt der >Hochmut< nicht nur destruktiv, sondern offenkundig auch unbezähmbar zu sein. Damit wird nun aber deutlich, daß Laudato den uneigentlichen Signifikanten >Vulkanausbruch< und seine primären Signifikate nicht wegen eines vermeintlich inadäquaten tertium comparationis zurückweist, sondern sich vielmehr gegen Angelos argumentativen Gebrauch des Vergleiches verwahrt, mit dem dieser die Wehrlosigkeit und Passivität des Adels rechtfertigt. Zwar transportiert die Vulkan-Semantik durchaus auch Merkmale, mit denen sich das Versagen jeglicher >Klugheit< gegenüber einem Volksaufstand belegen läßt, diese Merkmale sollten jedoch - so die implizite Logik von Laudatos Reaktion - nicht zu einem sinnvollen tertium comparationis zwischen >Vulkan< und >VolkAusbruch< und >Aufstand< gezählt werden. Wie weitreichend oder restriktiv dem semantischen Bereich >Natur< also eine Vergleichsfunktion für gesellschaftliche Vorgänge zuzubilligen ist, bleibt unausgesprochen strittig, die Anteile von >similitudo< und Differenz wären erst noch zu bestimmen. Klärung wird ein Vergleich mit dem Gleichnis für >Klugheit< erbringen, das der >Nachredner< als privilegierte Sprechinstanz am Ende des Spiels verwendet. Zunächst bleibt festzuhalten: >Klugheit< kann, so Laudato, zwar nicht den >VulkanausbruchLöwen< bei Feind nicht in Zweifel gezogen wird und sich am Ende bestätigt, bestätigt sich das Gleichnis in seiner argumentativen Akzentuierung durch Angelo gerade nicht, wird aber auch nicht zur Gänze widerlegt. Am Ende gehört jedenfalls Angelo ebenso wie Laudato zu den vier Attentätern, die »alle Vier zu gleich Feuer [geben]« (V/22, S. 364) und den durch seine Umnachtung geschwächten Führer des Aufstandes töten.
37
Als emblematische pictura scheint der >Vulkan< eher selten mißlingende Affektdämpfung zu bezeichnen; Henkel/Schöne 1996. Sp. 63f. zitieren aber die inscriptio »retinere nequeo« zur Abbildung des »feuerspeienden Ätna« aus dem Emblembuch von Juan de Boria (1581), deren subscriptio betont, »wie schwer es sey / daß Feuer / daß einer in sich heget / es sey [...] eine Bewegung des Gemiithes und der Begierden / [...] zuverbergen« (Sp. 64). - Das Paradigma >Vulkan< / >Feuer< / >Dampf< ist zwar auch bei Feind mehrfach besetzt (z.B. in der Beschreibung des »Schauplatzes« im Nebentext zum 12. Auftritt der zweiten Handlung, S. 180: »brennender Vesuv«), scheint aber argumentativ kaum funktionalisiert zu sein oder sich mit anderen Bildbereichen zu verbinden (vgl. erster Auftritt, erste Handlung, S. 37f.: »Ein hoher Geist gleicht der Rakete, [...], die strahlend in die Lüfte steigt, und uns nach ihrem Knalle zeigt, daß nur ihr Wesen Dampf gewest, [...]«).
125
>Kluger< Einspruch gegen Gleichnisrede scheint bei Weise, auch das führt die Diskussion zwischen Angelo und Laudato vor Augen, die nützlichere Verfahrensweise zu sein und ist der Selbstbestätigung des im Bereich der Natur von Mensch und Tier verbleibenden Gleichnisses bei Feind überlegen. >Klugheit< beweist sich darin, nicht auf Gleichnisse und ihre Ähnlichkeitspostulate zu verzichten, sondern die ihnen zugrunde liegenden Differenzen herauszuarbeiten und epistemisch zu nutzen. Festzuhalten ist für Weises Masaniello ferner, daß die (hier zunächst versagende) providentielle >Klugheit< - zu der allerdings das Trauerspiel selbst indirekt und >exemplarisch< anzuleiten beansprucht, da »der Masaniello in seinem LebensLauffe zwar einen unglückseligen Ausgang / gleichwohl aber dieses Schau-Spiel ein glückseliges Ende gewonnen habe« (Nachredner, S. 373) - mit den Grenzen der >Geduld< und drohenden Affektausbrüchen zu rechnen hat und lernt, sie in ihr Kalkül einzubeziehen. Nicht nur Masaniellos Rebellion, sondern auch seine spätere >Raserei< erfüllen so eine vernünftige Funktion innerhalb der »Göttlichen Providentz« (Nachredner, S. 372), als deren >letztes< Instrument sich jedoch am Ende offenkundig die »Politische Klugheit« (ebd.) der Herrschenden und nicht der >Machiavellismus< eines verbrecherischen Banditenführers erweist:38 Ein Tumult ist leicht angefangen / allein am Ende siehet man wie sich die Thorheit in ihrem Netze verwickelt; sonderlich da [...] ein hocherleuchteter ViCE-Rov, ein hochvernünfftiger Ertz-Bischoff / [...] mitten in dem Sturmwinde bezeugen / daß ihre Politische Klugheit nicht auf einer Eiche / sondern auffeiner Weide gewachsen sey: Ich will sagen: Wenn das Eichen-Holtz von der grausamen Lufft zerschmettert wird/so bücket sich die Weide / biß ein stilles Wetter die sämtlichen Zweige von sich selber wiederum aufrichtet. Wiewohl ich komme nicht hieher / dasjenige weitläufftig auszuführen /welches meine Hochgeneigte Zuschauer besser bey sich erwegen können / und welches unsern Gedancken / wils GOtt / bey heranwachsenden Alter mehr Gelegenheit zum Nachsinnen überlassen möchte. (Nachredner, S. 372-373)
38
Wobei sich natürlich an der Berechtigung der kritischen Einschätzung von Titzmann 1991a, S. 81 anläßlich des Bäurischen Machiavellus (1679) und des Masaniello nichts ändert: »Weise bekämpft offiziell den >Machiavellismus< [...] und seine Figuren praktizieren ihn inoffiziell unter dem Namen der politischen Klugheitgöttlichen Providenz< bleiben bei Weise (neben Masaniello) v.a. ein >klug< handelnder Fürst, >kluger< Klerus und Adel (vgl. Krämer 1994, S. 256-257). Daß allerdings , wie Beise 1997a, S. 197 meint, Masaniello und andere historische Trauerspiele Weises, z.B. Der Fall des Französischen Marschalls von Biron (1687), als »untragische Trauerspiele [...] die Ideologie der Aufklärung [transportieren]«, weil in ihnen im Sinne derTheodizee und im Unterschied zum bürgerlichen Trauerspiel »nur die Bösen und Dummen scheitern« (ebd.), vereinfacht die Textbefunde doch arg: Weder ist Masaniello nur >böse< und >dumm< und gescheitert, noch sind seine Gegner >gut< und nur erfolgreich oder der Ausgang der Handlung, abgesehen von der Bewertung des >NachrednersuntragischNachsinnen< über das Gleichnis des >Nachrednerskluger< Vorbeugung oder gar Gegenmaßnahme gegen den allgemeinen Aufstand< zu entschuldigen versucht wird. Außerdem nimmt der >Nachredner< damit nur das - für den Fortgang der Ereignisse hoch relevante - Gleichnis auf, das Kardinal Philomarini schon in der zweiten Handlung gegenüber den Herzögen von Caracciolo, den Brüdern Carlo und Ferrante, einsetzt, um dem Adel ein vorübergehendes Einlenken nahezulegen (II/6, S. 227), und dessen Semantik sich in der ersten Handlung vorbereitet, als Philomarini dem zögernden Vize-König Rhoderigo den von den Aufständischen geforderten Zollablaß abtrotzt (1/17, S. 197). Das Gleichnis >rahmt< somit durch seine syntagmatische Streuung nicht nur das Vulkan-Gleichnis, sondern durchläuft selbst auch eine lineare Entwicklung von seiner Genese in 1/17 über seine erste argumentativ erfolgreiche Entfaltung bis zur resümierenden Wiederholung und nochmaligen Veränderung in der Nachrede, deren hierarchisch hochrangige, ex post bewertende Sprechinstanz damit zugleich die Position Philomarinis favorisiert und legitimiert. Zunächst knüpft Philomarini nur an des Vize-Königs Satz »Es thut weh / man soll nachgeben« (1/17, S. 197) mit der Formulierung »sich wieder auffrichten« (ebd.) an und hat damit - zusammen mit der Verzeitlichung des Problems durch das Argument des Wechsel (»Nachgeben hat seine Zeit. Vielleicht erleben wir die Zeit / da man sich wieder auffrichten kann«, ebd.) - bereits den Kern eines tertium comparationis mit dem späteren Bild vom Baum im Sturm gefunden. Danach elaboriert er das Bild gegenüber dem Hochadel, dem das Entgegenkommen des Vize-Königs besonders schwer zu insinuieren ist, und fügt die Wetter-Semantik (»Sturm-Wind«, II/6, S. 227) hinzu: Der Adel solle sich zeitweise >bückenSturm< wieder >aufzurichtenSturmes< »sonderlich wohl gefallen« hat (ebd.), baut es sodann zu einem Vergleich mit dem sich »vor dem Winde« bückenden >Gras< weiter aus. Erst in der sich anschließenden Diskussion über die von Ferrante bestrittene Angemessenheit dieses Vergleiches (»Unser Vice-Roy darff aber mit keinem so geringen Gewächse verglichen werden«, ebd.) führt Carlo die maximal konträre Opposition >Gras versus harter Eichbaum< ein. Angesichts der im Sturme >zerbrechenden< Eiche bleibt vorerst nur die (temporäre) Flexibilität des >GrasesNachredner< gelingt die Lösung auch dieses semantischen decorum-Problems, indem er das Gleichnis weiter verändert, ihm ex post seine definitive Gestalt verleiht und die Opposition zwischen >Eiche< und >Gras< abschwächt. Er verlagert sie rekursiv in das semantische Paradigma >Baum< hinein und besetzt sie lexikalisch mit >Eiche
affekttheoretischen Hintergrund der zeitgenössischen Opernpoetologie mißdeutet. Thiel übersieht einerseits, daß es Schultheater und Musiktheater am Ende des 17. Jahrhunderts mit gemeinsamen affektrhetorischen Problemimplikationen zu tun haben, und leitet zugleich aus den Unterschieden Werturteile ab, so etwa wenn er die niedrige Figurenzahl des Librettos gegenüber Weises Drama als »revolutionary] Innovation« ausgibt (S. 265, Fußnote 63); kritisch zu Thiel äußert sich auch schon Krämer 1994, S. 244, Fußnote 12.
127
versus WeideBaumGrases< und der gefährlich >unklugen< Starre der >Eiche< positioniert - das scheint die gültige Formel zu sein. Diese Gleichnisformel, insbesondere das Bild der >WeideVulkanausbruch< durch >SturmwindSturmwind< vermag »durch Menschliche Gewalt nicht eingeschlossen werden« (Laudato, S. 305), beide Naturereignisse scheinen als einzige Reaktion nur passives Abwarten ihres jeweils von selbst eintretenden Endes (»stilles Wetter«, S. 372) nahezulegen. Das erst vom >Nachredner< eingeführte Bild der >Weide< vermittelt jedoch nicht nur den Deutungshorizont für beide Gleichnisse, sondern löst auch den Widerspruch auf, der ansonsten zwischen >kluger< Passivität und der am Ende erfolgten aktiven Gegenwehr entstünde. Als >klug< wird ein Verhalten definiert, das sich zwar zunächst in das Unabänderliche fügt, also auf aussichtslose Gegenwehr verzichtet, aber gleichwohl den Schaden aktiv zu begrenzen trachtet und providentiell das Ende der Gewalt kalkuliert. Das Verhalten der >Eiche< ist somit im übertragenen Sinn doppelt lesbar, nämlich einmal als inadäquater Widerstand - zuviel Aktivität - und einmal als starre Passivität - zuwenig Aktivität. Plädiert wird demgegenüber für ein >kluges< Verhalten, das einen dritten Weg aktiv beschreitet und wie die >Weide< von vornherein oder zumindest bei der ersten Attacke dem >Sturm< ausweicht, »biß ein stilles Wetter die sämtlichen Zweige von sich selber wiederum aufrichtet« (S. 372). Nicht die zwischen Angelo und Laudato verhandelte Alternative aus vollständiger Passivität und heroischer, tragisch endender Aktivität - beide münden, wie das ambige Beispiel der >Eiche< und das Schicksal Masaniellos demonstrieren, in >Zerschmetterung< - , sondern ein zum je richtigen Zeitpunkt angemessen ausbalanciertes Verhältnis von Aktivität und Passivität, von Abwehr und Entgegenkommen, von >Sich-Aufrichten< und >Sich-Bücken< zieht die richtige >Lehre< aus Philomarinis Providenz (»Nachgeben hat seine Zeit«, S. 197) und dem Beispiel des Masaniello.39 Aktives Ausweichen ist allemal die aussichtsreichste Reaktion sowohl gegenüber Vulkanausbrüchen als auch Stürmen. >Klug< ist es demnach gewesen, den Forderungen der Rebellen nach Wiederherstellung des alten privilegierenden Rechtszustandes nachzukommen und damit zugleich den Fehler mangelnder >Staatsklugheit< zu beheben.40 >Klug< ist es aber auch, den Zeitpunkt
39
40
Die Balance manifestiert sich auch in der sprachlichen Feinstruktur: Das fremdbestimmte, unnatürliche >Gebückt-werden< der >Weide< wird als Aktivität beschrieben, die natürliche, intrinsisch motivierte Aktivität - die >Weide< richtet ihre >Zweige< wieder auf - als außengeleiteter passiver Vorgang; zur >Ambivalenz< des Bildes vgl. andeutungsweise Luserke 2000, S. 171, Fußnote 35. Titzmann 1997 erblickt darin (nicht nur anläßlich des Masaniello) eine veränderte Bewertung - Aufwertung - der >Verstellung< (S. 549-553) und deutet »ihre Legitimierung« generell als »Indikator einer tiefen Krise des barocken ideologischen Systems, von der
128
nicht zu verpassen, an welchem die Rebellion den Herrschenden das Mittel bereitstellt, die sie zur Beendigung des Aufruhrs und der Gewaltherrschaft benötigen. Da dieses Mittel in der >Raserei< Masaniellos zu erblicken ist, wird ihr Ausbruch innerhalb des Gleichnisses von >Eiche< und >Weide< durch den Umschlag vom >Sturm< zum >stillen Wetter< markiert, also vom allgemeinen Aufstand< zur pathologischen Selbstausgrenzung seines Anführers, dessen >Narrheit< aus der Sicht des >Politicus< höchst >vernünftige< Folgen zeitigt. Der Mordanschlag des neapolitanischen Adels gegen Masaniello vollendet das Begonnene und »richtet« - um im Bild zu bleiben - »die sämtlichen Zweige von sich selber wiederum auf«. Der epistemische Wert von Gleichnis und Bildlichkeit liegt in Weises Masaniello nicht in einer starr vorausgesetzten Ähnlichkeit zweier semantischer Bereiche, deren Vergleichbarkeit sich am Ende bestätigt, sondern in der Unterbrechung ihrer Selbstbezüglichkeit und in der Bestimmung der Anteile von Ähnlichkeit und Differenz, deren Proportion über das jeweilige tertium comparationis und damit auch über die Angemessenheit des Gleichnisses entscheidet. Ähnlichkeit wird im Spiel der Differenzen disponibel, nicht entbehrlich, aber doch eingeschränkt und vermag ihre Bedeutungskonstitution nur mehr explizit differentiell abzusichern. Wie auch die opernpoetologische Verknüpfung von >Scharfsinn< und >Gleichnis< anläßlich der >Erklärungsfunktion< der Arie nahelegt, realisieren sich semantische Verschiebungen im Verhältnis von Differenz und Ähnlichkeit nur sukzessive und werden, gestützt von der Syntagmatik der Texte - hier mittels zweier aufeinander bezogener Gleichnisse für >kluges< bzw. >unkluges< Handeln - in Gang gesetzt. Die ihrerseits auf ihre semantischen Ähnlichkeiten und Unterschiede hin zu befragenden und dezidiert auf >Klugheit< bezogenen Gleichnisse im Masaniello legen jedenfalls ein (textintern) retrospektives >Nachsinnen< über ihre Beziehungen zum (>realenExempels< nahe. Was sich zeitlich zwischen der Genese des Sturm-Baum-Gleichnisses und dessen >Vollendung< in der Nachrede ereignet, beeinflußt nicht nur die Deutung dieses und auch des Vulkan-Gleichnisses, sondern die Ereignisse selbst verdanken sich wesentlich der rhetorischen Effizienz von Philomarinis Gleichnis-Einsatz. Die Verschiebung der Bildlichkeit erscheint im linearen Fortgang als sukzessiver Deutungsfortschritt (vom >Sich-Bücken< über den >Sturm-WindGras< und den zwischengeschalteten >Vulkanausbruch< bis zur >WeideKlugheit< feiert.41 Die Anpassung und Weiterentwicklung
41
sich dieses auch nicht mehr erholen wird« (S. 552), ohne allerdings den damit korrelierten Aspekt der Verzeitlichung der >Innen-AußenVerstellung< im 17. Jahrhundert siehe ansonsten ausführlich Geitner 1992, S. 10-80 und S. 107-124. Daß Weise »die Allegorie nur auf sehr kompliziertem Weg als didaktisches Element [nutzt]« und »allegorische Szenen [nicht an sich schon] eine lehrhafte Aussage [haben]«, sondern diese »erst in Verbindung mit realistischer Dramenhandlung [erlangen]«, sieht auch Zeller 1980, S. 223, anläßlich der rahmenden Gerichtsszenen im Bäurischen Machiavellus (1679) und im Politischen Quacksalber (1684) sowie des allegorischen Vorspiels im Gestürzten Markgraffvon Ancre (1679), das dem Zuschauer die aus dem Stück zu ziehenden Lehren in Frageform vermittelt (S. 211-223, hier S. 214). Eine genauere Analyse dieser Verfahren
129
der von den Figuren verwendeten Bildsemantik hält nicht nur mit den sozialen und politischen Ereignissen Schritt und bestimmt deren Deutung, sondern sie beeinflußt auch den Gang dieser Ereignisse mit. Worin die zirkuläre >ErklärungsDeutung< und >Erklärung< dessen legitim heranziehen kann, was u.a. mit Hilfe genau dieses Gleichnisses a priori erst verursacht worden ist. Auf diese Weise - als >kluge< rhetorische >petitio principii< und in der Zeit entfaltet bzw. syntagmatisch distanziert - bewährt sich das Gleichnis an der >Realität< und die >Realität< bestätigt die gleichnishafte >Regek Mindestens eine weitere Variante der Struktur und Funktion von Bildlichkeit im Masaniello erweist sich jedoch als signifikant und ordnet sich zudem in die komplexen Rahmungsstrukturen des Textes ein. Die aus einer durch zwei >Tenoristen< ersetzten Vorrede (»Anstatt des Vorredners kommen zwey Tenoristen«, S. 159-161) und dem einzelnen Nachredner (S. 371-373) bestehende Rahmung unterbricht ihre Symmetrie durch Differenz (»Anstatt«) und umschließt ferner nicht nur die interne Einrahmung von Masaniellos Ende durch die beiden oben analysierten Gleichnisse, deren zweites schon der abschließenden Nachrede angehört, sondern auch eine vorgezogene interne >Nachrede< des Narren Allegro, »des Vice-Roy kurtzweiligen Dieners« (S. 157) und »Pickelherings« (S. 265), dessen Auftritte sich im letzten Drittel des Trauerspiels häufen. Als >kluger< Narr erweist er sich als Kontrafaktur des >NachrednersKlugheit< zu erziehen (ebd.). Schon früh wird er auch als »rasend« wahrgenommen (ebd.), was ihn paradigmatisch zwar dem >wahnsinnigen< Masaniello annähert, ihn damit aber um so mehr gegen diesen - den >einfältigen Narren< - profiliert (Kaiser 1972, S. 151). Er schließt nicht nur die Binnenhandlung mit dem letzten Sprechakt unmittelbar vor dem Nachredner ab (»Der Koch hat angericht / ihr Herren komt zum Essen«, S. 371), sondern hat in zwei ihrerseits >rahmendenvernünftigen< Todes, wie sie später Feind vornimmt. Statt Kohärenz zelebriert Allegros Auftritt Fragmentierung und setzt den Kohärenzverlust, der zuvor Masaniellos Reden kennzeichnet, auf unmittelbare körperliche Weise fort, >verkörpert< gleichsam die Aufsplitterung der mit Masaniello verknüpften Bedeutung. Allegro macht synekdochische Beute nach Masaniellos Tod und partizipiert am Handel mit den Körperteilen des zerstückelten Masaniello: ALLEGRO. (Trägt ein Stücke von einem Fusse.) Ha ihr Leute / hab ich nicht einen guten Fisch-Fang gethan? [...]. [...] / denn da die Leute nur hörten / daß etliche den [...] MASANIELLO wollen todt machen / so bestalten sie schon gewisse Leute / die ihn
über ihre Funktion im Rahmen einer >didaktischen Dramaturgie< (S. 210) hinaus unterbleibt jedoch.
130
sollen in Stücken zureissen / damit sie auch eine RELIQUIC zum Gedächtnis aufheben könten. [...] / so war ich der erste / und hielt ihm bey dem Beine so feste / daß mir ein ziemlich Stücke in der Hand geblieben ist. Was meint ihr nun / [...] / und wieviel Ducaten ich vor ein klein bißgen werde fodern mögen? [...] / wo mir der Handel gut von statten gehet / so erschlag ich ein paar Bauern / und verkauffe ihr zerhacktes alles vor solches Fleisch. [...] / drum wird ich wohl einen Marckt suchen müssen / da man dergleichen besser zu bezahlen pfleget. (V/23, S. 365).
Auf beinahe entropische Weise löst sich Masaniello sukzessive auf, ist zunächst noch rudimentär präsent und zugleich semiotisch in die Summe seiner >Reliquien< vervielfältigt, bevor sein Symbolwert in monetären Tauschwert konvertiert wird und seine Reste auf dem >Markt< zirkulieren.42 Masaniellos Wirkung reicht so noch über den physischen Tod hinaus und scheint in eine Art sukzessiv reduzierte Restpräsenz zu münden (»zum Gedächtnis«). Allegro denkt außerdem daran, durch >gefälschte< - in der Fragmentierung dann wieder >ähnliche< - Stücke die Wertschöpfung noch zu steigern, folgt also ökonomischer Rationalität. Allegro bietet damit auf vermeintlich närrische Weise eine ökonomische Kontrafaktur zur politischen Klugheit/, wie sie in der Nachrede favorisiert wird.43 Ein größerer Gegensatz zur Stillstellung der >rasenden< Kohärenz- und Normbrüche Masaniellos in der >similitudo< eines Gleichnisses der göttlichen Providenz (wie bei Feind) ist kaum denkbar: Die Basis des Vergleichs, nämlich Masaniello, immerhin zunächst ein Katalysator >klugen< politischen Wandels, wird zerstückelt, sein - nun nicht mehr auf Ähnlichkeit mit der Vergleichsgröße beruhender - synekdochischer Zeichenwert multipliziert, auf zirkulierende >Reliquien< verteilt und als monetär verrechenbarer >Marktwert< konserviert. Allegros >närrische< ökonomische >Vernunft< desavouiert sich zwar selbst durch den phantasierten und monströsen Handel mit den >Reliquien< des verehrten und gefürchteten Volkshelden und kann als satirischer Kommentar zur »Geld-Sucht« gelesen werden. Als solcher bleibt sein Monolog jedoch ähnlich ambivalent wie später auch noch Feinds Satire vom Lobe der Geld-Sucht (1709) deren >Lob< der >Sucht< als Kritik am Affekt indirekt durchaus die vernünftigen Wirkungen von Geldwirtschaft anerkennt.44
42
43
44
Dieser von Allegro heraufbeschworene Reliquienhandel macht den erschossenen Masaniello jedoch gerade nicht zur >guten< Variante des >Märtyrers< (wie Beise 1997a, S. 192 meint), der mit dem Kopf seines enthaupteten >bösen< Antagonisten Caraffa (HI/18, S. 283) Zwiesprache gehalten hat (ebd., S. 284f.). Niefanger 2000, S. 157-158 sieht in Allegros ironisch >heilsgeschichtlicher< Distribution der Körperteil->Reliquien< Masaniellos das Komplement einer >höfischen Historiographie^ die die Geschichte des Rebellen »aus Gründen der Staatsraison ausgrenzen« muß (S. 158). Die Funktion und ambivalente Bewertung von >Geld< im Masaniello wäre einer eingehenden Untersuchung wert, zumal die Dramen-histoire ebenso wie das historische Vorbild des neapolitanischen Aufstandes von 1647 unter Führung von Tommaso Aniello ihren Ausgang in der Forderung nimmt, die alten Zoll- und Steuerprivilegien Karls V. wieder herzustellen (vgl. dazu Allegro, 1/4, S. 170). Masaniellos verschwenderischer und >närrischer< Umgang mit den >Ducaten< (IV/16, S. 327-329) belegt dagegen dessen getrübten Verstand und steht im Gegensatz zu früherem Verhalten (11/10, S. 234). Die Metaphorik
131
Darüber hinaus erweist sich die Position, die Allegro in diesem letzten Monolog zum Problem der Tilgung, Fragmentierung und Vervielfäligung von Bedeutungsträgern einnimmt, als Gegenpol zu dem, was er in seinem ersten Einzelauftritt thematisiert und vorführt: Wieder geht es um das Problem der Vervielfältigung - aber unter inversen Vorzeichen. Anstatt eine schon zu Lebzeiten nicht mehr sinnvoll agierende und zusammenhängend redende Figur aufzuspalten und ihren Zeichenwert ökonomisch zu definieren, findet nun die naturhafte Reproduktion einer sozialen Rolle statt, >Geld< wird durch >Samen< ersetzt. Allegro leidet angesichts des Zerfalls der Ständegesellschaft in soziale Gruppen - »die Bürger machen ein Regiment zusammen / die Weiber haben ihre COMPAGNIEN, die Bauren führen ihre SVADRONEN auff: ja die Kinder marchiren in ihrer Ordnung daher« (1/21, S. 207) - unter seiner solitären sozialen Rolle, innerhalb derer er nicht mehrere Funktionsrollen zugleich besetzen kann: »Nun bin ich der Narr allein l und muß in meinem Regiment zu Fusse / Obrister / Rittmeister / Cornet / Corporal / Mußquetirer / Drummelschläger und Profoß zugleiche seyn« (S. 207-208). Er löst das Problem durch einen »Samen von einem Kraute / das heist [...] Narren-Kraut« (ebd.), den er auf dem Feld in der Hoffnung aussät, daß »da junge Narren wollten aufgehn« (ebd.): (Er säet und singet.)
Ich streue meinen Samen aus / Viel Glücks zu dieser Müh! Jhr jungen Narren komt heraus / In meine Compagnie. Nun es ist gewagt: [...]. (Hier kucken allenthalben kleine Narren aus dem Boden herfür / und weil Allegro redet / so kommen sie allmählig in die Höhe.) Ach wie lange wird mir doch das Warten\ (S. 208-209).
Der Auftritt der >kleinen Narren< bleibt auf diese Szene und vier weitere (II/2, S. 214; II/3, S. 217; II/5, S. 223; HI/19, S. 289) beschränkt; sie belasten - und verlängern - durch ihre Existenz den weiteren Handlungsfortgang kaum - Allegros anfängliche Ungeduld deutet bereits darauf hin - und wo sie es doch zu tun drohen, gelingt es Allegro, sie wegzusperren (HI/19, S. 289). Die Unterbrechung durch Allegro verdeutlicht am närrisch gleichnishaften Exempel den Zusammenhang von sozialer Funktionsteilung und den Möglichkeiten, auf sie zu reagieren: Mehrere Rollen gleichzeitig zu spielen, scheint unmöglich, sie nacheinander wahrzunehmen, kostet Zeit und des räuberischen Beutezuges und >Fisch-Fanges< - V/23, S. 365 bezüglich Masaniellos >FußGoldstücke< - verbindet darüber hinaus unterschiedliche Tauschobjekte. >Geld< ist überhaupt eines der rekurrenten Themen von Weises Dramen, vgl. etwa auch Das Lust-Spiel von der Verkehrten Welt (1683), SW XII/1, 1/4, S. 21-22. Als perspektivenreich erweisen sich anläßlich von Gryphius< >Horribilicribrifax< und Weises Komödie Vom Verfolgten Lateiner (1696) die Thesen von Fulda 2000 zum Zusammenhang von >Tausch< und >TäuschungNarren< einzusetzen, erhöhte den Zeitbedarf noch spürbar, da die >Compagnie< ja nicht nur, wie in dieser Szene, synchron und nonverbal, d.h. nicht individuiert agieren kann (>tanzenspringenTeilung kopierten Funktion zerstört. Metaphorisch auf den >politischen Körper< (sensu Frühsorge 1974) übertragen, bedeutet dies, ohne die Analogie überbeanspruchen zu wollen, daß die der Ständegesellschaft inhärente Aufgabenteilung aufgehoben ist und von jedem Mitglied jeden Standes potentiell jede Funktion bzw. genauer: von allen dieselbe Funktion in einer entdifferenzierten Gesellschaft erfüllt werden könnte - was schon für die Zeit von Masaniellos Rebellion nicht oder nur ansatzweise gilt (vgl. Masaniellos Verbot Standes- und geschlechtsspezifischer Kleidung, das zumindest vorübergehend und symbolisch >entdifferenziertdifferenziertNarren< als Rollenträger, die zunächst die Rolle Allegros vervielfachen und identisch kopieren, um dann - im Zuge der von Allegro festgestellten Aufspaltung der Gesellschaft in deutlich unterschiedene Gruppen, die die
45
46
Allegros Rollenvielfalt führt zu >tödlicher< Selbstreferentialität und muß schon deshalb durch Differenzierung vermieden werden: »[...] wo ich einen Soldaten hencken lasse / so muß ich selber dran / und damit ist das Regiment RUINIRET« (1/21, S. 208). Die inscriptio »Ihrer sind zu viel« im Frontispiz von Weises Sammelband [...] Comödien Probe / {...], 1696 (SW VIII, nach S. 254) und der Vergleich zu zahlreicher Figuren mit zuviel Blumen in ihrer Erläuterung (S. 430) gewinnen hiermit zusätzliche Bedeutung: »Ein Stock / der wenig Knospen / hat kan dieselben mit der zulänglichen Nahrung besser versorgen / als wenn er den Safft gar zu weit außtheilen soll.« Inwieweit sich Analogien zur Geldwirtschaft in diesem Zusammenhang als tragfähig erweisen, bedürfte genauerer Prüfung, vgl. aber Achermann 1997 zum Zusammenhang von >Wort< und >WertSprache< und >Geld< u.a. bei Leibniz. Hörisch 1996, S. 35-49 plädiert zwar für eine >Literaturgeschichte< als diskurs- und systemtheoretisch konzipierte >Problemgeschichte< der >Poesie des GeldesBürgerBauernWeiberKinderNarren< mittels einer militärischen Rangordnung funktionale Differenzierung und Hierarchisierung zu verbinden. Die von den >Narren< innerhalb ihrer Gruppe zu spielenden militärischen Rollen setzen sich jedoch gegen ihre gemeinsame >eigentliche< Rolle als >Narren< nicht durch: Sie bleiben >Narrenkurzweiligem Diener des Vize-Königs< explizit zum Rebellen emanzipiert (1/21, S. 207), am Ende jedoch - im stichomythischen Konzert der geistlichen und politisch-höfischen Funktionsträger - wieder in seine alte und eigentliche Rolle eingerückt ist und Dienerfunktion erfüllt (»Der Koch hat angericht / ihr Herren komt zum Essen«, V/25, S. 371). Im übertragenen Sinn bedeutet dies nun erstens einen Differenzierungsgewinn der neapolitanischen Gesellschaft während des Aufstandes, der - analog zur gruppeninternen Funktionsteilung der >Narren< und ihrer externen Funktion - zunächst die Gruppe der Fischer als Träger gleicher Rollen zu einer hierarchisch und funktional differenzierten Korporation verändert und zu einer Art >Staat< im Staat unter der Führung Masaniellos formiert. Damit verknüpft ist zweitens ein Rollenzuwachs Masaniellos, der aus der usurpierten staatstragenden Rolle nicht mehr entlassen wird (vgl. nur III/4, S. 256 und IV/13, S. 320-321; siehe auch Abschnitt 4.3.2.), obwohl er nach eigener Einschätzung eigentlich seine alte Rolle als Angehöriger der FischerZunft nicht oder nur vorübergehend abgelegt hat. Da es ihm drittens nicht gelingt, den Rollenzuwachs rückgängig zu machen, den zeitweise und aus guten Gründen entstandenen sozialen Differenzierungsüberschuß zurückzustutzen und er nicht, wie Allegro und vorher schon die >kleinen NarrenRasender< selbst zum Katalysator der Wiederherstellung der alten, ständisch differenzierten Gesellschaftsordnung.47 Differenzierungsüberschuß und nachfolgende Entdifferenzierung - beide von Allegro mise en abyme vorgeführt - müssen, so ist zu folgern, vorübergehende Extreme bleiben, die sich in einem >klugen< Mittelzustand einpendeln. Als Dauerzustände oder gar sozial innovative Gesellschaftsmodelle bilden sie keine Alternative zu der am Ende vom Nachredner bekräftigten Gesellschaftsordnung. Wie schon im Falle der beiden Gleichnisse zeigt sich auch am Beispiel der beiden intern rahmenden Auftritte Allegros erneut, daß sich ihre latent argumentative Funktion und ihre >kommentierende< Beziehung zu den Ereignissen der Haupthandlung erst dann erschließt, wenn sie selbst als zeichenhaftes aber unterbrochenes Mikrosyntagma verstanden werden, das sich sukzessive aus zwei Analogien konstituiert.
47
Der Bilanz von Burger 1963, S. 75-93 ist also durchaus zuzustimmen, sie bedarf aber der Differenzierung: Masaniello »gelingt [es] nicht, das Kleid und damit die Rolle als Volksverführer loszuwerden. Deshalb verfällt er dem Wahnsinn der Tyrannen und wird zurecht wie ein >reißendes Tier< erschossen« (S. 91).
134
Ein Vergleich ihrer jeweiligen Ähnlichkeitsrelationen zum eigentlichem Geschehen - die komplementäre Beziehung von >Vervielfältigen< und >Zerstückeln< - offenbart darüber hinaus, wie sich Differenz über Ähnlichkeit konstituiert. Daß all dies andere Rezipienten als agierende Schüler und ihre Angehörigen vorauszusetzen scheint, ist jedoch nur vordergründig ein Widerspruch - nicht nur weil Masaniello bereits ein Jahr nach der Aufführung 1682 im Druck erschienen ist und Weise - wie gezeigt - den Druck seiner Dramen mit Vorbehalten und Rechtfertigungen begleitet und dort auch an den >Scharfsinn< seiner Leser appelliert. Gerade die semantische Komplexität der beiden, oben analysierten Narrenszenen und ihre Beziehung führt die dilemmatische Spannweite der Weiseschen Wirkungspoetik vor Augen, die nicht mehr nur die Zuschauer und jugendlichen Akteure der Aufführung, sondern auch kompetente Leser zu erreichen versucht. Deutlich wird dies schon allein daran, daß beide Szenen ihrer dramaturgischen Funktion ebenso genügen wie ihrer semantischen: Als unterhaltsame und massive Handlungsunterbrechungen mit grotesken Elementen bilden sie zugleich auch ein aufeinander bezogenes Bedeutungsgefüge, das einen aufmerksamen Leser erfordert. Wohin dagegen eine inadäquate Verabsolutierung der dramaturgischen Komponente führt, demonstriert das Unverständnis, das zumeist die ältere Forschung gerade gegenüber Weises Narrenfiguren und komischen Zwischenspielen an den Tag gelegt hat (»Der Narr ist in keinem Stücke Weises so im Wege, wie im Masaniello. [...]. Trüge er wenigstens dazu bei, uns die nötigen Ruhepunkte zu gewähren [...]«, Hess 1893, S. 73). Wer einseitig die Zuschauerperspektive einnimmt und sich intensiver Lektüre verweigert, wird etwa den hier besprochenen Szenen Allegros verständlicherweise wenig abgewinnen können und sie auf ihre pure dramaturgische Funktion - und oft nicht einmal mehr das - reduzieren.48 Des weiteren verweist der Appell des Nachredners an das spätere >Nachsinnen< der Erwachsenen auf eine Zukunft, in der das Gesehene und Gespielte in der Tat durch intensive Lektüre rekapituliert, vertieft und deutend nachvollzogen werden
48
Besonnener verfährt Hammes 1911, S. 187-191. In jüngerer Zeit können diese Figuren einschließlich Allegros mehr Aufmerksamkeit verbuchen, ohne daß etwa Allegros Einzelauftritte inhaltlich interpretiert würden, so etwa bei Zeller 1980, S. 193 zu Masaniello 1/21 und S. 233-236 zu Allegro abzüglich seiner exponierten Einzelauftritte (zur Funktion der Narren ebd. S. 180-197 und S. 229-238), bei Krämer 1994, S. 258-259 und schon bei Kaiser 1972, S. 151-152 oder Martini 1972, S. 207, 220, der der grotesken Szene in V/23 eine zeichenhafte, >erklärende< Funktion attestiert, ohne über vage Andeutungen hinauszugelangen (S. 220). Luserke 2000, S. 163 interpretiert Allegro immerhin »als Grenzgänger zwischen Komischem und Tragischem«, der das poetologische >Tabu< der Gattungstrennung innovativ durchbreche. - Entlarvendes Unverständnis für Weises Verfahren legt dagegen Wich 1962 an den Tag, der Hess' Position für sich reklamiert: »Wir verzichten auf die ausführliche Analyse einzelner Auftritte des Narren Allegro. Doch gilt ganz allgemein für die Pickelheringsszenen des Masaniello: Der Narr wirkt hier so störend wie in keinem der bisher besprochenen Weisedramen [...]« und »droht [...] oft genug den inneren Handlungszusammenhang zu sprengen« (S. 74). Mangelnde Bereitschaft zur genauen Analyse wird dem Text als Kohärenzdefizit angelastet.
135
kann, >Theater< und >Buch< einander also ergänzen.49 Schließlich bildet die Aufführungstrilogie, in welcher Masaniello als mittleres Stück am zweiten Tag gegeben wurde, selbst ein komplexes semantisches Netz, das kaum im Verlauf einer Schultheateraufführung vollständig zu durchschauen sein wird, auf das aber die Texte selbst explizit verweisen und so die den Texten eingeschriebene Adressatenrolle sowohl für Zuschauer als auch für Leser definieren - als Deutungsanreiz ex post für die je vergangene Aufführung, den je vorangehenden Text und als Rezeptionslenkung für die je folgende Aufführung, den je nachfolgenden Text. Dies soll - zumindest exemplarisch - in den nächsten beiden Abschnitten weiter verfolgt werden. 4.2.2. Affektwechsel und Affekthierarchisierung im Lustigen Nachspiel [...] von Tobias und der Schwalbe (1682) und im Ersten Lust-Spiel Von Jacobs doppelter Heyrath (1682) Schon der Nachredner im Masaniello initiiert, wie gesagt, neben einer retrospektiven (textinternen) auch eine (textexterne) prospektive Reflexion über eine >klug< wechselnde Mischung von >Eiche< und >WeideRebellion< und >HerrschaftNachrednersweitläufige Ausführungen - gibt darüber hinaus zu erkennen, daß Rezeptivität und Aktivität nicht nur der agierenden, sondern auch der passiv rezipierenden Adressaten des Schuldramas Masaniello idealiter selbst einem Kalkül >kluger< Mischung unterliegen. Das Problem des >höflichen< und zugleich freimütigen Rednersbearbeitet< wieder: Die Vermittlung nur passiv hinzunehmender Regeln, seien sie selbst rhetorische oder seien sie solche kluger >Privat-< oder >StaatspolitikMischung< beider Komponenten, oder durch ihren schnellen Wechsel im Nacheinander gelöst werden kann. Nichtparadoxe Beziehungen zwischen diesen beiden Zielen sind mithin nur als metaphorische (>Mischungunvermischt< und abwechselnd anstre-
49
Vgl. das Lustige Nachspiel / [...] von Tobias und der Schwalbe (SW XI, S. 249-379), das einen Tag nach Masaniello aufgeführt worden ist und in dem sich der Autor des Spiels im Spiel, Bonifacius Lautensack, mit der Aussicht auf eine verbesserte, zukünftige Druckfassung seines Stückes tröstet (HI/8, S. 331): »Aber ich wil es im Drucke dem geliebten Leser zu Gefallen schon zu ändern wissen« (siehe unten, Abschnitt 4.2.3.).
136
ben. Als Medien einer solchen >Lehre< bleiben nur temporalisierende Künste, die mit Hilfe sprachlicher, gelegentlich musikalischer Mittel in der Lage sind, narrative oder dramatische Segmente syntagmatisch anzuordnen, >Wechsel< und >MischungEiche< und >Weide< verdeutlicht, appelliert der >Nachredner< an das zukünftige >Nachsinnen< jugendlicher Adressaten (was potentiell auch die Agierenden mit beinhaltet), denen sich die Bedeutung des Gesehenen, >Agierten< einschließlich der Nachrede und seines Gleichnisses erst durch nachfolgende Deutungsarbeit (»besser bey sich erwegen«), zumal »bey heranwachsendem Alter«, erschließen wird und stellt außerdem schon für den nächsten Tag »etwas von einer annehmlichen FABEL und von einem kurtzweiligen Lust-Spiel gleich als zum CONFECTE« (ebd., S. 373) in Aussicht: Die unmittelbare Zukunft verspricht also zunächst Belohnung (»Confect«) und das >Abklingen< der Affekterregung, ihre Temperierung durch die Komödie am dritten Tag der Trilogie - einer Komödie zumal (Lustiges Nachspiel / Wie etwan vor diesem von Peter Sqventz aufgeführet worden / von Tobias und der Schwalbe / [...], SW XI, S. 249-379), die anläßlich der dargestellten Theateraufführung zum Geburtstag eines »vornehmen Graff[en]« (S. 252) Möglichkeiten und Grenzen ihrer Wirkung als Medium der Didaxe reflektiert und poetologisch absichert (»Wolan die Lehren sind die besten / Da uns Verstand und Lustigkeit / Zugleich erbauet und erfreut«, S. 379). Dieses >Nachspiel< reproduziert das Verhältnis von Theateraufführung und >Nachrede< bzw. >Nachspiel< nicht nur intern, sondern kommentiert in einem nachträglichen wirkungspoetischen Disput zwischen zwei >gräflichen Hofräten< (vierte Handlung, vierter Auftritt, S. 360-363) u. a. auch die Thematik des Masaniello vom Vortage (»Mancher wil regieren / und kan es nicht: mancher wil commendieren / und kan es nicht«, SW XI, S. 363).50 Insofern das >Nachspiel< also die vom >Nachredner< im Masaniello inaugurierte Zukunft des >Nachsinnens< vorwegnimmt und auf die Bühne bringt, schließt es nicht nur die gesamte Trilogie ab, sondern ordnet sich und das Korpus der drei aufeinanderfolgenden Dramen einer syntagmatischen - textinternen wie textübergreifenden - Dynamik der Selbstabbildung und Selbst->Erklärung< unter. Drohender Tautologie und Zirkularität im Verhältnis von >Exempel< und >Regel< versucht die Trilogie zu entgehen, indem sie sich im Wechsel zwischen bloßer Sukzession des Heterogenen und hierarchisierender Rahmung, also der Integration in einen kohärenten übergeordneten Zusammenhang, verwirklicht.51
50
51
Auch die »an statt des Vorredners kommenfden] zwey Tenoristen« verweisen am Anfang des Masaniello auf den ersten Tag der Trilogie zurück: »1. & 2. Tenorist. So scheinet heute neues Glücke / Das Gestern wunder-günstig war: [...]« (S. 159) und preisen im Chor das Prinzip des Wechsels, das die - wie der >Nachredner< sagen wird - »Heroische und grausame INVENTION« (S. 373) des Trauerspiels warnend relativiert: »Was helffen die rauhen und harten Geberden? Ein fröhlicher Wechsel der machet gelehrt« (S. 160). Wenn Kaminski 1998, S. 172 in Gryphius' >Schimpff-Spiel< Absurda Comica. Oder Herr Peter Sqentz (1658) beobachtet, daß aus »der Brechung der dargestellten Geschichte die
137
Als unentbehrliche Instrumente der Rezipientenaktivierung gelten scharfe Kontraste und >scharfsinnige< (argute) Gleichnisse, deren Ähnlichkeitsanteil am Verglichenen hinreichend hoch sein muß, um noch verstanden zu werden, zugleich aber so niedrig wie möglich sein sollte, um die Deutungsarbeit des Rezipienten zu aktivieren. Die schon zitierte, >ernste< poetologische Diskussion zwischen den >Hofräten< Sieghart und Robert im zugleich an Absurdis Comicis besonders reichen Lustigen Nachspiel [...] von Tobias und der Schwalbe (1682; SW XI) realisiert diesen Kontrast nicht nur selbst in hohem Maße, sondern thematisiert auch die damit einhergehenden Probleme mit seltener Deutlichkeit: Problematisch scheint - einmal mehr - das Ausmaß der Unterscheidung oder Vermischung von >Lust< und >(Deutungs-)ArbeitTrauerspiel< und >KomödieErnst< und >Komik< - in den Trilogien, innerhalb der Einzeltexte - nicht behindert, für deren >erfolgreiche< Rezeption aber durchaus relevant wird. Wie die impliziten Probleme mit der diätetischen Metaphorik der >MischungEssensGeschmacks< (Abschnitt 3.3.) gezeigt haben, erleichtert gerade die Vermischung von >Arznei< und >Konfekt< deren Akzeptanz und nutzt - stärker als deren kontrastreiche Sukzession - die >MedienSüßen< für das >BittereBelehrung< und >Vergnügung< von Seiten des Dichter-Lehrers noch durchgehalten werden und sich durch die Beschleunigung ihres kontrastreichen >Wechsels< einer Art >Mischung< in der Zeit annähern, so läßt sich die Trennung von >Arbeit< und >Lust< für den Zuschauer oder Leser sinnvollerweise kaum konsequent durchhalten: Auch das >Ernste< macht >Lustergötzliche< Gleichnisse verursachen >ernste< Deutungsanstrengungen.52 Daß Sieghart und Robert das Dilemma nicht beheben können, leuchtet ein, ebenso aber auch, daß vor diesem Hintergrund die Argumente des >Komödienkritikers< Sieghart nicht gänzlich zu verwerfen sind:
52
Brechung der Geschichte ihrer Darstellung« werde, dann gilt dies auch für Weises Nachspiel, das sich über seinen Titel in die Nachfolge Gryphius' und Shakespeares einreiht (siehe dazu unten). Angesichts der deutlichen Unterschiede zwischen Weises biblischem Tobias und die Schwalbe und dem aus Shakespeares >A Midsummer-Night's Dream< bekannten Pyramus-und-Thisbe-Binnen-Spiel im Peter Squentz und ihren unterschiedlichen Rahmenkontexten scheint es jedoch wenig plausibel, Weises Text als »Neubearbeitung mit erheblichen Veränderungen« einzustufen, um die >Bearbeitung< dann letztlich als inadäquat zu bewerten (Kommentar von E. Mannack in Gryphius 1991, S. 1144-1145, hier S. 1144); zu den Unterschieden zwischen Gryphius' dreiaktigem und Weises vieraktigem Spiel vgl. schon Haxel 1932, S. 37-38. Womit erneut eine rekursive semantische Struktur - ein >Wiedereintritt der Unterscheidung in das Unterschiedene< - aufscheint: Die latente Tautologie, daß >Arbeit< Unlust erzeugt und >Lust< nur von etwas erzeugt wird, was keine Unlust oder Arbeit impliziert, wird durchbrochen - das binäre Schema ist nicht mehr nur selbstreferentiell: >Arbeit< macht Lust, >Vergnügen< macht Arbeit. Luhmann beschreibt solche Strukturen als »Entkoppelung von Selbstreferenz und binärer Schematisierung« (Luhmann 1980d, S. 306) und interpretiert sie für das späte 17. Jahrhundert im Rahmen seiner historischen Wissenssoziologie als Indikatoren von Wandel.
138
SIEGHART. Wie kan sich mein Herr COLLEGE an solchen Possen DELECTIREN? [...]. [...]. ROBERT. Ich halte es vor eine ARTZNEY des Menschliche Elendes. [.-]. ROBERT. Das hat man davon / daß man desto freudiger an die zukünfftige Arbeit gehet / wenn sich das Gemüthe in leichten und gemeinen Possen erquicket hat. SIEGHART. Mit eben der Mühe ergötzte man sich an tief/sinnigen und wolgesetzten Erfindungen. ROBERT. Ach nein: Wenn ich mir über einer COMOEDIE den Kopff zerbrechen will / so habe ich wol sonsten eine Arbeit / darbey ich die Kräffte anwenden kan. Es gemahnet mich wie mit dem Schachspiele / darbey sich mancher den Kopf und das INGENIUM mehr verderbet / als wenn er in dem vornehmsten Gerichte solle REFERENTE seyn. Die Lust und die Arbeit müssen unterschieden werden. SIEGHART. Die Lust sol gleichwol vernünfftig seyn: was waren nun die elenden BauerPossen? [...]. [...]. [...]SIEGHART. Das Spiel hieng nirgend an einander l und wenn sich die CONNEXION weisen solle / so kam eine Schlägerey darzwischen / biß wir aus dem Spiele vor der Zeit lauffen musten. [...]. SIEGHART. Ich halte indessen darvor / es könten etliche MORALIA mit eingeschlossen seyn / da man auch mitten in der Kurtzweil etwas lernen könnle. (SW XI, S. 360-361). Zwar bereiten die beiden >Hofräte< innerhalb der Rahmenhandlung den Extremfall des von der Stoffwahl bis zur Aufführung in der Tat gründlich mißlungenen gräflichen Geburtstags-Festspiels zur biblischen Geschichte von >Tobias und der Schwalbe< nach, dessen didaktischer Wert - so wird befürchtet - sich nicht nur den drameninternen Zuschauern und Mitwirkenden nicht erschließt. Siegharts und Roberts Disput offenbart aber darüber hinaus die grundsätzliche Problematik: Wenn Robert als Verteidiger der >Possen-Artzney< auf einer, beinahe >modern< anmutenden, strikten temporalen (>freudiger an die zukünftige Arbeit/) und sachlichen Trennung von >Arbeit< und >Lust< beharrt, es also mit Verweis auf das anstrengende >Schachspiel< ablehnt, sich >über einer Komödie< den Kopf zu zerbrechen oder, wie Sieghart vorschlägt, sich der >ergötzlichen Mühe< einer Deutung tiefsinniger Erfindungen zu widmen, dann bleibt ihm nur, wie hier geschehen, sich nach der >Komödie< Gedanken über die Funktion der puren >Possen< innerhalb einer zeitlichen Abfolge von >Lust< und >Arbeit< zu machen. Seine temporalisierende und konsequent >trennende< Wirkungspoetik wird sich allerdings die Frage gefallen lassen müssen, wie es dann um die semiotischen Mittel der Affekterregung bestellt ist, wenn diese Mittel keinerlei >Vernunft< und >Tiefsinn< enthalten, also auch keinerlei Deutungsanstrengungen mehr erfordern. Das von Sieghart kritisierte und von Robert verteidigte, inkohärente und durch >Schlägereien< gestörte Binnenspiel erreicht affektive Aufmerksamkeit zwar durch permanente >UnterbrechungenVergnügen< durch >Ernst< oder >Belehrung< durch närrische Zwischenspiele auf, sondern bedrohen den Fortgang und den Erfolg der Aufführung durch externe >EinbrücheMoralia einschließen und >mitten in der Kurtzweil< etwas zu
139
lernen anbieten, vor diesem (spielinternen) Erfahrungshorizont alles andere als abwegig ist, belegt nicht zuletzt die Trilogie, der das Nachspiel einschließlich seines Binnenspieles angehört, aber auch dieses Nachspiel selbst. Es führt im Gegensatz zu Roberts vordergründig komödienapologetischer Argumentation am besten vor Augen, daß Lernen >mitten in der Kurzweil< - durch den Disput - möglich ist, daß >Lust< und >Vernunft< wenn schon nicht synchron, so doch in sehr engem zeitlichen Kontakt ihre Wirkung entfalten können und daß auch eine >absurde Komödie< Gelegenheit zur >tiefsinnigen< Deutungsarbeit bietet. Wie sich die einander ausschließenden Ziele der >Unterscheidung< und der >Mischung< dennoch versöhnen lassen, demonstriert das Nachspiel schließlich ebenfalls: Nicht nur durch temporalen >WechselUnterscheidung< beruht, sondern auch durch die hierarchisierende Inklusion, die das Inkludierte unvermischt intakt läßt und es dennoch in einen übergeordneten aber noch drameninternen (Deutungs-) Rahmen integriert. Das Binnenspiel wird so vom Rahmenspiel >eingeschlossenetliche Moralia mit einschließen mag (»mit eingeschlossen seyn«, S. 361). Daß das mißglückende Binnenspiel seinerseits immer wieder von aus der Rolle fallenden und >realiter< konkurrierenden Akteuren gefährdet wird,53 also gerade nicht intakt bleibt, sondern von der Rahmensituation gestört wird, erhält somit bereits innerhalb des Nachspiels den Status eines sinnvollen weil lehrhaften poetologischen Exempels. An ihm erweist sich um so mehr die Berechtigung einer Poetologie, wie sie in Siegharts und Roberts Disput indirekt Gestalt gewinnt und die auch eine paradoxieverdächtige Anwendung auf sich selbst noch zu verarbeiten und zu nutzen vermag: Nur anhand der Abweichung von sich selbst, am eigenen Gegenbeispiel bestätigt sie sich - und anhand einer von einer hinzukommenden Figur abrupt beendeten, sachlich aber unentschieden gebliebenen Diskussion, die >mitten in der Kurzweil< Reflexionsbedarf signalisiert. Realisiert Tobias und die Schwalbe seine poetologisch reflektierte Selbstthematisierung als Komödie in einer gattungsspezifisch präformierten, im Rahmen der Trilogie aber spezifisch funktionalisierten Spiel-im-Spiel-Struktur und führt damit vor, daß Selbstreferenz nur als unterbrochene (enttautologisierte), also auf zwei verschiedenen, aber simultan geschachtelten Ebenen sichtbar und auf nicht paradoxe Weise thematisiert werden kann, insofern sie sich im Rahmen-Binnen-Verhältnis54 und in 53
54
Vgl. nur HI/9, S. 333 oder HI/13, S. 348-349 und die Klage des selbst mitspielenden Autors Bonifacius (HI/15, S. 352): »Meine COMOEDIE ist mir auch in der Schlägerey zerrissen worden / und ich kan nicht TEMPORISIEREN.« Zum >Zerreissen< des Stückes tragen, wie sich zeigt, sowohl zu große Abhängigkeit vom vorgegebenen Text bei, so daß die auftretenden Unterbrechungen nicht überspielt werden können, als umgekehrt auch die Unfähigkeit, sich nach der Textvorlage zu richten, so daß diese Unterbrechungen durch >Temporisieren< überhaupt erst entstehen: »Ich kan fremde Sachen nicht außwendig lernen« (HI/11, S. 341). Vgl. nochmals Zeller 1980, der die >allegorische Umrahmung< bei Weise als dramatisches >Beweisverfahren< bezeichnet, sich aber auf Vorspiele bzw. Rahmenszenen beschränkt, die selbst schon mehr oder weniger forensische Züge aufweisen (S. 210-223). Logik und Rhetorik des >Beweises< oder der >Erklärung< zwischen similitudo und conclusio werden jedoch nicht thematisiert.
140
der hierarchischen Differenz beider Ebenen syntagmatisch entfaltet, so eröffnet das Erste Lust-Spiel Von Jacobs doppelter Heyrath [...] (SW V, S. 1-249) die Trilogie mit dem logischen Gegenstück zur hierarchisierenden Rahmung: Es führt in neunzig Szenen mit fünfzig Personennummern am biblischen Stoff - und an der nur mit Hilfe des persönlich eingreifenden Erzengels Raphael möglichen Ausnahme (V/15, S. 178-181) - vor, daß paradoxe Anforderungen, soll ihre Wertigkeit nicht durch Hierarchisierung verändert werden, nicht simultan, sondern nur im Nacheinander oder gar nicht erfüllt werden können.55 Hierarchisierung und Verzeitlichung bilden somit die beiden - gleichermaßen syntagmatisch zu verwirklichenden - Strategien, mit denen sowohl tautologisch als auch paradox blockierende Selbstreferenzen vermieden werden können, also die leere Selbstbezüglichkeit einer Verdoppelung durch >Ähnlichkeit< (etwa als >Spiegelunga ist aa ist nicht aZauberer< Sebub bringt dies - mit »wunderlichen Geberden« und sich »rasend« stellend - wie folgt zum Ausdruck, Ähnlichkeit und Widerspruch durch Endreime noch betonend: Die schöne Schäfferin sol mit dem Printzen leben: Doch er vergreiffe sich an keiner schönen Braut: Sie ist ihm nicht beschehrt / und gleichwol wird sie geben / Was er von Hertzen hofft / und was er sich vertraut. (SW V, V/14, S. 186)
Seine Unfähigkeit, die »dunckele Rede« (ebd.) zu deuten und die Paradoxie aufzulösen, führt dazu, daß er seiner (>schwarzenweißenGegenmacht< sind Raphael und die >übrigen Engel< (V/10, S. 178) gemeint, die dem verzweifelten Jacob die Möglichkeit zur doppelten Heirat< eröffnen und ihm damit einen Ausweg aus dem Dilemma aufzeigen, in das ihn sein präsumptiver Schwiegervater Laban gebracht hat. Dieser hatte ihm für siebenjährige Dienste als Knecht seine jüngere Tochter Rahel zur Frau versprochen, wird aber vor der Hochzeit von der ausbrechenden >Melancholie< ihrer älteren eifersüchtigen Schwester Lea (1/11, S. 39: »Wie so Melancholisch [...]?«) dazu bewogen, sein Versprechen zu brechen und, dem >Recht der Erstgeburt (ebd.) folgend, Jacob mit der bis nach dem Beilager vermummten Lea zu verheiraten. Vorausgehende Versuche Labans, Jacobs abgelaufene Dienstzeit zu verlängern und ihn über die Zahl der vergangenen Jahre zu täuschen oder einen Aufschub der Hochzeit zu erwirken, schlagen fehl (1/7, S. 26-28), so daß nur die betrügerische Ersetzung Rahels durch Lea Erfolg verspricht. Wo Verzeitlichung versagt und Sitte und Liebe eine Doppelhochzeit verbieten, bleibt nur eine Vertauschung, die ihrerseits die temporale Ordnung wiederherstellt: Laban rechtfertigt sie denn auch gegenüber Jacob mit dem Gebot temporaler Nachordnung. Wer zuerst geboren wird, wird zuerst verheiratet, Rahel hat Lea den Vortritt zu lassen: Es ist in unsren Lande nicht Sitte [...] / daß man die jüngste vor der ältesten ausgiebet; wer mich in Ehren um die Tochter anspricht / der muß sie nehmen / wie die Reihe nach einander gehet. (IV/3, S. 132).57
Nach der erschlichenen Hochzeit Leas wird verstärkt mit >Zeit< und >Geduld< argumentiert, um die ungeliebte Lea zu trösten (z.B. IV/7, S. 137, 138: »Ein Baum hat seine Zeit«; IV/15, S. 155; IV/16, ebd.: »ein Braut wil Zeit haben«; V/5, S. 170: »Der hitzige Rath ist nicht allzeit der beste.«). Erst der Erzengel Raphael vermag Jacob auf seinem Fluchtweg aufzuhalten und dazu zu bewegen, sowohl die legitime Ehefrau nicht zu verstoßen, als auch Rahel, der er »die Liebe versprochen« hat (V/11, S. 181), »Schande oder Traurigkeit« zu ersparen (ebd.) und stellt die Einwilligung Labans zu einer zweiten Hochzeit in Aussicht. Jacob ist »bereit / die Liebe mit zweyen Schwestern zu theilen« und will »auch den Weg wiederum zurücke nehmen« (ebd.): >Teilung< der Liebe und >Verdoppelung< der Braut verprechen die Simultaneität dessen, was sich ausschließt. Die Rückkehr Jacobs zusammen mit der ebenfalls geflohenen Rahel erfolgt allerdings erst, nachdem er der an der Lösbarkeit des Dilemmas zweifelnden
57
Vgl. 1. Mose 29, 26 in Luthers Übersetzung: »Es ist nicht Sitte in unserem Lande, daß man die jüngere weggebe vor der älteren« (zitiert nach: Lutherbibel 1985, S. 33). Abgesehen von wenigen wörtlichen Bezügen teilt Weises Schauspiel nur einige Grundzüge der >histoire< mit l.Mose 29. Dort erfolgt die Einigung mit Laban auch ohne göttlichen Eingriff noch im Verlauf dieses Gesprächs. Daß der Eingriff Raphaels der vom Nachredner des Masaniello beschworenen >göttlichen Providenz< mehr »Glaubwürdigkeit« verleihe (Kaiser 1972, S. 148) hält jedoch genauerer Prüfung nicht stand: Die Instrumente der Vorsehung sind (im Unterschied zu Feinds Masagniello) in Weises Trauerspiel >kluge Politici< - einschließlich der Mörder Masaniellos - und Masaniello selbst, jedenfalls aber keine >Betrüger< wie Laban (ebd., S. 149).
142
Rahel das >Geheimnis< offenbart hat, das sie in ihre Rechte einsetzt, ohne daß Lea »darbey verspielen« oder Rahel »nichts gewinnen« soll (V/15, S. 191-192). Die auch durch das göttliche >Wunder< der Simultaneität kognitiv nicht ganz auflösbare Paradoxie wird anschließend zur Zirkularität aus >Anfang< und >Ziel< dynamisiert, hinter der sich die verworfene, Lea oder Rahel ausschließende Problemlösung noch minimal manifestiert. Das folgende Gespräch zwischen Jacob, Lea, Rahel und deren Freundin Peninna verdeutlicht dies im Nacheinander seiner um >VerdoppelungTeilung< und linearen Zielbezug kreisenden Argumente: JACOB. Ein himmlisches Gesichte hat mir diese doppelte Heyrat verstattet; [...] / und meine liebste RAHEL wird etwas von der Liebe mit ändern theilen lassen. PENINNA. Ach wo zwey Weiber nicht die feste Liebe scheiden / so kan das Firmament numehr zwey Sonnen leiden. JACOB. Hier steht ein Bräutigam / der eins in zweyen ist. LEA. Der seine LEA liebt /
RAHEL. Und RAHELS nicht vergist. JACOB. Gott gebe / daß ich Lust an diesem Schlüsse finde. [...]. [...]. JACOB. Doch seht wo fang ich an l bey welcher bleibt das ZieH LEA. Bey mir hoffentlich.
RAHEL. Bey welcher JACOB will. JACOB. So kan es meiner Noth an keinem Tröste fehlen. [...](V/18, S. 195).
Rahel geht jedoch weiter von ihrer Vorzugsstellung bei Jacob aus und stuft ihre Liebe hierarchisch höher ein als seine zeitlich früher vollzogene, legitime Ehe mit Lea. Penninas Resümee ist somit eindeutig: »Ein Mensch kan nicht zwey Herren dienen / und ein Herr kan nimmermehr zwey Eheweiber zugleich liebhaben« (V/18, S. 197). Auch Laban fällt mit Erfolg in das gewohnte >Verzeitlichen< zurück, versucht, aus Jacobs >doppelter Heirat< Gewinn zu schlagen und an die erste siebenjährige Dienstzeit Jacobs eine zweite anzuhängen: [...] wiltu was zum besten haben / so verdiene es. Habt ihr um Lea sieben Jahre gedienet / so gedencket / daß mir Rahel um kein ander Geld feil ist. (V/20, S. 200).
Braut, Geld und Zeit sind für Laban und für Jacob miteinander verrechenbar: Rahel als zweite und später geheiratete Braut verlängert Jacobs unentgeltlichen Dienst für Laban auf insgesamt vierzehn Jahre (»ich wil sieben Jahr getreulich dienen«, ebd.). Die Weissagung des Engels bestätigt sich folglich nur eingeschränkt, da Laban auf Jacobs Forderung nicht bedingungslos eingeht; er akzeptiert es allerdings, die zeitliche Nachordnung von Dienstleistung und Belohnung außer Kraft zu setzen und willigt in die sofortige Heirat Rahels ein - vor Ablauf der zweiten sieben Jahre und die ersten sieben Jahre als >exemplarische< Vorleistung verbuchend (V/20, S. 200). Von den beiden Alternativen, entweder vierzehn Jahre für Rahel zu dienen (Jacob »um den Lohn zweymal vexieren«, ebd.) oder Rahel ohne die bzw. vor den erforderlichen Dienstleistungen zu >geben< (»den Lohn sieben Jahre voraus geben«, ebd.), siegt also die letztere. Statt >Arbeit vor Belohnung< - die ersten sieben Jahre erzielen
143
aber die falsche >Belohnung< - gilt nun immerhin >Belohnung vor ArbeitBelohnung< wird zeitlich zwischen der ersten und der zweiten Arbeitsphase positioniert. Somit hat die >wundersam< herbeigeführte Simultanehe gleichwohl ihren in der Zeit zu entrichtenden Preis, wird für Laban in temporalisierbaren, ökonomischen Nutzen übersetzt. Wie vor diesem Hintergrund die Doppelehe Jacobs simultan oder im schnellen Wechsel zwischen Lea und Rahel verwirklicht wird, bleibt offen. Unzweifelhaft kann jedenfalls das von Raphael verordnete >Wunder< der Gleichzeitigkeit, der >Mischung< des sich Ausschließenden das zeitliche Kalkül eines Wechsels aus >Arbeit< und >LustVorleistung< und späterer >Belohnung< nicht ganz außer Kraft setzen, das Jacob schon in seinem Einzelauftritt in der ersten Handlung expliziert. Diesem Kalkül der zeitlichen Nachordnung von >Mühsal< und >Vergnügung< lassen sich nämlich nicht nur Jacobs erste Dienstzeit und die Aussicht auf die Heirat der versprochenen Rahel, sondern außerdem auch Lea und Rahel selbst, also >Ehe< und >Liebemühselige< Beginn der Trilogie mit einem bekannten biblischen Stoff und die Aussicht auf zukünftiges Vergnügen an historischen (tragischen: Masaniello) und stärker komödiantischen Stoffen (literarischen und biblischen: Sqventz l Tobias) unterordnen:58 [...] eben durch das mühselige Wesen wird die zukünfftige Vergnügung viel tausend mahl süsser und angenehmer gemacht / [...]. Dessentwegen muß der Tag mit der Nacht / und der Sommer mit dem Winter abwechseln l daß die Lust aus der Unlust etwas lieblicher hervorspielen möge. Meine sieben Jahr / [...] / kommen mir nicht anders vor / als werens eintzele Tage gewesen / nur darum / weil ich anitzo in den Armen der wunder schönen RAHEL die unvergleichliche Belohnung empfinden soll. [...]. (1/3, S. 16-17).
Die von Jacob anhand des Tageszeiten- und Jahreszeitenzyklus plausibilisierte lineare Abfolge von >Unlust< und >Lust< wird zwar am Ende der Doppelten Heyrat um die umgekehrte Variante - >Lust< vor >Unlust< - ergänzt; sie ersetzt die erste Variante aber nicht, sondern bildet nun mit ihr zusammen eine zyklische Abfolge von >Unlust l —» Lust —> Unlust 2Schäffer< Lamuel bringt dies indirekt zum Ausdruck, wenn er im Vorspiel auf der sicheren Wirkung des biblischen Themas beharrt: »Was nach der Bibel schmeckt / das muß auch wohl belieben; Denn diese Feder hat aus Gottes Kraft geschrieben. Drum wer von Jacob lernt / der schickt sich in die Welt / Doch also / daß er auch dem Himmel wohl gefält« (S. 8). Die zu Anfang von Jedida für das Spiel formulierte >Lehre< nimmt sich allerdings sehr pauschal aus: »Da Jacob lehren soll / durch was vor Unglücks-Fälle Die Tugend dringen muß« (ebd.). - Wie meist in Weises biblischen Dramen fällt auch hier der verstärkte Einsatz der Musik als Affektmedium auf (s.o. Abschnitt 3.4.): So beginnt der als Schäfer verkleidete syrische Prinz Kemuel die zweite Handlung mit einem Lied zur Laute (II/l, S. 49-52, einschließlich Noteneinlagen) und schließt die dritte Handlung auf die gleiche Weise ab (HI/21, S. 124-126 einschließlich Noteneinlage). Dem Dramentext hat Weise außerdem (in der Originalpaginierung) 82 Seiten von Johann Kriegers Partitur beigebunden (hier S. 209-249), die auch kleine Sinfonien und Sonaten enthält (in der Originalpaginierung z.B. S. 258-275).
144
Schema, wobei die >Lust< zwischen den beiden siebenjährigen Arbeitsphasen Jacobs wie folgt zu differenzieren ist: Unlust l
[Lust -^ Unlust (Lea)] -> [Lust (Lea) / Lust (Rahel)]
Unlust 2
Jacob nimmt dies im obigen Zitat insofern vorweg, als er die Abfolge von >Tag< auf >Nacht< und >Sommer< auf >Winter< bereits zum permanenten zyklischen >WechseI< erweitert; damit stößt die Analogie aber zugleich auch an ihre Grenzen, wird sie doch dem am Schluß des Dramas erreichten Kompromiß-Zustand zwischen Linearität und Simultaneität nicht ganz gerecht. Zwar scheint sich die zyklisch abwechselnde Wiederholung des Gleichen in der Zeit als Kompromiß zwischen beiden Extremen anzubieten, da es sich aber bei der für Jacob, Lea, Rahel und Laban gefundenen Lösung eigentlich um die Gleichzeitigkeit zweier Zustände handelt, besteht Präzisierungsbedarf. Im Unterschied zu Jacobs Zeit als eheloser Knecht Labans, in der >Arbeit< und >Belohnung< nicht zugleich gegeben waren, leistet Jacob nunmehr als doppelt verheirateter und bereits lustvoll belohnter Schwiegersohn seine zweite Dienstzeit bei Laban ab, >Lust< und >Unlust< scheinen also nun zu koexistieren und seine >Arbeit< bietet keine Aussicht auf weitere >Belohnung< in der Zukunft. Eine Minimierung des Bezugszeitraumes, in dem jeweils >Lust< und >Unlust< vermeintlich koexistieren, zeigt jedoch, wie schon im Falle der Doppelehe selbst, daß >Mühsal< und >Vergnügen< nun im schnelleren Wechsel aufeinander folgen, also eigentlich nur diachron >gemischt< werden können. Jacobs Engels->Gesichten< zum Trotz scheint - ohne hierarchisierende Rahmung oder Schachtelung - eine weitergehende Einschränkung des zeitlichen Nacheinanders zugunsten der (utopischen) Gleichzeitigkeit des sich Widersprechenden unmöglich zu sein. An der behaupteten, von Gott angestoßenen und dann von den Betroffenen wieder partiell relativierten Ausnahme tritt also der entparadoxierende, d.h. verzeitlichende Normalfall um so deutlicher zu Tage. Auch der >doppelten Heirat< selbst liegt außerdem eine minimale Diachronie zugrunde: >Doppelt< bedeutet sowohl simultane Verdoppelung bzw. Teilung - zwei Frauen, geteilte Liebe - als auch das Nacheinander zweier Hochzeiten - auf die Hochzeit mit der falschen Frau folgt die Eheschließung mit der richtigen, allerdings ohne die erste Ehe zu annullieren. Jacob heiratet in der späteren Hochzeit Rahel hinzu und sieht sich sodann mit den Problemen von Simultaneität und Temporalisierung konfrontiert. Besonderen Stellenwert erhält in diesem Zusammenhang erneut Jacobs schon zitiertes Selbstgespräch, in dem mit seltener Explizitheit bereits die Notwendigkeit, ja Unvermeidbarkeit der Selbstreferenzunterbrechung formuliert wird und sich implizit zugleich abzeichnet, daß dies auf zwei verschiedene, aber miteinander verknüpfbare Weisen möglich ist. Zunächst gibt Jacob seine Einsicht zur Kenntnis, daß Affekte nur differentiell - als sich wandelnde bzw. aufeinanderfolgende - >empfindbarGottlosigkeit< des >Weltlings< und die nicht unterbrochene, also auch nicht reflektierbare, >freudlose< Selbstbezüglichkeit seiner >Freuden< kontrastiert mit dem Lustgewinn, den arbeitende fromme >Kinder< aus dem Wechsel von Lust und Unlust zur >Belohnung< ziehen. Unter der - gesellschaftlich alles andere als selbstverständlichen - Prämisse eines erwartbaren Wechsels von >Mühsal< und >VergnügungBelohnung< für >Mühsal< und >UnlustKlugheit< der >göttlichen Direction< als >gerecht< verstehen, zumal sie sich im Verlauf der Dramenhandlung bekanntlich gegen Labans betrügerischen Aufschub der >Belohnung< durchsetzt. Am Ende hat sich Jacobs Theodizee auf der Basis temporal i sierter Affekte nicht ohne Widerstände und durchaus mit Einschränkungen bewährt.59 Darüber hinaus impliziert Jacobs Formulierung »in der Freude selbst keine Freude [...] empfinden« und ihr Kontext sowohl den Zusammenhang von Hierarchisierung und Temporalisierung, also den beiden in Weises Trilogie abgehandelten Möglichkeiten der Unterbrechung von Selbstreferenz, als auch den Zusammenhang von Tautologie und Paradoxie, der nun am Textbeispiel geklärt werden kann. Beide Zusammenhänge haben sich schon mehrfach abgezeichnet; sie ergeben zusammen einen diskurskonstitutiven Problemkern, der sowohl die Zeitsemantik als auch die semiotische Ausstattung des Wissens über Affekte und die epistemischen Modalitäten seiner Generierung und seiner Selbstblockade betrifft und den es in seinen Grundzügen weiter zu entfalten gilt. Die von Jacob für den >gottlosen Weltling< negierte Aussage >Freude in der Freude empfinden< erweist sich zunächst einmal als tautologisch und signalisiert die Selbstreferenz des Affekts: >Sich in der Freude freuen< kann nur heißen, sich am Gegenstand der Freude zu freuen (tautologische Lesart) oder, - in rekursiver Anwendung auf die Freude - sich an der Freude selbst zu freuen (selbstreferentielle Lesart), was in beiden Fällen Ausdruck der Affektsteigerung ist. Die Negation der Aussage macht bewußt, daß ihre positive Fassung nur dann als sinnvoll, d.h. informativ gelten kann, wenn sie sinnvoll zu verneinen ist. Daß »ein ander«, also der >WeltlingFreude ist FreudeFreude ist nicht Freude< als sinnvolle Aussage zu verstehen, ist ihre offenkundige Widersprüchlickeit aufzulösen. Was bedeutet also die Aussage, die müßigen >Weltlinge< empfänden in ihrer unbegrenzten >Freude< keine >Freude



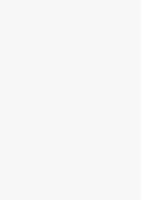
![Geschichte der Eidgenossen während des 16. und 17. Jahrhunderts [1]](https://ebin.pub/img/200x200/geschichte-der-eidgenossen-whrend-des-16-und-17-jahrhunderts-1.jpg)
![Geschichte der Eidgenossen während des 16. und 17. Jahrhunderts [3]](https://ebin.pub/img/200x200/geschichte-der-eidgenossen-whrend-des-16-und-17-jahrhunderts-3.jpg)
![Geschichte der Eidgenossen während des 16. und 17. Jahrhunderts [2]](https://ebin.pub/img/200x200/geschichte-der-eidgenossen-whrend-des-16-und-17-jahrhunderts-2.jpg)


