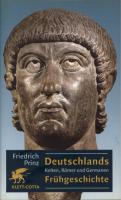Die Kelten in Süddeutschland: Der archäologische Führer 9783805345910
Der Keltenspezialist Holger Müller gibt für jeden Fundort wertvolle Tipps zur Anreise, eine historische Übersicht über d
117 68 22MB
German Pages 112 [123] Year 2014
Front Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Vorwort
Einleitung
Zeiteinteilung
Keltizitäts-Debatte
Fürstengrab-/Fürstensitzdebatte
Oppida
Wirtschaft
Viereckschanze
Der Glauberg
Die Geschichte der Grabungen
Die Befestigungsanlage
Die Grabanlage(n)
Die Pfostenlöcher und ihre Deutung
Der Glauberg als Kalenderheiligtum
Das Plateau
Die Funde
Die Statue des Fürsten vom Glauberg
Die Waffen
Die Bronzekannen
Die Fibeln
Der Goldschmuck aus Grab 1
Die Keltenwelt am Glauberg – das Museum
Weiteres Keltisches der Umgebung
Die Bedeutung des Glauberges
Reinheim
Geschichte der Grabung
Der spätbronzezeitliche Hortfund
Das Prunkgrab der „Fürstin von Reinheim“
Die Funde
Das Trinkgeschirr
Der Spiegel
Der Goldschmuck
Die Fibeln
Die Perlen
Die Bedeutung der Bestatteten
Donnersberg/Dannenfels
Die Grabungsgeschichte
Besiedlungsgeschichte
Das Oppidum
Die Mauern
Die Viereckschanze
Besiedlung
Die Funde
Keltisches um den Donnersberg
Hohenasperg
Grabungsgeschichte
Die Gräber
Die Bedeutung der Region
Hochdorf
Geschichte der Grabungen
Das Museum
Fürstengrab und Fürstensitz?
Der Fürst von Hochdorf
Die Funde
Die Bronzesitzbank
Das Trink- und Speisegeschirr
Der Wagen
Der Birkenrindehut
Der Goldschmuck
Herrschaft und ihre Symbole – Beispiele aus Hochdorf
Magdalenenberg
Grabungs-/Forschungsgeschichte
Das Fürstengrab und die Nachbestattungen
Das Fürstengrab im Franziskanermuseum
Nekropole und Kalendarium?
Heuneburg
Geschichte der Grabung
Entstehung und Entwicklung der Heuneburg
Funde und Befunde
Siedlungsstrukturen
Das Handwerk
Die Umgebung
Die Bedeutung der Heuneburg
Pyrene und die Heuneburg
Bopfingen und das Nördlinger Ries
Grabungsgeschichte
Der Ipf
Die Befestigungsanlagen
Das Fürstengrab
Der Goldberg
Viereckschanzen und Rechteckhöfe
Die Frage nach der Abhängigkeit der Siedlungen von Ipf und Goldberg
Manching
Forschungsgeschichte
Das Oppidum
Die Gebäude in Manching
Wichtige Funde
Münzfunde
Glas
Das Goldbäumchen
Die Waffenfunde
Tierknochen
Die Bedeutung Manchings für die keltische Metrologie
Manching als Fernhandelszentrum
Noch mehr Keltisches
Hallstatt und Neuchâtel
Schlusswort
Adressen/Kontakte
Literatur
Glossar
Informationen Zum Buch
Informationen Zum Autor
Back Cover
Recommend Papers

- Author / Uploaded
- Holger Müller
File loading please wait...
Citation preview
Holger Müller
Die Kelten in Süddeutschland Der archäologische Führer Herausgegeben von Holger Sonnabend und Christian Winkle
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über abrufbar.
© 2012 Verlag Philipp von Zabern, Darmstadt/Mainz ISBN: 978-3-8053-4277-3 Gestaltung und Umschlaggestaltung: Jutta Schneider, Frankfurt am Main Satz: Vollnhals Fotosatz, Neustadt a. d. Donau Druck: Beltz Druckpartner GmbH Co. KG, Hemsbach Alle Rechte, insbesondere das der Übersetzung in fremde Sprachen, vorbehalten. Ohne ausdrückliche Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, dieses Buch oder Teile daraus auf fotomechanischem Wege (Fotokopie, Mikrokopie) zu vervielfältigen oder unter Verwendung elektronischer Systeme zu verarbeiten und zu verbreiten. Printed on fade resistant and archival quality paper (PH 7 neutral) · tcf Weitere Publikationen aus unserem Programm finden Sie unter: www.zabern.de Elektronisch sind folgende Ausgaben erhältlich: eBook (PDF): 978-3-8053-4544-6 eBook (epub): 978-3-8053-4545-3
Inhalt
Vorwort
7
Einleitung 8 Zeiteinteilung 9 Keltizitäts-Debatte 10 Fürstengrab-/Fürstensitzdebatte 12 Oppida 14 Wirtschaft 15 Viereckschanze 16 Der Glauberg 18 Die Geschichte der Grabungen 18 Die Befestigungsanlage 20 Die Grabanlage(n) 21 Die Pfostenlöcher und ihre Deutung 24 Der Glauberg als Kalenderheiligtum 24 Das Plateau 25 Die Funde 26 Die Statue des Fürsten vom Glauberg 26 Die Waffen 28 Die Bronzekannen 30 Die Fibeln 31 Der Goldschmuck aus Grab 1 32 Die Keltenwelt am Glauberg – das Museum 33 Weiteres Keltisches der Umgebung 34 Die Bedeutung des Glauberges 34 Reinheim 35 Geschichte der Grabung 35 Der spätbronzezeitliche Hortfund 36 Das Prunkgrab der „Fürstin von Reinheim“ 36 Die Funde 37 Das Trinkgeschirr 37 Der Spiegel 38 Der Goldschmuck 38
Die Fibeln 39 Die Perlen 39 Die Bedeutung der Bestatteten 39 Donnersberg/Dannenfels 41 Die Grabungsgeschichte 41 Besiedlungsgeschichte 42 Das Oppidum 43 Die Mauern 43 Die Viereckschanze 45 Besiedlung 46 Die Funde 46 Keltisches um den Donnersberg 47 Hohenasperg 49 Grabungsgeschichte 49 Die Gräber 50 Die Bedeutung der Region 53 Hochdorf 54 Geschichte der Grabungen 54 Das Museum 55 Fürstengrab und Fürstensitz? 56 Der Fürst von Hochdorf 57 Die Funde 58 Die Bronzesitzbank 59 Das Trink- und Speisegeschirr 60 Der Wagen 62 Der Birkenrindehut 62 Der Goldschmuck 63 Herrschaft und ihre Symbole – Beispiele aus Hochdorf 64 Magdalenenberg 66 Grabungs-/Forschungsgeschichte 66 Das Fürstengrab und die Nachbestattungen 68 Das Fürstengrab im Franziskanermuseum 71 Nekropole und Kalendarium? 72
Inhalt
Heuneburg 74 Geschichte der Grabung 74 Entstehung und Entwicklung der Heuneburg 75 Funde und Befunde 76 Siedlungsstrukturen 76 Das Handwerk 77 Die Umgebung 78 Die Bedeutung der Heuneburg 79 Pyrene und die Heuneburg 80 Bopfingen und das Nördlinger Ries 81 Grabungsgeschichte 81 Der Ipf 82 Die Befestigungsanlagen 84 Das Fürstengrab 84 Der Goldberg 85 Viereckschanzen und Rechteckhöfe 85 Die Frage nach der Abhängigkeit der Siedlungen von Ipf und Goldberg 87 Manching 88 Forschungsgeschichte 88 Das Oppidum 90 Die Gebäude in Manching 92 Wichtige Funde 94 Münzfunde 94 Glas 95 Das Goldbäumchen 96 Die Waffenfunde 96 Tierknochen 97 Die Bedeutung Manchings für die keltische Metrologie 97 Manching als Fernhandelszentrum 98 Noch mehr Keltisches 100 Hallstatt und Neuchâtel 100 Schlusswort 101
Adressen/Kontakte 102 Literatur
107
Glossar 111
Vorwort
Vorwort An dieser Stelle ist es üblich, Dank zu sagen, und mit dieser Tradition möchte ich natürlich nicht brechen. Daher möchte ich zuerst den Herausgebern für die Aufnahme in die Reihe danken und vor allem Christian Winkle, dass er den Kontakt zum Verlag für mich hergestellt hat. Weiterhin danke ich Constanze Holler für alle zweckdienlichen Hinweise und die Unterstützung sowie den verschiedenen Museen für die Zurverfügungstellung von Abbildungen und Bildrechten.
[7]
Einleitung Ein Buch über die Kelten zu schreiben ist ein ambitioniertes Unterfangen, doch auch ein Führer zu den Kelten in Süddeutschland stellt einen Autor vor mehrere Probleme. So zwingt die Menge und Dichte der bedeutenden und sehenswerten archäologischen Denkmäler und Museen zu einer Auswahl, die im Grunde den Geschmack des Autoren wiederspiegelt und dem thematisch interessierten Leser willkürlich erscheinen mag. Aber dem ist natürlich nicht so. Vielmehr soll der Leser auf eine – hoffentlich reale – Reise zu Orten mitgenommen werden, die Forschung und Phantasie sowohl von Fachleuten als auch Laien seit langer Zeit in Bewegung halten und ausschlaggebend für einige bedeutende Kontroversen in wissenschaftlichen Diskursen sind. Dabei müssten durchaus die politischen Grenzen Deutschlands verlassen und bedeutende Funde in Österreich und der Schweiz behandelt werden. Leider reicht hierzu der Platz nicht aus. Ein weiterer Grund für die Auswahl bestimmter Plätze ist natürlich auch die Präsentation der Funde. Der Besucher soll schließlich etwas zu sehen bekommen und nicht nur wissen, dass er sich an einem für die Wissenschaft bedeutenden Platz befindet. Natürlich wird sich auch bemüht, weitere archäologisch relevante Sehenswürdigkeiten in der Umgebung der beschriebenen Fundstätten zu erwähnen, doch kann dies weder vollständig noch ausführlich geschehen. Auch bei der Beschreibung der Funde muss zwangsläufig eine Auswahl getroffen werden und es wird hauptsächlich auf eindrucksvolle und/oder in der Wissenschaft diskutierte Funde eingegangen. Bedenkt man, dass über die meisten Fundorte eigene, oft mehrbändige Publikationen erschienen sind, so kann man hoffentlich verstehen, dass die hier gelieferten Beschreibungen eher als Einführung zu verstehen sind. Auch eine Problematisierung bzw. Definition aller relevanten Begriffe kann hier nicht erfolgen. So wird zum Beispiel zwar bei den entsprechenden Funden auf die keltische Kunst eingegangen, die Frage, was Kunst aber überhaupt ist und wie sie sich von Handwerk unterscheidet, kann hier nicht behandelt werden. In diesem und anderen Fällen muss auf die angeführte Sekundärliteratur verwiesen werden. Bevor aber mit der Reise begonnen werden kann – sie wird vom Glauberg über die Heuneburg nach Manching führen –, sollen einige grundlegende Informationen zu wissenschaftlichen Fragen erörtert werden. Denn die Keltologie steckt voller Kontroversen, die zum Teil gerne ignoriert
[8]
Einleitung
erden, zum Teil aber auch zu Überinterpretationen führen. Der Leser w soll aber in die Lage versetzt werden, sich sein eigenes Bild zu machen. Im Gegensatz zu den mediterranen Kulturen kann die Deutung als keltisch betrachteter Funde nur in seltenen Fällen durch schriftliche Belege untermauert werden. Dies hat vor allem in der prähistorischen Forschung zu Kontroversen geführt, deren Kenntnis für das Verständnis der behandelten Orte wichtig ist.
Zeiteinteilung Die keltische Kultur in Süddeutschland liegt zeitlich in der späten Bronze- und (hauptsächlich) Eisenzeit. Eine genauere Einteilung erfolgt über die nach wichtigen Fundorten und den damit verbundenen Stilen benannte Hallstatt- und Latènezeit, die in weitere Stufen unterteilt wird (abgekürzt Ha und Lt). Diese Einteilung geht auf einen 1874 von Hans Hildebrand gemachten Vorschlag zurück, welcher sich letztendlich durchsetzen konnte. Dabei leitet Lt A die späte Eisenzeit ein. Ein maßgebliches Indiz für den Übergang von der Hallstatt- zur Latènezeit sind die durch einen Wandel der sozialen Strukturen hervorgerufenen Änderungen im Bestattungsbrauchtum (dieser trat in unterschiedlichen Regionen durchaus zu unterschiedlichen Zeiten ein, so dass die unten genannten Daten nur als Richtwerte zu betrachten sind). Archäologisch werden die Kelten hauptsächlich mit der La-Tène- Kultur der jüngeren Eisenzeit (ab dem 5. Jhd.) in Verbindung gebracht (dies bereits seit Joseph Déchelette), wobei aber die kulturellen und künstlerischen Wurzeln schon in der Hallstattkultur zu finden sind. Epoche
Stufe
Zeit (v. Chr.)
(späte) Bronzezeit
Ha A
1200–1000
Ha B
1000–850/750
Ha C
850/750–650
Ha D
650–475/450
Lt A
475/450–375
Lt B
375–275
Lt C
275–150
Lt D
150–15/0
Eisenzeit
[9]
Keltizitäts-Debatte Um die Kelten rankt sich trotz einer langen Forschungsgeschichte immer noch eine Vielzahl von Fragen. Wer sind sie? Wo kamen sie her? Eine lange Zeit in der Forschung vertretene Meinung besagte, dass das keltische Ursprungsgebiet in Böhmen sei und sich keltische Stämme von dort aus zuerst in Richtung Westen ausbreiteten, um anschließend in großen Süd- und Südostwanderungen in das Blickfeld der mediterranen Kulturen zu geraten. Doch zumindest die Vorstellung einer Wanderung aus einem gemeinsamen Ursprungsgebiet nach Westen muss heute als überholt angesehen werden. Vielmehr werden eher kulturelle Errungenschaften verbreitet worden sein, als große Personengruppen gewandert. Die Süd- und Südostwanderung keltischer Stämme ist hingegen anhand historischer Quellen gut belegt, auch wenn exakte Wanderwege und selbst die genaue Chronologie der Wanderung heftig diskutiert werden. Dies liegt unter anderem daran, dass eindeutige archäologische Belege für keltische Wanderbewegungen eher selten zu finden sind (zwar ist es möglich, mittels Strontiumisotopenanalyse an Zähnen Wanderungsbewegungen von Individuen nachzuweisen, aber ist diese Methode, vor allem aufgrund des Fehlens von Fundmaterial in statistisch relevanter Größenordnung ungeeignet, um Völkerwanderungen zu belegen). Für den süddeutschen Raum sind zwei Exzerpte von Interesse. Den frühesten Beleg für Kelten in Süddeutschland scheint der griechische Historiker Herodot (ca. 484–424 v. Chr.) zu liefern. Er berichtet: „Denn der Fluss Istros [Anm. Autor: gemeint ist die Donau] beginnt bei den Kelten und der Stadt Pyrene und fließt mitten durch Europa.“ (Hdt. 2,33) Gern wird in dieser Textstelle ein Indiz für die Existenz von Kelten im süddeutschen Raum gesehen. Bereits Henri d’Arbois de Jubainville nahm dieses Zitat 1877 als Beweis, dass die Heimat der Kelten in Süddeutschland zu suchen sei. Allerdings muss beachtet werden, dass Herodot weiter berichtet, die Kelten wohnten jenseits der Säulen des Herakles (Gibraltar) und allein hieran erkennt man die geographischen (Un-)Kenntnisse Herodots. Er unterteilte, wie viele seiner Zeitgenossen, aufgrund mangelnden Wissens den Norden der Welt in ein Gebiet der Kelten (Westen) und eins der Skythen (Osten). Dies spiegelt sich auch in den rekonstruierten Weltkarten des Eratosthenes (ca. 254–202 v. Chr.) und des Hekataios (ca. 550–490 v. Chr.) wieder (hierzu später
[ 10 ]
Einleitung
mehr im Kapitel Heuneburg). Doch haben wir mit dieser Erwähnung der κελτοι bei Herodot (und auch bei Hekataios von Milet, der noch vor Herodot schrieb) die erste namentliche Erwähnung einer mitteleuropäischen Bevölkerungsgruppe. Eine Art Ursprungslegende wiederum wird durch den römischen Annalisten Livius (ca. 59 v. Chr. – 17 n. Chr.) überliefert. Dieser berichtet vom gesamtgallischen König Ambigatus, der seine Söhne Bellovesus und Segovesus mit freiwilligen Siedlern auswandern lässt, um sein Reich von Überbevölkerung zu befreien (Liv. 5, 34). Bellovesus zieht nach Italien, Segovesus in die Hercynii saltus. Iulius Caesar (100–44 v. Chr.) folgend (der von Hercynia silva spricht), sind hiermit die Mittelgebirge vom Rhein bis in die Karpaten gemeint (Caes. Gall. 6, 24), d. h. auch der süddeutsche Raum. Nun schreiben aber Caesar und Livius in Lt D (um die prähistorische Zeiteinteilung zu benutzen) und der in Lt A schreibende Herodot liefert nur allzu vage Informationen. Hier setzt ein Teilproblem der Keltizitäts-Debatte ein, deren Grundlage im Prinzip die Frage ist, wie und woran man Kelten definieren kann. Wissenschaftshistorisch wurden ursprünglich die sogenannten keltischen Sprachen definiert, und das aufgrund der Tatsache, dass George Buchanan (1509–1582) die Schotten als Kelten bezeichnete. Auf eben dieser Basis wurden schließlich die keltischen Sprachen bestimmt, die allerdings nur auf den Britischen Inseln und Irland vertreten sind (abgesehen von wenigen Sprachtrümmern auf dem Festland wie das Lepontische). In die Bretagne (Bretonisch ist ebenfalls eine keltische Sprache) kamen keltische Sprachen durch walisische und kornische Einwanderer im 5. Jahrhundert n. Chr. Es leuchtet aber leicht ein, dass man anhand einer frühneuzeitlichen linguistischen Definition eine Bevölkerung eines weit entfernten Gebietes, deren Sprache man nicht kennt, nur schwer definieren kann. Archäologische Methoden können hier nur bedingt helfen, da man mit ihnen in erster Linie Kulturkreise (z. B. die Hallstatt- oder La-Tène-Kultur) definieren kann. Hier gibt es aber mehr regionale Unterschiede als Gemeinsamkeiten. Archäologisch muss der Keltenbegriff also als Teil eines umfassenden Kulturbegriffs gesehen werden, der damit seit Gustav Kossina (1858–1931) eine auf die materielle Kultur reduzierte Ausprägung hat. Es wird versucht, über die antiken Quellen eine Verbindung der Definitionen zu schaffen bzw. die eine oder andere Definition zu untermauern. Doch dies ist auch nur bedingt möglich, stammen die zu Rate gezogenen Quellen doch meist nicht aus derselben Zeit wie die archäologischen
[ 11 ]
unde. Genaugenommen wurde also eine sprachwissenschaftliche EinF teilung mittels einer ethnischen Bezeichnung definiert, eine Definition, die sich lange Zeit durchgesetzt hat und hierdurch gravierende Folgen, vor allem für die archäologische Forschung, nach sich zog. Das (zumindest vorläufige) Ergebnis der Debatte ist, dass es mit Sicherheit keine, das gesamte Mittel- und Westeuropa umfassende, keltische Kultur gegeben hat (wie es bis heute Verbreitungskarten in einigen Büchern und Museen suggerieren, die sich auf ein nicht haltbares archäologisch-linguistisches Keltenkonzept stützen), sondern vielmehr eine Vielzahl von Gesellschaften, die die eine oder andere Ähnlichkeit aufwiesen. Ein keltisches Reich, wie es ältere Literatur gerne suggeriert, hat es nie gegeben und die kulturellen Überlieferungen erlauben es ebenfalls nicht, von einem einheitlichen keltischen Europa in Hallstattund Latènezeit zu sprechen. Demnach ist die Bezeichnung Kelten eine Sammelbezeichnung, die „selbst keine Erklärungskraft besitzt und nur zu unserer vereinfachten Verständigung dient“ (Karl 2005; 106). Sie ist ungemein problematisch, aber ebenso nützlich und soll aus diesem Grund auch hier weiter verwendet werden.
Fürstengrab- / Fürstensitzdebatte Eine weitere für die keltischen Bodendenkmäler in Süddeutschland relevante Debatte ist die so genannte Fürstengrabdebatte (die sich auch auf die Fürstensitze übertragen lässt). Im Grunde rankt sich diese Debatte um die Bezeichnung eines mit reichen Beigaben in einem monumentalen Grab Bestatteten als „Fürsten“, da diese Bezeichnung im allgemeinen Sprachgebrauch auf eine machtpolitisch hervorgehobene Person schließen lässt. Als 1877 die Goldfunde im Grabhügel im Wald Gießübel-Talhaus nahe der Heuneburg alles bis dahin gefundene in den Schatten stellten, sprachen die Ausgräber von einem „Fürstengrab“. Der Begriff war geprägt, wurde gerne und viel benutzt und zugleich setzte die Diskussion über Macht und soziopolitische Stellung des/der Bestatteten ein. Seit den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts wird um den Begriff Fürstengrab eine heftige Diskussion geführt, da man allein aus dem Wert der Beigaben eines Grabes keine hundertprozentigen Rückschlüsse auf die Position des Bestatteten ziehen kann, sondern allenfalls die Art der Beigaben solche Rückschlüsse erlauben könnten (ausschlaggebend für die Diskussion
[ 12 ]
Einleitung
war u. a. der von Wolfgang Kimmig 1969 vorgelegte Kriterienkatalog für keltische Fürstensitze). Weiterhin wurde im Rahmen der Diskussion gezeigt, dass der auf den ersten Blick große Aufwand, der für eine der heute auffälligen Bestattungen betrieben wurde, weit weniger umfangreich war, als lange vermutet. Wurde ursprünglich angenommen, dass der Bau eines Fürstengrabes über ein Jahrzehnt in Anspruch genommen hat und nur von einer mehrere Gemeinschaften umfassenden Gruppe (nämlich der, welcher der Bestattete dann vorgestanden hätte) zu bewerkstelligen sei, wurde in dieser Diskussion gezeigt, dass auch durch die Arbeitskraft einer einzigen, relativ kleinen Dorf gemeinschaft innerhalb weniger Jahre ein imposantes Grab hätte errichtet werden können. Hierdurch würde der überregional einflussreiche Fürst aber zu einem Dorfoberhaupt degradiert werden. Als weiteres Indiz für ein Fürstengrab wird häufig die räumliche Nähe zu einem Fürstensitz gesehen (auch für die Bezeichnung „Fürstensitz“ sind die Ausgräber der Heuneburg verantwortlich, wurde doch bereits 1877 ein solcher in der Nähe des Fürstengrabes vermutet – eine Vermutung, welche die Ausgrabung von 1950 zu bestätigen schien). Da andererseits ein Fürstensitz oft durch die Nähe zu einem so genannten Fürstengrab definiert wird, ist man auch hier in einer Argumentationsschleife gefangen. Obwohl bereits 1974 Georg Kossak die Bezeichnung „Prunkgräber“ als Alternative genannt hat, hat sich diese Formulierung bislang nicht durchsetzen können. Inwieweit das mit eventuell verletzten Egos einiger Ausgräber zu tun hat (es klingt ja bekanntlich besser, wenn man sagen kann, dass man einen Fürsten ausgegraben hat), sei an dieser Stelle dahingestellt. Sicherlich gibt es aber auch touristische Gründe, da ein Fürstengrab einer Gemeinde mehr Besucher bringt, als nur ein Grab. Ist eine Bestattung im Vergleich zu anderen derselben Region und Epoche durch Aufwand und Ausstattung aufwändiger, so muss dies natürlich irgendwelche Gründe haben. Vielleicht war der Bestattete bedeutend (religiös, politisch, etc.), vielleicht beliebt oder einfach nur reich, aber auf ein genaues politisches Amt, gar eine Anführerschaft, kann anhand eines Grabes nur in Ausnahmen (z. B. in Hochdorf) geschlossen werden. Georg Kossak hält dies treffend fest, indem er in der Bestattung nur die „Reaktion der Nachwelt auf den Tod außergewöhnlicher Zeitgenossen“ (Kossak 1974; 13) sieht. Trotz allem wird in diesem Führer auch von „Fürsten“ gesprochen, da sich diese Bezeichnung bei den meisten Gräbern durchgesetzt hat.
[ 13 ]
Oppida Zu den wohl bedeutendsten oder zumindest auffälligsten keltischen Bodendenkmälern gehören die Oppida (die Bezeichnung selbst geht auf Iulius Caesar zurück). Insgesamt wurden bisher ca. 200 Oppida in neun Ländern gefunden. Die Forschung um diese oft als ersten Städte nördlich der Alpen bezeichneten Anlagen beginnt mit den Grabungen Joseph Déchelettes am Mont Beuvray, auf dem das antike Bibracte lag (1867– 1907). Zwar wurden bereits vorher einige Oppida ergraben (u. a. im Auftrag von Napoleon III.), doch entwickelte Déchelette das Konzept der „oppida-Zivilisation“. Doch erst der Archäologe Wolfgang Dehn schlug eine genauere Definition der Oppida vor. So musste nach Dehn ein Oppidum eine Mindestgröße von 30 ha haben, mit einer lückenlosen Mauer befestigt sein und idealerweise auf einer Anhöhe liegen. Außerdem musste sich diese befestigte Siedlung auf das 2./1. Jahrhundert v. Chr. datieren lassen. Diese Definition ist bis heute noch gültig, auch wenn die Größe der befestigten Fläche herabgesetzt wurde (auf 15 ha). Dass die Oppida allerdings fälschlich als älteste Städte bezeichnet werden, zeigt unter anderem das Beispiel der Heuneburg, einer Anlage, die aufgrund ihrer Größe und ihres Aufbaus sicher als Stadt zu titulieren ist, die aber wesentlich älter als die Oppida ist (s. Abb. 1). Die möglichen Gründe für die Entstehung der Oppida (deren Datierung regional äußerst unterschiedlich sein kann) sind vielfältig und in der Forschung viel diskutiert. Dabei spielt das Schutzbedürfnis ebenso eine Rolle, wie die Intensivierung des Fernhandels (wobei letzteres bereits bei der Entstehung der Fürstensitze eine wesentliche Rolle spielte). Denn für Letzteren benötigten Händler feste und vor allem sichere Anlaufpunkte. Weiterhin war eine gesellschaftliche Stabilität eine wesentliche Voraussetzung. Somit kann die Entstehung der Oppida als Indiz für einen gesellschaftlichen Wandel angesehen werden. Lange Zeit wurden in der Forschung mediterrane Einflüsse bei der Entstehung von Oppida postuliert. Vor allem keltische Söldner sollen das Wissen um das mediterrane Städtewesen in die Heimat getragen haben. Doch ist diese Argumentation eher fraglich. Auch wenn man mediterrane Einflüsse nicht gänzlich ausschließen kann, dürfen sie zumindest nicht überbewertet werden. Auffällig ist, dass die meisten Oppida in der zweiten Hälfte des 1. Jahrhunderts v. Chr. ihre Funktion verloren und zu großen Teilen verlassen wurden. Bis zu dieser Zeit sind die Oppida aber ein Zeichen für einen hohen Zentralisierungsgrad
[ 14 ]
Einleitung
der einzelnen Gebiete der stark strukturierten Keltiké. Doch muss festgehalten werden, dass Oppida ohne irgendwie geartete Vorgängersiedlungstypen nicht möglich wären. Diese können sowohl befestigt gewesen sein (dann ist an die Fürstensitze zu denken, wobei zwischen dem Verschwinden dieser Siedlungstypen und dem Auftauchen der Oppida auch 250 Jahre liegen, doch lassen sich Übergangstypen festmachen) oder unbefestigt. Allerdings hat die Forschung gezeigt, dass ein Oppidum nicht zwangsweise aus einer Vorsiedlung hervorgehen musste, sondern dass es oftmals tatsächliche Neugründungen waren. Somit kann man ein Bedürfnis nach einem Zentralort postulieren und damit auch eine Zentralisierung, auch wenn die tatsächlichen Gründe für die meisten Gründungen im Dunkeln bleiben. Kann man im westlichen Europa das Eindringen der Römer für das Verschwinden der Oppida als Grund nennen (diese forcierten die Neugründung von Städten in Ebenen und Tälern auch aus taktischen Gründen), sind die Gründe für das östliche Mitteleuropa noch unbekannt. Doch ist die Voraussetzung für ein Stadtleben eine funktionierende Geldwirtschaft.
Wirtschaft Dass die keltische Wirtschaft maßgeblich auf der Landwirtschaft beruhte, braucht einen erst einmal nicht zu überraschen. Doch zeigen vor allem Funde mediterraner Exportgüter in keltischen Gräbern, dass Kontakte zum Mittelmeerraum – vor allem zu den Etruskern, aber auch Griechen – bestanden haben. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass die mediterranen Gegenstände auch als Beutegut oder diploma tische Geschenke gedeutet werden. Allerdings ist letzteres ebenfalls ein Hinweis für Kontakte mit der Mittelmeerwelt. Doch vor allem Wein – antike Quellen bezeugen, dass die Kelten diesem, ursprünglich mediterranen Getränk sehr zusprachen – und das dazugehörige Trinkgeschirr fand regelmäßig seinen Weg nach Nordeuropa. Auch alltägliche (wenn auch aufgrund der Handelsentfernung teure) Schmuckstücke, die in relativ großer Zahl gefunden wurden (wie in Reinheim), zeugen von Fernhandelskontakten (im Falle von Bernsteinschmuck gab es Kontakte in den Ostseebereich). Geht man also von einem regelmäßigen NordSüd-Handel aus, muss bedacht werden, dass es sich bei den entsprechenden Grabfunden meist um Luxusgüter gehandelt hat und die Kelten daher adäquate Gegenleistungen erbringen mussten (selbst wenn sie als
[ 15 ]
Gastgeschenke zu deuten sind). Die antiken Quellen nennen einige der aus keltischen Gebieten stammenden Güter. Hierzu gehören vor allem Sklaven und Bergbauprodukte wie Salz und Erz. Vor allem das norische Eisen war im römischen Reich für seine Qualität bekannt. So schreibt u. a. Ovid in seinen Metamorphosen (Ov. 14, 712): „Jene, so bös wie die See, die sich hebt, wenn die Böcklein vom Himmel schwinden, so hart wie der Stahl,, der in norischem Feuer geglüht ist, […].“ (Übers. Breitenbach) Vor allem in Gallien spielte der Zwischenhandel mit dem aus Britannien stammenden Zinn eine nicht zu unterschätzende Rolle. Doch kann man in dem weiten keltischen Kulturraum, basierend auf Rohstoffvorkommen, Boden- und Klimabedingungen und natürlichen Handelswegen (wie Täler, Flussläufe etc.), verschiedene Wirtschaftsräume festlegen, so dass eine Betrachtung der gesamtkeltischen Wirtschaft an dieser Stelle nicht erfolgen kann (s. Abb. 2). Doch gibt es einige feste Faktoren, die für einen überregionalen Handel von Bedeutung sind. Dies sind neben den bereits genannten festen (und gesicherten) Siedlungen (Oppida oder in früherer Zeit die Fürstensitze), feste Gesellschaftsstrukturen, handelbare Rohstoffe, bekannte Handelswege und -partner, sowie ein akzeptiertes Tauschverfahren. Letzteres wird durch die Einführung eines Münzwesens erleichtert, wenn nicht gar erst ermöglicht. Der Beginn der keltischen Münzprägung wird in Lt C angesetzt, allerdings gab es wohl erst in Lt D genug unterschiedliche Nominalien, um von einem richtigen Währungssystem zu sprechen. Nachzuweisen ist dies anhand gefundener Tüpfelplatten (zur Herstellung der Schrötlinge) und Prägestempeln (so u. a. in Manching), aber auch von Feinwagen (ebenfalls in Manching und Hochdorf gefunden). Nun existieren auch typisch keltische Bildmotive. Ursprünglich wurden meist griechische Gold- und Silbermünzen (oft die von Philipp II. und Alexander III.) nachgeahmt. Eine Ausnahme hiervon ist Süddeutschland, wo eher römische Nominalien imitiert wurden.
Viereckschanze Sogenannte Viereckschanzen (der Begriff wurde 1910/11 von Paul Reinecke eingeführt) sind ein häufig anzutreffendes Bodendenkmal in Süddeutschland, welches allerdings ebenfalls einige wissenschaftliche Kontroversen hervorgerufen hat. Aufgrund ihrer nahezu quadratischen bzw.
[ 16 ]
Einleitung
rechteckigen Form und der sie umgebenden Wällen und Gräben wurden die Viereckschanzen im 19. Jahrhundert als römische Militärlager gedeutet. Ende des 19. Jahrhunderts führten latènezeitliche Funde in Viereckschanzen zu einer Umdeutung und diese Bodendenkmäler wurden einerseits zu keltischen Befestigungen bzw. Fliehburgen erklärt, andererseits aber auch zu keltischen Gutshöfen. Auch als Viehgehege – hierbei sollten die Wälle als Windschutz dienen – wurden die Viereckschanzen angesehen. Obwohl die letzte These noch Ende des 20. Jahrhunderts erneut formuliert wurde, sprechen die zahlreichen Funde innerhalb der Schanzen dagegen. Letztendlich wurden die Viereckschanzen aber auch als Heiligtümer/Kultplätze angesehen (ausschlaggebend waren hierfür die Grabungen an der Viereckschanze von Holzhausen, wo tiefe Schächte mit organischem Material, welches als Reste von Opfertieren gedeutet wurde, gefunden wurden), wobei die oft anzutreffende Nähe zu Grabhügeln als ein Argument herangezogen wird. Neuere Grabungen in Baden-Württemberg und Bayern zeigen aber, dass viele der Schanzen dauerhaft bewohnt waren und daher eher als die von Caesar erwähnten aedificia zu deuten sind. Letztendlich sprechen die Befunde inzwischen dafür, in den Viereckschanzen eine Denkmalgattung zu sehen, die wohl eine multifunktionale Bedeutung sowohl als Versammlungs- und Kultplatz als auch als Gutshof und Teil einer Siedlung hatten. Gegen diese Deutung spricht nicht, dass einzelne Viereckschanzen nur eine ausschließliche Nutzung aufwiesen. Schwerpunktmäßig sind Viereckschanzen vor allem in Bayern und Baden-Württemberg anzutreffen (als Grenze können Rhein, Main und Alpen gesehen werden) (s. Abb. 3).
[ 17 ]
Der Glauberg Die Reise zu den Kelten Süddeutschlands beginnt am östlichen Rand der Wetterau. Hier, zwischen Taunus und dem Vogelsberg, liegt Glauburg-Glauberg am Fuße des namengebenden Berges, der einer der letzten Ausläufer des Vogelsberges ist. Zu erreichen ist der ca. 32 km nordwestlich von Frankfurt am Main gelegene Ort mit dem Auto über die A8 (Ausfahrt Rehlingen). Anschließend folgt man der Beschilderung nach Rehlingen und zur Keltenwelt am Glauberg und dem Archäologischen Park Glauberg. Vor allem bei schönem Wetter ist der Parkplatz am Museum allerdings schnell überfüllt, alternativ kann man aber sein Auto auch am Bahnhof abstellen. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht man den Glauberg über Frankfurt am Main kommend nach ca. einstündiger Fahrt mit der Regionalbahn (Bahnhof Glauburg-Glauberg). Vom Bahnhof aus führt ein beschilderter Weg zum Museum und den frei zugänglichen archäologischen Park. Für den Spaziergang muss man ca. 40 Minuten rechnen. Ob man sich zuerst zu einem Spaziergang auf das Plateau (271m NN) aufmacht, zum rekonstruierten Grabhügel mit der Prozessionsstraße geht oder in das Museum, sei dem Besucher selbst überlassen, da es hier keine zwingend notwendige Reihenfolge gibt. Vom Museum hat man einen hervorragenden Blick auf den rekonstruierten Grabhügel mit den aufgestellten Pfosten, die als Kalendarium beschrieben werden. Auf dem Plateau ist ein Rundweg ausgeschildert. Der Besucher wird hier an 21 Stationen informiert.
Die Geschichte der Grabungen Bereits vor der archäologischen Erschließung waren das Areal und die Befestigungen auf und um den Glauberg der Bevölkerung bekannt und bereits seit dem 16. Jahrhundert beschäftigten sich Gelehrte mit ihm. Doch galt das Interesse zu dieser Zeit hauptsächlich der aus der Stauferzeit stammenden Reichsburg (erste urkundliche Erwähnung 1247). Im 19. Jahrhundert begann die ernsthafte wissenschaftliche Beschäf tigung mit dem Glauberg durch den Friedberger Altertumsforscher Johann Philipp Diefenbach, der die Wallanlagen zuerst teils den Chatten teils den Römern zuschrieb, sich zuletzt aber nicht mehr festlegen wollte. Die erste gezielte Grabung fand im Jahr 1844 statt und brach-
[ 18 ]
Der Glauberg
te mittelalterliche Funde hervor. Im Anschluss erfolgten weitere Untersuchungen der Wallanlage durch Friedrich Kofler, der den ersten halbwegs verlässlichen Plan des Glauberges erstellte. Ausgehend von bei Flurbereinigungen gemachten Zufallsfunden fanden ab 1912 die ersten systematischen Grabungen statt. Die umfangreichen Grabungen der dreißiger Jahre des 20. Jahrhunderts (1933–1939) durch Heinrich Richter zeigten, dass der Berg bereits in der Jungsteinzeit (Mitte des 5. Jahrtausends v. Chr.) besiedelt war. Dies belegen Funde der so genannten Rössener Kultur und der Michelsberger Kultur. Den Endpunkt der Besiedlung des Bergrückens markiert die bereits genannte staufische Reichsburg. Späthallstatt-/Frühlatènezeitliche Funde beweisen aber auch eine frühkeltische Besiedlung. Seit Mitte der achtziger Jahre des 20. Jahrhunderts führt das Landesdenkmalamt Hessen Untersuchungen auf dem Plateau durch, doch ist der wohl spektakulärste Fund des Glaubergs der Initiative von Mitgliedern des Heimatvereins Glauberg zu verdanken. 1987 entdeckten diese aus der Luft am Fuße des Plateaus einen Kreisgraben, der 1994 vom Denkmalamt untersucht wurde und sich als frühlatènezeitlicher Grabhügel herausstellte. Die in der Folge gefundenen Gräber, Gräben und Pfostenlöcher führten zu diversen Kontroversen in der Forschung, zeigen aber die Bedeutung, die der Glauberg in der frühen Latènezeit gehabt haben muss. Zu dieser Zeit war er anscheinend ein überregionales Zentrum. Der Aufbau des Museums und des archäologischen Parks konnte durch großzügige Sponsorengelder finanziert werden. So konnte u. a. im Jahr 2007 die als Kalenderbauwerk gedeutete Pfahlkonstruktion rekonstruiert werden. Das Museum selbst, dessen Gebäude ein Ergebnis eines Architekturwettbewerbs ist, eröffnete 2011. Für die damalige Zeit aufsehenerregend war die Bergung der Gräber. Diese erfolgte (zuerst bei Grab 1 aus Grabhügel 1) als Block. Ein Problem bei der Analyse der Funde (dies gilt gleichsam für die Funde aus den meisten hier behandelten Gräbern) war, dass sie durch das Gewicht der Erd- und Steinmassen, die auf ihnen lasteten, zu einer teilweise nur wenige Zentimeter dicken Schicht zusammengedrückt waren und sich dadurch auch die Zusammenhänge verschoben haben. Festzuhalten ist auch, dass man in der glücklichen Lage ist, bei den Glauberger Funden eine für die Region verhältnismäßig große Zahl organischen Materials (wenn auch oft nur in kleinsten Fragmenten) nachweisen und zuordnen zu können. Im Falle zum Beispiel der Kan-
[ 19 ]
neninhalte liegt es an den konservierenden (weil giftigen) Eigenschaften der Metallsalze, aber auch die Bodenbeschaffenheit und vor allem die vorbildlichen Bergungs- und Bearbeitungsmethoden der Gräber spielen eine nicht zu unterschätzende Rolle.
Die Befestigungsanlage Die älteste Befestigung des Glauberg-Plateaus ist mit Sicherheit der wohl bereits in der Späthallstattzeit erstmalig angelegte Ringwall (die Datierung erfolgte mittels C14-Daten). Hierbei handelt es sich genauer gesagt um eine zum Wall zusammengestürzte Mauer, die eine Fläche von nahezu 8 ha umschließt, auf der sich auch die eigentliche Siedlung befand. Die Erweiterung der umschlossenen Fläche durch den am Nordhang gelegenen Annexwall (auf ca. 12 ha), diente teilweise dem Schutz einer dort befindlichen Quelle und damit der Sicherung der Wasserversorgung (es wurde ein Wasserbecken von 50 x 150 m gefunden). Allerdings ist die Wall-Graben-Anlage im Bereich des Annexwalls nicht geschlossen, so dass fortifikatorische Gründe nicht ausschließlich herangezogen werden können. Zugleich konnten Grabungen zeigen, dass dieser Bereich (entgegen älteren Vermutungen) auch besiedelt war. Weitere, im Süden und Westen gelegene Wallanlagen können bislang in keinen Zusammenhang mit dem Ring- und Annexwall gebracht werden, allerdings gab es Vermutungen, dass die Anlage in der Spätlatènezeit zu einem Oppidum ausgebaut werden sollte. Das Gesamtbild weist aber zu viele Lücken auf, um in irgendeiner Form als Schutz gedient zu haben. Vielmehr werden diese Gräben als Bestandteil der Grabanlage gedeutet. Doch konnte auch dies bislang nicht bewiesen werden, vor allem deshalb, weil hier bislang noch keine systematischen Ausgrabungen stattgefunden haben. Eine alternative Deutung besagt, dass die Befestigungsanlagen schlicht nicht fertig gestellt wurden. Auch die Deutung als Fürstensitz resultiert einzig aus der Existenz des Prunkgrabes, da der allgemeinen Definition entsprechende Funde auf dem Plateau fehlen. Insgesamt wird die gesamte Graben-, Wall- und Postenanlage meist als „Heiliger Bezirk“ angesehen. Wenn die Anlagen keinen rein fortifikatorischen Nutzen hatten, wie oben beschrieben, stellt sich natürlich die Frage nach ihrer Funktion. Die Deutungen sind hier durchaus unterschiedlich. Teile der Anlage könnten Bestandteile eines Kalendariums sein (dazu unten mehr). Es
[ 20 ]
Der Glauberg
gibt aber auch die Vermutung, dass eine wichtige Handelstrasse direkt am Glauberg vorbeiführte und damit die Gesamtanlage repräsentative Zwecke erfüllen sollte.
Die Grabanlage(n) Die aus der Luft entdeckte, nach Südosten hin offene (hier setzte die sogenannte Prozessionsstraße – zwei im Abstand von 10 m parallel verlaufende Gräben – an) ringförmige Wall-/Grabenanlage entpuppte sich als Sensation, erwies sie sich doch als frühlatènezeitliches Prunkgrab, welches von weiteren Gräben umgeben und somit Teil einer monumentalen Grabanlage ist. Im Inneren des ca. 48 m durchmessenden ehemaligen Grabhügels (Grabhügel 1) wurden zwei Gräber (Grab 1 und Grab 2) gefunden, von denen auffälligerweise keins im Zentrum des Grabhügels lag. Die auffälligen Beigaben bezeugen die Bedeutung der Bestatteten und dienten als Indiz für die Deutung des Glauberges als Fürstensitz. Der Grabhügel und die Grabenanlagen wurden in neuester Zeit rekonstruiert, so dass man eine gute Vorstellung von der Anlage bekommt. Der Kreisgraben selbst hat eine variable Breite von 8,5 bis 14 m, so dass sich ein äußerer Durchmesser von ca. 68 m bei einer Tiefe zwischen 2,2 und 3,7 m ergibt, wobei die unterschiedliche Tiefe durch die Hanglage der Grabanlage bedingt ist. Die Befunde des Grabhügel 1 (die beiden Gräber und eine Grube, wobei keine zeitliche Abfolge nachzuweisen ist) sind in Verlängerung der 350 m langen Prozessionsstraße gereiht. Im Zentrum des Hügels befand sich die fundleere nahezu quadratische Grube (Seitenlänge 2,4 m x 2,8 m). Die Grube von Grab 1 hatte eine Größe von 4 m x 2,9 m, die sich zum Boden hin (bei einer Tiefe von 2,5 m) auf 3 m x 2,1 m verengt und mit humosem Boden verfüllt war. Die eigentliche Grabkammer, ursprünglich aus Eichenholz gefertigt, hatte eine Grundfläche von ca. 2,2 m x 1,1 m bei einer vermuteten Höhe von 0,8 m. Das Grab enthielt neben der Körperbestattung eines ca. dreißigjährigen Mannes eine mit Metansatz gefüllte bronzene Schnabelkanne, ein Eisenschwert, drei Lanzen mit Eisenspitzen, ein Köcher mit drei Pfeilen, ein Bogen in einem Lederfutteral, ein lederüberzogener Holzschild mit eisernem Randbeschlag und einen eisernen Schildbuckel. Als Kleidungsreste wurden nur ein Ledergürtel mit Bronzebesatz, sowie als Teil der Fußbekleidung gedeutete Bronzenieten und Eisen-, Stoff- und Lederreste gefunden. Weithin wurden zwei
[ 21 ]
goldene Ohrringe, ein verzierter Halsring, sowie drei Armringe (von denen einer am rechten Handgelenk getragen wurde, einer im Beckenbereich lag und der letzte zerbrochen abseits des Körpers postiert war), ein Fingerring, drei Bronzefibeln, eiserne Nieten, Röllchen und Stäbe (Nieten und Röllchen sind wahrscheinlich Teile eines unbekannten Gegenstandes, die Stäbe wurden in Schwertnähe gefunden) und sechs ca. 1,5 m lange Eschenholzstäbe mit Bronzetüllen gefunden, deren Funktion bislang nicht bekannt ist (ein Vergleich mit skythischen Funden schürt die Vermutung, dass es sich um Zeltstäbe gehandelt haben könnte). Weiterhin wurden die Reste einer blattkronenförmigen Kopfbedeckung gefunden. Die Beigaben waren zum größten Teil in Stoff gehüllt. Der Tote selbst war auf zwei mit Leder überzogene Balken gebettet. Analysen der stark erodierten und verwitterten Knochenreste ergaben, neben dem bereits genannten Alter von ca. dreißig Jahren, dass der Verstorbene ca. 1,69 m groß, mit starkem Knochenbau und ebensolchen Muskelansätzen war. Die Todesursache lässt sich nicht feststellen, wohl aber der gute Ernährungs- und Gesundheitszustand. Die Befundsituation machte deutlich, dass es sich um ein ungestörtes Grab handelte. Daher entschloss man sich, das Grab als Block (mit einem Gewicht von 2500 kg) zu bergen, um es dann unter optimalen Bedingungen untersuchen und die Funde restaurieren zu können. Diese M ethode wurde hier erstmals angewandt und aufgrund des Erfolges schließlich auch bei den anderen Gräbern und später auch bei anderen Grabungen angewandt. Grab 2 fand man im Randbereich von Grabhügel 1 an der Stelle, wo die Prozessionsstraße eine Lücke im Kreisgraben bildet. Die Grabgrube hatte eine Größe von 2,3 m x 1,2 m. In ihr fanden sich die Reste eines Holzbehälters, in dem die Überreste des Toten bestattet wurden. Eine Abdeckung wurde nicht gefunden, so dass davon auszugehen ist, dass hierfür Stoffe oder Leder/Felle verwendet wurden. Dem hier bestatteten dreißig bis vierzigjährigen Mann (mit einer Größe von 1,69 m) wurden ein Eisenschwert, mehrere unterschiedlich große eiserne Lanzenspitzen und ein nietenbesetzter Gürtel mit Gürtelhaken, Beschlägen, Hohlringen und Kettchen mitgegeben. Weiterhin fand man, wohl zur Tracht gehörig, eine Bronzefibel, fünf Bronzebuckel sowie Reste des Schuhbesatzes. Bedeutsam ist die 50 cm große Röhrenkanne aus Bronze, die mit Met gefüllt war (oder zumindest einem Getränk, welches stark mit Honig versetzt war). Im Gegensatz zu Grab 1 liegt hier eine Brandbestattung vor, so dass zumeist nur mittelgroße Leichenbrandfragmente (1–5 cm, in seltenen Fällen bis zu 8,5 cm) zu finden sind.
[ 22 ]
Der Glauberg
Ca. 240 m vom Grabhügel 1 (noch innerhalb der Graben-Wall-Anlage) wurde eine weitere Bestattung (Grab 3) in einem bislang nicht rekonstruierten, aber nur halb so großen Hügel (Grabhügel 2) gefunden. Dies geschah 1997 durch geomagnetische Prospektion. Am Nordrand des Kreisgrabens finden sich zwei unregelmäßige Pfostenreihen (in NordSüdrichtung angelegt). Der Grabhügel war ebenfalls von einem kreisförmigen Spitzgraben mit ca. 28 m Außendurchmesser umgeben. Die ca. 2,7 m x 1,4 m große Grabgrube war der einzige Befund dieses Hügels. Eine Grabkammer ist nicht nachweisbar, doch wurden Holzreste nachgewiesen, die zu einem Baumsarg gehört haben können. Dieser war offenbar mit Fellen ausgelegt. Dem hier Bestatteten (auch dieses Grab wurde als Block geborgen), dessen Knochen durch die Bodenverhältnisse weitgehend aufgelöst waren, waren ein Eisenschwert (77,4 cm Länge) in einer unverzierten Eisenscheide und eine Lanze mit großer Eisenspitze mitgegeben. Das Schwert war in Fell und Textil eingeschlagen. Am Fußende wurde ein Schuhbesatz aus Bronze und Eisen gefunden. Ein offener goldener Armring (Durchmesser 7 cm) und ein goldener Fingerring (Durchmesser 2,2 cm) bildeten die Schmuckbeigaben. Spuren auf der Oberfläche des Armreifes beweisen die häufige Benutzung dieser Schmuckstücke. Hingegen scheint der Fingerring ausschließlich für die Bestattung hergestellt worden zu sein. Weiterhin wurde ein Gürtel mit bronzenen Gürtelhaken mit stilisiertem Vogelkopf und kästchenförmigem Beschlag sowie drei zum Gürtel gehörige Hohlringe aus Bronze gefunden. Die Tracht wird durch zwei unterschiedlich große Fibeln ergänzt. Bei der Größeren handelte es sich um eine bronzene Maskenfibel mit einer durchbrochenen Schmuckplatte mit Verzierungen aus insgesamt 109 Korallenperlen. Die kleinere war aus Bronzedraht mit Goldauflage gefertigt. Neben dem Grabhügel 1 sind inzwischen insgesamt drei oder vier weitere Hügel bekannt, über deren Inhalt aber bislang kaum oder gar keine Erkenntnisse vorliegen. Alle Gräber lassen sich in das 5. Jahrhundert v. Chr. datieren, wobei bislang noch keine Aussage zur zeitlichen Reihenfolge der Bestattungen gemacht werden kann. Die sogenannte Prozessionsstraße wird von zwei 350 m langen, im Abstand von durchschnittlich 10,2 m parallel nach Südosten verlaufenden 6,7 m breiten und 2,8 m tiefen Spitzgräben gebildet, deren Aushub als seitlicher Wall aufgeschüttet war. Auch hier ist auffällig, dass diese Straße nicht zentral auf den Grabhügel zuläuft. Daher diente sie mit
[ 23 ]
Sicherheit nicht als Zugang zum Grabhügel, sondern entweder als symbolischer Weg des Toten in das Totenreich oder (und) als Teil des nach einigen Deutungen am Glauberg zu findenden Kalenderheiligtums (dazu später mehr). Ausschlaggebend für beide Deutungen ist eine Ausrichtung des Komplexes an astronomische Gegebenheiten. Die Bedeutung der gesamten im Südosten des Plateaus gelegenen Anlage ist im weitesten Sinne im sakralen Bereich zu suchen.
Die Pfostenlöcher und ihre Deutung Neben den Gräben und Gräbern wurden auch diverse Pfostenlöcher nachgewiesen, die in der Forschung zu interessanten (und diskutablen) Schlussfolgerungen geführt haben. Für den Besucher vorteilhaft erweist es sich, dass die meisten Pfosten wieder aufgestellt wurden, so dass man sich ein eigenes Bild machen kann (s. Abb. 4). In den nordwestlich des Grabes gelegenen Gräben, bzw. an deren Rändern sind die besagten Pfosten nachgewiesen worden. Weiterhin wurden vier Pfostenlöcher gefunden, die ein Rechteck bilden, in dessen Zentrum zwei weitere Pfosten nachzuweisen sind. Diese Kombination wird zumeist als Gebäude klassifiziert. Aufgrund der räumlichen Nähe zum Fundort der Statue und weiterer Statuenfragmente, liegt die Deutung nahe, in diesem Gebäude den eigentlichen Aufstellungsort der Statuen zu sehen, so dass, je nach Deutung der Statuen, dieses Gebäude als Tempel oder Heroon bezeichnet werden kann.
Der Glauberg als Kalenderheiligtum Das im Süden bzw. Südwesten des Glaubergplateaus gelegene GrabenPfosten-System wurde vor einigen Jahren dahingegen untersucht, ob es sich um ein Kalenderheiligtum handeln könnte. Da allein die Monumentalität der Anlage, welche die Landschaft beherrscht haben muss, für eine überregionale Bedeutung, wie sie in der Regel nur Heiligtümer haben, spricht, liegt es nahe, die Frage nach der Funktion dieses Heiligtums zu stellen. Betrachtet man die Befunde erst einmal neutral, so kann man recht schnell Auffälligkeiten erkennen. So führen die als Prozessionsstraße gedeuteten parallelen Gräben nicht zentral auf den ursprünglich sicherlich die Anlage beherrschenden Grabhügel. Dieser wiederum
[ 24 ]
Der Glauberg
lag nicht an einer topographisch ausgezeichneten Stelle, wie z. B. Grabhügel 2. Außerdem lassen sich einige Pfostenlöcher und Gräben ohne wirklich deutbare Funktion nachweisen. Doch deuten die gradlinige Ausrichtung, sowohl der orthogonal zueinanderstehenden Gräben, wie auch der Prozessionsstraße, auf eine absichtliche Ausrichtung durch die Erbauer hin. Eine solche Ausrichtung kann sich nun natürlich an Marken innerhalb der Anlage orientieren oder an Geländemarken, aber auch an astronomischen Phänomenen. Eindeutig ausgerichtet ist die Prozessionsstraße, aber es lassen sich keine signifikanten Geländemarken ausmachen. Astrophysikalische Untersuchungen zeigten aber, dass die Gräben auf den Punkt wiesen, wo im 5. Jahrhundert v. Chr. der Mondaufgangspunkt für die Große Südliche Mondwende lag. An diesem Punkt geht der Mond alle 18,6 Jahre auf und die Gräben markieren damit einen astronomischen Wendepunkt. Warum dieser Punkt allerdings mittels zweier Gräben markiert wurde, lässt sich nicht sagen. Allerdings hat der so definierbare Zyklus von ca. 19 Jahren an sich keinen praktischen Nutzen (z. B. für die Landwirtschaft), was zwar für einen rein sakralen Zweck des möglichen Kalendariums spricht. Allerdings muss man sich fragen, inwieweit dieser Aufwand gerechtfertigt gewesen sein sollte und ob nicht vielleicht doch nur eine zufällige Übereinstimmung vorliegt. Die entdeckten Pfosten wiederum könnten als Markierungen gedeutet werden, über die man von einem bestimmten Punkt aus astronomische Ereignisse anpeilen konnte. Die Hanglage der Anlage ermöglicht ein Anpeilen über den Grabhügel hinaus. Doch lassen sich nicht alle Pfosten eindeutig als Peilmarken erkennen. Wofür diese Pfosten letztendlich dienten, kann nur vermutet werden (ästhetische Gründe können ebenso eine Rolle gespielt haben, wie der Wunsch nach einer Alternativ peilung zum Beispiel bei schlechtem Wetter). Insgesamt ließ sich ein möglicher Beobachtungspunkt rekonstruieren. Da dieser markiert ist und auch die Pfosten rekonstruiert wurden, können sich Besucher jetzt ihr eigenes Bild machen (wenn sie am richtigen Tag am Glauberg sind).
Das Plateau Besucher, die heute das Plateau des Glauberges besichtigen, können bis auf die Gräben und die Wälle keine keltischen Siedlungsspuren mehr finden, vielmehr gehören die heute zu sehenden Gebäudereste zur mittelalterlichen Besiedlung. Nichtsdestotrotz muss der Glauberg in kelti-
[ 25 ]
scher Zeit von großer Bedeutung gewesen sein. Vor allem nach dem Auffinden des Fürstengrabes muss angenommen werden, dass sich der entsprechende Fürstensitz auf dem Glaubergplateau befunden hatte. Die Ausgrabungen haben gezeigt, dass das Plateau von einem Ringwall umschlossen war. Dieser entstand ca. 500 v. Chr. und hat eine Länge von rund 1,5 km. Die keltische Siedlung scheint um 450 v. Chr. von einer Feuersbrunst heimgesucht worden zu sein, doch wurde die zerstörte Mauer und sicherlich auch die zerstörten Gebäude schnell wieder neu errichtet. In diesem Zusammenhang wurde auch das besiedelte Areal vergrößert. Insgesamt ist die Deutung des Glaubergplateaus als Fürstensitz aber aufgrund der allgemeinen Definition problematisch. So fehlen zum Beispiel importierte Luxusgegenstände in der Siedlung ebenso wie andere Anzeichen von besonderem Wohlstand (was ein auffälliger Widerspruch zu den reichen Grabbeigaben darstellt).
Die Funde Die Statue des Fürsten vom Glauberg Die im nordwestlichen Kreisgraben des großen Grabhügels gefundene, nahezu lebensgroße 230 kg schwere Statue stellt einen der bedeutendsten Funde des Glauberges dar, da solche Statuen, die normalerweise nicht als Grabbeigaben benutzt wurden, naturgemäß der Zerstörung von Menschen und Natur verstärkt ausgesetzt waren. Somit ist der hervorragende Zustand der Glauberger Statue ein Glücksfall, ist sie doch bis auf die Füße vollständig erhalten. In ihrer Nähe wurden außerdem zahlreiche Fragmente weiterer (vermutlich dreier) Statuen gefunden, auf die an dieser Stelle aber nicht weiter eingegangen werden kann. Doch scheint es, als wären sich die Statuen, bis auf Ausführungsdetails, ähnlich. Die Deutungen der aus Bundsandstein, wie er lokal (das nächste Vorkommen ist ca. 3 km entfernt in Büdingen zu finden) zu finden war, gefertigten Statue gehen auseinander (Gottheit – Heros – der Bestattete). Da die Ausstattung der Statue allerdings große Parallelen zum Grabinventar von Grab 1 hat, ist die Vermutung erlaubt, in ihr ein Abbild des Bestatteten zu sehen. Inwieweit die Statue damit auch einen (idealisierten) Keltenfürsten des 5. Jahrhunderts v. Chr. darstellt, sei, die Fürstengrabdebatte bedenkend, dahingestellt. Zu den auffälligen Merkmalen der Statue gehören, neben der ungewöhnlichen Proportionen (kräftige Beine, eher schmächtiger Oberkörper), eine ornamentierte
[ 26 ]
Der Glauberg
Oberbekleidung (sie stellt wohl einen Kompositpanzer dar, der aus einzelnen waagerechten und sich überlappenden Lagen besteht; solch ein Panzer kann sowohl aus Leinen als auch aus Leder gefertigt worden sein), ein Halsring mit drei zapfenförmigen Verzierungen, der Ähnlichkeiten mit dem im Grab gefundenen aufweist, ein Schwert (auf der rechten Seite) und einen linkshändig getragen Schild mit Randbeschlag sowie drei Armreifen (links) und einem Fingerring (rechts). Die freie rechte Hand liegt auf dem Brustbein. Das Gesicht der Statue ist stilisiert, mit großen Augen und Schnurr- und Kinnbart. Weiterhin trägt die Statue auf dem Kopf eine so genannte Blattkrone. Dieses Merkmal ist r elativ häufig bei keltischen Statuen oder Stelen zu finden. Aufgrund der Asymmetrie der Blätter werden diese häufig mit Mistelblättern verglichen und diese Form der Kopfbedeckung daher als Mistelkrone bezeichnet. Aus antiken Quellen ist bekannt (auch wenn die Quellenstellen nicht unumstritten sind), dass die Mistel bei den Kelten heilig gewesen ist. So schreibt Plinius (Plin. nat. hist. 16, 249): „Denn nichts halten die Druiden – so nennen sie ihre Magier – für heiliger als die Mistel und den Baum, auf dem sie wächst, sofern es nur eine Eiche ist.“ (übers. Hofeneder 2008) Die Darstellung dieser Kronen scheinen den römischen Naturkundler zu bestätigen und Statuen/Stelen mit entsprechender Ikonographie wurden – auch aufgrund des Fehlens einer erhaltenen Mistelkrone – sakral gedeutet. Auch hier brachte der Glauberger Grabhügel Neues. Ein gefundener Eisendraht sowie weitere lange Zeit nicht deutbare Beigaben konnten zu einer Drahtunterkonstruktion einer realen Mistelkrone rekonstruiert werden. Zwar ist damit die eigentliche Bedeutung der Krone noch nicht stichhaltig erklärt, aber zumindest scheint bewiesen, dass es sich hierbei nicht nur um ein Symbol, sondern um einen realen Gegenstand gehandelt hat. Grundsätzlich muss aber davon ausgegangen werden, dass die Mistelkrone ein Statusobjekt und seinen Träger als machtvoll darstellt. Da aber nicht nur Statuen mit Mistelkrone gefunden wurden, sondern auch andere Objekte, von denen man ausgehen muss, dass sie keine reale Person darstellten (zu denken ist hier u. a. an den im Reinheimer Prunkgrab gefundenen Spiegelgriff), war solch ein Kopfschmuck wohl auch ein Attribut von Göttern und Heroen, was aber nicht zwangsläufig bedeutet, dass ein weltlicher Träger automatisch auch eine sakrale Funktion haben musste. Neben dem bereits oben erwähnten Pfostenviereck, welches als Heroon gedeutet werden kann, ist westlich des Hügels ein Grabenviereck mit
[ 27 ]
einer Größe von 11 m x 12 m nachweisbar. Hier ergaben die Ausgrabungen keinerlei Funde oder Befunde, trotzdem wird dieser Bereich oftmals als Kultbereich und/oder Tempelbezirk gedeutet, in dem die Statuen eventuell auch gestanden haben mögen. Die Ausrichtung der Statuenniederlegung entsprach der Gesamtausrichtung der Anlage. Dies, sowie der Erhalt der Statue und die sorgfältige Rückenlage, sprechen für eine gewollte Deponierung an der Stelle. Der ursprüngliche Standort hingegen ist unbekannt (s. Abb. 5).
Die Waffen In Grab 1 wurde ein 78 cm langes Eisenschwert gefunden, welches sich in einer Scheide aus Eisen mit aufgenieteten Bronzeblechen befand. Durch die Zerstörung des Grabes wurde das Schwert in mehrere Teile zerbrochen und vor allem der Griff (bestehend aus mit Ziernieten zusammengehaltener hölzerner Griffschale und Bronzeknauf mit Liniendekor und Einlagen) in Mitleidenschaft gezogen. Die Schwertscheide war vielfältig verziert, wofür erneut auch Koralle benutzt wurde (u. a. am Ortband). Außerdem weist die Schwertscheide vielfältige ornamentale Gravuren auf. Dabei hat der Künstler darauf geachtet, dass sich die Motive über die Mittelrippe spiegeln. An der Spitze kann man zwischen den Zirkelmotiven Tiere erkennen, die von Palmetten eingerahmt werden. Am Scheidenmund ist ein Mischwesen eingraviert und die Rankenmotive sind weit aufwändiger gestaltet. Ein Dekor aus Tierornamentik findet sich auch auf der Rückseite der Schwertscheide, wobei man hier Motivgruppen einteilen kann (an der Spitze zwei Tiere mit langen, ein Muster bildenden Schwänzen, in der Mitte sich wiederholende Vogel ornamentik, später tiergestaltige Muster). Der Schwertgriff, der sich trotz seiner starken Zerstörung in seiner Form rekonstruieren lassen kann, scheint in seiner Form dem Griff an der Statue zu entsprechen. Außerdem fand man drei große eiserne Lanzenspitzen von hoher handwerklicher Qualität. Die Lanzen hatten vermutlich eine Länge von mehr als 1,9 m und der Schaft war zwischen 1,3 und 1,8 cm dick. Ursprünglich waren diese Lanzen wohl stoffumwickelt in das Grab gelegt worden. Da es sich um mehrere Lanzen handelt, kann man schließen, dass diese auch als Wurfgeschosse benutzt wurden. Als weitere Bewaffnung war dem Toten aus Grab 1 ein stoffummantelter Holzköcher mit drei Pfeilen sowie (vermutlich) ein Bogen beigegeben. Aufgrund des schlechten Erhaltungszustandes des Köchers stellen die vorhandenen Rekonstruktionen nur Interpretationen dar. Er war ver-
[ 28 ]
Der Glauberg
mutlich ca. 50 cm lang und ca. 10 cm breit und stoffummantelt. Zwei gefundene Bronzeringe gehörten zur Befestigung der Tragevorrichtung. Die Köcherinnenseite bestand aus einem, mit sechs Nieten befestigten, Lederfutteral. Auffällig sind die drei gefundenen, in Stoff gewickelten Pfeilspitzen, da sie drei unterschiedliche Formen (eine Tüllenpfeilspitze und zwei unterschiedliche Blattpfeilspitzen) hatten. Auch dass die Pfeile mit den Spitzen nach oben im Köcher lagen, ist ungewöhnlich und entsprach sicherlich nicht der alltäglichen Tragweise. Parallelen hierfür finden sich aber auch in anderen Gräbern (z. B. Grab VI von Hohmichele), so dass ein symbolischer Grund angenommen werden kann. Vom Bogen selbst sind kaum Rückstände erhalten. Es wurde nur ein mehrfach geschwungenes Holzobjekt nachgewiesen. In ihm den Bogen zu vermuten, liegt aber nahe. Nachzuweisen war außerdem, dass die Oberfläche des Bogens ein pigmentiertes eingeschnitztes Mäandermuster aufwies. Durch diese Schnitzerei wurde die Stabilität des Bogens natürlich beeinträchtig, inwiefern die Nutzbarkeit aber beeinträchtigt wurde, kann nicht gesagt werden. Der Fund/Nachweis von zwei Ring-Niet-Kombinationen und Kollagenfasern auf beiden Seiten des Bogens lassen die Vermutung zu, dass auch eine Bogentasche existiert hat. Auf der Bestattung lag ein 1,1 m x ca. 70 cm großer ovaler Holzschild, der ebenfalls mit Stoff umwickelt war und einen eisernen Schildbuckel (43 cm x 28 cm) besaß. Der Schild bestand aus, auf beiden Seiten mit Rinderleder bespanntem, Lindenholz mit einer Gesamtdicke von gerade einmal einem Zentimeter. Am unteren Rand konnten eiserne Rand beschläge nachgewiesen werden. Der Schildbuckel war reich mit Zirkelornamentik verziert und mit sechs Eisennieten befestigt. Das Leder war wahrscheinlich bemalt oder anderweitig verziert. Das Schwert (aus Eisen) in Grab 2 war etwas länger (83 cm) als das in Grab 1 und, ebenso wie die Scheide aus Eisen und Bronze, stark beschädigt. Es wurde offensichtlich mit Textil eingeschlagen in das Grab gelegt. Außerdem ließ sich ein breiter Gürtel (den Verschluss bildete ein mit Fabeltieren verzierter Bronzehaken) nachweisen, der sicherlich zum Schwert gehörte. Hierbei handelt es sich vermutlich um die Schwertaufhängung. Knauf und Ortband sind aus Bronze und hatten Einlagen. Dass diese aus Koralle waren, wird vermutet, allerdings sind diese Einlagen größtenteils nicht mehr vorhanden. Auch das Bronzeblech der Schwertscheide ist reich mit Mäandern, Fabeltieren und floralen Mustern verziert. In diesem Grab wurden weiterhin vier Lanzenspitzen nachgewiesen, die ursprünglich ebenfalls in Textil eingeschlagen waren.
[ 29 ]
Die am Glauberg gefundene Schwertform (Stufe Lt A) hat ein weites Verbreitungsgebiet von den Mittelheingebirgen (teilweise der Champagne) bis nach Hallein und Niederösterreich. Oft wird versucht, anhand der Bewaffnung die Stellung des Bestatteten und den sozialen Rang zu bestimmen. Doch sind solche Aussagen mit Vorsicht zu genießen, da wir selbst bei vergleichender Betrachtung wenig über den tatsächlichen Wert einer Waffe und/oder ihren realen Nutzen sagen können. Daher lässt sich nur schwer sagen, ob es sich bei einem Schwert um ein Statussymbol oder eine wirkliche Waffe handelt und damit einhergehend, ob der Träger eine sozial hoch angesehene Person war oder ein (gegebenenfalls reicher) Krieger. Die antiken Quellen nennen an vielen Stellen keltische Söldner und diejenigen, die zurück in die Heimat kamen, waren sicherlich wohlhabende Männer und konnten sich daher auch prunkvolle Waffen leisten.
Die Bronzekannen In beiden Gräbern des Grabhügels 1 wurden Bronzekannen gefunden. Bei der Kanne aus Grab 1, die rechts oberhalb des Kopfes des Bestatteten deponiert wurde, handelt es sich um eine 52,5 cm hohe Schnabelkanne mit einem Fassungsvermögen von vier Litern. Sie ist damit eine der größten bekannten keltischen Bronzeschnabelkannen. Der Körper der Kanne weist als Dekoration acht vertikale Rippen sowie ornamentale und figürliche Gravuren auf. Auch die Standfläche ist mit Zickzacklinien und Kreuzen verziert. Am oberen Ende des Henkels befindet sich eine Figurengruppe, bestehend aus einem im Schneidersitz sitzenden Mann und zwei zurückblickenden Fabeltieren mit menschlichen Gesichtern. Die Attasche des Henkels hat die Form eines Menschenkopfes. Unterhalb davon sitzt ein Zierblech, welches ebenfalls ornamental und figürlich verziert ist. Der Henkel ist mit Kerben, Perlreihen und Rundbögen dekoriert. Die Deckplatte und die Schnabelseiten weisen weitere figürliche Dekorationselemente auf (Menschenköpfe und große Tiere). Aus der Verarbeitung kann man schließen, dass die Kanne nicht für den täglichen Gebrauch geeignet war, da u. a. der Henkel und seine Befestigung kaum ein mögliches Gesamtgewicht von mehr als 5 kg (die Kanne selbst wiegt 1350 g) ausgehalten hätte. Es ist außerdem auffällig, dass die Kanne, in ein Tuch eingeschlagen, in das Grab gestellt wurde. Textilreste eines Leinentuches wurden ebenso nachgewiesen, wie blau gefärbte Leinenstreifen. Die Kanne selbst enthielt eine organische Masse, in der durch weitere Untersuchungen Bienenwachs und Pollenkörner
[ 30 ]
Der Glauberg
nachgewiesen wurden. Dies sind eindeutige Hinweise dafür, dass sich ein stark honighaltiges Getränk (wohl Met bzw. Metansatz) in der Kanne befand. Derselbe Nachweis konnte auch für die in Grab 2 gefundene 50 cm hohe Röhrenkanne (Fassungsvermögen 8,9 Liter) erbracht werden. Dass sich die Pollen überhaupt über 2500 Jahre erhalten haben und nicht durch Bakterien zersetzt wurden, liegt an giftigen Kupfersalzen, die sich an den Kannenwänden gebildet und das Bakterienwachstum verhindert haben. Deutlich ist bei dieser Kanne, dass etruskische Schnabelkannen als Vorbild gedient haben, doch handelt es sich bei ihr, wie auch bei der Röhrenkanne aus Grab 2, um lokale Produktionen. Die Röhrenkanne aus Grab 2 erlaubte aufgrund ihrer starken Fragmentierung bei der Entdeckung einen Blick ins Innere, bereitete aber aus demselben Grund einige Probleme bei der Restaurierung. Die Kanne war, wie Ablagerungen beweisen, bis zum Rand gefüllt. Die Kanne selbst war aus einer Kombination von Eisen, Bronze und Eichenholz (dieses wurde für den Kannenboden benutzt und ist das einzig erhaltene Holz aus Grab 2; ein aus Holz gefertigter Deckel wird allerdings angenommen) gefertigt. Das Äußere ist zonenweise durch Punktierungen und Linien dekoriert. Dass die Kanne ursprünglich aus mehreren Teilen bestand, wurde durch eine äußerst sorgfältige Verarbeitung kaschiert. Der Henkel, der ebenso wie die Deckelfigur gegossen war, weist am oberen Ende einen widdergehörnten Löwenkopf, am unteren einen menschlichen Kopf auf. Diese Kanne war, ähnlich wie die aus Grab 1, mit einem gestreiften Leinentuch sowie Fell eingeschlagen. Die Pollenanalyse insbesondere der Schnabelkanne ergab eine große Anzahl unterschiedlicher Pollentypen. Dies ist einerseits ein Hinweis auf die Artenvielfalt der damaligen Zeit, aber auch darauf, dass der Honig von unterschiedlichen Bienenvölkern stammt. Die Tatsache, dass einige Pollen von Pflanzen stammten, die vermutlich zu keiner Zeit am Glauberg wuchsen, zeigt die überregionalen Handelsverbindungen.
Die Fibeln In Grab 1 wurden mehrere Bronzefibeln (zwei Vogelkopffibeln und eine tiergestaltige Fibel) gefunden. Um die Fibeln herum wurden Textil und Holzreste gefunden. Daraus könnte geschlossen werden, dass sich die Fibeln, auf Stoff aufgesteckt, in einer Art Schmuckkästchen befanden (drei nichtzuzuordnende Eisennieten könnten dann ebenfalls hierzu gehören). Alle drei Fibeln waren durch den Druck der eingestürzten Grabkammer stark beschädigt. Bei allen Fibeln konnten Einlagen und
[ 31 ]
Achsenendkugeln aus roter Koralle nachgewiesen werden. Die tier gestaltige Fibel stellt ein Mischwesen, bestehend aus Pferdekopf, Raubtierkörper und Flügeln dar und war insgesamt aufwändiger gestaltet als die Vogelkopffibeln. Über der Spiralkonstuktion waren zwei weitere Raubtiere angebracht. Die Vogelkopffibeln haben diverse Parallelen im östlichen Lt A-Kreis. Eine weitere Bronzefibel mit sechs Korallenperlen wurde in Grab 2 gefunden. Sie weist eine Eisenachse auf, war allerdings beim Fund in einem sehr schlechten Zustand.
Der Goldschmuck aus Grab 1 Der Goldschmuck aus Grab 1 bestand aus einem Halsring, Ohrringen, einem Arm- und einem Fingerring. Der mit drei zapfenförmigen Elementen verzierte Halsring – das als erstes geborgene Goldobjekt – hatte einen Feingehalt von ca. 93 % und war trotz des Einsturzes der Grabkammer nur leicht beschädigt. Eine Oberflächenuntersuchung zeigte nur geringe Gebrauchsspuren, was bedeutet, dass der Ring zur Zeit der Bestattung relativ neuwertig war (aber nicht eigens hierfür hergestellt wurde) oder sehr pfleglich behandelt wurde und damit ein Prestigeobjekt darstellte. Eine genaue Betrachtung zeigt allerdings einige Herstellungsfehler, die aber offenbar in Kauf genommen wurden, was für den Wert des Objekts spricht. Der hohl gearbeitete ca. 175 g schwere Ring war aus ca. 35 Einzelteilen zusammengelötet. Nur der auf der Brust getragene Teil des Ringes ist mit Dekor versehen, welcher neben den Zapfen aus zehn Köpfen im Profil, die als Flachrelief herausgearbeitet wurden, besteht. Zwischen den Zapfen befinden sich zwei Anhänger mit stilisierten Vogelpaaren in Kombination mit Blattmotiven, links und rechts werden sie von Menschenfiguren (mit unverhältnismäßig großen Köpfen) abgeschlossen, die eine ähnliche Handhaltung zeigen wie die Statue. Über die Bedeutung des Ringes und seine Verzierung kann viel diskutiert werden. Dass der Ring selbst ein Statussymbol war, steht dabei wohl außer Frage, ob aber die dekora tiven Köpfe in Zusammenhang mit dem Schädelkult der Kelten stehen oder einen Amulettcharakter haben, kann ebenso wenig sicher beantwortet werden wie die Frage, ob die Anzahl in irgendeiner Beziehung zur Bedeutung des Bestatteten steht. Die zapfenförmigen Anhängsel des Ringes haben Parallelen in anderen Fundkomplexen, ob und welche Bedeutung sie haben, ist aber unklar (s. Abb. 6, 7).
[ 32 ]
Der Glauberg
Die beiden Ohrringe (der eine rund, der andere oval) waren aus goldenem Perldraht gebogen (dessen Durchmesser zwischen 1,1 und 1,45 mm liegt) und haben ein Gewicht von 0,33 g bzw. 0,41 g. Auch sie hatten einen relativ hohen Feingehalt von 91 % bzw. 98 %. Am rechten Arm bzw. der rechten Hand des Toten wurden weiterhin ein goldener Armreif sowie ein goldener Fingerring gefunden. Auch diese hatten einen sehr hohen Goldgehalt (beim Armreif 87,5–90,5 % und beim Fingerring 94,7–96,1 %). Weiterhin konnten bei beiden Objekten Spuren von Silber als Legierungsbestandteile nachgewiesen werden. Der Armring (Gewicht: 33 g; Durchmesser: 6,5 cm) war teilweise eingedrückt und aus einem Rohr mit 0,85 cm Durchmesser gefertigt. Der Fingerring (Gewicht: 7,3 g; Innendurchmesser ca. 1,8 cm) war aus Draht (Durchmesser 1,3–1,8 mm) gefertigt (s. Abb. 8).
Die Keltenwelt am Glauberg – das Museum Im Jahr 2011 wurde am Glauberg ein neues Museum eröffnet, in dem die wichtigsten Funde ausgestellt werden, aber auch allgemeine Informationen zur Forschungsgeschichte des Glaubergs vermittelt werden. Das am Hang oberhalb des Grabhügels erbaute Museum fügt sich trotz seines auf den ersten Blick kantigen und modernen Baus in die Landschaft ein. Durch die Hanglage bedingt, ist der eigentliche Eingangsbereich in das Gebäude durch die Cafeteria geprägt und das Museum befindet sich in der ersten Etage. Hier befindet sich auch das Forschungszentrum. Das gesamte Gebäude ist barrierefrei. Der gesamte Museumsbereich ist etwas verwinkelt angelegt und es gibt keine offensichtliche Reihenfolge, in der man die Ausstellungsstücke betrachten sollte. Viel Wert wurde auf eine abwechslungsreiche Präsentation gelegt, die vor allem die Neugierde von Kindern und Jugendlichen anspricht. So gibt es Mediennischen, Schubladen und Gucklöcher in und hinter denen sich Funde und Rekonstruktionen verbergen. Auch Wände und Boden sollte man immer im Blick haben, finden sich dort doch Karten und eine Vielzahl von teils amüsanten Zitaten. Ein Highlight ist sicherlich die in einem eigenen Raumteil gestellte Statue des Fürsten vom Glauberg, die von den ihr entsprechenden Funden umgeben ist. Naturfreunde freuen sich über einen Bereich, in dem man neben Informationen zur Landwirtschaft und Archäobotanik auch aus einem Panoramafenster die Aussicht über den Grabhügel genießen kann. Einen noch besseren Blick liefert die ebenfalls barrierefreie zugängliche Dachterrasse.
[ 33 ]
Weiteres Keltisches der Umgebung Die Region um den Glauberg verfügt über weitere wichtige Fundplätze zur keltischen Geschichte und Kultur, die hier nicht ausführlicher behandelt werden können. Auf Initiative des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft wurde daher 2002 das Projekt „Keltenstraße“ initiiert. Man darf sich allerdings unter dieser Straße keine ausgeschilderte Route vorstellen. Vielmehr haben sich verschiedene Gemeinden (ursprünglich Bad Nauheim, Biebertal, Büdingen, Butzenbach, Friedberg, Glauburg und Oberursel) vernetzt, um archäologische Sachverhalte zu veranschaulichen. Ein Besuch dieser Orte, die jeweils verschiedene Aspekte der keltischen Kultur bzw. des keltischen Lebens aufarbeiten, lohnt daher allemal. So kann man zum Beispiel bei Bibertal den Dünsberg besuchen, den keltischen Oppidum, welcher von drei Ringwällen umgeben war. Hier wurde ein Zangentor rekonstruiert, von dem aus man einem archäologischen Lehrpfad folgen kann. Die Gründung des Vereins „KeltenWelten – keltische Stätten in Deutschland e.V.“ im Jahr 2006 formierte sich aus den genannten Gemeinden und hat inzwischen zahlreiche weitere Mitglieder.
Die Bedeutung des Glauberges Allein die spektakulären Funde zeigen die Bedeutung des Glauberges. Ähnlich wie andere überregional bedeutende Siedlungsplätze liegt er nicht im Zentrum einer Siedlungskammer. Durch seine Lage konnten von hier nicht nur wichtige Fernhandelswege (z. B. vom Untermain nach Thüringen) kontrolliert werden, sondern auch die kürzeste Landverbindung zwischen den für Handel wichtigen Flüssen Rhein und Weser. Auffällig ist allerdings, dass die anderen Funde der Umgebung als eher durchschnittlich zu bezeichnen sind und damit im Widerspruch sowohl zu den Grabbeigaben, als auch zur Monumentalität der Befestigungsanlagen stehen. So fehlt unter anderem der Nachweis irgendwelcher Werkstätten. Somit kann der Glauberg nicht, wie andere Fürstensitze, als wirtschaftliches Zentrum einer Region gedeutet werden und seine Bedeutung steht vielmehr im Zusammenhang mit dem vermuteten Heiligtum. Zwar ist die Deutung als Kalenderheiligtum in der modernen Forschung nicht unumstritten, aber zumindest kann man den Nachweis eines wie auch immer gearteten Ahnenkultes für den Glauberg annehmen (s. Abb. 2).
[ 34 ]
Reinheim
Reinheim Um nach Reinheim, also eigentlich zum Europäischen Kulturpark Bliesbruck-Reinheim, zu gelangen, fährt man von Frankfurt/Main auf der A63 über Mainz nach Kaiserslautern und anschließend auf der A6 Richtung Saarbrücken bis zur Ausfahrt Rohrbach. Hier folgt man der Beschilderung nach Blieskastel und anschließend der L105 bis Reinheim. Links der L208 folgend kommt nach ca. 400 m auf der linken Straßenseite ein Parkplatz, den man zu Stoßzeiten nutzen sollte (vor allem, wenn man nur am Keltengrab interessiert ist, ansonsten gibt es auch auf der französischen Seite des archäologischen Parks einen großen Parkplatz). Fährt man über die Blies hinweg, findet man rechter Hand (direkt vor dem Kreisverkehr) einige weitere Parkmöglichkeiten, die allerdings zumeist von Mitarbeitern genutzt werden. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist der Park stündlich mit der Linie 501 (am besten ab Homburg) zu erreichen. Obwohl der archäologische Park mehrere Ausstellungsgebäude (inklusive des rekonstruierten und begehbaren Grabhügels) hat, befinden sich die meisten Originale im Museum in Saarbrücken. Zwar sind die Repliken von hervorragender Qualität, doch sollte man unbedingt einen Abstecher in die Landeshauptstadt machen.
Geschichte der Grabung Obwohl es in diesem Führer hauptsächlich um die keltische Kultur geht, muss gerade im Falle von Reinheim darauf verwiesen werden, das die Region auch reich an anderen archäologischen Funden ist. So vereint auch der 1987 unter der Trägerschaft des Départements Moselle und des Saarpfalz-Kreises entstandene Europäische Kulturpark Bliesbruck-Reinheim neben dem hier primär betrachteten Prunkgrab noch eine römische Villa und ein römisches Vicus nebst hervorragend erhaltener und rekonstruierter Thermenanlage. Insgesamt umfassen die Grabfunde einen Zeitraum, der 2000 Jahre von Ha A bis zur Epoche der Merowinger reicht. 1952 entdeckte der Kiesgrubenbesitzer Johannes Schiel beim Abbau eine Körperbestattung mit Bronzehalsring. Als zwei Jahre später ein Bronzefigürchen (später als Spiegelgriff identifiziert) gefunden wurde,
[ 35 ]
wurden die Arbeiten eingestellt und das Landesdenkmalamt informiert. Die im März 1954 durchgeführten Grabungen führten zur Entdeckung des reichen keltischen Frauengrabes, welches in Lt B zu datieren ist. Die Nachuntersuchungen der folgenden Jahre führten zur Identifikation von drei beieinander gelegenen Grabhügeln, von denen der der Fürstin von Reinheim der größte war. Aufgrund der allgemeinen Definition muss zu einem Fürstengrab immer ein Fürstensitz gehören. Im Falle der Fürstin von Reinheim könnte dies der Homerich gewesen sein, dessen Besiedlung bereits ab dem 9. Jahrhundert v. Chr. nachgewiesen werden kann. Im Zuge der Gründung des Europäischen Kulturparks wurden die Grabhügel an anderer Stelle rekonstruiert, wobei das Fürstinnengrab als begehbare Ausstellungsfläche erstellt wurde (s. Abb. 9). Insgesamt war aber die keltische Nekropole in Reinheim wesentlich umfangreicher, auch wenn hier nicht auf alle Einzelheiten eingegangen werden kann. So lassen sich in der näheren Umgebung zum Prunkgrab weitere Tumuli und andere Gräber nachweisen, deren Entstehungszeit von der Hallstattzeit bis zur mittleren Latènezeit reicht. Allein die Belegdauer der Nekropole (deren Fläche sich insgesamt auf 12 Hektar erstreckt) von 500 Jahren zeigt deren Bedeutung.
Der spätbronzezeitliche Hortfund Bereits im Jahr 1964 stieß man beim Ausheben eines Wasserleitungsgrabens auf den ersten Hortfund, bestehend aus vier Klapperbrechen und einer Phalere, die gemeinsam einem Pferdegeschirr zugeordnet werden. Weiterhin wurden mehrere Arm- und Fußringe sowie ein Tüllenmeißel gefunden. Weitere Hortfunde wurden wenige Kilometer entfernt in Erfweiler-Ehlingen gemacht.
Das Prunkgrab der „Fürstin von Reinheim“ Die Funde im Prunkgrab zeugen nicht nur von der gesellschaftlichen Bedeutung der Bestatteten, sondern sind ein deutliches Zeichen für die Existenz von Fernhandelsbeziehungen. So weist die große Anzahl (130) an Bernsteinperlen auf Handelsbeziehungen in das Baltikum hin, während die korallenbesetzte Fibel und die karthagischen Glasaugenperlen
[ 36 ]
Reinheim
ein deutliches Zeichen für Südkontakte darstellen. Das Grab selbst war ursprünglich durch einen Kreisgraben mit ca. 20 m Innendurchmesser begrenzt (bei 0,4 m Tiefe und 0,6 m Breite). Es enthielt die (nur durch Holzspuren nachweisbare) aus Eichenholz gefertigte Grabkammer (min. 3,5 m x 2,7 m x 1,2 m). Die Höhe von 1,2 m wird aufgrund der Größe der Röhrenkanne, die auf einem Tisch gestanden hat, vermutet. Die Funde erlauben eine Datierung um das Jahr 370 v. Chr.
Die Funde Durch seine spektakulären Funde stellt das Prunkgrab von Reinheim eine der reichsten Bestattungen keltischer Frauen in Mitteleuropa dar (einzig vergleichbar mit dem Frauengrab von Vix). Doch ist zu beachten, dass die Geschlechtsbestimmung einzig aufgrund der Beigaben (in diesem Fall dem beidseitigen Tragen von Armreifen, welches bislang nicht bei zeitgleichen Männergräbern zu finden ist) erfolgt ist. Die Knochen selbst haben sich durch die Kieselsäure im Sandboden vollständig aufgelöst. Trotz der großen Bedeutung der Funde und des Gesamtzusammenhangs kann auch hier nur eine Auswahl genauer beschrieben werden.
Das Trinkgeschirr Etwas abseits des Körpers, ursprünglich auf einem Tisch stehend, wurde eine reich verzierte bronzene Röhrenkanne (51 cm) nebst zweier Bronzebecken und zwei goldenen Trinkhornbeschlägen gefunden. Dabei stellt vor allem die Kanne aufgrund ihrer Gravuren und Figuren ein handwerkliches Meisterstück dar. So sind Deckel, Ausguss und Teile des Körpers mit feinen Ranken- und Spiralornamenten bedeckt. An der Oberseite des Griffes findet sich eine als Dionysos Lenaios gedeutete bärtige Maske mit darunter sitzendem Widderkopf. Den unteren Abschluss des Henkels bildet eine Satyrmaske. Allgemein ist das Maskenmotiv ein bedeutendes Stilmittel der frühen keltischen Kunst. Inwieweit es tatsächlich in Zusammenhang mit dem von vielen keltischen Stämmen praktizierten Schädelkult (zu erinnern ist hier an das gallische Heiligtum von Roquepertuse, aber auch an die entsprechenden Belege bei den antiken Autoren, wie z. B. Diod. 5, 29, 4-5) und der damit zusammenhängenden Bedeutung des Kopfes als Sitz des Lebens zu sehen ist, kann nicht mit abschließender Sicherheit gesagt werden (immerhin ist ja nicht jeder, der Porträtbilder besitzt, ein Kopfjäger und auch die römischen Büsten zeugen nicht von einem Schädel-
[ 37 ]
kult, sondern allenfalls von einem Ahnenkult). Den Griff des Kannendeckels bildet ein menschenköpfiges Pferd, dessen vergrößertes Abbild zwischen den rekonstruierten Grabhügeln zu sehen ist. Der Kopf weißt die bereits bekannte Darstellung einer Mistelkrone auf. Die Kanne war nachweislich mit Wein gefüllt und gemeinsam mit den Becken und den Trinkhörnern auf einem Tisch drapiert.
Der Spiegel Vom bronzenen Spiegel ist an sich nur der Griff erhalten, doch liegt die Vermutung nahe, dass dieser zu einem Handspiegel gehörte. Vermutet wird außerdem, dass zum Spiegel eine Tasche aus organischem und daher nicht mehr erhaltenem Material gehört hat. Der Spiegelgriff stellt eine janusköpfige Figur dar, die eine ähnliche Kopf bedeckung wie die Statue vom Glauberg trägt. Da ein solcher Kunstgegenstand wohl kaum eine reale Person darstellt, zeigt der Griff wohl einen keltischen Gott oder Heros. Aufgrund der Janusköpfigkeit der Figur und eben der Blattkrone wird der Spiegel als sakrales Gerät vornehmlich für die Weissagung gedeutet, eine Deutung, die aber nicht bewiesen werden kann. Einen Luxusgegenstand stellt der Spiegel aber allemal dar.
Der Goldschmuck Die Tote trug, wohl als Zeichen ihrer gesellschaftlichen Stellung, einen aus 25 Einzelteilen zusammengelöteten, tordierten Goldring. Die Enden des Halsringes (der ein Gewicht von ca. 187 g hat) bildeten plastische Darstellungen einer mehrgesichtigen Gottheit. Auffällig ist die Kopfbedeckung der Figur, die als phrygischer Helm mit Raubvogelkopf gedeutet werden kann. Dieses Attribut wiederum wird mit der griechischen Göttin Athene bzw. ihrem römischen Pendant Minerva in Verbindung gebracht, so dass der Ring als Indiz für Mittelmeer kontakte herangezogen werden kann. Den eigentlichen Abschluss des Ringes bildet eine Art Raubtierkopf, der als Löwe gedeutet wird. Rechtsseitig trug die Bestattete einen goldenen Armring (ca. 117 g), dessen offene Enden mit denen des Halsringes zusammenpassten. Doch ist hier die gesamte Göttin mit auf der Brust zusammengelegten Händen als Flachrelief dargestellt. Bei genauerer Betrachtung entdeckt man allerdings, dass die Göttin Flügel hat. Flügel und Löwe sind Attribute von Artemis, der griechischen Göttin der Jagd, die ihren Ursprung im Orient hatte (so erscheint der Name bereits in Linear B und bei Lydern
[ 38 ]
Reinheim
und Lykiern und wird oft mit Kybele in Zusammenhang gebracht). Insgesamt kann man also feststellen, dass die Attribute zweier mediterraner Gottheiten zu einer einzelnen verschmelzen. Vielleicht stellt die Darstellung die bei Caesar erwähnte keltische Minerva dar (Caes. Gall. 6, 17, 2). Einen weiteren Goldarmreif trug die Bestattete am linken Arm (nebst je einem Armring aus Glas und Ölschiefer).
Die Fibeln Mehrere Fibeln von herausragender handwerklicher Qualität vervollständigen die Tracht der Bestatteten. Eine längliche Goldscheibenfibel (3,75 cm x 2,5 cm) mit Einlagen aus roter Koralle (auch dies ein Hinweis für Kontakte in die Mittelmeerwelt) wurde im Brustbereich gefunden und hielt ursprünglich wohl das Totengewand oder das Leichentuch zusammen. Eine weitere korallenbesetzte Goldfibel, diese aber rund (Durchmesser 4,1 cm), wurde zu Füßen der Toten gefunden, wo sie vermutlich ein nicht mehr näher bestimmbares Kleidungsstück zusammenhielt. Ein paar Zentimeter unterhalb der rechten Hand wurde eine Bronzefibel gefunden, die einen Hahn darstellte und ebenfalls mit roter Koralle besetzt war (6,4 cm x 3,3 cm). Die Spiralachse dieser Fibel wird von zwei weißen Beinperlen abgeschlossen. Auf der linken Brustseite wurde schließlich noch eine Maskenfibel aus Zinn gefunden, deren Funktion ebenso wie die der Hähnchenfibel nicht geklärt ist.
Die Perlen Einen Hinweis für die weitreichenden Kontakte, die die Kelten des Bliesgau hatten, sind die zahlreichen im Fürstinnengrab gefundenen Perlen. Diese, vermutlich zu einem Kollier gehörig, dessen ursprüngliches Aussehen nur noch vermutet werden kann, stammten zum größten Teil aus dem Baltikum (gefunden wurden 132 Bernsteinperlen). Doch gehörten zum Kollier auch einige phönikische Augenperlen.
Die Bedeutung der Bestatteten Wie bei allen prunkvollen Bestattungen stellt sich die Frage nach der Bedeutung des Toten. Wie bereits in der Einleitung ausgeführt, ist es unmöglich, sichere Aussagen über die politische Bedeutung der Keltin zu treffen, doch zeugt der vergleichsweise große Bestattungsaufwand,
[ 39 ]
dass die Fürstin von Reinheim in irgendeiner Form (und sei es nur wirtschaftlich) großen Einfluss besaß. Einige der Beigaben erlauben es, die Bestattete in einen sakralen Kontext zu bringen. Hierzu g ehören nicht nur die bereits oben erwähnten Göttinnendarstellungen auf den Enden des Hals- und eines Armreifes. Auch die große Zahl der Bernsteinperlen kann als Indiz gesehen werden. Denn aufgrund seiner elektrostatischen Eigenschaften galt Bernstein in der Antike als Material mit Zauberkraft (zumindest belegen das einige griechisch-römische Quellen). Auch ein im Grab gefundener Stab wird als Kultstab gedeutet. Ein deutlicheres Zeichen sind hingegen die menschengestaltigen Anhänger, die wohl als Amulette gedeutet werden dürfen. Weiterhin muss der Spiegelgriff, der ebenfalls eine Gottheit darstellt, in Erinnerung gerufen werden. Diese Häufung religiös zu deutender Beigaben erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass es sich bei der Bestatteten um eine Art Priesterin gehandelt hat. Sie als Druidin zu bezeichnen wäre hingegen falsch, vor allem, weil alle literarischen Belege für Druidinnen als unwahr entlarvt wurden und Caesar, der am genauesten über dieses Priesteramt berichtet, es als reine Männerdomäne darstellt.
[ 40 ]
Donnersberg/Dannenfels
Donnersberg/Dannenfels In der Nähe von Kaiserslautern, am besten über die A63 (Ausfahrt Dreisen/Weitersweiler) oder A61 (Ausfahrt Alzey) zu erreichen, liegt am Nordrand des Pfälzer Waldes auf dem Donnersberg eins der größten keltischen Oppida Deutschlands. Ambitionierte Wanderer können vom Fuße des Donnersberges (z. B. aus Dannenfels) den Besuch dieser höchsten Erhebung des Nordpfälzer Berglandes (687 m) beginnen, wer es aber etwas einfacher haben möchte, sollte seinen Besuch vom Parkplatz auf dem Berg aus starten. Festes Schuhwerk ist allemal zu empfehlen, da man, wenn man das ganze Oppidum erlaufen möchte, einiges an Kilometern auf Waldwegen (die manchmal nicht mehr als Trampelpfade sind) zurücklegen muss. Ortsunkundigen empfiehlt sich der Kauf der Wanderkarte „Keltenweg“ (am Ludwigsturm auf dem Donnersberg erhältlich). Von dort sollte man auch seinen Rundweg starten. Die Markierungen des Keltenweges sind leider zum Teil nur schlecht zu finden. Alternativ zum Keltenweg, kann man auch entlang bzw. auf dem Ringwall um das Oppidum wandern. Auf diesem Weg bekommt man eine sehr gute Vorstellung von der ursprünglichen Größe der Siedlung. Außerdem wird man schnell feststellen, dass die Erbauer die natürlichen Geländeeigenschaften nutzten, um die Befestigungsanlagen zu optimieren. So wurden klippenartige Abbruch säume in den Verlauf der ehemaligen Befestigungsmauer integriert, so dass die Mauer teilweise mehr als 10 m über dem außenliegenden Gelände steht (s. Abb. 10).
Die Grabungsgeschichte Um das Jahr 1835 begann die erste wissenschaftliche Erforschung des Donnersberges durch Friedrich Lehne, doch erst Kurt Schumachers topographische Beschreibung des Plateaus (1910) offenbarte die sichere Erkenntnis, dass die eindrucksvolle Wallanlage zu den Überresten eines eindrucksvollen keltischen Oppidums gehörte. Doch schon 1893 wurden Grabungen am Schlackenwall und der Viereckschanze durchgeführt. Eine erste Ausgrabung beim Oppidum wurde 1930 durch die Römisch-Germanische Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts und des Historischen Museums der Pfalz in
[ 41 ]
Speyer initiiert. Obwohl dieses Projekt als Auftakt einer intensiven Erforschung geplant war, blieb es erst einmal bei einer nur zwei Wochen dauernden Grabungskampagne. Erst im Jahr 1974 startete die Erforschung des Donnersberges, eingeleitet durch das einzige Projekt der „Kommission zur Erforschung keltischer und frühgermanischer Denkmäler“, mit einer Grabungskampagne auf dem Berg unter Leitung von Heinz-Josef Engels. Die jährlichen Kampagnen endeten 1983. Erst 2004 wurde die Erforschung des Oppidums durch Andrea ZeebLanz weiter betrieben. Die Arbeiten auf dem Plateau wurden seit jeher durch die Beschaffenheit des Bodens, der aus archäologischer Sicht untersuchungsfeindlich ist, erschwert. Auf dem gewachsenen Felsen befindet sich eine 30– 40 cm dicke Schicht von Verwitterungsschutt, in der sich Gruben oder Pfostenlöcher nur schwer erkennen lassen, da diese in der Regel im Laufe der Jahrhunderte ebenfalls mit Verwitterungsschutt gefüllt sind. Die Oberfläche selbst besteht aus einer oft gerade einmal 10 cm dicken Humusschicht.
Besiedlungsgeschichte Obwohl die frühesten Funde auf dem Donnersberg aus der Jungsteinzeit stammten (von den sogenannten Linienbandkeramikern; datiert ca. 5300–4950 v. Chr.), wurde das Plateau zu dieser Zeit wohl noch nicht besiedelt. Eine erste Besiedlung lässt sich erst durch Keramik funde, die aus der Michelsberger Kultur stammen (ca. 4400–3540 v. Chr.), nachweisen. Allerdings lässt sich eine für Siedlungen dieser Kultur eigentlich typische Wallanlage nicht nachweisen. Ein jüngerer Besiedlungsniederschlag findet sich erst wieder für die spätbronzezeitliche Urnenfelderkultur (ca. 1300–800 v. Chr.), doch fehlt auch hier die typische Befestigungsanlage. Es gibt Anzeichen dafür, dass sich die Besiedlung bis in die Hallstattzeit kontinuierlich fortsetzte. Vermutlich wurde auch der sogenannte Schlackenwall von den hallstattzeitlichen Bewohnern errichtet. In der frühen Eisenzeit wurde die Siedlung auf dem Donnersberg aufgegeben und erst wieder im 2. Jahrhundert durch spätlatènezeitliche Kelten besiedelt. Diese erbauten um 130 v. Chr. die Mauer. Spätestens um 50 v. Chr. (wahrscheinlich aber in den siebziger Jahren v. Chr.) endet die Besiedlung auf dem Donnersberg.
[ 42 ]
Donnersberg/Dannenfels
Das Oppidum Das ehemals sicherlich mächtige Oppidum auf dem Donnersberg, ein mehr als 8 km langer Ringwall umschließt eine Gesamtfläche von ca. 240 ha, ist heute zum größten Teil waldbewachsen. Doch allein durch seine Lage – vom Plateau bietet sich bei klarem Wetter ein eindrucksvoller Blick bis zum Taunus und zum Odenwald – konnte von dieser Siedlung aus ein großer Landstrich beherrscht werden. Erbaut in der zweiten Hälfte des 2. Jahrhunderts vor Christus zählt es zu den größten mitteleuropäischen Siedlungsflächen. Die gut sichtbaren Wälle haben noch heute eine Höhe von ca. 1,4 m bis zu 2 m. Sie sind die Reste einer mächtigen, wahrscheinlich über 4 m hohen Pfostenschlitzmauer, die an mehreren Stellen rekonstruiert wurde. Die umfangreichste Rekonstruktion (in der Nähe des Parkplatzes) hat eine Brustwehr, die sicherlich nicht dem Original entsprochen hat (s. Abb. 11, 12). Durch die heute nur noch als Wälle vorhandenen Überreste der einstigen Mauern wird die gesamte Anlage in zwei Teile (Ost- und Westwerk) gegliedert. Lange Zeit wurde bei der Anlage vermutet, dass die Befestigungsanlagen des Oppidums nicht vollendet wurden, da der nördliche und westliche Wall nicht nachgewiesen werden konnten. Sie wurden aber einige Zeit vor der ersten wissenschaftlichen Unter suchung abgetragen um Forstwege anzulegen. Die Geländemerkmale der beiden Teile des Oppidums sind bei genauerer Betrachtung sehr unterschiedlich. So weist das Bodenrelief des Westwerks für den Siedlungsbau eher ungünstige Einschnitte auf, während sich im Bereich des Ostwerks mehrere Plateuflächen finden lassen. Auch die Funde bestätigen, dass hier die eigentliche Siedlung gelegen hat. Ein weiterer Wall teilt im Norden des Ostwerks eine Fläche von ca. 25 ha ab. Doch finden sich im Ostwerk noch zwei weitere kleinere Wälle. Dies sind im Norden der sogenannte Schlackenwall und der relativ zentral im Ostwerk zu findende Wall, der zur sogenannten Viereckschanze gehört.
Die Mauern Bereits früh wurde versucht, anhand der oberirdisch zu findenden Mauerreste (bei den Mauern handelte es sich um Pfostenschlitzmauern, die im Falle der Außenmauern auf der Innenseite durch eine Aufschüttung aus Steinen und Erde stabilisiert wurden) die Baugeschichte des Oppidum zu rekonstruieren. Die ursprüngliche Annahme besagte,
[ 43 ]
dass das Siedlungsareal ursprünglich relativ klein war und später fortschreitend erweitert wurde. Doch lagen dieser These keinerlei Untersuchungen der einzelnen Befestigungen zugrunde. Erst die Unter suchungen von Engels brachten die eigentliche Baugeschichte zu Tage. Es zeigte sich, dass in einer ersten Bauphase, die gesamte 8,5 km lange Umfassungsmauer errichtet wurde, sowie auch der das Ostund Westwerk trennende Wall. In einer weiteren Bauphase musste die Mauer des Ostwerks komplett erneuert werden (hierzu wurde eine neue Mauer knapp einen Meter vor die alte gebaut und der Zwischenraum ausgefüllt), wohingegen zur selben Zeit im Mauerbereich des Westwerks nur kleinere Reparaturen nachweisbar sind. Auffällig ist aber auch, dass die Mauern des Westwerks weit weniger mächtig als die des Ostwerks waren. Hieraus kann man auf verschieden genutzte Areale im Oppidum schließen. So wird das schwächer befestigte Westwerk als eine Art Fliehburg für die um das Oppidum wohnende Bevölkerung angesehen. Aber auch eine Nutzung als landwirtschaftliche Fläche wie in Manching ist denkbar. Die im Norden des Ostwerks abgeteilte Fläche ist neueren Datums, woraus man schließen kann, dass die bewohnte Siedlungsfläche aus nicht sicher rekonstruierbaren Gründen stark verkleinert wurde. Diese neue Stadtmauer war aber mit ca. 2 m wesentlich kleiner als die ursprüngliche Oppidumsmauer. Noch heute sind auch die Mauerreste des sogenannten Schlackenwalls mit einer Höhe von bis zu 1,2 m in der Landschaft sichtbar. Der Name stammt von der großen Anzahl verglaster Rhyolithstücken, die in dem Wall gefunden wurden, und der Name wurde sicher schon im frühen 19. Jahrhundert gebraucht. Eine erste wissenschaftliche Erklärung (die Bevölkerung dachte ursprünglich, dass die Verglasung durch einen Blitzschlag verursacht wurde), lieferte Kurt Bittel, der glaubte, eine Steinmauer mit Holzfront und -Innengerüst nachweisen zu können, die durch einen Brand zerstört wurde. Die Hitze hätte schließlich zur Verglasung der Trockenmauer geführt. Das Fehlen von Holzasche und -kohle spricht aber gegen diese Vermutung. Mineralogische Unter suchungen in neuerer Zeit führten zu der neuen These, dass es sich bei den nachgewiesenen Schlacken um Abfallprodukte aus der Glasherstellung handelt. Obwohl für diese These einiges spricht, fehlen bis heute die Nachweise der hierfür benötigten Öfen. Diese Öfen wären aber in der auf dem Donnersberg durchgeführten geomagnetischen Bodenprospektion nachzuweisen. Auch wenn diese Frage bislang nicht abschließend geklärt ist, müssen die Schlacken als Beleg für eine hand-
[ 44 ]
Donnersberg/Dannenfels
werkliche Produktionsstätte welcher Art auch immer gesehen werden. Auch wenn der Schlackenwall noch einige Fragen offen hält, konnte zumindest nachgewiesen werden, dass er die älteste Befestigungsanlage (wohl aus der frühen Eisenzeit) des Donnersberges darstellt. Eine Deutung als frühe Fliehburg liegt nahe, doch wurde die dazugehörige Siedlung bislang nicht gefunden. Für die gesamte Anlage sind insgesamt fünf Toranlagen nachweisbar, wobei diese sehr ungleichmäßig verteilt sind. So konnte im Westwerk bislang nur ein Eingang (an der Südwestecke) nachgewiesen werden, eine weitere ermöglichte den Durchgang vom West- zum Ostwerk. Im Ostwerk können schließlich drei Tore nachgewiesen werden, von denen je eins nach Norden, Südosten und Süden wies. Bis auf das Verbindungstor, welches durch moderne Bebauung zerstört wurde, lassen sich die anderen Tore bei einem Rundgang immer noch deutlich in den Wällen erkennen (das besterhaltene ist das Südtor, wo die typische Torgasse noch deutlich zu erkennen ist). Bei den Zugangstoren handelt es sich um die für keltische Siedlungen typischen Zangentore.
Die Viereckschanze Die sogenannte Viereckschanze des Donnersberger Oppidum ist aus mehreren Gründen beachtenswert. So liegt sie am äußersten Rand des Verbreitungsgebietes dieser Anlagen. Es wird vermutet, dass sie bereits vor der Errichtung des Oppidums entstanden ist. Das Tor der keltischen Viereckschanze wurde an der Südseite vermutet, allerdings brachten Ausgrabungen hier nur eine steinerne Toranlage zum Vorschein, die in das 9. Jahrhundert n. Chr. zu datieren ist und eine erneute Nutzung des umwallten Gebietes beweist. In der Nordostecke der Schanze wurde ein 5 m x 5,3 m großer Pfostenbau nachgewiesen, dessen Bedeutung allerdings nicht geklärt werden kann, vom Ausgräber allerdings als „Kulthütte“ bezeichnet wurde. Um der Bedeutung der Donnersberger Viereckschanze auf den Grund zu gehen, wurden im Jahr 2006 geophysikalische Messungen vorgenommen, in der Hoffnung, Strukturen von Gebäuden und Gruben nachweisen zu können. Allerdings waren diese Untersuchungen enttäuschend und brachten kaum verwertbare Befunde. Einzig eine frühneuzeitliche Nutzung der Schanze wurde nachgewiesen und einige nicht deutbare Pfostenlöcher identifiziert. Hierdurch konnte zwar Bauaktivität nachgewiesen werden, aber welchen Zweck diese Bauten hatten, ist unbekannt.
[ 45 ]
Besiedlung Die bereits oben beschriebenen Bodenverhältnisse auf dem Donnersberg haben zur Folge, dass sich keine klaren Siedlungsstrukturen dokumentieren lassen. Auch der ca. 500 Jahre lang auf dem Plateau betriebene Ackerbau hat sein Übriges dafür getan, dass Siedlungsspuren vernichtet wurden. Zuletzt ist auch noch die im frühen 20. Jahrhundert durchgeführte Aufforstung zu nennen, die ebenfalls die archäologischen Arbeiten in vielfältiger Hinsicht erschwert. Doch er lauben gerade diese Bodenverhältnisse, Vermutungen über den Aufbau der Siedlung anzustellen. Denn die Bodenverhältnisse sind seit jeher für das Einbringen von Pfosten ungünstig, so dass man davon ausgehen muss, dass die meisten Gebäude nicht durch Hauspfosten stabilisiert wurden, sondern man von Schwellbalkenkonstruktionen ausgehen muss. Hierfür spricht auch die geringe Zahl nachweisbarer Pfosten löcher (auch im Mauerbereich, wo man sie am ehesten vermuten könnte). Vermutungen zum eigentlichen Siedlungsaufbau können aber nur anhand von Vergleichen mit anderen großen Oppida angestellt werden (so u. a. Manching oder Bibracte). In Gebieten wo sich Funde häuften, kann man mit großer Wahrscheinlichkeit einen Siedlungsschwerpunkt annehmen. Auffällig – bedenkt man die Größe des Oppidums – ist, dass bislang kein Friedhof gefunden wurde. Aufgrund des felsigen Bodens auf dem Plateau muss eine Nekropole aber in den umgebenen Ebenen vermutet werden. Im Oppidum selbst sind nur einige wenige Brandbestattungen nachzuweisen.
Die Funde Die Funde vom Donnersberg zeugen von einem normalen Leben eines großen keltischen Oppidum. Das Hauptproblem liegt in den Jahrzehnte lang auf dem Donnersberg durchgeführten Raubgrabungen, die den Gesamtbefund natürlich stark verändern. Nachweisen kann man aber Handelskontakte mit der Mittelmeerwelt, da Amphoren und Bronzesiebe (bzw. deren Daumenplatten) gefunden wurden, wie sie für Weinhandel und -genuss benötigt wurden. Außergewöhnlich ist ein Trinkhornendbeschlag, der eine massiv gegossene menschengesichtige Gestalt (bzw. deren Maske) zeigt, die einen recht grimmigen Gesichtsausdruck zur Schau trägt. Von der Stirn dieser Maske ausgehend, sitzt ein nach hinten gerichteter Widderkopf, dem dieser Fund den Namen „Widderkopfmännchen“ verdankt. Dieses aus bronzehandwerklicher Sicht eher fehlerhafte Stück ist aufgrund seiner Komposition bislang einzigartig.
[ 46 ]
Donnersberg/Dannenfels
Nicht weiter auffällig sind die vielfältigen und zum normalen Fundspektrum einer prähistorischen Siedlung gehörenden Keramikscherben. Besondere, in irgendeiner Weise auffällige Formen lassen sich aber nicht nachweisen. Weiterhin wurde eine Vielzahl von Mahlsteinen gefunden, die teilweise als Importstücke (einige bestehen aus mittelrheinischer Basaltlava) in das Oppidum gekommen sein müssen, sowie die üblichen Eisengeräte (Messer, Sicheln, Werkzeuge). Aus der geringen Anzahl an gefundenen Waffen wird allgemein geschlossen, dass es in der Umgebung des Oppidums zu keinen größeren Kriegshandlungen gekommen ist. Das numismatische Fundmaterial vom Donnersberg stammt bedauerlicherweise in erster Linie aus Raubgrabungen (wie allgemein die meisten Metallfunde) und ist in den Handel gelangt, wodurch eine wissenschaftliche Auswertung nahezu verhindert wird. Festhalten kann man aber, dass auf dem Plateau auch zahlreiche Münzen gefunden wurden, die von weitentfernten Stämmen (z. B. Remern, Sequanern etc.) stammten. Dies spricht für die überregionalen Kontakte, die die Bewohner des Donnersberges gepflegt haben. Obwohl auch ein Münzstempelfragment gefunden wurde, kann nicht mit letzter Sicherheit gesagt werden, ob der Donnersberg eine Münzprägestätte war. Natürlich wurden auch auf dem Donnersberg diverse Schmuckstücke (bronzene Ringe, Fragmente von Glasringen) sowie Trachtzubehör (Fibeln, Gürtelbestandteile) gefunden.
Keltisches um den Donnersberg Vor allem Jugendlichen zu empfehlen ist das Keltendorf am Fuße des Donnersberges in Steinbach gelegen. Obwohl die Größe dieses 2003 ins Leben gerufenen und 2004 eröffneten Dorfes eher überschaubar ist, ist man vor Ort bemüht, den Besuchern einiges zu bieten. In mehreren Häusern werden verschiedene Aspekte des eisenzeitlichen Lebens erklärt. Dabei ist es durchaus erwünscht, dass der Besucher „Hand anlegt“ und die alltägliche Arbeitsweise und Geräte ausprobiert. Zweisprachige Tafeln geben Informationen zum keltischen Leben und weisen, was als vorbildlich betont werden muss, deutlich auf die Interpretationsspielräume hin, die bei den Rekonstruktionen vor allem der Gebäude existieren. So weist eins der Gebäude mehrere Etagen auf, die zwar statisch möglich waren, aber aufgrund der Holzbauweise
[ 47 ]
nicht nachzuweisen sind. Das gesamte Angebot wird durch Führungen und Mitmachaktionen für Jugendliche ergänzt (s. Abb. 13). Erwähnenswert ist auch der ebenfalls in Steinbach gelegene Keltengarten. Hier wird versucht die Landschaft zu rekonstruieren, wie sie zur Zeit der keltischen Besiedlung im Donnersbergkreis vorgeherrscht hat. Auch wenn man bei den Informationen zu diesem Garten eine teilweise starke Vermischung unterschiedlicher keltischer Strömungen erkennen kann (bei denen die Esotherik eine offensichtlich große Rolle spielt), muss den Initiatoren zu Gute gehalten werden, dass sie sich einiger Schwächen bewusst sind und offen damit umgehen. Der Garten stellt auf jeden Fall einen Beitrag zum Naturschutz der Region dar.
[ 48 ]
Hohenasperg
Hohenasperg Der A81 Richtung Stuttgart folgend, muss man an der Ausfahrt Asperg abfahren, um zum Hohenasperg zu kommen. Vor Ort ist, außer dem die umgebende Landschaft um ca. 100 m überragenden Zeugenberg selbst, kaum noch Keltisches zu sehen. Zumindest kann man mit gutem Gewissen behaupten, dass es eine Siedlungskontinuität bis in die heutige Zeit gibt, denn auf dem Berg ist heute neben der Renaissance festung Hohenasperg auch ein Justizvollzugskrankenhaus gelegen. Doch war die keltische Höhensiedlung auf dem Hohenasperg bedeutend und steht in Verbindung mit den vielen keltischen Funden der Region (so zum Beispiel zu den neuesten Grabfunden in Ludwigsburg und dem Fürstengrab von Hochdorf). Für die prähistorische Archäologie ist gerade diese genannte Siedlungskontinuität ein Problem, da die entsprechenden Fundschichten durch die tiefgreifenden Veränderungen (hier muss vor allem an den Festungsbau aus dem 16. Jahrhundert gedacht werden) vollständig zerstört wurden. Einzig an den Hängen des Hohenaspergs wurden einige Scherben gefunden. Diese belegen aber eine Besiedlung der Anhöhe seit ca. 4000 v. Chr. Dass allein in einem Umkreis von 10 km um den Berg ca. 400 Siedlungsstellen aus dem 5. Jahrhundert und diverse Grabhügel mit reichen Grabfunden gefunden wurden, zeugt von der Bedeutung des Hohensapergs. Daher wird hier der zu den umliegenden Gräbern gehörige Fürstensitz aus dem 6. und 5. Jahrhundert v. Chr. vermutet. Im Jahr 2003 wurde der ca. 30 km lange Keltenweg eröffnet. Er führt vom Hohenasperg über den Kleinaspergle, Katharinenlinde, Hochdorf, das Grabhügelfeld Pfaffenwäldle, den Grabhügel Birkle und Schökingen nach Hirschlanden und lässt sich sowohl zu Fuß als auch mit dem Rad gut nachvollziehen (s. Abb. 14, 15).
Grabungsgeschichte Aufgrund der bereits beschriebenen schlechten Fundsituation, kann die Bedeutung des Hohenaspergs nur durch die Funde in seiner näheren Umgebung erklärt werden. Die Bedeutung des Berges wurde wohl zuerst von Eduard Paulus dem Jüngeren erkannt. 1877 wurden
[ 49 ]
bei Arbeiten am Ludwigsburger Römerhügel zwei reiche Grabfunde ähnlich denen von Hochdorf gefunden. Paulus bezeichnete diese als Fürstengräber und setzte sie in den Zusammenhang mit der nahegelegenen Höhenfestung. 1879 fand Oskar Fraas, der bereits die Grabungen auf dem Römerhügel archäologisch begleitet hat, südlich des Hohenaspergs im Kleinaspergle ein weiteres reiches Grab, welches sich durch die gefundenen attischen Trinkschalen in die Mitte des 5. Jahrhunderts datieren ließ. Seit dieser Zeit wurde in der Region eine Vielzahl reicher Bestattungen gefunden. Das bei weitem reichste Grab der Hohenaspergregion wurde 1963 im Asperger Ortsteil Grafenbühl gefunden. Obwohl bereits antik beraubt, zeugten allein die zurückgelassenen Gegenstände vom ursprünglichen Reichtum der Grabbeigaben. Das Grab wurde in den Jahren 1964/1965 von Hartwig Zürn untersucht. Seit 1966 ist die Region um das Kleinaspergle ein Landschaftsschutzgebiet.
Die Gräber Oft ist in der Literatur die Rede von den Fürstengräbern um den Hohenasperg. Und tatsächlich ist die gesamte Region (vor allem südlich des Hohenasperges) reich an monumentalen Gräbern. Selbst der Großgrabhügel von Hochdorf muss in diesem Zusammenhang gesehen werden. Nicht auf alle Gräber kann hier ausführlich eingegangen werden. Neben Hochdorf (siehe unten) sind Katharinenlinde, Schöckingen, Hirschlanden, die Gräber des Asperger Stadtgebiets (Hohen asperg, Grafenbühl, Kleinaspergle), das Gräberfeld von Osterholz, der Ludwigsburger Römerhügel und Bad Cannstatt zu nennen. Bis jetzt sind auch noch nicht alle dieser Grabhügel untersucht worden. Es wird aber vermutet, dass von allen Gräbern der Region, das im Asperger Stadtgebiet 1963 gefundene (und ein Jahr später untersuchte) Grab in Grafenbühl am reichsten ausgestattet war. Wie bereits erwähnt, war es antik beraubt, aber allein die zurückgelassenen Beigaben lassen auf die ursprüngliche Ausstattung schließen. Schon diese Reste sprechen für weitreichende Fernkontakte. So wurde ein Klapperblech gefunden, wie es im griechischen und etruskischen Gebiet benutzt wurde. Außerdem wurden Bernstein- und Beinfragmente gefunden (letztere gehörten offensichtlich zu einer Sitzbank, die Ähnlichkeiten mit attischen Modellen aufweisen und auch importiert sein
[ 50 ]
Hohenasperg
könnte, oder zu einer Truhe) und auch die bekannten bernsteingesichtigen Sphingen werden als griechische Importware angesehen. Auch Reste eines Wagens sowie Anzeichen für ein Trinkgeschirr (z. B. ein Henkelbruchstück eines Bronzekessels und zwei gegossene Löwenfüße, die als Reste eines importierten Kesselgestells gedeutet werden) waren im Grafenbühler Grabhügel. Bestattet war hier ein ca. dreißigjähriger Mann, dessen Skelett völlig zerstört am südwestlichen Rand der Kammer lag. Bei der Auffindung war der Befund des Grafenbühler Grabes durch die jahrhundertlange landwirtschaftliche Nutzung stark gestört. Man kann aber vermuten, dass über diesem Grab ein ca. 40 m durchmessender Hügel gestanden hat. In der Nähe des Zentralgrabes, welches anscheinend über einem noch älteren Grab angelegt worden war, fand man auch 33 Nebenbestattungen. Heute ist der gesamte Grabhügel durch die Überbauung zerstört. Die Datierung des Grabes ist widersprüchlich. Stammen die zur Tracht des Toten gehörenden Fibeln aus der späten Hallstattzeit (Ha D2-D3, d. h. um 500 v. Chr.), so lassen sich einige der Beigaben in das 7. Jahrhundert datieren. Sie sind also gebraucht in das Grab gekommen. Auch das bereits 1879 ausgegrabene Nebengrab im Kleinaspergle fällt durch seine reiche Ausstattung auf (das Hauptgrab war antik beraubt). Indem sie einen Stollen in den Grabhügel trieben, gelangten die Ausgräber zu einer Grabkammer, die knapp 2,8 m in den gewachsenen Boden eingetieft war. Gewebeabdrücke zeigen, dass die Kammer mit Textilien ausgekleidet war oder zumindest die Beigaben damit eingeschlagen waren. Diese bestand aus einem umfangreichen Trinkservice, zu dem eine verzierte Bronzekanne, ein etruskischer Stamnos und zwei widderköpfige Trinkhornbeschläge aus Gold gehören, sowie einem Ring, einer eisernen mit Goldblech überzogenen Gürtelschnalle, diversen runden Goldplättchen und vier Goldblechstreifen. Auch hier liegen Beweise für Südkontakte, in Form des aus Etrurien stammenden Stamnos und einer attischen rotfigurigen Trinkschale sowie einer schwarzen attischen Schale, vor. Beide Schalen waren offensichtlich in Gebrauch und zerbrochen, wurden dann aber mittels einiger Goldplättchen repariert. Hieran kann man ermessen, welchen Wert sie für den Eigentümer gehabt haben. Hergestellt wurden die Schalen um 450 v. Chr. in Athen. In der rotfigurigen Schale ist eine Opferpriesterin zu sehen. Erwähnenswert ist auch die Asperger Schnabelkanne, die zwar nach etruskischen Vorbildern gefertigt, aber sicherlich eine eigenständige keltische Arbeit war. Hier wurde nicht kopiert, sondern der Hand
[ 51 ]
werker ließ sich inspirieren, erstellte aber eigene Formen. Der Henkel ist an beiden Rändern mit Masken verziert, bei denen sich der Künstler an griechischen Satyrdarstellungen orientiert hat, vermutlich denen des tatsächlich importierten Stamnos. Es muss vermutet werden, dass die Kanne nicht für den alltäglichen Gebrauch gedacht war, da ihre Standfläche verhältnismäßig klein ist und sie daher leicht umgefallen wäre. Nach ihrem Fund – zu dieser Zeit waren nur wenige etruskische Schnabelkannen bekannt – wurde die Kanne zwar bereits rekonstruiert, im Jahr 1986 gab es aber eine Neurekonstruktion entsprechend aktueller Forschungserkenntnisse. Bei dem Grab des Kleinaspergle handelt es sich um das jüngste Prunkgrab der Hohenasperg-Region. Allerdings muss beachtet werden, dass dieses Grab „nur“ eine Nebenbestattung im Grabhügel war. Fraas ließ den Stollen bis in das Hügelzentrum treiben und fand dort ein beraubtes Zentralgrab vor. Es wird vermutet, dass der ursprüngliche Grabhügel einen Durchmesser von ca. 40 m hatte und erst bei der Anlage des Nebengrabes auf seine endgültige Größe von 60 m Durchmesser vergrößert wurde und in der Zeit um 450/425 v. Chr. angelegt wurde. Auch die Bestattung im 1877 entdeckten Grab des Römerhügels war mit reichen Beigaben versehen. Hierzu gehört neben einem goldenen Halsreif und einem Dolch nebst Schleifstein auch ein Trink- und Essservice, bestehend aus einem Trinkhorn (von dem nur der Goldbeschlag gefunden wurde), einer Rippenziste, einem Kessel sowie einem Becken und einem Teller mit einem Perlrand. Außerdem wurden die Reste eines zum Teil bronzebeschlagenen Wagens und eines eisernen Pferdezaumzeugs gefunden. Im Jahr 1926 wurden bei dem Versuch, den Wasserbehälter, der zur Auffindung des Grabes beigetragen hat, zu erweitern, 15 Nachbestattungen gefunden. Insgesamt kann man feststellen, dass in der Hohenasperg-Region eine auffällig große Anzahl von Gräbern zu finden ist, die „Symbole der Macht“ (hierzu auch oben „Fürstengrab-/Fürstensitzdebatte“ und unter „Hochdorf“) enthalten (nicht auf alle konnte hier eingegangen werden). Diese Dichte ist auffällig und es ist allein deshalb fraglich, ob wirklich jeder der Bestatteten eine politische oder religiöse Machtposition inne hatte, oder ob nicht der eine oder andere der Bestatteten einfach nur reich genug war, um sich diese Beigaben leisten zu können.
[ 52 ]
Hohenasperg
Die Bedeutung der Region Die Vielzahl an Grab- und Siedlungsfunden in der näheren und weiteren Entfernung rund um den Hohenasperg belegen, dass die gesamte Region ein bedeutendes Zentrum der Frühlatènezeit in Südwestdeutschland war. Daher stellt sich für die Wissenschaft immer wieder die Frage, wie groß das Gebiet wohl gewesen sei, welches der Fürst vom Hohenasperg beherrschte. Aktuell geht man von einem Territorium aus, welches vom Schwarzwald bis zum Nordrand der Alb gereicht hatte. Außerdem muss man sich aufgrund des Reichtums der Gräber fragen, woher dieser stammt. Untersuchungen haben gezeigt, dass vor allem Eisen und Salz wichtige Handelsgüter der Region waren.
[ 53 ]
Hochdorf Die A5 bei Bruchsaal verlassend, folgt man zuerst der B35 und dann der B10 Richtung Stuttgart, um kurz nach Vaihingen an der Enz der Ausschilderung nach Hochdorf zu folgen. Im Ort angekommen, biegt man am Friedhof nach rechts und kommt direkt zum Museum (die Parkplätze befinden sich 50 m weiter). Wer auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen ist, kann stündlich Busse entweder ab dem IC- und ICE-Bahnhof Vaihingen/Enz oder den S-Bahnhöfen Stuttgart Feuerbach bzw. Stuttgart Zuffenhausen nehmen. Es ist sinnvoll zuerst in das Museum zu gehen. Anschließend kann man entscheiden, ob man den fünfminütigen Fußmarsch zum Grabhügel noch unternehmen möchte. Allein wegen der Aussicht ist dies aber empfehlenswert.
Geschichte der Grabungen Die Entdeckung des Hochdorfer Prunkgrabes ist Renate Leibfried zuzuschreiben, die 1977 auf einem Acker auffällige Steine entdeckte. Aus der Luft erkannte man schließlich einen Steinring. Vom ehemals ca. 6 m hohen Hügel waren zu dieser Zeit nur noch 1,5 m übrig (und dies beim Nordteil des Hügels; andere Bereiche waren vollständig eingeebnet und sogar bis unter die ursprüngliche hallstattzeitliche Oberfläche abgetragen). In den Jahren 1978/1979 wurden die Reste des Hügels schließlich vollständig ergraben und es wurde eine unberaubte und reich ausgestattete, hölzerne Grabkammer (4,7 m x 4,7 m) gefunden. Nicht nur, dass Gold, Bronze und Eisengegenstände gefunden wurden, auch diverse organische Materialien haben sich in dem Grab gut erhalten. Die Grabung gestaltete sich als aufwändiger als ursprünglich gedacht, da sich herausstellte, dass der Grabhügel auf einer jungsteinzeitlichen Siedlung lag, die ebenfalls ausgegraben werden musste. Bestattet war hier ein ca. vierzigjähriger Mann. Er lag auf einer Bronzeliege und trug aufwändigen Goldschmuck sowie Waffen. Außerdem war ihm ein kleines Säckchen mit Angelhaken auf die Brust gelegt worden. Im Grab befanden sich weiterhin ein Wagen, ein großer Bronzekessel, sowie mehrere Trinkhörner mit verzierten Beschlägen. Die
[ 54 ]
Hochdorf
Knochen des Bestatteten konnten vollständig und sachgerecht geborgen werden, wodurch eine genaue Untersuchung ermöglicht wurde, die es uns erlaubt, ein besseres Bild des Bestatteten zu erhalten, als bei anderen Gräbern. Das Grab selbst wird auf ca. 540 v. Chr. datiert. Es zählt zu den wohl besterhaltenen Prunkgräbern dieser Zeit. Obwohl in einem so großen Grabhügel zahlreiche Nachbestattungen zu vermuten waren (ähnlich wie beim Magdalenenberg), haben sich nur drei erhalten. Dies liegt aber sicherlich am schlechten Erhaltungszustand des Hügels insgesamt. Es existieren aber zahlreiche Bronzefunde, die aus diesen Gräbern stammen könnten. Die Untersuchung und Restaurierung der Funde dauerte fünf Jahre und gipfelte in einer in Stuttgart vorgestellten Landesausstellung.
Das Museum Das 1991 eröffnete Museum widmet sich ganz der keltischen Kultur und dem Hochdorfer Fürstengrab. Dies geschieht bereits durch die architektonischen Elemente. So spannt sich ein 60 m breiter und 6 m hoher Metallbogen über den gesamten Bau. Dessen Maße entsprechen den ursprünglichen Maßen des Grabhügels. Auch die im Museum rekonstruierte Grabkammer befindet sich an der entsprechenden Stelle. Betritt man das Museum, so wird man zuerst in einem allgemeinen Teil über die Arbeit der Archäologen und die Epocheneinteilungen informiert. Ausführlich wird auf die Arbeit der Ausgräber und Restauratoren in Hochdorf eingegangen. Aufgrund der räumlichen Nähe wird hier auch in einigen Tafeln auf die Prunkbestattung von Hohen asperg eingegangen, sowie auf keltische Fürstengräber im Allgemeinen und das keltische Bestattungsbrauchtum (s. Abb. 16). Weitere Schwerpunkte der Ausstellung bilden die keltische Tracht sowie die Hochdorfer Siedlung. Auch eine Kopie der Statue des Kriegers von Hirschlanden befindet sich im Museum. Vorbei an den ausgestellten Überresten des Hochdorfer Fürsten gelangt man in den Bereich des Museums, welcher sich hauptsächlich dem Fürstengrab widmet. Hier findet man neben einem Modell des Grabhügels Informationen zur Arbeitsweise auf der Baustelle und Rekonstruktionen diverser Funde. Die im Grab gefundenen Objekte werden auf Tafeln mit dem vermuteten Alltagsleben des Bestatteten in Verbindung gebracht. Weiterhin
[ 55 ]
wird der Besucher über die Handwerkstechnik der Kelten informiert, wobei positiv zu bemerken ist, dass kein Hehl daraus gemacht wird, dass es sich bei den gezeigten Fertigungsprozessen nur um Annahmen aufgrund von experimentalarchäologischen Untersuchungen handelt. Sicherlich ein Highlight der Ausstellung ist die maßstabsgetreue Rekonstruktion der Grabkammer, die eindrucksvoll die Ausmaße aber auch den Prunk und Aufwand, mit denen der Tote bestattet wurde, aufzeigt (s. Abb. 17). Zum Abschluss seines Besuches kann man sich noch einen mehrminütigen Film über Hochdorf ansehen. Ein Besuch des Freigeländes ist ebenfalls empfehlenswert. Hier werden verschiedene nachgewiesene Haustypen mit deren Funktion vor gestellt. Im größten der Häuser kann man nach Voranmeldung an museumsdidaktischen Aktivitäten teilnehmen.
Fürstengrab und Fürstensitz? Hochdorf ist vor allem auch für die Frage nach den potentiellen Wohnsitzen keltischer Fürsten von Bedeutung. In der Forschung wird allgemein davon ausgegangen, dass das Fürstengrab in direkter Abhängigkeit zur befestigten Siedlung auf dem 10 km entfernten Hohenasperg steht. Dennoch findet sich in unmittelbarer Nähe des Grabes eine weitere, ganz offensichtlich unbefestigte 15 ha große Siedlung (sie liegt z. T. unter dem heutigen Parkplatz des Museums), die allerdings nicht zeitgleich mit dem Grab ist.Weiterhin findet sich ein Grabhügelfeld im Pfaffenwäldle, welches weitere bedeutende Funde hervorgebracht hat. Trotz der Bedeutung der Funde existiert keine Publikation über die 1911 hier vorgenommene Grabung. Heutzutage kann man es über einen Waldrundweg besuchen. In der Siedlung selbst lassen sich diverse Werkstätten nachweisen. Unter anderem ist für die Hochdorfer Siedlung der seltene Nachweis einer Bernsteinbearbeitung erbracht worden. In der Siedlung von Hochdorf-Reps selbst wurde herausragende griechische Importkeramik gefunden, die von dem hohen Lebensstandard der Bewohner zeugt. Auffällig ist auch die planmäßige Bebauung, die der Siedlung den Charakter eines Straßendorfes gibt. Der Fund einer Feinwaage deutet an, dass diese Siedlung ein hochspezialisiertes Produktionszentrum war. Das eigentliche Fürstengrab ist umfangreich untersucht worden und lässt Rückschlüsse über die Art und Weise zu, wie man sich den Bau
[ 56 ]
Hochdorf
eines solchen Grabhügels vorstellen muss. Schon allein die Größe (der Durchmesser betrug ursprünglich 60 m) lässt vermuten, dass in meh reren Phasen vorgegangen wurde und einige Zeit bis zur Vollendung verstrich. Zur Stabilisierung des Hügels wurden Steineinbauten verwendet. Eingefasst wurde der Hügel von einem Steinkreis mit senkrecht stehenden Pfosten. Beim Grab selbst handelt es sich um ein Schachtgrab dessen hölzerne Grabkammer von einem Blockbau umgeben war, der wiederum durch einen Steinmantel und eine erneute 7,4 m x 7,5 m große Kammer geschützt war. Der Schacht war nach Norden hin ausgerichtet und besaß einen Eingang aus Steinmauern. Die Kammer selbst lag 2,5 m unter dem ursprünglichen Bodenniveau. Die 4,7 m x 4,7 m große Kammer hatte eine Mindesthöhe von einem Meter. Diese lässt sich aber nur anhand der Beigaben vermuten. Das Innere der Kammer war anscheinend mit Tüchern ausgelegt bzw. behangen. Vor allem im Bereich der oxidierten Eisenteile des Wagens ließen sich grobgewebte Stoffreste nachweisen. Außerdem wurde entlang der Wände eine Vielzahl von Eisenstiften und Bronzefibeln gefunden, die wohl dazu gedient haben, die Stoffbahnen zu drapieren und zu halten. An der Westseite der Kammer lag der Tote in Nord-Südausrichtung. Für die Datierung des Grabes gibt es verschiedene Anhaltspunkte. Zum einen kann man die Fibelformen heranziehen. Diese machten im Laufe der Zeit eine Veränderung durch, bedingt durch die Verbesserung der Webtechnik und die daraus resultierende größere Feinheit der Stoffe, die auch feinere Fibeln benötigten. Hierdurch kann das Grab auf die Übergangszeit zwischen Ha D1 und Ha D2 datiert werden. Eine dendrochronologische Datierung war indes nicht möglich, aber archäologisch kann der Kessel (u. a. aufgrund der sich darauf befindlichen Löwenfiguren) in die zweite Hälfte des 6. Jahrhunderts datiert werden, so dass das Grab danach entstanden sein muss. Hiermit reiht sich das Grab in die zeitgleichen bzw. zeitnahen Gräber der Hohenasperg-Region ein, zu der es im Allgemeinen gerechnet wird (s. Abb. 16, 18).
Der Fürst von Hochdorf Aufgrund des guten Erhaltungszustandes des Grabes, bedingt durch seine Unversehrtheit, und durch die Mitarbeit eines Anthropologen bei der Bergung der Knochenreste, ist es möglich, einige interessante
[ 57 ]
Fakten zu dem Bestatteten zu rekonstruieren. Er ist mit ca. vierzig bis fünfzig Jahren verstorben und ist damit für die damalige Zeit überdurchschnittlich alt geworden. Die Todesursache kann allerdings heute nicht mehr bestimmt werden. Mit einer Körpergröße von 187 cm hat er seine Zeitgenossen sicherlich überragt. Außerdem zeigen sich auf den Knochen stark ausgebildete Muskelansätze aus denen auf eine sehr kräftige Muskulatur geschlossen werden kann. Allerdings scheint der Fürst unter Arthritis gelitten zu haben, was in seinem Alter aber nicht ungewöhnlich ist. Auch sind seine Zähne stark abgenutzt, aber Karies und Zahlwurzelentzündungen konnten im Gegensatz zu Parodontitis nicht nachgewiesen werden. Insgesamt war der Bestattete eine körperlich auffallende Erscheinung.
Die Funde Die Beigaben des Hochdorfer Fürstengrabes waren reichhaltig. Die Tracht des Bestatteten bestand aus der mit zwei bronzenen Schlangenfibeln zusammengehaltenen Kleidung, einem Hut aus Birkenrinde, einem goldenen Halsring und einem Dolch. Weitere persönliche Gegenstände waren ein Nagelschneider (mit dazugehörender Tasche), ein Rasiermesser, ein Kamm, mehrere Bernsteinperlen, drei Angelhaken aus Eisen und ein Köcher mit Pfeilen. Einiges an Goldschmuck scheint indes extra für die Bestattung hergestellt worden zu sein. Hierzu gehören eventuell die bereits genannten Schlangenfibeln, sowie der Goldbelag des Dolches, das goldene Gürtelblech und die Schuhbeschläge. Weiterhin fand man ein Trinkgeschirr, bestehend aus neun mit Goldbändern verzierten Trinkhörnern, einem Bronzekessel, der als Importware anzusehen ist, sowie einer goldenen Schöpfschale. Auf dem ebenfalls mit ins Grab gegebenen Wagen waren neun Teller sowie drei Bronzeschalen gestapelt. Weiterhin fand man eine eiserne Axt, ein Messer und eine eiserne Lanzenspitze im Grab. Die meisten dieser Beigaben kann man als traditionell für diese Zeit ansehen, auffällig ist hingegen die bronzene Liege, auf die der Tote gebettet war. Beachtenswert für die Forschung ist die große Zahl an Textilfunden, die sich im Hochdorfer Grab erhalten haben. Auffällig ist außerdem, dass sämtliche Beigaben an den Wänden der Kammer gefunden wurden, während das Zentrum fundleer war.
[ 58 ]
Hochdorf
Die Bronzesitzbank Der Tote aus dem Prunkgrab war auf eine aufwändig verzierte bronzene Bank gebahrt. Diese, in der Literatur meist als Kline angesprochen, wurde von acht weiblichen Figuren auf Rädern getragen und war daher fahrbar. Sie hat eine Länge von 2,75 m und war mit Textilien und Fellen gepolstert. Außerdem existierte ein grasgefülltes Kissen, auf dem der Kopf des Toten ruhte. Dieses, in neueren Publikationen als Sofa titulierte Möbelstück ist bis heute ohne wirkliche Parallelen. Die Sitzbank stand an der Westseite der Grabkammer. Durch den Einsturz der Holzwand wurde die Rückenlehne auf die Sitzfläche gebrochen, was die Rekonstruktion am Anfang schwierig machte. Gefertigt waren Sitzfläche und Lehne jeweils aus sechs bronzenen Blechbahnen, die zusammengenietet wurden und deren Außenränder, ähnlich wie bei Situlen, um einen Eisenstab gelegt worden waren. An beiden Schmalseiten fanden sich angenietete Griffe, an der Rückenlehne sind Ringglieder und Anhänger angebracht, an denen wahrscheinlich die Polsterung bzw. Bespannung der Liege befestigt werden konnte. Eine Auflage aus Fellen und Stoffen konnte nachgewiesen werden, unklar ist aber, ob sie zur Totenausstattung gehörte oder zum Möbelstück an sich. Die Rückenlehne ist mit figuralen Szenen verziert. Die meisten sind durch verschiedene Punzen gebildet, die eine Art Perllinie bilden, wodurch die Figuren umrissen wurden. Dargestellt sind hier zwei Wagenfahrten, sowie drei Paare von Menschen, die Schwerter tragen (s. Abb. 18, 19). Aufgrund der Haltung werden sie als Schwerttänzer bezeichnet. Ähnliche Darstellungen finden sich auf dem Helm von Cremona. Außerdem bestand die Verzierung aus plastisch aus dem Blech getriebenen Ringbuckeln. Die gesamte Liege wird von acht gleichmäßig an den Längsseiten stehenden Frauenfiguren getragen, die die Kline auf Kopf und ausgestreckten Händen tragen. Verziert waren die Figuren mit Korallen. Außerdem sind die Figuren mit unterschiedlichen Schmuckstücken versehen. Augen und Nasen der Figuren sind im Gegensatz zu den Mündern sorgsam ausgearbeitet. Jede der Figuren steht auf einem Rad, wodurch die gesamte Kline zumindest in Richtung der Breitseite beweglich wurde. Die Figuren der Vorderseite (35 cm) waren drei Zentimeter höher als die hinteren. Hierdurch ergibt sich die relativ geringe Sitzhöhe von 35 cm.
[ 59 ]
Die Sitzbank zeigt deutliche Gebrauchsspuren und wurde daher wohl nicht extra für die Bestattung hergestellt. Es stellt sich aber die Frage nach dem Herstellungsort. Hierfür gibt es verschiedenste Deutungen, festhalten kann man aber, dass die gesamte Herstellung ohne eine Kenntnis der Kunst südlich der Alpen nicht vorstellbar ist. Das bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass es sich bei der Bank um ein Importstück handeln muss. Doch ist das Möbelstück mit großer Sicherheit im Zusammenhang mit dem Geschirr zu sehen. Zumindest zeigen Darstellungen auf oberitalienischen Situlen Gelage, bei denen ähnliche Möbelstücke eine Rolle gespielt haben. Man könnte so weit gehen, zu behaupten, dass das gesamte Grabinventar ein Spiegelbild der auf Situlen abgebildeten Gelage darstellt. Die Forschungen um die Sitzbank sind nicht abgeschlossen. Aktuell ist sie Forschungsgebiet eines von der DFG finanzierten Projekts.
Das Trink- und Speisegeschirr Das Trinkgeschirr des Hochdorfer Fürsten bestand aus neun gold verzierten Trinkhörnern, einem mit drei ruhenden Löwen dekorierten Bronzekessel sowie einer goldenen Schale, die zum Schöpfen und/oder Trinken benutzt wurde. Auch das auf den Wagen gestapelte Speise geschirr reichte ebenfalls für neun Personen aus. Aus diesem Tafel geschirr kann man auf die Bedeutung schließen, die das Gastmahl bei den Kelten hatte. Dies bestätigen die antiken Quellen. So schreibt Athenaios (Poseidon zitierend): „Wenn eine größere Anzahl gemeinsam eine Mahlzeit einnimmt, sitzen sie im Kreis, in der Mitte der mächtigste, wie ein Chorleiter. […] Der Gast sitzt neben ihm, dann folgen der Reihe nach zu beiden Seiten die anderen je nach der Würde, die sie haben.“ (Athen. 4, 36) In der Folge beschreibt Athenaios sogar das Geschirr, eine Beschreibung, die auffällig mit Grabfunden aus keltischen Gräbern übereinstimmt: „Die Bediensteten reichen das Getränk in Krügen herum, die wie Schnabelgefäße aussehen und entweder aus Ton oder Silber gefertigt sind. Aus solchem Material bestehen auch die Platten, auf denen sie die Speisen vorlegen. Andere benutzen bronzene, wieder andere aus Holz oder aus Weidenruten geflochtene Körbe.“ (Athen. 4, 36) Die Trinkhörner waren an der Südwand der Grabkammer mit eisernen Haken befestigt. Acht der Hörner bestanden aus den Hornscheiden von Auerochsen, das neunte Horn wurde aus Eisen geformt und hing direkt über dem Kopf des Toten. An der Spitze dieses Hornes war ein
[ 60 ]
Hochdorf
Gehänge aus Eisenkettchen mit verzierten Knochenperlen angebracht. Alle Hörner hatten tordierte Henkel und sind an der Mündung mit Goldbändern geschmückt (wohl erst für die Bestattung), außerdem sind die Hörner aus Horn mit zwei, das Eisenhorn mit drei Bronzebändern verziert gewesen. Die Spitzen der Auerochsenhörner waren mit geschnitzten Knochenknöpfchen versehen, von denen aber nur drei erhalten sind. Die Anzahl der dem Toten mitgegebenen Hörner sowie das Volumen des Eisenhornes von ca. 5,5 l sind bislang ohne Parallelen. Der rundbodige Bronzekessel stand ursprünglich auf einem eisenbeschlagenen Holzgestell (dessen ursprüngliche Form aufgrund der starken Beschädigungen nicht mehr sicher rekonstruiert werden kann) in der nordwestlichen Ecke der Grabkammer. Er hatte ein Fassungsvermögen von 500 l, war mit drei ruhenden Löwen verziert und besaß drei bewegliche Henkel (s. Abb. 20). Bei ihm handelte es sich um ein Importstück aus einer griechischen Werkstatt. Auffällig ist, dass einer der drei L öwen, aus welchen Gründen auch immer, erst in Süddeutschland gegossen wurde. Archäobotanische Untersuchungen zeigten, dass der Kessel Met enthielt, dessen Honig in einem größeren Umkreis um den Hügel gesammelt wurde. Dieser Umkreis wird zugleich als Einflussbereich des Toten gesehen, doch ist dies eine nicht beweisbare These. Auf dem Kesselrand haben sich Textilreste erhalten und im Kessel fand man die genannte Goldschale. Ursprünglich stand diese somit vermutlich auf Tüchern. Zum Speisegeschirr werden alle auf dem Wagen gelagerten Gegenstände gezählt. Neben neun Tellern und drei Platten/Becken waren dies eine Axt, ein Messer und ein nicht näher zu definierender Gegenstand aus Hirschgeweih. Mindestens zwei der Becken waren geflickt, sie waren also (wertvolle) Gebrauchsgegenstände. Obgleich von diesem Beckentyp (Typ Hatten, zurückgehend auf etruskische Vorbilder) bislang nur wenige Exemplare gefunden wurden, ist es auffällig, dass gerade im nahegelegenen Ludwigsburger Römerhügel ein nahezu identisches Exemplar zum Vorschein kam. Sowohl die Ränder der Becken als auch die der Teller sind unterschiedlich verziert und auch bei den Tellern sind Reparaturen bemerkbar. Das gesamte Geschirr hatte eine wesentliche Bedeutung im Totenkult (wie Parallelfunde zeigen), aber es wurde ganz offensichtlich nicht einzig für die Bestattung hergestellt, sondern war bereits vorher in Gebrauch.
[ 61 ]
Die Tatsache, dass zumindest eins der Trinkhörner eindeutig kostbarer war als die anderen, ist ein Beleg dafür, dass der Bestattete eine hervorgehobene Position gegenüber seinen Mitmenschen hatte. Wir haben im Hochdorfer Grab einen der wenigen greifbaren Belege, dass es sich beim Bestatteten tatsächlich um eine über seine normalen Mitmenschen herausragende Persönlichkeit handelt.
Der Wagen Der vierrädrige Wagen des Fürsten war nahezu komplett mit Eisenblech überzogen. Hierdurch haben sich Holzreste als Abdruck erhalten. Er weist ein hölzernes, aber bronzeverziertes Doppeljoch auf. Hierzu passend fand man Schirr- und Zaumzeug in doppelter Ausführung und einen Pferdestachel. Die Räder besaßen zehn Speichen und hatten einen Durchmesser von 89 cm. Im Verhältnis zu den Rädern wirkt der nur 8,5 cm hohe Kasten des Wagens geradezu zierlich. Der Kasten ist durch Eisenhalbkugeln reich verziert. Die ebenfalls eisenbeschlagene Deichsel hatte eine Länge von fast 2,4 m. Über ihre Beweglichkeit wird in der Forschung viel diskutiert. Durch den Einbruch der Kammerdecke w urde der Wagen stark zertrümmert und auf eine Stärke von knapp 5 cm zusammengedrückt worden. Neben dem beschriebenen Geschirr lag auf dem Wagen noch das mit Bronzescheiben reich verzierte Schirrzeug für zwei Pferde. Im Gegensatz zu anderen Wagengräbern war der Hochdorfer Wagen nahezu komplett montiert in die Grabkammer gestellt worden (nur die Achsnägel fehlten; s. Abb. 21).
Der Birkenrindehut Auch wenn für den Laien auf den ersten Blick nur bedingt spektakulär, ist der Hut aus Birkenrinde doch eine besondere Betonung wert. Er hat einen Durchmesser von knapp 40 cm und ist aus zwei, jeweils aus einem Rindenstück gearbeiteten, runden Scheiben gefertigt. An ihren Rändern wurden die Scheiben, aus denen Segmente geschnitten waren, um die konische Form zu erhalten, vernäht. Die äußere Scheibe weist Verzierungen auf. Dieser Hut wurde lange Zeit als Rang- bzw. Herrschaftsabzeichen verstanden. Ausschlaggebend ist hierfür nicht nur die Stele von Hirschlanden, die einen ähnlichen Hut auf hat (ursprünglich deutete man diesen als Lederhut), sondern auch der Nachweis von zum Teil vernähter Birkenrinde in anderen Gräbern (u. a. in Cannstatt). Inzwischen hat sich aber gezeigt, dass ähnliche Hüte auch in wesentlich
[ 62 ]
Hochdorf
weniger reichen Bestattungen zu finden sind. Damit scheinen diese Hüte zumindest keine ungewöhnlichen Beigaben in reichen Gräbern gewesen zu sein, sondern vielleicht eher eine regionale Mode.
Der Goldschmuck Der Tote von Hochdorf war mit reichem Goldschmuck bestattet. Hierzu gehörte ein goldener Halsreif mit einem Innendurchmesser von 20 cm, der aus einem Stück gearbeitet wurde. Der Ring war in drei Wülste gegliedert, die durch umlaufende Rippen verziert waren. Eine weitere Verzierung erfolgte durch Punzierung mit nachweislich drei verschiedenen Punzen. Diese Form der Halsringe wird als typische Beigabe für hallstattzeitliche Fürstengräber angesehen. Anders ist es mit dem übrigen Goldschmuck, der eher einmalig bzw. zumindest außerordentlich selten zu finden ist. Aus verschiedenen Gründen kann davon ausgegangen werden, dass dieser restliche Schmuck einzig für die Bestattung – wohl an Ort und Stelle – hergestellt wurde. Hierzu gehören zwei goldene Schlangenfibeln, ein Armreif, ein Gürtelblech, der Goldüberzug des Antennendolches, sowie die goldenen Schuhbeschläge. Die Schlangenfibeln sind insofern auffällig, als dass sie die einzigen derartigen hallstattzeitlichen Fibeln sind, die nördlich der Alpen gefunden wurden. Für den alltäglichen Gebrauch waren diese Fibeln nicht geeignet, zu leicht konnten sie auseinandergezogen werden. Sie waren daher wohl nur als Dekoration angesteckt. Hierfür spricht auch, dass beide auf der rechten (also der Grabkammerwand abgewandten) Seite angebracht waren. Dies war daher auch die Seite, die die an der Bestattung Teilnehmenden sehen konnten. Auch der Armreif, aufgrund seiner Breite kann man ihn eher als Stulpe bezeichnen, zeigte keine Gebrauchsspuren und war rechtsseitig getragen. Auch die den Dolch verzierenden Goldbleche waren mit der originalen Bronzescheide nicht so verwunden, dass sie einem alltäglichen Gebrauch standgehalten hätten. Die Verzierungen des Dolchbleches haben stilistische Ähnlichkeit mit dem goldenen Gürtelblech. Dieses war auf ein unverziertes Bronzeblech aufgenäht. Beachtenswert ist die Goldblechverzierung der Schuhe. Obwohl von den Schuhen selbst nichts erhalten ist, konnte deren Form an der Form der Bleche rekonstruiert werden. Es handelte sich um bis über die Knöchel reichende Schuhe mit aufgebogener Spitze ähnlich den Schnabelschuhen aus dem
[ 63 ]
frühen östlichen Latènebereich. Auch diese Bleche wurden nicht sorgfältig mit dem Schuh verbunden, sondern der linke wurde anscheinen mit dem rechten vertauscht. Zur Verzierung des gesamten Goldschmuckes wurden offenbar vier identische Punzen verwendet, was dafür spricht, dass diese Gegen stände aus einer Werkstatt stammen müssen. Ähnliches konnte auch bei den Verzierungen der Trinkhörner beobachtet werden. Nur der Halsreif passt nicht in das Muster, da er völlig andere Punzen aufweist. Er war also woanders gefertigt worden und es lässt sich auch aus diesen Informationen schließen, dass er nicht erst eigens für die Bestattung hergestellt wurde. Doch nur der Nachweis einer Goldverarbeitungsstätte in direkter Nähe des Grabhügels ließe den Schluss zu, dass dieser Goldschmuck vor Ort und für die Bestattung gefertigt wurde. Denn obwohl identische Punzen verwendet wurden, ist der Verzierungsstil sehr unterschiedlich.
Herrschaft und ihre Symbole – Beispiele aus Hochdorf Da mit dem Grab von Hochdorf eine der bestdokumentierten, hervorragend untersuchten und nicht beraubten Bestattungen in einem Großgrabhügel vorliegt, kann man in dem Bestatteten mit großer Sicherheit eine machtpolitisch bedeutende Person seiner Zeit sehen. Der allgemeinen – und, wenn wohl auch oft zutreffend, leider kaum diskutierten – Annahme folgend, sollen sich unter den Grabbeigaben einer solchen Person auch Gegenstände befinden, die seine Macht symbo lisieren. In Hochdorf liegt ein ähnlicher Fall vor wie am Glauberg (wenn auch nicht mit derselben direkten räumlichen Verknüpfung): es wurde eine Stele (die Statue vor Hirschlanden) gefunden, die ähnliche Gegenstände zeigt, wie sie im Hochdorfer Grab gefunden wurden. Hierzu gehören der konische Birkenrindenhut, der goldene Halsring sowie der prächtige Dolch. Daher werden diese Gegenstände gerne als Symbole der Macht angesehen. Doch vor allem die goldenen Halsringe scheinen, wenn auch unzweifelhaft wertvoll, bei den antiken Kelten nicht selten gewesen zu sein. Zum einen sind sie in recht großer Zahl gefunden worden, zum anderen berichten verschiedene antike Autoren davon, dass das Tragen von Goldschmuck bei den keltischen Völkern üblich gewesen ist. So berichtet u. a. Diodorus Siculus:
[ 64 ]
Ostsee
Nordsee Elbe
We se
r
We ic
hs
Od
el
er
in Rhe
Mo sel
Dn
Sein
e
au
n Do
Inn
Lo
Donau
ire
Dr
Save
au
u
na
Do
Rhône
Po
r
e Tib
Adria
Eb
Korsika
Mittelmeer
ro
100 200 300 km
Abb. 1: Oppida
Sardinien
Ta
jo
0
Kr. Ludwigshafen
Ostsee
Nordsee
Wes er
Elbe
We ic
h
Ode
r
Rh ein
os M
Sein
Loire
Hohenasperg
Rh e
in
e
Glauberg
el
Mont Lassais
Donau
au
Heuneburg
n Do
Inn
Drau Sav
e
Rhône
Po
Adria
Arno
er Tib
0
100
200
300 km
Mittelmeer
Korsika
Sardinien
Abb. 2: Handelswege
Od
er
N
Elb
e
S
Rhe
in
Main
Do nau
Donau
Bodensee
Pl
Genfer See
Drau Sa
ve
Abb. 3: Viereckschanzen
Adria
Po
0
50
100
150 km
Mittelmeer
Abb. 4: Rekonstruierte Pfosten am Glauberg
Abb. 5: Statue vom Glauberg
Abb. 6: Halsreif vom Glauberg in der Fundsituation
Abb. 7: Halsreif vom Glauberg
Abb. 8: Fingerring vom Glauberg
Abb. 9: Rekonstruierte Grabhügel im Europäischen Kulturpark Reinheim-Bliesbrück
Abb. 10: Der Donnersberg
Abb. 11: Wallschnitt am Donnersberg
Abb. 12: Rekonstruierte Mauer am Donnersberg
Abb. 13: Keltendorf am Donnersberg
Schlosspark Monrepos
N
te
ur
kf
an
Fr tr.
rS
Asperger Str.
S
str.
Lehen
Hirschbe
rgstr.
Bahnhofstr.
81
Asperger Str.
ASPERG
MÖGLINGEN Abb. 14: Funde der Hohenaspergregion
ge Markgrönin
0
. r Str
200 400 600 m
Abb. 15: Der Hohenasperg
Abb. 16: Museum Hochdorf Abb. 17: Rekonstruierte Grabkammer
Abb. 18: Detailansicht der Hochdorfer Liege
Abb. 19: Detailansicht der Hochdorfer Liege
Abb. 20: Löwe auf dem Kessel von Hochdorf
Abb. 21: Wagen von Hochdorf
Abb. 22: Der Magdalenenberg
Abb. 23: Grabkammer aus dem Magdalenenberg im Franziskanermuseum in Villingen-Schwenningen
Abb. 24: Gebäuderekonstruktionen im Freilichtmuseum der Heuneburg
Abb. 25: Der Ipf
Hochdorf
„Denn um die Handgelenke und Arme tragen sie Reifen, aber um den Nacken dicke ganz goldene Ringe und dazu schöne Fingerringe.“ (Diod. 5, 27, 3) Andere Autoren wie Polybios oder Strabon berichten ähnliches. Zu den Statusobjekten kommen der Wagen und ein Trinkservice hinzu. Gräber, die diese Beigaben aufweisen, werden daher als Grablegen von Stammesführern oder Priestern angesehen (dazu auch oben „Fürstengrab-/Fürstensitzdebatte“). Das Hochdorfer Fürstengrab ist ein Indiz dafür, dass auch die Präsentation des Toten im Rahmen der Bestattung eine wesentliche Rolle gespielt haben mag. Dies kann man vor allem daraus schließen, dass einige der Beigaben extra für die Bestattung angefertigt wurden, aber auch die Art der Präsentation des Leichnams auf der Bronzebank ist ein Hinweis hierfür.
[ 65 ]
Magdalenenberg Folgt man der A81 Richtung Süden, so gelangt man über die B27 nach Villingen-Schwenningen. Südlich des Stadtteils Villingen (der über die B33 zu erreichen ist) liegt der Magdalenenberg in exponierter Lage auf dem 769 m hohen Warenberg. Der mächtige ca. 8 m hohe Grabhügel selbst ist zwar ein hübsches Ziel für eine Wanderung, bietet aber dem an prähistorischen Ausgrabungen Interessierten kaum Informationen (s. Abb. 22). Das vor allem für den Laien etwas unspektakuläre Erscheinungsbild (beeindruckend sind allemal die Steinmassen, die bei der Ausgrabung beiseite geschafft werden mussten und immer noch in der Landschaft liegen) darf aber nicht über die wissenschaftliche Bedeutung des Ortes und die dort gemachten Funde hinwegtäuschen. Hierüber informiert eine Dauerausstellung im in Villingen gelegenen Franziskanermuseum. Parken sollte man auf einem der vielen ausgeschilderten Parkplätze und zu Fuß zum Museum gehen. Der für die Definition eines Fürstengrabes obligatorische Fürstensitz befindet sich ca. 3,5 km nordwestlich. Funde beweisen die chrono logische Parallelität. Der durch die Grabfunde nachzuweisende Reichtum der Siedlung ist durch die steigende Bedeutung des Eisens bedingt und damit durch die in der Region befindlichen Erzvorkommen.
Grabungs-/Forschungsgeschichte Eine erste Erwähnung des Magdalenenberges findet sich im Jahr 1320 und auch in den späteren Jahren stieß die markante Erhebung auf großes Interesse der Bevölkerung. Die Silhouette des Hügels findet sich auf diversen zeitgenössischen Abbildungen (so auch auf einem Kupferstich des Jahres 1704), im Jahr 1610 wurde auf der Kuppe ein Kreuz errichtet und Hexenprozessakten des Jahres 1633 ist zu entnehmen, dass die Beklagte unter Folter gestand, auf der Erhebung mit dem Teufel getanzt zu haben. Daher ist es nicht verwunderlich, dass der Grabhügel und die Umgebung bei der Bevölkerung als Geisterort galten. Schließlich wurde der Hügel aber auch landwirtschaftlich genutzt und verlor durch regelmäßiges Pflügen einiges an Höhe. 1887 erkannte man in ihm wieder einen künstlich aufgeschütteten Hügel, der als Grabhügel identifiziert wurde, und es wurde von Ernst Wagner ein Suchschnitt angelegt.
[ 66 ]
Magdalenenberg
Die ersten Grabungen auf dem Magdalenengrab wurden bereits im Jahr 1890 von Ernst Wagner und Karl Schumacher durchgeführt. Sie arbeiteten sich in der sogenannten Trichtermethode in den Hügel hinein. Die Hoffnung auf ein prächtig ausgestattetes Fürstengrab (in der mündlichen Tradition der einheimischen Bevölkerung wurde schon lange von einem verborgenen Schatz gesprochen, außerdem schürten andere in dieser Zeit gemachten Funde aus Fürstengräbern diese Hoffnung) wurde allerdings getäuscht, man fand nur ein bereits in vorrömischer Zeit völlig beraubtes zentral gelegenes Wagengrab, dessen hölzerne Grabkammer allerdings in einem hervorragenden Erhaltungszustand war. Von den sicherlich einmal wertvollen Bei gaben sind nur einige von den Räubern übersehene Reste geblieben (u. a. ein ca. 4 cm hoher Bronzevogel; einige Geräte für die Körper hygiene, sowie Teile von Zaumzeug und einem Wagen). Die Beraubung fand offensichtlich zu einer Zeit statt, als die Kammerdecke noch nicht eingestürzt war. Spuren der Plünderung sind drei Tannenholzspaten, die aufgrund der Dendrochronologiedaten beweisen, dass das Grab bereits ca. dreißig Jahre nach seiner Errichtung geplündert wurde. Hierfür musste ein nahezu 6 m tiefer Schacht in den Hügel gegraben werden, so dass man davon ausgehen muss, dass dieser Eingriff von der damaligen Bevölkerung mitbekommen wurde. Warum die Beraubung geduldet wurde, kann nicht mehr gesagt werden. Doch scheint gerade diese Beraubung in Verbindung mit dem lehmigen Boden Ursache für den guten Erhaltungszustand der Grabkammer gewesen zu sein. Durch das Loch in der Kammer konnte Wasser eindringen, welches wegen des verdichteten Lehmbodens nicht abfließen konnte und so das Holz konservierte. In der Hoffnung, unter der Kammer Funde zu machen, wurde von den ersten (wissenschaftlichen) Ausgräbern ein Loch in den Boden der Grabkammer geschlagen. Weitere Grabungen wurden in dieser Zeit nicht vorgenommen, die Enttäuschung über den fehlenden „Schatz“ war zu groß. Doch beeindruckte die Grabkammer so sehr, dass man sie der Öffentlichkeit als Besichtigungsobjekt erhalten wollte. In den achtziger Jahren bis zur endgültigen Bergung wurde die Kammer aber erneut von nachrieselndem Erdreich bedeckt. Aufgrund dieser ungünstigen „Lagerung“ waren bis zur endgültigen Bergung einige Lagen der Seitenwände vermodert. Erst in den Jahren 1970 bis 1973 wurde der riesige Grabhügel einer umfangreichen Untersuchung durch Konrad Spindler unterzogen, der
[ 67 ]
den gesamten Hügel aufdeckte und dabei zahlreiche Nachbestattungen fand und untersuchte (die wissenschaftliche Betreuung lag bei Edward Sandmeister). Dabei wendete er für die damalige Zeit modernste Methoden an. Die hieraus resultierenden, umfangreichen und richtungsweisenden Ergebnisse waren der in sechs Bänden publizierte Grabungsbericht. Am Ende der Grabungen wurde der Hügel wieder zu seiner ursprünglichen Größen aufgeschüttet.
Das Fürstengrab und die Nachbestattungen Bereits 1890 wurde in dem 102 m durchmessenden und ursprünglich wohl 8 m hohen Grabhügel gezielt nach dem Zentralgrab gesucht und, wie bereits erwähnt, eine bereits beraubte, eindrucksvolle hölzerne Grabkammer gefunden. Diese wurde zuerst dendrochronologisch auf das Jahr 577 v. Chr. datiert. Aufgrund neuer Erkenntnisse wurde dieses Datum mehrfach korrigiert. Eine letzte Untersuchung aus dem Jahr 1995 zwang die Wissenschaftler zu einer Neu- bzw. Umdatierung auf das Jahr 616 v. Chr. Doch liegt auch hiermit kein exaktes Datum für die Erstellung des Hügels vor. Eine dendrochronologische Datierung legt das Fälldatum des Holzes fest und liefert keine Informationen darüber, wie lange es gelagert wurde. Außerdem liefert der Magdalenenberg mehrere dendrochronologische Daten, die um ein paar Jahre auseinander liegen. Hiermit könnte versucht werden, den zeitlichen Verlauf des Grabbaus zu rekonstruieren. Immerhin wurden im Kern des Hügels (nur hier sind die Erhaltungsbedingungen gut genug) auch Hölzer gefunden, die sich auf das Jahr 613 v. Chr. datieren lassen und dafür sprechen, dass allein der Aufbau des Hügelkerns (also der Grabkammer, der zentralen Stein packung und den ersten Teilen des Erdhügels) mehrere Jahre dauerte. Der Hügel selbst ist mit einem Gesamtvolumen von nahezu 33.000 m³ der größte hallstattzeitliche Grabhügel Mitteleuropas (auf Basis dieses Volumens wurden sehr umstrittene Versuche unternommen, die Arbeitsdauer für den Bau des Monumentes zu berechnen; die Ergebnisse schwanken zwischen vier und achtzehn Jahren). Im Zentrum des Hügels befand sich eine in einer Steinpackung gelegene rechteckige hölzerne Grabkammer in einem einzigartigen Erhaltungszustand. Ursächlich hierfür war eine unter dem Hügel befindliche Wasseransammlung, die den Kammerboden und Teile der Wände konserviert hat. Für die sauber gearbeitete Kammer wurden insgesamt neunzig Eichen verbaut, die
[ 68 ]
Magdalenenberg
im Jahr 616 v. Chr. gefällt wurden. In der Kammer selbst wurden nur noch Reste der ehemals sicher reichen Bestattung gefunden. Hierzu gehören Teile eines Wagens (ähnlich dem aus dem Hochdorfer Fürstengrab), Teile von Zaumzeug, einige Bleche, sowie einige Holzgeräte und Leder- und Fellreste. Vor allem der hervorragende Erhaltungs zustand der organischen Funde ist einzigartig und bereichert die moderne Forschung erheblich. Neben den Skelettresten des Toten (anthropologische Untersuchungen ergaben, dass es sich um einen ca. vierzigjährigen Mann gehandelt hat) wurden auch die Überreste eines einjährigen Schweines gefunden, welches wohl als Verpflegung im Totenreich (oder auf dem Weg dorthin) dienen sollte. Die Grabkammer selbst wurde unmittelbar auf dem gewachsenen Boden angelegt und war von einem Steinhügel umgeben. Während der Grabungskampagne von Spindler wurden insgesamt 126 weitere Gräber mit insgesamt 136 Nachbestattungen (und somit zehn Doppelbestattungen) im Grabhügel gefunden und reiches Fundmaterial freigelegt. Hiermit ist der Magdalenenberg die bislang größte Nachbestattungsnekropole im westlichen Hallstattkreis. Dabei muss aber auch beachtet werden, dass nicht sicher gesagt werden kann, ob und wie viele Gräber bereits zerstört worden waren. Allein bei der Trichtergrabung des Jahres 1890 wurde immerhin eine Fläche von 25 m Durchmesser stark beeinträchtigt, es wurde eine Drainage zur Trockenlegung des Grabes gelegt und die Erosion der achtzig Jahre bis zur modernen Grabung könnten ihr Übriges getan haben. Die große Zahl der Nachbestattungen ist auffällig und bedarf einer Erklärung. Die Gründe für diese Begräbnissitte können allerdings vielfältig sein. Eventuell handelte es sich bei den Nachbestatteten um Personen, die in Abhängigkeit zum Fürsten im Hauptgrab standen. Eventuell haben wir es auch mit einer Art von Ahnenkult zu tun. Da es kaum Überschneidung der Gräber gibt, kann man davon ausgehen, dass diese in irgendeiner Weise oberirdisch gekennzeichnet waren. Bei den Nachbestattungen handelt es sich bis auf wenige Ausnahmen um Körperbestattungen. Die Toten wurden in voller Tracht bestattet und da diese Bestattungen zumeist nicht gestört waren, konnte man anhand der Funde eine Vielzahl von Informationen zum Alltagsleben der Kelten sammeln. So verrät die Lage der Gewandfibeln etwas über die Art und Weise der Kleidung. Neben Fibeln wurden mit Gravierungen verzierte Tonnenarmbänder aus Bronze als Armschmuck getragen, sie finden sich aber nur in reich ausgestatteten Frauengräbern. Bei den Männergräbern
[ 69 ]
ist auffällig, dass Dolche nur dann zur Grabausstattung gehörten, wenn der Bestattete über vierzig Jahre alt geworden ist. Der Dolch kennzeichnet anscheinend eine gesellschaftliche Stellung. Doch hat u. a. Konrad Spindler zu Recht formuliert, dass man bis heute den sozialen Status einer Person am besten anhand ihrer Kleidung erkennen kann und diese in prähistorischen Bestattungen nur in den seltensten Fällen erhalten ist. Das teilweise verhältnismäßig gut erhaltene Holz, aber auch anderes organisches Material, welches in den Gräbern gefunden wurde, ermöglicht nicht nur über die Dendrochronologie eine Altersbestimmung, sondern erlaubt auch einen Einblick in die Vegetation, die vor ca. 2600 Jahren am Magdalenenberg existiert hat. Durch diese Daten lässt sich auch feststellen, dass die Nachbestattungen bis in das 6. Jahrhundert hinein stattfanden. Auffällig an den Nachbestattungen ist, dass diese Gräber auf verschiedenen Ebenen des Hügels streng tangential zur Mitte angelegt waren. Außerdem waren die Toten, soweit es bei der tangentialen Ordnung möglich war, mit dem Kopf nach Osten bestattet. Hierdurch bildeten sich zwei Halbkreise mit südöstlicher Ausrichtung. Man muss davon ausgehen, dass diese Bestattungsform mit Absicht gewählt wurde. Weiterhin ist zu beobachten, dass die reicher ausgestatteten Gräber (also vermutlich die von sozial höher gestellten Personen) näher am Zentralgrab lagen als die von Ärmeren. Hieraus wird auf eine sozial differenzierte Gesellschaft geschlossen, die von einer Elite beherrscht wurde. Letztendlich wurde aber trotz aller Auffälligkeiten festgestellt, dass sich innerhalb der Bestattungen des Magdalenenberges keine soziale Schichtung nachweisen lässt. Anhand der Knochen konnte auch die ungefähre Lebenserwartung der Bestatteten ermittelt werden. Dabei konnte festgestellt werden, dass knapp 50 % ein Alter von 25–39 Jahren erreicht haben. Diverse Beigaben zeugen auch am Magdalenenberg von weitreichenden Handelskontakten. So belegt die in Grab 81 gefundene Dragofibel Kontakte nach Osteuropa und Bernsteinperlen, wie die des Kolliers aus Grab 191, bezeugen Kontakte nach Nordeuropa. Auch wurden persönliche Gegenstände (z. B. Amulette und Spielzeug, wie die in Grab 9 gefundene Rassel), gefunden, die die Vorstellungswelt der Kelten verdeutlichen. Außerdem wurden diverse Geräte zur Körperpflege gefunden. In den meisten Gräbern wurden außerdem kleine Gefäße gefunden, die für den alltäglichen Gebrauch zu klein erscheinen, so dass man ihnen eine Rolle im Bestattungsritus zuschreibt.
[ 70 ]
Magdalenenberg
Ein weiterer Fund im Grabhügel lässt Rückschlüsse auf das keltische Bestattungsritual zu. Es wurde nämlich eine 2,5 m x 1,5 m große Schleppe gefunden, welche von mehreren Eichenstämmen flankiert wurde (dieser Weg lässt sich 20 m weit verfolgen). Es ist zu vermuten, dass auf dieser der Fürst zu Grabe gezogen wurde.
Das Fürstengrab im Franziskanermuseum Konrad Spindler verstand es nicht nur, die Grabungen am Magdalenenberg und die daraus resultierenden Forschungen effektiv durchzuführen und zeitnah zu publizieren, er war auch in der Lage, die Villinger Bevölkerung für „ihr“ Fürstengrab zu gewinnen. Und so wurde den Funden bereits kurz nach der Grabung im Franziskanermuseum von Villingen eine Abteilung zur Ur- und Frühgeschichte geschaffen, in der die Funde ausgestellt werden. Im Rahmen eines Stadtqualitätsprogrammes konnte zwanzig Jahre nach Gründung der Abteilung eine Neukonzeption der Ausstellung erfolgen. Im Zentrum der Ausstellung steht die direkt nach ihrer Freilegung in Polyethylen konservierte Grabkammer, die in dem Zustand gezeigt wird, wie ihn die Ausgräber des Jahres 1890 zurückgelassen haben (s. Abb. 23). Weiterhin bemüht man sich, die Forschungsgeschichte zu illustrieren. Dies geschah durch die, mittels Zitaten und Aufnahmen bereicherten Biographien der Ausgräber. Letztere sind heute leider nicht mehr im Hauptraum zu sehen, sondern in einem gesonderten Raum, in dem Gruppenveranstaltungen (Kindergeburtstage etc.) stattfinden. Wenn man aber den jeweiligen Aufseher bittet, wird man auch in diesen Raum gelassen, wo man außerdem einführende Informationen zu den dendrochronologischen und archäobotanischen Untersuchungen am Magdalenenberg erhält. Auch die Hinweise zu den wissenschaftlich bedeutenden Textilfunden sind in einer Art Treppenhaus untergebracht in dem sich auch eine Rekonstruktion der gefundenen Stangensetzungen findet. Im Museum wird postuliert, dass diese Stangen zur Stabilitätssteigerung der Gesamtkonstruktion des Grabhügels eingesetzt wurden. Auf die relativ neue Deutung des Magdalenenberges als Kalendarium (siehe unten) wird im Museum nicht eingegangen. Die den Magdalenenberg betreffende Abteilung beschränkt sich aktuell auf einen Raum, in dem immer noch die Reste der Grabkammer im Mittelpunkt stehen. In Vitrinen an den Wänden finden sich ausge-
[ 71 ]
wählte Stücke aus den Gräbern. Weiterhin gibt es ein Modell des Grabhügels, in dem alle Gräber mit ihrer Lage gezeigt werden.
Nekropole und Kalendarium? Moderne Untersuchungen lassen vermuten, dass es sich bei dem Magdalenenberg um mehr als nur eine Nekropole gehandelt haben könnte. Nicht nur die auffällige Ausrichtung der Bestatteten, auch die ursprünglich nur unzureichend erklärbaren Stangensetzungen führten dazu, dass der Mainzer Archäologe Allard Mees das Fürstengrab in Hinblick auf eine mögliche Verwendung als Kalendarium hin untersuchte. Auffällig war zuallererst die bereits erwähnte Ausrichtung der Toten. Außerdem konnten Stangensetzungen nachgewiesen werden, die bereits vor dem Bau des Tumulus errichtet wurden. Zwei der Stangensetzungen waren radial nach Nordwesten ausgerichtet (St I & St II). Sie hatten Entsprechungen, die nach Südosten gerichtet waren (St IV & St V). Eine weitere Stangensetzung zeigte nach Süden (St III). Datierungen ergaben, dass St I im Jahr 614 v. Chr. errichtet wurde, St II um 618 und St III ca. 616–614 entstanden. Betrachtet man die möglichen Blickrichtungen vom Fürstengrab aus, so stellt man fest, dass ein Fernblick nur nach Südosten möglich ist. In Hinblick auf eine Kalenderfunktion des Grabbaus, werden diese Stangensetzungen von Mees als Peilmarken gesehen. Doch gibt es auch eine andere Erklärung. So können die Stangen auch zur Stabilisierung der Erdarbeiten gedient haben. Bedenkt man die (sicherlich beabsichtigte) Ausrichtung der Nachbestattungen, so können die Stangen auch Orientierungshilfen für die Bestatter gewesen sein. Bereits in frühen Publikationen (z. B. Meyer-Orlac 1983) wurde auf das unregelmäßige und damit auffällige Verteilungsmuster der Nachbestattungen hingewiesen. Mees fand nun heraus, dass man mittels eines großen Teils der Nachbestattungen Sternbilder abbilden kann (z. B. Kleiner und Großer Bär/Wagen etc.). Allerdings gibt es einige Gräber, die keinem Sternbild zuzuordnen sind. Dass nicht für jeden heute zu einem Sternbild gehörigen Stern ein Grab existiert, lässt sich hingegen erklären. Erst ab der Zeit der Renaissance wurde diese Festsetzung vorgenommen. In der Antike schwankten die Sternzahlen eines Sternbildes durchaus. Natürlich sah der Sternenhimmel vor 2600 Jahren anders aus als heute, aber moderne Hilfsmittel ermög
[ 72 ]
Magdalenenberg
lichen eine exakte Rekonstruktion. So konnte mit Hilfe von NASATechnologie festgestellt werden, dass das Abbild des Magdalenenberges einen Himmel zeigt, wie er im Nordosten zwischen Wintersonnenwende und Sommersonnenwende zu sehen war. Auch für eine der an sich auffälligen Doppelbestattungen scheint es eine Erklärung zu geben. Die Doppelbestattung aus Grab 78 bestand aus zwei über einanderliegenden Frauengräbern, von denen das eine als Beigabe ein Gürtelblech mit Sonnen- bzw. Sternenmotiven hatte. Die (reicher) Bestattete wird als Frau des Fürsten interpretiert, die gemeinsam mit ihrer Dienerin bestattet wurde (u. a. aufgrund der zeitlichen Nähe dieser Bestattung zu der des Zentralgrabes und der außergewöhnlich reichen Beigaben). Die Lage des Grabes stimmt mit der Lage eines der hellsten sichtbaren Sterne des Sommerhimmels, Wega (Sternbild Leier; Wega ist der wohl am besten untersuchte Stern und diente Astronomen als Nullpunkt zur Kalibrierung der fotometrischen Helligkeitsskala), überein. Festhalten muss man aber, dass diese Deutung alles andere als unumstritten ist.
[ 73 ]
Heuneburg Südlich von Stuttgart gelegen, zwischen der A81 und der A7 liegt die Heuneburg. Von Ulm kommend, folgt man der B311 bis man auf die entsprechende Beschilderung trifft. Aus der anderen Richtung folgt man der B32. Das Heuneburgmuseum liegt in Herbertingen-Hundersingen. Um zum dazugehörigen Freilichtmuseum zu kommen, folgt man 2 km der Straße nach Binzwangen. Vor dem Besuch des Freilichtmuseums ist aber die Besichtigung der Ausstellung anzuraten. Hier wird mittels einiger ausgewählter Stücke, aber vor allem durch diverse Plakate und Tafeln über die Kelten allgemein und über keltische Stätten und damit die Heuneburg im Speziellen auf zwei Etagen informiert. Eine dritte Etage ist Sonderausstellungen vorbehalten, die aber in der Regel im Zusammenhang mit den Funden der Heuneburg stehen. Im Freilichtmuseum, der eigentlichen Heuneburg, wo immer noch Grabungen stattfinden, wurden mehrere Gebäude und die weit sichtbare Wehrmauer rekonstruiert. Auch wenn man sicherlich über die Authentizität solcher Rekonstruktionen streiten kann, vermitteln sie doch einen Eindruck, wie die Heuneburg ursprünglich ausgesehen haben mag. Der Kräutergarten hingegen ist wohl eher den esoterisch Interessierten gewidmet. In der Nähe des Freilichtmuseums sind außerdem zwei Grabhügel aufgeschüttet worden.
Geschichte der Grabung „Denn der Fluss Istros [Anm. Autor: gemeint ist die Donau] beginnt bei den Kelten und der Stadt Pyrene und fließt mitten durch Europa.“ (Hdt. 2,33) Die Identifikation der vom Griechischen Historiker genannten Stadt ist bis heute nicht gelungen, aber einige Wissenschaftler haben sich dafür ausgesprochen, Pyrene mit der Heuneburg in Zusammenhang zu bringen. Wie auch immer diese Frage zu entscheiden ist – weiter unten folgen einige Überlegungen – fest steht, dass die Heuneburg zu den bedeutendsten archäologischen Fundstätten in Mitteleuropa gehört. Und so ist es nicht weiter verwunderlich, dass die Heuneburg vor allem für die Erforschung der Hallstattzeit eine wesentliche Schlüsselrolle spielt.
[ 74 ]
Heuneburg
Die systematische Untersuchung der eigentlichen Heuneburg beginnt in den fünfziger Jahren des 20. Jahrhunderts, vorher widmete man sich den monumentalen Großgrabhügeln der Umgebung, die bedeutende Funde hervorbrachten. So lieferte der Grabhügel im Gießübel-Talhau die Grundlage für die Definition eines Fürstengrabes. Weitere Bedeutung haben die 1937/38 durchgeführten Grabungen auf dem Hohmichele. Im Jahr 1950 wurden auf dem Plateau der Heuneburg erste Suchschnitte angelegt, deren Funde alle Erwartungen der Ausgräber bei Weitem übertrafen. Die Grabungen wurden mit kürzeren Unterbrechungen bis in das Jahr 1979 fortgeführt. In dieser Zeit konnte ca. ein Drittel des Burgplateaus ergraben und dokumentiert werden. In den neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts fanden schließlich Untersuchungen in der, bei Nachgrabungen im oben genannten Grabhügel entdeckten Außensiedlung statt. Schließlich setzten zwischen 2004 und 2010 im Zusammenhang mit dem DFG-Schwerpunktprogramm Frühkeltische Fürstensitze neue, umfangreiche Grabungen und Forschungen im Bereich der Heuneburg ein, die erneut zu, für die Archäologie spektakulären Ergebnissen geführt haben.
Entstehung und Entwicklung der Heuneburg Über der Donau auf einem Bergsporn liegt die Heuneburg in prädestinierter Lage. Inzwischen weiß man, dass es sich bei der Anlage auf dem Berg nur um eine Art Akropole gehandelt hat, um die herum eine über 70 ha große Siedlung existierte. Somit kann man im Zusammenhang mit der Heuneburg mit gutem Gewissen von einer Stadt sprechen. Bei der Entstehung der Heuneburg kann man zwei frühe Phasen festhalten. Um das Jahr 625 v. Chr. entstand die erste befestigte Siedlung, die ca. zwanzig Herrenhöfe enthielt. Die günstige Lage, aber wohl auch der Schutz, den die eindrucksvolle Mauer bot, förderte die handwerkliche Produktion und vor allem den Handel. Für eine politische Zentralisierung scheinen die diversen Fürstengräber der Umgebung zu sprechen. Doch bereits um das Jahr 600 wurden diese Höfe abgerissen (eine Brandkatastrophe oder ähnliches ist nicht nachzuweisen, so dass man von einem frühen Urbanisierungsakt ausgehen muss) und es entstand eine kleinteiligere Bebauung in Form von Häuserzeilen an einem sich verzweigenden Wegenetz. Die Mauer der Heuneburg wurde in einer für die damalige Zeit ungewöhnlichen Bauweise errichtet,
[ 75 ]
ämlich mittels luftgetrockneter Lehmziegel, die mit Kalkmörtel vern putzt wurden. Ähnliche Bauten findet man in dieser Zeit im griechischetruskischen Raum, allerdings besitzen diese Mauern noch keine Bastionen, wie sie in der Heuneburg nachzuweisen sind. Solche finden sich aber auf Abbildungen phönizischer Mauern. Ob dies nun aber für einen phönizischen Baumeister spricht, sei an dieser Stelle dahingestellt. Um 540 v. Chr. gab es einen nachweislichen Bruch. Die ursprünglich riesige Außensiedlung reduzierte sich auf das Areal direkt vor der Burg und auf den Resten der Außensiedlung wurden reich ausgestattete, monumentale Grabhügel errichtet. Auf der Heuneburg selbst wurde die Mauer im mediterranen Stil abgerissen und durch eine Holz-Erde-Mauer ersetzt. Die Zerstörungen waren so gründlich, dass die Ausgräber von einem kriegerischen Ereignis ausgegangen sind. Nachweisen lässt sich zumindest ein verheerender Brand, der aber eine Vielzahl von Gründen gehabt haben kann. Ein kultureller Bruch lässt sich aber nicht fassen, so dass die Aggressoren, wenn man eine militärische Aktion als ursächlich für die Zerstörungen ansehen will, wohl aus der Nachbarschaft stammten.
Funde und Befunde Siedlungsstrukturen Bereits bei den ersten Suchschnitten wurde die Ringmauer der Heuneburg entdeckt, eine Lehmziegelmauer mediterraner Bauart, die bis zu dieser Zeit niemand nördlich der Alpen vermutet hätte. Doch konnten aufgrund der insgesamt hervorragenden Befundlage insgesamt vierzehn Baustadien nachgewiesen werden, zu denen zehn Befestigungsmauern gehörten. Damit bietet die Heuneburg einen einzigartigen Einblick in einen Siedlungsablauf der späten Hallstattzeit (Ha D) und die damit verbundene Chronologie. Innerhalb der Lehmziegelmauer befanden sich einheitliche, in Zeilen eng angeordnete Häuser. Die neusten Grabungen (2004–2010) brachten auch im Bereich der Siedlungsstrukturen vielfältige neue Erkenntnisse. So wurde unter anderem im Jahr 2005 ein monumentales Tor aus der Hallstattzeit gefunden. Es liegt gegenüber des heutigen Besucherparkplatzes, hat ein Kalksteinfundament und ist 16 m lang. Verbrannte Lehmziegel lassen den Schluss zu, dass das Tor entsprechend der restlichen Mauer gefertigt war. Das Tor war in Richtung auf die vorgelagerten Großgrabhügel
[ 76 ]
Heuneburg
ausgerichtet. Untersuchungen der Außensiedlung ergaben ein gesamtes Siedlungsareal von ca. 100 ha, in dem sich teilweise Anwesen von 1–1,5 ha Größe befanden. Diese außergewöhnliche Gesamtgröße und Siedlungsstruktur hat natürlich Folgen für die gesamte Fürstensitz forschung. Demographische Berechnungen ergaben eine mögliche Gesamtbevölkerung von ca. 5000 Menschen, womit die Heuneburg fast die Bevölkerungszahl Athens zur selben Zeit hatte (hier schätzt man die Bevölkerung auf 5000–10000 Personen). Mit dem Untergang der Großsiedlung (um 540 v. Chr.) lassen sich auch neue Siedlungsstrukturen nachweisen. So wird die Lehmziegelmauer durch eine eher traditionelle Holz-Erde-Mauer ersetzt und die Innenbebauung des Burgbaus veränderte sich grundlegend. Die relativ einheitlichen Gebäude verschwinden und werden durch Gebäude unterschiedlicher (zum Teil beträchtlicher) Größe ersetzt (s. Abb. 24).
Das Handwerk Wie für eine Stadt üblich, kann auch in der Heuneburg eine Vielzahl unterschiedlicher Handwerker nachgewiesen werden. Dabei unterscheidet sich die Qualität der hergestellten Waren maßgeblich von der der ländlichen Siedlungen. So finden sich im Bereich der Keramik auf der Heuneburg frühe mehrfarbige Gefäßbemalungen, die die Dekore ablösten, welche durch Ritzungen und Stempel entstanden (die so genannte Alb-Hegau-Keramik). Durch Bemalung konnte die Keramikproduktion maßgeblich erhöht werden. Auf der Heuneburg konnte auch eine Fibelproduktion nachgewiesen werden, da drei Halbfabrikate, einige Rohgüsse und Gusszapfen, sowie geschmiedete Stäbe und Fragmente von Gussformen gefunden wurden. Weiterhin wurden Schmelztiegel, Reste von transportablen Öfen, Scherben von Blasebalgdüsen, Schlackenstücke, Barrenfragmente und etwa 250 Bronzeklumpen entdeckt. Auch wenn bislang keine Werkstatt nachgewiesen werden konnte, können diese Funde als Werkstattabfall gedeutet werden (allerdings auch als Nachweise für einen Feuerschaden). Beachtenswert ist der Fund einer Gussform für eine Henkelattasche. Hiermit lässt sich nachweisen, dass die Handwerker der Heuneburg nicht nur etruskische Originale umarbeiteten oder durch bloßes Ab formen nachmachten, sondern aus verschiedenen Vorbildern eigene Ataschentypen schufen. Diese Gussform ist somit eine Vorstufe zu der, einige Jahre später entstandenen Attasche auf der Schnabelkanne vom Kleinaspergle. Sicher kann auch Eisenverarbeitung vermutet werden.
[ 77 ]
Ein weiterer, wie die große Anzahl an Funden zeigt, wichtiger Handwerkszweig der Heuneburg war die Schnitzerei in verschiedensten Materialien (Knochen, Geweih, Elfenbein, Holz, Koralle, Bernstein, Gagat). Man kann daher die Heuneburg mit Fug und Recht als Zentrum neuer Innovationen und Technologien bezeichnen. Auch die Tatsache, dass arbeitsteilige Produktionsmethoden nachzuweisen sind, sind vor allem für die berechtige Bezeichnung der Heuneburg als „Stadt“ von Bedeutung.
Die Umgebung In der näheren Umgebung der Heuneburg fand man eine Vielzahl reich ausgestatteter Holzkammergräber, die der sozialen Elite der Stadt zugesprochen werden. Ähnlich wie bei der eigentlichen Siedlung, gab es auch hier einen Bruch um ca. 540 v. Chr. Doch sind diese Gräber forschungsgeschichtlich von großer Bedeutung (auch wenn an dieser Stelle nicht auf alle eingegangen werden kann). So veranlassten zwei 1876 bei Feldarbeiten abgetragene (und damit aufgespürte) Großgrabhügel im Gewann Gießübel und die reichen Beigaben, die gefunden wurden, Eduard Paulus dazu, den Begriff Fürstengrab zu prägen. Der Grabhügel ist aber für die Erforschung der Siedlungsstrukturen der Heuneburg von weit größerer Bedeutung, wurde doch bei einer in den fünfziger Jahren durchgeführten Nachgrabung festgestellt, dass er auf ehemaligem Siedlungsareal angelegt war. Damit wurde deutlich, dass das Heuneburgplateau nur ein Teil – wie es scheint, der am besten befestigte Teil – der Gesamtsiedlung war, vergleichbar mit einer Akropolis einer griechischen Polis. Außerdem spricht die Tatsache, dass die Gießübel-Nekropole nicht in eine größere, bereits vorhandene Nekropole integriert wurde dafür, in ihr eine Nekropole für eine Bevölkerung mit gesellschaftlicher Sonderstellung zu sehen. Spektakulär ist einer der neuesten Funde. Im Jahr 2005 wurde in der Bettelbühn-Nekropole bei Herbertingen (einer Gruppe von sieben frühkeltischen Grabhügeln) ein außergewöhnlich reich ausgestattetes Grab eines etwa dreijährigen Mädchens gefunden, welches in Ha D datiert werden konnte. Bei diesem Grab handelte es sich um eine Nebenbestattung in einem ehemals mächtigen, heute aber nahezu verschliffenen Grabhügel. Im Jahr 2010 gelang es schließlich dem Landesamt für Denkmalpflege, das Zentralgrab zu finden. Auch dieses
[ 78 ]
Heuneburg
Grab war ein unberaubtes Frauengrab und eine enge Beziehung zwischen der Frau und dem Mädchen kann vermutet werden, da beide mit ähnlichen Beigaben bestattet wurden. Die nahe Verbindung von Frauen- und Kindergrab wird als Indiz genommen, dass sozialer Rang vererbt war, da das Kind sicherlich noch keine eigenen Verdienste erwerben konnte. Die Frau trug an den Füßen zwei Bronzeringe, am rechten Unterarm drei Gagatringe, außerdem wurde in der Hüftregion qualitätsvoller Bernsteinschmuck gefunden. Auch im Halsbereich fanden sich Bernsteinperlen und Goldschmuck. Ein reich verziertes Goldband ergänzt die wertvollen Funde (um nur die aufsehenerregenden zu nennen). Das Grab wird daher als Fürstinnengrab gedeutet und wäre damit eines der ältesten Fürstinnengräber Süddeutschlands. Daher wird dem Grab eine Schlüsselstellung bei der Erforschung der gesellschaftlichen Strukturen der Hallstattzeit zugeschrieben. In einer Ecke der Grabkammer wurde ein weiteres Skelett gefunden, doch ist die Zuordnung bislang nicht geklärt. Die aufgrund der Bodenverhältnisse gut erhaltene ca. 4 m x 5 m große Grabkammer der Zentral bestattung wurde als achtzig Tonnen wiegender Block geborgen um unter Laborbedingungen untersuchen werden zu können. Dendrochronologische Untersuchungen der Eichenbohlen, die für den Kammerboden verwendet wurden, datieren das Grab in das frühe 6. Jahrhundert v. Chr. Eine weitere bedeutende Nekropole der Region ist die so genannte Speckhau-Hohmichele-Gruppe. Hierzu gehören insgesamt 36 Grabhügel (unter anderem der Hohmichele, der der zweitgrößte hallstattzeitliche Grabhügel Europas ist). Die Untersuchung dieser Hügel bzw. der darin vorhandenen Nachbestattungen zeigte, dass sie mindestens 200 Jahre lang genutzt wurden.
Die Bedeutung der Heuneburg Es steht außer Frage, dass es sich bei der Heuneburg um eine der bedeutendsten, wenn nicht gar die bedeutendste späthallstattzeitliche Siedlung nördlich der Alpen handelte. Die Größe der Anlage und die Funde auch in den Gräbern lassen entsprechende Schlüsse zu und zeigen, dass die Heuneburg eine Drehscheibe des prähistorischen Handels gewesen ist und mit Fug und Recht als Stadt bezeichnet werden kann.
[ 79 ]
Pyrene und die Heuneburg Oft findet sich in der Literatur die Information, dass die Heuneburg mit dem bei Herodot genannten Pyrene gleichzusetzen sei. Auch wenn es eine reizvolle Idee ist, dass der von Cicero als Vater der Geschichtsschreibung titulierte, aus dem kleinasiatischen Halikarnassos stammende Grieche Kenntnisse von der Heuneburg gehabt haben soll, muss diese Vorstellung als unhaltbar (wenn nicht gar absurd) bezeichnet werden. Dass die Heuneburg zur Wirkungszeit des griechischen Historikers ihre herausragende Bedeutung längst verloren hatte, ist zugegebenermaßen nur ein schwaches Argument, denn Herodot kann die bedeutende, an der Quelle der Donau liegende Stadt sowieso nur aus Berichten gekannt haben, da er selbst nie im westlichen Mittelmeergebiet, geschweige denn jenseits der Alpen gewesen ist. Betrachtet man den Gesamtkontext der Quelle, so wird einem einiges deutlich: Herodot geht es an dieser Stelle weder um die Lage von Pyrene noch darum, irgendwelche Informationen zu den Kelten zu liefern. Vielmehr geht es ihm um die großen Flüsse der antiken Welt. Herodot hat keine Ahnung, wo die Donau tatsächlich entspringt. Für ihn ist das Land der Kelten, wo die Quellen liegen sollen, der gesamte, der damaligen griechischen Welt nahezu unbekannte Nordwesten Europas. Die Tatsache, dass Herodot behauptet, die Donau und der Nil entsprängen den gleichen Längengraden, zeigt ebenfalls die fehlende Exaktheit der geographischen Kenntnisse Herodots. Mit der Nennung der Kelten folgt er hier dem antiken Weltbild, welches bereits Hekataios entworfen hat und das sich noch im Weltbild des Eratosthenes wiederspiegelt. Dies unterteilt die Völker des Nordens grob in Kelten (Westen) und Skythen (Osten). Betrachtet man die gesamte Beschreibung, so kann man feststellen, dass Herodot die Donauquellen jenseits der bekannten Welt lokalisiert, nämlich jenseits der Säulen des Herakles. Zwar gab es bereits seit dem 7. Jahrhundert Schifffahrt in den Atlantik hinein nach Tartessos und Britannien, trotzdem markierte das heutige Gibraltar noch mindestens bis in das 5. Jahrhundert hinein den westlichsten Punkt der bekannten Welt. Wenn also Herodot die Quellen der Donau bei den Kelten, und diese westlich der Säulen des Herakles verortet, dann bedeutet das schlicht, dass er keine Ahnung hatte, wo sich die Quellen befanden. Damit hatte er aber auch keine Ahnung, wo Pyrene lag (und ob es überhaupt existierte) und die Gleichsetzung mit der Heuneburg, nur weil sie nach den heutigen Kenntnissen in der Nähe der Donau quellen lag, ist reine Spekulation und recht weit hergeholt.
[ 80 ]
Bopfingen und das Nördlinger Ries
Bopfingen und das Nördlinger Ries Am Nördlinger Ries nahe Bopfingen liegt der 668 m hohe Ipf und auf ihm eine bedeutende keltische Siedlung. Am besten erreicht man Bopfingen über die A7 (Autobahnausfahrt nach Westhausen) und folgt dann der B29 bis nach Bopfingen. Im Ort selbst findet man im Seelhaus ein kleines Museum, welches sich mit der Archäologie und der Geschichte der Region beschäftigt. Zum Ipf kommt man in einer ca. einstündigen Wanderung oder mit dem Auto über die Alte Kirchheimer Straße. Wer diese nicht findet, folgt der L1076 Richtung Kirchheim am Ries bis zur Beschilderung. Aufgrund seines markanten Profils kann man den, die Höhensiedlung tragenden Berg praktisch nicht verfehlen (s. Abb. 25). Allgemein muss man um Bopfingen und im Nördlinger Ries mit offenen Augen unterwegs sein, ist die gesamte Region doch aufgrund ihrer fruchtbaren Böden schon seit ältesten Zeiten bewohnt. Seit dem 6. Jahrhundert belegen die Funde eine außergewöhnlich hohe Besiedlungsdichte. Die hügelige Landschaft bot ideale Möglichkeiten zur Anlage befestigter Höhensiedlungen, wie die auf dem Ipf. Nicht nur die Böden und die hervorragende Verkehrslage waren die Grundlage des Reichtums der Region, auch die Bohn- und Doggererzvorkommen waren, wie Grab- und Siedlungsfunde belegen, bedeutsam. So befindet sich bereits wenige Kilometer vom Ipf entfernt, nahe der K3305, eine weitere Siedlung auf dem Plateau des 514 m hohen Goldberges. Wer etwas Zeit mitbringt, kann die Region gut zu Fuß oder mit dem Rad erkunden.
Grabungsgeschichte Einen vollständigen Überblick über die verschiedenen Grabungen im Nördlinger Ries an dieser Stelle zu geben wäre vermessen, zu fundreich ist der gesamte Bereich. Aber vor allem die seit 1989 durch das Landesdenkmalamt Baden-Württemberg durchgeführten (Rettungs-)Grabungen führten zu nicht vorhersehbaren Ergebnissen und zu einer Neubewertung der gesamten Region. Vor allem am westlichen Rand des Ries lässt sich eine Vielzahl von eisenzeitlichen Fundstellen nachweisen. Neben den unten erwähnten Funden auf dem Goldberg, der
[ 81 ]
Grabhügelgruppe und den Viereckschanzen und Rechteckhöfen z ählen hierzu auch im Bopfinger Stadtgebiet gemachte Funde einer hallstattzeitlichen Brandgräbernekropole. Bei der Auffindung der Bodendenkmäler half einmal mehr die Luftbildarchäologie. In diesem Zusammenhang muss der Luftbildarchäologe Otto Braasch genannt werden, dem einige dieser Entdeckungen zu verdanken sind. Doch auch die geophysikalischen Untersuchungen von Harald von der Osten-Woldenburg und Arno Patzel erweiterten das Verständnis der Funde erheblich. So sind auch die einzelnen hier beschriebenen Fundplätze (die nur eine Auswahl darstellen können) in ihrer Bedeutung nur im Zusammenhang der gesamten Fundsituation des Ries zu verstehen. Denn obwohl zum Beispiel auf dem Ipf nur spärliche Nachweise für Südimporte zu finden sind, existieren solche, die gesamte Region betreffend, doch in signifikanter Zahl (zu denken ist hier an die Amphorenfunde und Funde attischer rotfiguriger Keramik am Weiler Osterholz). Heute ist das Ipf-Goldberg-Gebiet Grabungsschutzgebiet nach § 22 des baden-württembergischen Gesetzes zum Schutz der Kulturdenkmale. Diese Schaffung einer archäologischen Reservatsfläche war nur durch den intensiven Ankauf von Gelände möglich. Der Ipf selbst ist bereits seit 1982 Naturschutzgebiet, was bei seinem Besuch unbedingt beachtet werden sollte.
Der Ipf Eindrucksvoll erhebt sich der von weitem sichtbare Kegelstupf des Ipfs im Nördlinger Ries. Seine noch heute erkennbaren Befestigungsanlagen lassen sich bis in die späte Bronzezeit zurückdatieren. Vom Parkplatz am Fuße des Berges folgt man einem Weg, der vermutlich dem alten Zugangsweg entsprach. Erste Grabungen auf dem Plateau wurden 1907 und 1908 von Friedrich Hertlein durchgeführt. Auf dessen Ergebnissen beruhen praktisch bis heute die Erkenntnisse zum Ipf. Die große Zahl an Siedlungen, Grabhügeln und Gräberfeldern im Umkreis des Berges lassen den Schluss zu, dass er ein Siedlungszentrum der keltischen Hallstatt- und Latènezeit war und man damit in der Siedlung wohl einen sogenannten Fürstensitz (des 6. und 5. Jahrhundert v. Chr.) sehen kann. Allein die räumliche Nähe zum, ebenfalls eine befestigte Siedlung tragenden Goldberg, lässt Fragen zum Verhältnis der beiden Anlagen zueinander aufkommen. Letztendlich
[ 82 ]
Bopfingen und das Nördlinger Ries
f ehlen aber bislang alle eindeutigen Belege, die die Frage nach einem möglichen Fürstensitz mit Sicherheit beantworten könnten. Es fehlte ein für die übliche Definition des Plateaus als Fürstensitz notwendiger Großgrabhügel mit Prunkbestattung, ebenso wie Funde von Importwaren (bei den geomagnetischen Messungen des Jahres 2000 wurden nun aber auch zwei Grabhügel entdeckt; allerdings werden diese allein aufgrund der Datierung eher im Zusammenhang mit dem Goldberg gesehen). Zwei Lesefunde (eine kleine Scherbe einer attischen Trinkschale, sowie ein Stück eines Glasgefäßes) können zwar als Beleg für Südkontakte herhalten, stehen aber ansonsten ohne Befundzusammenhang. Neuere Untersuchungen festigen allerdings die Vermutung, dass es sich beim Ipf doch um einen Fürstensitz gehandelt haben kann. Denn allein seine verkehrsgeographisch dominierende Lage macht deutlich, dass von hier aus die gesamte Region zu kontrollieren war. Das Ries selbst wiederum war ein wichtiger Nord-Süd-Verbindungsweg, eröffnet es doch eine natürliche Verbindung von Schwäbischer Alp und Frankenalp. Die von Hertlein 1911 publizierten Funde lassen den Schluss zu, dass der Ipf mindestens von der Jungsteinzeit bis zur frühen Eisenzeit besiedelt war. Die neueren Lesefunde entstammen zumeist der späten Bronzezeit und nur in sehr geringem Maß der Hallstattzeit. Im Jahr 2004 fanden im Rahmen eines Schwerpunktprogrammes der Deutschen Forschungsgemeinschaft erneute Ausgrabungen statt. Das Magnetogramm der geophysikalischen Prospektion zeigte auf dem Plateau zahlreiche Strukturen, die es zu untersuchen und zu datieren galt. Ein Grabungsschnitt im Zentrum des Plateaus zeigte, dass unter der dünnen Humusschicht bis zu 80 cm tiefe Gräben und Gruben in die Oberfläche geschlagen worden waren. Auch kleinere Pfosten gruben wurden gefunden. Ein zweiter Schnitt an der Ostseite der Befestigung wiederum ergab verschiedene Kulturschichten, die bis zu einer Tiefe von 2,5 m herab reichten. Dieser Schnitt brachte eine große Anzahl von Keramik- und Kleinfunden, sowie Tierknochen zutage, wodurch die lange Siedlungstätigkeit bewiesen werden konnte. Auch konnten weitere Scherben von griechischer Keramik gefunden werden, die in die zweite Hälfte des 6. Jahrhunderts zu datieren sind und die bereits seit Hertlein vermuteten Südkontakte zu beweisen scheinen. Die Unterburg wurde im Winter 2004/2005 geomagnetisch untersucht. Diese Untersuchung ergab große rechteckige Grabenstrukturen, die nicht zur ursprünglichen Annahme, bei der Unterburg handele es
[ 83 ]
sich um Ackerfläche, passten. Vielmehr erinnerten diese Strukturen an Rechteckhöfe und es scheint, dass von diesen eine Vielzahl dicht an dicht in der Unterburg existierte. Für die Definition des Ipfs als Fürstensitz ist insgesamt eine Betrachtung der gesamten Region erforderlich. Gesamt betrachtet ist inzwischen die obligatorische Bestattung in einem Großgrabhügel gefunden worden und der ebenfalls für die Definition eines Fürstensitzes erforderliche Nachweis von Südimporten findet sich sowohl auf dem Ipf (hier zwar nur in kleinerer Zahl), als auch (weitaus häufiger) in den eindeutig im Zusammenhang zu sehenden Viereckschanzen (insgesamt sind bisher rund vierzig griechische Keramikscherben gefunden worden).
Die Befestigungsanlagen Hertlein konnte bei seinen Grabungen feststellen, dass das 2,4 ha große Plateau von einer ca. 5 m breiten Holzkastenmauer umgeben war. Unterhalb des Plateaus erstreckt sich ein System von Mauern und Gräben, welches auch zwei Wasserstellen mit einschließt und eine Fläche von 11,5 ha umfasst (allerdings eignen sich nur ca. 7 ha für eine Besiedlung). In dem Wall der Ostflanke konnte Hertlein eine Pfostenschlitzmauer nachweisen, die selbst auf älteren Befestigungsanlagen stand. Die Pfostenschlitzmauer selbst wurde aufgrund des Fundes einer Scherbe und eines Amuletts in die jüngere Latènezeit datiert. Insgesamt beschreibt er in den vorgefundenen Wällen bis zu 5 m breite Mauern mit verschiedenen Holzeinbauten.
Das Fürstengrab Um dem Ipf seinen Status als Fürstensitz aber eindeutig zusprechen zu können, fehlte lange Zeit der für die Definition wichtige Prunkgrabhügel. Dieser sollte erst im Jahr 2001 von Otto Braasch bei einem Routineflug in der Nähe des Weilers Osterholz entdeckt werden. Er entdeckte einen 64 m durchmessenden Kreisgraben eines inzwischen stark abgeflachten Grabhügels, in dessen Nähe ein weiterer kleinerer (20 m Durchmesser) Grabhügel auszumachen war. Eine Grabung des Jahres 2003 konnte im kleineren Grabhügel eine Brandbestattung in einer ca. 3,4 m x 2,7 m großen Grabgrube nachweisen. Die Bestattung war intakt. Als Beigabe fand man ein Keramikservice, welches in Ha C datiert wurde. Es bestand aus insgesamt achtzehn Gefäßen. Außerdem fand man die Reste von Fleischbeigaben.
[ 84 ]
Bopfingen und das Nördlinger Ries
Der Goldberg Ca. 4,5 km vom Ipf entfernt erhebt sich der Goldberg mit einer weiteren hallstattzeitlichen Besiedlung. Die Abhängigkeit dieser Siedlung, die archäologisch wesentlich besser untersucht ist als die auf dem Ipf, zu der Niederlassung auf dem Ipf ist bislang noch nicht abschließend geklärt. Der Plan der hier ergrabenen Siedlung zeigt aber deutlich ein befestigtes Hofareal, so dass bereits der Prähistoriker Gerhard Bersu, der hier in den Jahren zwischen 1911 und 1929 umfangreiche Grabungen durchführte, den Goldberg als Sitz eines hallstattzeitlichen Fürsten titulierte. Der archäologische Befund dieses als „Residenz“ titulierten Anwesens war für die damalige Zeit einmalig und ein Vergleich mit der Heuneburg, zumindest was Umfang und Dichte der Besiedlung, sowie die Bedeutung als Handelsknoten betraf, lag und liegt bis heute nahe. Der Siedlungswechsel hin zum Ipf – die Gründe hierfür sind nicht rekonstruierbar – fand um 500 v. Chr. statt. Bersu konnte aber auf dem Goldberg insgesamt fünf Siedlungsphasen zwischen 4000 und 250 v. Chr. nachweisen. Leider lassen sich heute die hallstattzeitlichen Befunde nicht mehr detailliert rekonstruieren. Damit ist eine Nachverfolgung der Siedlungsabfolge unmöglich. Umgeben war der Goldberg von einer Holz-Erde-Mauer. Das so genannte Hofareal befindet sich in der Nordostecke und war von Palisaden und Gräben umschlossen.
Viereckschanzen und Rechteckhöfe Im näheren und weiteren Umkreis von Bopfingen findet man mehrere Viereckschanzen und auch eine Vielzahl von Rechteckhöfen. Obwohl beide, wie die Namen verraten, eine rechteckige Form aufweisen, gibt es Kriterien, wie man sie beide meist leicht unterscheiden kann. So sind die Rechteckhöfe zumeist kleiner als die Viereckschanzen (auch wenn sich im Nördlinger Ries eine der kleinsten dieser Schanzen befindet) und ein Phänomen der Hallstattzeit. Die größeren Viereckschanzen hingegen entstanden erst in der Latènezeit und sind ein Indiz dafür, dass die lokalen Eliten ihre Fürstensitze verließen und in den Ebenen siedelten. Die erste Viereckschanze wurde 1979 von Otto Braasch am Fuße des Ipf entdeckt. Zwischen 1989 und 1992 wurde diese und ihr Umfeld
[ 85 ]
(insgesamt 3,5 ha) vollständig ausgegraben. Diese Grabungen und ihre Ergebnisse veränderten die bis dahin fast einhellige Meinung, bei Viereckschanzen handele es sich um abgelegene Kultbauten. Die Bopfinger Schanze lag vielmehr inmitten von Siedlungsflächen und hatte mehr den Charakter eines Hofes, als den einer Kultstätte. Auch die ca. 60 m x 60 m großen rechteckigen Areale in der Ipfer Unterburg (die hier dicht an dicht lagen) dienten sicherlich als Siedlungsfläche, sind aber eher als Rechteckhöfe anzusprechen, wohingegen man den Viereckschanzen zwischen Ipf und Goldberg durchaus auch einen kultischen Charakter zuweisen kann. Somit bewiesen die Viereckschanzen des Ries, dass man dieser Art Bodendenkmal keine einheitliche Nutzungsform zuweisen kann, wie es die ältere Forschung lange vermutete. Doch legt die Topographie nahe, dass auch die Viereckschanzen zwischen Ipf und Goldberg in enger Beziehung zu den beiden Siedlungen gestanden haben. In diesen pallisadenumwehrten Höfen wurden ebenso wie in den Höhensiedlungen Beweise für Südimporte gefunden. Die doppelte Viereckschanze südöstlich des Weilers Osterholz (der Gewannname „Schanze“ wurde ursprünglich mit einer Schanzanlage aus dem Dreißigjährigen Krieg in Verbindung gebracht), wurde mittels geophysikalischer Prospektionen im Jahr 2002 untersucht. Hierdurch konnten Pfostenstellungen nachgewiesen werden, die für eine Bebauung sprechen. Weitere Anomalien in der geomagnetischen Kartierung lassen eine Grube/Keller vermuten. Die Anomalien der südlichen Schanze sind weniger stark ausgeprägt, was durch die höhere Erosion in diesem Bereich erklärt werden kann. Im Umfeld der Schanzen können weitere Gräben nachgewiesen werden, deren Bedeutung aber nur durch eine Grabung nachgewiesen werden kann. Auch oberirdisch gut erhalten ist heute noch die 3 km vom Ipf entfernte Anlage von Kirchheim-Jagsteim. Eine weitere Viereckschanze wurde 2001 von Otto Braasch lokalisiert, so dass in der Umgebung des Ipfs vier Viereckschanzen existieren, die alle ca. 3–4 km vom Ipf entfernt sind (mindestens drei von ihnen lagen auch in Sichtentfernung). Der Bezug dieser Schanzen zum Ipf ist eindeutig und die Konzentration auffällig. Sie markieren anscheinend das unmittelbare Siedlungsumfeld. In der Unterburg des Ipf und dessen Umgebung lassen sich weitere Rechteckhöfe von ca. 60 m x 60 m Größe nachweisen. Insgesamt stellt sich die Frage, inwiefern sich die Rechteckhöfe (die allgemein als Sitz von Großgrundbesitzern und damit der sozialen
[ 86 ]
Bopfingen und das Nördlinger Ries
Elite gedeutet werden) mit der Existenz eines Fürstensitzes (also des Sitzes der sozialen Elite) vertragen. Letztendlich werden die Burg und ihre Befestigungen als Ausdruck der politischen und wirtschaftlichen Dominanz der Bewohner der Rechteckhöfe verstanden.
Die Frage nach der Abhängigkeit der Siedlungen von Ipf und Goldberg Letztendlich muss die Frage nach der Abhängigkeit zweier befestigter Höhensiedlungen in einem so kleinräumigen Gebiet gestellt werden. Dank der großflächigen Untersuchungen im Ries kann diese Frage zumindest ansatzweise beantwortet werden. So scheint es, als ob die späthallstattliche Siedlung auf dem Goldberg im Laufe des 6. Jahrhunderts v. Chr. an Bedeutung verloren hat. Genau in dieser Zeit entstehen aber die ersten mit Palisaden umgebenen Gehöfte am Fuße des Ipf. Für Ha D3 (ca. 500–450 v. Chr.) fehlt hier jeglicher Siedlungsbefund. Erst in Lt A scheint sich die Siedlung erneut entwickelt zu haben. Es ist also eine Verlagerung der Siedlung auf den Ipf hin festzustellen. Parallel dazu setzen auch die Südimporte ein. Trotzdem können die genauen Gründe für die Verlagerung des Fürstensitzes nicht hundert prozentig geklärt werden. Vielleicht spielt die verbesserte Kontrolle der Erzvorkommen (u. a. auf dem nahen Härtsfeld) eine nicht unerhebliche Rolle. Insgesamt ist aber das Nördlinger Ries schon in frühester Zeit ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt in alle Himmels richtungen.
[ 87 ]
Manching Als letzten in Deutschland gelegenen Ort wenden wir uns der nahe Ingolstadt gelegenen Keltenstadt Manching zu. Manching ist mit 380 ha als eins der größten Oppida zu bezeichnen. Allein die Anzahl der Publikationen zeugen von der großen Bedeutung der seit mehr als fünfzig Jahren durch das Bayrische Landesamt für Denkmalpflege und der Archäologischen Staatssammlung in München sowie der RömischGermanischen Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts geförderten Forschungen an dieser Stelle. Diese Forschungen und die dafür grundlegenden Grabungen waren aus vielen Gründen nicht immer ganz leicht. Vor allem die bis in moderne Zeiten anhaltende Nutzung der Fläche für die Landwirtschaft hat vermutlich nachhaltig Befunde zerstört. Doch auch der 1936–1938 durchgeführte Bau des Flughafens Manching zerstörte große Teile des Oppidums. Da der Flughafen immer noch sowohl militärisch als auch zivil (seit 2001) genutzt wird, sind moderne Grabungen nicht möglich. Nur während der 1955 durchgeführten Instandhaltungsarbeiten, konnte eine solche im verhältnismäßig großen Stil durchgeführt werden. Trotz der teilweise erschwerten Bedingungen wurde in Manching eine Vielzahl von Grabungen mit einer Fülle bedeutender Funde durchgeführt, von denen hier nur eine Auswahl beschrieben werden kann. Seit 2003 bietet das Kelten Römer Museum Manching den adäquaten Rahmen für entsprechende Ausstellungen. Außerhalb des Museums gibt es nur wenig zu sehen (an einigen Stellen kann man den Wall und natürlich das Ost-Tor begutachten), was vor allem an der modernen Bebauung und dem militärischen Sperrgebiet liegt.
Forschungsgeschichte Der Wall des Oppidums war der Bevölkerung bereits seit Jahrhunderten bekannt und die Steine dienten der lokalen Bevölkerung zum Teil als Baumaterial. Auf einer Karte von 1603 ist der Wall verzeichnet, doch existiert schon eine schriftliche Erwähnung aus dem Jahr 1417. Allerdings beschäftigte man sich erst seit dem 19. Jahrhundert mit diesem von der Bevölkerung „Pfahl“ genannten Bauwerk und er kannte es als prähistorisch. Doch wie bei vielen anderen prähistori-
[ 88 ]
Manching
schen Anlagen, wurde auch das Oppidum von Manching zuerst den Römern zugeschrieben. So brachte Joseph Andreas Buchner 1831 den Manchinger Ringwall mit den in römischen Quellen (u. a. im Itinerarium provinciarum Antonini Augusti) genannten Vallatum in Verbindung. Bereits in den folgenden Jahren wurden spektakuläre Funde (über tausend Regenbogenschüsselchen, der Ingolstädter Silberbecher etc.) gemacht (s. Abb. 22). 1879 wurde die Festung Ingolstadt durch den Bau des Forts Manching erweitert, wobei große Teile des Westteils des Oppidum zerstört wurden. Doch führte die militärische Nutzung auch zu einer weiteren Erforschung der Anlage. So erkannte der Hauptmann A.D. Hugo Arnold als erstes, dass es sich hier um ein keltisches Oppidum handelte. Einige Jahre später rekonstruierte der Kaserneninspektor Friedrich Brumann, der die Anlage erneut für eine römische hielt, ein Schlachtgeschehen um Manching und nahm Ausgrabungen vor. Die moderne Erforschung des Oppidums muss man allerdings mit der 1892/1893 im Auftrag der „Kommission zur Erforschung der Urgeschichte Bayerns bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften“ durchgeführten Grabung von Joseph Fink beginnen. Neben Grabungen an den vermuteten Toren und der Viereckschanze erstellte Fink den Plan eines im Ortsbereich von Manching gelegenen Gräberfeldes. International bekannt wurde Manching durch die Arbeiten von Paul Reinecke, der für seine Charakterisierung der Spätlatènezeit Funde aus Manching verwendete. Durch den bereits erwähnten Bau des Wehrmachtflughafens wurde die Erforschung des Oppidums erschwert und Teile der Anlage zerstört. Der Anwesenheit von Mitgliedern des Historischen Vereins Ingolstadt ist es zu verdanken, dass trotz der Zerstörung einige Befunde und Funde (wie der im September 1936 entdeckte Münzschatz) aufgenommen werden konnten. Dank der Initiative von Werner Krämer konnten während der Bau- und Instand haltungsmaßnahmen, die durch die NATO und später die Luftwaffe durchgeführt wurden, großangelegte Grabungen durchgeführt werden, die allein aufgrund der großen Fundmenge die Bedeutung des Oppidums zeigten. Seit dieser Zeit werden regelmäßig Grabungen unter Leitung der „Römisch-Germanischen Kommission“ in Frankfurt durchgeführt. Viele dieser Grabungen erfolgten aus der Not, weil ansonsten großangelegte Bauprojekte (wie die Erschließung eines Baugebietes oder der Bau von Umgebungsstraßen durch das Oppidum) die Grabungen verhindert hätten.
[ 89 ]
Insgesamt ist Manching wohl das besterforschte Oppidum in Europa und die bedeutenden Forschungsergebnisse stehen im krassen Gegensatz zu den Zerstörungen, die moderne Baumaßnahmen verursachten. Die Vielzahl der sich teilweise überlagernden Befunde stellt die Ausgräber aber auch vor das Problem, einzelne Grundrisse exakt herauszuarbeiten.
Das Oppidum Allein die Lage des Oppidums ist auffällig, liegen Oppida doch im Allgemeinen auf hohen und damit gut zu verteidigenden Bergplateaus und sind hierdurch einer Zerstörung durch Erosion verstärkt ausgesetzt. Manching hingegen liegt untypischerweise in einer Ebene. Doch gerade diese Lage machte Manching zu einem wichtigen Handelsstützpunkt, bildete doch ein heute durch die Begradigung der Donau verlandeter Donautalarm die ideale Voraussetzung für einen Handelshafen. Somit war Manching in mehrere Richtungen an wichtige Wasserstraßen angebunden, lag aber auch für den Landverkehr günstig im Donautal. Heute noch sind Tore im Osten und Süden der Stadtanlage nachweisbar, so dass Manching als Kreuzungspunkt wichtiger Handelswege gesehen werden kann. Und auch ohne Bergplateau war das Oppidum durch natürliche Gegebenheiten (in diesem Fall eben der Fluss und die umgebenen Moore) geschützt. Gerade diese Moore waren aber auch wirtschaftlich für die Region bedeutsam, enthielten sie doch große Mengen an Eisenerz, dem so genannten Raseneisenerz. Außerdem existierten landwirtschaftlich sehr ergiebige Böden und am Nordrand des Beckens gab es Steine und Bohnerzvorkommen. Aufgrund der verhältnismäßig reichen Erzvorkommen ist es nicht verwunderlich, dass man überall in der Siedlung Eisenverarbeitung nachweisen kann. Bautechnisch bedeutsam sind nachgewiesene Drainagegräben, die benötigt wurden, um Siedlungsfläche in einer relativ feuchten Umgebung zu schaffen. Einige der Manching umgebenen Gräben können auch als ein Überlaufsystem gedeutet werden. Vielfach wurden Versuche unternommen, die Herkunft der Manchinger Siedler (die frühesten Hinweise für eine Siedlung stammen aus dem späten 4. Jahrhundert v. Chr.) ebenso zu bestimmen, wie den in der Region vorherrschenden Stamm. Die Funde zeigen aber, dass kulturelle Einflüsse sowohl aus Westen, Osten und Süden gleichermaßen zu
[ 90 ]
Manching
finden sind, so dass die erste Frage nicht zu beantworten ist. Als vorherrschender Stamm werden oftmals die Vindeliker genannt, doch lag dann dieses bedeutende Oppidum am Rand des Stammesgebietes (was zumindest ungewöhnlich ist). Offensichtlich gab es in Manching aber boiische Siedler oder zumindest sehr gute Kontakte zu den Boiern, da dieser Stamm durch Funde (z. B. die Goldmünzen, aber auch eine Scherbe mit der Inschrift BOIOS) in dem Oppidum stark repräsentiert ist. Aufgrund seiner Lage und Funde bildet Manching heute die Schnittstelle zwischen Ost- und Westhallstattkreis. Bei Straßenbauarbeiten entdeckte Depotfunde (Waffen und Geräte) lassen auf ein frühes Siedlungszentrum (die ältesten stammen aus dem Ende des 4. Jahrhunderts v. Chr.) schließen. Eine starke Vergrößerung des Siedlungsareals (und damit verbunden der Ausbau zum eigent lichen Oppidum) fand im 2. Jahrhundert v. Chr. statt. Nun lässt der Befund es zu, auf ein Siedlungsmuster und damit auf eine geregelte Infrastruktur zu schließen, wohingegen man bei der älteren Siedlung davon, gestützt von Befunden, ausgehen kann, dass sich die Wege innerhalb der Siedlung den natürlichen Gegebenheiten anpassten. Nachweisen lassen sich ca. 1 ha große Siedlungseinheiten, die sich entlang der Wege reihen. Einhergehend hiermit kann man von einem starken Bevölkerungsanstieg ausgehen. Manching war in dieser Blütezeit nicht nur zentraler Markt und Kultplatz für die lokale Bevölkerung, sondern wohl auch als wirtschaftlicher und politischer Schnittpunkt von überregionaler Bedeutung. Funde aus der Zeit gegen Ende des 2. Jahrhunderts zeigen aber Auffälligkeiten, die Indizien für eine Krisenzeit darstellen. So häufen sich im Bereich der Zentralfläche der Siedlung Funde von Waffenbruchstücken, die nicht mehr als Verlustfunde zu deuten sind. Die Verteilung der Funde spricht gegen eine Deponierung, doch weisen viele der Waffen Zeichen kultischer Zerstörung (z. B. aufgerollte Klingen) auf. Diese Auffälligkeit ist schwer zu deuten und lässt Spielraum für eine Vielfalt von Interpretationen. Ein aus Eisenblech gefertigtes Pferd, welches zerstört im selben Areal gefunden wurde, scheint ein Kultgegenstand gewesen zu sein (ob Abbild oder Trophäe, kann nicht gesagt werden), so dass die Gesamtheit der Beobachtungen zu der These geführt hat, man habe hier Zeichen für die gewaltsame Zerstörung eines Heiligtums. Die Migrationsbewegungen der Zeit (u. a. der Zug der Kimbern und Teutonen, der auch durch die Region geführt hat) könnten mit Kampfhandlungen in Manching in Verbindung gebracht werden. Auch die Deponierung boischer
[ 91 ]
Statere, eine Häufung von Pfeilspitzen und verkohlte Getreidereste könnten für Kampfhandlungen im Oppidum sprechen. Auch die 7 km lange Mauer wurde erst im 2. Jahrhundert gebaut. Da Manching zu diesem Zeitpunkt aber fast 200 Jahre ohne eine solche Befestigung auskam (es handelt sich um eine Mauer in Form des bei Caesar beschriebenen Murus Gallicus, dem nachträglich eine Pfostenschlitzmauer vorgesetzt wurde bzw. der durch diese ersetzt wurde), kann auch diese fortifikatorische Maßnahme als Indiz für eine Krisenzeit genommen werden. Entlang der Mauer sind noch heute das gut erhaltene Süd- und Osttor zu sehen. Beide sind in Form eines Zangentors erbaut worden. Vor allem das Osttor wurde sorgfältig untersucht und es gehört wohl zu den besterforschten Befestigungswerken. Es stellte sich heraus, dass dieses ursprünglich mächtige Tor (es bestand aus einem zweigeschossigen Haus mit einer Höhe von ca. 8–10 m) wenige Jahre nach 80 v. Chr. durch einen Brand zerstört wurde. Allein dass der Schutt offenbar nicht weggeräumt wurde, zeigt, dass es sich hierbei um ein einschneidendes (und wohl kriegerisches) Ereignis gehandelt hat, welches das Ende von Manching symbolisiert. Hierfür sprechen auch die diversen Depotfunde. Die Befunde im Bereich des Oppidums sind, wie bereits erwähnt, vielfältig und reichen von Pfostenlöchern und Vorratsgruben über Brunnen und Gräben bis hin zu diversen Bebauungsstrukturen. Ein Oppidum dieser Größenordnung beherbergte sicherlich zu seiner Blütezeit viele tausend Menschen, und konnte sich daher nicht mehr ausschließlich aus eigenen Ressourcen versorgen. Umso wichtiger war daher der Handel mit dem Umland. Doch beweisen Funde von landwirtschaftlichem Gerät in verschiedenen Siedlungseinheiten, dass die Bevölkerung bemüht war, sich zumindest eine Grundversorgung zu sichern. Sogar landwirtschaftlich genutzte Flächen konnten innerhalb des Oppidums nachgewiesen werden. Zum Oppidum selbst gehören mehrere Gräberfelder, auf die an dieser Stelle nicht weiter eingegangen werden kann. Es sei aber erwähnt, dass die Vielzahl verhältnismäßig reich ausgestatteter Gräber eine wichtige Forschungsgrundlage für die Frage nach Tracht und Bewaffnung der Manchinger Bevölkerung darstellt.
Die Gebäude in Manching Die Gebäude des Oppidums einer bestimmten Funktion zuzuordnen, erweist sich in vielen Fällen als schwierig. Die an anderer Stelle oft
[ 92 ]
Manching
vorhandenen Hinweise in Lehmböden in den Gebäuden fehlen in Manching. Gerade in diesen Böden haben sich anderenorts die aus sagekräftigen Funde regelrecht eingetreten, die Hinweise auf die ursprüngliche Nutzung zulassen. In Manching musste versucht werden, die Bedeutung auf Basis der Grundrisse zu erschließen. Bauten, bei denen außenliegende Pfostenlöcher Treppen vermuten lassen, werden daher als Vorratsspeicher gedeutet (eine Deutung, die durch Getreidefunde erhärtet wird), vor allem, wenn die Baupfosten eine entsprechende Tiefe besaßen (die zugleich ein Indiz für die Höhe des Gebäudes ist). Mehrere dieser Speicher konnten auf dem gesamten Siedlungsgelände nachgewiesen werden, wobei einer der größten in der Nähe des vermuteten Hafens zu finden ist. Ein weiterer für Manching typischer Gebäudetyp ist das Langhaus. Inwiefern diese auch als Wohnhäuser gedient haben, kann nicht gesagt werden, da sich keine Hinweise auf eine Unterteilung des Gesamtraums finden lassen. So kann man in diesem Gebäudetyp Stallungen oder Magazine vermuten. Hierfür sprechen auch die, in der Nähe dieser Gebäude gehäuft gefundenen Beschlagteile von Wagen und Pferdegeschirrteilen. Die große Anzahl an Speichern, Ställen und Magazinen zeigt, dass das Oppidum ehemals ein bedeutender Umschlagplatz für Handelsgüter und daher sicherlich wohlhabend war. Als Wohngebäude werden hingegen eher quadratische Bauten gedeutet. Bei diesen lässt sich oftmals eine Innengliederung nachweisen. Nachzuweisen sind sowohl ebenerdige Häuser, wie auch einige Grubenhäuser. Letztere kann man stets mit handwerklicher Tätigkeit (meist Metallverarbeitung) in Verbindung bringen und sie waren nur in Ausnahmefällen auch bewohnt. Im Grunde lassen sich in Manching alle für das Funktionieren einer Siedlung benötigten Handwerkstätigkeiten nachweisen. Zur Inneneinrichtung der Gebäude kann noch weniger gesagt werden, als zu den Gebäuden selbst. Herd- und Feuerstellen gehören naturgemäß zu Wohn-, aber auch Handwerksgebäuden. Wandhaken lassen darauf schließen, dass Gebrauchsgegenstände aufgehängt wurden und Reste von Scharnieren und Beschlägen sprechen für Truhen und Kästchen als Aufbewahrungsmöbel. Keller existierten in Form von Erdkellern außerhalb der Gebäude und größere Wohnkomplexe hatten kleinere Vorratsgruben und eigene Brunnen. Da verschiedene Formen von Schlüsseln und Schlossblechen zu den häufigeren Funden in Manching gehörten, sahen seine Bewohner die Notwendigkeit, ihr Eigentum auf
[ 93 ]
diese Weise zu schützen. Das Sicherheitsbedürfnis in Manching scheint zumindest groß gewesen zu sein. Hierfür könnte auch die verhältnismäßig große Zahl an Waffenfunden sprechen. Feststellen kann man aber, dass in diesem Oppidum die Häuser nicht willkürlich sondern eher planmäßig konstruiert wurden. Es scheint so, als ob die Gründer eine klare Vorstellung hatten, wie eine Stadt auszusehen hat. Diese Beobachtung schürt natürlich jegliche Spekula tionen. Kannten die Gründer mediterrane Städte? In diesem Fall könnte man in ihnen zurückgekehrte keltische Söldner sehen. Auf den ersten Blick wird diese These von den zahlreichen Waffenfunden gestützt und der Tatsache, dass Schwerter in den Manchinger Gräbern eine häufig anzutreffende Beigabe waren. Letztendlich begibt man sich aber mit solchen Überlegungen in den Bereich der Spekulation.
Wichtige Funde Münzfunde Durch die Münzfunde in Manching (und die von für die Münzprägung wichtigen Objekte) konnte das Wissen über die keltische Numismatik erweitert bzw. Thesen gefestigt und bewiesen werden. In Manching wurden Münzen aus allen in der Antike wichtigen Münzmetallen (Gold, Silber, Potin, Bronze) gefunden. Aufsehenerregend war unter anderem der Fund von mehr als 400 Goldmünzen (so genannten Regenbogenschüsselchen), die in der Nähe des Manchinger Hafens gemeinsam mit einem Goldklumpen deponiert worden waren und dem Stamm der Boier zugeordnet werden (und einen Hinweis auf die Handelspartner geben könnte). Die Münzen bestehen aus sehr reinem böhmischen Gold und haben ein Gewicht von 7–7,5 g. Auf der Rückseite haben sie ein Muster, nach dem sie als Muschelstatere bezeichnet werden. Nur sehr schlecht ist auf der Vorderseite ein Kopf zu er kennen. Insgesamt basiert die Münzprägung der Kelten auch stilistisch auf Vorbildern aus dem Mittelmeerraum (so wurden ursprünglich Statere von Philipp II. von Makedonien imitiert). Der Beginn der Münzprägung wird mit der ersten Rückkehr keltischer Söldner datiert, die das Geld ihrer Auftraggeber mitbrachten (und sicher auch ausgeben wollten). Die ältesten in Manching geprägten Münzen stammen aus dem 3. Jahrhundert v. Chr. und die Vielzahl von Münzfunden in dem Oppidum
[ 94 ]
Manching
belegt, dass sich hier eine der frühesten Münzstätten nördlich der Alpen befunden haben wird. Wie alltäglich mit Geld umgegangen wurde, kann anhand des Fundes einer Geldbörse interpretiert werden. In dieser Börse befanden sich sechs Goldmünzen, die nur einen Bruchteil des zur Verfügung stehenden Platzes ausmachten. Auch wenn man davon ausgehen kann, dass es sich bei diesem Fund nicht um einen Verlustfund handelt (dafür ist der Wert des Inhaltes doch zu hoch), kann man doch davon ausgehen, dass man in diesem Oppidum durchaus größere Geldbeträge mit sich führte. Auch dies ist ein Hinweis auf den Wohlstand der Siedlung und darauf, dass es sich bei Manching um einen Warenumschlagplatz größerer Ordnung handelte. Auf Basis der gefundenen Nominalien kann man ein Nominalsystem entwickeln, welches in Gold geprägt aus Stateren (aufgrund fehlender keltischer Nomenklatur muss auf die griechisch-römische Benennung der Nominalien zurückgegriffen werden) zu 7–8 g (hierzu gehören auch die Regenbogenschüsselchen), Viertelstateren und 1/24-Stateren bestand, in Silber aus Quinaren zu ca. 1,8 g und einer 0,4 g wiegenden Kleinmünze. Weiterhin existieren sehr zinnreiche Bronzemünzen, die allerdings nicht geprägt, sondern gegossen wurden (zu ca. 4 g). Dass auch Fälschungen gefunden wurden (z. B. Gold- und Silbermünzen mit Bronzekern), ist numismatisch ebenso interessant, wie der Fund di verser Tüpfelplatten, mit denen die Schrötlinge hergestellt wurden. Weiterhin wurde eine Patrize gefunden, die wohl zur Herstellung des Münzstempels benutzt wurde (was bedeutet, dass keltische Stempel im Gegensatz zu römisch-griechischen gegossen wurden). Der Fund dieser Patrize ist der einzige Hinweis auf die in Manching geprägten Münztypen (sie trägt das Münzbild eines Kreuzquinars). Diese Münze war offenbar für den überregionalen Handel gedacht (der Münztyp ist in Süddeutschland und Böhmen verbreitet), doch gibt es auch Kleinsilbermünzen, die nur in Manching gefunden wurden und somit dem Regionalhandel dienten.
Glas Manching, so scheinen es die Funde zu belegen, war offenbar ein Zentrum der keltischen Glasherstellung, was vor allem die Funde von Rohglas unterstreichen. Auch wurde vor allem in den Frauengräbern eine Vielzahl unterschiedlichster Glasarmreifen gefunden, deren Herstellung ein nicht unerhebliches Wissen voraussetzt. Außerdem kann
[ 95 ]
man über diese Funde verschiedene Modeerscheinungen nachweisen und chronologisch ordnen. Waren ursprünglich noch mehrfarbige Glasprodukte mit starkem Blauanteil vorherrschend (die ältesten Glasarmreife kann man ins 3. Jahrhundert v. Chr. datieren), so kamen im zweiten Jahrhundert Ringe in Mode, deren Grundfarbe gelb war. Gegen Ende dieses Jahrhunderts schließlich herrschten einfarbige Glasreifen vor. Im Gegensatz zum Glasschmuck scheinen Glasgefäße aber importiert worden zu sein. Die seltenen Funde zeugen für den Wert (und die Zerbrechlichkeit) dieser Importwaren. Die gegossenen Gefäße waren ein- oder mehrfarbig und scheinen aus Italien und Griechenland zu stammen.
Das Goldbäumchen Einen Einblick in keltische Kulthandlungen scheint das 1984 auf der Trasse der Nordumgebung gefundene Goldbäumchen zu geben. Es war in einer vergoldeten und verzierten Holzschatulle in eine ansonsten unscheinbare Grube deponiert worden. Wann dies geschehen ist, kann heute nicht mehr gesagt werden, das Bäumchen selbst wird aus stilistischen Gründen in das 3. Jahrhundert datiert. Die moderne Rekonstruktion zeigt den geschwungenen, und mit augenförmigen Ornamenten versehenen, vergoldeten Holzstamm mit eichelähnlichen Holzknospen und vergoldeten Bronzeblättern. Im Gegensatz zum Stamm erinnern die Blätter an Efeublätter und zumindest dieses Detail spricht für eine hellenistische Inspiration, wenn auch der eigentliche Herstellungsort nördlich der Alpen (vielleicht gar in Manching selbst) zu suchen ist. Hierfür sprechen verschiedene Details bei der Herstellungsart. Es ist nicht verwunderlich, dass dieser Kunstgegenstand in einem kultisch-religiösen Zusammenhang gesehen wird. Ob es als Sinnbild eines Baumkultes oder einer Gottheit zu sehen ist oder als Weihegabe für eine nicht näher bestimmbare Gottheit (dann aber wohl eine Vegetationsgottheit), kann heute nicht mehr beantwortet werden.
Die Waffenfunde In keiner keltischen Siedlung hat man eine derart große Zahl an Waffen gefunden, wie in Manching. Viele dieser Funde sind Verlustfunde (d. h. der Träger hat beim täglichen Gebrauch Teile der Waffe, z. B. ein Ortband, verloren), was dafür spricht, dass man bewaffnet durch das Oppidum ging. Ob hierbei das Sicherheitsbedürfnis oder einfach
[ 96 ]
Manching
Imponiergehabe die größere Rolle gespielt haben, muss ofenbleiben. Die antiken Quellen beschreiben die Kelten aber durchaus als Prahler, so dass Letzteres nicht auszuschließen ist.
Tierknochen In Manching wurden auch Tierknochen in geradezu unüberschaubarer Zahl gefunden. Deren Analyse lässt Rückschlüsse auf die Nutz- und Haustiere der damaligen Zeit zu und damit auch auf die Essgewohnheiten der Bevölkerung. Schweinefleisch war den Knochenfunden zufolge das am häufigsten verzehrte Fleisch, ein Befund, der sich mit den Aussagen in den antiken Quellen deckt. Auch andere übliche Nutztierarten konnten anhand der Knochen nachgewiesen werden (Pferd, Rind, Schaf, Ziege, Hund). Abnutzungserscheinungen an Rinderknochen zeigen, dass diese Tiere auch (vielleicht überwiegend) als Arbeitstiere genutzt wurden. Auch Schafe scheinen in erster Linie als Wolllieferanten, was aus dem Alter der Tiere bei der Schlachtung hervorgeht, gedient zu haben. Erstaunen muss, dass es trotz der vielen Tierknochenfunde wenig bis gar keine Nachweise für Lederverarbeitung gibt. Dieses doch recht geruchsintensive Gewerbe wurde also offensichtlich abseits der Siedlung betrieben oder in einem der bislang nicht untersuchten Areale. Als man sich verstärkt den Überresten von Fischen widmete, konnte auf diesem Weg indirekt ein Handel mit der Mittelmeerwelt nachgewiesen werden. Denn neben den in der Donau vorkommenden Fischen, wie Schleie, Zander, Wels und Karpfen, wurden auch Fischknöchelchen gefunden, die keiner der indigenen Fischart zugewiesen werden konnte. Letztendlich wurde dieser Fisch als eine im Mittelmeer vorkommende Art identifiziert, die vermutlich durch das von den Römern importierte, bei den Kelten beliebte Garum in das Oppidum gekommen ist. Wir haben also durch einen Fisch einen Nachweis für den Fernhandel Manchings.
Die Bedeutung Manchings für die keltische Metrologie Die keltische Metrologie ist aufgrund seltener Funde und fehlender Schriftlichkeit ein für die Forschung nur schwer zu behandelndes Gebiet. Einige der Funde und Befunde aus Manchingen sind aber gerade
[ 97 ]
für diese Thematik bedeutend. Hierzu gehört neben der Vielzahl an Münzen auch ein eiserner Stab mit mehreren Bronzeringen. Ein Vielfaches der Länge dieses Stabes (15,45 cm) lässt sich in den Maßen vieler Grundrisse wiederfinden, so dass dieser Stab als Maßstab interpretiert werden kann. Die Existenz von Feinwagen belegt indirekt die Existenz von vermutlich normierten kleineren Gewichten, doch wird auch vermutet, dass auf diese verzichtet wurde und man eventuell einfach auf die sowieso normierten Münzen zurückgriff. Für Manching liegt aber der Glücksfall vor, dass man zwei Gewichte aus Blei gefunden hat, die sicherlich einem Maßsystem zugehörig waren (das eine Gewicht hat mit 125 g exakt das doppelte Gewicht des anderen). Hierfür spricht, dass beide Gewichte stempelgleich sind, d. h. eine höhere Instanz für ihr exaktes Gewicht garantierte. Ein weiteres, aber stark beschädigtes Bleigewicht hat heute noch ein Gewicht von 50,6 g.
Manching als Fernhandelszentrum Wie bereits vielfach erwähnt, spricht eine Vielzahl der in Manching gemachten Funde direkt oder indirekt für die Bedeutung des Oppidums als Handelsstützpunkt. Vor allem importierte Fernhandelsgüter werfen ein Licht auf die Bedürfnisse und Wünsche der Bewohner des Oppidums (und der weiteren Handelspartner). So belegen viele Amphorenfunde die Beliebtheit des aus dem Mittelmeerraum stammenden Weins und stützen damit gleichlautende Angaben in antiken Quellen. So schreibt unter anderem Diodor: „Da dem Wein sehr zugetan, betrinken sich die Gallier mit ungemischtem Wein, der von Kaufleuten eingeführt wird, und nehmen unmäßig wie sie sind, den Trank gierig zu sich […]. Und deshalb sehen auch viele italische Kaufleute wegen ihrer gewohnten Gewinnsucht in der Vorliebe, welche die Gallier für den Wein haben, einen Glücksfall. Die bringen nämlich auf schiffbaren Flüssen in Booten und auf dem Land mit Wagen den Wein herbei und erhalten dafür einen unglaublichen Preis; denn für einen Krug Wein bekommen sie im Tausch einen Sklaven […].“ (Diod. 5, 26, 3) Bestätigen tut dies Athenaios: „Das Getränk ist bei den Reichen Wein, der aus Italien und dem Gebiet um Massilia eingeführt wird.“ (Athen. 4, 36).
[ 98 ]
Manching
Die in Manching gefundenen Amphoren fassten ca. zwanzig Liter, somit war das Gesamtgewicht so groß, dass Lieferungen, vor allem in größerer Menge, hauptsächlich auf dem Wasserweg erfolgten. Manchings Donauhafen erklärt daher die große Zahl gefundener Amphoren. Östlich von Manching findet man nur noch vereinzelt Amphorenscherben. Sollte auch in diesen Gebieten Wein gehandelt worden sein (in den Gebieten gefundene Bronzegefäße, wie sie zum Weingenuss Verwendung fanden, sprechen dafür), so wurde er in anderen Gefäßen transportiert. Versuche die Handelswege zu rekonstruieren, zeigten, dass die Amphoren in Kampanien gefertigt wurden. Folgt man den gefundenen Schiffwracks, so verlief der Handel zuerst Rhône-aufwärts, dann über Hochrhein, Neckar und Donau. Datieren lässt sich der Handel bzw. die Amphoren auf die Zeit zwischen 150 und ca. 70 v. Chr. Dieses Enddatum markiert anscheinend auch den Beginn des wirtschaftlichen Niederganges des Oppidums. Als Gegenwert für den Wein lassen sich verschiedene Produkte nennen, doch wird vor allem das Eisen eine bedeutende Rolle gespielt haben. Eine Siedlung vom Umfang Manchings, in der spezialisierte Hand werker lebten, musste natürlich mit Nahrungsmitteln versorgt werden. Dies geschah aus dem Umland. In der Umgebung, also dem gesamten Ingolstädter Becken sind mehrere Viereckschanzen und offene Siedlungen nachweisbar, die die benötigten Lebensmittel geliefert haben werden.
[ 99 ]
Noch mehr Keltisches Prähistorische Völkerschaften richten sich nicht nach modernen politischen Grenzen. Doch geschieht gerade dies aus verschiedenen Gründen in diesem Reiseführer. Es muss aber jedem bewusst sein, dass eine Reise zu den Kelten – auch zu den Kelten Süddeutschlands – nicht nur auf die hier beschriebenen Orte beschränkt sein muss (oder gar darf) und auch nicht an den Landesgrenzen enden soll. Zu viel Bedeutsames findet sich jenseits dieser Grenzen. Doch bietet Manching einen durchaus sinnvollen Abschluss, ist das Oppidum doch der beiden spätbronzezeitlichen Kulturkreise des westlichen und östlichen Hallstattkreises gelegen und vereint Merkmale beider. Gerade da die beiden für die Kelten relevanten Epochen nach Orten benannt wurden, die außerhalb des behandelten Gebietes liegen, soll zumindest ein kleiner Blick über den Tellerrand erfolgen.
Hallstatt und Neuchâtel Die Fundorte Hallstatt und Neuchâtel sind auch im Rahmen eines süddeutschen Reiseführers erwähnenswert, sind nach ihnen doch die für die Kelten relevanten Epochen unterteilt. Die ältere der beiden Epochen ist nach dem, zwischen 1846 und 1863 im österreichischen Salzkammergut ausgegrabenen, Gräberfeld nach dem Hallstätter See benannt. Hier wurden mit, für die damalige Zeit hervorragender Dokumentation fast tausend Gräber des 7. und 6. Jahrhunderts v. Chr. ausgegraben. Die Latènezeit ist nach den 1857 gemachten Funden in La Tène am Neuenburger See benannt. Hier wurden bei niedrigem Wasserstand zuerst Pfahlstümpfe gefunden, genauere Untersuchungen brachten aber mehrere Tausend Gegenstände – oft Waffen, aber auch andere Funde wie Eisen, Bronze, Keramik, Leder und Holz – zu Tage, die zumeist aus dem 3. und 2. Jahrhundert stammten. Die Funde werden als Opfergaben gewertet, die von einem Steg aus (daher die Pfahlstümpfe) in den See geworfen wurden. Bedeutend und für die Klassifizierung des Stils vornehmlich zu beachten, sind die verzierten Schwertscheiden. Heute informiert ein archäologischer Park nebst Museum – das so genannte Latènium – die Besucher vor Ort.
[ 100 ]
Schlusswort
Schlusswort Fährt man mit offenen Augen durch Süddeutschland, so findet man vielerorts Hinweise auf die Kelten. Nicht alles davon kann als wissenschaftlich fundiert gelten, doch muss man einräumen, dass auch keltische Baumkreise, wie man sie unter anderem in Stamsried nahe Regensburg finden kann (dort an der Kirchbachaue gelegen), und ähnliche populäre Errungenschaften neopaganer Bewegungen für die Keltologie mehr als nur esoterischer Firlefanz sind. Denn auch, oder vor allem diese Themen wecken das Interesse an den Kelten und bringen interessierte Besucher in Museen und Ausstellungen. Mit steigendem öffentlichem Interesse an einem Thema steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass Finanzierungen für weitere Forschungen genehmigt werden. Bedenkt man, dass allein in Baden-Württemberg mehrere hundert Grabhügel bekannt, aber noch nicht untersucht sind, so erkennt man diese Notwendigkeit. In diesem Führer konnte nur ein Schlaglicht auf einige ausgewählte Regionen geworfen werden. Die dort gemachten Entdeckungen haben zwar die keltologische Forschung weit vorangetrieben, doch sind sie, wie die meisten modernen Erkenntnisse, ein Resultat aus überregionaler Forschung. Hierfür muss zwangsläufig der Blick in andere Länder geworfen werden, wie zum Beispiel nach Frankreich, wo die Untersuchungen der von Caesar genannten Oppida (so z. B. in Bibracte), aber auch der großen Fürstensitze wie dem Mont Lassoir im Vergleich für ähnliche Befunde im gesamten westlichen Hallstattkreis relevant sind. Neben Grabungen und archäologischen Parks spielen auch die diversen Museen eine wesentliche Rolle. Zu diesen und zu weiteren Grabungen sei auf das Verzeichnis im Anhang verwiesen. Abschließend sei dem Leser eine angenehme Reise gewünscht. Sie wird ihn in nicht nur landschaftlich, sondern auch kulturell reizvolle Gegenden führen, in denen es sich lohnt, den einen oder anderen Ab stecher abseits der keltischen Spuren zu unternehmen.
[ 101 ]
Adressen/Kontakte Vereine Arbeitskreis Historische Keltologie e.V. Universität Stuttgart Historisches Institut c./o. Holger Müller (1. Vorsitzender) Keplerstr. 17 D – 70174 Stuttgart Mail: [email protected] http://www.histkelt.kelteninfo.de Dünsberg-Verein e.V. Gießener Straße 4 D – 35444 Biebertal Telefon: +49 (0)6409 / 9649 Telefax: +49 (0)6409 / 661030 http://www.duensberg-verein.de Gesellschaft für Archäologie in Württemberg und Hohenzollern e.V. Berliner Straße 12 D – 73728 Esslingen am Neckar Telefon: +49 (0) 711 / 57744154 Telefax: +49 (0)711 / 57744167 Mail: [email protected] http://www.gesellschaft-vfg.de KeltenWelten – keltische Stätten in Deutschland e.V. Geschäftsstelle KeltenWelten Keltenwelt am Glauberg c/o Bahnhofstraße 43 D – 63695 Glauburg Telefon: +49 (0) 6041 / 96 95 50 Telefax: +49 (0)6041 / 96 95 51 Mail: [email protected] http://www.verein-keltenwelten.de/de/startseite
[ 102 ]
Adressen/Kontakte
Societas Celtologica Europaea Indogermanisches Seminar Universität Zürich Rämistrasse 68 CH-8001 Zürich Mail: [email protected] http://www.celtologica.eu
Museen/Grabungen etc. Bibracte Mont Beuvray F – 71990 Saint-Léger-sous-Beuvray Telefon: +33 (0) 385865235 Mail: [email protected] http://www.bibracte.fr Europäischer Kulturpark Bliesbruck-Reinheim Robert-Schuman-Straße 2 D – 66453 Gersheim – Reinheim Telefon: +49 (0) 6843 / 900211 Telefax: +49 (0) 6846 / 900225 Mail: [email protected] http://www.saarpfalz-kreis.de/europaeischerkulturpark/index-de.htm Franziskanermuseum Villingen-Schwenningen Rietgasse 2 D – 78050 Villingen-Schwenningen Telefon: +49 (0) 7721 / 822351 Telefax: +49 (0) 7721 / 822357 Mail: [email protected] http://www.villingen-schwenningen.de/kultur/staedtische-museen/ franziskanermuseum.html Historisches Museum Basel Steinenberg 4 CH – 4051 Basel Telefon: +41 (0) 612058600
[ 103 ]
Telefax: +41 (0) 612058601 Mail: [email protected] http://www.hmb.ch kelten römer museum manching Im Erlet 2 D – 85077 Manching Telefon: +49 (0) 8459 / 32373-0 Telefax: +49 (0) 8459 / 3237329 Mail: [email protected] http://www.museum-manching.de Keltendorf Steinbach Keltendorf am Donnersberg e.V. Brühlstraße D – 67808 Steinbach Telefon: +49 (0) 6352 / 1712 Mail: [email protected] http://www.keltendorf-steinbach.de/ Keltenmuseum Hallein Pflegerplatz 5 A-5400 Hallein Telefon: +43 (0) 6245 / 80783 oder 84288 Telefax: +43 (0) 6245 / 80783-14 Mail: [email protected] http://www.keltenmuseum.at Keltenmuseum Heuneburg Museumsverwaltung Holzgasse 6 D – 88518 Herbertingen Telefon: +49 (0) 7586 / 920838 Telefax: + 49 (0) 7586 / 920860 Mail: [email protected] http://www.heuneburg.de/keltenmuseum-heuneburg/ Keltenmuseum Hochdorf/Enz Keltenstr.2 D – 71735 Eberdingen-Hochdorf
[ 104 ]
Adressen/Kontakte
Telefon: +49 (0) 7042 / 78911 Telefax: + 49 (0) 7042 / 370744 Mail: [email protected] http://www.keltenmuseum.de Keltenwelt am Glauberg Am Glauberg 1 D – 63695 Glauburg Telefon: +49 (0) 6041 / 823300 Telefax: +49 (0) 6041 / 8233011 Mail: [email protected] http://www.keltenwelt-glauberg.de/ Landesmuseum Mainz Große Bleiche 49 – 51 D – 55116 Mainz Telefon: +49 (0) 6131 / 28570 Telefax: +49 (0) 6131 / 2857288 Mail: [email protected] http://www.landesmuseum-mainz.de Laténium Neuenburger Archäologie-Park und Museum Espace Paul Vouga CH – 2068 Hauterive Telefon: +41 (0) 328896917 Telefax: +41 (0) 328896286 Mail: [email protected] http://www.latenium.ch Musée Archéologique Palais Rohan 2, Place du Château F – 67000 Straßburg Telefon: +41 (0) 388525000 http://www.musees-strasbourg.org/musee_archeo Musée du Pays Châtillonnais Trésor de Vix
[ 105 ]
14 Rue de la Libération F – 21400 Châtillon-sur-Seine Telefon: +41 (0) 380912467 http://musee-vix.fr Museum für Vor- und Frühgeschichte Am Schlossplatz 16 (Kreisständehaus) D – 66119 Saarbrücken Telefon: +49 (0) 681 / 954050 Mail: [email protected] bzw. [email protected] http://www.vorgeschichte.de Museum Hallstatt Seestraße 56 A-4830 Hallstatt Telefon: +43 (0) 61348280 15 Telefax: +43 (0) 61348398 Mail: [email protected] http://www.museum-hallstatt.at Museum im Seelhaus Spitalplatz 1 D – 73441 Bopfingen Telefon: +49 (0) 7362 / 3855 Römisch-Germanisches Zentralmuseum Ernst-Ludwig-Platz 2 D – 55116 Mainz Telefon: +49 (0) 6131 / 91240 Telefax: +49 (0) 6131 / 9124199 Mail: [email protected] http://www.rgzm.de Württembergisches Landesmuseum Schillerplatz 6 (Altes Schloss) D – 70173 Stuttgart Telefon: +49 (0) 711 / 89535111 Telefax: +49 (0) 711 / 89535444 http://www.landesmuseum-stuttgart.de
[ 106 ]
Literatur
Literatur Allgemein und weiterführend BIEL, JÖRG; RIECKHOFF, SABINE (Hgg.): Die Kelten in Deutschland, Stuttgart 2001. BIRKHAN, HELMUT: Kelten. Versuch einer Gesamtdarstellung ihrer Kultur, Wien 1997. BIRKHAN, HELMUT: Kelten – Bilder ihrer Kultur, Wien 1999. BIRKHAN, HELMUT (Hg.) Bausteine zum Studium der Keltologie, Wien 2005. BITTEL, KURT, et al. (Hgg.): Die Kelten in Baden-Württemberg, Stuttgart 1981. BOFINGER, JÖRG, et al. (Hgg.): Entdeckungen. Höhepunkte der Landesarchäologie 2007–2010, Esslingen 2011. BURKERT, WALTER: Griechische Religion der archaischen und klassischen Epoche, Stuttgart [u. a.] 1977. CUNLIFFE, BARRY: Die Kelten und ihre Geschichte, Bergisch Gladbach 20048. EGGERT, MANFRED K. H.; SAMIDA, STEFANIE: Ur- und Frühgeschichtliche Archäologie, Tübingen Basel 2009. GEYH, MEBUS A.: Handbuch der physikalischen und chemischen Altersbestimmung, Darmstadt 2005. HOFENEDER, ANDREAS: Die Religion der Kelten in den antiken literarischen Zeugnissen, 3 Bände, Wien 2005–2012. KARL, RAIMUND: Altkeltische Sozialstrukturen, Budapest 2006. KLEIN, THOMAS F.: Wege zu den Kelten. 100 Ausflüge in die Vergangenheit, Darmstadt 2004. KOCH, JOHN T.: An Atlas for Celtic Studies. Archaeology and Names in Ancient Europe and Early Medieval Ireland, Britain, and Brittany, Oxford 2007.
Keltizitäts-Debatte COLLIS, JOHN: The Celts. Origins, Myths, Inventions, Stroud 20062. COLLIS, JOHN: Die Entwicklung des Kelten-Konzepts in Britannien während des 18. Jahrhunderts, in: Birkhan, Helmut: Kelten-Einfälle an der Donau. Akten des Vierten Symposiums Deutschsprachiger Keltologinnen und Keltologen; philologische – historische – archäologische Evidenzen, Wien 2007, S. 111–126.
[ 107 ]
CUNLIFFE, BARRY; KOCH, JOHN T. (Hgg.): Celtic from the West. Alternative perspectives from archaeology, genetics, language and literature, Oxford 2010. KARL, RAIMUND: Die Keltizitäts-Debatte und die Archäologie der britischen Inseln, in: Birkhan, Helmut: Bausteine zum Studium der Keltologie, Wien 2005, S. 104–147.
Fürstengrabdebatte BURMEISTER, STEFAN: Geschlecht, Alter und Herrschaft in der Späthallstattzeit Württembergs, Münster [u. a.] 2000. KIMMIG, WOLFGANG: Zum Problem späthallstätter Adelssitze, in: Otto, Karl-Heinz: Siedlung, Burg und Stadt. Studien zu ihren Anfängen, Berlin 1969, S. 95–113. KOSSAK, GEORG: Prunkgräber. Bemerkungen zu Eigenschaften und Aussagewert, in: Kossak, Georg; Ulbert, G.: Studien zur vor- und frühgeschichtlichen Archäologie, München 1974, S. 3–33. NORTMANN, HANS: Modell eines Herrschaftssystems. Frühkeltische Prunkgräber der Hunsrück-Eifel-Kultur, in: Das Rätsel der Kelten vom Glauberg. Glaube, Mythos, Wirklichkeit, Stuttgart 2002, S. 33–46. STEUER, HEIKO: Fürstengräber, Adelsgräber, Elitengräber: Methodisches zur Anthropologie der Prunkgräber, in: Carnap-Bornheim; Krausse, Dirk; Wesse, Anke: Herrschaft – Tod – Bestattung. Zu den vor- und frühgeschichtlichen Prunkgräbern als archäologisch-historische Quelle, Bonn 2006, S. 11–25.
Oppida AUDOUZE, FRANÇOISE; BÜCHSENSCHÜTZ, OLIVIER: Towns, villages and countryside of Celtic Europe. From the beginning of the second millennium to the end of the first century BC Bloomington [u. a.] 1992. COLLIS, JOHN: Oppida. Earliest towns north of the Alps, Sheffield 1984. FICHTL, STEPHAN; RIECKHOFF, SABINE: Keltenstädte aus der Luft, 2011, Stuttgart 2011.
Wirtschaft Forschungen zur keltischen Eisenerzverhüttung in Südwestdeutschland, Stuttgart 2005.
[ 108 ]
Literatur
Viereckschanzen BITTEL, KURT, et al.: Die keltischen Viereckschanzen, Stuttgart 1990. WIELAND, GÜNTHER (Hg.) Keltische Viereckschanzen. Einem Rätsel auf der Spur, Stuttgart 1999.
Der Glauberg Das Rätsel der Kelten vom Glauberg. Glaube, Mythos, Wirklichkeit, Stuttgart 2002. HESSISCHES LANDESMUSEUM DARMSTADT; LANDESAMT FÜR DENKMALPFLEGE HESSEN (Hgg.): Der Glauberg in keltischer Zeit. Zum neuesten Stand der Forschung, Bonn 2008. DEISS, BRUNO: Zur Struktur und Orientierung der Grabensysteme um die Fürstengrabhügel am Glauberg, in: Der Glauberg in keltischer Zeit. Zum neuesten Stand der Forschung, Bonn 2008, S. 279–294.
Reinheim ECHT, RUDOLF: Das Fürstinnengrab von Reinheim. Studien zur Kulturgeschichte der Früh-La-Tène-Zeit, Bonn 1999. HOFENEDER, ANDREAS: Die ‚Druidinnen‘ der Historia Augusta, in: Keltische Forschungen 3 (2008), S. 63–87. MÜLLER, HOLGER: Keltische Frauen an der Macht. Ausnahme oder Regel?, in: Karl, Raimund; Leskovar, Jutta: Interpretierte Eisenzeiten. Fallstudien, Methoden, Theorie. Tagungsbericht der 3. Linzer Gespräche zur interpretativen Eisenzeitarchäologie, Linz 2009, S. 321–330. REINHARD, WALTER: Kelten, Römer und Germanen im Bliesgau, Reinheim 2010.
Donnersberg/Dannenfels ZEEB-LANZ, ANDREA: Der Donnersberg. Eine bedeutende spätkeltische Stadtanlage, Speyer 2008.
Magdalenenberg MEES, ALLARD: Der Sternenhimmel vom Magdalenenberg. Das Fürstengrab bei Villingen-Schwenningen – ein Kalenderwerk der Hallstattzeit, in: Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz 54.1 (2007), S. 217–264. MEYER-ORLAC, RUTH: Einige Erwägungen zu den Stangensetzungen im Magdalenenberg, in: Archäologische Nachrichten Baden (1983), S. 12–21.
[ 109 ]
SPINDLER, KONRAD (Hg.) Der Magdalenenberg bei Villingen. Ein Fürstengrabhügel des 7. vorchristlichen Jahrhunderts, Stuttgart 19992. SPINDLER, KONRAD: Magdalenenberg. Der hallstattzeitliche Fürstengrabhügel bei Villingen im Schwarzwald, 6 Bd.,Villingen 1971– 1977.
Hohenasperg BALZER, INES: Die Erforschung des Siedlungsdynamik im Umfeld des frühkeltischen Fürstensitzes Hohenasperg, Kr. Ludwigsburg, auf archäologischen und naturwissenschaftlichen Grundlagen, in: Krausse, Dirk: Frühe Zentralisierungs- und Urbanisierungsprozesse. Zur Genese und Entwicklung frühkeltischer Fürstensitze und ihres territorialen Umlandes, Stuttgart 2008, S. 143–161. BOLAY, GERTRUD, et al.: Kelten am Hohenasperg, Asperg 2010.
Heuneburg BOFINGER, JÖRG; GOLDNER-BOFINGER, ANITA: Terassen und Gräben – Siedlungsstrukturen und Befestigungssysteme der Heuneburg-Vorburg, in: Krausse, Dirk: Frühe Zentralisierungs- und Urbanisierungsprozesse. Zur Genese und Entwicklung frühkeltischer Fürstensitze und ihres territorialen Umlandes, Stuttgart 2008, S. 209–227. Burkhardt, Nadine: Die Lehmziegelmauer der Heuneburg im mediterranen Vergleich, in: Krausse, Dirk: „Fürstensitze“ und Zentralorte der frühen Kelten, 2011, S. 29–50.
Hochdorf Der Keltenfürst von Hochdorf. Methoden und Ergebnisse der Landesarchäologie, Stuttgart 1985.
Bopfingen KRAUSE, RÜDIGER: Der Ipf. Frühkeltischer Fürstensitz und Zentrum keltischer Besiedlung am Nördlinger Ries, Stuttgart 2007.
Manching SIEVERS, SUSANNE: Manching. Die Keltenstadt, Darmstadt 2003.
[ 110 ]
Glossar
Glossar A Annexwall Wallanlage, die ergänzend zur eigentlichen Befestigungsanlage (oft nachträglich) erbaut wurde. Attasche Figürlich oder ornamental verzierte Halterung zwischen Gefäßkörpern und Henkeln/Griffen bei Metallgefäßen. B Befund Die bei einer archäologischen Grabung angetroffenen Fundumstände. Bohnerz Bohnenförmige Eisenerzvorkommen, die durch Ausfällung von ursprünglich in sauren Wässern gelöstem Eisen entstehen. Diese chemische Reaktion tritt u. a. in Kalkschichten auf. Bohnerz hat einen Eisenoxidanteil von bis zu 76%.
K Keltike Aus antiker Sicht keltisch besiedeltes Gebiet (im allgemeinen Nordwesteuropa ohne Groß britannien und Irland). M Metrologie Lehre von den Maßeinheiten und Gewichten. N Nekropole Ein Gräberfeld. O Ortband Der unterste Beschlag einer Schwertscheide. Oppidum Eine stadtartige befestigte Großsiedlung nördlich der Alpen.
D Dendrochronologie Methode der Altersbestimmung von Hölzern mittels Analyse der Wachstumsringe. F Flachrelief Plastische Ausarbeitung von Figuren und Ornamenten mit geringer Tiefe. G Garum Römische Fischsauce
I In situ In der ursprünglichen Position/ Lage.
P Palmette Eine ornamentale Verzierung, die einzelnen gefächerten Palmblättern ähnlich sieht. Pfostenschlitzmauer Eine trocken aus Stein errichtete Mauer, bei der im Abstand von bis zu 3 m Holzpfosten zur Versteifung der Mauer vertikal eingestellt werden.
[ 111 ]
Punzierung Prägevorgang bei Metall oder Leder, bei dem Muster und Figuren mittels verschiedenartiger Punzen in den Werkstoff eingearbeitet werden.
Stele Eine Steinplatte, die senkrecht im Boden steht.
R Relief Plastische Darstellung vor einem Hintergrund. Ringwall Ringförmige Wallanlage, die meist aus fortifikatorischen Gründen erbaut wurde. Röhrenkanne Kanne mit röhrenartiger Mündung. S Schnabelkanne Kanne mit lang ausgezogener Mündung.
T Tordiert Ein schraubenförmig gedrehtes Objekt. Tumulus Ein Grabhügel. Z Zangentor Ein Tor, bei dem die Befestigungsmauer auf beiden Seiten des Tores vor demselben rechtwinklig in das Oppidum hineinführt. Somit kann der Zugang zum Tor von den Mauern aus besser verteidigt werden. Zeugenberg Durch Erosionsvorgänge isolierter Einzelberg.
Abbildungsnachweis Abb. 1–3, 14: P. Palm, Berlin Abb. 5: P. Odovdy (zur Verfügung gestellt von der Keltenwelt am Glauberg) Abb. 6–8: Landesamt für Denkmalpflege Hessen (zur Verfügung gestellt von der Keltenwelt am Glauberg) Abb. 17: S. Stork, Keltenmuseum Hochdorf/Enz
Abb. 18–21: vom Verfasser (mit Erlaubnis des Keltenmuseums Hochdorf/Enz) Abb. 22: Städtische Museen VillingenSchwenningen Abb. 23: M. Kienzler (mit Erlaubnis der Städtische Museen VillingenSchwenningen) Alle übrigen stammen vom Verfasser.
[ 112 ]
Informationen Zum Buch - Historische Hintergründe - 12 Archäologische Stätten - 5 Archäologische Parks - 16 Museen und Sammlungen - Nützliche Hinweise zu Lage und Anfahrt - Mit zahlreichen Bildern und Karten
Informationen Zum Autor Holger Müller, 1976 in Berlin geboren, lehrt Alte Geschichte an der Universität Kassel und ist Mitarbeiter des Historischen Instituts der Universität Stuttgart. Er ist Mitglied der Societas Celtologica Europaea und 1. Vorsitzender des Arbeitskreises Historische Keltologie e.V.





![Von Göttern und Helden: Die mythische Welt der Kelten, Germanen und Wikinger [1. ed.]
3806221634, 9783806221633](https://ebin.pub/img/200x200/von-gttern-und-helden-die-mythische-welt-der-kelten-germanen-und-wikinger-1nbsped-3806221634-9783806221633.jpg)