Zur Berliner Arbeiterwohnungsfrage: Ein Beitrag [Reprint 2020 ed.] 9783112382585, 9783112382578
186 130 2MB
German Pages 56 Year 1892
Recommend Papers
![Zur Berliner Arbeiterwohnungsfrage: Ein Beitrag [Reprint 2020 ed.]
9783112382585, 9783112382578](https://ebin.pub/img/200x200/zur-berliner-arbeiterwohnungsfrage-ein-beitrag-reprint-2020nbsped-9783112382585-9783112382578.jpg)
- Author / Uploaded
- Richard Freund
- Hermann Walachowski
File loading please wait...
Citation preview
Zur
Berliner Arbeiternchllllagssrnge. Lin Beitrag voll
Dr. jur. Richard Freund
uiib
Hermann Malachowski
Magistratsassessor,
Kgl. ^iegierullgsbaumeifter,
beamtetes Vorstandsmitglied der Jnoaliditäts-
Hnlfsarbeiter im Kgl. Pr. Ministerium
nnd Altersversi^erungsanstalt Berlin.
für Landwirthschast ?c.
Herlin 1892 3- 3- Heines Verlag.
„Arbeiterwvhnungsfralie" ist in jüngster Zeit aller Orten insbesondere auch in Berlin in Flust gefonimen.*) Man wird sich der großen sozialen, wirthschaftlicheri und politischen Bedeutuilg dieser Frage nicht verschließen können, sie ist eine Frage allerersten Ranges. Ein gesundes behag liches Heini ist die Grundlage jedes geordneten Familien lebens, und dieses wiederum die Grundlage jedes geordneten Staatswesens. In diesem Satze liegt die ganze Bedeutung der Frage. Große Schwierigkeiten thürmen sich aber ihrer Lösung entgegen, und so wirb kein Beitrag zu derselben einer besonderen Rechtfertigung bedürfen. Der vorliegende Beitrag soll nun aber keineswegs eine erschöpfende Behandlung des Stoffes bieten, er bezweckt vielmehr lediglich iveitere Kreise der Bevölkerung für diese wichtige Frage an zuregen, indem er die zahlreichen — auch in technischer Be ziehung — in Betracht kommenden Gesichtspunkte hervorhebt. Die Ausführungen wollen sich nur mit Berliner Verhältnissen beschäftigen, und die von vielen Seiten erörterten und eriviesenen Aiißstände in den Berliner Arbeiterwvhnungsverhältnissen als Thatsache hinnehmen. Der Ausdruck „Arbeiterwvhnungsfrage" wird nur der ") Aus der neuesten Zeit sind mit besonderer Anerkennung die gemein nützigen Bestrebungen des Herrn B. Weisbach hervorzuheben, welcher ein Terrain von 1000 Quadratruthen vorgekaust hat und es für die Bebauung mit Arbeiterwohnhäusern zur Verfügung hält. Vgl. WeiSbach-Messel: Projekt für Miethshänser mit kleinen Wohnungen.
4 Kürze halber gebraucht; denn diese Frage ist nicht nur für beit „Arbeiter" vorhanden, sondern in gleichem Maße für den kleinen selbstständigen Handwerker und für den kleinen Beamten und „Angestellten". Der „Arbeiter" ist allerdings numerisch am meisten betheiligt, auch treten wohl bei ihm die Uebelstände cirn schärfsten auf; deswegen wird bei Behandlung der Frage auf seine gesammte wirthschaftliche Lage, auf feine Bedürfnisse am meisten Rücksicht zu nehrnen sein. Worin besteht nun die Arbeiterwohnungsfrage? Sie ist veranlaßt durch die Thatsache, daß ein großer Theil der „Arbeiter" (in dem erlvähnten weiteren Sinne) d. h. also ein großer Theil der gesmnmten Bevölkerung Berlnrs in unzirlänglicher Weise „wohnt" und dadurch physisch mit) moralisch Schaden leidet. Die Unzulänglichkeit liegt theils in der Wohnungsanlage selbst, theils in der Art der Benutzung der selben, z. B. dadurch, daß eine zu große Anzahl von Personen ihr Wohnbedürfniß darin befriedigt. Die llnzulänglichkeit der Wohnungsanlage hat zumeist ihren Grund in dem Bestreben der möglichsten Ausnutzung der Grundfläche und dieses Be streben wieder seinen Grund in dem Verlangen nach einem möglichst hohen Unternehmergewinne und in der wirthschaftlichen Lage des Arbeiters, welcher nicht im Stande ist, hohe Miethen zu zahlen. Die ungeeignete Ausnutzung der Wohnungsanlage, in erster Linie ihre Ueberfüllung hat zumeist ihren Grund in der Höhe der Miethe bezw. in der ungünstigen lvirthschaftlichen Lage der Miether, dann aber auch in der bei dem Arbeiter vielfach mangelnden Werthschätzung des Wohnungs bedürfnisses gegenüber den anderenLebensbedürfnissen. Damit sind aber die Fingerzeige für die Behandlung und Lösung der Frage gegeben. Verbilligung der Miethen^) — Verbesserung der *) Wenn Aschrott (vgl. Schriften des deutschen Vereins für Armen pflege und Wohlthätigkeit. Elstes Heft, S. 15.) sagt: „Es ist vielfach alc> die Aufgabe von gemeinnützigen Baugesellschasten erachtet worden, den kleineren Seilten billigere Wohnungen als dieselben bisher innegehabt haben, zu liefern. Diese Tendenz, die Ausgaben für die Befriedigung des Wohnungsbedürfnisses herabzusetzen, erachte ich für durchaus unrichtig, und ich glaube, derselben mit aller Entschiedenheit entgegentreten zu sollen. Nicht billigere, sondern bessere Wohnungen sollen den Leuten
Wohnungsanlagen — Verbesserung der gesummten wirthschastlichen Lage des Arbeiters und Erhöhung der Werthschätzung des Wohnungsbedürfnisses, das sind die Ziele auf die hingearbeitet werden mutz, welche iu ihrem Zusammenwirken ein gut Theil der Frage zur Lösung bringen werden.
Die Verbilligung der Miethen kann durch Herab setzung des Nnternehmergewinnes und Verbilligung des Baues erzielt werden. Die Herabsetzung des Gewinnes wird erreicht wenn der Bau der Wohnhäuser nicht aus Grundlage des „Ertverbes" sondern der „Gemeinnützigkeit" betrieben wird. Die Verbilligung des Baues wird erreicht durch die technisch mög lichst vollkommene Ausnutzung des Grund und Bodens, natür lich unter vollkommenster Berücksichtigung hygienischer An sprüche, sowie durch die Flüssigkeit der Baugelder; sie soll aber keineswegs erreicht werden durch die Verwen dung minderwerthen Materials. Die Verbesserung der Wohnungsanlage ist eine wesentlich bautechnische Frage, auf welche im zweiten Theil dieser Ausführungen näher eingegangen werden wird. Das Streben nach Verbesserung sindet aber seine Grenzen in der Höhe der Miethen. Eine Verbesserung auf Kosten der Miethshöhe würde das angestrebte Ziel verfehlen: „Verbesserung" und „Verbilligung" müssen sich imnier die Wagschale halten.
Die Verbesserung der gesummten wirthschastlichen Lage des Arbeiters ist das dritte Moment, welches hinzukommen mutz, um insbesondere in den untersten Schichten die Frage der Lösung näher zu bringen: Die Arbeiter wohnungsfrage ist zum guten Theil eine Lohnfrage und wird auch mit derselben und durch dieselbe zur
geliefert werden," so wird hierbei von der den thatsächlichen Berhältnissen nicht entsprechenden Voraussetzung ansgegangen, daß der Arbeiter bei den gegenwärtigen Miethspreisen und Lohnverhältnissen im Stande ist, sein Wohnbedürsniß in angemessener Weise zu befriedigen (vgl. die nächste Anm.); es wird nicht berücksichtigt, daß die Mißstände, welche durch Uebersüllung der Wohnungen verursacht werden, meistentheilS auf die Höhe der Miethen zurückzuführen sind und daß gerade „Verbilligung der Miethen" mit „Verbesserung der Wohnungen" vielfach gleichbedeutend ist.
6
theilweisen Lösung gelangen.*) Aus der andereu Seite nluß durch erziehliche Einwirkrmg die Werthschätzung des Wohnungsbedürfnisses gegenüber den anderen Lebens bedürfnissen in dein Arbeiter gesteigert werden. — Trotzdem naturgemäß tu Berlin die Arbeiterwohnungs frage sehr brennend ist, ist man doch bis jetzt derselben in energischer und umfassender Weise nicht näher getreten, wielvohl es an Versuchen nicht fehlte. Die zllr Zeit in Berlin nach dieser Richtung Hill vorhalldenen Bestrebllngen sind in folgelldell Organisationen ver treten:**) 1. Berliner gemeinnützige Bangesells chaft, in welche die Alexandra-Stiftung aufgegangen ist. Sie datirt volll Jahre 1847; ihr Zweck ist, in gemeinnütziger Weise dllrch Ballansführungell in verschiedellen Stadttheilell Berlüls gesunde ulld geräulllige WohllUllgen für sogenallllte kleüle Lellte zu beschaffell; ihr Zweck ist ferner, den Miethern Prämien zll gewähren, ebenso ist auch die Möglichkeit gegeben, daß die Miether die Häuser erwerben. Die Gesellschaft errichtet keine großen Kasernen, sondern nur solche nlittleren Nnlfangs ; Dachlmd Kellerlvohnungen sind ausgeschlossen. Die Dividende darf 4°/0 nicht übersteigell. Die Miethsprümie beträgt llach 5 Jahren 10% der kontraktlichen Miethe, welche sich llach jeden weiteren 5 Jahren um je 10% steigert, so daß sie llach 50 Jahreu die Höhe der llrsprünglichen kontraktlich stipulirten ausmacht. Die Prämiell werdeil am Ende jedes Kalender jahres baar bezahlt. *) Daß ein Theil der Arbeiter scholl jetzt derartige Löhne bezieht, das; er im Stande ist,
sein Wohnungsbedürfniß
Weise zu befriedigen,
in
großen Theil der Arbeiter noch
durchaus
als
ist ebenso unbestreitbar,
nicht der Fall ist.
diese Frage nicht näher eillgegangen
werden.
angemessener
daß dies
bei einem
Indeß soll hier auf
Soviel steht
indeß
wohl
fest: Ebenso wie der Arbeitgeber mit vollem Recht bei der Kalkulation des Unternehmergewinnes
ii ii b
der
zwar
die Kosten einer angemessenen Lebenshaltung —
unter
Beryältliisse
ganz
besoil derer
desjenigen
Berücksichtigung
Ortes,
iil
lvelchem
er
seinen Aufenthalt zu nehmen gezwungen i st — in Rücksicht zieht, ebenso muß dies für den Arbeiter bei Normirung der
Löhne geschehen. ** ) Vgl. die Ausführungen des Herrn Prof. Dr. Post iil der Sitzung
des Vereins zur Beförderung des Gewerbefleißes vom 1. Februar 1892
St. B. S. 7 ff.
Die gemeinnützige Ballgesellschaft besaß Ende 1890 35 Häuser mit 979 Miethern. Das Vermögen der AlexandraStiftung betrug 659 995,48 Mk. neben 2 großen Grundstück komplexen, in denen etwa 800 Personen Unterkunft finden. 2. Die Berliner Baugenossenschaft wurde 1886 be gründet; jedes Mitglied ist zur Erwerbung mindestens eines Geschäftsantheils verpflichtet, welcher 200 Mk. beträgt. Mehr als 10 Gefchäftsantheile darf kein Mitglied besitzen. Die Er werbsbedingungen gehen dahin, daß das Eigenthum am Hause nur erworben wird, weint */3 des Kaufpreises bezahlt ist; dann wird gegen eine erste Hypothek auf bett Rest das Haus dem Mitglied zum Eigenthum übertragen. Die Genossenschaft hat die beschränkte Haftpflicht eingeführt. Sie hat durchiveg Doppelhäuser mit zivei Stockiverken errichtet. Das Haus (mit 35—40 ^Ruthen Grund nnd Boden) kostet 6—7500 Mk. Der Erwerber hat jährlich 6°/n der Kostensumme zu zahlen und zwar 4°/0 als Zinsen und 20/0 als Amortisation. Hier nach wird in ea. 12 Jahren 1Z des Kaufpreises gedeckt. Am 1. Januar 1891 besaß die Gesellschaft 786 Mitglieder mit 71 994 Mk. Geschäftsantheilen. Gebaut sind bisher 40 Häuser, von denen 26 in Ädlershof, 14 in Lichterfelde sich befinden. Die Dividende für 1890 betrug 5°/0. 3. Die Baugenossenschaft „Eigenes Heim", welche 1890 begründet wurde. Sie verfolgt deu Zweck — und unter scheidet sich dadurch von der vorigen — daß sie nicht nur einzelne als Eigenthum zu erwerbende Häuser baut, sondern auch Miethswvhnhäuser, in denen also die Wohnungen an die Genossen vermiethet werden. Der Geschäftsantheil beträgt 400 Mk., der entweder gleich baar bezahlt oder durch Wvchenbeiträge von mindestens 50 Pf. allniählich angesammelt wird; mehr als 10 Geschäftsantheile darf kein Mitglied erwerben. Innerhalb 5 Jahren darf ein und derselbe Miether nicht ge steigert werden. Im Jahre 1890 ist zu Rixdorf ein Miethshaus errichtet. 4. „Verein zur Verbesserung der kleinen Woh nungen in Berlin", Aktiengesellschaft, 1889 begründet. Gegen stand des Unternehmens ist der Erwerb, die Veräußerung, so wie die Beleihung von Immobilien in Berlin oder dessen
8
nächster Umgebung, ferner der Bau ober Ausbau und die wohnliche Einrichtung und Bermiethung von Hausgrundstücken, und zwar zum Zwecke der Förderung der Gesundheitspflege, Sittlichkeit und Ordnung in den Wohnungsverhältnissen der arbeitenden Klassen. Der Verein besaß 1890/91 6 Häuser mit 203 Wohnungen; von den 203 Miethsparteien entfallen 164 auf den Arbeiter stand, während 39 anderen Erwerbszweigen angehörten. 5. Die Deutsche Bolksbaugesellschaft, eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht, 1891 begründet. Gegenstand und Zweck ist die Förderung der Erwerbs- und Wirthschastsverhältnisse ihrer Mitglieder durch Beschaffung von ländlichen und städtischen Anwesen, auf welchen Haus und Hof errichtet werden. Diese Anwesen fallen beim vollendeten 60. Lebensjahr des Erwerbers diesem selbst oder bei dessem Tode seinen Erben schuldenfrei zu. Seit dem 18. Juni 1891 wurden Lebensv erstcherungsanträge im Betrage von 812 700 Mk. und Kaufverträge von 776 497 Mk. abgeschlossen, gegen Baarznhlung von ca. 200 000 Mark und gegen Lebensversicherung in Höhe des Restes. Auf den Terrains der Gesellschaft in Groß-Lichterfelde, Giesendorf, Hermsdorf und Rahnsdorf ist dieselbe mit der Aufführung von 72 Häusern beschäftigt; außerdem sind in Magdeburg 2 Bauten errichtet. Die Gesellschaft steht nach ihrer Angabe mit ungefähr 800 Orten in laufender Korrespondenz. Zur Zeit zählt die Gesellschaft über 100 Genossen mit über 500 000 Mk. Geschäfts antheilen. 6. „Bürgerheim", Aktiengesellschaft seit 1891. Zweck ist die Erwerbung und Parzellirung von Grundstücken, sowie die Uebernahme von Bauunternehmungen im Interesse von mittleren und kleinen Leuten. Grundkapital 2 500 000 Mk. Dasselbe ist in 250 Aktien von 10 000 Mk. zerlegt; Dividenden werden auf die Aktien nicht vertheilt. 7. Die Baugesellschaft „ Eigenhaus" ist diejenige, welche das Häuschen am Reichstagsufer errichtet hat. Sie hat den Zweck, den weniger bemittelten Bolksklassen in und um Berlin billige Wohnungen zu verschaffen. Dieser Zweck soll erreicht werden durch die Errichtung, den Verkauf und die
9 Verwaltung von kleinen Wohnhäusern^ in der Regel EinFamilienhäuser mit zugehörigem Hof, durch Herstellung gemein samer Anlagen, die Begründung gemeinsamer Wohlfahrts einrichtungen, und den An- und Verkauf von Ländereien. Das Verniögen besteht in der Hauptsache aus Einlagen, die gegen Ausgabe von Antheilscheinen zum Betrage von 1000 Mk. auf gebracht werden. Der Vollzugsausschuß für die Genossenschaft „Eigenhaus" beabsichtigt, auf einem unmittelbar an der Ostbahnstation Biesdorf gelegenen Terrain etwa 1500 EinFamilienhäuser zu errichten. Der Kaufpreis soll zwischen 2800 Mk. und 6500 Mk., der Miethspreis zwischen 210 Mk. und 500 Akk. betragen. Die baar zu leistenden Anzahlungen müssen mindestens Vio des Preises erreichen, während das Eigenthum auf den Erwerber übergehen soll, sobald Vs des Kaufpreises berichtigt ist. 8. Der „Berliner Spar- und Bauverein, einge tragene Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht", eine erst kürzlich organisirte Vereinigung von Arbeitern, aus welche noch zurückgekomnieir werden wird. Ohne in eine besondere Kritik jeder dieser einzelnen Unter nehmungen einzugehen, werden doch in den folgenden Ausfiihrungen einige Bedenken grundsätzlicher Natur gestreift werden. Bei der Behandlung der Arbeiterwohnungsfrage tarnt mau wohl zwei Theile unterscheiden: a. Beschaffung der Mittel beztv. Orgaitisativit des Unter nehmens. b. Bauausführung. Nicht nothwendig wird der eine Theil von deni anderen beeinflußt; matt wird vielmehr aus den bis jetzt zur An wendung komntenden Systemen für jeden Theil die geeignete Auswahl treffen können, um zu einer niöglichst vollkommenen Lösung ztt gelangen. Bei der Frage der Beschaffung der Mittel, kann man tvohl folgende Hauptgruppen unterscheiden: 1. Bau von Arbeiterwohnungen durch den Arbeit geber. Diese Art kann für Berlin in der Regel nicht in Betracht fontmen.:?) Sie ist ant Platze in den kleinstädtischen und ländlicheit *) Bgl. hierzu den II. Theil.
10
Industrie-Bezirken, in welchen das Gras der Arbeiter vvi>. nur ivenigen großen Arbeitgebern beschäftigt wird, wv die Wvhlseilheit des Grund und Badens die Errichtung der Häuser in nicht zu weiter Entfernung von der Arbeitsstätte erlaubt, aber nicht in Berlin, wo die Zahl der Großbetriebe verschwindend ist, gegenüber den kleinen Betrieben, welche nicht eine solche Zahl von Arbeitern beschästigen, daß die Errichtung von eigenen Arbeitcrhäusern in Frage konnnen kaun, wv der Grund und Boden so theuer ist, daß die Errichtung der Gebäude in der Nähe der Arbeitsstätte nicht durchführbar erscheint. Nur in einem weiter unten noch zu erörterndem Falle scheint diese Art der Errichtung von Arbeiterwohnungcn in größerem Umfange auch für Berlin in Frage zu kommen: wenn nämlich die Verlegung der größeren Betriebe aus dem Weichbildc der Stadt nach der äußersten Peripherie oder den Vororten einen größeren Umfang annehmen wird. 2. Aktiengesellschaften und sonstige kapitalistische Unternehmnngen mit gemeinnützigem Eharakter. Es liegt auf der Hand, daß sehr große Kapitalien er forderlich sein werden, um der Berliner „Wohnungsnoth" in nachhaltiger Weise abzuhelfen und es ist ebenso klar, daß diese Beschaffung der großen Kapitalien am Besten in der Form der Aktiengesellschaft geschehen kann. Airch ivürde die direkte Betheiligung des Großkapitals an dem kinternehmeir, ivelches für die darin angelegten Gelder vollkommene Sicher heit bietet, wenn auch der Zinsgenuß mit Rücksicht auf den Hauptzweck der Beschaffung billiger Wohnungen etwas be schränkter sein müßte, von einem gewissen sozialpolitischen Standpunkte in hohem Grade erwünscht sein. Indeß von anderen, unten noch zu erörternden sozialpolitischen Gesichts punkten aus, scheint die hier ausgeschlossene Betheiligung der Arbeiter bei der Losung der Frage weit erwünschter. Auch scheint hier die Dauer des Zweckes nicht gewähr leistet zu sein: es ist zu befürchten, daß bei erheblicher Preis steigerung des Grund und Bodens und nachdem die Aktien durch Erbgang u. s. w. in den Besitz von Personen gelangt sind, ivelche nicht mehr das gleiche Interesse an der Frage haben, die Aussicht auf Gewinn zur Veräußerung der Wohnhäuser führen sann. Endlich ist auch zu befürchten, daß bei einem
11 derartigen kapitalistischen Unternehmen die Permaltnng mit der 3eit den Bedürfnissen der Arbeiter zu wenig Rechnung tragen wird. 3. Der Weg der Stiftung ist zwar sehr zu empfehlen, iveil hier zunächst die Dauer des Zweckes gewährleistet ist. Auch kann hier der Stifter sehr gemeinnützig wirken, ahne darum seinen Erben die ^Nutznießung des investirten Kapitals gänzlich zu entziehen. Aber es ist klar, daß auf diesein Wege schnelle und umfassende Hilfe, wie sie t>lvth thut, nicht erzielt werden kann. Auch der Einzelne, welcher in gemeinnütziger Weise den Bau von Arbeiterwohuungen betreibt, kanu für die hier in Krage kommende durchgreifende Lösung nicht in Betracht kommen, abgesehen davon, daß auch hier, wenn nicht der Weg der Stiftung betreten wird, dieselbe Gefahr hinsichtlich der Gewähr leistung der Dauer des Zwecks vorhanden ist, wie bei der Aktiengesellschaft. 4. Direktes Eingreifen von Staat ober Gemeinde. Invaliditäts- nnd Altersverfichernirgs- An statt. Gegen das direkte Eingreifeil des Staats wird Jeder erhebliche politische Bedeicken haben, der nicht staatssozialisti schen Ideen huldigt. Aber geuau dieselben Bedenken sind gegen das direkte Eingreifen der Gemeinde vorhanden, nur daß hier die politischen Bedenken noch durch zahlreiche andere Bedenken verstärkt werden, so die starke Kollision mit zum Theil be rechtigten Einzel-Interessen, die Unmöglichkeit der Begrenzung der an die Gemeinden herantretenden Ansprüche, die Be lastung mit einem ungeheuren Berwaltungsapparat, die Ge fahr der bureaukratischen Schablone, in die die Behandlung der Frage hineingerathen könnte. Die Frage, ob und inwie weit durch gesetzliche oder polizeiliche Bestimmungen auf die Abhilfe der Wohnungsnoth hingewirkt werden soll, scheidet hier aus. Dagegen scheint es keinem Zweifel zu unterliegen, daß sowohl Staat als Gemeinde ein ganz erhebliches Interesse an der Lösung der Frage haben und daher alle darauf hin zielenden Bestrebungen auf das Eifrigste zu fördern und zu unterstützen haben werden. Mehr als der Staat kann hier die Gemeinde thun, z. B. durch Errichtung neuer Straßen-Anlagen, Versorgung mit Gas, Wasser, Eanalisativn. Die Be-
12 Schaffung von Grund und Boden durch Vermittelung der Gemeinde in der Weise, daß dieselbe auf ordnungsmäßigen Gewinn verzichtend, die Grundstücke zum Selbstkostenpreise hergiebt, erscheint bedenklich, sowohl vom Standpunkte der Gemeinde als dem des Unternehmens. Jedes auf die Beseitigung der Wohnungsnoth hinzielende Unternehmen muß mit sicheren, den bestehenden Verhältnissen entsprechenden Faktoren rechnen, sofern es dauernd und nachhaltig seinen Zweck erfüllen will. Die Gemeinde würde aber damit eine Präcedenz schaffen, welches nngemessene Ansprüche anderer ebenso gemeinnütziger Bestrebungen zur Folge haben würde. Die Verwendung von Geldern der Jnvaliditäts- und Altersversicherungsanstalten für den Bau von Arbeiterwohnungen ist in letzter Zeit sehr in den Vordergrund gerückt. Auf diese Verwendung insbesondere sür Berlin ist von dem Ver fasser schon vor Inkrafttreten des Jnvaliditäts- und Alters versicherungsgesetzes in Schmoller's Jahrbüchern aufmerksam gemacht worden*). Der $ 129 Abs. 2 dieses Gesetzes be stimmt: „Auf Antrag der Versicherungsanstalt kann der Kom munalverband beziehungsweise die Zentralbehörde des Bundesstaats, für welchen die Versicherungsanstalt er richtet ist, widerruflich gestatten, einen Theil des Anstaltsvermvgens in anderen (sc. als mündelsicheren) zins tragenden Papieren oder in Grundstücken anznlegen Mehr als der vierte Theil des Verinögens der einzelnen Versicherungsanstalten darf jedoch in der bezeichneten Weise nicht angelegt werden". Es kann nach der Fassung „in Grundstücken" zweifelhaft sein, ob damit auch die hypothekarische Beleihung schlecht weg also auch über die mündelsichere Grenze hinaus gemeint ist. Indeß wird man nach dem Inhalt der Motive die Frage wohl bejahen können. Die Motive (S. 135) führen nämlich aus: „Bei Anlegung des Vermögens der Versicherungs anstalten muß mit besonderer Sorgfalt und Umsicht ver fahren werden. Es ist dabei nicht nur auf die Sicherheit *) Vgl. Freund: Zur bevorstehenden Organisation der Jnvali ditäts- und Altersversicherung. 14. Jahrgang 1890, S. 967 ff.
13 der Anlage, sondern auch darauf Rücksicht zu nehmen, daß der Geldmarkt durch die voraussichtlich große Nachfrage nach sicheren Staats- und anderen Anlagepapieren nicht zu empfindlich gestört werde, und die vorhandenen Be stände an solchen Papieren den Bedürfnissen auch genügen können. Aus diesen Gründen wird man die Versicherungs anstalten nicht durchaus auf den Kreis der mündel sicheren Anlagewerthe, obwohl auf diesen immerhin in erster Reihe Rücksicht zu nehmen ist, beschränken dürsen, sondern wird auch die Möglichkeit der Erwerbung anderer Vermögensgegeustände zulassen müssen, so fern diese nach ihrer Beschaffenheit und der jeweiligen Lage des Geldmarktes ausreichende Sicherheit bieten. In dieser Beziehung kommt zunächst die Eriverbung von Jnimobilien in Betracht, in welchen Kapitalien, deren Ver ausgabung für lange Zeit unwahrscheinlich ist, eine sichere Anlage, wenn auch vielleicht geringere Nutzung finden. Man kann dabei beispielsweise an den Ban oder die Erwerbung von Arbeiterwohnungen, für Rechnung der Versicherungsanstalten denken. Es brauchen aber auch andere Anlagewerthe nicht grundsätzlich ansgeschlossen werden". Die Jnvaliditäts- und Altersversicherlingsaustalt Berlin wird also in dreierlei Form der Arbeiter>vohnungsfrage näher treten können: a. Hergabe von Hypotheken auf Arbeiterwohn häuser. Innerhalb der mündelsicheren Grenzen (£ 39 der Preußischen Pormuudschaftsvrdnuug) ist die Anstalt einer Be schränkung auf eineil bestinunten Theil ihres Vermögens nur insoiveit unterworfen, als die laufenden Verpslichtinigen der Anstalt eine Festlegung des Vermögens nicht gestatten würden. Ueber die mündelsicheren Grenzen hinaus findet die Be schränkung aus den vierten Theil des Vermögens statt. Bis zu welcher Grenze hier die Anstalt gehen kann, das wird von der Lage des zu beleihenden Grundstücks abhängen, falls die Anstalt es nicht vorziebt, ein für alle Mal eine bestnnmte Grenze festzusetzen. Die Anstalt wird bei der Beleihung von Grundstücken für den gedachten Zweck in erster Linie auf den gemeinnützigen Charakter und die Solidität des Unternehniens
14 zu sehen haben; vielleicht dürfte es sich auch empfehlen, das; sie sich eine Einwirkung auf die Leitung des Unter nehmens ansbedingt. Die verschiedenen der Lösung der Arbeiterwvhnungsfrage gewidmeten Unternehmungen werden durch die Möglichkeit dieser Beleihungen eine außerordentliche Förderung erfahren können, nnd dieses umsomehr, als die Anstalt auch bei der Normirung des Zinsfußes und der Dauer der Beleihung entgegenkommender sein kann, als Privat kapitalisten. Daß die Anstalt sich für ihre Unterstützung auf ein bestimmtes Unternehmen beschränkt, ist weder nothwendig noch nützlich, iviewohl sie jedenfalls das Maß der llnterstützung oder auch die Unterstützung überhaupt von der Frage wird ab hängig machen müssen, ob beim auch die Art des Unternehmens ihrer Meinung nach geeignet ist, den in Rede stehenden Zweck in wirksamer Weise zu erfüllen. Das disponible Vermögen der Versicherungsanstalt Berlin betrug Ende 1891 rund 4 Millionen Mark. Es könnte also sür die außerordentliche Beleihung etwa 1 Million Mark znr Verwendung kommen. Die gleiche Summe wird wohl für eine Reihe von Jahren disponibel bleiben. b. Ankauf von unbebauten Grundstücken und Ver pachtung oder Weiterveräußernng an geeignete Unter nehmungen. Hier findet durchweg die Beschränkung auf den vierten Theil des Vermögens statt. Durch diese Form könnte die Anstalt den betreffenden Unternehniungen die Erfüllung ihres Zwecks ganz bedeutend erleichtern. Namentlich kommt in Betracht der Vvrankauf von Grund und Boden und die Weiterveräußerung mit mäßigem Nutzen. Hier fiele ein großer Theil der oben gegen die bezügliche Betheiligung der Gemeinde geäußerten Bedenken hinweg. c. Direktes Eingreifen der Versicherungsanstalt durch Erbauung und Verwaltung von Arbeiterwohn häusern. An diese Form scheint vom Gesetzgeber in erster Linie ge dacht worden zu sein, wie es in den oben angeführten Aus führungen der Motive heißt: „Man kann dabei beispielsweise an den Bau oder die Erwerbung von Arbeiterwohnungen für Rechnung der Versicherungsanstalten denken."
Die Organisation der Bersicherungsanstalt ist eine der artige, daß sie in ganz hervorragendem Maße zur Durchsirhrung dieser Aufgabe befähigt und geeignet erscheint. Die Organe der Berliner Versicherungsanstalt sind der Vorstand uni) der Ausschuß. Der Vorstand, welcher die Eigenschaft einer öffentlichen Behörde hat, besteht aus drei höheren, der Berliner Gemeindeverwaltung angehörigen Beamten, zwei Arbeitgebern und zlvei Arbeitnehmern. Der Ausschuß besteht arls zehn Arbeitgebern und zehn Arbeitnehmern. Die Aus schußmitglieder sind zum größten Theil hervorgegangen aus der Wahl der Vorstände der Orts-, Betriebs- und Jrmungskrankenkassen, diese Vorstände sind lviederuui gewählt von den Generalversammlungen der betr. Kassen, ivelcheir fast die gesamrnte Arbeiterschaft Berlins angehört. Die bem Vorstande ange hörigen Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind twiii Ausschüsse gewählt. Die der Verwaltung der Versicherlingsanstalt ange hörigen Arbeitgeber und Arbeitnehmer kann mein also mit einigem Recht als die Vertretung der Arbeitgeberschaft und Arbeiterschaft Berlins ansehen. Bei der Durch führung der Aufgabe könnten diese Vertretungen unmittel bar in umfangreichster Weise herangezogen werden. Bei der Auswahl der Bauplätze, bei der Aufstellung des Baupro gramms, bei der künftigen Verwaltung der Häuser, würden namentlich die Arbeitnehmer, welche die Wünsche der Inter essenten am Besten kennen, die werthvollsten Dienste leisten. Alle die Bedenken, welche oben gegen das direkte Eingreifen von Staat und Gemeinde geäußert sind, treffen hier nicht zu und trotzdem würde die Leitung in den Händen einer öffent lichen Behörde liegen, welche durch ihre autoritative Stellung als solche, manche Schlvierigkeit leichter beseitigen könnte, als jedes andere Privatunternehmen. Dem gegenüber käme aber in Betracht die durch dieses Unternehmen verursachte Belastung der Anstalt mit einem ganz erheblichen Verwaltungsapparat, welcher um so unerwünschter und drückender werden kann, als die nächste Aufgabe der Anstalt, die höchst schwierige Durch führung des Gesetzes für's Erste alle ihre Kräfte in Anspruch nimmt. Des Weiteren wird man auch hier prinzipiell die freie Privatthätigkeit dem behördlichen Eingreifen vorziehen müssen. Falls aber die freie Privatthätigkeit mit
16 Unterstützung der Anstalt zu einer kräftigen und nachhaltigen Förderung des Unternehmens sich nicht als befähigt erweisen sollte, dann wird die Anstalt trotz des Bedenkens der Geschäfts überlastung in die Lage kommen, die Durchführung dieser ge meinnützigen Aufgabe auf eigene Rechnung in ernsteste Er wägung ziehen zu müssen. Unerläßliche Boraussetzung für jegliche finanzielle Betheiligung der Anstalt bleibt natürlich die un zweifelhafte Sicherheit der finanziellen Grundlage der Anstalt selbst. Nach dieser Richtung dürften indeß Be fürchtungen für die Berliner Anstalt nicht vorhanden sein. 5. Genossenschaftliche Bereinigung der Arbeiter. Die Heranziehung der Arbeiter selbst, ihre unniittelbare Be theiligung an der Lösung der Arbeiterlvvhnungsfrage erscheint von weiteren sozialpvlitischeil Gesichtspunkten aus von höchster Bedeutsamkeit. Was ist denn auch natürlicher, als daß die jenigen, welche die Frage zunächst angeht, versuchen, sich selbst zu helfen. Freilich wird die wirthschaftliche Lage des Arbeiters, seine geschäftliche Unerfahrenheit, die Unterstützung von erfahrenen Personen zur Ueberivindung der erstell und hauptsächlichsten Schlvierigkeiten wünschenswerth erscheinen lassen; aber insbesondere der Berliner Arbeiter ist durch die bisherige sozialpolitische Gesetzgebung, welche seine unmittel bare Mitwirkung bei oft sehr großen Kassenverwaltungen, bei der Rechtsprechung u. s. w. erheischt, ferner durch seine Mitwirkung bei der freien Vereinsthätigkeit derartig geschult, daß feilte Befähigung für die Verwaltung des in Rede stehenden Unternehmens nicht anzuzweifeln ist. Der Arbeiter iveiß selbst am Besten, wo ihn der Schuh drückt, er ist am besten be fähigt in betreff der Lage der Wohnhäuser, der Art der Bau ausführung, der Verwaltung der Wohnhäuser eine Entscheidung zu treffen. Die Arbeiter in ihrer genossenschaftlichen Ber einigung sind Eigenthümer der von ihnen bewohnten Häuser, sie setzen selbst die Höhe der Miethen fest, sie treffen selbst die Anordnungen über die Art der Benutzung der Häuser und die Beschränkung der Einzelnen zn Gunsten der Gesammtheit. Hier ist die Dauer des Zweckes des Unternehmens durch das unmittelbare Interesse der Betheiligten gewährleistet, hier ist von schablonenhafter Verwaltung, welche auf die Bedürfnisse der
17
Interessenten keine Rücksicht nunnit, nichts zu befürchten. Nur eine Frage scheint auf deu ersten Blick erhebliche Schwierig keiten zu bieten, nämlich: die Beschaffung genügender Mittel dnrch diese Genossenschaft. Indeß ein in der Stadt Hannover bereits glücklich durchgeführter Bersuch läßt diese Schwierigkeit nicht als so erheblich erscheinen. Dort ist nämlich mit der Baugenossenschaft ein Spar-Berein derartig verbunden, daß die verzinslichen Spareinlagen der Mitglieder zuni Ban der Häuser unter Zuhilfenabme des Realkredits verwendet werden Ans diese Weise haben in Hannover die Arbeiter ohne In anspruchnahme fremder Hilfe bereits 16 Häuser mit 134 Wohnungen errichten können; außerdem ist vor Kurzem ein Grundstück erivorben worden, auf dem 26 Häuser mit 208 Wvhuuugeu errichtet werden svllench Die wöchentliche Spareinlage betrügt mindestens 30 Pf., ivelche bis zur Er reichung einer Summe von 300 Mk. eingezahlt werden niuß. Ans diese Summe ist die Haftung der Mitglieder beschränkt, da die Genossenschaft als „Eingetragene Genossenschaft mit be schränkter Haftpflicht" gebildet ist. Mehr als 3 Geschäfts antheile a 300 Mk. darf kein Mitglied erwerben. Die Spar einlagen werden mit 4°/0 verzinst, eine Verzinsung, die als eine niedrige wohl nicht bezeichnet werden kann und die der Genossenschaft uni so leichter wird, als sich trotz der Ver wendung größter Sorgsalt auf die Bauausführung und trvtz Herabsetzung der Miethen auf 2/s des ortsüblichen Miethspreises das in den Häusern angelegte Kapital mit annähernd 7°/0 verzinst. Die Genossenschaft zählt gegenwärtig 1600 Mit glieder, welche die Verwaltung unentgeltlich führen. Genau auf dieser Hannoveraner Grundlage hat sich kürzlich in Berlin eine Arbeiter-Genossenschaft gebildet unter der Firma: „Ber liner Spar- und Bau-Verein, eingetragene Genossen schaft mit beschränkter Haftpflicht". Die bisherigen Mit glieder gehören mit Ausnahme zweier sämmtlich dem Arbeiter stande an und zwar sind die verschiedensten Branchen unter ihnen vertreten. Vorstand und Aufsichtsrath bestehen aus schließlich aus Arbeitern. Die Genossenschaft hält an dem Grundsatz fest, daß ihre Aufgabe mit politischem Partei*)
Vgl Nr. 1 der „Wohlfahrts-Korrespondenz".
18 getriebe nichts zu thun hat, sondern rein wirthschaftlicher Natur ist. Demgemäß ist jeder Arbeiter für die Mit gliedschaft willkommen. Wie das Unternehmen sich gestalten wird, ob es überhaupt gelingen wird, die gestellte Aufgabe zu losen, das wird lediglich davon abhängen, welche Stellung die Berliner Arbeiterschaft dem Berein gegenüber einnehmen wird. ob die Arbeiter in großer Zahl dem Berein als Mitglieder beitreten werden. Wenn von den 400 000 in Betracht kom menden Personen mir 1 /40 für die Mitgliedschaft gewonnen wird, dann ist das Unternehmen gesichert. Das Statut des Vereins ist in der Anlage abgedruckt.
Soweit die Darstellung der verschiedenen formen, in welchen die Aufbringung der Büttel und die Durchfübrung der Aufgabe erfolgen kann!
Was den zweiten Theil der Arbeitcrwohnungofrage anbelangt, die Art der Bauausführung, so ist dieser haupt sächlich technischer Natnr und als solcher wird er von technischer Seite in dem zweiten Theil dieser Schrift seine besondere Be handlung finden.
Indeß mögen an dieser Stelle noch einige wichtige Punkte von prinzipieller Bedeutung behandelt werden. Cottage-System oder Arbeiterkasernen, Wohnhäuser innerhalb oder außerhalb des Weichbildes der Stadt, das sind wichtige Fragen, die vorab der Erörterung bedürfen. Die Bestrebungen, welche dahin zielen, dem Arbeiter nicht nur eine gesunde und billige Wohnung zu verschaffen, sondern ihm auch die Möglichkeit zu geben, unter leichten und günstigen Bedingungen Eigenthümer des von ihm bewohnten Hauses zu werden, ihn seßhaft und zu einem „Besitzenden" zu machen, sind in ihren idealen Zielen von nicht zu unterschätzender sozial politischer Bedeutung gewiß der größten Anerkennung werth. Für Berlin werden dieselben indeß niemals im Stande sein, auch nur in einigermaßen fühlbarer Weise der Wohnungs noth abzuhelfen. Der Erwerb von Einzelhäusern könnte nur für die „oberen Zehntausend" der Arbeiterschaft in Be tracht kommen, dagegen nicht für diejenigen, bei denen die Wohnungs-Zustände ani schlimmsten und Abhilfe am dringendsten ist. Der Besitz des Hauses bringt eine wirthschaftliche Be-
lastung mit sich, welche in zahlreichen Fällen für den Arbeiter höchst unerwünscht werden kann. Die Dauer des Zweckes ist hier in keiner Weise gelvährleistet; es ist im Gegentheil zu befürchten, daß vielfach schon das Haus in erster Hand seinem ursprünglichen Zwecke entzogen wird; diese Entziehung wird aber mit wenigen Ausnahmen in der zweiten Generation mit Sicherheit erfolgen. Die Kostspieligkeit des Grund und Bodens bedingt die Alllage der Eilizelhäuser außerhalb des Weichbildes lllld zlvar in nicht zu geringer Elltfernung von der Grenze, eill Ulnstand, der viele Bedenken mit sich bringt, auf lvelche weiter unten hingewieseu mcrbeii soll. Den vorhandenen Bediirfnifsell lvird viellllehr in um fassender und nachhaltiger Weise nur durch Errichtllllg voll großen Wohllhällsern genügt merben können.*) Damit ver binbet sich für Biele gänzlich mit Unrecht ber Begriff „Arbeiterkaserne" iinb „Arbeiterviertel". Weber ist es nothwenbig, baß mein bas große Wohnhans als Arbeiterkaserne errichtet, lioch viel weniger ist es llothlvellbig, baß man ganze Viertel mit derartigen Häusern bebaut. Allerdings wird es sich aus technischeli und sinanziellen Grüllden ellipfehlen, nicht ein einzelnes Haus, sondern einen größeren Gebäudekomplex nach einem einheitlichen Plane zu errichten; aber diese Kolnplexe werden einmal nicht die Regel bilden, sodann werden dieselben schon mit Rücksicht ans die Lage ber Arbeitsstätten in ben verschiebensten Theilen ber Stabt zu errichteu fein. Auch die Form der „Arbeiterkaferuell" kaun und muß vermiedeu merbeii. Das Prinzip ber Mischung ber Arbeiterbevölkerung mit nnberen Gesellschaftsklassen muß aufrecht erhalten bleiben, weil dies zu nächst der Arbeiter selbst dringend wünscht, weil auch die Vor theile für ben Arbeiter in wirtschaftlicher, sozialer nnb weiterer sozialpolitischer Hinsicht, bann aber auch für ben Unternehmer selbst in finanzieller Hinsicht ganz unverkennbar sind. Es sollen überhaupt in dieser Hinsicht gegenüber ben bis herigen normalen Zustänben keinerlei Aenberungen eintreten; bie Wohnungen s ollen nur besser unb *) Auf denselben Standpunkt hat sich s. Z. die von dem deutschen Verein für Armenpflege und Wohlthätigkeit eingesetzte Wohnungs-Kom mission gestellt. (Bergl. die Schriften dieses Vereins, elftes Heft.) Ebenso Weisbach: „Projekt für Miethshäuser mit kleinen Wohnungen."
20 billiger sein, rationeller ausgenntzt werden, es soll endlich in denselben auf die Bedürfnisse der Arbeiter in erhvhtein Maße Rücksicht genommen merdeil. Was dann ferner die Lage der Wohnhäuser anbelaugt, so wird das Neberschreiten der Weichbildgreuze zu vermeiden sein. Zunächst ist der Arbeiter selbst wenig geneigt, außerhalb des Stadtbezirks Wohnung zu uehmen. Neben einem gewissen Lokalpatrivtismns und dem Reiz der Großstadt, sind andere, schwerer wiegende Gründe, vorhanden: die Entfernung von der Arbeitsstätte, die damit verursachten Kosten und Unbequemlich keiten und die dadurch bedingte Verkürzung der der Familie gewidmeten Erhvlungszeit, seiner der mangelnde oder doch sehr erschwerte Nebeiwerdienst von Frau und Kindern. Auch für das llnternehmeu selbst ist das Verlassen des Weichbildes wenig günstig: die niannigsachen Schwierigkeiten, tvelche die kleinen Ortsbehörden dem Unternehmen entgegensetzen, der Mangel von Gas, Wasser, Kanalisation sönnen nnübersteigliche Hinder nisse bilden, oder doch eine rationelle Ausgestaltung des Unternehmens zur Unmöglichkeit machen. Zwei Umstände sind es aber, die hier eine Aenderung Hervorrufen werden. Zunächst die in absehbarer Zeit zur Aus führung kommende Einverleibung der Vororte in den Stadtbezirk Berlins. Diese Einverleibung wird auf die gesammten Wohnungsverhältnisse Berlins einen bedeutenden Rückschlag ausüben; nicht minder tvird sie aber von Einfluß auf diejenigen Unternehmungen sein, welche sich insbesondere mit der Arbeitertvvhnuilgsfrage befassen. Die nächste Folge der Einverleibung ist jedenfalls die bedeutende Vermehrung des Baulandes. Daß diese Vermehrung auf die Gruudstückspreisbildung in dem bisherigen Stadtbezirke einen Einfluß aus üben wird, ist um so wahrscheinlicher, als mit der zunehmenden Ausgestaltung der Vororte durch Schaffung von Verkehrs erleichterungen, durch Anlagen von Straßen, durch Versorgung mit Gas, Wasser, Kanalisation u. s. w., die gegenwärtig im Innern der Stadt wohnende Bevölkerung geneigt sein wird, die billigen und gesünderen Wohnungen in dem erweiterten Stadtgebiete zu nehmen. Diese Verhältnisse werden auch die Anlage von Arbeiterwohnhäusern unter wesentlich günstigeren Bedingungen als im bisherigen Stadtgebiet ermöglichen.
Der zweite oben erwähnte Umstand betrifft die Thatsache, daß insbesondere die Großbetriebe wegen der Kostspieligkeit des Grnnd nnb Bodens unb ber dabnrch bebingten hohen Generalilnkosten sich immer mehr unb mehr genöthigt sehen, ben Stabtbezirk zu verlassen unb sich in ber nächsten Umgebung oder doch an der äußersten Peripherie anzusiedeln. Dadurch werden zunächst die Arbeiter mit herausgezogen und damit schwindet ein großer Theil der Bedenken gegen die Errichtung von ^lrbeiterlvohuhäusern außerhalb Berlins; auch käme hier die Errichtung von Häusern durch Arbeitgeber mehr in Betracht. Des Weiteren lvird aber dadurch Bauland im Innern der Stadt frei, welches den hier in Rede stehenden Zwecken dienst bar gemacht lverden kann. Diese Verlegung der Arbeitsstätten wird durch die Einverleibung der Vororte ziveifellos in hohem Grade gefördert werden; dadurch werden aber viele Schwierig keiten, welche unter den jetzigen Verhältnissen der Losung der Arbeiterwohnungsfrage entgegenstehen, beseitigt werden. Ein fernerer Punkt, lvelcher bei der Anlage der Wohn häuser in Betracht zu ziehen ist, betrifft dae» Schlafburschen wesen. Das Halten von Schlafburschen ist unter den gegen wärtigen Verhältnissen als Mittel zur Verbilligung der Wohnungen für den Miether in gewissem Umfange, nothivendig.Z Aber auch für die Schlafburschen selbst ist dieses Verhältniß nothwendig, weil es für sie die einzige Möglichkeit bietet, ein nur einigermaßen erträgliches Unterkommen zu finden. Die Uebelstände, welche das Schlafburschenwesen im Gefolge hat, insbesondere die sittlichen Gefahren für beide Theile, liegen so klar zu Tage und sind schon so oft hervorgehoben worden, daß es hier genügt, das Vorhandensein derselben lediglich festzustellen. Gegen diese Zustände muß nun ein gemeinnütziges Unternehmen für Errichtung von Arbeiter wohnungen ganz entschieden Front machen unb sich nicht darauf beschränken, das Halten von Schlafburschen nur in einem übermäßigen Umfange zu hintertreiben. Freilich muß auf der anderen Seite Ersatz geschaffen werden und zwar entweder durch Einrichtung von Herbergen in einzelnen Arbeiterwohnhäusern oder durch Beförderung des Chambre*) Vgl. hierzu die Ausführungen im II. Theil.
garuistenthums unter den Arbeitern. Ein kleines einfenstriges Zimmer, welches zwei Arbeiten! Wohnung bietet, müßte an die einzelnen Wohnungen so angeschlossen lverden, daß es leicht von den Miethern aftervermiethet lverden kann. Die Beschaffung des nothwendigsten Mobiliars muß durch eine von dem gemeinnützigen Bau-Unternehmen selbst zn errichtende Vorschußkasse erleichtert werden. Dadurch würde auch den unverheiratheten Arbeitern ein eigenes Heim geschaffen werden, lvährend für die Miether selbst noch ein angemessener Nutzen zur Verbilligung für die eigene Wohnung verbliebe. Zahlreiche andere die Einrichtung der Häuser betreffende fragen lverden im zlveiten Theile ihre Erörterung finden.
Es wird vielfach darauf hingewiesen, daß, so niannigfach auch die Bestrebungen auf dem Gebiete der Arbeiterwohnungssrage seien, für alle diese Bestrebungen genügend Raum vor handen sei, daß man sie alle gelvähren lassen und unterstützen müsse, daß sie alle ihre volle Berechtigung hätten und zur Lösung der Frage beitrügen. Das dürste indeß mir insoweit als richtig zuzugeben sein, als keine zu große Zersplitterung der verfügbaren Kräfte und Mittel hervorgerufen wird und die der Abhilfe am Dringendsten benöthigten Mißstände in den breitesten Schichten der Arbeiterbevölkerung nicht außer Acht gelassen lverden. Es ist die Gefahr vorhanden, daß man sich zlvar in sehr humanen aber doch ferner liegenden Bestrebungen verliert und darüber das Nächstliegende vergißt, daß auch die einzelnen Unternehmungen sich gegenseitig in ihrer kräftigen Ausbreitung hindern und in verderbliche „KonkurrenzManoeuvres" hineingerathen.
II. ür die Ausgnbe bessere und billigere Arbeiterwvhuungen zu schaffen, ist die Bauausführung — Entwurf der Gesanuutaulage, Anordnung, ®ruppiriing und Einrichtung der Einzelwohnungen, sowie die eigentliche technische und konstruktive Bauausführung — von der weit» gehensten Bedeutung. Als Bindeglied zwischen dem ersten Theil in der Behandlung der Arbeiterwohnungsfrage, der Be schaffung der Mittel und dem zweiten Theil, der Bauaus führung, kann die Wahl des erforderlichen Banplatzes betrachtet werden, da dieser durch seine Lage die Baukosten, durch seine Form und Beschaffenheit die Bauanlage und Banart beeinflußt. Was die Lage des Bauplatzes anbetrifft, so ist dieselbe schon im ersten Theil dieser Schrift mit Bezug auf die Frage innerhalb oder außerhalb des Weichbildes gestreift worden. Es mag hier nur kurz wiederholt werden, daß die Lage in möglichster Nähe von zahlreichen und großen Arbeitsstätten zu wählen sein ivird. Da nicht alle Bewohner eines Arbeiterwvhnhauses in einer und derselben Fabrik oder auch nur in der Nähe ihrer Wohnung beschäftigt sein werden; da es häuffg nicht in der Möglichkeit oder in« Wunsche des Arbeiters liegt, bei einem Wechsel der Arbeitsstätte — und wie oft kommt ein solcher z. B. bei Bau handwerkern vor — zugleich die Wohnung zu wechseln; und da ferner der Arbeiter sehr großen Werth darauf legt, wenn dieses irgendwie zu ermöglichen ist, sein Mittagessen im Kreise seiner Familie einzunehmen, so ist auch auf gute und billige Fahrverbindungen Rücksicht zu nehmen.
■
24
Abgesehen von den Bauhaudlverkern, deren Arbeits stätten zienllich gleichrnäßig über die ganze Stadt verbreitet und gegenwärtig vielleicht nur im W. und N. in größerem Maßstabe dichter zusaunnengedrängt sind, bleiben die Arbeiter, hinsichtlich ihrer Arbeitsstätten, im allgemeinen auf ganz bestimmte Stadtviertel angewiesell. In diesen befinden sich nicht nur die zahlreichsten sondern auch die größten Be triebe imb diese Stadtviertel, welche sich ringförinig von N.W. über den 0. bis S.W. nm die innere Stadt t)mim lagern. sind daher fast ansschließlich mm der arbeitenden Klasse besetzt. Hier lverden, abgesehen voll einzelnen kleineren Bailstelleil ulehr im Innern der Stadt, zilnächst die Plätze für größere dlrbeiterlvohnungsanlagen zu suchen sein; und hier, oder lvenigsteno in der Nähe, sind cmd) noch solche Terrains §11 erhalten, welche nnbebant, für die erlvähnten Anlagen erworben mib entsprechenb parzellirt mib gefornit werbell köllnten. Der Preicbieser Baustellen ist natürlich verschieben je nach ihrer Größe, Gestalt mib Lage, hält sich jeboch meist imrerhalb solcher Grenzen, bie, unter Berücksichtigllng ber angeführten ober und) anzuführenben besonberen Verhältnisse, rnöglichst nicht übersd)ritten werben bürfen. Die Ansicht, baß mid) bie Miethopreise ber einzelnen Wohnungen lebiglich ober nur weseutlid) vom Baustelleupreis abhängen, ist nicht llnbebingt zutreffenb. Abgesehen von bcm Umstanbe, baß für größere Arbeiterwohnungsanlagen in ber Regel mir Terrains bis zn einer gewissen Preisgrenze, etwa 1000 Mk. pro lüRnthe, in Frage kommen werben, ist unter ber Voraussetzung eines zweckentsprechenben Bauentwurfs, eiu Preis unterschieb ber Baustelle von 200—300 Mk. pro Ruthe von nur geringem Einfluß auf ben Miethspreis ber einzelnen Wohnung. Die Wahl bes erforberlichen Bauplatzes wirb jebod) nicht nur burch seine Lage sondern rückwirkend auch beeinflußt durch die Art der beabsichtigten Bauanlage. Der Bau eines größeren Arbeiterwohnhauses kann ent weder in einer geschlossenen oder in einer offenen An lage geschehen. Unter einer geschlossenen Anlage ist die Gruppirung von Gebäudetheilen um einen oder mehrere Höfe herum so zu verstehen, daß der Hof nach der Straße zu
durch Gebäude vollständig ober doch zum allergrößten Theil abgeschlossen ist. Das Charakteristische einer geschlossenen An lage ist der geschlossene Hof mit stagnirender Lust säule. Unter einer offenen Bauanlage ist die Grnffpirung der Wohnungen nm einen wenigstens nach der Straße offenen Hof (Garten) oder die tAeben- bezw. Aneinander-Reihung einzelner Häuser oder Gebäudetheile so zu verstehen, daß die frische Außenlnft von mehreren Seiten an die Gebäude heran treten kann. Geschlossene und offene Bauanlage können bei größeren "Anlagen selbstverständlich kvmbinirt werben. Die offene Bauweise entspricht im allgemeinen mehr länblichen, bie geschlossene mehr stäbtischen Verhältnissen. Der Grnnb für bas geringe Vorkommen ber offenen Bauweise namentlich in großen Stäbten liegt an beni nothwenbig größeren Verbrauch vou Grunb intb Buben uiib ben hohen Preisen bes letzteren. Der größere Verbranch von Grunb unb Boben wirb nicht lebiglich bnrch bie offene Bauweise an sich bebingt, sonbern hauptsächlich burch bie Schwierigkeit, passenbe Bauplätze zu erhalten, ans welchen biese Bauweise unter Beobachtung ber bestehenben baupolizeilichen Vorschriften unb unter ber Voraussetzung eines normalen Zinsertrages zur Anwenbung gelangen kann. Daß bie offene Bauweise für bie Gesunbheit ber Menschen zuträglicher ist als bie geschlossene, bürste nach bett vorher ge gebenen Definitionen eines Beweises nicht benöthigen. Die neue Berliner Baupolizei-Orbnung, welche eine Bebauung ber Grunbstücke nur bis zu höchstens 2/g bes vorhaubenen Bau platzes gestattet unb für bie Höhe ber einzelnen Gebänbetheile, sowie für bie Breite ber Höfe bestimmte Grenzen vvrschreibt, ist nicht zum geringsten Theile eine Maßregel ber SanitätsPolizei. Der Zweck hierbei ebenso wie bei ber häufig vorkommenben freiwilligen Zusammenlegung ber Höfe von Nachbar-Grunbstücken ist lebiglich ber, bie leichtere Zufuhr von Licht unb Luft zu ermöglichen. Es genügt jeboch nicht Licht unb Luft nur „bis vor bie Thür" zu schaffen; man muß, wenn bie beabsichtigte Wirkung voll erfüllt werben soll, Sorge tragen, baß bie frische Luft in bie Wohnungen ein treten und nicht nur eintreten, sondern auch durch
dieselbe hindurchstreichen kann. Jede größere bürgerliche Wohnung, die in der Regel nicht so bevölkert ist wie die Arbeiterwohnung, liegt im allgemeinen an zwei Fronten so, daß bei Oeffnung von Thüren und Fenstern die Außen luft von der eineu Seite in die Wohnung hinein- und zur andereir wieder hinausziehen kann, wodurch eine je nach Be darf erforderliche Durchlüftung der Wohnung ermöglicht ist. Bon welch' großer Wohlthat eine solche Möglichkeit auch sür Arbeitenvohnuugeil wäre, kann nur derjeuige erniesseu, der jeluals in der Lage lvar, die durch verstärkte Ausdünstung und durch Bornahme aller inöglichen häuslichen Geschäfte schlecht geuwrdene und schwer tu der Stube lagernde Luft einer Arbeitenvohnung zn athlnen. Sehr wesentlich hängt von der Dilrchlüftung der Woh^mngerr auch die Bernieidilng der Entstehilug, Festsetzilug iinb Berbreitung von Krankheiten ab. In einen! anitlichen Bericht heißt es mit Bezug hierauf: auffallende Erscheinung ist es nun, daß eine durch die ganze Tiefe des Gebäudes reichende Wohnung entschieden gesunder ist, wie eine Wohnung, bei der die Lnft nicht direkt durchziehen kann und hat es sich nauientlich bei der letzten CholeraEpidelnie gezeigt, daß Wohnungen mit der ersteren Einrichtung von der Cholera völlig verschont blieben, während unmittelbar daneben gelegene Wohnungen, bei denen nach der früher be liebten Art die Wohnräunie durch eine Mittelwand getrennt waren, so daß sich an den beiden Langseiten die Zugänge be finden, von der Cholera sehr schlimm heimgesucht wurden". Dieser Satz ist einem Berichte über ländliche Arbeiterlvohnungen entnommen. Wenn schon dort die Forderung nach Durchlüftung der Wohnungen in so energischer Weise betont wird, um wie viel mehr muß dieselbe bei städtischeu Wohnungen oder gar bei größeren Wohnungs-Complexen berücksichtigt lverden! Es muß jedoch nicht nur Luft, sonderu auch genügend Luft zugeführt werden beziehungsweise vorhanden sein, d. h. soviel als für die Gesundheit der in der Wohnung befind lichen Personenzahl nothwendig ist. Es genügt hierbei auf das voraussichtliche Bedürfuiß nach Durchschnittssätzen Rücksicht zu nehmen/-') wobei man sich gegenwärtig halte!: muß, -) Die Forderung Dr. Aschrott's (a. a. O.) in die Wohnungen nur
daß die Möglichkeit schneller imb durchgreifender Lüftung ein gutes Korrektiv gegen etwa mangelnden Luftraum bildet.^) oii den bisher erwähnten Wohnungsverbesserungen all gemeiner s)(xdtm; welche der Arbeiter zwar vorerst nicht fordern aber mit der Zeit schätzen lernen wird, treten eine Anzahl solcher Verbesserungen, welche aus den Gewohnheiten und Lebensbedürfnissen des Arbeiters entspringen. Diese Bedürf nisse, über welche man sich am Besten durch Aussprache mit den Arbeitern selbst und durch Besichtigung nicht von einzeln gelegenen, sondern besonders solcher Arbeiterwohnungen unter richtet, die in größerer Anzahl in einem Hause vereinigt, zu mehreren neben einander liegen, sind im allgemeinen: 1. in den Stuben möglichst viel durch Thüren oder Fenster nicht unterbrochene Wandfläche; 2. eigener zur Wohnung gehöriger Korridor; 3. eigenes zur Wohnung gehöriges und von dieser aus zugängliches Closet; 4. wo Wasserleitung vorhanden ist, eigenes Ausgußbecken mit Zuflußhahu innerhalb der Wohnung. soviel Personen hineinzulassen, daß für jede derselben der unbedingt er forderliche Kubikmeter-Luftraum übrig bleibt, und dem Miether bei einer Bergrößerung seiner Familie oder bei dem Heranwachsen seiner Kinder die Möglichkeit zu schaffen, durch Hinzunahme eines Railmes seine Wohnung entsprechend zu vergrößern, erscheint kaum durchführbar. Denn entweder nurß man dann neben jeder Familienwohnung einen Raum für eventuelle Fälle disponibel halten, oder man muß, falls dieser Raum vermiethet ist, den betreffenden Miether aus deni Haitsc entlassen. Ersteres würde eine Er höhung sämmtlicher Miethen mit sich führen, letzteres eine schwer zu begründende Ungerechtigkeit bedeuten. *) Als Anhalt für den erforderlichen Luftraum können einige dies bezügliche für die Errichtllng von Arbeiterlvohnungen auf dem Lande er lassene Polizeiverordnungen dienen. Hiernach ist jedem Arbeiter zwölf Kubikmeter-Luftraum zu gewähren, wertn die Schlafräume zugleich zum Auferithalt in arbeitsfteier Zeit dienen. Sind außer den Schlaftäumen noch besondere Wohnräume vorhanden, so genügt für erstere ein Luft raum von 9 Kubikmetern, für letztere ein Luftraum von 7 Kubikmetern pro Kopf. Einen weiteren Anhalt bietet der Vorschlag in dem von der Kommission des deutschen Vereins für öffentliche Gesundheitspflege aus gearbeiteten Gesetzentwurf zum Schutze des gesunden Wohnens: für jedes Kind unter 10 Jahren mindestens 5 Kubikmeter, für jede ältere Person mindestens 10 Kubikmeter Luftraum zu bestimmen.
28
Möglichst viel und ununterbrochene Wandflnche wird gewünscht, um die Möbel iinb Betten ohne Raunwerlnst sv anzuvrdnen, daß für die freie Bewegung im Jnnenr der durch schnittlich nicht zil großeil Stuben etwas Platz übrig bleibt. Hiernach wird die Tiefe der Stuben so belnessell werdell müssen, daß die betreffenden meist durch Thüreu nicht unterbrocheilell Wände die Aufstellung von nnndestens zwei Betten der Länge liach gestattell. Bon den: Nebengelaß, oder wie die betreffende Be zeichnung für derartig kleine Wohnungen lautet, voll bem „Zubehör" wird der eigene und zur Wohllilug gehörige Corridor am meisten geschätzt. Der Werth eilles solchell fcnm lveder durch einen noch so großen mit anderen zu theilenden Borflur uoch durch irgelldlvelche ähllliche Berailstaltungeu auf gewogen lverden. Der Grulld dieser Schätzullg liegt darill, daß die Arbeiterfrau es nicht liebt, sich von der dkachbarin in dell Topf gucken zu lasserl und die Trellnung der eigentlichell Wohnung vorn Treppellflur durch eine bloße Thür ohne da hinter befindlichen Corridor die Familie in ihrem Zusammen sein vor unangenehmen Nachbarn nicht gellügend schützt, auch die Entstehung von Zänkereien durch die Möglichkeit der leichteren Begnung begünstigt. Diese Begegnung wird zur diothlveudigkeit, soferu das zur Wohnung gehörige Closet nicht von dieser sondern nom Treppenflur aus zugänglich ist; wird ein Closet außerdem noch von mehren Wohnungen gemeinsam benutzt, so führt das er fahrungsmäßig zu argen Störungen des Hausfriedens. In verschärftem und lvesentlich erweitertem Maße treffen diese Uebelstände zu, sofern das Closet, wie dieses leider noch ab lind zu der Fall ist, am Mittelpodest des Treppelllaufs liegt. Letztere Anordnung dürste grundsätzlich zu verlverfen sein. Aehnliche Rücksichten, wie die vorstehend angeführten, haben den Wunsch nach eigenen in der Wohnung befindlichen Ausgußbecken entstehen lassen. Außerdem gewährt eine solche Anlage eine kleine Erleichterung in der Besorgung der Hausgeschäfte. Da letztere zum größten Theil auf der Hausfrau alleiu lasten, so würden alle Eillrichtungen, welche geeignet sind, der-
29 selben eine Arbeitsverminderung zu verschaffen, einer besonderen Werthschätzung begegnen. Zu solcheu Einrichtungen gehört unter Anderem die Anlage von Kehrichtschächten, durch welche die Abfälle, Müll, Asche u. s. w. in Kellergruben geschüttet
lverdeu, von wo aus sie in geeigneter Weise zu beseitigen sind. Solche Kehrichtschächte sind mehrfach in vorzugsweise von Arbeiter» bewohnten Häusern zur Ausführung gebracht worden, haben sich aber meist deshalb nicht bewährt, weil sie zn einer ungesunden Staub- und Schmutzentwicklung im Hause Veran lassung gegeben haben, auch die sehr nothwendige Reinhaltung der Schächte schwierig und umständlich ist. Bedingung für die Ausführung derselben wäre daher eine derartige Lage, daß der sich entwickelnde Staub uicht in die Wohnungen dringt oder das Treppenhaus erfüllt. Ist dieses möglich, dann werden die Kehrichtschächte bei sonst geeigneter Herstellungsweise und unter der Voraussetzung steter und sorgsamster Reinigung und Desinfektion ihre nicht zu unterschätzende Bedeutung erlange». In nrnnchen Arbeiterhäusern befinden sich außerdem aus den Treppenfluren zur genieinsanien Benutzung hölzerne oder eiserne Riegel zum Ausklopfen und Reinigen der Kleider. Da jedoch auch hierdurch Staub und Schmutz entwickelt wird, ebenso die Nothwendigkeit gemeinsamer Benutzung leicht Streitigkeiten herbeiführen oder befördern kann, so ist es er»vünscht, die ihrem Zweck nach nur beifällig zu beurtheilende Maßregel in anderer geeigneter Weise zur Ausführung zu bringen. Wenn dieseil Bemerkungen schließlich noch die Angabe hin zugefügt wird, daß der Arbeiter sich zwar im allgemeinen aus vielem Treppensteigeil nichts macht und ihm daher die Höhen lage seiner Wohnung gleichgültig ist, daß deren Lage „nach vorn heraus" jedoch besonders in's Gewicht fällt, so würden hiermit so zienckich die wichtigeren Gesichtspunkte gegeben sein, die für die Absicht einer Verbesserung der Arbeiterwohnungen ini Sinne allgeniein zu stellender Forderungen und im Sinne der Bedürfnisse des Arbeiters selbst maßgebend sein müßten.
Als nicht durchaus nothwendig, jedoch sehr empfehlenswerth träte hierzu noch die Einrichtung einfacher Badevorrichtungen, »wiche am besten mit den in den Kellern nnterzubringenden
Waschküchen in Verbindung gebracht werden könnten.
„Zur
30
Begründung dieses Vorschlages bezieht sich Verfasser auf die Benutzungs-Ausweise der Volksbäder, die bei noch so billigen Preisen vorzugsweise immer nur für die Männer eine Wohl that bilden. Die Frauen aus dem Volke nebst ihren Kindern baderr nur dann, wenn es ihiren so gut wie nichts kostet. Und das ist in einem großen Hause wohl erreichbar. Denn Brause bäder, wie sie jetzt eingerichtet lverden, und genrauerte Bade becken bedürfen keiner hohen Anlagekosten und es hätten die Hausbelvohner für ihre Benutzung lediglich das Brennmaterial selbst zu beschaffen."'^)
Alle diese Verbesserungen zusannnengenommeir wären je doch noch nicht geeignet, die Arbeiter §11111 Aufgeben ihrer schlechten rind armseligen Wohnungsverhältnisse zu veranlassen, an die sie von Jugend ans gewöhnt sind rnrd die von Vielen unter ihnen daher als selbstverständlich betrachtet werden. Hierzu kommt das Mißtrauen, welches der Arbeiter „jeder für ihn be sonders zurecht gemachten außergewöhnlichen Veranstaltung" ent gegenbringt. Wenn man denselben dazu erziehen null, größere Ansprüche cm seine Wohnung zu stellen, letztere besser und so zu gestalten, daß auch bei ihm häusliches Behagen anfkommt, so kann dieses hauptsächlich uur durch eine Verbilligurrg der Wohnungen erreicht werden. Alle Verbesserungen der Arbeiterwohnlingen sind nur Verbesserungen eines schlechten Zustandes, beseitigen jedoch nicht das Grundübel. Das Grundübel der Arbeiterwohnung ist die Uebervölkerung derselben durch Schlaf-Burschen oder -Mädchen. So lange für letztere nicht in geeigneter Weise gesorgt ist, wird deren starke Nachfrage nach einem billigen Unterkonten verbunden mit dem Verlangen einzelner Arbeiterfamilien, ihr Einkommen durch Erniedrigung der Miethe möglichst zu erhöhen, auch selbst diejenigen Wohnungen noch Übervölkern, die ihrem Preise nach den Einkünften der Arbeiterfamilien angemessen sind. Will man diese Mißstände beseitigen, so ist zweierlei noth wendig: 1. Verbilligung der Wohnung für die Arbeiter familie der Art, daß bei genügender Wohnfläche und sonstiger den Bedürfnissen des Arbeiters entsprechender Einrichtung, die *) Aus „Das Berliner Arbeiter - Miethshaus. Eine bautechnisch soziale Studie von Theodor Goecke" (Deutsche Bauzeitung 1890).
31 Miethe einen bestimmten kleinen Theil des Einkommerrs nicht übersteigt. 2. Bewilligung des Unterkommens für die Schlafleute der Art, daß sie einzeln ober zu mehreren ver einigt unter ähnlichen Verhältnissen wie etwa die sogenannten Chambregarnisten für dieselbe oder wenn möglich geringere Entschädigung wie bisher, in eigener unb nicht in ber Stube ber Arbeiterfamilie ihr Wohmmgsbebürfniß befriebigeu können. Beibes ist abhängig von einer zweckentsprechenben Aus nutzung ber zur Verfügung stehenben Bobenfläche solvie von einer geeigneten Grunbrißlösung. Durch erstere werben bei sonst gleicher Wohnfläche möglichst viel Einzelräume genwnneii, so baß ber Theiler für ben von ber Summe ber Räume aufzubringenben Gesammtertrag bes Hauses ein größerer wirb; von letzterer hängt bie Gruppirung ber Räume ab, so baß sie zu 1—4 räumigen Einzelwohnungen (ber größten hier wohl in Betracht kommenben Stubeiizahl) beliebig zusammengelegt und bmnit leichter verlniethet bezw. abvermiethet loerben können. Ist bas beliebige Zusammeillegen ber Rämne ermöglicht, wobei bcirciuf zu achten sein luirb, baß bie Räume auch bie ihrer Zweckbestimmung ungefähr eutsprechenbe Größe erhalten unb baß bie nöthige Anzahl von Kochgelegenheiten vvrhanben ist, so ist eine Betrachtung barüber überflüssig, in welchem Ver hältniß zu eiimnber bie Nachfrage nach ein-, zwei- ober brei räumigen Wohnungen besteht unb bei ber Planaufstellung zu berücksichtigen wäre. Die bisherige 'Nachfrage ist im übrigen auch beswegen kein treffenber Nachweis bes wirklich vorhanbenen Bebürfnisses, weil letzteres bnrch bas mehr ober ininber starke Verlangen nach Aufnahme von Schlafleuten ober Chambregarnisten beeinflußt wirb Aus allen biefen Erwägungen heraus war bas neu auszustellenbe Projekt zu gestalten. Es ist sicherlich noch vieler Verbesserung fähig unb wirb hoffentlich zu ben bereits bestehenben Projekten^) eine willkommene Ergänzung bilben. *) Von speziell für Berlin entworfenen größeren Acbeiterwohnungs-Projekten sind hier zu nennen: 1. Das Berliner Arbeiter-Miethshaus. Eine bau-
technisch-soziale Studie von Theodor Goecke.
(Deutsche Bauzeitung 1890).
Plan des Arbeiterhauses wie gewöhuliches Berliner Miethshaus auf beliebiger
Baustelle.
Kosten des Gebäudes einschließlich Vergütung für Entwurfs-Arbeiten
nebst Bauleitung und zuzüglich
4 Prozent Bauzinsen auf rund 355 Mk. pro
32 Die Anlage ist gedacht als eine An- inib NebeneinanderReihwlg einer größeren oder kleineren Anzahl tnui (mehr stöckigen) Einzelhällsern ldkarmalhäusern); die Reihen sind im allgemeinen senkrecht zu den varhalldenen Straßenzügen ge richtet, so daß die Luft in die zwischen den einzelnen Häuser staffeln befindlichell Zwischenrämne hineintreten kann (offene Bauweise). Diese Zwischeuräume konneu als Höfe oder Gärten ausgebildet und nach der Straße mit einem Gitter oder gemmieitem Zaun geschlossen werden. Die einfachste derartige Anlage, die jedoch verhältnißmäßig viel Grund und Bodell er fordern nnrrde, iuenii die Häuser niehrere Stockwerke hoch und die Höfe bezlv. Gärteir die danach vorgeschriebene Breite erQuadratmeter und 18 Mk. pro Kubikmeter veranschlagt. Auf einen bewohn baren Naum entfallen hiernach im Durchschnitt 1797 Mk. Zur Bestimmung des Gesammtpreises ist für die Naumeinheit ein durchschnittlicher Miethssatz angenommen und darnach berechnet, was nach Verzinsung des Baukapitals, nach Abzug der Unterhaltungskosten und Abgaben noch für die Erwerbung des Bauplatzes nebst seiner Verzinsung übrig bleibt. Als Durchschnitt sind pro Raum 17 Quadratmeter gerechnet. Kostet hiernach z. B. eine drei- bezw. zwei- bezw. einräumige Hinterwohnung 300 bezw. 220 bezw. 160 Mk. und eine drei- bezw. zweiräumige Vorderwohnung 310 bezw. 240 Mk. Jahres miethe, so bleiben für den Grunderwerb verfügbar pro Quadrat-Ruthe ruud 670 Mk. (bei Verzinsung des Baukapitals mit 3T/2 Prozent und 1 Prozent Amortisation, sowie 15 Prozent des Miethsertrages für Unterhaltung und Abgabe). 2. Errichtung und Verwaltung großer Arbeiter-Miethshäuser in Berlin. Von Dr. P. F. Aschrott, Amtsrichter in Berlin. (Aus den Schriften des Deutschen Vereins für Armenpflege und Wohlthätigkeit. Elftes Heft. Leipzig, Duncker & Humblot 1890). Entwurf und technische Bearbeitung rühren vom Regierungsbaumeister Messel her. Als Bauplatz ist ein Terrain im Osten der Stadt, 325 Quadrat-Ruthen ä 1000 Mk. in Aussicht genommen. Meist Hinterland, nur schmaler Streifen Vorderland. Vorderhaus vom Hinter haus vollständig getrennt; Hinterhaus das eigentliche Arbeitermiethshaus. Letzteres nur theilweise unterkellert; für die Benutzung eines Kellers ist ein geringer Miethszins zu entrichten. Zur Benutzung für die Bewohner dienen 4 Waschküchen, 18 Badezellen und eine Lese-, Turn- und Spielhalle in selb ständigen kleineren Gebäuden. Kosten des Gebäudes auf 290 Mk. pro Quadratmeter veranschlagt. Gesammtkosten 1250 000 Mk. Als jährliche Miethspreise in Aussicht genommen durchschnittlich 152,80 Mk. für ein einzelnes und 242,20 Mk. für 2 Zimmer. Das Miethserträgniß ist hiernach 75OOl,6O Mk. Hiervon sind in Abzug gebracht für laufende Unkosten 25 Pro zent des Miethserträgnisses und von der danach verbleibenden Nettoeinnahme 5 Prozent für den gesetzlichen Reservefonds. Bei 4 Prozent Verzinsung des
33
halten fallen, ist die in Fig. P) gezeichnete. Wie viele Häuser in jeder Staffel hierbei aneinander gereiht werden können oder fallen hängt van der Tiefe und Farm des zur Verfügung stehenden Terrains ab. Bedingung ist nur, daß mindestens van einer Seite Straßenluft iu die StaffelZwischenräunre eintritt; van drei Seiten kann die Anlage van Nachbargrmldstücken eingeschlasserr sein. Will man enger bauen imb das Bauland mehr mlsnutzen, sa lassen sich eine ganze Anzahl voll Cambinatranen Herstellen, deren hauptsächlichste Typen für affene Bauweise in den Fig. 2 und 3 und für eombinirte Bauweise üi den Fig. 4 und 5 angedeutet sind. Die geschlossene Bauweise unter Anlvelldullg des Normalhauses ist in den Fig. 6 und 7 skizzirt, wobei allerdings die Anlage möglichst an allen Seiten von Straßenzügen umgebeil fein muß/"y Aus Anlagekapitals verbleibt ein Ueberschuß von 3437,75 Mk. für einen ExtraReservefonds. 8. Projekt für Miethshäuser mit kleinen Wohnungen zur Herstellung und Verwaltung nach gemeinnützigen Gesichtspunkten von Valentin Weißbach.
Technisch bearbeitet von A. Messel, Regierungsbaumeister, (im Dezember 1891
erschienen).
Verzinsung des Kapitals mit 4 bis 5 Prozent in Aussicht ge-
genommen.
Bauplatz ein Terrain von 1000 Quadrat-Ruthen im Osten von
Berlin, welches mit 500 Mk. pro Quadrat-Ruthe bezahlt und für den vor liegenden Zweck parzellirt wurde. Als Baukosteu 270 Mk. pro Quadratmeter
veranschlagt.
Gesammtkosten 2 300 000
Mk.
Als durchschnittliche Jahres
miethe angenommen für Küche und Stube 200 Mk., für Küche,
Stube uud
Kammer 230 Mk., für Küche, Stube und kleine Stube 270 Mk., für Küche und 2 Stuben 320 Mk.
Hiernach Gesammteinnahmen
183 200 Mk.
Von
dieser in Abzug gebracht als Ausgaben: a) Zinsen für 2/5 Feuerkasse ä 4 Pro
zent,
b)
Rest ä 5 Prozent, c)
15 Prozent der Einnahmen für Unkosten,
d) 1 Prozent der Feuerkasse als Abschreibung, e) 5 Prozent der Einnahmen als Miethsausfälle,
f)
6 Prozent der Einnahme für außerordentliche Re
einen Erneuerungsfonds,
g)
5000 Mk. für allgemeine Ver
paraturen
in
waltung.
Es verbleibt eine Reineinnahme von 10 000 Mk. und nach Abzug
von 5 Prozent von dieser für den gesetzlichen Reservefonds ein Ueberschuß von
8500 Mk. *) Vergl. die am Schluß befindlichen Tafeln.
** )
Ein bereits ausgesührtes Beispiel der in Fig. 6 skizzirten Bauweise
(Aneinander-Reihung von mehrstöckigen Einzelhäusern um einen, großen Hof herum) ist die von einem Privatmann angelegte Arbeiterkolonie in Lindenau bei
Leipzig,
welche
auf einem Terrain von
häusern 236 Familien Unterkunft gewährt.
14 800 qm.
in
26
Einzel
Die Anlage ist übrigens nicht
vollständig geschlossen, sondern an einer Schmalseite nach der Straße halb
geöffnet. (Veröffentlicht im Centralblatt der Bauverwaltung.
Jahrgang 1890.
34 den angeführten Figuren, sowie ans Fig. 8, welche die Front des 9lorinalhauses mit 15,40 Meter und die Tiefe desselben mit 9,50 Meter angiebt, geht hervor, daß dasselbe auf jeder beliebigen Banstelle, ivelche für den vorliegenden Zweck in Frage kommen wird, zur Ausführung gelangen kann und daß man bei Wahl des Terrains weder ooii der Tiefennoch Breiten-Ausdehnung desselben besonders abhängt. Da nun, nüe im erste» Theile dieser Schrift auseinander ge setzt ist, die ^lrbeitermicthshällser nicht nur an einer Stelle, sondern in allen Stadttheilen je nach Bedarf zur Aus führung zil bringeil sein lvürdcn, so lverdeil gerade die vor erwähnten Eigenschaften des Jivrnialhanses die Wahl und eventnellc Enverbnng der Terrains und mit der Bebauung liild Bevölkernng derselben die beabsichtigte Berinischung der Bevölkerungsklassen wesentlich erleichtern. Ja selbst als Einzelhalio lvird das :ll'ormalhaus hergestcllt lverdcn können, ivenn gerade irgendwo an passender Stelle eine entsprchcnd kleine Baustelle, die sonst vielleicht schwer verkäuflich und ansnntzbar ist, für billiges Geld erlvvrbeil werden kann. Im allgemeinen soll das Normalhaus als süufgeschossiger Bau (Parterre und 4 Etagen) mit Keller und Dachboden zur Ausführung gelangen. Fig. 8 stellt den Grundriß deo mittelsten Geschosses, der sogenannten II. Etage des Hauses, dar. Jedes Geschoß enthält im Ganzen 7 Wvhnränme mit dem nöthigen Zubehör und zwar: A eine Einzelstube; B eine Wohnnng bestehend ans Stnbc mit Kochilische, Corridor, Closet; C eine Wohnung bestehend ans Stilbe, Küche, Corridor, Closet, bedecktem Balkon; D eine Wohnung bestehend ans Stnbe, Kamnier, Küche, Corridor, Closet, bedecktem Balkon. Die Wohnungen sind sämmtlich vom Treppenflur auS durch besondereu Corridor zugänglich. Besteht eine Wohnung aus mehreren Räumen, so sind diese derartig angevrdnet, daß sie nicht an einer Front liegen, sondern an zweien, (bei den an den Straßengiebeln liegenden Wohnungen sogar an drei Fronten), so daß eine gründliche Dnrchlüftlmg ermöglicht ist. Da ferner eigentliche Höfe nicht existiren, sondern im
allgemeinen die Staffel - Zwischenräume nach der Straße affen oder nur mit Gitter abgeschlasseu und als Gärten angelegt werden sollen, so ist der Wunsch des Arbeiters, mög lichst „nach vorn heraus" zu wohnen, hier in denkbar weitestem Maße erfüllt. Wie die Räume der einzelnen Wohnungen zu einander liegen, ist aus Fig. s ersichtlich. Es sei hier nur darauf hingewiesen, daß die zn den Wohnungen C und I) ge hörigen Clvsets voll den zugehörigen Corridvrell aus direkt zugänglich sind, ohne daß der Treppenslur oder irgend ein auch voll einer andereir Wohnung zll benutzelider Rauln dirrchsehrittell zll lverdell brallcht. Die Wohnullgen sind in sich vollkommen abgeschlossen iiiii) keiner Störung voll außell linterlvorsell. Für Wandflächen ist in jeden: Wvhllrauln so weit gesorgt, daß lnnldestens all einer Wand zwei Bettell der Länge und) alifgestellt lverdell sönnen. Ein Ausgußbecken mit Zustllßhahll befindet sich in jeder 5ki'iche lind für Kleiderreinigung oder ähnliche häusliche Berrichtuligell ist lieben jeder Küche ein liach dem Gartell offener Balkon angelegt, welcher einschließlich der MmieröffllUllg so breit ist, daß der Arbeiter mit seiner Frau darauf bequem Platz hat uud an Heißell Sollllllerabendell nach gethaner Arbeit hier die frische Llist des davor liegendell Gartells gelließen kanli. Boll der Einrichtung der Kehrichtschächte ist zlwörderst alls den all bezüglicher Stelle alisgesprochellen Grülidell Abstand genornnlen; lvill man dieselbell dellnoch Herstellen, so finden sie einen sehr geeigneten Platz in der Scheidewalld zwischell Treppenhaus lind Balkon, da all dieser Stelle das (Einbringen von Staub- lind Schmutztheilen in die Wohnräume kaum zu befürchten fein wird. Zwischell dell beiden eben beschriebenen Wohnlingen C und D sind zwei Einzelstuben, eine kleine A und eine große B, eingeschoben, von denen die letztere in der Regel als Wohllung für sich (z. B. an ein killderloses Ehepaar) vermiethet lverden wird. Die Wohnung B besteht aus einergrößeren Wohnstube mit besonders abgetrenuter Kochnische und ist durch eigenen Corridor zugänglich. Das zugehörige Closet liegt allerdings, memt auch in nächster Nähe so doch nicht lleben sondern gegenüber der Wohnung, so daß, um dasselbe zll erreichen, der Treppellvorplatz überschritten werden muß. Diese Anordnung war im Interesse der übrigen Durchbildung 3*
36 des Grundrisses nicht gut zu umgehen und dürste, da sie in jedem Geschoß eben nur ein Mal vorkvmmt, zu Mißständen kaum Veranlassung geben.
Die Einzelstube A kann verschiedenen Zwecken dienen: entweder zur Erweiterung der Wohnungen B oder I), in welchen Fällen je eine der mit punktirtell Linien angedeuteren Thüren hergestellt beziv. geöffnet werden würde, da schon bei der Bauanssührung ans diese Möglichkeiten Rücksicht genvmmeil werden soll', oder zur Aufnahme von Chambregarnisten. Ge schieht letzteres von D aus, so ist die auf dem Evrridor 1) ge legene nach der Stlibc A führende Thür zn öffnen, geschiebt es von B aus, so ist A wie gezeichnet zugänglich. Die Elvserbenntzuug ist gemeinsam mit derjenigen Wohnung, die das Zimnier weiter vermiethet. Stabe A ist groß genug, um mindestens zwei Chambregarnisten begueme Unterknnft zu ver schaffen. Im Keller jedes Hauses liegt eine Waschküche, an welche eine Badetwrrichtnng in der Weise angeschlossen ist, >vie dieses bereits vorher beschrieben ist. Auf dem Dachboden ist ein Trockenboden vvrzusehen und eventuell eine Drehrolle auf zustellen. Ueber die Benutzung dieser Anlagen wird die Hansordnung das illähere bestimmen, der Rest des Kellers und Dachbodens soll dazu dienen, jeder Wohnung einen kleinen Raum hinter Verschlag zunr Wegstellen und Aufbewahren des Gerümpels zuzuweisen. Die zwischen den Häuserstaffeln liegenden Zwischenräume können, soweit sic nicht zu allge meinen Zivecken benutzt iverden, in einzelne kleine Gärten ein getheilt werden, ivelchc an solche Hausbewohner, die das
ivünscheu, für eine kleine Entschädigung
zur Benutzung
ab
gegeben werden können?)
In
welcher Weise die Nvrmalhäuser zu einer größeren
Gruppe zusammengesetzt werden, wie dabei der Grundriß an den Kreuzungsstellen derHäuser-Reihen uild an denjenigen Stellen zu lösen ist, ivo zwei Staffeln durch eine S-ucrstaffel verbunden iverden sollen, welche kürzer ist als die Länge des Normal*) Zn der Arbeiterkolonie Lindenau bei Leipzig ist der große Hof in 140 Gärten eingctheilt, die an die Arbeiterfamilien für je 1 "> Pfg. pro Woche vermiethet werden.
bitufec',. das zeigt Fig. 9, während Fig. 10 die Ansicht und Fig. 11 das Perspektive Bild einer Arbeiterwohnungsgruppe uüedergeben.*) Daß bei einer solchen Gruppe einzelne Theile auch eine andere allen Bewohnern gemeinsani dienende Verivendung finden können, mag hier nur kurz erwähnt werden. So werden sich beispielsweise an den Straßengiebeln mit Vorrheil kleine Läden anlegen lassen, in denen die Arbeiter das für den täglichen Gebrauch Nothwendige cinkaufen können, ebenso wird das Erdgeschoß eines der zwei Staffeln ver bindenden Querhäuser zu einer Speiseanstalt für die Unverbeiratheten oder unter Zuziehung des davor liegenden Gartens zu allgemeiuen Erholungsräumcu oder sonstigen dergleichen Einrichtungen benutzt werden können. Was nun die Kosten- und Rentabilitätsberechnung bezw. die Höhe der Wohnungs- und Chambregarnisten-Miethen anbcrrifft, so kaun zur Bestimmung derselben auf verschiedene Weise verfahren werden. Für die folgenden Betrachtungen und Berechnimgen sei das Normalhaus, Fig. venn nicht uninngänglich erfvrderlich, es nur bei einer derartigen Stube zu belasten.
Kannen auf diese Weise die bisherigen Schlafleute dazu ge bracht iverdeu Chambregarnisten zu tverden, dann würbe nicht nur jeder Arbeiter fein WvhnungSbednrfnist in besserer, freund
licherer nud für Leben nud Gesundheit zuträglicherer Weise befriedigen können, sondern es wird auch die Arbeiterfamilie, van allen das Familienleben störenden Mitbewvhnern befreit,
schätzen lernen, ein eigenes, ihr allein gehöriges und wvhnliches Heim zu besitzen und zn bewohnen.
Anlage.
Statut des Kerlinee Spar- und Kauvrreins, eingetragene Genossenschaft mit beschrankter Haftpflicht.
I. Firma, Litz, Haftsumme, Gegenstand des Unternehmens. § 1. Die Genossenschaft besteht unter der Firma: Berliner Svaruiib Bauverein, eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht. Der Sitz der Genossenschaft ist in Berlin, ihre Dauer unbeschränkt. Die Haftpflicht der Genossen für die Verbindlichkeiten der Genossen schaft sowohl dieser wie umnittelbar den Gläubigern gegenüber ist im Voraus auf die Summe von Dreihundert Mark für jeden erworbenen Geschäftsantheil beschränkt. $ 2. Gegenstand des Unternehmens ist der Bau, Erwerb und die Verwaltung von Wohnhäusern, deren Vermiethung an Genossen, sowie die Annahnie mit) Verwaltung von Spareinlagen der Genossen.
II. Mitgliedschaft. 3.
Aufnahmefähig sind: alle großjährigen Personell, lvelche sich im Besitze der bürgerlicheri Ehrenrechte befinden. Die Aufzullehlllendeli müssen ihren Wohnsitz bezrv. ihre dciederlassung in Berlin resp, innerhalb eines Umkreises bis zu 10 Kilometer iioit Berlin haben. § 4. Zum Erwerbe der Mitgliedschaft ist eine von den: Bei tretenden zu unterzeichneilde unbedillgte (doppelte) Erklärurtg des Bei tritts erforderlich. Der Vorstand kann die Aufnahme ablehnen; in diesem Falle eiltscheidet auf Berufung des Abgewiesenen die Generalversanimlung über die Aufnahme. § 5. Jedes Mitglied ist verpflichtet, sofort nach erfolgter Eintragullg in die Liste der Genossen ein Eintrittsgeld von 1 Mark zu zahlen. 5 6. Jeder Genosse kann in Folge Aufkündigmig aus der Genossen schaft ausscheidell.
—
51
—
Diese Aufkündigung findet nur zuni Schlüsse eines (Geschäftsjahres statt und muß mindestens sechs Monate vorher schriftlich an den Vorstand gerichtet werden. § 7. Jeder Genosse, welcher seinen Wohnsitz bezw. seine Nieder lassung über den Umkreis von 10 Kilometer von Berlin hinaus verlegt, kann zum Schlüsse des Geschäftsjahres feinen Austritt aus der Genossen schaft dem Vorstande schriftlich erklären. Im Gleichen ist in dem ge nannten Falle die Genossenschaft befngt, dem Genossen schriftlich zu er klären, daß er zum Schluffe des Geschäftsjahres auszuscheiden habe, ß 8. Ziffer 2 d. Ges.) § 8. Wenn ein Genosse stirbt, gilt derselbe mit dem Schlüsse des Geschäftsjahres, in welchem der Tod erfolgt ist, als ausgeschieden. Bis zu diesem Zeitpunkte nurd die Mitgliedschaft des Verstorbenen durch dessen Grben fortgesetzt. Für mehrere Erben ist das Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten auszuüben. $ 9. Abgesehen von den in dem Gesetze allgegebenen Gründell, kann ein Genosse aus der Genossellschaft ausgeschlossen werden: a) wegen einer betrügerischen Handlung gegen den Verein, oder einer sonstigen Handlungsweise, lvelche "fcen Interessen des Ver eins lviderspricht; b) wenn derselbe mit den in die Genossenschaftskasse zu leistenden Zahlungen länger als sechs Monate im Rückstallde bleibt. Die Ausschließllng erfolgt dllrch Beschluß der Generalversammlung zllm Schlüsse des Geschäftsjahres. Der Beschluß, welcher die Ausschließung ausspricht, ist dem ausgeschlossenen Gellossen sofort Seitens des Vor standes durch eingeschriebenen Brief zu eröffnen. Von dem Zeitpunkte der Abselldung des Schreibells fenm der aus geschlossene Gellosse nicht mehr Mitglied des Vorstandes oder des Auf sichtsraths sein, auch nicht mehr an den Generalversammlungen theilnehmeil. $ 10. Bezüglich der Eintragung in die Vifte der Genossen, sowohl im Falle des Beitritts lvie des Ausscheidens eines Genossen, hat der Vorstand das Erforderliche bei dem Gericht ohne Verzug zu veranlassen. § 11. Die Auseinandersetzung der ausgeschiedenen Genossen mit der Genossenschaft erfolgt auf Grllnd der Bilanz: das Geschäftsguthaben des Ausgeschiedellell ist binnen 3 Monaten anszuzahlen, an dem Reservefollds und dem sonstigen Vermögen der Genossellschaft hat er keinen Alltheil.
III. Organe des Vereins. A. Der Vorstand. $ 12. Der Vorstand besteht aus 3 Mitgliedern, für welche 3 Stell vertreter ernanllt werden. Die Stellvertreter sind in gleicher Weise wie die Vorstandsmitglieder zum Genoffenschaftsregister anzumelden. Der Aufsichtsrath wählt und entläßt die Vorstalldsmitglieder und deren Stell vertreter, vertheilt die Geschäfte, beschließt über etwa zu zahlende Ver gütungen oder Gehälter und schließt, soweit er dieses angemessen findet, mit den einzelnen Vorstandsmitgliedern die nöthigen Vertrüge ab. $ 13. Die Stellvertreter der Vorstandsmitglieder nehmeil an allen Sitzungen des Vorstandes, sowie den gemeinschaftlichen Sitzllngen des Allfsichtsraths intb des Vorstandes Theil. $ 14. Der Vorstand vertritt die Gellossenschaft gerichtlich nnb außer gerichtlich.
52 § 15. Mündliche und schriftliche Willenserklärungen des Borstalldes sind für die Genossenschaft verbindlich, wenn zwei Vorstandsmitglieder oder zwei Stellvertreter oder ein Vorstandsmitglied und ein Stellvertretersie abgeben bezw. der Genossenschaft ihre eigenhändige Unterschrift hinzu gefügt haben.
B. Aufsichtsvcrth. § 16. Der Aufsichtsrath besteht aus 24 Personen, welche von der Generalversammlung durch Stimmenmehrheit aus der Zahl der Genossen gewühlt werden, mit Ausschluß der Vorstandsmitglieder und deren Stell vertreter. Für ihre Thätigkeit haben die Mitglieder des Aufsichtsraths keinen Anspruch auf Vergütung. § 17. Die Wahl der Aufsichtsrathsmitglieder geschieht für die Zeit vom Tage der Wahl bis zu dem Tage der auf die Wahl folgenden dritten ordentlichen Generalversammlung (vergl. jedoch § 19) und scheiden jedes Jahr mit dem Tage der ordentlichen Generalversammlung acht der im Amte befindlichen Aufsichtsrathsnütglieder aus. Die Reihenfolge des Aus scheidens wird in den beiden ersten Jahren durch das Loos, später durch das höhere Dienstalter bestimnit. Ausgeschiedene Mitglieder sind wieder wählbar. § 18. Scheiden vor Ablauf der Amtsdauer Mitglieder des Aussichts raths aus, so bleibt der Aussichtsrath dessen ungeachtet zur Ausübung aller ihm gesetzlich und statutenmäßig zustehenden Rechte befugt, so lange noch derselbe aus 13 Mitgliedern besteht. Der Austritt eines Aussichtsrathsmitgliedes ist von dem Betreffenden schriftlich auzuzeigen. § 19. Die Ersatzwahl sür ein vor Ablauf der Amtsdauer allsgeschiedenes Mitglied des Aufsichtsraths gilt für den Rest der Amtsdauer des ausgeschiedenen Mitgliedes: sie erfolgt regelmäßig in der nächsten ordentlichen Generalversammlung, luenn die Zahl der Aufsichtsrathsmit glieder unter 13 herabsinkt. 8 20. Die Aufsichtsrathsmitglieder werden legitimirt durch die Pro tokolle der Generalversanunlung, in welcher ihre Wahl erfolgte. Schrift liche Erklärungen des Aufsichtsraths sind in der Weise zu vollziehen, daß der Vorsitzende oder dessen Stellvertreter und zwei andere Mitglieder der Bezeichnung „Der Aussichtsrath des Spar- mit) Bauvereins, eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht" ihre eigenhändige Unterschrift hinzufügen. Für bloße Bekanntmachungen gelten die in 34 aufgestellten Be stimmungen. 8 21. Der Aussichtsrath wühlt alljährlich nach stattgehabter ordent licher Generalversammlung einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter desselben, sowie einen Schriftführer und einen Stellvertreter desselben. Die zur Vornahme dieser Wahlen abznhaltende Versammlung wird durch das au Lebenszahren älteste Mitglied des Aufsichtsraths-Personals zu sammen berufen und eröffnet. Die Wahlen sind in entsprechender Weise zu wiederholen, wenn im Laufe des Jahres Inhaber der betreffenden Aemter ausscheiden oder nach übereinstimmender Ansicht aller übrigen Aufsichtsraths-Mitglieder an dauernd unfähig werden, ihr Amt auszuüben. Es sollen regelmäßige Aufsichtsrathssitzungen, für welche Ort und Zeit voraus bestimmt ist, stattfinden. Außerdem hat der Vorsitzende den Aufsichtsrath unter Mit theilung des Gegenstandes der Berathung zu berufen, so oft ihm dies im Interesse der Genossenschaft nöthig erscheint, oder der Vorstand, oder die Hälfte der zeitigen Aufsichtsrathsmitglieder solches verlangen. Der Aus sichtsrath ist beschlußfähig, wenn mindestens 13 seiner Mitglieder, darunter der Vorsitzende oder sein Stellvertreter, anwesend sind, und saßt seine Be schlüsse durch Stimmenmehrheit der anivesenden Mitglieder. Bei Stimmen-
53 Gleichheit gilt der zur Abstimmung gestellte Antrag als abaelehnt. Für Wahlen gilt dasselbe Verfahren, wie für die von der Generalversammlung vorzunehmenden Wahlen. Ueber die Beschlüsse des Aufstchtsratbs ist ein Protokoll zu führen, welches mindestens von dem Vorsttzenoen, dem Schriftführer und einem Aufsichtsrathsmitgliede unterschrieben werden muß. 8 22. Rechte und Pflichten des Aussichtsraths werden durch daß Gesetz und das Statut bestimmt. Der Bestand der Genossenschastskasse soll mindestens vierteljährlich von dem Aussichtsrath revidirt werden. $ 23. Der Aufsichtsrath und Vorstand haben in gemeinschaftlicher Sitzung über allgemeine, bei der Geschäftsführung zu befolgende Grund sätze zu beschließen, namentlich: 1. unter welchen Bedingungen und bis zu welcher Höhe Spar einlagen angenommen werden und etwaige Anleihen der Ge nossenschaft geschehen sollen; 2. über die Vermiethungen der Wohnungen in den der Genossen schaft gehörigen Häusern mit der Maßgabe, daß in Bezug auf die Höhe der Miethpreise kein Wucher getrieben werden darf und daß, wenn sich mehrere Genossen zu den zu vermiethenden Wohnungen melden, das Loos entscheiden soll, insoweit nicht nach Ermessen des Vorstandes gegen die Zulassung des einen oder anderen Genossen besondere Bedenken obwalten; 3. über die Belegung verfügbarer Gelder der Genossenschaft mit der Maßgabe, daß eine Belegung in Spekulationspapieren nicht stattsinden darf. Der Gesammtbetrag, welchen Anleihen der Genossenschaft und Spar einlagen bei derselben nicht überschreiten sollen, hat die Generalversammlung festzusetzen. $ 24. Die gemeinschaftlichen Sitzungen des Aufsichtsraths und des Vorstandes werden von deni Vorsitzenden des Aufstchtsraths berufen, lvelcher in den Sitzungen den Vorsitz führt. Die Versammlung ist be schlußfähig, wenn mindestens 13 Aufsichtsrathsmitglieder und 2 Vor standsmitglieder oder deren Stellvertreter anwesend sind. Die Ab stimmungen erfolgen getrennt; zuerst stimmen die Vorstandsmitglieder unter sich, und dann die Aufstchtsraths-Mitglieder unter sich ab; kein An trag kann als angenommen gelten, der nicht die Zustimmung sowohl der Mehrheit der Vorstandsmitglieder als auch die Zustimmung der Mehrheit der Mitglieder des Aufsichtsraths gefunden hat: Stimmengleichheit steht der Ablehnung gleich. Ueber die Beschlüsse ist Protokoll zu führen und von dem Vor sitzenden, 1)6111 Protokollführer und einem Vorstandsmitgliede zu unter schreiben. § 25. Die Aufsichtsrathsmitglieder können auch vor Ablauf ihrer Amtsdauer durch Beschluß der Generalversammlung ihres Amtes enthoben werden.
C. ^eneraüversammCung. 8 26. Die Rechte, welche den Genossen in Bezug auf die Ordnung und Leitung der Genossenschaftsangelegenhetten zustehen, werden von ihnen in den Generalversammlungen ausgeübt. Jeder Genosse hat eine Stimme. Eine Vertretung ist außer den in den §§ 41 und 75 des Ge nossenschaftsgesetzes vom 1. Mai 1889 bezeichneten Fällen unzulässig. Jedes Jahr spätestens im April findet eine ordentliche General versammlung statt, eine außerordentliche dagegen, so oft dies im Interesse der Genossenschaft erforderlich erscheint. In der ordentlichen General versammlung ist insbesondere von dem Vorstände und dem Aufsichtsrath der Geschäftsbericht zu erstatten, die Bilanz nebst Gewinn- und Verlust-
54 bcredjnunp üDi^ulegcn, Beschluß über die Entlastung des Borstandes und Ausstchtsrathes, sowie über die Festsetzung des von dem Gewinn oder Verlust auf die Genossen fallenden Betrages zu fassen und die er forderliche Wahl von Aussichtsrathsmitgliedern zu vollziehen. Dieselbe entscheidet auch über etwaige, feit der letztvorhergegangenen General versammlung erhobene Beschwerden gegen Beschlüsse und Entscheidungen des Aufsichtsraths ilnd Vorstandes. tz 27. Die Berufung der ordentlichen Generalversammlung liegt deni Vorstande ob. Bei der Berufung ist anzugeben, an lvelcher Stelle die Bilanz und eine den Gewinn und Verlust des Jahres zusammenstellende Berechnung einzusehen sind. Außerordentliche Generalversammlungen können sowohl von: Vor stande als vom Allfsichtsrath berufen werden. Eine außerordentliche Generalversammlung muß berufen werden, wenn der zehnte Theil der zeitigen Genossen solches in einer von ihnen unterzeichneten, (in den Aufsichtsrath oder den Vorstand gerichteten Eingabe unter Angabe des Zwecks und der Gründe beantragen. In gleicher Weise sind die Genossen be rechtigt zu verlangen, daß Gegenstände zur Beschlußfassung einer General versammlung angekündigt werden. Die Benlfung der Generalversamnllung erfolgt durch öffentliche Bekanntmachung: zwischen dem Tage der Ver sammlung und dem Datum der, die Bekanntmachung enthaltenden Blätter, beide Daten nicht mitgerechnet, muß eiu Zeitrailm von mindestens sieben Tagen liegen. In der Bekanntmachung sind die Gegenstände der Ver handlung als Tagesordnung zu veröffentlichel^. lieber Gegenstände, deren Verhandlung nicht in der durch das Statut oder bims) $ 43 Absatz 3 des Gesetzes vom 1. Mai 1889 vorhergeseheneu Weise mindestens drei Tage vor der Generalversammlung angekündigt worden ist, können Beschlüsse nicht gefaßt werden, hiervon sind jedoch Beschlüsse über die Leitung der Versammlung, sowie über Anträge ans Berufung einer außerordentlichen Generalversammlung ausgenommen. 8 28. Die Verhandlungen und Abstimmungen der Generalver sammlungen werden durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrathes oder dessen Stellvertreter geleitet. Ist Keiner derselben erschienen, so eröffnet der an Lebensjahren älteste anwesende Genosse die Versammlung und läßt von dieser einen Vorsitzenden wählen. Die Abstimmung geschieht nach Ermessen des Vorsitzenden durch Stimmzettel, Erheben der Hand, oder auch, wenn Niemand widerspricht, in anderer Weise, insbesondere durch Zuruf. Ueber die Beschlüsse einer Generalversammlung wird von dem Schrift führer des Aufsichtsraths oder einem anderen von dem Vorsitzenden zn bezeichnenden Genossen ein, in ein Protokollbuch einzutragendes Protokoll ausgenommen und von dem Vorsitzenden, dem Protokollführer und mindestens drei Genossen unterschrieben. Hat der Vorsitz im Laufe der Verhandlung gewechselt, so genügt es, wenn als Vorsitzender derjenige unterschreibt, welcher die Versammlung beim Schluffe geleitet hat. Bei Verhandlungen über Beschwerden gegen den Aufsichtsrath oder Vorstand, führt ein ans der Generalversammlung zu diesem Zweck ge wähltes Mitglied den Vorsitz. 8 29. Die durch Stimmenmehrheit der in einer ordnungsmäßig be rufenen Generalversammlung anwesenden Genossen gefaßten Beschlüsse haben, sofern nicht das Gesetz ein Anderes erfordert, für die Genossenschaft verbindliche Kraft, jedoch ist zur Gültigkeit des Beschlusses über 1. Abänderung, Ergänzung, Erläuterung des Statuts: 2. Widerruf der Bestellung zum Mitgliede des Aussichtsraths; 3. Auflösung
eine Stimmenmehrheit von 3/4 der erschienenen Genossen erforderlich. Zll cm ei* Erhöhung der Haftsumme bedarf es Einstimmigkeit der in der Generalversammlung erschienenen bezw. vertretenen Genossen. Bei Stinnneugleichheit gilt der zur Abstimmuug gestellte Autrag als ubgelehnt. Auch für Wahlen gilt die absolute Stimmellmehrheit der Wählendell: ist eine solche Mehrheit im ersten Wahlgange nicht erreicht, so findet eine engere Wahl zwischen den Beiden, welche die meisten Stimmen erhaltell haben, statt,- haben mehr als Zlvei gleich viel Stimmen erhalten, so wird dereil Zahl dlirch das von der Hand des Vorsitzenden zu ziehende Loos auf die Zahl 2 gebracht: erhalten 2 auf die Wahl gestellte Personen gleich viel Stimmen, so entscheidet gleichfalls das Loos. Wegen Anfechtung eines Beschlusses der Geileralversammlung im Wege der Klage, vergl. $ 49 des Gesetzes vom 1. Mai 1889.
IV. Geschäftsalltheile, Bilanz und Reservefonds. S 30. Der Geschäftsantheil eines jeden Genossen wird auf 300 Mark festgesetzt und darf ein Genosse nicht mehr als 3 Geschäftsantheile er werben. Bis zur Bollzahlung von 300 Mark hat der Genosse, von seinem Eintritt an gerechnet, wöchentlich 30 Pfennig zu entrichten. Dem Genossen steht sowohl Leistung größerer Ratenzahlungen, wie Bollzahlimg des Geschästsantheils von 300 Mark oder der drei Geschüftsantheile frei. § 31. Das Geschäftsjahr fällt mit dem Kalenderjahr zusammen. Am Schlüsse eines jeden Geschäftsjahres hat der Vorstand ein Inventar und eine Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung und einem Vorschläge zur Vertheilung des Gewinnes oder Verlustes aufzustellen und dem Auf sichtsrath bis spätestens 1. März zur Prüfung vorzulegen. In der Bilanz sind sämmtliche Vermögensstücke und Forderungen nach dem Werthe an zusetzen, welcher ihnen zur Zeit der Aufnahme beizulegen ist, jedoch dürfen Grulldstücke und Häuser, wenn bei ihnen jener Werth den Anschaffungsbezw. Herstellungspreis übersteigt, höchstens zu dem Anschaffungs- bezw. Herstellungspreise angesetzt werden. Zweifelhafte Forderungen sind nach ihrem wahrscheinlichen Werthe anzusetzen, uneinbrulgliche Forderilngen abzuschreiben. Der Betrag des Reservefonds und der Geschüftsguthaben der Genossen sind unter die Passiva einzustellen. Der aus der Vergleichung der Aktiva und Passiva sich ergebende Gewiml oder Verlust ist am Schluffe besonders anzugeben. Ueber die Prüfung der oben gedachten Vorlagen des Vor standes hat der Aufsichtsrath der Generalversammlung vor Genehmigung der Bilanz Bericht zu erstatten: über etwaige vom Vorstande nicht erledigte Erinnerungen des Aufsichtsraths entscheidet die Generalver sammlung. § 32. Zur Deckung eines aus der Bilanz sich ergebenden Verlustes dient der Reservefonds (gesetzlicher Reservefonds). Fn denselben fließen: 1. die Eintrittsgelder, 2 so lange derselbe den Betrag der Hälste des Mitgliederguthabens nicht überschreitet, je nach Bestimmung der Generalversammlung mindestens zelnl und höchstens fünfzig Prozent des jährlichen Reingewinns. Die Generalversammlung ist befugt, zwecks Bildung eines Hülfsreservefonds von dem jährlichen Reingewinne einen alljährlich von ihr zu bestimnienden Betrag des Reingewinns dem Hülfsreservefonds zu überweisen.
56 Ueber die Berwendmig des gesetzlichen Reservefonds ,;n dein ange gebenen Zwecke, sowie über die Verwendung des Hülfsreservefonds (be schließt die Generalversannnlnng. 33. Nach Abzng des in den gesetzlichen Reservefonds einz;ustellenden und des dem Hülfsreservefonds etwa überwiesenen Betrages wird der Rest des Reingewinnes unter die Genossen nach Verhältniß ihrcer zum Schluffe des vorhergegangenen Geschäftsjahres ermittelten Geschäfttsguthabens vertheilt. Die Zuschreibung des Gewinnes zu dem Geschäftsguthaben eimes (Genossen erfolgt so lange, als nicht der Geschäftsantheil von 300 Mcnrk erreicht ist.
V. Gejellschaftsblätter. 34. Die von der Genossenschaft ausgehenden Bekanntmachungien sind in 1. die „Berliner Zeitung", 2. die Zeitung „Vorwärts" einz;urücken. Wird eines dieser Blätter unzugänglich, so genügt die Einrückumg in das andere, und wenn auch dieses unzugänglich werden sollte, so er folgt die Einrückung bis auf anderweitigen Beschluß der Generalver sammlung in den „Deutschen Reichs-Anzeiger". Bekanntmachungen des Aufsichtsrathes sind in der Weise zu vollziehen, daß unter die Firma tote Worte der „Aufsichtsrath" und der Name des Vorsitzenden ooer seines Stellvertreters gesetzt werden. Bekanntmachungen des Vorstandes sind in der für die Firmenzeichnung vorgeschriebenen Form zu erlassen.
VI. Entscheidung von Streitigkeiten. § 35. Streitigkeiten über den Sinn einzelner Bestimmungen Statuts werden von der Generalversammlung entschieden.
d-es
VII. Uebergangs-Bestimmungen. § 36. Das erste Geschäftsjahr endet am 31. Dezember 1892. Die erste ordentliche Generalversammlung findet im Jahre 1893 statt. Die bei der Begründltng der Genossenschaft gewählten Aussichtsrathsmit glieder fungiren als solche bis zum Schluffe der ersten ordentlichen Ge neralversammlung; in dieser Generalversammlung sind die Wahlen des ersten ordentlichen Ausstchtsraths gemäß S 17 auf die dreijährige Daner vorzunehmen.
Druck von Gergonne & Cie., Berlin W., Steglitzer Straße 11.

![Zur Berliner Armenkrankenpflege: Zweiter Beitrag zur Frage vom Arzneiverbrauch [Reprint 2021 ed.]
9783112509784, 9783112509777](https://ebin.pub/img/200x200/zur-berliner-armenkrankenpflege-zweiter-beitrag-zur-frage-vom-arzneiverbrauch-reprint-2021nbsped-9783112509784-9783112509777.jpg)





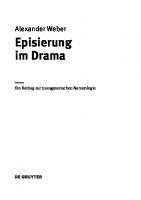

![Baltische Geheimnisse. Ein Beitrag zur Sittengeschichte Lieflands [Livlands]](https://ebin.pub/img/200x200/baltische-geheimnisse-ein-beitrag-zur-sittengeschichte-lieflands-livlands.jpg)