Umbau. Theorien zum Bauen im Bestand 9783035608830, 9783035611021
New Perspectives on Old Structures UmBau has appeared since 1979 as an interdisciplinary journal published by the Aust
173 63 3MB
German Pages 144 Year 2017
Inhalt
Editorial
Thema_Teil. 1 Umbau /Theorie
Der Umbau
Zu Hermann Czechs Text „Der Umbau“
Von der Modifikation
Zwischen Geografie und architektonischem Zeichen
Thema_Teil 2 Stadtumbau
Umbau anders. Smart City als Interface
Punktuelle Transformationsprozesse im konsolidierten urbanen Gefüge der europäischen Stadt
Funktionen des „Ebenerds“– „StadtParterre“ reloaded
Nutzungsmischung in der Quartierserneuerung
Thema_Teil 3 Ökologie
Nachhaltige Lösungsansätze für Gebäudeerneuerungen
Umbau: Der Ring als Landschaft
Anhang
Kurzbiografien der AutorInnen
Dank und Bildnachweis
Backlist
Recommend Papers
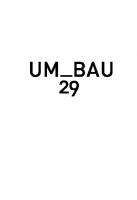
- Author / Uploaded
- Österreichische Gesellschaft für Architektur (editor)
File loading please wait...
Citation preview
UM_BAU 29
UMBAU 29 Umbau. Theorien zum Bauen im Bestand Österreichische Gesellschaft für Architektur – ÖGFA (Hrsg.)
Birkhäuser Basel
6
Thema_Teil 2
Editorial
Stadtumbau
Thema_Teil 1
42
Umbau / Theorie
Manfred Russo
Der Umbau
Umbau anders. Smart City als Interface
14
58
Andreas Vass
Ulrich Huhs
10 Hermann Czech
Zu Hermann Czechs Punktuelle TransText „Der Umbau“ formationsprozesse im konsolidierten 26 Vittorio Gregotti urbanen Gefüge der Von der Modifikation europäischen Stadt 32
70
Paolo Vitali
Angelika Psenner
Zwischen Geografie und architektonischem Zeichen
Funktionen des „Ebenerds“– „StadtParterre“ reloaded
84
Anhang
Betül Bretschneider
Nutzungsmischung in der Quartierserneuerung
139 Kurzbiografien der AutorInnen
140 Dank und Bildnachweis
Thema_Teil 3
141
Ökologie
Backlist
98 Jörg Lamster
Nachhaltige Lösungsansätze für Gebäudeerneuerungen 114 Andreas Vass
Umbau: Der Ring als Landschaft
Inhalt
Editorial
Als „Bauen im Bestand“ ist die Auseinandersetzung mit Fragen der Altbauerneuerung in den letzten Jahren zum vielbeachteten Thema architektonischer Praxis geworden. Neunutzung und Veränderung des Baubestands stellen heute in Europa die überwiegende Mehrheit der Bauinvestitionen. Dennoch blickt die vorherrschende Architekturtheorie über das „Neue“ meist nicht hinaus und die Beschäftigung mit dem „Alten“ wird weiterhin, wenn überhaupt, als Ausnahme wahrgenommen. Die normative Rolle des Bau-, Stadt- oder Landschaftsbestands wird, wo sie nicht nach wie vor als Einschränkung negativ gewertet wird, in der Regel als zu komplex ausgeblendet. Und die Rede vom „Bauen im Bestand“ tendiert ihrerseits dazu, das Vorhandene lediglich als passiven Hintergrund aufzufassen, was dem Verhältnis von Projekt und Bestand in keiner Weise gerecht wird. Demgegenüber betont der Begriff „Umbau“ einerseits den Transformationsprozess, der beim Arbeiten im Baubestand greifbar wird, andererseits ist sein Bedeutungsfeld viel weiter gefasst. In den Natur- und Geisteswissenschaften ist der permanente „Umbau“ des jeweiligen Wissensstands längst selbstverständliche Voraussetzung geworden und niemand würde hier auf den Gedanken verfallen, eine Methode oder Theorie „ex novo“ aufstellen zu können. In der Kunst wie in der Warenproduktion überdeckt hingegen das „Neue“ insbesondere seit der Moderne nur allzu oft den Transformationsprozess, aus dem es hervorgegangen ist, obwohl gerade die künstlerische und architektonische Moderne nicht wenige Beispiele kennt, die diese Verschiebungen und Verwandlungen, die dem Werk zugrunde liegen, im Werk selbst reflektieren. Architektur als Aufbauen auf und Umbauen von Vorhandenem wurde zuerst im städtischen (und landschaftlichen) Maßstab theoretisiert, wo sich im Wiederaufbau der europäischen Städte nach dem Zweiten Weltkrieg die Forderung nach einer Tabula rasa als unerfüllbar oder nicht erstrebenswert herausstellte. Trotz aller Versuche der Wirtschaftswunderzeit, die Stadt in großem Maßstab neu zu denken, und gerade angesichts der Neuauflage einer Stadtplanung „auf der grünen Wiese“ (oder im Wüstensand) in den boomenden Megacities der letzten Jahrzehnte scheinen aus heutiger Sicht die Beispiele eines typologisch bewussten Stadtumbaus interessanter. Die Beschleunigung und Offensichtlichkeit der Transformation von Landschaften und ganzen Regionen hat auch in diesem Bereich zu einer Neudefinition des Verhältnisses von Bestand und Projekt geführt. Die soziokulturellen Veränderungsprozesse urbaner Gesellschaften im Gefolge der „neuen Technologien“, die Frage der Funktion von Bau- und Stadtbeständen als Speicher potenzieller kollektiver Gedächtnisinhalte und nicht zuletzt die Erkenntnis von der Begrenztheit der Ressourcen, der Fragilität ökologischer Kreisläufe und der Notwendigkeit einer Lebenszyklusplanung sind weitere Faktoren, die eine Beschäftigung mit dem Konzept des Umbaus notwendig machen. Schließlich ist der Umbau-Gedanke Voraussetzung für eine Architektur, der es weniger um Aufmerksamkeit oder breite Akzeptanz geht, der weder die Sicherheit eines Stils noch die der moralisch richtigen Haltung zukommt. Dafür stehen exemplarisch die beiden, erstmals in den 1980er Jahren publizierten Grundsatztexte von Hermann Czech und Vittorio Gregotti, die durch ihren Ursprung in einer kritischen Auseinandersetzung mit der Moderne verbunden sind, obwohl sie unterschiedlichen sprachlichen Kontexten 6
UMBAU 29
und Denktraditionen entstammen. Für Vittorio Gregotti stellt die „Modifikation“ einen zentralen theoretischen wie projektrelevanten Ansatz dar, in dem nicht nur der Umbau der eigenen Modelle, sondern auch jener der Methoden – inklusive jener des „von Fall zu Fall“ – einen offenen Ausgang haben. Wie Gregotti geht auch Czech davon aus, den Bestand nicht als Hintergrund, sondern als Ausgangspunkt architektonischer Entscheidungen aufzufassen. Während Architektur bei Hermann Czech generell zu Hintergrund wird, zu „mehrschichtigem“ Hintergrund, wird die Komplexität des Vorgefundenen – Baubestand, Anforderungen, Kontext, Referenzen – als „Überbestimmtheit“ sichtbar, die „für den Benützer, der anderes zu tun hat“, in die Unbestimmtheit umschlägt, die den Spielraum eröffnet, der Architektur überhaupt erst möglich macht: „Ein Umbau ist interessanter als ein Neubau, weil im Grunde alles Umbau ist.“ Diese beiden Grundsatztexte werden jeweils durch Begleittexte kontextualisiert: Paolo Vitalis Text lotet stichprobenartig das geistes- und architekturgeschichtliche Umfeld aus, das für Gregotti maßgebend war und dessen Rezeption in Italien bis heute bestimmt; Andreas Vass geht anhand eines Querschnitts durch Czechs architekturtheoretisches Werk der Frage nach der Konstanz und Komplexität des für Czech so zentralen Begriffs „Umbau“ nach. Der zweite Abschnitt von UMBAU 29 fokussiert auf Umbau im städtischen Maßstab. Manfred Russo nimmt eine system- und medientheoretische Untersuchung der zur Stadt der Zukunft stilisierten „Smart City“ vor, die tiefgreifende Umschichtungen städtischer Realität auslösen könnte, deren Anzeichen bereits heute zu beobachten sind. Komplementär stellt Ulrich Huhs in einer vergleichenden Analyse stadttypologischer Modelle der Transformation der gründerzeitlichen Stadt, die in den 1960er bis 1980er Jahren in Wien und Berlin erprobt wurden, die Frage nach der Relevanz dieser Ansätze, den öffentlichen Raum im Rahmen des Stadtumbaus zu erweitern, für die Gegenwart. Zwei Texte, die aus komplementären Blickwinkeln das für die Veränderungsprozesse der Wiener Gründerzeitviertel entscheidende Problem der Erdgeschoßzonen thematisieren, schließen den Abschnitt ab: Angelika Psenner untersucht räumliche Aspekte und Potenziale der Permeabilität von Straßenraum und Baublock. Betül Bretschneider geht dagegen der Frage nach den Ursachen und Mechanismen der laufenden Transformationsprozesse der Erdgeschosse in Wiener Gründerzeitvierteln auf den Grund. In einem dritten Abschnitt wird gezeigt, wie in ganz unterschiedlichen Facetten und Maßstäben der Umbaufrage Aspekte der Ökologie eingeschrieben sind. Naheliegend ist die bauliche Erneuerung von Wohnquartieren aus der Nachkriegszeit ein europäisches Thema von eminenter Relevanz in der Ressourcenfrage. Jörg Lamster beleuchtet die komplexen Entscheidungskriterien zwischen Umbau und Neubau anhand einiger Schweizer Beispiele. Dass auch der Fall einer so tiefgreifenden stadträumlichen Umwälzung, wie der Bau der Wiener Ringstraßenanlage, auf einer differenzierten Reinterpretation topografischer wie baulicher Bestände fußt, die diesen Prozess als herausragendes Beispiel einer ökologisch deutbaren Stadtlandschaft ausweist, erläutert Andreas Vass im abschließenden Essay zum „Ring als Landschaft im Umbau“. Das Redaktionsteam
Editorial
7
Autor
Thema_Teil 1 Umbau / Theorie
Hermann Czech
Der Umbau Wenn Loos’ frühe ausgeführte Arbeiten Einbauten von Geschäftslokalen und Wohnungen in bestehende Häuser sind, so entspricht dies zunächst dem üblichen Beginn einer Architektenlaufbahn. Und wenn auch in seinem späteren Werk Einbauten, Umbauten – kurz der Umgang mit bestehender Substanz – eine bedeutende Rolle beibehalten, so könnte das einfach im Zusammenhang damit gesehen werden, daß er eben fast keine großen Bauvorhaben verwirklichen konnte. Zu Otto Wagner fallen einem keine Umbauten ein. Aber liegt das wirklich nur am Bauvolumen? Ist es nicht vielmehr so, daß der Umbau in der Architektur von Adolf Loos eine konstitutive Rolle spielt – weit über die Rolle von Fingerübungen eines Anfängers im Metier hinaus? Und steht nicht Loos’ Werk bereits für eine Zeitströmung, die nicht mehr geradlinig in die technisch-industrielle Moderne fortschreitet, sondern diese bereits vorfindet und ihr gegenüber eine komplexe reflektierende Haltung einnimmt? Der urbane Aspekt Die Großstadt des 19. Jahrhunderts ist ein Werk verschiedener Maßstäbe. Zunächst ist sie ein Netz der Verkehrserschließung, durch die die Bebauung (z.B. in „Baublöcken“) strukturiert wird. Sodann ist sie eine Addition von Baustrukturen (z.B. „Häusern“). Technisch und rechtlich davon unterschieden besteht meist ein dritter baulicher Maßstab: der der individuellen Nutzung, also der des Geschäfts, des Cafés, der Wohnung, der Werkstatt. Jeder dieser Maßstäbe ist die Ausformung, Spezifizierung des nächstgrößeren. Ordnung entsteht durch die Entscheidungen in den größeren, Vielfalt durch die Entscheidungen in den kleineren Maßstäben. (Wenn z.B. die kleinmaßstäblichen Entscheidungen verlorengehen, etwa weil es nur mehr große Wohnbauträger oder große Kaufhäuser gibt, dann ist es müßig, sie auf architektonischem Wege simulieren zu wollen.) Zu den verschiedenen Maßstäben gehören verschiedene Zeithorizonte. Die Entscheidungen in den jeweils größeren Maßstäben sind längerfristig als die in den kleineren. Ohne den Vorgang des Umbaus wäre also städtisches Leben gar nicht denkbar. Otto Wagner hat den großmaßstäblichen Stadtumbau der Gründerzeit noch vollendet; Loos hat das Ergebnis bereits vorgefunden und räsonierend die Fehlleistungen der Ringstraße durch einen hypothetischen Stadtplan kritisiert. Die städtebaulichen Einzelprojekte von Loos, die die großmaßstäbliche Stadtstruktur bestätigt und durch pointierte 10
UMBAU 29
Wirkungen bereichert hatten, wären sie ausgeführt worden, sind in dieser Maßstabrelation zu verstehen: sie greifen die größermaßstäblichen Vorgaben z.B. der Ringstraße auf und sind selbst Strukturen, die eine vielfältige kleinmaßstäbliche Nutzung erlauben. Der baulich-räumliche Aspekt In der Hierarchie dieser Maßstäbe sind die „Einrichtungen“ von Geschäften oder Wohnungen die ,,kleinen“ Aufgaben – wenn schon nicht die minderen, so jedenfalls nicht die den großen Architekten auf der Höhe ihres Schaffens angemessenen. Loos’ Interventionen an bestehender Bausubstanz entsprechen nun nicht mehr dieser Maßstabshierarchie der klassischen Metropole. Sie sind nicht Ausdeutungen, sondern Umdeutungen, nicht Ausbauten, sondern Umbauten. Ein solcher Umbau geht an die Bau„Substanz“, indem er sie in Frage stellt – aber eben nicht, indem er sie beseitigt. Loos’ Eingriffe lassen sich einigen wenigen Figurationen zuordnen. Eine könnte man als die Anbringung von Raumschichten beschreiben: im Fall der Villa Karma außen, im allgemeinen jedoch im Inneren wird nicht bloß eine verkleidende Materialschicht, sondern eine Raumschicht eingeführt, die mit dem verbleibenden Raum in Beziehung tritt. Die ursprüngliche Raumgestalt wird dadurch im Dienste von neuen, oft axialen Raumzusammenhängen modifiziert oder konterkariert; die Raumschicht selbst liefert kleine Räume, Verbindungsgänge oder Einbauschränke. Nur im Falle von eingezogenen Decken bleibt das Volumen ungenutzt. Eine weitere Figuration des räumlichen Eingriffs ist die Entfernung und Abfangung einer tragenden Wand, insbesondere im Zusammenhang mit einem raumerweiternden Zubau. Der statisch erforderliche Unterzug zur Abfangung der darüberliegenden Lasten wird zu einem prominenten Mittel der Decken- und Raumgliederung (Haus Mandl). Während die Entfernung oder Versetzung von Decken naturgemäß selten vorkommt, ist die Unterteilung von Abschnitten vorhandener Räume durch eine zusätzliche Decke – etwa als Galerie – eine ebenfalls prototypische Figuration. Diese Mittel und ihre räumlichen Konsequenzen sind bei Loos nicht speziell dem Umbau zuzuordnen, sondern allgemeine Elemente seines räumlichen Denkens. Eine Chronologie bestimmter Entwurfsgedanken würde vielleicht sogar ihren Ursprung in Umbauentwürfen nahelegen. Der Umbau ist nicht etwa dem Neubau durch Kompromisse unterlegen, sondern die Elemente des Altbaus gehen mit seinen Veränderungen und den neugeschaffenen Elementen eine neue Einheit ein, die ein vollgültiges Werk darstellt. Der kulturelle Aspekt Der Begriff Umbau beinhaltet also eine Dialektik zweier Bestrebungen: des Bewahrens und des Veränderns. Obwohl Loos keinen Zweifel daran läßt, daß er modern, der Zukunft zugewandt ist, liegt der Schwerpunkt seiner Argumentation auf dem Bewahren. Veränderung ist nur erlaubt, wenn sie Verbesserung bringt. Denn Typus und Form „sind das Resultat unbewußter Gesamtarbeit der Menschen eines ganzen Kulturkreises“ – „der einzelne Mensch Der Umbau
11
12
UMBAU 29
Hermann Czech
ist unfähig, eine Form zu schaffen, also auch der Architekt.“ Und doch ist Loos überzeugt davon, daß es die Leistung eines einzelnen sein kann, einen Typus zu schaffen, nicht nur in einer Tradition zu stehen, sondern auch eine neue zu begründen. Aber der lebensreformatorische Ansatz Loos’ besteht nicht darin, die isolierte Keimzelle einer neuen Welt zu züchten, sondern darin, in der bestehenden Kultur alles aufzugreifen, was ihrer Weiterentwicklung dient. Er erdenkt nicht jede Einzelheit von Grund auf neu. Wer neue Gedanken mitteilen will, kann sich nicht gleichzeitig einer neuen Sprache bedienen. Im Physischen wie im Geistigen sucht er zwar nicht – wie Otto Wagner – das dauerhafteste Material, wohl aber das von angemessener Haltbarkeit. Vom „Weiterverwenden“ führt durchaus eine Gedankenverbindung zum Wiederverwerten, wie ja auch der Raumplan das Verständnis des ökologischen Prinzips weckt – nämlich beim Erörtern eines Systems an die Folgen außerhalb des Systems zu denken. Der methodische Aspekt Das Charakteristikum des Umbaus – wir kehren jetzt zum architektonischen Entwurf zurück – besteht also darin, daß Entscheidungen bereits vorgegeben sind. Macht man sich einmal bewußt, daß jeder Entwurfsprozeß eine Entscheidungsreihe darstellt, in der spätere Entscheidungen von früheren determiniert sind, so macht es keinen wesentlichen Unterschied, ob die früheren Entscheidungen eigene oder fremde waren. Jeder Entwurfsvorgang beinhaltet Festlegungen, die von nachfolgenden Gedanken entweder akzeptiert oder umgestoßen werden müssen. Gerade der „Raumplan“ erfordert ein ständiges Rückkoppeln von Geschoß zu Geschoß, von Längs- zu Querschnitt, wobei es nicht unbedingt leichter fällt, eine eigene Vorentscheidung wieder aufzugeben als einen existierenden Bauteil zu entfernen. Tendenziell zielt der Raumplan auf ein völlig stimmiges Gebilde, an dem nichts mehr verändert werden kann. Aber Loos’ Entwürfe haben immer den Charakter des work in progress an sich; seine Präsentationen – etwa für Wettbewerbe – haben nie die nahtlose Perfektion jener von Otto Wagner, welche fertig dem Kopfe entsprungen zu sein scheinen. Deshalb ist für Loos auch die Möglichkeit der zukünftigen Veränderung durch andere vorstellbar; erst er konnte die Geschichte vom armen reichen Manne schreiben, die besagt, daß eine Wohnung, ein Haus mit dem Benützer weiterleben und Entscheidungen eines anderen Geschmacks – das heißt, einer anderen Ethik – ertragen muß. Und erst von einem Verständnis des Loos’schen Werks aus ist die Delegation ästhetischer Entscheidungen an andere – an Benutzer, an Spätere – konzipierbar: und zwar nicht aufgrund der unaufrichtigen Fiktion einer vorgeblichen Neutralität, die keine Entscheidungen trifft, um sie dem Nutzer zu überlassen. Loos läßt uns eine Architektur ahnen, die stark genug ist, eine Vorgabe zu sein, offen, vieles aufzunehmen, aber auch des Leids der Entstellung gewärtig. Der Umbau
13
Andreas Vass
Zu Hermann Czechs Text „Der Umbau“ Zwischen Dezember 1989 und Februar 1990 fand in der Wiener Albertina, dem Historischen Museum der Stadt Wien und im Looshaus am Michaelerplatz eine Einzelausstellung zum Werk von Adolf Loos statt – nach den ersten Aufarbeitungen der 1960er Jahre die umfassendste und bislang letzte in Wien.1 Zum Ausstellungskomitee zählte damals auch der bereits unter anderem durch Forschungen zur Wiener Moderne (Wagner, Loos und Frank) profilierte Architekt Hermann Czech. Einer seiner Beiträge zu dieser Ausstellung war die vor dem Eingang der Albertina aufgestellte Rekonstruktion des MarmorGeschäftsportals Spitz in Holz, eines Umbaus, wie die meisten von Loos’ Projekten bis Anfang der 1920er Jahre, von denen Czech insbesondere die Kärntner Bar im Zuge der Rekonstruktion ihres Portals wenige Jahre zuvor eingehend untersucht hatte.2 Der Text „Der Umbau“, hier als einer der nach wie vor grundlegenden Ansätze zum Thema abgedruckt, entstand 1989 im Rahmen der Vorbereitung zu dieser Ausstellung.3 Er geht vom Werk Adolf Loos’ aus, fasst aber grundsätzliche Gedanken zum Thema, die ihre Aktualität und Gültigkeit bis heute nicht eingebüßt haben. Wie das Œuvre von Adolf Loos weist auch Hermann Czechs architektonisches Werk eine auffällige Anzahl von Umbauten auf. Wenn Czech jenseits der Zufälligkeiten einer Auftragslage von der „konstitutive[n] Rolle“ ausgeht, die diese Aufgabe für die spezifische architektonische Haltung von Adolf Loos spielte, so trifft das jedenfalls auch auf seine eigene Arbeit und Haltung zu. Architektur als Veränderung von Vorgefundenem zu denken, ist in Hermann Czechs theoretischem wie architektonischem Werk von Anfang an eine Konstante. Czech vollzieht dabei eine bemerkenswerte Begriffsausdehnung: Demnach erstreckt sich Umbau konsequenterweise auf alles Vorhandene, vom Materiellen über das Immaterielle bis zum Vorhandensein eines Gedankens, den andere oder man selbst gefasst hat. Er bildet die Klammer, in der die Dialektik zwischen Bewahren, Verändern und Zerstören jeweils aufs Neue in Gang gesetzt wird. In das Vorhandene fallen fremde oder eigene Entscheidungsreihen, die in einen Entwurfszusammenhang genommen werden, ohne daraus ein ideologisches Regelwerk abzuleiten. In paradoxer Formulierung ist dieser Gedanke in seinem Text „Zur Abwechslung“ (1973) 4 auf den Punkt gebracht: „Ein Umbau ist interessanter als ein Neubau, weil im Grunde alles Umbau ist.“ Was sich als spätere Replik auf Holleins medienwirksamen Slogan „Alles ist Architektur“ (1968) lesen ließe – die unmittelbare Replik im Text „Nur keine Panik“(1971) 5 lautet bekanntlich: „Architektur ist Hintergrund. Alles andere ist nicht Architektur.“ –, fordert doch zu ungleich schärferem und weiter reichendem Nachdenken auf. Wenn Architektur weder omnipräsent ist gleich dem Äther, den die Physik vor Einstein vergeblich zu postulieren versuchte (auf die Droge, die uns diese Wahrnehmung schafft, 14
UMBAU 29
warten wir seit Holleins Collagen vergeblich), noch – etwa durch Methode oder bloße Intuition – aus dem Nichts entsteht, so ist zumindest die Frage gerechtfertigt, wie aus Etwas, das nicht unbedingt Architektur sein muss, jene Gebilde entstehen, die auch ohne Kenntnis des Urhebers und ohne, dass sie sich in den Vordergrund drängen, als Architektur erfahren werden können. Czechs Text „Der Umbau“ steht für sich; er bedarf keiner weiteren Erklärung. Da sich aber jeder Gedanke, nicht nur der zum Entwurf, erst aus konkreten biografischen Momenten bildet und diese im Fall der Überlegungen zum Umbau in den Texten Hermann Czechs zahlreiche Spuren hinterlassen haben, soll hier der Versuch unternommen werden, zumindest einige dieser Momente aufzuspüren. Sachlichkeit Bereits in „Neuere Sachlichkeit“ (1963) 6, einem der frühesten programmatischen Texte, die in den Sammelband Zur Abwechslung aufgenommen wurden, sind wesentliche Fragen gestellt, die eine Auffassung von Architektur als Umbau implizieren. Czech geht von „einigen Sätzen Theodor W. Adornos“ aus dessen Vortrag im Museum des 20. Jahrhunderts aus, einer „Sonderveranstaltung“ zum „Europa-Gespräch“ 1963. Der letzte, wesentliche Satz, den Czech „sinngemäß“ zitiert – „Man kann nur über die Sachlichkeit hinaus, indem man noch sachlicher ist“ –, wird zum Ausgangspunkt von Überlegungen, die bei einer Kritik des Funktionalismus und des Kant’schen Zweckbegriffs ansetzen, der „Baukunst als jene [definiert], die Dinge wohlgefällig macht, die ihren ‚Bestimmungsgrund in einem willkürlichen Zwecke‘ haben“ und daher zur gängigen Vorstellung einer Trennung zwischen „reiner Kunst“ und Architektur führt, die „eben unrein und ‚angewandt‘“ sei und von „außerhalb liegenden Zwecken“ bestimmt werde. „Man könnte so weit gehen, die Entscheidungen dem Benützer oder Auftraggeber, dem ‚Konsumierenden‘ zu überlassen, der schließlich am besten wissen muß, was er braucht. ‚Sachlichkeit‘ dagegen tendiert genau in die andere Richtung. Gegenüber den ‚Forderungen der Sache selbst‘ hat der Konsumierende sein Recht verloren. Sie stellen sich dem Künstler aus dem Material, das er bearbeitet. […] Neben Kants Definition der Baukunst steht die höhere Hegels, in der nicht mehr von Zwecken die Rede ist: ihre allgemeine Aufgabe ist, ‚die äußere, unorganische Natur so zurecht zu arbeiten, daß sie als kunstgemäße Außenwelt dem Geiste verwandt wird‘.“ Czech deutet das „allgemeinste Material“ von Architektur an als „Funktion und Konstruktion im Raum“. Das Material, an dem er diese Überlegungen konkretisiert, ist aber ein anderes: es sind die vorhandenen Strukturen der Stadt (konkret ansetzend an der Zu Hermann Czechs Text „Der Umbau“
15
zeitgenössischen Kritik von Lucius Burckhardt an Brasilia und Chandigarh).7 Obwohl die Stadt, nach Adorno, „doch jedenfalls das Werk von ‚Produzierenden‘ und ‚Konsumierenden‘ gemeinsam“ ist, besteht Czech auf der Feststellung, dass „selbst die veränderlichste Struktur nicht Geschichte vorwegnehmen und eine Stadt schaffen“ könne. „Der technische Begriff der Variabilität sollte nicht mit ‚Freiheit‘ in Verbindung gebracht werden. Der Spätere ist jedem Planungsakt gegenüber frei; er kann den invariabelsten Bau vernichten oder verändern, den noch so variablen in einer Weise umwidmen, die nicht vorhergesehen wurde.“ Freiheit ist also im städtischen wie im architektonischen Maßstab keine Frage einer „Struktur, die jeden Wechsel [zuläßt]“, sondern einer bewussten Erforschung der „‚Forderungen der Sache selbst‘, [die] sich dem Künstler aus dem Material [stellen], das er bearbeitet“. Der Text schließt mit den Sätzen: „Sachlichkeit als eine Haltung der Reflexion stellt tatsächlich eine Stufe der Bewußtheit dar, hinter die nicht zurückgegangen werden kann. Jeder Verzicht auf eine Überlegung bedeutet einen Qualitätsverlust.“ Den Gedankenstrang der „Sachlichkeit“ entwickelte Czech nicht nur in jüngerer Zeit in etlichen Vorträgen zu einem zentralen Thema, er spielt auch im für Czechs Textsammlung titelgebenden Text „Zur Abwechslung“ eine wichtige Rolle, dem der eingangs erwähnte Schlüsselsatz zum Umbau entnommen ist: „Ein Umbau ist interessanter als ein Neubau – weil im Grunde alles Umbau ist.“ Der letzte Abschnitt dieses Texts, „Mehrschichtigkeit“, endet mit einer implizit „sachlichen“ Interpretation von Josef Franks „akzidentistischer“ Forderung, wir sollten „unsere Umgebung so gestalten, als wäre sie durch Zufall entstanden“. Czech bezieht diesen „Zufall“, Franks Argumentation folgend, auf „das Vorbild, das Vorhandene“. Damit greift er das Thema des vorletzten Textabschnitts, „Das Vorhandene“, auf: „Das Vorhandene ist die Stadt. Sie ist stärker als alles, was einer statt ihrer erfinden kann. Statt eine planmäßige Welt zu errichten, finden wir eine gewaltige Masse vor, die wir nur durch Hinzufügen von Kleinigkeiten verändern können, verfremden, umdeuten, vielleicht steuern. Aber wie die Natur ist diese Masse viel mehr ein Gegenstand der Erkenntnis als der Veränderung.“ Dass es trotzdem auch andere Wege gibt, als „die Architektur auf[zu]geben“, erfährt der Leser im Abschnitt „Mehrschichtigkeit“ am Beispiel der „Theorie der Gartenkunst“, die neben einer „Gestaltung ‚gegen‘ die Natur, Bewunderung, [...] schließlich die Nachahmung und das Gleichnis, die Gestaltung ‚parallel zur Natur‘“ kenne. Also eine Gestaltung, die sich die „vorgegebene 16
UMBAU 29
Andreas Vass
Welt“, Husserls Erkenntnisvoraussetzung, als solche bewusst macht und sie daher „durch Hinzufügen von Kleinigkeiten verändern“ kann. „Ähnlich [wie bei der Gestaltung ‚parallel zur Natur‘] verhalten wir uns zum Vorhandenen. Je mehr wir davon begreifen, desto weniger müssen wir uns in Gegensatz dazu bringen, desto leichter können wir unsere Entscheidungen als Fortsetzung eines Kontinuums verstehen. Ein Umbau ist interessanter als ein Neubau – weil im Grunde alles Umbau ist.“ Einen Gedankengang weiter ermöglicht, ja erzwingt die Haltung der Sachlichkeit geradezu die Erkenntnis, dass ihr „Material“, das Vorhandene, eine Komplexität aufweist, die nur mehr mit Franks „Zufall“ darzustellen ist. Franks „Zufall“ – „das Als ob“ – meint, da das Vorhandene ja nicht wirklich durch Zufall entstanden ist, „sondern aus zahllosen – im einzelnen nachvollziehbaren – Motivationen früherer Geister“, dass wir „[a]nalog […] Vielfalt erreichen [können], wenn wir alle unsere Motivationen in den Entwurf einfließen lassen, allen Verästelungen der Gedankenreihe nachgehen, statt jeweils einer Schnapsidee von einem Rezept nachzuhängen, eine flache Disziplin durchzuhalten. Das Ziel ist eine Deckung aller Überlegungen zu einem Ergebnis, das definiert, aber durchsichtig ist und das mehrschichtige Netzwerk der Beziehungen bestehen läßt.“ Wo das Vorhandene (z.B. eines konkreten Bauplatzes) eben nicht als „äußerer Bestimmungsgrund“, der dem Produkt, Architektur, fremd bleibt und ihm von der Konsumtionsseite her angetragen wird, sondern als Material der Entwurfsarbeit selbst aufgefasst wird, wo also Architektur als Umbau aufgefasst wird, da ist die Grenze zwischen den „Umweltfaktoren“ und persönlichen „Motivationen“ oder sich unwillkürlich einstellenden „Assoziationen“ aufgehoben. Diese sind demgemäß im Text „Einige weitere Entwurfsgedanken“(1980) 8 in einem analogen Zusammenhang, der das Umbau-Denken als Entwurfsprinzip mit dem Begriff des „Systems“ näher erläutert und an die „Sachlichkeit“ anknüpft, zugleich eine Eigenheit aller „Bau-Teile“ von Architektur, deren „Reichtum“ darin besteht, gegenüber „skulpturaler Form [...] bereits den realen Charakter des ‚Objekts‘“ aufzuweisen. Ein weiterer Begriff, der schon in „Neuere Sachlichkeit“ mit dem „realen Charakter des ‚Objekts‘“ assoziiert wird, wogegen er auch durch die „veränderlichste Struktur“ und generell durch keinen „Planungsakt“ ins Spiel gebracht werden kann, ist die „Freiheit“ – hier die des „Späteren“, der „den invariabelsten Bau vernichten oder verändern, den noch so variablen in einer Weise umwidmen [kann], die nicht vorhergesehen wurde“. Sie scheint Zu Hermann Czechs Text „Der Umbau“
17
„Das Vorhandene ist die Stadt. Sie ist stärker als alles, was einer statt ihrer erfinden kann. Statt eine planmäßige Welt zu errichten, finden wir eine gewaltige Masse vor, die wir nur durch Hinzufügen von Kleinigkeiten verändern können, verfremden, umdeuten,vielleicht steuern.“ Hermann Czech
18
UMBAU 29
Andreas Vass
aber, wie das Vorhandensein selbst, spielerisch vom Entwurfsprozess in das „Objekt“ und zurück zu wechseln, wenn die (in „Zur Abwechslung“) dem Entwerfenden implizit zugeschriebene Befreiung von „flacher Disziplin“ 9 in „Manierismus und Partizipation“ (1977) 10 als Potenzial von Architektur architektonische Machbarkeitsträume in ihrem Appellcharakter relativiert – sei es als Appell an die Lösung „unsere[r] politischen, unsere[r] sozialen“ oder „unsere[r] Umweltprobleme“ und selbst als bloßer Appell an unsere „Freiheit“ und „Selbstverwirklichung“: „[Architektur] kann Freiheit, Selbstverwirklichung realisieren, und zwar sowohl direkt, als konkretes Objekt (ohne daß sie notwendigerweise Elemente der Variabilität oder Eigenleistungen der Benutzer enthält) als auch bildlich, als Ausdruck (ohne daß sie notwendigerweise ablesbare Chiffren oder Zitate aufweist). Sie muß in ihre Innerlichkeit das Äußere, Äußerliche, das uns umgibt, in ihre Einheit das Vielfältige, das möglich ist, hineinnehmen.“ Und schließlich: Diese „Offenheit und Imagination [gestattet], auch Fremdprozesse in Gang zu setzen und zu ertragen, […]“. Selbst fehlgeleitete Umbauprozesse, zum Beispiel im städtebaulichen Maßstab, können so à la longue produktiv werden: „Eine realistische Einstellung muß diese eskalierenden Veränderungen hinnehmen, ja sie beschleunigen. Die Veränderungen müßten noch stärker sein, die Ergebnisse möglichst häßlich; dann wollen wir warten, bis sie Bestand geworden sind.“ Wenn der titelgebende „Manierismus“ hier zunächst mit den Etiketten der „Sachlichkeit“ versehen wird – „eine Haltung der Intellektualität, der Bewußtheit; und weiter ein Sinn für das Irreguläre, Absurde, die jeweils aufgestellten Regeln Durchbrechende“ –, so verweist letzteres wiederum auf das „System“ und dessen Grenzen von „Einige weitere Entwurfsgedanken“. Zum Begriff „Deformation“ heißt es da: „Beim Entwerfen gehen wir mit Systemen vor, in die wir die Anforderungen (gestellte oder eigene) fassen. Keines der Systeme ist ganz zureichend, mindestens an den ‚Kanten‘ des Systems müssen wir uns ein weiteres System einfallen lassen. Das Entwerfen ist eine fortschreitende Reihe von Entscheidungen, die in den Modifikationen der Systeme und ihrer Überlagerung merkbar bleiben. Das Ergebnis kann trotzdem vordergründig einfach sein, wenn alle Überlagerungen zur Deckung kommen […].“ Und weiter zum „Raumplan“: „Alle Räume, die wir schaffen, bilden neben sich und zwischen einander Negativ-Räume. Sie zu vernachlässigen, ist nicht nur im praktischen, sondern auch im künstlerischen Sinn unökonomisch. Loos hat dieses Prinzip vom Grundriß in den Schnitt übertragen. […] Inzwischen kennen wir Zu Hermann Czechs Text „Der Umbau“
19
dieses Prinzip – beim Erörtern eines Systems auch an die Folgen außerhalb des Systems zu denken – als das der Ökologie.“ Sachlichkeit erfasst die innere Komplexität eines Systems bis in die scheinbare Zufälligkeit und von dort – in „Zur Wientalbrücke“(1983) 11 – bis an den „Rand“, „wo das System nicht mehr stimmt“: „Dort wo das System […] unrein wird, dort wird es eigentlich interessant.“ Ökonomie Die Bearbeitung der Ränder wird, wie im letzten Beispiel in Bezug auf Loos’ Raumplan gezeigt, auch mit dem Begriff der Ökonomie verknüpft. Dieser zielt zunächst auf das Verhältnis von Ursache, oder Aufwand, und Wirkung. In „Mehr Licht“ (1964) 12, einem weiteren ganz frühen Text, heißt es dazu: „Tatsächlich wären aber Räume denkbar, deren Wirkung nicht auf ihrer Baugestalt, sondern auf ihren Lichtverhältnissen beruht. Nicht nur würde solche Architektur das treffen, wovon ohnehin das Erlebnis am meisten abhängt (wenn man einmal von der Temperatur absieht), sie wäre auch imstande, ihre Wirkungen zu verändern, ohne daß Material bewegt werden müßte.“ Wir haben es also mit einer Ökonomie der Veränderung zu tun. Diese berücksichtigt nicht nur „Negativ-Räume“, die sich im Entwerfen oder auch in Altbauten ergeben. Nicht nur das Studium von Loos’ zahlreichen Umbauten zeigt, dass die Bearbeitung der Ränder im praktischen Sinn eine Frage der Raumreserven ist. In „Wohnbau und Althaus“ (1985) 13 nimmt diese Frage breiten Raum ein: „Die Wandstärke stellt auch eine Raumreserve dar […]. Solche Veränderungen der Wände sind Zeichen der Inbesitznahme durch den Bewohner; sie werden aber von Nachfolgern nicht als unzumutbare Einschränkung empfunden, sondern als liebenswerte Spuren der Vergangenheit. Die starken Wände verkleinern auch die Wohnung nicht, denn überall, wo sie Öffnungen haben, trägt diese Distanz des Schwellenbereiches zur erlebten Größe der Wohnung bei.“ Über den bloß volumenmäßigen Raumgewinn hinaus besteht auch hier die Ökonomie in der mit geringem oder ohne jeden physischen Aufwand erzielbaren Wirkung: „Der Inhalt dieser Mauern ist – oft auch im technischen Sinn – unergründlich. Das Geheimnis der Mauern (und Decken) bewirkt, daß der Bewohner nicht nur die statische Konstruktion seines Hauses nicht versteht, sondern hinter den Fußboden-, Wand- und Deckenflächen seiner Welt eine Gegenwelt vermutet, die für ihn etwas Irrationales hat.“ Letztlich ist es die „nicht machbare Eigenschaft des Alters“, die den „Altbau dem Neubau ex definitione überlegen“ macht. Wie schon gezeigt, ist es eine Frage der „Bewußtheit“, diese Überlegenheit zu nutzbar zu machen. Die Dichte an Wissen und Erkenntnissen über das Vorhandene erspart uns, wie in „Zur Abwechslung“ dargestellt, den sinnlosen Aufwand eines Gegensatzes, indem sie ermöglicht, „unsere Entscheidungen als Fortsetzung eines Kontinuums [zu] verstehen“. 14 Teil an dieser Ökonomie hat damit auch, und gerade, das in „Manierismus und Partizipation“ angesprochene „Irreguläre“, vielleicht sogar das in „Elemente der Stadtvorstellung“ (1990) 15 erwähnte „Chaos“, das gleichermaßen die gründerzeitliche Stadt wie die des 20. Jahrhunderts mit ihrer Ablösung des Verkehrssystems von der Bebauung überall dort durchzieht, „wo das jeweilige Begriffssystem nicht zureicht“. 20
UMBAU 29
Andreas Vass
Ökonomie, ob sie Raumreserven, die Reduktion des Widerstands des Vorhandenen, nur teilweise kontrollierbare oder chaotische Wirkungen oder die, wie schon Alois Riegl feststellte, nur durch den nicht herstellbaren „Alterswert“ erzielbare Offenheit zum Gegenstand hat, ist jedenfalls nicht im Sinne funktionaler Berechenbarkeit zu verstehen. „Das Ergebnis befindet sich auf der schöpferischen, unsicheren Seite“, wie in „Mehrschichtigkeit“(1977) 16 im Zusammenhang mit den solcherart erzielten Interpretationsspielräumen festgestellt wird. In „Wohnbau und Althaus“ wird diese Unterscheidung explizit: „Es scheint an der Zeit, daß Architekten sich bewußt machen, daß ‚Wohnbau‘ als selbständige Aufgabe und Programm keine zentrale Rolle mehr spielt. […] Denn von den Altbauten wissen wir inzwischen, daß man überall wohnen kann, daß die ‚Lebensqualität‘ nur ganz vordergründig von der professionellen Funktionalität eines Grundrisses abhängt. […] Eine hervorstechende Eigenschaft der städtischen Altbauten ist ihre A-Funktionalität, gemessen an heutiger Grundriß-Kritik.“ Überbestimmtheit Als ein weiterer, mit dieser „A-Funktionalität“ des Vorhandenen korrespondierender Schlüsselbegriff in Czechs Texten könnte die „Überbestimmtheit“ angesehen werden, die im Zusammenhang mit Umbau-Fragen mehrfach erwähnt wird. In „Räumlicher Städtebau“(1969) 17 wird dieser eigentlich aus der Tragwerkslehre stammende Begriff 18 im spielerisch-ironischen Gedankenexperiment in einen städtischen Maßstab übersetzt. Eine Potenzierung der„bestehenden Stadt“, deren „flächige Struktur“„anpassungsfähig und variationsreich“ ist, wird durch deren Übertragung ins Dreidimensionale erreicht: „[…] als Gedankenmodell das total verbaute Volumen, die zufällige äußere Begrenzung“, was auf die „geschlossen bebaubaren Hoffnungsgebiete“ angewandt „wuchernde, amöbenhaft wachsende und wandernde Gebilde“ ergibt. „Das statische System ist vielfach überbestimmt und überdimensioniert. Jeder Teil des Systems ist durch ein andres System ersetzbar. Während des Umbaus nehmen die Kräfte einen andren Verlauf – diese statischen ‚Umleitungen‘ können durch elektronische Datenverarbeitung kontrolliert werden.“ Vergleicht man dieses Gedanken-Experiment mit Charakterisierungen der gründerzeitlichen Stadt, wie sie z.B. in „Ins Auge sehen“ (1985) 19 gegeben werden, zeigt sich der „Räumliche Städtebau“ als Überzeichnung der Potenziale der bestehenden, seit Roland Rainers Planungskonzept historischen Blockstruktur: „Städtische Dynamik zeigte sich ehemals im Umprägen, Umdeuten einer Bebauungsstruktur durch eine andere – Häuser stehen dann aus verschiedenen Perioden, an verschiedenen Baulinien mit verschiedenen Standards nebeneinander; in einer Überblendung zeigen sie die Erinnerung der vergangenen und die Vision der zukünftigen Stadt.“ Zu Hermann Czechs Text „Der Umbau“
21
Diese Überblendung nimmt in der Gründerzeitstadt, wie „Elemente der Stadtvorstellung“ in Weiterführung des zuletzt zitierten Gedankengangs wie auch des hier abgedruckten „Umbau“Texts ausführt, innerhalb ihrer „Abstrahierung von Funktionen“ in der „elementare[n] Unterscheidung von Bebauung und Verkehr“, die Form einer Überlagerung von „baulichen Maßstäben“ an, der auf der Zeitachse Maßstäbe von Umbauzyklen entsprechen: „Jeder dieser Maßstäbe ist die Ausformung, Spezifizierung des nächstgrößeren. Ordnung entsteht durch die Entscheidungen in den größeren, Vielfalt durch die Entscheidungen in den kleineren Maßstäben. Zu den verschiedenen Maßstäben gehören verschiedene Zeithorizonte. Die Entscheidungen in den jeweils größeren Maßstäben sind längerfristig als die in den kleineren. Nicht nur die Stadtentwicklung, sondern das städtische Leben selbst ist also nicht ohne den Umbau möglich.“ Aber nicht nur statisch und städtebaulich fordert der UmbauFall die Überbestimmtheit des Systems heraus. Im Text„Mehrschichtigkeit“ geht es um Bedeutungsfragen: Zwar rechtfertigt die „nicht machbare Eigenschaft des Alters“ Denkmalpflege. Dennoch besteht Czech auf der Gegenwärtigkeit jeder Neuverwendung, die „eine neue Schicht auf[trägt]“. Nach Wolfgang Mistelbauer macht diese Mehrschichtigkeit Gebäude zu „Zeitmaschinen“. „Neuverwendung und Umbau sind eine Umdeutung des Bestandes und machen uns daher aufgeschlossen für Mehrdeutigkeit und Mehrfachsinn. Raum und Bauwerk entstehen aus vielfachen und oft widersprüchlichen Gedankengängen; deren wahrnehmbares Netzwerk bildet die ästhetische ‚Informationsdichte‘. Die historische Mehrschichtigkeit ist das Muster für andere: die räumliche Mehrdeutigkeit etwa, die Überlagerung verschiedener zusammentreffender (oder auch simulierter) Raumgedanken; […].“ Mit anderen Worten: Es entsteht ein „überbestimmtes“ System, das vom Benutzer auf unterschiedliche Weisen interpretiert werden kann. „Die Überbestimmtheit schafft für den Benützer, der anderes zu tun hat, eine Unbestimmtheit und damit jenen Spielraum, den Josef Frank meint, wenn er fordert, ‚daß wir unsere Umgebung so gestalten sollen, als wäre sie durch Zufall entstanden‘. Aus einem bewußten Entwurfsprozeß entsteht eine Architektur, die nur spricht, wenn sie gefragt wird.“ In diesem Entwerfen ist Überbestimmtheit aber nicht notwendig mit einer sich aufdrängenden Komplexität verbunden, im Gegenteil, nach „Einige weitere Entwurfsgedanken“ kann „das Ergebnis“ sogar „vordergründig einfach sein, wenn alle Überlagerungen zur Deckung kommen“. In „Zur Abwechslung“ sind diese 22
UMBAU 29
Andreas Vass
„Die Überbestimmtheit schafft für den Benützer, der anderes zu tun hat, eine Unbestimmtheit und damit jenen Spielraum, den Josef Frank meint, wenn er fordert, ‚daß wir unsere Umgebung so gestalten sollen, als wäre sie durch Zufall entstanden‘.“ Hermann Czech
Zu Hermann Czechs Text „Der Umbau“
23
„Überlagerungen“ explizit die „Überlegungen“eines Entwurfs, dessen Entscheidungsketten in einen überbestimmten Zustand umschlagen, der „definiert, aber durchsichtig ist und das mehrschichtige Netzwerk der Beziehungen bestehen läßt“. Bei einem solchen Umbau, wie Czech ihn gerade auch am Werk von Loos konstatiert, das im hier abgedruckten Text im Vordergrund steht, gehen „die Elemente des Altbaus […] mit seinen Veränderungen und neugeschaffenen Elementen eine neue Einheit ein, die ein vollgültiges Werk darstellt“. Überbestimmtheit wird zu einem tragenden Moment des Werks selbst, wo der alltägliche, umdeutende Umbau der Stadt überschritten und zum Umbau im architektonischen Sinn wird, der „an die Bau-‚Substanz‘“ geht. Inwieweit dieser ins Werk gesetzten Überbestimmtheit, wie das bei der statischen und städtebaulichen der Fall zu sein scheint, eine stabilisierende Wirkung zukommt, muss offen bleiben. Anders gefragt: Ist der „reale Charakter des Objekts“ mit der Realität des Werks einer als Umbau verstandenen Architektur noch zur Deckung zu bringen? Wird sich Umbau, nicht nur im architektonischen Werk von Adolf Loos, tatsächlich darauf beschränken, „dazustehen und Ruhe zu geben“?
24
UMBAU 29
Andreas Vass
1 Vorausgegangen waren die kleineren Ausstellungen
handene der Stadt insofern auch als „künstlerisches
in der Galerie Würthle, 1961, zusammengestellt von
Material der Architektur“ auftritt (während es zweifels-
Johann Georg Gsteu „unter dem Protektorat der
frei das physische Material stellt, aus dem ein Umbau
Zentralvereinigung der Architekten Österreichs“, und
zu einem Großteil bestehen wird), als ihm die aus
im Museum des 20. Jahrhunderts, 1964, organisiert
früheren Nutzungen resultierenden Verhaltensweisen
von Johannes Spalt und Friedrich Kurrent. Nach 1989
eingeschrieben sind, denen sich unser aktuelles Ver-
war in Wien erst wieder in der 2014 / 15 im MAK
halten unwillkürlich akkomodiert, widersetzt oder mit
gezeigten Ausstellung „Wege der Moderne – Josef
mehr oder weniger diffusen Gefühlen der Fremdheit,
Hoffmann, Adolf Loos und die Folgen“ eine breitere
des Erstaunens oder der Ambivalenz aussetzt. Siehe
Auswahl aus dem Werk von Adolf Loos, mit Fokus auf
Hermann Czech: „Komfort – ein Gegenstand der
den Interieurs, zu sehen.
Architekturtheorie?“, in: Werk, Bauen + Wohnen
2 Die Rekonstruktion des Portals der Kärntner Bar
3 / 2003, 10 – 15).
erfolgte 1985 für die Ausstellung „Traum und Wirklich-
8 „Einige weitere Entwurfsgedanken“, in: Czech:
keit“. Das Portal wurde nach einer Zwischenstation
Zur Abwechslung, a.a.O., 1996, 81.
1986 in der Ausstellung „Vienne“ im Pariser Centre
9 … durch im Sinne von „Sachlichkeit“ konsequente
Pompidou und einer weiteren 1986 –1989 in der Arka-
Verfolgung auch widersprüchlicher Gedankenreihen
denhalle des MAK im Zuge der Anfang 1990 abge-
und Problemstellungen.
schlossenen Restaurierung der Loos-Bar durch
10 „Manierismus und Partizipation“, in: ebd., 89 – 91.
Burkhardt Rukschcio dort montiert. Siehe auch „Archi-
11 „Zur Wientalbrücke“, in: ebd., 100 –104.
tektur und Kaffeehaus“ (1988) in Hermann Czech:
12 „Mehr Licht“, in: ebd., 19 – 21.
Zur Abwechslung. Ausgewählte Schriften zur Architek-
13 „Wohnbau und Althaus“, in: ebd., 106 – 109.
tur Wien, verbesserte und erweiterte Neuausgabe,
14 Was allerdings nicht ausschließt, dass nach Czech
Löcker, Wien 1996, 123 – 124.
auch der Gegensatz eine sinnvolle Umbau-Strategie
3 „Der Umbau“, in: Adolf Loos, Red. Burkhardt
sein kann – soweit er aus einer bewussten Entscheidung
Rukschcio, Graphische Sammlung Albertina, Löcker,
hervorgeht, die das Vorhandene als integralen Teil
Wien 1989, 159 – 172. Wiederabdruck u.a. in Czech:
Entwurfsprozess versteht.
Zur Abwechslungg, a.a.O., 1996, 125 – 127.
15 „Elemente der Stadtvorstellung“, in: Czech: Zur
4 „Zur Abwechslung“, in: ebd., 76 – 79.
Abwechslung, a.a. O., 1996, 131 – 138.
5 „Nur keine Panik“, in: ebd., 63.
16 „Mehrschichtigkeit“, in: ebd., 79 – 80.
6 „Neuere Sachlichkeit“, in: ebd., 56 – 57.
17 „Räumlicher Städtebau“, in: ebd., 84.
7 2003, in dem Text „Komfort – ein Gegenstand der
18 Als statisch überbestimmt bezeichnet man Tragwerke,
Architekturtheorie?“ wird Czech dann dieses Material
in denen der Kräfteverlauf mehr als einen Weg nehmen
nochmals anders definieren: „Die ‚Zwecke‘, die als
kann, wodurch einerseits innere Spannungen auftreten
Zwangsvorgabe von außen kommen, sind […] ein
können, andererseits aber unvorhergesehene Belastun-
Missverständnis. Wie Musik mit Ohren vernehmbar
gen oder das Versagen von Bauteilen abgefedert werden
sein muss, so ist der Bau seinem Wesen nach benutzbar.
können.
Die ‚Funktion‘ ist dem Entwurf nicht vorgegeben,
19 „Ins Auge sehen“, in: Czech: Zur Abwechslung,
sondern immer erst im Entwurf vermittelt. Vorher ist
a.a.O., 1996, 128 – 130.
sie nicht da; wie Raum und Konstruktion wird sie erst durch die Architektur geschaffen. Ja, das eigentliche künstlerische Material der Architektur ist nicht der Baustoff, die Konstruktion, die skulpturale Form, nicht einmal der Raum oder das Licht – es ist das Verhalten von Menschen.“ Man könnte vermuten, dass das VorZu Hermann Czechs Text „Der Umbau“
25
Vittorio Gregotti
Von der Modifikation1 Keine neue Architektur entsteht ohne eine Modifikation des Bestehenden, aber das Interesse, das dem Begriff Umbau seit einigen Jahren entgegengebracht wird, basiert nicht auf einer so banalen Feststellung, sofern man unter Umbau die Besinnung auf die Bedeutung des Bestands als strukturelles Material und nicht als bloßen Hintergrund im Entwurfsprozess versteht. Das Projekt der Modifikation zeigt uns auch, dass jeder Fall eine spezifische Wahrheit hat, die es zu erforschen und zu enthüllen gilt, sei es als das Wesen seiner Zweckbestimmung, sei es als die einem Ort und seiner Geografie innewohnende Wahrheit: sozusagen die Materialität seiner eigenen Geschichte. Damit stellt sich die Frage, ob Entwurfserfahrung übertragbar ist und inwiefern außer den Modellen auch die Methoden, einschließlich der von Fall zu Fall spezifischen Methode, veränderbar sind. Ich betrachte daher die Idee der Modifikation in diesem Sinne als das den architektonischen Entwurf bestimmende konzeptuelle Instrument, das zunehmend ein besonderes Gewicht erlangt hat. Mehr noch, das Konzept der Modifikation könnte, bei aller unterschiedlicher Interpretation, überhaupt als das kontinuierlichste und tragfähigste Element innerhalb der Veränderungen der Architekturtheorie der letzten dreißig Jahre angesehen werden. Man könnte sich zudem fragen, ob nicht sogar eine Modifikationssprache oder eine Gruppe von Modifikationssprachen beschreibbar wäre, vergleichbar den verschiedenen Avantgarde-Sprachen, die das Neue benennen. Dazu muss zunächst berücksichtigt werden, dass sich, wenn auch in oftmals divergierenden Formen und mit teilweise fragwürdigen Ergebnissen, in den letzten dreißig Jahren innerhalb der architektonischen Kultur ein steigendes Interesse an einem anderen Begriff abgezeichnet hat, der dem der Modifikation nahesteht: dem Begriff der Zugehörigkeit. Dieser Begriff der Zugehörigkeit (zu einer Tradition, einer Kultur, einem Ort usw.) steht, gerade auch innerhalb der Tradition der Moderne selbst, der Idee der Tabula rasa gegenüber – der Idee des Neubeginns, des solitären Objekts, des unbegrenzt und gleichförmig teilbaren Raumes, die die konstruktivistische Avantgarde kennzeichnete. Er steht auch in einem klaren Gegensatz zum Prozess der Internationalisierung der Technik, der Finanzströme, der Macht, des Massengeschmacks und des Verhaltens, das uns umgibt und von dem wir offensichtlich profitieren, insofern es das besagte Raumkonzept der Avantgarde zu hochgradig effizienter, ökonomisch-technischer Signifikanz getrieben hat. Dennoch muss man auf diesen Begriff der Zugehörigkeit Bezug nehmen, um die Aufmerksamkeit für den Stoff der Erinnerung innerhalb der Avantgarde selbst zu erklären – nicht im Sinne einer Nostalgie, sondern als Aufmerksamkeit, die, durch kontextuelle Verschiebung der zum Erbe der Erinnerung zählenden Materialien, als Gegenpol, als Collage, als objet trouvé, als Konstitution neuer Ordnungssysteme und Repertoires auftritt. 26
UMBAU 29
Man könnte sich im Grunde fragen, wie sehr nicht der große Erfolg des Konzepts der „Verfremdung“, das in der klassischen Moderne so verbreitet war, der dialektischen Auseinandersetzung mit dem spezifischen Kontext geschuldet ist, wie weit also das Vorhandensein von Zugehörigkeitsregeln für diese Ausnahme notwendig ist. In der architektonischen Avantgarde gilt alle Anstrengung stets dem Neuen als einem eigenständigen Wert, der mit der Idee der Warenproduktion auf besondere Weise verbunden ist, als deren Mimesis Architektur sich behauptet. Im Gegensatz dazu artikuliert das Konzept der Zugehörigkeit das Interesse an der Geschichte der Disziplin in ihrer Kontinuität, an der Idee des Ortes als Identität, aber auch als unreines Material. Dieses Interesse entwickelt Querbeziehungen, für die der Prozess des Entwerfens im Vordergrund steht, ein Modifikationsprozess, der das in der Umgebung vorgefundene Material aufgreift, organisiert und daraus Asymmetrie, unterschiedliche Dichten und die Qualität der Vielfalt baut. Die Geschichte dieser Transformation ist langwierig und komplex und alles andere als geradlinig: Sie bildet sich eher aus Spannungsverhältnissen denn aus Übereinstimmungen und sie gehört auch zur Tradition der Moderne, nicht nur in ihren gemäßigten Spielarten, sondern – aus angemessener historischer Distanz betrachtet – auch in den Abweichungen, die jenseits der einzelnen kreativen Persönlichkeiten sogar die radikalsten Realisierungen des europäischen Rationalismus der Zwischenkriegszeit den unterschiedlichen kulturellen und konkret körperlichen Situationen entsprechend spezifisch ausformen und ausdifferenzieren. Die Verschiedenheit von Bauplätzen wurde schon in den 1950er Jahren in Ernesto N. Rogers’ Theorie der „lokalen Bestände“2 als Wert betrachtet und spiegelt sich auch im Interesse an der Geschichte als Grundlage eines Projekts wider: an einer Geschichte, welche die Idee der Moderne kritisch hinterfragt und artikuliert, deren Sinn und Grenzen erweitert und sie von einer (historischen) Position in Tradition verwandelt. Mit dem zunehmenden Interesse für die Stadt und das Territorium als primäre Materialien des Architekturentwurfs – gleichermaßen dessen Subjekt wie Inhalt – wird die Idee der Zugehörigkeit für das Projekt geradezu zu einer Lehrmeinung. Die Stadtanalyse mit ihren Studien zur Stadt und zur Beziehung zwischen Morphologie und Typologie zum einen, die Begriffe Siedlung, Umwelt und Geografie als Geschichte zum anderen bildeten die Basis für ein immer stärkeres Interesse am Ort als Fundament für das Projekt. Von der Modifikation
27
Was das Thema des spezifischen Kontexts betrifft, so bieten sich für den Entwurf zwei Methoden an: Die eine antwortet mimetisch und stilistisch, sucht die Übereinstimmung und übernimmt Motive oder Symbole; die andere kennt weder Verbindlichkeit noch sichtbare Anpassung – vielmehr nimmt die Veränderung der Beziehungen, die Konfrontation, selbst die Bedeutung einer Sprache, besser gesagt einer Tendenz, Sprache auszubilden, an. Wenn also die Qualität, die es ins Werk zu setzen gilt, aus dem Spannungsverhältnis zum Einzelfall als dem Wesen der spezifischen Aufgabe und der ortsgebundenen Wahrheit erwächst, bilden nicht nur die Unterschiede einen Wert, sondern dann bedeutet entwerfen auch, die Regeln unserer Zugehörigkeit selbst zu modifizieren. Es scheint sich also die berühmte Debatte der bildenden Kunst zwischen Modell und Ausdruck umzukehren, indem der Ausdruck3 als Interpretation des Einzelfalls strukturbildend für das Modell wirkt. Die Techniken, die durch das Projekt ins Spiel gebracht werden, entspringen den Regeln des Metiers und der Tradition der Disziplin, aber es ist die Auseinandersetzung mit dem Bauplatz und es ist der spezifische Fall, die dem Projekt selbst Konkretheit verleihen. Im Übrigen muss für das Projekt heute die Unmöglichkeit einer natürlichen Übereinstimmung mit dem Ort anerkannt werden. Die Qualität der Architektur liegt in erster Linie in der Qualität dieser Nicht-Übereinstimmung. Aus dieser Perspektive gewinnen vor allem die Ideen des Feldes, des Projektbereichs sowie die Definition der Grenzen des Eingriffs an Gewicht. Man kann mit Dislokation, Gruppierung, Konstitution neuer Hierarchien arbeiten oder mit dem Wechsel der Position der im spezifischen kontextuellen Feld vorgesehenen Materialien. Die Beziehung zwischen avancierten und angemessenen Techniken, zwischen Typologie und Topografie bildet ebenso wie das Projekt des Ortes 4 und das Erkennen eines Bebauungsansatzes5 die wesentlichen neuen Elemente einer Architektur der Modifikation. Es scheint, dass diese Feststellungen in Bezug auf einige wirkmächtige Umstände konvergieren. Der erste Umstand besteht darin, dass sich die Voraussetzungen für die Architekturproduktion in Europa radikal gewandelt haben. Die wichtigste Triebkraft der Entwicklung liegt vollständig in der Transformation der bereits urbanisierten territorialen Räume und nicht auf quantitativer Expansion. Man könnte wie so viele behaupten, dass die typische Situation in Europa seit den 1980er Jahren die des Bauens im Bestand ist. Das Vorhandene ist überall zum gebauten Erbe geworden. Jeder architektonische Eingriff wird zunehmend zu einer situationsbedingten, partiellen Transformation – Umnutzung, Restaurierung –, zugleich aber auch durch kontextuelle Bezugnahme auf bereits mit Bedeutung behaftete Materialien zu etwas Neuem und Andersartigem. Selbst die städtische Peripherie wird zu einem Ort, der durch kontextuelle Konsolidierung seine Identität sucht. Außerdem wird das Projekt als Umbau durch strategisches Vorgehen, durch zurückhaltende Eingriffe, durch 28
UMBAU 29
Vittorio Gregotti
minimale, aber weitreichende Bedeutungsänderungen bewirkende Verschiebungen zu einem wirksamen und aus gutem Grund praktikablen Instrument dort, wo es Landschaft zum Gegenstand hat – bzw. was von diesem Konzept überdauert. Der zweite Umstand hat mit der generellen Verfassung des architektonischen Denkens zu tun, das im Zeichen des Verfalls der großen Ideologien der zentralisierten Transformation und der globalen Utopien steht: sei es zu seinem Schaden oder zu seinem Nutzen. Es scheint indessen heute notwendig, am kleinen Bedeutungsunterschied zu arbeiten, auch wenn es um den großen Maßstab geht, um in den Bildungsgesetzen des Ortes den wesentlichen Stoff zu finden, der mit dem Fortschritt der Disziplin konfrontiert werden muss. Mithilfe dieses Stoffes gilt es nicht so sehr die Ziele einer großen Neuordnung als vielmehr die der Fragestellung und der Hypothese aufzuzeigen. Ohne Zweifel verweist das Thema der Zugehörigkeit unter diesen Fragestellungen auf eine Reihe besorgniserregender Unsicherheiten. Zunächst, wie können die Gefahren eines neuen stilistischen Regionalismus vermieden werden? Und wenn dieser Regionalismus sich auch als kritisch bezeichnet, wie kann man verhindern, dem Ort als charakteristischem verhaftet zu bleiben, oder einer empirischen Arbeitsweise, die das Projekt auf ein Werk der Anpassung reduziert, oder der Auflösung der architektonischen Form in einer reinen Bestandssicherung? Stattdessen soll gerade der Entwurf als Modifikation, wie ich ihn zu definieren versuche, den Ort in einen Gegenstand der Architektur verwandeln. Er soll durch die immer wieder erneuerte Entwicklung einer Besiedlung den originären und zugleich symbolischen Akt der Kontaktnahme mit dem Boden, mit der physischen Umwelt, mit der Idee der Natur als Gesamtheit der vorhandenen materiellen Dinge wieder begründen. Auf Basis einer Lektüre der spezifischen Situation wird eine Sprache der Modifikation daher in ihrem Aufbau über tragfähige Elemente verfügen müssen. Sie wird durch diese Lektüre aber nicht auf alle Elemente ihrer Grundlegung stoßen, die vielmehr nur in der Entwicklung der instrumentellen und figurativen Modelle zu finden sein werden, die die Tradition der Disziplin, von anderen spezifischen Wahrheiten ausgehend, herausarbeitet und weitergibt. Natürlich ist jede Alternative zwischen Modell und Kontext eine Vereinfachung, die, wie immer, die Wahrheit zugleich klärt und verdeckt. Die klare Unterscheidung zwischen dem Archetypischen und dem Akzidentellen ist dagegen oft eine Frage des Blickwinkels auf den spezifischen Fall. Ein architektonisches Monument ist klarerweise immer auch Erfindung eines neuen städtebaulichen Elements, einer Straßenfassade oder eines Platzhintergrunds. Die Stadtstruktur findet ihren Ausdruck gerade in den unbebauten Räumen der Stadt, wo die Definition des inneren Profils zum Element der Stabilität und der Verbindung zwischen den unabhängig voneinander konzipierten Teilen und der Komplexität des Rests der urbanen Materie wird, die es umgibt und mit der es verschmilzt. Während der poché des Von der Modifikation
29
Gebäudeplans uns hilft, Stabilität und Erfindung eines Typs zu erkennen, genügt eine [kleine] Wahrnehmungsverschiebung, damit der Plan zur Matrix wird, die den Kontext und damit den Bebauungsansatz, der ihn bestimmt, lesbar macht. Ohne Zweifel versuche ich mit dem Konzept der Modifikation als Fundament des Projekts auch eine Strategie zu beschreiben, die vor allem darauf ausgerichtet ist, Fehler zu minimieren und Hindernisse zu umgehen. Es handelt sich um eine Strategie, die von den riskanten Großzügigkeiten der Meister der Moderne weit entfernt ist und sogar eine besorgniserregende Ähnlichkeit mit dem vagen Begriff der Reform aufweist, der – undefiniert und anpassungsfähig – die Politik unserer Tage durchzieht. Mit dem Konzept der Modifikation ist also keinerlei Hoffnung auf endgültig befreiende Gesten verbunden, auf globale Versöhnungen, perfekte Übereinstimmungen oder definitive Utopien. Der Kontext bildet immer ein indirektes Material für die Absicherung einer Architektur des Ortes. Was die Architektur der Modifikation anbieten kann, ist die Beschreibung des Spannungsverhältnisses zu diesen unerreichbaren Werten, sicher nicht die Akzeptanz ihrer Auflösung in einer Dekoration unserer Umwelt. Schließlich gibt es einen letzten Grund, der für die Tauglichkeit des Konzepts der Modifikation spricht: Es ist das weit verbreitete Verlangen nach einer Atempause angesichts des unerträglichen supertechnischen und superstilistischen Geschwätzes der Architekturproduktion der letzten Jahre; das Verlangen nach einer Sedimentierung des kreativen Prozesses, einer Konsolidierung von Regeln, die spezifischen Bedürfnissen entsprechen, nach einer Rückkehr zu einem gewissen Tiefgang des Metiers im Gegensatz zur desorientierten Allverfügbarkeit der Profession. Dieser Wunsch nach einer Atempause wird sich nur erfüllen, wenn das Projekt in erster Linie stiller Umbau des spezifisch Gegenwärtigen wird. Zwischen den Zukunftsversprechen und einer Nostalgie der Integrität der Vergangenheit ist die Dringlichkeit des Projekts der Gegenwart einzufordern und die Instrumente, die ich zu beschreiben versucht habe, sind wahrscheinlich die angemessensten, um es zu realisieren.
30
UMBAU 29
Vittorio Gregotti
1 Der italienische Begriff modificazione oszilliert zwi-
Es geht um die sowohl physische als auch symbolische
schen Modifikation, Veränderung, Umbau. Die engli-
Verankerung des Projekts im Boden, der mit allen seinen
sche Übersetzung On Modification legte auch im
im Projekt aufgegriffenen und modifizierten Spuren
Deutschen die größere Worttreue nahe. Im Textverlauf
früherer Nutzungen und Veränderungen als Substrat
wird fallweise der Begriff Umbau verwendet, wenn
des Ortes angesehen wird. Durch Modifikation des
Modifikation zu spezifisch erscheint.
Untergrunds, des Geländes, der Erschließungen und
2 preesistenze ambientali – Der Begriff wird mit wört-
schließlich der Materialität, Gestaltfindung und
lichen Übersetzungen wie „Präexistenz(en) der Umwelt“
Nutzung der Oberfläche erfährt dieser Boden / Ort seine
nur unzureichend erfasst. Umweltbestände deuten schon
neue Präsenz.
besser die konkreten Bezüge an, die hier angesprochen
5 principio insediativo – Dieser wörtlich als „Prinzip
sind. Tatsächlich geht es aber um Bestände, die sich
der Besiedlung“ zu übersetzende Begriff könnte im
„vor Ort“ oder „in der Umgebung“ befinden, also um
Deutschen irreführende Assoziationen zum Siedlungs-
den konkreten, sei es natürlich oder baulich gegebenen
bau oder zur Untersuchung von Siedlungsformen her-
Kontext eines Projekts.
vorrufen. Beides wäre verkürzend. Es geht hier vielmehr
3 Im Original parti und rendu, zwei Begriffe aus der
um den konkreten räumlichen Entwurfsansatz, der aus
Entwurfstheorie der französischen Akademie des
dem Projekt des Ortes / Bodens heraus Grundstrukturen
18. Jahrhunderts.
und Beziehungsmuster festlegt, die in die Anordnung
4 progetto del suolo – wörtlich Projekt des Bodens
der wesentlichen physischen und funktionalen Elemente
bzw. der Oberflächengestaltung, dem Sinn nach umfasst
des Projekts übertragen werden. Daher scheint uns hier
der Begriff aber wesentlich mehr als im deutschsprachi-
die Übersetzung mit dem konkret entwurfsbezogenen
gen Raum unter Oberflächengestaltung verstanden wird:
Begriff des „Bebauungsansatzes“ zielführender.
Von der Modifikation
31
Paolo Vitali
Zwischen Geografie und architektonischem Zeichen Modifikation als konzeptuelles und operatives Instrument im Denken von Gregotti
„Architektur hat die Aufgabe, das Wesen des Ortes durch Modifikation zu enthüllen.“ Vittorio Gregotti, 1982 (Vorwort zur französischen Ausgabe von Il territorio dell’architettura) Eine Gruppe junger italienischer Architekten und Kritiker trat vor einigen Jahren mit der Forderung nach einer Erneuerung der theoretischen Grundlegung der Disziplin hervor. Dem krisenhaften Zustand der zeitgenössischen Architektur und insbesondere der Entwurfspraxis sollte durch eine Auseinandersetzung mit den theoretischen Positionen der 1960er und 1970er Jahre, den nach Meinung dieser Gruppe letzten relevanten architektonischen Ansätzen im kulturellen Kontext der italienischen Architektur, begegnet werden. Diese Erneuerung sollte sich sowohl der „Rhetorik der Zerstreuung“ und den „relativistischen Abwegen“ als auch dem „analytischen und veristischen Fetischismus“ entgegenstellen, „der die Debatte über die Architektur und über die Stadt überrollt“ hätte.1 Die Suche nach einer tragfähigen, theoretischen Basis der architektonischen Arbeit – um mit den Worten von Aureli, Costa, Kim, Mantia und Skansi zu sprechen: „eine klare ideologische Positionierung in Bezug zur Sprache der Architektur als kritischem Dispositiv gegenüber der Realität“ – ist ein Argument, das in den Diskussionen um Grundsätze und Praxis der italienischen Architektur zyklisch wiederkehrt, oszillierend zwischen der Notwendigkeit einer näheren Auseinandersetzung mit der Realität und der Flucht vor dieser in eine ersehnte Autonomie. Die von dieser Gruppe ausgelösten Diskussionen waren so gesehen zunächst exemplarisch für den Umgang mit den Leistungen einer „Vätergeneration“, die in einer bis heute männerdominierten Architekturszene Italiens positiv wie negativ zur Verteidigung des eigenen Standpunkts instrumentalisiert wird.2 Derartige Bezugnahmen engen die Lektüre der Schlüsseltexte der italienischen Nachkriegsarchitektur meist auf deren ideologische Positionierungen ein, die in ihrer Zeitgebundenheit und oftmals nachträglichen Zuspitzung die Aktualität der Inhalte und gedanklichen Ansätze, aber auch deren Ursprünge in interdisziplinären, europäischen Diskursen verdecken. Die noch in den ambivalenten Verstrickungen der italienischen Moderne mit dem faschistischen Regime wurzelnden Kämpfe zwischen Rationalisten und Organikern in der Nachkriegszeit, die Zersplitterung der Linken in den aufreibenden Rückzugsgefechten 32
UMBAU 29
Die frühe Intuition der „Form des Territoriums als Instanz der integralen Veränderbarkeit der Umwelt“, die in der Folge kontinuierlich artikuliert und argumentiert wird, ist wahrscheinlich das Zentrum, um das sich sein Theoriegebäude dreht …
Zwischen Geografie und architektonischem Zeichen
33
der 1970er Jahre und die sich ab 1980 konsolidierenden „Schulen“ wirken in der Rezeption dieser Schriften bis heute nach. Eine weniger instrumentalisierende Lektüre dieser Texte wäre also angebracht. In diesem Rezeptionskontext ist auch Vittorio Gregottis hier erstmals auf deutsch publizierter Text „Von der Modifikation“ zu sehen, der in seinen Fragestellungen und Thesen auf dessen grundlegende Schrift von 1966 Il territorio dell’architettura 3 zurückgeht und in einer ersten Fassung 1984 als Leitartikel der Casabella-Ausgabe „Architettura come modificazione“ erschienen ist. Dabei darf nicht übersehen werden, dass die bis heute an italienischen Fakultäten präsenten „heiligen Texte“ Rossis, Tafuris oder Gregottis aus den 1960er Jahren selbst durch diese Suche nach einer theoretischen Basis motiviert waren. Innerhalb dieses Kanons war es Gregottis besonderer Beitrag, die Erforschung des „Territoriums“ der Disziplin und des Territoriums der Stadt, eines geografischen Raums oder einer Gesellschaft, also der Autonomie und Heteronomie der Architektur, von Anfang an in ihrer wechselweisen Bezugnahme zu untersuchen. Die Genese eines Gutteils der theoretischen Reflexionen der italienischen Nachkriegsarchitektur (von Persönlichkeiten wie Rogers und Zevi bis zu den sogenannten „heiligen Texten“) ist im Zusammenhang von Forschungsarbeiten zu suchen, die (wenn auch in dialektischer Beziehung) Praxis und Theorie in sich vereinigten. Gregotti spricht diesbezüglich von „zwei Seiten des Projekts, die wechselseitig bedingt und unerlässlich“ sind, im Bewusstsein, dass „jeder Anlassfall eine spezifische, zu erforschende Wahrheit bietet“, sowie andererseits auch die Chance für „einen Neubeginn, eine technisch präzise Gründung“.4 Das trifft sicherlich auch für die eigene Arbeit Vittorio Gregottis zu, der, wie Leonardo Benevolo schreibt, im Lauf seiner langen Karriere als „ausübender Architekt, Theoretiker, Kritiker und Universitätslehrer [...] die gesamte Bandbreite der kulturellen Erfahrungen seiner Zeit“ 5 aufweisen kann und der diese Position stets in Theorie und Praxis vertreten hat. Für Gregotti war die „Unvermeidbarkeit der theoretischen Reflexion als konkretes Fundament des Projekts in der Gegenwart“ seit der Zeit der Arbeit an Il territorio dell’ architettura 6 ebenso klar wie dass „diese theoretische Reflexion aus der Bezugnahme zwischen einer Lektüre der Regeln und Prinzipien der spezifischen Situation und der Erfahrung und Tradition gewonnen wird“.7 Schon damals folgte für ihn daraus auch die Notwendigkeit, die Begriffe dieser Reflexion – der komplizierten Beziehung von Projekt und Geschichte – neu zu definieren und zu präzisieren, ohne „sich Illusionen zu machen über den ‚universellen‘ Wert unserer Theorien oder über die Übertragbarkeit von Modellen und Methoden“. Worauf er es anlegt, ist nicht weniger als eine „experimentelle, antidoktrinäre und problembewusste Entwurfsmethode“, eine offene Forschung.8 Die frühe Intuition der „Form des Territoriums als Instanz der integralen Veränderbarkeit der Umwelt“, die in der Folge kontinuierlich artikuliert und argumentiert wird, ist wahrscheinlich das Zentrum, um das sich sein Theoriegebäude dreht, das auf der 34
UMBAU 29
Paolo Vitali
Übertragung der „Materialien der Architektur von den abstrakten, modellhaften Kategorien in die wiedererlangte Körperlichkeit der ‚Kontexte‘, der ‚Orte‘ und der ‚Lagen‘“ aufbaut.9 „Die spezifische Wahrheit ist die des Ortes“ unterstreicht Gregotti immer wieder: „Die Geografie des Ortes als physische Seinsweise seiner Geschichte ist es, die, indem sie begrenzt, zu handeln erlaubt.“10 Fundament dieser Theorie des Ortes ist eine Lektüre von Husserls Phänomenologie, die in Il territorio dell’architettura eine zentrale Rolle spielt. Die für Gregotti prägende Auseinandersetzung mit der Phänomenologie Edmund Husserls geht auf die Bekanntschaft mit dem italienischen Philosophen Enzo Paci zurück, der nach dem Zweiten Weltkrieg die Phänomenologie in Italien bekannt machte.11 Mit Paci, der unter der Leitung von Ernesto N. Rogers ebenso wie Gregotti seit Anfang der 1950er Jahre Redaktionsmitglied von Casabella.Continuità war, kam Gregotti zu dieser Zeit auch mit dem Freundeskreis von Schriftstellern, Künstlern und Intellektuellen in Mailand in Berührung, der sich um die 1946 von Antonio Banfi gegründete antifaschistische „Casa della Cultura“ formiert hatte. Von Husserls Auffassung der Phänomene als „Zeitobjekte“, die „Zeitextensionen auch in sich enthalten“, inspiriert, scheinen insbesondere Gregottis Interpretationen der Historizität der Orte und des Territoriums als Schrift.12 Diese Orientierung auf die Frage des Territoriums, die sich als „spezifisches Ergebnis der architektonischen Bestimmung der Orte innerhalb eines territorialen Kontexts“13 versteht, soll die Grundlage für den Aufbau eines neuen architektonischen Vokabulariums und Instrumentariums werden, einer neuen wissenschaftlichen und didaktischen Terminologie, in der die spezifischen, neu konzipierten oder gefundenen Termini zu tatsächlich operativen Begriffen werden, zu Instrumenten des Entwurfs, zur „Synthese zwischen abstrakter Konzeptualisierung und dem ‚konkreten Handeln‘ des Entwerfers“.14 Es geht hier, wie angedeutet, um eine Orientierung, die den sozialen Umbrüchen und den „operativen Konjunkturen“ aufmerksam, aber nicht hörig gegenübertritt. Das zeigt sich in Gregottis Reflexionen während der Zeit seiner Leitung von Casabella (1982 – 1996) durch die Untermauerung eines Standpunkts, der das Thema der Transformation, als Modifikation des Bezugssystems verstanden, des „Bauens im Gebauten“ thematisierte, das er, vor dem Hintergrund der 1980 er Jahre, vorausblickend als Teil eines strukturellen Wandels der Arbeitsbedingungen im Feld der Architektur in Europa erkannte. „Jeder architektonische Eingriff“, unterstreicht Gregotti, „wird zunehmend zu einer situationsbedingten, parziellen Transformation: Umnutzung, Restaurierung – zugleich aber auch, durch kontextuelle Bezugnahme auf bereits mit Bedeutung behaftete Materialien, zu etwas Neuem und Andersartigem“.15 Im Licht von all dem und in Anbetracht der Aktualität dieser Gedanken ist es interessant, heute den Essay „Von der Modifikation“ wieder zu lesen. Der Essay entstand aus der Überarbeitung eines Casabella-Editorials von 1984 16 für die 1991 erschienene Textsammlung Dentro l’architettura.17 Casabella spielte unter der Direktion von Vittorio Gregotti eine unzweifelhafte, wenn auch nicht programmatische Rolle in der Theoriebildung innerhalb der italienischen Architekturlandschaft. Die Zeitschrift wurde für Gregotti, was sie 20 Jahre früher auch für Rogers gewesen war 18: ein Instrument „für eine kohärente Möglichkeit einer kritischen und offenen Wissensvermittlung“ und Ort wichtiger konzeptueller Arbeit. Die Veröffentlichung des Textes in Casabella lehrt uns einiges über die Art, mit der der Autor die Idee der Entwicklung einer Entwurfstheorie konzipierte: Zwischen Geografie und architektonischem Zeichen
35
als aufmerksame und geduldige Forschung, die über das Schreiben erfolgt. Wobei Schreiben das Ergebnis eines Nachdenkprozesses ist, der „von der Sorge um Systematik frei ist“ und „einer rigoros organisierten Methodik“ des Berufswissens ein Experimentierfeld vorzieht: ein widersprüchlicher, nicht systematischer Prozess, mehr Übung als Traktat, mehr Versuch als abgeschlossenes Werk, der sich „[der Frage nach] einer Definition des Aufgabengebiets und der Artikulation des Architekturentwurfs widmet“. Ein Schreiben, das „nur eine Reihe von Hinweisen auf umsichtige und vernünftige Vorgangsweisen“ gibt, das aber auch, durch seine Fähigkeit, das Denken zu organisieren, als Moment einer kritischen Bezugnahme auf die Wirklichkeit fungiert, als vorbereitendes und ergänzendes Moment einer Ordnung des Entwurfs. Als Moment, in dem „die in sprachlichen Termini gedachte und ausgedrückte Reflexion, die von Beginn an mit der Erinnerung und der visuellen Vorstellung aufs engste verknüpft ist, sich in konkretes Material des Architekturentwurfs verwandelt“.19 Schließlich kann nach dieser Auffassung der Entwurf selbst Eigenschaften einer Schrift annehmen, die als Ordnungsprinzip „nicht so sehr die Grenzen seines Territoriums absteckt, sondern vielmehr die brüchige, geologische Tiefe der Schichten seiner Implikationen ergründet, wie auch die Verbindungen zu den unterschiedlichen Ebenen der Wirklichkeit und zu deren Formen“.20 Gregotti baut seine Argumentation ausgehend von dem Paradox eines für die Architektur scheinbar so trivialen Begriffs wie des Umbaus auf, der aber als „konzeptives Instrument, das den Architekturentwurf anleitet“,21 reich an theoretischen Implikationen ist: ein strukturelles Element, geeignet, den Entwurfsgedanken in einer langfristigen historischen Perspektive wiedereinzugliedern und seine Verbindungen mit der Tradition wieder herzustellen – mit einer „Tradition der Moderne“, einer Tradition des Berufsfelds, die als durchgängiges Gewebe einen Ort der Konfrontation von Erfahrungen bilden kann. Gregotti sieht Modifikation als einen Begriff, der sich in dialektischer Weise mit dem der „Zugehörigkeit“ verbindet, eine „eigentliche Schule des Projekts“, die in der Lage ist, sich der „Indifferenz gegenüber dem Ort, dem Gedanken der Autonomie des Objekts und der Auslöschung des historischen Raums“,22 welche die radikalsten Abwege der Avantgarden ausgezeichnet hatte, zu widersetzen und das moderne Erbe an der Geschichte der Disziplin wiederzugewinnen. In diesem Sinn ist der Ansatz kulturell offensichtlich Ernesto N. Rogers geschuldet. Gregotti selbst betont, dass die Theorie der „lokalen Bestände“ von Ernesto N. Rogers schon in den 1950er Jahren die Verschiedenheit von Bauplätzen als Wert betrachtet hatte,23 was auch durch das Interesse an der Geschichte als Material des Projekts Bedeutung bekam: eine Geschichte, welche die Idee der Moderne kritisch hinterfragt und artikuliert, eine Geschichte, die Sinn und Grenzen der Moderne erweitert und sie von einer Position in eine Tradition verwandelt.24 Genauso evident ist aber die konzeptuelle Verschiebung, die Gregotti vorschlägt, indem er die Frage der Lage in ihrer komplex36
UMBAU 29
Paolo Vitali
en Beziehung zum Projekt ins Zentrum rückt, die Idee des Ortes als Fundament, die ihre Synthese im Begriff des „Bebauungsansatzes“ erfährt, der sich „immer wieder als Akt der Gründung und zugleich der Entschleierung des historischen Kontexts“ zeigt.25 Die Implikationen dieser Verschiebung werden von Gregotti selbst in einem wichtigen Beitrag aus dem Jahr 1983 geklärt: „Der ärgste Feind der Architektur der Moderne ist jene Auffassung vom Raum, die ihn lediglich ökonomisch und technisch betrachtet und gleichgültig ist gegenüber jedem anderen Wert eines Ortes. Die gebaute Umwelt [im Sinne von Husserl und der Phänomenologie, Anm. d.A.], die uns umgibt, ist […] die physische Darstellung ihrer eigenen Geschichte. Was sie charakterisiert, ist die Art und Weise, in der sich die verschiedenen Bedeutungsebenen, welche die spezifische Qualität des Ortes hervorbringen, überlagert haben, nicht nur, soweit sie unserer Wahrnehmung zugänglich sind, sondern auch durch das, was den Ort in struktureller Hinsicht ausmacht. […] Durch den Begriff des Ortes und die ihm entsprechende Bebauungsform wird die Umwelt zum konstitutiven Element architektonischen Schaffens. Daraus ergeben sich neue Prinzipien und Entwurfsmethoden, die der Anordnung des Objekts in einem spezifischen Gebiet den Vorrang geben und die Veränderungen des Kontexts im architektonischen Eingriff erkennen lassen. […] Der Ursprung der Architektur liegt weder in der Urhütte noch im mythischen ‚Haus Adams im Paradies‘. Noch bevor eine Stütze zur Säule wurde, ein Dach zum Tympanon und bevor man noch Stein auf Stein setzte, hat der Mensch einen Stein auf die Erde gesetzt, um einen Ort mitten in einer unbekannten Welt wiederzuerkennen, um ihn zum Gegenstand der Anschauung zu machen und zu verändern.“ 26 Modifikation ist in dieser Perspektive also wesentlich mehr als die simple, physische Transformation eines Ortes: Sie ist „Besinnung auf die Bedeutung des Bestandes als strukturelles Material und nicht als bloßen Hintergrund im Entwurfsprozess“.27 Weil „nur die Begegnung mit dem Ort (und der spezifische Fall) dem Projekt Konkretheit verleiht“.28 Das Projekt als Dialog, als „Sprache des Wissens vom Ort“, als „System der Beziehungen zwischen den Dingen, die einen besonderen Wert erlangen ausgehend von ihrer eigenen Position, und daher auch im Verhältnis zu den Positionen des Bestandes“, als System, das „heute die Unmöglichkeit einer natürlichen Übereinstimmung mit dem Ort anerkennen [muss]. Die Qualität der Architektur liegt vor allem in der Qualität dieser Nicht-Übereinstimmung.“ 29 Die Aktualität des Begriffs der Modifikation – „Dialektik mit der historisch-geografischen Vergangenheit“ als notwendige Vorbedingung des „Projekts der Zukunft“ – liegt also in seiner Fähigkeit, Architektur weiterhin über ihr eigenes Wesen und über die Zwischen Geografie und architektonischem Zeichen
37
Natur des Projekts als „Ordnungshypothese“, die dem „gesamten physischen Umfeld“ Bedeutung verleiht, zu befragen. Zwar haben sich seither die Rahmenbedingungen in den innerdisziplinären Debatten, in der Wirtschaft, in der Gesellschaft und im kulturellen Leben wesentlich gewandelt,30 sodass es den Anschein hat, als wären die Voraussetzungen abhanden gekommen, denen diese Debatte ihren Ursprung verdankte. Auch könnte man meinen, dass für ein Verständnis der Zukunft der Architektur im Zeitalter der Globalisierung wenig davon zu erwarten ist, „zu verstehen, wie wir modern sein können, ohne den Kontakt mit unseren Ursprüngen zu verlieren“.31 Und auch wenn manche seiner Entwurfsentscheidungen nicht der Konsequenz von Gregottis theoretischen Ansätzen standzuhalten scheinen, so hat uns seine Architekturlektion, die auf der Idee aufbaut, nach „Einzelobjekten“ vorzugehen und „lieber minimale, spezifische Verschiebungen vorzunehmen, als sich den Gesetzen einer totalisierenden Utopie zu beugen, die vorgibt jede Geste zum Modell zu machen“,32 dennoch auch heute noch vieles aufzuzeigen.
1 Pier Vittorio Aureli / Andrea Costa / Ilhyum Kim /
L’architettura della città und Manfredo Tafuris
Giuseppe Mantia / Luca Skansi: Città e Architettura.
Teorie e storia dell’architettura von 1968 ist Il territorio
Note a margine della crisi, „Arch’it“ (files),
dell’architettura einer der „Meilensteine“ italienischer
http://architettura.it/files /20091209/ (09.12.2002).
Architekturtheorie der zweiten Hälfte des 20. Jahr-
2 Eine Gegenposition bezog in den durch dieses
hunderts.
Manifest ausgelösten Diskussionen z. B. Luca Molinari,
4 Vittorio Gregotti: „Premessa“, in: Sergio Crotti (Hg.):
Kritiker, Architekturhistoriker und seinerzeit wissen-
Vittorio Gregotti, Zanicchelli, Bologna 1986, 7.
schaftlicher Leiter der Architektursektion der Mailänder
5 Leonardo Benevolo: Storia dell’architettura moderna
Triennale. Er forderte eine kritische Aufarbeitung des
(15. Auflage), Roma – Bari 1990, 974.
kulturellen Erbes der italienischen Architektur und
6 Vittorio Gregotti: Il territorio dell’architettura,
Theorie der 1960er Jahre, deren Erfolg er mit dem
Milano 1966.
Scheitern einer radikaleren Moderne im Allgemeinen
7 Gregotti, „Premessa“, a.a. O., 6.
und der „architettura radicale“ im Besonderen in
8 Crotti: „Sperimentalismo disciplinare“, in: ebd., 13.
Zusammenhang bringt; er fordert stattdessen eine
9 Crotti: „Un mestiere impaziente“, in: ebd., 8 – 9.
intensive Auseinandersetzung mit den herausragenden
10 Gregotti: „Premessa“, a.a. O., 7
Beispielen einer kontextuellen Praxis zwischen u. a.
11 Siehe insb.: Enzo Paci: Tempo e relazione, Torino
Mario Ridolfi, Giancarlo de Carlo und Gino Valle.
1954, und Tempo e Verità Nella Fenomenologia di
(L. Molinari: La realtà ha bisogno dell'architettura,
Husserl, Milano 1961; Pacis Lektüre von Husserl, der
“Arch’it” (files), http://architettura.it/files/20021226/
für ihn während seiner gesamten philosophischen –
(26. 12. 2002).
Laufbahn der wichtigste Bezugspunkt blieb, erfolgte
3 Neben Aldo Rossis ebenfalls 1966 erschienenem Buch
von der Position seines von Sartre beeinflussten
38
UMBAU 29
Paolo Vitali
Existenzialismus und kritischen Marxismus. Die
20 Gregotti: „Io scrivo che Omero racconta…“
Methode der Epoché als vorurteilslose Konfrontation
(Editorial), in: Casabella 546, Mai 1988, 2 – 3, neu in:
mit der „vorgegebenen Welt“ und die Fähigkeit des
ders.: Le scarpe di Van Gogh. Modificazioni nell’archi-
Menschen, in der Gegenwart der „Lebenswelt“ die
tettura, Torino 1994, 39.
Welt zu entdecken, die ihr vorausging, stellen zentrale,
21 Gregotti: „Della modificazione“, a.a. O., 70.
auf Husserl bezogene Themen in Pacis Philosophie dar.
22 Crotti:„Progetto come modificazione“, in: ders.(Hg.):
12 Edmund Husserl: Ding und Raum – Vorlesungen
Vittorio Gregotti, a.a. O., 14.
1907, Husserliana Bd. XVI, 60 – 65. Zur zeitlichen
23 Rogers: „Le preesistenze ambientali e i temi pratici
Konstitution der vorkategorialen „Lebenswelt“ siehe
contemporanei“, in: Casabella.Continuità 204,
auch Pacis Vortragstext „Il significato dell’uomo in
Februar – März 1955, 3 – 6.
Marx e in Husserl“ (Vortrag am 24. 10. 1962 in Prag,
24 Gregotti: „Della modificazione“, a.a. O., 72.
publiziert in Aut Aut Nr. 74, 1963).
25 Crotti: „Un mestiere impaziente“, a.a. O., 8.
13 Crotti: „Un mestiere impaziente“, a.a. O., 8.
26 Grußbotschaft von Vittorio Gregotti an die „New
14 Crotti: „Sperimentalismo disciplinare“, ebd., 13.
York Architecture League“, 1983, in: Kenneth Frampton:
15 Gregotti: „Della modificazione“, in: ders., Dentro
Storia dell’architettura moderna, Bologna 1993, 390,
l’architettura, Torino 1991, 73.
ebenso ders.: Tettonica e architettura. Poetica della
16 Gregotti: „Modificazione“, in: Casabella, 498 – 499
forma architettonica nel XIX e nel XX secolo, Milano
(Architettura come modificazione), Jänner – Februar
1999, 26 – 27.
1984, 2 – 7.
27 Gregotti: „Della modificazione“, a.a. O., 70.
17 Anhand von acht Begriffen – Präzision, Technik,
28 Gregotti: „Premessa“, a.a. O., 7.
Monumentalität, Modifikation, Atopie, Einfachheit,
29 Gregotti: „Della modificazione“, a.a. O., 73.
Methode und Bild – schlägt das Buch den Umriss einer
30 Zur Einsicht in die Notwendigkeit, die Entwurfs-
„möglichen Architektur einer neuen Moderne“ vor.
strategien im physischen Raum den veränderten sozialen
Gregotti: Dentro l’architettura, a. a. O.
und ökonomischen Bedingungen anzupassen, siehe
18 Ernesto N. Rogers leitete die Zeitschrift Casabella –
Bernardo Secchi: „Le condizioni sono cambiate“, in:
von ihm programmatisch in Casabella. Continuità
Casabella 498 – 499, a.a. O., 8 – 13 (s. Anm. 16).
umbenannt – 1953 – 1964. „In der Redaktion von
31 Einer der entschiedenen Verfechter dieser Position
Casabella.Continuità bildete sich eine permanente
ist Kenneth Frampton: „Was in der Architektur zählt –
Arbeitsgruppe, bald unter dem Namen ‚Centro Studi‘
so Frampton – ist Aufmerksamkeit für regionale Kul-
bekannt, mit explizitem Verweis auf seine Bestimmung
turen, für die städtischen und geografischen Referenzen
als Ort der Debatte und der Forschung, wo junge
und für traditionelle Werte.“ L. Prestinenza Puglisi:
Forscher zusammenkommen, die sich wenig später zu
Silenziose avanguardie. Una storia dell’architettura
neuen Persönlichkeiten der italienischen Architektur
1976 – 2001, Torino 2001, 155.
entwickeln sollten, wie Giancarlo de Carlo,
32 Gregotti: „Modificazione“, a.a. O., 4.
Vittorio Gregotti, Francesco Tentori und Aldo Rossi, die in diesem fruchtbaren Kontext ihren Platz fanden, um ihre persönlichen, unterschiedlichen und besonderen Berufungen und Poetiken zu entfalten.“ Siehe O. S. Pierini: Continuità e discontinuità in Casabella e Spazio, https://taccuinourbano.net/ 2015/ 01/27/continuita-e-discontinuita-in-casabella-espazio (27. 01. 2015). 19 Gregotti: Il territorio dell’architettura (nuova edizione), Milano 2008 (1966), III. Zwischen Geografie und architektonischem Zeichen
39
Autor
Thema_Teil 2 Stadtumbau
Manfred Russo
Umbau anders. Smart City als Interface Wenn hier der Versuch unternommen werden soll, einige neu aufkommende Phänomene der Stadt von Morgen, die der Vereinfachung halber mit Smart City bezeichnet wird, aus der Perspektive der Designwissenschaften und einer durch System- bzw. Medientheorie inspirierten Architekturanschauung zu beschreiben, so vor allem deshalb, weil diese Erscheinungen weder mit herkömmlichen Stadtsoziologien noch mit Architekturtheorien der Stadt angemessen zu erfassen sind, sondern bei näherer Betrachtung einer völlig anderen Logik zu folgen scheinen. Weder Kunst noch Zustimmung oder Ablehnung zur Geschichte spielen hier eine Rolle, vielmehr ist es die Entwicklung von Medien, primär Kommunikationsgeräten, die das Design, die Systeme und Strukturen beeinflussen. Vor dem Hintergrund des Hertzian space wird Design von vornherein als eine Lebensform oder Kulturtechnik als medieninduziertes Zusammenspiel von Gerät, Mensch und Umwelt gedacht. Die in unglaublicher Weise zunehmende Kompetenz in der Prozessierung von Daten mittels Speicherung, Netzwerken und Graphiken ist in der Lage, nahezu jedes vorstellbare Gerät zu entwickeln und vor allem alle miteinander zu verbinden. Zugleich verschwinden die PCs, werden gleichsam unsichtbar, durchdringen aber immer mehr Lebensbereiche und wandern in andere Gadgets wie das Smartphone aus. Bill Gates hat das Szenario der Smart City als einen Raum beschrieben, der mit Sensoren gespickt ist und mittels Software über Netze zu einer perfekten Zirkulation des Verkehrs und des Energieverbrauchs führt. Das Smartphone wird zu einer Art intelligenten Kompass, der den Stadtbewohner durch das Chaos des Alltagslebens leitet und darf nicht als ein modisches Spielzeug betrachtet werden, das bald wieder verschwinden wird, sondern es ist die konsequente Entwicklung einer anthropologischen Mediologie, die in dieser Form bereits 1949 durch Ernst Jüngers „Phonophor“ in seinem Roman Heliopolis antizipiert wurde. Das Smartphone wird heute dazu ausgelegt, das urbane Leben durch nützliche Orte 1 zu personalisieren, indem ständig alle zum Profil passenden Lokale und Geschäfte der jeweiligen Umgebung empfohlen werden, soziale Kontakte über Plattformen wie Facebook oder Twitter abgewickelt werden.2 Am Smartphone erscheinen die Stadt und in Hinkunft wohl auch zahlreiche Elemente des Wohngebäudes als Benutzeroberfläche, deren Funktionen in zunehmender Weise über den integrierten Computer zu regulieren sein werden. Architekten und Stadtplaner werden sich darauf einstellen müssen, diesem Bedarf und dem neuen Charakter von Benutzeroberflächen zu entsprechen. Die Wahrnehmung von Architektur und Stadt durch künftige Generationen wird möglicherweise von den äußeren symbolischen Qualitäten absehen bzw. sie in völlig neuer Weise formatieren, weil Wahrnehmung und Kommunikation über eine dominante Interaktion mittels Interface ablaufen werden. Durch die revolutionären Methoden des elektronischen Mappings wird zugleich ein virtueller Raum etabliert, in den man jederzeit wechseln 42
UMBAU 29
kann und der ein Eindringen in den realen Raum oder auch umgekehrt möglich macht.3 Damit kann die uralte Grundfunktion der Architektur, die Abschirmung als eine Differenzierung zwischen Innen und Außen, zwar nicht aufgehoben, aber doch komplexer organisiert werden, weil die Grenzen zwischen realen und virtuellen Raum verwischt werden. Das wirft zahlreiche weitere Fragen auf, die sich auf den medialen Charakter der Architektur beziehen, etwa inwiefern die Architektur zu einem Medium neuer Kulturtechniken wird, ob und wie die neuen Techniken Lebensweisen ausbilden und in Verbindung mit den Gadgets die architektonischen Formen ändern und vor allem, wie die Formreferenz – mithin die zentrale Eigenschaft des Architekten – sich verändert, vermindert oder erweitert wird. Die neu formatierte Operativität der Architektur in der Smart City bezieht sich auf Räumlichkeiten, die durch ein System von Öffnungen und Schließungen gekennzeichnet sind. Der Netzcharakter der Architektur ist nicht nur innerhalb der Gebäude verwoben, sondern steht vor allem in Zusammenhang mit der Stadt, ebenso wird ein völlig neuer Verkehrscharakter der Stadt durch Kommunikation erzielt. Es sei erwähnt, dass eine derartige Entwicklung natürlich auch begründete Befürchtungen hinsichtlich eines Demokratieverlusts hervorruft bzw. eines Rückzugs in eine Art von elektronischem Kokon, eines telecocoon 4, der eine Teilnahme am Leben im öffentlichen Raum verhindert, weil man diesen nur mehr als eine Ausweitung des eigenen privaten Raums betrachtet, der einer ständigen Rationalisierung der eigenen Interessen dient. Vieles spricht auch für das Zukunftsszenario einer kommunitaristischen Stadt, deren Bewohner sich auf die Beobachtung der Identität der eigenen oder ähnlicher Gruppen konzentrieren und den Kontakt zu fremdartigen Gruppen vermeiden. Dies scheint insofern nicht unplausibel, als aufgrund der Deterritorialisierung durch die neuen Medien eine kompensatorische Retribalisierung entsteht. In anderen Worten: Der Verlust des Territoriums erzeugt eine Renaissance des Stammesdenkens. Die Technologie der neuen Medien, die eine Voraussetzung der Smart City darstellt, löst den Raum in Zeit auf. Distanzen werden immer schneller überwunden, Menschen, Waren und Finanzen zirkulieren unaufhörlich. Die Kommunikation, die über elektromagnetische Strahlungen erfolgt, kann keine Raumgrenzen beachten, sie führt zur Weltgesellschaft, die grundsätzlich ortlos ist. Insoferne könnte sich die Smart City zu einer merkwürdigen Kreuzung aus einer Kommunikation von neuen Medien, die den Charakter der Weltkommunikation 5 aufweist, aber andererseits einer Stadtbevölkerung, die gerade deshalb zu Gemeinschaft und Zugehörigkeit, zu Community und Lokalität tendiert, entwickeln. Freilich wird es auch in zunehmender Weise unklar, wie das demokratische Potenzial des öffentlichen Raums der Stadt zu beurteilen ist, wenn die politische Öffentlichkeit ihre Räume nicht nur längst in die traditionellen Medien (Habermas) verlagert hat, sondern mittlerweile auch in die Räume der neuen Medien diffundiert, die zunehmend kommunitaristischen Charakter annehmen. Allerdings weisen auch Untersuchungen darauf hin, dass es zu einer simultanen Überlagerung von öffentlichen und privaten Sphären kommen kann, wenn etwa bei japanischen Jugendlichen eine Aufmerksamkeitsteilung zwischen der physischen Situation, in der sie sich befanden, und den gleichzeitigen medialen Kontakten mit anderen konstatiert wurde. Man kann demnach von einer Vordergrund- und Hintergrundaufmerksamkeit und einem gleichzeitigen Hin- und Herpendeln zwischen Kommunikation im physischen Raum und den Chats durch SMS sprechen.6 Hier wird die Idee Umbau anders. Smart City als Interface
43
einer Membranfunktion des Smartphones ins Spiel gebracht, die uns die Regulierung der Kontakte zur Umwelt ermöglicht und abwesende Andere entweder ruft oder nicht ruft.7 Jedenfalls darf die Behauptung aufgestellt werden, dass das Design der Smart City unter dem Paradigma der Kommunikation steht. Diese Entwicklung ist nicht neu, aber dennoch noch lange nicht ausreichend verstanden. Die Orientierung des Designs an Kommunikation kündigt sich bereits durch die Ablösung von den älteren ästhetischen Theorien an. Fortan zählte nicht mehr die Mimesis der Natur, sondern Technik und Wissenschaft bilden die Grundlagen des Designs, ebenso ist der Designer kein übergeordneter Künstler, kein Genie mehr, sondern ein Partner im Prozess der industriellen Produktion. Wenn der Mensch kein Naturwesen mehr ist, ist er gezwungen, sich in Synergie und Innervation mit der Technik zu entwickeln. Es gibt kein Sein apriori, sondern gemäß dem Satz Heideggers nur ein „Entwerfend sein zu einem Sein-Können“.8 Daher kann Otl Aicher auch vom Menschen behaupten: „Er ist nicht, er richtet sich ein […] erst Geräte, solche des Machens und solche der Kommunikation vervollständigen uns und setzen uns in unsere Menschlichkeit ein. Der Mensch, jeder einzelne entfaltet sich nach Maßgabe seiner richtigen Geräte.“ 9 Bei Otl Aicher vermittelt Design zwischen Dingen, Menschen und der Umwelt und die sich daraus entwickelnden Formen erheben den Anspruch, auch eine Lebensform zu sein. Der paradoxe, aber folgerichtige Schluss lautet daher, Menschlichkeit kann erst durch Technik entstehen. In anderen Worten, nach Luhmann: „Seit die Menschheit völlig von der Technik abhängig ist, macht es keinen Sinn mehr, Technik von Humanität zu unterscheiden. Technik als zweite Natur – das sind die ‚nichtnatürlichen Selbstverständlichkeiten‘.“10 Die Wahrnehmung von Stadt als operatives Gefüge Stadt und Architektur werden zumeist als visuelles Phänomen oder als Text verstanden. Eine neuere, medial begründete Sichtweise besteht darin, sie als ein operatives Gefüge zu verstehen, das auf Vorgängen der Transformation, Verarbeitung und Speicherung beruht, und daraus die Einsicht abzuleiten, dass damit urbane und architektonische Räume geschaffen werden. „Architektonische Elemente sind wie die geometrischen ebenso symbolische wie materiale Operationen, also operative Elemente, die einen architektonischen Raum als solchen modellieren.“11 Wenn man den Stadtraum als Membran versteht, der von Energie und Strahlungen, von Gasen und Flüssigkeiten, von bewegten Objekten und Personen durchzogen wird und diese auch gelagert werden müssen, ist er als System von Öffnungen und Schließungen zu denken. Erst wenn man die Stadt unter dem Aspekt einer Steuerung und Regulierung aller Daten-, Energie-, Objekt- und Personenflüsse betrachtet, erschließt sich der Charakter der Smart City und die neue Rolle der avancierten Bewohnerschaft. Die Gebäude wirken in ihrem Inneren durch Operationen und Verknüpfungen von Energie- und Informationsflüssen, sie treten aber auch nach außen mit dem umgebenden Stadtraum in 44
UMBAU 29
Manfred Russo
operative Verbindung. Zustrom und Abfluss von Energie, Daten, Personen und Dingen erfordern den Anschluss an die Stadtkanäle. Die Stadt war seit jeher ein Behälter der Gebäude und ein Netz der Infrastruktur, das auf Straßen, Brücken, Wasserleitungen, Abwasserkanälen, Gas- und Stromleitungen beruhte, ebenso wie Kommunikationsverbindungen durch Telefonleitungen oder Postdienste. Die Infrastruktur lässt sich ebenso als ein komplexes System von Öffnungen und Schließungen bezeichnen, das die Prozessierung von Menschen, Energie und Daten im Stadtraum realisiert. Im Falle der öffentlichen Verkehrsmittel kann man auch den Transport von Personen auf der Basis einer datenbasierten Prozessierung ansehen. Im Falle der Stadt ist das elektronische Netzwerk des Hertzian space als die kommende Struktur zu bezeichnen, die die mediale Voraussetzung für das neue Interface zwischen Mensch und Stadt bildet, indem die Prozessierung von Daten und Vorgängen zwischen den Bewohnern und den städtischen Funktionen koordiniert wird. Das Interface des Smartphones vermittelt zwischen den Artefakten der Stadt, stellt Verbindungen des Nutzers zu den komplizierten Systemen des Verkehrs, des Energieverbrauchs und der sozialen Kontakte her. Diese Entwicklung von Dialogzonen zwischen Mensch und Maschine erfordert eine ästhetische Optimierung der Benutzeroberfläche, die die Stadt abbilden soll und neben dem realen Raum zugleich neuerdings auch virtual reality erzeugt. Der Computer verliert in der Gestalt des Smartphones seinen Werkzeugcharakter und avanciert damit im Sinne McLuhans zu einer Körperextension, ja zum Organ des Menschen, das ihn mit der Stadt verbindet, deren unterschiedliche symbolische Ausdrücke – sofern man diese Begriffe überhaupt noch verwenden kann – am Display des Smartphones erscheinen. Die Wahrnehmung der Stadt verändert sich damit fundamental. Gibt es noch ein „Sehen der Stadt?“wie durch den Panoramablick, der der Phantasie der mittelalterlichen Maler entsprang, wenn sie vom Überfliegen der Stadt träumten. Ende des 20. Jahrhunderts waren die Architekten nach Michel de Certeau mit ihren Skyskrapern vom selben skopischen Trieb beseelt, wenn sie die Utopie der Maler in die Realität setzten und damit die Fiktion erzeugten, die Komplexität der Stadt sichtbar zu machen. De Certeau fragte allerdings, wenn er vom Panoramablick vom Dach des World Trade Centers, das bekanntlich durch die Terroranschläge von 9 / 11 vernichtet wurde, sprach: „… ist dieses gewaltige Textgewebe, das man da unten vor Augen hat, etwas anderes als eine Vorstellung, ein optisches Artefakt?“ Denn „die gewöhnlichen Nutzer der Stadt aber leben unten, jenseits der Schwellen, Umbau anders. Smart City als Interface
45
wo die Sichtbarkeit aufhört. Die Elementarform dieser Erfahrung bilden die Fußgänger, die Wandersmänner (Silesius), deren Körper dem mehr oder weniger deutlichen Schriftbild eines städtischen Textes folgen, den sie schreiben ohne ihn lesen zu können.“12 Können wir annehmen, dass die Benutzeroberfläche des Smartphones ebenso ein optisches Artefakt darstellt, das eine Art von Bildtext vorgibt, dem der Benutzer folgt? Wir wissen es nicht, denn die Stadt ist opak und ähnelt einer Black Box, die immer mehr über die Benutzeroberfläche bedienbar ist. Jedenfalls wird ein Dialog ingang gesetzt, der das Verhältnis zwischen Stadt und Bewohner initiiert und weniger einem iterativen Verfahren denn einer Feedback-Schleife gleicht. Ein kybernetischer Regelkreis ersetzt die alte Vorstellung von Ursache und Wirkung durch ein Selektionsprinzip, bei dem sich jene Dinge durchsetzen, die sich im Gebrauch bewähren. Die Stadt wird aus einer Perspektive des Benutzerinteresses wahrgenommen und die Sinnstiftung erfolgt mittels Mobilphone und einem nutzerfreundlichen System. Mapping in der Smart City. Die Stadt als Benutzeroberfläche im virtuellen Raum Durch die Übertragung der Navigation 13 an Google Maps mittels individualisierter Suchbefehle wird ein Mapping hergestellt und damit ein Werkzeug geliefert, mit dem auf den Echtzeitverkehr reagiert werden kann – nebenbei erhält man auch Informationen über Shops, Restaurants oder andere Details auf dieser Strecke. Diese spezifische Raumsituation kann sich sehr weit ausdehnen, aber als konnektive Technologie auch den Status einer merkwürdigen Intimität zur Umgebung, eine Art intimer Wolke einnehmen, in der die Leute in jedem beliebigen Moment Zugang zueinander haben könnten 14, entweder in Echtzeit oder auch als digitale Avatare.15 Bemerkenswert ist die damit erfolgende radikale Rückwendung zum physischen Raum.16 Man kann annehmen, dass die aktuelle Generation der Smartphonenutzer physische und mentale Eigenschaften im Sinne einer Kulturtechnik entwickeln, die auf eine neue Art von Raum abzielen, der durch ein System von Spuren und sich entfaltenden Szenarien entziffert wird.17 Mittels Smartphone verfügt jeder Bürger über ein Instrument, mit dem er sozusagen die Stadt in seiner Tasche trägt, die sich auf diese Weise enthüllt und durch Prozessierung wahrgenommen wird. Das Smartphone lokalisiert präzise in Raum und Zeit und kennt die Präferenzen, Zeitpläne und Konsumgewohnheiten seiner Nutzer. Die stille Revolution besteht nun darin, dass die räumlich unscharfen Bestimmungen der neuen Medien in den 1990er Jahren nun durch die Möglichkeit präziser Verortung in Raum und Zeit ersetzt worden sind. LBS (location based services) bieten eine Vielzahl von Diensten an, wie Informationen zu Mobilität, Unterhaltung oder Essen. Über „Dodgeball“ erhält man seit 2000 lokale Informationen über Unfälle, über Freunde und Bekannte und über interessante Treffpunkte und Veranstaltungsorte.18 Nach dem Verkauf an Google setzte der Gründer, Dennis Crowley, 2009 eine neue Firma mit dem Namen „Foursquare“ auf, die dieses Konzept in neuer Weise weiter verfolgt und eine Vielzahl von Apps liefert, die auf räumliche Entdeckung der Stadt abzielen und damit so 46
UMBAU 29
Manfred Russo
Man kann annehmen, dass die aktuelle Generation der Smartphonenutzer physische und mentale Eigenschaften im Sinne einer Kulturtechnik entwickeln, die auf eine neue Art von Raum abzielen, der durch ein System von Spuren und sich entfaltenden Szenarien entziffert wird.
Umbau anders. Smart City als Interface
47
etwas wie eine Wiederverzauberung der Stadt ermöglichen.19 Neue soziale Motivationen und Ansporne werden durch Rollenspiele, wie zum Beispiel „Du bist der Bürgermeister von…“,20 ermöglicht, die eine fortlaufende Interaktion mit der Stadt zulassen. Die ursprüngliche Befürchtung einer Neutralisierung der Stadt und Zerstörung der städtischen Atmosphäre weicht nun der Bereitstellung eines neuen Interface mit dem physischen Raum der Stadt. Diese einzelnen Netzwerke müssen gar nicht so groß sein, sie erreichen in der Stadt leicht das rechte Ausmaß einer kritischen Masse. Plattformen wie Tinder und Grindr 21 sind Dating Apps, die einer Vereinigung von Bürgern in der näheren Umgebung zu sozialen bis erotischen Zwecken wie Flirts und mehr dienen.22 Die Menschen werden in dynamischen Prozessen mit Orten in der Stadt verbunden und verändern auf diese Weise den Modus des Lebens in der Stadt. Das Smartphone bleibt das integrale Werkzeug zur Generierung von Daten, Interface und Kollision, indem es verschiedenste Datenströme verteilt und kombiniert. Diese Konstellationen fördern natürlich auch Verhaltensänderungen, Datenplattformen können durch ihre Fähigkeit Konnektivität herzustellen in kürzester Zeit die Bürger in einen smart mob verwandeln. Diese lokal basierten Medien können die Emergenz eines Schwarmverhaltens erzeugen und eine Verwandlung einzelner Individuen in eine Menge oder Masse bewirken. Dazu bedarf dieser amorphe und poröse smart mob weder einer spezifischen Agenda noch irgendwelcher Familienähnlichkeiten. Es ist nichts anderes als eine flexible Gruppe von Leuten, die durch digitale Medien im physischen Raum verbunden werden und darin konvergieren. Optimistischen Prognosen, die primär an die Zivilgesellschaft zur Erweiterung der Handlungsmöglichkeiten und Ermächtigungen adressiert waren, wurden allerdings durch bestimmte Ereignisse der unmittelbaren Vergangenheit, wie etwa Silvester 2016 in Köln etwas gedämpft. Mobilität. Das Portfolio des Transports Das Auto hat als Symbol der Befreiung ausgedient. Amerikanischen Schätzungen zufolge stehen Autos 95 % der Zeit nutzlos herum, ebenso könnte jedes geteilte Auto zehn bis dreizehn privat genutzte PKWs ersetzen. Zahlreiche Dienste der Sharing Economy stehen bereits zur Verfügung, Zipcar ist einer der bekanntesten unter zahlreichen weiteren in Europa. Ebenso wurde in einem Projekt „Hubcab by the Senseable City Lab“ ausgerechnet, dass man 95 % der Taxifahrten in New York teilen könnte und das gesamte Taxiaufkommen mit 40 % der bestehenden Flotte geleistet werden könnte.23 Ebenso spricht man von einem breiten Portfolio an Optionen, das durch die Echtzeitinformationen ein neues Regime persönlicher Mobilität ermögliche. Viele Städte verfügen bereits über CityBike- und CityCar-Systeme, vielfach gibt es auch schon Angaben über den ökologischen Fußabdruck des jeweiligen Transportmittels und des geplanten Weges. Man kann situativ aufgrund von Echtzeitinformationen bestimmen, ob man sich gerade für den überfüllten Bus oder ein Sharing-Elektrofahrrad entscheiden möchte.24 48
UMBAU 29
Manfred Russo
Energiebeispiel ThermoWolke. Die Wärme sucht den Menschen Künftige Architektur wird es mit der Ausarbeitung von Plänen zu einem System von miteinander verbundenen Sensoren, Operationen und Aktionen zu tun haben, um sich auf der Basis von experimentellen und funktionalen Anforderungen zu aktualisieren. Auf Basis von Kommunikations- und Lernsystemen können Sensornetzwerke Gebäude in intelligente Agenten mit Lernkapazitäten umwandelnn, die quasi mit ihren Bewohnern koexistieren. Damit erfüllt sich – je nach Sichtweise – der Traum oder die Bedrohung eines dynamischen Raumes, der Menschen, Umwelt, Infrastruktur und persönliche Geräte vereinigt.25 Der Triumph der Zentralheizung wurde durch die Erfindung des Thermostats ermöglicht, der eine stabile Regelung der erwünschten Temperatur sicherte, indem durch die Messung der Raumtemperatur eine automatische An- und Abschaltung der Heizung erfolgte. Der nächste Schritt in der Entwicklung der Systeme könnte daher eine Synchronisierung der Wärme mit der körperlichen Anwesenheit der Bewohner ermöglichen. Durch den Einsatz raffinierter Bewegungsmelder, die mit Wärmequellen gekoppelt werden, könnte eine individuelle Thermo-Wolke jedem Menschen durch das Gebäude folgen und ständigen individuellen Wärmekomfort mit der Minimierung eines Heizaufwands für das gesamte Gebäude verbinden. „Der Mensch sucht nicht mehr die Wärme, die Wärme sucht den Menschen.“26 Diese Form einer Lenkung der Energie betrifft auch andere Systeme. Bekanntlich tendieren die Verbrauchergewohnheiten der Stadtbewohner dazu, den Energiebedarf zu bestimmten Zeiten zu Spitzen zu führen, ein Umstand, der die Energieproduktion dazu nötigt, ständig so viel Energie zu produzieren, um das mögliche Maximum an Bedarf decken zu können. Mit entsprechenden digitalen Systemen wäre ein neues System von regionaler Energieproduktion möglich, das erneuerbare Energie ins Netz zurückspeichert und auch den Überflussstrom in Akkumulatoren hochlädt. Dies würde das Verbraucherbewusstsein mobilisieren und den aufwändigeren Konsum in Zeiten außerhalb der Verbraucherspitzen verlegen (Geschirrspüler und Waschmaschinen). All dies ist bei den derzeitigen Top-down-Systemen nicht möglich.27 Transformation der digitalen Architektur. Von der organischen Form zum kybernetischen Dialog Auch das Verhältnis zur Architektur wird nachhaltig verändert. Vor allem könnte sich ein Wandel in den Vorstellungen von digital inspirierter Architektur ergeben, die von der Betonung der expressiven organischen Darstellung mit einem großen Hang zur Aufmerksamkeitserzeugung hin zu wesentlich reduzierteren und formal einfachen Formen führt, die aber den Anforderungen und Erwartungen der Virtualität moderner User entsprechen. Der ursprüngliche Approach einer digital inspirierten Architektur war auf die Form ausgerichtet und gipfelte in der Hervorbringung architektonischer Skulpturen, die sich durch deutliche visuelle Prägnanz auszeichneten. Gebilde wie Frank Gehrys Guggenheim Museum in Bilbao wurden zur Ikone und fanden Umbau anders. Smart City als Interface
49
Auch das Verhältnis zur Architektur wird nachhaltig verändert. Vor allem könnte sich ein Wandel in den Vorstellungen von digital inspirierter Architektur ergeben, die von der Betonung der expressiven organischen Darstellung ... hin zu wesentlich reduzierteren ... Formen führt.
50
UMBAU 29
Manfred Russo
weltweite Verbreitung. Dies führte zu einem vorübergehenden Regime von irregulären und organisch anmutenden Gebäuden. Die parametrische Designsoftware erlaubte den Architekten nach dem Skript einer internen Logik die Eingabe von Datenwerten, die sich auf objektive kontextuelle Faktoren bezogen, um oft außerordentlich komplexe Lösungen in der Form spezifischer Artefakte zu erzeugen. Damit ließen sich die Grenzen der Tradition aushebeln und neue formale Lösungen anbieten.28 Diese Formen hatten zwar eine Ähnlichkeit mit „Organischem“, waren aber nur statische Visualisierungen großer komplexer Elemente. Daher ergab sich eine Fortsetzung dieses Denkens, das nun den Ehrgeiz entwickelte, nicht nur wie ein lebendiger Organismus auszusehen, sondern auch wie ein lebendiges System zu agieren. Bereits die Metabolisten hatten die Idee, eine Antwort auf die Bewegungen der soziodynamischen Kräfte zu finden, indem sie ein System entwickelten, das transportable Wohnkapseln vorsah. Kurokawas Nakagin Capsule Tower, der als ein Gerüst für die Einhängung beweglicher, individueller Wohnkapseln diente, sah einen ständigen Wechsel der Anordnung der Gehäuse aufgrund der wechselnden Wohnsituationen vor. Tatsächlich aber wurde nach der Fertigstellung keine einzige Kapselposition mehr verändert, was unterstreicht, dass die Flexibilität von Strukturen anders funktionieren dürfte.29 Interaktivität zwischen Gebäude und Nutzer Eine in dieser Hinsicht möglicherweise zielführendere Linie wurde durch den Kybernetiker Gordon Pask eingeleitet, der eine Designstrategie der Selbstorganisation entwickelte, die der Kybernetik eines dynamischen Systems entsprach. Dabei ist das Ziel des Designs immer unterbestimmt und der Administrator ist nicht mehr der autoritäre Apparat, der mit diesem technischen Begriff assoziiert wird, sondern eine Mischung aus Katalysator, Krücke, Gedächtnis und Schiedsrichter. Der Architekt wird damit eher zum Choreographen dynamischer und angewandter Kräfte, als jemand, der das Endresultat in penibler Weise vorschreibt.30 Diese Interaktivität zwischen Gebäude und Bewohner wurde allerdings zunächst ebenfalls zur Inspiration für einen Typus von Architektur, wie ihn Cedric Price in seinem Generator Project vorgeschlagen hatte. Als eine Art von Zentrum für Aktivitäten sollten hundertfünfzig vorfabrizierte Kuben ähnlich wie im Nakagin Tower mittels der Software „The Boredom Programme“ emporgehoben und verschoben werden, um, sobald es zu lange statisch verharrt, andere durch gezielte Störung zu aktivieren. Aber auch hier ging es mehr um die Architektur als Provokation im Geiste des Situationismus, die zum Dialog und zur wechselseitigen Reaktion, allerdings alles auf kybernetischer Basis, führen sollte. Aus der Perspektive der Kybernetik und einer avancierten Systemtheorie werden Gebäude primär als eine Funktion angewandter Lerneinheiten verstanden, die im Dialog mit ihren Bewohnern stehen. Damit steht Kybernik in Gegensatz zu jenen an der Form Umbau anders. Smart City als Interface
51
orientierten Architekten aus dem 20. Jahrhundert mit ihren verspäteten Schwärmereien für Geschwindigkeit, Dematerialisierung, Miniaturisierung und einem romantischen und übertriebenen formalen Ausdruck von Komplexität.31 Digitale Werkzeuge müssen aber nicht der Kalkulation von Komplexität für die visuellen Sinne dienen, sondern können eine neue Form von Komplexität generieren. Die Dynamik drückt sich nicht mehr in der Form, sondern in der Performanz eines lebendigen Organismus aus. Der Computer, der mit Hilfe bestimmter Programme mit den Nutzern interagiert, wird zum integralen Bestandteil des Gebäudes. Daraus folgt, dass der Planungs- und Produktionsprozess eine neue Form annehmen wird und der Architekt die Gebäude aus der Perspektive der Operativität neu bewerten muss. „Der Prozess des Architekturschaffens kann eher zu einer iterativen Kette, denn zu einem linearen Prozess werden. Heute sind das Design, die Dokumentation, Konstruktion und das Wohnen unterschiedliche Phasen im Leben eines Gebäudes, von verschiedenen Spezialisten mit unterschiedlichen Werkzeugen ausgeführt. Mit jedem Schritt, mit dem die Kette der Architekturproduktion in das digitale System übergeht, wird aber der Prozess vereinheitlicht.“32 Für die Architekten könnte dies zu einer neuen Art der Ermächtigung führen, die sich neben der Planung auf Produktion von Wissen und dessen Archivierung für jedes Gebäude auf Lebensdauer bezieht. Auch für die künftigen Bewohner soll durch Einbeziehung auf allen Stufen der Planung, der Konstruktion und in die gesamte Handlungskette die Entwicklung und das Benutzen der Architektur zu einer neuen Erfahrung werden. Die Neuformatierung der Schirmfunktion im virtuellen Raum. Architektur als Pokémon? Slavoj Žižek hat unlängst scharfsinnige Beobachtungen zu Pokémon Go angestellt: Während Internet und Computer die Nutzer bisher eher von ihrer Umwelt abkapselten, ist durch die SixthSense-Technologie, eine Kombination aus Webcam, Spiegel und Smartphone, eine interaktive Beziehung zu realen Objekten in der Stadt möglich. Durch die ständige Beobachtung der Bewegungen der eigenen Person werden die im Umraum befindlichen Objekte im Datenstrom erfasst und liefern auf Wunsch sofort eine Reihe von Informationen dazu. Mittels virtuellem Bildschirm wird dies auf eine Fläche in der unmittelbaren Umgebung projiziert. Zum Beispiel eine sexistische Männerphantasie, zu der das Gerät die entsprechende Information liefert: „geschieden, leicht zu verführen, mag Jazz und Dostojewski, versteht sich auf Fellatio“.33 Man kann bei diesem Beispiel, das durch die typische Ironie Žižeks gekennzeichnet ist, vermuten, dass die sich möglicherweise anbahnende Kommunikation nicht unbedingt durch ein beiderseitiges Interesse an Dostojewski motiviert sein muss. Aber wichtiger noch ist folgender Gedanke: „Wenn ein Spieler einem Pokémon begegnet, dann bedient sich der Augmented-Reality-Modus (AR) des SpielerSmartphones der Handy-Kamera und eines Gyroskops, um das 52
UMBAU 29
Manfred Russo
Pokémon wie einen Teil der realen Welt darzustellen.“34 Der AR-Modus macht den Unterschied. „Statt uns aus der realen Welt herauszureißen und in einen künstlichen virtuellen Raum einzuführen, verbindet es vielmehr beide miteinander. Unser Blick auf die Wirklichkeit und unser Umgang mit ihr wird vom Fantasiebild des digitalen Bildschirms vorgeformt.“35 Durch diese zwischengeschaltete Bildebene wird die Wirklichkeit mit virtuellen Elementen ergänzt, um die Motivation für das Mitspielen wachzuhalten. Es ist diese Ergänzung der Wirklichkeit durch virtuelle Elemente, die eine ansonsten triviale Realität plötzlich so spannend macht. Die Projektion der Information auf die realen Objekte erzeugt eine „mystifizierende oder geradezu magische Wirkung“.36 Der daraus resultierende Effekt führt nach Žižek zu falschem Bewusstsein und wäre daher als Ideologie zu qualifizieren, freilich äußert sich in diesem Urteil auch eine gewisse Hilflosigkeit im Umgang mit derartigen Phänomenen. Die Architektur wird in diesem neuen Hertzian space nicht nur zu einer Art von Interface zwischen Nutzer und Gebäude, sondern möglicherweise auch zwischen realem und virtuellem Raum. Mittels Smartphone als Portal zu größeren Systemen kann die Architektur als Mediator zwischen Funktionen mit täglichen, menschlichen Maßstäben und weiten Netzwerken nach Maßstäben der Menschheit agieren.„Architekten waren für Jahrtausende mit Körpern befasst, die durch ihre Haut und ihre unmittelbare sinnlich wahrnehmbare Umgebung begrenzt wurden […], nun müssen sie elektronisch verstärkte, neu konfigurierbare, virtuelle Körper bedenken, die über große Distanzen wahrnehmen und handeln können, teilweise aber auch in ihren unmittelbaren Umgebungen verankert bleiben.“37 Die prädigitalen Menschen navigierten in ihrer unmittelbaren physischen Umgebung, während die modernen Cyborgs mit ihren Smartphones den Raum in einer fundamental anderen Weise einnehmen. Das hat weitreichende Konsequenzen, denn die Architektur steht nun vor der Herausforderung, den Möglichkeitsraum in einer technischen Anbindung an den realen Raum zu knüpfen. Neue Medien schaffen neue Räume, die es zuvor so nicht gegeben hat, die man vielleicht ahnte, aber dennoch nicht räumlich präzisieren konnte. Diese merkwürdige Parallelität von realem und virtuellem Raum ist auch noch im Anfangsstadium, aber man kann schon einige Überlegungen anstellen: „Maßstäbe und Kontexte werden unscharf, weil wir elastisch zwischen ihnen hindurch schlüpfen. In dem einen Moment können wir in einem Zimmer mit drei anderen Leuten stehen, aber das digital-räumliche Netzwerk kann mir auch zeigen, dass zwei enge Freunde im Restaurant gleich nebenan sich befinden Umbau anders. Smart City als Interface
53
oder eine an Erotik interessierte Person nur einen Block weiter. Die Personen und der Raum sind zwar noch ein zentraler Anker, aber die oberen und unteren Grenzen der menschlichen Realität sind nach außen explodiert und die Architektur muss die gesamte Weite dieses Raumes umfassen – in all seiner Dynamik – und zugleich in Beziehung zu den Menschen treten … Erstmals hat sich die Architektur mit einer tiefen nicht tektonischen Realität zu konfrontieren […].“38 Stefan Trüby schreibt über die pervasive hertzianische Architektur des dritten Maschinenzeitalters: „Sie besteht aus großen und kleinen Gadgets (Bauteilen und PDAs), die sich zu einer ExitArchitektur formieren, die – jenseits der Kategorien von Innen und Außen – nur noch pseudotribalistische Schwarmstrukturen und Fluchtbewegungen kennt.“39 Hier wird diese Möglichkeit der Grenzüberschreitungen noch mit Bezug auf James Bond-Filme dramatisiert, deren „Gadgets dem beweglichen Helden zugeordnet [sind,] dem Helden des Eindringens und der Flucht“.40 In diesem Fall liegt der Fokus auf der zweifellos nicht unproblematischen Entwicklung, die durch die Grenzverwischungen von Innen und Außen im künftigen virtual space auf uns zukommen werden. Dirk Baecker paraphrasiert die „destruction of the box“ von Frank Lloyd Wright, um seine Medientheorie der Architektur zu erklären. Wichtig ist ihm hier festzuhalten, dass Abschirmung nicht nur Einschließung ist, sondern auf die Differenz zwischen Innen und Außen setzt. „Abschirmung kommt nur dann zur Geltung, wenn sie die Möglichkeit der Schließung gegen die Möglichkeit der Öffnung profiliert.“41 Das Außen soll nicht nur ausgeschlossen werden, sondern muss zugänglich bleiben. Das Innen soll nicht nur Schutz bieten, sondern auch verlassen werden können.42 Diese Grundfrage einer Schließung und Öffnung der Architektur wird die Beziehung zum virtuellen Raum formatieren müssen. Die Grenzen zwischen Außen und Innen werden schwieriger zu erkennen sein und dementsprechend auch die Setzung von Abschirmungen. Wenn der virtuelle Raum wie bei Pokémon Go in den realen Raum hineinspringt, so wird er vom Menschen wie in einem Spiel auch für wahr gehalten, um dies aber auch sogleich wieder vergessen zu können. Dieses „Als-ob“ eines Spiels wird die Architektur in den kommenden Dekaden oder auch Jahrhunderten mehr als lebendig halten.
54
UMBAU 29
Manfred Russo
Fab Labs. Community of Practice in der Erdgeschosszone Eine letzte Prognose zur Stadtentwicklung mit tendenziell utopischem Charakter betrifft eine Rückführung der Produktion in die Stadt, allerdings unter den völlig neuen Gesichtspunkten einer dezentralisierten Produktion im Sinne des dritten Maschinenzeitalters, die möglicherweise den Auswirkungen auf die Stadtform der beiden ersten industriellen Revolutionen um nichts nachstehen wird. Die Produktion könnte – wenn sie aus der Fabrik auszieht – wieder in das Alltagsleben integriert werden. Die Gesellschaft könnte zu einem vorindustriellen Modell, das lokal und benutzerzentriert ist, zurückkehren. Damit könnten die Stadt und die verwaisten Erdgeschosszonen neu belebt werden. Dies ist das Programm von Fab Lab, das weltweit in jedem Stadtviertel, jedem Uni-Campus oder auch in Dörfern auf dem Land ein derartiges Fabrikationszentrum mit entsprechenden Geräten und dem Angebot von Werkzeugen für digitale und reale Produktion installieren möchte. Der Gründer, Neil Gershenfeld 43 möchte die Menschen zu einer neuen Form der Ermächtigung bringen, um die Welt um sie herum verändern und „hacken“ zu können, anstelle des passiven Konsums von Information und Produkten. Medientheoretisch steht dabei der 3D-Drucker im Vordergrund, der das neue Medium der Produktion darstellt und eine völlige neue mediale Formierung der Bildung, die von der klassischen Schule hin zum Fab Lab führt, indem eine praxisbetonte Ausbildung durch einen Prozess der Kooperation vermittelt wird. Produktion und Erziehung sollen durch neue sozietäre Kommunikation in gemeinsamer Aktion realisiert werden. Der 3D-Drucker bietet die Möglichkeit zur Schaffung materieller Formen durch digital kontrollierte Prozesse, indem durch schichtweise aufgebrachte Materialien eine Form erzeugt wird. Dies ermöglicht nach den Prognosen von Zukunftsforschern nicht nur die Herstellung hochkomplexer geometrischer Formen, sondern auch den Umsturz der ökonomischen Maßstäbe und der Gesetze der Massenproduktion. Für die 3D-Drucker gibt es keinen Unterschied in der Herstellung zwischen identischen Objekten oder Unikaten, die Kosten für die Produktion eines Einzelobjekts sind gleich wie für die einer Einheit aus einer Serie von tausend Stück.44 Die Produktion der Dinge soll so kundenfreundlich und einfach werden wie der derzeitige Ausdruck eines Dokuments vom PC. Eine wesentliche Konsequenz soll die daraus entstehende Sozialität sein, die der einer community of practice entspricht.45 Diese ist dadurch charakterisiert, dass Wissenstransfer nicht einseitig zwischen Personen mit unterschiedlichen Erfahrungs- und Wissensniveau verläuft, sondern außerhalb formaler Lernumgebungen. Durch den Gebrauch benutzerfreundlicher Software können Designs online gestellt und mit Freunden, einer breiteren Gemeinschaft oder der Öffentlichkeit überhaupt geteilt werden. So wie bei der open software können durch das Projekt selbst neue Modi der Zusammenarbeit zwischen einer Vielzahl von Akteuren entstehen. Insbesondere die Gemeinschaft, die rund um diese Projekte wächst: „Die Leute machen ein Projekt, publizieren den Prozess und das Resultat, andere Leute fragen wie es gemacht wurde und diskutieren das Projekt. Wenn diese Gemeinschaft von Leuten einmal ein Projekt mit dem open source-Ethos teilt, dann kann es keiner mehr stoppen.“46 Ein Marktplatz für herunterladbare und druckbare Objekte könnte den Beruf des Designers durch eine alternative Ökonomie, die sowohl finanziell als auch sozial motiviert ist, neu bestimmen. Der Herstellungsprozess könnte sich daheim in der Wohnung Umbau anders. Smart City als Interface
55
abspielen, sobald die 3D-Drucker so universell wie simple Tintenstrahldrucker verbreitet sind, oder in einem Fabrikationszentrum in jedem Stadtviertel organisiert werden. Fab Labs dienen aber nicht nur der Produktion, sondern auch dem Lernen und dem Erwerb von Wissen. Es geht um die Entwicklung eines Handlungsfeldes, in dem abstraktes Wissen, konkrete Fertigkeiten, notwendige Ressourcen, praktische Anweisungen und auch Diskussion über die eigene Praxis beinhaltet sind. Jedes Lab ist der Kern einer auf Herstellung fokussierten Gemeinschaft. Die Labs beherbergen regelmäßig stattfindende Kurse, Workshops und soziale Events. Neue Typologien von Gebäuden erinnern an mittelalterliche Dörfer in Großbritannien. Peranakan Shophouses in Singapur oder Machiya Residences in Kiotos Künstlerdistrikten kombinieren Wohnen mit Fabrikation.47 Auch wenn es nicht in den individuellen Wohnheimen passiert, kann sich eine Plattform für gemeinschaftliche Produktion durch die Stadt verbreiten, die eine offene Infrastruktur etabliert, die Gemeindemitglieder in Hersteller verwandelt und Zentren für das Sharing von Wissen, Gestaltung und Sozialisation bereitstellt.
1 Der Begriff des useful place kommt aus den Navigationssystemen von TomTom und meint eben Orte wie Tankstellen, Museen, Parkplätze und Restaurants etc. in: Martijn de Waal: The City as Interface. How New Media are Changing the City, nai010, Amsterdam 2014, 186. 2 Misa Matsuda: „Mobile Communication and Selective Society“, in: Mizuko Ito / Daisuke Okabe / Misa Matsuda: Personal, Portable, Pedestrian, Mobile Phones in Japanese Life, MIT Press, Cambrigde, MA, 2006, 123 – 142. 3 Slavoj Žižek: „‚Pokémon Go‘ ist Ideologie“, in: Die Zeit 34 / 2016, 11.08.2016, 34. 4 Richard Ling: New Tech, New Ties, MIT Press, Cambrigde, MA, 2009, 160. 5 Norbert Bolz: Weltkommunikation, Fink, München 2001. 6 Daisuke Okabe / Mizuko Ito: „Technosocial Situations: Emergent Structuring of Mobile E-mail Use“, in: Mizuko Ito et al., a.a.O., 257 – 273: 264. 7 Ebd., 15.
56
UMBAU 29
Manfred Russo
8 Martin Heidegger: Sein und Zeit (1927), De Gruyter,
28 Ebd., 74.
Berlin 2006, 336.
29 Ebd., Kapitel 6 („Living Architecture“).
9 Otl Aicher: Analog und digital, Ernst & Sohn,
30 Ebd., 78.
Berlin 1991, 27.
31 Ebd., 80.
10 Niklas Luhmann: Die Gesellschaft der Gesellschaft,
32 Ebd., 85.
Suhrkamp, Frankfurt / M. 1998, 532; vgl. auch Norbert
33 Zizek a.a.O., 34.
Bolz: Das Gestell, Kapitel „Die technotrophe Gesell-
34 Ebd.
schaft“, Fink, München 2012.
35 Ebd.
11 Wolfgang Schäffner: „Elemente architektonischer
36 Ebd.
Medien“, in: Zeitschrift für Medien- und Kultur-
37 Ratti /Claudel, a.a.O., 83.
technik, 139.
38 Antoine Picon: „Digital / Minimal?“ in: Architettura,
12 Ebd., 182.
25. 2. 2006, zit. nach Ratti / Claudel, a.a.O., 84.
13 Der Begriff der digitalen Navigation elektronischer
39 Stephan Trüby: Exit-Architektur. Design zwischen
Landkarten wird von Bruno Latour im Gegensatz zum
Krieg und Frieden, Springer, Wien – New York 2008, 70.
mimetischen Gebrauch der herkömmlichen Landkarten
40 Ebd.
eingeführt. Bruno Latour / Valérie November / Eduardo
41 Dirk Baecker: „Die Dekonstruktion der Schachtel.
Camacho-Hübner: „Entering Risky Territory: Space in
Innen und Außen in der Architektur“, in:
the Age of Digital Navigation“, in: Environment and
Niklas Luhmann / Frederic D. Bunsen / Dirk Baecker
Planning D: Society and Space, 28 / 2010, 581–599.
(Hg.): Unbeobachtbare Welt, Haux Verlag, Bielefeld
14 Siehe Anm. 2.
1990, 91.
15 Amber Case: „We Are All Cyborgs now“, TED
42 Ebd., 95.
Women, International Trade Center, Washington DC,
43 Neil Gershenfeld, zit. nach Ratti /Claudel,
December 8, 2010; http://www.ted.com/talks/
a.a.O., 128.
amber_case_we_are_all_cyborgs_now/transcript
44 Ebd., 125.
16 Antoine Picon: „La Ville Territoire des Cyborgs“,
45 Jean Lave / Etienne Wenger: Situated Learning:
in: Flux 15, 76 – 79.
Legitimate Periphered Participation, Learning in
17 Picon: „Architecture and the Virtual: Towards a
Doing, Cambridge University Press, Cambridge –
New Materiality“, in: Praxis: New Technologies New
New York 1991.
Architectures 6, 2004, 114 – 121.
46 Ratti / Claudel, a.a. O., 126.
18 Caroline Mc Carthy: Dodgeball: A eulogy – CNET;
47 Eric Swyngedouw: „Circulations and Metabolisms“,
https://www.cnet.com/news/dodgeball-a-eulogy/
in: David Harvey: The Right of the City, New Left
19 Picon: „Architecture and the Virtual“, a.a.O.
Review 53, Sep – Okt 2008, 23 – 40.
20 How to Become a Foursquare Mayor: 4 Steps (with Pictures) http://www.wikihow.com/Become-a-Foursquare-Mayor. 21 de Waal, a. a. O., 75. 22 Ebd., 79. 23 Carlo Ratti / Matthieu Claudel: The City of Tomorrow, Yale University Press, New York – London 2016, 100. 24 Ebd., 106. 25 Ratti / Claudel, a.a.O., 81. 26 Ebd., 110. 27 Ebd., 116. Umbau anders. Smart City als Interface
57
Ulrich Huhs
Punktuelle Transformationsprozesse im konsolidierten urbanen Gefüge der europäischen Stadt Parzellenbezogene Adaptionen des gründerzeitlichen Baublocks in Wien und Berlin
Adaptionen innerhalb des vorhandenen städtischen Gewebes Die Entwicklung der Morphologie der europäischen Stadt wird planungsseitig durch zwei wesentliche Faktoren bestimmt: zum Einen in Wachstumsphasen durch großflächige Stadterweiterungen und zum Anderen durch kontinuierliche Transformationsprozesse innerhalb des konsolidierten, städtischen Gefüges. Dieser punktuelle Stadtumbau findet zum Teil unterhalb der öffentlichen Wahrnehmungsgrenze statt – er zeigt jedoch exemplarisch das interpretatorische Potenzial in Bezug auf die stadtstrukturellen Gegebenheiten. Das Ausloten dieses Grundgewebes, die architektonische Interpretation zur Transformation und Erweiterung sollen im Folgenden anhand singulärer Stadtbausteine am Beispiel der Typologie des Wohnungsbaus untersucht werden. Der urbane Raum als Lebensort der BewohnerInnen bedarf einer kontinuierlichen aktiven Entwicklung und Adaption an die gesellschaftlichen Entwicklungen. In Boomphasen der Stadtentwicklung, wie sie heute die verspäteten Metropolen Wien oder Berlin erleben,1 laufen die Entwicklungen aufgrund der großen Nachfrage nach Wohnraum Gefahr, dass im positivem wie auch im negativen Sinne Evaluiertes aus vorangegangenen Wachstumsschüben übersehen wird. Die kurzfristigen Antworten des Massenwohnbaus, die dem Primat der Kostenoptimierung folgen, beinhalten eine bewusste Reduktion der Komplexität, die für die Generierung und Entwicklung von dauerhaften und entwicklungsoffenen städtischen Lebensräumen erforderlich ist. Zwei Themen der Architekturdiskussion der letzten Jahre – zum Einen der social turn mit dem Perspektivenwechsel auf die Stadt der NutzerInnen und zum Anderen die Wiederentdeckung nutzungsneutraler Gebäudestrukturen im Kontext der Nachhaltigkeitsdiskussion – haben sich von verschiedenen Blickrichtungen aus den Anforderungen heutiger Lebensraumgenerierung angenähert. Ein Baustein der Stadt, das Wohnhaus und seine Beziehung zum öffentlichen Raum, soll im Folgenden im Kontext der Adaption der Gründerzeitstadt betrachtet werden. Die aktuelle Innenentwicklung im Wiener Bestandsgefüge wird unter anderem durch das stadtplanerische Ziel der Nachverdichtung innerhalb der bestehenden Infrastruktur bestimmt.2 Die Stadt der kurzen Wege als Teilaspekt der Nachhaltigkeitsdiskussion 58
UMBAU 29
beinhaltet einerseits die notwendige Individualverkehrsreduzierung mit direkter Rückkopplung auf die urbane Lebensqualität und andererseits, in ökonomischer Hinsicht, die umfassendere Nutzung der vorhandenen Infrastrukturressourcen der Kommune. Die Akteure dieser eingeleiteten Innenverdichtung sind aufgrund der ansteigenden Grundpreisentwicklung seit den 2000er Jahren überwiegend privatwirtschaftliche Immobilienentwickler, deren Kernaufgabe die Kapitalverzinsung ist. Das unternehmerische Handeln zielt systemimmanent auf die Maximierung der verwertbaren Wohnnutzfläche am jeweiligen Standort, d.h. vorrangiger Planungsinhalt ist das Ausloten der baurechtlich maximal zulässigen Kubatur. Übergeordnete, gesamtgesellschaftliche Anliegen – wie sie zum Beispiel im öffentlichen Mietwohnungsbau der 1970er auf Basis eines sich öffnenden Gesellschaftsideals verfolgt wurden – sind in der privatwirtschaftlichen Wohnbauproduktion kein ökonomisch verwertbarer Planungsparameter. Die Kapitalverzinsungsinteressen der ProjektentwicklerInnen treffen auf das Eigentums- und Anlegerinteresse der KäuferInnen: die Einzelwohnung wird zur handelbaren Ware. Im Zuge dieser Produktion von Eigentumswohnungen im Umfeld der konsolidierten Gründerzeitstadt sind öffentliche Anliegen zur Behebung von städtebaulichen Mängeln im Bestand nur im Zuge von allfälligen Umwidmungsansuchen implementierbar. Innerhalb der bestehenden Fluchtlinienwidmungen des Flächenwidmungs- und Bebauungsplans entstehen Gebäude, deren Erscheinung durch die Ausnutzung des zulässigen Lichtraumprofils der Wiener Bauordnung geprägt sind. Berechtigte öffentliche Anliegen an der Weiterentwicklung der konsolidierten Kernstadt, zum Beispiel Ergänzung von urbanen Freiräumen, bleiben innerhalb der privatwirtschaftlichen Verwertung der Bestandswidmung unberücksichtigt. Entsteht aus der gewinnorientierten Wohnbauproduktion von Einzeleigentum innerhalb der konsolidierten Stadt ein gesamtgesellschaftlicher Mangel? Niklas Maak hat in seinen Aufsätzen wiederholt und pointiert auf die antiurbanistischen Tendenzen des gehobenen Eigentumswohnungsbaus hingewiesen.3 Die Stadt ist hier nicht mehr als der Interaktionsraum der Stadtgesellschaft zu verstehen, sondern als der gefährliche Außenraum, vor dem man sich schützen muss, und Stadt ist nur noch das in sicherer Distanz betrachtete Bild von Stadt. Der Bildtopos des geschützten Blicks aus dem Hochhausapartment in Manhattan auf die pulsierende Stadt geht als cineastisch geprägtes Wunschbild global in die Vermarktung von Wohnimmobilien ein. Innovative Beiträge zur Weiterentwicklung von urbanem Wohnen und öffentlichem Raum und deren Verhältnis zueinander werden bei dieser durch Sicherheitsdenken dominierten und defensiv konnotierten4 Vorgangsweise schwerlich entstehen. Wie kann dagegen im Zuge der nachverdichtenden Adaption der Kernstadt das urbanistische Potenzial für die Stadt der BewohnerInnen aktiviert werden? Zu den Transformationsprozessen des Baublocks Im Rahmen der nachfolgenden Betrachtungen wird anhand der Gebäudetypologie des Wohnbaus der Umbau innerhalb des gründerzeitlich bebauten Stadtgewebes untersucht. Die Betrachtung konzentriert sich auf den städtebaulichen Typus des Baublocks als eines der konstituierenden Elemente der europäischen Stadt. Im Fall der Gründerzeitstadt dominiert die Blockrandbebauung bis Punktuelle Transformationsprozesse im konsolidierten urbanen Gefüge
59
heute das Bild zentrumsnaher Quartiere der mitteleuropäischen Großstädte wie Wien oder Berlin. Da das Layout der vorhandenen Infrastruktur – Erschließung und technische Einbauten – strukturell eine längere Nutzungsdauer aufweist als die oberirdische Bausubstanz der Gebäude, stellt sich die Frage der punktuellen, zyklischen Adaption derselben. Aufgrund der komplexen räumlichen Rahmenbedingungen innerhalb der konsolidierten Stadt kann im ambitionierten Fall der Dialog zwischen dem gründerzeitlichen Stadtgewebe und der parzellenbasierten Intervention zu einer punktuellen Verbesserung des urbanen Umfelds führen. Die Leistungsfähigkeit dieses kleinteiligen Stadtumbaus ist aufgrund der Wechselwirkung mit dem angrenzenden Bestand – insbesondere das Verhältnis zum öffentlichen Raum – direkt ablesbar. Bewusst wurde der Ansatz des Rückblicks auf den Zeitraum 1970 – 1989 gewählt. Die Zeitspanne umfasst einen Amplitudenzyklus aus einer zukunftsorientierten, am Wirtschaftsaufschwung partizipierenden Hochphase, die durch gesellschaftliche Öffnungsprozesse ab Ende der 1960 er Jahre geprägt war,5 und einer retartierenden Phase der Kritik des Weltwirtschaftsmodells ab Mitte der 1970er Jahre.6 Die Grundhaltung war – bei aller Differenzierung der subjektiven Blickrichtungen – von einer Zukunftsorientierung geprägt, die das Versprechen auf ein besseres Morgen als gesellschaftlichen Auftrag verstand. Die zeitliche Distanz ermöglicht einen strukturellen Blick auf die jeweiligen Lösungen und ihre Bedeutung für heutige Transformationsprozesse innerhalb der konsolidierten Stadt. Die nachfolgenden Beispiele aus Wien und Berlin zeigen einen durch unterschiedliche Rahmenbedingungen geprägten Blick auf den Umgang mit dem städtischen Baublock. In den Gründerzeitvierteln Wiens wurden nach dem Zweiten Weltkrieg die zerstörten und beschädigten Gebäude zum großen Teil blockschließend wiederhergestellt oder neu errichtet, so dass der Eindruck einer homogenen Blockstruktur das Bild der konsolidierten Stadt weiterhin dominierte. Der fachliche Diskurs fokussierte auf die Transformation des allgegenwärtigen Blocks und unter dem Eindruck einer großen Bestandszahl an Substandardwohnungen auf Fragen der Erneuerung des Wohnens.7 Die Berliner Ausgangslage nach Ende des Zweiten Weltkriegs war auf stadtstruktureller Ebene durch eine Bipolarität geprägt: auf der einen Seite durch gründerzeitliche Stadtviertel mit in Relation geringem Zerstörungsgrad wie dem Prenzlauerberg und auf der anderen Seite durch Gebiete mit großflächigen Totalverlusten der Gebäudesubstanz wie in der südlichen Friedrichstadt. 60
UMBAU 29
Ulrich Huhs
Nachdem die nachfolgenden Abrisssanierungen und das Leitbild der autogerechten Stadt den Stadtkörper inselartig zergliedert hatten, begannen in der Westberliner Diskussion Ende der 1960er Jahre Fragen nach der Identität der europäischen Stadt virulent zu werden. Der reale Verlust des historischen städtischen Gefüges, zugespitzt in den fortgesetzten Flächensanierungen in Kreuzberg, mündete in einen öffentlichen Diskurs zu Fragen des Stadtbildes und der Leistungsfähigkeit gründerzeitlicher Typologien, die über die ursprüngliche Kritik am Bauwirtschaftsfunktionalismus der Nachkriegsmoderne hinausgingen.8 Institutionell sichtbar wurden diese Prozesse in der 1979 implementierten Internationalen Bauausstellung IBA 1987 mit den Themenschwerpunkten kritische Rekonstruktion und behutsame Stadterneuerung.9 Korrespondenz von Wohnungsbau und städtischem Raum Wohnungsbau als ein konstituierendes Element des Stadtkörpers bildet im Bezug zum urbanen Raum den Hintergrund für die öffentlichen und halböffentlichen Räume und tritt mit diesen in Beziehung. Die Gründerzeitstadt, die im Bereich des Mietwohnungsbaus überwiegend unter den Rahmenbedingung der Kapitalverzinsung von Privateigentümern errichtet wurde, basierte auf kommunalen Stadtweiterungsplänen,10 die als zentrale Aussage den öffentlichen Raum – Straßen, Plätze, Parks, öffentliche Einrichtungen – festschrieben. Die im Privatbesitz befindliche Parzellenstruktur konnte im Rahmen weniger Festlegungen von den Besitzern maximal überbaut werden.11 Das Verhältnis zum öffentlichen Raum war eindeutig: Das Haus bildet straßenbegleitend eine Raumkante – eine eindeutige Grenze zwischen Außen und Innen. Der Binnenbereich des Innenhofs stellt eine kontrollierte Halböffentlichkeit her. Dies entsprach im weitesten Sinne dem Gesellschaftsbild zur Errichtungszeit: Repräsentation und Ordnung nach außen und Kontrolle nach innen.12 Obwohl sich die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und die Ansprüche an den öffentlichen Raum seit der Errichtung um die vorletzte Jahrhundertwende mehrfach gewandelt haben, werden diese Quartiere weiterhin als Abbild des Urbanen und Städtischen wahrgenommen. In Vierteln, in denen die gründerzeitliche Bebauung auf mittelalterliche oder neuzeitliche Erschließungssysteme trifft, fehlt vielfach dieser eingeschriebene öffentliche Raum. Die Bebauung entsteht nicht wie in den geplanten Stadterweiterungen innerhalb eines Zeitfensters, sondern zeigt unterschiedliche Dichtestufen der biedermeierlichen bis frühmodernen Bebauung. Die zentrale Lagegunst dieser Stadträume bringt sie in den Nachverdichtungsfokus bei gleichzeitig vorhandenem Mangel an zeitgemäßen öffentlichen Räumen für die Stadtgesellschaft. Die kontinuierliche Weiterentwicklung des Wohnungsbaus generiert ein Abbild des gesellschaftlichen Wandels und seiner Akteure. Der Großteil der fortlaufenden Adaptionen findet in stadträumlicher Hinsicht weitestgehend unsichtbar innerhalb des Gebäudebestands statt. Erst auf der Ebene der nachverdichtenden Ersatzneubauten im Umfeld der konsolidierten Stadt wird die Frage zum Verhältnis zum öffentlichen Raum virulent und ermöglicht im Idealfall die Weiterentwicklung des urbanen Freiraums. Punktuelle Transformationsprozesse im konsolidierten urbanen Gefüge
61
Im Innenwachstum mit überwiegend immobilienwirtschaftlichen Akteuren wird diese Notwendigkeit zur kulturellen und sozialen Weiterentwicklung des Wohnbaus, von wenigen positiven Ausnahmen abgesehen, negiert. Unter den Bedingungen von Angebot- und Nachfragesystemen werden die Parameter des Wohnens auf die messbaren Kennziffern, die technische Ausstattung und die Makellosigkeit der Innenoberflächen reduziert: die Wohnung als Ware. Strukturelle und räumliche Qualitäten auf der Ebene der Stadt und des Hauses – die Kernaufgaben der Architektur – bleiben hierbei nachgereiht. Wie kann unter diesen Voraussetzungen das Spannungsfeld privatwirtschaftlich basierter Nachverdichtung und die Qualitätsverbesserung des öffentlichen Raumes in der konsolidierten Stadt gewinnbringend für die Allgemeinheit zusammengebracht werden?13 Und wie könnten Typologien für viertelbezogene, öffentliche und halböffentliche Räume auf privaten Liegenschaften aussehen? Im Folgenden werden sechs ausgewählte Projekte der 1970er und 1980er Jahre aus Wien und Berlin mit transformierten, städtebaulichen Typologien im Gefüge der konsolidierten Stadt in einer kompakten Charakterisierung ihres Beitrags für den öffentlichen Raum und die Verbesserung des Wohnumfelds vorgestellt. Diese sind im Kontext des heutigen Umbaus der Stadt als Diskussionsbeitrag und Aufforderung an alle Beteiligten – Administration, Bauträger, PlanerInnen – zu verstehen, den aktuellen Horizont für die Weiterentwicklung der Stadt des 21. Jahrhunderts nicht auf den kleinsten gemeinsamen Nenner zu verengen, sondern Rahmenbedingungen zu entwickeln, um das Potenzial für die Zukunft der Stadt ausloten zu können. Der transformierte Block als Modell der durchgrünten Stadt (1) Harry Glück + Partner: Wohnhausanlage Inzersdorferstraße, Wien-Meidling, 1971 –1974 Das erste Wiener Terrassenhaus in der Inzersdorfer Straße verbindet den industriellen Geschosswohnbau mit den Idealen der durchgrünten Stadt. Die hofseitige Terrassierung der nach Süden aufgebrochenen gründerzeitlichen Blockstruktur wirkt als artifizieller, grüner Hügel in den im Zuge des Bauvorhabens verkehrsberuhigten Straßenraum und bildet die räumliche Fassung eines innerstädtischen Pocketparks. Die Terrassenhausidee der 1910er Jahre wird auf den großvolumigen Geschosswohnbau transferiert, mit den wohnungsbezogenen Privatterrassen wird eine kompakte Abstraktion des Wunschbildes vom eigenen Haus mit Garten in der Stadt realisiert, das gleichzeitig visuell und kleinklimatisch dem Umfeld zugute kommt. Konfliktpotenzial boten die hofseitigen, erdgeschossigen Wohnungen, die durch die öffentliche Parknutzung beeinträchtigt waren. Eine störungsunempfindlichere, stadtraumbezogene Erdgeschossnutzung könnte aus dem reinen Siedlungsbau ein im Stadtraum verankertes Gebäude generieren, das den Mehrwert des Pocketparks im Viertel dauerhaft bespielbar macht.
62
UMBAU 29
Ulrich Huhs
Der transformierte Block als urbaner Stadtraum (2) Wilhelm Holzbauer + Partner: Wohnhausanlage Weiglgasse,Wien-Rudolfsheim, 1974 –1979 Die aus dem Wettbewerb „Wohnen Morgen“ hervorgegangene Wohnhausanlage in der Weiglgasse stellt in städtebaulicher Hinsicht eine radikale Uminterpretation der geschlossenen, gründerzeitlichen Blockstruktur dar. Die raumbildende, großstädtische Zeilenbebauung öffnet sich in Nord-Süd-Richtung zum Stadtraum und bietet alternierend zwei halböffentliche Grünräume und eine öffentliche, fußläufige Durchwegung an. Dem akuten Verlust des Straßenraums als Ort des öffentlichen Lebens durch den motorisierten Individualverkehr wird mit einer blockinternen Wohnstraße auf zwei Ebenen begegnet: auf der tiefer gelegenen waren bei Besiedlung Ladenlokale und ein Kaffeehaus, auf der obere n Gemeinschaftsräume und -loggien vorgesehen. Die terrassierten Wohnzeilen bestehen überwiegend aus gestapelten Maisonettewohnungen. Die offenen Laubengangerschließungen der vier Zeilen sind jeweils zum öffentlichen Raum orientiert – alle Wohnungen zum innerstädtisch geschaffenen Grünraum. Die Zielsetzung, verschiedene öffentliche Räume auf der Parzelle als Mehrwert für das Umfeld zu generieren, wurde teilweise im Betrieb aufgegeben. Die Sperrung der Durchgänge der Grünräume, fehlende Nachvermietungen der Ladenlokale und der nachträgliche Garagenzubau auf der unteren Ebene der Wohnstraße haben das ursprüngliche, öffentliche Raumpotenzial reduziert, das durch ein aktives Wohnhausanlagenmanagement wiederbelebt werden könnte. Eine hybride Blockfüllung (3) Franz Kiener, Manfred Schuster: Rudolf-Krammer-Hof, Wien-Mariahilf, 1980 – 1983 Die durch den Block gesteckte Lückenverbauung reagiert durch vertikale und horizontale Schichtungen von Nutzungen und Raumzonen auf die hohen Verkehrsimmissionen am Standort. An der Wienzeile zeigt der ausdifferenzierte Baukörper einen geschosshohen Sockel mit eingeschnittener Freitreppe auf die Stadtebene +1, einer Art Stadtterrasse mit Pflanztrögen im Straßenraum – mit Einblick und Durchwegung durch den begrünten Innenhof. Auf der nunmehr eingeschossig angehobenen Stadtebene sind Büroflächen beidseitig an einem Gartenhof situiert, darüber sind sechs Wohngeschosse angeordnet. Die wienflussseitig, südorientierten Maisonettewohnungen erhalten vorgelagerte Schallschutzwintergärten zur hochfrequentierten Westausfahrt. Die vielfältig nutzbaren, hofseitigen Laubengänge transformieren die Qualitäten des Pawlatschenhauses und erweitern den gemeinschaftlichen Freiraum in die Vertikale. Der Glücksfall einer hybriden Nutzungsanforderung ermöglicht im Rahmen des geförderten Wohnbaus ein städtisches Haus. Allein der erdgeschossige Garagensockel auf der Seite der Mollardgasse ist aus heutiger Sicht abschirmend in seiner Wirkung. Eine Ladenlokalzone könnte eine Interaktionszone im erweiterten Kreuzungsbereich anbieten und die vertikale Verzahnung der beiden Stadtebenen anbieten. Punktuelle Transformationsprozesse im konsolidierten urbanen Gefüge
63
1 Harry Glück + Partner: Wohnhausanlage Inzersdorferstraße, Wien-Meidling, 1971 –1974 Geförderte Wohnhausanlage, Direktauftrag 223 Wohneinheiten 1 – 4-Zimmerwohnungen GFZ 3.5
Splitlevel- und Etagenwohnungen Private Freibereiche: hofseitig Terrassen, gassenseitige Geschosswohnungen: keine Freibereiche. Halböffentlicher Freibereich: Gemeinschaftsdachterrasse mit Schwimmbad. Öffentlicher Freibereich: verkehrsberuhigte Straße, Grünhof als Pocketpark (bei Erstbesiedlung, heute halböffentlich). 2 Wilhelm Holzbauer + Partner: Wohnhausanlage Weiglgasse, Wien-Rudolfsheim, 1974 – 1979 Geförderte Wohnhausanlage, Wettbewerb 1. Preis 292 Wohneinheiten 1 – 4-Zimmerwohnungen 45 m2 bis 120 m2 GFZ 2.8
Maisonette-, Splitlevel- und Etagenwohnungen Private Freibereiche: alle Wohnungen Terrassen. Halböffentlicher Freibereich: Grünhöfe. Öffentlicher Freibereich: Wohnstraße. 3 Franz Kiener, Manfred Schuster: Rudolf-KrammerHof, Wien-Mariahilf, 1980 – 1983 geförderte Wohnhausanlage, Direktauftrag 51 Wohneinheiten 1 – 3-Zimmerwohnungen 46 m2 bis 95 m2 GFZ 4.8 (EG komplett überbaut)
Maisonette- und Etagenwohnungen Private Freibereiche: wienzeilenseitig Wintergärten, Mollardgasse Dachgeschoss Dachterrassen, sonst keine. Halböffentlicher Freibereich: Grünhof, Laubengänge. Öffentlicher Freibereich: Durchwegung bei Besiedlung, heute halböffentlich.
64
UMBAU 29
Ulrich Huhs
4 Alvaro Siza: Wohnhaus Schlesisches Tor, Berlin-Kreuzberg, 1980 –1985, Tageszentrum für Senioren 1982 –1988 / Kindergarten 1983 –1988 Sozialer Wohnungsbau, Wettbewerb 1. Preis 46 Wohneinheiten 2 – 4-Zimmerwohnungen GFZ 3.5 (Wohnhaus)
Etagenwohnungen Private Freibereiche: Wintergärten. Halböffenticher Freibereich: begrünter Innenhof. Öffentlicher Freibereich: Erschließung des begrünten Blockbinnenbereichs. 5 Josef Paul Kleihues: Block 270, Vinetaplatz, Berlin-Wedding, 1971 –1977 Sozialer Wohnungsbau, Wettbewerb 1. Preis 126 Wohneinheiten 1 – 5 ½-Zimmerwohnungen GFZ 1.9 Maisonette- und Etagenwohnungen Private Freibereiche: gassenseitig Loggien, hofseitig Balkone. Halböffenticher Freibereich: begrünter Innenhof. Öffentlicher Freibereich: Diagonaldurchwegung Innenhof zum Vinetaplatz. 6 Jürgen Sawade, Dieter Frowein, Dietmar Grötzebach, Günter Plessow: Wohnen am Kleistpark, Berlin-Schöneberg, 1972 – 1977 Sozialer Wohnungsbau, geladener Wettbewerb 1. Preis 514 Wohneinheiten 1 – 4-Zimmerwohnungen 41 m2 bis 84 m2 GFZ 3.0
Etagenwohnungen Private Freibereiche: alle Wohnungen Minimaloggien. Halböffentliche Freibereiche: Binnenhof, Promenadendeck, Luftgeschoss Wohnscheibe, Gemeinschaftsdachterrassen. Öffentlicher Freibereich: Fußgängerbrücke zum Kleistpark – nicht realisiert.
Punktuelle Transformationsprozesse im konsolidierten urbanen Gefüge
65
Fragmentierte Schließung des Baublocks (4) Alvaro Siza: Wohnhaus Schlesisches Tor, Berlin-Kreuzberg, 1980 – 1985, Tageszentrum für Senioren 1982 – 1988 / Kindergarten 1983 – 1988 Im Rahmen der IBA 1979 – 1987 wurde der Baublock am Schlesischen Tor auf zwei Ebenen adaptiert: im Kontext der IBA Altbau wurde die sanierungsbedürftige Gründerzeitsubstanz einer „behutsamen Stadterneuerung“ unterzogen, im Kontext der IBA Neubau wurden die Kriegslücken im Blockrand unter dem Leitthema der „kritischen Rekonstruktion“ bearbeitet. Die fragmentierte Schließung der Fehlstellen im Blockrand ist als Kommentar auf das Nachkriegs-Berlin lesbar. Die Zerstörung des Stadtkörpers ist allgegenwärtig und wird von Alvaro Siza mit einem poetischen Kommentar in Gebäudeform mit sichtbaren Brüchen beantwortet: Ein siebengeschossiges Wohnhaus, ein eingeschossiges, in der Baulücke freigestelltes Tageszentrum für Senioren mit Gemeinschaftsdachterrasse und eine Lückenfüllung mit einem viergeschossigen Schwesterwohnhaus mit Kindergarten. Der begrünte Blockbinnenbereich wird durch Gebäudefugen zu den Nachbargebäuden punktuell begeh- und erfahrbar: ein informeller Quartierspark entsteht. Die Sockelzone, im Wettbewerbsprojekt zur Gänze, ist in der Umsetzung zur Hälfte mit Ladenlokalen bespielt, in die ein bereits am Standort bestehendes türkisches Restaurant integriert wurde. Die Sensibilität, mit der die brachliegenden Qualitäten des Ortes durch das Bauvorhaben aktiviert und integriert wurden, verweist auf den besonderen Anspruch und das Potenzial einer Internationalen Bauausstellung. Der Block als Wohnhof (5) Josef Paul Kleihues: Block 270, Vinetaplatz, Berlin-Wedding, 1971 – 1977 Das Wohnhaus am Vinetaplatz manifestiert die erste geschlossene Blockbebauung im Westberliner Stadtgebiet der Nachkriegszeit. Die Gebäudetypologie ist als gebauter Protest gegen die Auflösung der stadträumlichen Strukturen der Gründerzeitgebiete durch die Flächensanierungen der 1960er Jahre lesbar. Im Sanierungsgebiet Wedding Brunnenstraße wurde durch den Abbruch der bestehenden, gründerzeitlichen Blockrandbebauung in den 1960er Jahren und den Neubau offener Siedlungsstrukturen der stadträumliche Zusammenhang aufgelöst und durch einen indifferenten, abstandsgründominierten Außenraum ohne räumliche Hierarchisierung ersetzt. Errichtet auf zehn zusammengefassten gründerzeitlichen Parzellen, versucht der Neubau die Anforderungen des Wohnbaus mit den Fragen der identitätsbildenden Stadtraumgenerierung zu vereinen. Bezugnehmend auf Modelle des raumbildenden Städtebaus der Zwischenkriegszeit z.B. in Rotterdam oder Wien 14 entsteht ein begrünter und vom Verkehr abgeschirmter, beruhigter Wohnhof. Das Wesen des Blocks, die Zweiseitigkeit von straßenseitiger Öffentlichkeit und halböffentlicher Sphäre des Hofraums, wird als Potenzial für das Wohnen wiederentdeckt und die Wohnungen partizipieren in Form durchgesteckter Grundrisslösungen 66
UMBAU 29
Ulrich Huhs
von dieser beidseitigen Qualität. Als singulär gebauter Kommentar kann der Baublock 270 den Stadtraum am Vinetaplatz nicht wiederherstellen und bietet alternativ mit den fußläufigen Diagonaldurchwegungen des durchgrünten Innenhofs einen neuen halböffentlichen Freiraum an. Ein hochverdichtetes Stadtfragment (6) Jürgen Sawade, Dieter Frowein, Dietmar Grötzebach, Günter Plessow: Wohnen am Kleistpark, Berlin-Schöneberg, 1972 – 1977 Die Wohnhausanlage am Kleistpark, situiert auf einem Eckgrundstück an der Potsdamerstraße, zeigt prototypisch die Übergangsphase bauwirtschaftsfunktionalistischer Wohnraumproduktion zu Fragestellungen der Stadtraumbildung in innerstädtischen Bestandssituationen. Elemente beider Welten werden in dem sozialen Wohnbau mit 514 Wohneinheiten kombiniert: am Blockrand ist ein U-förmiger Wohnhof mit durchgesteckten Familienwohnungen platziert und in der zweiten Reihe eine straßenüberbrückende Hochhausscheibe mit Kleinwohnungen. Die hohe Bebauungsdichte am Standort wird mit einer Abfolge differenzierter Außenräume kombiniert: ein straßenraumerweiternder Platz vor der erdgeschossigen Ladenlokalzone, ein halböffentlicher Binnenhof und eine fußläufige Spielstraße mit Freitreppe auf die Dachterrasse des eingeschossigen Parkdecks, ein witterungsgeschützter Außenraum im Luftgeschoss des Hochhauses und Gemeinschaftsdachterrassen auf allen Baukörpern. Zu Zeiten des Planungsideals der autogerechten Stadt projektiert, war zusätzlich ein öffentlicher, kreuzungsfreier Übergang zum südlich gelegenen Kleistpark für das angrenzende Quartier vorgesehen, der nicht realisiert wurde. Die Anlage Wohnen am Kleistpark zeigt, bei allen Mängel der Bespielung,15 eine collagenartige, städtebauliche Antwort auf die Fragestellung der Nachverdichtung. Die Weiterentwicklung der konsolidierten Stadt Wenn wir Stadt weiterhin als Labor gesellschaftlicher Entwicklung begreifen, dürfen wir die Fragen nach innovativen Beiträgen zum zukünftigen urbanen Wohnen in der konsolidierten Stadt nicht durch die Arbeitsebene des kleinsten gemeinsamen Nenners blockieren. Bei den im gründerzeitlichen Kernbereich vorherrschenden Liegenschaftsverwertungen, die durch maximale Füllung des Baurechtsrahmens mit Eigentums- und Anlegerwohnungen geprägt sind, entstehen Kubaturen ohne immanente Idee zum Urbanen. Die Wohnung als Produkt hat systemimmanent eine reine Binnenperspektive – die Stadt spielt außer bei der Lagegunst des Grundstücks keine Rolle. Das Wechselspiel von Haus und öffentlichem Raum wird in dieser Vorgangsweise außer Kraft gesetzt: Eigentum verpflichtet nicht mehr. Dies ist weder im Sinne der WohnungskäuferInnen noch der StadtbewohnerInnen, die weder Einfluss auf die Parameter des Fertigprodukts Wohnhaus haben noch auf die langfristig wirksamen Entscheidungen zum öffentlichen und halböffentlichen Raum. Punktuelle Transformationsprozesse im konsolidierten urbanen Gefüge
67
Die Frage, die sich stellt, lautet: Wie können Rahmenbedingungen geschaffen werden, die unter der gesamtgesellschaftlichen Zielsetzung der Nachverdichtung einen Möglichkeitsraum aufspannen, in dem innovative, städtebauliche Weiterentwicklungen innerhalb der konsolidierten Stadt Platz finden? Wie können administrative Regelungen aussehen, die anstatt zu 100 Prozent auszufüllende Lichtraumprofile festzulegen im Rahmen der allfälligen Umwidmungsansuchen Kubaturwidmungen mit Spielräumen für verpflichtende, öffentlich aneigenbare Räume zeichnen, die projektbezogen grundbücherlich abgesichert werden? Dies kann für die notwendige Weiterentwicklung des urbanen Wohnens in der konsolidierten Stadt ebenso entscheidend werden wie eine Bauträgerschaft, die eine kritische Hinterfragung des Status quo der Wohnbauproduktion zum Nutzen der Stadtgesellschaft aktiv mitgestalten will.
1 Bevölkerungswachstum Wien und Berlin 2004 – 2015: jeweils rund 200.000 Einwohner. 2 STEP 2005 und 2025, Stadtentwicklungsplan Wien. 3 Niklas Maak: Wohnkomplex. Warum wir andere Häuser brauchen, München 2014, 43 – 53: Die Stadt. „Leben wie Sophie Charlotte“. 4 Defensiv konnotiert: Das Sicherheitsdenken und Bewahren hat die Zukunftszuversicht als treibende Kraft gesellschaftlichen Handels abgelöst. Bauen – eigentlich ein Vertrauensvorschuss in die Zukunft – wird durch die Vermarktungsmechanismen in eine defensiv dominierte Handlung umdefiniert: Schutz und Sicherheit für die Person und das eingesetzte Kapital. 5 Bruno Kreisky, österreichischer Bundeskanzler 1970 – 1983, Willy Brandt, deutscher Bundeskanzler 1969 –1974. 6 Alexander Mitscherlich: Die Unwirtlichkeit der Städte. Anstiftung zum Unfrieden, Frankfurt am Main, 1965; Club of Rome: The Limits of Growth / Die Grenzen des Wachstum, St. Gallen, 1972. 7 Wettbewerb Wohnen Morgen, österreichweiter Wettbewerb 1974, BM für Bauten und Technik, österreichische Wohnbauforschung.
68
UMBAU 29
Ulrich Huhs
8 Wolf Jobst Siedler: Die gemordete Stadt: Abgesang
Literaturnachweise
auf Putte und Straße, Platz und Baum, Siedler, Berlin
Harry Glück + Partner, Wohnhausanlage
1964; Aldo Rossi: L’architettura della città, 1966,
Inzersdorferstraße, Wien-Meidling, 1971 – 1974
dt. Gütersloh 1973.
Kurt Freisitzer / Harry Glück: Sozialer Wohnungsbau,
9 Internationale Bauausstellung Berlin 1987, DAM,
Entstehung.Zustand.Alternativen, Wien 1979.
Frankfurt am Main 1986.
Irenäus Eibl-Eibesfeldt / Hans Hass / Kurt Freisitzer et al.:
10 z. B. in Berlin der sogenannte Hobrechtplan von
Stadt und Lebensqualität. Neue Konzepte im Wohnbau
1862 – ein Straßenregulierungsplan für die Erweiterung
auf dem Prüfstand der Humanethologie und der
der stark wachsenden Residenzstadt.
Bewohnerurteile, Stuttgart 1985.
11 Berlin: Traufhöhe 22 m, Wendekreis der Feuerspritze
Wilhelm Holzbauer + Partner, Wohnhausanlage
als mindeste Hofgröße.
Weiglgasse, Wien-Rudolfsheim, 1974 – 1979
12 Jonas Geist: Das Berliner Mietshaus. Band 2:
Bundesministerium für Bauten und Technik:
1862 – 1945, Prestel, München 1984.
Wohnen Morgen, baukünstlerischer Wettbewerb Wien,
13 Im Zuge von Umwidmungsansuchen könnten
Wien 1974.
von Seiten der Administration bindende Auflagen fest-
Österreichisches Institut für Bauforschung (Hg.):
gelegt werden, die im Gegenzug für die privaten
Wohnen Morgen, Wien 1979.
Umwidmungsgewinne durch z. B. Höherzonierungen
Wilhelm Holzbauer: Bauten und Projekte 1953 – 1985,
als Beitrag für den öffentlichen Raum zum Tragen
Salzburg 1985.
kommen.
Peter Machart: Wohnbau in Wien 1923 – 1983, Wien
14 Tusschendijken Wohnsiedlung, Rotterdam, Architekt
1984, 164 –165.
Oud; Wohnhöfe des Roten Wien.
Franz Kiener, Manfred Schuster, Rudolf-Krammer-Hof,
15 Aufgrund geringer sozialer Durchmischung und
Wien-Mariahilf, 1980 – 1983
Verwahrlosung stand das Ensemble 1998 vor dem
Peter Machart: Wohnbau in Wien 1923 – 1983, Wien
Abbruch. Durch bauliche Sanierungsmaßnahmen und
1984, 146 – 149.
Implementierung eines aktiven Wohnanlagenmanage-
Alvaro Siza, Wohnhaus Schlesisches Tor, Berlin-
ment konnte das Gebäudeensemble neu bespielt werden.
Kreuzberg, 1980 – 1985 Neighbourhood. Where Alvaro meets Aldo. Portuguese Pavilion at Venice Architecture Biennale 2016. Brigitte Fleck: Alvaro Siza, Basel – Boston – Berlin 1992, 77 – 85. Learning form IBA – die IBA 1987 in Berlin, hg.v. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Berlin 2010. Josef Paul Kleihues, Block 270 Vinetaplatz, Berlin-Wedding, 1971 – 1977 Josef Paul Kleihues: Works 1966 – 1980, vol. 1, hg.v. Thorsten Scheer, Ostfildern 2008. Jürgen Sawade, Dieter Frowein, Dietmar Grötzebach, Günter Plessow, Wohnen am Kleistpark, Berlin- Schöneberg, 1970 – 1977 Wolfgang Schäche (Hg.): Jürgen Sawade. Bauten und Projekte 1970 – 1995, Berlin 1997.
Punktuelle Transformationsprozesse im konsolidierten urbanen Gefüge
69
Angelika Psenner
Funktionen des „Ebenerds“– „StadtParterre“ reloaded In der realen Stadt stehen die Potenziale des Straßenraums in direkter Abhängigkeit zu Konstitution und Nutzung des angrenzenden Erdgeschosses. Deshalb sprechen wir in unseren Studien vom sogenannten StadtParterre.1 Die StadtParterre-Idee erfasst die Parterrezone einer Stadt als Ganzes: Dabei werden umbaute und nichtumbaute Areale – also Straße, Erdgeschoss und Hof – als Einheit behandelt, sodass Interrelationen sichtbar und entsprechend analysiert und behandelt werden können. Für diesen Zugang stellen sich die derzeit (in Wien) zur Verfügung stehenden Analyse- und Planungsinstrumente als kaum geeignet heraus: Die Flächenmehrzweckkarte (MZK) beinhaltet wohl genaue Informationen bezüglich öffentlicher Raum; sobald wir die Parzellengrenze nach innen überschreiten, stehen wir jedoch vor einer weißen Fläche. Da die MZK lediglich die Umrisse der Gebäude erfasst, wird die innere Struktur der Stadt ausgespart. EG-, Straßen- und Hof-Nutzungen sind demnach nicht in der nötigen Klarheit dokumentiert und können deshalb nicht objektiv im strukturellen Zusammenhang untersucht werden. Das klassische 3D-Stadtmodell wiederum erweist sich für Analysen im Mikrostrukturbereich als ungeeignet, da die derzeit verwendeten Parameter Modelle in grobmaschiger Auflösung produzieren, die in erster Linie für die Vogelperspektive ausgelegt sind. Die gesuchten Informationen auf Aughöhe vermögen diese nicht anzubieten.2 Doch in unserer stadtanalytischen Arbeit waren wir schon einmal bedeutend weiter. Bereits im 18. Jahrhundert hat Giovanni Battista Nolli in seiner „nuova pianta di Roma“ – besser geläufig als „Nolli-Plan“ – neben den bebauten Parzellen vor allem die öffentlich zugänglichen Stadträume (Kirchen, Gärten und Innenhöfe) darzustellen vermocht. Weniger bekannt sind die Arbeiten der Stadtmorphologen Gianfranco Caniggia und Saverio Muratori: indem sie Hausgrundriss an Hausgrundriss legten und so letztendlich das feinstrukturierte städtische Gewebe zur Darstellung brachten, entwickelten sie in den 1960 er Jahren die Methode der Zusammenhängenden Grundrissaufnahme (ZGA).3 In der Folge nahmen viele StadtforscherInnen und 70
UMBAU 29
StadtplanerInnen diese Art morphologischer Studien auf.4 Den größten Anklang fanden sie wohl in der Schweiz: Die in den 1960er Jahren von Tessiner Architekten eingeleitete und in den 1970er Jahren an der ETH Zürich weitergeführte Inventarisierungsarbeit erfuhr in den späten 1990 ern mit der Gesamterfassung der Kernstadt Zürich einen neuen Auftrieb.5 (vgl. Psenner 2014a, 31f.) Ein jähes Ende erfuhr der Einsatz dieser feingliedrigen, detailreichen ZGA-Plandarstellung in den 2000 er Jahren mit dem Aufkommen der 3D-Stadtmodelle. Im Digitalisierungssturm jener Zeit wurde zunehmend Wert auf eine „zeitgemäße Grundlage für eine moderne Stadtplanung“ gelegt, sodass nicht weiter in die ob ihrer aufwendigen Datenerhebung zeit- und ressourcenintensive ZGA-Methodik investiert wurde.6 Für exakte morphologische Studien zum Thema öffentlicher Raum und Parterre einer Stadt erweisen sich 3D-Modelle in der vorhandenen Form jedoch als ungeeignet (siehe oben). Im Zuge einer in den Jahren 2012 – 2014 an der TU Wien durchgeführten Pilotstudie wurde die oben besprochene Darstellungs- und Analysemethode nun erneut aufgegriffen, weiterentwickelt und in die Dreidimensionalität übergeführt. Um die zuvor beschriebene Herangehensweise der StadtParterre-Idee zu unterstreichen, sprechen wir nun von der Dreidimensionalen Zusammenhängenden Parterreaufnahme (3D -ZPA). Abb.1 Für die Erstellung einer 3D -ZPA werden die entsprechenden, in der Baupolizei archivierten Dokumente (sowohl Schriftstücke, die Informationen zu Gewerbegenehmigungen und Platzzins- bzw. Gebrauchsabgaben beinhalten, als auch Pläne) fotografiert und analysiert. Die auf diese Weise erhobenen historischen und aktuellen Daten werden im Feld vor Ort kontrolliert und bei Bedarf ergänzt. Daraufhin werden die Plandaten, aufbauend auf die digitale Flächenmehrzweckkarte in ein dreidimensionales Modell eingearbeitet.7 Ebenso werden nahezu lückenlose Hausbiografien erstellt: Sie geben Aufschluss über die Besitzverhältnisse, die diversen baulichen Veränderungen und vor allem über die sich im Lauf der Jahre verändernde Nutzungssituation in den Erdgeschossen, Höfen und am Gehsteig. Abb.2 Die kleinteilige, exakte Darstellung des 3D -ZPA erlaubt nun eine eingehende strukturelle Analyse der städtebaulichen Situation: So kann z.B. aufgrund der Gewerbegenehmigungen und Platzzinsvorgaben die historische Nutzungsstruktur (fast lückenlos) festgestellt und diese den aktuellen Nutzungen gegenübergestellt werden. Daraus geht ein deutlicher Rückgang der sogenannten halböffentlichen Nutzungen im Erdgeschoss hervor. Abb.3 Funktionen des „Ebenerds“ – „StadtParterre“ reloaded
71
Abb. 1 Die Mehrzweckkarte (oben) zeigt lediglich die Umrisse der Bebauung, während die 3D-ZPA (unten) die innere Struktur des StadtParterres wiedergibt.
Abb. 2 Modelldarstellung 3D-ZPA.
72
UMBAU 29
Angelika Psenner
Abb. 3 Die Gegenüberstellung der historischen Nutzungsstruktur von 1910 und der aktuellen StadtParterre-Situation ermöglicht die Abhandlung grundlegender Forschungsfragen: Wie funktionierte das historische Wiener StadtParterre und welche urbanen Funktionen und Abläufe stellen wir heute fest? Welche Relation bestand / besteht zwischen öffentlichem Raum und dem Leben innerhalb der angrenzenden Gebäude?
Funktionen des „Ebenerds“ – „StadtParterre“ reloaded
73
In der Städtebau-Theorie beschreibt der Terminus „halböffentlich“ eine für die Allgemeinheit offene, jedoch zeitlich beschränkte und über sozial definierte Interaktionen geregelte Zugänglichkeit zu Räumen, welche sich eigentlich in privatem Besitz befinden – es sind Räume innerhalb von privaten Häusern bzw. Einheiten, die eine gewollte, jedoch geordnete und gelenkte Besucherfrequenz aufweisen. Halböffentliche Nutzungen sind z.B. Geschäfte, Praxen, Kaffeehäuser, Gastwirtschaften und dergleichen. Erdgeschoss-Nutzungen Im Rahmen der Pilotstudie wurde ein Gassenzug in einem Wiener Innenbezirk erforscht. Es handelt sich hierbei um eine Straße in Nebenlage (weder eine Hauptverkehrs-, noch eine Geschäftsstraße) in einem dicht verbauten gründerzeitlichen Areal.8 Im untersuchten 190 m kurzen Straßenstück waren um 1910 folgende Nutzungen in der EG-Zone untergebracht: 7 Gastwirtschaften / Kaffeehäuser / Kaffeesiederei / Branntweiner 5 nicht genauer beschriebene Verkaufs- bzw. Gassenlokale, zuweilen auch „Gewölbe“ bzw. „Gwölb“ genannt 4 Gemischtwarenverschleißer 3 Bäckereien / Zuckerbäckereien 2 Pfaidler(in) 2 Waschwarenerzeugung 2 Tischlerei / Möbelfabrik 2 Fleischselcherei und Fleischhauerei 1 Apotheke 1 Molkerei 1 Herren-Frisör 1 Druckerei der Sonn- und Montagszeitung 1 Bethaus 1 Pharmafirma 1 Privatlehranstalt für Krawattennähen 1 Korkwarenerzeugungsgewerbe; ab 1912: Tischlerei 1 Rahmen- und Leistenerzeugungsbetrieb; ab 1928: Glasschleiferei 1 Geschäft mit Celluloidwaren 1 Papierverschleißer; ab 1911: Schlossermeister 1 Wäscheputzerei Diese lange Liste an unterschiedlichen gewerblichen – zumeist produktionsorientierten – Nutzungen zeugt von einer großen und reichen Varianz, die dazu beiträgt, dass das gründerzeitliche StadtParterre als außerordentlich belebt angenommen werden darf.9 Das damals existente Angebot geht also weit über den heute geforderten Einzelhandel hinaus. Es versteht sich, dass die aktuell in der Stadtforschung rege diskutierten Themen der Post-Wachstumsökonomie und der Mobilitätsproblematik hier nun Erwähnung finden müssen. Ich kann als Stadt(planungs)forscherin nicht umhin, an dieser Stelle die Relevanz eines systemischen Umdenkens in Bezug auf unsere, derzeit als allgemein 74
UMBAU 29
Angelika Psenner
richtig gesehene und viel zu selten angezweifelte Macht der Wachstumsökonomie anzusprechen und die – damit Hand in Hand einhergehende – Allmacht der aktuellen Form unseres Mobilitätsverständnisses. Permeabilität der Fassade Aus historischer Sicht stellt die Wiener Erdgeschosszone also großteils halböffentlichen Raum dar. Aufgrund der hohen Besuchsfrequenz bewirkte diese spezielle, dem Straßenraum zugewandte, offene Nutzungsweise, dass die Fassade als permeable fungierte: Sie ermöglichte einen übergreifenden Austausch zwischen öffentlichen und halböffentlichen Sphären. Originalaufnahmen aus der Zeit belegen, dass die Türen der Gassenläden und der sogenannten „Gewölbe“, die diversen Fenster, Tore und Hauseinfahrten zumeist offenstanden. Ebenso zeigen Bilder aus diversen südeuropäischen Städten – nämlich jenen, deren belebtes, funktionierendes Erdgeschoss uns augenblicklich in Erinnerung gerufen wird –, dass die Fassaden dort noch heute durchlässig sind. Und zwar nicht nur visuell einsichtig (durch große Glasscheiben), sondern eben real, haptisch und funktional verbunden. Es ist notwendig, dass wir diesen Permeabilitätszustand von Um- oder Neubauten prüfen: Die visuelle Durchlässigkeit muss sowohl bei Tag als auch bei Nacht (Thema: Sicherheitsgefühl und indirekte Beleuchtung des öffentlichen Raums durch Gassenfenster und Vitrinen) von einer gewissen Qualität sein. Dieser Umstand weist mit einem Mal den Einbau von EG-Garagen oder Lagerräumen als widersinnig aus. Ebenso müssen reine Fixverglasungen im Erdgeschoss – welche derzeit aus Kostengründen gerne Anwendung finden, die jedoch ein Öffnen und Verbinden unmöglich machen – in Frage gestellt werden. Die haptische 10 Durchlässigkeit soll sichergestellt sein: halböffentliche oder auch private Nutzungen des Parterres können auf die Straße hinauswachsen und umgekehrt bleiben die Räumlichkeiten zugänglich für den public flow. Damit wird eine Grundvoraussetzung für ein ansprechendes, belebtes StadtParterre geschaffen. Gehsteig Unter dem ganzheitlichen Aspekt des Begriffs StadtParterre und unterstützt durch die mikrostrukturelle Darstellungsweise der ZPA wird nun auch die Primärfunktion des Gehsteigs wieder ins rechte Licht gerückt: . Der einfach und direkt zugängliche Gehsteig ist der wichtigste Aufenthaltsort im öffentlichen Raum, der Ort, an dem Menschen aufeinandertreffen, wo sie einander relativ frei begegnen oder einander einfach nur beobachten können. Es ist nicht zuletzt auch ein Ort, an dem Minderheiten und Mehrheiten einer diversifizierten Gesellschaft sich interaktiv integrieren können. Funktionen des „Ebenerds“ – „StadtParterre“ reloaded
75
. Klarerweise sollte es möglich sein, diesen seinen vielfältigen Funktionen entsprechend geräumigen (!) städtischen Ort auf unterschiedlichste Art und Weise zu bespielen. Laut Straßenverkehrsordnung ist der Gehsteig integraler Bestandteil der Straße und als solcher dem Verkehr vorbehalten. Die Benützung von Gehsteigen „zu anderen Zwecken als zu solchen des Straßenverkehrs“ ist bewilligungspflichtig. Laut §78 ist es ausdrücklich verboten „den Fußgängerverkehr durch unbegründetes Stehenbleiben zu behindern“. (Psenner 2004c; 2011a: 203f.) Ab einer Gehsteig-Mindestbreite von 4 m wird urbanes Stadtleben gefördert, denn eine geeignete Gehsteigbreite ist Voraussetzung, um sich in angenehmer Distanz zu begegnen und sich in Gruppen aufhalten zu können. Dieses social gathering führt dann wiederum dazu, dass öffentlicher Raum vorteilhaft wahrgenommen werden kann. (Psenner 2011a: 200f.) Öffentlicher Straßenraum Auf die Verkehrsthematik kann an dieser Stelle nicht genauer eingegangen werden – hier sei auf andere Publikationen zum Thema verwiesen („Don’t Even Think Of Parking Here. Wiener Straßenraum: Verhandlung von Nutzungsrechten und Nutzungsansprüchen“, Psenner 2014 b). In Wien war öffentlicher Straßenraum immer „für alle zugänglich“; seine Nutzung war den Bedürfnissen des alltäglichen Lebens der BürgerInnen vorbehalten; das Besetzen von Straßenraum durch private Güter jeder Art war bei Strafe und Kerker verboten (vgl. Psenner 2014 b: 128). Erst im Jahr 1938 – durch das Inkrafttreten der NS-StVO – wurde das Parkieren von Fuhrwerken / Fahrzeugen bei Nacht generell erlaubt. Erst ab diesem Zeitpunkt war die rechtliche Voraussetzung für diese Art der Privatisierung durch Privilegierte geschaffen worden – zum Vergleich: Tokio, eine 35-Millionen-Metropole, kann / will sich diese Ungleichbehandlung von BürgerInnen nicht erlauben. (vgl. Psenner 2014b: 138f.) Um ein Funktionieren der StadtParterres sicherzustellen, ist es erforderlich, die StVO – im Übrigen eine Neuformulierung der genannten NS-StVO – im Ganzen neu zu überdenken. Ein Gendern der Gesetzesformulierung (wie zuletzt im Jahr 2015, bei der letzten Novellierung der StVO) greift für eine reale Verbesserung der gesetzlichen Bestimmungen zu kurz. Der räumliche Zusammenhang des StadtParterres Während das historische StadtParterre als einheitliche, in sich verbundene Struktur funktionierte Abb.4 oben , ist die ursprüngliche Permeabilität und der Austausch zwischen den verschiedenen Zonen heute nicht mehr gegeben. Uneinsichtige Barrieren (zumeist unternutzte oder strukturfremde Bereiche wie Garage, Lager mit ihren zugemauerten Fenstern; die Großeinheiten von Supermärkten, mit ihren verklebten Fenstern) zerlegen und brechen das StadtParterre.
76
UMBAU 29
Angelika Psenner
Abb.4 Während das historische StadtParterre als einheitliche, in sich verbundene Struktur funktionierte (oben), ist die ursprüngliche Permeabilität und der Austausch zwischen den verschiedenen Zonen heute nicht mehr gegeben. Uneinsichtige Barrieren (zumeist unternutzte oder strukturfremde Bereiche) zerlegen und brechen das StadtParterre.
Conclusio Auf Grundlage der ZPA und der entsprechenden Hausbiografien lassen sich architektonische und nutzungstechnische Veränderungen des historischen StadtParterres feststellen und analysieren. Ebenso werden Änderungen in der Fassadengestaltung betreffend Gebäudeöffnungen und die damit einhergehenden FassadenPermeabilität erfasst, sodass Art und Qualität der Verbindungen zwischen gebautem Raum, Hof und Straße klassifiziert werden können. Schlussendlich gewinnen wir anhand dieses systemischen, ganzheitlichen Zugangs Einsicht in die funktionalen Zusammenhänge der derzeitigen Nutzungslage. Daraus lassen sich allgemeingültige Aussagen über das Wiener StadtParterre ableiten. Abschließend möchte ich also die besprochenen Themen in einem Register überblicksmäßig zusammenfassen und diesen Vorschläge-Katalog durch weitere Themen (welche in ihrer Diskussion den Rahmen des vorliegenden Texts gesprengt hätten) ergänzen:
Funktionen des „Ebenerds“ – „StadtParterre“ reloaded
77
Register / Katalog: Die EG -Zonen (zumindest die straßenzugewandten Räume, die ursprünglich oft als „Gewölbe“ bezeichnet wurden) müssen als halböffentliche Zone im Flächenwidmungsund Bebauungsplan tituliert werden. Diese Zone hat eine halböffentliche Wertigkeit, sodass sie mit bestimmten Auflagen bedacht werden kann. Verbot bestimmter Unternutzungen (Garage, Lager, subjektiver Leerstand). Nachdem ein Verbot schwer durchsetzbar ist, kann diese Forderung nur dadurch erreicht werden, dass bestimmte für das StadtParterre aus systemischer Sicht ungünstige Nutzungen mit Auflagen versehen werden. Eine Rechtfertigung dafür sehe ich in dem Umstand, dass jede Art der Unternutzung sich auf die Nachbargebäude und letztendlich auf den gesamten Straßenzug auswirkt und dass diese negativen Folgewirkungen wiederum durch die Gesellschaft getragen werden müssen (Straßenbelebungsaktionen der Stadt, höheres Sicherheitsaufgebot etc.). Gemäß seiner Funktion innerhalb des Systems StadtParterre soll das EG wieder vermehrt in direkter logistischer und baulicher Verbindung zum Keller stehen. Dadurch können den Geschäfts-, Handels- und Gewerberäumen zugeordnete Lager entsprechend situiert werden. Zudem können Lager im Keller auch einfach von der Straße aus bedient, d. h. befüllt werden – sofern, wie z.B. in Manhattan und früher auch in Wien, die Zulieferluken wieder eingeführt /geöffnet werden (damit verbunden ist die Forderung nach breiteren Gehsteigen, s.u.). Kleinteiligkeit. Produzierendes Gewerbe und lokale Kleinökonomien sind erwiesenermaßen auf kleine, flexible, kostengünstige Einheiten angewiesen. Diesem Umstand wird z.B. in italienischen Städten seit jeher Rechnung getragen: in Rom und Venedig wird jede Straßenöffnung, ob Fenster oder Tür, durchnummeriert, womit eine hochflexible Kleinteiligkeit fest in die sich ständig ändernde Stadtstruktur eingeschrieben bleibt. (vgl. Psenner 2014a: 84) Von Vertretern der Wirtschaft wird immer wieder das Zusammenlegen von kleinen Einheiten verlangt, mit der Begründung, dass „VerbraucherInnen“ heute ein großes Sortiment verlangen und der Einzelhandel eben nicht umhin kann, dieses bereitzustellen – ein Umstand der nach großen Lager- und Angebotsflächen verlange. Doch erstens gehören Lagerflächen, so wie früher, in den Keller (wir sind heute technisch in der Lage, jeden Kellerraum so auszuführen, dass er zur Lagerung von Gütern taugt; siehe auch oben „Verbindung zum Keller“) und zweitens kann die Aussage bezüglich „Kundenwunsch“ auch getrost angezweifelt werden, wenn man – nicht zuletzt durch Eigenbeobachtung – feststellt, dass über die Zeit doch immer wieder die gleichen Artikel gekauft werden. Die Sortimentsfrage ist wohl eher ein marktdienlicher Manipulations- und Werbefaktor. Gediegene Raumhöhen, um jede Art der Nutzung zu ermöglichen. Das Wissen um die funktionale und gestalterische Kraft großzügiger Raumhöhen ist in den Köpfen der PlanerInnen und EntscheidungsträgerInnen bereits präsent und muss hier nicht weiter ausgeführt werden. (vgl. dazu: Psenner 2011b, 2012a, 2014a) Visuelle Permeabilität. „Die Fenster – die ursprünglich die Verbindung zwischen Öffentlich und Privat herstellten, die zur Interaktion einluden und damit das Erdgeschosslokal, sofern dies mit der Nutzung kompatibel war, zum halböffentlichen Raum machte – diese Fenster werden nun verspiegelt, mit Plakaten verklebt oder ganz 78
UMBAU 29
Angelika Psenner
zugemauert. Sodass die mit der Straße korrelierenden Räume des Hauses endgültig von der städtischen Öffentlichkeit abgetrennt werden. Damit verliert der Straßenraum eine Sphäre, die über die rein euklidischen Raumabmessungen weit hinausgeht. Das ambivalente Nutzungsangebot, das Nebeneinander von gegensätzlichen Möglichkeiten, die Widersprüche und die daraus erwachsende Spannung, die das – wie Häußermann / Siebel es formulieren –‚ positive Moment der urbanen Lebensqualität, des Stadtlebens im Allgemeinen ausmachen‘, wird damit beträchtlich reduziert.“ (Psenner 2005: 8) Auch dieser Aspekt ist bereits anerkannt und gilt nun als „State of the art“. Haptische Durchlässigkeit. Für ein funktionierendes StadtParterre ist die reale Durchlässigkeit der Erdgeschossfassade von großer Wichtigkeit: Der Austausch zwischen Innen und Außen muss gegeben sein. In den ursprünglichen Einreichplänen der gründerzeitlichen Stadthäuser waren kleinteilige Einheiten mit Gassenlokalen, auch „Gewölb“ genannten, Räumen vorgesehen. Hier war im Durchschnitt jede zweite, oft aber auch jede Öffnungsachse als Gassentüre ausformuliert. Zusätzlich wurde die Gassenfassade ihrer Sonderfunktion entsprechend speziell gestaltet: die historische Portalkonstruktion bediente sich einer filigranen Holz-Glas-Struktur, welche der Mauer vorgelagert wurde und mittels derer diese sensible Zone entsprechend inszeniert werden konnte: bessere Einsichtigkeit, Zugänglichkeit, witterungsgeschützte Präsentation der Waren. Der Vergleich mit, vor allem, südeuropäischen Stadtkulturen zeigt, dass dort EG-Nutzungen nach wie vor in den Straßenraum hinauswachsen können. Werden z. B. Kinderwagen- und Radabstellräum direkt über die Gasse erschlossen, so erfahren diese Nebenräume nicht nur eine sinnvollere Anwendung, sondern bereichern und beleben – wenn z. B. auch mal ein Rad im notwendigerweise geräumigen (!) Gehsteigbereich repariert wird – zugleich auch der Straßenraum. Denn wir wissen nicht erst seit Jan Gehl, „dass Nutzungen weitere Nutzungen anziehen“. Über das StadtParterre-Konzept wird das EG in einen systemischen Zusammenhang mit den Innenhöfen gestellt: die Entsiegelung und Nutzbarmachung der Innenhöfe – die per Flächenwidmungsplan und Bebauungsplan über die Widmung „G“ = „gärtnerische Ausgestaltung“ zwar bereits vorgesehen ist – muss umgesetzt: gefordert, gefördert und exekutiert werden.11 Entsprechende Ausgestaltung des öffentlichen Raums: . Gehsteigbreite: Mindestbreite von 4m (z.B. nach New Yorker Vorbild). Von einer Gehsteig-mittigen Straßenbeschilderung (um das Öffnen der Autotüren geparkter Pkws zu ermöglichen), ist generell abzusehen. . Gestaltung / Verschattung des Gehsteigs: Der Gehsteig ist ein besonderer Ort, den es mit Bedacht zu gestalten gilt. Die sensible Übergangszone zwischen Innen und Außen benötigt Raum, der ein Inszenieren des Austausches zwischen Halböffentlich und Öffentlich zulässt. Zudem wird für die wärmere Jahreszeit unter den gegebenen klimatischen Voraussetzungen (Klimawandel) eine entsprechende Verschattung des Gehsteigs wichtiger. In Anlehnung an die einst gängige, typische Wiener „Sonnenplache“ wäre Funktionen des „Ebenerds“ – „StadtParterre“ reloaded
79
Abb. 5 Stadtsystemische Analyse eines StadtParterre-Ausschnitts.
eine neue flexible, textile Lösung anzudenken. Haptisch geschlossene EG -Fassaden, welche zudem zumeist keine temporäre Verschattungsmöglichkeit vorsehen, sind zu vermeiden. . Straßenraum: Rückbau des stehenden MIV. Permanente Vereinnahmung von Straßenraum durch privates Gut muss entsprechend verrechnet werden. Parken im öffentlichen Raum muss teuer sein, denn die indirekt verursachten Mehrkosten, welche ein nicht funktionierendes StadtParterre hervorruft, müssen die Stadt, also die Gesellschaft tragen. In diesem Sinne sollen z. B. Schrägparkanlagen – eine besonders ungünstige Erfindung der 1970er Jahre – zur Gänze verschwinden. (ad Parken im öffentlichen Raum vgl. Psenner 2011a: 203 – 209; 2014b; 2015a) Abb.5 80
UMBAU 29
Angelika Psenner
Änderung der StVO: Zum Abschluss eine der wichtigsten Forderungen: die Abänderung der StVO – ein Gesetz, das sich in seiner Formulierung an das NS -Gesetz von 1938 anlehnt und dessen Ziel es war, die Vormachtstellung des motorisierten Individualverkehrs (MIV) durchzupushen. Ich denke, es ist an der Zeit, dieses Gesetz an die Ansprüche einer aufgeklärten Gesellschaft anzupassen. . Straßenraum ist nicht per se Verkehrsraum, sondern Aufenthaltsraum für StadtbewohnerInnen! Mobilität ist nur eine Form des Aufenthalts. . Gehsteige sind besondere Bereiche: Sie sind essenzielle städtische Räume für das Zusammenleben der Menschen, sie sind Orte, an denen Menschen aufeinandertreffen, dementsprechend müssen sie genügend Platz für die BenützerInnen bieten. Der Passus „verkehrsfremde Nutzung ist bewilligungspflichtig“ muss gestrichen werden. . Der §78, welcher „unbegründetes Stehenbleiben“ verbietet, muss ersatzlos gestrichen werden. Er führt z.B. dazu, dass Gassenverkauf immer wieder eingeschränkt und verboten wird – wegen der sich hier bildenden Menschentrauben. Dadurch bewirkt er indirekt eine Zunahme der Verhüttelung von öffentlichem Raum: denn Gewerbe, die in erster Linie über den Gassenverkauf funktionieren, müssen nun zunehmend auf die Nutzung von sogenannten „Standeln“ ausweichen. Änderung des Garagengesetzes: Die Stellplatzverordnung muss gestrichen werden: Autobesitz ist kein Grundrecht, er verursacht vielmehr direkte und indirekte Kosten die – wie bekannt – nur zu einem Bruchteil von den BesitzerInnen selbst getragen werden. (Psenner 2015b; 2015c; 2014a; 2014b; 2012b)
1 Der vorliegende Text basiert auf den Erkenntnissen
teiligere Ebene – nämlich die zusätzlichen Daten der
diverser Studien und Forschungsprojekte, welche in den
ZPA – einzubringen (der Unterschied zwischen ZPA und
vergangenen Jahren unter der Leitung der Autorin
ZGA wird im Folgenden erklärt).
abgewickelt wurden (2004 IFK-Wien; 2010 – 2014 FB
3 Muratori und Caniggia erstellten ZGAs zu diversen
Städtebau, TU Wien; seit September 2015 FB Städtebau,
Innenstadtbereichen u.a. von Venedig, Como, Florenz,
TU Wien).
Rom und Ponticelli, einem der äußeren Quartieri in
2 Das 3D-Stadtmodell Wien wurde im Jahr 2002 in
Neapel.
Auftrag gegeben und wird seither im Dreijahresrhyth-
4 Besonders erwähnenswert ist die umfassende Studie
mus überprüft und ergänzt. Es bietet die Tools: Baukör-
zu diversen Pariser Quartiers unter der Leitung von
permodell, Dachmodell und digitales Geländemodell.
Bruno Fortier (vgl. Fortier 1989).
Die entsprechenden Geodaten werden von der Stadtver-
5 Meist umfasst die ZGA neben dem Erdgeschoss auch
messung Wien (MA41) verwaltet. Es gilt hier eine klein-
Keller- und Regelgeschoss-Pläne, manchmal auch eine
Funktionen des „Ebenerds“ – „StadtParterre“ reloaded
81
typologische Katalogisierung der Wohnbauten. Die
Literaturnachweise
Zürcher Studie aus dem Jahr 1999 lief unter der Leitung Davis, Howard (2012): Living Over the Store: der Bauforscherin Margareta Peters. Von folgenden
Architecture and Urban Life, London – New York:
Schweizer Städten bzw. Quartieren bestehen ZGA:
Routledge.
Bellinzona, Luzern, Bern (Altstadt), Solothurn (Zu-
Fortier, Bruno (1989): La Métropole Imaginaire:
stand um 1900), Bern (Altstadt um 1200), Biel, Tessin,
Un atlas de Paris, Bruxelles: Pierre Mardaga.
Zurzach, Le Landeron, Baden, Wil, SG (Altstadt),
Gehl, Jan (1996; orig. 1978): Life between Buildings:
Zürich (Altstadt historisch, Altstadt um 1955, Indus-
Using Public Space, translated by Jo Koch, København:
triequartier und Stadelhofen).
Arkitektens Forlag.
6 Mittlerweile verfügt nahezu jede größere Stadt über
Krusche, Jürgen / Roost, Frank / Dept. Architektur
ein entsprechendes 3D-Stadtmodell – eine für die Pro-
ETH Zürich (Hg.) (2010): Tokyo. Die Straße als gelebter
jektplanung (Simulation geplanter Bauprojekte) geeig-
Raum, Baden, CH: Lars Müller Publishers.
nete visuelle Darstellungsform bzw. ein effizientes
Muratori, Saverio (1960): Studi per un operante storia
Arbeitsinstrument für Sichtbarkeits-, Lärmausbrei-
urbana di Venezia, Roma: Istituto Poligrafico e Zecca
tungs- und Solarpotenzialanalysen, Schattenberechnun- dello Stato, Libreria dello Stato. gen, Überflutungssimulationen, Windkanalstudien etc.
Peters, Margareta (1999): „Elektronische Erfassung
7 Die Modellierung erfolgt mit der Bauplanungs -
eines Industriequartiers: Zusammenhängende Grund-
software Autodesk Revit®, die speziell für Building
rissaufnahme in Zürich, ein Experiment“, in: Schweizer
Information Modeling (BIM) entwickelt wurde und
Ingenieur und Architekt 117, Nr. 37, 779 –784.
einen koordinierten und konsistenten modellbasierten
http://retro.seals.ch/cntmng?pid=sbz-003:1999:117::587
Planungszugang ermöglicht – im Hinblick auf etwaige
(11.08.2016).
zukünftige Forschungs- oder Planungsvorhaben.
Psenner, Angelika (2004a): Wahrnehmung im urbanen
8 Aus Gründen des Datenschutzes werden alle Anga-
öffentlichen Raum, Wien: Turia und Kant.
ben bezüglich der hier besprochenen Studien zum
. (2004b): „Kleingaragen, Kleinhandel und Kleinbürger-
Wiener StadtParterre (sowohl die abgeschlossene Pilot-
lichkeit: Wiens Erdgeschoßzone und öffentlicher
studie als auch das laufende FWF-geförderte
Raum“, ORF-Science, im Netz:
Forschungsprojekt) anonymisiert.
http://science.orf.at/science/news/116778.
9 Diese Annahme wird durch unzählige historische,
. (2004c): „Kleingaragen, Kleinhandelssterben, Klein-
sowohl bildliche als auch literarische, Aufnahmen
bürgerlichkeit: Einfluss von Struktur und Nutzung der
belegt und bestätigt.
Erdgeschoßzone auf den städtischen Raum“, Vortrag
10 Hier ist „haptisch“ als Gegenpol zu „visuell“
am IFK, Wien am 28. 06. 2004.
gemeint! – wohlgemerkt nicht das Gegenteil (denn das
. (2004d): down and out: Erdgeschoß und Straßenraum
wäre „taktil“). Haptisch (aus dem Griechischen: „fühl-
in Wien bzw. Das Erdgeschoß in der Stadt, Vortrag im
bar“ bzw. „zum Berühren geeignet“) bezeichnet das
Rahmen der LVA „Wechselwirkungen zwischen dem
tastende „Begreifen“ im Wortsinne, also die Wahrneh-
Strukturwandel der Öffentlichkeit und des öffentlichen
mung durch aktive Exploration.
Raumes“ am Institut für Städtebau, TU Graz, am
11 Im Rahmen der laufenden StadtParterre-Studie
18. 10. 2004.
ergibt die detaillierte Analyse der Innenhof-Situation,
. (2005): „Parterre. Wechselwirkung zwischen Erdge-
dass sämtliche Innenhöfe des gewählten Parterre-
schoss und Straßenraum in Wien“, in: IWI Kulturverein
Systems fast vollständig versiegelt sind und dass sie
zur Förderung der Interdisziplinarität (Hg.), dérive
zumeist lediglich zum Abstellen von Müllcontainern
Nr. 18 / 2005, 8 – 11.
und Fahrrädern genutzt werden.
. (2011a): „Integrative Diversität zu ebener Erd’? Das Entwicklungspotenzial der stadträumlichen Struktur des Wiener Gründerzeit-Parterres“, in:
82
UMBAU 29
Angelika Psenner
Sozialwissenschaftliche Studiengesellschaft (Hg.):
Level Environment – Urban Parterre Mapping (UPM)“,
SWS Rundschau, Heft 2 / 2011, 195 – 218.
in: H. Murteira / M. Forte: Digital Cities in-between
. (2011b): „The Price of Generous Ceiling Heights: The
History and Archaeology, Oxford University Press.
Influence of Historic Building Value on Vienna’s Grün-
Scheuvens, Rudi / Schütz, Theresa / Rießland, Martina
derzeit Architecture“, in: Efe Duyan (Hg.): Theory; For
(Hg.) (2012): Perspektive Erdgeschoss, Werkstattbericht
the Sake of the Theory, Istanbul: Dakam Publishing,
121, Wien: MA 18, Stadtentwicklung und Stadtplanung.
395 – 409.
Wüstenrot Stiftung (Hg.) (2014): Herausforderung
. (2012a): „Mixed Building Use Promotes Mixed Urba-
Erdgeschoss – Ground floor interface, Berlin: Jovis.
nity: Insights from Historical Use-neutral Architecture“, in: M. Schenk et al. (Hg.): REAL CORP 2012,
Anmerkung und Dank
RE-MIXING THE CITY – Toward Sustainability and
Der vorliegende Text basiert wesentlich auf den Erkennt-
Resilience? Wien, 463 – 473. Download:
nissen des aktuell am Fachbereich Städtebau an der
http://www.corp.at/archive/CORP2012_18.pdf
TU Wien unter der Leitung der Autorin laufenden
(12. 08. 2016).
Forschungsprojekts „StadtParterre, Wien“ – finanziert
. (2012b): „Wie wollen wir das Wiener Gründerzeit-
durch den Österreichischen Wissenschaftsfonds (FWF).
Parterre nützen?“, in: Scheuvens / Schütz / Rießland:
Die hier ebenso zitierte abgeschlossene Pilotstudie wurde
Perspektive Erdgeschoss, 18 – 23.
über folgende Preisgelder gefördert: Wissenschaftspreis
. (2014a): Das Wiener Gründerzeit-Parterre: Eine ana-
der Wiener Wirtschaftskammer 2012, Forschungsför-
lytische Bestandsaufnahme. Pilotstudie (Abschlussbe-
derung durch die Hochschuljubiläumsstiftung der Stadt
richt der Studie), Wien: TU Wien, FB für Städtebau.
Wien 2012 und Forschungsstipendium der TU Wien
. (2014b): „Don’t Even Think Of Parking Here. Wiener
2012. Besonderer Dank gilt Christoph Luchsinger, der
Straßenraum: Verhandlung von Nutzungsrechten und
in seiner Position als Fachbereichsleiter am FB Städtebau,
Nutzungsansprüchen“, in: Ingo H. Warnke / Beatrix
TU Wien, die Durchführung beider Studien ermöglichte.
Busse (Hg.): Place-Making in urbanen Diskursen –
Ebenso möchte ich mich beim Wiener Planungsdirektor
Interdisziplinäre Beiträge zur Stadtforschung [Diskurs-
Thomas Madreiter für seine Unterstützung bei der
muster – Discourse Patterns 7], Boston – Berlin: de
Initialisierung des Projekts bedanken.
Gruyter, 121 – 147. . (2014c): „Visualität der Stadt als Wahrnehmungsund Bewertungsressource“, in: Warnke/ Busse (Hg.): Place-Making in urbanen Diskursen, 91 – 119. . (2015a): „Street Life! It’s the Only Life I Know. Street Life, and there’s a Thousand Parts to Play“, in: Schenk et al. (Hg.): REAL CORP 2015, 579 – 590, und http://www.corp.at/archive/ CORP2015_30.pdf (12.08.2016). . (2015b): „Historischer Überblick über die Entwicklung der Straße & des öffentlichen Raums“, in: E. Raith, FB Städtebau, TU Wien (Hg.): Mission Mikrourbanismus. Kurze Nacht der Stadterneuerung IV, Wien, 102 – 109. . (2015c): „Fakten zum Wiener Gründerzeit-Parterre und seinen Nutzungschancen“, in: Raith (Hg.): Mission Mikrourbanismus, 110 – 118. . (2016): „Spatial Representation of Vienna’s StreetFunktionen des „Ebenerds“ – „StadtParterre“ reloaded
83
Betül Bretschneider
Nutzungsmischung in der Quartierserneuerung Die kleinräumige Mischung von Wohnräumen und Arbeitsstätten war bis zum Zeitalter der Industrialisierung immer schon ein Hauptmerkmal von Urbanität. Bis zur Industrialisierung gab es auch nur wenige Gründe für eine funktionale Trennung von Arbeiten und Wohnen. Der Bedarf an größeren, kostengünstigeren und erweiterbaren Standorten mit einer günstigen Verkehrserschließung für Massenwarentransporte führte dazu, dass die Betriebe an den Stadtrand übersiedelten. In der Folge wurden in der Nähe von Fabriksanlagen große, monofunktionale Siedlungen für die Arbeitskräfte errichtet. Die Prinzipien der funktionalen Zonentrennung, wie sie Tony Garnier als eine imaginäre, expansionsfähige „Cité industrielle“ bereits 1917 ausformuliert hatte, beeinflusste die ersten Stadtplanungsmodelle der Sowjetunion. Später in den 1920er Jahren wurde die funktionale Trennung von der CIAM-Gruppe 1 zum Grundprinzip erhoben und gab die Richtung für die „Stadt der Moderne“ in der Nachkriegszeit vor, nicht zuletzt auch in den USA. Die Kritik an der US-amerikanischen Stadtentwicklungspolitik an den durch funktionale Trennung verödeten und leer stehenden Stadtzentren, am uferlosen urban sprawl und den großflächigen Abrissen im Zuge der Stadterneuerung wurde bereits in den 1960er Jahren in Fachkreisen immer lauter.2 In den 1980er Jahren entstanden immer mehr Initiativen wie „Smart Growth“, „New Urbanism“ und „Transit Oriented Development“, die neben der baulichen Verdichtung und Verkehrsreduktion die Nutzungsmischung als Weg zu einer nachhaltigen Stadterneuerung definierten. Zu Zeiten der aus Europa abziehenden Produktionsindustrie, seit den 1990er Jahren, werden ungenutzte Brachflächen zur Neubebauung freigegeben. Mit der Zeit wurde die Bedeutung funktionaler und sozialer Diversität in neuen Stadtvierteln, die aus von einander entkoppelten, tagsüber einsamen Wohnsiedlungen alias Schlafstädten und nachts menschenleeren Büro- oder Gewerbegebieten bestehen, immer wichtiger. Die europäische Stadtpolitik positionierte sich zunehmend anhand von strategischen Stadtplänen für eine feinmaschige Nutzungsmischung in den neuen Stadtvierteln. Zudem wurde in einer Zeit der stark vorangetriebenen Städtekonkurrenz und des Stadtmarketings zunehmend deutlich, dass die Prämissen für eine urbane Nachhaltigkeit weitgehend mit den Auswahlkriterien der weltweit agierenden Konzerne bei der Suche von Standorten für ihre Headquarters übereinstimmen. Zu diesen gehören urbane Qualitäten wie kleinteilige funktionale und soziale Vielfalt, ein ausreichendes Angebot an leistbaren Wohnungen und Arbeitsräumen, aber auch leicht zugänglichen kulturellen und sozialen Einrichtungen sowie öffentlichen Verkehrsmitteln und Grünflächen. Gerade diese Eigenschaften, die zu einer urbanen Nachhaltigkeit führen sollen, sind gleichzeitig auch wichtige Voraussetzungen für einen wachsenden Städtetourismus. 84
UMBAU 29
Aus diesen Gründen versuchen die europäischen Städte ihre traditionell kleinteilige Nutzungsvielfalt beizubehalten oder wiederzugewinnen. Trotz aller Einsicht der Stadtpolitik in die Problematik und Bekenntnissen zur erneuten Annäherung der unterschiedlichen Stadtfunktionen verläuft dieser Prozess nicht ohne Hindernisse, insbesondere in den neuen Stadtvierteln. Die neuen Strategiepläne der europäischen Städte empfehlen zwar ähnlich klingende Ziele zur Nachhaltigkeit, in ihrer realen Umsetzung unterscheiden sie sich zum Teil jedoch maßgeblich voneinander. Heute verwandeln die Umbrüche der Marktwirtschaft auch die europäische Stadtpolitik sichtbar. Die Großinvestoren sowie die mächtigen Träger der Bauwirtschaft und deren kurzfristige Interessen bestimmen zunehmend die Stadtplanung und die Stadttransformationsprozesse sowie das Baugeschehen. Die Planungsentscheidungen der Stadt sind heute einerseits unverbindlicher und die Reglementierung ist flexibler denn je. Die Änderungsprozesse beschleunigen sich im Einklang mit den Konjunkturschwankungen des Marktes. Andererseits jedoch finden die ArchitektInnen und PlanerInnen den Rahmen der Gebäudeplanung stark einschränkend, weil die anzuwendenden Baugesetze, Normen und Verordnungen und die damit verbundenen Spruchpraktiken zunehmend komplexer und unübersichtlicher werden. Im Zusammenhang mit den Zielsetzungen zur kleinräumlichen Nutzungsmischung entwickelte sich in der europäischen Stadtpolitik ein Bewusstsein für die tragende und stabilisierende Rolle der kleinststrukturierten Unternehmen. Deren Beitrag als traditionelle Nutzer der Erdgeschosszonen wurde für die Regenerierung der Stadtquartiere und ihrer Belebung immer deutlicher. In diesem Zusammenhang drängt sich die Frage auf, warum die Räume der Erdgeschosszone, die ursprünglich von straßenseitigen Nahversorgern und von hofseitigen Werkstätten belegt waren, so lange leer standen oder nur minderwertig als Lagerräume genutzt wurden. Warum werden sie nach wie vor zu Müllräumen oder Autoabstellplätzen umgebaut, obwohl der Bedarf an leistbaren Arbeitsräumen permanent steigt – insbesondere an solchen, die von der Straße aus gut sichtbar und zugänglich sind? In diesem Artikel werden den urbanen Wandel Wiens betreffend die jüngsten Veränderungen im Zusammenhang mit der Nutzungsmischung und ihrem Hauptschauplatz – der Erdgeschosszone – zusammengefasst. Außerdem werden Prozesse der Umstrukturierung der Wiener Erdgeschosszonen dargestellt und dabei neue Nutzungstendenzen und oft paradox erscheinende Eigentümerinteressen sowie vorprogrammierte Hindernisse erläutert. Stadterneuerung und Erdgeschosszone Das Wiener Stadtbild ist nach wie vor überwiegend von gründerzeitlicher Blockrandbebauung geprägt, die in ihrer Geschichte im Erdgeschossbereich gemischte Nutzungen und in den oberen Geschossen Wohnungen beherbergte. Von den insgesamt rund 150.000 Bauten wurden rund 35.000 vor 1919 errichtet. Davon sind 32.000 der Gründerzeit, also einem Entstehungsjahr zwischen 1850 und 1919, zuzuordnen.3, 4 Abb. 1 Während die Bevölkerungszahl ihren Höhepunkt im Jahr 1916 mit 2.239.000 EinwohnernInnen5 erreichte und danach bis Nutzungsmischung in der Quartierserneuerung
85
in die 1980er Jahre auf 1,5 Millionen sank, wurde die historisch gewachsene Stadt weiterhin verdichtet und umgebaut. Zugleich dehnte sie sich aufgrund gestiegener Grundstückspreise und Platzansprüche in die Vororte aus.6 , 7 Nachdem Wien durch den Wiederaufbau der 1950er und 1960er Jahre von den Kriegsschäden befreit worden war, konnte sich die Stadtverwaltung den Aufgaben der Stadterneuerung widmen. Bis dahin hatte die Erneuerung und Modernisierung der alten Bausubstanz im Vergleich zur Neubautätigkeit weniger Aufmerksamkeit erhalten. 1974 wurde mit dem „Bundesgesetz betreffend die Assanierung von Wohngebieten“ eine rechtliche Grundlage geschaffen, um die Probleme der gründerzeitlichen Bausubstanz zu beheben. Im Zuge der ersten Stadterneuerungsvorhaben sollten die BewohnerInnen der verwahrlosten historischen Bauten abgesiedelt werden. Abriss- und Abbruchtätigkeiten wurden in den Mittelpunkt gestellt. Dennoch gelang es einer Initiative von ArchitektInnen und FernsehjournalistInnen unter medialer Präsenz das Projekt „Planquadrat“ im 4. Bezirk durchzusetzen – ein partizipatives Sanierungsprojekt, das noch heute als Musterbeispiel für bewohnerorientierte und schonende Sanierung gilt. Wegen der heruntergekommenen, engmaschigen und kleinteiligen Parzellen- und Baustruktur war auch das Viertel um den Spittelberg am Anfang der 1970er Jahre vom Abriss bedroht, jedoch durch die 1973 gegründete Bürgerinitiative vor dem großflächigen Abbruch gerettet.8 Nach der von der Stadt Wien geförderten Sanierung dauerte es jedoch nicht lange, bis die Mieten im chic gewordenen Viertel in die Höhe stiegen: Dieses Phänomen der „Aufwertung“ brachte in den letzten Jahren auch in diesem Fall ein erneutes Verödungsrisiko mit sich, weil die Erdgeschosslokale ihr Angebot nur bedingt an den BewohnernInnen des Viertels, und mehr an der flanierenden Gastronomie- und Tourismusklientel orientierten. Oder sie standen lange Zeit leer, weil sie nicht mehr leistbar waren. Die Dichte der Schanigärten und der jährliche Weihnachtsmarkt beeinträchtigen die Lebensqualität der BewohnerInnen die mittlerweile fast nur mehr zu den zahlungskräftigen Einkommensgruppen gehören. 1984 trat schließlich das Wohnhaussanierungsgesetz in Kraft und durch Beschluss des Wiener Gemeinderats wurde der „Wiener Bodenbereitstellungs- und Stadterneuerungsfonds“, später umbenannt in „Fonds für Wohnbau und Stadterneuerung“, der heutige „Wohnfonds Wien“, gegründet. Die Aufgaben dieser gemeinnützigen Organisationseinheit der Stadt Wien sind Liegenschafts86
UMBAU 29
Betül Bretschneider
Die Großinvestoren sowie die mächtigen Träger der Bauwirtschaft und deren kurzfristige Interessen bestimmen zunehmend die Stadtplanung und die Stadttransformationsprozesse sowie das Baugeschehen.
Nutzungsmischung in der Quartierserneuerung
87
management, Projektentwicklung und Qualitätssicherung im geförderten Wiener Wohnbau unter anderem durch die Durchführung von Stadterneuerungsmaßnahmen, Beratung, Koordination und Kontrolle der geförderten Zinshaussanierungen sowie die Entwicklung von Blocksanierungen.9 Ab Mitte der 1980er Jahre begann in den alten Baublöcken Wiens ein breiter und allgegenwärtiger Erneuerungsprozess. Die Stadterneuerungsinitiative der Gemeinde Wien förderte die Sanierung der Gründerzeithäuser, fokussiert auf die Wohngeschosse. Die Erdgeschosse wurden meist nur zum Teil erneuert. Ein wichtiger Grund dafür war, dass die Sanierungsförderungsgelder aus dem Topf der Wohnbauförderung kamen und deshalb vor allem für Wohnungssanierung sowie für Wohnraumschaffung (die neu errichteten Dachgeschosswohnungen) eingesetzt wurden. Die Handwerks- oder Gewerbeunternehmen im Erdgeschoss beziehungsweise im Hoftrakt, die früher fallweise tatsächlich Emissionen verursacht haben, wurden von der Stadtverwaltung als störend für die AnrainerInnen angesehen. Dies war der überwiegende Grund für die Abrisse im Zuge der Haussanierungen von ebenerdigen Werkstätten in den Hofbereichen der Gründerzeitblöcke Wiens. Auch die Wohnfunktion war in der Erdgeschosszone vor allem wegen schlechter Lichtverhältnisse und fehlender Intimität schon längst stigmatisiert und durch behördliche Restriktionen geschwächt. Infolgedessen wurden die Parterre-Wohnungen zwar anfänglich nicht, aber in den letzten Jahren doch häufiger saniert. Die ursprünglichen BewohnerInnen der Erdgeschosswohnungen müssen meist nach der Sanierung wegen der steigenden Mieten ausziehen. Die neuen NutzerInnen der Erdgeschosswohnungen sind je nach Lage Besserverdienende. Die Umnutzung eines Gewerbelokals in eine Wohnung ist fast nicht möglich. Die für Nutzungsänderungen geltenden baurechtlichen und zivilrechtlichen Bestimmungen der Umwidmungsverfahren gelten überhaupt für alle Nutzungsarten als schwierig. Erst ab dem Ende der 1990er Jahre wurde der Leerstand, ausgelöst durch die Schließung von Geschäften, Gewerbe- und Handwerksbetrieben, von den Wirtschaftsorganisationen, der Stadtpolitik sowie von der lokalen Presse und somit von den BewohnerInnen deutlich als Problem wahrgenommen. Das Thema der „nicht aktiven Nutzung“ in der Erdgeschosszone rückte in den letzten Jahren zugleich in den Planungsprozessen für neu entstehende Stadtentwicklungsgebiete in den Vordergrund, jedoch bis heute ohne wirksame Konsequenzen in der Planungs- und Baupraxis. 88
UMBAU 29
Betül Bretschneider
Verlorene Raumressourcen der Stadt Erdgeschosszonen und ihre räumlichen Strukturen mit angrenzenden offenen Flächen wie Höfen, Straßen, Plätzen und Grünräumen prägen das alltägliche Stadtbild und die Gesichter der Straßenzüge. Sie beeinflussen das Lebensgefühl der StadtbewohnerInnen; Verwahrlosung durch zugeklebte Schaufenster, Einfahrten oder Lagerräume führen zu einer Abwertung und Stigmatisierung des Umfelds und des Stadtquartiers. Abb.2 Der durch das Verschwinden von Kleinunternehmen zunehmende Leerstand von Erdgeschossflächen oder deren Umwandlung zu kleinen Garagen im Zuge der Dachgeschossausbauten lösten aber nicht nur in den Problemzonen der Stadt einen schleichenden Wandel aus. Die fehlende Auslastung der vorhandenen Räume im Erdgeschoss bedeutet eine erhebliche Ressourcenverschwendung, während gleichzeitig durch das Geschäftsund Gewerbesterben zunehmend mehr Stadtteile unterversorgt bleiben. Mit dem Verlust lokaler Arbeitsstätten kommen auch die kleinräumigen Verflechtungen der diversen Stadtfunktionen abhanden, was schließlich auch die typologischen Eigenschaften des Stadtgefüges entscheidend und dauerhaft verändert. Außerdem schwächt der Leerstand den Identitätsbezug der BewohnerInnen zu ihrem Viertel. Europaweit treten trotz aller Ähnlichkeiten der Stadtstrukturen zugleich bedeutende Differenzen auf – bedingt durch die Beschaffenheit der Straßenräume, ihre Höhe, Breite, die Fassadenstruktur von angrenzenden Gebäuden, durch die Blockzwischenräume, die Intensität des fließenden und ruhenden Verkehrs, die rechtlichen Regulierungen für Nutzungsmöglichkeiten und nicht zuletzt durch Mietpreise und Eigentumsverhältnisse. Aber die Vorschriften und die Planung der Stadtverwaltungen formen die Nutzungsarten der Erdgeschosszone und der angrenzenden Straßenräume. In den Städtevergleichen wird deutlich, dass die Städte, die in ihren zentralen Stadtteilen keine Einkaufszentren und Hypermärkte zulassen, mit mehr Nutzungsvielfalt rechnen können. Sogar die zentralen Stadtgebiete in Paris oder London weisen trotz sehr hoher Immobilienpreise und extremer Flächenkonkurrenz eine hochgradige Nutzungsvielfalt in ihren räumlich kleinstrukturierten Erdgeschosszonen auf. Je höher die soziale Durchmischung der BewohnerInnen entlang der Straßenzüge, desto stärker ist die bewohnerorientierte Nahversorgung. Kleinstunternehmen als Katalysatoren In Wien wächst durch die zunehmende Anzahl von ShoppingMalls am Stadtrand und von innerstädtischen Einkaufszentren die Abhängigkeit vom motorisierten Verkehr. Diese Entwicklung benachteiligt die Menschen ohne Auto, die von Nahversorgung und Serviceeinrichtungen ihrer Nahumgebung abhängig sind. Im Jahr 2011 betrug die Verkaufsflächendichte in Wien 1,5 m2 und österreichweit 2,0 m2 pro Einwohner. Das ist nach der Schweiz und San Marino der dritthöchste Wert in Europa.10 Durch die neu errichteten Einkaufszentren steigt die Größe der Gesamtverkaufsfläche ständig.11 Die großen Handelsunternehmen, die schneller als der Gesamthandelssektor wachsen, brachten in den letzten Jahrzenten die kleinen Geschäfte der Erdgeschosszonen stark unter Druck.12 Nutzungsmischung in der Quartierserneuerung
89
Der Anteil der Kleinst- und Einzelunternehmen ist sowohl in Wien als auch in ganz Österreich mit rund 90% aller Unternehmen sehr hoch.13 Erhebliche Teile von ihnen waren als traditionelle ErdgeschossnutzerInnen immer schon die eigentlichen Nutzungsmischer in den historisch gewachsenen Stadtvierteln und profitierten von der Sichtbarkeit und Zugänglichkeit vom Straßenraum aus. Sie leben heute noch von Laufkundschaft direkt aus dem Quartier. Neue Nutzungstendenzen in der Erdgeschosszone Der Leerstand in der Erdgeschosszone löste mit der Zeit eine Gegentendenz aus. Immer mehr kleine Unternehmen starten in geteilten Arbeitsräumen in den Parterren und Souterrains der Gründerzeitstadt, die sie sich leisten können und die ihnen Vernetzungen ermöglichen. Sie überzeugen immer mehr Hauseigentümer und Hausverwaltungen davon, leerstehende oder minderwertige, oft als Lager genutzte Erdgeschossräume zu vermieten. In bestimmten Straßenzügen sieht man in den letzten Jahren immer mehr Arbeitsräume von Neunutzern, die meist von einigen wenigen „Impuls gebenden“ Vorreitern und niedrigen Mieten angelockt wurden. Anfänglich war es die sogenannte„ethnische Wirtschaft“, die die verlassenen Erdgeschosslokale von vormaligen Greisslern, Fleischereien, Gastronomiebetrieben oder Handwerkern übernommen hat. Nach und nach wurden in unterschiedlichen Stadtvierteln die ungenutzten oder untergenutzten Erdgeschossräume, die sich überwiegend um Märkte oder an Plätzen und in verkehrsberuhigten Zonen konzentrierten, mit neuen Nutzungen belegt, zum Beispiel rund um den Karmelitermarkt und den Brunnenmarkt in Wien. Je grüner, zentraler und verkehrsärmer, desto schneller ändern sich die Straßenzüge oder die Plätze. Die Reindorfstraße im 15. Bezirk oder das Gebiet um das Weißgerberviertel im 3. Bezirk in Wien beherbergen beispielweise heute zahlreiche Künstlerateliers oder kunsthandwerkliche Nischenunternehmen, weil die Räume entweder durch Hilfe von Nachbarschaftsinitiativen vermittelt worden sind oder weil sich Kunst- oder Musik-Universitäten in der Nähe befinden. Eine leichte Erreichbarkeit spielt bei dieser Entwicklung ebenso eine Rolle wie die Dynamik der die Bewohnerstruktur und Beschaffenheit des Straßenraums. Die Leistungen der Kreativwirtschaft sind angepasst an die Bedürfnisse einer wohlhabenden Gesellschaft mit höheren Ansprüchen. Es wird in kleinen Mengen, individuell und kreativ produziert. Design, Nahversorgung und Handwerk vermischen sich dabei. Eine große Herausforderung angesichts meist prekärer Arbeitsverhältnisse bleibt die Verfügung über leistbare Arbeitsräume, die vorzugsweise mitten im Geschehen der Stadt liegen sollen. Angesichts dieser Entwicklungen ist es nicht leicht verständlich, warum der Immobilienmarkt das verlorene Potenzial ignoriert, die Räume der Straßenebene so oft leer lässt oder nur als Lagerräume vermietet und denkt, dass die Sanierungsinvestitionen nicht amortisierbar wären.
90
UMBAU 29
Betül Bretschneider
Die Interessen des Immobilienmarktes und der Leerstand Die Gründe, die zum Leerstand führen, sind vielfältig. Der Großinvestoreneinstieg am Gründerzeithausmarkt nach der Finanzkrise trieb die Kauf- und Mietpreise am Immobilienmarkt in die Höhe. Mit dieser Entwicklung änderten sich die Strukturen und die Verhaltensweisen von Hauseigentümern deutlich. Nach der letzen Finanzkrise begannen Investorengemeinschaften aus zahlungskräftigen Privatpersonenkreisen reihenweise Gründerzeithäuser in Wien als Anlageobjekte zu kaufen. Die Preise für diese Objekte stiegen in den letzten Jahren stark an. Die Kaufpreisstatistik der Stadt Wien gibt allein zwischen 1995 und 2004 eine Preiserhöhung von 75% an. Eine Studie, die vom Institut für Finanzwissenschaft und Infrastrukturpolitik der TU Wien im Jahr 2004 durchgeführt wurde, berichtet, dass in der untersuchten Periode zwischen 1995 und 2004 die KäuferInnen die alten Zinshäuser nur kurzfristig behielten – die durchschnittliche Behaltedauer lag unter zwei Jahren, während die anderen Häuser mindestens zehn bis 15 Jahre bis zu einem Weiterverkauf gehalten wurden.14 Die Spekulationsgewinne am Immobilienmarkt Wiens sind mit der Zeit wieder gesunken. Jetzt bleiben als Investitionsziel nur mehr die Gebiete der Stadt übrig, die einen höheren Migrationsanteil aufweisen, weil die Preise in diesen Gebieten im Vergleich weniger gestiegen sind. Jahrzehntelang galten sie als Stadtteile, die für Investitionen nicht geeignet sind. Sie liegen in der Regel außerhalb der Gürtelzone und waren immer schon die Arbeiterviertel Wiens. Neben den Immobilienentwicklern legten in den letzten Jahrzehnten auch die sogenannten institutionellen Investoren wie Banken und Versicherungen, aber auch ausländische Einzelinvestoren am „sicheren“ Immobilienmarkt an und kauften zahlreiche Häuser als „Alleineigentümer“. Aus diesem Grund verkaufen sie die Erdgeschosslokale nicht, selbst wenn diese auch länger leer stehen, weil sie keine Miteigentümer zulassen wollen. Zur Vermietung nötige Investitionen für eine Sanierung von Parterre- und Souterrainräumen, die oft fast mehr als 100 Jahre lang nur mangelhaft instand gehalten wurden, kommen kaum in Frage. Einerseits würden sich die Sanierungsinvestitionen nicht amortisieren. Zahlreiche Erdgeschossräume bleiben auch deswegen feucht, verschimmelt und vernachlässigt, weil die Baufirmen und Planungsbüros häufig von einer Sanierung abraten, nicht zuletzt weil im Angesicht der geltenden Baunormen und Baugesetze die gängigen Sanierungspraktiken mit Risiken und Hindernissen verbunden sind.
Nutzungsmischung in der Quartierserneuerung
91
Andererseits würde ein Verkaufsangebot lukrativer, wenn mehr vermietbare Objekte im angebotenen Haus leer stünden. Die Beseitigung des Leerstands durch Vermietung oder Verkauf scheint auch für andere Investoren, die angekaufte Häuser möglichst kurzfristig mit Maximalgewinn verkaufen wollen, nicht erstrebenswert zu sein. Hauptgrund dafür ist die proportionale Wertsteigerung der Immobilie durch leerstehende und dadurch verkaufbare oder vermietbare Anteile (Wohnungen oder Gewerbelokale) im Haus. Zudem wird in der Immobilienbranche der Einbau von Erdgeschossgaragen als Voraussetzung für eine gewinnbringende Vermarktung von neuen Dachgeschosswohnungen angesehen. Die kurzfristigen EigentümerInnen der Gründerzeithäuser lassen im Zuge des Dachgeschossausbaus und der Haussanierung die Kategorien der Wohnungen, die von ihren MieterInnen befreit worden sind, erhöhen. Die Erdgeschosslokale oder Parterrewohnungen fallen dem Einbau von Garagen zum Opfer, obwohl oft in der Nähe eine nicht ausgelastete Tiefgarage verfügbar ist. Weiters können bei Leerstand zum Teil die Betriebskosten bei einem „Ausfall der Mieteinnahme“ von HauseigentümerInnen steuerlich geltend gemacht werden. Wenn das Haus (teilweise) leer steht, erhöhen sich die negativen Einkünfte, die durch Mietausfälle entstanden sind. Diese Verluste können mit anderen positiven Einkünften gegengerechnet werden und führen zu Steuerersparnissen. Kann hier die Annahme einer überhöhten fiktiven Mieteinnahme als Berechnungsbasis zur Abschreibung verwendet werden? Abb.3 Zwischennutzung: ein Wiener Zukunftsmodell? Um für Kreativunternehmen leistbare Arbeitsräume als Existenzbasis zu schaffen, gibt es auch in Wien Initiativen. In den letzten Jahren wurden ein paar leer stehende Häuser als „Zwischennutzungshäuser“ für zahlreiche kleine Unternehmen, Vereine oder KünstlerInnen verfügbar gemacht. Das Modell „Zwischennutzung“, dessen Ursprung unter anderem in Deutschland liegt, bedeutet im Allgemeinen zeitlich begrenzte Nutzungsvereinbarungen zwischen den EigentümerInnen und NutzerInnen. Räume werden in der Regel zwar nicht gegen Miete, jedoch gegen eine geringe „Nutzungsgebühr“ vergeben. Obwohl sich die Nutzungsgebühren der Wiener Zwischennutzungshäuser zum Teil marktüblichen Mietpreisen angleichen, gibt es nur jährlich befristete Nutzungsverträge. Daher bliebt die Fluktuation der NutzerInnen hoch. Anders als bei den Vorläufermodellen in Deutschland fehlt hier die Absicherung für ein mehrjähriges Nutzungsrecht. Das Zwischennutzungsmodell der Leipziger Initiative „HausHalten“ etwa, welches kreative Nutzer mit HauseigentümerInnen leer stehender Häuser unter dem Motto „viel Fläche für wenig Geld“ zusammenbrachte, bot in den vergangenen Jahren eine Mindestnutzungsdauer von fünf Jahren und ohne Nutzungsgebühr.15 Derzeit bekommen in Wien Erdgeschosslokale, die zu hippen Hotelzimmern umgebaut worden sind, als kreative Lösung für leer stehende Erdgeschosse mediale 92
UMBAU 29
Betül Bretschneider
Abb. 1 Ein typischer Wiener Gründerzeitblock mit hoher baulicher Dichte in der Stuwerstraße, Wien 2.
Abb. 2 Der Straßenraum vor der Erdgeschosszone.
Abb. 3 Bau einer Minigarage für die neuen Wohnungen im Dachgeschoss.
Nutzungsmischung in der Quartierserneuerung
93
Aufmerksamkeit. Die Frage ist, ob die Hotelzimmer im Parterre – ebenso wie die in den letzten Jahren propagierten Arztpraxen oder Anwaltskanzleien – die Renditeerwartungen der EigentümerInnen nicht noch mehr in die Höhe treiben. Während die Mietverträge immer kürzer befristet werden, steigen die Mietpreise kontinuierlich. Wie kann die Flächenkonkurrenz durch Nutzungsarten, die höhere Erwartungen an Mieteinnahmen erwecken, eingedämmt werden, damit die Erdgeschossräume als leistbare Arbeitsräume verfügbar werden? An dieser Stelle stellt sich weiters die dringende Frage, inwiefern die Dynamik der Änderungsprozesse steuerbar ist, ohne die Lebendigkeit und den Zusammenhalt der Stadt zu gefährden? Wie kann die Geschwindigkeit der sich von den Innenbezirken langsam nach außen ausbreitenden Belebung in den Erdgeschossen und Straßenzügen Wiens soweit gesteuert werden, dass die Auslöser dieses Wandels nicht durch stark steigende Mieten vertrieben werden?
Der Beitrag basiert u.a. auf den folgenden Forschungspublikationen der Autorin: Remix City Nutzungsmischung. Ein Diskurs zu neuer Urbanität: Frankfurt, Berlin, Bern, Bruxelles, New York. Oxford, Peter Lang, Wien 2002 – 2007. Modellentwicklung für Erdgeschosszone und samt angrenzenden Stadträumen, Forschungsprojekt i.R. Smart Vienna, 2012: Teilpubliziert in www.erdgeschosszone.com, 2013 – 2014. Ökologische Quartierserneuerung. Transformation der Erdgeschosszone und Stadträume, Springer VS, Berlin 2014 (Überarbeitung von: Optimierung des Blocksanierungsprogramms zur nachhaltigen Entwicklung der Erdgeschosszone und der (halb-)öffentlichen Räume, 2006 – 2008: BMVIT-Berichte aus Energie- und Umweltforschung).
94
UMBAU 29
Betül Bretschneider
1 Congrès Internationaux d’Architecture Moderne
hohe Bebauungsdichte bis zu 85% auf (Potyka, a.a.O.).
(CIAM) ist eine Reihe von Kongressen und Manifesten,
Triebfeder der Verdichtung wie auch des Stadtwachs-
die in den Jahren von 1928 bis 1959 stattfanden. CIAM
tums war bei stagnierender bis schrumpfender Bevölke-
wurde von Le Corbusier und Sigfried Giedion gegrün-
rung der stark gestiegene Anspruch an den
det, um mit namenhaften europäischen ArchitektInnen
Wohnungsstandard und an die Wohnfläche pro Person.
und StadtplanerInnen einen Diskurs zu Modellen für
7 Cristian Abrihan: Wien – Dekorative Fassaden-
neue industrielle Städte zu entwickeln, die in die Funkti-
elemente in der Zeit zwischen 1840 und 1918,
onsbereiche wie Wohnen, Arbeit, Erholung und Verkehr
hg. v. MA18 Stadtentwicklung, Nr. 133, Wien 2013.
unterteilt werden. Die historischen Stadtzentren wie in
8 Dimitris Manikas: Beiträge zur Baukunst
Paris oder Barcelona sollten zum Teil gemäß der neuen
1968 – 2006, Böhlau, Wien 2006. Architekt
Stadtentwicklung abgerissen werden.
Friedrich Kurrent hat zusammen mit zahlreichen
2 Die bekannteste Kritikerin, die Architektur- und Stadt-
Kreativen und Kulturschaffenden erfolgreich gegen die
forscherin Jane Jacobs, verhinderte durch ihre Initiative
Abrisspläne des Wiener Spittelberg-Viertels gekämpft.
mit einer Bürgerbewegung den Abriss des Viertels
9 Die Behörde für die Stadterneuerung
Greenwich Village in Manhattan in den 1960 er Jahren.
(wohnfonds_wien) beschrieb ihre eigene Aufgabe
Sie kämpfte für eine gemischte Bebauung mit vielfäl-
folgendermaßen: „Die Stadterneuerung in Wien verfolgt
tigen Nutzungen für unterscheidliche soziale Gruppen
das Ziel, die Altsubstanz nach Möglichkeit zu erhalten
einer gewachsenen Stadt und gegen die Umsetzung
und, soweit dies wirtschaftlich vertretbar ist, auch zu
der Pläne von Robert Moses zur Stadterneuerung, die
verbessern, und zwar unter Einbeziehung der betroffenen
mit großflächigen Abrissen der Stadtviertel verbunden
Bewohner. Weitere Ziele sind die Verbesserung des
waren.
Wohnkomforts und des Wohnumfeldes (Infrastruktur),
3 Hugo Potyka: Gründerzeit – Auslandserfahrungen,
Teilabbrüche zur Verbesserung der Belichtungs- und
unveröffentlichte Studie im Auftrag der MA 19 der
Belüftungsverhältnisse, Erhalt wohnungsnaher Arbeits-
Stadt Wien 2006.
plätze sowie die Verbesserung der Verkehrssituation
4 Die ältere kleinstrukturierte Bebauung Wiens wurde
(z.B. Garagen, Radwege).“ (www.wohnfonds.wien.at;
im Laufe der Gründerzeit flächendeckend abgerissen
Zugriff 14. 6. 2013).
und durch dichtere und höhere Bebauung ersetzt. Auch
10 RegioData Research GmbH, 2012.
heute, nach über 100 Jahren werden immer mehr
11 Die Zahl der Verkaufsflächen des Einzelhandels
Häuser, insbesondere jene, die eine geringere Bauhöhe
betrug in Österreich 2006 rund 16.000.000 m2 und der
als die klassischen Gründerzeithäuser aufweisen, abge-
Filialisierungsgrad 34%: Tendenz steigend.
rissen, um höheren Mehrgeschosswohnhäusern Platz zu
12 Statistik Austria: Leistung- und Strukturstatistik
machen. So sinkt heute die Anzahl an Gründerzeithäu-
2010 (erstellt 2012).
sern langsam, aber permanent. Die wirtschaftliche
13 Die Zahl der Unternehmen in Österreich betrug
sowie technische Begründung für eine Abrissgenehmi-
im Jahr 2013, 318.260. Davon waren 87,3% Kleinst-
gung scheint zur Zeit leichter argumentierbar zu sein.
betriebe mit 0 bis 9 Mitarbeitern. Im Jahr 2015 gab es
5 Statistisches Jahrbuch 2014. Kapitel 2: Bevölkerung.
allein rund 290.000 Ein-Personen-Unternehmen in
Statistik Austria, 2014 (Zugriff 3. 4. 2014).
Österreich. (Q: http://wko.at/statistik/jahrbuch/unter-
6 In Wien beträgt die Geschossflächenzahl (GFZ) inner-
nehmen-GK.pdf, Stand: Dezember 2015).
halb des Gürtels bis zu 4,0 und außerhalb des Gürtels
14 Feigelfeld, Czasny, Blaas, Wieser: Eigentümer-
zwischen 2,5 und 3,5. Berlin hingegen hat eine GFZ
strukturen im Wiener Althausbestand, Arbeitsgemein-
zwischen 2,5 und 3,5. Der Bebauungsgrad in Wien
schaft SRZ Stadt + Regionalforschung GmbH,
schwankt zwischen 0,6 und 0,8. Die Grundstücksflächen
IFIP – TU Wien 2007.
bzw. Parzellen weisen in den gründerzeitlichen Vierteln
15 Haushalten / Wächterhäuser in Leipzig:
Wiens, wie u.a. im 2. Bezirk oder 7. Bezirk eine sehr
www.haushalten.org.
Nutzungsmischung in der Quartierserneuerung
95
Thema_Teil 3 Ökologie
Jörg Lamster
Nachhaltige Lösungsansätze für Gebäudeerneuerungen In den letzten Jahren sind europaweit umgreifende Sanierungsaktivitäten von Gebäuden unterschiedlichen Alters zu beobachten. Die vordergründigen Motive sind a) die Erneuerungen von Gebäuden, um diese energetisch nachhaltig zu machen, und b) die Tatsache, dass viele Gebäude den heutigen technischen oder nutzungsspezifischen Anforderungen nicht mehr genügen. Dabei stehen Gebäude im Fokus, die, in den 1960er und 1970er Jahren erbaut, heute in einem Alter sind, in welchem eine zyklische Sanierung, soweit noch nicht geschehen, dringend vollzogen werden müsste. Breitenwirksame Aktivitäten zu Gebäudeerneuerungen sind spätestens seit den IPCC-Berichten zum Klimawandel 2007 entstanden. Die Weltwirtschaftskrise 2008 und die daraus resultierenden niedrigen Zinsen haben diese Aktivitäten noch verstärkt. Doch liegt der Grund für Sanierungen, Umbauten und Ersatzneubauten tatsächlich nur in den Bereichen Energie, Umwelt und Kostenersparnis? Was macht Eingriffe in die gebaute Umwelt notwendig? Und wer entscheidet darüber? Woran liegt es, wenn dringende Erneuerungen unterlassen oder andere Gebäude offensichtlich vor ihrer Zeit abgerissen werden? Darauf gibt es keine einfachen Antworten. Die Thematik auf einzelne Motive wie Ökologie zu reduzieren, ignoriert den wesentlich komplexeren Sachzusammenhang. In der Folge werden der Ökologie architektonische, bautechnische, raumplanerische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Aspekte gegenübergestellt. Der ökologische Aspekt wird anhand einer Primärenergiebilanz näher untersucht. Der Inhalt basiert auf Beispielen des schweizerischen Marktes und Gebäudebestands. Doch abgesehen von unwesentlichen lokalen Eigenschaften sind die Inhalte auf den gesamten deutschsprachigen Raum übertragbar. Messlatte der Beurteilung sämtlicher baulicher Maßnahmen könnte der „kleinstmögliche Eingriff“1 im Sinne Lucius Burckhardts sein. „Diejenigen Eingriffe sind die wirkungsvollsten, die auf das Landschaftsbild in unseren Köpfen einwirken und ein ästhetisches Verständnis der Umwelt erzeugen.“ 2 Die Veränderung der gebauten Umwelt unterliegt Zyklen, ihre Betrachtung ermöglicht ein besseres Verständnis der Zusammenhänge. 98
UMBAU 29
Thomas Lützkendorf hat mit der Unterscheidung von Produkt-, Prozess-, Gebäude- und Flächennutzungszyklen eine grundsätzliche Ordnung geschaffen, die in der Folge angewendet werden soll.3 Abb. 1 Begriffe Es braucht eine Einigung auf Begriffe, um die ungenaue Vieldeutigkeit von Begriffen wie Umbau, Sanierung und Umnutzung zu vermeiden. Ein Begriffsmodell liefert die „SIA-Norm 469 Erhaltung von Bauwerken“4 aus dem Jahr 1997. Diese stellt den Lebenszyklus eines Gebäudes in den drei Phasen (Ersatz-)Neubau, Erhaltung und Abbruch dar. Zur Erhaltung als zentraler Phase gehören Überwachung, Unterhalt und Veränderung eines Gebäudes. Der Unterhalt trifft den umgangssprachlichen Begriff Sanierung recht genau. Im Rahmen des Unterhalts werden Gebäude instandgesetzt. Instandsetzung ist das „Wiederherstellen der Sicherheit und der Gebrauchstauglichkeit für eine festgelegte Dauer“.5 Oder sie werden erneuert, das meint das „Wiederherstellen eines gesamten Bauwerks oder von Teilen desselben in einen mit dem ursprünglichen Gebäude vergleichbaren Zustand“.6 Die umgangssprachlichen Begriffe Umbau und Umnutzung entsprechen in der SIA 469 dem Begriff Veränderung. Eine Veränderung wird durch Anpassung „ohne wesentliche Eingriffe in das Bauwerk“, Umbau „mit wesentlichen Eingriffen in das Bauwerk“ oder Erweiterung „durch Hinzufügen neuer Bauwerksteile“ vollzogen. Der Ersatzneubau ist die finale Option, wenn Unterhalt und Veränderung nicht mehr zielführend sind, wenn also bei einem Gebäude irreparable Obsoleszenzen auftreten.
Funktionelle Obsoleszenz
Problem des Platzbedarfs; Grundrissorganisation
Materielle Obsoleszenz
Problem materieller und konstruktiver Widerstandsfähigkeit und Dauerhaftigkeit
Technische Obsoleszenz
Problem der Veränderung des technischen und ausrüstungsmäßigen Standards
Administrative Obsoleszenz
Problem der Veränderung von Normen und Gesetzen
Obsoleszenz von Stil und Mode
Problem der Kurzlebigkeit modischer Trends
Ausprägungen der Obsoleszenz 7 Nachhaltige Lösungsansätze für Gebäudeerneuerungen
99
Erneuerung oder Ersatzneubau? Ob ein Gebäude erneuert und in seiner Grundsubstanz erhalten bleibt oder doch eher einem Ersatzneubau weicht, hängt von der Nutzbarkeit des Gebäudes, den Betriebs- und Unterhaltskosten und von den Absichten des Eigentümers ab. Ist abzusehen, dass ein Gebäude in der gegebenen Struktur (Ausbaustandard, Grundrisse, Standortattraktivität) mittelfristig nicht mehr nutzbar und deshalb auch nicht mehr vermietbar ist, ist eine Veränderung des Gebäudes in Betracht zu ziehen. Bei schwerwiegenden strukturellen Mängeln (zu kleine Nutzungseinheiten, zu geringe Flexibilität), die nicht oder nur unwirtschaftlich änderbar sind, liegt der Entscheid für einen Ersatzneubau nahe. Das Gebäude ist zumindest funktional obsolet. Der Entscheid für einen Ersatzneubau wird ebenfalls begünstigt, wenn Gebäude aufgrund falsch dimensionierter Räume, einer ungedämmten Gebäudehülle oder veralteter Gebäudetechnik nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben sind. Der angestrebte Einsatz von Erdsonden kann beispielsweise den Entscheid für Ersatzneubauten unterstützen, da häufig der notwendige Platz für Sondenfelder oder Erdregister fehlt. In solchen Fällen sind Gebäude materiell, technisch oder sogar in Stil und Mode obsolet. Die Absicht des Eigentümers mit einem Gebäude hat möglicherweise den größten Einfluss auf den Entscheid Erneuern oder Ersetzen. Als Beispiel dient die „Verlotterungsstrategie“, bei welcher Gebäude vorsätzlich durch Unterlassen von Instandhaltung und Instandsetzung so heruntergewirtschaftet werden, dass ein Ersatzneubau unumgänglich wird. Ein Grund dafür kann die deutlich bessere Ausnützung des Grundstücks durch einen Neubau sein, wobei bis zum Zeitpunkt des Ersatzes bewusst jegliche Maßnahmen des Unterhalts vermieden werden. Grundsätzlich sind alle Bauteile außer der tragenden Struktur mehrfach gut erneuerbar. Ein Entscheid kann bei der Beurteilung von Bauteilen grundsätzlich immer zugunsten Erneuerung ausfallen, wenn diese nicht durch mangelnde Instandhaltung oder unterlassene Instandsetzung so in Mitleidenschaft gezogen sind, dass eine Erneuerung nicht mehr in Frage kommt. Beweggründe als Auslöser von Veränderungen Aber wie kommt es zu dem Entscheid, an einem Gebäude etwas zu verändern? Welche Erkenntnisse liegen dem zugrunde? Und wer trifft diese Entscheide? In der Folge sind vier beispielhafte Phänomene aufgeführt. 1. Zeiterwartungen und Interessen Die zeitliche Dimension spielt auf vielschichtige Weise eine Rolle bei Art, Umfang und Zeitpunkt von Veränderungen. Beteiligte oder betroffene Akteure 8 haben unterschiedliche 100
UMBAU 29
Jörg Lamster
Interessen und damit auch unterschiedliche Zeiterwartungen. Bei Planern und Entwicklern lässt sich häufig beobachten, dass sie nicht über die Projektierung hinaussehen. Das ist für sie sogar ein Vorteil, vor allem dann, wenn so die planungsrelevanten Erstellungskosten den Lebenszykluskosten nicht gegenübergestellt werden müssen. Man rät zur Investition in günstigere Konstruktionen und Bauteile und kann die möglicherweise höheren Folgekosten ausblenden. Schnellere Bauteilalterung und frühzeitige materielle Obsoleszenz sind die Folge. Ein typisches Beispiel ist der Entscheid für günstige Wärmedämmverbundsysteme statt aufwendigerer hinterlüfteter Systeme. Die Gesellschaft, institutionell vertreten durch Behörden, Normen, Gesetze und Interessenverbände hat grundsätzlich langfristige Zeiterwartungen. Ihr geht es nicht um das Gebäude, sondern um den öffentlichen Raum, um langfristige Nutzungsperspektiven, Standortentwicklung sowie kulturelles, kommerzielles und nicht-kommerzielles Angebot. Die Perspektiven reichen weit über einen Gebäudezyklus hinaus. Die Gesellschaft ist sensibel gegenüber Veränderungen des Raums und des baukulturelle Erbes. Die Zeiterwartung der Gebäudeeigentümer liegt in der Regel bei mindestens einer Generation. Bei institutionellen Eigentümern wie Pensionskassen oder Wohnbaugenossenschaften ist sie noch deutlich höher. Wohnbaugenossenschaften planen ihre Gebäude in Zyklen von 90 Jahren und mehr und definieren schon in der Projektierung Erneuerungszyklen und einen möglichen Ersatz des Gebäudes. Deutlich kürzer sind die Zeiterwartungen von NutzerInnen (z.B. MieterInnen). Ihr Interesse bezieht sich maximal auf den Zustand der Nutzungseinheit (z.B. Mietwohnung). Der zeitliche Horizont liegt bei fünf bis dreißig Jahren im Wohnbereich und ein bis zwanzig Jahren bei Verwaltungsbauten. 2. Nutzungsanforderungen Gebäude, die ihren Nutzungsanforderungen nicht (mehr) genügen, sind funktional obsolet. Mangelhafte Nutzungsanalysen sind fataler als alternde oder minderwertige Bauteile. Der Zürcher Tagesanzeiger veröffentlichte im Dezember 2011 Resultate einer Studie der Soziologin Joëlle Zimmerli zum Thema „Wie Zürcher wirklich wohnen wollen“.9 Die Studie zeigt Ergebnisse einer Befragung von EinwohnerInnen der Stadt Zürich zu ihren Ansprüchen an das Wohnen und das Umfeld ihrer Wohnungen. Der Tagesanzeiger bezog sich in seinem Artikel nur auf die Nutzungsanforderungen an die Wohnung, wodurch die Studie verzerrt, fast irreführend wiedergegeben wurde. Demgemäß sind den ZürcherInnen in absteigender Folge 1. der Balkon oder die Dachterrasse, 2. eine günstige Wohnung, 3. ein energieeffizientes Haus, 4. eine unverbaute Aussicht, 5. eine große Wohnung, 6. Intimsphäre und 7. ein hoher Ausbaustandard wichtig. Die vollständige Lektüre der Studie macht aber deutlich, dass die Zürcher Bevölkerung hohen Wert auch auf das Umfeld ihrer Wohnungen legt. Da stehen ganz andere Anforderungen im Vordergrund, beispielsweise „einige alte Bauten zu haben, die typisch für das Quartier sind“, oder „belebte öffentliche Orte, an denen nichts konsumiert werden Nachhaltige Lösungsansätze für Gebäudeerneuerungen
101
muss“. Bei der Betrachtung des mit hochpreisigen Wohnungen neu erbauten Quartiers Zürich-West könnte der Eindruck entstehen, dass die Entwickler nur den Artikel des Tagesanzeigers gelesen haben. Trotz des extrem geringen Wohnungsleerstands in Zürich sind die Wohnungen in Zürich-West nur schwer vermietbar. Die Wohnflächen erweisen sich heute als zu groß. Tatsächlich ist erstmals seit Jahrzehnten in Zürich ein Rückgang der durchschnittlichen Wohnflächen pro Person zu verzeichnen. 3. Bodenpreise Das rasante Ansteigen der Bodenpreise in zentralen Lagen kippt das Verhältnis von Bodenwert und Gebäudewert eindeutig zugunsten des Bodens. Bei dem Kauf eines bebauten Grundstücks in zentraler Lage geht es vor allem um das Bauland und eine spätere optimale Ausnutzung. Lässt sich diese nicht durch eine sinnvolle Erweiterung des Bestands realisieren, ist der Entscheid für einen Neubau quasi vorgegeben. Die Bodenpreise haben sich im Kanton Zürich in den letzten vierzig Jahren annähernd vervierfacht. Der Trend wird bestätigt durch einen Vergleich der Bodenpreise von Abbruchliegenschaften mit unbebauten Liegenschaften im Kanton Zürich. Bodenpreise von Abbruchliegenschaften 10 sind in der Regel höher als von unbebauten Flächen. Abbruchliegenschaften liegen häufig in deutlich besserer und zentralerer Lage und weisen eine bessere Infrastruktur und eine höhere Standortattraktivität auf. Erneuerungsstrategien für den Gebäudebestand sind nicht relevant. Zur Entwicklung des Grundstücks gehört ein Ersatzneubau. In Zürich-Aussersihl wurde 2015 ein überbautes Grundstück zum Verkauf angeboten. Ein Startpreis von 3,6 Mio. SFr. für ein 250 m2 großes Grundstück überbaut mit maximal 200 m2 Hauptnutzfläche ist selbst für Zürcher Verhältnisse ein stolzer Preis, der vom tatsächlichen Verkaufspreis möglicherweise noch übertroffen wurde. Es ging bei dem Handel also nicht um das Gebäude, sondern ausschließlich um das Grundstück, welches künftig siebengeschossig überbaut werden kann. Das Bestandsgebäude fügte sich noch vor wenigen Jahren perfekt in das damals unterentwickelte, sehr zentral gelegene Quartier. Abb. 2 4. Raumplanung und Gestaltungspläne Die Raumplanung, geregelt auf Ebene von Kantonen und Gemeinden, hat indirekten Einfluss auf das Alter von Gebäuden, nämlich dann, wenn es darum geht, Bauzonen zu verändern oder aufzuwerten. „Mit der Revision des Raumplanungsgesetzes im Mai 2014 stehen Gemeinden vor der Herausforderung, eine angestrebte Entwicklung nach innen durch qualitätsvolle bauliche Verdichtung planerisch umzusetzen. […] Voraussetzung für die Umsetzung entsprechender Verdichtungsstrategien sind durch die Eigentümer mitgetragene Massnahmen.“11 Die Vermeidung von weiterer Umwandlung von Kulturland in Bauland bedeutet eine Verdichtung der bestehenden Bauzonen. Die Zonen werden aufgewertet, die betroffenen EigentümerInnen können ihre Liegenschaften höher ausnutzen, das verspricht eine höhere Wertabschöpfung. Um die Verdichtung mit räumlicher und gestalterischer Qualität zu verbinden, werden ab einer bestimmten Größe Gestaltungspläne verlangt, die für die EigentümerInnen verbindliche Regeln zur Gestaltung, Nutzung, Energieverbrauch usw. beinhalten. Mit dem Versprechen der höheren Wertabschöpfung werden private EigentümerInnen so in die Pflicht genommen. Die Realisierung geschieht in der Praxis aus privaten und gesellschaftlichen Interessen häufig im Ersatz des Bestands durch Neubauten. 102
UMBAU 29
Jörg Lamster
Inhalte und Vorgehensweisen Ersatzzeitpunkte oder Notwendigkeiten zur Veränderung von Gebäuden ergeben sich auch aus physikalischen oder strukturellen Gründen wie Bauteilalter, Konstruktionsweise und Instandsetzungszyklen. In der Lebenszyklusgrafik von Lützkendorf sind sie als Produktlebenszyklus und Gebäudelebenszyklus dargestellt. Diese gepaart mit Nutzungsanforderungen und strategischen Überlegungen zur Zukunft der Gebäude sind näher zu betrachten. Langfristiges Planen und Bewirtschaften Die Baugenossenschaft Oberstrass aus Zürich hat 2012 für ihr Portfolio eine Erneuerungsstrategie entwickelt mit dem Ziel von zukunftsfähigen, gut nutzbaren und den Zielen der 2000-WattGesellschaft entsprechenden Gebäuden. Das gesamte Portfolio ist zwischen 1928 und 1938 gebaut und seither kaum verändert worden. Schwächen zeigen sich heute weniger in der Bausubstanz als in der Nutzbarkeit und Energieversorgung. Mittelfristig sollen die heute 80 bis 90 Jahre alten Gebäude entweder grundlegend erneuert oder durch Neubauten ersetzt werden. In dem Rahmen soll ein Energienetz mit regenerativer Energie umgesetzt werden. Die Erneuerungsstrategie basiert auf einem langfristigen Szenario, in welchem für alle sieben Siedlungen Zyklen über die nächsten siebzig Jahre entwickelt wurden. Kriterien sind Nutzung, Investitionskosten, Gesamtkosten, Energieversorgung sowie Erstellungs- und Bewirtschaftungsprozesse. Eine gleichzeitige Erneuerung aller Siedlungen kommt aus organisatorischen und Kostengründen nicht in Frage. Die Strategie sieht vor, dass das Portfolio etwa im Jahr 2037 2000-Watt-fähig ist und dass 2076 die letzten, dann 140 Jahre alten Gebäude durch Neubauten ersetzt sein werden. Abb. 3 Die Perspektive ist langfristig, da der Gebäudebestand heute schon vergleichsweise alt ist und der Blick in die Zukunft selbst noch einmal einen Gebäudezyklus beträgt. Generell gelten für Wohnbauten Zyklen von mindestens fünfzig, häufig bis zu neunzig Jahren. Neunzig Jahre entsprechen drei Erneuerungszyklen, Gebäude werden also zweimal erneuert, bevor sie durch einen Neubau ersetzt werden. Für Büro- und Verwaltungsgebäude gelten deutlich kürzere Lebenszyklen (30 – 40 Jahre). Das liegt an den erwähnten Zeiterwartungen und Nutzungsanforderungen. Die Laufzeiten von Mietverträgen von Büro- und Verkaufsflächen liegen in der Schweiz zwischen sechs und zehn Jahren. Da Nutzerwechsel häufig auch Veränderungen an der Bausubstanz mit sich bringen, liegt die Vermutung nahe, dass es im Bürosektor kaum Bauteile gibt, die ihr Potenzial des physischen Bauteilalters tatsächlich ausschöpfen. Nachhaltige Lösungsansätze für Gebäudeerneuerungen
103
Gebäuden
Gebrauchswert
Abb. 1 Lebenszyklen von
physische / Bauzeit moralische und Erstinvestition Wertminderung
Moderni- Sanierungsierung Verfall und Abbruch
Lebensdauer
Produktlebenszyklus Prozesslebenszyklus Gebäudelebenszyklus Flächennutzungszyklus
Abb. 2 Abbruchliegenschaft in Zürich-Aussersihl
Szenario A «Neues Wohnen Winterthurerstrasse» Areale 1/2 A Areal 3 A Areale 4/5 Areal 6
2080
2070
2060
2050
2040
2030
2
2020
Areal 7 Scheuchzerhof
Szenario B «Neues Wohnen Röslihof»
A Areale 1/2
S
Areal 3 Areale 4/5
UMBAU 29
2080
2070
2060
Gesamtsanierung mit Beibehaltung der bestehenden Wärmeversorgung
Abb. 3 Erneuerungs-
Gesamtsanierung mit Wechsel zu anergetischer Wärmeversorgung
szenarien für ein genossen-
Ersatzneubauten mit anergetischer Wärmeversorgung
104
2050
2040
2030
2020
Areal 6 A Areal 7 Scheuchzerhof A
Jörg Lamster
schaftliches Portfolio
Abb. 4 Ersatzzeitpunkte am Beispiel des Außenputzes (links) und Fenster (rechts)
Abb. 5 Abbrucharbeiten am Zentrum Friesenberg, Zürich
Nachhaltige Lösungsansätze für Gebäudeerneuerungen
105
Abwägen der Eingriffstiefe Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie liefert die Stadt Zürich ein aktuelles Beispiel einer Erneuerung mit optionaler Erweiterung für eine 1960er-Jahre-Wohnungsbau-Ikone, eine Hochhausstruktur in zentraler Lage. Für die bereits 1992 energetisch sanierte Überbauung sind nun langfristige Perspektiven für Nutzung und Bewirtschaftung entwickelt worden. Das Wettbewerbsprojekt aus den 1960er Jahren war um sechs Geschosse höher als das heutige Gebäude. Ingenieure haben nachgewiesen, dass die Struktur eine entsprechende Aufstockung auch heute noch zulassen würde. Darauf aufbauend hat ein Team aus ArchitektInnen, GebäudetechnikerInnen, BauphysikerInnen und weiteren SpezialistInnen zwei Szenarien mit unterschiedlichen Eingriffstiefen und Zeithorizonten entwickelt. Das eine Szenario fokussiert auf minimale Eingriffe. Die Gebäudehülle wird energetisch verbessert, aber nicht umfassend gedämmt. Eine Nachrüstung mit einer mechanischen Lüftungsanlage ist nicht vorgesehen, der Platz für vertikale Verteilungen oder dezentrale Lösungen ist schlicht nicht vorhanden. Aufgrund des Anschlusses an einen regenerativen Energieverbund sind mit geringer Eingriffstiefe die 2000-Watt-Anforderungen, zu deren Einhalt sich die Stadt verpflichtet hat, erfüllbar. Die Maßnahmen könnten kurzfristig umgesetzt werden. Der heute sehr niedrige Mietzins der Wohnungen könnte weitgehend erhalten bleiben. Das zweite Szenario sieht eine höhere Eingriffstiefe und die Aufstockung um sechs Geschosse vor. Die Umsetzung käme aber erst zu einem späteren Zeitpunkt. Der heutige Bestand bekäme so viel Zeit, dass heute schon erkennbar veraltete Bauteile dann materiell obsolet wären. Gleichzeitig wäre so die erwähnte Aufstockung tatsächlich umsetzbar, eine Maßnahme zur inneren Verdichtung des Quartiers. Alterung von Bauteilen und Konstruktionen Bauteile altern und gelangen irgendwann zu einem Punkt, in dem sie erneuert oder ersetzt werden sollten. Dafür gibt es Alterungskurven. Diese eher wissenschaftlichen Betrachtungen schließen äußere physische Umstände wie witterungsgeschützt oder der Witterung ausgesetzt mit ein. Ein relativer Restwert des Bauteils von 20% gilt als der spätest sinnvolle Zeitpunkt eines Ersatzes bzw. einer Instandsetzung. Im Rahmen einer Instandsetzung wird der Zustand des Bauteils wiederhergestellt. Gestützt auf eine ältere Studie des IP Bau 12 lohnt sich ein beispielhafter Blick auf die beiden Bauteile Außenputz und Fenster. Für beide Bauteile werden Ersatzzeitpunkte gruppiert nach ZehnJahresklassen des Montagezeitpunktes dargestellt.13 Abb. 4 Das Resultat zeigt, dass Putze und Fenster aus den Jahren 1928 –1938 106
UMBAU 29
Jörg Lamster
im Jahr 1985 zur Hälfte ersetzt waren, die noch vorhandenen 50%14 hatten also ein Bauteilalter von durchschnittlich 52 bzw. 55 Jahren erreicht. Die Putze und Fenster aus den Jahren 1958 –1968 waren 1993 schon zur Hälfte ersetzt, 50% beider Bauteile sind also innerhalb der ersten dreißig Jahre ersetzt worden. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, das Resultat zu interpretieren. Eine ist, dass seit den 1980er Jahren mit der Montage von Außenwärmedämmungen alte Putze verschwunden sind. Die zweite, welche dem Verlauf der Kurven eher entspricht, ist, dass es unterschiedliche Qualitäten in den Baustandards verschiedener Epochen gibt. IP Bau verweist auf Kunststoffputze, eingesetzt seit den 1960er Jahren, die in späteren energetischen Sanierungen mit Wärmedämmverbundsystemen große Bedeutung bekommen haben. Sie verhindern die Aufnahme von Schlagregen, welcher nicht von der dahinterliegenden Polystyrol-Dämmung aufgenommen werden kann. Die Lebensdauer von Kunststoffputzen wird optimistisch mit dreißig, pessimistisch mit zwanzig Jahren beziffert, während mineralische Putze ohne Probleme den Lebenszyklus der tragenden Wand und damit des gesamten Gebäudes erbringen, also ca. 75 Jahre. Die allgemeine Annahme, dass die 1960er und 1970er Jahre auch in der Schweiz eine Hochkonjunktur mit zum Teil eklatanten Konstruktions- und Ausführungsmängeln bedeuteten, scheint bestätigt. Ein Großteil des heutigen Gebäudebestands ist aus diesen Jahren. Diese heute fünfzigjährigen Gebäude sind aufgrund ihrer überalterten Bauteile sanierungsbedürftig. Eine dritte Interpretation der Ersatzzeitpunkte könnte sein, dass eine eher mineralische (oder sortenreine) Bauweise längere Bauteilzyklen mit sich bringt als Mischkonstruktionen wie Wärmedämmverbundsysteme. Der Architekt Michael Geschwentner bringt das „Baumeisterhaus“ als mögliche nachhaltige Lösung ins Spiel. Wer die schweizerische Konnotation versteht, weiß, dass damit ein Haus aus einer Hand und aus vorwiegend mineralischen Baustoffen gemeint ist. Energetische Sanierung Die Idee des„Baumeisterhauses“ hinterfragt die heute sakrosankte Meinung, dass Lösungen wie Fassadendämmungen zwingend zu nachhaltigen Lösungen führen. Energetisch sanierte Gebäude haben dichtere Gebäudehüllen, können deshalb häufig nur unzureichend mit Feuchte und Schlagregen umgehen. Die dadurch notwendigen Lüftungsanlagen bringen hohen konstruktiven und betrieblichen Mehraufwand mit sich und stellen einen Konflikt zu den angrenzenden Bauteilen mit deutlich höheren Lebenszyklen dar, soweit die Systeme konstruktiv nicht sauber getrennt sind. Nachhaltige Lösungsansätze für Gebäudeerneuerungen
107
Das am meisten in energetischen Sanierungen eingesetzte Bauteil ist das Fenster, welches tatsächlich einen großen Hebel zur Reduktion des Heizwärmebedarfs besitzt. Der Ersatz alter Fenster mit U-Werten zwischen 2 und 6 W/m2K durch neue Wärmeschutzfenster mit U-Werten von kleiner als 1 W/m2K wird durch Subventionen gefördert. Man bringt mittlerweile den Ersatz von zehnjährigen Fenstern ins Spiel, weil sie den heutigen Standards nicht mehr entsprechen. Der Ersatz ist unter Einbezug der Grauen Energie aber gar nicht zu rechtfertigen. Die sehr kontrovers geführten Debatten zum „Sanierungsstau“ und „Dämmwahn“ zeigen, dass es lohnt, energetische Sanierungen kritisch zu betrachten. Artikel wie „Stoppt den Dämmwahn!“ in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Mai 2014, oder „Menschen wohnen wie in Plastik eingeschweißt“ in der Welt, März 2012, machen darauf aufmerksam, dass die staatlich geförderten energetischen Sanierungen zu Aktionismus und unüberlegtem Handeln führen können. Es werden hohe Energieeinsparungen versprochen, die sich in der Praxis als unrealistisch erweisen. Minderwertige Wärmedämmverbundsysteme mit kurzen Lebenserwartungen werden auf zumeist völlig intakte mineralische Außenwände aufgetragen. KritikerInnen vermuten hinter den Förderprogrammen eine gezielt gesteuerte Lobbyarbeit von Chemiekonzernen und Dämmstoffherstellern. Der Dämmwahn ist kein deutsches Phänomen. In der Schweiz fiel 2011 in einem viel beachteten Artikel der Begriff „Isolationshaft“.15 Der Hintergrund ist ähnlich. Der sich für die Energieeffizienz von Gebäuden verdient gemachte Verein Minergie zeigt auf der Homepage offen die Förderer des Vereins. Das sind unter anderem die Dämmstoffhersteller. Auswirkungen auf das baukulturelle Erbe Betroffen von den energetischen Sanierungen ist auch das baukulturelle Erbe. Die Denkmalpflege bringt weitere Argumente ins Spiel. Reto Bieli von der Kantonalen Denkmalpflege Basel Stadt weist darauf hin, dass die heute gängigen Nachhaltigkeitsziele normativer Art sind. Dafür bilden quantitative Zielvorgaben (zum Beispiel „2000 Watt“) die Grundlage. Argumente qualitativer Natur, die nicht eindeutig messbar und vermittelbar sind, treten in den Hintergrund, beispielsweise der kulturelle Wert, der gestaltete Raum und die Architektur. Auf normativer Ebene sind ArchitektInnen den GebäudetechnikplanerInnen, die die normative Sprache gelernt haben, unterlegen. Das von Bieli ins Spiel gebrachte „deskriptive Denken“ nimmt sich der qualitativen Argumente an. Qualitäten werden beschrieben und nicht gemessen. Damit kann die Baukultur und die Architektur in der Nachhaltig108
UMBAU 29
Jörg Lamster
keitsdebatte besser platziert werden. Das hat Auswirkungen auf Entscheide bezüglich Erneuern oder Ersetzen, da das Unterlassen von Maßnahmen oder der von Burckhardt geforderte kleinstmögliche Eingriff nun eine Option darstellt. Die Denkmalpflege hält die andere, inhaltlich diametral geführte Debatte über den „Sanierungsstau“ dementsprechend auch nicht für zielführend. Primärenergiebilanz als ökologisches Bewertungssystem Eine verbreitete Methode zur Beurteilung der Eingriffstiefe bei Gebäuden ist die Primärenergiebilanz. In ihr werden gleichzeitig Ressourcenaufwände und Treibhausgasemissionen für die Erstellung (Materialeinsatz inkl. Erstellung, Transport, Montage, Ersatz durch Instandsetzungen, Rückbau), für den Betrieb (Betrieb der Gebäudetechnik, Strombedarf für die Nutzung) und für die durch ein Gebäude ausgelöste Mobilität gegenübergestellt. Das ist wie eine Berechnung von Aufwand (durch Materialien und Bauteile) und Ertrag (z.B. weniger Energieverbräuche oder mehr Nutzen) von baulichen Maßnahmen.16 Die Methode ist im Merkblatt „SIA 2040 Effizienzpfad Energie“ definiert. Die Erfüllung der Zielwerte des Effizienzpfades stellt die 2000-Watt-Kompabilität von Gebäuden dar. Die Richtlinie ist in viele politische Instrumente (Bauzonenordnungen, Gestaltungspläne) integriert. Vergleichbare Bilanzen werden im Rahmen von DGNB- bzw. ÖGNB-Zertifizierungen genutzt. Eine Baugenossenschaft macht den Vergleich Die Familienheim-Genossenschaft Zürich FGZ hat 2009 beschlossen, ihren Gebäudepark mit über 2000 Wohnungen bis 2050 auf 2000-Watt-Kurs zu bringen. Dafür soll sowohl der Heizenergiebedarf als auch der CO2-Ausstoß durch Gebäudeerneuerungen und Neubauten sowie durch Nutzung erneuerbarer Energieträger um ein Vielfaches gesenkt werden. Das bedeutet, dass künftig die Gebäude besser gedämmt und gleichzeitig fossile Energieträger verabschiedet werden müssten. Bezüglich Energieträger wurde die Genossenschaft in der Nachbarschaft fündig. Ihre Siedlungen liegen in der Nähe von mehreren Großbetrieben (Swisscom, Credit Suisse, Sportzentrum, Stadtspital), die durch ihre Prozesse große Mengen Abwärme erzeugen. Man entschied sich für die Lösung eines Wärmenetzes, welches die Abwärme des Gewerbes zu den Wärmebezügern des Wohnens bringt. Der Entscheid für die Nutzung der Abwärme entspricht dem Energieplan der Stadt Zürich, welcher die Nutzung von Abwärme als oberste Priorität sieht. Eine große Pellet- oder Holzschnitzelheizanlage kam nicht infrage, da sie wegen der Feinstaubemissionen auf hohe Anforderungen in der Bewilligung stoßen würde. Da die Abwärme eher außerhalb der Heizperiode anfällt, sind saisonale Erdspeicher nötig, die durch Erdsonden erschlossen werden. Diese Erdsondenfelder brauchen viel Platz, der in bebauten Gebieten kaum vorhanden ist. Die Baugenossenschaft verband die Frage, wo das ca.15.000 m2 große Erdsondenfeld platziert werden sollte, mit einem gemäß ihrer Erneuerungsstrategie allemal Nachhaltige Lösungsansätze für Gebäudeerneuerungen
109
anstehenden Ersatzneubau in unmittelbarer Nähe zu den Abwärme liefernden Großbetrieben. Das betroffene Areal bildet das Zentrum der Genossenschaftssiedlungen, ein Areal mit guter Erschließung durch öV und Infrastrukturen wie Quartiersladen, Kleingewerbe und Gemeinschaftsräumen der Genossenschaft. Daran angrenzend liegen Wohnungsbauten aus den 1960 er Jahren, die funktionell wie materiell obsolet sind. Der Abriss des Zentrums und der Wohnungsbauten würde eine Anpassung an geänderte Nutzungsanforderungen erfüllen und gleichzeitig die Fläche freispielen für das Erdsondenfeld. Die Genossenschaft wollte wissen, ob der Entscheid für Ersatzneubauten auch ökologisch vertretbar wäre. Dazu ließ sie eine Gesamtprimärenergiebilanz erstellen, welche den Neubauten Erneuerungsvarianten mit unterschiedlichen Eingriffstiefen gegenüberstellte. Die Bilanzierung Die Systemgrenze der Bilanzierung bilden die Parzellen der betroffenen Bauten. Betrachtet sind folgende Varianten: 1 Bestand 2 Minimalsanierung mit fossiler Energieversorgung 3 Minimalsanierung mit Abwärmenutzung 4 Gesamtsanierung mit Abwärmenutzung 5 Ersatzneubau Der Bestand weist aufgrund der ungedämmten Gebäude und der fossilen Energieversorgung einen erwartungsgemäß sehr hohen Primärenergieverbrauch für den Betrieb aus. Die Minimalsanierung beinhaltet die Dämmung von Dach und Kellerdecken und den Fensterersatz als energetische Maßnahmen sowie den Ersatz von Küchen und Bädern. Unterschieden wird bei der Minimalsanierung der Beibehalt der fossilen Energieversorgung und der Anschluss an das neue Abwärmenetz (Variante 3, die so gar nicht umsetzbar wäre). Der Aufwand der Grauen Energie hält sich in Maßen, während der Betrieb deutlich reduziert werden kann. Die Gesamtsanierung beschreibt einen tiefen Eingriff in die bestehende Substanz. Neben den Maßnahmen der Minimalsanierung werden vor allem noch die Fassaden gedämmt. Der Einsatz von Photovoltaik-Modulen zur Eigenproduktion von Strom ermöglicht die Reduktion der nicht erneuerbaren Primärenergie auf ein Minimum. Die für den Eingriff aufzuwendende Graue Energie liegt bei 42% des Ersatzneubaus. Die in den Ersatzneubau zu investierende Graue Energie ist deutlich höher als bei jeder Erneuerungsvariante. Das liegt auch daran, dass die Nutzfläche beim Neubau fast verdoppelt wird. Der nicht erneuerbare Anteil des Betriebs kann durch die Eigenproduktion von Strom durch Photovoltaikmodule auf den Dächern eliminiert werden.17 Das Resultat der Bilanzierung ging sehr knapp zugunsten des Ersatzneubaus aus, interpretiert wurde das Resultat wie ein Pari, sodass soziale Argumente den Ausschlag geben konnten. Ausschlaggebend für das gute Resultat des Ersatzneubaus ist offensichtlich die geänderte Energieversorgung. Regenerative Energieversorgungen sind auch für Erneuerungen einsetzbar (z.B. Pelletheizungen oder Energie-Contracting-Lösungen). Zwänge wie nur schwer zu dämmende Bauteile der Gebäudehülle oder zu kleine Dachflächen für Photovoltaik-Anlagen sind häufig aber Realität. 110
UMBAU 29
Jörg Lamster
Auswirkung des Entscheids auf das gesamte Portfolio Doch welche Auswirkungen hat der Wechsel von fossiler Energie zu Abwärme für die bestehende Bausubstanz des gesamten Portfolios? Betroffen vom Anschluss an das Anergienetz sind ja nicht nur die Zentrumsbauten. Zum Verständnis braucht es zusätzliche Informationen zu Abwärmenutzung und Wärmepumpen. Für deren Einsatz gelten zwei Faustregeln. Regel 1: Der Temperaturhub ist möglichst klein zu halten, damit die Wärmepumpen nicht zu viel Strom verbrauchen. Wegen der niedrigen Vorlauftemperatur von ca. 30°C bietet sich die Nutzung von Fußboden-, Wand- oder Deckenheizungen an, da die Wärmeabgabeflächen größer sind als bei Radiatoren. Regel 2: Die Gebäudehülle des betroffenen Gebäudes sollte möglichst gut gedämmt sein, um den Heizwärmebedarf einzuschränken und hohe Heizlasten während der kalten Jahreszeit zu vermeiden. Diese Maßnahme dient auch der Entlastung der Wärmepumpen. Keine der beiden Regeln kann von den heutigen Bestandsbauten eingehalten werden. Sie sind zum überwiegenden Teil ungedämmt. Die Wärme wird über Radiatoren abgegeben. Das legt also nahe, dass die Baugenossenschaft in den nächsten Jahren massive Ressourcen in die Erneuerung ihres Gebäudebestands legt. Das Ziel ist in der Gesamtstrategie verankert: Senkung des Heizwärmebedarfs durch besser gedämmte Bestandsbauten und Ersatzneubauten zum einen sowie die Nutzung erneuerbarer Energien zum anderen. Für die Gebäude bedeutet das, dass neben besser gedämmten Gebäudehüllen neue Wärmeabgabesysteme eingefügt werden müssten. Das sind in der Praxis Fußbodenheizungen in neuen Estrichböden verlegt. Das ist ein Eingriff, der in Zahlen ausgedrückt bis zu 15% der Grauen Energie eines Neubaus ausmachen kann. Hier spielt der Faktor Zeit eine entscheidende Rolle, denn dermaßen tiefe Eingriffe in die Bausubstanz sind nur zu rechtfertigen, wenn die so instandgesetzten Gebäude noch einen Lebenszyklus durchlaufen. Haben die Gebäude kürzere Zyklen, z.B. weil sie bezüglich Nutzung obsolet sind und in absehbarer Zeit durch Neubauten ersetzt werden, ist der eingesetzte Materialaufwand nicht zu rechtfertigen. Abb. 5 Zukunft Künftige Möglichkeiten und Herangehensweisen werden in der Forschung entwickelt. Die eidgenössischen technischen Hochschulen in Zürich und in Lausanne arbeiten an langfristig angelegten Projekten zur Erfassung des schweizerischen Gebäudeparks. Resultate daraus sind bereits verarbeitet als Grundlage der energetischen Kennwerte für das erwähnte Merkblatt „SIA 2040 Effizienzpfad Energie“ zum Erreichen der 2000-Watt-Anforderungen auf Gebäudeebene und Untersuchungen der Bundesämter für energetische Sanierungsstrategien.18 Am Departement Architektur werden Methoden für einfachere Bauprozesse und Fertigungstechniken erarbeitet. Die ehemaligen Fachhochschulen leisten einen erheblichen Beitrag in anwendungsorientierten Forschungsfeldern. Beispielhaft erwähnt seien das Forschungsprojekt IEA Annex 50 Nachhaltige Lösungsansätze für Gebäudeerneuerungen
111
Prefabricated Retrofit of Building 19 mehrerer Hochschulen und das Projekt SanStrat der Hochschule Luzern,20 in welchen Gebäudetypologien im Wohnungsbau des 20. Jahrhunderts auf ihr Erneuerungspotenzial untersucht wurden. Weniger zielführend ist die aktuell stattfindende Harmonisierung europäischer Normen zur Umweltdeklaration von Baustoffen und Bauteilen bzw. die Bewertung von Gebäuden (zum Beispiel EN 15304, 15941, 15942 und 15987). Eine gezielte Lobbyarbeit von Baustoffproduzenten und Interessenverbänden wird dahin führen, dass Umweltdeklarationen nur geringe Aussagekraft besitzen. Die Relevanz von Ökobilanzen würde dadurch stark eingeschränkt.
112
UMBAU 29
Jörg Lamster
1 Lucius Burckhardt: Der kleinstmögliche Eingriff,
jedoch die Knappheit von Ressourcen. In der Primär-
hg. v. Markus Ritter / Martin Schmitz, Schmitz Verlag,
energiebilanz werden nur nicht erneuerbare Ressourcen-
Berlin 2013.
und Energieaufwände dargestellt. Die Graue Energie ist
2 Ebd.
dementsprechend die nicht erneuerbare Primärenergie
3 Holger König / Niklaus Kohler / Johannes Kreissig /
der Erstellung. Analog werden die Treibhausgasemissio-
Thomas Lützkendorf: Lebenszyklusanalyse in der
nen dargestellt.
Gebäudeplanung, Detail Green Books, München 2009.
17 Dazu ist die Annahme, dass die späteren Bewohner
4 SIA = Schweizerischer Ingenieurs- und Architekten-
bei allen Varianten reinen Ökostrom benutzen, keine
verein.
realistische Annahme, aber eine Art der Neutralisierung
5 SIA 469: 1997.
des Faktors Nutzung, der nur durch Bindungen im
6 Ebd.
Mietvertrag beeinflusst werden kann.
7 Heinz Ronner / Fredl Kölliker / Emil Rysler: Der Zahn
18 Z.B. Massimo Fillipini: Erneuerung von Einfamili-
der Zeit, Birkhäuser, Basel 1994.
enhäusern, ETH Zürich, Bundesamt für Energie, 2011.
8 Akteure sind alle an der Umsetzung, Erhaltung und
19 Mark Zimmermann / Peter Schwehr: Prefabricated
Nutzung von Gebäuden Beteiligte wie Entwickler,
Retrofit of Building, Schlussbericht, BFE 2011.
Planer, Eigentümer, Betreiber, Nutzer sowie die Gesell-
20 Robert Fischer / Peter Schwehr: SanStrat – Argumen-
schaft und die öffentliche Hand.
tarium Sanierung – ganzheitliche Sanierungsstrategien
9 http://www.tagesanzeiger.ch/zuerich/stadt/Wie-
für Wohnbauten und Siedlungen der 1940er bis 1970er
Zuercher-wirklich-wohnen-wollen/story/10656465
Jahre, Faktor Verlag AG, Zürich, 2013.
10 Abbruchliegenschaften sind überbaute Liegenschaften, die aufgrund des Bodens, nicht aber aufgrund der Überbauung marktfähig sind. 11 Raimund Kemper: Zukunft Stockwerkeigentum, Hochschule für Technik Rapperswil, Institut für Raumentwicklung, 2015. 12 Impulsprogramm IP Bau, damaliges Bundesamt für Konjunkturfragen, September 1995. 13 Diese Kurven finden sich in Paul Meyer-Meierling: Gesamtleitung von Bauten, vdf-Verlag Zürich, 1. Auflage 1999, und Impulsprogramm IP Bau, a.a.O. 14 Der durchschnittliche Ersatzzeitpunkt entspricht demjenigen Zeitpunkt, bei dem 50% des entsprechenden Bauteils ersetzt worden sind. 15 Matthias Daum: „Gugerli und die Architekten“, im Schweiz-Teil der ZEIT, 06. 10. 2011. 16 Die Primärenergiebilanz stellt die Energie- und Ressourcenaufwände über den gesamten Prozess der Gewinnung eines Stoffes bis hin zur Montage im Gebäude dar. Am Beispiel von Erdöl wird also die Gewinnung aus dem Boden und die Raffinerie bis hin zur Montage der Polystyrolschaum-Dämmung bzw. des Heizöls im Tank verwandelt in Raumwärme dargestellt. Zusätzlich einbezogen wird der Rückbau und die Wiederverwertung von Stoffen. Nicht dargestellt wird Nachhaltige Lösungsansätze für Gebäudeerneuerungen
113
Andreas Vass
Umbau: Der Ring als Landschaft „Je mehr wir davon [vom Vorhandenen, Anm.] begreifen, desto weniger müssen wir uns in Gegensatz dazu bringen, desto leichter können wir unsere Entscheidungen als Fortsetzung eines Kontinuums verstehen.“ Hermann Czech, „Zur Abwechslung“ Zur Fragestellung Zum 150-jährigen Jubiläum der Eröffnung der Wiener Ringstraße wurde im Jahr 2015 der Beginn einer Phase städtischer Erneuerung und Expansion gefeiert, die bis vor den Ersten Weltkrieg dauern sollte und Wien bis heute prägt. Während – nach der epochalen Aufarbeitung, die auf Initiative und unter der Leitung von Renate Wagner-Rieger in den 1970er Jahren in einem 17-bändigen Werk zur Ringstraße ihren Niederschlag fand – in einem zweiten Durchgang verfeinerter und vertiefter Forschung in zahlreichen Publikationen, Tagungen und Ausstellungen neue Dokumente ans Tageslicht gefördert und biografische wie stadthistorische Bezüge neu durchleuchtet wurden, schien sich zeitgleich die aktuelle Stadtentwicklung von der grundlegenden Anerkennung des Werts dieser größten und bedeutendsten zusammenhängenden städtebaulichen Realisierung der Stadtgeschichte Wiens verabschieden zu wollen. Gegen Jahresende 2014 waren ein Masterplan Glacis und eine Neuauflage des Hochhauskonzepts beschlossen worden, die beide unter dem Deckmantel „rahmensetzender“ Richtlinien und Regelwerke eine Kehrtwende in der Politik gegenüber diesem Stadtraum einläuten sollten. Gleichzeitig gingen die Kontroversen um das Projekt, das als zumindest eines der auslösenden Momente dieser Wende betrachtet werden kann, nämlich die Luxusimmobilien-Entwicklung im Bereich des Hotels InterContinental und des Wiener Eislaufvereins, in das dritte Jahr. Während die Auseinandersetzungen um dieses als Präzedenzfall einer neuen – und nach Meinung zahlreicher ExpertInnen fatalen – Politik des „Laissez faire“ angesehene Vorhaben nun schon das fünfte Jahr hindurch andauern und der Widerstand dagegen immer größere Kreise zieht, bleibt die Frage, was hier eigentlich auf dem Spiel steht, nur unzureichend beantwortet. Für viele ist es der Titel des Weltkulturerbes „Historisches Zentrum von Wien“, der verloren wäre, sollte diese Politik, die auf dürftiger argumentativer Basis 114
UMBAU 29
einen „Maßstabssprung“ im Zentrum der Stadt herbeiredet, fortgesetzt werden. Andere sehen einseitig und willkürlich Interessen einiger Exponenten der Immobilienwirtschaft bedient. Die allgemeine Empörung über den Raub am Recht auf das Stadtzentrum steigt. Aber was sagt uns dieser umkämpfte Raum? Was könnte er sagen? Die Rede von der Stadtreparatur geht um, doch was ist hier eigentlich reparaturbedürftig? Und lauert hinter dergleichen gutklingenden Versprechen nicht vielmehr eine von manchen lancierte, aber nie konsistent argumentierte Vorstellung eines Stadtumbaus? Ist dieser Umbau eine notwendige Entwicklung, gegen die sich zu stellen müßig wäre, ja eine „reaktionäre“ Haltung, der „Nostalgie“ verdächtig? Andererseits: Was könnte Umbau im Fall der Ringstraße bedeuten? Wenn wir von Umbau reden, wo setzen wir an? Bei Gebäuden, Räumen oder Nutzungen? Die genannten Stadtplanungsinstrumente und der Präzedenzfall am Heumarkt gehen jedenfalls klar in die Richtung einer Aufhebung oder zumindest Aufweichung des relativ strikten Schutzes, den das Areal der Ringstraße seit der Einführung der Schutzzone auf Basis des Altstadterhaltungsgesetzes von 1972 im Jahr darauf genoss und der durch die gleichzeitig einsetzende Neubewertung der historistischen Architektur im allgemeinen Bewusstsein verankert schien. Nunmehr werden aber mit der Bauhöhe und dem Freiraum Konstituenten zur Diskussion gestellt, die für den Bestand der Ringstraße strukturell sind. Was also hieße hier Umbau? Die einleitenden Texte in dieser Ausgabe von UMBAU stecken einen theoretischen Rahmen ab, der aber einer Ergänzung und Adaptierung bedarf, um sich unter den seit den 1990er Jahren beschleunigt einsetzenden Umbrüchen auf politischem, geistesgeschichtlichem und technologischem Gebiet heute bewähren zu können. Hermann Czech wie auch Vittorio Gregotti entwickelten ihr Denken einer Architektur als „Veränderung von Bestehendem“ aus ihrer Auseinandersetzung mit dem verblassenden Heroismus der Moderne, die sich „Veränderung“ als Schlachtruf zugelegt hatte und damit in eine Redundanzschleife geraten war, in der das Echo begonnen hatte, ganz andere Signifikate zu produzieren. Der gerade noch revolutionäre Gestus war modisch und fügte sich hauteng in die Kommerzialisierung des Alltags. Wenn „Veränderung“ überhaupt noch zu retten war, musste also geklärt werden, was und warum. Der Blick musste sich den Beständen zuwenden. Sei es in manieristischer Sichtung der vorhandenen architektonischen Mittel, sei es in der Vertiefung in einen Untergrund, in den die Notwendigkeit einer Veränderung eingeschrieben wäre als ihrem Territorium. Umbau: Der Ring als Landschaft
115
Doch hat sich mittlerweile die Schleife, in der sich die auslaufende Moderne verfing, von dieser vollständig gelöst, und reibungslos versetzen die Signifikate eines zunehmend totalitären, globalen Marktes der Finanztitel Mittel wie Orte in den Rausch ihrer sich immer rasanter drehenden Zyklen. Werkzeuge und Erde sind zu Sehnsuchtsbegriffen geworden, fern jeder „Realität“. Theorieseminare ebenso wie baupraktische Arbeit erfreuen sich einer lange nicht mehr gekannten Beliebtheit an den Architekturschulen. Das Handwerk wird wiederentdeckt und steckt, wie jede Entdeckung, erneut in den Kinderschuhen. Und doch hält sich ein Trend für einen Trend schon viel zu lange, vielleicht weil er als in der Geschichte menschlicher Zivilisationen älteste Fiktionalisierung sich hartnäckig einer vollständigen Ablösung von den Beständen widersetzt, denen wir unsere Existenz verdanken: Landschaft. Es geht hier nicht mehr darum, sich in ein – unsicher gewordenes, in Auflösung begriffenes – Territorium einzuschreiben, um sich seiner zu vergewissern, und auch nicht um eine Reflexion des eigenen Tuns, die der Selbstbestätigung mit einem „Als-ob“ entkommt. Was aber bleibt sind die „Sachen“, die uns bei diesem Tun im Weg stehen, und die Beobachtung, die unserem kollektiven Verhalten eingeschrieben ist. Was bleibt ist Landschaft als Umbau im kollektiven Maßstab. Daher sollen hier einige skizzenhafte Thesen zur Anlage der Ringstraße als Landschaft im Umbau versucht werden. Ein Ansatz zu einer Anamnese dieses „Theaters“, als das Eugenio Turri Landschaft zu interpretieren versuchte, die insofern als morphologisch verstanden werden kann, als Morphologie nicht bloß formale Regeln einer als real hingenommenen Umwelt nachzeichnet, sondern Entstehungsgründen und Wirkungsweisen der Bestände auf die Spur zu kommen versucht, deren Formen wir lesen. Methode dieser Anamnese ist die Montage vorgefundener, gedachter und materialisierter Umweltbestände mit den ihnen unterlegten, unwillentlich innewohnenden oder zugeschriebenen (Be-)Deutungen.1 Geistige Voraussetzungen Staatsidee Der Ringstraßenbereich steht bis heute emblematisch und faktisch wie kein anderer Ort für das politische Leben der Republik. Nirgendwo sonst sind öffentliche Aktivitäten in vergleichbarer Vielfalt, Dichte und Konstanz konzentriert. Immer mehr wird dieses Stadtgebiet zum Forum unterschiedlichster Massenveranstaltungen und Freizeitangebote, die sich mit seiner Funktion als politische Bühne, aber auch mit den zahlreichen alltäglichen Nutzungen überlagern. Die Dialektik von Gesellschaft und Staat findet hier ihre räumliche Repräsentation. Doch in welchem Verhältnis steht das Repräsentierte 116
UMBAU 29
Andreas Vass
zu dem, was hier repräsentiert? Das führt zur Frage nach der Staatsidee, die am Ursprung des Projekts der Ringstraße stand. Wenn im Fremdenblatt vom 2.5.1865, dem Tag nach der Eröffnung der Ringstraße, auf Seite 1 die Bedeutung dieses Ereignisses mit dem Verweis unterstrichen wurde, dass „die Hauptstadt eines großen Reiches […] das Spiegelbild […] der sozialen und politischen Entwicklung, des im Gesammtkörper des Staates pulsirenden Lebens“ wiedergebe, so wird in dieser Momentaufnahme einer Idee ein anderes Bild präsentiert, das der neoabsolutistischen Geste eines immer noch jungen Kaisers: Die Metapher des „Blutkreislaufs“ physiokratischer Staatskonzepte meint den vom Staat in Gang zu haltenden Kreislauf des Kapitals und der Waren. Franz Josephs Amtsantritt 17 Jahre zuvor, in den letzten Tagen der militärisch niedergeschlagenen bürgerlichen Revolution, brachte das Ende der „constitutionellen“ Hoffnungen der Studenten und einer aufstrebenden Bildungsschicht, die als die eigentlichen Träger der Revolution gesehen werden, deren unzureichendes Verständnis der komplexen nationalen und sozialen Gemengelage aber auch Hauptursache für deren Scheitern war. Ein Exponent dieser jungen Intellektuellen, der damals 31-jährige Philologe, Hegelianer und Privatdozent für Kunstgeschichte Rudolph Eitelberger, nach der Märzrevolution im April 1848 und bis in den Jänner 1849 „Haupt-Redacteur“ der amtlichen Wiener Zeitung, sollte ab 1858 in der Planung und Entwicklung der Stadterweiterung eine wichtige Rolle spielen: Er war Mitglied sowohl der Beurteilungskommission des internationalen städtebaulichen Wettbewerbs, des ersten seiner Art überhaupt, als auch der Kommission, die aus den Preisträgerprojekten bis Mai 1859 den „Grundplan“ entwickelte, der über 50 Jahre lang als immer wieder adaptiertes und doch in seinen wesentlichen Festlegungen beibehaltenes Grundgerüst des neuen Stadtgebiets fungierte. Schon im April 1848 hatte er in der Wiener Zeitung in einem detaillierten Reformvorschlag für die staatliche Baubehörde, den „Hofbaurath“, neben dem grundlegenden Ruf nach einem Ende der „Kunst-Censur“, vor allem in Fragen der Wahl des architektonischen Stils und auch internationale „Concurse“ für wichtige staatliche Bauvorhaben gefordert. Er war hier also, zehn Jahre später, in seinem Element. Seine staatspolitische Position, die für viele der in das Projekt maßgeblich involvierten Beamten der Staatsministerien und Experten als charakteristisch angesehen werden kann, wird aus seinen eindringlichen Appellen während der Revolutionsereignisse deutlich. Am 7.10.1848, mitten in den bürgerkriegsartigen Kämpfen in der Wiener Innenstadt, richtet er sich an seine „Mitbürger“ mit der Versicherung, dass sein Blatt „[…] nie aufhören [werde], die Principien der Freiheit mit denen der Gesetzlichkeit zu versöhnen […]“ und zwei Tage später: „Was wir endlich wünschen, ist, daß alle Klubbs, welche Farbe, Richtung sie auch haben mögen, in dem Einen Punkte übereinkommen, den inneren Frieden zu wahren, die Anarchie zu bekämpfen. Noch liegt die bessere Zukunft Oesterreichs in den Händen des Reichstages, noch ist Mäßigung, Gerechtigkeit kein leerer Wahn, noch ist Vertrauen, hohes Vertrauen zu den Vertretern des Volkes; in seinen Händen liegt Alles, Alles, was das Volk beglücken, Frieden und Eintracht anbahnen kann. Möge er das Wort sprechen, das versöhnend den aufgeregten Willen beschwichtigen kann, bevor der Damm gebrochen, die Strömung das Land überfluthet.“ Umbau: Der Ring als Landschaft
117
Noch zum Jahreswechsel schreibt er, dass er keine „Ursache hätte, die Grundsätze zu bereuen oder zu verändern, welche [ihn] seit der Übernahme der Redaktion geleiten“. Und weiter: „Der Wahrheit ihr Recht, der Freiheit den gesetzlichen Boden zu erringen, den Grundsätzen der Mäßigung, Ordnung und Gesittung eine feste Stütze zu geben, war inmitten der erschütternden Bewegungen des Staates sein unwandelbares Ziel und die Theilnahme, mit welcher diesem Streben ein großer Theil der Leser folgte, hat in ihm die Überzeugung festgestellt, daß, wenn auch im Einzelnen für den Augenblick diese Grundsätze erschüttert werden konnten, sie in der Mehrzahl der Bevölkerung doch tiefe Wurzel gefaßt haben. Dies gibt uns einen trostreichen Blick in die Zukunft, und Muth, auf der eingeschlagenen Bahn fortzuwandeln.“ Diese Hoffnungen bauten auf der – nie in Kraft getretenen – Verfassung von Kremsier auf, die auch im internationalen Vergleich als fortschrittlich galt und in ihrer konstitutionellen Einschränkung der kaiserlichen Machtbefugnisse bis zum Ende der Monarchie unerreicht blieb. Das „Wesen der konstitutionellen Staatsform“ charakterisiert Eitelberger 1848 in Die Reform des Hofbauraths damit, dass „in einer solchen […] der jedesmalige verantwortliche Minister sich an die Sachkundigen zu wenden [hat]“. Allein die Verantwortlichkeit eines Ministers gegenüber einer Volksversammlung war im April 1848 noch nicht mehr als eine Forderung und wurde erst mit dem Februarpatent von 1861 wieder eingeführt. Freiheit ist für Eitelberger eine Errungenschaft, die zwar konstitutionell abgesichert werden muss, aber nur „durch erhöhten Verstand und Energie des Willens“ immer wieder neu realisiert wird. Großstadt Wenn Eitelberger zehn Jahre später, am 10. März 1858, also fünf Wochen nach der Ausschreibung des Wettbewerbs, in einem vielbeachteten, wenig später auch publizierten Vortrag Über Städteanlagen und Stadtbauten 2 den Zusammenhang der RingstraßenPlanung, der „Massregel, die Allen so ganz an der Zeit erscheint“ und für ihn ganz im Hegel’schen Sinn „aus den tiefsten Strömungen [der Zeit] hervor[geht]“ mit „Fragen der Staatsweisheit, mit Elementen, die eigentlich staatenbildend genannt werden können“, betont, muss man sich fragen, welchen Staat er hier meint. 1859 ist es wiederum Eitelberger, der die zunächst in der Wiener Zeitung veröffentlichte und anschließend von der „Kaiserlich-Königlichen Hof- und Staatsdruckerei“ herausgegebene Auflage der preisgekrönten Entwürfe – mitsamt „kaiserlichem Handbillet“ und Wettbewerbsausschreibung – redigiert und mit einem einleitenden Text versieht. Auch hier wird wieder gleich einleitend unterstrichen, dass die „Erweiterung der Stadt Wien“ nicht als „isolirte Erscheinung, nicht als Frucht plötzlicher Entschließung“ zu sehen ist. „Sie beruht auf einer inneren Nothwendigkeit. Sie hängt mit der Entwicklung des europäischen Handels und Güterverkehrs und der Ausbildung der österreichischen Staatsidee innig zusammen.“ Man schrieb das Jahr der Niederlagen bei Solferino und Magenta, das Reich war am Rand des Staatsbankrotts, Franz Joseph in Europa zusehends isoliert und der unter dem Einfluss seiner Mutter proklamierte Neoabsolutismus zeichnete sich als Sackgasse ab. Der Baumeister dieses Versuchs, ein Reich gegen alle inneren Spannungen zusammenzuhalten, Innenminister Alexander von Bach, der jetzt zurücktreten musste, war selbst im Juli 1848 als Justizminister in das liberale Kabinett unter Anton von Doblhoff-Dier berufen worden und galt noch bis kurz vor der gewaltsamen Auflösung des Kremsierer 118
UMBAU 29
Andreas Vass
Reichstags als Anhänger der von diesem ausgearbeiteten liberalen Verfassung. Er war es, der 1857 die Vorbereitungen zur Stadterweiterung, bis dahin Agenda des Außenministers, selbst übernommen hatte, was den entscheidenden Wechsel von einem privatwirtschaftlich zu entwickelnden Projekt zu einem staatlich gelenkten brachte, in dem die lukrierten Gewinne vor Ort in neue öffentliche Gebäude und Institutionen investiert werden würden. Diese spricht Eitelberger in Konkretisierung der „Staatsidee“ an: Was „der Kaiserstadt jenen Glanz geben soll, den sie heut zu Tage theilweise noch entbehrt“ sind letztlich „alle jene Gegenstände“ einer bürgerlichen Gesellschaft, die den „grossen Unterschied zwischen einer grossen Stadt und einer Grossstadt“ ausmachen, die ihren „reich gegliederte[n] Organismus ‚durch grosse künstlerische und staatliche Ideen auf ein höheres Niveau‘“ heben. Der„in der heutigen Welt-Architektur“ ausgebildete „Typus […] entfaltet sich theils in gewissen Bauanlagen, Plätzen, grossen Strassen, Squares, Boulevards, Quais, Markthallen, Vergnügungsorten u.s.f., […] theils auch in der Formensprache der Architektur selbst“. Schon das von Alexander von Bach aufgesetzte Kaiserliche Handschreiben nennt einige der bürgerlichen „Bauanlagen“: Opernhaus, Bibliothek, Stadthaus, Museen und Galerien. Nicht vorgesehen: eine Erneuerung oder Erweiterung der Hofburg – und das sollte noch im Grundplan so bleiben. Ist die Ringstraßenanlage also eine „Parallelaktion“ der gescheiterten bürgerlichen Revolution, die sich hier, sublimiert in Stadtbaukunst, als gebautes Manifest einer modernen Großstadt den Weg in die Wirklichkeit bahnt? Nicht ephemere Kompensation, wie sie Musik oder Theater leisten können, sondern dauerhafter Anstoß, in den Anstrengungen, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit zu wahren, nicht nachzulassen? Jedenfalls war Eitelbergers Vorstellung und, so steht zu vermuten, die der Beamten in Bachs Ministerium eine, die durchaus neue Maßstäbe setzen sollte, aber nicht etwa in Baumassen oder Bauhöhen, sondern in den gestellten geistigen Ansprüchen. So stärkt „die Ueberzeugung […], dass man in diesen Dingen einer höheren Gewalt gehorcht, […] die Kraft des Willens und fordert, da es müssig erscheint, über den Vortheil und Nachtheil grosser Städte zu sprechen, ‚zum klaren Denken über die Bedingungen auf‘, unter denen das leibliche wie das geistige Wohl derselben gedeihen kann.“3 „Erhöhte[r] Verstand und Energie des Willens“, die er in seinem ersten Artikel in der Wiener Zeitung, am 14. 4. 1848 zur Sicherung der Freiheit für notwendig erachtet, müssten freilich „ein[en] Theil der kranken Wienergemüthlichkeit“ ersetzen, „[…] und hoffentlich wird gerade so viel falsche Gemüthlichkeit verschwinden, dass das wahre und rechte Gemüth seinen Platz und seine Stellung finden wird“.4 Angesichts des Projekts, das zehn Jahre später diese Stadt von Grund auf zu verändern beginnen sollte, erhält dieser Satz den Charakter einer fast schon prophetischen Vision. Werden einer Morphologie „Verständige Benützung der Natürlichen und Geographischen Verhältnisse“ 5 Das von Beamten des Innenministeriums unter Freiherrn von Bach verfasste Kaiserliche Handschreiben vom 20. 12. 1857, in dem die Schleifung der Befestigungsanlagen und die nachfolgende Stadterweiterung im gesamten Areal des Glacis angeordnet wurden, ging Umbau: Der Ring als Landschaft
119
Der Ring – Morphologische Analyse Einflussbereiche der monumentalen Hochpunkte und lokale Raumbeziehungen Monumentale Hochpunkte Monumentale Zonen Sichtachsen Straßenachsen-Querungen Lokale Monumentalräume Plätze als Entrées zur Innenstadt
120
UMBAU 29
Andreas Vass
Der Ring – Morphologische Analyse Notation eines polaren / multipolaren Gedächtnisbilds der Landschaft Ringstraße Monumentale Hochpunkte Monumentale Zonen Sichtachsen Wienflusstal Hochhäuser bis 1975 Donaukanalabhang Hochhäuser bis 1960 Plateau der Institutionen Historische Achsen
Umbau: Der Ring als Landschaft
121
konkret auf die einzelnen zu berücksichtigenden Gegebenheiten ein. Die „Erweiterung der inneren Stadt Wien mit Rücksicht auf eine entsprechende Verbindung derselben mit den Vorstädten“ sollte durch Öffnung neuer Ausgänge „unter Bedachtnahme auf die in die Vorstädte führenden Hauptverkehrs-Linien“ und durch „Herstellung neuer, jene Verkehrslinien vermittelnder Brücken“ erfolgen. Für die unterschiedlichen Abschnitte des Glacis wurden jeweils auf die Bedingtheiten der Lage abgestimmte programmatische Festlegungen getroffen. Dass diese zunächst noch teilweise durch die bis zuletzt vom Militär urgierten Einrichtungen und unverbauten Räume geprägt waren, änderte nichts an ihrer topografisch motivierten Anlage. Im Gegenteil wurde die strategische Erfassung des Terrains zur Grundlage ihrer nachfolgenden städtebaulichen Ausdeutung. Diese konkretisiert sich bereits in der Concursausschreibung zur Erlangung eines Grundplanes, die knapp fünf Wochen später, am 30.1.1858, das Programm für die weitere Entwicklung vorgibt: „Insbesondere ist es die Aufgabe der Concurrenten, den ‚gegebenen‘ Raum in den angedeuteten Beziehungen und unter Beachtung der Allerhöchst vorgeschriebenen Gesichtspunkte entsprechend und zwar in der Art zu disponieren, dass die Neubauten sich sowohl an die innere Stadt, mit Bedachtnahme auf eine thunlichst anzustrebende Regulirung derselben, als auch an die Vorstädte ‚organisch anschliessen‘.“ Noch deutlicher wird wiederum Rudolph Eitelberger in seinem bereits zitierten Vortrag vom 10.3.1858: „Die ganze Formation des Terrains ist der Art, dass eine Vielgestaltigkeit der Bau-Gruppen möglich ist. Das Bauterrain bewegt sich nicht in viereckigen Formen, sondern geht in grossem Bogen von einem Ende des Donaukanals nach dem andern. Es lehnt sich hier an Wasser, gegen die Laimgrube an Hügel an, es hat selbst gegen die innere Stadtseite reich bewegte Formen. Diese Verbindung des neuen Wien mit dem alten wird in dem Gegensatze zwischen Alt und Neu selbst einen grossen Reiz gewähren, so schwierig sie in organischer künstlerischer Beziehung herzustellen sein dürfte.“6 Die landschaftlichen Vorzüge des natürlichen Terrains von Wien, „Ebene und Gebirg, FIuss und Hügelland“, spielen für Eitelberger eine große Rolle. Seine Überlegungen gehen dabei weit über die Erweiterung der inneren Stadt hinaus. Die Aufhebung des Bauverbots am Linienwall wenige Wochen nach seinem Vortrag ist ihm eine nachträgliche Anmerkung in der Publikation des Vortragsmanuskripts7 wert. So muss dieses Großprojekt der Intention nach schon 1858 als gesamtstädtisches gesehen werden, was sich auch in den meisten der preisgekrönten Projekte andeutet. Als Beispiele können die Integration eines neuen Hauptbahnhofs beim 122
UMBAU 29
Andreas Vass
Zollamtsgebäude in einigen Entwürfen, die Anlage eines Donaukanalhafens im Projekt Sicardsburg-Van der Nüll, oder die als vierreihige Allee ausgeführte „Verbindungsstraße zur Donau“ im Projekt Förster, die den Schottenring mit dem Augartenspitz verbunden hätte, gelten.8 Theophil Hansen und der „romantische Städtebau“ Erst das Projekt, das Theophil Hansen als Jurymitglied des „Concurses“ nachträglich erstellt hatte, beschränkte sich ausschließlich auf die Disposition der Freiräume und Volumen der öffentlichen und privaten Bauten im Bereich des Glacis.9 Hansen radikalisiert die mit der Wettbewerbsausschreibung und in Eitelbergers Vortrag aufgeworfenen Fragen, indem er einerseits die „in ihren Gedanken schon vorgebildet[en]“ Typen der öffentlichen Gebäude als möglichst freigestellte, auf ihre Wirkung in einem offenen Raum hin angelegte Brennpunkte einsetzte: „Auch habe ich weniger auf eine Menge von Bauplätzen für neue Wohnungen als auf eine Anlage Rücksicht genommen, welche durch monumentale Bauten und großartige Plätze, sowie durch ‚malerische Gruppirung der Gebäude‘ einen Gürtel um die innere Stadt bildet, durch welchen die Vorstädte mit der letzteren in Verbindung gebracht werden.“10 Andererseits ging er an den Rändern dieses Systems zur Inneren Stadt bzw. zu den Vorstädten hin noch konkreter auf die dort vorhandenen Bestände ein. So sollten die Basteien in einigen Abschnitten erhalten bleiben, um einen „wirklich angenehmen Spaziergang nicht zu verlieren“. Im Anschluss an den 6. Bezirk behielt er den Getreidemarkt als in die Geländekante integrierten Marktplatz bei, der allerdings die Durchgängigkeit der Lastenstraße unterbrochen hätte. Die neuen Querverbindungen setzen in einfachster Weise bestehende Straßenverläufe fort, die fallweise durch hinzugefügte Baukörper vor dem Eintritt in die Vorstadt ergänzt wurden. Es ist also nicht so sehr der hohe Grünraumanteil,11 durch den Hansen das Zusammenfügen von Innerer und Vor-Stadt als landschaftliche Aufgabe in dem Sinn begriff, der sich in der Folge immer mehr abzeichnen sollte und uns heute den einmaligen Wert und die Aktualität der Ringstraßenanlage darzustellen scheint. Ausschlaggebend dafür ist vielmehr die Konkretheit der Anknüpfung an den Bestand, die umso deutlicher hervortritt, als sie, besonders was die öffentlichen Gebäude betrifft, durch weitestgehend freigestellte autonome Baukörper erfolgt. Dadurch verschwindet die figurative Autonomie der einzelnen Freiräume fast vollständig und es tritt die Gesamtform des Polygons einerseits und die Kleinteiligkeit und Unregelmäßigkeit des Bestandes Umbau: Der Ring als Landschaft
123
andererseits als kontrastierende Wirkung umso stärker hervor. Insgesamt entsteht eine Sprödigkeit, die den „malerischen Reiz“ der, bedingt durch das Polygon, vielfach über Eck in weiten, asymmetrischen Perspektiven erscheinenden Baukörper jene „falsche Gemüthlichkeit“ nimmt, die Eitelberger im stetigen Kampf um Freiheit und Rechtstaatlichkeit notwendig zurückgedrängt sah. Hansens Plan erscheint damit trotz der noch deutlich offeneren Anlage wie eine Vorwegnahme der nachfolgenden Umbau-Schritte, die diesen landschaftlichen Ansatz bei beträchtlicher Verdichtung weitertragen sollten. Hansen knüpft dabei sogar an bedeutende Bestände aus dem Barock, dessen architektonische Zeugen um die Mitte des 19. Jahrhunderts noch kaum geschätzt wurden, an. Auch er erhält zwar die „wahrhaft großstädtische Vedute“ vom Kärntnertor und von den Basteien zur Karlskirche nicht, deren Verlust schon zeitgenössische Kritiker beklagten.12 Aber er erweist den barocken Bauten seine Reverenz, indem er ihnen mit einfachen Mitteln das angemessene Umfeld schafft oder bewahrt: Der Karlskirche die offene Flusslandschaft des Wienflusses und die niedrige Bebauungskante der Wiedener Vorstadt; der Front der Palais Trautson und Auersperg eine Erweiterung der vorbeiziehenden Allee der „Lastenstraße“; und dem Komplex Hofburg – Albrechtspalais eine neue Fassung des äußeren Burgplatzes und des Burggartens. Die Hofburg würde „als ein historisches Gebäude zu erhalten und zu verwenden sein“ und – Hansens wichtigste programmatische Ergänzung zur Wettbewerbsausschreibung – um eine neue Residenz ergänzt, die freistehend quer zum Bestand zwischen Burgplatz und Burggarten auf den architektonisch bedeutendsten Teil der Hofburg, nämlich Fischer von Erlachs Hofbibliotheksbau, Bezug nimmt. Im Unterschied zu Sempers späterem „Kaiserforum“-Konzept bleibt der Raum aber zum Volksgarten hin offen, um „alle gezwungenen Künsteleien“ einer symmetrischen Anlage zu vermeiden. Hansen rechtfertigt diesen Vorschlag mit der „Isolirung des Hofgartens“, das heißt der fehlenden privaten Verbindung zwischen Kaiserresidenz und Garten, etwas, das „jeder einen Garten besitzende Privatmann“ beansprucht. Die Wirkung wäre aber gerade nicht Intimität und Rückzug, sondern ein ziemlich exponiertes Heraustreten des Kaisers aus seiner barocken Residenzstadt in den neuen offenen Raum einer bürgerlichen Gesellschaft gewesen, in dem sich seine Residenz neben den deutlich größeren benachbarten öffentlichen Gebäuden – Museum, Bibliothek, Theater – fast bescheiden ausgenommen hätte. Ein wenig von dieser Wirkung ist trotz der monumentalen Baumasse der Semper’schen Exedra durch den offen gebliebenen Raum des „Forums“ auch heute noch 124
UMBAU 29
Andreas Vass
spürbar. Architekturgeschichtlich sind die Vorbilder von Hansens Vorschlag, dessen Prinzipien er später auch in die Planungen zum Reichstag einfließen ließ,13 in den städtebaulichen Planungen des englischen Barock, bei Christopher Wren oder Nicholas Hawksmoor zu suchen, wie auch – unmittelbar – in Karl Friedrich Schinkels städtebaulichen Projekten für Berlin, die Julius Posener als „romantischen Städtebau“ bezeichnet. Das Polygon Als Katalysator dieses „romantischen Städtebaus“ mit seinen offenen, nicht nur spiegelsymmetrischen, sondern auch tangentialen und diagonalen räumlichen Beziehungen über weite Freiräume hinweg fungiert das Polygon der Ringstraße selbst. Obwohl im Handschreiben noch von einem „rings um die innere Stadt [anzulegenden] Gürtel“ die Rede ist, schlagen, von wenigen Ausnahmen abgesehen, die meisten eingereichten Entwürfe eine polygonale Anlage aus gerade fluchtenden Alleen vor. Dieses Vorherrschen linearperspektivischer Räume wurde von der zeitgenössischen Presse schon anlässlich der Ausstellung der Wettbewerbsprojekte bemerkt.14 Es muss also selbst für die Erwartungshaltung eines am Pariser Vorbild der Boulevards geschulten Publikums auffällig gewesen sein. Trotzdem ergibt sich auch diese Grundfigur der Ringstraße, die im Lauf des 14-monatigen kollektiven Planungsprozesses in zahllosen Einzelschritten und Verschiebungen ihre definitive Form annimmt, aus den vorhandenen baulichen und den durch sie geprägten mentalen Strukturen: Die Abschnitte des „Gürtels“, die das Kaiserliche Handschreiben nennt – von der Biberbastei (heute Stubenviertel) den Donaukanal entlang, „gegen die Rossau und die Alservorstadt“, der Abschnitt Schottentor-Volksgarten, die „frei zu lassen[de] Fläche ausserhalb des Burgthores bis zu den kaiserlichen Stallungen“, der Abschnitt beiderseits des Kärntnertores und „bis gegen das Karolinentor“ (in Verlängerung der Weihburggasse), und von diesem bis zum Donaukanal –, geben bereits ein grobes Bild der späteren Einteilung des „Rings“. Vom Schwung des Donauarms und dem ersten zu diesem orthogonalen Stück bei der Franz-Josefs-Kaserne (Stubenviertel) ausgehend, spannt sich das unregelmäßige Siebeneck über die Eckpunkte der Wasserkunstbastei (Schwarzenbergplatz) im Südosten sowie der Mölkerbastei im Nordwesten, die letztlich auf die Achsen der Votivkirche und des Palais Schwarzenberg als Winkelsymmetralen eingestellt werden, bis zur Scheitelstrecke am Burgtor, deren Enden durch die Anlage von Volks- und Burggarten, der ersten Stadterweiterung nach Sprengung der Burgbastei durch die Napoleonischen Truppen 1809, bereits näherungsweise vorgezeichnet waren. Orthogonalität der Polygonseiten beim Kärntner- und beim Schottentor und Parallelität zur „Halbbastei“ beim Volksgarten legen die Geometrie endgültig fest. Das Polygon der Ringstraße war schon im Handschreiben ein in zwei parallele Boulevards für den Personen- und den Güterverkehr aufgegliedertes Verkehrsbauwerk, das der Entlastung der inneren Stadt diente. Eine der ersten Verwaltungsmaßnahmen unmittelbar nach der Eröffnung am 1. Mai 1865 war die Neuordnung des Stellwagenverkehrs, wobei „jene Omnibus- oder Stellwägen, welche von einer Vorstadt in eine andere, oder von einem außer den Linien gelegenen Orte durch eine Vorstadt in eine andere Vorstadt verkehren, und bisher durch die k.k. Hofburg gefahren sind, […] in Hinkunft Umbau: Der Ring als Landschaft
125
ohne weitere Einfahrt in die Stadt den Weg über die Ringstraße zu nehmen“ hatten. Es diente also der tangentialen Umfahrung der Innenstadt, war aber, vor allem auf seinem inneren Ast, der eigentlichen Ringstraße, von Anfang an zugleich der „Corso“ der Equipagen des gehobenen Bürgertums und des Adels. Die beschriebenen Abschnitte, die perspektivischen Räume der Polygonseiten, an deren Enden sich jeweils neue Perspektiven auftaten, waren ihrer gesellschaftlichen Funktion nach unterschiedlich besetzt. Ihre Abfolge nahm mit dem Äußeren Burgtor seinen Anfangspunkt, von dem nach Norden und nach Süden zwei unterschiedliche Hälften des Polygons ausgingen. Richtung Süden begann hier das Promenieren zu Pferd oder im Einoder Zweispänner, dessen Ziel zugleich Hauptschauplatz dieser linearen Vergnügung war: die Hauptallee im Prater. Über den Opern- und Kärntnerring ging es im leichten Gefälle zum Wiental hinunter und anschließend parallel zum Wienfluss durch das ehemalige populäre Erholungsgebiet des ,Wasserglacis‘ am Stadtpark vorbei, der verkleinerten, kommunalen Variante des Vergnügungsgebiets jenseits des Donaukanals – einem Zugeständnis an den 1861 erstmals wieder gewählten Gemeinderat. Diese Freizeitnutzung gewichtete den südlichen Teil des Polygons deutlich anders als den nördlichen. Dieser gliedert sich in zwei Abschnitte: den fast horizontalen zwischen Burgtor und Schottentor, wo der im Handschreiben noch vorgesehene Exerzierplatz sukzessive von den wichtigsten kulturellen und politischen Institutionen verdrängt wurde, und den in gerader Linie Richtung Donaukanal abfallenden Schottenring, wo der Raster der Ringstraßenblocks die größte Flächenausdehnung erhält und Handel, Banken und Börse 15 den Ton angeben. Indem das Kaiserliche Handschreiben die Gebiete zwischen Schottentor und Donaukanal – das „Textilviertel“– einerseits, und rund um das Kärntnertor bis zum Karolinentor andererseits als die hauptsächlich für private Bebauung zur Verfügung stehenden Bauparzellen anspricht, greift es auch die Schwerpunkte der Vorläuferprojekte auf, die zuerst 1817 und ab Mitte der 1830er Jahre in immer dichterer Folge vorgeschlagen wurden. Allein Ludwig von Förster, der neben Sicardsburg und Van der Nüll einflussreichste Preisträger und Architekt der Ringstraßenplanungen, entwickelte zwischen 1839 und 1856 acht Stadterweiterungsprojekte, die neben dem Bereich um die Biberbastei vor allem das Gebiet des Kärntnertors und eben das „Textilviertel“ zum Inhalt hatten. Für die erste, in der Folge immer wieder abgewandelte Planung für dieses im Überschwemmungsbereich 16 der Donau gelegene Gebiet wurde Förster 1839 durch eine „Gruppe von Bankiers“ 17 beauftragt. Mit einer geradezu Camillo Sittes „künstlerische Grundsätze“ vorwegnehmenden kompakten Bebauungsstruktur von unübertroffener Klarheit und Präzision ordnet Förster das Schwemmland bis hinauf zur Mölkerbastei innerhalb der erweiterten Mauern zu einem neuen Stadtviertel mit dem vollen Programm einer bürgerlichen Stadt. Eine „Öffentliche Börse“ darf da nicht fehlen. Eines der größten Gebäude ist ein „Bazar mit einer an den vier Ecken zugänglichen Passage“.18 Das Kärntnertor ist dagegen von Anfang an, wohl aufgrund des dort seit 1708 bestehenden Hoftheaters, der favorisierte Standort des neuen Theater- und / oder Operngebäudes, häufig kombiniert mit Akademien oder Museen. Der Bereich Biberbastei schließlich war seit Mitte des 18. Jahrhunderts durch die Errichtung des Hauptzollbzw. Hauptpostamts ebenfalls nutzungsmäßig festgelegt. Die ab 1855 hier errichtete Franz-Josephs-Kaserne sollte eine Episode bleiben: Sie musste zwar zunächst mitsamt 126
UMBAU 29
Andreas Vass
unverbaubarem Vorfeld in die Ringstraßenplanungen integriert werden, wurde aber nur 33 Jahre später doch abgebrochen, um der Postsparkasse und dem Stubenviertel, dem späten und abschließenden Beitrag Otto Wagners zur Ringstraßenanlage, Platz zu machen. Deren Anlage zeigt nochmals programmatisch und stadträumlich die erstaunliche Kontinuität und Anpassungsfähigkeit der Planungen fast über das gesamte 19. Jahrhundert hinweg. Die Querachse über den Ring zwischen Postsparkasse und Zollamtsgebäude wiederholte noch ein letztes Mal (und nur für kurze Zeit 19) das Prinzip, das, abgeleitet von der als Matrize wirkenden Burg-Achse, auf die übrigen Seiten des Vielecks übertragen wurde, aber auch auf die beiden markantesten Eckpunkte Schottentor und Schwarzenbergplatz. Unterhaltung und Freizeit sowie Politik und Wirtschaft – jeweils getrennt und verbunden durch die Achsen des barocken Palais und der neugotischen Kirche – ordnen sich um diese Hauptachse, die zunächst zum Kaiserforum wurde und schließlich zum Ort der Aufbewahrung und Konsumtion materiell – in Schrift-, Natur- und Kunstgegenständen – gespeicherter Kultur. Eine Vielheit reiht sich auf entlang des Vielecks. Dessen Ganzheit, die in der Bewegung erlebt werden kann, ist nicht gebrochen, wie es seine „gebrochene“ Form vermuten ließe, sondern durch differenzierende Bezüge in einem fragilen Schwebezustand gehalten. „Ich gehe gerne den Ring entlang. Das führt zu keinem Ziel“, schreibt Marlene Streeruwitz, und: „Das Österreichische sammelt sich nicht um ein Ereignis oder ein Dokument. Viele Geschichten und Gschichterln schaffen eine Zugehörigkeit, die wir immer erst im letzten Augenblick mobilisieren können. Und diese Zugehörigkeit ist dann nie eine Zusammengehörigkeit. Dem entspricht diese Aufreihung der Orte des bürgerlichen Selbstbewusstseins am Ring bis heute.“ 20 „Charakteristische Kunstform“ und Blockbebauung Vom Kaiserlichen Handschreiben an stehen öffentliche Bauten und Räume klar an der Spitze der Anforderungen an die Stadterweiterung. Das Interesse an privatem „Baugrund“, das der neuen bürgerlichen Mittel- und Oberschicht weniger beengte, repräsentative Wohnverhältnisse schaffen sollte, wird zunächst nur negativ erwähnt, als die Fläche, die „nicht einer anderweitigen Bestimmung vorbehalten wird“ und aus deren Verkauf vor allem die „Kosten der Herstellung öffentlicher Gebäude“ bestritten werden sollen. Die Frage nach dieser Hierarchie ist über weite Strecken zentrales Thema der öffentlichen Debatten (und Kritiken) um die Entwicklung der Ringstraße in den folgenden Jahren und Jahrzehnten.21 Während sowohl das nüchtern abgefasste Handschreiben, als auch die Concursausschreibung keine näheren Angaben darüber machen, wie man, über die „auch“ in Bedacht zu nehmende „Verschönerung Meiner Haupt- und Residenzstadt“ oder die „in technischer und künstlerischer Beziehung“ auszuführende Regulierung hinaus die Bedeutung des Öffentlichen städtebaulich zur Geltung bringen könnte, geht Eitelberger, wie bereits gezeigt wurde, in seinem richtungsweisenden Vortrag und in der Einleitung zur Publikation der Siegerprojekte ausführlich auf diese Frage ein. Der Vortrag gibt einen Abriss der Stadtbaugeschichte und städtebaulicher Theorien von Aristoteles bis zum Paris seiner Gegenwart, einem unvermeidlichen Maßstab, und geht dabei von der grundsätzlichen Anforderung aus, Städtebau als Kunst zu betrachten, wobei „der Künstler, selbst der grösste, nur als Glied eines grossen Kunstorganismus, als die ‚Spitze der tektonischen Thätigkeit einer Gesammtheit erscheint‘“.22 In der festen Überzeugung, dass Umbau: Der Ring als Landschaft
127
Museumserweiterung Maria Theresien Platz /
Vorgabe war eine veränderte Wegführung durch die
Heldenplatz
Raumfolge Hofburg – Heldenplatz – Maria Theresien
Studio Hochbau TU Wien, Prof. Steixner, 2015 / 2016
Platz – Museumsquartier. Die Seitenachsen werden zu
Betreuer: Erich Hubmann, Andreas Vass
Hauptwegen. Die Wahrnehmung wird ohne physischen
Projekt: Katarzyna Curylo, Michael Hochreiter
Eingriff radikal verändert. Eine räumlich differenzierte
M 1
Nutzung des übergreifenden Freiraums wird provoziert. Die Studierenden unterlegen die neue Wegführung mit den Erweiterungstrakten der Museen. Das KHM wird unter dem Ring mit dem Corps de Logis verbunden. Anknüpfend an die Typologie der historistischen Kandelaber bilden die Belichtungselemente der unterirdischen Museumsräume eine neue Schicht räumlicher Strukturierung entlang der tangentialen Bewegungsräume auf dem Maria Theresien Platz.
128
UMBAU 29
Andreas Vass
„der Geist es ist, der die Welt beherrscht“ würde es seiner Ansicht nach von der „Entfaltung der Kunst und Architektur […], an die sich die der Gewerbe und Wissenschaft anschliessen, [abhängen] […], ob [Wien] unter den grösseren Städten Osteuropas die erste tonangebende sein wird, oder auf das Niveau von Städten zweiten Ranges Europas herabsinkt.“ Was die Gestaltung der neuen „in ihren Gedanken schon vorgebildet[en]“ Bautypen betrifft, führt er eine grundsätzliche Unterscheidung ein, wobei wiederum die Frage des „Gemüths“ als zentrales Kriterium erscheint: Während im Bereich der privaten Wohnbauten 23, und insofern die Stadt „wohnlich“ sein solle, das „Gemüth“ in Betracht zu ziehen wäre, da hier „Fragen der physischen und psychischen Gesundheit“ und des „moralischen Einflusses der Wohnungen“ ausschlaggebend sind, ist bei öffentlichen Bauten „das ächt wahre gesunde Gemüth nur mit einer vollendeten und charakteristischen Kunstform befriedigt“. „Gemüthlichkeit“ komme hier keinesfalls in Frage. Noch konkreter legt er in der Einführung zu den publizierten Siegerprojekten des Wettbewerbs darauf Wert, dass es in Bezug auf diese „charakteristische Kunstform“ „keinen absoluten Gegensatz zwischen reinen Nützlichkeitsbauten und reinen Kunstbauten gibt“. Er wendet sich gegen die „sehr schädliche Doctrin, welche Kunst nur für eine gewisse Reihe von Bauten verlangt“ und zitiert sich gewissermaßen selbst mit der Forderung nach einer architecture parlante: „das Bauwerk soll in seiner Kunstform Charakter haben“. Einige Züge dieser „Charaktere“, in denen sich bereits die folgende Entwicklung abzeichnet, werden schon in den wenigen bekannten dreidimensionalen Darstellungen aus dem Wettbewerb deutlich. So findet man in Försters Perspektiven und auch in Sicardsburgs und Van der Nülls axonometrischen Ansichten das Repertoire einer großstädtischen Architektur ausgebreitet, das die neuen Bauaufgaben einer bürgerlichen Gesellschaft mit einer relativ freien Kombination historisch legitimierter Mittel der plastischen Durchbildung der Baukörper repräsentieren soll. Während die privaten Wohnbauten mit wenigen Akzenten an exponierten Punkten in Blöcke mehr oder weniger einheitlicher Höhe integriert sind, zeichnen sich die öffentlichen Bauten durch ihre reiche Gliederung sowohl in der Höhenentwicklung als auch im Grundriss aus. Als Standard könnte man Hauptbaukörper, in etwa gleich hoch wie die Wohnhausblocks, und überhöhte Mittelpartien sowie teils überhöhte Eckrisalite und -türme, teils auch niedrigere Seitenteile angeben. Stilistisch sind die Projekte unterschiedlich gewichtet aber in beiden Fällen auch in sich differenziert und frei gestaltet. Im Wesentlichen findet man also schon hier vor, was sich in der Folge an der Ringstraße als Regel durchsetzen sollte. Wenn auch nach den kritischen Debatten um das Opernhaus und den Tod Sicardsburgs und Van der Nülls der streng wissenschaftliche Historismus dominierte, bleiben die räumlich-plastischen Mittel der „Kunstform“, die ein öffentliches gegenüber einem privaten Gebäude auszeichnen, dieselben, ja sie werden mit zunehmender Verdichtung umso wichtiger: Den öffentlichen Gebäuden bleiben je nach Bedeutung abgestuft die Hochpunkte – aber auch besondere Abweichungen nach unten – vorbehalten, ebenso wie signifikante Abweichungen von den Fluchtlinien. Weithin sichtbare, oft auf die Achse einer Polygonseite zentrierte Kuppeln, Türme oder Risalite markieren den zentralen Baukörper, meist den Haupteingang oder, in zweiter Linie, die Ecken dieser Bauten. Die Projekte sind in Wettbewerben vergebene, individuelle, aber Umbau: Der Ring als Landschaft
129
von intensiven öffentlichen Diskussionen begleitete Leistungen von höchstem baukünstlerischen Anspruch. Trotz Stilpluralismus ist auch heute noch ihre intuitive Lesbarkeit der einfachen, aber effizienten Regel der privilegierten Ausnahme von einer linearen Ordnung zu verdanken. Die unbewusst aufgenommene politische Botschaft stellt den Vorrang des Gemeinwohls vor dem Privaten heraus, bei gleichzeitiger Einordnung staatlicher und kommunaler Repräsentation in die Gesamtheit der privaten Baumasse. Aber auch innerhalb der strikt geregelten privaten Blockbebauung gibt es Spielräume, die für die Wiener Ringstraße charakteristisch sind. Die stadträumlich relevanten Festlegungen beschränkten sich für Privatbauten im Wesentlichen auf die zwingend vorgegebenen Baulinien (selbst den Eingang markierende Säulen bedürfen vor der Baulinie einer Sondergenehmigung) und auf die maximale Bauhöhe „bis zum Dachsaume“ von 13 Klaftern (24,6 m).24 Mit dem Bild der Pariser Boulevards als Maßstab richtet sich die zeitgenössische Kritik sowohl gegen den Mangel an „einheitlichem Plane“als auch gegen die Monotonie der „Zinshaus-Speculations-Architektur“.25 Tatsächlich zeigt der Vergleich sofort den Unterschied: Es fehlt weitgehend die lineare Ordnung und zurückhaltende Plastizität der „corniches“ und „balcons“, aber auch der bis ins Detail regulierter Fenstertypen und Dachformen, die den Haussmann’schen Boulevard zu dem einen Stadtraum zusammenschweißen, der das Einzelgebäude hinter einer durchgängigen Straßenfront verschwinden lässt. Während Stadtregulierungen und Straßendurchbrüche in zahlreichen europäischen Städten diesem Pariser Muster folgten, das seine Vorläufer etwa in den Turiner Stadterweiterungsprojekten des 18. und 19. Jahrhunderts, den englischen „crescents“ oder in der Pariser Rue de Rivoli hatte, nehmen die Fassadenabwicklungen in der Ringstraßenanlage eher Bezug zu dem älteren Modell der italienischen Straßenfluchten der Renaissance, die, von der ferraresischen Stadterweiterung des 15. Jahrhunderts und den wenig später einsetzenden römischen Straßenfassungen und Durchbrüchen ausgehend, stets die Individualität der in die Flucht gereihten, durch plastische Fassaden portraitierten oder maskierten Gebäude beibehielten oder sogar betonten. Die perspektivischen Stadtszenen der italienischen Renaissancemalerei zeigen diesen Typ eines zivilen Raums ebenso wie Palladios Kulissenarchitektur im Teatro Olimpico in Vicenza. Die Wiener Ringstraßenhäuser bleiben also auch dort „Palais“, wo sie in Mietwohnungen aufgeteilt sind: Die betonte Mitte oder akzentuierte Seitenteile, Erker, Balkone, Bi- und Triforen oder die monumentalen Tore, historistische Bauplastik, Materialwechsel von Putz zu Stein zu Terracotta sind die reichlich eingesetzten Mittel dieser Individualisierung. Durchgängige Geschossbänder fehlen meist ebenso wie einheitliche Traufenhöhen. Erst in der Masse ergibt sich durch das Spiel zwischen strikten Fluchten und Maximalhöhen sowie den gegensätzlichen Bedürfnissen nach Repräsentation und Wirtschaftlichkeit eine relativ einheitliche Erscheinung, wozu auch eine von Bauherren wie Architekten als verbindlich angesehene Typologie entscheidend beiträgt. Auch wenn insgesamt die Horizontalität der privaten Baublöcke der eindeutig vorherrschende Eindruck ist, bleibt im Einzelnen, bedingt auch durch die bei dieser Vorgangsweise unvermeidlichen Qualitätsschwankungen der Architektur, eine Ambivalenz, die als Erklärung der gegensätzlichen Kritiken der Zeitgenossen gelten kann.26 Erst bei der Errichtung des Rathausviertels an der Stelle des im Grundplan noch freigehaltenen Exerzierplatzes wird das vielbeachtete Vorbild des Heinrichhofs gegenüber der Oper, der zum ersten Mal eine 130
UMBAU 29
Andreas Vass
einheitliche Gestaltung für einen gesamten Ringstraßenblock zeigt, aufgegriffen. Hier gelingt es sogar, zu den öffentlichen Bauten hin durchgängige Arkaden vorzuschreiben. Und trotzdem wirken die Fassaden nicht als vereinheitlichte Auskleidung eines Straßenraums nach Pariser Modell. Wie auch in anderen Gebieten der Ringstraßenanlage werden Bezüge vielmehr durch ein teilweise hohes Maß an Koordination zwischen den beteiligten Architekten erzielt. Die Weiterentwicklung des Grundplanes, die im Wesentlichen ein Zurückdrängen der militärischen zugunsten eines vergrößerten Platzanspruchs der zivilen öffentlichen Nutzungen wie auch des privaten Wohnbaus brachten, und insbesondere im Rathausviertel, im „Kaiserforum“ und im Bereich des Wienflusses ihren baulichen Niederschlag fanden, sind vielfach detailliert beschrieben worden und können hier aus Platzgründen keiner eingehenden Analyse unterzogen werden. Es soll daher hier nur noch anhand einiger Schlaglichter auf Wendepunkte des 20. Jahrhunderts die immaterielle Seite einer als Umbau verstandenen Landschaft des Rings zur Sprache kommen, die für einen aktuellen Umgang besonders relevant ist: Nur als Landschaft erschließt sich die Ringstraßenanlage in ihren Potenzialen als Speicher aktivierbarer Bedeutungen oder als Projektionsfläche für Ausdeutungen, die diese „Reserven“ 27 nicht ausbeuten, sondern in ihrer Regenerationsfähigkeit bewahren. Umbau durch Aneignung, Wahrnehmung und Nutzung Während die generelle Wertschätzung der Ringstraßenanlage bis zum Ersten Weltkrieg bei aller fachlichen Kritik und trotz des sich wandelnden Geschmacks der kulturellen Eliten unbestritten sein dürfte, würde die Ausrufung der Republik und die Übernahme der Stadtregierung durch die Sozialdemokratische Partei hier einen Bruch erwarten lassen. Offensichtlich kam es aber anders. Gerade zu der Zeit, als künstlerische und intellektuelle Avantgarden ihren Minimalkonsens in der Ablehnung der „lächerliche[n] Architekturkomödie“28 der historistischen Stadt suchten, begann der Stadtraum des Rings durch die Arbeiterbewegung einen Bedeutungwandel durchzumachen. Die Haltung der Arbeiterschaft zielte schon vor dem Ersten Weltkrieg auf die Aneignung ab, die dann das Rote Wien in großem Stil praktizierte. So schreibt die Arbeiterinnenzeitung am 18. 1.1910 in ihrer Beilage „Freie Stunden“: „Also, es war einmal eine Zeit und sie liegt nicht gar so fern, etwa 28 Jahre hinter unserer Zeitrechnung, wo es einer Proletarierfrau nie in den Sinn kommen konnte, über ihre Toilette nachzudenken. Wozu auch, wo und wann hätte sie Gelegenheit, so was wie Toilette zu machen? Etwa ‚um auf der Ringstraße Spalier zu bilden‘ wenn die Vornehmen und Reichen in ihren Karossen promenierten; […] Was uns selbst als Erinnerung der ersten bewußt erlebten Lebensjahre beherrscht, spielt in den Siebzigerjahren des vorigen Jahrhunderts. Die Basteien existierten nicht mehr, die Ringstraße von Stubentor bis zur Oper war vollständig ausgebaut, Umbau: Der Ring als Landschaft
131
vom da ab waren freie Plätze, auf denen allerlei Kunstbauten im Entstehen waren. Das Parlament, das Rathaus, die Universität, die Votivkirche. Was hinter diesen Plätzen war, da wo heute das schöne Rathausviertel ist, wo die verkehrsreiche Lastenstraße ihren Zug nimmt, war ödes, stellenweise durch Bretter vernageltes Terrain, das in der Dunkelheit zu passieren, man sich ebenso scheute, wie etwa heute einen Teil der Schmelz. […] Im allgemeinen galt damals das Wort Proletarier für eine Art Ehrenbeleidigung. Man beachtete das sogenannte Volk nur, wenn es in vier bis fünf Reihen aufgestellt den Ring und den Prater besetzte, um die Equipagen anläßlich einer Praterfahrt anzustaunen, ein Schauspiel, das man heute fast nie mehr sieht und merkwürdigerweise hatte man damals vor dieser gaffenden Menge niemals Angst. Sie war die Folie, die man zum Prunk brauchte. Heute am 1. Mai trauen sich nur einige mutige Wagenbesitzer in den Prater, obwohl auch nicht mehr Proletariat beisammen ist als dazumal. Ja, heute gafft man nicht mehr, heute promeniert man zu seinem eigenen Vergnügen und das scheint gefährlicher zu sein.“ 29 Und wenige Monate später, am 11.10.1910 titelte die Arbeiterinnenzeitung auf Seite 1: „Der 2. Oktober. Ein unvergleichlich schöner Herbsttag kündigte sich an, als frühmorgens in den Arbeiterbezirken Wiens Tagreveille geblasen wurde, um das Proletariat zur Demonstration auf die Ringstraße zu rufen. […] Es war ein erhebender, überwältigender Anblick, als die Züge aus den Bezirken, die auf dem Karlsplatz Aufstellung genommen hatten, von dort über den Ring zogen. Zu beiden Seiten der Straße ein dichtes Spalier; Publikum aus dem Bürgertum, aber auch aus dem Proletariat. Viele, abgehärmte Arbeiterfrauen konnte man sehen, die mit der Einkauftasche in der Hand die Demonstration betrachteten. […] Selbst bürgerliche Zeitungen schätzen die Teilnehmerzahl an der Demonstration auf 300.000 Menschen.“ 30 Nutzung und Wahrnehmung der Ringstraße waren aber auch in der Zwischenkriegszeit vielfältig, wie ein Ausschnitt aus der Zeitschrift Photo-Kinosport vom März 1932 zeigen mag: 31 „In der Stadt kann man bei Sonne endlich darangehen, die wichtigsten und schönsten Denkmäler aufzunehmen. […] Machen wir zum Beispiel einen Rundgang über die Ringstraße. Während der Fahrt mit der Tramway ist es natürlich ausgeschlossen, gut zu filmen. Denn es gilt als oberstes Prinzip, daß die Kamera während der Aufnahme ruhig gehalten und nicht erschüttert wird, […]“ und so wird ein volles Panorama der Ringstraße abgespult, aus der Sicht des Hobby-Kameramanns der hier anderen seine Tipps gibt. Und was schreibt die London Information of the Austrian Socialists in Great Britain am 1. Mai 1945? Auf Seite 1 steht hier in 132
UMBAU 29
Andreas Vass
großen Lettern „MAY DAY of EUROPEAN FREEDOM, RED VIENNA WILL RISE AGAIN“ und darunter: „For the first time after eleven years the workers of liberated Vienna will proudly parade ‚their old red banners over the Ringstrasse‘. This thought fills our hearts with joy. The people of Vienna have suffered and fought. They are free. ‚The Ringstrasse is theirs again. Red Vienna will rise again.‘“ 32 Den Wirtschaftsboom nach der Unterzeichnung des Staatsvertrags überlebte dieser Traum aber nicht lange. Auch wenn weiterhin jedes Jahr über den Ring paradiert wurde und sich später auch neue Zeichen der Widerständigkeit fallweise in Aktionen und Demonstrationen Platz schaffen sollten, wurden Potenziale neuer Deutungen nicht mehr (bzw. noch nicht) wahrgenommen. Die Anlage der Ringstraße und erst recht ihre Architektur entsprachen, kaum dass im Schock der unmittelbaren Nachkriegszeit die wichtigsten öffentlichen Bauten in ihrer äußeren Erscheinung wiederhergestellt waren, nicht dem Selbstbild einer Stadt, die sich im Aufschwung sah, und mit der düsteren Vergangenheit auch die Vorvergangenheit, in der die Katastrophe begonnen hatte, am liebsten verdrängt hätte. International dominante Stadtmodelle der Moderne, die auf funktional wie stadträumlich solitäre Großkomplexe ohne Bezug zur Struktur der bestehenden Stadt setzten, boten den willkommenen Vorwand. Die einfache Höhenregel wurde nicht mehr verstanden. Durch die Bomben des Zweiten Weltkriegs freigewordene und letzte noch freigebliebene Parzellen wurden jetzt am Stadtpark, an der Zollamtsstraße und am Donaukanal mit Hochbauten besetzt, die privatwirtschaftlichen Nutzungen das Privileg der Höhe und damit der Sichtbarkeit verschafften, das zuvor exklusives Anrecht der „funktionslosen“ Kuppeln und Türme der öffentlichen Institutionen gewesen war. Erst in den 1970er Jahren setzte eine entscheidende Wende ein. Erneut waren es staatliche Institutionen, unter deren Mitwirkung die Bauten der Ringstraße (und des Historismus generell) neuerliche Wertschätzung fanden: So war es das Institut für Kunstgeschichte der Universität Wien und die wenig später zur ersten ordentlichen Professorin in der Geschichte des Instituts ernannte Renate Wagner-Rieger, die Studierende im Sommer 1970 zum Protest gegen den Abriss des der CA gehörenden Hauses Schottenring 10 animierten; und Herta Firnberg, soeben als erste Kulturministerin der Zweiten Republik im Amt, nahm diesen Protest zum Anlass, sich für den Schutz der bislang wenig geachteten Ringstraßenbauten im Rahmen des Denkmalschutzes einzusetzen. Mit dem Wiener Altstadterhaltungsgesetz von 1972 wurde dann schon 1973 die gesamte Wiener Innenstadt einschließlich der Ringstraßenanlage zur Schutzzone erklärt. Damit schien die Zerstörung Umbau: Der Ring als Landschaft
133
vorerst gebannt. Es wurde restauriert, renoviert, umgebaut – besser oder schlechter, aber doch so, dass das Vorhandene des revolutionären Traums von „Freiheit und Rechtsstaatlichkeit“ auch für künftige Generationen lesbar blieb. Doch um die Jahrtausendwende stieg der Druck der Immobilienwirtschaft spürbar. Die Preise begannen in zuvor unvorstellbare Höhen zu klettern, die Stadtverwaltung hatte die Devise des „Draufsetzens“ ausgegeben und so stellte sich bald manches Eck im Gebiet der Ringstraße auf „siebenstöckiges Mährisch-Ostrau“ um. Die eingangs erwähnten Planungen scheinen jetzt erneut Schleier der Verdrängung über die Ringstraße breiten zu wollen. Wenn Alfred Pfoser schreibt, dass „der massige Repräsentativbau des Wiener Rathauses […] erstaunlich gut […] für die Erlebnisgesellschaft des 21. Jahrhunderts [verwertbar ist]“, so trifft das in unterschiedlicher Intensität auf die gesamte Ringstraßenanlage zu. Darin liegt ein guter Teil ihres Werts und die Chance, ihn auch für künftige Generationen zu erhalten, aber auch die Gefahr einer Übernutzung oder verfehlter Inanspruchnahmen für substanzschädigende Verwertungsinteressen. Landschaften ebenso wie Städte sind heute diesem Zwiespalt ausgesetzt und bedürfen in einer Gesellschaft, in der Bedürfnisbefriedigung Simultaneität und Simulation in Eins fasst und das Erlebnis total zu werden droht, unseres Schutzes. Die Landschaft des Rings, aus dem Umbau eines revolutionären Anspruchs hervorgegangen, ist mit Vorsicht zu genießen. Ausblick auf künftige Ausdeutungen des Bestands Was wären nach diesen Umrissen einer Analyse der Ringstraße als Landschaft im Umbau die Grundsätze für die weitere Entwicklung? Hier sollen nur einige Eckpunkte angegeben werden: . Das Ringstraßenareal ist als ganzheitlicher Raum zu betrachten, vom Innenstadtkern bis an den Rand der Innenbezirke und entlang seines gesamten Verlaufs unter Einschluss der stärker beeinträchtigten Gebiete; eine Langfriststrategie zur Wiedergewinnung ver loren gegangener räumlicher Qualitäten in allen Teilen des Ringstraßenareals auf Grundlage einer punktgenauen strukturellen und semiotisch-morphologischen Analyse ist zu entwickeln; Weiterentwicklung des „Masterplan Ring“ unter Abkehr vom im Masterplan Glacis zugrunde gelegten Verdichtungsansatz. . Der Schwerpunkt des Umbaus liegt auf der Wahrnehmungsebene und im Bereich des kollektiven Bewusstseins, der Ausdeutungen des Bestands. Er sollte sich an einer Ein dämmung der „Eventisierung“ und einer Stärkung der politischen Dimension sowie der Alltagswahrnehmungen und -nutzungen orientieren. . Das Ringstraßenareal ist als Grünraum zu stärken. Dazu sollte nach einem Gesamtkonzept vorgegangen werden, das auf einer detaillierten Analyse der Bedeutungen der vorhandenen Bepflanzungen und möglicher Nutzungsänderungen aufbaut. Der Anspruch 134
UMBAU 29
Andreas Vass
wären ein Erhalt der historischen Gartenanlagen bei gleichzeitiger Schaffung neuer Freiräume für kompatible Nutzungen sowie die Erhöhung der Kontinuität des Boulevardcharakters der Straßenräume durch Pflanzung neuer hochwachsender Bäume, insbesondere entlang der Lastenstraße und an den wichtigsten Radialstraßen soweit es die Straßenquerschnitte erlauben. . Klärung der Bewegungslinien der unterschiedlichen Verkehrsteilnehmer nach Kriterien der räumlichen Wahrnehmung sowie der Stärkung und Ausdifferenzierung eines kollektiven Bewusstseins; Ausweitung bestehender und Schaffung neuer Wegführungen für den fußläufigen und nichtmotorisierten Verkehr. . Schaffung parzellenscharfer differenzierter Schutzbestimmungen nach architekturhistorischen und bedeutungsgeschichtlichen Kriterien für den Erhalt und die punktuelle Erneuerung des Baubestands. Oberstes Prinzip dieser Erneuerung sollte sein, dass diese nicht der Gewinnung zusätzlicher Nutzflächen, sondern der Verbesserung des Baubestandes dient. . Keine weitere oberirdische Verdichtung für private Nutzungen, weder in der Fläche, noch in der Höhe und Stopp aller derzeit laufenden Vorhaben dieser Art; Ausnahmen sollen nur nach den strengsten stadträumlichen Kriterien und ausschließlich für zur Gänze öffentliche (zu 100 Prozent von der öffentlichen Hand getragene und allgemein zugängliche) Nutzungen von herausragender gesamtstaatlicher Bedeutung gewährt werden. Die Grundsatzfrage bleibt: Gelingt es, sich der Landschaft des Rings als emblematischem Raum der Republik zu vergewissern und damit, bei aller Dichte und Vielfalt heterogener Deutungen und Inanspruchnahmen, die „Zugehörigkeit“ der „Orte bürgerlichen Selbstbewusstseins“ als Reserve einer utopischen „Zusammengehörigkeit“ auszudeuten?
1 Voraussetzung jeder Anamnese ist aber nicht der
3 Ebd., 32.
scheinbar neutrale Blick von oben, sondern die empa-
4 Rudolph Eitelberger: „Was hat die Kunst von den
thische Befragung auf Augenhöhe. Nicht der Grundriss
Bewegungen der Gegenwart zu hoffen oder zu fürch-
produziert die Erkenntnis. Die aus Quellen und Bestän-
ten?“, in: Wiener Zeitung, 14. 4.1848.
den sprechenden Zusammenhänge werden in Text
5 Das Fremden-Blatt schreibt auf Seite 1 am
und Zeichnung übersetzt. Neben Analysezeichnungen,
2. Mai 1865: „Aus den steinernen Gesichtszügen einer
die im Rahmen eines Erasmus-Stipendiats von
Weltstadt kann der kundige Reisende sich rasch die
Letizia Raineri und Jessica Seminara, beide von der
Geschichte derselben, den Rang ihrer civilisatorischen
Universität Reggio Calabria, im Frühjahr 2015 in
Entwicklung, die staatliche Reife und die gesellschaftli-
unserem Atelier entstanden, werden auch Zeichnungen
che Bildung ihrer Bevölkerung skizziren. Je großartiger
aus einem Entwurfsseminar an der TU Wien, das ich
die Anlage, ‚je verständiger die Benützung der natürlichen
im Wintersemester 2015 / 16 betreuen konnte, insbeson-
und geographischen Verhältnisse‘, je umfangreicher
dere aus einem Projekt von Katarzina Curylo und
die öffentlichen Bauwerke und kommunalen Anstalten,
Michael Hochreiter, herangezogen.
je kunstreicher die Anwendung und Durchführung
2 Prof. Rudolph Eitelberger Ritter v. Edelberg: Über
eines guten architektonischen Styles – um so günstiger
Städteanlagen und Stadtbauten. Ein Vortrag gehalten
und erhebender wird der Eindruck sein, welchen der
am 10. März 1858, Wien, Druck und Verlag von
Fremde von dem Gesammtbilde der Weltstadt empfängt
Carl Gerold’s Sohn 1858, 1.
[...]“; zit. nach: Andreas Nierhaus: „‚Die architektoniUmbau: Der Ring als Landschaft
135
sche Schönheit Wiens liegt ausschließlich in den Gebäu-
Projekt Peter Josef Lennés parkartig angelegtem Ent-
den der Zukunft.‘ Planen und Bauen in den Pionier
wurf verwandt, andererseits steht er konträr zu dessen
jahren der Ringstraße“, in: Der Ring. Pionierjahre einer
selbstbezogener Auffassung von „landschaftlicher“
Prachtstraße, Ausstellungskatalog im Wien Museum,
Gestaltung.
11. 6. – 4. 10. 2015.
12 „Wiener Brief“, in: Neue Freie Presse, Morgenblatt,
6 Eitelberger, 1858, a. a. O., 34.
25. 9. 1864; zit. nach: Andreas Zeese: „Reflex und
7 Ebd., 35.
Reflexion, Die Entstehung der Ringstraße zwischen
8 Schon der „Motivenbericht“ zum Grundplan hält
ästhetischer Kritik und städtebaulicher Theoriebildung“,
1859 fest, dass bei dessen Erstellung „die künftige Ent-
in: Harald R. Stühlinger (Hg.): Vom Werden der Wiener
wicklung Wiens nicht außer Acht gelassen“ wurde,
Ringstraße, Ausstellungskatalog Wienbibliothek im
um sogleich einzuschränken, dass „die direkte Behand-
Rathaus, Wien, 2015, 327 – 344: 334.
lung der hierauf abzielenden Fragen […] umfangreiche
13 So trägt Hansen in den Lageplan des Wettbewerbs
Vorerhebungen [bedinge] und besonderen zum Theil
für die Anlage der Hofmuseen, 1866, auch die beiden,
schon eingeleiteten Verhandlungen vorbehalten ist“.
hier noch getrennt gedachten Häuser des Reichsrats
Allerdings gelingt es auch hier wieder erst durch Initia-
ein. Das Herrenhaus ist hier so positioniert, dass die in
tive des Staates 1888(!), die zähen Widerstände gegen
seiner Hauptachse aufgestellte Monumentalsäule der
eine Vereinigung sowohl seitens der Gemeinde Wien als
Pallas Athene genau auf die Achse des Burgrings zu
auch auf Seiten der Vorortgemeinden zu überwinden
liegen gekommen wäre, was durch eine in den Plan ein-
und in der Folge den lange geforderten Generalregulie-
getragene Sichtachse hervorgehoben ist; der Baukörper
rungsplan in die Wege zu leiten.
wäre mit seinen zwei seitlichen Tempelfronten und
9 Theophil Hansen: „Erläuterungen zu dem von dem
dem breiten Pronaos des Mittelteils dahinter in Schräg-
Unterzeichneten verfaßten Erweiterungsplan von Wien“,
ansicht in Erscheinung getreten. In der realisierten
in: Die Presse, 10. 4. 1859. Die Abgabe der Wettbe-
Fassung des Parlamentsentwurfs wird diese Position
werbsprojekte erfolgte bis zum 31. 7. 1858. Vom 18. 10.
vom ebenfalls als Tempelfront ausgebildeten Eckrisalit
bis zum 21. 11. wurden die 85 Einreichungen öffentlich
eingenommen.
ausgestellt. Zwischen dem 27. 10. und dem 4. 12. tagte
14 Wiener Kommunal-Kalender, Jahrgang 1866,
die „Beurtheilungscommission“ elf Mal und teilte
Die Wiener Stadterweiterung, 138 – 157.
schließlich am 10. 12. 1858 dem Innenminister das
15 Auch nach Übersiedlung der Wiener Börse im Jahr
Ergebnis der Beratungen zur öffentlichen Kundmachung
1998 ist die Geschäftswelt in diesem Viertel der Ring-
mit. Unmittelbar danach dürfte Hansen, der nach
straße spürbar präsent. Die wirtschaftlichen Umstruk-
eigenen Angaben „wegen Krankheit“ nicht am Wettbe-
turierungen seit den 1970er Jahren haben hier aller-
werb teilnehmen hatte können, den mit „Dezember
dings gebietsweise zu Leerständen und krisenhaften
1858“ datierten Plan, der auf den von ihm in der Beur-
Erscheinungen geführt, wie sie sonst im Ringstraßen-
teilungskommission vertretenen Standpunkten beruht,
bereich unbekannt sind, aber in der Folge auch zu
entwickelt haben. Er liegt damit noch vor der Entwick-
neuen Freizeitnutzungen.
lung des Grundplans, der dem Kaiser am 16. 5. 1859
16 K.k. Hof- und Staatsdruckerei, Niveaulinie und
vorgelegt wurde.
Inundationslinie von 1830 und 1858, Wiener Stadt-
10 Die Betonung „malerischer“ Wirkungen finden
und Landesarchiv 3.2.1.1.P15.22; in: Harald Stühlinger
sich auch in mehreren anderen Projektbeschreibungen,
(Hg.), a.a.O., 25.
so zum Beispiel bei Ludwig von Förster oder
17 Nierhaus: Der Ring, a.a.O., 93.
Friedrich Stache. In keinem der Wettbewerbsprojekte
18 Daneben gibt es einen Hauptplatz mit Kirche,
ist der „malerische“ Ansatz aber so konsequent auf
Pfarrhaus, Schule und Denkmälern, einen Platz vor dem
den gesamten Raum der Ringstraßenanlage bezogen.
Schottentor mit Theater und Museen, eine gegenüber
11 In seinem hohen Grünraumanteil ist Hansens
der Alservorstadt gelegenen Kaserne und ein Postamt
136
UMBAU 29
Andreas Vass
im Viertel zwischen Stuben- und Biberbastei. Die gesamte
in Wiener Architekturfragen lobt er die „Künstler
Front zum Donaukanal ist zwar noch von der neuen
und Banausen am Kärntnerring“, die den „Wiener Bau-
Stadtmauer abgeschlossen, aber durch die Anlage dreier
charakter“ verstanden und „alles vermieden [hätten],
neuer Brücken mit linksufrig gelegenen Planungen für
diesen zu stören“, indem sie den Häusern einen
den Ausbau zum Kai vorbereitet.
„gerade[n] Gesimsabschluß, ohne Dächer, Kuppel,
19 Durch die Errichtung des Kriegsministeriums
Erker und andere Aufbauten“ gaben. Bei den Neubau-
1909 – 13 wurde die mit dem Bau der Postsparkasse
ten am Stubenring dagegen wäre durch Ausnützung der
1906 / 07 vollendete Achsenbeziehung wieder gekappt.
Dächer für „Ateliers und andere vermietbare Räume“
20 Marlene Streeruwitz: „Das Runde an Österreich“,
das Gefühl eines „Fünfstöckige[n] Mährisch-Ostrau“
in: Die Presse, 28. 1. 2014.
entstanden. Loos’ Forderung: „Gleiches Unrecht für
21 Andreas Zeese: „Reflex und Reflexion. Die Entste-
alle. […] Wer sich verpflichtet, über sein Hauptgesims
hung der Ringstraße zwischen ästhetischer Kritik und
nichts, aber auch gar nichts aufzubauen, dem werden
städtebaulicher Theoriebildung, gibt einen detaillierten
sechs Stockwerke bewilligt.“
Überblick der Debatten rund um die Fragen der Raum-
Zit. nach: Adolf Loos: Über Architektur. Ausgewählte
bildung im Bereich der Ringstraße“, in: Stühlinger
Schriften, hg. v. Adolf Opel, Prachner, Wien 1995,
(Hg.), a.a.O., 327– 344.
28 –30; 68 –71.
22 Eitelberger, 1858, a.a.O., 2.
27 Gabriele Kaiser formulierte, in Vorbereitung des
23 Ebd., 36. Eitelberger denkt hier wohl in erster Linie
heurigen Programmschwerpunkts der ÖGFA „Die Ver-
an das „bürgerliche Wohnhaus“, das er zwei Jahre
sprechen der Zukunft“, diesen Gedanken der „Reser-
später in einer eigenen Publikation, gemeinsam mit
ven“, die ausgebildet oder imaginiert und „von späteren
Heinrich Ferstel verfasst, propagieren wird.
Generationen angezapft werden könnten. Diese Form
24 Bauordnung vom 23. 9. 1859, §38; hier war auch
des Vorwärtsdenkens geht von der Vorstellung aus, dass
die Mindesthöhe der Räume mit 10 Schuh (ca. 3,20 m)
in Orten, Landschaften und Gebäuden Potenziale ruhen
für Gewölbe und 9 Schuh (ca. 2,90 m) für ebene Decken
(oder auf sie projiziert werden können), deren latente
festgelegt (siehe: Kurt Mollik, Hermann Reining,
Qualität erkannt und ausgedeutet wird, wenn geänderte
Rudolf Wurzer, „Planung und Verwirklichung der
Voraussetzungen zum Umdenken zwingen.“ Programm-
Wiener Ringstraßenzone“, in: Renate Wagner Rieger
zeitschrift der ÖGFA, Ausgabe 2 – 2017.
(Hg.): Die Wiener Ringstraße, Bild einer Epoche,
28 Joseph August Lux: „Tote Architektur. Zum Hof-
Band III, 179. Daraus ergab sich die in der frühesten
burgbau“, in: Arbeiter-Zeitung Nr. 74, 16. 3. 1906, 2.
Bauphase teilweise 6- , später in der Regel 5-geschossige
29 „Es war einmal...“, Arbeiterinnenzeitung, Beilage
Bauweise.
„Freie Stunden, Nr. 2, 18. 1. 1910, 3.
25 Rudolf von Eitelberger / Heinrich Ferstel: Das bür-
30 „Der 2. Oktober“, in: Arbeiterinnenzeitung,
gerliche Wohnhaus und das Wiener Zinshaus. Ein
11. 10. 1910, 1.
Vorschlag aus Anlaß der Erweiterung der inneren Stadt
31 Leo Fränkel: „Motiv-Reigen“, in: Photo- und
Wien’s, Wien, 1860 und E[lim] H[enry] d’Avigdor:
Kinosport, März 1932, 58ff.
Das Wohlsein der Menschen in Grossstädten, Mit
32 „May Day of European Freedom, Red Vienna will
besonderer Rücksicht auf Wien, Wien 1874. Beides zit.
rise again“, in: London Information of the Austrian
nach: Zeese, a.a.O., 332 u. 336.
Socialists in Great Britain, N°10, 1. 5. 1945, 1.
26 Auch Adolf Loos’ Kommentare zur Ringstraße sind in diesem Kontext zu sehen: 1898 kritisiert er in Die Potemkin’sche Stadt die Wohnbauten von „Neu-Wien“, deren Palast-Architekturen mit „angenagelt[en]“ Fassaden den unehrlichen „Wunsch der Bevölkerung“ nach „feudaler Pracht und Herrengröße“ zeigen. 1910, Umbau: Der Ring als Landschaft
137
138
UMBAU 29
Andreas Vass
Kurzbiografien der AutorInnen
Jörg Lamster Dipl. Ing. Arch. TH SIA, MAS Wirtschaftsingenieur;
Betül Bretschneider
Gründer, Mitinhaber Durable Planung und Beratung,
Architekturstudium an der TU Wien, Dr. techn.; nach
Zürich; Lehrtätigkeiten Strategische Bauerneuerung,
langjähriger Lehr- und Planungstätigkeit Gründung
Bauphysik, Materialökologie und Nachhaltigkeit;
des Büros für interdisziplinäre Bau- und Stadtforschung
Norm-Kommissionstätigkeiten beim Schweizerischen
UrbanTransForm zu den Themen wie Nutzungs-
Ingenieurs- und Architektenverein SIA
mischung, Quartierserneuerung, Erdgeschosszone und Begrünung. Sie publizierte u.a. Bücher wie Remix
Angelika Psenner
City-Nutzungsmischung und Ökologische Quartierser-
belegt die Elise Richter Habilitationsposition am FB
neuerung-Transformation der Erdgeschosszone.
Städtebau an der TU Wien. DI Dr. Psenner hat
Hermann Czech
Soziologie (IHS, Wien) studiert, lehrt und betreibt
Geboren in Wien. Student bei Konrad Wachsmann und
Architektur- und Stadtplanungsforschung. Ihre Arbeit
Ernst A. Plischke. Ungleichartiges architektonisches
wurde international mehrfach ausgezeichnet.
Architektur (TU Wien / École La Villette, Paris) und
und planerisches Werk; zahlreiche kritische und theoretische Publikationen zur Architektur.
Manfred Russo Kultursoziologe und Stadtforscher. Zuletzt (2012 –
Vittorio Gregotti
2015) Gastprofessur an der Bauhaus-Universität
1974 Gründung von Gregotti associati, das er bis heute
Weimar. Langjährige Lehrtätigkeit an der Universität
leitet. Professuren an der IU aV in Venedig und an den
Wien und anderen Hochschulen: Linz, Klagenfurt,
Architekturfakultäten von Mailand und Palermo; ver-
Universität für angewandte Kunst, TU Wien. Vorstand
antwortlich für den Einführungsteil der XIII. Triennale
ÖGFA. Zahlreiche Veröffentlichungen zum Thema
in Mailand 1964; Direktor der Sektoren Architektur
Stadt. Zuletzt: Projekt Stadt. Eine Geschichte der
und visuelle Künste der Biennale von Venedig von 1974
Urbanität, 2016 bei Birkhäuser.
bis 1976; Direktor von Rassegna 1979 bis 1998 und von Casabella 1982 bis 1996; zahlreiche Essays und
Andreas Vass
Buchpublikationen sowie regelmäßige Beiträge in italie-
Architekt in Wien (Hubmann • Vass, Architekten ZT),
nischen Tageszeitungen.
Forschung und Publikationen u.a. zu Adolf Loos, Le Corbusier und Hannes Meyer. Senior Lecturer an
Ulrich Huhs
der Akademie der bildenden Künste Wien, Lehrtätigkeit
Architekt, univ. Lektor, Studium RWTH Aachen und
an zahlreichen europäischen und außereuropäischen
HdK Berlin, Studien der Geschichte HU Berlin, Büro-
Hochschulen, Vorstandsmitglied der ÖGFA.
gründung 2005, seit 2010 Lehrauftrag TU Wien, seit 2014 Vorstandsmitglied der ÖGFA, Arbeiten in den
Paolo Vitali
Bereichen Wohnungsbau, Bauen im Bestand, Möbel-
Architekt in Mailand, Forschungsdoktorat in Architek-
entwicklung. Holzbaupreis wienwood 2015.
turentwurf und Städtebau; Lehrtätigkeit an der Architekturfakultät der Polytechnischen Universität Mailand; er verbindet Forschungen auf dem Gebiet der Morphologie des zeitgenössischen Stadtraums mit freiberuflicher Tätigkeit als Entwerfer und Publizist (Architekturtheorie, Geschichte des Territoriums, italienische Moderne, Industriearchitektur).
Kurzbiografien der AutorInnen
139
Wir danken den Institutionen und Unternehmen
Bildnachweis Umschlagfoto: Margherita Spiluttini, ©Architekturzentrum Wien, Sammlung; Bar im ehemaligen Pförtnerhaus Swiss Re Zentrum, Rüschlikon (CH), 2001, eine Kooperation der ÖGFA mit der ig-architekturfotografie S. 12: Wohnung Adolf Loos, Paris XVI, 10, Rue des Belles Feuilles, Frankreich, Grundrissentwurf um 1925. Papier, Tinte, © ALA (Adolf Loos Archiv, Albertina) 119 S. 64 / 65: © Huhs S. 72 oben / S. 73: ©Psenner S. 72 unten: © Psenner / Kodydek S. 77: © Kodydek / Psenner S. 80: © Schremmer / Wimberger (modifiziert durch Psenner) S. 93: © Bretschneider S.104/105: Abb.1: Original © König et al., München 2009. Lebenszyklusanalyse in der Gebäudeplanung Abb. 2: © Durable Planung und Beratung Abb. 3: © Durable Planung und Beratung Abb. 4: © Impulsprogramm IP Bau, Bern 1994. Alterungsverhalten von Bauteilen und Unterhaltskosten Abb. 5: © Durable Planung und Beratung S. 120 / 120: © Hubmann / Vass S. 128: © Curylo / Hochreiter Textquellen Hermann Czech, Der Umbau (1989), in: ders., Zur Abwechslung. Ausgewählte Schriften zur Architektur. Wien; verbesserte und erweiterte Ausgabe des gleichnamigen, 1977 im Verlag Löcker & Wögenstein erschienenen Buches, Wien 1996, S.125 – 127 Mit freundlicher Genehmigung des Löcker Verlags, Wien Vittorio Gregotti, Della modificazione (1984), in: ders., Dentro l’architettura, Milano 1991, S. 75 – 81 Mit freundlicher Genehmigung des Verlags Bollati Boringhieri, Milano
140
UMBAU 29
Dank und Bildnachweis
UMBAU 28 2016
UM BAU 9 1985
Das Geschäft mit der Stadt
vergriffen
UmBau 27 2014
UM BAU 8 1984
Plenum. Orte der Macht, Sonderausgabe Biennale
vergriffen
Venedig 2014
UM BAU 6 |7 1983
UmBau 26 2013
vergriffen
Status Quo Vadis – Die Zukunft der Architektur als
UM BAU 5 1981
Prognose und Programm /A Prospectus on the
vergriffen
Future of Architecture
UM BAU 4 1981
UmBau 25 2010
vergriffen
Architektur im Ausverkauf – Auf dem Weg zu einer
UM BAU 3 1980
Ökonomie des Überflusses /Architecture for Sale –
vergriffen
Towards an Economy of Excess
UM BAU 2 1980
UmBau 24 2009
vergriffen
Strategien der Transparenz – Zwischen Emanzipation
UM BAU 1 1979
und Kontrolle / Strategies of Transparency – Between
vergriffen
Emancipation and Control UmBau 23 2007
Sonderpublikationen
Diffus im Fokus – Haare, Schlamm oder Schmutz
Umsicht 2 1997
zum Beispiel / Focus on Blur – Hair and mud and
Ernst Beneder, Zugänge
dirt, for example
UmSicht 1 1997
UmBau 22 2005
Andreas Fellerer, Jiri Vendl
Wettbewerb! Competition!
UnErhörte Entwürfe
UmBau 21 2004 Lernen von CK / Learning from Calvin Klein
Der UMBAU erscheint seit 1979 als interdisziplinäre
UmBau 20 2003
Zeitschrift, die sich nicht auf die zeichnerische und
Architektur und Gesellschaft / Morality and
bildliche Präsentation von Architektur beschränkt,
Architecture
sondern Hintergründe und Zusammenhänge sichtbar
UmBau 19 2002
machen möchte.
Diagramme, Typen, Algorithmen / Diagrams,
Alle nicht vergriffenen Publikationen sind über das
Types, Algorithms
Sekretariat der ÖGFA zu beziehen. Von den vergriffenen
UmBau 18 2001
Heften sind dort zum Selbstkostenpreis plus Spesen
Im Sog des Neuen / The Call of the New
Fotokopien erhältlich. Weitere Informationen und
vergriffen
Inhalte der Hefte auf unten genannter Webseite unter
UM BAU 17 2000
„Publikationen“.
UM BAU 15 | 16 1997 UM BAU 14 1993
ÖGFA Österreichische Gesellschaft für Architektur
UM BAU 13 1991
1090 Wien, Liechtensteinstraße 46a / 5
UM BAU 12 1990
Telefon (+43-1) 319 77 15
vergriffen
Fax (+43-1) 319 77 15-9
UM BAU 11 1987
[email protected]
vergriffen
www.oegfa.at
UM BAU 10 1986 vergriffen
Backlist
141
Ausgezeichnet Die visuelle Neukonzeption, die seit UMBAU 28 zum Einsatz kommt, wurde im Wettbewerb „Die schönsten deutschen Bücher 2016“ ausgezeichnet. Aus der Jurybegründung: „Man öffnet das Buch, legt es mit den Innenseiten auf den Tisch, klappt die Zweidrittelscheinbinde nach unten, und es präsentiert sich ein Kleinplakat. Diese geschickte Falzung ist so animierend, dass man beginnt, mit der Umschlagmechanik rumzuspielen. […] Die Schriftgrößen beschränken sich auf drei Grade. Der Satzspiegel nutzt unter Begrenzung minimaler Stege das Format aus, der Grundtext erscheint in einer bewährten Serifenschrift mit gutem Zeilenabstand, durch Flattersatz und übergroße Einzüge der großen Satzbreite entgegenwirkend. Bei Textsortenwechsel ist die Spalte sehr weit eingezogen; diese gedachte senkrechte Linie wird für die Titel der Beiträge, im lebenden Kolumnentitel und den ganzseitigen Schmuckzitaten genutzt. Die zweispaltigen Endnoten im kleinen Schriftgrad halten Register und erscheinen sehr luftig. Es ist schon erstaunlich, wie abwechslungsreich sich die Seitenabfolge durch diese wenigen Maßnahmen gestalten. […] Der Buchblock lässt sich dank Fadenheftung und offenem Rücken optimal aufschlagen. Eine Zeitschrift für Architektur mit visuellem Anspruch für den sachlichen Diskurs.“ Wir als Gestalterinnen des neuen UMBAU freuen uns sehr für alle Beteiligten, besonders für unsere Auftraggeberin, die ÖGFA, die so für den von ihr lancierten Diskurs eine erweiterte Aufmerksamkeit erhält. Gabriele Lenz und Elena Henrich
142
UMBAU 29
Herausgeberin
Library of Congress Cataloging-in-Publication data
ÖGFA Österreichische Gesellschaft für Architektur
A CIP catalog record for this book has been applied
Inhaltliches Konzept und Redaktion UMBAU
for at the Library of Congress.
Der Vorstand der ÖGFA (Elise Feiersinger, Gabu Heindl, Ulrich Huhs, Gabriele Kaiser,
Bibliografische Information der Deutschen
Michael Klein, Christina Linortner, Iris Meder,
Nationalbibliothek
Gabriele Ruff, Manfred Russo, Andreas Vass)
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese
Redaktionsteam UMBAU 29
Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
Ulrich Huhs, Manfred Russo, Andreas Vass
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
Lektorat
http://dnb.dnb.de abrufbar.
Claudia Mazanek Übersetzung aus dem Italienischen
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch
Andreas Vass
begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbil-
Visuelle Konzeption und Gestaltung
dungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfil-
lenz+ büro für visuelle gestaltung, Wien
mung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und
Gabriele Lenz und Elena Henrich
der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben,
Mitarbeit: Melanie Tonkowik
auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten.
www.gabrielelenz.at
Eine Vervielfältigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen der
Projektkoordination
gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes in
Petra Schmid (Birkhäuser), Basel
der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätz-
Elena Henrich (lenz+), Wien
lich vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechts.
Herstellung Katja Jaeger (Birkhäuser), Berlin
Dieses Buch ist auch als E-Book (ISBN PDF 978-3-0356-0883-0;
Elena Henrich (lenz+), Wien
ISBN EPUB 978-3-0356-0873-1) erschienen.
Bildbearbeitung und Lithografie © 2017 Birkhäuser Verlag GmbH, Basel
Elena Henrich (lenz+), Wien
Postfach 44, 4009 Basel, Schweiz Schriften
Ein Unternehmen der Walter de Gruyter GmbH,
Sabon (Jan Tschichold, 1967)
Berlin / Boston
FF DIN (Albert-Jan Pool, 1995)
© 2017 ÖGFA und die AutorInnen.
Papier
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil der Publikation darf
Munken Lynx, 240g /m2
ohne schriftliche Genehmigung der Herausgeberin und
Munken Print White, 115g /m2
der AutorInnen in irgendeiner Form reproduziert werden.
Druck und Bindung gugler*print, Melk an der Donau
ISBN 978-3-0356-1102-1
www.gugler.at
987654321
Gedruckt auf säurefreiem Papier, hergestellt aus
www.birkhauser.com
chlorfrei gebleichtem Zellstoff. TCF ∞ Printed in Austria
Impressum









![Brücken bauen: Festschrift für Marcelo Sancinetti zum 70. Geburtstag [1 ed.]
9783428580279, 9783428180271](https://ebin.pub/img/200x200/brcken-bauen-festschrift-fr-marcelo-sancinetti-zum-70-geburtstag-1nbsped-9783428580279-9783428180271.jpg)