Promenade der Fremden 9783495826065, 9783495492031
117 50 12MB
German Pages [121]
Eins – Die letzte Weißwurst
Zwei – Sounds of Shanghai
Drei – Es gibt nur ein Willy Hegel
Vier – Mäh Ling
Fünf – Taifun Leckmi
Sechs – Socialist Core Values
Sieben – A simple man»
Acht – Right?
Neun – Der neutrale Standpunkt
Zehn – Fsis is pruuf
Elf – Koi Freiheit
Zwölf – Die Promenade der Fremden
Dreizehn – Schlachtschüssel mit Bittermelone – zugleich ein Nachwort aus der Coronakrise
Recommend Papers

- Author / Uploaded
- Franz-Alois Fischer
File loading please wait...
Citation preview
Philosophi e
rzählt
Franz-Alois Fischer
Promenade der Fremden
B
https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
Philosophi e
rzählt Franz-Alois Fischer Promenade der Fremden
Philosophie_erzählt VERLAG KARL ALBER
A
https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
Franz-Alois Fischer (*1983), Franke, studierte Jura, Philosophie und Italienisch. Schon immer zwischen den Welten unterwegs, ist er nach philosophischer Promotion über Hegel an der LMU München heute Rechtsanwalt und Professor für Öffentliches Recht in München und gibt regelmäßig Seminare zur Politischen Philosophie an der LMU. Als freier Autor schreibt er philosophische, juristische und literarische Texte. 2019 war er für einen Sommer Gastdozent für Philosophie an der Fudan-Universität Shanghai und hat über seine Erfahrungen dort das Buch »Promenade der Fremden« geschrieben.
https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
Franz-Alois Fischer
Promenade der Fremden
Verlag Karl Alber Freiburg / München
https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
®
MIX Papier aus verantwortungsvollen Quellen
www.fsc.org
FSC® C083411
Originalausgabe © VERLAG KARL ALBER in der Verlag Herder GmbH, Freiburg / München 2021 Alle Rechte vorbehalten www.verlag-alber.de Umschlagmotiv: Jan Becke Satz: SatzWeise, Bad Wünnenberg Herstellung: CPI books GmbH, Leck Printed in Germany ISBN (Print) 978-3-495-49203-1 ISBN E-Book (EPUB) 978-3-495-82606-5
https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
Eins Die letzte Weißwurst
Jetzt kommt meine Lieblings-Szene im Film, eine klassische Feelgood-Montage. Rachel lässt sich von ihrer ausgeflippten Freundin neu einkleiden, unterstützt vom lustigen schwulen Cousin. Ziel der Aktion ist es, Rachels Schwiegermutter in spe dazu zu bringen, sie endlich zu respektieren. Rachel Chu nämlich, das muss man wissen, ist Professorin für Spieltheorie. Und: Sie sieht auch noch super aus. Trotzdem ist sie der Schwiegermutter nicht gut genug, um ihren Sohn zu heiraten und Teil ihrer superreichen Familie aus Singapur zu werden. Mit vereinten Kräften wird das gar nicht mal so hässliche Entlein Rachel nun in einen wunderschönen Schwan verwandelt. Um sie herum scharwenzeln aufgeregte Chinesen, der Cousin hat ein ganzes Team von Mode-Profis mit Clipboards und Headsets mitgebracht und der Vater der ausgeflippten Freundin (der lustige Kokstyp aus Hangover) ist ebenfalls dabei, macht Trockenbumsbewegungen und begrapscht eine Frau. Im Hintergrund läuft eine chinesische Version von Material Girl. Rasch erkenne ich die bekannten Anfangstakte, der Song wird lauter, der Gesang setzt ein. Zuerst bin ich kurz irritiert, dann begeistert, nach ein paar Takten singe ich schon mit. Da heißt es in etwa: »Tschütschi dong man no do hop hap …« Im weiteren Verlauf der Szene sieht man Rachel Kleider anprobieren und schließlich vor der Kirche vorfahren, um dort sogleich alle Blicke der asiatischen Presse auf sich zu ziehen. Als sie aus dem Wagen aussteigt, wird das Lied noch einmal lauter: »… to ta pöi da tin gei hanhi (hanhi!)« Und dann kommt’s: »He wan ke ji jang tü twohundred degrees Mio to jeja when you hold me.« 5 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
Und wieder und wieder. Ich höre dreimal hin, aber die singen das wirklich. Meinen die vielleicht die Temperaturen da im Sommer – twohundred degrees? Oder geht’s um Liebe? Als ich zurückklicke, um die zweite Hälfte der Montage noch einmal zu sehen, spüre ich ein Säuseln an meinem rechten Ohr. Ich schrecke auf. Eine zierliche chinesische Stewardess fragt mich, wohl schon zum zweiten, dritten Mal, zurückhaltend zart und doch bestimmt, mit nur leichtem Akzent: »Western or Chinese?« Ich überlege, ob sie mich meint und streiche mir dabei über den rötlichen Bart; das sollte doch offensichtlich sein: Western. Dann aber fällt mein Blick auf den Servierwagen und mir wird klar, dass es ums Essen geht. Ich lasse mir kurz die Auswahl erklären. Es gibt eine warme Laugensemmel mit eingebackener Miniweißwurst, Senf und Krautsalat, der mir verdächtig nach Kimchi aussieht, oder einen chinesischen Eintopf mit Kartoffeln. Beides wird mit Stäbchen und einer Gabel serviert. Da ich die letzte Weißwurst schon hinter mir habe, nehme ich den Eintopf und dazu einen Weißwein. Alles a bissl weich, aber nicht schlecht, oder? Beim Essen frage ich mich, ob ich nicht selbst die letzte Weißwurst bin, hier zwischen all den Chinesen. Die husten und schlürfen in einem fort und ich hock ganz weich dazwischen herum. Kurz muss ich albern kichern. Nach dem Essen hole ich den Bildschirm wieder aus seiner Versenkung und klicke erneut auf Crazy Rich Asians. Ich muss unbedingt sehen, wie sich Rachel auf der Hochzeit schlägt und ich drücke ihr wirklich die Daumen. Es sind noch vier Stunden bis zur Landung in Shanghai und laut Info-Monitor sind wir irgendwo über Russland im weiteren Sinne. Mir wird bewusst, dass wir um die halbe Welt fliegen und dabei immer über Land bleiben. Ist das eigentlich eher beruhigend oder beängstigend? Ich strecke meine Beine weit aus, die Fudan-Universität hat uns die guten Plätze am Übergang zur Business-Class gebucht. Noch nicht die kleinste Turbulenz. Vielleicht ist es der Weißwein, das Essen, der Film oder doch eine Spätfolge der letzten Weißwurst vom Flughafen Franz Josef Strauß: Zum ersten Mal seit Monaten fühle ich Ruhe. Freilich, der Reisestress hat mich ein bisschen kirre gemacht, ich bin ein bisschen aufgekratzt, aber doch 6 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
ruhig: Die Heimat scheint ebenso weit weg zu sein wie das Ziel in der Ferne: Shanghai. Dabei hatte ich ja überhaupt keine Ahnung, was auf mich zukommen sollte! Noch vor ein paar Monaten wusste ich beinahe gar nichts über Shanghai und musste mir übers Internet erst einmal das Gröbste zusammensuchen: 25 Millionen Einwohner, größter Containerhafen, dritthöchstes Gebäude der Welt. Fünf Universitäten, von denen zwei in der chinesischen Version der Ivy League sind. Der Bürgermeister heißt Ying Yong. Erstmals sah ich, wo genau Shanghai eigentlich liegt. Auf der Online-Karte musste ich ganz China nach links wischen, bis ich es endlich fand. Sofort wurde ich nervös: Shanghai liegt also, im wahrsten Sinne des Wortes, am anderen Ende der Welt. Ich war schon lange nicht mehr geflogen und erst einmal in meinem Leben eine vergleichbar weite Strecke. Als nächstes las ich übers Wetter und erfuhr, dass die schlechteste Reisezeit für Shanghai der August sei: Bis zu 40 Grad, bis zu 100 Prozent Luftfeuchtigkeit; immerzu Gewitter, zuweilen ein Taifun als Bonus. Natürlich war der August eben der Monat, in dem unsere Summer School stattfinden sollte. Schon die Gedanken ans Wetter trieben mir die ersten Schweißperlen auf die Stirn. Kurz zuvor hatte mir mein Doktorvater auf einem unserer gemeinsamen Weinabende mitgeteilt, dass es »jetzt klappt mit Shanghai«. Es war schon seit zwei, drei Jahren im Raum gestanden, dass uns ein Ruf aus China nach China ereilen könnte. Ich hatte das allerdings nie als besonders konkrete Gefahr wahrgenommen, da solche allgemeinen Ankündigungen im universitären Kontext üblicherweise im Sand verlaufen. Immerhin war mein Doktorvater schon ein paarmal »drüben« gewesen, in Peking und in Shanghai. Wann immer wir darauf zu sprechen gekommen waren, hatte er sich stets sehr positiv über China geäußert – was mich ehrlicherweise überrascht hatte. Zum einen weil wir in Deutschland ja eher ein negatives Bild von China haben: Menschenrechte, Überwachung, Technologieklau und all die weiteren Schlagwörter aus den Zeitungsartikeln. Zum andern weil mein Doktorvater meist weit über den Dingen zu schweben 7 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
schien – mehr den großen Geistern nachfliegend als dem Zeitgeist nachlaufend –, und dementsprechend selten positiv, noch seltener mit Emotionen über die Dinge der Welt sprach. Bei Shanghai indes war er an jenem Abend richtiggehend ins Schwärmen geraten. Er hatte vom »besseren New York« gesprochen und dem unbedingten Gefühl, auf dem Gipfelpunkt der Gegenwart zu sein – einer sehr dynamischen Gegenwart freilich, die sich in rasender Geschwindigkeit auf dem Boden einer jahrtausendalten Tradition entfalte. Auch das Essen hatte er in für ihn ungewöhnlich vielen Worten gelobt: Die chinesische Küche vereine eine unermessliche Fülle an fremden Produkten, Texturen und Kochstilen in sich, die sie dann wiederum in einer riesigen Bandbreite von Regionalküchen ausdifferenziere. Im Grunde hatte ich ihn nur einmal ähnlich euphorisch erlebt: Bei unserem allerersten Weinabend, als wir eine Trockenbeerenauslese aus Escherndorf getrunken hatten, die ich ihm als »etwas Besonderes aus der fränkischen Heimat« angekündigt hatte. Damals war es die Überraschung darüber gewesen, dass ein Wein von Weltformat ebenso gut aus einem kleinen fränkischen Bauerndorf wie aus dem Burgund oder dem Bordeaux stammen konnte. Im Fall von China war ich mir über die Gründe seiner Begeisterung nicht ganz im Klaren. Die Begeisterung war zweifellos groß und echt und ihr mussten ganz besondere Erfahrungen zugrunde liegen. Aber ich konnte jenseits der konkreten Einzelheiten, die er mir erzählt hatte und die sicherlich faszinierend waren, dieses Mehr noch nicht genau identifizieren, welches das Interesse für die Teile zur Begeisterung fürs Ganze erheben könnte. Am meisten hatte mich an seinen Erzählungen überrascht, wie sehr er betont hatte, dass die Chinesen durchaus an der Sache interessiert seien – wobei er vor allem den Gegensatz zu den USA vor Augen gehabt hatte, wohin ja doch immer noch die meisten Akademiker zum weiteren Karriereschliff gingen. Zwar seien die Chinesen im Zweifel noch kapitalistischer als die Amerikaner und man wisse als aufmerksamer, aus dem Ausland eingekaufter Philosoph jederzeit genau, dass man eben das sei: eingekauft. Aber im Unterschied zu den Amerikanern seien ihnen 8 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
die Äußerlichkeiten von Journal-Rankings, Connections und aufgeplusterten Lebensläufen nicht allzu wichtig. Nein, da sei ihnen die Sache wichtiger, denn schließlich wolle man ja wissen, was genau man eingekauft hat. Das war sicherlich ein ambivalentes Kompliment gewesen. Aber ist es letztlich denn so wichtig, woher das Interesse an der Sache kommt? Hauptsache, ein Interesse ist vorhanden. Den übrigen Abend hatten wir, wie stets an den Weinabenden, vor allem über Kulinarisches gesprochen. Ich hatte erfahren, dass die Chinesen gern auf knorpligem Zeug herumkauen – für uns ungewohnt, aber doch lohnend, weil es den Raum der Texturen erweitert. Außerdem hatte mir mein Doktorvater erzählt, dass es in China im Prinzip keine gehobene Küche gebe, die man mit der europäischen Sterneküche vergleichen könne. Zwar erschlössen sich mittlerweile auch europäische Gastronomen den chinesischen Markt und eröffneten Sternetempel – die zielten aber letztlich nur auf Touristen und Businessfritzen. Demgegenüber sei die Qualität einfacher Restaurants um ein Vielfaches höher als in Europa, insbesondere in Deutschland. Und die regionalen Unterschiede seien beachtlich: In Shanghai etwa gebe es vor allem Fisch und Meeresfrüchte, alles in allem eine eher leichte, nahezu mediterrane Küche. Er hatte mich außerdem ermutigt, auch das verrückte Zeug mal zu probieren. Am Ende des Abends hatte er mich dann noch einmal gefragt, ob ich wirklich nach Shanghai zur Summer School möchte. Da ich die Jahre zuvor auf die allgemeinen Ankündigungen hin stets Interesse bekundet hatte, den Abend über nun seine begeisternden Erzählungen gehört hatte und überdies in jener weinseligen Stimmung gewesen war, die sich aus einem schönen Weinabend zwangsläufig ergibt, hatte ich, ohne zu zögern, ja gesagt. Erst nachdem mein Doktorvater gegangen war, dämmerte mir, worauf ich mich eigentlich eingelassen hatte: der Flug, das Wetter, vor allem aber Vorlesungen auf Englisch an einer äußerst renommierten Universität für chinesische Studenten. »EliteStudenten aus ganz China«, um genau zu sein, denn so wurde 9 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
es mir mitgeteilt in einer Mail von Shuangli, der Organisatorin der Summer School in Shanghai. Wie ich bald erfuhr, hatten die Verantwortlichen in Fudan monatelang nicht auf Mails aus Deutschland geantwortet, sodass die ganze Zeit über unsicher war, ob die angedachte Summer School überhaupt würde stattfinden können. Die erste Mail aus Fudan beinhaltete dann jedoch gleich ein fertiges Programm und die höfliche, aber bestimmte Bitte, sich doch jetzt ganz schnell, ohne weitere Verzögerungen, um alles zu kümmern. Die chinesischen Gastgeber wollten gern alles bezahlen, im Gegenzug erwarteten sie allerdings auch Sofortzusagen, Vorlesungsthemen, Literaturlisten, Skripte – alles am besten schon am gleichen Tag. Die weitere Planung ergab, dass wir insgesamt drei Dozenten fürs Team Alt-Europa zur Summer School senden würden. Daniel, ein Münchner Kollege, den ich bereits flüchtig kannte, sollte über Kant lehren; Roland, ein österreichischer Kollege, über Fichte und ich selbst über Hegel. In der Themenwahl waren wir frei: Daniel entschied sich für die Freiheit, Roland für das Selbstbewusstsein und ich mich für den Staat. »Das ist ein tolles Programm für China!«, dachte ich und wurde gleich unsicher, ob man »das machen kann«. Doch mein Doktorvater winkte es durch. Es könne schon sein, dass da ein paar von der Partei zuschauten, aber die Chinesen wollten deutsche Philosophen, die klassische deutsche Philosophie unterrichten – und sie wüssten auch, was sie dann bekommen. Was sie anschließend daraus machten, sei ja nicht unser Problem. In den Folgewochen hatte ich gesundheitliche Probleme, musste sogar eine Woche ins Krankenhaus, und als es gerade wieder bergauf zu gehen schien, bekam ich eine äußerst schmerzhafte Fußentzündung, wegen der ich einige Zeit gar nicht mehr laufen konnte. Je näher Shanghai rückte, desto schlechter wurde mein Zustand. Eine Woche vor dem Abflugtermin musste ich ernsthaft überlegen, meine Teilnahme an der Summer School abzusagen. Ich ging die möglichen Konsequenzen durch, um zu dem Ergebnis zu gelangen, dass eine Absage schon möglich wäre. Ich habe ohnehin nie eine Karriere machen wollen und habe dementsprechend auch nichts zu verlieren. 10 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
Aber irgendetwas sträubte sich in mir gegen die Absage. Einige Tage vor dem Abflug beklebte dann mein Physiotherapeut mein gesamtes linkes Bein mit langen blauen Kinesio-Tapes und ich erinnerte mich daran, dass ich noch während der Zeit meines Studiums davon ausging, »Kinesiologie« bedeute so viel wie chinesische Heilkunde. Die Bedenken, die ich gegenüber der Reise nach China vorbrachte, wischte der Physiotherapeut rasch beiseite: »Notfalls kommst am Tag vorm Abflug nochmal her, dann mach ich dir ne Schiene dran.« Nach einer kurzen Pause stellte er klar: »Du fährst nach Shanghai!« Und so bin ich zusammen mit Daniel, anderthalb Stunden vor unserem Flug, im Airbräu im Münchner Flughafen gesessen beim letzten Weißwurstfrühstück für die nächsten drei Wochen. Der Kollege hat so nervös gewirkt, wie ich mich gefühlt habe, was gut war, weil ich dann im Vergleich zu ihm den Ruhigen spielen konnte. Ich habe so getan, als sei ich Vielflieger, irgendwie ein Mann von Welt, obwohl ich natürlich – über mein Wikipedia-Wissen hinaus – auch keine Ahnung hatte, was uns erwartet. Ich kann wieder laufen, habe aber zur Sicherheit meine Krücken mitgebracht. Ein sehr zu empfehlender Trick, denn wir durften an allen Schlangen vorbei direkt nach vorn gehen. So kurz vor dem Abflug haben wir das Gefühl gehabt, als müssten wir Weißbier und Weißwurst jetzt noch einmal so richtig genießen, weil wir sie für Münchner Verhältnisse äußerst lange entbehren müssten. Aber irgendwie wollte mir das schon nicht mehr recht gelingen: Die Wurst weich, der Senf weich, die Brezn weich, das Bier weich – ich kann nicht sagen, es hätte geschmeckt. Was sich trotzdem eingestellt hat, wie stets beim Weißwurstfrühstück, ist die namensgebende Wurstigkeit. Nachdem man bei den ersten Schlucken noch aufstoßen muss, legt sich das Bier wie ein sanfter, leicht prickelnder Schleier über das Gemüt. Die Last des Gedankens nimmt ab. Das ist, was die Bayern Gemütlichkeit nennen: Ein Zustand des Wohlvertrauten, aber auch der Langeweile. Dieser Zustand sollte sich in den kommenden Wochen tatsächlich grundlegend ändern. 11 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
Zwei Sounds of Shanghai
Das erste Geräusch: ein knorpeliges Krachen. Beim ersten gemeinsamen Lunch mit unseren chinesischen Gastgebern erinnerte ich mich an den Rat meines Doktorvaters und griff deshalb gleich beim ersten Gericht, das auf den Drehtisch gebracht wurde, herzhaft zu: ein Volltreffer! Einmal, zweimal, dreimal musste ich hineinbeißen und herumkauen, erst wurde es noch mehr, dann doch weniger, endlich war es heruntergeschluckt. »Jellyfish«, erklärte mir ein Chinese, »speciality from Shanghai.« Ich hatte soeben eine sauer eingelegte, kalt servierte Qualle gegessen. Immer neue Speisen kamen auf den Tisch und Sisi, die Assistentin der Fakultät, drehte jedes Mal behutsam den Tisch in unsere Richtung, damit wir Westler stets das Neueste probieren konnten. Das Tischgespräch bestand derweil im Wesentlichen aus Floskeln. Einer der chinesischen Uni-Mitarbeiter erzählte, dass er sich auf Kant spezialisierte, weil ihm irgendein Professor einmal gesagt hatte, dass Kant der Beste sei. Ich erklärte ihm darauf, dass ich Hegel mache, weil er der einzige von den bekannteren Namen war, den die Philosophen an meinem Studienort in Würzburg nie erwähnt hatten. Das hatte mich neugierig gemacht, da musste was zu holen sein. Wir sprachen noch kurz über Selbstbewusstsein bei Fichte, über Freiheit bei Kant, durchgehend untermalt vom lautstarken Schlürfen der Fischsuppe. Hin und wieder fiel mein Blick auf den Assistenten des Dekans, einen lustig-fülligen Kerl, der mir von Anfang an sympathisch war, weil er genauso stark schwitzte wie ich. Außerdem aß er die Schweinerippen samt den Knochen, eine Rippe nach der anderen, immer wieder war das Krachen der Knochen und
13 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
Knorpel zu hören, während wir Übrigen den Ablauf der ersten Arbeitswoche besprachen. Nach dem Essen laufen wir draußen gegen eine nasse Wand: ein Gefühl, als ob man ein sehr kleines, fensterloses Zimmer betritt, das bis unter die Decke mit warmnasser, frisch gewaschener Wäsche gefüllt ist. Ein Fahrrad kreuzt, Hupen von links, Moped von rechts, da noch ein Moped und wieder ein Fahrrad – aus allen, in alle Richtungen. Irgendwie schaffen wir es in ein Taxi. Jetzt sitze ich zwischen einem der chinesischen Assistenten und meinem Kollegen Daniel auf der Rückbank ohne Anschnallgurt, unser Fahrer schlängelt sich quer durch die Fahrspuren und alle drei Sekunden wechselt die Musik, scheinbar zufällig: erst eine laut schreiende Moderation, dann eine Art Schlager, ein Kinderchor, ein chinesischer Rap. »Es ist so viel Schweiß in diesem Auto, dass der Unterschied zwischen eigenem und fremdem ein fließender ist«, denke ich. Ich schrecke auf, als der Fahrer laut und bronchial aus dem halb geöffneten Fenster spuckt und mir im selben Augenblick mein chinesischer Nebenmann in den Schoß niest. Ich denke an mein erstes chinesisches Frühstück von heute morgen zurück. Da habe ich jedes Mal, wenn ich an die Saftbar gegangen bin, im Frühstücksraum meinen Sitzplatz verloren. Zweimal saß bei meiner Rückkehr ein Chinese auf ihm, beim dritten und letzten Mal war der chinesische Platzräuber schon wieder verschwunden. Er hatte mir aber – das wirkte wie eine Drohung – eine halbe Bananenschale am Platz zurückgelassen, obwohl ich doch nur einen Saft direkt an der Bar getrunken und einen zum Mitnehmen eingeschenkt hatte. Der Raum war die ganze Zeit über von einem Räuspern und Husten erfüllt, das sich irgendwie glutamatig anhörte. Wundersamerweise überleben wir die Taxifahrt und kommen zurück ins Hotel, wo Daniel und ich an der Bar noch ein Bier bestellen wollen. Die Getränkekarte ist bebildert und wird uns auf einem iPad gereicht; wir sollen dann mit dem Finger zeigen, welches Bier wir wollen und bekommen doch immer ein anderes. Die Hitze des Tages ist hier in der klimatisierten Hotelbar bloß noch Erinnerung – allein die Erinnerung reicht allerdings, um mir wieder eine glänzende Röte ins Gesicht zu 14 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
treiben. Denken kann ich schon seit dem Frühstück nicht mehr, aber ich bin ja zum Glück nur hier, um den Hegel vorzustellen. »Yes, yes«, sagt uns das Barpersonal, wenn wir unsere Bestellung zu präzisieren versuchen. Das scheint hier eine allgemeine Methode gegenüber uns zu sein, von den Uni-Mitarbeitern haben wir es auch schon ein paar Mal gehört. Irgendwie mögen die uns und irgendwie verachten die uns auch. Wie soll man es ihnen verdenken? Hier will jeder einen Teil beitragen zu irgendwas, das ist anstrengend, aber auch bewundernswert. Vielleicht betrachten sich die Chinesen wirklich noch als Staatsbürger – ein Begriff, der bei uns gänzlich aus der Mode gekommen ist. Dann wäre ich mit Hegel womöglich genau richtig hier. Hegel wer? Ich verbinde mit dem Namen kaum noch etwas … Lieber denke ich an meinen persönlichen Assistenten, den mir die Fudan-Universität zugeteilt hat und der wie ein taiwanesischer Martial-Arts-Kämpfer aussieht. Er sprach heute Mittag immer von einem Hä-gäl. Der erscheint mir jetzt, als das dritte nicht bestellte Bier kommt, viel bedenkenswerter als der andere, der Hegel. Es ist noch sehr früh, aber ich verabschiede mich und lasse den Kollegen an der Bar zurück. Im kühlen, geräumigen Zimmer, das ein bisschen nach Katzenstreu und Fluss riecht, ist endlich Ruhe. Ich lasse mich in das weiche Bett fallen, sinke tief ein und werde halb umschlossen vom weißen, dumpfen, weichgespülten Stoff, der ein feines Chlor-Aroma im Raum verteilt. Als ich gerade dabei bin, wegzunicken, klingelt es laut und unnachgiebig. Eine Chinesin steht mit entschuldigender Gestik in der Tür, um dennoch sogleich weiter hineinzutreten. Sie geht zur Minibar und macht dort eine ausladende Geste, auf die ich wohl irgendwie reagieren soll. Ich zucke mit den Schultern, sie macht ein Geräusch und füllt dann den Instantkaffee auf. Das Gleiche exerzieren wir noch mit den Plüschhausschuhen durch und auch mit dieser dünnen Decke vor dem Bett, auf der in roter Schrift »Good Night« steht und mit der ich nichts anzufangen weiß. Zum Schluss lässt die Zimmerdame einen Zettel da, auf dem steht, dass sie da war und noch einmal: »Good Night«. Auf
15 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
dem Weg zur Tür niest sie, zieht geräuschvoll hoch und hustet schleimig. Sie macht dabei einen sehr fröhlichen Eindruck. Ich kann jetzt nicht mehr schlafen und denke eine Zeit lang an den Hä-gäl, aber die Gedanken laufen, kaum angedacht, an mir herunter wie der Schweiß beim Durchqueren der mittäglichen Waschküche von Shanghai. Hier treffen Welten aufeinander. Zahllose Chinesen voller Selbstbewusstsein und ein einzelner, fast bewusstloser europäischer Geist. Die Abgehärteten gegen den Aufgeweichten. Ich schmunzle über diesen letzten Gedanken kurz, will ihn dann aber doch als zu pathetisch verwerfen – da klingelt es noch einmal. Ein feister chinesischer Mann betritt mein Zimmer und bringt mir eine Obstschale, darin ein mit einer Blüte verzierter Apfel und: eine halbe Banane.
16 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
Chinesischer Turndown Service: Halbe Banane mit Apfel
17 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
Drei Es gibt nur ein Willy Hegel
Die ersten Tage liegen hinter mir und waren aufregend und neu. Zusammen mit Daniel war ich früh morgens gelandet, gegen die nassheiße Wand und hinein gelaufen in die überwältigende Weite der Stadt, die in keine Richtung ein Ende findet. Jetzt, da uns die Stadt aufgenommen hat, ist alles um uns herum Shanghai – rechts, links, oben, unten. Wo immer wir hinblicken, ragen die Hochhäuser in den Himmel, wo immer wir entlanglaufen, nässen sie auf uns herunter. Und trotzdem fühle ich mich frei. Befreit. Das Lasche meiner Münchner Existenz ist verschwunden und etwas Neues ist an seinen Platz getreten, das ich noch nicht genau benennen kann. Ich würde diesem Neuen gern denkend nachspüren, doch kann ich kaum einen Gedanken festhalten: Alles ist neu und nass und heiß, und meine Gedanken rasen, unkontrollierbar, in alle Richtungen davon. Ich komme ihnen kaum noch nach, dabei sind da schöne dabei, flüchtig zwar, doch aufregend, sie tragen eine Hoffnung in sich, die ich lange nicht empfunden habe. Ein erstes Selfie, das ich lieber für mich behalten werde, zeigt, wie mein Gesicht rot in angestrengte Denker-Falten geworfen ist – vergeblich, denn unter diesen Bedingungen bekomme ich einfach keinen klaren Gedanken zu fassen. Vielleicht, so schwirrt es mir durch den Kopf, habe ich ja das Nachdenken verlernt. Das wäre schön, oder? Abgesehen vom drückenden Gefühl, in eine Waschküche geraten zu sein, sind unsere ersten Eindrücke seit der Landung ausnehmend positiv. Wir sind begeistert vom Hotel, das auf jedem Zimmer einen Glastisch mit breitem Ledersessel davor hat, sodass man sich beim Vorbereiten aufs Seminar wie ein Vorstandsvorsitzender fühlen kann. Unsere Gastgeber sind von einer aufopferungsvollen Freundlichkeit beseelt, die uns fast be19 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
schämt. Obwohl sie uns hier alles bezahlen, bedachten sie uns schon zur Ankunft mit Geschenken. Für die armseligen Minikrüge mit München-Wappen, die ich schnell noch als Mitbringsel am Flughafen gekauft hatte, schämte ich mich beim Überreichen. Ich habe jetzt noch das Gefühl, dass es besser gewesen wäre, gar nichts mitzubringen. Eine Widrigkeit, für die Shanghai im Speziellen nichts kann, kam an den ersten Tagen noch hinzu, nämlich der Jetlag. Wir waren über Nacht geflogen. Den Fehler, während des Tages unserer Ankunft zu schlafen, konnte ich bei all dem Trubel vermeiden, aber natürlich bin ich am ersten Abend früh ins Bett gefallen. Um ein Uhr nachts war ich dann schon wieder wach; oder sagen wir: bei Bewusstsein. Irgendwie müde und doch aufgekratzt, zu erschöpft, um ernsthaft arbeiten zu können, zu kirre, um mich auszuruhen. Im Verlauf der Nacht drohte dann das diffuse Durcheinander der rasenden Gedanken, die ich seit der Ankunft hier habe, mich gänzlich zu verschlingen. Den Gedanken nachzugehen, war nicht mehr unterhaltsam, sondern furchteinflößend. Kein Gedanke hatte Bestand und so rasch, wie sie einander ablösten, mussten sie letzten Endes ins Nichts führen. Mir wurde mit einem Mal bewusst, wie weit entfernt von daheim ich wirklich war, sodann auch, wie hoch über dem Boden ich mich befand. Bevor ich mich in eine Panik hineinsteigern konnte, raffte ich mich lieber auf und ging zum Fenster. Vielleicht war es ja gar nicht gar so hoch? Ich schaute hinaus auf die dunkle Promenade und meine Beine wurden zu Gummi. Zum Glück sind die Hürden, die der chinesische Staat vor den westlichen Teil des Internets gesetzt hat, nicht allzu schwer zu umgehen. Mit einem VPN-Client konnte ich mich übers hoteleigene WLAN so mit dem Netz verbinden, als säße ich mit meinem Laptop in Europa. Dann konnte ich Netflix schauen und ein bissl den bewährten Zerstreuungsritualen frönen. Irgendwann in der Früh – es war schon lange hell – bin ich doch noch einmal eingeschlafen, nur um kurz darauf wieder von meinem Handy geweckt zu werden, mit starken Kopfschmerzen. Die zweite Nacht war düster. Man konnte nur ein paar Häuserblocks weit sehen, denn überall war Nebel oder Smog, wobei 20 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
mir der Unterschied während meines Aufenthaltes nie ganz klar wurde. Das linderte zwar das Gefühl von Verlorenheit in der Weite, rief jedoch das Gefühl des Eingeschlossenseins hervor; ein Gefängnis im Hochnebel. Da war es schön, dass ich mit ein paar Leuten in der Heimat schreiben konnte, die aber auch irgendwann ins Bett mussten, sodass ich wieder bei Netflix landete. In der Früh war es auch damit zu Ende, weil der VPN seinen Geist aufgab. Er ließ sich noch zweimal für ein paar Minuten verbinden, dann war er dauerhaft gesperrt. Vielleicht war der chinesische Staat doch etwas wehrhafter als zunächst vermutet. In jedem Fall waren damit Youtube, Netflix und all die anderen Zerstreuungsplattformen für mich unerreichbar. Die Gedanken waren mir die Nacht über geblieben, drängend und rasend wie die Nacht zuvor, aber noch unbestimmter und diffuser. Es war, als jagte ich Geistern hinterher, die mit jeder Minute der Schlaflosigkeit weiter an Kontur einbüßten. Sie verdichteten sich zu einem Nebel, der mir den Blick auf die Wirklichkeit zu nehmen drohte. Zum Schluss war eine chinesische Version von CNN meine letzte Ablenkungsmöglichkeit; es war der einzige englischsprachige Sender, der im Hotelfernseher zu finden war. Die Moderatoren sahen sehr asiatisch aus und sprachen sehr amerikanisch. Sie berichteten von Unwettern in Japan und Indien, standen vor großen animierten Wetterkarten, und analysierten die Lage smart und elanvoll. Seit meiner Ankunft sah ich außer meinen Kollegen keinen einzigen Westler und begegnete überall nur Chinesen. Vielleicht war es aber doch übertrieben und irgendwie auch typisch westlich, sich über diesen Befund in China ernsthaft zu wundern. Im Fernsehen hatten sie die Unwetter abgehandelt und zeigten nun Bilder von Menschenmassen und Polizisten, irgendwie ging es wohl um Hongkong. Plötzlich wurde das Bild schwarz. Damit war mir also auch die letzte Zerstreuung genommen und merkwürdigerweise fühlte sich das genauso an, als wäre die letzte Verbindung zur Außenwelt gekappt worden. Ich war auf mich selbst zurückgeworfen. Später erfuhr ich, dass das die Zensur der Hongkong-Reportagen gewesen war. Doch in jenem Moment bezog ich es auf mich. Für eine ganz formlose Zeitspanne – ich kann nicht sagen, waren es Sekunden, 21 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
Minuten oder die restlichen Stunden der schlaflosen Nacht –, für eine unbestimmte Dauer war der Unterschied zwischen meinem Gedankennebel und mir selbst aufgehoben. Derjenige, der diesen Gedanken, erst spaßig-sportlich, dann immer verzweifelter, hinterherjagte, wurde eins mit ihnen. Ich war die. Es lag auf der Hand, dass irgendetwas Grundsätzliches nicht stimmen könne. So war ich mir in jenem zeitlosen Augenblick ganz sicher, mein Leben ändern zu müssen. Am nächsten Tag weiß ich noch von meinem Entschluss, aber die unmittelbare Verzweiflung, die zu ihm führte, ist verflogen. Heute besuche ich Daniels erste Kant-Vorlesung. Es geht um Freiheit und um die Frage, ob es denn wirklich zwei Welten braucht, um die Freiheit zu sichern: eine Welt der Erscheinungen, in der wir bloße Spielbälle der Naturgesetze sind wie die Tiere, und eine ominöse andere Welt, in der Freiheit möglich ist. So, wie ich das verstehe, brauchen wir die zweite Welt überhaupt nur, weil sie die Freiheit ermöglicht. Die chinesischen Studenten wirken in der Mehrzahl brav und sind insgesamt ein wenig undurchsichtig; man ist sich nie ganz sicher, ob etwas gut bei ihnen ankommt oder nicht. Fast vollständig fehlen diese alternativen Typen, die in unseren Seminaren in Deutschland so häufig sind. Solche, die durch besonders auffällige Frisuren, extravagante Kleidung oder Kosmetik, gerne aber auch einfach durch allgemeine Ungepflegtheit ihr Anderssein und ihren Tiefsinn nach außen zu tragen versuchen – und die dann inhaltlich manchmal doch eher lasch und enttäuschend sind. Die Studenten im Vorlesungssaal der Fudan-Universität könnten auch – nach unseren Maßstäben – fast alle BWL oder Jura studieren, was mich an eine Freundin in Deutschland erinnert, die sich sehr darüber wunderte, dass es überhaupt chinesische Philosophiestudenten geben soll, weil Philosophie doch nichts bringe. Beim Anblick der hiesigen Studentenschaft denke ich mir, dass man in der Philosophie natürlich genauso Karriere machen kann wie in der Raketentechnik. Professor ist schließlich Professor. Ein weiterer Unterschied in den allgemeinen Äußerlichkeiten besteht darin, dass hier kaum dicke Leute zu sehen sind, obwohl doch 22 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
alle die ganze Zeit am essen sind. Nur wenn man ganz genau hinschaut, findet man ein paar Personen im Auditorium, die für die chinesischen Maßstäbe einen Hauch von Alternativität versprühen. Einer von ihnen zeichnet sich durch eine große Kastenbrille aus, die ihm etwas Nerdiges verleiht. Er meldet sich jetzt schon zum dritten Mal. Er spricht schlechtes Englisch, aber immerhin spricht er, und er verbreitet mit seinen Fragen eine große Unruhe im übrigen Publikum, das sonst still und etwas gehemmt wirkt. Wenn ich ihn recht verstehe, will er darauf hinaus, dass die Beschreibung der ersten Welt – also der Welt der Naturgesetze, in der wir uns als Tiere begreifen müssen – doch bereits fehlerhaft sei. »You cannot say: one, two, three, four, six!«, sagt er mehrfach, »There is always something between, that cannot be determinated.« Dann rekurriert er irgendwie auf Quantenphysik. Daniel gibt sich die größte Mühe, sein Anliegen zu verstehen, aber ein echter Dialog kommt nicht zustande. Trotzdem ist etwas im Hörsaal zu spüren: ein Funke? Der Anfang eines Gedankens? Ich weiß nicht. Es ist heiß, alle sind müde und erschöpft von den Anstrengungen eines ganzen Tags mit Kant … Was auch immer da war, es ist rasch erloschen. Nach der Vorlesung werden wir, die Gäste aus Europa, von unseren Assistenten in ein Restaurant in Uninähe eingeladen. Die Speisen sind wieder so vielfältig, die Portionen so reichlich, dass man es ein opulentes Mahl nennen muss. Am späteren Abend sitze ich dann bei einem Bier zusammen mit den Kollegen an der Hotelbar. Die anderen Hotelgäste sind sämtlich Chinesen und so ist die Bar jeden Abend verwaist, denn die Chinesen trinken nichts und gehen auch nicht weg. Ein Student, etwa Mitte zwanzig, erzählte uns in der Mittagspause, dass er noch nie in einer Bar war. Dafür hatte er während seines letzten DeutschlandAufenthalts das Gesamtwerk von Thomas Mann gelesen. Daraufhin machte ich reflexhaft einen Witz über torture (dass das Gesamtwerk von Thomas Mann in Deutschland als Folterwerkzeug für Studenten gelte), strich aber nur ein paar Höflichkeitslacher ein. Hoffentlich hatten sie das nicht auf Hongkong be23 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
zogen! Bei uns in Deutschland wäre es jedenfalls leichter, ein paar Studenten zu finden, die noch nie im Hörsaal waren, als einen einzigen, der noch nie in einer Bar war. Beides irgendwie verrückt. Der Kellner, großgewachsen und etwas dümmlich dreinblickend – und damit eine außergewöhnliche Erscheinung –, hat uns jetzt schon zum wiederholten Mal das falsche Bier gebracht. Diesmal gibt es Tsingtao statt Heineken. Taugt aber und ist auch grad egal. Wir haben jetzt die erste Vorlesungseinheit hinter uns und sind nun ein wenig schlauer, wie das hier läuft. Einige Einheiten Kant, Fichte und Hegel stehen zwar noch aus, aber wir haben alle das Bedürfnis nach einem ersten Zwischenfazit und tragen daher unsere Anekdoten der ersten Tage zusammen. Über manches lachen wir, über manches wundern wir uns. Uns verbindet die schöne Klammer des gemeinsamen Erlebens auf Zeit. Fast komme ich mir vor wie in einer dieser Filmszenen, wenn sich alte Freunde ein letztes Mal wiedersehen und über die alten Zeiten sprechen. Dabei sind wir doch mittendrin, und eigentlich kennen wir uns auch nicht wirklich, das ist schon komisch. Beim dritten Bier – Asahi statt Tsingtao, das wir eigentlich nachbestellen wollten, weil es wirklich geschmeckt hat – stecken wir beim Zuprosten konspirativ die Köpfe zusammen. Das geht von Daniel aus und es ist klar, dass jetzt eine wichtige Frage von ihm kommen muss. »Ganz ehrlich«, beginnt er, um nach langer denkerischer Pause zu vollenden, »können die was?« Wir schauen uns an und brechen in nahezu hysterisches Gelächter aus. Die ganze Anspannung der zurückliegenden Tage prusten wir aus uns heraus. Der große Chinese und seine Kollegin hinter der Bar schauen uns irritiert an, ganz kurz, ehe sie sich wieder ihrer Aufgabe zuwenden: Seit bald einer Stunde sind sie dabei, den Kaffeevollautomaten zu reinigen, wobei sie ihn mit einer Mischung von Akribie und Faszination behandeln, wie man sie von einem NASA-Wissenschaftler erwartete, der ein UFO untersucht. Wir nehmen unser Gespräch wieder auf, indem ich davon
24 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
erzähle, wie nach der Kant-Vorlesung ein Student zu mir kam, um mir eine Frage zu stellen. »Normalerweise«, sage ich, »kommen da ja Fragen zu irgendwas Konkretem und ich hatte mich daher schon darauf eingestellt, die Frage nicht beantworten zu können. Aber der hat mich ganz eindringlich angeschaut und gefragt: ›Pro fä so, one question. What äh is äh metaphysic?‹ Was willst du da sagen? Des is, wie wenn einer am Ende des Jurastudiums herkommt und sagt: ›Alles gut, ich hab das ja alles verstanden, nur eine Frage noch: Was ist denn eigentlich dieses Grundgesetz, von dem immer alle reden?‹ – Manche Leute, die hast schon verloren, bevor du das erste Wort gesagt hast.« Roland, dem Wiener Kollegen, gefällt das außerordentlich. Ein wenig später wird er dann allerdings ernster und meint, dass unter den Studenten schon einige sehr schlaue dabei seien und er alles in allem positiv vom Niveau überrascht sei. »…, oder?«, in typisch Wiener Art schließt er nicht fragend, sondern bestätigend. Und in gewisser Hinsicht hat er auch recht. Dann will er sich abermals zum Rauchen verabschieden, doch Daniel und ich beschließen, mitzukommen. Zum Rauchen muss man einen kleinen Bereich links neben dem Hoteleingang aufsuchen, der von einem sich bückenden roten Plastikmännchen bewacht wird. Roland bietet mir eine Zigarette an, die ich jedoch ablehne. Eine Weile schaue ich den anderen beiden beim Rauchen zu, dann will ich es aber doch wissen. »Ne, jetzt mal ernst«, sage ich, »Können die was? – Ich mein jetzt nicht, ob die schlau sind oder fleißig oder gebildet. Das ist ja offensichtlich. Aber können die auch Philosophie? Meint ihr, dass der nächste große Philosoph – und da rede ich jetzt von der Gewichtsklasse Kant und Hegel –, dass der in vielleicht zwanzig oder fünfzig Jahren aus China kommen könnte? Bei uns entstehen die ja offenbar nicht mehr.« Die beiden wiegeln ab. Kant und Hegel werde es sobald nicht nochmal geben, die kämen aus der Glanzzeit der Philosophie und die sei zweihundert Jahre her. Aber ich muss nachbohren, schließlich ist das der erste halbwegs klare Gedanke, den ich hier zu fassen bekomme: »Der heutige Kant und der heutige Hegel, die wären ja kein bisschen wie Kant oder Hegel. Kant und Hegel 25 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
sind ja alte Säcke aus einer anderen Zeit!« Aber die anderen beiden lassen sich nicht mehr aus der Reserve locken und so geht jeder bald auf sein Zimmer. Ich nehme meine Unruhe mit ins Bett und schalte den Fernseher ein, wieder einmal auf Ablenkung hoffend. Erst zeigen sie Regen, dann Hongkong, fünf Minuten später wird das Bild schwarz. »Das ist doch scheiße«, denke ich. »Wer kann denn jetzt bitte schlafen, solange meine Frage noch unbeantwortet im Raum steht.« Also rufe ich – auch wenn es mit dem Handy pervers kostspielig ist – einen guten Freund in München an. Der ist zunächst ganz erschrocken, weil ich mich so unverhofft bei ihm melde, und befürchtet schon, es wäre etwas passiert, bis er merkt, dass es sich um ein dringliches philosophisches Problem handelt. Er erfasst sofort, worum es geht, und wir können uns das ganze Drumherum, das philosophische Gelaber und Geziere, sparen. Er, der selbst bereits mit Philosophie im Gepäck in China war, weiß auch nicht, wie es die Chinesen unterm Strich mit dem freien Denken halten wollen. Ob dort ein großer Geist entstehen kann? Er ist unsicher. Aber er ist sich ganz sicher, dass in China gerade etwas entsteht, und zwar etwas Neues und Großes. Und allein deswegen müsse man solche Chancen, wie sie unsere Summer School bietet, nutzen, und sei es auch nur, um diesen neuen Geist kennenzulernen. Und eines sei sicher: Wer auch immer es sein wird, der oder die diesen neuen Geist verkörpert, Hegel wird es nicht sein. Der ist nämlich schon seit zweihundert Jahren tot. – Das waren meinerseits gut investierte 30 Euro. Für mich ist das nämlich doppelt beruhigend. Zum einen heißt das ja, dass sie uns den Hegel, anders als den Transrapid, ja gar nicht wegnehmen können. Der ist ja schon lange vorbei. Und zum andern heißt das für uns, dass wir hier ja vielleicht Geburtshelfer für jemanden sein können, der zwar nicht der Hegel und auch nicht der Kant, aber vielleicht der Song oder die Xiang sein wird. Und den Song oder die Xiang können die uns dann in zweihundert Jahren nach Europa bringen. Das ist doch schön. Ich beschließe, meinen Studenten morgen das Lied »Es gibt nur ein Willy Hegel« beizubringen. Da freu ich mich schon drauf. Jetzt ist mein Kopf leer. Ich schlafe wie ein Baby. 26 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
Vier Mäh Ling
Hier wird es im August viel früher dunkel als bei uns. Es dämmert schon, als wir uns am frühen Abend zum Campus begeben. Zuvor wollten wir im Hotel noch gemütlich essen, machten jedoch den Fehler, Burger vom Western Menu zu bestellen. Während die Kellner eine heißdampfende chinesische Spezialität nach der anderen an die Nebentische brachten, von denen eine besser als die andere aussah, und als unsere chinesischen Mitgäste bereits genüsslich zu schlürfen begonnen hatten, wurden wir immer hungriger und wegen der fortschreitenden Zeit immer nervöser. Vorgestern waren wir schon einmal zu spät zu den AbendDiskussionen gekommen, weil wir uns verlaufen hatten: Wir hatten es geschafft, drei verschiedene Treppenaufgänge in den fünften Stock hochzulaufen, die uns allesamt nicht auf den richtigen Flur führten, sodass wir dreimal fünf Treppen hoch und wieder hinunter hetzen mussten, mit durchgeschwitzten Hemden und zunehmend krampfenden Waden. Uns kam dann – ebenfalls sichtlich verschwitzt – der sympathische Feiste vom ersten Lunch entgegengelaufen; höflich grüßend, aber auf eine verbindliche Art und Weise beunruhigt. Da wir immer noch nicht wissen, wie sehr man die Geduld der Chinesen mit Unpünktlichkeit strapazieren darf, haben wir uns den Burger schnell einpacken lassen. Das hat weitere Minuten gekostet und nun sind es nur noch zehn Minuten bis zum Beginn der abendlichen Gruppendiskussionen. Jetzt laufen wir schnellen Schrittes hinaus in die Abenddämmerung mit unseren Paketchen, kleine Crown-Plaza-Schuhtüten, in jeder fein säuberlich aufgestapelt, eine Plastikbox mit Burger, eine Plastikbox mit Pommes und eine zusammengedrehte Frischhaltefolie 27 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
mit Ketchup. Wir hetzen und zuweilen streift mich der Hauch eines Lüftchens, dem aber stets die, inzwischen vertraute, nasse Wärmepeitsche folgt. Am Eingang des Campus, der bewacht ist wie eine US-amerikanische Botschaft, werden wir eingehend kontrolliert. Ein kleiner uniformierter Mann beäugt kritisch unsere Summer-School-Pässe, die ziemlich hübsch sind: ein nettes Logo neben unseren Namen, die »Ludwig-Maximilians-Universität« auf Deutsch und Chinesisch, farbenfroh und beinah futuristisch gestaltet. So in etwa würde ich mir einen Backstage-Pass auf der Comic-Con vorstellen. Währenddessen fahren immer wieder Mopedfahrer vor, die am Tor abgewiesen werden und beim folgenden Wendemanöver beinahe mit vorbeiradelnden Studentinnen kollidieren. Als wir endlich vor dem richtigen Gebäude angekommen sind, rennt uns erneut ein Uni-Mitarbeiter aufgeregt entgegen, den ich noch nicht kenne. Er lotst uns hastig durchs Hauptgebäude zum Aufzug, der uns hoch in den 24. Stock fahren soll. Wieder bemerke ich, dass die Chinesen nicht auf die Tür-Automatik warten, sobald jemand den Aufzug betreten oder verlassen hat, sondern sich stets einer findet, der die Türen schnellstmöglich per Knopfdruck schließt. Hier hat offenbar niemand Zeit zu verlieren – kein Wunder, wenn man die ganze Welt erobern will. Die Luft im Aufzug ist schwülheiß und abgestanden und die Anspannung unseres Begleiters ist geradezu greifbar. Als er beim Verlassen des Fahrstuhls jedoch bemerkt, dass wir unser Abendessen noch mit uns herumtragen, mäßigt er seine Hast und ist sogleich hilfsbereit. Er schlägt uns vor, zunächst in einem unklimatisierten Nebenraum unser Abendessen zu uns zu nehmen, während unsere Gruppen schon einmal ohne unsere Moderation zu diskutieren anfangen. Auf dem Weg in den Nebenraum winken wir kurz in unsere Gruppenräume, in denen das Gemurmel sofort andächtig verstummt. Der beißende Burgergeruch erfüllt sofort den Raum und ich komme mir ziemlich proletenhaft vor, ja richtig schäbig. Ich kann uns für einen kurzen Moment mit den Augen unserer Gastgeber sehen und mir lebhaft vorstellen, wie abstoßend es sein muss, uns dabei zuzusehen, wie wir jeder beidhändig ein massiges, strengriechen28 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
des Gesuppe aus Fleisch, aufgeweichtem Brötchen und süßlicher Soße hinunterschlingen. Aber dann schmeckt es eben doch, vielleicht nur aus Gewohnheit. Als ich dann, nassgeschwitzt und mit pappenden Händen, zu meiner Gruppe hinübergehe, verstummen dort wieder alle. Ein Student steht leise auf und wischt mit einem Tuch einen Stuhl sauber sowie den Tischbereich zu seiner Rechten. Dann bietet er mir höflich, aber bestimmt den dergestalt präparierten Platz neben ihm an. Ich weiß im Grunde gar nicht, was ich hier machen soll. Entweder habe ich beim ersten Lunch nicht aufgepasst, als diese Gruppentreffen womöglich besprochen wurden, oder sie wurden einfach nicht besprochen – jedenfalls ist die Situation unklar und erstmal traut sich niemand, etwas zu sagen. Kurz überlege ich, ob ich einfach abwarten und schauen soll, wie lange sich das durchhalten lässt, doch dann wechsle ich unversehens in den Professorenmodus. Die meisten scheinen mich nicht oder nur halb zu verstehen. Unvermittelt drückt mir eine Studentin ihr Handy in die Hand. Ich weiß erst gar nicht, was sie will, bis ich erkenne, dass auf dem Display ein paar Fragen zu Kant stehen. Die helfen uns allerdings auch nicht weiter. Also einigen wir uns darauf, dass die Studenten zunächst unter sich auf Chinesisch diskutieren und mir anschließend ihre Ergebnisse auf Englisch vorstellen. So beginnt eine zögerliche Diskussion; höflich, zurückhaltend und respektvoll. Da ich ohnehin nichts verstehe, verlasse ich den Raum und drehe noch eine Runde durchs Gebäude. Ich luge kurz in die anderen Diskussionsräume, in denen meine Kollegen einigermaßen feierlich über Kant dozieren. Außer uns scheint auf dem Stockwerk niemand mehr zu sein, die Flure sind menschenleer und still. Ich komme an einer Konfuzius-Büste vorbei und an einer Büste von Karl Marx, entscheide mich nach kurzem Überlegen allerdings jeweils gegen ein Selfie. Schließlich finde ich noch eine Gelegenheit, meine Hände zu waschen. Als ich zurück zu meiner Gruppe komme, hat sich das Diskussionsklima deutlich verändert: Die Lautstärke ist beachtlich, die Tonlage geht rauf und runter, das Tempo wechselt sekündlich und die Redebeiträge werden von zischenden Sch-Lauten dominiert. Mich 29 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
beachtet noch niemand so recht und daher nutze ich die Gelegenheit, der Sprache nachzuhören. Hier und da höre ich einen Hä-gäl heraus und zunehmend gewinne ich den Eindruck, dass sie den Kant »Kanto« nennen – was ich ziemlich gut finde. Vielleicht ist auch ein Schelling dabei, aber der ist zwischen all den Zischlauten natürlich schwer auszumachen. Es ist eine schöne Sprache: abwechslungsreicher und melodischer als unsere, ein richtiger Flow. Ich erwische mich dabei, an Stellen, die besonders gut klingen, bestätigend zu nicken und, wenn einer viel zischt, eher skeptisch zu schauen. Vielleicht ist das ja der ganze Trick? Manchmal wird geklatscht, wenn einer mit seinem Beitrag fertig ist. Bei unserer Vorstellung am ersten Tag haben sie das auch schon gemacht, aber im Rahmen einer normalen Diskussion finde ich es schon bemerkenswert. Ich will nicht unterbrechen, aber als kurz eine allgemeine Stille einsetzt, schalte ich mich ein und stelle die Arbeitssprache wieder auf Englisch um. Der nervöse Kerl mit der riesigen Kastenbrille meldet sich und stellt seine Frage zu Kant, exakt dieselbe, die er in der Vorlesung heute Mittag schon gestellt hat. Wieder wendet er sich gegen Kants These, dass die Welt der Erscheinungen vollständig durch Naturgesetze determiniert sei und schon deswegen Kants darauf aufbauender Freiheitsbegriff falsch sei. Er will, gegen Kant, einen anderen Freiheitsbegriff entwerfen. Es geht also ans Eingemachte. Zuerst will ich ihn rasch abbügeln, aber er lässt das nicht zu und im zweiten Anlauf lasse ich mich auf seine These ein. Ich beziehe die anderen ins Gespräch ein und gemeinsam entwickeln wir einen Fünf-Punkte-Plan zur Widerlegung Kants einerseits und zur Entwicklung eines alternativen Freiheitsbegriffs andererseits. Jetzt hat es zwischen uns gefunkt und wir sind, kultur- und sprachübergreifend, in einem echten philosophischen Seminar. Zum ersten Mal seit meiner Ankunft sehe ich Ironie in den Augen einiger Chinesen aufblitzen, und es kommt mir vor, als legten manche für einen Moment ihre Hülle aus distanzwahrender Höflichkeit ab. Eine bildhübsche Chinesin zu meiner Linken schiebt mir unterdessen mit einem freundlichen Lächeln eine Box mit Taschentüchern herüber, auf der lauter bunte Ziegen abgebildet 30 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
sind. Ich schaue gedankenverloren auf die Ziegen und mir kommt diese Darreichung eines Schweißtuchs seltsam intim vor, doch dann bemerke ich, dass mir der Schweiß vom Kinn tropft und bereits eine kleine Pfütze auf dem frisch gewischten Tisch vor mir gebildet hat. Ich greife mir also ein Ziegen-Tüchlein und poliere den Tisch wieder trocken, während ich dem sichtlich erfreuten Studenten mit der Kastenbrille die Empfehlung gebe, ein Buch über seine Kant-Kritik zu schreiben. Ich frage ihn nach seinem Namen. Halb abwinkend, nennt er mir den Namen John. Wie einige Chinesen tritt er gegenüber den Westlern mit einem leicht aussprechbaren, wahrscheinlich frei erfundenen West-Namen auf. Mit der Dame rechts von mir diskutiere ich noch kurz über Hegel und Marx, mit dem Ergebnis, dass sich das Festhalten an institutionalisierter Objektivität und der Geist der Revolution ja nicht unbedingt ausschließen müssen. Sie stellt sich als Chen Lu vor. Gegen Ende unserer ersten Abend-Diskussion möchten sich noch die anderen bei mir vorstellen. Ich kann mir da nichts merken, die chinesischen Namen verstehe ich zum Großteil nicht, die westlichen Fake-Namen vergesse ich sogleich wieder, ich nicke aber jede und jeden nacheinander höflich ab. Nur der Name der Taschentuch-Spenderin bleibt hängen: Sie heißt Ling. Zum Schluss schießen wir noch ein Gruppenfoto, auf dem alle ein Peace-Zeichen machen. Ich schließe mich an. Wahrscheinlich bedeutet das in China sonst was. Als wir zusammenpacken, klärt mich eine Studentin noch darüber auf, dass heute National Chinese Valentine’s Day ist – und vor der Tür warten dann tatsächlich ein paar Jungs und Mädels mit Blumensträußen. Ich bringe vorsichtig meine Verwunderung zum Ausdruck, dass sie am Valentinstag bis halb zehn im Kantseminar sitzen und gebe allen mit auf den Heimweg, dass sie fei vor lauter Philosophie nicht das Leben vergessen sollen, was mir den letzten Applaus des Abends einbringt. In kleinen Grüppchen gehen wir dann hinaus in die immer noch schneidend heiße Sommernacht. Zwei, drei Fragen gibt es noch und unter der Allee, die zum Hauptausgang des Campus führt, kommt Ling auf mich zu. Noch einmal reicht sie mir ihre Taschentücherbox und ich bediene mich und wische mir das 31 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
Kinn. Ich spüre eine laue Brise und über uns schreien die Bäume, ohrenbetäubend. Was ist das bloß? »Pro fä so Fran«, setzt sie an und ringt ersichtlich nach Worten. Irgendwie freut es mich, dass sie mich duzt und trotzdem den Titel mit nennt. Sie unternimmt weitere Versuche, einen englischen Satz zu konstruieren, bricht aber immer wieder ab. Ich vermute unwillkürlich hinter ihrer Formulierungsschwäche eine romantische Verlegenheit und beginne mir auszumalen, wie das wohl sein wird, die Mäh Ling in Schweinfurt bei meiner Familie vorzustellen. Ob sie wohl Bratwürste mag und Schoppen? Es mag am Spirit des National Chinese Valentine’s Day liegen, aber ich rechne jetzt fest mit einer romantischen Botschaft. Ihr zartflüsterndes Ringen nach Worten wird fast gänzlich übertönt vom nicht ablassenden Schreien aus den Bäumen. Endlich hat sie fertigformuliert. Es geht um Hegel und sein Verhältnis zu Kants Begriff von transzendentaler Freiheit. Mäh Ling war also nur an meinem Geist interessiert und schon wieder wurde ich von einer Frau wie ein Subjekt behandelt. Am Ausgang des Campus werde ich von meinem Assistenten eingeholt, der mir nachgejoggt sein muss. Ein wenig ärgerlich frage ich ihn, was dieses Geschrei in den Bäumen eigentlich soll. Er drückt auf seinem Smartphone herum und zeigt mir dann ein Bild von einem Tier, unter dem sein deutscher Name steht: die Braune Singzikade. Die Männchen trommeln pausenlos, die Weibchen schweigen, und ab Ende August fallen alle tot vom Baum. Was für ein Leben. Zurück im Hotel sehe ich, dass ich das »I’m busy relaxing«Schild aus Versehen an meiner Tür habe hängen lassen. Beim Betreten des Zimmers finde ich auf der Türschwelle einen Zettel mit einer etwas passiv-aggressiv klingenden Botschaft: Der Mann mit dem Obst wäre so gern gekommen, hätte ich doch bloß das Schild nicht hinausgehängt. Auch der Turn-Down-Service traute sich wegen des Schildchens nicht hinein, sodass mein Vorhang noch weit offen steht. Ich stelle mich ans Fenster und sehe die Skyline von Shanghai bunt blinken. War das gestern auch schon so oder ist es heute wegen des Valentinstags? Ich sehe die Lichter klar, sie scheinen sich zu bewegen und die ganze 32 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
Stadt mit ihnen. Ich bilde mir ein, sie greifen zu können und doch wirkt sie unendlich weit weg. Schwankt der Boden unter meinen Füßen? Ich schließe die Augen und greife mit den Händen in meine Hosentaschen. Die rechte Hand fasst ein Papier. Ich hole es hervor, es ist eine Karte mit chinesischen Schriftzeichen, die vor meinen Augen verschwimmen. Ich stelle mir vor, wie der Klang hinaufgeht und wieder herunter, schneller und wieder langsamer, alles gebettet ins Sch-Sch hypnotisierender Fremdheit.
33 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
Fünf Taifun Leckmi
Wir sind mittlerweile seit einer Woche in Shanghai und in den letzten Tagen hat sich die Stimmung unserer Gastgeber ein wenig verdüstert. Verschämt haben sie uns nun schon mehrfach etwas von einem Taifun zugeraunt, der irgendwann an diesem Wochenende die Stadt heimsuchen soll: »A typhoon is coming to Shanghai.« Die Summer School muss deswegen eventuell ausfallen, heißt es, und wir könnten stattdessen mit unseren Assistenten ein Sightseeing machen – aber vorsichtshalber besser ins Museum gehen, als durch die Stadt laufen. Eigentlich ja eine spannende Sache, nun auch noch einen Taifun mitzunehmen. Die hundert besten Gerichte der Chinesischen Küche, die vereinnahmende Kombination von Hitze und Luftfeuchtigkeit, kulturübergreifende Diskussionen über Marxismus, Liberalismus, Kapitalismus, über das schwache Europa, das starke China, dazu noch den Hegel im Gepäck – und jetzt noch ein Taifun obendrauf. Unter uns Europäern herrscht eine gewisse Ratlosigkeit bezüglich des Wesens eines Taifuns. Daniel vertritt die Ansicht, ein Taifun sei mehr oder weniger das Gleiche wie ein Hurrikan, er sei bloß über einem anderen Meer entstanden und komme daher aus einer anderen Himmelsrichtung. Roland widerspricht und meint, Taifun und Hurrikan unterschieden sich nur in der Intensität, der Taifun habe nämlich mehr Wirbel; wohingegen ich mich meine zu erinnern, der Taifun sei unter den Stürmen gerade der ohne Wirbel. Da wir mit unseren Smartphones nicht an der chinesischen Firewall vorbeikommen, können wir das auf die Schnelle nicht googeln und merken, wie aufgeschmissen wir da sind. Die einzige Suchmaschine, die der chinesische Staat uns 35 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
Westlern gelassen hat, ist eine eingeschränkte und den chinesischen Bedürfnissen angepasste Version von Bing. Aber die macht keine Freude. Alles, was wir – immerhin drei Akademiker! – mit ihrer Hilfe herausfinden, ist der Name des Taifuns: Lekima. Das Wesen des Taifuns im Allgemeinen bleibt unklar. Am Freitagmorgen sitzen wir beim Frühstück und warten gespannt auf die Nachricht, ob die Summer School wegen des Taifuns schon heute ausfällt oder nicht. Daniel hat seinen Laptop aufgeklappt und schaut nach E-Mails, Roland starrt auf sein Smartphone und ich blicke zur Tür: Vielleicht schicken sie ja einen unserer Assistenten persönlich vorbei? In jedem Fall würden sie uns nicht vergeblich zum Campus laufen lassen, denn in ganz Shanghai ist alles perfekt organisiert – mit Ausnahme des Milchschäumers hier im Frühstückssaal, in dem sich nie Milch befindet, obwohl während der gesamten Frühstückszeit zwei Hotelmitarbeiter neben dem Kaffee-Automaten stehen und sich allem Anschein nach angeregt über exakt dieses Problem unterhalten, dass nämlich immer dann, wenn einer von uns Westlern die Taste »Cappuccino« drückt, nur heiße Luft kommt, bestenfalls ein paar Spritzer krustiger Milchrest. Aber ändern tun sie daran nichts. Ich glaube, heute Morgen hat unser großer Kellner aus der Hotelbar, der uns abends immer die falschen Biere bringt, Dienst an der Kaffeemaschine. Er schaut ähnlich ausdrucksarm auf das leere Milchfach wie sonst auf die englischchinesische Bierkarte auf dem iPad, mithilfe dessen wir immer unsere Bestellungen aufgeben sollen. Beim Blick durchs Fenster fällt mir nichts auf: Draußen schaut alles ganz normal aus, es regnet und vielleicht ist es ein bisschen dunkler als sonst um diese Uhrzeit. Einen Taifun hätte ich mir anders vorgestellt! Ein Chinese setzt sich direkt neben mich, obwohl im Speisesaal noch viele andere Plätze und auch ganze Tische frei sind. Er bringt ein imposantes Sammelsurium an Frühstück mit: eine heißduftende Frühstücksschlürfsuppe mit allerlei Einlage; ein mit Käse überbackenes Croissant, das von ein paar Marmeladen und einer ordentlichen Portion sauer eingelegtem Kohl begleitet wird; dann Spiegeleier, Speck und daneben noch etwas, das ausschaut wie Leberkäse – später finde 36 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
ich es am Buffet wieder, wo es laut Schildchen »Swiss flat meat« heißen soll. Diese kulinarische Vollverwirrung ist wohl dem Umstand geschuldet, dass unser Hotel ein asiatisches und ein westliches Frühstücksbuffet anbietet, wobei die Grenzen verschwimmen; neben den asiatischen Pancakes habe ich zum Beispiel vorhin eine Maggi-Gewürzflasche entdeckt. Als mein Nebenmann genüsslich seine Suppe zu schlürfen beginnt, kommt es mir vor, als würde es draußen schon ein klein wenig dunkler. Nach der Suppe tunkt er den Speck in die Marmelade, legt ihn aufs Käse-Croissant und isst das alles ohne Anstalten. Zuerst denke ich, dass er ein bisschen blöd sein muss. Aber dann dämmert mir, dass unsere Art zu essen auf die Chinesen nicht weniger blöd wirkt. All der Schinken und Speck und immer diese riesengroßen Eier – all diese Grobheiten schon in der Früh und am Abend dann siffige Burger. Da uns keine Absage erreicht, brechen wir auf und gehen durch den stärker werdenden Regen zur Uni. Es sind wieder Gruppendiskussionen angesetzt, doch es sind viel weniger Studenten als beim letzten Mal gekommen. Insbesondere vermisse ich Ling. Heute scheint es sich zu bestätigen, dass ich die Gruppe mit den Problemfällen abbekommen habe. Der freundliche Student, der mir vor der ersten Diskussionsrunde so zuvorkommend Tisch und Stuhl gewischt hatte, entpuppt sich als ziemlich anstrengender Besserwisser. Wobei man vielleicht auch sagen könnte, er sei aufgetaut und habe seine Hemmungen abgelegt – was ich zunächst als gutes Zeichen werte. Außerdem Chen Lu, die wieder zu meiner Rechten sitzt und die nur über Marx redet. Sie stellt dabei Fragen, weitgehend ohne Fragen zu stellen. Das ist mir aus dem akademischen Betrieb daheim allerdings wohlvertraut. Schließlich meldet sich John zu Wort. Er hat ja seit der ersten Vorlesung schon einen arg nervösen Eindruck gemacht, doch heute ist er kaum zu halten. Da wir uns diesmal über Fichte unterhalten sollen, von dem ich freilich keine Ahnung habe, gehe ich zur Tafel, um meine Ahnungslosigkeit durch eine Tafelanschrift zu kaschieren – ein bewährtes Mittel. Die Tafel ist jedoch von einer Leinwand verdeckt, die eigentlich als Projektionsfläche für den Beamer dient 37 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
und von der ich nicht weiß, wie ich sie hochgezogen bekomme. So bleibt mir nur ein kleiner Streifen am unteren Tafelrand. In dessen linke Hälfte schreibe ich nun das Einzige, was ich von Fichte weiß: »The I posits itself.« – Das Ich setzt sich selbst. Mit dieser Art von Selbstbezüglichkeit kann man immer gut starten, denn da braucht man eigentlich nix zu wissen – außer der Trivialität, dass Selbstbezüglichkeit sich auf sich selbst bezieht. Dann kann man dasjenige, was sich bezieht, durch irgendetwas Beliebiges ersetzen, solange man aufpasst, dass hinten das Gleiche herauskommt, was man vorne hineingesteckt hat. Also fange ich an, da ein bissl was drum rum zu erklären. Aber ganz gegen meine Absicht wecke ich schlafende Geister. Der Tischwischer, dessen Namen ich mir nicht merken konnte, eilt an die Tafel und schnappt sich ein Stück Kreide. Er ersetzt »The I« durch »A=A« und erklärt in einer Mischung aus Chinesisch, Englisch und Deutsch, »what äh self äh ref-äh-rence is ähbout«. Jetzt kommt John hinzu, ebenfalls mit Kreide bewaffnet. Sehr bald geht uns der Platz aus, weil die Leinwand noch immer vor der Tafel hängt. Wir halten sie nach oben, damit auch er seine Version präsentieren kann. Er schreibt »Everything is everything«, wirft die Kreide weg und beginnt, wild gestikulierend, auf und ab zu schreiten. Dann tritt er erneut an die Tafel, wischt mit der Hand in seinem Satz herum, bessert aus, schreitet wieder. Es hat sich jetzt eine Eigendynamik entwickelt, die ich nicht mehr aufhalten kann. Mit der Leinwand hilft uns ein weiterer Student, der sich in dieser Angelegenheit einschaltet: Die Leinwand mit ihrer Roll-Automatik war nicht an den Strom angeschlossen. Er holt das nach und drückt auf ein unscheinbares Knöpfchen: Jetzt haben wir die ganze Tafel! Zu dritt schreiben wir sie aus allen Ecken voll, diskutieren miteinander, durcheinander und übereinander hinweg. Am Ende haben wir ein chaotisches Exempel der Selbstbezüglichkeit geschaffen – oder ist es uns nicht vielmehr unter der Hand entstanden? »Eigentlich wunderschön, ein Kunstwerk!«, denke ich mir, als ich einen Schritt zurücktrete, um mein Schlussfazit zu ziehen. Vielleicht ist ja irgendwo da drinnen die Weltformel versteckt? Oder wenigstens ein Hinweis auf den Untergang der Zivilisation? Beides 38 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
zugegeben eher unwahrscheinlich, dennoch bin ich ein bisschen stolz auf das Gemeinschaftswerk. Durch unseren Raum weht jetzt ein fast irritierend laues Lüftchen. Ich trete ans Fenster und blicke auf die sich verdunkelnde Stadt. Der Regen peitscht, hart aus Osten stürmend, durch die Straßen. »Lekima has arrived«, sagt John, mit frohlockender Stimme, und meine Leute klatschen. Am Abend warten wir in der Hotellobby auf zwei Uni-Mitarbeiter, die uns ausführen möchten: Daniels Assistent Yifan und eine chinesische Doktorandin. Sie haben aufgrund des Taifuns ihre Ankunftszeit schon dreimal nach hinten verschieben müssen. Der Blick nach draußen schaut gar nicht so wild aus. Als die beiden endlich ankommen, fahren wir mit dem Taxi in ein Restaurant. Auf der Fahrt stellt sich die Doktorandin, die seit einigen Auslandssemestern in Heidelberg erstaunlich gut Deutsch spricht, als Hildi vor. Ich bin mir nicht sicher, ob sie einen chinesischen Namen – vielleicht in vereinfachter Aussprache – nennt, der sich anhört wie Hildi oder ob sie als Westnamen Hildi gewählt hat. Im Restaurant speisen wir einmal mehr fürstlich. Seit dem Nachmittag schreiben uns immer wieder besorgte Freunde aus Deutschland, wo anscheinend von dem Sturm berichtet wird. Den Chinesen ist das peinlich; sie entschuldigen sich bei jeder Gelegenheit für ihren Taifun. Wir akzeptieren die Entschuldigungen großmütig und wollen weiter in eine Bar. Also verlassen wir das Lokal, vor dem unser bestelltes Taxi schon wartet. Wie ich, der ich als erster auf die Straße getreten bin, allein auf das Taxi zugehe, fährt mir der Taxifahrer im Schritttempo vor der Nase weg. Hat der etwa Angst? Ich beschleunige ein bisschen, er beschleunigt auch, lässt den Abstand zwischen uns nicht schrumpfen. Es ist furchtbar albern, aber vielleicht fürchtet er sich ja wirklich vor mir. Wer weiß, wie ich auf ihn wirke, so als Fremder, als großer weißer Mann im dunklen Sturm. Seine kuriose Reaktion hat allerdings bewirkt, dass ich jetzt trotz Schirm vollständig durchnässt bin, denn der Regen peitscht unablässig aus jeder Richtung. Mir reicht es und ich schicke Hildi vor, die besorgt zu Hilfe eilt. Sie erklärt dem Taxi39 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
fahrer, dass der nasse weiße Mann zu ihr gehört und dann dürfen wir einsteigen. Im Radio läuft eine chinesische Version von Material Girl, die ich sogleich wiedererkenne aus Crazy Rich Asians. Das fühlt sich, obwohl ich das Lied erst eine gute Woche kenne, beinahe heimisch an, ich singe mit, nuschle die chinesischen Laute, so gut es geht, und verlege mich aufs Summen, wenn ich allzu unsicher werde. Beim Refrain werde ich dann wieder laut und bestimmt: »two hundred degrees – when you hold me«. Für chinesische Ohren muss meine Performance schrecklich klingen, doch unsere chinesischen Begleiter sind zu höflich, um sich irgendeine Form des Urteilens über meine Singerei anmerken zu lassen. Ich fühle mich auch darum berufen, zu singen, weil ich es so frappierend europäisch finde, in einem Popsong Unsinn durch Unsinn zu ersetzen. Vielleicht ist der chinesische Teil des Textes dagegen ganz wunderschön. Ich wünsche mir das. Ich erzähle Hildi vom Film und bin erstaunt, dass sie noch nie von ihm gehört hat. Dabei ist das doch der erste amerikanische Mainstream-Film mit einer rein amerikanischasiatischen Cast. Hildi wirkt interessiert, aber ich kann einmal mehr nicht einschätzen, ob das echt ist oder gespielt oder ob es da überhaupt einen Unterschied gibt. Ich frage sie auch, ob das Hochzeitsritual, das im Film dargestellt wird – die Braut schreitet in einer kathedralengleichen Kirche wie eine Elfe über einen gefluteten Gang, aus dem Farne und Orchideen wachsen – typisch chinesisch sei. Sie bemüht sich sehr, mir interessiert zu folgen, hat aber keine Ahnung, wovon ich rede. Sie gelobt aber, das alles herauszufinden und behandelt meinen Versuch, ungezwungenen Smalltalk zu machen, letztlich als Rechercheauftrag. Mir schwant, dass beides – der Film wie auch das im Film dargestellte Ritual – den Chinesen nicht egaler sein könnten. Wir landen sodann in einer europäischen Bar. Um uns eine Freude zu machen, bestellen unsere beiden Begleiter einen französischen Nachtisch, eine, wenn ich das recht verstehe: Crème brulée. Wir trinken Bier – diesmal Heineken, bestellt wie geliefert, hören schlechte europäische Musik, am Nebentisch raucht sogar einer Shisha. Hier ist alles so leicht am Thema vorbei. Aber schön! Als ich die Bestellung schon vergessen habe, bringt 40 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
die Kellnerin den Nachtisch. Ich traue meinen Augen nicht: Die »Crème brulée« ist ein riesiges Kastenweißbrot, mit viel Wohlwollen und im weitesten Sinne so etwas wie French Toast, das man mit mehreren Kugeln Eis garniert und anschließend mit einer Soße übergossen hat, die entfernt an Vanillesauce erinnert; daneben liegen grobe Stücke von Wassermelone und über alles gibt es dann noch a weiße Soße und a rote Soße drüber und grüne Streusel obendrauf. Was für eine grobe Pampe! Die Diskrepanz zur Feinheit von allem, was mir bislang hier serviert worden ist, könnte größer nicht sein, und ich muss unmittelbar an den Mann vom Frühstück denken, der die Marmelade auf den Speck hat. Wahrscheinlich können wir unsere Irritation weniger gut als unsere Gastgeber verbergen, denn uns wird sofort versichert, dass diese »Crème brulée« bei chinesischen Studenten sehr beliebt sei. »Ist das euer Ernst?«, will ich fragen. Aber mei. Im Hintergrund läuft die schlechtestmögliche Auswahl westlicher Popmusik und am Nebentisch sitzt ein sichtlich europäisierter Chinese mit Kappe falschrum und Muscle-Shirt. Er tippt auf seinem Smartphone herum und singt das Lied falsch mit. Na klar! Die nehmen uns genauso wahr, wie dieser Nachtisch ist: grob, überdimensioniert, matschig, drei Saucen drauf. Das ist ja auch unsere moderne Freiheitsauffassung: So grob und unkultiviert sein zu können, wie wir wollen. Die Chinesen dürfen das im Alltag offensichtlich nicht, dazu müssen sie hierher kommen. Über die Crème brulée ist letztlich das Gleiche wie über den Burger vor ein paar Tagen zu sagen: Eklig und grob, aber macht satt und ist gewohnt. Und genauso ist das mit dem Liberalismus. Ich versuche, meine frisch gewonnene Erkenntnis meinen Tischnachbarn mitzuteilen, während ich die letzten Reste vom Nachtisch vom Teller kratze. Yifan und Hildi lächeln mich an, die Deutschen schauen, als hätte ich sie nicht mehr alle. Daniel nimmt schließlich das Gespräch wieder auf, indem er mich darauf hinweist, dass ich noch etwas Vanillesauce im Bart habe. Nachdem wir die Bar verlassen haben, will ich gegen die Ratschläge meiner Begleiter noch eine Runde um den Block drehen und schnorre mir zu diesem Zweck eine Spazier-Zigarette 41 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
von Roland. Er hat über die Tage sein Sortiment erweitert und lässt mir die Wahl zwischen einer ganz dünnen, seltsam grünlichen chinesischen Zigarette und einem klobigen Westmodell. Ich entscheide mich für das Vertraute und bereue das, noch bevor ich zu rauchen beginne. Der Regen kommt jetzt gleichzeitig aus allen Richtungen. Ich werde fast von einem Elektromoped überfahren, das ich nicht hören kann und dessen Fahrer sich eine Art Rundumschirm gebaut hat, sodass er nichts sehen kann. Bei der nächsten Bö kapituliert schließlich mein Schirm, er klappt sich nach außen und schlägt mir ins Gesicht. Ich werfe ihn kurzerhand in den Huangpu River, was sicher 1000 Yuan kostete, wenn es denn jemand sehen könnte. Den Versuch eines Lungenzugs muss ich auf halbem Weg abbrechen. Ich huste einige Male halblaut und atme mich gegen den peitschenden Sturm wieder zurück in einen Rhythmus. Dann gibt auch die Zigarette auf, halb geraucht nur, und das nächste Moped schießt, wild hupend, an mir vorbei – immerhin habe ich das gehört. Alles ist nass. Der Taifun kann mich mal, denke ich, mich selbst setzend als der, der dem Sturm trotzt. Aber eigentlich ist mir schon klar, dass ich – streng genommen – hier draußen nix verloren habe.
42 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
Weltformel oder Lost in Translation? Die interkulturelle Tafelanschrift im Fichte-Seminar
43 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
Sechs Socialist Core Values
»I-ie-ch« – Pause – »kenne … Ha-ba-mas … von neun« – längere Pause – »zehn« – sehr lange Pause und dann mit einem Mal ganz schnell: »hundertsiebenundsechzig.« Er schaut uns erwartungsvoll an und fügt dann hinzu: »A-ah-ls … i-ie-ch … in Frankfurt« – extra lange Pause – »studiert habe.« Der Emeritus ist sichtlich zufrieden mit seinen Angaben und wendet sich wieder von uns ab, noch bevor wir antworten können. Wegen der Nachwehen des Taifuns – die Sturmwarnung gilt noch bis in die frühen Abendstunden – essen wir heute in der Bibliothek der Fudan-Universität gemeinsam zu Abend. Das chinesische Abendessen findet in der Regel sehr früh statt, zu einer Zeit, in der bei uns allenfalls ein paar Rentner zum EarlyBird-Special gehen. Es wäre daher noch zu gefährlich, zu einem offiziellen Termin vor die Tür zu gehen, und die Veranstalter haben sich kurzerhand dazu entschlossen, eine Tafel in der wunderschönen alten Bibliothek herzurichten. Der Weg zum Abendessen ist also zugleich eine kleine Bibliotheksbesichtigung. Zuerst geht es eine Weile zwischen Buchreihen hindurch, die sich von denen unserer Bibliotheken kaum unterscheiden. Dann allerdings kommen wir in einen hellerleuchteten Saal mit einem riesigen, massiven Tisch in der Mitte, auf dem Schriftrollen ausgebreitet sind. Hier soll das Abendessen stattfinden. Einige Studenten beeilen sich, die kostbaren Schriftstücke vorsichtig zusammenzurollen und in die umstehenden Schränke zu verstauen, die bis an die Decke reichen. In diesen Schränken müssen sich hunderte, wenn nicht tausende weitere Schriftrollen befinden; und die Rollen sehen aus, als ob sie hunderte, wenn nicht tausende Jahre alt wären. Vor jeder Glastür der 45 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
Schränke befindet sich ein Ständer, der etwa anderthalb Meter hoch und einen halben Meter breit und aus hauchdünnen Bambusstängeln geflochten ist. Diese Ständer sehen aus wie das originale Urbild von den Fake-Bambus-Bast-Dingern, die man in unseren europäischen Einrichtungsgeschäften so häufig sieht. Einige Kartons in der Ecke, die noch aufs Auspacken warten, stören das Gesamtbild nur wenig. Yifan ist gleich nach unserem Eintreffen zu einem Beistelltischlein geeilt, auf dem Utensilien zum Teebrühen bereitstehen: ein geriffeltes Kännchen, das recht antik ausschaut und auf einem Stövchen steht; kleine Gefäße aus Glas, Messing oder Kupfer; niedrige, breite Tassen und ein Bastkorb. Und ein BrittaWasserfilter. Mit selbstverständlicher Sicherheit einer jahrhundertealten Tradition folgend, brüht Yifan für alle Gäste Tee, aus frischen Blättern, die er einem der Behälter entnommen hat. Die Zeremonie ist eindrucksvoll und ich kann nicht verstehen, wie zwei der Gäste dennoch ihren Tee ablehnen können. Unsere Gastgeber haben mittlerweile mitbekommen, dass die Deutschen eine Menge Bier trinken – eine Menge, die zu trinken nur Barbaren fähig sind, eine Unmenge. Ich bin froh, dass unsere Gastgeber nur eine abstrakte, aber keine konkrete Vorstellung davon haben, was es heißt, einen Tag auf dem Oktoberfest in München zu verbringen. Wenn ich mir ausmale, wie es auf sie wirken müsste, wenn sie ihre deutschen Gäste beim Trinken von vier, fünf oder mehr Litern Bier erleben würden, aus Krügen, die größer sind als die hiesigen Teekannen … Unsere Gastgeber entschuldigen sich während des Teetrinkens mehrfach, dass sie uns in der Bibliothek leider kein Bier servieren könnten. Ergänzend zum Tee aus den hübschen, flachen, weißen Tassen, gibt es für jeden eine Cola aus der Dose, ein Fläschchen stilles Wasser von der Firma Nestlé sowie ein kleines Trinkpäckchen mit Strohhalm, worin sich irgendetwas Orangiges befinden soll. Zwar gibt es auf dem Universitätsgelände vier Restaurants, die heute allesamt wegen des Sturms geschlossen haben, aber diese können so kurzfristig keinen Koch für uns abkommandieren; die Lösung lautet Lieferdienst. Unsere Gastgeber haben einen ausgewählt, der kantonesisches Essen an46 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
bietet, denn dieses entspricht ungefähr dem, was in Deutschland als »Chinesisch« verkauft wird – wie uns von denen erklärt wird, die schon einmal in Deutschland waren. Die augenfälligste Konsequenz ist, dass alle gelieferten Gerichte auf Reis als Beilage basieren, was ganz untypisch für Shanghaier Küche ist. Tatsächlich ist es mein erster Kontakt mit Reis, seit ich hier bin. Auf dem Reis liegen grünes Gemüse und verschiedene Fleischsorten: eine glasierte Entenbrust, ein bisschen Hühnchen mit Knochen, rotes, anscheinend gepökeltes Fleisch und deftig-fetter Schweinebauch. Dazu gibt es eine klare helle Sauce aus einem kleinen Plastikbeutel, die ein bisschen salzig und ein bisschen süßlich schmeckt. Sojasauce habe ich ebenfalls noch nirgends gesehen. Vor dem Essen muss zunächst recht umständlich die Tischordnung bestimmt werden. Während hier und da getuschelt, sich hingesetzt und wieder aufgestanden wird, erklärt mir eine Studentin, wie das hier mit der Herumsitzerei so abzulaufen hat. Dabei blickt sie allerdings ganz schüchtern zur Seite, damit niemand sonst ihre Erklärungen mitbekommt. Ich erfahre, dass es in China Regeln fürs Sitzen gibt, gegen die der Knigge ein selbsterklärendes Kinderbuch ist. Die oberste Regel lautet, dass der wichtigste Mann stets am nächsten an der Tür sitzt. So werden alle Speisen an ihm zuerst vorbeigebracht, er darf bestellen und abbestellen und auch bestimmen, wann welche Speisen wieder abgetragen werden. Der Preis für diese Privilegien besteht in der Pflicht zum Bezahlen. Insofern ist es heute Abend kein guter Deal, der wichtigste Mann zu sein, denn beim Lieferdienst-Essen bekommt jeder seine eigene, festgelegte Portion – daher gibt es nichts mehr zu entscheiden, sondern nur noch zu bezahlen. Trotzdem wird das Prozedere akribisch eingehalten. Ist der wichtigste Mann einmal platziert, bildet er den Bezugspunkt für die restliche Anordnung: Die nächstwichtigen Personen dürfen neben ihm sitzen, die dritt- und viertwichtigsten wiederum neben diesen und so reihen sich die Leute entsprechend ihrer Wichtigkeit aneinander. Was diese Wichtigkeit im Einzelnen bestimmt, kann mir die Studentin auch nur kompliziert und vage erläutern: Es hängt wohl vor allem von Familie, Status und Alter ab, aber irgendwelche mir nicht ganz begreiflichen Zusatz47 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
faktoren spielen auch eine Rolle. Hier in der Bibliothek zum Beispiel nimmt den Spitzenplatz nicht der Älteste ein, sondern der Dekan der Fakultät. Wir, die Gäste aus Europa, sitzen ein bisschen weiter entfernt vom wichtigsten Platz, aber noch so nahe, dass der Älteste am Tisch – Habermas’ Kollege von 1967 – direkt neben uns sitzt und uns, begleitend zu seinen Erzählungen von seinen Stationen in Deutschland, fortwährend ins Essen spuckt. Jetzt fängt er wieder an mit Habermas, diesmal in Frageform: »Habe … Si-ie … gesehen« – lange Pause – »Ha-ba-mas Rede für … neunzigste Geburtstag?« Wir müssen das leider verneinen. »Ohohohoho!«, winkt er ab, spuckt dabei noch ein bissl in Richtung unsrer Teetassen und beginnt dann, sich von uns abwendend, vergnügt auf einem Hähnchenknorpel herumzukauen. Wir wenden uns zur anderen Seite, wo Yifan gerade mit frischem Tee heraneilt, um ihn durch die Tischgemeinschaft zirkulieren zu lassen. Wir merken schnell, dass es Sitte ist, immer nur seinem Tischnachbarn vom Tee einzugießen, nicht aber sich selbst, das scheint verpönt. Heute sind mehrere Professoren, die ansonsten nicht in die Organisation vor Ort eingebunden sind, sowie einige ausgewählte Studenten mit zum Essen gekommen und ich vermute, dass das heute eigentlich das große Kennenlernessen mit den wichtigen Leuten hätte werden sollen. Neben allen Organisatoren und akademischen Honoratioren, wie dem Dekan, sind auch einige Deutschkundige der Fakultät eingeladen, die allerdings eher maskottchenhaft wirken, wie der Habermas-Verehrer zu unserer Rechten. Zu Beginn wurden uns alle mit unverständlichen Namen und als »distinguished professor« vorgestellt. Einer distinguishter als der andere, aber letztlich scheinen sie hauptsächlich fürs Knorpelkauen und Teeschlürfen gekommen zu sein; für uns interessieren sie sich jedenfalls nicht. Doch sind wir wahrscheinlich einfach zu kleine Nummern, eigentlich warten die auf Habermas, nur wird der es vermutlich nicht mehr hierher schaffen. Bei den Studenten verhält es sich ein wenig anders. Sie machen zwar ebenfalls den Eindruck, als hätten sie Sehnsucht nach Habermas oder vergleichbar renommierten Leuten, aber sie sind zumindest interessiert und vergleichsweise gesprächsfreudig. 48 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
Außerdem moderiert Yifan ganz ausgezeichnet. Im Lauf des Gesprächs stellt sich heraus, dass auch einige der Studenten das eine oder andere Semester in Deutschland verbracht haben. Ihr Deutsch ist deutlich besser als ihr Englisch und, im Gegensatz zum Habermas-Maskottchen, auch nicht mehr auf dem Stand von 1967. Wir plaudern ein wenig, bis sich einer der Studenten – der sich als Qi vorstellt und der auf eine zurückhaltende Weise bossig wirkt, womöglich weil er im Unterschied zu Yifan nicht dafür bezahlt wird, sich um uns zu kümmern – unvermittelt nach vorn lehnt und mich aus heiterem Himmel fragt, wie ich eigentlich die sudetendeutsche Frage in Baden-Württemberg nach 1946 bewerte. Ich bin perplex und muss einen lauten Lacher unterdrücken. Das ist ein Scherz, oder? Nein, tatsächlich hat Qi Geschichte in Tübingen studiert und sich dort – zunächst aus Interesse, später für eine Hausarbeit – mit der sudetendeutschen Frage auseinandergesetzt. Ich versuche, die Peinlichkeit, als deutscher Professor darüber deutlich weniger zu wissen als ein chinesischer Student, mit Eloquenz und Witz zu umschiffen, es gelingt mir jedoch nicht. Schon sind wir beim Unterschied zwischen Schwaben und Badensern angelangt und auch bei diesem Aspekt wartet Qi mit profundem Detailwissen auf. Zunächst korrigiert er mich, auf keinen Fall von Badensern, sondern stets von Badnern zu reden. Seine Fähigkeit, diesen Unterschied in einer fremden Sprache so exakt klanglich herauszuarbeiten, begeistert mich, ebenso sein darüber hinausgehendes Wissen zu den kulturellen Unterschieden zwischen den süddeutschen Volksgruppen. Er rekurriert bei seinen Erläuterungen vor allem auf das Kriterium der Gemütlichkeit, was mir sehr plausibel erscheint. Während die Schwaben sehr sparsam und in ihrem Sparen eher verkopft und etwas unlocker seien, pflegten die Badner tendenziell eine Gemütlichkeit, die – da muss ich gleich zustimmen – sonst eher mit den Bayern in Verbindung gebracht werde. Ich komme aus dem Staunen kaum heraus und lasse mir am Ende unserer Unterhaltung noch ein Spätzlerezept erklären, von dem Qi behauptet, es sei kinderleicht. Ich zweifle nicht daran.
49 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
Von der Distinguished-Fraktion kommt nichts Verwertbares mehr. Nachdem Yifan ein letztes Mal den Tee nachgefüllt hat, verabschieden sich die ersten und allmählich löst sich die Tischgesellschaft auf. Einige schütteln uns die Hände, aber ich bin mir unsicher, ob das allgemein üblich ist oder bloß ein Entgegenkommen uns Westlern gegenüber. An diesem Abend liege ich mit einer etwas grüblerischen Stimmung im Bett; heute hat mich besonders viel verwundert. Trotzdem liege ich ganz entspannt. Draußen ist es schon wieder unfassbar heiß, der Taifun hat nur kurze Linderung verschafft. Ich weiß immer noch nicht so richtig, was die eigentlich von uns wollen. Am nächsten Tag haben wir den Vormittag frei, bevor Daniel mit seiner letzten Kant-Vorlesung weitermacht, und wir nutzen die Zeit, um mit Yifan ein bisschen durch die Stadt zu gehen, der uns pflichtschuldig herumführt. Zum ersten Mal fahre ich UBahn in Shanghai. Auf den Bahnsteigen stehen extrem viele Menschen dichtgedrängt und wenn sich die U-Bahn-Türen öffnen, drückt einen die hineinströmende Masse mit ins Wagenteil. Wenn es darum geht, in die U-Bahn zu pressen, entwickeln auch die zierlichen Chinesen eine wahnsinnige Kraft, gegen die man sich bewähren muss. Da reicht es nicht, bloß einen Kopf größer als die meisten hier zu sein, ebenso wenig, das Doppelte auf die Waage zu bringen. Das sorgt nur dafür, dass die Leute uns häufiger anstarren und manchmal sogar anfassen. Als wir nun in der U-Bahn stehen, zuppelt eine kleine Frau an meinen Beinhaaren, mutmaßlich angelockt von der womöglich ungewohnten Beinbehaarung und vom blauen Kinesiotape, das die kurze Hose freilegt und das über meinen gesamten Unterschenkel bis übers Knie hinaufreicht. In einer U-Bahn-Station in der Stadtmitte schlendern wir ein wenig umher, denn sie beherbergt eine ganze Einkaufspassage mit Buch- und Kunstläden. Dort fallen mir im Zwischengeschoss große Plakate auf. Sie zeigen kunstvoll gestaltete Bilder und Symbole aus der chinesischen Landschaft und Kultur, und sie tragen den englischen Titel »Socialist Core Values«. 50 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
Große Schriftzeichen, die mir natürlich nichts sagen, nehmen fast die Hälfte des Bildes ein. Das seien Poster der Regierung, die die Chinesen beim Gang zur Arbeit daran erinnern sollen, was wirklich wichtig sei, erklärt uns Yifan. Dann übersetzt er uns auch einige der Zeichen, sie stehen für Dinge wie Gerechtigkeit, Frieden, Solidarität. Freiheit ist nicht darunter, wie Yifan, der über Adorno promoviert, aus eigenem Antrieb hinzufügt. Mir kommt das alles merkwürdig vor. Ich muss an München denken und an die U-Bahn-Station an der LMU. Da gibt es Schaukästen und Tafeln für die Leute von der Kunstakademie, in denen sich vornehmlich die Kunst-Studenten selbstverwirklichen. Kurz vor meiner Abreise nach China ist mir dort eine schwarze Tafel aufgefallen. Auf der Tafel stand eine begriffliche Trias, nicht in minimalistischer Verfremdung oder in stylischer Designschrift, sondern schludrig mit Kreide hingeschrieben: »Barmherzigkeit, Warhaftigkeit, Nachsicht«. Da hat die Freiheit also ebenso gefehlt. Es kann natürlich sein, dass sich die Freiheit, obwohl ungenannt, gerade darin zeigen soll, Wahrhaftigkeit falsch zu schreiben oder überhaupt irgendetwas so hässlich und ungeordnet hinzukritzeln. Wir würden uns dann auf die Kunstfreiheit berufen und auf den vordergründig beruhigenden Gedanken, dass es sich dabei ja immerhin nicht um staatliche Propaganda handele. Und weiter? Träger der Kunstakademie ist ja auch der Staat. Und dann: Wird Unsinn wirklich besser, wenn er von privater Hand verzapft wird? Wir sind mittlerweile wieder an die Oberfläche getreten und biegen nun auf die East-Nanjing-Road ein. Die brütende Hitze und der Geruch von tausend Wet Markets und Fressständen schlagen uns entgegen.
51 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
Staatliche »Socialist Core Values« in der U-Bahn von Shanghai vs. Gekritzel der Kunstakademie in der Münchner U-Bahn-Station Universität
52 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
53 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
Sieben A simple man
»Do they also have duck?« – Für einen Moment drohen Yifans Gesichtszüge zu entgleisen, doch augenblicklich ist er wieder gefasst: »Yes, I think so. I can order duck for you«, sagt er zu Daniel. Yifan ruft die Kellnerin herbei, die bei unserem Betreten des Restaurants ebenfalls für einen Moment ganz perplex war – weil da plötzlich ein Trupp verschwitzter Westler in der Tür stand, die beim Übertreten der Klimaschranke zwischen dem feuchtheißen Shanghai und dem auf Schlachthaustemperatur heruntergekühlten Gastraum sogleich zu dampfen begannen. Uns ist durchaus bewusst, wie grob, unkultiviert und nahezu viehisch wir auf die Chinesen manchmal wirken müssen und wie gut sie es verstehen, sich auch nicht den leisesten Anflug von Widerwillen anmerken zu lassen. Da ist immer nur dieser verschwindend kurze, erste Moment der Irritation, in dem sich der Unterschied zwischen ihnen und uns offenbart und sich ein kleiner Graben auftut zwischen China und dem Westen. Bevor dieser sich jedoch zu einer Schlucht vertiefen könnte, fangen sich die Chinesen stets wieder. Wie so vieles, das mir hier begegnet, ist auch dies ambivalent zu sehen: Einerseits hat man das Gefühl, alle Spontaneität sei ihnen aberzogen worden, die seien nicht authentisch. Andererseits aber hilft diese Art der höflichen Zurückhaltung über viele Schwierigkeiten hinweg und ermöglicht daher oft erst die Interaktion mit uns Westlern. Yifan hat diese Verhaltensweise perfektioniert. Ihm ist seine Verwunderung über unsere Grobheit fast niemals anzusehen und seine Spontaneität setzt er nur selten und dann sehr dosiert ein. Vielleicht könnte man es positiv formulieren, indem man sagt, dass er sich sehr gut im Griff hat, 55 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
was allerdings sicherlich auch Teil seiner Arbeitsbeschreibung ist. Denn Yifan ist ein wahres Faktotum, und mittlerweile auch mein erster Ansprechpartner, nachdem mein persönlicher Assistent nach einem kurzen Dienst zu Beginn der Summer School verschwunden ist. Ich hatte mich mit ihm ohnehin nicht wirklich verständigen können, nun hat er sich laut Yifan aufs Land abgesetzt. Das klingt nach einer Schutzbehauptung, ich weiß aber nicht genau wofür – und will das sicher auch nicht wissen. Yifan übernimmt fortan die Aufgaben meines Assistenten mit der gleichen bemerkenswerten Gelassenheit wie seine übrigen. Der Service, den uns die Fudan-Universität in Form von Yifan bietet, kann gar nicht hoch genug gewürdigt werden. Er steht uns mehr oder minder 24 Stunden am Tag zur Verfügung, begleitet uns überall hin, erklärt Dinge, zeigt Wege, erfüllt Wünsche und bestellt uns in den Restaurants das beste Essen, das ich je gegessen habe. Aber selbst bei Yifan könnte es noch eine andere Seite geben, denn der nette Yifan begleitet uns eben überall hin und wir wissen, dass er von der Uni bezahlt wird. Wofür genau, wissen wir nicht. Unsere Kellnerin hat die höfliche Zurückhaltung nicht im gleichen Maß perfektioniert wie Yifan. Sie war bei unserer Ankunft sichtlich irritiert und für ein paar Sekunden schien sie wie gelähmt, bis Yifan und die anderen Chinesen hinter uns ebenfalls das Lokal betraten. Da lösten sich ihre Gesichtszüge sofort, ihre Augen begannen zu funkeln, fast als gäbe es da ein geheimes Einvernehmen zwischen den Chinesen, dass ein paar Westler im Restaurant schon in Ordnung gehen, solange ein Einheimischer dabei ist und aufpasst. Oder als gäbe es da eine Art Gleichgewicht, das wieder gewahrt war, als die chinesische Begleitung sich zeigte. So sachte nun also der Anflug von Irritation bei Yifan auch gewesen war, Daniel hat ihn bemerkt. Deshalb fragt er wegen seines Wunsches nach Ente doch noch einmal nach: »Did I do something wrong? Don’t you eat duck here?« »Yes, we eat duck in China«, antwortet Yifan. In netten Worten – diplomatisch, aber bestimmt – erklärt er uns, dass das
56 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
regional verschieden sei und dass die Ente vor allem in der Region um Peking beliebt sei. »Yes, we know that in Germany, it’s called Peking Duck!«, fällt ihm Daniel ins Wort, um dann halb in Yifans, halb in meine Richtung weiterzureden: »With the crispy skin and … was heißt nochmal Pfannkuchen auf Englisch?« Ich weiß nicht, worauf er hinauswill – und weiß auch gerade nicht die Antwort auf seine Frage; in meiner Not versuche ich es mit »very slim cake«. »Yes, yes«, sagt Yifan, und langsam glaube ich, dass er auch nicht mehr weiß, worum es geht. Im Vergleich mit Donnerstagabend haben sich die Verhältnisse verkehrt. Am Donnerstag haben wir noch diesen grob-monströsen Nachtisch gegessen, von dem uns die Chinesen erklärt haben, sie hielten ihn für Crème brulée, und jetzt erklären wir den Chinesen, was wir für PekingEnte halten. Die Gemeinsamkeit besteht darin, dass beides gleichermaßen an der Sache vorbeigeht, aber wenigstens der Versuch einer Vermittlung unternommen wird. Ist ja auch schon was. Um endlich das Problem mit der Ente aufzuklären, führt Yifan nun aus, dass wir uns in einem quasi-mongolischen Restaurant befinden – also, soweit ich das verstehe, nicht so richtig Mongolei, aber so ähnlich und zu kompliziert, um es uns zu erklären. Und in der mongolischen Küche gebe es eigentlich keine Ente, auch wenn die hier auf der Karte stehe. Es sei also schon okay, wenn wir unbedingt Ente essen möchten, aber die eigentliche Spezialität der Mongolei sei Lamm, und wenn wir einverstanden wären, würde er uns das gern in verschiedenen Zubereitungsarten bestellen. Wir sind einverstanden, die Ente für Daniel gibt es trotzdem. Beim Bestellen der Getränke kommt es zu einer neuerlichen Irritation. Als Ergänzung zum obligatorischen Jasmintee bestellen Daniel und ich Bier und als wir uns zwischen small und large für large entschieden haben, merkt Yifan, dass wir beide je eines wollen. Jetzt huscht fast ein Entsetzen über sein Gesicht. Wie jemand allein einen halben Liter Bier trinken kann, geht über seine Vorstellungskraft. Ich glaube, »allein« findet er schon 57 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
komisch, den »halben Liter« dazu unbegreiflich. Um unser Verhalten ins rechte Licht zu rücken, erzähle ich ihm von der Einheit »Maß Bier«, die beim Oktoberfestbesuch so bedeutsam wird. Ich lasse ihn diesen Terminus technicus mehrmals aufsagen, wobei ich besonderen Wert auf die Betonung »Mass« statt »Maaß« lege und ihm auch erkläre, dass Maß Bier für den echten Bayern eigentlich ein Wort ist – »Massbier« – und deshalb unbedingt zusammen ausgesprochen werden muss. Gerade als das Bier an den Tisch gebracht wird, erzähle ich ihm, dass es da Leute bei uns in München gibt, die vier oder fünf von diesen Massbier hintereinander trinken. Yifan scheint schon der Gedanke Übelkeit zu bereiten. Als ich dann die ersten tiefen Schlucke vom abermals hervorragenden chinesischen Bier trinke, erwische ich mich beim Gedanken, ich hätte soeben etwas Wertvolles zum Austausch der Kulturen beigetragen. Was für ein Unsinn! Mein Gehirn scheint diesen steten Wechsel von Hitze und Kälte nicht gut zu verkraften. Sie haben uns hier bis in die Nähe des Gefrierpunkts heruntergekühlt und der Schweiß, der die Rückseite meines Hemds durchnässt hat, beginnt allmählich zu kristallisieren. Ich denke an Mandelentzündung mit schwerem Verlauf, aber was will man machen. Trotz der gefühlten Minusgrade schwitze ich immer weiter. Das Essen ist großartig. Zu unserer Überraschung beginnt es mit etwas Süßem: einer milchig-trüben Suppe, in der wieder eine von diesen roten Beeren schwimmt, die in fast allen hiesigen Gerichten zu finden sind. Sie schauen so ähnlich aus wie diese Goji-Beeren, die die BWLer der Systemgastronomie bei uns auf den Basmati-Reis setzen, aber die chinesischen Beeren schmecken glücklicherweise nicht so bescheuert und kleben sich auch nicht so penetrant in die Zähne. Auf die Suppe folgen drei Türmchen, gebaut aus süßlich-schärflich marinierten Palmherzen, ehe weitere Suppen serviert werden, darunter eine mit dicken, bissfesten Nudeln, die anscheinend aus Kartoffeln gemacht sind. Obwohl der Tisch bereits zu Dreivierteln mit Speisen bedeckt ist, bringt die Kellnerin immer neue heran. So folgen die ersten Lammfleisch-Gerichte, schmackhafte Eintöpfe mit Kreuzkümmel und Kurkuma, die orientalisch wirken. Heiß58 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
dampfend serviert, wärmen sie uns in diesen Schlachthaustemperaturen wieder auf. Das Highlight kommt zuletzt: Eine Platte, auf der Lammfleischstücke liegen, vorportioniert, mit Fett und Knochen. Das Lamm schaut blass aus, ist offenbar gänzlich anders gegart worden, als das gewöhnlich in Deutschland geschieht. Es ist äußerst zart, schmilzt geradezu auf der Zunge und schmeckt so intensiv nach Lamm, wie ich das noch nie geschmeckt habe. Meine Gesichtszüge entgleisen vor Wonne. Das Einzige, was hier noch an unsere Küche erinnert, ist das unsinnige, angetrocknete Petersiliensträußchen, an dem das Lamm angerichtet ist. Das lässt mich kurz schmunzeln. Yifan erklärt uns, dass wir uns in einem chinesischen Staatsrestaurant befinden. Überall in China gebe es solche staatlichen Restaurants, die jeweils eine bestimmte chinesische Region repräsentieren, aus der auch die verwendeten Zutaten stammen. Der Staat sorge dafür, dass die Produkte zuverlässig frisch in die Restaurants geliefert werden. So bekomme dieses Restaurant beispielsweise sein Lammfleisch täglich aus dem Nordwesten Chinas geliefert, wo noch heute Nomaden und Hirten leben, die sich hauptsächlich von Eintöpfen mit Kartoffeln und Lammfleisch ernähren. Daher bekomme man in ganz China die verschiedensten regionalen Spezialitäten in einer Qualität, als sei man in der jeweiligen Region vor Ort. Daniel ist während des Essens sichtlich unentspannt, stochert nervös in den Schüsseln und auf den Platten herum. Um ihn an meiner Begeisterung teilhaben zu lassen, nötige ich ihn, ein Stück Lamm zu probieren. Er verzieht das Gesicht und ich ärgere mich darüber, weil er mir vorkommt wie ein bockiges Kind. Muss er denn den ungehobelten Eindruck noch verstärken, den wir ständig und überall machen? Mir selbst tut es leid, wann immer ich zu diesem Eindruck beitrage – aber ich kann ja nicht aus meiner Haut. Ich werde nicht mehr zum Chinesen, auch wenn ich noch so gut die Stäbchen handhabe, alles probiere, was man mir vorsetzt, und sogar versuche, die chinesischen Popsongs mitzusingen. Aber muss man seine Fremdheit so betonen, indem man beim Essen auch noch das Gesicht verzieht?
59 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
Leicht gereizt – und also auch vom Gemüt her offenkundig kein Chinese – frage ich ihn, was denn los sei. »Mir schmeckt das Lamm zu lammig.« Die Antwort ist irgendwie blöd, aber nicht unplausibel. Mein Schlichtungsversuch besteht in der These, dass man zwar grundsätzlich kein Lamm mögen muss, dass man aber, wenn man Lamm mag, dieses Lamm hier besonders mögen muss. Da er bei diesem Konsens nichts zu verlieren hat, willigt er ein. Doch auch mit seiner extra georderten Ente, der er sich daraufhin wieder stochernd zuwendet, scheint er nicht vollends zufrieden. Erst nach der zweiten Runde Bier rückt er endlich mit der Sprache heraus. Als Kind sei er in seiner Heimatstadt Dortmund einmal in einem chinesischen Restaurant gewesen und dort habe er frittierte Ente in einem frittierten Blätterteig-Nest gegessen, was ihm vorzüglich geschmeckt habe und eine seiner liebsten Erinnerungen sei. Mit dieser Vorstellung sei er nun nach China gereist und seine Vorfreude sei überall enttäuscht worden: hier beim Quasi-Mongolen, ebenso beim kantonesischen Lieferdienst und erst recht in all den Restaurants mit lokaler Küche, die ja durchgehend leicht und mediterran sei. Die Diskussion greift jetzt auf den restlichen Tisch über und die Chinesen, die selbstverständlich niemanden bloßstellen wollen, zeigen großes Verständnis für die Enttäuschung des Kollegen. Ich dagegen bestehe darauf, dass es unsinnig sei, Frittiertes auf Frittiertem zu servieren; das sei der typische Fehler in Deutschland, wo man sonst immerzu Weichgekochtes auf Weichgekochtem serviert. Hildi, die ebenfalls dabei ist, pflichtet an dieser Stelle entschieden bei. Der Kollege sieht es irgendwo ein, kann aber seine Präferenz natürlich trotzdem nicht von jetzt auf gleich verändern. Auch wenn er das Argument – selbstredend als Kantianer –rational nachvollziehen kann, kann er doch nicht aus seiner Haut. Aber da geht es mir ja nicht anders und es geht vielmehr jedem so und das ist, wie stets, eine melancholische Erkenntnis. In einem Tonfall, der zwischen Resignation und Selbstbekräftigung schwankt, sagt er: »You know, I’m just a simple man. I want what I want.« 60 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
Ich esse weit über meinen Hunger und doch muss ich es am Ende, wie stets hier, nicht bereuen: Alles ist ausnehmend bekömmlich und ich habe mich nicht überfressen. Die Rechnung für den gesamten Tisch übernimmt Yifan mit seiner Universitätskreditkarte. Aus Interesse frage ich ihn, wie hoch sie ist: umgerechnet etwa 80 Euro für mehr als ein Dutzend Speisen höchster Qualität, dazu noch unsere Biere. Von einem solchen Betrag könnte man sich in München höchstens ein unspektakuläres Abendessen leisten, mit einer einzigen weiteren Person: zwei Portionen Schweinsbraten, Nachtisch und eine Flasche Wein. Vor dem Restaurant versammeln sich unsere chinesischen Begleiter zum Rauchen. Mit einem Schlag ist es wieder mindestens 20 Grad wärmer, der Schweiß beginnt sogleich zu rinnen, dank reichlich Essen und Bier noch ergiebiger als zuvor. Wenigstens brauche ich mich nicht mehr vor einer Mandelentzündung zu fürchten, denn mein eiskalter Rücken wird nasswarm binnen Sekunden. Dass seine chinesischen Kollegen rauchen, scheint Yifan zu missfallen, er schaut sie böse an; aber als er unser Interesse bemerkt, fragt er uns, ob wir mitrauchen wollen. Erst will ich reflexhaft abwiegeln, lasse mir dann aber eine der chinesischen Zigaretten geben, an die ich zuletzt häufiger denken musste, seit ich meine Wahl der ordinären Westzigarette in der Sturmnacht so bereut hatte. Es handelt sich um eine dünne, gleichsam grazile Zigarette mit einem gelbgrünen Filter, und entsprechend gelbgrün ist auch die Packung gehalten, mittig eine Blüte und darüber rote Schriftzeichen. Ich schaue auf die dampfende Straße und nehme einen vorsichtigen Zug. Der Rauch schmeckt süßlich, nach Nelke und Jasmin, sein Wölkchen hüllt meinen Kopf ein. Wo ich stehe und schwitze habe ich für einen kurzen Moment vergessen. Nun wage ich, zum ersten Mal seit meinem siebzehnten Lebensjahr, wieder einen vollen Lungenzug. Der Hustenreflex ist sehr schwach und beim zweiten Zug verschwunden. Sanft zieht der Rauch durch die feinen Verästelungen meiner Lunge. »A simple man«, denke ich, lache ein wenig und puffe Daniel neckisch in die Seite. Mein Ärger ist verflogen. 61 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
Am nächsten Tag hält Daniel seine letzte Kant-Vorlesung. Ich habe von ihm den Auftrag bekommen, ein paar Fotos für seine Familie zu machen, wie er vorm chinesischen Auditorium vorträgt. Das erledige ich gleich zu Beginn, denn ich bin vom gestrigen Abend noch verkatert; leicht nur, weil wir hier insgesamt viel weniger Alkohol trinken und dazu besser essen als in Deutschland, andererseits doch merklich, weil mir die Hitze nach wie vor zu schaffen macht. Sie lässt auch nachts nie richtig nach und ich schlafe deswegen schlecht. Nachdem ich ein paar anständige Fotos mit meinem Smartphone gemacht habe, gehe ich zu meinem Platz in der zweiten Sitzreihe und massiere mir ein wenig die Schläfen. Dann checke ich kurz mein Whatsapp, das nur hier im Uninetz richtig funktioniert, und auch noch mein Tinder, auf dem ich einen Haufen roter Dinger habe. Dem kann ich jedoch jetzt nicht nachgehen – jetzt ist Kant – und so lege ich mein Smartphone zur Seite. Wie es sich für eine Abschlussvorlesung gehört, setzt der Kollege heute zum ganz großen Bogen an. Es geht darum, all die Fragen zur Freiheit bei Kant, die er in den letzten Tagen aufgeworfen hat, einer großen Antwort zuzuführen. Das kann, soviel habe sogar ich als Hegelianer geahnt, nur mit einem Blick auf Kants Gesamtwerk geschehen. Und genau das ist die heutige Perspektive. Sein Auftreten ist zwar ein wenig hemdsärmelig – im wahrsten Sinne des Wortes: kurzes Hemd, Schweißflecken unter den Achseln – inhaltlich aber traumwandlerisch sicher, einfach und bestimmt. Ob ich mit meinem eigenen Auftritt in ein paar Tagen auch dieses Niveau erreichen werde – oder werde ich bloß genauso stark schwitzen? Wieder gehen wir mit Kant von zwei Welten aus. Die erste ist die empirische Welt, die durch und durch determiniert ist, in der alles vorherbestimmt und daher keine Freiheit möglich ist. Mit dieser Welt geben sich tatsächlich die meisten unserer Zeitgenossen zufrieden, sie unterscheiden sich höchstens darin, ob sie den Grund der Determiniertheit in Psychologie, Biologie, Ökonomie oder irgendwelchen modischen Sachzwängen sehen. Bei Kant aber gibt es noch eine zweite Welt, die intelligible Welt. Sie ist mit rein theoretischen Mitteln nicht zu ergründen, wenn62 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
gleich sich einsehen lässt, dass diese Welt denknotwendig ist und nur sie die Freiheit ermöglicht. Freiheit ist also, so könnte man Kants Grundeinsicht abkürzen, nicht von dieser Welt, ohne dass man sie deshalb gleich vollständig dem lieben Gott überlassen muss. Vielleicht ist das Kants großes Verdienst: Einen Rest vom metaphysischen Zauber noch in unsere, je nach Blickwinkel: verkommene oder aufgeklärte, Moderne gerettet zu haben? Was sonst hätten wir hier verloren? Verknüpft, so führt der Kollege weiter aus, sind beide Welten durch den kategorischen Imperativ, der uns einerseits die Wirklichkeit unserer Freiheit erkennen lässt und andererseits diese Freiheit durch seine Befolgung erst ermöglicht. Um uns dieses asymmetrische Verhältnis zu erläutern, wandern seine Gedanken durch Erkenntnistheorie, Ethik und Rechtsphilosophie. Im Zentrum steht dabei das spezifisch Kantische Verständnis von Autonomie: Wie kann ich einem allgemeinen Gesetz, nämlich dem kategorischen Imperativ, unterworfen sein, und gleichzeitig, indem ich dieses Gesetz befolge, frei und selbstbestimmt sein? Am Ende seines Vortrags macht er alle Türen wieder zu, die er in den letzten Tagen aufgestoßen hat. Ich bin begeistert, überlege, unmittelbar nach dem Vortrag zu applaudieren, aber das machen die Chinesen immer erst ganz am Ende, nach den Fragen aus dem Publikum. Diese sind leider großteils unsinnig und lassen darauf schließen, dass die meisten Zuhörer schon vor dem ersten Satz aus dem Vortrag ausgestiegen sind, geschweige denn die ganze Reise mitgemacht haben. Der Kollege gibt sich größte Mühe, bei manchen Fragen nicht die Fassung zu verlieren. Aber wir können das nicht so gut wie die Chinesen. Ein ulkiger Opa mit Jogginghose aus der ersten Reihe darf die Abschlussfrage stellen: »Do they also have luck?« Ich lache laut los, tarne das aber ziemlich geschickt als Hustenanfall, ein paar Chinesinnen müssen kichern. Jetzt weiß natürlich niemand, was er mit »they« meint oder mit »luck«. Nach zäher Nachfragerei stellt sich heraus, dass »they« Kant ist und »luck« Glück. Er will also wissen, ob es bei Kant einen Begriff von Glück gibt. Mein Kollege nimmt sich diese Frage sichtlich zu Herzen und bemüht sich 63 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
auf eine fast rührende Weise um eine Erklärung. In diesem Fall erklärt er sehr diplomatisch, dass Kant Glück zwar kenne, aber für moralisch irrelevant halte. Ich halte das für ein gutes Schlusswort und auch im Publikum wird vielfach genickt, damit können sie wohl etwas anfangen. Draußen diskutieren wir noch mit dem Dekan und Shuangli, die die Summer School mitorganisiert. Sie ist unzufrieden mit dem Vortrag und versucht, das auf eine übernette Art auszudrücken. Es sei doch sehr unüblich in China, über mehrere Werke eines Autors in einer Vorlesung zu sprechen. Das habe die chinesischen Studenten überfordert und auch in der Sache die metaphysischen Zusammenhänge verdunkelt. Parallel zur Kritik versucht sie, wie um die Ehre der Einheimischen zu retten, eine tiefschürfende Debatte über irgendwelche Details von Kants Moralphilosophie zu starten. Das wiederum überfordert den Kollegen, der schließlich gerade seine achte Vorlesungsstunde in brütender Hitze hinter sich gebracht hat. Er gibt sich geschlagen. »I’m just a simple man«, sagt er, diesmal als eine Art Beendigungstatbestand. In ihrem Gesicht flackert ein leicht überhebliches Grinsen auf. Dann verabschiedet sie sich mit der Ankündigung, ganz »unfortunately« nicht zu meinen Vorlesungen kommen zu können, obwohl sie sich ja eigentlich ungemein für Hegel interessiere. Ich reiche Daniel eine grüne chinesische Zigarette und wir rauchen wortlos im die brütende Hitze durchschneidenden Dauergeschrei der Singzikaden aus den Bäumen um uns herum.
64 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
Acht Right?
»Self-Consciousness, the German Selbstbewusstsein«, sagt Roland und macht eine langgezogene Pause. Er führt die Hand an sein Kinn, legt seinen Daumen neben dem rechten Mundwinkel, seinen Zeige- und Mittelfinger neben dem linken ab. Er verharrt nun einige Zeit in dieser Pose, sein Blick ist starr und geht durch das Publikum hindurch. Er könnte einem tiefen Gedanken nachhorchen oder ebenso gut den Faden verloren haben. Die Unbestimmtheit macht einen melancholischen Eindruck. Dann fährt er fort: »Self-consciousness, according to Fichte, is infinetly undetermined, in German: ›unbestimmt‹.« Dabei zeigt er auf ein Tafelbild, das er vor ein paar Minuten angezeichnet hat, ohne es bislang zu erklären: »S|S« steht dort. Er zieht einen Pfeil vom rechten S auf das linke S und erläutert wie folgt: »In order for a subject to acknowledge itself, it has to distinguish itself from itself, creating two subjects: S and S. Then, in order to compare these two subjects with each other, there must be a third one, and so on. So it follows,« sagt er und streicht die Trennlinie zwischen den beiden S durch, »that there is no determinate version of a subject. It refers to an infinity of itself.« Noch einmal greift er sich ans Kinn und schaut eindringlich durch uns hindurch in die metaphysische Ferne. Ich betrachte sein fein säuberlich über den dünnen Bauch gespanntes weißes Hemd und seine hellgrünen Hosenträger, denke mir: ein cooler Stil. Seine Augen fokussieren etwas, jetzt scheint er uns wieder zu sehen, anzusehen gar. »Right?«, schließt er. Das ist sein österreichisches Oder; keine Frage, eher eine Bestätigung. Auf der Tafel steht jetzt STS und ich muss an die Band denken, an Großvater oder Fürstenfeld, und ein starkes Gefühl von Heimat überkommt mich. Dabei komme ich doch gar nicht aus Österreich. 65 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
Doch meine Gedanken wandern, wohin sie wollen, während ich meine Hose zurechtzupfe, die mir schweißnass an den Knien pappt. Merkwürdig, dass mir das Österreichische in der Fremde einen solchen Halt geben kann! Mein Blick haftet wieder auf der Pose des Vortragenden. Er schaut mich an und sagt: »Right?« Ich habe allerdings nicht mitbekommen, worauf sich das diesmal bezieht. Unser österreichischer Kollege Roland stieß einen Tag nach unserer Ankunft, ganz in der Früh, zu uns dazu. Allein aufgrund seiner Nationalität freute ich mich auf ihn. Es war doch beruhigend, dass unser Team Europa, das bislang nur aus Daniel und mir bestanden hatte, Verstärkung bekommen sollte. Denn an unserem ersten Tag hatten wir ausschließlich Chinesen gesehen, sei es im Hotel, auf der Straße, an der Uni; und meist waren sie noch in Gruppen unterwegs, sodass wir zwei Europäer uns ein wenig verlassen vorkamen. Die chinesische Dauerpräsenz, die in China natürlich keine Überraschung sein konnte, hatte uns doch ziemlich eingeschüchtert und war allgegenwärtig wie die Schwüle der Stadt, die uns selbst in die auf 18 Grad herunterklimatisierten Innenräume verfolgte. Nichtsdestoweniger war ich nun doch bestürzt, wie schnell ich in die Kategorien von »wir« und »die« hineingeraten war, dass ich mich als Deutscher nach anderthalb Tagen schon so stark nach der Gesellschaft eines Österreichers sehnen konnte. Die erste Begegnung ergab sich dann direkt nach dem Frühstück am zweiten Tag, als ich mit dem Daniel in der Hotel-Lobby wartete, wo uns unsere persönlichen Assistenten abholen wollten. An jenem Tag war nämlich der offizielle Beginn der Summer School und zudem wollte man uns eine erste Führung über das Uni-Gelände geben. Zwischen Daniel und mir war bereits Hektik ausgebrochen: Wo sollten wir auf unsere Assistenten warten? War es früh um neun wirklich schon so unfassbar heiß draußen, wie es uns ein Vorfühlen im nicht klimatisierten Windfang hat vermuten lassen? Und wie weit war die Uni entfernt, würden wir überhaupt laufen müssen? Schließlich waren wir uns auch über die Kleiderordnung uneins: Während Daniel 66 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
ganz leger – kurze Hose, kurzärmeliges Hemd – unterwegs war, hatte ich mich in Hemd und Jackett gekleidet, die ich beide schon im Frühstückssaal durchgeschwitzt hatte. Tatsächlich war ich, wie sich zeigen sollte, deutlich overdressed, die chinesischen Professorinnen trugen leichte Sommerkleider, die Professoren Leinenhosen und Kurzarmhemden. In diese Unruhe hinein schlappte auf einmal, ganz relaxed, ein wenig wie in Zeitlupe, ein netter Kerl aus Wien. All unsere Hektik wurde mit einem lakonischen »Grias de« beiseite gewischt. Unsere Mahnung, schnell seine Tasche zu holen, weil wir ja gleich – jeden Moment! – abgeholt würden, winkte er lässig ab. Schließlich hatte sein persönlicher Assistent gerade in der Hotelbar »a Melange« bestellt. Er sprach dabei das A lang und hell aus – »Melaasch« – und nicht wie ein O, wie wir das in Deutschland tun. Er erzählte, dass er bis eben mit seinem Assistenten Qi auswärts, in einer Art Cafe hier im Studentenviertel, gefrühstückt hätte und bereits um fünf Uhr in der Früh gelandet war. Der Flug wäre ein Alptraum gewesen, heftige Turbulenzen, zwischenzeitlich wären Orangensaft und Becher separat durch die Luft geflogen. Das Frühstück sei jedoch fantastisch gewesen. Das »fantastisch« sprach er ganz ruhig, beinahe gelangweilt aus, mit einem weichen T und langgezogenen Vokalen: »fahn-dahsdiesch!« Obwohl das Wort für gewöhnlich ja nicht sehr aussagekräftig ist, war ich sofort davon überzeugt, dass dieses Frühstück tatsächlich fantastisch gewesen sein musste. Dass das Essen in Shanghai immer und überall im echten Wortsinn fantastisch ist, konnte ich am zweiten Tag ja noch nicht wissen, aber aufgrund der Art, wie er das Wort betont hatte, hatte ich schon zu diesem Zeitpunkt keinerlei Zweifel. Sodann kam wieder Nervosität auf, weil unsere Assistenten eintrafen. Wir mussten aufbrechen, zur Campus-Besichtigung und zur ersten Vorstellungsrunde, die laut dem aufwändig gestalteten, futuristischen Flyer eine veritable »Opening Ceremony« sein sollte. Sollten wir nun auf unseren neuen Kollegen warten, bis sein Assistent ausgetrunken und er seine Tasche aus dem Zimmer geholt haben würde? »Na, geht’s ihr doch schon
67 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
mal vor. Der Qi trinkt seine Melange und dann treffen wir uns drüben.« Noch bevor wir antworten konnten, schloss er mit einem wienerischen: »Oder?« Das war entwaffnend. Zwar äußerlich als Frage formuliert, doch untergründig für jeden spürbar eine Ansage. Wir taten, wie uns geheißen. In der zweiten Hälfte seiner Premieren-Vorlesung nehme ich einen kleinen Spannungsabfall wahr. Immer häufiger macht er Pausen, schaut sich fragend im Raum um. Auf den beiden Bildschirmen, die im brandneuen Vorlesungssaal links und rechts hinter dem Podium an der Wand hängen, stehen Fichte-Zitate in englischer und chinesischer Übersetzung. Einige Studenten fotografieren die Bildschirme ab, obwohl er zu Beginn angekündigt hat, die Folien der Präsentation an die Teilnehmer zu verschicken. Zuweilen schließt er Aussagen mit seinem jetzt schon vertraut und typisch klingenden: »Right?« Die Antworten aber bleiben stets aus und irgendwann mischt sich Resignation in seinen Blick. Er scheint enttäuscht, offenbart eine weitere Facette jener Melancholie, die von Beginn an wahrzunehmen war. Seine melancholische Grundstimmung hat allerdings die kokette Überlegenheit eingebüßt, die er sonst ausstrahlt, wenn er lächelnd seine Sätze mit einer Frage beendet, die nur Bestätigung zulässt – wohlwissend, dass ihn der Charme seines Dialekts mit dieser Unverschämtheit durchkommen lässt. Jetzt ist diese charmante Schicht abgeblättert, vielleicht weil er in seiner Rolle als Vortragender stärker auf sein Selbst zurückgeworfen ist als im normalen Miteinander. Seit vielen Sekunden wartet er auf eine Antwort, er schaut nicht mehr durchs Publikum hindurch, sondern schaut uns direkt an. Der Saal ist still, nur das leichte Surren der Klimaanlage ist zu hören. Nach einigen weiteren Sekunden nimmt er die Hand von seinem Kinn. Kurz bevor er dann seine Frage doch selbst beantwortet, wirkt er allmählich verzweifelt. Da er sogleich weiterredet, kann ich diese Verzweiflung jedoch nicht recht fassen. Was ist ihr Grund? Die Enttäuschung darüber, keine Antwort zu erhalten? Das ist doch das tägliche Brot eines 68 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
Professors. Selbstredend ist es umso schlimmer, keine Antwort zu erhalten, wenn man etwas unterrichtet, das einem wirklich am Herzen liegt. Aber auch das kann für einen Professor doch nicht ungewohnt sein. Vielleicht ist es in der Philosophie besonders schmerzlich, weil wir Philosophie-Dozenten oftmals meinen, die Dinge, die wir unterrichten, hätten jeden anzugehen? Ich kenne das von mir selbst, wann immer ich über Hegel’sche Metaphysik spreche. Ist es für meinen Kollegen nochmals schmerzlicher, weil er gerade über Selbstbewusstsein referiert und die Unmöglichkeit, es rational zu fassen? Ist ihm die ausbleibende Reaktion gar ein Beweis für seine These, es mit einem nahezu sinnlosen Unterfangen zu tun zu haben? Ahnt er in diesem Moment, dass alle Versuche, das Selbstbewusstsein theoretisch einzuholen, fehlschlagen müssen? Die Verzweiflung ist kurz aufgeblitzt, doch seine nächsten Ausführungen schließt er wieder mit: »Right?« Diesmal wartet er kürzer ab, seine Haltung kippt diesmal nicht. Der kurze Verzweiflungsmoment lässt mich dennoch nicht los, die restliche Vorlesung denke ich noch weiter über ihn nach, während ich dem Vortrag nur noch mit einem Ohr folge und nur zuweilen noch mit einem Auge auf die Zitate auf den Bildschirmen schaue. Wenn man nur halb dabei ist, wirkt der Vortrag erstaunlich lasch. Eine Berieselung mit Worten, die weder aus dem Vollen der Wirklichkeit schöpfen noch aus einer anderen, aufregenden Welt stammen. Es ist wenig begeisternd und wirkt eher wie Dienst nach Vorschrift. Freilich mit Pausen, die Tiefgründigkeit suggerieren, und mit Anschauungsmaterial, das dunkel und verworren ist: lange Sätze eines Philosophen, der in einer fremden Sprache kompliziert über alte Probleme schreibt und schon hunderte Jahre tot ist. Alles verlustreich ins Englische übersetzt und in schöne chinesische Schriftzeichen, die bereits viel von ihrem exotischen Charakter eingebüßt haben und auf eine unbegreifliche Weise vertraut wirken. Manchmal folge ich mit den Augen ihrer detaillierten Verschlungenheit. Man kann tief ins Detail hineintauchen, ohne sich zu verlieren, weil jedes Zeichen letztlich überschaubar und endlich bleibt, schön, und dennoch erfrischend pragmatisch. 69 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
Inzwischen dämmert mir aber, dass mein Urteil über die Vorlesung unfair ist. Ich passe ja nur halb auf und bekomme gar nicht mit, falls etwas Wichtiges verhandelt wird. Und dann denke ich in einem Anflug von unmerklicher Euphorie, dass hier selbstverständlich etwas Wichtiges verhandelt wird. Etwas, das uns alle angeht und das jederzeit Melancholie und sogar Verzweiflung rechtfertigt: Denn es geht um die Frage, ob wir selbst eine Sonderrolle in der Welt einnehmen, ob wir selbst, als Subjekte, wirklich so grundsätzlich anders sind als alles andere, dem wir gegenüberstehen können. Auch ohne einen Fichte-Vortrag ist mir intuitiv vollkommen klar, dass das so sein muss. Die Probleme beginnen aber sofort, sobald man dieses Besondere in Worte fassen will. Einer von denen, die es trotzdem versuchten, war Fichte. Der schrieb viel Unsinniges, Überkompliziertes und Absurdes, wie jeder große Philosoph, und irrte sich in fast allen Details. Aber das Großartige an Fichte ist, dass er das wenige Grundsätzliche, was stimmte, geradezu in die Welt hinausschrie und sich niemals davon abbringen ließ, dass Philosophieren eine zutiefst menschliche und ganz wesentliche Tätigkeit ist. Das war ein Enthusiasmus, der heute nur noch in Bereichen denkbar ist, wo es um das große Geld geht. Niemand wird mehr im Namen der Wahrheit oder einer guten Idee wirklich übergriffig. Nicht einmal Roland. Er kann nur fragen, ohne zu fragen. Jetzt werde ich selbst melancholisch. Freilich wäre es vermessen, sich heute für Fichte zu halten – oder für Hegel oder für Kant. Aber von vornherein all das, was Fichte ausgemacht hat, nicht mehr sein zu können, und sich trotzdem für Fichte zu begeistern, ihn sogar in andere Länder zu exportieren, – das scheint mir ein verdammt schlechter Deal zu sein. Nachdem wir am Abend vor seiner Vorlesungspremiere noch groß ausgegangen waren, manche Köstlichkeit gegessen, manches Bier getrunken und viel gelacht haben, fällt das heutige Abendessen karger aus. Wir unterhalten uns immer noch gut, im Großen und Ganzen ist es ein vergnüglicher Abend, aber das spontane und freie Element, das die Zeit unseres Kennenlernens ausgemacht hat, ist verlorengegangen. Den Abend darauf 70 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
trinken wir bloß noch ein kurzes Bier zusammen, dann verabschiedet sich Roland schon zum Rauchen. Wir können ihn durch die Glasfront des Hotels beobachten: Er steht allein im kleinen Rauchereck beim Plastikmännchen, zieht bedächtig an seinen mitgebrachten Lucky Strikes. Am dritten Abend, nachdem er seine letzte Vorlesung gehalten hat, sehen wir ihn gar nicht. Sehr spät schickt er uns eine kurze Nachricht, dass er mit Qi eine Runde in der Stadt dreht. Beim Frühstück tags darauf sehe ich ihn allein über einer Tasse Melange sitzen, eine englische Zeitung vor sich. Anscheinend hat er sein Frühstück bereits beendet. Er sieht mich, reagiert aber bemerkenswert neutral und versucht nicht einmal, eine freundliche Miene aufzusetzen. Er grüßt mich, aber so, als wären wir Fremde. Je nachdem, welchen Maßstab man anlegt, sind wir das natürlich auch, aber sein Verhalten steht in krasser Diskrepanz zu dem jovialen Ersteindruck, den er anfangs auf uns alle machte. Da erinnerte er mich noch an die Heimat, obwohl wir uns überhaupt nicht kannten – jetzt kennen wir uns ein bisschen und er ist ein Fremder geworden. Ich setze mich trotzdem zu ihm; ihn scheint es zumindest nicht zu stören. Wir kommen ein bisschen ins Gespräch und er erzählt von seinem Abend in der Stadt. Bei Sonnenuntergang waren Qi und er im Oriental Pearl Tower, wo man auf Glasplatten hoch über dem Bezirk Pudong gehen kann. Die Aussicht, so schließt er, sei fantastisch gewesen. Mich freut es, gerade dieses Wort von ihm zu hören. Er spricht es immer noch weich aus, doch es trägt nicht mehr diese unmittelbare Überzeugungskraft in sich. Um sie wiederherzustellen, müsste er jetzt wenigstens – wie Fichte – auf den Tisch hauen, mir keine Wahl lassen, als das auch so zu sehen, denke ich mir. Aber in seinem Blick, in seinen Gesten schimmert wieder diese Verzweiflung durch. Als ob er resignierte, weil ja doch keine echte Verbindung zwischen uns hergestellt werden kann, weil ohnehin nichts wirklich mitteilenswert ist und der Drang, sich immer wieder ergebnislos mitteilen zu müssen, bloß noch quält. Er bricht dann rasch auf und lässt mich mit meinem Apfelsaft sitzen. Im Aufstehen sagt er noch: »Ich schau schon mal rüber. Wir sehen uns dann bei der nächsten Vor71 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
lesung. Oder?« Ich nicke das selbstverständlich ab. Er geht aus dem Speisesaal, geht etwas langsamer, als das in solch einer Situation normal wäre; es wirkt seltsam unschlüssig. Mich lässt er zurück mit einer gesteigerten Aufmerksamkeit für die Dinge um mich herum. Ich höre ein Klappern, ein Zischen, das Köcheln der Suppen am Buffet, die saugenden Zischgeräusche der leeren Milchschäumer; dazu das Schlürfen, Zuzeln und schleimige Husten der wenigstens hundert einheimischen Gäste im Frühstücksraum. Wenn alles nur äußerlich ist – Geräusch, Gefühl, Empfindung, Sinn –, dann wird es mit dem Selbstbewusstsein schwierig. Aber plötzlich wird mir klar, womöglich zum ersten Mal überhaupt: Nein, im Gegenteil! Es verhält sich exakt anders herum: Mein Selbst ist gerade das Einzige, was mich nicht nervt, das Einzige, was mich nicht von mir ablenkt. Das geistige Refugium gegenüber all dem Blubbern, Brutzeln, Schlürfen und Husten, das alles überhaupt keinen Sinn ergibt! Und es hat ja auch keinen Sinn, weil es nur die Sinne betrifft, denke ich noch, bin aber schon mitten in der Sache. Alles davor, alles danach: Verdeckung des Relevanten. Und das bin ich. Ha! Ich sage etwas in dieser Art und haue zur Bestätigung meiner selbst so fest auf den Tisch, dass ein paar der Hotelgäste verschreckt zu mir herüberschauen. Einem hängt dabei eine nur halb geschlürfte Nudel aus dem Mund. Ich schaue sie an, bestimmt, voller Spannung. »Right?«, sage ich. Die Chinesen nicken mir zu.
72 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
Neun Der neutrale Standpunkt
Ich sitze mit einer bildschönen Chinesin, die sich Jasmine nennt und wohl Ende zwanzig ist, in einer amerikanisierten Bar in der Nähe der Fudan-Universität. Das Mobiliar, insbesondere die Sechser-Sitzecken aus rotem Kunstleder, erinnert an amerikanische Diners, direkt neben dem Eingang steht ein breiter, riesiger Bierkühlschrank mit unzähligen Biersorten aus aller Welt. Das Bier kann man sich selbst herausnehmen und dann an der Kasse bezahlen wie in einem 7-Eleven. Die rechte Seite des Gastraums wird von einer großen Bar eingenommen, an der man bei einer Vielzahl von Barkeepern, die allesamt unbeschäftigt scheinen, Cocktails bestellen kann. Ich war mit meinen beiden Kollegen schon einmal hier, die Cocktailbestellung misslang uns jedoch auf ganzer Linie. Unter einem halben Dutzend Barkeepern war kein einziger, der auch nur ein Wort Englisch sprach; ein erstaunlich häufiges Phänomen in der Gastronomie Shanghais. Mit Händen und Füßen gelang es uns immerhin, einen Whisky zu ordern, mehr war aber nicht drin. Um mir diese Blöße kein zweites Mal zu geben, habe ich für Jasmine und mich zwei Bier gekauft. Aussuchen, zugreifen und zum Abkassieren herüberreichen – da kann auch mit Sprachbarriere nichts schiefgehen. Die Bar wird von einem komischen Publikum bevölkert, was mir allerdings erst auffällt, als ich mit den Getränken zurück an unseren Platz gehe. Da sind zunächst ein paar westlich-chinesische Kombinationen, meist der Mann aus dem Westen, die Frau aus China. Bei diesen Paaren schauen die Frauen immer deutlich besser aus als die Männer. Manche der Männer erinnern an einen bestimmten Typ von Thailand-Tourist, ein bissl schmierig, ein bissl ungepflegt, aber dennoch mit einem ebenso unge73 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
sunden wie anscheinend unerschütterlichen Selbstbewusstsein. Das Gefälle an Geld und Macht ist ebenso groß wie das von körperlicher Attraktivität. Einige jüngere männliche Chinesen, vielleicht Studenten, sitzen vereinzelt in einem der Sitzabteile und trinken einsam ihre ein, zwei europäischen Biere. Manche haben Baseballcaps auf, manche tragen T-Shirts mit kitschigen englischen Phrasen auf dem Niveau von »horses make me happy« oder auch »good vibes only« mit einem großen gelben Stern als i-Punkt. Ich erinnere mich, wie Yifan mir erzählte, dass die chinesischen Studenten keine Bars oder Discos besuchten, sondern nur Playstation spielten und essen gingen – und wie es mir daraufhin nicht gelingen wollte, mir ein Studium ohne Alkohol und Kneipen vorzustellen. Jetzt wird mir klar, dass Yifan nur von den normalen, also den halbwegs erfolgreichen Studenten sprach. Die anderen scheint es nämlich auch zu geben, sie sitzen hier und sie erinnern mich an das komische Dessert, das wir am Taifun-Abend serviert bekamen. Ich frage mich, ob die Chinesen diesen West-Unsinn ironisch auftragen oder ob dahinter eine echte, wie auch immer geartete Sehnsucht steckt. Mir selbst scheinen die einheimischen Kulturangebote viel subtiler, feiner und gschmackiger zu sein als die westlichen Pendants. Aber vielleicht spielt der Reiz des Exotischen mithinein, für den objektive Qualitätskriterien nicht in Betracht kommen. Ich merke, ein bissl zu lang nachsinnend herumzustehen, während mich Jasmine schon unauffällig beäugt. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, was sie denkt oder will. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ist mir das auch wurscht. Jasmine ist mein erstes chinesisches Tinderdate. Vor einer Woche, als ich nachmittags über den Campus ging, öffnete ich aus reiner Neugier mein Tinder. In Deutschland ist das eine furchtbar nervige Angelegenheit, man sieht nur gefilterte Bilder mit dem Hashtag #nofilter, und ich habe nie recht verstanden, was man da überhaupt schreiben soll. Mal habe ich in meinem Profil Anwalt, mal Philosoph als Beruf angegeben, manchmal beides. Was die reine Optik betraf, hatte das auf die Attraktivität meiner Matches keine große Auswirkung. Bei den 74 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
folgenden Chats und gelegentlichen Treffen – wenn es denn so weit kam – habe ich gleichwohl gemerkt, dass der Philosoph vor allem Frauen anzog, die mit der Philosophie die Hoffnung verknüpften, auf ein Verständnis ihr subjektives Leiden betreffend zu stoßen. Diese Erwartung kenne ich auch aus dem analogen Leben. Was mich überraschte, war die Tatsache, dass für diese Erwartung allein ein paar Bilder und die bloße Angabe »Philosoph« genügten, ohne dass ich als Person – wie ich bin, wirke, rede – dazu irgendetwas beigetragen hätte. Hier in Shanghai interessierte mich zuallererst, ob Tinder überhaupt funktioniert. Soweit ich das verstanden hatte, haben die Chinesen nämlich auch fürs Dating eine eigene App; ich konnte mir solche Informationen natürlich nur im Uni-Netzwerk zusammengoogeln, sonst kam mir seit dem zweiten Abend, seit dem Verlust des VPN, stets die chinesische Firewall dazwischen. Mein Eindruck ist, dass die Chinesen ihre Leute gar nicht daran hindern wollen, zu suchen, zu daten, sich zusammenzufinden und digitales Zeug zu machen, die wollen vielmehr nur, dass die Chinesen das mit chinesischen Anwendungen machen. Das dürfte einerseits die chinesische Digitalwirtschaft freuen, die so einen Milliardenmarkt für ihre Produkte reserviert bekommt, und andererseits natürlich auch den allumfassenden, datengierigen Staat, dem der Zugriff auf nationale Anbieter deutlich leichter fallen dürfte. Letztgenannter wird ja bei uns in Deutschland gerne pauschal aufgerufen, wenn es »um China« geht. Ist man selbst im Land, fällt auf, dass das chinesische Netz schneller und zuverlässiger ist als das deutsche und dass es stets und überall drahtlos verfügbar ist – zumindest in einer Metropole wie Shanghai. Auch scheinen all die Apps, die in China anstelle unserer westlichen Gegenstücke genutzt werden, auf den ersten Blick technisch überlegen. Jeder hier benutzt die, ohne etwas zu vermissen, und alles geht schneller und einfacher. Beim bargeldlosen Bezahlen sieht es ähnlich aus. Außer uns Europäern habe ich noch niemanden bar bezahlen sehen. Vor ein paar Tagen waren wir mit Hildi in der Mensa zum Mittagessen. Wir waren recht spät dran und die Aufladeautomaten für die 75 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
Mensakarten waren schon abgesperrt. Als Hildi an der Kasse bemerkte, dass sich auf ihrer Mensakarte nicht mehr genug Guthaben für uns drei befand, fragte sie einen der einheimischen Studenten, der direkt hinter uns in der Schlange stand, ob er für uns mitbezahlen könne. Innerhalb von wenigen Sekunden überwies sie ihm den ausgelegten Betrag per Smartphone zurück. Soweit ich es nachvollziehen konnte, funktionierte das mittels eines spontan generierten QR-Codes, den der andere mit seinem Smartphone scannte, wodurch ihm das Geld augenblicklich auf sein Konto überwiesen wurde. Ich machte also Tinder an, um festzustellen, dass das auch in China geht und offenbar rege genutzt wird. Ich wischte ein bissl herum, mit der in Deutschland antrainierten Gleichgültigkeit. Die grundsätzliche Methode ist folgende: Da sowieso kaum eine zurückwischt, die man wirklich attraktiv findet, kann man gleich alle wischen, in der Hoffnung, dass irgendwann doch eine dabei ist, die vielleicht aus Versehen zurückwischt oder vielleicht auch irgendetwas jenseits der Standardaspekte interessant findet. So wusste ich ja bereits, dass ich zuweilen mit dem Philosophen punkten konnte, der bei manchen mit der Hoffnung auf Verständnis ihr subjektives Leiden betreffend verbunden war. In seltenen Fällen kann es sogar dazu führen, dass ich von einer gewischt werde, die eigentlich zu attraktiv ist – was dann allerdings auch bedeutet, dass die besagte Hoffnung besonders stark ausgeprägt sein muss. Vor diesem Hintergrund war ich sehr erstaunt, ja euphorisch, als ich hier in Shanghai Matches und sogar Superlikes en masse von wunderschönen Chinesinnen bekam. Die sind im Minutentakt eingetrudelt und manche Damen schrieben mich sofort an; zwar meist mit unverständlichem Zeug, aber immerhin. Ich überlegte, woran das liegen könnte und stellte in meiner leichten Euphorie natürlich zuerst die Hypothese auf, ich könnte für das chinesische Auge womöglich besonders attraktiv sein. Ein Freund, mit dem ich mich noch abends per Skype darüber unterhielt, lieferte mir jedoch eine überzeugendere Erklärung. Zum einen schauten wir West-Typen für die Chinesen alle vergleichsweise ähnlich aus, so wie wir uns umgekehrt ja auch mit den feineren Unterschieden zwischen 76 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
chinesischen Gesichtern schwertun. Das hieße, so der Freund weiter, der Unterschied zwischen mir und etwa Ryan Gosling sei für das chinesische Auge geringer. Zudem seien nach wie vor viele Chinesinnen scharf auf ein, wie er das nannte. »Ticket in den Westen«. Ich konnte der Erklärung meines Freundes einiges abgewinnen, doch mittlerweile frage ich mich, was die im Westen wollen, wo doch alles schlechter ist, besonders das Essen. Aber da denke ich sicherlich zu kurz, weil ich mich hier, ebenso wie daheim und wie immer und wie alle, in einer Bubble bewege. Und dann denke ich, dass dieses »wie immer« und »wie alle« so unbestimmt ist, dass auch das mit der Bubble ein Unsinn sein muss. Mit diesen Gedanken kehre ich zu unserem Tisch zurück und setze mich neben Jasmine. Ich überlege, ob ich meine Gedanken mit ihr teilen soll. Habe ich jetzt den Verstand verloren? Vielleicht ist das mit den Bubbles doch kein Unsinn ist, weil ich auf die Idee, mit einem chinesischen Tinderdate über Bubbles in West und Ost zu reden, doch wirklich nur in einer Bubble kommen kann. Die Band Foreigner holt mich zurück in die PlastikBubble der Bar. »I want to know what love is …« tönt es in mäßiger Lautstärke von der Theke herüber und sehr laut vom Nebentisch, wo einer der Fake-West-Chinesen den Song mitsingt, ohne den Text oder auch nur die Sprache, in der er verfasst ist, zu kennen. Ähnliches muss ich den Chinesen zumuten, wenn ich im Uni-Supermarkt anfange, die chinesische Popmusik mitzuträllern. Endlich will ich mich Jasmine zuwenden, da sehe ich im Augenwinkel einen Typen, zwei Tische entfernt, hektisch winken. Es ist Daniel, den ich noch gar nicht bemerkt hatte. Er sitzt neben einer blonden Frau und winkt mir immerfort zu. Dann scheint er zu überlegen, spricht länger mit seiner Begleitung, irgendwie zögern beide, doch dann stehen sie auf und kommen zu uns. Er schaut zuerst mich an, dann Jasmine, wir stellen uns beide auf Englisch vor, ohne dass ich den Hintergrund unseres Treffens erwähne. Anschließend stellt er uns seine Begleitung als eine Sylvia vor, die er bereits aus München kenne und die er eine »besonders gute Freundin« nennt. Sylvia 77 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
ist für ein ganzes Jahr mit einem Stipendium in Shanghai. Als ich noch überlege, was eine »besonders gute« Freundin eigentlich sein soll, sitzen die beiden schon mit an unserem Tisch – allerdings lassen sie einen Platz frei zwischen uns und ihnen. Sie sitzen also bei uns, ohne direkt neben uns zu sitzen. Das fühlt sich sehr komisch an und ich weiß nicht, ob wir jetzt miteinander reden sollen oder nicht. Da mir immer noch kein interessanter Gesprächsanfang für Jasmine eingefallen ist, schweigen wir auf unserer Tischseite noch einen Moment, sodass wir das Gespräch der anderen mitbekommen. Zunächst unterhalten sie sich allgemein über kumulative Habilitationen. Jasmine schaut mich interessiert an und ich übersetze ihr das ins Englische. »Das ist total uninteressant«, denke ich mir, »und das dümmstmögliche Thema für ein Tinderdate ever.« Inzwischen haben die beiden mitbekommen, dass Jasmine und ich zuhören, wodurch wir vollends in das Langweiler-Gespräch involviert sind. Es ist schrecklich! Außerdem beginnt Sylvia, mich kritisch von der Seite anzuschauen, kaum dass Daniel ihr ein paar Sätze über mich gesagt hat. Nach einer Weile kommen wir, ohne irgendwie Rücksicht auf Jasmine zu nehmen, auf China zu sprechen. Es beginnt ganz harmlos. »Und wie gefällt es dir in Shanghai?«, fragt Sylvia. Auch wenn die Frage banal ist, stresst mich die Situation: Die sitzen da und sitzen doch nicht da, wir unterhalten uns und unterhalten uns doch nicht und wohin auch immer das Date mit der schönen Jasmine hätte führen können, das hat sich – Stand jetzt – erledigt. »Sehr gut«, antworte ich deshalb möglichst schlicht, ehe ich zögernd anfüge, »besonders das Essen. Mir graut schon davor, daheim wieder die deutsche Küche mit ihrem immergleichen weich auf weich essen zu müssen.« Derweil entschuldigt sich Jasmine für einen Toilettengang; ich bin mir unsicher, ob sie vorhat, zurückzukommen. Der Kollege lässt sie umständlich aus der Sitzbank und schaut ihr irritiert hinterher. Dann wandert sein Blick wieder zu Sylvia, die allmählich Fahrt aufnimmt: »Da redest du jetzt aber von Shanghai«, erwidert sie, und ich sehe, wie sich ihre Haltung ein wenig 78 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
anspannt; sie dreht sich zu mir herüber, beugt aber gleichzeitig ihren Oberkörper nach hinten. »Ich habe eine vierwöchige Reise durch das ländliche China gemacht,« sagt sie und faltet die Hände zusammen, um sie in ihrem Schoß zu vergraben. »Schrecklich!« »Was war denn?«, frage ich. Innerlich frage ich mich vor allem, ob Jasmine jetzt schon gegangen ist, und rege mich – zugegebenermaßen über Gebühr – über diesen sentimentalen Tonfall in Sylvias Stimme auf. Als gäbe es für uns einen Moralpreis zu gewinnen durch irgendein Urteil, dass hier irgendetwas schrecklich ist. Worum geht es ihr überhaupt? Auf welchem Maßstab könnte solch ein Urteil fußen? Sie antwortet: »Man kann hier auf dem Land eine unglaubliche Tierquälerei beobachten. Überhaupt das ganze UmweltThema. Ganz ehrlich: Mir kommt es hoch, wenn ich daran denke. Ich kann hier gar nichts mehr mit Genuss essen.« »Kannst du denn deinen Geschmack nach tierethischen Gesichtspunkten ausrichten?«, erwidere ich. Mir ist sofort klar, dass das ein Fehler gewesen ist. Auch der Kollege fühlt die Anspannung wachsen und versucht, zu intervenieren. Unbeholfen will er auf das Thema Philosophie umschwenken. Jasmine ist immer noch nicht zurück und Sylvia ist jetzt kurz davor, mich offiziell zum Feind zu erklären. Sehr deutlich ist mir, in welche Schublade sie mich gern stecken möchte. Da ohnehin nichts mehr zu retten ist, nehme ich die mir angetragene Rolle offensiv an und sage: »Das ist schon interessant. Obwohl wir Deutschen so unkultiviert sind, hat man uns doch zumindest hierher eingeladen, um sozusagen im Sommerschlussverkauf unsere klassische deutsche Philosophie zu verhökern. So sehr uns die Chinesen in Technologie, Ess-Kultur und Tradition überlegen sein mögen – in Sachen Philosophie sind sie uns unterlegen. Wenn wir auf Shanghai schauen und ehrlich sind, Sylvia, könnten wir aber in Sachen Nachhaltigkeit und Umweltschutz auch noch etwas von ihnen lernen.« Sie dreht sich empört von mir weg: »So ein Unsinn! Die Chinesen haben genauso brillante Philosophen: Laotse, Zhuangze, Mengze …« Dabei spricht sie die Namen übertrieben chine79 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
sisch aus: »Lao-tsäh, Zhuang-tsäh, Meng-tsäh …« Es schießt mir durch den Kopf, die Aufzählung mit Schnau-tsäh weiterzuführen, aber ich verkneife mir das. Wenn ich noch einen Ton sage, reden wir gleich über Menschenrechte und Überwachung und die Uiguren – und eben das will ich vermeiden. Nicht, dass das keine wichtigen Themen wären … Aber wer sind wir gschissenen Akademiker aus Europa, am besten noch direkt aus München-Schwabing mit Stipendium von der Studienstiftung eingeflogen, dass wir uns hier zum Richter aufspielen. Welchen Standpunkt vermeinen wir, einnehmen zu können angesichts dieser undurchsichtigen Welt? Auch ohne mein Zutun ist Sylvia nun, wie befürchtet, bei den Menschenrechten angelangt. »Unsere Kultur ist doch lebendig, sie ist sogar Vorreiter für die ganze Welt! Wir achten die Menschenrechte, wir haben einen Rechtsstaat, wir schützen die Tiere und unsere Presse ist frei, ohne Zensur.« Ich weiß in dem Moment gar nicht, was von all diesen Dingen stimmt oder nicht, aber ich kann das alles nicht ernst nehmen, weil es allzu leicht zu erwarten und zu durchschauen ist. Allein deswegen kann das doch nicht wahr sein! Ich erinnere mich an Daniels Vortrag über Kant und an seine Frage, inwiefern es in der Philosophie streng rational zugehe. Ist es überhaupt möglich, objektive Urteile zu fällen, ohne uns selbst als Subjekte miteinzubeziehen? Nie zuvor war mir so klar, dass es nicht möglich ist. Und trotzdem antworte ich ein letztes Mal: »Unsere Kultur ist eine gefilterte Instagram-Version der amerikanischen Kultur, unter der als Hashtag #nofilter steht. Es gibt sie überhaupt nicht mehr, unsere Kultur!« »Und seit wann soll das deiner Meinung nach der Fall sein?«, bellt Sylvia mit bebender Unterlippe. Beinahe entgeht mir, dass das eine Falle ist und sie mich zwischen 1945 und 1933 entscheiden lassen will, doch bevor ich antworten kann, kommt Jasmine zurück. Sie sieht noch schöner aus. Das Attraktivitätsgefälle ist fast beschämend. Aber hier geht es nicht um Moral, wir sind ja in einem Überwachungsstaat. Auf der Taxifahrt ins Hotel erzähle ich ihr vom Oktoberfest, »the greatest beerfest in the world«, und sie schaut mich mit funkelnden Augen an. 80 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
Zehn Fsis is pruuf
»Fsis is pruuf!«, schreit mir der ältere Herr im gelben T-Shirt mehrmals ins Gesicht. Dicke Speicheltropfen fliegen durch die Luft und verfehlen mich nur knapp, mehrmals haut er auf mein Rednerpult. Es ist die erste Situation während meines Aufenthalts, die ich ansatzweise als bedrohlich empfinde. Ich möchte erwidern. – »Fsis is pruuf!« Wieder haut er auf mein Pult. Das muss ein blinder Passagier sein. Zu Beginn der ersten Kant-Vorlesung Daniels, mit der die Summer School begann, setzte ich mich ausgerechnet neben diesen alten Herrn, freilich ohne zu ahnen, welch seltsame Auftritte er in den kommenden Tagen noch hinlegen sollte. Vielleicht aber hätten mir seine zwei großen Jutebeutel, die er wie eine Barriere neben sich aufgestellt hatte, sowie die nervöse Unruhe, die von ihm ausging, eine Warnung sein sollen. Unser dritter Kollege, der Österreicher, saß rechts von mir und bedeutete mir nach einigen Minuten schüchtern, doch einmal neben mich auf den Boden zu schauen. Einer der beiden Jutebeutel war umgekippt und aus ihm war eine unverschlossene Thermoskanne herausgerollt und aus dieser floss nun eine klebrige, fast breiige, rote Flüssigkeit, die sich langsam zu meinen Schuhen vorarbeitete. Eine Thermoskanne haben hier übrigens alle, doch die meisten befüllen sie mit heißem Leitungswasser, das nach einem Chloraufguss in der Sauna riecht. Reflexhaft zog ich die Beine hoch. Da erst bemerkte der alte Mann sein Malheur, anstatt jedoch irgendeine Gegenmaßnahme zu ergreifen, entschied er sich für eine plötzliche Flucht ans hintere Ende des Vorlesungssaals. Dort setzte er sich neben eine junge Studentin, die in der Pause dann seinen Jutebeutel holte und auch die rote Lache mit einigen Papiertaschentüchern aufwischte. Er könnte 81 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
ihr Vater, eher noch ihr Großvater sein, und vielleicht hat er sich dank seiner jungen Verwandten in die Summer School hineinschmuggeln können. Vielleicht ist er auch einer von der Partei, einer, der womöglich früher sehr wichtig war und heute sehr verrückt. Hochrangige Funktionäre wird man ja nur schwer wieder los. Ich versuche noch immer, irgendeine Antwort zu finden, die ihn wenigstens Ruhe geben lässt. Aber er wiederholt nur nochmals aufgebrachter seinen Ausruf. Beim dritten Mal verstehe ich zumindest, was er überhaupt meint, nämlich dass es bewiesen sei. Leider weiß ich nicht, was bewiesen sein soll, kann nur vermuten, dass er irgendetwas im Sinn hat, das ich soeben in meiner Vorlesung gesagt habe, vielleicht aber auch gerade das Gegenteil davon. Wie soll ich das denn wissen? Jedenfalls soll irgendetwas bewiesen sein. Froh, wenigstens ein bisschen verstanden zu haben, pflichte ich ihm bei. Vor der Pause heute Mittag stellte er auch schon eine Frage, die sich mir nicht sogleich erschloss: »What äh is äh with tha buty of äh tha fish?« Zuerst kam mir der schöne Gedanke, der Herr sei vielleicht ein ehemaliger Fischer vom Hafen Yangshan, der sich nach der Schönheit der Fische erkundigen wolle. Als ich nachhakte, stellte sich jedoch heraus, dass er wissen wollte, wie es um die Pflicht bei Fichte stehe: »What is with the duty of the Fichte?« Zum Ende der Summer School waren uns diese Art von Fragen, die nichts, aber auch gar nichts mit dem Thema unserer jeweiligen Vorlesung zu tun haben, bereits wohlvertraut. Diese Erfahrung im Aneinander-vorbei-Reden half mir gleichwohl auch nicht, seine Frage zu beantworten. Ich möchte die Vorlesung nun endlich beschließen und erzähle ihm daher – auf sein drittes »Fsis is pruuf!« hin – noch kurz was vom Pferd. Während ich allerlei philosophischen Kram zu einer Pseudo-Antwort verleime, zieht der alte Mann mit beiden Daumen den Bund seiner Jogginghose leicht nach vorn und lässt sie auf seinen Bauch zurückschnalzen. Dann nimmt er seine Jutebeutel und geht langsam in Richtung Tür, laut im chinesischen Stakkato lachend, mit seiner freien Hand halb winkend, halb abwinkend. 82 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
Nach zwei Wochen Shanghai bin ich auch schon ein bisschen Kirre; ich muss mich anstrengen, um die Form zu wahren, denn noch immer sind Scholars und distinguished Professors und Zeuch um uns herum und uns werden alle paar Minuten Neue vorgestellt. Mehr noch als der akademische Trubel hat die chinesische Dauerbeschallung meinen Kopf zermürbt. Wo man auch hingeht, stets wird man von einer Frauenstimme vom Band vollgequatscht – im Bus, in der Metro, im Taxi, überall laufen Dauerschleifen mit irgendeiner chinesischen Frauenstimme. Langsam, schnell, hinauf mit der Tonhöhe und wieder herunter, ohne dass man auch nur eine Silbe versteht. Selbst wenn man an der Ampel wartet, hat man keine ruhige Minute, sondern wird von der Ampel vollgequatscht. Ich habe der Ampel durchaus schon geantwortet: »Schnauze!« oder »Shut up!« oder auch mal »Danke, sehr gern!« Aber das bringt alles nichts, die Stimmen quatschen erbarmungslos weiter. Im kleinen Supermarkt auf dem Campus-Gelände, wo ich mir die Unmengen Wasser kaufe, die ich benötige, um meinen hohen täglichen Schweißverlust wieder auszugleichen, wird man zwar von Ansagen verschont, dafür läuft jedoch chinesische Musik in Dauerschleife. Recht bald habe ich angefangen, einfach mitzusingen, freilich ohne ein Wort zu verstehen. Aber das geht! Hinauf mit der Stimme und herunter, mal langsam, mal schnell, die wichtigsten Laute sind »ma«, »ja«, »ka«, »na« und »sa« sowie »sch«, »schü«, »schosch« aus der ZischlautAbteilung. Aus denen lässt sich, so meine Wahrnehmung, im Grunde jedes Lied rekonstruieren. Als mir zum ersten Mal bewusst wurde, dass ich mitsang, war mir das peinlich. Aber dann dachte ich mir, dass ich hier ohnehin die meiste Zeit wie ein Außerirdischer angeschaut werde, auch wenn ich mich betont zurückhaltend verhalte, und also durchs Mitsingen auch nicht viel an meinem allgemeinen Eindruck kaputt machen könnte. Seither singe und summe ich, wo immer sich die Gelegenheit bietet, sehr gern mit. Aber in China sind die Chinesen schon sehr, sehr da – immer, überall, denke ich, als ich meine Sachen zusammenpacke. Der Eindruck des Überwältigtwerdens wird noch dadurch ver83 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
stärkt, dass die Menschen hierzulande häufig in großen Gruppen unterwegs sind, oftmals zu mehreren hundert, was bei uns doch deutlich seltener vorkommt. Und noch seltener erlebt man es bei uns, dass die Leute in diesen Gruppen allesamt gleich gekleidet sind; hier dagegen sieht man das öfter, ohne dass der Grund der Uniformierung offensichtlich wäre. Heute Morgen erst kreuzte eine große Schar von mehreren hundert Kindern meinen Weg. Ich war in ziemlicher Eile, weil ich recht spät auf dem Weg zu meiner Vorlesung war. Ich beschleunigte also meinen Schritt, um noch irgendwie zwischen den ersten Reihen hindurchzukommen, denn sonst hätte mich der Kinderzug wahrscheinlich einige Minuten Wartezeit gekostet. Kaum dass ich sie passiert hatte, hörte ich lautes Geschrei und drehte mich noch einmal um. Einige der Kinder winkten mir, und wie ich zurückwinkte, winkten sie alle, lachten laut und begannen, auf mich loszuplappern. Fsüß. Die letzte Vorlesung ist beendet. Es war ein Erfolg, irgendwie. Diejenigen, die nach vielen Vorlesungsstunden Fragen stellen, die vermuten lassen, dass sie, die Fragesteller, schon nach wenigen Sekunden nicht mehr folgen konnten, gibt es schließlich überall. Es gibt in jedem Auditorium einen gewissen Prozentsatz von Leuten, die du schon verloren hast, bevor du überhaupt anfängst. Aber die muss es geben, meines Erachtens tragen sie wesentlich zur Stabilität des Ganzen bei. In München im Univiertel haben wir einen unfassbar nervigen Typen, der sich Tommy nennt. Er ist laut und unverschämt, niemand mag ihn wirklich und doch schafft er es, irgendwie immerzu bei allem dabei zu sein und mitzureden. Der ist auch so ein Fall, bei dem immer schon vor dem ersten Wort klar ist, dass da alles verloren ist. Aber irgendwo braucht das Viertel ihn auch und jeder vermisste ihn, wenn er einmal nicht mehr da wäre. Ich hätte den alten Mann im gelben T-Shirt in Gedanken einfach Tommy nennen sollen. Am Nachmittag spazieren wir mit Yifan, unserem ständigen Begleiter, durch die Altstadt von Shanghai. Yifan ist ausgesprochen 84 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
nett, zuverlässig und geradezu treu, und wir bieten ihm jeden Tag aufs Neue an, sich auch einmal etwas Zeit für sich zu nehmen, uns zu sagen, wenn ihm Zeit oder Lust zu unseren Unternehmungen fehlen. Aber Yifan kann ebenso wenig aus seiner Haut wie wir. Wann immer einer von uns anspricht, dass es diesmal wieder sehr anstrengend sein müsse für den Yifan, antwortet dann ein anderer, dass wir es ihm ja freigestellt hätten. Das hat natürlich ein bissl was von Selbstbetrug zu Lasten Dritter. Auch dabei ist Hildi, die ich mittlerweile sehr ins Herz geschlossen habe und die – vielleicht dem akademischen Status als Doktorandin und ihren Deutschkenntnissen geschuldet – gegenüber Yifan, und ganz subtil auch gegenüber uns, wie eine Chefin wirkt. Wir haben hier in den letzten zwei Wochen im Grunde bereits alle Tabus gebrochen, haben mit den Chinesen über Freiheit diskutiert, über Demokratie, Religion, Amerika, Trump, Mao und Hongkong geredet und ich Blödmann habe sogar, gegen einschlägige Warnungen, Tibet angesprochen – wobei es mir wirklich nur ums Bergsteigen ging, aber es wurde natürlich trotzdem politisch. Da wir folglich eh keine Chance mehr auf einen Preis für interkulturelle Sensibilität haben, ist es mir grad wurscht und ich spreche Yifan aus einer Laune heraus auf Ai Weiwei an. Vor Kurzem war der wieder prominent in unseren Medien, weil er sehr kritisch mit Berlin abgerechnet hatte. Sehr zu meiner Verwunderung kennt Yifan Ai Weiwei gar nicht. Und Yifan kennt eigentlich alles, der liest Adorno und Hermann Hesse, ist bestens vertraut mit deutscher Geschichte, Kultur und sogar der deutschen Küche. Doch Ai Weiwei kennt er nicht. Freilich hat er ihn sogleich mit seinem Handy gesucht, um seine Wissenslücke zu schließen. Ich erwische mich dabei, mich verstohlen umzuschauen, weil ich jemanden aus meiner Gruppe angestiftet habe, nach einem Dissidenten zu suchen. Aber natürlich passiert nix. Vielleicht ist Ai Weiwei, der chinesische Künstler schlechthin in unsren Augen, eine Erfindung des Westens? Oder die Zensur in China funktioniert wirklich, auch bei weltgewandten Menschen wie Yifan? Schwer zu sagen. Wir sind inzwischen in eine etwas rauere Gegend vor85 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
gedrungen. Auf den Bürgersteigen hocken vor jedem Haus chinesische Männer auf winzigen Klappstühlen. Es ist unfassbar heiß in den Straßenschluchten und die klapprigen Ventilatoren, die manche Männer neben sich aufgestellt haben, können der Hitze nichts entgegensetzen. Von den Einheimischen bewegt sich in diesem Stadtviertel kaum einer und ich glaube, dass wir gar nicht in erster Linie auffallen, weil wir größer, dicker und haariger sind, sondern vor allem, weil wir uns so zügig durch die Straßen bewegen. Die Höchstgeschwindigkeit der Viertelbewohner scheint dagegen ein gemächliches Schlurfen zu sein. Wir kommen an einer kleinen Gruppe finster dreinschauender Chinesen vorbei, die sich um einen Gaskocher auf einem Klappergestell versammelt haben. Darauf steht ein Topf mit blubbernder Brühe, in der, beinahe Mitleid erregend, ein paar traurige Nudeln schwimmen. Um den Topf läuft eine Schildkröte herum, ganz putzig. »Fsüß!«, wollen wir schon ausrufen – da wird uns nahezu gleichzeitig klar, welche Stunde es der Schildkröte geschlagen hat. Wir bleiben stehen. Einer der Chinesen hat eine Luftpumpe in der Hand und beginnt nun, hektisch in unsere Richtung zu pumpen, als wollte er uns vertreiben. Wir werden Tommy, die Schildkröte, nicht retten können; ja, ich habe sie benannt und damit den Kardinalfehler des Fleischessers begangen. Bevor der Mann rabiatere Methoden als Luftpumpen einsetzt, gehen wir schnell weiter. Hildi lacht vergnügt, Yifan wirkt eher besorgt. Ein paar hundert Meter die Straße hinunter kehren wir in einem Restaurant ein. Einmal mehr werden wir drinnen um etwa 30 Grad heruntergekühlt. Augenblicklich friert der Schweiß am Rücken fest. Daniel ist seit dem Luftpumpenzwischenfall einem hysterischen Lachen verfallen, das er offensichtlich nicht mehr im Griff hat. Ich glaube, in seinem Kopf haben die Chinesen die Kontrolle übernommen. Heute Mittag war ich es, der für ein paar Minuten nicht mehr aufhören konnte, zu kichern, und sobald ich mich dem Kollegen zuwende, muss ich mitlachen. So ein Lachflash ist ansteckend. Zu ganzen Sätzen ist er nicht mehr imstande und er starrt fast panisch auf die einmal mehr mit mehreren hunderten Gerichten vollgeschriebene Speisekarte – 86 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
alle bebildert, die Bilder für unsere Augen größtenteils nicht zu unterscheiden. Ein paar Bratwürschte könnten jetzt helfen oder ein Schnitzel oder ein Weißbier – aber ich befürchte, dass das die Speisekarte nicht hergeben wird, auch wenn ich sie noch nicht mal ansatzweise durchblättern konnte. Wenn ich es schaffe, Daniel zu ignorieren, unterhalte ich mich mit Hildi über Politik. Ich erzähle ihr, dass im Hotelfernseher manchmal CNN schwarz wird, wenn über Hongkong berichtet wird, meistens noch bevor die Polizei anfängt, auf die Demonstranten loszugehen. Auch gestehe ich, dass mich das in einer der ersten Nächte kalt erwischt hat und ich dachte, meine letzte Verbindung in den Westen sei gekappt. Sie erklärt mir daraufhin, dass das die übliche Form der Zensur sei: Für ein paar Minuten werde der Bildschirm schwarz, bis zum Wetterbericht komme das Bild aber zuverlässig zurück. Manchmal passiere es auch, dass die Zensur unbegreiflicherweise nicht einsetze oder erst ein paar Minuten zu spät, wenn die Polizei schon dabei ist, die Demonstranten zu prügeln. Yifan klinkt sich ins Gespräch ein, indem er uns die neuesten Informationen zu den Hong-Kong-Protesten am Smartphone heraussucht. Ich finde es beruhigend, dass der Regierungsmann, der den Zensur-Knopf zu drücken hat, anscheinend auch manchmal schläft oder auf dem Klo ist oder auf Kur. Das hat etwas sehr Deutsches und lässt mich ahnen, dass manche Unterschiede doch eher marginal sein könnten. Nach und nach werden jetzt die Speisen aufgetischt. Daniel hat seinen Lachflash überwunden und einmal mehr seine Rolle als kulinarischer Querulant eingenommen. Bei jeder neuen Schüssel fragt er nach, was genau das jeweils sei, Hildi benennt manches auf Deutsch und der bedauernswerte Yifan muss beim Rest nach den deutschen Übersetzungen suchen. Es gibt Schwein, Aal, Chicken (das können komischerweise alle Chinesen auf Englisch), eine Art Chinakohl, verschiedene Sorten von Pilzen; alles ist wunderbar, fantastisch. Zum Schluss wird noch ein letzter heißdampfender Topf gebracht. Hildi schaut uns durch ihre starken Brillengläser an, verstohlen und triumphierend: »Tuuurtle.« Meinen Kollegen zerreißt es fast und er fällt zurück in hys87 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
terisches Gelächter. Ich glaube, er ist bis zum Rückflug verloren. Nachdem ich auch eine Weile gelacht habe, esse ich gleichwohl bedenkenlos mit – der Tommy ist ja schon tot und umsonst soll er auch nicht gestorben sein. Von Hildi lasse ich mir noch ein bissl was übers Yin erzählen und übers Yang. Alle Viecher, die ebenerdig umeinander kriechen, gehören anscheinend zum Yin, wobei meine Gesprächspartnerin gleich einschränkt, dass das natürlich nicht in der gleichen Weise beweisbar sei wie die Erkenntnisse der westlichen Medizin. Das ist die Vorlage, auf die ich gewartet habe. Ich grätsche dazwischen und haue auf den Tisch: »Fsis is pruuf!« Sie schaut mich an, als hätte ich den Verstand verloren. Daniel lacht Tränen, aber schon vorher; der bekommt gar nichts mehr mit. Hildi erzählt mir interessante Sachen über die chinesische Küche, noch mehr über Yin und Yang, über traditionelle Arzneien und Heilkunde. Ab und zu sehe ich ein Funkeln in ihren Augen. Ich weiß nicht, ob das mehr ist als der Stolz der Chinesen über die Überlegenheit ihrer Kultur. Wir verabreden uns für den Abend noch einmal, wir wollen uns auf der Promenade vor unserem Hotel treffen. Und für den morgigen Tag schlägt Yifan einen Ausflug ins »alte China« vor, wo er uns Gärten und Tempel zeigen möchte. Yifan nennt dabei mehrfach den Ort, den er uns zeigen will, aber wir können ihn uns nicht merken. Wie immer muss und wird er sich um alles kümmern. »No problem, no problem«, sagt er beinah mantrahaft. Später treffen wir uns wie verabredet an der Uferpromenade, die in den Stadtführern nur »the Bund« genannt wird. Wir schauen aus nächster Nähe auf die blinkenden Hochhäuser von Pudong. Ich frage Hildi – das will ich schon die ganze Zeit tun, und jetzt scheint mir der richtige Augenblick dafür zu sein – nach ihrem echten, ihrem chinesischen Namen. Sie lacht, hell und zart, sieht mich an und sagt: »Hildi ist okay, der ist zu kompliziert«, dabei tatscht sie mir ein bisschen zärtlich, ein bisschen beschwichtigend, ein bisschen herablassend auf die Schulter. Ich lasse vorerst ab und blicke zurück auf die Skyline. 88 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
Ans Ufergeländer gelehnt, rauchen wir die feinen grünen chinesischen Zigaretten; überall um uns herum hören wir die chinesischen Frauenstimmen unablässig vom Band quatschen. »Ma, ja, ka, na, sa – sch, schü, schosch.« Die Lichter wandern hinauf, herunter, sie blinken schneller und wieder langsamer. Ich atme den süßlichen Rauch ein und wieder aus. Neben mir kichert es von Zeit zu Zeit noch, aber es wird weniger, leiser. Die letzte Frage, die noch zu mir durchdringt, lautet: »Hat dir die Schildkrötensuppe gut geschmeckt?«; und ich bejahe sie entschieden. Wir stehen da noch eine Weile. Gequatsche, Gekicher. Irgendwo spielt auch Musik und ich summe mit. »Ma-schü, schna-ja, sa-schosch- ka …« Allmählich gehen drüben die Lichter aus. Erst der Shanghai Tower, dann der Oriental Pearl TV Tower und zuletzt das Shanghai World Financial Center. Wie wir hier stehen, plaudern, da braucht es keinen Beweis. Oder? Das Interesse aneinander ist echt und doch sind die Versuche, einander wahrhaft zu verstehen, zum Scheitern verurteilt. Aber wir müssen das trotzdem versuchen, immer und immer wieder. »Right?«, frage ich, nach Bestätigung heischend, erst nach links, dann nach rechts. Aber da steht niemand mehr. Ich lehne allein am Geländer. Es wird so langsam Zeit, wieder ins alte Europa zurückzukehren.
89 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
Marx’ Erbe oder: Dialektischer Materialismus
90 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
Elf Koi Freiheit
Nachdem die Summer School gestern mit meiner letzten Vorlesung endete, machen wir heute noch einen Ausflug ins alte China. Der gute Yifan hat sich von sich aus bereit erklärt, uns dorthin zu begleiten, obwohl er uns gegenüber mit dem Ende der Summer School eigentlich in keiner Weise mehr verpflichtet ist. Wo genau es hingeht, weiß ich, obwohl Yifan es bereits mehrfach erwähnt hat, nicht. Wir fahren wohl »raus aus Shanghai«, aber auf meine Nachfrage, wie weit entfernt unser Zielort sei, erfahre ich, dass auch unser Ziel irgendwie mit zu Shanghai gehört. Mittlerweile habe ich trotz Googlesperre – wer braucht schon diesen Westkram? – übers chinesische Netz digitales Kartenmaterial heruntergeladen, mit dem ich notfalls auch offline arbeiten kann. Aber für meine Orientierung hilft es nur bedingt weiter: Da steht zwar irgendwo Shanghai, doch nichts auf der Karte lässt Rückschlüsse darauf zu, wo das anfängt und wo es aufhört. Ich zoome hinein und hinein, irgendwann entdecke ich den Bund und finde, von ihm ausgehend, sogar die Universität und unser Hotel. Sobald ich jedoch wieder herauszoome, um zu sehen, wo unser Ziel liegt, verliere ich in den sehr vergröberten Strukturen sofort wieder den Überblick. Ohne Idee vom Zielort steige ich also mit Yifan und Daniel ins Taxi. Roland hat sich bereits aus der Runde verabschiedet, er fliegt heute Nachmittag zurück nach Wien. Daniel und ich bleiben noch ein paar Tage. Yifan lassen wir wegen der Kommunikation mit dem Fahrer vorn Platz nehmen, ich quetsche mich mit den Kollegen auf die Rückbank. Wir sind kaum fünf Minuten unterwegs, da stehen wir bereits auf einer der großen Ausfallstraßen stadtauswärts im Stau. Gerade geht nichts mehr. Der Taxifahrer redet ziemlich aufgeregt auf Yifan ein, vielleicht er91 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
läutert er ihm seine Vermutungen zu den Stauursachen, vielleicht lästert er auch bloß über uns. Wenn man so wenig von der Sprache versteht wie wir, hat man da stets Zweifel. Manchmal lachen die beiden unvermittelt, wobei sich Yifan merklich zurückhält. Das spricht doch fürs Lästern. Endlich habe ich unsere Position auf der Karte im Smartphone gefunden. Drei Zoomstufen hinein und ich sehe unseren Standort im Verhältnis zum Hotel: Wir befinden uns nördlich, allerdings noch nicht sonderlich weit entfernt. Dann will ich es ins gesamte Ausflugsunternehmen einordnen und zoome eine Stufe hinaus. Das kann ich noch handhaben. Ich erkenne zwar Hotel und Universität nicht mehr, aber immer noch die große Ringstraße, von der ich weiß, dass sie am Hotel vorbeiführt. Je nach Auflösungsstufe heißt sie mal Middle Ring Road, mal Handan Road, doch beides sagt den Einheimischen nichts: weder Yifan noch dem Taxifahrer. Denn die Chinesen haben für alles geheime eigene Namen, auf den Internet-Karten steht dagegen meist nur Touristensprech für Leute wie uns. »The Bund« zum Beispiel habe ich noch keinen Chinesen sagen hören, die sagen irgendetwas für uns Westler Unverständliches, einen chinesischen Namen, der übersetzt, so viel hat Yifan uns verraten, heißt: Promenade der Fremden. Ich denke ein wenig darüber nach und höre mit einem Ohr aufs Gespräch zwischen Taxifahrer und Yifan, das ein wenig an Schärfe zu gewinnen scheint. Ich werde ein bisschen unruhig, weil wir seit einer gefühlten halben Stunde in der Hitze festsitzen und die Klimaanlage des Autos jetzt bereits schwächelt. Die Luft steht, draußen wie drinnen: Wir haben den heißesten Tag seit unserer Ankunft. Es hat 37 Grad im Schatten, aber wenigstens regnet es nicht. Ich zoome eine weitere Stufe heraus und die Grenzen Shanghais verschwimmen schon wieder. Wir befinden uns wohl noch »drinnen« – soviel ist klar, da wir ja bislang kaum fortgekommen sind –, aber es ist nicht auszumachen, wo Shanghai überhaupt aufhört. Ich frage Yifan nochmals, wie unser Zielort heißt und verstehe sogar halbwegs die Antwort: irgendetwas wie »guau-zu«. Ich suche das auf der Karte und werde nicht fündig. Also zoome ich eine weitere Stufe heraus. Jetzt sehe ich die 92 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
südostchinesische Küstenlinie und eine Reihe von Ortschaften in ihrer Nähe. Mindestens fünf davon klingen nach »guau-zu«, gefühlt heißt hier alles so. Ich traue mich nicht, ein weiteres Mal nachzufragen, scrolle ein bisschen in unsere Fahrtrichtung und zoome dann wieder hinein. Gut 60 Kilometer Luftlinie von unserem Hotel entdecke ich etwas, das »guau-zu« sein könnte. Ich suche den Namen im Netz und erfahre, dass es sich bei diesem »guau-zu« um eine 7-Millionen-Stadt handelt. Nun gut, das wird kaum das ländliche China sein. Interessehalber mache ich noch ein bisschen weiter und recherchiere wahllos ein paar Orte, deren Namen ungefähr nach »guau-zu« klingen. Fünfeinhalb Millionen Einwohner, acht Millionen, sechs Millionen – all das nur in dem kleinen Ausschnitt, den ich nach zweimaligem Herauszoomen sehe, also dem Ausschnitt, der den Unterschied zwischen Shanghai und dem Rest Chinas gerade so erahnen lässt. Niemand in Deutschland hat je von diesen Ortschaften gehört, mir kommt es vor wie das Scrollen zwischen Escherndorf, Nordheim und Sommerach auf Google Maps. Es fällt mir schwer, diese abstrakten Zahlen ernst zu nehmen … Von einem Beinaheunfall werde ich aus den Gedanken gerissen. Der Taxifahrer muss so scharf bremsen, dass es mich leicht aus dem Sitz hebt und ich mich instinktiv am Vordersitz abstützen muss, weil es, wie in allen chinesischen Taxis, keine Gurte gibt. Das Smartphone fällt mir aus der Hand, nimmt jedoch keinen Schaden. Durch seine Vollbremsung konnte der Fahrer einen Unfall verhindern, aber er muss dennoch einen ordentlichen Schreck bekommen haben. Er kurbelt sein Fenster herunter, sagt einige schärfer klingende Worte mit vielen Zischlauten, zieht dann geräuschvoll hoch und spuckt auf den Boden vor die Beifahrertür unseres Beinahe-Unfallgegners. Der meckert kurz zurück, dann hat sich die Geschichte beiderseits erledigt. Ein kurzes Husten von mir veranlasst Yifan, aus seinem Rucksack eine Flasche Wasser hervorzuholen, die er mir in die Hand drückt. Ich will dem armen Kerl nicht sein Wasser wegsaufen, wenn er schon der Einzige ist, der daran gedacht hat, etwas zu trinken mitzunehmen – aber er beschwichtigt mich: 93 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
»No, I brought this for you.« Für Daniel hat er ebenfalls Wasser mitgenommen, er bekommt auch eine Flasche ausgehändigt. Yifan selbst trinkt derweil Tee aus seiner Thermoskanne. Die Erfrischung tut mir gut, die Fahrt geht weiter. Die Wasserflasche ist ein Kunstwerk für sich. Die einzige Sachinformation, die ich auf ihr erkennen kann, ist die Volumenangabe von 535 Millilitern. Im Übrigen ist sie spektakulär. Große rote Schriftzeichen, vier an der Zahl, bedeuten vermutlich den Markennamen, daneben finden sich einige kleinere grüne Schriftzeichen. Links von der Schrift befindet sich die dominante Figur des Bildes: Ein Hirsch, mit einem Smoking bekleidet, entsteigt dem Schalltrichter eines Grammophons. Vor ihm sitzt ein Affe in Russenhocke, ebenfalls im Smoking, und schaut den Hirsch komisch, ja fast lüstern an. Aus dem Geweih des Hirschs wabert ein buntes Sammelsurium verschiedener Symbole hervor: Die meisten entstammen dem Bereich der Flora, doch ein paar Vögel und abstrakte Ornamente sind ebenfalls darunter. Alles vornehmlich in grün, gelb, rot, rosa gehalten. Die ganze Komposition wirkt auf mich irritierend und stimmig zugleich; ich bin begeistert: vom stillen Wasser. Mittlerweile sind wir in einem rasanten Tempo unterwegs; in Staus geraten wir nicht mehr, wenngleich weiterhin sehr viele Autos auf den Straßen sind. Unser Fahrer schneidet andere Verkehrsteilnehmer einige Male so knapp, dass ein Unfall unvermeidlich scheint. Es kommt nichts und niemand zu schaden, dennoch ist es beängstigend. Während eines besonders abrupten Spurwechsels mache ich allerdings den Fehler, vom Wasser zu trinken und gleichzeitig weiter auf dem Smartphone herumzudrücken, immer noch auf der Suche nach dem alten China. Ich verschütte einen ordentlichen Schluck Wasser direkt aufs Telefon und schalte es dann vorsichtshalber sofort aus. Nach insgesamt anderthalb Stunden im Auto erreichen wir endlich unser Ziel. Da ich mich nicht traue, das Smartphone wieder anzuschalten, bleibe ich im Unklaren darüber, wo wir eigentlich sind. Vielleicht sind wir noch in Shanghai, vielleicht sind wir auch außerhalb von Shanghai: Macht das wirklich einen Unter94 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
schied? In jedem Fall hat sich die Szenerie deutlich verändert, verglichen mit dem Trubel am Bund, wirkt es hier wie in einer Kleinstadt. Durch den alten Ortskern, in dem wir uns laut Yifan befinden, fließt ein Bach. Wir passieren ihn ein paar Mal über zierliche Brückchen, schlendern durch die Altstadt in der trockenen Mittagshitze. Zuweilen bleibe ich stehen, um aufs Wasser zu schauen. Es ist dunkelgrün und bewegt sich fast gar nicht. Viele der Häuschen am Bachufer sind mit roten Lampions geschmückt, auch Banner mit Schriftzeichen sieht man. Am Bach und in den Gassen sind kaum Leute unterwegs und es herrscht eine solche Ruhe, wie ich sie in China noch nicht erlebt habe. Trotz der Hitze und ihrer Folgen, namentlich Schweiß, Durst und Kopfweh, überträgt sich die Ruhe auf mein Gemüt. Yifan schreitet vorneweg und erklärt uns, dass wir die »old gardens« suchen sowie den Tempel. Zwei etwas breitere Straßen, die in deutschen Kleinstädten vermutlich als Hauptstraßen durchgingen, wirken recht touristisch. In ihnen herrscht ein Duft, der zwischen beißend und betörend schwankt. Der Grund dafür sind unzählige Essensläden, deren eine Hälfte westlichkapitalistischen Zuschnitts ist, mit bunten Bildern der angebotenen Speisen im Schaukasten, teils sogar mit unsinnigen englischen Beschreibungen; die andere Hälfte der Läden ist östlichkapitalistischen Zuschnitts, keine Bilder, strenger Geruch. Ich sehe Berge von frittierten Hühnerfüßen, Hundertschaften von Spießchen und Bällchen aus unbekannten Zutaten; und überall gibt es weißdampfende Teegetränke in überdimensionierten Plastikbechern dazu. Ich würde alles so gern probieren, doch Yifan treibt uns weiter. Seine Mission ist es, uns schnellstmöglich in die Alten Gärten zu führen. Einmal biegen wir falsch ab und verlieren ein paar Minuten, wofür Yifan sich mehrmals entschuldigt, nach etwa einer halben Stunde kommen wir an. In den Gärten ist es noch ruhiger und noch heißer. Der Schweiß rinnt an mir herab, nur am großen See in der Mitte des Gartens kommt eine schwache Brise auf. Wir kommen an Pavillons vorbei, durchqueren kunstvoll angelegte Ensembles von Büschen, Sträuchern und Felsen und wir gehen über schmale Holzbrücken, von denen einige auch ohne 95 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
Gewässer unter sich die Landschaft verschönern. Der Garten ändert sein Aussehen, seinen Charakter, wann immer ich ihn aus einer neuen Position betrachte. Im See schwimmen kleine Inseln und aus dem Wasser ragen einige fein verzierte, elegant wuchtige vasen-artige Gebilde, hinter dem See folgen weitere Pavillons, wieder Felsen, wieder Büsche. Einer der Pavillons ist nach einem berühmten Kalligraphen der Ming-Dynastie benannt und vor ihm befindet sich ein flacher Teich, in dem sich hunderte bunte Karpfen tummeln. Manche schwimmen aggressiv aufeinander zu, ein komischer Bruch mit der fast meditativen Idylle. Rasch finde ich den Grund heraus: Ein kleiner Junge wirft Futter ins Wasser. Später erfahre ich, dass es spezielles Karpfenfutter an der Information zu kaufen gibt. Die Fische sind wunderschön: von schwarzweiß bis orangeschimmernd, helle und dunkle, einfarbige und gemusterte, rote, rot-schwarze, rot-weiße; keiner gleicht genau dem anderen. An einer Stelle ballen sie sich besonders dicht. Ich bekomme fast Mitleid, wie sie übereinander und sogar aus dem Wasser springen, um möglichst viel vom Fressen zu ergattern. Sie reißen ihre Mäuler auf, als müssten sie nach Luft schnappen. Ich frage Yifan, ob das Koi-Karpfen sind. »No, no koi«, sagt er, heftig abwinkend. Vermutlich ist das der japanische Begriff für die Fische, den sie in China weniger mögen. Ich erzähle ihm, dass wir daheim in Franken die Karpfen frittieren, vornehmlich zur Faschingszeit. Dabei stelle ich fest, dass das Konzept Fasching gar nicht so leicht auf Englisch zu erklären ist. »No, no, we don’t eat them«, sagt Yifan. Das finde ich bemerkenswert, sonst futtern die Chinesen doch auch alles, was ihnen unter die Finger kommt. Ich frage also nach. »The fish«, so Yifan, »means freedom. If the fish are fine, we are fine.« Wir besichtigen noch einige der Pavillons, die feine Schreibstuben aus dem 16. Jahrhundert beherbergen. Da haben die Chinesen in aller Ruhe ihre Schriftzeichen gemalt. Und auch heute noch ist diese Ruhe zu spüren, obwohl überall in den Gärten die Besucher reden und schwitzen und Fische füttern. Ich würde 96 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
mich gern in eine der Stuben setzen, um eine Zeit lang zu verweilen, aber vor den Eingängen sind Absperrbänder angebracht. Die Schreibutensilien sind hier mit der gleichen Sorgfalt angeordnet wie die Schminkutensilien in Europa. Beinahe halte ich das für ein Kompliment für die Schreibutensilien, dann besinne ich mich eines Besseren. Nach dem Rundgang durch die Alten Gärten gehen wir essen. In einem der kleinen Läden gibt es soup dumplings für uns. Das sind mit heißer Suppe gefüllte Teigtaschen– und sie sind eine besondere Herausforderung für den ungeübten Stäbchenesser. Denn man muss die Dumplings, auf den Stäbchen balancierend, aufbeißen und zuerst die Suppe herausschlürfen, bevor man den eigentlichen Dumpling essen kann. Den ersten stecke ich mir noch als Ganzen in den Mund, sodass mir die heiße Suppe den Gaumen verbrüht. Yifan kreischt leicht auf, entschuldigt sich sodann und erklärt mir das korrekte und schmerzlose Vorgehen. Zu trinken gibt es erstaunlicherweise keinen Tee, sondern einen dunkelroten Saft, der nach gekippten oder auch vergifteten Kirschen schmeckt. Daniel gibt nach dem ersten Nippen ein lautes »Wääh!« von sich. Am späteren Nachmittag gehen wir zum Tempel, eine frei und großzügig angelegte Ansammlung von mehreren offenen Tempelhallen mit einem kleinen zentralen Platz in der Mitte. Vor der Tempelanlage befinden sich große Feuerstellen, tief in den Boden eingegraben, in denen Kohlen glühen. Es riecht nach verkohlter Pappe, überlagert von einem süßen, schweren Aroma, das ein wenig an das E-Zeug erinnert, das bei uns die gesundheitsbewussten Raucher qualmen – aber weniger zurückhaltend, viel intensiver, eindringlicher. Der Tempel ist weit und offen angelegt, es gibt mehrere Hallen mit riesigen Buddha-Statuen. Hier sei nichts besonders verboten, sagt uns Yifan, nur sollten wir bitte den Buddha nicht fotografieren. Wir dürfen sogar in eine der Hallen hineingehen, in der etwa zwanzig Mönche gerade in eine Zeremonie vertieft sind. Sie klopfen unentwegt auf ein Gefäß und sprechen dazu die immergleichen Laute. Ich frage 97 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
Yifan, ob das echt chinesisch sei und er bejaht es. Beim Betreten der Halle müssen wir lediglich aufpassen, nicht auf eine kleine Erhöhung am Eingang zu treten, weil es sich bei ihr, so Yifan, um die Schulter des Buddhas handele. In allen Räumen sind kleine Altäre aufgebaut, auf denen Früchte und andere Speisen liegen. Vor manchen Altären knien einzelne Frauen nieder, wahrscheinlich beten sie. Hier ist der Gipfel der Ruhe erreicht, wir riechen die glühenden Kohlen, wir hören die schnellen, gleichläufigen Schläge, den monotonen Singsang der Mönche. Frei bewegen wir uns durch die Tempelhallen und werden immer stiller. Kurz vor dem Ausgang des Tempelgeländes kommen wir noch an einem Verkaufsstand vorbei, der Ketten und Amulette und sonstiges Zeuch anbietet. Daneben ist ein Bassin mit ebenso hübschen Karpfen, wie ich sie in den Gärten bestaunt habe. Ich frage Yifan, was es mit ihnen auf sich hat, der deshalb die gelangweilt wirkende Merchandise-Tante hinter dem Tresen anspricht. Dann übersetzt er, was er von ihr erfahren hat: Man könne für 200 Yuan einen Karpfen kaufen, um ihn zu befreien, was bedeute, dass man ihn in den Bach hinter dem Stand werfen dürfe. Das klingt blöd und gut zugleich, nach kurzer Überlegung stimme ich dem Geschäft zu. Die Verkäuferin lässt meinen Schein zweimal durch ein Echtheitsprüfgerät laufen, dann ist der Handel besiegelt. Ich wähle einen besonders schönen Karpfen aus und versuche, ihn mit den Händen zu fangen. Zweimal schlüpft er mir durch die Finger, dann ergreife ich ihn mit Yifans Hilfe. Der Karpfen zappelt wild, als ich ihn aus dem Bassin hebe. Mit dem kämpfenden Karpfen im Arm gehe ich zum Brückchen, blicke auf den Bach hinunter, in dem bereits hunderte Artgenossen umeinander schwimmen. Ich überlege kurz, ob ich irgendetwas Feierliches sagen soll. Doch im Hintergrund höre ich den monotonen Singsang, ich rieche die Kohlen und den dumpf muffigen Geruch des Karpfens. In diesem Ambiente scheint mir eine Rede unangemessen und so streichle ich den Karpfen und flüstere ihm bloß etwas ins Ohr: »In Franken würden wir dich frittieren, bis du nicht mehr zu erkennen wärst und dann würden wir dich in Kartoffelsalat ersaufen. Aber ich respektiere, 98 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
dass du ein kultivierter Karpfen bist und befreie dich hiermit.« Sodann werfe ich ihn im hohen Bogen in den Bach. Er macht einen satten Bauchplatscher. Ich bin vollkommen überzeugt, etwas Gutes getan zu haben. Daniel zündet am Ausgang noch ein paar kostenpflichtige Kleinfackeln an, was ihn insgesamt sogar mehr als 200 Yuan kostet. Bevor wir zur Rückfahrt aufbrechen, muss Yifan noch einmal auf Toilette. Ich begleite ihn, teils damit er nicht glaubt, unsere Gruppe aufzuhalten, teils weil ich unschlüssig bin, ob ich nicht auch muss. Letztlich warte ich draußen auf ihn. Der Tempel schließt um diese Zeit für Touristen. Während ich noch auf Yifan warte, sehe ich, wie ein zahnloser Chinese die Karpfen aus dem Bach keschert und wieder ins Bassin zurückbringt. Hier haben sie ganz offenbar verstanden, wie das mit der Freiheit läuft.
99 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
Zwölf Die Promenade der Fremden
Vom tiefen Bellen eines großen Kampfhunds werden wir aus unserer Unterhaltung gerissen. Das Viech, so muss man es wirklich nennen, ist uns beängstigend nah gekommen, versperrt uns den Weg und fletscht die Zähne. Auf der Promenade sind heute Mittag tausende Chinesen unterwegs und jeder von ihnen könnte der Halter sein. Doch keiner scheint sich um den Hund zu kümmern. Wieder bellt er. Ich spaziere zusammen mit Hildi über the Bund; wir wollten uns an meinem vorletzten Tag in Shanghai unbedingt noch einmal treffen. Sie erzählt mir schon seit unserem Aufbruch gegen zehn Uhr morgens, teils auf Deutsch, teils auf Englisch, eine faszinierende Geschichte nach der anderen über Pudong, Shanghai und China im Allgemeinen. Jetzt tritt sie schräg hinter mich, versteckt sich vor dem Kampfhund. Das Viech bellt ein weiteres Mal und nähert sich bis auf Sprungweite. Es ist inzwischen so nah gekommen, dass ich glaube, es riechen zu können, durch all die anderen Gerüche hindurch. Shanghai ist, besonders hier auf der Promenade, ein wahrer Geruchsmoloch: das trübmodrige Wasser des Huangpu-Flusses, der Schweiß von Touristen und gehetzten Einheimischen, die süßliche Brise, die von den ultrafuturistischen Hochhäusern drüben in Pudong herüberweht, der Duft frisch gebratener Speisen und – wie als Grundmotiv – dieses Teeige, das überall immerzu in der Luft liegt. Durch all das hindurch bilde ich mir ein, den Hund riechen zu können: Den strengen Körpergeruch eines Raubtiers und den faulen Atem. Weil sie mir näher kommt, auch weil sie mir so interessante Sachen erzählt hat, spüre ich eine Anziehung zu Hildi. Sie ist – auch das ist irgendwie ein Verdienst Chinas, etwas Neues – die 101 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
erste Kantianerin überhaupt, die mir gefällt. Trotz der Gefahr, die da bellend vor uns steht, muss ich schmunzeln: Wenige Minuten bevor der Kampfhund in unseren Weg trat, erzählte sie mir von einem großen Schild, das während der Kolonialzeit vor einem Parkeingang an der Promenade stand: »Zutritt für Hunde und Chinesen verboten«. Das hat sich offensichtlich geändert. Wir schlendern bereits zwei Stunden über Shanghais berühmte Uferpromenade vis-àvis der Skyline von Pudong. Auch an meinem vorletzten Tag hat es dieselbe brütend schwüle, dauerpräsente Hitze, die durch Mark und Bein geht. Reiseführer und Online-Karten nennen die Promenade the Bund. In weiten Teilen der Reiseliteratur gilt sie als Nummer Eins unter den Sehenswürdigkeiten von Shanghai. Wer also nach Shanghai kommt, sollte sich unbedingt the Bund anschauen. Dabei ist die Hauptattraktion gar nicht einmal die Promenade selbst, sondern der Blick hinüber nach Pudong, der sich, von den richtigen Punkten aus, schwindelerregend spektakulär ausnehmen kann. Dort, am gegenüberliegenden Ufer, wurde in wenigen Jahrzehnten eine Art neueres, größeres, cooleres Manhattan hingestellt, das irgendwie leichter und frischer wirkt. Von der Promenade aus kann man es wie in einem Ausstellungskatalog der Zukunft betrachten. Ansonsten gibt es auf der Promenade selbst außer unfassbaren Menschenmassen nichts Nennenswertes. Man kann eben herumschlendern. Mir kam das von Anfang an komisch vor: the Bund. Warum sollten die Chinesen die Top-Attraktion einer ihrer Mega-Städte auf Englisch benennen? Das könnte man sich in Deutschland vorstellen oder auch in Skandinavien, aber doch nicht in China. Bald nach meiner Ankunft in Shanghai fand ich heraus, dass tatsächlich kein Einheimischer und vor allem nicht die Taxifahrer den Namen the Bund kennen. Yifan klärte mich bei einem unserer Spaziergänge schließlich auf: The Bund ist ein Kunstname für die Touristen. Die Shanghaier dagegen benutzen für ihre Promenade einen eigenen Namen, einen chinesischen natürlich, der auf Deutsch übersetzt so viel heißt wie: Die Promenade der Fremden. 102 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
Das fand ich großartig, das leuchtete mir sofort ein. Da scheinen die Chinesen schon sehr gewieft. Sie haben nämlich verstanden, dass man für uns Deppen aus dem Westen simple Namen erfinden muss, damit wir uns zurechtfinden – eine Silbe aus vier Buchstaben, das ist idiotensicher. Und außerdem wissen sie, dass es vorteilhaft ist, die Deppen aus dem Ausland ins eigene Land zu lassen, was die Chinesen so wohltuend von beispielsweise den Nordkoreanern unterscheidet. Denn die Deppen sind zwar ziemlich unbeholfen und vertragen die Hitze schlecht, aber sie bringen Geld und Technologie mit sowie ihre Geschichte, Kultur und Philosophie. Dafür kann man ihnen dann sogar die große Promenade mit dem besten Ausblick der Stadt überlassen. Einen Shanghaier, der zum eigenen Lustwandeln über die Promenade geht, wird man lange suchen müssen. Und zum Schluss – ein großes Zeugnis chinesischen Humors, wie ich finde – benennt man das insgeheim, für sich selbst, ganz ehrlich und sachgemäß: Die Promenade der Fremden. Wenn ich nun hier entlang spaziere, habe ich freilich zwiespältige Gefühle. Ich sehe das bessere Manhattan, ebenso gigantische wie gigantomanische Baukunst; ich sehe das derzeitige Spitzenprodukt der Moderne, vielleicht aber auch schon die Ansätze einer anderen, zukünftigen Epoche; ich sehe ein steingewordenes Wirtschaftswachstum, dem selbst der Himmel keine Grenze zu setzen scheint. Dahinter ahne ich, und so geht es wohl den meisten Europäern, allerdings auch die Opfer dieser neuen Zeit, die unsichtbaren Kollateralschäden dieser Wachstumsexplosion. Das ist der Zwiespalt im Gefühl: Bewunderung und Angewidertsein in Einem. Oft begegnen wir den Chinesen mit einer entsprechenden, wenig aufrichtigen Haltung: Faszination, gemischt mit Verachtung. Zurück in Deutschland, wenn keine Chinesen mehr zugegen sind, flüstern wir, meist unter vorgehaltener Hand, man müsse doch einmal die Menschenrechte ansprechen. Das ist unser Humor. Ich kann nicht behaupten, ich fände ihn witziger. Wieder bellt der Hund und Hildi schmiegt sich jetzt vorsichtig an mich. Das ist bestimmt ein großer Tabubruch, aber schön. Die 103 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
Situation erlaubt es mir nicht, darüber nachzusinnen; in Gedanken bereite ich mich vielmehr bildreich, adrenalinunterfüttert darauf vor, den Hund irgendwie abzuwehren. Wenn er uns anspringt, sollte ich zumindest meinen Unterarm vor dem Körper anwinkeln, damit das Viech erst einmal nur meinen Arm zu fassen bekommt und mir nicht gleich mein Gesicht kaputtbeißen kann. Ich schweife ab und male mir eine epische Schlacht aus: Mensch gegen Hund. Besser noch: Europäer gegen Kampfhund, zum Schutz der Chinesin, auf der eigens für uns Fremde hingestellten Promenade. Und weiter: Ich sehe schon die eiternde Infektion, die dem Hundebiss notwendig folgen und letzten Endes zur Notamputation meines rechten Unterarms führen muss. »So wird es kommen«, höre ich es aus einem dunklen Schacht in meinem Inneren sprechen, der alle äußeren Eindrücke – Skyline, Huangpu, Promenade – verschluckt hat. Im nächsten Augenblick sehe ich plötzlich ganz deutlich, wie sich die Haare auf meinem Unterarm aufstellen, blond im einfallenden Sonnenlicht und auf glänzender Haut. Dann knurrt es und ich sehe bloß noch die gefletschten Zähne des angriffsbereiten Hundes. Da tritt auf einmal ein Einheimischer aus der Masse heraus und eilt in großen Schritten auf den Hund zu. Es ist fast, als wechselte er den Aggregatszustand von Masse zu Einzelnem. Schon baut er sich zwischen uns und dem Hund auf und schreit wütend auf ihn ein. In der gleißenden Mittagssonne sehe ich den Speichel des Hundebesitzers in alle Richtungen stäuben, er hört nicht auf zu schimpfen und schlägt mehrmals auf den Hund ein. Dieser jault laut auf, zieht seinen Schwanz ein und trottet winselnd mit seinem Halter ab. Hildi tritt hinter mir hervor und ich fühle mich wie ihr Retter, obwohl ich keine Ahnung habe, woher der Hundehalter auf einmal kam. Wir lachen erleichtert und schlendern weiter die Promenade entlang, wobei mein Gang etwas breiter und aufrechter als zuvor ist. Ich spreche sie nochmals auf ihren echten Namen, mein Interesse an ihm ebbt nicht ab, aber sie wiegelt zum wiederholten Male ab. Manchmal bleibt einer der chinesischen Touristen stehen 104 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
und starrt mich an oder winkt oder möchte sogar ein Bild mit mir machen. Vor jeder Aufnahme wische ich mir mit dem Handrücken den Schweiß von der Stirn, von Mal zu Mal theatralischer. Ich muss mich zusammenreißen, um nicht einen Tag vor dem Abflug noch einen Wisch-Tick auszubilden. Die bleierne Hitze rund um die Uhr und die Nässe der Luft, dazu mein Hang zum Schwitzen: Ich beginne mich auf kühle Münchner Abende im Frühherbst zu freuen. Nach einem weiteren Foto sage ich zu Hildi: »Weißt du, das ist schon lustig mit der Promenade:« – Sie schaut mich erwartungsvoll an. – »Zuerst einmal finde ich es ziemlich witzig von euch, dass ihr eure Top-Attraktion für die Touristen mit einem blöden englischen Namen verseht, um sie dann insgeheim nach uns Fremden zu benennen. Und zu eurem Geheimnamen ist mir gerade eingefallen, dass Promenade ja ein altes deutsches Wort für Spaziergang ist. Und einen Spaziergang machen wir ja gerade.« Ich halte kurz inne und schaue sie an: »Dann bin ich jetzt der Fremde.« Sie lacht. Es überrascht mich gar nicht mehr, dass sie natürlich auch das Wort Promenade kennt. Ihr Deutsch ist großartig, allenfalls einen leichten Akzent hört man ihm an. Ebenso wie Qi, mit dem ich in der Bibliothek über Baden-Württemberg und Spätzle philosophieren durfte, macht sie manchmal den Eindruck, als stellte sie sich in Bezug auf Deutschland und die deutsche Sprache absichtlich ein bisschen dumm, damit wir fremden Deutschen das auch verstehen können. Als gäbe es ein geheimes Wissen über Deutschland und das alte Europa, das nur den Chinesen bekannt ist. Als erzählten sie uns ein paar Märchen über unsere Heimat, die wir selbst noch nicht kennen, kindgerecht aufbereitet. Ein Grund für diese Haltung uns gegenüber könnte darin liegen, dass sie unsere Geschichte nicht sonderlich beeindruckt. Vor allem ihre Dauer halten sie für einen Witz, ähnlich wie wir den Amerikanern gegenüber empfinden, wenn sie darüber staunen, dass es Häuser und Dinge aus dem Mittelalter gibt, die über 500 Jahre alt sind. Zudem mag bei der einen oder dem anderen eine gewisse Verachtung für unsere Werte mit hineinspielen, zumindest für die tatsächlich gelebten 105 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
Werte: Menschenrechte, die wir mit einem seicht-moralischen Gefühl besonders dann thematisieren, wenn sie gerade keinem wirtschaftlichen Erfolg entgegenstehen; unsere Vorstellung, wir seien irgendwie freier in der Benutzung von Apple, Google oder Facebook, nur weil bei denen nicht der Staat, sondern Private dahinterstehen. Sogar zum Thema Promenade kann meine Begleitung mit zusätzlichen Fun Facts aufwarten. So erzählt sie mir vom Schweizer Soziologen Lucius Burckhardt, der in den Achtzigerjahren des letzten Jahrhunderts die Wissenschaft der Promenadologie entwickelt habe. Bei dieser – sie holt tief Luft und spricht das Wort tatsächlich fehlerfrei aus – Spaziergangswissenschaft, gehe es darum, den Menschen in seinem urbanen Umfeld zu kontextualisieren. Nur in jenem Bereich seiner Umgebung, den der Mensch durch Spaziergänge erkunden könne, sei echte Wahrnehmung möglich. Wo er hingegen nicht spazieren könne, da gebe es für den Menschen bloß sinnliches Sehen, ohne alle tiefere Bedeutung. Ich bin beeindruckt und belustigt zugleich. Wie kann man nur von so einem Unsinn wissen? Doch gleich darauf schäme ich mich, weil sie fehlerfrei »Spaziergangswissenschaft« sagen kann, ich aber nicht einmal für würdig erachtet werde, ihren Namen zu erfahren. Nachfragen muss ich trotzdem: »Woher zur Hölle weißt du denn sowas?« Sie erklärt mir, dass sie während ihrer Jahre in Deutschland für ein paar Monate in Kassel lebte, um die Geschichte der dortigen Gesamthochschule zu erforschen, die für ihre Promotion über Wissenschaftsgeschichte relevant war. An der Kasseler Hochschule, die heute eine Universität ist, hatte Burckhardt seine Theorie entwickelt. Die Erklärung ist zwar biografisch überzeugend, sie macht die ganze Sache allerdings noch schräger; hätte es nicht einfach ein Zufallsfund auf Wikipedia sein können? Wir überqueren mit einer Fähre den Huangpu, um am anderen Ufer das höchste Gebäude der Stadt, das dritthöchste der Welt zu erklimmen, den Shanghai Tower. Aus der Nähe wirkt der 106 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
Wolkenkratzer wie eine sich in den Himmel hineinschraubende Glasspirale, während er von der Promenade aus noch wie ein unspektakulärer Pfeiler unter den vielen anderen der PudongSkyline ausgesehen hat. Meine Begleiterin lotst mich geschickt an den Menschenmassen vorbei, die vor dem Haupteingang warten, und bucht uns mittels irgendeiner App für den halben Preis zu einer geführten chinesischen Gruppe dazu, die den Seiteneingang nutzen darf. Wir kommen also sogleich in die Eingangshalle, müssen dafür jedoch auch ein paar Nachteile in Kauf nehmen: Wir müssen uns brav in Zweierreihen aufstellen, bekommen gelbe Bändchen in die Hand, die wir von Zeit zu Zeit hochhalten sollen, und außerdem wird von uns erwartet, dass wir »Wooh-Wooh« rufen, wann immer unser Guide irgendetwas gesagt hat. Wie gewohnt werde ich zuerst komisch angeschaut, auch meine blauen Kinesio-Tapes, von denen immer noch Reste an meinem linken Bein kleben, werden kritisch beäugt und von einer Dame sogar angezuppelt – wie schon vor ein paar Tagen in der U-Bahn. Aber als ich die gelben Dinger in die Luft recke und halbwegs synchron bei den Ritualen mitmache, legt sich die Verwunderung über meine Anwesenheit. Meine Begleitung erweist sich auch noch als ausgezeichnete Simultan-Dolmetscherin, sodass ich die wichtigsten Erläuterungen unseres Führers mitbekomme. So weiß ich auch, dass es der schnellste Aufzug der Welt ist, der uns in weniger als einer Minute ins hundertneunzehnte Stockwerk fährt. Droben ist ein ziemlich einfallsloses Restaurant untergebracht, dessen äußere Seitenwände komplett mit Plexiglas umschlossen sind. Die Aussicht in alle vier Himmelsrichtungen ist atemberaubend. Erstmals sehe ich den Huangpu, wie er sich in voller Breite durch Shanghai schlängelt, auf ihm unzählige Containerschiffe, die den Hafen ansteuern, von dem aus die Waren in alle Welt und bis zu uns verschifft werden. Die meisten der anderen Hochhäuser, die sich über die Stadt ausbreiten, sehen von hier oben aus wie Miniaturen. Es ist diesig, dennoch reicht der Blick aufs Meer hinaus. Zur anderen Seite nimmt die Stadt einfach kein Ende und man bekommt ein Bild von der abstrakten Zahl: 26.000.000 Einwohner. Erst aus dieser Höhe fällt mir auf, dass das Shanghai 107 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
World Financial Center wie ein Flaschenöffner aussieht; bestimmt hat es auch einen besseren chinesischen Namen, der sich über Geldgier und Reiselust des Westens lustig macht. Mir schwant, welche Flaschen dort geöffnet werden und was anschließend mit den Kronkorken geschieht. Allmählich wird mir etwas schummrig von der Höhe und ich schaue mich zur Entlastung ein bisschen im Restaurant um, das sehr beruhigend ist: flach und kühl und langweilig. »Chapeau!«, sage ich zu meiner Begleiterin, als ich wieder zurück an die Plexiglasscheiben trete. Sie lächelt mich an und ich meine, sie versteht, was ich meine. Wir gehen ein wenig herum und setzen uns im Schneidersitz vor die Glaswand des Shanghai Towers, die dem Osten Shanghais zugewandt ist. Wir blicken wiederum auf ein Meer, ein Meer riesengroßer Plattenbauten, und erahnen, dass dies die notwendige Kehrseite des himmelstürmenden Wachstums von Pudong ist. Dort gibt es sicherlich Formen von Leid und Armut, die einem auf der Promenade nie begegnen werden. Ich frage sie noch einmal nach ihrem Namen. Mir kommt es vor, als wären wir uns über den Tag so nahe gekommen, dass jetzt endlich ein echtes persönliches Verstehen möglich geworden ist. Meine dritte Nachfrage scheint sie überzeugt zu haben, dass ich ihren Namen wirklich lernen will. Sie besorgt sich von einem vorbeilaufenden Kellner Zettel und Stift und malt ein großes, mehrfach in sich verschnörkeltes Schriftzeichen auf das Papier. Ich schaue ihr begeistert zu und zähle die einzelnen Striche, die sie fein aufeinander abstimmt: Es sind insgesamt sechzehn. Sie erläutert mir Einzelheiten, während sie zu Ende malt. Alles hat eine Bedeutung: Die Schreibrichtung, die Größe und Reihenfolge der Striche, ihre Proportionen und Lageverhältnisse. Als sie den Stift beiseitelegt, frage ich, ob das ihr Name sei. Sie lacht und winkt ab: Es ist das Zeichen für Schildkröte. Humor hat sie also auch noch. Aber was ist denn nun mit ihrem Namen? Sie seufzt, wendet den Zettel und setzt von Neuem an. Sie malt ein Zeichen mit noch mehr Strichen, abermals fein säuberlich. Sie spricht mir das Wort vor – ein längeres Wort, mit Pausen, die Stimme geht 108 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
rauf und wieder runter und er hört sich doch an wie aus einem Guss – aber der Klang entschwindet mir sofort wieder. Der Name setzt sich offenbar aus zwei Teilen zusammen. Sie erklärt mir, dass der erste Teil für eine Eigenschaft stehe und entweder als elegant und fein übersetzt werden könnte oder aber als stimmlos und die Sprache verschlagend; der zweite Teil stehe für einen mächtigen Krieger und sei eigentlich ein Jungenname. Ihre Eltern hätten ihr den Namen gegeben, weil sie als Tochter das einzige Kind geblieben sei. Bei diesen Worten huscht eine Emotion über ihr Gesicht. Ich ahne die Abgründe von EinKind-Politik und männlicher Erbtradition, traue mich aber nicht, danach zu fragen. Ich will keine Wunden aufreißen. Bei uns scheint mir das alles einfacher zu sein, da heißen die Älteren Karl-Heinz und die Jüngeren Chiara. Um sie auf leichtere Gedanken zu bringen, schäkere ich ein bisschen mit ihr, als wir mit dem schnellsten Aufzug der Welt wieder auf den Boden Pudongs zurückfahren. Wie sich die Aufzugtüren öffnen, will ich – halb im Scherz, halb im Ernst – noch einmal dafür gelobt werden, wie heldenhaft ich sie vorhin vor dem bösen Kampfhund rettete. Sie klopft mir leicht gegen die Brust und lacht: »Ich habe doch dich gerettet!« Erst denke ich, sie will mich bloß necken, doch schlagartig wird mir klar, dass sie recht hat. Während ich in meinem inneren Tunnel verschwunden war, schimpfte sie auf Chinesisch, und zwar bestimmt mit dem Hundehalter – darum kam der überhaupt. Jetzt erst, in der Erinnerung, höre ich es bewusst. Als sie merkt, dass mir soeben der wahre Verlauf der Begebenheit klar wird, lacht sie erneut. Dann schaut sie mich nervös an: Sie hat sich für einen Moment gehen lassen und mir das unbegründete Gefühl der Überlegenheit genommen. Wir schauen uns an und atmen gleichzeitig tief ein. Der Moment, den wir hatten, ist weg. Ich schlage vor, dass wir noch ein wenig weiter spazieren, es ist noch nicht spät. Sie ist einverstanden. Die Luft ist jetzt ein bisschen raus, unseren Unterhaltungen fehlt die untergründige Spannung. Sie lässt sich jedoch nichts anmerken und lenkt unser Gespräch, höchst professionell, von einer interessanten Sache 109 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
zum nächsten faszinierenden Ding. Ich staune, schmunzle. Der Rückweg zur Promenade wird eine kurzweilige Stunde werden, gemeinsam mit Hildi, der elegant-feinen, gar nicht stimmlosen Kriegerin – die Bedeutung ihres Namens ist noch da, der Klang jedoch ist weit schon weg – ist es schön. Die Skyline von Pudong ragt hinter uns in den heißen Nachmittagshimmel.
110 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
Der Shanghai Tower, das dritthöchste Gebäude der Welt, schraubt sich in den Himmel über Pudong
111 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
Dreizehn Schlachtschüssel mit Bittermelone zugleich ein Nachwort aus der Coronakrise
Vor einem Jahr, fast auf den Tag genau, stiegen wir in den Flieger nach Shanghai, noch im Ungewissen darüber, was für eine aufregende und kuriose Zeit uns dort erwarten würde. Heute, fast auf den Tag genau, hätten wir unsere Mission, den Chinesen die Deutsche Philosophie näherzubringen, in Peking fortsetzen sollen, und zwar an der staatlichen Renmin-Universität, die auf Deutsch meist Chinesische Volksuniversität genannt wird. Diese ursprüngliche Planung wurde von einer, wie es zunächst hieß: mysteriösen Lungenkrankheit zunichte gemacht. Schon früh im Jahr wurde uns klar, dass sich die Peking-Pläne nicht würden umsetzen lassen, schon zu einer Zeit, als wir die mysteriöse Krankheit noch für ein regionales chinesisches Problem hielten. Anfang des Jahres 2020 war die Krankheit als Corona-Virus zwar weltweit bekannt geworden, wurde jedoch weiterhin in ihrem pandemischen Potenzial unterschätzt. Selbst als die ersten Vorboten der Pandemie in die bayerische Automobilzuliefererbranche einbrachen, ging das Leben in Bayern – in meiner Wahlheimat München und in meiner Heimat Franken – noch ohne Einschränkungen weiter. So kam es, dass ich im Februar 2020 noch einmal eine Schweinfurter Schlachtschüssel besuchte, das unterfränkische Kulturgut schlechthin, von dem man am meisten befürchten muss, dass es für alle Zukunft verschwunden ist. Die Schweinfurter Schlachtschüssel ist nämlich die, womöglich weltweit, coronafreundlichste Art des persönlichen Zusammenkommens. Das Wesen einer solchen Schlachtschüssel besteht im Allgemeinen darin, dass sich eine größere Zahl von 113 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
wenigstens zwanzig Personen in einem meist schlecht belüfteten, eng bestuhlten Raum trifft, um dort über viele Stunden eine gekochte Sau in mehreren Gängen komplett zu verspeisen. Die BWLer nennen das zugrunde liegende Prinzip heute nose to tail, der unterfränkische Metzger bevorzugt seit jeher die Benennung ganze Wutz – unser Ausdruck für die Sau. Das Besondere an der Schweinfurter Version der Schlachtschüssel besteht darin, dass Schwein und Beilagen – Sauerkraut, Kren, Schwarzbrot, dazu Salz und Pfeffer, welche die Aufzählung zwingend abschließen – direkt auf den Tisch serviert werden. Es gibt Besteck, aber keine Teller. An einer langen Tafel werden im Abstand von wenigen Metern Fleischhäufchen des jeweiligen Gangs angerichtet, sodass jeweils eine Gruppe von vier bis acht Personen sich am Häufchen bedienen kann. Die Kellner, im Hauptberuf allesamt Metzger, tragen fortwährend große, vom Fleischsaft tropfende Platten durch den Raum, füllen im Minutentakt die Häufchen wieder auf, und zwar so kunstvoll in die Mitte der Kleingruppen, dass jeder auf alle Teile zugreifen kann. Man holt sich die dampfenden Stücke vom Schwein mit der Gabel heran, schneidet, so man will, ein bisschen Fett oder Knorpel ab, und tunkt die Stücke dann in die selbst angerichtete SalzPfeffer-Mischung oder in den Kren, bevor man sie isst. Dazwischen gabelt man hin und wieder zur Abwechslung ein Stück Brot auf, das man sich klugerweise vorportioniert hat. Was man an Fett oder Sonstigem abgeschnitten hat oder was man einfach nicht mehr aufessen mag, schiebt man wieder zurück in die Tischmitte, wo es von den Metzgerkellnern eingesammelt wird. Aus diesen zurückgeschobenen Stücken machen sie zeitgleich im Keller Wurst, die von den Tapferen und Standfesten, die den ganzen Tag durchhalten, am Ende zur Belohnung mit nach Hause genommen werden kann. Bei diesem Ablauf ist es unvermeidlich – und das ist Teil der unterfränkischen Lebensart –, dass ein reger Austausch von Säften aus Schwein und Mensch stattfindet. Man sitzt nah beieinander, man tätschelt und tatscht sich mit fortschreitender Zeit immer herzlicher an. Getrunken wird entweder Wein- oder Mostschorle, serviert in der Einheitsgröße von einem halben 114 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
Liter. Nur wenige und eher die Unkundigen trinken Bier dazu. Vom Bier ist deswegen abzuraten, weil über die vielen Stunden sehr viel Schwein und sehr viel Getränk zusammenkommen und diese Mischung im Fall des Biers in der Regel zu mächtig wird. Aber da ist natürlich jeder frei. Die kulinarischen Höhepunkte sind die Gänge mit den Innereien wie Herz, Nieren, Lunge, besonders aber der Rüssel und andere Teile des Kopfs. Zu vorgerückter Stunde, meist kurz bevor die genannten Spezialitäten serviert werden, finden sich spontan gebildete Chöre zusammen, die bekannte deutsche Schlager und Volkslieder singen. Begleitet werden sie dabei von einem Alleinunterhalter am Keyboard, der zuverlässig ausschaut wie ein Palliativpatient auf seinem letzten Heimbesuch und zu dessen Aufgaben es auch gehört, die Lieder auf die Themen Schwein und Schweinfurt umzudichten. Da heißt es zum Beispiel: »Bring mir doch ein kleines bisschen Nierle, Nierle« auf die Melodie von Schenk mir doch ein kleines bisschen Liebe. Auch bei diesem essenziellen Programmpunkt wird viel – wie wir heute wissen: Aerosol produziert. Außerdem braucht es für eine echte Schlachtschüssel noch einen kleinen fensterlosen Schnapsraum, in dem bis vor wenigen Jahren die schönsten Doppelseiten aus der 90er-Jahre-Zeitschrift Coupé hingen. Irgendeiner – auch ich habe das schon gemacht – bricht das Siegel, in der Regel zu noch viel zu junger Stunde, indem er die erste Runde Schnaps aus diesem Kämmerchen holt. Meist handelt es sich um großzügig eingeschenkte Willys oder Mirabellen, die vom Schnapsglasrand heruntertropfen. Wer holt, der zahlt – einen Euro pro Stück, früher eine Mark. Die Schnäpse sind von minderer Qualität, doch sie erfüllen punktgenau ihren Zweck, der ohnehin kaum mit ihrem Geschmack zusammenhängt. Irgendwann gibt es dann auch noch Kaffee und längliche Stücke von Käse- oder Streuselkuchen. Die Schweinfurter Schlachtschüssel im Februar 2020 fand noch wie gewohnt statt. Nur wenige der Anwesenden verzichteten, aufgeschreckt von den neuesten Webasto-Meldungen, aufs Händeschütteln. Der übrige Ablauf war hingegen ganz tradi115 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
tionsgemäß: Man saß stundenlang gemeinsam in einem fensterlosen Raum, tätschelte und umarmte sich bei jeder Gelegenheit, tauschte angespeichelte Fleisch- und Fettstückchen aus und sang so laut wie man besoffen war, Aerosole überall. Heute, da ich Anlass habe, an meinen Shanghai-Aufenthalt zu denken, werde ich auch doppelt an die Schlachtschüssel erinnert. Denn zum einen kommt sie von allem, was die deutsche Küche zu bieten hat, der chinesischen Kochkunst, wie ich sie kennenlernte, am Nächsten. Und zum andern gab es damals, als ich in Shanghai war, bei einem unserer wunderbar opulenten Abendessen eine Begebenheit, die mich zwischen all den chinesischen Köstlichkeiten an die Schweinfurter Schlachtschüssel denken ließ. Zum ersten Punkt ist zu sagen, dass gerade das, worüber sich der deutsche Erstbesucher einer Schlachtschüssel am meisten verwundert, in der chinesischen Kochkunst geradezu als Grundprinzip gilt, nämlich das Prinzip der ganzen Wutz. Notfalls kann man das sogar tierethisch begründen, was mir jedoch weder der chinesische noch der fränkische Ansatz zu sein scheint. Das Ganze-Wutz-Prinzip ist vielmehr im Wunsch begründet, dem Tier in Konsistenz und Textur mehr Variation und Abwechslung abzuringen, als jene Eindimensionalität, die für die deutsche Küche so typisch ist. Insgesamt sind die Schweinfurter den Shanghaiern in diesem Aspekt natürlich unterlegen, weil in Schweinfurt die gekochte Sau, auch wenn sie in Gänze verarbeitet wird, am Ende doch in allen Teilen eher weich zubereitet wird. Organisierten die Chinesen einmal eine Schlachtschüssel, so ließen sie bestimmt die Knochen am Fleisch und bereiteten die verschiedenen Teile ganz unterschiedlich zu, um mehr Variationen in Geschmack und Textur zu erreichen. Aber im Vergleich zu einem weichen Schweinsbraten mit weichen Knödeln und weicher Soße ist bereits die Schweinfurter Schlachtschüssel komplex. Was nun jenes Abendessen in Shanghai betrifft, das mich an die Schlachtschüssel denken ließ, so wurde uns bei diesem als einem der letzten von vielen, vielen Gängen ein heißdampfen116 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
der Topf mit einer klaren, von kleinen Fettaugen bedeckten Suppe serviert. In der Suppe schwammen verschiedene Stücke gräulichen Fleischs, manche mit Fett, manche mit Knochen, manche mit beidem – und auch Stücke einer mir gänzlich unbekannten Substanz: mundgerecht, fest, grünlich mit einer Tendenz ins Orangefarbene. Der Geruch irritierte mich, weil er vertraut und fremd zugleich war: einerseits Schlachthaus, andererseits Zitrusfrucht im weitesten Sinne. Im längst gewachsenen Vertrauen auf die chinesischen Köche nahm ich mir gleichwohl eine randvolle Schüssel. Es schmeckte nach fettigem gekochten Schwein, also nach Schlachtschüssel, aber dieser Sau-Geschmack war vollständig eingebettet in ein ganz bitteres Aroma. Die umsitzenden Chinesen lösten auf meine Nachfrage das Rätsel: Ich aß gerade gekochte Sau mit Bittermelone, dem Grundnahrungsmittel schlechthin für arme Shanghaier. Die Bittermelone war sehr ungewohnt, aber sie erfüllte den gleichen Zweck wie bei uns in Unterfranken die Mostschorlen. Dem Fett muss etwas entgegengesetzt werden, das es mit ihm aufnehmen kann. Was, ist eigentlich wurscht. Übrigens erinnere ich mich mit Schrecken an die Wochen nach meiner Rückkehr nach Deutschland. In dieser Zeit der Wiedereingliederung in die heimischen Essgewohnheiten schmeckte mir fast gar nichts mehr. Die chinesische Küche hatte mich im Guten verdorben: Nichts in Deutschland war wahrnehmbar gewürzt, alles war weich. Im Vergleich zu China war das Essen farblos. In liebevoller Absicht lud man mich zum Weißwurstfrühstück mit Senf und Brezn ein – und es war einfach nur weich. Das Weißbier schmeckte schon beim ersten Schluck wie früher das Aufstoßen nach dem letzten. Ich geriet tatsächlich in tiefe Sorge, weil mir dieser große Kulturvorsprung bayerischer Lebensart, die Gemütlichkeit, plötzlich nicht mehr zugänglich zu sein schien. Die allgemeine Unruhe meiner Gedanken nach den aufreibenden Eindrücken Shanghais verstärkte meine Sorgen noch. War ich nun auf immer unfähig zur Gemütlichkeit, würde ich nach Schwaben ziehen müssen?
117 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
Viele bei uns in Deutschland glauben ja, Corona komme von den wet markets in China. Das kann man wohl nicht gänzlich ausschließen, aber falls es tatsächlich stimmen sollte, wäre es bloß eine faktisch-zufällige Erklärung: Da hätte dann also eine Fledermaus auf ein Pangolin gespuckt, das wiederum irgendein Chinese gegessen hätte – oder aus dessen Schuppen er irgendeinen Unsinn gemacht hätte, den dann eben ein anderer Chinese gegessen hätte. Aber wenn es so gewesen wäre, wer wäre da jetzt schuld? Die Fledermaus? Das Schuppentier? Der eine Chinese? Der andere Chinese? Auf jeden Fall doch nicht die Chinesen insgesamt! Und selbst wenn die Chinesen schuld wären, weil sie womöglich die Corona-Gefahr nicht ernst genug genommen haben könnten, so wären wir doch an unserer eigenen Situation mindestens ebenso schuld, weil wir so planlos mit ihr umgegangen sind. Wir haben im Westen nämlich genauso unsere dummen und unsere bösen Leute und viele Verantwortliche, die ganz ohne chinesische Hilfe schlimmen Unfug anstellen. Manchmal jedoch beschleicht mich der Eindruck, dass unsere Dummheit eine unmittelbare und notwendige Folge unserer Freiheit ist. Falls dem so wäre, hätten die Chinesen freilich einen Vorteil dadurch, dass sie nicht in unserem Sinne frei sind. So möchte ich die Welt allerdings nicht ansehen. Wenn der Westen etwas vorzuweisen hat, das ihn auszeichnet, dann wäre das ja gerade unser spezifisches Freiheitsverständnis. Also die Freiheit, dumm zu sein und schlau zu sein, Forschung zu betreiben oder eine Gaststätte, eine Klageschrift zu schreiben oder Liebesgedichte. In dieser Lebensdimension haben wir gegenüber den Chinesen unendlich mehr zu bieten, auch wenn sie mehr Leute haben, bald auch mehr Geld und obendrein den »Patienten Zero«. Es wäre schmerzhaft, die Schweinfurter Schlachtschüssel dauerhaft zu verlieren. Aber wenn sie der Preis für die Freiheit ist, dann bin ich bereit, sie zu opfern – vorausgesetzt freilich, der Rest passt. Inzwischen schmecken Weißwurst und Weißbier wieder, auch die Gemütlichkeit ist wieder eingekehrt. Zum chinesischen Res118 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
taurant in Deutschland gehe ich jedoch nicht mehr, da steht zu viel auf dem Spiel. Rachel Chu aus Crazy Rich Asians nimmt all die Schwierigkeiten mit der Familie aus Fernost ja der Liebe wegen auf sich. Aber sie ist natürlich nicht echt, sondern bloß eine Figur aus einem Film, der den Asien-Hype in den USA zu Geld machen will. Mei, darin sind sich West und Ost ja gleich. Im Film kehrt das Motiv immer wieder, dass die Hauptfiguren nicht machen dürfen, was sie glücklich macht. Aber das Motiv finden wir bei Kant und Hegel ebenso. Und außerdem ist das nur ein Film. Der Geld einspielen soll. Also: Wo ist der entscheidende Unterschied?
119 https://doi.org/10.5771/9783495826065 .
https://doi.org/10.5771/9783495826065 .


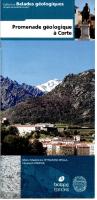
![Ordnungen des Anderen: Zum Problem des Eigenen in der Soziologie des Fremden [1. Aufl.]
9783839400845](https://ebin.pub/img/200x200/ordnungen-des-anderen-zum-problem-des-eigenen-in-der-soziologie-des-fremden-1-aufl-9783839400845.jpg)



![Die völkerrechtliche Verantwortlichkeit im Rahmen der Pacht fremden Hoheitsgebiets [1 ed.]
9783428584116, 9783428184118](https://ebin.pub/img/200x200/die-vlkerrechtliche-verantwortlichkeit-im-rahmen-der-pacht-fremden-hoheitsgebiets-1nbsped-9783428584116-9783428184118.jpg)

![Die völkerrechtliche Stellung der fremden Truppen im Saargebiet [Reprint 2010 ed.]
9783111414362, 9783111050386](https://ebin.pub/img/200x200/die-vlkerrechtliche-stellung-der-fremden-truppen-im-saargebiet-reprint-2010nbsped-9783111414362-9783111050386.jpg)