Franziskus von Assisi: Eine historische Darstellung 9783205100980, 3205005252, 9783205005254
118 23 23MB
German Pages [380] Year 1982
Recommend Papers

- Author / Uploaded
- Gert Wendelborn
File loading please wait...
Citation preview
GERT
WENDELBORN
Franziskus von Assisi
GERT W E N D E L B O R N
FRANZISKUS VON ASSISI Eine historische Darstellung
VERLAG HERMANN BÖHLAUS NACHF. WIEN-KÖLN-GRAZ
ISBN 3-205-00525-2 2. Auflage 1982 1977 Hermann Böhlaus Nachf. Gesellschaft m. b. H. Wien—Köln—Graz © 1977 by Koehler & Amelang (VOB), Leipzig Printed in GDR • Typografie Armin Wohlgemuth Schutzumschlaggestaltung A. Kresser
Inhalt Einführung 7 ERSTER
TEIL
Religiös-soziale Bewegungen vor und neben der frühen franziskanischen Bewegung 1. Frühe religiöse Gruppen mit häretischem Einschlag 13 2. Religiös-soziale Bewegungen im Gefolge der gregorianischen Reformpolitik 16 3. Wanderprediger vom Anfang des 12. Jahrhunderts 27 4. Die Gegenkirche der Katharer 34 5. Die Humiliaten 50 6. Die Waldenser 58 7. Die Katholischen Armen und die Wiederversöhnten Armen 67 8. Die gesellschaftlichen Hintergründe des Frömmigkeitswandels 71 ZWEITER
TEIL
Franziskus von Assisi und die ursprüngliche franziskanische Bruderschaft 9. Die Quellenlage 85 10. Die Jugend des Franziskus 101 11. Die Jahre des Umbruchs 114 12. Die Anfänge der Bruderschaft und die Urregel 121 33. Das Verständnis des Franziskus von seiner Berufung 136 14. Der Grundansatz der Nachfolge Christi 152 15. Die Armut 168 16. Die Demut 176 17. Der Gehorsam 184 18. Die Eindeutigkeit des neuen Lebens 188 19. Das Verhalten zu den Brüdern und zur Schöpfung 195 20. Die Natur als Anlaß zur Freude 214 21. Die Wanderpredigt 222 22. Die Arbeit 229 23. Der Bettel 233 24. Gemeinschaft und Eremitentum 236
25. Die Ausbreitung der Minoriten in Italien 247 26. Franziskus im Nahen Osten 250 DRITTER
TEIL
Der Beginn der Umbildung der minoritischen Bruderschaft in den Bettelorden der Franziskaner 27. Die Krise in der Bruderschaft während der Abwesenheit des Franziskus 259 28. Gefährdungen durch Erschlaffen des Enthusiasmus und Häresie 262 29. Die Kurie und das Amt des Kardinalprotektors 269 30. Ämter in der Bruderschaft und Amtsniederlegung des Franziskus 282 31. Franziskus und die Ordensgelehrten 293 32. Der Wille des Franziskus zur Erhaltung seines Grundansatzes 300 33. Der Wille des Franziskus zur Rechtgläubigkeit 309 34. Die schriftlichen Urkunden aus den letzten Lebensjahren 320 35. Stigmen, Krankheit und Tod des Franziskus 332 Schluß 343 Literaturverzeichnis 345 Abbildungsverzeichnis 355 Register 357
Einführung Ein neues Buch über Franz von Assisi wird den einen erfreuen, den anderen überraschen. Einerseits wird eine Darstellung dieses wohl beliebtesten Heiligen der Kirchengeschichte weit über die katholische Christenheit hinaus stets ihren Leserkreis finden, auch wenn es bereits eine schier unübersehbare Zahl von Darstellungen seines Lebens und Wirkens gibt. Andererseits ist die Herausgabe einer neuen Franz-Monographie auch durch die internationale Forschungssituation gerechtfertigt. Die Zeit der großen, romanhaft gefärbten Darstellungen ist wohl unwiederbringlich dahin, so stark der Reiz etwa des Werkes Paul Sabatiers auf Grund seiner stellenweise fast dichterischen Darstellungskraft, verbunden mit strenger wissenschaftlicher Arbeit, für mehrere Generationen auch gewesen ist. Die heutigen Interpreten des Franziskus gehen nüchterner und auch vorsichtiger zu Werke. Sie sind bei allen Unterschieden, die es etwa zwischen den katholischen und den evangelischen Forschern auch heute noch gibt, willens, ihre Darlegungen durch eine bewußt kritische Auswahl des durch die alten „Legenden" zur Verfügung gestellten Materials und durch vorrangige Anlehnung an die unbezweifelbar echten schriftlichen Willensbekundungen des Heiligen zu untermauern. Mir scheint, daß dieser Trend sich auch insofern verstärken muß, als mit formgeschichtlichen Mitteln, wie sie etwa von vielen Neutestamentlern hinsichtlich der synoptischen Evangelien seit langem angewandt werden, das historisch Echte von den legendarischen Übermalungen und Entstellungen noch bewußter geschieden werden muß, so schwierig die Entscheidung in vielen 7
Einzelfällen auch ist. Dies kann im vollen Ausmaß von der vorliegenden Monographie nicht geleistet werden, die sich an einen weiteren Leserkreis wendet und deshalb auf einen wissenschaftlichen Apparat verzichtet. Eine solche Aufgabe erfordert auch, daß der Autor die gesamte Mönchsliteratur genausogut kennt wie die Geschichte der religiösen Bewegungen des Mittelalters, und übersteigt insofern meine gegenwärtigen Möglichkeiten. Dieses Buch stellt sich eine bescheidenere Aufgabe: Es sieht sein Ziel nidit zuletzt darin, den interessierten Leser mit dem Stand der wissenschaftlichen Forschung auf diesem Sektor intensiv vertraut zu machen. Natürlich kommen dazu Einzelbeobachtungen am Werk des Franziskus und an den Darstellungen seiner Schüler über ihn, die geeignet sein könnten, unsere Erkenntnisse im Detail zu bereichern oder auch zu modifizieren. Darüber hinaus sollten die Christen in einer modernen Gesellschaft neu zu klären versuchen, warum und inwieweit Leben und Werk des umbrischen Heiligen für sie zum unverlierbaren Besitz gehören. Es sollte ihnen jedenfalls zu denken geben, daß progressive Historiker ihre scharfe Ablehnung zum mindesten der Politik der beiden großen Bettelorden, die schnell zu den wirksamsten Werkzeugen päpstlicher Machtpolitik im Hochmittelalter aufstiegen, bekundet haben. Und was speziell Leben und Werk des Franziskus betrifft, so haben bereits dem Geist der Aufklärung verpflichtete Kirchenhistoriker vor zwei Jahrhunderten sich recht negativ geäußert. Der Göttinger Historiker Ludwig Th. von Spittler konnte sich dabei in seinem „Grundriß der Geschichte der christlichen Kirche" (5. Aufl. 1812) zu der Behauptung steigern, man tue Franz alle Ehre an, wenn man glaube, es habe ihm im Kopfe gefehlt. Er sei in moralische Schwärmerei verfallen, die sich durch völlige Verleugnung aller Bequemlichkeiten des Lebens kundgetan habe. Auf derselben Ebene liegt es, wenn Johann Matthias Schröckh in seiner 1798 in Leipzig erschienenen „Christlichen Kirchengeschichte" sich die Wundmale des Franziskus nur so erklären kann, 8
daß dieser sie sich in betrügerischer Absicht selbst beigebracht habe. Es wird den, der sich aufklärerischem Geist verpflichtet weiß, aufhorchen lassen, wenn er erfährt, daß das Interesse an Franz zu Anfang des 19. Jahrhunderts im Zeichen des Kampfes gegen Aufklärung und Revolution und der bewußten Hinwendung gerade zum zuvor diskreditierten Wunderhaften und Übernatürlichen neu erwachte. Der Franziskaner Ambros Styra hat in seiner Dissertation „Franziskus von Assisi in der neueren deutschen Literatur", deren uns hier interessierende Anfangsteile 1927 in Breslau im Druck erschienen sind, die Geschichte dieser Franziskus-Renaissance, die weithin im Zeichen der Restauration stand, anschaulich dargestellt. Er zeigt freilich, daß die Neuentdeckung der christlichen Legendenwelt des Mittelalters schon durch Herder angebahnt wurde, für den Poesie und Religion urverwandt waren, wenn er auch noch um ihre rationalisierende und moralisierende Deutung zwecks besserer Verständlichkeit für den zeitgenössischen Leser bemüht war. Bereits Herders Schüler, der Dichter Gotthard Ludwig Th. Kosegarten, verzichtete in seinen „Legenden" (Berlin 1804) auf eine modernisierende Interpretation. In Wien wurde damals noch die Lektüre der „Legenden" als abergläubisch verboten, und eine damals gern gelesene literarische Zeitschrift sprach von ihnen als von Blüten „des höchsten Triumphes verkrüppelter Mönchsphantasie, des bodenlosesten Aberwitzes". Ungeachtet dieser scharfen Gegenwehr erweckten alle damals Franz zugeschriebenen Gesänge, unter denen sich aber auch der Sonnengesang befand, schnell Begeisterung, als der bekannte, nachhaltig vom Geist der Romantik beeinflußte katholische Gelehrte und Publizist Joseph von Görres sie 1826 in der 1821 begründeten Zeitschrift „Der Katholik" abdrucken ließ. Daß er es ebenso wie Clemens Brentano in antiaufklärerischem Geiste tat, beweist schon der Umstand, daß beide längere Zeit begeistert am Lager stigmatisierter Frauen verweilten. Typisch romantisch feierte Görres Franz als 9
den poetischen Heiligen, den Troubadour Gottes. Bald ergoß sich eine Flut ähnlicher Sammlungen auf den literarischen Markt; gelegentlich führten sie sogar zu Konversionen, obwohl sie dem ästhetischen Genuß ebenso wie der Erbauung dienen wollten. Die Frage, ob man Franz recht versteht, wenn man ihn in erster Linie als Ekstatiker betrachtet und die Stigmatisation in diesem Sinne als Höhepunkt seines Lebens ansieht, muß von uns indes eindeutig verneint werden. Das historische Bild wird jedoch auch getrübt, wenn man — wie es nach wie vor in katholischen Kreisen geschieht — Franz in erster Linie als den kirchentreuen, sich der Hierarchie vorbehaltlos unterwerfenden Katholiken sieht. Gewiß war er weithin auch dieses, und die sich daraus ergebende Problematik muß von uns eingehend erörtert werden. Primär aber gehört Franz mit der von ihm ins Leben gerufenen ursprünglichen franziskanischen Bruderschaft, die vom späteren Bettelorden unterschieden werden muß, in eine Reihe mit den religiösen Bewegungen des Mittelalters, was heute auch von katholischen Forschern nicht mehr bestritten wird. Deshalb sieht der erste Hauptteil dieses Buches seine Aufgabe darin, wesentliche Motive dieser religiösen Bewegungen vor Augen zu stellen, um so die ursprüngliche franziskanische Bewegung in sie einzuordnen, aber auch von ihnen abheben zu können. Naturgemäß mußte ich mir in diesem ersten Teil hinsichtlich der Breite der Darstellung Zurückhaltung auferlegen, um den eigentlichen Gegenstand des Buches nicht ungebührlich in den Hintergrund zu drängen. Eine Beschränkung ist aber hier auch deshalb angemessen, weil in demselben Verlag wie das vorliegende Buch bereits 1956 die in weiten Kreisen bekannt gewordene Monographie des Leipziger Historikers Ernst Werner über sozial-religiöse Bewegungen im Zeitalter des Reformpapsttums unter dem Titel „Pauperes Christi" herausgekommen ist. Im Mittelpunkt der Darstellung steht selbstverständlich Franz von Assisi selbst. Sein Wollen und Tun suchte ich 10
in allen Nuancierungen zu erfassen, ohne absolute Vollständigkeit anzustreben. Dabei mußte das Fremdartige und unwiederholbar Vergangene im Wirken des Heiligen, das eine Imitation im vordergründigen Sinne verbietet, plastisch hervortreten. Es wird aber auch der Versuch unternommen, die ganze Problematik dieses Werkes sichtbar werden zu lassen, das eine weitgehende Umdeutung und Entstellung durch seine Nachfahren wie durch die offiziellen Gremien der Weltkirche ermöglichte. Audi hier müssen wir uns vor ungebührlichen Vereinfachungen hüten. In gewissem Maße war Franz ein Opfer der offiziellen Kirche seiner Zeit, die unentwirrbar in die Feudalordnung verwoben war und sich davon nicht zugunsten des Rufes in die evangelische Freiheit losmachen konnte beziehungsweise wollte. Und Franz verdient gerade deshalb nach wie vor und heute mehr denn je unsere Hochachtung, weil er sich wie andere religiöse Bewegungen seiner Zeit dem Dienst und nicht dem Herrschaftswillen in klerikaler Bemäntelung verpflichtet wußte und deshalb ungeachtet seiner Bereitschaft zur Unterwerfung unter die ekklesiale Gewalt ein unübersehbares Mahnzeichen in Antithese zu einer weithin verweldichten und pervertierten Kirche aufrichtete. Andererseits sollten wir nüchtern wahrnehmen, wenn dies gelegentlich auch von evangelischen Forschern bestritten wird, daß das Lebensideal des Franziskus in seiner Reinheit nicht institutionalisierbar war. Man mag in diesem Zusammenhang von utopischen beziehungsweise illusionären Zügen in seinem Wollen sprechen. Der christliche Betrachter muß sich freilich darüber im klaren sein, daß hier das Lebensrecht des von Jesus selbst gelebten und nicht zuletzt in der Bergpredigt gelehrten Ethos auf dem Spiele steht. Denn der von Karlmann Beyschlag in seiner Monographie „Die Bergpredigt und Franz von Assisi" postulierte Gegensatz zwischen der Bergpredigt und dem Ethos des umbrischen Heiligen mutet gekünstelt an und vermag mich nicht zu überzeugen. Die religiösen Bewegungen vor Franz und er selbst wol11
len gerade zu konkretem Gehorsam ohne Ausflüchte ermutigen. Es ist wenigstens zu erwägen, ob denn nicht für einen solchen konkreten Gehorsam im Sinne des Franziskus heute angesichts völlig neuartiger gesellschaftlicher Gegebenheiten bessere Voraussetzungen bestehen als im Mittelalter. Gewiß, das Lebensideal des Franziskus kann in keiner irdischen Gesellschaftsordnung zum Maß des allgemeinen Verhaltens werden, transzendiert es doch das für alle verpflichtend zu Machende beträchtlich. Aber der Verzicht auf das Eigene und damit die Selbstentäußerung kann in einer Gesellschaft, die auf sozialer Gerechtigkeit beruht, nicht mehr so mißbraucht werden, wie das in der Feudalordnung des Mittelalters der Fall war. Auch von hier aus gesehen, kann das Wollen des Franziskus von Assisi für uns heute auf erregende Weise interessant werden. Ich widme dieses Buch meiner lieben Frau. Ihr ist es zu danken, wenn manches vom franziskanischen Geist in unserm Hause präsent ist. Herrn Dr. phil. Hans Giesecke danke ich herzlich für seine Hilfe bei der textlichen Gestaltung des Buches. Ebenfalls gedankt sei Frau Ulla Heise für die Zusammenstellung des Bildteils. Rostock, im Februar 1976
Gert
Wendelborn
ERSTER T E I L
Religiös=soziale Bewegungen vor und neben der frühen franziskanischen Bewegung 1. Frühe religiöse Gruppen mit häretischem Einschlag
Die Grenzen zwischen den religiösen Bewegungen des Mittelalters und der Häresie sind durchaus fließend. So schwer es ist, aus den meist spärlichen Angaben der Chronisten und kirchlichen Ketzerbestreiter sich ein genaues Bild über die jeweilige Gruppe zu machen, ketzerische Züge springen doch bei den meisten gerade der frühen Gruppen ins Auge. Deshalb sollte der Leser für dieses Kapitel die Angaben in Herbert Grundmanns Handbuch „Ketzergeschichte des Mittelalters" mit heranziehen. Das Frühmittelalter war von solchen häretischen Strömungen frei gewesen. Seit dem 11. Jahrhundert aber traten sie in verschiedenen Orten in Erscheinung. Zwar war schon im 8. Jahrhundert ein Laie namens Aldebert aufgetreten und wegen Häresie verurteilt worden. Aber das blieb ein Einzelfall. Im 11. Jahrhundert dagegen sind an manchen Orten Personen und Gruppen nachweisbar, die die kirchliche Einheit verließen, ohne daß sie schon eine größere Zahl von Anhängern hätten um sich sammeln und eine feste Organisation hätten ausbilden können. Audi standen sie offenbar nicht in Verbindung miteinander, wenn sie auch durch verwandte Einwirkungen bestimmt gewesen sein werden. Diese Einwirkungen kamen offenbar aus dem Osten, genauer: von den neumanichäischen, gemäßigt und dann auch schroff dualistischen Bogomilen im byzan13
tinischen Reich, die später der Gegenkirche der Katharer die entscheidenden Impulse gaben. So verjagte kurz nach der Jahrtausendwende ein Bauer Liuthard in der Champagne seine Frau, zerschlug die Kruzifixe der Kirche seines Dorfes, verweigerte den Geistlichen die Zahlung des Zehnten und wollte den alttestamentlichen Propheten nicht mehr glauben. Bruchstücke einer dualistisch-gnostischen Ablehnung von Ehe, Kreuz, Altem Testament und kirchlicher Macht mögen zu ihm gelangt sein. Im französischen Aquitanien lehnte um 1018 eine Gruppe mönchsähnlich zusammen lebender Menschen nicht nur die Kraft des Kreuzes, sondern auch Taufe und Ehe ab und entsagte dem Genuß bestimmter Nahrungsmittel. Sehr oft sollten in den folgenden Jahrhunderten religiöse Protestgruppen die Wirksamkeit kirchlicher Sakramente einschließlich der Eucharistie bestreiten, einmal, weil diese von unwürdigen Priestern gespendet würden, zum andern aber auch, weil der kirchliche Glaube an die im Sakrament selbst für den Empfänger enthaltene Heilskraft dem Streben nach persönlicher Heiligkeit entgegenzuwirken schien. In Orléans vertrat eine Gruppe Gebildeter im Zusammenhang mit den genannten Ablehnungen bereits die Ansicht, alles Materielle sei unrein und aller wahre Glaube deshalb innerlich. Sie verwarfen schon Inkarnation und Auferstehung Christi, und man wird an die spätere Geisttaufe der Katharer, das Consolamentum, erinnert, wenn man hört, die Entsühnung des Menschen erfolge durch den Heiligen Geist mittels Handauflegung. Mehr als zwölf von ihnen wurden im Jahre 1022 verbrannt. Diese Kanoniker von Orléans waren die ersten Ketzer, die — übrigens taten sie es lachend — den Scheiterhaufen besteigen mußten. Die von ihnen geübte Handauflegung ist hier erstmalig bezeugt. Kurze Zeit später, 1025, wurden in Arras Häretiker aufgespürt. Sie hielten vollends Kirchen und Altäre, Priesterweihen und überhaupt die gesamte kirchliche Hierarchie für sinnlos. Zum kirchenkritischen Zug kam bei ihnen ein sozialer, indem sie erklärten, man müsse von der Handarbeit 14
leben. Absage an die Welt und Handeln aus dem Geist der Liebe und Brüderlichkeit bedingten einander schon bei ihnen. Sie wandten sich gegen die Kindertaufe, weil nur die Erwachsenentaufe als Zeichen einer vollzogenen persönlichen Glaubensentscheidung geistlich förderlich sei — das entscheidende Argument aller Kritiker der Kindertaufe bis in die Gegenwart. Nur die Taten zählen nach ihrer Meinung, keine formalen Glaubensbekenntnisse; ein wirkliches Bekenntnis kann sich nur als erneuertes Tun darstellen. Schon in dieser Gruppe, die wahrscheinlich vorwiegend aus Handwerkern bestand, vertrat man die Überzeugung, man müsse wie die Apostel leben. Dieser evangelisch-apostolische Grundimpuls der Rückkehr zu den wirklich geistlichen Anfängen der ursprünglichen christlichen Kirche sollte für die meisten religiösen Bewegungen der Folgezeit wegweisend werden. Um dieselbe Zeit tauchten verwandte Gruppen in Oberitalien auf. Am bekanntesten wurde die in Monteforte, einem Ort zwischen Turin und Genua. In ihr verbanden sich Ablehnung des äußerlichen Kirchenwesens und Streben nach einer wahrhaft geistlichen, innerlichen Frömmigkeit mit einer geistigen, den anstößigen Buchstaben umdeutenden Schriftauslegung. Auch hier stehen soziale und asketisch-dualistische Züge nebeneinander. Diese Gruppe lebte in Gütergemeinschaft und wollte ihren Besitz mit allen Menschen teilen. Sie entsagte wie die meisten gnostisch beeinflußten Kreise dem geschlechtlichen Leben und verwarf den Fleischgenuß, da Fleisch ex coitu entstanden sei. Sympathisch berührt ihre lautere, heitere Lebensform, in der Anliegen des Franziskus vorweggenommen zu sein scheinen. Die Mitglieder der Gruppe ließen sich im Alter durch einen Bruder töten, um die Seligkeit des Märtyrertodes zu kosten. Als die Burg, in der sie lebten, mit Waffengewalt besetzt worden war, wurden sie sämtlich verbrannt. Offensichtlich verbanden sich auch hier neumanichäische Ideen mit einem elementaren Protest gegen ein veräußerlichtes und geistloses kirchliches Leben. 15
2. Religiös-soziale Bewegungen im Gefolge der gregorianischen Reformpolitik Wie schwer es ist, ketzerische-Strömungen sauber von der rechtgläubigen kirchlichen Reformbewegung zu trennen, verdeutlichen gerade jene Bestrebungen, die durch die gregorianische Reformpolitik mitverursacht wurden. Papst Gregor VII. (1073—1085) und seine Anhänger scheuten sich nicht, in ihrem dramatischen Ringen mit dem deutschen Kaisertum und den diesem verpflichteten Reichsbischöfen Methoden anzuwenden, mit denen sie rigoros das Ziel verfolgten, die Herrschaft der zentralistisch-kurial verstandenen Kirche über die weltlichen Mächte mit dem Kaisertum an der Spitze herbeizuführen. Dabei nahm das gregorianische Papsttum, wie seine Unterstützung der Mailänder Pataria zeigt, auch soziale Bestrebungen in seinen Dienst, solange eine Möglichkeit bestand, diese den eigenen klerikalen Bestrebungen unterzuordnen. Man ermunterte die Laien zur offenen Revolte gegen ihre Priester und Prälaten, soweit diese in Simonie und Laieninvestitur verstrickt blieben und nicht im Zölibat leben wollten — ein im Mittelalter schier beispielloses Unternehmen! Die Folge war, daß vielerorts solche Priester beschimpft, mißhandelt und boykottiert und die von ihnen gespendeten Sakramente mit Füßen getreten wurden. Da aber die Kirchenführung naturgemäß an einer wirklichen Revolte niederer Volksschichten zwecks sozialer und gesellschafdicher Besserstellung nicht interessiert sein konnte, korrigierte sie spätestens gegen Ende des 11. Jahrhunderts ihre bisherige Politik zugunsten eines Kompromisses mit den weltlichen Gewalten, ohne dabei die eigentliche klerikale Zielstellung aus den Augen zu verlieren. Dabei kann man dem ursprünglichen Anliegen, die Gesamtkirche von weltlicher Bevormundung zu befreien und der Entfremdung kirchlicher Amtsträger von ihren eigentlichen geistlichen Aufgaben ein Ende zu bereiten, seine Berechtigung kaum absprechen. Da aber die Trennung des kirchlichen und staatlichen Aufgabenbereichs unter den Bedingungen der Feudalge16
sellschaft nicht zu verwirklichen war und von den kirchenleitenden Organen auch gar nicht ernsthaft erstrebt wurde, mußte die Theorie von der Überordnung der geistlichen über die weltliche Gewalt dem kirchlichen Machtstreben eine Scheinlegitimation verleihen. Die religiös-soziale Bewegung der Pataria in Mailand wird indes erst wirklich verständlich, wenn man die gesellschaftlichen Umschichtungsprozesse jener Zeit berücksichtigt. Sie waren in Italien in stärkerem oder geringerem Maße zumindest in allen entwickelteren Gebieten feststellbar; in einer so bedeutenden Stadt wie Mailand, wo Industrie und Fernhandel mächtig aufgeblüht waren, hatten sie ganz besondere Fortschritte gemacht. Typisch für alle sich entwickelnden italienischen Städte war in diesem wie in den folgenden Jahrhunderten, daß es sowohl im Adel wie im heranwachsenden Bürgertum zu mannigfachen Differenzierungen und deshalb auch zu wechselnden Koalitionen kam, in deren Ergebnis es dem reicheren Bürgertum gelang, seine ökonomische Position auch politisch zu untermauern, und in denen es sich mit jenem Teil des Adels verband, der sich auf die veränderten Bedingungen in diesen Städten realistisch einzustellen verstand. Der Auflösungsprozeß der feudalen Grundherrschaften alten Typs hatte in Italien bereits im 10. Jahrhundert eingesetzt. Durch städtische Produktion, Seeverkehr, Fern- und Binnenhandel wurde die Entwicklung der Manufakturen gerade in Oberitalien beschleunigt. Die Kaufleute konnten sich manchenorts schnell bereichern; in Mailand hatten sie in der Standespyramide denn auch bald hinter dem niederen Adel, den sogenannten Valvassoren, ihren Platz. Die Handwerker fanden sich schnell in Zünften zusammen. Die Valvassoren verbündeten sich hier mit dem reichen Bürgertum gegen den hohen Adel der Capitani und die mit diesem liierte, oft selbst dem Hochadel entstammende Geistlichkeit mit dem auf weitgehende Autonomie von Rom bedachten Erzbischof an der Spitze. Diesem Bündnis gehörten zeitweise auch die ärmeren Schichten der Stadtbevölkerung an, was der Pa17
taria revolutionäre Kraft verlieh. Die Kleriker dagegen unterschieden sich außer durch ihre Standeskleidung in keiner Weise von anderen Feudalherren; sie entfalteten einen unglaublichen Prunk, liebten Jagd und Spiel und auch die Frauen und hatten sich ihre kirchlichen Ämter wohl sämtlich erkauft, waren also Simonisten im Verständnis der Reformpartei. Dem Reformpapsttum mußte es sehr am Herzen liegen, um der Durchsetzung der eigenen Herrschaft willen das Mailänder Widerstandszentrum niederzuwerfen und sich auf diese Weise den beherrschenden Einfluß in der gesamten Lombardei zu sichern. In der Pataria verband sich untrennbar der Klassenkampf gegen den Feudaladel mit dem geisdichen Kampf gegen den verweltlichten Stadtklerus. Den ständigen Schutz ihrer Führer übernahmen lange Zeit Handwerker und Plebejer, wobei auch in der Pataria die Frauen ein wichtiges Element bildeten; die Führer der Pataria entstammten freilich dem Adel. Sie waren, wie uns dies etwa vom Diakon Ariald berichtet wird, begeistert von der Vollkommenheit der Urkirche und forderten von den Klerikern die wirkliche Befolgung der Armut Jesu. Die mit ihnen verbundenen Kleriker führten an der sogenannten Kanonikerkirche ein gemeinsames Leben. Dem positiven Ideal entsprach die harte Verwerfung der kirchlichen Gegenwart. Landulf sprach vom Sakrament, das die simonistischen Stadtpriester verwalteten, als von Hundemist und von den Kirchen, in denen diese amtierten, als von Maultierställen. Er forderte die Einziehung des Besitzes unwürdiger Kleriker und vertrat ihnen gegenüber das Recht der Gewalt. Tatsächlich kam es zu zahllosen Gewaltakten gegen diese Kleriker, die nicht nur kirchenkritischen, sondern auch revolutionären Charakter trugen. Die Anhänger dieser Partei nannten sich selbst Patarener, ein Name, der später zur ausschließlichen Bezeichnung für alle Ketzer, besonders die Katharer, in Italien wurde. Ob bei dieser Namenswahl bereits bogomilische Einflüsse aus Bosnien mitgespielt haben könnten, 18
ist in der Forschung umstritten. Am wahrscheinlichsten bleibt, daß es sich dabei ursprünglich um die Bezeichnung der Mailänder Lumpenhändler und Trödler gehandelt hat. Jedenfalls blieb die Bewegimg im dogmatischen Sinn völlig rechtgläubig, und das Reformpapsttum konnte denn auch mittels seiner Legaten ein offizielles Bündnis mit ihr schließen und ihre am Ende doch unterlegenen Führer nach deren gewaltsamem Tod zu Heiligen erklären. Diese Niederlage war eine Folge davon, daß das Bündnis zwischen den niederen Schichten einerseits, dem wohlhabenden Bürgertum und dem niederen Adel andererseits naturgemäß nicht von Dauer war; sie war aber auch darin begründet, daß die Kurie den offiziellen Stadtklerus mit dem Erzbischof an der Spitze entsprechend ihrer eigenen Zielsetzung wohl demütigte und zu äußerlich bekundetem Gehorsam zwang, aber nicht eigentlich antastete. Immerhin hatte sich diese Empörung niederer Schichten gegen die mit dem Feudalsystem unentwirrbar verquickte kirchliche Obrigkeit inzwischen auch auf andere lombardische Städte ausgedehnt. Eine Minderheit von ihnen ließ sich nicht wieder mit der offiziellen Kirchenleitung versöhnen, nahm häretischen Charakter an und ging in den zahllosen Sekten auf, die im 12. Jahrhundert über die gesamte Lombardei verstreut waren. Es mag schon an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, daß sich religiöse und politische Zielsetzungen später bei Arnold von Brescia gleichfalls verbanden. Er griff viele Gedanken der Pataria auf und verknüpfte sie als Schüler Abaelards mit einer kritischen Theologie. Als wirksamer Agitator polemisierte auch er gegen den irdischen Besitz der Kirche und forderte die strenge Befolgung des armen Lebens Jesu von allen Klerikern. Im Gegensatz zu den Führern der Pataria dehnte er diese Forderung auf das Papsttum selbst aus. Er schilderte die Päpste als Tyrannen, die ihre Macht durch Feuer und Blut erlangt hätten. Zu diesem späten Zeitpunkt gingen also die Epigonen der ursprünglichen Reformpartei zur Opposition gegen die kirchliche Hierarchie an sich über. 19
Arnold war bemüht, die Nachfolge des armen Jesus selbst vorzuleben; er kleidete sich in schlichteste Gewänder. Der einzelne sollte wie die Kirche als ganze zu tatsächlich geistlichem Leben zurückgeführt werden. Nach zweijähriger Klosterhaft aus Frankreich ausgewiesen, versuchte Arnold, die Autonomiebestrebungen des Senats der Stadt Rom gegen das Papsttum für seine Ziele nutzbar zu machen, in denen sich nationalrömische und kaiserliche Ideale mischten. Er sah in Rom, dem Zentrum des antiken Weltreichs, ähnlich wie dies zwei Jahrhunderte später Cola di Rienzo tun sollte (vergleiche dazu mein Buch „Gott und Geschichte" S. 259f.), auch das Zentrum eines neuen idealen Kaiserreiches. Er stellte sich deshalb 1147 an die Spitze der nationalrömischen Bewegung und hatte zeitweise faktisch die Stellung eines Volkstribunen in Rom inne. Seine Anhänger erklärten bereits 1152 die sogenannte Konstantinische Schenkung für eine Fabel. Indes versagte der deutsche Kaiser Friedrich Barbarossa Arnold seine Unterstützung und opferte seinen potentiellen Bundesgenossen wohl aus taktischen Erwägungen, um sich die Möglichkeit einer Wiederannäherung an das Papsttum offenzuhalten. Er lieferte Arnold 1155 an die Kurie aus, was zu dessen Hinrichtung führte. Seine Anhänger, die Arnoldisten, die in ihrer Mehrzahl in der Lombardei lebten und deshalb auch Lombarden genannt wurden, verschmolzen allmählich mit den Waldensern. Im 11. Jahrhundert wurden Forderungen des Reformpapsttums indes nicht nur durch die Pataria revolutionär ausgeweitet. In mancher Hinsicht ähnliche Züge trug die Bewegung des Johannes Gualberti in Florenz, nur daß es sich hierbei um eine Mönchsbewegimg handelte. Gualberti, ursprünglich Mönch, trat aus seinem Kloster wieder aus, weil an dessen Spitze ein simonistischer Abt stand, und untersuchte darauf eingehend das Leben in den Eremitenkolonien Romualds östlich Florenz, die Ende des 10. Jahrhunderts im Zusammenhang mit einem starken Aufflammen eremitischer Tendenzen im Bereich der römischen Kirche entstanden waren. Nach ihrem Vorbild 20
errichtete er 1039 das Kloster Vallombrosa, nicht indes, um hier ein beschauliches Eremitenleben zu führen, sondern um sein Kloster als Stützpunkt im Kampf gegen den simonistischen Klerus von Florenz nutzen zu können. Seine Eremitensiedlungen waren dazu bestimmt, Florenz förmlich einzukreisen. In den sechziger Jahren zogen seine Mönche durch das Land und riefen das Volk öffentlich zum Kampf gegen die Simonisten auf; in diesem Vorgehen glichen sie den Hirsauern, freilich noch ohne Laien um sich zu sammeln. Sie fanden Unterstützung durch die Bürger von Florenz, die gern einen ärmeren und schwächeren Klerus gesehen hätten, während auf der Seite des Bischofs die reichen, grundbesitzenden Schichten standen. Auch Gualberti erreichte zeitweise den Boykott der offiziellen gottesdienstlichen Handlungen in der Stadt und die Verspottung der Priester. Er zwang mit seinen Anhängern den Bischof, sich der Feuerprobe zu unterziehen, bei der dieser natürlich unterlag. Sein Kloster wurde zeitweise zu einem Stützpunkt der Reform für die ganze Toskana und darüber hinaus für die Lombardei, denn aus beiden Gebieten strömten Geistliche und Laien zu ihm, um sich seinen Weisungen zu unterstellen. Weil seine Mönche so stark im kirchenpolitischen Kampf engagiert waren, hatten Konversen die tägliche Arbeit im Kloster zu verrichten. Viele Einsiedlerkolonien besaßen schon vor dem Kloster von Vallombrosa solche ihren Klöstern inkorporierte und durch Eid fest an sie gebundene Laien; bei Romuald begegnet auch der Name „Konversen" erstmalig im westlichen Kulturkreis. In starkem Maße bedienten sich dann die Zisterzienser dieser Einrichtung, wo die Konversen in der Landwirtschaft zu arbeiten und durch Rodung von Wald Land urbar zu machen hatten, während die Konversen in Kluniazenserklöstern nur als Gehilfen im Gottesdienst verwendet wurden. Ernst Werner macht mit Recht darauf aufmerksam, daß es sich bei der florentinischen Reformbewegung im Unterschied zu der in Mailand erst um die embryonale Phase des bürgerlichen Emanzipationskampfes gehandelt 21
habe, der noch ganz unter fremder Leitung und für kirchliche Ziele verlaufen sei. Um so aufschlußreicher ist diese Bewegung in dem von uns behandelten Zusammenhang. Die gregorianische Reformpartei besaß zeitweise im Kloster Hirsau die stärkste Stütze. Dieses Kloster machte sich vorübergehend unabhängig von jedem weltlichen Einfluß, um ganz den Zielen des Reformpapsttums dienen zu können. Wilhelm, der seit 1069 Abt dieses Klosters war, setzte in ihm eine bisher nicht gekannte vollständige Unterordnung unter seine Person und strenge Bestrafung aller Übertretungen durch. Diesem Beispiel folgten weitere süd- und mitteldeutsche Klöster, ohne daß es zur Gründung einer Hirsauer Kongregation gekommen wäre. In diesen gregorianischen Festungen fanden alle vertriebenen Gesinnungsgenossen Zuflucht; von hier aus wurde der Angriff auf den Gegner geleitet. Seit drei Jahrhunderten, seit der Zug irischer Mönche nach dem fränkischen Reich aufgehört hatte, gab es in den deutschen Ländern keine mönchischen Wanderprediger mehr. Denn es war ein strenges Prinzip des benediktinischen Mönchtums, die stabilitas loci nicht zu durchbrechen, also die Klostermauern nicht zugunsten eines öffendichen Wirkens hinter sich zu lassen. Die Predigt der Hirsauer Mönche war naturgemäß eine politische Predigt, die im Streit zwischen Papst und Kaiser leidenschaftlich Partei ergriff. Dabei vertraten sie nicht die Weltherrschaft des Papsttums und erstrebten nicht die Erniedrigung des Kaisers zu einem Vasallen Roms. In ihren Angriffen auf die Sakramentsverwaltung durch unwürdige Priester, ihrer Forderung einer wahrhaft geistlichen Kirche und ihrem Appell an das Volk aber waren sie der häretischen Propaganda zum Verwechseln ähnlich, ohne daß an ihrer Rechtgläubigkeit gezweifelt werden könnte. Die Gemeinschaft mit den Simonisten als den Erzketzern ihrer Zeit sei streng zu meiden; wahres Priestertum gab es für sie allein in der Gemeinschaft der Gregorianer. Die predigenden Hirsauer Mönche machten zeitweise auf 22
das Volk der umliegenden Gebiete einen so starken Eindruck, daß diese ihnen in Scharen ihre Dienste anboten. Aus den so gewonnenen dienenden Brüdern, die den Einfluß der Hirsauer zunächst bedeutend stärkten, formte Abt Wilhelm eine eigene Genossenschaft. Als eine völlig neue Erscheinung im deutschen Volksleben bildeten sich an vielen Orten Laienvereinigungen zum Zweck gemeinsamen Lebens unter der geistlichen Leitung eines Priesters oder Mönches. Sie führten die Gütergemeinschaft ein und gaben ihrer ganzen Lebensführung eine religiöse Färbung, um so die Bedingungen der apostolischen Zeit wiederherzustellen. Besonders stark war auch hier der Zustrom von Frauen, in diesem Fall meist aus Bauernfamilien. Es kam vor, daß ganze Dörfer sich gleichsam in geisdiche Genossenschaften verwandelten. Doch begleiteten diese Frauen noch nicht wie in Westfrankreich die apostolischen Prediger. Eine Ähnlichkeit besteht zu späteren italienischen Laiengenossenschaften, den sogenannten Büßergemeinden, deren Mitglieder weiterhin als Bauern arbeiteten und auf Privatbesitz an Produktionsinstrumenten verzichteten; neu urbar gemachte Ackerflächen wurden zum Eigentum der Gemeinde. Die Mitglieder blieben verheiratet, legten aber ein Gelübde über gemeinsames Leben, persönliche Armut und Gehorsam gegenüber dem geisdichen Leiter ab. Diese „Büßer" galten als kirchliche Personen und waren im Zusammenhang damit vom Militärdienst befreit, durften auch nicht zu öffentlichen Diensten herangezogen werden. Sie bestanden aus zwei Gruppen: Die einen lebten genossenschaftlich zusammen und hatten sich einem geistlichen Leiter unterstellt, die andern dagegen wohnten auch weiterhin in ihren Privathäusern über verschiedene Parochien verstreut und fanden sich nur einmal monadich zu einer gemeinsamen Versammlung zusammen. Die Hirsauer Laiengenossenschaften wurden von Papst Urban II. im Jahre 1091 approbiert. Neben ihnen besaßen auch die Hirsauer noch eigendiche Konversen, die direkt dem Kloster angegliedert und einer strengen Disziplin unterwor23
fen waren. Ähnliche Konversengruppen entstanden zur gleichen Zeit durch Zudrang von Laien zu umliegenden Klöstern im heutigen belgisch-französischen Grenzbereich, was darauf hinweist, daß das Bedürfnis nach derartigen Lebensformen weit verbreitet war. Doch hatten die Hirsauer Laiengenossenschaften keinen langen Bestand. Nicht alle vom gregorianischen Reformpapsttum angeregten Gruppen blieben in den Grenzen der Rechtgläubigkeit. Mehrere von ihnen radikalisierten sich vielmehr in solchem Maße, daß die Kurie, die sie zunächst nach Kräften unterstützt hatte, die Kontrolle über sie verlor und sie in Ketzerei abglitten. Zwar wurde ein Priester Ramihrdus 1 0 7 7 in Cambrai verbrannt, weil er sich weigerte, das Abendmahlssakrament aus der Hand eines simonistischen Klerikers entgegenzunehmen, obgleich er in sämtlichen dogmatischen Fragen die rechte kirchliche Lehre vertrat. Gregor VII., über die Hinrichtung empört, feierte ihn denn auch als Märtyrer. Die Bewegung gegen den Bischof trug hier wie bald darauf in manchen anderen west- und mitteleuropäischen Städten und ähnlich wie in Mailand emanzipatorischen und auch sozialen Charakter. Nach dem Tode des Ramihrdus bildeten seine Anhänger zeitweise eine eigene Sekte, in die auch häretische Tendenzen Einlaß fanden. Vertreter der gregorianischen Reformpartei war ursprünglich auch der Laie Tanchelm, der zu Anfang des 12. Jahrhunderts im Küsten- und Inselbereich von Antwerpen als Wanderprediger auftrat. Seine antiklerikalen Tendenzen verband er jedoch in der Schlußphase seiner Wirksamkeit mit einem übersteigerten prophetischen Selbstbewußtsein. Die von ihm vollzogene Selbstvergottung ist ein typisch „gnostisches" Phänomen. Wenn er die reichen Gaben seiner Anhänger verpraßte, so dürfte hier der auch später zu beobachtende Umschlag von strenger Askese in Libertinismus vorliegen. Der innere Kreis seiner Anhänger bestand in Nachahmung der Apostel aus zwölf Männern, zu denen sich eine Frau als Vertre24
terin der Maria gesellte. Tanchelm wurde 1115 von einem Priester erschlagen. Sehr ähnliche Züge weist Eudo oder Eon von Stella auf, der drei Jahrzehnte später wirkte. Er war ein besitzloser Adliger der Bretagne. Er gründete eine selbständige Kirche mit eigenen Bischöfen und Erzbischöfen, denen er Namen wie „Weisheit" oder „Gerechtigkeit" zulegte oder die er nach den Aposteln benannte. Da er sich selbst den Namen „Äon" gab, dürften im Hintergrund gnostische Äonenspekulationen stehen. Sein Sendungs- und Selbstbewußtsein war nicht geringer als das Tanchelms. Mit seiner Gefolgschaft, die großenteils aus Holzfällern und Köhlern bestand, durchzog er plündernd und mordend die benachbarten Provinzen. Magische Vorstellungen aus der keltischen Vorzeit dürften in diesem nur oberflächlich christianisierten Gebiet sein Selbstbewußtsein mitgeformt haben, indem sie sich mit neumanichäischen Ideen verbanden. Seine Anhänger sind als dualistische Antipoden der westfranzösischen Wanderprediger zu begreifen, doch trug diese Bewegung kaum religiöses Gepräge. Der apostolische Gedanke der Nachfolge, so kennzeichnend für die große Mehrzahl der religiösen Bewegungen des Mittelalters, fehlt hier ganz. Eudo starb im Gefängnis des Reimser Erzbischofs; seine Anhänger wurden in der Mehrzahl zum Feuertod verurteilt. Um so stärker tritt uns der Gedanke der Nachfolge in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts bei Peter von Bruis und seinem Schüler Heinrich von Lausanne entgegen. Die „Petrobrusianer" wollten die Kirche von jeder irdischen Fessel befreien. Peter, der ehemalige Priester aus der Provence, zog seit etwa 1105 wie andere religiöse Wanderprediger barfuß und mit langem Bart in der üblichen Pilgertracht durch ganz Südfrankreich und suchte überall das Volk zur Empörung gegen die bestehende Kirche zu veranlassen. Er rief sogar zum Niederreißen aller Kirchen aus Stein auf, denn Gott könne an jedem Ort angebetet werden. Alle Kruzifixe seien als Symbole des Werkzeugs, mit dem Jesus gemartert wurde, zu ver25
nichten. Peter verwarf nicht nur Kindertaufe und Eucharistie, sondern auch Messen, Fürbitten und Almosen für die Toten. Er wurde 1125 vom Volk verbrannt. Sein Schüler Heinrich von Lausanne war bereits seit 1101 als Bußprediger umhergezogen. Der Bischof von Le Mans erteilte ihm die Erlaubnis zur Predigt in dieser Stadt, doch Heinrich hetzte während einer Abwesenheit des Bischofs die Stadtbevölkerung gegen die Geistlichkeit auf und forderte die Schaffung eines armen Klerus. Der soziale Charakter dieser Forderung erhellt daraus, daß Heinrich zugleich verlangte, Eheschließungen sollten zukünftig ohne Mitgift erfolgen. Heinrich erstrebte auch die Abschaffung der Prostitution, indem er die unter seinem Einfluß stehenden Frauen, die oft aus sozialen Gründen in ihr jetziges „Gewerbe" geraten waren, eidlich zum Verzicht auf die Unzucht verpflichtete, ihnen Ehemänner aus seiner Anhängerschaft zuwies und ihnen aus der Gemeinschaftskasse eine Aussteuer mitgab, ihnen auch einfache Kleider für ihr neues Leben kaufte — ohne damit indes durchschlagenden Erfolg zu haben. Als Heinrich aus Le Mans vertrieben worden war, fanatisierte er die Massen in weiten Gebieten der Provence derart, daß seine Anhänger, die „Heinricianer", Kirchen schändeten, Altäre zerschlugen, Kruzifixe anzündeten, Priester verprügelten und Mönche aus einer merkwürdig modernen Auffassung des Gesdilechtlichen heraus zur Heirat zwangen. Heinrich trat für ein einfaches, apostolisches Leben ohne Kleiderluxus und größeren Aufwand ein. Statt dem Klerus Bußleistungen zu erbringen, sollten die Gläubigen ohne priesterliche Vermitdung einander beichten. Seine Anhänger bildeten denn auch eine Art eigener Laienkirche aus, in der Heinrichs Führerstellung unangefochten war. Wohl zum erstenmal im Mittelalter berief sich Heinrich auf das Evangelium, indem er die Bibel gegen die spätere kirchliche Tradition, die sich von der ursprünglidien biblischen Lehre entfernt habe, ausspielte. Er wurde offenbar vor allem von den unteren Volksschichten unterstützt, doch auch Feudalherren stellten sich schüt26
zend vor ihn, weil sie klerikale Interessen als Konkurrenz zu den eigenen Machtbestrebungen verstanden. 3. Wanderprediger vom Anfang des 12. Jahrhunderts In Westfrankreich traten bereits gegen Ende des 11. Jahrhunderts Wanderprediger auf, doch fällt ihre Hauptwirksamkeit in den Beginn des 12. Jahrhunderts. Im Unterschied zu den zuletzt behandelten Wanderpredigern verblieben sie, obgleich auch bei ihnen zeitweise die Gefahr des Abgleitens in Ketzerei bestand, auf kirchlichem Boden und konnten deshalb nach einer radikalen Zwischenphase von der Kurie für deren eigene Zielsetzung in Dienst genommen werden — ein Schicksal, das das spätere Geschick des Franziskanerordens weithin schon vorwegnahm. Bei allen diesen Wanderpredigern kann man drei Phasen ihrer Wirksamkeit unterscheiden: Sie begannen in der Regel als Eremiten, wurden darauf zu Wanderpredigern und endeten schließlich als Klostergründer. Namendich seien von ihnen als ihre prominentesten Vertreter Robert von Arbrissel, Bernhard von Thiron, Vitalis von Savigny und Girald von Salles genannt; zu ihnen kommt der vornehme deutsche Kleriker Norbert von Xanten. Das ursprüngliche eremitische Leitbild hatten sie mit vielen anderen Christen ihrer Zeit gemeinsam. Sie alle flohen ihre bisherige Tätigkeit, um sich in die Einsamkeit der Wälder und Einöden zurückzuziehen, obgleich etwa Norbert als Mitglied des Königshofes Heinrichs V. gute Aussichten besaß, ein hoher Prälat zu werden. Norbert freilich nahm im Gegensatz zu den westfranzösischen Wanderpredigern nur kurzen Unterricht bei einem Einsiedler und suchte dann, nachdem ihm die höheren Weihen erteilt worden waren, mit den Chorherren in Xanten eine geistliche Lebensform zu verwirklichen. Ohne ein Mönch zu sein, trug er hier das Mönchsgewand, und ohne eine Predigerstelle zu besitzen, hielt er Predigten, bald vor dem Volk, bald im Kapitel vor den Gesinnungsgenossen. 27
In den ersten Zeiten des Enthusiasmus zogen sich auch die Zisterzienser in Sumpfgebiete zurück und verwandelten sie in fruchtbares Ackerland. Freilich ist zu berücksichtigen, daß sie im östlichen Frankreich wirkten, wo die Zivilisation schon viel weiter fortgeschritten war als in Westfrankreich. Eine solche eremitische Welle, wie sie sich in Italien schon im 10. Jahrhundert entfaltete und dann über Frankreich bis nach Schottland ausbreitete, hatte es zuvor noch nicht gegeben. Ein ähnlich starkes Drängen nach einem Leben als Einsiedler war nur am Anfang des morgenländischen Mönchtums in Ägypten feststellbar gewesen. Dabei ist zu berücksichtigen, daß das teilweise rauhe und unwirtliche Klima ein eremitisches Leben im Westen zusätzlich erschwerte. Hier mögen östliche Einflüsse mitgewirkt haben, denn die ersten Einsiedlerkolonien des Westens fanden sich im süditalienischen Kalabrien, der Grenzscheide zwischen morgen- und abendländischer Kultur. Die Einsiedeleien bedeuteten eine bewußte Abkehr vom landläufigen kirchlichen Leben einschließlich des Lebens in den reichen Klöstern, das ihnen als Zerrbild der Vorschriften des Evangeliums wie der Benediktinerregel erschien. Westfrankreich mit seinen riesigen Waldgebieten, die erst an wenigen Stellen gerodet waren, bot für ein so verstandenes Einsiedlerleben die günstigsten Voraussetzungen. Die Einsiedler widmeten sich hier mit ihren Gefährten der Urbarmachung des Bodens, zunächst noch planlos, dann aber systematisch, dabei vom Feudaladel unterstützt. Auch die Päpste bestätigten einige so entstehende Klostergründungen. Jeder Eremit zog um seine Klause Bauern, Köhler, Handwerker und Vagabundierende an, so daß die Einsiedeleien und die von ihnen geschaffenen Klöster zu Siedlungsmittelpunkten wurden, die sich zu kleinen Dörfern ausweiteten und eine wichtige Kulturfunktion erfüllten. An der Wende vom 11. zum 12. Jahrhundert betrieben diese Einsiedler für kurze Zeit auch Wanderpredigt. Die einzigartige Verbindung von Wanderpredigt und Einsied28
lertum stellt ein Novum gegenüber dem eremitischen Leben früherer Zeiten dar. Wie kam es dazu? Robert von Arbrissel etwa hatte sich in seiner Einsiedelei harten Kasteiungen hingegeben, was ihn in den Ruf großer Heiligkeit brachte und ihm viele Schüler zuführte. Er predigte zunächst den benachbarten Eremiten, darauf seinen Schülern und bald auch dem Volk. Den Klerikern seiner Umgebung befahl er, nach dem Beispiel der Apostel zu leben, und durchzog darauf ganz Westfrankreich. Auch er und seine Begleiter gingen barfuß, waren in Säcke und Lumpen gehüllt und trugen lange Bärte. Sie wollten wie Jesus und die Apostel nichts besitzen, allein von Almosen leben und das Volk beeinflussen. Sie nannten sich deshalb Pauperes Christi, die Armen Christi, und diese Selbstbezeichnung wurde von den andern Wanderpredigern samt ihren Anhängern übernommen. Robert erstrebte denn auch keine Unterordnung seiner Anhänger im Sinne ihrer Unterwerfung unter einen neuen Herrn, sondern verstand sich als ihr treu für sie sorgender Vater. Die ganze Gemeinschaft sollte von evangelischem Brudersinn getragen sein. Audi das Volk sollte zu einem Leben tatsächlicher Christusnachfolge bekehrt werden. Roberts Predigten kreisten, was im Hinblick auf die spätere Predigt des Franziskus von großem Interesse ist, um Buße und Frieden, wobei der Frieden des Herzens wie innerhalb der menschlichen Gemeinschaft die Frucht der Buße sein sollte. Diese Wanderpredigt wurde zunächst von der Kurie gebilligt. Indes polemisierte auch Robert scharf gegen die Verweltlichung des Priesterstandes. Im schroffen Gegensatz zum welthaften Leben der kirchlichen Hierarchie prägte er die auch bei Franz wiederkehrende Formel, man müsse dem nackten Christus am Kreuz nackt folgen. Die Selbstbezeichnung „Pauperes Christi" war nicht eigentlich eine Neuerfindung durch Wanderprediger, da sie bei Mönchen und Nonnen schon seit dem 9. Jahrhundert auftrat; in dieser Häufung und Akzentuierung war sie jedoch neu. Die Wanderpredigt dieser Männer wies nicht 29
nur eine kirchenkritische, sondern auch eine soziale Färbung auf. Robert etwa sorgte sich unablässig um Nahrung und Kleidung seiner Anhänger und wollte dadurch die Fürsorge Jesu für seine Jünger imitieren. Die Chronik berichtet auch vom tiefen Mitleid Bernhards von Thiron mit Armen und Bettlern, Kranken und Krüppeln. Vitalis bekleidete und sättigte mit großem organisatorischem Geschick die Armen und errichtete Unterkünfte für Kranke. Ein besonderes Problem aber stellte auch für die Wanderprediger der gewaltige Zustrom von Frauen dar, unter denen viele Prostituierte waren. Robert und Vitalis überwiesen sie Einsiedlerklöstern, Vitalis gab ihnen aber auch wie Heinrich von Lausanne Ehegatten. Bei Robert steigerte sich diese Fürsorge für die Frauen zu einem förmlichen Frauenkult, der in gewissem Zusammenhang mit der immer stärker werdenden Marienverehrung steht. Er sah in der Frau das Symbol der Menschheitserlösung, da sich in jeder Frau die Gottesmutter aufs neue darstelle. Robert legte sich auf den Wanderungen auch des öfteren nachts zu Anhängerinnen, nicht etwa im Zeichen des Libertinismus, sondern als zusätzliche Prüfung seiner völligen Beherrschung des Trieblebens und gleichsam neuartiges Martyrium. Er mag als gebürtiger Bretone diese Anregung von irischen Christen erhalten haben, die ebenfalls ein Zusammenleben mit Frauen unter Verzicht auf geschlechtliche Annäherung (Syneisaktentum) als „weiße Marter" kannten. Widerstrebend schritt Robert indes 1101 auf Grund der scharfen Kritik einiger Bischöfe an seiner Behandlung der Frauenwelt zur Gründung eines eigenen Klosters in Fontevrault nahe der unteren Loire. Damit war seine letzte Wirkungsphase eröffnet. Durch diese Klostergründung, die sich bald zu einer eigenen Kongregation ausweitete, sorgte er dafür, daß seine Anhänger beiderlei Geschlechts das unstete Wanderleben durch ein gemeinsames Leben an festem Ort ersetzten. Durch diesen Schritt, der die durch ihn erstrebte Lebensform dem traditionel30
len klösterlichen Leben weithin annäherte, bewahrte er sich und seine Anhängerschaft davor, wie Heinrich von Lausanne in die Häresie abzugleiten, entschärfte damit aber faktisch seine ursprüngliche Zielstellung. Nur diese Bereitschaft unterschied ihn und verwandte Wanderprediger letztlich von solchen Wanderpredigern wie Peter von Bruis und Heinrich von Lausanne. Alle anderen westfranzösischen Wanderprediger folgten im Zeitraum bis etwa 1120 dem Beispiel Roberts. Norbert von Xanten begab sich auf die Wanderpredigt im östlichen und nordöstlichen Frankreich, nachdem er in einer Stadt, wie es später auch Waldes tun sollte, seinen gesamten Besitz verschenkt hatte. In buchstäblicher Befolgung der Aussendungsrede Jesu wollte schon er, wie später Franz, weder eine Tasche noch Schuhe noch zwei Röcke mit auf den Weg nehmen, sondern begnügte sich mit einer Leinentunika und einem Mantel, um so selbst vorleben zu können, daß wir auf dieser Erde nur Pilger und Wanderer sind. Mehr noch als die Armut galt ihm in dieser Zeit die Wanderpredigt als Zeichen apostolischer Nachfolge. Auch seine Predigt war eine Bußpredigt; auch in ihr spielte das Bestreben, Frieden zu stiften, eine große Rolle. Nachdem auch er ein Kloster gegründet hatte, erhielt seine Predigt einen neuen Charakter. Die Umfunktionierung seiner Predigttätigkeit wie überhaupt seiner gesamten Wirksamkeit gelang der Kurie im Falle Norberts und des von ihm gegründeten Prämonstratenserordens besonders gut. Das zeigt seine bestimmende Rolle bei der kirchlichen Predigt gegen die Anhänger Tanchelms in Antwerpen; ihm war es in erster Linie zu danken, daß diese bedeutende Stadt zum kirchlichen Gehorsam zurückkehrte. Aus dem Kirchenkritiker Norbert war der verläßliche Mann der Kirche geworden, der unerbittlich gegen jede ketzerische Regung einschritt, und sein Orden folgte ihm darin einschränkungslos. Die Prämonstratenser waren nach den Zisterziensern der zweite Orden von wirklich internationalem Gepräge, so daß er für die Ziele kurialer Politik ausgezeichnet zu nutzen war, 31
weshalb die Päpste ihn auch mit reichen Privilegien beschenkten. Freilich waren die Prämonstratenser auf Verständigung mit den Bischöfen ihrer Diözesen angewiesen und bildeten deshalb teilweise auch Tendenzen zu regionalen Zusammenschlüssen aus, die die zentralistische Organisation durchbrachen. So konnten sie noch nicht in dem Maße für die Ketzerbekämpfung eingesetzt werden, wie dies später mit den Dominikanern geschah; vielmehr kam die primäre Rolle bei dieser wichtigen kirchlichen Aufgabe zunächst den Zisterziensern zu. Mit der Gründung des Klosters Premontre nahe Laon im heutigen französisch-belgischen Grenzgebiet schuf Norbert eine Musterschule für streng asketisch lebende Kleriker. Er lehnte die Annahme der Zisterzienserregel ab, da diese ihm eine weitere Predigt- und Seelsorgetätigkeit unmöglich gemacht hätte. Vielmehr wurde die für alle durch ein gemeinsames Leben verbundenen Kleriker verbindliche Augustinerregel angenommen, doch sollte die Gemeinschaft ein eigenständiges Gepräge besitzen und streng den Grundsatz der Armut vertreten. Deshalb verschärfte Norbert die asketischen Anforderungen und verbot seinen Ordensleuten den Genuß von Fett und Fleisch. Es ist zu beachten, daß Norbert seinen Orden nicht als Predigerorden im Sinne der späteren Dominikaner, sondern als Orden von Eremiten-Kanonikern verstand. Ohne die Einrichtungen der Zisterzienser einfach zu kopieren, übernahm Norbert für seinen Orden doch deren zentralistisches Prinzip, das er sogar noch verschärfte. In viel stärkerem Maße als die Zisterzienser modifizierten die Prämonstratenser ihre Grundregel durch Sonderbestimmungen für die Lebensordnung in ihren Klöstern, denn sie beabsichtigten die fast völlige Angleichung des Lebens der ihnen zugehörigen Kanoniker an ein strenges Mönchsleben. Laienbrüder hatten auch hier die äußeren Geschäfte der Klöster zu besorgen. Für die Christianisierung der ostelbischen Gebiete leisteten die Prämonstratenser wie die Zisterzienser Großes, wurden freilich ebenso wie diese für die Expansionspolitik deutscher Feudal32
1 Das vermutlich älteste Porträt des Franziskits, Kapelle des heiligen Gregor in Subiaco
Fresko
in
der
3 Franz bei der Betreuung
2 Grotte
des Franziskus,
von
Tonto
Leprakranken
Colombo
fvyflprr! i
4 Franz mif seinen ersten Gefährten Fresko von Giotto di Bondone in Kreuz, Florenz (Ausschnitt)
vor Papst der Kirche
Honorius III., vom heiligen
gewalten gegenüber den slawischen Völkern mißbraucht. Zunächst konnte sich auch dieser Orden des Andrangs von Frauen nicht erwehren. Bald aber wurde er immer stärker den älteren Mönchsorden angeglichen, was sich nicht zuletzt im Verzicht auf die Seelsorge und in dem allmählich durchgesetzten Ausschluß von Frauen aus dem Orden kundtat. Robert von Arbrissel unterstellte das Kloster Fontevrault einer Äbtissin. In den in seiner Kongregation geschaffenen Doppelklöstern von Mönchen und Nonnen hatten die Nonnen den Mönchen zu gebieten. Die Gesamtleitung jedes Doppelklosters lag in den Händen einer Äbtissin. Die Mönche hatten für den Lebensunterhalt des Gesamtinstituts sowie für den Gottesdienst zu sorgen, was Robert in der Fürsorge des Zebedaiden Johannes für die Mutter des Herrn vorgebildet sah. Gerade dieses Prinzip, das von anderen Klosterstiften kaum imitiert wurde, hatte den raschen Niedergang der Kongregation von Fontevrault nach Roberts Tod zur Folge. Immerhin schickte noch der Lyoneser Kaufmann Waldes nach seiner Bekehrung 1173 seine Töchter in das Kloster Fontevrault. Das Doppelklosterwesen machte zunächst unter den bisherigen Wanderpredigern, die nunmehr zu Kloster- und Ordensgründungen übergingen, Schule, doch waren Mönche und Nonnen hier in der Regel gleichgestellt. Das Institut der Doppelklöster wurde in dieser Zeit nicht neu erfunden, vielmehr lassen sich Doppelklöster seit dem 7. Jahrhundert in verschiedenen Teilen Westeuropas, besonders in Spanien, Frankreich und auf den britischen Inseln, nachweisen. Auch Roberts Zeitgenosse, der Bretone Abaelard, entwickelte eine Theorie des Doppelklosterwesens, die interessante Parallelen zur Kongregation von Fontevrault aufweist. Doch auch die von früheren Wanderpredigern gegründeten neuen Kongregationen näherten sich schnell den Zisterziensern an, ja schlössen sich ihnen in einem folgenden Entwicklungsstadium völlig an. Man beschritt jetzt auch hier den Weg zum reichen 33
Kloster. Die rechtgläubige Prediger- und Nachfolgebewegung war damit bald zu ihrem Ende gelangt. Das Erbe der Pauperes Christi übernahmen nicht die katholischen Klöster, sondern die dualistischen Ketzer. 4. Die Gegenkirche der Katharer Die katharische Bewegung war keine christliche Kirche. Ihre Lebensauffassung und ihr Lehrgebäude waren unchristlich, denn sie trugen eindeutig neugnostisch-dualistischen Charakter. Dabei ist freilich zu berücksichtigen, daß der zeitgenössische Dualismus auf dem Balkan und im eigentlichen byzantinischen Reich selbst zumindest die Frucht eines Protestes gegen die herrschende Kirche im Geist eines ethischen Rigorismus war. Die Übergänge zwischen ethischem Rigorismus und ontologischem Dualismus mit seiner Annahme zweier entgegengesetzter Urprinzipien sind grundsätzlich fließend. Der Katharismus hat keine christlichen Wurzeln, sondern leitet sich von den Bogomilen ab, die in Bulgarien aufkamen. Grundsätzlich vertraten zumindest die konsequenten Anhänger dieser Strömungen eine Grundschau der Welt und des menschlichen Lebens, wie wir sie in den ersten nachchristlichen Jahrhunderten bereits in den verwirrend vielgestaltigen Ausprägungen der Gnosis, die offenbar sehr weit zurückreichende Voraussetzungen in der synkretistischen Religionswelt des Ostens hatte, und später in der von Mani gestifteten Religion finden, auf welchen im einzelnen noch nicht aufgeklärten Wegen sie einander auch immer befruchtet haben mögen. Die katharische Dogmatik bildete durchaus kein geschlossenes System von Glaubenslehren, sondern wies wie die Gnosis eine große Variationsbreite auf. Das Grunderlebnis aber war auch hier das des unversöhnlichen Gegensatzes zwischen der Seele des reinen Menschen und der bösen Welt. Satan als der Gott dieser Welt wurde zumindest in den radikalen katharischen Systemen als negatives Urprinzip dem positiven Urprinzip des guten Gottes als des Herrn der unsichtbaren Lichtwelt gleich34
geordnet. In der sichtbaren Welt ist der Teufel also allmächtig wie der gute Gott in seiner Welt. Das Alte Testament wurde auch hier vollständig oder doch zum großen Teil verworfen oder bestenfalls im Sinn der eigenen Lehre umgedeutet. Das Neue Testament wurde zwar als die grundlegende Urkunde von Christus anerkannt, doch galt Christus meist nur als guter Engel unter anderen. Seinem Leiden und Sterben stand man verständnislos gegenüber oder verwarf es als illegitime Unterordnung Vinter die Gesetze der bösen Materie ausdrücklich, und auch seine wahre Leiblichkeit wurde gern zugunsten der Vorstellung eines Scheinleibes negiert. Natürlich ist auch die Auferstehung des Fleisches für den Katharer undenkbar. Will man verstehen, warum trotzdem zeitweise Massen einfacher katholischer Gläubiger den Katharern zuströmten, so muß man sich klarmachen, daß es zwischen dem Dualismus gnostischen Typs und der christlichen Anthropologie und Weltschau bestimmte Berührungen gibt. Gewiß hat der christliche Glaube stets darauf verzichtet, das Prinzip des Bösen auf dieselbe Stufe wie das des Guten zu stellen, Gott und Teufel als zwei ewig bestehende Prinzipien zu denken. Er hat niemals die Welt als gute Schöpfung Gottes in der Weise preisgegeben, daß er sie zu einer Schöpfung des Teufels oder eines Zwischenwesens von minderem Rang, also eines Demiurgen, degradiert hätte. Er hat stets daran festgehalten, daß Gott trotz allem, was dagegen zu sprechen scheint, Herr der Welt ist und der Satan letztlich auch gegen seinen Willen ihm dienen muß, daß mithin Gott allein ewig und beständig in allem Wechsel der Dinge ist und am Ende aller Tage auch sichtbar den letzten großen Sieg über die teuflischen Gewalten davontragen wird. Aber auch die christliche Anthropologie war stets Ausdruck einer pessimistischen Sicht der Kräfte und Möglichkeiten des natürlichen Menschen, sofern die Erbsündenlehre ihr Kernstück bildet. Die anthropologische Grundeinstellung hat naturgemäß starke Auswirkungen auf das praktische Handeln. Die 35
christliche Ethik gerade während des ersten Jahrtausends war nicht geprägt vom griechischen Gedanken der Erziehung, der Annäherung an ein vorgegebenes Ideal, vom schöpferischen Tatendrang, von der Leidenschaft, sich die Erde und ihre Güter Untertan zu machen. Sie war vielmehr geprägt von Weltentsagung, Askese und Weltdistanz. Die sichtbare Welt blieb im Grunde immer das Tal der Tränen und die Stätte der Sünde, aus der nur einzelne gläubige Seelen in die bessere ewige Welt hinübergerettet werden können. Kajetan Eßer, der diese Fragen in seinem Aufsatz „Franziskus von Assisi und die Katharer seiner Zeit" aufwirft, sieht richtig, daß solche Tendenzen in der alten Kirche durch den Einfluß des Neuplatonismus erheblich verstärkt wurden, da dieser auf Grund seiner Abwertung des Materiellen eine Spiritualisierung der christlichen Botschaft nahelegen mußte. Die Überbetonung des Geistigen führte dazu, daß das Reich der Ideen als das eigentlich Seiende der angeblichen Scheinwelt des Materiellen entgegengestellt wurde. Auch der Manichäismus habe ungeachtet seiner Verwerfung im praktischen Leben der Kirche, vor allem aber in der Askese des Mönchtums, tiefe Spuren hinterlassen. So konnte bei vielen einfachen Gläubigen der Eindruck entstehen, daß die Katharer wie andere religiöse Bewegungen des Mittelalters in ihrer praktischen Lebensgestaltung und in ihrer Distanzierung von allem Welthaften folgerichtig seien, wo die offizielle katholische Kirche bei prinzipiell gleicher Zielsetzung auf halbem Wege stehen bleibe oder illegitime Kompromisse mit der Welt schließe. Ein ungeteiltes Leben mit Gott erschien ihnen gleichbedeutend mit der Freiheit von sämtlichen welthaften Verstrickungen. Die Kirche dagegen glaubte zu wissen, daß nur einzelne besonders begnadete Gläubige Gottes Forderungen vollständig nachkommen könnten, ja sie unterschied bewußt zwischen Gottes Geboten, die für alle verpflichtend sind, und Gottes Ratschlägen etwa in der Bergpredigt, deren Realisierung nur wenigen Vollkommenen möglich sei. Als ein solcher vollkommener und hei36
liger Mensch aber erschien ihr der Mönch, der sich von der Welt in ein Kloster zurückgezogen hat. Mochte das tatsächliche Leben in den Klöstern auch oft in diametralem Gegensatz zu diesem Bild stehen und die Reaktion der Vertreter religiöser Bewegungen hervorrufen, so wurde doch dieses Ideal theoretisch nie zurückgenommen. Der Mönch hatte sich drei bindenden Verpflichtungen zu unterwerfen: den Verpflichtungen zu absolutem Gehorsam, zur Armut und zum Verzicht auf das geschlechtliche Leben. Diese Pflichten, besonders aber die der Armut, standen in Übereinstimmung mit dem Grundimpuls der religiösen Bewegungen. Der Verzicht auf das geschlechtliche Leben schien gerade auch den Katharern weithin entgegenzukommen, wurde doch durch ihn der Eindruck erweckt, der Bereich des Sexuellen sei ein Bereich besonderer Gefährdung und die Triebwelt gehöre im Grunde zu den Niederungen der Wirklichkeit, die den Menschen nach unten ziehen, statt ihn der göttlichen Welt des Geistes entgegenzuführen. Vor allem aber waren es die Verstrickungen der offiziellen Kirche und ihrer Amtsträger in Reichtum und Machtstreben im Gefüge der Feudalordnung, die viele an der Kirche irre werden ließen, weil sie ihre Lehre und ihr konkretes Verhalten nicht in Übereinstimmimg zu bringen vermochten. Die katharischen Prediger sprachen nur aus, was viele einfache Gläubige längst gedacht, aber kaum auszusprechen gewagt hatten. So mußte ihre Gegenkirche vielen, die die dogmatischen Hintergründe nicht zu durchschauen vermochten, als entschlossene Rückkehr zum ursprünglichen Evangelium erscheinen. Die Katharer konnten als Bestandteil der religiösen Armutsbewegungen angesehen werden, was sie gerade in der ersten Phase ihrer Geschichte weithin tatsächlich waren. Nur ihr ethischer Grundimpuls macht ihre atemberaubenden Anfangserfolge in Italien und Frankreich verständlich. Auch die Bogomilen forderten von der Kirche die Rückkehr zu einem wahrhaft christlichen Leben unter völligem 37
Verzicht auf Besitz, Prunk und Macht. Sie lebten wie Büßer unter sehr bescheidenen Bedingungen und nährten sich auf ihren Wanderungen vom Bettel. Viele von ihnen waren durch den nationalen und sozialen Umbruch in Bulgarien um die Mitte des 10. Jahrhunderts zum Leiden an der Welt und zur Resignation, aber auch zur strikten Ablehnung aller staatlichen wie kirchlichen Macht geführt worden. Um 1060 waren sie über die ganze Balkanhalbinsel verbreitet. Um 1110 jedoch setzte eine schwere Verfolgung durch den byzantinischen Kaiser ein, die zu einer bedeutenden Veränderung in der Struktur und im Ausbreitungsgebiet der Bewegung führte. In Kleinasien entfachten gebildete Vertreter des hohen Adels, die sich der Gemeinschaft anschlössen, das Interesse an dualistischen Lehren, und in der Folge davon kam es zu einer beträchtlichen Verschärfung der eigenen Antithese zur Welt wie zur offiziellen Kirche. So wurde aus dem ethisch-weltflüchtigen ein metaphysisch-ontologischer Dualismus. Da die in Bulgarien verbliebenen Bogomilen aber diese Umgestaltung nicht mitvollziehen konnten, begann jetzt die Differenzierung zwischen der gemäßigten „bulgarischen Kirche" und der schrofferen „dragowitischen Kirche", so nach einer Landschaft in Thrazien genannt. Die bald darauf entstehende bosnische Kirche, der es als einziger gelang, zeitweilig den Status einer Staatskirche zu erlangen, und die in dogmatischen Fragen einen vermittelnden Standpunkt einnahm, verstärkte diesen Differenzierungsprozeß noch, und die Missionare dieser Kirche in Italien und Frankreich trugen die Spaltung alsbald auch nach dem Westen, so daß die Katharer dort nie ein einheitliches Gepräge trugen. Die katharische Häresie war anfangs im westlichen Kulturkreis nicht leicht zu durchschauen, da sie zunächst nicht die ketzerische Lehre, sondern das apostelgleiche Leben betonte und manche Züge anderer religiöser Bewegungen übernahm. Die anfangs noch kleinen, an einen Ort gebundenen Gruppen blieben großenteils anonym 38
und ließen nur einzelne Momente dualistischer Weltauffassung erkennen, die insofern willkürlich anmuten und verwirren mußten, als sie zunächst durch relativ zufällige Berührung mit bogomilischen Wanderpredigern aufgenommen worden waren. Audi diese Gruppen bezeichneten sich als „Pauperes Christi" und erklärten, es sei ihr Los, wie Schafe unter den Wölfen ruhelos von Stadt zu Stadt fliehen zu müssen. Sie verglichen bewußt ihre eigene Verfolgungssituation mit dem Leiden der Apostel und Märtyrer. Ihre Standhaftigkeit, ja ihr gelassenes und fröhliches Aufsichnehmen selbst des Feuertodes machte auf die Umgebung großen Eindruck. Da der Boden in manchen Gebieten Süd- und Westeuropas durch andere religiöse Bewegungen schon gelockert war, gelang es den Katharern in den vierziger Jahren des 12. Jahrhunderts in kürzester Zeit, das gesamte Gebiet zwischen Rhein und Pyrenäen mit ihren Stützpunkten zu durchsetzen. Die Selbstbezeichnung „Katharer", aus der bald das Schimpfwort „Ketzer" gebildet werden sollte, kennzeichnete sie als die Reinen gegenüber der Welt und als die echten Vertreter des christlichen Glaubens, und Selbstbezeichnungen wie „gute Christen" oder häufiger noch „gute Menschen" verfolgten dasselbe Ziel. Indes war die katharische Ethik von Anfang an dualistisch geprägt, sollte doch die Askese die Überlegenheit der Gläubigen über alles Welthafte sinnfällig demonstrieren. Alle Gebote waren im Grunde Verbote, die sich folgerichtig aus dem grundlegenden Gebot der Enthaltung von der Materie ableiteten. Alle aktuellen Sünden bestanden für den Katharer in der Hingabe an die Welt, jede Verstrickung in das Materielle galt als sündhaft. Diese Folgerichtigkeit gab der katharischen Ethik zweifellos etwas Geschlossenes und ließ sie als konsequent erscheinen, solange es um die Eindeutigkeit und Konsequenz der persönlichen Entscheidung und die Verwerfung aller falschen Kompromisse ging. Der eminent negative Charakter dieser Ethik war aber zugleich ihre Schwäche. Der abgründige Pessimismus gegenüber dem natürlichen 39
menschlichen Leben setzte zwar hier und da kritische Potenzen frei, verhinderte aber gleichzeitig die Ausbildung einer positiven, auf aktive Veränderung des als falsch Erkannten geriditeten Ethik. Sie ließ deshalb im Grunde auch keine revolutionären Energien aufkommen. Außerdem zwang sie im Lauf ihrer Geschichte die katharische Kirche zu mannigfachen Kompromissen, die eine gewisse Parallele zu christlichen Problemen des 2. Jahrhunderts bilden, weil die Normativität des Faktischen den ursprünglichen Impuls zu radikaler Weltverneinung durchkreuzte. So war der Untergang der katharischen Kirche nach zeitweiliger Blüte nicht nur die Folge des brutalen Vernichtungswillens der katholischen Kirche, sondern war auch im eigenen Wesen begründet. Man kann nicht sagen, daß die Katharer mit ihrer Überzeugung nicht Ernst gemacht hätten; ihr anfänglicher Erfolg resultierte ja gerade aus der Überzeugungskraft ihres konkreten Verhaltens. Freilich übernahm die katharische Kirche von Anfang an die Unterscheidung zwischen einfachen Gläubigen (Credentes) und Vollkommenen (Perfecti) von den Bogomilen. Nur die Perfecti waren im eigentlichen Sinne Katharer; nur sie hatten sich deshalb auch ganz dem katharischen Ethos zu unterstellen, und sie taten es tatsächlich. Als Wanderprediger zogen sie von Ort zu Ort, in ihrem Äußeren den Wanderpredigern der religiösen Bewegungen vielfach gleichend, so daß auch Verwechslungen mit Vertretern der ursprünglichen franziskanischen Bruderschaft möglich waren. Zuweilen gingen auch die katharischen Perfecti barfuß und mit langem Bart sowie einem Kapuzenmantel umher, wenn ihnen auch keine feste Kleidung vorgeschrieben war. Sie beteten sehr oft, bis zu 250 Vaterunser täglich, und fasteten streng. Der Genuß von Fleisch, tierischem Fett, Käse, Milch und Eiern war ihnen strikt untersagt, überhaupt der Genuß aller Nahrungsmittel, die ex coitu entstanden seien. So waren sie in der Regel mager und bleich, zeigten stets eine tiefbetrübte Miene, die ihnen dem Wandel im irdischen Jammertal angemessen schien, und sprachen mit tränen40
reicher Stimme. Sie waren wirklich arm, denn sie hatten bei ihrer Aufnahme in den Stand der Vollkommenen auf jede Form des Privateigentums verzichtet und waren ganz auf Gaben der Gläubigen angewiesen. Die Verpflichtung zu persönlicher Armut hatte freilich, zumindest in der Spätphase des Katharertums im 13. Jahrhundert, keinen Einfluß mehr auf die Kirche als ganze. Diese verfügte damals vielmehr über reichliche Geldmittel, und zu einer Zeit, da die katholische Kirche ihren Gliedern Zinsgeschäfte als unsittlich verbot — freilich durchaus nicht immer mit durchschlagendem Erfolg —, durften die katharischen Perfecti nicht nur zum Zwecke der Tarnung auf den Märkten als Händler auftreten und Geldgeschäfte tätigen, bei denen ein Zinsfuß von 2 0 Prozent keine Bedenken erregte. Hier wiederholte sich gewissermaßen der Widerspruch der christlichen Klöster, deren einzelne Insassen arm waren, die aber als Gesamtkörperschaft oft über großen Reichtum verfügten. Die Credentes waren an das katharische Ethos keinesfalls streng gebunden. Sie nahmen zu ihrem Schutz sogar weiterhin an den katholischen Gottesdiensten teil. Ursprünglich waren sie Anwärter auf den Status eines Vollkommenen und versuchten, sich auch im Lebensvollzug auf diesen die Welt überwindenden Endzustand zuzurüsten. Fraglos hat es während des Bestehens der katharischen Kirche stets Gläubige gegeben, die sich selbst so verstanden. Darauf weist nicht zuletzt der gerade in der Spätphase dieser Kirche aufkommende, uns geradezu martialisch anmutende Brauch der sogenannten Endura hin; es handelt sich hierbei um den nach Empfang des Consolamentum, der katharischen Geisttaufe, zwecks Abstreifung alles Irdischen bewußt vollzogenen Hungertod, der, da die Aufnahme von Flüssigkeit weiterhin gestattet blieb, zu qualvollen Agonien von bis zu sieben, ja zwölf W o chen führte. Andererseits verleitete die unklare Stellung der Credentes, die im Grande noch keine Mitglieder, sondern erst Anwärter auf die Mitgliedschaft in der katharischen Kirche 41
waren, zu einer leichtfertigen Selbstbefreiung vom Ethos im weitesten Sinne. Die Credentes behielten ihren Besitz, schon damit sie die Perfecti unterstützen und ihnen ihren Lebensunterhalt garantieren konnten. Sie lebten weiter in der Ehe. Ihr äußeres Leben änderte sich im Grunde durch ihre Berührung mit den Katharern also überhaupt nicht. Das braucht an sich noch keinen Anlaß zu Bedenken zu geben. Die absolute Verwerfung der Ehe und ihre Gleichstellung mit Blutschande, Ehebruch und sexuellen Perversionen in der katharischen Moralauffassung ließ aber viele Credentes ein tatsächlich unmoralisches Verhalten genauso wie das eheliche Zusammenleben entschuldigen, ja manchen von ihnen erschienen Blutschande und sexuell Abnormes weniger sündhaft als das eheliche Leben mit dem ihnen angetrauten Partner. Die sittlichen Folgen einer solchen Einstellung mußten zum Teil verheerend sein. Auffallend ist auch bei einigen Katharern der in rigoristischen Kreisen immer wieder feststellbare Umschlag der Askese in Libertinismus, wenn auch zugegeben werden muß, daß libertinistisdie Praktiken bei den Katharern nicht vorherrschend waren. Früher war die Forschung geneigt, derartige Berichte katholischer Theologen und Inquisitoren als den Versuch moralischer Diskriminierung zwecks Erleichterung des eigenen Vorgehens gegen die Ketzer und deshalb als unglaubhaft beiseitezuschieben. Indessen sind die Berichte über libertinistisdie Praktiken zu zahlreich, als daß man sie als grobe Fälschungen abtun könnte. Und ein libertinistisches Verhalten, wie es nach strenger Askese und der dadurch angeblich vollzogenen Selbstabtötung später bei manchen Vertretern der freigeistigen Ideologie zweifelsfrei nachweisbar ist, scheint auch insofern gut verständlich, als der Gnostiker seit je durch bewußt unsittliche Praktiken ebenso wie durch leidenschaftliche Weltentsagung seine Weltüberlegenheit beweisen zu können meinte. Auch die Katharer verwarfen Kultus und Sakramente der katholischen Kirche. Ihr Gottesdienst dürfte zunächst 42
denkbar schlichte Formen aufgewiesen haben. Im Laufe der Zeit ist aber eine zunehmend stärkere Nachahmung des kultischen Lebens der katholischen Kirche festzustellen, die mit der Erschlaffung des ursprünglichen ethischen Grundimpulses und einem allmählichen Verkirchlichungsprozeß, der auch zur Ausbildung von Ämtern führte, Hand in Hand ging. Gewiß lehnten die Katharer nicht nur das Ehesakrament, sondern auch alle anderen katholischen Sakramente ab. Die Kindertaufe und das katholische Verständnis der Eucharistie waren ihnen sehr anstößig. Im Vor-Consolamentum suchten sie jedoch die katholische Taufe und Firmung nachzuahmen, und die Sitte des Brotbrechens pflegten sie von Anfang an. Auch sakramentale Bußhandlungen erwiesen sich als immer notwendiger, da mit dem Nachlassen des anfänglichen Rigorismus die Vergebung konkreter Sünden eines Perfectus erforderlich wurde. Jedoch hielten die Katharer daran fest, daß nur ein geistlich lebender Perfectus zur Ausübung gottesdienstlicher und sakramentaler Handlungen befugt sei. In diesemZusammenhang mag erwähnt sein, daß es unter den katharischen Perfecti Amtsbewußtsein und Amtsvollmacht im katholischen Sinne nicht gab. Auch ihre Bischöfe hatten unter den Perfecti nur den Ehrenvorrang eines primus inter pares und waren alles andere als Kirchenfürsten; kein einziger Ritus war ihnen allein vorbehalten. Das strikte Verbot des Tötens einschließlich des Vollzugs der Todesstrafe durch eine staatliche Gewalt und der Verletzung eines Feindes in der Notwehr zeigt ebenso wie die Verwerfung aller zur Äußerlichkeit neigenden Praktiken, etwa der Gebete für Verstorbene und der Ablässe, daß der Charakter einer religiösen Bewegung weithin beibehalten wurde. Daß angesichts der brutalen Verfolgung durch die Inquisition die Katharer gelegentlich auch zur Gegenwehr schritten, indem sie Inquisitoren ermordeten, kann ihnen ernstlich nicht angelastet werden. Hervorzuheben ist schließlich auch, daß die Frau — meist freilich die adligeFrau in den katharischen Gemeinden der Provence— vor allem inder erstenPhase derBewegung eine wesentlich 43
aktivere Rolle spielen konnte als in der katholischen Kirche und zeitweise sogar wirkliche Gleichberechtigung mit dem Mann besaß; diese Freiheit wurde allerdings im Zuge des Institutionalisierungsprozesses im Lauf der Zeit mehr und mehr beschnitten. Während die Bogomilen die Handarbeit verachtet hatten, übernahmen die westeuropäischen Katharer von anderen religiösen Bewegungen die Hochschätzung der Arbeit. Viele Perfecti erwarben ihren Lebensunterhalt selbst, indem sie sich in Toulouse und anderen Zentren der südfranzösischen Tuchproduktion etwa als Weber betätigten, wobei sie nach einer gewissen Zeit der Arbeit in ein anderes Gebiet weiterzogen. Der katholischen Geistlichkeit warfen die Katharer stets vor, daß sie vom Schweiß anderer lebe. Die katholischen Festtage galten ihnen als Verdinglichung der Frömmigkeit, die Heiligenverehrung als Anbetung toter Knochen. Zum wichtigsten Zentrum der Katharer im Bereich der römischen Kirche wurde Südfrankreich. Hier erlangten die Katharer eine solche Stärke, daß sie es 1165 wagen konnten, Katholiken zu einem Disput über die Wahrheit ihrer Lehre im Languedoc einzuladen, der tatsächlich zustande kam. Im Mai 1167 hielten sie nahe Toulouse ungehindert ein eigenes Konzil ab und festigten dadurch die Organisation ihrer Kirche beträchtlich. Mit der Schaffung einer selbständigen Hierarchie von Bischöfen wurde hiermit allerdings der folgenschwere Schritt vollzogen, die kirchenkritische Protestbewegung zu einer förmlichen Gegenkirche umzustrukturieren. Die Katharer konnten dies tun, weil sie mit Unterstützung der weltlichen Großen in Südfrankreich bis zu den Albigenserkriegen zu einer geduldeten, halboffiziellen Kirche aufstiegen. Natürlich war dies nicht die Folge ihrer Missionen, sondern beruhte auf dem nüchternen Machtkalkül der eifrig um ihre Selbständigkeit besorgten und die katholische Kirche als Konkurrentin empfindenden provencalischen Adligen. Von besonderer Bedeutung war es, daß der Graf von Toulouse, der ursprünglich schroff gegen die Katha44
rer Stellung bezogen hatte, sie aus politischen Gründen zu fördern begann. Viele kleine Adlige, denen es nicht gelungen war, in den sich entwickelnden Städten Fuß zu fassen und sich der aufstrebenden Schicht der Händler und Kaufleute zu assimilieren, befanden sich ökonomisch in einer Krisensituation. In ihrer Blütezeit strömten zu den Katharern gerade in Südfrankreich zahlreiche Vertreter der armen Schichten, die großenteils als Weber arbeiteten; gelang es ihnen nicht, in den Zentren der Tuchfabrikation heimisch zu werden, waren sie schutzlos und gesellten sich den Massen des Lumpenproletariats zu, das sich überall bildete, wo aufkommende Industrie zur Massenabwanderung vom Lande und damit zur Entwurzelung führte. Die Pfarrgeistlichkeit besaß keinerlei Kontakt mit diesen Schichten, so daß sie der katholischen Kirche leicht entglitten. Viele Frauen waren unter denen, die sich von den Katharern angezogen fühlten, teils aus ehrlicher Begeisterung, teils, was besonders für adlige Damen galt, weil sie hier inmitten einer Welt der Diskriminierung der Frau etwa in den katharischen Frauenkonventen, die Nonnenklöster und Rastplätze in einem waren, eine relativ selbständige Rolle spielen konnten. Innerhalb der katholischen Hierarchie herrschte im 12. Jahrhundert eine große Unsicherheit und Unruhe angesichts der sich lawinenartig ausbreitenden Gefahr der Häresie. Die Bischöfe hatten die Entscheidung in solchen Fällen bisher gern den sogenannten Gottesgerichten überlassen oder solange hinausgeschoben, bis sie ihnen durch Lynchjustiz abgenommen worden war. Angesichts des Versagens der schon durch Karl den Großen eingesetzten Sendgerichte, die kaum noch eine reale Bedeutung besaßen, waren die Bischöfe und ihre Stellvertreter nun gezwungen, in Ketzerangelegenheiten selbst die Initiative zu ergreifen. In gewisser Weise bedeutete es einen Fortschritt, daß die Untersuchung jetzt durch theologische Sachverständige geführt wurde. Deren Ergebnis bildete die Grundlage für die Urteilsfindung. Wenn die Ange45
klagten an ihrer abweichenden Überzeugung festhielten, wurden sie nicht nur aus der Kirche ausgeschlossen, also exkommuniziert, sondern auch der weltlichen Obrigkeit zur Bestrafung übergeben. Für diese Bestrafung gab es noch keine feste Regel; zuweilen begnügte man sich mit der Landesverweisung, in anderen Fällen schritt man zur Hinrichtung. Die meisten Verbrennungen erfolgten zunächst in Nordfrankreich, während sie in Südfrankreich und Italien noch Ausnahmen blieben. Die Kurie bezog bis gegen Ende des 12. Jahrhunderts noch keine eindeutige Position. Alle Beschlüsse der Synoden und Konzilien des 12. Jahrhunderts in der Ketzerfrage bis zum Pontifikat Alexanders III. (1159—1181) beschäftigten sich mit den speziellen Verhältnissen in Südfrankreich und wandten sich vor allem gegen den Adel, der die Häretiker unterstützte oder sie doch nicht behinderte. Auf der Synode von Tours 1163 wurde neben Gütereinziehung und Haft zum erstenmal der wirtschaftliche und gesellschaftliche Boykott als wirksames Mittel zur Bekämpfung der Häresie empfohlen. Das III. Laterankonzil 1179 verbot, mit Ketzern Handel zu treiben oder sie auch nur zu beherbergen, erkannte ihnen das Recht auf ein christliches Begräbnis ab und forderte die weltlichen Fürsten erstmals zu einem Kreuzzug gegen die „Albigenser", also gegen die vornehmlich aus Katharern bestehenden ketzerischen Gruppen des Languedoc und anderer südfranzösischer Landschaften, auf. Die Durchführung dieser Beschlüsse wurde jedoch noch den kirchlichen und politischen Mächten in Südfrankreich überlassen. Zur gleichen Zeit bemühten sich die Zisterzienser, zunächst vom Grafen von Toulouse und anderen Adligen unterstützt, um die Bekehrung der Katharer durch Predigten, blieben jedoch im wesentlichen erfolglos. Die Zisterzienser ließen sich durch ihre Erfolglosigkeit nicht beirren und setzten auch zu Anfang des 13. Jahrhunderts ihre Predigttätigkeit in verstärktem Maße fort. Der Abt des zisterziensischen Stammklosters Citeaur predigte mit 46
anderen Zisterzienseräbten 1207 in fast jedem südfranzösischen Dorf, wobei es zu heftigen Disputen mit Ketzern kam. Da sie hoch zu Roß heranritten und als hohe Herren erscheinen wollten, verurteilten sie sich selbst zur Wirkungslosigkeit. Nicht besser erging es dem spanischen Bischof Diego von Osma während seiner Tätigkeit in Südfrankreich 1201 bis 1207, denn auch ihm warfen die Katharer vor, er predige zu Pferde und trete mit großem Prunk auf. Ohne Ergebnis endete deshalb auch ein Disput, den Diego, sein Begleiter Dominikus und zwei katholische Bischöfe in Gegenwart eines Grafen 1207 in Pamiers mit Katharern und Waldensern führten. Dominikus, der spätere Gründer des Dominikanerordens, zog daraus selbstkritische Konsequenzen. Er erkannte klar, daß Aussicht auf Bekehrung einiger Häretiker nur dann bestehe, wenn man sich ihnen äußerlich angleiche und damit die Berechtigung ihres Ideals der Nachfolge des armen Christus anerkenne, ohne dadurch aufzuhören, mit aller Energie die katholische Lehre zu vertreten. Der Kreuzzug, zu dem schon das III. Laterankonzil aufgerufen hatte, kam 1181 unter Leitung eines Abtes von Clairvaux und eines Kardinallegaten tatsächlich zustande, blieb aber ohne große Beteiligung und verlief im Sande. Man appellierte zu dieser Zeit noch an die Fürsten, den Kampf gegen die Häretiker in die eigenen Hände zu nehmen. Das beharrliche Ringen der Kurie mit dem deutschen Kaisertum der Staufer und die Kreuzzüge gegen den Islam lenkten vom Kampf gegen die Ketzer ab, zumal man das volle Ausmaß der Bedrohung wohl noch immer nicht durchschaut hatte. In Tours warnte Alexander III. noch vor zu harten Strafen gegen Häretiker mit der Begründung, Nachsicht sei christlicher als zu große Strenge. Schon 1184 aber wurden bei einer Zusammenkunft Kaiser Friedrich Barbarossas mit Alexanders Nachfolger Lucius III. (1181—1185) endgültig die Weichen für die harte Ketzerpolitik der Folgezeit gestellt, nachdem König Ludwig VII. in Frankreich bereits vorgeprescht war. Voraussetzung des Beschlusses von Verona war die 47
Einigung zwischen Kaiser- und Papsttum durch einen Kompromiß. Durch diese Beratung wurde auch die Kaisermacht direkt in die Ketzerbekämpfung eingeschaltet, indem die Häresie als Bedrohung für die Ordnung des Reiches hingestellt wurde. Die im Einvernehmen mit dem Kaiser herausgegebene Bulle Ad abolendam war die erste grundsätzliche Stellungnahme der Kurie in der Ketzerfrage. In ihr wurden klare Richtlinien veröffentlicht, welche Phänomene als Häresien zu bezeichnen seien. Als erstes Merkmal der Ketzerei wurde die unbefugte Predigt genannt, eine Auffassung, die für die Waldenser äußerst folgenreich werden sollte. Als zweites Merkmal galt jede Abweichung von der katholischen Sakramentslehre. Die Durchführung regelmäßiger Untersuchungen (Inquisitionen) durch die Bischöfe sowie die planmäßige Aufspürung der Ketzerei wurden verfügt. Die Kurie befahl die eidliche Verpflichtung aller weltlichen Obrigkeiten einschließlich der Grafen und Stadträte zu wirksamem Vorgehen gegen die Ketzer auf Ersuchen der Kirche. Zwar wurde noch nicht von der Todesstrafe gesprochen; vielmehr beschränkte man sich auf Reichsacht, Verbannung, Gütereinziehung und Zerstörung der Häuser der Delinquenten. In Aragon aber wurde 1197 die Todesstrafe für Ketzerei bereits eingeführt. Die volle Durchführung dieser harten Repressionsmaßnahmen war zwar anfangs noch nicht möglich, aber der mächtige Papst Innozenz III. (1198—1216) nutzte bald die von seinen Vorgängern geschaffenen rechtlichen Möglichkeiten zur Eindämmung der Ketzergefahr, erkannte er doch als erster, daß die von den Katharern ausgehende Gefahr ernster zu nehmen sei als die Gefahr des Islams. Die Folge war, daß der Abt von Citeaux von neuem den Kreuzzug gegen die Ketzer predigte, der 1209 zum Ausbruch der schrecklichen Albigenserkriege führte. Die überlebenden Katharer flüchteten seit 1233 auf Grund der Einführung der planmäßigen päpstlichen Inquisition durch Gregor IX. und der durch sie verursachten verschärften Ketzerbekämpfung aus Nordfrankreich nach Italien. Die nord48
italienischen Städte wurden nach den Albigenserkriegen zum eigentlichen Zentrum der Katharer, denn hier waren die Ketzer viel schwerer aufzuspüren, und hier gab es keine zentrale Gewalt, die sie bekämpfte. Zwar hatte das IV. Laterankonzil ausführliche Bestimmungen über das Vorgehen gegen die Ketzer erlassen, aber damit wurden nur ältere Bestimmungen zusammengestellt. Schon seit 1199 wurden Ketzerei und Majestätsverbrechen identifiziert. Zugleich verbot das Konzil allen Klerikern streng die Beteiligung an Wasser- und Feuerproben und entzog die Entscheidung über die Häresie damit ausdrücklich und endgültig dem Zufall der „Gottesurteile", wie es Innozenz III. 1212 in einem Brief an den Bischof von Straßburg gefordert hatte. Eine katholische Glaubensformel wurde als Kriterium für die Beurteilung aller Häresien formuliert. Friedrich II. hielt ungeachtet seiner fundamentalen Differenzen mit dem Papsttum wie seine Vorgänger dieselbe Linie ein und bedrohte besonders seit seiner Kaiserkrönung im November 1220 jeden Katharer in seinem Reich mit dem Bann. Die italienischen Städte folgten diesem Schritt nur zögernd. Die zur kaiserlichen Partei der Ghibellinen sich zählenden oberitalienischen Städte waren auf weitgehende Selbständigkeit von der Kurie bedacht und tolerierten deshalb anfänglich, wenigstens teilweise, das Wirken der Katharer in ihrem Machtbereich. Allmählich aber sahen auch sie sich genötigt, das Reichsgesetz gegen die Ketzer in ihre Statuten aufzunehmen. Friedrich II. befahl 1224, zunächst auf die Lombardei beschränkt, die Verbrennung aller Katharer, wogegen freilich in einigen italienischen Städten zunächst eine starke Opposition bestand. Papst Gregor IX. (1227-1241) befahl 1231 die Ketzerverbrennung für seinen Kirchenstaat, denn selbst hier war eine gewisse katharische Aktivität spürbar. 1232 wurde die Ketzerverbrennung dann endgültig Reichsgesetz. Auf diesem Gesetz konnte die 1233 offiziell ins Leben gerufene Inquisition aufbauen. Die der päpstlichen Partei der Guelfen angehörenden Städte setzten diesen 49
Beschluß sofort in die Tat um. Die Inquisition ging sogleich an die systematische physische Vernichtung der Katharer durch eine auf lange Sicht arbeitende erbarmungslose Maschinerie. Papst Innozenz IV. (1243—1254) führte die Folter beim Ketzerprozeß ein und stellte sich mehrmals schützend vor seine Inquisitoren. Bald flohen Massen von Katharern nach Norditalien. 1330 erlosch in der südfranzösischen Stadt Carcassonne der letzte Scheiterhaufen für einen Katharer. Um dieselbe Zeit verstummten die Katharer auch in Norditalien. Die letzte Nachricht von ihnen stammt aus dem Jahre 1412. 5. Die Humiliaten Zu der Zeit, als die dualistische Gegenkirche der Katharer Süd- und Westeuropa überflutete, entstanden hier neue echt christliche Bewegungen. Von ihnen sind die Waldenser weithin bekannt geworden. Unbekannter blieben die Humiliaten, denen wir uns zunächst zuwenden wollen. Über die genauen Umstände und den Ort ihrer Entstehimg sind wir ebensowenig unterrichtet wie über die Namen ihrer Führer. Mit einer einheitlichen Entstehung ist nicht zu rechnen, da sie selbst kein geschlossenes Gepräge trugen. Doch steht fest, daß die mit den Waldensern vielfältig verwandten Humiliaten in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts in Oberitalien entstanden und in der Lombardei, ganz besonders in Mailand, dem früheren Zentrum der Pataria, besonders stark vertreten waren. Es ist grundsätzlich möglich, daß frühere Armutsbewegungen wie etwa die Arnoldisten einen gewissen Einfluß auf sie ausgeübt haben, doch fehlt den Humiliaten der aggressiv-kirchenkritische Charakter der Arnoldisten. Eindeutig ist das Bestreben der Humiliaten, in ihrer eigenen Lebensgestaltung zu den apostolischen Ursprüngen der Kirche zurückzukehren und auch andere Christen für dieses Ideal zu gewinnen. Sie waren jedoch nicht der Ansicht, daß die gesamte Christenheit ihre Lebensform zu übernehmen habe. Wir finden deshalb bei ihnen keine 50
Wanderpredigt. Das Lehrgebäude der katholischen Kirche betrachteten sie für sich als verbindlich, ohne den dogmatischen Fragen im engeren Sinne eine spezielle Aufmerksamkeit zuzuwenden. Im Gegensatz zu den französischen Waldensern waren sie grundsätzliche Gegner des Bettels. Sie waren entschlossen, sich von eigener manueller Arbeit zu ernähren. Dazu bestanden in Oberitalien günstige Möglichkeiten, da sich hier die Tuchindustrie schnell entwickelt hatte. Während die katharischen „Vollkommenen" in Südfrankreich nur zeitweilig in der Textilindustrie arbeiteten und dann an andere Orte weiterzogen, besaßen alle Humiliaten einen festen ständigen Wohnort. Einem Teil von ihnen gelang es sogar, eigene Manufakturen zu schaffen, so daß sie nicht genötigt waren, mit ungeistlich lebenden Menschen zusammenzuarbeiten. Ihre regelmäßige Arbeit diente natürlich, solange sie eine Armutsbewegung waren, nicht dazu, Besitz anzuhäufen. Vielmehr lebten sie selbst bescheiden und verschenkten alles, was sie nicht imbedingt zum eigenen Lebensunterhalt benötigten. Sie suchten ihre tägliche Arbeit mit ihrer geistlichen Lebensform möglichst eng zu verbinden. Doch gab es offenbar von Anfang an zwei Ausprägungen des geistlichen Lebens: Die einen beschränkten sich darauf, sich regelmäßig auf Versammlungen zu treffen, die gottesdienstlichen Charakter trugen. Dieser Teil der Humiliaten lebte weiter in seinen Privathäusern. Die ihm zugehörigen Männer und Frauen blieben verheiratet, vereinbarten aber oft, auf ein Intimleben zu verzichten. Man kann diesen Zweig der Humiliaten am ehesten mit dem späteren Dritten Orden der Franziskaner, den Tertiariem, vergleichen. Der andere Teil der Humiliaten war konsequenter in der Durchsetzung einer geistlichen Lebensform: Die ihm angehörenden Männer und Frauen lebten zusammen in Gemeinschaftshäusern, also klosterähnlich, jedoch unter Beibehaltung der Handarbeit. Sie predigten im Rahmen ihrer Gemeinschaft, übten Seelsorge untereinander sowie an 51
ihren Hörern und nahmen diesen die Beichte ab. Der Eintritt in ihre Gemeinschaft war mit dem völligen Verzicht auf Privateigentum verbunden. Die Humiliaten bekundeten ihre Bedürfnislosigkeit äußerlich schon dadurch, daß sie als Antwort auf den schnell um sich greifenden Kleiderluxus in den begüterten Kreisen auf modisch gefärbte Kleidung verzichteten und sich mit einfachen, ungefärbten Gewändern begnügten, die jedoch ähnlich wie in der franziskanischen Bruderschaft nicht unordentlich und verschmutzt sein durften. Dieser Lebensstil erregte kaum den Unwillen der Kurie, zumal hier, wie schon die Selbstbezeichnung „Humiliaten" kundtat, Demut und Armut in innigem Zusammenhang standen und keine Neigung zur Revolte vorhanden war, mochte ihnen das Gehaben vieler Prälaten und Priester auch abstoßend erscheinen. Auch konnte es der Kurie gefallen, daß die Humiliaten ihren scharfen Gegensatz zu den häretischen Katharern nicht verbargen. Es mußte jedoch Argwohn und Mißfallen bei den offiziellen kirchlichen Instanzen erregen, daß die Humiliaten, die in ihrer überwiegenden Anzahl zunächst ja Laien waren, für sich das Predigtrecht in Anspruch nahmen. Seit Jahrhunderten vertrat die Kirche die Ansicht, daß einzig ordinierte Priester von Gott zur Predigt berufen seien; ohne Berufung habe nach Rom. 10,15 niemand das Recht zur Predigt. Noch Wilhelm von St. Amour vertrat in seinem Kampf gegen die als Konkurrenz empfundene Predigt der Bettelmönche um die Mitte des 13. Jahrhunderts die Auffassung, nur die Bischöfe und ihre Stellvertreter als Nachfolger der Apostel und die Pfarrer als Nachfolger der 72 von Jesus ausgesandten Jünger besäßen die göttliche Legitimation zur Predigt. Auch den Mönchen der traditionellen Orden, die in Ausnahmefällen einen inneren Drang zur Predigttätigkeit empfanden, wurde dieses Recht prinzipiell bestritten und nur selten gewährt. Galt dies schon organisierten Mönchen gegenüber, so mußte eine Laienpredigt auf noch viel stärkeren Widerstand stoßen, und dieser Widerstand mußte sich 52
in einer Zeit des jähen Aufkommens einer ketzerischen Bedrohung durch die Katharer noch vervielfachen. Die Humiliaten waren jedoch nicht bereit, auf das Predigtrecht zu verzichten, da sie sich von Gott selbst auf Grund ihres apostolischen Lebens dazu berufen wußten. Hinter diesem Streit stand ein fundamental unterschiedliches Verständnis vom Wesen der Kirche. Für die offizielle Kirche ermächtigte allein das Amt zur Predigt, für die Humiliaten dagegen die geistliche Qualität des Lebensvollzugs. Bezeichnenderweise brach der Dissens zwischen offizieller Kirche und den Waldensern an derselben Frage auf, und hier erwies er sich als nicht aufhebbar, da bei den Waldensern die Berufung zur Predigt eine noch weit zentralere Rolle als bei den Humiliaten spielte. Bei diesen war die Predigt letztlich dem geistlichen Zusammenleben untergeordnet, weshalb hier später ein Kompromiß erzielt werden konnte, doch trieb ihr Predigtanspruch auch sie für zwei Jahrzehnte gleichsam in die Illegalität. Papst Alexander III. gewährte weder den Waldensern noch den Humiliaten das von ihnen erbetene Predigtrecht, ließ es vielmehr 1179 durch das III. Laterankonzil ausdrücklich bestreiten, und Lucius III. exkommunizierte beide Bewegungen 1184, als sie dem Verbot Widerstand entgegensetzten. Eine Änderung des Verhältnisses der Kurie zu den Humiliaten wurde jedoch durch Papst Innozenz III. durchgesetzt. Innozenz war von seinem eigenen Lebensstil her alles andere als ein Freund der Armutsbewegungen. Er trieb die Klerikalisierungstendenzen des Papsttums vielmehr praktisch wie theoretisch auf die Spitze. Praktisch geschah dies, indem Innozenz seine Hegemonie über fast alle weltlichen Fürsten Europas in stärkerem oder geringerem Maße verwirklichte und einige von ihnen förmlich zu seinen Lehensträgern machte. Theoretisch wurde dieses Herrschaftsstreben dadurch untermauert, daß Innozenz die geistliche Gewalt der weltlichen an Rang bewußt vorordnete, ja sich selbst als Papst sogar über die Engel, zu schweigen von den Menschen, erhaben wußte. Er war 53
jedoch ein äußerst gewiegter Kirchenpolitiker und Diplomat, und deshalb erkannte er früher als die meisten anderen Prälaten, daß man der Oppositionsbewegung in der Kirche nur durch eine kluge Differenzierungspolitik Herr werden könne. So modifizierte er die Ketzerpolitik seiner Vorgänger beträchtlich. Gegen oppositionelle Bewegungen, die wie die Katharer eindeutig häretisch lehrten, deshalb also der katholischen Kirche nicht untergeordnet werden konnten, verfügte er die denkbar härtesten Strafen. Wo er jedoch eine Möglichkeit sah, Gruppen mit ursprünglichem apostolischem Anliegen durch ein geschicktes Verhalten in den Schoß der Kirche zurückzuführen, setzte er — freilich in den einzelnen Phasen seines Pontifikats mit unterschiedlicher Konsequenz — gegen den hartnäckigen Widerstand der meisten Prälaten, die die Situation noch nicht durchschauten, eine flexiblere Behandlung und ein größeres Entgegenkommen durch. Er erkannte klar, daß die Humiliaten ähnlich den Waldensern keine Ketzer im eigentlich dogmatischen Sinne seien, sondern daß sie nur durch ihren Ungehorsam gegenüber einer einzelnen päpstlichen Verfügung quasi in den Verdacht der Ketzerei geraten waren. Hellsichtig spürte er, daß hier echte religiöse Reserven vorlägen, die in einer geistlich erschlafften Kirche unter Umständen so umfunktioniert werden konnten, daß sie dieser selbst zugute kamen und in den Dienst der kurialen Politik zu stellen waren. Er begründete seine Haltung vielfach theoretisch, indem er von den kirchlichen Amtsträgern eine sorgfältige Unterscheidung verlangte. Man müsse die Spreu vom Weizen trennen, und der Arzt müsse Unheilbares am kranken menschlichen Körper ausschneiden, damit es nicht weiterwuchere, das Heilbare dagegen durch sorgfältige und liebevolle Behandlung der Genesung zuführen. Diese modifizierte Politik gegenüber oppositionellen Strömungen in der Kirche schlug im Falle der Waldenser im wesentlichen fehl. Sie führte jedoch zur Entstehung der beiden großen Bettelorden als schlagkräftiger Werkzeuge 54
kurialer Politik und war auch gegenüber der überwiegenden Mehrheit der Humiliaten von Erfolg gekrönt. Den religiösen Bewegungen wurde gestattet, an den meisten ihrer Leitbilder festzuhalten, was insofern möglich war, als sich von Anfang an der Konflikt nicht eigentlich an der Frage der konkreten Lebenshaltung entfacht hatte. Die religiösen Bewegungen unterschieden sich grundsätzlich ja auch nicht von den bestehenden Mönchsorden, befanden sich vielmehr im Einklang mit den drei mönchischen Gelöbnissen der Armut, des Gehorsams und der Keuschheit. Das kann insofern nicht verwundern, als die Mönchsorden sich selbst ursprünglichen religiösen Bewegungen verdankten. Während der religiöse Grundimpuls der Mönchsorden aber nach einer enthusiastischen Anfangszeit erlahmt war und trotz gelegentlicher Reformbestrebungen auf die Dauer nicht wieder zum Leben erweckt werden konnte, verschärften die religiösen Bewegungen noch die mönchische Zielsetzung. Während das Gelübde persönlicher Armut des einzelnen Mönchs die Anhäufung riesiger Ländereien und großen Reichtums durch das Kloster als Gesamtkorporation nicht im geringsten behinderte, erkannten die religiösen Bewegungen diese Unterscheidung von persönlicher und gleichsam kollektiver Armut nicht an, sondern wollten auch als Gruppe arm bleiben. Andererseits mußte Innozenz bestrebt sein, die für die Kirche gefährlichsten Zielsetzungen dieser Bewegungen aufzufangen oder doch zu entschärfen. Schon im Anfang seines Pontifikats forderte Innozenz die Armutsbewegungen zur Aussöhnung mit der Kirche auf. In Verona griff er 1199 persönlich ein, weil dort unterschiedslos alle Anhänger des Gedankens der apostolischen Nachfolge als Ketzer verfolgt wurden. Es gelang ihm zunächst, einige Gruppen von Humiliaten in oberitalienischen Städten der Kirche wieder zuzuführen. Zur selben Zeit durften die Humiliaten ihm die Statuten unterbreiten, nach denen sie bisher gelebt hatten. Nach zweijähriger intensiver Prüfung nahm Innozenz im Sommer 55
1201 die meisten Humiliaten als religiöse Laiengenossenschaft wieder in den Schoß der Kirche auf und approbierte ihre Regel. Dabei war er auch in diesem Falle bestrebt, so weit wie möglich auf alte Mönchsregeln zurückzugreifen. Neben den bisher genannten beiden Gruppen von Humiliaten gab es seit einiger Zeit noch eine kleine dritte Gruppe, die aus Chorherren, Kanonikern und Kanonissen bestand. In ihrem Fall konnte Innozenz auf die Augustinerregel als Grundregel des gemeinschaftlich zusammenlebenden Priesterstandes zurückgreifen, im Falle der klosterähnlich zusammenlebenden Laien, die am ehesten Mönchen glichen, war die Benediktinerregel anzuwenden. Diese beiden Gruppen wurden als 1. beziehungsweise 2. Orden der Humiliaten organisiert. Der 1. Orden erhielt die Erlaubnis, neu eintretende Mitglieder, die ja Laien waren, mit der Tonsur zu versehen, also in den Klerikerstand zu erheben. Im 2. Orden, in dem Männer und Frauen bisher ohne Beschränkung gelebt hatten, wurde nun eine strikte Trennimg der Geschlechter durchgeführt, so daß seine Ordenshäuser faktisch den Status von Doppelklöstern erhielten. Am schwierigsten war das Problem der in Privathäusem lebenden Verheirateten zu lösen. Auf diesen ursprünglichen und stärksten Zweig der Genossenschaft war keine traditionelle Mönchsregel anwendbar. Ihm wurde deshalb auch überhaupt keine eigentliche Regel gegeben. Vielmehr bestätigte Innozenz ihren „Vorsatz" (Propositum), die bei der Kurie eingereichte kurze Zusammenfassung ihrer Lebensnormen. Damit wurden ihre Grundsätze der Vermeidung von Kleiderluxus, des Erwerbs von Lebensunterhalt durch Handarbeit, der Absage an Wucher und Zinsnehmen, der Rückgabe unrechtmäßig erworbenen Gutes, der Verwendung aller überschüssigen Einkünfte als Almosen für Arme, der Einhaltung ehelicher Pflichten und eines friedfertigen, sittenreinen Lebens in Demut, Geduld und Liebe offiziell anerkannt. Sie mußten jedoch Gehorsam gegen alle kirchlichen Prälaten geloben und wurden im Gegensatz zum 1. Orden zur Zahlung des 56
Kirchenzehnten verpflichtet, während für den 2. Orden in dieser Frage eine Zwischenlösung gefunden wurde. Die von allen Humiliaten zugunsten des Gebots unbedingter Wahrhaftigkeit erstrebte Ablehnung des Eides nahm die Kurie nicht hin, befreite sie aber von unnötigen und freiwilligen Eidesleistungen. Das wichtigste Zugeständnis an den 3. Orden war die Erlaubnis, jeden Sonntag an einem geeigneten Ort Versammlungen abzuhalten und dort fähige und erprobte Brüder mit Genehmigimg des zuständigen Bischofs predigen zu lassen. Die Bischöfe wurden zugleich angewiesen, eine solche Erlaubnis außer in begründeten Ausnahmefällen zu gewähren. Jedoch wurde nur die ethisch bestimmte Predigt als Aufruf zu einem wahrhaft christlichen Lebenswandel gestattet, während ihnen das Recht zu dogmatischen Predigten vorenthalten wurde. Die Einschränkung erregte aber nicht den Unwillen der Humiliaten, da sie ohnehin an theologischdogmatischen Lehrpredigten vom Grundcharakter ihrer Frömmigkeit her nicht interessiert waren. Den Zerfall der Gesamtgenossenschaft in drei selbständige Orden verhinderte die Kurie, indem sie im Laufe der Zeit den genau geregelten organisatorischen Aufbau durch Bildung eines Generalkapitels und Einsetzung eines Generalministers bereicherte. So erhielt sich die Gesamtgenossenschaft der Humiliaten noch lange am Leben. Der 3. Orden ist bis in die Mitte des 14. Jahrhunderts feststellbar, regulierte Humiliaten sind sogar bis 1571 nachzuweisen. Das bedeutet jedoch nicht, daß das ursprüngliche religiöse Anliegen ohne Abstriche lebendig geblieben wäre. Nichtreligiöse Motive überlagerten vielmehr bald die geistlichen. Der starke Zustrom von Frauen auch zu dieser Gemeinschaft gab ihren Doppelklöstern ähnlich den Beginenkonventen im niederländisch-rheinischen Gebiet den Charakter von Versorgungsanstalten für Frauen, für die außerhalb des Klosters kein Raum war. Dadurch gelang es freilich im 13. Jahrhundert, das Problem der häretischen Frauengruppen in Italien ähnlich zu lösen wie in den orthodoxen 57
Beginenkonventen Nordwesteuropas, zumal in diesen Häusern auch viele durch die Ketzerpredigt der Humiliaten Bekehrte Platz fanden. Es ist aber auch festzustellen, daß humiliatische Manufakturen während des 13. Jahrhunderts sich oft stark auf Gewinn bedacht zeigten. Auch für die Verwaltung einiger Städte erlangten die Humiliaten Bedeutung. Die Minderheit unter den Humiliaten, die sich nicht auf den Kompromiß von 1201 einließ, war naturgemäß in der Folgezeit schweren Verfolgungen ausgesetzt und wurde wie andere religiöse Gemeinschaften in den Untergrund gedrängt, weshalb die auf uns gekommenen Nachrichten über sie spärlich blieben. Sie besaß viele Gemeinsamkeiten mit den aus der Waldenserbewegung hervorgegangenen Lombardischen Armen, doch ist in der Forschung die Frage umstritten geblieben, welche der beiden Gruppen den bestimmenden Einfluß auf die andere ausübte und ob es zu einer organisatorischen Verschmelzung beider Gruppen oder nur zum Übergang einzelner Mitglieder in die andere Bewegung gekommen ist. Die harte Verfolgung führte auch in diesem Fall zu einer Versteifung der oppositionellen Haltung und zu scharf akzentuierter Kirchenfeindschaft. 6. Die Waldenser Über die Person und das Leben des Stifters der Waldenserbewegung wissen wir nur wenig. Audi die näheren Umstände seiner „Bekehrung" sind weithin ins Dunkel gehüllt, denn die uns überkommenen Berichte tragen in so starkem Maße die Züge frommer Mönchslegenden, daß sie historisch fast werdos sind. Nicht einmal der Waldes zugeschriebene Vorname Petrus, der erstmals erst 1368 bezeugt ist, verdient Glaubwürdigkeit, ja es ist möglich, daß Waldes wie andere Zeitgenossen überhaupt keinen Vornamen besessen hat. Fest steht jedoch, daß Waldes ein reicher Kaufmann aus Lyon war und über bedeutende Besitztümer an Wäldern,Ackern, Wiesen, Weinbergen, Häusern, Mühlen und Backstuben innerhalb und in der Um58
gebung der Stadt verfügt hat. Sein radikaler Bruch mit seinem bisherigen Leben erfolgte 1173/74. Er stellte seine Frau durch Überlassung eines Teils seines bisherigen Vermögens materiell sicher, vertraute seine beiden Töchter, mit einer großen Geldsumme versehen, dem Orden von Fontevrault an, der inzwischen zu einem Versorgungsinstitut für adlige und gutbürgerliche Töchter geworden war, und suchte mit dem verbleibenden größeren Teil seiner beweglichen Habe die einer schweren Hungersnot ausgesetzten Armen zu beköstigen. Waldes veranlaßte zwei Kleriker der Stadt, ihm große Teile der Bibel wie die Evangelien und den Psalter sowie eine Sammlung von Väterzitaten zu übersetzen, da er keine Lateinkenntnisse besaß. Er beschäftigte sich eingehend mit diesen Übersetzungen und lernte sie im Laufe der Zeit auswendig. Einer intensiven Bibelschulung wurden bald darauf auch die von ihm zur Wanderpredigt bestimmten Anhänger, die meist den niederen Volksschichten entstammten und vor allem in der Anfangsperiode nicht auf die Männerwelt beschränkt waren, unterzogen. Die Inquisitoren sollten später oft über die erstaunlichen Bibelkenntnisse der Waldenser seufzen, die große Stücke auswendig hersagen konnten, und sahen sich genötigt, eine spezielle Theorie zu entwickeln, mit deren Hilfe sie sich und anderen diese Bibelfestigkeit als besondere List des Teufels verständlich machen konnten. Bald besaßen die Waldenser auch viele Bibelmanuskripte in der in Südfrankreich gebräuchlichen Volkssprache; diese Übersetzungen waren großenteils von den Katharern geschaffen worden, deren Mission schon in voller Blüte stand, als die der Waldenser erst begann. Nachdem Waldes sich in die biblische Verkündigung eingearbeitet hatte, begann er 1177 selbst mit der Wanderpredigt in der Umgebung seiner Heimatstadt und begründete aus seinen Anhängern, die ihm offenbar sofort zuströmten, eine eigene religiöse Gemeinschaft. Der Teil seiner Anhänger, der zur vollen Übernahme des armen Lebens, wie es der frühere Lyoneser Kaufmann jetzt führte, 59
und zur Preisgabe der Ehe — möglichst im Einverständnis mit dem Ehepartner — bereit war und auch über ausreichende Fähigkeiten verfügte, wirkte bald in derselben Weise wie Waldes selbst. Die Wanderprediger kehrten anscheinend immer wieder nach Lyon als dem Zentrum ihrer Bewegung zurück, bis sie von dort vertrieben wurden. Danach dürften sie keinen festen Stammsitz mehr gehabt haben, sich aber besonders gern an verschiedenen Orten des Bistums Narbonne zusammengefunden haben. Eine bestimmte Tracht besaßen sie nicht, denn sie wollten äußerlich sowenig wie möglich auffallen. Diese Wanderprediger entsprachen hinsichtlich ihres vollkommenen Lebenswandels den katharischen Perfecti. Daneben gab es auch bei den Waldensern eine große Zahl von Credentes, die ihr eheliches Leben fortsetzten, aber dazu erzogen wurden, den biblischen Geboten soweit wie möglich zu gehorchen und den Lebensunterhalt der Perfecti zu gewährleisten. Die waldensischen Perfecti verzichteten nämlich auf den Bettel der Franziskaner, lehnten aber auch die körperliche Arbeit für sich strikt ab, was später zum Zerwürfnis mit dem größten Teil ihres italienisdien Zweiges führte, der sich wie die Humiliaten zur Handarbeit bekannte. Die französischen Waldenser beriefen sich bei der Ablehnung körperlicher Arbeit für die Wanderprediger darauf, daß diese nach dem Gebot des Herrn Mt. 6,24—34 sich nicht um den kommenden Tag sorgen dürften und sich ungeteilt der geistlichen Arbeit widmen sollten. Körperliche Arbeit sei unvermeidlich mit einer Teilung des Interesses sowie mit einer Verstrickung in weltliche Angelegenheiten verbunden und leiste der Besitzgier Vorschub. Andererseits besäßen die Wanderprediger auf Grund ihrer geistlichen Arbeit das Recht auf Versorgung mit dem Lebensnotwendigen und dürften deshalb nicht in die Situation gebracht werden, dies erst erbetteln zu müssen. Die Loslösung von Familie, festem Wohnsitz, Eigentum und Berufspflichten sollte also zur Freiheit von allen das Predigtamt behindernden irdischen Bindungen führen. 60
Zweifellos gehören auch die Waldenser in die Reihe der Armutsbewegungen. Jedoch spielte die Wanderpredigt bei ihnen von Anfang an eine ebenso zentrale Rolle. Als unumgängliches Mittel für diese waren Armut und Wanderpredigt untrennbar miteinander verknüpft. Die Waldenser waren fest davon überzeugt, von Christus selbst den Auftrag zur Laienpredigt erhalten zu haben. Sie wollten mit ihr durchaus nicht in Konkurrenz mit den Predigten der Pfarrer in ihren Parochien treten, wollten diese vielmehr angesichts des geistlichen Verfalls der Kirche und ihrer Hilflosigkeit gegenüber der häretischen Gefahr wirksam unterstützen. Gewiß sahen die Waldenser von Anfang an die Schäden am Leibe der Kirche und kritisierten das Verhalten weltlich lebender Priester. Sie fühlten sich jedoch als treue und völlig rechtgläubige Katholiken und dachten zunächst nicht an eine Absonderung von der Kirche. Sie führten deshalb einen Zweifrontenkrieg gegen die Schäden in der eigenen Kirche wie gegen die Häresie der Katharer. Von Anfang an stellten sie sich den Katharern offensiv entgegen, predigten gegen sie, führten öffentliche Dispute mit ihnen und verfaßten in Einzelfällen wie Durandus von Osca auch Streitschriften gegen sie. Manche ernsthaften Katholiken wie Durandus scheinen gerade in Südfrankreich den Waldensern beigetreten zu sein, weil sie die katharische Häresie allein durch diese für besiegbar hielten. Die Waldenser wollten den Beweis erbringen, daß man ein apostolisches Leben führen könne, ohne in Ketzerei zu verfallen. Darüber hinaus betrachteten sie sich mit einem gewissen Recht als die konsequenten Vertreter des apostolischen Lebens, da die Katharer bereits bestimmte illegitime Kompromisse mit der Welt geschlossen hatten. Ihre Predigt unter den noch katholischen einfachen Gläubigen aber trug, wie die Mehrheit der Forscher heute mit Recht annimmt, den Charakter der Bußpredigt, wie dies auch ähnlich von der frühen franziskanischen Predigt gilt. Buße war dabei als Absage an das bisherige Leben, soweit es Gottes Geboten widersprach, und Übernahme 61
einer bewußt apostolischen Lebensform verstanden. Waldes und seine Anhänger konnten es nicht ertragen, daß nur sie die rechte Lebensweise gefunden haben sollten; sie sahen ihre primäre Aufgabe darin, auch andere zu erwecken. Mittels der ihnen verliehenen speziellen Gnade Gottes sollte so die Kirche zu ihrer ursprünglichen Reinheit zurückgeführt oder doch wenigstens ihr wieder angenähert werden. Die priesterliche wie die waldensische Predigt sollten in der Kirche zusammenwirken und gemeinsam dem Heil der Menschen dienen, ohne einander die Legitimität zu bestreiten. Die waldensische Predigt unterstrich nach Kräften den Entscheidungsernst der Stunde und drang auf das schlichte Tun des Guten ohne Vorbehalte und Ausflüchte. 1179 begab sich Waldes mit einigen Anhängern nach Rom und legte der Kurie die ihm übersetzten Bücher zum Beweis seiner Rechtgläubigkeit vor, um so für seine Genossenschaft die Predigterlaubnis zu erwirken, weil der Erzbischof von Lyon seine Wünsche anscheinend nicht erfüllt hatte. Der Papst setzte eine Untersuchungskommission ein, die unter dem Vorsitz des ebenso intelligenten wie arroganten englischen Prälaten Walter Map, dem Vertrauten des englischen Königs, stand. Dieser war voller Verachtung für die Laien, deren Ersuchen er als anmaßend empfand, und fürchtete wohl auch, ihre Predigt könne zukünftig nicht unter Kontrolle gehalten werden. Er ließ deshalb bewußt das Untersuchungsverfahren zu einer Farce entarten. Alexander III. behandelte die Waldenser nidit eigentlich unfreundlich, gestattete ihnen die Predigt aber nur bei ausdrücklicher Bitte des für die Parochie zuständigen Priesters; er verzichtete dabei offenbar bewußt auf eine eindeutige Entscheidung, um so die konkrete Verantwortung auf die unteren Instanzen abschieben zu können. Auch in Lyon scheint man die Entscheidung bewußt verzögert zu haben. 1180 legte Waldes vor dem Erzbischof seiner Heimatstadt und einem päpstlichen Legaten ein ihm aufgedrängtes orthodoxes Glaubensbekenntnis in Form eines Propositums, aber mit scharf 62
antikatharischer Tendenz, ab. Das Propositum billigte sein Armutsideal, ließ aber die Frage einer generellen Fredigterlaubnis aufs neue in der Schwebe und vertagte damit die endgültige Entscheidung nur. Etwa 1182/83 verhängte ein neuer Lyoneser Erzbischof ein Predigtverbot über die junge Gemeinschaft. Als Waldes sich ihm nicht unterwarf und dies mit dem Missionsbefehl in Mk. 16,15 und mit Apg. 5,29 begründete, exkommunizierte der Erzbischof ihn und seine Gefährten, da der Widerstand eines Laien gegen den Befehl eines Prälaten als Todsünde und Häresie galt. Da der Erzbischof zugleich weltlicher Herr der Stadt und des umliegenden Gebietes war, ließ er Waldes und seine Anhänger sofort aus Lyon ausweisen. Papst Lucius III. bestätigte diese Entscheidung und machte sie für die gesamte römische Kirche rechtsverbindlich, indem er die Waldenser 1184 exkommunizierte; damit wollte er auch die waldensische Mission in der Lombardei treffen, die offenbar sofort nach der Ausweisimg aus Lyon begonnen hatte. Die Waldenser scheinen in Südfrankreich von einigen Klerikern nach wie vor geschützt worden zu sein, doch war ihre gesamte künftige Geschichte von harten Verfolgungen begleitet, die zeitweise die Gefahr ihrer Ausrottung mit sich brachten; es war jedoch trotz des planmäßigen Vorgehens der Inquisition und der damit verbundenen beträchtlichen Dezimierung nicht möglich, sie völlig zu beseitigen. Vielmehr breiteten sich die Waldenser schnell über fast ganz Kontinentaleuropa bis nach Polen und Ungarn aus. In Südfrankreich profitierten auch sie von der zeitweilig ketzerfreundlichen Politik der Fürsten, wenn sie hier auch nicht die Bedeutung der Katharer erlangten. Die Verfolgung der Waldenser blieb nicht ohne Einfluß auf ihr Selbstverständnis und führte bei einem beträchtlichen Teil von ihnen zu einer Radikalisierung, was zugleich eine Differenzierung innerhalb ihrer Reihen mit sich brachte. Vor allem unter ihrem oberitalienischen Zweig, den Lombardischen Armen, verstärkten sich die 63
kirchenkritischen Tendenzen beträchtlich, während der Großteil der französischen Waldenser noch lange auf einem gemäßigten Standpunkt verharrte. Doch ist eine säuberliche geographische Trennung der beiden Gruppen nicht möglich. Die Radikalen nahmen jetzt einen donatistischen Standpunkt ein, erkannten also die Wirksamkeit der von unwürdigen katholischen Priestern gespendeten Sakramente nicht mehr an. Von daher schritten sie in der Folgezeit großenteils zu einer absoluten Verwerfung der römischen Kirche fort. Vielen von ihnen erschien nun die katholische Kirche als die in der Apokalypse geweissagte „Hure Babylon", das heißt als eine teuflische Pseudokirche, die die Massen der Gläubigen zu verführen und vom wahren Heil abzubringen suchte. Hier wird die Entwicklung zur privilegierten Staatskirche unter Kaiser Konstantin und Papst Silvester mit einem eindeutig negativen Vorzeichen versehen, was für viele religiöse Bewegungen der Folgezeit vorbildlich sein sollte. Der radikale Flügel der Waldenser war auch eher als der gemäßigte zum Aufbau einer eigenen kirchlichen Organisation bereit, was sich in der Einsetzung von Leitern auf Lebenszeit zeigte. Hier wurde auch am schnellsten eine eigene Sakramentsverwaltung eingeführt. Im Mittelpunkt stand dabei naturgemäß das Bußsakrament, weil dieses am direktesten der von den Waldensern angestrebten Lebensänderung und Unterstellung unter Gottes Willen entsprach. Gegen das katholische Sakramentsverständnis mit seiner Neigung zum nicht mehr existentiell gefüllten Sakramentalismus, der einer Veräußerlichung des Glaubenslebens Vorschub leisten konnte, wurde bald harte Kritik laut, die sich auch in der Ablehnung der Kindertaufe äußerte. Schon auf Grund der Verfolgungssituation mußten eigene Taufen und das Brotbrechen zeitweise wieder reduziert werden; das kam insofern der waldensischen Grundtendenz entgegen, als diese stets zu vermeiden suchte, daß sakramentale Handlungen die Predigt in den Hintergrund drängten. Die innere Entfremdung der Waldenser von der katho64
lischen Kirche wurde durch zweierlei noch vertieft. Einerseits führte die Entwicklung bei ihnen, wohl unter dem Einfluß der Katharer, zu einer strikten Ablehnung vieler kirchlicher Praktiken, die auch das Mißfallen anderer religiöser Bewegungen erregt hatten, weil sie geeignet waren, eine bewußte Glaubensentscheidung zu nivellieren. Dazu gehörten das gesamte Ablaßwesen, das sich im Zusammenhang mit den Kreuzzügen rasch entwickelt hatte, sowie andere Satisfaktionsleistungen wie Wallfahrten, aber wohl auch die Heiligenverehrung, die Gebete für die Toten und die Mehrzahl der Feiertage. Ein zweiter Komplex von Sonderlehren war die Auswirkung dessen, daß aus dem biblizistischen Ansatz jetzt kritische Folgerungen für die Gestaltung des kirchlichen Lebens gezogen und die kirchliche Tradition am biblischen Ursprung gemessen wurden. Seit dem 13. Jahrhundert verwarf das gesamte Waldensertum den Eid, weil er die schlichte Wahrhaftigkeit gefährdete, jede Form des Tötens, die Todesstrafe und überhaupt alle vergeltende Gerichtsbarkeit. Die Ablehnung des Tötens führte auch zur Verwerfung des Kriegsdienstes. Jede Art der Gewaltanwendung gegen Andersdenkende galt den Waldensern als unchristlich. Audi in diesem Punkt ist eine gewisse katharische Beeinflussung nicht von der Hand zu weisen. Sie bedeutete jedoch keinen Übergang zur Häresie; vielmehr überzeugten sich die Waldenser davon, daß die katharische Auffassung in dieser Frage der biblisdien Weisung entsprach. Anders verhält es sich bei einigen waldensischen Gruppen, die unter dem Einfluß der Katharer tatsächlich häretische dualistische Lehren aufnahmen. Doch erfaßte dieser Einfluß niemals das Waldensertum als solches, und er war auch in den betreffenden waldensischen Gruppen schon deshalb zeitlich begrenzt, weil die Kirche der Katharer im Gegensatz zur waldensischen Kirche vernichtet werden konnte. Im Zusammenhang mit solchen Beeinflussungen einiger waldensischer Gruppen durch den Katharismus muß es auch gesehen werden, daß sich in waldensischen Kreisen hier und da liberti65
nistische Anschauungen und Praktiken nachweisen lassen, die im 14. Jahrhundert auch durch freigeistige Einflüsse hervorgerufen wurden. Diese Anschauungen haben vollends das Waldensertum als solches nicht formen können, das vielmehr stets an einem klaren, biblisch begründeten Ethos festhielt. Waldes selbst, faktisch der erste Bischof der waldensischen Gemeinschaft, hielt entschieden am gemäßigten Standpunkt der Anfangsjahre fest. Da sich seine Reisetätigkeit aber auf Südfrankreich beschränkt zu haben scheint, entglitt die Entwicklung des oberitalienischen Zweiges, der offenbar von arnoldistischen Anschauungen beeinflußt wurde, seinen Händen. Waldes reagierte auf diesen Dissens so, daß er 1205 in schroffer Form den Lombardischen Armen die Gemeinschaft aufkündigte. Wie an früherer Stelle bereits erwähnt, war dieser Bruch nicht nur die Folge des radikal kirchenkritischen Trends unter den Lombardischen Armen, sondern auch ihres Prinzips der Handarbeit, das sich mit der ursprünglichen waldensischen Bewertung des ausschließlich geistlichen Lebens der Wanderprediger nicht vereinbaren ließ. Der italienische Zweig erwiderte den Ausschluß mit ebenso schroffen Maßnahmen. Waldes selbst starb wahrscheinlich schon wenige Jahre später. Nach dem Tode der Hauptrivalen Waldes, Vivet und Johannes von Ronco kam es zu neuen Kontakten zwischen den beiden Zweigen, die schließlich 1218 zu „Friedensverhandlungen" bei Bergamo führten. Da auf beiden Seiten der ehrliche Wunsch nach Wiederaufnahme der Gemeinschaft bestand, bahnte sich zunächst ein Kompromiß an. Die Gegensätze brachen jedoch von neuem auf, als die Lombardischen Armen, die die härtere Linie vertraten, die Seligkeit des verstorbenen Stifters anzweifelten. So kam es zu keiner Einigung; die Gemeinschaft zerriß auf lange Zeit. Dies hatte die Gründung unterschiedlicher waldensischer Gemeinden in mehreren Ländern zur Folge, bis spätere Entwicklungen und die äußeren Schicksale der einzelnen Gruppen den Streit gegenstandslos machten. 66
7. Die Katholischen Armen und die Wiederversöhnten Armen Bei den Waldensern kam es im Gegensatz zu den Humiliaten nicht zur Rückführung der überwiegenden Majorität in die katholische Kirche. Nur zwei kleinere waldensische Gruppen konnten mit der Kirche versöhnt werden. Dabei handelt es sich zum einen um die Gruppe südfranzösischer Waldenser mit dem bedeutenden Theologen Durandus von Osca. Ihre Versöhnung mit der Kirche war das Ergebnis der durch Innozenz gebilligten Bemühungen des in der südfranzösischen Ketzermission tätigen Bischofs Diego von Osma. Sich den Wanderpredigern äußerlich angleichend, führte er mit der waldensischen Gruppe um Durandus 1207 in Pamiers einen öffentlichen Disput. Die beteiligten waldensischen Kleriker erklärten sich für besiegt, unterwarfen sich der katholischen Kirche und bemühten sich an der Kurie um eine Legitimation ihrer Wanderpredigt und des durch sie bedingten Lebensstils. Sie ließen sich in Rom einer Glaubensprüfung unterziehen und beschworen darauf fast dasselbe Glaubensbekenntnis mit antikatharischer Tendenz wie rund dreißig Jahre zuvor Waldes und seine Gefährten. Neben der eindeutigen Absage an dogmatische Häresien steht die Verpflichtimg zum Gehorsam gegen Papst und Bischöfe und die unbedingte Anerkennung aller von ordinierten Priestern gespendeten Sakramente. Durandus gab den Gedanken einer speziellen Beauftragung zur Wanderpredigt durch Christus selbst preis. In seinem um 1220 erschienenen Liber contra Manichaeos verzichtete er deshalb auch im Unterschied zu seinem zwei Jahrzehnte zuvor verfaßten Liber antiheresis auf eine Begründung der waldensischen Wanderpredigt in der Beauftragung der Apostel durch Christus. Die Gruppe um Durandus mäßigte ihren Standpunkt in den Fragen der Eidesleistung und des Tötens erheblich. Insofern tritt, von ihrer Seite her gesehen, der Kompromiß deutlich zutage. Sofern sie prinzipiell auf die Polemik gegen den Verfall des geistlichen Lebens in der Kirche verzich67
teten und den Gehorsam gegen Papst und Prälaten nicht mehr vom Gehorsam gegen Gott unterschieden, verließen sie die ursprüngliche waldensische Linie und unterwarfen sich voll der katholischen Ekklesiologie. Damit wurden sie jedoch dem ursprünglichen waldensischen Anliegen nicht einfach untreu, zumal die Waldenser auf ihre dogmatische Orthodoxie gerade zu Anfang großen Wert gelegt und die päpstliche Billigung ihrer Wanderpredigt erstrebt hatten. Die Katholischen Armen durften im wesentlichen an ihrer bisherigen Lebensform festhalten. Sie durften weiterhin auf Eigentum und Besitz in jeder Form verzichten und von den Gaben der Gläubigen leben. Vor allem aber wurde ihre Wanderpredigt vom Papst legitimiert. Ausdrücklich wurde festgelegt, daß sie nicht nur ihre Ketzerpredigt, sondern auch die Predigt vor ihrer Gemeinschaft und ihren „Freunden", das heißt allen sich ihnen unterstellenden Laien, sowie deren seelsorgerliche Betreuung weiterführen durften. Das bedeutete, daß sie auch weiterhin für ihre Lebensform werben und neue Anhänger gewinnen durften. Sie ließen es sich zunächst angelegen sein, unter ihren früheren waldensischen Brüdern für ihre neue Gemeinschaft zu werben, woraus sich ein intensiver Kontakt mit diesen ergeben haben wird. Die Erlaubnis dazu wurde ihnen in einem vom Bekenntnis gesonderten Propositum gegeben. Da ein Propositum nicht den Rang einer Mönchsregel besaß, war damit freilich die rechtliche Absicherung schwächer. Bei den Katholischen Armen, die sämtlich gebildet und fast ausschließlich Kleriker waren, handelte es sich um den ersten Versuch, eine neuartige Organisationsform zu schaffen, die ihre Ausbildung später im Dominikanerorden als dem spezifischen Predigerorden finden sollte. Die Erlaubnis zur Werbung unter ihnen bisher fernstehenden Menschen hatte zur Folge, daß die Katholischen Armen 1212 im südfranzösischen Pyrenäenbistum Eine eine Art von Doppelkloster völlig getrennt lebender Männer und Frauen gründeten, in dem diese bisher 68
offenbar recht vermögenden Anhänger auf ihren Besitz verzichteten und sich zu einem religiösen und karitativen Leben strenger Art zusammenfanden. Sympathisch mutet ihre Fürsorge für Arme, Kranke, Waisenkinder und arme Wöchnerinnen an. In manchem ähnelte ihr Leben dem im 2. Humiliatenorden; jedoch waren sie von diesem durch ihren Verzicht auf Handarbeit geschieden. Den Katholischen Armen war ein befriedetes Leben innerhalb der römischen Kirche in den nächsten Jahren noch nicht beschieden. Der südfranzösische Episkopat, dem die geistliche Lebensform persönlich sehr fremd und der durch die Ketzergefahr in seinem Gebiet in Unruhe versetzt war, der auch die neue kuriale Taktik gegenüber den Vertretern religiöser Bewegungen noch nicht voll durchschaute, behinderte Durandus und seine Gefährten in vielfacher Hinsicht und wurde sogar schriftlich und dann auch mündlich bei der Kurie gegen sie vorstellig. Daß äußerlich kaum ein Unterschied von den Waldensern vorhanden war, verstärkte das Mißtrauen des Episkopats auch in Nordspanien und Oberitalien. Man klagte die Katholischen Armen an, Waldenser zu ihren Gottesdiensten zuzulassen, viele Menschen vom Besuch des ordentlichen katholischen Gottesdienstes abzuhalten, entlaufene Mönche bei sich aufzunehmen und ihre anstößige Kleidung nicht verändert zu haben. Innozenz gab darauf in einem ernsten, aber im Ton gemäßigt gehaltenen Schreiben Durandus und seinen Gefährten die Anweisung, durch konkrete Maßnahmen wie die Nichtzulassung mönchischer Apostaten, Lösung der Verbindung zu den Waldensern, Änderung ihrer Tracht und Teilnahme an den katholischen Gottesdiensten die Bischöfe zufriedenzustellen. Gleichzeitig aber schärfte er dem Episkopat ein, mit den Katholischen Armen Geduld zu üben und ihre volle Respektierung der katholischen Kirche höher zu bewerten als die waldensischen Rudimente in ihrem Verhalten. Der Episkopat konnte sich diesen Anweisungen nicht entziehen, suchte aber auch in der Folgezeit die Wirk69
samkeit der Katholischen Armen zu behindern oder doch wenigstens einzuschränken. Er trug dadurch die Hauptverantwortung dafür, daß Durandus und seinen Gefährten kein größerer Erfolg mehr beschieden war. Zu besonderen Querelen führte das Bestreben des Episkopats, den Katholischen Armen einen Vorsteher aufzuzwingen, den sie sich nicht selbst erwählen konnten. Dies widerstrebte dem urwaldensischen Prinzip, es nicht zu einer Machtwillkür in der Gemeinschaft kommen zu lassen; es scheint, daß die Katholischen Armen sich in dieser Frage gegen den Episkopat durchsetzten. 1212 erreichte Durandus durch eine neuerliche Romreise, daß Innozenz seine Gemeinschaft und deren „besondere Freunde" unter den Schutz des apostolischen Stuhles stellte. Das sicherte ihnen für die nächsten Jahrzehnte ihre Existenz. Jedoch wurde 1237 ihre Bitte an Gregor IX. um Anerkennung als regulärer Orden abgelehnt. Gregors Nachfolger Innozenz IV. verlangte sogar ihren Eintritt in einen der approbierten Orden; diese Forderung, der sie offenbar Folge geleistet haben, bedeutete das Ende ihrer Gemeinschaft. Der lombardische Zweig verschmolz 1256 mit dem Orden der Augustiner-Eremiten. Die zweite Gruppe wiedergewonnener Waldenser war die Gruppe um Bernhard Prim(us), die zuvor in Südfrankreich gegen die Katharer tätig gewesen war, aber auch in Norditalien gewirkt hatte. Diese Gruppe scheint, aufs ganze gesehen, zu den gemäßigten Waldensern gehört, jedoch den ungeistlich lebenden Klerus hart getadelt und gelegentlich selbst das Abendmahl gespendet zu haben. Als Prim 1210 bei Innozenz III. um seine kirchliche Approbation nachsuchte, mußte er seinen „Irrtum" in diesen beiden Fragen klar widerrufen und Besserung geloben. Er erhielt ein Propositum, das dem des Durandus sehr ähnlich war, aber etwas kräftigere waldensische Züge trug. Die katholische Ekklesiologie übernahm auch Prim mit der Erklärung, Christus sei Lehrer und Lenker seiner Gemeinschaft, zugleich mit ihm aber der Papst; die Kirche sei auf Erden stets eine ecclesia permixta, bestehe also 70
immer aus Guten und Bösen. So gab es nur einen prinzipiellen Unterschied der Wiederversöhnten zu den Katholischen Armen: Offenbar unter dem Einfluß des italienischen Teils ihrer Mitglieder übernahmen sie das Prinzip der Handarbeit, wenn auch mit der Einschränkung, daß „die Ruhe zum Lernen" und die seelsorgerlichhomiletische Arbeit der dazu Befähigten nicht darunter leiden durften. Auch die Wiederversöhnten Armen blieben nicht ohne Widerspruch. Verdacht wurde besonders ihrem freien Zusammenleben mit Frauen gegenüber laut, aber auch hinsichtlich ihrer waldensischen Sandalen. Darauf mußten sie sich zu strenger Keuschheit und zum Tragen normalen Schuhwerks verpflichten. Bezüglich der Predigt wurde 1212 bei der Modifizierung ihres Propositums der Akzent stark auf die Ketzerbekämpfung gelegt. Über Verbreitung und Schicksal der Wiederversöhnten Armen ist fast nichts bekannt; das deutet darauf hin, daß sie niemals wesentliche Bedeutung erlangt haben. Sie hörten offenbar schon vor den Katholischen Armen zu bestehen auf und schlössen sich ebenfalls anderen Orden an, viele von ihnen den Dominikanern.
8. Die gesellschaftlidien Hintergründe des Frömmigkeitswandels
Was waren die Ursachen dafür, daß seit dem 11. Jahrhundert immer neue religiöse Reformbewegungen auftraten, die die Kirche zu ihrem ursprünglichen apostolischen Zustand zurückführen wollten? Als entscheidende Ursache trat uns bisher das Streben der Kirche nach Herrschaft statt nach einem Leben des Dienstes, der Armut und Selbstlosigkeit entgegen. Die Kirche wurde immer enger in das Geflecht der Feudalordnung verwoben, so daß ihre Prälaten sich zu reichen und mächtigen Kirchenfürsten entwickelten, die in ihrer Machtfülle wie in ihrem zur Schau gestellten Prunk mit den weltlichen Fürsten konkurrierten. Daß die überwiegende Mehrzahl der Prälaten einschließlich der Äbte der großen Klöster selbst 71
dem Adel entstammte, begünstigte diesen Prozeß und stand in inniger Wechselwirkung mit ihm. Wir können uns heute kaum noch eine rechte Vorstellung von dem ihrem Platz in der Feudalpyramide entsprechenden herrscherlichen Auftreten der offiziellen kirchlichen Repräsentanten machen, doch könnte ein reiches Belegmaterial von Tatsachen beigebracht werden. Typische Vertreter der mittelalterlichen Feudalgewalt waren in der Regel die sich zur kaiserlichen Partei zählenden Prälaten; sie waren vom Kaiser oder König mit ihrem Bistum belehnt worden, hatten sich also nach Ansicht der gregorianischen Reformpartei der Simonie schuldig gemacht. Ihr Adel galt den Zeitgenossen als Garantie ihrer Heiligkeit. So umgab sich Adalbert von Bremen, der sich anschickte, der „Primas des Nordens" zu werden, damit den gesamten norddeutsch-skandinavischen Raum zu beherrschen und darüber hinaus bestimmenden Einfluß auf das Kaisertum zu gewinnen, mit einer Schar von Künstlern, Schmeichlern und Spielleuten und einem großen Gefolge bewaffneter Ritter, die er in ganz Sachsen anwerben ließ. Tagsüber pflegte er zu schlafen, nachts aber gab er sich üppigen Gastmählern und dem Würfelspiel hin. Von jähzorniger und aufbrausender Natur, schlug er vor Wut seine Leute blutig und verspottete an seiner Tafel voller Arroganz selbst hohe Herren. Bedenkenlos wurden goldene Leuchter und Kreuze, ja ganze Altäre eingeschmolzen, wenn die Mittel für den aufwendigen Lebensstil versiegt waren. Hartnäckig suchten viele Erzbischöfe und Bischöfe ihre Herrschaft über die sich entwickelnde Stadt und die umliegenden Gebiete zu bewahren und auszubauen; das führte zu zahllosen kriegerischen Verwicklungen. Die Reliquienschätze ihrer Bischofskirchen waren als Demonstration der Bedeutung ihres Sitzes gedacht und wurden deshalb mit großer Anstrengung durch immer neue kostbare Stücke bereichert. Die Prälaten berauschten sich am Glanz des Goldes und der Edelsteine, mit denen die Insignien ihrer Amtsgewalt überladen waren. Ihre geistlichen Verpflichtungen übertrugen 72
sie meist Stellvertretern, weil sie selbst fast völlig von ihren weltlichen Aufgaben ausgefüllt waren und diese ihr eigentliches Interesse in Anspruch nahmen. Ehrgeizig und zielbewußt suchten sie ihren Machtbereich auf Kosten anderer auszudehnen. Begaben sie sich aber in ihren Diözesen auf Visitationsreisen, so war auch dies in erster Linie eine Zurschaustellung ihrer fürstlichen Macht, die den einzelnen Kirchen wegen der damit verbundenen Ausgaben teuer zu stehen kam. Manche Pfarrer mußten sich zur Bestreitung dieser Ausgaben in Schulden stürzen und sogar Kirchenschmuck verkaufen. Man bekommt einen Eindruck von dem auf diesen Reisen entfalteten Prunk, wenn man die Verfügung des III. Laterankonzils liest, die Erzbischöfe sollten auf ihren Reisen nicht mehr als 40 bis 50 Pferde bei sich haben und darauf verzichten, mit Jagdhunden und Vögeln auszufahren. Es könnte angenommen werden, daß sich die Situation angesichts des Sieges der gregorianischen Reformpartei grundlegend gewandelt habe, war der Sieg dieser Partei an der Kurie doch mit einer weiteren Zentralisierung der kirchlichen Verwaltung verbunden. In Wahrheit wurde aus dem Kampf um die kirchliche Eigenständigkeit alsbald ein Kampf um klerikale Herrschaft über die weltlichen Gewalten, so daß sidi der kuriale Drang nach Reichtum und Macht in der Endkonsequenz noch vergrößerte. Durch die Schwächung des salischen Kaisertums im Investiturstreit und das Wormser Konkordat 1122 wurden die Erzbischöfe und Bischöfe aus königlichen Vasallen nun erst zu relativ unabhängigen Landesfürsten über „geistliche" Territorien. Friedrich Heer hat in seinem Buche „Die Tragödie des heiligen Reiches" festgestellt, daß die Kontinuität des alten bischöflichen Typs auch durch den Investiturstreit hindurch ungebrochen erhalten geblieben sei. Er urteilt, die Bewegung Gregors VII. habe, aufs Ganze gesehen, nicht zur Spiritualisierung der Bischofsherren geführt, sondern sie noch stärker verweltlichen lassen, da die Bischöfe nun vom König unabhängiger geworden seien und die stärker gewordene Bindung 73
an den Papst wegen der räumlichen Entfernung für ihren Lebensstil wenig ins Gewicht gefallen sei. „Ihr Aufstieg zu Landesfürsten, zumindest zu großen Kirchenherren, die ihren Besitz abzurunden und auszuweiten strebten, ihre politische Macht bald in die eine, bald in die andere Waagschale werfend, wurde durch die Schwächung des Reiches seit dem späten 11. Jahrhundert nur gefördert." (S. 14) Dieses Streben nach Ausweitung der eigenen Macht griff naturgemäß alsbald auch auf den einfachen Priesterstand über. Manche Kleriker erwarben sechs oder mehr Pfarrkirchen, ohne willens zu sein, den Verpflichtungen auch nur e i n e s Amtes nachzukommen. Zuweilen nahm die Habgier der Prälaten geradezu kriminelle Formen an, etwa wenn ein Bischof von Lisieux, einem Wallfahrtsort in der Normandie, zur Zeit einer Hungersnot seine Kornvorräte bewußt zurückhielt, um so die Kornpreise weiter in die Höhe schrauben zu können. Machtfülle und herrscherliches Auftreten der Prälaten wurden von der damaligen offiziellen Kirche nicht als Widerspruch zu ihrer geistlichen Bestimmung aufgefaßt, weil das feudale Ständedenken selbstverständlich vorausgesetzt und mit theologischen Scheinargumenten legitimiert wurde. Konnten doch die Konstitutionen zweier italienischer Städte den festen Grundsatz aufstellen, ein Bürger gleiche an Wert zwei Bauern, ein Ritter zwei Bürgern und ein Baron zwei Rittern. Das Mitglied des feudalen Standes besaß seinen Wert kraft seiner Geburt, weshalb ihm dieser auch nicht genommen werden konnte. Der durch Privilegien erworbene Reichtum war die Folge der „edlen" Geburt selbst, während die persönliche Tüchtigkeit sekundär blieb. Auch seine Rechte im streng juristischen Sinne waren deshalb Folge seiner Geburt. An Gleichheit vor dem Gesetz war gar nicht zu denken, denn ein Höriger konnte überhaupt keine aktive Rolle vor Gericht spielen, weil er nicht als Rechtsperson anerkannt wurde. Außerdem war dem Herrn jederzeit eine willkürliche Änderung seiner angestammten Rechte zu seinen 74
Gunsten möglich, was die Willkür der Mächtigen selbstverständlich außerordentlich begünstigte. Die Herren waren auf ihren Besitztümern weithin selbst Schöpfer des Rechts, so daß ihre Untergebenen ihnen auf Gedeih und Verderb ausgeliefert waren. Keinem war es gestattet, seinen Stand mit einem anderen zu vertauschen; wer dies versuchte, galt als verworfen, weil er freventlich Gottes ewigen Willen zu durchbrechen suche. Dagegen wurde der Wert der Treue zum Herrn im Sinne unbedingter Gefolgschaft stark hervorgehoben. Einer besonders großenDiskriminierung war die Frau ausgesetzt, die strikt dem Manne untergeordnet war und ebenfalls nicht als eigentliche Rechtsperson gewertet wurde, vielmehr im öffentlichen Leben in vieler Hinsicht den Unfreien gleichgestellt war. Sie war auf das Wirken im Hause bei unbedingter Unterordnung unter ihren „Eheherm" eingeschränkt. Reichen Frauen wurde es deshalb zuweilen ausdrücklich verboten, durch eine Heirat nach außerhalb ihren Besitz der betreffenden Stadt zu entziehen, und sie hatte eine Zuwiderhandlung oft mit Verlust der Hälfte ihres Besitztums zu büßen. Heribert Roggen äußert in seinem interessanten, wenn auch gelegentlich an gesellschaftswissenschaftlicher Unschärfe leidenden Aufsatz „Die Lebensform des hl. Franziskus von Assisi in ihrem Verhältnis zur feudalen und bürgerlichen Gesellschaft Italiens", die poetische Verklärung besonders der adligen Dame im ritterlichen Minnedienst habe diese Situation nicht verändert, denn sie sei eine parasoziale Erscheinung ohne wesentlichen Einfluß auf den Stand der Frau im allgemeinen gewesen. So war für viele Frauen der Eintritt in einen Konvent der einzige Weg, sich aus der ihnen auferlegten Enge zu befreien und wenigstens in einem begrenzten Lebenskreis eine aktive Rolle zu spielen. Die offizielle Kirche erkannte die Reformbedürftigkeit einer solchen Ordnung nicht an, sondern untermauerte diese ideologisch noch. Sie ging dabei von der Behauptung aus, Gott selbst habe nicht nur auf Erden, sondern 75
sogar im Himmel die feste Rangordnung der Stände für alle Zeiten gültig und deshalb unabänderlich festgelegt, weshalb ihre Verwischung geradezu ein Sakrileg sei. Der ganze Kosmos galt im Grunde als ein großer Lehensverband, und auch der Himmel wurde feudalisiert, indem die Engelscharen mit ihren vielerlei Abstufungen zum himmlischen Urbild der irdischen Ständeordnung erklärt wurden. Der himmlische Christus in seiner Erhabenheit wurde als ein mächtiger Himmelsvogt betrachtet, obgleich sich bereits im 12. Jahrhundert in Teilen des Klerus ein gewisser Widerstand gegen die Verabsolutierung solcher feudal geprägter Vorstellungen regte. Unter den eng mit demStauferreich verbundenen Prälaten indes konnte man in Aufnahme damals geläufiger Engelvorstellungen bis zu 30 Himmelsstände zählen, galt doch — wie Friedrich Heer mit Recht hervorhebt — jede Bereicherung des ständischen Gefüges im Himmel als zusätzliche Stützung des Weltbaus. Jedenfalls galt der reale irdische Stand jedes Menschen als ein wenn auch nur schwaches Abbild der himmlischen Ordnung, so daß himmlische und irdische Ordnung einander bedingen. Theologen wie Hugo von St. Victor stellten ausdrücklich fest, Gott habe bestimmt, daß die einen herrschen und die andern dienen. Auch die Herrschaft der Seele über den Körper in dem als Mikrokosmos verstandenen Individuum wurde als Bestätigung der unveränderlichen göttlichen Ordnung betrachtet. So wurde der Sinn der Geschichte nicht in Vorwärtsbewegung und Dynamik, sondern in der Bewahrung des Bestehenden erblickt, sei doch Gott unbewegt und unveränderlich, während die Sünde Bewegung und Wandel in die Welt gebracht habe. Als der erste große „Neuerer" galt weithin der Teufel, womit das Neue, weil es die ursprüngliche Ordnung zerstöre, zu etwas geradezu metaphysisch Bösem erklärt wurde—und der Neuerer eo ipso zum Ketzer. Dieser Grundeinstellung zur bestehenden „Ordnung" entsprach ein bestimmter Frömmigkeitstyp, der sich auch im Kultus niederschlug und den romanischen Kirchenbau 76
prägte. Kajetan Eßer macht in seinem Aufsatz „Die religiösen Bewegungen des Hochmittelalters und Franziskus von Assisi" in Band II der Festgabe für Joseph Lortz, S. 287—315 darauf aufmerksam, daß die christliche Kirche der Antike und des Frühmittelalters einseitig an der Gottheit Christi anstelle seiner menschlichen Natur interessiert gewesen sei, weil sie den seit seiner Auferstehung im Himmel Thronenden ganz als himmlischen Herrscher verstand. Die Folge war, daß seine kultische Verehrung im Gottesdienst dem Zeremoniell nachgebildet wurde, mit dem sich die irdischen Herrscher umgaben, und daß auch die liturgische Sprache starke Züge feudaler Unterwerfung trug. Selbst der Gekreuzigte wurde als Sieger mit der Krone und damit als Herrscher aufgefaßt, was sich in den byzantinischen Kruzifixen, die lange Zeit auch für die westliche Welt vorbildlich waren, bekundete. Diesem Herrscher gegenüber war der einzelne Gläubige nicht von Belang, sowenig sich der Feudalherr für das individuelle Schicksal des einzelnen ihm untergebenen Hörigen interessierte. Das Individuum verschwand hier im Ganzen des Volkes Gottes, das gern als Familie vorgestellt wurde, über die Gott als Familienvater unumschränkt herrschte. Individuelle Seelenvorgänge konnten somit überhaupt nicht ins Blickfeld des kirchlichen Lebens treten. Die vorgegebene Gemeinschaft teilte dem einzelnen Christen auch im speziell kirchlichen Sinne das ihm zukommende Maß und damit die ihm gemäße Ordnung zu. Wir machten uns das Aufkommen und die rasche Entwicklung der religiösen Reformbewegungen an der Wende zum Hochmittelalter als Protest gegen die sich rasch verstärkende Klerikalisierung der Kirche und ihre immer stärkere Einordnung in das feudale Herrschaftsgefüge und damit als Widerspruch gegen die immer spürbarer sich auftuende Kluft zwischen überkommenem evangelischem Leitbild und kirchlicher Wirklichkeit verständlich. Doch reicht diese Erklärung allein nicht aus. Das Aufkommen eines frühen Bürgertums in Italien und Süd77
frankreich als Folge des Beginns der industriellen Entwicklung und der raschen Steigerung des Binnen- und Außenhandels ließ zugleich eine neue Klasse entstehen, die von einem neuartigen Selbst- und Weltbewußtsein erfüllt war; hier bildete sich der Nährboden für eine neue Frömmigkeit. Wenn die Entwicklung in den italienischen Städten im einzelnen auch recht unterschiedlich verlief, so wurden doch in allen Zentren des städtischen Lebens die Feudalherren als bisherige Alleinbesitzer der Herrschaft entmachtet oder doch zu beträchtlichen Kompromissen gezwungen. Sie hatten die Herrschaft, auch wenn sie sich taktisch klug auf die neue Situation einstellten, künftig mit dem reichen Bürgertum zu teilen und sich gemeinsam mit diesem von den kleinbürgerlichen und plebejischen Schichten abzugrenzen. Die Macht des aufkommenden Großbürgertums, wozu in erster Linie die Kaufleute und Besitzer großer Manufakturen zählten, beruhte nicht mehr auf dem schon kraft der Geburt ererbten Stand, sondern auf der eigenen Leistung und dem durch kluge Ausnutzung der neuen Möglichkeiten erworbenen Reichtum. Manche Vertreter dieser neuen Klasse traten durch ihren Unternehmungsgeist hervor und setzten sich kraft des durch keine ethischen Schranken gehemmten Strebens nach persönlichem Gewinn schnell gegen ihre Rivalen durch. Sie ordneten sich nicht in das überkommene ständische Gefüge ein, wenn sie alsbald auch selbst ihre neuerworbenen Privilegien nach „unten" absicherten. Zunächst aber hatten sie sich im Kampf gegen die Feudalherren durchzusetzen und ihre städtische Freiheit zu erobern. Ihr Rang wurde von ihrer Arbeit und ihrem Geldbesitz entschieden; sie dachten nicht primär standesgemäß, sondern streng ökonomisch, wenn sie auch bald einen eigenen Standesstolz entwickelten. Die Kirche war diesen bürgerlichen Emanzipationsbewegungen zunächst durchaus nicht gewogen, weil deren Sieg für sie mit beträchtlichen Einbußen an feudaler Gewalt verbunden war. Viele Bischöfe und Erzbischöfe mußten die Herrschaft über ihren Bischofssitz, die lange 78
unangefochten geblieben war, jetzt an die bürgerliche Spitzenschicht abtreten. Dieser Herrschaftswechsel vollzog sich in den vielen italienischen Bischofssitzen über einen langen Zeitraum vom 11. bis zum 13. Jahrhundert. Andererseits machte schon Friedrich Glaser in seiner Monographie „Die Franziskanische Bewegung. Ein Beitrag zur Geschichte sozialer Reformideen im Mittelalter" darauf aufmerksam, daß die päpstliche Kurie als erste Institution in Italien ein geordnetes Finanzwesen organisiert habe, was nur so möglich war, daß sie ihre rasch anwachsenden internationalen Geldtransaktionen den Bankiers anvertraute. Da die Abgaben der Weltkirche in Naturalien oder in der Landeswährung einliefen, mußten sie in römische Währung umgetauscht werden, und da der unmittelbare Transport großer Geldsummen sich als ungünstig und unbequem erwies, trat weithin der Wechselbrief an seine Stelle. So sei die Kirche recht eigentlich zur Schöpferin des modernen europäischen Bankwesens geworden. Aber nicht nur Banken, sondern auch Wucherer fanden in Rom ein reiches Betätigungsfeld, war doch der damals übliche Zinsfuß erstaunlich hoch. Die religiösen Bewegungen des Mittelalters stellten zweifellos den Versuch dar, zum ursprünglichen christlichen Ethos zurückzukehren, und waren insofern von einem eminent religiösen Pathos getragen, was ihrer sozialen Akzentuierung in vielen Fällen nicht abträglich war. Sie waren zugleich Ausdruck einer neuartigen, vom frühbürgerlichen Lebensgefühl gespeisten Frömmigkeit; da aber die breiten ärmeren Schichten in viel höherem Maße als die bürgerliche Oberschicht die eigentliche Basis der religiösen Volksbewegungen bildeten, wendete sich das neuartige Bewußtsein unter Berufung auf das Urchristentum ebenfalls gegen das bürgerliche Gewinnstreben mit seiner starken Gefährdung des christlichen Ethos. Dieser Frömmigkeitswandel, der nur wenig ins Bewußtsein der allgemeinen Kirchengeschichtsschreibung gedrungen ist, war, wie Kajetan Eßer mit Recht hervorhebt, in Wahr79
heit noch gravierender als der Frömmigkeitswandel im Zeichen von Humanismus und Renaissance zwei bis drei Jahrhunderte später im Anbruch der Neuzeit. Auch in religiöser Hinsicht erwachte jetzt das Individuum und entwickelte einen bisher unbekannten Sinn für das Persönliche und Einmalige. In der Kunst führte dies zum wenn auch schrittweisen Übergang von der Romanik zur Gotik. Die romanische Kirche war wie eine Königshalle gestaltet gewesen, in der sich das Volk vor dem in der Apsis thronenden Herrscher Christus versammelt. Dagegen gab die gotische Kathedrale, in mehrere Kirchenschiffe gegliedert und mit Altären und Nebenkapellen versehen, dem einzelnen Gläubigen viel größere Möglichkeiten für seine persönliche Frömmigkeit. Plastik und Malerei wandten sich allmählich der Gestaltung des Details zu und drangen gelegentlich bis zum Porträt vor. Die sich rasch entwickelnde scholastische Theologie war bestrebt, den zuvor wie selbstverständlich von den Vätern übernommenen Glauben philosophisch abzusichern und spekulativ zu begründen, weil der gebildete Gläubige jetzt das Geglaubte weithin auch mit Hilfe seiner Vernunft einsichtig machen wollte. In diesem Zusammenhang mußte sich das Interesse auch der mensdilichen Seite des Lebens Jesu zuwenden. Das nun aufkommende völlig neuartige Kruzifix, in dem an die Stelle des unbewegt starren Siegers mit der Krone, der eigentlich dem Leid und der Qual enthoben blieb, der Schmerzensmann in seiner Todesnot trat, legt davon ebenso Zeugnis ab wie die plastischen und dramatischen Schilderungen des Leidens und Sterbens Jesu in der gebundenen religiösen Lyrik, so etwa in dem Thomas von Celano — dem Franziskus-Biographen — zugeschriebenen „Dies irae". Die Kreuzzüge, die es großen Menschenmengen ermöglichten, das Heimatland Jesu kennenzulernen, trugen wesentlich zu diesem Frömmigkeitswandel bei. Damit wurde nun auch die durch Christus bewirkte Erlösung auf ihre persönliche Auswirkung hin bedacht. Es wurde gleichsam neu entdeckt, daß sich Jesus in seinem 80
Opfertod am Kreuz dem einzelnen verlorenen Menschen liebend zugewandt hatte. In den religiösen Bewegungen trat sofort neben diesen persönlichen Zuspruch der persönliche Anspruch. Nicht nur der am Kreuz sterbende Gottessohn, sondern das vorbildliche Reden und Handeln des irdischen Jesus, wie es besonders die synoptischen Evangelien anschaulich darstellen, gelangte in den Mittelpunkt ihres Interesses und mußte alsbald ihre Aufmerksamkeit auf die Armut und Selbstverleugnung Jesu als Ansporn zu wahrhaft christlichem Leben lenken. Im Gegensatz zur landläufigen allegorischen Interpretation der Evangelien legte man hier großen Wert auf die buchstäbliche und nicht abgeschwächte Befolgung des vorbildlichen Handelns Jesu. Der einzelne Christ wurde selbständiger, selbstverantwortlicher und mündiger; er ging nicht mehr einfach in der Masse des Gottesvolkes auf. Dadurch schwand zeitweise sogar der Sinn für das sakramentale Leben gerade in dem von der offiziellen Kirche gelehrten und praktizierten Sinn. Es ist kein Zufall, daß das IV. Laterankonzil unter Androhung der Exkommunikation den Empfang der geweihten Hostie wenigstens einmal jährlich zur Pflicht machen mußte. Dagegen schob sich die Ethik als das, was das praktische Leben des Glaubenden formte, in den Mittelpunkt des Interesses. Deshalb kann es nicht verwundern, daß die original christlichen Armutsbewegungen, die nicht von dualistischen Strömungen beeinflußt waren, dem eigentlichen kirchlichen Dogma nur geringe Aufmerksamkeit widmeten und sich ganz auf ethische Fragen konzentrierten. Kirchliche Interpreten aus dem Bereich des Luthertums haben in diesem Zusammenhang von einem starken Trend zur Werkgerechtigkeit in den religiösen Bewegungen gesprochen und diese von der Reformation des 16. Jahrhunderts dadurch abgehoben, daß sie sie als zugespitzt katholische Bestrebungen gedeutet haben. Das ist nicht einfach falsch, erfaßt aber nicht das Wesen dieser Strömungen, weil es ihnen ein falsches Denkschema aufzwingt. Den religiösen Bewe81
gungen des Mittelalters ging es nicht eigentlich um Werkgerechtigkeit, sondern um das schlichte Tim des Guten in tatsächlicher Nachfolge Jesu und der Apostel. Dabei lag ihnen am Herzen, daß sich Gottes Gebot auch in seiner radikalen Form erfüllen lasse, wenn in den Menschen die ehrliche Bereitschaft dazu vorhanden ist. So nötigten sie sich außerordentliche asketische und altruistische Leistungen ab, ohne sie doch eigentlich als Leistungen zu verstehen. Ihnen ging es um die Aufhebung des schmerzlichen und unerträglichen Widerspruchs zwischen Wort und Tat, Theorie und Praxis. Die eigenverantwortete Gestaltung des konkreten Lebensvollzuges wurde zum Kriterium für die Echtheit des christlichen Bekenntnisses. Gelang diese aber, so lag es nahe, auf Grund des neuen Frömmigkeitsverständnisses daraus die Folgerungen für den persönlichen Auftrag innerhalb der Kirche abzuleiten und sich nicht mehr mit der rein passiven Rolle des Laien in ihr zufrieden zu geben. Auch in der Kirche suchte sich innerhalb der religiösen Bewegungen das Tun vor das sakramental Vorgegebene zu schieben, und wichtiger als die Beauftragung durch die Kirche mußte das persönliche Berufungsbewußtsein werden. Dieses wollte sich in und mit der Kirche realisieren, zog aber notfalls den Weg ohne die Kirche und außerhalb ihrer der Preisgabe der göttlichen Berufung vor. Schon durch ihre bloße Existenz untergruben diese Bewegungen deshalb die Autorität und das Selbstverständnis der offiziellen Kirche in ihrem traditionellen Sinn, obgleich oder gerade weil ihre Anhänger ihr christliches Bekenntnis zur Mitte ihres realen Lebens machten und notfalls selbst den Tod für ihre Überzeugimg nicht scheuten. Als wahre Kirche galt hier nicht mehr die durch die sakramentale Ordnung erlöste und durch die hierarchische Ordnung geleitete Menge der Getauften, sondern die Schar derer, die das apostolische Leben verwirklichten. An die Stelle bereits stark verdinglichter kirchlicher Bußleistungen trat wieder die echte Metanoia im Sinne des Evangeliums als grundlegende innere Umkehr des Menschen mit eindeuti82
gen Auswirkungen auf sein konkretes Leben. Gerade in diesem Sinn konnte die Buße Ausdruck für das neue Leben überhaupt werden. Auf diesem Hintergrund erschließen sidi uns auch Leben und Werk des Franziskus.
ZWEITER TEIL
Franziskus von Assisi und die ursprüngliche franziskanische Bruderschaft
9. Die Quellenlage Die wichtigste Grundlage der vorliegenden Darstellung von Leben und Werk des Franziskus bildet naturgemäß das von ihm selbst in schriftlicher Form Hinterlassene. Es handelt sich einmal um die beiden Regelentwürfe von 1221 (REG II) und 1223 (REGIII) und sein Testament (TEST), zum andern um eine Reihe von Briefen. Diese sind nach wie vor am leichtesten und zuverlässigsten in der Edition von Heinrich Boehmer „Analekten zur Geschichte des Franciscus von Assisi" greifbar. Weitere teils wissenschaftliche, teils sich an einen breiteren Leserkreis wendende Ausgaben vor allem katholischer Forscher sind im Literaturverzeichnis genannt. Neben anderen Stücken, die nur in Einzelfällen überliefert sind, trägt auch das „Lob der Tugenden" („Laudes de virtutibus") hymnischen Charakter und ist ohne Zweifel echt. Ungeachtet seiner Kürze hat es große theologische Bedeutung, weil es die Einheit der Tugenden und damit von allem, was zu Franz' religiöser Zielsetzung gehört (Weisheit, Einfalt, Armut, Demut und Gehorsam), in eindrucksvoller Weise unterstreicht. Über die Regelentwürfe und das Testament, auch die Briefe und die „Admonitionen" (ADMON) wird im vorletzten Kapitel noch des näheren die Rede sein. Hier sind jedoch Bemerkungen über die sogenannten Legenden, von Ordensmitgliedern verfaßte „biographische" Darstellungen, am Platze. Wenn ich mich 85
im folgenden diesen „Legenden" zuwende, kann es freilich nur um die Erläuterung meines Grundverständnisses gehen, da ich in dieser Darstellung ohne kritischenApparat in keine detaillierte Diskussion mit anderen Forschern über den Wert der einzelnen Quellen eintreten kann. Strittig ist seit dem Ende des vergangenen Jahrhunderts vor allem die Frage, ob man die beiden Darstellungen des Thomas von Celano (1 und 2 CEL) und die beiden „Legenden" Bonaventuras oder die sogenannte Legenda Antiqua in ihrer Vielfalt mit den drei großen „Blöcken" der Legenda TriumSociorum (3 Soc), desSpeculum Perfectionis (SPEC) und der Actus Beati Francisci et Sociorum eius (ACT) der eigenen Darstellung zugrunde legen soll. Die katholischen Forscher entschieden sich lange Zeit einseitig für den ersteren Weg, weil die Darstellungen Celanos bis zu ihrer Ablösimg durch die „Legenden" Bonaventuras (BON) 1266 kirchenoffiziellen Charakter trugen. Celanos erste „Legende" (1 CEL) entstand auf ausdrücklichen Befehl Gregors IX. und konnte schon 1229 dessen amtliche Billigung erlangen. Thomas von Celano schien dem Papst offenbar gerade deshalb für diese Aufgabe geeignet, weil er niemals dem intimen Freundeskreis des Franziskus angehört hatte, vielmehr erst um das Jahr 1215 dem Orden beigetreten war. Wahrscheinlich von adliger Abstammung, hielt er sich während einiger für den Orden entscheidender Jahre außerhalb Italiens auf. Er begleitete mit anderen Brüdern Cäsarius von Speyer 1221 auf dessen Wanderung nach Deutschland und hatte dort zeitweilig Ordensämter inne. 1228 aber konnte er in Assisi der feierlichen Heiligsprechung des verstorbenen Gründers beiwohnen. Gerade seine Abwesenheit von der italienischen Heimat in der Zeit, als Franziskus mit andersgearteten Tendenzen innerhalb seiner Bruderschaft und an der Kurie zu ringen hatte, machte ihn für sein Werk, das dem Ausgleich dienen wollte, in den Augen des Papstes geeignet. Man muß sich bei der Bewertung der beiden Werke Celanos einer vereinfachenden Schwarzweißmalerei enthalten. Einerseits bedarf es seit je keines Beweises, daß wir in 86
ihnen äußerst kostbare Quellen besitzen, auf deren Auswertung kein Forscher verzichten kann. Andererseits ist nicht zu verkennen, daß Celano zwar aus innerstem Antrieb seinem Orden dienen wollte, auch Franz von Herzen verehrte, aber doch die Grundintention seines Meisters nicht völlig begriff, diese vielmehr durch mönchische und klerikale Intentionen teilweise entstellte. Es ging ihm aber auch nicht so sehr darum, seine eigene Auffassung darzustellen, vielmehr meinte er als Beauftragter und Vertreter einer ganzen Gruppe zu sprechen, was schon der in seinem Prolog verwendete Plural zeigt. Er war nicht eigentlich der Interessenvertreter einer Partei, wie überhaupt zu dieser Zeit die beiden gegnerischen Parteien im Orden noch keine klaren Konturen angenommen hatten und ein Ausgleich noch möglich schien. Deshalb konnten ihm auch die engsten Schüler des Franziskus ihr Vertrauen schenken. Trotzdem sprach er in erster Linie für die offiziellen Persönlichkeiten des Ordens und seinen früheren Kardinalprotektor, den jetzigen Papst. Seine gewandte Feder und sein flüssiger Stil ebenso wie seine profunde Kenntnis der kirchlichen Überlieferung weisen ihn als Gebildeten aus, der sich von dem Kern bewußt einfacher Anhänger des Poverello deutlich unterschied. Celano glorifizierte denn auch in seiner ersten Darstellung Gregor IX. ebenso wie den damals an der Spitze des Ordens stehenden Elias von Cortona, während er die Namen der engsten Freunde des Franziskus nach Möglichkeit verschwieg, angeblich, um ihre Demut nicht zu beleidigen. Jede Zeile kündet von seiner ehrlichen Bewunderung des Heiligen, doch überfremdete er dessen Bild teilweise, indem er sein Werk mittels mönchischer Viten zu deuten suchte. Es muß freilich damit geredinet werden, daß manche ihm zugekommenen Nachrichten über Franz im Prozeß längerer mündlicher Überlieferung bereits verändert und durch Züge der mönchischen Wanderlegenden „angereichert" worden waren. So ist schon 1 CEL nicht frei von legendären Zügen im heutigen Sinn des Wortes. Dies ist um so verständlicher, als Celano offenbar nur in geringem 87
Maße auf persönliche Erfahrungen mit Franz zurückgreifen konnte. Karlmann Beyschlag formuliert in seiner Dissertation „Die Bergpredigt und Franz von Assisi" mit Recht, Celano habe ein Heiligenbild gezeichnet, daß sich vom Bild anderer Heiliger nur graduell unterscheide, worüber Franz' Originalität oft verlorengehe. 2 CEL steht aufs Ganze gesehen nicht im Widerspruch zu 1 CEL, enthält jedoch eine Reihe neuartiger Tendenzen. Dieses Werk verfaßte Celano 1247, als der Stern des Elias im Orden untergegangen war, weshalb dieser jetzt auch nicht mehr erwähnt wird. In ihm öffnete er sich viel stärker als in 1 CEL den Anliegen der ursprünglichen Schüler des Franz und gab freimütig einzelne Irrtümer in Wertungen seiner früheren Schrift zu, was für Celanos Ehrlichkeit spricht. Audi 2 CEL ist freilich alles andere eher als eine Privatarbeit. Das Ordenskapitel des Jahres 1244 ließ Material über Franz und die Anfänge der Bruderschaft sammeln und betraute Celano als Haupt einer Kommission mit dessen Sichtung. Celano griff in weitem Maße auf solches Material zurück, das uns auch in SPEC überliefert ist. Im ersten Teil stellte er Jugend und Bekehrung des Franz sowie die Anfänge seiner Bruderschaft bis etwa 1212 dar; im zweiten Teil verzichtete er auf die Darstellung des zeitlichen Ganges der Bewegung und ordnete den Stoff nach systematischen Gesichtspunkten. Celano glättete dabei den Stil seiner Vorlage beziehungsweise Vorlagen und gab ihnen eine künstlerische Abrundung, indem er sich um Straffung, Zusammenfassung und resümierende Wertung bemühte. Er wollte mit 2 CEL nicht eigentlich 1 CEL negieren, setzte aber neue, kritische Akzente und verstand wohl 2 CEL als eine notwendige Ergänzung von 1 CEL. Der Zug zum Legendarischen hat sich freilich in 2 CEL gegenüber 1 CEL bereits wesentlich verstärkt, weil das vorbildliche Leben eines Heiligen geschildert werden sollte. Manches wird, offenbar bewußt, verschwiegen, so einige Fragen der sich entwickelnden Ordensverfassung, vor allem aber die brisanten Ereignisse der Jahre 1219/20, über die wir nur durch Jordan 88
von Giano informiert sind. 2 CEL ist für uns trotzdem eine hervorragende Quelle, zumal 112 seiner 143 Kapitel in SPEC keine Parallele besitzen. Mit seinem Schweigen zu einigen problematischen Erscheinungen der Ordensentwicklung wollte Celano offenbar dazu helfen, die gravierend gewordenen Gegensätze im Orden zu entschärfen, sollte sein Werk doch nicht Wißbegierde befriedigen, sondern der Erbauung seiner Brüder dienen. Obgleich er hierin der laxen Richtung stillschweigend entgegenkam, konnte er sie doch auch heftig attackieren, was das Vertrauen des engen Franz-Kreises gefestigt haben wird. Gewisse sich schon bei Celano andeutende Tendenzen, den ursprünglichen Ansatz des Heiligen so zu entschärfen, daß er mit der tatsächlichen Ordensentwicklung in Übereinstimmung gebracht werden konnte, zugleich aber soviel wie möglich vom Ansatz zu bewahren und fruchtbar zu machen, wurden durch Bonaventuras Legenda major, die 1 2 6 3 vom Generalkapitel bestätigt wurde, zu Ende geführt. BON kommt für uns als Quelle kaum noch in Betracht, so beliebt diese Vita lange Zeit hindurch als offizielle Darstellung des Ordensgründers, die sämtliche anderen „Legenden" verdrängen sollte, in der katholischen Kirche gewesen ist. Nur in wenigen Einzelfällen konnte Bonaventura bisher unbekanntes historisches Material beifügen. BON wurde noch weit mehr als die Viten Celanos in ordenspolitischer Absicht verfaßt. Bonaventura wollte durch Postulierung einer mittleren Linie die den Orden erschütternden Streitigkeiten beseitigen, doch war dieser Versuch erfolglos. Deshalb stellte er das ihm greifbare Material, das er seiner Zielsetzung dienstbar machen konnte, zusammen, glich nach Möglichkeit die Unstimmigkeiten seiner Vorlagen aus und formte daraus mit der ihm eigenen Kraft und literarischen Geschicklichkeit ein Neues. Er war ein meisterhafter Kompilator, dem Stümperarbeit fernlag. Aber eine bloße Kompilation, mag sie noch so gelungen sein, ist eben keine historische Quelle im eigentlichen Sinn. Celano war vom Papst gezwungen worden, als drittes Werk noch einen sich ausschließ89
lieh mit Wundern beschäftigenden Traktat zu schreiben (Tractatus de Miraculis), in dem sich vorwiegend Wunder finden, die erst nach dem Tode des Franziskus an seinem Grabe oder gar im Gedenken an ihn sich ereignet haben sollen. Bonaventura hat mit sicherem Instinkt viele dieser Wunder weggelassen; dennoch hat sich in BON der Trend zum Mirakulösen bedeutend verstärkt. Als das Gipfelwunder an Franz selbst erscheinen jetzt seine breit behandelten Stigmen, die ihrerseits neue Wunder hervorrufen. Franz ist hier zum großen Wundertäter geworden, und seine Stigmen erscheinen als Beglaubigung seines Werkes gegenüber böswilligen Anfeindungen von seiten des Weltklerus. Gegenüber joachitischenTendenzen unter den Spiritualen betont Bonaventura stark die Verbundenheit des Franziskus mit Christus, um so zu verhindern, daß er einem von Christus losgelösten Reich des Heiligen Geistes zugewiesen werden könnte. Franz erscheint als Herold Christi und kann in diesem Zusammenhang auch mit Johannes dem Täufer verglichen werden, womit zugleich verhindert wird, daß er an die Stelle Christi selbst tritt. Bonaventura schuf, wie Heinrich Tilemann in seinen „Studien zur Individualität des Franziskus von Assisi" richtig bemerkt, mit dieser „Legende" der Ordensmajorität ein Mittel, das sie voll auszunutzen bestrebt war, nachdem bisherige Darstellungen ihr hindernd im Wege gestanden hatten. Sie wollte mittels BON der Autorität der Vertrauten des Franz endgültig ein Ende bereiten, was ihr freilich in diesem Ausmaß nicht gelang. Neben den bisher genannten Viten aber stehen andere, die lange Zeit von der katholischen Forschung mit großem Mißtrauen betrachtet und auch von einigen protestantischen Gelehrten voreilig abgewertet wurden. Gern warf man ihnen eine spiritualistische Tendenz vor und erklärte sie folglich zu Tendenzschriften der Armutseiferer gegenüber der Ordensmajorität. Tatsächlich kann nicht geleugnet werden, daß sich an einigen Stellen dieser „Legenden" eine solche tendenziös gefärbte Kritik an der Ordensleitung findet. Doch ist es relativ leicht möglich, 90
diese späteren Zusätze und Interpretationen vom historisch Glaubwürdigen zu trennen. Aufs Ganze gesehen verdient etwa SPEC mindestens ebensoviel Vertrauen wie 1 und 2 CEL. Seine vorschnelle Diskreditierung diente letzdich dem Zweck, den Abstand der Ordensentwicklung von der ursprünglichen Zielsetzung des Franziskus zu verdecken oder doch zu bemänteln. Im einzelnen freilich ist nach wie vor große Umsicht geboten, denn es besteht in der Forschung weniger denn je Einigkeit über die rechte Einordnung dieser Quellen. Immerhin bahnt sich in der katholischen Forschung seit der in minutiöser Kleinarbeit geschaffenen Monographie von Sophronius Clasen „Legenda Antiqua S. Francisci" in der Bewertung dieser Quellen ein beachtlicher Umschwung an. Es ist mir an dieser Stelle nicht möglich, die detaillierten Analysen Ciasens im einzelnen auszuwerten, und obgleich ich ihnen meinen Respekt nicht versage, stimme ich etwa im Hinblick auf die Beurteilung des Verhältnisses von 2 CEL und SPEC nicht mit ihm überein. Entscheidend aber ist, daß Clasen auch im SPEC gutes, glaubwürdiges Material sehen zu können meint, denn dieser Konsens wiegt viel schwerer als dessen entwicklungsgeschichtliche Einordnung im einzelnen. (Das neue Werk von Rosalind B. Brooke: „Scripta Leonis, Rufini et Angeli sociorum S. Francisci", Oxford 1970, ist mir leider nicht zugänglich.) Kein Forscher kann heute an diesen „Legenden" ungestraft vorübergehen, denn sie enthalten eine Fülle wertvollen historischen Materials. Die Diskussion in der Forschung lief meist auf die Frage hinaus, ob der Franz-Schüler Leo noch am Abend seines langen Lebens eine dieser Viten beziehungsweise ihren Grundstock selbst verfaßt habe, allein oder zusammen mit anderen alten Franz-Gefährten wie Angelo und Rufinus, oder ob es sich dabei um späte Fälschungen der Spiritualen handele. Ich leugne nicht die Berechtigung dieser Frage und bin überzeugt, daß wir in den Viten des Leo-Kreises auf Material stoßen, das von diesem selbst aus eigenem Erleben beigesteuert werden konnte. 91
Trotzdem möchte ich davor warnen, die Frage der Augenzeugenschaft zu sehr in den Vordergrund zu rücken und etwa die in 3 Soc sechzehnmal auftretende Formel „wir, die wir mit ihm waren" allzu sicher für das äußere Zeichen der Augenzeugenschaft zu erklären, da es sich hierbei durchaus um eine der Absicherung dienende schematische Formel handeln kann. Die Frage nach möglichen Augenzeugen ist insofern naiv, als sie den langen Prozeß der mündlichen Überlieferung der meisten Stoffe übersieht, bei dem es unvermeidlich zu Veränderungen, Abschleifungen und Zusätzen kam. Leider hat die Forschung die schon vor 45 Jahren von Lilly Zarncke in ihrer preisgekrönten Arbeit „Der Anteil des Kardinals Ugolino an der Ausbildung der drei Orden des heiligen Franz" gegebenen grundsätzlichen Hinweise nicht ausreichend beachtet, ja sie zum Teil ohne nähere Prüfung ausdrücklich verworfen. Frau Zarncke fordert die Anwendung der Ergebnisse der formgeschichtlichen Arbeit an den synoptischen Evangelien auf die Franz-Legenden. Man ließ sich offenbar von ihrer radikalen Skepsis gegenüber der Historizität einiger liebgewordener Quellenteile schrecken und wollte die Arbeit an den Quellen gleichsam nicht von vorn beginnen. Dieser Neuanfang unter streng wissenschaftlichen Gesichtspunkten wird sich jedoch auf die Dauer kaum vermeiden lassen. Natürlich würde er durchaus nicht alles Erarbeitete ungültig machen, und es ist auch kaum zu erhoffen, daß bei strenger Anwendung formgeschichtlicher Erkenntnisse sich volle Einstimmigkeit erzielen läßt, wie die Geschichte formgeschichtlicher Forschungen an den Evangelien seit dem ersten Weltkrieg hinlänglich beweist. Trotzdem würde auf diese Weise die Erforschung des Lebenswerks des Franziskus auf eine qualitativ neue Stufe gehoben werden. Frau Zarncke wies besonders darauf hin, daß man bei derartigen „Legenden" nicht in dem Sinne von geistigem Eigentum eines Verfassers sprechen kann, wie dies heute bei der Abfassung eines literarischen Werkes geboten ist. „Vor, neben und nach der Niederschrift der Erzählung 92
läuft der Prozeß mündlicher Tradierung, an dem ein ganzer Erzähler- und Zuhörerkreis mitarbeitet, in dem dessen Bedürfnisse, Fragen und sonderlichen Anschauungen hineinströmen und an dem ursprünglichen Traditionsstoff Änderungen bewirken." Erst allmählich seien die einzelnen Erzählungsstücke, Logien, Gespräche, Parabeln und Anekdoten zu einem größeren Ganzen zusammengewachsen, denn die Tradition habe lange Zeit nur die Einzelstücke als loses, unverbunden umherlaufendes Gut weitergegeben. Man muß bei jedem Einzelstück seinen „Sitz im Leben" ergründen, das heißt feststellen, zu welchem Zweck es tradiert wurde. Beachtet man dies, so wird die Frage nach dem Erarbeiter der Endredaktion zwar nicht gegenstandslos, verliert aber erheblich an Gewicht, und es ist nicht mehr möglich, das Gesamtmaterial einer Schrift blodkartig zu beurteilen. Vielmehr finden sich in jeder Schrift Materialien von recht unterschiedlichem historischem Wert, und die einzelnen Stücke müssen jeweils für sich auf ihren Sachgehalt hin geprüft werden. Was 3 Soc betrifft, so wurde der historische Wert dieser Quelle früher von mehreren Forschern bezweifelt. Walter Goetz behauptete in seiner an sich profunden Studie „Die Quellen zur Geschichte des hl. Franz von Assisi", 3 Soc sei eine Kompilation aus 1 und 2 CEL. Eröffnet hatte bereits 1 9 0 0 der Jesuit van Ortroy die Attacken auf 3 Soc mit einem Generalangriff, 1902 von Lemmens unterstützt. Man wies darauf hin, daß weder Schriftsteller des 13. Jahrhunderts noch Spiritualen des 14. Jahrhunderts 3 Soc zitieren. Goetz sprach von bloß rhetorischen Erweiterungen, die auf eine spätere Entstehungszeit hindeuteten. 3 Soc sei noch später als BON verfaßt, wenn Goetz auch zugestand, daß der Darstellung gelegentlich originales Wissen zugrunde liegen müsse; Sondernachrichten der 3 Soc weisen auch nach seiner Überzeugimg auf einen Nebenzweig der Überlieferung hin. Goetz macht 3 Soc gerade zum Vorwurf, daß sie schlechthin nichts über die Ordenskonflikte bringe, also auch die schwachen Andeutungen Celanos unterschlage. Doch sah er sich zu dem
93
Eingeständnis genötigt: „Immerhin bleibt auffallend, daß sich eine Kompilation aus so später Zeit nicht weit stärker durch sachliche Irrtümer und legendarischen Ausbau der Uberlieferung verrät." Der Verfasser habe mit Vorsicht gearbeitet und eine gewisse Schlichtheit in seine Erzählung gebracht, so daß er in dieser Hinsicht den Gedanken des Franziskus näher zu stehen scheine als BON. Goetz stellt fest, daß 3 Soc, abgesehen von Visionen, wie 1 CEL auf Berichte von Wundern verzichte. Heute scheint die Forschung geneigt, zur Wertschätzung der 3 Soc bis zum Generalangriff van Ortroys zurückzukehren, wenn sie dabei auch mit Recht größere Zurückhaltung als etwa Sabatier wahrt. Paul Sabatier wußte in seinem oft aufgelegten Buch „Leben des heiligen Franz von Assisi" noch präzise anzugeben, daß 3 Soc am 11. 8 . 1 2 4 6 im kleinen Kloster Greccio, dem Hauptquartier der Observanten, durch Leo, Angelo und Rufinus, die auch andere Vertraute des Heiligen um Mitteilungen gebeten hatten, vollendet worden sei. Er sah in 3 Soc die erste Kundgebung d e r Brüder, die dem Geist und Buchstaben der Regel treu geblieben waren. Mit Recht urteilt Sabatier, durch die große Unbefangenheit der Verfasser sei eine Schilderung von unvergleichlicher Frische und Lebendigkeit entstanden. Die heute vorliegende „Legende" sei freilich nur ein Bruchstück des Originals, das vor seiner Verbreitung von den Ordensautoritäten sorgfältig geprüft und nach Bedarf zurechtgestutzt worden sei. Der letzte und wichtigste Teil der „Legende" sei wohl unterdrückt worden. Trotzdem nennt Sabatier sie das schönste franziskanische Denkmal. Lilly Zarncke ist skeptisch gegenüber dem Prolog der 3 Soc, in dem sie keine echte Einleitung der „drei Gefährten" zu sejien vermag. Die Einstellung zu diesem „Brief" kann jedoch nicht den Ausschlag für die Beurteilung der einzelnen Stücke der 3 Soc geben. Sophronius Clasen kommt das große Verdienst zu, in seinem quellenkritischen Werk nach langer Verurteilung der 3 Soc durch fast den ganzen Minoritenorden eine sachliche Wertung 94
angebahnt und diese exakt abgesichert zu haben. Er stellte fest, daß 3 Soc in der handschriftlichen Überlieferung im großen und ganzen geschlossen und von den anderen großen Sammlungen wie SPEC und A C T abgegrenzt sei. Die grundlegende These von Frau Zarncke im Grunde bestätigend, kam Gasen bei der Untersuchung einer Vielzahl von Franziskusbüchern in den einzelnen Ordensprovinzen zu dem Schluß, 3 Soc, SPEC und A C T seien keineswegs ein im säuberlich begrenzten Flußbett gleichmäßig dahinziehender Strom, der so zu uns kommt, wie er aus der Quelle gespeist wurde, und dessen Wasser man durch vergleichende Proben leicht von späterer Trübung reinigen könne; vielmehr ergieße sich die handschriftliche Überlieferung wie ein ungebändigter, oft die Ufer überschwemmender Strom, der sich von allen Seiten speist und schließlich zu einem schwer überschaubaren Mündungsdelta auseinandergeht (S. 211). Das Material der 3 Soc sei am wenigsten durch spätere Einwirkungen verändert worden, denn alle Abweichungen der jüngsten von den ältesten Franziskusbüchern seien nur geringfügig oder bloße Umstellungen. Im Gegensatz zu Goetz gelangt Clasen zu dem Ergebnis, einige Bemerkungen zwischen den Zeilen sprächen für eine frühe Abfassungszeit ihrer Berichte. Schon hinsichdich der Jugend des Franz lasse sich 3 Soc als Quelle für 2 CEL unbezweifelbar beweisen, denn CEL greife vieles, was 3 Soc in schlichter Erzählung als natürliches Geschehen schildere, auf und gestalte es zu außergewöhnlichen Vorgängen und Wundern um. Das Fehlen älterer Handschriften könne nicht gegen eine frühe Abfassungszeit der 3 Soc geltend gemacht werden, denn es sei offenbar durch den Vernichtungsbefehl des Generalkapitels von 1266 verursacht worden; auch der vollständige Text von 2 CEL liege ja bisher nur in zwei Handschriften vor. Clasen tritt auch für die Abfassung der 3 Soc durch wirkliche Franz-Gefährten ein, denn aus der Schrift sei noch keinerlei spiritualistische Tendenz erkennbar, fehle doch im Gegensatz zu SPEC und A C T noch jede Auseinandersetzung über die 95
Armut. 3 Soc bringe als einzige Quelle viele Aussagen, die nur von den Franz-Gefährten mit ihrer genauen Kenntnis der Frühzeit des Ordens stammen könnten. Mit Sabatier verficht deshalb Clasen die These, 3 Soc sei die von Angelo, Leo und Rufinus 1246 vollendete Drei-Gefährten-Legende. Der von 3 Soc abgetrennte Teil sei jedoch nicht, wie Sabatier meinte, SPEC, sondern der zweite Teil von 2 CEL. Der voranstehende Brief stehe nur im Widerspruch zur heutigen verkürzten Form der 3 Soc. Wolle man die Grundschrift der 3 Soc in ihrer Gesamtheit kennenlernen, so müsse man die vorliegende Form um 2 CEL 26 bis 220 ergänzen. Die Verkürzung zu einem Torso der 3 Soc mit Verlust ihres Hauptteils sei durchaus kein Einzelfall in der mittelalterlichen Überlieferung. Wegen der Verstümmelung habe zunächst kein sonderliches Interesse mehr für sie bestanden, doch sei dieses später wieder erwacht, als die Eiferer die Frühzeit des Ordens und die ursprüngliche Absicht des Ordensstifters zum Zeugen für ihre eigene Intention aufriefen, was zum Entstehen vieler Handschriften mit 3 Soc im 14. Jahrhundert geführt habe. Die Authentizität der 3 Soc erhelle auch daraus, daß diese sich der gedanklichen und stichwortmäßigen Verbindung bediene, die besonders bei mündlichen Berichten häufig vorkomme. Wird auch gegenüber den Personen der drei Gefährten mehr Zurückhaltung geboten sein, als Clasen sie übt, so sind seine Ausführungen zu 3 Soc doch recht überzeugend. Problematischer erscheinen mir seine Ausführungen zur SPEC-Gruppe, deren Differenzierungen ich hier nicht darstellen kann. Er hält eine Abfassung des SPEC vor 1 CEL für unmöglich, weil dann in der schriftlichen Tradition eine Lücke von über einem Jahrhundert klaffe; andererseits gehe es aber auch nicht an, die heutige Gestalt des SPEC als programmatische Schrift der Armutseiferer abzustempeln, da die meisten Abschreiber ihrer Handschriften der Kommunität angehört haben müssen. Auch die Art der Berichte verrate schon auf den ersten Blick den unkomplizierten und von hagiographischer 96
Stilistik unberührten Erzähler, der seine Berichte fast immer mit gleichlautenden Worten einleite. SPEC greife in seiner jetzigen Form also zweifellos auf echtes historisches Erzählungsgut des Leo-Kreises zurück. Die Kompilatoren des SPEC aus dem ersten Drittel des 14. Jahrhunderts hätten Schriften Leos, Erzählungen aus 2 CEL (Teil 2) und mündliches Überlieferungsgut miteinander verbunden. Der Kompilator habe dem Material aus der CEL-Gruppe das Gewand der Volkssprache gegeben. Nur 26 Kapitel seien überhaupt nicht von CEL beeinflußt worden. Indes, das Argument von der nachträglichen Umwandlung des zunächst gelehrten Materials in schlichte, volkssprachlich geformte Erzählungen ist meines Erachtens nicht haltbar. Clasen konnte zu dieser These nur kommen, weil er die Priorität von 1 CEL vor SPEC sichern wollte. Wird man also Clasen auch hier in seiner Grundtendenz der freundlichen Beurteilung des SPEC folgen können, so wird man doch noch stärker als er die historische Zuverlässigkeit eines Großteils der Einzelstücke des SPEC vertreten müssen. In diesem Punkte dürfte Karlmann Beyschlag, der in seiner Dissertation einen detaillierten Vergleich der Einzelstücke von 2 CEL und SPEC vornahm, nach wie vor im Recht sein. Tritt Clasen für die Endredaktion des SPEC um das Jahr 1330 ein, so hält Beyschlag das am Schluß von SPEC angegebene Datum 1318 für richtig, während Sabatier im SPEC eine schon 1228 verfaßte Protestschrift Leos gegen Maßnahmen des Elias sah. In Weiterführung der Quellenanalyse von Walter Goetz bewies Beyschlag, daß die SPEC-Fassung mancher Stücke älter und ursprünglicher sei als die 2 CEL-Fassung. CEL habe den groben Stil des SPEC oft geglättet und veredelt, was viel einleuchtender ist als Ciasens Annahme des umgekehrten Vorgangs. Erst einige deutlich erkennbare spiritualistisch klingende Zusätze seien der Redaktion von 1318 zuzuschreiben. Von den 125 Kapiteln des SPEC seien mindestens 93 als inhaltlich echt und als Vorlage für Celano anzunehmen. Nur bei 11 Kapiteln sei die Be97
arbeitung durch einen spiritualistischen Redaktor bei echtem Grundmaterial wahrscheinlich zu machen, wozu höchstens noch 5 weitere spiritualistisch geprägte Kapitel kämen. Auch Beyschlag nimmt einen vielgestaltigen Entwicklungsprozeß des echten SPEC-Materials an, der sich von 1 2 2 8 bis nach 1 2 4 7 erstreckt haben könnte. Sei SPEC auch in der vorliegenden Form eine Tendenzschrift der Observanten, so sei sie doch in ihren echten Teilen nicht als Kampfschrift anzusehen. Diese Teile seien Celanos Darstellung überlegen, weil die Intention des Franziskus hier noch nicht durch asketische und allgemeinmönchische Züge überfremdet sei. Die ACT waren schon vonSabatier nicht zu seiner Beweisführung herangezogen worden. Trotzdem enthalten auch sie, wie Clasen nachgewiesen hat, interessantes historisches Material. Ihre endgültige Gestalt entstand etwa zu derselben Zeit wie SPEC in seiner jetzigen Form. Clasen datiert die meisten ihrer Stücke auf 1 3 3 0 / 4 0 . Die Berührung der Acr-Stücke mit Celano ist aber viel geringer, und ihre Quellen sind durchweg bedeutend jünger. Das echte Material entstammt großenteils offenbar der Überlieferung in den Eremitorien und kleinen Klöstern Mittelitaliens, wo sich der strenge Geist des Ordensgründers noch lange bewahrte. Wie der „Spiegel der Vollkommenheit", so verfolgten auch die „Franziskus-Akten" eine pädagogische Absicht: Sie wollten den Orden an das ursprüngliche Ideal erinnern. Ein hagiographisches Anliegen wie bei Celano liegt dagegen nicht vor. Die ACT wollten auch durch warnende Beispiele die Mitglieder des Ordens, deren erste Leidenschaft erkaltet war, zur Umkehr rufen. Bei den beliebten und verbreiteten Fioretti handelt es sich offenbar um eine freie und auswählende Übersetzung der ACT, jedoch unter popularisierendem Gesichtspunkt, wobei die Poetik den historischen Kern teilweise verdeckt. Bedurften die wichtigsten „Legenden", auf die ich mich im folgenden im wesentlichen stütze, einer ausführlichen Erörterung, so brauche ich auf die der Forschung seit 98
langem bekannten wichtigsten Chroniken nur eben hinzuweisen. An erster Stelle verdient Jordan von Giano genannt zu werden, der aus dem umbrischen Tal von Spoleto stammte. Er gehörte zu den Brüdern, die 1221 nach Deutschland zogen, und er scheint sich dort bis zu seinem Tode in franziskanischen Klöstern aufgehalten zu haben. Erst im Frühjahr 1262 diktierte er nach längerer Vorbereitung sein Werk einem Ordensbruder. Im Vordergrund seiner Aufmerksamkeit steht naturgemäß die Entwicklung des Ordens in Deutschland, so daß in unserm Zusammenhang nur die Anfangskapitel von Bedeutung sind. Sein Werk leidet daran, daß unwichtige Details sich zuweilen ungebührlich in den Vordergrund drängen, während Wichtiges mit wenigen Bemerkungen abgetan wird. Sabatier erinnerte diese Chronik an Memoiren eines alten Soldaten. In einigen der in reicher Zahl gebotenen Anekdoten nahm er schon etwas vom poetischen Hauch der Fioretti wahr. Ungemein wichtig ist für uns diese Chronik, weil sie sich als einzige Quelle mit der Ordenskrise der Jahre 1219/20 befaßt, die Giano selbst noch in Italien miterlebte. Frau Zarncke schließt aus dem unregelmäßigen Stil der Chronik, daß es sich bei ihr nicht so sehr um ein persönlich-geschichtliches Memoirenwerk handele als um eine in chronologischen Zusammenhang gebrachte und durch historische Berichte verbundene Anekdotensammlung. Wenn man deshalb auch von der Betonung der Autorität des Verfassers absehen müsse, so könne man doch das durch diesen zugänglich gemachte alte Erzählergut hoch werten. Für uns nur von geringem Interesse ist das zweite große Werk eines Ordenschronisten, „Die Ankunft der Minderbrüder in England" von Thomas von Eccleston. Er, dessen Persönlichkeit für uns fast ganz im dunkel liegt, scheint sich zeitlebens in englischen Minoritenlclöstern aufgehalten zu haben. Fünfundzwanzig Jahre lang sammelte er Material zu seiner Arbeit, die uns vom Beginn der franziskanischen Tätigkeit in England 1224 bis etwa 1260 führt. Sein Werk ist doppelt so lang wie das Jordan 99
von Gianos, doch leidet seine Darstellung an einem gewissen Schematismus und an chronologischen Unklarheiten. Er besaß wohl auch Zugang zu offiziellen Dokumenten, doch fällt die Tendenz einer gewissen Glorifizierung der englischen Ordensprovinz auf. Von den nicht dem Orden angehörenden Chronisten sei an dieser Stelle nur auf den wichtigsten von ihnen, Jakob von Vitry, hingewiesen. Dieser stammte aus einem Ort an der Seine und hatte als französischer Kleriker im belgischen Grenzgebiet gegen die Albigenser gepredigt. Er war sehr darum bemüht, die religiöse Frauenwelt wieder der Kirche zuzuführen, und unterstützte deshalb später die rechtgläubigen Beginen Nordfrankreichs nach Kräften. Überhaupt war er von aufrichtiger persönlicher Frömmigkeit erfüllt und empfand deshalb auch Sympathie für religiöse Reformbewegungen, die der Kirche dienstbar gemacht werden konnten, wenn er auch um ihre Problematik durch Überspitzung ihres Ansatzes wußte. Vor Antritt seines Bischofsamtes in Acre (Palästina) durchreiste er 1216 mehrere Monate lang Italien und lernte dabei sowohl die Humiliaten als auch die franziskanische Bruderschaft kennen. Während er das ungeistliche Treiben am päpstlichen Hof mit Bestürzung und Befremden erleben mußte, muteten ihn diese religiösen Bewegungen mit ihrem ehrlichen Bemühen um Nachfolge Jesu sehr sympathisch an, und seine anfängliche Zurückhaltung gegen die Minoriten verwandelte sich schnell in helle Begeisterung. Diese Begeisterung trübte freilich ab und zu sein Urteil und machte ihn geneigt, schnell sich herausbildende legendarische Züge unkritisch zu übernehmen, wie Frau Zamcke dies hinsichtlich seiner Schilderung der Predigt, die Franz vor dem ägyptischen Sultan hielt, wohl mit Recht annimmt. Auch in Palästina nämlich kümmerte sich Jakob von Vitry warmherzig um die dortigen Minoriten, bevor er sich wenige Jahre später in seine Heimat zurückbegab. Trotzdem können wir ihn mit Kajetan Eßer als einen der geistvollsten Beobachter des kanonikalen und monastischen Lebens seiner Umwelt bezeichnen. Von In100
teresse ist für uns der Brief, den er Anfang Oktober 1216 kurz vor seiner Überfahrt nach Palästina im Hafen von Genua an seine Freunde in Lüttich schrieb; ferner ein Brief vom November 1219 an seine Freunde in Lothringen, am Tage nach der Einnahme von Damiette durch die Truppen des Sultans verfaßt. Zu erwähnen ist auch das 32. Kapitel seiner Historia Orientalis, wohl 1221 beendet, wozu noch zwei kurz vor 1228 verfaßte Predigten kommen. Jakob schrieb nicht als Geschichtsforscher, sondern als Prediger, der einem geistlichen Zweck dienen wollte. Gerade der lebendig geschriebene Brief von 1216 mit seinen konkreten Mitteilungen ist für uns jedoch als erstes uns zugängliches Zeugnis über die franziskanische Bruderschaft von neutraler Seite ungemein wichtig.
10. Die Jugend des Franziskus
Die offiziellen Ordenslegenden setzen sämtlich bei der Jugend des Heiligen ein, und auch 3 Soc bringt darüber interessantesMaterial. Einerseits müssen wir darüber sehr froh sein. Die Jugend etwa des Waldes oder auch des Dominikus ist völlig in dunkel gehüllt, wie wir überhaupt über deren Leben nur spärliche Nachrichten besitzen. Die Reichhaltigkeit der Nachrichten über Franz beweist, daß er der volkstümlichste Heilige des Mittelalters war. In der reichen Fülle der Nachrichten über ihn spiegelt sich etwas von seiner ungewöhnlichen Persönlichkeit und seiner Originalität, die die Zeitgenossen offensichtlich stark beschäftigt hat. Andererseits verführt der Reichtum des vorhandenen Materials aber auch den Forscher, zumal die Überlieferung oft von großemReiz ist, dazu, Geschichten anstelle von Geschichte zu bieten. Diese Verführung ist im Hinblick auf die Jugendberichte besonders groß. Gerade hier tritt hervor, daß die Chronisten des Mittelalters kein naturgetreues Bild seiner Persönlichkeit in ihren Entwicklungsphasen malen wollten. Natürlich wollten sie nicht lügen, aber ihre Darstellung diente nicht der Befriedigung eines historischen Interesses, sondern der Erbauung. Deshalb preßten sie die 101
ihnen überkommenen Nachrichten in ein vorgegebenes Gesamtschema. 1 CEL malt die Jugendgeschichte des Franziskus in düsteren Farben. Um so deutlicher hebt sich die auf seine „Bekehrung" folgende Lebensperiode von der Jugend ab. Schon bald aber konnte man es im Orden nicht mehr ertragen, daß dessen Gründer in seiner Jugend nicht den geistlichen Anforderungen entsprach. Schon in 2 CEL beginnt daher die auch in 3 Soc feststellbare Tendenz, an die Stelle eines Bruches eine stetige Entwicklung treten zu lassen, und dieser Trend erreicht bei BON seinen Abschluß. Die Forscher neigen dazu, die Darstellung von 1 CEL für historisch echt und die folgende für dogmatisch verfremdet zu erklären. Daran ist etwas Wahres: Franz nahm selbst, wie sein Testament beweist, in seinem Leben einen scharfen Bruch wahr und betrachtete es vor seiner Bekehrung als ein Leben in der Sünde. Er bringt jedoch keinerlei Einzelheiten über seinen damaligen Lebenswandel. Daß er angesichts seines späteren radikalen Leitmotivs, das er restlos in Realität umzusetzen bestrebt war, seine Jugend entschieden abwerten mußte, ist fast selbstverständlich. Es besagt noch wenig darüber, wie ein objektiver Historiker der Gegenwart über Franz' Jugend urteilen muß. Man muß sich klarmachen, daß die beiden divergierenden Darstellungsschemata wegen ihrer Tendenz mit Vorsicht zu betrachten sind. Ernst Benz hat schon 1934 in seiner berühmten Monographie „Ecclesia spiritualis" diesen Sachverhalt mit dankenswerter Deutlichkeit ins Bewußtsein gehoben. Danach liegt der ersten Darstellung Celanos die Idee der Wiedergeburt zugrunde. 2 CEL dagegen neigt dazu, schon in der Kindheit des Heiligen allerorten Gottes geheimnisvolles, freilich dem oberflächlichen Blick noch verborgenes Walten wahrzunehmen. BON vollends formt Franz' Jugendgeschichte nach dem Bild der Kindheitsgeschichte Jesu um. Was er darstellt, ist die Entwicklung eines geistlichen Heroen, denn sie ist verstanden als Verwirklichung von Anlagen, die von Anfang an kraft Gottes gnädiger Führung in ihm schlummerten, sich im 102
Lauf seines Lebens aber immer klarer entfalteten. Hier ist die Bekehrung nicht mehr Bruch mit der Vergangenheit, sondern deren Vollendung, Krönung und Erfüllung, und den glorreichen Abschluß dieser Entwicklung bildet die Stigmatisation. Es ist also geboten, bei der Darstellung der Jugend des Franziskus besondere Vorsicht walten zu lassen. Und es ist an manchen Stellen erforderlich, sich mit einem Möglichkeits- oder Wahrscheinlichkeitsurteil zu begnügen, statt absolute Sicherheit vorzutäuschen. Eines nämlich müssen wir von Anfang an in unser Bewußtsein heben: So reichlich die Quellen über Franz zu fließen scheinen, so bleiben doch viele wichtige Momente seines Lebens im ungewissen und sind deshalb auch in der Forschung umstritten; es gibt in unserer Kenntnis seines Lebens und Wirkens mannigfache weiße Flecken. Geboren ist Franz 1181 oder 1182 in der umbrischen Stadt Assisi. Deshalb ist er als Franz von Assisi in die Geschichte eingegangen. Sein eigentlicher Familienname aber lautete Bernardone, denn Pietro Bernardone war der Name seines Vaters; er begegnet in den Urkunden Assisis in einigen Varianten, weil es im Mittelalter in vielen Fällen noch keine feste Schreibform der Namen gab. Auch Franz' „Vorname" ist nicht original, denn er wurde auf den Namen Giovanni getauft. Warum wurde er trotzdem Francesco genannt — ein Name, den die katholischen Forscher meist in seiner latinisierten Form und die evangelischen Forscher in der Regel in seiner deutschen Übersetzung verwenden? Wir wissen es nicht genau, denn es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es heißt, der bei seiner Geburt abwesende Vater habe ihn „Francesco" gerufen. Sein Vater hatte oft in Südfrankreich zu tun. Schätzte er dieses Land so, daß er seinen Sohn mit dem damals sehr ungewöhnlichen und etwas stutzerhaft klingenden Namen „der Franzose" rief? Oder geht dieser Name gar nicht auf die Initiative seines Vaters zurück, sondern ist nur ein später gebräuchlich gewordener „Spitzname", der Franz wegen seines jugendlichen Gehabes beigelegt 103
wurde? Oder hat schon dieser Name theologische Hintergründe? Die Provence war nicht nur der Stammsitz der Troubadoure, mit denen Franz von der früheren Forschung wohl vorschnell zusammengebracht wurde, sondern auch das Zentrum der religiösen Bewegungen. Hier wirkten Waldenser wie Katharer; offenbar waren sie bis zur Stadt Assisi vorgedrungen, und Franz ist mit ihnen schon in seiner Jugend in Berührung gekommen; zuweilen wurden sie vom Volk einfach als „Franzosen" bezeichnet. Sollte etwa der Vater auf seinen Reisen nach Südfrankreich wie andere Kaufleute dieser Zeit mit derartigen Strömungen persönlich bekannt geworden sein? Das paßt freilich wenig zu dem Bild, das die „Legenden" von ihm entwerfen. Es gibt noch eine letzte Erklärung für den Namen. Früher nahm man allgemein an, daß Franzens Mutter Pica eine Adlige aus der Provence gewesen sei. Man konnte sogar Überlegungen darüber anstellen, auf welchem großen Handelsplatz in Südfrankreich der Vater sie kennengelernt haben könnte. Genaue Überprüfungen italienischer Lokalforscher führten jedoch zu einem negativen Ergebnis. Tatsächlich wissen wir über die Mutter fast nichts. Daß sie in einer „Legende" als „Domina Pica" bezeichnet wird, braucht nicht auf adlige Herkunft zu deuten, denn „Herrin" konnte schon damals eine allgemeine Geschlechtsbezeichnung sein. Wir müssen uns deshalb auch von der Deutungsmöglichkeit trennen, Franz habe seinen Namen vom Vater als Ausdruck der Hochachtung vor der Mutter erhalten. Dagegen verdienen die überkommenen Nachrichten über den Vater unser Vertrauen. Pietro Bernardone gehörte zu den Großkaufleuten und damit zu den reichsten Männern von Assisi. Er war ein Tuchhändler, der sich oft auf Geschäftsfahrten befand. Seine Reisen führten ihn offenbar besonders häufig nach Südfrankreich. Es war damals üblich, daß Tuchhändler im Fernhandel engagiert waren. Zugleich waren sie als Geldleiher tätig, weil sich das hauptberufliche Gewerbe eines Bankiers noch nicht entwickelt hatte. Er muß also ein Mann von Kapital gewesen 104
sein. Dafür spricht auch, daß er in Assisi selbst eine Tuchhandlung betrieb. Audi Gesellen und Mitarbeiter müssen in seinem Dienst gestanden haben, die in der Lage waren, während seiner Abwesenheit das Geschäft zu leiten. Er hatte ausschließlich mit wohlhabenden Leuten zu tun, denn das niedere Volk war weder imstande noch willens, sich teure Stoffe zu kaufen, sondern webte sich seine grobe Kleidung selbst. So kann es nicht verwundem, daß es Pietro Bernardone als Vertreter des aufstrebenden Bürgertums sichtlich gelang, auch politisch in seiner städtischen Kommune Einfluß zu gewinnen und an der Verwaltung der Stadt Anteil zu nehmen, wie dies Arnaldo Fortini nachweisen konnte. Zwar war die gesellschaftliche Entwicklung in Mittelitalien, das unter dem direkten Einfluß des Papstes stand, nicht so weit fortgeschritten wie in der Lombardei, aber es gelang doch einigen umbrischen Städten, die an der Fernverkehrsstraße vom Norden nach Rom lagen, die anderen Gebiete Mittelund Süditaliens hinter sich zu lassen. Assisi erhielt 1198 den Rang einer Kommune, als Umbrien, das bisher unter deutscher Oberherrschaft das Herzogtum Spoleto gebildet hatte, in den Kirchenstaat aufgenommen wurde. Vielleicht hatten Bernardones Vorfahren eine solche Entwicklung vorausgesehen, denn sein Vater war vermutlich aus dem westlich Florenz gelegenen Lucca eingewandert, wo er als Tuchhändler tätig gewesen war und wo seine Familie schon seit mehreren Generationen das Tuchmacherhandwerk betrieben hatte. Der junge Francesco lernte mithin den Lebensstil und das Selbstverständnis des emporstrebenden Großbürgertums — und die Tuchhändler galten als die wohlhabendsten und erfolgreichsten Kaufleute — aus eigener Anschauung kennen. Ihm standen alle Möglichkeiten offen, die der neue Reichtum erschloß, und er scheint sie zunächst weidlich genutzt zu haben. Vielleicht durfte er seinen Vater sogar gelegentlich nach Frankreich begleiten. Jedenfalls konnte er sich auch auf Französisch verständigen, wobei freilich berücksichtigt werden muß, 105
daß Italienisch und Französisch beziehungsweise Provencalisch einander damals sprachlich noch weit näher standen als heute. Er scheint gern in französischer Sprache gesungen zu haben, was früher meist mit seinem Ritterund Troubadourideal in Zusammenhang gebracht wurde. Indes fällt auf, daß nach einer Reihe gelegentlicher Andeutungen der Quellen Franz sich gerade dann sprechend oder singend der französischen Sprache bediente, wenn er sich in einem besonderen religiösen Hochgefühl befand. Das ist ein weiteres Indiz dafür, daß er Französisch mit den religiösen Bewegungen seiner Zeit eng zusammensah. Aber wie es sich damit auch verhalten mag, Franz als der älteste Sohn der Familie hatte selbstverständlich im Geschäft seines Vaters tätig zu sein und ist diesen Verpflichtungen zunächst offenbar bereitwillig und mit großem Geschick nachgekommen. Andeutungen der Quellen lassen vermuten, daß er zunächst als der natürliche Erbe seines väterlichen Betriebs galt. Sein geschäftlicher Erfolg ließ die Eltern auch wohl über die exzentrischen Züge seines Wesens anfangs hinwegsehen, ja sie sahen diese trotz gelegentlichen Murrens vermutlich nicht ungern, sofern der luxuriöse Lebensstil des jungen Mannes den eigenen Wohlstand sichtbar machte. Franz erhielt eine Bildung, die dem Stand der Familie entsprach. Da das Erziehungswesen damals noch fast ausschließlich in kirchlichen Händen lag, wurde er von den Priestern von San Giorgio in Assisi ausgebildet. Hier erlernte er die lateinische Sprache. Dies bereitete insofern keine großen Schwierigkeiten, als die italienische mit der lateinischen Sprache noch heute eine große Verwandtschaft aufweist. Damals gab es noch gar keine eigene italienische Schriftsprache, wenn auch im mündlichen Austausch des einfachen Volkes seit langer Zeit unterschiedliche italienische Dialekte verwandt wurden. Diese Dialekte standen dem Latein noch weit näher als die heutige italienische Sprache. Gerade das mag freilich Franz zu gelegentlichen Verwechslungen Anlaß gegeben haben, denn sein Latein — die damals selbstverständliche Schriftsprache aller Gebil106
deten — ist von italienischen Vokabeln durchsetzt. Man hat ihn deshalb oft als nur halbgebildet angesehen, zumal er sich selber später als ungebildet und als „idiota" bezeichnete. Dabei ist indes zu berücksichtigen, daß diese Selbstbezeichnung einerseits Ausdruck seiner Demut war, zum andern „idiota" damals nicht nur den Ungebildeten, sondern auch einfach den Laien im Gegensatz zum Kleriker bezeichnete. Gewiß ist sein Stil denkbar schlicht. Die einzelnen Sätze werden meist durch ein stereotypes „und" aneinandergereiht; von einem gesdiliffenen, formgewandten Stil kann man tatsächlich nicht reden. Audi hat Franz offenbar nach Möglichkeit nicht selbst zur Feder gegriffen, sondern seine Briefe und Regelfassungen lieber diktiert, da ihm das Schreiben wohl ebenso wie das Lesen eine gewisse Mühe bereitete. Er selbst unterzeichnete seine Briefe dann einfach mit einem das Kreuz symbolisierenden Zeichen (siehe Abb. 10). Daß er auf Formfragen keinerlei Wert legte, ist nicht in erster Linie Ausdruck seines faktischen Unvermögens, sondern entspricht seinem Wesen und seiner Zielstellung. Man sollte seine Bildung nicht zu sehr abwerten, denn sie gab ihm doch eine solide Grundlage für sein späteres Wirken, soweit dieses auf intellektuelle Hilfen angewiesen war. Seine Bildung übertraf jedenfalls das Durchschnittsmaß seiner Standesgenossen und war besser, als er selbst es zugab. Indes schien Franz über die Grenzen seines Standes hinauszustreben. War es persönliche Veranlagung, die ihn das Handwerk eines Ritters romantisch verklären ließ? Wollte er aus Ehrgeiz seinen Stand hinter sich lassen und in den niederen Adel aufgenommen werden? Es ist schwer, darüber Sicheres zu sagen. Man sprach oft davon, daß ihm der Sinn für romantische Abenteuer wie ein starkes ästhetisches Empfinden von der zärdichen und gefühlvollen Mutter überkommen seien. Die Mutter wird in ihrem Naturell gern dem angeblich gefühllosen und rohen Vater entgegengestellt. Dafür, daß Franz eine zärtliche Mutter besessen hat, spricht der Umstand, daß er später die mütterliche Fürsorge und das Gefühl der Ge107
borgenheit zum Symbol seiner neuartigen brüderlichen Gemeinschaft erheben konnte. Es ist auch anzunehmen, daß sein Vater in seinem Geschäftsgeist, der über dem Streben nach Erfolg alles andere zurücktreten ließ, ein typischer Vertreter des jungen Bürgertums war. Wir müssen jedoch auch damit rechnen, daß die „Legenden" den Vater karikierten, weil in den Mönchsviten das völlige Unverständnis des Vaters gern als Stilmittel benutzt wird, um den heroischen Geist des Helden um so heller erstrahlen zu lassen. Tatsache ist freilich, daß Franz von seinem Naturell her alles andere als ein typischer Kaufmann war. Er bildete offenbar früh ein reiches Innenleben aus, besaß eine Seele mit mancherlei weiblich-gefühlvollen Zügen, konnte stilvoll Feste feiern und hatte ein großes, zu seiner Zeit sonst wohl selten anzutreffendes Sensorium für das Feine und Anmutige einschließlich der Schönheiten der Natur. Auch muß ihm eine natürliche Heiterkeit und Beschwingtheit eigen gewesen sein. Er war ersichtlich sehr kontaktfreudig und konnte leicht Menschen zu Freunden gewinnen. Die ungewöhnliche Persönlichkeit, die mit ihrem seelischen Reichtum und ihrer Ausstrahlungskraft viele in ihren Bann zog, bildete sich sicher schon in der Jugend aus. So wurde der junge Franz, wie man gelegentlich formuliert hat, zum Haupt der Jeunesse doree von Assisi. Er sammelte viele junge Männer seines Standes um sich und feierte mit ihnen Feste, bei denen es höchst vergnüglich zugegangen sein muß. Man zog noch des Nachts singend und musizierend durch die Straßen der Stadt; man gab sich ausgelassen und liebte den Wein. Franz mochte wohl gern vor den anderen glänzen, und er verfügte über genügend Mittel, unterhalten zu können. Er galt als sehr gebefreudig, ja als ausgesprochen verschwenderisch, so daß die Eltern ihn gelegentlich zur Zurückhaltung ermahnen mußten. Die bürgerliche Anbetung des Geldes muß ihm wohl schon von Natur fremd gewesen sein; dazu aber kam der Ehrgeiz, die anderen zu übertrumpfen und eine unangefochtene Führerstellung unter ihnen ein108
zunehmen. Das war natürlich, an seinem späteren Lebensideal gemessen, ein Leben der Eitelkeit. War es jedoch ein Leben der Unmoral, ein Leben in den Abgründen des Schmutzes? Das war es sicherlich schon darum nicht, weil Franz von Natur ein feines ästhetisches Empfinden besaß und alle Berührung mit Unreinem ihm verhaßt war. Sollte er da das Unsaubere im moralischen Sinne geliebt haben? Die Angaben der Quellen, er habe nie die Zote ertragen, sind sicher glaubwürdig. Die Vergnügungen, denen man sich hingab, werden bei aller Ausgelassenheit meist harmlos gewesen sein, zumal der Südländer viel Empfinden für echte Festesfreude besitzt. Immerhin ist nicht auszuschließen, daß die vornehme Jugend zuweilen die gebotenen Grenzen des Anstandes überschritten hat. Es ist möglich, daß der junge Franz auch dem weiblichen Geschlecht gegenüber zu offen war, wenn er auch gewisse Formen der Höflichkeit und des Anstandes aus einer inneren Vornehmheit heraus stets beachtet haben wird. Es könnte sein, daß eine etwaige spätere Unsicherheit der Welt der Frau gegenüber mit auf gelegentliche Entgleisungen seiner Jugend zurückzuführen ist. Franz liebte auch die kostbare, auffallende Kleidung. So soll er sich, was damals ungewöhnlich war, ab und zu zweifarbig gekleidet haben. Man sang Chansons, deren Art wir nicht genau kennen, die aber wohl den Liedern fahrender Spielleute ähnelten, die damals, von Südfrankreich kommend, durch Italien zogen und besonders gern an Fürstenhöfen auftraten, waren sie doch selbst Ritter. Nach diesen „Jongleuren" hat man auch Franz als „Spielmann Gottes" bezeichnet. Die ritterliche Kultur erfreute sich im Zusammenhang mit den Kreuzzügen, die auch den Kaufleuten neue Märkte erschlossen, allgemeiner Wertschätzung. Audi Ritterepen waren Franz vielleicht teilweise bekannt und beeinflußten seine Lebenseinstellung. Dies alles muß bei ihm einen unklar-schwärmerischen Zug gehabt haben und war wohl in erster Linie Ausdruck der Sehnsucht nach einem andersgearteten Leben, das ilm innerlich ganz auszufüllen vermocht hätte, 109
verfügte er doch über eine sehr lebendige und zuweilen ausschweifende Phantasie. Kurt-Victor Selge formuliert, es habe in ihm eine unbestimmte Unruhe gesteckt, die ihn zu neuen Zielen, einer reicheren Verwirklichung der in ihm schlummernden Möglichkeiten getrieben habe. Jedenfalls suchte er sich schon in seiner Kleidung jungen Adligen anzugleichen. Als Mitglied einer angesehenen Kaufmannsfamilie erregte er damit zwar ein gewisses Aufsehen, aber doch nicht eigentlich Mißfallen, zumal das reiche Bürgertum danach strebte, einen Adel neuer Art auszubilden. In Italien wetteiferten die kleinen Höfe mit den Stadtstaaten Florenz und Mailand darin, prachtvolle Turniere und Lanzenrennen zu veranstalten. Franz brauchte nicht unbedingt dem Beruf seines Vaters treu zu bleiben. Seine Familie war hinreichend begütert, um ihm eine standesgemäße ritterliche Lebenshaltung zu ermöglichen. Gerade in den lateinischen Kreuzfahrerstaaten des Nahen Ostens suchte man zur Stärkung der militärischen Macht waffenfähige junge Männer zu gewinnen und verlieh Kaufleuten bereitwillig die Standesrechte eines Ritters. Dem kam entgegen, daß Franz, wie es scheint, den starken Trieb besaß, sich an aufsehenerregenden Handlungen zu beteiligen, die große Anstrengungen erforderten und sogar das Leben kosten konnten. Einiges deutet darauf hin, daß ein starker Geltungstrieb ihn nach unvergänglichem Ruhm dürsten ließ. Natürlich war für das Waffenhandwerk auch viel Willenskraft und Härte nötig. Man darf die Entschlossenheit und Energie im Wesen des Franziskus über seinen künstlerischen und eher weichen Zügen nicht übersehen; er war eine Persönlichkeit mit starken inneren Spannungen. Wie ganz Italien, so war auch die Stadt Assisi mit dem ständigen Kampf zwischen dem deutschen Kaisertum und dem Papsttum konfrontiert, sah sich von beiden Gewalten bedroht und strebte nach möglichst großer Eigenständigkeit. Assisi beteiligte sich in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts an den großen Unabhängigkeitskämpfen gegen das deutsche Kaisertum. Dafür wurde die Stadt 110
1174 vom Kanzler des Reiches, dem Mainzer Erzbischof Christian, nach der Einnahme hart bestraft; sie verlor einige Jahre später ihre relative Selbständigkeit und mußte sich dem vom Herzog von Spoleto eingesetzten schwäbischen Adligen Konrad von Yrslingen unterwerfen. Dieser errichtete oberhalb der am Abhang des Gebirges gelegenen Stadt eine große Zwingburg, von der aus er die Bewohner der Stadt, die von Haß gegen ihn erfüllt waren, in Schach hielt. Als aber der erst zweiunddreißigjährige Sohn Barbarossas, Heinrich VI., 1197 plötzlich der Malaria erlag, war dies das Signal für viele italienische Städte, sich von der deutschen Fremdherrschaft frei zu machen. Konrad von Yrslingen suchte zwar durch Paktieren mit dem soeben den päpstlichen Thron besteigenden Innozenz III. seine persönliche Macht zu bewahren und begab sich an die Kurie, um sein Lehen aus der Hand des Papstes neu zu empfangen. Aber noch während seiner Reise stellten ihn die Bewohner Assisis, die nicht die eine mit einer andern Fremdherrschaft vertauschen wollten, vor vollendete Tatsachen. Sie schleiften die verhaßte Zwingburg, deren Ruinen noch heute erhalten sind, und bauten mit Hilfe des Materials in Windeseile die Stadtbefestigungen einschließlich der Stadtmauern aus, um sich wirksamer als bisher verteidigen zu können. Es ist anzunehmen, daß auch der etwa siebzehnjährige Franz an diesem Werk seinen Anteil hatte; er konnte später seine Kenntnisse im Mauerbau gut verwenden, als er zerstörte Kirchen aus eigenem Antrieb wiederherstellte. Der größte Teil der Befestigungsarbeiten wurde vom niederen Volk, den Minores, ausgeführt; deren Selbstbewußtsein war infolge dieser ergebnisreichen Aktion stark gewachsen. Sie waren nicht länger gewillt, sich von den einheimischen Tyrannen, den reichen Majores, unterdrücken zu lassen. Will man ihren Kampf voll würdigen, so muß man berücksichtigen, daß die Sklaverei in Assisi erst 1202 abgeschafft wurde, die Leibeigenen aber kaum besser gestellt waren als die bisherigen Sklaven. Die 111
große Mehrzahl der Adligen leistete hartnäckigen Widerstand und verbarrikadierte sich in ihren Häusern. Einzelne Häuser wurden von den Volksmassen in Brand gesteckt. Bei den Kämpfen fanden mehrere Adlige den Tod. Andere entkamen oder befanden sich in größerer Sicherheit in ihren Schlössern außerhalb der Stadt. Sie verrieten ihre Stadt und wandten sich um Hilfe an ihre mächtigen Standesgenossen in dem nahe gelegenen Perugia; es überragte Assisi an Bedeutung und strebte seit langem danach, die kleinereNachbarstadt unter seine Botmäßigkeit zu zwingen. Noch als zwei Jahrzehnte später Franz in Perugia öffentlich predigte, bekam er das militante Wesen der dortigen Adligen zu spüren. Während seiner Predigt jagten ständig Bewaffnete auf ihren Pferden an ihm vorüber und suchten die Versammelten zu provozieren. 1202 ergriff Perugia die Gelegenheit, sich in die inneren Angelegenheiten Assisis einzumischen, angeblich um dort die Ordnung wiederherzustellen. Die Truppen Assisis unterlagen in der Entscheidungsschlacht am Tiber. Die Folge war, daß Franz zusammen mit einigen Adligen Assisis, die auf der Seite ihrer Stadt gekämpft hatten, ein Jahr lang unter harten Bedingungen im Kerker von Perugia zubringen mußte. Er hatte also auf der Seite der Minores gekämpft, galt aber den Siegern als ein zum Adel Gehöriger, weil er offenbar in ritterlicher Manier das Kriegshandwerk und die Reitkunst erlernt hatte. Er soll seine Mitgefangenen aufgemuntert haben, indem er humorvoll über Kerker und Ketten — und ein damaliger Kerker war sehr strapaziös — spottete. Interessant ist außerdem die Nachricht, daß er erfolgreich den Streit eines Adligen mit seinen Standesgenossen geschlichtet und den verhängten Boykott aufgehoben haben soll; das spricht dafür, daß er schon als junger Mann den unmenschlichen Charakter starrer Etikette erkannt und diesem entgegengewirkt hat, vielleicht auch für das ihm wohl angeborene gute und mitfühlende Herz. Die Gefangenen wurden erst Ende 1203 in ihre Heimat entlassen, als der Bürgerkrieg in Assisi mit einem Kompromiß be112
endet worden war. In einem Vertrag zwischen Adel und Bürgerschaft von Assisi wurde festgelegt, daß die geschädigten Adligen Anspruch auf Wiedergutmachung hätten; andererseits mußte der Adel erklären, daß er ohne das Einverständnis der Bürgerschaft keine Bündnisse mit auswärtigen Kräften mehr schließen werde. Für Franz, der nach der Rüdekehr zunächst die alte Lebensweise wieder aufnahm, schien sich eine letzte Möglichkeit zu ergeben, damit er sich ritterlichen Ruhm erwerben und vielleicht für immer in den Ritterstand aufgenommen werden konnte. In Süditalien tobte seit Jahren ein erbitterter Bürgerkrieg. Er war die Folge des Todes Heinrichs VI. und seiner normannischen Gemahlin Konstanze, der ein machtpolitisches Vakuum in diesem Gebiet geschaffen hatte. Innozenz III. suchte die Gelegenheit zu nutzen, um das frühere normannische Königreich in Sizilien und Süditalien in ein päpstliches Lehen unter seinem bestimmenden Einfluß zu verwandeln. Einige durch die Staufer in diesem Gebiet angesiedelte deutsche Adlige strebten danach, ihre bisherige Macht zu behaupten. Von ihnen waren einzelne jetzt bereit, obwohl sie vorher streng kaiserlich gesinnt gewesen waren, um der Aufrechterhaltung ihrer Macht willen in den Dienst des Papstes zu treten. Das machte sich der französische Graf Walter (Walther) von Brienne zunutze, der aus egoistischen Motiven die Gegensätze unter den kleinen Vasallen dieses Gebietes systematisch schürte und einen grausamen Kleinkrieg mit viel militärischem Geschick trieb. Er baute auf den allgemeinen Haß gegen die deutsche Fremdherrschaft und ließ durch seine Emissäre in verschiedenen Teilen Italiens Freiwillige für sein Heer anwerben. Ihm gelang es, den Widerstand des deutschen Adels in Süditalien zu brechen und den Papst aus einer zeitweise aussichtslos erscheinenden militärischen Situation zu befreien. Als Walter selbst 1 2 0 5 fiel, wurde der Kampf in einer Woge des nationalen Hochgefühls fortgeführt. Auch ein Adliger aus Assisi wollte sich der Truppe des Grafen zugesellen, und Franz schloß sich seinem Ge113
folge an. Ob das Gerücht, er habe seine besonders kostbare Ritterrüstung mit der Kleidung eines unbemittelten Ritters vertauscht, zuverlässig ist, muß zweifelhaft bleiben. Indes auch dieser entscheidende Versuch des Franziskus, durch aktive Teilnahme am Krieg in den Ritterstand aufzusteigen, führte nicht zum Ergebnis. Die Ursachen dafür sind nicht klar, weil die Erzählung legendäre Züge trägt. Vielleicht ist der Kriegszug des Adligen aus Assisi überhaupt nicht zur Ausführung gelangt. Wahrscheinlicher ist aber nach der Aussage der Quellen, daß Franz aus irgendeinem Grunde — sei es eine erlittene Kränkung, sei es eine plötzliche Änderung seines Entschlusses — den Trupp verlassen hat und nach Assisi zurückgekehrt ist. Mag er vielleicht auch krank geworden sein — jedenfalls begann noch einmal das alte Leben; es sollte nicht mehr lange dauern.
11. Die Jahre des Umbruchs
Nach der Gefangenschaft in Perugia erkrankte Franz für eine gewisse Zeit lebensgefährlich, was zu seinem inneren Wandel beigetragen haben soll. Doch ist die Bedeutung dieser Krankheit für ihn nicht mehr präzise auszumachen, zumal in erbaulichen Darstellungen frommer Helden ein Krankenlager gern als Mahnung Gottes zur Umkehr im Hinblick auf die menschliche Vergänglichkeit gedeutet wird. Daß Franz ernster wurde und zur Schwermut zu neigen begann, war letztlich sicher in derUnsicherheitüber den einzuschlagenden weiteren Lebensweg begründet. Es ist uns nicht möglich, die Motive für seine Sinnesänderung im einzelnen schlüssig aufzuhellen. Jedenfalls vollzog sich die folgende Entwicklung nicht schlagartig, sondern in einem langwierigen Prozeß des Tastens und Suchens. BON spricht von einem längeren Entwicklungsprozeß vom Kleineren zum Größeren. Franz selbst deutete am Ende seines Lebens in seinem Testament diese Entwicklung so: „Parum steti et exivi de saeculo", was wohl am besten so zu übertragen ist: „Ich stand eine Zeitlang im Zweifel und verließ dann die Welt." Diese 114
Jahre des Suchens umfaßten den Zeitraum von 1206 bis 1209. Es war Franz wohl von Anfang an klar, daß der Eintritt in ein Kloster für ihn keine Lösung des Problems darstellte. Er wollte in irgendeiner Weise den Weg der religiösen Bewegungen gehen, ohne daß geklärt werden kann, in welchem Maße er dabei direkt von diesen beeinflußt wurde. Man dürfte nicht fehlgehen in der Annahme, daß er von Anfang an in dem Gesamtrahmen der Bewegungen einen persönlich geprägten, eigenständigen Weg einschlagen wollte. Er lehnte das Mönchtum nicht als solches ab, suchte aber für sich selbst eine noch höhere geistliche Existenzweise. Während des langen Ringens um Klarheit stand sein Leben naturgemäß unter einer starken inneren Spannung. Der bisher so kontaktfreudige junge Mann suchte jetzt gern die Einsamkeit auf, nur von einem gleichaltrigen Freund begleitet, der sich ihm anzupassen wußte. Er betete oft in Kirchen und besonders gern in einer Felsenhöhle vor der Stadt, die den Blicken Neugieriger verborgen war, bedeckten doch damals noch dichte Wälder die Gebirgszüge der Apenninen, wo dem Betrachter heute kahle Höhen entgegentreten. Er hat wohl um diese Zeit auch eine erste Pilgerreise nach Rom angetreten. Dort soll er die Gaben anderer Pilger weit übertroffen haben, was immerhin möglich ist, da er offenbar auch in Assisi um diese Zeit schon manche Armen beköstigte und bekleidete.Vor allem aber wird berichtet, daß er seine bürgerliche Kleidung für einen Tag mit einem Bettlergewand vertauscht und sich den andern Bettlern zugesellt habe, dabei französisch um Almosen bittend. Es ist durchaus möglich, daß er sich auf diese Weise selbst erproben wollte, ob er das nötige Maß an Selbstdemütigung aufbringe; als er die Probe bestand, soll er dies durch einen Freudenausbruch kundgetan haben. Eine andere Betätigimg dieser Zeit bestand für Franz darin, verfallene kleine Kirchen wieder instand zu setzen, für eine würdige Aufbewahrung der Hostien zu sorgen und sie mit Paramenten und ö l für die ewige Lampe auszustatten. Es könnte auch sein, daß er schon jetzt selber mit 115
dem Besen verschmutzte, weil wenig benutzte Kirchlein reinigte. Darin drückt sich einmal sein ästhetisches Empfinden aus, dem es nicht erträglich war, das Heilige in unwürdigem Zustand zu sehen, zum andern wandte er sich gerade den verfallenen Kirchen zu, weil sie in ihrer Weise den armen und demütigen Christus versinnbildlichten. Einzelnen Kirchen sandte er wohl auch sakrale Geräte und den Priestern Meßgewänder. Zu dieser Zeit lebte er noch zu Hause und wurde in seiner neuartigen Beschäftigung zunächst wohl nicht behindert, weil sein Vater sich oft auf Reisen befand und seine Mutter, die ihn besonders geliebt zu haben scheint, tatenlos zusah. Im Zeitraum 1207 bis 1209 besserte Franz eigenhändig drei Kirchen aus. Er begann mit der Kapelle San Damiano, nur eine Viertelstunde Fußweg von Assisi entfernt. Diese hochgelegene, baufällige kleine Feldkapelle von der Art, wie es viele um Assisi herum gab, besaß nur e i n e n Schmuck von künstlerischem Wert: einen großen Altarkruzifixus in altitalienisch-byzantinischer Art, der Franz stark beeindruckte. Er verkaufte im nahe gelegenen Foligno einen großen Tuchballen samt dem Pferd, auf dem er ihn dorthin gebracht hatte, nahm also zu dieser Zeit noch ohne Bedenken Geld an. Den Erlös wollte er dem Priester von San Damiano übergeben. Der hatte bereits zuvor mehrmals Geld von Franz für den Kauf von ö l angenommen, jetzt aber lehnte er das weit größere Geschenk ab, weil er wohl Ungelegenheiten mit dem Vater befürchtete. Franz warf den Geldbeutel in eine Fensternische der Kapelle, wo er unbeachtet liegen blieb. Bald äußerte Franz den Wunsch, bei dem Priester wohnen zu dürfen, was dieser gestattete. Nun machte er sich an die Ausbesserung der verfallenen Kapelle, wofür der Priester ihn mit Nahrung versorgte. Vor dem Vater, der ihn schließlich gewaltsam zurückschaffen wollte, verbarg sich Franz zunächst in der Felsenhöhle. Darauf stellte er sich selbst dem Vater, indem er freiwillig Assisi betrat, offenbar von Beschimpfungen der Menge begleitet. Der Vater behandelte ihn wohl recht grob und suchte ihn mit Gewalt 116
daran zu hindern, weiter einem Treiben nachzugehen, das er nur als närrisch ansehen konnte. Die nachsichtige Mutter ließ ihn jedoch bei Abwesenheit des Vaters wieder frei, und er begab sich aufs neue nach San Damiano. Jetzt betrieb der Vater bei den Konsuln der Stadt seine Ausweisung und leitete seine Enterbung ein. Die Konsuln ließen den Sohn des prominenten Bürgers ihrer Stadt vorladen; Franz aber verweigerte sich den Behörden, da er sich bereits als Person geistlichen Standes wußte, die nicht mehr einem säkularen Forum unterstand. Dagegen leistete er der Vorladung seines Bischofs, Guidos II. von Assisi ( 1 2 0 4 ^ 1 2 2 6 ) , sofort Folge. In der Vorhalle des bischöflichen Palastes begegnete Franz seinen Eltern. Er befolgte die Aufforderung des Bischofs, sein Geld dem Vater zurückzuerstatten, unverzüglich und tat ein übriges, indem er nach einem kurzen Verweilen in einem Nebenraum nackt — nach 2 CEL trug er ein härenes Gewand und ein Lendentuch — vor den Versammelten erschien und auch sein Kleiderbündel vor den Vater hinlegte. Damit vollzog er ostentativ den vollständigen Auszug aus der bürgerlichen Welt. Er brach jede Beziehung zum elterlichen Haus sofort ab und hat sich anscheinend nie um eine Wiederanknüpfung der Beziehungen bemüht. Dies zeugt von der Härte und eisernen Entschlossenheit, die Franz aufbringen konnte. Er erklärte vor den Versammelten, da jetzt Pietro Bernardone nicht mehr sein Vater sei, wolle er nur noch Gott seinen Vater nennen. Schon hier tritt sein Bestreben entgegen, die Folgerungen aus einer Neuerkenntnis kompromißlos zu ziehen. Der Bischof soll den nackten jungen Mann nach 1 CEL mit seinem Mantel bedeckt haben, während es sich nach BON um den ärmlichen Mantel des bischöflichen Gärtners handelte. Franz zeichnete mit einem Ziegelstein auf diesen Mantel ein Kreuz. Als er Assisi verlassen hatte, sang er auf Provencalisch. Die Szene vor dem Bischof dürfte sich im Frühjahr 1 2 0 7 abgespielt haben, vielleicht aber auch schon 1206. In den folgenden Jahren führte Franz—um mit Cuthbert zu sprechen—das Leben eines einzeln auftretenden Enthusiasten. 117
Er bekam freilich sofort die Unbilden eines solchen Lebens in aller Härte zu spüren. Schon auf seinem ersten Marsch soll er von Wegelagerern seines Mantels beraubt worden sein, dazu Mißhandlungen erduldet haben, obwohl er sich ihnen treuherzig als Herold des großen Königs vorgestellt hatte. Nur noch mit einem Hemd bekleidet, wandte er sich zunächst Hilfe suchend an das Benediktinerkloster inVallingegno. Dort wurde er jedoch entgegen der Ordensregel, weil man ihn für einen Landstreicher hielt, sehr unfreundlich behandelt. Er durfte zwar einige Tage in der Küche arbeiten, erhielt aber weder Kleidung noch ausreichende Nahrung und verließ die ungastliche Stätte notgedrungen wieder. Darauf wandte er sich an einen Freund in Gubbio, der ihn mit der notwendigsten Kleidung versah. Franz trug in den beiden folgenden Jahren die typische Eremitenkleidung: Er war mit einer kurzen Tunika, einem Ledergürtel, Sandalen, einem Wander- und Bettelsack sowie einem Pilgerstab versehen. Damit galt er als Eremit, ohne sich einer Eremitengenossenschaft anzuschließen. Es ist kaum noch auszumachen, ob er auf diese Weise zum Ausdruck bringen wollte, daß er dem eremitischen Leben am nächsten stehe, ob diese Kleidung als Schutz gedacht war oder ob er sie einfach als angemessene Pilgerkleidung betrachtete. In Gubbio wohnte Franz im Hospital, wo er sich eine Zeitlang der Pflege Aussätziger widmete. Er hatte sich schon vor dem endgültigen Bruch mit seinem Vater hin und wieder dem Dienst an Leprakranken gewidmet. Diese Bemühungen spielten in den Anfängen seiner geistlichen Wirksamkeit eine herausragende Rolle, ja Franz erinnerte sich in seinem testamentarischen Rückblick nur dieser Seite seines anfänglichen Wirkens. Sie war für ihn der offenkundige Beweis, daß er das alte Leben kompromißlos hinter sich gelassen hatte. Ursprünglich waren das schreckliche Aussehen und der üble Geruch vieler Leprakranker für ihn als einen sensiblen Menschen von abstoßender Wirkung. Als er einmal zu Pferde plötzlich einem solchen Menschen begegnete, floh er zunächst in 118
panischem Schrecken. Alsbald aber schämte er sich, kehrte zurück, küßte dem Kranken die Hand — eine Ehre, die man damals nur Adligen zu erweisen pflegte — und schenkte ihm alles Geld, das er bei sich trug. Sollte dieser Bericht fromme Legende sein, so steht doch fest, daß Franz in diesem Zeitraum besonders die Leprastation San Salvatore delle Pareti in der Umgebung Assisis aufsuchte und sich unter völliger Überwindung seiner natürlichen Abneigung selbstlos der Pflege von Leprakranken hingab. In dieser Selbstüberwindung konkretisierte sich für ihn zum erstenmal die bewußte willentliche Absage an sein bisheriges Leben. Franz war nicht der erste Fromme, der sich Leprakranken widmete. Uns sind ähnliche Berichte von verschiedenen Heiligen auch früherer Jahrhunderte überliefert, und auch die Gründerin der rechtgläubigen Beginenbewegung, Maria von Oignies, gab sich dieser Arbeit hin. Viele Orden waren ausschließlich zur Pflege Leprakranker gegründet worden, so unter Alexander III. der Orden der Cruzigerer (Kreuzträger), denen das Hospital bei Assisi gehörte, und der Ritterorden vom heiligen Lazarus. So gab es in den meisten europäischen Ländern Leprosenheime; insgesamt sollen zu Lebzeiten des Franziskus 19 000 solcher Stationen bestanden haben; dort lebten die Aussätzigen klosterähnlich zusammen und erhielten ihre Verpflegung. Sie nahmen wegen ihrer besonders trostlosen Lage unter den Armen und Kranken des Mittelalters eine bevorzugte Stellung ein. Ihr Schicksal verglich man in Auslegung von Jes.53,4 mit Leiden und Kreuzestod Jesu selbst. Durch die Kreuzzüge hatte sich diese Krankheit im westlichen Kulturkreis rapide ausgebreitet. Mochten auch einzelne Arten ungefährlicher sein als andere, die Lepra galt als sehr ansteckend und versetzte die Bevölkerung wegen der völligen Ohnmacht der Ärzte in panischen Schrecken. So wurden die Aussätzigen sämtlich aus ihrem bisherigen Lebenskreis verstoßen und mußten sich ständig in den Leprosorien aufhalten, die fast jede Stadt und viele Dörfer besaßen. Hier siechten sie langsam und unter Qualen 119
dahin. Durch eine Klapper mußten sie Vorübergehende auf die von ihnen ausgehende Gefahr aufmerksam machen. Geldspenden durften sie nur einer Schale entnehmen, die sie am Wegrand aufstellten. Durch eine besondere Tracht mußten sie sich kenntlich machen. Bald kehrte Franz zum Priester von San Damiano zurück. Er erbettelte für ihn in Assisi ö l und wohl auch Steine für seine Reparaturen. Dann aber begnügte er sich damit nicht mehr, sondern erbettelte in seiner Vaterstadt auch Nahrung für sich selbst, weil er sich nicht mehr von dem Priester beköstigen lassen wollte. Er war wohl zunächst des öfteren Beschimpfungen durch einen jüngerenBruder und durch den Vater ausgesetzt. Deshalb soll er einen Bettler für Kost damit beauftragt haben, ihn jedesmal zu segnen, wenn Familienangehörige ihn verfluchten. Die Speisereste bildeten in seiner Schüssel ein so unappetitliches Gemisch, daß er zuweilen nahe daran gewesen sein soll, sich schon bei ihrem Anblick zu übergeben. Aber auch hierin überwand er seine Gefühlsregungen mit eiserner Energie. Als er beim Betteln einmal an einem Haus vorüberkam, in dem frühere Freunde festlich versammelt waren, soll er sich zunächst geschämt haben, sich ihnen als armer Bettler zu zeigen, aber auch in diesem Falle war er so unerbittlich gegen sich selbst, daß er nicht nur bettelnd in das Haus ging, sondern den früheren Freunden auch seine Regung der Scham offen eingestand. Schon hier begegnet uns der Heilige, der niemals bei anderen eine bessere Beurteilung dulden wollte, als er sie wirklich verdiente. Im Frühjahr 1208 dürfte Franz seine Reparaturarbeiten an San Damiano abgeschlossen haben. Er führte in der Folgezeit ähnliche Arbeiten an San Pietro, einer damals vor den Mauern Assisis gelegenen alten Benediktinerkirche, und in der kleinen Feldkapelle Portiuncula durch; diese sollte bald für die franziskanische Bruderschaft eine große Bedeutung gewinnen; hier schuf Franz eine eigentümliche Form des Spitzbogengewölbes, die sonst nur in Südfrankreich vorkommt. So bewies er handwerkliches Geschick und Sinn für künstlerische Form. Die am Weg120
rand gelegene Kapelle Portiuncula hieß eigentlich Santa Maria degli Angeli. Sie soll schon 352 von Pilgern, die aus Palästina zurückkehrten, erbaut worden sein. Zeitweise war sie ein berühmter Wallfahrtsort gewesen und gehörte nun wie San Damiano der Benediktinerabtei auf dem Monte Subasio. Ein von dort kommender Priester hielt gelegentlich in der Portiuncula Messe, und Franz bot sich ihm als Meßdiener an, da er nun meistens bei diesem Kirchlein wohnte. Noch zweimal kehrte er zu derartigen Arbeiten zurück: 1213 baute er unweit San Gemini an einer Maria geweihten Kirche, und 1216 hatte er großen Anteil an der Ausbesserung von Santa Maria del Vescovado in Assisi, indem er den Chor renovierte und über dem Hochaltar einen kostbaren Baldachin anbrachte. 22. Die Anfänge der Bruderschaft und die Urregel Am 24. Februar des Jahres 1209 — nach Meinung einiger katholischer Forscher schon 1208 — hörte Franz in der Portiuncula das Tagesevangelium zu Ehren des Apostels Matthias, die Aussendungsrede Jesu an seine Jünger nach Mt. 10,5 ff. Dieser Text beeindruckte ihn derart, daß er ihn sich sofort nach der Messe vom Priester — man hält heute auch für möglich, daß es sich um einen Waldenser gehandelt habe — noch einmal erklären ließ. Voll Freude rief Franz dann aus: „Das ist es, was ich will. Das ist es, was ich suche. Das will ich von ganzem Herzen tun." Dieser freudige Ausruf zeigt, daß er den biblischen Text als Beseitigung der ihm bisher noch verbliebenen Unklarheiten über den einzuschlagenden Weg empfand. Neunzig Jahre zuvor war es Norbert von Xanten beim Hören dieses Textes ebenso gegangen, dreißig Jahre zuvor Waldes. Hier wurde nicht eigentlich ein vorgegebenes Ideal durch ein Bibelwort bestätigt, sondern im Hören auf die Bibel formte sich das Lebensziel selbst klar heraus. Laurentius Casutt formuliert in seiner Studie „Das Erbe eines großen Herzens", durch das Evangelium sei sein Ideal gewissermaßen modifiziert worden. Kein anderer 121
Ordensstifter sei so unmittelbar vom Evangelium abhängig wie Franz. Freilich hörte Franz diesen Text gleichsam in Auswahl. Verschiedenes daran wurde ihm äußerst wichtig, als das Zentrum aber empfand er offensichtlich Vers 9 und 10: „Verschafft euch nicht Gold noch Silber noch Kupfer in eure Gürtel; keine Tasche auf den Weg noch zwei Leibröcke noch Sandalen noch einen Stab, denn der Arbeiter ist seiner Nahrung wert." Bestimmte ihn der Gesamttext zur apostolischen Wanderpredigt, so ermunterte ihn Mt. 10,9 f. im besonderen, in wörtlicher Befolgung der Mahnung Jesu und in Nachahmung seiner ersten Jünger die Sandalen ebenso wegzuwerfen wie denPilgerstab und Wandersack und den Ledergürtel mit einem Strick zu vertauschen. Indem er fortan barfuß wanderte, übertraf er noch die Waldenser. Der Wandersack war nicht mehr nötig, weil Gaben nur für den gegenwärtigen Tag angenommen wurden; ein Geldbeutel verbot sich wegen der radikalen Distanz vom Geld. Der Strick diente dazu, das grobe Gewand zusammenzuhalten. Mit diesem Wechsel der Kleidung bekundete Franz, daß er das eremitische ebenso wie das mönchische Leitbild hinter sich zu lassen bestrebt war, um im Vollmaß Zeuge seines Herrn zu sein, und er legte größten Wert darauf, daß die Kleidung präziser äußerer Ausdruck seiner neuen Lebensweise sei, wollte er doch auch durch sie für die neue christliche Existenz werben. Die neue Kleidung war zunächst alles andere als ein Ordensgewand. Sie entsprach der Kleidung der umbrischen Bauern, die sich in ihrer Ärmlichkeit kaum von der Kleidung der Deklassierten unterschied. Es handelte sich dabei um einen langen bräunlichen Kittel aus roher Wolle, wie er noch heute in einigen italienischen Gebieten von Fischern und Hirten getragen werden soll. Freilich waren die Mitglieder der franziskanischen Bruderschaft bald an dieser Kleidung kenntlich, und insofern ist Kajetan Eßer mit der Auffassung im Recht, sehr bald hätten sich die Schüler des Franziskus durch diese Kleidung von Orden 122
und anderen religiösen Bewegungen auch im Bewußtsein des Volkes abgehoben. Zu einem eigentlichen Ordenskleid wurde es trotzdem erst durch Einwirkimg der Kurie, da diese daran interessiert war, die Unterschiede der Minoriten zu anderen kirchlichen Gruppierungen einzuebnen. Wie wenig Franz diese Kleidung als Ordenskleid empfand, erhellt schon daraus, daß er und seine Jünger sie sich von der Bevölkerung schenken ließen. Sie achteten dabei nur darauf, daß es sich um möglichst abgetragene und ärmliche Stücke handelte, wenn Franz auch die innere Freiheit besaß, ihm geschenkte neuwertige Kleidung zu tragen. Und er konnte sie oder Teile davon an Arme oder Bettler abtreten, was bei einer Ordenskleidung undenkbar gewesen wäre. Selbst seine ärmlichen Kleider empfand er sowenig als seinen Besitz, daß er sie des öfteren verschenkte. Einige Zeugnisse der „Legenden" beweisen zweifelsfrei, daß er gelegentlich in der Öffentlichkeit sich auf diese Weise völlig entblößt hat. Franz selbst trug nur Hosen und einen Kittel mit Kapuze. Die Kapuze war wohl ein oben an den Kittel angenähter Sack. Auch die Bauern liebten diese Kapuzen, weil sie sich mit ihrer Hilfe besser vor Unwetter schützen konnten. Franz allerdings machte auch dies an sich im niederen Volk allgemein benutzte Kleidungsstück zu einem Symbol seiner Lebensweise, indem er auf seine Kreuzesform Wert legte. Vielleicht trugen er und seine ersten Begleiter öfters auch mit Kreide oder Lehm gezeichnete Kreuze auf dem Rückenteil ihres Kittels. Ein Untergewand ohne Kapuze trugen weder Franz noch seine ersten Schüler; später dürfte es üblich geworden sein, und Franz gab dazu ausdrücklich seine Zustimmung. Es handelte sich aber bei der in späteren Jahren von ihm wohl erlaubten zweiten Tunika um ein Gewand, das man zum Wechseln der Kleider mit sich führen durfte. Ein solches Gewand zum Wechseln besaß Franz zumindest am Ende seines Lebens, weil das seine Krankheiten erforderlich machten. Da die Quellen berichten, er habe 123
mehrmals seinen Mantel verschenkt, muß er gelegentlich auch einen solchen getragen haben. Sowenig er einem Formalismus das Wort redete, so streng achtete er indes zunächst bei sich selbst, dann aber auch bei den Seinen darauf, daß sie sich nicht nach Art der Reichen mit bequemen Kleidern versahen. Als Vorbild nähte er sich ein grobes Tuch auf seine Kutte. Auch sein Sterbehemd ließ er nach SPEC 15 mit Sacktuch umhüllen. Die rauhe Kleidung war zwar beim einfachen Volk üblich, doch trugen die Minoriten sie wohl auch aus asketischen Erwägungen. Die beißende Wolle sollte sie vielleicht Tag und Nacht quälen und so zur Selbstabtötung beitragen. Die Brüder durften jedoch auf den Kittel außen und innen Stoffetzen nähen. Die geflickte Kleidung sollte sie vor aller Welt als Arme kenntlich machen. Die von innen aufgesetzten Flicken hatten bestimmte Körperstellen zu wärmen, denn mit nur einem Kittel bekleidet froren die Brüder zuweilen erbärmlich. Auch diese Kleidung war als Pilgertracht gedacht; die Brüder wollten ja die Wanderpredigt ausüben. Daß die Kleiderbestimmungen keine Theorie blieben, beweist die Chronik des Prämonstratenser-Propstes Burkhard von Ursperg, der schon 1210 auf einer Reise durch Italien die Minoriten kennengelernt hat. Er berichtet, daß sie im Sommer wie im Winter barfuß gegangen seien. Jakob vonVitry aber schrieb in einem Brief vom Oktober 1216: „Sie haben keine Pelze und kein Leinenzeug, vielmehr nur Tuniken aus Wolle, die mit Kapuzen versehen sind; auch haben sie keine Kappen oder Mäntel oder Kukullen oder irgendein anderes Kleidungsstück." Und in seiner Historia Orientalis bemerkt er, die neu in die Bruderschaft Eintretenden bekämen einen dünnen Strick mit Tunika und überließen alles andere der Vorsehung. Selbst nach der Regel von 1223 durften die Brüder nur im Notfall Fußbekleidung tragen. Noch der englische Erzbischof Grosseteste freute sich über die geflickten Ärmel der Brüder. Franz hatte zum Zeitpunkt der endgültigen Ausbildung seines Lebensziels noch nicht die Absicht, andere um sich 124
zu sammeln und aus ihnen eine Bruderschaft zu formen. Seine beginnende Predigt in Assisi und Umgebung, mehr aber wohl noch die Ausstrahlungskraft seines Vorbildes, zog aber schon nach mehreren Wochen Männer in seinen Bann. So wurde unversehens aus dem frommen Einzelgänger Franz der Kern einer Gemeinschaft. Franz stand offenbar diesem Zustrom zunächst mit einer gewissen Ratlosigkeit gegenüber, besaß er doch keinerlei Mittel mehr, um für die neuen Gefährten zu sorgen. Indes gewann wohl das Gottvertrauen alsbald die Oberhand über bestehende Bedenken. Franz warb keinen an; wer aber zu ihm stieß, der hatte sich sofort in vollem Maße der Lebensweise anzugleichen, die er sich selbst gewählt hatte. Er hatte gleich beim Eintritt in die Gemeinschaft seinen gesamten Besitz an Arme zu verschenken und so den völligen Bruch mit der bisherigen Lebensweise kundzutun. Eine Ausnahmestellung für Brüder, die den höheren Ständen entstammten, gab es dabei nicht. Die ersten Brüder kamen, gemäß dem damaligen Wirkungskreis des Franziskus, aus der Stadt Assisi und ihrer näheren Umgebung. Franz nahm unterschiedslos Männer aller Stände und Berufe bei sich auf, wenn ihre Berufung nur echt war, hatten doch für ihn die Standesschranken der übrigen Welt ihre Bedeutung gänzlich verloren. Viele von ihnen dürften ebenso jung gewesen sein wie er selbst; Franz war damals 27 Jahre alt. Schon seine Jugendlichkeit schloß in einem gewissen Maße ein Vater-Kind-Verhältnis zu seinen Gefährten aus; sie legte dagegen ein brüderliches Verhältnis nahe. Dies galt erst recht im Hinblick auf solche Brüder, die ihn an Alter wesentlich überragten und im Leben bereits eine prominente Rolle gespielt hatten, mochten sie zunächst auch eine kleine Minderheit bilden. Sein erster Schüler ist uns wie die meisten anderen Gefährten nicht bekannt; schon 1 CEL unterschlägt seinen Namen, die folgenden Darstellungen wissen nichts von seiner Existenz, weil er wahrscheinlich die Bruderschaft bald wieder verließ. So wurde der vermutlich zweite Schüler Bernhard von Quintavalle (gestorben nach 1241) — 125
den Familiennamen gibt freilich erst Bernhard von Bessa an — von BON zum ersten Jünger erklärt. Bernhard entstammte einer der angesehensten Familien von Assisi und war zuvor Rechtskonsular, nicht, wie früher oft angegeben, Kaufmann. Auch wenn er nur wenig älter gewesen sein sollte als Franz, so ist es doch durchaus glaubwürdig, daß er seinen Schritt gut überdacht hat und lange über den einzuschlagenden Weg im Zweifel blieb. Er lud Franz mehrmals in sein Haus und beobachtete ihn im stillen. Die Legende weiß zu berichten, daß er ihm sogar ein Nachtlager anbot und angesichts seines intensiven Gebetslebens endgültige Gewißheit erlangte. Bernhard war der erste Schüler, der sich auf dem Marktplatz von Assisi öffentlich seines gesamten Besitzes entäußerte, was Franz naturgemäß stark beeindruckte. Dagegen war der dritte Schüler nicht, wie früher behauptet wurde, Peter Catanii (der Familienname begegnet in vielen Variationen), sondern ein uns sonst unbekannter Peter, der dem einfachen Volk entstammte. Der spätere Schüler Catanii dagegen besaß gute juristische Kenntnisse, die er sich an der berühmten Rechtsschule in Bologna angeeignet und als juristischer Anwalt des Domkapitels, wo er eine reiche Pfründe besaß, genutzt hatte. (Die Angabe später Quellen, er sei Chorherr von San Rufino in Assisi gewesen, hat sidi nicht bestätigt.) Der vierte Schüler schließlich dürfte Ägidius gewesen sein, der den Erwartungen seines Lehrers wohl besonders entsprach. Über ihn sind wir besser informiert als über die meisten Schüler des Franziskus, da nach seinem Tode 1261 viele seiner Aussprüche in einer schriftlichen Sammlung verbreitet wurden, die wohl der Kreis um Leo herstellte, um dadurch an die ursprüngliche geistliche Lebensweise mahnend zu erinnern. Eine eigentliche Vita will diese Sammlung von kurzen und einprägsamen Sprüchen nicht sein. Die Sätze des Ägidius zeugen von großer Schlagfertigkeit und sind oft hintersinnig. Sein Leben war auch nach seiner Bekehrung recht vielgestaltig. Er befand sich oft auf Wanderungen, verrichtete mannigfaltige Ge126
legenheitsarbeiten, suchte mehr durch sein Beispiel als durch lange Reden seine Lebenserkenntnisse zu verbreiten, war als Bauernsohn im besten Sinne volkstümlich, begab sich zur Mission 1214 sogar nach Tunis, gab aber nach seiner Rückkehr 1215 sein Wanderleben auf und zog sich, darin ein Beispiel für seine Freunde der ersten Generation, in die „Einöde" zurück; auch diese gingen nach und nach in der Mehrzahl in kleine Niederlassungen, nachdem wohl auch Zeiten eines eremitischen und asketisch strengen Lebens für sie wichtig gewesen waren. Schon die bisherigen Beispiele belegen, daß die Schüler des Franziskus überwiegend dem einfachen Volk entstammten. Ausdrücklich stellt Franz noch in seinem Testament fest: „Und wir waren Ungebildete und allen Untertan." Dies dürfte auch von den meisten der Schüler gelten, die in den folgenden Jahren — gleichsam als zweite Generation — zur Bruderschaft stießen. Der bedeutendste ist unter ihnen der wohl 1210 eingetretene Leo, Priester aus Assisi (gestorben 1271), der für die Bewahrung der ursprünglichen Anliegen seines Lehrers später von besonderer Wichtigkeit geworden sein dürfte. Franz machte ihn zu seinem Sekretär und Beichtvater, vertraute ihm in dieser Eigenschaft manche Geheimnisse seines Glaubenslebens an und nannte ihn zärtlich — wohl in scherzhafter Antithese zu seinem Vornamen „Löwe" — „Bruder kleines Lamm Gottes". Er liebte an ihm vor allem „die große Reinheit und taubenhafte Unschuld". Auch viele andere frühe Schüler zeichneten sich durch ihre Herzenseinfalt und große persönliche Anhänglichkeit aus, die gewiß zuweilen naive Züge trug, aber sehr nach des Lehrers Sinn war. Das extremste Beispiel hierfür bietet der junge Bauer Johannes, der seine Wirksamkeit damit begann, daß er Franz mit dem Besen beim Reinigen einer Kirche half. Er wurde „der Einfältige" genannt, weil er seinen Lehrer so kindlich verehrte, daß er jede seiner Bewegungen nachzuahmen suchte. Man denkt auch an den sonst unbekannten Jacobus, der arglos mit einem Leprakranken spazierenging. Kaum weniger populär als Ägidius war Juni127
perus (Bruder Wacholder), der in origineller und zuweilen burlesker Weise mehr noch durch Handlungen als durch Worte Brüder, die zu erlahmen schienen, an ihr gemeinsames Lebensvorhaben erinnerte. Diese so schlichten Menschen besaßen eine erstaunliche Individualität, wenn ihre Bescheidenheit auch im allgemeinen verhindert hat, daß von ihnen zu uns Kunde drang. Franz nahm sogar Diebe und Räuber liebevoll bei sich auf. Neben den Brüdern aus dem einfachen Volk standen freilich von Anfang an die Brüder von vornehmer Herkunft. 1216 berichtet Jakob von Vitry von vielen ursprünglich Reichen unter den Brüdern. Tatsächlich gab es von Anfang an Adlige unter ihnen, meist Ritter. Der vielleicht Bekannteste war Angelus Tancredi, den Franz in der umbrischen Kleinstadt Rieti gewonnen hatte und der später längere Zeit an der Kurie weilte, wohl Franz' zwölfter Schüler. Da kann es nicht wundernehmen, daß Franz auch Anhänger aus dem Gebildetenadel und dem Stand der Gelehrten gewann. Der erste Priester, der zu ihm stieß, war Silvester von Assisi. Nach einigen Jahren standen die Kleriker, zunächst noch eine kleine Minderheit, neben den Laien. Bei den Brüdern, die 1221 nach Deutschland zogen, handelte es sich nach Giano schon um zwölf Kleriker und fünfzehn Laien. Unter den ersten Brüdern, die englischen Boden betraten, waren vier Kleriker. Julian von Speyer hatte am Hof des französischen Königs eine angesehene Stellung inne, Crescenz von Jesi war ein berühmter Arzt, Johannes Parenti ein Lehrer des Rechts aus Rom, Pacificus war als Meister des Liedes auf dem Kapitol preisgekrönt worden, Moricus hatte zur Genossenschaft der Cruzigerer gehört. In dieser Bruderschaft war für den schüchternen Rufinus, Abkömmling eines Adelsgeschlechts aus Assisi und naher Verwandter der Klara, den Franz zur Predigt gewaltsam zwingen mußte, ebenso Raum wie für den redegewandten Massäus, der durch seine stattliche Erscheinung und sein gewinnendes Wesen viele Herzen im Sturm eroberte. Über Klara selbst, eine frühe und sehr echte Schülerin von Franz, handle ich an dieser Stelle nicht 128
R pjpi s >ti\u 0 il-u-Vf-'. fern m i u n t t l u l ^ ^ Ä ^ J I J I J I : p
- - • - wh»; 'In j S w M M / f c y
.. ä r, , r u , ^ . « u J n ^ f J w Ä .
m«^ ^
iw?
•
•
.
-
pr»}m«j)r vo
V. ' -tuir-
J
,
«ttnjfo e r - Jimg—i iur-Utu
wc|UU..Tmr. I w p ^ " "
u4
»Mtfl^ " f « *
m«
.C-T-' : S>,
•»ftp 4k 4ui« W ¡Cn?

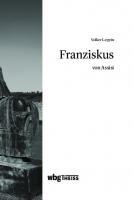
![Das Leben des heiligen Franziskus von Assisi [Neuausgabe ed.]](https://ebin.pub/img/200x200/das-leben-des-heiligen-franziskus-von-assisi-neuausgabenbsped.jpg)

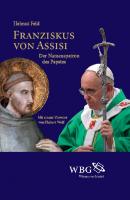

![Historische und beschreibende Darstellung von Persien, von den ältesten Zeiten bis auf die neueste [2]](https://ebin.pub/img/200x200/historische-und-beschreibende-darstellung-von-persien-von-den-ltesten-zeiten-bis-auf-die-neueste-2.jpg)
![Historische und beschreibende Darstellung von Persien, von den ältesten Zeiten bis auf die neueste [1]](https://ebin.pub/img/200x200/historische-und-beschreibende-darstellung-von-persien-von-den-ltesten-zeiten-bis-auf-die-neueste-1.jpg)

