Festschrift Ignaz Goldziher: Von Freunden und Verehrern gewidmet [Reprint 2020 ed.] 9783111651941, 9783111268248
206 62 103MB
German Pages 545 [552] Year 1911
Recommend Papers
![Festschrift Ignaz Goldziher: Von Freunden und Verehrern gewidmet [Reprint 2020 ed.]
9783111651941, 9783111268248](https://ebin.pub/img/200x200/festschrift-ignaz-goldziher-von-freunden-und-verehrern-gewidmet-reprint-2020nbsped-9783111651941-9783111268248.jpg)
- Author / Uploaded
- Carl Bezold (editor)
File loading please wait...
Citation preview
Zeitschrift für Assprio1og;ie, Band XXVI.
Verlag von Karl J. Trübner in Straßbur^;
FESTSCHRIFT
IGNAZ GOLDZIHER VON FREUiNDEN UND VEREHRERN GEWIDMET UND IN IHREM A U F T R A G HERAUSGEGEBEN VON
CARL BEZOLD.
MIT EINEM BILDNIS GOLDZIHER'S,
ZWEI TAEELX UND DREI ABB1LDUNGEX.
STRASSBURG VERLAG VON KARL J. TRÜBNER 1911.
Zeitschrift für Assyriologie Band X X V I und Band X X V I I Heft
VORREDE. Als Ältester derer, welche Ihnen, lieber G o l d z i h e r , je durch eine wissenschaftliche Arbeit ihre Verehrung ausdrücken, und als Ihr langjähriger Freund und Korrespondent darf ich es wohl unternehmen, eine kurze Vorrede für diese Festgabe zu schreiben, nachdem mich ihr Redaktor dazu aufgefordert hat. Die Gelegenheit zu der Ehrung bietet der Abschluß des vierzigsten Jahres Ihrer akademischen Tätigkeit, aber unser Motiv ist der Wunsch, die Anerkennung Ihrer hohen Verdienste um die Wissenschaft auszudrücken. Bei allen Ihren Arbeiten haben Sie als echter Philolog auch das Kleine sorgfältig und methodisch beachtet, aber doch immer den Blick auf die großen Zusammenhänge gerichtet und mit bestem Erfolg die Entwicklung geistiger Bewegungen historisch festgestellt. Nach verschiedenen Richtungen hin haben Sie unsere Kenntnis orientalischen Fühlens, Glaubens und Denkens mächtig gefördert. Ich hebe hervor, daß erst Sie das Wesen der muslimischen normativen Tradition ins wahre Licht gestellt haben. Mir liegt dies zu betonen eben besonders nahe, weil ich, wie Sie wissen, Ihnen da anfangs nur zögernd folgte, schließlich aber von der Richtigkeit Ihrer Auffassung völlig überzeugt worden bin. Vielfach haben Sie uns neue Beiträge dazu geliefert, zu erkennen, welchen Einfluß die drei großen aus Vorderasien stammenden Religionen auf einander geübt haben. Als umfassender Kenner der arabischen Theologie und Philosophie
IV
Vorrede.
haben Sie keinen Rivalen. Sie verstehen es meisterhaft, aus weitläufigen, abstrusen und ermüdenden Schriften die Quintessenz herauszusuchen und in anziehender Form darzustellen. Welch reichen Inhalt haben bei aller Gedrängtheit Ihre vor Kurzem erschienenen, prächtigen »Vorlesungen über den Islam«! So hat sich denn eine große Zahl von Orientalisten aus Europa und Amerika, ja selbst aus A f r i k a zusammengefunden, Ihnen ihre Verehrung zu bezeugen. Die Zahl würde noch größer sein, hätte der unerbittliche Tod nicht schon manchen der Freunde hinweggerafft. V o r Allem werden auch Sie unsern de Goeje vermissen. Möge es Ihnen, lieber Freund, vergönnt sein, noch bis zu einem fernen Ziele in glücklichen Lebensverhältnissen Ihre K r a f t im Dienste der Wissenschaft zu bewähren! S t r a s s b u r g im Dezember
1911.
Th. Nöldeke.
V
INHALT. Seite
Vorrede. Von Th. N ö l d e k e Berichtigungen
III VII
VERZEICHNIS DER BEITRÄGE. B a r t h , J . (Berlin) — Zur Kritik des Diwans der Hudeiliten . . . B a r t h o l d , W . (St. Petersburg) — Die persische Su'üblja und die moderne Wissenschaft B a s s e t , R e n é (Algier) — Contribution à l'étude du Dîwân d'Aous ben Hadjar B e c k e r , C. H. (Hamburg) — Christliche Polemik und islamische Dogmenbildung B e n c h e n e b , M. (Algier) — Poème didactique sur le féminin par Borhân ad-dïn Abu Ishâq Ibrahim ben 'Omar al-ôa'barï . . . B e r c h e m , M a x v a n (Crans, Schweiz) — Epigraphie des Danishmendides B e v a l i , A. A. (Cambridge) — The Hebrew word ^ ü p . . . . B e z o l d , C. (Heidelberg) — Zwei assyrische Berichte de B o e r , T. J . (Amsterdam) — ^ i f ^ j l B r ü n no w , R . (Princeton, NJ) — Zur neuesten Entwicklung der Meschetta-Frage B u d d e , Karl (Marburg i/H) — Hos. 7, 12 B u h l , Fr. (Kopenhagen) — Die Krisis der Umajjadenherrschaft im Jahre 684 E e r d m a n s , B. D. (Leiden) — Die Naiim haffobeoth . . . . F r i e d l a e n d e r , I. (New York) — Qirqisânï's Polemik gegen den Islam G e y e r , R . (Wien) — Al-Samau'al ibn 'Âdiyâ G o t t h e i l , R i c h a r d (New York) — A Fetwa on the Appointment of Dhimmis to office G r i m m e , H u b e r t (Münster i/W) — Über einige Klassen südarabischer Lehnwörter im Koran G u i d i , I g n a z i o (Rom) — Il Codice sacerdotale H a r t m a n n , M a r t i n (Hermsdorf-Berlin) — Qusaij H i r s c h f e l d , H. (London) — Ein Karäer über den Mohammed gemachten Vorwurf jüdischer Torähfälschung H o u t s m a , M. Th. (Utrecht) — Die Hashwïya J a c o b , Georg (Kiel) — Sejjid Gazi J u y n b o l l , Th. W . (Leiden) — Über die Bedeutung des Wortes Taschrxk
277 249 295 175 359 477 37 114 400 521 30 442 33 93 305 203 158 16 435 111 196 240 393
VI
Inhalt. Seite
K a h l e , P a u l (Halle a/S) — spiel K e r n , F r . (Berlin) —
Marktszene aus einem egyptischen Schatten484
Murgitische und antimurgitische Tendenztraditionen
in Sujutî's al Id all*
al maçnïi'a
f i l ahâdit
L i t t m a n n , E n n o (Straßburg i/E) — L o w , I m m a n u e l (Szegedin) —
.
169
Ein nordabessinisches Heldenlied
al maudû'a
504
Aramäische Lurchnamen.
SoL y a l l , C. J. (London) — ^ s i =
I. Eidechsen
126
Metre
388
M a c d o n a l d , D u n c a n B . (Hartford, Conn.) — amulet D i e Doppeldaten
Description of a silver 267
M a h l e r , E d . (Budapest) von Assuan
—
der aramäischen Papyri
M a r ç a i s , W . (Algier) —
L'alternance vocalique a-u (a-i) au parfait du
61
verbe régulier (I^ re forme) dans le parler arabe de Tanger M a r g o l i o u t h , D . S. (Oxford) — M e z , A . (Basel) —
.
414
On Ibn al-Mu'allim, the Poet of W ä s i t
.
334
V o n der muhammedanischen Stadt im 4. Jahrhundert
457
M i t t w o c h , E u g e n (Berlin) — Altarabische Amulette und Beschwörungen
270
Nicholson, Reynold
215
N ö l d e k e , Th. Punktation
A . (Cambridge) —
(Straßburg i/E) —
.
.
Inkonsequenzen in der hebräischen
P o z n a n s k i , S a m u e l (Warschau) — schem Psalmenkommentar R h o d o k a n a k i s , N . (Graz) —
Ibrahim b. A d h a m
38
Zu arabisch rti
382
R o t h s t e i n , J . W . (Breslau) — Jotham's Fabel (Jud. 9, 7 — 1 5 ) rhythmisch-kritisch behandelt S c h u l t h e ß , F r i e d r i c h (Königsberg) — S c h w a l l y , F r i e d r i c h (Gießen) — S e y b o l d , C. F . (Tübingen) —
Zu Süra 919.10 .
.
.
.
Ein arabisches Liber Vagatorum
Grägüjefac
S n o u c k H u r g r o n j e , C . (Leiden) —
.
.
.
22 148
.
.
420 408
Sa'd ès-Suwênî, ein seltsamer W a l î
in Hadhramôt Sobernheim,
1
A u s Mose ibn Chiquitilla's arabi-
221
M. (Berlin) —
Das Zuckermonopol unter Sultan Barsbâï
467
S t r z y g o w s k i , J o s e f (Wien) — Der große hellenistische Kunstkreis im Innern Asiens
.
.
;
531
S t u m m e , H a n s (Leipzig) — Gedanken über libysch-phönizische Anklänge
513
T a l l q v i s t , K n u t (Helsingfors) — Wallin
495
Ein arabischer Reisebericht von G. A .
T o r r e y , C h a r l e s C. (New Haven, Conn.) — Inscriptions W e 11 h a u s e n , J. (Göttingen) —
N e w Notes on some Old 77
Carmina Hudsailitarum ed. Kosegarten
N r . 56 und 75 Y a h u d a , A . S. (Berlin) —
287 Yemenische Sprichwörter aus Sanaa
Z e t t e r s t é e n , K . V . (Uppsala) —
Zwei Gedichte des Suheim
.
.
345
.
.
319
VII
BERICHTIGUNGEN. In
dem Artikel
des Herrn Prof. B a r t h o l d ,
der infolge einer längeren
Reise Korrektur zu lesen verhindert war, 1. S. 250, Z. 1 9 : den st. der; S. 254, Z. 24: befanden st. befunden; N . I, Z. 2 : dabiqi st. In;
Z. 10: unter st. neben;
st. dabiqi;
Z. 16: Himmelsgegenden st. Himmelgegenden;
S. 256, Z. 8: Ispahan st. Ispahan; Z. 1 6 : miiläbida
st. malähida;
approfondie st. affrondie; S. 258, Z. I I f.: der M u h ^ i r ü n S. 260, Z. 3 : iäzirgänän mus;
S. 2 6 1 , Z. 1 2 :
hiradmande D i l N n oder 2P|fr{\ D H K n . oder teils dieses, teils jenes hat, ist unsicher; s. NORZI zu den Stellen. 2) KITTEL hat hier 3) Beachte, daß hier durch die Verschiedenheit von Dagesh und Rafe ein wesentlicher Unterschied des Lautes entsteht, während sonst die Verschiedenheit der Vokalisation für das Ohr von geringer Bedeutung gewesen sein dürfte.
IO
Th. Xöldeke
17; Ps. 147, 7 neben 13JJ. 1 Sam. 12, 3 (freilich in andrer Bedeutung). Zuweilen tritt selbst __ ( ) in Konkurrenz, z. B. Onn Jes. 44, 27; N1? Ex. 20, 5. 23, 24; Deut. 5, 9 (neben und andern Formen mit .__); aber hier sind Imperativ-, resp. Vetativformen; vgl. 1 Chr. 28, 9. Jedoch auch Tl'p'inn Jud. 9, 9, 11, 13. Und so in e i n e m Vers irnNIV und irrwrv Jes. 44, 13. Selbst wo der Guttural von Haus aus einen Vokal hat, wird vereinzelt dieser nach einem Vorsatz getilgt; also im direkten Gegensatz zu der gewöhnlichen Einschiebung eines Hatef-Vokals bei silbenschließendem Guttural: "iüyi lob 4,2; nSnS I Chr. 5, 26 (Andre r6[£); Fjtl'nS Haggai 2, 16; Jes. 11, 15; 1 ) IDN.S Ps. 105, 22. 149, 8 und vielleicht Num. 33, 3 neben IcnS Jud. 15, 10 und vielleicht Num. 30, 3. In nVTl sechsmal, VH! sechsmal, VHjl öfter ist ein außergewöhnliches einfaches Shwa mob. (sonst rvn, VH; Gen. 24, 60). Diese Vertretung eines Hatef-Vokals durch __ auch in n v r , r v n x , r r r r , ¡-itin u . s . w .
Neben den gewöhnlichen Hatef-Formen kommen aber auch noch mehrere andere vor.
So T^DO Ps. 73, 9; Tj^Oni
Ex. 9, 23 (aber "^¡T; "T^njn; ir^n:; 7|SnN); das _
soll hier
vielleicht ein langes l ausdrücken. Das stimmte einigermaßen zu "i^JTS Jes. 1, 3 1 ; Jer. 22, 1 (neben häufigem "i^JS wie nSjJS, nojtt Num. 23, 7 (Imp.); nSilNH (mit dem Ton auf 'N) öfter und zu nSyn Hab. 1, 15 (sonst oft nSyn). Wieder eine andre Behandlung solcher Silben in in^rNH lob 20, 26 (neben laSrtf"1 u. s. w.); UnKn Prov. 1,22. Daß hier eine Pual- und eine Pielform vorliege, ist kaum anzunehmen 1) Daß auch die rabbinische Überlieferang hier die Präposition 3 findet, ist nicht zweifelhaft.
Vgl. Targum und Pesh,
Inkonsequenzen in der hebräischen Punktation.
I I
und wird auch durch das wunderliche 7]"Grpn Ps. 94, 20 nicht wahrscheinlich. In außergewöhnlicher Weise statt eines
Hatef-Vokals
ein langer bei anlautendem X in D^rlX, Tj^rlN Jud. 1 9 , 9 (als PI. aufgefaßt; in Pausa), T^ilX, V^rtN u . s . w . ; VfiniN, TpnniN, DnniX 1 ) (aber t m . N , CiTnm.X,
nirnx, nlm.X), ferner in TnX
Jes. 21, 12. 56, 1 2 ; D12X (st. constr.) Jes. 1 , 3 ; Prov. 14, 4 (aber •qpox lob
39, 9;
DnyDXl. Zach.
7,14).
Ein vielleicht langes _T statt _: in VEhtr, ¡TChtr und in O T T T ' T V T T (neben VttHg., Hatef für Shwa mob. bei Nichtgutturalen findet sich gelegentlich. Einige Fälle hatten wir schon; ferner z. B . TpTjN'! Num.
24, 9;
"oinn Gen.
27,34,
38;
niontr Ez.
35, 9;
Ez. 4, 9, 10; -133^0 Num. 23, 25; njJOC'XI Dan. 8, 13 nuptfx, n^ptrxi) u. s. w. nie volle Einigkeit N O R Z I
z . B . zu 1 R e g .
la^rrtn (sonst
In diesem Punkt ist aber wohl
der Tradition 14, 2 1 ;
In gewissen Formen
Ps.
erreicht
39,13;
2
Chr.
worden. 1 2 , 1 3 u-
Vgl. passim.
fällt ein Vortonvokal bald weg,
bald bleibt er und wird dann verlängert.
E s heißt rnbX,
nntr"1 u. s. w„ aber n T p Jer. 3, 8, 11; rnj} 1 u. s. w. rny.3 Jes. 30, 33 neben ¡Ti^p Jes. 34, 9; Hos. 7, 4; r 6 i X Jer. 12, 1 2 ; ^X Deut. 4, 24. 9, 3; Joel 2, 5 neben n b i x trx Jes. 29, 6. 30, 30. 33, 14.
Ähnlich D^S'piy Ps. 8, 3;
D ^ i y Joel 2, 16; Thr. 4, 4;
lob 3, 16
neben
¡T^'V-
Soviel wir sehen, unmotivierte Verschiedenheit der Vokalisation in gleichen oder doch ganz ähnlichen Fällen finden wir auch sonst vielfach.
Ich führe einige auf: in^prpl Jes.
6, 3, 9; nbpn Gen. 19, 16, aber nSöpS Ez. 16, 5. —
N^DO
Micha 4, 8 im selben Vers mit rD^öü (wie n r b c p ) und sonst 1) Vielleicht Verwechslung mit der » K a r a w a n e « bedeutenden Partizipform
nnix Gen. 37,25; ninix jes. 21,13,
12
Th. Xöldeke *r6titoö ; - :
vv : v und
u . s . w . ,7
rü3~lC G e n . 41, 43,
sessivsuffixen. — i Sam. 33, 35
ID^I,
29, 3
—
¡"IJD, ; wofür
Beim folgender 1 1 , 20.
der
Weise:
20, 1 2 ;
J e s - 49- 4 ! n\Syn
Ex.
H o s . 5, 3 ;
."OD vT z u
32, 7;
N a h . 3, 5 ;
60, 5 ;
nrpn,
¡TSm
der
beiden
Jer.
1,10;
Num.
72, 8
jB3i, rnn
l o b 3, 6 ;
Sehr Wir
n ^ p n
der
^
haben
T]*! E x .
1, 3 ,
Micha 4,11;
sind
—
auch
^¡23 2 R e g .
11;
nrp.in a
der
rVNin
Ps.
apoc.
von
verschiedenen
Art
Sti^l N u m .
21,1;
]pni;
^T.l
Ex.
20;2)
4,
26;
l o b 36,
ffi'Jl o f t ,
15,
aber
]Sn,
"101, "10*1. a b e r ] J T 1 ,
^Nl;
G e n . 3 2 , 8. 3 3 , 1 ;
Jud.
7,16
S c h l i e ß l i c h n o c h «"VI, a b e r
die
3, 1 8 ;
1) Ü L w , j j L l i wie L i i , ) '• 1 n: W o ,
25,
u . s. w .
31, 49; 1,
in
Qal
da
fani;
^rrn
aber
ntrni;
Gen.
" i n " ! E x . 1 8 , 9.
da
2, 1 0
aus
Wir
v T ' '
Jer.
n^y.n;
u . s. w . ,
ntg'j,
-
H^iS;1)
öfter
öfter
zum
Teil
P r o v
auffallendem
Imperf.
B e i 2. G u t t . ] 0 ? l l
verschieden haben
aber
2 Reg.
19,
aber
Num.
des
—
49,21;
Punktation
"IT'??
Gestalten
—
Pos-
Gen.
¡"Up, VT
TVSrn),
aber
öfter
nach
öfter,
(mit
•n,2rn
Ezra —
D^SJ J e r . PDpttQ
die
neben
40, 4 ,
2 C h r . 24, 26,
36, 10;
iryjn, ifJNtt;
']}]}.
Ex.
lob 31,27
G e n . 1, 2 2 ;
rlIT
nur
Ps.
und
(da
starken Radikale. ns?i
24, 1 9 ;
^¡11 l o b
—
sich
so mit
U . s. w .
schwankt
7 , 8. 1 3 , 1 5 ,
öfter;
verschiedenen
erklären
•nb
war
v . 4.
29, 2 1 ;
Silbe)
'H 1 ?
ebd.
Jer. 33, 6
n^JJrn Ex.
1, 1 0 ;
erwarten
^Niüb
Ez. 6,12.
m r n
rnrn. —
i r ü- s n o : :v
T j a p t t b D e u t . 6, 7. 1 1 , 1 9 ;
J e s . 8, 1 7
ersten
Die
3, 4 ;
T P ^
ro^-ic, TT :•; und
2 Sam.
Verba
,n,.!!pl
—
rvü3"]D, aber
neben
Perf.
vni'woo. T : : ~
neben
i'N'lö^ P r o v . 3 1 , 1
JSPn,
aber
neben i ^ K O Ruth
6 ,> 2 2 .
i^1.
aber
Formen
des
DE3 ( P a u s a )
Nifal Ex.
von
16, 21
) '• V
2) Beachte, daß hier mit dem Einschub des V o k a l s der 2. R a d . erweicht wird, sodaß der Unterschied der Formen stärker wird.
Inkonsequenzen in der hebräischen Punktation.
neben
13
öfter; DCa Ez. 21, 12; töDa Jos. 7, 9; Jer. 6, 12 ne-
ben H3DJ Ez. 26, 2 und ohne Verdopplung HDDJ Ez. 41, 7 wie nj23jfl Jes. 19, 3 — p a Eccl. 12, 6; lOa Arnos 3 , 1 1 ; Itspa Ez. 6, 9 (aber nttpa lob 10, 1); l'Pta n n n (Pausa) Jes. 63, 19. 64, 2 (aber ohne Verdopplung l^ta D^in Jud. 5, 5).1) — Mit virtueller Verdopplung des Gutturals als ersten Radikals nna Mal. 2, 5;
i n a
Ps. 69, 4,
n n a
Cant. I, 6, in Pausa
Ps.
Tina
102, 4 und mit Auflösung nana Jes. 22, 23. Beim Impt. sg. f. und pl. m. Qal von ']}]} wird, je nachdem die Endung oder die Stammsilbe den Ton trägt,
_
V
oder
gesetzt, also z. B. im ersten Fall U Jer. 7, 29, im
andern l-fai Micha 1 , 1 6 . Wie weit hier aber die Bestimmung der Betonung natürlich, wie weit künstlich ist, können wir nicht mehr erkennen. die Imperativformen
Seltsam sind jedoch auf alle Fälle Num. 22, 1 1 , 17 2 ) und
^Tnx
Num. 22, 6. 23, 7. Bei den Verben 'KS zeigen sich verschiedene Inkonsequenzen der Vokalisation. Ich hebe nur hervor, daß im Buch lob die Pausalform "IDtf'l die vorletzte, sonst die letzte Silbe betont:
lob 3, 2. 4, 1 u. s. w., aber lOt^l Num. 1
24, 3, 15 u. s. w., und daß es 2 Sam. 6, 6 3; 1 R e g . 6, 10 fnN.11 heißt.
Ä
aber Jud. 16,
In der Vokalisation des fragenden H mit _ , mit oder ohne wirkliche oder virtuelle Verdopplung des folgenden Konsonanten herrscht viel Schwanken. Ich stelle hier nur zusammen Gen. 17, 17; ~pn3n Ez. 20, 30; 1) Die Aussprache mit } führt die Formen zu
über.
Das mag in
der Sprache wirklich geschehen sein, wie denn die Plenarschreibung in n ' 2 n Jes. 24, 3 für diesen Übergang spricht.
Aber dann müßte wohl im Per-
fekt die Verdopplung wegfallen. — Seltsam zu 'plQ2) S. oben S. 8.
Gen. 1 7 , 23 neben QnSlOa '
v :
:
I4
l'h. XölHcke
n n g y ^ S n Gen. 18, 21 mit V e r d o p p l u n g und PI2il?n Gen. 34, 31; n ^ a b
Gen. 27, 38 ohne V e r d o p p l u n g und f ü g e dazu das
g a n z u n g e w ö h n l i c h e D O W n 1 Sam. 10, 24. 17, 25; 2 R e g . 6, 32. A u c h die Vokalisation des A r t i k e l s H (¡1, n) ist in g a n z gleichen F ä l l e n nicht immer dieselbe. Schließlich noch e i n i g e Einzelheiten: B e i r n p y j j ' l N u m . 5, 16 g e g e n ü b e r n ^ t p y n i E z . 24, 11 und PH^l Jer. 9, 11
ge-
g e n ü b e r H T ^ l Jes. 44, 7 w i r d die d e f e k t i v e oder die Plenarschreibung
die
Punktation
bestimmt
haben,
ganz
D n t o n L e v . 2 3 , 1 0 und sonst g e g e n ü b e r DON^l!
wie
F ü r die B e u r t e i l u n g dieser Tradition ist das w i c h t i g ! w e r d e n so auch auf den Unterschied v o n 7, 4 u n d
in
Sam. 1 6 , 1 7 .
1
Wir
iTSÜ ^CNH Cant. T • :
•• T : T
"'Oittn Cant. 4, 5 k e i n G e w i c h t legen, obgleich
an sich beide F o r m e n richtig sein könnten. 1 ) F ü r die w i r k l i c h e S p r a c h e ist es g e w i ß v o n ebenso g e r i n g e r B e d e u t u n g , d a ß es v o r f o l g e n d e m A n l a u t N, ]} (nämlich bei ¡TUT, g e l e s e n "OIX, Gen. 6, 6; 2 S a m . 24, 16; Jer. 26, 19; D,ril7X Jona 3, 10;
1 Chr. 21, 15) Dn3*1 (mit B e t o n u n g der
Pänultima), sonst o n ^ l Gen. 24, 67. 38, 12; Ps. 106, 45 heißt. W a r u m von
(Pausalform
und v o n "IJS
also mit S h w a mob. des 2. R a -
dikals, gebildet wird g e g e n ü b e r unklar. und
Denn
7|5p1 Deut. 15,14. 16,13
^HD u. s. w., ist g a n z
daß ein unmittelbarer Zusammenstoß v o n -¡5
sonst nicht g e m i e d e n wird, z e i g e n F o r m e n w i e TO 1 .
Mal. 2 , 1 5 ; 1S2J Mal. 2 , 1 0 und J>3j?X E z . 2 2 , 2 0 ; p j ? n 13, 17 u. a. m. —
Die
seltsame W e i c h h e i t
Deut.
des S in n£lP>
P E i n »Pflaster«, w o f ü r E i n i g e noch deutlicher 1) Das zeigen die arabischen und aramäischen Formen. c ' n e an(lre Bildung. 26; D13Xi~! ' s t a ^ er
nSlP. DONln Ex. 36,
Inkonsequenzen
in der hebräischen
15
Punklaüon.
lesen, soll wahrscheinlich einen Unterschied von nSJJl »glühende Kohle« Jes. 6, 6 ausdrücken.
Warum aber
^"pD^.
Gen. 21, 6 gegenüber pnj^l Gen. 17,17; pnjiWl Gen. 18,12? Die virtuelle Verdopplung des Gutturals in t3inö Gen. 14, 23, pnt? oft und
Jes. 14, 3 (wo Andre "JTö) ist
nicht ohne Analogie, obgleich für JD in solchen Fällen sonst ö erscheint.
Ganz singulär ist aber fjnnQ 1 Sam. 23, 28;
2 Sam. 18,16 und gar ^ t ^ ö l Jes. 14,3 (wo Andre "101). Hat die hebräische Sprache zur Zeit ihres Lebens auch gewiß sowenig wie irgend eine andre volle Konsequenz in der Behandlung der Laute durchgeführt und mögen auch vielleicht die Unterschiede innerhalb unsrer Punktation eben noch Spuren echter Schwankungen zeigen, so haben wir doch nirgends die geringste Gewähr dafür, daß von zwei in der Punktation vorkommenden Lautvarianten jede gerade der betreffenden Schriftstelle von Haus aus gebühre. W i e Jesaia oder auch Esra, geschweige Debora das Hebräische ausgesprochen hatten, oder gar wie sich etwa die Sprache im Munde des Nordisraeliten Hosea von der seiner judäischen Zeitgenossen unterschieden hatte, das konnte die spätere Synagoge nicht wissen, und ihre Führer haben auch gar nicht daran gedacht, sich darum zu bemühen. Sie wollten nur die Rezitation des Gottesdienstes fest regeln und haben uns damit wenigstens einen zwar etwas künstlichen und in sich widerspruchsvollen, aber doch überaus dankenswerten R e flex der Aussprache des Hebräischen im letzten Stadium seines Lebens hinterlassen.
i6
Il Codice sacerdotale. Per Ignazio Guidi.
Per non preporre un lungo titolo ad un articolo brevissimo, ho scritto qui sopra II Codice sacerdotale, ma naturalmente non intendo parlare di esso in generale, e solo voglio accennare ad una questione relativa ad una piccola parte di esso. E la questione è la seguente: Neil' ipotesi che il detto codice sia stato composto in Babilonia, nella seconda metà del periodo dell' esilio, evvi connessione storica fra le condizioni degli Ebrei che vivevano colà e taluni luoghi del Codice? I quali mentre figurano nella parte narrativa del Codice, hanno tuttavia stretta attinenza con precetti religiosi. Farò alcune brevi considerazioni, mancandomi ora il tempo per estendere tali ricerche, e qui lo spazio per esporle in modo non troppo incompleto. Che la grandezza e potenza di Babilonia e i magnifici tempj e palazzi, in gran parte ricostruiti dallo stesso Nabuccodonosor, abbiano colpito profondamente gli animi degli esuli ebrei, è cosa che si ammetterà facilmente. Era una potenza ed una civiltà troppo superiore, nei riguardi materiali, che non poteva non impressionare gli Ebrei, i quali in numero relativamente non grande, si vedevano trasportati in mezzo ad una sì maestosa città. E questi Ebrei non avevano certamente il fervore e il zelo per la legge mosaica, propri del giudaismo posteriore; erano ancora lontani i tempi quando, per non mancare all' osservanza del sabato, si giungeva a farsi trucidare dai nemici, senza opporre resistenza.
!7
I. Guidi, Il Codice sacerdotale.
E che uno spirito profondamente religioso non fosse generale, lo mostrano i ripetuti rimproveri di Ezechiele, ed anche i passi analoghi del libro di Geremia; e in questo riguardo non sono privi di significato anche quei passi che si vogliono posteriori al profeta. Per es. la pericope del sabato ( X V I I 19—27) mostrerebbe, in ogni caso, la sua poca osservanza anco dopo il ritorno, fatto, del resto, ben noto dal passo di Nehemia X I I I 15. Questa condizione degli animi rendeva gli Ebrei più disposti a subire l'influenza babilonese anche in ciò che riguardava, più o men davvicino, credenze ed usi religiosi. A parte le vere defezioni, come il culto di Gad e Meni rimproverato nel libro di Isaia ( L X V 11), idee e concetti babilonesi dovevano diffondersi largamente. E un indizio che così fosse si può scorgere nel fatto che i detti concetti occorrono, se non esclusivamente, prevalentemente, nella letteratura che si ritiene posteriore all' esilio. Ricordo qui i miti babilonesi di Marduk e Tiàmat, Rahab, Behemoth e Leviathan. Una parte di questi, e in una forma che li ricorda più o men chiaramente, poteva esser nota da prima, come è il caso per Rahab, Is. X X X 7, ma la loro menzione più frequente è in testi posteriori, fino a giungere ad apocrifi come il I V di Ezra e il libro di Enoch. La relazione di questi luoghi con idee babilonesi è stata riconosciuta da parecchio tempo. Un altro esempio è il libro di Afoikar; è nota la sua influenza sulla letteratura ebraica posteriore, e nominatamente su scritti composti nella Diaspora, cioè il libro di Tobia. Ora la scoperta del papiro aramaico della colonia giudaica di Elefantina dimostra quanto antico è il passaggio di questo scritto presso gli Ebrei. Vale il medesimo per il capo X I V del Genesi, dal quale risulta conoscenza di tradizioni e letteratura assiro-babilonese, come, in parte almeno, per il libro di Daniele e quello di Ester, se in quest' ultimo si vuol riconoscere un fondo babilonese ed elamitico. Del resto, la disposizione naturale a subire l'influenza babilonese era accresciuta da una circostanza favorevole, cioè la relativa mitezza colla quale gli Ebrei erano Zeitschr. f. Assyriologie, X X V I
2
i8
I. Guidi
trattati in Babilonia e il pacifico convivere nel paese, ancora durante il regno di Nabuccodonosor; una dura e continuata tirannia avrebbe di molto diminuita quell' influenza. Per le persecuzioni del periodo greco e romano molto hanno sofferto gli Ebrei, ma l'idea giudaica molto deve ad esse. Senonchè agli occhi dei Sacerdoti e delle loro scuole in Babilonia, tale condizione di cose doveva costituire un pericolo per la religione avita degli Ebrei, e questo pericolo era tanto più grande in quanto che mancava ad essi un luogo di riunione religiosa per il culto regolare e l'istruzione — non più il tempio e non ancora la vera sinagoga. Ora è lecito dimandare : In alcuni luoghi d'indole narrativa del Codice sacerdotale, evvi relazione colle dette condizioni degli Ebrei e col pericolo che essi correvano di mancare ad obblighi religiosi? U n a grave preoccupazione del Codice è 1' osservanza del sabato; esso ha cura di conservarci la memoria di una, dirò così, storia edificante (Num. X V 32) dell'uomo condannato a morte, perchè raccoglieva legna in giorno di sabato. Nella storia della Creazione si ribadisce la santità del sabato, messo in relazione colla Creazione, ed Es. X X X I 13 s., si torna, quasi affannosamente, ad inculcarne l'osservanza — videte ut sabbatum meum custodiatis — custodite sabbatum mcum — custodiant filii Israel sabbatum — il sabato che, come in Ezechiele, è il segno dell' alleanza, è un patto perpetuo e per tutte le generazioni. Orbene qualunque soluzione si voglia dare alla questione sulla origine del sabato, egli è certo che, per i Babilonesi, esso non aveva affatto il carattere ed il significato che aveva presso gli Ebrei; per quelli era giorno nefasto, per questi giorno di gioia e di riposo, e tale si è poi sempre mantenuto. Vivendo pacificamente in mezzo a chi non lo osservava, gli Ebrei erano esposti a mancare nominatamente al precetto del riposo. Eatti analoghi non si sono veduti in Europa, in tempi recenti, quando la convivenza di Israeliti e Cristiani ha cessato di esser regolata da leggi vessatorie? L'influenza dell' esilio sulla l e g g e
Il Codice sacerdotale.
l
9
del sabato è nota, ma, se non erro, era il pericolo che correvano gli Ebrei di non osservarlo, che dovea spingere le scuole sacerdotali ad inculcarlo con tanta premura. U n altro punto inculcato nel Codice è che l'uomo è creato ad immagine di Dio, e, conseguentemente, che l'immagine di Dio è quella degli uomini. Questo è ripetutamente detto — ad imaginem suam, ad imaginem Dei — ad similitudinem Dei fecit illum — ad imaginem Dei factus est homo — Gen. I 27; V i ; I X 6; mentre nella letteratura anteriore non vi è di ciò menzione chiara. Io non discuto il profondo senso etico da riconoscere in queste parole, ma rilevo 1' opportunità di esse per gli Ebrei, che vedevano strane forme di divinità e di simboli di divinità, fornite di ali o per altro modo dissimili affatto dall' uomo, che invece dominava su tutti gli animali. Quale piacere prendessero gli Ebrei del tempo a rappresentanze figurate di animali e di uomini, si può trarre dagli acerbi rimproveri di Ezechiele ( V i l i 10; X X I I I 14). Era quindi importante ricordare che il Dio degli Ebrei non si doveva immaginare in alcuna forma strana o somigliante ad animali. Un altro grande precetto inculcato nella parte storica del Codice è la circoncisione, Gen. X V I I ; essa è imposta direttamente da Dio ad Abramo, ben anteriormente a Mosè, e deve durare per tutte le generazioni della sua discendenza; essa è 1' alleanza con Dio. Su questo precetto si torna relativamente alla Pasqua (Es. X I I 43) affinchè nessuno straniero o servo vi prenda parte, se non porti questo segno dell' alleanza con Dio, perchè nessuno può mancarne che faccia parte della comunità religiosa d'Israele. Ora la circoncisione, propria di tanti popoli dell' antichità, nominatamente affricani, non era praticata appunto dagli Assiri e dai Babilonesi. L a CTIÜO nS~in, di un popolo cioè che, credendosi superiore, schernisce chi non ha gì' istituti e gli usi propri, poteva ora avvenire al rovescio, da parte dei Babilonesi, che si sentivano vincitori e si credevano superiori agli Ebrei. V i era quindi pericolo che questi fossero tentati di non osser-
20
T. G u i d i
vare il precetto, ed era opportuno da parte delle scuole sacerdotali significarne l'importanza. Del resto, se queste parti del Codice avevano per iscopo di premunire gli Ebrei da un pericolo, per ciò stesso dovevano ripetere cose non nuove, ma già da lungo tempo conosciute ed ammesse come mosaiche, poiché altrimenti non avrebbero trovato fede. Un' altra circostanza mi sembra altresì esser notevole. Quando il codice inculca le cose che abbiamo dette, ha sempre cura di aggiungere che il precetto dato da Dio vale per tutte le generazioni, ed è un patto sempiterno, o, in altri termini, che esso conservava tutto il suo valore dopo tanti anni e tante peripezie che avevano profondamente alterato la vita ebraica. Chi viveva in Babilonia non avea ragione di sottrarsi a questo precetti, nè più nè meno di quelli che vivevano in Palestina — statuam pactum meum post te in g e n e r a t i o n i b u s t u i s , f o e d e r e s e m p i t e r n o — eritque pactum meum in carne vestra in f o e d u s s e m p i t e r n u m Gen. X V I I 7 , 1 3 etc. Nel ripetere il precetto del sabato s'insiste sulla medesima idea (Es. X X X I 13) — custodiant filii Israel sabbatum et celebrent illud in g e n e r a t i o n i b u s suis. P a c t u m e s t s e m p i t e r n u m inter me et filios Israel s i g n u m q u e p e r p e t u u m . Nel passo parallelo di Es. X X 9 questo concetto non è espresso; si suppone che in alcuni versetti di questa parte relativa al sabato vi possano essere dei ritocchi (p. es. n b ) ma se questi ritocchi appartengono alla redazione definitiva in Palestina, non era più il caso d'insistere che l'istituzione del sabato dovea durare in perpetuo. Questa cura di notare che i precetti dovevano durare sempre, occorre spesso, come è noto, nel Codice, nominatamente per quel riguarda il possesso di Canaan. Dio promette dare a Giacobbe questa terra (Gen. X L V I I I 3) tibi et semini tuo post te in p o s s e s s i o n e m s e m p i t e r n a m . A l l e scuole sacerdotali importava esortare gli Ebrei a tener sempre gli occhi rivolti alla Palestina e non a Babilonia. E noto che un lungo tratto del Codice narra 1' acquisto fatto da A b r a m o e pienamente regolare, del sepolcro per Sara e che poi fu il
[I C o d i c e
sacerdotale.
sepolcro per tutta la famiglia, Gen. X X I I I , e il BUDDE (Gesch. d althebr. Lit. 195) rileva 1' importanza 'di questo capo in riguardo di quanto ho detto. Il sepolcro di A b r a m o non era certo considerato come un »heroon«, ma era sempre una sacra memoria nazionale, alla quale gli Ebrei, ovunque fossero, dovevano aver rivolti gli occhi. Questi precetti la cui osservanza esigeva il Codice, non erano di difficile attuazione come altre parti di esso non altrettanto facili a mettere in pratica, mentre ben più arduo era 1' elaborato sistema teocratico, che pure aveva per iscopo la difesa della religione d'Israele.
22
Jotham's Fabel (Jud. 9, 7 — 1 5 )
rhythmisch-kritisch
behandelt. Von / . W.
Rothstein.
Von Salomo wird i R e g . 5, 12 f. gerühmt, er habe über die Bäume, von der Zeder an herab bis zum Y s o p , über Vierfüßler und V ö g e l , über Gewürm und Wassertiere zu reden verstanden. In welchem Sinn dies gemeint ist, darüber kann ein Zweifel nicht bestehen, weil es zu den Zeugnissen von seiner alle Welt in Erstaunen setzenden Weisheit gerechnet wird. Inwieweit das L o b Salomo's der geschichtlichen Wirklichkeit entspricht, das festzustellen ist natürlich unmöglich, interessiert uns jetzt auch nicht. W o h l aber dürfen wir aus ihm die Gewißheit der Erinnerung des späteren Israel entnehmen, daß die alte Zeit reich an Dichtungen und Weisheitssprüchen war, die an das Leben der Kreatur anknüpften und aus ihm allerlei Weisheit den Menschen zuzuführen suchten. Nicht bloß das Buch der Sprüche bezeugt, daß Israel in dieser Hinsicht nicht hinter anderen semitischen Stämmen zurückstand, auch die prophetische und poetische Literatur des alten Testaments bietet zahlreiche Beweise dafür. Man war von Natur empfänglich für die Harmonie und Schönheit, für alles Charakteristische im Kosmos und seinem Leben, für die Herrlichkeit des Himmels wie für die Offenbarungen der unendlichen Mannigfaltigkeit des Lebens der irdischen Kreatur. Bevorzugten Geistern wurde da alles zum Gleichnis und leicht kleidete sich der religiöse und sittliche Gedanke lehrhaft ein in das köstliche
J . W . R o t h s l e i n , J o t h a m ' s F a b e l rhythmisch-kritisch
behandelt.
Gewand, das dem dichterischen Empfinden und Verständnis der Reichtum der Kreatur und ihres Lebens so bereitwillig darbietet. E s wäre leicht, dies mit einer sehr großen Zahl von Beispielen aus allen Teilen des alten Testaments zu belegen. Das ist aber meine Absicht nicht. Vielmehr beabsichtige ich hier, nur ein Beispiel solcher an das Naturleben anknüpfenden Weisheitsdichtung aus dem reichen Schatz, den das biblische Schrifttum an Geisteserzeugnissen dieser Art enthält, herauszuheben und einer besonderen Bearbeitung zu unterziehen. Die P a r a b e l J o t h a m ' s begegnet uns in Jud. g in einem geschichtlich sehr bedeutsamen Abschnitt. Ob sie nun wirklich ihrer Entstehungszeit nach mit dem Vorgang zusammenhängt, von dem die sie umgebende Erzählung berichtet, oder ob sie jüngerer Zeit entstammt und erst von späterer Redaktorenhand dem Bericht eingefügt ist, kann wohl gefragt werden, aber ich lasse diese F r a g e jetzt auf sich beruhen, wenngleich es, wie wir sehen werden, sicher ist, daß an der Dichtung selbst redigiert worden ist; mir genügt zunächst die Gewißheit, daß die Parabel mindestens zu den Erzeugnissen der älteren Perioden des israelitischen Geisteslebens gehört. Mein Interesse ist jetzt auch nicht auf ihren Inhalt und seine Bedeutung gerichtet, so wertvoll es auch ist, auch diese für die Erforschung der Strömungen in der politischen Entwicklung des älteren Israel ausgiebig zu beachten. Mir kommt es hier nur auf die formale, ästhetische Seite der Dichtung an. Ich möchte gern ihre ursprüngliche Gestalt festlegen und absondern alles, was später hinzugefügt ist, und wieder möglichst in Ordnung bringen, was durch spätere Eingriffe in Unordnung geraten ist, — alles aber, um mich dann an ihrer ursprünglichen Schönheit erfreuen zu können. Um dies Ziel zu erreichen, gilt es, den überlieferten T e x t kritischer Prüfung zu unterziehen, und zwar muß diese Prüfung zugleich eine rhythmologische sein. Mit der Anwendung der gewöhnlichen Grundsätze der Textkritik ist es nicht genug; mittels ihrer werden wir nur an
J . W . Rothstein
24
wenigen Stellen auf Schäden im überlieferten Text aufmerksam. Wir haben es aber hier mit einem poetischen Text zu tun, und da versteht sich von selbst, daß die kritischen Maßstäbe, nach denen der Text zu beurteilen ist, demgemäß gewählt werden müssen, daß die poetischen Sätze nach Maßgabe der poetischen Satzbildung und ihrer Gesetze beurteilt zu werden verlangen. Um das erstrebte Ziel zu erreichen, muß also unsere Kritik eine rhythmologische sein, und so ist auch die hier dargebotene Behandlung des überlieferten Textes der Parabel Jotham's angelegt und durchgeführt. Die rhythmologischen Grundsätze, nach denen ich verfahre, habe ich in meinen Grundzügen des hebräischen Rhythmus (Leipzig, Hinrichs, 1909) niedergelegt. Ich denke, sie bewähren sich auch hier. Ich lasse nun den Text folgen in der Gestalt, die sich aus meiner rhythmologischen Kritik ergibt. Die kritischen Bemerkungen und Eingriffe, die ich für nötig halte, sind in den Fußnoten kenntlich gemacht und begründet. Die Hochtonsilbe habe ich durch einen Akzent bezeichnet, der meist über den Anfangskonsonant derselben gestellt ist. Die Siglen für die alten Versionen sind die in K I T T E L ' S Bibl. hebr. 1. 1 . 1 cm 1 ?« DS^N yotsh 1. 1 , 1 . c - p o nn^y ntro1?
1 1 1 "oyn lyotr 7b 1 1 , 1 . b Dijiyn c ^ n -|T?n 8 *
a) N u r
wenn
man
voraussetzt,
daß die Parabel
Sichemiten gedichtet ist, sind die W o r t e der Dichtung.
Sonst läßt sich auch denken,
wendet werden sollte, wurde.
von Anbeginn
für die
ursprünglicher Bestandteil daß,
wenn sie auf andere ange-
dafür der N a m e der alsdann gemeinten Leute eingesetzt
A b e r immerhin ist sehr wahrscheinlich, daß die Parabel von vornherein
für ganz bestimmte L e u t e gedichtet stimmter N a m e stand.
Freilich
ohne weiteres sichergestellt.
wurde,
also hier von A n f a n g an ein be-
ob das die Sichemiten w a r e n ,
setzt und auch nirgends den rhythmischen Wohllaut störend. lich ist er nicht u n d ,
ist damit nicht
b) Der Artikel ist bei diesem W o r t überall geNotwendig frei-
da zweifellos der Artikel in der poetischen Diktion im
allgemeinen nicht gewöhnlich ist, so wäre es denkbar, daß er ursprünglich auch liier nicht stand.
Einfaches Q i ^ y
ließe sich in v. 8^. I 0 a .
I2a.
wäre in allen Sätzen ausreichend.
I 4 a ebensogut ¡"VT1}
w
' e JTT^
u
- s-
Natürlich sprechen.
Jotham's Fabel rhythmisch-kritisch behandelt. I, •o^y
d
I •^yn
I , ro?o . ty
1 . lrty 1 . 1 c p t f y n ty
c
I nnx ^
I, rvi1?
I o,jiyn
b
I , l. yu1? T C ^ n i
I f,:cH
1
1
,
1 , nN ^ b
, 1 , jn:n 'ro^rn
mm ort1; iöN'i 9 I I w m n
,
k ,
I M-iotr
1 1 D'iJiyn ei-lOX" 1 10
1 pna
nionn onS insni n 1 .1 ^jn Ti'nnn
c) Hier liegt der Ton auf der zweiten Silbe; der Zusammenstoß zweier Hochtonsilben, der bei gewohnlicher Betonung der Segolata eintreten würde, ist hier sehr übellautend. a) M n O N " ! '
a ber
rhythmisch jedenfalls besser ohne
poetischen Diktion auch unnötig.
dies ist in der
Vielleicht stand ursprünglich sogar i p O X da,
und erst die Einarbeitung der Dichtung in die Prosaerzählung hat, wie andere Zusätze, auch die Form l^OX'H herbeigeführt.
b) Das Wort fehlt im über-
lieferten T e x t , muß aber des Rhythmus wegen und nach V . 10. 12. 14 zugesetzt werden.
c) Auch dieser Zusatz ist rhythmisch nötig und bedarf nach
V . 10b. 12b. 14b keiner weiteren Rechtfertigung. nach
un
Lesart recht übel, weil J"lN
mit
Hochton gelesen werden muß, aber die Nota
acc. so herauszuheben ist unnatürlich und sicher vom Dichter nicht beabsichtigt. Nun bietet (8® in V . II (allerdings auch nur dort): fit) anoXeixpaaa eyd>.
Das
ist aber sicher der ursprüngliche Text; ® hat ihn an dieser Stelle noch vorgefunden.
Ersetzen wir
durch
Die sachliche Richtigkeit des
so
der Vers rhythmisch in Ordnung.
wird durch den nachdrücklichen Gegensatz
des vorausgehenden n n X (V. 8) bezeugt. ist auch unschwer zu begreifen.
Die Verderbnis eines
i"
e'n
PN
Ob wir dann das vorausgehende Verbum wie
A k k . der Relation = itt lesen: T ^ I P D (dann ist »in Hinsicht auf«) • ; ~ t; v oder ^ n b i n n (ohne Fragepartikel), woran sich ''JtJH als Objekt ohne weiteres
anschließt, ist von keiner Wichtigkeit. D'ttÖKl O T I ^ N
O.
aber
mischen Aufbaus und ist nur eine Glosse. TOV &eöv ävdQEs, ® A aber = g) S. zu V . 8 b .
f) In M folgt hierauf der Satz: U T K
dieser Relativsatz fällt außerhalb des rhyth® B liest den Satz: iv § So^daovai
ill: rjv iv ifiol iöo^aoev o -&eös xal
av&Qomoi.
h) Hier und in V . 12 ist der Anklang der Schlußsilbe des
26
J. \V. Rothstein I, iroj? 1 , n ^ y n
I.
1 ty
I , n x r:?
.
1 nnx
. - p
I n ^ y n
I »iiox11
^
lsart onb ^ N n i 13 1 l ,1 «nth-pn b,0N T i ' n n n
, 1 , yu1? T o ? m
1 , 1 , irr 1 ?}? j > » ¡
I.
f
1 nü5xn
1 ¿yn Q S N
1 1 lDIl 1N3
d
1 rmK''
h
iun.I IÖN^I 15
i^oS »n« D>n»'o an« n s t « gDN
llilSn TIN n« "»Nm TON,"! 1» tt>N NXfl ^N DN1
W o r t e s an das vorausgehende zu V . 9.
rhythmisch beachtenswert.
k) M fügt noch hinzu: n 3 1 t D D T O l S n
ein Zusatz, sogar nach ' p n O a) S. zu V . 8 h .
D^D^X n D l ^ D ! " ! '
d) S. zu V . 8 b .
i) S. die Note al)cr
das ' s t sicher
recht matter und prosaischer.
b) S. die Note zu V . 9.
bietet den Zusatz in V . 9.
e'n
nXI-
e) i f l " y p | - ^ T >
c) Der überlieferte T e x t
a t> er
das ist eine Glosse wie in
a^er
wozu hier auf einmal
E s fehlt in ® A und ist zweifellos nachträglich zugesetzt.
f) Ursprünglich wird
auch hier wie in den Parallelsätzen "ItOxS ( s o ® B ) gestanden haben.
In dem
T T T
breiteren "iCONfP^N wiedererkennen. g) Die A n t w o r t
( v gl-
I5aa)
dazu V .
dürfen wir die Hand des Bearbeiters
Rhythmisch macht der überlieferte T e x t
keine Schwierigkeit,
des Dornstrauchs ist nicht mehr in ihrer ursprünglichen poeti-
schen Knappheit erhalten, sondern recht prosaisch ausgeweitet.
Tn unveränderter
Ursprünglichkeit sind die einen rhythmisch tadellosen Halbvers bietenden W o r t e I D n 1 N 3 erhalten. saisch verändert.
A b e r der dazu gehörige erste Halbvers ist schon pro-
W i e er gelautet hat, ist schwerlich sicher festzustellen, aber es
ist sehr wahrscheinlich,
daß im überlieferten Wortlaut I
noch erhalten ist. misch
der ursprüngliche T e x t I
O b er etwa so aussah: 1J-|N • T W O D n N
wäre er so ohne A n s t o ß ;
denn
I TOlOn
stellen, also als rhythmische Einheit anzusehen, ist ohne Bedenken. D i ^ y
?
Rhyth-
DTISTD unter einen Hochton zu Die W o r t e
" p O ^ sind nach dem Zusammenhang sachlich überflüssig, und das, was
sie sagen, ist selbstverständlich auch schon in dem "HB^D enthalten. I
I
wäre auch: ^JIN 0 , n t i ' ö D f l N D K i T
Das käme sogar vielleicht dem überlie-
ferten T e x t noch näher, würde jedenfalls auch sachlich gut sein. von P Ö N D i
möglicherweise
Möglich
I
zunächst
Der Zusatz
durch eine Doppelschreibung infolge der
vielen hier aufeinanderfolgenden gleichen Buchstaben herbeigeführt, könnte von jüngerer Hand stammen.
Rhythmisch wäre der Halbvers tadellos.
Sicherheit nicht zu erlangen.
Daß V . I5b
Natürlich ist
0X1) Zusatz ist, ergibt sich
schon daraus, daß hier vom »Dornstrauch« in dritter Person die R e d e ist, wäh-
2
Jotham's Fabel rhythmisch-kritisch behandelt.
7
Man wird vielleicht an der Ausscheidung einiger Sätze Anstoß nehmen und von ihr aus meine rhythmologische Auffassung anfechten zu können meinen. Indes, man wird zugeben m ü s s e n , daß der ursprüngliche Text nicht bloß mehr oder weniger zufällige Einbußen und Veränderungen erlitten hat, sondern auch bewußter Bearbeitung unterzogen worden ist. Schwerlich wird jemand mein in den kritischen Noten begründetes Urteil über V. i5 b für unrichtig erklären, und vielleicht darf ich erwarten, daß, wer dies nicht zu tun imstande ist, auch die Möglichkeit zugibt, daß die gleiche Hand, die V. i5 b geschaffen, auch für die breite prosaische Gestalt von V. 15^ die Verantwortung trägt, da ja zweifellos die Gestalt des Satzes V. i5 b die von V. 15^ zur Voraussetzung hat. Die an sich ja sachlich sehr klare Gestalt von V. 15a/7 ist aber so, wie sie vor uns liegt, durchaus prosaisch. Ihre Nichtursprünglichkeit hängt daher von der auch nach der formalen Seite zweifellos poetischen Natur der ganzen Parabel ab; ist diese unbestreitbar — und ich denke, sie ist unbestreitbar —, so ist ebenso unbestreitbar, daß V. nicht so, wie er lautet, von dem ursprünglichen Dichter herrührt. Ich hoffe hierzu auf Zustimmung. Weiter hoffe ich aber auch, daß man die Berechtigung, die rein prosaischen Überleitungssätze V. ga. i i a . 13a, i5 a als Zusätze auszuscheiden, anerkennt. Notwendig würden sie selbst nicht einmal in rend er vorher redendes Subjekt ist.
Die Nennung der Zedern des Libanon allein
fällt auch aus der graden Linie des Zusammenhangs heraus, spricht also auch für eine fremde H a n d , die hier einen Zusatz gemacht hat. — Die charakteristische Verschiedenheit
der Antwort des niedrig am Boden wachsenden,
mit
spitzen, bedrohlichen Dornen ausgerüsteten Strauches von der der anderen edlen, ihrer ganzen Art nach friedlichen Bäume wird recht fühlbar, wenn man beachtet, daß sie sagen,
sie wollten sich nicht aus ihrer bisherigen bescheidenen
Stellung erheben, um über den anderen Bäumen zu schweben,
während der
Dornstrauch sagt, er denke gar nicht daran, seine bisherige Stellung zu ändern, verlange aber, daß die Bäume sich x ihm unterordneten, lässig, wenn auch nicht mit Feuer, drohenden Dornen beugen.
sich unter seine unab-
wie der Zusatz sagt, so doch mit Stichen
Recht euphemistisch klingt es, wenn er sie auffordert,
falls sie ihn salben wollten, in seinem Schatten ihre Zuflucht zu suchen.
28
J . \ Y . Rothstein
einer rein prosaischen Erzählung sein. Bei verständiger Lesung und Betonung der Sätze würde sogar ein Hörer leicht merken, daß ein Subjektwechsel eingetreten ist, daß in den Fragesätzen die Antwort auf die vorausgehende Aufforderung enthalten ist. In einer Dichtung ist eine solche dramatische Beweglichkeit der R e d e noch verständlicher. Überleitungssätze, wie diese in V. g a u. s. w., hemmen nur den schönen Fluß der Rede. Und daß echte Dichter in dieser Hinsicht Ansprüche an ihre Leser stellen, beweist schon allein Psalm 2. Ich denke also mit Recht erwarten zu dürfen, daß man meine Kritik nicht als Gewalttätigkeit brandmarkt, wenn ich diese Sätze meiner rhythmologischen Auffassung der Parabel zum Opfer bringe. V o n wirklich lebendiger Empfindung für poetischen Ausdruck und poetische Satzgestaltung fürchte ich einen solchen Vorwurf auch keineswegs. — Ernstlicher, scheint's, könnte man mir die Ausscheidung von Sätzen wie die in V . gh. i3 b und in V . i i b vorhalten. Indes, ich überlasse in Bezug auf die in V. 11 b ausgeschiedenen Worte die in der Note dazu gegebene Begründung getrost der Erw ä g u n g des Lesers. Nur möchte ich die Möglichkeit noch aussprechen, daß das eine W o r t T Ü l i n auch als eine von der bearbeitenden Hand verwertete Variante für , pnD angesehen werden kann. Und was die Sätze in V . 9b. i3 b anlangt, die inhaltlich einander gleichwertig sind, so sind auch sie als Zusätze eines Bearbeiters gerade bei der Frucht des Ölbaums und des Weinstocks leicht begreiflich; sie steigern die Wertschätzung dieser Frucht zum höchstmöglichen Superlativ. Zur nachträglichen Steigerung solcher oder ähnlicher A r t finden sich auch sonst im alten Testament A n a logien; die Neigung, solche den alten Texten einzufügen, gehörte geradezu zu den charakteristischen Eigentümlichkeiten der jüngeren redigierenden und rekonstruierenden Schriftstellerei. In V . 14* haben wir in der Beifügung des bs zu D ^ y n ein Beispiel dazu. — Im übrigen aber glaube ich ohne Sorge es dem gesunden Gefühl für Poesie und poetische Satzgestaltung anheimgeben zu dürfen zu beur-
J o t h a m ' s Fabel rhythmisch-kritisch behandelt.
29
teilen, ob die oben als ursprüngliche Bestandteile der Dichtung herausgehobenen Sätze in ihrer Form wie in ihrem Inhalt den Eindruck zu machen vermögen, die Gestalt der Parabel zu bieten, in der sie vom Dichter selbst ursprünglich verfaßt war, oder ob zu ihrer inhaltlichen Vollständigkeit und zur Erreichung ihres didaktischen Zweckes die ausgeschiedenen Sätze und Worte unbedingt erforderlich sind. Ich denke, das Urteil wird im Sinne jener ersten Frage ausfallen. Inwieweit die Parabel in der Gestalt, in der sie oben vorliegt, meine rhythmologischen Grundsätze zu erhärten vermag, unterlasse ich festzustellen, freue mich aber doch eine Bestätigung derselben in ihr finden zu dürfen. Sehr am Herzen aber liegt mir der Wunsch, es möchte diese kleine Arbeit auch von dem Mann, dem sie einen verehrungsvollen Gruß auch von mir zutragen soll, für wert erachtet werden, als ein Blättlein in den Blumenkranz eingefügt zu sein, den ihm würdigere und angesehenere Genossen in der Arbeit an den mannigfaltigen Aufgaben der semitischen Forschung gewunden haben. Hoffentlich findet sein kritisches Auge Wohlgefallen an dem Ergebnis meiner Arbeit.
3°
Hos. 7, 12. Von Karl
Budde.
A u s Deinem Munde, lieber Freund, weiß ich, daß Du mehr als einmal meine Textherstellung von E x . 22, 30 (vgl. Z A T W X I , 1891 S. 112 f.) als Beispiel dafür angeführt hast, daß es möglich sei, beschädigte T e x t e durch freie Vermutung sicher zu berichtigen. Laß mich denn sehen, ob es mir gelingt, Dir als Glückwunsch zu Deinem Ehrentag ein neues Pröbchen dieser feinen Kunst abzulegen, die, so laut auch die Spuren der Vorgänger warnen mögen, doch jeden rechten Philologen immer von neuem locken wird. Ich wähle dafür eine Stelle eines Prophetenbuchs, das anerkanntermaßen besonders schwer gelitten hat, während seine eigenartige Schönheit uns doppelt fühlen läßt, was wir dabei verloren haben, ich meine natürlich das Buch Hosea. Die Stelle Hos. 7, 12 ist längst als verdorben anerkannt. A n Versuchen der Heilung hat es wahrlich nicht gefehlt; aber, sehe ich recht, so befriedigt keiner, vielmehr gehn alle an der Hauptsache vorbei. Ich spare mir deshalb die A n führung und Widerlegung und verweise einfach auf die Liste in HARPER'S Kommentar S. 299 f. und zur Ergänzung auf Z A T W X X X I , 1911 S. 26. Entscheidend für unseren Vers ist die in v. 11 eingeführte Gleichsetzung Ephraim's mit der Taube. Daß sie auch v. 12 noch beherrscht, daß also Ephraim auch hier noch die Taube oder vielmehr, nachdem 11 b zur Mehrzahl übergegangen, ein Taubenschwarm ist, geht deutlich aus dem ersten Gliede hervor, wo Jahwe sein Netz über sie wirft. Richtig übersetzt also MARTI hier "pH mit »ausfliegen«, nur daß "C'T ntt'NT nicht heißt »so oft«, son-
K . Budde, Hos. 7, 12.
31
dem »wenn sie [das nächste Mal] ausfliegen [werden]«. Wenn das aber so ist, so muß die Herstellung nicht erst beim dritten, sondern schon beim zweiten Grlied einsetzen. » W i e V ö g e l des Himmels« ist falsch, weil sie das nach dem vorigen Glied in der Tat s i n d , und besonders lahm klingt dieser V e r g l e i c h mit V ö g e l n ü b e r h a u p t , weil sie ja ausdrücklich T a u b e n genannt sind. Das D ist nicht das des Vergleichs, sondern nimmt im parallelen Glied das "IBWr auf, FpJ? ist daher nicht das Nomen fjij;, sondern der Infinitiv Fpy. Fast unerläßlich ist dabei das Suffix, also üLiyS. Damit ließe sich CPCttTl als Akkusativ der Richtung verbinden; wahrscheinlicher aber gehört das W o r t zu DTTIK und ist deshalb D^Gli'O zu lesen: »wenn sie auffliegen, aus der Luft hol' ich sie herunter«. Der himmlische Vogelsteller kann natürlich mehr als ein irdischer und rühmt sich seiner Kunst. Daß O^DSTÖC£1J?- in das alltägliche OWnSlJ?? verlesen wurde, kann durchaus nicht Wunder nehmen. Neben dem deutlichen •*V~!')N hätte CTDW nicht unter Streichung des zweiten 1 oder beider als DTE^X oder DHDN (von ~IDN) gelesen werden sollen; denn Tauben werden weder gezüchtigt noch angebunden. Vielmehr ist das erste 1 zu streichen und OTDK zu lesen, wofür auch einige Handschriften und das stillschweigende K e re der wunderlichen Doppelschreibung und Doppelvokalisation eintreten: »ich putze sie fort«. Für das nächste W o r t ergibt sich neben 121?1 und DS1J73 von selbst nicht die Aussprache yöttto, sondern JjDWS: »sobald man hört«. W a s hört man? Natürlich die Tauben, ihre Naturlaute, ihr Gurren. Vogelzüge können sich, wo das Gesichtsfeld beschränkt ist, ehe man sie sieht, durch ihre Laute vernehmbar machen: »Er hört — schon kann er nicht mehr sehn — die nahen Stimmen furchtbar krähn.« A u c h sind gerade die Laute der Tauben im Alten Testament sprichwörtlich, vgl. Jos. 38,14. 59, 11. Nah. 2, 8. Irgend eine Bezeichnung dafür wird also in dem undeutbaren Omy 1 ? zu suchen sein. Nach jenen Stellen (vermutungsweise auch
32
K . Budde, Hos. 7, 12.
Nah. 2, 8) möchte man am ersten an eine Bildung von Hin denken,' also am einfachsten OPJn ; indessen weist v. 16 auf T . eine andere Spur. Das wunderliche QJJJ'? 1t ist dort nicht Dittographie des Vorhergehenden (OORT), sondern Randglosse, Berichtigung zu dem unbrauchbaren DJJTD; man lese daher wirklich dafür »wegen des Stammeins ihrer Zunge im Lande Ägypten« oder •Jw'p? D ^ O , oder piX3 Denn 'tyb bedeutet nach Jes. 28, 11. 33, 19 auch barbare loqui, welschen. Die Verschuldung der hier Bedrohten ist immer noch die von v. 11 (vgl. auch v. 13), daß sie statt bei Jahwe im Ausland Hilfe gesucht, statt Hebräisch zu reden Ägyptisch geradebrecht haben. Welschen tun aber auch die Tauben, weil auch ihre Sprache unverständlich ist und daher wie ein Stammeln klingt. Deshalb ist eben dieses W o r t und nur dieses auch für v. 12 das richtige und für •mj) 1 ? einfach OH einsetzen: »sobald man ihr Welschen hört«. E s liegt darin eine äußerst feine Anspielung auf die Ausländerei, das Ägyptischreden der Ephraimiten, ohne daß das Bild im geringsten geschädigt oder gar verlassen würde. Hosea ist allen übrigen Propheten, Jeremia etwa ausgenommen, durch den Reichtum seiner Bilder überlegen, und niemand weiß sie so voll auszuführen und auszunutzen wie er. E s ist kaum denkbar, daß er das Bild der Taube in v. 11 nur eben eingeführt hätte, um es sofort wieder zu verlassen und dann in v. 12 ebenso verloren, als wenn gar nichts vorausgegangen wäre, einen Vergleich mit Vögeln im allgemeinen einzustreuen. Durch äußerst leichte Herstellungen gewinnt man in v. 11 und 12 eine durchgeführte Allegorie bis zum vollen Abschluß: So ward Ephraim zur Taube, einfältig, ohne Hirn: Ä g y p t e n riefen sie, nach Assur zogen sie. Sowie sie hinziehn, werf' ich über sie mein Netz, Sobald sie auffliegen, aus der Luft hol' ich sie herunter, Putze sie fort, sobald man ihr Welschen hört.
33
Die Nasim V o n B. D.
hassobeoth. Eerdmans.
A n zwei Stellen im A . T. .findet sich eine Bemerkung über Weiber, welche sich bei dem Eingang des Offenbarungszeltes, des Ohel mo'ed, aufhielten. Exod. 38, 8b sagt, daß das große Becken und sein Gestelle angefertigt wurden aus
Kupfer, aus den Spiegeln der nasim hassobeoth, welche sahen am Eingang des Ohel mo'ed. 1 Sam. 2, 22 erwähnt als Sünde der Söhne Eli's, daß sie buhlten mit den Weibern ha$sobeoth am Eingang des Ohel mo'ed. A n beiden Stellen gehört die Bemerkung nicht zum ursprünglichen Text. Exod. 38, 8 existiert das Ohel mo'ed noch nicht. E s wird erst Exod. 40, 18 aufgerichtet. Daher hat
L X X (38, 26) hinzugefügt ev fi ijfjjQa enrj^ev avxrjv, ohne in
dieser Weise einen guten Zusammenhang hervorrufen zu können. 1 Sam. 2 ist vom Hekal in Silo die Rede. Die Erwähnung des Ohel mo'ed paßt also gar nicht zum Kontext. V. 2 2b fehlt in L X X und wird deshalb allgemein als Glosse ausgeschieden. Die Art der Glosse aber bereitet der Auslegung Schwierigkeit. Man weiß nicht recht, in welcher Weise diese Glossen am besten zu erklären seien. Die KAUTZSCH'sche Bibelübersetzung bemerkt z. B. zu Exod. 38,8, daß »die Glosse wahrscheinlich aus 1 Sam. 2, 22 (s. dort) herübergenommen ist«. Zu 1 Sam. 2, 22 aber wird bemerkt »dieser Halbvers ist nach Exod. 38, 8 gebildet daß man auch weibliches Personal bei den Heiligtümern verwendete, zeigt Exod. 38, 8«. In derselben Weise wird in N O W A C K ' S Handkommentar von B Ä N T S C H bei Exod. 38, 8 auf 1 Sam. 2, 22 hingewiesen und von N O W A C K bei 1 Sam. 2, 22 auf Exod. 38, 8. Zeitschr. f. Assyriologie, XXVI.
3
34
B. D. Eerdmans
Nach WELLHAUSEN ist I Sam. 2, 22 Glosse, aus Exod. 38, 8 entstanden (Text d. B. Satn. S. 46): die ganze Stelle, später als Exod. 38, 8, ist wohl ein Versuch, etwa der Pharisäer, dem Priesteradel eins anzuhängen. Diese Vermutung WELLHAUSEN'S sieht nicht sehr wahrscheinlich aus, da, wie er selbst einräumt, »der den Sadducäern freundliche Josephus, der übrigens die L X X vor sich hat, doch diesen Skandal (aus dem Urtext?) nicht vergessen hat«. Das scheint vielmehr dafür zu sprechen, daß die L X X diese Bemerkung absichtlich unterdrückt haben. Gewöhnlich übersetzt man den Ausdruck nasim hassobeoth durch »die Weiber, welche Dienst taten«. Auf Grund dieser Ubersetzung meint man annehmen zu können, daß auch Weiber zum Tempelpersonal gehört haben. WELLHAUSEN redet von Tempelmägden, ist aber nicht geneigt, der haggadischen Bemerkung Wahrscheinlichkeit zuzuschreiben. NOWACK (H. Arch. II S. 1 1 1 ) aber scheint es für möglich zu erachten, daß es am Heiligtum dienende Weiber gegeben hat, w i e auch BÄNTSCH (Exod. S. 296), S T R A C K U. a.
Es
wird jedoch nirgendwo angegeben, welchen Dienst diese Weiber zu leisten hätten. STRACK bemerkt (Kommentar zu Exod. 38, 8): »jedenfalls hat man auch an die Aufführung heiliger Tänze und Gesänge zu denken« (Exod. 15, 20. Ps. 68, 26). E s leuchtet aber ein, daß die Freude Mirjam's Exod. 15, 20 mit irgend einem Dienst am noch nicht existierenden heiligen Zelt nichts zu tun haben kann. Ps. 68, 26 ist von Prozessionen die Rede mit Sängern, Saitenspielern und paukenschlagenden Jungfrauen. Diese Prozessionen werden von den Israeliten gebildet, welche zum Tempel ziehen, und können also für die Erklärung eines regelmäßigen Dienstes von Weibern am Eingang des Tempels auch nicht ins Gewicht fallen. Wenn heilige Gesänge und Tänze von diesen Weibern aufgeführt worden wären, hätte dieses auch eher innerhalb des Tempels statt am »Eingang des Zeltes« stattgefunden. E s nimmt kein Wunder, daß wir aus dem A. T. nichts
Die NaSim
35
has$obcoth.
näheres über den Dienst dieser Weiber ermitteln können, denn es ist sehr wahrscheinlich, daß die gewöhnliche Übersetzung falsch ist und daß von einem Dienst gar nicht die Rede ist. 1 ) Man meint, das Verbum N2Ü bedeute Num. 4, 23. 8, 24 f. »Dienst tun« und das Substantiv t02f bezeichne Num. 4, 3. 30. 35 den Dienst der Leute am Heiligtum. Das scheint aber nicht richtig. A n den betreffenden Stellen (die einzigen, welche für diese Bedeutung herangezogen werden können) folgt hinter K21£ immer die nähere Bestimmung »um den Dienst im Heiligtum zu verrichten«. Num. 4, 3: »nimmt auf die Gesamtzahl der Söhne Kehath's von Allen, die kommen zum saba, um Dienst am Heiligtum zu verrichten« (ähnlich 4> 3o. 35)Num. 4, 23: »Nimm die Gesamtzahl der Söhne Gerson's auf alle, die kommen, um saba zu bilden (frOÜ JOS1?), um Dienst zu verrichten« (ähnlich 8, 24 f.). Saba kann hier also nicht heissen »Dienst tun«, sondern muß hier bedeuten »eine Reihe bilden und sich zum Dienst bereit halten«. Der Begriff »Dienst tun« an sich ist aber mit dem Ausdruck nicht verbunden. Saba meint die Versammlung, die Reihe, der sich zu irgendeinem Zweck aufstellenden oder meldenden Personen. Daher kann es geradesogut Kriegsheer bedeuten wie ein Heer von Gestirnen, welche Jahwe alle mit Namen ruft (Jes. 40, 26). In Hinsicht auf Num. 4, 3 u. s. w. werden wir Exod. 38, 8 also übersetzen müssen: »die Weiber, welche sich ansammeln« oder: »die Weiber, welche eine Reihe bilden« am Eingang des Zeltes. E s fragt sich, zu welchem Zweck die Glossen die Weiber bei dem Eingang des Zeltes sich ansammeln lassen. Natürlich nicht, um irgend einen Anteil an dem gewöhnlichen Tempeldienst zu nehmen. Wenn Weiber zum gewöhnlichen 1) Die Lesart der L X X , welche statt frOü C"l5£ gelesen hat, gibt keinen Sinn und verdient keine Beachtung.
3*
36
B. D. Eerdmans, Die Nahm
has$obeoth.
Tempelpersonal gehört hätten, würde der Chronist uns hierüber schon berichtet haben, und würden die Weiber sich auch in dem Heiligtum selbst befinden und nicht am EinEingang, d. h. außerhalb des Heiligtums. Man würde vielleicht geneigt sein anzunehmen, daß die Glossen auf eine Art Vestalinnen anspielen, wie solche bei den Babyloniern vorkamen und im Codex Hammurabi erwähnt werden. Dagegen spricht aber Exod. 38, 8, wo die Weiber Metallspiegel haben. Das zeigt, daß die Weiber sich in ihrem schönsten Putz, mit Kohl und Schminke bestrichen, bei dem Heiligtum aufhielten und also gerade keine Vestalinnen sein wollten. Die Spiegel dienen dazu, sich selbst zu bewundern und den Schmuck zu ordnen, wie das bei den orientalischen Weibern noch jetzt Sitte ist. Die Spiegel verraten also, daß die Weiber sich dorthin setzten, um zu gefallen. Wenn diese Erklärung von Exod. 38, 8 richtig ist, ist es wahrscheinlich, daß die Glosse uns eine wertvolle historische Notiz erhalten hat, welche nicht erst in sehr später Zeit, sondern viel früher als Randbemerkung niedergeschrieben worden sein muß. Wir können nämlich aus Deut. 23, ig schließen, daß es Sitte war, sich in der Nähe des Tempels zu prostituieren und den Ertrag oder einen Teil des Ertrags in das Haus Jahve's zu bringen. Es wird dort verboten und und wurde auch von den älteren Propheten gerügt (Micha 1, 7; Arnos 2, 7 f.; Hosea 4, 14). E s ist merkwürdig, daß diese Weiber dem Verfasser der Bemerkung in Exod. 38, 8 nicht anstößlich vorgekommen sind, denn sonst hätte er das heilige Becken nicht aus ihren Kupferspiegeln anfertigen lassen. Er kann also die Ansicht des Deuteronomiums nicht ganz geteilt haben. Dies spricht dafür, daß die gewöhnliche Ansicht über den sehr späten Ursprung von Exod. 25 — 40 unrichtig ist (cfr. Alt. Stud III S. 98 ff.); denn in der nachexilischen Zeit hätte sicher kein Priester sich eine solche Erklärung der Herkunft des Beckens erlaubt.
37
The Hebrew word
pap.
By A. A. Bevan. T h e grammatical form of the word
"commander"
or "ruler", has always been regarded as anomalous. Since no root ]2£p is known to exist, " ^ p is usually treated as a derivative from n2£p, the supposed Hebrew equivalent of the Arabic "to decide". The fact that no such verb occurs in the Old Testament is perhaps not an insuperable difficulty; but even if w e postulate the verb in Hebrew the formation of ^lip remains unexplained. T h e only apparent analogies which OLSHAUSEN is able to cite are J^PI (where the final n may be taken as part of the root) and the very doubtful anal; Xeyd/uevov "'JPSFI (Lev. V I 14). Nor can w e have recourse to the supposition that the form ^Jij? is due to a scribal error, for the word occurs in no less than 12 passages, only one of which (Prov. X X V 15) has a suspicious appearance. In the absence of a better explanation, I would venture to suggest that ^Jip may have been borrowed by the Hebrews from A r a b i a , and that the termination may be the Sabaean definite article, which, as is well known, takes the form of a suffixed n. T h e extensive commerce of the Sabaeans would sufficiently account for the introduction of a Sabaean word into Palestine at an early period, and that an official title borrowed from a foreign language may retain the definite article is proved, in particular, by the Arabic titles which have passed into Spanish, alcalde {— ^^-«¿LftJl), alcaide ( = JoUJI), and others.
3«
Aus Mose ibn Chiquitilla's arabischem Psalmenkommentar. Von Samuel
Poznanski.
Als Schöpfer der jüdischen Bibclexegeso im eigentlichen Sinn des Wortes gilt mit Recht der Gaon Saadja al-Fajjümi (8g2 — 942), der vermutlich alle 24 Bücher der heiligen Schrift arabisch übersetzt und kommentiert hat, dazu manche Bücher, wie z. B. den Pentateuch und die Psalmen, in zwei Rezensionen. Doch ist auch die Bibelexege zu einem wahren Aufschwung erst dann gelangt, nachdem 'Abu Zakarjä Jahjä (Jehüda b. Däwid) llajjüg das Gesetz der Trilitteralität auch für die hebräischen Wurzeln entdeckt und nachdem der geniale Abulwalid Merwän ibn Ganäh das Werk seines Vorgängers fortgeführt und den Aufbau der hebräischen Sprachwissenschaft zu einem gewissen Abschluß gebracht hatte, und dies geschah bekanntlich in Spanien im X . — X I . Jahrhundert. Erst dann konnte an eine rationelle und sinngemäße Auslegung der Schrift geschritten werden und erst dann konnten in solchem (reist gehaltene Kommentare entstehen. Zwar enthalten schon die Werke Abulwalid's, und ganz besonders sein Wörterbuch (Kitäb al-usül), sehr viel Exegetisches, aber der erste Grammatiker aus seiner Schule, der es unternommen hat, fortlaufende Kommentare zu den biblischen Büchern in arabischer Sprache zu verfassen, war der in der Überschrift genannte Mose b. S a m u e l H a k k o h e n ibn C h i q u i t i l l a (Gikatilla, nVtOpJ), der in Kordova geboren war und ungefähr 1050—80 geblüht hat. Daneben verfaßte er noch eine Monographie über das grammatische Geschlecht u. d. T.
S. Poznariski, Aus Mose ihn Chiquitilla's arabischem Psalmenkominentar.
39
Kitäb at-tadkir wat-ta nit, sowie hebräische Gedichte und Predigten und übersetzte außerdem zwei Schriften Hajjüg's, über die schwach- und doppellautigen Verba, aus dem Arabischen ins Hebräische. Alle diese Schriften ibn Ch.'s (mit Ausnahme der Übersetzung) schienen aber lange Zeit ganz verloren gegangen zu sein, sodaß, als ich im Jahre 1895 daran g i n g , ein Bild seiner Persönlichkeit und seiner wissenschaftlichen Bedeutung zu geben, ich das nur auf Grund spärlicher Zitate, die ich aus der jüdischen Literatur gesammelt, tun konnte. 1 ) Dabei waren diese Zitate nur zum ganz geringen Teil in der arabischen Originalsprache enthalten, die meisten aber in hebräischer Paraphrase, sodaß das Bild kein allzu adäquates sein konnte. Dann glaubte ich auch feststellen zu können, »daß die Schriften ibn Ch.'s seit dem E n d e des X I I I . Jahrhunderts keinem Schriftsteller mehr vorgelegen haben und auch am E n d e dieses Jahrhunderts nur in Griechenland bekannt waren, 2 ) während im westlichen Europa David Kimhi der letzte ist, der sie benützt hat« (p. 69). Durch neu hinzugekommene Untersuchungen aber und durch neu entdeckte handschriftliche Funde muß dieses Urteil wesentlich modifiziert werden. 3 ) 1) Mose seiner
Schriften,
b. Samuel
Hakkohen
Leipzig 1895.
ibn
Chiquitilla
nebst den
Fragmenten
Hier ist auch alles bisher Gesagte näher be-
gründet, s. besonders die Einleitung und Abschn. I (p. 1 — 2 5 ) .
Von den p. 24
angeführten zwei Strophen ibn Ch.'s gehört die zweite nicht ihm, sondern Mose ibn E z r a ,
s. B R O D V , M G W J
4 0 , 3 6 n. 1 3 , d a f ü r h a t W E R T H E I M E R
(D^TIM1
Heft I I I , Jerusalem 1902, f. 16) ein Pijut mit dem Akrostichon j ^ p
HSTD
Ediert, das er ibn Ch. zuschreibt (Chiquitilla stammt ja vom spanischen chico »klein«, also
Ob
m
i t Recht?
2) Nämlich dem Autor des " l I X D H s. meine Schrift p. 65.
meiner Abhandlung Ta.nh.oum Yerouschalmi de Jonas
Josef b. Dawid ha-Jewäni,
Weitere Zitate aus ibn Ch. bei diesem Autor sind in et son Commentaire
sur
le
livre
(Paris 1900, S.-A. aus R E J 4 0 — 4 1 ) , p. 38, n. 1 mitgeteilt.
3) Seit dem Erscheinen meiner Schrift haben über ibn Ch. nur noch kurz gehandelt: STEINSCHNEIDER, Ar ab. Lit. arab.
Lit.,
p. 63) und BACHER, Jew.
d. Juden
Enc.,
§ 91
(dazu mein Zur
s. v. (V, 666—67).
jüd.-
Außerdem ent-
hält die soeben erwähnte Abhandlung über Tanliüm einen Anhang (p. 28—44)
40
S. Poznanski
Zunächst muß bemerkt werden, dató die Schriften ibn Ch.'s auch Autoren, die nach dem X I I I . Jahrhundert gelebt,1) vorgelegen haben. So hat z. B. Semtob ibn Major in seinem 1384 verfaßten Superkommentar zu Abraham ibn Ezra, betitelt 'PTlin "lINDn, seine Anführungen des ibn Ch. nicht aus dem von ihm kommentierten ibn Ezra geschöpft, wie ich ursprünglich annehmen zu müssen glaubte, sondern direkt aus erster Quelle. Allerdings steht das nur für die oben genannte grammatische Monographie fest, nicht aber für die Bibelkommentare.2) Was nun diese anbetrifft, so ist es interessant zu erfahren, daß einzelne Teile davon in einer Bücherliste aus Bagdad aus dem Ende des X I I . Jahrhunderts erwähnt werden und zwar einmal als n^DpS pt> HDJ? n n i ¡ r y t ^ TDSn und dann als n^Dpí pt> U IN TD2H iblü.*) Sie befanden sich mithin in Privalbibliotheken. Dann sind auch die Schriften selbst, wenn auch fragmentarisch, aufgetaucht resp. identifiziert worden. So hat HARKAVY in der Petersburger Bibliothek 4 Blatt der grammatischen Monographie gefunden und daraus die Artikel ¡"UXn und iTtt'm mitgeteilt.4) Ferner über das Verhältnis dieses Autors zu ibn Gh., wo auch eine ganze R e i h e neuer Zitate, besonders aus Tanhüm's Psalmenkomnientar, publiziert ist. 1) A u s dem X I I I . Jahrhundert kommt hinzu außer Tanhum noch Isaak b. Elazar Hallewi aus Bagdad (s. meine Schrift, p. 63), der in seinem handschriftlichen ~|rp n S l f Erklärungen des ibn Ch. nicht aus ibn Ezra (wie die bisher bekannten), sondern aus erster Quelle schöpft, s. weiter unten, S. 56, A n m . 1. 2) S. mein Tanhoum Yer., p. 30, n. 2.
j
3) S. J Q R 13, 53, nr. 26 und 54, nr. 65 und dazu meine Bemerkungen ib. p. 326 ob. " p D E n bezeichnet oft nicht Übersetzung sondern Kommentar, aber möglicherweise hat ibn Ch. diese beiden biblischen Bücher auch übersetzt 4) S. R É J 3 1 , 389. Der Artikel ¡ T C U I zeigt nun, daß die Erklärung dieses W o r t e s nicht im Kommentar zu J e s . 28, 29 resp. Hi. 5, 2 enthalten wa|(s. meine Schrift p. 100. 116. 144), andererseits wird sich weiter unten zeigen, daß die Auseinandersetzung über die Form u. s. w . nicht in der grammatischen Monographie, sondern im Bibelkommentar ihren Ort hatte, bei df.r Dürftigkeit des Materials war eben der gehörige Platz eines jeden Zitats ulimöglich zu bestimmen. Der Artikel ¡"lEtT >st a u s Isaak b. Samuel's arabisch K o m m e n t a r zu II S a m . 17, 29 durch G. MARGOLIOUTH ( J Q R 10, 398) bekartnt
Aus
Mose
ihn
Chi mznn ien] mxn
miDü }nm lmias: in"1! noipn nnaj -itrx ¡ y írron nnx IJI nJID: "DT K^l. Diese Worte sind sehr knapp gefaßt und daher nicht ganz verständlich. das Original ibn Ch.'s: ^ p
1
Sie werden aber klar durch
X i : ntf^ r r m n 1ÖP ^"ixn Ipi
-ÜN1?'?
n:x -prñ np nrnis - i x ^ x mn T6X inj?1?« xmx ntrni nny i r o :nxn nmpns 'nybxa nrxm xn:ix pto n ^ x i -arxi atr nnx -¡irr -ox na:1? mann vm loni xo ^ y nana onyi ip ^S nntoxro^x -lys nen D-CT -GX nVipa p ^x imcü in1! noips nn:r, -itrx j y ip in: ^ nr^x nr;n nn^l D'H'Dy. Ibn Ch. will also sagen, daß es im Hebräischen zuläßig sei, im Lauf der Rede von einer Person zur anderen überzugehen, so hier von der zweiten Sing, zur dritten Plur., ebenso wie es in Ez. 31, 1 o ]iTl heißt, anstatt, wie es der Kontext erfordert, ]nnV) Ein weiterer Beweis für die Autorschaft ibn Ch.'s ist die Anführung seiner eigenen Werke.
So zitiert er seine
grammatische Monographie zweimal: 1. zu 66, 3: ipD "OJTl
^ -ptyyo X T U N O ye N X A - C N npi N X N D X ' J X RRNN n ^ y X - M n^y x r h i ¡TE WT: Vip x¿'x yo rmn^xi Tcñn^x nxnr; 2. zu 1 ig, 176: hjTDp^N P (?-nKtíÓN) nxittóx ^ y "DIN nti'l Trñn^x nxnr ^ -pñ np^pn x r o npi x-éñoi xñüíb p n • • • maxn^xi. Von seinen Bibelkommentaren zitiert er zunächst einmal (zu 38, 4) den zu Jesaja: JSXfO my
DinO ^X ipS
x ^ x ^ix^x n c o p r xñn ^ys rraxDix^x rHttoi nntío^x •n ]D pnee n^y; 70 mpnyx xc ^ y npnx'? irixróxi N^YC"1 I £ D
X A M T R ^S N ^ Y
NXR^
-ip
xnb
XDÍXE.
Gemeint ist
hier der Kommentar zu Jes. 1, 6, wo ibn Ch. in der Tat die1) E s
entfällt
RÉJ 31- 3I5-
daher
meine
Emendation
p. 1 0 6 .
Vgl.
auch
BACHER,
S. Poznariski
46
selbe Erklärung gegeben hat, s. die Nachweise in meiner Schrift p. 135—136. Polemisiert wird hier entweder gegen Menahem b. Sarük {Mafyberet p. 185a s. v. DH) oder, was wahrscheinlicher, gegen Abulwalid (Usül 763, 13). Ob ibn Ch. nun auch Jeremia kommentiert hat, habe ich in meiner Schrift p. 18 als unsicher hingestellt, und diese Unsicherheit bleibt auch jetzt bestehen. Zu 37, 31 heißt es nämlich: N^NO N 3 " 2 NQ ^ Y Hyo"1 N^> ^ Y O N VTIEW -iyon N1? NIL nDNnüNI " niatyno ^ b]) nop ^ ,B. Da es sich nun hier um eine Frage der hebräischen Grammatik handelt, nämlich die Setzung eines Fem. Sing, anstatt Plur. Masc. vor dem Nomen, so ist es möglich, daß sie nicht im Kommentar zu Jcr. 51, 29, sondern in der grammatischen Monographie enthalten war. 1 ) Übrigens behandelt sie schon Abulwalid (1Opuscules cd. DERENBOURG p. 371, vgl. Luma 365, 18) und zitiert dabei ebenfalls unsere beiden Verse. Der Kommentar zu den X I I kl. Propheten wird ebenfalls nur einmal zu 66, 9 zitiert: ^ y CPTa 13ti>E3 DITPI H^ipi ip )C Nnsjn fpNnD1 "H^K tn-IB^N y o
P N3t>y; H^N
^ y i p"yn -lirNS (0 im npyio notr r r m o n Gemeint ist hier der Kommentar zu Am. 2, 13.
N31DD NO
!TS.
UNNNN
Die Zitate aus dem Kommentar zu Hiob (35, 20 zu Hi. 7, 5; 37, 20 zu Hi. 24,1 und 76, 9 zu Hi. 37, 22) hat bereits B A C H E R , nach meinen Mitteilungen, in der Vorrede ( S . - A . p. 3) zu seiner Edition von ibn Ch.'s Hiob veröffentlicht. Nachträglich fand ich noch eines zu 75, 3: "ON nyiO llpN T 1'pl ^ y
TU^D
rrrn yotrx ^note
IDIO
-isis ^ip t>no
DIEITN
cr-itro
,
-]Sn nyiilö £ HN3-IDS NO ^ y i . Worin die Ähnlichkeit mit Hi. 20, 3 bestehen soll, ist nicht rccht ersichtlich. In ed. B A C H E R ist nur die Übersetzung zu diesem Vers enthalten, nicht aber der Kommentar. 1) Vgl. auch seinen Kommentar zu 18, 35: NPin^tt'N ^ y Pinn31 Tpi nop T ^no c NJE mynt'pN rm 1 ? mrui npn ;Nri Nnmnpi 133 nnsy "unNion " mnirno toa by-
Aus
Mose
ihn
Chiquitilla's
arabischem
47
Psalmenkommentar.
Endlich zitiert ibn Ch. zu 31, 21 eine seiner Predigten: -ijihn x o
-iyim •npx'prx p i i y x x a t r x ^ m o ipn ^ j n
x o ^ y i fttnn n x lDr-n x i n p i nypab D'D.^ni ^j?« p-it^x p r r a -i6e
x ^ n
d^
mx
xiai
x i ^ c o r yyi
^a h x j - i d e
-nax^x ]X bipn yiDiD^N - p n rvbx yp1' öS x o n }ab xan ¡ - j t j » 'si d ^ i - u o^nr'px p m h i p n x xor^yx pr6x
pi
]xttnpaöt>N j x i i n ^ x
}xrD nro"1 irn
Tin nnpbn
sa
¡rare
^xrxa p 6 x
rrerc dxex p
d x c x p -pnepa n x t y x p a i y jxra nx^yx p
*by n n i o » ¡rpDB r o x ; xiraiD
jxnpSyo ixn^D^D
]tt>r6x "np^n ^ ^ r n n e n - m
p
p r 6 x pnpbn ^ n jxnp^n -next'x 'pxedx n^rn'rx t3\?3 naxriD jy p>r6x2
p a X ^ X P - p n e n " i n t r s "iiax'px "np^n ^X.
Man könnte ge-
neigt sein N33rc
'v zu lesen, aber auch Mose ibn Ezra
in seiner Poetik
bezeichnet ibn Ch. als einen der hervor-
ragendsten Prediger (X^Dr'TX n ^ N p i , s. meine Schrift p. 10, n. 2).
Die Zusammenstellung unseres Psalmverses mit E x .
28, 28 wird im Namen ibn Ch.'s von ibn Ezra in seinem kurzen Kommentar zu dem letztgenannten V e r s
angeführt
(s. meine Schrift p. 198), und es ist interessant zu sehen, daß sie einen A n l a ß hat.
zu einem vollständigen E x k u r s
gegeben
Die hier bekämpfte Übersetzung von D21 durch ¿L^.
ist die Abuhvalid's (s. Usül 679, 8). II. Eine nähere Charakteristik des Kommentars zu geben, muß der von mir geplanten Edition überlassen werden. Bemerken will ich nur, daß er ein fast fortlaufender, aber ziemlich knapp ist, und daß nur hin und wieder Digressionen vorkommen. So, außer der soeben mitgeteilten, zu 26, 1, wo sich, aus A n l a ß von nj?DX, eine längere Auseinandersetzung über die F o r m mj?"lfi (Prov. 25, 19) und mit ihr verwandte Formen findet. Die Erklärung dieser Formen war der Gegenstand einer Kontroverse zwischen den jüdischen Grammatikern Spaniens, die schon früher aus den Schriften ibn
4«
S. Poznanski
Ezra's und einiger seiner Nachfolger bekannt war; 1 ) — sie werden auch hier zitiert: *Abü Zakarjä, d. i. Hajjüg; »der Verfasser des Mustalhak« (pr6nDc6x 3nN5i), d. i. Abulwalid, und »der Verfasser der Traktate der Gesellung« (^XD") DnX2£ pXSH^X),2) d. i. Samuel ibn Nagdela. — Eine zweite längere Digression findet sich zu 77, 3 und richtet sich gegen die Auffassung, daß hier 1_P statt T y stehe, und gegen die Ansicht desselben, nicht genannten Verfassers, daß in I Kön. 2, 28 C^COX statt no^tr stehe. Ibn Ch. bekämpft diese Erklärungsweise aufs heftigste, nennt sie sinnlos und nichtig und der Vernunft widersprechend, da man auf solche Weise z. B. in jedem Ausspruch des Pentateuchs: »und Gott sprach zu Mose« Gott anstatt Mose setzen könne und umgekehrt: I1? NÜX'? BIPYC^X JE -IXDSSK 7113 -P-II ^ X M IX^NN
TOI
•'S n ^ x - 6 x n^-i^i n t o 12h rur dS jxn ]j? -inNin -ixrcx^x n ^ x yäio ntpo y i i s n ^ x ^ x y n niro
" -dti
Nun ist bekanntlich die Methode der sogen, stellvertretenden Ausdrucksweise (DTi r o NO ^ p XD) die Abulwalid's (.Luma, Abschn. 27), die auch eine geharnischte Polemik von Seiten ibn Ezra's hervorgerufen hat. Merkwürdigerweise aber findet sich bei Abulwalid zwar die Erklärung von I Kön. 2, 28, wie sie hier gegeben ist, nicht aber die von Ps. 7 7 , 3 , und hat er diesen Vers anders erklärt (s. Usül 275, 18). Trotzdem ist es unwahrscheinlich, daß hier ein anderer Autor gemeint sein soll.3) Hin und wieder geht ibn Ch. auf isagogische und historische Fragen ein, erklärt die Überschriften der einzelnen Psalmen u. s. w., alles Eigentümlichkeiten, die schon früher 1) S. über alles Nähere meine Schrift p. 120. 1 9 1 und Tanh. Yer. p. 28 —29.
Es zeigt sich nun wiederum, daß diese Kontroverse nicht der grammati-
schen Monographie zuzuweisen ist, sondern dem Psalmenkommentar. 2) So und nicht »Sendschreiben der Genossen«, s. R E J 58, 184. 3) So
BACHER,
Alls
der
Schrifterklärung
des Abulwalid
p. 29, n.
I.
Vgl. auch meine Edition von ibn Bal'äm's Kommentar zum Buche der Richter p. 20, n. 6.
A u s Mose ibn Chiquitilla's arabischein Psalmenkommentar.
49
bekannt waren. 1 ) So fragt er z. B . , warum Ps. 3 und Ps. 30 zu den ersten des Psalters gehören, während doch die Ereignisse, die ihnen zu Grunde liegen, am Ende der Herrschaft David's stattgefunden haben, und gibt entsprechende Erklärungen. — So meint er, daß Ps. 127 trotz der Überschrift von David herrühre, der sich im Bau des Heiligtums mit Salomo vereinigt fühlte, nachdem er es schmerzlich empfunden hatte, daß er ihn nicht ausführen konnte: pBtfl XOC i n H^Xp XED H C ^ m t y ö n TtT ipi n3X i :33 6n
mb
HD233 p y o ni»oi n o S x f x ^
."ITH P D33X T n i x i f-QD y3öl.2)
rmbw
byz
Eine historische Bemerkung
findet sich zu 68, 32: W O i m ^ÖD "l^i p i "IKip^X D^öttTD "Oyi ¡ r o m i ^33-ir 7x3 x c e p ^ x i D x ^ x
,!
?y
x - r x p ]X3 mx 1 ?
Dn^y DIS^X "l^ö1?. Daß die Analogie mit Zerubabel und Nehemia hier nicht angebracht ist, hat ibn Ch. nicht gemerkt. 3 ) Die Grammatik wird in großem Maße berücksichtigt; dabei werden auch syntaktische Regeln aufgestellt und verschiedene lexikalische Bemerkungen gemacht. Die Vergleichung mit verwandten semitischen Sprachen (Aramäisch, Neuhebräisch und Arabisch), die besonders Abulwalid mit so glänzendem Erfolg für die hebräische Grammatik und Lexikographie und für die Bibelexegese fruchtbar gemacht hat, wird auch von ibn Ch. angewandt, sodaß die bisher 1) Vgl. meine Schrift p. 3 1 .
2) Ähnlich zu 30,1: n o n nron T t r r r ^ n"?x n o r a ^ x ^ ipi p n y r o -| i ri jx^ ^
r r a n n33n ^ y o p p o r p ]x j n
xb r p by x o -iay yn ~ip r f t x n o xb - i n 7x3 n x nt> ^ip mb a n r e s t r cpc-n n n x n i c r t a k t n ^ x xms
nö,ni
^wb ¡V3 ri33n
x m i D m r n n x y T i m m rv3 n : ^ x i n "[33 nobtr
(daraus in seinem Namen
bei ibn Ezra z. S t . , vgl. meine Schrift p. 107. 162).
S. auch noch die längere Vorrede Saadja's zu den Psalmen Harkavy-Festschrift,
tt6
(ed.
Eppexstein,
hebr. Abteil., p. 145, 1. 26), seine Überselzung zu 127, I
und die Bemerkung des Herausgebers
Schreier
dazu.
3) V g l . auch ibn Ezra und Kimlii z. St. Z e i t s c h r . f. A s s y r i o l o g i e , X X V I .
4
S. Poznariski
bekannton wenigen Beispiele ,(s. meine Schrift p. 35) jetzt, wenn auch nicht ganz bedeutend, vermehrt werden können. 1 ) Das Biblisch-Aramäische nennt auch er, wie alle jüdischarabischen Autoren, »Syrisch« (,JN'HD),2) doch finden sich von den drei Vergleichen, die er macht, schon zwei (nämlich "|nD,l 52, 7 mit nDJrr Ezra 6 , 1 1 »versetzen« und D'WSy 104, 12 mit i"PEJ? Dan. 4, 9 »Zweig«) schon bei Abulwalid (Usül 439, 5 und 538, 30). Die dritte ist die Verglcichung von Dynn 2, 9 mit Dan. 2, 40 »zerbrechen«. Außerdem vgl. noch
zu nrvnü 68,7: nna p im mt^x nxn x-tn^x nrrr« ipn -ojn gemeint ist hier das targumische Tlü »dürsten« (s. Usül 606, 1). Die Vergleiche mit dem Neuhebräischen sind alle Abulwalid entnommen.3) Viel selbständiger ist er in den Vergleichen mit dem Arabischen. Hier hat er nur einen Abulwalid entnommen,4) die anderen aber sind sein Eigentum. Dabei finden sich auch bei ihm, wie bei Abulwalid, sowohl Wortvergleichungen als auch sprachliche Analogien, und zieht er zur Bekräftigung der letzteren immer arabische Verse heran. Zur ersten Kategorie gehören drei Vergleiche: 1. Zu 52, 7: "inD1! ipl ^ X n D ^ X p £ X l N 0 2 H ND2£;
•O-iy^N
JE mp-O ^ X y S ^ X p
im • • • nDi WpnDß, ge-jrvn Ipn n 3jn
meint ist ^ o ; 2. zu 6 8 , 1 1 : 5)"|nj?ND5 m w -pSx znDiß^x "n^x "oy ^ i j ^ x ^s v 6 x p
xßr r6m nvBo ip pxbx ^
nxDyß f x ; xßmi
-|r6m ^j? -rxy rn ^ T ß ^ x i
1) Vgl. ZDMG 60, 394. 2) Vgl. BACHER, Die hebr ,-neuhebr. d. Ab-ulwalid p. 30, n. 2.
u. hebr.-aram.
Sprachvergleichung
_3) r i M t y n 33. 14 ( U f ü l 703, 9) und 65. 14 ( IB - 3 3 1 . 9) " n d ebenso 2 , D l S ^ b 3 > 9 mit ™[ S Ol^O im Sejer Jefira (ib. 95, 32), dessen Verfasser auch er als »die Alten« ( X i ^ X l X ^ X ) bezeichnet (und ebenso ibn Bai'am zu Jes. 29, 11).
4) Nämlich die Analogie von D I " C ß 16, I (das manche von Ct"C> »Gold«, ableiten) mit ICJLVIOTX^ (Usül 505, 2 3 ; vgl. BACHER, Die hebr.-arab. vergleichung
d. Abulwalid
Sprach-
p. 64, n. 6).
5) Dies ist die Erklärung Abulwalid's (U$ül 2 2 1 , 30, vgl. ibn Ezra z. St.).
Aus Mose ihn Chiquililla's arabischem Psalmenkommentar. • ^ X Dncti' T ^ r u i 3.
zu
7 7 , ,5:
XOX'pr
^ x p N o r X n ^ T I X VJD, a l s o
i - m
¡"13 p ^ X
xbü
NQ2
D'PS, a l s o
noysx
mit
^
»Stamm«
"X-^-iy^
|**i! » v o l l
5
D3X50
sein«
1
und
Tioysii
verwandt.').
V o n Vergleichungen der zweiten K a t e g o r i e haben wir vier: 1. Z u
68,10:
i^o^x -ü:tn
px1?
nxt^x
nconr1 n - d
s - i y ^ x ^ i p r x S r n - | r 6 m •TI'PX r p n m a n : DIM b x p s ortra ^ X
^ns:
)o
pntra
im
XTIX^X X O n X j y c i .
noxe^
Der
hier
ni2£(?)x-D zitierte
nn---
D ^ I T
^yx
n ^ x
ipD
xipx x a x i
X~!2
ibn Ch.
und
topnDe
1
Wort keinen
des
auch
o n ^ D j ^ ¿ x n o a 'X n n
p y
das gibt
xyo
cxnübx xioytox
Verses
gütigst
mitteilt,
(s. meine Abhandlung p. 3 3 — 3 4 ) im
Namen ibn Ch.'s die Vergleichung von n r O r D H ' 3 9 . 3 rnit O w k i ^ mit Heranziehung eines arabischen Verses.
Ibn Bariin (ed. KOKOWZOFF p. 72) hat sie sich
zu eigen gemacht. 2) Vgl. GOLDZIHER, Arch. f . Rel.
1 3 , 22 11. 4.
3) Dies ist die Erklärung Abuhvalid's, s. Usül 285, 20. 4®
5-
S. Poznariski
wird dieser Vers in T A und L A s. v.
mit OtX-i! am
A n f a n g angeführt, sodaß die Anwendung wegfiele, doch hat Zamabsari in
'Asäs
al-baläga
3. Zu 76, 5: r:yt>x
x-ix [lay] *pt3 m n o i h n ipi
n D n s ^j? annit'X xnao ^xp npi NiT'S ¡lyanc"
I, 1 1 3 den Vers ohne Tibx ' j x a ^ N
1
pinni rnä ipnot'X
p yacxi xnao c ö y x naxs
-]1? -rr n ^ x ^aa n ^ x '•££ n ^ x pnnDXS 2-iy^x x i y t r pi?n
p
-|prr n S x xnaxi i p r p x^ np n n b x 2x^x jx •oy» s
mn 2x
px"6x XDaxi libtt ipn x^ btvsbx ]x xan -ixnx - p - i n n ^ x m s
n^N. 0 — **
UJJÄ
Das Metrum des arabischen Verses ^
—
(JKJO »iL!
0 4» —
JC5©
ÄJJI
^
S«
^ÄC XJÜI ^ ¿ i
_ W0
^
\JÜI
0
ist Ramal, und auch hier ist das Wort ÜX, das zweimal vorkommt, nach Prof. GOLDZIHER kaum richtig. Ibn Ezra z. St. zitiert die hier gegebene Erklärung ibn Ch.'s kurz und verwirft sie (s. meine Schrift p. 1 1 1 . 170). 4. Zu 77, 3. Nachdem ibn Ch. hier die Erklärung, daß ,
I
"T anstatt T y stehe, verwirft (s. o. S. 48), fährt er fort: ,,
j x V o ^ x xanai npi • • • riip^x
ay nax maa n 1 ?^
^ }ipx
m-in XDO oniDx^x riD^i VTIDX idgpi ^ p ^ x d -pa ^ y
yp 1
xaDisa f]VDt>x "in ^ y ^Dn -lyxtt^x ^xpi m n n 1 by DTam t>xpi -p n^rx ^ ^ayo x i x nxayos ^ o n
-pa ^ y d^i.
In die-
sem Vers J! y+L j i
jlJ,
LLya o^lJI
¿2
Ju^s
ist das Metrum Tawil. Vgl. auch ibn Ezra z. St. III. Seine Vorgänger nennt ibn Ch. nicht allzu oft. DasTargum zu den Psalmen scheint er ebensowenig gekannt zu haben wie die anderen seiner Zeitgenossen, 1 ) dagegen zitiert er zu 12,7 das Targum Jonatan zu Jes. 30, 26: HTnr HIXID CTiy^tPl 1) S. BACHER, Leben und Werke des Abnlwalid
p. 60, n. 2.
53
Aus Afoso ihn (.'lnquiliUa's arabischem Psalmenkonimenlar. l
)l •'S r m-iäo im ¿ 6 m b y i s - n y ^ x x n n xa'rxix F|yxä npi Sxps crnynty m m n e n n n x i n m c - n y ^ n y p jrov ^«p -ipi i is d o anicö im r 6 m ^ya-ixi n x o n ^ n o i n by. Öfters zitiert er die Traditionsliteratur, deren Vertreter er (mit Ausnahme von i, i; s. o. S. 44) »die Alten« (^XIX^X) nennt. So noch zu 15, 3. 5 (zweimal); 24, 7 und 107,1. Anonym schcint er sie zu 7,1 zu zitieren: i p i ' r c p HSÜlb ^lXC ¡"UX K'ir ^S ^ p i nconn p m i r p t r . Hier ist wohl die Stelle Mo'ed Katan 18b gemeint (vgl. auch Targum, Rasi und ibn Ezra z. St.). Mit ^XIX^X bezeichnet er einmal (zu 19, 15) auch die Autoren der Gebete 2 ): XD "ÖN XTXy "'S "HOX ]1!t6 IM"1 l'pi n:ioiy - e x ^
XJ^XIX
m a m (xo)
x m y mxyn p
nnpn
Ti'' D'orc r e m o x o n -lya -p-i jna x ^ i i n o x -ipi rna-o m t r y pixbäa
no6tr n n a m x n n t r r r r 6 x " - p s ^ o }un
•arnn'px x n n "by xt>Dn n a i a ^ x t o p D^xprl -\bn ]X x : - n nbxp x o E r rügt auch einen sprachlichen Fehler im Gebet vor dem soeben genannten Priestersegen, indem manche a i y fälschlich mit konstruieren anstatt mit wie in Mal. 3, 4, oder mit by, wie in dem zu erklärenden Vers Ps. 104, 34: v^y an j r "?yai ^ (i.
-¡^^
naiyi Dx^xa Hym nany^x
^
anyi
p n -inx 'by x^x n x : y o risr x"?i ^mtr
-p^y ix -¡b ^ip ^ x ns-iaai -ps 1 ? a i y n r i x ^ x
^ip*1 70.3)
In Zusammenhang damit sei die Stelle zu 68, 17 mitgeteilt, wo ibn Ch. gegen einen Pajtän, der als Benenn u n g von Engeln gebraucht, polemisiert: T3tf "10X p pya
npi n - n a o x s x ^ x v y i n s x"> p n i r n a f ^ x ^ x i
RIRXBO^x x n a x i n a ^ ö S x
BVS'PX ^>nx
-XDDX p
1) Gemeint ist der Ausspruch Jannai's (Jer.
w i
Sanhedrin
I V , 2, fol. 22 unt.),
der aus unserem Vers gefolgert hat, daß man bei der Erklärung der Schrift immer 49 Gründe für eine Entscheidung und 49 für eine entgegengesetzte ableiten können müsse. 2) Das tut auch Abukvalid, s. BACHER, ib. 73, n. 27. 3) Denselben Fehler rügt auch ibn Ezra (Safrot vielleicht aus ibn Ch. geschöpft hat.
ed. LIPPMANX 43 a), der
54
Poznanski
•Tl'PX
So
Saadja ibn —
Ch.,
ohne
Ebenso
mir
RW
b n s
zu er
nächst ihn:
die
npi
auch
nur
(vgl.
Pajtänim
zu
das
Targum,
i b n E z r a z. S t .
auch
Kimhi's
106, 37:
• • • 7xnix^>x
mittelalterlichen
zu
10,
c r : y n m x y
2
Saadja
ltrsrv
^ y
7°TC^X
^ r
i y T
z. St.,
ed. M A R G U L I E S
im
Erklärungen resp.
"lOyi
botene
33,
und
xnxi
nxES
folgt
W b .
s. v.).
HEX
DHE'!
^ y 70
DHT
rät
H D br\ü N I E
^Y
p.
im
dann
^ x
^ t ^
nVip
7 x 2 7x1 - i y n 7 x 2 n p x o ? p 7 3 n*? S x p - ' S
Dann H^X
xnu'^x damit
^
in
zu
m s - n
ebenfalls, Lri^-no
Ein
r i n n s t
Usül
p p n
ihn 7X
Mal
zu
motD2
X n M
Saadja's
er
Saadja's
bezieht
Vip
nax^ jxrs
p.
^X
n o
frnD"1 n 1 ? « i n
p
(72 = )
er
TPl
resp.
Ge-
HtfX
X"im
71;
^ t r ^
"?y t p n n
F]inn
rvm
Saadja's
(zu 7 "Xm
m x
i c x ^ x ^xp
w b b XE,_lf
rva
^
7 7 , 2) r6ip Sno
p y m
XJTX
und p. V I ) ihm
^ n f x
npi
mnEDt'X
im
754, 4 , w o ebenfalls die liturgischen Dichter zitiert' sind;
BACHF.R, Z D M G J 6 , 402, n. 6.
ip
er
xnbx pxo
D^l
m-12
folgt 'S
MXE
rpn
Ti^rm
p p ^ x
Über-
YIP"
(ed. G A L L I N E R
,
^xps
¿DE1?
xmiic
D a s ist d i e 7:
7*6 X C ?
wiederum
}>ya
i c x
X X ) :
aip
nennen:
mp
2£3xro i m xy-i n x a y e i 1) S.
,_in
die Ü b e r s e t z u n g
ohne
lehnt So
•l-iyo'pxs n n y n .
^X
rras
anderes
ir
Gesprochene
HiX
LEHMANN
74, 14:
j^pn
stimmt
überein.
(ed.
DVSi?K
,
i ? x p i ] x ; x n i r D^I m i r ) p 3 D n p s
""'BO D ^
Saadja's
Gott
bxp
7X
zu-
widerlegt
isttn
Zweimal
hinzu:
T e r
1p
er
die Ü b e r s e t z u n g
nennen.
von
zitiert und
Qiytrnn
damit
zu
das
niotca
x:xi
10 unt.). ihn
Autoren
Fajjumiten ir
^ipx
(vgl.
auf
fügt
den
m n
7X
ohne
9
n^ia
setzung
als
•,yiin^X
ab,
jüdischen
m x
1
ytr
Wort
und
N T R 70 7x1: i S i I-IID ^ Y
• n ^ y
^ X
das
ity. Von
7x0
aber u . s. w . ,
nennen
fjxiix
^Y
•^x
^ x
ihn
zitiert
COVE^x
b n ü
erklären
und Abulwalid1)
7c vgl.
Aus Mose ibn Chkjuiülla's arabischem Psalmenkonimcntar.
X:X1 -¡X22K yällD , £.
^Xn^X b • • • die Abulwalid's
{Luina
55
Die erste Ansicht ist
3 1 1 ob.), die zweite die Saadja's (s.
meine Schrift p. 170).
Weiter wird Saadja bekanntlich von
den jüdisch-arabischen Autoren als »der Übersetzer« (tDSD/X) schlechthin bezeichnet, und daher ist er wohl auch zu 38, 6 gemeint: 70^ y o 1 tino" nSip ^ im XHynC Ta ipo: WNan n1? -iDEOtJN m » bbi 70 pias^x x i n ^ x r x i no!?i -lyno n p n •J^N ¡TS XijKl
N3~HK. Ibn Ch. macht sich aber auch
die Erklärungen Saadja's stillschweigend zu eigen, so zu 21, 3: ^ x xnncxiix n x xaxi ¡ t ^ x vnstr nenxi ^ m
i n y xo
,!
?x x i n y x n x a y a j i n DIS
p
xrxi
e n T ]Vtin~
"|^>X DXJ^X. Die hier bekämpfte Erklärung ist die Abulwalid's (Usül 68, 27), dagegen ist es Saadja, der ntiHXl mit ¡"DXTPiDXl übersetzt und dazu bemerkt (ed. w i « nn^yas Dns
p.
LEHMANN
II):
1
7vttnr n^ip 70 ntsnxi nppntt'Ni. )
Die jüdisch-spanischen Grammatiker: I.Iajjüg, Abulwalid und Samuel ibn Nagdela zitiert er, wie wir oben S. 48 gesehen, zu 26, 1 in dem Exkurs über myiO. Der erste von ihnen wird weiter unten noch erwähnt werden zu 8, 8 und dann noch: 1. zu 69, 19: bs n m p 7X 7 ^ x fp-in n x r c snxü t>xpi
bnn
n^vs 'by xr6x r n s v n T\bs bys blxn 70 i w n^x: ^ e a
-not? n n p nnp bno ^ y N.I xcax r n x n nr6tr nbw n y c c yetr "L^x rnrr n r r M C C '
(vgl. dazu I.Iajjüg ed.
JASTROW
p. 32
und meine Schrift p. 168—169); 2. zu 107, 30: 1H"I0 'pX ipl inn"1
•'X ra" im x1? m o ^ p -ipi D r n x i c r n ^ x
nnxü x n n ^ x ^ y
ciisn 1
7x2 npi c n ^ y -|tn yxanex ? x n r v o r
xn^xrnx pn^nDo^x rixnr nnxtf t V i ^ x ^ x
,!
?y ix rbbt< nxr-c
•^X f ^ X n^nyo^X "'S. Ibn Ch. leitet also auch im (Iii. 24,1) von Tin ab und es folgen ihm hierin ibn Ezra z. St. und 1) S. Lehmann's Bemerkung p. 10, 11. 4.
S. Poznanski
56
Josef Kimhi (s. David Kimhi's Wb. s. v. Tin).') Außerdem wird Ilajjüg auch noch anonym angeführt zu 7, 6: 112 ^"pi nntiws n u n
N i D i m r p - i T br\a
n3N ^ p x s
N3N1 r p - i n 1 n a x
tpT
N ^ N T (s. ed. J A S T R O W p. 161 unt.; U$ül 6 6 8 , 1 7 und ibn Ezra z. St.). Abulwalid ist bekanntlich die Hauptquellc, aus der die Bibclcxegeten geschöpft haben; umsomehr ist es zu verwundern, daß er von ibn Ch. namentlich nur an den zwei bisher erwähnten Stellen (zu 26, 1 und 107, 30) angeführt wird, und dabei beide Male als »der Verfasser des Mustalhak«, das doch seine Erstlingsschrift gewesen. Dafür aber zitiert er ihn öfters anonym und verwirft seine Ansichten, so zu 21,3 (s. o. S. 55); 32, 4 (die Erklärung von n t i 6 als ^ ü i l 'DCH, s. Usül 7 0 4 , 1 1 ) ; 3 8 , 4 (s. o. S. 4 6 ) ; 3 9 , 3 ( N U Y 1 ? ist Plur. von M J ? 1 ? ,
s. Usül
354,15);
n^I b p y
NE
(vgl. meine Schrift p.
40, 7
tfnni
-IÜP n c N o n
p y n t ^ N
164);
1
56,
("IDS
o^pim D^n nav
^
•j'w "iyO H l \ s. Usül 50, 32); 69, 4 (über m31, s. Opuscules 2 1 8 7 ) ; 7 4 , 8 (s. o. S. 5 1 ) ; 7 7 , 2 . 3 (s. o. Ss. 4 8 . 5 5 ) ; 1 0 9 , 3 ) und 126, 4 (323 »trocken« vom Targumischen, s. Usül 403, 23). Aber selbstverständlich wird Abulwalid auch stillschweigend reichlich benutzt, wie dies auch von Seiten seines jüngeren 1) Im Namen ibn Ch.'s zitiert sie Isaak ben Elazar Hallewi in seinem HTO ^O" 1 i m tnatr H by
-P-IN t r n p n
^YCO
und 76, 12.
Zum Schluß sei bemerkt, daß ibn Ch. auch christliche Erklärer ('HNüa^N) gekannt und benutzt hat. Dies taten schon die Geonim Hai und Samuel b. Hofni, aber sie beide hatten vor sich die Pesitta, 2 ) die jüdischen Autoren in Spanien dagegen scheinen lateinische Übersetzungen und Kirchenväter gekannt zu haben. Ein solches Zitat bei ibn Ch. zu 8, 3 findet sich weiter unten, ein anderes, viel interessanteres, zu 65, 14 ist christologischen Inhalts und lautet: 1) S. BACHEK, Z A T W 2) V g l . R E J 50, 29.
13, 132.
Tpnyi
5«
S. Poznanski
x i m rvDebx
TON^R
M
P R
X E T C
IR
IR6TR
'2
NXÜ^x;
die
Beziehung
also des »Lammes« auf Christus ist eine V e r -
rücktheit.
Ebenso zitiert dieselbe Erklärung" ibn BaTäm zu
Jes. 16, i (ed. DERENBOURG p. 57) und bezeichnet sie ebenfalls als wahnsinnig (DXD-D^X^ ITOU' Nim).
Gemeint ist hier
(s. ÜERENBOURG's A n m . z. St.) H i e r o n y m u s . 1 )
Ein christlicher E x e g e t , Hafs b. Birr al-Küti, von dem sich handschriftlich ein Psalter in arabischen Reimen erhalten hat, ist nur aus Zitaten bei jüdisch-spanischen Autoren bekannt 2 ) und wird auch von ibn Ch. zu 55, 22 angeführt: raci
nxnn n u r n s i m p S i-p no^on
^toipbx
HJOI
mn^x p
mS n p i
p p£n m i r ^ piDE^x xnn m i n D^ttn i n n s n n
m s mnbx:; ruo a^p^xi niö^x oxriD 'pno nxnn ^m
m s DX^C p D ^ x p
'px
r r n x f / m e n ,16x27x1
E s ist dies ein V e r s , den auch der spätere Mose ibn Ezra in seiner Poetik zitiert mit einigen, wenn auch unbedeutenden Varianten, doch stimmt unser T e x t ganz mit der Mailänder Handschrift des Ilafs überein.-') I V . Die bisherigen Mitteilungen haben wohl zur Genüge die Bedeutung des Kommentars ergeben und gezeigt, daß wir es hier mit einem der wichtigsten exegetischen Denkmäler aus der spanischen Glanzperiode zu tun haben. U m aber eine Ogenauere VorstellungO von seiner A n l a gÖe und seinem Charakter zu geben, lasse ich hier als zusammenhängende Probe den Kommentar zu einem ganzen Kapitel folgen und 1) Außerdem setzer«
zitiert ibn
Bai'am
noch
zweimal
den
»christlichen
Über-
D i i n E ) : ™ Deut. 14, 1 (bei FUCHS, 1. c. p. X V I I I , s. seine
A n m . z. St.) und zu Jes. 21, 12 (ed. DERENBOURG p. 68), und dann heißt es in seinem handschriftlichen Kommentar zu Hab. 2,
D^l ^SX rj^X^X p f y ' j X
4:
"HNÜ1?^ • • • ITTEJ? PI3n
H ö ^ X \5J?D ^ H3X ¡TC-
2) S. die Literatur über ihn bei STEINSCHNEIDER, Arab. p. i n .
Lit. d.
Juden
342, der geneigt ist anzunehmen, daß Hafs doch Jude gewesen, nur daß
sein Psalter von Christen interpoliert wurde. 3) S. R E J 30, 66.
Aus Mose ihn Ohiquitilla's arabischem
Psalmenkommentar.
59
wähle, um den mir gewährten R a u m nicht zu überschreiten, das kurze, aber in vieler Hinsicht interessante Kap. 8.
T u n inan *x na
a m
- m y
n x ^ x 1
DE ?
x n ^ y
^nin
D ^ i y
""so
n^ipa
iajn
annxinn
xe
xnnxtt»
csjjd
ans
-ijn
i n
Tip
nam ipn
o n ^ n o ptoxa ^
näxb
6
nxiax^x
.xn^x
iipcoj"
p
) n r x ^ x
rian
ti^x
1
ixcd
.omnx 70
nntö
x^> n ^ x
o n p x n x
^ p
risxjjx'wi
n
xnyETi
n^pn^i
sj.nnnxpbx
7x21
x,-6rtr s
niayo^x
i n m p
V
p n ^ c b x
rnnxnbx ^ayi
7x1:
nani
onnxiExn
nxjji
irnDnm
p^r
p
ipi
^i?»
nnna
n^na
nn-nco^x
]xs
itrx
•o.DiTEioa^x
p^f fXDax^x
xn ?
nan
i£
^rtr
1
.XCD^X
n ^ t r n ^ " i n n u 7V0 1 ? i p i
nüat:^ ip
bnübx
^rxao
701 x t a b i a y i i ~ n n
•'s - ] d d n d k j ? x c a x
by
i">x IDV
onacbx'i
p x ^ x
inx-x
ninan
).na
>xi^xn
rbt»r^x bin
!
nw-n 2
i^h
nti'x
n i n p b
i b x n r i D a nbs
nay
p
by_
^xtonx
o-pan i ? s r n 3
iay
i^xSyxi
n^x
¡rinxt^x
xrrs
xen
xnan
nxDnax'bx
70 x ^ b p
xos
xnn^jjEi
nnapa
n y
d\-6xc
1) Diese E r k l ä r u n g wird im N a m e n ihn Ch.'s von ibn E z r a z. St. zitiert: vian
n m
m i y
n n s t ^
i a i U N S i D x1? n r n 2) m s .
^x
Dninnbv
Dnini
^ r
xin
»«--ine
m
i c x
(VTICQ
T(ÜV
hjrcöv)
toreularibus) a u f g e f a ß t ; welcher christlicher Erklärer es aber als mentiert, ist mir u n b e k a n n t . 4) A u c h diese E r k l ä r u n g u m y i
1';' n n - n m Schrift 1. c.
an i t x 3
Di-psn
findet sich
i - o t
sb
DEian o m m
Kommentatoren
u n d Vulg. (pro 'Spindel-
kom-
bei ibn E z : a im N a m e n ibn Ch.'s
dx
d ^ i j j
mEni
5) A h n l i c h bei ibn Ezra im eigenen 6) So erklären NeJdrim
^nn
Ni^xav
3) H a wird als K e l t e r von den I . X X
iTp
ntro
p-106.161.
iec
nbr^rn
n w i n o n ^ .
s
-
-ix mcin
«
Namen.
die Übersetzungen ( L X X , Targ., Pes.) u n d alle jüdischen
(Rasi, ibn Ezra, K i i n h i ) , nur der T a l m u d
38 a) scheint hier Q i n ^ X
a s
'
Gott aufzufassen.
{JioS ha-Säna
21 b,
6o
S. Poznanski, Aus Mose ihn C]ii
»
III:
21.
»
»
III:
I.
»
358
1.
»
338
I-
18.
II.
1.
»
Arses:
19.
»
337
2.
»
»
8.
»
336
I.
»
5.
>
:
Darius I I I : 28. März 335 »
nach
I I I : 1 2 . April 3 3 1
MAHLER
22. April 359 v. Chr. II.
8.
»
358
»
337
» 338
» 336
28. März 335 1 3 . April 3 3 1
Nach diesen Tatsachen dürften heute auch schon jene die Brauchbarkeit
Die Doppeldaten der aramäischen Papyri von Assuan.
75
Auf diese Weise finden wir auch, daß das Datum: »20. Marcheschwan im Jahre 17 des Königs Darms", das am Schluß der von ED. SACHAU veröffentlichten aramäischen Papyrusurkunden aus Elephantine 1 ) sich befindet, in julianische Zeitrechnung umgesetzt, folgendes Kalenderdatum gibt: 25. November des Jahres 407 v. Chr. Ebenso entspricht das in Z. 4 der Urkunde I stehende Datum: »Monat Tammuz im Jahre 14 des Königs Darius« der Zeit 14. Juli— 1 1 . August des Jahres 410 v. Chr. E s sind also die julianischen Jahreszahlen, die SACHAU für Darius II Nothus gibt, zu rektifizieren. Das Jahr 14 dieses Königs ist nicht das Jahr 4 1 1 /1 o v. Chr., sondern 410/ 409, und das Jahr 17 ist nicht 408 / 407 , sondern 407/406 v.Chr., und Darius regierte nicht 424—405, sondern 423—404 v. Chr. Wir können dies übrigens auch den früher besprochenen Urkunden H, J, K des Assuaner Eundes entnehmen. Denn diesen zufolge ist: Elul ( = Payni) d. J. 4 Darius = September d. J. 420 3. Kislev » 8 » = 16. Dez. » 426 24. Schebat »13 » = 9 . Febr. » 410. E s muß sonach das 1. Jahr des Königs Darius = 423/422 v. Chr. sein und somit Jahr 14 = 410/409 und Jahr 17 = 407/406 v. Chr. Auf jeden Fall aber erkennen wir, daß den jüdischen Kalenderangaben in den zu Assuan und Elephantine gefundenen aramäischen Papyri weder das Neulicht, noch die Bestimmung des wahren Neumondes und auch nicht der sogenannte reformierte jüdische Kalender als Grundlage der Zählung diente; hiefür war die zyklische Bestimmungsmethode der Babylonier mit ihrem 19 jährigen Zyklus maßgebend, dessen 9. Jahr in das Jahr 587 v. Chr. fiel, d. i. das Jahr der Deportation der Juden durch Nebukadnezar. meiner Tabellen anerkennen, die dies vor 1 6 J a h r e n , da das chronologische Material jedenfalls ein dürftigeres war als heute, nicht tun zu können glaubten. 1) Abhandl.
d. K.
Preuss.
Akad.
d. IViss.
1907.
7n is apparently Htt'ri. 1) One of the texts has
Sarru,
and another
rubu.
2) I have given freely the substance of the texts, not translating any single one exactly.
New
N o t e s on s o m e O l d
79
Inscriptions.
T h e whole passage might be translated as follows: And may 10 [the Lady, MJistress of Gebal, give [him] fai>or in the sight of the gods, and in the sight of the people of this land, and the favor of the people of 11 [other] lan[ds]. Whosoever thou art, prince or man, who doest further work on [this] 12 al[tar, or on] this [engravJed- work (?) of gold, or on this portico, there am I, Yehawmelek, 13 [king of Gebal, and I am] the doer of that work. Or if thou put (here) nothing at all, there am I. And if W h a t follows is too fragmentary for any restoration.
satisfactory
Tabnit. In lines 3 — 5 , the finder of the sarcophagus is urged not to open it, and it is said that no silver, nor gold, nor jewels have been buried in the coffin with the king. T h e text of lines 4 b and 5 a is very difficult:
2
ntroo S n p n j^hn. W i t h this passage must be compared, first, E s m u n a z a r line 5: D20 p DtP 2 D30 p CpS"1 and then also Nerab II 6 f.: It'nil ^J? 'r'l. This last passage is to be translated, obviously, " A n d they did not put (i. e. bury) with me any vessel (or, ornament?) of silver or bronze". T h e Esman c azar passage: "Do not seek here(?) jewels, for no jewels are deposited here". (The general meaning of p , "with me" or "in it" or "here", is certain, though the form itself is of uncertain origin. A s for DIP, it is either -lEtt' or cril>, passive participle. T h e latter seems to me preferable, the singular number being unobjectionable.) In the Tabnit passage, finally, there are two very troublesome words, fS-lK (or ^IN) and ItrOO (or "IIW30). Of the former, it is sufficient to say now that it corresponds to p in the Esmun'azar passage; that is, it is, in the sentence, at least a rough equivalent of an adverb of place, "here". 1 ) 1) I
do
not
mean
by
this
to
imply
a n y t h i n g as
to
its composition.
I
8o
C. Torrey
But it is the latter part of the phrase, nB'DOJÖ^I, that calls for special attention.
First comcs ^ IT, beyond any doubt.
What remains has always (so far as I am aware) been divided iti'C • 3D.
But after b?, in this negative clause,
the
plural number is not to be expected, according to Semitic usage; the noun following must be singular, that is, This leaves what appears to be a participle (presumably pual or hof^al), "Itföü. The only plausible etymology which suggests itself is the one obtained from the very common Assyrian verb muiSur, meaning "leave, leave behind", etc. The form "lt5'PP would be a perfect parallel to the passive participle Dt^ in the corresponding phrase of the Esmunazar inscription. The logical connection of the word would then extend to f]D2 and JHn as well as to p . In the seventh line of the inscription occurs the phrase • T O jnr by bti. It is customary 1 ) to substitute for ^l1 the two words "l"? p \ on the supposition that the engraver omitted twice© by accident the letter compare Esmünc azar, line 8, D1? p 1 bti. This is desperate treatment, indeed. A n engraver might easily omit the letter once-, but against its omission twice within the space of four letters the chances are almost infinite. The letter is a very easy one to carve, and there was abundant space. Whether by is supposed to be defective, or not, we can be quite certain of this, that the reading originally intended was not p\ The reasons for dissatisfaction with the reading by are two in number: (i) the difficulty of connecting it with any known North-Semitic root; and (2) the supposed necessity would suggest, however, that the first element in the compound might ( = - p ) "hand, side", used adverbially.
Cf. b n!"in> b H i n .
etc-
^IN
be would
then be a compound preposition. 1) So, for example, COOKE, North buch,
and Altsem.
II, p. 6.
Texte-,
Sem. Inscriptions',
LANDAU, Beiträge
zur
LIDZISARSKI,
Altertumskunde
des
HandOrients
8I
New Notes 011 some Old Inscriptions.
(or desirability) here of a clause containing the second person rather than the third. But neither reason is justified. A suitable etymology, well supported, is to be had; and as for the third person, I shall show that it is the one to be expected here. The word intended is 'PJJ, jussive, from Arabic Jj->, "take, obtain". The verb is a very common one in Arabic, but only a few traces of its use in the North-Semitic dia7
lects have survived. In Syriac we have only the verb ^ a J , "torment", whose connection with the original root is, moreover, quite uncertain. N ö L D E K E , N e u e B e i t r ä g e z u r s e m i t i s c h e n S p r a c h w i s s e n s c h a f t (igio), p. 216, in speaking of the Talmudic word tf^KJ (an evil spirit), says: "Das Wort ließe sich zu »quälen« ziehen, das wieder zu J j j , J - ö gehören wird, als dessen Grundbedeutung etwa »greifen, packen« anzusehen wäre." But we have much older and more direct testimony than this. In Ezra 6: 1 1 , Dan. 2: 5, 3: 29, occurs the phrase - o y r v I^U HiVD, "his house shall be made a rubbish-hcap". However the word "P13 (or "613) be pronounced and interpreted, it is very important to observe that the old Greek translator (or translators)1) derived it from meaning "take possession". I Esdr. 6: 31 gives x a l r d v n a q y o v x a avTov e l v a i ß a a i X i x a , Dan. 2: 5 x a l d v a h ] r p d i ] O E T a i v / u a j v rd vnriQyovxa e l s TO ß a a i X i x o v , and Dan. 3: 96 f j o l x i a a v r o v S r j fj,Ev&rjoezai. These renderings, taken in connection with our passage in the Tabnit inscription, arc enough to prove the use of the root in the Syro-Palestinian dialects. A s for the change from the second person to the third, this is simply due to the imprecation. The feeling was always strong in the Semitic Orient that t h e s e c o n d p e r s o n ought to be avoided, so far as possible, in passages containing curses or other expressions of ill omen. It would be 1) As I have shown in my Ezra Studies, the old Greek versions of Daniel and Ezra ("I Esdras") were made in the middle of the second century B.C. See especially pp. 82 f., 84 f. Z o i t s c h r . f. A s s y r i o l o g i e , X X V I .
6
82
C. Torrcy
easy to multiply illustrations here, but the subject has been treated in many places. See especially G O L D Z I H E R , Abhandlungen zur arabischen Philologie 1, 3 8 — 4 1 ; L A N E , Thousand and One Nights I , 117 (note 8); M E R X , Die vier kanonischen Evangelien I , 235, note; L E V Y , Lexicon s. v. "OR. Hence, for example, the public reader of the Hebrew scriptures read Lev. 18: 7 ff. with the substitution of suffixes of the third person for those of the second. (Notice also the strikingchange of person in II Chron. 7: 20.) And hence in Matt. 14: 26, Mark 6: 49, the dai/xdviov of the original rendering was altered to the harmless cpavTaojua.1) In inscriptions of approximately the age of Tabnit we find the very same change, from second person to third, occurring at the point where the curse begins. Thus Nerab II, lines 8 f.: "Whosoever thou art that shalt injure (second person) . . . ., may Sahar and Nikal and Nusk make his death shameful!"2) So also the Guzneh Boundary Stone 2 ): "Whosoever thou art . . . ., may (the gods) destroy him and his seed!" Also at the end of the Byblos inscription, in spite of the present mutilation it is quite certain that the same change of persons takes place, and for the same reason.3) Another example, from a later day, is furnished by the Syriac inscription published in L L D Z B A R S K L , Handbuch, 484, 3. In Nerab I, lines 10 f., the second person is indeed retained in the imprecation (as of course would occasionally happen). There, however, the case is somewhat different, inasmuch as the curse is immediately followed by a blessing invoked on the 1) So the Lewis Syriac text proves conclusively. It is not at least extremely probable that the clause o eozi itfdtofitjvFVOfitvov viae nagaxArjoscos was inserted in Acts 4: 36 for a similar reason? The origin of the name Barnabas (Son of Nabu, Nebo) was of course perfectly well understood. Why, otherwise, should the interpretation (!) of the name have been given at all? 2) Regarding the text of this, see further below, p. 90. 3) The condition, introduced by a verb in the second person, begins at the end of line 13.
The conclusion, which therefore must have contained a
curse, was expressed in the third
person, as is seen in the last words of line 15.
New
N o t e s on s o n i c O l d
Inscriptions.
«3
one (addressed also in the second person) who spares the tomb. The translation of lines 3 ff.: Whatever man thou art, who findest this coffin, do not in any wise 4 open (it) upon me, nor disturb me; for with me is no silver, with me is no 5 gold, nor any ornament, deposited And if thou shalt in any 7 wise open (it) upon me, or in any wise disturb me, — may he obtain no seed among the living, under the sun, 8 nor any resting place among the shades! Esmunazar. Line 3. It is not safe to build much on the words (repeated in line 12) which say that the king' was "snatched away by an untimely death". It is indeed very probable that he was comparatively young when he died, and his mother appears to have survived him. But it must always be borne in mind that in the TiJ? tO we have an exact equivalent of the Greek UOJOOS, which is omnipresent on the Greek gravestones of this same region, seemingly irrespective of the age of the departed one. Nearly ever}' death is "untimely" to the bereaved friends and relatives; at any rate, the probability of a customary formula must be taken into account here. Drv is not "orphan" (as it is usually rendered), but "fatherless", as in Job 24: 9. So also the Arabic and Syriac usage, frequently. no'JN "widow" bears the same relation to TOO^N that ntr "year" bears to nitt'. There is no reason for hesitating over the word. Line 4. It is absolute!)' certain that in rWDJp we have the interrogative ( = indefinite relative) and the pronoun PX (see above, on the Byblos inscription). It is equally certain that the 3p is to be connected with the 'D, and not with the preceding sentence; the comparison of line 20 leaves no room for question as to this. Comparing the other occurrences of this customary formula (Byblos 1 1 , Tabnit 3, Nerab I, 5, II, 8, Guzneh 2), the conclusion is obvious that 6®
84
C.
Torrev
the Dp is used here merely to emphasize the indefinite idea in the the use resembling more or less closely that of Ht etc. in Heb. fit '•O, Kin Ht , D, the zig in Gr. dang, the strengthening elements . in who ever, who soever, etc. The origin of the word )p is not easy to find. In my Ezra Studies, p. 185, I suggested, faute de mieux, the borrowed Greek word [eijxcbv. The reason for the suggestion was found in the combination of several considerations. Some such word as elxtbv "image, likeness, figure", or persona, TiQooamov, etc., seems natural here: "Likeness of whomsoever thou art."1) The principal use of the Syriac >cclLd ( = persona and HQOOWJIOV) resembles the use of the ]p in this inscription. It is very often used with negatives (like the French personne), but also, in very old usage, in a manner startlingly like' the }p in these Esmunazar passages, its province being to add strong emphasis. Thus Matt. 5: 34 (in the Lewis text, and carried over into the Curetonian) ^aaicaJ-o? |3 ¡ui] bfjLoaai oXcos "swear not at all"; 9, 9
CURET., Spic.
13 oiiooJ-D ) nN 1. "fate has no existence at
all";
Aphr. ed. W r i g h t , 352, 16 iJavs ^oou^ looi oiieoij "what sort of house at all had they in this world?" In these cases, and the similar ones which arc known (see N o l d e k e , Syr. Gramm., § 223), the word likeness would be a fairly good substitute for ^csXa.2) A n d all the most characteristic use of the Syriac word suggests its origin in some element kon -f the indefinite ma. A s for the probability of such a borrowing from the Greek in the time of Esmunazar, the date (probably the fourth century B.C.) is not too 1) B u t
there is n o e v i d e n c e ,
s o far as I k n o w ,
r e s p o n d i n g to t h a t s u p p o s e d in this 2) I t "curse". merely
may
The a late
be
added
Rabbinical
Jewish
here,
D31p,
that
there is n o g e n u i n e S e m i t i c
cor-
word
to w h i c h m i s t a k e n a p p e a l has b e e n m a d e ,
e u p h e m i s t i c s u b s t i t u t e for
teristic c r e a t i o n s of t h e sort.
of a u s a g e in G r e e k
passage.
qurban,
one
of several
is
charac-
X e w "Notes on sonic Old Inscriptions.
«5
early. But it may be that some better explanation of the will be found. 1 ) Line 6. D313 is not a mistake for DJ1313, as it is generally regarded. The word is written the same way in both copies of the inscription. The hypothesis of exact reproduction of a faulty original is not admissible, for the two copies do not agree throughout, letter for letter. The original copy was certainly read through carefully by more than one pair of interested eyes, before it was handed over to the engraver. Moreover, the word "13, D,r]3 "prating" (abundantly attested in O.T. Hebrew) is just the word to expect here. The whole inscription is somewhat hysterically written, from beginning to end. It was probably composed by Am-'Astart, the queen-mother, who is made very prominent in it; and there is some evidence that she had definite reason to apprehend that an attempt would be made to remove the sarcophagus of her son, because of political or family troubles. It may be that the carving of the inscription in two places is to be explained in this way: A s originally composed, it extended only as far as the middle of our line 12. The stone-cutter accordingly engraved it on the end of the sarcophagus. Then Am-Astart changed her mind, and added to the document an amount almost equal to its original extent. The stone-cutter began with his new material where he had left off before, and added a little more than one line, evidently intending at first to fill the space at the end of the sarcophagus and then continue in some adjoining space. But he decided, or was bidden, to make a better piece of work, in one continuous space; so, breaking off in the middle of a word, he smoothed off the top of the sarcophagus lid and carved the whole inscription there. I do not believe that any skilled workman who had in his hand 1) Borrowing to be considered.
of
the Persian gon,
"color,
fashion", is
also a possibility
W e know that this was borrowed b y the J e w s , at least (¡11
the form l^'j) as early as Dan. 7 : 1 5 (my
Notes
on A r a m , of Dan.,
in loc.).
86
C.
Torrev
this present document of 22 lines would ever h a v e b e g u n to c a r v e in the small (unnecessarily small) s p a c e occupied b y the f r a g m e n t a r y copy. Line 9. T h e part of the imprecation which is contained in this line and the following is generally misunderstood, I think. COOKE, for e x a m p l e , renders: " A n d ma}' the holy g o d s deliver them u p to a m i g h t y prince who shall rule over t h e m , to cut off that prince or m a n who shall open this resting-place", etc. B u t w a s the O ^ D regarded as such a terrible man-eater a s all this? 1 ) On the contrary: TID h a s j u s t the s a m e m e a n i n g here a s in line 21, viz. " e x clude" ( = g i v e over to destruction). nN is the accusative particle, for ¡VN, a s in B y b l o s lines 3 and 7. •iniip'P is then to b e connected with D3"12D,'I. T h e p h r a s e in the second half of line 9 is not logically complete; but all the thought of A m - A s t a r t w a s concentrated on "the m i g h t y ruler" (probably the immediate successor of E s m u n ' a z a r II) who w a s e x p e c t e d to m a k e the attempt to r e m o v e the s a r c o p h a g u s from the royal necropolis. I h o p e to return to this subject later, in a m o n o g r a p h on the E s m u n ' a z a r dynasty.
Bod-Astart. Inscription I (CIS I 4).
W h e t h e r the k i n g n a m e d here
is the one n a m e d in the other B o d - A s t a r t inscriptions, uncertain.
is
A n excellent parallel to the n a m e h a s just been
found b y the H a r v a r d
e x c a v a t o r s at S a m a r i a , in the Old
H e b r e w form V I 3 (unmistakably written). the c o m p o u n d
T h e first part of
is doubtless the noun "13, " m e m b e r " .
The
vowel b e c a m e o a n d ii in the Phoenician pronunciation, j u s t a s a b e c a m e o and u. T h e latter half of the inscription, from the middle of line 3, r e a d s : T ¿ M I p N p t r JTK Dnj£
i m n t r j T C |3 3
1) R e c o l l e c t that he is not speaking of " d e l i v e r i n g u p " a city, or a people, but merely the individuals w h o m he is cursing.
Xcnv Xotes on sonic Old Inscriptions.
mntpy 1 ? ^n 1 ?. The 11 at the beginning of the last line is entirely gone, and the dotted letters are missing in part, though the remaining traces are in every case sufficient to make the reading certain. A s I have argued elsewhere, 1 ) is "colonnade", the same word as the Aramaic NIPtl'K (with prosthetic X) found in Ezr. 5: 3, 9 and the Elephantine papyri, and the Assyrian Surinnu. Whoever compares the Surinnu passages in the inscriptions of Asurbanapal ( K B I I 260—263) with the Wltt'N passage in the Elephantine letter, will see much to suggest that the two words designate the same thing, namely, something which stands in, or belongs to, the outer court of a temple. It stands upright, may be adorned with gold or silver, and (in the case of NiTii'N) is evidently more extensive than a single column. From the wording of the Bod- c Astart inscription we must conclude that the goddess 'Astart already possessed a colonnade in one (at least) of the other districts of the great city. The translation: (Dated) in the month tnefa, cession-year
of the king Bod- Astart,
(at the time) when donians,
=
king of the
in the acSidonians;
llS'Kp) Bod- Astart, king of the
built this Colonnade of the Sea-District
Si-
to his god,
'Astart. Inscription II {Repertoire, 287 — 297, 300—302, 765 ff.). I believe that my original translation in J A O S X X I I I (1902), 1 5 6 — 1 7 3 , the first publication of any sort which this inscription received, will stand as correct, except in one short passage. A little below the middle of the inscription is found the reading "ltM"12£lJ2tiW, and the context on both sides makes it evident that the words intended by these letters form a clause by themselves. They might be omitted entirely without any effect either on what precedes or on what follows, p tfN is obviously the familiar phrase "he who built", and what follows can hardly be anything else than "and 1) Especially Ezra
Studies,
p. 176.
88 Sidon".
C. Torrev
I would suggest that in this short clause the king
is boasting, in general terms, of his renown as a builder. "ItT is the denominative verb, "walled",
from
"wall".
¡"132 is used absolutely, as often in the Old Testament. whole clause is: "He who was a builder, Sidon."
and who
The walled
The apparent difficulty in the position of the verb
vanishes as soon as the attempt is made to put the words in any other order. ]~iîi TLTI p tî>N would not do at all! Bod- c Astart did not "build Sidon", he only built (or repaired, or enlarged) the city wall. It was therefore necessary to put "IB* after and we have no reason to doubt that the order of the words was one which was often adopted. Inscription III [Répertoire, no. 5 0 7 ; L l D Z B A R S K l , Altsemitische Texte p. 20). The beginning reads: m n t f j n 2 "pC • r u -|t>0 p i . The name Sedeq-yatôn-melek is like Marduk-aplu-iddin, Bël-sar-usur, p I M C Sin-zër-bâni (Nërab I), and the host of others, mostly Assyro-Babylonian. That the father of Bod-'A start did not reign, is shown, I think, by two things: (1) the fact that in the standard long inscription of the Esmun temple he does not name his father at all; and (2) the presence of the 1 before p in this shorter inscription. (Is it not likely- that the 1 belonged to the formula regularly used in such cases? It made it possible for the king to tell who his father was, and at the same time to indicate that the father did not reign.) The inscription celebrates the building operations of one man only. "He built this house to his god", not, " They built this house to their god." The stones bearing this shorter form of the inscription were found in the lowest part of the temple wall, and this was undpubtedly the older form of the document. The king began by using a very brief formula, in which he gave his father's name. Later on, he changed to the longer and more magniloquent formula, and in this he said nothing about his father.
New
N o t e s on s o m e O l d
89
Inscriptions.
T h e translation: The king Bod-Astart (who was also the son of Sedeq-yaton-melek), king of the Sidonians, grandson of king Esmiiriazar, king of the Sidonians, built this house for his god ESinun, the Holy Lord. Siloatn. In line 1, after "11J?-, the probable order of the missing words is decidedly this: ] n : n [DK DD2t? DZ&nn]
The
inverse order of the two participles is less likefy. In line 3, the gap after ^NlOtr ] b l .
is to be filled as follows:
LIDZBARSKI, Ephem. I 311, thought that he saw
part of a j after 01; and this is by far the most probable letter to expect, under the circumstances.') the manner
T h e variation in
of writing the jO was very likely a literary
finesse-, cf. also Ezr. 6: 14 Dy^D-l • • • • OJJD soour
rnnn
Jer. 10: 11
NJPKO, etc.
In line 4, read H2p3n DO-l, " A n d on the D a y Tunnel".
of the
This seems to me the only satisfactory interpreta-
tion; supposing the day to have been honored (as it undoubtedly was) by a great celebration, so that it was thereafter known as "the D a y of the Tunnel". Zenjirlf. Bar-Rekeb. Translate in lines 6 f.: " M y Lord Tiglathpileser placed me upon the throne of my father, and in my father's palace, laboring more (zealously) than any one (of my predecessors had labored)." This agrees with what is said below. Translate in lines 16 f.: " A n d through me (came) a prosperity which was not enjoyed by (literally, did not belong to) my fathers, the kings of Sam'al." 1) I h a v e 110 d o u b t that the w o r d no
one
of
plausibility.
the
proposed
etymologies
,~|"1T >n this line m e a n s " f i s s u r e " , b u t
seems
to m e
to h a v e e v e n the smallest
C. Torrey
9°
T h e word which, is divided by the end of line 17 is iO^.3, "all of it".
Compare the 0 in the corresponding suffix
in Hebrew, Is. 44: 15 being perhaps the best single example. Translate: "It is a house, all of which is for them" (viz. the ancestors of Bar-Rekeb). Nerab II. T h e interpretation which renders ¡"ON ntnt2 in line 5 by " W h a t do I see?" seems to me not only too fanciful, but also logically objectionable. W e should certainly expect in that case " W h a t did I see?", especially as the verbs which follow are all in the perfect tense. Moreover, the verb TflKriK in line 4, immediately correlated with H3X n i n e , also e x presses past time. It seems to me very much more probable that w e have here a passive participle of the haf1 el stem (i. e., presumably, a hof'al), such participles being very often used in speaking of actions or events completed in past time. Translate: "On the day of my death my mouth was not restrained from speaking, and with my eyes I was permitted to see. Children of the fourth generation wept over me", etc. This hof^al, runo, would be very closely related to the haf^el "Win (Mesa', line 4), "caused me to see (my desire)"; cf. also and p n n in lines 16 f. of the Sachau papyrus from Elephantine. In lines 7 f., the passage ^nriN DJiin b mriK1? must be rendered: "In order that my coffin may not be plundered (?) by another." TIjnN is certainly the subject of the verb, which may be either passive or intransitive peal. of the agent. W i t h the "another" compare the inscription LIDZBARSKI, Handb. 484, 3, line 3, which is a perfect parallel. Guzneh. T h e text of this old Aramaic boundary stone from Cilicia, published b y MONTGOMERY in the J A O S X X V I I I (1907), 164 f f r e a d s as follows:
N e w Notes on some Old Inscriptions.
I ^ott^yn r 6 71 I an"1 2nn n x n 701 I
91
cnnn nan
nS v Njntbi I irntri i n p MONTGOMERY'S reading differed from this at the end of the second line and the beginning of the third.
After
the words nK T 701 he read 125£n, and made no conjecture for the last letters of the line.
Line 3 he began with 72,
rendering: " A n d whoever thou art who wilt [destroy, overwhelm] him Be'el Samen", etc. I have examined carcfully, with lighting from every side, the plaster cast made from a w a x impression of the stone. T h e readings which I have given above are, I think, quite certain, with the exception of the n in and even there, n is the only letter which the traces suggest. I translate: Thus far the boundary of DNL. Whosoever thou art who destroy est (it), — BaalSamen the great, Sakar, and Samai, shall destroy him and his seed! Point
and finni?
Is it the hafel
of the
verb
(2Dn, V_*J) which is used, for example, in Sura 111 of the K o r a n , where Mohammed, in his fierce imprecation upon A b u Lahab, says: "May he utterly perishTl T h e verb is otherwise known only in Arabic. The Abydos Lion-weight. (CIS II 108.)
T h e reading appears to be: NSDr v N-nnD 'pnp^ 7:SQN T h e first word is generally read 7~|£DX (which is possible), and has often been connected with the problematic JMIEDN which occurs seven times in the Aramaic of Ezra. But the word in Ezra never means "exact" or "exactly" (see my Ezra Studies, p. 174); and the meaning "diligently", emjueXwg, studiose, will hardly do for the inscription on this weight.
92
C. Torrey, New Notes on some Old Inscriptions.
The first word is probably a proper name, telling to whom the lion belonged, as in case of the most of the weights of this kind; see G. F. H I L L , Handbook of Greek and Roman Coins, p. 29. The word K,_inD is probably "staters"; cf. the Lewis Syriac of Matt. 17: 27, where for the Greek evgrjoeig aTaTi]Qa we read ^ v z > »-i k.Zo. Compare no. 9 of the weights described by H I L L , loc. cit.\ "Onethird manah in shekels", etc.
93
Qirqisani's Polemik gegen den Islam. Von I.
Friedlaender.
Abü Jüsuf Ja c qüb al-Qirqisänx *) ist eine der ältesten und bedeutendsten Autoritäten der Karäer. Aus seinem Leben ist nur Weniges bekannt. Er blühte in der ersten Hälfte des zehnten Jahrhunderts 2 ) und stammte, wie sein Name besagt, aus Qirqisän, dem alten Circesium am Euphrat. 3 ) Er machte, wie aus gelegentlichen Andeutungen in seinen Schriften hervorgeht, ausgedehnte Reisen, besuchte Persien und Indien, wo er die Gebräuche der dortigen Heiden beobachtete, 4 ) stand in persönlichem Verkehr mit den Vertretern der mannigfaltigen jüdischen Sekten 5 ) und diskutierte mit muhammedanischen Theologen über Fragen der islamischen Dogmatik. 6 ) Er entfaltete eine umfangreiche literarische Tätigkeit, die von großem Einfluß auf die Entwickelung des Karäertums war und auch im rabbanitischen Schrifttum ein lebhaftes Echo fand. 7 ) Sein Bild, wie es sich in 1) Die Literatur über QirqisänT findet man am besten zusammengestellt bei
STEINSCHNEIDER,
zu die Nachträge von
Arabische
Literatur
POZNANSKI,
abdruck aus der Orientalistischen
Zur
der
Literaturzeitung,
2) STEINSCHNEIDER, ibidem.
§ 43 p. 79 f.
Juden
jüdisch-arabischen
Literatur
(Sonder-
Jahrg. V I I Nr. 7—9) p. 48.
HARKAVY in der Einleitung zu seiner Edi-
tion des Qirqisänl (vgl. über dieselbe unten p. 94, N. 2) p. 247. 3) H A R K A V Y , ibidem.
Vgl. hier-
STEINSCHNEIDER, ibidem p. 80.
4) HARKAVY, ibidem, besonders Anm. 5. 5) Ibidem p. 248. 6) Vgl. im Text unten p. 110 Z. 6. 7) V g l . H A R K A V Y , ibidem p. 248.
94
1. l-'riedlaendiT
seinen Schriften abspiegelt, ist das eines gebildeten und denkenden Mannes, der treu am angestammten Glauben festhält, aber weder den Schwächen der eigenen Religionsgenossenschaft kritiklos gegenübersteht noch den Bekennern der anderen Religionen in blindem Eifer entgegentritt. Unter seinen Schriften nimmt, soweit sich bis jetzt urteilen läßt, sein Kitäb al-anwär wdl-maräqib »Buch der Leuchten und Aussichtstürme« den ersten Platz ein.1) Das W e r k , das sich in dreizehn Traktate gliedert, hat die Behandlung der Gesetze zum Gegenstand, beschäftigt sich aber in den ersten vier Traktaten, die gewissermaßen ein Präludium zum Ganzen bilden, mit Fragen historischen und philosophischen Inhalts. Der erste Traktat, der von dem Verfasser als Einleitung bezeichnet wird, enthält eine Übersicht über die Ketzereien und Sektierereien innerhalb des Judentums, zu denen er auch das Christentum rechnet. Der zweite Traktat enthält die Beweise für die Notwendigkeit des Forschens und Spekulierens in religiösen Dingen. Der dritte Traktat beschäftigt sich mit der Widerlegung der jüdischen Sekten und deren Glaubensvorstellungen, während der vierte die Mittel und W e g e auseinandersetzt, mit deren Hilfe eine richtige Erkenntnis der Gesetze erreicht werden könne. V o n diesen vier einleitenden Traktaten wurde der erste, der in ig Kapiteln ungewöhnlich wertvolles Material für die jüdische Religionsgeschichte bietet, von HARKAVY 2 ) vollständig ediert. V o n dem dritten Traktat, der J U 3 J I ä re (V^Aj^Üil^ (J^lsÜt betitelt ist und in 25 Kapitel zerfällt,^ 1) V g l . über dieses "Werk HARKAVY, ibidem p. 249; Qirgisäni-Handschriften
im British
Museum
POZNANSKI,
Die
in der Steinschneider-Festschrift
(Leipzig 1896) p. 195 ff. 2) In den Memoiren (Zapiski) der orientalischen Abteilung der Kaiserlich rassischen archäologischen Gesellschaft zu Petersburg, Band V I I I (1894) p. 247 ff., mit
einer ausführlichen,
rassisch
Vgl. auch BACHER in Jewish 3) Die Überschriften
geschriebenen
Quarterly
dieser
Review
Kapitel
Einleitung lind
Inhaltsangabe.
V I I , 687 ff.
s. bei POZNANSKI, Die
Qirgisäni-
Oirqisam's Polemik gegen den Islam.
95
sind bis jetzt das ib. Kapitel, das eine Polemik g e g e n das Christentum enthält, von HIRSCHFELD 1 ) und Kapitel 1 7 — 1 8 , die der W i d e r l e g u n g der Seelcnwanderungslehre gewidmet sind, von POZNANSKI 2 ) ediert worden. W ä h r e n d meines Aufenthaltes in London im Sommer 1909 kopierte ich K a pitel 13, 14 und 15, von denen die ersten zwei sich mit dem jüdischen Sektenstifter A b u 'Isä al-Isfahäm beschäftigen, während Kapitel 15 sich g e g e n den Islam richtet. Im folgenden bringe ich das letztere Kapitel zum A b d r u c k . Der vorliegende T e x t ist dem Codex des British Museum Or. 2524 (fol. 39 b —4Ö a ) entnommen, über dessen äußere Beschaffenheit POZNANSKI (Die Qirqisäni-Handschriften des British Museum in der Steinschneider-Festschrift p. 197 ff.) und MARGOLIOUTH (Katalog des British Museum II p. 172 Nr. 584) erschöpfend informieren. Mit Rücksicht auf den Leserkreis dieses Sammelwerkes habe ich den Text, der in hebräischen Quadratbuchstaben geschrieben ist, in arabische Lettern transskribiert. Die vulgären Schreibungen und W o r t formen, die in derartigen T e x t e n g a n g und g ä b e sind und möglicherweise den Abschreibern zur Last fallen, habe ich in die Noten verwiesen und im T e x t durch klassische ersetzt. A n mehreren Stellen ist die Handschrift verwischt oder durchlöchert. Ich habe die Lücken, soweit es mir möglich war, zu ergänzen gesucht. W i e Qirqisäni zweimal in dem vorliegenden Kapitel 3 ) und auch sonst in seinem W e r k 4 ) erwähnt, hatte er sich Handschriften
p. 198 f. und MARGOLIOUTH im Katalog des British Museum
II p. 172. 1) Arabic Chrestomathy in Hebrew Characters
(London 1892) p. 116 ff.
2) In Semitic Studies in Memory of Rev. Dr. Alexander Kohut
(Beilin
1897) p. 435 ff. 3) Unten p. 97 1. Z. und p. 110 Z. 5. 9
4) Am Ende des 13. Kapitels (unsere Handschrift fol. 34b) y JkJU Lo £ I i J e J J o
N
JJ WJOLAUJ
M.
8J-Ö
-
nSj
I?
3 L I Ä S ' und im
96
I. Kriedlaendcr
bereits vorher in einer selbständigen Schrift, von der sich jedoch keine Spur erhalten hat, mit dem Islam eingehend auseinandergesetzt. In dem vorliegenden Traktat jedoch, der sich, wie aus den Kapitelüberschriften hervorgeht, mit innerjüdischen Heterodoxien beschäftigt, hat eine selbständige W i d e r l e g u n g des Islams oder Christentums keinen R a u m . Die W i d e r l e g u n g der beiden Religionen hat hier auch in der Tat, wie der Verfasser klar g e n u g andeutet, 1 ) lediglich als A n h a n g zur Polemik gegen A b ü Tsä al-Isfahäni R a u m gefunden, dessen Grundlehre, die A n e r k e n n u n g des prophetischen Charakters des christlichen und islamischen Religionsstifters, 2 ) — eine Anschauung, die von außerordentlicher religionsgeschichtlicher Tragweite ist,3) — Qirqisäni als Hauptangriffspunkt dient. Der Verfasser zeigt sich mit dem Lehrinhalt des Islam durchaus vertraut. E r zitiert den Qoran mit großer Fertigkeit, und die Ungenauigkeiten, die er sich dabei zu Schulden kommen läßt, 4 ) sprechen eher für seine Belesenheit in demselben als dagegen. E r ist auch mit den außerqoranischen und teilweise im Hadith enthaltenen Legenden über Muhammed bekannt 5 ) und ist sich des Unterschiedes zwischen dem muhammedanischen Volksglauben und den Anschauungen der muhammedanischen Theologen, mit denen er in persönliche Berührung kam, bewußt. 6 ) Die in diesem Kapitel behandelten Streitpunkte, wie die Abrogation der Thora, die 16. Kapitel ( H I R S C H F E L D ,
(^4-L>*JI
Arabic
Chrestomathy
(et). (»-jAlfi sb
, *
'
&JJI
ivXa.
Lg-o
iu^JUl
L J p f
" ) J u * i
¿yc
^
U i j J
I O
'
C o )Jj-äj^ —
i X ^ X ^ J
o S
Jj!
^J^O
i?
>> -
L»
ÄJLXS'
^
: ¿ L L ö
(^^JO
0
j, ' *
9
' ° *> o L o J
J^jo
ljLÄXJ!
jv^J.lXj
^
(jÄÄJI
^
o a ü j
^cj-JI
¿ U ö j
(JLjJI
1) I n d e r u n m i t t e l b a r 2) M s .
^ ¿ J
LgJjcl
Ujlx
^Läüjt
* L^j
J,l
JcXaXWIJ
L g j l i
vorhergehenden
Polemik
" ^ ¿ I S '
gegen
Jkiio Abu
» t U x o J ß \ j
^
^ j j '
cIsä.
m a r e O
3) M s -
—
meine Selections
from
iC3Nir6K-
5) H i e r
und
6) Q o r a n
10)
Qoran
12)
Ms.
unten
5, 4 7 .
Qoran
Über
Z. 13
16,45; x a i x r -
Writings
^ ß 'lN
7) Q o r a n
^jli. 2 I
9) . 7-
ft ohne
die K o n s t r u k t i o n
the Arabic
4) M s .
8) I m
)xJ
5
^ ^ j !
»
^ t X J I (I w < j f j J !
^
o®
Lgil
gv
L ä j !
^
J l ^ J I
f
°""H^
Lo
¿ J r
¿ o L ^
"""
¡ s ^ y
viu^fXs!
v i U
¡j.Ä=£
£
Lgjo
f ¡f
' ^ c U i Jjcl
IgJjel
S K Ä
)
JlüJI —
jv-LvuJI
,jjoj
«jl
a*
1
J.ÄJ
üi
J l
9
' ,
yS>
tXä^ * i S ^ - s ?
JJi*JI
(J-** J l
U l i '
Im 1
of Maimonides
Man
p
10, 94. Qoran
')
erwartet
p. X X
'
m
geschrieben Qoran
(JL^Li.
^
| II.
^ vgl.
Oircpsäm's Polemik* ^ogen den Islam.
nx
^
püaüj!
i L
4
jJjoj b
i-iottn
[4o ]
)D^iy
o J L l ü
n n n
y o J ü J
^
: V n n O -
J&dJl
obiy
npn
JuubJI
m a
~iti>x
^
nx
^ x i ^
oo-wJ!
^jf
niyistr
jn
-an
^Aä-Li i
J U
ö J L b
«¿JUö
°
)
J y ü
X+AÄJI
6
)ii r n r o
y
iij
(j-* inix
vpi^
'»x^jh ^tXÜ
w
*
^r
J '
J j o
(»yJ Jfjuy
|Jj
natrn
^JjilJt^
-
io^yJ!
^
" e;'
nityyb
^ra
Coli :
n x ? m
üJJÜJI^
bejka.!
nan
yf&i
);i
9
' ¿ U ^ l
nrt
nx
wnintrio
&}yS
uÄlJI
pLxJI nairn
'
b j M
m i n
?
J y "
3
i
Lg^i 1
i s ^ y
nx^m
o n m - 6
viiJj.5^ ^ ü
£
a'-
ä-
99
j»jjJt
-itrx • n n y
n ^ x
iUö
J l
M ij'
vj^
nx
J
ntre
or^
L^öjl^i
0
-—
n^tr Üxlilj
^
y
5
^
o J I £ •""JJ^tf
xJji' £
sj^Jlj
^ ¿ p t
LgXoij s^AAJI
¿JUö^ ¿ 1
Lsc^io jvää.
>
LÄfi
^ x ä U
asJUf
Li!
ö u l o
X s
^-ut^wJI
¿¿I
¿U6
dann
2) Ms. n o m b x -
£
Jou
(dauern
müsse)
d^j?^
^ ¿ j
7) Ibidem V e r s 2 3 . Vielleicht ist hier »er (Maleachi) er-
deren Bewahrung und die Beobachtung von bis zu jenem T a g ,
der der T a g der A u f -
erstehung ist«. 9) Ms. -j-
XÖ3X.
1 1 ) Ibidem V e r s 24.
ül
4) E x o d u s 3 1 , 1 6 .
zu ergänzen und wörtlich folgendermaßen zu übersetzen: Satzungen
)-jnn2
jAi-l
ilj
8) D a s Folgende scheint nicht ganz in Ordnung zu sein.
deren
10
^jb
:
6) Maleachi 3 , 2 2 .
wähnt aber nichts als die X h o r a ,
- ^
^p^XI-
3) Numeri 1 5 , 2 3 .
5) Leviticus 2 3 , 2 1 .
J j ä ^
^ . ¿ « J
verbessert in
w
jvXii' » j ^ J I
")t Jt-
[42a]
)
(jjtx« ^.^LC
¿ J Ü
, >
:
^ I Ä
' t x ^
¿ü^yJt
viJÜ ^
(ftX-lX
^
y
ü
^
iui ^ - J
^
^ K J ¿öl
^¿iäJ^
Ijjfi fv^Dys |Jl*Jt
ySo ItX^
^tXXfJI
ItXifc
jj^AiLuCj
1) D e r R e s t der Z e i l e , die die erste auf d e r S e i t e ist, ist 2) M s .
9
5tXs®j
^jel
, SJ.S'CXJ
|JL*JI
SjAä.
«.^Li»^
G J o
0
! jk.iC ykSt.
«J
,jl
o^
nS'ö
;
IO I
5
)
^
abgerissen.
^n-ftN-
3) M s . 5) V e r w i s c h t .
4) Am
Ende
Verwischt. läßt sich
noch ¡ " H I 1
( o c l e r i"l"D)
unterscheiden.
102
I.
0
0
i |JL*J! L ü l
¿Lb' Lc
£
( j ^ J
J U !
Jjf
^JJO
J U a j |
IS*"}*
L ä j l
Friedlaender
^L^Aibf!
15*-"
j ^ j L ^ i
¿Uli
^ . f c
Juij
^a+Ä.
y--'
od-'l
jüoUf
^ÄJ!
tXJuo
äOjyJI
3tkiC
LgijJjiLuj
Ju*Jt
^la.
0
ivgjLxi'
Jjli ö
SlXj»
l+jlj
j+ssoLwjj
j,
J y ü !
•')
«Jjji^
ÄJ^yJI
i
J.J^LÄJI
^yc
y k
JvÄ
u
kijjuc
¿ U ö
(JÄiLüje
Lo
^so
»tX®
L ö j l
IjkJfc
f - f c ^
J '
(¿J'
xÄfJudy
kj^jjdJ j i d J ^ )
Jjsl
ü
^ 2 b
]
^>1
^jy+^y.
^Ä-il!
iJJj-ftJlj
[^JJsäJJI^ ¿Uli
QH3D
( j U
l^J
JJ
x j ^ L ä j j
1) M s . +
j
is"*^ [4
: (VÄ^e
2)
£
L^Jjc^J
v^tXx
x c U a .
¿u^ÄJ!
LöjI
i j ^
Lg.i^.a.1
^ L a J !
IcX^J
[ f ^ ]
(^ÄJI
f
£
LixitXä
¿ j
3
o>ji
( j L
¿1)6
Jjj>
¿IJi
(vXÖJo
m £
( j i U a j
auo
(J^i^s: jv^oji^j
"ltt^N
¿j-g-dl J j ^
3N13V
-^¿ELW^I. Lä_st
. Ijjc^
oSLÄ*^
Durchstrichen.
Ms.
3) V e r w i s c h t .
Raum
für
einige
Buchstaben.
Wohl
£
=
XaJLc
d e r K a r ä e r J e s u g e g e n ü b e r ist eine
freund-
- S U ! zu ergänzen. liche.
Vgl.
.
^
die W o r t e
Die Stellung Qirqisäni's
M
(ed. H A R K A V Y
w
p. 3 0 5
m
Z . 9) .
^jo
Qirqisani's P o l e m i k gegen den Islam.
i i L J I
l^ffj
^
JoJLil
^yiaxJlj
^«¿J
^ j J !
¿JUdo 0
^SUJ
05
w
iLgHLcÜI^
;
L i J
^A-Jl i
£
viLäJf
JjC^j
Jy>
J 6
^f^iLwiff
"l-jl
v—iUJI
L+jlj
3
jj
5
^
,
J l
^ Jl^JJ
)oiliLl
>
ö
ö
Jüö
)
)fstjÜ
&K3
oty
Uj
x + ^ L
JOJI
JA.
^ L a i i d j
^Xl
)i;i
nnü1
)i;,i
2
^ ¿ ü !
JLäj
LÖJI
jlo
"
JO^J
^J-frA-L«
J J j
c
^JJU
j j
^JJ«
^ s !
^ A J
Jjj'
luLuuaJf
¿ J ^ * ! !
9
w
¿ J U j ^
¡t-qt
0l;l
^SÄJ
JÜJI s
L-^J
^ S j & m , ) } J - J . L J L J
y -
Ijje
^
y c j l L
I03
(JjX)
i r n w vnnnci
J,l XJÖ ^ . L ^
- m
lötr
jXiXJuwj
ÜMO
^ ^ Ä J L
¿JÜAJ
J-J^-J
^ I J J
L J
n - o ^ -ibia p
nnji
^LÖ ^ ä ä .
ÄJJI
tr^
m n
^ ^ I Ä J L J
Juaa!
Ü
ron
' cw0 ^ S^iO liJ^j
i^cXif
^ ( j J I
.fr
I^j
^-j-ÄI
^ ^ t
wI^L&aJIj
[43a]
cU-Cj 1) j
iXaäI^JI 7
^
jUIÄJI [(¿y-]^1'
)
leitet die F r a g e ein.
2) M s . hier lind Z. 6 sowie auch p. 1 0 7 Z. 9 Pj^T-
CrcmäH der Schreibweise G '
=
des A u t o r s (oder des K o p i s t e n ) kann freilich 3) Ms. 1*13. 4) Ms. ^ ^ X 5) 1 7) E t w a j»L>! 3 Oirqisäni
beruft,
(Ms. r v w a ) O^ÄiO J ö ])• 199). in
seiner
sj.»
trug
»^Uj
™
ergänzen.
die
folgende
¿^ä^JI
«yf^LwaJI
Ks
enthielt
Einleitung
wohl
Das
K i m
-
1
'3'
2
° 1 -
24. K a p i t e l ,
G ^
= sein. b) Zacharia 6, 1 2 . auf welches
Überschrift:
o^aJI
^t
«j!Jl ¿00
(Ms.
sich hier i_jLjJ|
ptrj^NV
(POZNANSKI in der Steinschneider-Festschrift eine W i d e r l e g u n g
der A n s i c h t ,
der QirqisänT auch
(ed. H A R K A V V p. 3 0 6 Z. 1 , p. 3 1 9 Z. 4)
Erwähnung
tut
104
I. Friedlaender
^ J^jo
0 J - ^a^-Lm+J! J j J
ijy-s^
J J J a > j Lo
r
-
f ÄJ^JJ!
uoSl^i ^jje
^IxAjill ^tXJI
ÄJÜI
ääUÄ». 4
O-xJI
^
^JO
)fLo
Co
(^cXjJ
5
tXji Ü J U ^ m J I
J
t>Np[l!T]
-
u
c n n
h o
r v c r
s^io :n
nx
o-» Jjü £ & U&JjoUJ
und
l r r j w
^Uaäl
„
) ¿uaau d J J J
fV^JjO
t j ^ j
)
x
liX&j » ¿Lift
S
j
Lil ä
^Npirv r 6 -ico b : Kirr JLs3
)nirDn
»j-js
tX^ij
-
(JJ-J
ltinro
(V^i^J
6
^
gftt* ¡j-o
ö
Loj
)) 8 h d i
(jLi
UJ
g ^ y i j
Vj"*^
¿JU-J
-
f^-Lo;
)x3j.iJI5
LO J l
^
Ä-UI
^.«MJ!
5
UäLs
UA-Ij
[V^cyol J^c
t ^.olilj
^föjiff
*) Jcsaia 66, 23. 11) Zacharia 1 4 , 1 8 .
Qirqisanl's
Polemik
gegen
den
Islam.
105
t
f & y J . ?
|vf>
¡JJI
0 j j ü
^jü
5 jw^ü
O v j j M
^s.^
?
^
xAc
w.®Lgj!^
L^j
a > j j d u
^ j ! —
J l
^fcXiJ
(V-fcj^J
^
O
O
^
£
viUj
JSlf
:
gj'lj^/Oj
xaXC
(v-g-jf
f^'yt.
¡üisöj\juo
J y i Ä i
¿ U ö
^
) j ü y J
3
Lo
i L t a
XJ
I^j'f
iu!
^¿Läl
üj^«
i ü ^ x
Leo
¿ot
1) M s . 2)
ysc>
tjv»
^ f y d !
Lo
^ K i
i s ^
^
i
y
6
J !
i
Li I i :
M
(j**
J k J j J !
vi
^
^lyiJI
viJUi
¿ k p
^
^ ^
¿ULJ^J' pjli
J 6
f g L
t
|*^Xl!L) Jvä
^j!
8
^jyÄM^. 8
J ^ w j
— jjij
6
° ' ^-^vO
iv^i^clj
xxia*Ai
(^J-ULl
naiünNV1-
2) E t w a :
-sie erreichen
es nicht
vollständig
bezüglich seiner
(d. h. M u -
hammed's)«. 3) D a s J
hat hier und unten p. 1 0 8 Z. 6
in diesen T e x t e n .
4) M s .
^in^V
o® die K r a f t von I i i ,
wie
sonst
QirqisanT's Polemik gegen den Tslam.
Lc,
j j j ^ . f
y & l
j ^ J
«J £
oJiajl,
,
^
Lo
(¿U ¿1
JuVo
u u J !
ü
^
sJ
a's
Masculinum
ruiinNjr-
2) Derselbe gleichzeitige Geblauch mininum
^
¿1
kt^ÜuJ!
¿Us;l*JL
1) ms.
JoJt o J U j " c ' £
,J
o,
^oill
¿jSy
«ytXÄ*jl3
von
findet sich auch bei Maimonides.
und Wissenschaft
des Judentums
&
Vgl. Monatsschrift
für
und FeGcschichte
52, 622 A n m . 7.
3) Ich gewinne dem W o r t keinen rechten Sinn ab:
» W a s aber unkennt-
lich (oder befremdlich) ist« ? 4) Diese F o r m ,
wohl
Plural
von J o i X ß ,
ist in den Lexicis nicht ver-
zeichnet. 5) Vor n O ^ O ß Falls
die Lesart
Xamensform Leben
des
und Lehre
'lat
HQ^DD
Buchstaben 3DÖ> die beabsichtigt
Pseudopropheten des Muhammed
ist,
dann
von Jamäma
durchstrichen
enthalten.
Mach
SPRENGER,
MI 305 bedeutet der ihm von den Muham-
medanern gegebene Schimpfname Museilima »das Muslimchen«. (TRIMME'S {Muhammed
sind.
dürfte sie die ursprüngliche
Die Annahme
I 158), dali sein ursprünglicher N a m e Maslama war und
daß Musailima »Klein-Maslama« bedeutet, liegt jedoch viel näher.
Proben aus
Museilima's Qoran s. bei Tbn Hisäm ed. Wüsi'F.XKEI.I), p. 6) S. oben p. 103 A n m . 2. ") Verwischt.
Etwa
zu
ergänzen: »Da, trotz der Beschäftigung mit
derselben (der Polemik), das Vorkommen einer Verständigung nicht garantiert ist.«
io8
I. Fricdlaender
JLaj
jv^aIc
')S.JJmjii
^
8i\si>j
: xLdf
--
JJ3
ad ^JLs pyÄJ) g
l
ü 5
iMj
J
Jl^ xJ
Uili
j
^
(vCjij (j^-*)
b'j
viöK
jt
3)
¡üy^jo Lj^ÄtXi
1L!
lstX.1
o i !
Jii
UStj
j j J J !
4
) kiiLül
i y ^
) . . . . ')iüys %
Liji
ÄJÜT S I &
J o j l i Ü I sj ^ ß ^ o i y ^ j c J a - J J ! I J l ^ J ^ ^ t i j il
IOQ
iL^il
¿jj« ¿ i s ü ü ^ ä j
äylycj!
»ycS^ 3
poli Ix
k^l
jjjeLä
ö-So
^Äs». j u u j
Jö
jj-jjJlj
sAffiLi-Jt
icj&J
5
^ a J
JJT U5f «ÄS
JüiL f- ,
ü-LäLÜf
y ,
dllj
o
)^ielydl
J y a J I
(V^i-io »
J^c.
£
^ ^ U3l.
^Lae^l
LgjÜ
jt
^
^
Ud^J
cuü^
,J
Lo J ^
^ L ä J !
LgiLi
£
¿ü^ejüi
Ü!
1) Die folgenden Qoranzitate, die sich in dieser Form nicht finden, beruhen der folgenden Stellen: Sure 6, 109 1 1 *il j i j j xJÜ! auf einer Verwechselung 29, 49 bf L 5 t , xJJ! ¿Li»! U ! JJ ^ A A X ; 20, 133 X J L L i A i ' l j ü p ; 13, 8 T>U& p j j U3f. 2) Zum Teil verwischt.
Wohl
(oder
zu ergänzen.
3) JLC V I I I »als Ursache (&JL&) angeben, eine Entschuldigung vorbringen«, s. L A X E S. v.
4) xJLsÜJI dürfte wohl =
¿¿JljLÜ! sein.
Dieselbe Schreibung findet sich
unten Z. 8 und bei HIRSCHFELD, Arabic Chrestomathy
118, 11.
5) Ms. "iDNin^N6) Ms. n " S 7) t X ^ j j ' i
statl;
iN f j . ' ' bezieht sich ungenau auf
^
8) Falls Qirqisäm keine Verwechselung mit Muhammed b. 'Omar al-Wäqidl und dessen bekanntem Werk Kitab al-Magäzi (BROCKELMANN, Geschichte
I IO
1. Kriedlaender, Oirqisam's Polemik gegen den Islam.
pjjl
' ) |vXls»Lo
s^Ai s ^ * ^. Lisi L>
^
^ ¿ J l
JyS
f g**
dtue
jJü
^ l y ü f fr
,jjo
* 'jssLsCjj
dLJLfc
5
Lo
k_>Uij£[46a]Jf
pjj! ^ J j o ^
sLiJU-w
^
LJU
^^XJO CD«^» o®
6
« >
LJL
)J.jLw*X — v-äi'j
dU ^JJO ( j l i ¿j-gjJI ^ L i ^ü
LgjyLft J I ^ J ! £ ¿üJla*lj sf^ydl j l j, s'tXSLJI
«Lui ¿ b ^ o j , j ü
(jOjc! j! (v^ÄAJ (»XÄ-U d^lLa.
^-xia^iLj! ^L
£ ÄJ^j^ ¿UÖ J l ö Lg->j
h.wä'IU p-j-*"^ pX^Ls OMXS»
s'oLg-i ftXjtvj kDI
Lg-A-s äl^jdt iftXÄÄ^ db^jCk ^jiyJl
Lüyl
Ii!
Li,!
¿L)6 £ xJ^i-, viJÜj»
iJUI
jvXÄ
i\)yxi\
Über den Mohammed gemachten Vorwurf jüdischer Tonihfälschunj;. iöÜ
Sl^jjJI tXä
Jdu
^ J-o
^ u u ^jli
j&Ju
yjffjü
Jyi+JI ^f
Ui &X4JI C a « :
^^Josli
^L».
^^J-Cof
äl^^jdf
jfixJI
£
(j!
^sd
¿1
1
«J
Ljlj ^.•^¿.j'
(?)JuS ^ I j ^jo
^Lo
J^^a^.
Juu
. sjk».
Z e i t s c h r i f t f. A s s y r i o l o ^ i e ,
XXVI.
tXi" tX*J
(jtyül xcyi^
I I3
X
¿J.J!
ii4
Zwei assyrische Berichte. V o n C.
Etzold.
I. In einem zwar schon öfters, aber offenbar immer noch nicht genug behandelten Brief aus Ninive 1 ) schreibt der Hofastrolog Baiasi an den K ö n i g (Asarhaddon) : i
A-na
iulmu(viu)
Sarri btli-ja
2 ardu-ka (m) Ba-la-si-i
iarri bili-ja
5 liq-ru-bu ina ili äribi (is$üru) 6 ià Sarru bi-
[li iS-]pur-an-ni
7 Intima äribu [(i$$üru) mi-]2)im-ma
bit amili ü-si-ri-ib
g amihi iü mi-im-ma la Sù-a-tam
su ikaiad(àd)
Inuma surdü (i$süru) In a-ri-bu
11
12 mi-im-ma ' ià na-iü-ü pän amili id-di mi-lu
13 a-na bit amili Sa-ni-iS
15 bltu Sil i$-di-]}u ibaii(Si)
17 Inuma is-su-ru
p. 1841
("concerning
certain
birds in a man's house"),
Leiters
I V , p. 363 f., no. 353.
(mit Transskription)
Transskription
von
Zusammenhangs
8 atta 10 qätis$üru 14 ana
16 ii-di-J}u ni-
lu-u Slra 18 lu-u is-fu-ru
1) British Museum, 82-5-22, 169. BE/.OI.I), Catal.
74
3 lu-u
a-na Sarri btli-ja 4 (il11) Nabtt (i/u) Marduk a-na
19 lu-u
Zuerst wurden Zz. 7 — 2 2 ediert,
omens
derived
from
von
the appearances
of
dann der ganze T e x t von R . FR. HARPER,
Zz. 5 — 2 2 sind übersetzt von BEHRENS,
und von HUNGER, Tieromina
KI.AUBER, Beamtentum
71 f.
33 f.;
Aber
Zz. 2 7 — 4 0
die Herstellung
Briefe mit eines
zwischen den Omina und ihrer Deutung ist nirgends versucht;
meint doch BEHRENS (a. a. O. S. 75, N . 1): «ein solcher Zusammenhang ist so selten,
daß
wir
ihn
auch
in dem
vorliegenden Omen
kaum suchen dürfen«.
Das Nachstehende wird wohl gegen diese Ansicht sprechen. 2)
iryyyTrjç. V u l g : stellio. Syrer: Saadja u. Abulwalld: üjlioc.. Haj u. Maim: Bei Haj: D"ûyD. Rasi: lézard. 1 ) afr: laissarde. BERLINER, ^ ¿ ¿ 4 4 5 (XMIR1^ Hull 122* D S aus Sonc ICITTT^, edd falsch XTrTvS), R D K im W B zitiert: Ntinin;^ 2 ) = Michl Jöfi Lev 11. S. Nr. 19. BERLINER, KaH2: R M T ^ V 1) Lacerta Réj 33, 118 zu TIOHT Lucerta Arach V I 72B Réj 17, 118 TODIN* nXD 1 ?- Deutsch: egdes GRÜNBAUM, Chrestom. 40. 42. 365. eydex Bodenschatz II 72. negdis BRÜIJ., Jahrb. V I I I 166 n. hegdessen GRUNWALD, Mitteilungen X I I I , 101. 2) [Dr. G. SCHLESSINGER : CAIX, Stuäj di etimologia italiana e romanza. Firenzc 1878, p. 380 über die prov. Formen des lat. languria.]
134
T. T.öw
B-lNttW^, ed I^ar: "Hltt^) BNTnb Rasi bei Michl Jöfi Lev 11 BOCHART:
BENZINGER, Archaeol.
40: Gecko.
s'slSà£., iuliàc 1 ) Damïrï II 107. PSM 2654 [NÖLDEKE: iyUäc, pl LUÖÄ in der Literatur nicht selten.], larger than like the LANE.
Oft
Damïrï: es heißt auch ijäj^I
geschrieben,
DOZY.
eUj-N ¿U^i1, hat viele Arten,
weiß, rot, gelb, grün, alle mit schwarzen Punkten. In Ä g y p t e n : äd^1.
Die Syrer geben es zu
Vi\n.., Hua,
1-*^.?,
.
E x k u r s : S o n s t i g e persische und arabische E i d e c h s e n n amen. «-> . o«> YAJJJ yi',
YAJV-' yjl
Geckoeidechse =
L A N E SV \jOyi.
' —St i. - " " Vgl. uOjj'
unter
.v^m; um m tbrêç, eine Eidechse am
Karmel Z D P V 141. JIIJ^J
SCHWARZ, D. heil. Land
(hebr. ed. LUNCZ): UND'? Saadja L i y i in unserem: abubrisch. ^fijSji
300 (deutsch). 368 im ägypt. Arabisch;
lézard, DOZY ( J Ï ^ J berrugas, verrue).
Da-
mïrï I 147: ein Vogel. o^> (JÀ^À- j j l lézard,
(•' lézard DOZY.
¡jyï) JJ! grüne Eidechse, DOZY. species of lizard called ¿VJ LANE. büszähy.
SEETZEN. espèce de lézard vénimeux, DOZY.
x j b yi\ kleine schwarze Eidechse, DOZY. 1) Damïrï aus Gauharï: = HÀ'^y, dem pLw ähnlich, eine Art .lie.
Stellen bei
BOCH.
1 1073.
Aramäische Lurclinaiuen. 1
[
SEETZEN I I I 429
IV
X^LA-IÄ; pers. V I I i i 20 zu J l j J l x . ar.
I 3,5
508.
I I 812 zu x j j S ' —
XwljjS', iuiLI^, ( j u j l j j X ^ J Í J Í ,
Zu JAXSJÍ,
I 675 « J j L u ^ Á = y X i j í .
I 585 ¿LWIA-IÄ, die k l e i n s t e
Eidechse, nach A n d e r e n : Chamäleon. p. V : g r i e c h . e i n e E i d e c h s e , w e l c h e mit Salz gegessen
wird. p. V : e i n e E i d e c h s e
JMXJJS'.
¿uLí XMJHKXS* M a g h r e b :
gartija animal.
lézard g r i s , l é z a r d d e m u r ,
la-
DOZY.
dallayn-, Pristurus collaris A n d e r s , G e c k o n i d e .
STEIN-
DACHNER.
¿üd^S1 D a m I I 15, g r ö ß e r als
das M ä n n c h e n :
io^i^iäxJI I I 106 (BOCH. I 1054 lz JOySyCLi. u. JojitXe. Das. a u c h 1055 Dem ijßjjl
ähnlich.
Eidechsenart
im K a r m e l
L a c e r t a ocellata.
; D e m i n . O^A^ÁC,
Seh lie, sä hliyye Z D P V 30, 141,
die k l e i n e s.,
eine
F o r s k . V I I I u. 13
s a l a m a n d r e , DOZY a u s I b n Bt.
¡¿X^S-U.
SEETZEN, d e r a u s T r i p o l i s a u c h XJLÄA« k e n n t I I 99. I I I 427. I V 507
L a c e r t a ocellata L, scincus v a r i e g a t u s S e h n .
(BREHM 138 f. Perleidechse).
S e q a y é , lézard au L i b a n BERG-
GREN.
sohala IX.
= orbanae
L a c e r t a agilis.
errabdne
S E E T Z E N I I I 53. 411, 439. I V 539. R O S E N M Ü L L E R ,
Tierreich ( j ó j i l ! 262. ¿frá? D a m I I 3468 z w i s c h e n
«-Lj^,
Forsk.
Bibl. Jjy
136
i. Löw-
unter IOÜÄ£. Sonst Pflanzenname: Garcinia mangostana DOZY aus Ibn Bt. äser, mehri, MÜLLER II 31 Nr. 552 u. 673 Eidechse. ângug Wassereidechse HÜMMEL 93. 372. godhä ind. Z D M G 61, 641. V II 812 =
JU-LJÄ, xä^.
P- V I 1025 lacerta. xûjjis, àjy^, x à j f f p. eidechsenähnliches Tier V II 1046. V II 1 1 2 0 lacerta XavL^Aa, ¡ j O j j ! ^Luj. tjiL«, ^j^xi lézard vert. DOZY II 624. V II 1329 lacertae genus. lich.
Dam II 34, eine A r t dem ^jOy^ pL» ähn[NÖLDEKE: Allerlei darüber Gähiz, Hajawän 6, 127 f.]
(BOCH. I 1073.)
Südarabisch: yirgad,
Agama
sinaitica HEYD STEINDACHNER.')
lattt, Acanthrodactylus
cantoris GTHR und Eremias
gut-
tulata LICHT. bedbedad, Scincus muscatensis jemb, lazög, Chalcides
MURR.
ocellatus
(FORSK).
bod, Sterodactylus pulcher
ANDERS.
dallayn,
ANDERS.
Pristurus
collaris
njézal, Hemidactylus turcicus (L) B ö T T G . und H. yerburii ANDERS.
15. LUININ n. pr. stellt SCHEFTELOWITZ ZU altbaktrisch: Eidechse. QP
7
16.
ardeno.
kahrpuna,
TOMN.
Die
S a m . NJÏ-PJ?.
entlehnte arabische
H O M M E L 365
Form
n.
amh.
entspricht
1) Batrachier und Reptilien aus Südarabien und Sokôtra (Sitzber. d. Wien. Akad. CXII Abt. I. Januar 1903).
Aramäischc I .urchnanicn. genau dem jüd.-aram. Nimn. FRAENKEL 123. W n i n (Lev 11 2 9 Gbgr). Wl~nj? Samar. für , wie Syrer und wie Hull 127* und Tanch Nöah Buber n. 190. steht für ] m n Ber r 82,7 = jBer V I I I i2 b 35 . N31Tin p m jBer I 3d20. To/Saf Ber i2 b : wenn das Tier sich krümmt, hebt es den Kopf. Der S c h l e u d e r s c h w a n z trägt wirklich den Kopf hoch, BREHM 59. LUNCZ j z. St.: er bewegt den Kopf fortwährend. LUNCZ denkt wohl an Agama pallida, die W e c h s e l a g a m o , deren beständiges Kopfnicken die glaubenseifrigen Mohammedaner ärgert, da sie glauben, der Teufel spotte ihrer Gebete. BREHM 57. SERILLO erklärt es richtig durch DU. Lv führt noch Targ 1 C 1 1 2 2 an: TOMN, L A NRPN lies NRNN. Vgl. u. S. 143 Z. 17. VULL. I 615: s y r i s c h ! Es einfach = »Krokodil« zu setzen, BROCK, sv U. DALM. SV ist unrichtig. Jak Edess Hex cod Leyd ,54B PSM. 1368: |1 i^-so) Ik-^Cij PfE N 4380 =
un< :
j
|J?i— hat Jak Edess für
^ 1
. . . . A-Ijs^SO
^ir»
=
V^'
-
B A 4044:
| . nVj-^ 11 * S -. 1i_s£^eo )»•">«?
Es ist aus PSM. 1368 D B B 771 zu ergänzen: persisch ^P?. 4043 hat
BA
B B : die Krokodilseier, die im Wasser bleiben,
werden zu {J?t-", die an's Land gespülten: ) S i e h e
hiezu
unter j u i a n . Jak Edess Hexaem Leyd 6i r : •-xX AJSOI_z| •ji .\V?
r3
s , i^o
¡J) Jalk Arnos 5 4 4 . Die Furcht des Skorpions vor dem stellio B O C H . I 1 0 8 5 aus ^
1) Sonstige Eidechsennamen: £iyvtg colotes = daxaiaßiorrjs, %, ¿ i s. L A N D B E R G , Etndes
(eigentlich »Taster«), »Sonde« für und neben ¡JJU^P,
I, 126, N .
V g l . auch
RUZICKA,
157
Zu Sura 919-io-
gefaßt, e r g ä b e sich in unsern V e r s e n der oben berührte G e danke des Handelsgeschäftes zwischen Gott und Mensch mit der Seele. A b e r die V e r b a bilden keinen Gegensatz, und diese E r k l ä r u n g , die vielleicht dem einen oder andern Muslim zugeschrieben werden kann (s. S . 150,3 f.), liegt doch weit ab. Bezüglich
und endlich w ä r e eine B e m ä n g e -
l u n g der herrschenden A u f f a s s u n g vielleicht pedantisch, d a der Sinn nicht zweifelhaft sein kann.
E s ist aber nicht aus-
geschlossen, daß dem Propheten hier und sonst bei diesen Verben
die konkretere B e d e u t u n g v o r g e s c h w e b t hat
und
daß sie zu den von CH. C. TORREY 1892 gesammelten kaufmännischen u s d r ü c k e nsein, des enttäuscht Qoräns zuwerden«, rechnen auch sind. buchbedeutet j a A »erfolglos stäblich »eine Niederlage erleiden « (vgl. Sura 3122, ' - opp»Sieg«),
Beim Spiel heißt der verlierende Pfeil v * ^ ' (s-
verbiet ed. FREYTAG II, 678 unt. und HUBER, S. 34). E b e n s o heißt ^¿1, wie setzen, E r f o l g haben«. Verba
6 —
Meisirspiel
ursprünglich »sich durch-
Die ausschließliche B e z i e h u n g beider
auf die Seligkeit
bei den muslimischen
Theologen
wird allerdings sehr alt sein. Ich möchte die V e r s e übersetzen: »Ein g u t e s
G e s c h ä f t m a c h t (für's Jenseits), Almosen
aber V e r l u s t e m a c h t , w e r sie B A V I , 4, S . 178. — Schon Ham. Scholiast
219, V . 2:
wer
gibt,
versteckt.«
^ g,1
LLjli
faßt der
als Denominativ von jj^j^luIc}: »als Kundschafter aussenden«.
4) Gloss. Balädun, Do/.v I , 4 3 9 b , dazu
« —
440^.
158
Über einige Klassen südarabischer Lehnwörter im Koran. V o n Hubert
Grimme.
Die Worte, womit Mohammed in der islamischen Frühzeit sich selber charakterisiert hat: »Ich bin kein neuartiger Prophet« (46, 8), haben durch die neuere Koranforschung reichliche Bestätigung gefunden. Mancherlei Ideen und Begriffe, die einen wichtigen Teil seines religiös-sozialen Systems ausmachen, konnten als entlehnt nachgewiesen werden. Ging nun diese Forschung darauf hinaus, Mohammed als geistigen Schuldner gegenüber dem Juden- und Christentum hinzustellen, so drängt sich in neuester Zeit die Ahnung einer dritten für die Entstehung des Islams wichtigen Geistesströmung immer mehr auf. Lange bevor Mohammed in Mekka den Götterglauben seiner Mitbürger bekämpfte, hatte das Gebäude des südarabischen Heidentums durch Kräfte, deren Ursprung wir noch nicht genauer bestimmen können, eine mächtige Erschütterung erfahren. Ein Monotheismus, der weder Juden- noch Christentum war, aber mit beiden manches gemeinsam hatte, war aufgetreten: den alten Göttern stellte sich ein einziger Gott Rahmän, »der Erbarmer«, entgegen; in seinem Gefolge waren vertreten der Begriff des Jenseits oder »der fernen Welt«, der Offenbarung oder »der Freudenbotschaft« und des der Gottheit gegenüberstehenden bösen Prinzips. Daß Mohammed als Bewohner einer Stadt, deren materielle Kultur mit der südarabischen enge Berührung zeigte, von diesem südarabischen Monotheismus Kunde bekommen hatte, möchte man ohne weiteres annehmen: ein
H . Grimme, Ü b e r einige Klassen südarabischer Lehnwörter im Koran.
1^9
direktes Zeugnis dafür liegt vielleicht in Vers 19 der SabaSure (34) vor: »Iblis hat seinen W a h n ihnen (d. h. den Sabäern) trefflich gemacht; so sind sie ihm denn gefolgt a u ß e r e i n e r G r u p p e v o n G l ä u b i g e n « . Sodann fordert Mohammed's Lehre in vielen Punkten förmlich zu einer Vergleichung mit dem Lehrinhalt des südarabischen Monotheismus heraus. So nahe es nun liegt, Mohammed die Rolle eines von Südarabien her inspirierten Propheten zuzuweisen, so schwierig ist es, dieses im einzelnen darzutun. W i e soll man vor allem dort Sabäisches im Koran konstatieren, wo es sich um Ideen handelt, die sich zwar im sabäischen Monotheismus finden, aber auf jüdisch-christlicher Grundlage stehen? Um hier scharf zu scheiden und zu bestimmen, gibt es kaum ein anderes Mittel als an die Lehnwörter zu appellieren. W e n n für charakteristische Begriffe einmal ein fester Ausdruck geschaffen ist, so pflegt dieser, wenn die Begriffe wandern, sie zu begleiten; und verwischt sich selbst in der fremden U m g e b u n g bei längerem Gebrauch das Fremdartige des Begriffes, so bleibt doch häufig von'der ursprünglichen Form etwas zurück, das, unter die Lupe des Forschers gebracht, Aufschluß über die Heimat oder die Wanderrichtung der Begriffe verschafft. Nun gibt es im Koran einige Wörter, die schon deshalb, weil sie spezifisch südarabische Begriffe enthalten, den Verdacht sabäischen Ursprungs erwecken, durch die Entsprechung ihrer Form mit südarabischen Sprachresten aber mit Sicherheit als Lehnwörter zu erweisen sind. der Koran von dem
So redet
der Sabäer (34, 23): da die Er-
richtung von Staudämmen zu den Eigentümlichkeiten
der
sabäischen Kultur gehörte und zudem der Ausdruck D"IJ? in sabäischen Inschriften (Glaser 554, 618) vorkommt, so muß als südarabisches Lehnwort angesehen werden. In S. 26, I2Q ist von
die R e d e , die das südarabische Volk
i6o
H. Grimme
i A d sich in stolzem Übermut gebaut habe: auch dieser Ausdruck verrät Entlehnung, weil einesteils die Bauwerke der Sabäer den Nordarabern besonders imponierten, und sodann Gl. 618, 21 nyOJiO als Ausdruck für ein besonders festes Bauwerk überliefert. Nach dem Koran setzte Gott Adam (2, 28) und David (38, 25) als
auf Erden ein: das
heißt vermutlich so viel wie »Statthalter«, genauer »Oberster eines o i ü s p « ; da nur im Sabäischen solche Mibläfe bestanden, so kann koran. ¿¿¿-yLi- kaum etwas anderes sein als das sabäische HS^n (Gl. 618, 11).
Zweimal gebraucht Moham-
med den Ausdruck »den piß* seines Herrn fürchten« (79, 40; 55, 46). Der Sinn der Phrase
eines Gottes« bleibt
dunkel; doch da eine Anzahl von sabäischen Inschriften (z. B. Gl. 5 5 4 , 3 1 ; 1359/60, 14) sie ebenso enthalten, so ist zu folgern, daß sie sabäische Heimatsrechte habe. Bei der großen Menge dessen, was wir als südarabische Lehnwörter bezeichnen möchten, ist jedoch lediglich die äußere Form entscheidend für die Bestimmung ihres Ursprungs. Wenn ihre Untersuchung zur Zeit über erste Anfänge nicht hinauskommt, so liegt solches an dem geringen Grad von Wissen, welches wir von den sabäischen Wortformen besitzen. Südarabische Worte sind uns fast nur in Konsonantschreibung zugänglich; selten läßt uns ein in nordarabischer oder griechischer Transskription überlieferter Name etwas von den Verhältnissen des Vokalismus ahnen. Eines dürfte jedoch gewiß sein: daß man im Unrecht ist, wenn man südarabische Wörter nach den Regeln des Nordarabischcn vokalisiert und ausspricht. Bloße Konsonantenvergleichung leistet nun sehr wenig für unsere Zwecke. Fälle, wo durch sie die Lehnwortnatur eines Wortes zu Tage tritt, sind sehr selten. Für »Juden« gebraucht der Koran die durchaus unklassische Kollektivform
9-
keine andere Sprache als das Sabäische weist
Ü b e r einige K l a s s e n südarabischer L e h n w ö r t e r im K o r a n .
16 I
diese Kurzform auf (vgl. Gl. 394/5 ~liT); sie muß demnach dem Propheten von Südarabien her zugetragen worden sein. Vermutungsweise möchte ich das Gleiche von dem Kollektiv i ^ L ä j »Christen« annehmen, das aus keiner der uns genauer bekannten Sprachen zu belegen ist; allerdings fehlt uns bislang die sabäische Inschrift, die von »Christen« redet. Das koranische
»Kirche« ist zwar in letzter Hinsicht mit
aramäischem blitä »Ei« identisch; aber so viel wir bisher sehen,
hat dieses
die Bedeutung
»christliche Kirche«
Südarabien erhalten (vgl. Gl. 618, 117). sein,
in
So wird es erlaubt
als sabäisches Lehnwort zu bezeichnen.
In alt-
mekkanischen Suren wird öfters von > — ( s g l .
im
Sinne von »Schriftstücken auf Blättern« geredet.
Nun heißt
»Blatt« im Arabischen außerdem noch HsxL>e: woher die auffällige Metathese der Konsonanten? erstgenannten W o r t
Sie ist m. E. bei dem
sabäische Eigentümlichkeit;
denn
ein
HEIUi (Plur. Fjnii) »Dokument« ist uns aus dem Südarabischen bekannt geworden (vgl. Hai. 199, 8; Gl. 424, 8, n).
Daß der
Gottesname
Zeit den
10 s
.r
der in mittelmekkanischer
Namen Allah in den Schatten stellte, der südarabischen Rahmänreligion entstammt, liegt auf der Hand; denn ob er auch von Aramäern geprägt worden ist, so hat er doch erst bei den Sabäern die Fortbildung vom Gottesbeiwort zum Gottes. c eigennamen durchgemacht. abgesehen
davon,
»Kopfsteuer« (9, 29) ist,
daß dem Nordaraber
die
Besteuerung
nach Köpfen etwas Fremdes war, deshalb als Lehnwort zu nehmen, weil die nordarabische Wurzel bedeutet.
nur »vergelten«
Im Südarabischen (Minäischen) gibt es nun ein
¡TT:,, das »Abgabe« bedeuten Zeitschr. f. Assyriologie, X X V I .
könnte (Gl.
284,
3): 11
so wird
I 62
H. Grimme
man bei der Bestimmung der Heimat des Wortes vor allem an Südarabien denken. Ich möchte bei der Konstatierung von südarabischen Lehnwörtern auf Grund konsonantischer Eigentümlichkeiten nicht stehen bleiben; auch die Vokale sagen dafür allerlei aus. Nur wird man gut tun, sich von vornherein das Hypothetische mancher Ergebnisse klar zu machen, da wir jetzt und vielleicht für immer von exakten Begriffen über den sabäischen Vokalismus weit entfernt sind. Ich halte die Wortform kittil für das südarabische Gegenstück zu nordarabischem kattll.
Zweifel an ihrem »echt-
arabischen« Ursprung haben schon SPRENGER {Leben Lehre
des Mohammed
{Semit. I, 51) geäußert.
und
II, 197, Anm.) und DE LAGARDE Da Eigennamen wie
und
ursprünglich in Südarabien beheimatet sind (vgl. m"! Gl. 1079, 3, ^SO"! S D 20, 1), so darf man dasselbe wohl auch von der ganzen Bildung behaupten — was aber nicht ausschließt, daß sich in Anlehnung daran das Spätarabische allerhand dem Sabäischen fremde kittil-Formen zurechtgemacht habe. Sodann scheint die Konsequenz zu fordern, daß auch Quadrilittera der Art katlll im Sabäischen kitlll gelautet hätten, da Doppelkonsonanz im Wortkörper ähnlich wie Gemination auf die Vokale wirkt. Daraufhin bekommen nun nicht wenige koranische Wörter für uns Lehnwortnatur. ( ^ j j L o »trefflich« (nicht »wahrhaft«).
Im
Sabäischen
finden sich von p~lü »trefflich« mancherlei Ableitungen, darunter auch ein als Eigenname gebrauchtes p!2£ (z. B. CIS 287, 2), das vermutlich siddik lautete. »christlicher Priester«. aramäischen kissls
Form kassis
Das Wort wird in der
ins Sabäische gelangt, hier zu
(Gl. 618, 67) geworden und dann nach Mittelarabien
weitergewandert sein.
Über einige Klassen südarabischer Lehnwörter im Koran.
163
( j . ^ (87, 7 f.). Der Kontext lautet: »Das Kitäb (Urteil) der Frevler ist auf (ß) Siggin — Und was lehrt dich, was Siggin sei? — Ein in Zeilen geschriebenes (markürn) Schriftstück.« Parallelstellen wie 80, 13 (»Es ist eine Mitteilung auf (fz) hochgeehrten Blättern«) oder 52, 3 (»Bei dem Kitäb, das geschrieben auf (_/?) ausgebreitetem Pergament«) beweisen, daß Siggin als Material zu deuten ist, auf welchem das Urteil geschrieben sei. Ich vergleiche nun siggin mit äthiop. senguen »Schmutz« und vermute als dessen sabäische Entsprechung s-n-g-n oder s-gg-n (mit Assimilation des n wie in bat für bant, Kiddat für Kindat, Muddir für Mundir, und ohne Emphase im s, da g der ursprüngliche Träger einer solchen gewesen, wie amharisch eikä »Schmutz« nahelegt). V o n s-gg-n (Vokale unbestimmt) mag ein Adjektiv siggin gebildet worden sein, das Mohammed herübernahm, um damit seinen Hörern geheimnisvoll das Abschreckende des Urteils der Sünder anzudeuten. Ein Blick auf das Gegenstück zu siggin,
auf
^AAZC
bzw. (J^AAA, scheint unsere Auffassung zu bestätigen.
S. 87,
18 f. heißt es: »Das Kitäb der Frommen ist auf nllijjin
—
Und was lehrt dich, was üllijjiln ist? — Ein in Zeilen geschriebenes Schriftstück.« ?
Der nächste Verwandte dieses Wortes -6 >
scheint mir ( j l j ^ =
( J ^ ä »Titel« zu sein, das ursprüng-
lich »Rotschrift« bedeutet haben wird.
Die
Grammatiker
bringen es mit ^j-fc zusammen, womit wohl äthiop.
mlla
(nach seinem Partizip zu schließen eigentlich »bunt färben«, wie amh. allald)
identisch ist.
Ohne mich auf die Einzel-
heiten der Vokale und der Endung von koranischem jji(-u-)n
lilli-
einzulassen, sei hier nur die Möglichkeit einer Be-
deutung »bunt gefärbte« (seil. Blätter) betont. I o d^.y^--. vermutlich äthiop. Gaber el, das sabäisiert worden 11*
i64
H. Grimme
ist, wobei e zu l und vor diesem l das a der Pänultima zu i wurde. A l s Urbild hat griechisches diaßokog zu gelten, das als dijablos von Äthiopien nach Südarabien wanderte. Hier ergab Versetzung des j in die letzte Silbe -io-, das zu l monophthongiert wurde. Dadurch bekam das W o r t Ä h n lichkeit mit den im Sabäischen sehr zahlreichen Eigennamen mit vorgesetztem dl »der von . .«, sodaß als maßgebendes Wortelement *Ablls oder mit ¿-Umlaut 'Iblls gefühlt wurde, was endlich zur A b w e r f u n g des dl führte. JJMJ^IM. S e i n e v o n N Ö L D E K E ( Z A 17, 83 f.) v o r g e s c h l a g e n e
Zurückführung auf Andreas ist mir sehr einleuchtend, zumal die koranische Phrase (19, 58) »Wir erhöhten ihn zu einem hohen Platz« einer Erinnerung an das Kreuzmartyrium des Andreas entstammen könnte. Im Sabäischen mußte nun m. E. Andreas durch 1 Addreas-Adrls zu 'ldrls werden. 0
Griechisches evayyehov oder syrisches 'euangeljön erlitt im Äthiopischen die Verkürzung zu iiangel. Ins Sabäische übertragen mußte, wie bei Gaberei, e zu l und sodann a zu i werden; der Ü b e r g a n g von uingil zu 'ingil geschah wohl wegen der als unbequem empfundenen Lautfolge 11-i. e.
¡J^j^jr
Ursprünglich pers. äbrek »Wassergießer« (vgl.
DE LA GARDE, Ges. Abhandl. S. 7), das so vom Aramäischen übernommen wurde. Bei den nahen Beziehungen der Spätsabäer mit Persien ist anzunehmen, daß von hierher die Weitergabe nach Südarabien erfolgte; warum sich hier ä zu a verkürzte, bleibt unklar; als diese Veränderung aber einmal vollzogen war, mußte ihr der Umlaut von a zu i auf dem Fuß folgen. Dies dürfte etwas wie »Ton« bedeuten,
gemäß
seiner ständigen Verbindung mit »Steine von . .«. Baidäwl bringt es mit persischem seng-gil zusammen; dagegen möchte
Über einige Klassen siidarabischcr Lehnwörter im Koran.
165
ich seine Ableitung aus dem Semitischen befürworten. Im Amharischen heißt »Töpferton« Sakhilä. Dieses W o r t zeigt jenen ¿-Laut, für den in den ciserythräischen Sprachen außer k auch noch andere Laute einzutreten pflegen (vgl. darüber meine Ausführungen in Z D M G L V , 464 f.). Ich stelle daher zu sakhilä
noch arab.
»rote Farbe«,
späthebr. "IpD,
"lj?D »rot färben, schminken«, aram. NHpD »rote Farbe«, ev. assyr. zafaalü »eine A r t Bronze«. nun ein dazu gehöriges siggil
Dem Sabäischen stände
gut an bei der Voraussetzung,
daß die Vokalfolge i-i adjektivischer Umbildung des obigen Themas entstammt sei. Dann würde
bedeuten: »(Steihe
von) rötlicher (Erde)«. o
Man pflegt dieses vom Koran als südarabischer Eigenname gebrauchte W o r t
mit jenem noch rätselhaften
Fremdwort zusammenzustellen, auf welches hebr. '¿'3S9 zurückgeht. Dann wäre weniger das i der Pänultima, als das i der Ultima sabäische Zutat.
Daß
bei dieser Ableitung
nicht das Aramäische, dem das Sabäische so viele Lehnwörter verdankt,
als Vermittler
gelten kann,
ergibt
sich
daraus, daß das aramäische Äquivalent im Auslaut t statt s zeigt (xnp^0).
Ein weiteres Eingehen auf formale Einzel-
heiten empfiehlt sich nicht Grundlage der Etymologie. •,
wegen
der Unsicherheit
erschlossen aus dem Plural
der
(S. 35, 25).
Nach der Vokalfolge i-i und dem Vorkommen von
in
Gl. 554, 93 und 618, 128 (DDlljj D,piP »dunkelfarbenes Getränk«) zu schließen, ist das Original in südarabischer Sprachzone zu suchen. W i e kittil zu kattil, so wird kuttül zu fiattül stehen, d. h. kattül wurde zu kuttül infolge eines für Südarabien geltenden» vokalharmonischen Gesetzes. Deshalb mag der
H. Grimme
i66
i> koranische Gottesbeiname (j^tXä »hochheilig« Lehnwort dem Sabäischen sein, welches die Wurzel k - d - s zwar H a u s aus nicht besaß, sie aber seit dem Aufkommen Rahmänreligion in Lehnwörtern zeigte, z. B. in KHp 6 1 8 , 3), was wohl k u d u s zu vokalisieren ist gemäß dem ?j . 5 ? ranischen, aber nicht nordarabischen JJ^lXj und =
aus von der (Gl. ko7|t>0
(Gl. 554, 84) und in fenp »weihen« (Gl. 618, 66), wovon kuddüs als Partizipiale gebildet sein mag. Endlich möchte ich auch noch 5 u k t f i l wegen der auffälligen Folge von u-ü als sabäisch bezeichnen. Sein ein' ° f
ziger koranischer Vertreter O^cXi»! »Grube«, event. »Gruben« (S. 85, 4) steht begrifflich anscheinend auf südarabischem Boden. W e g e n dieses W o r t e s dem Südarabischen einen Pluralis fractus 3 uktül (neben oder statt ' a k t ü l ) zuzuweisen, scheint nach dem, was D. H . MÜLLER, (ZDMG 37, 366 Anm.) ausgeführt hat, bedenklich; immerhin hat sein Widerspruch noch nicht die mehrfach überlieferten ' n k t f i l F o r m e n ganz aus der Welt geschafft. Sollte weiter auf das Sabäische nicht auch die Vokalfolge ü-u hinweisen, wie sie in den beiden koranischen Eigen9
f
'
'
namen î-JL>mj.j und u ^ j j J vorkommt? Der Name Josef war jedenfalls nach Südarabien eingeführt — von welcher Seite, das läßt die Tradition erraten, daß der jüdische K ö n i g Du Nuwäs ihn von H a u s aus getragen; ward nun das o von Josef in arabischem Munde jedenfalls zu ü, so wurde durch dieses ü das unbetonte e gezwungen, sich ihm qualitativ anzugleichen. F ü r das nur aus griechischer oder äthiopischer U m g e b u n g nach Saba eingeführt sein k a n n , gilt ähnliches: nachdem Jonas zu Jünas geworden, mußte sein a nach u zu ausweichen. Im Nordarabischen wären die Formen Jüsif und Jünas wohl möglich gewesen. Ein anderer W e g , um zur Konstatierung von südarabischen Lehnwörtern des K o r a n s zu gelangen, geht von der
Ü b e r einige Klassen südarabischcr Lehnwörter im Koran.
167
Neuerklärung einiger auf -in oder -Tt endenden Wörter aus. Das Südarabische verfährt bei der Bildung von Nisbeformen ähnlich wie das Hebräische: es kontrahiert -ijj zu -l. Darauf weist, daß in den Inschriften neben 'p- auch ] geschrieben wird (vgl. S D 7, 1 parallel mit und bezüglich des Feminins die von D. H. MÜLLER in Z D M G 37» 334 ff- abgedruckte Bemerkung Jäküt's). Die Annahme, die sabäischen Nisbeendungen seien -In und -it gewesen, läßt uns nun folgende Lehnwörter des Korans verstehen: (6 g, 30). Offenbar ein Wort, mit dem Mohammed bei seinen Hörern Effekt machen wollte. Er gebraucht es in einer Höllenschilderung: »Für die Ungerechten gibt es keine Speisung als eine solche mit gislin
—
Nur die
Sünder bekommen solches als Speise«. Nach Baidäwl wäre soviel wie ¿)L*..e »Spülicht«; genauer genommen ist es aber wohl »Spülichtartiges«, indem ein gasl oder gisl (als südarabisch durch die Verbalform ^tiTljr Gl. 1052, 7 erwiesen) mit der sabäischen Nisbeendung darin vorliegen wird. (j.AÄ^w. Während in S. 23, 20 vom Sinai als geredet wird, gebraucht S. 95, 2 dafür sich JJ^ÄXAU aus zwei Gründen wegen
der Nisbeendung,
^Jb
j j i e . Hier läßt
als südarabisch
erweisen:
die in Verbindung mit
»Berg«
wohl am Platze ist, und wegen der von dem 2 dieser Endung bewirkten Umlautung des ai zu i. — A u c h
(37,
130), das (37, 123) gegenübersteht, könnte mit der sabäischen Nisbeendung gebildet sein; doch mag hier Mohammed die Endung lediglich als Notanker in seiner Reimnot benutzt haben, weshalb ich das W o r t nicht eigentlich zur Klasse der Lehnwörter rechne. OJ^ÄC.
Der koranische Dämon ilfrit
scheint einen Na-
l68
H. Grimme, Über einige Klassen südarabischer Lehnwörter im Koran.
mcn zu tragen, der dem entspricht, was nach der A n schauung der A r a b e r für einen Dämon besonders wesentlich ist: er bedeutet nämlich m. E. »der Zottige«. E s liegt ihm ein Stamm zu Grunde, der im Amharischen guafara, im Nordarabischen ^¿e »zottig sein«. sche ihn als
lautet
—
beides
mit der
Bedeutung
Indem ich nun annehme, daß das Südarabikannte (wobei bezüglich des Gegenüber-
stehens von g und i auf nordarab.
=
südarab.
hingewiesen werden kann), so erklärt sich ilfrlt
als
iafr
»Vließ« mit feminal-neutralem -ft, dessen i das a des Stammes zu i verfärbte. nordarabischen — o
Mit
OO^-AÄ
Dichtern
müßten natürlich auch die bei
vertretenen
Formen ^Äc, ^J-^jLc,
u. ä. als südarabische Reminiszenzen erklärt werden.
Ohne hier weiter zu gehen, möchtc ich meinen Gegenstand nicht ohne den Hinweis verlassen, daß uns ein genaues Eingehen auf die lautlichen Eigentümlichkeiten alles dessen, was die nordarabische Literatur an südarabischen Lehnwörtern oder Transskriptionen enthält, vielleicht noch allerlei Wesentliches des südarabischen Vokalismus vermitteln könne. S o könnte die F r a g e nach südarabischem Schwa, die ich in Z D M G 61, S. 83 angeschnitten habe, noch weiter verfolgt werden, wobei alle nordarabischen Personennamen >
> -
der F o r m kutalu Herkunft zu untersuchen
>
- >
wären.
u. a.) auf südarabische A u s dem koranischen
W o r t (^JJ-ÄL«, das doch wohl als »Hilfsmittel« gedeutet werden muß, aber weder nordarabisch ist (wegen des langen a), noch äthiopisch oder aramäisch (wegen der W u r z e l iän), ließe sich vielleicht ein Sabäismus konstatieren, da das Sabäische die Wurzel iän »helfen« besitzt; und in Fortsetzung dieser A n n a h m e könnte man vielleicht zu dem Lautgesetz g e l a n g e n , daß im Sabäischen ähnlich wie im Äthiopischen ein Laryngallaut auf vorhergehendes a verlängernd einwirkte.
169
Murgitische und antimurgitische Tendenztraditionen in Sujutl's
al
idäli
al
masnita
f l
l
Von Fr.
Kern.
aliädit
al
maudu
a.
W e n n wir aus den A n g a b e n der muslimischen Theologen kein einheitliches Bild vom irgä gewinnen können, 1 ) so liegt dies daran, daß sich dieser Begriff mit der Zeit verschoben hat. W ä h r e n d die Grundlehre des irgä früher darin bestand, daß man Gottes Urteil über den Sünder nicht vorgreifen dürfe, so wurde später das Hauptgewicht auf die Seligkeit durch den Glauben allein gelegt. Fanatiker wie A h m a d b. Hanbai und Ibn Hazm bezeichnen sogar solche Parteien, die sonst als vollkommen orthodox gelten, als Murgiten, weil sie einen von dem ihrigen abweichenden Glaubensbegriff lehren. 2 ) Murgiten wie Antimurgitcn arbeiten mit verfänglichen Traditionen, nach denen der Prophet, die Genossen und die 1) Die ältesten Quellen sind jetzt die drei ungedruckten Schriften iitäb al älim wa l mutCL allim und al fiqh al ausat von A b u Mut!' al Balhi (Dialoge zwischen ihm und A b u HanTfa) und ar risäla ilä ' Utmän al Batti von A b u Hanifa (?, vgl. den Fihrist). 2) A h m a d b. Hanbai, kitäb as sunna (ms. Berlin) die Hanafiten; Ibn Hazm, al milal wa n nikal, an mehreren Stellen, die Hanafiten und As'ariten! Bei den Hanafiten sind sie aber im Recht. A b u Hanifa erklärt sich in der risäla ilä ' Utmän al Batti für einen Murgiten; er beanstandet lediglich den Namen:
l^jXi'
JjuJ!
JJC!
^yS
l+i jvwSfl
^t
^x
£]voig (poßri'&rjaexai ae nolv. Unter diesen der islamischen Orthodoxie abscheulichen und verächtlichen Häretikern können nur die verstanden sein, die das Wort Gottes für erschaffen erklärten. Danach wäre es schon zur Zeit des Johannes (700—750) für einen Muslim gefährlich gewesen, an der E w i g k e i t des Qoräns zu zweifeln. Erst wirft das Christentum das Problem in den Islam — Johannes war natürlich nicht der Erste, der es formulierte — und nachdem es dort zu wirken begonnen, nutzten spätere diesen Tatbestand wieder für ihre Polemik aus. 5. A u c h die Lehre von den E i g e n s c h a f t e n (sifät) G o t t e s ist auf dem W e g e über die christliche Apologetik in den Islam gekommen. E s mußte den Christen viel daran 1) M . 94, 1 5 8 5 f. und sonst. 2) AI. 96, 1 3 4 1 f.
Christliche Polemik und islamische Dogmenbildung.
l8g
liegen, die Menschwerdung Gottes dialektisch zu erweisen. Der G e d a n k e n g a n g war dabei immer der: W e n n man von Gott überhaupt etwas Körperliches aussagt, wie z. B. er sitzt auf einem Thron, wenn man von einer Hand Gottes, seinem Reden, Stehen und ähnlichem redet, wenn man Gott niederfahren läßt usw., warum soll dann nicht auch Gott in dem vornehmsten seiner Geschöpfe Platz genommen haben? D e r Mensch ist doch ein würdigerer Sitz Gottes als der Thron. Diese G e d a n k e n g ä n g e waren im K a m p f e mit den Juden und Häretikern erwachsen. Sie paßten dann aber auch g e g e n den Islam und sind g e g e n ihn angewandt worden. So lesen wir ARENDZEX S. 7 Z. 17 ff. die folgende Polemik Theodor's g e g e n Juden u n d Muhammedaner (bezeichnet als i j L j ^ I ^ c c X j
d^AÄ)
t S f Ijk» JkAÄj ^ xil (JLJ^I ^ e c L (J-^0 jJJ
u*"-!^ b i s s*IÄJ
*JUI ^ JUu
fcW
^
(j'i
¿Uls» üf Jj-äj d l j j
UflsLie £jJl> il U ¿ U ä
y^y
l-frq»^
Ijo
tXÄi
, j t j »Li ,jf ¿¿-oljw^l i^äI^J tj-iß Sjaä^ (übersetzt bei G R A F 285 f.). Der Gedanke wird dann noch etwas weiter gesponnen und zwischen wirklicher und virtueller Bedeutung dieser Anthropomorphismen geschieden. A u c h diese Scheidung spielt dann bekanntlich im Islam eine große Rolle. Noch deutlicher bekommen wir diese Gedanken im 7. Mimar Theodor's (GRAF 188 f.) auseinandergesetzt, wo sich der K a m p f aber nicht g e g e n den Islam richtet. A b e r alle die Probleme, welche die Mu'tazila b e w e g t haben, sind hier in christlichem Gewände dargelegt. W e n n Du, Häretiker, — so heißt es dort etwa — die Sohnschaft ableugnen zu müssen glaubst, so mußt D u auch alle Attribute Gottes leugnen, die für dich ebenso viel Geheimnisse enthalten wie die Sohnschaft. Dann folgen die bekannten G e d a n k e n g ä n g e : W i e kann Gott Leben haben, wenn er nicht die Akzidenzien
igo
C. H. Becker
wie Essen, Trinken usw. hat? W i e steht es mit seinem Hören, Sehen, Wissen, Machen usw. — kurz wir haben hier den ganzen mu tazilitischen Gedankenapparat vor uns. Die A b h ä n g i g k e i t der mu'tazilitischen Philosophie von der christlichen ist eine lang bekannte Tatsache; neu scheint mir hier nur der Nachweis, daß durch die christliche Apologetik der Islam einfach g e z w u n g e n wurde, zu diesen christlichen F r a g e n Stellung zu nehmen, und so sind diese zu der führenden R o l l e gekommen, die sie in den dogmatischen Kämpfen des jungen Islam gespielt haben. W i e das junge Christentum erst im K a m p f e mit judenchristlichen Strömungen sich dogmatisch ausgestaltet, so bildet sich auch der Islam erst im K a m p f e g e g e n die christlichen Strömungen in- und außerhalb des Kreises seiner Bekenner. Noch auf eins möchte ich hier aufmerksam machen. D a ß die ganze Methode des kaläm aus dem Christentum stammt, ist bekannt. W e r hinter einander islamische D o g matiker und christliche Patristik liest, wird von den Zusammenhängen so überzeugt, daß er des Einzelbeweises gar nicht mehr bedarf. E s ist ein und dieselbe Gedankenwelt. Daß auf die Dauer der Vernunftbeweis immer größere Bedeutung als der Schriftbeweis erlangt, 1 ) hängt auch vielleicht damit zusammen, daß in der christlich-islamischen Polemik der Schriftbeweis eo ipso ausscheiden mußte. So lesen wir immer, daß die Parteien ausmachen, nicht auf Grund ihrer Schriften, sondern ix xotvwv Y.al O¡uoloyov/UEVOJV svvoitbv einander zu widerlegen. 2 ) D a ß schließlich die Mu tazila, wie G O L D Z I H E R (Vorlesungen 117) nachgewiesen hat, alles andere als liberal war, ja daß sie zur Begründerin des islamischen Dogmatismus werden mußte, ist nach dem Gesagten doppelt klar; denn sie erbt mit der Methode und den Gedanken der christlichen K i r c h e auch deren Absolutheit und Unduldsamkeit. 1) Vgl. GOI.D7.IHER, Vorlesungen 2) M. 97, 1551.
127.
191
Christliche Polemik und islamische Dogmenbildung.
6. Zum Schluß ein (Tedanke, von dem man meistens annimmt, daß er den umgekehrten W e g genommen hat — d. h. vom Islam ins Christentum eingedrungen: D i e A b n e i g u n g g e g e n bildliche Darstellungen, die im Islam das B i l d e r v e r b o t , im Christentum den B i l d e r s t r e i t erzeugt hat. 1 ) Ü b e r die Tatsache, daß im Islam ein Bilderverbot besteht, braucht man keine W o r t e mehr zu verlieren, seitdem CHAUVIN aus den üblichsten Fiqhbüchern sämtlicher R i t e n , auch der Schi'a, die unzweideutigen B e l e g e zusammengestellt 2 ) und seitdem SXOUCK HURGRONJE in meisterhafter K n a p p h e i t die Grundgedanken des Verbotes formuliert hat. 3 ) Natürlich bleibt es nach wie vor ein Unsinn, von einem »qoränischen« Bilderverbot zu reden; denn die Qoränkommentare zu dem meistens als B e l e g angeführten V e r s Qorän V , 92 enthalten keine A n d e u t u n g davon. 4 ) D a s »qoränische« Bilderverbot ist ein Überbleibsel aus einer Zeit, der noch Qorän und Gesetz identisch waren. A u c h der ganze Eifer, mit dem man das V e r b o t abzuleugnen versuchte und G e g e n b e w e i s e aus der P r a x i s erbrachte, erklärt sich nur aus dem mangelnden Verständnis des natürlichen Gegensatzes zwischen i äda und scherta. V o n einer ganz anderen Seite interessiert es uns hier. Bestehen tatsächlich Zusammenhänge zwischen Bilderverbot und Bilderstreit? Die L e g e n d e bei Theophanes (ed. DE BOOR 401, 2 9) ist bekannt. 5 ) E i n J u d e aus Laodicea verspricht dem K a l i f e n Jazid II. eine Lebensdauer von 40 Jahren, wenn er sämtliche Bilder und K r e u z e in den christlichen K i r c h e n vernichte. D e r Kalif erläßt den B e f e h l dazu, doch der T o d 1) Arexdzf.x, Einleitung; ScHWAR/.i.osE, Der Bilderstreit
(Gotha 1890)
36 ff. 2) La défense des Images gique
{Annales
de VAcadémie
1896). 3) Z D M G 6 1 , 186 ff. 4) Ich habe Baidäwl und Tabarï, Tafsïr
d'Archéologie
de Bel-
V I I , 20 ff. verglichen.
5) Schwarzlosf., 1. c. 38 f.; Arendzex I ff.; Weli.hausex, Arabisches Reich 202 f.
C. H. Becker
ereilt ihn, ehe das grausame Verdikt überall durchgeführt war. Leo der Isaurier sei dann später durch einen syrischen Christen Beser (Brjorjg = Bischr),') der in der Gefangenschaft Muslim geworden war, zum Bilderkampfe bewogen worden. Dieser begann im Jahre 726. So etwa erzählen Theophanes und andere. WELLHAUSEN bezweifelt das Edikt Jazxd's mit Unrecht; denn es steht durch zeitgenössische ägyptische Quellen außer aller Frage, daß unter Jazid im Jahre 104 (722—3) wenigstens in Ägypten »die Kreuze zerbrochen, die Bilder zerstört und die Götzenstatuen vernichtet wurden.« 2 ) Aus anderen Provinzen fehlen die Belege, wahrscheinlich, weil das Vorgehen in Ägypten isoliert gewesen ist. Erst nachträglich, als alle Welt vom Bilderstreit des Isauriers erfüllt war, brachten christliche Schriftsteller die ägyptischen Nachrichten damit in Zusammenhang. SCHWARZLOSE hat zweifellos (S. 37, 43) recht, wenn er das ganze Problem in jüdischen Kreisen entstehen läßt, die froh waren, eine wirksame W a f f e gegen ihre christlichen Gegner gefunden zu haben; aber erst als die Polemik der Juden auch unter den Christen Anhang fand, wurde die Bilderfrage zum Problem für die ganze Welt des Ostens, wohl auch damals erst für den Islam. Jedenfalls hat dabei der Islam keine entscheidende Rolle gespielt; denn sonst hätte Johannes von Damaskus, der unmittelbar unter dem Eindruck des kaiserlichen Bilderverbotes (726) die erste seiner sechs Streitschriften gegen die Bilderbekämpfer (Ikonoklasten) schrieb und der über die Verhältnisse in Damaskus wie kein anderer Christ Bescheid wußte, nicht versäumt, auf diesen für den Kaiser niederschmetternden Zusammenhang hinzuweisen. E s ist überhaupt meines Erachtens beweisend, daß Johannes in seinen drei echten Bilderschriften nirgends die Muslime als Gegner anführt, 1) Uber diesen stehen ganz interessante Details bei Michel le Syrien Livre X I Chap. X X I (Üben;. S. 503). 2) EVF.TTS, History of the Patriarchs of the Coptic Church (Patr. Or. V, 0 ITT, 72; ehitat 11, 493, 2; Ibn TaghribirdI I, 278.
193
Christliche Polemik und islamische Dogmenbildung.
sondern nur die Juden und die Ikonoklasten, während er doch sonst den Muslimen gegenüber kein Blatt vor den Mund nimmt; Theodor dagegen, der sich immer so vorsichtig als möglich ausdrückt, wenn er gegen Muhammedaner polemisiert, wirft sie in seinem Traktat für die Bilderverehrung immerzu mit den Juden zusammen. Während Theodor fast alle seine Gedanken von Johannes entlehnt, — neu ist bei ihm die Polemik gegen den Islam, ja er kennt schon das islamische Hadith, nachdem die Musawwirün am jüngsten Tage die Aufgabe bekommen, ihren Geschöpfen Lebensodem einzublasen. ARENDZEN S. 18/19 (vgl- GRAF 297/8) lesen wir: ¿ÜOIAÄJI
'fl-LS^Iii» LjUu
yyO
^jt
^jyiyju
^jJtXJJ vp-ZO^-i
Daneben halte man das bekannte Hadith (katiz el-ummäl II, 200 (4248); Bochäri (KREHL) II, 41, IV, 105 f.; Qastelläni VIII, 481 f.; Zarqäni zum Muwatta^ IV, 204 und häufig1)):
Geht man unter diesen Umständen zu weit, wenn man annimmt, daß die Hadithe über das Taswir sich erst in der Zeit des Bildersturms resp. seiner dogmatischen Vorbereitung gebildet haben, als die ganze Kirche das Problem erörterte und der Islam nur die ihm passende Antwort zu formulieren brauchte? In eigener Werkstatt hat der Islam sein Dogma von der Verwerflichkeit der Bilder wenigstens in dieser Formulierung sicher nicht erzeugt. Es handelt sich nämlich auch im Hadith nicht nur um Bilder beliebiger Art, sondern um die speziellen Bilder der c h r i s t l i c h e n H e i l i g e n v e r e h r u n g ; neben dem Bilde erscheint das K r e u z . 1) Anm.
bei der Korrektur:
In einer der letzten Nummern der D L Z hat
GOLDZIHER anläßlich einer Anzeige des GRAF'schen Buches auch auf diese Beziehung aufmerksam gemacht und einige andere Quellen zitiert. Zeitschr. f. Assyriologie, X X V I .
13
194
C. H. Becker
Bei Qastellän! V I I I , 481 ist eine Bochärltradition interpretiert, in der das übliche tapwlr, Plural lasäwlr dieser Hadlthe durch tasällb ersetzt ist. Qastellän! sagt dazu: *_*jJLaÄJt
JLäj ^ L a j J ! V^yLa.S' ^ I x a ö ^5! ^ A J L O J
Beide haben recht; tasällb ist natürlich Plural von ta$llb und nicht von sallb; es ist eine jener Infinitivformen, die ihren Verbalcharakter vollständig verloren haben; ähnlich wie tasäwir, tazäjln, tamäthil nicht mehr die Tätigkeit, sondern das Resultat der Tätigkeit bezeichnen, heißt tasällb Kreuzesdarstellungen, Kruzifixe. Uns interessiert hier nur, daß der Terminus in den Kapiteln über das Bilderverbot als synonym mit taswir vorkommt. Darin liegt doch ein wichtiger Fingerzeig dafür, daß das islamische Bilderverbot nicht aus einer allgemeinen Abneigung gegen bildliche Darstellungen entstanden ist, sondern mit dem Kampf gegen Heiligenbilder und Kruzifixe, 1 ) wie er von den Ikonoklasten entfacht war, irgendwie — wenigstens in der Fragestellung — zusammenhängt. Der ganze Zusammenhang dieser Arbeit legt diese These doppelt nah; denn die F r a g e nach der religiösen Stellung zu den Bildern war zur Zeit der ersten dogmatischen K ä m p f e im Islam das H a u p t p r o b l e m der christlichen Kirche, deren Fragestellungen, wenn auch oft nicht die Antworten, der Islam nachweislich übernommen hat. Daß das Problem u r s p r ü n g l i c h ein jüdisches ist, scheint mir ganz klar. A u s 'Aböda zärä I I I geht deutlich hervor, daß die im islamischen Recht ausschlaggebende Fragestellung über Ehren und Nichtehren der Bilder und über die Beschränkung des Verbotes auf Lebewesen aus dem Judenl) SCHWAR/LOSE, . c. 12 ff., 212.
Christliche Polemik und islamische Dogmenbildung.
I95
tum übernommen ist; aber als zeitgeschichtliches Problem tritt die Bilderfrage an den Islam im c h r i s t l i c h e n Gewand. Bekanntlich drehte sich im Christentum der Streit um die TiQoaxvvrjai? und ihre Bedeutung (ob Anbetung oder bloß Verehrung). Theodor wendet sich in seiner Streitschrift (ARENDZEN 17, G R A F 296) auch gegen die Muhammedaner
und verweist auf Qorän II, 32, wo Gott den Engeln befohlen habe, vor Adam niederzufallen. Auch das sei keine Anbetung, sondern eine ngoaxvvrjatg Tijurjrix7] gewesen — eine Behauptung, die übrigens bei Behandlung des gleichen Themas auch Ibn Hazm IV, 209 bestätigt. Er sagt, die Niederwerfung der Engel vor Adam wäre kein üoLvc Oy^1, sondern ein gewesen. Also auch hier verfolgen wir bis in späte Zeit das Nachwirken christlicher Fragestellungen. So hat sich uns die Patristik als eine wertvolle Quelle erwiesen. Man wird die Bedeutung der christlichen Polemik für die islamische Dogmenbildung als recht erheblich einzuschätzen haben. Im Rahmen dieser Festschrift konnte das erörterte Problem nur angedeutet, nicht aber ausführlich begründet werden. Ich glaubte aber im Sinne des Meisters, dem diese Ehrung gilt, zu handeln, wenn ich gerade diese welthistorischen Beziehungen weiter aufzuhellen versuchte. Ich wußte mich hier auf seinen Bahnen. Und wenn es schließlich nur Andeutungen geworden sind, so möge er des Grundsatzes gedenken:
196
Die Hashwïya. Von M. Th.
Houtsma.
Über die Frage, wer unter den Hashwïya zu verstehen seien, herrscht bei den europäischen Gelehrten keine vollkommene Übereinstimmung. DOZY sagt in seinem Supplément (I, 292), daß x j ^ & i l oder Jjct der Name einer Sekte sei und fügt hinzu: »On n'est pas d'accord sur l'origine de ce mot, ni sur les opinions que professait cette secte; voyez Gl. Edrisi.« In diesem Glossar s. 286 berufen sich die Herausgeber auf den betreffenden Artikel in dem Dictionary of the technical terms used in the sciences of the Mtisulmans ed. Calcutta I, 396 f. Der Verfasser dieses A r tikels teilt darin erst seine eigene Meinung mit, des Inhalts, daß die Hashwïya oder Hashawïya Leute »seien, die an dem buchstäblichen Sinn festhalten, sich zum Anthropomorphismus und Anderem bekennen und zu den irrenden Sekten gehören. Diese Auffassung begründet er mit einem Zitat aus al-Subkï's Kommentar zu den Grundlehren von ibn alHädjib, in welchem auch eine etymologische Erklärung des Namens vorgetragen wird, die offenbar nach derjenigen des Namens der Mu tazila kopiert ist und uns nur insoweit interessiert, als daraus hervorgeht, daß nach der Meinung alSubki's die richtige Aussprache al-Hashawiya ist. Darauf wird mit J ^ ' j
eine andere Erklärung vorgetragen,
nach s «-
welcher der Name Hashwïya auszusprechen und von in dem Sinne von
(Körper) herzuleiten sei.
Darauf
197
M. Th. Houtsma, Die Hashwiya. heißt es: eine andere Meinung ist
daß damit Leute
gemeint seien, die die Forschung über diejenigen K o r a n verse, die schwerlich nach dem buchstäblichen Sinn
inter-
pretiert werden können, unterlassen, vielmehr an demjenigen, was A l l a h gemeint hat, festhalten, indem sie mit V e r w e r f u n g des buchstäblichen Sinnes A l l ä h die E r k l ä r u n g anheimstellen.
Diese Meinung wird aber von al-Subki
mißbilligt
aus dem naheliegenden Grund, daß in diesem Fall die alten muhammedanischen Rechtsgelehrten (oiJLJ!) unter der Benennung
al - Hashwiya
einbegriffen
Sekten zu rechnen wären. des Dictionary
und
zu
den
irrenden
Schließlich zitiert der Verfasser
noch die Meinung al-Khafädji's in der XA^LÄ.
zu al-Baidäwi's Korankommentar zu Sura 2, 36, welche wir aber als zu gekünstelt beiseite lassen. DE GOEJE hat sich in seinem Glossar zu den arabischen Geographen, Bibl. Geogr. Arab. I V , 225 mit der zweiten von al-Subki erwähnten A u f f a s s u n g , daß nämlich J&A
so
viel sei als Anthropomorphismus und Hashwiya, Hashawlya oder A h l al-Hashw verstanden erklärt.
die Anthropomorphisten
andeute, ein-
Nirgends aber kommt Hashw in dieser
Bedeutung vor; wenn von denjenigen Hashwiya die R e d e ist, die sich offen zum Anthropomorphismus bekennen, so werden Yäküt ¿Ü^I!
sie näher angedeutet
als HJ^MA-I / i g . J I
(so bei
an der von DE GOEJE zitierten Stelle I V , 99) oder ¿LJAÄJO, z. B . S h a h r a s t ä n i ed. C U R E T O N 77, 2.
Ausführlich hat darauf VAN VLOTEN in einem auf dem Pariser Orientalisten-Kongreß gehaltenen V o r t r a g (vgl. Actes du ne Congres international des Orientalistes, -3® session, S. 99 ff.) über die Hashwiya gehandelt und vollkommen richtig auf Grund der von ihm zitierten Stellen festgestellt, daß unter Hashwiya die Traditionarier zu verstehen seien. Allein am Schluß des betreffenden Passus a. a. O. S. 105 neigt er wieder zu der Deutung DE GOEJE'S hin und versucht den Namen Hashwiya von I.Iashw in der Bedeutung »bas peuple,
M. Th. Houtsma
vulgus« herzuleiten, indem er bemerkt: »Les Motazila auraient donnée le nom hachivîa qui
sympathisaient
ou vulgaristes aux traditionnistes
avec le peuple
conceptions anthropomorphiques.«
et
en partageaient
les
Diese Ableitung, welche,
was VAN VLOTEN freilich nicht geltend macht,
gewisser-
maßen ein A n a l o g o n in ^ L Ä (== Sunnite, vgl. GOLDZIHER in Z D M G 36, 278 ff.) hätte, scheitert meines Erachtens an dem gleichwertigen A u s d r u c k A h l al-hashw. aber
nach
Mukhtalif
dem
ausdrücklichen
al Hadith
Zeugnis
S o viel steht
in ibn
Kutaiba's
fest, daß Hashwïya eine in mutazili-
tischen Kreisen aufgekommene schimpfliche Bezeichnung der A s h ä b al-Hadith ist. Stelle
im Wortlaut
Der Deutlichkeit halber setze ich die her
(Cod. Leid.
f. 97*):
fSyjiJ
I^Jlï LJ^J SJA^JIJ äüüUJfj ¿ Ü ^ i L . W e n n dem aber so ist, so ist es angezeigt, für weitere Aufschlüsse über die ursprüngliche Bedeutung dieses Namens uns bei einem m u tazilitischen Autor 1 ), R a t s zu erholen. Ich schlug deshalb das i - J - X j ' ^ ^ ä £ J - ^ ' j ¿U-Jl ^-alxi 1) Die alte mu tazilitische Literatur schien, ehe die zaiditischen Hss. nach Europa kamen, unwiederbringlich verloren, doch durch die Zaiditen ist uns vieles erhalten. Ich möchte bei dieser Gelegenheit aufmerksam machen auf Cod. Leid. 2807, vgl. LANDBERG, Catalogue de Manuscrits arabes provenant d'une bibliothèque privée a-Jl-Medîna J^ilf
S. 163 Nr. 589, wo dieser mit dem Titel angeführt ist und dem bekannten Zaiditen A b u Tälib
Yahyä b. al-Husain zugeschrieben wird.
Das bezieht sich aber nur auf die
Ziyädät; das diesen zugrunde liegende Werk, der
^ j j i i , hat den fast
unbekannten Mu'taziliten A b u ' A i ï . b : Khalläd, einen Schüler des A b u Häshim zum Verfasser. Einige kurze Nachlichten über ihn findet man im Fihrist I, 174 und bei ARNOLD, AI Mütazilyh
u! s. w. S. 62.
In den Ziyädät werden neben
A b u Tälib noch andere Namen angeführt und namentlich sehr oft A b u '1-Käsim, womit wahrscheinlich der bekannte imamitische Theologe al-Sharïf al-Murtadä ' A l l b. Tähir (f 436 =
1044) gemeint ist.
Dem Werk sind am Schluß 5
u^IavLJ
XamaAJ
Lyoò
.V F e Uva on the A p p o i n t m e n t of D h i m m i s to office.
¿¿Iii
J,l»j"
J j l
yi
xJUl
ïyi
y,
JysXs
p K ^ L j ¿
|vJoül
¿
j^jXáJI
cjlo^tpi
u
¿
^
ooli»^
^^JLAJI
jXXmíjo
^ L û J l
JjJf
¿
I?jL«JI3
J j ^ ü l J
)¿
jf
CJIJ^I ^
^ j j o ! (J./»
LJ_j!
Iàaaxi
^ ¿ K J I
y
büaJ^u
^ L u
^ L o á J L jv-g-ix ^ j J I
xjLs
Ifcjl
b
i ) Ms. ^ . / O . 5) ib. V ,
5
)Jl*J
^
*¿«IA-O
^jü-CJI
«ylJ^Jt
^LiSf!^
k+j^lj
(j>
^ ¿ ^
(Const. 1298) p. 6.
GOI.D/JHER,
5) I. e. tlie so-called " P a c t of Omar".
A
«—
3) Ms. unreadable!
4) Cfr. the writings cited by
}
^iff
^.A+JLM+JI^
SIJUJIJ
2) So Ms.!
(¿JJ!
jemor
,
t
' passieren.
229
Sa'd es-Suweni.
sollen, kennen sie das dazu gehörende nijm. Ganz wie im vorislamischen Arabien, so gibt es auch in Hadhramot Reime, welche dem Gedächtnis in bezug auf den Wechsel der Jahreszeiten zu Hilfe kommen. Einer von diesen in gereimter Prosa abgefaßten Sätzen gilt als ein Produkt von Sa d es-Suweni's Geist: lä habbat el-ölja besäbi (sie, nicht bis-säbt ) biS-idl, mä jögrob el-kawili '/-ö/.') »Wenn der Nordwind weht am siebenten es-Sol (d. h. am siebenten T a g e des Aufenthalts des Mondes im Gestirn es-Sol, welches außerhalb Hadhramot's esSaulah oder auch der »Schwanz des Skorpions« heißt), »So kommen die '61-Vögel (taubenartige Vögel, welche die reifende Hirse fressen) nicht mehr in die Nähe des Ackerrandes.« So haben die meisten nijüm ihre Memorialreime, aber ob noch andere als der angeführte sich von Sa'd es-Suweni herschreiben, müssen wir dahingestellt sein lassen. Ich lasse jetzt drei kleine auf Sa c d bezügliche Erzählungen folgen, deren Inhalt in ganz Hadhramot bekannt ist; ich gebe dieselben in der Form, in der sie mir von demselben Terimi, welchen ich oben für die Beerdigungsanekdote zitierte, in die Feder diktiert wurden. Der Übersetzung f ü g e ich nur wenige A n m e r k u n g e n hinzu. 1) Eine andere Lesart der letzten Worte lautet: •wili 'l-'Sl.
Hawili
mä 'äd jibrah-
fil-ba-
(cfr. i J ^ ä , ^ I j ä ) ist das Wiillchen, welches den ganzen
Acker von benachbarten Grundstücken abgrenzt. außerdem durch Grenzsteine Rethen,
Plur. awthän)
Hie und da ist die Grenze angegeben.
Die 'ölja
ist
der kühle Nordwind, der frühmorgens weht und der Entwicklung der Saat sehr zuträglich ist:
lä mäii
*ölja fig-(öboh jibti
'l-'amal
mä jilgi
sabul
»wenn es
keinen Nordwind am frühen Morgen gibt, so dauert es lange, bis das Getreide Ähren treibt«.
Der
7. Tag des Gestirns es-Söl gilt als der normale für die
völlige R e i f e der Sommerhirse (ef-fe/)\ ist dieselbe einmal reif, so können die Vtl-Vögel ihr nicht mehr schaden.
2 30
C. Snouck Hurgronje
I.
(Text.) Jegülün enn es-Suweni kän jisni fi biroh fi Terim, uba'ed, hädä es-sejjid möla 'Adan jedirris fi mahdharah uba'ed jegül bemiswäk haggoh häkadä fi täseh, ke'ennoh jechot boh fil-mä h a g g es-sorb, uho jegittib el-motr h a g g Sa'd es-Suweni. Uba'ed 'irif ennoh mön es-sejjid hädä, ujesil malä jeddoh tin mön hädä Ii mechammar bil-mä h a g g eddamän, usellehä uhadaf bhä; hattä jom nawwas behä, hazarhä 's-sejjid, gäl lijamä'atoh Ii jigre'ün 'endoh: (jinne'ü elchelfeh mön najäset Sa'ed. C^anna 6 '1-chelfeh, jät fi barra '1-chelfeh. (Übersetzung.) Man sagt, Sa'd es-Suweni sei mit der senäwah beschäftigt gewesen auf seinem Grundstück 1 ) in Terim, und dann habe der Sejjid, der [Heilige] von Aden 2 ) in einem Obergern ach einen Vortrag gehalten; dann habe er mit seinem Zahnbürstholz so3) gemacht in dem Trinkbecher, als zöge er damit Linien durch das Trinkwasser, und so habe 1) Ebenso von Hadhramöt
wie
im Altarabischen
das Grundstück
wird
auch im heutigen Sprachgebrauch
ohne weiteres
bir,
Brunnen,
genannt.
Ohne
bir weder Datteln noch Getreide. 2) Mola
drückt alles aus, was im Altarabischen (äfcib oder dü, in andern
Dialekten auch rä'i Heilige von A d e n
und abü heißt:
der Mann von . . . .
Hier ist der große
aus dem Sejjidgeschlecht 'Aidarüs gemeint,
dessen Grab für
weite Kreise Ziel von Wallfahrten und Gelübden ist. 3) Bei den W o r t e n gäl
häkadä
machte der Erzähler natürlich eine Be-
wegung mit der Hand, um das Hinundherrühren im Gefäß zu veranschaulichen. Wirkungen Feldarbeiter
aus
der F e m e ,
zugeschrieben
wie
sie hier sowohl dem Sejjid als dem heiligen
werden,
V g l . z. B. HF.RKLOTS, Qanoon-e-islam Well,
der Heilige von N a g o r e ,
verspürt,
daß ein Schiffskapitän,
begegnet
man
in vielen
Heiligenlegenden.
(2 n d ed., Madras 1863), S. 160, wo Qädir
während er sich rasieren läßt,
aus der Ferne
dessen Schiff ein Leck bekommen hatte,
für
den Fall seiner R e t t u n g ihm bedeutende Geschenke gelobt, worauf Qädir seinen Handspiegel fortwirft, welcher durch Allah's Gnaden das in N o t weilende Schiff erreicht und sich daran klebend das unheilvolle L o c h zuschließt.
231
Sa c d es-Suweni.
er die Ackerabteilungen des S a d es-Suweni abgeteilt. Sodann hat dieser (Sa'd) verstanden, daß es von unserem Sejjid komme, und er nahm seine Hand voll Erde, von dieser mit dem Düngerwasser vermischten [Erde], und nahm das auf und warf es hin. Wie er das aufgenommen hat, hat es der Sejjid bemerßt und zu den bei ihm Versammelten, die bei ihm hörten, gesagt: schließet das Fenster") vor dem Dreck des Sa'd. Jene haben das Fenster zugemacht, und tatsächlich traf die [hingeworfene Erde] die Außenseite des Fensters.
II. (Text.) Ed-döleh hagg Terfm Ii fi zamän Sa'ed, ho me'oh dhabjeh, jefukkhä fil-chala kul jom, toköl min el-'amal hagg ennäs, tädihom walä had jistänis jötrodhä. Lehattä ädat Sa'öd kadälik, hatta gabadhhä ho udebehhä, walä had däri illä ho wehormatoh. Uba'ed ed-döleh mesähin ed-dhabjeh haggoh tidhwi kama 'l-'ädeh, mä dhawat. Hatta dawwar fi Terim kullehä walä ha^, "O K e e p e r " , one of the Ninety-nine Most Beautiful Names frequently used in charms,
come, within a circle, the names of the Seven Sleepers and their dog arranged so as to make a hexagon or Solomon's Seal in the centre of which stands xJUI. T h e names of the Seven Sleepers diverge widely from the forms found elsewhere and Qitmir, the d o g , thanks to his Arabic zvazi?
268
D. JB. Macdonald
alone as usually, holds his own. Although the Qamûs gives five different sets of these names, only one (IsaJ^j) of the names here occurs in these and practically only three here agree with those given by REINAUD, Description des Monuments Musulmans, II, p. 59. Nearest comes the set given by Baydâwï, at least as FLEISCHER (I, 559) edited it. Beginning at the lower left hand and going first round the outside circle they run : ji^jJaiaAiS' (with the Ji> above), yftJaS, laaJ^j, LuXiXlo, IuLùo. Then, passing to the inner circle, ¡ji^joLi, J^yjy/i, j^yj^iO. The object of the arrangement evidently has been to secure letters at the right points suited to form the hexagon, which was probably drawn first and the names arranged round it. For this purpose the L i of uijjoLw had to come in the outer circle. The number of shins should also be noticed.
On the other side is a magic square, surrounded by the names of the four archangels J^AJI^AS», JJOKJ^, J^jl^-tJ, The body of the square is made up of the myste-
Description
rious combinations
o f a silver a m u l e t .
269
of letters t j a j U f j ^ and
which
stand at the beginnings of Suras X I X and X L I I respectively.
The letters of
»«*•> are inserted in the divisions
of the square, moving from left to right, and those of ( j a * * ^ , moving from right to left. Thus each division has two letters. Further, the point at which each bar of divisions is begun is so chosen that the diagonals of the square add up to the same amounts as the horizontal and perpendicular bars, 278 for
and 195 for { j a x j ^ f .
In the second bar from
the foot and in the square in it to the right &/\jo is an error for
Also the combination which should be (j*/®
is always arranged Wo*-
In this last difference there may
be some mystery which I have not divined.
The square,
then, translated into figures would stand thus: — 8/90
40/70
70/10
60/5
100/20
70/10
60/5
100/20
8/90
40/70
100/20
70/90
40/70
70/10
60/5
40/70
70/10
60/5
100/20
8/90
60/5
100/20
8/90
40/70
70/10
A l l the elements contained in these figures are of great talismanic value, but I do not remember in the Arabic magical literature ever to have seen them so combined. A s to their separate use it is needless to accumulate references. REINAUD'S Description is still most valuable and DOUTTE'S Magie et Religion is a book in a class by itself. REINAUD deals with the Seven Sleepers in vol. I, pp. 184—186, II, 59; with the Quranic combinations II, 236 and 250; with Solomon's Seal II, 55. DOUTTE with the Seven Sleepers p. 198; with the Quranic combinations pp. 165 and 173; with Solomon's Seal p. 156.
270
Altarabische Amulette und Beschwörungen. Nach Hamza al-Isbahänl. Von Eugen
Mittwoch.
Abü c Abdalläh Hamza b. al-Hasan al-Isbahäni, gewöhnlich kurz Hamza al-Isbahänl genannt, schrieb in der ersten Hälfte des vierten islamischen Jahrhunderts eine größere Zahl von Werken, von denen nur einige auf uns gekommen sind. Von diesen sind die »Annalen« schon frühzeitig von den europäischen Orientalisten in den Kreis ihrer Studien gezogen worden. So ist es zu erklären, daß Hamza in der arabischen Literaturgeschichte vorzugsweise als Historiker bekannt geworden ist, obwohl er sich in der Mehrzahl seiner Schriften mit philologischen Dingen beschäftigt hat. Auf die philologische Seite von Hamza's Tätigkeit hat zum erstenmal der Forscher, dem diese Blätter gewidmet s i n d , m i t Nachdruck hingewiesen. Hierdurch angeregt habe ich die gesamte literarische Lebensarbeit Hamza's, vor allem aber seine philologischen Werke zum Gegenstand einer Sonderstudie2) gemacht. In dieser habe ich im besonderen auch Hamza's Sprüchwörtersammlung näher beschrieben, die uns in dem Münchener Codex Aumer Nr. 642 erhalten ist und die speziell die komparativen Sprüchwörter, das sind die 1) GOI.DZIHER, Muhammedanische Studien I S. 209—213. 2) Die literarische Tätigkeit Hamza al-I$bahänis. Ein Beitrag zur älteren arabischen Literaturgeschichte, erschienen in den Mitteilungen des Seminars für orientalische Sprachen Bd. X I I Abt. II. Berlin 1909. Ich zitiere die Arbeit im folgenden als L T H I nach den Seiten des Sonderdrucks.
E. Mittwoch, Altarabische Amulette und Beschwörungen.
2~] \
Sprüchwörter nach dem Schema (tX^ ^jc JJLSI ySt>, behandelt. Dieses Buch verdient unser Interesse besonders aus dem Grund, daß es eine Hauptquelle für Maidäni's bekanntes W e r k über die arabischen Sprüchwörter bildet. In diesem zerfallen die nach dem Alphabet geordneten Kapitel in je drei Abschnitte, von denen sich der erste mit Sprüchwörtern allgemeiner Art, der zweite mit komparativen und der dritte mit Sprüchwörtern, die in späterer Zeit entstanden sind, befaßt. A l l e s , was also der zweite Abschnitt eines jeden K a pitels von al-Maidäni enthält, ist — mit geringfügigen Ausnahmen — fast bis aufs W o r t aus Hamza's Buch übernommen. 1 ) Das ist übrigens von Maidäni selbst in einer Bemerkung, die er in der Einleitung 2 ) macht, deutlich genug zugestanden. 3 ) E r sagt dort: iM »«jUXJ! ItXie Jf ^ « ^ i t ^ j j s ^ a . oUcS' ^ Lo oJUiij Die uräfät«, die Maidäni also weggelassen hat, bilden in Hamza's Sprüchwörtersammlung gleichsam einen Anhang. E s sind zum Teil fauräfät im eigentlichen Sinn des Wortes, T i e r f a b e l n , zum größeren Teil aber $uräfät im Sinn von F a b e l e i e n , nämlich Berichte über verschiedenartige abergläubische Bräuche der alten Araber. 4 ) A u f diesen Abschnitt denke ich demnächst an anderer Stelle zurückzukommen. Hier greife ich nur den Schlußteil des Kapitels heraus, der Bemerkungen über die Amulette, die bei den Arabern in Gebrauch waren, und die zu ihnen gehörigen Beschwörungsformeln enthält. 5 ) 1) V g l . im einzelnen L T H I S. 4 0 — 4 2 . 2) Maidäni, ed. Kairo 1284, S. 0 oben. 3) V g l . auch H H V , 392.
—
Trotz der Bemerkung
in der Einleitung
hat Maidäni die Tatsache, daß er das ganze Buch Hamza's ausgeschrieben hat, dadurch verschleiert,
daß er im Lauf des "Werkes hier und da Hamza zitiert.
So hat es dann den Anschein,
als seien nur diese vereinzelten Stellen diesem
Autor entnommen. 4) V g l . L T H I S. 39. 5) Blatt 2 i 8 r — 2 i g v
der Handschrift.
272
E . Mittwoch
Zunächst zählt Hamza die Namen von 17 verschiedenen foarazät') und abgär, also von Muscheln und Steinen, auf, die bei den Arabern als Amulette Verwendung fanden. Bunte Steine und Muscheln sind nicht nur bei den alten Arabern, sondern bei vielen Völkern in den verschiedensten Ländern und Zeiten als Amulette gebraucht worden und haben sich bis auf unsere T a g e als solche erhalten. Viele von den von Hamza angeführten Beschwörungsformeln sind auch sonst, besonders in den großen arabischen Wörterbüchern, 2 ) angeführt. V o r allem das Lisän al 'Arab enthält manchen hierhergehörigen Spruch. Hier wird fast an allen Stellen al - Lihjäni 3 ) als Gewährsmann für diese Dinge genannt. 4 ) Man möchte daher zunächst vermuten, daß dieses Autors Sprüchwörtersammlung Jlixif! J J Ü I , die unser Hamza für sein gleichnamiges W e r k benutzt hat, 5 ) in einem A n h a n g ebenfalls die fyuräfät und faarazät behandelt habe. Dem kann aber nicht so sein; denn Hamza macht in der Einleitung seines W e r k e s nähere A n g a b e n über den U m f a n g verschiedener Bücher, die er benutzt habe, und sagt dabei, al-Lihjäni's Schrift habe ungefähr 10 Seiten umfaßt. 6 ) Sie kann also schon aus diesem Grund nicht einen A n h a n g gehabt haben, der fast ebenso groß ist. So wird man annehmen müssen, daß al-Lihjäni diese Dinge in einem anderen W e r k , vielleicht in seinem Kitäb an-nawädir,7) behandelt hat, und daß Hamza auch dieses andere W e r k Lihjänl's unmittelbar oder mittelbar benutzt hat. 1) H H V , 392 ist statt
— vielmehr y y f ^ Ä
zu lesen.
2) V g l . unten die Anmerkungen zum arabischen T e x t . 3) Schüler des K i s ä ' l vgl. Fihrist
und Lehrer des A b u ' U b a i d al-Qäsim b. Salläm;
S. 1®A und FLÜGEL, Grammatische
4) V g l . besonders Lisän
Schulen
S. 53.
I, 266, 14. V I I , 384, 9 v . u . X V I I I , 273, 2.
5) V g l . L T H I S . 18. 6) S. L T H I S. 34 und 52. —
Hamza
hat eine besondere Vorliebe da-
für, seiner Vorgänger und seine W e r k e nach Inhalt und U m f a n g zahlenmässig zu bestimmen. 7) V g l . Fihrist
a. a. O .
Altarabische Amulette und Beschwörungen.
273
Ich gebe nun den T e x t nach der einzigen erhaltenen Handschrift. Einige Stellen, die korrumpiert sind, lassen sich nach den Wörterbüchern leicht verbessern. Bei einigen anderen zweifelhaften Stellen wird es wohl auch noch möglich sein, sie in sonstigen Werken zu belegen und so den T e x t zu heilen.
I " I
O_
eile
')
Üj
pjJ
5)
o
¿e> ¥ — Das in b ist fragwürdig; man erwartete »und es s a n k seine linke Seite wie die eines Demütigen nieder«. Vs. 9 lies L g i l ^ l »seine Höhen«. X X X I . Auf den Tod des ' A m r b. Murra, der von R i ab erschlagen worden, weil er dessen Kamelin ins Euter getroffen und getötet hatte. Die Versordnung ist falsch.
Das erhellt schon daraus,
daß Vs. 1 mit iui und seinem sonstigen Inhalt auf dasjenige zurückweist, was erst später folgt.
A n den A n f a n g gehört
Vs. 7, in welchem 0 J L 0 statt o d - o zu lesen ist; denn der Angeredete, nicht der Dichter hat getötet. Als sinngemäße Ordnung ist herzustellen: 7. »Du hast einen Mann getötet, der nicht im Bunde mit der Treulosigkeit und Bosheit stand; mögest Du tief erniedrigt werden. 2. Du hast herbeigeführt, was die (Kamelin) Basüs über ihre Leute brachte, zwei Tausend Zügel (feindliche Reiter) vor zwei Tausend Kämpfern (feindlichen Fußgängern)«; 0J Ü^ V 9 (statt
jj' lies
auch
würde genügen).
Hier folgt etwa Vs. 5 in der Lesung
das noch
von j in Vs. 2 regiert ist: 5. (Du hast herbeigeführt) »Speere (der Feinde) von den hattitischen mit bläulichen Spitzen, die oben scharf, unten stark sind.« Dann folgen Vs. 1. 3. 4. 6. 8; dann: 9. »Sie (meine Stammesgenossen) haben Hudeil ernie-
Zur Kritik des Diwans der Hudeiliten.
drigt
durch
den
Sohn
der
Lubna
(dessen
285 Tod
sie
nicht
rächen), u n d h a b e n ihre N a s e n v e r s t ü m m e l t (sich selbst g e schändet) d u r c h d e n B e r e d t e n u n d G r o ß e n . «
Lies
^¿jiJb
*c
w e g e n des p a r a l l e l e n
auf
a.
g e h t auf d e n Ü b e r f a l l d e s L i h j ä n i t e n ^JJ CXJ^
XXXIV
tötete.
^J^LJ in
Abu
Gundab, wobei
Darauf
schlug
Abü
er dessen z w e i
Gundab
den
Schutzgäste
Zeid
und
seine
L e u t e b e i a l - ' A r g , w o b e i Z e i d floh. V s . 1 ist v o m S c h o l . falsch e r k l ä r t , i n d e m &
jekt
e s als S u b -
-
v o n ys>- d e n
Zuheir
ansieht.
Vielmehr
?. 0 9 u n d 2 e i n e n S a t z , dessen S u b j e k t XJ^A ich d o c h , o b seine L e u t e
bilden
Vs. 1
in 2 ist: (1) » W ü ß t e
d e n Zuheir tadeln w e r d e n
wegen
dessen, w a s v o n allen S e i t e n ü b e r sie g e b r a c h t hat (2) d u r c h Zuheir's H ä n d e
die z u ihnen g e h ö r i g e S c h a a r v o n
al-'Arg,
u n d w e g e n d e r G e f a n g e n e n (von ihnen), die an die b e i d e n s t a r k e n S t ä m m e L a h m u n d G ä l i b v e r k a u f t w o r d e n sind.« XXXVIII.
6. L i e s
das S c h l i m m e v o n m i r . « XXXIX. Kumeir
1.
Statt
^JÜ!
»die
Leute
wollen
nur
S. S c h o l . iftXißf
lies
^tXs&f
»ich
führe
die
usw.«
X L I . In d e r p r o s a i s c h e n E i n l e i t u n g Z. 7 lies ; —
Z. 11
statt
natürlich
V s . 2 lies 10. L i e s ¿ti'Lftj. XLV.
V s . 4. L i e s f^J^o
XLVI. fangene
der
bekommen.
Ma'kil Lihjän
»werdet Ihr treffen«.
b. H u w e i l i d in
den
hat
Händen
durch Fürsprache der
B.
G l e i c h w o h l w o l l e n j e n e ihn töten.
E i n l e i t u n g Z. 9 lies x f L i s » ^-O s c h i e d e n sind.)
IJuna'a
Gefrei-
(In d e r pros.
¿Loy» ^JJO, d a B e i d e v e r -
286
J . Barth, Zur Kritik des Diwans der Hudeiliten.
Vs. 2 ist unverständlich, wenn nicht Vs. 3 vor ihn gesetzt wird; denn in - ¿ I j J Vs. 2 wird das feminine Subjekt vorausgesetzt, das in VS. 3 vorliegt: 3. »Ich habe die B. Sahm (meinen Stamm1)) gerufen, und ihre Führer säumten nicht, ihre Brust über Dich zu werfen (Dich zu schützen), 2, indem sie Gegner zurückdrängten, die gegen Euch zornig waren, gegen die Ihr schlimmes Verderben angerichtet hattet«. — Lies jv-gJ für Lgj. Vs. 6 übersetze: »Wenn sie (die Gegner) schwören (Gefangene nicht freizuguben), so schwöre ich, ich werde nicht2) von ihnen, noch von den beiden (Gefangenen, s. pros. Einleitung) abstehen, bis wir (deren) Fesseln lösen.« X L V I I . Vs. 1. Für ( J j lies fa> | J j »wir wünschen es aber nicht, (ihrem Rat zu folgen)«. LV. Vs. 1. Da es sich um ein Vergehen gegen den Gatten handelt, ist J-LX-IÄ. statt «¿LIXXÄ. ZU lesen; für das folgende J d a s
keinen Sinn gibt, lies
»Hast Du
nicht Deinen Mann gefürchtet oder lässcst Deinen Vater 3 ) f r e i (in Ruhe), auf ihn weiter einzusprechen?« G ^
.
9
•
T
o -
9
Vs. 2 lies OJOCXÄ, oder ^jey^- usw. »Es verschafft mir Genugtuung, daß ihre Hände a b g e s c h n i t t e n sind;4) sie sind nicht abgeschnitten worden, indem sie gefärbt sind (sondern vom Blut gerötet?)«. 1) S. pros. Einleitung zu X L V I I . 2) Das ist beim Schwur, wie öfter, zu ergänzen. 3) Auch hierunter soll nach dem Schol. bei den Hudeiliten der Gatte gemeint sein. 4) Vgl. das b ß j o
» U S « in Asma'i's Bericht in der Einleitung.
287
Carmina Hudsailitarum ed. Kosegarten Nr. 5 6 und 75. Von J .
Wellhausen.
Diese beiden Lieder haben ein geschichtliches Interesse. Nr. 75 ist eine poetische Epistel des Abul l ijäl an Muäwia, am Schluß abgebrochen. Sie lautet auf deutsch folgendermaßen. »Vom Abul cijäl, dem Hudailiten — hört was ich sage und tragt meine Botschaft klar und deutlich vor! 2 Laß an Muäwia b. Cahr ein (schriftliches) Zeichen gelangen, womit der schnellste Postbote zu ihm eilt, 3 und an 'Amr ein Blatt von mir, auf dem eine kribbelnden Ameisen gleichende Schrift hervorsticht, 4 und an Ibn Sa'd — den nenne ich zuletzt, weil er uns beiden Unbill erwiesen und geringschätzig behandelt hat 5 bei der Teilung der Beute: seitdem ehre ich ihn nicht mehr, da ich gesehen habe, wie er handelt — 6 und an die weisen Leute, wo immer du sie triffst, die guten Alten und Korankenner. 7
Wir haben, nachdem ihr abgezogen wäret, in unserem Lager bei den Wiesen (Amräg) einen Tag erlebt, nach welchem gefragt werden wird, 8 eine herzbeklemmende Gefahr, deren Abwehr viel Blut kostete, der aber nicht auszuweichen war. 9 Auf jedem Kampfplatz (die Schlacht besteht aus vielen einzelnen Szenen) sah man von uns einen Mann stürzen, dessen Blut spritzte wie das Wasser aus der Öffnung eines Schlauches, 10 oder einen greisen Saijid, dessen Gehirn ausfloß, oder einen, der auf das Vorderende einer Lanze gebeugt (Blut) hustete. 1 1 Als nämlich der Ragab und die beiden Gumäde vorbei waren und ein
288
J . Wcllhausen
neuer Monat eintrat, der Scha'bän, 12 da bestimmten wir nach dem Aufbruch der Feinde neun Tage, ganz und voll gerechnet, 13 und es ergab sich ein K a m p f , wo man Blut molk, und Melker des Kampfes waren verzweifelte heldenhafte Männer. 14 Und die Feinde rückten vor bis an das Ende des Blachfeldes, manchmal haltend und manchmal aufbrechend; dann hüben sie sich von dannen. 15 Die Pfeile schwirrten hartnäckig um uns herum, ihre Spitzen sahen aus wie Ähren; 16 die Lanzen von hüben und drüben glichen Brunnenseilen, die wir und sie (in das Wasser = in das Blut) hinabließen.« Bei dieser A f f ä r e ist der Dichter selbst beteiligt gewesen; er gibt zwar keineswegs ein genügendes Bild von ihr, schildert sie aber doch nicht so ganz aus freier Hand mit bombastischen Phrasen, wie den Kampf vor Konstantinopel in Nr. 74, wo er, wie es scheint, nicht dabei war. Die Situation erhellt aus der kurzen historischen Einleitung nicht, sie muß aus dem Liede selbst erkannt werden und das gelingt auch einigermaßen. Bei einem Feldzug im südöstlichen Kleinasien, zur Zeit Muäwia's, sind nach dem Abzug des arabischen Hauptheeres einige Truppen zurückgeblieben (7) und von den Romäern eingeschlossen. Nach mehreren Monaten (11) beschließen sie heimzukehren, da die Feinde abgezogen zu sein scheinen (12). Sie sind jedoch nicht wirklich abgezogen, und die Heimkehr gestaltet sich zu einem gefährlichen Durchbruch (13—16). Als Ort werden »die Wiesen« angegeben; daraus kann man leider nichts ersehen. Besser läßt sich die Zeit bestimmen. Die des Chalifen 'Utmän ist ausgeschlossen, wenn auch schon damals Muäwia in Syrien regierte. Nach der Ermordung 'Utmän's (18 Dulhigga 35 = 17. Juni 656) ließ Muäwia die Waffen gegen die Romäer notgedrungen ruhen, bis er seinen Gegner c Ali losgeworden war und die Herrschaft über das gesamte arabische Reich gewonnen hatte (41 A H . = Sommer 661 AD.). Bald nachher nahm er die Expeditionen gegen Kleinasien wieder auf. Tabari setzt die erste in den
Carolina Hudsailitaram ed. Kosegarten Nr. 56 und 75.
289
Sommer 662 (42 AH.), Theophanes in den Sommer 663 (6154 AM.). Ein positiver Anhalt ergibt sich aus der Zusammenstellung der Namen Mu'äwia, c Amr und Ibn Sacd. 'Amr ist ohne Zweifel der ägyptische Emir 'Amr b. al 'AQ. E r starb nach Tab. 2, 27 am Tage des Fastenbruchs 43 A H . = 6. Januar 664. Damit haben wir den terminus ad quem. In Ibn Sa'd hat NÖLDEKE vor langen Jahren den A n parier Qais b. Sa'd b. 'Ubäda sehen wollen, den tüchtigsten Helfer c Ali's, der auch nach dessen Tod den Kampf gegen Mu'äwia fortsetzte, so lange es noch möglich war. Der gehört aber durchaus nicht in diese Gesellschaft. Viel näher liegt es an 'Abdallah b. S a ' d b. Abilsarh zu denken, der mit Mu'äwia und ' A m r der Hauptvertreter der Partei 'Utmän's war, wenigstens außerhalb Arabiens und des 'Iräq. NÖLDEKE hat ihn vielleicht deshalb außer Betracht gelassen, weil er nach seiner Vertreibung aus Ägypten sich nach Palästina zurückzog und dort unseren Blicken entschwindet. Wann er starb, sagt die alte Tradition nicht. Bei der Schlacht von Qiffin (37 A H . = Ende Juli 657) befand er sich noch unter den vornehmsten Genossen Mu'äwia's. Da wird er zufällig und beiläufig von Abu Mihnaf (Tab. 1, 3329) erwähnt, hinterher nicht mehr. Damit ist indessen nicht ausgeschlossen, daß er noch bis in das Chalifat Mu'äwia's hinein gelebt hat; und man hat nach Abul 'ijäl allen Grund dies anzunehmen, da eben kein anderer als Ibn Sa'd in das von jenem aufgeführte Kleeblatt hineinpaßt. E s ist bemerkenswert, daß diese drei Männer neben einander wie eine Art Triumvire erscheinen, wenngleich Mu'äwia als TIQOJXOOV(ißovkog obenan steht. Abul 'ijäl mag den Ibn Sa'd nicht leiden, weil er glaubt von ihm als Beuteteiler irgend einmal ungerecht behandelt zu sein. E r spricht aber auch von Mu äwia und 'Amr nicht mit besonderem Respekt. E r richtet seine Botschaft nicht bloß an die Regenten, sondern zugleich an die weisen Männer, die guten Alten und Korankenner, die sich nicht in der Umgebung des Chalifen befinden, sondern »wo man sie trifft.« Zeitschr. f. Assyriologie, X X V I .
19
2 go
J.
Wellhausen
Weit größere Schwierigkeiten für die Datierung bietet das aus älterer Zeit stammende Lied Nr. 56, welches dem Ma'qil b. Huwailid zugeschrieben wird. E s geht eine Einleitung voraus, die ich mitübersetze. »Abu Jaksüm, der König der Habasa, zog mit dem Elefanten aus, er und seine Mannen, in feindlicher Absicht gegen die Ka'ba. Und von jedem Stamm der Araber, den sie passierten, nahmen sie einige Leute mit, Als sie aber nach al Mugammas, an der Grenze des heiligen Gebietes von Mekka, kamen, hemmte Gott den Elefanten und sendete Vögel in Schwärmen (Sura 105, 3) gegen sie. Da flohen viele von den Königen von Jaman, von Kinda und Himjar und Habas, in die Berge der Hudail und wurden dort getötet oder gefangen. Abu Jaksüm aber kehrte durch das Gebiet der Kinäna nach Jaman zurück, und von jedem Stamm, den er passierte, nahm er zur Sicherheit Geiseln mit. A l s er nun heimgekehrt war, hielten sich die Kinäna an die Hudail und sagten: zieht mit euren Gefangenen von Kinda und Himjar und Habas aus (zu Abu Jaksüm, um dagegen unsere Geiseln einzutauschen). Die Hudail taten das auch; Maqil b. Huwailid von Sahm und Gäfil b. Qahr von Quraim brachten die Gefangenen zu Abu Jaksüm und lösten damit die Geiseln der Kinäna, die jener auf dem Hinwege 1 ) aus dem Nagd fortgeschleppt hatte. — Ibn Haija aber, ein Vetter Ma'qil's, wollte einen Gefangenen, den er in seiner Gewalt hatte, nicht an Ma'qil übergeben, weil es ein vornehmer Mann war, für den er reiches Lösegeld einzunehmen hoffte; und er drohte deswegen dem Ma'qil mit dem Schwert. — Und Macqil sprach: »Wenn du (o Geliebte!) unser erst jüngst geknüpftes Band zerrissen hast und umgestimmt bist von Verläumdern 2 und von dem Gerede der Feinde — welcher Mann hätte keine Tadler! 3 so habe ich doch manche schreckliche Winternacht, in der rieselndes Naß sich herabsenkte, 4 durchritten 1) V o r h e r Rückweg.
ist es einmal auf
dem H i n w e g
geschehen,
einmal
auf
dem
Carmina Hudsailitarum ed. Kosegarten Nr. 56 und 75.
291
bis zum Morgen, mit zerzauston Gesellen, die der Windsbraut glichen, 5 die wie ein Gießbach dahinschossen, den die schmutzige tosende (Flut) angeschwellt hat. 6 Und von schwarzen kraushaarigen Männern, vor deren gleichen einem graut, 1 deren gleichmäßiger Marsch das Haar bleicht, die alle Speerwerfer und Pfeilschützen zugleich sind, 8 habe ich eure Söhne heimgebracht, ohne daß einer von euch mich begleitete. 9 Meine hochtragenden Kamele werden heimgetrieben (und geschlachtet) für euren Gast und für den Schützling, wenngleich das Weidevieh reiche Nahrung hat (und die Not nicht zum Schlachten zwingt). 10 Derart habe ich mich für euch angestrengt; alle Menschen haben ja einen Versorger (und ich bin der eurige). 11
Bestell dem Kulail und seinen Brüdern — denn ich bin (gegen sie) aufgebracht: 12 Ibn Haija schäme sich, daß er zu mir kam, mich zu töten; es ist zum Erstaunen. I J Wenn einer den Dank, den zu entrichten er aufgefordert wird, darbringt, indem er das schneidige Schwert erhebt, so ist das der schlechteste Dank. 14 E s ist, wie wenn man von einem Knecht Gewinn erhofft, er aber darauf erpicht ist, den Gewinn zu vereiteln. 15 Und ich (sage), wie der Diktierer eines Buchs auf Pergament gesagt hat, während der Schreiber es aufzeichnete: 16 der Zeuge, der dabei war und ruhig Blut hatte, sieht von der Sache, was der Abwesende nicht sieht. 17 Bei deinem Leben, der Verzicht, der nicht länger hinhält, ist besser als das vorspiegelnde Verlangen, 18 und das Zaudern, das du beschwingst mit Erfolg, ist besser als die erfolglose Eile.« Die Weisheitssprüche am Schluß, die auf eine schriftliche Quelle zurückgeführt werden, sind lose angefügt, finden sich aber auch in den Tabaqat des Ibn Qutaiba 418. 419 an derselben Stelle, Die Verse 11 — 1 4 werden im A nhang der historischen Einleitung in eine Verbindung mit dem Vorhergehenden gebracht, die wenig einleuchtet und ad hoc erfunden zu sein scheint. In Wahrheit bezieht sich die Ein19*
zqz
J . Wellhausen
leitung nur auf Vers 6—8, wo von dem Zuge des Abu Jaksüm die Rede sein soll. Abu Jaksüm, der Vater des Jaksüm, der ihm nachfolgte, hieß eigentlich Abraha und war abessinischer Vizekönig von Jaman. Nach der Inschrift von Hicja Guräb fiel der letzte himjarische König Du Nuwäs A D . 525. Sein Nachfolger unter abessinischer Oberhoheit wurde zunächst ein einheimischer Fürst, Esimiphanus. A n dessen Stelle trat dann 531 der Abessinier Abraha: Auf der von Glaser entdeckten Inschrift von Marib (AD. 542 und 543), die von einem Bündnis zwischen Kaiser Justinian und den Abessiniern berichtet, figuriert Abraha als Vizekönig von Jaman. Nach Prokop I, 20, 13 hat eben er den Zug gegen die Perser, den die Abessinier dem Kaiser versprochen hatten, unternommen; es wird nicht lange nach 543 geschehen sein. Dieser Zug ist es, der nach arabischer Erinnerung bei Mekka gescheitert ist, durch den Ausbruch der Pocken im abessinischen Heer. In der Einleitung zu unserem Gedicht wird ein Nachspiel hinzugefügt, um Vers 6—8 zu erklären und den Anlaß anzugeben, weshalb eine Gesandschaft der Hudail an Abraha abging, nachdem er wieder zu Hause angelangt war. Die Hudail hatten gefangene Abessinier in Händen und wechselten dafür die Geiseln aus, die Abraha mit nach Jaman geschleppt hatte. Der Abgesandte der Hudail an Abraha soll Ma'qil b. Huwailid gewesen sein, dem das Lied Nr. 56 zugeschrieben wird. E r war seinerzeit der angesehenste Mann seines Volkes, das Haupt des mächtigen Geschlechtes Hunaa; er rühmt sich überall in seinen Gedichten, wie aufopfernd und wacker er seine Pflichten als Saijid erfüllt habe. Aber er lebte erst später und war gleichalterig mit Muhammed. Nach Nr. 54 war er ein Zeitgenosse des Abu Hiras, der in interessanten Liedern über die Zerstörung des Heiligtums der Göttin c Uzza in Nahla (nach dem Falle Mekka's A H . 8) klagt und über die Entleerung des alten Arabiens, infolge der Eroberungszüge des Islams unter dem Chalifen 'Umar 1 ) 1) Vgl. Jaqüt 3, 665. 666, Agäni
2 1 , 57. 58 und Tbn Hisäm 866.
Tu
Carmina Hudsailitarum ed. Kosegarten Nr. 56 und 75.
-93
Nach Nr. 61 hatte er einen Zusammenstoß mit Hälid b. Zuhair, und dieser war nach Agäni 6, 62. 63 ein Bekannter des berühmten A b u Duaib, der auf einem afrikanischen Feldz u g unter dem Chalifen 'Utmän umkam. Ma'qil b. Huwailid kann also nicht schon um die Mitte des sechsten Jahrhunderts in hervorragender Stellung gewesen sein. Nach einer anderen A n g a b e (Nr. 147 und Ibn Qutaiba 418. 419) soll nun auch nicht er, sondern sein Vater Huwailid oder dessen älterer Bruder Hälid zu A b u Jaksüm gegangen sein. Indessen das sieht ein wenig nach Korrektur aus; das Floruit dieser Männer kann auch nicht bis ± 550 hinaufgerückt werden, wenngleich sie damals wohl schon gelebt haben mögen. Überhaupt gehören, soweit man sehen kann, diejenigen hudailischen Dichter, die noch im arabischen Heidentum wurzeln, doch erst der letzten Generation vor dem Islam an und überschreiten großenteils die Grenze der Higra. A u s den Beziehungen, die sich zwischen ihnen konstatieren lassen, erhellt, daß sie so ziemlich alle der gleichen Periode angehören. Außer viel ältere falls dem schrieben.
Nr. 56 soll freilich auch Nr. 57 ( = 147) in eine Zeit hinaufreichen. Dies Fragment wird gleichMa'qil oder seinem Vatersbruder Hälid zugeE s lautet:
»Ist es doch wirklich im Lauf der Zeit dahin gekommen, daß ich nun im Verließ des Martad sitze und dort einheiraten soll, in eine Sippe, die ihre Weiber nicht beschneidet und das Essen von Heuschrecken nicht für ekelhaft hält! Ich habe ihnen aber gesagt: es sind Leute in den Gegend von Nahla und da herum, bei denen meine Wohnstatt und meine Heimat ist.« Das Scholion gibt dazu die gleiche Gelegenheit an, wie der Leidener Handschrift, die nur die zweite Hälfte der Sammlung des Sukkari enthält, stehen die Lieder des A b u Hiräs nicht, wohl aber in der von JOSEPH HELL ZU Kähira Sammlung.
entdeckten
Abschrift einer nicht
von
Sukkari
redigierten
2g4
J. Wellhausen, Carmina Hudsailitarum ed. Kosegarten Nr. 56 und 75.
zu Nr. 56: A b u Jaksüm hatte dem Macqil (als er zu ihm kam, um die Geiseln zu lösen) angeboten, er solle bei ihm bleiben, er wolle ihn verheiraten. In den Versen selbst ist jedoch nicht von A b u Jaksüm die Rede, sondern von Martad. Das ist ein Famienname; die Martad waren ein stolzes einheimisches Burggrafengeschlecht in Jaman. U n d einen Martad kann Ma c qil noch recht wohl in seiner Zeit besucht haben, ebenso wie in weit früherer Zeit und unter anderen Umständen der irrende K ö n i g Maralqais bei einem Martad einkehrte. Mit 56, 6—8 steht es aber anders. Hier sind mit den schwarzen, kraushaarigen Männern, von denen die Söhne der Angeredeten 1 ) heimgeholt werden, jedenfalls die Abessinier gemeint, die zur Zeit Ma'qil's längst aus Jaman vertrieben waren. Man kann nun nicht annehmen, daß der Dichter, sowie es etwa in 80, 6 und 242, 56 geschieht, im Ich seines Geschlechts und seiner Vorfahren rede. Denn sonst redet er im eigenen Ich und streicht der treulosen Geliebten gegenüber seine Person heraus; man hat auch durchaus den Eindruck, als habe er das Heer der Abessinier in seiner eigentümlichen Ausrüstung und in seiner geschlossenen A r t zu marschieren selber gesehen. Dann scheint nur übrig zu bleiben, daß in dem Lied Nr. 56 oder wenigstens in dem Vers 6—8 ein Rest viel älterer Poesie erhalten ist, als wie sie sonst im Divan der Hudail vorkommt. Daß die arabische Kunstpoesie überhaupt bis in den A n f a n g des sechsten christlichen Jahrhunderts zurückgeht, läßt sich nicht bezweifeln. 1) »eure Söhne«.
Können
das die Söhne der Kinäna sein?
sich sonst keine Spur, daß die Anrede an die K i n ä n a gerichtet ist.
Es
findet
2
95
Contribution à l'étude du Dîwân d'Aous ben Hadjar. Par René
Basset.
En 1892, M. R . G E Y E R publiait une édition des fragments du Dîwân d'Aous ben Hadjar, (1) non d'après un manuscrit de cet ouvrage, mais d'après les poèmes et les vers isolés qu'il avait recueillis. Il avait été devancé par le P. CHEIKHO (2), mais le texte qu'il donnait était beaucoup plus complet. Il ne pouvait l'être entièrement, malgré tout soin qu'il y avait apporté et j'ai pu, à mon tour, recueillir quelques débris — disjecti membra poetae et les ajouter à ceux qu'il a donnés ou qui ont été réunis par les critiques qui se sont occupés de son édition. Celle-ci a donné lieu aux articles suivants: BARTH, ap. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. T. XLVII, 1 8 9 3 , p. 3 2 3 — 3 3 2 . ROSEN, Zapiski vostotehnago otdieleniya imperatorskago russkago archeologitcheskago obchtchesva. T. VII, p. 376 -385. A. FISCHER, ap. Gottingische Gelehrte Anzeigen, 1895. T. I, P- 37 1 395id. ap. Zeitschr. d. D. Morg. Ges. T. X L I X , 1895, p. 85 — 144.
id. Noch einmal Aus ben Hajar. Zeitschr. d. D Morg. Ges., 1 8 9 5 , p. 6 7 3 . id. ap. Zeitschr. d. D. Morg. Ges. T. LXI, 1910, p. 154—160. F R A E N K E L , ap. Zeitschr. d. D. Morg. Ges. T. X L I X , 1 8 9 5 , p. 297. 1 ) 1) Gedichte
und
Fragmente
des Aus
Ibn Hajar,
Vienne, 1882, in 8°.
296
R . Basset
Voici les auteurs que j'ai dépouillés: (Ach.) Ibn c Achôur, Chifà
el Qalb el Dj arîlj. (commentaire
de la Bordah). L e Qaire, 1296, in 8°. (Am.) E l Amidi, El Moitàzanah. Constantinople, 1288, in 40. (Bal.) E l Balaoni, Kitàb Alîf Bà. L e Qaire, 1287, 2 v. in 40. (Bay.) E l Djâhizh, El Bay an wàt tabayyin. L e Qaire, 1313, 2 v. in 4°. (Cher.) Ech Cherichi, Commentaire des Séances de Hariri. Boulaq, 1300 hég., 2 v. in 40. (Hich.) Ibn Hichâm, Commentaire de la Maqsourah d'Ibn Dor aid. Ms. de la Bibl; Nat. d'Alger, n° 1831. (Kh.) Eth Tha'âlibi, Khà$ el Khàss. L e Qaire, 1326 hég. in 8°. (Lis.) Ibn Manzhoûr, Lisàn el cArab. Boulaq, 1299, 2 v. T. I —II, X V — X X . 1 ) (Maw.) E l Mawardi, Adab ed donya. L e Qaire, 1315, in 8°. (Mei.) E l Meidânî, Madjma el Amthàl. Boulaq, 1284, 2 v. in 4°. (Mof.) E l Mofadhdhal, Amthàl elcArab. Constantinople, 1300, in 8°. (Mor.) Ibn al Athîr, Kitàb el Morassd éd. SEYBOLD. Weimar, 1 8 9 6 , in 8 ° . (Nob.) Ibn Nobatah, Sark el ' Oyoun (commentaire de l'épître d'Ibn Zaidoun). Boulaq, 1278, in 40. ('Ok.) E l c Okbari, Charlj. et tibyàn (commentaire de Motanabbi). L e Qaire, 1308, 2 v. (Om.) c Omar en Namari, Bahdjat el Madjâlis, ms. de la Bibl. Nat. d'Alger, n° 1868. (Q.) Ibn el Qoutyya, Kitàb el Afàl, éd. GUIDI. Leiden, 1894. (Saf.) E s Safadi, Commentaire de la Lamyyat elcAdjam. Le Qaire, 1290, 2 v. in 40. (Sik.) Ibn es Sikkît, Tahdzîb el Alfàzh. Beyrout, 1 8 9 6 — 9 8 . (Sin.) El 'Askari, Kitàb es Sinâatain. L e Qaire, 1320, in 40. 1) Les tomes I I I — X I V ont été dépouillés par M. GEYER.
Contribution à l'ctude du Dîwân d'Aous bcn Hadjar.
297
(T.) El Djâhizh, Risâlah f i manâqib et Tork (ap. VAN VLOTEN, Tria opuscula). Leiden, 1903, in 8°. (W.) Ibn Wallâd, Kitàb al Maksûr wal Mamdüd éd. BRÔNNLE. Leiden, 1900. (Z.) Ez Zaouzanî, Commentaire des Moallaqàt. Alexandrie, 1292, in 8°. (Zam.) Zamakhchari, Commentaire de la Lamyyat el ''Arab. Constantinople, 1300, in 40. I v. i cité par Lis. II, 80 avec la var. (¿jot pour Sin. p. 245 cite le vers 12 précédé de celui-ci jsXJJI
IÁ*¿J_>J
LyJ!
¡j^^
^-jf. pS'jiX&Ls
qu'il cite encore isolé p. 327. On peut y ajoindre ce vers cité par Sin. 259 f J U I ^ à a ItLáJI LxiI^
^¿j'ii «yl^^i^JI L«Li Jjjst.
II v. 9 cité par Lis. I, 67. III v. 2 cité par Lis. II, 198; X X , 173. — v. 3, Lis. II, 196. 198; X V , 1 1 7 ; X X , 193. — v. 6 Lis. II, 266 avec la var.
IV v. 4 cité par Lis. X V I I I , 17, 5; Sin. 54. — v. 5 Sin. 54 avec cette var. au i r hém. xxj&XM/JO L e vers 14 cité par Lis. X V I I I , 176; le vers 19 par Sin. 297 avec la var. suiv. ím*'¿ Lo j.iüvjo U l e b & ^ L v » UL&.
29 8
R.
Basset
VII Les vers 3 et 4 cités par Sik. 325 avec les var. ^mc^o tXij et ^LaÌ.1^. X Les vers 2 et 3 cités par Sik. 638 avec la var. au 2e hém. du vers 2
et au vers 3
— L e vers 5 cité par Lis. X V I I I , 121.
L e vers 8 par Sik. 343; 'Ok. II, 47; tous deux ont la leçon de GEYER
XJK-IJ.
C f . FISCHER, Z D M G
1895, p. 9 1 .
XI L e vers 4 cité par Us. X V I I , 388. XII L e vers 3 cité par Sin. 255. L e même (p. 254) donne comme faisant partie de cette pièce y ^Ajit LjsS? ¿.C
twL^
if J
O^Xi tXî
et aussi ^
^¿À'j
(jjjitaLl ^.-¿.i»
Ljw ^ j L i j
•phjZ.
je.
puis le vers 3 avec la var. «noi pour o i l et il cite en note cette variante •UUli
¿
byb
ensuite dans la pièce, ce vers Ij^cXj (J ^ J S ^ i ^ l i
^ ¿ i f iJJO ¿jJóJI ^j-gJ vy-il
L e vers 14 dans Lis. X V I I , 324; le vers 16 dans Sin. p. 197 avec la var. et LgXó^i
¿Lo.
Il cite en note les var. Ly^r* et
et LgjLò^x (cf. FISCHER, G'ôtt. Gel.
Contribution à l'étude du Dîwân d'Aous lien Hadjar.
-99
Anz. 1895, 385, ZDMG 1895, 93). Le vers 17 dans Sin. 329 avec la var. au 2 e hém. jyt.(\jo
silkciajiJlî
Le vers 29 dans T. p. 49 cf.
ZDMG 1895, p. 94
FISCHER,
(au lieu de Hamâsa I, (Ie, 5 v. u. lire I, 11e, 25 v. u.). — Le vers 36 dans Saf. II, 259; le vers 35 dans Lis. I, 72; le vers 37 dans Sin. 222 avec la var.
c>«JtX^.f. XIV
Le vers 3 cité par Q. 68 — le vers 7 par Sin. 195, avec les variantes
JV^JÎXJ
XV Le vers 4 dans lis. X V I I , 32. XVII Le vers 1 cité par Ok. I, 239 avec la var. «Jjil xAJt — le vers 6 par Zamakhchari, Asâs el balàghah I, 329 (oublié par et
GEYER)
—
le vers 7 par W . 104 avec les var. ^¡>1
— le vers 8 par Nob. 66 — le vers 11 par Bal.
I, 279 — le vers 15 par Lis. I, 297 avec la var. XX Le vers 1 cité par Kh. 76, Sin. 346. — Le vers 3 par Kh. 76; Am. 143 avec la var. c Ok.
Sik. 167; Lis. I, 314;
I, 175. 217; II, 318; Mei. I, 29; Bay. II, 179. — Le vers 5
par Sik. 29; Mei. II, 264 avec la var. vers 12 par Lis. I, 225; Sin. 121. XXI Le vers 3 dans Nob. 66 avec la var.
tXole
— Le
3
0 0
R.
Basset
XXIII Le vers 5 dans Lis. X V I I I , 93. — L c vers 6 dans Lis. X V I I , 456. — Lo vers 19 dans Sin. 320, — L e vers 20 dans Sin. 320. —
L e vers 26 dans Lis. X I X , 337. —
L e vers 27
est ainsi donné dans Lis. X X , 255 i_àjl^îaJ! L$À>o jÀi^U IjCtX&e
^js-li- sioj
US' o^isLsî
et X X , 299 avec cette var. »—¿jtjJaJt
I gt
' ^sCj
iSjj
oJas» l+S' c^-brs?
L c vers 30 dans Lis. X V I I , 18. — Le vers 37 dans Bay. II, 50; Ach. 60. —
L e vers 42 dans Lis. I, 332 avec la var.
— Le vers 56 par Sik. 682 avec la var. au 2 e hém. J o l j £¿+¿¿1 v-àJ.~»
LgJ (à ajouter à la remarque de
FISCHER, G'àlt. Gel. Anz.
1895, 583). —
Le vers 57 est ainsi
donné par Sik. 525 OLWLUOJ sy^ ^ye i_)Jo
sva^JI »Ljisa. O^^IJ
et dans Lis. X X , 205 avec la var.
^-Lib.
XXIV L e vers 1 dans Lis. X X , 191. — X V I I , 12 2 ; Sik. 31 avec la var. i-jU-w XXVI L c vers 1 dans Sin. 243.
XXVIII L e vers 1 dans Z. 74.
L e vers 2 dans Lis. UO-XAJC.
30I
Contribution à l'étude du Dîwân d'Aous ben Hadjar.
XXIX Le vers 18 dans Lis. X I X , 37. — Le vers 21 dans Lis. X X , 283. — Le vers 22 dans Lis. X V I I I . 245. On peut rattacher à cette pièce les suivants Mor. 98 Jki^j SjJ^ÀJI jò
J^
Isolai ^ ^ b ijMjà
et W 45 *
-
1
JlX^VJ! iLiiLl
LS
-
*
L g J j i—à^i! ^
Lw..=» ^
r
U-U
XXX Le vers 6 dans Maw. 226 avec la var. c^Ài bi. XXXI Le vers 1 dans Sin. 54 avec la var. s^X» — Le vers 5 dans Maw. 143. — Le vers 7 dans Sin. 218. — Le vers 14 dans Lis. X I X , 185. — Le vers 17 dans Zamakhchari, Asâs el balâghah I, 34 (oublié par GEYER). — Le vers 18 dans Lis. X I X , 198. — Le vers 20 dans Lis. XVII, 217. — Le vers 24 dans Lis. II, 241. — Le vers 26 dans Lis. I, 209. — Le vers 38 dans Lis. X X , 204. — Le vers 44 dans Maw. 143. — Le vers 45 dans Hich. f. 46; Maw. 143. — Le vers 46 dans Sin. 26; Maw. 143; Cher. I, 378. XXXII Le vers 11 est cité par Lis. II, 395. — Le vers 13 par Lis. I, 402. XXXIII Les vers 2 et 3 dans 'Ok. I, 83 avec la var. au v. 3. — Le vers 5 dans Lis. X X , 19. XXXV Le vers 2 dans Lis. X V I I I , 210. — Le vers 4 dans El Askari, Kitàb el Koramâ 21 avec la var. I .g * g 't
302
R.
Basset
XXXVI L e vers 4 dans Sin. 41. XXXVIII L e vers 3 dans Sik. 541 et dans Mei. I, 387 avec la var.
^oU.
var.
—
L e 2e hém. dans Mor. 78 avec
la
; Lis. X X , 320 avec la var. ^ ^ i o ^ÀjLsXXXIX Cette pièce est donnée plus complète par Bay. II, 53—54
U.II3I jVg-A-^ L« I¿1
LftA^à
UI
;
Lo^ifl
JJuo ïjc^LC ¡syu0
Jé)
„L^a
Lo
l+w^JI ^.JJJ! ia^/j
^JJ^IJ ty>L
J^ï
Us'
if
yi
xJUIj
IJÌLa^-
XLIII L e vers 4 dans Lis. I, 341. — Le vers 7 dans Sik. 406 avec la var. ^yy**
•••
{(aouîl).
Om. f. 2.
Il est aussi attribué à A b o u Y a ' q o u b el K h a r i m i . II R i m e e n O (basît).
à^-S
(^¿».L J L a i J I
»Kx+Jf kjLJI ^.s&lyJI
Lis. X I X , 314. 5 III R i m e en sJjLJj
ioJai» v-jlyJ!
((aouîl).
oUii
Lis. II, 140. IV
R i m e e n ^ (taouîl).
Ces vers sont du m ê m e mètre et sur la même rime que la pièce X I V , mais le sujet est différent. E l H a z n ben E l Hârith, un des Banou'l c A m î r eut pour fils Mihdjan: celui-ci fut père de Cho'aïth ben Sahm à qui on enleva des chameaux. Il alla trouver A o u s b. H a d j a r pour invoquer son aide.
Celui-ci lui UU
.(Kor. 36, 69) xj ^ÄAÄJ Loj jJUoJf sl-U-ic l^j
3-3
Zwei Gedichte des Suhcim.
Im Jahr 40 d. H. wurde Suheim w e g e n eines Liebesverhältnisses getötet.
Die näheren Umstände werden
ver-
schiedentlich berichtet.') Sein Diwan im Cod. L enthält vierzehn Gedichte verschiedenen Umfangs, deren zwei (Nr. I V und V) schon längst herausgegeben worden sind.2) In B findet sich nur die erste Qasida, die sog. ^IajJJI, die nach Sujuti 3 ) nur 58 Verse enthielt. Die hier mitgeteilten Gedichte sind beide im Versmaß Tawll abgefaßt. Der Cod. L beginnt Bl. 56 r. folgendermaßen:
Xw
^ l ^ v ä ! IS^ ^Äj < i^t o«.
J^l!
e
^LoJI
tXn^l
ij'Lö 4 )
tXi^
jvlä 1
oiaäxJ
(V^jJI cXaä
iXt^
ycliaJ ^Ls
O iCCiLiaJ ¿JJI i A i ,
1) S. hierüber die oben angeführten Quellen. 2) i V (jJ-^ l jo n
NüI.DEKE,(j^o Delecius
veterum o l ^ J ! carminum cXJtXi
Arabicorum (jl^j
51
sq.
3) A . a. O. 112. 4) L X J L O ; vgl. BROCKEI.MANN, Geschichte I, 92. al-arüs
Zur Schreibung des Namens ¿ 0 L 0 I, 590, 14.
5) L pAsP.
der arabischen
Litteratur
oder weniger gut i i j ' L ö vgl. Tag
324
K. V.
^jj
¿ÜJ.*j
Zettersteen
¿JUlc
^JJ
^J-J
¿LiLaj
2
^JI
)o
^¿j«
I. L f f b
S ;
I
J U
^ ¿ Z
I
jolx.
^
Üja+ä
O l
O
I
XXjo ¿ U ä a J I
xiLt
^ ¿ J l
0./JJI
is^*J!
UajI
^yo
LLuCil
1) L
o l k ^ j
O
^AjJI
in
B,
Bl. 230 v . :
vilJLo
V. 1 1190;
Nr. 8155
^yi
^tX^aJI
J^c.
^ J l
Ju.il
jl^J
¿ J l
Lo
tX^il
^ b j i .
2) Überschrift
T086,
b ^ Ä r i
sly
J
^¿j
joL*«
Sibawcih II, 3 3 5 ; Bänat
su äd
Asrär
al-'arabija
(ed. GuiDl)
(inkorrekt: l o ^ L c
56;
Kämil
^jt ^ I ^ " '
Sawähid
V. 2
(nach T h o r b e c k e ;
SujütT
(VA^J xiLöj
III, 6 6 5 ; SujütT, Sari
al-mugni
(ed. S f . y b o l » ) 59; 366; '
Agäni Hizana
XX,
Ibn Ja'is 3 0 1 , 3;
Jsäba
I, 129, 2 7 3 ;
V. 4 L
IT, 'Ainl
18).
—
Lo^Xcl) ' ¿j>.
o L k ^ n j ' ; L Cxlosse zu v ^ a ä J I : L ä ä j ^aÄS^ —
StXiO
^ L ^ v i l
äJ^aJ!
über der Linie: l x i l * / 0 ; B am R a n d : y H * ^ ^ ¿ J I ^iXxUI^.
u^L^vil^
die Kairiner A u s g a b e verdruckt
V . 3 B jv=>.Iäj; SujütT |VÄ.LflJ J U » y i
SujütT ^ . s t a t t
^xi
ScX.A.«ajdf
1 1 2 (enthält die V e r s e I — 5 , 8, 1 1 ,
am R a n d in L in türkischer Schrift: XÄAflJ —
^¿j
JLJI;
Iju^Äj!
Zwei Gcdichte des Suheim. l^Slo
«J
** LÜUJ
^ü J
g^
IO^J
OO^Jf
^-JJ-J ü ^ a x ^ l ^
I
Lä.e
b e ^
**
Q
^.cL
-*
^jjJ
^
v^JiXc
kJa-)^
^xitXjl.
IjjiJI
Cr -- -» O-®
^
o j ^
^ - ¿ . « j ' cJtXi»-!
3
!
cLÖAAJI
¿LkjjJ!
oL^s ^J ^ilsLc
l—AJ!^
^ > J ^•Sj'N
o p l
. ö^ L^IÄ
jTJJO LÄO^
J-Cl«¿»J^
I
£¿=¡1
Lg^ä^Aj^
x
iöj
tXiij
Ü
LASkL^ä u«.4.-wiwJI o
I
3-5
jyöIp
I
-
^
Sj-^Ä
fS
G
(^.c
.
o '
1
xi'Lj
is^+c.
l
joL^j'
V^JOj^
LlM
cjsUa-
l
Lc
-Uö
III, 665
J^i'v^J!
(auch 1 1 , 20, 19); •Agäni ^ ä Ü s ! I, 273 f.
^LotXS';
oJLs;
-Ü'
o
- o^
> i >
T "
»¿j
^¿Lül
kjlj
^xi
L
Var. zu O j ^ I !
jhl oJUs.
V. 9 B :
I, 6 1 9 , Fußnote 2.
^
^ ^^äXDI
J^A)
^oLg-J
(jJ^-'l. — V. 7 V . 8 Agäni SiVj, LüiL.
— V . 14 Sahäh Zu
^li
i ' o "
sJUf ^ i L l
—
"""M (5^?
dann folgt V . 5 und V . 8. —
Sujütl
Schriften
^
^«jjVO
( ¿ j i j J - ^ + j ^ ^.Xj'
V . 14, 1 7 , 20, 18, 19 mit Erklärung.
Fr.EisCHF.R, Klein.
Q
L^ÄC.
Lioli
vgl. auch Agänt X X , 158.
Lfi
^.lÄzi.1
tX.üi
I I I , 665. — V . 6 L
¿¿^¿AJ
il^LJO
'S-
Lol6l_ V . 5 'Aini
jVyUäJI
'Aini
X I X , 169 —
s. v. t i l j J ;
V.
n
IJizäna
im Sinn von »Botschaft« vgl.
K . V . Zettersteen
(26
L-YOÜ J L ^ J
L
—
^
L
LO ^ L Ö ^ L L
J
J
"
Ö ^ L »
i^JOy
OAXÖI
— 0
O ^ J !
y—
^ÄS»
£—
LJLJ
J
U
J-JJJI
XZJ
JL
¿
V. 17
^
LG.JLO'
¿jjc
X X , 3.
Agätii
X I X , 169 LCJ,
V. 21 "Worte,
B am
V . 19 Sabäb
Agäni IFFOJJ
Rand:
UÄJJ
S-~
J W— 9
LLXJ»
J Ü U L
1 ^ 5 J L ^
^
U J
xiS J ^ W J
® SL
CIY.^
^ÄAJ
O LG-UC
JGJUYÜ!
L I
C ^ J J L
&JUI
&
L O ^ LCJ
J j l
JLS
1
V. 18 B
Agäni
241. — V. 20
—
¿J
JJTXJL»
B xvi «A. g
J u u j LÄ^aj. —
IAJIO^J
A -
«¿>LFTJ
IS^-K?
LuAjcif
> O A -XJUUO>>
°"
1*
VJ-''
J f y L l ^ L p f
J»JJ
LJLOLW^
— 0
^
J J I L
I
udÄ3
£.
' • S y ^ )
O
I^TXLL
S!J>L$J
1
L J L
ÄJ
Lisan
al-'arab
T ^ y
übei
s. v.
dor
^"j 5 - 1 i S * ^ ' '
(vj^aJI ^ . ^ . j ! ) Hizäna
Linie
und Lisän
I, 2 7 4 ;
Ibn
V , 98; X I X , 169; X X , 6 und Hizäna IH
¿oLyw
ÜJ
SJJI
^¿f^JI
unc
und Tag alarus
JUJUI
^jl
^ÄJIJ.
al-arab
Quteiba
s.v.
'
|
(ed. DE GOEJE)
I, 2 7 3 : JU.XO
Es
folgen noch
einige
die jedoch so undeutlich geschrieben sind, daß ich vorlaufig auf alle Enlziffe-
rangsversuchc
verzichten muß. —
V. 23
B ^ ^ . ¿ L ^ j statt ^ ¿ L } ^ ;
I- am R a n d von
jüngerer Hand: ^ i l Q s . i_fli'. — V. 25 L am R a n d : i w l s ' i i t S j L . i . J ! ^ j !
Zwei Gedichte des Suheim. >
^ K J L
^J-A-LJ ^ Ä j y - '
uJ.A*JI
y >\
/J
Lo^
I
I
Lo
J
Lxil^-üJ!
L.A£
3
xxJjiÄi
]
ß'I
J j . ä . 0 U'AÄ s l X ® |VJL=>- s t \ J 0 j s j . » JLii
Öjy}!
al- arab und Tag al-'arüs 505;
B L^JCijoo ^ j O L t j ;
Hauptsache nach mit L übereinstimmt: ^SIjm**
J ö
^ jJ!
LAJBIVJO
V . 26 B t>Lj. — V . 27 Saljah,
jjl 1 5 ^ 1 ;
«^¿LaJ
o LAJI+Xu (^jIÄJ i^yX^D
(jJ.I*Jl
LÄUS
O
|vj
>
^:oolj>l
—
^.^'¿mj
«VLä
I
^
j
^.¿J
—
x^uJI
O
^ I
J U
¡2"]
JjjeltXcs-l
. x j j J a J l j . f l > j s o l ^ u J d l ö ^ ^iiy^x
die der «.j!
JLs
stXiO c j j . ä - 1 |»jU. JLä
528
K. V.
sl-j.il
xi
fO ^ S
^ ü l
xj'iXi»! x j j j L * j '
^j!
JjjLU CJlXä-lj
^fly-M*
Jli'
ij'y
|VJ
5
^J j . i a . 1
O
1
a.jUI'1
Ldic!
(Xi
O
Ys.
Jj.ÄAi
34
B
6
Lolo Agäni Lyl+J IAJIo
jjl
5c\iß
jvj'Li»
j^a^iLl
-
o jT^ÄJI^
y^S-
(J
i J h ^ > Ä
8
Juu
StXfl>
StXiS
^yuX |VjLia-
tiX&j
bö^j
tX^
StXiC
£
aijJä)
i j « ^
Jüij
^ ^
solj.*J
Lo
(>5'
S ^ JUÄ
stjj
^j^Läj
jj4*JLs
LoLuJI
— yjwA^aia.
^J-AXI
ü!
¿JLäj
UJot
" -¿JltXSiXj
¡¿¿yO.
O
J ö j
^!jol*JI
^'¿Mi; bis auf
^j^XlwJI
StXxAÄ
LaaC
^^waJ!
B
am
Rand:
^ol^J!^
LjOcXs»!^ ; Asäs al-baläga ^Xmi',
l^jlS'
QU
xiaÄJ
^557"*
Jj^ill
XAJtX^.
M 1 ^j-giliac!
IjJ
(¿1
JU"
O -LJOI^JI
^ e
IjaJIÄ.
¿Jlöj
Zetterstecn
» | V—t Agänl
V—; XX,
5 i-m^V v — Jotjjdt XX,
Jl«jJI
s. v. ¡ ¿ ö y
—
^ y i ^ J i
V . 35 ^yd
^Xm
d i j S j J I
nach B ; L
^¿c
dieselbe Lesart als Var. in L ; Ihn Outeiba 241
5 l * ^
Li'^J
^yO
Kämil
167
ebenso
V . 36 Ihn Quteiba, a. a. O.
IJOJU
U3f
1*1^1
^yO ^ j J L j ' l j ;
5 ^aäjI
tX3fj.*Jf
u»a.*j
Lo
SAÄJ
Li!
üit
^JLiiXxj ( . L i l ! ^.O-lt »ito ^
^
LXJ ^jsa
L-äjy
^.XAJIj ^jJoi.-S
Zwei Gedichte des Suheim. L/JIj
i^tXJI ^ . ¿ J ! IlXj
3-9
Llclo ^ L ] Jwcuj!
Uaj^ siLc.1
l*Jbl.w ( j a j o l J.28JI ^ L J L J J ^ ä ä j
I
xJifjcVjt ¿ J ü l
jl
^wAÄä ^j-J-Äi'
UjÜ' ijC^ÄX^JI
I
jjLiuJI
^ Cefjuo ^Tjjj-ti
UilS' CJ^aaJI ¡j
. | L__xa>U
£ — ((
UjUs ^wÜ!
l l
L^
CIJ
iüCg^ O J ^
^öyS
j o I ^ j xIXÄ l ^ j J w X.1ÄJI y o AJL~» (jlj^JlJ JuOj feLwXjJ
^
^jOÜ ts^y0
J 0"^G I^aääs»^
ü- i iß^ c>Jj*i
l
«'iK ^LgXil pLo I j>t
l XJ
^ol^ CJ+Ä S l^jfö iü-xj »LmxJf XÄ4Ä
O liLöjO jjuuJ o f j ^ L j ^ C l
jJLj Kamil
*
^
^ ^
167
L J U J i k ^ a j ^-«.¿jl Lo XAÜJ Loft>
v^ij
uaju
L*jl
cuj-A J ! x j Lx) ^ Ä i C
öÄ-oli
JjjD L^äj^xi ^ J u w
V. 37 B zwischen den Zeilen ( j t ö ^ l ^ ¿ j j ; L b i ^ c IxisLw ^ ü J . — V. 39 B ^AÄs!. — V. 40 L
£
— V. 38 B
und ^ a s ! Lo. — V. 41
L o o t \ * i . — V. 42 B Glosse zu L ^ j ^ : ^.^»J! ^jC; ebendaselbst: Ljjj' ^5! äJC-Us.!^ gl.^il Lgj ¿U.&2». .!. — V. 45 Hizäna IV, 244.
330
(jl
L
K. V.
l».^
JLJ
ajIo
I
oj™»
^jljtX-A^iJ!
LgÄx
o l c l i
J^iJI
I
Zetterstcen
L g j y ^
(jjj
;
Jü.ii'Lj
IjotXi-
LAAU
¿juc
OJ^J
LÄau Jjüj'
0.-0./J
iJ^Ä
L»y
S'Lcj
kjü./
u^X-'l
pfi
äJL^
jTjjo
|fj
£
S^io
^J-X)
( J ^ ^
(¿-y--'
*JJ
J-5
äjI^J
^-A^t
tXi^i
rLg..'l
cjlXJ
131
UJLS
JLs
Lül+j
ltV.5^
XXJuÜä
tXüj
OLJÖ
Jobfl
^
L
1
xJljtJuo
(tX^jo
Lxaä.
¿^¡¿J
O ) ^
Jo iüjO
Üj ^.Syjj
SjjC
ü
OXx
—
V.
~
«¿jyiJl 50
Glosse
in
B
^ I ^ J I
^
4 8 Glosse
¿üfj ^xi
H a n d in L : ^ j J I
uö^Al
JJÖ
V . 46 Glosse in B ^^JLä^JI ^ j L j l V * - ^ ' *
jk*'
iX^
OÜt
^
in
B
^ J ^ l
Randglosse
ScNjU. —
p^aUI
O^LXJ
a O
Ö»
^SXj
Jlsxi
O
I
QJJ
s
Jlii
^x+aOj
J^c.
^ y t
^.ftXi
iüJOo
iuxi
»jtVc
xaajo
JUi
^
¿¿aä^IL
von
V . 49 I^
^ j l i l jüngerer
Zwei Gedichte des Suheim. Lyta
yi
¿JltXj
üJjcLd
(Jo
^«JLA*
^JÜOO
sLLmi ¿ ^ - » ¿ J
J-Ö'j
^
J - ^
O
I
jyJ^jJI
I
¿jU
¿>
J^t^J!
J a i
ä
J^jj
S ^
&
¿LÜäj
Ä.*JUJ!j VI^LJ ^ A J
^JL&O oijuis
il
Iiis
xj
U j
ci"^
^t-Ä^wo ¿ t l ^
^jJaj O
La=».Lau
j ' o
j>L*J!
LöLa.
"
*
"
iL^jis
a ^ ^.«i
j x
ju | jyx
u y
8
¿A5
)jS3JC
O
l
is
O
^
LAJIJ.^JI
isaX+AU « j ' O j
^ L i l
ÖLCJ.J!
V. 54 schen
t\.fijJI
jJiJlj
öax+JU
^Xääj
Glosse in B ^ J t X i J I
den Zeilen
Jüs und Tag al-arus
*Jt>jt ^ J l
^
s. v. ( j ^ - S -
Jj^U
eLgj^i!
J.i'
eL+JI ^AJ
JL^-t
LO
&
£_
jl
folgende Glosse zu ü ü x i ' .
Glosse in B ¿¿JU».|o
a -0*0 ^.zi Ii
^JÜÜ.A^.1
^¿Loj
Jlüjj
v^a+jü
Ä « ,
—
xJ
B zwiV . 57
^ J ' j A J itg-A^i Lisän
al-'arab
33 2
K. V. Zetterstéen O jjj-'l
EIajI^JIJ |*A.íá*JI J^ji^+JI C^A+J!
Lx^¿Lo ^jsáJt ^ L S «ylyíJI J ¿ Í j i. LJLJÚJ! íj+iúJI I
t xJUl
-
x^SLA^AJI ^JaiijJj
I
g.i¿tj J U A J J Á Í Ul¿
ïjL
-c =¿'j! ol^lJI
¿Ló
t
(jl^xíJ! II. c*
, a-
L¿jl tXÁ*J! J U j j' tXS L^o sL»„uJI
!t\ A.s¡ tXï Lo Jjij -
-.a-r.
«
i
«
/)!
1S^
liiL«* Lg-Xxlj JoJj!
""
'•""
1
7 ti
o ' ' * *«
^••"aÏ' tXi'j
L
jus?
x
L^JLAÍI
¿
O «lesili ^.XÄÄJ viöjJI lj> jv! ô ItX
¿ íújo tí¿
!¿t
|¿Jj I j ^ l üj
o-
s
íil^u j!
¿üiL««
lá .ludi
U lo
¿pf
¿J $1 UUL il,
Ö ¿I
ilj
V. 59 Fehlt in B. — V. 6i L al-arüs
iS X
lu
il ill
AJlXü Jk+jS il B
Lzsän
Ojí^ al-arab
und
s. v. (jiaA^o; Ibn Hisäm (cd. Wüstenfeld) I, 2, 697 ^jI^xaJI ; ^ J J l o statt ^.jas'xXj; B fügt hinzu v^^Ajl. V. 4 Lisän
al-arab
und Tag al-arüs
s. v. P ^ ó
: ¿I il ; í o XiiU.
Tag
Zwei Gedichte des Suhcim. £ —
tiX+JW o ^ J I
U4L
O«-..-"
(5^:?
0
¿j,
333
W
'
" Ä
> ^ vi '
8 «? (jl ^jJßj
^isl
It>
CyO (Jjjjcf Xj'tXfijl S-'i ¿Gfe'
Ij-^Äx
ltX.»Ä« ( j ö ^ l
b ^ l
¿jjo
^gJJI
(JJO
U ö !
P
¿bl/
pjj
iSl*}
«Xg-iö
tX*Äj
J-fl^Jl
o T &T J^JLrLi
x
fj.
U ;
JdLj
¿ ü b
J X l i
— .
" "* II
*
^5!
O
ItX
(ji^pl
J u l ^ l
^ o l ^ i l
«•A.^a.it!
^Ol^i
s U U J I
UuLöj^
L^Li
(jO^Sil
jj^o
j J i
^aäI^XÜI
s s J L
X
^
j + X
Ä
—
V . 14 L
zu
oder
nl't
£
xi^i».
im Scholion aber subscriptum, aus
vgl. LANE S. V.
£
(jd-oJb
äJo
¿ p
ÄÄJ
jjo
^
JujJo
wotjJj'
LuXt
(
pjj
¿ y
j Ü
ibl
O
V . 8 L vokalisicrt
I
(JIÄJLaaa;
s ^ L ' l
äiöliXl"
ÄffljJjlj
(jl^AJj
0
Sil 20j*Aj'
1
ot^is
* £1^ -
t(X*x.a
¿jjs
il
O
b j i '
— .
^ ° " lt \i ' M 3 ^ ^ - » J l ij>
fjy
!Ui
£
jjJÜÜIj
d^taJua
O I ItX
--
.
t.-g.xii'
I »I jLLL«
¿J.J
®'
— V . 13 L
^jeJÜli'.
geändert, im Scholion aber
^y(sic);
la
334
On Ibn al-Mu allim, the Poet of Wasit. By D. S.
Margohouth.
Of Najm al-dln Abu'l-Ghana im Muhammad b. 'All called Ibn al-Muallim (501—592) there is a'biographical notice in Ibn Khallikan's Dictionary,1) much of which was reproduced by H A M M E R - P U R G S T A L L in his History of Arabic Literature,2) and which was excerpted by the authors of the Turkish Kamils al-Alant. A very few lines are assigned to him by Yakut in his Geographical Dictionary in the articles Jaban and Hurth, and Ibn al-Athlr has a few words about him in his obituary of the year 592. B R O C K E L M A N N merely mentions him as a rival of Ibn al-TacawIdhi.3) Ibn Khallikan, as usual, is loud in his praise of Ibn al-Muallim's verse, but mentions the interesting fact in connexion with it that the members of the R i f a i order were in the habit of reciting it; a fact to which there appears to be no allusion in the accounts of that order which have recently been composed by French scholars.4) Of the disputes between him and Ibn al-Ta'awidhi there remains one monument in the Diwan of the latter poet,5) of which however the Caircne printer was unwilling to set up more than a few verses 1) Transi. D E S L A N E , III, 166—172. 2) VII, 1 0 5 1 — 1 0 5 3 .
3) I. 249-
4) LE CHATELIER, Confréries
L'ONT & COPPOLANI, Confréries
5) My edition, no. 52.
Musulmanes
326—329.
du Hedjaz 202—210; DE-
D. S. Margoliouth, On Ibn al-Mu'allim, the Poet of Wasit.
335
owing to its coarseness; and the copy of Ibn al-Mucallim's Dlwan which is in the Bodleian Library, of the date 608,') contains no satire on the other, and indeed little that could be called satire on any one, or more severe than his poetical correspondence with the physician of Wasit, Ibn al-Barkhushl, copied by Ibn Abi Usaibi'ah (I, 257). The verses which are over 3000 in number are mainly encomia and dirges; there are however some poetical epistles, some ghazals, and some epigrams. The poetical interest of the dlwan is perhaps not very great; but it might be worth editing on the ground of the historical allusions, which, if they do not give us much detailed information, at any rate render us somewhat more familiar with personages casually mentioned in Ibn al-Athir's chronicle, and teach us something of the condition of Wasit and its neighbourhood during the sixth century A H . I propose to collect from it a few details concerning the poet's life, the names of the more important subjects of his eulogies, and certain epigrams which illustrate the manners of the time. The dlwan appears to be arranged on no principle that can be guessed; it is neither chronological nor alphabetical nor divided according to the subjects. It covers however at least fifty years, since the author mentions his twentieth year in one poem and his seventieth in others. The personages mentioned in the poems are a fair chronological guide. The poet was born at al-Hurth, in the district of Wasit, and according to Yakut had property in Jaban, a neighbouring village; the latter is rarely mentioned in the diwan, whereas there are many allusions to the former, which had a kadi, who was subject to the ka4l of Wasit, at one time Ibn al-Damaghani, to whom the poet addresses more than one complaint about the local magistrate. A more important place than al-Hurth was Gharraf, properly the name of a canal, but also of a collection of villages; it had a governor 1) Marsh. 5 1 6 .
336
D . S. Margoliouth
(amir or wall), at one time Mujahid al-din Bahruz al-Ghiyathi, who figures repeatedly in Ibn al-Athir's Chronicle; as governor of Takrit, afterwards as shihnah of Baghdad, an office to which he was appointed in the year 532. He died in the year 540. A village of Gharraf to which the poet sometimes alludes had the name Halah; there is a dirge on an amir of Halah, named Yahya b. Mukbil b. Abi'l-Jabr. In another village, probably in the same region, called Jauraja, the poet possessed property; in one of the odes he complains of having lost both revenues and palm-trees there, whence the first syllable of the name (jaur) would have done for the whole. His fame as a poet seems to have spread abroad when he was quite young, and he appears to have enjoyed the patronage of Bek Abah, feudal lord of Basrah, and at one time shihnah of Baghdad; to this office he was raised in 529 by the Sultan Mas'ud, who afterwards employed him to deal with the son of Dubais in Hillah, on which occasion he according to Ibn al-Athir displayed cowardice and incompetence, in consequence of which he lost his office. The poems addressed to this personage by Ibn al-Muallim belong to a period before 529. He is given the titles Nasr al-din and Zahir al-daulah, at another time Husam al-daulah; such variation is not uncommon. The subject of the two poetical epistles addressed to this personage seems to be the same. The poet is detained at Balas, whence he is to accompany Bek Abah to Basrah, and his patron delays him week after week. If he must be delayed, let it not be at Balas, where the "water is like an incurable disease, and the interpreter a Turcoman". Ibn al-Athir gives 532 as the date for the termination of the rule of the Banu Marwan at Miyyafarikin, which has been
described
by
Mr. AMEDROZ in the J R A S
f o r 1903.
The poet seems to have entered into relations with this family some years before that date, and several of his odes are addressed to members of it: in a poem in honour of
337
O n Ibn al-Mu'allim, the P o e t of W a s i t .
R a d i al-din b. Humaid b. Kamarra he mentions a calamity that had ruined (azala) the Banu Marwan, this being a dispute between members of the family. On one occasion he writes "in the name of 'Abdallah b. Marwan to his uncle Marwan". c A b d al-Baki b. Marwan and A b u Su ud A h m a d b. Marwan are also addressed by him in odes. The place wherewith he connects the latter is not Miyyafarikm, but Humamiyyah, in the neighbourhood of Wasit, and al-Mughlrah, which is apparently unknown to Yakut. A rather more familiar figure is Saif al-daulah (called by Ibn Khallikan Nur al-daulah) Dubais b. Mazyad, prince of Hillah, which was visited by the poet before 530. W h e n he reached Hillah, it was a place of gloom to him (he says), because his friend Mansur b. 'Antar was in prison; when he was released, it became bright. H e was allowed to address some encomia to Dubais, one of which contains an elaborate account of the talents of Buthainah, a singingwoman belonging to the prince. This was probably a breach of etiquette; and the poet appears to have been imprisoned by Dubais (whether in consequence of this indiscretion or not), and to have been rescued by Thikat al-daulah c A b d al-Razzak b. al-Husain, who had previously been governor of Wasit, where doubtless our poet had made his acquaintance. This personage also promised to help him in Baghdad, whither he now proceeded, like so many poets, in quest of fortune. The Caliph Mustarshid was a mortal enemy of Dubais, and it was natural that the poet should encourage this animosity in the encomium which he was allowed to present to the sovereign; he also attacked Dubais in an ode addressed to the Vizier Sharaf al-din c A l i b. Tarrad. H e had no difficulty, it would seem, in getting his encomia accepted, though occasionally intermediaries had to be employed in presenting them; the difficulty lay rather in obtaining payment, whence we get (in the case of ' A l l b. Tarrad) a series of the following character: first an encomium: then a reminder: then a complaint of being refused admittance by the door-keeper: then a Zcitschrift f. Assyriologie, X X V I .
22
33«
D . S. Margoliouth
remonstrance at the smallness of the sum finally awarded. Another appeal was addressed to the Treasurer (Sakib almakhzan) Athir al-daulah Abu'l-Futuh Hamzah, also known to us from Ibn al-Athir. It would appear that he was cast into prison in Baghdad also, in the company of a one-eyed astrologer, who dictated to him, and constantly compelled him to erase what he had dictated. Perhaps he derived from this experience a dislike of astrologers: in an epigram which will be quoted later he triumphs over an astrologer who had prophesied the appearance of a comet, which after all failed to appear. His place of detention in Baghdad is given as the residence of Sacd al-daulah, called (J^-Ij. Hence he addressed an appeal to the Sultan Mahmud, on his way to the Tomb of 'All, reminding him of the merit to be acquired by releasing prisoners. How he eventually obtained release is not clear. H e travelled further than Baghdad in search of fortune; to Mausil, whither he was invited by the governor Jikar (ob. 539), and in the neighbourhood of which he was attacked and taken prisoner. The place where he had this misfortune was Ribat al- c Akr, and the captor a Turcoman leader named Korkuban. The Turcomans are generally mentioned by him with opprobrious epithets; on the other hand he is friendly towards the Kurds, and mentions in one poem five members of this nation who had entertained him hospitably; their names were Ghalib, Abu'l-Ward al-Saghir, c Adnan al-Tarld, c Azzar and Sallar. The greater part of his life was evidently spent at alHurth, which he disliked much as other poets who had been in Baghdad disliked their provincial homes. Still Wasit was near enough to the capital to enable the poet to keep in touch with the court; and he addressed an encomium to Muktafl, and on the occasion of Mustanjid going to the fortress of al-Mahakl he at the instance of the vizier al-Baladi composed a geographical poem describing the stations between Baghdad and this fortress. The expedition of Mustanjid
339
On Ibn al-Mu allim, the Poet of W a s i t .
was in the year 557, and a short account of it is given by Ibn al-Athir; to this the lines of Ibn al-Mucallim offer a supplement. Elsewhere he adds that the conqueror of Mahaki was the Amir al-Hajj Tashkin. Besides the Viziers w e find him addressing encomia to the Sahib al-makhzan and to the Mutawalll dlwan al-zimam, one Za'lm al-din b. al-Khallal. His complaints of al-Hurth usually are confined to generalities; it is a place which would have driven the poetry out of the mind of Jarir, had he settled there. It is like fate; when a patron tries to exalt him, al-Hurth depresses him. H e couples it with the dlwan (secretarial duties?) and a party hostile to him in a triad of evils that have overtaken him in his old age. T o one Najm al-din Mimlan, who had taken Juwaizah (from the Maz^/adites ?), and dammed the breach of c Abduyah, which for its depth was like a sea, he addresses a request to be allowed to quit al-Hurth, where his means are always decreasing and the straitness of his breast increasing. The troubles which he experienced in his home were probably to a great extent due to the peculation of officials. W h e n a sum was allotted him by a governor, the governor's deputy might keep it from him; a fierce remonstrance is addressed to A b u J a'far the naib for keeping back a sum assigned him by Baha' al-din al- Amid. The governor of Basrah Buzabah assigned him a pension (.rasm); this he claims as a debt from A b u Taghlib, the kaiib of Buzabah, to whom the affairs of c Irak have been entrusted. T h e governors appointed to look after Wasit have neglected the justice and mercy which they were instructed to deal out; A b u J a'far Zain al-din ' A i n al-Kufat is asked to help. H e is again imprisoned at the demand of one Rustam, "whose god is gold"; he appeals to the ruler of Wasit, T a j al-din c Alam al-shariah ' A l l b. A h m a d b. al-Bukharl, denying the debt. His relations with the Banu Ghazal, a family of some importance in Wasit, provide the material for several odes. He composes an encomium on Muhaddhib al-din Abu'l22*
340
D. S. Margoliouth
Karam b. Ghazal, "seeking help and wealth wherewith to humiliate his enemies and obliterate his poverty"; Abu'lKaram orders his case to be settled by one who "alarms him instead of quieting, bruises him instead of binding"; instead of obtaining a reward he finds his property taken away. He now makes an application to the Vizier Kawam al-dln, declaring that these Banu Ghazal are Batinis, and dragging Wasit back to the days of Paganism; if their rule be restored to Wasit, then all is up with the Batlhah. Quarrels of this sort seem to have occupied a great deal of the poet's time; we learn from them many names of governors of Basrah, Wasit, and places of less importance, and occasionally are brought into the presence of the more important functionaries of Baghdad, though Ibn al-Mu allim's circle is clearly less exalted than that in which Ta'awidhi moves. Basrah appears to have been regularly a fief (iktd) of a Turk; besides Bek Abah we hear of Buz Abah Muzaffir al-din, perhaps identical with the Buz Abah of Ibn al-Athir X I , 39; of Toghrul, praised for his services to Haddadiyyah, a village afterwards visited by Yakut. Of magistrates in Wasit bearing the title Nazir we learn several names; c AmId al-din Y a h y a b. Ziyadah, 'Amid al-din Sandal, perhaps the personage mentioned by Ibn al-Athir X I , 243, A b u Ja'far b. al-Baladi, afterwards vizier; the 'Amid of Wasit is also mentioned, a man named Nasir al-din Abu'l-Hasan b. Sa'd. The theory that men were ashamed of being Turks, and regarded the name as a reproach is no more borne out by these poems than it is by those of Mutanabbi; on the contrary Turks in high places are complimented on their origin. One of the Turks occupies on the whole the chief place in the diwan of Ibn al-Mu allim, viz. the prefect of the Pilgrims, Mujir al-din Tashkln. The first poem in the diwan celebrates an event connected with this personage which was regarded as of sufficient importance to be registered in the chronicles. In the year 571 he was commanded by the Caliph to depose the governor of Meccah, who had built
On Ibn al-Mu allim, the Poet of W a s i t .
341
a fortress on A b u Kubais, and annoyed the pilgrims from 'Irak; he succeeded in taking the fortress, and removing the rebellious governor. The poet compliments him also for his services to Gharraf, which with al-Hurth appears to have been his "fief"; Ibn al-Mu allim asserts that Tashkin was the first feudal lord of these places who had ever received an encomium from himself. In another poem he is praised for his benefits to Hillah, which he calls al-Faiha, and which Tashkin has filled with justice and prosperity. A poem sent by oversight without mention of Tashkin's name causes another to be composed excusing it; the poet appears to have been regularly in Tashkin's employment, and to have composed verses not only upon but for his patron when they were required. A geographical poem on the stations to Meccah, not unlike others which have come down to us, was composed by Ibn al-Mu allim, recording his own pilgrimage, and in honour of this leader of the pilgrims, then called Nasir al-dln. The poet's praise of this personage is confirmed by Ibn al-Athir; he outlived the poet by some years, as he died in 602, as prefect of Khuzistan, whither he had been sent after his arrest, which is recorded by Ibn al-Athir, who regularly calls him Tashtakin. There are besides odes addressed to numerous men of eminence, who probably paid or promised payment for a kasidah\ owing to the stereotyped character of the compliments we learn less about these personages from the verses than from the headings. One is almost astonished at the prevalence of titles compounded with din, which, as is well known, only come into use at the beginning of this century; an index of proper names to this diwan would show that the language was being ransacked to find variations. Certain compounds appear to have been more honourable than others, as w e see in the case of Tashkin; but it is not easy to make out any hierarchy. The tashbib occupies as a rule something like half the kasldah\ to us it has little interest, but as may be seen from Ibn Khallikan, the judgment of
34 2
D. S. Margoliouth
the poet's contemporaries was very different from ours; it is as an erotic poet that he chiefly wins Ibn Khallikan's praise. H e also even in his lifetime was frequently cited by preachers, a m o n g them the celebrated Abu'l-Faraj b. al-jauzl; such citations usually come from poems dealing with zuhd or asceticism, which scarcely seems to be the subject of any odes in this diwan, though some verses of the sort are to be found in the dirges, which arc chiefly on local celebrities. T h e verse in general seems to the present writer facile and graceful, but to posses neither quality in the same degree as Ta'awidhi's. I close this paper with a selection of epigrams from the diwan, illustrating various sides of the poet's life.
UoLl xJlw jJUl!
OjiaiLl}
il
auL
(jOj
*JI
^j-jo ¿ta-oiaJlj x. ))^ ^
LijsLc^j
(^oUs.
«-! ^^¿Jl
j.s'
'(X) i
Icj
J
iyu
-
^^«¿vo ifj
^ ¿ 1 «utXj!
JUx
»
a
JuiJj jJ-JI^ ( j j j J I
3
aai ^j-io tJUyMi.^ i
J
!
J l xJj
^JjXax J j j ' JuaiJ!
Jo
^y*^)
Loj
^
¿j
oys» ¿6b
^JJsl
^
^
j j b tXi'
On Ibn al-Mu allim, the Poet of AVasit. ^.JUM
¿Jjla.
¿
X.XAMJ
JJ
343
tXo-l^ ^..«il! jSÒ**
sJÜ! J ; L ó ^A^XJl
¡jjj&xJj
ÍOwLc ¿ U ó
¿
l^jljli
J
ÒyM I
iOj.*¿.J
jt
Lo ^ ^ x t X j l ^íX-SÍ? |*Ls
l^jj-ia.
^ L i - f ¿ t X ^ J l (jl
^ASÍ
o ! ^ jvXÜ
L£LÍ.
CVjüo
^tX^aï
xa-Uxi ¿
srLá^i xJj
^clXÀJ J j j |vJ
IÊÀ.
cól
j^aáJ! v-aí^j
xJ (jj-^f
l*J
tjà.^1
lir'
X-U/LJ
¿Ul
JLí;
iXïy
^Äi ^cJjjj
JJaxxli
LXÏj
LJ!
ctf^
^
L^j-o j j K Lo J^^CLáau.J
^»X^i J j l J !
^J
Jl*JI
J,! *jY ILjC-,
X^-Lo
JjJl
^ffi
oUM Jj^iL
Jlö
^
Lilj
L>jj' (jl ¿OlXgJ'
1 ^ 'L¿ij LIAXIW LlJI
»
U
(J*^
¿ w 0 "'lptP
steht.
parallel
H o s . 2, 7 steht ilpti>
womit man den K ö r p e r einrieb,
359
Poème didactique s u r le féminin par Borhân ad-dîn A b u Ishâq Ibrâhïm ben c Omar al-Ga bari. Par M.
Bencheneb.
Borhân ad-din A b u Ishâq Ibrâhïm ben 'Omar ben Ibrâhïm ben Halïl al-moqri' as-Sâfi'ï al-Gabarï est né vers v
(
640 (i e r Juillet 1242 — 20 Juin 1243) a G a b a r , citadelle (çaÎa) située sur l'Euphrate entre Bâlis at ar-Raqqa. On n'est pas d'accord sur sa konya, les uns disent A b u Ishâq, les autres A b u l - ' A b b â s ou A b u Mohammad. A l Ga'barî est encore appelé Ibn as-Sarrâg, La même divergence existe encore au sujet de son laqab: il aurait porté celui de Taqiyy ad-dïn avant de se rendre en Syrie. Quant à son ethnique, il ajoutait lui-même après al-Ga'barl, celui de as-Salafï pour indiquer peut-être qu'il suivait la voie tracée par les premiers musulmans. Après avoir fait dans sa ville natale de bonnes études qu'il compléta à Mossoul et ensuite à Bagdad où il se fit délivrer le diplôme de licence par le hâfiz Yusof ben Halîl, il se rendit à Damas d'où, après y avoir passé quelques années consacrées à l'étude et à l'enseignement, il alla se fixer à al-Halîl (Hébron), comme saï/j. (gardien en chef) du sanctuaire du patriarche Abraham et de ses descendants. Il mourut dans cette dernière localité le dimanche 5 du mois de ramadan 732 (31 Mai 1332), après y avoir vécu environ 40 ans. Soyutï seul dit que sa mort arriva en 733-
3Ôo
M. Bcnchcneb
Parsuit'e de ce long séjour à al-Halïl, il est appelé quelquefois al-Halilî. Parmi ses maîtres, on cite Mohammad ben Sâlim al-Manbagï, al-Wogûhï, Ibn an-Naggârï, al-Fahr Ibn al-Bohârï, Ibrahim ben Galîl (sic). Pendant son séjour à Mossoul, il étudia le Kitâb at-tagïz fï moljtasar al-wagïz fï foru as-Sciji'iyy a sous la direction de son auteur, Tâg ad-dïn Abul Qâsim 'Abdar-Rahïm ben Mohammad ben Mohammad, connu sous le nom d'Ibn Yunos al-Mawsilï as-Sâfi c ï mort en 671/1272—3 (Cf. I;IH 1,313, n ° 3°73 e t Ibn Sobkï, labaqât as-Sâficyya V, 72). Al-Ga'barï passait pour avoir de vastes connaissances, surtout dans la lecture coranique, le droit, le hadît, la langue et l'histoire. Ibn Batuta qui l'avait vu, lors de son passage à Hébron s'exprime ainsi: ». . . je vis dans cette ville le professeur, le prince, le vénérable, l'imâm, le prédicateur Borhân ad-dïn al-Gabarï, un des hommes saints, élus de Dieu, et un des imâms célèbres« (trad. D e f r e m e r y et S a n g i n i j e t t t , Paris 1893, I, 116). Parmi environ cent ouvrages qu'il a composés, on cite les suivants qui existent dans les bibliothèques d'Europe, du Caire ou d'Alger: i° al-hibat al-hanïa fil-mosannafât alCrdbariyya, 2° ciqd ad-dorar fï cadd as-sowar, 30 taqrïb aima mfil fï tarlïb an-nozûl, 40 tadhib al-omniyya fî lahdîb asv
(
Sâtibiyya, 50 Kanz al-ma ânï fï sarlj. Iiirz al-amânï wa wagh at-tahâm, 6° al-zvâdilia fï tagwïd al-Fâtilia, 70 rosûm attalidït fï coliïm al-hadït, 8° al-ifsàh bi-marâtib as-sibâh, 9 0 Kitâb al-masyahat as-Sdmiyya, io° cawâlï maSyaJjat alGa^barï, ii° at-tarsf fï sinaat (var. fï tilm) al-badt, 12° ôamïlat arbâb al-marâsid fï sari} 'aqïlat atrâb alqasaid fï asnâl-maqâsid, 130 vozhat al-barara fî qirâat al-dimmat al-asara, 140 iarh at-tagïz fï mofytasar al-wagïz C
v
ç
fî forû ai-Sàfi yya (il a achevé le commentaire que l'auteur fit sur son propue ouvrage), 150 Qasïda, 160 tadmït at-tadkïr fit-tanït wat-tadkïr.
Poeme didactique sur le féminin.
36I
Les ouvrages suivants sont considérés comme perdus: i° Kitäb al-mittelbar f ï ifytisär al-Mofytasar [l Ibn alHâgib f i l osûl], 20 abrégé de la Kâfiyat Ibn al-Hâgib fln0 0 nafyw, 3 Manâsik, 4 Ihkâm al-hamza H- Hi sain waHamza; 5 0 Ifatisâr asbâb an - vozûl dAbiil- Hasan 1 All beu Ahmad al-Wâliidî; 6° al-ifhäm wal-isäba f î masâhh alKitäba; 70 al-ihtidä fll-waqf wal-ibtidä; 8° al-lgäz fllalgäz; 90 taliqiq at-teiIlm fît-tarqlq wat-taffflm; io° tadkirat al-boffâz f l mostabih al-alfäz; 11° Hadïqat az-zakar f l \idd äy as-sowar; 120 risâlat fis-Sazuädd; 130 Rawdat 0 at-tarlf; 14 as-sabll al-ahmad ilä *ilm al-Halll ben Ahmad; 150 Sarai fll-qiraät as-sab'; i6° ' Oqüd al-gomän f l lagwld al-Qorän\ 17 0 Sarh al-Qasldat ar-raiyyat fl tilm al0 hatt llbn al-Bawwäb; 18 was/ al-ihtidä fll-tvaqf wal0 ibtidä; 19 al-madad f l mdrifat al-adad; 20° maw'id alKiräm f l mawlid an- Nabiyy 'alayh as-$aläl was-saläm; 2i° Nahg ad-damäta; 22° Yawäqlt al-mawäqlt. C'est le tadmlt at-tadklr flt-tcinlt tvat-iadklr qui traite du féminin que nous publions d'après deux manuscrits dont l'un existe à la Bibliothèque Nationale d'Alger, 2460 et dont l'autre qui, sans date, semble avoir été copié sur le premier, nous appartient. Sans l'exiguité de la place qui nous est réservée, nous aurions pu compléter ce travail par un premier index des noms féminins à forme masculine et un second index des noms appartenant aux deux genres d'après al-Ga'barï, Ibn al Hâgib, Sxbawaïh, Ibn Sïda, Ibn Mâlik, Soyûtï, Nür ad-dïn, Ibn Nfmat Allah al-Hosaïnî al-Gazâ'irï, etc. Sur la biographie d'al-Gra'barï, cf.: Ibn Batata, Voyages, éd. et trad. D E F R E M E R Y et SANGUINETTI, Paris 1893, I, 1 1 6 ;
— BROCKELMANN, Geschichte der arabischen Litterqtur, Berlin 1902, II, 164; — I.Iâggî Halïfa, Kasf ad-donün 'an äsämilkotob wal-fonün, ed. FLÜGEL, Leipzig 1858, I, 3 1 3 ; — Sobkï, Tabaqät as-Säfiyya, Caire 1324, VI, 82; Mogïr ad-dïn alHanbali, Kitäb al-Ons al-galil bi-tarlfr al-Qods wal-Halll, Caire 1283, II, 496; — Ibn Säkir al Kotobï, Fawät al-zua-
o6 2
M. Bonclicncb
faydt, Bulaq 1299, I, 30; — Soyuti, Bogyat al-wo at f l tabaqat al-logawiyyln zvan-nohat, Caire 1326, p. 184; — AbalFida, Tarih, Constantinople 1286, IV, n o ; — Mortada, Tag al-Arils, Caire 1307, III, 103. r OJuLdt A
^l_jtxJ! J
iwiUJ! ^ ¿ ^ J l
pLo^J
^
J
I+jl
jfy
j
iX^Ul « ^ L ^ oyoUJI
,J
^s.
(.bill ^
^jl
fJL
JU
Jk^
^ J J I (CtXil
o ^JLw l+C
a ^CsiJI
^SUO
tX*j" £
X i y+t.'G.i ^ SjLi^lj «
I 1. ^ L j t i J U L
idJI (jLxJI iX^c (^vj' if
oUS'" LJua^JI^ Jjl
^
tX.^1^1 xJil!
'jsl^j
o l jAVtJf
I
^
J^lc vio^JI SiXjli ^-giai is.
JUL
-kiAi. ia^i? J i a ^jol *Afl S ^
pC'j oLi Li
1) Sur la loculion proverbial o r f «..»wiC' , cf. Ma'idam, cd. Caire 0, H, 249; Asas al-balaga, Lis.'Ar. s. v. iaxi» ct Lis.'Ar., Qamus s. yi^t.
POÙNU: DIDACTIQUE SUR LE FÉMININ. 0
I \
"TI • "
J
P.«— JOL^JIJ
¿ S I
^SITXL
?O E i&x^Oj
. AXUÂI
YS£>
£ V¿J'
^
(JLP
(¿JÍJ-JT
FÍXJI
C
¿
¿ I Ä J L
^
^
^ JJS
y
^.A^AÏ
^
(JLÁJ^I^
B^-Ä-LFI
>L;L
TXS
IIUÜJ
¿AAJIÄJI
1 / 0
O-
ISÖJIX+JQ
')
..J
*
—
>
LXÀ»
(•^•ÄJJ
i ^ j J
UÄJ
Û&Mlj
L*Í)
a
IT LA.
TXOL^
^.¿I)
"
6
»
!)T
—
^
S^
'
->
YT^Ò-'S
i
L¿
* — !
CJLO^C
^ÜAÜÍI
XAÀAS'
IXIJ
OUO^XS
¿
^.JÛ
(JIAJ
JJ-AÄ^ÄJ!
' ' i l '
OIL
III
0 O - * Ü¿J
J^LI
I U
IÓ
Ü^L¿
J I U Ä ^
JCXÜJ
¿WOJ
J-AO^I
I * « . / : » - ! T ¿ £ ITXJ j
^JLIJ!
O.
Ï^YJTAÂ/O
y (J
¿Ü
•éy—=¿
IXJB I
I
^JIAJ
PO>LJ
Ó*
CIÓ
I
'ÀAjmÌ
«XA»!
0 ¿»ÜF^
9
"
(J-JLJIRAJI
ÒYÒLXJI
-O CXÄÄ
XFTXIALJL L ^ J Ü L J W C - j j i j
o
^ U
" O «.¿ IA^AW ^ J J F
L Ê L J
(¿I
3^3 0
í\tl
¿AÁ+JI
IB'J
i r /
¿UTXSJ
(^TXÍO
¿
¿IAJIJ
LJIV^I^
^J^XJJ
x + Z ^
—^.A/I^ÓJ
JJJUJL
il f a u t p e u t - ê t r e lire
«¿XI
X
A I Á J
L Á Í LAW
LGJLX!
F
064
Bencliencb — x i
^tX?)
ijl
y ww «jJtë'
ut
(jU
(jl
(¿h^^ij
^JLìàaJIJ
imw (jLi^JI^
o
Ui0txJt;
fiJ t, _
^ — ï .
-
i^jl^-t
1*1
f Lì ^ j L i
j-Ï^i+i
liâiJ
ÒwAjLc
!| X/oiLc
„ 00!
[vi'
a I—g-A.^?
> -
o-
„Ugjf
jv^
i_5jA2.it
lj.Jj
Isaùyxi
j!
|W
w — ^jl«*».
i^llil
tfrîl ^
„0_ ^àxJ!
w 53 ijlliu!^
Nj
¿tj
. S u
^jl—»—e
»m-^JLAÎJI^
(¿)!ò
J^Zd
' j ^ À ^ x i s '
( j L î ^ . — ^ jjLci.iaÀJIj ^ L i i a i t J l j (jltX*A«
os5 ^JUsaà»
KJM.j ^ . J
J^lX
fjiwo
iljjlj
Lo
ò ò j J ! 0
t
•
~ '
Î-La^J
X4.Ê
xJLot
Lliij IçU^JJ
jLLisaj
c^jjÀi
(jl
xJl
cjtl^.
^ . s a . i ' ¿J
juaòj
» jl
J.^
ils
j,
lòj
LjÌaO^
LgJlj
jAkXcli
^v^ÌxaJj
Las*
1) Cor. X I I , 32. 2) Cor. X C V I , 15. 3) Sur ce grammairien, cf. Brockei.MANN, Gcsch. d. arab. Litt.
I, 101.
4) ^jl.w.A.S'' ^X.3 désigne Moliammad ben A h m a d b e n Kaisan; cf. B r o c k e i . MAX.V I, 110. 5) Sur ce personnage, cf. BROCKEÎ.MANN I, 118.
Poème didactique sur le féminin. ^ I ^ L L
' j ^ - '
é
^ U L — g J I
^Igl
À'JI
J
aaJ
^LÍaiJ
SlXÎÛ ^jc
(J.AÏ
^jI
J-i'^
x+l^o
U f
lixí
s¿
y
lo
u y i
iij.i^aJt
^jK-ujI
If
cy^a»
o ^ s ?
!j - l i
l^Ilí
C^-ikfj
sol
ôJ-j
f
^jJLoj
OS.ÀJ ¿
'
L** ^Jy^-y
¡s^
JIaûàj!
t j ^ J
fa 2
(jl—¡kfil
(j'j
'
—
^ L r j j i
^
.
-
û
¿üLet
T
J^xi s ! ^
!;l;¿t
x
—
s L J ! ^ ¿ j
y
5
)yü!
Lillj.
j v ^ j l i J O^JL».*»/
AAIJ!^ ^ J ^ - U J I
(jl
silJI
jjIeI
j'
U »
^^JLaaíü
JJ
«jtXiSkf ¿I
aJ
Lie > - J j J û f 5
^L^JI^
¿ücJ!^
( j ^
^-ScXs! (^jl
j
)
pUàô.1
oólrsO^J-i.
Xj
^
(JÓ.XJ
¿
^JJ-IAJI y
¿
(JoLttJ^
¿
^yj^j-^i
^jL.31 tX^ij LgJI ^ À — Î + J I
^.i
IjSj
LgJ loL^llt
XAÍJ./!
1) Sic. 2) O j £ ! l licence pour ¿ ^ X J I ; sur le liadit cf. Soyïitï, Kit.
addorar
d'Ibn Hagar al-Haitamï, Kit. 'Azîzï, as-Sirâg
al-monîr
al Ilïït al baïrûtï,
^ o
al montatira f i l ahâdit al moStahira al fataiml
iarh al-Gàmi'
Kit. asnâl
iaditiyya,
3) Cf. BROf'KICr.MANX I, 1 1 6 .
Caire 1 3 0 7 , p. 1 6 3 ;
assagir lis-Soyûtî,
matâlib f i ahâdit
1 3 1 9 , p. 105.
icjLàaJ! publ. en marge
Mohtalifat
al-
Caire 1 3 0 4 , I, 2 8 7 ; al marâtib,
Bairût
4«
366
M. Bcnchcneb
L ^ J l ^
4.ÄJ
ôô
Oij'j
2
jjl^C^I
X«jLwj
)xX^j
5'
-'¿I 0
Mj
' ) ïyJO
î
^
o --
^
a
O .wjiH
loU.Ä.c.1 O J.*Ä.«j
— ä ä ^ I ä .
®
£jlxJI O «
iüüiXjaJ |V¿
^jlx.0
^jjO
Oj-^O^+Jt
^gjLjUÄAfaÜ
|W
I
xA.Ä.1
^StXJ
- I
1)
pour s l ^ j o , cf.
2) ¿ J . : ^
pour
•
i« -
Qämus
lOj
fem. t jvyft*^ ^.aaJ ^ j j i
q ^r ï L c
^ o
^t
'i^yCy
G ( Jr2^ j l ^ ^jjé
* 0 ^ L Ê >^ fo -» ( J G gli'^
*
i) Licence p o u r S j ^ J B , Zcitsch--. f. A s s y r i o l o g i e , X X V I .
ct
S j cXsO.
2)
Sic. 24
°> J^ o G
Uô
3 7 0 .
M. o
-
> o
¡jl^s-jji)
-
•»
-
Bencheneb
-fu-
5 .
¡S
t °
{¿-^ì
tVffl-w
'
'J '
#
JlX-C
'
^ « ¿ J
c. « y t j j i l !
òyo
II.
J J s ú J U I j
^jfj
y
S
^ j U l
¿
, j L a * J
L g j
^i'l
Ls>vLs*
j » ^
A^ÄÄJ
^ ¿ 1 ¿ A ¿
t^jlj—,
0
J j - ü J j
I
¿,aLá/>
'^i^iò
o ü ^ y
(_5t\J
j
Li'
¿AAS»
L S J - ^
ÒjÀ/3
^./i
t l ^ - ^jlvJtj
I,
io6.
y
c u » S
LsCfLi"
CJÍÍ
£ ¿ 1
i
xj'liJj *
l Ä r l j ^
^^jcLuo
^ J j X i j
J i X f J !
lÎROCKF.r.MAXiV
¿ u ^ a J D >
¿ J ' j ^ j
^(.Xxaä
J c V c
Lj
J^a-fjJ
Cf.
L o !
¿ U . J I
j.scLixí'
i)
a
ë l X j
^
«*-uJ
1^-í'iy.ij >
^ I x v J I
pLo^l
— á j i a J f
( j l ^ j ^ l
'
sJ
^j^kjnZjo
à
VÍAJÚLJ
yS>2
C H J
^ X j t
ä a A C .
}
ItX^»!^
i l ^ J I ^
Àxiù
id
lo
Xy. - ¿ ^
15
ItXîÛ
¿
«L J ^
*
P o è m e didactique sur le féminin.
^ j l i J I ftXiO J à j L !
''i^ûii. iU^ O ^.AIÛAXJI
&ÀAJ
I vl .jl IS'
.„ *Mi Àjf
i
°
^jl
J^è i >
.
*
'il/ 4JIS
A*iîl
^ v jvi'
^j!
LU
u
ikj û
^j^^f
jjlj
^
I
X4JI
s^O
j^aJ S itXij
8"-
¡s. «
i 4 n ^cXJ'^
¿Ui»
S si
(jttX
~ . > —. a ^ J
' ' i ii ^yjLkJI^
—AÀ/J!
¿LgJlj
o cy-oL^
^ j!
5 -j S j
. O *
IcXxS^jj'
XXjJlj J Cl ^
Xjlj
l^Ji^u
1-g.^T 1) Cf. B r o c k e i . m a w 2) I.icence pour
¿ J
Cl
sLi^
a
|VÀè
?', «-r o- fiB î® f ^.sî ^ « - U c j
«*
x
¡aÀia.
Ojt^
^
s--:
. xJ
L+i'
— g p i ^ g iiaj
-
o O xijo «.S^gJ
0
l à y
Joli
tXÎ!
J ^
s-r ^.¿Î'
'' xjijJi&j
G iUil
«
î j À ^
" C\ .
O»
&X£.
^
j,
j^Xjijl^
>
3 Jj.si.Xi
lj.iC
S, s ^ J
(^.«J
? --
^jX)
to J
X
AÏ
S?
eLS>
Ifi
¿ ^ ¿ j
)
—
ir.
Ijj^ -
^
J j i i X-LoLr. J l X i - ¿ L ' L o ^ j j t
s'tir.
I, 1 2 5 .
9
a
xXÉ
i j j ^
^
tfîû^
a
Ulkxi
M -- J-AÀXJ
)l
15'
37"
^LftJ!
ijjlj
^yéyXfj
3 7
TT^TÌ
-
M .
^ ¿ L S .
BCNCLIENEB
I ¿ L ¿ I F
«
O -
«LIILJ
O
—
O O L
, J L
C W B H
^ J L
J J A
ÏT^
®
I ^ T X I '
^ J L
IT®»
U
J
Ä - E L + I
L * I
S Ò ^
S
X Í Í Á J
TC X R .
0
?
T»
^ ' I"""*" ¿ U S I L I J
^ ¿ C
TFA
ILUI
J . J S L ¿ !
B ^
i*
L A * Ï
^
sL¿*JL
I —
°
-
T
O ^ X A ^ J
Y IÍO
I)
CF.
5li-i.il O —
O .
XX
XJ
&
C
C
xj¡
S
ó.
^ I O L
I,
303.
S
¿
^
,
_ I T X ^ J
I
I
O LI^-^O
S ^ ^ ^ ^ U
'
O
^
U
K X & J
U
— 85^—
O ^ O L Ï J
IÎROC'.KET.MAXX
t" '
S I* IxJI^
Í O I J
„ „
Í L G J F ^
J ^ L ^ C
I ^ J ^ I ^ J
L ^ X I K F K L
^j^tafl
„
I T X F J
¿ Ü . ^
V * - " ^
I ^ LÍAÁJ
J J . Ä J
¿
¿Ü^JTJ^
S
KI'O
-FEL-J.
¿ U ^ U ;
^ . A A ^ X J J I
R*
T X J J + I L
I
V I O L
*
S , ^ J L C O
G — J . X » À 5
VÍA
TX.Ï
Y ^ * * }
^JLSL
^
O--
S
XÄftjj ¡>L
¿ÍX
i ^ l
S
Vj — W^
^ ^ G J O L
X-tßylj 0
J#
IWFTJÜLJ
° Ä Ä Ä
*" & — 3
Poeme
didactique
sur le f é m i n i n .
373
Í (jUóiUL
à
c L y J j . 1
Ôa^ÙI
d J i X f )
O.JwJj
^tXs-j.
^ L
¿JÜI
¿
aaJ
^ p k
« I J J I
( 3 J L u
( J X Ä J
ij'^l
J s '
^ K — «
l i ^
J o l )
^
¿
c j j j l
y O j
^¿liif
ikl!
fòt
r
I
ò [
tX*J!
J ^ l i '
jlj^
IJ
¡^AÄ.
^ l ^ L ^ J I
id
^JO
¿LísLo
J.Ï
y j t i i
C^AÂXÏj
ïjyJ&ÂjO
o . j l ¿
^J.ÜJ}
Lg_áÁÍ
l-gJ-Lt
S j ^ t ^ J
¿
o ^ i ï l s
^ á á j l j
^ s U j
S-Àj
l < S . O j t X » - J I
A-S?
IÎ&lVâJ
^ j L o
SS.^JlJ
i^A
2) S i c .
- a y
UJl
ÀA£
Liû J u : '
jvli
'
i l i l i
sLàjoj
^jL+o^Ji
itaii!
x,
i'j.r.li^
^.¿J
/ù^
£
xLA^iï
i ^ Â I ,
LwXstXJtj 3) L e Qâniûs
Jlî
¿ U l i l j
IjjilCj
11e d o n n e (¡ne
¿ L i . ^
il^cjjiî'J'j
11«
376
M.
(JLFTJYI
LS.^
J.Í
ÇJO
B I NCHENEB
IS
I* J
U'ÍÜJT
O-»
HI
*
¿LKFFU!
I^AÄV.
^JLO
D L Á Í
JJLG.S-^JT
ÍJ^OXM — Y ^ÄRLI
«IF!
') LU
ÉLJ^JJÍJ
SL.
5 O^ÜS.
XJJ
XIJUAJU
»..LXJF
^ Ü
JIS-LJ'J
I^TX^J
FTÍI C J T X Í !
ND
X^AOÄJ
G-A^Ó
(JIIJ-LJL
J Ö
IÜSB
V-AÍJ-E
^ B Í
XXI
,JU'J¿
^ O
¿ ! IJÜÜJJO
I*
L_IÏPL
¿LÍÜJ
¿
CVJJ
Y
I*
JVI
XCJ
^
BROCKELMANN
I,
^ U ^ I
J O J YIA*^A«J
W
GK/O^
IJ.Í'J
ÓAAJ'LXJI
ÄJ
I^JUUÍAMIÍ
L 4 S Ü Í
¿¿¿J>
CYJJOT
ÜÜÍ
LG.J^.0
^5!
100.
B Y T E
¿JLCXS^
GLÁ^VÁÍ'
SU»
PI'
^ " ^ J
LWLÍJJ
LS\¿
1) SIC.
ILOLAFIJ!
V^MJ
^Ó^JÜ
O^JÍI-I
¿
T^OT
XLLIB
JA.^,
BEILI
LDL
J I ^ Ä
XJVAX^J _
2) C f .
¿JLJ-S"
L*JL_O
Í
Í.L*UJJJ
P«»
I
SOLAJ
^JIAJ
JV¿
UDÌ
Ü.J!
2)
^ F J
¿
JYS O*A
377
P o c m e didactique sur le féminin.
ÒkXjLiJJ joLìó'
o
^jl
IûjUUI
^jli^
J (Jj
J
G
^
,jl
jj J
xcl+i
^ U - w y
Ci J g fo/O ( j j L i ' X k x i
f
i
¿fôjlj
•*»
-
LVÏ
^ ¿ ' 1
-hj
0 fi J—«Li».
-óo
I
0
Jsììa^I. * o—
^ÌSS^j
L
i
£
J^IAAAÓ
^ÀJ
JL>J!
t
l i a -
idiij
| * L A S
t^cl^
^JIÌ
^xLc,
¿'^^j'
poète et compagnon du Prophète,
s'est livrée devant Haibar.
0
J l ^
¿ J l s
t» - - 0 * °
- —
ViAjlÀjt
tXi'j
o i ï j
lòl^
S j + A -
d j J i X i
¿¿.skis
Cf. Ibn * A b d a l - B a r r ,
K i t .
Jo
ci
Ì\XMJ 8
\ M j £ . X J j
CH^ii
t) Il se peut que l'auteur ait eu cil vue ^jLàau I ^.j
9
G
^.X! JaiOj v i l j y é j
^¿¿J
svl^j
Lot
cjl^JaJI
G
(Jol-vJ.,«
—
o
O^j^O
> "
^
1319, II,
fi
s
U > s !
" «•" Cr J ^^¿.»Jli
le^l
-wXtfj
-
ti
-
j o j
CJj-ftS' ^-xii.
jl
iJLjlj
-
lycjt
il
X
«i
j ^ j l
òòj-J!
£
> 0
yoLc.
o JuùJt
^
^wêU
is'Jv.^1^
ULwiS»
«iti
¿1
^IjjSÍX
o
J
i) Sic.
G ^ ó^jjjo
JojÍJf
!¿u
Sí-, (JJJD
— g EU.au ( J ¿ y
® > J
0
m is^y
I • '
•»» o
i'fii J
'^
)
Pf*
0
J G • U** • ^
8
-oj »*£J-| »Schakal« = Heuler zu stellen, geht nicht gut an. So noch, aber mit Fragezeichen, GESF.XIUS-KAUTZSCH
N. Khodokanakis
3«4
der eben auch mit Lobpreisungen (guter Nachrede,
evioyeiv)
verbundenen Dieses hebr. "On h ä n g t , und
trotz n, ohne Zweifel mit
zusammen.
Sunntt
Dieser W u r z e l k o m m e n die
B e d e u t u n g e n zu: »wiederholen, erzählen, preisen, lehren lernen« u. z. nach Sprachen in folgender V e r t e i l u n g : bisch:
I. »doppeln, falten«
(ebenso
—
Ara-
II.
I V . »loben, preisen«; 2UJ »Lob, Preis«; doch angeblich auch »tadeln« und »Tadel«, 1 ) da es eigentlich »wiederholte V e r kündung,
Verbreitung 2 )
einer guten
oder schlechten A u s «w
sage« bedeute; bräisch
vgl.
9
111:
Hamäsa
H3B' »wiederholen«. T T
—
— Aramäisch bz 1
He-
»wieder-
holen, erzählen, rezitieren« 3 ), weiterhin »lernen, lehren«, v g l . K3FI »Traditionskundiger, Misnalehrer«,
]aPl »wir haben g e -
lernt« (zur E i n f ü h r u n g eines Misnasatzes),
KJJFI »es ist g e -
lehrt worden« (zur E i n f ü h r u n g einer Baraitä). 4 ) r i s c h II, i
»wiederholen, ankünden, melden«.
—
Assy-
D i e Grund-
b e d e u t u n g (vgl. das Zahlwort für 2) dürfte sein: »zwei-mal, zwei-fach sein, bzw. machen«; daraus entwickelte sich: wiederholen
verkünden
rezitieren
I (Jud. V , 11. ^n) preisen (v^JI ^
I = ) tan (Jud. X I , 40)
1) J j l
I lehren, lernen.
LMi»^ ÄJ (Lisän,
s.
]an,
I
(=
^t ^(Xx ^jjo ^ L y j ü l ÄJ oi^aj" Lo ¿L&ll
v. XVIII, 134).
2) (j^LÜt £ 3) Nör.DEKE, Neue
cujj)
-T
^g! J > k i s L u j l i s tXäj cb(l. Beiträge
4) H . L . STRACK, Einleitung
S. 77. in den Talmud
S. 3.
Zu arabisch
385
rti.
Vergleichen wir diese Bedeutungen der R a d i x
und ihrer
nordsemitischen Entsprechungen (einschließlich
, 3n
Jud. V , 11;
X I , 40) mit den schon vorher gewonnenen Bedeutungen von so ergibt sich ein auffallender Parallelismus in ihnen bis auf Eines: was ich als die Grundbedeutung von fehlt, wenigstens explicite, arabisches
a)
der R a d i x ^y
ansehe,
Hält man aber
b) «Ä-^Ls? JÜLcj
zusammen
mit a) |Jz »rezitieren, erzählen« J5.H etc., b) mit Sunnü »verkünden, melden«, ^ j I
»loben«, so läßt sich auch für ^ ¿ j ' )
»jemandes L o b wiederholt verkünden, ein Hadit tradieren« als Grundbedeutung »zweifach machen, w i e d e r h o l e n « vermuten, von w o aus die in der Sprache explicite Bedeutungen sich ähnlich wie bei
erhaltenen
abgezweigt hätten.
A u c h aus den, besonders der arabischen Sprache eignenden, Wörtern mit Gegensinn, über die unlängst NÖLDEKE in seinen Neuen Beiträgen
so ausführlich gehandelt hat, läßt
sich für diesen W a h r s c h e i n l i c h k e i t s s c h l u ß vielleicht eine ^j Stütze gewinnen. bedeutet »schwach sein«, aber ist auch soviel als
C>y) und
II, III, I V bedeutet »falten, doppeln«; und so wird lA_äjuä parallel zu V ^ ä j verwendet: Lisän & öS KÄxcLäj'
^ ¿ J ! SLüI
s. v. X V I I I , 124: ^ ¿ j ' j ,
und 125, 6 unten
^JLXM
E s ist nun merkwürdig, daß die R a d i x wir, dem
iS ÄJ
zu der
analog, eine Bedeutung »doppeln, wiederholen«
1) I. F o r m w i e in 2) Lisän
(jLij'bllj
s. v. X I , 108 unten: i_AA,«o
Zeitschr. f. Assyriologie, X X V I .
= 2
5
386
N. Rhoclokanafcis
angenommen haben, mit >-ä*-ö auch im Sinne von »schwach sein« eine semasiologische Berührung aufweist. Das mögen folgende Belege aus Lisän und jjÄi
®
äUjj
SJJC\
zeigen:
¿ j , schließlich
i-ft*.*iJI xajjJIj sxjjJ! c
*
>
(*j.aj
-uf-
s
>
-
In d i e s e Kategorie (ja nicht zu ^iyyjl ^ j j ) gehört auch ¿d == iJ i ^ 1 ) »nachgiebig, nachsichtig, mitfühlend, barmherzig sein; milde verfahren«. Vergleichen wir diese, in den Glossen mit vjüuö paraphrasierten Anwendungen von ^¿^ mit jenen, in denen es sich semasiologisch (in der schon übertragenen Bedeutung des »Lobens, Berichtens, Tradierens«) mit der R a d i x berührt, so wir ein Ansatz = »zweifach sein, machen« bis zu einem gewissen Grade wahrscheinlich. In Hinblick auf aram. ^ A mehr! tru, soqotri tro, shauri tro gegen W'iW und den semasiologischen Parallelismus der hier behandelten Wurzeln ist die F r a g e zwar gewagt, aber immerhin schwer zu unterdrücken, wenn auch noch schwerer zu bejahen, ob schließlich HIST, dazu D^tP = p n ) und ^ ^ nicht — allerdings sehr alte — R e flexe ein und derselben, eventuell zweiradikaligen, »Wurzel« sind. Bei ¡^-ij müßten wir zum Wechsel der Sonorlaute n-r n
noch die Metathese tr > rt annehmen, was eben recht mißlich ist. Ich möchte mich auch dagegen sträuben, bei dem allen altarabischen Lexikographen neben bzw. jJij als geläufigen
oder
2
) (auch ö ö kommt vor,
eventuell also zu einer R a d i x ni) eine Metathese aus 0) 1) »Zu gunsten jemandes schwach sein«; Lisän XÄ+ä.) j J o u o j .
2) S. ob. p. 382.
^ ^
s. v. X I X , 23 auch
Vgl. W Z K M X X V , 82, N. 4. Vgl. Lisän
s. v. X V I I I , 134, 4 unten (Ibn el-'A'rabl):
Cö». J l s
JLäj.
Zu arabisch rti.
3^7
zu vermuten, Das ist eben alles, wie so vieles in der semitischen Wurzeluntersuchung, unsicher. Nun kehre ich an den Ausgangspunkt der Untersuchung, zum Dfäri zurück. Pag. 74 ult. meiner Texte (Südarabische Exped. VIII) kommt als änaf Xeyoaevov in einem Verse vor:
sidd härbak: - uel-haiat tarti-lah. Ii — Zu *J ^ i y
die Glossen:
sl^-l ^ ä j ! b ! J j u bl ' Lg.jjii».
Also doch wohl zu übersetzen: »führ' kräftig deinen Kampf und laß beiseite (achte gering) das Leben«.1)
Dieses rti^ ist
zu (^J) — oijuö »nachlasssen, lockerlassen« zu stellen; etwa: »klammere dich nicht, halte nicht gar so fest an deinem -o* S > ' Leben«; vgl. ^ i j I »ein Schwächling; jem., der etwas 1 0 ' ci nicht fest durchführt«: ' y !
J). Zu beachten ist, daß in
dem herangezogenen Verse rti neben sdd vorkommt, ganz wie in einem Lisän s. v. ^Jj und I j o citierten Verse des A b u N u f r a y l a (s^-w> ' ^
Si
t
-- o--
') L>
(j, i- ,
, -
ytfX^JLj
^J^fjO
^AflXo
xJ
[^iJ.iJ!
^
^ - ^ ^ ¿ J
^ ^
u^LJ ,
Lo
U
„, O
Loj^Lo
,
(jo'tX^JI
u~.ll
isL^
1
^¿LLJ
s
3)
¿l^aJLj
j
c
- )
^jOjikj'
i=LJ!
olil]
6
)
LaAS» iwftXJ I Xx-Lc lit
(JC^LjO
7
«1
I
J
JI
i
c
y
i
¿jmI
)uoS —
V
i
8
9 o> \J~*+ jC
S
392
C. J. Lyall, > jf -
JoLiSl
= Metre. jjL>\
Neither of these features is perhaps decisive as regards the authorship of the piece, which, as already observed, is cited by at least three good authorities on classical poetry. It is probably an early work, even if it is not the composition of c Abid. It may at any rate be presumed that it was already in existence, and admired, when al-Khalil was constructing his metrical system; and it seems likely that he took from it his use of ^si to designate a metre.
393
Über die Bedeutung des Wortes Taschrik. Von Th. W.
Juynboll.
Mit dem Namen »Taschrik-Tage« bezeichnen die späteren Muslime die Tage, welche die Pilgrime in Minä verbringen nach Ablauf des jährlichen Opferfestes am i o. Du'l-Hiddjah.1) A n jedem dieser Tage (i i.—13. Du'l-Hiddjah) wiederholt man Mittags, nachdem die Sonne ihren höchsten Punkt am Himmel erreicht hat (ba'da'l-Zawäl), die Zeremonie des Steinwerfens, die auch am Morgen des 10. Du'l-Hiddjah bereits stattgefunden hat. Die Vermutung D O Z Y ' S (De Israe liefen te Mekka. Haarlem 1864, S. 129—137), daß der Name Taschrik aus dem hebräischen 'ppDH verderbt sei und also einfach das Steinwerfen bezeichne, könnte meines Erachtens nur Beifall finden, wenn man mit D O Z Y als wahrscheinlich annehmen wollte, daß die Feierlichkeiten des Haddj ihren Ursprung den Juden verdanken. Die muslimischen Philologen pflegen Taschrik als ein a r a b i s c h e s Wort zu betrachten, dessen Bedeutung nach der Auffassung der Mehrheit zusammenhienge mit dem Verbum , j j i J M (d. h. die Sonne geht auf) oder (d. h. das Licht der Sonne strahlt). Daher meint man das Wort Taschrik erklären zu können als eine »früh am Morgen zu verrichtende« Zeremonie, eine Feierlichkeit, die begangen wird, 1) Aber in einem Vers des Achtal (Ltsän X I I , 43; 394) heißt auch der 10. Du'l-Hiddjah ein Taschrik-Tag:
jlsXjj
LJ^JMS)
Z e i t s c h r . f. Assyriologio, X X V I .
£
LgX^ljuO
VIJJ+Ö.l
Tädj al-'Arüs (¿1 -0
VI,
LLJ-GJLJJ
Th. W. Juynboll
394
» s o b a l d d i e S o n n e a u f g e g a n g e n ist« oder » n a c h d e m das L i c h t der S o n n e ü b e r die E r d e zu s t r a h l e n ang e f a n g e n hat« (ebenso wie z.B. auch die Verba sabbaha und massä das Kommen, Sein, Abreisen usw. »nachdem es Morgen bezw. Abend geworden ist« bezeichnen). »Auch die Festsalät,« sagen die arabischen Gelehrten, »heißt Taschrik, weil sie früh am Morgen abgehalten wird«.1) Wirklich scheint das W o r t Taschrlk im A n f a n g des Islam in diesem Sinne (also als eine früh am Morgen zu verrichtende Zeremonie) aufgefaßt zu sein. Nur daraus läßt sich erklären, daß die Festsalät (speziell die am Morgen des 10. Dul-Hiddjah, aber auch die des i. Schauwäl) in gewissen muslimischen Kreisen Taschrik genannt wurde. Das W o r t kommt in diesem Sinne mehrmals in der Überlieferung vor: »Wer opfert, bevor er sich am Taschrik (d. h. an der Festsalät) beteiligt hat, muß noch ein zweites Opfer darbringen,« soll der Prophet gesagt haben. 2 ) In einer dem 'Ali zuge1) Mutarrizi, Al-MughrtbfiTartlb al-Murib (Cod. Lugd. Bat. 613 Warn.): CiOtJJs tö!
(jM+.uJf
cXAXJI SJ^LIO ^J^JMUlJIJ
viUö ^jbf CJ^Löl Iii oÖ^mI ^JJO
; Zamachscharl, Al-Faik
(Cod. Lugd. Bat. 307a Warn., S. 597 = edit. Haiderabad I, 320): (Jjj^&jdl L$Äisj ¿JJö (J^i L^il^äl J U j l+S'
¡J^^^MJI
jjiM-ÄJI
(j^o yOj c\a*JI äiLo
^»O Ii! (Jj^-ii ^ÄJI/J
xjK
^-"JCjijJf ^¿tXsB g ^j'l Iii (gJMjj (vgl.Lisän und Tädjal-Arüs, a. a. O.; Ibn al-Athlr, Nihäjah II, 215). 2) S. Faih, a. a. O.: ^f J^aJ ^ | tVjuuLs (J^J^ijJi ^jjO JuulII S^Lo (vg'- Lisän, Tädj, Nihäjah, a. a. O.). Die muslimischen Pilger müssen die Zeremonien des 10. Du 1-Hiddjah also anfangen mit dem spezifisch muslimischen Gottesdienst, dem Festsalät, oder wie der Prophet nach der tÜberlieferung gesagt hat: !j.S5 ¡j, ÄJ l j u j Lo J^t ^yO [var.: ^a^Xwa+JI XjLä] IaÄÄau u L o l ÖJÜ xAjti
. ..
Über die Bedeutung des Wortes Tasclmk.
395
schriebenen Überlieferung heißt es in allgemeinem Sinne: »Der Freitagsgottesdienst und der Taschrik (d. h. die Festsalät, auch die des i. Schauwäl) dürfen nur an größeren Orten (nämlich nur dort, wo eine genügende Anzahl Muslime sich daran beteiligen kann) abgehalten werden«. 1 ) Auch die Musallä wurde daher Muscharrak (d. h. Stelle des Taschrik) genannt.2) Dieser ganz eigentümliche Name ist jedoch gewiß nicht erst von den Muslimen erfunden. Schon im Heidentum muß es einen Taschrik gegeben haben. Die Festsalät war ein i s l a m i s c h e r Taschrik; was war aber der a l t h e i d n i s c h e ? Nach einigen muslimischen Gelehrten soll das Opfern am Morgen des 10. Du'l-Hiddjah Taschrik geheißen haben; 3 ) nach anderen bezeichnete Taschrik im Heidentum das Hersagen der Worte: »Aschrik Thablr, kaimä nughir!« (vgl. |*J ^"OJ ¡jjl tX*J (Buchau, Sa/ii/i,
^.X+A^+Jl IiXjM Al-Adhähi, BSb i). 1) Faik, .1. a. O.: axLs. y^a/>
Ül ^yiyi^S i f j
b) (vgl. AV-
häjah, Lisän, a. a. O.).
2) Lisän, a.a. O.r ^J^Ä+Jl
JLäjj [juuJt S^Le (^J^jäjdl] Jt
Xxi
^tXJI
. . . oijUaJI
(jjjAw^JI JyJuo J ¿JJtXS^ ( j j ^ & J I o i j e i !
(JJj-Ä+JI J ^ j ' j u^+xü! (^f ifj LüXiaxi ^^a+Jf
^jlji.!
J y J Ü pij
tX*j xks ^^-c
Ju^ij ^.JtXx*Jt
JLäjj ^jil ¿UL\J
xX+j cXa*J| JwÖj (vgl. Tädj, Ni-
häjah, a. a. O. und die Stellen bei Jäküt und BekrT, unten, S. 398, N. 2). 3) Nihäjah, a. a. O.: (^tX^JI j j ^ ¿U j o
pLl] (vgl. Lisän,
a. a. O.). 26*
Taiij,
Th. W. Juynboll
396
T a k b i r : das H e r s a g e n der W o r t e : »Allähu akbar«). Die Pilger pflegten nämlich damals am Morgen des 10. Du'lH i d d j a h in Muzdalifah zu warten, bis die ersten Strahlen der aufgehenden Sonne oben g e g e n die Gipfel der B e r g e sichtbar wurden »so wie die T u r b a n e auf den H ä u p t e r n der Männer«. 1 ) Erst dann fing der schnelle Lauf nach Minä an. D a r u m rief m a n : » K o m m in das Licht der Sonne, Thabir, damit wir [nach Minä] laufen können!«. A b e r die F r a g e , w a r u m denn gerade die T a g e n a c h dem 10. Du'l-Hiddjah die Taschrik-Tage hießen, indem doch die sogen. Taschrlk-Feierlichkeit (die Salat, bezw. das Opfern oder das H e r s a g e n der W o r t e »Aschrik Thabir« usw.) a u s s c h l i e ß l i c h a m 10. D u ' l - H i d d j a h stattfand, lassen die muslimischen Gelehrten tatsächlich unbeantwortet. 2 ) Man darf also annehmen, daß sie den wahren U r s p r u n g der B e n e n n u n g dieser T a g e nicht mehr kannten. 1) Azraki, ed. lywO
WÜSTENFELD
£
, S. 130: u^+^UI ooiJUfi (¿1 ^JCü-
|»JUC L^jK J L c i ! iJ^V^
cjjLÖJ ^j.*.
Nihajah
II, 215:
yjjf. j' (Jjj"^ ^^Jfcfij UxS' (j^+^JI eyÖ
^Jj^aÜI j , J ^ - l
Lgjl J.Ä.JI ^5! ^ i + J
ItX^J ^JIjMXXJI |»Ll ^j! p.-g.-ÖjU yiöy y i ü l i JJ-UÜJ
I^ÄJlä^ (j**•.«¿Jt ^XJaS
j
^c!
y l^j&'j] 0t.A4.Au
^JJAjJU
[jvxJLtfl xJÜ! (vgl. Fä'ii, MutamzT, Lisäti, Tädj, a. a. O.).
2) Fa'ik, a. a. O.: ^sü!
Lgj^f ¿ U j . J
Mutarrizi, a. a. O.:
xJ l*xJ sI+jm Lo ^IxOj
^sUI.
[ ^ . ^ . . ¿ j J ! |*LI] Lg.il
Ü^XunJ Lisän,
j»Ul o ^ - « - j
a. a. O.: L&y
dUJo AJ
i^jjJ l*.0 (vgl. oben, X. 1 und S. 395, X. 3).
LgJli
Über die Bedeutung des Wortes Taschrik.
397
Wenn man nun ins A u g e faßt, daß die Pilger während der sogen. Taschrlk-Tage nur e i n e b e s o n d e r e religiöse Handlung — nämlich das Steinwerfen — in Minä zu verrichten haben, so liegt die Vermutung nahe, daß der Name dieser Tage jener eigentümlichen Zeremonie entlehnt sei. Auch das Steinwerfen konnte ja Taschrik heißen. Zwar wirft man die Steine während der Taschrlk-Tage erst, nachdem die Sonne ihren höchsten Punkt am Himmel erreicht hat, aber am 10. Du'l-Hiddjah findet auch das Steinwerfen ebenso wie das Opfern und die Festsalät früh am Morgen »während des Strahlens der Morgensonne« statt.1) Daß die heidnischen Araber das Steinwerfen wirklich Taschrik genannt haben, wird in den arabischen Wörterbüchern zwar nicht ausdrücklich erwähnt, aber das in einem zur Erklärung von Taschrik angeführten Verse des Abu Du'aib 2 ) vorkommende Wort Muscharrak kann nur die S t e l l e bezeichnen, w o das S t e i n w e r f e n s t a t t f i n d e t . Dieser Dichter, der ein Zeitgenosse des Propheten war, beweint den Tod seiner fünf Söhne 3 ) und beklagt sich über sein Schicksal, indem er sagt: »Es ist als ob ich für die Wechselfälle des Schicksals ein Steinhaufen geworden sei, der jeden T a g mit 1) Nach PIOUTSMA'S Ansicht wäre das Steinwerfen am
Morgen
10. Du 1-Hijjah kein alter Brauch, sondern eine islamische Neuerung.
des Weil
nämlich diese Feierlichkeit im Heidentum während der Taschrlk-Tage a m M i t t a g (ba c da'l-Zawäl) begangen wurde (vgl. Ibn Hischäm, ed. WÜSTF.NFELD, S. 76 f.) und an diesen Tagen nur eine N a c h a h m u n g
der Zeremonie des 10. Du'l-
Hiddjah sein konnte, so muß sie damals a u c h am 10. D u ' l - H i d d j a h Mittags z u r s e l b e n Z e i t (also ba'da'l-Zawäl) stattgefunden haben, meint er (HOUTSMA, Het skopelisme Kon.
Akad.
en het steenwerpen
v. Wetensch. Afd.
te Mina,
Letterk.
in Verslagen
en Mededeel.
4. Reeks V I , 1 9 7 — 1 9 9 ) .
v. d.
Der Grand
für diese Annahme scheint mir jedoch zu schwach. 2) S. die Literatur bei DOXY, a. a. O., S. 1 3 5 ; poesis et poetarurn,
vgl. Ibn Qotaiba,
cd. DE GOEJE, S. 345 und unten, S. 398, N . 2. —
Vers lautet:
3) Vgl. Aghäni
V I , 58; Jäküt,
ed. WÜSTENFELI) I V , 539.
Uber Der
398
Th. W . Juynboll
dem Stein des Muscharrak 1 ) getroffen wird« — d. h. also ein Steinhaufen an der Stelle, w o die Taschrik-Zeremonie stattfindet, der nicht nur beim Haddj, sondern sogar j e d e n T a g mit Steinen geworfen wird. Die Ansicht der arabischen Philologen, daß hier mit Muscharrak eine beliebige »Stelle der Festsalät« (Musallä) gemeint sei,2) kann nicht richtig sein. Der Islam hat den uralten Brauch des Steinwerfens, den er nicht austilgen konnte, gewissermaßen in eine muslimische Feierlichkeit umgestaltet durch die Vorschrift, daß der Muslim bei jedem W u r f e den Takbir (die W o r t e : »Im Namen Gottes, Allah ist groß!«) aussprechen muß. Die Ansicht des A b ü Hanifah, daß der Ausdruck Taschrlk eigentlich den Takbir bezeichne, 3 ) muß sich meines Erachtens auf diesen Takbir beim Steinwerfen bezogen haben. A u f Grund des oben Gesagten dürfte die A n n a h m e nicht ganz unberechtigt scheinen, i. daß die Zeremonie des Steinwerfens (speziell die am Morgen des 10. Du'l-Hiddjah) im Heidentum Taschrlk genannt wurde, 2. daß man unter diesem Namen im A n f a n g des Islam in gewissen muslimischen Kreisen die Festsalät zu verstehen pflegte, weil auch diese muslimische Feierlichkeit »früh am Morgen nach A u f g a n g 1) Vielleicht ist Muscharrik zu lesen, d. h. mit dem Stein des »Steinwerfers, der sich an der Taschrfk-Feierlichkeit beteiligt«; vgl. Dozv, a. a. O., S. 136 f. 2) Jäbüt,
ed.
WÜSTENFELD IV, 539: J l s Äjt KJAM
tX£\jC ^ÄXJ ^¿IS'
ÄU>M.II!
I^jf JLüi XAÄJ ^.S'IJO
li)L»w Oj-sl C^Skj-i-
XJJJÜ
V»)^
SLJIJ
; Vgl. Bckri, ed. Wüstenffxd II, 560 f.:
Mi.
^UJLxJI y d * j
. ^ J l ¿jol^.^..' ^ j K 3) Tällj,
a. a. O.:
HjjSÖ
iJijÄ/o J^ojc
JyS ÜJuJ.^-
(J^Ä+J!
JSJ
XÄAJU [juöyo ^j!
(¿jKj
Joy^C-
^jjlXAJIJ! SjJai
Äxi
^jl
JLi'
Über die Bedeutung des Wortes Taschrik.
399
der Sonne« begangen wurde, 3. daß aber das W o r t Taschrik sich später nur erhielt in dem Ausdruck A i j ä m al-Taschrik, d. h. eigentlich die Tage, an denen das Steinwerfen — der altheidnische Taschrik — nochmals wiederholt wurde (sei es denn auch nicht am Morgen und nicht nur bei dem Steinhaufen der 'Akabah, sondern nach dem Mittag und bei den drei verschiedenen Steinhaufen in Minä). Taschrik heißt bekanntlich auch: Fleisch in Streifen schneiden und in der Sonne trocknen, damit es sich halte. Daher begann man, nachdem der Ursprung des Namens vergessen war, den Ausdruck A i j ä m al-Taschrik aufzufassen als: die Tage, an denen das Opferfleisch getrocknet wird.') Diese scheinbar ganz einfache Ableitung des Namens kann aber meines Erachtens nicht die richtige sein, weil sich dann nicht erklären ließe, warum die Festsalät anfänglich Taschrik geheißen hätte. A u c h in dem oben zitierten Verse des A b ü Du aib bezeichnet das W o r t Muscharrak gewiß nicht die Stelle, wo Fleisch getrocknet wird. 1) Vgl. z. B. Lisän,
(j'j-cio ^^Läbfl
a. a. O.:
...
g j o j j ü j XAxiaÜJ rLl
(Jj.Jj.iiJj
ouytiu xijoj xi
400
Von T. J. de Boer.
A n verschiedenen Stellen meiner Geschichte der Philosophie im Islam (1901) habe ich den Einfluß hermetischer Weisheit auf die Entwicklung der islamischen Gedankenwelt betont. 1 ) Mit ZELLER2) nahm ich damals an, diese Weisheit, sofern nämlich Philosophisches darin, stamme hauptsächlich aus der platonisch-pythagoräischen Schule her. Im ganzen ist das gewiß richtig. Seitdem sind aber die vortrefflichen Studien REITZENSTEIN'S 3) über die hermetische Literatur erschienen, die ZELLER'S Ansichten vielfach berichtigen und den Zusammenhang des harränischen sogenannten »altsemitischen« Heidentums mit hellenistischer Mysterienreligion, speziell mit der yvmaig hermetischer Gemeinden aufdecken. E s dürfte jetzt wohl klar sein, daß vieles von dem, was ich als »neupythagoräische Naturphilosophie« oder als »platonische Weisheit« (z. B. bei R ä z i , den Lauteren, usw.) bezeichnet habe, durch das hermetische Schrifttum vermittelt wurde. Eben diese Weisheit, die in innigster Verbindung mit Astrologie und Alchemie vom Hellenismus übernommen wurde, hat von A n f a n g an und bis auf den heutigen T a g im Orient viel tiefer und in weit größerem Umfange gewirkt 1) S. S. 20, 27, 151, vor allem aber S. 69 ff., wo bloß der Name fehlt. 2) Die Philosophie der Griechen III, 23, S. 224 ff. 3) R . REITZENSTEIN , Point,mdres. Studien zur griechisch-ägyptischen und frühchristlichen Literatur. Leipzig 1904. Vgl. jetzt auch desselben Die hellenistischen Mysterienreligionen. Leipzig und Berlin 1910.
T. J . de Beer, ^ t ^ j l .
4°I
als die mehr oder weniger neuplatonisch bearbeitete peripatetische Philosophie. Das braucht dem verehrten Meister und Freund, dem dieser Beitrag gewidmet wird, nicht gesagt zu werden.1) Es wäre nun eine verlockende Aufgabe, auf die sachlichen Zusammenhänge zwischen hermetischer yvcöaig und den im Islam verbreiteten Philosophemen, die man vielleicht am besten unter der Bezeichnung »Offenbarungsphilosophie« zusammenfaßt, näher einzugehen. Leider muß ich mir das jetzt versagen. Ich möchte bloß versuchen, den dunklen Namen, der an der Spitze hermetischer Tradition im Orient steht, aus dem ursprünglichen Vorstellungskreis heraus zu deuten. Nach unseren ältesten Quellen heißt der erste in der Prophetenreihe, von dem die harränischen Sabier ihre Offenbarungsweisheit herleiten, Wir können diese Tradition zurückführen auf al-Kindl (gest. nach 870) und seinen Schüler al-Sarahs! (gest. 899). Nach ihnen berichtet der Fihrist, S. 318, die berühmten Lehrer der Sabier seien Ij'ltl) und Hermes, denen einige noch 'Ayados daifuov Solon hinzufügen. Dieselbe Reihenfolge bietet al-Jacqübi (ed. H o u t s m a I, S. 166; er schrieb 891), wo er über hellenistische Sabier redet: ¿UÜJCiS'
^jjc jviiji.*;} ¿JULo
^ - y ö l i j j J f ¿JjJ-e
l^j^j ^AAjLaJ! (1. Ä x A i l ) l l o
^
JLfiJj ¿UJ^ÜÜ ö d ^ J I ^.ffj
J^c p-gjjo ¿¿¿jLks
ijJL^ OySkj
^jjl^l (JsA>
Damit stimmt die Überlieferung bei al-Mubassir (schrieb 1053) in seinem Mufytär al-hikam wamaliäsin al-kalim.2) Der Kultur
1) S. I. G01.D7.IHF.R, Die islamische und die jüdische Philosophie (Die der Gegenwart I, 5), S. 51 f. 2) Handschriften Leiden, Nr. 1487 und 1488, und Berlin Nr. 7859.
402
T . J . do R o e r
erste Abschnitt dieses W e r k e s handelt vom Propheten Seth, dessen griechischer N a m e der erste ^Kj!
Jj^l:
at+^l
Cod. Leid. 1487, fol. 3).
U n d im zweiten A b -
schnitt (ibid., fol. 4 verso) lesen wir folgendes:
^¿j
sxiLwj
L*Ä>0 LjiJuC OjUae
«JwXc «JJt
jÜJlX«
(jj^jyo^l
£
^^Ü! itwil^l
«j.®
^XXJOJ
^AAjlj^JI O^L
^it.
j^l
löjJI
JaÄi ^.ao^JI J j c I
J-üii
^jJI
piLJI
vJuJCJI
^ .i
ÜX-Lt
^LijJaJf
(jLi^io ».*.
o [l. JAJUÖJI], gemeint ist al-gänu [1. algämi~\ al-$agïr von al-Saibänl (s. m. Lit. I 172). E s fehlen zu A n f a n g Süre 1,—2, 3, nach fol. 68 Süre 1 0 , 7 4 — 1 1 , 6 5 , nach fol. 175 Süre 5 9 , 9 — 7 2 [I.74], 41, nach fol. 176 Süre 76, 1 6 — 1 1 0 . Vollendet an einem Dienstag im R a b f I [1. II] 975/Sept. [1. Okt.]
C. F. Seybold, Gragujefac ^jLiyèSjh..
4°9
1567 unter der Regierung des Sultans Selîm [II 1566—1574] in dem Schlosse [1. Städtchen] xaaüj^cl^Ä [so mit 1.
[Aquifagia
gujevac
statt o !
Eibl. Uff. 1. 1.) [Grägüjefaö
—
Kra-
(c = tz)~\ von Mahmüd ibn 'Abdalgafür, Mu'eddin [?]
an der Hauptmoschee des Mustafa Beg. 177 Blatt, 2 7 : 1 8 , 19 : 11, 17 Zeilen, [nicht] stark beschmutzt und abgegriffen, in abgenutztem orient, [schwarzem] Lederband mit [der üblichen floralen Tief-] Pressung [in der Mitte der Deckel und der Klappe], E x libris Uffenbach (s. Bibl. Uff. col. 701, vol. X X I V ) Wolf.« Außerdem habe ich zu solcher Beschreibung noch folgendes zu sagen. Die stete Wiederholung von »mit Pausazeichen, am Rande Einteilung in »ji*-, V)^* und ^¿-fc« u. ä., welche bei BROCKELMANN meist die einzige Beschreibung einer Qor'änhandschrift ausmacht, ist deswegen ganz nichtssagend, ja fast unnötig, da fast alle Qor'änhandschriften dieselben Beitaten haben, so daß eigentlich im Gegenteil nur das Fehlen derselben in einer Handschrift zu bemerken wäre (vgl. nur NÖLDEKE, Geschichte des Qorâns S. 323 und 353). Dagegen hätten die viel selteneren ü - B e m e r k u n g e n am Rande fol. 56 b , 7 6 a, 89 b , 95% s s i44 b a - d j y StM? und 113 b und 153* v^»'.? (mit Angabe von Süre und Vers) notiert werden sollen, besonders die oben erwähnte türkische SiX^-Note, die freilich in ihrer Kursive nicht so ganz leicht zu entziffern ist fol. 56 r zu Süre 7, 205 : ^ÄÄ-LÖ. yi ¿LUuk+S'jJ tS jO yj ^ÄjyoLi». dbyLCjl StX^1 yi ¿JjIäj! yi XsîU
ySD Jj' ^Ui
OkÄ-l^j XjJsj! ^jJ SiXXnij yo 3
5t\j! JyjJi
oo!
(J^f (^tXJ^f (^y! L> «Jïi'jl jjO^J
jjZw
V^aô-IJ L^àjo itLÜj x-àJ^i L$Juo üxam SiX^ J-xjl^wf ^Juj JÄUI^ tX^yt^ oI^Ä^I Zeitschr. f. Assyriologie, X X V I .
^lyül Lg-00 27
^jlj
4 IO
C. F . Seybold
sj.iO StXiäS' 4^
SÖ^
(Jtj ^ j l i - i J l j ¿LJLIjJ StXiß j L a J I j ' ¿ f .
J J Ü iü-w
V^l? y + x l J!
[^xUl]
Dabei ist zu bemerken, daß das arabische Zitat im gedruckten algämi 1 alsaglr, Büläq 1302 am R a n d von A b u Jüsuf's kitäb ALFACIT-AG sich nicht findet, was B R O C K E L M A N N hätte verifizieren müssen; ebensowenig verweist er auf die in Hamburg 55 vorhandene Neubearbeitung des algämi' alsaglr, was doch hätte geschehen müssen, selbst wenn das Zitat auch da sich nicht findet. Zu den aus alBeidäw! stammenden, an den A n f a n g der Süren gerückten Prophetentraditionen müßte bemerkt sein, daß sie oft Varianten zu FLEISCHER'S T e x t bieten, wie z. B. zu Süre 76, fol. 17 6 b : \JOY2*
¿OJLvJj ¿ U i ! [äjpl^ö.
^«¿Ls
Zu Süre 3
yitXJI
IYS
—
Statt des vielfach ungenauen Auszugs (oben) des Kolophons hätte dieser fast als das interessanteste am ganzen Qoränkodex vollständig gegeben werden sollen: 0 0 w OLJJI
OÜUÖI
ijl
_LÄÄJ! *»» jV^jjJI^J.
LX)
» X-U!
UllLiXw.^JI^
YS.
^xääJI v^fiöc ^^iiJI ^.J ^.A^J.^v.+Jlj
^.¿J^cfj-ft iu^aä £ ^¿SA^AX JYJJUOJ
PJ^-JA
^
¿IÄ*JI . ' ¿>.laJJ' XJj iUsfcj
l^jLuO^JIj
^^nJ!
OLJJ
^OLÄ. [JÜÄ 1 JM*J
xJJI ^ y u
SJ^J
^«A+^-J
^AÄXJ+JI
Lti^'J!
£
= ] JjjÄÄo^-wJ >J»ÄÄJI
iüJj^
s^x.
Grägujefac
4
yt-.
1 1
Zu beachten ist die schlimme Verwechslung des östlichen und westarabischen Sprachgebrauchs von ¿U^oü : festes Schloß, Zitadelle, Qasba, alcazaba im Maghrib und Spanien, kleinere Stadt, Städtchen im Türkischen, Persischen und Hindüstäni (vgl. nur SAMY'S Dictionnaire turc-français-, ausführlicher S A M Y i m Qämüs
i turki
u n d B A R B I E R DE M E Y N A R D ; B E A U S -
SIER etc.) DADICHI richtig »in oppidulo«. Zu Aquifagia, das blind aus UFFENBACH'S gedruckten Katalogen übernommen wird, ist noch zu bemerken, daß die latinisierte Form mit q auf das Konto von UFFENBACH resp. MAJUS (vgl. Z D M G 64, 594) fällt, während DADICHI'S lateinisch eingeschriebene Notiz Aguifagia aufweist, welche zeigt, daß DADICHI nur am A n f a n g des Wortes unterschlägt und den Rest mit Aguifagia wiedergibt, was BROCKELMANN nicht gemerkt hat. Im Index S. 225 hat dieser vorn ein eigenmächtiges t hinzugemacht: wodurch der gefälschte Name noch an die falsche alphabetische Stelle rückt; mit Klammer »(Aquifagia?)« gibt er hier wenigstens durch Fragezeichen einem gelinden Zweifel an der Lokalität Raum, die nie und nirgends auf der Welt, weil nur in DADICHI'S Phantasie existiert hat, und welche nach der unzweifelhaften Identifizierung mit Kragujewatz ihre prekäre Existenzberechtigung ein für allemal verliert. S. 240 fungiert Aquifagia nochmals (ohne Fragezeichen). Zu vergleichen ist noch für die ältere Form die aus dem modern Serbischen übernommene in SAMY'S Dictionnaire Universel Qämüs ula^lätn (V) 3608 W a s nun die Endung betrifft, so könnte man versucht sein, das Schluß-c mit kurzem Hacken statt der gewöhnlichen Bogenrundung am Ende = c + h zu nehmen, also statt
zu lesen, was sogar der gewöhnlichen tür-
kischen Form serbischer Eigennamen fast mehr entspräche (serb. -vac =
zvatz, sonst kroatisch etc. =
MOSTRAS, Dictionnaire
géographique
witza), vgl. nur
de VEmpire O T 2 !
Ottoman +
412
c. F. Seybold
(1873) S. 160 XÄsy£*»J Leskoftscha, Leskovatz,
161
Loftscha, Lovatz,
Drinowatz,
S. 170 i i Ä i y i L o
S. 90
saJ^-o^O Drinoftscha,
Melkoftscha, Milkowatz,
S. 164
Doch spricht die Schluß-
Mitroftscha, Mitrowitza u. v. a.
form ^ eben in obiger R a n d b e m e r k u n g fol. 56 1 in ^ und ^ in der Randnote 114 a in kürzung rot ^
=
, sowie die häufige Pausalab-
^ =
für
nicht
so daß wir
hier die serbische Form ganz wiedergegeben vor uns haben g-iu^el^c K r a g u j e v a c .
Diese alte serbische Metropole und
längere Zeit kleine Residenzstadt finde ich auch in dem ganz oberflächlich beschriebenen Rechnungsbuch des Ministers des Auswärtigen (nicht: »eines höhern Finanzbeamten«) R e i s el kuttäb
oder
Reis
itsxijÄjÄ
Efendi,
Lei
im Breslauer
Türe. 46, 402 b :
U L ^au-s«. v^xJjj", w o zweimal nach
einander ¡ t a i j t j i aus
kontrahiert aus « Ä Ä j ^ i l j i
verschrieben sein muß. Den Schreiber unseres K o d e x kurzerhand
zum
Mustafa Beg«.
»Mu'eddin
an
macht der
BROCKELMANN
Hauptmoschee
Dies liest er aus dem türkisierten JAÄÄO^«J heraus, über das er uns keinerlei
*QJC
schluß gibt.
des
Auf-
W i e schon oben angedeutet, nehme ich letz-
teres als ¿AJ ^ I x t a x zur Seite {y*u auch =
JJÜ? yMi
=
am K o p f
oder
VULLERS) der Galerie der
Gämi c des M. B. Zur türkischen Verlängerung ( j ^ i ^ vgl. oben = «
1
und öfters
"®
(vgl. H a m b u r g Nr. 274)
=
^
u. a.
Mit dem Mahfil k a n n die Galerie des Mueddin
in der Moschee gemeint sein, dann ist BROCKELMANN'S Dekretierung »Mueddin« vielleicht richtig; es kann aber auch
Grägujefac
4T3
^j^ybSyS..
eine andere Galerie sein, auf oder neben welcher der Schreiber kopiert hat; vgl. Hadlqat ulgewämi (Konstantinopeler Moscheenbeschreibungen), Stambul 1281 II 33: ¿LüjXbj^ä
xiaJLc [^juoIÄ. ^-Jj-fc]
jJ^jJ cs^^
t
A m R a n d der Kolophonseite fol. 17
findet sich noch
abwechselnd schwarz und rot ¿ I ä i—JjJIj ^^-«oIä (vgl. dazu P e r t s c h , Handschriften,
Verzeichnis der türk.
Berl. S. 581) und
.j-Li+jJ» ¿LgAJI viLojj XÄAwf ^M jksL+zö lXJOK
iS^y
^^
414
L'alternance vocalique a-u (a-i) au parfait du verbe régulier (Ière forme) dans le parler arabe de Tanger. Par W. Marçais.
On peut distinguer, en tangérois, deux types généraux de flexion, pour la conjugaison du parfait du verbe régulier (Ière forme): i° un premier type est caractérisé par le maintien, aux jères e(- 2 es personnes, de la voyelle de la 3e pers. masc. sing. (a, â, o, e, e, g). C'est, en somme, semble-t-il, le type le plus fréquent dans le parler considéré; ainsi: n"îas naiastr) naî(isti
{
ftâr ft&rX. ftârXi
trokt tr'ôkti
{
»j'ai dormi« »tu as dormi« »j'ai déjeuné« »tu as déjeuné«
»il a dormi«
; n")asna »nous avons dormi« ; na!astor) »vous avez dormi« »il a déjeuné« ; fiàrna ; ftârto
»nous avons déjeuné« »vous avez déjeuné«
t f o k »il a abandonné« »j'ai abandonné« ; tr'okna »nous avons abandonné« »tu as abandonné«; trdkto »vous avez abandonné« kteb »il a écrit«
ktebt
»j'ai écrit«
ktebti
»tu as écrit«
; ktebna
»nous avons écrit«
; ktebto »vous avez écrit« »il a échappé« »j'ai échappé« ; fletna »nous avons échappé« »tu as échappé« ; fletto »vous avez échappé« flet
flett
fleJXi 1) Dans le présent article, t est employé pour transcrire ts affriqué, 1 pour transcrire l emphatique; o représente une voyelle intermédiaire entre « et o fermé.
W . Marçais, L'alternance vocalique a-u (a-i).
flçb f\çbt
415
»il a demandé«
»j'ai demandé«
ftybti »tu as demandé«
; flçbna
»nous avons demandé«
; f\gbto
»vous avez demandé«
etc. etc. 20 Un deuxième type est caractérisé par l'apparition, aux i è r e s et 2 es personnes, d'une voyelle différente de celle de la 3 e pers. masc. sing. Dans le plus grand nombre des verbes qui offrent ce type de flexion, cette voyelle est u (o); dans un très petit nombre seulement, elle est i\ ainsi: a) alternance vocalique a (à, o, e, e etc.) — u (o) dlj.a.11) »il est entré« dfyult »je suis entré« ; dfoulna2) »nous sommes entrés« dfyulti »tu es entré« ; dfrulto »vous êtes entrés« steolt sî'olti
sial »il a toussé« »j'ai toussé« ; sïeolna2) »nous avons toussé« »tu as toussé« ; sieolto »vous avez toussé«
nqost »j'ai gravé« nqosti »tu as gravé«
nqâi »il a gravé« ; nqoina »nous avons gravé« ; nqoito »vous avez gravé«
nyozt »j'ai piqué« nyozti »tu as piqué«
ny'ôz »il a piqué« ; nyozna »nous avons piqué« ; nyozto »vous avez piqué«
skuti skutti
sket »il s'est tu« »je me suis tu« ; skutna »nous nous sommes tus» »tu t'es tu« ; skutto »vous vous êtes tus« forez »il est sorti«
¡jrnzt
»je suis sorti«
fyruzti »tu es sorti«
;
fcruina
»nous sommes sortis«
;
fyruzto
»vous êtes sortis«
etc. etc. 1) O u thaï avec assimilation de sourdité: d!i 2) Ou dfiunna
(thunna),
sieonna
th.
avec assimilation régressive In >
nn.
4Ï6
AV. Marçais
b) alternance vocalique a (a, o, etc.) — i dhak1
lìab
,
.
\dhikt
;') »il a ri« { „ . , . \4hikU
{
»il a joué«
et hab de ce type.
dhak
heibt heib\i
»j ai ri« ; . »tu as ri« ; »j'ai joué« ; »tuas joué«;
dkikna
,, ..
dhikto lieibna h'ibto
»nous avons ri« »vous avez ri« »nous avons joué« »vous avez joué«
sont, à ma connaissance, les deux seuls verbes
Une semblable alternance vocalique dans le verbe régulier est entièrement inconnue de la langue ancienne. D'autre part, il semble impossible, sur le terrain dialectal, de lui assigner une cause phonétique : l'accentuation, le voisinage consonantique sont exactement les mêmes dans dfaal, stal, sket et dhak que dans dfouit, si'olti, skutna et dkikto. Il faut donc chercher ailleurs l'explication de cette flexion dialectale. Or, en examinant dans le détail, la conjugaison du verbe régulier tangérois, il apparaît: i° que dans les verbes qui ignorent au parfait l'alternance vocalique, le futur offre la même vocalisation que le parfait; ainsi: n"ias ftàr tfok flgb
»il a dormi« ti"ïast »j'ai dormi« »il a déjeuné« ftârt »j'ai déjeuné« »il a abandonné« tr'okt »j'ai abandonné« »il a demandé«
ie\gbt
»j'ai demandé«
iemas
»il dormira«
ùftâr»'Adéjeunera« ùtfôk ùàgb
»il abandonnera« »il demandera«;
2° que dans les verbes qui connaissent au parfait l'alternance vocalique a (à, ô etc.) — u (o), le futur a u comme voyelle radicale; ainsi: dfpal si al nqàS lirez
»il »il »il »il
est entré« dfyidt »je suis entré« a toussé« sfolt »j'ai toussé« a gravé« ngoit »j'ai gravé« est sorti« Ijruzt »je suis sorti«
i) Généralement tfrak.
iëdfpil ùsfol lenqos ùfyruz
»il »il »il »il
entrera« toussera« gravera« sortira« ;
417
L'alternance vocalique a-u (a-i).
3° que dans les deux verbes qui connaissent au futur l'alternance vocalique a-i, le futur a i comme voyelle radicale; ainsi: dhak »il a ri« Ltab »il a joué«
dkikt l'/ibt
»j'ai ri« »j'ai joué«
ùdbik ùlfib
»il rira« »il jouera«.
Il faut renoncer pour le tangérois à une explication totale des manifestations variées de la flexion vocalique de la racine au futur du verbe régulier; on ne peut pas la tenter dans l'état actuel des études de dialectologie maghribine. Pour les verbes à futur dialectal u, il semble bien sans doute qu' on soit en présence de cas de conservation d'un vocalisme ancien ; ainsi : ùsï'ol ùnqoS
—
=
class.
; ùdfyul — class. iM'-tXj !
class. (ji-ft-s? etc. ; conservation
intermittente
et
capricieuse du reste, puisque, pour beaucoup d'autres verbes à futur u classique, le parler offre aujourd'hui un futur
![Festschrift für Paul Natorp: Zum Siebzigsten Geburtstage von Schülern und Freunden gewidmet [Reprint 2020 ed.]
9783111651934, 9783111268231](https://ebin.pub/img/200x200/festschrift-fr-paul-natorp-zum-siebzigsten-geburtstage-von-schlern-und-freunden-gewidmet-reprint-2020nbsped-9783111651934-9783111268231.jpg)
![Aktuelle Betriebswirtschaft: Festschrift zum 60. Geburtstag von Konrad Mellerowicz, gewidmet von seinen Freunden, Kollegen und Schülern [Reprint 2018 ed.]
9783111514970, 9783111147130](https://ebin.pub/img/200x200/aktuelle-betriebswirtschaft-festschrift-zum-60-geburtstag-von-konrad-mellerowicz-gewidmet-von-seinen-freunden-kollegen-und-schlern-reprint-2018nbsped-9783111514970-9783111147130.jpg)
![Karl Wilhelm Kortüm: Ein Lebensbild. Den Freunden und Verehrern [Reprint 2018 ed.]
9783111716282, 9783111154107](https://ebin.pub/img/200x200/karl-wilhelm-kortm-ein-lebensbild-den-freunden-und-verehrern-reprint-2018nbsped-9783111716282-9783111154107.jpg)
![Der Schach-Struwwelpeter: Ein Reimbüchlein allen Freunden des Königlichen Spiels gewidmet [Reprint 2022 ed.]
9783112623947](https://ebin.pub/img/200x200/der-schach-struwwelpeter-ein-reimbchlein-allen-freunden-des-kniglichen-spiels-gewidmet-reprint-2022nbsped-9783112623947.jpg)
![Festschrift Johannes Vahlen zum Siebenzigsten Geburtstag: Gewidmet von Seinen Schülern [Reprint 2020 ed.]
9783112348147, 9783112348130](https://ebin.pub/img/200x200/festschrift-johannes-vahlen-zum-siebenzigsten-geburtstag-gewidmet-von-seinen-schlern-reprint-2020nbsped-9783112348147-9783112348130.jpg)
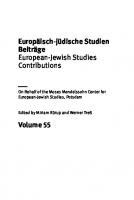

![Festschrift für Carl Schmitt: Zum 70. Geburtstag dargebracht von Freunden und Schülern [3 ed.]
3428079779, 9783428079773](https://ebin.pub/img/200x200/festschrift-fr-carl-schmitt-zum-70-geburtstag-dargebracht-von-freunden-und-schlern-3nbsped-3428079779-9783428079773.jpg)
![Festschrift der Universität Leipzig zur fünfhundertjährigen Jubelfeier gewidmet von der Juristischen Gesellschaft in Leipzig [Reprint 2020 ed.]
9783112365762, 9783112365755](https://ebin.pub/img/200x200/festschrift-der-universitt-leipzig-zur-fnfhundertjhrigen-jubelfeier-gewidmet-von-der-juristischen-gesellschaft-in-leipzig-reprint-2020nbsped-9783112365762-9783112365755.jpg)
![Miszellaneen der angewandten Mechanik: Festschrift Walter Tollmien zum 60. Geburtstag am 13. Oktober 1960 von seinen Freunden und Schülern [Reprint 2021 ed.]
9783112575406, 9783112575390](https://ebin.pub/img/200x200/miszellaneen-der-angewandten-mechanik-festschrift-walter-tollmien-zum-60-geburtstag-am-13-oktober-1960-von-seinen-freunden-und-schlern-reprint-2021nbsped-9783112575406-9783112575390.jpg)