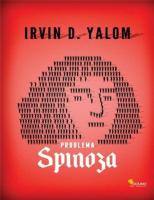Spinoza: Theologisch-politischer Traktat 9783050064574, 9783050060705
Baruch de Spinoza’s Tractatus Theologico-Politicus sought to apply theology and politics to further peaceful coexistence
160 61 1MB
German Pages 288 [292] Year 2013
Zitierweise und Siglen
Vorwort
1.Einführung
2.Anlaß und philosophische Grundlagen des Theologisch-politischen Traktat sowie der Kontext in Spinozas Werk (Vorrede)
3.Prophetie und Propheten im Theologisch-politischen Traktat(Kapitel 1–3)
4. Exoterisches und esoterisches Religionsverständnis im Theologischpolitischen Traktat. „Göttliches Gesetz“, „religiöse Zeremonien“ und „Wunder“ als vermittelnde ironische Tropen zwischen Volksfrömmigkeit und amor Dei intellectualis (Kapitel 4–6)
5.Spinoza und die Auslegung der Bibel (Kapitel 7)
6.Spinoza’s Biblical Scholarship (Chapter 8–10)
7.Das Wort Gottes und die wahre Religion: Das Fazit von Spinozas Bibelkritik (Kapitel 11–12)
8.Der systematische Ertrag der exegetischen Arbeit. Die Schlichtheit der biblischen Botschaft, der Kerngehalt des Offenbarungsglaubens und die Schriftgemäßheit des „weltanschaulichen“ Pluralismus(Kapitel 13–14)
9.Spinoza’s Reasons to Believe (Chapter 15)
10.Die Grundlagen des Staates. Kapitel 16 des Theologisch-politischen Traktat
11.Spinoza’s Respublica divina. The Rise and Fall, Virtues and Vices of the Hebrew Republic (Chapter 17–18)
12.Friedlicher Staat, Religionsgesetze und Gedankenfreiheit(Kapitel 19–20)
13.Der Theologisch-politische Traktat im Kontext seiner Zeit
14.Ausblick: Eine vorläufige Einschätzung
Auswahlbibliographie
Personenregister
Sachregister
Hinweise zu den Autorinnen und Autoren
Recommend Papers

- Author / Uploaded
- Otfried Höffe (editor)
File loading please wait...
Citation preview
Baruch de Spinoza
Theologisch-politischer Traktat
Klassiker Auslegen Klassiker Auslegen Herausgegeben von Herausgegeben von von Herausgegeben Otfried Höffe Otfried Höffe Höffe Otfried Band 54 36 Band Band 45
Otfried Höffe ist Leiter der Forschungsstelle Politische Philosophie an Otfried Höffe ist Leiter der Forschungsstelle Politische Philosophie der Universität Tübingen. an der Universität Tübingen. Otfried Höffe ist o. Professor für Philosophie an der Universität Tübingen
Baruch de Spinoza
Theologischpolitischer Traktat Herausgegeben von Otfried Höffe
Akademie Verlag
Lektorat: Dr. Mischka Dammaschke Herstellung: Christoph Neubarth Titelbild: Porträt des Baruch de Spinoza, Ölgemälde eines unbekannten Malers, ca. 1665, Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, © Wikimedia Commons Einbandgestaltung: K. Groß, J. Metze, Chamäleon Design Agentur Berlin Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data A CIP catalog record for this book has been applied for at the Library of Congress. Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechts.
© 2014 Akademie Verlag GmbH www.degruyter.de/akademie Ein Unternehmen von De Gruyter Gedruckt in Deutschland Dieses Papier ist alterungsbeständig nach DIN/ISO 9706.
ISBN 978-3-05-006070-5 eISBN 978-3-05-006457-4
Inhalt
Zitierweise und Siglen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VII
Vorwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IX
1. Einführung Otfried Höffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
2. Anlaß und philosophische Grundlagen des Theologisch-politischen Traktat sowie der Kontext in Spinozas Werk (Vorrede) Robert Schnepf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 3. Prophetie und Propheten im Theologisch-politischen Traktat (Kapitel 1–3) Dirk Brantl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
4. Exoterisches und esoterisches Religionsverständnis im Theologischpolitischen Traktat. „Göttliches Gesetz“, „religiöse Zeremonien“ und „Wunder“ als vermittelnde ironische Tropen zwischen Volksfrömmigkeit und amor Dei intellectualis (Kapitel 4–6) Jan-Hendrik Wulf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 5. Spinoza und die Auslegung der Bibel (Kapitel 7) Theo Verbeek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93
6. Spinoza’s Biblical Scholarship (Chapter 8–10) Edwin Curley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109
7. Das Wort Gottes und die wahre Religion: Das Fazit von Spinozas Bibelkritik (Kapitel 11–12) Piet Steenbakkers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127
VI
Inhalt
8. Der systematische Ertrag der exegetischen Arbeit. Die Schlichtheit der biblischen Botschaft, der Kerngehalt des Offenbarungsglaubens und die Schriftgemäßheit des „weltanschaulichen“ Pluralismus (Kapitel 13–14) Manfred Walther . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 9. Spinoza’s Reasons to Believe (Chapter 15) Alex Anderson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157
10. Die Grundlagen des Staates. Kapitel 16 des Theologisch-politischen Traktat Otfried Höffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
171
11. Spinoza’s Respublica divina. The Rise and Fall, Virtues and Vices of the Hebrew Republic (Chapter 17–18) Yitzhak Y. Melamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 12. Friedlicher Staat, Religionsgesetze und Gedankenfreiheit (Kapitel 19–20) Michael Hampe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
211
13. Der Theologisch-politische Traktat im Kontext seiner Zeit Pina Totaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
227
14. Ausblick: Eine vorläufige Einschätzung Otfried Höffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
247
Auswahlbibliographie . . . . . . . . . . . . Personenregister . . . . . . . . . . . . . . . Sachregister . . . . . . . . . . . . . . . . . Hinweise zu den Autorinnen und Autoren .
261 267 271 275
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . . . . .
VII
Zitierweise und Siglen Die Schriften Spinozas werden nach folgenden Ausgaben zitiert: TTP Tractatus theologico-politicus (Theologisch-politischer Traktat, neu übers. u. hrsg. v. W. Bartuschat, Hamburg 2012). TP Tractatus politicus (Politischer Traktat, lat.-dt., neu übers. u. hrsg. v. W. Bartuschat, Hamburg 2 2010). E Ethik (Die Ethik nach geometrischer Methode dargestellt, lat.-dt., neu übers. u. hrsg. v. W. Bartuschat, Hamburg 3 2010). Ep Briefe (Briefwechsel, übers. v. C. Gebhardt, hrsg. v. M. Walther, Hamburg 3 1986). KV Korte Verhandeling (Kurze Abhandlung von Gott, dem Menschen und dessen Glück, übers. v. C. Gebhardt, hrsg. v. W. Bartuschat, Hamburg 5 1991).
Seitenangaben ohne Sigel beziehen sich in der Regel auf den TTP. Die Kapitel des TTP und des TP werden in römischen Ziffern angegeben, für den TP werden zusätzlich die Paragraphen in arabischen Ziffern angegeben. Auf andere Literatur wird mit dem Namen des Verfassers und dem Erscheinungsjahr Bezug genommen.
IX
Vorwort In der Geschichte des politischen Denkens spielt der Frühaufklärer Baruch de Spinoza selten eine bedeutende Rolle. Zu den Gründen gehört, daß sein Hauptwerk, die Ethik, selbst für Fachphilosophen einen so elitären Charakter hat, daß man Spinoza zwar kennt, aber nur selten sich auf ein näheres Studium einläßt. Noch wichtiger dürfte sein, daß die Ethik, obwohl eine wahre Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, dem Bereich des Politischen so wenige Seiten, nämlich im wesentlichen nur die beiden Anmerkungen zum Lehrsatz 37 des Teils IV widmet, daß diese selbst von Spinoza-Kennern oft nicht näher wahrgenommen werden. Deutlich anders verhält es sich mit dem Tractatus theologico-politicus, dem Theologisch-politischen Traktat. Schon der Titel kündigt einen Beitrag zum politischen Denken an. Darüber hinaus weist er auf eine Aufgabe, die nicht bloß für die damalige Zeit, sondern auch vielerorts heute aktuell ist. Als Frage formuliert: Wie können zwei der bedeutendsten Mächte in der Geschichte der Menschheit, die Religion bzw. deren Auslegung, die Theologie, und das Recht samt Staat, kurz: das Politische, trotz vielfacher Konf likte auf eine letztlich friedliche Weise miteinander, zumindest aber nebeneinander bestehen? Ohne Zweifel gibt der Theologisch-politische Traktat auf diese Frage eine ebenso originelle wie provozierende Antwort, die bis heute eine Auseinandersetzung verdient. Die Beiträge des hier vorgelegten kooperativen Kommentars, allesamt Originaltexte, versuchen sowohl Spinozas nähere Frage als auch seine genaue, zweifellos komplexe Antwort herauszuarbeiten. Das zur Vorbereitung dieses Bandes veranstaltete Symposion begann am 21. Februar 2013, dem Todestag des Philosophen; und erscheinen soll dieser Kommentar an Spinozas Geburtstag, dem 24. November. Erneut ist zu danken: als erstes den Autoren, sodann für engagierte Mitarbeit Dr. Dirk Brantl und besonders Serina Hirschmann M.A., nicht zuletzt der wieder einmal großzügigen Fritz-Thyssen-Stiftung. Tübingen, im August 2013 Otfried Höffe
1 Otfried Höffe
Einführung
1.1 Lebensweg Baruch de Spinoza ist eine überragende, gegenüber Hobbes, Descartes und Locke freilich oft unterschätzte Gründerfigur der neuzeitlichen Philosophie. Folgt man einer beliebten Gegenüberstellung, so ist er zumindest methodisch, wegen seiner geometrischen Methode, einer der größten Vertreter des Rationalismus, der übrigens im selben Jahr geboren wird wie einer der bedeutendsten Vertreter der Gegenrichtung, des Empirismus: John Locke. Aus den wenigen, nicht immer zuverlässigen Quellen (gesammelt in Freudenthal 1899, stark erweitert in Walther 2006), läßt sich in etwa folgender Lebensweg erschließen: Bento oder Baruch de Spinoza, der sich seit seiner Exkommunikation Benediktus Spinoza nennt (beide Vornamen bedeuten dasselbe: der Gesegnete), wird am 24. November 1632 im jüdischen Viertel von Amsterdam geboren. Nicht zuletzt dank ihrer sephardisch-jüdischen Gemeinde ist die Stadt damals das wirtschaftliche und geistige Zentrum einer aufblühenden Großmacht, den mit dem katholischen Spanien verfeindeten calvinistischen, ansonsten recht aufgeklärten, liberalen Niederlanden. Spinoza entstammt einer knapp 40 Jahre vorher aus Portugal eingewanderten Familie sogenannter Marranen (von span. Marrano: Schwein, häßlicher Kerl). Es sind die Ende des 15. Jahrhunderts in Spanien zwangsgetauften (hebr. Anussim: Gezwungene), später auch aus dem zunächst liberaleren Portugal vertriebenen, ihrer Religion aber treuen Juden.
O H
Der künftige Philosoph gibt ein Musterbeispiel für die Fremdsprachenkenntnisse mancher Frühaufklärer ab: In seiner Familie spricht man Portugiesisch, die geläufige Schriftsprache ist das Spanische, in der jüdischen Schule lernt er Hebräisch, auf der Straße Grundkenntnisse des Niederländischen und später neben ein wenig Griechisch auch die damalige Sprache der Gelehrten, die Spinoza dann für fast alle seine Schriften wählt, das Latein. Der fünfjährige Baruch wird als Mitglied in der Gesellschaft Ets Haim („Baum des Lebens“), einer Art jüdischer Schule, eingeschrieben und lernt dort die hebräische Bibel, für Christen: das Alte Testament, kennen. Im Fortgang wird er unter anderem mit dem großen jüdischen Philosophen des Mittelalters vertraut, mit Moses ben Maimon, Maimonides (1135–1204), der in seiner Zeit auch islamische und christliche Denker beeinf lußt. Bis zum Rabbiner setzt Spinoza seine biblisch-talmudische Ausbildung nicht fort, da er als 17jähriger im elterlichen Handelsgeschäft mitzuarbeiten hat; seine Studien gibt er aber nicht auf. Die jüdische Gemeinde von Amsterdam führt unter Leitung von wohlhabenden Kauf leuten, unter ihnen Spinozas Großvater Abraham und der Vater Michael, intern ein strenges, an eine Diktatur grenzendes Regime. Theologisch ist die Gemeinde jedoch heftig zerstritten. Als Rabbiner wirken in Amsterdam der konservative Anhänger der jüdischen Mystik, der Kabbala, Isaac Aboab de Fonseca (1605–1693), und als Oberrabiner der streng orthodoxe Saul Levi Morteira (1596–1660). Vermutlich ein weiterer Rabbiner, der liberale und kosmopolitisch gesinnte Menasseh ben Israel (1604–1657), vor allem aber Handelsfreunde von der Börse, ermuntern Spinoza, seinen intellektuellen Horizont zu erweitern und – zunächst bei dem Ex-Jesuiten, Freigeist und Vertreter einer radikal auf Gleichheit aller verpf lichteten Republik, Francis Van den Enden (1602–1674) – Latein zu lernen, ferner nichtjüdische Philosophen, hier vor allem Descartes, sowie Mathematik und Physik zu studieren. Von Menasseh gewiß nicht beabsichtigt, entfremdet sich Spinoza dabei dem Judentum, woraufhin er mit einem sogenannten kleinen Bann belegt wird. Nachdem Spinoza nicht mit Anpassung reagiert, überfällt ihn ein existentielles Schlüsselerlebnis: Am 27. Juli 1656, im Alter von 23 Jahren, wird er, von Morteira betrieben – Menasseh ben Israel weilt in England –, mit jenem Anathema („cherem“), also Bannf luch der jüdischen Gemeinde belegt, mit dem Josua Jericho verf luchte (vgl. Josua 6, 26). Ob außer theologischen Gründen, insbesondere dem Angriff auf die Gültigkeit der jüdischen Gesetze, auch politische Verbindungen Spi-
E
nozas zu angeblich revolutionären Kreisen eine Rolle gespielt haben, so etwa sein Verkehr in einem Kreis freisinniger, für Vernunft und Toleranz und gegen staatlichen Zwang in Religionsdingen plädierender mennonitischer Kauf leute, läßt sich nicht belegen. Bei den letztgenannten, nichtdogmatischen Christen, erweitert Spinoza seine Kenntnisse wesentlicher philosophischer Strömungen der Zeit. Der Bann wird vor allem deshalb zu einem existentiellen Einschnitt, weil es sich bei ihm nicht etwa nur um eine religiöse Angelegenheit, sondern auch um eine in familiärer, sozialer und wirtschaftlicher Hinsicht harte Strafe handelt. Spinoza muß aus dem mit seinem Bruder geführten Geschäft aussteigen, und viele andere Berufsmöglichkeiten sind ihm von nun an versperrt. Eventuell wird der Bann nicht nur wegen Spinozas heterodoxer und heteropraktischer Ansichten, sondern auch wegen eines entsprechenden „freigeistigen“ Lebenswandels verhängt. Der Bann wurde damals nicht selten ausgesprochen. Während aber andere Betroffene sich um eine Rücknahme bemühten, weigert sich Spinoza und könnte dafür die zwei gewichtigen Gründe haben, daß er weder ein nichtstaatliches Gericht noch die Äußerlichkeit der orthodoxen Lebensweise anerkennt. Im Theologisch-politischen Traktat wird der Philosoph jedenfalls die von ihm abgelehnte Lebensweise kritisieren, und in der Ethik, im Anhang zum ersten Teil, wird er das kritisierte Argumentationsmuster eine Flucht ins Asyl der Unwissenheit (E I, 89: ignorantiae asylum) nennen. Den Ausschluß aus der Amsterdamer Synagoge nimmt der junge Spinoza nicht unkommentiert hin. Schon bald könnte er auf Spanisch eine leider verlorene Apologia verfaßt haben, in der er die Vorwürfe „schrecklicher Ketzerei“ und „ungeheuerlicher Handlungen“ zurückweist. Ob Grundgedanken dieser Apologia, wenn sie denn tatsächlich geschrieben wurde, in den Theologisch-politischen Traktat eingehen, ist strittig. Der Philosoph, nach der Beschreibung des frühen Biographen Johannes Colerus ein Mann von mittlerer Größe, mit einem regelmäßigen Gesicht und schwarzen Haaren (vgl. Walther 1998, 88), lebt fortan ohne Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft. Zum Erstaunen seiner Zeitgenossen, aber in Übereinstimmung mit seinen philosophischen Überzeugungen führt er trotzdem ein rundum rechtschaffenes, primär intellektuelles Leben. Bescheiden, aber nicht aller Lebensfreude versperrt, lebt er trotz freundschaftlicher Verbindungen wie
O H
ein „heimatloser Außenseiter“ (Bartuschat 2 2006, 26). Der nach dem Bann mittellos gewordene Spinoza wird von Van den Enden in sein Haus aufgenommen, wo er dessen Tochter Clara kennenlernt. Daß er sie gern geheiratet hätte, aber von einem wohlhabenden Konkurrenten ausgestochen und deshalb ehelos bleiben wird, könnte eine von Colerus verbreitete Legende sein. Um zusätzlich zu finanziellen Zuwendungen, die er von einigen Freunden erhält, seinen Lebensunterhalt zu verdienen, lernt Spinoza das hochanspruchsvolle Handwerk eines Schleifers von Linsen für Brillen, Mikroskope und Teleskope. Dabei bringt er es zu einer Meisterschaft, die ihn bei hochangesehenen Zeitgenossen wie dem Physiker, Astronomen und Mathematiker Christiaan Huygens (1629–1695) und dem Universalgelehrten Gottfried Wilhelm Leibniz (1646– 1716) über seine philosophischen Leistungen hinaus berühmt macht. Im Jahre 1660 zieht Spinoza in die Nähe der Universitätsstadt Leiden, nach Rijnsburg, wo sich freikirchliche, der Toleranz verpf lichtete Kollegiaten treffen. Hier vollendet er vermutlich seine auf Latein verfaßte Schrift, die aber nur in der niederländischen Übersetzung, zudem erst seit Mitte des 19. Jahrhunderts bekannt ist: Korte Verhandeling van God, de Mensch en deszelfs Welstand („Kurze Abhandlung von Gott, dem Menschen und dessen Wohlergehen“, 1660). In derselben Zeit, vermutlich sogar vor der Korte Verhandeling arbeitet Spinoza am unvollendet gebliebenen Tractatus de intellectus emendatione („Abhandlung über die Verbesserung des Verstandes“). Der in philosophischen Kreisen mittlerweile hoch angesehene Spinoza siedelt im Jahr 1663 nach Voorburg nahe dem zentraler gelegenen Den Haag um, wohin er im Jahr 1670 zieht. Vermutlich zwei Jahre später stellt ihm der französische König Ludwig XIV., der Sonnenkönig, eine Staatspension in Aussicht. Weil Spinoza aber als Gegenleistung dem König ein Werk widmen soll, lehnt er höf lich ab. Schon im folgenden Jahr erhält er von der Universität Heidelberg das sowohl wissenschaftlich als auch finanziell überaus attraktive Angebot auf eine ordentliche Professur für Philosophie. Die Universität ist damals eine der berühmtesten Hochschulen der Zeit; zu ihrem Lehrkörper gehört der für viele Generationen bedeutendste Völkerrechtler, der im selben Jahr wie Spinoza und John Locke geborene Samuel Pufendorf (1632–1694). Der für die Heidelberger Universität zuständige Landesherr, der Kurfürst von der Pfalz, sichert Spinoza ausdrücklich „die vollste Freiheit zu philosophieren“ zu. Allerdings erwartet der Kurfürst, daß die Freiheit zu philosophieren
E
„nicht zur Störung der öffentlich anerkannten Religion“ (Ep 47, 205) mißbraucht werde. Nach einer längeren Überlegungszeit lehnt der Philosoph das ehrenvolle Angebot ab. Er will sich nämlich in Ruhe, ohne ablenkende Aufgaben ganz dem Vollenden seines philosophischen Systems widmen. Vor allem will er sich nicht der geringsten Gefahr erneuter religiös-politischer Angriffe aussetzen. Die Entscheidung gegen das Angebot erspart ihm übrigens die Erfahrung, daß schon im nächsten Jahr, 1674, französische Truppen Heidelberg einnehmen und die Universität schließen. Wenige Jahre später, am 21. Februar 1677, im Alter von 44 Jahren, um drei Uhr in der Frühe, stirbt der gesundheitlich immer etwas schwache Spinoza im Beisein seines Freundes und Arztes Schuller an Tuberkulose. Trotz früherer Anfeindungen wird dieser laut Bertrand Russell „nobelste und liebenswerteste der großen Philosophen“ (Russell 2 1961, 552) vier Tage danach unter großer Anteilnahme der Bevölkerung in der neuerbauten Den Haager Kirche am Spuy zu Grabe getragen. Auf einem später errichteten Gedächtnisstein – das Grab selbst wird im 18. Jahrhundert aufgelöst – steht auf Latein: „Hier deckt die Erde die Gebeine Benedictus de Spinoza, ehemals in der Neuen Kirche begraben“ (etwas frei nach Hubbeling 1977, 35). Noch im selben Jahr erscheinen die Opera posthuma und fast zeitgleich auf Niederländisch De Nagelate Schriften („Die nachgelassenen Schriften“). Die vom Verleger Rieuwertsz besorgte Ausgabe enthält das Hauptwerk, die Ethik, den unvollendeten Politischen Traktat und die frühere, ebenfalls unvollendete Abhandlung über die Verbesserung des Verstandes, ferner Briefe, in denen nicht nur persönliche Nachrichten, sondern vor allem auch philosophische Überlegungen stehen. Den Anhang bildet eine Hebräische Grammatik, die auf Vorarbeiten zum Theologisch-politischen Traktat zurückgeht und das dort monierte Defizit, es gebe „kein Wörterbuch, keine Sprachlehre, keine Redekunst“ des Hebräischen (TTP VII, 130), zu einem wichtigen Teil beheben dürfte. Niedergeschrieben wird die Grammatik vermutlich erst gegen Ende von Spinozas Leben. Hingegen werden in die Werkausgabe weder die Kurze Abhandlung noch der bereits veröffentlichte Theologisch-politische Traktat aufgenommen. Zu einem der Ausgabe später hinzugesetzten Porträt in Medaillon-Form gehört der (auf Latein verfaßte) Text: „Es ist der Mühe wert auf das Bild Spinozas zu schauen, der die Natur, d. h. Gott, und die Ordnung der Dinge kannte. / Das Anlitz dieses Mannes kann dargestellt werden, doch an der Gestaltung eines
O H
Geistes scheitern die künstlerischen Hände eines Zeuxis. / Dieser ist kräftig in seinen Schriften; hier handelt er von sehr tiefsinnigen Sachen. Wer ihn kennenlernen will, lese seine Schriften“ (nach Hubbeling 1977, 37).
1.2 Philosophische Entwicklung Spinozas früher philosophischer Text, die Kurze Abhandlung von Gott, dem Menschen und dessen Wohlergehen, beginnt, wie der Titel ankündigt, mit einer Theorie Gottes, läßt eine Anthropologie folgen und endet mit einer Ethik, die sich aus den Theorien von Gott und dem Menschen ergibt. Der Text greift also schon der Gliederung, außerdem Grundgedanken von Spinozas Hauptwerk, der Ethik, vor. Vielleicht in Kenntnis von Aristoteles’ wirkungsmächtiger Kritik dieser zwei sowohl in der Antike als auch zu Spinozas Zeiten geschätzten Lebensformen (s. Nikomachische Ethik, I 3) lehnt er das Genußleben und die dem öffentlichen Ansehen und der Macht gewidmete Lebensform vehement ab. In scharfem Gegensatz zu Descartes’ Versuch, die neue mathematische Physik mit einer theistischen Weltsicht zu verbinden, skizziert Spinoza eine weit neuartigere und zugleich provokativere Position: Gott ist mit der Natur identisch; infolgedessen kann es keine – von Juden wie Christen behauptete – Schöpfung geben; Gottes Wirken ist notwendig; eine göttliche Vorsehung gibt es ebensowenig wie einen freien menschlichen Willen. Einen Unterschied zur Ethik darf man jedoch nicht übersehen: Die Korte Verhandeling bedient sich erst ansatzweise der in der Ethik vorbildlich praktizierten, für Spinoza idealen Beweismethode, der Methode der Geometrie. Die andere Frühschrift, der Tractatus de intellectus emendatione, enthält den Abriß einer Methodenlehre, die die dafür entscheidende Instanz, den Verstand, von den Irrungen des Alltags freisetzen und zum wahren Glück führen soll. Unter seinem eigenen Namen veröffentlicht Spinoza nur eine einzige Schrift, die zweiteilige Abhandlung über Descartes’ Prinzipien der Philosophie (1663). Nach eigener Angabe in nicht mehr als 14 Tagen geschrieben, will sich der Autor mit ihr öffentlich als soliden Philosophen ausweisen. Der später verfaßte anspruchsvollere, sowohl religionspolitisch als auch staats-, nicht zuletzt philosophiepolitisch brisante Tractatus theologico-politicus (kurz: Traktat, 1670) erscheint anonym. Und erst nach dem Tod wird das monumentale Hauptwerk
E
veröffentlicht, eine veritable Enzyklopädie der Philosophie, die Ethica, ordine geometrico demonstrata: Ethik, nach geometrischer Methode dargelegt (vgl. dazu Hampe/Schnepf 2006). Denn wegen mißlicher Erfahrungen mit der politischen und theologischen Öffentlichkeit lehnt Spinoza ein Erscheinen dieses Werks schon zu Lebzeiten ab. In der Ethik, also nicht bei dem Philosophen, der auch Mathematiker war, bei Descartes, sondern bei einem Nur-Philosophen, eben bei Spinoza, erhält der Rationalismus seine in methodischer Hinsicht radikalste Gestalt. Von Blaise Pascals (1623–1662) Kritik am geometrischen Geist unbeeinf lußt, zwingt sie die mathematische Methode dem gesamten System der Philosophie auf. Die wahre Philosophie sei nämlich genauso irrtumsfrei zu begreifen, wie man wisse, daß die Winkel eines Dreiecks gleich zwei rechten seien: „Denn das Wahre ist der Prüfstein seiner selbst und des Falschen“ (Ep 76, 286). Es ist deshalb keine persönliche Arroganz, wenn Spinoza im selben Brief schreibt, er nehme nicht an, die beste Philosophie entdeckt zu haben, er wisse (!) aber, daß er die wahre verstehe. Weit strenger als vor ihm Hobbes folgt Spinoza dem Vorbild Euklids. Bis auf den letzten Teil, der auf eine Einleitung zwei Axiome folgen läßt, beginnt jeder Teil der Ethik mit Definitionen, und angefangen mit Gott dürfen alle Ausdrücke nicht etwa im gewöhnlichen, sondern ausschließlich im jeweils definierten Sinn verstanden werden. Auf die Definitionen folgen Erläuterungen, an die sich Axiome, Lehrsätze und deren Beweise anschließen. In diesem deduktiven Verfahren, bestehend aus Definitionen, Axiomen, Lehrsätzen, Beweisen und Erläuterungen, entfaltet Spinoza ein umfassendes philosophisches System: Aus dem Zusammenwirken von Metaphysik als Verbindung von philosophischer Theologie und Erkenntnistheorie mit Philosophie des Geistes, Affektenlehre und Ethik entsteht ein pantheistischer Substanzmonismus, der auf eine eigentümliche Weise einen Determinismus mit der Möglichkeit verbindet, ein freier Mensch zu sein. Danach ist Gott weder wie bei Hobbes aus dem philosophischen System ausgeschlossen noch wie bei Descartes der Garant der Wahrheit und auch nicht wie beim späteren Gegenspieler Descartes’, Pascal, als „Gott Abrahams, Gott Isaaks, Gott Jakobs“, der Gegenstand religiösen Glaubens. Als Teil nicht einer Bewußtseinsphilosophie, sondern einer Seins-, Erkenntnis-, Natur- und Moralphilosophie gilt Gott als die vollkommene und zugleich einzige (griech. monos) Substanz. An die Stelle der menschlichen
O H
Willensfreiheit tritt ein Existieren aus der Notwendigkeit der eigenen Natur, ohne deshalb auszuschließen, ein freier Mensch zu sein. Spinoza will mit diesem Monismus die Probleme aus Descartes’ Zweiteilung (zwei geschaffenen Substanzen: Materie und Geist) oder Dreiteilung (zusätzlich gibt es den ungeschaffenen Gott) wie durch einen systematischen Handstreich lösen: Es gibt nur eine einzige Substanz, Gott, daher Substanzmonismus, und diese Substanz ist ihrem Wesen nach aus sich selbst und durch sich selbst („causa sui“: Ursache und Grund seiner selbst). Die verschiedenen Grundformen der Wirklichkeit sind nichts anderes als Eigenschaften (Attribute) Gottes. Dieses Innewohnen (Immanenz) aller Dinge in Gott und Gottes in allen Dingen beläuft sich auf einen Pantheismus (Allgottlehre: Gott ist alles und in allem). Es schließt einen die Welt übersteigenden, transzendenten Gottesbegriff aus und trägt Spinoza den auf den ersten Blick erstaunlichen Vorwurf des Atheismus ein, da sein System doch bei einem Gottesbegriff ansetzt. Da der Philosoph aber den im Judentum und Christentum bislang dominanten, auch in der nachgriechischen Philosophie vorherrschenden, eben transzendenten Gottesbegriff leugnet, ist der Vorwurf nicht rundum unberechtigt. Als Grund seiner selbst ist Gott nach Spinoza zweierlei zugleich: notwendig und frei. Der Philosoph behauptet also in seiner Ethik eine Gott innewohnende und zugleich der Welt immanente Kausalität. Da Gott reine Einheit ohne irgendeine Differenz ist, kann die Welt keine Schöpfung, sondern nur als eine Weise (modus) sein, in der Gott ist. Und weil sich neben der göttlichen Kausalität keine andere denken läßt, kann es keinen freien Willen geben. Der Mensch handelt notwendig, steht aber trotzdem unter dem Anspruch der Rechtschaffenheit oder Tugend. Deren Grundlage liegt im Streben nach Selbsterhaltung. Dieses wiederum ist nur dadurch möglich, daß sich der Mensch der „Knechtschaft“ genannten Herrschaft der Affekte des Leidens entzieht und jenes Leben unter Leitung der Vernunft führt, das von den Affekten des Handelns bestimmt ist. Dann tritt nämlich an die Stelle der passiven Affekte Begierde, Freude und Trauer der aktive Affekt der fortitudo, der „Tapferkeit“ im Sinne von Charakterstärke. Auch wenn Spinoza hier Aristoteles nicht erwähnt (er nennt grundsätzlich in der Ethik kaum einen Philosophen), erinnert der Gegensatz zweifellos an die aus der Nikomachischen Ethik (z. B. I 1, 1095a 8–10) bekannte Opposition von kata pathos, nach Leidenschaft, und kata logon, nach Vernunft leben.
E
Da dem einzelnen allein die Selbsterhaltung, immerhin sein Leitinteresse, schwerlich gelingt, läßt er sich auf Gesellschaft ein und organisiert sich im Staat. Dieser ist umso stabiler, je mehr seine Regierung die in Frieden und Freiheit bestehende Selbsterhaltung befördert. Wird diese Aufgabe vernachlässigt oder sogar verletzt, so ist mit Empörung der Bürger zu rechnen. Und eines kann der Mensch nicht an den Staat abtreten, da es sich ohnehin nicht einschränken läßt: die Freiheit zu denken, die im Theologisch-politischen Traktat Freiheit zu philosophieren heißt. Spinozas Hauptwerk, die Ethik, setzt sich scharf gegen den die damaligen Philosophie-Debatten dominierenden Descartes ab. Während dieser angesichts von Zweifeln Wahrheit begründen will, hat Spinoza ein radikal neues Leitmotiv: Er will – man könnte ihn hier einen Platoniker nennen – Vollkommenheit begreifen. Denn alle Erkenntnis, ob auf Gott, die Natur oder die Möglichkeit menschlichen Handelns gerichtet, diene dem höchsten Ziel, dem schlechthin Guten. Und genau dieses Zieles wegen trägt das Werk den Titel Ethik, obwohl es in fünf Teilen die gesamte Philosophie abhandelt. Sieht man von den allzu knappen Hinweisen in den beiden Anmerkungen zum Lehrsatz 37 von Teil IV ab, so fehlt nur die in den beiden Traktaten, dem Traktatus theologico-politicus und dem Traktatus politicus, behandelte politische Philosophie. Die fünf Teile der Ethik handeln nämlich über (1) Gott, (2) den menschlichen Geist, (3) den Ursprung und (4) die Herrschaft der Leidenschaften sowie (5) die menschliche Freiheit unter der Macht des Verstandes. Ob Spinoza in den 1660er Jahren dem Kreis um den damals führenden Staatsmann, dem liberalen Republikaner Jan de Witt (1625–1672), nahesteht, ist strittig. Als Ratspensionär Hollands leitet de Witt seit 1650 die gesamte niederländische Politik. In diesem Umfeld könnte in gründlichen, sich über fünf Jahre erstreckenden Studien der Theologisch-politische Traktat entstanden sein. Dessen Grundgedanken sind jedenfalls de Witts Staats- und Kirchenpolitik nicht fern. Nicht etwa nur Hobbes, sondern selbst der sonst so zurückhaltend lebende Spinoza zieht sich also keineswegs in einen philosophischen Elfenbeinturm zurück. Während aber Hobbes vornehmlich die Sache der Monarchie vertritt, stellt sich Spinoza auf die Seite deren Gegner, der Republikaner. Darüber hinaus nimmt er Stellung zum kirchenpolitischen Streit zwischen den strengen, für eine Theokratie als Staatsreligion eintretenden Calvinisten und den gemäßigten Calvinisten sowie weiteren protestantischen Kirchen.
O H
Spinoza schlägt sich nämlich klar auf die Seite der Gemäßigten, freilich modo scientifico, also primär mit philosophischen, sekundär auch mit ökonomischen Argumenten. Der Text erscheint im Jahr 1670 nur auf Latein. Denn um ein Verbot der Schrift zu verhindern, sperrt sich der Autor nachdrücklich gegen eine Veröffentlichung auf Holländisch. Da die Behörden erst gegen volkssprachliche Texte einzuschreiten pf legen, nutzt Spinoza auf diese Weise ein für die Frühaufklärung typisches Phänomen, die „Sprachbarriere als Schutz für den Verfasser und sein Werk“ (Gawlick 1976, XIV). Als zusätzlichen Schutz läßt er die Schrift nur anonym, angeblich in Hamburg, tatsächlich aber in Amsterdam bei dem befreundeten Verlagsbuchhändler Jan Rieuwertsz erscheinen. Schon nach wenigen Wochen steht aber Spinoza als Verfasser fest. Weil sein Text wie angedeutet recht unmittelbar in die religiöse und politische Situation der Zeit eingreift, wird sein Autor wie zwei Staatsphilosophen vor ihm, Machiavelli und Hobbes, sehr rasch zu einer berühmten und noch mehr zu einer berüchtigten Person. Anders als Machiavelli wird er aber nicht ins Gefängnis geworfen, anders als Hobbes muß er kein einziges Mal, um das Leben zu retten, aus seinem Vaterland f liehen; er kann in den denn doch liberaleren Niederlanden bleiben. Nach Fertigstellung der Ethik wendet sich Spinoza im selben Jahr, 1675, erneut der politischen Philosophie zu. Die Arbeit an einem Tractatus politicus kann der Autor aber wegen seines baldigen Todes nicht vollenden. Die Schrift, die zu Beginn des Demokratie-Kapitels abbricht, baut auf Gedanken eines Parteigängers von Jan de Witt auf. Es sind Gedanken von Pieter de la Court beziehungsweise Van den Hove (1618–1685), die den Wohlstand eines Landes auf kompromißlose Handels- und Gewerbefreiheit zurückführen, der ihrerseits eine religiöse und politische Freiheit entsprechen sollte. Der Theologisch-politische Traktat weicht zwar in mancher Hinsicht von Hobbes ab, steht ihm aber trotzdem recht nahe. Beispielsweise übernimmt er in Kapitel 16 Hobbes’ Ansicht, der Staat sei nicht bloß für die genuin weltlichen Angelegenheiten, sondern auch für Religionsdinge entscheidungskompetent (s. in diesem Band, Kap. 10.7). Im Politischen Traktat dagegen unterscheidet sich Spinoza schärfer vom Engländer, insbesondere verwirft er dessen Unterwerfungsvertrag. Außerdem lehnt er die Zuständigkeit des Souveräns für Religionsfragen ab. Zusätzlich plädiert er für ein sich wechselseitig kontrollierendes Gef lecht
E
von Gremien, in das möglichst viele Individuen einzubinden seien. Den Wohlstand wiederum hält er sowohl innenpolitisch als auch außenpolitisch für wichtig. Intern fördere er nämlich den Frieden, und extern sei er ein Machtfaktor der Staaten gegeneinander.
1.3 Leitgedanken des Theologisch-politischen Traktat Spinozas Hauptwerk, die Ethik, ist wie angedeutet ein philosophisch höchst anspruchsvoller Text. Schon methodisch erschließt er sich nur veritablen, zudem sehr geduldigen Fachphilosophen. Und daß das Leitmotiv, das Glück der Menschen, verstanden als ein wahrhaft gelingendes Leben, an eine derart argumentativ aufwendige Metaphysik gebunden sein soll, erscheint zwar als wenig plausibel, Spinoza selbst trägt aber eine weithin überzeugende Argumentation vor. Unausgesprochen steht die von ihm favorisierte Lebensweise im Gegensatz zu dem, was der Philosoph im damaligen Amsterdamer Judentum erfährt: In der Ethik tritt an die Stelle einer von außen autoritativ übernommenen Lebensform ein Leben, das aus dem Inneren des Menschen selbst, und zwar seiner aktiven, nicht passiven Affekte, geführt wird. Zugleich tritt in der Ethik, auch wenn es die Schrift so nicht hervorhebt, an die Stelle religiöser und staatlicher Vorschriften eine philosophisch begründete Erkenntnis, ein Wissen. Vor allem diesem Grundgedanken, der Aufhebung eines autoritären Glaubens zugunsten eines freien Philosophierens, ist der Theologisch-politische Traktat gewidmet. Allerdings vertritt er ihn auf eine neue, politisch raffinierte und philosophisch subtile Weise. Denn ein Leben aus religiösem Glauben, sofern es rechtschaffen: in Gerechtigkeit und Liebe, geführt wird, bleibt berechtigt. Für dieses Leben braucht es nämlich keine philosophische („mathematische“) Gewißheit, vielmehr genügt die auch den Propheten eigene moralische Gewißheit (certitudo moralis) (TTP II, 32). Und die öffentlichen Gewalten erhalten oder behalten das Recht, allgemein verbindliche Beschlüsse zu erlassen. Schon wegen dieser beiden Thesen darf Spinoza am Ende von Kapitel 14 behaupten, er habe keine Neuerungen einzuführen, sondern lediglich das Entstellte zu verbessern beabsichtigt. Und vermutlich nicht nur in einer rhetorisch gemeinten Bescheidenheit schließt er mit der Hoffnung, daß er das Entstellte „eines Tages endgültig korrigiert zu sehen bekommt“ (TTP XIV, 225).
O H
Wie gelingt es Spinoza, das Entstellte richtig zu stellen? Zunächst räumt er das Außergewöhnliche seines Leitgedankens ein: daß „nur sehr wenige (verglichen mit der ganzen Menschheit) unter der Leitung der Vernunft zu einer tugendhaften Lebensführung gelangen“. Infolgedessen müßte man, scheint es, „am Heil nahezu aller Menschen zweifeln“ (TTP XV, 236 f.). Wer dieser allzu pessimistischen, überdies undemokratischen, weil die meisten Bürger benachteiligenden Folge entgehen will, braucht einen alternativen Zugang zum Heil (salus) oder Glück (beatitudo; beide Begriffe sind in etwa gleichbedeutend, ob auch vollständig, bleibt unklar). Spinoza sieht die Alternative in der Heiligen Schrift, die für ihn, den aus der Amsterdamer Synagoge exkommunizierten Juden, bemerkenswerterweise keineswegs ausschließlich aus dem Alten Testament besteht. Auch wenn er sich mit dessen Texten weit mehr auseinandersetzt, bezieht er zusätzlich zahlreiche Texte der „reformjüdischen“ Schrift, des Neuen Testaments, ein. Um den alternativen Zugang über die Schrift zu finden, soll man diese allerdings grundlegend anders als in der herrschenden jüdischen, aber auch calvinistischen Orthodoxie lesen. Die sachgerechte Lektüre werde nämlich bislang affektiv durch Aberglauben und kognitiv durch Vorurteile verhindert, die Spinoza zunächst benennen, sodann ausräumen will. Ein Brief an den Freund aus Deutschland, Heinrich Oldenburg, damals Sekretär der Royal Society in London, führt für das Leitinteresse drei nähere Ziele an (Ep 30, 141 f.): Als erstes sollen die Vorurteile der Theologie aufgedeckt werden, weil sie die Menschen an der Hinwendung zur Philosophie am meisten hindern. Als größtes Hindernis gilt dabei die Ansicht, die Schrift bedürfe einer gelehrten Auslegung. In einem gewissen Vorgriff auf Nietzsche sieht Spinoza hier ein Machtinteresse der Schriftgelehrten, der Rabbiner, am Werk. In Wahrheit, heißt es schon in der Vorrede und greift es die Überschrift von Kapitel 13 auf, lehre die Schrift „nur ganz einfache Dinge“: einen Gehorsam gegen moralische Forderungen. Der von dem Propheten offenbarte „Begriff des … göttlichen Geistes“ bedeute, „Gott von ganzem Herzen gehorsam zu sein, indem man Gerechtigkeit und Nächstenliebe übt“ (TTP Vorrede, 10 f.). Kritiker dürften allerdings bezweifeln, daß alle alttestamentlichen Bücher nur diese eine Botschaft einer universalistischen Moral enthalten. Zweitens will Spinoza den gegen ihn erhobenen Vorwurf des Atheismus abwehren. Vor allem will er drittens, was er schon im erweiterten Titel der Schrift als beherrschendes Thema nennt, mit allen Mitteln „die Freiheit zu philosophie-
E
ren“ (Titel) und „zu sagen, was man denkt“ (Vorrede, 12), verteidigen. Dafür ist in politischer Hinsicht eine Unterscheidung wesentlich: den höchsten staatlichen Gewalten, also dem Souverän, kommt das Recht zu, über alle Handlungen zu beschließen. Denn der Vernunft gehorchend (!) habe jeder „ein für allemal beschlossen, das Recht, gemäß eigenem Urteil zu leben, dem Souverän zu übertragen“ (TTP XX, 310). Nach eigenem Gutdünken anders zu handeln, gilt sogar als ruchlos (ebd.); ein Widerstandsrecht sieht Spinoza nicht vor. Hingegen habe man sich nicht verpf lichtet, auch so „zu urteilen und nachzudenken“ (TTP XX, 314). Spinoza setzt also die Gedanken- oder Philosophiefreiheit scharf gegen Handlungsfreiheit ab. Allerdings muß man sich fragen, ob zwischen Handeln und Denken immer eine klare Grenze zu ziehen ist. Nicht erst seit der neueren Sprechakttheorie weiß man, daß Reden auch ein Handeln sein kann. Und da beispielsweise Predigten, religiöse Schriften und der Kult unter die Gedankenfreiheit fallen, sie aber nicht nur Rede-, sondern auch Handlungscharakter haben, müssen sie von staatlicher Seite unzensiert und unkontrolliert freigegeben werden, was nun in den Bereich des Handelns hereinreicht. Gegen Ende seiner Schrift (TTP XX, 316) faßt Spinoza es bilanzierend zusammen: „1. Es ist unmöglich, den Menschen die Freiheit zu sagen, was sie denken, zu nehmen; 2. diese Freiheit kann jedem gelassen werden, ohne das Recht und die Autorität des Souveräns zu gefährden, und jeder kann sie unbeschadet dieses Rechts bewahren, sofern er sich daraus nicht die Erlaubnis nimmt, ein neues Recht in den Staat einzuführen oder etwas gegen die etablierten Gesetze zu unternehmen; 3. jeder kann diese Freiheit haben, ohne den Frieden im Staat zu gefährden, und sie wird keinen Mißstand hervorrufen, der sich nicht leicht beheben ließe; 4. jeder kann sie auch ohne Gefahr für die Frömmigkeit haben; 5. Gesetze über spekulative Dinge sind völlig nutzlos“. An diesem dreifachen Vorhaben – alternative Bibel-Lektüre, Abwehr des Atheismus-Vorwurfes und Unterscheidung von Handlungs- und Denkfreiheit – hat Spinoza nicht etwa ein akademisches, vielmehr ein politisches und ein existentielles Interesse. Denn einerseits will er den damaligen Streit über die angemessene „Staatsform“ modo philosophico, also argumentativ, überwinden. Andererseits kommt es ihm, einem Philosophen aus Leidenschaft, für sein eigenes Leben auf ein von Grund auf freies Denken an.
O H
Spinoza will also der Vernunft einen Freiraum verschaffen, was er jedoch durch die beiden mächtigsten Instanzen der Zeit erschwert oder sogar verhindert sieht: seitens der Religionsgemeinschaften im Namen der Frömmigkeit und seitens des Staates im Namen des (politischen) Friedens. Dem widerspricht nun der Philosoph mit der zweiteiligen Gegenthese: Während ein Aufheben des freien Denkens beide, die Frömmigkeit und den Frieden, zugleich verhindere, werden durch die Anerkennung der Denkfreiheit beiden Mächten ihre konstitutiven Ziele garantiert: den Religionsgemeinschaften die Frömmigkeit und dem Staat der Frieden. Zweifellos macht sich Spinoza seine Aufgabe nicht leicht. Trotzdem muß sein Vorhaben, achtet man nicht auf die Argumente und auf die ihnen zugrundeliegende Klugheit, sondern auf die unmittelbare Wirkung, als rundum gescheitert gelten: In den Niederlanden wird der Traktat sowohl politisch als auch theologisch heftig attackiert. Trotz einf lußreicher Freunde wie des späteren Amsterdamer Bürgermeisters Johann Hudde (1628–1704) setzt sich durch, was der Tractatus den glühendsten Haß, nämlich dessen theologische Gestalt, nennt (TTP XVII, 269). Auf scharfe Kritik stößt beispielsweise Kapitel 6 „Von den Wundern“. Jedenfalls wird am 19. Juli 1674 der Text durch einen Erlaß des Hofes von Holland verboten, übrigens unter anderem zusammen mit Hobbes’ eine Generation vorher erschienenem Hauptwerk, dem Leviathan (1651), da er der kirchlichen Orthodoxie als ähnlich gefährlich gilt. Und etwa mit dem Leipziger Philosophieprofessor Jakob Thomasius, dem Vater des deutschen Frühaufklärers Christian Thomasius beginnend, erfährt Spinoza auch außerhalb seines Landes scharfe Kritik. Paradoxerweise, aber eigentlich vorhersehbar verhelfen Kritik und Verbot dem Traktat zu einer raschen Verbreitung. Wie früher Hobbes wegen De cive (1642/1647) und noch früher Machiavelli wegen Il Principe/Der Fürst (1513/1531) werden die verbotenen Autoren zu europäischen Berühmtheiten. Schon in den 1670er Jahren wird der Traktat ins Niederländische, Französische und Englische übersetzt. Die deutsche Übersetzung hingegen erscheint erst in den Jahren der großen Spinoza-Rezeption in Deutschland, 1787, sie erfährt aber auch dann keine mit der Ethik vergleichbare Wirkung. Einer der großen Philosophen vor Spinoza, René Descartes, läßt sein Hauptwerk, die Meditationes de prima philosophia (1641), von bedeutenden Denkern seiner Zeit beurteilen und nimmt zu deren Einwänden ausführlich
E
Stellung. Spinoza geht nicht so vor. Ein Grund könnte darin liegen, daß er, der nicht ganz so berühmte Autor, wenige philosophisch bedeutende Kritiker finden würde. Gegen Descartes treten unter anderem Mersenne, ein Stammvater des neuzeitlichen Empirismus, der Mathematiker, Naturwissenschaftler und Philosoph Pierre Gassendi und der überragende Staatsphilosoph der frühen Neuzeit, Thomas Hobbes auf. Vielleicht war sich Spinoza aber auch seiner Sache so sicher, daß er die Einwände für philosophisch belanglos, daher keiner Erwiderung für würdig hielt. Warum läßt sich ein Philosoph auf das ebenso mühselige wie gefährliche Geschäft ein, Vorurteile der biblischen Theologen zu überwinden und beispielsweise sowohl den Offenbarungscharakter der Schrift als auch das Auserwähltsein der Juden zu bestreiten? Spinoza hält es für einen Zwischenschritt zu seinem eigentlichen Interesse, die Verteidigung der Freiheit zu philosophieren. Dieses Leitinteresse schlägt den großen Bogen von der Erläuterung des Titels bis zum Schlußkapitel, denn die Erläuterung des Titels spricht von dieser Freiheit, und die Überschrift des letzten Kapitels erklärt, „daß es in einem freien Staate jedem erlaubt ist, zu denken, was er will, und zu sagen, was er denkt“ ( TTP XX, 306 f.).
1.4 Koexistenz trotz Trennung Blickt man nur auf Spinozas Titelerläuterung, so könnte man in der Verteidigung der Philosophiefreiheit ein partikulares Berufsinteresse sehen. Die Berufsvertreter, hier die Philosophen, wollen ihr Geschäft, unbehelligt von Einsprüchen der Theologen qua Schriftgelehrten und des Staates ausüben. Im Schlußkapitel sieht man aber Spinozas weit größeres, allgemeinmenschliches Interesse, das später den Rang eines Menschenrechtes erlangt; es geht um die Freiheit der öffentlichen Meinungsäußerung. Die beiden einschlägigen Arten von Vorurteilen bestimmen übrigens die Gliederung: Nach der Vorrede widmet sich der umfangreichere erste Hauptteil, Kapitel 1–15, den theologischen, danach der deutlich kürzere zweite Hauptteil, Kapitel 16–20, den politischen Vorurteilen. Im ersten Hauptteil geht es überwiegend um das Alte Testament, dabei im Methoden-Kapitel 7 um die von Spinoza praktizierte Theorie der Interpretation, um seine Hermeneutik. Nur Kapitel 11 widmet sich dem Neuen Testament mit der Frage, ob die Apostel als
O H
(Gehorsam gegen Gott fordernde) Propheten oder aber als (argumentierende) Lehrer geschrieben haben. Auf Christus geht Spinoza freilich vielerorts ein. Er hält ihn aber nicht für den Sohn Gottes, womit er bei aller Wertschätzung des Christentums hier und in anderen wichtigen Dingen kein Christ ist. Spinoza hält Christus nur für einen außerordentlichen Menschen, der insofern mit Moses vergleichbar ist, als beide „Gottes Stimme“ heißen können (TTP I, 21). Daß Spinoza mit der Theologie beginnt und ihr mehr als den dreifachen Umfang der Politik widmet, dürfte zweierlei bedeuten. Zum einen gelten die theologischen Vorurteile als gewichtiger, zum anderen deren Entlarvung als komplexer. Vermutlich kommt etwas Drittes hinzu: Die theologischen Fragen des ersten Teils sind ausschließlich auf deren Bezugstext, die Bibel, bezogen, insofern von den politischen Fragen unabhängig. Wie schon die Überschriften der Kapitel 17 und 18 zeigen, da sie vom Staat und der Geschichte der Hebräer sprechen, spielen hingegen in die politischen Fragen die theologischen hinein. Die Theologie beeinf lußt die Politik noch grundlegender. Was heute vielleicht als eine Besonderheit von Alt-Israel aussieht, die Verquickung von Religion und Staat, ist in Wahrheit eine Gemeinsamkeit des Alten Orients, uns etwa von Alt-Ägypten und von Babylon bekannt. Allerdings erhält damals über das Alte Testament nur die altisraelische Variante eine für Europa bestimmende Kraft: Der in den damaligen Niederlanden vorherrschende Calvinismus strenger Observanz verquickt weltliches und geistliches Recht. Jede Abweichung von der kirchlichen Orthodoxie hält er für ein Vergehen, sogar Verbrechen, das die weltliche Obrigkeit zu ahnden habe. Spinoza erlebt es ja am eigenen Leib: Weil sich die calvinistische Orthodoxie von seinem Theologisch-politischen Traktat angegriffen fühlt, läßt sie ihn vom Hof verbieten. Hätten die Theologen freilich die Bibel in Spinozas Sinn unvorbelastet gelesen, so hätten sie die neutestamentliche Kritik an der altorientalischen, dabei auch altisraelischen Verquickung ernst genommen und damit Spinoza die Aufklärungsarbeit erleichtert. Die Theologen hätten nicht nur das Titelzitat des Traktat anerkannt, daß der Geist den Menschen von Gott gegeben ist und sie mit diesem Geist in Gott bleiben und Gott in ihnen ist, wobei „Geist“ für das freie Denken stehen dürfte. Sie hätten sich auch der säkularen Revolution erinnert, die in der neutestamentlichen These der Entquickung von weltlicher und religiöser Macht enthalten ist. Wer nämlich das berühmte Wort anerkennt: „So gebet dem Kaiser, was des Kaisers, und Gott, was Gottes ist“ (Matthäus 22, 21),
E
mag der Synagoge und den Kirchen erlauben, Häretiker – wenn sie es denn überhaupt sind – aus ihrer Religionsgemeinschaft auszuschließen. Der Ausschluß dürfte aber keinerlei weltliche Folgen haben. Auf diese ihn sowohl stützende als auch vor mancherlei Anfeindungen schützende These beruft sich aber der große Bibelkenner Spinoza erstaunlicherweise nicht. Solange die altisraelische, aber nicht mehr neutestamentliche Verquickung als Vorbild dient, ist der unvorbelastete Blick auf die eigentlichen Aufgaben des Staates verstellt. Man darf die betreffenden Institutionen und Personen durchaus für verblendet erklären. Ein Beispiel für diese Verblendung: Unter Berufung auf Jesus erklärt Spinoza, Unreinheit kommt nicht von Außen (Pharisäer hatten Jesus vorgeworfen, seine Jünger würden die vorgeschriebenen Waschungen unterlassen), sondern von Innen. Weil derartige Verblendungen ihren Ursprung in der Theologie haben, verhindern in der Tat deren Vorurteile den klaren Blick auf den Staat. Aus diesem Grund sind die theologischen Vorurteile genau so wie bei Spinoza, nämlich vor den politischen Vorurteilen zu traktieren. Die Tragweite dieser Sachlage liegt auf der Hand: Solange die theologischen Vorurteile herrschen, ist eine Überwindung der politischen Vorurteile nicht zu erwarten. Sobald aber die theologischen Vorurteile entlarvt sind, fällt die Überwindung der politischen Vorurteile leichter. Auf den ersten Blick sieht diese Grundthese ebenso einfach wie klar aus. Die beiden Bereiche, erklärt Spinoza im vorletzten Absatz von Kapitel 14 und im Kapitel 15, Glaube samt biblischer Theologie und Vernunft beziehungsweise Philosophie, sind scharf zu trennen: Die Theologie ist als (bibelimmanente) Auslegung religiöser Texte für den Glauben zuständig, der wiederum zum Gehorsam gegen Gott und zur Frömmigkeit verpf lichtet. Dem natürlichen Denken dagegen, der Vernunft beziehungsweise Philosophie, kommt es auf die Erkenntnis an, die ihrerseits auf die ewige Wahrheit verpf lichtet ist. Man kann auch von einem doppelten Gehorsam sprechen, dort gegen den geoffenbarten Gott, hier gegen die eine natürliche Wahrheit. Und weil beide Gehorsamspf lichten gleichwertig, aber verschiedenartig sind, steht keine von ihnen im Dienst der anderen. Weder darf man die Vernunft als Magd der Theologie noch den Glauben als Magd der Vernunft mißbrauchen (vgl. TTP XV, 226). Spinoza hält übrigens beide, Vernunft und Glauben, für unverzichtbar. Insofern vertritt er nicht bloß eine begriff liche Trennung, sondern auch eine lebensweltliche Komplementarität und auf diese Weise die Vereinbarkeit von
O H
zwei grundverschiedenen Einstellungen zur Moral, folglich die Koexistenz von Offenbarung und Philosophie: Spinoza unternimmt und ihm gelingt auch die paradoxe Aufgabe, die Rationalität der Irrationalität, nämlich die Funktionalität der für Propheten eigentümlichen, freilich allgemeinmenschlichen Vorstellungskraft (imaginatio), aufzuzeigen. Damit schlägt er zwischen Rationalismus und Ablehnung der Vernunft einen „dritten Weg“ ein. Im Gegensatz zur Alternative von Rationalismus mit dem Prinzip „sola ratione“, allein die Vernunft, und dem vernunftskeptischen Prinzip „sine ratio“, ganz ohne Vernunft, vertritt er ein adressatenabhängiges Sowohl-als-auch: Für die wenigen Menschen, die zur Philosophie fähig sind, verhilft zur tugendhaften Lebensführung schon die bloße Leitung der Vernunft. Die überwiegende Mehrheit gelangt dagegen nur über den von der Offenbarung gelehrten Weg des Gehorsams zum Heil (TTP XV, 236). Betrachtet man bloß die Trennungsthese ohne die Komplementaritätsthese, so stellt sich die Frage, welche Instanz den Gehorsam gegen Gott, und zwar sowohl die Art als auch die Tragweite dieses Gehorsams, prüft. Ist es die Philosophie, so maßt sie sich an, was durch die Trennungsthese doch ausgeschlossen ist: eine Kompetenz für den Glauben und dessen Auslegung geoffenbarter Texte, mithin eine theologische Kompetenz. Ist es dagegen die Theologie, so kann der Philosoph sie gar nicht prüfen. Ihrem Richterstuhl entzogen, kann die Philosophie ihre Einschätzung der Theologie, namentlich den Vorwurf theologischer Vorurteile, nicht aufrechterhalten. Mehr noch: Die Philosophie vermag den Vorwurf, weil er einen ihr grundfremden Gegenstand betrifft, nicht einmal sachgerecht zu formulieren. Spinoza selbst wirft die Frage der Prüfungsinstanz nur indirekt auf, indem er nämlich ein klares Kriterium vertritt. Es entspricht einem jede Expertokratie des Glaubens- beziehungsweise Heilswissens ablehnenden Prinzip der Reformation „sola scriptura“, allein die Schrift. Das Prinzip hat zur Folge, daß jeder unvoreingenommene Leser, ohne ein Bibel-Gelehrter oder ein Philosoph zu sein, die Schrift sachgerecht verstehen kann. Und dabei kommt er, so Spinoza, zur Einsicht, daß die Bibel letztlich nichts anderes lehrt als die bloße Vernunft: Um glücklich beziehungsweise selig zu werden, muß man Gerechtigkeit und Nächstenliebe üben. In seinen Argumenten erweist sich Spinoza als intimer Kenner der Schrift. Zugleich präsentiert er sich unter den Philosophen – nach Hobbes – als einer
E
der ersten Vertreter kritischer Exegese und Bibelkritik, eine Leistung, die man bei aller sonstigen Wertschätzung oder auch Kritik der frühneuzeitlichen Philosophie nicht unterschätzen darf: Nicht das geringste Verdienst der Vor- und Frühaufklärer Hobbes und Spinoza liegt in der vorurteilsfreien Lektüre der Heiligen Schrift, in ihrer Begründung einer auch das Buch aller Bücher, die Bibel, nicht aussparenden kritischen Exegese. Andererseits darf man nicht vergessen, daß der Stand der Bibelforschung im 16. und 17. Jahrhundert eindrucksvoll ist und Spinoza sie nur begrenzt kennt. Die methodischen Grundzüge der Hermeneutik legt Spinoza wie gesagt im Kapitel 7 des Traktat dar. Dort trägt er Gesichtspunkte philologischer und historischer Argumente vor, die das methodische Arsenal einer wissenschaftlichen Bibelkritik erheblich bereichern. Ihre Grundhaltung, die sich auf sich selbst verlassende, weder „ein übernatürliches Licht“ noch „eine äußere Autorität“ (TTP VII, 144) anerkennende Einstellung, das Prinzip „ex sola scriptura“, vertritt sinngemäß schon die Vorrede. Dort heißt es nämlich: „die Schrift [ist] von neuem mit unbefangenem und freiem Geist zu prüfen und nichts über sie zu behaupten und als ihre Aussage gelten zu lassen, was ich nicht mit voller Klarheit ihr selbst entnehmen könnte“ (Vorrede, 9). Zu den Vorbedingungen gehört, daß die natürliche Erkenntnis allen Menschen gemeinsam ist (TTP II, 32). Als wichtigstes Ergebnis findet Spinoza, daß es in „dem, was die Schrift ausdrücklich lehrt“, nichts gibt, „was mit dem Verstand nicht in Einklang wäre oder ihm entgegenstünde (Vorrede, 10), und zwar mit „der natürlichen Kapazität und gewöhnlichen Auffassungskraft der Menschen“ (TTP VII, 144). Obwohl nach Kapitel 7 „die Methode der Schriftinterpretation sich von der Methode der Interpretation der Natur nicht unterscheidet“, nämlich in einer getreuen Geschichte der Schrift die sicheren Daten und Prinzipien zu sehen, aus denen „in richtiger Folgerung der Geist der Verfasser der Schrift zu erschließen“ ist, wird Spinoza wenige Zeilen später einräumen, „daß die Schrift sehr oft von Dingen handelt, die sich aus den Prinzipien des natürlichen Lichts nicht herleiten lassen“ (TTP VII, 120 f.). Vorausgesetzt man hat ein weites Verständnis von Philosophie, so kann man diese Bibelkritik philosophisch nennen. Sie bedient sich nämlich exklusiv dessen, was die Philosophie vor dem Glauben auszeichnet, der eigenen, natürlichen Vernunft. Allerdings hat Spinozas Bibelkritik auch einen theologischen Charakter. Obschon sie den Anspruch der Schrift verwirft, göttliche Offenbarung zu
O H
sein, billigt sie ihr einen besonderen Rang zu, dessentwegen sie eine so intensive Auseinandersetzung verdient: Die Schrift vermag Spinoza zufolge in der ihrer Entstehungs- und Wirkungszeit angemessenen Weise eine allgemeinmenschliche Moral zu etablieren, die der Gerechtigkeit und Liebe (vgl. Vorrede).
1.5 Schwierigkeiten der Interpretation Klassische Texte der Philosophie sind nie simpel. Der Traktat macht davon keine Ausnahme. Im Gegenteil ist er ein vielschichtiger Text, der schon wegen der genannten Rückfrage eine besondere Komplexität erwarten läßt. Zwei Dinge sind freilich ziemlich klar: als Leitinteresse eine Verteidigung der Freiheit zu philosophieren und als Hauptstütze für das Leitinteresse die Trennungsthese. Nicht so klar ist deren Tragweite. Hier legen sich verschiedene, teils sich ergänzende, teils sich widersprechende Deutungen nahe: Die von Spinoza so vehement geforderte Freiheit besteht zweifellos noch nicht, sonst müßte sie ja nicht gefordert werden. Dieser Umstand, daß sie also noch nicht gegeben ist, läßt die Argumentation nicht unbeeinf lußt. Es kann zumindest nicht ausgeschlossen werden, daß der Autor sich der Situation einer noch zu realisierenden philosophischen Freiheit insofern beugt, als er manche seiner Überzeugungen zurückhält, vielleicht sogar unterdrückt und andere nur andeutet. Immerhin räumt er ein, daß sein Text sich der Ausdrucksweise der Zeit anpaßt und die Fassungskraft der zeitgenössischen Leser berücksichtigt. Für die Beziehung des Traktat zur Religion legen sich nun drei Deutungen nahe: (1) Spionoza kritisiert das Judentum, mit dem er entweder (1.1), biographisch motiviert, abrechnet oder (1.2) dessen mittelalterliche Religionsphilosophie, vor allem die des Maimonides, er endgültig verwirft. (2) Er kritisiert das Christentum, dann entweder (2.1) aus jüdischer oder (2.2) aus innerchristlicher, näherhin neutestamentlicher oder aber (2.3) aus einer nichtreligiösen Perspektive. (3) Er verwirft alle Religion. Zumindest die dritte Deutung erscheint als wenig plausibel. Denn warum soll jemand die Trennungsthese vertreten, der der einen Seite, eben der Religion, alles über die allgemeinmenschliche Moral hinausgehende Recht abstreitet. Ohnehin erkennt Spinoza im Kapitel 14 „Vom Glauben“ (fides) ein dogmatisches Minimum an. Es besteht aus sieben Glaubensartikeln, die für alle Gläubigen glei-
E
chermaßen gültig seien, daher keinen Raum für religiöse oder kirchliche Streitigkeiten ließen. Von den sieben Dogmen sind zumindest die ersten sechs mit den theoretischen Aussagen seines Hauptwerkes, der Ethik, verträglich: Es gibt (1) einen Gott, das heißt ein höchstes, gerechtes und barmherziges Wesen, das (2) einzig und (3) allgegenwärtig ist, (4) die höchste Herrschaft über alles besitzt und (5) den man verehrt, indem man Gerechtigkeit und Nächstenliebe übt und dadurch (6) selig wird. Schließlich erklärt Spinoza (7) Gott für barmherzig, da er dem Reuigen seine Sünden verzeiht. Das erste Dogma hat einen ontologischen – Gott als das höchste Wesen – und einen moralischen Teil: Gott als höchst gerecht und barmherzig, die in den folgenden Dogmen – nur – expliziert werden, der ontologische Teil in den Dogmen 2–4 und der moralische Teil in den Dogmen 5–7. Abgesehen von diesem dogmatischen, freilich primär moralisch orientierten Glaubensminimum räumt Spinoza der Religion nur das Recht ein, auf affektive Weise, durch Frömmigkeit (pietas), zum rechtschaffenen Leben anzuleiten. Infolgedessen scheiden bei der ersten Deutung die bloß oder auch nur primär biographische Lesart und bei der zweiten Deutung die nichtreligiöse Perspektive als unplausibel aus. Die anderen Deutungen dürften dagegen ein gewisses Recht haben, mehr aber kaum. Keine der Lesarten, weder die Kritik an Maimonides noch die am Christentum aus jüdischer oder aber die aus der innerchristlichen Perspektive, verdienen ein Exklusivrecht.
1.6 Ein Frühaufklärer Das Leitinteresse am freien Denken erweist Spinoza als einen Frühaufklärer. Vom Titel bis zum Schlußkapitel verlangt der Traktat, was die Aufklärungsepoche an die Spitze ihrer Forderungen stellt: ein allgemeinmenschliches Recht auf die Freiheit zu denken, was man will, und zu sagen, was man denkt. Dabei schränkt der Philosoph die geforderte Freiheit nicht etwa auf den eigenen Berufsstand ein. Vielmehr schiebt er jede Einschränkung beiseite und setzt sich für eine allgemeine Denk- und Redefreiheit ein. Auf diese Weise agiert er als Wortführer der Menschheit. Spinoza ist auch in dem Sinn Aufklärer und Wortführer der Menschheit, als er sich ganz auf die allen Menschen gemeinsame, natürliche Vernunft beruft. Selbst
O H
für die Schriftauslegung erkennt er weder eine übernatürliche Offenbarung noch eine äußere Autorität an (TTP VII, 144). Nicht zuletzt greift er insofern der klassischen Aufklärung vor, als er die beiden dominanten Mächte der Zeit, Religion und Staat, der Kritik unterwirft. Bei allem Respekt vor den zwei Hauptmächten, dem Staat mit seinen Gesetzen und den Religionsgemeinschaften mit ihren Glaubenssätzen, Ritualen und dem Anspruch auf göttliche Wahrheit, beruft sich Spinoza auf das Recht, das man später zu den „Menschenrechten“ zählt, das Recht, mittels der eigenen Vernunft sich selber ein freies Urteil zu bilden. Dafür braucht es, wird Kant in seiner berühmten Aufklärungsschrift betonen, Mut, den Spinoza in der Tat in hohem Maß unter Beweis stellt. Wo er es für erforderlich hält, greift er die Vorurteile beider Seiten, außer den politischen auch die theologischen Vorurteile, an. Und stets arbeitet er sich in seine Themen „mit Leib und Seele“ ein, sucht dabei Anfeindungen wo möglich zu verhindern, tritt ihnen aber, sofern sie sich nicht verhindern lassen, unerschrocken entgegen. Daß sich darin ein hohes Maß an intellektueller und existentieller Courage zeigt, belegt das Schicksal von Spinozas älterem Zeitgenossen Jan de Witt, der nicht bloß aus seinem Amt vertrieben, sondern auch zusammen mit seinem Bruder Cornelis von einer aufgebrachten Menge ermordet wird. Aufklärer ist Spinoza auch darin, daß er wie schon angedeutet mit der kritischen Analyse der Heiligen Schrift die historisch-kritische Bibelwissenschaft mitbegründet. Nach Spinozas Grundgedanken ist die Schrift keine zeitlose Offenbarung, vielmehr besteht sie vor allem aus Bildreden, die sich an die Einbildungskraft der damaligen Zeitgenossen und deren Fassungskraft richten. Unter dieser Voraussetzung liegt die erforderliche Hermeneutik beziehungsweise Exegese auf der Hand: Die Auslegung der Texte, eben der Bildreden, muß aus den Texten selbst, aus ihrer Sprache erfolgen. Sofern es auch auf den geschichtlichgesellschaftlichen Zusammenhang ankommt, scheint freilich doch erforderlich zu sein, worüber der schlichte Leser kaum verfügt: ein gewisses Maß an Gelehrsamkeit. Sofern die Texte lediglich Bildreden sind, sucht eine weitergehende Hermeneutik, eine Exegese zweiter Stufe, ihren versteckten Subtext, nämlich den vernünftigen Kern, auf. Laut Spinoza ist er moralischer und nur moralischer Natur: Das Gesetz der Schrift soll zur Rechtschaffenheit und Nächstenliebe anleiten. Hier erscheint die Religion als Mittel zur moralischen Kultivierung
E
der Menschen, womit dem, der diesen Leitzweck anerkennt, die Unterschiede der Religionen und deren Konfessionen unerheblich werden. Nach Marx’ vielzitierter elften Feuerbachthese haben die Philosophen bisher die Welt nur verschieden interpretiert, „es kömmt aber darauf an, sie zu verändern“. Mit dem darin anklingenden Anspruch auf revolutionäre Neuigkeit hat sich Marx maßlos überschätzt. Nicht den ersten, aber auch nicht den geringsten Gegenbeleg bietet Spinozas Traktat. Denn er nimmt sich nichts weniger vor, als zwei Welten zu verändern, die Welt der Religion und die Welt der Politik. Und bei beiden Versuchen ist Spinoza durchaus erfolgreich: Nicht unmittelbar, aber auf Dauer werden die Religionsgemeinschaften in Europa und werden vor allem die (west-)europäischen Staaten die geforderte Denk- und Redefreiheit anerkennen. Wie weit Spinozas Traktat dafür mitverantwortlich ist, läßt sich schwer sagen. Alleinverantwortlich ist er jedenfalls nicht, vielmehr spielt eine Fülle der „Aufklärer“ genannten Autoren eine Rolle. Und außer den entsprechenden Intellektuellen darf man das Gewicht der wirtschaftlichen, sozialen und politischen Faktoren nicht unterschätzen. Denn wie schon der erwähnte Pieter de la Court erklärt, tragen religiöse und politische Freiheit zur Blüte eines Gemeinwesens bei.
1.7 Ein Blick in die Wirkungsgeschichte Achtet man auf die ersten Reaktionen, so muß man Spinozas Eintreten für die Freiheit als mißlungen ansehen. Statt die Freiheit zu fördern, statt zumindest für den eigenen Text eine freie öffentliche Diskussion zu stimulieren, provoziert er Anfeindungen. Wegen des Traktat zeiht man Spinoza sogar des damals größten geistigen Verbrechens, des Atheismus. „Folgerichtig“ wird das Werk vehement abgelehnt, seine Verbreitung verboten. Selbst der „Fürst der Aufklärung“, Leibniz, hält das Buch, allerdings bevor er um den Verfasser weiß, für „unerträglich freidenkerisch“ (Brief Nr. 29 an Thomasius, 23.9.1670). Auch nach einem kurzen Briefwechsel im Jahre 1671 – Leibniz schreibt am 5. Oktober an Spinoza, der fünf Wochen später antwortet (Ep 45 und 46) – und seinem Besuch bei Spinoza nimmt Leibniz seine Ablehnung von Spinozas Philosophie nicht entscheidend zurück.
O H
Die ablehnenden Reaktionen mußte der Autor erwarten, erklärt er doch selber in der Vorrede (13), „wie hartnäckig dem Geiste jene Vorurteile anhaften, die das Gemüt unter dem Schein einer frömmelnden Religion angenommen hat“. Andererseits versucht er gar nicht, ein breites Publikum zu überzeugen. Denn er weiß, „daß dem Volk der Aberglaube so unmöglich zu nehmen ist wie die Furcht“. Ebenso weiß er, „daß die Beständigkeit des Volkes Halsstarrigkeit ist und daß es sich nicht von der Vernunft leiten, sondern von blindem Eifer zu Lob und Tadel fortreißen läßt“ (ebd.). Trotz seines Prinzips der eigenen Lektüre richtet Spinoza sich also an wenige Leser, nämlich nur diejenigen, die schon über eine gewisse Bereitschaft zum freien Philosophieren verfügen, die Bereitschaft aber noch nicht in die Tat umsetzen können, da ihnen das Vorurteil im Weg steht, „die Vernunft müsse die Magd der Theologie sein“ (ebd.). Beginnend mit Lessing, danach Herder, Goethe und Mendelssohn, werden später vor allem deutsche Autoren Spinoza schätzen, sich dabei aber vornehmlich, häufig sogar ausschließlich auf die Ethik stützen. Nach Spinozas Wertschätzung seitens der Nachidealisten Schopenhauer und Nietzsche beziehen sich die großen deutschen Soziologen der Jahrzehnte um die Wende des 19. zum 20. Jahrhundert, Ferdinand Tönnis (1855–1936) und Georg Simmel (1858–1918), auch Werner Sombart (1863–1941), ernsthaft auf Spinoza. Bald darauf wird Spinoza wie andere Klassiker der Philosophie Gegenstand einer breiten internationalen Debatte. In Deutschland, wo Carl Gebhardt im Jahr 1924 (Nachdruck: 1972) eine monumentale kritische Edition herausbringt – die neuste kritische Edition verdanken wir Fokke Akkerman (1999) –, bricht allerdings am Ende der Weimarer Republik die Spinoza-Debatte ein, und nach dem zweiten Weltkrieg kommt es zu keiner bedeutenden Spinoza-Renaissance mehr. Zum Abschluß dieses allzu kurzen Blicks in die Wirkungsgeschichte (s. ausführlicher Kap. 13 in diesem Band), seien aus dem deutschen Sprachraum noch drei weder philosophische noch theologische oder politische Vorkriegsstimmen erwähnt (nach Hessing 1933, 221 f.). Der Begründer der Psychoanalyse, Siegmund Freud, schreibt im Alter von 75 Jahren: „Ich habe mein langes Leben hindurch der Person wie der Denkleistung des grossen Philosophen Spinoza eine außerordentliche, etwas scheue Hochachtung entgegengebracht.“ Nach einem der größten Naturforscher, Albert Einstein, ist Spinoza „der Erste gewesen, der den Gedanken der deterministischen Gebundenheit allen Geschehens wirklich
E
konsequent auf das menschliche Denken, Fühlen und Handeln angewendet hat. Nach meiner Ansicht hat sich sein Standpunkt unter den um Klarheit und Folgerichtigkeit Kämpfenden nur darum nicht allgemein durchsetzen können, weil hierzu nicht nur Konsequenz des Denkens, sondern auch eine ungewöhnliche Lauterkeit, Seelengrösse und – Bescheidenheit gehört.“ Schließlich erklärt ein damals vielgelesener Schriftsteller, Jakob Wassermann (1873–1934): „Spinoza, das ist ja wie ein Stück des Geisteshimmel, unter dem man schafft und wandelt“.1
Literatur Aristoteles: Nikomachische Ethik, übers. u. hrsg. v. U. Wolf, Reinbek 2006; griech.: Ethica Nicomachea, hrsg. v. I. Bywater, Oxford 1890 (neuste Auf lage: Cambridge 2010). Bartuschat, W. 2 2006: Baruch de Spinoza, München. Freudenthal, J. 1899 (Hrsg.): Die Lebensgeschichte Spinozas in Quellenschriften: Urkunden und nichtamtlichen Nachrichten, Leipzig. Gawlick, G. 1976: Einleitung, in: Ders. (Hrsg.), Baruch de Spinoza. Theologisch-Politischer Traktat, Hamburg, XI–XXX. Hampe, M./Schnepf, R. (Hrsg.) 2006: Baruch de Spinoza. Ethik in geometrischer Ordnung dargestellt (= Klassiker Auslegen, Bd. 31), Berlin. Hessing, S. 1933: Äußerungen von Persönlichkeiten über Spinoza, in: Ders. (Hrsg.), SpinozaFestschrift zum 300. Geburtstag B. Spinozas (1632–1932), Heidelberg, 221 f. Hubbeling, H. G. 1977: Spinozas Leben und geistesgeschichtlicher Hintergrund, in: Ders., Spinoza, Freiburg/München. Leibniz, G. W. 2 2006: Sämtliche Schriften und Briefe, hrsg. v. d. Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften u. d. Akademie der Wissenschaften in Göttingen, 2. Reihe, Bd. 1, Berlin. Russell, B. 2 1961: History of Western Philosophy, and its Connection with Political and Social Circumstances from the Earliest Times to the Present Day, London; dt.: Philosophie des Abendlandes: Ihr Zusammenhang mit der politischen und sozialen Entwicklung, Darmstadt 3 1954. Strauss, L. 1971: Anleitung zum Studium von Spinozas Theologisch-Politischem Traktat, in: N. Altwicker (Hrsg.), Texte zur Geschichte des Spinozismus, Darmstadt, 300–361. Walther, M. (Hrsg.) 1998: Baruch de Spinoza. Lebensbeschreibungen und Dokumente, Hamburg. – (Hrsg.) 2006: Die Lebensgeschichte Spinozas. Zweite, stark erweiterte und vollständig neu kommentierte Auf lage der Ausgabe von Jakob Freudenthal 1899, 2 Bde., Stuttgart-Bad Cannstatt.
1 Für kritische Bemerkungen vor allem zu Spinozas Biographie danke ich Piet Steenbakkers.
2 Robert Schnepf
Anlaß und philosophische Grundlagen des Theologischpolitischen Traktat sowie der Kontext in Spinozas Werk (Vorrede)
2.1 Der Theologisch-politische Traktat als Intervention Der vollständige Titel des Theologisch-politischen Traktat stellt eine komplexe These vor, die im Verlauf des gesamten Buchs begründet werden soll. Mit ihr werden „die Freiheit zu philosophieren“, die „Frömmigkeit“ und der „Frieden im Staate“ in wechselseitige Verhältnisse gesetzt: Die Freiheit zu philosophieren stellt keine Gefahr für Frömmigkeit und Frieden im Staat dar, alle drei sind miteinander kompatibel; eine Aufhebung der Freiheit zu philosophieren impliziert sogar die Aufhebung von Frömmigkeit und Frieden im Staat. Vielleicht muß man Spinoza sogar die weitergehenden Thesen zuschreiben, daß eine Aufhebung der Frömmigkeit eine Aufhebung der Freiheit zu philosophieren und des Friedens im Staat zur Folge hat, sowie daß die Aufhebung des Friedens im Staat eine Aufhebung der Freiheit zu philosophieren und der Frömmigkeit bedeutet. Nach dieser stärkeren These wären die Freiheit zu philosophieren, wahre Frömmigkeit und Frieden im Staat wechselseitig voneinander abhängig (James 2012, 13). Nun sind solche Thesen für einen heutigen Leser, der in einer modernen westlichen Gesellschaft sozialisiert wurde, auf den ersten Blick eher uninteressant. Wir sind einen mehr oder weniger gut funktionierenden Pluralismus von Konfessionen, Religionen und Weltanschauungen gewohnt, in vielen dieser Gesellschaften sind Bürgerkriegserfahrungen nur noch aus Erzählungen und der Geschichtsschreibung bekannt, und die Freiheit zu philosophieren erscheint oft
R S
als blanke Selbstverständlichkeit. Selbst wenn es sich so verhalten sollte, daß Texte wie der Theologisch-politische Traktat zur Vorgeschichte moderner Gesellschaften gehören oder gar den Ausgangspunkt und das Herzstück „radikaler Aufklärung“ ausmachen (Israel 2001, kritisch dazu Saar 2013b), wäre die Beschäftigung mit ihnen eher eine für Liebhaber oder Spezialisten und es wäre nicht abzusehen, wie das eigene Nachdenken über Gesellschaft, Politik und Religion dadurch provoziert oder befördert werden könnte. Der systematischen Relevanz des Textes und der im vollständigen Titel des Traktat genannten Thesen kommt man vielleicht am besten auf die Spur, wenn man eine Überlegung in den Mittelpunkt stellt, die im Umgang mit philosophischen Texten eher ungewohnt ist: Mit der Publikation des Theologisch-politischen Traktat interveniert Spinoza in einer bestimmten politischen Situation in den Niederlanden.1 Rückt man den Interventionscharakter dieser Schrift in den Mittelpunkt, dann stellen sich nämlich verschiedene Anschlußfragen. Eine Intervention ist situationsbezogen und als solche entsprechend nur verständlich, wenn man diese Situation so genau wie möglich rekonstruiert; in einer Situation hat eine Intervention bestimmte Adressaten, auf die die Intervention eine bestimmte Wirkung ausüben soll; eine ref lektierte Intervention erfolgt auf der Grundlage einer Diagnose der Situation, die hinter Oberf lächenerscheinungen grundlegendere Mechanismen annimmt; eine Intervention bedient sich solcher Mittel, die dem Intervenierenden in dieser Situation angemessen und erfolgversprechend erscheinen; schließlich gilt aber auch, daß Interventionen – wie wohl jedes menschliche Handeln – immer Folgen haben, die unbeabsichtigt sind und mit den Intentionen des Intervenierenden nicht zusammenpassen oder jenseits dieser Intentionen liegen (und das macht einen guten Teil der „Wirkungsgeschichte“ einer Intervention aus). Daß sich der Traktat nun als eine solche Intervention lesen läßt, macht bereits das Vorwort deutlich: In ihm findet sich nicht nur eine Art Tiefendiagnose der Situation, in die Spinoza mit seinem Text intervenieren will, sondern auch eine Angabe zum möglichen Adressatenkreis. Dann aber lassen sich alle die eben aufgeworfenen Fragen auch anläßlich des Traktat stellen. Deshalb sollen im Folgenden knapp sein genauer Kontext, das Verhältnis zu anderen Schriften Spinozas, 1 Vgl. beispielsweise Yovel 1985, der einen ähnlichen Ansatz verfolgt, um Spinozas spezifische Argumentationsweise und den für den TTP spezifischen Gebrauch der Sprache zu rekonstruieren, sowie James 2012, 13.
A G
die den theoretischen Hintergrund ausmachen, von dem aus er interveniert, und seine im Vorwort entwickelte Tiefendiagnose der Situation, in die er interveniert, skizziert werden. Vor diesem Hintergrund erschließt sich das Programm des Traktat und auch die spezifische Relevanz der im Untertitel genannten Thesen. Systematisch relevant für uns Heutige scheinen mir dabei insbesondere der Typ von Tiefendiagnostik, den Spinoza vorschlägt, und der Typ von Intervention, den er praktiziert. Dabei wird es im Folgenden bei bloßen Skizzen bleiben müssen – die indessen auch die Funktion haben sollen, einige der Probleme aufzuwerfen, die sich bei der Lektüre der einzelnen Kapitel stellen mögen. Eines der gravierendsten sei vorweg benannt: Liest man den Text im skizzierten Sinn als Intervention, dann wird man in Rechnung stellen müssen, daß Spinoza über weite Strecken adressatenbezogen argumentiert, so daß eine Diskrepanz zwischen Argumentationsressourcen, die seine Theorie enthält, und den im Traktat tatsächlich vorgebrachten Argumenten bestehen kann. Es mag sogar sein, daß er an einzelne Stellen in seinem Werk für Thesen argumentiert, die für seine Intervention hilfreich sind, die aber vor dem Hintergrund etwa der Ethik zu relativieren sind. Hier wird man im Einzelfall prüfen müssen.2
2.2 Zur Entstehungsgeschichte des Theologisch-politischen Traktat und sein Verhältnis zur Ethik Daß sich der Theologisch-politische Traktat im skizzierten Sinn (auch) als eine philosophische Intervention interpretieren läßt, macht schon seine Entstehungsgeschichte deutlich. Seine früheste Erwähnung findet sich in einem Brief Spinozas von Ende September/Anfang Oktober 1665 an Heinrich von Oldenburg (vgl. Steenbakkers 2010, 29 ff.). Oldenburg hatte in seinem Schreiben die Wirren und 2 Eine Interpretation des TTP wird explizit oder implizit auf die Thesen von Leo Strauss 1952 reagieren müssen, der aus tatsächlichen oder vermeintlichen Widersprüchen innerhalb des TTP und zwischen TTP und Ethik geschlossen hat, daß Spinoza unter den Bedingungen des Schreibens unter Verfolgung eine esoterische Geheimlehre nur indirekt in einem exoterischen Text dargestellt habe. Damit zusammen hängen die Fragen, ob Spinoza im TTP lediglich eine Argumentation und ein Modell für unphilosophische Leser entwickelt habe und die Ethik die unverstellte Darstellung seiner Theorie sei, beziehungsweise ob der TTP geradezu als eine Art Einführung oder Hinführung zu seiner Philosophie verstanden werden könne – vgl. dazu die hilfreiche Kontroverse zwischen Tosel 1995 und Laux 1995.
R S
Grausamkeiten des kürzlich ausgebrochenen englisch-niederländischen Kriegs beklagt (Ep 29, 139). Spinoza reagiert mit einer Anspielung auf den „lachenden Philosophen“ Demokrit, der angesichts dieses Krieges wohl auch in Gelächter ausbrechen würde. Ihn, Spinoza, bewegten „diese Wirren weder zum Lachen noch auch zum Weinen, sondern vielmehr zum Philosophieren und zum besseren Beobachten der menschlichen Natur.“ (Ep 30(1), 141) Spinoza nimmt das zum Anlaß, eine Bemerkung in Oldenburgs Brief aufzugreifen, der geschrieben hatte, daß er Spinoza eher „theologisieren“ als „philosophieren“ sehe, wenn er „Gedanken über die Engel, die Prophetie und die Wunder“ aufschreibe (Ep 29, 139). Spinoza muß also in einem verloren gegangenen Brief zuvor schon von seiner neuen Beschäftigung berichtet haben. Für Oldenburg, den Sekretär der Royal Academy und Vertrauten Robert Boyles, der sich bisher mit Spinoza vor allem über naturwissenschaftliche und metaphysische Probleme ausgetauscht hatte, war diese Ankündigung Spinozas wohl erstaunlich und begründungsbedürftig, und entsprechend fragt er explizit nach dem Plan dieses neuen Projekts und Spinozas Absichten dabei. Diese Fragen stellen sich umso dringlicher, wenn man sich vor Augen hält, daß Spinoza seit ca. 1663 an seiner Ethik gearbeitet und dieses ehrgeizige und aufwendige Projekt zugunsten des Traktat unterbrochen hat. Spinoza charakterisiert den Traktat in seinem Antwortschreiben nun als eine „Abhandlung über meine Auffassung von der Schrift“, also der Bibel. Er nennt dabei drei Absichten, die seinen Themenwechsel begründen, nämlich 1. die Vorurteile (praejudicia) der Theologen zu bekämpfen, die die Menschen daran hinderten, sich der Philosophie zuzuwenden; 2. den Vorwurf des Atheismus von sich abzuwehren; und 3. „die Freiheit, zu philosophieren und zu sagen, was man denkt“ zu verteidigen, und zwar „auf alle Weise“ (Ep 30(1), 141 f.). Vermutlich ist die Charakterisierung des Traktat als eine Abhandlung über seine „Auffassungen von der Schrift“ ebenso stark verkürzend wie seine Angaben zur Gesamtintention, die hinter dem ihm steckt. Dieser Eindruck muß sich zumindest rückblickend vom Traktat aus einstellen, der deutlich aus zwei Teilen besteht, von denen nur der erste theologischen Fragen gewidmet ist, der zweite indessen der Staatslehre beziehungsweise der politischen Theorie. Gleichwohl kann man festhalten, daß Spinoza mit seinem nur provisorisch für einen Briefpartner skizzierten Projekt bereits unmittelbar praktische Absichten verfolgt, und zwar solche, die auf eine Veränderung der Überzeugungen,
A G
der Haltungen und der Handlungen seiner Zeitgenossen zielen. Mit dem ersten Punkt zielt er auf Überzeugungen, Haltungen und Handlungen nicht nur von Theologen, sondern auch von denen, die sich durch die Theologen am Philosophieren hindern lassen; mit dem zweiten Punkt zielt er auf Teile der Öffentlichkeit in den Niederlanden, in der er sich dem Vorwurf des Atheismus ausgesetzt sieht; und mit dem dritten Punkt schließlich auf alle die Überzeugungen, Haltungen und Handlungen, die faktisch in den Niederlanden zu seiner Zeit die Freiheit zu philosophieren und zu sagen, was man denkt, bedrohen oder gar einschränken. In diesem Sinn soll bereits nach dieser Auskunft des Briefwechsels der Theologisch-politische Traktat keine rein theoretische Abhandlung sein, sondern eine Intervention eines Philosophen zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer bestimmten Situation. Zwei weitere Punkte lassen sich aus diesen Überlegungen zur Entstehungsgeschichte gewinnen. Der erste betrifft Berichte, wonach Spinoza bereits wesentlich früher eine Art Proto-Traktat geschrieben habe. Salomon van Til berichtet in seiner 1694 erschienenen Schrift Het voor-hof der heydenen von einem spanischsprachigen Traktat Spinozas, den dieser aber nie publiziert, und in dem er bereits seine Kritik am Judentum begründet habe. Dieses Material sei in den Theologischpolitischen Traktat eingegangen. Im Kern ist das die einzige Quelle für die Existenz dieses Proto-Traktat, der in der Forschung auch oft Apologie genannt wurde. Inwieweit diesem Bericht zu trauen ist, ist umstritten (vgl. Steenbakkers 2010, 30 f.; Walther/Czelinski 2006, Bd. I, 399). Datiert wird dieser Text – wenn es ihn denn je gab – auf die Zeit um 1656, also die Zeit unmittelbar nach dem Konf likt mit der jüdischen Gemeinde, der zum Bann gegen Spinoza geführt hat. Nun ist es natürlich schwer, auf dieser schmalen Grundlage irgendwelche stabilen Aussagen zu gewinnen. Um zu plausibilisieren, daß Spinoza auf Material, das auf die Zeit seiner Ausbildung in der jüdischen Gemeinde zurückgeht (vgl. Popkin 2004, 17 ff.; Popkin 1996; Nadler 2011, 57 ff.) zurückgreifen konnte, als er den Theologisch-politischen Traktat schrieb, ist die Annahme eines ProtoTraktat weitgehend entbehrlich. Mehr noch: Selbst wenn es diese Schrift gegeben haben sollte, kann sie zu nicht mehr denn zur Materialquelle gedient haben. Denn zum einen mußte das Material aus einem Manuskript, das in der Situation um 1656 eine ganz bestimmte Funktion in den Auseinandersetzung mit der jüdischen Gemeinde gehabt haben dürfte, in eine Schrift integriert werden, die offensichtlich einen ganz anderer Zweck verfolgt und der eine ganz andere Kon-
R S
zeption zugrunde liegt. Zum anderen verfügte Spinoza zur Zeit der Abfassung des Traktat über ein ganz anderes theoretisches Rüstzeug als 1656. Er hatte nämlich nach 1656 nicht nur die Abhandlung zur Verbesserung des Verstandes und die Kurze Abhandlung geschrieben sowie die Prinzipien der Cartesianischen Philosophie publiziert – vielmehr noch war er eben seit 1663 mitten in der Arbeit an der Ethik. Der theoretische Hintergrund, vor dem sich Spinoza ab 1665 mit der jüdisch-christlichen Tradition auseinandersetzt, ist also ein ganz anderer als 1656. Insgesamt wird man dem Traktat vermutlich nur gerecht, wenn man rekonstruiert, welche Funktion die erneute Auseinandersetzung mit dem Alten Testament – und damit auch mit der jüdischen Tradition – im bestimmten Kontext seiner Intervention in die Situation in den Niederlanden um 1665 hat. Damit ergibt sich der zweite Punkt: Spinoza hat für den Theologisch-politischen Traktat die Arbeit an der Ethik, an der er vermutlich seit 1663 gearbeitet hatte, unterbrochen, um sie dann 1670 bis zur Fertigstellung des Manuskripts 1675 wieder aufzunehmen. Zum einen bestätigt das den Interventionscharakter des Traktat, muß Spinoza doch über gute, ja zwingende Gründe verfügt haben, seine Arbeit zu unterbrechen (vgl. dazu 2.3). Zum anderen stellt sich die Frage, wie genau sich der Traktat zur Ethik verhält. Dabei ist einerseits zu fragen, welche Rolle die Ethik im Hintergrund der Argumentation des Traktat spielt, andererseits aber auch, ob und wie er seinerseits die Arbeit an der Ethik beeinf lußt hat. Antonio Negri etwa hat die These vertreten, daß die Arbeit am Traktat zu einem grundlegenden Konzeptionswechsel in Spinozas gesamter Philosophie geführt habe (vgl. Negri 1982, 110 ff.). Für Negri hat sich Spinoza nämlich mit den ersten beiden Teilen der Ethik in eine geradezu aporetische Situation manövriert; der Versuch, endliche Einzeldinge (Modi) in einem hierarchischen System von der einen Substanz her zu begreifen, sei 1664 in eine Krise geraten; der Theologisch-politische Traktat habe ihm gleichsam die Möglichkeit gegeben, in einer Art Phänomenologie der politischen, geschichtlichen und ökonomischen Welt die Wirklichkeit neu zu begreifen (zur grundsätzlichen Kritik an Negri vgl. Saar 2013a, 168 ff.). Demgegenüber läßt sich zeigen, daß der Zusammenhang zwischen dem Traktat und der Ethik in vielen Fällen deutlich enger ist, daß ersterer an einzelnen Stellen geradezu einzelne Theorieteile der Ethik voraussetzt (oder zumindest mit ihnen kompatibel ist), und zwar auch mit solchen Theoriestücken, die Negri auf die Zeit vor dem vermeintlichen systematischen Neuansatz datiert (vgl. Melamed 2010). Gleichwohl wird das Verhältnis des Traktat zur Ethik
A G
nicht so sein können, als stützte sich der Traktat argumentativ einfach auf die Ethik oder als lasse er sich gleichsam aus der Ethik ableiten. Die Ethik war noch nicht fertig und der Theologisch-politische Traktat mußte seine Überzeugungskraft auch unabhängig von ihr gewinnen können. Die Ethik und der Traktat richten sich zudem an sehr verschiedene Leserkreise, was auch dazu führt, daß die Argumentationsweise und die Ebenen des Argumentierens in beiden Texten sehr verschieden sind. Tatsächlich finden sich im Traktat auch Formulierungen und Thesen, die vor dem Hintergrund der Ethik eigentlich als falsch und inadäquat erscheinen.3 Schließlich und vor allem aber ist der Traktat auch eine Intervention zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer bestimmten Situation. Der Traktat zielt auf ein anderes, weiter gefaßtes Publikum als die Ethik, die letztlich philosophisch gut trainierte Leser voraussetzt und im Ganzen nicht als Intervention in eine politisch-gesellschaftliche Situation hinein, sondern als Hilfestellung zur Orientierung des eigenen Lebens dienen soll. Auch wenn das Verhältnis zwischen Theologisch-politischem Traktat und der Ethik schwierig zu bestimmen ist, sind sie letztlich doch vor dem Hintergrund einer beiden zugrundeliegenden Haltung und Überzeugung zu interpretieren. Sie zeigt sich in Spinozas Reaktion auf Oldenburgs Klagen über die Unvernunft der Menschen im englisch-niederländischen Krieg (Ep 30(1)): Spinoza schreibt dort, ihn bewegten die Ereignisse nicht zum Lachen oder Weinen, sondern zum Philosophieren und Beobachten der menschlichen Natur. Diese Haltung führt zu einer Konsequenz, mit der er seinen Kommentar zu dem Krieg abschließt: „Jetzt aber lasse ich jeden nach seinem Sinn leben, und wer will, der möge immer für sein Glück sterben, wenn ich nur das wahre leben darf.“ (Ep 30(1), 141) Er begründet diese Haltung damit, daß jeder Mensch nur ein Teil der Natur sei und „daß ich doch nicht weiß, wie jeder Teil der Natur mit seinem Ganzen zusammenstimmt und wie er mit den übrigen Teilen zusammenhängt“ (ebd.), also durch einen Rückgriff auf zentrale Aussagen der Metaphysik seiner Ethik. Entsprechend findet sich diese Haltung auch in der Ethik, etwa im Vorwort des dritten Teils (vgl. E III, 219 f.), und auch dort wird sie im Rückgriff auf die 3 Vgl. hierzu erneut Strauss 1957 oder die Liste inadäquater Ausdrücke bei Yovel 1985, 327. Ein Beispiel für solche Spannungen zwischen TTP und Ethik bietet auch die Argumentation in TTP XVI, daß die Natur alles Recht habe, da die Macht der Natur die Macht Gottes sei und Gott das höchste Recht habe (vgl. TTP XVI, 238 f.). Das Argument setzt einen Gottesbegriff voraus, der etwa vor dem Hintergrund von E II, Lehrsatz 3, Anmerkung inadäquat erscheinen muß – vgl. dazu Schnepf 1993.
R S
Natur und ihre Gesetze und Regeln begründet. Noch eindrücklicher findet sich diese Maxime schließlich in der Einleitung des Tractatus Politicus: „Um das, was Gegenstand dieser Wissenschaft ist, mit derselben Unbefangenheit, mit der wir es bei der Mathematik zu tun pf legen, zu erforschen, habe ich mich sorgsam bemüht, menschliche Tätigkeiten nicht zu verlachen, nicht zu beklagen, sondern zu begreifen.“ (TP I, 4, 9 f.) Diese Haltung scheint eine Konstante zu sein. Sie verdankt sich nicht erst der Zuwendung zu Fragen der Politik und Geschichte im Theologisch-politischen Traktat, sondern ist in der metaphysischen Konzeption des ersten Teils der Ethik begründet, insbesondere auch in der Kritik des moralischen Vokabulars schon im Appendix zu ihrem ersten Teil. Dabei wirft diese Haltung zugleich zwei Probleme auf, die eine Interpretation des Traktat zu berücksichtigen hat: Zum einen stellt sich die Frage, in welchem Sinn eine Theorie, die den Schwerpunkt so sehr auf das Verstehen und Analysieren legt, überhaupt normative Behauptungen entwickeln und begründen kann und will. Zum anderen stellt sich die damit zusammenhängende Frage, wieso und mit welchen Absichten jemand, der diese Haltung hat, überhaupt in eine politisch-gesellschaftliche Situation intervenieren möchte. Normalerweise interveniert jemand gerade dann, wenn er etwas verachtet, haßt oder etwas von ihm Geschätztes bedroht wird – beziehungsweise wenn es seinen normativen Erwartungen nicht entspricht.
2.3 Kontext und Anlaß des Theologisch-politischen Traktat Die Arbeit am Traktat beginnt 1665 und Spinoza korrespondiert darüber mit Oldenburg vor dem Hintergrund des englisch-niederländischen Kriegs, der seit 1664 tobt. Dabei ist vermutlich weniger der Konf likt selbst, als vielmehr die Veränderung der innenpolitischen Situation in den Niederlanden für Spinoza zentral. Um sie in den Blick zu bekommen, muß man sich vorab zumindest grob über einige Strukturmerkmale der politisch-gesellschaftlichen Situation in den Niederlanden zur Zeit der Herrschaft Jan de Witts, also des Regimes der „wahren Freiheit“ orientieren. Drei Punkte sollen dabei in aller Kürze genügen: 1. Amsterdam ist in der fraglichen Zeit das Zentrum des frühen europäischen Handels- und Finanzkapitalismus (vgl. hierzu und zum Folgenden Braudel 1986, 187–303; Israel 1998; Lademacher 1983, Kap. 2 und 3; Hecker 1975, 1.
A G
Teil). Im Hafen von Amsterdam werden die Güter des Ostseeraums, aus den spanischen Kolonien in Lateinamerika und aus den eigenen Kolonien umgeschlagen (die Familie Spinozas und zeitweise Spinoza selbst waren in diesem Handel tätig – vgl. Nadler 1999, 80). Diese Geschäfte waren kreditfinanziert und durch ein entwickeltes Versicherungswesen abgesichert. (Daher auch die Entwicklung der Wahrscheinlichkeitsrechnung, für die sich Spinoza interessiert hat – vgl. Ep 38.) Mit Schuld- und Anteilsscheinen konnte gehandelt werden, so daß Amsterdam eine der ausdifferenziertesten und umsatzstärksten Börsen hatte und entsprechend auch Börsenzusammenbrüche kannte. In anderen Provinzen der Niederlande hing die Wirtschaft hingegen immer noch hauptsächlich von traditionelleren Gewerben ab, etwa der Fischerei oder der Landwirtschaft. Entsprechend gab es Interessenkollisionen zwischen Provinzen mit eher traditionellen Wirtschaftsformen und Provinzen – insbesondere eben Amsterdam –, die vor allem von diesem Handels- und Finanzkapitalismus lebten. Zugleich differenzierte sich die Gesellschaft aus: Eine reiche Handels- und Finanzaristokratie konkurrierte mit dem alten Adel und mittleren Kauf leuten, in anderen Regionen dominierten Bauern in verschiedenen Lebenslagen, zugleich suchten kaum ausgebildete Arme in prekären Beschäftigungsverhältnissen sowohl auf dem Land wie in den Städten sich irgendwie durchzuschlagen. 2. Die Konf likte zwischen diesen unterschiedlichen Provinzen und Bevölkerungsgruppen wurden in den „Vereinigten Provinzen“ im Rahmen von politischen Institutionen ausgetragen, die sich zu gutem Teil noch der Zeit der spanischen Herrschaft verdankten (vgl. hierzu auch Spinozas Analysen in TP IX, 14, 203 f.). Hier standen sich zwei Richtungen gegenüber, diese staatlichen Institutionen zu modifizieren und zu besetzen. Aus der spanischen Zeit hatte sich – unter diesem Namen – das Amt des Statthalters erhalten, das gewohnheitsgemäß mit einem Angehörigen aus dem Haus der Oranier besetzt wurde. Demgegenüber stand das Amt des Ratspensionärs, der gleichsam oberstes Exekutivorgan der vereinigten Generalstände der Vereinigten Provinzen war (neben den Generalständen der einzelnen Länder und deren Räten). Die Herrschaft von Jan de Witt (der eben Ratspensionär war) wurde in einer Phase begründet, als das Amt des Statthalters abgeschafft worden war, während der aber die Anhänger des Hauses von Oranien weiterhin quasi-monarchistische Ziele verfolgten, um den Statthalterposten der Tradi-
R S
tion entsprechend wieder zu besetzen. Der Ausdruck „wahre Freiheit“ meint primär dieses republikanische System ohne Statthalter (und erst recht ohne Monarchen). Der Konf likt zwischen den verschiedenen Verfassungskonzeptionen bildet die regionalen und ökonomischen Spannungen ab: Das Regime Jan de Witts konnte sich vor allem auf die Handels- und Finanzaristokratie stützen, die Bewegung der Oranier vor allem auf die eher traditionellen Regionen und Bevölkerungsschichten (vgl. zu de Witts Konzeption Prokhovnik 2004, 88 ff.). 3. Überlagert und verstärkt wurden diese Konf likte durch Religionsstreitigkeiten (vgl. van der Wall 2003 und 1995). Damit ist weniger der Konf likt zwischen Katholiken, kleineren Kirchen (wie etwa den Mennoniten) oder Juden und der calvinistischen Kirche gemeint, als vielmehr der tiefe Konf likt in der calvinistischen Kirche selbst. Hier standen sich unterschiedliche Auslegungen oder Weiterentwicklungen des Calvinismus gegenüber, nämlich einmal ein orthodoxer Calvinismus, der sich an der Auslegung von Gomarus orientierte, und ein eher liberaler Calivinismus, der sich an die Theologie von Arminius anschloß. Für den orthodoxen Calivinismus charakteristisch waren nicht nur bestimmte dogmatische Punkte (etwa in der Prädestinationslehre), sondern auch die Vorstellung, daß das gesamte staatliche und gesellschaftliche Leben nach den Geboten der Schrift einzurichten sei. Gerade in diesem Punkt erlebte die Interpretation des Alten Testaments in der protestantischen Theologie eine neue Konjunktur, und hieraus erklärt sich das Interesse an der Theokratie des alten Israel als eines Modells zur Gestaltung der eigenen Gegenwart (vgl. TTP XVII). Tendenziell unterstützten orthodoxe Calvinisten die Sache der Oranier (die sich zumindest gelegentlich bereitwillig auf die Orthodoxen stützten), während liberalere Theologen eher das System der Regenten um de Witt unterstützten. Entsprechend hatten die unterschiedlichen theologischen Richtungen auch unterschiedlichen Anklang in den verschiedenen Bevölkerungsgruppen und Regionen. Damit ergibt sich in groben Umrissen die Struktur der politisch-gesellschaftlichen Situation, in die Spinoza mit seinem Theologisch-politischen Traktat interveniert: Der entscheidende Punkt ist dabei, daß religiöse und theologische Konf likte einerseits und originär politische und ökonomische Konf likte untrennbar ineinander verf lochten zu sein schienen, Konf likte die sich nicht
A G
zuletzt wegen der Eigendynamik des Handelskapitalismus verschärften, der ein ganz anderes Verhalten von den Menschen in seinem Einzugsbereich forderte, als es manchem Traditionalisten Recht war. Dieser Konf likt betrifft deshalb nicht etwa nur die grundlegende Frage nach der Legitimation politischer Herrschaft und die Frage nach der Staatsform überhaupt, sondern mehr noch einzelne politische Detailprobleme wie Feiertagsordnungen, Kleiderordnungen, Luxus, Gewinnstreben, Toleranz oder Duldung Andersgläubiger. In der Konsequenz kommt es nicht nur immer wieder zu harten Repressionen, sondern zu geradezu bürgerkriegsähnlichen Zuständen, die etwa zur Hinrichtung Oldenbarnevelts (1619) beziehungsweise zur bestialischen Ermordung der Brüder de Witt (1672) führten. Ist man nun auf der Suche nach einem Anlaß, warum Spinoza die Arbeit an der Ethik unterbrochen hat, um sich dem Traktat zu widmen, lassen sich zwei Vermutungen anstellen: Zum einen kann man an den schon mehrfach zitierten Brief 30(1) anknüpfen. Der dort erwähnte englisch-niederländische Krieg hat die innenpolitische Lage verschärft. De Witt war auf Zugeständnisse an seine innenpolitischen Gegner angewiesen, die militärische Lage sah in der Anfangsphase eher schlecht aus, so daß das Regime der „wahren Freiheit“ alles andere als stabil erscheinen mußte (vgl. zur prekären Lage de Witts Rowen 1986). Spinoza hätte dann – so diese These – in kritischer Lage interveniert, um das System de Witt zu stabilisieren (doch ist fraglich, ob das nicht kontraproduktiv gewesen wäre, weil ein solches Engagement Spinozas de Witt geradezu diskreditiert hätte). Zum anderen ist vorgeschlagen worden, Spinozas Verwicklung in die Neubesetzung einer Pfarrstelle Voorburg in diesem Sinn zu deuten (Nadler 2011, 49 f.). Er sei dadurch erneut als Atheist ins Gerede gekommen und genau darauf ließe sich die Bemerkung in Ep 30(1) beziehen. Letztlich sind solche Überlegungen aber angesichts der Quellenlage eher spekulativ.
2.4 Die Vorrede I: Die Tiefendiagnose Die Vorrede ist nach den Regeln der klassischen Rhetorik gegliedert (Akkerman 1985, 384): Das exordium (Abschn. 1–6) skizziert eine Theorie des Aberglaubens, die propositio (Abschn. 7–8) entwickelt das Thema des Buches aus der Theorie des Aberglaubens, die narratio (Abschn. 9) berichtet von den Motiven des Autors
R S
zum Schreiben, die divisio (Abschn.10–14) gibt einen Überblick über den Aufbau des Buches, und die abschließende peroratio (Abschn. 15–16) spezifiziert den Adressatenkreis und die Erwartungen, die der Autor mit seinem Werk verbindet. Spinoza entwickelt also das Thema des Traktat in den ersten beiden Abschnitten des Vorworts aus seiner Theorie des Aberglaubens (superstitio). Der erste Satz nennt bereits die zwei zentralen Begriffe für die weitere Argumentation: „Rat“ beziehungsweise „Plan“ (consilium)4 und „Glück“ (fortuna) werden einander gegenübergestellt. Könnten die Menschen ihre Angelegenheiten nach einem sicheren Plan (certo consilio) beherrschen (regere), oder wären sie dem Glück nicht so ausgeliefert (weil es ihnen immer günstig wäre), dann würden sie nicht dem Aberglauben verfallen. Daß die Theorieskizze Spinozas auch auf eine Diagnose der Rezeptionsbedingungen abzielt, wird daran deutlich, daß er im Abschnitt 2 dafür argumentiert, daß Menschen unter den Bedingungen des Aberglaubens für vernünftigen Rat unempfänglich, beziehungsweise ihm gegenüber sogar feindselig eingestellt sind. Zusammen mit der zu Beginn des fünften Abschnittes eingeführten These, daß alle Menschen von Natur aus dem Aberglauben „unterworfen sind“ (homines natura superstitioni esse obnoxios), ergibt sich, daß auch die Adressaten des Traktat den von ihm herausgearbeiteten Mechanismen unterliegen sollen. So gelesen läßt sich aus den beiden ersten Absätzen der Vorrede auch eine indirekte Charakterisierung des Typs von Intervention entnehmen, die Spinoza mit dem Traktat insgesamt verfolgt: Es handelt sich eben selbst um eine Art Rat (consilium), und zwar um einen Rat, die Dinge in einer ganz bestimmten Weise zu betrachten. So interpretiert, lassen sich auch die oben aufgeworfenen Fragen beantworten (vgl. 2.2, Ende): Wenn man die Dinge nicht belachen oder beweinen will, sondern nur verstehen möchte, kann man gleichwohl einen Rat geben, ohne damit eine Forderung zu erheben oder Erwartungen zu verknüpfen. Wer einen Rat erhält, ist nicht verpf lichtet, diesen Rat auch anzunehmen. Das paßt recht gut zu einer Bemerkung im Vorwort des Politischen Traktat, nach der es unsinnig sei, aus abstrakten Rechtstheorien normative Forderungen abzuleiten (vgl. TP I, 1, 7). Schließlich paßt diese Interpretation auch zu den metaethischen Posi4 Bartuschat übersetzt „consilium“ im ersten Absatz mit „Plan“, im Folgenden auch mit „Rat“. Er kann so den nötigen Kontrast im ersten Absatz herausarbeiten, schwächt aber den Zusammenhang mit dem zweiten ab. Auf die zentrale Rolle der Begriffe „fortuna“ und „consilium“ in der Vorrede hat Moreau 1994, 468 ff., hingewiesen.
A G
tionen, die Spinoza in der Ethik entwickelt: Dort kennt er nämlich auch keine originär moralischen Pf lichten etwa im Kantischen Sinn oder im Sinn theologisch fundierter Naturrechtskonzeptionen (vgl. Schnepf 2000 und 2008). Die Resultate des Traktat als naturrechtliche oder vernunftrechtliche Normen mit verpf lichtendem Charakter zu lesen, wäre daher ein grobes Mißverständnis (vgl. zum Naturrechtsbegriff Spinozas Walther 1985). Die Theorie des Aberglaubens selbst wird in vier Schritten ausgehend vom Begriff des Glücks (fortuna) aufgebaut, nämlich einer Art Strukturanalyse menschlicher Alltagserfahrung, einer These über menschliche affektive Reaktionen auf diese Struktur menschlicher Alltagserfahrung (vgl. Moreau 1994, 470 ff.), einer These über den Zusammenhang affektiver Reaktionen und menschlicher Überzeugungssysteme, und schließlich einer Skizze der möglichen Eigendynamik und Geschichte solcher Überzeugungssysteme. 1. Im Alltag erfahren wir uns als nach Gütern strebend, die nicht völlig in unserer Verfügung liegen. Diese Güter sind Güter, weil sie von uns affektiv besetzt sind. Zugleich erfahren wir im permanenten Wechsel zwischen dem Erfolg und dem Scheitern unseres Strebens, daß diese Güter nicht kontrolliert verfügbar sind. Scheitern und Erfolg werden von uns als kontingent erfahren, weil prinzipiell die Komplexität und die Macht der uns umgebenden Dinge unsere Handlungs- und Erkenntnismöglichkeiten bei weitem übersteigen. „Glück“ ist geradezu ein Ausdruck dieser Kontingenzerfahrung. 2. Nach affektiv besetzten Gütern in einer Situation der Ungewißheit zu streben, ist zwangsläufig von bestimmten affektiven Reaktionen begleitet, nämlich je nach Einschätzung der Situation von Hoffnung und Furcht. Insofern wir uns im Alltag prinzipiell als nach affektiv besetzten Gütern strebend erfahren, die wir nur kontingenterweise erlangen, schwanken wir im Alltag ebenso prinzipiell zwischen Hoffnung und Furcht. 3. Was man glaubt oder meint, beziehungsweise wovon man überzeugt ist, ist zumeist von dem affektiven Zustand abhängig, in dem man sich befindet. Affekte können zumindest Ursachen von Überzeugungen sein. Spinoza interessiert nun insbesondere der Zustand der Furcht. Er vertritt die These, daß Menschen, „solange sie in Furcht schweben“, glauben (putant), daß etwas, das ihnen begegnet und „an ein vergangenes gutes oder schlechtes Ereignis erinnert“ (Abschn. 2), ein Zeichen für den Erfolg oder Mißerfolg ihres
R S
Strebens sei. Dabei ist es seinerseits kontingent, was die Rolle eines solchen Zeichens spielen kann. Der unhintergehbare affektive Zustand des Schwankens zwischen Hoffnung und Furcht führt für Spinoza also notwendigerweise zu einer Art Kontingenzkompensationsreaktion, nämlich zu ihrerseits kontingenten und irreführenden Kausalattributionen, deren primäre Funktion es ist, Furcht in Hoffnung zu verwandeln. 4. Nimmt man nun noch an, daß alles dies vor dem Hintergrund eines religiösen Überzeugungssystems geschieht, entwickelt sich Aberglaube (superstitio): „Und wenn sie mit großem Erstaunen etwas Ungewohntes sehen, halten sie es für ein Wunderzeichen, das den Zorn der Götter oder der höchsten Gottheit kundtut; es nicht mit Opfern und Gelübden zu besänftigen erscheint Menschen im Banne des Aberglaubens und fern der Religion als Frevel.“ (Abschn. 2) Wenn sich in den Zeichen, aber auch im glücklichen oder unglücklichen Ausgang einer Angelegenheit der Wille der Götter oder Gottes manifestiert, dann kommt alles darauf an, den Willen der Götter günstig zu stimmen. Zum Aberglauben gehören soziale Praktiken des Strafens und des gewaltsamen Ausschließens. Spinoza unterscheidet vermutlich strikt terminologisch zwischen Aberglauben (superstitio) und Vorurteil (praeiudicium). Ein Vorurteil ist primär ein epistemischer Zustand, der darin besteht, eine falsche Meinung oder Überzeugung zu haben. Aberglaube ist demgegenüber eine falsche Überzeugung von den Göttern oder von Gott, die der Kontingenzbewältigung in einer komplexer werdenden Welt unter der Bedingung der Unkenntnis der wahren Kausalzusammenhänge entspringt, wesentlich durch die Affekte der Furcht oder der Angst getragen ist und soziale Praktiken gewaltsamer Exklusion motiviert: Aberglaube ist nicht nur ein individueller epistemischer, sondern primär ein individueller affektiver Zustand (vgl. James 2012, 25), der durch die Eigendynamik sozialer Praktiken dann sogar noch gestützt und verstärkt wird. Dabei charakterisiert Spinoza Aberglauben als eine Art aus Furcht entstandenen Wahnsinn (Abschn. 3), also als eine Krankheit. Das wiederum paßt gut zur Interpretation des Traktat als einer philosophischen Intervention vom Typ des Rates – nun allerdings gleichsam zugespitzt als analog zu einem therapeutischen Rat eines Arztes.5 5 Daß Spinozas Philosophie insgesamt – also auch im Fall der Ethik – eher therapeutisch konzipiert ist, ist natürlich eine weitreichende These. Vgl. zu diesem Ansatz zur Interpretation der Ethik Renz 2008.
A G
Daß die Theorie des Aberglaubens im Kontext des Vorworts zum Traktat als eine Art Tiefendiagnose des theologisch-politischen Problemkomplexes gelesen werden kann, ergibt sich daraus, daß Spinoza in den Abschnitten 5–8 auch einige Grundzüge der Situation, in die hinein er interveniert, im Rückgriff auf diese Theorie erklärt: Aberglaube ist als soziale Praktik ein zentraler kausaler Faktor für die Genese der in 2.3 geschilderten, problematischen Verquickung von Religion und Politik. Aus der Kontingenz der Inhalte des Aberglaubens ergibt sich seine permanente Anfälligkeit für plötzliche Umschläge ins Gegenteil, aus seiner Verbindung mit Opfer und Rachegedanken sein Hang zur Gewalttätigkeit und aus beidem, daß er ein Grund für zahlreiche Aufstände und Rebellionen, also für Instabilität und Gewaltausbrüche ist (Abschn. 5 und 7). Umgekehrt läßt sich Aberglaube auch politisch instrumentalisieren, wenn es beispielsweise gelingt, seiner Instabilität durch Repression zu begegnen (Abschn. 6). Auch ermöglicht es der Aberglaube, daß sich Menschen geradezu pervers im Interesse der politischen Herrschaft verhalten, etwa wenn sie sich selbst freudig für das Vaterland auf dem Altar der Schlachtfelder opfern (Abschn. 7).6 Es scheint mir wahrscheinlich, daß die Charakterisierung der eigenen Situation in den Niederlanden (Abschn. 8) zu einem guten Teil ironisch zu lesen ist. Spinoza hatte Beispiele aus seinem unmittelbaren Umfeld vor Augen, die zeigten, daß das Regime der „wahren Freiheit“ eben keines der vollen Freiheit (libertas integra) war. Die Analysen des Vorworts müssen entsprechend auch als Analysen der Problemlage in den Niederlanden um 1670 gelesen werden. Fragt man sich, wie Spinoza seine Tiefendiagnose zu plausibilisieren versucht, so finden sich auf der Oberf läche des Textes vor allem zwei rhetorische Mittel, nämlich zum einen der Appell an die Alltagserfahrung, zum anderen aber der Hinweis auf ein Exemplum, nämlich auf Begebenheiten aus der Vita Alexanders des Großen, wie sie in der – zu Spinozas Zeit hochgeschätzten – Alexanderbiographie von Q. Curtius Rufus berichtet werden. Doch lohnt es sich, noch genauer hinzuschauen und einzelne Begriffe und Formulierungen in den Blick zu nehmen: „Fortuna“ ist beispielsweise kein theoretischer Begriff der Philosophie Spinozas (im Unterschied zu Machiavelli, für den der Fortunabegriff in
6 Diese Passage liest sich wie eine Wiederholung des Kommentars zum englisch-niederländischen Krieg in Ep 30(1) an Oldenburg, der oben ausführlich zitiert wurde.
R S
seiner Analyse der Politik zentral ist – vgl. Kersting 1988, 104 ff.). Spinoza greift damit vielmehr einen Begriff auf, der im 15. und 16. Jahrhundert in der Moralphilosophie (etwa bei Lorenzo Valla) und in der von ihm intensiv gelesenen spanischen Literatur eine erstaunliche Karriere gemacht hat.7 Die Konjunktur der Fortuna-Thematik läßt sich vielleicht so deuten, daß sie eine Möglichkeit ist, die neuen Erfahrungen im frühen Handelskapitalismus, in dem man „durch Glück“ zu ungeheurem Reichtum und zu ungeheurer Armut kommen konnte, zu thematisieren, und dabei zu zeigen, daß sich gerade unter diesen Bedingungen eine verstärkte Entkoppelung von Wohlstand und Moralität einstellt. Dabei teilt Spinoza jedoch letztlich die Diagnose, die sich bereits bei Descartes findet, daß nämlich das Urteil, etwas hänge vom Zufall (fortune) ab, letztlich nur besagt, daß eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür besteht, ohne aber alle Ursachen zu kennen (vgl. Descartes 1984, Art. 145, 225). Vor diesem Hintergrund wird auch der Umstand relevant, daß Spinoza allein in den ersten zwei Absätzen der Vorrede an drei Stellen Formulierungen aus den Komödien von Terenz aufgreift.8 Das betrifft bereits den ersten Satz des Vorworts, das betrifft aber auch so zentrale Beobachtungen wie die von der Wechselhaftigkeit des Hoffens und Fürchtens und die von den Problemen der Ratsuche. Der starke Rückgriff auf die Geschichtsschreibung, vor allem aber auf antike Komödien vor dem Hintergrund der zeitgenössischen spanischen Literatur war für Spinozas Zeitgenossen leicht zu erkennen. Methodisch bedeutet er mehreres: Die Anspielungen auf die Komödie schaffen von vornherein eine Art Distanz zum Dargestellten, die deutlich macht, daß Spinoza angesichts der Probleme nicht etwa „weint“, sondern eher „lacht“, und dieses distanzierende 7 Quevedo etwa läßt in Die Fortuna mit Hirn oder die Stunde aller die personifizierte Fortuna vor den Richtstuhl der Götter treten und vereinbart mit Jupiter, daß alle Menschen zu einer bestimmten Stunde nicht das haben, was ihnen durch Glück zugeteilt worden ist, sondern was sie aufgrund der Moral eigentlich haben müßten. Dieser Text ist ein Paradebeispiel spanischer satirischer Sozialkritik des Goldenen Zeitalters. Hintergrund ist hier die Erfahrung, das Glück und Unglück in der Welt nicht nach Prinzipien der Gerechtigkeit verteilt sind, sondern aus nicht durchschaubaren Gründen (fortuna) in geradezu empörender Weise – vgl. zu Spinozas Bezüge zu antiken Autoren, aber auch zum Jesuitentheater van den Endens Proietti 2010; zu seinem Verhältnis zur spanischen Literatur Ansaldi 2001. 8 Vgl. hierzu den Kommentar in der TTP-Ausgabe der Oeuvres von J.-P. Moreau (Akkerman 1999, 697 f.). Der Kommentar macht darüber hinaus deutlich, wie sehr die klassisch-römische Literatur in der Vorrede präsent ist.
A G
Lachen ist gleichsam eine Vorübung zu dem Typ von kaltem Verstehen, das bereits in Ep 30(1) als methodische Grundhaltung angestrebt wird. Zugleich bieten die Literatur wie auch die Geschichtsschreibung beziehungsweise die Schriften praktischer Politiker (vgl. TP I, 1, 7) geradezu eine Überfülle an Erfahrungswissen. Schließlich funktionieren auch Komödien nur durch Wiedererkennungseffekte. Der Rückgriff auf den eigentlich inadäquaten und defizitären FortunaBegriff ermöglicht es dabei, an eine zu Spinozas Zeit vorherrschende Selbstinterpretation des Erfahrungswissens anzuknüpfen. Spinoza versucht mit durchaus rhetorischen Mitteln im Rückgriff auf Erfahrungswissen eine Theorie des Aberglaubens für seine zeitgenössischen Leser zu plausibilisieren, denen die Ethik noch nicht vorlag. Dabei ist die von ihm vorgelegte Theorieskizze mit den Argumentationen der Ethik kompatibel, sie läßt sich sogar aus einigen ihrer Lehrsätze entwickeln. Das betrifft nicht nur die terminologische Unterscheidung zwischen „Aberglaube“ (superstitio) und „Vorurteil“ (praeiudicium) sowie die Genealogie des Aberglaubens, die sich ziemlich genau mit der korrespondierenden Skizze in E I, Anhang decken. Viel mehr noch betrifft es auch die These vom Schwanken zwischen Furcht und Hoffnung und die Genese des Aberglaubens aus der Furcht sowie die Theorie des Omens (vgl. E III, Lehrsatz 50 einschließlich der Anmerkung). Die Tiefendiagnose des politisch-theologischen Problemkomplexes hat ihre theoretischen Fundamente in Theoriestücken, die in der Ethik systematisch begründet werden, und die dort in Textteilen präsentiert werden, die zum Teil auf die Zeit vor der Arbeit am Theologisch-politischen Traktat zu datieren sind (sicher für E I, Anhang), zum Teil eventuell erst später entstanden sind (E III, Lehrsatz 50).
2.5 Die Vorrede II: Zu Programm und Adressatenkreis des Traktat Spinoza kündigt in Abschnitt 8 an, für die eingangs erwähnten Kompatibilitätsbeziehungsweise Abhängigkeitsthesen argumentieren zu wollen. Das soll in zwei Schritten dadurch geschehen, daß Vorurteile (praeiudicia) über die Religion und über das „Recht des Souveräns“ aufgezeigt werden (indicare). Vor dem Hintergrund der Tiefendiagnose ist an der genauen Formulierung der unmittelbaren Aufgabe zweierlei entscheidend: Zum einen zielen die im Traktat entwickelten
R S
Argumentationen ausschließlich auf Vorurteile, nicht auf den Aberglauben. Zum anderen sollen diese Vorurteile lediglich aufgezeigt werden, nicht aber „weggeräumt werden“ (removere – wie es in einer parallelen Formulierung in E I, Anhang, 79 heißt). Die Aufgabe des Traktat ist also angesichts der Tiefendiagnose von vornherein eine bescheidene. Das ist aber wiederum aus der Tiefendiagnose erklärbar. Denn wenn Aberglaube eine notwendige Folge des Schwankens zwischen Furcht und Hoffnung, also kein epistemischer sondern primär ein affektiver Zustand ist, dann kann Aberglaube nur durch eine Bearbeitung der Affekte, die jemand hat, gemildert oder gar überwunden werden. Das erfordert eine individuelle Bearbeitung der je eigenen Affekte beziehungsweise affektiven Reaktionen (und genau das ist etwas, wozu die Ethik in einigen ihrer Teile Hinweise geben soll). Dann aber kann der Aberglaube auf der Argumentationsebene, auf der sich der Traktat bewegt, gar nicht beseitigt werden. Das bedeutet, daß die Vorurteile, die ja durch den Aberglauben gestützt werden, auch nicht einfach in dem Sinn beseitigt werden können, daß ihnen jemand überhaupt nicht mehr anhängt. Bei Allem, was man tun kann, ist aufzuzeigen, daß es Vorurteile sind, um damit die Folgen des Aberglaubens bei den Adressaten zu mildern und einen eher unbefangenen Blick zu ermöglichen. Das Ziel des Traktat ist deshalb nicht, daß niemand in einer Gesellschaft mehr dem Aberglauben anhängt. Eher läßt es sich so umschreiben, daß diejenigen, die sich ihre Vorurteile aufzeigen lassen, mit ihrem Aberglauben und dem Aberglauben der anderen in produktiverer, nicht dermaßen desaströser Weise rechnen und umgehen. Doch noch ein weiterer Punkt läßt sich aus dieser genauen Aufgabenbeschreibung des Traktat gewinnen: Um jemandem, der in Vorurteilen befangen ist, klar zu machen, daß er in Vorurteilen befangen ist, ist es nicht nötig, an die Stelle der Vorurteile in jedem Fall philosophische Wahrheiten zu setzen. Ganz im Gegenteil wird die Argumentation an einigen Kernpunkten der Vorurteile ansetzen müssen, diese teils durch interne Kritik, teils durch den Rückgriff auf dem Adressatenkreis plausible Theoreme der systematischen Philosophie korrigieren und bereinigen müssen, aber so, daß die letztlich in der Struktur des Aberglaubens Verharrenden durch die Korrektur ihrer Vorurteile gleichwohl eine für sie geeignete und konstruktivere Lebensform finden können. So lassen sich zahlreiche Spannungen zwischen den Begriffen der Ethik und den Resultaten des Theologisch-politischen Traktat, aber auch zwischen verschiedenen Passagen
A G
des Traktat selbst, erklären.9 Beide Punkte zusammengenommen erklären die deutliche Einschränkung des Adressatenkreises, die Spinoza in den Abschnitten 15–16 vornimmt: Der Traktat richtet sich nur an Leser, die bereits gewillt und in der Lage sind, ihre Überzeugungen einer Art Selbstprüfung zu unterziehen, jedoch nicht an diejenigen, die durch solche Argumentationen gemäß der Tiefendiagnose Spinozas prinzipiell nicht zu erreichen sind. Insofern Spinoza bei seinen gelegentlichen Theorieimporten in diese Selbstprüfung an Zuspitzungen von Resultaten cartesianischer Philosophie anknüpft, die seinen Lesern aus dem Metaphysischen Anhang zu den Prinzipien der cartesianischen Philosophie bekannt gewesen sein können, wird man seine unmittelbaren Adressaten vermutlich am ehesten im Kreis der im Anschluß an Descartes Philosophierenden suchen müssen – allerdings nicht nur unter professionellen Philosophen, sondern auch unter philosophierenden Laien in öffentlichen Ämtern und der Handelsaristokratie. Von hier aus erschließt sich auch das Programm des Traktat, das Spinoza in der divisio der Vorrede (Abschn. 10–14) vorstellt. Dabei skizzieren die Abschnitte 10–12 das eher theologische Programm, die Abschnitte 13–14 sind dem politiktheoretisch-staatsphilosophischen gewidmet. Der entscheidende argumentationsstrategische Zug besteht im theologischen Teil darin, daß Spinoza, indem er ankündigt, die Schrift „von neuem mit unbefangenem und freiem Geist“ (Abschn. 10) prüfen zu wollen, zunächst grundsätzlich den Offenbarungscharakter und die Autorität der Bibel akzeptiert. Natürlich kann man den Offenbarungsbegriff sehr verschieden verstehen, doch bleibt, daß der Offenbarungscharakter und die Autorität der Bibel aus der Ethik nicht ableitbar sind. Spinoza verstärkt diesen Ansatz noch, wenn er dafür argumentiert, daß die Schrift „aus ihr selbst“ zu interpretieren sei (Abschn. 9), und damit zumindest nominell eine weitverbreitete Maxime der Schriftauslegung aufgreift (vgl. James 2012, 139 ff.; Walther 1995). Es ist also nicht so, daß methodologisch nur dasjenige in der Bibel akzeptabel ist, was philosophischer Erkenntnis entspricht. Gerade aus der Prüfung der Offenbarungsreligion an dem Dokument der 9 Der hier skizzierte Ansatz unterscheidet sich deutlich von demjenigen, den Strauss 1952 vorgeschlagen hat (vgl. Fn. 2). Strauss versucht sich die Eigenheiten des TTP dadurch zu erklären, daß Spinoza durch widersprüchliche Formulierungen in einer Situation der Verfolgung seine eigentliche Lehre gleichsam nur für Eingeweihte offenbaren wollte. Nach dem hier entwickelten Vorschlag geht es um eine öffentliche Intervention, die die Adressaten erreichen möchte, die zunächst nicht die Position des Verfassers teilen (es geht um „Überzeugungsarbeit“).
R S
Offenbarung selbst soll sich ergeben, daß ihre Autorität nach ihrem eigenen Selbstverständnis „nur dort von Gewicht ist, wo es um den Lebenswandel und die wahre Tugend geht, ihre Meinungen uns sonst aber wenig bedeuten“ (Abschn. 10). Daraus ergibt sich die Trennung der Aufgabenbereiche von Religion und Philosophie, und zusätzlich, daß diese Kernoffenbarung mit verschiedensten Auslegungen und Riten verbunden sein kann, so daß niemandem die Freiheit, über diese Dinge zu urteilen, genommen werden kann (und in der Konsequenz sich eine Religion oder eine Theologie auch nicht des Staates zu diesem Zweck bemächtigen darf (vgl. Abschn. 12)). Spinoza bereitet damit die Entf lechtung der religiösen und der politischen Konf likte vor. Daß die sich ergebende wahre religiöse Haltung beziehungsweise Frömmigkeit immer noch nicht die Haltung desjenigen ist, der philosophische Erkenntnis im Sinn der Ethik hat, ergibt sich meines Erachtens daraus, daß Tugend hier immer noch wesentlich an den Begriff des Gehorsams gebunden ist (vgl. Abschn. 11) – was für die Tugendlehre der Ethik nicht gilt. Ein in gewissem Maße analoges argumentatives Vorgehen kündigt Spinoza auch für den politiktheoretisch-staatsphilosophischen Teil an. Das argumentationsstrategische Ziel ist es nun, nach der Entf lechtung von Religion, Philosophie und Politik die bereits im Titel des Traktat vorgestellte Kompatibilitäts- beziehungsweise Abhängigkeitsthese zu begründen. Dreh- und Angelpunkt ist dabei die These, daß sich das natürliche Recht eines jeden nur soweit erstrecke, wie „seine Begierden und seine Macht reichen“ (Abschn. 13). Schaut man sich Spinozas Argument für diese These in Kapitel 16 an, dann geht er wiederum von einem Satz aus, der recht eigentlich vom Himmel fällt, den aber seine Adressaten zunächst ohne Probleme zugeben können, nämlich daß Gottes Macht Gottes Recht sei (TTP XVI, 238 f.). Wie bereits die Zusammenfassung dieser Argumentation in der Vorrede deutlich macht, soll sie zu einer umfassenden Revision der Betrachtungsweise politischer Prozesse führen: Niemand kann gegen das Verhalten und die Handlungen eines Anderen auf der Ebene der natürlichen Rechte eine rechtliche Einrede begründen, denn es gibt naturrechtlich keine Differenz zwischen faktischen Handlungen und normativ Gesolltem oder Erlaubtem (vgl. Walther 1985). Stattdessen rückt die Analyse politischer Verhältnisse und Prozesse in Termini der Macht in den Mittelpunkt (wobei unter Macht weniger „Macht über …“ als vielmehr das Vermögen, etwas zu tun, zu verstehen ist – vgl. Saar 2013a, 133 ff.). Eine Konsequenz ist, daß die Inhaber der Regierungsgewalt
A G
alles Recht haben, zu tun, was sie können, daß aber auch umgekehrt die Untertanen – schlicht weil sie faktisch immer auch eine Macht haben – ebenfalls im Staat ein natürliches Recht haben (das so weit reicht, wie ihre Macht in den jeweiligen konkreten Verhältnissen reicht). Wenn es Spinoza zu zeigen gelingt, daß ein Staat dann am stabilsten und mächtigsten ist, wenn es ihm durch geeignete Institution und Verfahren gelingt, die divergierenden individuellen Lebensweisen, Interessen und Überzeugungen so zu berücksichtigen, daß sie möglichst wenig Grund zu innerer Distanz oder gar zu offener Rebellion haben, dann hätte er damit zugleich für seine Kompatibilitäts- beziehungsweise Abhängigkeitsthese argumentiert. Gerade die theoretische Depotenzierung der Rede von vorstaatlichen Rechten eröffnet so den Weg zu einer Theorie von Demokratie und Freiheit.
2.6 Der Traktat als Modell einer nicht-normativistischen philosophischen Intervention Es läßt sich nun vorläufig der Typ von Intervention genauer charakterisieren, den Spinoza mit seinem Traktat entwickelt und ausprobiert. Offensichtlich läßt sich sein Vorhaben zunächst gegen verschiedene Modelle abgrenzen: Grundsätzlich handelt es sich nicht um eine Intervention, die im Rückgriff auf rechtliche oder ethische Normen Normverletzungen beklagt und die Befolgung von Normen einfordert. Entsprechend spricht sich diese Philosophie auch keine Schiedsrichterrolle in gesellschaftlichen Konf likten zu. Deshalb wird man ihm weder ein Modell der philosophischen Intervention zuschreiben können, das sich von Normbegründung und Aufklärung einen anhaltenden Fortschritt in der Geschichte der Menschheit oder auch nur in besonderen Situationen verspricht, noch ein Modell, das der Realisierung von Normen durch unmittelbare politische Aktion vorarbeitet – sei es durch Revolten oder Revolutionen, sei es durch geplante Neugründungen von Gesellschaften. Die Abschnitte 7–10 in Kapitel 18 lassen sich durchaus in diesem Sinn lesen. Der Vorschlag, den Traktat als Intervention in der Form eines Rates ohne verpf lichtende Kraft zu lesen, die Dinge in einer bestimmten Weise zu betrachten, trägt dieser zunächst einmal bescheideneren Funktion der Philosophie im gesellschaftlichen Konf likt Rechnung.
R S
Die Qualität eines Rats hängt natürlich davon ab, ob er gut begründet ist, insbesondere durch eine sorgfältige Analyse der Situation. Aus Spinozas Programm lassen sich Grundzüge seiner Strategie der Analyse entnehmen und damit auch seine oben skizzierte Tiefendiagnose weiter anreichern. Dreh- und Angelpunkt ist hier die Entf lechtungsstrategie. Ihr Ziel ist es, aufzuzeigen, daß in einem gesellschaftlichen Konf likt mehrere unterschiedliche Sphären zusammenstoßen, die je ihre Eigenlogiken haben. Im Beispielsfall sind dies die Sphären der Religion, der Politik und der Philosophie (man mag sich noch weitere Sphären denken, etwa die der Ökonomie). Dabei gilt es, die Kernprinzipien dieser Eigenlogiken herauszuarbeiten, im Fall der Religion etwa die der Offenbarung, im Fall der Politik etwa die der Macht, und im Fall der Philosophie die eines besonderen Typs des Erkennens. Erst dann kann untersucht werden, in welches konstruktive Verhältnis diese unterschiedenen Sphären gesetzt werden können. Dabei geht es nicht darum, die konstitutiven Eigenlogiken der unterschiedenen Sphären im Rückgriff auf irgendwelche normativen Vorstellungen verändern zu wollen. Ganz im Sinn der Grundhaltung gegenüber Konf likten, daß es nicht zu beweinen oder zu verlachen gelte, sondern zu verstehen, setzt dieses Konzept auf den Primat der Funktionsanalyse unterschiedener gesellschaftlich relevanter Sphären und ihrer Interaktion, um die Funktionalität und Disfunktionalität gegebener Verhältnisse – durchaus im Blick auf das Glück und die Freiheit der Menschen – beurteilen und geeignete Ratschläge geben zu können. Diese Analysestrategie ist nun in einem letzten Schritt der Überlegungen noch weiter zu modifizieren, um der Diagnose von der unhintergehbaren Aberglaubensstruktur der Alltagserfahrung Rechnung zu tragen. Aberglaube spielt dabei eine doppelte Rolle, nämlich einerseits auf der Ebene der zu analysierenden Verhältnisse und andererseits als Bedingung, unter der die Intervention stattfindet. Auf der einen Seite ist Aberglaube ein zentraler, affektbegründeter Faktor, wenn es darum geht, zu erklären, wie es zu Überzeugungen und Praktiken kommt, durch die die verschiedenen Sphären in disfunktionale und desaströse Verhältnisse geraten; auf der anderen Seite ist Aberglaube als primär affektiver Zustand der Grund dafür, an eingeübten Praktiken festzuhalten und von Vorurteilen nicht abzugehen. Die philosophische Intervention hat deshalb an die jeweils konkrete Form des Konf likts, die jeweilige Debattenlage, die jeweiligen besonderen Vorurteile anzuknüpfen und Argumentationsstrategien zu entwickeln, die die faktischen Überzeugungen der Adressaten zum Ausgangs-
A G
punkt nehmen, gleichzeitig aber so modifizieren, daß sie einen neuen Blick auf die Verhältnisse werfen können, und ihrem Schwanken zwischen Furcht und Hoffnung gleichwohl Rechnung getragen wird. Die extreme Kontextsensitivität des Theologisch-politischen Traktat, die dem heutigen Interpreten so viel Mühe bereitet und viele umwegige Erörterungen im Text eher befremdlich und für uns heute irrelevant erscheinen läßt, ergibt sich konsequent daraus, daß Spinoza ein noch heute systematisch relevantes Konzept der philosophischen Intervention in seiner Situation zu realisieren versucht – ein Konzept, das sich in letzter Konsequenz aus seiner systematischen Philosophie ergibt, die er in der Ethik zu exponieren und zu begründen unternimmt.
Literatur Akkerman, F. 1985: Le Caractère rhéthorique du Traité théologico-politique, in: Spinoza entre Lumières et Romantism (Les Cahier de Fontenay, nos. 36–38), 381–390. Akkerman, F. (Hrsg.) 1999: Spinoza Oevres III, übers. v. J. Lagrée/P.-F. Moreau, Paris. Ansaldi, S. 2001: Spinoza et le Baroque. Infini, Désir, Multitude, Paris. Braudel, F. 1986: Sozialgeschichte des 15.–18. Jahrhunderts, Bd. 3: Aufbruch zur Weltwirtschaft, München. Descartes, R. 1984: Die Leidenschaften der Seele, übers. v. K. Hammacher, Hamburg. Hecker, K. 1975: Gesellschaftliche Wirklichkeit und Vernunft in der Philosophie Spinozas. Untersuchung über die immanente Systematik der Gesellschaftsphilosophie Spinozas im Zusammenhang seines philosophischen Gesamtwerks und zum Problem ihres ideologischen Sinngehalts, Regensburg. Israel, J. 1998: The Dutch Republic. Its Rise, Greatness and Fall, 1477–1806, Oxford. –2001: Radical Enlightenment. Philosophy an the Making of Modernity 1650–1750, Oxford. James, S. 2012: Spinoza on Philosophy, Religion, and Politics. The Theologico-Political Treatise, Oxford. Kersting, W. 1988: Niccolò Machiavelli, München. Lademacher, H. 1983: Geschichte der Niederlande, Darmstadt. Laux, H. 1995: Religion et phiosophie dans le Traité Théologico-politique. Débat avec André Tosel, in: Studia Spinozana 11, 189–199. Melamed, Y. Y. 2010: The Metaphysics of the Theological-Political Treatise, in: Y. Y. Melamed/M. A. Rosenthal (eds.), Spinoza’s Theological-Political Treatise. A Critical Guide, Cambridge 2010, 128–142. Moreau, P.-F. 1994: Spinoza. L´expérience et l´éternité, Paris. Nadler, S. 1999: Spinoza. A Life, Cambridge. – 2011: A Book Forged in Hell. Spinoza’s Scandalous Treatise and the Birth of the Secular Age, Princeton/Oxford. Negri, A. 1982: Die wilde Anomalie. Spinozas Entwurf einer freien Gesellschaft, Berlin.
R S
Popkin, R. 1996: Spinoza and Bible Scholarship, in: D. Garrett (ed.), The Cambridge Companion to Spinoza, Cambridge, 383–407. – 2004: Spinoza, Oxford. Proietti, O. 2010: Philodonius, 1657. Spinoza, Van den Enden e i classici latini, Macerata. Prokhovnik, R. 2004: Spinoza and Republicanism, Hundmills. Renz, U. 2008: Spinoza. Philosophische Therapeutik der Emotionen, in: H. Landwehr/U. Renz (Hrsg.), Klassische Emotionstheorien, Berlin, 312–320. Rowen, H. H. 1986: John de Witt. Statesman of the True Freedom, Cambridg. Saar, M. 2013a: Die Immanenz der Macht. Politische Theorie nach Spinoza, Frankfurt/M. – 2013b: Notwendige Geschichte. Zur Debatte um „radikale Aufklärung“, in: C. Schmidt (Hrsg.), Können wir der Geschichte entkommen? Geschichtsphilosophie am Beginn des 21. Jahrhunderts, Frankfurt/New York, 42–59. Schnepf, R. 1993: Hic igitur facile intelligimus, quid Jus Naturae sit – Zur Argumentationsweise Spinozas in TP 2/3, in: Studia Spinozana 9, 108–130. – 2000: Variationen der Frage nach dem Guten. Metaethische Überlegungen bei Aristoteles, Spinoza und Kant, in: K. Hammacher/I. Reimers-Tovote/M. Walther (Hrsg.), Zur Aktualität der Ethik Spinozas, Würzburg, 421–451. – 2008: Von der Naturalisierung der Ontologie zur Naturalisierung der Ethik. Spinozas Metaethik im Kontext spätscholastischer Entia-Moralia-Theorien, in: Studia Spinozana 16, 105–127. Steenbakkers, P. 2010: The Text of Spinoza’s Tractatus Theologico-Politicus, in: Y. Y. Melamed/M. A. Rosenthal (eds.), Spinoza’s Theological-Political Treatise. A Critical Guide, Cambridge 2010, 29–40. Strauss, L. 1952: How to Study Spinoza’s Theological-Political Treatise, in: Ders., Persecution and the Art of Writing, New York, 142–201. Tosel, A. 1995: Que faire avec le Traité Théologico-politique? Réforme de l´imaginaire religiuex et/ou introduction à la philosophie?, in: Studia Spinozana 11, 165–188. Van der Wall, E. 2003: The Religious Context of the Early Dutch Enlightenment: Moral Religion and Society, in: Van Bunge (Hrsg.), The Early Enlightenment in the Dutch Republic 1650–1750, Leiden 39–57. – 1995: The Tractatus theologico-politicus and Dutch Calvinism 1670–1700, in: Studia Spinozana 11, 201–226. Walther, M. 1985: Die Transformation des Naturrechts in der Rechtsphilosophie Spinozas, in: Studia Spinozana 1, 73–104. – 1995: Biblische Hermeneutik und historische Erklärung: Lodewijk Meyer und Benedict de Spinoza über Norm, Methode und Ergebnis wissenschaftlicher Bibelauslegung, in: Studia Spinozana 11, 227–300. Walther, M./Czelinski, M. 2006: Die Lebensgeschichte Spinozas. Zweite, stark erweiterte und vollständig neu kommentierte Auf lage der Ausgabe von Jakob Freudenthal, 2 Bde., Stuttgart-Bad Cannstatt. Yovel, Y. 1985: Spinoza: The Psychology of the Multitude and the Uses of Language, in: Studia Spinozana 1, 305–331.
3 Dirk Brantl
Prophetie und Propheten im Theologisch-politischen Traktat (Kapitel 1–3)
Spinozas Traktat über Theologie und Politik zielt letztlich weder auf erstere noch auf letztere, sondern, wie der Untertitel erläutert, auf den Nachweis nicht nur der Kompatibilität von Denk- und Redefreiheit mit sittlicher und staatlicher Stabilität, sondern sogar von deren Notwendigkeit hierfür. Entsprechend zerfällt der Traktat in zwei Teile, deren erster versucht, die Gestaltung des sittlichen Lebens aus den Händen theologischer Autoritäten zu nehmen, während der zweite diese Aufgabe in die Hände eines demokratisch verfaßten Staates legt. Dabei ist es sicherlich nicht uninteressant zu fragen, inwieweit Spinoza seine Schrift tatsächlich zur normativen Fundierung des niederländischen Regimes seiner Zeit und vor allem der Position Jan de Witts verfaßt hat. Verteidigt er die Redefreiheit per se oder vor allem seine eigene im Angesicht zu erwartender Feindseligkeiten? Fordert er also eine allgemeine Freiheit ein oder ist der Traktat eine Apologie von Spinozas philosophischer Tätigkeit? Unabhängig vom historischen Kontext bleibt aber stets die Frage nach der philosophischen Kohärenz im Mittelpunkt. Im Rahmen von deren Interpretation müssen die Kapitel 1–3 in einen Zusammenhang mit dem Gesamtwerk gesetzt werden: Weshalb beginnt ein Traktat zur Verteidigung der Denk- und Redefreiheit mit einer Analyse der Prophetie? Wir können hier schon festhalten: Die abgehandelten Kapitel legen den Grundstein zu einem weiten Bogen, an dessen Ende die Entmachtung geistlicher Autoritäten zugunsten des Staates stehen
D B
wird. Es wird also nicht überraschen, wenn am Ende dieser Kapitel eine außerordentlich def lationäre Lesart von Prophetie steht.
3.1 Die Gabe der Prophetie 3.1.1 Was ist Prophetie? Spinoza beginnt den theologischen Teil des Theologisch-politischen Traktat, dessen Ziel im Nachweis der Unabhängigkeit der Theologie von der Philosophie liegen soll, mit einem für den heutigen philosophisch interessierten Leser randständigen Thema: der Quelle und dem Status von Prophezeiungen. Bei näherer Betrachtung hat der Gegenstand für Spinoza jedoch größte Bedeutung. Der Haupttext des Traktat beginnt mit folgendem Satz: „Prophetie oder Offenbarung ist die sichere Erkenntnis einer den Menschen von Gott offenbarten Sache“ (TTP I, 14). Dabei interessiert weniger die eher fragwürdige Definition, bei der das Definiens das zu Definierende enthält („revelatio est … cognitio a Deo revelata“), als vielmehr zunächst die Formulierung „prophetia sive revelatio“. Indem Spinoza diese Gleichstellung von Prophetie mit Offenbarung vornimmt, verbreitert er nämlich den Bereich der Prophetie über das hinaus, was der Laie heute darunter versteht: die Bücher der großen und kleinen Propheten des Alten Testaments. In der Tat deckt Spinoza mit dem Begriff auch die Person Jesu ab, inhaltlich auch Dinge wie etwa die Zehn Gebote und das Mosaische Gesetz insgesamt (während das Buch der Offenbarung interessanterweise keinerlei Erwähnung findet). Unter Offenbarung wiederum kann die gesamte Heilige Schrift verstanden werden, so daß der Begriff das Programm der Kapitel 1 bis 6 auf zunächst unklare Weise abzudecken scheint. (Über die Identifikation von Prophetie und Offenbarung vgl. Walther 1991, 68 f.) Mit der Verbreiterung des Begriffs der Prophetie zerfällt der größte und theologisch entscheidende Teil der Heiligen Schrift insgesamt in zwei Hauptteile, Prophezeiungen und Geschichten. Beide sind ein Aspekt der biblischen Lehre, und sie unterscheiden sich weder ihrem Ziel, noch ihrem Inhalt oder ihrer Herkunft nach: Vielmehr sind die Geschichten Nacherzählungen historischer Ereignisse, deren Lehre in der Beispielhaftigkeit ihres Inhalts liegt. Prophezeiungen hingegen sind Nacherzählungen nicht von Geschehnissen per se, sondern von Kommunikationsakten,
P P T -
die einen besonderen Status haben, den sie ihres direkten göttlichen Ursprungs verdanken. Beginnt das erste Kapitel zielstrebig (und philosophisch angemessen) mit einer Definition des Gegenstandes, so stellt schon der zweite Absatz der Schrift den Leser vor ein Problem, stellt er doch bereits eine Art Exkurs dar, darüber hinaus auch einen Verweis auf ein Denken, das Spinozas Adressaten nur im Grundriß zugänglich war. Kurz, dieser Absatz verbindet den theologischen Argumentationsgang mit Spinozas Philosophie, dem Leser seiner Zeit höchstens in der Form seiner Principia philosophiae cartesianae (1663) geläufig, während seine Ethik erst sieben Jahre nach dem Traktat erscheint. Dieses Verweisen auf die eigene Philosophie auch im Rahmen des theologischen Teils des Traktat findet sich immer wieder und wird besonders in dessen Kapiteln 3 und 4 von Bedeutung sein. Grundsätzlich stellt sich hier eine doppelte Frage: Erstens, sind die philosophischen Analysen im Traktat stets nur Illustrationen oder spielen sie eine substantielle Rolle im Argument? Diese Frage wird um so wichtiger, wenn wir Spinozas Methodenideal im Traktat kennenlernen werden. Daran schließt zweitens die Frage an, wie ernst Spinoza die eigenen Ausführungen zur Theologie und vor allem seine Trennungsthese (vgl. hierzu Kap. 1 in diesem Band) nimmt. (Hieran zweifelt bspw. Bartuschat 2 2006, 159 f.) Hier erläutert er zunächst, daß seine Definition der Prophetie die natürliche Erkenntnis keineswegs ausschließe. Dies sei so, da alle Erkenntnis, auch die natürliche, letztlich von Gott ausgehe. Diese Aussage, die hier etwas isoliert dasteht, verweist natürlich auf Spinozas Pantheismus. Daß er dennoch die natürliche Erkenntnis aus der prophetischen ausgeschlossen wissen will, referiert deshalb gerade nicht auf eine substantielle Differenz zwischen beiden Erkenntnisformen, sondern auf den Umstand, daß das einfache Volk, der vulgus, diesen Ausschluß verlangt. Stets „auf das Seltene und der eigenen Natur Fremde erpicht“ (TTP I, 14; vgl. TTP VI, 98), ist gerade dem gewöhnlichen Volk das Gewöhnliche zu gewöhnlich, will es stets „bezaubert“ werden, um so mehr, je bedeutender die Sache ist, um die es geht: Nicht Erkenntnis, sondern Erstaunen strebt der vulgus an. Hier findet sich Spinozas empirischer Erkenntniselitarismus wieder, den er auch in der Ethik vertritt, wenn er feststellt, daß alle Formen menschlicher Erkenntnis zwar allen Menschen zugänglich seien (E II, Lehrsatz 47 und E V, Lehrsatz 4, Anm.), nur wenige aber die höhere Erkenntnisform der ratio,
D B
noch weniger die höchste, die intuitio, erreichen (E V, Lehrsatz 42, Anm.). Dies liegt letztlich in der menschlichen Ohnmacht gegenüber den eigenen (passiven) Leidenschaften, die zu überwinden nur wenigen gelingt. Der größte Teil der Menschen, der vulgus, bleibt bei der geringsten Erkenntnisform, der sinnlichen imaginatio, stehen, die auf der Sammlung und Ordnung von Sinneseindrücken basiert, oder gar der bloßen Vorstufe, der experientia vaga, bei der die „Erkenntnis“-stiftenden Sinneseindrücke sogar ungeordnet bleiben. (Zwei nicht ganz identische Stufungen der Erkenntnisformen finden sich in der Abhandlung über die Verbesserung des Verstandes II, 19 und E II, Lehrsatz 40, Anm. 2.) In dieser Erläuterung der Erkenntnisformen findet sich auch ein möglicher Schlüssel zur Beantwortung der Frage, wie ernst dem Philosophen Spinoza die Beschäftigung mit Theologie im Religionsteil des Theologisch-politischen Traktat ist: Da der vulgus nun einmal ist, wie er ist, und da Spinoza keine Pädagogik schreibt, sondern einen Traktat über Frieden, Frömmigkeit und Meinungsfreiheit, so muß die Verwirklichung dieser drei Ziele dem jeweiligen Adressaten angemessen sein. Bedarf auch der stoische Weise (sapiens) aus der Ethik hierfür nicht der Theologie, und genügt dem vernunftfähigen Bürger schon die richtige Theorie der Politik, so braucht der vulgus die Botschaft der Theologie, bereinigt allerdings um die irrelevanten Passagen und falschen Interpretationen, die aus der friedensförderlichen Theologie einen Zwist stiftenden Aberglauben machen (vgl. TTP VII, 120). Man darf aber nicht übersehen, daß dieses Argument zwar im Hintergrund steht, Spinoza selbst aber über die Verachtung des vulgus für die natürliche Vernunft hinaus auch noch ein Sachargument vorbringt. Denn die prophetische Erkenntnis unterscheidet sich von der natürlichen darin, daß „jene über die Grenzen der natürlichen hinausreicht und die Gesetze der menschlichen Natur, in sich betrachtet, nicht ihre Ursache sein können“ (TTP I, 15). In bezug auf ihre Gewißheit und ihre Quelle (respectu certitudinis et fontis) – als die eine Substanz kann keine Erkenntnis von woanders f ließen als aus Gott – ist die natürliche der prophetischen Erkenntnis allerdings nicht nachgeordnet (wir werden sehen, daß sie ihr in ersterer Hinsicht sogar vorgeordnet ist). Wäre dem nicht so, so müßte man annehmen, die Propheten seien keine Menschen gewesen, hätten einen quasi übermenschlichen Geist besessen. Sie zeichnen sich gegenüber anderen Menschen aber nur durch eine besonders starke Ausprägung der Vorstellungskraft aus (vgl. TTP I, 28 Fn.). Gleichzeitig betont Spinoza
P P T -
wiederum, daß es gerade die Natur des Geistes (mentis natura) ist, in der „die erste Ursache der göttlichen Offenbarung“ (TTP I, 15) liegt. Spinoza möchte mit diesen Ausführungen wohl lediglich zum einen den Status des Propheten erden und zum anderen sich so weit wie möglich, seiner Trennungsthese gemäß, einer Bewertung der natürlichen gegenüber der prophetischen Erkenntnis enthalten. Im Ergebnis produziert er aber hiermit eine nicht unproblematische Aussage. Denn was soll es bedeuten, daß die Gesetze der menschlichen Natur (humanae naturae leges) nicht die Ursache der entsprechenden Erkenntnis sein können? Insofern für den Philosophen Spinoza die Ratschlüsse Gottes (decreta Dei) nicht dessen Willensäußerungen sind, sondern nichts anderes als die Folgen seiner Natur (E I, Lehrsatz 33, Anm. 2), ist es unklar, wie ein Mensch zu einer Erkenntnis jenseits seiner Teilhabe an Gottes Wesen gelangen sollte. Andererseits erlaubt diese Formulierung Spinoza, seine Aussagen theologisch relativ unkontrovers zu tätigen, ohne seine eigene Philosophie explizit kompromittieren zu müssen. Gleichzeitig begründet diese Aussage Spinozas Methodenideal im Bereich der Theologie: Gerade weil die prophetische Erkenntnis „über die Grenzen der natürlichen Erkenntnis hinausgeht“ (TTP I, 15), bedarf die Theologie einer strikten Bibelexegese, die sich streng an den Wortlaut des Textes hält, schlicht, weil uns aufgrund der anscheinend transzendenten Natur dieser Erkenntnis keine philosophische Analyse der entsprechenden Offenbarungen möglich ist.
3.1.2 Wie funktioniert und was bezweckt Prophetie? Ist die natürliche Erkenntnis einmal aus der göttlichen ausgeschlossen, so kann Spinoza sich der Frage zuwenden, worin denn die prophetische Erkenntnis bestehe. Als Offenbarung Gottes stellt sich bei ihr dann die Frage: Wie offenbart sich Gott? Hier wirft Spinoza, seiner methodischen Prämisse folgend, den Blick in die Schrift und unterscheidet die Formen der Offenbarung in zwei mal zwei Kategorien (vgl. hierzu die Darstellung in Laux 1993, 18–24): Die Offenbarung kann sprachlich oder bildlich erfolgen, das heißt sie kann in Worten oder Bildern (verba, figurae) bestehen. Zweitens können diese Worte oder Bilder real oder bloß imaginär sein. Der Überblick über die in der Schrift gesammelten Prophezeiungen ergibt nun für Spinoza das folgende Ergebnis: Bis auf zwei haben alle
D B
Propheten entweder nur vorgestellte Worte oder reale oder vorgestellte Bilder wahrgenommen. Die Ausnahmen sind einmal Moses, der Gottes Worte real vernahm, und zum anderen Jesus, der insofern eine Sonderstellung einnimmt, als er mit Gott überhaupt nicht sinnlich, sondern „von Geist zu Geist“ kommunizierte (TTP I, 22). Dieses Ergebnis ist für Spinoza in zweierlei Hinsicht von Bedeutung. Zum einen kann er die Propheten selbst gemäß den religiösen Traditionen seiner Leser hierarchisieren. In dieser Hinsicht wird Moses, als nicht nur Prophet, sondern auch Gesetzgeber und Herrscher des jüdischen Volkes, über alle anderen jüdischen Propheten erhoben (obgleich er diese Gesetze nicht als Prophet gegeben hat: TTP III, 57 f.). Zu ihm allein spricht Gott tatsächlich. Ganz seinem Methodenideal folgend, löst Spinoza an dieser Stelle unklare Passagen (1 Sam 3) mit Verweis auf andere Bibelstellen. So verweist seine (so isoliert, wie sie dasteht, seltsam unref lektiert wirkende) Feststellung, Samuel könne keine wahre Stimme gehört haben, da man „einen Unterschied zwischen der Prophetie des Moses und derjenigen der anderen Propheten machen“ müsse (TTP I, 17), schlicht auf die Stelle Num 12, 6–7, die analog zu Spinozas Kategorisierung der Arten göttlicher Offenbarung Moses auf eben diese Weise von den anderen Propheten abhebt (vgl. TTP I, 20 f.). Auf andere Weise schließlich nimmt Jesus eine kategorische Sonderstellung ein, die es Spinoza erlaubt, ihn zugleich aus dem Pulk der biblischen Propheten herauszuheben und eine Aussage über seinen messianischen Status zu vermeiden. Jesu Erkenntnis von Gottes Willen wird, wie es zunächst scheint, analog zur höchsten Erkenntnisform der Ethik, der Intuition, konstruiert: Jesus erkennt Gottes Willen in seinem eigenen Geiste, insofern er an dessen Geist teilhat (TTP I, 21) – wie alle Menschen, nur sind sich wenige dessen bewußt und können zur Reinheit dieser Erkenntnisform fortschreiten. Und wie die intuitio es mit sich bringt, ist diese Erkenntnis einer (bloß) rationalen Erläuterung nicht zugänglich, allenfalls kann sie in ihrer rationalen Unbegreif lichkeit umschrieben werden. Jesus wird aber nicht zu einem Kantischen Ideal erhoben, zur Personifikation einer praktischen Idee, die anzustreben (und doch niemals zu erreichen) dem Menschen aufgegeben ist. Vielmehr verbleibt ihm ein Sonderstatus, der dem Umstand geschuldet ist, daß seine Erkenntnis von Gottes Willen die schon oben erwähnte Transzendenz des Gegenstandes berührt. Sie bezieht sich auf etwas,
P P T -
„was in den ersten Grundlagen unserer Erkenntnis nicht enthalten ist“ (TTP I, 21) und Jesus eben deshalb von den Menschen abhebt. Wichtiger als diese Hierarchisierung ist aber das zweite Ergebnis von Spinozas Untersuchung: Die Gabe des Propheten, seine besondere Empfänglichkeit für göttliche Botschaften, liegt bloß in seiner besonders lebhaften Vorstellungskraft begründet. Dieses zweite Ergebnis von Spinozas Untersuchung birgt in doppelter Hinsicht eine immense Sprengkraft, die den Status der Theologie ebenso bestimmt wie deren Verhältnis zur Philosophie. Um dies zu erläutern, müssen wir uns wieder der bereits erwähnten Hierarchie der Erkenntnisformen zuwenden. Wie gesehen, findet sich, die Vorstufe der experientia vaga ausgenommen, bei Spinoza eine Dreigliederung der menschlichen Erkenntnis. In dieser spiegelt sich der Entwicklungsgang des einzelnen Menschen wieder. Beginnend mit der sinnlichen Erkenntnis, die auf der Vorstellungskraft basiert, und die die fehlerhafteste Form darstellt, kann der Mensch zur Vernunft fortschreiten, zum rationalen Schließen aus Obersätzen. Diese Form der Erkenntnis folgt dem Methodenideal der frühen Neuzeit, der Geometrie, und ihr Gipfel liegt in der systematischen Ableitung des natürlichen und des praktischen Wissens über die Welt aus ihren ersten Anfängen – mit anderen Worten, in Spinozas Ethik. Diese rationale Erkenntnis, deren Erreichung durchaus einer größeren Zahl von Individuen möglich ist, weist allerdings über sich hinaus auf die dritte Erkenntnisform, die Intuition, die unter Umgehung von Schlußverfahren die direkte Erkenntnis des Wesens Gottes und a fortiori der Welt (und des Erkennenden selbst) erlaubt – der Mensch schreitet fort von der Erkenntnis der „Essenz gewisser Attribute Gottes“ zu der der „Essenz von Dingen“ (E II, Lehrsatz 40, Anm. 2). Diese letzte Erkenntnisform allerdings ist aufgrund des notwendigen Verhaftetseins des Menschen in den Leidenschaften (auch der Weise hat Teil an der extensio, besitzt also einen Körper, der durch andere Körper auf vielfältige Weise affiziert wird: E II, Lehrsatz 23) nur durch die Überwindung unzähliger Hindernisse zu erreichen, entsprechend empirisch sehr selten. Indem das prophetische Wissen, dem die Lehre der Schrift entspringt, auf bloßer imaginatio basiert, also auf der niedrigsten und fehlerhaftesten Erkenntnisform, kann das Ziel der Prophetie nicht eine wahre Erkenntnis sein. Als Erkenntnisform ist die Vorstellungskraft inadäquat, und indem Spinoza den größten Teil prophetischer Offenbarung in der Bibel auf die Vorstellungskraft reduziert, wird damit der Status prophetischen Wissens insgesamt in Frage
D B
gestellt. Da letztlich auch die Sonderstellung Mose diesen Rahmen nicht sprengt – das Hören einer realen Stimme ist immer noch eine sinnliche Wahrnehmung, die hier nur als Zeichen im Akt der Imagination dient (vgl. TTP I, 29) –, die Position Jesu hingegen nicht weiter erörtert wird, ergibt sich das Bild der Prophetie als erkenntnistheoretisch ungenügendem Kommunikationsakt. In der Tat folgert Spinoza, daß Prophezeiungen nicht den Erkenntnisgewinn ihrer Adressaten (oder auch des Propheten selbst) zum Ziel haben. Sie sind vielmehr Befehle, Ratschläge, Mahnungen, Warnungen oder Drohungen, die im Zusammenhang mit dem göttlichen Willen auf den Gehorsam der Adressaten abzielen (vgl. TTP XIII, 210 f.), der darin besteht, Gerechtigkeit und Nächstenliebe zu üben (vgl. TTP XIII, 212 f.). Indem dies damit für die gesamte theologische Lehre gilt, reduziert sich die Theologie also auf den (friedens- und freiheitsförderlichen) Gehorsam. Gehorsam aber wogegen? Nicht gegen den Glauben an die Dinge, die bloß theoretische Lehren der Propheten darstellen; nicht gegen die Aussagen über die Welt, die bloß den Vorstellungen der Propheten entspringen. In beiden Fällen gilt nämlich, daß Gott seine Offenbarung der Fassungskraft des jeweiligen Propheten angepaßt hat und deren Prophezeiung gegebenenfalls in einen theologisch bedeutsamen Kern und bloß spekulative Nebenumstände zerfällt. Letztere allerdings sind theologisch irrelevant und haben, als Ausdruck der „vorgefaßten Ansichten“ (TTP II, 38, opiniones praeconceptae) der jeweiligen Personen, keinen göttlichen Ursprung. Dies belegt Spinoza wiederum exegetisch, über den Nachweis der Widersprüchlichkeit verschiedener Prophezeiungen (so bspw. in der Frage über die Veränderbarkeit von Gottes Ratschluß zwischen Samuel und Jeremias: vgl. TTP I, 46 f.). Als göttlicher Gehalt bleibt für Spinoza nur das übrig, was er als die konstante und damit essentielle Lehre der heiligen Schrift ausmachen wird (vgl. TTP XII, 206), nämlich Gehorsam und Liebe. Für das Verhältnis der Philosophie zur Theologie ergibt sich so implizit, daß das Erheben von Erkenntnisansprüchen durch Theologen, insofern diese Ansprüche auf Offenbarungen im Rahmen der Schrift basieren, zum Nachteil der Theologie und deren Ansehen sein muß, da die Prophetie eben auf inadäquaten Erkenntnissen aufbaut. Als Erkenntnis kann sie entsprechend nur das vertreten, was auch die Philosophie als praktische Vorgaben machen kann. (Auch auf theoretischem Gebiet gesteht Spinoza der prophetischen Erkenntnis einige wahre Annahmen zu, namentlich die, ohne die deren praktische Konsequenzen, Ge-
P P T -
horsam und Liebe, aufgehoben würden: TTP XIV, 221 f.) Hieraus ergibt sich eine praktische Kompatibilität der Theologie mit der Philosophie, die aber nur dann zustande kommen kann, wenn sich die Theologie nicht über ihre Grenzen hinaus erhebt. Sie befiehlt dann den Gehorsam gegenüber den richtigen Dingen, nämlich gegenüber den moralischen Tugenden, die der Tugendhafte aus der Erkenntnis der richtigen Lebensweise (ratio vivendi) heraus von selbst lebt. Allerdings fordert die Theologie weder eine Ref lexion über die Grundlagen dieser Lebensweise, noch hat sie selbst die Möglichkeit, diese Ref lexion angemessen zu gestalten.
3.1.3 Worin besteht Prophetie nicht? Schließlich muß Spinoza sich noch mit einer gängigen Interpretation auseinandersetzen, namentlich mit der Behauptung, die Prophetie bestehe darin, daß dem Propheten Gottes Geist eingef lößt werde. Diese Formulierung setzt eine Form von göttlicher Äußerlichkeit voraus, die Spinozas Philosophie diametral entgegengesetzt ist: Gott ist kein Außen, sondern eine Gesamtheit, deren der einzelne Mensch ein Teil ist. Unter bestimmten Umständen hat der Mensch unterschiedlichen Anteil an Gott, je größer, um so größer und adäquater seine Erkenntnis Gottes ist. Die Propheten haben aber, wie oben gesagt wurde, keine genauere Gotteserkenntnis als andere Menschen, vielmehr zeichnen sie sich eben durch ein lebhafteres Vorstellungsvermögen aus, und „wer über eine stark ausgeprägte Vorstellungskraft verfügt, ist kaum zu reiner Einsicht fähig“ (TTP II, 31). Spinoza lehnt nun aber die Vorstellung der Beseelung des Propheten durch den Geist Gottes nicht einfach ab, sondern er macht sich – an dieser Stelle ganz Hobbesianisch – an eine etymologische Untersuchung, die dem Konzept des spiritus Dei eine neue, Spinoza genehme Bedeutung verleiht. Zu diesem Zweck unternimmt er eine Untersuchung der Bedeutung von „Geist“ (ruach) in der Bibel und findet deren sieben, und schließt eine Analyse dessen an, was in der Bibel „Gottes“ ist (fünf). Seine Deutung dessen, was der Geist Gottes bedeutet, wenn er einen Propheten erfüllt, ergibt sich implizit aus einem Ausschlußverfahren. Einige der Bedeutungen von ruach (bspw. „Weltgegenden“) können schlicht nicht auf Menschen angewendet werden. Spiritus Dei kann entsprechend an der einen Stelle einen besonders starken
D B
Sturm beschreiben; auf Menschen bezogen kann er an anderer Stelle besondere Kühnheit meinen (vgl. TTP I, 25). Auf die Prophetie bezogen aber kann der Ausdruck nach Spinoza nur die außerordentliche Seelenstärke der Propheten, ihre besondere Tugendhaftigkeit bedeuten, sowie ihre Fähigkeit, den Sinn des göttlichen Willens zum Ausdruck zu bringen (vgl. 28). An dieser Stelle muß aber freilich deutlich erwähnt werden, daß unter den Bedeutungen, die Spinoza für ruach anführt, auch schlicht Geist oder Seele (mens, anima) sind, und daß etwas Gottes sein kann, weil es „zur Natur Gottes gehört und gleichsam ein Teil Gottes ist“ (23). Die von Spinoza abgelehnte Vorstellung einer äußeren Beseelung des Propheten durch den Geist Gottes ist also durchaus eine ebenso plausible Lesart des Ausdrucks spiritus Dei – wenn man Spinozas Methodenideal der Bibelexegese wertfrei folgt. Abzulehnen ist diese Vorstellung nur, wenn man Spinozas philosophische Annahmen als bereits anerkannt voraussetzt.
3.2 Die Sicherheit prophetischer Erkenntnis Die Untersuchung ging aus vom ersten Satz des Traktat: „Prophetie oder Offenbarung ist die sichere Erkenntnis einer den Menschen von Gott offenbarten Sache“ (TTP I, 14). Behandelte der erste Teil dieses Aufsatzes die Frage nach dem Status von Prophetie, so muß nun die Formulierung „sichere Erkenntnis“ hinterfragt werden. Denn mit dem Umstand, daß für die meisten Propheten eine göttliche Eingebung in bloßer Vorstellungskraft besteht, ergibt sich für sie ebenso wie für ihre Hörer eine schwierige Frage: Wie unterscheidet man den Propheten vom delirierenden Wahnsinnigen? Wie kann sich der Prophet selbst sicher sein, daß er eine göttliche Botschaft erhalten, daß er nicht einfach etwas erträumt hat oder den Verstand verliert? Spinoza beantwortet beide Fragen mit einer gängigen Antwort. Indem er dies tut, wirft er allerdings implizit erneut die schon im Kontext der Prophetie selbst akut gewordene Rückfrage auf, inwiefern er selbst seine Trennungsthese ernstnimmt. Denn seine Antwort, die für sich das Zeugnis der Orthodoxie einfordern kann, ist erkenntnistheoretisch ein Zugeständnis ans Scheitern, und an dieser Stelle
P P T -
kann sich eben auch die Theologie der erkenntnistheoretischen, und damit der genuin philosophischen Fragestellung nicht entziehen. Für Spinoza reicht die bloße Behauptung einer göttlichen Offenbarung für die Akzeptanz einer Person als Prophet nicht aus. Auf die Argumentation Deut 18, 21 f. rekurrierend, verlangt er ein Zeichen (signum), mit anderen Worten ein Wunder, um dem Propheten Glaubwürdigkeit zu verleihen. Dabei dient das Zeichen dem Propheten wie seinen Adressaten als Versicherung. So mag der Prophet bereits an Gott glauben – Abraham ist hier Spinozas Beispiel (TTP II, 32) –, doch folgt für ihn daraus nicht, daß jede Stimme, die er hört und die von sich behauptet, göttlich zu sein, dies auch ist. Dieses Problem ist freilich noch dringlicher für den Adressaten der Offenbarung, für den der Prophet die alleinige Quelle der Botschaft ist. Für deren Göttlichkeit bürgt dann lediglich die Behauptung des Propheten. Der gesamte Vorgang der Offenbarung wie der Vergewisserung durch Zeichen erfolgt hierbei im Bereich der sinnlichen Wahrnehmung. Sicherheit gewinnt der Prophet wie sein Adressat dadurch, daß verbal oder bildlich eine Ankündigung zukünftiger Ereignisse geschieht, die dann wirklich eintreten. Gerade die Unmöglichkeit des Nachvollziehens eines Kausalzusammenhangs zwischen Ankündigung und Geschehnis bildet dabei das „Wunderbare“ des Zeichens und erweist dem Propheten wie seinem Hörer die Göttlichkeit der Botschaft. Freilich besteht das Wunder eigentlich nur in der Unwissenheit derer, die etwas als Wunder betrachten, was eigentlich nach der Ordnung der Natur geschieht – nur eben eines Teils dieser Ordnung, in den die Wundergläubigen keinen Einblick haben (vgl. hierzu TTP VI). Entsprechend geht es nicht darum, daß der Prophet seine Hörer davon überzeugen kann, daß alles, was er sagt, in einem wissenschaftlichen Sinne wahr ist – es geht nicht um eine vera cognitio –, sondern lediglich davon, daß seine Vorstellungen sicher göttlichen Ursprungs sind – certa cognitio. Je eher das Zeichen natürlich erklärbar ist, um so weniger taugt es als Zeichen für die Göttlichkeit einer Botschaft. Allerdings fügt Spinoza seinen Ausführungen sogleich hinzu, daß das Zeichen selbst ebenfalls nicht ausreicht. Wiederum auf Moses (Deut 13, 2–6) rekurrierend, ergänzt Spinoza, daß Gott auch falschen Propheten ein Zeichen mitgebe, um das Volk zu versuchen. Damit ist freilich die Sicherheit der prophetischen Erkenntnis wieder zunichte gemacht. Spinoza versucht aber das Problem da-
D B
durch, wenn nicht zu lösen, so doch zu entschärfen, daß er zwei Formen von Sicherheit unterscheidet, die mathematische und die moralische (vgl. TTP II, 34). Die certitudo mathematica entspricht dabei der Sicherheit wissenschaftlicher Erkenntnis, die durch die richtige Methode, also durch stringente Deduktion more geometrico gewonnen wird. Der Begriff der certitudo moralis ist schwieriger zu verstehen, weil er eine unsichere Sicherheit verspricht, allerdings, so die Pointe, eine ausreichende, eine, die versichert, daß darauf gegründete Handlungen nicht moralisch tadelnswert sind. Wer aufgrund dieser moralischen Gewißheit handelt, ist normativ gesehen auf der sicheren Seite, auch wenn er sich in der Sache irren sollte. Spinoza rekurriert wohl implizit – auch wenn die Unterscheidung in verschiedenen Formen eine bis zu Aristoteles zurückreichende Tradition hat – auf Descartes’ Verwendung von „assurance morale“ im Discours de la méthode (Descartes 1637, 62) und auf die „certitudo moralis“ von dessen Principia philosophiae (Descartes 1644, 631). Descartes setzt diese Form der Gewißheit gegen die „absolute“ ab, indem sie zwar nicht vollständig gewiß sei, aber doch „für die Anwendung im wirklichen Leben ausreicht“ (ebd.). Diese moralische Gewißheit ist jedoch nicht etwa eigentlich eine Form von Unsicherheit, und anders als beispielsweise im Bereich der Wunder, wo Spinoza einen theologischen Begriff im Grunde eliminiert, insistiert Spinoza hier, daß die Prophetie „einen hohen Grad an Gewißheit“ (TTP II, 33) besitzt (vgl. hierzu James 2012, 61 ff.). Um diese moralische Sicherheit zu gewährleisten, geht Spinoza wiederum einen ganz eigenen Weg, der auch durchaus nicht mit dem Vorhergehenden zusammenhängt und wiederum auf seine Philosophie zu verweisen scheint. Der vertrauenswürdige Prophet erfüllt für ihn nämlich drei Bedingungen, die beiden biblischen, daß er nichts gegen die orthodoxe Lehre predige und sich durch ein göttliches Zeichen ausweisen könne, und eine weitere, daß Gott nämlich nur schlechte Menschen mit falschen Prophezeiungen verführe (Spinoza verweist auf die biblische Geschichte von Micha und Ahab: 1 Kön 22; dieses dritte Element des wahren Propheten übernimmt Spinoza von Maimonides: vgl. Nadler 2011, 71 f.). Die drei Aspekte, die einen wahren Propheten ausmachen, sind daher nach Spinoza (1) das lebhafte Vorstellungsvermögen sowie die (2) durch ein Zeichen beglaubigte (3) wahre Lehre (vgl. TTP II, 33 f.). Wahr ist die Lehre, indem sie orthodox ist; orthodox, indem sie nichts gegen Gerechtigkeit und Liebe predigt. Der Prophet gewinnt die moralische Gewißheit aus dem Zeichen Gottes. Der
P P T -
Hörer des Propheten, der letzterem schlicht glauben kann oder nicht, kann aber, wie wir sahen, aus dem Zeichen des Propheten keine Gewißheit schöpfen, und eine Einschätzung von dessen Vorstellungskraft ist ihm ohnehin nicht zugänglich. Das Hauptgewicht zur Bewertung der Wahrhaftigkeit einer Prophezeiung liegt also in ihrem Inhalt, der sich letztlich nach seiner moralischen Orthodoxie bemißt (die wiederum darin wurzelt, daß der Prophet einen „dem Rechten und Guten zugewandten Sinn“ besitzt: TTP XV, 233).
3.3 Die Vielfalt prophetischer Erkenntnis und die Notwendigkeit ihrer Interpretation Nach der Ethik sagen unsere sinnlichen Wahrnehmungen und die auf ihnen basierenden Vorstellungen mehr über uns aus als über die Welt, die wir wahrnehmen (E II, Lehrsatz 16, Folgesatz 2). Insofern die Propheten sich durch nicht mehr als eine besonders lebhafte Vorstellungskraft auszeichnen, gilt für sie natürlich dasselbe. Und da sie zu verschiedenen Zeiten prophezeiten und aus verschiedenen Gesellschaftsschichten stammten, ergibt sich daraus eine Vielfalt bezüglich Form und Ausformulierung der Prophezeiungen. Dies gilt auch dann, wenn die Offenbarungen denselben Inhalt hatten. Zum einen bedeutet dies, daß ein Prophet nach seinem Temperament und seiner Gemütslage prophezeit. Durchaus auf seine Assoziationspsychologie rekurrierend, ist für Spinoza ein heiteres Temperament für Positives, ein düsteres eher für die Androhung von Strafgerichten geeignet (vgl. TTP II, 35 ff.). Darüber hinaus unterscheiden sich Prophezeiungen, auch wenn sie dasselbe beinhalten, ihrem Stil und ihren Umständen nach, je nach dem Bildungsstand und der gesellschaftlichen Position des Propheten (37). Drittens schließlich unterscheiden sich die Prophezeiungen durch das Maß an Vorstellungskraft der Propheten in eher klare und eher dunkle (37 f.). Dabei scheint Spinoza ein früheres Argument umzukehren, wenn er argumentiert, daß eine Prophezeiung um so dunkler sei, je schwächer die Vorstellungskraft ist. Am Ende des ersten Kapitels hatte er behauptet, daß es gerade die Lebhaftigkeit der Imagination und die daraus folgende kreativere Verknüpfung von Bildern sei, die zur Verworrenheit von Offenbarungen beitrage (vgl. TTP I, 30).
D B
Mit diesen Analysen verfolgt Spinoza ein doppeltes Ziel: Zum einen reduziert er den Status der Prophetie, vor allem in bezug auf die Umstände der eigentlichen Prophezeiungen, noch einmal. Vieles von dem, was eine Prophezeiung, insbesondere an Spekulativem, enthält, ist kontingent, hängt von der Stimmung, dem Status, der Sozialisierung des Propheten ab und kann daher nicht nur keinen philosophischen Gehalt haben, sondern muß auch im Rahmen einer theologischen Deutung wegfallen. (Auch hier enthält sich Spinoza jeder ausdrücklichen Aussage zum Wahrhaftigkeitsanspruch seiner eigenen Konstruktion. Zum Problem des Verhältnisses von Argumenten zu Überzeugungen im TTP vgl. Strauss 1930 und Cook 1996.) Wiederum trennt Spinoza nicht nur Theologie und Philosophie, er reduziert auch die Aussagekraft theologischer Argumente auf ein Minimum. Zum anderen liegt gerade in diesem Minimum das eigentliche Moment von Spinozas theologischen Bemühungen im Traktat, das in einer spezifischen, keiner allgemeinen Reduzierung des Status der Theologie (und der organisierten Religion) liegt. Denn der von Spinoza durchaus geschätzte Kern der Prophezeiungen findet sich letztlich in nichts anderem als in den Begriffen der Gerechtigkeit und Liebe, die die Handlungsanleitung in theologischer, politischer und ethischer Hinsicht gleichermaßen subsumieren. Reduziert werden nur das Spekulative und das Zeremonielle in der Religion. So sind die drei Ordnungsformen der Theologie, Politik und Ethik letztlich an unterschiedliche, durch ihre Erkenntnisfähigkeiten unterschiedene Adressaten gerichtet und analytisch voneinander (im Falle von Theologie und Philosophie: strikt) zu trennen. Ihre Botschaften jedoch sind nicht nur kompatibel, sondern letztlich im Kern identisch.
3.4 Die Reichweite der Prophetengabe und der Status des jüdischen Volkes Das dritte Kapitel des Theologisch-politischen Traktat ist in seiner Bedeutung schwerer zu fassen. In ihm spielt die Frage nach der Prophetie eigentlich nur eine Nebenrolle. Sind die ersten zwei Kapitel gegen eine falsche Vorstellung dessen gerichtet, was Prophetie sei, und damit gegen eine falsche und potentiell gesellschaftlich disruptive Interpretation von Religion, wendet sich das folgende gegen den Gedanken einer substantiellen Auserwählung der Hebräer. Implizit
P P T -
allerdings, und der Allgemeinheit des philosophischen Gedankengangs nach, wendet es sich gegen den Gedanken einer göttlichen Bevorzugung in bezug auf jede Volksgruppe oder Glaubensgemeinschaft. Die für den Menschen bedeutendsten Eigenschaften sind nicht so unter sie verteilt, daß eine Gruppe einer anderen überlegen ist. Vielmehr beziehen sie sich entweder auf menschliche Individuen oder auf staatliche Institutionen. Die Gabe der Prophetie kommt an dieser Stelle also nur als Teil des Erwähltheitsanspruchs des jüdischen Volkes vor. Dies mag auch dem Umstand geschuldet sein, daß das Kapitel selbst die Untersuchung der Prophetie bereits mit einem daran anschließenden Teilabschnitt in der Argumentation verbindet. Nach Manfred Walther schließt Spinoza an die Untersuchung der Propheten als „spezifische Träger göttlicher Selbstmitteilung“ die Elemente an, die nach orthodoxer Auffassung „den besonderen Inhalt der göttlichen Offenbarung“ ausmachen (Walther 1991, 69), nämlich die Erwählung des jüdischen Volkes (Kap. 3), das Gesetz (Kap. 4), die Zeremonien (Kap. 5) und die Wunder (Kap. 6). Spinozas Argumentationsgang erfolgt in drei großen Schritten. Zuerst thematisiert Spinoza das wahre Glück (felicitas) und die wahre Glückseligkeit (beatitudo), die in einem Zustand, nicht einer Relation bestehen. Man ist nicht glücklich, weil man weiser, stärker, freier als andere ist, sondern weil man weise, stark und frei ist (vgl. TTP III, 50). Das Bestehen auf einem Auserwähltsein gegenüber anderen ist also an sich kindisch und mit der rechten Vernunft nicht im Einklang. So verwende Moses das Konzept in bezug auf das jüdische Volk nur, um die göttliche Botschaft dessen „kindische[r] Fassungskraft“ anzupassen (51). In einem zweiten Schritt erläutert Spinoza zentrale Begriffe, die um den Komplex der Auserwählung kreisen. Auch für diese Erläuterung des Status des jüdischen Volkes greift Spinoza auf Begriffserklärungen, hier nicht etymologischer, sondern philosophischer Natur, zurück. Denn die relevanten Begriffe, directio Dei, auxilium Dei, electio Dei und fortuna, kontextualisiert er in Rückgriff auf die in der Ethik dargelegte Identitätsphilosophie (51 f.). Schon bei der Leitung Gottes (directio Dei) insistiert er, daß die Ratschlüsse Gottes und die Ordnung der Welt ein und dasselbe sind. Denn unter Leitung Gottes will Spinoza nichts anderes verstanden wissen als eben die determinierte Kausalordnung der Welt, die nichts anderes ist als eine spezifische (und not-
D B
wendige) Ausformung der einen unendlichen Substanz, Gottes. Unklar ist dabei freilich der Status des in der Ethik unpersönlichen Gottes, der hier wie gelegentlich im Traktat deutlich personalisierter auftritt. Spinoza läßt es an dieser Stelle schlicht offen, inwiefern Gottes decreta tatsächlich intentionaler Natur sind. Den Beistand Gottes (auxilium Dei) unterteilt Spinoza in inneren und äußeren (internum, externum). Beide Formen beschreiben dabei lediglich bestimmte Verhältnisse menschlicher Individuen zu ihrer Umwelt, indem sie die Macht beschreiben, die der Mensch aufgrund seiner inneren Konstitution einerseits, aufgrund äußerer Ursachen andererseits besitzt. Beistand, besser: Hilfsmittel Gottes ist diese Macht insofern, als sie tatsächlich eine Gabe Gottes ist, allerdings nicht im Sinne eines Geschenkes, sondern im Sinne einer Teilhabe am determinierten Kausalzusammenhang der Welt und damit Gottes. Die Auserwählung (electio Dei), um die es Spinoza eigentlich geht, wird schon hier reduziert zu einer Folge aus der directio Dei: Insofern jeder nur gemäß der Leitung Gottes, also gemäß seiner eigenen determinierten Natur, handelt und wählt, ist letztlich jeder notwendig auserwählt zu tun, was er tut. Und da die Natur Gott ist, ist jeder von Gott auserwählt zu tun, was er tut. Dem Schicksal (fortuna) schließlich kommt, ganz wie dem Zufall in der Ethik (E I, Anhang), überhaupt kein ontologischer Status zu. Schicksal und Zufall sind Zuschreibungen, die sich auf Ereignisse beziehen, deren Kausalzusammenhänge sich unserer Kenntnis entziehen. Damit lösen sie sich in Spinozas deterministischer Philosophie letztlich in das Zusammenspiel aus dem objektiven Ratschluß Gottes und den empirischen Erkenntnisdefiziten des endlichen Modus Mensch auf. Bei allen vier Aspekten kann man sich fragen, ob sich Spinoza hier mit einem Nachweis der Kompatibilität seiner theologischen Interpretation mit seiner Philosophie zufrieden gibt, oder ob die – für seine These der Trennung der beiden Untersuchungsbereiche voneinander nicht ungefährliche – Einführung philosophischer Analysen nicht letztlich nachweisen will, daß die Philosophie mit ihrem Wahrheitsanspruch doch für das wahre Verständnis der Theologie unerläßlich ist. Wenn die Philosophie der Theologie deren Begriffe erklären muß, um deren Ziel, den Gehorsam gegen das göttliche Gesetz, erfüllen zu können, dann bleibt die Theologie, ganz unabhängig von ihrem Ziel, von der Philosophie abhängig. (Allerdings, so könnte man einwenden, ist Kap. 3 des TTP eher ein Exkurs,
P P T -
nicht nur anti-jüdischer, sondern auch politischer und moralischer, nicht theologischer Natur.) In einem dritten Schritt schließlich stellt Spinoza die Frage danach, was der Mensch begehren darf. Dreierlei Begehren zählt Spinoza auf: (1) die Neugier auf die Erkenntnis von Kausalzusammenhängen, (2) die Tugend im Sinne der Beherrschung der passiven Leidenschaften und (3) das weltliche Wohlbefinden (vgl. TTP III, 53). Im folgenden argumentiert er, daß die Eigenschaften der Neugier und Tugend allen Menschen zueigen oder zugänglich sind, daß Unterschiede zwischen Völkern also nur im Hinblick auf den dritten Punkt gegeben sind, und dies nicht im Hinblick auf die Qualität des Volkes (Spinoza nimmt keine entwicklungsgeschichtlichen Aspekte in den Blick, wie dies bspw. hundert Jahre später Rousseau tun wird), sondern nur auf dessen Institutionen. Der Schlüssel zum Kapitel findet sich ebenfalls in dieser Passage, denn die Institutionen wiederum hängen von der Qualität der sie besetzenden Personen ab. Besitzen diese einer politischen Leitung angemessene Eigenschaften (ingenia und vigilantia: Geisteskraft und Wachsamkeit, TTP III, 53; vgl. E IV, Anhang, Hauptsatz 13), so nimmt ihre politische Technik die Politik aus den Händen des Schicksals. Fehlen ihnen diese Eigenschaften, so wird das Schicksal die politische Führung übernehmen. (Man vergleiche diese Analyse mit der des „acutissimus Machiavellus“ – TP V 7, 66 – in dessen Principe, Kap. 25.) Im Grunde haben wir es hier mit einer Tautologie zu tun: Schicksal ist, wie wir oben sahen, nichts anderes als die Notwendigkeit der natürlichen Ordnung, soweit sie sich unserer Kenntnis entzieht. Daß, je weniger politische Weisheit die Führer haben, um so mehr der Staat vom Schicksal abhängig ist, bedeutet also nichts anderes als: Je weniger wir Kenntnis von dieser Ordnung haben, desto weniger haben wir Kenntnis von dieser Ordnung. (Eine konstruktivere Bedeutung des Kapitels vor allem für die politische Theorie des TTP nimmt Rosenthal 2002, 231 ff. an.) Mit diesen Analysen bewehrt, stellt sich Spinoza sodann die Frage, worin die Auserwählung des jüdischen Volkes lag. Seine Antwort ist, obgleich mit ernster Miene als schlichte Folgerung vorgetragen, von beißender Ironie: Ja, die Hebräer konnten als auserwählt gelten, aber gerade weil sie als Staat f lorierten, obgleich ihnen die Qualitäten einer politischen Technik in hohem Maße abgingen (vgl. TTP III, 54 f.). Ergo war ihre fortgesetzte Existenz als Staat göttlicher Hilfe (auxilium Dei externum) geschuldet, das aber, wie Spinoza bereits erläuterte,
D B
nichts anderes als die Macht äußerer Gegenstände ist, soweit diese sich zufällig positiv auf uns auswirken. Insofern diese äußere Macht, dargestellt hier wiederum im theologischen Kontext als Wille Gottes, etwas verspricht, so freilich nur das, was Gegenstand der institutionellen politischen Ordnung ist, nämlich die Bequemlichkeiten und Errungenschaften dieses Lebens (commoda, foelicitas temporanea), die dritte der oben genannten erlaubten Begehrungen. So liegt die Auserwählung der Hebräer also nur darin, daß sie trotz ihres Mangels an politischer Klugheit ein sicheres und bequemes Leben im Schoß eines funktionierenden Staates hatten. Und entsprechend hatte „ein Jude für sich betrachtet, also außerhalb von Gesellschaft und Staat, keine Gabe Gottes vor den anderen voraus“ und es bestand kein Unterschied „zwischen ihm und einem Heiden“ (TTP III, 57 f.). Weder dem Wissen noch der Tugend nach auserwählt, ist den Juden aber auch die Prophetengabe nicht allein zueigen (vgl. 58). Philosophisch folgt dies ebenso klar wie die vorherigen Punkte, denn wie die Neugier und die Tugend, so ist auch die Vorstellungskraft eine allgemeinmenschliche Eigenschaft. (Spinoza leitet diese Erkenntnis aber wiederum aus biblischen Stellen her: 58–61.) Seine Auseinandersetzung mit den Pharisäern (vgl. 63 f.) schließlich läuft letztlich darauf hinaus, die Kehrseite der politischen Auserwählung von Völkern darzulegen, nämlich den Umstand, daß Individuen nur durch den zweiten der oben genannten Aspekte, nämlich durch ihre Tugendhaftigkeit auserwählt seien (vgl. 64). Diese Auserwählung wiederum rekurriert freilich auf den Umstand, daß die Tugend als Macht der Vernunft, die zum Handeln aus eigener, nicht fremder Notwendigkeit führt, ihr eigener Lohn ist (E V, Lehrsatz 42). Vor allem aber trennt sie den Begriff der electio von allen überindividuellen (Gruppen-, Standes-, Volks-) Aspekten ebenso wie von allen politischen Dimensionen. Die Auserwähltheit, richtig verstanden, bezieht sich auf die verinnerlichte moralische Existenzweise, die Spinoza in der Ethik als richtiges Leben anpreist.
3.5 Fazit In den ersten drei Kapiteln des Theologisch-politischen Traktats reduziert Spinoza den Status prophetischer Erkenntnis, indem er ihr alle spekulative Bedeutung, überhaupt fast alle genuine Welterkenntnis ebenso abspricht wie eine wissen-
P P T -
schaftlich angemessene Gewißheit ihrer Botschaften. Nicht zuletzt schränkt er die Gabe der Prophetie auf allgemeinmenschliche und erkenntnistheoretisch inadäquate Fähigkeiten ein, so daß keine besondere Gruppe von Menschen, das heißt keine Glaubenskongregation und kein Volk, sich diesbezüglich eine Sonderstellung herausnehmen kann. Dies alles geschieht aber nicht um der völligen Entwertung der prophetischen Erkenntnis willen, sondern vielmehr um durch eine Einschränkung ihres Wirkungsbereichs und ihres Inhalts dasjenige herauszuheben und zu betonen, was in der Analyse als ihr positiver Gehalt verbleibt. Abgelehnt werden vor allem die aus der Prophetie abgeleiteten Übergriffe der Theologie auf die Philosophie, übrig bleibt das, was Spinoza als die eigentliche Heilige Schrift versteht, die mit der philosophischen Ethik kompatible Handlungsanleitung zu Gerechtigkeit und Liebe. Dabei bedient sich Spinoza immer wieder – gegen sein erklärtes Methodenideal – der philosophischen Begriffsanalyse und des Verweises auf sein eigenes Denksystem, wodurch unklar bleibt, wie sauber Spinoza seine eigene Trennungsthese aufrecht erhält. Von Interesse ist für ihn letztlich die inhaltliche Kompatibilisierung von Theologie und Ethik (und später im TTP auch der Politik). Unterschieden mögen Theologie und Ethik methodisch sein, indem sie sich über ihre Herangehensweise Menschen von je verschiedenen Erkenntnisfähigkeiten zuwenden. Am Ende beschäftigen sich aber beide mit der Lebensweise der Menschen und schreiben denselben Inhalt, Gerechtigkeit und Liebe, vor.
Literatur Bartuschat, W. 2 2006: Baruch de Spinoza, München. Cook, J. Th. 1995: „Did Spinoza Lie to His Landlady?“ In: Studia Spinozana 11. Spinoza’s Philosophy of Religion, Würzburg, 15–37. Descartes, R 1637: Discours de la méthode, Amsterdam, in: L. Gäbe (Hrsg.), René Descartes, Von der Methode, franz.-dt., Hamburg 1960. – 1644: Principia philosophiae, Amsterdam, in: Chr. Wohlers (Hrsg.), René Descartes, Die Prinzipien der Philosophie, lat.-dt., Hamburg 2005. James, S. 2012: Spinoza on Philosophy, Religion, and Politics. The Theologico-Political Treatise, Oxford. Laux, H. 1993: Imagination et religion chez Spinoza. La potentia dans l’histoire, Paris. Machiavelli, N. 1513: Il principe, in: Ph. Rippel (Hrsg.), Niccolò Machiavelli, Il Principe/Der Fürst, ital.-dt., Stuttgart 1986.
D B
Nadler, S. 2011: A Book Forged in Hell. Spinoza’s Scandalous Treatise and the Birth of the Secular Age, Princeton. Rosenthal, M. A. 2002: „Why Spinoza Chose the Hebrews. The Exemplary Function of Prophecy in the Theological-Political Treatise“, in: H. Ravven/L. Goodman (Hrsg.), Jewish Themes in Spinoza’s Philosophy, Albany, NY, 225–260. Strauss, L. 1930: Die Religionskritik Spinozas als Grundlage seiner Bibelwissenschaft. Untersuchungen zu Spinozas Theologisch-politischem Traktat, Berlin. Walther, M. 1991: „Spinozas Kritik der Wunder – Ein Wunder der Kritik?“ In: Zeitschrift für Theologie und Kirche 88, 68–80.
4 Jan-Hendrik Wulf
Exoterisches und esoterisches Religionsverständnis im Theologischpolitischen Traktat „Göttliches Gesetz“, „religiöse Zeremonien“ und „Wunder“ als vermittelnde ironische Tropen zwischen Volksfrömmigkeit und amor Dei intellectualis (Kapitel 4–6) Versteckt in einer Anmerkung zum Lehrsatz 47 im zweiten Buch der Ethik beschreibt Spinoza die Ursache der meisten philosophischen Kontroversen als nicht in der Sache, sondern nur im Gebrauch der Sprache begründet: „Und das ist es, woraus die meisten Streitereien entspringen: daß Menschen ihre eigenen Gedanken nicht richtig ausbreiten oder die eines anderen falsch deuten. Denn in der Tat, wenn sie einander am heftigsten widersprechen, haben sie entweder dieselben Gedanken oder denken an verschiedene Dinge, so daß die Irrtümer und Widersinnigkeiten, die sie bei dem anderen vermuten, gar keine sind.“ (E II, Lehrsatz 47,196 f.) Daß das in dieser Bemerkung beschriebene schwierige Verhältnis von sprachlichem Signifikanten zu dem ihm entsprechenden Signifikat auch umgekehrt als einfache Deutungsschablone für das Werk des Philosophen dienen kann, hatte bereits im Jahr 1911 der Prager Linguist Fritz Mauthner erkannt, der im zweiten Band seines Wörterbuchs der Philosophie Spinozas Denken als ein ironisches Spiel mit sprachlichen Tropen beschreibt: Spinozas „bettelfreche Sprache“, so Mauthner, setze bei einem zentralen Begriff wie „Gott bestenfalls nur ein altes Wort für ein neugefundenes x“ (Mauthner 1980, 434). Spinozas Gedanken entfalten ihre Kontroversität damit weniger auf der syntagmatischen Ebene synthetischer Sachaussagen, als vielmehr auf der paradigmatischen Ebene der von ihm verwendeten Signifikanten, deren traditionelle Semantik er kritisch umdeutet und durch eigene Konzepte ersetzt.
J-H W
Spinozas Rhetorik verlangt eine besondere Technik des Lesens und Interpretierens, denn die jeweils mit einem traditionellen und einem von Spinoza hergeleiteten Konzept doppelt besetzten Wörter bewirken auf der Textebene oft nur angedeutete Wechsel von „eigentlicher“ zu „uneigentlicher“ Sprechweise des Philosophen, je nachdem, ob er mit den gleichen Worten seine eigenen oder fremde Standpunkte beschreibt. Geben sich solche ironischen Tropen in der Lektüre durch scheinbare Widersprüche oder besonders nichtssagende philosophisch-theologische Allgemeinplätze zu erkennen, müssen sie von den Lesern (durch Analogieschlüsse und den Rekurs auf andere Textpassagen) mit dem eigentlich Gemeinten substituiert werden. Diese Rekonstruktion der semantischen Tiefenstruktur des Textes in der Lektüre setzt bei den Lesern voraus, daß sie Spinozas Begriff lichkeit bereits internalisiert haben – insofern kann man hier von einer exoterischen und einer esoterischen Bedeutungsebene des philosophischen Textes sprechen. Spinozas Rhetorik der ironischen Tropen wurde schon von seinen Zeitgenossen erkannt und zumeist als Versuch kritisiert, atheistische Lehren durch uneigentliches Sprechen zu verschleiern – so 1677 von dem französischen Mystiker Pierre (Petrus) Poiret Naudé (1646–1719) oder 1734 von dem niederländischen Mathematiker und Philosophen Willem Jacob ’s Gravesande (1688–1742). In jüngerer Zeit haben Leo Strauss und Yirmiyahu Yovel die uneigentliche Redeweise Spinozas vor dem Hintergrund möglicher Verfolgung oder seiner marranischen Herkunft zu deuten versucht (Jongeneelen 2011; Yovel 1994; Strauss 1988). Für die folgende Analyse der Kapitel 4–6 des Traktat sollen die ironischen Tropen Spinozas jedoch vor dem Hintergrund seiner vor allem in der Ethik (E II und E III) dargelegten Sprachtheorie in ihrer gesamten semantischen Bandbreite als konstitutiver Bestandteil des Textes gedeutet werden. In Ethik II hebt Spinoza in der Anmerkung zu Lehrsatz 49 hervor, daß zwischen einer Idee als einem Begriff des Geistes und der bildlichen Vorstellung davon sowie zwischen Ideen und den Worten, mit denen die Dinge bezeichnet werden, unterschieden werden müsse (moneo, ut accurate distinguant inter ideam, sive mentis conceptum, et inter imagines rerum … inter ideas et verba, quibus res significamus; E II, Lehrsatz 49, Anm., 202 f). Eine Idee besteht für Spinoza nicht aus Wörtern, da in der Metaphysik der Ethik deren Essenz (wie die der Bilder) bloß in „körperlichen Bewegungen“ liegt, die den Begriff des Denkens nicht in sich schließen (verbo-
E R
rum … essentia a solis motibus corporeis constituitur, qui Cogationis conceptum minime involvunt; E II, Lehrsatz 49, Anm., 204 f). Worte spielen bei Spinoza für die Entstehung mentaler Konzepte daher keine tragende Rolle. So weist er auch in der Definition der Affekte in Ethik III darauf hin, daß ihm sein unüblicher Gebrauch der Worte bewußt sei (haec nomina ex communi usu aliud significare scio), daß er aber nicht die Bedeutung seiner Worte, sondern die Natur der Dinge erklären wolle (meum institutum non est verborum significationem, sed rerum naturam explicare; E III, Definition 20, 348 f.), die er ohnehin nur grob mit Worten umreißen könne. Da mentale Konzepte für Spinoza nicht durch Worte entstehen, liegt im jeweiligen Erkennen der Ironie seines Sprachgebrauchs auch ein Moment der Erkenntnis. Diese esoterische Schreibweise Spinozas setzt gar nicht voraus, daß sich das von ihm favorisierte conceptum cogitationis beim Leser über die Wortwahl einstellt, sondern überläßt die Zuordnung von exoterischen (uneigentlichen) und esoterischen (eigentlichen) Konzepten (und damit die Tiefe der semantischen Durchdringung des Textes) hier ein Stück weit den einzelnen Lesern und ihren jeweiligen metaphysischen Bedürfnissen und kognitiven Fähigkeiten: Da nach der in der Vorrede des Traktat dargelegten Ansicht Spinozas nur wenige Menschen zu geistiger Gottesliebe (amor Dei intellectualis; E V, Lehrsatz 33, 576) und zu tugendhaftem Lebenswandel überhaupt berufen seien, sondern vielmehr inadäquate Ideen von Gott entwickelten, seien die traditionellen theologischen Konzepte von Religiosität, die nicht auf natürlicher Erkenntnis, sondern auf geoffenbarter Erkenntnis (cognitio revelata) und Gehorsam (obedientia) bauten, für einen Großteil der Menschen dauerhaft unverzichtbar und damit auch nicht in Bausch und Bogen zu verwerfen (vgl. TTP XV, 236 f.). Insofern die Leser sich in der Lektüre damit selbst als Konstrukteure eines Gedankens betätigen müssen, steht Spinoza in der intellektuellen Tradition vieler arabischer und jüdischer Philosophen des Mittelalters, die in ihren Werken oft unterschiedliche exoterische und esoterische Bedeutungsebenen adressiert haben – ganz analog zu der auch nach dieser Tradition entwickelten rabbinischen PaRDeS-Typologie des vierfachen Schriftsinns (Peshat, Remez, Derash und Sod) zur Unterscheidung einer wörtlichen, symbolisch-allegorischen, vergleichenden und geheimen Textebene) zur Deutung der Heiligen Schrift (González Diéguez 2013, 84–92; Cassuto 1999, 31–51). Die in der Vorrede des Traktat ausgesprochene „Ausladung“ gegenüber allen affektbestimmten Lesern (TTP Vorrede, 13)
J-H W
verweist hier als Motiv für die Anwendung dieses esoterischen Verfahrens ebenso auf Spinozas in der Ethik ausgeführte Lehre der vernunftwidrigen menschlichen Affekte wie auf den elitaristischen Vernunftbegriff des mittelalterlichen Philosophen Maimonides, der in seinem auch von Spinoza zitierten Hauptwerk Wegweiser für die Verwirrten 7, 15 erklärt hatte, bestimmte Gedanken nur fragmentarisch ausführen oder in falscher Reihenfolge präsentieren zu wollen, um eine Rekonstruktion seines Textes nur durch intellektuell dazu auch berufene Leser zu ermöglichen (Maimonides 2009, 59). Ausgehend von diesen Vorüberlegungen, die in Spinozas Philosophie eine besondere Beachtung der sprachlichen Tropen und ihres semantischen Spannungsverhältnisses von exoterischer und esoterischer Begriff lichkeit nahelegen, soll hier im folgenden auch die Analyse der Kapitel 4–6 des Theologisch-politischen Traktat erfolgen, in denen Spinoza die Begriffe „göttliches Gesetz“, „religiöse Zeremonien“ und „Wunder“ diskutiert. Seine Begriffsklärungen, die immer wieder um den problematischen Zeichen- und Verweisungscharakter des Sprechens über religiöse Erkenntnisse und das Textverständnis der Bibel kreisen, liefern argumentative Grundbausteine, auf denen in den weiteren Kapiteln des Traktat die von Spinoza vertretene Möglichkeit der libertas philosophandi begründet wird. Im Sinne der „Trennungsthese“ (vgl. TTP Vorrede, 10; TTP XV, 231) geht es dabei um die Differenzierung autonomer und heteronomer Formen religiöser Erkenntnis und Praxis, dies jedoch ausdrücklich weder im Sinne einer Verallgemeinerbarkeit der Möglichkeit rationaler Erkenntnis für alle Menschen, noch im Sinne einer moralischen Wertigkeit: So konzediert Spinoza in Kapitel 15, daß das theologische Grunddogma der Offenbarung zwar faktisch einer rationalen Analyse durch das natürliche Licht entzogen sei, die Menschen aber dennoch ihr moralisches Urteilsvermögen darauf anwenden könnten, das Geoffenbarte nicht blind, sondern „mit einer wenigstens moralischen Gewißheit“ (TTP XV, 233) anzunehmen. Insofern stellt Spinoza durchaus in Aussicht, daß der in den religiösen Offenbarungsquellen geforderte Gehorsam die aus philosophischer Perspektive nachteiligen Folgen einer nicht durch die Vernunft und durch adäquate Ideen bestimmten Gotteserkenntnis zumindest in der daraus resultierenden Lebenspraxis ein Stück weit kompensieren könne.
E R
4.1 Das göttliche Gesetz als individuelle Lebensregel (Kapitel 4) Die Frage von Gehorsam und Freiheit läßt sich nun insbesondere auf den im vierten Kapitel des Traktat im Mittelpunkt stehenden Begriff des „göttlichen Gesetzes“ (de lege divina) anwenden. Im traditionellen Verständnis der sich auf die jüdische Bibel beziehenden monotheistischen Religionen werden diese Gesetze in der Regel als die Gläubigen unmittelbar bindende Vorschriften eines göttlichen Souveräns angesehen (Rutherford 2010, 143). Spinoza referiert zwei alternative Deutungen und verfolgt (wie auch in Kap. 5 und 6) die argumentative Strategie, den traditionellen Gebrauch des Attributes „göttlich“ (divinus) wie des Gesetzes-Begriffes (lex) zunächst einmal aus philosophischer Perspektive als Katachresen zu entlarven und ihnen eine alternative Semantik entgegenzusetzen. Dies betrifft zum einen das Adjektiv „göttlich“ und den sich in seiner Verwendung manifestierenden Anspruch, etwas vom Wesen oder der Natur Gottes begriff lich (im Sinne einer adäquaten Idee) erfaßt zu haben: Ironischerweise finde, so Spinoza zu Beginn des sechsten Kapitels, das Adjektiv „göttlich“ im allgemeinen Sprachgebrauch in erster Linie Anwendung auf alles Wissen, das die menschliche Fassungskraft übersteige, ebenso wie auf jedes Werk, dessen Ursache dem gewöhnlichen Volk unbekannt bleibe (vgl. TTP VI, 98). Damit bezeichnet es aus Spinozas Sicht eher den Zustand einer kognitiven Gottesferne derer, die das Wort unwissentlich ironisch im Munde führen, denn es werde stets dasjenige als „göttlich“ bezeichnet, was der jeweiligen menschlichen Erkenntnis entzogen scheint. Ausführlicher diskutiert Spinoza in Kapitel 4 den Begriff des Gesetzes in seiner großen Bandbreite semantischer Implikationen. Allgemein definiert er als „Gesetz“ (lex) eine verallgemeinerbare Weise, nach der eine Gruppe von Menschen handelt, und unterscheidet dabei zwei Formen, die entweder von der Notwendigkeit in der Natur oder bloß vom menschlichen Belieben abhängen und zur Bequemlichkeit oder Sicherheit des Lebens erlassen werden (vgl. TTP IV, 67). Letztere müßten „zutreffender Rechtsgesetz“ (magis proprie ius) genannt werden, denn sie hingen nur von der Macht des menschlichen Geistes ab und seien der Naturgesetzlichkeit von daher nachgeordnet. Spinoza merkt hier kritisch an, daß im allgemeinen sprachlichen Gebrauch der Gesetzes-Begriff (lex) nur „in einem übertragenen Sinne“ (per translationem) auf die notwendigen Abläufe
J-H W
in der Natur angewandt werde, während er in menschlichen Angelegenheiten hauptsächlich das bezeichne, was eigentlich als „Anordnung“ (mandatum) aufgefaßt werden müsse, als eine Regel, die, insofern sie die menschliche Macht einschränke, von den Menschen erfüllt oder mißachtet werden könne. So gelangt Spinoza zu dem Schluß, daß der Gesetzes-Begriff offenbar üblicherweise in einem eingeschränkten Sinne so definiert werde (lex particularius definienda videtur), daß es sich dabei um eine Lebensregel (ratio vivendi) handle, die Menschen sich oder anderen um irgendeines Zweckes willen vorschrieben (vgl. TTP IV, 68). Der wahre Zweck einer vom Gesetzgeber vorgeschriebenen allgemeinen Lebensregel bleibe den danach Handelnden (dem einfachen Volk) aus Mangel an vernünftiger Einsicht jedoch zumeist verborgen. Er werde auch von den Gesetzgebern nicht preisgegeben, da sie den Gesetzen andere Zwecke hinzugefügt hätten, um die nicht vernunftgemäß lebenden Menschen durch nachgeordnete Zwecke, die ihnen unmittelbarer einleuchten müßten, zu verpf lichten. Dabei handele es sich um zeitliche Güter, also konkrete Vergünstigungen, die vom Volk besonders begehrt oder, im Falle des Ungehorsams, als Strafe besonders gefürchtet würden. Doch könne ein Mensch, der aus Angst vor dem Galgen und nicht aus tieferer Einsicht handele, aus der Sicht Spinozas nicht „gerecht“ (justus) genannt werden. Gerecht könne nur jemand heißen, der festen Sinnes nach eigenem, nicht aus fremdem Beschluß (ex proprio, non vero alieno decreto) handle (vgl. TTP IV, 69). Diese Ausdifferenzierung bereitet hier den argumentativen Boden dafür, die Befolgung offenbarter biblischer Gebote in der zeitgenössischen religiösen Praxis – vor allem hinsichtlich ihres jeweiligen Zwecks – näher zu qualifizieren. Insofern Menschen sich oder anderen ein „Gesetz“ also die Lebensregel zu einem greifbaren Nutzen (wie dem Erhalt des Lebens, eines Staates oder einer Gemeinschaft) aus eigenem Gutdünken vorschreiben, so möchte Spinoza darunter nur das „menschliche Gesetz“ (lex humana) verstehen, insofern eine Lebensregel aber durch die Vervollkommnung des Verstandes allein auf das höchste Gut (nämlich die wahre Erkenntnis und Liebe Gottes) abziele, wolle er von „göttlichem Gesetz“ (lex divina) sprechen (vgl. TTP IV, 69). So zieht Spinoza den Schluß, daß die Frage, ob ein Gesetz „göttlich“ oder „menschlich“ zu nennen sei, sich an dessen Zweck bemessen lassen müsse – je nachdem, ob sich dieser bloß auf die Sicherung des Lebens und des Staa-
E R
tes oder auf die wahre Erkenntnis und Liebe Gottes beziehen lasse. Insofern definiert Spinoza das „göttliche Gesetz“ aus seinem auf die Natur des höchsten Gutes gerichteten Zweck heraus: Da die menschliche Erkenntnis allein von der Erkenntnis Gottes abhänge und der menschliche Verstand ohne Gott nicht sein und nichts begreifen könne, hänge auch die menschliche Vollkommenheit und Glückseligkeit allein von der Erkenntnis Gottes als dem höchsten Zweck menschlichen Handelns ab (vgl. TTP IV, 70 f.). Dies aber sei durch ein fortgesetztes Streben nach Erkenntnis der natürlichen Dinge zu erfüllen, da Gott die Ursache aller Dinge sei und die Erkenntnis der Wirkung einer Ursache gleichzusetzen sei mit der Erkenntnis einer Eigenschaft der Ursache. Die Mittel, die dieser höchste Zweck erfordert, könnten Spinoza zufolge „Verordnungen Gottes“ (jussa Dei) genannt werden, weil sie von Gott, sofern er den menschlichen Geist bewohne, vorgegeben würden – und diese Lebensregel verdiene zu Recht die Bezeichnung „göttliches Gesetz“. Erst vor dem Hintergrund von Spinozas an anderer Stelle formulierter Kritik an personifizierten (anthropomorphen) Gottesbildern wird dabei der Begriff „Verordnungen Gottes“ als eine ironische Trope erkennbar. Der von Spinoza formulierte Zweck dieses Gesetzes verdeutlicht dies: Gott als das höchste Gut zu verehren (Deum ut summum bonum amare). Diese Liebe Gottes als das höchste Glück der Menschen könne nur so lange als „göttliches Gesetz“ bezeichnet werden, wie sie dem Zweck der Erkenntnis des höchsten Gutes diene und nicht aus Angst vor Strafe oder Liebe zu anderen Vergnügungen befolgt werde (vgl. TTP IV, 71). Eine Offenbarungserzählung ist hier nicht vonnöten, denn Spinoza zufolge ist das göttliche Gesetz (und damit die menschliche Begabung zum Glück) der Natur des Menschen inhärent und dem menschlichen Geist bereits eingeschrieben (humanæ menti innata et quasi inscripta). Damit hat sich Spinozas eigener Begriff vom „göttlichen Gesetz“ essentiell noch weiter vom Begriff des menschlichen Gesetzes entfernt: es manifestiert sich nicht einmal mehr in einer kodifizierten Satzung verbalisierter Regeln, sondern nur in der Lebensregel derer, die nach ihm streben (vgl. TTP V, 82). Während Spinoza das nur menschlichen Zwecken dienende Gesetz als „menschlich“ definiert, läßt er doch noch eine überraschende Ausnahme zu: Wenn ein Gesetz wie das Mosaische, unbeschadet seines Zweckes, ursächlich auf Offenbarung gründe, könne es ebenso auf Gott bezogen werden, da es „durch das prophetische Licht“ (lumine prophetico) sanktioniert sei (TTP IV, 72). Hier
J-H W
stellt Spinoza durch einen pragmatischen Kontext eine andere Semantik her, die seinen vorherigen Ansichten und Definitionen zu widersprechen scheint, hatte er doch zunächst alle seine argumentative Energie darauf verwandt, das „göttliche Gesetz“ als eine Lebensregel zu definieren, deren alleiniger Zweck zum summum bonum führen solle. Doch indem Spinoza lediglich erklärt, daß in diesem Zusammenhang von einem göttlichen Gesetz gesprochen werden könne, nicht aber, daß er selbst diese Terminologie für allgemeingültig und angemessen halte, zeigt sich die deskriptive Seite seiner Argumentation, innerhalb derer er eine exoterische Semantik durch eine ironische Trope referiert. So fügt er einschränkend hinzu, daß die Formulierung für den Spezialfall des Gemeinwesens der alten Hebräer seine Richtigkeit gehabt habe und daß sich dieser Gebrauch des Wortes im Zusammenhang mit „Offenbarung“ mutmaßlich auf die Erkenntnisweise der prophetischen Erleuchtung stütze. Bedenkt man jedoch, welchen geringen epistemologischen Wert Spinoza der Prophetie in den ersten beiden Kapiteln des Traktat einräumt, so wird die hier von Spinoza vorgenommene Qualifizierung des Offenbarungswissens als „göttlich“ zu einer allenfalls ironischen Konzession an die von ihm referierten pragmatischen Kontexte – denn immerhin hatte er den Propheten kein verläßliches Erkenntnisvermögen, sondern allenfalls eine Macht des lebhafteren Vorstellens (potentia vividius imaginandi) attestiert (TTP II, 31) und die Möglichkeit verworfen, daß prophetische Erkenntnis durch die normalen Naturgesetze erklärbar wäre oder die Macht Gottes ursächlich zu erkennen gäbe (vgl. TTP I, 29). Spinoza möchte im Theologisch-politischen Traktat zeigen, daß man „durch den Geist allein, ohne Worte und Bilder“ (pura mente extra verba et imagines) (TTP IV, 76) Gott als einen Gesetzgeber begreifen könne. Hierzu entwickelt Spinoza eine Theorie der Natur des „göttlichen Willens“ (voluntas Dei), der mit dem „göttlichen Verstand“ (Dei intellectus) gleichzusetzen und nur in bezug auf die Theorie, die der menschliche Verstand sich vom göttlichen Verstand mache, zu unterscheiden sei. Denn in Wirklichkeit sei es einerlei, ob man sage, daß die Summe der Winkel eines Dreiecks der Summe von zwei rechten Winkeln entspreche, bilde den Willen und die Entscheidung Gottes oder aber die Erkenntnis Gottes ab: Alles von Gott Bejahte oder Verneinte bilde immer eine ewige Notwendigkeit und damit eine Wahrheit (æternam semper necessitatem sive veritatem) ab (vgl. TTP IV, 74). Daraus folgt, daß nichts in der Welt Vorgefun-
E R
dene oder Mögliche dem göttlichen Gesetz widersprechen könne. Spinoza führt hier aus, daß das Verbot, vom Baum der Erkenntnis zu essen, nur in Adams mangelhafter Erkenntnis als „göttliches Gesetz“ habe aufgefaßt werden können, da die Ausführung der Tat faktisch auf keinerlei Hindernisse gestoßen sei. Analog gelte dies für den Dekalog, der nur aufgrund mangelnder Erkenntnis der Hebräer als Gesetz (lex) im Sinne von Vorschriften und Verordnungen (præcepta et institua) und nicht als ewige Wahrheit (æterna veritas) aufgefaßt wurde. Diese mangelhafte Erkenntnis habe sich auch bei den Propheten und sogar bei Moses in bezug auf die Ratschlüsse Gottes (Dei decreta) gezeigt, die in inadäquater Weise nicht als ewige Wahrheiten (ut æternas veritates) wahrgenommen wurden. Dieser Gesetzesbegriff steht für Spinoza in einem direkten Zusammenhang mit einem anthropomorphen Gottesbegriff, der sich Gott fälschlicherweise in menschlicher Vorstellung als gerechten oder barmherzigen Führer, Gesetzgeber oder König vorstellt – auch wenn es sich hierbei nur um menschliche Attribute handle, die auf Gott keine Anwendung finden dürften (vgl. TTP IV, 75). Zum Abschluß des vierten Kapitels versucht Spinoza anhand von Bibelzitaten zu belegen, daß auch die Heilige Schrift seine Auffassung eines durch Vernunfterkenntnis übermittelten „göttlichen Gesetzes“ unterstütze. Spinozas Beweisführung zielt dabei nicht auf die Etablierung eines autoritativen Schriftsinns, sondern steht im traditionellen jüdischen Verständnis der „Tora des Lebens“ (Torat chayim), in der die Erschließung des ursprünglichen Sinnes ein ständiges Weiterwachsen gelehrter und frommer Interpretationen zur Voraussetzung hat (Greenfield 2006, xv). Im Zentrum steht dabei Spinozas Problematisierung der lateinischen Textfassung der Bibel. Er diskutiert hier ausführlich die Frage nach der angemessenen Übersetzung des biblischen Textes, zitiert und erläutert das hebräische Original des Alten Testaments im Vergleich zur Vulgata und führt für einige Passagen des Neuen Testaments die lateinische Übersetzung einer alternativen altsyrischen Fassung an. Dies ist vergleichbar mit den Interpretationen, die der Targum Onkelos, die für die Exegese bedeutsame erste Übersetzung der Tora ins Aramäische, innerhalb der jüdischen Tradition ermöglicht, weil auch hier von den Übersetzern des biblischen Textes Wendungen gewählt wurden, die eine Anthropomorphisierung Gottes umgingen. Inhaltlich bezieht sich Spinoza vor allem auf die Sprüche Salomos 16, 22, der den Besitz des Verstandes als Quelle des (wahren) Lebens bezeichnet und in 2, 3 behauptet, daß Gott Weisheit gebe (vgl. TTP IV, 78 f.). Weiterhin zitiert
J-H W
Spinoza hier aus dem Römerbrief 1, 20, allerdings in der lateinischen Übersetzung Novum Testamentum ex syriaco latinum (Genève 1569) des zum Christentum konvertierten Juden Immanuel Tremellius (1510–1580). Hier heißt es, daß das verborgene Wesen Gottes von der Schöpfung der Welt her in seinen Geschöpfen „durch den Verstand“ (occulta enim Dei, a fundamentis mundi, in creaturis suis per intellectum conspiciuntur) erblickt werde (TTP IV, 80). Daraus zieht Spinoza am Ende des vierten Kapitels das Fazit, daß selbst die Schrift seine Auffassung vom „natürlichen“, also verstandesgemäßen göttlichen Gesetz ausdrücklich unterstützt. Doch aus dieser kühnen Schlußfolgerung ergeben sich neue Probleme, denn nun bleibt umso mehr zu klären, welche Relevanz die in der Bibel verhandelten Sachverhalte denn noch haben können, wenn das göttliche Gesetz laut Spinoza als dem menschlichen Geist eingeboren und eingeschrieben (humanæ menti innata et quasi inscripta) gelten müsse (TTP V, 82).
4.2 Religiöse Zeremonien zum säkularen Zweck des Staatserhalts (Kapitel 5) Im fünften Kapitel des Theologisch-politischen Traktat untersucht Spinoza den Zweck religiöser Zeremonien und des Glaubens an die biblischen Geschichten. Während jedoch die Frage der Zeremonien in den Kontext des mit Kapitel 3 begonnenen Argumentationsstranges der Historisierung des staatlichen Gemeinwesens der biblischen Hebräer und ihrer Auserwählung gestellt und dem „säkularen“ Zweck des Staatserhalts zugeordnet wird, liegt der Zweck des Glaubens an die biblischen Geschichten in der von Spinoza konstatierten unterschiedlichen Fassungskraft der Menschen und fällt deshalb in den Bereich der im Anschluß des Kapitels fortgeführten Bibelkritik (Kap. 6–9) und ihrer Funktionalisierung als einer Quelle heteronomer moralischer Praxis. In seiner Analyse der religiösen Zeremonien rekurriert Spinoza auf die Historisierungsthese (vgl. Kap. 3), derzufolge der in der Bibel beschriebene Staat der Hebräer nicht in den Kontext eines übernatürlichen Heilsgeschehens eingeordnet, sondern analog zu den politischen Maßstäben eines modernen Staatswesens analysiert werden müsse. Demgegenüber bleiben so die nachbiblisch hergeleiteten Zeremonien der christlichen Kirchen (Taufe, Abendmahl, Feste, äußerliche Gebete) von Spinozas Kritik ausgenommen: Sie könnten ihm zufolge keinesfalls
E R
als Mittel zur Erlangung von Glückseligkeit angesehen werden, sondern gälten nur als äußerliche Zeichen der allgemeinen Kirche (universalis Ecclesiæ signa externa institutæ), denn weder sei ein abgesondert lebender Christenmensch an die Zeremonien gebunden, noch gälten sie für Niederländer in anderen Ländern als verbindlich, wenn dort, wie etwa in Japan, die christliche Religion verboten sei (vgl. TTP V, 91). Ob dieser explizite Ausnahmetatbestand im Sinne von Leo Strauss als uneigentliche Redeweise Spinozas vor einem repressiven gesellschaftlichen Hintergrund interpretiert werden kann, läßt sich nicht aus dem Wortlaut des Textes klären, sondern hängt allein davon ab, wie die Leser aus eigener Anschauung vielleicht doch noch auf eindeutige Parallelen zwischen zeitgenössischer christlicher Glaubenspraxis und dem von Spinoza geschilderten Staat der Hebräer stoßen würden oder die dem Christentum im Traktat positiv attribuierten ethisch-philosophischen Eigenschaften als für die Wirklichkeit gar nicht repräsentativ betrachten könnten. Spinoza behauptet zumindest in Hinsicht auf die im Neuen Testament ausgebreiteten Lehren Jesu Christi, daß sie in seinen Augen keinen blinden Gehorsam verlangten, sondern allgemeingültige Lehren (documenta universalia) zu rein geistigen Zwecken formulierten (vgl. TTP V, 84). Daß Spinoza eine Mißdeutung der Zeremonien durch seine christlichen Leser offenbar doch nicht ganz ausschließt, bezeugt aber der explizite Hinweis darauf, daß diese Zeremonien bloß für die Hebräer, ihre temporäre Auserwählung und ihr historisches Reich von Bedeutung gewesen seien. Da sie sich inhaltlich nur auf das leibliche und zeitliche Glück (solam corporis temporaneam fœlicitatem et imperii tranquillitatem) der Hebräer bezogen hätten, wäre ihr Zweck auch vollständig auf dieses historische Gemeinwesen beschränkt geblieben. Obwohl diese Zeremonien in der Bibel auf ein Gesetz Gottes zurückgeführt (ad legem Dei referebantur) und auf dem Wege der Offenbarung eingesetzt worden seien, trügen sie als Kollektivhandlungen nichts zur Glückseligkeit und Tugend des einzelnen bei und gehörten deshalb auch nicht zum göttlichen Gesetz (vgl. TTP V, 82). Daß seine Analyse auch durch den Wortlaut und die Autorität der Bibel gestützt würde, begründet Spinoza unter anderem mit dem Propheten Jesaja, der in Jes 1, 10 und 16–17 explizit auf den Begriff des „göttlichen Gesetzes“ (lex divina) Bezug nehme und darunter Reinigung des Gemütes, Einübung der Tugend sowie Armenfürsorge verstehe, Opfer und Zeremonien jedoch davon ausschließe (vgl. TTP V, 82 f.). Im weiteren verheiße der Bibeltext in bezug auf die Zeremonien bloß leibliches Wohlergehen und leibliche Freuden (wie auch der Penta-
J-H W
teuch in bezug auf die mosaischen Gebote allein Ruhm, Ehre, Siege, Reichtum, Freuden und Gesundheit verheiße). Dieser klar eingegrenzte Zweck verdeutliche aber auch den Unterschied zu einem von Spinoza als universalem Sittengesetz bestimmten göttlichen Gesetz. Am deutlichsten erscheine die auch in der Bibel vorgenommene Unterscheidung von religiösen Zeremonien und göttlichem Gesetz in Jesaja 58. Hier empfiehlt der Prophet zunächst die Liebe zu sich selbst und seinem Nächsten und verheißt dafür Glückseligkeit (beatitudo). Bei der sich direkt anschließenden Empfehlung zur Einhaltung des Sabbats hingegen verheißt Jesaja lediglich die Sicherheit des Staates sowie leibliches Glück und Wohlergehen (vgl. TTP V, 84 f.). Doch wenn Spinoza damit seine Ansichten hier ausdrücklich auch durch die Autorität der Schrift (Scripturæ authoritate) legitimiert sieht (TTP V, 87), muß man diese Aussage vor dem Hintergrund seiner Einschätzungen in Kapitel 13 verstehen, in denen er die Autorität der Schrift auf den Bereich der Theologie beschränkte: daß es sich hierbei nicht um eine rationale Beweisführung, sondern nur um eine moralische Rückversicherung handelt, die er deshalb für die Leser anführt, weil seine eigene gründliche Herleitung zu Beginn von Kapitel 5 bei den gewöhnlichen Theologen nicht viel gelte (apud communes theologos non multum valet). Somit bezeugen die zahlreichen biblischen Belegstellen im Traktat, deren argumentativer Nutzen vom Verfasser selbst eher zurückhaltend beurteilt wird, daß die Frage der diskursiven Legitimität implizit (in ironisierter Form) im Text immer präsent ist (vgl. TTP V, 82). Im anschließenden, von Spinoza alternativ zur biblischen Offenbarungsgeschichte entwickelten historischen Narrativ erfährt der Leser, daß das Volk des Exodus „ungebildeten Geistes und durch elende Knechtschaft herunterkommen“ (TTP V, 89) gewesen und daß ihr Anführer Moses, als das Gemeinwesen der Hebräer von außen militärisch bedroht gewesen sei, „kraft göttlicher Tugend und gestützt auf göttlichen Befehl“ (virtute et jussu divino) die Religion im Staate eingeführt habe (TTP V, 90), damit das Volk weniger aus Furcht vor Strafe, denn aus moralischer Verpf lichtung und aus Hoffnung auf Wohltaten seine Pf licht erfülle. Diese unverblümte utilitaristische Umdeutung der Urszene des Monotheismus entlarvt nicht nur alle darauf basierende gesellschaftliche religiöse Praxis als uneigentlichen Zwecken folgend, sie enthält auch erneut eine ironische Trope: insofern Moses nämlich jussu divino gehandelt habe, bedeutet dies im Licht der Anthropomorphismus-Kritik Spinozas in Kapitel 4
E R
kein aktives Eingreifen Gottes auf Seiten Moses, sondern nur, daß dieser durch die Umstände begünstigt wurde, seine politischen Ziele erfolgreich in die Tat umzusetzen. Auch wenn der Zweck des Staatserhalts für Spinoza ein würdiger Zweck ist (vgl. TTP V, 87), zeigt sich hier, daß die Menschen unter dem bloßen Vorwand der religiösen Andacht zu Gehorsam angeleitet werden, der dem ihnen zumeist verborgenen Zweck des Staatserhalts diene. Der Zweck religiöser Zeremonien liegt für Spinoza weder in einer inhärenten Sinnhaftigkeit der Verrichtungen, noch resultiert er aus unmittelbarem göttlichen Dekret, sondern besteht geradezu in der Fremdbestimmtheit derer (omnia ex mandato alterius agerent), die sie ausführen (TTP V, 91).
4.3 Die biblischen Geschichten als heilsame Anschauungen für das Volk (Kapitel 5) Spinozas zweites Anliegen in Kapitel 5 des Traktat besteht darin, mit Hilfe der Vernunft auch den Zweck des Glaubens an die Geschichten der Heiligen Schrift nachzuweisen und festzustellen, für wen er nützlich und notwendig ist. Da Spinozas elitaristischem Vernunftmodell zufolge nur wenige Menschen die Fähigkeit besäßen, auf dem Wege der Vernunft zu einer eigenen Meinung zu gelangen, ließen sich die meisten von ihnen lieber durch bereits anerkannte Erfahrungen (empirische Tatsachen) belehren. Dies gelte umso mehr für eine bestimmte Lehre, die sich an ein ganzes Volk oder die gesamte Menschheit richte: Der Inhalt der Heiligen Schrift müsse daher, wenn die Adressaten nicht nur wenige Gelehrte seien, an die Fassungskraft des gemeinen Volkes (ad captum plebis) angepaßt sein und auf Erfahrungswissen rekurrieren (vgl. TTP V, 92 f.). So vermittle die Schrift die spekulative Lehre (speculatio), daß es einen Schöpfer der Welt gebe, der alle mit höchster Weisheit leite und zumindest für jene Menschen, die fromm und rechtschaffen lebten, Sorge trage, hingegen die Sünder bestrafe. Diese Tatbestände würden in der Bibel jedoch nicht durch Definitionen, sondern nur durch Erzählungen entsprechender Vorkommnisse, also bloß durch Erfahrung (sola experientia) belegt. Da geistig-abstrakte Begriffe aber nun einmal prinzipiell nicht durch empirische Vorgänge adäquat dargestellt werden könnten, könne auch die Bibel kein klares Verständnis der Vorgänge oder gar eine Erkenntnis Gottes liefern, sondern ihre Leser nur zu Gehorsam und De-
J-H W
mut (ad obedientiam et devotionem) anleiten (vgl. TTP V, 92 ff.). Deshalb sei die Bibel nur für das gewöhnliche Volk verfaßt worden, für dieses sei sie aber – wegen der hier vermittelten heilsamen Ansichten (salutares opiniones) – höchst notwendig (TTP V, 95 und 93). Sofern man also die den biblischen Erzählungen innewohnende moralische Lehre nicht beherzige oder sein Leben bessere, sei die reine Kenntnis dieser Geschichten vollkommen zwecklos (vgl. TTP V, 95). Umgekehrt hält Spinoza es jedoch auch für möglich, daß ein Mensch, der die Bibel und ihre Geschichten nicht kenne (oder sie unbeachtet lasse) und nur kraft seiner eigenen Vernunft von Gott wisse, glückseliger als das Volk sei, da er außer den wahren Ansichten auch noch einen klaren und deutlichen Begriff (præter veras opiniones clarum insuper et distinctam … conceptum) habe (TTP V, 93). So fordere das göttliche Gesetz keineswegs den Glauben an die biblischen Geschichten, und diese könnten, für sich genommen, auch keine Erkenntnis Gottes und damit keine wahre Gottesliebe begründen (vgl. TTP IV, 72).
4.4 Wunderglaube als Kategorie beschränkter subjektiver Erkenntnisfähigkeit (Kapitel 6) Das sechste Kapitel des Theologisch-politischen Traktat, das der Bedeutung der biblischen Wundergeschichten sowie der (von Spinoza umgehend verneinten) Frage nachgeht, inwiefern sich diese gegen die Ordnung der Natur ereignen könnten, hat in der frühen Rezeption des Werkes die größten Kontroversen ausgelöst und dazu beigetragen, daß der Traktat bereits im Jahre 1674 in den Niederlanden verboten wurde. Spinoza stellt eingangs fest, daß sich nach seiner Überzeugung nichts gegen die ewige Ordnung der Natur und die Naturgesetze ereignen könne, daß Wundergeschichten deshalb auch keine genauere Erkenntnis vom Wesen Gottes ermöglichten und somit auch die Bibel, wenn sie von göttlichen Befehlen oder Absichten handle, nichts als die natürliche Ordnung bezeuge (vgl. TTP VI, 104 f.). Vom Begriff des Wunders bleibt bei Spinoza insofern wenig übrig. Damit stellte er sich nicht nur gegen die naive Volksfrömmigkeit, sondern auch gegen die zeitgenössischen Befürworter einer auf Kausalität beruhenden mechanistischen Naturwissenschaft, die, wie Pierre Bayle, Wunder als göttliche ad-hoc-Interventionen deuten oder, wie Leibniz, immerhin als göttlich vorherbestimmte Ereignisse, die die Kräfte der singulären
E R
geschaffenen Substanzen übersteigen könnten, im Rahmen der prästabilierten Harmonie nicht völlig ausschließen mochten. Für die naturwissenschaftlich denkenden Zeitgenossen Spinozas lag darin kein Widerspruch, denn in ihren Augen hatte Gott selbst die Grenzen des Möglichen und damit die Naturgesetze bestimmt (Nadler 2011, 81 f.). Spinozas eigener intellektueller Bezugspunkt zum Verständnis der Wunder reicht zurück in die Antike. So beschließt er das sechste Kapitel des Traktat mit einem Zitat aus Flavius Josephus’ Jüdischen Altertümern (II § 347 f.). Josephus hatte seine Leser bereits zum Ende des ersten nachchristlichen Jahrhunderts aufgefordert, das Wort „Wunder“ (miraculum) in den überlieferten Geschichten vom Exodus des jüdischen Volkes oder dem Kriegszug Alexanders der Großen gegen die Perser nicht zu wörtlich aufzufassen, sondern darin den subjektiven Blick des Erzählers, einen göttlichen Willensakt oder eben nur ein natürliches Ereignis zu erkennen. Damit wird das Wunder nicht als objektives Geschehen in der Natur, sondern als spezifische subjektive Wahrnehmungsweise und Interpretation eines Ereignisses aufgefaßt. Dieses Verständnis empfiehlt Spinoza auch im Umgang mit den biblischen Wundergeschichten: Es müsse jedem Menschen freistehen, die Geschichten selbst zu interpretieren, solange dieser Prozeß zu einem guten Weg der Verehrung Gottes anleite (vgl. TTP VI, 117). Im ersten Kapitel des Traktat hatte Spinoza die Prophetie im Sinne der Trennungsthese zu einer der Vernunft unzugänglichen, theologischen Problemstellung erklärt. Im Gegensatz dazu betrachtet er die Frage der Wunder als ein rein philosophisches Problem, denn diese Thematik gehört für ihn in den Bereich der Naturerkenntnis und nicht der Theologie. Insofern sieht er sich hier (anders als in Kap. 1) berechtigt, in der Beurteilung der Wunder unmittelbar auf die Grundlagen seines eigenen Vernunftbegriffes zu rekurrieren und die entsprechenden in der Bibel offenbarten Prinzipien dazu außer Acht zu lassen (vgl. TTP VI, 115 f.). Bereits 1663 hatte Spinoza sich in einem Frühwerk, den Cogitata Metaphisica, vorsichtig zu Wundern erklärt, hier aber nur Zweifel am außergewöhnlichen Ereignis in der Natur als einem Ausweis der Macht Gottes geäußert, da die feste und unveränderliche Ordnung der Natur doch ein viel größeres Wunder darstelle (Principia philosophiæ cartesianæ 1925, 267; Nadler 2011, 83). Wundererzählungen erfüllten in der traditionellen Theologie und Philosophie als Zeichen der göttlichen Vorsehung, als Botschaften oder Warnungen oder auch als Wahrheitsbeweis einer Prophezeiung einen festen Zweck. Weil
J-H W
sie wie die öffentlichen Zeremonien zugleich Ausdruck von Machtbeziehungen im sozialen Leben und in der religiösen Praxis darstellen, greift Spinoza diese Thematik im Traktat auf und spitzt seine ältere Aussage aus den Cogitata dahingehend zu, daß ein übernatürliches Wunder einen göttlichen Selbstwiderspruch darstellen müßte, da Gottes Weisheit ewige Notwendigkeit und Wahrheit einschließe (TTP VI, 117). Eine hier angelegte Homologie von Gott und Natur unter dem Begriff der einen Substanz, wie sie Spinoza später in der Ethik herleitet (E I, Lehrsatz 17, 42–44; E I, Lehrsatz 33, 68), muß im argumentativen Rahmen des Traktat dabei noch nicht zwingend vorausgesetzt werden (Nadler 2011, 89). Indem sich Spinozas Herleitung des Wunderbegriffs jedoch auch mit den oben angeführten traditionellen theologisch-politischen Zwecken der Wundererzählung auseinandersetzt, liefert seine essentialistische Definition zunächst nur eine paradox erscheinende Antinomie: Wunder (miracula) seien natürliche Dinge (res naturales) und sollten weder als etwas Neues noch als etwas der Natur Widerstreitendes erscheinen (neque nova … neque naturæ repugnantur videantur), sondern als etwas, das den natürlichen Dingen sehr nahekomme (ad res naturales maxime accedentia). Sie sind im Sinne dieser Definition also gar keine Wunder mehr (vgl. TTP VI, 117). So könne man von einem Wunder eigentlich nur noch bei einem tatsächlichen oder scheinbaren Versagen der menschlichen Fassungskraft (opus, quod hominum captum superat aut superare creditur) sprechen (vgl. TTP VI, 105). Daraus schließt Spinoza, daß der Tatbestand des „Wunders“ keine objektiv vorhandene empirische Realität beschreibt, sondern nur eine Deutungsfigur des beschränkten menschlichen Verstandes und der begrenzten menschlichen Ansichten. Seine Definition des Wunders bezieht sich deshalb nicht essentiell auf das Wunder selbst, sondern auf die menschliche Kognition und ihre spezifische Deutung natürlicher Vorgänge, deren Ursachen vom menschlichen Verstand aus verschiedenen Gründen nicht erkannt werden (vgl. TTP VI, 101). Somit ist es folgerichtig, daß Spinoza dem Wunder keinerlei Bedeutung für die Erkenntnis der Essenz und Existenz Gottes und der göttlichen Vorsehung einräumt (vgl. TTP VI, 102). Solche Erkenntnis könne sich, wie die Anmerkung zum Text erläutert, nur durch klare und deutliche, nicht aber durch verworrene Ideen einstellen: Notwendig sei es, einfache Begriffe mit jenen Begriffen, die sich auf die göttliche Natur beziehen, zu verknüpfen (vgl. TTP VI, 320 f.), da das Dasein Gottes eben nicht aus der Anschauung, sondern aus festen und uner-
E R
schütterlichen Begriffen erfaßt werde (vgl. TTP VI, 102 f.). Könnte eine andere Macht diese Begriffe verändern, müßten die Menschen an deren Wahrheit nämlich zu Recht zweifeln. Wenn also in der Natur irgendetwas mit der Macht der Natur im Widerstreit läge, so müsse man mit Fug und Recht auch an den ersten Begriffen und an der Möglichkeit verstandesgemäßer Erkenntnis überhaupt zweifeln – und damit auch an der Möglichkeit, zu einer sicheren Erkenntnis Gottes zu gelangen (vgl. TTP VI, 103). Da in der Erkenntnis der natürlichen Ordnung für Spinoza der Weg des einzelnen zu Gott besteht, müsse der Wunderglaube den Zweifel an Gott und damit (unter den Menschen, die sich in ihrer Suche nach Gott ihres Verstandes bedienen) auch den Atheismus befördern (vgl. TTP VI, 105). Insofern definiert Spinoza das Wunder als ein Werk, das sich nicht anhand eines ihm selbst inhärenten Charakteristikums oder einer Ursache, sondern nur anhand einer Eigenschaft des menschlichen Verstandes definieren lasse (miraculum ... opus esse, quod per causam explicari non potest). Da der menschliche Verstand aber nun einmal das von Spinoza bevorzugte Instrument menschlicher Erkenntnisgewinnung ist, folgt daraus, daß die Wahrnehmung eines Wunders gar keinen Erkenntnisgewinn mit sich führen könne (vgl. TTP VI, 103). Nur im Bereich der Volksfrömmigkeit werde ein Werk oder eine Handlung, deren Ursache man nicht erkenne, häufig als „göttlich“ attribuiert (TTP VI, 98), denn aus historischen Gründen gelange die Mehrzahl der Menschen nur dadurch zu einer besonderen Verehrung der Macht Gottes, daß ihnen infolge unerklärlicher Ereignisse die Macht der Natur als durch Gott unterworfen erscheint. So hätten die ersten Wundererzählungen der biblischen Hebräer dazu gedient, die Überlegenheit des monotheistischen Gottes gegenüber den Heiden und den von ihnen verehrten Naturgottheiten hervorzuheben: Die Hebräer würden durch die Herrschaft dieses Gottes, der den gewöhnlichen Gang der Naturereignisse durch seine Macht aus dem Tritt bringen könne, einen Vorteil genießen. Doch dies aus purer Unwissenheit zu behaupten und menschliche Interessen und göttliche Ratschlüsse in eins zu setzen, bezeichnet Spinoza als reine Anmaßung (vgl. TTP VI, 99). Parallel zu diesem Ansatz, die Motive der Wundergläubigkeit in ihrer anthropologisch-historischen Entwicklung zu verfolgen, muß sich Spinoza jedoch auch mit dem überlieferten Bibeltext selbst auseinandersetzen, ohne dabei den im Sinne der Trennungsthese des Traktat durch die Philosophie unhinterfragbaren
J-H W
Bereich der Theologie zu verletzen. Spinoza hält dabei an seiner ursprünglichen Definition fest, daß auch die Wundergeschichten in der Bibel allein als Werke aufgefaßt werden könnten, deren Verständnis die menschliche Fassungskraft übersteige oder zumindest im Glauben der biblischen Erzähler überstiegen habe (vgl. TTP VI, 105). Diese skeptische Lesart findet Spinoza sogar im 5. Buch Mose bestätigt: Hier fordert der biblische Erzähler, einen trügerischen Propheten, der zum Götzendienst aufrufe, dem Tode zu überantworten, selbst wenn dieser in den Augen des Volkes Wunder tue, denn damit teste der Gott der Israeliten nur die Treue seines Volkes (5. Mose 13, 2–4). Spinoza möchte hier keinerlei Dissonanz zwischen dem Wahrheitsgehalt des biblischen Textes und seinen eigenen epistemologischen Grundsätzen zulassen. So konstatiert er, daß in biblischen Wundererzählungen die Kenntnis gewisser „Nebenumstände“ (circumstantiæ) ein Wunder als natürliches Ereignis zu identifizieren helfen könne. Da viele biblische Erzählungen in einem besonderen poetischen Stil gehalten seien, fänden diese Nebenumstände allerdings oft keinerlei direkte Erwähnung (vgl. TTP VI, 109). Daß die Bibel die wahren Umstände der Wundergeschichten nicht unmittelbar lehre, liege daran, daß es schlichtweg nicht ihrem Zweck entspreche (vgl. TTP VI, 108). Der wahre Zweck der Bibel bestehe nämlich nicht darin, die natürlichen Ursachen der von ihr geschilderten Sachverhalte zu lehren, sondern bei ihren Adressaten Bewunderung und Verehrung auszulösen. Insofern seien Nebenumstände, etwa das Vorherrschen bestimmter Windverhältnisse, die beim Durchqueren des Roten Meeres das Zurückweichen des Wassers bewirkt haben müssen, im Lobgesang des jüdischen Volkes (2. Mose 15, 10) explizit erwähnt, zuvor in der Exodus-Erzählung (2. Mose 14, 27) aber weggelassen worden, um die Leser stärker zu beeindrucken (vgl. TTP VI, 110). Dies gelte aber auch für alle anderen Wundererzählungen, in denen beispielsweise eine direkte Wirksamkeit von erfüllten Bittgebeten nahegelegt werde. Hier spreche der biblische Erzähler sehr „uneigentlich“ (improprie) von den Ereignissen und von Gott, da der Zweck der biblischen Erzählung nicht darin bestehe, die Vernunft, sondern vielmehr die Fantasie und Vorstellungskraft ihrer Leser anzuregen und zu größerer Verehrung anzuhalten (vgl. TTP VI, 111). Wo die aufklärerischen Nebenumstände im Bibeltext vollständig fehlen, erklärt Spinoza daher die biblischen Schilderungen, etwa vom unmittelbaren Eingreifen Gottes, zu sprachlichen Tropen und substituiert sie umstandslos durch
E R
andere Wendungen. Dies betrifft etwa die in den Psalmen als „Wort Gottes“ beschriebene natürliche Wärme und Bewegung des Windes, durch welche Reif und Schnee schmelzen. Analog müsse man davon ausgehen, daß unter „Gottes Ratschluß, Geheiß, Spruch und Wort (Dei decretum, jussum, dictum et verbum) nichts anderes als das Wirken und die Ordnung der Natur selbst zu verstehen sei“ (TTP VI, 109). Insbesondere Christen bereite die Ausdrucksweise der hebräischen Sprache ein Verständnisproblem, das Wundertatbestände in der Übersetzung aufscheinen lasse, wo sie sich weder zugetragen hätten, noch vom biblischen Erzähler gemeint gewesen seien. Spinoza nennt hier als Beispiel Jesaja 48, wo den Juden verkündet wird, daß sie auf dem Rückweg aus dem babylonischen Exil nach Jerusalem keinen Durst leiden würden: et non sitiverunt, per deserta eos duxit, aquam ex petra iis instillare fecit, petram rupit, et fluxerunt aquæ. Hier dürfe der hebräische Urtext niemals wörtlich genommen werden, in dem Sinne, daß Gott den Fels brechen und aus ihm Wasser hervorf ließen lassen werde – es solle damit nur ausgesagt werden, daß die Juden in der Wüste Quellen finden würden (vgl. TTP VI, 114 f.). Wie wichtig für Spinoza die Frage der adäquaten philologischen Analyse und Übersetzung des biblischen Hebräisch war, zeigt sich neben den zahlreichen Belegstellen im Traktat auch in seinem unvollendet geblieben Compendium grammatices linguæ hebrææ (Cassuto 1999, 5–31). Nicht zuletzt spiegle der biblische Text jedoch auch das geistige Fassungsvermögen und die Denkweise seiner Autoren in ihrer jeweiligen Zeit wider. So plädiert Spinoza auch für eine Historisierung des Wunderbegriffes: Für Ereignisse, die in der Bibel unerklärlich erscheinen, könne die zeitgenössische Naturwissenschaft bereits oft eine Erklärung liefern (vgl. TTP VI, 102). Spinoza zufolge müsse man also, um die biblischen Wunder zu verstehen und aus den Darstellungen ihren wirklichen Verlauf zu ermitteln, auch die Ansichten (opiniones) der Urheber des biblischen Textes kennen und diese von ihren sinnlichen Wahrnehmungen (sensus) unterscheiden (vgl. TTP VI, 113). Sonst bestehe die Gefahr, daß von biblischen Erzählern imaginierte Ereignisse mit realen Ereignissen verwechselt würden. Dabei bezieht sich Spinoza etwa auf die Gotteserscheinung am Berg Sinai, die bei vernunftgemäßer Betrachtung nicht auf ein reales Ereignis, sondern nur auf die Affektionen, die das Vorstellungsvermögen durch die äußeren Sinne erfährt, zurückgeführt werden könne. Insofern müßten solche biblischen Schilderungen von Philosophen nicht als real anerkannt werden (non debent ut reales
J-H W
a philosophis accipi), wenn sie vernünftigen Maßstäben widersprächen (vgl. TTP VI, 113 f.). Wenn sich wirklich einmal etwas im biblischen Text finde, das den Naturgesetzen eklatant widerspreche, so empfiehlt Spinoza als letzte Möglichkeit zu erwägen, ob die entsprechende Passage womöglich nachträglich durch Frevlerhände (a sacrilegis hominibus) in den heiligen Text eingefügt worden sei (vgl. TTP VI, 111). Insgesamt, so sein Fazit, verhelfe gründliches Nachdenken aber dazu, daß man in der Bibel kaum etwas finde, das geradezu im Widerspruch zur Vernunft stehe (vgl. TTP VI, 115). Die konsequente Enttarnung aller Wundertatbestände hat jedoch zur Konsequenz, daß auch Spinoza in Tropen spricht, wenn er den semantisch von ihm selbst letztlich bis zur Unkenntlichkeit entleerten Signifikanten in seiner eigenen Sprache weiterverwenden möchte: So warnt er etwa vor der Gefahr, die Ansichten und Urteile derer, die über ein Wunder berichten, mit dem „Wunder selbst, wie es sich tatsächlich zugetragen“ habe (cum ipso miraculo, prout revera contigit), zu verwechseln (TTP VI, 113). An anderer Stelle betont er, daß die Kenntnis der hebräischen Sprache ein besseres Verständnis der Wunder, wie sie sich wirklich zugetragen hätten (miracula, ut realiter contigerint), ermögliche (TTP VI, 114). Vielleicht ist diese uneigentliche Redeweise Spinozas ein rhetorisches Spiel mit seinen Lesern, denn das „Wunder“ bleibt bei ihm immer, selbst wenn es eine naturgemäße Weise gibt, auf die sich ein dahinter liegendes Ereignis in Wirklichkeit zugetragen haben mag, ein Nicht-Ereignis, das nur durch die inadäquate Anschauung derer definiert ist, die dieses Wort verwenden. Denn das Wort „Wunder“ kann im Sinne des Traktat nur in Beziehung auf die jeweiligen Ansichten der Menschen (und ihre Vorstellungskraft) verstanden werden (nomen miraculi non nisi respective ad hominum opiniones posse intellegi) und bedeutet nichts anderes als ein Werk, dessen natürliche Ursache wir nach dem Beispiel eines anderen gewohnten Dinges nicht erklären können oder das wenigstens derjenige nicht erklären kann, der von einem Wunder schreibt oder spricht (vgl. TTP VI, 101). Das gedankliche Experiment, zu dem Spinoza seine Leser in den Kapiteln 4–6 des Traktat einlädt, besteht in einem geistigen und emotionalen Perspektivenwechsel: Anders als bei den meisten Propheten der Bibel, bei denen große Unklarheit hinsichtlich der Frage bestehe, wie die Ordnung der Natur mit ihrem jeweiligen Begriff von Gottes Vorsehung in Einklang zu bringen sei, dürften die Philosophen, die die Dinge nicht aus Wundern, sondern aus klaren Begriffen zu
E R
erkennen trachten und das wahre Glück in der Tugend und in der Seelenruhe erkennen, niemals dem Wunsch nachgeben, der Natur ihren eigenen Willen aufzuzwingen, sondern umgekehrt der Natur zu gehorchen (nec student, ut natura iis, sed contra, ut ipsi naturæ pareant). Denn Gottes Vorsehung, wie sie in den Naturgesetzen erscheine, sei nicht auf die alleinigen Bedürfnisse der menschlichen Gattung hin zugeschnitten, sondern trage der Natur im Ganzen Rechnung (Deum non solius humani generis, sed totius naturæ rationem habere – vgl. 106 f.; ebenso: TTP XVI, 238–241). Damit reiht sich der Theologisch-politische Traktat in die geistesgeschichtliche Wende ein, die im frühneuzeitlichen Europa die menschliche Selbstverortung aus den kognitiven und affektiven Beschränkungen eines kosmologischen Anthropozentrismus herauszuführen begann. Dies ist letztlich die über den Traktat hinausweisende Zielrichtung der Religionskritik Spinozas: daß die Perspektive auf Gott und auf die kognitiven und rituellen Gewohnheiten, die dieses Verhältnis in der sozialen Praxis bestimmen (Respekt für das göttliche Gesetz, öffentliche religiöse Zeremonien und Handlungen sowie der Wunderglaube), sich von ihrem affektbasierten wie kognitiv beschränkenden Anthropozentrismus löst, um diejenigen Menschen, die aufgrund ihres höher gestimmten Erkenntnisvermögens dazu berufen sein mögen, zu Seelenruhe und Glückseligkeit zu führen.
Literatur Cassuto, P. 1999: Spinoza hébraïsant. L’hébreu dans le „Tractatus theologico-politicus“ et le „Compendium grammatices linguæ hebrææ“, Paris/Louvain. González Diéguez, G. 2013: Zero Degree of Interpretation? Spinoza and the Literal Meaning of Scripture in the Jewish Exegetical Tradition, in: A. Bento/J. A. Silva Rosa (Hrsg.), Revisiting Spinoza’s Theological-Political Treatise, Hildesheim/Zürich/New York, 73–97. Greenfield, I. 2006/5767, Preface, in: I. Drazin/S. A. Wagner (Hrsg.), Onkelos on the Torah, Jerusalem, xv–xvi. Maimonides, M. 2009, Wegweiser für die Verwirrten. Eine Textauswahl zur Schöpfungsfrage, arab./ hebr./dt., Freiburg im Breisgau. Nadler, S. 2011: A Book Forged in Hell: Spinoza’s Scandalous Treatise and the Birth of the Secular Age, Princeton. Rutherford, D. 2010: Spinoza’s Conception of Law: Metaphysics and Ethics, in: Y. Y. Melamed (Hrsg.), Spinoza’s Theological-Political Treatise. A Critical Guide, Cambridge. Strauss, L. 1988: Prosecution and the Art of Writing, Chicago/London. Yovel, Y. 1994: Das Abenteuer der Immanenz, Göttingen.
5 Theo Verbeek
Spinoza und die Auslegung der Bibel (Kapitel 7)
Die Methode, die von Spinoza im siebten Kapitel vorgetragen wird, ist, wenigstens auf einer verbalen Ebene, mit der der reformierten Hermeneutik identisch. Revolutionär ist daher nicht die Methode als solche, sondern ihre spezifische Anwendung in den Kapiteln 8–11. Das siebte Kapitel des Theologisch-politischen Traktat untergliedert sich in drei Teile: 1) die Vorstellung der Methode (TTP VII, 119–130); 2) die Kritik daran, wie diese Methode gewöhnlich verwendet wird (VII, 130–138); 3) eine Besprechung von Einwänden und Alternativen (VII, 138–144). Wie gewöhnlich wird das Argument darüber hinaus in mehreren Kapiteln entfaltet, insbesondere in den Kapiteln 13–15.
5.1 Die „Methode“ Kapitel 7 beginnt mit einem Angriff auf die Theologie und die Theologen, der zeigt, daß die Auslegung der Heiligen Schrift von Spinoza gar nicht positiv bewertet wird, egal ob sie vom Volke oder von Theologen gepf legt wird. Die ersten seien nur darauf aus, „die anderen unter dem Vorwand der Religion zu nötigen, mit ihnen einer Meinung zu sein“, während letztere meistens einzig darauf bedacht seien, „die eigenen Erfindungen und Einfälle [sua figmenta et placita] möglichst gut aus den Heiligen Büchern herauszupressen und mit Hilfe der göttlichen Autorität unanfechtbar [zu] machen“ (TTP VII, 119). Für das Volk stände
T V
die Bibelauslegung also im Dienste eines sozialen Konformismus; für die Theologen sei sie ein Mittel, um ihre Macht und Autorität zu stärken. Dies würde letztlich erklären, warum sie „die Schrift mit blindem und unbesonnenem Eifer ... interpretieren und Neues in die Religion“ (ebd.) hineinbringen – eine Aussage, die als Kritik der Reformation gelesen werden kann. Die Auslegung der Schrift führe zu Streitigkeiten und Auseinandersetzungen, sei daher politisch und sozial eine große Gefahr. Es könnte deshalb Spinozas Absicht gewesen sein, die willkürliche Bibelauslegung wie sie vom Volk und von den Theologen gepf legt wird, durch eine wissenschaftlichere zu ersetzen. Im 14. Kapitel aber, das mit demselben Thema beginnt, wird klar, daß sein eigentliches Problem nicht die Willkür ist, sondern Macht und Autorität. Was Spinoza den Theologen vorwirft, ist nicht, daß „sie die Worte der Schrift ... den eigenen Meinungen anpassen“, sondern „daß sie eben diese Freiheit anderen nicht zugestehen wollen“. Im Gegenteil solle jeder die Schrift auf eigene Weise auslegen, so lange er „in Dingen der Gerechtigkeit und Nächstenliebe Gott mit größerer Bereitwilligkeit ... gehorchen“ kann (TTP XIV, 216 f.). Folglich ist es nicht sehr wahrscheinlich, daß Spinoza sich im siebten Kapitel um die Einführung einer neuen Methode kümmert – jeder möge seine eigene Methode haben. Viel wahrscheinlicher ist, daß es ihm darum geht, den Begriff eines „Richters“ oder einer „Norm“ der Bibelauslegung und damit den Begriff der Autorität in theologischen Angelegenheiten zurückzuweisen – eine solche „Norm“ und letztendlich eine maßgebende Theologie wären unerlaubt und vielleicht unmöglich. Die Idee, daß es einen „Richter“ oder eine „Norm“ der Schriftauslegung gibt, war Allgemeingut der Calvinistischen Theologie, die den Entgleisungen der Täufer und anderer „Enthusiasten“ gegenüber in vielerlei Hinsicht eine neue Art von Disziplinierung einzuführen versuchte. Die Hauptpunkte der Calvinistischen Hermeneutik sind folgende: 1) die Bibel soll „aus ihr selbst“ verstanden werden; 2) nur die, die von Gottes Gnade erfüllt sind, können den wahren Sinn der Schrift verstehen; 3) der „Richter“ oder die „Norm“ aller Bibelauslegung aber ist die Kirche, und in der Kirche deren „Lehrer und Propheten“. Mit seiner Kritik der Vormachtstellung der Theologen verwirft Spinoza also die Idee, daß es eine Norm oder einen Richter geben soll. Keine Auslegung der Bibel wäre somit privilegiert, selbst dann nicht, wenn sie von Gelehrten unterstützt würde.
S A B
Spinozas Präsentation der Methode der Bibelauslegung beginnt mit einem rätselhaften Vergleich. Rätselhaft deshalb, weil er auf die Trennung von Philosophie und Theologie, die als eine der Hauptthesen des Traktat angesehen werden kann, zu verzichten scheint. Die Methode der Schriftauslegung (interpretatio scripturae) solle dieselbe sein wie die Methode der Naturauslegung (interpretatio naturae): „In der Tat, wie die Methode der Naturinterpretation hauptsächlich darin besteht, eine Geschichte der Natur zusammenzustellen, aus der wir, wie aus sicheren Daten, die Definitionen der natürlichen Dinge erschließen, so ist es auch für die Interpretation der Schrift nötig, sich ihre unverfälschte Geschichte zu erarbeiten und aus ihr als sicheren Daten und Prinzipien in richtiger Folgerung den Geist der Verfasser der Schrift zu erschließen.“ (TTP VII, 120 f.) Der Ausdruck interpretatio naturae wurde von Francis Bacon (1561–1626) geprägt, um damit anzudeuten, daß die Erkenntnis der Natur nicht von vorgefaßten Meinungen und Urteilen, sondern von den Dingen selbst abzuleiten sei. Damit unterschied sich seine Methode von der üblichen: „Die Auffassung, deren man sich gewöhnlich bezüglich der Natur bedient, pf lege ich zur Unterscheidung die Antizipation der Natur zu nennen (da es ein unbesonnenes und voreiliges Verfahren ist); jenen Weg aber, der in gebührender Weise von den Dingen her bestimmt wird, die Interpretation der Natur“ (Neues Organon I, aph. 26). Der Sinn des von Spinoza gemachten Vergleichs wäre also, daß wir, wenn wir die Schrift auslegen, nicht „antizipierend“, sondern „interpretierend“ verfahren sollen, das heißt, daß wir die Schrift aus ihr selbst heraus verstehen. Das war, wie wir schon gesehen haben, auch ein wichtiges Axiom der reformierten Hermeneutik. Aber Bacon glaubt auch, daß die Grundlage einer Interpretation der Natur eine Geschichte der Natur sei: „Hätten die Menschen eine gediegene Geschichte der Natur und der Erfahrung vorliegen und machten sich mit ihr eifrig vertraut und könnten sie sich zu zweierlei aufraffen – einmal, den überkommenen Meinungen und Begriffen zu entsagen, sodann den Geist von den allgemeinsten und ihnen am nächsten liegenden Grundsätzen zur Zeit noch fernzuhalten –, dann könnte es geschehen, daß sie aus eigener und redlicher Kraft des Geistes, ohne fremde Anleitung, auf meine Art der Interpretation stoßen“ (Neues Organon, I aph. 130). Dieses Programm (Interpretation statt Antizipation, und dies auf der Grundlage einer „Geschichte“) wird von Spinoza umgearbeitet zu einer Regel: „Die generelle Regel der Schriftinterpretation ist also, der Schrift nichts als ihre Lehre zuzuschreiben, was wir nicht im Lichte ihrer Geschichte, soweit es mög-
T V
lich ist, untersucht hätten“ (VII, 122). Diese Regel läßt sich in drei spezifischere Regeln zergliedern: 1) die Geschichte soll „auf die Natur und die Eigentümlichkeiten der Sprache eingehen, in der die Bücher der Schrift geschrieben sind und in der ihre Verfasser gewöhnlich sprachen“ (ebd.); 2) sie soll gerichtet sein auf das Sammeln aller in der Bibel angetroffenen Meinungen zu jedem Thema: Die Geschichte „muß die Aussagen jedes Buches zusammenstellen und nach Hauptpunkten ordnen, um so alles, was von demselben Gegenstand handelt, schnell zur Hand zu haben“ (VII, 123) – ein Verfahren, das die Definitionen ergeben soll, die zuvor gefordert wurden; 3) die Geschichte soll sich mit den historischen Umständen im weitesten Sinne befassen: nicht nur die Umstände, unter denen die Bücher geschrieben wurden (das Leben und die Persönlichkeit der Propheten, die Geschichte des Jüdischen Volkes), sondern auch damit, wie und von wem sie überliefert wurden (vgl. TTP VII, 124 f.). Dies zeigt schon, daß sich Spinoza mit seinem eigentümlichen Vergleich zwischen Bibelauslegung und Naturerklärung einer doppelten Unklarheit bedient. Die erste ist die implizit angenommene Identität von Philosophie und Theologie, die nur zu rechtfertigen wäre, wenn beide das gleiche Ziel hätten, nämlich die Erkenntnis der Wahrheit – was für die Theologen allerdings nicht in Frage kommt, von Spinoza aber der Theologie abgesprochen wird: seines Erachtens ist die Erkenntnis der Wahrheit der Philosophie vorbehalten. Die zweite ist die Mehrdeutigkeit des Wortes Geschichte. Einerseits handelt es sich um ein genaues und vorurteilsfreies Studium des Textes (ein Verfahren, das etwa mit der Naturgeschichte Bacons verglichen werden kann), andererseits um die Erkenntnis der historischen Umstände, unter denen der Text zustande gekommen ist, und um die Geschichte der Überlieferung (ein Verfahren, das nur mit der Naturgeschichte Bacons verbunden werden kann, wenn man die Bibel als einen historischen Gegenstand betrachtet). Geschichte umfaßt bei Spinoza immer Text und Kontext. Verglichen mit den zeitgenössischen Methoden der Bibelauslegung, enthält die von Spinoza vorgestellte Methode an sich nicht viel Neues. Sie hat im Gegenteil eine große Ähnlichkeit mit dem in der Protestantischen Hermeneutik üblichen Verfahren, insbesondere mit der Methode Calvins (1509–1564). Calvin zufolge ist die erste Aufgabe des Interpreten, „den Gedanken des Schriftstellers“ zu rekonstruieren und herauszufinden, was im Geiste Moses, Davids, Jeremias, Matthäus und Paulus vor sich ging. Eine umfassende Kenntnis der biblischen
S A B
Sprachen ist also unentbehrlich. Dann soll er die „Umstände“ (circumstantiae) genau erforschen und alle kulturellen, psychologischen, geographischen, zeremoniellen und institutionellen Einzelheiten gründlich studieren und diese zu einer „Geschichte“ (historia) zusammenfügen. Beide, die philologische Kenntnis der Sprache und die historische Kenntnis der Umstände, seien die notwendigen Vorbedingungen für das Verstehen des sogenannten „primären Sinnes“ (sensus prior), der aber vom geistigen Sinn streng unterschieden wird. Den geistigen Sinn versteht nämlich nur der von Gottes Gnade erleuchtete Gläubige. Obwohl die Schriftsteller (Moses, David usw.) ihre je eigene Persönlichkeit und ihren Stil haben, sind sie nur „sichere und beglaubigte Schreiber [amanuenses, notaires] des Heiligen Geistes“ (Calvin 1955, 787). Gelehrtheit und Wissenschaft können also niemals den Glauben ersetzen. Obgleich im 17. Jahrhundert dieses Modell zunehmend unter Druck geriet, wurde es immer noch ernst genommen. Jeder reformierte Theologe war zugleich Philologe und Historiker; jeder Prediger „Hirt“ und „Lehrer“. Dessen ungeachtet hielt man aber der Katholischen Theologie gegenüber auch am Prinzip fest, daß die Bibel absolut „klar“ sei, und daß sie „aus ihr selbst heraus“ verstanden werden soll – ein Ausdruck, der einem auch bei Spinoza begegnet. Heißt das, daß Spinoza ein Krypto-Calvinist ist? Natürlich nicht, und das nicht nur, weil er ausdrücklich die Lehre verwirft, daß für die Auslegung der Schrift „übernatürliche Erleuchtung“ erforderlich wäre (siehe unten). Viel wichtiger ist die Tatsache, daß er auch andere Voraussetzungen der Calvinistischen Hermeneutik explizit zurückweist. Die wichtigsten sind wohl: 1) die Idee, daß die Schrift eine geistige Einheit sei – Spinoza zufolge sind die Propheten und Jünger nicht nur Schreiber, sondern richtige Autoren, deren Psychologie den Inhalt, und nicht nur den Stil ihrer Texte erklärt (TTP I–II); 2) der Gedanke, daß die Bibel die Wahrheit und nur die Wahrheit enthält – Spinoza zufolge dreht sich die Auslegung der Schrift nur um die Bedeutung der Texte. Für die reformierten Theologen hingegen hingen gerade diese Voraussetzungen eng zusammen, weil nur sie die Anwendung des Prinzips der absoluten Klarheit der Schrift ermöglichten. Dieses Prinzip wurde folgendermaßen ausgelegt: 1) in wesentlichen Punkten ist der biblische Text vollkommen klar; 2) augenscheinlich unklare Texte können durch einen Vergleich mit den klaren Texten restlos erläutert werden. Was soll man aber unter „Klarheit“ verstehen? Diese Frage wurde in Hinsicht auf das Axiom, daß die Schrift die Wahrheit und nur die Wahrheit enthält,
T V
beantwortet. Zum Beispiel wäre die Aussage, daß „der H, dein Gott, ... ein verzehrendes Feuer und ein eifriger Gott“ ist (Deut 4, 24), einzig deshalb unklar, weil Gott kein Feuer sein kann. Der Text soll also mit Hilfe anderer Texte „erklärt“ werden, namentlich mit solchen, in denen auf klare Weise ausgesagt wird, daß Gott nichts Körperliches hat. Daß der Text keine Unwahrheit enthalten kann, ist also die erste Voraussetzung der Hermeneutik; daß alle Texte der Bibel denselben Autor haben die zweite. Beide waren für die Calvinisten gleich wesentlich. Spinozas erstes Argument ist demnach, daß, wenn die Bibel aus ihr selbst heraus verstanden werden soll, das Verfahren der Theologen ihre eigenen Grundsätze durchbricht. Unerwarteterweise räumt Spinoza dennoch ein, daß die Schrift eine gewisse Einheit hat. Diese Einheit aber, die nur mit Hilfe einer eigentümlichen „Historie“ festgestellt werden könnte, betreffe die moralische Lehre der Schrift. Erneut beruft sich Spinoza implizit auf Bacon, aber nicht ohne dessen Lehre erheblich zu modifizieren. Spinoza zufolge wäre es das Ziel einer „Historie“, zu Begriffsbestimmungen und Definitionen zu kommen (VII, 120 f.). Das ist, will sich Spinoza hier auf Bacon beziehen, genaugenommen falsch. Bacon ist nämlich gar nicht an Definitionen interessiert, die auch nur aus Worten bestehen und folglich nur andere Worte erzeugen, und die seines Erachtens charakteristisch sind für die Philosophien von Aristoteles und Platon (Neues Organon I, aph. 59, 63, 105). Weiterhin meint Spinoza, daß die erste Aufgabe der Naturforschung die Feststellung allgemeiner Begriffe ist, woraus dann weniger allgemeine Begriffe abgeleitet werden sollen, während das Baconsche Verfahren auf das genaue Gegenteil abzielt. Es scheint eher so, als habe Spinoza Descartes und Hobbes, nicht Bacon vor Augen. In einem längeren Text (vgl. TTP VII 125 f.) aber verbindet er diese Methode mit der der Schriftauslegung. Das Resultat der „Geschichte“ der Schrift wäre „das höchst Allgemeine ..., was die Basis und Grundlage der ganzen Schrift ist, und schließlich, was in ihr von allen Propheten als ewige und allen Sterblichen gleichermaßen zuträgliche Lehre empfohlen wird, zum Beispiel daß ein einziger und allmächtiger Gott existiert, der allein anzubeten ist, der für alle Sorge trägt und vornehmlich diejenigen liebt, die ihn anbeten und ihren Nächsten lieben wie sich selbst usw.“ (VII, 126). „Allgemein“ hieße also: „was von jedem einzelnen Autor unterschrieben wird.“ Diese allgemeine Lehre wäre überdies identisch mit Spinozas eigener allgemeiner Glaubenslehre. In einer zweiten Phase sol-
S A B
len davon dann die „anderen Punkte“ abgeleitet werden, welche die „übliche Lebensführung betreffen“ (ebd.). Falls sich Widersprüche mit der allgemeinen Lehre ergeben, „ist zu berücksichtigen, aus welchem Anlaß, zu welcher Zeit und für wen die diesbezüglichen Passagen geschrieben wurden“ (ebd.). Das ist in mehreren Hinsichten merkwürdig. Nicht nur weil Spinoza mehr als einmal behauptet, daß die Schrift keine Einheit ist, sondern auch weil seine eigene „allgemeine Glaubenslehre“ nur dazu dient, uns zum Gehorsam zu motivieren. Im allgemeinen Glauben wird also die moralische Lehre vorausgesetzt – ja, die moralische Lehre dient sogar dazu, die Interpretation des Glaubens zu steuern. Es kann also keine Rede davon sein, daß man mit Hilfe der allgemeinen Lehre entweder moralische Unklarheiten erklärt oder Widersprüche zwischen moralischen Geboten auf löst.
5.2 Die Unbrauchbarkeit der Methode Die vielleicht wichtigste Tatsache ist, daß Spinoza im siebten Kapitel nicht nur eine Methode der Interpretation vorstellt, sondern zugleich ihre Untauglichkeit im Falle der Schrift mit Nachdruck hervorhebt. Wie gesagt, besteht die von Spinoza geforderte „Geschichte“ oder „Historie“ aus drei Elementen: 1) Lektüre der Schrift aus sich selbst; 2) Kenntnis der biblischen Sprachen; 3) Kenntnis der Umstände und der psychologischen und historischen Hintergründe. Wir sahen schon, wie es um das erste dieser Elemente steht. Das einzige, allerdings problematische, Ergebnis dieser Lektüre wäre einerseits ein „allgemeiner Glaube“, andererseits eine moralische Lehre. Im mittleren Teil des Kapitels aber bemüht sich Spinoza zu zeigen, daß die beiden anderen Teile der Geschichte, insoweit sie die Heilige Schrift betreffen, nicht realisiert werden können, aus Mangel an adäquaten Daten. Zuerst behauptet Spinoza, daß unsere Kenntnis der biblischen Sprachen nicht zureichend ist, weil die alten hebräischen Sprachkundigen nichts hinterlassen haben, „kein Wörterbuch, keine Grammatik, keine Stilkunde“ (VII, 130). In einem längeren Passus (VII, 130–137) erörtert Spinoza ausführlich einige Schwierigkeiten der Hebräischen Sprache und die vielen Doppeldeutigkeiten, die aus ihr entspringen. Diese machen es unmöglich, „eine Methode zu finden, gestützt auf die sich der wahre Sinn aller Aussagen der Bibel mit Sicherheit ermitteln ließe“
T V
(VII, 131). Hinzu kommt der Umstand, daß es auch noch Bücher gibt, die nicht in der ursprünglichen Sprache überliefert wurden, wie etwa das Evangelium nach Matthäus, der Hebräerbrief, und vielleicht auch das Buch Hiob (VII, 136). Die benötigten philologischen Kenntnisse sind also entweder gar nicht vorhanden oder nicht zureichend. Das zweite Element der vorgestellten Methode war die Geschichte im eigentlichen Sinne, das heißt die Kenntnis der Umstände im weitesten Sinne des Wortes. Von dieser behauptet Spinoza ebenfalls, daß sie unmöglich zu erlangen sei (vgl. TTP VII, 134). Auch diesen Teil der Geschichte müssen wir also entbehren. Zwar wird in den Kapiteln 8–10 dieser Mangel an Informationen neu bewertet, um die Autorität der Schrift zu reduzieren. Hier aber wird er herangezogen, um die Unmöglichkeit der Auslegung darzutun. Demnach wäre die Kenntnis der Umstände nur dann erforderlich, wenn der zu interpretierende Text wesenhaft unklar ist, das heißt, wenn er „unglaubliche oder unbegreif liche Dinge enthält oder in dunklen Ausdrücken geschrieben ist“ (VII, 134). Es gäbe also Texte, die ohne irgendeine Vorbereitung oder Geschichte interpretiert werden könnten. Philosophische oder wissenschaftliche Texte zum Beispiel können verstanden werden ohne jede Kenntnis des Kontextes. Folglich würden auch die biblischen Texte ohne „Geschichte“ verstanden werden können, vorausgesetzt sie handeln von begreif lichen Sachen: „Dinge, die ihrer Natur nach leicht begriffen werden, können niemals so dunkel ausgedrückt werden, daß sie sich nicht leicht verstehen ließen“ (VII, 136). Umso mehr ein Text Verstandesbegriffen Ausdruck gibt, desto leichter ist es, ihn zu interpretieren. So leicht, daß der Leser gar keine „Geschichte“ braucht, um ihn restlos zu verstehen. Umso mehr dagegen ein Verfasser von seiner Einbildungskraft geleitet wird, desto notwendiger bedarf der Leser einer „Geschichte.“ Für die Auslegung der Schrift aber ist dies ein verhängnisvolles Ergebnis, da Spinoza im ersten und zweiten Kapitel ausführlich gezeigt hat, daß bei fast allen Propheten die Einbildungskraft im Vergleich zum Verstand überentwickelt war. In einer wahrscheinlich authentischen Anmerkung wird dieses Ergebnis aber in dem Sinne ein wenig beschönigt, daß nicht nur die Lehrsätze des Euklid „ehe sie noch bewiesen sind, von einem jedem begriffen“ werden, sondern auch die „Erzählungen von künftigen wie vergangenen Ereignissen, die das, was für Menschen glaubhaft ist, nicht überschreiten“, wie auch Gesetze, Satzungen und ethische Lehren, „begreif lich und klar“ [perceptibiles] sein können, selbst wenn „sie sich nicht mathematisch beweisen lassen“
S A B
(VII, 136 Fn.). Die Heilige Schrift wäre demnach entweder „begreif lich und klar“ insoweit sie Aussagen enthält, die, obwohl sie in der Schrift nie bewiesen werden, doch vom Verstand bewiesen werden könnten, oder insoweit sie die Geschichte des jüdischen Volkes erzählt und eine moralische Lehre enthält. Mit Wahrheit soll das alles natürlich nichts zu tun haben: eine Geschichte kann klar und begreif lich sein und dennoch von Anfang bis Ende erfunden. Wundererzählungen zum Beispiel sind Spinoza zufolge ganz falsch; aber er sagt niemals, daß sie „dunkel“ oder „unklar“ sind. Auch ein Gebot ist meistens klar und begreif lich, selbst wenn es nicht richtig ist: „Du sollst stehlen und töten“ ist nicht weniger klar als „Du sollst nicht stehlen“ und „Du sollst nicht töten.“1 Jedenfalls bedeutet dies, daß es für die professionelle Theologie keine Rolle mehr gibt, denn entweder ist ein biblischer Text grundsätzlich unklar (und in einem solchen Falle könnten wir ihn nur verstehen und interpretieren mittels einer Geschichte, die es nicht gibt), oder ist er völlig klar (und in diesem Falle wird er auch ohne jede Gelehrtheit verstanden). Folglich gäbe es für die von den Theologen, das heißt von der Kirche als Lehranstalt beanspruchte Autorität, gar keinen Grund. Aber die Methode der Theologen wäre auch auf einer noch grundlegenderen Ebene gänzlich verfehlt und kontradiktorisch. Was Spinoza grundsätzlich in Frage stellt, ist die Möglichkeit eines systematischen Vergleichs „klarer“ und „dunkler“ Stellen, der es letztendlich ermöglichen soll, die ganze Schrift, und nicht nur die an sich klaren Stellen, völlig zu verstehen. Ein solcher Vergleich war wesentlich für die orthodoxe Calvinistische Theologie, weil nur auf diese Weise am Dogma der absoluten Klarheit der Schrift, namentlich gegen die Auffassung der Römisch-Katholischen Theologie, aber auch gegen die Arminianer, festgehalten werden konnte. Nach Spinoza ist diese Methode aus mehreren Gründen ungeeignet. Der erste bezieht sich auf das Prinzip als solches. Wir sahen schon, daß es für seine Anwendung wesentlich ist, anzunehmen, daß die Schrift die Wahrheit enthält und nichts als die Wahrheit – das war ja der Grund dafür, daß man einen Passus wie „der H, dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer und ein eifriger Gott“ (Deut 4, 24) „dunkel“ findet. Für Spinoza aber, der dasselbe Beispiel zitiert, gibt es hier gar nichts Dunkles, sondern nur Falsches: „Moses’ Aussagen Gott ist ein Feuer; Gott ist eifersüchtig sind äußerst klar, solange wir nur 1 Im Gegenteil, ein moralisch richtiges Gebot oder ein Gesetz muß fast immer „interpretiert“ werden – es gibt ja Fälle, in denen es nicht nachgelebt werden kann. Diese Folgerung wird allerdings von Spinoza vermieden.
T V
auf die Wortbedeutung achten; deshalb zähle ich sie zu den klaren Aussagen, mögen sie auch unter dem Aspekt von Wahrheit und Vernunft völlig dunkel sein“ (VII, 123). Der zweite Grund ist die Tatsache, daß die Bibel nicht ein einzelnes Buch ist; daß sie von mehreren Autoren geschrieben wurde; daß wir gar keine Sicherheit darüber haben, ob diese Autoren dieselben Ansichten hatten; und daß die meisten Propheten nicht die Absicht hatten, die Aussagen anderer Propheten auszulegen oder zu kommentieren: „Ein Vergleichen der Reden kann in der Tat nur zufällig Licht in eine Rede bringen, weil ja kein Prophet in der Absicht geschrieben hat, die eigenen Ausdrücke oder die eines anderen Propheten seiner Leserschaft zu erklären; dann aber auch, weil wir die Gedanken eines Propheten, Apostels usw. nicht aus den Gedanken eines anderen erschließen können, es sei denn, ... in Dingen der Lebensführung, unmöglich aber wenn sie spekulative Fragen behandeln oder von Wundern und geschichtlichen Ereignissen erzählen“ (VII, 134). Ein dritter Grund schließlich wird nicht im siebten sondern im 15. Kapitel erörtert. Dort heißt es nämlich, daß, wenn man es mit zwei Textstellen zu tun hat und der offenbare Sinn dieser Stellen widersprüchlich ist, man nicht wissen kann, welche von beiden als „Auslegung“ der anderen gelten kann (vgl. TTP XV, 230 f.). Wenn alle Stellen der Bibel die gleiche Autorität haben, dann ist es nicht möglich, die eine der anderen vorzuziehen. Die theologische Methode wäre also völlig verfehlt. Sie kann weder den Sinn der Schrift feststellen, noch den Theologen Autorität geben.
5.3 Einwände und Alternativen In der zweiten Hälfte des Kapitels bemüht sich Spinoza die von ihm „abweichenden Positionen zu erörtern“ (VII, 138), und unter diesen namentlich die des Maimonides (1135–1204). Maimonides glaube „nämlich, jede Stelle der Schrift lasse einen unterschiedlichen, ja sogar gegensätzlichen Sinn zu, und wir seien des wahren Sinnes einer jeden erst gewiß, wenn wir wüßten, daß diese Stelle, so wie wir sie interpretieren, nichts enthält, was mit der Vernunft nicht übereinstimmte oder ihr widerspräche. Zeigte sich, daß ihr buchstäblicher Sinn der Vernunft widerspricht, müßte diese Stelle, meint er, wie klar sie auch sein mag, anders interpretiert werden“ (VII, 139). Um dies zu erläutern, führt Spinoza ein lan-
S A B
ges Zitat aus dem Führer der Unschlüssigen an, in welchem Maimonides ausführt, warum er die biblischen Texte über die Schöpfung der Welt nicht auf dieselbe Weise, nämlich metaphorisch, erklärt wie solche, in denen von Gott wie von einem körperlichen Wesen geredet wird. Er gibt dafür zwei Gründe an: 1) für die Unkörperlichkeit Gottes, so Maimondes, gäbe es klare Beweise, während die Ewigkeit der Welt nicht bewiesen sei; 2) der Glaube, daß Gott unkörperlich sei, widerstreite nicht dem Gesetz, während der Glaube an die Ewigkeit der Welt das Gesetz zerstöre (VII, 139 f.). An sich verschafft dieser Text eine gute Einsicht in die Grenzen der Maimonideischen Auslegungspraxis: 1) im Falle eines Widerspruchs zwischen einer Textstelle und einer philosophisch bewiesenen Wahrheit soll erstere so erklärt werden, daß es nicht länger einen Widerspruch gibt; 2) keine Auslegung der Schrift soll die Autorität des Gesetzes untergraben. Also soll man die Stellen, in denen von der Schöpfung der Welt geredet wird, nicht bildlich auslegen. Einerseits, weil es nicht endgültig bewiesen sei, daß die Welt ewig ist, andererseits, weil der Glaube an eine ewige Welt die Autorität des Gesetzes untergrabe. Das heißt aber, daß Spinoza die von Maimonides vertretene Position neu und konditional formuliert: Wenn bewiesen wäre, die Welt sei ewig, dann hätte Maimonides alle solche Stellen bildlich auslegen müssen. Er folgert daraus, daß Maimonides „über den wahren Sinn der Schrift … im Ungewissen [bliebe], solange er an der Wahrheit der Sache noch zweifeln kann“ (VII, 140). Diese Folgerung ist aber nur unter gewissen Bedingungen richtig. Die Voraussetzung der Maimonideischen Methode ist eine zweifache: 1) es kann nur eine Wahrheit geben; 2) die Schrift enthält die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Ein Widerspruch zwischen der Wahrheit, wie sie von der Philosophie bewiesen wird, und dem wahren Sinn einer biblischen Aussage könne es also überhaupt nicht geben. Wenn sich aber keine philosophische Wahrheit finden läßt, der der Text der Bibel zu widersprechen scheint, so lehrt Maimonides, dann soll der biblische Text durchaus wörtlich verstanden werden. Der Sinn einer einzelnen Textstelle würde also nur dann unsicher bleiben, wenn die Philosophie fortwährend neue Wahrheiten endgültig beweisen würde. Wahrscheinlich hielt Maimonides das aber für unmöglich. In diesem Sinne ist die Darstellung, die Spinoza von Maimonides’ Methode gibt, historisch nicht korrekt. Das läßt vermuten, daß Spinozas Verhältnis zu Maimonides kaum eindeutig ist, und sei es nur, weil Spinoza an anderen Stellen gewisse biblische Texte gar nicht buchstäblich auslegt, zum Beispiel mit Bezug auf den Sündenfall, wo er zwar zugibt,
T V
daß in der Schrift von einem göttlichen Gebot geredet wird, dies aber aus der Tatsache erklärt, daß Adam kein Philosoph oder Mediziner war – in einem solchen Falle hätte er wohl verstanden, daß es nicht zu der Natur Gottes gehöre, gebieten zu können, er folglich nicht unter einem Gebot stand, und daß sein „Fall“ entsprechend keine Strafe war, sondern vielmehr die unvermeidliche und durchaus natürliche Folge seines eigenen Handelns (TTP IV, 74). Das aber ist eine Auslegung ganz im Sinne des Maimonides. Es kommt also darauf an, den genauen Punkt zu bestimmen, an dem die Auslegungsverfahren von Spinoza und Maimonides divergieren. Die von Spinoza gegen Maimonides angeführten drei Argumente bieten dazu einiges Material: 1) wenn Maimonides recht hat, dann wäre die Bedeutung einer jeden Stelle der Bibel grundsätzlich unsicher, denn „solange die Wahrheit einer Sache nicht feststeht, wissen wir nicht, ob die Sache mit der Vernunft übereinstimmt oder nicht, und folglich wissen wir auch nicht, ob der buchstäbliche Sinn wahr oder falsch ist“; 2) „nahezu alles, was sich in der Schrift findet, läßt sich nicht aus Prinzipien herleiten, die dank des natürlichen Lichts bekannt sind, wie wir schon gezeigt haben; von seiner Wahrheit können wir uns somit nicht kraft des natürlichen Lichts überzeugen und folglich auch nicht von dem wahren Sinn und dem Geist der Schrift, sondern benötigten wir hierfür unausweichlich irgendein anderes Licht“; 3) „das einfache Volk, das in der Regel von Beweisen nichts versteht oder keine Zeit hat, sich ihnen zu widmen, [könnte] Zugang zur Schrift allein unter der Autorität und Beglaubigung derer haben ..., die philosophieren, und [müßte] folglich annehmen ..., die Philosophen könnten sich im Feld der Schriftinterpretation nicht irren“ (VII, 140). Was das erste Argument angeht, ist das Wesentliche schon gesagt worden, ausgenommen, daß, was dort als die authentische Position des Maimonides vorgestellt wurde, hier als Erwiderung gegen ihn aufgefaßt wird. Jedenfalls würde das Argument nur dann zutreffen, wenn entweder die Philosophie immer neue Wahrheiten entdeckt, oder es grundsätzlich unmöglich ist, zwischen vernünftigen und die Vernunft transzendierenden Wahrheiten zu unterscheiden. Diesen Unterschied trifft Spinoza nicht, und in der Tat kann er ihn auch gar nicht machen. Daher scheint es, daß Spinoza nur sagen wollte, bei der Auslegung der Schrift sei die Frage nach ihrer Wahrheit, und folglich nach dem Verhältnis der in ihr gefundenen Wahrheit zu der von der Philosophie gelehrten, überhaupt nicht zu stellen, oder aber, daß die Wahrheit für die Auslegung kein Leitprinzip sein kann. Der einzige Weg,
S A B
um eine dunkle Stelle zu erklären, wäre mit Hilfe der „Geschichte“, das heißt mit der Kenntnis der Umstände. Hier, wo es, statt dem Maimonides zugeschrieben zu werden, gegen ihn benützt wird, hat das Argument eine zugespitzte Bedeutung: Da Spinoza selber eine ganze Reihe neuer Wahrheiten lehrte, namentlich auch, die Welt sei ewig, könnte das Argument bedeuten, daß die Auslegung der Schrift nicht der neuen Philosophie angepaßt werden dürfe. Das zweite Argument ist komplizierter, nicht nur weil es mit Spinozas eigener Behauptung im Widerspruch zu stehen scheint, daß die wesentlichen, das heißt die moralischen Lehren der Schrift gleichwohl von „gemeinen Prinzipien“ abgeleitet werden können. Auch hatte er vor einigen Seiten die Position derjenigen, die glauben, man brauche, um die Schrift zu verstehen, übernatürliche Erleuchtung, als unbegreif lich zurückgewiesen: „Wenn sie nun behaupten, das natürliche Licht reiche für diese Aufgabe nicht aus, ist das eindeutig falsch“ (VII, 138). Das gegen Maimonides angeführte Argument scheint damit völlig widersprüchlich zu sein. Eine Lösung wäre vielleicht, daß es sich um ein argumentum ad hominem handelt: wenn man annimmt, es gäbe eine die Vernunft transzendierende Wahrheit, zu der man nur durch die Schrift Zugang habe, dann darf man nicht neben der Schrift die Vernunft als Autorität aufführen. Anders gesagt: alle Autorität wäre entweder bei der Schrift oder bei der Vernunft. Damit wäre die Auslegung des Prinzips der absoluten Klarheit der Schrift, wie sie die reformierten Kirchen vertreten (wo, wie gesagt, ein gewisser Begriff der Wahrheit vorausgesetzt wird), widerlegt. Mit dem dritten Argument sind wir zurück bei dem eigentlichen Thema dieses Hauptstücks, nämlich daß keine besondere Auslegung Autorität haben soll, was wohl bedeutet, daß die Auslegung der Schrift nicht einer professionellen Klasse anvertraut werden soll. Damit wäre die Auslegung der Schrift die Sache jedes einzelnen Gläubigen, unter der Bedingung, daß die praktischen Folgen, die er aus seiner Auslegung zieht, nicht gesetzwidrig seien. Das Argument hätte also auch die allgemeinere Bedeutung, daß, trotz der Tatsache, daß Philosophen auch im praktischen (politischen und moralischen) Sinne die Wahrheit mit Gewißheit erkennen (was nach Spinoza der Fall ist), sie dennoch in der Gesellschaft keine spezifische Autorität haben sollen; im Staat soll alle Autorität im Souverän konzentriert oder von ihm abgeleitet werden – ein Thema, das in bezug auf die Religion im 19. Kapitel weiter ausgeführt wird.
T V
Es soll nicht unerwähnt bleiben, daß es einige Diskussionen gegeben hat über die Frage, ob der von Spinoza angeführte „Maimonides“ der historische Maimonides sein soll, oder ob der Name für einen zeitgenössischen Theologen stehen solle. Namentlich hat man dabei an einen der Freunde Spinozas gedacht, nämlich Lodewijk Meijer (1629–1681). Wäre dies richtig, dann sollte man die im Tractatus geführte Diskussion als Zeichen einer Meinungsverschiedenheit, vielleicht sogar eines Bruchs mit dem ehemaligen Freund auffassen. Dies kann aber nur teilweise zutreffen, nicht zuletzt deshalb, weil Meijer in seiner Arbeit durchaus ironisch zu verfahren scheint und namentlich darauf abzielt, die Absurdität der Cartesianischen Theologie aufzuweisen (s. Verbeek 2005). Überdies sahen wir schon, daß sogar Spinozas eigene Position, insofern ja auch er Texte metaphorisch auslegt, eine gewisse Verwandtschaft mit der des Maimonides besitzt. Und endlich schreibt Spinoza in Kapitel 13, das in mancher Hinsicht das logische Gegenstück des siebten Kapitels ist, „den meisten Theologen“ eine Auslegungsweise zu, die mit der des historischen Maimonides identisch ist: „Trotzdem haben die Theologen gemeinhin [communes tamen theologi] behauptet, man müsse alles, was sie kraft des natürlichen Lichts als unvereinbar mit der göttlichen Natur ausgeben konnten, metaphorisch interpretieren und alles, was ihrer Fassungskraft entging, buchstäblich nehmen“ – und auch dort folgert er, daß man bei einem solchen Verfahren voraussetzen muß, daß „die Schrift nicht für das gemeine Volk, d. h. die Ungebildeten, geschrieben [sei], sondern nur für sehr gebildete Leute, vor allem also für die Philosophen“ (TTP XIII, 214). Demnach steht „Maimonides“ nicht für eine spezifische Theologie, sondern für fast alle Theologen insofern sie annehmen, daß, erstens, die Schrift die Wahrheit enthält und nichts als die Wahrheit und, zweitens, daß nur insoweit die Schrift auch von natürlichen Wahrheiten spricht, philosophische Begriffe ihre Auslegung mitbestimmen. Allerdings gingen darin die Cartesianischen Theologen weiter als die meisten anderen, indem sie alles, was in der Schrift über die Natur im Allgemeinen gelehrt wird, als nicht zum Sinn der Schrift gehörend betrachteten. Wenn man aber, wie Spinoza, die Wahrheitsfrage als irrelevant zur Auslegung der Schrift betrachtet, dann gibt es zwischen Theologie und Philosophie überhaupt keine Verbindung, außer diejenige, daß die Theologie, als ein spezifisches Produkt der Einbildungskraft, und die Theologen, als eine besondere soziale Klasse, Gegenstand der Philosophie sein können und gemessen an ihrem Einf luß auf das Handeln, sogar sein müssen.
S A B
5.4 Schluß Wie gesagt, zieht sich das Argument des siebten Kapitels über mehrere Kapitel hin, und es ist unmöglich, die Problematik der Schriftauslegung von den anderen von Spinoza gestellten Fragen zu isolieren. Zuerst sollte man unterscheiden zwischen dem, was Spinoza in diesem Kapitel tut, nämlich zu zeigen, daß sich der Sinn der Schrift mit der theologischen Methode nicht bestimmen läßt, und dem, was er in den anderen Kapiteln tut – namentlich wenn er in den Kapiteln 8–10 die von ihm im siebten Kapitel als untauglich verworfene Methode anwendet, um die Autorität der Schrift zu untergraben. Die erste Hauptfolgerung aber ist, daß die von Theologen beanspruchte Autorität auf nichts gegründet sei. Ihre Methode, wenn sie auch prinzipiell „wissenschaftlich“ ist (was an sich von Spinoza nicht bestritten wird), wäre für die Erreichung der von ihnen selbst gesetzten Ziele untauglich, weil die für die Anwendung ihrer Methode wesentlichen Informationen entweder widersprüchlich oder gar nicht vorhanden seien. Dieselbe Tatsache aber ermöglicht es Spinoza, in den Kapiteln 8–10 die Autorität der Schrift als solche in Frage zu stellen – alles, was man historisch und philologisch in bezug auf die Schrift und die Autorität der Schrift annimmt, ist unsicher; folglich könne die Schrift nicht zur Sicherung der Wahrheit verwendet werden. Umgekehrt, und das ist die zweite, jetzt implizitere Folgerung, soll jedermann frei sein, die Schrift auf seine eigene Weise auszulegen, freilich unter der Bedingung, daß jede Auslegung den Gehorsam gegen das Gesetz stärken soll. Eine Norm der Auslegung gäbe es demnach nicht, es sei denn, der weltliche Gesetzgeber gäbe sie vor – ein Problem, das Spinoza im 19. Kapitel diskutieren wird. Spinozas nächste Folgerung wäre dann, daß in Sachen der Schriftauslegung die Wahrheitsfrage eine ganze Reihe von Schwierigkeiten verursacht, die nicht nur die Auslegung als solche, sondern auch die Philosophie und das öffentliche Leben belasten. Also soll man die Schriftauslegung, wie alle Vorstellungen der Gläubigen, nicht auf ihre Wahrheit, sondern auf ihren Motivationswert hin beurteilen. Die einzige Frage wäre, ob diese oder jene Auslegung zum besseren Gehorsam führe. Folglich soll die Auslegung der Schrift nur auf das moralische Handeln gerichtet sein, dessen Grenzen vom Souverän bestimmt werden. Ist dagegen die Auslegung der Schrift auf die Feststellung rein spekulativer Wahrheiten gerichtet, dann wären Bürgerkrieg und Aufstand kaum zu vermeiden. Ein Gedanke,
T V
der vor dem Hintergrund der politischen Geschehnisse des 17. Jahrhunderts allererst seine volle Bedeutung erhalten sollte.
Literatur Bacon, F. 1990: Neues Organon, lat.-dt., Teilband 1, hrsg. u. eingel. v. W. Krohn, Hamburg. Calvin, J. 1955: Unterricht in der christlichen Religion, übers. u. bearb. v. O. Weber, Neukirchen. Verbeek, Th. 2005: Probleme der Bibelinterpretation: Clauberg, Meyer und Spinoza, in: J. Schönert/F. Vollhardt (Hrsg.), Geschichte der Hermeneutik und die Methodik der textinterpretierenden Disziplinen, Berlin, 187–201.
6 Edwin Curley
Spinoza’s Biblical Scholarship (Chapter 8–10)
6.1 The Issues Historians of philosophy, analyzing Spinoza’s contribution to biblical scholarship, have often focused on his denial that Moses was the author of the Pentateuch. This is understandable, but unfortunate. In the 12th century Maimonides had made it a fundamental principle of Judaism that the Pentateuch came to us from God through Moses, „who acted like a secretary taking dictation.“ To deny this, he thought, was to be either an atheist or a heretic of the worst kind (Twersky 1972, 420 f.). By the 17th century, when doubt about this proposition was growing, Spinoza could still write that almost everyone believed Moses to be the author of the Pentateuch (TTP VIII, 146).1 Even today conservative Christians still defend the Mosaic authorship, as part of their war against critical biblical scholarship. Though the issue is undoubtedly important, Spinoza was not the first to deny the Mosaic authorship, and preoccupation with this issue has led historians to devote much energy to finding precursors, sometimes seeming to deny Spinoza any claim to originality as a biblical scholar. Not only did this deprive Spinoza of credit which was his due, it also distracted us from more important questions: if Moses was not the author of the Pentateuch, who was? What about the other 1 Page references to the TTP are given to the German edition in Wolfgang Bartuschat’s translation. Translations of citations and paraphrases are my own.
E C
books of the Bible? Does Spinoza challenge traditional views about their authorship also? On what grounds? More fundamentally: why do modern biblical scholars often regard Spinoza as a seminal figure in the history of their discipline, and credit him with setting biblical criticism on a productive, properly scientific course? And most important: what do his inquiries imply about the truth of the religions which hold these texts to be sacred?
6.2 The Question of Mosaic Authorship Before taking up these questions, though, we must discuss the authorship of the Pentateuch. Spinoza did, of course, have precursors in denying that Moses wrote it. Some problems about the traditional theory were too obvious to escape notice. The last eight verses of Deuteronomy describe Moses’s death. So the Talmud, a major source for the traditional view, says only that Moses wrote everything in the Pentateuch except those last few verses, which it assigns to Joshua instead (Talmud, Baba Bathra 15a). Luther adopted a variant of this view, ascribing the entire final chapter to either Joshua or Eleazar (Luther 1960, 310). These are quite conservative solutions, which attribute only a small portion of the text to another author, and attribute that portion to an author roughly contemporary with Moses, who might have been an eyewitness to many of the events reported, and could at least have heard accounts of them directly from Moses himself. Popkin, who wrote extensively on Spinoza’s biblical scholarship, had no trouble showing that in Spinoza’s day many Christian commentators accepted such conservative solutions and did not think they presented any problem for believers (Popkin 1996, 388). But conservative solutions don’t work. One of Spinoza’s contributions to this discipline was to show that in a way most subsequent scholars found conclusive (cf. ABD 1992, VI, 618 f.). Immediately after reporting the death of Moses, Deuteronomy describes his burial, commenting that „no one knows his burial place to this day.“ (Deut 34, 6) Four verses later it eulogizes him, saying: „Never since has there arisen a prophet in Israel like Moses.“ This language clearly implies an author writing long after Moses’s death. To assign it to a contemporary is anachronistic. Clues like this don’t occur only in the last chapter of the Pentateuch; they’re scattered throughout the text in a way which defies any simple theory
S’ B S
of its composition. For example, in Gen 12, 6, the author, describing Abraham’s passage through Canaan, writes: „the Canaanite was then in the land.“ Whoever wrote that verse was evidently writing when the Canaanites were not in the land. But that could not be Moses or any contemporary, like Joshua. In their days the Canaanites were in the land. Those are problems of anachronism; there are also problems of point of view. Often „Moses“ speaks of himself in the first person (Deut 2, 2, „Then the L said to me ...“); but he also often speaks of himself in the third person (Num 12, 3, „Moses was very humble, more so than anyone else on ... earth.“) If Moses was the author, why does he go back and forth between the first person and the third? And how could a truly humble man say that he’s the humblest man on earth? Yet on the theory of Mosaic authorship, that’s precisely what Moses did.
6.3 Precursors Popkin’s favorite candidate for a precursor who anticipated Spinoza’s arguments was Isaac La Peyrère, a 17th century French Millenarian best known for claiming that there were men before Adam. Though Spinoza must have read La Peyrère, and though La Peyrère did question Moses’s authorship of the Pentateuch on some of the same grounds Spinoza did, it’s doubtful that he had any significant inf luence on Spinoza. La Peyrère lacked what Spinoza thought was one essential qualification for serious Old Testament scholarship: a knowledge of the language in which the Hebrew Bible was written. And his arguments against the Mosaic authorship were much more limited than Spinoza’s. Spinoza himself credits the 12th century Jewish commentator Ibn Ezra with having noted many of the problems about the supposed Mosaic authorship (TTP VIII, 146). But Ibn Ezra only hinted at the problems. Spinoza thinks that’s because he realized Moses couldn’t have written the Pentateuch, but didn’t dare say so openly. (This would not be surprising, if Maimonides correctly reported 12th century views about the essentials of Judaism.) Ibn Ezra’s style is allusive; modern scholars still debate what he thought about the problems he raised. A recent translator writes that he „no doubt wanted to make his novel approach to the Pentateuch obscure to the uninformed and unintelligent,“ but that he was not „an anti-traditionalist in disguise,“ or „a forerunner of modern biblical cri-
E C
ticism“ (Ibn Ezra 1988, I, xv, xx). But Spinoza clearly read Ibn Ezra as an „antitraditionalist“. And the use he makes of him at the beginning of chapter 8 – spelling out the problems Ibn Ezra had raised in a veiled way, giving him credit for being the first to call attention to these problems, and adding numerous examples of his own – shows that Spinoza himself regarded Ibn Ezra as his true precursor. If we think Spinoza’s doubts about Scripture must have begun long before his excommunication in 1656, probably as early as his teens (Wolf 1927, 42), long before he could have had any contact with La Peyrère, it would be hard to find a better candidate. This was Gebhardt’s view (Gebhardt 1987, 228–235). By mid-17th century Spinoza had precursors who were offering quite radical solutions, and who were open about this. In Leviathan Hobbes came as close to Spinoza as anyone, arguing that whoever wrote the account of Moses’s burial must have been writing „long after the death of Moses,“ pointing out that the anachronisms are not only in the last chapter of Deuteronomy, noting the references in the Pentateuch to earlier works, now lost, and contending that only a relatively small part of the Pentateuch can reasonably be ascribed to Moses, the „Volume of the Law“ set out in Deut 11–27 (Hobbes 1994, 252 f.). La Peyrère, by contrast, seems to have thought that Moses wrote most of the Pentateuch. He has no doubt, for example, that Moses gave an accurate account of the exodus from Egypt and of the laws delivered at Mt. Sinai. On these matters Spinoza seems unlikely to have been inf luenced by Hobbes either. Leviathan was not published in a language he could read until 1667, by which time the excommunication was long past, and he’d been at work on the Tractatus for two years. Moreover, Spinoza makes a much stronger case for these conclusions than Hobbes had. One way he does this is by offering many more examples of anachronism. The numbers matter, because the more anachronisms there are, the harder it is to devise conservative hypotheses to explain them. He also raises problems Hobbes had not mentioned, like the problem of point of view. (La Peyrère did not mention this either.) But he reaches roughly the same conclusion about how much of the Pentateuch Moses actually wrote: mainly „the book of the second covenant,“ which he identifies with Deut 11–26, but also the song attributed to Moses in Deut 32 (TTP VIII, 150–53). That makes Moses’s contribution to the Pentateuch a rather small part of the whole, much less than the high percentage conservative commentators insisted on.
S’ B S
6.4 The Ezran Hypothesis The most significant point on which Hobbes and Spinoza agree is that the Hebrew Bible, in the form in which it has come down to us, is largely the work of Ezra, a priest in the post-exilic period. The hypothesis that Ezra did much to shape the Hebrew Bible had been around for a long time. There’s a wonderfully informative account of this history in Malcolm 2002. Both Hobbes and Spinoza embrace it, though in different forms, and on quite different grounds. La Peyrère does not mention it. For Hobbes the Ezran hypothesis is simply the thesis that the entire Hebrew Bible, in its final form, was „set forth“ by Ezra (Hobbes 1994, 255 f.). He bases this on a passage in 2 Esdras in which the author, who presents himself as the post-exilic priest Ezra, petitions God to enable him to restore the scriptures, which are supposed to have been lost. This „Ezra“ claims to have said to God: „Your law has been burned, and no one knows the things which have been done or will be done by you. If I have found favor with you, send the holy spirit into me, and I will write everything that has happened in the world from the beginning, the things that were written in your law, so that people may be able to find the path ...“ (2 Esdras 14, 21 f.). 2 Esdras is an odd text, and not a very credible one. Modern scholarship holds that it was written after the destruction of the Second Temple in 70 CE, several centuries after the death of the historical Ezra (ABD 1992, VI, 612). If that’s correct, the historical Ezra could not have been the author of 2 Esdras. Hence the scare quotes around „Ezra“, in referring to the author of this work. In the passage cited „Ezra“ reports that God granted his request, and that for forty days and forty nights, without stopping for food, drink, or rest, he dictated the scriptures to five amanuenses. The amanuenses got to stop for nourishment and sleep. This process yielded ninety-four books, of which twenty-four were to be published and seventy reserved for restricted circulation „among the wise.“ It’s hard to believe that Hobbes actually expects us to accept this tale. It assumes that we have our present Hebrew Bible only because of a miracle. All extant manuscripts of the Hebrew Bible must derive from copies made by Ezra’s amanuenses, dictated by Ezra under divine inspiration, in a superhuman feat of endurance. Elsewhere in Leviathan Hobbes is skeptical about miracles, cautioning us that we’re too easily deceived by false stories of miracles (Hobbes 1994,
E C
298–300). In this context he invites a more specific skepticism by reminding us that 2 Esdras does not have the sanction of „the church“, which classifies that book as apocryphal, not canonical. Hobbes explains that what this means is that though the church does not think 2 Esdras has a well-grounded claim to inspired authorship, and so does not expect members of the church to accept what it says, it does think 2 Esdras is „profitable ... for our instruction.“ As Malcolm has shown, Hobbes’s theory of Ezra’s authorship of the Hebrew Bible became a common feature of skeptical attacks on religion in the Enlightenment. Spinoza’s version of the Ezran hypothesis (TTP VIII, 155–58) is more limited, and based on an argument modern scholars might more easily regard as a serious contribution to their discipline. First, he doesn’t claim that it holds for every book in the Hebrew Bible. He applies it only to the series of books beginning with the Pentateuch and extending through the next several books, to the end of 2 Kings, a sequence which purports to tell the history of the people of Israel from the creation down to the Babylonian Captivity. I follow Freedman 1994 in calling this sequence of texts „the Primary History“ of the people of Israel. It’s unclear how many books we should include in this Primary History. Spinoza thinks of himself as having argued for Ezra’s authorship of twelve books (TTP VIII, 158; IX, 160). He gets to that number by including the five books of the Pentateuch, Joshua, Judges, Ruth, 1 and 2 Samuel, and 1 and 2 Kings. But it’s doubtful that he’s entitled to include Ruth. He never really discusses its authorship, and it doesn’t fit the pattern of the books he does discuss. Freedman doesn’t count Ruth as part of his Primary History. So I’ll count eleven books in the sequence, recognizing that Spinoza would say „twelve“. None of these books, Spinoza argues, could have been written by the author to whom tradition ascribed it. „Tradition“ here means the account given in Tractate Baba Bathra of the Babylonian Talmud, 14b–15b. So not only did Moses not write the Pentateuch, Joshua did not write Joshua, Samuel did not write either the book of Judges or the books bearing his name, and Jeremiah did not write the books of Kings. In each case the reasons for denying these traditional ascriptions are similar to those we’ve already discussed, though Spinoza deals with them much more brief ly. All these books were „written“, he thinks, by Ezra. What’s the evidence for Ezra’s authorship? And what does „written“ mean here? Spinoza’s argument is essentially a literary one. First, if we pay careful attention to the way these books
S’ B S
are written, we’ll see that they had a single author, trying to tell a coherent story, the history of the Jews, beginning with their origin in the creation and ending with the first destruction of Jerusalem and their captivity in Babylon (TTP VIII, 155 f.). One sign of this is the way the books are linked together. As soon as the author has stopped narrating the life of Moses, he passes to the history of Joshua, using these words: „And it came to pass, after Moses, the servant of God, died, that God said to Joshua ...“ (Jos 1, 1). Similar transitional formulas are used to tie the other books together. What’s more, the author evidently wants to tell his story in chronological order. And most crucially, there’s a common theme to the narrative: the history of the Jewish people is the history of God’s providential dealings with them. Moses promulgated laws, and made certain predictions about what God would do for (or to) the Jews, depending on whether or not they obeyed his laws. If they obeyed, he would see that they f lourished. If they disobeyed, they would be punished. The subsequent history of the Jewish people is the story of how these predictions were fulfilled. When the Jews were obedient, they prospered. When they were disobedient, they did not. The author ignores things which don’t contribute to his case for that perspective, or refers us to other historians for an account of them (TTP VIII, 156). The failure of Ruth to contribute to this narrative is one reason for doubting that that book really belongs in the group Spinoza ascribes to Ezra. So far we have an argument for a single author. But why Ezra? First, since the author carries the story into the period of the Babylonian Captivity – the last event the Primary History mentions is Jehoiachin’s release from prison in the thirty-seventh year of the exile – if there was only one author, it can’t be anyone earlier than that period (TTP VIII, 156). Spinoza is apparently mistaken about Ezra’s dates, taking him to have f lourished in the time right after the return from Babylon, in the second half of the 6th century BCE (TTP X, 175). Modern scholarship makes Ezra a contemporary of Artaxerxes I, who reigned in the mid5th century (ABD 1992, II, 726 f.). But whatever Ezra’s dates were, the singleauthor theory, combined with the scope of the history recorded in these books, limits the candidates for its author to people who lived in the time of the captivity or later. Second, Scripture describes Ezra as someone who zealously studied God’s law, became skilled in it, honored it, and tried to teach it to the people of his time, amplifying it with explanations, to make it more intelligible to them. (Esr 7, 1–10;
E C
Neh 8, 1–8.) Spinoza can cite canonical scripture in favor of these propositions. He does not need to appeal to the Apocrypha. Given his caustic dismissal of 2 Esdras (also known as 4 Ezra) as containing „legends added by some trif ler“ (TTP X, 182), it seems unlikely that he would have wanted to. Furthermore, scripture does not mention anyone else in the post-exilic period who possessed all these qualifications: a zealous student of the law, who tried to explain it to the people, amplifying it as necessary. Spinoza does not advance his claim about Ezra’s authorship of these books as something we can be certain of. He says he will assume that Ezra was their author „until someone establishes another writer with greater certainty“ (TTP IX, 159). But if Ezra was not the author, Spinoza’s arguments seem at least to make it probable that the author was someone like Ezra, particularly as regards the relatively late date at which he was writing. Perhaps that’s enough for us to know.
6.5 What Ezra is Supposed to Have Done What does Spinoza mean when he says that Ezra was the writer of these books? So far I’ve used the words „author“ and „writer“ as if they were synonyms. But Spinoza makes a distinction between the Latin terms I translate this way. When he’s discussing Moses, he frames the question the way the literature typically does, as when he writes that „no one has any basis for saying that Moses was the author [autor] of the Pentateuch“ and that it’s completely contrary to reason to say that (TTP VIII, 152). But when he’s advancing his hypothesis about Ezra, he uses the term scriptor: Ezra was the writer of those books (e. g. at TTP IX, 159). I take it that Spinoza uses autor to refer to someone who is the originator of a work, whereas scriptor is a more general term, which might refer to a work’s originator, but might also refer to its editor. Spinoza really thinks of Ezra’s role as more akin to that of an editor than to that of an author in the strict sense. He did not just make up the stories he told, as some polemicists against Judaism and Christianity inferred from 2 Esdras (Malcolm 2002, 400–402). He had at his disposal manuscripts of the works of earlier historians, works now lost, which he collected and organized as best he could, sometimes adding material of his own to explain things which needed explanation and to make the overall story more coherent (TTP VIII, 158; IX, 159).
S’ B S
It was not news that the writers of our present scriptures knew, and used, the works of earlier historians now lost. Our present scriptures sometimes mention these works, as when 1 Kings refers us to the Book of the Annals of the Kings of Judah for information about the life of Rehoboam, which the author of Kings chooses not to get into (1 Kings 14, 29). In Leviathan Hobbes had noted this (Hobbes 1994, 254). So does La Peyrère. But neither Hobbes nor La Peyrère used this datum the way Spinoza does, to give us insight into the way Ezra worked when he constructed the Primary History. Given Hobbes’s at least nominal acceptance of 2 Esdras, he could hardly have presented Ezra as having edited previously existing materials. La Peyrère never says anything about the Ezran hypothesis. Spinoza does not give Ezra high marks as an editor. In chapter 9 of the Tractatus he writes that Ezra „did not put the narratives contained in these books in final form, and did not do anything but collect the narratives from different writers, sometimes just copying them, and that he left them to posterity without having examined or ordered them“ (TTP IX, 159). What’s most interesting about this passage is that in supporting his criticism of Ezra, Spinoza is led to discuss numerous passages in which the Hebrew Bible, as it has come down to us, contains inconsistencies. He takes this as evidence that however much Ezra may have wanted to tell a coherent story, he couldn’t do so. Spinoza speculates that this was because he did not live long enough to complete the daunting project he had embarked on.
6.6 Doublets One important kind of evidence for this theory involves what modern scholars call „doublets“, i. e., repetitions of similar passages, which differ in ways scholars take to show that the passages in which they occur originated in different sources (Speiser 1964, xxxi–xxxiii). As an example Spinoza offers the different versions of David’s entry into Saul’s court in 1 Samuel (TTP IX, 162). In one version David went to Saul because Saul had called him, on the advice of his servants, when he wanted a skillful musician to play the lyre for him (1 Sam 16, 17–21). In the other the initiator of the events was David’s father, Jesse, who sent David to attend his brothers, soldiers in Saul’s camp; David became known to Saul only when he
E C
asked questions which suggested a willingness to fight Goliath; he was taken into the court as a result of his victory in that battle. In the first story David is said to be a warrior, a man of valor. In the second, he’s just a boy, who has no experience in battle (1 Sam 17, 17–8, 31–3, 38–9, 18, 1–2). Inconsistencies of this sort occur, Spinoza says, because the editor has collected stories from different historians, „piling them up indiscriminately, so that afterwards they might be more easily examined and reduced to order“ (TTP IX, 161 f.). Sometimes the „doublets“ get a different treatment. Notoriously, there are two different versions of the Decalogue. This fact evidently made an early and deep impression on Spinoza. He first brings the issue up in the 1st chapter, where he writes: „In the opinion of certain Jews, God did not utter the words of the Decalogue. They think, rather, that the Israelites only heard a sound, which did not utter any words, and that while this sound lasted, they perceived the Laws of the Decalogue with a pure mind. At one time I too was inclined to think this, because I saw that the words of the Decalogue in Exodus are not the same as those of the Decalogue in Deuteronomy. Since God spoke only once, it seems to follow from this [variation] that the Decalogue does not intend to teach God’s very words, but only their meaning.“ (TTP I, 17 f.) Spinoza does not say here what the differences between the two versions were, and proceeds to give reasons for rejecting his earlier opinion. But the problem had apparently bothered him long before he began to write the Tractatus. It’s also a problem one of his rabbis, Manasseh ben Israel, had discussed in a work Spinoza must have read, his Conciliator. More of that later. Spinoza returns to the Decalogue at the end of chapter 8 (TTP VIII, 158), where he enumerates three differences between the two versions. In Deut 5, 21 the tenth commandment orders the prohibitions differently, commanding the Israelites first not to covet their neighbor’s wife, and only then not to covet his house and other possessions, altering the order of Ex 20, 17. This at least shows that we’re not dealing in these passages with a stenographic transcript of God’s words. More significant, though, are the differences concerning the commandment to keep the sabbath. In Deuteronomy, not only is this commandment stated more fully, with more emphasis on the application to slaves, but the fundamental reason for observing the sabbath is different: not because it was on the seventh day that God rested after creating the world (as in Ex 20, 8–11), but to comme-
S’ B S
morate God’s bringing his people out of bondage in the land of Egypt (Deut 5, 12–15). Spinoza does not explain these differences as he had those in the story of David and Saul. He does not present them as arising simply because Ezra reproduced different sources, without reconciling the inconsistencies between them. Instead he postulates that Ezra was responsible for the variations in Deuteronomy, which he introduced as he was trying to explain the law of God to the men of his time (TTP VIII, 158). On this theory Ezra gives a reason for this commandment which is more consistent with his overall theological perspective, emphasizing God’s providential relation with the people of Israel. Spinoza thinks this was probably because Deuteronomy was the first book Ezra wrote. After the return from exile, the people urgently needed to have the law explained to them. Only after that did Ezra undertake the task of writing a complete history of the Hebrew people, from the creation to Nebuchadnezzar’s destruction of Jerusalem in the early sixth century.
6.7 Can We Assume Consistency? Even today there will be resistance in some quarters to acknowlede that there are genuine inconsistencies in the texts. This was especially true in Spinoza’s day. Manasseh ben Israel’s Conciliator was an attempt by a learned rabbi to identify all prima facie contradictions in the Hebrew Bible and to explain why they were not really contradictions. Manasseh operated on the assumption that because the Bible is „in the highest degree true, it cannot contain any text really contradictory of another.“ (Manasseh 1972, ix) Spinoza condemns this principle in his preface to the TTP: „Most [theologians] presuppose, as a foundation for understanding Scripture and unearthing its true meaning, that it is everywhere true and divine. So what we ought to establish by understanding Scripture, and subjecting it to a strict examination, and what we would be far better taught by Scripture itself, which needs no human inventions, they maintain at the outset as a rule for the interpretation of Scripture“ (TTP Preface, 8 f.). Spinoza’s alternative principle – that we must first seek to understand Scripture, using ordinary scholarly principles, and not assuming in advance that we are dealing with the word of God – is one of the defining principles of modern criti-
E C
cal biblical scholarship, and one reason modern biblical scholars regard Spinoza as a seminal figure in the history of their discipline. Popkin speaks of Spinoza’s „total secularization“ of the Bible as an historical document, and says that Spinoza could do this because he had „a radically different metaphysics ... a metaphysics for a world without a supernatural dimension“ (Popkin 1996, 403). But Spinoza’s hermeneutic principles have been accepted by scholars of quite varying religious perspectives – e. g. by orthodox Jews (Kugel 2007, 45) – perhaps because they depend, not on a naturalistic metaphysics, but on the common sense proposition that before we can conclude that a particular text is of divine origin, we must first try to work out what it says.
6.8 Chronological Questions Since there are still many for whom the truth, and hence, consistency, of Scripture is a first principle, it may be helpful to add a further example of a prima facie inconsistency in the Hebrew Bible involving a different kind of issue. Much of Spinoza’s discussion in chapter 9 is devoted to problems of chronology. His most detailed example is too complicated to discuss here (TTP IX, 162–65). It involves the prima facie inconsistency between the statement in 1 Kings 6, 1 that 480 years passed between the Exodus and Solomon’s construction of the temple and the total you get if you add up the years of each individual period which Scripture reports between those two events (in excess of 580 years). But he has another, more manageable example. The last fourteen chapters of Genesis tell the story of Joseph and his brothers. Gen 37 reports how the brothers sold Joseph to the Egyptians. Gen 38 interrupts the story of Joseph with a story about Judah and Tamar, in which Judah first marries a Canaanite woman, Shua’s daughter, then arranges for his first son by Shua’s daughter to marry Tamar. When that son dies without having fathered a child, he arranges for his second son to marry Tamar. After that son also dies without children, Judah promises Tamar that when his third son grows up, he will fulfill the brother-in-law’s duty and marry her. But Tamar does not trust his promise. When she sees that the third son has grown up, but still has not been given to her in marriage, she disguises herself as a prostitute, and has intercourse with Judah. This produces two children, one of whom has fathered two children
S’ B S
by the time Judah moves to Egypt. Gen 38 does not tell that part of Judah’s story. It ends with the birth of Judah’s children by Tamar. Then Gen 39 goes back to the story of Joseph in Egypt. The problem is that all these things are supposed to have happened within a definite – all too short – time period: between the time Joseph was sold into bondage and the time he was reunited with his father in Egypt. Gen 38 begins the story of Judah and Tamar by saying „It happened at that time that Judah went down from his brothers“. Our normal narrative expectations would dictate that the italicized phrase refers to the time at issue in the immediately preceding verse, which describes Joseph being sold into bondage. In Gen 46 Jacob moves his whole family to Egypt, to be reunited with Joseph. Judah is part of this move, as are his surviving son by Shua’s daughter, the children he had by Tamar, and the two grandchildren he had through one of Tamar’s sons. But according to calculations generally agreed on, only twenty-two years passed between the time Joseph was sold into bondage and the time of his reunion with his family. (The traditional calculation goes back to a rabbinic work on biblical chronology dating from the 2nd century C. E., Seder Olam, and is assumed in Ibn Ezra’s commentary on Gen 38. Spinoza reproduces it in TTP IX, 160 f.) This raises an awkward question: how could all the things related in Gen 38 have happened in twenty-two years? How could Judah have produced three sons by Shua’s daughter, all of whom grew up to be of marriageable age, and then two sons by Tamar, one of whom became old enough to have children, in that time? Seder Olam managed to squeeze all these events into that twenty-two year period by assuming that Judah’s sons all married at the age of seven (Seder Olam 2005, 32–36). Later commentators found this implausible. In his commentary on Genesis, Ibn Ezra rejected Seder Olam’s theory, arguing that the earliest possible age of procreation (and hence, of marriage) is twelve. His solution is that the phrase „at that time“ in Gen 38, 1 does not refer to the time in the immediately preceding verse –when Joseph was sold – but to an earlier time. He doesn’t say when that earlier time was, or explain how Judah’s absence in Canaan (assumed in Gen 38) would have been consistent with the role he is supposed to have played in the sale of Joseph in Gen 37 (See Ibn Ezra 1988, I, 354 f.). To some extent Spinoza accepts this solution. Like Ibn Ezra, he doesn’t think „at that time“ can refer to the time when Joseph was sold into bondage. But he
E C
gives more weight than Ibn Ezra did to our normal narrative expectations. He hypothesizes that the narrative of Gen 38 has been taken from another book and inserted into the Joseph narrative, without having been properly integrated into its new surroundings: „Since not all these events can be related to the time in question in Genesis, they must be related to another time, treated just previously in another book. Ezra, then, has merely copied this story, and inserted it among the others, without having examined it“ (TTP IX, 161). A leading 20th century commentator on Genesis substantially agrees with Spinoza, though he’s less harsh in his judgment of the editor. He concludes that the inconsistency shows that „the narrators acted in the main as custodians of diverse traditions which they did not attempt to co-ordinate and harmonize when the respective data appeared to be in conf lict“ (Speiser 1964, 299). Spinoza’s fundamental idea – that the person who ultimately compiled these stories often put together the inconsistent narratives he found in his sources without resolving the inconsistencies – that idea remains intact. Spinoza is critical of Ezra’s editorial work, but he reserves his most caustic words for the rabbis who have tried to persuade us that the apparent inconsistencies in the text are not real inconsistencies: „If anyone wants to compare the narratives of the book of Chronicles with those of the books of Kings, he will find numerous similar discrepancies, which I don’t need to recount here. Much less do I need to discuss the devices authors use to try to reconcile these accounts. For the rabbis are completely crazy. The commentators I have read indulge in idle fancies and hypotheses, and in the end, completely corrupt the language itself“ (TTP IX, 165 f.). As an example he offers the statement in 2 Chr 22, 2, that Ahaziah was fortytwo when he began to reign, which conf licts with the claim in 2 Kings 8, 26, that he was twenty-two at that point. This was one of the nearly two dozen discrepancies between the narratives of Kings and Chronicles Manasseh discussed in his Conciliator (Manasseh 1972, II, 94 f.). Manasseh mentions two ways commentators have tried to resolve this conf lict, without expressing a preference for one over the other. Spinoza discusses only one of those solutions: Gersonides’ proposal that the author of Chronicles was calculating Ahaziah’s age from the reign of Omri, not from Ahaziah’s birth. Spinoza comments that „[i]f they could show that this was what the author of the books of Chronicles meant, I wouldn’t hesitate to say that he didn’t know how to express himself. And they invent many
S’ B S
other things of this kind. If these things were true, I would say, without qualification, that the ancient Hebrews were completely ignorant both of their own language and of how to tell a story in an orderly way“ (TTP IX, 166). Gersonides’s hypothesis f louts the way we normally calculate someone’s age. If this sort of explanation is permissible, then we are playing a game with no rules. As Spinoza puts it, „there will be no principle or standard for interpreting Scripture. We can invent anything we like“ (ibid.). Spinoza not only denies the Mosaic authorship of the Pentateuch, he also challenges the traditional view of the authorship of all the other books which make up Freedman’s „Primary History“ of the people of Israel, and has a plausible theory about who did write them. He doesn’t claim to be certain of that writer’s identity, but he can at least tell us approximately when he lived, how he proceeded in constructing his history, and what his theological perspective on the history of Israel was. Developing this theory, based entirely on internal evidence from the text itself, and not on tradition, occupies most of chapters 8 and 9 of the Tractatus. Here we see Spinoza operating in ways which have no parallel in La Peyrère or Hobbes, making use of arguments from doublets and chronological problems which demonstrate his knowledge of the tradition of Jewish biblical commentary, a tradition which was closed to these predecessors by their lack of Hebrew.
6.9 Implications of Spinoza’s Theory Why do these questions of authorship matter? Conservative Christians may argue that there are a number of texts in the New Testament which suggest that Jesus thought Moses was the author of the Pentateuch. Commonly cited are Mark 7, 10, Mark 10, 3–8, and Matthew 8, 4, in all of which Jesus reportedly refers to passages in the Pentateuch as coming from Moses. For those who believe Jesus was the son of God, whose beliefs about Scripture have special standing, these passages are strong evidence for Moses’s authorship. For readers who lack that theological commitment, these passages will just be indications that Jesus held a view common among the Jews of his time, but a view which may nevertheless be false.
E C
Let’s set aside these theological issues, and ask what the implications of Spinoza’s view are, independently of anything in the New Testament. One implication seems obvious: if Spinoza is right in his theory of the composition of the books making up the Primary History, we can’t assume that those books are a reliable account of that history. If, in their present form, they are essentially the work of Ezra (or of an editor writing in the post-exilic period), working with the kinds of materials Spinoza takes Ezra to have had at his disposal – chronicles written by earlier historians, which were not consistent, have not survived to be examined, and, for all we know, may themselves have been second- or thirdhand accounts, dealing mainly with events in the remote past (that is, dealing with events the most important of which took place many centuries before our Bible took final form) – that will tend to diminish the authority of the Hebrew Bible as an historical work. It may be correct in what it says happened; but its saying that is not much reason to believe what it says. Spinoza does not make these skeptical implications of his work explicit. He leaves the reader to draw his own conclusions. But he doesn’t conclude, and wouldn’t want us to think, that the Bible is without value. It may be unreliable as a work of history, but it does contain important moral teachings. Spinoza would insist particularly on its teaching that we must pursue justice and seek to love our neighbors (see, e. g., TTP XIV, 221). I don’t think Spinoza wanted to endorse all the moral teachings of Scripture. In chapter 17 he quotes Ezekiel’s claim that God said „I gave them statutes which were not good, and laws they could not live by“ (TTP XVII, 276). In context (20, 25–26) Ezekiel seems to be referring to laws requiring the sacrifice of the first-born (e. g. Ex 22, 28–29). Perhaps Spinoza would extend his use of this passage to other Scriptural commands, such as those which require the killing of witches (Ex 22, 18), or the extermination of the Canaanites (Deut 7, 1–2). But however that comes out, this much is clear: Spinoza doesn’t wish to endorse every command God is represented in Scripture as having given. If we are generally skeptical about the accuracy of Scripture as an historical record of God’s dealings with his people – as Spinoza’s biblical criticism surely encourages us to be – then we are not bound to accept as a genuine divine command everything Scripture represents as a divine command. Spinoza’s hermeneutics permits us to pick and choose, perhaps relying on our own independent moral judgment. The cost of this is that in obeying biblical commands,
S’ B S
we may not be able to justify our actions by saying that we are merely obeying God’s will. That might be a price worth paying. But I think he would add that philosophers should not think of these imperatives as justified simply because they are divine commands. God cannot properly be conceived as a lawgiver (TTP IV, 72–77). If the commands are justified, it must be because obedience to them contributes to the optimal functioning of human society, something which is in all our interests.
6.10 Summing Up Toward the end of his 1996 article on Spinoza’s biblical scholarship, Popkin wrote that Spinoza was not really much of an historical scholar, compared to some of his contemporaries (Popkin 1996, 403). This would be a perfectly reasonable thing to say, if you think Spinoza’s contribution to biblical scholarship was limited to adding a few examples of anachronism in support of a theory, already well-developed by others, that Moses did not write absolutely all of the Pentateuch. In this article I’ve tried to show that his contributions were more significant than that: that he supported his denial of the Mosaic authorship by lines of argument you won’t find in Hobbes or La Peyrère, that he extended his skepticism about the authorship of the Hebrew Bible to many of its other books, and that he developed a positive theory about the writing of the core historical books which he defended by using arguments of a kind which figure crucially in modern scholarship, but don’t seem to appear in his predecessors. In his remarks on the history of critical biblical scholarship, E. A. Speiser begins by giving credit to Ibn Ezra for having been the first to suggest the problems in the assumption of Moses’s authorship of the Pentateuch. But, he says, „it required ... the penetrating probing of Spinoza ... to launch ,higher‘ biblical criticism – that is, internal analysis as opposed to textual or ,lower‘ criticism – on a truly productive course“ (Speiser 1964, xx). This seems a more just assessment of Spinoza’s contribution than what you find in Popkin.
E C
Bibliography References to the Talmud are to the Soncino Babylonian Talmud, trans. under the editorship of I. Epstein, London 1935–1952. ABD: The Anchor Bible Dictionary, ed. by D. N. Freedman et al., 6 Volumes, New York 1992. Freedman, D. N./Geohegan, J. 1994: „Martin Noth: Retrospect and Prospect“, in: The History of Israel’s Traditions, the Heritage of Martin Noth, ed. by S. McKenzie and P. Graham, Sheffield, 128–152. Gebhardt C. 1987: Einleitung zu den beiden Traktaten, in: Spinoza. Opera, hrsg. v. C. Gebhardt, Heidelberg, 223–258. Hobbes, Th. 1994: Leviathan, ed. by E. Curley, Indianapolis. Ibn Ezra’s Commentary on the Pentateuch, trans. and annot. by N. Strickman and A. Silver, 5 Volumes, New York 1988. Kugel, J. 2007: How to Read the Bible, New York. La Peyrère, I. de 1655: Systema theologicum ex praeadamitarum hypothesi, Pars prima. Luther, M. 1960: Lectures on Deuteronomy, Luther’s Works, Vol. IX, ed. by J. Pelikan et al., Saint Louis. Maimonides, M. 1963: The Guide of the Perplexed, trans. with intr. and notes by Sh. Pines, Chicago. Malcolm, N. 2002: Hobbes, Ezra and the Bible, in: Aspects of Hobbes, Oxford, 383–431. Manasseh ben Israel, R. 1972: The Conciliator, trans. by E. H. Lindo, New York [Reprint of a translation first published in London in 1842]. Popkin, R. 1996: „Spinoza and Biblical Scholarship“, in: Garrett, D. (ed.) 1996: The Cambridge Companion to Spinoza, New York, 383–407. Seder Olam: Seder Olam, The Rabbinic View of Biblical Chronology, trans. with comm. by H. Guggenheim, Rowman and Littlefield, 2005. Speiser, E. A. (ed.) 1964: Genesis, trans. and annot. by E. A. Speiser, New York. Twersky, I. (ed.) 1972: A Maimonides Reader, West Orange, N.J. Wolf, A. (ed.) 1927: The Oldest Biography of Spinoza, New York.
7 Piet Steenbakkers
Das Wort Gottes und die wahre Religion: Das Fazit von Spinozas Bibelkritik (Kapitel 11–12)
7.1 Die Stellung des Neuen Testaments in Spinozas Bibelkritik Spinoza selber hat seinen 1670 erschienenen Traktat als „theologisch-politisch“ bezeichnet, und schon auf den ersten Blick zeigt sich, daß die Kapitel 1–15 von Bibel und Religion handeln, und die Kapitel 16–20 von Politik. Der Bindestrich ist jedoch nicht ohne Bedeutung: Das Buch ist namentlich nicht, wie der Untertitel zu besagen scheint, eine Klitterung von gesonderten Aufsätzen, sondern es konzentriert sich auf den spezifischen Zusammenhang zwischen den beiden Bereichen. Obwohl im Untertitel von dissertationes aliquot, „einigen Abhandlungen“, die Rede ist, wird der Zusammenhang gleich näher bestimmt als „einige Abhandlungen, in denen gezeigt wird, daß die Freiheit zu philosophieren nicht nur ohne Schaden für die Frömmigkeit und den Frieden im Staat zugestanden werden kann, sondern auch nicht aufgehoben werden kann, ohne zugleich den Frieden im Staat und die Frömmigkeit aufzuheben“ (TTP, Titelblatt). Es gilt herauszuarbeiten, wie Religion und Politik, oder mehr noch religiöse und politische Gewalt, sich gegenseitig bestimmen und beschränken. Die zentrale Frage, die Spinoza in diesem Buch zu beantworten versucht, ist, welcher Raum da noch für die Freiheit des Philosophierens, der Meinungsäußerung und der wissenschaftlichen Betätigung gelassen wird. Auf den zweiten Blick sieht man, daß die Verteilung der Bestandteile einen unausgeglichenen Eindruck macht: Nur ein Viertel der Kapitel beschäftigt sich mit
P S
Politik, und sogar in diesen Kapiteln geht Spinoza noch ausführlich auf die biblische Darstellung des Hebräerstaates ein. Für das zentrale Thema des Buches ist Spinozas Bibelauslegung also maßgebend. Nicht umsonst, denn er wendet sich an ein Publikum, dessen Bewertung der Bibel als Buch der Bücher, als das Wort Gottes, er billigen kann, wenn auch in einer spezifischen Bedeutung. Welche Bedeutung das ist, wird in diesem Kapitel ausgeführt. Nicht nur zwischen Religion und Politik, sondern auch innerhalb der Darstellung der Bibelkritik gibt es ein weiteres Ungleichgewicht: Nach zehn Kapiteln, die sich ausführlich und bis ins kleinste Detail mit der problematischen Zuverlässigkeit der Bücher des Alten Testaments beschäftigen, hat Spinoza im elften Kapitel über das Neue Testament nur wenig zu sagen. Für eine Darlegung, die versucht, Offenbarung und philosophisches Wissen ganz voneinander zu trennen, handelt es sich dabei allerdings um ein Problem von entscheidender Bedeutung: die philosophischen Anmaßungen der Apostel. Die drei Gründe, die Spinoza am Ende des zehnten Kapitels anführt, um sich einer erschöpfenden Untersuchung des Neuen Testaments zu entziehen, sind schlicht: „Es wäre nun an der Zeit, in gleicher Weise auch die Bücher des Neuen Testaments zu untersuchen. Weil dies aber, wie ich höre, schon von sehr gelehrten und vor allem sprachkundigen Männern geschehen ist, und auch, weil meine Kenntnis der griechischen Sprache nicht gut genug ist, mich an eine solche Aufgabe heranzuwagen, und schließlich, weil wir diese auf hebräisch geschriebenen Bücher nicht mehr in ihrer Urschrift besitzen, möchte ich lieber von dieser Arbeit absehen“ (TTP X, 187). Besonders wichtig ist hier also die Kenntnis der Sprachen. Das stimmt auch mit der Methode für die Untersuchung der Schrift überein, die er im siebten Kapitel dargelegt hat. Die erste Regel dieser Methode lautet (VII, 122): „Sie [die Untersuchung] muß auf die Natur und Eigentümlichkeiten der Sprache eingehen, in der die Bücher der Schrift geschrieben sind und in der ihre Verfasser gewöhnlich sprachen.“ Man braucht sich also nicht zu wundern, daß Spinoza sich selbst nicht für zuständig hält, eine solche Analyse des Neuen Testaments zu liefern. Die Gründe, die er anführt, lassen jedoch manches ungeklärt. Wer sind die gelehrten Männer, über welche Spinoza angeblich gehört hat, daß sie eine solche Untersuchung bereits ausgeführt haben, und inwiefern akzeptiert er ihre Ergebnisse? Natürlich hat es seit Lorenzo Valla, dessen Collatio Novi Testamenti jedoch erst 1505 von Erasmus veröffentlicht worden ist, im 16. und 17. Jahrhundert eine ganze Menge von
D W G R
oft hervorragenden Gelehrten gegeben, die sich eingehend mit dem Text des Neuen Testaments befaßt haben. Es ist aber klar, daß Spinoza weder ihre Arbeiten gut gekannt hat, noch ihren Folgerungen im Allgemeinen zustimmte, zumal diese häufig im Widerspruch zueinander standen. Seine Bemerkung über die hebräischen Urschriften der Bücher des Neuen Testaments bestätigt das. An einer anderen Stelle des Methodenkapitels (VII, 136) ist Spinoza deutlicher: „Eine letzte Schwierigkeit, bestimmte Bücher der Schrift nach dieser Methode zu interpretieren, entsteht daraus, daß wir sie nicht in ihrer Originalsprache haben. Das Evangelium nach Matthäus und zweifellos auch der Hebräerbrief sind nach allgemeiner Ansicht (ex communi opinione) auf Hebräisch abgefaßt, doch nicht in ihrem Original erhalten.“ In der Fortsetzung der schon angeführten ersten Regel seiner Methode (vgl. VII, 122) breitet Spinoza diese Behauptung noch weiter aus: „Und weil die Schreiber des Alten wie des Neuen Testaments allesamt Hebräer waren, ist natürlich vor allem eine Kenntnis der hebräischen Sprache erforderlich, nicht nur für das Verständnis der Bücher des Alten Testaments, die in dieser Sprache geschrieben worden sind, sondern auch für die des Neuen Testaments, die zwar in anderen Sprachen verbreitet sind, aber doch hebräische Bücher sind (hebraizant tamen).“ Dasselbe finden wir auch in Spinozas 75. Brief: „Johannes hat sein Evangelium zwar griechisch geschrieben, aber dabei hebraisiert er doch (hebraizat tamen)“ (Ep 75, 283). Spinoza war also der Meinung, daß einige Bücher des Neuen Testaments ursprünglich hebräisch waren, und daß sie allesamt zumindest hebräisch angehaucht sind. Unter „Hebräisch“ muß man hier wahrscheinlich auch Aramäisch, die Sprache Jesu und der Apostel, fassen. Die communis opinio aber war – zu Spinozas Zeit und auch jetzt noch – daß die ursprüngliche Sprache, auch für das Matthäusevangelium und den Hebräerbrief, Griechisch war. Wohl hat sich im 17. Jahrhundert eine wissenschaftliche Polemik erhoben über die Frage, ob es sich da um die allgemeine Koine handelte oder um eine eigene Variante des Griechischen, die von Daniel Heinsius als dialectus hellenistica bezeichnet worden ist (Heinsius 1639; De Jonge 1980, 32–35). Spinozas Gedanke, daß das Griechische des Neuen Testaments „hebraisierend“ war, mag mit Heinsius’ Theorie verwandt sein. Die Auffassung, daß dem Evangelium nach Matthäus ein hebräischer Urtext zugrunde liegt, war zwar im frühen Christentum ziemlich verbreitet, ihr begegnet man aber im 17. Jahrhundert kaum noch. Einer der wenigen Verfasser, der das behauptete, war Christoph Sand oder Sandius, mutmaßlicher Herausgeber der sozinianischen Bibliotheca Fratrum
P S
Polonorum. Seinem Nucleus historiae ecclesiasticae, den Spinoza besaß (Te Winkel 1914, Nr. 102; Aler 1965, Nr. 126), war ein Tractatus de veteribus scriptoribus ecclesiasticis vorangestellt, in dem Sandius, mit Hinweis auf eine Reihe von Verfassern und Kirchenvätern, schreibt: „aus alten Quellen … geht hervor, daß Matthäus sein Evangelium in der hebräischen Sprache verfaßt hat“ (Sandius 1669, 10–11). Es ist auch nicht ohne Bedeutung, daß Spinoza in seinem lateinischen Traktat die Bibelstellen nicht aus der Vulgata zitiert, sondern aus der Ausgabe von Immanuel Tremellius von 1569 (Te Winkel 1914, Nr. 2; Aler 1965, Nr. 143), der das Neue Testament aus aramäischen Quellen ins Lateinische übersetzt hat. Spinoza hat sich also nicht in die sehr umfangreiche philologische Literatur seiner Zeit über den neutestamentlichen Text eingearbeitet. Man bekommt den Eindruck (insbesondere wenn man dazu noch die Titel in seiner Bibliothek betrachtet), daß sein Interesse nicht systematisch war: Er las nur, was er für seine Argumentation benötigte. Und das waren, im Falle des Neuen Testaments, eigentlich nur zwei Hauptthemen: erstens die philosophierende Tendenz der Apostel, welche im starken Kontrast zur Prophetie im Alten Testament steht; und zweitens der ethische Zusammenhang der zwei Teile der christlichen Bibel, die, so Spinoza, beide nur ein und dieselbe Botschaft haben, nämlich das göttliche Liebesgebot. Weil diese zwei Themen von kardinaler Bedeutung für das ganze Unternehmen des Tractatus theologico-politicus sind, ist es nicht unangemessen zu sagen, daß Spinoza in den Kapiteln 11 und 12 das eigentliche Fazit seiner Bibelkritik zieht.
7.2 Die Apostel: Propheten und Lehrer Spinoza beginnt seine Behandlung des Neuen Testaments mit der (nicht weiter nachgewiesenen) Behauptung: „Kein Leser des Neuen Testaments kann bezweifeln, daß die Apostel Propheten waren“ (TTP XI, 188). Das Problem ist nur, daß diese Tatsache (wenn es eine Tatsache ist) nirgendwo im Bibeltext belegt wird, und daher kann Spinoza, kraft seiner universellen Regel der Schriftinterpretation ex sola Scriptura (VII, 121), den Aposteln keine Prophetien zuschreiben. So wird Gott nie redend eingeführt, wie das bei den alttestamentlichen Propheten üblich ist. Statt dessen begründen die Apostel ihre Lehren durch die Vernunft und stützen sie auf Schlußfolgerungen (XI, 189). Das bedeutet, daß sie sich als
D W G R
Lehrer manifestiert haben und nicht als Propheten (XI, 191 f.): Was sie predigten und schrieben, ohne Bestätigung durch Zeichen, basierte auf natürlicher Erkenntnis, nicht – wie bei den Propheten – auf Offenbarung. Spinoza ist bereit einzuräumen, daß die Apostel dazu auch noch gepredigt und ihre Worte zugleich mit Zeichen bekräftigt haben – das Echtheitszeichen der Prophetie (XI, 192; II, 32). Was wir aber von ihnen haben, die Evangelien, Briefe und Handlungen, ist darauf ausgerichtet, durch Unterrichtung zu überzeugen. Ihr Auftrag war es, die Lehren, die Jesus auf dem Berge gegeben hat (Matthäus 5–7), zu verbreiten. Diese Trennung zwischen Prophetie und Unterrichtung, zwischen Einbildungskraft und Vernunft, impliziert, daß die Apostel dasjenige, was sie von Jesus gelernt haben, nicht als geoffenbartes Wort Gottes weitergegeben haben, sondern als Unterricht für alle, auch für die Ungebildeten. Da hatten sie keine andere Wahl als sich dessen, was allen Menschen gemein ist, zu bedienen, daß heißt der Vernunft (vgl. dazu E II, Lehrsätze 38–40 samt zugehörigen Folgesätzen und Anmerkungen). Diese Sachlage zeigt, daß Jesus für Spinoza zwar ein außerordentlicher Mensch war, dem (wie er es anderswo ausdrückt: TTP I, 21 f.; IV, 75 f.) die göttlichen Ratschlüsse unmittelbar offenbart worden sind, und der sich „mit Gott von Geist zu Geist“ verständigt hat, aber nicht in irgendeinem bedeutungsvollen Sinne als Sohn Gottes, geschweige denn als Gott, hingestellt werden kann (vgl. dazu auch Ep 73, 277 und Matheron 1971, 253–261). Jesus hat als einziger Mensch Gottes Offenbarungen ohne Hilfe der Vorstellungskraft empfangen (TTP I, 22), und so, durch den Geist Jesu, hat Gott sich den Aposteln bekundet (I, 21), die berufen waren, diese Botschaft als allgemeine Wahrheit allen Menschen zu predigen (XI, 192). Damit aber hat Spinoza gewissermaßen ein wichtiges Argument um die Religion von der Philosophie zu trennen aufgegeben, oder zumindest abgestuft (James 2012, 179 f.). Denn mit Bezug auf das Alte Testament hatte er gezeigt, daß die Prophetie gerade deshalb keine Bedrohung der Philosophie sein kann, weil die Propheten nur an die Einbildungskraft appellieren, und nicht an die Vernunft; daß sie keine Wahrheiten lehrten, sondern eine Lebensweise (TTP II, 45). Jetzt ist diese Trennung wieder problematisch geworden, denn die Apostel lehrten und schrieben kraft ihres natürlichen Urteils. Daß dies tatsächlich zu einer verhängnisvollen Vermischung von Religion und philosophischer Spekulation geführt hat, spricht Spinoza am Ende des Kapitels aus. Als Lehrer haben die Apostel auch ihre eigenen Lehrmethoden gehabt, und deshalb haben sie der Re-
P S
ligion oft sehr voneinander abweichende Grundlagen gegeben. Spinozas Beispiel hier ist der Gegensatz zwischen Paulus und Jakobus in Sachen der Prädestination: Paulus lehrt, „daß niemand sich seiner Werke, sondern jeder allein seines Glaubens rühmen könne … wie überhaupt die ganze Lehre der Prädestination. Jakobus dagegen lehrt …, daß der Mensch auf Grund seiner Werke gerechtfertigt werde und nicht nur auf Grund des Glaubens“ (XI, 196). Jedoch, so behauptet Spinoza, stimmen die Apostel in der Religion selbst vollends überein. Ebenso wie er nachher in der Darstellung der sieben Dogmen des allgemeingültigen Glaubens (XIV, 221 f.) großzügig von unwichtigen Details wie der Trinität abstrahieren wird (die Dreieinigkeit wird nicht erwähnt, gehört aber gerade deshalb zweifelsohne zu den Dogmen, „über die es unter rechtschaffenen Menschen Kontroversen geben kann“, also nicht zum allgemeinen Glauben), erklärt er hier den heiklen Streitpunkt der Prädestination als irrelevant, ja sogar schädlich für die Religion. Streitigkeiten und Schismen über diese und ähnliche Probleme werden andauern, bis die Religion endlich von philosophischen Spekulationen getrennt und auf die sehr wenigen notwendigen Dogmen zurückgeführt wird (XI, 196). Im nächsten Kapitel muß Spinoza denn auch die folgenden Fragen beantworten: Was bleibt von der Religion übrig ohne diese Spekulationen; was ist die zentrale Botschaft der Schrift; wurde diese verdorben; in welchem Sinne gilt die Schrift als heilig; und was ist eigentlich das Wort Gottes?
7.3 Das Wort Gottes Als Spinoza 1665 anfing, den Tractatus theologico-politicus zu verfassen, schrieb er an Oldenburg, daß er damit unter anderem die Beschuldigung des Atheismus von sich abwehren wollte (Ep 30, 142). Im zwölften Kapitel behauptet er ausdrücklich, daß er nichts gesagt hat, „was gottlos wäre oder nach Gottlosigkeit röche“ (TTP XII, 198). Im Gegenteil: Gerade diejenigen, die „Papier und Tinte“ statt Gottes Wort verehren, verwandeln die Religion in Aberglauben. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig (2. Kor 3, 6). Das zwölfte Kapitel wird mit einem rhetorischen Feuerwerk eröffnet. Falls seine Leser selber noch nicht auf den Gedanken gekommen waren, führt Spinoza die möglichen abergläubigen Beschwerden gegen seine Bibelkritik erst mal selbst ein. Wenn man die Bibel für einen Brief hält, den Gott den Menschen unmittel-
D W G R
bar vom Himmel gesandt hat, dann ist es nach der vorangehenden Darstellung wohl mit Gottes Wort in diesem Sinne getan: Die Bibel als geschichtliches Buch hat sich als „fehlerhaft, verstümmelt, verfälscht und in sich widerspruchsvoll“ erwiesen (XII, 197). Diese fast aggressive Übertreibung bewirkt, daß Spinozas intendierte Leser, die lectores philosophici (Vorrede, 12), erst recht neugierig werden: Wie steht es denn um Gottes Wort? Gerade weil dieses Kapitel sich zum Ziel setzt, die wahre Religion von Aberglaube zu trennen (XII, 198), ist eine Differenzierung der Leser angebracht. Der philosophisch gebildete Leser findet auch gleich eine Anspielung auf Descartes’ Meditationes: Selbst wenn es vom Wort Gottes, so wie es einmal den Propheten gegeben war, nur noch Bruchstücke gäbe, hat Gott sein ewiges Wort, den ewigen Bund und die wahre Religion, den Herzen der Menschen, dem menschlichen Geist, eingeschrieben, und mit seinem Siegel, das heißt mit der Idee seiner selbst, bestätigt. (Vgl. Med. III, am Ende, Descartes 1996, Bd. VII, 51: Deum, me creando, ideam illam mihi indidisse, ut esset tanquam nota artificis operi suo impressa; „daß Gott, als er mich erschuf, seine Idee mir eingesteckt hat, damit sie seinem Werke wie das Merkzeichen des Handwerkers eingeprägt sein sollte.“) Die erste große Frage lautet jetzt: In welchem Sinne kann ein Buch, ein totes Ding, heilig und göttlich genannt werden? Wohl nur, wenn und solange es zur Übung der Frömmigkeit und Religion verwendet wird (TTP XII, 199). Es gibt keine materiellen Eigenschaften, die an sich Heiligkeit gewährleisten. „Heilig“ und „profan“ sind, wie gut und schlecht, schön und häßlich, und überhaupt alle Bewertungen bloße Denkweisen (modi cogitandi), die nur mit Bezug auf den Geist des Wahrnehmenden eine Bedeutung haben (siehe dazu u. a. E I, Anhang, 81 und 91–95; E IV, Vorwort, 377–379; Ep 54, 219 f.). Außerhalb des Geistes ist nichts absolut heilig, profan oder unrein. Auch die Schrift ist nur heilig, solange sie die Menschen dazu bewegen kann, dem göttlichen Gesetz zu gehorchen. Sie verdirbt denn auch nicht dadurch, daß sich im Text Fehler einschleichen, sondern durch Vernachlässigung des göttlichen Gesetzes (TTP XII, 200). Was dann zurückbleibt, ist nur noch Papier und Tinte, Gegenstand des Aberglaubens und Fanatismus. Wie Nietzsche später, führt Spinoza hier eine Art Umkehrung durch: Die Göttlichkeit der Moral wird nicht von einem transzendenten, höchsten Wesen bedingt, sondern von den Menschen selbst, die so ihre selbst geschaffenen Werte sakralisieren. Wenn diese nicht länger eingehalten werden, verschwindet damit auch die Göttlichkeit. „Gott ist todt! Gott bleibt
P S
todt! Und wir haben ihn getödtet“ (Nietzsche, Die fröhliche Wissenschaft, § 125; KSA, Bd. III, 481). Das Kernstück des Kapitels ist Spinozas Behandlung des Begriffs „Wort Gottes“ (debar Jehovah) im eigentlichen Sinne (XII, 201–203). Er setzt dabei seine früheren Ausführungen über die Gründe, weshalb etwas „Gottes“ genannt wird, fort (I, 22–29; VI, 108). Das Ergebnis ist, daß die Schrift Gottes Wort heißt aus drei Gründen: 1. Gott ist der ewige Verfasser oder Urheber (aeternus author) der wahren Religion, die in der Schrift gelehrt wird; 2. Weissagungen künftiger Ereignisse werden in ihr als Ratschlüsse Gottes dargestellt; 3. die tatsächlichen Verfasser (qui revera fuerunt ejus authores) geben ihre Lehren als Aussprüche Gottes. Der Unterschied zwischen dem ewigen Urheber und den tatsächlichen Verfassern läßt sich philosophisch in etwa so verstehen wie der Unterschied zwischen Gott als absolut erster Ursache (E I, Lehrsatz 16, Folgesatz 3) und den endlichen modi als nächsten Ursachen (causae proximae: E II, Lehrsatz 7, Anmerkung, 111– 113). Nur weil die Schrift die wahre Religion lehrt, und – so muß man hinzufügen – so lange wie die Menschen diese wahre Religion auch der Schrift entnehmen, ist sie Gottes Wort, und kann Gott als deren Urheber betrachtet werden. Spinoza untermauert seine These mit einer Reihe von weiteren Bemerkungen. Daß die Bibelbücher sich in ein Altes und ein Neues Testament aufgliedern, erklärt er mit Begriffen, die offensichtlich dem christlichen Selbstverständnis entgegenkommen. Laut dieser Sicht sei die Religion von den Propheten aufgrund des Alten Bundes als Landesgesetz gepredigt worden, von den Aposteln aber kraft des Leidens Jesu als allgemeines Gesetz (TTP XII, 202 f.). Als solches gehört diese Auffassung zu den historischen Argumenten des christlichen Antijudaismus (Lasker 2010, 59–62). Eine so weitgehende Annäherung zum Christentum findet man sonst bei Spinoza in dieser Form nicht. Die hier von ihm vertretene Position ist jedoch schon in seiner Analyse des Apostelamts im elften Kapitel enthalten, in dem er die Apostel als Lehrer aller Menschen dargestellt hat. Deshalb müßten sie auch an die universelle Vernunft appellieren, statt an die zeit- und ortsgebundene Einbildungskraft, die kennzeichnend war für die Propheten. Ob seine christlichen Zeitgenossen Spinozas Annäherungsversuch zu schätzen wußten, ist jedoch zweifelhaft. Wie sich aus dem 42. Brief von Velthuysen an Ostens ergibt, war es ihnen immerhin klar, daß für Spinoza die christliche Bibel nicht den exklusiven Heilsweg bildete: „Es bleibt dem Autor auch nicht ein Beweisgrund, um darzutun, daß Muhamed kein wahrer Prophet gewesen ist,
D W G R
weil die Türken auch nach der Vorschrift ihres Propheten die moralischen Tugenden, über die alle Völker einig sind, pf legen“ (Ep 42, 192). Das wird von Spinoza in seiner Antwort auch bedingungsweise bejaht: Wenn die Türken und Heiden Gott durch Gerechtigkeitspf lege und Nächstenliebe verehren, so haben sie den Geist Christi (Ep 43, 197 f.). Spinoza führt weitere Argumente an für seine Theorie, daß die Göttlichkeit der Schrift nicht in ihrem Wortlaut liegt (TTP XII, 203 f.). Die Zufälligkeiten der geschichtlichen Entstehung der Bibelbücher wie auch ihrer Kanonisierung zeigen, daß die Schrift, so wie wir sie jetzt kennen, ein kontingentes Ergebnis von historischen Ereignissen ist. Für das Neue Testament gilt zusätzlich, daß die Apostel für ihre Unterrichtung pädagogische Hilfsmittel brauchten, die in Sachen Religion entbehrlich sind. Auch die exakte Zahl der Evangelien ist eine historische Zufälligkeit: Wenn es weniger (oder gar mehr) als vier gegeben hätte, wäre die Botschaft nicht weniger klar und vollkommen gewesen. Spinozas Schlußfolgerung ist also, „daß die Schrift nur im Hinblick auf die Religion, d. h. das allgemeingültige göttliche Gesetz, im eigentlichen Sinne Wort Gottes heißt“, und daß sie als solches „nicht fehlerhaft, verfälscht und verstümmelt ist“ (XII, 204 f.). Was die Bibel göttlich macht, ist ihr Sinn, und dieser ist unverfälscht auf uns gekommen (TTP XII, 205), wenn die Worte auch oft verändert worden sind. Hier greift Spinoza implizit zurück auf den wichtigen Unterschied, den er im siebten Kapitel gemacht hat zwischen dem wahren Sinn eines Textes (sensus orationum) und der Wahrheit der Sache (2. Regel der Methode, TTP VII, 123 f.). Die Hauptlehre der Schrift ist das Liebesgebot, „Gott über alles zu lieben und seinen Nächsten wie sich selbst“ (XII, 205; siehe Lukas 10, 25, Matthäus 22, 35–40, Markus 12, 28–33; Römer 13, 8). Diese Grundlage der gesamten Religion wird von Spinoza dargeboten in Begriffen, die mit seiner Definition der Essenz in der Ethica verwandt sind: „mit deren Wegnahme [fällt] das ganze Gebäude mit einem Male zusammen“ (vgl. E II, Definition 2, 99: Ad essentiam alicuius rei id pertinere dico, quo dato res necessario ponitur et quo sublato res necessario tollitur; „Zur Essenz irgendeines Dinges gehört meinem Verständnis nach das, mit dessen Gegebensein das Ding notwendigerweise gesetzt und mit dessen Aufhebung das Ding notwendigerweise aufgehoben wird“). Es handelt sich hier, so Spinoza, tatsächlich um das Wesen der Religion. Das Liebesgebot als eigentlicher Kern einer jeden Religion ist einer der tragenden Gedanken des Tractatus theologico-politicus. In Spinozas Philosophie
P S
hängen die Begriffe der Nächstenliebe (charitas) und der Liebe (amor) eng zusammen (schon in KV II, § 18, 94 f.). So wird in der Ethik die Liebe zu Gott (amor erga Deum, E V, Lehrsätze 16–20) und die geistige Gottesliebe (amor Dei intellectualis, E V, Lehrsätze 32–37) mit einer Moral der Menschenliebe verbunden (zwar ohne das Wort charitas zu verwenden; siehe E IV, Anhang, Hauptsätze 9–12, 511 f.); die gleiche ethische Lehre unterstellt Spinoza im Tractatus theologico-politicus der Religion. Im 14. Kapitel zieht Spinoza wiederum das Johannes-Wort heran, das er schon als Leitspruch dem Buche vorangestellt hatte: „Daran erkennen wir, daß wir in Gott bleiben und Gott in uns, daß er uns von seinem Geist gegeben hat“ (1. Johannes 4, 13; vgl. TTP, Titelblatt). Jetzt erläutert er allerdings, was Gott uns von seinem Geiste gegeben hat: „nämlich die Nächstenliebe“ (nempe charitatem: XIV, 219). Spinoza fährt fort: Denn Johannes hatte vorher gesagt, „daß Gott Nächstenliebe ist, und daraus (aus seinen dort entwickelten Grundsätzen) schließt er, daß den Geist Gottes wahrhaft hat, wer die Nächstenliebe hat“ (ebd.). Der Name Johannes ist in der christlichen Tradition verbunden mit drei Briefen, dem Johannesevangelium und der Offenbarung des Johannes. Er wird auch als der „Liebesjünger Jesu“ gesehen, von dem im Johannesevangelium die Rede ist (Joh. 13, 23 und 19, 26). Spinoza betont im vierten Kapitel, daß das Liebesgebot zugleich das höchste Gesetz und der höchste Lohn des Gesetzes ist (vgl. TTP IV, 69 ff.). Wenn man die von Spinoza verwendeten Bibelstellen betrachtet, ergibt sich eine interessante Parallele mit Johann Sebastian Bachs Kantate Du sollt Gott, deinen Herren, lieben (BWV 77). Bach ist dafür sicherlich nicht von Spinoza beeinf lußt: Sie haben nur beide aus denselben biblischen Quellen geschöpft. In den drei synoptischen Evangelien (Matthäus, Markus und Lukas) wird erzählt, daß ein Schriftgelehrter Jesus fragt, was das höchste Gebot sei. Bachs Kantate 77 gründet auf der Fassung, die das Lukasevangelium (10, 25–27) darbietet: „Und siehe, da stand ein Schriftgelehrter auf, versuchte ihn und sprach: Meister, was muß ich tun, daß ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm: Wie steht im Gesetz geschrieben? Wie lieset du? Er antwortete und sprach: Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüte und deinen Nächsten als dich selbst.“ Jesus erläutert denn den Begriff des Nächsten mit dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter, das auch eine wichtige Rolle spielt in der Kantate. Matthäus (22, 35–40) und Markus (12, 28 ff.) – aber nicht Lukas – nennen die Liebe zu Gott und zum Nächsten
D W G R
ausdrücklich das höchste Gebot. Bach verwendet auch die Melodie des LutherChorals Dies sind die heil’gen zehn Gebot als Grundlage des Chors, mit dem die Kantate öffnet (Petzoldt 1999, 139). Die andere Schriftlesung des 13. Sonntags nach Trinitatis, für den Bach diese Kantate schrieb, bestätigt den Zusammenhang des Liebesgebots mit dem Gesetz des Alten Bundes: Im Galaterbrief 3, 15–22 betont Paulus die Beziehung zwischen Glauben und Gesetz. Spinoza und Bach haben also beide, jeder auf eigene Weise, ausgedrückt, daß der Kern und Gipfel der biblischen Botschaft ist, Gott zu lieben und seinen Nächsten wie sich selbst. Für Spinoza haben sich mit diesem Ergebnis auch die übrigen Sittenlehren, die davon abhängen, als unverfälscht erwiesen (TTP XII, 206 f.). Nur beschränkte Teile des Bibeltextes, so stellt sich jetzt heraus, sind „verderblich“. Darunter aber auch eine für Spinozas Unternehmen sehr wichtige Kategorie, nämlich die der philosophischen Spekulationen, die er im religiösen Kontext immer mit Sektierismus, Fanatismus, Unterdrückung und Schismen verbindet. Für den Verfasser des Tractatus theologico-politicus ist gerade das die größte Sorge.
Literatur Aler, J. M. M. 1965: Catalogus van de Bibliotheek der Vereniging Het Spinozahuis te Rijnsberg, Leiden. De Jonge, H. J. 1980: De bestudering van het Nieuwe Testament aan de Noordnederlandse universiteiten en het Remonstrants Seminarie van 1575 tot 1700, Amsterdam. Descartes, R. 1996: Œuvres de Descartes, hrsg. v. C. Adam/P. Tannery, Paris. Heinsius, D. 1639: Sacrarum exercitationum ad Novum Testamentum libri XX, Leiden. James, S. 2012: Spinoza on Philosophy, Religion, and Politics: The Theological-Political Treatise, Oxford. Lasker, D. J. 2010: Ref lections of the Medieval Jewish-Christian Debate in the Theological-Political Treatise and the Epistles, in: Y. Y. Melamed/M. A. Rosenthal (Hrsg.), Spinoza’s Theological-Political Treatise. A Critical Guide, Cambridge, 56–71. Matheron, A. 1971: Le Christ et le salut des ignorants chez Spinoza, Paris. Nietzsche, F. 1999: Kritische Studienausgabe, hrsg. v. G. Colli/M. Montinari, Berlin. Petzoldt, M. 1999: Theologische Aspekte der Leipziger Kantaten Bachs, in: C. Wolff (Hrsg.), Die Welt der Bach-Kantaten, Bd. III: Johann Sebastian Bachs Leipziger Kirchenkantaten, Stuttgart, 127–141. Sandius, C. C. 1669: Nucleus historiae ecclesiasticae, cui praefixus est Tractatus de veteribus scriptoribus ecclesiasticis, Amsterdam. Te Winkel, J. 1914: Catalogus van de boekerij der Vereeniging „Het Spinozahuis“, Den Haag.
8 Manfred Walther
Der systematische Ertrag der exegetischen Arbeit Die Schlichtheit der biblischen Botschaft, der Kerngehalt des Offenbarungsglaubens und die Schriftgemäßheit des „weltanschaulichen“ Pluralismus (Kapitel 13–14)
Nach der Bestimmung des Offenbarungscharakters der Schriften des Alten Testamentes (Kap. 1–2), der vier Offenbarungsgehalte (Kap. 3–6), der ref lexiven Bestimmung der dabei befolgten Methode (Kap. 7), der Entstehungs-, Redaktions- und Überlieferungsgeschichte dieser Schriften (Kap. 8–10) sowie des Charakters und Gehalts des Neuen Testamentes (Kap. 11) ziehen die Kapitel 12–15 die systematischen Konsequenzen aus den dargelegten Befunden. Die Ausführungen in den Kapiteln 14 und 15 bezeichnet Spinoza selber als „das wesentliche Anliegen dieses Traktats“ (TTP XIV, 225). Im 13. Kapitel will Spinoza aufzeigen, daß, weil die biblischen Schriften allein darauf abzielen, alle ihre Adressaten – im Alten Testament die Juden, im Neuen Testament alle Menschen – zu einem Leben in Gehorsam gegen Gottes Gebot zu bewegen, und weil dieser „Gehorsam … bloß in der Liebe zum Nächsten besteht“ (TTP XIII, 209) – daß aus diesen Gründen ihre Lehren über Gott sehr schlicht und genau durch diese praxisanleitende Funktion bestimmt sind, nicht aber uns tiefere spekulative Einsichten über die Beschaffenheit der Wirklichkeit vermitteln wollen. Im 14. Kapitel stellt Spinoza jene wenigen elementaren biblischen und allgemein konsentierten spekulativen Glaubensinhalte/Dogmen über Gott und sein Verhältnis zu den Menschen (credo minimum) zusammen, deren Funktion allein in der Anleitung zur rechten Lebensführung besteht, das heißt welche die notwendige Bedingung dafür sind, diese Nächstenliebe im Modus des Gehorsams gegen
M W
Gottes Gebot zu praktizieren – woraus folgt, daß zugleich alle diejenigen, zum Teil miteinander unverträglichen Anschauungen, welche die Menschen schon zu biblischen Zeiten je nach ihrer jeweiligen Sinnesart zusätzlich zu diesem Gehorsam motivierten und später motivieren konnten, von der Bibel selber freigegeben sind (weltanschaulicher Pluralismus). Zugleich macht Spinoza darauf aufmerksam, daß dieser Minimalgehalt einer Deutung fähig ist, welche mit der wissenschaftlich-philosophischen Erkenntnis übereinstimmt.
8.1 Die Schlichtheit der biblischen Botschaft und die angemaßte Expertokratie der Theologen (Kapitel 13) Spinoza beginnt seine diesbezüglichen Ausführungen mit der Rekapitulation von schon Erarbeitetem. Leitender Gesichtspunkt ist dabei zu zeigen, daß es der Bibel nicht um eine wissenschaftliche Darlegung geht: • Die Propheten als Träger der Schriftoffenbarung zeichnen sich, wie Kapitel 2 ergeben hat, nicht durch außergewöhnliche Erkenntniskraft, sondern durch die Stärke ihres Vorstellungsvermögens aus; Inhalt ihrer Verkündigung sind „ganz einfache Dinge“, und zwar in Anpassung/Akkommodation Gottes an „ihre[ ] vorgefaßten Meinungen“ (TTP XIII, 208).1 • Um der leichten Verständlichkeit für jedermann willen argumentiert die Schrift nicht wissenschaftlich, sondern rekurriert allein auf die Erfahrung, nämlich auf Wunder und Geschichten, damit alle affektiv angesprochen werden. Die Propheten hatten ja alle Juden zu Adressaten und die Apostel die gesamte versammelte Gemeinde. • Die „Schwierigkeiten, die Schrift zu verstehen“, verdanken sich nicht der Übernatürlichkeit ihrer Botschaft, sondern unserer weitgehenden Unkenntnis sowie den Eigentümlichkeiten „der (hebräischen) Sprache“ (TTP VII). 1 Daß die biblischen Texte sich in ihrer Ausdrucksweise einer Akkommodation, einer Anpassung, verdanken, ist alte Lehre der Kirche, und zwar nicht nur in dem Sinne, daß die Sprecher sich den Verstehensbedingungen ihrer Adressaten anpassen, sondern auch in dem Sinne, daß Gott sich „an die Schwäche des menschlichen Fassungsvermögens“ angepaßt hat (s. Körtner 1998, Sp. 254). In diesem Sinne gebraucht Spinoza den Ausdruck hier und später noch mehrfach.
D E A
Daraus folgt, daß die Schrift weder sublime Spekulationen noch philosophische Sachverhalte enthält, „sondern nur ganz einfache Dinge, die selbst der langsamste Geist erfassen kann“ (TTP XIII, 208). Die gegenteilige Überzeugung, daß Gott nämlich in der Schrift den Menschen ansonsten unzugängliche, für ihr Heil unabdingbare Geheimnisse offenbart habe, suchen die „Experten des Heils“, die Theologen, allen Gläubigen einzupf lanzen. Dadurch machen sie alle Gläubigen von ihrer Autorität abhängig. Aufgezeigt werden soll daher in diesem Kapitel, „daß in der Schrift keine andere Wissenschaft empfohlen wird als diejenige, die für alle Menschen nötig ist, um Gott nach dieser Vorschrift gehorchen zu können, und die nicht zu kennen die Menschen unausweichlich widerspenstig oder zumindest undiszipliniert machte“ (TTP XIII, 209). Der Expertenanspruch der Theologen wird durch den Nachweis destruiert, daß es sich bei dem, was die Theologen als Ausdruck des von ihnen reklamierten „übernatürlich[n] Licht[s]“ ausgeben, um etwas handelt, das „schon vor Zeiten bei den heidnischen Philosophen … abgedroschenes Zeug war“ (ebd.). Das bedeutet freilich nicht, „daß zur Lehre der Schrift nichts Spekulatives gehört“ – dieses ist jedoch „sehr selten und sehr einfachen Inhalts“; es zu bestimmen, ist Gegenstand des folgenden Kapitels. Was die Schrift verlangt, ist daher nicht eine höhere „Wissenschaft“, sondern „Gehorsam gegen Gott“, der „bloß in der Liebe zum Nächsten besteht“, sowie solche „Wissenschaft“, welche die Menschen zum Gehorsam motiviert und deren Unkenntnis sie „widerspenstig oder zumindest undiszipliniert“ macht. Alle anderen Spekulationen, handele es sich um die Gottes- oder die Naturerkenntnis, „sind von der offenbarten Religion zu trennen“ (209 f.). Die folgenden Ausführungen dienen der genaueren Darlegung und klareren Erläuterung (vgl. TTP XIII, 210), das heißt dem exegetischen Beleg, dem „Schriftbeweis“, zweier Behauptungen Spinozas: Die erste Behauptung ist, „daß“ – der Bibel selber zufolge – „die geistige, d. h. tiefergehende Erkenntnis Gottes, anders als der Gehorsam, keine allen Gläubigen gemeinsame Gabe ist“ (210). Nach dem Zeugnis des Mose haben die Erzväter Gott nämlich nicht unter dem Namen „Jehova“2 gekannt, der sich auf „Gott in seiner unbedingten Es2 Diese Lesart des im hebräischen Original unpunktierten, d. h. ohne Vokale geschriebenen Namens JHWH ist später durch die korrekte Lesart „Jahwe“ ersetzt worden. Vgl. Aptroot 2001, Sp. 503 f.
M W
senz“ bezieht, sondern nur als „El (mächtig)“, also in seiner Beziehung zu seiner Schöpfung. Obwohl also die Erzväter keinen adäquaten Gottesbegriff hatten, vertrauten sie Gott, und Moses pries sie in der „Einfachheit im Glauben“; umgekehrt hielt die „einzigartige Gotteserkenntnis“ Moses nicht davon ab, an den göttlichen Verheißungen zu zweifeln. Fazit: Adäquate Gotteserkenntnis ist nach dem expliziten biblischem Zeugnis selber nicht gefordert, sondern, wie bei Mose, „eine nur einigen Gläubigen erteilte Gabe“, und zudem auch keineswegs hinreichend. Wenn es im 1. Buch Mose gleichwohl heißt, „die Erzväter hätten im Namen Jehovas gepredigt“, so erklärt sich das daraus, daß der Verfasser nicht deren eigene Sprache, sondern die seiner eigenen, also einer späteren Zeit benutzt. Klar ist, daß die Gläubigen in ihrer „Erkenntnis des Göttlichen“ sich sehr voneinander unterschieden. Weisheit, die zur adäquaten Gotteserkenntnis befähigt, wie sie Mose zuteil wurde, kann ja auch niemand auf „Anordnung“ an den Tag legen, „so wenig“ wie jemand auf Anordnung „leben und existieren“ kann (211). Die biblische Botschaft wendet sich aber an alle, setzt also nur eine Fähigkeit voraus, die alle haben, nämlich die zu gehorchen. Die zweite Behauptung ist, „daß jene Erkenntnis, die Gott durch die Vermittlung der Propheten ausnahmslos von allen verlangt und die zu haben jeder gehalten ist, nichts weiter ist als eine Erkenntnis der göttlichen Gerechtigkeit und Liebe“ (210), also der durch eine bestimme Lebensführung nachahmbaren Eigenschaften Gottes. Es folgen Schriftbelege aus Jeremia und aus dem 2. Buch Mose, schließlich aus dem 1. Johannesbrief, dem zufolge angesichts der Tatsache, daß „niemand ihn [Gott] jemals gesehen hat“, „derjenige Gott wahrhaft in sich hat und wahrhaft erkennt, der Nächstenliebe besitzt“ (213) und den im höchsten Maße gerechten und barmherzigen Gott als „unvergleichliche[s] Musterbild des wahren Lebens“ erkennt, also durch ein anthropomorphes Gottesbild zu frommer Lebensführung motiviert wird. Damit harmoniert die Tatsache, daß sich in der Bibel keine explizite Gottesdefinition findet. Folglich gehört „die geistige Erkenntnis Gottes, die seine Natur, wie sie in sich (in se) ist, betrachtet“, die daher auch nicht als Musterbild eigener Lebensführung zu dienen vermag, nicht „zum Glauben und zur offenbarten Religion“, die Menschen können also diesbezüglich „himmelweit irren“ (213), ohne damit zu freveln. Daß die Gottesvorstellungen der Propheten nach deren Vorverständnissen (praeconceptis … opinionibus) ausfallen und somit ein Pluralismus von Gottesvor-
D E A
stellungen in der Schrift selber überliefert ist, kann daher ebenso wenig erstaunen wie das anthropomorphe Sprechen von Gott, denn nur so konnten die Adressaten durch die prophetische Verkündigung erreicht und zum Gehorsam motiviert werden. Die Theologen machen, wenn sie behaupten, die mit rationaler Erkenntnis konf ligierenden Aussagen der Schrift über Gott seien „metaphorisch [zu] interpretier[en]“, alles andere aber sei „buchstäblich“ zu nehmen, nicht nur ihr eigenes jeweiliges Verständnis dessen, was sie für rational halten, zum Kriterium des Schriftsinnes. Hätten sie recht, so wäre darüber hinaus die Schrift nur für Gebildete, insbesondere für Philosophen, geschrieben. Dann hätten die Propheten aber, um eine Irreführung der Gläubigen zu vermeiden, anders reden, vor allem aber „ausdrücklich und klar“ die wahren Attribute Gottes lehren müssen, „was aber nirgendwo geschehen ist“ (214). Fazit: „Meinungen als Meinungen, d. h. unbezüglich auf die Werke“ sind für „Frömmigkeit oder Gottlosigkeit“ irrelevant; entscheidend ist ihre Funktion, die Menschen zum Gehorsam zu motivieren. Nicht auf Orthodoxie, sondern auf Orthopraxie kommt es also an, und zwar schon deshalb, weil man „wahre Gotteserkenntnis“ (TTP XIII, 214) nicht fordern kann. Historisch-kontextbezogene Schriftauslegung, welche keine eigenen Ansichten über Gott in die Schrift hineinliest, sondern sich an den expliziten Sinn der Texte hält, findet dort Gottesvorstellungen artikuliert, welche wissenschaftlich unhaltbar sind. Damit wird die kerygmatisch-praktische, handlungsanleitende Funktion der biblischen Texte im Modus des Gehorsams zum Kriterium ihrer Göttlichkeit, und eben diese Funktion läßt sich exegetisch nachweisen.
8.2 Das spekulative Minimum: Die sieben Dogmen des allgemeinen Glaubens (Kapitel 14) 8.2.1 Die Unerläßlichkeit kritischer Differenzierung Die kontextbezogene Ermittlung der Bedeutung der biblischen Texte hat ergeben, daß sich in ihnen nicht nur die Lebenspraxis der Autoren nieder-
M W
schlägt,3 sondern auch die Rücksicht auf die Adressaten der Verkündigung, so daß diese Texte nicht nur durch die „unterschiedliche[ ] Geistesart“ der einzelnen Autoren, sondern auch durch die über fast zweitausend Jahre sich erstreckenden Denkweisen verschiedener „Zeitalter[ ]“ (TTP XIV, 216) geprägt waren, die, wie in Kapitel 8–10 des Traktat ausgeführt, auch ihre Spuren in der Überlieferungsgeschichte der einzelnen Schriften hinterlassen haben. „Wer“ also „den ganzen Inhalt der Schrift ohne Unterschied als allgemeingültig und unbedingte Lehre über Gott nimmt“ und sie allen anderen aufherrschen will, mißbraucht „die Autorität der Schrift“ (216). Daraus ergibt sich das Desiderat, zwischen den jeweiligen Ausdrucksformen und dem zentralen Gehalt der biblischen Botschaft kritisch zu unterscheiden. Geschieht das nicht, so kommt es zu einer Perversion der biblischen Botschaft: Jede „Sekte“ gibt ihrer „Geistesart“ (ingenium) angepaßte biblische Belegstellen mit Ausschließlichkeitsanspruch als „göttliche Lehren“ aus und bekämpft daher alle anderen, die sich „eben diese Freiheit“ nehmen, als „Feinde Gottes“, während sie die eigenen Anhänger, und zwar unabhängig von deren Lebensführung, „als Auserwählte Gottes“ (TTP XIV, 216 f.) ansieht. Nicht diese Freiheit der Aneignung der biblischen Botschaft gemäß der jeweiligen Geistesart, sondern jener Ausschließlichkeitsanspruch ist frevelhaft und für den Staat gefährlich (vgl. 217), weil er die Bürger entzweit. Angesichts der großen Reichweite der „Meinungsfreiheit“ in „Fragen des Glaubens“ ist zu bestimmen, „was der Glaube ist und was seine Grundlagen sind“, und Philosophie und Glauben sind voneinander zu trennen. Diese Trennung „vorzunehmen“ ist „das wesentliche Anliegen des ganzen Werkes“ (217).
8.2.2 Die Definition des Glaubens Auszugehen ist vom im 13. Kapitel erarbeiteten Befund, daß die Absicht beider Testamente ein „Kompendium des Gehorsams“ ist, und zwar eines Gehorsams „aufrichtigen Herzens“ (TTP XIV, 217). Nicht mit einem Appell an die Vernunft, sondern mit Drohungen und Belohnungen sucht Mose die Adressaten zu 3 Vgl. die „wissenssoziologisch“ angelegte Aufdeckung des Einf lusses, den die jeweilige Lebenspraxis auf die Gottesvorstellungen der Propheten hatte, in TTP II.
D E A
überzeugen – was mit Wissenschaft nichts zu tun hat. „Die Lehre des Evangeliums“ enthält nichts als die Aufforderung: „an Gott glauben und ihn verehren“, also ihm gehorchen (217), nämlich sein Gebot „der Liebe zum Nächsten“ (218) befolgen. Mit dieser Norm ist „das richtige Kriterium für die Bestimmung des Glaubens“ (217) gefunden, um das es in diesem Kapitel geht: Unabdingbar für den rechten Glauben sind der Schrift zufolge solche Dogmen, welche notwendige Bedingungen dafür sind, daß die Menschen aufrichtig gehorchen. Glaube ist demgemäß zu definieren als „von Gott solche Dinge denken, die zu ignorieren den Gehorsam gegen Gott aufhebt und die anzuerkennen in diesem Gehorsam notwendigerweise enthalten ist“ (218). Nur so kann dem entgegengewirkt werden, daß jedermann oder jede Gruppe die je eigene Form der Aneignung der konstitutiven Glaubensinhalte für „ein unentbehrliches Mittel“ rechten Glaubens hält und alle, die dem nicht zustimmen, mit allen Mitteln bekämpft, so daß die Kirchengeschichte ein dauernder, auch gewaltsamer Streit um die heilsnotwenigen Dogmen ist. Die „weltanschaulichen“ Implikationen des rechten Glaubens sind die folgenden: 1. Nur zusammen mit dem Gehorsam führt der Glaube zum Heil (Jakobus 2,17). 2. Der aufrichtige Gehorsam impliziert „den wahren und heilbringenden Glauben“ (219), wie Spinoza unter Rekurs wiederum auf den Jakobus-Brief, vor allem aber und ausführlicher auf den 1. Johannes-Brief biblisch absichert: Da Gott Liebe ist, hat „den Geist Gottes wahrhaft …, wer die Nächstenliebe hat“. Johannes geht aber noch weiter, indem er aus der Unsichtbarkeit Gottes schließt, daß wir nur „auf Grund der Liebe zum Nächsten“ (219) Gott fühlen oder wahrnehmen und deshalb die einzige Form der Gotteserkenntnis in der Teilhabe an dieser Liebe besteht – was Spinoza mit Skepsis zur Kenntnis nimmt. Es folgt eine Stelle aus diesem Brief (1. Johannes 33 f.), die Spinozas Interpretation explizit zum Ausdruck bringt – und als Motto dem Traktat vorangestellt ist. Darin ist impliziert, daß „die wirklichen Antichristen diejenigen sind, die aufrichtige und gerechtigkeitsliebende Menschen“ wegen der Unterschiede der Dogmen „verfolgen“ (220).
M W
Nicht um „wahre“ als vielmehr um „fromme Dogmen“, das heißt um zur rechten Lebenspraxis motivierende, geht es also in der biblischen Verkündigung, auch wenn einige darunter sind, die „nicht den Schatten einer Wahrheit haben“ (220) – eine Anspielung auf die unterschiedlichen Deutungen, welche die anschließend dargelegten essentiellen Glaubensartikel zulassen –, vorausgesetzt freilich, daß die Gläubigen die Falschheit ihrer diesbezüglichen Überzeugungen nicht kennen, weil das die Autorität Gottes als des Gesetzgebers unterminierte. Damit thematisiert Spinoza den kritischen Punkt seines ganzen Unternehmens: Zwar eröffnet er mit der Differenzierung zwischen der Kernbotschaft, die als einzige sich durchhaltende Lehre der gesamten Schrift beider Testamente ausgewiesen wird, und deren ganz unterschiedlichen Artikulationsweisen die Freiheit, seine Glaubensüberzeugungen im Einklang mit seiner je individuellen Weltsicht neu zu fassen, um „aufrichtigen Herzens gehorsam“ zu sein (217). Ohne eine solche Differenzierung wären die Menschen zum Beispiel, um nur weniges zu nennen, gehalten, am geozentrischen Weltbild unbedingt festzuhalten, die Evolutionslehre Darwins und überhaupt alle Erkenntnisse der neueren Wissenschaft, welche nicht mit dem biblischen Weltbild verträglich sind, als gottlos abzulehnen und deren Verfechter zu bekämpfen! Aber die Reaktionen auf die kognitiven und affektiven Dissonanzen, die eine solche Erkenntnis, die dem biblischen Weltbild widerspricht, bei dem jeweiligen Gläubigen auslösen können, werden, wie Spinozas sozialpsychologischen Einsichten zu entnehmen ist, oft durchaus problematisch sein. „Menschen können“ nämlich, wie Spinoza in der Ethik (IV, Lehrsatz 33) ausführt, „ihrer Natur nach voneinander abweichen, insofern sie von Affekten, die Leidenschaften sind, bedrängt werden“ (E IV, 427). Und Leidenschaften wie Furcht und Hoffnung spielen ja insbesondere in der alttestamentarischen Verkündigung, wie Spinoza mehrfach ausführt, eine bedeutsame Rolle. Da nun, gemäß den Gesetzen der Affektnachahmung, jeder danach sterbt, daß alle anderen seine Präferenzen teilen, weil seine Liebe zu den präferierten Gütern dadurch intensiviert wird, wird jedermann, sofern er von Leidenschaften bestimmt wird, „aus ungestümer Leidenschaft“ danach streben, „daß alle anderen nach seinem Sinne leben“ (E IV, Lehrsatz 37, Anm. 1), so daß die Menschen in Konf likt miteinander geraten. Was für Güter gilt, gilt auch für essentielle Überzeugungen: Jeder sucht nach ihrer Bestätigung durch alle anderen. Nun weist Spinoza freilich nach, daß die von ihm aufgezeigte Differenz zwischen dem propositionalen Gehalt der biblischen Texte und ihrem
D E A
kerygmatischen, pragmatischen, auf die rechte Lebenspraxis zielende Kern den biblischen Texten immanent ist. Am Beispiel der biblischen Verwendung der Qualifikation „heilig“ (sanctus) führt er aus: „Heilig und göttlich nennt man das, was zur Ausübung von Frömmigkeit und Religion bestimmt ist, und es bleibt nur solange heilig, wie die Menschen dies in religiöser Weise tun“ (TTP XII, 199). Die Verabsolutierung der durch die religiöse Einbildungskraft bedingten Ausdrucksmittel zu Aussagen über an sich bestehende Sachverhalte (Wahrheiten), die gegenüber anderen Ausdrucksmitteln unbedingt durchzusetzen sind, wird von der Bibel selber als abergläubisch qualifiziert, wie Spinoza anschließend an der Verwendung des Ausdrucks „Haus Gottes“ aufzeigt. „Der Religiöse heiligt das, woran er glaubt, mit seiner Konsequenz in der Übung von Liebe und Gerechtigkeit“.4 Die von Spinoza als universell qualifizierten Dogmen sind daher solche, die allgemein konsentiert sind. Spinozas Weigerung, einer Übersetzung des Theologisch-politischen Traktat in die Nationalsprache zuzustimmen, weil er genau solche Reaktionen vermeiden wollte, zeigt, daß er sich des Problems bewußt war. Aber selbst sein Vertrauen darauf, daß des Lateinischen Kundige eher zu denen gehören, an die er sich, wie in der Vorrede ausgeführt, als „philosophische[ ] Leser“ (Vorrede, 12) wendet, wurde, wie man weiß, massiv enttäuscht. Gerade die „liberalen Cartesianer“ sahen sich durch seine Bestimmung des Verhältnisses von Vernunft und Schrift aufs äußerste provoziert.5 Es mußten Jahrhunderte vergehen, bis sich jene weltanschaulich pluralistische Gesellschaft herausbilden konnte, auf deren Erscheinen und Konsolidierung er aus war – und verschwunden ist der von ihm als unbiblisch bekämpfte offenbarungsreligiöse Fundamentalismus ja bis heute nicht, so daß seine Ausführungen nicht nur weiterhin relevant sind, sondern wohl eher erneut an Aktualität gewonnen haben.
4 Vgl. dazu den Abschnitt „E. Aberglaube und religiöses Phänomen“ in der einzigen neueren deutschsprachigen Monographie zum TTP von Alexander Samely (1993, 66–71; das Zitat auf S. 67). 5 Das zeigt Ueno 1997 auf; als Beispiel für diese Reaktion führt er den Brief Lambert van Velthuysens über den TTP an (Ep 42). Vgl. dazu ferner für Deutschland Sparn 1984 und, was die angeblich desaströsen Implikationen seiner Religionsphilosophie betrifft, Walther 1995b.
M W
8.2.3 Die sieben Dogmen des allgemeinen Glaubens Welches sind nun jene teils ontologischen, teils ethisch-moralischen Dogmen, „über die es unter rechtschaffenen Menschen [keine] Kontroversen geben kann“ (TTP XIV, 221)? Sie müssen notwendig sein, um die Menschen zur rechten Lebensführung im Modus des Gehorsams zu motivieren, so daß Spinoza sich also zu ihrer Begründung nicht auf die Schrift beruft, sondern sie „from the concept of obedience to God in conjunction with the general character of human nature“ deduziert (Christian 1965, 92; Matheron 1971, 95). Sie müssen zugleich Raum lassen für unterschiedliche Deutungen, und Spinoza skizziert im Anschluß an die Auf listung dieser Dogmen verschiedene Deutungen, von denen jeweils eine seiner eigenen Philosophie entspricht. Damit beansprucht er, daß auch seine eigene Philosophie als eine spezifische Variante der wahren Religion zu verstehen ist – gemäß der in der Ethik gegebenen Definition: „Was auch immer wir begehren und tun – wenn wir seine Ursache sind, sofern wir die Idee Gottes haben, oder besser, insofern wir Gott erkennen, rechne ich es zur Religion“ (E IV, Lehrsatz 37, 441). Diese Nachweise dienen ihm dazu, das zweite Ziel, das er mit der Publikation des Traktat verfolgt, zu erreichen, nämlich „die Meinung, die das Volk von mir hat, das mich unaufhörlich des Atheismus beschuldigt“, zu widerlegen (Ep 30, 142). Die im folgenden aufgeführten Dogmen sind bewußt so neutral wie möglich formuliert, und ihre Rechtfertigung besteht in dem Aufweis, daß ohne den Glauben an sie der Gehorsam gegen Gott unmöglich ist. Für fünf dieser Dogmen gibt Spinoza sowohl eine anthropomorph geprägte Deutung, welche sich an Jesus-Worte anlehnt, als auch eine solche, die diese negiert und mit seiner eigenen Philosophie übereinstimmt. Hinzu kommt in fünf Fällen eine ganz und gar anthropomorphistische Variante.6 Die sieben Dogmen (TTP XIV, 221 f.) sind so geordnet, daß auf das erste, sowohl eine ontologische als auch eine ethische Eigenschaft Gottes benennende Dogma zunächst drei folgen, welche die ontologische Eigenschaft Gottes genauer fassen, sodann drei weitere, welche die ethische Eigenschaft explizieren.
6 Vgl. die tabellarische Übersicht bei Matheron 1971, 98. Was folgt, ist Matherons Ansatz insgesamt (98–114) verpf lichtet.
D E A
„1. Gott, d. h. ein höchstes Wesen [existiert], das im höchsten Maße gerecht und barmherzig ist und darin das Vorbild des wahren Lebens.“ Ohne das Wissen um oder den Glauben an die Existenz Gottes kann niemand ihm gehorchen noch ihn als Richter anerkennen. Die Existenz Gottes nimmt der Unwissende einfach an. Daß Gott notwendig existiert, beweist Spinoza in Ethik I, Lehrsatz 11, seine Einzigkeit im Folgesatz 1 zu Lehrsatz 14. Was Gott oder das Vorbild wahren Lebens genau ist, „ob Feuer, Geist, Licht, Gedanke“ etc. oder Substanz mit unendlichen Attributen (ebd.), gehört ebenso wenig zum Glauben wie das Wissen um den Grund, aus dem er „das Vorbild wahren Lebens“ ist, sei es, daß „er gerechten und barmherzigen Gemüts ist“, sei es, „weil alle Dinge durch ihn sind und handeln und folglich auch wir durch ihn erkennen und sehen, was wahrhaft gerecht und gut ist“ – ein Rekurs auf Spinozas Tugendlehre, wie sie in der Ethik IV, Lehrsätze 24, 28, 37 etc. ausgeführt ist. Da die Vollkommenheit des Menschen „der Natur und Vollkommenheit des“ geliebten Dinges entspricht, ist „am vollkommensten und der höchsten Glückseligkeit am meisten teilhaftig, wer die geistige Erkenntnis Gottes ... über alles liebt und sich ihrer im höchsten Maße erfreut“, hatte Spinoza schon im vierten Kapitel des Traktat formuliert (TTP IV, 70). Die folgenden drei Dogmen geben die für die Befolgungsbereitschaft notwendigen ontologischen Bestimmungen Gottes an. „2. Gott ist einzig.“ Das ist die Bedingung dafür, daß wir ihm wegen seines alles andere überragenden Wesens „höchste Verehrung, Bewunderung und Liebe“ (TTP XIV, 221) entgegenbringen. Diese Eigenschaft Gottes ist keiner weiteren, sei es anthropozentrisch, sei es anti-anthropozentrisch gefärbten Interpretation bedürftig oder auch nur fähig. Die Einzigkeit Gottes beweist Spinoza im Lehrsatz 14 in der Ethik I. „3. Er ist allgegenwärtig; oder alle Dinge sind ihm offenbar.“ Die Unverborgenheit und Durchsichtigkeit aller Dinge für Gott ist Bedingung dafür, daß er alles mit Gerechtigkeit lenken kann. Ob Gott alle Dinge aufgrund
M W
seines Wesens oder seiner Macht gegenwärtig sind (zu ersterem s. Ep 75), ist unerheblich für den Glauben. „4. Er hat über alle Dinge höchstes Recht und höchste Gewalt und tut nichts unter dem Zwang eines Rechts, sondern alles nach freiem Ermessen und aus einzigartiger Gnade.“ Deshalb müssen ihm alle gehorchen, „er selber aber niemandem“. Gottes Allmacht ist Wirkursache aller Dinge (E I, Lehrsatz 16, Folgesatz 1). Ob er die Welt „aus Freiheit des Willens“ (TTP XIII, 213) oder aus der Notwendigkeit seiner Natur lenkt (zu letzterem vgl. E I, Lehrsatz 17; Lehrsatz 32, Folgesatz 1; TTP IV, 77) und ob er „die Gesetze wie ein Fürst vorschreibt oder als ewige Wahrheiten lehrt“ (vgl. TTP IV, 77), ist nicht relevant. Es folgen die drei für die ethische Dimension konstitutiven Eigenschaften Gottes. „5. Die Verehrung Gottes und der darin enthaltene Gehorsam bestehen allein in der Gerechtigkeit und einer Liebe, die Nächstenliebe ist.“ Dieses Dogma hat Spinoza bereits zuvor als Kernbotschaft der Schrift herausgestellt. Ob der Mensch aus Freiheit des Willens oder kraft der Notwendigkeit des göttlichen Ratschlusses gehorcht (vgl. E III, Lehrsatz, Anm. 3, 235 f.; E I, Lehrsatz 32), indem unser Handeln den Gesetzmäßigkeiten, welche unsere Präferenzbildung beherrschen, folgt, also durch diese zusammen mit den jeweiligen Randbedingungen determiniert ist, kann offen bleiben. Die Haltung, die derjenige, welcher „den Weg der Tugend geht“, anderen gegenüber einnimmt, bezeichnet Spinoza als „Liebe oder Edelmut“ (E IV, Lehrsatz 46), als eine der Weisen, in denen er „Moralität und Religion“ praktiziert (E V, Lehrsatz 41). „6. Alle, die gemäß dieser Lebensführung Gott gehorchen, sind gerettet und nur sie, die anderen aber, die unter der Herrschaft der Lüste leben, verloren.“ Dieser Glaube bringt sie dazu, „Gott mehr zu gehorchen als ihren Lüsten“ (TTP XIV, 222). Ob „die Belohnung der Guten und die Bestrafung der Bösen auf natürlichem oder übernatürlichem Weg erfolgt“ ist „nicht von Gewicht“ (223). (Zu ersterem vgl. E IV, Lehrsatz 18, Anmerkung; E V, Lehrsatz 42; TTP IV,
D E A
73; Brief 19 an Willem van Blyenbergh.) Derjenige, der nach der Leitung der Vernunft lebt, das heißt „den Weg der Tugend geht“, wird das Gut, auf das er selber aus ist, „auch für andere Menschen begehren und umso mehr, je größer seine Erkenntnis Gottes ist“ (E IV, Lehrsatz 37). Weil wir an der Tugend „eine innere Freude“ haben, können wir „unsere sinnlichen Lüste hemmen“. Daher ist „Glückseligkeit“ nicht der Lohn der Tugend, sondern eben „genau Tugend“ selber (E V, Lehrsatz 42), also keine fremdverursachte – übernatürliche – Handlungsfolge. „7. Gott verzeiht denen ihre Sünden, die sie bereuen.“ Da niemand ohne Sünde ist, müßten wir ohne den Glauben an Gottes in der Vergebung sich ausdrückende Barmherzigkeit in Hoffnungslosigkeit verfallen, während der feste Glaube an seine vergebende Barmherzigkeit „einen noch größeren Ansporn“ gibt, „Gott zu lieben“ (TTP XIV, 222). Diese Formulierungen lassen deutlich erkennen, daß der Gehorsam, zu welchem die sieben Dogmen insgesamt die Menschen bewegen, nicht ein autoritär, durch Drohung oder Zwang aufgeherrschtes, lediglich äußerlich gebotskonformes Verhalten meint, sondern eine auf dem liebevollen Vertrauen auf eine Autorität beruhende, insofern „innere Handlung des Gemüts“ ist (TTP XVII, 256). Dieses siebente Dogma ist außer dem zweiten, das inhaltlich philosophisch unproblematisch ist, das einzige, für das Spinoza keine philosophische Deutung angibt. Eine solche scheint auch ausgeschlossen (so auch Samely 1993, 89f.), denn in Ethik IV, Lehrsatz 54 heißt es: „Reue ist keine Tugend …; wer bereut, was er getan hat, ist vielmehr doppelt unglücklich oder ohnmächtig.“ Aber bereits in der folgenden Anmerkung führt er aus, daß, da „Menschen selten nach dem Gebot der Vernunft leben“, dieser passive Affekt „mehr Vorteile als Nachteile mit sich“ bringt – ist Reue doch „Trauer unter Begleitung der Idee seiner selbst als deren Ursache“ (E III, Lehrsatz 51, Anmerkung), bringt also eine Selbstdistanzierung vom eigenen Handeln zum Ausdruck, mag diese auch nicht lange anhalten. Die wiederholte Erfahrung des eigenen Versagens in der Unterworfenheit unter die Leidenschaften erhöht nun aber unsere Bereitschaft, die Mechanismen unseres Affektlebens zu studieren, denen wir ja als relativ ohnmächtiger Teil der gesamten Natur immer wieder notwendig unterworfen sind (E IV, Axiom und Lehrsatz 3). Gelingt das für konkrete Leidenschaften, so ist,
M W
wie Ethik V, Lehrsatz 3 ausführt, die Kraft dieser Leidenschaften gebrochen. „Wer sich und seine Affekte klar und deutlich einsieht, liebt Gott und umso mehr, je mehr er sich und seine Affekte einsieht“ (E V, Lehrsatz 15), und in solcher Erkenntnis und der damit gegebenen Steigerung unserer Handlungsmacht liegt die Erlösung von der Macht der Leidenschaften über uns. Die Art und Weise, in der sich die Individuen gemäß ihrer je eigenen Verfaßtheit diese Dogmen aneignen/interpretieren – Spinoza läßt die Leser keineswegs im Unklaren darüber, welche Interpretation einem auf Wahrheit gerichteten Denken angemessen ist7 –, darauf kommt es also, was den Glauben betrifft, nicht an, sofern sie daraus nicht die Berechtigung zu Vergehen entnehmen oder ihr Gehorsam darunter leidet. Wer sich in seiner jeweiligen Gegenwart die Glaubensinhalte „den Kräften seiner Vernunft und seinen Fähigkeiten gemäß“ aneignet, um so „ohne inneren Zwiespalt und ohne Zögern“, „ohne Bedenken und von ganzem Herzen“, also „einig mit sich selbst“, in aufrichtiger Gesinnung für „Gerechtigkeit und Nächstenliebe“ einzutreten, der tut damit nichts anderes als in biblischen Zeiten, als der Glaubensinhalt ebenfalls gemäß dem Fassungsvermögen und den Ansichten der Propheten und der Masse jener Zeit geoffenbart und abgefaßt war. So allein können die Menschen in Frieden und Eintracht im Staate zusammenleben (TTP XIV, 223). Es folgt ein kurzer Ausblick auf das folgende Kapitel, in dem zum einen die vollkommene Verschiedenheit von Glaube oder Theologie einerseits, Philosophie andererseits hinsichtlich ihrer Zielsetzung (Wahrheit versus Gehorsam und Frömmigkeit) und Grundlagen (Gemeinbegriffe versus historische Berichte und Sprache) aufgezeigt, zum anderen aber, und das ist die Pointe, deren praktische Koinzidenz bezüglich der rechten Lebensführung und die mit dieser Koinzidenz unterstellte Unentbehrlichkeit der Offenbarungsreligion für die meisten Menschen herausgestellt sowie die spezifische Art des Wissens um diese Unersetzbarkeit genauer bestimmt wird.
7 Das hat auch die sofort einsetzende Kritik erkannt, die daher keine Schwierigkeiten damit hatte, Spinozas eigene Philosophie daraus zu rekonstruieren – und zu bekämpfen. Schon durch dieses Faktum der frühen Rezeptionsgeschichte wird die von Leo Strauss aufgestellte und von vielen übernommene These falsifiziert, der TTP könne in seinem wahren Gehalt nur durch eine komplexe, zwischen esoterischer und exoterischer Ausdrucksweise unterscheidenden Hermeneutik entschlüsselt werden (vgl. Strauss 1971). Vgl. die diesbezügliche Kritik an Strauss in Levine 2000.
D E A
Spinoza teilt daher – das sei im Vorgriff auf den Ertrag von Kapitel 15 (vgl. dazu den folgenden Beitrag A. Andersons) gesagt – weder die Position derjenigen, die im Namen der Vernunft die (Offenbarungs-)Religion mit dem Ziel ihrer Eliminierung bekämpfen, noch die derjenigen, die in ihr den einzigen Weg zum Heil sehen. Einerseits deckt er – mit der radikalen religionskritischen Richtung der Aufklärung – durch die strikt historisch-kontextuell verfahrende Schriftauslegung die epistemische Defizienz der mehr oder weniger durch die Vorstellungskraft (imaginatio) geprägten Ausdrucksweise der biblischen Schriften auf. Andererseits aber hält er es für illusorisch, daß alle Menschen zu einer vernunftgeleiteten Lebensführung kommen, so daß die imaginativ geprägte, auf Autorität gegründete rechte Lebensführung im Modus des Gehorsams, wie die Offenbarungsreligion sie verkörpert, für das friedfertige harmonische Zusammenleben aller Gesellschaftsmitglieder unentbehrlich ist. Spinoza geht also ebenso wie im Streit um das Verhältnis von Körper und Geist – aggressiver Idealismus versus reduktiver Materialismus –, um die Handlungstheorie – Kognitivismus versus Emotivismus, Freiheit versus Determinismus – und um das Verhältnis von Demokratie und Liberalismus in der politischen Theorie – entweder Gleichheit oder Freiheit – in der Frage von Status und Funktion der Religion einen dritten Weg.
8.3 Schluß In welchem Ausmaß Spinoza eine durch die leidvollen Erfahrungen der Religionskriege ausgelöste Strömung unter den Gläubigen seiner Zeit erfaßt und artikuliert, indem er als den Kern einer angemessenen Deutung der biblischen Heilsbotschaft die Anleitung zur rechten, dem Nächsten liebevoll zugewandten Lebensführung im Gehorsam gegen Gott angibt, wird unter anderem deutlich an den Ähnlichkeiten und (partiellen) Übereinstimmungen, welche sein Verständnis dieser Kernbotschaft z. B. mit der um die Mitte des 17. Jahrhunderts in Deutschland einsetzenden pietistischen Bewegung um Philipp Jakob Spener in Halle/Leipzig aufweist. Das bietet z. B. dem Leipziger Theologen Johann Benedikt Carpzov denn auch die Gelegenheit, in seinem Osterprogramm für 1695, in dem er Spinoza wegen dessen Leugnung der Auferstehung angreift, Spener vorzuwerfen: „Denn in der Tat: man steigt auf diesen Stufen des Pietismus zum
M W
Atheismus“ – und das bedeutet für ihn: zu Spinoza – „herab, und schließlich wird jedwede Religion von Grund auf umgestürzt“ (Carpzov 1695, zit. nach Koch 2003, 178). Zur selben Zeit beginnt sich, ganz im Einklang mit Spinozas Befunden, ein Bewußtsein der Priorität der Religion gegenüber der Theologie zu entwickeln, das zur Etablierung der Praktischen Theologie als neuer Disziplin führt (Ahlers 1980, bes. 69–75, 79, 84, 126, 156 f.). Es ist also, auch angesichts der vollkommenden Deckung der zentralen Unterscheidungen der Hermeneutik Spinozas und denjenigen Martin Luthers (vgl. Walther 1995a, 285–293), alles andere als zufällig, daß Spinozas im Traktat ausgearbeitete und praktizierte Methode der konsequent historisch-kritischen, kontextuellen Schriftauslegung zunächst im Protestantismus und dann, mit Verspätung, auch im Katholizismus (Tübinger Schule) aufgegriffen wird. Denn sie hat eine für das friedlich-kooperative Zusammenleben von Gläubigen verschiedener Konfession nicht hoch genug zu bewertende Entlastungsfunktion: Indem sie den historischen Abstand zwischen den Weltbildern der biblischen Zeitalter und der eigenen Gegenwart deutlich macht, nötigt sie dazu und ermöglicht es zugleich, zwischen der Kernbotschaft der Schrift und historisch kontingenten und wechselnden Artikulationsformen dieser Kernbotschaft – einschließlich der je eigenen! – zu unterscheiden, und ermutigt dazu, den eigenen Glauben authentisch, das heißt im Einklang mit der jeweiligen Gegenwart zu leben, statt sich unter das Joch angeblich heilsnotwendiger „alter“ Ansichten zu begeben und sich damit Gewalt anzutun – was sich dann, keineswegs zufällig, in einer ganz anderen Art von „Glaubens“praxis, nämlich oft gewaltbewehrter Verfolgung der Abweichler äußert. Diese, Spinoza zufolge auch den biblischen Schriften selber immanente Differenzierungsleistung dürfte im übrigen auch – zumindest implizit – die Grundlage für jeden die Christenheit und das Judentum übergreifenden ökumenischen Dialog unter den Weltreligionen sein.
Literatur Ahlers, B. 1980: Die Unterscheidung von Theologie und Religion. Ein Beitrag zur Vorgeschichte der Praktischen Theologie im 18. Jahrhundert, Gütersloh. Aptroot, M. 4 2001: „JHWH“, in: Religion in Geschichte und Gegenwart, Bd. 4, Tübingen, Sp. 503 f. Carpzov, J. B. (II.) 1695: Rector Academiae Lipsiensis Festum Paschatos Pie Celebrandum Intimat, Leipzig, o. J.
D E A
Christian, W. A. 1965: Spinoza on Theology and Truth, in: R. E. Cushman/E. Grislis (Hrsg.), The heritage of Christian Thought. Essays in honor of Robert Lowry Calhoun, New York, 89–107. Koch, E. 2003: Johann Benedikt Carpzov und Philipp Jakob Spener. Zur Geschichte einer erbitterten Gegnerschaft, in: S. Michel/A. Straßberger (Hrsg.), Eruditio – Confessio – Pietas. Kontinuität und Wandel in der lutherischen Konfessionskultur am Ende des 17. Jahrhunderts. Das Beispiel Johann Benedikt Carpzovs (1639–1699), Leipzig (Leucoria-Studien; 12), 161–182. Levine, N. 2000: Ethics and Interpretation, or How to Study Spinoza’s Tractatus Theologico-Politicus Without Strauss, in: The Journal of Jewish Thought and Philosophy 10, 57–110. Matheron, A. 1971: Le Christ et le salut des ignorants, Paris. Samely, A. 1993: Spinozas Theorie der Religion, Würzburg. Sparn, W. 1984: Formalis Atheus? Die Krise der protestantischen Orthodoxie, gespiegelt in ihrer Auseinandersetzung mit Spinoza, in: K. Gründer/W. Schmidt-Biggemann (Hrsg.), Spinoza in der Frühzeit seiner religiösen Wirkung, Heidelberg, 27–63. Strauss, L. 1971: Anleitung zum Studium von Spinozas Theologisch-politischem Traktat (1948), in: N. Altwicker (Hrsg.), Texte zur Geschichte des Spinozismus, Darmstadt, 300–361. Ueno, O. 1997: Spinoza’s Biblical Interpretation – Theology and Philosophy, Their Separation and Their Coincidence, in: Philosophical Studies of Yamaguchi University 6, 35–51. Walther, M. 1995a: Biblische Hermeneutik und historische Erklärung. Lodewijk Meyer und Benedikt de Spinoza über Norm, Methode und Ergebnis wissenschaftlicher Bibelauslegung, in: Studia Spinozana 11, 227–299. Walther, M. 1995b: Machina civilis oder von deutscher Freiheit. Formen, Inhalte und Trägerschichten der Reaktion auf den politiktheoretischen Gehalt von Spinozas Tractatus theologico-politicus in Deutschland bis 1700, in: L’Hérésie Spinoziste, hrsg. v. P. Cristofolini, Amsterdam, 184–260.
9 Alex Anderson
Spinoza’s Reasons to Believe (Chapter 15)
9.1 Introduction In this essay, I aim to give an analysis of Spinoza’s argument in chapter 15 of the Theological-Political Treatise (TTP). The chapter is central to the concerns of the Treatise, as it is there that Spinoza demonstrates (according to its title) that neither theology nor philosophy is the auxiliary of the other, and gives the persuasive reasons to accept the authority of theology and Scripture. Spinoza urges his reader to read chapters 14 and 15 „again and again“ as they contain the essential aim of the treatise (TTP XIV, 2251 ); and chapter 15 clearly marks the culmination of the first movement of the book laid out in the plan in the Preface (TTP Preface, 11). It is thus an important chapter. In this essay, I aim here to give an analytical hermeneutic of the chapter’s argument; in so doing, I aim to follow, in the words of the great Spinoza commentator Martial Gueroult, „l’ordre des raisons“, showing the sequence of demonstrations and reasons (conclusive and otherwise) leading to Spinoza’s separation of theology and philosophy and acceptance of Scriptural authority. For, as Spinoza states in chapter 13, in a slogan to which we should pay heed: „invisible things, which are only the objects of thought, can be seen with no other eyes than demonstrations“ („Nam res invisibiles, et quae solius mentis 1 Page references to the TTP are given to the German edition in Wolfgang Bartuschat’s translation. Translations of citations and paraphrases are my own. For the citations which I judge to be most important I translate and give the original Latin.
A A
sunt objecta, nullis aliis oculis videri possunt quam per demonstrationes“) (TTP XIII, 211 f.). To see these things, we thus must follow the demonstrations. Since the chapter is a short one, my commentary is as well. Spinoza begins the chapter by refuting „dogmatic“ and „sceptical“ positions which seek to accommodate the meaning of Scripture to the truth or truth to the meaning of Scripture. Spinoza then gives his reasons to accept the authority of Scripture, and its fundamental dogma – that all can be saved by obedience alone. Spinoza argues that these reasons for belief, while not obtaining to the mathematical certainty of a true demonstration through first causes, can nevertheless be accepted with „moral certainty“, a category he draws from the Cartesian philosophy. After parsing Spinoza’s reasons, and discussing some interpretations of the chapter in the secondary literature, I conclude that readers have good reason to accept Spinoza’s claims in good faith with moral certainty.
9.2 Analytical Exposition Spinoza begins the chapter by opposing two hermeneutical tendencies: that of „dogmatists“ who claim that the meaning of Scripture is to be adapted to reason; and that of „sceptics“ who claim that reason is to be adapted to Scripture. This is the same opposition that Spinoza’s friend and collaborator Lodewijk Meyer had made in the Preface to his 1666 work, Philosophy Interpreter of Sacred Scripture (PSSI) (cf. Meyer 1666, 23). For Spinoza, both positions are indefensible: the dogmatist is driven to misinterpret the meaning of Scripture; and the sceptic is driven to accept as divine doctrine „the prejudices of ancient common people“. For Spinoza, both positions „have lost their sense“ (insaniet), „one with reason, and one without reason“ (TTP XV, 226). Spinoza gives two Rabbinic („Pharisaeos“) authorities for the two positions: (1) Maimonides as the dogmatist, whose hermeneutics he had criticized at length in chapter 7; and (2) R. Jehuda Alphakhar as the sceptic, who, in reaction to the dogmatic hermeneutics of Maimonides, „fell into the opposite error“ of subordinating reason to the meaning of Scripture (TTP XV, 226 f.). This led Alphakar to posit a universal rule for interpretation: 1. Everything Scripture teaches dogmatically must be admitted as absolutely true.
S’ R B
2. Nothing which directly contradicts these teachings will be found in Scripture. 3. Only things which contradict them indirectly, by consequences, will be found. 4. These indirectly contradictory passages are to be interpreted metaphorically (cf. TTP XV, 227). In giving this universal rule, Annotation 28 refers to Meyer’s PSSI, where Meyer states the same rule on the authority of „having read it somewhere or having heard it from someone“ (PSSI XI, § 9). Spinoza’s footnote in the Tractatus states that he remembers having „read this once in a letter against Maimonides which is to be found in the letters attributed to Maimonides“ (TTP XV, 227, note 1).2 We thus might be led to suspect that the „someone“ from whom Meyer heard the rule was his good friend and collaborator Spinoza. For Spinoza, Alphakar’s rule is mistaken insofar as it continues to subordinate reason to the meaning of the text: while „it is true that Scripture must be explained through Scripture as long as we are only seeking the meaning of the sentences“ („de solo orationum sensu“) „and the minds of the prophets“ („mente prophetarum“); nevertheless, „after we have found the true meaning“ („verum sensum“) „it is necessary to make use of judgment and reason in order to accord to it our assent“ („necessario judicio et ratione utendum, ut ipsi assensum praebeamus“) (TTP XV, 228). Thus, Spinoza suggests (as Meyer had argued) that Alphakar’s rule will lead one to have to accept irrational claims, such as that something can come from nothing. Furthermore, the rule itself is founded only on Alphakar’s own authority („ex propria authoritate“); since neither reason nor Scripture states any such thing (cf. 228). The norm for correct interpretation thus remains outside of the text itself, violating Spinoza’s principle of interpreting Scripture from itself alone. Spinoza goes on to ask whether one would have to accept a meaning of Scripture as the truth if it contradicts reason. While the opponent might respond that the true sense never contradicts reason, Spinoza shows that Scripture (Moses) 2 The editors of the English edition of the PSSI suggest that Meyer learned of the doctrine from Spinoza, who found it in the works of Alphakar. Examination of the writings of Alphakar reveals, however, only a superficial resemblance. It seems that Meyer had indeed forgotten (or perhaps prefers not to name) the source of the teaching he discusses here. (Cf. Moreau/Lagrée 1988, 178, note 16.)
A A
expressly affirms and teaches that „God is jealous“, which contradicts reason, and would have to be taken to be true (TTP XV, 229). Likewise, Scripture expressly attributes local motion to God, which also contradicts reason; or again, Scripture expressly states that the skies are the home and throne of God (TTP XV, 230). In each of these cases, therefore, the straight meaning of the text contradicts reason. Finally, Spinoza notes that it is not the case that Scripture never explicitly contradicts itself. For instance, Moses states directly that „God is fire“ and yet also directly denies that God has any resemblance with visible things (TTP XV, 230). Were an opponent to follow Alphakar’s rule, and state that the second claim contradicts the first only indirectly, then he would be led to affirm that „God is fire“, which is contrary to reason (TTP XV, 230 f.). Likewise, Samuel directly negates that God revokes his judgment (i. e. changes his decree), whereas Jeremy in contrast affirms that God revokes the good and the bad which he had decreed (TTP XV, 230). Since each statement is universal and opposed to the other, it cannot be determined which meaning should prevail. The interpreter who follows the rule of Alphakar will thus be left without a reason to decide, and thus will be „held to accept as true that which at the same time he rejects as false“ („verum amplecti et simul tanquam falsum rejicere tenetur“) (TTP XV, 231). The propositions are that (1) God is either fire or completely dissimilar from visible things; and (2) that God either revokes (changes) decrees or does not. The first is interesting as Moses is held to have enunciated both propositions of the dilemma; the question thus arises of whether he contradicts himself intentionally and taught something he does not believe; and, if so, why. The second is interesting insofar as it opposes a principle of Spinoza’s „universal faith“ of chapter 14 to a metaphysical principle expressed throughout his theoretical texts: strict causal necessitarianism (see, e. g. KV IV and VI and E I, prop. 29 and 33). Spinoza concludes this argument with the result that the sceptical rule of Alphakar should be rejected as much as the dogmatic one of Maimonides; neither the one nor the other can ground the authorities of reason and Scripture in the event of contradiction. He concludes on this basis that neither should theology be auxiliary to philosophy nor vice versa, but each should „reign in its domain“ („unaquaeque suum regnum obtineat“) (TTP XV, 231). For reason this domain is that of truth and wisdom („veritas et sapientia“), and for theology that of piety and obedience („pietas et obedientia“) (ibid.). This division is necessary because the power of reason does not extend so far as to be able to conclude that, „people can
S’ R B
attain to beatitude through obedience alone and without intelligence of things“ („homines sola obedientia absque rerum intelligentia possint esse beati“); whereas theology teaches only this and commands only obedience. On this schema, theology determines only the dogmas of the faith (as Spinoza had shown in chapter 14); whereas „the precise way in which they are to be understood by reason of the truth“ („quomodo autem praecise ratione veritatis intelligenda sint“) is left to be determined by reason, the „true light of the mind“ („revera mentis lux“) (ibid.). This thus leads Spinoza to his reconciliation of the authorities of reason and of theology, where Spinoza defines „theology“ as „revelation, insofar as it indicates the aim, which we had said that Scripture intends (that is the reason and way to obey, or the dogmas of true faith and piety)“ („revelationem, quatenus indicat scopum, quem diximus Scripturam intendere (nempe rationem et modum obediendi, sive verae pietatis et fidei dogmata“); or, put otherwise, the „word of God“ („Dei verbum“) as Spinoza had defined it in chapter 12. Consequently, Spinoza claims to have shown that theology accords with reason with respect to its „precepts and teachings for life“ („praecepta sive documenta vitae“); and that with respect to it „intention and end“ („intentum et finem“), it does not contradict it. For this reason, he can conclude that it is „universally valid for all“ („omnibus universalis est“) (TTP XV, 232). Spinoza’s language is important here and surely carefully chosen: the teachings for the guidance of life given by theology and philosophy are „in accord“; whereas the intention and end of theology „does not contradict“ philosophy. But this does not mean that the ends of each are the same; for, the end of theology could be a means to the end of philosophy. Given this understanding of theology, Spinoza believes he can address another conf lict between the competing authorities of reason and Scripture. If, after finding the true meaning of Scripture, one is driven to conclude that its true meaning is something which contradicts reason, that conclusion should not compel one to a complete dismissal of Scripture on the basis of reason. For, Spinoza states, everything of such a kind in the Bible can safely be „ignored without lacking charity“ („salva charitate ignorare“), without impinging upon theology or the Word of God (TTP XV, 232). Thus, things which unambiguously contradict reason according to their only plausible meaning can be safely ignored, salva charitate, while the core Verbum Dei remains unperturbed. In this way, the foundations of theology and philosophy can be kept apart. It is interesting that Spinoza invokes the core value of „charity“ to justify the active ignoring of irra-
A A
tional meanings in the Bible. The reader is thus led to infer how Spinoza might resolve some of the explicit contradictions and irrational meanings he had already exposited in the chapter. Nevertheless, the question of the persuasiveness of the authority of Scripture for a philosophical reader has not yet been answered. For, given that Spinoza has conceded that reason cannot demonstrate whether the fundamental dogma of theology – that all can be saved by obedience alone („homines vel sola obedientia salvantur“) – is true or false („verum sit an falsum“), the question remains: why should anyone believe it? (TTP XV, 232) To this objection, Spinoza responds that while the fundamental dogma of faith cannot be demonstrated by reason, and thus that a revelation was absolutely necessary to teach it, this revelation being given, we can make „use of our judgment to accept it with an at least moral certainty“ („nos judicio uti posse, ut id jam revelatum morali saltem certitudine amplectamur“) (TTP XV, 233). Spinoza thus makes use of the category of „moral certainty“ to distinguish the epistemic status of revelation from that of reason. This is a category that Spinoza has introduced in chapter 2, „On Prophecy“, to which he explicitly refers back in this context, even going so far as to say that „on this point“ (i. e. the fundamental dogma of faith) „we cannot expect any greater certitude than that of the prophets themselves“ (ibid.). It is thus on the basis of this moral certainty alone that Scripture is authoritative. Spinoza’s reference for the category of „moral certainty“, especially as contrasted with „mathematical certainty“, is likely the Cartesian philosophy. Descartes uses this category in several of his works, in contrast to the „philosophical“, „mathematical,“ or „metaphysical“ certainty attained through the Cartesian method of secure deduction from clear and distinct ideas. In the Discourse on the Method, Descartes says that it is only possible to have a „moral certainty“ about things such as „having a body, there being stars and an earth, and the like“; writing, „although we have a moral certainty about these things, so that it seems we cannot doubt them without being extravagant, nevertheless when it is a question of metaphysical certainty, we cannot reasonably deny that there are adequate grounds for not being entirely sure about them“ (Descartes 1637, 129). For Descartes, therefore, even our „having a body“ remains an object of moral certainty and not of metaphysical certainty.
S’ R B
At the very end of Descartes’s later philosophical textbook, The Principles of Philosophy, he also invokes the category, writing of his new physical explanations that „my explanations appear to be at least morally certain“ (Descartes 1644, 290). There, he states that these are explanations which cannot be demonstratively proven on the basis of the Cartesian method of proceeding only on the basis of clear and distinct ideas, but which nevertheless „have sufficient certainty for the application to ordinary life“ (ibid.). As an example, he gives the fact that even those who have never been to Rome can know it is a town in Italy with moral certainty on the basis of so much evidence from experience and hearsay. It is thus something we know through experience and not through the Cartesian method of demonstration from philosophically („mathematically“) certain true ideas. On that basis, I do not really know that Rome is in Italy. It is to the former less strict kind of epistemic („moral“) warrant to which Spinoza appeals in his persuasion of the authority of Scripture. In chapter 2, Spinoza had stated the three conditions which led a prophet to be certain of his prophecy, which he restates here in this context: (1) a vivid and distinct imagination; (2) a sign; (3) finally and most importantly, a soul inclined towards the just and the good (TTP XV, 233). Since the first condition, the vivid imagination, could only be valid for the prophets, we are left with the other two (sign and doctrine) in order to determine whether we can be morally certain of revelation. According to Spinoza, it is on the basis of these same two conditions that Moses himself had recommended that a „true prophet can be recognized against a false one“, by the „conjunction of his doctrine and his miracles“ (TTP XV, 234). Spinoza thus explicitly identifies the epistemic „sign“ of chapter 2 with the metaphysical „miracle“ of chapter 6 in this context, the latter discredited. For Spinoza, these same two criteria are those by which we can be persuaded of the authority of revelation: „For each time that we see prophets recommending above all charity and justice without intending anything else, we can thus conclude that it is not from bad deception, but from a sincere soul, that they taught that men can attain to beatitude by faith and obedience, and since they have in addition confirmed it by signs ...“ („Nam quoniam videmus prophetas charitatem et justitiam supra omnia commendare et nihil aliud intendere, hinc concludimus eos non dolo malo, sed ex vero animo, docuisse homines obedientia et fide beatos fieri, et quia hoc insuper signis confirmaverunt …“ (TTP XV, 234).
A A
It is noteworthy that Spinoza invokes the category of „bad deception“ (dolo malo) in this context. As Don Garett has recently argued, Spinoza (or presumably Spinoza3 ) draws a crucial distinction between „good deception“ (dolo bono) and „bad deception“ (dolo malo) in Annotation 32 of the Tractatus. For Spinoza, the category of „bad deception“ itself can only emerge in civil society, in which „it is the civil law which decides what is good and bad“ („ubi communi jure decernitur, quid bonum et quid malum sit“); whereas, in the state of nature it is not possible to conceive of any bad deception (TTP XV, 329, note 32). There, in the conceptual space beyond the state of civil jurisdiction, there is only good deception according to natural right. A deception can thus only be „bad“ in relation to the ends of the social pact, and it is with that in mind that Spinoza concludes that it was not from bad deception (non dolo malo) that the prophets taught that obedience alone saves. Spinoza adds a number of other reasons to persuade the will and intellect of the reader of the authority of Scripture. The first is that we are „comforted in this conviction“ by the fact that the prophets „delivered no moral teaching that was not in perfect accord with reason“ (TTP XV, 234). It is thus with „sensible judgment“ (sano judicio) that Spinoza says we can accept the fundamental dogma of all theology and Scripture even when no mathematical demonstration of it can be given. Spinoza then gives a battery of other reasons relating to the usefulness of this dogma: (1) it is confirmed by the testimony of so many prophets; (2) it procures such great consolation for those with little reason; (3) its great utility for the state; (4) it can be believed without the least danger or harm (TTP XV, 234 f.). This list is merely adumbrated and I leave the reader, as Spinoza did, to autonomously assay its items; it can nevertheless be noted that the reasons seem scarcely theoretical but rather in each case seem to be fundamentally practical, and thus could be subordinate to other, theoretical aims. Given these reasons, it would be „impious“ not to accept the fundamental dogma of faith on the only basis that it is not mathematically demonstrated. For, Spinoza writes, calling to mind again the rhetoric of Descartes, it is not as though in living our life wisely („ad vitam sapienter institudendam“) we can admit of true only that to which no doubt can attain (TTP XV, 235). Thus, the wise person will accept the dogma of theology, and its domain of piety. 3 There remains some doubt about the true authorship of many of these annotations. For a basic discussion, see Akkerman 1999, 18–37.
S’ R B
Having drawn this crucial distinction, Spinoza goes on to put it to use, showing the foolhardiness of attempting to find a mathematical demonstration of the fundamental dogma of faith. For Spinoza, this effort, which cannot succeed, can only end up placing theology under the authority of reason. And if one were to ground one’s certainty in the fundamental dogma of theology on the basis of the interior testimony of the Holy Spirit („interno spiritus sancti testimonio“ – the Reformed position4 ), then Spinoza would show that with respect to the „truth and certainty of speculative things“ („de veritate ... et certitudine rerum, quae solius sunt speculationis“), no spirit can give testimony other than reason. There is thus, for Spinoza, against his Reformed interlocutors, no internal testimony of the Holy Spirit other than that of reason. And were one to claim authority on the basis of any other internal spirit, then, according to Spinoza, one would speak only on the basis of prejudices and affects; or, that it is „from a great fear of being defeated by a philosopher and exposed to public ridicule that they take refuge in the sacred“ (TTP XV, 236). The attempt is vain, however, for „what altar can be prepared as refuge for one who has violated the majesty of reason?“ („qui rationis majestatem laedit?“) (ibid.). This kind of „testimony of the Holy Spirit“ is thus an asylum for the ignorant, guilty of lèse-majesté against reason and philosophy. Spinoza therefore claims to have achieved the aims of the chapter: to separate theology and philosophy, such that neither is the auxiliary of the other; and to give the persuasive reason for accepting the fundamental dogma of faith. Having done so, Spinoza ends the chapter by stressing the utility and necessity of Scripture. Since it is not possible for reason to grasp by the natural light alone that, „simple obedience is the way of salvation“ („simplex obedientia via ad salutem sit“) and this can be learned only from revelation, it follows that „Scripture has brought great consolation to mortals“ („sequitur Scripturam magnum admodum solamen mortalibus attulisse“) (TTP XV, 236). Spinoza then finishes the chapter with a passage stating that, without Scripture, the salvation of almost all would be in doubt: „Absolutely everyone can obey, while only very few, in comparison with the whole of humankind, acquire the practice of virtue under the guidance of reason alone, and thus if we did not have the testimony of Scripture, we would doubt of the salvation of almost everyone.“ („Quippe omnes absolute obedire poss4 See for instance Meyer’s characterization of the Reformed position in PSSI, chapters X–XI.
A A
unt, et non nisi paucissimi sunt, si cum toto genere comparentur, qui virtutis habitum ex solo rationis ductu acquirunt, adeoque, nisi hoc Scripturae testimonium haberemus, de omnium fere salute dubitaremus“) (TTP XV, 236 f.) Thus, given that the salvation of almost everyone would be in doubt, the dogma of theology has given great solace to mortals, and we would thus be wise to accede to the testimony of the Scripture which we have. Nevertheless, this is only true for almost everyone, implying that there are some few for whom salvation could be assured without this Scriptural testimony of the path to salvation through obedience alone.
9.3 Review of Some Commentators Should we take Spinoza at his word, in good faith? Leo Strauss thought not. In his early Spinoza’s Critique of Religion, Strauss focuses upon Spinoza’s claim that the „fundamental dogma of theology“ is that all can be saved by obedience alone. For Strauss, this dogma, which is „not accessible to reason“ shows that, „Spinoza thus expressly foregoes every attempt to reconcile religion – as he understands and recognizes it, and believes he finds it in Scripture – with his principles, which simply exclude all possibility of revelation“ (Strauss 1997, 246). While Strauss does cite Spinoza’s claim that we can only be „morally certain“ of the fundamental dogma of faith, he understands this as a moral and not an epistemic claim Strauss assimilates that of which we can be morally certain to the Golden Rule (love of neighbour), and implies that it is this truth and foundation for religion which is „contra-rational“ (ibid., 247). Thus, while Strauss did focus on the problems with Spinoza’s argument in this chapter, he missed the epistemic status of the category of „moral certainty“ in the Cartesian context of Spinoza’s writing, and thus assimilates Spinoza’s claim about salvation through obedience to one of the theoretical validity of morality in general (in line with a generally Nietzschean historiography of philosophy). Likewise, in the later „How to Study Spinoza’s Theological-Political Treatise“, Strauss claimed that Spinoza contradicts himself on precisely this point. Strauss showed that Spinoza claimed both that all can be saved by obedience, and that this cannot be known by natural knowledge, and claimed on the basis of this putative „contradiction“ that Spinoza must deny one
S’ R B
of the two (Strauss 1952, 170).5 However, as can be seen, this is not really a contradiction; Spinoza certainly claims that it is possible to be morally certain of things which cannot be known according to natural (i. e. deductive) knowledge, but this is not a contradiction. For Alexandre Matheron in Le Christ et le salut des ignorants chez Spinoza, the resolution of the issue lies in distinguishing two senses of „salvation“ (salus). Matheron is explicit about an interpretive premise: „a postulate, right away: Spinoza, in conformity with the idea that he has of the philosopher, does not lie ... he never says what he does not think“ (Matheron 1971, 149). Since Matheron accepts that Spinoza teaches that only those with intellectual knowledge of and love of God are saved „in the strong sense“, he is led to conclude that Spinoza accepts only with moral certainty that simple obedience saves in a „weak sense“ (ibid., 152). According to Matheron, this sense can be understood (on the basis of a reference to Pythagorean transmigration in a note by Leibniz of things heard from Tschirnhaus) as the transmigration and reincarnation of souls such that each will eventually attain to salvation „in the strong sense“ (ibid., 239). In this way he maintains two senses of the word „salus“ and thereby keeps Spinoza to his word. Graeme Hunter has argued that it is possible to retain a distinction between two senses of salvation without recourse to Pythagorean (or Neoplatonist) transmigration: „[Matheron’s] conclusion – that the accounts of salvation given in the Ethics and the TTP are compatible – can be reached more efficiently than he realizes, and in a way that stays closer to the surface sense of both the TTP and the Ethics. It is also possible to dispense with both of the hidden doctrines which Matheron finds it necessary to postulate – with scant textual evidence – in order to justify his conclusions.“ (Hunter 2005, 158) According to Hunter, the strong sense of salvation is „eternal salvation“ in accordance with the beatitude of part V of the Ethics, but Spinoza admits of a weaker or „temporal“ sense of salvation which would be „a passionate joy that arose from obedience to God but lasted at most for one’s lifetime“ (Hunter 2005, 160). This thus allows Hunter to accept Spinoza’s claim that all can be saved through obedience as true. Nevertheless, it as much as Matheron’s interpretation suffers from a lack of textual authority.
5 Strauss here appears to read Spinoza in accord with the method of contradiction which Maimonides tells his reader to follow in the Introduction to the Guide of the Perplexed.
A A
In another recent book, Spinoza on Philosophy, Religion, and Politics, Susan James has emphasized some of the strangeness of Spinoza’s account for his „separation“ of theology from philosophy, saying that the arguments look „a trif le suspect“ (James 2012, 219). She focuses upon the „one aspect“ of the theological teaching that is supposed to be „beyond philosophical reach“ – that all can be saved by obedience alone –, arguing that the Treatise thus „slightly redresses the uneven balance“ between philosophy and theology (ibid.). However, on James’s reading, Spinoza thereby „has not put the two practices on an equal footing, nor shown that neither is the handmaid of the other“ (221). In order to account for the strange claims, James refers to the tradition of Renaissance humanism in which Spinoza would have been steeped from his days in the Amsterdam Latin school of Franciscus van den Enden, and argues that the model underlying Spinoza’s putative „separation“ of philosophical from theological authority is Ciceronian. For Cicero, in De Officiis, there are two levels of virtue: „an everyday one fitted for ordinary people leading ordinary lives, and a more elevated one achievably only by philosophical sages“ and „the first [is] is a similitude of the second“ (James 2012, 225). On James’s account, Spinoza adapts this picture and „uses a Ciceronian model first to characterize theology and philosophy, and then to explicate the ways in which they are unequal“ (ibid.). According to James’s overall reading of the Treatise, in which its main opponents are the preachers and theologians of Calvinism, Spinoza adapts this Ciceronian model of salvation and beatitude as a challenge to that of Calvin: „Because Cicero’s position was widely known, it could be used as a means of contesting the Reformed Church’s interpretation of salvation. Revived and rewritten, it could function as a recognizable counterweight to Calvinism by offering an alternative to the Church’s forbidding doctrine of predestination. And this is exactly how the Treatise tacitly employs it.“ (ibid.) While the references to the humanist context and to Cicero are indeed illuminating this model of salvation in Spinoza’s usage cannot straightforwardly operate as a „counterweight“ to the „forbidding doctrine of predestination“. For, Spinoza’s own doctrine of election must also be compatible with his repeatedly expressed strict metaphysical necessitarianism, despite the article of Spinoza’s dogma straight-forwardly of the universal faith that God forgives sinners their transgressions. Indeed, metaphysical predestination of the elect might be precisely the Calvinism of Spinoza’s position on salvation. (See KV VI, where Spinoza connects his metaphysical necessitarianism to the doctrine of divine predestination.)
S’ R B
Thus, while Spinoza may indeed be arguing in a suspect way for his doctrine of theological salvation, it nevertheless cannot be in opposition to predestination. Put otherwise, according to Spinoza’s own doctrine, he must choose between the contradictory statements of Samuel and Jeremy in the Bible, while relegating the other to be ignored, salva charitate.
9.4 Conclusion There may nevertheless be a less conclusive reason to accept Spinoza’s claim in good faith. This is that of the epistemic constraints in ever demonstrating that there is an intention contrary to what is said hidden behind an explicit enunciation. While there may be a whole series of clues leading one to plausibly infer that a speaker or writer does not mean what they say, there can never be any demonstrative proof of it, short of an explicit sign which would make the inference completely certain. Descartes sums up this epistemic constraint well in the same section at the very end of the Principles of Philosophy in which he gives his account of „moral certainty“: „Suppose for example that someone wants to read a letter written in Latin but encoded so that the letters of the alphabet do not have their proper value, and he guesses that ... each letter should be replaced by the one immediately following it. If, by using this key, he can make up Latin words from the letters, he will be in no doubt that the true meaning of the letter is contained in these words. It is true that his knowledge is based merely on conjecture, and it is conceivable that the writer did not replace the original letters with their immediate successors in the alphabet, but with others, thus encoding quite a different message; but this possibility is so unlikely ... that it does not seem credible.“ (Descartes 1644, 290) As Descartes shows here, in the very context of his account of moral certainty, any ascription of deceptive intention (without an explicit sign) will always be probable inference and thus will always remain conjectural, even if it seems beyond a reasonable doubt. For this reason, and given Descartes’s and Spinoza’s stringent conditions on true knowledge, it seems prudent and wise to take Spinoza at his
A A
word, in good faith, and to accept his reason to be persuaded of the authority of Scripture, at least with moral certainty.
Bibliography Akkerman, F. 1999: Introduction, in: Tractatus theologico-politicus/Traité théologico-politique, trad. et notes par J. Lagrée et P.-F. Moreau, Paris. Descartes, R. 1637: Discourse de la méthode, in: R. Descartes, The Philosophical Writings of Descartes, 3 Volumes, ed. by J. Cottingham/R. Stoothoff/D. Murdoch, Cambridge et. al. 1985, Vol. 1, 111–151. – 1644: Principia philosophiae, in: R. Descartes, The Philosophical Writings of Descartes, 3 Volumes, ed. by J. Cottingham/R. Stoothoff/D. Murdoch, Cambridge et. al. 1985, Vol. 1, 193–291. Dumont, F. 1995: Raisons Communes. Montréal. Garrett, D. 2010: „Promising Ideas“: Hobbes and contract in Spinoza’s political philosophy, in: Y. Y. Melamed/M. A. Rosenthal (eds.), Spinoza’s Theological-Political Treatise. A Critical Guide, Cambridge, 192–209. Gueroult, M. 1968: Spinoza: Dieu, Volume I, Paris. Hunter, G. 2005: Radical Protestantism in Spinoza’s Thought, Chippenham. James, S. 2012: Spinoza on Philosophy, Religion, and Politics, New York. Lagrée, J./Moreau, P.-F. 1988: Introduction, in: L. Meyer, La Philosophie interprète de l’Écriture sainte, trad. par J. Lagrée et P.-F. Moreau, Collection „Horizons“, Paris 1988, 1–17. Matheron, A. 1971: Le Christ et le salut des ignorants chez Spinoza, Paris. Meyer, L. 2005: Philosophy as the Interpreter of Holy Scripture (1666) [Philosophia S. Scripturae interpres], trans. S. Shirley, intro. and notes by L. C. Rice and F. Pastijn, Milwaukee. Strauss, L. 1952: „How to Study Spinoza’s Theological-Political Treatise“, in: Ders., Persecution and the Art of Writing, New York, 142–201. – 1997: Spinoza’s Critique of Religion, trans. E. M. Sinclair, Chicago [orig. German 1930].
10 Otfried Höffe
Die Grundlagen des Staates. Kapitel 16 des Theologischpolitischen Traktat
Mit Kapitel 16 beginnt der zweite Teil des Theologisch-politischen Traktat. Der erste, theologische Teil suchte nachzuweisen, daß selbst der Prophetie und Offenbarung zufolge Frömmigkeit beziehungsweise Glaube und natürliche Vernunft, man kann ebenso sagen: daß autoritative Religion und freies Denken, getrennte, aber koexistenzfähige Bereiche sind. Der darauf folgende politische Teil enthält Spinozas Rechts- und Staatsphilosophie. Während nach dem ersten Teil gemäß dem erweiterten Buchtitel „die Freiheit zu philosophieren … ohne Schaden für die Frömmigkeit … zugestanden werden kann“, wird dasselbe jetzt in bezug auf „den Frieden im Staat“ gezeigt: Weder die Stabilität des Staates noch die Sicherheit und Freiheit seiner Bürger werden gefährdet. Der entsprechende Nachweis erfolgt in Form einer Genese von Recht und Staat, entfaltet im Rahmen einer naturalistischen Metaphysik, die hier im Traktat vom Begriff des Naturrechts ausgeht. Der umfangreichere theologische Teil erstreckte sich über 15 Kapitel; dem gegenüber gibt sich der staatsphilosophische Teil mit einem Drittel, fünf Kapiteln, zufrieden. Sie setzen bei den Grundlagen von Recht und Staat an (Kap. 16), weisen nach, daß es weder möglich noch nötig ist, alles auf die höchsten Gewalten zu übertragen (Kap. 17). Sie erschließen aus der Staatsverfassung und Geschichte der Hebräer einige politische Lehrsätze (Kap. 18), erklären, daß das Recht in geistlichen Dingen, einschließlich der Entscheidung über den äußeren religiösen Kult, allein den höchsten Gewalten zusteht (Kap. 19). Und sie enden mit
O H
dem Argumentationsziel des gesamten Traktat, daß in einem freien Staat nicht jeder handeln darf, wie er will, es ihm jedoch erlaubt ist, zu denken, was er will, und zu sagen, was er denkt (Kap. 20). Kapitel 16 enthält nun die Grundlagen und mit ihnen schon die wesentlichen Bausteine von Spinozas gesamter Rechts- und Staatsphilosophie. Diese steht in der Tradition von Hobbes’ De cive und Leviathan, sucht aber noch konsequenter eine von genuin normativen Elementen freie, insofern rein naturalistische Theorie. In dieser Hinsicht bricht sie mit der überlieferten Naturrechtstheorie, namentlich mit der bis in die spanische Spätscholastik reichenden aristotelischthomistischen Tradition. Spinoza behält zwar den überlieferten Ausdruck des Naturrechts bei, gibt ihm aber eine grundlegend neue, nämlich ausschließlich naturalistische Bedeutung. Man kann darin eine „semantische Revolution“ sehen (Walther 1985, 73). Diese beginnt jedoch schon vorher, spätestens bei Hobbes, und läßt sich, wird sich zeigen, als radikale Naturalisierung nicht leicht durchhalten. Kapitel 16 enthält jedenfalls sowohl normative als auch offenbarungsrechtliche Elemente, was sich auf eine Abschwächung des Naturalismus beläuft. Um die Grundbausteine von Spinozas Rechts- und Staatstheorie samt ihrem inneren Zusammenhang zum Sprechen zu bringen und dabei die Überzeugungskraft der Begriffe und Argumente zu prüfen, empfiehlt sich eine genaue, dem Text pedantisch folgende Interpretation. Auf Verweise zu anderen Stellen kann sie weithin verzichten.
10.1 Unklarheiten der Gliederung Die genaue Gliederung von Kapitel 16 ist nach dessen Programmhinweisen nicht klar. Die Kapitelüberschrift nennt vier Themen. Allerdings kann man das erste Thema, die Grundlagen des Staates, auch als Oberthema der drei anderen Themen verstehen, was eine Dreigliederung statt einer Viergliederung ergibt. Ihr zufolge sind, um die Grundlagen des Staates zu klären, (1) das natürliche Recht, (2) das bürgerliche, sprich: staatliche Recht und (3) das Recht der höchsten Gewalten, also die Souveränität, zu bestimmen. Gemäß dem ersten, einführenden Abschnitt bilden die Grundlagen des Staates aber kein Oberthema, vielmehr wird eine Zweiteilung angekündigt. Nachdem
D G S
im ersten Teil des Traktat die Philosophie von der Theologie getrennt sei und die Theologie jedem die Freiheit zu philosophieren gewähre, sei nun zu untersuchen, wie weit die Philosophiefreiheit sich im besten Staat erstrecke. Genau dafür seien zunächst das rein natürliche Recht des einzelnen und anschließend die Grundlagen des Staates zu erörtern. Unabhängig von dieser Unklarheit – Zwei-, Drei- oder Viergliederung – fällt bei der einführenden Programmskizze eine zweite Unklarheit auf: Zunächst ist vom besten Staat die Rede, danach wie schon in der Kapitelüberschrift vom bloßen Staat. Liest man den Text selbst, so folgen nach dem einführenden Abschnitt fünf Überlegungsreihen, womit sich eine Sechsteilung ergibt: Nach (1) dem einführenden Abschnitt behandeln (2) die Abschnitte 2–4 das natürliche Recht rein für sich, ohne Blick auf den Staat. Es besteht in einem Recht jedes Individuums auf alles, was einen Kriegszustand zur Folge hat, auch wenn nicht von Krieg, wohl aber vom Feind die Rede ist. (3) Die Abschnitte 5–7 begründen, warum man überhaupt und inwieweit jeder für sich das Recht auf alles beanspruche, was eine Gesellschaft mit höchster Gewalt notwendig macht. (4) Gemäß den Abschnitten 8–11 entsteht dabei eine demokratische Gewalt, so daß bis hier „die Grundlagen und das Recht des Staates“ als „dargelegt“ gelten (Abschn. 12). Auf den Zwischenabschnitt 12 folgen (5) in den Abschnitten 13–18 Begriffsbestimmungen zum bürgerlichen Privatrecht (Abschn. 13), zum Unrecht (Abschn. 14), zur Gerechtigkeit (Abschn. 15), zu Bundesgenossen (Abschn. 16), zum Feind (Abschn. 17) und zum Majestätsverbrechen (Abschn. 18). (6) Die letzten Abschnitte (19–22) stellen sich Einwänden und offenen Fragen. Will man der in der Überschrift angedeuteten Dreiteilung nahekommen, so müßte man die Einführung als Teil Null ansehen und die vorgeschlagenen Teile 2 und 3 zusammennehmen, so daß sich folgende Gliederung ergibt: (1) Natürliches Recht (Abschn. 2–7), (2) Souveränität (Abschn. 8–11), (3) staatliches Recht (Abschn. 12–18), woran sich (4) die in der Überschrift nicht genannten Einwände und offenen Fragen anschließen (Abschn. 19–22).
O H
10.2 Recht auf alles Gleich zu Beginn wird das natürliche Recht „Recht und Gesetz der Natur“ (ius iustitutum naturae) genannt und als eine von der Natur bestimmte (naturaliter determinatum) Regel definiert, auf eine gewisse Weise da und tätig zu sein (und in diesem Sinn zu beharren: Prinzip Selbsterhaltung). Im Fortgang der Überlegung erscheint allerdings ein Moment, das in dieser Regel nicht enthalten ist; es besteht im Recht auf alles. Vielleicht soll das Recht auf alles aber auch nichts anderes, vor allem nicht mehr als dieses bedeuten: Mangels jedes normativen Momentes ist nichts der eigenen naturalen Macht entzogen. Dieses Recht des Subjekts, als es selber zu leben und zu agieren, wird streng naturalistisch eingeführt. Es hat eine universale Reichweite, da es jedes natürliche Wesen, nicht nur den Menschen betrifft, dabei jedes Individuum, nicht etwa die jeweilige Art. Nach Spinozas ausdrücklich subhumanem Beispiel, Fische seien bestimmt, im Wasser zu schwimmen und als große Fische die kleineren zu fressen, scheint das Recht aber für biologische Arten spezifisch zu sein. Da das Recht im Lateinischen ius heißt, ist zwar der Anspruch eines (humanen oder subhumanen) Individuums gemeint. Dem Naturalismus treu und im Vermeiden jeder Teleologie bedeutet es aber keinen irgendwie gearteten moralischen oder anderweitig normativen Anspruch. Dieses Fehlen jeder normativen Perspektive wird im Abschnitt 3 besonders deutlich, denn danach ist es erlaubt, was die Moral zu verbieten pf legt: Man darf mit Gewalt, List oder wie auch immer agieren. Innerhalb des natürlichen Rechts werden selbst traditionell so unstrittige Naturrechtsgebote wie „Verträge sind zu halten“ („pacta sunt servanda“) nicht als normative Verbindlichkeiten anerkannt. Spinozas Hinweis, daß ein von einem Räuber erzwungenes Versprechen unverbindlich bleibt (Abschn. 6), ist freilich kein starkes Argument. Denn ein Versprechen ist weniger als ein Vertrag, und vor allem ist eine erzwungene Verabredung kaum verbindlich. Treffender ist der zweite Hinweis, daß man einem Versprechen, etwa zu fasten, sobald es als töricht erkannt ist, untreu werden darf. Nach Überwindung des Naturzustandes, im Staatszustand, verhält es sich freilich anders. Jetzt gibt es ein Basisversprechen, das einzuhalten ist: Die Treue, die man stillschweigend oder ausdrücklich der höchsten Gewalt gelobt hat, darf man nicht brechen (vgl. TTP XX, 311). Andernfalls wird man zum Aufrührer.
D G S
Das (vorstaatliche) Recht wird dagegen rein naturalistisch, ohne jedes Pf lichtmoment, definiert. Es besteht in nichts anderem als der eigenen naturalen Macht (potentia), ohne daß hier von rechtem oder unrechtem Gebrauch, nicht einmal von einer technischen oder pragmatischen Sachgerechtigkeit gesprochen werden kann. Das Recht der Natur erstreckt sich genau so weit wie ihre Macht; Recht und Macht der Natur sind koextensiv. Mangels jeden normativen Moments fällt das subjektive Recht mit seiner faktischen Durchsetzbarkeit zusammen; beide sind einerlei. Walther (1985, 83) sieht hier eine Differenz zu Hobbes: Während nach Hobbes im Naturzustand jeder ein Recht auf alles besitze (De cive, Kap. 1, § 10; vgl. Leviathan, Kap. 14),1 habe nach Spinoza „niemand ein Recht auf irgendetwas“. In Wahrheit dürfte es mindestens in der Sache keine Differenz geben. Denn eine Pointe Hobbes’ liegt doch in der Einsicht, daß das Recht auf alles sich bei näherer Betrachtung als ein Recht auf nichts erweist. Ein Unterschied liegt allenfalls darin, daß Spinoza das aktuelle Recht auf alles von der jeweiligen Macht abhängig macht, Hobbes hingegen nicht. Wenn aber Spinoza hier Hobbes überlegen sein möchte, müßte er Hobbes’ Argument entkräften, daß wegen Bündnissen und Hinterlist selbst die Schwachen die Starken töten können, weshalb es kein wesentliches Machtgefälle gebe. In seiner näheren Erläuterung setzt Spinoza die Natur mit Gott gleich, worin seine Metaphysik, ihr Pantheismus, anklingt: Das Recht der Natur, jetzt als ein Recht auf alles bestimmt, ist die Macht Gottes, der seinerseits ein Recht auf alles hat. Freilich gibt es eventuell einen leicht zu übersehenden und in seiner Tragweite unklaren Unterschied. Bei der Natur setzt Spinoza die Einschränkung hinzu, die bei Gott fehlt: „so weit ... wie ihre Macht sich erstreckt“ (TTP XVI, 238); die tatsächliche Allmacht kommt also ausschließlich Gott, nicht auch der Natur zu. Falls man diesen Unterschied anerkennt – die Interpretation dürfte freilich strittig sein –, drängen sich zwei Rückfragen auf. Einmal: Warum kann es trotz der Gleichsetzung der Natur mit Gott diese Differenz geben? Zum anderen: Welche generelle, insbesondere aber welche rechts- und staatstheoretische Folge hat diese Differenz?
1 Spinoza dürfte von Hobbes zunächst De cive, später aber auch andere Schriften, einschließlich dem Leviathan zur Kenntnis genommen haben.
O H
Weil die Macht der gesamten Natur in nichts anderem als der Macht aller Individuen besteht, hat auch jedes Individuum ein Recht auf alles, freilich erneut mit dem Zusatz: „was in seiner Macht steht“ (potest) (ebd.), also so weit wie seine Macht reicht. Diese Aussage stützt einen negativen Naturalismus, nämlich daß das Recht auf alles lediglich jede normative Begrenzung ausschließt. Allerdings fragt man sich, warum sich Spinoza die Argumentation nicht einfacher macht und schlicht erklärt: Rein naturaliter betrachtet, also ohne jede normative Perspektive, dürfen Individuen alles, was sie nach Maßgabe ihrer individuellen Macht vermögen. Wegen seines rein naturalistischen Rechtsbegriffs erkennt Spinoza triftigerweise keinen Unterschied zwischen humanen und subhumanen Wesen und bei den Menschen keinen zwischen Geisteskranken und geistig Gesunden an. Infolgedessen ist eine Differenz unerheblich, obwohl sie im nächsten Abschnitt bei der Differenz von schwächeren Katzen und mächtigen Löwen anklingt und sich dort auf weit mehr als bloß einen graduellen Unterschied beläuft. Der dort entscheidende Unterschied vom Weisen (sapiens) zum Unwissenden beziehungsweise Toren (ignarus) dürfte selbst mehr als nur eine Artdifferenz sein. Beide haben ihr eigenes, gattungseigenes Recht. Denn jener folgt der Vernunft (ratio), dieser einer Negation von Vernunft, der Begierde (appetitus). Wegen dieser Differenz kann sich Spinoza nicht wie Hobbes (z. B. Leviathan, Kap. 14) auf ein Gesetz der Natur berufen, das in einer von der Vernunft bestimmten Vorschrift bestehe. Der zumindest in der Ethik methodisch kompromißlose Rationalist Spinoza lehnt also hier, beim Nichtberücksichtigen der Differenz von Geisteskranken und geistig Gesunden, nachdrücklich jeden Rekurs auf die Ratio ab. Damit gibt er innerhalb seiner Metaphysik dem inhaltlichen Naturalismus einen Vorrang vor dem methodischen Rationalismus. Allerdings wird der inhaltliche Naturalismus im nächsten Teil, bei der Vertragstheorie (Abschn. 8–11), Schwierigkeiten haben, die für politische Stabilität unerläßliche Pf licht zu begründen, den Staatsvertrag einzuhalten. Zur Bekräftigung seiner Ansicht – welcher genau: des von aller Naturalität freien Rechts? – beruft sich Spinoza merkwürdigerweise auf eine Autorität. Die Merkwürdigkeit fällt umso größer aus, als er sich nicht auf einen Philosophen, hier etwa Hobbes’ Leviathan (Kap. 13, vorletzter Abschnitt) beruft, wonach es im Naturzustand weder Recht noch Unrecht gebe. Stattdessen fällt er aus der rein naturalistischen Argumentation heraus, da er eine religiöse Autorität benennt,
D G S
den Apostel Paulus. Gemeint ist eine Passage aus dem Römerbrief (Kap. 7, Vers 7 ff.), nach der Menschen, die unter der Herrschaft der Natur leben, keine Sünde, mithin keine moralischen Kriterien anerkennen. Die Berufung auf eine religiöse Autorität wäre im ersten Teil des Traktat, der Auseinandersetzung mit theologischen Vorurteilen gut vertretbar, im zweiten rechts- und staatstheoretischen Teil irritiert sie. Vielleicht hat Spinoza aber hier das rhetorische Motiv, für den Ansatz seiner Rechts- und Staatstheorie auch Theologen zu überzeugen. Freilich gewinnt er mit der Berufung auf einen Reformjuden, Paulus, eher Christen, während er bei (traditionellen) Juden mit Widerspruch zu rechnen hat. Im nächsten Abschnitt lautet die genaue These zu Beginn anders als am Ende. So vermißt man erneut die von einem methodischen Rationalisten erwartete, in Spinozas Hauptwerk, der Ethik, auch weithin praktizierte (geometrische) Klarheit und Stringenz. Für die Anfangsthese des nächsten Abschnitts braucht Spinoza nämlich ein Zusatzargument, auf das er in seiner Schlußthese zu Recht verzichtet: daß die Menschen, weil sie von Geburt an unwissend und nicht vernünftig sind, nicht angehalten sind, gemäß den Gesetzen der gesunden Vernunft (sana ratio) zu leben. Argumentativ genügte eine Behauptung, die sich an den vorausgehenden Abschnitt nahtlos anschlösse, nämlich daß beide, der Weise und der Unwissende, jeweils ihrer Natur, dort also der Vernunft, hier den Affekten, folgen dürften. Genauer müßte es schlicht heißen: Obwohl die intellektuelle Seite der bessere Teil unseres Seins ist (vgl. TTP IV, 70), folgen die einen de facto der Vernunft, die anderen ebenso de facto den Affekten; Punkt. Spinoza schließt daraus auf seine Variante von Hobbes’ Naturzustand als Kriegszustand: Jeder dürfe jeden anderen für seinen Feind (hostis) halten, der ihn an der Ausführung seiner Absicht hindere (Abschn. 3). Allerdings ist „Feind“ ein Begriff, der besser zu Vertrag und Staatszustand als zum Naturzustand paßt. Ferner sei nichts verboten, weder Streit noch Haß, noch Zorn (Abschn. 4). Die Tragweite beider Aussagen liegt auf der Hand, wird aber nicht ausgesprochen: Der Naturzustand ist nicht bloß instabil, er gefährdet auch die den Menschen leitende Antriebskraft, den Selbsterhaltungstrieb („conatus sese conservandi“).
O H
10.3 Vertragstheorie des Staates Die bloße Selbsterhaltung („conservare suum esse“) erweist sich somit als dysfunktional, was die von Hobbes bekannte Aufforderung zur Folge hat: „e statu naturali exeunudum est“, „aus dem Naturzustand muß man heraustreten“. Der dritte Teil von Kapitel 16 (Abschnitt 5–7) untersucht nun, wie es möglich wird, den Naturzustand um des natürlichen Zweckes der Selbsterhaltung willen zu überwinden. Spinoza setzt bei zwei heterogenen Aussagen an: Nach der ersten Aussage ist es weit nützlicher, nach den Vorschriften unserer Vernunft zu leben. Denn nur sie ziele auf den wahren Nutzen der Menschen, die sichere Selbsterhaltung. Damit wird zwar ein normatives Moment relevant, worin man ein Aufgeben des puren Naturalismus sehen kann. Es ist aber lediglich ein Moment pragmatischer, auf das eigene Wohl verpf lichteter oder sogar nur funktionaler Vernunft. Voll überzeugen kann Spinoza freilich nicht. Daß angeblich niemand bezweifeln kann, daß es nützlicher ist, der Vernunft zu folgen, mag „im Prinzip“ richtig sein, trifft realiter aber auf Unwissende beziehungsweise Toren nicht zu. Da diese sogar die Mehrheit der Menschen bilden sollen, kann die behauptete Unbezweifelbarkeit nicht überzeugen, es sei denn, im Ausdruck „bezweifeln“ sei die Vernunft schon präsent: Wer Zweifel erhebe, habe Vernunft, die wiederum deren überragenden Nutzen impliziere. Das Argument wandert dann freilich von einer bloß theoretischen Vernunft, die zu zweifeln versteht, zu einer auch, sogar primär praktischen Vernunft, die nach dem wahren Nutzen zu leben vermag. Plausibler ist es vermutlich, hier zwei Stufen von Vernunftdefizit zu unterscheiden: Die Unbeherrschten wissen um den Nutzen der Vernunftvorschriften, wegen ihrer Unbeherrschtheit befolgen sie sie jedoch nicht. Dem vollständig Unwissenden dagegen treten die Vernunftvorschriften gar nicht in den Blick. Spinozas zweite Aussage leuchtet eher ein: daß jeder so weit wie möglich, „sicher und ohne Furcht zu leben wünscht“ (TTP XVI, 240). Ebenso leuchtet der Zusatz ein, der als Erläuterung des „sicher leben“ gelten kann: daß man ohne wechselseitige Hilfe „höchst elend“ (241) lebt. Spinoza müßte sogar weiter gehen und einräumen, daß es Neugeborenen ohne die Hilfe von Erwachsenen noch schlechter ergeht, als höchst elend zu leben. Sie können nämlich weder überleben noch, wenn sie denn doch überleben, im Laufe der Zeit zu eigenständigen Subjekten heranwachsen.
D G S
Die Sicherheit und die Bequemlichkeit des Lebens werden übrigens schon in Kapitel 3 (53 f.) als Staatszweck genannt. Das der Gedankenfreiheit gewidmete Schlußkapitel (XX, 308 f.) erklärt allerdings die Freiheit zum wahren Zweck, was als Widerspruch oder, freundlicher, als Spannung, jedenfalls als ein ernstes Problem zu interpretieren ist. Es ist der Widerspruch oder die Spannung zwischen einem ebenso innovativen wie provokativen und einem eher konservativen Staatszweck: Nach Spinozas provokativem Leitziel kommt es sowohl der Religion als auch der Politik letztlich auf die Freiheit, damit auf die Eigenständigkeit und Mündigkeit der Bürger an; nach dem konventionellen, an Paternalismus oder Maternalismus erinnernden Ziel gibt man sich mit der Sicherheit und Bequemlichkeit des Lebens zufrieden. In der Argumentation, die sich an die zweite Aussage samt ihrem Zusatz anschließt, werden die zwei negativen Aussagen „ohne Furcht“ und „höchst elend“ ins Positive gewendet, sogar zu dessen Superlativ, einem „möglichst gut“ (optime) (TTP XVI, 240 f.) leben, extrapoliert. Selbst die so erweiterte Aussage genügt jedoch nicht für das anvisierte Beweisziel: daß die Menschen „sich notwendig vereinigen“ und einen Staat im Sinne eines Gemeinwesens (res publica) schaffen. Dazu braucht es denn doch die erste Aussage, nämlich den Nutzen einer Vernunftvorschrift, die die für sich unvernünftige Begierde einschränkt, sie darüber hinaus lenkt. Die Vernunft behält dabei ihre nur funktionale oder pragmatisch-instrumentelle Bedeutung. Die affektive Seite gibt das Ziel vor: „in Sicherheit und möglichst gut ... leben“ (240); die Vernunft qua Sachzwang bestimmt den zum Ziel notwendigen zweiteiligen Weg. Zum einen müssen die Menschen sich vereinigen und sich vertraglich auf die Vernunftvorschriften festlegen. Wie vor ihm schon Hobbes so ist Spinoza zumindest hier ein Vertragstheoretiker, ein Kontraktualist. Zum anderen ist die Begierde auf die (hier stillschweigend und an entsprechender Stelle von Hobbes, Leviathan, Kap. 14, her bekannte) Goldene Regel zu verpf lichten niemandem anzutun, was man selbst nicht angetan haben will („neminique facere, quod sibi fieri non vult“). Erneut taucht eine Schwierigkeit auf: Um das Beweisziel, die Notwendigkeit einer staatsförmigen Gesellschaft unter Bedingungen der Goldenen Regel, zu erreichen, braucht es ein gewisses Maß an Vernunft, das man bei den Unwissenden aber nicht voraussetzen kann. Man mag zwar auf Erziehung hoffen, sie spielt aber weder im Kapitel 16 noch in einem der anderen staatsphilosophischen Ka-
O H
pitel des Traktat eine Rolle. Gibt es also doch den zu Beginn von Abschnitt 8 bestrittenen Widerspruch gegen das natürliche Recht? Ist es erneut schwierig, einen reinen, von aller Normativität freien Naturalismus durchzuhalten? Zugunsten der Annahme von Vernunft finden sich zwei Argumente. Das erste ist sozialpsychologischer Natur und erklärt, niemand will als unvernünftig erscheinen, weshalb keiner der Vernunftvorschrift offen zu widersprechen wagt (Abschn. 5). Zum anderen wird eine pragmatische Vernunft unterstellt, die sogar den Rang eines allgemeingültigen Gesetzes der menschlichen Natur haben soll, daß niemand etwas, das er für gut hält, vernachlässigt, es sei denn wegen eines für größer gehaltenen Gutes oder Schadens. Allerdings muß er den größeren Nutzen oder Schaden einsehen, was Vernunft voraussetzt und Spinozas radikalen Naturalismus gefährdet. Die aus dem – jetzt eingeschränkten – Naturalismus gezogenen Schlußfolgerungen können hingegen überzeugen: Weil allein die Nützlichkeit zählt, ist ein Vertrag nur unter dieser Bedingung gültig, womit Spinoza eine utilitäre, pragmatische Vertragstheorie vertritt. Ewige Treue zu fordern, also ein kategorisches Gebot aufzustellen, gilt als töricht. Um die Vertragstreue nicht bloß wünschen und hoffen, sondern tatsächlich erwarten zu können, muß aus dem Vertragsbruch mehr Schaden als Nutzen folgen. Andernfalls kann niemand der Treue eines anderen sicher sein, was auch für den in Kapitel 20 (Abschn. 9) genannten Aufrührer gelten muß, auch wenn es dort nicht ausgesprochen wird. Allerdings drängt sich die Frage auf, ob sich mit einer bloß hypothetischen, utilitären Vertragstreue die zu einer Staatstheorie gehörende politische Stabilität begründen läßt. Nach Spinoza hat der Staat das Wohlergehen der Bürgerschaft zu maximieren. Gelingt ihm das nicht, muß er mit Gehorsamsverweigerung rechnen. Wer aber entscheidet über das Gelingen? Aus naturalistischer Perspektive jeder Bürger für sich, was ihn aber gegebenenfalls zu Protest sogar Widerstand animiert und dann zweifellos jeder politischen Stabilität spottet. Infolgedessen erreicht Spinoza selbst mit seinem bloß partiellen Naturalismus nicht sein Zwischenziel, die Begründung einer die Selbsterhaltung garantierenden politischen Stabilität.
D G S
10.4 Absolutistische Demokratie
Abschnitt 8 zieht zunächst eine Zwischenbilanz: Überträgt jeder seine ganze Macht auf die Gesellschaft, und zwar unmittelbar auf sie, womit Hobbes’ Theorem des Stellvertreters (Leviathan, Kap. 16) entfällt, so hat diese Gesellschaft, das Gemeinwesen, das höchste Recht der Natur auf alles. Sie besitzt die höchste Regierungsgewalt, die suprema potestas, die Souveränität. Einer derartigen Gewalt, sagt Spinoza, gehorcht jeder, sowohl der Vernünftige, der es aus freiem Willen tut, als auch der Nichtvernünftige, der aus Furcht vor härtester Bestrafung gehorcht. Der Autor gibt an dieser Stelle aber keine Rechtfertigung, vielleicht weil sie seines Erachtens auf der Hand liegt: Souverän ist, wer das innere und äußere Gewaltmonopol besitzt, also über die Ordnungsmacht im Inneren verfügt, damit Aufruhr und Bürgerkriege verhindert, und zusätzlich nach außen die Fähigkeit zum defensiven, notfalls auch offensiven Krieg besitzt. Das Recht zu einer derartigen Souveränität gebührt nach Spinoza einer Demokratie. Der Traktat ist daher, was eine verbreitete Geschichte des politischen Denkens unterschlägt, einer der wichtigsten demokratietheoretischen und zugleich freiheitstheoretischen Schriften der Frühaufklärung. Der Begriff der Demokratie ist allerdings vieldeutig. (1) Elementarerweise liegt dort eine Demokratie vor, wo alle Gewalt vom Volk ausgeht. (2) Bei einem anspruchsvolleren Begriff dient alle Gewalt dem Volk. (3) Bei einem noch anspruchsvolleren Begriff wird die Gewalt vom Volk ausgeübt, sei es direkt oder mittels regelmäßiger Wahl von Abgeordneten, also repräsentativ. (4) Ferner erwartet man, daß die Demokratie sich an das Recht und an eine Verfassung mit Grund- und Menschenrechten bindet. Man erwartet also eine konstitutionelle Demokratie. Nicht zuletzt sollen (5) ihre Gewalten geteilt sein. Spinozas Begriff der Demokratie, eine allgemeine Vereinigung (coetus universus) von Menschen, die zusammen (collegialiter) das höchste Recht auf alles hat, was sie vermag, entspricht am ehesten dem ersten, verfassungstheoretsich zwar entscheidenden, gehaltlich aber wenig anspruchsvollen Begriff. Wie bei ihm so bleibt auch bei Spinoza zumindest auf den ersten Blick offen, ob das Volk beziehungsweise das Zusammen kollektiv („alle zusammen“) oder distributiv („jeder einzelne“) zu verstehen ist. Da Spinoza vom Beginn dieses Kapitels, ab Abschnitt
O H
2, von jedem einzelnen Individuum spricht, legt sich allerdings das distributive Verständnis nahe. Im nächsten Teilabschnitt kommen zwei weitere Demokratiebegriffe hinzu, dabei als erstes der zweite der genannten Begriffe, die Herrschaft für das Volk, denn die höchste Gewalt hat laut Spinoza für das Gemeinwohl (bonum commune) zu sorgen. Offen bleibt erneut, jetzt beim Gemeinwohl, ob es (a) utilitaristisch nur als Kollektivwohl zu verstehen sei oder (b) rein distributiv, zugleich dem Rechts- und Gerechtigkeitsbegriff näher, als Wohl jedes einzelnen oder auch (c) in einer gewissen Verbindung von beiden, von Kollektiv- und Distributivwohl. Spinoza spricht auch von der „Mehrheit“ einer Versammlung (Abschn. 9) und „Mehrheit der gesamten Gesellschaft“ (Abschn. 11), worin der dritte Demokratiebegriff anklingt. Dabei läßt sich kaum entscheiden, ob er an eine direkte oder an eine repräsentative Demokratie denkt. Eher läßt der Text beide Optionen zu, ohne auf die entsprechende Alternative auch nur anzuspielen. Schließlich kommen selbst der vierte und der fünfte Demokratiebegriff ins Spiel, beide aber nur negativ, in ausdrücklicher Ablehnung. Für Spinoza ist die Demokratie ausdrücklich und nachdrücklich „an kein Gesetz gebunden“ (TTP XVI, 244), sie ist im wörtlichen Sinn absolutistisch, von allen rechtlichen Vorgaben losgelöst, während die Verpf lichtung auf das Gemeinwohl nicht zurückgenommen wird. Bei der Monarchie und Aristokratie diskutiert Spinoza auch deren konstitutionelle Gestalt und sieht sie für die Selbsterhaltung der jeweiligen Staatsform als unabdingbar an. Und nach Kapitel 17, schon in der Überschrift, kann niemand auf die höchste Gewalt alles übertragen. Ähnliche Argumente sind für die Demokratietheorie des Kapitels 16 denkbar, werden von Spinoza aber nicht vorgebracht. Der demokratische Absolutismus des Traktat beläuft sich also auf einen Superlativ von Staatsmacht, der die heute übliche, rechts- und verfassungsstaatliche Bindung, die konstitutionelle Demokratie, ausschließt. Indem der lediglich um seiner Lebensdienlichkeit, sogar Lebensnotwendigkeit erforderliche Staat alle Macht erhält, kann bei Spinoza von einer Zähmung der Demokratie durch kategorisch gültige Rechts- und Verfassungsvorgaben keine Rede sein. Selbst eine Teilung der Regierungsgewalt findet nicht statt. Trotzdem ist im nächsten Abschnitt von höchsten Gewalten im Plural die Rede, was als im Argumentationsgang widersprüchlich erscheint.
D G S
Anders sieht es bei der Ablehnung des vierten Demokratiebegriffs aus: Vom vorher eingeführten Recht auf alles her ist der behauptete Absolutismus der Demokratie, daß sie also weder auf Gesetz noch Verfassung noch Grund- und Menschenrechte verpf lichtet sei, nur folgerichtig. Der Text selbst führt zwei – zusätzliche? – Gründe dafür an: den Zwang der Notwendigkeit, womit er auf den Vorrang des größeren Gutes vor dem kleineren Gut anspielt (s. Abschn. 6), und das Anraten der Vernunft, was inhaltlich dasselbe bedeutet. Die Gefahr einer absolutistischen oder auch despotischen Demokratie, die einen unbedingten Gehorsam einfordert, sieht Spinoza durchaus. Denn die höchste Gewalt könne widersinnige Befehle geben. Er erklärt diese Möglichkeit aber für das kleinere Übel und den unbedingten Gehorsam für risikoarm, da die höchsten Gewalten „widersinnige Befehle“ aus zwei Gründen „nur selten“ gäben (TTP XVI, 244). Keiner der beiden Gründe ist prinzipieller Natur. Zum einen bestehe die höchste Gewalt nur solange, wie sie tatsächlich ihre Herrschaft behaupten könne, was unter Berufung auf Seneca (aus Die Trojanerinnen, Vers 258 ff.) im Fall einer Gewaltherrschaft nur sehr selten vorkomme. Zum anderen sei es fast ausgeschlossen, daß in einer hinreichend großen Versammlung sich „die Mehrheit“ in einer „Widersinnigkeit zusammenfindet“ (TTP XVI, 245). Daß Demagogen, wie schon antike Denker befürchten, zum Beispiel Platon (Politeia VIII, 563e–564d) und Aristoteles (Politik IV 4, 1292a5 ff.), eine Volksversammlung auf Abwege führen können oder, wie später John Stuart Mill (On Liberty, Abschn. 4) sagen wird, es zu einer „Tyrannis der Mehrheit“ kommen kann, zieht Spinoza nicht in Erwägung. Insofern erliegt er einem realitätsfernen demokratischen Optimismus. Einem demokratischen Absolutismus treu, spricht unser Philosoph folgerichtig nicht von Bürgern, sondern von Untertanen und unterwirft diese der genannten absoluten Gehorsamspf licht. Mitlaufend vertritt er Hobbes’ Imperativen- oder Befehlstheorie des Rechts (Leviathan, Kap. 26), nach der die höchste Gewalt Befehle erteilt. Zusätzlich kommt ein Rechtspositivismus ins Spiel, da Spinoza stillschweigend jede überpositive Kritik- und Korrekturinstanz ausschließt: Die Untertanen haben „nur das als Recht anzuerkennen ..., was der Souverän für Recht erklärt“ (TTP XVI, 245). Den naheliegenden Einwand, die Untertanen würden dabei zu Sklaven, wehrt Spinoza mit dem Argument ab, am meisten sei Sklave, wer sich von seiner Lust zu vorteilswidrigem Handeln hinreißen lasse, frei dagegen, wer bloß nach der
O H
Leitung der Vernunft lebe. Diese Antwort unterschlägt freilich die mittlere Position, daß man insofern zwar nicht superlativisch, aber doch komparativ ein Sklave sein kann, als man die mögliche Freiheit nicht voll ausschöpft. In vermindertem Maß bleibt nämlich Sklave, wer sich mit einer Basis- oder Elementarvernunft zufrieden gibt, die den Zusammenschluß zu irgendeinem, selbst absolutistischen Gemeinwesen gebietet. Den darin liegenden Rest von Sklaventum überwindet man nur innerhalb einer konstitutionellen Demokratie, die ein sowohl kollektiv als auch distributiv zu verstehendes Gemeinwohl als verbindliches normatives Kriterium anerkennt. Allein in einer konstitutionellen Demokratie fällt zusammen, was Spinozas Leitinteresse gebietet: Obwohl auch die rechts- und verfassungsstaatliche Demokratie nicht auf ein Zwangsrecht verzichtet, der Bürger insofern einer fremden Instanz unterworfen ist, kann er sich dank der genannten Vorgaben in dieser Instanz wiederfinden. Sie ist also bloß auf den ersten Blick eine fremde, bei näherer Betrachtung aber die eigene Instanz. Noch ein weiteres Problem wirft Spinozas demokratischer Absolutismus auf. Da der Autor die Möglichkeit, daß die höchsten Gewalten ihrer Gewalt verlustig gehen, sieht, muß er anerkennen, daß diese Möglichkeit auch wirklich wird. Das kann aber – nur? – auf eine Weise geschehen, die der strenge Absolutismus nicht vorsieht: Die Untertanen verweigern den Gehorsam, werden also zu Aufrührern.
10.5 Staatliches Recht Gemäß Abschnitt 12 sind durch die vorangegangenen Überlegungen die Grundlagen und das Recht des Staates dargelegt (vgl. TTP XVI, 247). Der Naturzustand ist durch einen Staatszustand, „bürgerliche[r] Zustand“ (status civilis) (ebd.) genannt, abgelöst und die dafür entscheidenden Begriffe sind geklärt. Die nächsten Abschnitte führen neue Begriffe ein. Der erste neue Begriff, das bürgerliche Privatrecht (Abschn. 13), erhält zwei Bestimmungen, die untereinander nicht so konf liktfrei sind, wie Spinoza unterstellt. Einerseits bestehe das bürgerliche Privatrecht in einer an das natürliche Recht erinnernden „Freiheit eines jeden, sich in seinem Zustand zu erhalten“, andererseits in dem, was der demokratische Absolutismus beinhaltet, nämlich
D G S
daß die Freiheit „von den Erlassen des Souveräns begrenzt“ (247) werde. Diese Erlasse brauchen aber nicht immer die individuelle Freiheit zu schützen. Der zweite neue Begriff, das Unrecht, ist wie bei Hobbes (Leviathan, Kap. 13, vorletzter Absatz), nur im bürgerlichen, nicht im natürlichen Zustand denkbar. Konsequenterweise bedeutet er, daß man einen den Erlassen der höchsten Gewalt widersprechenden Schaden erleidet (Abschn. 14). Der nächste der Gerechtigkeit gewidmete Abschnitt 15 bestimmt seinen Gegenstand traditionell als personale, nicht als institutionelle Gerechtigkeit. Näherhin wird sie als beharrliche Gesinnung definiert, jedem das zukommen zu lassen, was ihm nach dem Gesetz, allerdings nicht dem natürlichen, sondern dem bürgerlichen Gesetz zukommt. Darin klingt die vielzitierte Formel „suum cuique“ („Jedem das Seine“) an. Bekanntlich ist ihr näheres Verständnis strittig, da die Formel offen läßt, was denn unter dem Seinen zu verstehen ist. Spinoza löst nicht etwa den Streit, sondern entgeht ihm, da er das Seine vom Gesetz her bestimmt und unter dem Gesetz nicht etwa das oft kaum weniger strittige natürliche, vielmehr das positive („bürgerliche“) Gesetz versteht. Weiterhin bezieht er die Gerechtigkeitsgesinnung nicht auf irgendwen, auch nicht auf alle Menschen, die beispielsweise als Eltern, Kinder, Lehrer oder schlicht als Mitmenschen andere gemäß dem geltenden Recht behandeln sollen. Adressat des Gerechtigkeitsbegriffs sind diejenigen, die „eingesetzt sind, die Streitigkeiten“ unparteiisch, ohne Ansehen der Personen, „zu schlichten“, also die autorisierten Richter. Auffallend ist Spinozas konkretisierende Bemerkung. Denn sie wiederholt nicht die seit dem Kodex Hammurapi von vielen Gesetzgebern erhobene Forderung, auch den Armen und Schwachen ihr Recht zukommen zu lassen. Sie betrifft vielmehr die Reichen und wirft erstaunlicherweise den Richtern nicht deren Vorzugsbehandlung vor. Spinoza, selber gewiß nicht reich, also hier nicht Anwalt eigener Interessen, hält es vielmehr für ungerecht, wenn Richter, wie man hier konkretisieren darf, die Reichen beneiden. Denkt er dabei an die vielfach wohlhabenden Mitglieder seiner ehemaligen jüdischen Gemeinde, oder ist es ein Zeichen der von ihm auch persönlich gelebten Vernunft, den Reichtum, an dem er ohnehin desinteressiert ist, nicht zum Gegenstand eines unvernünftigen Affekts, des Neids, zu machen? Immerhin widerspräche er der für den Berufsstand des Richters konstitutiven Aufgabe, „alle gleich zu behandeln“.
O H
Sodann setzt Spinoza auf eine zunächst erstaunliche Weise die Gerechtigkeit mit der Billigkeit (aequitas) und die Ungerechtigkeit mit der Unbilligkeit gleich. Diese Gleichsetzung ist deshalb erstaunlich, weil es sich bei der Billigkeit nach der maßgeblichen, bis in die frühe Neuzeit, auch bis in Spinozas Zeit vorherrschenden Bestimmung des Aristoteles (Nikomachische Ethik, V 14) um ein für Spezialfälle erforderliches Korrektiv der Gerechtigkeit handelt. In Fällen, in denen die wörtliche Anwendung einer Rechtsbestimmung zu einem offensichtlichen Unrecht führt, soll nämlich die Billigkeit das Unrecht verhindern. Diese Aufgabe dürfte aber für die vorher geforderte Auslegung des Rechts als „richtige“ Auslegung wesentlich sein, was Spinozas Gleichsetzung eine gewisse Rechtfertigung gibt, auch wenn der Zusammenhang von Billigkeit und Gerechtigkeit treffender mit Aristoteles als Korrektiv zu bestimmen wäre. In diesem Korrektiv-Sinn liegt übrigens eine Bedeutung der lange Zeit beliebten Rechtsformel von „gerecht und billig Denkenden“.
10.6 Bundesgenossen, Feinde, Majestätsverbrechen In den nächsten drei Abschnitten 16, 17 und 18 führt Spinoza sukzessive drei für das Thema „bürgerliches Recht“ wichtige Begriffe ein. Der erste Begriff betrifft internationale Beziehungen: „Bundesgenossen“ verabreden vertraglich, aus Gründen der Gefahrenabwehr oder um irgendeines anderen Vorteils willen, „sich nicht gegenseitig zu verletzen, sondern im Gegenteil sich im Notfall zu helfen“ (248). Dabei bilden sie freilich keinen gemeinsamen Staat, denn nach Spinoza behält jeder Staat seine eigene Regierung (Abschn. 16). Die näheren Erläuterungen sind nicht notwendige Folgerungen der bisherigen Überlegungen. Mit der Berufung auf die Erfahrung erweist sich Spinoza hier als politischer Realist, vielleicht sogar als Machiavellist: Entfällt die Vertragsgrundlage, das Verhindern der Kriegsgefahr oder das Nichtmehrbestehen des Nutzens, so wird, sagt er, auch der Vertrag hinfällig, und zwar „ganz von selbst“, also nicht etwa erst nach förmlicher Kündigung. Obwohl Spinoza ab Kapitel 16 eine rein vernünftige, insofern doch säkulare Rechts- und Staatstheorie entwickelt, beruft er sich im Abschnitt 16 dieses Kapitels auf Frömmigkeit und Religion. Allerdings spricht er danach von einem Verbrechen, also nicht ganz konsequent von einem säkular definierten Verstoß
D G S
statt von dessen religiöser Entsprechung, einer Sünde: Hier durchaus machiavellistisch verbietet Spinoza dem Inhaber der Regierungsgewalt, „Versprechungen [zu] halten, die zu einer Schädigung seines Staates führen würden“. Das Hauptargument ist ebenfalls rein säkularer Natur: Der Betreffende bricht „die den Untertanen gelobte Treue, zu der er doch in erster Linie verpf lichtet ist“ (TTP XVI, 248). Dieses personale Argument könnte man um den institutionellen Aspekt ergänzen, um das normative Leitprinzip des Staates, das Gemeinwohl. Spinoza selber führt aber nur einen das personale Argument ergänzenden, die Verpf lichtung normativ verstärkenden Aspekt ein: daß die Treue zu halten „in der Regel höchst feierlich“ (ebd.) versprochen wird. In der Art dieses Versprechens klingt nun an, was einmal mehr den konsequenten Naturalismus gefährdet. Unter dem „heiligen“ Versprechen kann man sich nämlich kaum etwas anderes als eine kategorische Verbindlichkeit vorstellen, die überdies unter der nicht säkularen, sondern religiösen Qualifikation als „heilig“ erscheint. Andererseits spielt Spinoza auf die zu seiner Zeit selbstverständliche, noch heute weithin übliche Eidesformel an, bei der man sich auf Gott beruft, damals zusätzlich auf die Bibel schwört. Insofern bezieht sich Spinoza erneut auf Frömmigkeit und Religion, was für einen säkularen Theorieansatz nicht konsequent ist, gegenüber der politischen Realität aber überzeugt. Bundesgenossen haben wegen ihrer Leistungen, zu helfen und zu nützen, den Rang von außenpolitischen Freunden. Zusammen mit dem kurzen Kapitel 20 zum Begriff des Feindes finden wir hier die von Carl Schmitt (1932) bekannte, in der Regel diskreditierte politische Opposition von Freund und Feind. Wie Schmitt meint auch Spinoza nicht den Feind in Privatverhältnissen, den inimicus, sondern den hostis, also den bewaffneten und kriegsbereiten Feind, zu dem ein Staat, nicht das Individuum, in feindlicher Beziehung steht. Die Möglichkeit von einem derartigen öffentlichen Feind ist mindestens außenpolitisch nur mangels politischer Erfahrung zu leugnen. Und dort, wo politische Gruppen das Gemeinwesen gewaltsam (!) auf lösen wollen, ist auch innenpolitisch die Rede von Feinden nicht unsinnig. Spinoza schränkt den Ausdruck hostis wie üblich auf die Außenpolitik ein und vertritt dabei einen engeren Begriff. Dieser ist aber von seinem Thema, der Überwindung des auch außenpolitischen Naturzustandes her, geradezu geboten: Wer außerhalb des Staates lebend, zu diesem sich weder im Verhältnis des
O H
Bundesgenossen noch des Untertans befindet, ist ein Feind. Spinozas Begründung hebt auf die Differenz von Recht und Haß, damit stillschweigend auf die vom hostis zum inimicus ab. Haß spielt nämlich in privaten, das Recht dagegen in öffentlichen Verhältnissen eine Rolle. Gemäß seiner grundsätzlichen Betrachtung sieht Spinoza außenpolitisch nur zwei Möglichkeiten: Entweder erklären sich Staatsfremde zur Bundesgenossenschaft bereit, oder sie müssen sich unterwerfen lassen. Allerdings führt er dabei unbemerkt einen gegenüber dem Kapitel 19 zweifach bescheideneren Begriff ein. Zum einen braucht es „keine Form vertraglicher Übereinkunft“ („nullo contrahendi genere“: TTP XVI, 249), was weniger als ein ausdrücklicher Vertrag sein kann. Zum anderen wird inhaltlich kein wechselseitiger Nutzen, nicht einmal eine Art von Nichtangriffspakt erwähnt; es genügt, daß die eigene Regierung anerkannt wird. Das mit der Anerkennung Gemeinte bleibt freilich offen. Nun besteht nach den Abschnitten 8 und 9 die Regierung im Inbegriff der höchsten Gewalten, also der Souveränität. Eine Regierung anerkennen heißt daher, sie gegenüber „ihren Untertanen und dem eigenen Territorium als Souverän zu akzeptieren“ (vgl. TTP XVI, 248). Weil die Regierung der Souverän ist, darf man sagen: Sie anzuerkennen bedeutet, nicht in deren innere Angelegenheiten einzugreifen, folglich auch keinen Krieg gegen sie zu führen. Infolgedessen verwendet Spinoza zwei unterschiedliche Begriffe von Bundesgenossenschaft. In Abschnitt 17 vertritt er den bescheideneren, negativen Begriff: Der negative Bundesgenosse greift nicht in fremde Souveränität ein. Nach der anspruchsvolleren Bestimmung von Abschnitt 16 hilft der positive Bundesgenosse in Notfällen, was einen Beistand in Kriegssituationen einschließt; überdies erbringt er (weitere) Vorteile. Beim Leitbegriff des nächsten Abschnitts, dem Majestätsverbrechen („crimen laesae maiestatis“), kommt in der Sache Carl Schmitts innenpolitischer Feinbegriff ins Spiel, womit Schmitt endgültig beides, seine sachliche Originalität und das Recht auf die weit verbreitete, aber übereilte Kritik, verliert. Bei der Majestät ist nicht etwa an einen Monarchen zu denken, auch nicht an einen staatstheoretisch extrem geschrumpften, konstitutionell gebundenen Monarchen. Denn Spinozas Ausdruck für Staat ist res publica, also das Gemeinwesen qua Republik. Das genannte Verbrechen können nun lediglich Untertanen oder Bürger begehen, weil nur sie ihre Rechte, in Spinozas absolutistischer Demokratie: vorbehaltlos alle Rechte, übertragen haben. Und das Verbrechen
D G S
begeht, wer „das Recht des Souveräns in irgendeiner Weise an sich zu reißen oder auf eine[n] zu übertragen“ (249) versucht, zugespitzt: wer auf einen Umsturz hinarbeitet. Daß schon der Versuch strafbar ist, versteht sich, da bei vollbrachter Tat, wie Spinoza realistisch erklärt, „der Staat meistens zu spät eingreifen“ (ebd.) würde. Das Strafrecht gegenüber dem Majestätsverbrechen gründet also in nichts anderem als einem Recht auf kollektive Selbsterhaltung. Der schon fürs Individuum entscheidende Begriff, das uneingeschränkte Recht auf Selbsterhaltung, erhält hier eine zweite, nicht mehr individuelle, persönliche, sondern politisch-kollektive und öffentliche Dimension. Bei der näheren Ausgestaltung ist Spinoza konsequent streng: Nicht erst im großen Umsturzversuch wird die Majestät beziehungsweise Souveränität des Gemeinwesens angegriffen. Schon wer „nach eigenem Gutdünken und ohne Wissen der höchsten Versammlung ..., eine öffentliche Angelegenheit zu besorgen“ (249) unternommen hat, macht sich schuldig und verdient seine Verurteilung. Und dies gilt kategorisch, ohne eine konsequentialistische Entschuldbarkeit. Daß der Staat eventuell daraus einen Nutzen zieht, dürfte ein Grund sein – darf man ergänzen –, die Regierung zu beeinf lussen. Es müßte aber vorab geschehen und dann die Zustimmung suchen. Wer sich dieser Mühe entzieht, macht sich strafbar; Punkt. Für bürgerlichen Ungehorsam, selbst einen unter strengen Kautelen hat Spinozas absolutistische Demokratie keinen Platz.
10.7 Ein Einwand Die letzten vier Abschnitte, immerhin ein gutes Viertel von Kapitel 16, sind einer Aufgabe gewidmet, der sich Spinoza in seinem Hauptwerk, der Ethik, nicht unterzieht. Er setzt sich hier mit Einwänden auseinander, genau genommen nur mit einem einzigen, aber grundlegenden Einwand, den er in mehreren Schritten, daher mehreren Abschnitten sukzessive vertieft. Dem Einwand zufolge widerspricht die in Abschnitt 2 vertretene These dem offenbarten göttlichen Gesetz. Denn nach der These folgt, wer die Vernunft nicht gebraucht „im Naturzustand ... mit höchstem Recht der Natur“, also vollkommen legitimerweise, „nach den Gesetzen der Triebe“ (TTP XVI, 250) lebt, was aber, wenn diese Gesetze
O H
der Begierde anderen Menschen Schaden zufügen, dem göttlichen Gebot der Nächstenliebe zuwiderläuft. Auf zweierlei ist hier zu achten. Erstens darf man die Qualifikation des göttlichen Gesetzes als „offenbart“ nicht überlesen. Denn der Widerspruch betrifft nur diese Teilmenge, nicht die andere Teilmenge, das göttliche „natürliche“ Gesetz. Außerdem versucht Spinoza nicht den genannten Widerspruch mit dem Hinweis abzuschwächen, die Begierde könne auch zu Zuneigung führen. Noch weniger will er den Widerspruch bestreiten. Er erkennt ihn vielmehr an und löst ihn doch auf, allerdings in der den Traktat von Anfang an beherrschenden, nämlich die Offenbarung relativierenden Weise. Danach ist der Naturzustand in zweierlei Hinsicht, sowohl „der Natur“, mithin sachlich betrachtet, als auch „der Zeit nach“ (250), gegenüber dem offenbarten göttlichen Gebot, vorrangig. Der für beide Gesichtspunkte gemeinsame Grund liegt in einer wohlbestimmten Ignoranz. Unter anderem unter Berufung auf die Autorität des (Reformjuden) Paulus (besonders Römerbrief , Kap. 9, Vers 18) erklärt unser Philosoph, daß man von Natur aus, das heißt „unter Leitung der Vernunft“ (Abschn. 19 Fn.) zwar Gott zu lieben verbunden sei, die Verbindlichkeit aber keinen Rechtscharakter habe. Hier erscheint die Liebe zu Gott nicht als bloße Tugend, nicht als geschuldete Rechtspf licht, sondern als ein verdienstliches Mehr. Zugunsten des doppelten Vorrangs des Naturzustandes führt der nächste Abschnitt zusätzlich zum Nichtwissen im Naturzustand ein weiteres Argument an: „die Freiheit, in der wir alle geboren werden“ (TTP XVI, 250). Allerdings beruft sich Spinoza anschließend nur indirekt darauf. Er argumentiert nicht wirklich naturrechtlich, sondern in erneuter Abweichung davon – einem erneuten methodischen Rückfall? – offenbarungsrechtlich: Gott hat die Menschen durch einen Bund, also einen Vertrag verpf lichtet, was sowohl eine vorvertragliche Sachlage, die Conditio humana, als auch eine vorvertragliche Zeit voraussetzt. Der im Abschnitt 20 erweiterte Einwand stellt nicht weniger infrage als die den Traktat leitende These der Trennung von Offenbarung und natürlicher Vernunft, dabei zugleich von Religion und Staat. Der Einwand besagt nämlich, daß die höchsten Gewalten ebenso wie deren Untertanen an das göttliche Recht (hier ohne den Zusatz des „offenbarten“) gebunden seien, was der These widerspreche, nach dem natürlichen Recht sei „von Rechts wegen alles erlaubt“ (251). Die Entkräftung kommt dem Einwand zunächst weit entgegen: Im Naturzustand ist man durchaus an das geoffenbarte Recht gebunden, aber nicht etwa
D G S
schlechthin, kategorisch, sondern utilitär: weil es vorteilhafter und für das Heil notwendig ist. Und da kein kategorisches Gebot vorliegt, darf man, dann freilich „auf seine Gefahr“, von ihm abweichen. Infolgedessen darf die höchste Gewalt „bloß nach [ihrem] eigenen Beschluß“ agieren und braucht niemanden „als Richter“ (ebd.), mithin niemanden als übergeordnete Gewalt anzuerkennen. Ob sich die höchste Gewalt klugerweise an das göttliche Recht bindet oder nicht, bleibt ihr also vollkommen freigestellt, was die Trennungsthese erneut in ihr Recht setzt. Im Fortgang präzisiert der Abschnitt: Während das vorpositive Recht, das Naturrecht, von den Gesetzen der Natur abhängt, „die sich nicht ohnehin nach der Religion ... richten“, hängt das bürgerliche, sprich das positive, staatliche Recht nur vom eigenen Ratschluß der höchsten Staatsgewalt ab. Wie aber verhält es sich, geht die Auseinandersetzung mit dem Einwand weiter, wenn Befehle der Staatsgewalt der Religion oder dem durch den Bund gelobten Gehorsam gegen Gott widersprechen? Da er in den folgenden Kapiteln diese Frage näher erörtert, kann sich Spinoza hier mit einer kurzen Antwort begnügen, gegeben in zwei Teilen. Nach der ersten, prinzipielleren Teilantwort muß man zwar „Gott über alles ... gehorchen“ (252), vorausgesetzt, daß man eine unzweifelhafte Offenbarung besitzt. Weil aber, so die zweite, erfahrungsbasierte Teilantwort, in Religionsdingen die Menschen am meisten irren und besonders heftig miteinander wetteifern, würde das Recht des Staates vom momentanen Urteil und Affekt des einzelnen abhängig gemacht. Außerdem könnte man Glaube oder Aberglaube zum Vorwand nehmen, sich alles zu erlauben. Aus beiden Gründen – Spinoza selbst sieht allerdings nicht die Zweiheit seiner Argumentation – würde „das Recht des Staates ... zutiefst verletzt“ (ebd.). Konsequenterweise vertritt er die in philosophischer Hinsicht Hobbessche und, politisch gesagt, staatskirchenrechtliche, sowohl anglikanische als auch in vielen kontinentaleuropäischen, einschließlich skandinavischen Ländern praktizierte Lösung: Die Staatsgewalt ist nicht bloß für die typisch weltlichen Dinge entscheidungskompetent, sondern auch für die Religionsangelegenheiten, sofern sie das Handeln betreffen. Der vorletzte Abschnitt, den der letzte komplettiert, überlegt, wie man zu einer von Heiden – gemeint sind alle Nichtjuden und Nichtchristen, also beispielsweise Türken und Japaner – ausgeübten Regierungsgewalt sich zu stellen habe. Spinoza nennt zwei alternative Optionen, die er beide schon von den Juden
O H
während ihrer babylonischen Gefangenschaft praktiziert sieht: Entweder verweigert man jeden Vertrag und ist bereit, das Äußerste zu erdulden, oder man schließt einen Vertrag, gibt dann aber sein Recht, sich und seine Religion zu verteidigen, auf und hat Gehorsam zu leisten. Erstaunlicherweise stellt sich Spinoza bei der zweiten Option nur Tyrannen vor. So religionstolerante heidnische Herrscher wie den Perserkönig Kyros zieht er nicht in Erwägung. Und gegen den Tyrannen erlaubt er Gehorsamsverweigerung, mithin denn doch eine Auf lehnung. Allerdings macht er dafür eine starke, zudem seiner Skepsis gegen Offenbarung zuwiderlaufende Voraussetzung: Gott muß „mit einer unzweifelhaften Offenbarung seine besondere Hilfe gegen den Tyrannen verheißen“ (253). Überblickt man die vorangehende Detailinterpretation, so erlaubt sie für Kapitel 16 diese sehr vorläufige Bilanz: Spinoza entwickelt ziemlich konzis und weithin überzeugend Schritt für Schritt die Grundbausteine seiner Rechts- und Staatstheorie. Die dabei verwendeten Begriffe sind aber nicht immer hinreichend klar, auch die Argumente sind es nicht; vor allem sind sie weder rein offenbarungsfreier, bloß vernunfttheoretischer noch im Rahmen der Vernunft rein naturalistischer Natur. Da sich gewisse normative „Reste“ finden, erreicht Spinoza noch nicht die volle begriff liche und argumentative Klarheit. Darin dürfte ein Grund liegen, fraglos jedoch nicht der einzige, warum unser Denker einige Jahre später an einem weiteren staatsphilosophischen Text, dem Politischen Traktat, arbeitet. Eine vollständig naturalistische, von aller Normativität freie Rechts- und Staatsbegründung ist ihm jedenfalls im Theologisch-politischen Traktat nicht gelungen.
Literatur Aristoteles: Nikomachische Ethik, übers. u. hrsg. v. U. Wolf, Reinbek 2006; griech.: Ethica Nicomachea, hrsg. v. I. Bywater, Oyford 1890 (neuste Auf lage: Cambridge 2010). – : Politik, nach der Übers. v. F Susemihl m. Einl., Bibliogr. und zusätzl. Anm. v. W. Kullmann auf der Grundlage der Bearb. v. N. Tsouyopoulos und E. Grassi; neu hrsg. v. U. Wolf, Reinbek 1994; griech.: Politica, hrsg. v. W. D. Ross, Oxford 1957 (15. Nachdruck: Oxford 2009). Hobbes, Th. 1984: De cive. The English Version, ed. by H. Warrender, Oxford; dt.: Vom Bürger, in: Ders., Vom Menschen – Vom Bürger. Elemente der Philosophie II/III, übers. v. M. FrischeisenKöhler, hrsg. v. G. Gawlick, Hamburg 1994, 59–327.
D G S
– 11 2011: Leviathan, hrsg. u. eingel. v. I. Fetscher, Frankfurt/M; engl: Leviathan, hrsg. v. C. B. Macpherson, London 1968. Mill, J. S. 1859: Über die Freiheit, übers. v. B. Lemke, mit Anh. u. Nachw. hrsg. v. M. Schlenke, Stuttgart 1988. Platon: Der Staat, hrsg. v. G. Eigler, übers. v. F Schleiermacher, Darmstadt 1971. Schmitt, C. 1932: Der Begriff des Politischen, Berlin. Seneca: Die Trojanerinnen, in: Ders.: Sämtliche Tragödien, lat./dt., übers. u. erl. v. Th. Thomann, Bd. 1, Zürich/Stuttgart, 157–237. Walther, M. 1985: Die Transformation des Naturrechts in der Rechtsphilosophie Spinozas, in: Giancotti u. a. (Hrsg.), Studia Spinoziana 1: Spinoza’s Philosophy of Society, Würzburg, 73–104.
11 Yitzhak Y. Melamed
Spinoza’s Respublica divina The Rise and Fall, Virtues and Vices of the Hebrew Republic (Chapter 17–18)
Chapters 17 and 18 of the Tractatus theologico-politicus constitute a textual unit in which Spinoza submits the case of the ancient Hebrew state to close examination. This is not the work of a historian, at least not in any sense that we, twenty-first century readers, would recognize as such. Many of Spinoza’s claims in these chapters are highly speculative, and seem to be poorly backed by historical evidence (Cf. Verbeek 2003, 126). Other claims are broad-brush, ahistorical generalizations: for example, in a marginal note (to be discussed shortly), Spinoza refers to his Jewish contemporaries as if they were identical with the ancient Hebrews. Projections from Spinoza’s own experience of his Jewish and Dutch contemporaries are quite common, and the Erastian lesson that Spinoza attempts to draw from his „history“ of the ancient Hebrew state is all too conspicuous. Even Spinoza’s philosophical arguments in these two chapters are not uniformly convincing, as I will attempt to show. Yet in spite of all these faults, the two chapters are a masterpiece of their own kind: a case study of the psychological foundations of politics and religion. The work that comes closest in my mind is Freud’s Der Mann Moses und die monotheistische Religion (1939). The two works are similar not only in terms of their chronological subject matter – the Hebrews of Moses’s time – but also in their attempt to reconstruct the communal psyche of the Hebrews in order to demonstrate their respective social theories about the foundation of civilization. Needless to say, there are numerous differences between the two
Y Y. M
works, not the least of which are their distinct aims and the very different political contexts in which they were produced. We will return to this comparison with Freud’s Moses and Monotheism toward the end of the essay, but let me first stage the background for our discussion. Chapter 16 of the Tractatus begins a new section of the book which primarily deals with the foundations of Spinoza’s political theory and the relation between religion and the state. In this chapter Spinoza presents an outline of his political theory and his understanding of key notions such as right, power, the state of nature, the social contract, sovereignty, democracy, and justice. The title of chapter 17 announces its aim and focus: „showing that no one can transfer everything to the Supreme Power, and that this is not necessary; on the Hebrew Republic, as it was during the life of Moses, and after his death, before they elected Kings, and on its excellence; and finally, on the causes why the divine Republic [Respublica divina] could perish, and could hardly survive without rebellions“ (cf. TTP XVII, 254).1 The far less ambitious title of the eighteenth chapter states that in it „certain Political doctrines are inferred from the Republic and history of the Hebrews“ (cf. TTP XVIII, 282). Essentially, the two chapters present a surprising, ironic, and penetrating reading of the story of the divine Hebrew Republic, a reading which highlights both how much and how little was achieved by the use of the fantastic political device of attributing divine sanctification to the state and its sovereign.
11.1 „It’s obedience which makes the subject, not the reason for the obedience“ In the 16th chapter of the Tractatus Spinoza argues that the right of any individual extends as far as his power does (cf. TTP XVI, 238), and that it is „a universal law of human nature that no one neglects to pursue what he judges to be good, 1 Unless otherwise marked, all quotes from the TTP are taken from the drafts of Edwin Curley’s translation of these works, and I thank him for the permission to use this superb translation. I have relied on Gebhardt’s critical edition (Spinoza Opera, 4 vols., Heidelberg 1925) for the Latin text of Spinoza. Page references are given to Bartuschat’s German translation of the TTP (Baruch de Spinoza. Theologisch-politischer Traktat, Hamburg 2012). I am greatly indebted to Zev Harvey, Nick Kauffman, Oded Schechter, and Theo Verbeek, for their helpful comments on earlier drafts of this paper.
S’ R
unless he hopes for a greater good, or fears a greater harm“ (242). From this Spinoza concludes that agreements have force only if it is in our interest to keep them. These realistic, illusion-free foundations of Spinoza’s political philosophy explain his open rejection of Hobbes’s theory of the social contract: for Spinoza we never transcend the state of nature (Ep 50). Like all other things, the rights of the sovereign in Spinoza’s state extend as far his powers (cf. TTP XVI, 245). This may, at first, seem like granting the sovereign an unlimited right to all things (and indeed Spinoza warns his readers that we are obliged to carry out the commands of the sovereign, however absurd they may be (245)), but upon closer examination, it is clear that mortal sovereigns, having limited powers, are equally limited in their rights. The sovereign may order me to turn the square into a circle, but alas this task is beyond my power, and consequently, beyond his power and right. Similarly, Spinoza argues, „the supreme power would act in vain if he commanded a subject to hate someone who had joined the subject to himself by a benefit, or to love someone who had harmed him, or not to be offended by insults, or not to desire to be freed from fear“ (cf. TTP XVII, 254). In other words, as powerful as the sovereign may be, he had better be aware of what is, and is not, possible according to the laws of logic, the laws of nature, and particularly, the laws of human nature. Knowledge of the laws of human nature should make the sovereign realize that ruthless tyranny is not likely to last long (cf. TTP V, 88), and that if the state wishes to control the hearts and minds of its people, it had better achieve this goal not through compulsion, but rather with more sophisticated, less transparent, and less violent measures. Obedience to the state can be achieved by the binding of love or reverence, just as much as through compulsion and fear (cf. TTP XVII, 255), but since fear is also certain to generate resentment and hate in the subjects’ minds, it is the least reliable measure for securing a constant and peaceful obedience. What are the aims of Spinoza’s state? Paraphrasing Vergil’s locution, Spinoza writes: „To establish the state so that there’s no place for fraud – to establish everything so that everyone, whatever his mentality, prefers the public right to private advantage, this is the task, this is our concern“ (cf. TTP XVII, 257). Spinoza has very little sympathy for the masses which are governed by the affects, not reason, and therefore can only be restrained by opposed affects (cf. E IV,
Y Y. M
prop. 37, scholium 2, 443 ff.). For this reason, Spinoza’s political philosophy is grounded in an economy of human emotions. Remarkably, Spinoza believes that a sophisticated sovereign may manipulate the minds of the masses quite radically: „Without any intellectual incoherence, we can conceive men who believe, love, hate, disdain, or are overcome by any kind of affect whatever, solely in accordance with the right of the state“ (cf. TTP XVII, 256; italics added). Spinoza also believes that the greatest threat to the state is almost always internal, and that rulers are in far more danger from their own subjects than from external enemies (cf. TTP XVII, 257 f.). This state of things makes the need for a sophisticated, non-violent means of controlling the masses all the more pressing.
11.2 „Would that the Indians also believed me to be a God“ Of all the political devices aimed at manipulating the masses, Spinoza is most impressed by the ascription of divine authority, or even divine nature, to sovereigns. Addressing the numerous cases of ancient rulers who demanded to be worshiped as gods, Spinoza explains this phenomenon not as insane hubris and idolatry – as both Jews and Christians saw it – but rather as shrewd, well-calculated policy. Quoting the Roman historian, Quintus Curtius Rufus, Spinoza scrutinizes Alexander’s response to Hermolaus when the latter reproached Alexander for wishing to be hailed as the son of Jupiter: „It was almost enough to make me laugh when Hermolaus asked me to reject Jupiter, by whose oracle I’m recognized [as his son]. Are even the answers of the Gods in my power? He offered me the name of son.“ At this point, Spinoza interpolates and asks the reader to note well Alexander’s next sentences: „To accept it was hardly unhelpful to the affairs we’re engaged in. Would that the Indians also believed me to be a God. For wars depend on reputation, and often a false belief has been just as effective as a true one“ (cf. TTP XVII, 258; Spinoza here quotes Quintus Curtius VIII, 8). Having the sovereign recognized as God’s representative on earth yields sweeping political benefits and repercussions, for it is one thing to fight or challenge a mortal ruler, quite another to oppose the
S’ R
divine.2 Spinoza suggests that this political device can be used in various manners, and with various degrees of shrewdness, and he notes that not all people are likely to be deceived by its coarser variants (cf. TTP XVII, 259). The stratagem of the ancient Hebrew state, while clearly distinct from the ancient cult of the ruler, went much further, according to Spinoza, in assimilating political and divine authority.
11.3 The Hebrew State at the Time of Moses The condition of the Hebrews upon their exodus from Egypt provides, for Spinoza, an example of a human multitude living under no law. Having escaped slavery, they had the power to decide whether to institute new laws, keep their unadulterated natural right, or transfer it to someone else (TTP XVII, 259 f.; cf. V, 88 f. ). Upon Moses’s advice they decided to transfer their rights collectively, not to any mortal, but to God. Spinoza stresses that this transfer of rights to God „was made in the same way we have conceived it to be done in ordinary society“ (TTP III, 261). It was an explicit covenant through which the Hebrews freely agreed to transfer their rights and to abide only by laws established through prophetic revelation. Spinoza’s insistence that the Hebrews freely chose to adopt the covenant is not trivial, since a famous midrashic source suggests that they were compelled under threat to accept it.3 Spinoza could not adopt this view, since it was essential for his argument to show that the covenant was binding (i. e., that it was considered as such by the Hebrews). The result of this unique event was a political arrangement that was equally unique. „God alone, then, had sovereignty over the Hebrews. By the force of the covenant this [state] alone was rightly called the Kingdom of God [Regnum Dei], and God was rightly called also the King of the Hebrews [Rex Hebraeorum]. As a result the enemies of this state [were rightly called] enemies of God, and citizens who wanted to usurp his authority [were rightly held] guilty of treason against 2 Cf. Spinoza’s claim in chapter 5 that for a monarchy to be stable, the monarch „ought to have something above ordinary human nature. If he does not surpass ordinary human nature, he at least must strive with all his might to persuade the common people of this“ (cf. TTP V, 88). 3 See Babylonian Talmud, Tractate Shabbat, 88a. According to one of the opinions cited in this source, it was only at the time of Esther that the Jews freely accepted the Torah.
Y Y. M
God’s majesty. And finally, the laws of the state [were rightly called] laws and commands of God [jura & mandata Dei]“ (TTP XVII, 260 f.). Attempting to characterize this first stage of the Hebrew state, in which civil and religious law were strictly identical, Spinoza suggests that it may be properly called a theocracy, since God was the Hebrews’ only sovereign. Yet, claims Spinoza, this political arrangement was also quite close to democracy, since all citizens were equal, and had an equal right to consult God and interpret God’s laws. Here, Spinoza is following a long, common (though not exclusive), line in traditional Jewish literature, according to which divine and human dominion are taken as essentially contradictory.4 Hence, the Kingdom of God (or Theocracy) would not only be compatible with democracy (i. e., the lack of human dominion over others), but would actually require it. According to Spinoza this first stage of the Hebrew state, in which all citizens could approach God equally, lasted for only a brief time, since when God was revealed at Mt. Sinai the Hebrews were completely terrified by the experience, and immediately asked Moses to serve as mediator between them and God (Deut 18, 16 and 5, 24–27). As a result, Spinoza claims, they abolished their first covenant, transferred to Moses the right to consult God, and made him God’s sole representative among the Hebrews (cf. TTP XVII, 262). Spinoza notes that the doctrines of the Hebrews’ religion (which were also the state’s civil laws) were commands and obligations and not any speculative teachings (cf. TTP XVII, 261). This point would serve Spinoza’s later argument that the state should not intervene in purely philosophical disputes (cf. TTP XVIII, 287). The vast proliferation of commandments in the Hebrew religion had the distinct function of training the subjects to be obedient (TTP XVII, 274). Spinoza stresses that had Moses chosen a successor who would have inherited all of his powers, this second stage of the Hebrew state could have been considered a genuine monarchy, indeed, a very powerful monarchy, since the subjects of this state would consider obedience to the monarch tantamount to obedience 4 This tradition can be traced back to various biblical passages, such as scripture’s justification for the severe restrictions on slavery: „For the children of Israel are my slaves“ (Lev 25, 55), which the talmudists explicate: „they are my slaves, and not slaves to slaves“ (Babylonian Talmud, Bava Metzia, 10a). This topos has wide repercussions in rabbinic literature, Jewish philosophy (see, for example, Harvey 2012), and even poetry (see Yehuda Halevy’s poem „Avdey Zman“ [Slaves of Time]). For a similar view of God’s kingdom in Hobbes, see Harvey 2006, 318.
S’ R
to God. However, instead of choosing one successor Moses left to his successors a form of state in which authority was divided between the high priest, who retained the sole right to interpret the law and communicate with God, and a supreme commander, who administered the state according to the law (cf. TTP XVII, 262 f.). Before we turn to examine Spinoza’s portrayal of the Hebrew state after the death of Moses, let me point out a noteworthy discrepancy between Spinoza’s description of the early stages of the Hebrew state and the biblical text. Spinoza’s claim that before the revelation at Sinai, the Hebrews all had an equal right to consult God, just like Moses, f lies in the face of the biblical narrative of the events before Sinai. In chapters 15–18 of Exodus, it is only Moses and not any other Hebrew who consults and approaches God. Even when the Hebrews complain about their condition after the exodus from Egypt, they do not approach God directly, but turn to Moses, and it is only Moses who then approaches God (see Ex 16, 2–4 and 17, 2–4). The text makes this point very clear, and it seems that Spinoza must have had an important didactic purpose for introducing the early egalitarian stage of the Hebrew state, which is barely backed by the biblical text.
11.4 The Hebrew State after Moses Following Moses’s death, claims Spinoza, the Hebrew state transformed into another political arrangement in which power was split between the Priests and Levites, on the one hand, and the tribe leaders and supreme army commander, on the other. The first were the courtiers of the tabernacle, the divine court (cf. TTP XVII, 263), and the chief priest was the sole interpreter of the word of God. The leaders of the twelve tribes and the supreme commander administered the state and army, but could not consult God directly, but only through the mediation of the high priest. Spinoza provides a detailed and sympathetic account of the checks and balances that resulted from this division of power. The Levites, the divine courtiers, were fed and maintained by the mandatory gifts of the other Hebrews. Their wellbeing was secured, yet they were not allowed to own any land of their own (cf. XVII, 264). Spinoza’s account of this division of power between the religious authority of the Priests and Levites, and the political authority of the tribe leaders, does not
Y Y. M
fit well either with scripture or with Spinoza’s own claims elsewhere. According to the biblical narrative (which Spinoza accepts in XVII, 264 and 276 f.), the Levites and Priests were elected to their positions during Moses’s time. Hence, if any division of power resulted from these appointments, Spinoza should have avoided ascribing to Moses all religious and political powers. Interestingly, Spinoza is completely silent about the fact that Moses, the Hebrews’ sole human ruler, was not permitted to enter the Land of Israel. The period of Joshua, the political and military leader who succeeded Moses and led the armies of the Hebrews in their conquest of Canaan, constitutes another distinct phase in Spinoza’s account of the development of the Hebrew state. After Joshua’s death, there was no need for a supreme leader who would command all the tribes, and the Hebrew state assumed the form of a federacy, one not that different, Spinoza notes, from the Sovereign Federate States of the Netherlands of his own time (cf. TTP XVII, 267). In its last phase the Hebrew state deteriorated into a regular monarchy. In agreement with scripture, Spinoza describes the election of Saul (1 Sam 8, 6–8), the first mortal king, as a desertion of the divine law (cf. TTP XVII, 279 f.). We will return to this period when we discuss the decline of the Hebrew state.
11.5 Spinoza’s Ahistorical History Overall, Spinoza’s discussion of the Hebrew state in its various phases portrays it as an exceptional political arrangement that is exceedingly successful at achieving the loyalty and devotion of its citizens, restraining the sovereign’s power, and securing internal peace and equality.5 It manages this through a sophisticated appeal to divine authority in its various provisions. The rhetoric of Spinoza’s text attests to his unconcealed admiration for some of the achievements of the Hebrew state: „Nowhere did the citizens possess their property with a greater right than did the subjects of this state, who, with the leader, had an equal share 5 There is some tension between this rather positive depiction of the Hebrew state and Spinoza’s insinuation in chapter 3 of the TTP that the success of the Hebrew state was due to luck only, or in Spinoza’s own words, „solely through God’s external assistance“ (TTP III, 54).
S’ R
of the lands and fields.6 Each one was the everlasting lord of his own share. If poverty compelled anyone to sell his estate or field, it had to be restored to him once again when the jubilee year came … Nowhere could poverty be more bearable than where the people had to cultivate, with the utmost piety, loving-kindness towards their neighbor (i. e., towards their fellow citizens), so that God, their King, would favor them“ (TTP XVII, 274). Spinoza discusses various measures that helped achieve such an egalitarian and restrained society. One of these was reliance on a citizen army rather than mercenaries. Spinoza thought that this measure would significantly limit the ability of the leaders to oppress the people or launch unnecessary wars (cf. TTP XVII, 269 ff.). Well, today we know better; we know that popular excitement, patriotism, and nationalism can easily make a citizen army outdo any mercenaries in barbarism and war enthusiasm. In addition to admiring the accomplishments of the Hebrew society, Spinoza also portrays it as xenophobic, to the extent that hatred for other nations was not just permitted but even commanded. Consequently, such hatred became part of the psychological nature of the Hebrews (cf. TTP XVII, 272). At this point I would like to address an issue I have been postponing so far, i. e., the historicity of Spinoza’s claims and his frequent projection of conditions from his own times onto the case of the Hebrew state. I will not be able to discuss here all the instances of this attitude, but a few cases may help illustrate my point. First, let us have a close look at a marginal note of Spinoza’s regarding the Hebrews’ temple. Spinoza discusses at some length the importance of the temple, God’s dwelling place or the court of the supreme majesty of the state. He marks the intricate laws governing the conduct of the Hebrews at the temple, and then notes: „To this day they can’t read without great horror about Manasseh’s disgraceful conduct [atque adeo ut hodierni adhuc non sine magno horrore illud Manassae flagitium legant], how he dared to place an idol in the temple itself“ (TTP XVII, 275; italics added). There is something remarkable about Spinoza’s conviction that the Jews of his own day are the very same people as the subjects of the ancient Hebrew state. As I noted at the beginning of this paper, we would hardly recognize this kind of hermeneutic practice as historical writing. Yet such 6 The priestly elite was prohibited from owning any land, while the civic leadership (heads of tribes and judges) could not accumulate lands due to the law of the Jubilee.
Y Y. M
generalizations, in which terms like „Pharisees“ or „Hebrews“ range over civilizations of two millennia, are not at all rare in the Tractatus.7 Let us have a look at another example. We have just mentioned Spinoza’s description of the xenophobic psyche of the Hebrews. There are, in fact, numerous biblical passages that command charity and love toward the stranger [Ger] (see, for example, Ex 22, 20; Lev 19, 33 and 24, 22; Deut 14, 29), envision God’s house as a place of prayer for all the nations (Isaiah 56, 7), and prohibit hatred even for those nations, such as the Egyptians and Edomites, with whom the Hebrews shared a hostile past (Deut 23, 8).8 It seems that Spinoza’s broad-brush claim about the xenophobic psyche of the Hebrews is, at least in part, a projection from his acquaintance with the minds of seventeenth-century Dutch Jews; alternatively, it may be that the claim is made in service of his political argument (i. e., proving that despite its exceptional virtues the Hebrew state should not be imitated). One striking point in this context is Spinoza’s assertion that the ancient Hebrews considered other lands „unclean and profane“ [immunda & profana] (TTP XVII, 272). Now, such a notion of the „uncleanness of the land of the nations“ [tumeat eretz ha-amim] does exist within Jewish literature, but it has no trace in the Bible, and its origins can be traced at best to the second century BCE,9 several centuries after the destruction of Hebrew state. Here again, I believe, Spinoza treats the Hebrews as an ahistorical category, ranging over biblical and rabbinic subjects without recognizing the fundamental and obvious divide between these civilizations. The third and last example I would like to discuss is Spinoza’s claim that the election of the Levites caused resentment that contributed significantly to the decline of the Hebrew state. The Levites were chosen to serve as the temple’s courtiers and their sustenance fell on the other tribes. This, Spinoza claims, led 7 See, for example, TTP III, 60: „Pharisaei tamen contra acriter contendunt“ (note the tense); see also VII, 142 f.; VIII, 146; IX, 168 and 174. 8 Indeed, within rabbinic tradition, salvation, i. e., having a share in the world to come, is not restricted to Jews only. See Tosefta Sanherdrin, XIII 2. 9 See Babylonian Talmud, Tractate Shabbat, 15b. Spinoza’s cites 1 Sam 26, 19 in order to show that the Hebrews considered living outside the Land of Israel as tantamount to practicing idolatry. This issue, however, is clearly distinct from the claim that other lands are ritually unclean. Furthermore, Spinoza’s reading of 1 Sam 26, 19 relies heavily on the rabbinic exposition of this verse (Babylonian Talmud, Tractate Ketubot, 110b) rather than the plain sense of scripture.
S’ R
to a „continual murmuring, and a weariness with feeding men who were idle, envied, and not related to them by blood“ (cf. TTP XVII, 277). Spinoza provides no textual source to support this claim, which is very central to his explanation of the fall of the Hebrew state. As far as I can see, there is no trace in the Bible of this resentment, which Spinoza describes as „continual.“ The only evidence that Spinoza cites for his chief explanation for the decline of the Hebrew state – the election of the Levites and the ensuing resentment toward them – is the story of Korah (Num 16), but this event occurred right at the beginning of the Hebrew state. Furthermore, the value of this evidence is highly questionable, since Korah, the leader of this rebellion against Moses, was a Levite himself, and in his complaint he does not at all mention the alleged idleness of the Levites.10
11.6 „I gave them statutes which were not good, and laws by which they would not live“: The Decline of the Hebrew State At the center of Spinoza’s explanation of the dissolution of the Hebrew state lies his interpretation of two extraordinary verses in Ezekiel 20, 25 f.: „Moreover, I gave them statutes which were not good, and laws by which they would not live, for I defiled them with their own gifts, by rejecting everything which opened the womb, so that I might destroy them, that they might know that I am God.“ Unlike his usual custom, Spinoza does not quote the Hebrew original here, but rather provides his own, quite reasonable, translation. Spinoza understands these two verses as alluding to the choice of Levites to serve as the courtiers of the temple. Here Spinoza is referring to the claim that originally these were the firstborns who were supposed to serve as priests in the tabernacle and temple; only after the sin of the Golden Calf (Ex 32, 25–29), were the firstborn rejected („rejecting everything which opened the womb“) and replaced by the Levites, the only tribe that did not partake in the sin. The biblical text alludes to this issue (Num 8, 6–18), but it is far more developed in rabbinic literature.11 It is note10 Perhaps Spinoza is relying here on Ibn Ezra’s commentary on Ex 32, 29, which stresses that Korah was a firstborn. 11 See, for example, Babylonian Talmud, Tractate Zevachim, 112b, Tractate Yoma, 66b, Bamidbar Rabbah, 1:10, and Ibn Ezra’s long commentary on Ex 32, 29.
Y Y. M
worthy that according to many rabbinic sources the Levites were chosen much earlier. Indeed, quite a few sources suggest that the tribe of Levi was not enslaved in Egypt,12 and according to some the descendants of Levi were elected to replace the firstborn following the sin of Reuben – Jacob’s firstborn – who defiled his father’s bed (Gen 49, 3).13 Regardless of these reservations, Spinoza’s explanation of the election of the Levites as God’s response to the sin of the Golden Calf fits well with the mainstream of rabbinic sources. Yet, unlike the rabbinic sources, Spinoza presents the election of the Levites as a curse, the response of an angry God who was intent on punishing the Hebrews and destroying their unique state (cf. TTP XVII, 278). Why was the election of the Levites such a momentous event according to Spinoza? We can discern at least two reasons. First, the egalitarian order was essential for the Hebrew state to function properly, and once this strict egalitarianism broke down, all the social and psychological maladies of inequality followed. Resentment, envy, and the desire to usurp power brought about constant struggles, instability, and corruption, and once the delicate equilibrium of the original state was shaken, the descent into civil strife and tyranny was just a matter of time. Second – and here comes the proto-Freudian element I alluded to at the beginning of this article – Spinoza suggests that the various gifts which the other tribes were always obliged to give to the Levites continually reminded them of their great sin, the worship of the Golden Calf, which was the reason for the elevation of the Levites and the rejection of all the other tribes (ibid.). This feeling of defilement and rejection, the constant presence of the reminders of their original sin, made them resent the Levites even more and left them dissatisfied with God, the sovereign of their state. The result was a constant push toward new forms of worship and new political arrangements.14
12 See Shemot Rabbah, 5, 20. Cf. Nachmanides’ Commentary on the Pentateuch, Gen 5, 4. 13 See the commentary of Kli Yakar (Shlomo Ephraim of Leczyca, a sixteenth-century commentator) on Gen 49, 4. Cf. the commentaries of Rashi, Ibn Ezra and Sforno on Gen 49, 3–4, and Bereshit Rabbah 99, 6. 14 For an insightful discussion of Spinoza’s description of the last phases of the Hebrew Republic, see Rosenthal 2002, 239–241.
S’ R
11.7 Political Lessons from the Case Study of the Hebrew State The divine Hebrew Republic occupied the imagination of quite a few early modern minds (Nelson 2010; Melamed 2010; Totaro in this volume), and the question of whether the achievements of this state could be imitated was broadly in the air. Spinoza’s paradoxical interpretation of this political myth, his view of the Hebrew state as combining ingenious political thinking with base affects (e. g., the hatred of strangers), was at least in part intended as a spoiler for these nostalgic fantasies. In order to show that a resort to the Hebrew state is neither possible nor desirable, Spinoza presents two explicit arguments. First, he claims, the Hebrew state was based on a genuine covenant with God. But, as he goes on to remind his Christian readers, God’s new covenant is not written in ink or on stone tablets, but „written on the heart, by the Spirit of God“ (TTP XVIII, 282). In other words, one cannot resort to the Jewish law and remain Christian. This is an argumentative strategy that Spinoza often employs: he charges his adversaries with Judaizing, or following the path of the Pharisees.15 Spinoza’s second argument is even more interesting. Modern mercantilism, with its crucial reliance on close, friendly interactions with foreign cultures and states, is incompatible with the xenophobic and isolationist nature of the Hebrew state. Put simply, were the Dutch to adopt the essential features of the Hebrew state, they would have to shut themselves within their borders and forfeit their immense economic achievements (cf. TTP XVIII, 282). Thus, both in terms of the Flesh (the economy), as well as in terms of the Spirit (the irrelevance of the Jewish law), Christian Netherlands cannot and should not aim at imitating God’s Divine Republic. Although we should not revive the Hebrew state as a whole, Spinoza points out several important lessons from this extraordinary case study. He begins by noting two features of the Hebrew state which are „perhaps worth imitating“ (TTP XVIII, 282) First, Spinoza marks, it is not contrary to God’s rule to choose a supreme majesty, as we can see from the transfer of rights to Moses in Sinai. 15 See, for example, Spinoza’s claim that the belief in ghosts is truly of a Pharisee, not Christian, origin, and that therefore good Christians should reject it (cf. TTP II, 48). For a detailed discussion of this issue, see Melamed 2012, 143.
Y Y. M
Second, Spinoza argues, we can learn from the history of the priesthood after Moses’s death that the right to excommunicate should not be granted to the religious authorities, but should rather belong to the civil sovereign (cf. TTP XVIII, 283). Spinoza supports this last claim with a somewhat creative reading of three incidents in which judges or kings (but not priests) cursed those who disobeyed their commands. Then, Spinoza turns to draw several further lessons from the history of the Hebrew state. Most of these lessons serve in one way or another to further his overarching Erastian argument. Addressing the Hebrews’ second commonwealth, after their return from the Babylonian exile, Spinoza notes that only in this period, after the priests from the Hasmonean dynasty usurped civil authority and became kings, did the deep divisions among the various Jewish sects appear. As long as the original division of power (following Moses’s death) between religious and civil authorities remained intact, the Priests’ pattern of behavior was conservative and restrained. Once they gained civil power they used their priestly authority to promulgate new edicts concerning beliefs and ceremonies. These innovations did not escape the notice of their opponents, and the result was proliferation of quarrels regarding the practice of religion (cf. TTP XVIII, 283 f.). Another crucial lesson which Spinoza draws from the destruction of the Hebrew state is that a preacher should not be allowed to pronounce judgment publicly on religious issues without obtaining permission from the sovereign. The activity of prophets who did not shy away from admonishing and scolding the sovereigns contributed significantly to the destabilization of the Hebrew state (cf. TTP XVIII, 280). Furthermore, Spinoza argues, the prophets scolded even monarchs, who, according to the testimony of scripture, rule piously. As a result, Spinoza summarizes, „religion derived more harm than good“ from granting prophets the freedom to criticize the sovereign (TTP XVIII, 284 f.). Spinoza is also not particularly enthusiastic about monarchical government. He notes that in comparison with the earlier stages of the Hebrew state the period of Hebrew monarchy was characterized by the spread of civil wars, conf licts with an increasing number of prophets, and wars waged merely for the sake of glory (TTP XVIII, 285). At the very end of chapter 18, Spinoza drives many of these lessons home, and applies them to his English and Dutch contemporaries. He argues that radical
S’ R
political shifts are harmful, as they result in dissonance between the psychology of the people, who were accustomed to one form of government, and the practice required by another. „The form of each state cannot be changed without a danger that the whole state will be ruined“ (TTP XVIII, 291). The State of Holland, Spinoza notes, never had kings, but only counts (cf. TTP XVIII, 290). If the Dutch wish to avoid the complete ruin of their state, they should not follow the path of the ancient Hebrew state, and should refrain from monarchical government.
11.8 Conclusions At the beginning of this article I suggested that Spinoza’s discussion of the divine Hebrew Republic cannot be considered as „historical“ practice in any sense remotely close to ours (cf. Gottlieb 2007, 289 and Verbeek in this volume). Throughout this paper we have seen Spinoza presenting a variety of claims that are poorly documented in the Biblical texts. It is precisely these deviations from the Biblical narratives that can help us understand the overarching aims of Spinoza’s argument. His didactic history is not meant to document the past „wie es eigentlich gewesen,“ to use Ranke’s trope, but rather to support his political argument in favor of Erastianism and the freedom to philosophize (the explicit aims of chapters 19 and 20). Spinoza’s account of the Hebrew Republic is not free of tensions. Key elements in this account, such as the division of power following the death of Moses, are sometimes described in positive terms, as maintaining a healthy balance of powers, but at other times are presented as the main cause of the destruction of the state. There are numerous discrepancies between Spinoza’s detailed account of the Hebrew state in chapters 17 and 18, and the more succinct, and more negative, discussion of the same issue in chapter 5.16 These tensions notwithstanding, the outlines of Spinoza’s political thinking are presented in a concentrated form 16 Cf. Verbeek 2003, 125 f. In chapter 5 Spinoza describes the Hebrews upon their exodus from Egypt as unfit for democracy, while in chapter 18 the early theocratic stages of the Hebrew state are described in terms very close to democracy. Similarly, chapter 5 does not mention a pre-Sinai egalitarian phase, in which all Hebrews were equally permitted to approach God. There are quite a few other discrepancies between the two accounts.
Y Y. M
and in sharp relief in this focused, exemplary study of the extraordinary case of the Divine Hebrew Republic.
Bibliography References to the Tosefta are based on the following edition: Zuckermandel, M. S. (ed.) 1963: Tosefta (Erfurt Manuscript), Jerusalem. Curtius Rufus, Q. 1946: History of Alexander, trans. by J. C. Rolfe, 2 Volumes, Cambridge Mass. Gottlieb, M. 2007: Spinoza’s Method(s) of Biblical Interpretation Reconsidered, in: Jewish Studies Quarterly 14, 268–317. Harvey, W. Z. 2006: The Israelite Kingdom of God in Hobbes’ Political Thought, in: Hebraic Political Studies 1, 310–327. – 2012: Anarchism, Egalitarianism, and Communism in Isaac Abrabanel [in Hebrew], in: B. Brown/ M. Lorberbaum/A. Rosenak/Y. Stern (eds.), ’Al Da’at ha-Qahal, Essays in Honor of Aviezer Ravitzky, Jerusalem, Vol. 1, 213–229. Melamed, Y. Y. 2010: Review of Nelson 2010, Notre Dame Philosophical Reviews, Sept. 16th, 2010. – 2012: ,Christus secundum spiritum‘: Spinoza, Jesus, and the Infinite Intellect, in: N. Stahl (ed.), The Jewish Jesus, New York, 140–151. Nelson, E. 2010: The Hebrew Republic: Jewish Sources and the Transformation of European Political Thought, Cambridge Mass. Rosenthal, M. A. 2002: Why Spinoza Chose the Hebrews, in H. M. Ravven/L. E. Goodman (eds.), Jewish Themes in Spinoza’s Philosophy, Albany NY, 225–260. Verbeek, Th. 2003: Spinoza’s Theologico-Political Treatise: Exploring ,the Will of God‘, Aldershot.
12 Michael Hampe
Friedlicher Staat, Religionsgesetze und Gedankenfreiheit (Kapitel 19–20)
Es ist hilfreich, schon bei der Lektüre des 19. Kapitels des Theologisch-politischen Traktat vor Augen zu haben, worauf die Argumentation Spinozas im 20. und letzten Kapitel seines Buches hinausläuft. Deshalb werde ich nach der Darstellung der Themenstellung des 19. Kapitels zuerst einen Gedankengang aus dem 20. Kapitel aufgreifen, um dann auf das 19. einzugehen und schließlich zum 20. zurückzukehren.
12.1 Problem der Spaltung der Bürgerschaft durch konfessionelle Konf likte Spinoza wurde während des Dreißigjährigen Krieges, der auch ein Glaubenskrieg war, als Nachkomme von unter Todesdrohungen durch die Christen zur Konversion gezwungenen und aus Portugal vertriebenen Juden geboren. 1672 wurden die liberalen Regenten der Niederlande, die Brüder de Witt, von einem fanatischen Mob gelyncht. Der Traktat wurde von der Kirche verboten. Religiöse Zensur und religiös motivierte Gewalt waren in Spinozas Leben, auch in den liberalen Niederlanden, eine Selbstverständlichkeit. Die Unterscheidung zwischen Rechtgläubigen und Ungläubigen führte im 17. Jahrhundert in Europa ebenso wie heute abermals weltweit immer wieder zu Gewalt und Krieg. Deshalb versuchten Staatsführer ihr Gebiet unter anderem durch eine Verein-
M H
heitlichung des Glaubens zu befrieden. „Cuius regio eius religio“ ist das 1612 von Joachim Stephani geprägte Rechtsprinzip des Augsburger Religions- und des Westfälischen Friedens (vgl. Böckenförde 1967). Thomas Hobbes sah es 1651 in seiner Staatstheorie im Leviathan noch als ein Risiko an, unterschiedliche Glaubensbekenntnisse und eine religiöse und weltliche Doppelspitze in einem Staat zuzulassen. Freiheit war für den bürgerkriegserfahrenen Hobbes vor allem ein körperliches Problem: Hat man Bewegungsfreiheit oder liegt man in Fesseln? (Vgl. Hobbes 1991, XXI, 163.) Gewissens- und Gedankenfreiheit wird von ihm unter den Dingen abgehandelt, „die einen Staat schwächen oder zu seiner Auflösung führen“ können (Hobbes 1991, XXIX, 247). Denn durch sie können sich unterschiedliche Parteiungen in einem Staat bilden, die nicht nur verschieden denken, sondern schließlich auch gegeneinander kämpfen und so den Staat zerstören. Der Anfang des 19. Kapitels, in dem Spinoza die Verwaltung des religiösen Rechts und des Kultus allein in die Hände der jeweiligen Regierung legt, um einen Kampf zwischen Kirche und König zu verhindern, in der etwa die Kirche einen Regierungsinhaber als nicht rechtgläubig einstuft und aus der Religionsgemeinschaft ausschließt, scheint auf den ersten Blick ganz auf dieser Hobbesschen Linie zu liegen. Tatsächlich spielt die Gedankenfreiheit für Spinoza im Staat jedoch eine ganz andere, positive und wichtigere Rolle als für Hobbes. Spinoza nennt zu Beginn des 19. Kapitels das Beispiel des Konf liktes zwischen dem Bischof von Mailand, Ambrosius, und dem oströmischen Kaiser Theodosius im Jahre 388 n. Chr. In einer Auseinandersetzung zwischen Persern, Juden und Christen kam es auf dem damaligen römischen Staatsgebiet zu Gewaltausbrüchen und einer Synagogenzerstörung. Als Theodosius, selbst Christ nach dem Nicänischen Glaubensbekenntnis, die brandschatzenden Christen zur Rechenschaft und zum Wiederaufbau der Synagoge zwingen wollte, griff Bischof Ambrosius ein: Theodosius dürfe sich als Christ nicht auf die Seite der Juden stellen. Denn das würde darauf hindeuten, daß er selbst vom rechten Glauben abgefallen sei. Theodosius wies diesen Einwand zurück. Ambrosius schloß Theodosius daraufhin vom zentralen christlichen Kult des Abendmahles aus. Theodosius mußte nachgeben und die Zerstörung der Synagoge durch die Christen ungestraft lassen (vgl. Gotter 2011, 133 f.). Mit diesem Beispiel macht Spinoza erstens die Gefahr von gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Anhängern unterschiedlicher Religionen
F S, R G
überhaupt deutlich und greift zweitens den Konf likt zwischen weltlichem und kirchlichem Recht auf. Theodosius hätte die Christen als Gewalttäter, die sich nicht an das weltliche römische Recht gehalten haben, zur Rechenschaft ziehen müssen, ohne Ansehen des religiösen Bekenntnisses von ihm selbst und dem der Gewalttäter. Ambrosius sah den Vorgang dagegen rein religiös und wandte das kirchenrechtliche Zwangsmittel des Ausschlusses einer Person von der heiligen Eucharistie gegen den Kaiser an. Der Kaiser konnte dieses Recht nicht brechen. Um einen Kampf wie diesen zwischen Religionsgemeinschaften oder zwischen den hohen Vertretern des weltlichen und des kirchlichen Rechts zu verhindern, will Spinoza zeigen, „daß die Religion nur durch den Beschluß derer, denen das Recht zu befehlen zusteht, Rechtskraft erlangt und daß Gott kein besonderes Reich unter den Menschen hat, es sei denn durch die, welche die Regierungsgewalt innehaben, und des weiteren, daß der religiöse Kult und die Ausübung der Frömmigkeit sich nach dem Frieden und Interesse des Staates richten müssen und folglich allein von dem Souverän zu regeln sind, der mithin auch deren Interpret sein muß“ (TTP XIX, 292). Vor diesem Hintergrund muß es zunächst erstaunen, daß Spinoza im 20. Kapitel des Traktat zeigt, „daß es in einem freien Staate jedem erlaubt ist, zu denken, was er will, und zu sagen, was er denkt“ (TTP XX, 306). Man muß bei Spinoza jedoch klar unterscheiden zwischen einerseits den Instanzen, die Recht festlegen und Handlungen, einschließlich der kultischen, regeln, sowie andererseits den Vertretern von Gedanken und Überzeugungen, denen, die Ideen haben. Daß sich Spinoza trotz seiner Lebenserfahrungen mit auf religiöse Differenzen zurückgehender Gewalt und trotz des eben zitierten historischen Beispiels letztlich nicht der Hobbesschen Strategie einer vollständigen Vereinheitlichung der Glaubensmeinungen in einem Staat durch die Herrschergewalt angeschlossen hat, liegt nicht nur daran, daß er erstens ein staatliches Streben nach Beherrschung der Gedanken seiner Untertanen für wenig ratsam und dem Staat selbst nicht zuträglich ansah, sondern die Beherrschung von Gedanken auch zweitens für schlichtweg – man könnte sagen: ontologisch – unmöglich hielt. Diese beiden Themen werden im 20. Kapitel behandelt. Zunächst zum letzten Punkt, der Unmöglichkeit der Gedankenbeherrschung „von außen“.
M H
12.2 Unbeherrschbarkeit des Geistes Es ist nach Spinoza „unmöglich, daß das Gemüt eines Menschen dem Recht eines anderen völlig unterliegt. Niemand kann nämlich sein natürliches Recht, d. h. seine Fähigkeit, die Vernunft frei zu betätigen und über alles zu urteilen, einem anderen übertragen; und niemand kann dazu gezwungen werden“ (TTP XX, 306). Die Erzeugung eines Souveräns mit einem körperlichen Gewaltmonopol, wodurch man seine Fähigkeit, zum eigenen Schutz und zur Ausdehnung des eigenen Machtbereichs sogar körperliche Gewalt an anderen auszuüben, auf einen anderen überträgt (vgl. Hobbes 1991, XVII, 134), hat im geistigen Bereich nach Spinoza keine Parallele. Dies mag angesichts von Spinozas Verständnis des menschlichen Geistes als der Idee des Körpers, also vor dem Hintergrund dessen, was man als seinen psychophysischen Parallelismus bezeichnet hat, zunächst erstaunen (E II, Lehrsatz 13 und Lehrsatz 7). Sollte man nicht denken, daß die Erzeugung eines Souveräns, wenn sie, wie etwa das Frontispiz des Hobbesschen Leviathan es anschaulich macht, die Erschaffung eines großen Körpers ist, sie in Spinozas Augen auch die Erschaffung eines großen „Geistes“ sein muß? Es ist vielleicht möglich, eine Gemeinschaft von Menschen, die in demokratischen Prozessen oder auch einfach nur in koordinierter Arbeit gemeinsam Wirkungen hervorbringt, als einen gemeinsamen Geist, als Idee dieser komplexen körperlichen Wirkeinheit zu begreifen. Doch bedeutet das nicht, daß auch ein einzelner Mensch auf einen anderen einzelnen Menschen oder eine Gruppe von anderen Menschen seine Fähigkeit zu denken, zu schließen und zu wollen (oder zu streben und sich selbst zu erhalten) übertragen kann. Es kann deshalb nach Spinoza keinen geistigen Souverän geben, weil ein anderer an meiner Stelle und für mich oder ich gemeinsam mit ihm zwar schlagen oder ziehen, er jedoch nicht an meiner Stelle und für mich denken oder eine Überzeugung haben kann. Oder anders gesagt: Meine geistige Macht ist nicht delegierbar. Auch im staatlichen Zustand bleibt es, jetzt genauer auf die Religion bezogen, das „Recht eines jeden, das niemand, selbst wenn er wollte, aufgeben kann“ (TTP XX, 306). Der psychophysische Parallelismus Spinozas geht also nicht so weit, daß er im Politischen vom Hobbesschen konstruktiven Materialismus nicht unterscheidbar wäre. In diesem Zusammenhang muß man drei Aspekte an individuellen Körpern und Geistern unterscheiden: Erstens ihre Vernünftigkeit und das, was mit den notiones communes als ihre Gemeinsamkeit erfaßbar ist. Zweitens ihr individuel-
F S, R G
les Selbsterhaltungsstreben, das sich nicht nur auf das, was an ihnen vernünftig ist, bezieht, sondern auch auf alle partikularen Aspekte ihrer leib-seelischen Beschaffenheit. Drittens schließlich ihre individuelle Geschichte, die sich eventuell auf sehr spezielle Konventionen bezieht. Die Vereinheitlichung, die im Staat verlangt wird und die Spinoza im Politischen Traktat auch so beschreibt, als würden die Menschen durch einen einzigen Geist geführt („una veluti mente ducatur“, TP II 21, 30), kann sich nur auf den ersten Aspekt beziehen: die von Menschen geteilte Vernünftigkeit. Deshalb müssen die Gesetze, die ein Staat für alle Menschen erläßt, durch die Vernunft nachvollziehbar sein (TP II 21, 31 f.). Die durch den Staat und die Gesetze erreichte Vereinheitlichung führt nicht tatsächlich zur Entstehung eines gemeinsamen Geistes, sondern ist nur so „als ob“ (veluti) es einen gemeinsamen Geist gäbe (vgl. M. L. Morgan in Spinoza 2002, 687 Fn. 21), auch wenn Spinoza an anderer Stelle vom Körper und Geist des ganzen Staates wie einer tatsächlichen Realität spricht („totius imperii corpus et mens“ – TP III 2, 34). Spinoza bestreitet nicht die Möglichkeit, die Ansichten und Überzeugungen einer anderen Person durch Reden zu beeinflussen. Und natürlich kennt er die Tugenden des Propheten, der unter anderem, wie Moses, über die Einbildungskraft verfügen muß, die es ihm erlaubt Reden zu halten, die die Herzen der Mitglieder seines Volkes erreichen. Doch niemals kann jemand durch Rhetorik ein perfektes Geistesgefängnis errichten, aus dem kein Gedanke mehr entweichen und sich verselbständigen kann, so daß das eigene Denken unmöglich wird. Ebenso kann mich jemand anderes in meinem Streben mich selbst zu erhalten zwar unterstützen oder hindern, doch mein Streben mich selbst zu erhalten kann ich nicht delegieren. Das staatliche Gewaltmonopol mag mich schützen und so mein Selbsterhaltungsstreben fördern, doch muß immer noch ich selbst nach meiner Erhaltung streben, im Staat wie im Naturzustand, mein conatus bleibt bei mir und geht nie in der staatlichen Ganzheit auf (vgl. E III, Lehrsatz 6). Nun zum zweiten Punkt, der Unzuträglichkeit des Versuchs eines Staates für diesen Staat selbst, das Denken der Untertanen zu lenken: Wenn eine Obrigkeit unter Gewaltandrohung ihre Untertanen dazu bringen will, bestimmte Ansichten nicht zu haben, bestimmte Urteile nicht zu fällen, so kann sie sich nur an die Reden der Menschen halten, das heißt bestimmte Äußerungen verbieten, weil sie, wie wir eben gesehen haben, höchstens einen indirekten Zugang auf die Geister ihrer Untertanen über Rhetorik und Propaganda hat, aber diese Geister nie
M H
direkt beherrschen kann. Die Gewalt des Staates kann direkt nur auf das Körperliche zugreifen, also in diesem Fall die Bewegungen der Zunge. Wenn jedoch die Reden zwar beherrschbar sind, nicht aber die Gedanken, werden sich bei den Menschen, deren Reden beherrscht werden, Reden und Gedanken voneinander entkoppeln; es entstehen Menschen, die A sagen, obwohl sie B meinen. Natürlich muß auch die Doppelaspekttheorie des Psychophysischen (vgl. E II, Lehrsatz 13, Anmerkung) Spinoza erlauben, daß Menschen lügen, daß sie anderes sagen als sie meinen. Für die auf diese Weise in ihren verbalen Äußerungen beherrschten Menschen gilt, daß sie „jeden Tag eine Sache dächten und eine andere sagten“ (TTP XX, 312). Damit würde ein solcher Staat seine Untertanen zu „Heuchelei und Unredlichkeit“ (adulatio & perfidia) erziehen. Die Fähigkeit der Untertanen, Verträge einzuhalten würde untergraben und damit untergrübe der Staat als Vertragsprodukt sich selbst (ebd.). Denn er beruht nach Spinoza auf Vertragsschluß und erhält sich in seinem Handels- und Rechtssystem durch die Verläßlichkeit der Menschen, für alle Parteien nützliche Verträge miteinander zu schließen (vgl. TTP XVI, 243). Würde jeder jedem mißtrauen, weil jeder davon ausgeht, daß der andere anderes meint als er sagt, käme es zu keinen vertraglichen Vereinbarungen mehr, sie verlören ihren Nutzen. Handel und Recht brächen zusammen. Es ist aus verschiedenen Gründen interessant, daß Spinoza, trotz seines psychophysischen Parallelismus hier eine relative Unabhängigkeit des Redens vom Denken annimmt. Dies dürfte unter anderem daran liegen, daß er der sozialen Relevanz des menschlichen Affektlebens viel Aufmerksamkeit geschenkt hat und die Widersprüchlichkeit des menschlichen Affekt- und Geisteslebens, wie seine Ethik zeigt, gut kennt. Menschen fürchten das eine und hoffen das andere und wissen ein Drittes (vgl. etwa E III, Definitionen der Affekte 13 und 32). Was sich davon in einer Äußerung oder einer Handlung niederschlägt, hängt von den inneren Kräfteverhältnissen in einem Geist ab, der einen Ideenzusammenhang darstellt. Wenn Menschen über Gott A glauben, die Obrigkeit aber die Behauptung „Gott sei A“ unter eine harte Strafe stellt, werden Menschen aus Furcht vor der Strafe öffentlich äußern, daß Gott nicht A sei. Es wird also durch die eine bestimmte Meinungsäußerung bei Strafe verbietende Anordnung nicht die Meinung selbst geändert oder die Idee, daß Gott A ist, aus dem Geist entfernt, sondern lediglich eine zusätzliche Idee etabliert, eine Furcht davor erzeugt zu sagen, daß Gott A ist, die bezogen auf die Handlungsrelevanz des
F S, R G
Sprechens stärker ist als die Meinung, daß Gott A ist. Diese Einstellung zu der Überzeugung, daß Gott A ist, stellt eine weitere Idee mit dem Gehalt dar: „Zu sagen, daß Gott A ist, ist gefährlich.“ Die Strafandrohung eliminiert also nicht den verbotenen Gedanken, sondern ergänzt ihn durch eine Idee über die Folgen der Äußerung, daß Gott A ist, die mit dem Affekt der Furcht einhergeht. Nun handelt ein Wesen nach Spinozas Ethik genau dann frei, wenn es seiner eigenen Natur gemäß tätig ist (E I, Definition 7). Aufgrund einer Drohung und aus Furcht etwas zu sagen, ist daher alles andere als freies Handeln. Auch in einem inneren Widerspruch zu stecken, indem man A sagen will, und es vielleicht auch sagt, aber um seine Selbsterhaltung fürchten zu müssen, wenn man A sagt, weil dieses Sprechen bestraft werden könnte und es dann doch nicht sagen zu wollen, ist eine unfreie Lage, weil sie durch den Affekt der Furcht mit Leiden verbundenen ist (E III, Definitionen der Affekte 13). Nun könnte man, in Anlehnung an Hobbes, meinen, daß diese Furcht eben der Preis ist, den man zahlen muß, wenn man mit Hilfe des staatlichen Gewaltmonopols seine Selbsterhaltung sichern will. Doch das ist nicht Spinozas Überzeugung. Sicherlich ist die Selbsterhaltung der Einzelnen ein Staatsziel. Doch geht es dabei nicht einfach um Lebensverlängerung. Wer sich selbst nur erhalten kann, indem er lügt, erhält sich nicht als freies Wesen und insofern überhaupt nicht als das Selbst, das er ist. Selbsterhaltung und freie Verwirklichung des Selbst im Handeln hängen vielmehr eng miteinander zusammen. Deshalb kann bei Spinoza, anders als bei Hobbes, die Freiheit nicht für die Selbsterhaltung geopfert werden. Denn die Funktion des Staates bestimmt Spinoza wie folgt: „sein höchster Zweck“ besteht nicht darin, „die Menschen zu beherrschen ... und dem Recht eines anderen zu unterwerfen, sondern im Gegenteil darin, einen jeden von der Furcht zu befreien [bspw. um seine Selbsterhaltung, Hervorhebung vom Verf.], damit er so weit wie möglich in Sicherheit lebt, d. h. damit er sein natürliches Recht zu existieren und zu wirken (Jus suum naturale ad existendum, & operandum) ohne Gefahr für sich und den anderen in bestmöglicher Weise behält.“ Es ist nicht „der Zweck des Staates ..., die Menschen aus vernünftigen Wesen in Tiere oder Automaten zu verwandeln (ex rationalibus bestias, vel automata facere), sondern im Gegenteil ..., sicherzustellen, daß ihr Geist und ihr Körper ihre Funktionen ungefährdet verrichten, sie selbst ihre Vernunft, die frei ist, gebrauchen und sich nicht mit Haß, Zorn und Arglist bekämpfen noch ein-
M H
ander feindselig gesinnt sind. Der Zweck des Staates ist in Wahrheit also die Freiheit (Finis ergo Reipublicae revera libertas est)“ (TTP XX, 308). Der Staat, der seinen Zweck erfüllt, ist deshalb auch ein hohes Gut für die Vernünftigen, weil sie in ihm freier leben können als im Naturzustand, in dem sie von anderen bedroht oder auf sich allein gestellt, ohne Unterstützung und in Furcht leben müssen. Entsprechend heißt es in der Ethik: „Der Mensch, der von der Vernunft geleitet wird, ist freier in einem Staate, wo er nach gemeinsamem Beschlusse (ex communi decreto) lebt, als in der Einsamkeit, wo er sich allein gehorcht“ (E IV, Lehrsatz 73). Allerdings kann man wohl davon ausgehen, daß Spinoza die meisten Staaten als ihren Zweck nicht erfüllend ansah, weil sie entweder in Parteiungen gespalten sind, die keine gemeinsamen Beschlüsse zustandebringen oder gar von Personen regiert werden, die nicht im Willen des Gemeinwohls (von dem noch zu sprechen sein wird) handeln, sondern tun, was ihnen als Privatpersonen beliebt,1 so daß „alles ... wird zugrundegehen“ (omnia … in deterius ruent, TTP XIX, 302). Nur wenn die Regierenden frei sprechen und sagen, was sie denken, und die Bürger ebenso handeln können, kann es zu gemeinsamen Beschlüssen kommen, an die sich alle gebunden fühlen, auch die, die nicht für sie argumentiert und gestimmt haben. Auch viele moderne gesellschaftliche Verhältnisse untergraben die Freiheit und die vernünftige Selbsterhaltung in diesem Spinozistischen Sinne. Zuallererst aber natürlich ein staatlicher Gesinnungsterror, der die Bürger daran hindern will, sich selbst Gedanken zu machen, sei es durch Zensur des gesprochenen und geschriebenen Wortes mit Strafandrohungen bei Verstoß oder durch in das Privatleben dringende politische Propaganda oder beides. Doch auch eine Gesellschaft, in der sich die Individuen gegenseitig ständig nach bestimmten fiktiven Idealen vergleichen und befürchten, speziellen abstrakten Standards nicht gerecht zu werden, hindert sie an der Entfaltung ihrer Kräfte. Zwar kannte Spinoza nicht die Auswüchse des Dauervergleichs, wie er in heutigen westlichen Gesellschaften existiert, die alle Lebensbereiche marktförmig zu organisieren versuchen und jede Äußerung, jedes Verhalten und das Aussehen von Personen bewerten und „ranken“ (vor allem mit Hilfe der neuen Technologien, die die entsprechenden „buttons“ bereitstellen). Doch sind Spinozas teleologiekritische Überlegungen in 1 Wie etwa Silvio Berlusconi in seinen Amtszeiten als Ministerpräsident Italiens Anklagen und Verurteilungen als Privatmann durch die italienische Justiz mit seiner präsidialen Immunität zu entgehen versuchte.
F S, R G
der Ethik (E I, Anhang) sehr wohl zusammen mit dem Freiheitsverständnis des Traktat geeignet, genau diese „Bewertungswut“ nach abstrakten Kriterien, die nichts mit der Natur des jeweiligen Individuums zu tun haben, zu kritisieren. Spinoza unterscheidet also, wie wir gesehen haben, zwischen der Einschränkung des Handelns, des Sprechens und des Denkens in einem Staat. Frieden im Staat wäre nicht möglich, „wenn nicht jeder das Recht, nach eigenem Beschluß zu handeln, aufgäbe“ (TTP XX, 309). Wenn Beschlüsse im Staat gefaßt und Gesetze erlassen werden, muß sich das Handeln aller Staatsangehörigen, auch derer, die anders denken, als es der Mehrheitsbeschluß nahelegt, nach diesen Beschlüssen und Gesetzen richten. Doch das heißt eben nicht, daß deshalb auch von allen entsprechend gedacht und gesprochen werden muß. Sofern das Sprechen nicht aufwieglerisch ist, also dazu auffordert, den Gesetzen entgegen zu handeln und nicht den Haß gegen die Obrigkeit oder andere Gruppen zu schüren und damit Unfrieden zu stiften versucht, soll es nach Spinoza nicht eingeschränkt werden. Das Denken kann, wie wir gesehen haben, ohnehin durch keine Obrigkeit beherrscht werden. Deshalb soll jeder Staatsbürger „ohne Einschränkung denken und urteilen und folglich auch sprechen, vorausgesetzt, daß er sich damit begnügt, einfach zu sprechen und zu lehren und seine Ansichten allein mit der Vernunft verficht, nicht aber mit Arglist, Zorn und Haß oder in der Absicht, etwas auf den eigenen Beschluß hin in den Staat einzuführen“ (TTP XX, 309). Diese Fluchtpunkte des Denkens Spinozas über die geistige Freiheit von Bürgern eines Staates sind im Auge zu behalten, wenn wir uns jetzt wieder seiner Behandlung des Rechtes in geistlichen Dingen im 19. Kapitel zuwenden.
12.3 Einheit der Gesetzesauslegung und des Gesetzesschutzes Aufgrund der Unbeherrschbarkeit des Geistes durch eine dem betreffenden Individuum äußere Macht kann die staatliche Gewalt in geistlichen Angelegenheiten nur den „äußeren religiösen Kult“ (externo Religionis cultu), nicht aber die „Frömmigkeit“ (pietate) und den „inneren Gottesdienst“ (Dei interno cultu) regeln (TTP XIX, 292). Der innerliche Gottesdienst ist so wenig wie irgendein anderer Gedankenvorgang auf andere übertragbar. Daß die staatliche und nicht eine kirchliche Gewalt den Kultus regelt, ergibt sich für Spinoza aus der Tatsache, daß es auch im Staat darum gehen muß, daß die Gebote der Gerechtigkeit
M H
und Liebe (justitia & charitas) erfüllt und ihre Erfüllung durchgesetzt werden. Dazu ist nur ein Gewaltmonopol in der Lage. Es ist für Spinoza unerheblich, ob die durchzusetzenden Gebote durch natürliche Einsicht (lumine naturali) oder die Offenbarung (revelatione) gegeben sind (vgl. TTP XIX, 293). Damit weist er auch den Monopolanspruch einer kirchlichen Gewalt auf Auslegung der offenbarenden Schriften und Regelung des Verhaltens nach den in diesen Schriften geoffenbarten Gesetzen zurück. Wenn bestimmte Gesetze in einem Staat gelten sollen, egal welche Quelle für ihre Geltung in Anspruch genommen wird: die Vernunft oder der göttliche Wille, so muß auch ein einziges staatliches Gewaltmonopol über ihrer Einhaltung wachen. Weil der staatliche Souverän zu entscheiden hat, was als Verstoß gegen ein Gesetz zu gelten hat und was nicht, um eventuell sein Gewaltmonopol anzuwenden, muß er die Gesetze auch auslegen können. Es kann nur eine einzige Instanz im Staat geben, die alle Gesetze erkennt beziehungsweise erläßt und sie schützt, indem sie über ihrer Einhaltung wacht und Verstöße gegen sie ahndet. Einen Gottesstaat im weltlichen Staat, der nach eigenen Kriterien Gesetze und Verstöße gegen sie erkennt, die von den weltlichen Gesetzen verschieden sind, duldet Spinoza nicht. Moses ist für Spinoza deshalb gleichzeitig Prophet der Gesetze und weltlicher Herrscher gewesen, der die von ihm erkannten und verkündeten Gesetze auch durchzusetzen vermochte. Er hat als König die Hohepriester eingesetzt und die kultische Hierarchie festgelegt (vgl. TTP XIX, 304 f.). Als das hebräische Reich zerstört wurde und es keinen König der Juden mehr gab, sondern die Juden dem König von Babylon unterstanden, verloren die dem Judentum geoffenbarten Gesetze deshalb auch ihre Rechtsverbindlichkeit; sie waren jetzt nicht mehr durchsetzbar (vgl. TTP XIX, 295). Daß kein Gesetz ohne das Schwert gilt, diese Hobbessche Einsicht2 gilt auch bei Spinoza und auch für die religiösen Gesetze. Im Christentum war diese notwendige Anbindung der religiösen Gesetze an die weltliche Herrschaft nach Spinoza deshalb unklarer als im Judentum, weil die christliche Religion sich zunächst privat, gegen den Willen der Herrschenden im gesellschaftlichen „Untergrund“ ausbreitete (vgl. TTP XIX, 303).
2 „… that the Lawes are of no power to protect them, without a Sword in the hands of a man, or men, to cause those laws to be put in execution.“ (Hobbes 1991, XXI, 147 f.)
F S, R G
Daß die göttliche Ordnung als Regulativ des menschlichen Handelns in ihrer Realisierung auf einen weltlichen Herrscher mit einem Gewaltmonopol angewiesen ist, liegt daran, daß Gott für Spinoza gar kein Gesetzgeber ist (vgl. TTP XIX, 296). Im Sinne der Ethik ist er ja auch keine Person, die in ihrem Handeln irgendwelche Ziele verfolgt, sondern eine kreative Substanz, die durch nichts in ihrer kreativen Aktivität eingeschränkt werden kann (vgl. E I, Anhang und E I, Definition 7). Nur anthropomorphe Irrtümer können letztlich zu der Vorstellung führen, der göttliche Gesetzgeber wolle herrschen und habe einen weltlichen Stellvertreter in einem Hohepriester oder Propheten nötig. Ob sich das menschliche Handeln nach den von Gott geschaffenen Ordnungen richtet oder nicht, ist im Sinne der Ethica Gott selbst „gleichgültig“, weil die Substanz ohnehin nichts will, keine Präferenzen hat und keine Ziele verfolgt. Gott hat die Welt auch nicht für den Menschen eingerichtet, d. h. teleologisch auf seine Bedürfnisse hingeordnet. Vor allem kümmert er sich nicht wie eine sorgende Person um die, die ihm vermeintlich näherstehen, weil sie seine Gesetze erfüllen. Wenn sich niemand darum kümmert, daß Gerechtigkeit und Liebe handlungsleitend sind, konstatiert Spinoza – Salomo zitierend –, trifft „den Gerechten wie den Ungerechten … das gleiche Schicksal“ (TTP XIX, 296). Gott schützt den Gerechten nicht vor den Torheiten der Ungerechten. Deshalb ist auch der Einsichtige auf den Schutz des Staates angewiesen. Nur ein staatliches Gewaltmonopol kann Zufälle und Willkür durch Mitmenschen ein wenig eindämmen. Es geht hier also nicht um die Frage, ob der göttliche Wille auf Erden geschehe, sondern ob die Menschen selbst in der Lage sind, aufgrund der göttlichen Ordnung das menschliche Leid zu vermindern und die menschliche Freiheit zu vergrößern. Das Leid wird vermehrt, wenn nicht nach den Prinzipien der Gerechtigkeit und Liebe gehandelt wird. Geschieht dies dagegen, wird das Leid vermindert und die menschliche Freiheit vergrößert. Ohne die Vermittlung durch eine Regierungsmacht „können wir mithin Gott nicht als über die Menschen herrschend und deren Angelegenheiten nach Gerechtigkeit und Billigkeit regelnd verstehen“ (TTP XIX, 296). Die Regierungsmacht stellt also ein Bild des nach Gesetzen herrschenden Gottes auf, um den Menschen die Regeln klar zu machen, nach denen man sich zu richten hat, wenn man gemeinschaftlich die Freiheit der Menschen vergrößern will. De facto herrschen aber nur menschliche Personen über Menschen. Und sie sind nicht durch Gott, sondern durch
M H
die nach Frieden und Freiheit strebenden Menschen zu dieser Herrschaft legitimiert. Die Vorstellung eines regierenden Gottes mag für Menschen hilfreich und leitend sein, denen die Idee der Ethik von Gott als einer nicht personalen Substanz nicht zugänglich ist, um die bindende Kraft der Gesetze nachzuvollziehen. Doch es wäre nach Spinoza falsch, eine kirchliche Herrschaft tatsächlich auf einer anthropomorphen Gottesvorstellung zu begründen oder auch die weltliche Herrschaft als durch einen göttlichen Willen legitimiert oder ihn vertretend zu deuten. Seine Theorie der Herrschaft, der Macht überhaupt und der Macht im Staate ist, wie Martin Saar auf sehr überzeugende Weise jüngst dargestellt hat, eine radikal immanente, die alle transzendenten Legitimationsquellen ausschließt (vgl. Saar 2013). Das Bild des herrschenden Gottes oder des göttlichen Willens als Grund der Gesetze ist also nur ein imaginativer Anhaltspunkt für die wenig einsichtigen Beherrschten, denen die vernünftige Grundlage der Herrschaft, der sie legitimierende Vertrag und der Zweck des Friedens und der Selbsterhaltung, nicht verständlich gemacht werden kann. Weil die Wirksamkeit der göttlichen Ordnung für das menschliche Handeln auf das staatliche Gewaltmonopol angewiesen ist, kann es keine fromme Handlung geben, die sich gegen den Staat richtet. Wer den Staat untergräbt, untergräbt damit auch die Möglichkeit, daß die göttliche Ordnung durch Gesetze durchgesetzt wird. Es kann daher keine anti-staatliche Frömmigkeit geben. Weil aber das Leben im Staat die Freiheit und die öffentliche Nützlichkeit oder das Gemeinwohl (publicae utilitati) zum Ziel hat (vgl. TTP XIX, 297), untergräbt derjenige, der den Staat mit vermeintlich frommem Handeln unterminiert, letztlich das gemeinschaftliche Streben nach Freiheit und das Gemeinwohl. Spinoza anerkennt also die Trennung von Kirche und Staat insofern nicht, als er das Streben nach Gerechtigkeit und Liebe nicht als ein privates Streben ansieht, sondern als eine staatliche Aufgabe. Das Streben nach Glück (beatitudo), um das es in der Ethik geht (E V, Lehrsatz 42), ist hingegen eine private und keine staatliche Angelegenheit. Auch die Ansichten über Gott und die innere Frömmigkeit bleiben Privatsache. Doch es ist nach Spinoza unmöglich, daß sich jemand auf seine private Frömmigkeit (oder sein Streben nach Glück) beruft, wenn er sich einem geltenden Gesetz im Staat widersetzt. Einen Widerspruch zwischen dem Streben nach öffentlichem Wohl und nach Frömmigkeit kann es nicht geben, weil die Gemeinschaft des Staates ja allererst die Freiheit garantiert, in der
F S, R G
jeder einzelne nach seinem Glück streben und seine Frömmigkeit im Geiste ausüben kann, ohne von anderen bedroht zu werden. Darum „kann auch niemand nach dem Gebot Gottes gegenüber den Nächsten fromm handeln, wenn Frömmigkeit und Religion nicht dem öffentlichen Wohl entsprechen“ (TTP XIX, 298). (Daß Christus und seine Jünger unabhängig von der jüdischen und römischen Staatsmacht Frömmigkeit und Nächstenliebe übten, war nach Spinoza nur aufgrund von Jesu „Gewalt …, Wunder zu vollbringen“ möglich (299)). Wer dagegen etwa jemanden aus Nächstenliebe vor seiner staatlich angeordneten Strafe bewahren will, untergräbt damit die Autorität der Staatsmacht, die ihn selbst schützt. Eine subversive Funktion der Religion gegenüber dem Staat erkennt Spinoza also nicht an. (Die es freilich gibt, wie sich an beliebigen Beispielen aus Geschichte und Gegenwart leicht zeigen läßt.) In der gegenwärtigen Situation kann man diese Position durchaus nachvollziehen. Menschen, die sich im Namen der Frömmigkeit und des Glücks gegen die Rechtsgesetze wenden, sind suspekt geworden. Die westliche Welt hat seit Spinoza keine guten Erfahrungen mit Bestrebungen gemacht, die das Glück zu einer öffentlichen Angelegenheit machen wollten. Alle Menschen mit dem Christentum, dem Islam oder dem Kommunismus ins Glück führen zu wollen, hat zu nichts anderem als totalitärem Terror geführt: das Privatleben der Menschen wurde nicht anerkannt, sondern von einer Kirche oder Partei durchforscht. Abweichungen in Lebenszielen, die nicht der Linie entsprachen, die die entsprechenden Institutionen als die richtige vorgaben, wurden rechtlich oder psychiatrisch verfolgt. Ein Staat, der sich nicht nur um Selbsterhaltung und äußere Freiheit seiner Bürger, sondern auch um deren Glück kümmern möchte, wird in der Regel über kurz oder lang zu einer Gefahr für seine Bürger. Deshalb gibt es heute Abwehrrechte, mit denen sich Menschen gegen Übergriffe des Staates – auch wenn sie sich nichts, was den bürgerlichen und den Strafgesetzen zuwider läuft, haben zuschulden kommen lassen – in ihre Privatangelegenheiten zu schützen versuchen. Spinoza hat den Totalitarismus der das Glück befördernden Religionen erfahren. Seine Staatstheorie ist auch eine Reaktion darauf. Einige, den Menschen, wie er angeblich wirklich ist, zu erkennen glaubende und ihn beglücken wollende Regimes sind in Europa auf Spinozas Denken gefolgt. Es hat auch ihnen gegenüber seine Berechtigung behalten und sich in seiner Aktualität in dieser Hinsicht bis heute bewährt.
M H
12.4 Demokratie Die Freiheit der inneren Frömmigkeit wird in der zweiten Hälfte des letzten Kapitels des Traktat auf die Freiheit des Philosophierens ausgedehnt. Der beste Staat gesteht nach Spinoza „einem jeden dieselbe Freiheit zu philosophieren zu …, die, wie wir gezeigt haben, der Glaube einem jeden zugesteht“ (TTP XX, 311). Die Freiheit zu denken, zu urteilen, zu philosophieren, mag für den Staat unbequem sein, sie mag zu Streitigkeiten führen und den Regierenden lästig erscheinen. Doch das ist kein Grund, sie gesetzlich einzuschränken. Sie ist eine Tugend für den Einzelnen, denn er realisiert sein Tätigkeitsvermögen in ihr. Auch Laster wie „Üppigkeit, Neid, Habsucht, Trunksucht“ versucht man nicht durch gesetzliche Verbote einzuschränken, obwohl auch sie unangenehme Effekte in der Gemeinschaft haben. Es ist nach Spinoza unmöglich, das ganze Leben gesetzlich zu regeln. Denn das führt zwangsläufig zu Empörungen gegen die Obrigkeit (vgl. TTP XX, 312), weil es immer Menschen geben wird, die eine bestimmte gesetzliche Regelung für falsch halten. Je mehr gesetzliche Regelungen eingeführt werden, umso mehr Menschen werden die gesetzgebende Obrigkeit als eine Bedrückung ansehen, vor allem dann, wenn sie meinen, daß die Gesetze verbieten, richtige Ansichten zu haben, die durch das natürliche Licht einleuchten. Eine solche Entwicklung führt dazu, daß die Neigung abnimmt, die Beschlüsse der Mehrheit der Gemeinschaft oder die Anordnungen der von der Mehrheit der Gemeinschaft eingesetzten Gesetzgeber zu befolgen. Die Identifikation mit dem schützenden Staat sinkt und die Gemeinschaft untergräbt ihren Zusammenhalt in einem Prozeß der Entfremdung der Regierten von den selbst gewählten Regierenden. Spinozas Verständnis der staatlichen Gemeinschaft ist ein für seine Zeit ungewöhnlich radikal demokratisches und freiheitliches. Jeder einzelne hat in seinem Handeln dem zu entsprechen, was die Gemeinschaft beschlossen hat. Die Mehrheit entscheidet, was getan werden und was gelten soll. Doch die Mehrheit kann nie das Denken aller bestimmen. Die Verpf lichtung des Einzelnen auf die Beschlüsse der Mehrheit der Gemeinschaft grenzt nie die Freiheit der Einzelnen zu urteilen und zu glauben und sich zu äußern gänzlich ein. Denken, Frömmigkeit und das Streben nach Glück bleiben dem Zugriff der Gemeinschaft entzogen und allein Sache des Einzelnen. Der ideale Staat ist eine Gemeinschaft der zusammen
F S, R G
im Sinne der Mehrheit solidarisch Handelnden, die als Einzelne frei urteilen und nach ihrem Glück streben und diese Freiheit auch bei den anderen anerkennen. „Damit nicht Beifallgetöse (assentatio), sondern Loyalität (fides) Annerkennung findet und der Souverän die Herrschaft über den Staat fest in Händen hat und nicht gezwungen wird, Aufrührern Platz zu machen, ist es deshalb unerläßlich, die Freiheit des Urteils (Judicii libertas) zu gewähren, und erforderlich, die Menschen so zu regieren, daß sie bei aller Verschiedenheit, ja Gegensätzlichkeit der von ihnen geäußerten Meinungen in Eintracht miteinander leben können. Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß eine solche Form des Regierens die beste ist und die wenigsten Mißstände mit sich bringt, weil sie der Natur der Menschen (hominum natura) im höchsten Maße entspricht. Denn in einem demokratischen Staat (der dem natürlichen Zustand am nächsten kommt), kommen alle ... darin überein, nach gemeinsamem Beschluß zu handeln, nicht aber so zu urteilen und nachzudenken“ (TTP XX, 314). Spinozas idealer Staat ist ein Ideal geblieben. In allen real existierenden Staaten ist der eine oder andere Mißstand, den Spinoza benennt, Wirklichkeit geblieben. In vielen demokratischen Staaten haben sich die Regierten den von ihnen gewählten Regierenden entfremdet, weil die Regierenden alles durch Gesetze regeln wollen und die Regierten die Regelungsf lut nicht mehr durchschauen und sie ihnen nicht das Ergebnis vernünftigen Nachdenkens, sondern oft von Korruption gekennzeichneter Kompromißbildung zwischen Einf lußgruppen zu sein scheint. Durch Verallgemeinerung von Marktprozessen kontrollieren sich die Menschen auch in den vermeintlich freiheitlichen Gesellschaften nach abstrakten Idealen in den unterschiedlichsten Hinsichten gegenseitig. Und in undemokratischen despotisch regierten Staaten werden Menschen durch Zensur und Gesinnungsterror weiterhin zu Kriechertum vor den Staatsgewalten und Heuchelei gezwungen. Spinozas Denken über die Gedanken- und Meinungsfreiheit ist daher, weil es noch nicht verwirklicht werden konnte, ein plausibler Maßstab geblieben, an dem sich auch die gegenwärtigen realen politischen Verhältnisse messen und von dem aus sie sich kritisieren lassen.
M H
Literatur Böckenförde, E.-W. 1967: Die Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation, in: Säkularisation und Utopie, Erbacher Studien, Ernst Forsthoff zum 65. Geburtstag, Stuttgart, 75–94. Gotter, U. 2011: Zwischen Christentum und Staatsraison. Römisches Imperium und religiöse Gewalt, in: J. Hahn (Hrsg.), Spätantiker Staat und religiöser Konf likt, Berlin/New York, 133–158. Hobbes, Th. 1991: Leviathan, ed. by R. Tuck, Cambridge; dt.: Leviathan oder Stoff, Form und Gewalt eines kirchlich und bürgerlichen Staates, hrsg. u. eingel. v. I. Fetscher, Frankfurt/M. 1984. Saar, M. 2013: Die Immanenz der Macht: Politische Theorie nach Spinoza, Frankfurt/M.
13 Pina Totaro
Der Theologisch-politische Traktat im Kontext seiner Zeit
Im September 1665 schreibt Henry Oldenburg, Sekretär der Royal Society in London, einen Brief an Spinoza, in dem er ihn unter anderem zu dem Thema des Buches, an dem er gerade arbeitet, befragt. In seiner Antwort äußert sich Spinoza darüber, welche Beweggründe und Zielvorstellungen ihn beim Schreiben seines Tractatus theologico-politicus geleitet haben: „Ich verfasse eben eine Abhandlung über meine Auffassung von der Schrift. Dazu bestimmen mich: 1. die Vorurteile der Theologen; diese Vorurteile hindern ja, wie ich weiß, am meisten die Menschen, ihren Geist der Philosophie zuzuwenden; darum widme ich mich der Aufgabe, sie aufzudecken und sie aus dem Sinne der Klügeren zu entfernen; 2. die Meinung, die das Volk von mir hat, das mich unaufhörlich des Atheismus beschuldigt: ich sehe mich gezwungen, diese Meinung womöglich von mir abzuwehren; 3. die Freiheit zu philosophieren und zu sagen, was man denkt; diese Freiheit möchte ich auf alle Weise verteidigen, da sie hier bei dem allzugroßen Ansehen und der Frechheit der Prediger auf alle mögliche Weise unterdrückt wird.“ (Ep 30, 141 f.) Die hier hervorgehobenen drei Punkte zeigen in erster Linie die starke Einbindung der entstehenden Abhandlung Spinozas in den kulturellen und äußerst komplexen philosophischen und theologischen Kontext der Zeit, zeichnen aber auch ein Bild des Philosophen, der im Zentrum sehr intensiver und polemischer Auseinandersetzungen steht. In seinem Buch, geschrieben mit dem ihm eigenen Verständnis dessen, was unter „der Schrift“ zu verstehen ist, wendet sich
P T
Spinoza nicht nur gegen die Vorurteile der Theologen, sondern auch gegen die von verschiedener Seite erhobenen Vorwürfe, die ihn des Atheismus bezichtigen, und verteidigt die Freiheit zu philosophieren und das zu sagen, was wir denken. Das Werk Spinozas ist historisch und politisch bestimmt durch die Herausbildung der Republik der Sieben Vereinigten Provinzen in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, die Heinrich Oldenburg in seinem Brief an Spinoza vom 31. Juli 1663 definiert als einen Staat, „der so frei ist, daß man denken darf, was man will und sagen, was man denkt“ (Ep 14, 63). Die Vereinigten Provinzen stellten eine politische Anomalie im modernen Europa dar, denn unter den wichtigsten Staatengebilden der frühen Neuzeit sind die Vereinigten Niederlande das einzige Staatswesen mit einer republikanischen Staatsform1 . Doch werden auf mehreren Ebenen immer wieder starke Spannungen und Konf likte deutlich. Die Beziehungen zwischen den Vereinigten Provinzen, verstanden als nationale Einheit, und den einzelnen anderen Provinzen verschlechtern sich immer wieder, vor allem aufgrund immanenter Konf likte zwischen der reichsten und mächtigsten Provinz Holland und den anderen Provinzen, zwischen den sogenannten Orangisten, die von der immer rückständiger werdenden Calvinistischen Kirche und deren Anhängern in der Bevölkerung unterstützt werden, und den sogenannten Regenten, den Vertretern der Führungsschicht der reichen Händler und Unternehmer. In diesem komplexen gesellschaftlichen Rahmen übernimmt die Calvinistische Kirche eine ganz besondere Rolle. Der Calvinismus wird als Staatsreligion angesehen, doch sollte er nicht als Staatskirche im engsten Sinne verstanden werden. Es handelt sich hier eher um die Kirche oder Religion der Regierenden. Der Calvinismus war eine Landesreligion, in dem Sinne, daß in den verschiedenen Provinzen die Gottesdienste nach derselben Liturgie vollzogen und dieselben Bibeltexte benutzt wurden. Die größte Bedeutung wurde nach dem reformierten Kirchenrecht jedoch den lokalen oder regionalen Kirchengemeinden beigemessen, die sich eventuell in sogenannten „Klassen“ versammelten. Was jedoch die Unabhängigkeit der Provinz Holland anbelangt, die Spinoza in seinem Tractatus zu verteidigen scheint, so war diese aufgrund des gegenseitigen Verteidigungs- und Kooperationsvertrags an die 1 Ich möchte Theo Verbeek meinen Dank aussprechen für all die vielen nützlichen Hilfen bei der Erstellung dieses Teils des Artikels.
D T- T K Z
Entscheidungen der anderen sechs Provinzen gebunden. In dieser Konföderation der Sieben Republiken der Vereinigten Provinzen war die Provinz Holland die reichste und wohl auch bedeutendste. Die Beziehungen zwischen Kirche, Stadhouder (Statthalter) und den Streitkräften veränderten sich ständig in direkter Abhängigkeit von den jeweiligen Machtgleichgewichten und politischen und wirtschaftlichen Bedingungen und waren bestimmt von dem jeweils aufkommenden Konf liktpotential mit der Regierung der Generalstände und der mangelnden Stabilität der Regierung selbst. Innerhalb dieser sehr schwierigen und komplexen Rahmenbedingungen, getragen von innovativen Lösungsversuchen und unsicheren Experimenten, sind der theologischpolitische Erneuerungsansatz und die philosophischen Denkansätze Spinozas anzusiedeln. Beginnend mit den Klassikern, von der Untersuchung von Koenraad Oege Meinsma über Spinoza und seinen holländischen Freundeskreis (1896) (Spinoza en zijn kring Historisch-kritische Studien over Hollandsche vrijgeesten) über das Werk von Paul Vernière mit dem Titel Spinoza et la pensée française avant la Révolution aus dem Jahre 1954 (der sich vor allem mit der Verbreitung und Rezeption von Spinozas Ethica beschäftigt) bis hin zu den Untersuchungen von Jonathan I. Israel über Spinoza und das Radical Enlightenment (2001) und von Steven Nadler über das Leben des Spinoza (1999), haben viele Forscher wichtige Beiträge geleistet zum Thema der Philosophie des Glücks und der Wirkungsgeschichte des Philosophen in seiner Zeit. Hier sei unter den neuesten Veröffentlichungen zu Themen wie The early Dutch reception of the Tractatus theologico-politicus oder Spinoza and Spinozism, so die Titel der beiden Bücher von Wiep van Bunge, nur verwiesen auf die Untersuchungen von Theo Verbeek, Edwin Curley, Pierre-François Moreau, Manfred Walther und Winfried Schröder, um einige der Werke herausragender Forscher zu erwähnen. Das Umfeld des holländischen Goldenen Jahrhunderts steht dann im Mittelpunkt der Aufsätze von Henry Méchoulan oder Yosef Kaplan, die sich vor allem auf die Lebensbedingungen der Juden in Amsterdam konzentrieren. Alle diese wissenschaftlichen Aufsätze haben die auf Spinoza einwirkenden Einf lüsse ebenso erforscht wie die implizite und explizite Rezeption seiner Philosophie und deren Einf luß auf das Denken zeitgenössischer Autoren und im Besonderen deren Niederschlag in den Schriften der Zeit. Andere richteten ihre Aufmerksamkeit auf bestimmte geographische Gebiete, auf spezifische
P T
intellektuelle und religiöse Zirkel oder bestimmte Sprachgemeinden. Auch fehlten, in bezug auf die im Tractatus theologico-politicus behandelten Themen, keineswegs Beiträge zur Bibelexegese, zu den Auseinandersetzungen zwischen der religiösen und politischen Macht, zu der Frage, wem das jus circa sacra zusteht, zu der Verbreitung eines neuen Verständnisses von Wahrheit und göttlicher Heiligkeit, über Spinozas Verhältnis zum Cartesianismus, zum Stoizismus und Epikureismus. Diese wichtigen Forschungsarbeiten haben es uns erlaubt, unsere Kenntnisse über den philosophischen, politischen und kulturellen Kontext, in dem Spinoza lebte, zu erweitern und sein Werk im Licht der damaligen Lehren, die sein eigenes Denken am stärksten beeinf lußt haben könnten, besser zu verstehen. K. O. Meinsma, Israel Salvator Révah, Richard Popkin, Andrew Fix, H. Méchoulan, Yirmiyahu Yovel, zusammen mit vielen anderen haben darüber hinaus aufgezeigt, wie die Glaubenssätze der Marranen, Quäker, Mennoniten, Arminianer, Sozinianer sowie anderer radikaler christlicher Glaubensrichtungen die intellektuelle Auseinandersetzung in Holland und im Europa des 17. Jahrhunderts stark beeinf lußt haben. Neben den vielen Ansätzen, die den allgemeinen Kontext des Tractatus theologico-politicus veranschaulichen wollen, beschränke ich mich im folgenden darauf, einige Elemente, die das Denken Spinozas beeinf lußt haben könnten (um dann wiederum vom Denken Spinozas selbst beinf lußt zu werden) hervorzuheben. Darüber hinaus möchte ich die Debatte über die am meisten verbreiteten theologisch-politischen Modelle nachzeichnen und aufzeigen, welche Rolle diese im Tractatus spielen und wie sie mit der nachfolgenden Diskussion über Theologie und Politik ins Verhältnis gesetzt werden können. Schon der Titel des Tractatus theologico-politicus selbst, und diese Schrift ist das einzige Originalwerk, das der Autor noch zu seinen Lebzeiten veröffentlicht hat (die Principia philosophiae cartesianae ist eher Interpretation und Kommentar), unterstreicht, daß für Spinoza die theologische Dimension und der Bereich der Politik eng miteinander verbunden waren. Die doppeldeutige Natur dieser Wechselbeziehung zeigt sich in den vielen Phasen und Dynamiken des frühneuzeitlichen Europas, in einer Epoche der europäischen Geschichte, die vor allem gekennzeichnet ist durch tiefgehende religiöse Gegensätze und deren politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Rückwirkungen und Konsequenzen, von den Verfolgungen der sogenannten Ketzer und Dissidenten, von der Vertreibung der Juden aus Spanien und Portugal, bis hin zur Geburt neuer poli-
D T- T K Z
tischer Akteure und Protagonisten, genährt von revolutionären Unruhen und starken apokalyptisch-messianischen Bewegungen. Die Autoren, die in dieser Epoche aus unterschiedlichen Perspektiven theologisch-politische Überlegungen anstellten, nahmen in erster Linie die Römische Geschichte als Vorbild und bezogen sich durchgängig auf die Gelehrten der griechischen und römischen Antike, wie das Beispiel eines Erasmus, Bodin, Grotius oder Justus Lipsius zeigt, aber auch auf die umfassenden Schriften politischer Autoren, deren politische Lehren sich an Machiavelli und am Machiavellismus orientierten. Eine andere Sichtweise wird in den Schriften der Autoren deutlich, die sich auf Augustinus und dessen Definition der Beziehungen zwischen Theologie und Politik beziehen. Augustinus wandte sich entschieden gegen die Verherrlichung des Mythos des antiken Roms und der republikanischen Fasten und hatte der irdischen politischen Ordnungsmacht, die er als eine der heidnischen Mentalität zugehörige Eigenheit betrachtete, die absolute Transzendenz des christlichen Gottes entgegengesetzt. Der auch im 17. Jahrhundert verbreitete Augustinismus übernimmt somit die Vorbildlichkeit der civitas Dei, des transzendenten Gottesstaats, der in der Überzeugung einiger Autoren der civitas terrena, dem irdischen Staat immer überlegen bleiben wird. In der Zeit des Goldenen Jahrhunderts entsteht in den Vereinigten Provinzen, dem einzigen bedeutenden, nicht monarchisch organisierten Nationalstaat der Frühen Neuzeit, letztendlich ein neues, bis dahin noch gänzlich unbekanntes Modell der politischen Theologie, die respublica hebraeorum. Nach dem Wiederauf leben der antiken Geschichtsschreibung eines Titus Livius, Tacitus, Polybios und Strabon im 16. und 17. Jahrhundert und damit auch der Mythen der Vergangenheit, wie zum Beispiel die Entstehung Roms, die Kategorien des Römischen Rechts und die griechische Philosophie, entsteht nun mit der respublica hebraeorum ein ethisch-politisches Modell, das von der biblischen Geschichte inspiriert ist. Das Studium der antiken jüdischen Institutionen beeinf lußte die Diskussionen in Holland sehr stark, nicht nur in ihren religionsgeschichtlichen Aspekten, sondern vor allem in bezug auf die Suche nach den Ursprüngen des Republikanismus, auf die Kritik des monarchistischen Absolutismus und die Geburt eines modernen theologisch-politischen Denkansatzes.
P T
13.1 Das theologisch-politische Modell des Holländischen Machiavellismus Von Seiten Spinozas selbst verfügen wir über keinerlei Belege dafür, daß er augustinische Schriften gelesen hat. Dennoch sind in seinen Werken Elemente zu erkennen, die eine direkte Kenntnis der Schriften Augustinus’ und anderer als jansenistisch zu bezeichnenden Autoren vermuten läßt. Sicher kann jedoch bestätigt werden, daß Spinoza die Schriften Machiavellis kannte, denn er besaß in seiner Privatbibliothek eine italienische, Testina genannte Ausgabe der Opere aus dem Jahre 1550, und unter den Büchern in Oktavformat befand sich ebenfalls die lateinische Übersetzung des Principe, was auch die Verbreitung der Schriften Machiavellis in Holland und dem nordwestlichen Europa belegt. Auch wenn der Name des f lorentinischen Staatssekretärs explizit nur im Tractatus politicus, nicht aber im Tractatus theologico-politicus erscheint, so ist doch der Einf luß Machiavellis in den Schriften Spinozas deutlich vorhanden. Auch werden dessen Schriften im Umfeld der holländischen und auch anderer zeitgenössischer Autoren rezipiert, allerdings häufig nur in kritischer und polemischer Absicht. In seiner 1641 in Amsterdam veröffentlichten Dissertatio de arcanis rerumpublicarum zum Beispiel, aber auch in seinen anderen Werken steht Arnold Clapmar in seinen Ausführungen über den Zusammenhang zwischen Religion und Staatsräson in vollem Widerspruch zu den Positionen Machiavellis, oder besser gesagt zu einem allgemein falsch verstandenen Machiavelli, dessen Ausführungen zur Notwendigkeit des Einsatzes von Gewalt in der Politik mit einer reinen Verherrlichung der Gewalt gleichgesetzt wurden. Das Buch Clapmars übte in Europa großen Einf luß aus. Besonders zwei Schriften, das 1657 erschienene Werk Bedekte konsten (Verdeckte Künste) von Gerard van Wassenaer und das Pieter de la Court zugeschriebene und 1662 erschienene Buch Nauwkeurige consideratie van staet (Betrachtungen über den Staat) zeigen ebenfalls die Bedeutung dieser Thematik, mit der sich Clapmar und vor ihm vor allem Machiavelli im Rahmen der allgemeinen Auffassung des Rechts als Machtfaktor und in der Diskussion über die Funktion der Religion im Staatswesen auseinandergesetzt hatten. Der Zusammenhang zwischen Religion und Politik ist – unabhängig von den unterschiedlichen Ansätzen – der bevorzugte Ort der Auseinandersetzung mit, oder besser gesagt der Polemik gegen Machiavelli.
D T- T K Z
Im Principe (Der Fürst) und in den Discorsi sulla prima Deca di Tito Livio (Abhandlungen über die ersten zehn Bücher des Titus Livius) fanden die Autoren des 17. Jahrhunderts ein politisches Modell, das die Römische Geschichte und den Mythos der Gründung Roms aus ganz anderer Sicht neu interpretierte. Die Aufgabe der Religion im gesellschaftlichen und staatlichen Leben, die Gewalt als konstitutiver Akt und Überlegungen über die irdische Natur der Politik sind einige der Leitgedanken, die in den zeitgenössischen Abhandlungen vor allem Machiavelli zugeschrieben werden. Als absolut widernatürlich wird die Definition der Religion (religio) als reines Herrschaftsinstrument (instrumentum regni) angesehen, genauer gesagt die reine Instrumentalisierung der Religion im antiken Rom, und daraus entsteht eine theologisch-politische Dimension, die gerade im Goldenen Jahrhundert kontrovers diskutiert oder widerlegt werden sollte. Mit Machiavelli und dem Machiavellismus veränderte diese Suche nach der Anerkennung der Autonomie der civitas terrena den gesamten Bedeutungshorizont, der sich mit der seit Augustinus ausgesprochenen und nach ihm von der gesamten Christenheit geteilten theologischen Verurteilung herausgebildet hatte. Wenn der Augustinismus die blutbef leckte Herkunft des der Politik zugrunde liegenden Herrschaftsmechanismus immer wieder anprangert, so gibt Machiavelli demselben ein ganz neues Fundament. Das Prinzip der Politik wird neu eingebunden in ein ganz anderes Verständnis der menschlichen Natur, in eine realistischere Betrachtung der ihr innewohnenden vielschichtigen Bestandteile und Zwiespältigkeit sowie der Triebfedern für deren Veränderung. So kann eine neue Dialektik zwischen den Vorrechten des Theologen und den Instanzen der Politik entstehen. Das, was im Fall des von Romulus begangenen Brudermords zum Beispiel als Ausf luß eines triebgesteuerten Hangs zu Gewalt und Unterdrückung gebrandmarkt wird, wird von Machiavelli als Versuch gesehen, dem Inhaber der Macht größere Stärke und Stabilität zu gewährleisten, und zwar nicht für sich selbst, sondern im Namen des Allgemeinwohls. Mit dem Aufkommen des Begriffs des Politischen zeigt sich auch die Notwendigkeit einer einheitlichen und stark zentralisierten Regierung sowie die Notwendigkeit, auf den Einsatz von Gewalt gegen diejenigen zurückzugreifen, die sich dem widersetzten. Die Religion übernimmt dann eine funktionale Rolle für die Stabilität und Festigung, die wirtschaftliche Logik und die Regierungsstrategien der Republik. Sie wird somit notwendigerweise zur Zivilreligion. Durch die Entlarvung der in den traditionellen Beziehungen zwischen Theologie und Politik verborge-
P T
nen Ambivalenz beweist Machiavelli einerseits, daß die Legitimation politischer Macht durch Gott nicht begründbar ist und andererseits, daß die theologische Einf lußsphäre funktional von politischen Einf lüssen bestimmt wird (Discorsi I, Kap. 11, Abs. 3; Abs. 8–12; Abs. 19). Gott selbst (und alles, was das Göttliche anbetrifft) bekommt in dieser Sichtweise eine politische Bedeutung, bis zu dem Punkt, daß die Ehrfurcht gegenüber Gott zur Ehrfurcht gegenüber der Autorität des Fürsten wird, der die Inkarnation der göttlichen Macht darstellt, die ihm, dem Fürsten sozusagen innewohnt. Mit Machiavelli und dem Machiavellismus wird der Religion jedwede eschatologische und charismatische Bestimmung entzogen, sie wird ihres spirituellen Potentials und ihrer Projektion in die Transzendenz beraubt, um somit die irdische Herrschaft des Fürsten zu verherrlichen und dessen politisches Handeln zu stärken. Diese überwiegend weltliche Interpretation des Religiösen in den Schriften Machiavellis hat es vielen der politischen Autoren des 17. Jahrhunderts erlaubt, die Rolle des Florentiner Staatssekretärs im komplexen Prozeß der Säkularisierung der Religion, die als das Fundament der Moderne angesehen wird, in den Mittelpunkt zu stellen. Besonders die politischen Autoren in Holland setzen sich für ein republikanisches politisches System ein und betonen – im Widerspruch zur Monarchie –, daß im politischen Staat die einzelnen Neigungen des Individuums, aus denen sich die Religion ja nährt, neutralisiert werden zu Gunsten einer sich immer mehr verbreitenden kollektiven Vernunft (vgl. Visentin 2001). Es ist von daher kein Zufall, daß in den Werken der Brüder De la Court [van Hove] eine sehr treue Anlehnung an das machiavellistische Modell zu bemerken ist, die nicht nur in der wiederholten Bezugnahme auf Machiavelli als Quelle deutlich wird, sondern auch in der Gliederung der verschiedenen Kapitel, die sogar in den einzelnen Überschriften die Inhalte der Discorsi sulla prima Deca di Tito Livio, aber auch des Principe wiederholen. In deren systematisch aufgebauten Werken, den Consideratien van Staat ofte Politike Weegschaal und in den Politike Discoursen wird den Begriffen, so zum Beispiel dem Begriff virtus, durchgängig eine neue Bedeutung zugewiesen, die somit ihren ursprünglichen Sinn verlieren. Dieser Prozeß, alten Begriffen ganz neue Bedeutungen zuzuweisen, stellt wohl – wie schon von Otfried Höffe (2012, 108) hervorgehoben – eines der signifikantesten Merkmale des Moralbegriffes bei Machiavelli dar. Im Tractatus theologico-politicus finden wir allgemeine Überlegungen zu dem komplexen Spannungsverhältnis zwischen Politik und der magmatischen Di-
D T- T K Z
mension der Religion. Aus der philosophischen Perspektive Spinozas stellt die Verknüpfung von Theologie und Politik ein bestimmendes strukturierendes Element im gesellschaftlichen Zusammenleben und in der staatlichen Organisation dar, denn dies gründet sich auf dieselben affektiven Wurzeln des Menschen. Die europäische Geschichte und die besondere Lage in den Vereinigten Provinzen zeigen, daß die Religion über ein Potential verfügt, das weder ignoriert noch zerstört werden darf, sondern richtungsweisend gehegt und gepf legt werden muß. Nicht nur weil sie reines instrumentum regni in den Händen der Inhaber der politischen Macht ist, auch nicht aufgrund ihrer Nützlichkeit und als Träger der absoluten Wahrheit, sondern weil sie dieser unstabilen Mischung einander entgegengesetzter Triebe und Leidenschaften entspricht, dessen, was den Menschen ausmacht, den Menschen mit seinen ambivalenten Verhaltensmustern und seiner wankelmütigen Natur. Die Wechselbeziehungen zwischen Theologie und Politik führen allerdings nicht zur Verminderung des theologischen Einf lußbereichs oder zur Unterordnung der Theologie unter die Politik, sondern implizieren eine neue Funktion der Politik; eine Politik, die die Vorrechte des Individuums garantiert und ihnen den Vorrang gibt und die die Religion als autonome und für den gesellschaftlichen Zusammenhalt unumgehbare Kraft ansieht. Spinoza übernimmt Machiavellis Menschenbild, das heißt der Mensch ist weder Subjekt einer Billigung des gegenwärtig existierenden Bösen, das in der Zukunft besiegt werden und von dem man sich befreien kann, noch anzusehen als einfacher „Ort“ des Kampfes zwischen Lastern und Tugenden in der grundsätzlichen Verderbtheit der menschlichen Natur, auf die erzieherisch eingewirkt werden muß, um die schlimmsten Auswüchse abzumildern. Doch anders als Machiavelli analysiert Spinoza die ursprünglichen Triebfedern, die den Menschen der Religion annähern und die Vorurteile als Wurzel des Aberglaubens, um eine neue Lesart der biblischen Schriften zu erarbeiten und eine Politik zu entwickeln, die die von der Dynamik des Glaubens ausgelösten Mechanismen auch bewußt und stärker einbezieht. Somit legt Spinoza die grundlegenden Gesetzmäßigkeiten einer von ihm als catholica oder universalis definierten religio fest, die nicht im Kontrast sondern im harmonischen Einklang mit dem Politischen steht, das Werkzeug, das Gesundheit und Seelenheil, Glaube, Treue und Redlichkeit, Liebe, Nächstenliebe und Gerechtigkeit gewährleisten kann. Im Rahmen seiner kritischen Widerlegung der herkömmlichen Bibelauslegung unterstreicht Spinoza im Tractatus die Inhalte einer einzigen Offenbarung, bestehend aus den „moralische[n] Bestim-
P T
mungen ... als eine allgemeinallgemeingültige Morallehre“ (documenta moralia, omnibus hominibus universalia) (TTP V, 83). Die Allgemeingültigkeit ist ein charakteristisches Merkmal der im Tractatus niedergelegten Theologie, die nicht nur das Volk des Alten Testaments betrifft, sondern sich an die gesamte Menschheit wendet. Die im Tractatus begründete theologia oder religio vera besteht in den wenigen von Spinoza im 14. Kapitel niedergelegten Lehren. Diese werden in dem besonderen historischen Kontext Hollands im 17. Jahrhundert verfaßt und enthalten ein neues theologisch-politisches Modell, das die Freiheit und die Wahrung des Friedens einbezieht, auf Verfolgungen und Exilierung verzichtet und die Integration und den Dialog begünstigen sollte. Ein solches Modell ist vor allem in einer Demokratie durchsetzbar, mit einer Regierung, die Spinoza als „die ungeteilte Versammlung von Menschen, die gemeinschaftlich ein höchstes Recht über alles, was in ihrer Macht steht, innehat“ (TTP XVI, 244) definiert. In vielerlei Hinsicht beruft sich Spinoza in seinen theologisch-politischen Überlegungen auf Machiavelli (obwohl derselbe nie explizit im Tractatus zitiert wird) und auf das von Hobbes (der im Tractatus nur einmal in einer Anmerkung zitiert wird) dargelegte absolutistische Modell. Die Konzeption des Bundes als ein die menschlichen Beziehungen durchdringendes Element, die Notwendigkeit der Eingrenzung der im Naturstaat unabdingbaren individuell ausgeübten Rechtssouveränität, die Vorstellung von einer potentia als handlungsfähige Autorität, all das sind einige der bei Machiavelli und Hobbes vorhandenen Leitgedanken, die wir bei Spinoza, aber auch in großen Teilen der zeitgenössischen holländischen politischen Historiographie, wiederfinden. Dennoch betont Spinoza einige wesentliche Unterschiede zwischen der eigenen Auffassung von Politik und der von Hobbes. Dies betrifft vor allem den anderen Ansatz bei der Definition des Begriffes Freiheit und der Wechselbeziehungen zwischen Freiheit und Frieden (wie Spinoza in TTP XVI, 246, Anm. verdeutlicht), aber auch die Definition von Demokratie als Verkörperung der kollektiven Machtausübung (collegialiter ist der signifikante, in diesem Zusammhang benutzte Begriff) und die Betonung, daß es dem Individuum nicht möglich ist, auf die Ausübung seines natürlichen Rechts zu verzichten. So schreibt Spinoza in der Vorrede zum Tractatus: „Da jedoch niemand die Macht sich zu verteidigen so weit preisgeben kann, daß er aufhörte Mensch zu sein, schließe ich, daß niemand seines natürlichen Rechts uneingeschränkt beraubt werden kann, die Untertanen also manches, gleichsam
D T- T K Z
naturrechtlich, behalten, was ihnen ohne große Gefahr für den Staat nicht genommen werden kann“ (12).
13.2 Das theologisch-politische Modell der respublica hebraeorum Abgesehen von der Wiederaufnahme der auch von Machiavelli („acutissimus Machiavellus“ – TP V 7, 66) und Hobbes behandelten Themenstellungen, der beispielhaften Rolle der Römischen und Griechischen Geschichte oder der an Augustinus orientierten Interpretation der Beziehung zwischen Recht und Sünde, übernimmt Spinoza im Tractatus theologico-politicus ein weiteres Paradigma. Es handelt sich um den Topos der respublica hebraeorum, der vom 16. bis ins 18. Jahrhundert in den politisch-philosophischen Abhandlungen sehr weit verbreitetet war. In den Vereinigten Provinzen übernimmt die Diskussion über den Staat der Hebräer eine besonders herausragende Rolle, vor allem aufgrund der zentralen ethischen Relevanz und der bei der Frage des jus circa sacra dargelegten Lösungen, sowie aufgrund der Gültigkeit des vorgestellten föderalen und republikanischen Staatsmodells. Die Veröffentlichung des Tractatus theologico-politicus im Jahre 1670 war entscheidend in der Debatte über den antiken Staat der Hebräer, die sich in der holländichen Republik aufgrund ihrer theologisch-politischen Bedeutung in eine ganz besondere Richtung entwickelt hatte. Ein Jahrhundert zuvor, zwischen 1569 und 1572, erschien in Antwerpen, herausgegeben von dem Spanier Benedictus Arias Montano im Verlag des Buchdruckers Plantin, die bedeutendste, noch nie dagewesene polyglotte Bibel, die Biblia sacra (hebraice, chaldaice, graece et latine), Philippi II, cura et studio Benedicti Ariae Montani, die so genannte Königliche Polyglotte, für die Phillipp II. die Schirmherrschaft übernommen hatte. Das Werk kann als Vollendung der großen Epoche des Humanismus und der Renaissance angesehen werden, die – zusammen mit der Reformation – den Gelehrten Zugang zu den Bibeltexten in ihren Originalsprachen gegeben hatte. Dadurch waren die Voraussetzungen für die Verbreitung einer neuen kulturellen Atmosphäre gegeben, denn diese Bibelausgabe machte die vertiefte Kenntnis der hebräischen Überlieferung, der rabbinischen Literatur und der Denkmodelle der jüdischen Philosophen wie Philon, Flavius Josephus oder Maimonides möglich. Das Werk Montanos
P T
– gefolgt von den Antiquitatum judaicarum libri (1593) – erlaubt es, auch dank seiner umfassenden Kommentare, Hilfsmittel und Chronologien, die respublica hebraeorum nicht als eine religiöse Gemeinschaft zu sehen, sondern als eine wahre sozio-politische und kulturelle Urgemeinschaft. In der Republik der Vereinigten Provinzen wird sie zu einem wahren Modell, mit dem die eigenen institutionellen Strukturen verglichen oder in dem sie sogar wiedererkannt werden können. Allgemein wird überall der Vergleich des Staats im antiken Israel mit den Organisationsstrukturen der modernen Staaten zu einem immer wiederkehrenden Thema in den philosophischen und theologisch-politischen Veröffentlichungen. Die der respublica hebraeorum gezollte Aufmerksamkeit beschränkte sich nicht nur auf die Theologen und die Welt der Kunst, wo in der Dichtung, der Malerei und den Schönen Künsten immer wieder biblische Themen und Ereignisse interpretiert wurden. Das Wissen um das antike Israel wurde auch in den gebildeten Zirkeln der Humanisten und Hebraisten, in den Akademien und Universitäten diskutiert, wo das gelehrte Studium der „Jüdischen Altertümer“ und der Geschichte des jüdischen Rechts dazu beitrug, aus dem Mythos der respublica hebraeorum ein zugkräftiges politisches, konstitutionelles und republikanisches Staatsmodell (vgl. Campos Boralevi 2002, 445) zu machen. Der in der Schrift überlieferte Auszug aus Ägypten und die Flucht aus der Versklavung vermittelte die Geschichte eines Volkes, dem es gelang, sich Gesetze zu geben und durch eine besondere Rechtsordnung die Stabilität des eigenen Staatsgebildes zu gewährleisten. Die Natur dieses von den verschiedenen jüdischen Stämmen direkt mit Gott geschlossenen Bundes (Berith) schien darüber hinaus einer politischen Verfassung zu entsprechen, die zwar auf dem Konzept eines einheitlichen Staates beruht, jedoch als Grundlage die „Föderation“ zwischen unterschiedlichen regionalen Eigenheiten und Identitäten hat, also gleich dem Staatenbund der Sieben Provinzen. Es folgten viele Neuausgaben der Bibel von Montano, und überall wurden immer mehr Schriften antiker und moderner Autoren übersetzt und der respublica hebraeorum gewidmete Abhandlungen veröffentlicht. Hier sollen nur einige der Titel genannt werden, um zu belegen, daß dieses biblische Modell bei den Gelehrten der unterschiedlichsten Religionszugehörigkeiten seit dem 16. Jahrhundert höchste Beachtung und Verbreitung gefunden hatte. So wurde die Abhandlung De politia judaica tam civili quam ecclesiastica aus dem Nachlaß des lutherischen Pastors Corneille Bonaventure Bertram im Jahre
D T- T K Z
1641 in Leiden unter dem Titel De republica ebraeorum neu herausgegeben; daneben erschien die De republica hebraeorum des Katholiken Carlo Sigonio (1582), sowie die Schrift De republica hebraeorum von Johannes-Stephanus Menocchio (1648); unter den Büchern protestantischer Autoren finden wir die Abhandlungen Antiquitates sacrae veterum hebraeorum (1708) und Palaestina ex monumentis veteribus illustrata (1714) von Hadrianus Relandus; daneben sei die Vindiciae contra tyrannos des Hugenotten Stephanus Junius (1610) und die Politica methodice digesta et exemplis sacris et profanis illustrata des Calvinisten Johannes Althusius (1614) anzumerken. Unter den Autoren, die die politia judaica als Archetypus einer perfekten Republik idealisieren, sei unter den vielen anderen an die Werke von Joseph Scaliger, Johannes Drusius, Johannes und Adam Boreel, Constantin l’Empereur, Gerardus Johannes Vossius, Sixtinus Amama, Johannes Coccejus, Guilelmus Vorstius, Georgius Gentius erinnert, und besonders Hugo Grotius sollte nicht vergessen werden. Im Besonderen ist Peter van der Kun (Cunaeus), der Autor einer De republica hebraeorum, die im Jahre 1617 im Elsevier-Verlag in Leiden erschien, zu erwähnen. In seinem Buch wird die absolute Überlegenheit des Gründungsmythos der Politeia biblica mit seiner theokratischen und föderalen Regierung konstatiert. Aus den Kommentaren Maimonides und den Überlegungen in den politischen Schriften Jean Bodins leitet Cunaeus ab, daß das jüdisch-hebräische theologisch-politische Modell dem griechischen und römischen weit überlegen ist. In den Auslegungen des holländischen Humanisten hatte Moses als Prophet und Gesetzgeber zum ersten Mal in der Weltgeschichte dem Staat einen schriftlich festgelegten Gesetzeskodex gegeben und das Volk auch darin unterwiesen, was falsch und was richtig sei, um letztendlich durch die Übernahme dieser von Gott gegebenen Rechte und Gesetze zu gewährleisten, daß die Gemeinschaft zur respublica oder zum Commonwealth würde. Und eben diesen Begriff Commonwealth benutzt Clemens Barksdale in seiner Übersetzung des Buches aus dem Jahre 1653 in die englische Sprache: „He [Moses] was the first writer and publisher of Laws, teaching the people, what was right or wrong, just or unjust, and by what Decrees that Common-wealth was to be established, which the most high God had commanded to settle in Palestine“ (Cunaeus 1653, 37). Cunaeus verbreitet im christlichen Europa somit die ethisch-politischen Gedanken Maimonides zusammen mit einem Gesellschaftsmodell, das auf das göttliche Gesetz und die durch die Agrargesetze gewährleistete soziale
P T
Gleichheit gegründet war, ebenso wie auf die Institution des Sanhedrin, der die allgemeine concordia der respublica zum Ziel hat. Die umfassende Rekonstruktion der Gründungsgeschichte der respublica von Israel zeigte auch, wie dieses Modell an die Bedürfnisse der neuen holländischen Republik angepaßt werden könnte. So sollte die Zivilregierung, die auch über die religiöse Macht verfügte, ein für alle modernen Staaten gültiges ethisches Verfassungsmodell etablieren. Mit Cunaeus und den anderen Autoren, die sein Werk inspiriert hatten – ohne Zweifel auch Grotius – wurde die politische Theologie der hebräischen Republik zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert – bis zu Locke, Toland und darüber hinaus – ein ethisch-politisches, konstitutionelles und republikanisches Modell. Das Werk fand enorme Verbreitung in Europa, wurde in die englische, französische und holländische Sprache übersetzt, und auch noch im Laufe des 18. Jahrhunderts erschienen mehrere Neuausgaben. Es wurde zum wohl mächtigsten Instrument zur Verbreitung eines ethischen und republikanischen Staatsmodells, gegründet auf das Fundament der allgemein absolut anerkannten Autorität der Bibel und das Prinzip der sozialen Gerechtigkeit auf der Grundlage des direkt zwischen Volk und Gott geschlossenen Bundes (Foedus/Berith) als Gründungsakt. Die respublica hebraeorum wurde zu einem in Europa sehr verbreiteten Modell, das vor allem von den Lehrstühlen der Universitäten verkündet wurde, wie die Fälle von Bertram und Cunaeus zeigen, die in Genf beziehungsweise in Leiden lehrten (vgl. Ligota 1992, 157). Gerade in der holländischen Tradition der gebildeten und gelehrten humanistischen und hebraistischen Zirkel wurde die respublica hebraeorum der politeia biblica zum republikanischen Modell, auf dem das novus Israel der Vereinigten Provinzen mit seiner dem jüdischen Staat ähnlichen föderalen Struktur aufgebaut werden sollte. Die Gesetzgebung Moses diente im europäischen Rechtsdenken des 17. Jahrhunderts als gemeinsamer Bezugspunkt. Sowohl im lutherischen als auch im katholischen Umfeld schien Moses’ respublica hebraeorum der Garant für Glück und Wohlstand (vgl. Sigonio und Bertram) zu sein, doch in den reformierten Ländern und den calvinistischen Provinzen der Niederlande sollte sich dies in besonderem Maße zu einer perfekten Verteilung der politischen und religiösen Funktionen herauskristallisieren. Die Geschichte der respublica hebraeorum modelliert und gestaltet die Menschheitsgeschichte von Adam bis Jesus Christus neu, indem sie die in der Bibel erzählten Ereignisse den Bedürfnissen der Moderne annähert und neu in-
D T- T K Z
terpretiert. Spinoza selbst widmet den Institutionen und der Organisation einer solchen Republik im Tractatus zwei Kapitel, namentlich das 17. und 18. Kapitel, ohne sich auf das römische Rechtssystem und dessen Gesetze zu berufen, deren Quellen ihm sehr wohl bekannt waren und die er immer implizit oder explizit zitiert hatte, so zum Beispiel die Historien des Tacitus. Schon vor Spinoza hatte sich Montano von dem institutionellen Modell des antiken Roms distanziert und demgegenüber das jüdische Modell dem klassischen als überlegen erklärt. Verglichen mit diesem Ansatz hat Spinoza andere Prämissen und Zielvorstellungen. Es scheint, als wolle er den Juden den wahren Sinn ihrer alleine durch das Reich Gottes sanktionierten Geschichte zurückgeben, und den Christen eine neue Lesart der Geschichte, in der die Juden so lange keinen Platz mehr hatten. Im antiken Griechenland und in der Römischen Geschichte wurde der Souverän angebetet und verehrt, und die Vergöttlichung des Monarchen war ein wichtiges Instrument zur Machterhaltung. Unterlagen von Alexander dem Großen bis Augustus alle Fragen der sozialen und politischen Verfassung sehr strengen sakralen Regeln und Prozeduren, so findet Spinoza in der theologischen Politik des antiken Israels ein – wenn auch nicht projezierbares – Modell der staatlichen Organisation und des Machtgleichgewichts. Die Theokratie oder der Gottesstaat, verstanden als die Ablehnung eines irdischen Herrschers, übernimmt bei Spinoza in vieler Hinsicht demokratische Züge, gerade bezogen auf das die Allgemeinheit betreffende Gleichheitsprinzip und den repräsentativen Charakter der politischen Ämter. Die Theokratie verbietet in der Tat die Herrschaft des Menschen über den Menschen und erlaubt weder die absolute Alleinherrschaft des Menschen noch jedwede Form von Hierokratie. Spinoza beruft sich auf den antimonarchischen Auftrag der respublica hebraeorum. So betont er bezugnehmend auf den im Auszug aus Ägypten beschriebenen Staat, daß die Juden alle absolut frei und gleich und kraft des Bundes alle jus imperii absolute retinuerunt waren. Jeder Stamm hatte das gleiche Recht, die Gesetze anzunehmen und auszulegen, und auch die Möglichkeit, staatliche Funktionen zu verwalten, beruhte auf gleichen Rechten (aequali utriusque jure). Die hebraistischen Studien, das erweiterte Wissen und die Kontakte zu der vielfältigen marranischen Welt stellen den Hintergrund dar für die Debatte über das biblische Israel in den gelehrten Zirkeln Hollands und der respublica literarum. Spinoza wendet sich mit seinem Tractatus theologico-politicus an die Gelehrten seiner Zeit, an die philosophisch bewanderten Leser, die
P T
der lateinischen Sprache mächtig sind und die Schlüssigkeit und Gültigkeit seiner theologisch-politischen Überlegungen erkennen können. In seinen Ausführungen unterscheidet er sich deutlich von traditionellen Auslegungen der Bibel und von denen der anderen holländischen Autoren seiner Zeit, von Lodewijk Wolzogen über Gerard Vossius oder Graevius, und begründet eine neue, historisch-kritische Lesart der Heiligen Schrift, frei von der Idealisierung der Vergangenheit und den Vorurteilen der Gegenwart. In seinen Werken ist der Einf luß vieler Autoren seiner Zeit, auch vieler chrétiens sans église, die in Holland Aufnahme und Asyl gefunden hatten, durchgängig vorhanden, doch Quelle seiner Ref lexionen über das jüdische Volk scheint eher Philon von Alexandria gewesen zu sein, so wie Flavius Josephus als Quelle für die Rekonstruktion der Geschichte des jüdischen Altertums herangezogen wurde. Doch hinsichtlich des letzteren verdeutlicht Spinoza die Gefahr, die von einer Regierung der Priesterschaft und der Konzentration des politischen und priesterlichen Einf lußbereichs ausgeht. Gegen die Priesterschaft des antiken Israel, die die theokratische Regierung zerstört hat, um die Interessen der eigenen Kaste zu verteidigen, lehnt Spinoza die hierokratische Theokratie ab und verteidigt einzig und allein die Grundlagen der Demokratie. Aus der Bibel selbst leitet Spinoza nicht den Gegensatz zwischen den fest miteinander verbundenen Elementen der Theologie und Politik ab, sondern die Prämissen für die neue Definition des theologischen Fundaments und der politischen Dynamiken. Die von Spinoza provozierte Diskussion über die respublica hebraeorum entsteht zwar aus der Auseinandersetzung mit den von unterschiedlichen zeitgenössischen Autoren – unter anderem Grotius, Castellion, Hobbes und andere politische Autoren – aufgestellten Thesen, doch weist er der biblischen Geschichte eine präzise Funktion zu. Spinoza setzt sich mit der spätantiken Literatur und den Quellen des mittelalterlichen Judaismus auseinander und entdeckt hier einen neuen kulturellen Horizont, aus dem er ganz neue gesellschaftliche Instanzen ableitet. Die Gültigkeit des antiken jüdischen Staates bleibt für ihn unumstritten, da er eine Konföderation unterschiedlicher regionaler Identitäten und Kulturen darstellt, die innerhalb dieses föderativen Gebildes alle gleich und autonom vertreten und organisiert sind. Dennoch lenkt Spinoza sein Interesse vor allem auf die Konf likte und Krisen innerhalb dieses antiken Staatsgebildes und deren Ursachen. Im Incipit des 18. Kapitels, in dem er „einige politische ... Lehren“ niederlegt, die auf „dem Staat und der Geschichte der
D T- T K Z
Hebräer“ (TTP XVIII, 282) beruhen, bestätigt Spinoza auf der einen Seite die diesem Staat innewohnende Fähigkeit, sich in alle Ewigkeit zu bewahren, auf der anderen Seite jedoch auch dessen absolute Nichtwiederholbarkeit: „Obwohl der Staate der Hebräer … immerwährend hätte sein können, kann sich heute doch niemand an ihm orientieren, noch wäre dies ratsam“ (ebd.). Obwohl dieses Modell nicht als nachahmenswert angesehen werden kann, so waren die inneren Organisationsmechanismen und das System der Rechtsverteilung, mit denen die respublica hebraeorum ausgestattet war, für Spinoza doch bemerkenswert, hatte sie doch in ihr Verfassungssystem den Föderalismus als staatliche Ordnung und mit dem ethisch-politischen Instrument des Jubeljahrs, des Jahres der Freilassung, das Verfahren eines periodischen Schuldenerlasses und einer Umverteilung des Besitzes übernommen. Spinoza erkannte darüber hinaus in der jüdischen Theokratie ein Modell für die Einheit der Gewalten als effizientes Instrument zur Erreichung sozialer Gerechtigkeit und zur Verstärkung der auf das Allgemeinwohl gerichteten Aufmerksamkeit. Die Theokratie gab in der Rationalität der Ethik den Geboten der lex divina einen neuen Stellenwert, denn das Politische war eng an den Bereich der Freiheit gebunden, und somit wurde auch die respublica divina als ein Staat neu gegründet, der sich im Inneren selbst regulieren und gegen äußere Angriffe und Feinde verteidigen konnte. Für Spinoza war das von den Juden zu Zeiten der Bibel übernommene Staatsmodell beispielhaft, vor allem was die Lenkung und Kontrolle der res publica anbetraf, denn der Staat war mit nahezu perfekten Mechanismen ausgestattet, um die Macht der Herrschenden zu kontrollieren und zu begrenzen und die gerechte Verteilung des Besitzes und der Reichtümer unter den Beherrschten zu garantieren. Andere Autoren hatten Moses als Inhaber einer absoluten Macht instrumentalisiert und betont, die Juden hätten Moses zum Inhaber der Reichsgewalt gemacht, nachdem sie selber auf ihr eigenes Recht, sich direkt an die göttliche Macht zu wenden, verzichtet und ihm alle Ämter übertragen hatten. Doch blieb die Lenkung der res publica im Mosaischen Gesetz verankert, und die Gewaltenteilung gewährleistete eine Vielfalt an unterschiedlich zugewiesenen Instanzen und Funktionen. Die Geschichte der Juden, wo und wie auch immer sie im Laufe des 17. Jahrhunderts zitiert und neu ausgelegt werden mag, gewinnt im Tractatus Dimensionen einer Universalgeschichte, nahezu emblematischen Charakter, auch wenn sie nicht mehr so zweckmäßig erscheint, wie es die Geschichte
P T
der Gründung Roms für Machiavelli im Modell der Discorsi war oder wie das Leben Alexander des Großen im Werk des Curtius Rufus. Gerade die Bücher der Historiae Alexandri Magni von Rufus zirkulierten in verschiedenen Ausgaben im Holland des 17. Jahrhunderts (nicht nur in lateinischer, sondern auch in niederländischer Sprache). Im Staat des antiken Israel war Gott nur Referent und Garant der Theologie und der Politik, niemand konnte deshalb einem ihm gleichgesetzten Wesen unterworfen werden, sondern nur Gott selbst. Die barmherzige Liebe gegenüber dem Mitbürger wurde als die höchste Form der Gottesfürchtigkeit geschätzt und alle waren in gleicher Weise dem strengen Gehorsam gegenüber den Gesetzen verpf lichtet. Als die Leviten dann dem öffentlichen Bereich zugehörige Funktionen und Ämter übernahmen, begann der Niedergang der respublica hebraeorum als Hierokratie, ebenso wie nach dem theologisch-politischen Modell des Augustinus der Gewaltakt des Brudermordes, der die Genese der römischen und heidnischen civitas terrena kennzeichnete, gleichzeitig auch schon der Vorbote des darauf folgenden Untergangs Roms ist. Die respublica hebraeorum des Alten Testaments beinhaltet nach Spinoza eine Darstellung der Beziehung oder Interaktion zwischen dem politisch-rechtlichen und dem religiösen Aspekt. Einen solchen Staat können wir mithilfe seiner in der Bibel erzählten Geschichte nachzeichnen, seine Geburt, Fortentwicklung und letztendlich seinen Untergang nachverfolgen. Im Gegensatz zu anderen Autoren, die sich auf die Verherrlichung oder auf den symbolisch-metaphorischen Charakter konzentrierten, interessiert es Spinoza mehr, die Gründe zu analysieren, die zu Beginn dessen Größe und dann seinen Verfall bestimmt hatten, um im Rückblick auf die Antike die Probleme der Moderne zu verstehen. Der Vergleich, den er zwischen dem alten Israel und dem Holland des 17. Jahrhunderts zieht („beinahe vergleichbar (sieht man einmal von dem gemeinsamen Tempel ab) mit den autarken Provinzen des Staatenbundes der Niederländer“ (TTP XVII, 266); „eodem fere modo [der Stämme Israels] (si templum commune demas) ac Praepotentes Confoederati Belgarum Ordines“), erlaubt es in diesem Sinne, Ursachen und Ursprünge der Schwachstellen des Staates in einer Krise zu finden, die wiederum ihre Ursache hatte in der Tatsache, daß die unterschiedlichen Funktionen nicht eindeutig definiert waren und den „Theologen“ die eigentlichen Vorrechte der Politik zugewiesen wurden. Hieraus leitet Spinoza dann auch die Notwendigkeit ab, auf alle Weise – wie er in dem am Beginn dieses Artikels
D T- T K Z
zitierten Brief an Oldenburg schreibt – der Überheblichkeit der „Theologen“ zu widersprechen, welches ebenfalls zu einer seiner wichtigsten Zielsetzungen im Tractatus wird. Das von Spinoza analysierte Modell hat, ebenso wie alle gelehrten Abhandlungen über die respublica hebraeorum, im modernen Europa einen universalen und interkonfessionellen Charakter (vgl. Campos Boralevi 2011, 73 f.). In diesem Zusammenhang versucht der Tractatus theologico-politicus zu beweisen, daß die Freiheit zu philosophieren nicht nur gewährt werden kann, sondern daß sie gar nicht verweigert werden kann, ohne gleichzeitig auch den politischen Frieden zu verweigern, oder besser den Frieden im Staate, der die Gottesfürchtigkeit selbst oder auch die wahre Religion ist. Diese wahre Religion besteht nach Spinoza nicht in einer spezifischen, positiven Religion, sondern in dem göttlichen Gesetz selbst, das dem gesamten Menschengeschlecht durch die Propheten und Apostel offenbart worden ist. Die wahre Religion unterscheidet sich genau betrachtet und nach der Methode der Schriftauslegung des sola scriptura in keiner Weise von der, die auch das natürliche Licht uns lehrt (vgl. TTP, Vorrede). Die im 16. Jahrhundert entstandene Auseinandersetzung mit der respublica hebraeorum sollte sich auch lange in die Zeit der Aufklärung fortsetzen und konzentrierte sich auf den Bedeutungsgehalt der Theokratie und die Rolle der Regierungsfunktionen, die Moses übernommen hatte, verstanden als absoluter Monarch beziehungsweise als Oberhaupt einer aristokratischen und oligarchischen Machtausübung. Nach der Fertigstellung der 34 Bände des Thesaurus antiquitatum sacrarum von Blasius Ugolinus in den Jahren 1744–1769, also wenige Jahre vor der Revolution, veröffentlicht Giovanni Francesco Conforti in Neapel im Jahre 1780 eine kritische Abhandlung über Hugo Grotius mit dem Titel De imperio summarum potestatum circa sacra. In seiner einführenden Prolusione diskutiert Conforti die Besonderheiten in der Natur der Theokratie. Er zitiert dieselben Quellen, auf die sich schon Spinoza bezogen hatte und stellt sich darauf die Frage, ob Moses das Volk summo arbitratu regiert oder aber ob dessen Regierung ein imperium aristocraticum gewesen sei, und wirft damit eine Problematik auf, die deutliche Rückwirkungen auf die theologisch-politische Debatte der Zeit haben sollte. Dieses letzte Zeugnis belegt letztendlich die Kontinuität und Vitalität einer auch von Spinoza in seinem Tractatus wieder aufgenommenen und bearbeiteten Thematik, die die philosophische Debatte
P T
nahezu drei Jahrhunderte lang durchdrungen hatte und die in vielerlei Hinsicht auch noch heute aktuell ist.
Literatur Cunaeus, P. 1617: De Republica Hebraeorum libri tres, Leiden (phot. repr. with an Introduction by L. Campos Boralevi, Firenze, 1996); engl. transl. by Clemens Barksdale, London 1653. Campos Boralevi, L. 2002: La „Respublica Hebraeorum“ nella tradizione olandese, in: L. Campos Boralevi/D. Quaglioni (eds.), Politeia Biblica, Firenze, 431–463. – 2011: Ascesa e declino di un modello federale: la „Respublica Hebraeorum“ nell’Europa moderna, in: L. Campos Boralevi (ed.), Challenging Centralism. Decentramento e autonomie nel pensiero politico moderno, Firenze, 73–88. Höffe, O. 2012: Provisorische Amoral (Kapitel 18–19), in: O. Höffe (Hrsg.), Niccolò Machiavelli. Der Fürst (Klassiker Auslegen, Bd. 50), Berlin, 107–119. Ligota, R. C. 1992: Histoire à fondement théologique: la République des Hébreux, in: Groupe de recherches Spinozistes, L’Écriture Sainte au temps de Spinoza et dans le système Spinoziste, Travaux et documents, 4, Paris, 149–167. Machiavelli, N. 1531: Discorsi. Gedanken über Politik und Staasführung, übers., eingel. u. erl. v. R. Zorn, mit einem Geleitwort von H. Münkler, Frankfurt/M. 3 2007. Meinsma, K. O. 1983: Spinoza et son cercle, Paris (ed. or.: Spinoza en zijn Kring. Historischkritische studiën over Hollandsche vrijgeesten, Den Haag 1896). Nadler, S. 1999: Spinoza. A Life, Cambridge. Révah, I. S. 1995: Des marranes à Spinoza, Paris. Visentin, S. 2001: La libertà necessaria. Teoria e pratica della democrazia in Spinoza, Pisa.
14 Otfried Höffe
Ausblick: Eine vorläufige Einschätzung
Die nähere Interpretation von Spinozas Theologisch-politischem Traktat, die Analyse seiner Begriffe, Argumente und deren Bedeutung, geschah in den vorangehenden Kommentaren. Hier erfolgt eine erste, sehr persönliche Einschätzung: 1. Spinozas Grundinteressen können bei liberalen Demokraten mit voller Zustimmung rechnen: (1) Die wissenschaftliche Bibelkritik ist zumindest für Christentum und Judentum längst selbstverständlich, auch wenn sich manche sogenannten Fundamentalisten dagegen wehren. (2) Die Freiheit zu philosophieren ist als Gedanken-, Meinungs- und Pressefreiheit sowie als Zensurfreiheit schon zu einem einklagbaren Bestandteil rechts- und verfassungsstaatlicher Demokratien avanciert. (3) Aufgrund der weit fortgeschrittenen Säkularisierung hat die gegen Spinoza erhobene Anklage des Atheismus allen Charakter, sogar jeden Hauch von gesellschaftlichem und rechtlichem Vorwurf verloren. (4) Spinozas Trennungsthese, sowohl die Trennung der Theologie samt Offenbarung und der auf einer allgemeinen Menschenvernunft basierenden Philosophie als auch die Trennung der Institutionen Kirche beziehungsweise Religionsgemeinschaften und Staat, wird von beiden Seiten längst anerkannt. (5) Ebenso anerkannt ist Spinozas These, es gebe nur eine einzige rechtsrelevante Autorität, und diese liege beim Staat. Allenfalls wird für grundlegende Konf likte ein Recht auf bürgerlichen Ungehorsam eingeräumt. Dieses kann aber nur
O H
unter strengen Kautelen, einschließlich der Bereitschaft, Nachteile inkauf zu nehmen, legitim sein. (6) Spinozas Komplemetaritätsthese, eine wohlbestimmte Ergänzung von Offenbarung und Vernunft, erfährt heute zwar keine allseitige, aber doch eine weit verbreitete Zustimmung: Ein rechtschaffenes, von Gerechtigkeit und Liebe geleitetes Leben muß nicht notwendig aus jener natürlichen Vernunft geführt werden, die zwar allen Menschen eigen ist, aber nur bei wenigen Menschen über die nötige Macht verfügt. Die vielen anderen können ihr rechtschaffenes Leben durchaus aufgrund ihres religiösen Glaubens führen. Auf der anderen Seite stellen selbst Kritiker an Begleiterscheinungen mancher Aufklärung, etwa an einer (überzogenen) Traditions-, Kirchen- und Religionskritik, die Grundeinstellung nicht infrage, daß der Vernunft jedes Menschen ein Freiraum gebührt, zu dem das Recht gehört, religiöse und staatliche Autoritäten einer fairen Kritik auszusetzen. Aufgrund dieser tiefen und facettenreichen Anerkennung ist mit der Neigung zu rechnen, daß man „in dubio pro Benedicto“ denkt, sich also im Zweifelsfall auf die Seite Spinozas und nicht der Religion beziehungsweise Religionsgemeinschaften stellt. Eine möglichst objektive Beurteilung, eine judikative Kritik des Dafür und Dawider, wirft freilich einen neutralen, gegen beide Seiten, geoffenbarte Religion und vernunftbasierte Religionskritik, unparteiischen Blick. 2. Wie viele große Philosophen vor und nach ihm so diagnostiziert auch Spinoza einen grundlegenden Streit und schlägt sich nicht auf die Seite von einer der beiden Parteien, sondern sucht einen neuen, dritten Weg. Der für den Traktat, vor allem dessen ersten Teil entscheidende Streit betrifft das Verhältnis von Theologie und Vernunft. Dabei behauptet die eine Seite, „Dogmatiker“ genannt, die Schrift müsse der Vernunft angepaßt werden. Die Gegenseite aber, der Skeptiker, erklärt, die Vernunft müsse sich der Schrift anpassen. Beiden Positionen wirft Spinoza völligen Irrtum vor („toto coelo errare“) und vertritt ihnen gegenüber die Trennungsthese (TTP XV, 226). Mit ihr, dem neuen Weg, der Trennung von Religion und Vernunft, erweist sich Spinoza als ein kreativer Denker. 3. Die Triftigkeit der bibelkritischen Argumente läßt sich relativ leicht bilanzieren: In vielen Einzelfragen hat Spinoza Richtiges gesehen, in anderen sich geirrt. Daß die Thora beziehungsweise der Pentateuch, die sogenannten fünf
A: E E
Bücher Moses, nicht von Moses stammen können, hat der Philosoph überzeugend nachgewiesen. Seine Vermutung, der Pentateuch sei von einem jüdischen Priester und Schriftgelehrten, Esra, verfaßt, war damals zwar neu, ist jedoch, wie sich später zeigt, nicht haltbar. Richtig ist, daß Esra die Juden aus der babylonischen Gefangenschaft führt (458 v. Chr.) und sie mit neuem Nachdruck auf die Thora verpf lichtet. Einige Spinoza-Freunde sehen im Traktat die „Geburtsurkunde der historisch-kritischen Bibelwissenschaft“ (Gawlick 1976, XXV). Damit überschätzen sie dessen Innovation, denn unter den Philosophen darf man Hobbes mit seinem Leviathan, auch mit De cive nicht vergessen. Zudem gibt es eine ältere, nicht von Philosophen unternommene Schriftkritik. Ohne Zweifel aber gehört der Theologisch-politische Traktat zu den frühen, überdies bedeutsamen Beiträgen der historisch-kritischen Bibelwissenschaft. Und fraglos bewundernswert ist, wie gründlich und in der Regel umsichtig Spinoza seine Vorschläge und deren Argumente entwickelt, obwohl er bloß auf wenige der bald darauf selbstverständlichen Hilfsmittel zurückgreifen kann. Spinozas Überlegungen teilen allerdings das Schicksal aller historisch-kritischen Wissenschaften: Sobald neues Material auftaucht oder sich die Methoden verfeinern, gelegentlich aber auch nur wegen eines zweiten, umsichtigeren Blicks sind viele Aussagen sachlich überholt, heute daher nur noch von wissenschaftsgeschichtlicher Bedeutung. Dieser Umstand ist ambivalent. Er zeigt nämlich, wie stark die Entwicklung mancher Wissenschaft, zumal deren Anfänge, von Philosophen mitgeprägt ist, sie sich dann aber davon löst. Auch muß man sich fragen, warum ein Philosoph, hier Spinoza, sich so stark auf nicht genuin philosophische, vielmehr einzelwissenschaftliche Aufgaben einläßt. Das naheliegende Argument, früher seien Philosophie und Einzelwissenschaften nicht so klar wie heute getrennt, kann wenig überzeugen. Denn genaugenommen gab es auch früher nur die Personal- und keine Sachunion. Beispielsweise war Aristoteles nicht nur ein überragender Wissenschafts-, Rhetorik- und Erkenntnistheoretiker, überdies Metaphysiker, Moralphilosoph und politischer Philosoph, sondern auch ein außergewöhnlicher Biologe. Ähnlich war Descartes nicht bloß ein großer Metaphysiker, sondern auch ein bedeutender Physiker und der wohl größte Mathematiker seiner Zeit. Bei Aristoteles mag nun ein kleiner Anteil, der theoretische Teil seiner Biologie im Schnittfeld von Philosophie und Biologie stehen, ansonsten lassen sich beide
O H
Arbeitsbereiche klar trennen. Analog stehen Descartes’ Methodenüberlegungen des Discours de la méthode im Schnittfeld von Philosophie und Einzelwissenschaft. Seine Meditationes gehören aber eindeutig zur Metaphysik, die Beiträge zur analytischen Geometrie und zu Optik dagegen ebenso eindeutig zur Mathematik beziehungsweise zur Physik. Jedenfalls gibt es nach Thema, teilweise auch nach Methode schon sehr früh zwischen Philosophie und Einzelwissenschaften deutliche Unterschiede. Gewiß, es kann Zusammenhänge geben. Im Fall des Traktat ist es jedoch eine berechtigte Frage, ob zum Beispiel Spinozas These, die Schrift ist kein „Brief ..., den Gott den Menschen vom Himmel gesandt hat“ (TTP XII, 197), nicht mit weniger bibelkritischem Aufwand, also einfacher hätte begründet werden können. Die These, die Bibel sei kein vom Himmel gesandter Brief, trifft doch auch zu, wenn der Pentateuch von Moses, nicht von Esra oder anderen Autoren verfaßt worden wäre. 4. Bekanntlich herrscht im Alten Orient eine Verquickung von Religion, Staat und Gesellschaft, die mancherorts bis heute nachwirkt. Der neutestamentliche Satz „So gebet dem Kaiser, was des Kaisers, und Gott, was Gottes ist“ (Matthäus 22, 21) hebt die Verquickung jedoch zu einem wesentlichen Teil auf. An die Stelle der Verquickung tritt die Entquickung; die Verf lechtung wird durch Entf lechtung, die Verschmelzung durch Entschmelzen überwunden. Daher die Frage: Hätte Spinoza es sich bei seiner Trennungsthese nicht erheblich erleichtert, wenn er unmittelbar bei der Entf lechtung angesetzt hätte? Darauf legt sich eine doppelte Antwort nahe: Zum einen steht die Entf lechtung im Neuen Testament, so daß ein Adressat des Traktat, die jüdische Gemeinde Amsterdams, sie nicht anerkannt hätte. Zum anderen müßte ein bibelkundiger und in seiner Lektüre nicht von Scheuklappen eingeschränkter Christ zwar für die Anerkennung bereit sein. Der zweite, vielleicht sogar wichtigere Adressat des Traktat, der damals in den Niederlanden vorherrschende Calvinismus, läßt die Anerkennung aber de facto vermissen. Er praktiziert nämlich ein derart hohes Maß an Verf lechtung, weshalb Spinoza klugerweise nicht bei der Entf lechtung ansetzt. Es überrascht jedoch, daß er die Entf lechtung nicht einmal erwähnt und dann als Zusatzargument verwendet. Der große jüdische Neukantianer Hermann Cohen hält es übrigens für ein politisches Vorurteil von Spinoza, daß er eine theokratische Verfassung, wie sie im
A: E E
mosaischen Staatsverständnis liege, mit einer philosophisch begründbaren Religion, Sittlichkeit und einem den inneren Frieden garantierenden Rechtsordnung als unvereinbar behaupte. Stattdessen hält Cohen es für möglich, was Spinoza so vehement und kompromißlos bestreitet: daß der Staat der mosaischen Theokratie keine wahrhafte Religion und sittliche Politik begründen könne (vgl. Cohen 1924, 344). Nicht generell also, wohl aber für Alt-Israel verteidigt Cohen die Nichttrennung, ohne deshalb das für Spinoza wichtigere Beweisziel, ein moralisch fundiertes Gemeinwesen, gefährdet zu sehen. In anderer Weise ist nicht unbedenklich, daß Spinozas Bibelkritik nicht nur formaliter das unmittelbare Geoffenbartsein der Schrift und materialiter den Glauben an Wunder verwirft. Ihre weitergehende Behauptung, die Schrift wende sich an ein ungebildetes Nomadenvolk (vgl. TTP XI), ist überdies höchst „ehrenrührig“. Sie ist es zumal für die gläubigen Nachfahren, die längst über ein hohes Maß an Bildung verfügen. Weil sie gleichwohl die Thora für einen heiligen Text halten, werden sie sich spontan zunächst einmal Gegenargumente überlegen und selbst bei sie überzeugenden Pro-Argumenten deren Tragweite verkleinern. Daher muß man sich fragen, ob Spinoza, der in sachlicher Hinsicht zu Recht ein kompromißloser Philosoph ist, seine Aufgabe nicht rhetorisch falsch eingeschätzt, nämlich unnötige, überdies vorhersehbare Widerstände provoziert hat. Nur als zusätzliche Frage: Wäre es rhetorisch klüger gewesen, in der Heiligen Schrift die Passagen zugunsten von Rechtschaffenheit, Nächstenliebe und einer wenig zeremoniellen Gottesverehrung noch stärker hervorzuheben? Dem würde allerdings schon ein schriftexternes Kriterium zugrundeliegen, das dem primär moralischen Kern der Bibel, also einer Grundannahme Spinozas, entspricht. 5. Innerhalb der genuin philosophischen Argumentation bedient sich Spinoza unterschiedlicher Mittel und Verfahren. Beispielsweise schlägt er des öfteren Definitionen vor, die sich an einen bekannten Sprachgebrauch anschließen, an anderer Stelle, namentlich bei dem so wesentlichen Begriff des Naturrechts, nimmt er jedoch unter der Hand eine radikale Neudefinition vor. Derartige semantische Veränderungen mögen bei philosophisch wichtigen Ausdrücken vertretbar sein. Spinoza nimmt sie aber auch bei offenbarungstheologisch zentralen Ausdrücken vor. Als Beispiel könnte man schon das allererste Kapitel „Von der Prophetie“, immerhin ein Grundthema von Judentum und
O H
Christentum, sogar ein Grundthema aller Offenbarungsreligionen, anführen. Denn das Kapitel beginnt nicht bloß ohne jede Vorbereitung unmittelbar mit einer Definition der beiden einschlägigen Begriffe „Prophetie“ und „Prophet“. Die Offenbarungsreligion wird auch mit der Prophetie gleichgesetzt, was die vertraute Bezeichnung nur eines Teiles des Alten Testaments, der „Propheten“ beziehungsweise „Prophetischen Bücher“, ablehnt. Argumente für diese stillschweigende Ablehnung sucht man zwar vergeblich, andererseits war die Gleichsetzung „prophetia sive revelatio“, Prophetie oder Offenbarung, damals weit verbreitet. Anders verhält es sich mit der Definition des Glaubens (Kap. 14). Sie erfüllt zwar Spinozas eigenen Anspruch, klar zu sein, auch mag sie, wie der Autor behauptet, „aus dem soeben Bewiesenen“ (TTP XIV, 218) folgen. Es handelt sich aber um eine philosophieinterne Definition, um den ahistorischen Begriff einer metaphysischen Theologie, nicht um den historischen Begriff eines Gottes von Abraham, Isaak und Jakob, also des jüdischen Gottes. Und je nach Einschätzung ist von folgender Bestimmung zu sagen, daß sie entweder dem religiösen Glauben der Juden, auch der Christen und Muslime fremd ist oder aber daß sie nur einen Teil, bestenfalls einen philosophischen Kernteil des religiösen Begriffs trifft: „Glauben ist nichts anderes als von Gott solche Dinge denken, die zu ignorieren den Gehorsam gegen Gott aufhebt und die anzuerkennen in diesem Gehorsam notwendigerweise enthalten ist“ (TTP XIV, 218). Übernimmt man Spinozas Definitionen, so folgen viele der anschließenden Aussagen „fast von selbst“. Ähnlich wie das Hauptwerk, die Ethik, allerdings nicht annähernd so konsequent argumentiert auch der Traktat „more geometrico“, nach der geometrischen beziehungsweise mathematischen Methode: Aus den Definitionen, mit denen er beginnt, lassen sich gewisse Schlußfolgerungen problemlos ableiten. Analoges wie beim Glauben trifft auch auf die für die Trennungsthese entscheidende Definition der Theologie im Kapitel 15 zu. In beiden Fällen führt Spinoza eine problematische, jedenfalls begründungsbedürftige Definition ein, die das gesuchte Ergebnis präjudiziert. Für einen neutralen Leser verliert es damit an Überzeugungskraft. Zugespitzt gilt, daß „dieser Versuch, die theologischen Vorurteile abzubauen, nur dort erfolgreich sein konnte, wo er überf lüssig war“ (Gawlick 1976, XXVI).
A: E E
Im Unterschied zur Ethik folgt der Traktat freilich nicht ausschließlich, nicht einmal vorrangig der mathematischen Methode. Außer der certitudo geometrica, der geometrischen, daher wissenschaftlichen Gewißheit, beruft sich der Traktat vielerorts auf jene certitudo moralis, moralische Gewißheit (TTP II, 32 f.; XV, 233), die zwei Jahrzehnte vorher Descartes in der Principia philosophiae (1644, §§ 205) eingeführt hat. (Die Frage, ob Spinoza denselben Begriff moralischer Gewißheit wie Descartes hat, braucht hier nicht untersucht zu werden.) Zu Spinozas Voraussetzungen gehört die Behauptung, in der Religion komme es weniger auf den rechten Glauben als auf das rechte Handeln an. Weit wichtiger als die Orthodoxie ist ihm also im wörtlichen Sinn die Orthopraxie. Damit rangiert die Moral klar vor der (theoretischen) Wahrheit, und man darf sich fragen, warum Spinoza in seinem Hauptwerk, der Ethik, den weiten Umweg über Ontologie und Erkenntnistheorie nimmt, um erst am Ende den Vorrang der Moral zu konstatieren. Der Grund könnte in Spinozas Verständnis der Orthopraxie liegen. Es ist so stark philosophisch, insofern denn doch theoretisch eingefärbt, daß man paradox von einer ortho-doxen Orthopraxie oder orthopraktischen Ortho-doxie sprechen muß. Die doxa im Begriff der Orthodoxie ist allerdings nicht im engen Sinn als (religiöser) Glaube, sondern im weiten Verständnis als Inbegriff nichtpraktischer, also theoretischer Ansichten zu verstehen. Ersetzt also der Philosoph Spinoza die religiöse Orthodoxie lediglich durch eine philosophische Orthodoxie? Ist er vielleicht nicht nur – wegen seiner Vollkommenheitsperspektive: daß alle Erkenntnis dem höchsten Ziel, dem schlechthin Guten dient – ein Platoniker, sondern zusätzlich auch ein Aristoteliker? Denn er räumt der Philosophie, in Aristotelischen Begriffen dem bios theôrêtikos, dem theoretischen Leben, den Vorrang vor einem bios politikos, einem sittlich-politischen Leben ein, ohne es, wie Aristoteles auch, für illegitim zu halten (vgl. Nikomachische Ethik, X, 6–9). Nicht zeitgeschichtlich, aber wirkungsgeschichtlich wichtiger ist wohl, daß Spinoza mit seiner Wertschätzung der Orthopraxie einer Grundeinschätzung der Aufklärung vorgreift, die deutlich etwa bei Lessing und Kant die Religion auf moralische Praxis festlegt. Allerdings ist es anachronistisch, von einem Vorgriff zu sprechen. Richtig ist, daß sich Spinoza hier wie andernorts als ein bedeutender Frühaufklärer erweist. Der Traktat müßte freilich klären, ob es sich bei der genannten Wertschätzung um eine theologische These handelt, die sich aus einer unvoreingenommenen
O H
Lektüre ergibt: Spricht die Thora selbst für den Vorrang der Orthopraxie? In diesem Fall wären Theologen zuständig, folglich auch Schriftkenner, Schriftgelehrte. Ihnen gegenüber dürfte der schriftkundige Philosoph zwar auf eine vorurteilsfreie Lektüre drängen, weshalb man ihm nicht jede Kompetenz absprechen darf. Aber angefangen mit den Beschneidungs-, Reinigungs- und Speisegeboten über die Weisheitstexte bis zum Buch Hiob und dem Hohen Lied handelt die Bibel fraglos nicht nur über eine allgemeinmenschliche Moral. Plausibler ist es daher, im Vorrang der moralischen Orthopraxie keine theologische, sondern eine genuin philosophische These zu sehen, die da sagt: Wenn die Schrift eine mehr als partikulare Geltung, wenn sie eine universale Bedeutung beanspruchen will, muß die in ihr enthaltene moralische Orthopraxie, die der Gerechtigkeit und der Nächstenliebe, wichtiger als die Orthodoxie sein. Nur dann wäre Spinoza, der Philosoph, ex officio für den religiösen Text kompetent. Er müßte freilich den systematischen Vorrang der Orthopraxie voraussetzungsfrei aus einer unvoreingenommenen neuen Bibellektüre herausdestillieren. Ohnehin genügt die These vom OrthopraxieVorrang für sich allein genommen deshalb nicht, weil schon eine oberf lächliche Lektüre im Pentateuch idealtypisch gesehen zwei Arten von Orthopraxie entdeckt. Einerseits gibt es wie angedeutet die vielen an eine partikulare Ethnie gebundenen Verbindlichkeiten, die Beschneidungs-, Reinigungs- und Speisegebote. Andererseits ist im Gegensatz zu einem verbreiteten pauschalen Lob der Zehn Gebote die erste Tafel des Dekalogs von der zweiten Tafel grundverschieden. Die ersten drei Gebote sind nämlich an eine Religion, zudem an die von Alt-Israel gebunden, insofern nicht universal gültig. Die Gebote 4 bis 10 dagegen kann man durchaus als universalistische Moralgebote verstehen. Innerhalb der Orthopraxie braucht es also eine scharfe Selektion, die Unterscheidung der universalistischen von den partikular geltenden Elementen. Spinoza begründet das für ihn wesentliche Plädoyer zugunsten der Philosophiefreiheit, mit ihr das Plädoyer für die der Philosophie charakteristischen Leitidee, der Wahrheit, philosophiespezifisch, im Verhältnis zum religiösen Glauben sogar philosophieexklusiv. Sobald man diese Begründung anerkennt, liegen Trennungsthese und Philosophiefreiheit auf der Hand. Allerdings muß man sich fragen, warum der Gegner diese These anerkennen sollte, zumal sie ihm, stellt man einmal die Komplementarität von Glauben und moralischer Gewißheit zurück, Unrecht gibt.
A: E E
Greifen wir noch einmal Spinozas Definitionen auf. Für sie verkennt der Philosoph, daß sich sein genuines Metier von der Mathematik grundlegend unterscheidet. Wie Kant in der Kritik der reinen Vernunft zu Recht feststellt, kann nur die Mathematik mit im strengen Sinn willkürlichen Definitionen beginnen (KrV , AA III, 479 f.). Der Philosophie dagegen stehen die zu definierenden Gegenstände nicht zur freien Verfügung. Sie kann die Gegenstände, die in der Regel philosophieunabhängig existieren und die vorab, wenn auch bloß unklar bekannt sind, nur Schritt für Schritt auf den Begriff bringen. Dabei darf sie durchaus semantische Revisionen, eventuell sogar semantische Revolutionen vornehmen, diese sind aber zu begründen. Bei philosophieinternen Begriffen wie dem Naturrecht mag eine stillschweigende Umdefinition erlaubt, vielleicht sogar klug sein. Bei theologischen Begriffen, die einen außerphilosophischen „Sitz im Leben“ haben, ist das aber kaum zulässig. Hier wie auch andernorts im Traktat trifft das Aristoteles-Wort zu: „der Anfang ist … mehr als die Hälfte“ (Nikomachische Ethik, I 7, 1098b6): Spinoza trifft Vorentscheidungen, die ihm zwar erleichtern, das Beweisziel zu erreichen, den Skeptiker aber hellhörig machen. 6. Selbst wenn man den Vorrang der Orthopraxie und deren selektive Interpretation, die einer universalistischen Moral, akzeptiert, hat Spinoza seinen Streit mit den biblischen Theologen noch nicht gewonnen. Das vermutlich größte Problem des Traktat besteht nämlich in einer religiösen beziehungsweise offenbarungstheologischen These. Sie wird nicht notwendig von jeder Offenbarung, aber doch von wichtigen ihrer Texte vertreten: daß die menschliche Vernunft für sich – sei es in theoretischer, sei es in moralisch-praktischer Hinsicht oder in beiden Aspekten – in so hohem Maß unzulänglich ist, daß sie als verderbt, nämlich als zur Erkenntnis des Heils unfähig gilt. Darin liegt nun die entscheidende Gegenthese, mit der sich Spinoza auseinandersetzen müßte. Nach seinem theologischen Gegner kann keine der beiden Grundfragen einer Orthopraxie, weder die Frage, wo das Heil des Menschen liegt, noch die Frage, auf welchem Weg es erlangt werden kann, mit Mitteln der natürlichen Vernunft beantwortet werden, denn die natürliche Vernunft ist verderbt. Und genau deshalb halten entsprechende Theologen den Offenbarungsglauben nicht nur im Sinne der moralischen Gewißheit für einen alternativ möglichen Weg, sondern erklären ihn für heilsnotwendig.
O H
Spinoza kann freilich dies entgegnen: Einem der natürlichen Vernunft angeblich überlegenen, tatsächlich aber zum Selbstschutz gegen sie abgeschotteten Offenbarungsglauben drohen religiös gesehen Aberglaube und Götzendienst, politisch betrachtet hingegen Unfriede und Unfreiheit. Und wegen dieser zwei Gefahren bedürfe auch die Religion der Kritik. Dann aber stellt sich immer noch die Frage: Wer oder welche Instanz kann die Kritik mit welchen Argumenten vornehmen, ohne schon Partei zu sein? Muß man sich nicht vorab geradezu dezisionistisch entscheiden, ob man sich entweder auf die Seite einer der Kritik enthobenen Religion oder aber auf die einer gegen die Religion distanzierten, ihr sogar fremden Kritik schlägt? Weil sich diese Frage nicht verdrängen läßt, erscheint die Situation in einem wesentlichen Sinn als aporetisch, nämlich als wahrhaft ausweglos. Denn nicht etwa nur die Philosophie wirft der Religion, sondern beide Seiten, Religion und Philosophie, werfen sich gegenseitig weit- und tiefreichende Vorurteile vor: 7. Manche Religion und biblische Theologie erklärt, die natürliche Vernunft nehme irrtümlicherweise an, sie könne erstens erkennen, worin das menschliche Heil liege, und zweitens wissen, daß das menschliche Heil einen natürlichen Charakter habe, daher auf natürlichem Weg erreichbar sei. Tatsächlich, behauptet manche Religion, sei die natürliche Vernunft dazu unfähig, wobei der Hauptgrund im nichtnatürlichen Charakter des menschlichen Heils liege. Überall dort, wo man dem Heil einen übernatürlichen Charakter zuspricht, ist es auch nur auf übernatürlichem Weg zu erkennen und nur auf übernatürlichem Weg zu erreichen. Mit anderen Worten: Eine übernatürlich eingefärbte Orthodoxie verlangt nach einer übernatürlich eingefärbten Orthopraxie. Nimmt man allerdings den Standpunkt der natürlichen Vernunft ein, so entzieht die genannte Behauptung allzu offensichtlich die Religion und Theologie jeder Kritik. Gegen kognitive Begründungspf lichten gleichgültig, wird der Glaube zu einem rein nichtkognitiven, ausschließlich volitiven Fürwahrhalten. Der Glaube wird – der Kritiker wird sagen: pervertiert, degeneriert – zu einem (willkürlichen) Willensakt. Die Folge liegt auf der Hand: Ihr Standpunkt ist grundsätzlich unwiderlegbar. Die Philosophie beziehungsweise natürliche Vernunft werfen nun genau dies der Religion und der Theologie vor: Mit der genannten Unfähigkeitsthese, einem Vorurteil gegen die natürliche Vernunft, versuchen sie, deren Macht von
A: E E
Anfang an auszuhebeln. In Wahrheit sei die natürliche Vernunft aber zu beidem fähig, zur Erkenntnis sowohl des menschlichen Heils als auch des Weges zu diesem Heil. Zusätzlich und in systematischer Hinsicht sogar zuerst erklärt die natürliche Vernunft, das menschliche Heil habe gar keinen übernatürlichen, sondern einen natürlichen Charakter. In einem Punkt zusammengefaßt wirft der Gegner der Theologie schlicht eine Immunisierungsstrategie vor. Der Verteidiger kann allerdings den Vorwurf zurückgeben: Ohne zureichende Argumente werde das traditionelle Heilsversprechen, das Heil durch Offenbarung und Gehorsam, schlicht abgelöst vom Heil durch (die natürliche) Vernunft. Oder in den Worten des evangelischen Theologen Emanuel Hirsch (2 1960, 257): Spinoza läßt „alle Vorstellungen der gewöhnlichen Religion unter sich“. 8. Es versteht sich, daß ein so überragender Philosoph wie Spinoza sich dieser Aporie bewußt ist. Direkt nennt und erörtert er sie zwar nicht. Durch die Art der Argumentation zeigt er aber, daß er um die Aporie weiß. Angefangen mit dem Schriftzitat der Titelerläuterung nennt er im Traktat einerseits Bibelstellen, die dem „natürlichen Licht“ der Vernunft einen hohen Wert einräumen (z. B. Kap. 4). Andererseits betont er, daß die Apostel in ihren Briefen nicht als Propheten, folglich nicht als der Kritik enthobene Autoritätspersonen, sondern als Lehrer schreiben. Als solche berufen sie sich aber auf Argumente, womit sie ihre klare Wertschätzung der Vernunft bezeugen (Kap. 11); man kann auch sagen, daß es zu ihrem Beruf gehört: Wer nicht bloß als Herold einer fremden Autorität, sondern als Lehrer auftritt, darf sich nicht jeder Argumentation entziehen. Diese zwei Argumentationstypen Spinozas können zwar die orthodoxen, gegen die natürliche Vernunft skeptischen Gegner noch nicht widerlegen. Deren bislang als unüberwindbar fest erscheinende Wehr fängt aber an zu bröckeln: Wenn einerseits ein Lehrer ex officio Argumente vorträgt und wenn andererseits die Schrift die natürliche Vernunft hochschätzt, kann letztere nicht mehr als schlicht ohnmächtig oder verderbt bloßgestellt werden. Erstaunlicherweise beruft sich Spinoza zugunsten der natürlichen Vernunft nicht auf ein anderes, fraglos noch grundlegenderes Argument: Weil der Mensch zufolge der Genesis als Ebenbild Gottes geschaffen ist, kann die damit geschaffene natürliche Vernunft schwerlich als ohnmächtig oder verderbt gelten. Allenfalls könnte eine gewisse Sündenfalltheologie das Argument in Zweifel ziehen.
O H
Weder die vielen Beschneidungs-, Reinigungs- und Speisegebote noch die Aufforderung der Propheten zur Umkehr sprechen aber für einen den natürlichen Gehorsam überbietenden rein übernatürlichen Weg. 9. Ohne Zweifel will der Traktat in die damaligen Debatten intervenieren, freilich modo philosophico, nicht modo politico. Bietet Spinoza in dieser Hinsicht seinen Zeitgenossen eine veritable Alternative? Der Traktat will zur Verteidigung der Philosophiefreiheit zeigen, daß ihr der Glaube fast nichts in den Weg stellt. Das einschränkende „fast“ setzt der Freiheit aber doch Schranken. Sie bestehen in sieben „Dogmen des allgemeingültigen Glaubens“ (TTP XIV, 221), die Spinoza an eine einzige Bedingung knüpft: daß „der Gehorsam gegen Gott [sie] unbedingt voraussetzt“ (ebd.). Weil „deren Ignorieren den Gehorsam schlechterdings unmöglich macht“ (ebd.), lassen sie angeblich keinen Raum für kirchliche Streitigkeiten. Für Spinoza laufen die sieben Dogmen auf ein einziges hinaus: „Es existiert ein höchstes Wesen, das Gerechtigkeit und Nächstenliebe schätzt; und, um gerettet zu sein, sind alle gehalten, ihm zu gehorchen und es durch die Ausübung von Gerechtigkeit und Nächstenliebe zu verehren“ (ebd.). Zerlegt man diesen komplexen Satz in seine zwei Grundbestandteile, den metaphysischen beziehungsweise ontologischen ersten Teil – Es gibt einen Gott, das höchste Wesen – und den moralischen Teil – Gott ist höchst gerecht und barmherzig und ein Vorbild des wahren Lebens –, so sind die folgenden Dogmen nichts anderes als eine Explikation des ersten Dogmas. Die Dogmen 2, 3 und 4 explizieren den ontologischen, die Dogmen 5, 6 und 7 hingegen den moralischen Teil. Vorausgesetzt, daß sie überhaupt noch einen Gottesbegriff anerkennen, werden auch spätere Aufklärer einem Großteil dieser Dogmen zustimmen. (1) Daß es nach dem ersten Dogma Gott gibt, er also existent ist, wird Kant zwar bestreiten, allerdings nur in theoretischer, nicht moralisch-praktischer Hinsicht. Dagegen dürfte generell überzeugen, daß (2) Gott, wenn es ihn gibt, einzig und (3) allgegenwärtig ist und (4) die höchste Herrschaft über alles ausübt. Nicht unstrittig, unter der Perspektive des Gehorsam aber plausibel ist, daß Gott „im höchsten Maße gerecht und barmherzig ist und darin das Vorbild des wahren Lebens“ (ebd.) ist. Ebenso plausibel dürften die letzten drei Dogmen sein: (5) daß der Gehorsam gegen Gott „allein in der Gerechtigkeit und einer Liebe, die Nächsten-
A: E E
liebe ist“ (222), besteht, (6) daß, wer entsprechend lebt, selig ist und (7) daß Gott wegen seiner Barmherzigkeit den Reuigen ihre Sünden verzeiht. Es sind allerdings nur plausible, aus dem jüdisch-christlichen Denken herausdestillierte Dogmen, die über einen rein philosophischen Gottesbegriff hinausreichen. Dieses Mehr läßt sich freilich positiv verstehen: Unausdrücklich greift der Traktat dem Kantischen Projekt einer „Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft“ vor. Wenn auch nicht in annähernder Gründlichkeit versucht Spinoza zu zeigen, daß sich ein orthopraktischer Kern von Judentum und Christentum philosophisch, dabei universalistisch rechtfertigen läßt. Für manche Aufklärer geht Spinoza damit jedoch zu weit; die Anerkennung all dieser Dogmen halten sie für einen zu hohen Preis. Der Gegenseite wiederum erscheint Spinozas Zugeständnis an den Glauben als zu eng. Für sie enthält die göttliche Offenbarung weit mehr als nur die sieben allgemeinen Glaubensdogmen, ergänzt um das lebhafte Vorstellungsvermögen der Propheten. Insbesondere das theologische Grunddogma, daß der Mensch nur durch den Gehorsam gegen Gottes weiterreichende Gebote sein Heil erlange, hält die Orthodoxie für unverzichtbar. Und als kaum weniger unverzichtbar schätzt sie den Wunderglauben ein. Zumindest die Auferstehung Jesu beansprucht beides: ein Wunder und ein konstitutives Element des christlichen Glaubens zu sein. Somit legt sich diese sehr persönliche und nur vorläufige Einschätzung nahe: Systematisch betrachtet zeichnet sich der Traktat durch ein hohes Maß an Naturalismus aus (vgl. Kap. 10 in diesem Band), was in der Sache zwar höchst provokativ ist, den heutigen Naturalismus-Tendenzen in der Moral- und Rechtsphilosophie aber entgegenkommt. Naturalisierungsversuche müssen sich freilich der Frage stellen, ob sie, konsequent durchgeführt, tatsächlich wie bei Spinoza starker metaphysischer Annahmen bedürfen. Da Spinoza Gott und Natur gleichsetzt, kann man freilich auf den Gottesbegriff verzichten, was die metaphysischen Voraussetzungen erheblich verringert. Und das weitere Lehrstück, daß der Mensch denselben Gesetzen wie die gesamte Natur folgt, ist einem Naturalismus nur willkommen. Politisch betrachtet ist Spinozas Theologisch-politischer Traktat hingegen ein wichtiger Baustein in der mit Bodin beginnenden Geschichte der Trennung von Kirche und Staat, insbesondere in der Emanzipation des Staates von religiöser beziehungsweise theologischer Bevormundung. Anspruchsvoller als Bodin verkürzt Spinoza das Problem aber nicht auf die Trennung von Institutionen. Ihm
O H
geht es ebenso, zugleich grundsätzlicher um das Verhältnis von Religion und Vernunft. Und dafür vertritt er die pragmatische These, die selbst heute noch als Modell dienen kann: Obwohl Religion und Vernunft zu trennen sind, können sie einander ergänzen. Literatur Aristoteles: Nikomachische Ethik, übers. u. hrsg. v. U. Wolf, Reinbek 2006¸ griech.: Ethica Nicomachea, hrsg. v. I. Bywater, Oxford 1890 (neuste Auf lage: Cambridge 2010). Cohen, H. 1924: Jüdische Schriften, Bd. 3: Zur jüdischen Religionsphilosophie und ihrer Geschichte, Berlin (Mikrofiche-Ausgabe: 1997). Gawlick, G. 1976: Einleitung, in: Baruch de Spinoza. Theologisch-politischer Traktat, Hamburg, XI–XXX. Hirsch, E. 2 1960: Geschichte der neueren evangelischen Theologie, Bd. 1, Gütersloh. Kant, I. 1781/1787: Kritik der reinen Vernunft, in: Kants Werke. Akademie-Textausgabe, hrsg. v. der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften, Bd. 3/4, Berlin 1968.
Auswahlbibliographie 1. Schriften Spinozas 1.1 Lateinisch Spinoza Opera, hrsg. v. C. Gebhardt, 5 Bde., Heidelberg 1924/87.
1.2 Deutsch Sämtliche Werke, Hamburg: Bd. 1: Kurze Abhandlung von Gott, dem Menschen und dessen Glück, übers. v. C. Gebhardt, hrsg. v. W. Bartuschat, Hamburg 5 1991. Bd. 2: Die Ethik nach geometrischer Methode dargestellt, lat.-dt., neu übers. u. hrsg. v. W. Bartuschat, Hamburg 3 2010. Bd. 3: Theologisch-politischer Traktat, neu übers. u. hrsg. v. W. Bartuschat, Hamburg 2012. Bd. 4: Descartes’ Prinzipien auf geometrische Weise dargestellt mit einem Anhang, enthaltend Gedanken zur Metaphysik, neu übers. u. hrsg. v. W. Bartuschat, Hamburg 2005. Bd. 5.1: Abhandlung über die Verbesserung des Verstandes, lat.-dt., neu übers. u. hrsg. v. W. Bartuschat, Hamburg 2 2003. Bd. 5.2: Politischer Traktat, lat.-dt., neu übers. u. hrsg. v. W. Bartuschat, Hamburg 2 2010. Bd. 6: Briefwechsel, übers. v. C. Gebhardt, hrsg. v. M. Walther, Hamburg, 3 1986. Bd. 7: Lebensbeschreibungen und Dokumente, übers. v. C. Gebhardt, hrsg. v. M. Walther, Hamburg 1998. Ergänzungsband: Algebraische Berechnung des Regenbogens. Berechnung von Wahrscheinlichkeiten, niederl.-dt., übers. u. hrsg. v. H.-Ch. Lucas/M. J. Petry, Hamburg 1982. Werke in drei Bänden, hrsg v. W. Bartuschat, Hamburg 2006. Opera. Werke I: Tractatus theologico-politicus, übers. v. C. Gebhardt, hrsg. v. G. Gawlick/F. Niewöhner, Darmstadt 2 2011. Opera. Werke II: Tractatus de intellectus emendatione und Ethik, übers. v. C. Gebhardt, hrsg. v. K. Blumenstock, Darmstadt 2 2011.
2. Literatur 2.1 Biographien Colerus, J. 1706: The Life of Benedict de Spinoza, London (Nachdruck: Den Haag 1906). Freudenthal, J. 1899 (Hrsg.): Die Lebensgeschichte Spinozas in Quellenschriften: Urkunden und nichtamtlichen Nachrichten, Leipzig. Gullan-Whur, M. 2000: Within Reason: A Life of Spinoza, London. Hubbeling, H. G. 1977: Spinozas Leben und geistesgeschichtlicher Hintergrund, in: Ders., Spinoza, Freiburg/München.
A
Nadler, S. 2001: Spinoza. A Life, Cambridge. Walther, M. (Hrsg.) 2006: Die Lebensgeschichte Spinozas. Zweite, stark erweiterte und vollständig neu kommentierte Auf lage der Ausgabe von Jakob Freudenthal 1899, 2 Bde., Stuttgart-Bad Cannstatt.
2.2 Bibliographien, Forschungsberichte und Hilfsmittel Altwicker, N. 1987: Spinozas Theologisch-politischer Traktat und Politischer Traktat in der philosophischen Forschung der letzten fünfzig Jahre, in: Spinoza Opera, Bd. 5, Heidelberg, 265–446. Bartuschat, W. 1977: Neuere Spinoza-Literatur, in: Philosophische Rundschau 24, 1 ff. Boscherini, E. G. 1970: Lexicon Spinozanum, 2 Bde., Den Haag. Boucher, W. I. 1991: Spinoza in English. A Bibliography from the Seventeenth Century to the Present, Leiden u. a. 2 2002. Garrett, D. (Hrsg.) 1996: The Cambridge Companion to Spinoza, Cambridge. Hubbeling, H. 1990: Spinozism and Spinozistic Studies in the Netherlands Since World War II, in: E. Curley/P.-F. Moreau (Hrsg.), Spinoza, Leiden u. a., 381 ff. Kingma, J./Offenberg, A. K. 1985: Bibliography of Spinoza’s Works up to 1800. Corrected and annotated reproduction, Amsterdam. Préposiet, J. 1973: Bibliographie Spinoziste, Paris. Runes, D. D. 1951: Spinoza Dictionary, New York. Studia Spinozana 1985–2008, hrsg. v. d. Spinoza-Gesellschaft, 16 Bde., Alling/Würzburg.
2.3 Einführungen und Untersuchungen Adkins, B. 2009: True Freedom: Spinoza’s Practical Philosophy, Lanham/MD. Akkerman, F./Steenbakkers P. 2005: Spinoza to the Letter. Studies in Words, Texts and Books, Leiden. Allison, H. 1987: Benedict de Spinoza. An Introduction, New Haven. Altwicker, N. (Hrsg.) 1971: Texte zur Geschichte des Spinozismus, Darmstadt. Balibar, É. 1985: Spinoza et la politique, Paris. Bartuschat, W. 1993: Theorie und Praxis in Spinozas Ethik und Politik, in: É. Balibar u. a. (Hrsg.), Studia Spinozana 9, Würzburg, 59–78. – 2 2006: Baruch de Spinoza, München. Belaief, G. 1965: The relation between Civil Law and Higher Law. A Study of Spinoza’s Legal Philosophy, in: The Monist 49, 504–518. Blom, H. 1985: Politics, Virtue and Political Science: An Interpretation of Spinoza’s Political Philosophy, in: E. Giancotti u. a. (Hrsg.), Studia Spinozana 1, Alling, 209–230. Bolduc, C. R. 2009: Spinoza et l’approche éthique du problème de la libération. Critique du théologico-politique, Hildesheim. Brunschvigg, L. 4 1951: Spinoza et ses contemporains, Paris. Curley, E./Moreau, P.-F. (Hrsg.) 1990: Spinoza. Issues and Directions. The Proceedings of the Chicago Spinoza Conference, Leiden u. a.
A
Del Lucchese, F. 2011: Conf lict, Power, and Multitude in Machiavelli and Spinoza: Tumult and Indignation, London/New York. Delahunty, R. 1985: Spinoza, London. Della Rocca, M. 2008: Spinoza, London. Den Uyl, D. J. 1985: Sociality and Social Contract: A Spinozistic Perspective, in: E. Giancotti u. a. (Hrsg.), Studia Spinozana 1, Alling, 19–51. Donagan, A. 1989: Spinoza, Chicago. Fischer, K. 6 1946: Spinozas Leben, Werke und Lehre, Heidelberg. Förster, E/Melamed, Y. Y. (Hrsg.) 2012: Spinoza and German Idealism, Cambridge. Freudenthal, J. 1927: Spinoza, Leben und Lehre, bearb. v. C. Gebhardt, Heidelberg. Gebhardt, C. 1908: Spinoza als Politiker, Heidelberg. Grene, M. 1973: Spinoza, New York. Hampshire, S. 2008: Spinoza and Spinozism, Oxford. Hecker, K. 1975: Gesellschaftliche Wirklichkeit und Vernunft in der Philosophie Spinozas, Regensburg. Heertum, C. van/Grunert, F. (Hrsg.) 2010: Spinoza im Kontext. Voraussetzungen, Werk und Wirken eines radikalen Denkers, Halle/Saale. Hessing, S. (Hrsg.) 2 1962: Spinoza-Festschrift zum 300. Geburtstag B. Spinozas (1632–1932), Den Haag. Höffe, O. (Hrsg.) 1977: Zum Gedenken an den 300. Todestag von Benedict de Spinoza (Sonderheft Zeitschrift für philosophische Forschung, Jg. 31, Heft 4). Hubbeling, H. G. 1977: Spinoza, Freiburg/München. Huenemann, Ch. (Hrsg.) 2008/2010: Interpreting Spinoza. Critical Essays, Cambridge. James, S. 1996: Power and Difference. Spinoza’s Conception of Freedom, in: Journal of Political Philosophy 4, 207–228. Jarrett, Ch. E. 2007: Spinoza: A Guide for the Perplexed, Leicester. Lacroix, J. 1970: Spinoza et le problème du salut, Paris. Lloyd, G. 1996: Routledge Philosophy Guidebook to Spinoza and the Ethics, London. Matheron, A. 1988: Individu et communauté chez Spinoza, Paris (Nachdruck v. 1969). McShea, R. J. 1968: The Political Philosophy of Spinoza, New York/London. Melamed, Y. Y. 2013: Spinoza’s Metaphysics. Substance and Thought, Oxford. Misrahi, R. 1957: Le droit et la liberté politique chez Spinoza, in: Mélanges de Philosophie et de Littérature juives, 153–169. Moreau, J. 1977: Spinoza et le spinozisme, Paris. Moreau, P.-F. 1994/2009: Spinoza. L’experience et l’eternité, Paris. Nadler, S. 2004: Spinoza’s Heresy. Immortality and the Jewisch Mind, Oxford. Negri, A. 1981: L’anomalia selvaggia. Saggio su potere e potenza in Baruch Spinoza, Mailand. Norris, Ch. 1991: Spinoza and the Origins of Modern Critical Theory, Oxford. Parkinson, G. H. R. 1984: Spinoza on Freedom of Man and the Freedom of the Citizen, in: Z. Pelczynski/J. Gray (Hrsg.), Conceptions of Liberty in Political Philosophy, London, 39–56. Polka, B. 2010: Between Philosophy and Religion, 2 Bde., Lanham/MD. Popkin, R. 1979: The History of Skepticism from Erasmus to Spinoza, Berkeley/Los Angeles. Röd, W. 1969: Spinozas Lehre von der Societas, Turin. – 2002: Benedictus de Spinoza. Eine Einführung, Stuttgart.
A
Röhrich, W. 1965: Zur politischen Philosophie Spinozas, Kiel. Rosenthal, M. A. 1997: Two Collective Action Problems in Spinoza’s Social Contract Theory, in: History of Philosophy Quarterly 15, Heft 4, 389–409. Saar, M. 2013: Die Immanenz der Macht: Politische Theorie nach Spinoza, Frankfurt/M. Santos Campos, A. 2012: Spinoza’s Revolutions in Natural Law, Basingstoke. Scruton, R. 1986: Spinoza, Oxford/New York. Sigwart, H. C. W. 1842: Vergleichung der Rechts- und Staatstheorie des B. Spinoza und des Th. Hobbes, nebst Betrachtungen über das Verhältnis zwischen dem Staate und der Kirche, Tübingen. Steffen, H. 1968: Recht und Staat im System Spinozas, Bonn. Steinberg, J. 2008: On Being Sui Iuris. Spinoza and the Republican Idea of Liberty, in: History of European Ideas 34, Heft 3, 239–249. Strauss L. 1965: Preface to the English Translation, in: Ders., Spinoza’s Critique of Religion, New York. – 1997: Spinoza’s Critique of Religion, Chicago. Suhamy, A. 2011: Spinoza. Pas à Pas, Paris. Van Bunge, W. u. a. (Hrsg.) 2011: The Continuum Companion to Spinoza, London/New York. Viljanen, V. 2011: Spinoza’s Geometry of Power, Cambridge. Vries, Th. de 1970: Baruch de Spinoza, Reinbek 10 2004. Walther, M. 1971: Metaphysik als Anti-Theologie. Die Philosophie Spinozas im Zusammenhang der religionsphilosophischen Problematik, Hamburg. – 1985: Die Transformation des Naturrechts in der Rechtsphilosophie Spinozas, in: E. Giancotti u. a. (Hrsg.), Studia Spinozana 1, Alling, 73–104. – 1993: Philosophy and Politics in Spinoza, in: É. Balibar u. a. (Hrsg.), Studia Spinozana 9, Würzburg, 49–57. Wolfson, H. A. 1962: The Philosophy of Spinoza. Unfolding the Latent Processes of his Reasoning, Cambridge, MA/London. Yovel, Y. 1989: Spinoza and Other Heretics. The Adventures of Immanence, 2 Bde., Princeton; dt.: Spinoza. Das Abenteuer der Immanenz, Göttingen 1994. Zac, S. 1972: La morale de Spinoza, Paris. – 1979: Philosophie, Théologie, Politique Dans l’Œuvre de Spinoza, Paris.
2.4 Zum Theologisch-politischen Traktat Akkerman, F. 1985: Le Caractère rhéthorique du Traité théologico-politique, in: Spinoza entre Lumières et Romantism (Les Cahier de Fontenay, nos. 36–38), 381–390. Bagley, P. J. 2008: Philosophy, Theology, and Politics. A Reading of Benedict Spinoza’s Tractatus theologico-politicus, Leiden. Balibar, É. 1985: Jus – Pactum – Lex. Sur la constitution du sujet dans le Traité théologico-politique, in: E. Giancotti u. a. (Hrsg.), Studia Spinozana 1, Alling, 105–142. Bamberger, F. 1961: The Early Editions of Spinoza’s Tractatus theologico-politicus: A Reexamination, in: Studies in Bibliography and Booklore 5, 9–33. Bento, A/Silva Rosa, J. A. (Hrsg.) 2013: Revisiting Spinoza’s Theological-Political Treatise, Hildesheim/ Zürich/New York.
A
Bohrmann, G. 1914: Spinozas Stellung zur Religion, Eine Untersuchung auf der Grundlage des Theologisch-politischen Traktats, Gießen. Cohen, H. 1924: Spinoza über Staat und Religion, in: Ders., Jüdische Schriften, Bd. 3: Zur jüdischen Religionsphilosophie und ihrer Geschichte, Berlin, 290–372. Curley, E. 1990: Notes on a Neglected Masterpiece (II). The Theological-Political Treatise as a Prolegomenon to the Ethics, in: J.A. Cover/M. Kulstad (Hrsg.), Central Themes in Early Modern Philosophy, Indianapolis/Cambridge, 109–160. Dunner, J. 1955: Baruch Spinoza and Western Democracy: An Interpretation of his Philosophical, Religious and Political Thought, New York. Frampton, T. L. 2007: Spinoza and the Rise of Historical Criticism of the Bible, London/New York. Gatens, M. 2009: Spinoza’s Disturbing Thesis. Power Norms and Fiction in the Tractatus theologicopoliticus, in: History of Political Thought 30, Heft 3, 445–468. Gildin, H. 1980: Notes on Spinoza’s Critique of Religion, in: R. Kennington (Hrsg.), The Philosophy of Baruch Spinoza, Washington(DC), 155–172. James, S. 2012: Spinoza on Philosophy, Religion, and Politics. The Theologico-Political Treatise, Oxford u. a. Kreimendahl, L. 1983: Freiheitsgesetz und höchstes Gut in Spinozas Theologisch-politischem Traktat, Hildesheim. Krüger, G. 1931: Rezension zu: L. Strauss, Die Religionskritik Spinozas als Grundlage seiner Bibelwissenschaft, in: Deutsche Literaturzeitung, Heft 51, 2407–2412. Laux, H. 1993: Imagination et Religion chez Spinoza. La potentia dans l’histoire, Paris. – 1995: Religion et philosophie dans le Traité théologico-politique. Débat avec André Tosel, in: H. De Dijn u. a. (Hrsg.), Studia Spinozana 11, Würzburg, 189 ff. Levene, N. 2004/2009: Spinoza’s Revelation: Religion, Democracy, and Reason, Cambridge. Malet, A. 1966: Le Traité théologico-politique de Spinoza et la plusée biblique, Paris. Matheron, Alexandre 1971: Le Christ et le salut des ignorants chez Spinoza, Paris. Melamed, Y. Y./Rosenthal, M. A. (Hrsg.) 2010: Spinoza’s Theological-Political Treatise. A Critical Guide, Cambridge. Moreau, P.-F. 2005: La terminologie du „Je“ dans le Traité théologico-politique, in: F. Akkerman/P. Steenbakkers, Spinoza to the Letter. Studies in Words, Texts and Books, Leiden, 125–141. Nadler, S. 2011: A Book Forged in Hell. Spinoza’s Scandalous Treatise and the Birth of the Secular Age, Princeton. Parens, J. 2012: Maimonides and Spinoza. Their Conf licting Views of Human Nature, Chicago. Pines, S. 1968: Spinozas Tracatus theologico-politicus, Maimonides and Kant, in: O. Segal (Hrsg.), Further Studies in Philosophy, Jerusalem. Popkin, R. H. 1996: Spinoza and Bible Scholarship, in D. Garrett (Hrsg.), The Cambridge Companion to Spinoza, Cambridge, 383–407. Preus, J. S. 2009: Spinoza and the Irrelevance of Biblical Authority, Cambridge. Ravven, H. M./Goodman, L. E. 2002: Jewish Themes in Spinoza’s Philosophy, New York. Samely, A. 1993: Spinozas Theorie der Religion, Würzburg. Sass, K. 2 1962: Spinozas Bibelkritik und Gottesbegriff, in: Hessing 2 1962, 164–170. Smith, S. B. 1998: Spinoza, Liberalism, and the Question of Jewish Identity, Yale. Strauss, L. 1930: Die Religionskritik Spinozas als Grundlage seiner Bibelwissenschaft. Untersuchungen zu Spinozas Theologisch-politischem Traktat, Berlin (Nachdruck: Darmstadt 1981).
A
– 1948: Anleitung zum Studium von Spinozas Theologisch-politischem Traktat, in: N. Altwicker (Hrsg.) 1971, 300–361. Tosel, A. 1995: Que faire avec le Traité théologico-politique? Réforme de l’imaginaire et/ou introduction à la philosophie?, in: H. De Dijn u. a. (Hrsg.), Studia Spinozana 11, Würzburg, 165 ff. Ueno, O. 1997: Spinoza’s Biblical Interpretation – Theology and Philosophy, Their Separation and Their Coincidence, in: Philosophical Studies of Yamaguchi University 6, 35–51. van Bunge, W. 1989: On the Early Dutch Reception of the Tractatus theologico-politicus, in: Studia Spinozana 5, 225–227. van der Wall, E. G. E 1995: The Tractatus theologico-politicus and Dutch Calvinism, 1670–1700, in: Studia Spinozana 11, 201–226. Verbeek, Th. 2003: Spinoza’s Theologico-Political Treatise: Exploring ‚the Will of God‘, Farnham. Wolfson, H. A. 1961: Spinoza and the Religion of the Past, in: Ders., Religious Philosophy. A Group of Essays, Cambridge/MA. Yovel, Y. 1973: Bible Interpretation as Philosophical Praxis. A Study of Spinoza and Kant, in: Journal of the History of Philosophy 11, 189–212.
Personenregister
Abraham 61, 111, 252 Adam 79, 104, 111, 240 Ahab 62 Ahasja; Ahaziah (engl.) 122 Ahlers, B. 154 Akkerman, F. 24, 37, 42, 164 Aler, J. M. M. 130 Alexander der Große 41, 85, 198, 241, 244 Alphakar, J. 158–160 Althusius, J. 239 Ambrosius, Bischof von Mailand 212 f. Anderson, A. 153 Ansaldi, S. 42 Aptroot, M. 141 Aquin, Th. von 172 Aristoteles 6, 8, 62, 98, 183, 186, 249, 253, 255 Arminius 36 Artaxerxes I 115 Augustinus 231–233, 237, 244 Augustus 241
Carpzov, J. B. 153 Cassuto, P. 73, 89 Castellion, S. 242 Christian, W. A. 148 Christus, s. Jesus Cicero, M. T. 168 Clapmar, A. 232 Coccejus, J. 239 Cohen, H. 250 f. Colerus, J. 3 f. Conforti, G. F. 245 Cook, J. Th. 64 Court, P. de la (siehe auch Hove) 10, 23, 232, 234 Cunaeus, s. Kun Curley, E. 196, 229 Curtius Rufus, Q. 41, 198, 244 Czelinski, M. 31 Darwin, Ch. R. 146 David 96 f., 117–119 De Jonge, H. J. 129 Demokrit 30 Descartes, R. 1 f., 6–9, 14 f., 42, 45, 62, 98, 133, 162–164, 169, 249 f., 253 Drusius, J. 239
Bach, J. S. 136, 137 Bacon, F. 95 f., 98 Barksdale, C. 239 Bartuschat, W. 4, 38, 53, 109, 157, 196 Bayle, P. 84 Berlusconi, S. 218 Bertram, C. B. 238, 240 Blyenbergh, W. van 151 Böckenförde, E.-W. 212 Bodin, J. 231, 239, 259 Boreel, A. 239 Boreel, J. 239 Boyles, R. 30 Braudel, F. 34 Bunge, W. van 229
Einstein, A. 24 f. Eleasar, Eleazar (engl.) 110 Enden, C. van den 4 Enden, F. van den 2, 4, 42, 168 Erasmus von Rotterdam 128, 231 Esdras 113 Esra, Ezra (engl.) 113–117, 119, 122, 124, 249 f. Esther 199 Euklid 7, 100 Ezechiel, s. Hesekiel
Calvin, J. 96 f., 168 Campos Boralevi, L. 238, 245
Fix, A. 230 Flavius Josephus 85, 237, 242
268
PERSONENREGISTER
Fonseca, I. A. 2 Freedman, D. N. 114, 123 Freud, S. 24, 195 f. Freudenthal, J. 1 Garett, D. 164 Gassendi, P. 15 Gawlick, G. 10, 249, 252 Gebhardt, C. 24, 112, 196 Gentius, G. 239 Gersonides 122 f. Goethe, J. W. von 24 Goliath 118 Gomarus, F. 36 Gonzáles Diéguez, G. 73 Gotter, U. 212 Gottlieb, M. 209 Graevius, J. G. 242 Greenfield, I. 79 Grotius, H. 231, 239 f., 242, 245 Gueroult, M. 157 Halevy, Y. 200 Hammurapi 185 Hampe, M. 7 Harvey W. Z. 196, 200 Hecker, K. 34 Heinsius, D. 129 Herder, J. G. 24 Hermolaus 198 Hesekiel, Ezekiel (engl.) 124 Hessing, S. 24 Hirsch, E. 257 Hobbes, Th. 1, 7, 9 f., 14 f., 18 f., 59, 98, 112– 114, 117, 123, 125, 172, 175–180, 183, 185, 191, 197, 200, 212–214, 217, 220, 236 f., 242, 249 Höffe, O. 234 Hove, P. van (s. auch Court) 10, 234 Hubbeling, H. G. 5f. Hudde, J. 14 Hunter, G. 167 Huygens, Ch. 4 Ibn Ezra, A. 111 f., 121 f., 125, 205 f.
Isaak 252 Israel, J. I. 28, 34, 229 Jakob, Jacob (engl.) 7, 121, 132, 206, 252 James, S. 27 f., 40, 45, 62, 131, 168 Jeremiah, Jeremy (engl.) 58, 96, 114, 142, 160, 169 Jesaja, Isaiah (engl.) 81 f., 89, 204 Jesse 117 Jesus (Christus) 16, 17, 52, 56–58, 81, 123, 129, 131, 134, 136, 148, 223, 240, 259 Johannes 129, 136, 142, 145 Jojachin, Jehoiachin (engl.) 115 Jongeneelen, G. H. 72 Joseph 120–122 Josephus, F. 85, 242 Josua, Joshua 2, 110 f., 114 f., 202 Juda, Judah (engl.) 120 f. Junius, St. 239 Jupiter 42 Kaiser Theodosius 212 f. Kant, I. 22, 39, 253 f., 258 Kaplan, Y. 229 Kauffman, N. 196 Kersting, W. 42 Koch, E. 154 Konstantin der Große 239 Korah 205 Körtner, U. 140 Kugel, J. 120 Kun, P. van der (Cunaeus) 239 f. Kyros 192 La Peyrère, I. 111–113, 117, 123, 125 Lademacher, H. 34 Lasker, D. J. 134 Laux, H. 29, 55 Leibniz, G. W. 4, 23, 84, 167 Lessing, G. E. 24, 253 Levi 206 Levine, N. 152 Ligota, R. C. 240 Lipsius, J. 231 Locke, J. 1, 4, 240
PERSONENVERZEICHNIS Ludwig XIV. 4 Luther, M. 110, 137, 154 Machiavelli, N. 10, 14, 41, 67, 186 f., 231– 237, 244 Malcolm, N. 113 f., 116 Markus; Mark (engl.) 123, 135 f. Marx, K. 23 Matheron, A. 131, 148, 167 Matthäus, Matthew (engl.) 16, 96, 100, 123, 129–131, 135, 250 Mauthner, F. 71 Méchoulan, H. 229 f. Meijer, L., Meyer, L. (engl.) 106, 158 f., 165 Meinsma, K. O. 229 f. Melamed, Y. Y. 32, 207 Menasseh ben Israel, R. 2, 118 f., 122, 203 Mendelssohn, M. 24 Menocchio, J.-St. 239 Mersenne, M. 15 Micha 62 Mill, J. St. 183 Montano, B. A. 237 f., 240 Moreau, J. 38 f. Moreau, P.-F. 42, 229 Morgan, M. L. 215 Morteira, S. L. 2 Mose(s) 16, 56, 58, 61, 65, 79, 82 f., 88, 96 f., 101, 109–112, 114–116, 123, 125, 141 f., 144, 159 f., 163, 195 f., 199–202, 205, 207 f., 215, 220, 239 f., 243, 245, 249 f. Moses ben Maimon, Maimonides 2, 20, 62, 74, 102–106, 109, 111, 158–160, 237, 239 Muhamed 134 Nachmanides 206 Nadler, S. 31, 34, 37, 62, 85, 229 Naud‚ P. P. 72 Nebukadnezar, Nebuchadnezzar (engl.) 119 Negri, A. 32 Nelson, E. 207 Nietzsche, F. 12, 24, 133 f., 166 Oldenbarnevelt, J. van 37
Oldenburg, H. (von) 12, 29 f., 33 f., 132, 227 f., 245 Omri 122 Ostens, J. 134 Pascal, B. 7 Paulus 96, 132, 137, 177, 190 Petzoldt, M. 137 Phillip II. 237 Philon von Alexandria 237, 242 Plantin 237 Platon 98, 183 Polybios 231 Popkin, R. 31, 110 f., 120, 125, 230 Proietti, O. 42 Prokhovnik, R. 36 Pufendorf, S. 4 Rashi 206 Rehabeam, Rehoboam 117 Relandus, H. 239 Renz, U. 40 Révah, I. S. 230 Rieuwertsz, J. 5, 10 Romulus 233 Rosenthal, M. A. 67, 206 Rousseau, J.-J. 67 Rowen, H. H. 37 Ruben; Reuben 206 Russell, B. 5 Ruth 114 Rutherford, D. 75 s’ Gravesande, W. J. 72 Saar, M. 28, 32, 46, 222 Salomo 79, 221 Salomo; Solomon (engl.) 120 Samely, A. 147, 151 Samuel 56, 58, 114, 160, 169 Sand/Sandius, Ch. 129 f. Saul 117, 119, 202 Scaliger, J. 239 Schechter, O. 196 Schmitt, C. 187 f. Schnepf, R. 7, 33, 39
269
270
PERSONENREGISTER
Schopenhauer, A. 24 Schröder, W. 229 Schuller, G. H. 5 Seneca 183 Shua 120 f. Sigonio, C. 239 f. Simmel, G. 24 Sixtinus Amama 239 Sombart, W. 24 Sparn, W. 147 Speiser, E. A. 117, 122, 125 Spener, Ph. J. 153 Spinoza, A. 2 Spinoza, M. 2 Steenbakkers, P. 25, 29, 31 Stephani, J. 212 Strabon 231 Strauss, L. 29, 33, 45, 64, 72, 81, 152, 166 f. Tacitus 231, 241 Tamar 120 f. Te Winkel, J. 130 Thomasius, Ch. 14 Thomasius, J. 14 Til, S. van 31 Titus Livius 231 Toland, J. 240 Tönnis, F. 24
Totaro, P. 207 Tosel, A. 29 Tremellius, I. 80, 130 Tschirnhaus, E. W. von 167 Twersky, I. 109 Ueno, O. 147 Ugolinus, B. 245 Valla, L. 42, 128 Velthuysen, L. van 134, 147 Verbeek, Th. 106, 195 f., 229 Vergil 197 Vernière, P. 229 Visentin, S. 234 Vorstius, G. 239 Vossius, G. J. 239, 242 Wall, E. van der 36 Walther, M. 1, 3, 31, 39, 45 f., 52, 65, 147, 154, 172, 175, 229 Wassenaer, G. van 232 Wassermann, J. 25 Witt, C. de 22, 37, 211 Witt, J. de 9 f., 22, 34–37, 51, 211 Wolf, A. 112 Wolzogen, L. 242 Yovel, Y. 28, 33, 72, 230
Sachregister
Aberglaube 12, 24, 37–41, 43 f., 48, 54, 132 f., 191, 235, 256 Atheismus 8, 12 f., 23, 30 f., 72, 87, 132, 148, 154, 227 f., 247 Autorität 13, 19, 22, 45 f., 81 f., 93 f., 100– 105, 107, 141, 144, 146, 151, 153, 157, 162, 164 f., 168, 176 f., 198 f., 201 f., 208, 223 f., 236, 240, 247 f., 257 Bibel s. Heilige Schrift Bibelkritik 19, 80, 127 f., 130, 132, 247, 251 Calvinismus, calvinistisch 1, 12, 16, 36, 94, 97, 101, 228, 240, 250 Christentum 8, 16, 20 f., 80 f., 129, 134, 220, 223, 247, 252, 259 Demokratie, demokratisch 10, 47, 51, 153, 173, 181–184, 188 f., 196, 200, 209, 214, 224 f., 236, 241 f., 247 Determinismus 7, 24, 66, 153 Erkenntnis 9, 11, 19, 45 f., 53–62, 67 f., 73– 77, 83–87, 95 f., 131, 140 – prophetische E. 54 f., 58, 60 f., 68 f., 78 – sinnliche E. 54, 57, 166 f., 169 – sichere E. 52 – Vernunfterkenntnis 17, 79, 167 Ethik 6 f., 64, 69, 243 Freiheit 9 f., 23, 34, 36 f., 41, 46–48, 51, 75, 94, 144, 146, 150, 153, 171, 179, 184 f., 190, 212, 217–219, 221–225, 236, 243 – Philosophiefreiheit, Denkfreiheit 4, 9, 12–15, 20 f., 23, 27, 30 f., 46, 51, 54, 127, 144, 171, 173, 179, 211 f., 219, 224 f., 227 f., 245, 247, 254, 258 – Redefreiheit 13, 15, 21, 23, 30 f., 51, 54, 127, 144, 225, 247
Frieden 9, 11, 13 f., 27, 54, 127, 152, 171, 202, 213, 219, 222, 236, 245, 251 Frömmigkeit (pietas) 13 f., 17, 21, 27, 46, 54, 71, 84, 87, 127, 133, 143, 147, 160 f., 164, 171, 186 f., 213, 219, 222–224 Furcht 24, 39 f., 42–44, 49, 82, 146, 178 f., 181, 197, 216–218, 244 f. Gebote 36, 52, 76, 99, 118 f., 200, 174, 219 f., 243, 254, 258 f. Gehorsam 12, 16–18, 46, 58 f., 66, 73–76, 81, 83, 99, 107, 139–141, 143–146, 150–153, 158, 160–166, 180, 183 f., 191 f., 244, 252, 257–259 Geist, Verstand 6–9, 12, 16, 19, 23–25, 45, 54– 56, 59 f., 67, 72, 75–82, 86 f., 95–97, 100 f., 104, 131–133, 135 f., 141, 144 f., 149, 153, 176, 214–217, 219, 223, 227 Gerechtigkeit 11 f., 18, 20 f., 42, 58, 62, 64, 69, 94, 124, 135, 142, 145, 147, 149 f., 152, 163, 173, 175, 182, 185 f., 196, 219, 221 f., 235, 240, 243, 248, 254, 258 Geschichte 34, 47, 95–101, 105, 114 f., 123 f., 171, 202–205 Gesetz 13, 22, 34, 54–56, 65, 75 f., 100, 103, 107, 136 f., 150, 177, 180, 182 f., 185, 215, 219–225, 238–241, 244, 259 – göttliches G. 66, 74 f., 76–82, 84, 91, 133, 135, 189, 239, 245 – natürliches G., Naturgesetz 58, 90 f., 174, 176, 190 Gesellschaftsvertrag 196 f. Gewalt (potestas) 11, 13, 127, 150, 171–174, 181–185, 187 f., 190 f., 196 f., 201 f., 213, 216, 219–223 Glaube 11, 17–21, 80 f., 83 f., 97, 99, 103, 132, 137, 142, 144–146, 148–152, 154, 161, 165, 168, 171, 191, 212, 216, 224, 235, 248, 251–254, 256, 258 f. – Glaubensartikel 20, 146
272
Sachregister
Glückseligkeit (beatitudo) 65, 77, 81 f., 91, 149, 151 Gott 6–9, 12, 16–18, 21, 33, 40, 46, 53–62, 65 f., 68, 71, 73, 75, 77–80, 83–91, 94, 98, 101, 103 f., 118 f., 124, 130–137, 139–153, 160, 175, 187, 190–192, 198–201, 213, 216 f., 221 f., 231, 234, 238–240, 244, 250, 252, 258 f. Haß (odium) 14, 188, 197, 217, 219 Heil 12, 18, 141, 145, 153, 165–169, 191, 255–257, 259 Heiliger Geist 97 Heilige Schrift (Bibel) 12, 16, 18 f., 22, 30, 45, 52, 57–59, 69, 73–75, 79–85, 88–90, 93–99, 101–104, 113 f., 120, 124, 127 f., 130, 132– 135, 140–142, 147, 161 f., 237 f., 240, 242– 244, 250 f., 254 Herrschaft 8 f., 21, 37, 41, 87, 150, 177, 182 f., 220, 222, 225, 234, 241, 258 Hermeneutik 15, 19, 22, 93–98, 124, 152, 158, 154 Hoffnung 39 f., 43 f., 49, 82, 146 Höchste Gewalt s. Souverän Institution 47, 65, 67 f., 223, 231, 241, 247 Intuition 56 f. Israel 16, 36, 110, 114, 123, 202, 238, 240– 242, 244, 251, 254 Kirche 9, 17, 36, 81, 94, 101, 114, 168, 211 f., 222 f., 228 f.,247, 259 Leben 8, 11, 21, 51, 68, 79, 136, 139, 142, 149, 164 – Lebensregel, Lebensweise 3, 11, 47, 59, 69, 75–78, 131, 161 Leidenschaft (Trieb) 8 f., 54, 57, 67, 146, 151 f., 189, 233, 235 Liebe, Nächstenliebe 11 f., 18, 20–22, 58 f., 62, 64, 69, 82, 94, 98, 124, 130, 135 f., 139, 141 f., 145–147, 150, 152, 166, 190, 204, 220–223, 235, 244, 248, 251, 254, 258 f. – Gottesliebe 73, 84, 136 f., 149, 151, 167, 190
Macht (potentia) 6, 16, 33, 46–48, 66, 68, 76, 78, 85, 87, 94, 150, 174–176, 182, 214, 219, 222, 230, 233–236, 240, 243, 248 Moral 12, 18, 20, 133, 136, 150, 166, 174, 253–255 – moralische Lehre: 84, 98, 99, 101, 236 Mos geometricus 6 f., 62, 252 Natur 5 f., 9, 19, 33 f., 61, 66, 73, 75 f., 84–87, 89–91, 95 f., 149–151, 175–177, 181, 191, 219, 259 – Naturzustand 164, 175–178, 184, 187, 189 f., 196 f., 215, 218 – menschliche N. 30, 33, 38, 54 f., 77, 146, 180, 196 f., 199, 225, 233, 235 Naturalismus 172, 174, 176, 178, 180, 187, 259 Notwendigkeit 8, 67 f., 75, 78, 86, 150, 179, 183, 232, 233, 236, 244 Offenbarung 18 f., 22, 45 f., 48, 52, 55–58, 60 f., 63, 65, 74, 77 f., 81 f., 128, 131, 161–164, 199, 171, 190–192, 220, 235, 247 f., 252, 255, 257, 259 Pantheismus (pantheistisch) 7 f., 53, 175 Philosophie 7, 9 f., 12, 17–19, 30, 44, 46–48, 52, 57–59, 64, 66, 69, 85, 87, 95 f., 103– 107, 131, 144, 152, 157, 161, 165, 168, 173, 227, 247, 249 f., 253–265 Prophet 11 f., 16, 18, 54–65, 78 f., 82, 88, 90, 94, 96–98, 100, 102, 130 f., 133–135, 140, 142 f., 152, 215, 220 f., 239, 245, 252, 257– 259 Prophetie (Prophezeiung) 30, 51–53, 55–60, 62–64, 69, 78, 85, 130 f., 163, 171, 251 f. Rationalismus 1, 7, 18, 176 Recht 11, 13, 16, 21 f., 33, 46, 150, 171–176, 181, 183–186, 188–192, 212–214, 216 f., 219, 232, 236 f., 239, 241, 243, 247 f. – Rechtsordnung 238, 251 – natürliches R., Naturrecht 46 f., 171–174, 180, 190 f., 214, 217, 236, 251, 255 – bürgerliches R. 172 f., 184, 186
Sachregister Regierungsgewalt 46, 181 f., 187, 191, 213 Religion 16, 20–24, 27 f., 40 f., 43, 46, 48, 64, 75, 82, 93 f., 105, 127 f., 131–136, 141 f., 147, 150, 153 f., 171, 179, 186 f., 190–192, 212–214, 223, 228, 232–235, 248, 250 f., 253 f., 256 f., 260 – wahre R. 133 f., 148, 245 Republik (res publica) 188, 207, 209, 233, 239–241 Schicksal (fortuna) (Schicksal, Zufall) 38 f., 41–43, 65–67 Schöpfung 6, 8, 103, 142 Schrift s. Heilige Schrift – Schriftauslegung 22, 45, 94 f., 98, 107, 143, 153 f., 245 Selbsterhaltung 8 f., 173, 178, 180, 182, 189, 215, 217 f., 222 f. Souverän (Souveränität) 10, 13, 43, 75, 105, 107, 172 f., 181, 183, 185, 188 f., 213 f., 220, 225, 236, 241 Staat (civitas) (Gemeinwesen, Gesellschaft) 9 f., 13–17, 22, 27, 35, 44, 47, 51, 67 f., 76, 78, 80–82, 105, 127, 144, 147, 152, 171– 173, 178–182, 184, 186–191, 195 f., 197– 202, 205–209, 211–225, 228, 231, 234, 237–245, 247, 250 f., 259 – Staatszweck 179 Teleologie 174, 218 Theologie 7, 12, 16–18, 24, 36, 46, 51–55, 57– 59, 61, 64, 66, 69, 82, 85, 88, 93–96, 101, 106, 152, 154, 157, 160–162, 164–166, 173, 230 f., 233, 235 f., 240, 242, 244, 247 f., 252, 256 f.
273
Trennungsthese 18, 20, 53, 55, 60, 69, 74, 85, 87, 168, 191, 247 f., 250, 252, 254 Tugend 8, 46, 59, 67 f., 81 f., 91, 135, 150 f., 168, 190, 215, 224, 235 Untertan 47, 183 f., 187 f., 190, 196–198, 200, 202–204, 213, 215 f., 236 Ursache 8, 39, 54 f., 66, 77, 86–88, 90, 134, 148 Verfassung 181, 183, 238, 250 Vernunft 8, 12–14, 17–19, 21 f., 24, 54, 57, 68, 74, 83–85, 88, 90, 102, 104 f., 130 f., 134, 147, 151–153, 158–162, 165, 171, 176– 180, 183–185, 189 f., 214 f., 217–220, 234, 248, 255–257, 260 Volk (vulgus) (einfaches Volk) 24, 53 f., 64 f., 67–69, 75 f., 82–84, 88, 93 f., 104, 106, 135, 181 f., 215, 239 f. Vorsehung 6, 85 f., 90 f. Vorstellungskraft (imaginatio) 18, 54, 57, 59 f., 63, 68, 88, 90, 131, 153, 163 Vorurteil 12, 15–18, 22, 24, 30, 40, 43 f., 48, 165, 177, 227 f., 235, 242, 252, 256 Wahrheit 7, 17, 22, 44, 78 f., 86 f., 96 f., 101– 107, 131, 135, 146 f., 150, 152, 159–161, 230, 235, 253 f. Wille 91, 218, 220, 256 – freier W. 6, 8, 150, 181 – göttlicher W. 40, 56, 58, 60, 68, 78, 220–222 Wunder 30, 61 f., 65, 74, 84–90, 102, 113, 140, 223, 251, 259 Zeremonien 65, 74, 80–83, 86, 91 Zweck 76–78, 80–83, 88, 179, 217 f.
Hinweise zu den Autorinnen und Autoren
Alex Anderson ist Doktorand an der Philosophischen Fakultät der McGill University, Montreal, Kanada. Dirk Brantl studierte Geschichte und Philosophie an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen, wo er mehrere Jahre Philosophie lehrte. 2009 promovierte er mit einer Arbeit zur Ökonomischen Theorie des Gesellschaftsvertrags. 2010–2012 war er Stipendiat der Fritz-Thyssen-Stiftung zum Thema Manners in der Moralphilosophie des Thomas Hobbes, mit Forschungsaufenthalten in Oxford und Berkeley. Seit 2013 ist er Wissenschaftlicher Assistent an der KarlFranzens-Universität Graz. Seine Forschungsschwerpunkte liegen systematisch in der Politischen Philosophie und Wirtschaftsphilosophie, historisch in der Philosophie der Frühen Neuzeit.
Edwin Curley ist Professor emeritus an der University of Michigan, wo er von 1993 bis 2010 Philosophie lehrte. Seine bedeutendsten Werke verfaßte er über Spinoza, so unter anderem die Collected Works of Spinoza (incl. einer Übersetzung der Ethik und anderer Frühschriften: Princeton 1985, Bd. I), Spinoza’s Metaphysics (Cambridge 1969) und Behind the Geometrical Method (Princeton 1988). Darüber hinaus schrieb er über Descartes (Descartes Against the Skeptics, Harvard 1978) und Hobbes (incl. einer Ausgabe des Leviathan, die die Änderungen der lateinischen Übersetzung des Leviathan beinhaltet: Indianapolis 1994). Vor seiner Professur an der University of Michigan lehrte er an der University of Illinois in Chicago (1983–93), an der Northwestern University (1977–83) und am San Jose State College (1963–66). Von 1966 bis 1977 forschte er an der Australian National University in Canberra. Gegenwärtig arbeitet er am zweiten Band seiner Ausgabe von Spinozas Gesammelten Werken, der eine Übersetzung des Theologisch-politischen Traktat enthalten wird. Geplant ist die zeitgleiche Veröffentlichung einer Sammlung von Aufsätzen über den Traktat. Curley war Präsident der American Philosophical Association und ist Mitglied der American Academy of Arts and Sciences.
276
Zu den Autorinnen und Autoren
Michael Hampe, geb. 1961, lehrt Philosophie an der ETH Zürich. Letzte Buchpublikation: Tunguska oder Das Ende der Natur, München 2011.
Otfried Höffe, geb. 1943, nach 2-jährigem Wehrdienst ab 1964 Studium der Philosophie, Geschichte, Theologie und Soziologie in Münster, Tübingen, Saarbrücken und München; 1970 Promotion zum Dr. phil, 1974–75 Habilitation, 1976–78 nach Vertretung ord. Professor für Philosophie an der Universität Duisburg, 1978 ord. Professor für Ethik und Sozialphilosophie und Direktor des Internationalen Instituts für Sozialphilosophie und Politik an der Universität Freiburg (Schweiz), 1992–2011 Lehrstuhl für Philosophie an der Universität Tübingen, seit 1994 Leiter der Forschungsstelle Politische Philosophie. Ab 2002 ständiger Gastprofessor für Rechtsphilosophie an der Universität St. Gallen. Schwerpunkte: Aristoteles, Kant, Moral- und Rechtsphilosophie, Erkenntnistheorie. Otfried Höffe ist Herausgeber der Reihen „Denker“ (bisher 80 Bde.) und „Klassiker Auslegen“ (bisher 50 Bde.) und zunächst Herausgeber, später Mitherausgeber der Zeitschrift für philosophische Forschung. Er ist Mitglied der Heidelberger Akademie der Wissenschaften und der Senator der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina sowie Ehrenmitglied der Teheraner Akademie für Philosophie und Weltweisheit. Buchveröffentlichungen (Auswahl; zahlreiche Übers.): Immanuel Kant (1983, 8. Aufl. 2014); Politische Gerechtigkeit (1987, 4. Aufl. 2003); Aristoteles (1996, 4. Aufl. 2014); Demokratie im Zeitalter der Globalisierung (1999, TB 2002); Kants Kritik der reinen Vernunft. Die Grundlegung der modernen Philosophie (2003, 4. Aufl. 2004); Lebenskunst und Moral. Oder: Macht Tugend glücklich? (2007, TB 2009); Ist die Demokratie zukunftsfähig? (2009); Thomas Hobbes (2010); Kants Kritik der praktischen Vernunft (2012); Ethik. Eine philosophische Einführung (2013). Als Hrsg.: Aristoteles-Lexikon (2005); in der Reihe Klassiker Auslegen neuerdings Aristoteles: Poetik (2009); Kant: Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft (2010), Kant: Schriften zur Geschichtsphilosophie (2011), Machiavelli: Der Fürst (2012). Yitzhak Y. Melamed ist Professor für Philosopie an der Johns Hopkins Universität. Er arbeitet zur Philosophie der Frühen Neuzeit, dem deutschen Idealismus und einer Reihe von Themen der zeitgenössischen Metaphysik (Zeit,
ZU DEN AUTORINNEN UND AUTOREN
277
Mereologie und Tropen-Theorie). Sein Werk Spinoza’s Metaphysics: Substance and Thought erschien gerade bei Oxford University Press.
Robert Schnepf, Apl. Prof. an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Wichtige Publikationen: Metaphysik im ersten Teil der Ethik Spinozas, Würzburg 1996; Die Frage nach der Ursache – systematische und problemgeschichtliche Untersuchungen zum Kausalitäts- und zum Schöpfungsbegriff, Göttingen 2006; Geschichte erklären. Grundprobleme und Grundbegriffe, Göttingen 2011.
Piet Steenbakkers studierte Englisch und Philosophie an der Universität Groningen. Seit 1993 lehrt er an der Universität Utrecht Geschichte der neueren Philosophie. Seit 2004 bekleidet er den vom Verein „Het Spinozahuis“ gestifteten Lehrstuhl für Spinoza-Studien an der Erasmus-Universität Rotterdam. Steenbakkers gehört zur internationalen Forschungsgruppe „Groupe de recherches spinozistes“, die eine kritische Ausgabe der Werke Spinozas besorgt. Mit Fokke Akkerman (Groningen) arbeitet er derzeit an einer Ausgabe der Ethik. Gemeinsam mit Akkerman veröffentlichte er Spinoza to the letter. Studies in words, texts and books (2005), zusammen mit Wiep van Bunge, Henri Krop und Jeroen van de Ven The Continuum Companion to Spinoza (2011).
Pina Totaro ist Senior Researcher in Philosophie an der ILIESI-CNR, Università di Roma Sapienza. Ihre Forschung konzentriert sich auf die Philosophie der Moderne mit einem besonderen Schwerpunkt auf der Geschichte des Cartesianismus und Spinozismus. Hauptarbeitsbereiche sind unter anderem das philosophische und theologisch-politische Denken vom 16. bis zum 19. Jahrhundert, die Edition und Übersetzung philosophischer Texte, die Geschichte von Spinozas Philosophie in Italien und Europa, die Lehre von den Leidenschaften im 17. Jahrhundert, die radikale Bibelexegese des 17. und 18. Jahrhunderts sowie die Geschichte philosophischer und kultureller Terminologien. Unter Totaros Herausgeberschaft erschienen unter anderem B. de Spinoza Tractatus theologico-politicus/Trattato teologico-politico (Napoli 2007) und B. de Spinoza, Compendio di grammatica della lingua ebraica (Florenz 2013). Darüber hinaus veröffentlichte sie „Instrumenta mentis“. Contributi al lessico filosofico di Spinoza (Florenz 2009).
278
Zu den Autorinnen und Autoren
Manfred Walther (* 1938), emeritierter Professor der Rechtsphilosophie an der Juristischen Fakultät der Leibniz Universität Hannover. Hauptforschungsgebiete: (1) Geschichte der Rechts- und Staatsphilosophie von der Antike bis zur Gegenwart mit Schwerpunkt Frühe Neuzeit, bes. Spinoza; (2) Spinoza und Rezeptionsgeschichte seiner Philosophie, bes. in Deutschland; (3) Vertreibung und Emigration deutschsprachiger Rechtswissenschaftler seit 1933; (4) Religion und Politik. Publikationen (Auswahl): Metaphysik als Anti-Theologie (1971); Die Emigration deutschsprachiger Rechtswissenschaftler ab 1933, Bd. 1, (zus. m. Leonie Breunung) (2012); ca. 100 Aufsätze in Zeitschriften und Sammelbänden, u. a. Hat der juristische Positivismus die deutschen Juristen wehrlos gemacht? In: R. Dreier, W. Sellert (Hrsg.): Recht und Justiz im Dritten Reich (1989); Intervention in die „inneren Angelegenheiten“ souveräner Staaten zum Schutz der Menschenrechte. In: K. Graf Ballestrem (Hrsg.): Internationale Gerechtigkeit (2001); Natural Law, Civil Law, and International Law in Spinoza. In: Cardoso Law Review 25/2 (2003); (Mit-)Herausgeber von ca. 25 Sammelbänden, u. a. Religion und Politik (2004); Transformation des Gesetzesbegriffs im Übergang zur Moderne? (zus. m. N. Brieskorn, K. Wächter: 2007). Jan-Hendrik Wulf, Lehrer für Englisch, Geschichte und Darstellendes Spiel am Johanneum Lüneburg. Fakultätspreis der Philosophischen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (2011). Promotion zum Dr. phil. über das Thema „Spinoza in der jüdischen Aufklärung. Baruch Spinoza als diskursive Grenzfigur des Jüdischen und Nichtjüdischen in den Texten der Haskala von Moses Mendelssohn bis Salomon Rubin und in frühen zionistischen Zeugnissen“ (Berlin 2012). Referendariat und Zweites Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien in Berlin 2010–2012. Research Fellow am Franz Rosenzweig Research Centre for German-Jewish Literature and Cultural History an der Hebrew University of Jerusalem 2006–2007. Research Paper: „Refining Spinozism and Discovering Jewish Enlightenment Tradition: Moses Mendelssohn and the Maskil Readings of Spinoza“ (VIII EAJS Congress, Moscow 2006). Freier Journalist für „die tageszeitung” (taz) in Berlin von 2003–2006. Landesstipendium zur Förderung des künstlerischen und des wissenschaftlichen Nachwuchses des Landes Schleswig-Holstein (2001–2003). Erstes Staatsexamen und M.A. in Kiel 2000. Deutscher Sprachassistent am Trinity College Dublin (1994–95).
ZU DEN AUTORINNEN UND AUTOREN
279
Theo Verbeek, geb. 1945, ist Professor emeritus für Geschichte der neueren Philosophie an der Universität Utrecht. Seine Veröffentlichungen setzen sich mit Descartes, dem Niederländischen Cartesianismus und der Philosophie der Aufklärung auseinander. Er ist Autor des Buchs Spinoza’s Theologico-Political Treatise: Exploring ‚The Will of God‘ (Aldershot 2003) und einer niederländischen Übersetzung des Tractatus de intellectus emendatione (Groningen, 2. Aufl. 2010). Er ist Mitglied der Königlichen Niederländischen Akademie der Wissenschaften.