Rechtsforschung, Rechtspolitik und Unternehmertum: Gedächtnisschrift für Prof. Edgar Michael Wenz [1 ed.] 9783428496297, 9783428096299
Edgar Michael Wenz war Professor für Rechtssoziologie und Wirtschaftsrecht an der Universität Würzburg und Inhaber eines
117 63 71MB
German Pages 519 Year 1999
Recommend Papers
![Rechtsforschung, Rechtspolitik und Unternehmertum: Gedächtnisschrift für Prof. Edgar Michael Wenz [1 ed.]
9783428496297, 9783428096299](https://ebin.pub/img/200x200/rechtsforschung-rechtspolitik-und-unternehmertum-gedchtnisschrift-fr-prof-edgar-michael-wenz-1nbsped-9783428496297-9783428096299.jpg)
- Author / Uploaded
- Karpen
- Ulrich; Weber
- Ulrich; Willoweit
- Dietmar
File loading please wait...
Citation preview
Rechtsforschung, Rechtspolitik und Unternehmertum Gedächtnisschrift für Prof. Edgar Michael Wenz
Ai, %-uu fa^j
Rechtsforschung, Rechtspolitik und Unternehmertum Gedächtnisschrift für Prof. Edgar Michael Wenz
Herausgegeben von Ulrich Karpen, Ulrich Weber und Dietmar Willoweit
Duncker & Humblot · Berlin
Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme Rechtsforschung, Rechtspolitik und Unternehmertum : Gedächtnisschrift für Prof. Edgar Michael Wenz / hrsg. von Ulrich Karpen ... - Berlin : Duncker und Humblot, 1999 ISBN 3-428-09629-0
Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe und der Übersetzung, für sämtliche Beiträge vorbehalten © 1999 Duncker & Humblot GmbH, Berlin Fremddatenübernahme und Druck: Berliner Buchdruckerei Union GmbH, Berlin Printed in Germany ISBN 3-428-09629-0
Vorwort
Edgar Michael Wenz' Freunde wollten ihm zu seinem 75. Geburtstag am 6. Juli 1998 eine Festschrift überreichen. Dazu ist es nun nicht mehr gekommen. A m 13. September 1997 ist Edgar Michael Wenz gestorben. Aus der Festschrift mußte eine Gedächtnisschrift werden. Wir haben ihn gekannt und geschätzt, als Forscher, als Lehrer, als Freund, als einen bedeutenden Unternehmer. Wir legen diese Schrift in die Hände seiner Familie und stellen sie der Wissenschaft zur Verfügung. Bis zum Schluß ist Edgar Michael Wenz schöpferisch und sehr aktiv gewesen. Er war fest in die Führung seines Unternehmens eingebunden. Und er war wissenschaftlich tätig. Wenige Wochen vor seinem Tode schickte er den Herausgebern das umfangreiche, in diesem Buche abgedruckte Manuskript „Die forschungsbegleitete Gesetzgebung4' zur kritischen Lektüre vor der Publikation. A n rechtssoziologischen Fragen seit je interessiert, hatte er sich - stets neugierig - der Gesetzgebungslehre als einer praxisorientierten interdisziplinären Wissenschaft genähert. M i t politischem Gespür erkannte er die Bedeutung einer theoretisch angeleiteten und begleiteten „besseren" Gesetzgebung, soll der überlastete Staat wieder „schlanker" werden. Ein exemplarisches Leben ist zu Ende gegangen, reich, arbeitsam, erfüllt. Exemplarisch insofern, als ein Mann nach dem Weltkrieg unter schwierigen Bedingungen, auch mit starker physischer Beeinrächtigung, ein großes Unternehmen aufgebaut und zum Erfolg gebracht hat, wissenschaftlich immer wieder auf sich aufmerksam gemacht hat und - was vielleicht das Wichtigste ist - eine Familie gegründet und in ihr gelebt hat, die ein Großteil seiner Arbeit fortführt und so seiner Lebensleistung Bestand verleiht. Der unerwartete Tod des Mannes, den wir beschenken wollten und nun ehren, bietet Anlaß, diese Gedächtnisschrift zu einer „Summe" von Edgar Michael Wenz' Leben zu machen. Sein Werk liegt nun abgeschlossen vor uns. Wie facettenreich es ist, zeigt der erste Teil dieses Buches. Er versammelt Schriften des Toten aus allen Phasen seines Lebens, von der Dissertation über das Gewerberecht bis zu späten philosophischen Gedanken über „Freiheit und Eigenverantwortung". Der große literarische Bogen zeigt einen Menschen, der - im heute nicht mehr selbstverständlichen Sinne - umfassend und „klassisch" gebildet war. Er lebte aus den Kräften seiner Heimat - wie etwa der Beitrag über Fanny von Arnstein zeigt - und engagierte sich für sein Land und die Welt, wovon seine Gedanken über die Verantwortung für die Entwicklungsländer zeigt.
6
Vorwort
Im zweiten Teil des Buches entbieten ihm Freunde ein wissenschaftliches Gedenken. Jeder der Autoren hat Wenz gekannt. Sie haben sich bemüht, etwas von der Atmosphäre der Gespräche, dem Gedankenaustausch lebendig werden zu lassen, fortzuführen. Es liegt ihnen daran, das Anregende, Fragende, auch Entschiedene in Wenz' wissenschaftlichem Denken zum Vorschein zu bringen. Aus beidem, Eigenem wie Gewidmetem, wird die Person von Edgar Michael Wenz noch einmal lebendig, wird es möglich, sein Gedächtnis zu bewahren. Dieses Buch wurde möglich durch die Hilfe seiner Frau, Margaretha, und seiner Familie. Edgar Michael Wenz' letzte persönliche Mitarbeiterin, Frau Irmgard Cramer hat in Arnstein, Herr stud. iur. Simon Schwarz hat in Hamburg sorgfältig und getreulich bei der Herstellung des Buches mitgeholfen. Der Inhaber des Verlages Duncker und Humblot, Herr Professor Dr. h. c. Norbert Simon, hat die Schrift in sein Verlagsprogramm aufgenommen und mit Rat und Tat bei der Fertigstellung geholfen. Ihnen allen sagen die Herausgeber Dank. Ulrich Karpen Ulrich Weber Dietmar Willoweit
Inhaltsverzeichnis Teil I
Schriften von Ε. M. Wenz 1. Rechtswissenschaft Die Entwicklung der Gewerbefreiheit in Bayern. Eine historische, dogmatische und rechtsvergleichende Darstellung
19
Wann braucht der Große Befähigungsnachweis nicht erbracht zu werden?
52
Verfahrensänderung zur Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Genehmigung von umweltrelevanten Großvorhaben?
55
2. Rechtssoziologie Einführung in die theoretische Rechtssoziologie
65
Zum 100. Geburtstag von Theodor Geiger: Der heutige Diskussionsstand zur Rechtssoziologie Theodor Geigers
81
Die Reaktionstheorie - rechtstheoretische Voraussetzung für die Rechtsforschung
84
Von der Rechtsforschung zur Gesetzgebung. Gedanken zur Rechtssoziologie Theodor Geigers
93
Fragen von Naturwissenschaft und Technik an Rechtsphilosophie, Rechtstheorie, Rechtsdogmatik und Rechtssoziologie 107 3. Gesetzgebung Die forschungsbegleitete Gesetzgebung
113
4. Wissenschaftspolitik Können Wissenschaftsgerichtshöfe dazu beitragen, Akzeptanzkrisen der Großtechnologie zu lösen?
151
Der „Science court" - und er nützt doch!
158
8
nsverzeichnis
Die Akzeptanzkrise als Legitimationskrise - Können „Wissenschaftsgerichtshöfe" weiterhelfen?
165
Das Mißverständnis mit den „Wissenschaftsgerichtshöfen"
253
5. Politisches Abgeordneten-Diäten - Der Skandal ist die Kostenpauschale
271
Ein „Wirtschaftswunder" kann nicht versprochen, es muß erarbeitet werden
274
Die Diätenhöhe ist unbedenklich - Kostenpauschalen sind Rechtsbruch im Verfassungsrang
279
Taumelt Europa in den Justizstaat?
284
Freiheit, Sicherheit und Eigen Verantwortung
288
Ökologische Marktwirtschaft - Chancen und Grenzen. Umweltschutz am Prüfstein der sozialen Marktwirtschaft 299 Vom Brot und Entwicklungshilfe
307
Unsere Aufgabe: Die Entwicklungsländer
314
6. Historisches Michael Ignaz Schmidt als „erster deutscher Geschichtsschreiber"
325
Fanny von Arnstein - eine bedeutende Frauengestalt
333
7. Beruf Backen und Umwelt
341
Erfahrungen mit Stikkenöfen
348
Einflußgrößen. Ermittlung von Kennzahlen für Backöfen und Backanlagen
354
Das Sicht-und Duft-Backen
373
Was es sonst noch zu sagen gäbe
382
nsverzeichnis Teil II Gedächtnisbeiträge Ulrich Karpen Edgar Michael Wenz - Leben, Werk, Wirkung
389
Dietmar Willoweit Selbstbindung absoluter Herrschermacht durch Verwaltungsgesetzgebung - Eine staatssoziologische Problematik im Vorfeld der Aufklärung 403 Marcus Jaroschek Das Werk Max Webers in der internationalen Wissenschaft
415
Klaus E Röhl Vorlagepflichten als Auslegungsverbote
445
Gerd Habermann Zum Thema „Politiker und Staatsmann". Eine Skizze
457
Carl Bohret Reform der Staatstätigkeit durch experimentelle Rechtsetzung
465
Klaus Adomeit Arbeitsrecht und Ökonomie
479
Ulrich Weber Begrenzung des Strafrechts durch die Toleranz und Sicherung der Toleranz durch das Strafrecht 487
Bibliographie Edgar Michael Wenz
501
Personenregister
507
Sachregister
510
Abkürzungsverzeichnis a. a. Ο.
am angegebenen Ort
a. E.
am Ende
AbgG
Abgeordnetengesetz
Abs.
Absatz
AFG
Arbeitsförderungsgesetz
Ani.
Anlage
Anm.
Anmerkung
ARSP
Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie
Art.
Artikel
atw Aufl.
Atomwirtschaft - Atomtechnik. Zeitschrift für öffentliches Recht und öffentliche Verwaltung Auflage
BAG
Bundesarbeitsgericht
BayVBl.
Bayrische Verwaltungsblätter
Bd.
Band
BetrVG
Betriebsverfassungsgesetz
BGB
Bürgerliches Gesetzbuch
BGBl.
Bundesgesetzblatt
BIM
Bundesinnenministerium
BImSchV
Verordnungen zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
BJM
Bundesjustizministerium
BReg
Bundesregierung
BVerfG
Bundesverfassungsgericht
BVerfGE
Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts
BVR
Bundes Verfassungsrichter
bzw.
beziehungsweise
d. h.
das heißt
DBT
Deutscher Bundestag
ders.
derselbe
DGG
Deutsche Gesellschaft für Gesetzgebung
Diss.
Dissertation
DJT
Deutscher Juristentag
DÖV
Die öffentliche Verwaltung
DRiG
Deutsches Richtergesetz
DRiZ
Deutsche Richterzeitung
DVB1.
Deutsches Verwaltungsblatt
12
Abkürzungsverzeichnis
EAL
European Association of Legislation
ebda, ebd.
ebenda
EStG
Einkommenssteuergesetz
EuGH
Europäischer Gerichtshof
EuGRZ
Europäische Grundrechtszeitung
EuZW
Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
f, ff
folgende
F.A.Z.
Frankfurter Allgemeine Zeitung
FGG
Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit
Fn., FN
Fußnote
GFA
Gesetzesfolgenabschätzung
GG
Grundgesetz
GMBl.
Gemeinsames Ministerialblatt
GO
Geschäftsordnung
Hrsg.
Herausgeber
i. d. F.
in der Fassung
iwd
Informationsdienst des Instituts der deutschen Wirtschaft
Jhd.
Jahrhundert
JuS
Juristische Schulung
JZ
Juristenzeitung
KFA
Kostenfolgenabschätzung
KSchG
Kündigungsschutzgesetz
LWaldG
Landeswaldgesetz
m. w. N.
mit weiteren Nachweisen
NJW
Neue Juristische Wochenschrift
Nr.
Nummer
NVwZ
Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht
NZA
Neue Zeitschrift für Arbeits- und Sozialrecht
OVG
Oberverwaltungsgericht
PatG
Patentgesetz
Rn.
Randnummer
RTF
Rechtstatsachenforschung
s.
siehe
S.
Seite
StGB
Strafgesetzbuch
StPO
Strafprozeßordnung
TVG
Tarifvertragsgesetz
u. a.
unter anderem
UPR
Umwelt- und Planungsrecht
UWG
Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
v.
von, vom
Abkürzungsverzeichnis VerwArch
Verwaltungsarchiv. Zeitschrift für Verwaltungslehre, Verwaltungsrecht und Politik
VG
Verwaltungsgericht
vgl.
vergleiche
VO
Verordnung
VwGO
Verwaltungsgerichtsordnung
VwVfG
Verwaltungsverfahrensgesetz
ζ. B.
zum Beispiel
ZfRSoz
Zeitschrift für Rechtssoziologie
ZG
Zeitschrift für Gesetzgebung
Ziff.
Ziffer
ZPO
Zivilprozeßordnung
ZRP
Zeitschrift für Rechtspolitik
Teil I
Schriften von E. M. Wenz
1. Rechtswissenschaft
2 Gedächtnisschrift Wenz
Die Entwicklung der Gewerbefreiheit in Bayern Eine historische, dogmatische und rechtsvergleichende Darstellung Jur. Diss. Erlangen 1951 (Auszüge)
Vorwort Die vorliegende Arbeit mit dem Thema ,Die Entwicklung der Gewerbefreiheit in Bayern. Eine historische, dogmatische und rechtsvergleichende Darstellung 4 kann aus zwei Gründen aktuell genannt werden. Einmal wurde mit der Einführung des Lizenzierungsverbotes durch die US-Militärregierung um die Jahreswende 1948/49 die Problematik der Gewerbefreiheit i m allgemeinen und die Art und Weise ihrer Verwirklichung i m besonderen nachdrücklich in das Blickfeld der Öffentlichkeit gerückt. Der zweite Grund bezieht sich auf die mehrfach von offizieller Seite erhobene Forderung nach einem spezifisch bayerischen Verwaltungs- und Staatsrecht. Es soll versucht werden, die geschichtliche Entwicklung der Gewerbefreiheit, namentlich in Bayern, aufzuzeigen, eine dogmatische Untersuchung der technischen Begriffe Gewerbe und Gewerbefreiheit daran zu knüpfen und endlich das neuartige Lizenzierungsverbot kritisch zu untersuchen und auf deutsche Verhältnisse abzustimmen. Dabei ist es auch möglich, jene Kräfte herauszufinden, die auf ein Eigenleben Bayerns hinwirkten.
A. Die Epoche des Zunftwesens § 1: Die Zeit der klassischen Zunft Die Begriffe Zunft und Patriziat erfüllen die Geschichte der mittelalterlichen Städte 4 . A n dieser Stelle soll auf die Institution der Zunft jedoch nur insoweit eingegangen werden, als diese auf die Entwicklung der Gewerbefreiheit maßgeblich einwirkt.
4 Vgl. Popp, a. a. O., S. 16; auch v. Rohrscheidt „Zunft bis Gew. Frh.'\ S. 1 f. 2*
20
Edgar Michael Wenz
Das 14. und 15. Jhd. ist der Zeitraum des klassischen Zunftwesens: in dieser Zeitspanne hat es seinen Höhepunkt erreicht 5 . Die Zünfte stellen sich hier dar als obrigkeitlich genehmigte Zwangsverbände von Unternehmen des gleichen Gewerbes. Sie besitzen Gewerbe- und Handelsmonopol, sind die Träger der Gewerbepolizei, halten in Zunft- und Gewerbesachen Gerichtsbarkeit über die Zunftgenossen und haben Autonomie hinsichtlich des Zunftrechts und des Besteuerungsrechts 6 . Diese Rechtseinrichtungen und diese Machtstellung in der allgemeinen Rechtsordnung unterscheidet die Zunft der klassischen Zeit von der frühen Zunft. Diese trug fast ausschließlich wirtschaftlichen Charakter 7 . Der Zunftzwang stellt sich hier als ein Mittel zur Linderung wirtschaftlicher Nöte dar und hat noch nicht die Schärfe, die er in der Zeit der klassischen Zunft erhält 8 . Zusammenfassend kann von der Zunft der frühen Zeit (12. und 13. Jhd.) gesagt werden, daß sie vornehmlich dem Interesse des Konsumenten dient, wodurch wiederum rückwirkend eine Verbesserung der Lebenslage der Zunftgenossen erhofft wird. Der Grundsatz, das Interesse des Konsumenten zu wahren, wird zwar auch in der Zeit der klassischen Zunft beibehalten, doch tauchen hier grundlegende Neuerungen für den Bereich des Produzenten auf. Nunmehr garantiert der Zunftzwang
5 Auf Ursprung und frühe Entwicklung des Zunftwesens soll in diesem Zusammenhang nur soweit als unbedingt erforderlich eingegangen werden. Das Wort „Zunft" tritt im Mittelhochdeutschen zunächst als oberdeutsche Ableitung von zeman (= ziemen) mit der Grundbedeutung: Schicklichkeit, Gesetzmäßigkeit, auf. Die mittellateinische Urkundensprache kennt es als „zunfta monopolium, zunfta collegium". Die Erklärung des Wortes aus „Zusammenkunft" ist nach Kluge irrig. Die wirtschaftsgeschichtliche Parallelerscheinung in Niederdeutschland wird mit „Gilde" bezeichnet. Die Grundbedeutung dieses Wortes ist „opfern" (angelsächsisch geldan, altnord. gildi). Im 11. Jhd. erhält das Wort die Bedeutung „Versammlung zum Opferschmaus" und wird von da zu „geschlossene Gesellschaft", „Zweckverband". Über die Entstehung des Zunftwesens gehen die Ansichten auseinander. Überwiegend wird die Notwendigkeit eines Zusammenschlusses Gleichgesinnter und wirtschaftlich Gleichgerichteter, auch ein gewisses Selbstschutzinteresse der gemäß der mittelalterlichen Ständeordnung gering geachteten Handwerker aufgeführt. Für die letztere Annahme spricht, daß die ersten urkundlich beglaubigten Nachweise von Zünften aus dem 12. Jhd. aus dem Bereich der kleinen Handwerker stammen (Zunftbriefe der Fischer zu Worms [1106], Schuhmacher zu Würzburg [1128], der Bettzeichenweber zu Köln [1149], der Schuhmacher [1158] und Gewandschneider [1183] zu Magdeburg.) Im 13. Jhd. sind bereits Gewerbetreibende verschiedenster Art korporativ gegliedert. {Kluge, a. a. O. „Zunft-Gilde"; vgl. Popp, a. a. O., S. 11; HWBStW „Zunftwesen"; Schwerin, a. a. O., S. 217 in Anm. 44 z. gl. S.; vgl. auch den anonymen Autor S. 5; Wilda, a. a. O., S. 314.) 6 Schwerin, a. a. O., S. 216 f. 7
Dies geht aus den Leitsätzen der jeweiligen Zunftbriefe hervor. So betonen die Berliner Bäcker (1272), daß sie ihre Gilde errichtet haben „wente di gesunde mensche mach nich wesen ane brod"; die Regensburger Tuchfabrikation (1259) setzte ein aus 12 Richtern bestehendes Gericht ein, „um gutes Tuch in Regensburg zu erzielen". (HWBStW „Zunftwesen"). 8 Von den 7 ältesten Zunftbriefen sprechen 6 den Grundsatz des Zunftzwanges direkt aus. In der Rolle der Würzburger Schuhmacher von 1228 ist er nicht erwähnt. In der Zeit der frühen Zunft sind auch die Zünfte gegenseitig noch nicht ausschließlich abgegrenzt; Mitgliedschaft in verschiedenen Zünften ist möglich (HWBStW „Zunftwesen).
Die Entwicklung der Gewerbefreiheit in Bayern
21
der Gesamtheit der zunftgebundenen Gewerbetreibenden den Markt, d. h. er dient in einer Zeit wirtschaftlicher Detaillierung und damit erhöhter Marktbeschickung dazu, dem Mitglied der Zunft, d. i. dem Handwerksmeister, den „standesmäßen Unterhalt" aus genügender Beschäftigung zu sichern. Damit aber ist gleichzeitig die Notwendigkeit gegeben, das Konkurrenzproblem zu lösen. Grundsatz ist nach wie vor, jedem Zunftgenossen die wirtschaftliche Existenz zu sichern. Die Sicherungsmaßnahmen erfolgen in doppelter Richtung: einmal gegen alle außerhalb der Zunft stehenden Handwerker, zum anderen gegen den Zunftnachwuchs. Das Verfahren der Zunft gegen die außerhalb der Zunft stehenden Handwerker 9 ist außerordentlich hart und endet in der Vernichtung ihrer Existenz 1 0 . Ziel dieser Maßnahme ist, jeden nicht zur Zunft gehörigen Handwerker vom Betrieb des Gewerbes seiner Genossen dauernd auszuschließen 11 : Zwar werden bereits zur Zeit der klassischen Zunft aus Zweckmäßigkeitsgründen in der Bannmeile der Stadt einige wenige Gewerbetreibende belassen, ohne sie in die Zunft zu zwingen, aber weder diese Tatsache noch die Einrichtung der sog. „Freymeister" lockert den rigorosen Zunftzwang. Ein, wenn auch primitiver, Anfang von „Gewerbefreiheit" liegt in diesen Maßnahmen keinesfalls 12 .
9 Fricke, a. a. O., S. 97: „Jedoch geht der Zunftzwang nur auf Arbeiten, die um Lohn oder auf den Kauf gemacht werden. Daher einem jeden Hausvater unverwehrt ist, für sich und sein Haus und auch umsonst für andere außer seinem Hause Arbeiten zu machen. Nur darf er zu dieser Hausarbeit keine Gesellen setzen". Auch Ortloff, a. a. O., S. 330: „Der Zunftzwang gegen Personen, die nicht zum Handwerk gehören, geht jedoch nur auf Arbeiten, die auf den Kauf oder um Lohn gemacht werden. Jedermann darf in der Regel alle Zunftarbeiten, die er zu seinem und zu seiner in seinem Hause wohnenden Familie Gebrauch nötig hat, selbst verfertigen, auch darf er alles selbst machen, was er seinen Dienstboten als einen Teil ihres Lohnes zu geben hat. Es ist ferner nicht verboten, daß man die Geschicklichkeiten seiner Dienstboten zu Arbeiten, für sich und seine Familie in der Haushaltung benutzen kann. Doch darf kein Hausvater für seine Arbeiten sich eigens Gesellen setzen, - noch weniger aber Arbeiten, ohne Zuziehung eines werkverständigen Meisters übernehmen, woraus für einen dritten oder fürs Publikum Nachteil zu befürchten steht". 10 Vgl. Ortloff, a. a. O., S. 329 f.
n Popp, a. a. O., S. 14. Vgl. Fricke, a. a. O., S. 98: „Obgleich der Zunftzwang sich nicht nur auf die Stadt, sondern auch auf die benachbarten Dörfer erstreckt, so werden dennoch einige unentbehrliche Handwerker, als Schuster, Schneider, Schmiede, Bäcker, Rademacher und Leineweber auf dem Lande geduldet. Von jeder Art aber darf sich nicht mehr als ein einziger im Dorfe niederlassen. Auch dürfen diese Dorfmeister selten Gesellen halten und nur um Lohn für die Dorfschaft nicht aber für auswärtige und nicht für den Kauf arbeiten. Außer den Dorfmeistern wird auch den Dorfschulmeistern wegen ihres geringen Gehalts nachgesehen, daß sie für ihre Gemeinde arbeiten dürfen". S. 101: „Freymeister sind diejenigen Handwerker, welche das Recht an einem Orte zu arbeiten haben, ohne in die Zunft aufgenommen zu sein. Dergleichen Freymeister setzt der Landesherr, jedoch bei geschlossenen Zünften nicht anders, als wenn die gemeine Wohlfahrt es erfordert". Und: „Von den Freymeistern unterscheidet man die Gnadenmeister, welchen die Zunft selbst das Recht außer der Zunft zu arbeiten gegeben hat". 12
22
Edgar Michael Wenz
Der Betrieb des Handwerksmeisters stellt also eine Art „Planstelle" dar, deren Zahl für die jeweilige Zunftgemeinde beschränkt i s t 1 3 . Damit wird bereits i m 14. und 15. Jhd. aus der Notwendigkeit der beschränkten Meisterstellen das Nachwuchsproblem zur „Nachwuchssteuerung". Viele der diesbezüglichen Vorschriften sind wohl durch die Wesensart des mittelalterlichen Menschen bedingt, der auf äußere Ehrbarkeit des einzelnen größten Wert legte 1 4 . Nicht umsonst sagt das zeitgenössische Sprichwort: „Die Zünfte müssen so rein sein, als wenn sie von den Tauben gelesen wären". Jedoch geben die fachlich technischen Zulassungsbedingungen zum Meistertitel Zeugnis von gewollten Erschwerungen, die über das berechtigte Verlangen einer Härteprobe zur Erlangung einer Handwerkerelite hinausgehen 15 . Aber trotz solcher Anzeichen einer „Zunftkrisis" kann das Zunftwesen unbedenklich als die für den mittelalterlichen Menschen taugliche Gewerbeordnung angesehen werden 1 6 , denn es darf nicht außer acht gelassen werden, daß eine epochebestimmende Gemeinschaftsform wie das Zunftwesen nicht allein vernunftgebundenen Erwägungen entspringt, sondern daß „der Zeitgeist" selbst an der entsprechenden Lebensform mitwirkt. „ I m Mittelalter lagen die beiden Seiten des Bewußtseins - nach der Welt hin und nach dem Innern des Menschen selbst - wie unter einem gemeinsamen Schleier träumend oder halb wach. Der Schleier war gewoben aus Glauben, Kindesbefangenheit und Wahn; durch ihn hindurchgesehen schienen Welt und Geschichte wundersam gefärbt. Der Mensch aber kannte sich nur als Rasse, Volk, Partei, Korporation, Familie oder sonst in irgendeiner Form des Allgemeinen. In Italien zuerst verweht dieser Schleier in die Lüfte; es erwacht eine objektive Betrachtung und Behandlung des Staates und der sämtlichen Dinge dieser Welt überhaupt; daneben aber erhebt sich mit Macht das Subjektive. Der Mensch wird geistiges Individuum und erkennt sich als solches 1 7 ". Erst als diese geistigen Voraussetzungen geschaffen sind, erwacht das Verlangen nach „Gewerbefreiheit" i m modernen Sinn als ein „Grundrecht" des Individuums. 13
Tyszka, a. a. O., S. 46: „In einigen Zunftordnungen wird ein ,Numerus clausus' ausdrücklich festgelegt". 14 Bereits zur Erlernung des Handwerks war eheliche Geburt Voraussetzung. Ausgeschlossen bleiben Bastarde und Findlinge. Für alle Zünfte waren ausgeschlossen die Söhne sozial niedrig Stehender, z. B. Gerichtsdiener, Feldhüter, Nachtwächter, Totengräber. Zünfte vornehmerer Gewerbe schlossen auch die Angehörigen gewisser Berufe aus, wie z. B. Leineweber, Müller, Bader, Barbierer (vgl. HWBStW „Zunftwesen"; auch Wilda, a. a. O., S. 331). Besonderes Mißtrauen bringt man den Juden entgegen. V. Rohrscheidt („Zunft bis Gew. Frh.", S. 79) führt dazu aus: „Es war ihnen schon untersagt, ihre Kinder Lehrjungen werden zu lassen, weil man die ausgesprochene Befürchtung hatte, die Letzteren würden als Gesellen, unter Beförderung Seitens ihrer Stammesgenossen selbst Arbeiten auf eigene Rechnung übernehmen, also die Pfuscherei im Großen betreiben". 15 So ζ. B. lange Lehrzeit, Wanderschaft, Probezeit vor der Zulassung zur Zunft bei einem Handwerksmeister (die sog. Muthung), Anfertigung eines Meisterstücks. •6 Vgl. v. Rohrscheidt „Zunft bis Gew. Frh.", S. 87. 17 Burckhardt, a. a. O., S. 76.
Die Entwicklung der Gewerbefreiheit in Bayern
23
Aber selbst dann ist die Ausstrahlung dieser historisch gewachsenen Institution so stark, daß es langer Zeit bedarf, um ihre Auswirkungen einzudämmen. Die Entwicklung im späten 19. Jhd. zeigt, daß selbst der Staat auf sie zurückgreift, um ein Korrektiv gegen die Nachteile einer absoluten Gewerbefreiheit zu haben. In diesem Zeitpunkt greift der Gesetzgeber die letzten historisch faßbaren Ausläufer der Zünfte auf, um sie zum rechtlichen Sammelbecken i m Streit gegen die Auswüchse der Gewerbefreiheit auszugestalten. Daher ist es in diesem Zusammenhang notwendig, die Umgestaltung der Zünfte von einer autarken Wirtschaftsorganisationsform zu einem Korrektiv der Gewerbefreiheit in Gestalt der Innung seit dem späten 19. Jhd. eingehend zu verfolgen.
§ 2: Die Zeit des Zunftnepotismus Einen der ersten Verkünder der Gewerbefreiheit i m modernen Sinn mag man den Schwaben Friedrich Reiser nennen. Dieser fordert in einem Aktenstück, der sog. „Reformation Kaiser Sigismunds" die Abschaffung der Zunft und „jederman sein eygen hantwerk und gewerb treiben" zu lassen. Obwohl die zur gleichen Zeit auftretende taboritische Strömung mit ihrer Forderung nach Anerkennung der religiösen individuellen Überzeugung und einer republikanischen Staatsverfassung ohne Unterschied der Stände hierbei mitspielt, kommt Reiser zu seiner Forderung, die Zünfte „abzuthun", aus überwiegend wirtschaftlichen Gründen 1 8 . Erst die Zeit der Aufklärung bringt die Emanzipation des Individuums auf breiter Basis: „ W i r erachten die Wahrheit für selbstverständlich, daß alle Menschen gleich erschaffen sind, daß ihnen der Schöpfer gewisse angeborene und unveräußerliche Rechte verliehen hat, darunter Leben, Freiheit und Streben nach G l ü c k " 1 9 . Wirtschaftsgeschichtlich bedeutet die Zeit der Aufklärung den endgültigen Verfall des Zunftwesens. Die äußere Ordnung des Gewerbewesens durch die zünftischen Organisatio18
Er wirft den Zünften vor allem vor, daß sie zu „gewaltig" geworden seien, daß man den Eintritt in sie teuer erkaufen müsse, daß sie zu viele gesetzliche Schranken aufrichteten und daß eine Zunft im Rat der anderen abhelfe (vgl. HWBStW „Zunftwesen"). Auch die Maßnahmen der Reichsregierung, den Zunftmißständen zu steuern, stehen unter dem gleichen Gesichtspunkt. Vor allem wenden sie sich gegen die immer mehr überhand nehmende, eigennützige Personalpolitik der Zünfte. (Vgl. hierzu Popp, a. a. O., S. 22 ff.; auch Wilda, a. a. O., S. 326): „Je selbständiger und unabhängiger die Zünfte wurden, je wichtiger wurde die Mitgliedschaft. Sie hielten sich wie andere Gilden berechtigt, Personen die Aufnahme zu verweigern, sei es, daß sie dabei die allgemeinen Grundsätze des Gildewesens oder eigene Willküren oder die Mehrheit der Stimmen in einzelnen Fällen zur Richtschnur nahmen. Wer aber nicht zur Gilde gehörte, sollte nun auch nicht das Gewerbe in der Stadt betreiben dürfen. Dieser sich allmählich entwickelnde Grundsatz wurde zum Rechte erhoben und selbst erweitert, indem der Zunftzwang einer bestehenden Innung auch oft noch über die Umgebung der Stadt erstreckt wurde. Es wurde auf diese Weise aber ein schädliches Monopolienwesen erweckt, vorzüglich, wenn die Zünfte dahin trachteten, die Zahl ihrer Mitglieder möglichst zu verringern, um den Gewinnst der Einzelnen dadurch zu erhöhen". 19
Abs. II der Unabhängigkeitserklärung der 13 amerikanischen Kolonien vom 4. Juli 1776 (abgedr. bei Morison-Commager, a. a. O., Anhang).
24
Edgar Michael Wenz
nen stellt nun nicht mehr die natürliche und harmonische Konkretisierung des zeitgenössischen Wirtschaftsgeistes dar. Die Zunft als gewerbeorganisatorische Einrichtung kann den neuen Wirtschaftsbedingungen damit nicht mehr gerecht werden. Man kann der Reichsregierung nicht den Vorwurf machen, sie sei gegen diese Mißstände blind gewesen. Sie wendet sich in zahlreichen Reichspolizeiordnungen stets gegen die gleichen Mißstände, besonders gegen das Ausschließen „ehrlicher Personen" aus den Zünften, gegen die übertriebenen Härten der Zunftexekution (z. B. das Auftreiben und Unredlichmachen), gegen die unbilligen Forderungen gegenüber den Gesellen. Ausgehend von dem Reichsgesetz von 1672 (ausgestattet mit Gesetzeskraft 1726!) wurde die Zunftautonomie, sowie Schmähungen und Auftreibungen verboten. Nachdem alle diese Versuche erfolglos blieben, beabsichtigte das Reichsgesetz vom 16. August 1731 eine Reformierung des gesamten Handwerkswesens. M i t dem Reichsgesetz von 173 1 2 0 sollten die seit Jahrhunderten aufgespeicherten Übel mit einem Schlage beseitigt werden. Dazu aber muß die Zunftverfassung in ihren Grundfesten erschüttert und für die Zukunft ihre Autarkie gebrochen werden. § I des genannten Gesetzes w i l l daher die Autonomie der Zünfte beseitigen. Dafür soll ein Lizenzierungssystem treten. § I V versucht die sozialen Schranken zur Zulassung zur Handwerksausübung zu beseitigen. Die Durchführung des Gesetzes hätte bedeutet, daß nunmehr der Staat selbst die Regelung des Innungswesens, seine Gesetz- und Strafgewalt zu übernehmen gehabt hätte. Daß es der Reichsregierung mit dieser Absicht ernst war, zeigen die Schlußworte des Gesetzes, wonach „bei weiterem Muthwillen, Boßheit und Halsstarrigkeit . . . Wir und das Reich leicht Gelegenheit nehmen dörfften . . . alle Zünfte insgesamt und überhaupt völlig aufzuheben und abzuschaffen". Trotzdem wurde das Gesetz kaum publiziert und erst recht nicht beachtet, wie die Tatsache beweist, daß im Jahre 1764 Kaiser Franz I. erneut auf das Gesetz hinweisen mußte - jedoch mit gleich mangelhaftem Erfolg. Einzig und allein die preußische Regierung führte das Gesetz streng durch. Hier zeigt sich bereits die straffe Hand des großen Kurfürsten auch in gewerberechtlichen Fragen. Die Entwicklung in Preußen für den gleichen Zeitablauf faßt Rudolphi 21 folgendermaßen zusammen: 1. Zunächst werden die alten Privilegien bestätigt und damit den Zünften ihr Weiterbestehen auf der alten wirtschaftlichen Basis zugesichert; dabei wird aber zugleich nachdrücklich betont, daß allein der Herrscherwille Rechtsquelle der Privilegien ist.
20 Ursache zu diesem Gesetz war ein Aufruhr der Schulknechte in Augsburg, wodurch Preußen und Sachsen sich veranlaßt fühlten, dem Reich gegenüber deswegen vorstellig zu werden (Vgl. Popp, a. a. O., S. 22 ff.; Zee-Heräus, a. a. O., S. 13, ν. Rohrscheidt „Zunft bis Gew. Frh.", S. 90 f.). 21 A. a. 0.,S. 3.
Die Entwicklung der Gewerbefreiheit in Bayern
25
2. Es folgt die Zurückführung der politischen Zunftrechte auf ein dem Staate erträgliches Maß. Gegen erneute Bestätigungen der wirtschaftlichen Rechte werden Autonomie und Selbstjustiz eingeschränkt; zugleich beginnen Staatsaufsicht und Einbau in das neue Steuersystem. 3. Endlich folgt der Kampf gegen den Mißbrauch der den Zünften durch ihre Ausschließlichkeit eingeräumten wirtschaftlichen Macht, die der staatlichen Wirtschaftspolitik (Kolonisation, Hebung der Industrie) entgegenstand. In gleicher Weise wird die Entwicklung von v. Rohrscheidt
22
dargestellt.
In Bayern ergibt sich dagegen ein wesentlich ungünstigeres Bild. Im 18. Jhd. steht hier das Zunftwesen i m Zeichen einer ausgesprochen „personalen Inzucht". In der Zwischenzeit, da sich die klassische Zunft zur geschlossenen Zunft entwikkelt hatte, hatte sich auch eine grundlegende Änderung in der rechtlichen Bewertung einer Handwerksgerechtigkeit ergeben. Eine solche war zunächst eine personale Gerechtigkeit gewesen. „Sie wurden den in den Zunftverband Aufgenommenen nur als persönliche Gewerbebefugnisse auf Grund ihrer erwiesenen Fähigkeiten durch die Zunft, bzw. die Stadt- oder Landes-Obrigkeit verliehen. ,Kunst erbt nicht' war der Grundsatz, der damals maßgebend gewesen war. Allein schon i m 17. Jhd. wurde dieser alte Grundsatz außer Acht gelassen. Immer mehr wurde in Zunftkreisen die Gerechtigkeit als eine reale, als ein vererbbares und veräußerliches Eigentum angesehen. Je mehr die Zünfte anfingen, sich monopolistisch abzuschließen, desto allgemeiner bürgerte sich die Betrachtung der Gerechtigkeiten als reale ein. Und mit dem gänzlichen Geschlossenwerden der Zünfte, welches etwa zu Beginn des 18. Jhd. überall erfolgt war, hatte sich auch die Behandlung der Gerechtigkeiten als reale überall ausschließlich durchgesetzt. Für München ist hier bedeutsam das Jahr 1769. Bis dahin hatte der Magistrat der Stadt Gerechtigkeiten als nur personale betrachtet und behandelt, während die Zünfte sie als reale anerkannt wissen wollten. So kam es 1767 zu einem Streite zwischen Magistrat und Bürgerschaft, und dieser endete damit, daß zwei Jahre später 1769 in dem sogen.,Bürgervergleich 4 der Magistrat der Stadt München die vorhandenen Gerechtigkeiten als reale anerkannte". 23 War der Erwerb einer Hand Werksgerechtigkeit schon zur Zeit der klassischen Zunft nicht leicht gewesen, so war es in der Zeit der geschlossenen Zunft des ausgehenden 18. Jhd. für einen einzelnen Gewerbetreibenden, der nicht über besondere Hilfsmittel verfügte, nahezu unmöglich, eine solche Handwerksgerechtigkeit zu erlangen. Denn nunmehr trat persönliche Ehrbarkeit und fachliche Tüchtigkeit immer mehr in den Hintergrund und die Vergebung einer Gewerbegerechtigkeit wurde fast ausschließlich erstens von Geldmitteln des Bewerbers und zweitens noch mehr von persönlichen Beziehungen zur Zunft selbst abhängig gemacht. Zum ersten Punkt führt v. Tyszka 24 aus: „Denn die Zünfte waren in Bayern i m 18. Jhd. 22 „Zunft bis Gew. Frh"., S. VII. 23 v. Tyszka, a. a. O., S. 46 f.
26
Edgar Michael Wenz
durchgängig geschlossen'. Nur eine bestimmte, beschränkte Anzahl Meister war für jedes Gewerbe an jedem Ort zulässig und diese Zahl durfte in keinem Fall überschritten werden . . . Aber eine solche Gerechtigkeit zu erlangen war für den fremden und nicht bemittelten Gesellen fast ein unmöglich Ding. Denn die Gerechtigkeiten waren i m 18. Jhd. bereits überall realer Natur, d. h. vererbbares und veräußerliches Eigentumsrecht des derzeitigen Inhabers, die zu erkaufen schweres Geld kosteten. Die Meisterstücke, die ehemals dazu gedient hatten, das Handwerk technisch auf der Höhe zu halten, und die die Garantie bieten sollten, daß nur fähige und geschickte Leute Meister würden, arteten i m 17. und 18. Jhd. zu Maßnahmen zur Fernhaltung unbemittelter Gesellen aus. Einmal wurden dieselben derart gestaltet, daß ihre Anfertigung äußerst kostspielig wurde und sehr lange Zeit in Anspruch nahm. Dann mußte der Geselle mit recht hohen Gebühren sich in die Meisterlade einkaufen". - Zum zweiten Punkt sagt der gleiche Autor: „ E i n Meistersohn war von der Bezahlung der Gebühren beim Aufdingen und Freisprechen befreit. Wie es in den revidierten Handwerksordnungen heißt: ,Für welche Aufdingung und Ledigzählung der Meistersohn nicht, ein anderer Lehrjunge entgegen jederzeit in die Meisterlaad 2 Gl., dann denen Führern miteinander 1 Gl. 30 kr. zu erlegen schuldig sey'. Auch das hohe Lehrgeld brauchte ein Meistersohn nicht zu bezahlen." Eine weitere Erschwerung des Meisterwerdens war für den Fremden die lange Wanderzeit. Auch hierin genoß der Meistersohn Vorrechte. Die Gürtler-Ordnung bestimmt: „Ainem Maistersohn aber, oder welcher aine Maisterstocher oder -Wittib heuratet, dem wird ain Jahr des Wanderns nachgesehen". In allem und jedem genießen also die Meisterkinder größere Rechte 2 5 . Für diesen Zustand prägt v. Tyszka den treffenden Ausdruck des „Nepotismus der Z ü n f t e " 2 6 . Als dessen Folgeerscheinung führt er i m 2. Kapitel seiner Darstellung auf: „So könnten im ganzen drei Folgeerscheinungen des Abschließens der zünftigen Meister von den Außenstehenden festgestellt werden: 24 A. a. O., S. 46 f.; vgl. auch v. Rohrscheidt „Zunft bis Gew. Frh.", S. 142: „Den jungen Gesellen, namentlich den unbemittelten, wurde es meist herzlich schwer gemacht, Meister zu werden, da der Ausgaben und Unkosten gar mancherlei und hohe waren, denn der Zunft konnte nur daran gelegen sein, das Ansetzen neuer Meister nach Möglichkeit zu verhindern und so etwaiger Concurrenz zu wehren. Daher wurden für das Meisterstück nicht nur schwierige Aufgaben gestellt, man forderte auch die Anfertigung kostspieliger, veralteter Gegenstände, deren nachheriger Verkauf so gut als unmöglich war. So blieb dem armen Gesellen oft nichts weiter übrig, als sein geringes Spargeld in einem Meisterstücke anzulegen, das unveräußerlich blieb, während, wenn er dafür einen Abnehmer gefunden hätte, der Erlös ihm vielleicht die schuldenfreie Einrichtung seiner Werkstatt würde ermöglicht haben." 25 „Aber sollen aines Maisters Sohn oder Tochter dieses Rentamts, sondern allhiesige Bürgers und Maisters Kinder diejenige Freyheit und das Recht, so ihr Vatter oder Mutter von Handwerchs wegen gehabt, und genossen, jederzeit zu geniessen haben, und etwas mehreres als ain anderer befreyt seyndt. Wie von alters her gebräuchlich gewesen und noch ist". Zitiert bei v. Tyszka, a. a. O., S. 52. 2 6 A. a. O., S. 50.
Die Entwicklung der Gewerbefreiheit in Bayern
27
1. Die immer schärfere Herausstellung eines eigenen Gesellenstandes: Zusammenschließung der Gesellen zu festen Verbänden in den Gesellenladen und Erstarkung dieser. 2. Die Entstehung und die immer größere Zunahme von selbständig arbeitenden Handwerkern außerhalb der Zunft, aber innerhalb der Bannmeile derselben: als ,Pfuscher', oder als ,Freimeister', oder auch als selbständige Gesellen. 3. Die Zunahme des Handwerks außerhalb der Bannmeile der Zunft: des Landhandwerks". 2 7 Trotz aller Bemühungen können aber die Zünfte das Anwachsen der nicht zunftgebundenen Gewerbetreibenden nicht mehr unterdrücken. Auch die Zunftgerichtsbarkeit gegen diese Gewerbetreibenden kann ihr Anwachsen nicht mehr eindämmen, obwohl man mit größter Härte vorgeht. Fricke 28 führt dazu aus: „Damit die Ausübung des Zunftzwanges mit der öffentlichen Wohlfahrt bestehen möge und ausschweifende Thätlichkeiten vermieden werden; so kann zwar die Gilde dem Bönhaasen für sich beschicken und warnen; wenn solches aber ohne Wirkung ist und die Haussuchung vorgehen soll, so kann diese von der Gilde durch die Jungmeister nicht anders, als i m Beisein eines Gerichtsdieners oder Polizeiknechts geschehen. Bei dieser Haussuchung wird alles, was man von Handwerkszeuge und Arbeiten antrifft gepfändet. Doch wird dem Bönhaasen das erstemal gemeiniglich verstattet, die gepfändeten Sachen auszulösen, das zweitemal aber werden selbige konfiscirt, und dem Bönhaasen wird eine Geldstrafe angedroht. Wenn ihn auch dieses nicht abschreckt, so werden nicht nur die gepfändeten Instrumente und Arbeiten konfiscirt, sondern auch die gedrohte Geldstrafe beigetrieben und er selbst wird mit weggeführt und dem Stadtmagistrat zur Haft ausgeliefert. Die äußerste Strafe gegen einen Bönhaasen, den auch das Gefängnis nicht zwingen kann, ist die Landesverweisung". Die „Pfuscher" vermehren sich indes immer mehr, da die Bevölkerung sie wegen ihrer billigen Arbeit oft heimlich unterstützt. Der Umfang des Pfuscherwesens ergibt sich aus folgenden Urkunden: Ζ. B. aus dem Mandat (des Kurfürsten von Bayern) vom 21. April 1749, in welchem es heißt, „daß durchgehends alle Pfuscher, Stimpler, Störer, Fretter, dann andere schädliche Handwerks-Eingriff, unter was Nämen und Vorwand solche sich äußern mögen, in Zukunft verbothen, und solchergestalten auf ein beständiges abgeschafft sein sollen, das die Exedenten nicht nur mit wirklicher Confication ihrer Waren, Sachen, sondern nach Gestaltsame der Umstände mit empfindlichen Gelt- oder wo gar bey verspührender Incorribilität mit öffentlichen Schandstrafen angesehen, und abgebüßt werden sollen"; dem Mandat vom 9. August 1769, welches die Pfuscher abermals „abschaffte" und der Verordnung vom 9. Dezember 1778, welche bestimmt, daß diejenigen Handwerker, welche keiner Zunft einverleibt sind, sich einzünften lassen müssen. „ W o
27 A. a. O., S. 72 f. 28 A. a. O., S. 99 f.
28
Edgar Michael Wenz
diese sich hiezu nicht fügen wollten, alles arbeithen bey Strafe der Ausweisung aus der S t a d t . . . ober bey Zuchthausstraf verbothen sey". Beweis für weitere Klagen findet sich in einer Eingabe der gesamten Münchner Bürgerschaft an den Kurfürsten vom 26. September 1788; darin wird Klage geführt über die fortgesetzte Vermehrung der Personen, die ohne i m Besitze einer Gerechtigkeit ihr Handwerk treiben und sie beeinträchtigen: „ A n diese gesellen sich eine endlose Menge, sowohl einheimisch als auswärtige Pfuscher, fast unglaublich ist die Zahl der ersteren: Jeder Flüchtling und Abentheurer setzt sich nieder, verkauft nach belieben, und verehelicht sich, zeugt Kinder, und weicht nicht mehr von dannen". In der Eingabe der Münchner Zünfte vom 26. September 1788 heißt es: „ A l l e umliegenden Ortschafften strotzen von aufgenohmenen Handwerkern und Professionisten, unmöglich ist es sich allda zu nähren, sie schleppen also ihre Arbeithen und Fabrikaten hierher, und verkauffen selbe in unser aller Angesicht ohne Scheu. Es ist zwar dieser Unfug neuerdings durch ein gnädigst Rescript vom 23. August dieses Jahres eingestellt, allein, wo ist die Exekution?" Das Unterbieten der Preise durch die „Pfuscher" wird bekundet durch die Beschwerde der 8 zünftigen Schneidermeister des Städtchens Erding gegen einen Landschneider aus Langensweisling. Die zünftigen Schneidermeister sind der Ansicht, der gute Verdienst, den der Landschneider habe, rühre daher, „daß der Landmeister, der auf dem Lande in Ansehung seiner Victualien, und übrigen Bedürfnisse in viel vorteilhaffterer Lage ist, größtentheils einiges Vieh mit Feld und Wiesengründ besitzet, auf einem ganz wohlfeileren Boden steht, als wir städtische, auch im stände sey, seine Arbeith um etwas geringeren Preis zu liefern und deswegen auch von den Bürgern gesuchet werde. Daß wir aber, wenn wir mit den Landmeistern ohn unsere Schuld nit gleichen Schritt halten können, gänzlich zu Grunde gerichtet werden können". 2 9 Daß aber zur gleichen Zeit die Ursache des Übels klar erkannt wurde, zeigt die Münchner Ratsresolution vom 27. Februar 1789, die als Antwort auf die Klagen der Zünfte über Gewerbebeeinträchtigung erging und den mangelnden Verdienst im zünftigen Handwerk auf das Verhalten der zünftigen Meister selber zurückführt, „ w e i l sich die wenigsten Bürger um das Wohl ihrer eigenen Mitbürger bekümmern, sondern eine Bürgerclasse der anderen nicht selten selbst Brod und Nahrung schmällert, ja sogar eher fremden, nicht einmal eingezünfteten Professionisten und unberechtigten Handwerksleuten wegen einem meistens eingebildet, oder unbeträchtlich wohlfeileren Preys Arbeith und Verdienst zukommen läßt, wodurch die ungeheuere Zahl der verderblichen Pfuscher immer vermehret w i r d " . 3 0 Auch die Vermehrung der Freimeisterstellen zeigt ein gewisses staatliches Bemühen, den ärgsten Mißständen abzuhelfen und gegen die unerträglich gewordene M o n o p o l stellung der Zünfte ein Korrektiv zu schaffen, um, wie v. Rohrscheidt es darlegt, „nicht nur dem Publikum durch Schaffung einer größeren Concurrenz, als sie die geschlossene Innung zuließ, eine gewisse Erleichterung zu gewähren", sondern 29 Zitiert von v. Tyszka, a. a. O., S. 84 f. 30 Ebd.
Die Entwicklung der Gewerbefreiheit in Bayern
29
auch zugleich dem Handwerk „frisches, gesundes Blut" zuzuführen. 31 Hierauf weist schon die Bezeichnung der Freimeister in Bayern als „Hofschutzgefreite" oder "-verwandte" hin. „Dies waren Handwerker, die ebenfalls nicht dem Zunftverband angehören, sondern die ihre Gewerbebefugnisse aus der landesherrlichen Begünstigung ableiteten, die ihnen aus Anerkennung oder einem anderen Grund verliehen war. Vielfach waren es frühere Hofbedienstete. Sie standen in München unter dem Hofmarschallamt. Laut Mandat vom 23. März 1741 durften sie ihr Gewerbe nur auf eigene Hand betreiben und weder Gesellen noch Lehrjungen hal,
32
ten . Aber alle diese Bemühungen der Landesregierung müssen Stückwerk bleiben, denn dem Landesherren fehlt sowohl die staatliche Macht als auch die persönliche Kraft seiner Vorgänger an der Wende des 16. zum 17. Jhd. Im Jahre 1578 war verboten worden, neue Zünfte zu errichten, da sie „allein ihren eigenen Nutz und Fräß mit anderen Schaden suchen". Im Jahre 1608 hatte Kurfürst Maximilian von Bayern sogar den - allerdings nicht zur Ausführung gelangten - Plan gefaßt, die Gewerbe frei zu geben, „sodaß sie jedermann auch auf dem flachen Lande treiben könnte". Wenn auch diese fortschrittlichen Reformbestrebungen Bestrebungen geblieben waren und die historische Entwicklung (Einbeziehung Bayerns in die Feldzüge des 30-jährigen Krieges) ihre Durchführung schon deswegen zunichte machten, so zeigen diese Bestrebungen jedenfalls eine erfreuliche Aufgeschlossenheit der damaligen Landesherren. Diese aber kann bei den Souveränen Bayerns i m ausgehenden 18. Jhd. nicht gefunden werden. Das wenige, was an Abhilfe verordnet wurde, blieb aus den gleichen Gründen totes Gesetzeswerk, wie es i m Reichsverband der Fall war: Jede Reformbestrebung scheitert an der fehlenden Staatsgewalt. Endlich sind es engstirnige Bedenken, die die Durchführung auch des kleinsten geschlossenen Reformwerkes zunichte machten. „Auch Kurfürst Ferdinand Maria hat . . . an eine Aufhebung des Zunftwesens gedacht, da ihm die Auswüchs der Zunftorganisation bedenklich erschienen und er auch von der Einführung einer Gewerbefreiheit Vorteile erhoffte . . . Aber die Erkenntnis, daß mit einer so schwerwiegenden Maßnahme ein Einzelstaat nicht den Anfang machen könne, sondern vielmehr das Reich vorangehen müsse, verhinderte die Durchführung dieses Gedankens und man schritt wieder nur gegen die schlimmsten Mißstände i m Verordnungswege e i n " . 3 3 Die Regierungszeit des Kurfürsten Karl Theodor ergibt für Bayern, zusammengefaßt gesehen, folgende gewerbepolitische Situation: Die Zünfte beherrschen nach wie vor das Gewerbewesen. Es besteht kein typischer Unterschied in der gewerberechtlichen Handhabung zwischen Stadt und plattem Lande, wo ebenfalls 31 „Zunft bis Gew.Frh.", S. 159. 32 v. Tyszka, a. a. O., S. 86; vgl. auch Fricke, a. a. O., S. 102: „Auch wird gemeiniglich den Soldaten, welche ein Handwerk erlernt haben, sowohl während des Soldatenstandes, als nach erhaltenem ehrlichen Abschied, die Freymeisterschaft, ohne jedoch Jungen und Gesellen zu halten, verstattet". 33 Popp, a. a. O., S. 44 f.
Edgar Michael Wenz
30
Gewerbe aller Art betrieben werden. Dies hat seinen Grund in der Stadtflucht aller Handwerksgesellen, deren Zulassung zum Handwerksmeister an der Geschlossenheit der Zunft scheiterte und die den Nachstellungen der zünftigen Meister zu entgehen suchen, indem sie sich unter den Schutz eines Hofmarchherren stellen. Doch auch dort finden sie nur kümmerlichen Unterhalt 3 4 . So ergeben sich also für das Gewerbewesen Bayerns in dieser Zeit „trostlose, zerrüttete Zustände", die auch durch die Gründung von privilegierten Manufakturen nicht gebessert werden können 3 5 . W i l l man dieser Entwicklung gerechte Betrachtung angedeihen lassen, so darf nicht außer acht gelassen werden, daß sich gerade auf dem Gebiete des Gewerbewesens als einem Bereiche höchster Lebensnähe, der scharfen Blick für die Erfordernisse der Zeit zu seiner gedeihlichen Ordnung erfordert, der sonst so bejahenswerte Hang des bayerischen Menschenschlages zäh am Althergebrachten zu hängen, die größten Schäden verursacht. Dieser Wesenszug findet in dem Verkündungsmandat des 1756 unter Maximilian III. Joseph entstandenen „Codex Maximilianeus Bavaricus civilis" (oder „Chur.-Bayr. Land-Rechts) Ausdruck; nach diesem soll das neue Gesetzeswerk „nicht viel neues enthalten, sondern nur das ältere . . . Recht . . . in solche Gestalt und Enge gebracht werden, daß es auch Jeder welcher selber entweder von Amts oder eigene Angelegenheit wegen zu wissen bedarf, desto leichter begreiffen, behalten und befolgen kann". Das gewerbepolitische Denken Bayerns i m ausgehenden 18. Jhd. deckt sich also durchaus mit dem des 17. Jhd. Als nämlich i m Jahre 1609 Chur-Brandenburg den beiden höheren Reichskollegien den Vorschlag machte, die Handwerkszünfte aufzuheben, stimmten sämtliche weltlichen Deputierten mit Ausnahme Österreichs und Bayerns dafür, welch letztere sich die Meinung der geistlichen Deputierten und des „Reichsstatischen Collegiums" zu eigen machte, daß „man das Kind nicht mit dem Bade ausschütten dürfe". 3 6 U m zu einer neuen zeitgemäßen Ordnung zu finden, bedarf es eines Anstoßes von außen.
B. Die Epoche der Manchesterdoktrin (Freiwirtschaftslehre) § 3: Die Gewerbefreiheit der Wirtschaftsphilosophie
als Theorem der Aufklärung
I m Jahre 1751 übernahm der Schotte Adam Smith Vorlesungen über Moralphilosophie und trug in deren Rahmen über Naturrecht und Politik vor. Den Unterschied zwischen beiden Bereichen bestimmte er dahin, daß jene die Regeln entwickele, 34 v. Tyszka, a. a. O., S. 86 f. 35 Vgl. Popp, S. 44 f. 36 Popp, a. a. O., S. 24.
Die Entwicklung der Gewerbefreiheit in Bayern
31
die auf der Gerechtigkeit beruhen, diese dagegen besonders die Zweckmäßigkeit empfehle oder „was durch die Absicht, den Reichtum, die Macht und die Wohlfahrt eines Staates zu fördern", seine Erklärung finde. Aus den mannigfachen neuen Gesichtspunkten und Einsichten, die Smith dabei gewann, formte sich in den Folgejahren das grundlegende Werk „Inquiry into the nature and causes of the wealth of nations", mit dem Smith als erster das Gebiet der Nationalökonomie und ihren eigenen Inhalt dauernd bestimmte. Für die Entwicklung der Gewerbefreiheit in ganz Europa ist folgendes von grundlegender Bedeutung: Smith verkündet ein „heiliges und unverletzliches Recht des Individuums, seine Kraft und Geschicklichkeit so anzuwenden, wie er es passend findet, ohne dadurch seinen Nächsten zu schädigen". 37 Er stellt sich damit auf den gleichen Boden wie die Physiokraten in Frankreich. Hier hatte Francois Quesnay (geb. 4. 6. 1694) die Freiheit des Individuums proklamiert und diese Freiheit als „ordre naturel" zur Grundlage des gesamten Wirtschaftslebens gemacht. Beide wirtschaftsliberalistischen Systeme gliedern sich harmonisch in die rein vernunftgemäß aufgebaute, auf Rechtseinheit und Rechtsgleichheit gerichtete Staatsauffassung der naturrechtlichen Schule ein. „Die französischen Nationalökonomen, die sich Physiokraten nannten, gründeten die politische Ökonomie unmittelbar auf die Naturreligion. Damit sich die göttlichen Gesetze frei auswirken können, verlangten sie die Abschaffung aller Verfügungen, Einfuhrverbote und Zölle. Ihr System lief also auf eine völlige Freiheit des Handels und der Industrie hinaus." 3 8 Auch in den deutschen Gebieten setzt eine in sich geschlossene, nationalökonomisch-philosophische Literatur, die sich mit dem Problem der Gewerbefreiheit befaßt, erst mit dem Ende des 16. Jhd. ein, nachdem viele Jahre hindurch nur schwerfällige juristische Abhandlungen über das Zunftwesen verfaßt worden waren (vgl. ζ. B. die Schriften von Adrian Beier, Becher, Merperger). Auch i m Bereich dieser deutschen Fachliteratur beginnt der Streit für und gegen die Gewerbefreiheit und es wird wie in allen anderen Gebieten, die sich mit diesem Problem zu befassen haben, eine heftige Polemik geführt, die die gesamte Folgezeit anfüllt. Während Doktor Reimann (in seiner 1770 erschienenen Abhandlung „Das wahre Beste der löblichen Zünfte und Handwerke"), Hofrat Schlosser (in seiner Schrift „Über das neue französische System der Polizeifreiheit, insbesondere in der Auflösung der Zünfte"), /. S. Firnfaber (in seinem 1782 erschienenen Buch „Historisch-politische Betrachtung der Innungen und deren zweckmäßige Einrichtung") zwar die nun allerdings mittlerweile untragbar gewordenen Mißstände des Zunftwesens als reformbedürftig bezeichnen, sich aber ebenso heftig gegen die gänzliche Gewerbefreiheit wenden, redet u. a. vor allem Fr. Wm. Taube in seinem Buch „Geschichte der engelländischen Handelsschaft von den ältesten Zeiten bis auf das laufende Jahr 1776" entschieden der Gewerbefreiheit das Wort und stellt sich dabei auf den gleichen Boden, den Adam Smith eingenommen hatte. Eine bemerkenswert 37 Smith, a. a. O., S. 170. 38 Seignobos, a. a. O., S. 227, 230 f.
32
Edgar Michael Wenz
radikale Einstellung zeigt die Kriegs- und Domänenkammer zu Bromberg. Sie schreibt i m Bericht vom 22. 10. 1790: „ W i r halten die Zünfte überhaupt für ein Übel, welches aber nur durch ihre allgemeine Abschaffung gehoben werden kann .. . " 3 9 Die gleiche Einstellung zeigt Schlettwein, als er in dem „Ephemeriden" (Jahrgang 1778) eine Antwort auf die Rede des Kgl. Advokaten Séguier schreibt, der sich im französischen Parlament gegen die Gewerbefreiheit ausgesprochen hatte. Schlettwein ist es auch, der die Frage der Gewerbefreiheit und ihre Polemik so weit wie möglich zu verbreiten sucht. In diesem Sinne verfaßt er das 1772 in Karlsruhe erschienene Werk „Wichtigste Angelegenheiten für das ganze Publikum oder die natürliche Ordnung der Polit i k " 4 0 , worin er lebhaft seine eigene Theorie verteidigt. Unter dem Worte „Gewerbefreiheit" erhalten nunmehr alle die von den theoretischen Ergebnissen ausgehenden wirtschaftspolitischen Bestrebungen Richtung und Ziel. „Die freie Konkurrenz, das ungebundene Spiel der Kräfte war der Idealzustand, von dem man sich die Schaffung genügenden Lebensraumes für alle unter Ausgleich der Einzelinteressen versprach. Zur Erreichung dieses Zieles wurde als notwendige Voraussetzung die Beseitigung der Bindungen angesehen, die das herrschende Wirtschaftssystem dem Einzelnen auferlegte" 4 1 . Das aber war die noch immer ungebrochene Einrichtung der Zünfte.
§ 4: Die Entwicklung in Bayern von 1791 bis zum Ende der Aera Montgelas Gründlich beseitigt wurden die Zünfte durch die französische Revolution, die im Jahre 1791 für Frankreich das alte Zunftrecht schlagartig aufhob und dafür die nur durch polizeiliche Rücksichten bedingte Gewerbefreiheit setzte 42 . Dieser Vorgang ist auch für die Entwicklung in Deutschland von Bedeutung: Alle unter französischer Gewalt befindlichen deutschen Landesteile nahmen an der französischen Entwicklung teil. Für Bayern bedeutet dies, daß für die linksrheinischen Gebiete, die Pfalz, die Gewerbefreiheit nach französischem Muster eingeführt wird, welcher Zustand bis zur Durchsetzung der Gewerbefreiheit in ganz Bayern, d. i. bis zum 1. M a i 1868, andauert 43 . Aber auch auf die rechtsrheinischen
39
Zitiert bei v. Rohrscheidt „Zunft bis Gew. Frh.", S. 175. Vgl. HWBStW „Zunftwesen", sowie den anonymen Autor, S. 7. 4 1 Rudolph, a. a. O., S. 15. 42 In Frankreich war durch das Edikt vom Februar 1776 die Freiheit der Arbeit verkündet worden. Diese Verordnung aber wurde durch das „Edit du Roi portant nouvelle créations de Six Corps de Marchands et de 44 Communantés des Arts des Metiers - donné au mois d'Août 1776" wieder aufgehoben. 43 In der Pfalz wurde das französische Gesetz vom 2. - 17. März 1791 (Art. 7) zwar nicht publiziert, aber es wurden in später publizierten Gesetzen über Gewerbefreiheit, nämlich in 40
Die Entwicklung der Gewerbefreiheit in Bayern
33
Gebiete Bayerns wirken sich die Folgen der französischen Revolution, allerdings indirekt, aus. In der Person des Ministers Graf Montgelas findet sich eine starke Persönlichkeit, die aus der Fülle der staatsrechtlichen Neuerungen, wie sie die französische Revolution mit sich bringt, rücksichtslos auf die bayerischen Verhältnisse überträgt, was ihr für die Stärkung der Staatsgewalt einerseits und eine Modernisierung veralteter bayerischer staatlicher Verhältnisse andererseits dienlich erscheint und damit einem Jahrzehnt als der „Area Montgelas' 4 ihren Stempel aufdrückt 4 4 . Das Montgelas'sehe 45 Reformwerk und die historische Bedeutung des Grafen Montgelas selbst ist umstritten. Hier kann darauf nur insoweit eingegangen werden, als sein Wirken für die Entwicklung des Gewerbewesens in Bayern bedeutsam war. Sein Bemühen, die Staatsgewalt zu stärken, ist für die Entwicklung des Gewerbewesens von Bedeutung, weil dadurch zum ersten M a l gegen die bisherige starke Opposition der Stände angekämpft wird. Nur die Stärkung der Staatsgewalt ermöglicht das für die Gewerbepolitik Montgelas' typische Konzessionssystem. Sein Reformwerk läßt sich in zwei große Abschnitte gliedern 4 6 : Zunächst bekennt sich Montgelas in dem Streit um die Gewerbefreiheit zur gemäßigten Partei und vertritt daher die Beibehaltung der Zünfte, jedoch die „Brechung ihrer A l l macht" 4 7 . Kurz vor seinem Sturz setzt er sich in der Erkenntnis der Halbheit seines bisherigen Reform Werkes für eine unbegrenzte Gewerbefreiheit ein. Das tatsächlich durchgeführte Reformwerk läßt sich wiederum in zwei große Gruppen staatlicher Maßnahmen einteilen: 1. die Unzahl staatlicher Maßnahmen zur Abschaffung der aus dem geschlossenen Zunftwesen herrührenden akuten Mängel; 2. den Ausbau des Konzessionssystems.
dem vom 17. Juni 1791 (Art. 7 und 8), sowie in Art. 355 und 356 der Konstitution des Jahres III (1792), die Grundsätze des Gesetzes vom 2. - 17. 3. 1791 vorausgesetzt (Hank, a. a. O., S. 3, in Anm. 2 zur gl. Seite). 44 Vgl. G. Weber in „Allgemeine Weltgeschichte", Bd. 14, S. 283 (zitiert bei Popp, a. a. Ο., S. 65): „Ein hervorragendes Beispiel staatsreformierender Tätigkeit nach französischem Muster ... hatte Bayern unter der Verwaltung von Montgelas". 45 Maximilian Joseph, Graf Montgelas, seit 1799 Minister für auswärtige Angelegenheiten, 1803 der Finanzen, 1806 des Inneren, vereinigte er bis 2. Februar 1817 diese Staatsministerien in seiner Person. Vgl. Popp, a. a. O., S. 62 f. 47 Bereits 1799 sollten der Absicht des Kurfürsten Maximilian IV. Joseph entsprechend sämtliche Mauten und Akzisen in Bayern aufgehoben werden. Vor einer endgültigen Entscheidung aber wurden die Zünfte aller Städte und Märkte Bayerns zur Stellungnahme aufgefordert. Diese erklärten nach wie vor den Niedergang der Handwerke und Gewerbe durch die drückende Konkurrenz seitens der Landhandwerker und der Pfuscher (Vgl. Popp, a. a. O., S. 44). 3 Gedächtnisschrift Wenz
34
Edgar Michael Wenz
1. Diese Maßnahmen haben zur Folge: a) Die Aufhebung der Zwangs- und Bannrechte. Diese Maßnahme war der natürliche Ansatzpunkt für jede Gewerbereform, denn diese Rechte griffen in die persönliche Freiheit des Einzelnen so sehr ein, daß ihre Beibehaltung in einer Zeit, die den Grundsatz der Menschenrechte vertrat, nicht mehr möglich w a r 4 8 . M i t VO. vom 6. Februar 1802 4 9 fiel die Bannmeile der Städte. Damit durften sowohl die Landhandwerker in die Stadt als auch die Stadthandwerker auf das Land hinaus arbeiten. Die VO. vom 16. März 1804 über die „freie Gewerbeausübung der Handwerker" befreite die Landhandwerker von der Einengung auf ihren Gerichtsbezirk. Damit war „aller Zunftzwang der inländischen Gewerbe gegeneinander aufgehoben und es den inländischen Handwerksmeistern eines Gerichtsbezirkes unverwehrt, in den übrigen Gerichtsbezirken ohne Störung zu arbeiten". 5 0 A m weitherzigsten verfuhr man mit den Lumpensammlern. Durch Verordnung vom 25. Mai 1804 wurden die „gebannten Bezirke zur Sammlung von Lumpen für die Papiermühlen" aufgehoben und das Sammeln überall mit obrigkeitlicher Erlaubnis gestattet 51 . b) Beschneidung der Selbständigkeit und der Polizeigewalt der Zünfte. Die VO. vom 5. Dezember 1803 suchte (zunächst für den Bereich von München) gegen den Zunftnepotismus vorzugehen. Sie beschäftigte sich mit den Mißständen, die bei „der Abtretung eines bürgerlichen Gewerbes an einen anderen" eingerissen waren. Der Erwerb einer unpersönlichen Gewerbegerechtigkeit von einem anderen wurde von obrigkeitlicher Bewilligung abhängig gemacht, der neue Erwerber mußte einen Befähigungsbeweis erbringen. Verpfändung, Vererbung, Versteigerung und Verkauf eines Gewerbes wurden ausdrücklich verboten 5 2 . Für das übrige Gebiet versuchte der kurfürstliche Erlaß vom 1. Dezember 1809 den Grundsatz „Kunst erbt nicht" wieder durchzusetzen. Eine Handwerksbefugnis konnte damit nicht mehr den Rechtscharakter einer realen Gerechtigkeit oder des veräußerlichen Eigentums erlangen. Den Befähigungsnachweis hatte schon die VO. vom 26. Februar 1802 gefordert 53 . Danach wurde die den „eingekauften" Meistern zustehende Begünstigung, den Meistertitel ohne Anfertigung eines Meisterstücks zu erwerben, abgeschafft. Die Zunftgerichtsbarkeit, die im Laufe der Zeit eigenmächtig ihre Kompetenz immer weiter ausgedehnt hatte, wurde durch die VO. vom 14. März 1806 stark ein48 Abschaffung des Bierzwanges durch die Verordnung vom 20. Dezember 1799, des Brotzwanges durch die Verordnung vom 1. April 1801, des Tafernzwanges durch die Verordnung vom 22. Januar 1802, Verbot des Zunft- und Korporationszwanges für Wundärzte und Bader durch die Verordnung vom 16. März 1804 (aufgeführt bei Popp, a. a. O., S. 46 f.). 49 Churb. Reg. Bl. 1802, S. 94. so Churb. Reg. Bl. 1804, S. 298 f.
51 Churb. Reg. Bl. 1804, S. 582. 52 Churb. Reg. Bl. 1803, S. 1002 f. 53 Churb. Reg. Bl. 1802, S. 137.
Die Entwicklung der Gewerbefreiheit in Bayern
35
geschränkt. Danach durfte ohne Vorwissen und Genehmigung der Ortspolizeibehörde keine Handwerksstrafe mehr verhängt werden. Strafen, welche den Meistern oder Gesellen auf einige Zeit die Arbeit untersagten, waren überhaupt verboten. Ferner durften die eingegangenen Strafgelder von der Zunft nicht mehr zu einem Schmause oder dergleichen verwendet, sondern sie mußten wohltätigen Zwecken zugeführt werden 5 4 . Das Gesetz vom 31. Dezember 1806 regelte das Gebiet der Handwerks- und der Handelspolizei neu und vernichtete damit die alte Zunftgerichtsbarkeit völlig. Die Zünfte selbst wurden unter die Aufsicht der oberen Polizeibehörde gestellt. Neue Zunft- und Handwerksordnungen mußten von der oberen Verwaltungsbehörde bestätigt werden, die Entscheidung in Zunftstreitigkeiten behielt sich diese Behörde ebenfalls v o r 5 5 . c) Abschaffung von Handwerksmißbräuchen. Hier fielen vor allem die Begünstigungen für Meistersöhne (diese werden von nun an zur Lehrzeit verpflichtet und während dieser Ausbildungszeit den übrigen Lehrjungen gleichgestellt) sowie die Maßnahmen, die bisher die Nachwuchsförderung beschränkt hatten (ζ. B. Abschaffung der Muthjahre, Vermehrung der Lehrstellen bei den einzelnen Meistern) 5 6 : Auch das Wanderwesen der Gesellen wurde reformiert. Die VO. vom 16. März 1808 führte das bisher von den Zünften einseitig geleitete System der „handwerkskundschaften" in Form der von den Staatsbehörden auszustellenden Wanderbücher in die staatliche Zuständigkeit über 5 7 . 2. Die Jahre dieser „akuten Reformen" kennzeichnet Popp folgendermaßen: „Mannigfach waren die Eingriffe der Regierung in das gewerbliche Leben; heute griff man hier ein, morgen dort. Wenn man die damaligen Verordnungen i m Regierungsblatt durchsieht, so fällt einem sofort das Fehlen eines einheitlichen Planes zur Durchführung der Reformen auf. Wie es das Wirtschaftsleben jeweils erforderte, so griff man ein". Aber der Erfolg ist nicht der erhoffte. In einer Verordnung vom 5. Januar 1807 wird darüber lebhaft Klage geführt: „Ungern haben Wir wahrgenommen, daß Unsere Bemühungen nicht immer mit gleichem Erfolg belohnt, und von den Behörden öfters nicht gehörig unterstützt, oder wohl gar aus privaten Absichten ihrer Wirkungen beraubt wurden". 5 8 Der Auffassung Hanks 59, daß „die Macht der Zünfte von sich aus allmählich in Verfall geraten und an ihre Stelle ebenso geräuschlos die Macht der Regierungsbehörden getreten sei, ohne daß es gewaltsam legislativer Maßnahmen bedurfte", kann also nicht zugestimmt werden. Das Konzessionssystem setzt sich nicht von selbst durch, sondern muß von der Regierung gegen den erbitterten Widerstand aller davon betroffenen Kreise durchgesetzt werden. Sogar die unteren Behörden leisten Widerstand, indem sie nämlich 54 55 56 57 58 59 *
Popp, a. a. O., S. 60. Kgl. Reg. Bl. 1807, S. 202 ff. Popp, a. a. O., S. 61. Kgl. Reg. Bl. 1808, S. 630 g.; vgl. v. Rohrscheidt „Zunft bis Gew. Frh.", S. 12. a. a. O., S. 45, 50 f., Popp. A. a. O., S. 3.
36
Edgar Michael Wenz
persönliche Konzessionen auf andere überschreiben lassen. So muß am 2. November 1804 ausdrücklich angeordnet werden, daß nur die kurfürstliche Landesdirektion Konzessionen erteilen und bewilligen dürfe. Die Regierung muß also erst die Konzessionserteilung auf sich zentralisieren, um „ i n die heillosen Zustände bei der Erteilung oder eigenmächtigen Besitznahme der Gewerbebefugnis Ordnung zu bringen". 6 0 Das Kernstück des Montgelas'schen Konzessionssystems ist die Verordnung vom 2. Oktober 1811 über die Erteilung von Gewerbekonzessionen. Die Vollmacht für neue oder die Wiederbesetzung erloschener Gewerbetriebe hängt danach von der Genehmigung der Behörden ab. Bei jedem Gesuch zur Erteilung einer Konzession zu einem Gewerbe sollen die dasselbe bereits Betreibenden einvernommen werden und ohne Bedürfnis keine neue Konzession erteilt werden. Wohl werden durch diese unveräußerlichen staatlichen Konzessionen auf Lebenszeit dem Monopol der Zunftmeister ein Riegel vorgeschoben. Aber in dem an und für sich gesunden Bestreben, den letzten Einfluß dieser veralteten Organisation zu brechen, geht man gewerbepolitisch zu weit. „ M i t der Verleihung von Konzessionen ging man aber zu verschwenderisch um, so daß die Gewerbe großenteils übersetzt wurden. Einerseits entwickelte sich dafür für die Zunfthandwerker eine ungesunde Konkurrenz, während andrerseits auch den Konzessionären ein ausreichender Verdienst fehlte. Da ferner die Konzession immer nur für ein bestimmtes Gewerbe erteilt wurde, so war es den Beliehenen nicht möglich, ein anderes Gewerbe zu betreiben, wodurch sie sich vielleicht besser hätten ernähren können. Es war also auch das neue System mit Mängeln behaftet, indem es sowohl Nachteile der Gewerbebeschränkung als auch solche der Gewerbefreiheit aufwies". 6 1 Aber zu einer endgültigen Lösung des Problems sollte Montgelas nicht mehr kommen. Sein überraschender Sturz i m Jahre 1817 hinderte ihn, seine - von den in ganz Bayern herrschenden Grundsätzen der Freizügigkeit ausgehende - Sinnesänderung, die Gewerbe endgültig frei zu geben, in die Tat umzusetzen 62 . Denn nun ist auch für Bayern der gewerbepolitische Zeitpunkt gekommen, den v. Rohrscheidt 63 folgendermaßen festgelegt: „Was man auch immer gegen die Gewerbefreiheit sagen möchte, sie war nothwendig, sie war eine unabweisbare Forderung des Zeitgeistes".
*
60 61 62 63
Popp, a. a. 0.,S.51 ff. Vgl. Popp, a. a. O., S. 63. Vgl. Popp, a. a. O., S. 58. „Zunft bis Gew. Frh.", S. 328 f.
*
*
Die Entwicklung der Gewerbefreiheit in Bayern
37
C. Die Epoche des Protektionismus § 9. Die Zeit der Wieder er Stärkung der Innungen Die Reichsverfassung von 1871 gewährleistet die Freiheit des Handels und des Gewerbes, indem sie - ausgehend von dem Freizügigkeitsgrundsatz - in Art. 3 bestimmt, daß in sämtlichen zum Reichsgebiet gehörigen Territorien Gewerbe betrieben werden können. Sie nimmt also zwar den Grundsatz der Gewerbefreiheit nicht unmittelbar in den Verfassungswortlaut auf, postuliert ihn aber mittelbar, indem sie eben durch den Art. 3 auf den in den bereits vorangegangenen territorialen Gewerbeordnungen proklamierten Grundsatz der Gewerbefreiheit Bezug nimmt und ihn dadurch von landesrechtlicher zur reichsrechtlichen Norm erhebt. Damit ist der Grundsatz der Gewerbefreiheit auch verfassungsrechtlich auf Reichsebene anerkannt. Die RGO führt diesen neuen Rechtsgrundsatz durch: Es ist jedermann gestattet, ein Gewerbe zu betreiben, soweit die RGO nicht selbst Ausnahmen oder Beschränkungen vorschreibt oder zuläßt (§ 1 RGO). Die Unterscheidungen zwischen Stadt und Land in Bezug auf den Gewerbebetrieb und die Ausdehnung desselben hören auf (§ 2 RGO). Mehrfache Gewerbeausübung ist gestattet (§ 3). Den gewerblichen Korporationen steht kein Recht zu, andere vom Betrieb eines Gewerbes auszuschließen ( § 4 ) . Die bisherigen gewerblichen Privilegien dürfen für die Zukunft nicht mehr neu begründet werden (§§ 7 - 10). Damit findet die fast ein Jahrhundert lang gestellte, auf der Manchesterdoktrin beruhende Forderung, die freie gewerbliche Entfaltung des Einzelnen als ein Recht gesetzlich anzuerkennen, ihren Niederschlag. Aber auch bei dieser Regelung beweist sich der rechtshistorische Grundsatz, daß gesetzliche Regelungen meist hinter den tatsächlichen Vorgängen „herhinken". Die Kodifizierung der Lehren der Freihandelsschule erfolgt zu einer Zeit, da die tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnisse bereits zu einer neuen Lösung drängen. Die Theorien der Freihandelsschule genügten für eine Zeit der „primitiven" Industrialisierung. Der besonders nach 1871 mächtig anschwellende Industrialisierungsprozeß zeigt aber, daß die neuen wirtschaftlichen Gegebenheiten mit den Lehren der Freihandelsschule nicht mehr zu erfassen sind. Schon im Jahre 1872 werden auf dem Kongreß für Sozialpolitik - hauptsächlich durch Universitätslehrer für Nationalökonomie - eindringliche Hinweise auf den komplizierten Charakter der nunmehrigen wirtschaftlichen Erscheinungen gegeben, die mit den „klassischen" Grundsätzen der Freihandelsschule: „Moins gouverner" 1 0 2 , „laissez faire, laissez passer" 1 0 3 und „le monde va de l u i - m ê m e " 1 0 4 nicht mehr zu bewältigen sind. Immer mehr wird der Ruf nach einer gemeinnützigen Gestaltung des Wirtschaftslebens erhoben, besonders von 102
Geprägt von d'Argenson (1694- 1752). Gournay (Zeitgenosse von Quesnay). ι«4 Aufgeführt bei Hank, a. a. O., S. 30. 103
Edgar Michael Wenz
38
Lasalle und F. Α. Lange. Dieser Umschwung in der öffentlichen Meinung erleichtert das staatliche Bestreben, auf dem Wege der Gesetzgebung die absolute Gewerbefreiheit so einzuschränken, wie es der Gesetzgeber nach objektivem Abwägen der Interessen der Allgemeinheit und der Einzelperson für seine Pflicht hielt. Wie bereits in § 1 dieser Darstellung angedeutet, wird hierzu außerordentlich geschickt das letzte Relikt der mittelalterlichen Zunft - die Innung - zu neuem Leben erweckt und durch ihren systematischen gewerberechtlichen Ausbau ein Regulativ gegen die absolute Gewerbefreiheit geschaffen. Die Entwicklung dieser selbst ist damit für die Zukunft bedingt durch die Entwicklung der Innungen. I m übrigen aber zeichnet sich in diesen Jahren eine Wiederkehr des historischen Vorgangs ab, wie er besonders in Preußen und Bayern nach der Auflockerung des Gewerbezwanges (in Preußen nach 1810, in Bayern nach 1825) sich abspielte: Es erhebt sich ein allgemeines Klagen über den darniederliegenden Gewerbestand, wobei der Grund hierfür in dessen Freigabe gefunden wird. Vermag diese neuerliche Strömung auch nicht den Ausgangspunkt der Gewerbefreiheit, nämlich § 1 GO, zu ändern, so stellt sich die Folgezeit doch als ein neuerlicher heftiger Kampf gegen die Gewerbefreiheit, oder wie sie nunmehr in der gewerbepolitischen Polemik genannt wird, gegen die „Gewerbefrechheit" 1 0 5 d a r 1 0 6 . Für die folgende Entwicklung sind die neuen Innungen bedeutsam 1 0 7 . Sie sind freie gewerbliche Einrichtungen, keine Zwangsverbände und werden auf freiwilliger Grundlage gebildet. Dieser Zusammenschluß muß durch die höhere Verwal-
•05 Aufgeführt bei Hank, a. a. O., S. 30. Die Sonderregelung für das „Gewerbe im Umherziehen" kann nicht als eine Einschränkung der Gewerbefreiheit betrachtet werden. Es ist zwar an die Erteilung eines Legitimationsscheines gebunden und erinnert insofern noch an die Zeit des Konzessionssystems. Dabei ist aber zu beachten, daß auch für zahlreiche der sogen, stehenden Gewerbe staatliche Erlaubnis erteilt werden muß. Die Einschränkung bei den Gewerben im Umherziehen erklärt sich aus dem gleichen Sicherungsbedürfnis. Die in § 55 RGO getroffene Regelung entspricht der Ansicht der Kommission des Reichstags, die den entsprechenden Entwurf zu beraten hatte: „Die Kommission hat nicht diejenige Anschauung gehabt, die den Kreis der Leute, um die es sich hier handelt, gewissermaßen als einen Kreis von Parias ansieht, einen Teil der bürgerlichen Gesellschaft, der weniger ehrlich, weniger nützlich sein Gewerbe betreibt, als diejenigen, die das stehende Gewerbe kultivieren. Die allgemeinen Gesichtspunkte, von denen die Kommission sich leiten ließ, waren die, daß sie es für notwendig hielt, zu konstatieren, daß auch nicht der mindeste Grund vorliegt, die Konkurrenz des umherziehenden Gewerbebetriebs gegenüber dem stehenden Gewerbebetriebe auszuschließen oder wesentlich zu erschweren. Der zweite Gesichtspunkt war der, daß sie nur diejenigen Schranken billigte und aufrecht erhalten mußte, welche die öffentliche Ordnung und Sicherheit gebieten. Gegen den Entwurf vertrat die Kommission daher folgende prinzipielle Unterschiede: das Hausiergewerbe ist keinen anderen Beschränkungen unterworfen, als der stehende Gewerbebetrieb, soweit dies nicht in Form besonderer Ausnahmen festgestellt ist" (Zitiert bei Beyendorff, a. a. O., S. 13). 106
107
Die Regelung der RGO über die bestehenden Innungen war ohne Einfluß auf die bayerischen Verhältnisse, da hier ja durch die Gewerbeordnung von 1868 alle derartigen Verbände aufgehoben wurden. An der Entwicklung der neuen Innungen im Sinne der RGO nimmt Bayern in gleicher Weise wie die anderen deutschen Länder teil.
Die Entwicklung der Gewerbefreiheit in Bayern
39
tungsbehörde bestätigt werden 1 0 8 . Hierauf werden die Innungen zur juristischen Person. Sie bezwecken die Förderung der gemeinsamen gewerblichen Interessen derjenigen Gewerbetreibenden, die gleiche oder verwandte Gewerbe betreiben (§§ 97, 98 RGO). Rechtlich gesehen handelt es sich bei den neuen Innungen um Korporationen des privaten Rechts. Die rechtliche Ausgestaltung dieser neuen Innungen zeigt die zur Zeit ihrer Gründung noch herrschende Anschauung, „daß es nicht Aufgabe des Staates sei, die Innungsbildung positiv zu fördern, daß es vielmehr den Beteiligten zu überlassen sei, ob sie es ihren Interessen förderlich finden würden, zu Innungen zusammenzutreten". 109 Die Neubelebung des Innungswesens beginnt mit der staatlichen Regelung und Förderung des Lehrlingswesens durch das Gesetz vom 17. Juli 1878. Man gelangt nämlich sehr bald zu der Erkenntnis, daß das Lehrlingswesen schlechterdings nicht durchgreifend zu reformieren sei, wenn hierzu nicht außer den Polizeiorganen gewerbliche Institutionen vorhanden seien, die eine Stütze für die staatlichen Bemühungen geben könnten 1 1 0 . Die preußische Regierung versendet in diesem Zusammenhang ein Zirkular an die Bundesregierungen, um ein gemeinsames Vorgehen mit dem Zwecke einer Revision des derzeitigen Innungsstatus zu erreichen. Die bayerische Regierung zeigt sich zurückhaltend; der bayerische Innenminister lehnt es ab, an der Gründung neuer Innungen unmittelbar mitzuwirken, unterstützt jedoch Handels- und Gewerbekammern bei der Gründung gewerblicher Korporationen. Bayern vertritt die Ansicht, der Ausbau des Innungswesens könne nicht durch zusätzlichen gesetzgeberischen Akt erfolgen, sondern müsse durch einen harmonischen Ausbau auf dem Boden des bestehenden Rechts versucht werden 1 1 1 . Im großen und ganzen deckt sich diese Anschauung mit der in Preußen herrschenden Meinung. Hier ist man der Ansicht, daß der bisherige Rückgang des Innungswesens nicht auf die mangelhafte Gesetzgebung zurückgeführt werden könne, sondern daß diese Erscheinung auf ein mangelndes Interesse der Handwerkerkreise selbst hindeute, dergestalt nämlich, daß die in den neuen Innungen liegende Möglichkeit, durch rege Teilnahme sämtlicher Genossen die gemeinsamen Interessen des ganzen Gewerbes zu fördern, ungenützt geblieben s e i 1 1 2 . Diese fürsorgliche Haltung der Regierung erzielt jedoch vorläufig keinen greifbaren Erfolg. Das Verlangen nach Abänderung der gesetzlichen Bestimmungen über die Innungen wird nur noch größer. Die diesbezüglichen parlamentarischen 108
In Bayern die Kreisregierung. Vgl. Hank, a. a. O., S. 35 f., Beyendorf, a. a. O., S. 17 ff. Dieser begründet den privaten Charakter der neuen Innungen mit dem gesetzgeberischen Willen, die Gewerbefreiheit von zünftischem Einfluß frei zu halten, da es gerade die ratio legis der §§ 7 - 10 RGO ist, das Korporationswesen jedes öffentlich-rechtlichen Charakters zu entkleiden. HO Vgl. Hank, a. a. O., S. 37. m Vgl. Min. Entschl. vom 6. 2. 1879, MA Bl. 1879, S. 88 ff. 112 Vgl. Hank, a. a. O., S. 38. 109
40
Edgar Michael Wenz
Anträge kreisen sämtlich um den Grundgedanken, die Innungen - so weit es ohne Anwendung eines direkten oder indirekten Zwanges geschehen könne - wieder zu Organen der gewerblichen Selbstverwaltung für das Handwerk auszugestalten. Die Folge dieser Bewegung ist die Gewerbeordnungsnovelle vom 18. Juli 1881, die sogen. „Innungsnovelle", durch welche der bisher sehr labile Status der neuen Innungen der RGO gestrafft wird. Die Aufgaben der Innungen gliedern sich nunmehr in obligatorische und fakultative. Zu den ersteren - zu deren Erfüllung die Innungen gesetzlich verpflichtet sind - gehören Pflege des Gemeinschaftsgeistes und Schutz der Standesehre, Förderung der Beziehungen zwischen Meistern und Gesellen, des Handwerkswesens, der Gesellenarbeitsvermittlung, der Lehrlingsausbildung und Entscheidung von Streitigkeiten zwischen Innungsmeistern und Lehrlingen. Die fakultativen Aufgaben sind berufsfördernder und caritativer N a t u r 1 1 3 . Die staatliche Aufsicht ist gegenüber dem früheren Zustand erheblich ausgedehnt. Die zuständigen Gemeindebehörden haben als Aufsichtsbehörde die Befolgung der gesetzlichen und statuarischen Vorschriften zu überwachen, i m Weigerungsfall durch Ordnungsstrafen zu erzwingen. Gerade diese Ausdehnung der staatlichen Aufsicht aber führt zu einer tiefgreifenden Änderung der Rechtsnatur der Innungen i m Sinne der „Innungsnovelle". Hank 114 führt hierzu treffend aus: „Aus dieser weitgreifenden, die neuen Innungen in ihrer ganzen Existenz erfassenden staatlichen Aufsicht ergibt sich nun aber direkt und ohne weiteres, daß die genannten Innungen kraft öffentlichen Rechtes dem Staate zur Erfüllung ihrer obligatorischen wie ihrer erwählten zulässigen fakultativen Aufgaben, somit also zur Erfüllung ihres Lebenszweckes verpflichtet sind. Allein mit diesen Feststellungen ist nach dem oben Entwickelten, von dem ausgegangen wurde, jeder Zweifel bezüglich der rechtlichen Natur der neueren Innungen behoben. Durch die Zuteilung so bedeutender Privilegien und Begünstigungen behufs Durchsetzung ihrer größtenteils dem öffentlichrechtlichen Gebiete angehörigen Innungsaufgaben einerseits und durch die Unterstellung unter eine entsprechende, dem früheren Zustande gegenüber ganz wesentlich verstärkte Aufsicht, sind die neuen Innungen über ihre ehedem rein privatrechtliche Stellung hinaus zu Organen der gewerblichen Selbstverwaltung erhoben worden und haben damit neben ihrer privatrechtlich-korporativen Eigenschaft zugleich auch öffentlich-rechtlichen Charakter erlangt". Die bisher bestehenden Innungen haben sich dem neuen Innungsstatus anzupassen, um nicht der Auflösung anheim zu fallen. A m längsten halten sich die bisherigen Innungen in Bayern. Hier werden noch im Jahre 1888 42 nicht reorganisierte Innungen gezählt 1 1 5 .
113 Z. B. die Einrichtung von Lehrlingsschulen, Einrichtungen für Meister- und Gesellenfortbildung, Prüfungswesen, Einrichtung genossenschaftlicher Einkaufs- usw. -betriebe, Einrichtung von Unterstützungs- und Hilfskassen und von Schiedsgerichten zur Entscheidung von Streitigkeiten. '14 A. a. O., S. 78 f. us A. a. O., S. 78 f.
Die Entwicklung der Gewerbefreiheit in Bayern
41
Aber diese praktisch unbedeutende Ausnahme kann den erneuten Zug zu einer Mäßigung der Gewerbefreiheit nicht hemmen. Obwohl die Novelle von 1881 die Zwangsinnung verneint 1 1 6 , bedeutet die nunmehrige Ausgestaltung der Innungen „doch nicht nur einen eklatanten Bruch der vordem so eifrig verteidigten Rechte der individuellen Persönlichkeit, sondern muß sie doch auch als die erste Phase einer Entwicklung moderner Gewerbepolitik angesehen werden, die, wenn anders die in ihren Motiven wirkende Tendenz aufrecht erhalten werden sollte, notwendigerweise zu einer Potenzierung der autoritativen Stellung der Innungen in der Richtung auf die Einführung des Rechtsinstituts der Zwangsinnung führen mußte".117 Diese von Beyendorf richtig erkannte Strömung erweist sich ferner durch das in der gleichen Novelle zu Tage tretende staatliche Bemühen, die Errichtung größerer Vereinigungen von Innungen in seinen Bereich zu ziehen, obwohl die Innungen selbst nichts hindert, von sich aus solche Vereinigungen zu gründen. Diesen Innungsverbänden werden mit Gesetz vom 23. April 1886 Korporationsrechte verliehen. Damit können sich nunmehr einerseits gewerbetreibende Innungsmitglieder auf mit staatlichen Privilegien ausgestattete gewerbliche Einrichtungen stützen und damit an Aufgaben herangehen, an deren Lösung die Einzelinnung würde scheitern müssen, andererseits kann der Staat i m Umweg über diese Innungsverbände verstärkten gewerbepolitischen Einfluß ausüben. M i t dem Jahre 1891 beginnt eine neue, sozialpolitische Aera, in der das zur Zeit der Schaffung der RGO herrschende Dogma, daß der Staat als solcher nicht berufen sei, sich in das freie Spiel der wirtschaftlichen Kräfte einzumischen, immer mehr erschüttert w i r d 1 1 8 . Das gewerbegesetzliche Kernstück dieser Richtung ist das Gesetz vom 26. Juli 1897, die sogen. „Handwerkernovelle 4 ', die das gesamte Handwerkswesen neu regelt 1 1 9 . 116 § 97 RGO n. F.: ... „können ... zusammentreten." 117 Beyendorf, a. a. O., S. 41. n8 Beyendorf nennt diese Aera die Zeit des „energischen Protektionismus" (a. a. O., S. 2, 56). Sozialpolitische Wirkung hat vor allem das Gesetz vom 1. Juni 1891, das sogen. Arbeiterschutzgesetz. Noch bedeutsamer als das Arbeiterschutzgesetz jedoch ist für die Entwicklung der Gewerbefreiheit die Forderung nach der Wiedereinführung eines Befähigungsnachweises. 1892 wird der Antrag gestellt, „der Reichstag wolle beschließen, den Herrn Reichskanzler zu ersuchen, dem Reichstag alsbald Gesetze vorzulegen, durch welche die Vorschriften über Befähigungsnachweise ... geändert werden". 1893 erfolgt der Antrag, „den Herrn Reichskanzler zu ersuchen, dem Reichstag alsbald Gesetz vorzulegen, durch welche die Erlaubnis zur selbständigen Betreibung eines Handwerks unter vollständiger Zusammenlegung venwandter Gewerbe von dem vorausgegangenen Nachweis der Befähigung abhängig gemacht wird" (Zitiert bei Beyendorf a. a. O. S. 65 f.). Zunächst verhält sich die Regierung ablehnend; 1908 wird der Befähigungsnachweis durch Gesetz verlangt. 119 Die absolute Freiheit des Gewerbetreibenden war schon vorher durch die GO-Novelle vom 8. 12. 1884 und die Novelle vom 6. 7. 1887 immer mehr eingeschränkt worden. Das erstere Gesetz besagt, daß von einem bestimmten Zeitpunkt ab bei Vorhandensein von Innungen am Platze nur Innungsmitglieder Lehrlinge einstellen dürfen. Gemäß der zweiten Vor-
42
Edgar Michael Wenz
Dies tritt schon äußerlich in der Neufassung der Überschrift des Titels V I zu Tage. Dieser gibt eine Übersicht über das innungsreformierende Denken: „Innungen, Innungsausschüsse, Handwerkskammern, Innungsverbände". Nunmehr erhält die RGO einen einheitlichen Innungsbegriff; der bisherige Unterschied zwischen „bestehenden" und „neuen" Innungen fällt fort. Dafür tritt die Unterscheidung in „freie Innungen" und „Zwangsinnungen". Die freien Innungen sollen dabei die vor der Handwerkernovelle gegründeten Innungen erhalten und die Möglichkeit geben, bei Bedürfnis nach solchen Innungen neue zu begründen. Für sie gilt in weitem Maße, was die RGO bisher für die reorganisierten Innungen an Innungsaufgaben, Rechtsfähigkeit, Mitgliedschaft usw. vorgesehen hatte. Die Zwangsinnung verfolgt den Zweck, die Organisation des Handwerks vom Boden der Freiwilligkeit loszulösen und sie auf die Grundlage der Zwangsinnung zu stellen 1 2 0 . In der richtigen Erkenntnis, daß trotz der neuerlichen Reaktion gegen die absolute Gewerbefreiheit ausschließlichem neuen Zwang ebensoviel Abneigung entgegengesetzt würde, wird zunächst auf die Einführung eines allgemeinen unbedingten Innungszwanges verzichtet. Deshalb hatte man auch die i m Jahre 1894 vom preußischen Handelsministerium vorgebrachten Vorschläge auf Errichtung von Fachgenossenschaften und Handwerkskammern unberücksichtigt gelassen, weil - wie v. Rohrscheidt 121 ausführt - „die Fachgenossenschaften vielfach nur als Vorboten für den allgemeinen Zunftzwang und Befähigungsnachweis angesehen worden waren". Die Handwerkernovelle sieht daher in § 100 Abs. 1, Ziff. I, als erste Voraussetzung für die Bildung von Zwangsinnungen die Zustimmung der Mehrzahl der Beteiligten zum Innungszwang v o r 1 2 2 . Für die Gründung einer Zwangsinnung muß also ein „gewerbliches Bedürfnis" vorhanden sein; dieses sieht man dann als gegeben an, wenn der Bezirk der Innungen so abgegrenzt ist, daß ein Mitglied durch die Entfernung seines Wohnortes vom Sitz der Innung nicht behindert wird, am Genossenschaftsleben teilzunehmen und die Innungseinrichtungen zu benützen (§ 100, Abs. 1, Ziff. II). Ferner muß die Zahl der im Bezirk vorhandenen beteiligten Handwerker zur Bildung einer leistungsfähigen Innung ausreichen (§ 100, Abs. 1, Ziff. III). A u f diesen drei Voraussetzungen baut die moderne Zwangs-(Fach-)innung bis 1933 auf. M i t der Einrichtung der Zwangsinnungen sowie dem mit der Novelle vom 30. Mai 1908 wieder durchgesetzten Befähigungsnachweis - eingebaut als Abs. I I I des schrift konnten auch Nichtmitglieder von Innungen durch Weisung der Kreisregierung verpflichtet werden, zu den Innungsaufwendungen beizutragen, soweit es sich um Ausgaben für das Herbergswesen, Gesellenarbeitsvermittlung, Gesellen- und Meisterförderung und die Innungsschiedsgerichtsbarkeit handelte. 120 Vgl .Hank, a. a. O., S. 184. 121 „Zunft bis Gew. Frh.", S. 646. 122 Besonders in Süddeutschland war der Widerstand gegen die Zwangsinnungen groß; auch sprachen die in Österreich mit den dort im Jahre 1883 errichteten Zwangsgenossenschaften gemachten schlechten Erfahrungen gegen eine übereilte Einführung von Zwangsinnungen.
Die Entwicklung der Gewerbefreiheit in Bayern
43
§ 131 GO - zeichnet sich die weitere gewerbepolitische Entwicklung bereits deutlich ab. Zwar ist damit keinesfalls der ehemalige zünftische Status wiederhergestellt, denn die Zwangsinnung kann mit der ehemaligen Zunft nicht gleichgesetzt werden. Dies legt in treffender Weise Voigt 123 dar, der den Unterschied zwischen diesen beiden Institutionen folgendermaßen darlegt: „Die Aufnahme in die Zunft war die Vorbedingung zum Gewerbebetrieb, sie konnte gänzlich verweigert oder äußerst erschwert werden; während jetzt der Gewerbebetrieb die Vorbedingung für die Mitgliedschaft bei der Zwangsinnung ist. Die alte Zunft hatte eine weitgehende Autonomie in allen gewerblichen Angelegenheiten, die moderne ist auf wenige Funktionen beschränkt und nur ein Glied in der gesamten staatlichen Verwaltung des Gewerbewesens 4'. Vor allem besteht aber § 4 RGO unangetastet weiter und nimmt den Zwangsinnungen auch weiterhin das für die Zunft charakteristische Ausschließungsrecht. Jedenfalls aber zeichnet sich sowohl durch die Schaffung der Zwangsinnung als auch durch die Wiedereinführung des Befähigungsnachweises immer stärker die Idee der „ergänzenden Gemeinschaft" 1 2 4 ab, die in Überwindung der Manchesterdoktrin die absolute Gewerbefreiheit i m Interesse des Allgemeinwohls einschränkt.
§ 10: Die sozialverpflichtete
Gewerbefreiheit
als Grundrecht der RV1919
Während des ersten Weltkrieges selbst und während der ersten Nachkriegsjahre ergehen zahlreiche Gesetze, die für den Inhalt der RGO bedeutungsvoll werden 1 2 5 . Die rein kriegsbedingten Einschränkungen der Gewerbefreiheit werden nach Kriegsschluß verhältnismäßig rasch wieder aufgehoben 1 2 6 . Die Revolution von 1918 aber gibt vor allem dem sozialen Duktus in der Gewerbegesetzgebung noch stärkere Impulse als in der vorangegangenen Zeit. Damit ergibt sich für die weitere gesetzgeberische Entwicklung im Bereiche des Gewerbewesens eine gewisse Zweispurigkeit: Neben der unmittelbar die RGO betreffenden Gesetzgebung läuft eine weitere soziale Gesetzgebung, die hauptsächlich den Schutz der Arbeitnehmenden bezweckt. V. Landmann 127 bezeichnet diese Gesetze als „Nebengesetze" zur RGO. Diese Ansicht trifft aber nur zum Teil zu. Aus Gründen der Gesetzgebungsökonomie werden nicht mehr Novellen zur RGO, sondern 123 Zitiert bei Hank, a. a. O., S. 221. 124 Vgl. Hank, a. a. O., S. 224. 125 Vgl. Stier-Somlo, a. a. O., S. XXIV. 126 Ζ. B. folgendes Gesetz vom 4. 8. 1914: Ermächtigung des Bundesrates zu wirtschaftlichen Maßnahmen, Höchstpreisgesetz, Gesetz über die Aufhebung des Arbeiterschutzes. Die Nachkriegszeit brachte zur Beseitigung akuter Notstände in den verschiedensten Gewerben zahlreiche Gesetze, hauptsächlich die Frage der Genehmigung betreffend, die auf bestimmte Gewerbe, den turbulenten Nachkriegsjahren entsprechend, ausgedehnt wurden (Vgl. Meßbauer, a. a. O., S. 13 f.). 127 A. a. O., S. 28 f.
44
Edgar Michael Wenz
Spezialgesetze erlassen, die anfänglich als „Nebengesetze" aufgefaßt werden könnten. Indessen wachsen sie überraschend schnell zu einem Gesetzeskomplex heran, der für sich ein Eigenleben führt, wenn sich auch diese oder jene seiner Vorschriften mit Normen der RGO überschneidet. Diese neue gesetzgeberische Aera bedeutet indessen nicht den Anbruch einer neuen Epoche, denn keines der neuen Gesetze durchbricht das Grundprinzip der Gewerbefreiheit. Die § § 1 - 4 RGO gelten weiterhin unverändert. Indessen verfolgt die nunmehrige Nebengesetzgebung bewußt den Zweck, noch stärker als bisher die Interessen des Gemeinwohles über die individuellen Interessen des jeweiligen Gewerbetreibenden zu stellen. Diese Entwicklung - die dann allerdings nach 1933 in ein gänzlich anderes Geleise getrieben wurde - hätte zwangsläufig sich i m Sinne der am 7. Mai 1926 vom Reichstag angenommenen Zulassung entwickeln müssen: „Eine Revision der GO hält der Reichstag für notwendig. Diese Revision wird sich ergeben nach Abschluß des Handwerkergesetzes, Berufsausbildungsgesetzes und nach Verabschiedung des Gesetzes, das die Frage des Arbeiterschutzes in einem besonderen Gesetze regelt. Vor Erledigung dieser Gesetze hält der Reichstag die Revision der GO nicht für gegeben". Im Rahmen dieser angekündigten staatlichen Absicht - nämlich eine verstärkte Aufsicht der staatlichen Behörden auf die Gewerbe auszuüben - wird die Verordnung vom 25. April 1929 über die Errichtung der Handwerksrolle geschaffen. Diese Entwicklung zeigt, daß die Aufnahme des Grundsatzes von der Gewerbefreiheit in die Grundrechte der RV 1919 (Art. 111 und 151) nicht mehr als Garantie einer absoluten Gewerbefreiheit i m Sinne des 19. Jhd. gedacht ist, sondern daß zwar das Prinzip der Gewerbefreiheit anerkannt wird, sich jedoch der Umfang der praktischen Gewerbeausübung nach den bestehenden - ihn ganz wesentlich einschränkenden - Reichsgesetzen richtet 1 2 8 . Trotz dieser Einschränkungen besteht aber bis 1933 noch eine „echte" Gewerbefreiheit in dem Sinne, daß eben jene Einschränkungen als eine dem liberalen Grundzug der Wirtschaftsverfassung widersprechende soziale Notwendigkeit aufgefaßt wird und nicht etwa, daß der Grundsatz der Gewerbefreiheit dem Verfassungsleben widerspricht.
*
*
*
128 Vgl. in diesem Zusammenhang Stier-Somlo, a. a. O., S. XXVII: „ . . . in welchem hohen Maße der Grundsatz völliger Gewerbefreiheit im Laufe der Zeit zurücktreten mußte hinter die Anforderungen, die im Interesse des Gemeinwohles, im Interesse namentlich der arbeitenden Klassen gebieterisch Erfüllung verlangten. Ohne Zweifel ist diese Entwicklung zur Zeit noch nicht abgeschlossen, vielmehr werden den Gewerben auch künftig noch manche Fesseln angelegt werden müssen".
Die Entwicklung der Gewerbefreiheit in Bayern
45
E. Die Entwicklung seit 1945 § 12: Die Herrschaft
des Lizenzierungsgesetzes
Die ersten Jahre dieser Entwicklung sind gekennzeichnet durch das Wiederaufleben der deutschen Länder und durch die Übernahme der gesetzgeberischen Gewalt durch die Alliierten. Die erstere Tatsache erlaubt, wieder von einer Entwicklung der Gewerbefreiheit in Bayern als einem der drei Länder der ehemaligen USZone zu sprechen. Diese Tatsache ist wichtig: Nach dem zwar einheitlich gefaßten - jedoch der nationalen Mentalität der jeweiligen Besatzungsmacht verschiedenartig durchgesetzten - „Umerziehungsgrundsatz" entwickelt sich auch das Gewerbewesen auf deutschem Boden bis Dezember 1948 nicht einheitlich 1 4 5 . Für Bayern ergibt sich folgendes: Entwicklungsgeschichtlich kann der genannte Zeitraum in drei große Abschnitte eingeteilt werden: 1. die Zeit der Fortsetzung der bisherigen Zwangswirtschaft und der Kontrolle der ehemaligen Militärregierungen bis zum Lizenzierungsgesetz vom 23. 9. 1946, 2. die Zeit des Lizenzierungssystems bis zum 20. 12. 1948, 3. die Zeit der derzeitigen Gewerbefreiheit (Lizenzierungsverbot). 1. Die Besetzung des deutschen Gebietes nach dem militärischen Zusammenbruch führt zur Aufhebung der gesamten NS-Gesetzgebung. Das bedeutet, daß auch für den Bereich der Gewerbegesetzgebung die bisherigen Einschränkungen hätten gegenstandslos werden müssen. Aus ernährungstechnischen und wirtschaftspolitischen Gründen muß jedoch hier die bisherige Versorgungsart beibehalten werden, so daß im Bereich des Gewerbewesens sich zunächst die bisherige Praxis stärker als das neue Dogma erweisen mußte. Für diesen Zustand findet Reuß ]46 die Worte: „Der Staat war nach 1945 in der tragischen Lage, daß er seinem eigenen Wunsche zuwider das verhaßte Wirtschaftssystem der Nazi-Zeit zunächst noch fortführen mußte, da er als Konkursverwalter eines betrügerischen Bankerotteurs die Konkursmasse, so wie sie eben war, übernehmen mußte. So mußte der Staat, der den Zwang beseitigen und die Freiheit wieder herstellen wollte, um dieses Ziel zu erreichen, Zwang anwenden, um die Voraussetzungen für die Freiheit zu schaffen." 2. Das Gesetz über die Errichtung gewerblicher Unternehmungen vom 23. September 1946, kurz Lizenzierungsgesetz genannt, baut auf den Direktiven der USMilitärregierung vom 25. März 1946 auf, womit die Wirtschaftsminister der drei Länder der US-Zone die Weisung erhielten, einheitliche Richtlinien für die Zulassung verschiedener gewerblicher Unternehmungen, darunter auch der Einzelhandelsunternehmen mit Ausnahme von Lebensmittelbetrieben, auszuarbeiten.
145 Vgl. hierzu Reuß, a. a. O., S. 44. 146 A. a. O., S. 15.
46
Edgar Michael Wenz
Für die befohlene Neuordnung scheinen den beauftragten deutschen Stellen folgende Gesichtspunkte maßgeblich: Die neue Rechtsvorschrift soll aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht in die RGO eingearbeitet werden; lediglich die Lücken des Gewerberechts, die sich aus den veränderten Wirtschaftsverhältnissen von selbst ergeben hatten, zu schließen, erschien unzureichend; eine Anknüpfung an das bisherige Bewirtschaftungssystem, jedoch unter dem Ausblick auf die endgültige Befreiung der Gewerbe, also als eine ausgesprochene Übergangsvorschrift für sich selbst bestehend, erscheint als das Zweckmäßigste 1 4 7 . Das Lizenzierungsgesetz baut auf folgenden grundsätzlichen Bestimmungen auf: Art. 1, Abs. 1: Wer ein gewerbliches Unternehmen errichten will, das sich mit der Erzeugung, Bearbeitung, Verarbeitung, Verwertung, Verteilung, Beförderung oder Vermittlung von Waren oder mit der Ausführung oder Vermittlung gewerblicher Leistungen befaßt, bedarf hierzu einer besonderen Erlaubnis. Art. 2: Die Erlaubnis ist in der Regel zu versagen: 1. Wenn ein volkswirtschaftliches Bedürfnis für die Errichtung des Unternehmens nicht vorliegt, 2. wenn die für die Aufrechterhaltung des Betriebes erforderliche regelmäßige Belieferung des Unternehmens mit Rohstoffen oder Waren nicht gesichert ist, 3. wenn der Antragsteller oder die für die Leitung des Unternehmens bestimmten Personen nicht die für den Betrieb erforderliche sachliche oder persönliche Eignung besitzen, 4. wenn die für den Betrieb erforderlichen Mittel nicht nachgewiesen werden können. Damit ist ein Zustand geschaffen, wie er für alle Lizenzierungssysteme charakteristisch ist. Der Staat birgt - bildlich gesprochen - sämtliche Gewerbebefugnisse in sich und vergibt sie nach den von ihm für gut befundenen Richtlinien. Auch die Richtlinien für die Durchführung der Konzessionserteilung sind die jedes Lizenzierungssystems: Bedürfnisprüfung, Eignungs- und Zuverlässigkeitsprüfung, in Zeiten der Materialknappheit Prüfung des Existenzminimums. Damit ist Gründung und Entwicklung einer wirtschaftlichen Existenz wiederum der Einsicht und vor allem der Zuverlässigkeit der Behörden anvertraut - ein Zustand, der in Zeiten durchlöcherter Ethik nicht ideal genannt werden kann. M i t dem Inkrafttreten des Lizenzierungsgesetzes ist also ein Zustand geschaffen, bei dem Giese l4S die Frage aufwirft, „ob nach allem man noch von Gewerbefreiheit sprechen könne?' 4 und sie folgendermaßen beantwortet: „ M . E. noch weniger als i m 3. Reich. Das heutige Prinzip ist die Wirtschaftslenkung und somit Planung 147 Vgl. Adam-Springe, a. a. O., S. 3 f.; Reuss, a. a. O., S. 15 f. 148 Vgl. a. a. O., S. 280.
Die Entwicklung der Gewerbefreiheit in Bayern
47
und Lenkung des Gewerbewesens' 4. Diese Ansicht Gieses wird noch gestützt durch die Einstellung, die in den einzelnen Länderverfassungen der Gewerbefreiheit entgegengebracht wird. M i t Recht weist Giese darauf hin, daß von den neuen Länderverfassungen nur die Verfassung von Rheinland-Pfalz in Art. 52 die Gewerbefreiheit als ein Grundrecht proklamiert, während nahezu sämtliche anderen Verfassungen die Gewerbefreiheit erst als ein sekundäres Recht hinter der primär betonten Gemeinschaftsgebundenheit jeder wirtschaftlichen Betätigung vermerken 1 4 9 . Zwar ist das Lizenzierungsgesetz durchaus als eine Übergangsvorschrift gedacht und soll daher keinen endgültigen Zustand festlegen. Während man aber bei der Schaffung des Konzessionssystems von 1825 ausdrücklich auf die kommende Gewerbefreiheit hinwies, fehlt dem Lizenzierungsgesetz von 1946 eine solche Zielsetzung für die Zukunft. Es ist daher die Möglichkeit weiterer Einschränkungen gegeben, und die Verfechter der Gewerbefreiheit können vorläufig nur hoffen, daß das Lizenzierungssystem - als der neu proklamierten Doktrin völlig widersprechend - aus doktrinären Gründen sich nicht allzu lange halten werden.
§ 13: Die Direktiven der US-Militärregierung Die weitere Entwicklung nimmt - gemessen an den bisherigen Ereignissen - einen in jeder Beziehung überraschenden Verlauf. Dieser ist durch die in den Jahren 1947/48 einsetzenden politischen Vorgänge bedingt. Zu dieser Zeit löst sich das bisherigen Quartett der Siegermächte auf, und es beginnt eine deutlich wahrnehmbare und sich zuspitzende Trennung in einen Ost- und Westblock 1 5 0 , zu dem in stets steigendem Maße die westdeutschen Länder gerechnet werden. Im Gegensatz zu dem bisher für die Wirtschaftsfragen maßgebenden „Morgenthauplan" wird nun Westdeutschland als ein Bestandteil des europäischen Wirtschaftspotentials angesehen. Dementsprechend ändert sich auch die Einstellung der Besatzungsmächte in Wirtschaftsfragen. Allen Besatzungsmächten gleichartig ist die Überzeugung, daß Westdeutschland so schnell wie möglich eine bedeutende wirtschaftliche Leistungsquote zu erreichen hat. Die Bemühungen hierzu beginnen in der gleichen Zeit, da die Siegermächte aus dem Konglomerat der in Besatzungszonen erfaßten deutschen Länder wieder ein gesamtstaatliches Gebilde erstehen zu sehen wünschen. Charakteristisch für die nun beginnende Zeit - die man die „Aera der Direktiven" zu nennen versucht ist - ist die ungeheuere Eile, in der nun eine 149 Am weitesten geht die Verfassung des Landes Hessen in Art. 38: „Die Wirtschaft des Landes hat dem Wohl des ganzen Volkes und der Befriedigung seines Bedürfnisses zu dienen ...". Der Art. 153 der bayerischen Verfassung vom 2. Dezember 1946 garantiert der Wirtschaft Schutz und Förderung durch den Staat. Auf die Gewerbefreiheit geht Art. 153 selbst nicht ein; denn der Begriff der „wirtschaftlichen Freiheit" erscheint in Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Unabhängigkeit und ist hier wohl nur als eine Schutzvorschrift gegen Kartellisierungsabsichten gedacht. Im übrigen kann der Art. 153 nur als programmatischer Grundsatz ohne rechtliche Aktualität gewertet werden. 150 Vgl. Maunz, Deutsches Staatsrecht, S. 4.
Edgar Michael Wenz
48
völlige Neuordnung der Wirtschaft herbeigeführt werden soll. Denn eine Neuordnung ist angesichts der neuen politischen Lage notwendig. Sie kann sich aber nur in Form einer weitgehenden Befreiung der westdeutschen Wirtschaft auswirken. Es wäre in diesem Zusammenhang irrig, zu denken, daß die Siegermächte mit der nun einsetzenden Wirtschaftsbefreiung eine Emanzipation des wirtschaftenden Individuums als Selbstzweck beabsichtigen würden. Mindestens gleichbedeutend dürfte wohl zugleich der dringende Wunsch sein, für den Gesamtorganismus des Westens ein leistungsfähiges Wirtschaftsglied mittelbar über den Einzelnen zu schaffen. Besonders die Maßnahmen der US-Militärbehörden reden eine beredte Sprache von der Hast, mit der nunmehr die Dinge vorangetrieben werden und der Hartnäkkigkeit, mit der diese Behörden das ihnen Gutdünkende gegen alle Vorstellungen durchsetzen. So wird der Wirtschaftsrat beauftragt, eine der neuen Richtung entsprechende Regelung herbeizuführen, jedoch werden die von den deutschen Stellen gemachten Vorschläge zur Herbeiführung einer dem nunmehrigen Wirtschaftsstatus angemessenen Gewerbeordnung unberücksichtigt gelassen - der vom Wirtschaftsrat gefaßte Beschluß über ein Gewerbezulassungsgesetz wird abgelehnt. Abgelehnt wird ferner der mit Beschluß des Wirtschaftsrates vom 30. 9. 1948 der Militärregierung vorgelegte Vorschlag, das Gewerbewesen auf einheitlicher Basis zu regeln. Die US-Militärregierung wünscht Ländergesetzgebung - obwohl sie sich den Nachteilen einer solchen Regelung nicht verschließt, ist sie der Ansicht, dadurch den Ländern einen Ansporn zur Schaffung besonders liberaler Gesetze zu geben. Schon zu diesem Zeitpunkt bringt die US-Militärregierung in unmißverständlicher Weise zum Ausdruck, welche Grundsätze sie bei einer endgültigen Regelung berücksichtigt wissen w i l l ; so führt sie dazu bereits aus, daß in Fragen der Gewerbezulassung keinerlei Mitwirkung berufsständischer Organisationen in Frage kommen dürfe. M i t Ende des Jahres 1948 läuft jedoch die Frist der Lizenzierungsgesetze ab. Die Länder sehen sich daher gezwungen, schon vorher eine neue Gesetzgebung vorzubereiten. I m großen und ganzen sollen dabei die bisherigen Grundzüge der bisherigen Gewerbegesetzgebung beibehalten werden, zum Teil sind - auf Wunsch des Länderrates - noch Verschärfungen vorgesehen; vor allem soll aber auf jeden Fall der „große Befähigungsnachweis" beibehalten werden 1 5 1 . Eine solche Entwicklung widerstrebte jedoch durchaus den Absichten der USBehörden. Dies zeigt sich eindeutig in dem Schreiben an den bayerischen Ministerpräsidenten vom 18. 12. 1 9 4 8 1 5 2 : „Es ist der feste Grundsatz der Militärregierung, daß die Lizenzierung der Tätigkeiten von Einzelpersonen, offenen Handelsgesellschaften, Kapitalgesellschaften, Verbänden oder sonstigen juristischen Personen auf sämtlichen Gebieten undemokratisch ist und grundsätzlich nicht gebilligt werden kann, außer wenn solche Tätigkeiten in eine der nachstehenden Gruppen fallen 151
Vgl. „Wirtschaftsverwaltung Frankfurt", Heft 14 vom Dezember 1948. '52 Veröffentlicht im Bayer. Staatsanzeiger, Nr. 4/4. Jhrgg. vom 28. 1. 1949, S. 2, Spalte 4.
Die Entwicklung der Gewerbefreiheit in Bayern
49
. . . (Hier folgt nun eine genaue, in 6 Gruppen geordnete Aufzählung der lizenzierungspflichtigen Gewerbearten). Demgemäß ist die Lizenzierung auf allen Gebieten zu unterlassen, auf denen keine inneren und notwendigen Beziehungen zu den sechs oben genannten Gruppen bestehen". Die erwähnten sechs Gruppen, die also, wenn eine Zugehörigkeit zu diesen besteht, die Ausübung einer Tätigkeit zulassungspflichtig macht, sind solche, bei denen die Zulassungspflichtigkeit i m Interesse der öffentlichen Sicherheit, des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Wohlfahrt notwendig erscheint; dazu kommt dann noch Lizenzierungszwang aus rein steuerrechtlichen Gründen, der allerdings nicht dem Vollzug durch die Zulassungsbehörden unterliegt, weiter noch ein Katalog über die Tätigkeiten, die „ein öffentliches Interesse" berühren, worunter - nach unserer Auffassung - Betriebe zu verstehen sind, die dem allgemeinen privatwirtschaftlichen Verkehr entzogen sind; drüber hinaus werden noch einzelne freie Berufe erwähnt, für deren Ausübung der Nachweis der erforderlichen Ausbildung und Sachkunde und einer von einer staatlichen Behörde veranstalteten und unter ihrer Aufsicht erfolgten öffentlichen Prüfung erbracht werden muß. Es liegt hier unserer Auffassung nach aber eine Überschneidung mit den i m öffentlichen Interesse der Sicherheit, Gesundheit und Wohlfahrt zulassungspflichtigen Gruppen vor. Alles in allem ist natürlich diese ihrem Umfange nach sehr knappe, ja geradezu dürftige US-Militärregierungs-Direktive nicht dazu angetan, Klarheit zu schaffen. Es schließt sich daher zwischen der US-Militärregierung und den deutschen Behörden ein umfangreicher Schriftverkehr 1 5 3 an, der Klarheit in die verworrenen Verhältnisse bringen sollte. Das ist, wenn auch nur zum Teil, auch gelungen; es würde hier zu weit führen, die einzelnen Berufsarten und Gewerbezweige dahingehend zu untersuchen, ob sie zu den zulassungspflichtigen Gruppen gehören oder nicht. Die in dem Schreiben vom 18. 12. 1948 aufgeführten Richtlinien werden von den US-Behörden auch tatsächlich zur Grundlage der Neuordnung des Gewerbewesens gemacht. M i t dem 20. Dezember 1948 fällt das Lizenzierungsgesetz. Durch Anordnung der US-Militärregierung wird bestimmt, daß von diesem Zeitpunkt ab Gewerbefreiheit zu gelten habe, mit den Einschränkungen, die sich aus den Gesichtspunkten der öffentlichen Gesundheit, der öffentlichen Sicherheit und des Gemeinwohles ergeben. Außer diesen allgemeinen Anhaltspunkten wird keine positive Regelung getroffen. Diesem „gesetzlosen Zustand" hilft auch die Direktive vom 28. März 1949 nicht ab. I m einzelnen wird danach verlangt: die Beschränkungen der Gewerbefreiheit sind nur durch Gesetze zulässig und nur unter den bereits geltend gemachten Gesichtspunkten der öffentlichen Sicherheit und Gesund153 Vgl. dazu Reuss, S. 46 ff.; er erwähnt auch, S. 33, daß verschiedentlich sogar von den verschiedenen Fachabteilungen der Militärregierungen andere Auffassungen vertreten wurden, so ζ. B. hinsichtlich der Bank-, Sparkassen- und Versicherungsunternehmungen und sonstiger Kreditunternehmungen stand die Finance Division auf dem Standpunkt der Bedürfnisprüfung, während die sonst federführende Dekartellisierungsabteilung die Bedürfnisprüfung grundsätzlich verbot; vgl. dort auch weitere Beispiele.
4 Gedächtnisschrift Wenz
50
Edgar Michael Wenz
heit und des Gemeinwohles. Die Berufe, für die eine staatliche Zulassung verlangt werden kann, sind in einem Katalog aufzuführen, dessen Umfang sich nach dem anschließend geführten Schriftwechsel zwischen der bayerischen Staatsregierung und der US-Militärbehörde laufend ändert. Hierbei sind die deutschen Stellen bemüht, die US-Behörden auf die Besonderheiten der deutschen Wirtschaftsverhältnisse und die sich daraus ergebenden Notwendigkeiten hinzuweisen 1 5 4 . Für die Zulassung selbst scheiden aus die Gesichtspunkte der Bedürfnisprüfung, des Nachweises der erforderlichen Kapitalien und der erforderlichen Materialien. Eine Zuverlässigkeitsprüfung darf nur bei strafrechtlich belangten Personen und auch hier nur bei solchen, denen durch Strafurteil der Ausübung eines besonderen Gewerbes untersagt wurde, einsetzen; ein Befähigungsnachweis kann gefordert werden, jedoch ohne Mitwirkung privater Organisationen. Die neuen Bestimmungen sind also gerade das Gegenteil der Vorschriften des Lizenzierungsgesetzes von 1946. 1. Es wird die Gewerbefreiheit zum Ausgangspunkt der nun mehrigen Wirtschaftsordnung gemacht. Die neue Gewerbefreiheit ist zwar beschränkbar, doch nur durch die drei Generalgrundsätze, die von der US-Militärregierung aufgestellt wurden: öffentliche Gesundheit, öffentliche Sicherheit, Gemeinwohl. 2. Für die Einschränkungen scheiden die sämtlichen i m Lizenzierungsgesetz von 1946 für die Zulassung geforderten Voraussetzungen aus, nämlich das volkswirtschaftliche Bedürfnis, Kapitalmangel, Nachweis der fachlichen und persönlichen Zuverlässigkeit. Jedoch wird in den beiden letzten Punkten Spielraum für Sonderregelungen gelassen 1 55 . Der Schritt der US-Militärregierung, die Gewerbe freizugeben, schafft - i m ganzen gesehen - eine denkbar unerfreuliche Rechtsentwicklung. Allein in den Ländern der US-Zone herrscht keinerlei Rechtseinheit mehr; diese Rechtsverwirrung geht sogar soweit, daß in den verschiedenen Regierungsbezirken Bayerns die objektiv gleichen Vorschriften verschieden gehandhabt werden. Zwar gelten einheitlich die bisher erlassenen Gewerbezulassungsbestimmungen nicht mehr; es gilt dafür der Grundsatz der Gewerbefreiheit mit den bereits eingehend dargelegten Einschränkungsmöglichkeiten. Aber über das Wesen und die Ausgestaltung dieser Einschränkungen wird keine Einigkeit erzielt. Noch größere Rechtszersplitterung besteht im Hinblick auf die Zustände der britischen und französischen Z o n e 1 5 6 . Auch die Schaffung der Bundesrepublik bringt für diesen Zustand keinerlei Änderung.
154 Vgl. Reuss, a. a. O., S. 46 ff., Ani. 1 -23, wo er den Schriftwechsel zwischen den hessischen und den US-Militär-Behörden wiedergibt. Die entsprechende Korrespondenz für Bayern ist bis heute noch nicht zugänglich gemacht worden, iss Vgl. Reuss, a. a. O., S. 28. 156 Vgl. „Gewerbefreiheit" in „Rechts- und Wirtschaftspraxis" vom 28. 4. 1949, 1. und 2. Forts. Bl.
Die Entwicklung der Gewerbefreiheit in Bayern
51
Nachwort Die Auswertung der vorliegenden Arbeit ergibt in der Gesamtschau zunächst einmal, daß es ein Eigenleben Bayerns, aus dem allein ein spezifisch bayerisches Verwaltungs- und Staatsrecht fließen könnte, nur bedingt gegeben hat und geben kann. A m Anfang unserer historischen Untersuchung steht freilich eine Epoche, in der Bayern selbständig die Lösung seiner gewerberechtlichen Probleme suchte, und auch am Ende müssen wir eine Zeit vermerken, die in Bayern eine andere Regelung sieht als in einem großen Teil des übrigen Bundesgebietes. Dennoch aber nahm Bayern zu allen Zeiten an der Entwicklung i m gesamten Deutschland teil. Damals liefen seine Kodifikationen i m großen und ganzen parallel, wenn auch zum Teil zeitlich nachhängend, mit jenen in den anderen deutschen Ländern; heute sieht es sich durch seine andersverlaufende Entwicklung Schwierigkeiten gegenüber, denen es nur durch eine einheitliche Regelung, zumindest auf Bundesebene, begegnen kann. Eine kulturelle, wirtschaftliche und politische Einheit aber kann eben nur unter einem Recht blühen und gedeihen. A n diese Erkenntnis können wir nur den Wunsch knüpfen, daß sich auch die Hohen Kommissare der drei westlichen Besatzungsmächte dieser Erkenntnis nicht verschließen und die Möglichkeit geben, ein einheitliches deutsches Gewerbezulassungsrecht, das der deutschen Rechtstradition und Rechtsüberzeugung gerecht wird, zu schaffen.
4*
Wann braucht der Große Befähigungsnachweis nicht erbracht zu werden?*
Es ist eine wichtige Aufgabe des Gesetzgebers in einem Rechtsstaate, bei einem neuen Gesetz den Übergang vom alten zum neuen Rechtszustande kontinuierlich und erschütterungsfrei zu gestalten, um dadurch den Grundsatz der Billigkeit, welcher der Gerechtigkeit untrennbar verbunden ist, zum Durchbruch zu verhelfen. Die neue Handwerksordnung regelt diese Übergangsbestimmungen in den §§112 bis 120, deren Hauptmerkmal ist, daß bereits bestehende Handwerksbetriebe von der neuen Regelung, so insbesondere dem Erfordernis des Großen Befähigungsnachweises (Meisterprüfung), nicht betroffen werden. Hier soll aber nicht dieser Grundsatz interessieren, der wohl allgemein als richtig empfunden wird, sondern es soll auf die Grenzfälle hingewiesen werden, mit denen sich in der nächsten Zeit die zuständigen Behörden wohl des öfteren werden beschäftigen müssen. Die neue Handwerksordnung überraschte eine Reihe von Unternehmungslustigen mitten in den Vorbereitungen zum Betreiben eines Handwerks als stehendes Gewerbe; kostspielige Vorbereitungen waren getroffen, umfangreiche Verpflichtungen eingegangen worden (ζ. B. Grundstückskauf, Bau von Betriebsräumen, Bestellung von Einrichtungen und Maschinen usw., durch welche Dritte als Vertragspartner ihrerseits wiederum oftmals entscheidend betroffen werden). Es ist ja bekanntlich ein langer Weg, der von der Entschlußfasung im Familienkreis bis zu der Geschäftseröffnung zurückzulegen ist. Mitten in dieser Entwicklung - zu irgendeinem Zeitpunkt, aber jedenfalls noch vor Geschäftseröffnung - tritt nun die Handwerksordnung in Kraft. Das ganze Unternehmen scheint zunächst gefährdet zu sein, weil der junge Handwerker als künftiger Unternehmer keine Meisterprüfung abgelegt hat. Rechtslehre und Rechtsprechung haben sich schon früher, wenn auch aus anderen Anlässen, mit ähnlichen Fragen zu befassen gehabt. Man hat richtig die Gewerbefreiheit, als den früheren Rechtszustand, als ein sog. „subjektiv-öffentliches Recht 4 ' begriffen, welches die rechtliche Eigenart hat, daß es nach seinem Entstandensein nicht ohne weiteres entzogen werden kann. Dieses Recht allerdings hat man erst dann als entstanden angesehen, wenn gewisse Voraussetzungen eingetreten waren. Zu diesen Voraussetzungen gehörte, daß der Unternehmungslustige bestimmte Vorbereitungshandlungen getroffen hat, die zweifelsfrei und der Öffentlichkeit erkennbar auf die Errichtung eines Gewerbebetriebes hingezielt haben. * Erstveröffentlichung in: Konditorei und Café vom 2. Mai 1959.
Der Große Befähigungsnachweis
53
Durch derartige Maßnahmen hatte sich der Rechtszustand, ein Gewerbe betreiben zu dürfen, derartig „verdichtet", daß dadurch das nicht entziehbare Recht auf den Gewerbebetrieb, somit also auf die gewerbliche Ausübung entstanden war. In solchen Fällen muß also die Prüfung angestellt werden, ob und unter welchem Zeitpunkt die Vorbereitungshandlungen die Privatsphäre der einzelnen verlassen haben, ob und wann diese für die Gemeinschaft objektiv erkennbar waren, ob und wann sich das Planen und Tun zu konkreten Handlungen verdichtet haben, die zweifelsfrei auf die Errichtung eines Handwerksbetriebes hinzielen. Ohne Zweifel ist das nicht der Fall, solange das Projekt der Geschäftsgründung eine Familienangelegenheit war; auch „öffentliche" Debatten am Wirtstisch können diese Rechtslage nicht ändern; denn der Begriff der Öffentlichkeit muß i m Verwaltungsrecht notwendig ein anderer sein als beispielsweise i m Strafrecht. Der Kauf eines Grundstücks und die Plangestaltung durch den Architekten sind auch noch Privtangelegenheiten. Interessant wird die Sache aber dann, wenn die Baupläne, ordnungsgemäß ζ. B. als Bäckereiplanung bezeichnet, der zuständigen Behörde vorgelegt werden. M i t dem Eingang der Pläne bei der Baubehörde als der Vertreterin der Öffentlichkeit verläßt die Sache die privatrechtliche Sphäre und hat öffentlich-rechtliche Bedeutung; es entstehen Rechtsbeziehungen zwischen dem Staat und dem um einen Verwaltungsakt ersuchenden Individuum. Mag man zu diesem Zeitpunkt auch geteilter Meinung sein, ob diese öffentlich-rechtlichen Beziehungen ausreichen, so dürfte aber jeder Zweifel dann behoben sein, wenn der Bauplan für einen Handwerksbetrieb genehmigt ist; denn mit der Plangenehmigung werden dem Antragsteller die verschiedenen Auflagen gemacht, und zwar in erster Linie auch solche, die spezifisch gewerberechtlicher Natur sind. Die Antragsteller werden in diesem Moment gewissermaßen schon als Gewerbetreibende betrachtet. Je mehr die Entwicklung fortschreitet, um so mehr verdichten sich die Rechtsbeziehungen zwischen Öffentlichkeit und Individuum und um so sicherer darf das diesen Fragenkomplex entscheidende subjektiv-öffentliche Recht als entstanden angesehen werden. Man darf daher zu der Ansicht kommen, daß jedenfalls schon vor Eröffnung und Ausübung des Handwerksbetriebs dieser als bestehend angesehen werden muß, wobei es dahingestellt sein mag, zu welchem Zeitpunkt das nun genau der Fall sein wird. Das wird eben in jedem Fall anders sein und anders entschieden werden müssen. Diese Erkenntnis scheint auch gerecht zu sein; denn jeder Staatsbürger muß sich auf die derzeitige Rechtslage verlassen können, ohne jede Rücksicht auf Spekulationen, wie das künftige Recht aussehen mag. Solange Gesetze ihre Gültigkeit haben, muß der Staat seine Bürger schützen, die sich auf die Wirksamkeit dieser Gesetze verlassen und die im Vertrauen auf diese Gesetze einschneidende vermögensrechtliche Dispositionen treffen und Verpflichtungen eingehen. Diesem Grundsatz, der dem Begriff eines Rechtsstaates, wie es die Bundesrepublik Deutschland ist, innewohnt, müssen die Übergangsbestimmungen zum Rechte verhelfen - die „Wohltat der Übergangsbestimmungen", wie sich einer der
54
Edgar Michael Wenz
bedeutendsten Rechtsgelehrten, Walter Jellinek, gerade bei der Behandlung des § 1 der Gewerbeordnung ausdrückte. Ein Ausweg mag wohl in diesem oder jenem Fall die Ausnahmebewilligung des § 8 der Handwerksordnung sein. In vielen Fällen wird sich aber der unternehmungslustige Staatsbürger wohl mit Erfolg dagegen wehren können, einem Ermessensentscheid in seiner ganzen Fragwürdigkeit zu unterliegen. Wenn die neuen Organisationen des Handwerks die zuständige Verwaltungsbehörde und die Verwaltungsgerichte sich in Zukunft an diese alten und bewährten Rechtsgrundsätze erinnern, so wird der Übergang von der absoluten zur modifzierten, das heißt von der unbeschränkten zur uneingeschränkten Gewerbefreiheit ohne nennenswerte Erschütterung erfolgen können.
Verfahrensänderung zur Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Genehmigung von umweltrelevanten Großvorhaben?* Anmerkungen zum Karlsruher Kolloquium „Die Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Genehmigung von umweltrelevanten Großvorhaben" am 10. u. 11. Juni 1987 im Kernforschungszentrum Karlsruhe Die Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Genehmigung von umweltrelevanten Großvorhaben (Erörterungstermin) 1 sollte mehr unter einem sozialpsychologischen Aspekt 2 gesehen werden; diese Aufarbeitung wird aber offenkundig vernachlässigt 3 . Dies ist um so erstaunlicher, als bei den Terminen im allgemeinen keine Fakten oder rechtliche Überlegungen eingebracht werden, die nicht schon bekannt und erwartet wären 4 . Derartige soziologische und sozialpsychologische Überlegungen provozieren in aller Regel den Verdacht einer ,Sozialhygiene' 5 (statt ,beinharter Jurisprudenz'). Aber dieser Vorwurf kann recht leicht zur Ermunterung gereichen: Vermutlich gibt es keine therapeutische Maßnahme, die nicht mit Hygiene begänne . . . Die Öffentlichkeitsbeteiligung, die man im weiteren Sinne als Bürger- oder Laienbeteiligung ansehen kann, beruht auf dem Öffentlichkeitsgrundsatz, der das Entstehen des Rechtsstaates im vergangenen Jahrhundert begleitet hat. Dieser wiederum ist rechtshistorisch entstanden * Erstveröffentlichung in: Speyerer Forschungsbericht 70, Band 2, Speyer 1988; KfKBericht4357, Kernforschungszentrum Karlsruhe, 1989. 1 Solche Großvorhaben, insbesondere Großanlagen sind aufgelistet in § 9 des ,Gesetzes zur Beschleunigung verwaltungsgerichtlicher und finanzgerichtlicher Verfahren' vom 4. 7. 85. (Beschleunigungsnovelle); zur Öffentlichkeitsbeteiligung sei verwiesen beispielsweise auf: §§ 14 ff. der 9. BlmSchVoder §§ 8 ff. der Atomrechtlichen Verfahrensordnung, jeweils unter dem Begriff,Erörterungstermin'. 2
Dazu gibt es auch in den Gesetzesmaterialien so gut wie keine Hinweise. Diesen Eindruck mußte man auch haben vom Verlauf des Kolloquiums ,Die Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Genehmigung von umweltrelevanten Großvorhaben - rechtliche Grundlagen und praktische Erfahrungen' am 10./11. 6. 87 im Kernforschungszentrum Karlsruhe, veranstaltet gemeinsam mit der Verwaltungshochschule Speyer. 4 Vgl. dazu insbesondere die Materialien, die beim Karlsruher Kolloquium, Anm. 3, vorgestellt und im vorliegenden Bericht veröffentlicht worden sind. 5 So schon der Autor in Wenz, Das Mißverständnis mit den Wissenschaftsgerichtshöfen, ZRP 10/85, S. 267 ff. (271). 3
56
Edgar Michael Wenz
• aus dem emanzipatorischen Impetus des Bürgertums, • der zum Postulat der Partizipation führte, • die eine integrative Wirkungschance 6 anzielte; sie wird häufig als die eigentliche Aufgabe der Rechtsprechung, die Friedenstiftung, begriffen. Unter Öffentlichkeitsgrundsatz darf man nicht nur die Herstellung der Öffentlichkeit in Gerichtsverfahren, freilich das stärkste Beispiel, begreifen, sondern schlechthin die Schaffung von Transparenz und Teilhabe. Sie war vom Bürgertum immer deutlicher, schließlich leidenschaftlich gefordert worden. Und eigentlich kann man recht wohl Parallelen aus unseren Tagen zu jenen vergangenen Zeiten ziehen: War es früher die Kabinettsjustiz, die Angst vor dem Moloch Staat 7 , die die Ängste vor etwas Undurchsichtigem und Mysteriösem wachsen ließ, so sind es jetzt Bürokratie und der Moloch Technik und Wissenschaft, die Gesellschaft und Staat schon aufs tiefste beunruhigt haben. Da geschehen Dinge, die man nicht begreift; da werden Entscheidungen gefällt von Leuten, die man in der Sache nicht für kompetent hält - Unbehagen greift um sich, das durchaus Ursache für Unsicherheit, Verdrossenheit und fehlende Akzeptanz werden könnte. Die Lebenszeit einiger Generationen sind in der Geschichte nur ein Hauch. Niemand darf ernsthaft erwarten, daß die Ängste und Hoffnungen der Menschen sich so verändert haben könnten, daß man die Lehren der Geschichte einfach leugnen dürfte. Gewiß, es ist sehr viel rechtspolitisch erreicht worden: Das Öffentlichkeitsprinzip i m Gerichtsverfahren, die Laiengerichtsbarkeit, Transparenz für die Entscheidungen in Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtsprechung, durch deren Veröffentlichungen die Kritik nicht nur ermöglicht, sondern förmlich organisiert wird. Aber man sollte auch nicht übersehen, daß sich die Erwartungen der Bürger über das Erreichte hinaus erweitert haben; die Pflöcke politischer Forderungen, auch und gerade der partizipatorischen, werden immer weiter vorne eingeschlagen. Die Öffentlichkeitsbeteiligung beruht auf dem Öffentlichkeitsgrundsatz, der das Entstehen des Rechtsstaates i m vergangenen Jahrhundert begleitet hat; sie läßt sich an zwei Strängen erkennen: • die expressive darstellbare / dargestellte Hinwendung zur sozialen Bewußtseinslage der Bevölkerung, sowie • Ausschöpfung des Potentials, das i m Verfahren steckt 8 . 6 So auch Görlitz, Laienrichtertum, in: Handlexikon zur Rechtswissenschaft, 1972 ff.; mehr dazu bei Wenz, Wissenschaftsgerichtshöfe, 1983. 7 Diese Gedankengänge hat der Autor bereits entwickelt in Wenz, Wissenschaftsgerichtshöfe. Mittler zwischen Wissenschaft, Politik und Gesellschaft. Mit Beiträgen von Meinolf Dierkes, Wilhelm A. Kewenig, Gerd Roellecke und Edgar Michael Wenz, 1983, S. 111, ebenso in Wenz, a. a. O., 1985, S. 271, Anm. 35. 8 Siehe Meyer-Abich in: Grundrechtsschutz heute - Die rechtspolitische Tragweite der Konfliktträchtigkeit technischer Entwicklung für Staat und Wissenschaft, ZRP 1984, S. 43;
Öffentlichkeitsbeteiligung bei Genehmigung von umweltrelevanten Großvorhaben?
57
Über die Bewußtseinslage der Gesellschaft weiß man immer noch, jedenfalls gemessen an der Brisanz des Problems, relativ wenig. Die Untersuchungen der gemeinsamen Forschungsgruppe der Hochschule für Verwaltungswissenschaft Speyer und des Kernforschungszentrums Karlsruhe (Abteilung für Angewandte Systemanalyse) könnten wenigstens partiell erhellen und möglicherweise doch die empirische Sozialforschung künftig mehr in diese Richtung zu lenken verhelfen 9 . Die besondere Bedeutung des Verfahrens zur Rechtsfindung ist in der Wissenschaft überwiegend anerkannt. Angesehene Autoren mit internationalem Ansehen erkennen i m Verfahren eine legitimierende W i r k u n g 1 0 . Niklas Luhmann sieht die Legitimation durch Verfahren 11 , Arthur Kaufmann i m Verfahren 12 , Soziologen sprechen von der Chance der,Aussöhnung 4 oder gar der Revolution durch Verfahren' (Helmut Schelsky). Freilich kann man die Hoffnung auf die integrierende oder re-integrierende Wirkung des Verfahrens nur an die »richtigen' Adressaten knüpfen, an Bürger, bei denen man ein »generalisiertes Systemvertrauen' (Luhmann) erwarten darf und die deshalb auch einer sinnvermittelten Teilnahme fähig sind. Die anderen, i m Augenblick noch deutlich in der Minderzahl, brauchen bei rechtsstaatlichen Erwägungen nicht zu interessieren. Die Aufgabe ist groß genug, die objektiven und aufnahmebereiten Mitbürger zu erreichen. Alle rechtspolitischen Anstrengungen sollten auf diesen Personenkreis abgestimmt sein, von dem auch die Freisetzung meinungsbildender Kräfte erwartet werden darf. Auch wenn man die legitimierende Funktion des Verfahrens - es geht nur darum, Legalität ist ohnehin vorausgesetzt - bejaht, darf man dennoch nicht übersehen, daß die Rechtsordnung nur die Entscheidung garantieren k a n n 1 3 , nicht aber auch noch gleichzeitig deren Richtigkeit und Wahrheit. Der freiheitliche Staat kann eben nur gleiche Spielregeln verbürgen, nicht aber auch noch ein gerechtes Ergebnis (F. A. von Hayek). Die Verfahrens- und Entscheidungsgarantie ist wohl eine der wichtigsten Leistungen der Rechtsordnung für Staat und Gesellschaft. U m nun zur angestrebten
ablehnende Erwiderung u. a. Wagner, Grundrechtsschutz und Technologieentwicklung, ZRP 1985, S. 192 ff. 9 Systematische Untersuchungen zum Rechtsbewußtsein beispielsweise sind mir immer noch nicht bekannt. Freilich bedarf es dazu auch der öffentlichen Aufträge. Mit den Erfahrungen aus der Marktforschung müßte sich die empirische Sozialforschung doch Kenntnisse verschafft haben, sich erfolgreich mit diesem Problem zu beschäftigen. Zum Komplex siehe Wenz, a. a. O. 1985, FN 34. 10 So im Prinzip auch der Autor, a. a. O. 1985, S. 269, sich hier aber auf die eine ,legitimationsannähernde Wirkung' beschränkt. 11 In seiner bekannten Monographie »Legitimation durch Verfahren' 1960, häufig genug mißverstanden; man vermißt insbesondere rechtsethische Bezüge; Luhmann hat das klargestellt in der Neuauflage 1978, S. 1 - 7 , mit dem Hinweis, daß ,die Darstellung einer Funktion ... also keine versteckte Empfehlung, eine Krypto-Nominierung bedeutet'. 12 Einführung in die Rechtsphilosophie und Rechtstheorie der Gegenwart, 1979, S. 290 f. 13 So sinngemäß Luhmann, a. a. O., Anm. 11.
58
Edgar Michael Wenz
menschenmöglich wahrsten und richtigsten Entscheidung zu kommen, könnten diese Erkenntnisse weiterhelfen: • Alle Verfahren, die mit der Anwendung von Großtechnologie zu tun haben, beginnen bei der Verwaltung und enden vor Gericht. • Die verfaßte parlamentarische Demokratie beruht auf dem Gedanken der Repräsentation 14 . • Der Gesetzgeber muß die Verwaltung und die Gerichte, eben um des Erfordernisses der Offenheit zum sozialen und technischen Wandel willen, mit Generalklauseln und unbestimmten Rechtsbegriffen alleinlassen; die Anrufung der Sozial- und insbesondere Realwissenschaften ist nun zwingend und unerläßlich. Anders läßt sich Richtigkeit und Wahrheit der Entscheidung, die die Akzeptanz derselben durch die Betroffenen und Rechtsunterworfenen erleichtern würde (Luhmann), nicht erkennen, weil das Recht sich mit lediglich juristischen Methoden, und das gilt nicht minder für rechtsethische Verknüpfungen, nicht erfassen läßt. Aus dieser Erkenntnis der Fakten ergeben sich Überlegungen, diesen Weg gehen zu sollen: • Konstituierung von Institutionen unter Mitwirkung von Sachverständigen - bei der Verwaltung (Exekutive) in beratenden, - bei der Rechtssprechung in entscheidungsberechtigten Gremien; • Berufung von Repräsentanten aus der Bevölkerung, durch die das rechts- und gesellschaftspolitische Postulat der Partizipation eingelöst wird, • Auswahl dieser Repräsentanten nach Sach- und Fachkompetenz (Experten), die tunlichst jedoch nicht rechtskundig sein sollen, um so die Elemente des Laienrichtertums 15 einzubringen. Die Diskussion um eine tragfähige Integration technisch-wissenschaftlicher Informations- und Analysesysteme über den politischen Bereich, wo sie eine gewisse Tradition hatte, in Richtung Substitution der Entscheidungskompetenzen zu Verwaltung und Rechtsprechung erreichte, vornehmlich aus Großbritannien, den USA und Schweden kommend, i m vergangenen Jahrzehnt auch unsere Fachliteratur 16 .
14 Stellvertretend für eine reiche Literatur: Hasso Hofmann, Repräsentation - Studien zur Wort- und Begriffsgeschichte von der Antike bis ins 19. Jahrhundert, 1974. 15 Das Laienrichtertum hat sich im allgemeinen bewährt. Daran ändert sich auch nichts, daß die integrative Wirkung des Laienrichtertums nicht schlechthin offenkundig ist. Man würde dazu mehr wissen, wenn es einmal politisch versucht würde, dieses abzuschaffen. Mehr zum Laienrichtertum in Literaturangaben, bei Wenz, a. a. O. 1983, S. 108 ff. 16 Sehr instruktiv Meinolf Dierkes und Volker von Thienen ,Science Court - Ein Ausweg aus der Krise' in ,Wirtschaft und Wissenschaft' 4/1977; abgedruckt in Wenz, a. a. O., S. 111. In derselben Publikation werden nachfolgend durch Roellecke, Kewenig und Wenz die von Dierkes/v. Thienen gemachten Vorschläge kontrovers diskutiert.
Öffentlichkeitsbeteiligung bei Genehmigung von umweltrelevanten Großvorhaben?
59
A u f der Suche nach Verfahren mit friedensstiftender Wirkung für eine verunsicherte Bevölkerung führen Überlegungen recht schnell zu konstituierten Sachverständigengremien bei der Exekutive. Dieses ist ausgiebig diskutiert worden 1 7 . Verfassungsrechtliche Bedenken, die von allen Autoren gesehen werden, würden entfallen, wenn die Sachverständigen keine Rechtssetzungsbefugnis haben. Schließlich kann sich die Exekutive sachund fachkundig machen (lassen), wie immer sie das für zweckmäßig hält. Der Unterschied zur bisherigen Praxis bestünde darin, daß die Fachberatung, derer sich die Verwaltung schon immer bedient hat, nicht hinter verschlossenen Türen stattfindet, die Berufung der Sachverständigen regelhaft geschieht und volle Transparenz gewährleistet. So wären hier alle jene Merkmale gegeben, die das ordentliche Verfahren kennzeichnen, von dem man Vertrauensbildung und schließlich Legitimation erwarten darf 1 8 . Die Sachverständigengremien 19 können nur Empfehlungen beschließen, an die die Verwaltung keineswegs gebunden zu sein braucht, sich aber wohl in aller Regel daran hält. Das was angestrebt wird, die sozialpsychologische Wirkung, wird so jedenfalls erreicht werden - die technische Richtigkeit wird sicherlich darunter nicht leiden. Die Frage stellt sich nun, ob und wie sich diese Erkenntnisse aus der Theorie in die Praxis überführen lassen - ungeachtet der derzeitigen positiven Rechtslage. Erstens, würde ein derart konstituiertes Sachverständigengremium das öffentliche Erörterungsverfahren, immer aus sozialpsychologischer Sicht, ersetzen können? Und zweitens, welche weiteren juridischen und praktisch-politischen Probleme tun sich bei der Berufung dieses Gremiums wahrscheinlich auf? Die erste Frage zu bejahen macht Schwierigkeiten. A u f die sozial-psychologische ,Ventil-Wirkung 4 wird man wohl schwerlich verzichten können. Das macht aber keineswegs die Einrichtung eines Sachverständigengremiums überflüssig. Dessen Aufgabe soll es j a sein, die aufgeworfenen Fragen und Probleme sachverständig und öffentlich zu erörtern unter der Pflicht, in angemessener Frist ein 17 Literaturnachweis, siehe bei Wenz, a. a. O. 1985, S. 270 (Lukes, H. Wagner, Marburger, Ossenbühl). 18 Eine gewisse Entsprechung kann man in der parlamentarischen Praxis sehen, Hearings zu veranstalten und Enquête-Kommissionen einzusetzen; abgesehen von verfahrensrechtlichen Unterschieden dienen diese Aktivitäten der Politikberatung für Parlament und Gesetzgebung. Im Sinne der fünf Modelle von Dierkes könnte man, wenn man die Unterstützung des Parlaments durch ein Sachverständigengremium konstituieren wollte, eher an die Vorbilder der Royal-Commission und des Forscherparlaments denken. 19 Beachtung müßten hier finden die ,Science Court' Modelle I und II von Dierkes, a. a. O., FN 16. Bei den Vorschlägen hat, wie die nachfolgende Diskussion gezeigt hat, vor allem der Begriff des ,Science Court' erheblich gestört, der einen falschen Zungenschlag eingebracht hat. So konnte die ,Horrorvision einer Art wissenschaftlich-technologischen Kardinalskollegiums, das in eschatologischen Fragen richtet, in Anspruch und Wirkung eines Dogmas entstehen', Wenz 1983, S. 65.
60
Edgar Michael Wenz
Ergebnis vorzulegen. Der Einwand, i m wesentlichen würde genau das ja jetzt schon geschehen, wird eigentlich eher zur Stütze; es wird durch diesen Schritt keineswegs ein neuer Kosten- und Zeitaufwand eingeschoben. Der Unterschied liegt in der Institutionalisierung des Gremiums, i m eingerichteten Verfahren, das den wissenschaftlichen und technischen Ausweis der berufenen Sachverständigen ebenso regelt wie die Transparenz garantiert, die einem regelhaften und öffentlichen Verfahren immanent ist. Störungen der ersten Sitzungen sind durchaus vorstellbar, wie man auch ein Austrocknen des Interesses i m weiteren Verlauf erwarten darf. Aber man wird davon ausgehen dürfen, daß von diesem Sachverständigengremium vorgelegte Empfehlungen oder Beschlüsse in der einigermaßen loyal eingestimmten Bevölkerung eher auf Zustimmung stoßen und auf Konflikt angelegte Bemühungen eher scheitern lassen, als es bisher war? Immerhin scheinen die ,Rest-Zweifel 4 sich schließlich fügender Bürger immer noch größer zu sein als die Rest-Risiken. Bei dieser personalen Berufung dürfte es weniger juridische statt praktisch-politische Probleme geben. Aus rechtlicher Sicht lassen sich Sachverständigengremien einrichten und Regeln aufstellen. Da keine legislatorischen Befugnisse eingeräumt werden, bedarf es keiner demokratischen Wahl der Mitglieder. Es empföhle sich aber - anders läßt es sich wohl politisch auch gar nicht durchsetzen - , die Sachverständigen nach der politischen Zusammensetzung des parlamentarischen Organs zu berufen, das gewaltenteilig der Exekutive entspricht, in deren Zuständigkeit die jeweilige Entscheidung fallen würde. ,Proporz' also auch i m Sachverständigengremium? Es wäre wenig sinnvoll, diese Frage i m Brustton wissenschaftstheoretischer Überzeugungen zu verneinen. Ein Verfahren, das auf psychologische Wirkung ausgerichtet ist und das also Emotionen vorhersehen muß, kann nicht neue Probleme aufwerfen, indem es die politischen Verhältnisse ignoriert, auch noch mit Begründungen, die sich nicht beweisen lassen („Wer ist noch sachverständiger als der Sachverständige?" Und schließlich: „Was ist wissenschaftliche Wahrheit?") Der Vollständigkeit halber soll auch noch ein kurzer Blick geworfen werden auf die denkbaren Lösungen dieser Probleme, die sich am anderen und schließlich entscheidenden Ende des Weges zur Genehmigung einer Großanlage auftun: der Rechtsprechung. Hier wird die Entscheidung verlangt. Hier ist zu denken an eine Fachkammer i m Verwaltungsgerichtsverfahren, an die ,Technologiefachkamm e r ' 2 0 . Die Sachverständigen sind als Mitglieder des Spruchorgans, als Laien-/ Expertenrichter nämlich, gedacht. Da nach den bisherigen Erfahrungen ohnehin alle Anträge für umweltschutzrelevante Großvorhaben vor Gericht, und zwar jeweils in der höchsten Instanz, enden, kommt diesem Vorschlag auch die größte praktische Bedeutung zu. Die sich anschließende Diskussion wurde erwartungsgemäß kontrovers geführt, wobei die Ablehnungen oder bedingten Ablehnungen überwogen 2 1 . Aber 20 Sie entspricht dem Modell III von Dierkes, a. a. Ο., FN 16.
Öffentlichkeitsbeteiligung bei Genehmigung von umweltrelevanten Großvorhaben?
61
gerade bei den Ablehnungen wurde eben der sozialpsychologische Aspekt übersehen, mit dem offenbar Juristen nichts anfangen können, weil sie nur die Rechtskraft des Urteils interessiert. Rechtskräftige Urteile freilich hat es immer gegeben, sie sind auch vollstreckt worden. Aber da liegt j a nicht das Problem. Schwierigkeiten sind mit jeder Sicherheit zu erwarten bei den personalen Fragen sowohl bei der Besetzung der Sachverständigengremien wie dann erst recht bei den Expertenrichtern 22 . Aber sie sind gering gemessen daran, daß wir es j a mit einem viel größeren Problem zu tun haben, nämlich einer möglicherweise sogar staatsbedrohenden Akzeptanzkrise. Es geht bei den Technologiefachkammern nicht um die Evaluierung des Urteils in Sinne naturwissenschaftlich-technischer Richtigkeit. Sie wird selbstverständlich angestrebt, sie ist aber auch mit derartigen Gremien objektiv kaum erreichbar, jedenfalls nicht beweisbar. Es geht vielmehr um die Ausschöpfung des Potentials richterlicher Autorität; um die durch Fachkunde 2 3 gestützte und gewachsene Glaubwürdigkeit der Entscheidung; um die erkennbare Kompetenz des Gerichts, eben des Expertengerichts, dem man eher die »Wahrheit 4 des Spruchs zutraut. Diesen Weg, jedenfalls einen neuen und anderen Weg beschreiten zu sollen, ergibt sich konsequent aus der an sich besorgniserregenden Beobachtung, daß bei Entscheidungen in Angelegenheiten der Großtechnik nicht die Richtigkeit und 21 Es beteiligen sich daran Kuhnt, J. Schmitz, Wagner, Marburger, Lukes, Hasso Hofmann, Benda und Wenz; mehr dazu Wenz, a. a. O., 1983, S. 153 ff.; ders. 1985, S. 267 ff. Neuerdings auch dazu bedingt ablehnend Sendler in seinem Beitrag »Richter und Sachverständige' (in: NJW 47, S. 2907 ff.). Bei seiner Kritik des Autors (siehe Lit. Anm. 5 und 7) scheint er aber doch mehr die Evaluierung des Urteils zu suchen. Bestreitbar bleibt seine Meinung (im Anschluß an Hasso Hofmann, UPR 1984, S. 83), daß der ,Dialog im Fachjargon' (der Prozeßgegner), S. 2914, durch den weiteren Sachverständigen auf der Richterbank eher verwirren würde. Hier muß man entgegenhalten: Es ist dem Juristen auf der Richterbank, insbesondere dem Vorsitzenden, sicherlich unbenommen, die verlorengegangene ,Verständlichkeit' (Anm. 58) wiederherzustellen. Es ist auch schwer vorstellbar, daß der ,klagende Laie' ohne sachverständigen Beistand auftritt, aber um so mehr, daß der interessierte Laie die Sache bei einem Expertenrichter besser aufgehoben hofft, als daß ihn die Überzeugung friedvoller stimmen könnte, der Vorsitzende verstehe ja auch nicht mehr als er selbst. 22
Für das Interesse anerkannter Techniker und Wissenschaftler, lieber als Sachverständiger einer Partei aufzutreten denn als Mitglied eines Objektivitätspflichtigen Gremiums, gar eines Gerichtes, ist menschlich verständlich. Die Sachverständigen aller Herkünfte (»Halbgötter in Weiß') zugesprochene »Flexibilität' („Ich würde meinen ...") muß in die ganz andere Qualität der Entscheidung umschlagen („Ich entscheide ..."). Siehe dazu auch Wenz, a. a. O.» 1985» S. 267 ff. (268). 23 Siehe dazu Ossenbühl (DVB1. 1978» 8). Er fragt konkret, ob der davon ausgehende ,rechtsstaatliche Mehrwert' ausginge von der Annahme der Richtigkeit richterlicher Entscheidung, der größeren Fachkunde des Gerichts, der Öffentlichkeit des Verfahrens, dem Edukationseffekt richterlicher Kontrolle; er sieht die Lösung in der Objektivität, Unparteilichkeit und Unabhängigkeit, die „dem Status und Habitus des Richters eigen ist".
62
Edgar Michael Wenz
Wahrheit derselben zu interessieren scheint. Sie ist so und anders kaum einsichtig und schon gar nicht plausibel zu machen (was nicht schlechthin ein Fehler zu sein bräuchte, weil Wahrheit und Plausibilität eher Feinde sind). Die beklagte mangelnde Sozialakzeptanz hat eben sozialpsychologische Ursachen. Eigentlich aber liegt nichts näher, als ein sozialpsychologisch-soziologisches Phänomen mit keinem anderen Instrumentarium zu analysieren und aufzulösen zu versuchen als mit ebendiesem sozialpsychologischen-soziologischen. Die Öffentlichkeitsbeteiligung könnte zu diesem Instrumentarium passen. Sie sollte nur neu überdacht werden, um sie auch ausreichend effizient werden zu lassen.
2. Rechtssoziologie
Einführung in die theoretische Rechtssoziologie* Vorbemerkung Die Rechtssoziologie darf bei rechtspolitischen Überlegungen zur Gesetzgebung nicht nur nicht vergessen werden, sie muß dabei sogar eine ganz wichtige, sie tragende Rolle spielen. Da das Feld aber sehr weit und verzweigt ist, wurde vorgezogen, den speziellen Teil über Rechtssoziologie mit den Teilgebieten insbesondere der Rechtsforschung herauszunehmen und separat zu gestalten. Das fördert den Lesefluß beim eigentlichen Thema, soll aber nicht dazu verleiten, dieses Kapitel abzutun. Das sollte insbesondere bei ,gestandenen' Juristen nicht so sein, weil sie weitgehend, nicht nur überwiegend, sondern eigentlich ausschließlich ,schuld' daran waren, daß die Rechtssoziologie ein Mauerblümchen-Dasein bislang fristen mußte. Das kann da oder dort gleichgültig und schadlos sein. Bei der Gesetzgebungslehre allerdings gilt das nicht. Sie muß in die theoretischen Überlegungen und bei der praktischen Handlung eingeschlossen werden. Wenn Gesetze und Normen wirken sollen, was j a nun deren Sinn ist, und eben diese Wirkung keineswegs gewährleistet, sollten alle Gesetze und Normen beobachtet werden. Das Instrument der Wissenschaft ist die Forschung. Es ist bezeichnend, daß alle Autoren bei der Referierung juristischer Entscheidungen, die im Tatbestand oder in der Prognose auf unsicherem Boden stehen, seien es nun Urteile oder Verwaltungsakte, stets bedauernd beklagen, eine begleitende Rechtsforschung sei zwar zweckmäßig bis notwendig, aber nicht möglich; der Zeit- und Kostenaufwand stünden dem entgegen. So wird also sehr häufig S ach Verhaltsermittlung und Tatbestandsfeststellung auf anderen Kriterien aufgebaut als auf erwiesene Fakten; das gilt nicht nur für die Ausfüllung von unbestimmten Rechtsbegriffen oder Ausdeutung von Generalklauseln. Besonders schwer wiegt dieser Mangel, wenn mit den Entscheidungen Prognosen verbunden sind, häufig - und dies nicht nur im Strafrecht - verbunden sein müssen. Man wird beim alltäglichen justiziellen Betrieb und Verwaltungshandeln über diese Kosten- und Zeitüberlegungen nicht hinweggehen können. Aber ebenso müßte feststehen, daß diese Argumente nicht mehr greifen, wenn es um Gesetze geht. Eingriffe in das soziale Leben einer ganzen Gesellschaft, wie diese in aller Regel vom Gesetz j a ausgehen und ausgehen sollen,
* Teilweise erstveröffentlicht in: Zeitschrift für Rechtssoziologie, Band 15 (1994), Heft 1, S. 58 ff. 5 Gedächtnisschrift Wenz
66
Edgar Michael Wenz
verlangen dringend und unabweisbar entsprechende Studien und Untersuchungen, ob das Gesetz auf verläßliche Fakten in Ansatz, Begründung, Zweck und Ziel auch gestützt ist. Für den Erlaß eines Gesetzes gelten, das ist jedenfalls bislang nicht bestritten worden, doch andere Regeln als für ein Urteil oder einen Verwaltungsakt i m Einzelfall. Hier ist die Rede von einer begleitenden Rechtsforschung, nicht aber von den allgemeinen Vorbereitungen einer Rechtssetzung. Die Nagelprobe für ein Gesetz ist die Praxis. Diese Effektivitätskontrolle ist gleichzeitig auch eine Gesetzesevaluierung; denn nur das, was wirklich wirkt, kann auch bewertet werden. Somit haben wir hier eine Koinzidenz von Effektivität und Evaluierung.
I. Aufgaben der Rechtssoziologie Die Rechtssoziologie mag eine ungeliebte Schwester der Rechtswissenschaften sein, aber eine blutsverwandte Schwester ist sie eben doch. Und sie bringt viel Nutzen. Hier wäre zuvörderst die Beobachtung der Rechtswirklichkeit zu nennen, das Ist des Rechts ist möglicherweise relevanter als das Soll. Praktischen Nutzen bringt insbesondere die sog. soziologische Jurisprudenz', die die Realität mit dem Recht verbindet, es häufig genug erst zum Leben erweckt. So sind zu nennen in der Rechtssprechung die Sachverhaltsermittlung; die Normfindung durch die Konkretisierung von Generalklauseln und unbestimmten Rechtsbegriffen, die Rechtschöpfung bei Rechtslücken, die teleologische Auslegung; die Betreuung der sozialen Normen, die überdies das gesellschaftliche Leben häufig mehr beeinflussen als die kodifizierten. Nur wer die Wirklichkeit kennt, und das ist eben die Rechtssoziologie, kann mithelfen in der Rechtspolitik, etwa durch Prognosen und, wie hier behandelt, die Kontrolle der Effektivität; dabei müssen natürlich die erkenntnistheoretischen Grenzen einer soziologischen Jurisprudenz ebenso wie der Rechtsforschung erkannt und bedacht werden. Die Sozialforschung spielt für die Erkenntnis der Rechtswirklichkeit eine wesentliche, eigentlich unverzichtbare Rolle. Und von ihr her rühren auch die Belastungen der Rechtssoziologie wegen der angreifbaren Methoden eben der empirischen Sozialforschung. Sie war technisch noch nicht genügend ausgereift. Der eigentliche Grund aber war meistens die ideologische Trübung des Blicks auf die Forschungobjekte, der Vorwurf der ,interessensgeleiteten Forschung' 1 . Die Rechtssoziologen selbst haben das Thema überwiegend auch nur marginal behandelt. Nur selten wurde die Bedeutung der Rechtstatsachenforschung, hier synonym verstanden für alle Methoden der Rechtsforschung, in den Mittelpunkt des Interesses gestellt und die eigene Kompetenz behauptet 2 . Aber gesehen wurden 1
Jürgen Habermas, Erkenntnis und Interesse, 1968. Welch geringen Anteil die Rechtstatsachenforschung selbst im Rahmen der Arbeit des Bundesministeriums der Justiz hat, zeigt implizit Dieter Strempel, Der Beitrag der empi2
Einführung in die theoretische Rechtssoziologie
67
diese Fragen durchaus, so beispielsweise von Maihofer, der die Notwendigkeit deren Einbeziehung in die Erfolgskontrolle von Gesetzen betont. 3 Nicht selten mußte man den Eindruck haben, daß bei Themen, die das ,social engineering' berührten, ein vorgefaßtes Resultat nur bestätigt werden sollte. Davon war allerdings überwiegend betroffen die Meinungsforschung, insbesondere die Wahlforschung. Damit hängt wohl auch die Anmerkung des Bundespräsidenten Roman Herzog i m Herbst 1996 zusammen, der die Demoskopie zu jenen drei Bereichen gezählt hat, die er nicht ernst nehmen könne. Nachdenkenswert, aber möglicherweise auch für seriöse Meinungsforscher frustrierend, ist der Satz von Niklas Luhmann 4 : ,Aber faktisch werden gar nicht Meinungen erhoben, geschweige denn Handlungsbereitschaften, sondern Antworten.' Man kann durchaus geäußerte und festgehaltene Meinungen, die also Antworten sind, wenn man sie so auch angibt, als Fakten auswerten. Aber das ist ein anderer Bereich als der, in dem sich bei der von uns verstandenen Messung die Effektivität der Rechtsnormen bewegt. Bei den hier angeführten Überlegungen kann man sich durchaus auf Tatsachen beschränken, die durch den soziologischen Rechtsbegriff geschützt sind, somit die Reaktionstheorie, die unten behandelt wird. 5
II. Die Rechtsforschung Die Rechtsforschung 6 gehört zu den typischen Aufgaben der Rechtssoziologie, und zwar der praktischen und empirischen. Hermann Kantorowicz 7 hat die Dreidirischen Rechtsforschung zu einem realistischen Umgang mit dem Recht, in: Heinz Schäffer (Hrsg.), Gesetzgebung und Rechtskultur, 1987, S. 87 ff. 3 Werner Maihofer, Gesetzgebungswissenschaft, in: Günter Winkler/Bernd Schilcher (Hrsg.), Gesetzgebung, 1981, S. 22 ff., mit Ergebnissen der Rechtstatsachenforschung zum Begriff des Gesetzgebers. Die Anmerkung sei erlaubt, daß Maihofer in seiner politischen Laufbahn, immerhin als Bundesminister des Innern, nichts Konkretes und von außen Erkennbares in Richtung Effektivitätskontrolle bewirkt hat. 4 Niklas Luhmann, Wahrheit und Ideologie (Der Staat), 1962 und passim. 5 Edgar Michael Wenz, Die Reaktionstheorie - rechtstheoretische Voraussetzung für die Rechtsforschung, in: Zeitschrift für Rechtssoziologie 15 (1994), Heft 1, S. 58 ff. Sinngleich im Tagungsband zum Symposion zu Theodor Geiger, in: Theodor Geiger. Soziologie in einer Zeit zwischen Pathos und Nüchternheit. Beiträge zu Leben und Werk, hrsg. v. Siegfried Bachmann, 1995. 6 Instruktiv ist für die Methoden der Rechtsforschung, insbesondere Rechtstatsachenforschung, Manfred Rehbinder, Rechtssoziologie Anm. 21, der diesem Thema einen ganzen Abschnitt (3. Aufl., S. 43-94), widmet. 7 1910 auf dem ersten deutschen Soziologentag. Die Lehre, daß der Rechtsphilosophie die Idealität (Gerechtigkeits-, Wertvorstellungen), der Rechtsdogmatik aber die Normativität, das Sollen, zugewiesen ist, wird häufig bestritten, weil diese beiden Stränge sich nicht aus der notwendigen Gesamtschau des Rechts trennen ließen. Aber die wissenschaftliche Aufteilung 5=
68
Edgar Michael Wenz
mensionalität des Rechts eingebracht, bei der der Rechtssoziologie die Aufgabe zufällt, die Wirksamkeit, die Faktizität, die Rechtswirklichkeit zu beobachten und zu beschreiben. Die Ursachen für die Reserviertheit und die Ablehnung der Juristen gegenüber der Rechtssoziologie und eben auch Rechtsforschung liegen tiefer, zunächst einmal bei der politischen, insbesondere ideologieträchtigen Besetzung der gesamten Gesellschaftslehre ebenso wie der einzelner Bereiche (etwa mit sog. BindestrichSoziologien), vor allem in der Grundeinstellung, alles das, was gestaltbar schien, gestalten zu wollen und zu sollen, auch und insbesondere durch das Recht. Das hängt also an der grundsätzlichen Ausdeutung des Rechts als ,social engineering' 8 , als Lenkungsmittel der Gesellschaft. Die hauptsächlichen Streitpunkte zwischen Dogmatikern und Rechtssoziologen beruhen auf Mißverständnissen. Das zweite, jüngere ist den Dogmatikern zuzurechnen; das war das Thema, das eben behandelt wurde: Der den Rechtssoziologen angelastete Versuch der Abwendung vom Sollen in der Rechtswissenschaft als die beabsichtigte Umstrukturierung zu einer Seins-Wissenschaft, fand seinen Niederschlag in so manchen unqualifizierten und unberechtigten Äußerungen - so das ältere MißVerständnis in der gänzlich falschen Einordnung der sog. Freirechtslehre (Eugen Ehrlich) 9 . Dabei hat Ehrlich nur Rechtslücken durch das gelebte Recht ausfüllen wollen. Der berühmte § 1.2 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, die größte Stütze der Rechtssoziologie und der Gesetzgebungslehre, und die Entwicklung der Interessens- und Wertungsjurisprudenz mag hier mildernd gewirkt haben. Dazwischen stand der Vorwurf der konservativen Rechtswissenschaft an die Rechtssoziologie, sie versuche eine ,Knochenerweichung' des Rechts. 1 0 Dagegen war die Erwiderung: ,Rechtssoziologie hat mehr zu bieten als Reflexionen am Feierabend' 11 äußerst zurückhaltend. Alle diese Mißhelligkeiten haben das Verhältnis zwischen den Rechtswissenschaften im traditionellen Sinne und Rechtssoziologie enorm belastet 12 , sind aber
der Medizin in verschiedene Fachbereiche hat deren Wirksamkeit eher befördert als gehemmt. Gegen diese wissenschaftliche Abtrennung und Eigenständigkeit der Faktizität des Rechts, also die durch Rechtssoziologie beobachtete Rechtswirklichkeit, wird weniger Einspruch erhoben. 8 Roscoe Pound , Sociology of Law, 1945. 9 Vgl. Manfred Rehbinder, Rechtssoziologie, 1. Aufl., S. 58 f. Er bezeichnet es rundweg als wissenschaftlichen Skandal, wenn Juristen Eugen Ehrlich wegen der Thematisierung des »lebendigen Rechts' immer wieder vorwerfen, das würde gleichbedeutend sein mit Entscheiden contra legem, also im Kernpunkt seiner Lehre, den Kernpunkt seines Erkenntnisinteresses, das ,lebende Recht', einfach ignorieren. 10 Norbert Achterberg, Rechtstheoretische Grundlagen einer Kontrolle der Gesetzgebung durch die Wissenschaft, in: Rechtstheorie 1970, S. 147. 11 Karl-Dieter Opp, Soziologie im Recht, 1973, Vorwort. 12 Siehe dazu Edgar Michael Wenz (Hrsg.), Wissenschaftsgerichtshöfe - Mittler zwischen Wissenschaft, Politik und Gesellschaft, 1983, S. 75 ff.
Einführung in die theoretische Rechtssoziologie
69
mittlerweile doch weitgehend ausgeräumt, jedenfalls dort, wo sich die Rechtssoziologie auf ihr eigenes und eigentliches Tätigkeitsfeld beschränkt, nämlich die Beobachtung und Beschreibung des Rechts. Eine der vornehmsten Aufgaben ist dabei, die Wirksamkeit des Rechts i m Auge zu behalten, also die Effektivität der Normen durch Beobachtung der Rechts Wirklichkeit zu kontrollieren. Es geht um nichts anderes als um die Evaluierung von Gesetzen. Dieses Thema ist recht alt, ohne daß sichtbare Fortschritte erzielt worden wären. Dabei lebt der Staat, konkret also der Gesetzgeber, davon, daß seine Gesetze wirksam sind, ob und inwieweit den gewünschten Zweck und die ins Auge gefaßten verschiedenen Ziele herbeizuführen vermögen; oder ob man eines Tages feststellen muß, daß man total unerwünschte, contraproduktive Entwicklungen ausgelöst hat. Es geht also genau genommen um eine Rationalisierung der Gesetzgebung; alle die hier vorgetragenen Gründe sind theoretisch nicht zu bestreiten, sie sind schlicht und einfach vernünftig. Die Praxis der empirischen Rechtsforschung oder empirischen Sozialforschung, insbesondere Rechtstatsachenforschung, hat Manfred Rehbinder kurz gefaßt und leicht lesbar dargestellt. 13 Das Problem der Rechtsforschung könnte die Meßbarkeit sein. Für die Forschung ist das probateste und am wenigsten angreifbare Mittel die Messung. Deshalb ist das erste Ziel, alles meßbar zu machen, um dann die Ergebnisse zu erfassen 1 4 . U m die Meßbarkeit zu erreichen, muß man Wege suchen, alles das herauszufiltern, was Tatsache ist. Bei einer zu differenzierten Rechtsforschung werden die Probleme an der Tatsachenforschung hängenbleiben, zunächst einmal, was Tatsache ist und wie man sie festmacht, und dann, wie man sie in einen meßbaren Raster bringt.
I I I . Bedenken gegen die Sozialforschung? Die Bedenken gegen die empirische Sozialforschung, soweit sie Meinungen statt Fakten untersuchte, die wohl früher verständlich waren, sind dann immer mehr zurückgetreten. Der Markt- und Käuferforschung ist neben der Wahlforschung auch zu verdanken, daß die Instrumente der empirischen Soziologie sich enorm verfeinert und verbessert haben. Selbst die Meinungsforschung gilt heute in vielen Bereichen als unverzichtbar. Jedenfalls kommt die Wirtschaft ohne Markt- und Käuferforschung nicht mehr aus. Sie wird betrieben nicht nur vor Produktionsaufnahme neuer 13 Manfred Rehbinder, Rechtssoziologie, 3. Aufl., 1993, S. 67 ff. Er unterteilt die Methoden der Rechtstatsachenforschung 4 nach Untersuchungsgegenstand, Untersuchungsanordnung und Untersuchungstechnik. 14 Das war auch die Forderung von Galileo Galilei.
70
Edgar Michael Wenz
Waren, sondern auch und erst recht hinsichtlich der Akzeptanz nach der Markteinführung. Es ist kein Grund zu erkennen, warum die Politik dieses probate Mittel nicht auch einsetzen sollte zur Kontrolle der Akzeptanz der Gesetze, deren Befolgung und deren Wirkung. Nun stellt sich die Frage, wie weit diese Erkenntnisse, die neuen Methoden und Techniken geeignet sind, diese Aufgabe zu erfüllen. Mangels konkreter Erfahrungen ist man auf eine theoretische, genau genommen spekulative Beurteilung angewiesen. Solange keine nachprüfbaren Ergebnisse vorliegen, können die Verneiner nicht weiterhin ihre Position pauschal und ohne vertiefte Begründung verteidigen, ebenso wenig freilich wie die Verfechter einer solchen empirischen Rechtsforschung sie als unverzichtbar sehen dürfen. Wenn die empirische Rechtsforschung Akzeptanz und vor allen Dingen Wirksamkeit von Gesetzen kontrollieren soll, dann muß sie sich selbst dem gleichen Kontrollverfahren stellen.
IV. Die Forschungsmethodik Die empirische Sozialforschung i m Rechtswesen, bedeutender Zweig der praktischen und operationalen Rechtssoziologie - Hauptanliegen: Effektivitätsforschung i m Hinblick auf Gesetzgebungslehre und Implementation von Gesetzen - , ist sicherlich nicht das einzige, möglicherweise noch nicht einmal das wichtigste Feld der Rechtssoziologie, jedenfalls aber viel wichtiger, als sie bisher Aufmerksamkeit und Pflege hat erfahren dürfen. Es fehlt ihr allerdings eine rechtstheoretische Voraussetzung, auf der sie aufzubauen vermag, also eine soziologische Rechtstheorie, die die Bedürfnisse der empirischen Sozialforschung i m Rechtswesen abdeckt. Das klare Bedürfnis der empirischen Rechtsforschung - sei es nun Rechtstatsachenforschung 15 (RTF) oder Tatsachenrechtsforschung - ist ein theoretischer Ansatz, nach welchem das ,Abstraktum Recht' beobachtbar und möglichst meßbar und zählbar gemacht werden kann, so vorrangig für die Feststellung der Effektivität der Rechtsnormen, die Theodor Geiger ins Blickfeld gerückt hat 1 6 . Ohne eine festgelegte Methode sind Messungen der Effektivität und folglich die aus ihr fließenden Konsequenzen, insbesondere die Zielkontrolle von Gesetzesvorhaben, eine analytische Arbeit - mit dem Ziel der Operationalisierbarkeit des Rechtsbegriffs 15
Arthur Nußbaum hat die Rechtstatsachenforschung begründet (Hrsg. Manfred Rehbinder, 1968); Peter Noll hat in seiner,Gesetzgebungslehre', 1973, S. 69 ff., festgestellt, daß das Recht auch rechtsrelevante Tatsachen schafft (Tatsachenrechtsforschung). Auch die Erkenntnisse von Georg Jellinek, Allgemeine Staatslehre, 1905, der »Normativen Kraft des Faktischen' ist längst zum Klassiker geworden. 16 Einen interessanten Querschnitt durch das Werk von Theodor Geiger bietet der Tagungsband zum Symposion anläßlich seines 100. Geburtstages an der TU Braunschweig, Anm. 5.
Einführung in die theoretische Rechtssoziologie
71
und Besichtigung des Rechts als Tatsachenzusammenhang - nur abschätzbar, aber keineswegs mit Methoden nachvollziehbar, wie sie Wissenschaftlichkeit verlangt.
V. Die Reaktionstheorie als soziologische Rechtstheorie Die Reaktionstheorie, die hier eingeführt werden soll, zielt Recht und Rechtsleben in ihrer Gesamtheit an. Die Zwangs-, aber auch die Sanktionstheorie decken nur Straf- und Schuldrecht vollkommen ab, verleiten aber zum Denkansatz, daß Recht nichts anderes sei als Abwesenheit von Unrecht, also eine ,negatio negation s ' (Hegel) 1 7 . Diese sehr nüchterne und gewiß angreifbare Definition von Recht als Abwesenheit von Unrecht muß den Vorwurf des Zynismus dulden; sie ist auch eher dem Rechtsrealismus zuzurechnen 18 . Aber eben diese Definition beruht auf der theoretischen Grundlage der Zwangs- und der aus ihr erwachsenden Sanktionstheorie. Und in der Tat, man kann mit dieser Rechtstheorie nicht alle Felder des Rechts erfassen, schon gar nicht aus der Perspektive der praktischen Rechtssoziologie die breiten Bereiche des Zivilrechts und insbesondere des Verwaltungsrechts mit den vielen Leistungs- und Maßnahmegesetzen 19 , ebenso wenig wie die Akte der Freiwilligen Gerichtsbarkeit beobachten. Nicht nur der Normbruch, sondern auch die tatsächlichen und rechtlichen Voraussetzungen für die Gewährung von Vergünstigungen und Prämien wie zu Rechtsgestaltungen, Feststellungen und Beurkundungen stehen zur Prüfung an. Die bekannten soziologischen Rechtstheorien 20 vermögen diese Leistungen nicht zu erbringen. So zeigt sich, - daß die Anerkennungstheorie (Ehrlich, Kantorowicz, Fuchs) brauchbar ist für die genetische Rechtssoziologie und Rechtsgeschichte, auch Nutzen bringen kann für die Rechtsdogmatik, selbst für die Rechtsphilosophie, kaum aber für die praktische und empirische Rechtssoziologie; - daß die Zwangstheorie (Durkheim, Weber, Llewellyn, Geiger) an der Einengung auf Zwang, also Durchsetzbarkeit, leidet, die schon häufig angegriffen wurde 17 Werner Maihof er, Die gesellschaftliche Funktion des Rechts, in: Die Funktion des Rechts in der modernen Gesellschaft, Jahrbuch für Rechtssoziologie und Rechtstheorie, Bd. 1, 1970, S. 11 ff., den auch Manfred Rehbinder, Anm. 3, S. 147, zitiert. Beide Autoren sehen freilich in der Reaktion des Rechtsstabs auf den Normverstoß eher eine erneute Affirmation des Rechts. 18 Geiger bezeichnet seine Rechtssoziologie als ,soziologischen Rechtsrealismus4, in: Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts (1947a), Nachdruck 1987, S. 329. 19 Die Leistungsverwaltung im sozialen Rechtsstaat hat ohnehin die Eingriffsverwaltung an Bedeutung überholt; so jedenfalls Konrad Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 18., erg. Auf., 1991, S. 85 ff. 20 Thomas Bechtler, Der soziologische Rechtsbegriff, Schriftenreihe zur Rechtssoziologie und Rechtstatsachenforschung, Bd. 41, 1977, S. 35 ff.
72
Edgar Michael Wenz meist mit den Paradebeispielen Völkerrecht und positiven Sanktionen - und so für das Erkenntnisinteresse der Rechtsforschung zu kurz greift;
- daß allerdings die aus der Zwangstheorie gewachsene (und meist mit ihr auch behandelte) Sanktionstheorie eine Brücke schlägt zu der einzuführenden Reaktionstheorie; die Sanktionstheorie hebt nicht nur auf die Gesetzesstruktur ab, sondern auf Maßnahmen, die aus dem Zwang des Gesetzes fließen; - daß die strukturell-funktionale Rechtstheorie (Luhmann) 2 1 die Wirkungen des Rechts mit dem Blick auf seine Struktur und auf sich selbst als System und im Zusammenwirken mit anderen gesellschaftlichen Systemen beobachtet, also der empirischen Sozialforschung soviel wie nichts bringt; - daß die funktionale Rechtstheorie (Krawietz, Merton, Malinowski) zwar die Frage nach der sozialen Wirklichkeit des Rechts stellt und dabei auf seine gesellschaftlichen Funktionen abhebt, aber dafür immer schon einen Rechtsbegriff voraussetzt, zu dessen Klärung diese Überlegungen einen Beitrag leisten sollen; - daß die Rechtsstabstheorie (Röhl) und weitere daraus abgeleitete Theorien (Gerichtstheorie, Verfahrenstheorie) alle vorhergehenden Theorien ersetzt, die auf einen Rechtsstab aufbauen; sie deckt sich auch mit der hier thematisierten Reaktionstheorie i m ersten Anschein, gibt sich aber mit der Definition der Norm zufrieden. Sie vermag auch die erwarteten Leistungen für die empirische Sozialforschung nicht so zu erbringen wie eben die Reaktionstheorie, weil diese nicht den Rechtsstab und seine Mitglieder als Institution in den Mittelpunkt deren Interessen stellt, sondern das, was sie tun, oder genauer: wie sie i m Rahmen ihrer Kompetenzen i m vorgeschriebenen Verfahren reagieren (sie!).
VI. Der Rechtsstab Die zentrale Figur der Reaktionstheorie ist nun jene Institution, die zu reagieren' hat: Der Rechtsstab 22 . A u f ihn hebt die Reaktionstheorie zunächst einmal ab, weil sein Handeln beobachtbar ist. Sein Tätigwerden genügt den empirischen Evidenz- und Beobachtungskriterien. Wenn der Rechtsstab im Rahmen seiner hoheitlichen Kompetenzen tätig wird und auf dem ihm vorgeschriebenen Wege, wozu die ihm aufgegebene Form wesentlich gehört, hat er Fakten geschaffen, die dem empirischen Rechtsforscher Material zur Bewertung an die Hand geben. Hier ist also nun der Rechtsstab ins Blickfeld getreten, der - in seiner Funktion als Erzwingungsstab, die ihm die Zwangstheoretiker zuweisen - nur tätig wird, 21 Luhmann, Anm. 4, Bd. 1, S. 105. 22 Dieser Begriff wird Max Weber zugeschrieben (so beispielsweise Klaus F. Röhl, Rechtssoziologie, 1987, S. 35), obwohl Weber selbst den Begriff nicht gebraucht, statt dessen ,Erzwingungsstab' und ,Verwaltungsstab' (Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, hrsg. v. J. Winkelmann, 5. Aufl., Nachdruck 1985, S. 17 f., S. 26, aber auch ,Zwangsapparat' (ebd., S. 182).
Einführung in die theoretische Rechtssoziologie
73
wenn das Recht verletzt ist; er hat sich dann mit dem ,Fair zu beschäftigen, er hat den ,Streitfall· zu erledigen 2 3 , das heißt also: Er hat das Recht wiederherzustellen, Schaden wiedergutzumachen und gute Ordnung einkehren zu lassen , die »restitutio in harmoniam et eunomiam' 2 4 zu leisten. Dagegen wird von den Reaktionstheoretikern das Handeln des Rechtsstabs in allen Bereichen des Rechtslebens beobachtet, freilich nur insofern bewertet, als das Tätigwerden des Rechtsstabs Rechtsakte setzt - gleichgültig nun, ob der Polizeibeamte verwarnt, der Richter urteilt, der Oberinspektor Sozialhilfe gewährt, der Regierungsbaurat einen Bauplan genehmigt oder der Bundespräsident einer Gesetzesvorlage zustimmt. Immer und überall ist der Rechtsstab tätig geworden, hat er reagiert: auf Missetat, auf Anrufung und auf Antrag. Folgerichtig unterscheidet Geiger, i m Anschluß an Karl Olivecrona zwischen Aktionsnormen als Handlungsnormen gegenüber den Rechtsadressaten und sekundären Reaktionsnormen, die an den Rechtsstab gerichtet sind 2 5 . Das Beobachtungsfeld der Reaktionstheorie ist also nicht der Rechtsstab als solcher, seine Existenz, Kompetenz und Ausstattung; vielmehr ist lediglich das Handeln der Mitglieder des Rechtsstabs von definitorischer Bedeutung. Nur die rechtmäßig getätigten Akte finden das Interesse der empirischen Rechtsforschung, nur sie sind meß- und zählbar. Hier zeigt sich der - nicht vernachlässigbare - Unterschied zur Rechtsstabstheorie, die man also gewissermaßen als objektiv-statisch und deshalb wenig nutzbar bezeichnen kann, die Reaktionstheorie dagegen als aktiv-dynamisch mit Nutzen für die Rechtsforschung. In der rechtssoziologischen Literatur taucht der Begriff Reaktion erstmals bei Theodor Geiger a u f 2 6 , der dafür das Kürzel r eingeführt hat. Geiger geht es auch bei der Betrachtung der Effektivität des Rechts darum, die Normativität eines Verhaltens beobachtbar zu machen 2 7 . Unter dem Aspekt der Beobachtbarkeit sind rechtlich relevante Realakte, Entscheidungen und Sanktionsverhängung - also Reaktionen ganz allgemein - gleichwertig. Die Geiger eigentlich bisher nachgesagte Verengung auf die Zwangstheorie kann also aufgebrochen werden zur 23
Dazu auch Karl N. Llewellyn, Recht, Rechtsleben und Gesellschaft, hrsg. v. M. Rehbinder, 1977, S. 45 ff. 24 Man mag entgegenhalten, daß diese aus dem antiken, insbesondere hellenischen Verständnis des Rechts stammende Formulierung eher die gute Ordnung als bleibendes Weltverständnis im Blick hat, während die moderne Auffassung Recht als etwas sich Entwickelndes begreift, eher den Rechtsspruch, also das Recht fortschreibt. Man muß ganz und gar nicht der hier vertretenen Meinung beitreten, daß über den bereinigten Streitfall die gute ,alte' Ordnung - wieder - eingeführt wird. Die wiederhergestellte Ordnung kann dann durchaus ,neu' sein, sie braucht nicht haargenau mit der alten übereinzustimmen; die ,gute Ordnung' kann zu jeder Zeit neu definiert werden. 25 Theodor Geiger, Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts 1947, durchgesehen und hrsg. von Manfred Rehbinder, S. 104. In der Koppelung mit einer sekundären Reaktionsnorm entsteht erst die Rechtsnorm im juridischen Sinne. Theodor Geiger, Anm. 25, S. 31, 109 ff. 27 Erhard Blankenburg, Über die Unwirksamkeit von Gesetzen, in: Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie (ARSP), Bd. 63, 1977, S. 31 ff.
74
Edgar Michael Wenz
Reaktionstheorie, ohne den Zwischenschritt über den Begriff der Sanktionstheorie gehen zu müssen. Die Reaktionstheorie wurde von Rehbinder in die Studienliteratur eingeführt 2 8 . In der Literatur erstmals aufgetaucht ist der Begriff bei Peter Frey 2 9 : Nach seiner Meinung ist die ,Antwort des Apparats auf das Handeln des Einzelnen . . . ein Merkmal des Rechts, gleichgültig, ob diese Antwort positiv oder negativ ausf ä l l t 4 . 3 0 Er formalisiert den Vorgang, entkleidet ihn des Inhalts. Die Operationalisierung schafft einen konkreten, für die empirische Rechtsforschung tauglichen Begriff. Frey entwickelt die Reaktionstheorie als soziologischen Rechtsbegriff. Sein Anliegen ist in erster Linie, das Verwaltungsrecht mit in die Definition einzubeziehen 31 , nicht nur Straf- und Schuldrecht. Allerdings verzichtet er in seiner Version auf eine Abgrenzung des staatlichen Rechts zu anderen Rechtserscheinungen, also den sozialen Normen 3 2 . Untersuchungen zum Rechtspluralismus müßten also noch angestellt werden. Wenn wir Geiger folgen, kommt es i m Zusammenhang mit der Effektivität der Norm nicht auf die Zwangsandrohung an, die über der Norm schwebt, sondern auf ein konkretes, das heißt also effektives und beschreibbares Handeln des Rechtsstabs - gleichgültig nun, ob in der Verfolgung des Delikts, als justizielle Tätigkeit oder Verwaltungshandeln. Die Reaktionstheorie bringt jedenfalls durch den festzustellenden Normbruch und die Reaktion des Rechtsstabs einen zählbaren Fakt; das gilt ebenso für jeden Antrag auf ein Tätigwerden des Rechtsstabs. Das ist die Rechtswirklichkeit, sie ist also meßbar geworden.
VII. Die theoretische Basis der Reaktionstheorie Man muß bei derartigen Überlegungen sich immer wieder vor Augen führen, daß es hier nicht um philosophische oder gar transzendentale Betrachtungen des Rechts geht, sondern lediglich um die theoretische Grundlage der empirischen Rechtsforschung. Danach und nur danach soll das Instrumentarium vorbereitet werden.
2« Rehbinder, Anm. 9, S. 97 ff. 29 Peter Frey, Rechtsbegriff in der neuen Rechtssoziologie. Diss. Univ. d. Saarlandes, 1962, S. 160 ff. 30 Ebd., S. 196 ff. 31 Die hier einzuordnende Implementationsforschung richtet sich hauptsächlich an Verwaltung (und Politik), vorwiegend wegen eines Vollzugsdefizits, greift aber auch zur Rechtssprechung und Gesetzgebung über - ein weiterer Beweis, daß Rationalisierung der Rechtsanwendung ein gemeinsames Anliegen aller Zweige ist. 32 Frey, Anm. 29, S. 185, 199.
Einführung in die theoretische Rechtssoziologie
75
Wenn man den Zweck dieser Theorie, die Rechtsforschung zu ermöglichen, und das Ziel i m Auge hat, qua Gesetzgebung 33 den Rechtsstaat und das Postulat der Gerechtigkeit zu fördern, ist diese vorgeschaltete Annahme tragfähig, zumindest tolerierbar. Es sind auch keine sprachtheoretischen Bedenken zu erkennen. Begrifflich (philologisch und etymologisch) sind die Worte Reaktionen und Sanktionen klar definiert, und dies in dem hier verwandten Sinne 3 4 ; der tägliche Sprachgebrauch stimmt überein. Die Reaktion setzt lediglich einen Impuls voraus, der dann als causa eine Reihe von Folgen nach sich zieht, eigentlich mit der Strenge der Naturwissenschaften, wo auch dieser Begriff am meisten und am klarsten definiert gebraucht wird. Die Sanktion - durch ebenso negative wie positive Wirkung ohnehin vieldeutig - hat dagegen mehr einen ,intentionalen Charakter' 3 5 , sie soll und w i l l ein Verhalten bewirken. Sie gehört in das ,Befehlsmodell des Rechts', zur ,imperativen Theorie' 3 6 . So ist also schon begrifflich die Reaktionstheorie wesentlich weiter und umfassender als jede andere. Sie löst auch keine Diskussionen aus, ob Verwaltungsakte erfaßt werden oder ob und wie etwa die Maßnahmen und Entscheidungen der Freiwilligen Gerichtsbarkeit einzuordnen sind. Jedenfalls: Wenn der Bauplan genehmigt, die Erbfolge festgestellt und die Ehe als geschlossen erklärt wird, hat im Verständnis der Reaktionstheorie der Rechtsstab agiert, das Rechtsstabshandeln ist nach außen getreten. Es ist evident, zähl- und meßbar. Während die Sanktionstheorie sich stützt auf die Drohung mit Nachteilen bei Nichtbefolgen der Norm oder lockt mit Belohnung beim Erreichen von Vorgaben 3 7 , verzichtet die favorisierte Reaktionstheorie nicht nur auf die Kriterien von Drohung und Verlockung; sie geht auch nicht zwingend einher mit der Auffassung, daß i m soziologischen Sinne Recht erst entsteht, wenn geschehenes Unrecht erkannt und bekämpft w i r d 3 8 ; dem Ausgangspunkt der Zwangstheorie. Sie teilt auch nicht wie die Sanktionstheorie die implizite Vorstellung eines simplifizierenden behavioristischen Lernmodells. Die Reaktionstheorie hebt lediglich darauf ab, daß der Rechtsstab reagiert. Insofern greift Rehbinders Vorschlag der Erweiterung der Zwangstheorie zur Reaktionstheorie 39 nicht weit genug. Die Reaktionstheorie verdient theoretische Eigenständigkeit.
33
Edgar Michael Wenz, Von der Rechtsforschung zur Gesetzgebung, in: Tagungsband zu Theodor Geiger, Anm. 5, S. 261 ff. 34 So auch Duden, Das Fremdwörterbuch, ζ. B. 3. Aufl., 1974. 3 5 K. F. Röhl, Rechtssoziologie, 1987, S. 204. 3 6 K. F. Röhl, ebd., S. 209. 37 Siehe dazu insbesondere Röhl, ebd., S. 204 ff. Für ihn ist die Sanktion so wesentlich für die Struktur der Norm, daß bei der Behandlung der soziologischen Rechtsbegriffe, S. 212 ff., der Begriff der Sanktionstheorie sich nicht findet. 38 Siehe dazu Strempel, Anm. 2, und Luhmann, Anm. 4, die Theorie der ,Affirmation des Rechts' durch Bekämpfung des Unrechts. 39 Rehbinder, Anm. 9, S. 97 ff.
76
Edgar Michael Wenz
Die Kriminologie befaßt sich mit Untat und Missetäter; sie kann freilich nicht die Normbefolgung messen, also alle, die rechts fahren und links überholen, ebenso wenig wie die zivilistische Rechtsforschung ordnungsgemäß erfüllte Verträge. I m kriminellen und deliktischen Rechtsbereich, Strafnormen i m Verwaltungsrecht selbstverständlich eingeschlossen, ist dagegen die Messung relativ einfach: Immer wenn der Rechtsstab tätig geworden ist, hat man einen zählbaren Vorgang. Nur die Quote, also die quantifizierbare Bezugsgröße, läßt sich mangels Verhältniszahl in den meisten Fällen, wenn kein Totum zu erkennen ist, rechnerisch nicht ermitteln. Die Rechtsforschung hat es relativ leicht bei der Erfassung der Akte i m Verwaltungsrecht und in der Freiwilligen Gerichtsbarkeit und erst recht bei lediglich konstitutiven Akten etwa des Standesbeamten bei der Eheschließung. Sie braucht nur die in diesen Bereichen gestellten Anträge festzustellen, die stattgegebenen ebenso wie freilich auch die abgewiesenen. Die Einbeziehung dieses Normenkreises zeigt überaus deutlich, daß der Rechtsstab tätig wird, wenn man ihn i m Rahmen der Gesetze anruft. Es kann festgehalten werden, daß die Reaktionstheorie i m hier verstandenen Sinne wertvoll ist für den theoretischen Unterbau der Rechtsforschung. Diese findet zunächst ihren Niederschlag in der Rechtspflegestatistik 40 , die es in Deutschland schon seit 1879 gibt und die dann später 1968 nochmals ausgebaut wurde. Sie erfüllt damit eine wichtige Aufgabe des Rechts, die Rechtswirklichkeit zu erkennen und auch quantitativ die Effektivität der Normen zu erfassen. Ob bei der aktuellen Rechtslage wirklich alle wichtigen und interessanten rechtsrelevanten Vorfälle aufgearbeitet und richtig und ausreichend verwertet werden, ist eine andere Frage, die zur Rechtspolitik und vor allem zur Gesetzgebungslehre gehört. Die von Geiger aufgezeigte Problematik der Wirksamkeit einer Norm bei Leistungsgesetzen - etwa ein normativer Anspruch, der nicht geltend gemacht worden ist - ist mit der Reaktionstheorie für die empirische Rechtssoziologie aufgelöst. Der Rechtsstab brauchte nicht tätig zu werden, somit ist die Frage irrelevant geworden, oder genauer: geblieben 4 1 . Die Reaktionstheorie ist somit eine eigenständige Theorie, nicht nur eine Variante der Sanktions- oder gar der Zwangstheorie. Sie ist mit denkbaren Mißverständnissen nicht behaftet. Die Reaktionstheorie hebt lediglich darauf ab, daß der 40 Sinn dieser Arbeit ist es auch, stärkere statistische Aktivitäten anzuregen mit dem Blick auf rechtspolitische Anpassungen und/oder Veränderungen. Die Rechtspflegestatistik ist ein guter Anfang, auch wenn sie nur wenige Teilbereiche erfaßt und in erster Linie justiziellorganisatorischen Zwecken dienen soll. Auf keinen Fall ist es Aufgabe der Rechtspflegestatistik zu erkennen, welche Normen nun effizient sind, sondern nur, wie häufig effiziente Normen tatsächlich angewandt wurden und inwieweit die Rechtspflege damit belastet war. 41 In rein theoretischer Sicht wäre also im Extremfalle, wenn keiner der Berechtigten einen Antrag stellt, das Leistungsgesetz zwar ein formelles Gesetz, aber nicht Recht, oder es präziser auszudrücken: keinen effektive und relevante Norm; sie bleibt auch nicht zählbar und somit uninteressant.
Einführung in die theoretische Rechtssoziologie
77
Rechtsstab agiert / reagiert (hat); somit ist sie am ehesten Fortführung - oder auch Operationalisierung - der Rechtsstabstheorie. Die Reaktionstheorie braucht auch keinen Rechtsbereich auszusparen. Sie wirft die Frage auf, dem monistischen (etatistischen) oder dem pluralistischen (sozialen) Rechtsbegriff folgen zu sollen. Nachdem das Kriterium ein kompetenter Rechtsstab ist, aber den Rechtsvollzug nicht zur Bedingung macht, könnte sie streng genommen auch für das Völkerrecht 4 2 taugen. Evidente völkerrechtliche Akte, so beispielsweise Protestnoten bei Vertragsbruch, könnten für die Meß- und Zählbarkeit durchaus genügen. Erst recht könnte man das Kirchenrecht unter dem Blickwinkel der Reaktionstheorie betrachten. Man kommt dann zu einem bejahenden Ergebnis, weil die Kirchenorganisation Rechtsstäbe hat, die auch i m Rahmen deren Kompetenzen und den ihnen vorgegebenen Verfahrensnormen reagieren. Die gleichen Überlegungen gelten auch für das Verbandsrecht, das weitgehend vom Gesetzgeber autorisiert oder von der Rechtsprechung manifestiert worden ist; dort sind die Kompetenzen exakt geregelt. Die Funktionäre haben die Rolle des Rechtsstabs, der nach vorgegebenen und nachprüfbaren Regeln arbeitet, übernommen 4 3 Das Rechtssprachgefühl trügt also nicht, wenn es die Ordnungen der Zwischenstaatlichkeit der Kirchen und der großen Verbände als Völker recht, Kirchenrec/tf und Verbands recht nennt.
VIII. Die Praxisnähe der Reaktionstheorie Bei der Prüfung ihrer Funktionen in rechtspluralistischer Sicht des Rechts greift die Reaktionstheorie nur, soweit soziale Normen über Option und Legislation normativen Rechtscharakter erlangt haben. Dann kann diese Frage nicht strittig sein. Die sozialen Normen allerdings in ihrer Gesamtheit lassen sich deswegen nicht erfassen und umfassen, weil die Voraussetzung des Rechtsstabs fehlt. 4 4 Die
42
Hier freilich fehlt der definitorisch unverzichtbare Rechtsstab im Sinne eines Erzwingungsstabs, jedenfalls solange, als keine supranationalen Institutionen mit Durchsetzungsbefugnis existieren. Auch die Vorstellung eines ,ius cogens' im Sinne einer vernunftorientierten juristischen Argumentation, die ein stabiles Verhalten erwarten läßt (siehe Stefan Kadelbach, Zwingendes Völkerrecht, 1993) hilft in praxi wohl kaum weiter. 43 Das Verbandsrecht hat mittlerweile, auch ohne gesetzliche Autorisation oder richterliche Option, mittelbaren Rechtscharakter erlangt; es kann heutzutage Existenzen vernichten; siehe dazu das Spruchrecht insbesondere der Sportverbände, deren verhängte Sperren tiefgreifende materielle Folgen haben können (und sollen). Das sog. Bosman-Urteil 1996 hat vor allen Dingen Bewegung in diese Frage sowohl theoretisch wie praktisch gebracht. 44 ,Erst der Rechtsstab ist es, der eine Gruppenordnung zur Rechtsordnung macht', Rehbinder, Anm. 9, 1977, S. 97. Röhl gebraucht die Begriffe ,ordnungstragende Gruppe', allerdings auch ,Sanktionssubjekte', gerät aber damit ,in die Nähe oder gar mitten in den Bereich des Rechts', ebd., S. 208.
78
Edgar Michael Wenz
Reaktion von Gruppenmitgliedern, die bei abweichendem Verhalten vom Spott bis zum Ausschluß aus der Gruppe rechnen kann, genügt nicht; die Gruppe oder die Autorität der Meinungsführer der Gruppe können den Rechtsstab als unverzichtbares Element nicht ersetzen. 45 Wenn man sich der herrschenden Meinung anschließt, daß der Rechtsbegriff nicht ausufern und die Nähe des positiven Rechts nicht verlassen darf, sollten soziale Normen gar nicht erst einbezogen werden. Auch ist der Rechtsstab i m herkömmlichen positivistischen Sinn zu definieren. Er konzentriert sich also auf jene, die die staatliche Rechtsmaschinerie in Gang setzen, in Gang halten und im Rechtswege gefundene Entscheidungen durchsetzen, also die law-men Llewellyns und die Sanktionssubjekte Röhls. Die Kompetenzen und Verfahrensnormen (sekundäre Normen) sind genau angegeben. Eine Abgrenzung der Reaktionstheorie gegenüber der Rechtsstabstheorie ist eigentlich nicht notwendig, weil die Reaktionstheorie nach dieser Auffassung zu den Rechtsstabstheorien gehört, aus ihr abgeleitet ist, allerdings über diese hinausführt. Die Rechtsstabstheorie bildet den Überbegriff, der vielfältige, zum Teil auch disparate Theorien zusammenfaßt, sich über diesen Begriff auch strukturieren läßt; das gilt auch für das Kriterium des Rechtsstabs, in einem Ordnungspluralismus Rechts- und andere Sozialordnungen voneinander abzugrenzen. Aber für die Reaktionstheorie ist nicht die bloße Existenz des Rechtsstabs entscheidend, und darauf kommt es an, sondern dessen Handeln und Re-agieren. Der Rechtsstab ist in der Reaktionstheorie gewissermaßen eine objektive Bedingung der Möglichkeit. Es ist also für die Reaktionstheorie, anders als bei der Rechtsstabstheorie, völlig irrelevant, ob der Rechtsstab beispielsweise bei einer Normverletzung hätte tätig werden können, sollen oder gar müssen. Ob er reagiert (hat), das ist entscheidend. Es geht der Reaktionstheorie darum, aufgrund von evidenten Tatsachen die Tatsachenzusammenhänge festzuhalten und zu erkennen, was zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer bestimmten Gesellschaft Recht ist. Auch wenn die Rechtsstabstheorie als unabdingbare Voraussetzung der Reaktionstheorie wichtige rechtstheoretische Leistungen erbringt, braucht man keinesfalls der Meinung zu sein, eine der beiden Theorien, dann eben die jüngere, sei verzichtbar. Die Reaktionstheorie ist unverändert eigenständig, weil sie den entscheidenden Schritt weitergeht, die Effektivität der Norm dediziert zu beobachten - und bei Anforderung eben zu notieren, zu registrieren und auszuwerten. Zusammenfassend kann man also erkennen, daß für die Rechtsforschung kein einfacherer und vor allen Dingen sicherer Weg denkbar ist, als das Tätigwerden des Rechtsstabs und seine rechtlich relevanten hoheitlichen Akte zu notieren und auszuwerten. Auch wenn diese Gedanken unter der Prämisse standen, für die 45
Freilich führt das zur Erkenntnis, daß auch archaisches Recht diesen Namen jedenfalls dann verdient, wenn ein Mitglied der Gruppe (oder mehrere) als Rechtsstab anzusehen war, also in ihm zugeteilter Kompetenz beispielsweise Verhaltensweisen und Regeln durchgesetzt hat.
Einführung in die theoretische Rechtssoziologie
79
empirische Rechtsforschung ein theoretisches Fundament zu schaffen, bedeutet diese Einengung nicht, daß dieser soziologische Rechtsbegriff nicht auch umfassend gedacht und eingeführt wird. Eine Norm ist dann gültig und wirksam, wenn der Rechtsstab auf sie reagiert. Die Anwendung dieser Rechtstheorie in der Praxis wird die Arbeit der Rechtsforschung ermöglichen, auf jeden Fall aber erleichtern. Die Ausarbeitung der relativ einfach zu erhebenden Daten wird, wo immer sie geschieht, keinen besonderen Aufwand an Zeit und Kosten erfordern. Dieses praktische Forschungsinstrument ist somit nicht nur effektiv, sondern auch effizient. M i t dieser Methode kann die Rechtsforschung relativ einfach und leicht arbeiten. Genau genommen braucht sie nur Statistiken zu führen, die nur richtig und sinnvoll angeordnet sein müssen. Das kann von vorneherein schon geschehen mit Blick auf die Rationalisierung der Gesetzgebung. Der Zugriff zu diesen Statistiken ist dann auch relativ einfach und kostenarm. Die Zugrundelegung der Reaktionstheorie und deren Praxis ist entscheidend, um die Erkenntnisse zu gewinnen, die gesucht sind. Das leistet sie, weil sie praktikabel ist, nicht nur effektiv, sondern auch kostenarm und somit effizient. Die Reaktionstheorie ist jedenfalls hervorragend, in ihrer nützlichen Praktikabilität geradezu einsam geeignet für die Beobachtung der konditionalen Normen. Die Reaktionstheorie ist wesentlich schwieriger anwendbar, wenn es um die Prüfung von Planungsgesetzen, also wirklichkeitsbeeinflussende Verwaltungsgesetze geht, zu denen die Stufen von Zwecksetzungen zum finalen Ziel führen. In unserer Zeit der bis zum Wohlfahrtsstaat ausgearteten Verband mit sozialen Verpflichtungen sind das wohl die häufigsten, für Staat und Volkswirtschaft dazu die teuersten und für die gesellschaftliche Entwicklung auch die gefährlichsten, weil bei dieser Rechtslage sehr schnell schädliche Tendenzen sich einschleichen können, so daß der Bundesrepublik schließlich eines Tages nichts anderes übrig bleibt, als zu einer ,Futterkrippe' (Röpke) für Interessenklüngel auszuarten. Ganz gewiß liegt das nicht i m Sinne der damaligen Gesetzgeber und insbesondere den Träger und Schöpfer des Sozialstaates, der Ordnung der sozialen Marktwirtschaft. Es ist bei solchen finalen Gesetzen freilich erforderlich, das Gesetz in verschiedene zeitliche Abschnitte zu zerlegen. Die einzelnen Schritte der Gesetzes Verfolgung müssen beobachtet und dann bewertet, zu diesem Zweck eben gemessen werden. Da solche Gesetze in aller Regel Zwecke definieren oder solche implizit und freilich auch erkennbar zeigen, muß das Augenmerk eben auf die Zwecke und die Zweckerreichung gerichtet werden. Dazu bedarf es eines zeitlichen Längsquerschnitts in der empirischen Sozialforschung. Ob dann die Zwischenpunkte, die abgetragen werden müssen, sich nach der Zeit (Datum) orientieren oder abgetragen werden können und müssen, wenn ein definierter Zweck erreicht ist, hängt vom Inhalt des Gesetzes ab, in vielen Fällen sicherlich auch von der Methodik des Rechtsforschers. Das hier vorge-
80
Edgar Michael Wenz
schlagene Verfahren, das auch ,Panel-Verfahren' 46 genannt wird, hat sich in der Sozialforschung bewährt. Diese zeitliche Längsschnittuntersuchung wurde nämlich in der Verbraucherforschung und in der politischen Meinungsforschung entwickelt und häufig eingesetzt. Dieser Bezug zeigt, daß es ebenso bei Gesetzen tauglich sein muß, die auf einen mittleren bis längeren Zeitraum eine bestimmte soziale Entwicklung beobachten. Bei den genannten Streckenpunkten, etwa nach Erreichung einer bestimmten Zeit oder eines akzentuierten Zwecks, kann dann die Reaktionstheorie greifen. Dort wird gemessen, dort ist es auch angebracht und tauglich. Bei einem Wohnungsbaugesetz könnte beispielsweise der erste Zweck und somit der erste Schritt sein, daß daran Interessierte sich melden und erfassen lassen, dann eine bestimmte Summe Geldes i m Haushalt bereitgehalten (freilich vorher beschafft) werden kann. Dann könnten auch die weiteren Zwecke des auf einen längeren Zeitraum angelegten Gesetzes greifen, um dann eines Tages die erwartete Anzahl von neugebauten Wohnungen vermelden kann, also die eigentliche Zielerreichung, das eigentliche Ziel, das der Gesetzgeber auf dem Weg zur angemessenen ,Wohngerechtigkeit' angestrebt hat.
IX. Zusammenfassung Die empirische Rechtssoziologie hält ein Instrumentarium bereit, und auch die Wissenschaftler und Helfer, die damit umgehen können, Gesetze ab ihres Erlasses zu verfolgen mit dem expliziten Interesse, die Wirkung des Gesetzes zu erkennen - also genau das, was eigentlich der Gesetzgeber braucht, um entweder dann unterwegs das Gesetz zu stoppen, zu ändern oder eben geeignete Schritte zu überdenken, das angestrebte Ziel so oder anders zu erreichen. So kann nicht nur die empirische Rechtssoziologie ein ganz wichtiger Helfer der Gesetzgebung sein. Sie muß deshalb bei den Überlegungen zur Gesetzgebungstechnik einbezogen werden. Alles andere wäre irrational. Der angezeigte Weg über die Rechtssoziologie ist dazu geeignet, die Forderung nach einer Rationalisierung der Gesetzgebung zu erreichen. Der Mut, auch einmal neue Wege zu gehen und eine gewisse Erprobungsbereitschaft sollte sich alsbald einstellen. Zeit wäre es.
46
Rehbinder, Anm. 13. Panel beteuert dabei diejenige Gesamtheit, die sich wiederholt zum gleichen Thema äußerst.
Zum 100. Geburtstag von Theodor Geiger: Der heutige Diskussionsstand zur Rechtssoziologie Theodor Geigers* Beim Symposium an der T U Braunschweig anläßlich des 100. Geburtstags Theodor Geigers - der Juristischen Fakultät der Universität Würzburg durch Studium, Examen und Promotion verbunden - nahm die Rechtssoziologie aus den vielen sozialwissenschaftlichen Arbeitsfeldern Geigers den breitesten Raum ein, aber auch seine Lehre von der vertikalen Schichtung, mit der er der Klassentheorie Karl Marx' entgegentrat. Er untersuchte auch die „Intelligenz" als gesellschaftliche Schicht, der die Aufgabe zufiele, die Macht zu kritisieren und oppositionelle Kräfte aufzubauen. In einem Vortrag beim RIAS Berlin hat er schon 1950 die behauptete Verbindung zwischen Marxismus und Intelligenz als gescheitert bezeichnet. Während seines schwedischen Lebensabschnitts in Uppsala setzte er sich mit dem dort vertretenen theoretischen Wertnihilismus auseinander, dem es nur um die Einsicht in den Charakter der Werturteile als Ideologie ginge, während Geiger über den Verzicht auf Werturteile in der Praxis den praktischen Wertnihilismus einforderte. Nur positive Fakten und sinnlich wahrnehmbare Aussagen seien wissenschaftlich zugänglich. Er ging dabei noch weiter als Max Weber in seiner Forderung der Wertfreiheit der Sozialwissenschaften. Freilich konzedierte auch Geiger, daß neben dem Forschungsdenken auch Meinungsdenken Bedeutung habe; anders ließen sich politische Wunschvorstellungen, so auch seine des „intellektuellen Humanismus", nicht verwirklichen. Nur verlangt er vom Autor, „schriftstellerische Redlichkeit, gesellschaftspolitische Bewertungen von Ideologien" von vorneherein als nichtwissenschaftlich zu bezeichnen. A u f diesem Fundament wollte Geiger eine erfahrungswissenschaftlich fundierte allgemeine Rechtslehre aufbauen, die sich nicht in den „Gedankensümpfen der Metaphysik und Ideologie festfahren w i l l " : Eine theoretische Rechtssoziologie. Geiger wurde als Rechtssoziologe i m deutschen Sprachraum nur zögerlich rezipiert, obwohl führende Autoren (so u. a. Hirsch, Luhmann, Rehbinder) seinen Theorien fundamentale Bedeutung für die Rechtssoziologie zumessen. Das läßt sich mit seiner Emigration, allerdings auch mit seiner häufig als Polemik empfundenen Wendung gegen Rechtsphilosophie und -dogmatik begründen.
* Erstveröffentlichung in: Information der Bayerischen Julius-Maximilians-Universität Würzburg 1/26 vom 27. Januar 1992. 6 Gedächtnisschrift Wenz
82
Edgar Michael Wenz
Geigers Verdienst liegt in der präzisen Klärung und Definition juristischer Begriffe. U m deren Befreiung von Werturteilen zu sichern, bedient er sich einer Formelsprache, die der Algebra entlehnt ist. Von großer Bedeutung für die Rechtswissenschaft war und ist, daß er den „Normenkosmos" aufgezeigt hat, in dem das gesatzte Recht nur eine Sonderart aller Normen ist, die durch „differenzierende Begriffsanalysen" erarbeitet werden. Normen wachsen aus der „sozialen Interdependenz". Im Tatsachenzusammenhang lassen sich Wesen und Wirklichkeit der Normen erkennen. Geiger lehnt entschieden Werte wie gut und schlecht, gerecht und ungerecht als „imaginäre Begriffe" ab. Konsequenterweise verneint er auch jede Vorstellung eines Rechtsbewußtseins. Freilich läßt er damit den Rechtsanwender allein, der sich auch durch psychologische Reflexionen mit Begriffen wie Vorsatz, Irrtum und Arglist auseinandersetzen muß. Die verbindliche Rechtsnorm unterscheidet sich von den sozialen Normen (und sind auch nur daran erkennbar), daß sie sich auf einen Zwangsapparat stützen, der von „besonderen Organen monopolitisch gehandhabt" wird, vom „Rechtsstab" Max Webers. A m wichtigsten, lange bekämpft, aber doch am ehesten einsehbar, ist seine Unterscheidung zwischen Geltung und Verbindlichkeit von Normen, deren Bedeutung er nur in ihrer Wirkungschance sieht. Daß dogmatische und reale Geltung nicht gleichgesetzt werden können, ist eigentlich plausibel, war jedoch in früheren Denkschulen alles andere als selbstverständlich. Geiger ging noch weiter: Die Effektivität einer Norm, die durch Wirksamkeit erst Geltung erhält, läßt sich nach Bruchzahlen feststellen. Der Empirist Geiger hat allerdings nicht angegeben, wie gemessen werden könne. Die Befolgung von Normen geschieht still und leise, der Normbruch aber ist laut und läßt sich festhalten. Geiger hat freilich erkannt, daß die Reaktion des Rechtsstabes auf den Normbruch das entscheidende Kriterium ist: Dann hat die Norm Wirkung gezeigt, auf sie allein kommt es an, jetzt erst ist sie nach Geiger zur Rechtsnorm geworden. Diese Vorarbeit lenkt die Aufmerksamkeit auf die verletzte - statt der befolgten - Norm als empirisches Erkenntnisobjekt der praktischen Rechtssoziologie, somit der Rechtsforschung. Der besondere Verdienst Geigers liegt für die praktisch-empirische Rechtssoziologie darin, daß er die Effektivitätsquote für die Messung der Effektivität oder eben der Ineffektivität der Rechtsnormen eingeführt hat. Das war eine entscheidende Hilfe für die operationale und genetische Rechtssoziologie, konkret für die Rechtsforschung: die Rechtstatsachenforschung (die untersucht, wie das Recht neue Tatsachen schafft) und die Tatsachenrechtsforschung (mit dem Erkenntnisinteresse, wie Tatsachen das Recht beeinflussen). Von Theodor Geigers „Vorstudien" zur Rechtssoziologie - bewußt hat er sie so zurückhaltend tituliert - ließe sich eine „Reaktionstheorie" ableiten, die die von ihm vertretene Zwangstheorie modifiziert. Sie nimmt für empirische Rechtsfor-
Theodor Geiger
83
schungszwecke den Normbruch in den Blick, begreift Recht also - negatio negationis - als Abwesenheit von Unrecht. In Fortführung der Gedanken Theodor Geigers könnte so Rechtsforschung in seinem Sinne betrieben werden als eine der wesentlichen Aufgaben der Rechtssoziologie, die für ihn die „eigentliche Rechtswissenschaft" ist, um eine „Magie" entkleidet, verständlich von seinem Standpunkt der positivistischen Wissenschaftstheorie. Daraus folgt der Handlungsbedarf des Rechtsstabes einer „restitutio in harmoniam et eunomiam" - mit der Konsequenz rechtspolitischer Erkenntnisse und Postulate. Die kritische Würdigung der Rechtssoziologie Theodor Geigers steht unter dem belastenden Eindruck, daß schon wenige Jahre nach deren Veröffentlichung (1947 in dänischer Sprache) politisch eine Verrechtlichungstendenz aufkam, die Geiger nicht bedacht hatte. Die Gesetzgebungsmaschinerie produzierte in allen Industriestaaten eine zunehmende Gesetzesflut durch Maßnahmegesetze, die den sozialen Wandel forcieren sollten. Diese Maßnahmegesetze, die meist als Adressaten statt des Staatsbürgers die Exekutive haben, erfordern ein Überdenken der Normentheorie Geigers. Bei diesen Maßnahmegesetzen, die meist Umverteilung und ein „social engineering" anziehen, gelingt die Messung der „Effektivitätsquote" über den Normbruch kaum, eigentlich nicht, statt dessen viel besser durch den Abgleich der erreichten Ziele mit jenen, die die Gesetze angegeben hatten. De lege ferenda könnte das so aussehen: Jedenfalls Maßnahmegesetze sollten in der Regel auf Zeit erlassen werden; i m Gesetz müßte eine Frist festgeschrieben sein, nach deren Ablauf mit einer ebenfalls schon definierten Methode dessen Effektivität untersucht wird, mit der verbindlichen Auflage, die Untersuchungsergebnisse durch Aufhebung und Änderung des Gesetzes in einem vorgeschriebenen Zeitraum zu verwerten.
6*
Die Reaktionstheorie - rechtstheoretische Voraussetzung für die Rechtsforschung* Die empirische Sozialforschung im Rechtswesen, bedeutender Zweig der praktischen und operationalen Rechtssoziologie - Hauptanliegen: Effektivitätsforschung im Hinblick auf Gesetzgebungslehre und Implementation von Gesetzen - , ist sicherlich nicht das einzige, möglicherweise noch nicht einmal das wichtigste Feld der Rechtssoziologie, jedenfalls aber viel wichtiger, als sie bisher Aufmerksamkeit und Pflege hat erfahren dürfen. Es fehlt ihr allerdings eine rechtstheoretische Voraussetzung, auf der sie aufzubauen vermöchte, also eine soziologische Rechtstheorie, die die Bedürfnisse der empirischen Sozialforschung i m Rechtswesen abdeckt. Das klare Bedürfnis der empirischen Rechtsforschung - sei es nun Rechtstatsachenforschung 1 (RTF) oder Tatsachenrechtsforschung 2 - ist ein theoretischer Ansatz, nach welchem das „Abstraktum Recht" beobachtbar und möglichst meßbar und zählbar gemacht werden kann, so vorrangig für die Feststellung der Effektivität der Rechtsnormen, die Theodor Geiger ins Blickfeld gerückt hat 3 . Ohne eine festgelegte Methode sind Messungen der Effektivität und folglich die aus ihr fließenden Konsequenzen, insbesondere die Zielkontrolle von Gesetzesvorhaben 4 mit dem Ziel der Operationalisierbarkeit des Rechtsbegriffs und Besichtigung des Rechts als Tatsachenzusammenhang - nur abschätzbar, aber keineswegs mit Methoden nachvollziehbar, wie sie Wissenschaftlichkeit verlangt. Die bekannten soziologischen Rechtstheorien 5 vermögen diese Leistungen nicht zu erbringen. So zeigt sich,
* Erstveröffentlichung in: Zeitschrift für Rechtssoziologie, Band 15 (1994), Heft 1, S. 58 ff. 1 Nußbaum, Arthur, Die Rechtstatsachenforschung, Ausgew. v. M. Rehbinder, Berlin 1968. 2 Noll, Peter, Gesetzgebungslehre, Reinbek 1973, S. 69 ff. 3 Einen interessanten Querschnitt durch das Werk von Theodor Geiger bietet der Tagungsband zum Symposion anläßlich seines 100. Geburtstags an der TU Braunschweig (Bachmann, Theodor Geiger, Soziologe in einer Zeit „zwischen Pathos und Nüchternheit", Berlin 1994, Druck in Vorbereitung); insbesondere hat sich damit beschäftigt Wenz, Von der Rechtsforschung zur Gesetzgebung. Gedanken zur Rechtssoziologie Theodor Geigers. 4 Vgl. dazu Beutel, Frederick K., Die Experimentelle Rechtswissenschaft (übersetzt von O. Krüger), Berlin 1971, S. 34 ff. 5 Bechtler, Th., Der soziologische Rechtsbegriff (Schriftenreihe zur Rechtssoziologie und Rechtstatsachenforschung, Bd. 41), Berlin 1977, S. 35 ff.
Die Reaktionstheorie
85
- daß die Anerkennungstheorie (Ehrlich, Kantorowicz, Fuchs) brauchbar ist für die genetische Rechtssoziologie und Rechtsgeschichte, auch Nutzen bringen kann für die Rechtsdogmatik, selbst für die Rechtsphilosophie, kaum aber für die praktische und empirische Rechtssoziologie; - daß die Zwangstheorie (Durkheim, Weber, Llewellyn, Geiger) an der Einengung auf Zwang, also Durchsetzbarkeit, leidet, die schon häufig angegriffen wurde meist mit den Paradebeispielen Völkerrecht und positiven Sanktionen - und so für das Erkenntnisinteresse der Rechtsforschung zu kurz greift; - daß allerdings die aus der Zwangstheorie gewachsene (und meist mit ihr auch behandelte) Sanktionstheorie eine Brücke schlägt zu der einzuführenden Reaktionstheorie; die Sanktionstheorie hebt nicht nur auf die Gesetzesstruktur ab, sondern auf Maßnahmen, die aus dem Zwang des Gesetzes fließen; - daß die strukturell-funktionale Rechtstheorie (Luhmann) 6 die Wirkungen des Rechts mit dem Blick auf seine Struktur und auf sich selbst als System und i m Zusammenwirken mit anderen gesellschaftlichen Systemen beobachtet, also der empirischen Sozialforschung soviel wie nichts bringt; - daß die funktionale Rechtstheorie (Krawietz, Merton, Malinowski) zwar die Frage nach der sozialen Wirklichkeit des Rechts stellt und dabei auf seine gesellschaftlichen Funktionen abhebt, aber dafür immer schon einen Rechtsbegriff voraussetzt, zu dessen Klärung diese Arbeit einen Beitrag leisten soll; - daß die Rechtsstabstheorie (Röhl) und weitere daraus abgeleiteten Theorien (Gerichtstheorie, Verfahrenstheorie) alle vorhergehenden Theorien, die auf einen Rechtsstab aufbauen, ersetzt, sich auch mit der hier thematisierten Reaktionstheorie i m ersten Anschein deckt, sich aber mit der Definition der Norm zufriedengibt und nicht die erwarteten Leistungen für die empirische Sozialforschung zu erbringen vermag wie eben die Reaktionstheorie, weil diese nicht den Rechtsstab und seine Mitglieder als Institution i m Mittelpunkt deren Interessen stellt, sondern das, was sie tun, oder genauer: wie sie im Rahmen ihrer Kompetenzen i m vorgeschriebenen Verfahren reagieren (sie!). Die Reaktionstheorie zielt Recht und Rechtsleben in ihrer Gesamtheit an. Zwangs-, aber auch Sanktionstheorie decken nur Straf- und Schuldrecht vollkommen ab, verleiten aber zum Denkansatz, daß Recht nichts anderes sei als Abwesenheit von Unrecht, also eine „negatio negationis" (Hegel) 7 . Diese sehr nüchterne und ganz gewiß angreifbare Definition von Recht als Abwesenheit von Unrecht muß den Vorwurf des Zynismus dulden; sie ist auch eher dem Rechtsrealismus 6
Luhmann, Niklas, Rechtssoziologie, Hamburg 1972, Bd. 1, S. 105. Siehe dazu Maihofer, Werner, Die gesellschaftliche Funktion des Rechts, in: Die Funktion des Rechts in der modernen Gesellschaft, Jahrbuch für Rechtssoziologie und Rechtstheorie, Bd. 1, Bielefeld 1970, S. 11 ff., den auch Rehbinder, Manfred, in: Rechtssoziologie, 1. Aufl., Berlin/New York 1977, S. 147, zitiert. Beide Autoren sehen freilich in der Reaktion des Rechtsstabs auf den Normverstoß eher eine erneute Affirmation des Rechts. 7
86
Edgar Michael Wenz
zuzurechnen 8 . Aber eben diese Definition beruht auf der theoretischen Grundlage der Zwangs- und der aus ihr erwachsenden Sanktionstheorie. Und in der Tat, man kann mit dieser Rechtstheorie nicht alle Felder des Rechts erfassen, schon gar nicht aus der Perspektive der praktischen Rechtssoziologie die breiten Bereiche des Zivilrechts und insbesondere des Verwaltungsrechts mit den vielen Leistungs- und Maßnahmegesetzen 9 , ebenso wenig wie die Akte der Freiwilligen Gerichtsbarkeit beobachten. Nicht nur der Normbruch, sondern auch die tatsächlichen und rechtlichen Voraussetzungen für die Gewährung von Vergünstigungen und Prämien wie zu Rechtsgestaltungen, Feststellungen und Beurkundungen stehen zur Prüfung an. Die zentrale Figur der Reaktionstheorie ist nun jene Institution, die zu „reagieren" hat: Der Rechtsstab 10 . A u f ihn hebt die Reaktionstheorie zunächst einmal ab, weil sein Handeln beobachtbar ist. Sein Tätigwerden genügt den empirischen Evidenz- und Beobachtungskriterien. Wenn der Rechtsstab i m Rahmen seiner hoheitlichen Kompetenzen tätig wird und auf dem ihm vorgeschriebenen Wege, wozu die ihm aufgegebene Form wesentlich gehört, hat er Fakten geschaffen, die dem empirischen Rechtsforscher Material zur Bewertung an die Hand geben. Hier ist also nun der Rechtsstab ins Blickfeld getreten, der - in seiner Funktion als Erzwingungsstab, die ihm die Zwangstheoretiker zuweisen - nur tätig wird, wenn das Recht verletzt ist; er hat sich dann mit dem Fall zu beschäftigen, er hat den „Streitfall" zu erledigen 1 1 , das heißt also: Er hat das Recht wiederherzustellen, Schaden wiedergutzumachen und gute Ordnung wieder einkehren zu lassen, die „restitutio in harmoniam et eunomiam" 1 2 zu leisten. Dagegen wird von den Reaktionstheoretikern das Handeln des Rechtsstabs in allen Bereichen des Rechtslebens beobachtet, freilich nur insofern bewertet, als das Tätigwerden des Rechtsstabs Rechtsakte setzt - gleichgültig nun, ob der Polizeibeamte verwarnt, der Richter 8 Geiger bezeichnet seine Rechtssoziologie als „soziologischen Rechtsrealismus", in: 1947a, Nachdruck 1987, S. 329. 9 Die Leistungsverwaltung im sozialen Rechtsstaat hat ohnehin die Eingriffsverwaltung an Bedeutung überholt; so jedenfalls Hesse, Konrad, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 18., erg. Aufl., Heidelberg 1991, S. 75 ff. 10 Dieser Begriff wird Max Weber zugeschrieben (so beispielsweise Röhl, Klaus F., Rechtssoziologie, Köln/Berlin/Bonn/München 1987, S. 35), obwohl Weber selbst den Begriff nicht gebraucht, statt dessen „Erzwingungsstab" und „Verwaltungsstab" (Weber, Max, Wirtschaft und Gesellschaft, hrsg. v. Winkelmann, J., 5. rev. Aufl., Nachdruck Tübingen 1985, S. 17 f., S. 26, aber auch „Zwangsapparat" (ebd., S. 182). 11 Dazu auch Llewellyn, Karl N., Recht, Rechtsleben und Gesellschaft, hrsg. v. Rehbinder, M., Berlin 1977, S. 45 ff. 12 Man mag entgegenhalten, daß diese aus dem antiken, insbesondere hellenischen Verständnis des Rechts stammende Formulierung eher die gute Ordnung als bleibendes Weltverständnis im Blick hat, während die moderne Auffassung Recht als etwas sich Entwickelndes begreift, eher der Rechtsspruch, also das Recht fortschreibt. Man muß ganz und gar nicht der hier vertretenen Meinung beitreten, daß über den bereinigten Streitfall die gute „alte" Ordnung - wieder - eingeführt wird. Die wiederhergestellte Ordnung kann dann durchaus „neu" sein, sie braucht nicht haargenau mit der alten übereinzustimmen; die „gute Ordnung" kann zu jeder Zeit neu definiert werden.
Die Reaktionstheorie
87
urteilt, der Oberinspektor Sozialhilfe gewährt, der Regierungsbaurat einen Bauplan genehmigt oder der Bundespräsident einer Gesetzes vorläge zustimmt. Immer und überall ist der Rechtsstab tätig geworden, hat er reagiert: auf Missetat, auf Anrufung und auf Antrag. Folgerichtig unterscheidet Geiger, i m Anschluß an Karl Olivecrona, zwischen Aktionsnormen als Handlungsnormen gegenüber den Rechtsadressaten und sekundären Reaktionsnormen, die an den Rechtsstab gerichtet sind 1 3 . Das Beobachtungsfeld der Reaktionstheorie ist also nicht der Rechtsstab als solcher, seine Existenz, Kompetenz und Ausstattung; vielmehr ist lediglich das Handeln der Mitglieder des Rechtsstabs von definitorischer Bedeutung. Nur die rechtmäßig getätigten Akte finden das Interesse der empirischen Rechtsforschung, nur sie sind meß- und zählbar. Hier zeigt sich der - nicht vernachlässigbare - Unterschied zur Rechtsstabstheorie, die man also gewissermaßen als objektiv-statisch und deshalb wenig nutzbar bezeichnen kann, die Reaktionstheorie dagegen als aktiv-dynamisch mit Nutzen für die Rechtsforschung. In der rechtssoziologischen Literatur taucht der Begriff Reaktion erstmals bei Theodor Geiger auf 1 4 , der dafür das Kürzel r eingeführt hat. Geiger geht es auch bei der Betrachtung der Effektivität des Rechts darum, die Normativität eines Verhaltens beobachtbar zu machen 1 5 . Unter dem Aspekt der Beobachtbarkeit sind rechtlich relevante Realakte, Entscheidungen und Sanktionsverhängung - also Reaktionen ganz allgemein - gleichwertig. Die Geiger eigentlich bisher nachgesagte Verengung auf die Zwangstheorie kann also aufgebrochen werden zur Reaktionstheorie, ohne den Zwischenschritt über den Begriff der Sanktionstheorie gehen zu müssen. Die Reaktionstheorie wurde von Rehbinder in die Studienliteratur eingeführt 1 6 . In der Literatur erstmals aufgetaucht ist der Begriff bei Peter Frey 1 7 : Nach seiner Meinung ist die „Antwort des Apparats auf das Handeln des Einzelnen . . . ein Merkmal des Rechts, gleichgültig, ob diese Antwort positiv oder negativ ausf ä l l t " 1 8 . Frey formalisiert den Vorgang, entkleidet ihn des Inhalts. Die Operationalisierung schafft einen konkreten, für die empirische Rechtsforschung tauglichen Begriff. Frey entwickelt die Reaktionstheorie als soziologischen Rechtsbegriff. Sein Anliegen ist in erster Linie, das Verwaltungsrecht mit in die Definition des
13
Geiger, Theodor, Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts, 4. Aufl., durchgesehen und hrsg. von Rehbinder, Manfred, Berlin, S. 104. In der Koppelung mit einer sekundären Reaktionsnorm entsteht erst die Rechtsnorm im juridischen Sinne. 14 Geiger, Theodor, a. a. O., S. 31, 109 ff. 15 Blankenburg, Erhard, Über die Unwirksamkeit von Gesetzen, in: Archiv für Rechtsund Sozialphilosophie (ARSP), Bd. 63, 1977, S. 31 ff. 16 Rehbinder, Manfred, a. a. O., S. 97 ff.
17 Frey, Peter, Rechtsbegriff in der neuen Rechtssoziologie. Diss. Univ. d. Saarlandes, Saarbrücken 1962, S. 160 ff. is Ebd., S. 196 ff.
88
Edgar Michael Wenz
Rechtsbegriffs einzubeziehen, nicht nur Straf- und Schuldrecht. Allerdings verzichtet er in seiner Version auf eine Abgrenzung des staatlichen Rechts zu anderen Rechtserscheinungen, also den sozialen Normen 1 9 . Untersuchungen zum Rechtspluralismus müßten also noch angestellt werden. Wenn wir Geiger folgen, kommt es i m Zusammenhang mit der Effektivität der Norm nicht auf die Zwangsandrohung an, die über der Norm schwebt, sondern auf ein konkretes, das heißt also effektives und beschreibbares Handeln des Rechtsstabs - gleichgültig nun, ob in Verfolgung eines Deliktes, als justizielle Tätigkeit oder Verwaltungshandeln. Man muß bei derartigen Überlegungen sich immer wieder vor Augen führen, daß es hier nicht um philosophische oder gar transzendentale Betrachtungen des Rechts geht, sondern lediglich um die theoretische Grundlage der empirischen Rechtsforschung. Danach und nur danach soll das Instrumentarium vorbereitet werden. Wenn man den Zweck dieser Theorie, die Rechtsforschung zu ermöglichen, und das Ziel i m Auge hat, qua Gesetzgebung 20 den Rechtsstaat und das Postulat der Gerechtigkeit zu fördern, ist diese vorgeschaltete Annahme tragfähig, zumindest tolerierbar. Es sind auch keine sprachtheoretischen Bedenken zu erkennen. Begrifflich (philologisch und etymologisch) sind die Worte Reaktionen und Sanktionen klar definiert, und dies in dem hier verwandten Sinne 2 1 ; der tägliche Sprachgebrauch stimmt überein. Die Reaktion setzt lediglich einen Impuls voraus, der dann als causa eine Reihe von Folgen nach sich zieht, eigentlich mit der Strenge der Naturwissenschaften, wo auch dieser Begriff am meisten und am klarsten definiert gebraucht wird. Die Sanktion - durch ebenso negative wie positive Wirkung ohnehin vieldeutig - hat dagegen mehr einen „intentionalen Charakter" 2 2 , sie soll und w i l l ein Verhalten bewirken. Sie gehört in das „Befehlsmodell des Rechts", zur „imperativen Theorie" 2 3 . So ist also schon begrifflich die Reaktionstheorie wesentlich weiter und umfassender als jede andere. Sie löst auch keine Diskussionen aus, ob Verwaltungsakte erfaßt werden oder ob und wie etwa die Maßnahmen und Entscheidungen der Freiwilligen Gerichtsbarkeit einzuordnen sind. Jedenfalls: Wenn der Bauplan genehmigt, die Erbfolge festgestellt und die Ehe als geschlossen erklärt wird, hat i m Verständnis der Reaktionstheorie der Rechtsstab agiert, das Rechtsstabshandeln ist nach außen getreten. Es ist evident, zähl- und meßbar.
19 Ebd., S. 185, 199. Wenz, Edgar Michael, s. Fußnote 3, insbesondere „VI. Von der Rechtsforschung zur Gesetzgebung?", „V. Problematik der Gesetzesevaluation" und „VI. Fazit: Ein rechtspolitisches Postulat". 21 So auch Duden, Das Fremdwörterbuch, z. B. 3. Aufl., Mannheim/Wien/Zürich 1974. 22 Röhl, a. a. O., S. 204. 23 Röhl, a. a. O., S. 209. 20
Die Reaktionstheorie
89
Während die Sanktionstheorie sich stützt auf die Drohung mit Nachteilen bei Nichtbefolgen der Norm oder lockt mit Belohnung bei Erreichen von Vorgaben 24 , verzichtet die favorisierte Reaktionstheorie nicht nur auf die Kriterien von Drohung und Verlockung; sie geht auch nicht zwingend einher mit der Auffassung, daß i m soziologischen Sinne Recht erst entsteht, wenn geschehenes Unrecht erkannt und bekämpft w i r d 2 5 ; dem Ausgangspunkt der Zwangstheorie. Sie teilt auch nicht wie die Sanktionstheorie die implizite Vorstellung eines simplifizierenden behavioristischen Lernmodells. Die Reaktionstheorie hebt lediglich darauf ab, daß der Rechtsstab reagiert. Insofern greift Rehbinders Vorschlag der Erweiterung der Zwangstheorie zur Reaktionstheorie 26 nicht weit genug. Die Reaktionstheorie verdient theoretische Eigenständigkeit. Die Kriminologie befaßt sich mit Untat und Missetäter; sie kann freilich nicht die Normbefolgung messen, also alle, die rechts fahren und links überholen, ebensowenig wie die zivilistische Rechtsforschung ordnungsgemäß erfüllte Verträge. I m kriminellen und deliktischen Rechtsbereich, Strafnormen i m Verwaltungsrecht selbstverständlich eingeschlossen, ist dagegen die Messung relativ einfach: Immer wenn der Rechtsstab tätig geworden ist, hat man einen zählbaren Vorgang. Nur die Quote, also die quantifizierbare Bezugsgröße, läßt sich mangels Verhältniszahl in den meisten Fällen, wenn kein Totum zu erkennen ist, rechnerisch nicht ermitteln. Die Rechtsforschung hat es relativ leicht bei der Erfassung der Akte i m Verwaltungsrecht und in der Freiwilligen Gerichtsbarkeit und erst recht bei lediglich konstitutiven Akten etwa des Standesbeamten bei der Eheschließung. Sie braucht nur die in diesen Bereichen gestellten Anträge festzustellen, die stattgegebenen ebenso wie freilich auch die abgewiesenen. Die Einbeziehung dieses Normenkreises zeigt überaus deutlich, daß der Rechtsstab tätig wird, wenn man ihn i m Rahmen der Gesetze anruft. Es kann festgehalten werden, daß die Reaktionstheorie i m hier verstandenen Sinne wertvoll ist für den theoretischen Unterbau der Rechtsforschung. Diese findet zunächst ihren Niederschlag in der Rechtspflegestatistik 27 , die es in Deutschland schon seit 1879 gibt und die dann später 1968 nochmals ausgebaut wurde. Sie 24 Siehe dazu insbesondere Röhl, a. a. O., S. 204 ff. Für ihn ist die Sanktion so wesentlich für die Struktur der Norm, daß bei der Behandlung der soziologischen Rechtsbegriffe, a. a. O., S. 212 ff., der Begriff der Sanktionstheorie sich nicht findet. 25 Siehe dazu Fn. 6, die Theorie der „Affirmation des Rechts" durch Bekämpfung des Unrechts. 2 6 Rehbinder, a. a. O., S. 97 ff. 27 Sinn dieser Arbeit ist es auch, stärkere statistische Aktivitäten anzuregen mit dem Blick auf rechtspolitische Anpassungen und/oder Veränderungen. Die Rechtspflegestatistik ist ein guter Anfang, auch wenn sie nur wenige Teilbereiche erfaßt und in erster Linie justiziellorganisatorischen Zwecken dienen soll. Auf keinen Fall ist es Aufgabe der Rechtspflegestatistik zu erkennen, welche Normen nun effizient sind, sondern nur, wie häufig effiziente Normen tatsächlich angewandt wurden und inwieweit die Rechtspflege damit belastet war.
90
Edgar Michael Wenz
erfüllt damit eine wichtige Aufgabe des Rechts, die Rechtswirklichkeit zu erkennen und auch quantitativ die Effektivität von Normen zu erfassen. Ob bei der aktuellen Rechtslage wirklich alle wichtigen und interessanten rechtsrelevanten Vorfälle aufgearbeitet und richtig und ausreichend verwertet werden, ist eine andere Frage, die zur Rechtspolitik und vor allem zur Gesetzgebungslehre gehört. Die von Geiger aufgezeigte Problematik der Wirksamkeit einer Norm bei Leistungsgesetzen - etwa ein normativer Anspruch, der nicht geltend gemacht worden ist - ist mit der Reaktionstheorie für die empirische Rechtssoziologie aufgelöst. Der Rechtsstab brauchte nicht tätig zu werden, somit ist die Frage irrelevant geworden, oder genauer: geblieben 2 8 . Die Reaktionstheorie ist somit eine eigenständige Theorie, nicht nur eine Variante der Sanktions- oder gar der Zwangstheorie. Sie ist mit denkbaren Mißverständnissen nicht behaftet. Die Reaktionstheorie hebt lediglich darauf ab, daß der Rechtsstab agiert / reagiert (hat); somit ist sie am ehesten die Fortführung - oder auch Operationalisierung - der Rechtsstabstheorie. Die Reaktionstheorie braucht auch keinen Rechtsbereich auszusparen. Sie wirft die Frage auf, dem monistischen (etatistischen) oder dem pluralistischen (sozialen) Rechtsbegriff folgen zu sollen. Nachdem das Kriterium ein kompetenter Rechtsstab ist, aber den Rechtsvollzug nicht zur Bedingung macht, könnte sie streng genommen auch für das Völkerrecht 2 9 taugen. Evidente völkerrechtliche Akte, so beispielsweise Protestnoten bei Vertragsbruch, könnten für die Meß- und Zählbarkeit durchaus genügen. Erst recht könnte man das Kirchenrecht unter dem Blickwinkel der Reaktionstheorie betrachten. Man kommt dann zu einem bejahenden Ergebnis, weil die Kirchenorganisation Rechtsstäbe hat, die auch i m Rahmen deren Kompetenzen und den ihnen vorgegebenen Verfahrensnormen reagieren. Die gleichen Überlegungen gelten auch für das Verbandsrecht, das weitgehend vom Gesetzgeber autorisiert oder von der Rechtsprechung manifestiert worden ist; dort sind die Kompetenzen exakt geregelt. Die Funktionäre haben die Rolle des Rechtsstabs, der nach vorgegebenen und nachprüfbaren Regeln arbeitet, übernommen 3 0 .
28 In rein theoretischer Sicht wäre also im Extremfalle, wenn keiner der Berechtigten einen Antrag stellt, das Leistungsgesetz zwar ein formelles Gesetz, aber nicht Recht, oder um es präziser auszudrücken: keine effektive und relevante Norm; sie bleibt auch nicht zählbar und somit uninteressant. 29 Hier freilich fehlt der definitorisch unverzichtbare Rechtsstab im Sinne eines Erzwingungsstabs, jedenfalls solange, als keine supranationalen Institutionen mit Durchsetzungsbefugnis existieren. Auch die Vorstellung eines „ius cogens" im Sinne einer vernunftorientierten juristischen Argumentation, die ein stabiles Verhalten erwarten läßt (siehe Kadelbach, Stefan, Zwingendes Völkerrecht, Berlin 1993), hilft in praxi wohl kaum weiter. 30 Das Verbandsrecht hat mittlerweile, auch ohne gesetzliche Autorisation oder richterliche Option, mittelbaren Rechtscharakter erlangt; es kann heutzutage Existenzen vernichten; siehe dazu das Spruchrecht insbesondere der Sportverbände, deren verhängte Sperren tiefgreifende materielle Folgen haben können (und sollen).
Die Reaktionstheorie
91
Das Rechtssprachgefühl trügt also nicht, wenn es die Ordnungen der Zwischenstaatlichkeit der Kirchen und der großen Verbände als Völker recht, Kirchen recht und Verbands recht nennt. Bei der Prüfung ihrer Funktionen in rechtspluralistischer Sicht des Rechts greift die Reaktionstheorie nur, soweit soziale Normen über Option und Legislation normativen Rechtscharakter erlangt haben. Dann kann diese Frage nicht strittig sein. Die sozialen Normen allerdings in ihrer Gesamtheit lassen sich deswegen nicht erfassen und umfassen, weil die Voraussetzung des Rechtsstabs fehlt 3 1 . Die Reaktion von Gruppenmitgliedern, die bei abweichendem Verhalten vom Spott bis zum Ausschluß aus der Gruppe reichen kann, genügt nicht; die Gruppe oder die Autorität der Meinungsführer der Gruppe können den Rechtsstab als unverzichtbares Element nicht ersetzen 32 . Wenn man sich der herrschenden Meinung anschließt, daß der Rechtsbegriff nicht ausufern und die Nähe des positiven Rechtes nicht verlassen darf, sollten soziale Normen gar nicht erst einbezogen werden. Auch ist der Rechtsstab i m herkömmlichen positivistischen Sinn zu definieren. Er konzentriert sich also auf jene, die die staatliche Rechtsmaschinerie in Gang setzen, in Gang halten und i m Rechtswege gefundene Entscheidungen durchsetzen, also die law-men Llewellyns und die Sanktionssubjekte Röhls. Die Kompetenzen und Verfahrensnormen (sekundäre Normen) sind genau angegeben. Eine Abgrenzung der Reaktionstheorie gegenüber der Rechtsstabstheorie ist eigentlich nicht notwendig, weil die Reaktionstheorie nach dieser Auffassung zu den Rechtsstabstheorien gehört, aus ihr abgeleitet ist, allerdings über diese hinausführt. Die Rechtsstabstheorie bildet den Überbegriff, der vielfältige, zum Teil auch disparate Theorien zusammenfaßt, sich über diesen Begriff auch strukturieren läßt; das gilt auch für das Kriterium des Rechtsstabs, in einem Ordnungspluralismus Rechts- und andere Sozialordnungen voneinander abzugrenzen. Aber für die Reaktionstheorie ist nicht die bloße Existenz eines Rechtsstabs entscheidend, und darauf kommt es an, sondern dessen Handeln und Re-agieren. Der Rechtsstab ist in der Reaktionstheorie gewissermaßen eine objektive Bedingung der Möglichkeit. Es ist also für die Reaktionstheorie, anders als bei der Rechtsstabstheorie, völlig irrelevant, ob der Rechtsstab beispielsweise bei einer Normenverletzung hätte tätig werden können, sollen oder gar müssen. Ob er reagiert (hat), das ist entscheidend. Es geht der Reaktionstheorie darum, aufgrund von evidenten Tatsachen die Tatsachenzusammenhänge festzuhalten und zu erkennen, was zu einem bestimmten Zeit31
„Erst der Rechtsstab ist es, der eine Gruppenordnung zur Rechtsordnung macht", Rehbinder, a. a. O., 1977, S. 97. Röhl gebraucht die Begriffe „ordnungstragende Gruppe", allerdings auch „Sanktionssubjekte", gerät aber damit „in die Nähe oder gar mitten in den Bereich des Rechts", a. a. O., S. 208. 32 Freilich führt das zur Erkenntnis, daß auch archaisches Recht diesen Namen jedenfalls dann verdient, wenn ein Mitglied der Gruppe (oder mehrere) als Rechtsstab anzusehen war, also in ihm zugeteilter Kompetenz beispielsweise Verhaltensweisen und Regeln durchgesetzt that.
92
Edgar Michael Wenz
punkt in einer bestimmten Gesellschaft Recht ist. Auch wenn die Rechtsstabstheorie als unabdingbare Voraussetzung der Reaktionstheorie wichtige rechtstheoretische Leistungen erbringt, braucht man keinesfalls der Meinung zu sein, eine der beiden Theorien, dann eben die jüngere, sei verzichtbar. Die Reaktionstheorie ist unverändert eigenständig, weil sie eben den entscheidenden Schritt weitergeht, die Effektivität der Norm dezidiert zu beobachten - und bei Anforderung eben zu notieren, zu registrieren und auszuwerten. Zusammenfassend kann man also erkennen, daß für die Rechtsforschung kein einfacherer und vor allen Dingen sicherer Weg denkbar ist, als das Tätig werden des Rechtsstabs und seine rechtlich relevanten hoheitlichen Akte zu notieren und auszuwerten. Auch wenn diese Gedanken unter der Prämisse standen, für die empirische Rechtsforschung ein theoretisches Fundament zu schaffen, bedeutet diese Einengung nicht, daß dieser soziologische Rechtsbegriff nicht auch umfassend gedacht und eingeführt wird. Eine Norm ist dann gültig und wirksam, wenn der Rechtsstab auf sie reagiert.
Von der Rechtsforschung zur Gesetzgebung* Gedanken zur Rechtssoziologie Theodor Geigers
Wissenschaftliche Bemühungen um eine „Renaissance" Theodor Geigers, vornehmlich als Rechtssoziologe, brauchen sich nicht zu erschöpfen in kritischen Würdigungen seines Schrifttums und der darauf basierenden Sekundärliteratur. Geiger hat uns auch heute noch etwas zu sagen. Die Abstraktionshöhe seiner Gedanken erleichtert deren Aufarbeitung auch unter veränderten Verhältnissen; sie lädt zur Weiterführung ein.
I. Zur Normentheorie Theodor Geigers Seit 1947, als Geigers „Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts" erschienen, hat sich in allen Industriestaaten die Gesetzgebungstätigkeit förmlich überschlagen. Angeblicher oder wirklicher Regelungsbedarf brachte eine Gesetzesflut 1 . Es geht ja dabei überwiegend um Leistungs- und Maßnahmegesetze 2 , konkret die Sozialgesetzgebung, mit denen der politisch als richtig eingeschätzte soziale Wandel befördert werden soll. Geiger hat den Trend zu verstärkten Eingriffen des Staates in die Wirtschaft gesehen 3 , hat allerdings diese Erkenntnis nicht in seiner Normentheorie verwertet. * Erstveröffentlichung in: Siegfried Bachmann (Hrsg.), Theodor Geiger. Soziologie in einer Zeit „zwischen Pathos und Nüchternheit". Beiträge zu Leben und Werk, Berlin 1995, S. 253 ff. 1 Für viele: Josef Isensee, in: Politische Meinung, H. 237, S. 15 f., der eine „sich überschlagende Gesetzesmaschinerie", „Wegwerfgesetze" genannt, und „Gesetze ohne echte Rechtsidee" beklagt. Neuerdings Kritik auch seitens der Nationalökonomie, so Walter Hamm, Eine vermeidbare Fehlentwicklung, in: Orientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik, 50 (12/92), S. 67 ff. Anders Manfred Rehbinder, in: Rechtssoziologie, 2. völlig neubearb. Aufl., Berlin/New York 1989, S. 195, der unter Berufung auf Hubert Rottleuthner (Aspekte der Rechtsentwicklung in Deutschland, in: ZfRSoz 1985, S. 206 ff.) die These von der Gesetzesflut relativiert in eine Normänderungsflut. Rüdiger Voigt unterscheidet verschiedene Typen der Verrechtlichung, von denen im folgenden insbesondere die Vergesetzlichung (Parlamentarisierung) interessiert; ders., Verrechtlichung in Staat und Gesellschaft, in: R. Voigt (Hrsg.), Verrechtlichung, 1980, S. 15 ff. 2 Siehe dazu Ernst Forsthoff, Über Maßnahmegesetze, in: Forschungen und Berichte aus dem öffentlichen Recht, Gedächtnisschrift für Walter Jellinek (hrsg. v. O. Bachof, M. Drath u. a.), München 1955, S. 221 ff.
94
Edgar Michael Wenz
Die rechtsdogmatische Frage ist, ob die Normentheorie Geigers noch wissenschaftliche Bedeutung habe, nachdem sie i m ersten Anschein nur Normen anzuzielen scheint, die den Staatsbürger als Rechtsadressaten kennen, während Leistungs- und Maßnahmegesetze sich stets an die Exekutive wenden, der Staatsbürger dann der Benefiziar der Norm ist. Die Geiger'sehe Beschreibung der Norm (—• g) ν A A / B B erfaßt strukturell aber auch diesen Fall; der Normkern hat sich nicht verändert 4 . Geigers Normentheorie läßt sich also nicht nur auf Zivil- und Strafgesetze, sondern auch auf Leistungs- und Maßnahmegesetze anwenden. Kritisch ist die Anwendbarkeit auf die Normen von Plangesetzen, weil diese in der Regel nicht mehr konditional, sondern final programmiert sind. Dieser Gedankengang braucht hier nicht vertieft zu werden. Den Regelungen der Leistungs- und Maßnahmegesetze liegen allerdings meist keine habituellen Normen i m Sinne Geigers zugrunde. Bei der Sozialgesetzgebung freilich könnte man meinen, daß sich Erwartungen aus den Vorstellungen von Gerechtigkeit und Billigkeit herausgebildet haben (oder deren Herausbildung politisch forciert wurde). In diesem Bereich („Utopie und metaphysischer Trug 4 ') 5 darf man allerdings die Grundlagen der Rechtslehre Geigers nicht suchen. Ob diese Normen „subsistent" schon vorher galten, richtet sich wohl mehr nach der Interpretation der philosophischen Subsistenz.
II. Die Effektivitätsquote als Basis der empirischen Rechtsforschung Zu den besonderen Leistungen Geigers in der Rechtssoziologie gehören seine beharrlichen Hinweise auf die Bedeutung der Effektivität und daraus folgend die Lehre von der Effektivitätsquote 6 . Das geschah in einer Zeit - die aber in der Juris3 Geiger, 1960a, 4. Aufl. 1991, S. 355. Er führt den Grund dafür auf den politischen Machtzuwachs der Arbeiterschaft durch ihr Massengewicht zurück; die Demokratie mit dem Mehrheitsprinzip diene als politischer Hebel für Verteilungskämpfe. 4 Die Handlungsanleitung in der typischen Situation s führt zu einem bestimmten Gebaren g (Normkern); es führt zum Verhaltensmuster ν (Verbindlichkeitsstigma) mit der Konsequenz, daß die Rechtsadressaten AA es zu befolgen haben (im Falle des Zuwiderhandelns sich der Reaktion r aussetzen) zugunsten der Normbegünstigten BB, also Empfänger des zur Leistung verpflichteten Staatsorgans. Ober anders ausgedrückt: Der Verwaltungsbeamte (AA) wird verbindlich dazu angewiesen (v), bei Vorliegen der typisierten tatsächlichen Voraussetzungen (s) gegenüber dem Antragsteller (BB) in bestimmter Weise zu handeln (g), nämlich die beantragte Sozialleistung zu gewähren. 5 Geiger, 1960a, 4. Aufl. 1991, S. 342. Sinnähnlich formuliert Geiger auch in: Ideologie und Wahrheit (1953a, Neudruck 1968, S. 75): „ . . . Ausdruck ohne greifbaren Sinn", wenn „von sozialer Gerechtigkeit gesprochen wird". 6 Die Effektivitätsquote e = die Verhältniszahl der Fälle, in denen die Norm durch Befolgung oder die Reaktion auf Nichtbefolgung sich als wirksam erweist, bezogen auf die Gesamtzahl der Fälle. S. Geiger, 1947a, Nachdruck 1987, S. 33.
Von der Rechtsforschung zur Gesetzgebung
95
prudenz offenbar kein Ende zu finden scheint - , als die Rechtslehre in der Dogmatik nicht nur die überragende, sondern die nahezu einzige Bedeutung gesehen hat. Freilich haftet der Geiger'sehen Theorie der Mangel an, daß die Rechtsforschung damit in der Praxis eigentlich nichts anfangen kann 7 . Die Befolgung der Gesetze ist schwierig oder eigentlich gar nicht meßbar. Jedenfalls gilt das für die Strafrechts- wie für die deliktischen Normen des Zivilrechts. Zu messen ist eigentlich nur die Nicht-Befolgung oder - noch praktikabler - der Normbruch. Anders ist das freilich bei den Leistungs- und Maßnahmegesetzen. In aller Regel wird davon auszugehen sein, daß die Exekutive, wegen des in aller Regel geforderten Antragsprinzips, über ausreichendes statistisches Material verfügt, welche Gesetze, insbesondere Sozialgesetze, in Anspruch genommen worden sind. Nicht zu messen freilich ist auch hier die Zahl jener Staatsbürger, die die ihnen zustehenden Ansprüche nicht realisiert haben, somit die Gesamtzahl der Fälle, in denen materiell-rechtlich eine Anspruchsberechtigung vorlag, die jedoch nicht erfaßt worden sind. Die Quote als Verhältniszahl läßt sich aber nur dann feststellen, wenn das Totum (100%) bekannt ist. Das besondere Verdienst Geigers liegt für die praktisch-empirische Rechtssoziologie darin, daß er mit der Effektivität oder eben Ineffektivität der Rechtsnorm die Grundlage für die Messung eingeführt hat (auch wenn er dafür selbst keine praktischen Handlungsanleitungen gegeben hat und das auch bei seinen Erkenntnisinteressen gar nicht wollte). Das war eine entscheidende Hilfe für die operationale Rechtssoziologie, konkret für die Rechtsforschung: die Rechtstatsachenforschung 8 wie für die Tatsachenrechtsforschung 9 . Durch die entschiedene Herausarbeitung von Geltung und Verbindlichkeit von Normen allein durch ihre Wirkungschance hat Geiger auch die allgemeine Rechtslehre befruchtet, die sich lange Zeit schwergetan hat (und noch tut), die Realität der Norm - als Tatsachenzusammenhang, als Faktizität - auch in der Rechtsdogmatik in den Blick zu nehmen.
III. Reaktionstheorie statt Zwangs- und Sanktionstheorie? Alle Anhänger der Zwangstheorie als soziologischer Rechtstheorie 10 - neben Geiger Emile Durkheim, Max Weber und Karl N. Llewellyn, um die wichtigsten 7
Geiger äußert sich zwar zum Problem der Messung (1947a, Nachdruck 1987, S. 168 f.), es geht aber nur um die prinzipielle Quantifizierbarkeit als Faktizität; dagegen interessieren die Normbefolgung und die Dunkelziffer der Nichtbefolgung ihn nicht, weil dies kein juristisches, sondern lediglich ein statistisches Problem sei. Aber für die Rechtsforschung sind statistische Probleme nicht nur wichtig, sondern unverzichtbar. Der Nutzen von Kriminal- und Rechtspflegestatistiken, mehr als nur ein Ansatz für Rechtsforschung, ist deutlich. 8 Nußbaum, Arthur, Die Rechtstatsachenforschung. Ausgew. v. M. Rehbinder, Berlin 1968. 9 Noll, Peter, Gesetzgebungslehre, Reinbek 1973, S. 69 ff. 10
Bechtler, Th., Der soziologische Rechtsbegriff (Schriftenreihe zur Rechtssoziologie und Rechtstatsachenforschung, Bd. 41), Berlin 1977, S. 35 ff.
96
Edgar Michael Wenz
zu nennen - heben akzentuiert auf das Handeln des Rechtsstabs 11 in dem Sinne ab, daß es den Zwang des Gesetzes, die Drohung mit Nachteilen bei dessen Nichtbefolgung gewissermaßen verkörpert. Das Recht der Gegenwart arbeitet aber nicht nur mit der Drohung von Nachteilen, also mit „negativen Sanktionen", sondern auch mit „positiven Sanktionen", also der Einräumung von Vergünstigungen und rechtlich geschützten Freiheiten 1 2 . Anders als mit - negativen und positiven - Sanktionen läßt sich in einem geordneten Staatswesen (ohne gleich den Begriff des Rechtsstaates, der einen noch tieferen Sinngehalt hat, zu gebrauchen) die Funktion des Rechts nicht gewährleisten. Somit folgt auch der Schritt eigentlich zwangsläufig, den Begriff der Zwangstheorie durch jenen der Sanktionstheorie zu ersetzen, er beschreibt die Situation treffender. Wenn Manfred Rehbinder die „Zwangstheorie . . . zur Reaktionstheorie zu erweitern" 1 3 vorschlägt, dann hat man allerdings den Eindruck, er wolle den Begriff der Reaktionstheorie nicht zwingend eigenständig, sondern synonym für „Sanktionstheorie" verwenden. Das hat auch etwas für sich, weil die Sanktion die Folge der Reaktion ist. Danach wäre die Differenz nur philologisch-semantisch. Geiger bietet einen Ansatzpunkt, die Reaktionstheorie eigenständig zu begründen. Zunächst hat er das Kürzel r für Reaktion eingeführt. Geiger geht es auch bei der Betrachtung der Effektivität des Rechts darum, die Normativität eines Verhaltens beobachtbar zu machen 1 4 . Unter dem Aspekt der Beobachtbarkeit sind positive Reaktionen und negative Sanktionen gleichwertig. Die Geiger eigentlich bisher nachgesagte Verengung auf die Zwangstheorie kann also aufgebrochen werden zur Reaktionstheorie, ohne den Zwischenschritt über den Begriff der Sanktionstheorie gehen zu müssen. Die Reaktionstheorie wurde von Rehbinder in die Studienliteratur eingeführt 1 5 . In der Literatur erstmals aufgetaucht ist der Begriff bei Peter Frey 1 6 : Nach seiner Meinung ist die „Antwort des Apparats auf das Handeln des Einzelnen . . . ein Merkmal des Rechts, gleichgültig, ob diese Antwort positiv oder negativ aus11
Dieser Begriff wird Max Weber zugeschrieben (so beispielsweise Klaus F. Röhl, Rechtssoziologie, Köln/Berlin/Bonn/München 1987, S. 35), obwohl Weber selbst den Begriff nicht gebraucht, statt dessen „Erzwingungsstab" und „Verwaltungsstab" (Weber, Max, Wirtschaft und Gesellschaft, hrsg. v. J. Winkelmann, 5. rev. Aufl., Nachdruck Tübingen 1985, S. 17 f., S. 26), aber auch „Zwangsapparat" (ebenda S. 182). 12 Rehbinder, Manfred, Rechtssoziologie (Anm. 1), S. 60. 13 Ebenda. 14 Blankenburg, Erhard, Über die Unwirksamkeit von Gesetzen, in: Archiv für Rechtsund Sozialphilosophie (ARSP), Bd. 63, 1977, S. 31 ff. 15 Erstmals Rehbinder, Manfred, Rechtssoziologie, 1. Aufl., Berlin/New York 1977, S. 97 ff. 16 Frey, Peter, Rechtsbegriff in der neuen Rechtssoziologie, Diss. Univ. d. Saarlandes, Saarbrücken 1962, S. 160 ff.
Von der Rechtsforschung zur Gesetzgebung
97
f ä l l t " 1 7 . Frey formalisiert den Vorgang, entkleidet ihn des Inhalts. So ist er gut für die Rechtsforschung zu gebrauchen, auch der ähnlich scheinenden Sanktionstheorie überlegen. M i t dieser Reaktionstheorie lassen sich inhaltlich alle materiell-rechtlichen Verhaltensweisen erfassen, sowohl die Regeln aus dem Straf- wie aus dem zivilen Schuldrecht (für das die Zwangstheorie ausreichend wäre), als auch für die Normen des Verwaltungsrechts, insbesondere der Leistungsgesetze in der Sozialgesetzgebung 18 . Wenn wir Geiger folgen, kommt es i m Zusammenhang mit der Effektivität der Norm nicht auf die Zwangsandrohung an, die über der Norm schwebt, sondern auf ein konkretes, das heißt also effektives und beschreibbares Handeln des Rechtsstabs - gleichgültig nun, ob in Verfolgung eines Deliktes, als justizielle Tätigkeit oder Verwaltungshandeln, Polizei und Staatsanwalt gegen Missetaten; der Zivilrichter wegen Anspruchs aus Vertrag oder Delikt; das Sozialamt wegen Antrags auf Kindergeld - immer und überall ist der Rechtsstab tätig geworden, hat er reagiert: auf Missetat, auf Anrufung und auf Antrag, um hier nur die klassischen Beispiele für Rechtsstabshandeln aufzuführen. Folgerichtig unterscheidet Geiger, i m Anschluß an Karl Olivecrona, zwischen Aktionsnormen als Handlungsnormen gegenüber den Rechtsadressaten und sekundären Reaktionsnormen, die an den Rechtsstab gerichtet sind 1 9 . Während die Zwangs- und Sanktionstheorie sich stützt auf die Drohung mit Nachteilen bei Nichtbefolgen der Norm (oder lockt mit Belohnung beim Erreichen von Vorgaben), verzichtet die favorisierte Reaktionstheorie nicht nur auf die Kriterien von Drohung (und Verlockung); sie geht auch nicht zwingend einher mit der Auffassung, daß i m soziologischen Sinne Recht erst entsteht, wenn geschehenes Unrecht erkannt und bekämpft wird. Sie hebt lediglich darauf ab, daß der Rechtsstab reagiert. Insofern greift Rehbinders Vorschlag der Erweiterung der Zwangstheorie zur Reaktionstheorie nicht weit genug. Die Reaktionstheorie verdient theoretische Eigenständigkeit. Die Reaktionstheorie in dem hier verstandenen Sinne ist wertvoll für den weiteren theoretischen Unterbau der Rechtsforschung, insbesondere für die quantitative Erfassung der Effektivität von Normen. Die Kriminologie befaßt sich mit Untat und Missetäter; sie kann freilich nicht die Normbefolgung messen, also alle, die rechts fahren und links überholen, ebensowenig wie die zivilistische Rechtsforschung ordnungsgemäß erfüllte Verträge. I m kriminellen und deliktischen Rechtsbereich, Strafnormen und Verwaltungsrecht selbstverständlich eingeschlossen, ist 17 Ebenda, S. 198. 18 Die Leistungsverwaltung im sozialen Rechtsstaat hat ohnehin die Eingriffs Verwaltung an Bedeutung überholt; so jedenfalls Konrad Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 18. erg. Aufl., Heidelberg 1991, S. 85 f. 19 Geiger, 1947a, Nachdruck 1987, S. 104. In der Koppelung mit einer sekundären Reaktionsnorm entsteht erst die Rechtsnorm im juridischen Sinne. 7 Gedächtnisschrift Wenz
98
Edgar Michael Wenz
dagegen die Messung relativ einfach: Immer wenn der Rechtsstab tätig geworden ist, hat man einen zählbaren Vorgang. Nur die Quote, also die quantifizierbare Bezugsgröße, läßt sich mangels Verhältniszahl nicht rechnerisch ermitteln. Auch i m Zivilrecht ließe sich das Handeln des zuständigen Organs des Rechtsstabs, das Zivilgericht, nicht nur zählen, wie es ja schon geschieht, sondern durch Differenzierung und Strukturierung der rechtshängigen Fälle auswerten. Wenn man nur diese Lebens- und Rechtsbereiche beobachtet und sein Erkenntnisinteresse darauf beschränkt, wie es implizit die Zwangstheoretiker tun, kommt man zu dem Ergebnis, daß der Rechtsstab - in seiner Funktion als Erzwingungsstab - nur tätig wird, wenn das Recht verletzt ist; er hat sich dann mit dem „Fall" zu beschäftigen, er hat den „Streitfall" zu erledigen 2 0 . Aus rechtssoziologischer Sicht muß man dann zu dem Schluß kommen, daß Recht schlicht und einfach Abwesenheit von Unrecht bedeutet, also eine „negatio negationis" (Hegel) 2 1 . Aufgabe des Rechtsstabes ist es also, das Recht wiederherzustellen, Schaden wiedergutzumachen und gute Ordnung wieder einkehren zu lassen - „restitutio in harmoniam et eunomiam" 2 2 . Diese sehr nüchterne, ganz gewiß angreifbare Definition von Recht als Abwesenheit von Unrecht beruht auf Beobachtung und muß den Vorwurf des Zynismus dulden. Sie ist eher dem Rechtsrealismus zuzurechnen 23 . Aber diese Definition - und das ihr ihre eigentliche Schwäche - trägt interessanterweise nicht mehr bei der Betrachtung von Leistungs- und Maßnahmegesetzen, weil nun nicht der Normbruch, sondern die Voraussetzungen für die Gewährung von Vergünstigungen und Prämien zur Prüfung anstehen, es sei denn, man könnte sich dazu verstehen, daß der Zustand des nicht in Anspruch genommenen Rechts noch eine Art „schwebenden Unrechts" sei. Dieser also vorübergehende, keinesfalls zwingend aufzulösende Unrechts-Zustand wäre dann erst beseitigt, wenn der Staatsbürger den
20 Dazu auch Karl N. Llewellyn, Recht, Rechtsleben und Gesellschaft, hrsg. v. M. Rehbinder, Berlin 1977, S. 45 ff. 21 Siehe dazu Werner Maihofer, Die gesellschaftliche Funktion des Rechts, in: Die Funktion des Rechts in der modernen Gesellschaft, Jahrbuch für Rechtssoziologie und Rechtstheorie, Bd. 1, Bielefeld 1970, S. 11 ff., den auch M. Rehbinder (Anm. 1), S. 140, zitiert. Beide Autoren sehen freilich in der Reaktion des Rechtsstabes auf den Normverstoß eher eine erneute Affirmation des Rechts. 22 Man mag entgegenhalten, daß diese aus dem antiken, insbesondere hellenischen Verständnis des Rechts stammende Formulierung eher die gute Ordnung als bleibendes Weltverständnis im Blick hat, während die moderne Auffassung Recht als etwas sich Entwickelndes begreift, eher der Rechtsspruch also das Recht fortschreibt. Man muß ganz und gar nicht der hier vertretenen Meinung beitreten, daß über den bereinigten Streitfall die gute „alte" Ordnung - wieder - eingeführt wird. Die wiederhergestellte gute Ordnung kann dann durchaus „neu" sein, sie braucht nicht haargenau mit der alten übereinzustimmen; die gute Ordnung kann zu jeder Zeit neu definiert werden. 23 Geiger bezeichnet seine Rechtssoziologie als „soziologischen Rechtsrealismus" (in: 1947a, Nachdruck 1987, S. 329).
Von der Rechtsforschung zur Gesetzgebung
99
Anspruch, den ihm der Gesetzgeber eingeräumt hat, bei der zuständigen Behörde geltend macht, worauf dann der Rechtsstab reagiert, indem der zuständige Beamte den Antrag nicht nur entgegennimmt und bearbeitet, sondern auch entscheidet, genehmigt oder abweist. Ob schon durch die Antragstellung die Norm wirksam geworden ist, muß bezweifelt werden, weil sie inhaltlich die Norm j a gar nicht treffen könnte, also schon i m ersten Anschein nicht schlüssig ist. Gewiß kann man aber die Wirksamkeit der Norm annehmen, somit die Anwesenheit des Rechts, wenn der Antrag als formal ordnungsgemäß erkannt und dann - positiv oder negativ - beschieden wurde. Es bedarf dann i m Falle der Abweisung keiner Anrufung der Verwaltungsgerichtsbarkeit mehr. Der Rechtsstab ist tätig geworden, er hat dann einen Fakt gesetzt, der zähl- und meßbar ist. Man muß bei diesen Überlegungen sich immer wieder vor Augen führen, daß es hier nicht um philosophische oder gar transzendentale Betrachtungen des Rechts geht, sondern lediglich um die theoretische Grundlage einer empirischen Rechtsforschung. Danach und nur danach soll das Instrumentarium vorbereitet werden. Die Rechtsforschung hat es dagegen relativ leicht: Sie braucht nur die gestellten Anträge, über die es in aller Regel Statistiken gibt, zu erfassen, die stattgegebenen ebenso wie die abgewiesenen. Die Reaktionstheorie zeigt sich jedenfalls für die hier vorgetragenen Forschungsinteressen als wesentlich wirksamer als die Zwangstheorie. Die Reaktionstheorie geht eben nicht zwingend einher mit der Auffassung, daß i m soziologischen Sinne Recht erst entsteht, wenn geschehenes Unrecht erkannt und bekämpft wird, sie hebt lediglich darauf ab, daß der Rechtsstab agiert.
IV. Von der Rechtsforschung zur Gesetzgebung? Die auf Geigers „Vorarbeiten" aufbauende Theorie der Rechtsforschung, mit der er sich freilich nicht vertieft beschäftigt und zu der er erst recht keine konkreten Anleitungen hinterlassen hat, eröffnet den Weg zur Gesetzgebung, in die die Erkenntnisse eben dieser Rechtsforschung einfließen könnten, sogar einfließen müßten. Nur dort, wo sie sich zu einigermaßen angemessenen Kosten nicht realisieren läßt, wobei strenge Maßstäbe angelegt werden sollten, darf man auf vorhergehende, begleitende und kontrollierende Rechtsforschung verzichten. Dann müßte man sich mit der bisher üblichen Gesetzesvorbereitung, etwa über Experten-Gutachten, Hearings und Enquête-Kommissionen, zufriedengeben - aber nur dann. Die deutsche Gesetzgebungslehre hat sich mit diesem Thema durchwegs befaßt, es aber nur selten vertieft. M i t dem derzeitigen Diskussionsstand werden wir uns noch beschäftigen. In der angelsächsischen und skandinavischen Literatur sieht die Situation anders aus. Rehbinder verweist auf Roscoe Pound 2 4 , dann auf Frederik K. Beutel 2 5 , der für eine „experimentelle Rechtswissenschaft" plädiert 2 6 . 7'
100
Edgar Michael Wenz
Dieses Ergebnis ist insgesamt irritierend. Es kann sich nicht allein erklären lassen durch die langzeitige Zurückhaltung der Rechtswissenschaft gegenüber der Rechtssoziologie, sogar zeitweise deren Ablehnung 2 7 . Und wäre es denn (immer noch) so, so wäre es höchste Zeit, darüber nachzudenken und den Standpunkt zu revidieren. Die Wirtschaft beispielsweise kommt ohne Marktforschung nicht mehr aus. Sie wird betrieben nicht nur vor Produktionsaufnahme, sondern auch und erst recht hinsichtlich der Akzeptanz nach Markteinführung. Jedenfalls kümmert sich ein Strumpffabrikant nicht mehr um das Schicksal seiner Nylons und Socken als der Gesetzgeber um seine Gesetze - und das, obwohl der Strumpffabrikant den denkbar unbestechlichsten Kontrolleur hat, den Markt. Aber er w i l l trotzdem verfolgen, ob und wie er den Erfolg optimieren und maximieren kann. Der Markt- und Käuferforschung ist neben der Wahlforschung auch zu verdanken, daß die Instrumente der empirischen Soziologie sich enorm verfeinert und verbessert haben. Die Meinungsforschung gilt heute in vielen Bereichen als unverzichtbar. Die Politik arbeitet damit. So stellt sich ohnehin die Frage, warum dieses probate Mittel nicht auch zur Kontrolle der Akzeptanz der Gesetze, deren Befolgung und deren Wirkung eingesetzt wird. Der Einwand ist zu erwarten, daß die hier angeschnittene - rechtspolitische Thematik über die Erkenntnisinteressen Geigers deutlich hinausgeht. Aber dieser Aufsatz beschäftigt sich explizit auch mit der Fortführung seiner Überlegungen. Wenn Geiger sich schon vor über eineinhalb Generationen mit der Rechtsrealität, mit der Wirksamkeit der Norm beschäftigt hat, liegt der Fortgang sehr nahe, daß er sich i m weiteren Verlauf mit höchster Wahrscheinlichkeit auch mit der Norm i m Kontext und Konnex der anderen Normen und zwangsläufig mit der Wirksamkeit der Gesetze, ihre Effizienz und dem Erreichen der gesetzten Ziele, beschäftigt hätte. Zu Geigers Zeiten war die empirische Soziologie auch noch nicht weit genug entwickelt, um sie in wissenschaftliche Überlegungen schon einbeziehen zu können. Diese Gedankenfolge braucht sich also nicht gegenüber dem Vorwurf eines 24
Rehbinder (Anm. 1), S. 31: Der Protagonist des „social engineering", der die Idee eines „Rechtspflegeministeriums" einbringt. 2 5 Ebenda, S. 34. 26 Vgl. Beutel, Frederik Keating, Die Experimentelle Rechtswissenschaft (übers, von U. Krüger), Berlin 1971, S. 34 f. Als Stufen des Experiments werden u. a. erwähnt: „ ( . . . ) 3. Man müßte beobachten und messen, wie sich die angewandte Norm in der Gesellschaft auswirkt. ( . . . ) 6. Falls die Analyse zeigt, daß das Recht unwirksam ist, so müßten neue Wege vorgeschlagen werden, um den ursprünglich gewünschten Erfolg zu erreichen. 7. Die vorgeschlagene Regel müßte in Kraft gesetzt und das Verfahren wiederholt werden." 27 Siehe dazu Wenz, Edgar Michael (Hrsg.), Wissenschaftsgerichtshöfe - Mittler zwischen Wissenschaft, Politik und Gesellschaft, Frankfurt a. M./New York 1983, S. 75 ff. Hier ist auch zu erwähnen, daß F. K. Beutel (Anm. 26), S. 204 ff., die Probleme für die Verwirklichung seiner Idee darin sieht, die Juristen zu überzeugen.
Von der Rechtsforschung zur Gesetzgebung
101
Gedankenbruchs zu rechtfertigen. Die Wirksamkeit der Normen und die Wirksamkeit der Gesetze, und diese wiederum mit den - meßbaren - Erfolgen, also dem Erreichen der gesetzlichen Ziele, sind nahe Verwandte. Freilich bedarf dazu der Effektivitätsbegriff von Geiger einer Komplexitätsanreicherung 28 .
V. Problematik der Gesetzesevaluation Für Geiger ist ein Gesetz dann effektiv, wenn es befolgt wird oder auf seine Nichtbefolgung eine Reaktion des Rechtsstabes erfolgt. Der für eine Messung des Erfolges von Gesetzen taugliche Effektivitätsbegriff muß darüber hinaus, insbesondere bei den hier interessierenden Maßnahmegesetzen, die tatsächlichen Auswirkungen des Gesetzes in der sozialen Realität, gemessen an seinen Zwecksetzungen, erfassen 29 . Diese Auffassung von Effektivität setzt ein Verständnis des Gesetzes als Instrument gesellschaftlicher Problemlösung voraus. Fundamentales Forschungsinteresse einer Beschäftigung mit der Gesetzeseffektivität in diesem Sinn und ihrer Messung ist die Suche nach dem „richtigen Recht". Aber nicht in einem material-naturrechtlichen Sinn, sondern, ganz auf der Linie Geigers, in wertfreier Bedeutung. Die materialen Regelungsgehalte des kontingenten Rechts sind Ausdruck der Wertvorstellungen und Zielsetzungen der gerade herrschenden Mehrheit. Die Gestaltung der gesellschaftlichen Realität gemäß diesen Werten erfolgt mit Hilfe der Gesetze. Richtiges Recht ist also dasjenige, das seine Umsetzungsfunktion optimal erfüllt. Erfolgskontrolle von Gesetzen läßt sich somit als Teil eines Optimierungsprozesses i m Rahmen einer Zweck-Mittel-Relation verstehen, in der das Gesetz das zu optimierende Mittel darstellt. A u f diese Weise leistet Gesetzesevaluation einen Beitrag zur Rationalisierung von Politik. Wenn Erfolgskontrolle die planmäßige, überprüfbare Messung der Effektivität von Gesetzen ist, dann kann sie nur ex-post-Analyse sein, d. h. erst nach Ablauf einer bestimmten Geltungsperiode des in Kraft befindlichen Gesetzes 30 durchgeführt werden. M i t Erfolgskontrolle sind hier folglich weder Entwurfsprüfungen i m Gesetzgebungsverfahren gemeint 3 1 , mit denen beispielsweise durch Simulationen, Planspiele usw. man sich an die Tauglichkeit eines Gesetzes ex-ante herantasten 28
Noll, Peter, Die Berücksichtigung der Effektivität der Gesetze bei ihrer Schaffung, in: Theo Öhlinger (Hrsg.), Methodik der Gesetzgebung, Wien/New York 1982. 29 Öhlinger, Theo, Das Gesetz als Instrument gesellschaftlicher Problemlösung und seine Alternativen, in: ders. (Anm. 28), S. 17 ff. 30 Fricke, Peter, Modell zur Institutionalisierung einer Gesetzeskontrolle (Europäische Hochschulschriften, Reihe 31, Bd. 40). Frankfurt a. M./Bern 1983, S. 30. 31 Hugger, Werner, Gesetze - Ihre Vorbereitung, Abfassung und Prüfung, Baden-Baden 1983, S. 323 ff.
102
Edgar Michael Wenz
könnte, noch die rein gesetzgebungstechnischen Methoden zur Steigerung von Norm Verständlichkeit und Anwendungspraktikabilität 3 2 . Ebenso wenig ist damit die juristischnormative Geltungskontrolle durch das Bundesverfassungsgericht gemeint 3 3 . Man könnte hier ein beackertes Feld der empirischen Rechtsforschung vermuten, wird aber durch den Blick in die Literatur zur Gesetzgebungslehre eines anderen belehrt 3 4 . Wenngleich die Erkenntnisse der theoretischen Rechtssoziologie und ihrer praktisch-operationalen Möglichkeiten teilweise gesehen werden, so fehlt es doch an einer entsprechenden Gewichtung 3 5 und Ausarbeitung. Selbst bei den Rechtssoziologen wird dieses Thema überwiegend nur marginal behandelt. Nur selten wird die Bedeutung der Rechtstatsachenforschung (hier synonym verstanden für alle Methoden der Rechtsforschung) für diese Fragen so klar gesehen wie von Maihofer, der die Notwendigkeit ihrer Einbeziehung in die Erfolgskontrolle von Gesetzen betont 3 6 . So nimmt es nicht wunder, daß Impulse für die Gesetzesevaluations- und Implementationsforschung überwiegend nicht von Juristen, sondern von Politologen und Soziologen stammen. Es würde hier zu weit führen, die gesamte Problematik der Erfolgskontrolle von Gesetzen darzustellen, aber einige Kernprobleme sollen genannt werden. 32
Dazu R. Krebs, Die effektive Norm unter Berücksichtigung ihres Normzieles, in: Heinz Schäffer/Otto Triffterer (Hrsg.), Rationalisierung der Gesetzgebung, Baden-Baden 1984, S. 121 ff. 33 Schröder, H. J., Zur Erfolgskontrolle der Gesetzgebung, in: Jahrbuch für Rechtssoziologie und Rechtstheorie, Bd. 3, 1972, S. 276 ff. 34 Hans Schneider, Gesetzgebung, Heidelberg 1991, behandelt die Wirksamkeitskontrolle beispielsweise auf nur drei von mehr als 400 Seiten Umfang. Hermann Hill, Einführung in die Gesetzgebungslehre, Heidelberg 1982, erwähnt unter „Erfolgskontrolle" (S. 80 ff.) die Rechtstatsachenforschung als eine von mehreren Möglichkeiten zur Analyse der Zielerreichung, Peter Noll, Gesetzgebungslehre, Reinbek 1971, unter „Nachkontrolle" (S. 946 ff.). Thomas Raiser, Einführung in die Rechtssoziologie, Bielefeld 1982, S. 18 ff., Anwendung der Rechtstatsachenforschung in der Gesetzgebung, und K. F. Röhl (Anm. 11), S. 300 ff., Gesetzesevaluierung, immerhin zwei ausgewiesene Rechtssoziologen, finden in ihren Studienbüchern auch nur wenige Worte zu diesem Problemkreis. M. Rehbinder, der der „Soziologie der Gesetzgebung" (Anm. 1), S. 233 ff., relativ breiten Raum zugesteht, fordert nicht die Institutionalisierung der Rechtstatsachenforschung, deren Bedeutung er zwar betont, aber Zeitprobleme sieht, statt dessen will er konträre Expertengruppen zu Wort kommen lassen, aber scheint insgesamt mit der Befürchtung eines „Schusses ins Dunkle" zu resignieren (ebenda, S. 243). 35 Welch geringen Anteil die Rechtstatsachenforschung selbst im Rahmen der Arbeit des Bundesministeriums der Justiz hat, zeigt implizit D. Strempel, Der Beitrag der empirischen Rechtsforschung zu einem realistischen Umgang mit dem Recht, in: Heinz Schäffer (Hrsg.), Gesetzgebung und Rechtskultur, Wien 1987, S. 87 ff. 36 Maihofer, Werner, Gesetzgebungswissenschaft, in: Günter Winkler /Bernd Schilcher (Hrsg.), Gesetzgebung, Wien /New York 1981, S. 22 ff., mit Ergebnissen der Rechtstatsachenforschung zum Begriff des Gesetzgebers. Die Anmerkung sei erlaubt, daß Maihofer in seiner politischen Laufbahn, immerhin als Bundesminister des Innern, nichts Konkretes und von außen Erkennbares in Richtung Effektivitätskontrolle bewirkt hat.
Von der Rechtsforschung zur Gesetzgebung
103
Erfolgskontrolle w i l l den Zweck-/ Zielerreichungsgrad eines Gesetzes messen, also den tatsächlich erreichten Ist-Wert bei der Gesetzesverwirklichung dem angezielten Soll-Wert gegenüberstellen 37 . Klärungsbedürftig ist zunächst, was der Prüfungsmaßstab für die Effektivität eines Gesetzes sein soll, also die Bestimmung des Sollwerts. In Betracht kommen dafür die politischen Ziele oder die konkreten Zwecke des Gesetzes (Wirkungsauftrag) 3 8 . Der Erläuterung der rein heuristischen Differenzierung von Zielen und Zwecken dient das folgende Beispiel: Das Ziel, das der Gesetzgeber mit einem Gesetz verfolgt, reicht über dieses hinaus. Es bezeichnet den Soll-Zustand in der gesellschaftlichen Wirklichkeit, also beispielsweise Beseitigung von Wohnungsmangel und breite Streuung von Wohneigentum in allen Bevölkerungsschichten (vgl. § 1 I I Wohnungsbau- und Familienheimgesetz). U m diesem Ziel näher zu kommen, wird dem Gesetz die Förderung bestimmter Bauvorhaben als Zweck aufgegeben. Es wäre ζ. B. denkbar, daß nach dem Gesetz eine bestimmte Zahl an Neubauwohnungen pro Jahr zu fördern ist. Die Zwecksetzung beschreibt also, was mit den Anordnungen i m Gesetz (Auszahlung der Fördermittel) unmittelbar erreicht werden soll (jährliche Marge). Aber dieser Zweck bleibt hinter dem politischen Ziel zurück, ist nur ein Schritt auf dem Weg dahin. Bei der Erfolgskontrolle ist jedoch erforderlich, sich darüber klar zu werden, was Prüfungsmaßstab sein soll: Ziel oder Z w e c k 3 9 . Es leuchtet ein, daß eine größtmögliche Präzisierung der Ziele und Zwecke die Operationalisierung von Meßkriterien und -indikatoren erleichtert. Dennoch ist darauf hinzuweisen, daß die Zielformulierungen oft nur eine Teilmenge der intendierten Effekte beschreiben, so daß bei nachträglicher Operationalisierung möglicherweise nicht alle beabsichtigten Effekte gemessen oder aber unbeabsichtigte Effekte einbezogen werden 4 0 . Als zweiter großer Abschnitt der Analyse ist die Bestimmung des Ist-Wertes, also der Zustand der von dem Gesetz beeinflußten sozialen Wirklichkeit, zu bewäl37 König, K., Zur Evaluation der Gesetzgebung, in: Gerd-Michael Hellstern / Hellmut Wollmann (Hrsg.), Experimentelle Politik - Reformstrohfeuer oder Lernstrategie, Opladen 1983, S. 122 ff. 38 Im einzelnen dazu W. Hugger (Anm. 31), S. 165 f., 316 ff. 39 Diese ärgerlichen Fehlbelegungen von Sozialwohnungen benötigen eine nur einigermaßen funktionierende empirische Erhebung zum beweisbaren Faktum, das dann zur politischen Handlung förmlich zwingen müßte. Es würde sich dann die Lösung aufdrängen, von der Objektförderung abzugehen und verstärkt bis ausschließlich die (bisher vernachlässigte) Subjektförderung zu bevorzugen. Beim Kindergeld, um auch ein anderes Beispiel von Leistungsgesetzen anzuführen, wäre die Erkenntnis von Mißbrauch nicht so einfach. Zweck und Ziel des Gesetzes sind klar und einleuchtend; die Abweichungen von der Zielprojektion sind durch Vergleich mit der deutschen Bevölkerungspyramide noch einigermaßen erfahrbar. Was dann eigentlich den Gesetzgeber interessieren könnte, die sinnvolle, nämlich zweckorientierte Verwendung des Kindergeldes, das bleibt der Nachprüfung verschlossen: Der Vater kann das Kindergeld auch vertrinken. 40 Derlien, Hans-Ulrich, Die Erfolgskontrolle staatlicher Planung, Baden-Baden 1976, S. 24.
104
Edgar Michael Wenz
tigen. Dieser soll mit den Methoden der empirischen Sozialforschung ermittelt werden. Die Auswahl der Kriterien und die Qualität der Methodik trägt hier entscheidend dazu bei, den Analysezweck zu erfüllen. Rechtstatsachenforschung, Implementations-, Meinungs- und andere Zweige der empirischen Sozialforschung können hier wichtige Beiträge leisten. Maßgeblichen Einfluß auf die Ergebnisse der Erfolgskontrolle hat die Wahl des Meßzeitpunktes. Man muß dem Gesetz schließlich eine bestimmte „Bewährungszeit 4 ' zubilligen. Gesetzestechnisch könnte dieser Kontrolltermin durch die Aufnahme einer Berichtspflicht über den Erfolg des Gesetzes nach einem fixierten Zeitraum ins Gesetz eingefügt werden 4 1 . Radikaler als die Berichtspflicht, die die Geltungsdauer des Gesetzes nicht betrifft, ist Befristung des Gesetzes, um am Ende der Befristung nach Auswertung der Analysen über die weitere Geltung oder eine Novellierung zu entscheiden. Diese Form des Zeitgesetzes 42 ist aus juristischer Sicht nicht ganz unproblematisch 43 . Sie nähert sich relativ stark an eine „experimentelle Gesetzgebung" i m Sinne F. K. Beutels an. Damit ist zugleich eine weitere Frage angesprochen, nämlich die nach der Verwertung der Analyseergebnisse. Ihrer Zielsetzung nach sollten die Ergebnisse in das Gesetzgebungsverfahren einfließen und dort zur Fehlerkorrektur am Gesetz führen. Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit, sofern sich Gesetzmäßigkeiten feststellen lassen, die Erfahrungen auch in die Gesetzesentwicklung in anderen Bereichen einzubeziehen. Auch bisher gab es schon Ansätze zu einer Gesetzesevaluation 44 , allerdings ohne einen gemeinsamen Rahmen und zumeist unsystematisch. Zu erwähnen sind hier u. a. gesetzlich fixierte Berichtspflichten der Regierungen gegenüber dem Parlament, Große und Kleine Anfragen i m Bundestag und die Einsetzung von Enquête-Kommissionen. A u f der Ebene der Exekutive bzw. Regierung verfügen die Ministerien über informelle Rückkoppelungswege. Besonderes Gewicht haben hier die punktuellen Rückmeldungen aus der vollziehenden Verwaltung über den Gesetzesvollzug, bei denen wohl die Defizite des Gesetzes i m Vordergrund stehen dürften. In geringerem Maße wurden auch schon Aufträge für Implementationsstudien vergeben. Ein Grund für die zögerliche Nutzung der Erkenntnisse über die Möglichkeit einer Erfolgskontrolle seitens der Gesetzgebungsorgane darf man wohl darin sehen, daß die Ergebnisse einer Gesetzesevaluation erheblichen politischen Sprengstoff 41
Fricke, P. (Anm. 30), S. 61; Schäffer, Heinz, Rationalisierung der Rechtssetzung, in: ders. (Hrsg.), Theorie der Rechtssetzung, Wien/Mainz 1988, S. 239. 42 Zum Zeitgesetz umfassend Kindermann, H., Erfolgskontrolle durch Zeitgesetze, in: Schäffer/Triffterer (Anm. 32), S. 141 ff. 43 Mader, L., Experimentelle Gesetzgebung, in: Gesetzgebungstheorie und Rechtspolitik, Jahrbuch für Rechtssoziologie und Rechtstheorie, Bd. 13, 1988, S. 211 ff. 44 Zeh, W., Vollzugskontrolle und Wirkungsbeobachtung als Teilfunktion der Gesetzgebung, ebenda, S. 194 ff.; Fricke, P. (Anm. 30), S. 45 ff.; Schäffer, H. (Anm. 41), S. 238.
Von der Rechtsforschung zur Gesetzgebung
105
in sich tragen. Besonders bei mangelnder Effektivität von Gesetzen wird sich die Opposition über die zusätzliche „ M u n i t i o n " freuen; denn das wissenschaftlich bestätigte Versagen eines Gesetzes hat beim Wähler sicherlich mehr Gewicht als das alltägliche „Kettenrasseln". Soweit würde man den heute von Politikern überstrapazieren „Populismus" wohl nicht treiben wollen, die Chance einer wissenschaftlichen Gesetzgebungsevaluation durch mehr Transparenz als Ansatzpunkte für eine verstärkte demokratische Kontrolle dranzugeben. In der Literatur wurde die Forderung nach einer systematischen, planmäßigen und umfassenden Erfolgskontrolle schon häufiger erhoben 4 5 , insbesondere wird eine Institutionalisierung der Gesetzgebungsevaluation postuliert 4 6 . Klärungsbedürftig ist aber in diesem Zusammenhang noch manche Frage. Einige seien kurz angedeutet: Welches wäre die geeignete Form der Institutionalisierung? In welchem Umfang sollen die Gesetze der Erfolgskontrolle unterworfen werden? Welche Auswahlkriterien dafür sind sinnvoll? Wie hoch wären Kosten, Leistungsfähigkeit und Nutzen einer solchen Institution? Es ergeben sich gewiß viele Aufgaben, die sich vermutlich auch nur Schritt um Schritt lösen lassen.
VI. Fazit: Ein rechtspolitisches Postulat Zusammengefaßt, freilich auch nur überschlägig, könnte das rechtspolitische Postulat an den Gesetzgeber etwa so aussehen (de lege ferenda): -
Klar Ziel und Zweck des Gesetzes beschreiben müssen,
- mit einer Genauigkeit, die die Aufstellung von nachprüfbaren Kriterien zuläßt, - die in einer vorgegebenen Zeit, etwa auch in Stufen, erreicht werden müssen; - welche Fakten und Kriterien - in welchen Zeitabschnitten kontrolliert (gemessen) werden müssen, - wobei die Meßmethoden schon i m Gesetz oder in einem verbindlichen Anhang zum Gesetz festgelegt sind. Man mag entgegenhalten, daß das in die „Traumwelt der Gesetzgebung" gehört. Gewiß, gemessen an den derzeitigen, häufig geradezu schlampigen Gesetzen, die offenbar nur Interessengruppen besänftigen sollen, sich deshalb auch in Generalklauseln und unbestimmte Rechtsbegriffe flüchten, die sich den Pflichten der Idee des Rechtsstaates entziehen durch die Flucht in den Richterstaat, mag das stimmen. 45 Maihofer, W. (Anm. 36), S. 3; Schröder, H. J. (Anm. 33), S. 271; Schäffer, H. (Anm. 41), S. 237 f.; Derlien, H.-U. (Anm. 40), S. 30. 46 Moll, P. (Anm. 28), S. 146; Fricke, P. (Anm. 30), S. 94; Derlien, H.-U. (Anm. 40), S. 33; Öhlinger, Theo, Planung der Gesetzgebung und Wissenschaft. Einführung in das Tagungsthema, in: ders. (Anm. 28), S. 282; Zeh, W. (Anm. 44), S. 206 f.; Schneider, H. (Anm. 34), S. 106; Schäffer, H. (Anm. 41), S. 240.
106
Edgar Michael Wenz
Was man auch vortragen mag, vermutlich wieder einmal aus sogenannten „praktischen" Gründen, die rechtspolitische Forderung aufzuweichen, so mängelbehaftet auch die Durchführung dann sein mag - neue Wege zu suchen, ist auf jeden Fall einmal besser, als daß der Gesetzgeber sich unverdrossen auf die wissenschaftliche Diskussion, auf die Einschätzung des Zeitgeistes (dem gar nicht so selten Politiker in den Nebenzimmern ihres Wahlkreises auf die Spur gekommen zu sein wähnen), auf die veröffentlichte Meinung und schließlich auf Hearings und EnqueteKommissionen verläßt. Man mißt heutzutage gewissermaßen Fieber wie noch vor der Erfindung des Fieberthermometers - durch Handauflegen. Wir könnten uns nun damit begnügen, diesen Mißstand zu kritisieren und zu beklagen. Alle Autoren, die sich mit diesem Thema je befaßt haben, ließen es daran auch nicht fehlen. Wenn es aber ernsthaft um Gesetze in überschaubarer Zahl und größtmöglicher Prägnanz geht, dann darf das Ziel nur deren Effektivität sein. Womit wir wieder bei Theodor Geiger wären: Die Idee der Effektivität der Norm ist eine seiner wichtigsten Hinterlassenschaften. Wir müssen daraus lernen, die Konsequenzen zu ziehen, zunächst durch Institutionalisierung der Rechtsforschung als typische und vordringliche Aufgabe der Rechtssoziologie.
Fragen von Naturwissenschaft und Technik an Rechtsphilosophie, Rechtstheorie, Rechtsdogmatik und Rechtssoziologie* In allen Bezügen und Beziehungen, die bei so sehr unterschiedlichen Phaenomena wie ,Energie und Gerechtigkeit' sich herstellen und sich vorstellen lassen, ist die Rechtswissenschaft gefordert. Sie muß bei ihrem Bemühungen an die Erkenntnis anknüpfen, daß sie ihre Antworten nur aus dem eigenen Fundus und aus den eigenen Quellen zu schöpfen hat. Die Rechtswissenschaft muß Vorsicht obwalten lassen, bei interdisziplinärer Aufarbeitung nicht den bequem scheinenden Verlockungen des Synkretizismus zu erliegen, die häufig nichts anderes sind als ,Methodenklau'. Alle Wissenschaften haben ihre eigenen Strukturen; nur deren Funktionen, die abzulesen sind aus den mit den eigenen Denkmethoden erarbeiteten Resultaten, lassen sich verwerten. Das Thema läßt auch einen Konflikt von kaum abzusehender Tragweite erkennen: Die soziale Akzeptanzkrise gegenüber der Technologie. Sie hat einen qualitativen Umschlag in eine Vertrauenskrise in das Recht erfahren. Niemand behauptet, daß originär eine Rechtskrise die Akzeptanzkrise der Technologie - womit i m besonderen Maße die Verfahrenstechniken zur Beschaffung von Energie gemeint sind - herbeigeführt haben könnte. Aber angesichts der Bedeutung von Recht und Gesetz - mit der Forderung der Verwirklichung des Rechtsideals der Gerechtigkeit - als weitaus bedeutendste soziale Ordnungsfaktoren äußern sich zwangsläufig soziale Akzeptanzkrisen als Fragen an die Gerechtigkeit; so können sie zu Vertrauenskrisen in das Recht führen. Wenn die Gesellschaft aber weiter existieren will, wozu sie das Staatswesen und eben Recht und Gesetz braucht, muß nach Mitteln und Wegen Umschau gehalten werden, die zur Auflösung oder doch zumindest zur Aufweichung dieser Krise geeignet sein können. Die Aufmerksamkeit der Rechtswissenschaft hat dabei ihrem eigenen Fach zu gelten; sie hat sich dabei ihrer Methoden zu bedienen. Die Rechtswissenschaft wird gefordert in ihrem jurisprudentiellen Zweig der Rechtsanwendung, als Verwaltung und Rechtsprechung. Jurisprudenz und Rechtsanwendung, Entscheidungs-, Wertungs- und Handlungslehre und -kunst sehen sich vor das Problem gestellt, einerseits einem unentrinnbaren Entscheidungszwang zu * Erstveröffentlichung in: Reiner Kümmel, Monika Suhrcke (Hrsg.), Energie und Gerechtigkeit, Band 6 der interdisziplinären Reihe Politik - Recht - Gesellschaft, München, 1984, S. 230 ff.
108
Edgar Michael Wenz
unterliegen, andererseits aber eingeengt zu sein durch Theorien und Prämissen, die sie von anderen Wissenschaften und Lehren - beispielsweise Naturwissenschaften und Technik - angeliefert erhalten, denen sie gewissermaßen ausgeliefert sind. Die Rechtswissenschaft ist an Normen gebunden, findet aber nur Generalklauseln und unbestimmte Rechtsbegriffe, die sie konkretisieren muß. Sie ist gezwungen, eine Arbeit zu tun, die ihr der Gesetzgeber, aus welchen Gründen auch immer, überlassen hat. Nach unserer Meinung brauchen Rechtswissenschaft und Jurisprudenz keineswegs sich nur nach Hilfen umzusehen bei der Philosophie oder bei den Naturwissenschaften. Die Rechtswissenschaft muß sich Erkenntnisziele setzen, die sie auf eigenen Feldern finden kann. Die erste Frage ist zu stellen an die Rechtsphilosophie: Ist - angesichts der Vielfalt von Handlungsalternativen in unserer Industriegesellschaft - Rechtssicherheit, die sich darstellt als Rechtsgewißheit und als Rechts vertrauen, nicht eine der wichtigsten Voraussetzungen, Gerechtigkeit zu verwirklichen? Läßt sich Rechtssicherheit anders herstellen als durch positive Normen? Ist aber damit nicht auch wieder das Tor aufgestoßen zum Rechtspositivismus, der gerade überwunden schien - um der Gerechtigkeit willen? Oder kann nur i m rationalistischen Rechtspositivismus die Idee des liberalen Rechtsstaates verwirklicht werden, eben des Rechtsstaates, ohne den ein Grundrechtsschutz nicht denkbar ist - die Erfüllung und Verteidigung von Grundrechten, die sich gerade im Industriezeitalter Gefahren und Angriffen ausgesetzt sehen? Aus diesen Fragestellungen läßt sich die erste These ableiten: Die Rechtsphilosophie ist aufgefordert, Reflexionen erneut anzustellen zu der Fähigkeit des Rechtspositivismus, die Idealität des Rechts herbeizuführen. Rechtstheorie und Rechtsdogmatik sind befragt, wenn es um das Verhältnis von Sollens-Sätzen zu Seins-Sätzen geht, um die Einbindung der Erkenntnisse aus den Tatsachen- und Wirklichkeitswissenschaften in die Rechtswissenschaft und Rechtspraxis. Es gibt eine Reihe von Lehren, die sich mit dem scheinbar unüberwindlichen Gegensatz von Sollen und Sein befassen, vom Neu-Kantianismus, über Neu-Heglianismus, die Phaenomenologie und die ontologischen Strömungen bis zur Erkenntnis der „normativen Kraft des Faktischen" (Georg Jellinek) und der „Normativität des Seins" (Henkel). Aber die Generalklauseln der Industriegesellschaft - allgemein anerkannte Regeln der Technik, Stand der Technik, Stand von Wissenschaft und Technik (Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis), wirtschaftliche Vertretbarkeit - , die vielen unbestimmten Rechtsbegriffe, die nach den Erkenntnissen des realen Seins konkretisiert werden müssen, schließlich die anerkannten technischen Regelwerke ohne Rechtsnormcharakter - all' dies zwingt wegen ihrer Tragweite und des immensen Bedürfnisses nach Rechtssicherheit zu einer theoretischen und dogmatischen Aufarbeitung dieses Komplexes. Es geht hierbei vordergründig um die Verweisungstechniken, i m Kern aber um ein eigenes
Naturwissenschaft und Rechtsphilosophie
109
Verständnis der Rechtswissenschaft gegenüber Seins-Sätzen aus den Wirklichkeitsund Tatsachenwissenschaften. Die zweite These müßte von Rechtsdogmatik und Rechtssoziologie fordern, Erkenntnisse voranzubringen, außerrechtliche Normen, ohne Gefährdung rechtsstaatlicher Grundsätze, wirksam und gültig in das Rechtssystem einzubinden. Die dritte Frage ist gerichtet auf das Verhältnis der Rechtswissenschaft zu ihrer Tochter Rechtssoziologie. Man wird erkennen müssen, daß ein schlechtes Verhältnis noch besser wäre als gar kein Verhältnis. Die Ablehnung der Rechtssoziologie ließe sich freilich erklären durch die jüngere Geschichte dieses Wissenschaftszweiges. Die auffallende Beschäftigung mit der Richter- und Justizsoziologie provozierte eine Art ,Berührungsangst 4 der Juristen, die freilich häufig die Frage »Distanz oder Ignoranz?' aufkommen ließ. Darüber wurde nicht selten vergessen, daß die Rechtssoziologie die Wirklichkeitswissenschaft vom Recht ist, deren Erkenntnisinteressen angesiedelt sind i m Schnittpunkt von Sollen und Sein. Das Problem des Richters sind ja nicht die Konklusionen, sondern die richtigen Prämissen; diese aber wiederum stammen aus den empirischen Wissenschaften. Dennoch wäre ein Zurückdrängen der Rechtssoziologie auf die Rechtstatsachenforschung und auf die Mithilfe bei der Konkretisierung der Norm ein Verzicht auf die Chancen, die jede Wissenschaft zu eröffnen weiß, die sich nicht mit der Faktizität befaßt. So könnte sie auch der Rechtspolitik als Hilfswissenschaft der Gesetzgebungslehre („sociology into law") zudienen. Das Feld reicht so weit, wie Gesellschaft und Recht sich berühren. So könnte die dritte These also lauten, daß die Rechtswissenschaft das Verhältnis zu ihrer Tochter Rechtssoziologie aus einer Überfülle von Gründen überprüfen und neu ordnen muß. In diesem Zusammenhang lassen sich Angebote der Rechtssoziologie prüfen, so das Potential des Verfahrens, das Legitimation verschafft (Niklas Luhmann: „Legitimation durch Verfahren"). Verfahren ist hier freilich nicht zu verstehen als prozeßrechtlicher Ablauf, der durch (sekundäre) Normen geregelt ist - auch wenn deren Bedeutung, bis hin zum Grundrechtsschutz, nicht verkannt wird. Eine Vielzahl von Mißverständnissen in der Literatur müssen ausgeräumt werden, der Vorwurf des Wertnihilismus oder eines öden Gesetzespositivismus beispielsweise, obwohl wir es bei dieser Theorie mit nichts anderem zu tun haben als mit einer soziologischen Deskription und Analyse der Funktionen, die das Verfahren zu leisten vermag. Die psychologische und soziale Wirkung durch Verstreckung, Darstellung, Übernahme einer Rolle, Einleitung des Lernprozesses, Absorption von Enttäuschung, Isolierung des Protestierenden bewirken die Legitimierung durch Re-Integrierung des Gesetzesverletzen gewissermaßen qua Einsicht. Freilich haben sich diese Überlegungen nur mit dem Individualverfahren bislang befaßt, während die Untersuchungen zum Massenverfahren noch fehlen. Die vierte These also: Die Rechtswissenschaft, insbesondere die hierfür kompetente Rechtssoziologie, muß die legitimierenden Wirkungen des Verfahrens zu nützen versuchen, auch und gerade des Massenverfahrens.
110
Edgar Michael Wenz
Diese Erkenntnis der legitimierenden oder doch wenigstens legitimationserhöhenden Wirkung des Verfahrens leitet über zur fünften, den Themenausschnitt augenblicklich am meisten interessierenden Fragestellung: Wenn das Verfahren legitimierende Funktionen hat, was kann durch Institutionalisierung eines besonderen Verfahrens erreicht werden? Wäre die Institutionalisierung eines besonderen Verfahrens, das sich in der Einrichtung eines Wissenschaftsgerichtshofes (Science Court) verkörpert, nicht ein besonders geeigneter Weg, Akzeptanzkrisen des Rechts zu lösen oder doch wenigstens aufzuweichen? Eine Bejahung müßte dann auch gelten für Fragen der Großtechnologie, i m besonderen Maße der Energiebeschaffung, vornehmlich durch Kernkraftwerke. Diese Probleme stehen j a heute gewissermaßen stellvertretend für alle Probleme des Industriezeitalters, für Gift, Gen und eben Kernkraft. Der Begriff des Wissenschaftsgerichtshofes impliziert freilich Vorstellungen, daß das Gericht über »richtig oder falsch 4 in Fragen von Wissenschaft und Technik entscheiden sollte - eine Horrorvorstellung für jeden, dem die stete Offenheit der Wissenschaften ein unverzichtbares unantastbares Essentiale allein schon für den Begriff der Wissenschaften ist. Gerade Naturwissenschaftler wissen, daß sie noch nicht mehr haben leisten können, als an der Oberfläche des Kosmos herumzukratzen und sich die Beute unter dem Fingernagel anzugucken. Naturwissenschaftler liefern sich gewissermaßen jeden Tag die Beweise der Vorläufigkeit und Begrenztheit allen menschlichen Wissens. M i t dem kritischen Rationalismus Karl Poppers und allen Lehren, die sich nur in der Nähe aufhalten, stünden solche Vorstellungen i m härtesten und nie versöhnbaren Widerspruch. Vermutlich war dieser Begriff des Wissenschaftsgerichtshofes und Science Courts, der aus dem angelsächsischen Rechtskreis übernommen wurde, ursächlich dafür, daß diese Ideen - die MißVerständnisse eines wissenschaftlichen Kardinalkollegiums oder Heiligen Offizismus offenbar haben auslösen können - bislang nicht ernsthaft weiterverfolgt wurden. Dies sollte geschehen, das ist die fünfte These.
3. Gesetzgebung
Die forschungsbegleitete Gesetzgebung* I. Gesetzgeber und ihre Gesetze Man mag es als profanes, vor allem aber offenkundig unwissenschaftliches Thema verstehen, wenn danach gefragt wird, was den Gesetzgeber und einen Strumpffabrikanten bindet und trennt. Die Antwort ist recht einfach: Beide produzieren sie, jene Gesetze, diese Strümpfe und Socken. Aber ein Unterschied ist unverkennbar: Der Strumpffabrikant kümmert sich mehr um das Schicksal seiner Nylons als der Gesetzgeber um seine Gesetze - und das, obwohl der Strumpffabrikant den denkbar unbestechlisten Kontrolleur hat, nämlich den Markt. Aber er w i l l trotzdem verfolgen, ob und wie er den Erfolg optimieren und maximieren kann. Ganz und gar nicht so der Gesetzgeber. Das Zitat von Hans Schneider in seiner Monographie, Gesetzgebung, 1 wird von jenen, die sich mit der Materie je befaßt haben, keinen Widerspruch finden: „Ist ein Gesetz verabschiedet worden, so wendet sich das Parlament anderen Aufgaben zu und interessiert sich i m allgemeinen nicht für das weitere Schicksal des Gesetzes, seine Anwendung und seine Wirkungen. Ob das Gesetz die mit seinem Erlaß erstrebten Ziele erreicht oder verfehlt, pflegen die Abgeordneten nicht zu verfolgen." Dabei ist die Setzung von Normen, die Gesetzgebung 2 , der wirksamste und folgenreichste juridische Akt. Es ist ohnehin eine besondere - für die demokratische Staatsform freilich unverzichtbare - Art der Anmaßung, wenn ein kleiner Teil eines Volkes, also die M i t glieder der gesetzgebenden Körperschaften, dem ganzen Volk, der gesamten Gesellschaft Rechtsregeln setzt und zu Verhaltensweisen zwingt. In den westlichen parlamentarischen Demokratien freilich wird dieser Zweig relativiert, weil die Gesetzgeber selbst unter dem Zwang der Gesetze stehen 3 , jedenfalls aber die äußerste nur denkbare Sorgfalt bei einer Gesetzgebung obwalten lassen müssen. * Erstveröffentlichung, ι Gesetzgebung, 2. Aufl., 1991, S. 105 f. 2 Gesetze hier und künftig immer verstanden als jede Art von verfahrensgemäßer Setzung rechtsverbindlicher Normen, somit natürlich auch Rechtsverordnungen und kommunale Satzungen oder auch nur einzelne Teile eines umfangreichen Regelwerks. 3 Daß die bundesdeutschen Parlamente im Bund und in den Ländern sich von diesen eigentlich selbstverständlichen Regelungen auf manchen Gebieten, etwa der unbequemen fiskalischen Behandlung von Kosten (Spesen), absetzen, wie das in den letzten Jahren mehrfach geschehen ist, soll hier zwar erneut angeprangert, aber schließlich doch als marginale Erscheinung gesehen werden, die über kurz oder lang wieder verschwinden wird. Bedenklich 8 Gedächtnisschrift Wenz
114
Edgar Michael Wenz
Aus dieser Erkenntnis haben die Wissenschaften, insbesondere die Rechtswissenschaft, bislang aber keine Maßnahmen abgeleitet, die der Bedeutung der Gesetzgebung entsprächen. Gewiß, vor der Beschlußfassung wird zum Grundsatz und zum Kern des Gesetzes durchaus streitig debattiert, in den Aussschüssen ebenso wie im Plenum, oft genug ideologiebelastet. Dann bei der Ausarbeitung des Gesetzes, wo noch Weichen gestellt werden, läßt das Interesse erheblich nach. Schließlich wird während der Gültigkeit des Gesetzes erkennbares Interesse kaum oder eigentlich nicht aufgewendet, jedenfalls nicht routinemäßig und systematisch. Die Beobachtung des Produktes Gesetz und dessen Wirkung durch ihre Schöpfer, die gesetzgebenden Körperschaften, die Exekutive und die Politik, beschränkt sich häufig auch nur auf Normbrüche in spektakulären Fällen. Die Ausnahmen, die Berichterstattung vorschreiben, lassen Interesse und Bedürfnis des Gesetzgebers an Informationen erkennen, ohne freilich einen Weg aufzuzeigen, dem abzuhelfen. Diese Fakten sind ebenso überraschend wie bedauerlich, und das am Ende dieses Jahrhunderts, das auch unter dem Kennzeichen von Beobachtung und Kontrolle, nicht zuletzt der Bewertung vieler gesellschaftlicher Entwicklungen steht. Dabei gibt es aber kaum einen Autor, der bei den Gedanken an jung erlassenen oder noch zu erlassende Gesetze seine Bedenken nicht äußerte, ob sie denn nun auch i m gewünschten Sinne wirken werden. Nicht nur Wissenschaftler hegen derartige Sorgen, gelegentlich lassen auch Politiker solche erkennen. Ein wichtiger Gesichtspunkt freilich, der bei der Rationalisierung der Gesetzgebung eigentlich sogar vorne stehen könnte und sogar müßte, ist die Normenund Regelungsdichte hierzulande, die Normenflut 4 . Sie einzuschränken wäre nach aller Voraussicht der weiteste Schritt zur heute fast stereotyp angemahnten Rationalisierung der Gesetzgebung. Aber dieses Thema, das bei den meisten Autoren stimmt freilich, daß die Wissenschaft und die Medien den angegriffenen Verfassungsbruch nicht energisch genug weiterverfolgt haben, sondern statt dessen, hierbei der Bevölkerung folgend, wegen der relativ geringen Beträge, gemessen jedenfalls am Bundeshaushalt, das Thema wieder einschlafen ließen (Vgl. dazu Edgar Michael Wenz, Die Diätenhöhe ist unbedenklich - Kostenpauschalen sind Rechtsbruch im Verfassungsrang, in: Orientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik Nr. 53, Bonn; Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes, Leserbrief in: F.A.Z. vom 15. 8. 1988; Abgeordneten-Diäten. Der Skandal ist die Kostenpauschale, in: Mainfränkische Wirtschaft 10/1988, Würzburg; sinngleich auch in: Der Steuerzahler Mai 1889, Wiesbaden; neuerdings auch erweitert in: Der bayerische Steuerzahler 11 / 1995, München; Am ärgerlichsten sind die Kostenpauschalen, in: F.A.Z. vom 31. 10. 1995). 4 Für viele: Josef Isensee, in: Politische Meinung, H. 237, S. 15 f., der eine „sich überschlagende Gesetzesmaschinerie", „Wegwerfgesetze" genannt, und „Gesetze ohne echte Rechtsidee" beklagt. Neuerdings Kritik auch seitens der Nationalökonomie, so Walter Hamm, Eine vermeidbare Fehlentwicklung, in: Orientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik, 50 (12/92), S. 67 ff. Anders Manfred Rehbinder, in: Rechtssoziologie, 3. Aufl., 1993, S. 195, der unter Berufung auf Hubert Rottleuthner, Aspekte der Rechtsentwicklung in Deutschland, in: ZfRSoz 1985, S. 206 ff., die These von der Gesetzesflut relativiert in eine Normänderungsflut. Rüdiger Voigt unterscheidet verschiedene Typen der Verrechtlichung, von denen im folgenden insbesondere die Vergesetzlichung (Parlamentarisierung) interessiert; ders., Verrechtlichung in Staat und Gesellschaft, in: R. Voigt (Hrsg.), Verrechtlichung, 1980, S. 15 ff.
Die forschungsbegleitete Gesetzgebung
115
der Gesetzgebungslehre obenansteht, meist die Einleitung zum Thema bietet, soll hier bewußt ausgeklammert bleiben, ohne daß damit freilich das Problem als nachrangig bezeichnet würde.
II. Die Problematik der Gesetzesevaluation Das bedauerte mangelnde Interesse der Gesetzgeber am Gelingen und der Wirkung ihrer Gesetze bedeutet keineswegs, daß die Wissenschaften der Gesetzgebung keine Aufmerksamkeit widmen. Es gibt eine Reihe von Beiträgen, die meisten allerdings schon aus den 70er und 80er Jahren, die die Gesetzesevaluierung zum Gegenstand haben, allerdings verstreut in vielerlei Publikationen. Die Monographien zur Gesetzgebungslehre, etwa Peter Noll, Gesetzgebungslehre, 1971, und Hans Schneider, Gesetzgebung, 1991, ebenso wie das Studienbuch Hermann Hill, Einführung in die Gesetzgebungslehre, 1982, beschäftigen sich nur marginal mit diesem spezifischen Thema der Effektivität 5 . In den Beiträgen stellt man durchaus Überlegungen an, die zur späteren Wirksamkeit des Gesetzes führen (Gesetzesevaluation, Wirksamkeitsanalyse, Implementationsforschung) oder Störfaktoren auslösen könnten. Man hat aber dennoch den Eindruck, daß etwa Gedanken zu dogmatischen Normen, beispielsweise Prozeßordnungen usw. mehr Denkerschweiß und Druckerschwärze gefordert haben. In diese vermißte Richtung gehen Bemühungen und Interesse der vor etwa einem Jahrzehnt gegründeten Deutschen Gesellschaft für Gesetzgebung e. V. 6 und der einige Jahre später die Gesellschaft für europäische Gesetzgebung (European Association of Legislation) 7 folgte. Auch an manchen deutschen Universitäten und Hochschulen widmet man der Gesetzgebung besondere Aufmerksamkeit 8 . Eine instruktive Übersicht mit reicher Literaturangabe über den Stand der Gesetzgebungslehre gibt Ulrich Karpen 9 . Er untersucht die drei wichtigsten juri5 Schneider, Anm. 1, behandelt die Wirksamkeitskontrolle beispielsweise auf nur drei von mehr als 400 Seiten Umfang. Hermann Hill erwähnt die Erfolgskontrolle auf wenigen Seiten (80 ff.), dabei die Rehtstatsachenforschung als eine von mehreren Möglichkeiten zur Analyse der Zielerreichung, Peter Noll als Nachkontrolle ebenfalls nur im relativ geringfügigen Umfang, Gesetzgebungslehre, 1973, S. 146 ff. 6 DGG Deutsche Gesellschaft für Gesetzgebung e. V., Seminar für öffentliches Recht und Staatsrecht der Universität Hamburg, Schlüterstraße 28, 20146 Hamburg; gegründet 23. 6. 87, Präsident Prof. Dr. Ulrich Karpen. 7 EAL European Association of Legislation; gegründet 13. 12. 91; Adressen siehe Anm. 6. Auch hier Präsident in Personalunion Prof. Dr. Ulrich Karpen. Zu den beiden Gesetzgebungsgesellschaften mehr in Ulrich Karpen, Recht und Staat, 1994, Festschrift für Herbert Hellmrich, auch zur GEF (Gesellschaft für Entbürokratisierung); ebenfalls zur ZG (Zeitschrift für Gesetzgebung) als Organ der DGG. 8 Beispielsweise Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer. 9 Anm. 7, Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und Rechtssprechungslehre, 1989.
8=
116
Edgar Michael Wenz
dischen Akte Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtsprechung, die die Entscheidungspflicht gemeinsam haben. Bei der Auflistung der Aufgaben und Bestandteile der Gesetzgebungslehre hat er die Evaluations- und Implementationsmethoden angeführt, wenn auch ohne erkennbaren Schwerpunkt 1 0 , anders in einem späteren Beitrag 1 1 , wo er die Ergebnisse des Kongresses der E A L 1993 referiert.
I I I . Die Effektivität der Normen und Gesetze Bei der Thematik zu den Problemen der Gesetzesevaluation, somit Rationalisierung der Gesetzgebung, waren die Kernpunkte der Gesetzgebungslehre angerissen, allerdings so verwirrend nach Unterscheidungsmerkmalen sowohl in der Vorbereitung des Gesetzes („ex ante 4 ') und nach dem Erlaß und während der Gültigkeit des Gesetzes („ex post") aufbereitet, daß diese Differenzierung sich den Vorwurf mangelnder Sprachlogik gefallen lassen muß - jedenfalls dann, wenn damit auch Aktivitäten, Erkenntnisse und erwogene Maßnahmen zur Effektivitätskontrolle verbunden sein sollen. Der Begriff der Erfolgskontrolle oder gleichsinnig der Wirkungsanalyse fällt i m Schrifttum sehr häufig. Er ist der eigentliche Kern und das Ziel der Bemühungen. Es muß (jedenfalls dem Autor, und gewiß nicht nur diesem) unerfindlich bleiben, wie der Erfolg eines Gesetzes kontrolliert werden kann, bevor es erlassen ist und gilt. Alle Bemühungen der Rationalisierung der Gesetzgebung ex ante können keinesfalls auf Messung der Effektivität, der Wirksamkeit und der Effizienz, der Angemessenheit der Kosten, gerichtet sein. Es sind wohl doch nur Kontrollen eines Gegebenen möglich. Der Begriff der Effektivitätskontrolle kann also nur im Zusammenhang mit den Untersuchungen ex post gebraucht werden, also die Kontrolle der Wirkungen bereits erlassener und gültiger Gesetze. Alle anderen Auslegungen sind sprachlich widersinnig. Alle angestrebten Erkenntnisse vor Gültigkeit der Gesetze können nur auf freilich rational gestützte - Erwartungen, etwa auf Hoffnungen, sogar Spekulationen gestützt sein. Auch wenn man etwas „analysieren" soll, so muß es doch konkret vorliegen, somit gegeben sein. So ist auch der Begriff der Wirkungsanalyse nur für bereits erlassene und gültige Gesetze überhaupt sinnvoll. Freilich muß man sehen, daß Peter N o l l 1 2 , dem die Gesetzgebungslehre sehr viel verdankt, ausdrücklich „die Berücksichtigung der Effektivität der Gesetze bei ihrer Schaffung" verlangt. Wenn man diese Forderung wörtlich nähme, könnte man sie 10
Anm. 8, Zum gegenwärtigen Stand der Gesetzgebungslehre in der Bundesrepublik Deutschland, ZG 1986/1, S. 5 ff., wo er Gesetzgebungslehre mit Rechtssetzungswissenschaft als Erkenntnis- und Handlungswissenschaft (neben Seins- und Normenwissenschaft) treffend definiert. n Anm. 8, Beiträge zur Methodik der Gesetzgebung, in: ZG 1994 /1, S. 58 ff. 12 Peter Noll, Die Berücksichtigung der Effektivität der Gesetze bei ihrer Schaffung, in: Theo Öhlinger (Hrsg.), Methodik der Gesetzgebung, 1982.
Die forschungsbegleitete Gesetzgebung
117
so auslegen, daß der Gesetzgeber für die Beachtung seiner Gesetze auch Sorge tragen solle. Diese Interpretation freilich wäre zu lapidar, nahezu trivial. Spätestens seit dieser Zeit aber ist das rationale Postulat der Effektivitätskontrolle virulent. Die Spuren führen zurück zu Theodor Geiger (1891-1952). Für ihn war eine Norm, somit in ihrer Verflechtung ein Gesetz, dann überhaupt existent, wenn sie effektiv war (wenn sie befolgt wird) oder auf ihre Nichtbefolgung eine Reaktion des Rechtsstabes erfolgt. Der für eine Messung des Erfolges von Gesetzen taugliche Effektivitätsbegriff muß darüber hinaus, insbesondere bei den hier interessierenden Normen und Gesetzen, die tatsächlichen Auswirkungen des Gesetzes in der sozialen Realität, gemessen an seinen Zwecksetzungen, erfassen. Diese Auffassung von Effektivität setzt ein Verständnis des Gesetzes als Instrument gesellschaftlicher Problemlösung voraus. Freilich hat Theodor Geiger der Norm, und so dem Gesetz, zunächst einmal nur eine „Wirkungs-Chance' 4 zugerechnet, somit also die - eigentlich sehr eingegrenzte - rechtsreale Bedeutung des Gesetzes, lediglich Chancen zu seiner Wirkung zu haben, dargelegt i s t 1 3 . Es gibt Beispiele, daß die Rechtsadressaten, die Bürger, von Gesetzen einfach keine Kenntnis genommen haben, geschweige denn sie befolgten. Häufig zitiert wird in diesem Zusammenhang das Norwegische Hausangestelltengesetz, dem es u. a. an „adressatenbewußter Sprache" gemangelt habe 1 4 . Man braucht allerdings auf dieses skandinavische Beispiel gar nicht zurückzugreifen, um mangelnde Effektivität von Gesetzen auch hierzulande erkennen zu können. Exemplarisch sei hier genannt das Gesetz über die Gewährung eines einmaligen Heizölkostenzuschusses 1979 1 5 . Ob das mühselige Antragsverfahren zum Erfolg in keinem Verhältnis stand; ob der Sparwille der Verbraucher nicht ausgeprägt genug war; wie auch immer, die bereitgestellten Haushaltsmittel wurden nicht oder nur zu einem sehr geringen Teil abgerufen. Das Gesetz war also ineffektiv, obwohl es keine negativen, sondern positive Sanktionen in Aussicht stellte, also Vorteile daraus gezogen werden konnten. Die Wissenschaft hat sich freilich der Frage der Effektivität schon länger gewidmet. A m weitesten geht dabei Heinrich J. Schröder 16 . Gleich Hans Ryffel 1 7 erwei-
13 Theodor Geiger, Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts, 1947. Aufschlußreich ist der Tagungsband zum Symposion anläßlich des 100. Geburtstages Theodor Geigers: Theodor Geiger. Soziologe in einer Zeit zwischen Pathos und Nüchternheit. Beiträge zu Leben und Werk, Hrsg. Siegfried Bachmann, 1995. 14 Vgl. dazu Wilhelm Aubert, Soziale Funktion der Gesetzgebung, in: Studien und Materialien zur Rechtssoziologie, 1967, S. 284 ff. 15 Vgl. dazu Harald Kindermann, Erfolgskontrolle durch Zeitgesetze, in: Otto Triffterer/ Heinz Schäffer, Rationalisierung der Gesetzgebung, 1984, S. 133 ff. Damit leitet Kindermann seinen Beitrag ein. 16 Erfolgskontrolle der Gesetzgebung, in: Manfred Rehbinder und Helmut Schelsky, Zur Effektivität des Rechts, 1972, S. 272 ff. 17 Bedingende Faktoren der Effektivität des Rechts, in: Rehbinder und Schelsky, Anm. 16, S. 225 ff.
118
Edgar Michael Wenz
tert er die Bedingungen der Rechtsnormen „richtig" und „effektiv" noch um die Eigenschaft „zweckmäßig". Er sieht allerdings die Zweckmäßigkeit als Bestandteil der Richtigkeit, die er zuvor erkannt hatte, als in dafür vorgeschriebene Verfahren gesetzt (juristische Geltung) unter dem Anspruch praktischer Richtigkeit (normative Geltung). Sie muß auch befolgt und durchgesetzt werden (tatsächliche Geltung). Die Erkenntnis der Prüfung der Zweckmäßigkeit zielt nicht nur auf die „adressatenbewußte Sprache", sondern hat i m besonderen Maß die gestaltende Kraft des Rechts i m Blickwinkel. Die „wirklichkeitsgestaltende Gesetzgebung" hat in der modernen Gesellschaft eine entscheidende, ja existentielle Bedeutung. Hier ist die Gefahr der Fehlsteuerung am großen. Deshalb hängen von einer gelungenen Erfolgskontrolle Erfolg und Mißerfolg der angestrebten Gestaltung ab. Daß derartige gesellschaftsgestaltende Normen andere Kontrollanforderungen stellen als Normen, die lediglich gesellschaftliche Überzeugungen, also schon herrschende soziale Normen, affirmieren, liegt auf der Hand (Beispiele: Gestaltende Normen sind vorherrschend i m Wirtschafts- und Umweltrecht; affirmierende i m Strafrecht). Möglicherweise ist der rechtstheoretischen Bedeutung der Effektivität der Norm bei der Untersuchung der Effektivität ganzer Gesetze, eine Versammlung und „Vernetzung" von einzelnen Normen also, nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt worden. Wenn die Norm also effektiv, richtig und zweckmäßig sein muß, weil sie sonst von vorneherein keine Norm i s t 1 8 oder nicht mehr ist, so muß zwingend auch die Gesetzgebungskontrolle an diesen Kriterien ansetzen. Das ist der Raster für Gesetzeskontrolle, nicht anders als auch für die Kontrolle der einzelnen Norm. Nach Schröder ist die Erfolgskontrolle ihrerseits „selbst eine unverzichtbare Bedingung der Richtigkeit und Effektivität von Rechtsnormen" 1 9 . A u f sie könnte nur verzichtet werden, wenn Sicherheit bestünde, daß es nur „absolut richtige Rechtsnormen gäbe, die ohne Ausnahmen befolgt und durchgesetzt würden". Daraus kann man nur die Erkenntnis gewinnen, daß der Gesetzgeber schlicht und einfach verpflichtet ist, die Effektivität sicherzustellen; das bedeutet also die Wirksamkeit und Effizienz, diese gleichbedeutend mit der Kostenvernünftigkeit, entsprechend der gelungenen Relation von Aufwand und Erfolg. Fundamentales Forschungsinteresse 20 einer Beschäftigung mit der Gesetzeseffektivität in diesem Sinn und ihrer Messung ist die Suche nach dem „richtigen" Recht. Aber nicht in einem material-naturrechtlichen Sinn, sondern, ganz auf der Linie Geigers, in wertfreier Bedeutung. Die materialen Regelungsgehalte des kontingenten Rechts sind Ausdruck der Wertvorstellungen und Zielsetzungen der gerade herrschenden Mehrheit. Die Gestaltung der gesellschaftlichen Realität gemäß diesen Werten erfolgt mit Hilfe der Gesetze. Richtiges Recht ist also dasjenige, das seine Umsetzungsfunktion optimal erfüllt. Erfolgskontrolle von Gesetzen läßt ι» Schröder, Anm. 16, S. 272. 19 Schröder, Anm. 16, S. 273. 20
Hierzu folgend Edgar Michael Wenz, Von der Rechtsforschung zur Gesetzgebung, in: Tagungsband zu Theodor Geiger, Anm. 13, S. 261 ff.
Die forschungsbegleitete Gesetzgebung
119
sich somit als Teil eines Optimierungsprozesses i m Rahmen einer Zweck-MittelRelation verstehen, in der das Gesetz das zu optimierende Mittel darstellt. A u f diese Weise leistet Gesetzesevaluation einen Beitrag zur Rationalisierung von Politik. Man könnte hier ein beacktertes Feld der empirischen Rechtsforschung vermuten, wird aber durch den Blick in die Literatur zur Gesetzgebungslehre eines anderen belehrt 2 1 . Wenngleich die Erkenntnisse der theoretischen Rechtssoziologie und ihrer praktisch-operationalen Möglichkeiten teilweise gesehen werden, so fehlt es doch an einer entsprechenden Gewichtung und Ausarbeitung. So nimmt es nicht wunder, daß Impulse für die Gesetzesevaluations- und Implementationsforschung 2 2 überwiegend nicht von Juristen, sondern von Politologen und Soziologen stammen, die die kaum auf Gesetzgebungslehre ausgebildeten und daran interessierten Juristen zurückdrängen 23 . Zur Rolle der Rechtsforschung und Rechtssoziologie wird noch Stellung genommen. Die Rechtssoziologie führt in der Rechtswissenschaft ohnehin ein kümmerliches Dasein. Aber in der Gesetzgebungslehre müßte ihr Wert erkennbar sein. Immerhin geht es hier um die Wirklichkeit des Rechts, der eigentlich der Schwerpunkt des Interesses gebühren müßte. Das Thema der Rechtssoziologie wird für die Rechtsforschung deshalb breiter und vertieft in einem separaten Abschnitt erörtert 2 4 . Immerhin: Evaluations- und Implementationsforschung sind Zweige der Rechtssoziologie 25 , für die allerdings, so meint Thomas Raiser, „die Gesetzgebung wenig Interesse zeigt". Erfolgskontrolle w i l l den Z w e c k - / Zielerreichungsgrad eines Gesetzes messen, also den definierten, mit hohem Wahrscheinlichkeitsgrad erreichbaren Ist-Wert bei der Gesetzesverwirklichung dem angezielten Soll-Wert gegenüberstellen 26 . In dieser Konstellation ist dies die Position ex ante, vor der Gesetzgebung also. Ungeachtet der Aufweichung des Begriffs der „Erfolgskontrolle" sollen die von den Autoren jeweils verwendeten Begriffe ebenfalls verwendet werden. 21 Thomas Raiser, Einführung in die Rechtssoziologie, 1982, S. 18 ff. (Anwendung der Rechtstatsachenforschung in der Gesetzgebung) und Κ F. Röhl, Rechtssoziologie, 1987, S. 300 ff. (Gesetzesevaluierung), immerhin zwei bekannte Rechtssoziologen, finden in ihren Studienbüchern auch nur wenige Worte zu diesem Problemkreis. Manfred Rehbinder, der der Soziologie der Gesetzgebung, in: Rechtssoziologie, 3. Aufl., 1993, S. 245 ff., relativ breiten Raum zugesteht, fordert nicht die Institutionalisierung der Rechtstatsachenforschung, deren Bedeutung er zwar betont, aber Zeitprobleme sieht, satt dessen will er konträre Expertengruppen zu Wort kommen lassen, aber scheint insgesamt mit der Befürchtung eines Schusses ins Dunkle zu resignieren (ebenda, S. 256). 22 Vgl. dazu Renate Mayntz (Hrsg.), Implementation politischer Programme, zwei Sammelbände 1980-83 (Fn. 4, S. 283). 23 Vgl. dazu Ulrich Karpen, Anm. 10, S. 20, ebenso ders., Anm. 11, S. 11. 24 Siehe dazu Edgar Michael Wenz, Einführung in die theoretische Rechtssoziologie [in diesem Band, S. 65 ff.]. 2 5 Thomas Raiser, Das lebende Recht, 1995, S. 42. 26 Klaus König, Zur Evaluation der Gesetzgebung, in: Gerd-Michael Hellstern / Hellmut Wollmann (Hrsg.), Experimentelle Politik - Reformstrohfeuer oder Lernstrategie, 1983, S. 122 ff.
120
Edgar Michael Wenz
Die für die weitere Arbeit erforderliche Unterscheidung zwischen Gesetzen, die einen Zustand oder ein bestimmtes Verhalten des Adressaten fordern, und solchen, die auf Sicht eine Entwicklung anstreben, also über einen festgeschriebenen Zweck zu einem definierten Ziel gelangen wollen, kann man einteilen in konditionale und finale Gesetze. Bei konditionalen Gesetzen ist die Erfolgskontrolle einfacher, schwieriger dagegen bei finalen Gesetzen, die aber bevorzugt der Beobachtung bedürfen. Möglicherweise sind diese Schwierigkeiten der Grund, daß das Thema Erfolgskontrolle häufig genug angepickt, aber kaum echt aufgegriffen worden ist. Darauf wird noch einzugehen sein. Die Position ex ante kann nichts anderes sein als eine prognostische-heuristische Methode, die eine pragmatische-empirische nicht ersetzen, aber doch immerhin sinnvoll vorbereiten kann. A u f dem prognostisch-heuristischen Wege läßt sich wohl klären, welcher Prüfungsmaßstab für die Effektivität eines Gesetzes angelegt werden soll. Das setzt freilich voraus, daß die konkreten Zwecke und politischen Ziele des Gesetzes (Wirkungsauftrag) 27 konsequent angesteuert werden, in den meisten Fällen wohl Schritt um Schritt. Eine größtmögliche Präzisierung der Zwecke und Ziele wird die Operationalisierung von Meßkriterien und -indikatoren erleichtern. Dennoch ist darauf hinzuweisen, daß die Zweck- und Zielformulierungen oft nur eine Teilmenge der intendierten Effekte beschreiben, so daß bei nachträglicher Operationalisierung möglicherweise nicht alle beabsichtigten Effekte gemessen oder aber unbeabsichtigte Effekte einbezogen werden 2 8 . Ein Grund für die zögerliche Nutzung der Erkenntnisse über die Möglichkeiten einer Erfolgskontrolle seitens der Gesetzgebungsorgane darf man wohl darin sehen, daß die Ergebnisse einer Gesetzesevaluation erheblichen politischen Sprengstoff in sich tragen. Besonders bei mangelnder Effektivität von Gesetzen wird sich die Opposition über die zusätzliche „ M u n i t i o n " freuen; denn das wissenschaftlich bestätigte Versagen eines Gesetzes hat beim Wähler sicherlich mehr Gewicht als das alltägliche „Kettenrasseln". Soweit würde man den heute von Politikern überstrapazierten „Populismus" aber wohl nicht treiben wollen, die Chance einer wissenschaftlichen Gesetzgebungsevaluation durch mehr Transparenz als Ansatzpunkte für eine verstärkte demokratische Kontrolle dranzugeben. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, die bei den Lösungsvorschlägen zu besprechen wären, etwa die Opposition in die Entscheidungsfindung stärker einzubeziehen und damit Sprengstoff zumindest zu entschärfen. In der Literatur wurde die Forderung nach einer systematischen, planmäßigen und umfassenden Erfolgskontrolle und Gesetzesevaluation schon häufiger erhoben 2 9 und deren Institutionalisierung postuliert 3 0 . 27 Im einzelnen dazu Werner Hugger, Gesetze - Ihre Vorbereitung, Abfassung und Prüfung, 1983, S. 323 ff. 28 Hans-Ulrich Derlien, Die Erfolgskontrolle staatlicher Planung, 1976, S. 24. 2 9 Beispielsweise Werner Maihofer, Die gesellschaftliche Funktion des Rechts, in: Die Funktion des Rechts in der modernen Gesellschaft, Jahrbuch für Rechtssoziologie und
121
Die forschungsbegleitete Gesetzgebung
IV. Die Sicht aus der Position ex ante, vor der Gesetzgebung Die geradezu „klassische" Methode der Gesetzesevaluierung i m Vorfeld der Gesetzgebung - weshalb also in diesem Aufsatz der Begriff der Erfolgskontrolle in dieser Phase wohl richtig abgelehnt wurden - sind die Tests, also Simulationen, Planspiele usw., mit denen man sich ex ante an die Tauglichkeit des Gesetzes herantasten will. Angesprochen sind jedenfalls nicht die rein gesetzgebungstechnischen Methoden durch schon lange postulierte Steigerungen von Normverständlichkeit und Anwendungspraktikabilität 3 1 . Ebensowenig ist damit die juristischnormative
Geltungskontrolle
durch das Bundesverfassungsgericht
gemeint 3 2 .
Selbstverständlich hat die Rechtssprechung Einfluß auf die Gesetzgebung, sogar schon in einer frühen Phase, wo sie Mängel des Gesetzes entdeckt und Nachbesserungen des Gesetzes anregt, möglicherweise Verfassungswidrigkeit des Gesetzes und somit Ungültigkeit annimmt und deshalb das Bundesverfassungsgericht anruft. Die rechtsprechende Gewalt spielt bei der Rechtschöpfung eine ganz wesentliche Rolle. Sie ist gewissermaßen das elastische Organ, das den sozialen Wandel berücksichtigen, gewissermaßen Widersprüche zur realen und sozialen Wirklichkeit abfedern kann. Es ist dies eine Frage des gerechten Rechts, die hier aber nicht interessiert, weil es bei diesem Beitrag um einen Teilaspekt geht, um die Methode der Gesetzgebung nämlich. Richter als „Ersatzgesetzgeber" sind ohnehin in der Wissenschaft umstritten; die Gründe sind einleuchtend, sie sind Ausübende der dritten Gewalt, nicht abberufbar, erfüllen also nicht die demokratischen Kriterien der gesetzgebenden Gewalt. Über Rechtsfälle ohne besondere juristische Bedeutung kann man aus Gründen praktischer Überlegungen freilich hinwegsehen. Es ist auch gleichgültig, ob man Rechtssprechung als „internen" oder „externen" Einflußfaktor auf die Gesetzgebung ansieht. Das Bundesverfassungsgericht wird man wohl, da es in die Gültigkeit der Gesetze eingreifen und an den Gesetzgeber zwecks Normänderungen „appellieren" kann, durchaus als internen Faktor betrachRechtstheorie, Bd. 1, 1970, S. 11 ff., den auch M. Rehbinder zitiert. Beide Autoren sehen freilich in der Reaktion des Rechtsstabes auf den Normverstoß eher eine erneute Affirmation des Rechts; Heinrich-J. Schröder, Zur Erfolgskontrolle der Gesetzgebung, S. 271 ff.; R. Krebs, Die effektive Norm unter Berücksichtigung ihres Normzieles, in: Heinz Schäffer/ Otto Triffterer (Hrsg.), Rationalisierung der Gesetzgebung, 1984, S. 237 f.; Hans-Ulrich Derlien, Anm. 28, S. 30. 30 Peter Noll, Anm. 5, S. 146; Hans-Ulrich Derlien, Anm. 28, S. 33; Theo Öhlinger, Planung der Gesetzgebung und Wissenschaft. Einführung in das Tagungsthema, in: ders., Anm. 12, S. 282; Wolfgang Zeh, Vollzugskontrolle und Wirkungsbeobachtung als Teilfunktion der Gesetzgebung, in: Gesetzgebungstheorie und Rechtspolitik, Jahrbuch für Rechtssoziologie und Rechtstheorie, Bd. 13, 1988, S. 206 f.; Hans Schneider, Anm. 1, S. 106; Heinz Schäffer, Rationalisierung der Rechtssetzung, in: ders. (Hrsg.), Theorie der Rechtssetzung, 1988, S. 240; Peter Fricke, Modelle zur Institutionalisierung einer Gesetzeskontrolle, in: Europäische Hochschulschriften, Reihe 31, Bd. 49, 1983, S. 30. 31 Dazu R. Krebs, Anm. 29, S. 121 ff. 32 Heinz-J. Schröder, Anm. 16, S. 276 ff.
122
Edgar Michael Wenz
ten, aber deswegen nicht die gesamte Rechtssprechung, die wohl zu den externen Faktoren zu rechnen ist. Eine ganz wesentliche Rolle in der Literatur zur Rationalisierung der Gesetzgebung spielen die bereits erwähnten „Tests" der vorbereiteten Gesetze. Tests 33 oder Experimente sind hier nicht i m Sinne der exakten Naturwissenschaften 34 zu verstehen, also als letztes Wahrheitskriterium, vielmehr ebenfalls i m schon traditionellen Sinne der Sozialwissenschaften als Planspiele und Simulationen. Das wäre dann eigentlich die einzige Methode, wenn man dem Postulat von Peter N o l l 3 5 folgen wollte und - das wäre jedenfalls sinnvoll - die (ergänze: erwartete und angestrebte) Effektivität der Gesetze bei ihrer Herstellung berücksichtigen sollte und müßte. Andere Autoren 3 6 befassen sich sehr eingehend mit den Möglichkeiten, auch denkbare Störungen und ungewollte Fehlentwicklungen, die durch das Gesetz geschehen könnten. Das sind letztlich doch nichts anderes als „Spekulationen", ganz gewiß auf wohlüberlegter Basis, leider aber auf keinen Fall beschreibbare Fakten, also doch nur Hoffnungen, Erwartungen und Befürchtungen, aber eben keine Realitäten. Bei den Überlegungen aller Autoren spielen natürlich, wenngleich jedenfalls formal nur am Rande, Gerechtigkeitsprobleme hinein, ausgeprägter bei Renate Deckert 3 7 . Trotz dieser Bedenken zur Platzordnung i m System der Effektivitätskontrolle mit der ex ante-Methode kann diese für eben diese Effektivitätskontrolle von Wichtigkeit sein. Bei nach dieser Meinung unverzichtbaren ex post-Kontrolle braucht der Kontrolleur, also insbesondere die Wissenschaft der Rechtswirklichkeit, die Rechtssoziologie also, Kriterien und Maßstäbe, wo sie bei seiner Erfolgskontrolle ansetzen könnte. Aber diese kritischen, wahrscheinlich sogar sensiblen Punkte bei den Normen könnten durchaus bei den Gesetzesvorbereitungen erkannt und dingfest gemacht werden. Insofern könnten die Ergebnisse der ex ante-Methode durchaus bei der Erfolgskontrolle eine zwar nur dienende, aber zweifellos wichtige Rolle spielen. Die vorgreifende Wirkungsermittlung und ihre ex ante-Evaluierung erleichtert die Annäherung an die wichtige ex post-Kon-
33
Grundlegend Carl Bohret /Werner Hugger, Tests und Prüfung von Gesetzentwürfen. Anleitungen zur Vorabkontrolle und Verbesserung von Rechtsvorschriften, 1980, Sonderheft 5 der Schriften der Bundesakademie für öffentliche Verwaltung. Beide Autoren, jeder allein und gemeinsam, sind durch weitere Veröffentlichungen zum gleichen Thema hervorgetreten, beispielsweise „Der Praxistest von Gesetzesentwürfen", 1980. 34 Methodisch angelegter Versuch zur Klärung von Vorgängen und Umständen, zur Bestätigung von Theorien sowie als Grundlage neuer Naturkenntnisse. 3 5 Vgl. Anm. 12. 36
Das sind insbesondere Carl Bohret, Anm. 33, weiterhin Werner Hugger, Gesetze - Ihre Vorbereitung, Abfassung und Prüfung, 1983, S. 112 ff., S. 323 ff. 37 Folgenorientierung in der Rechtsanwendung, 1995, S. 191 f.
Die forschungsbegleitete Gesetzgebung
123
trolle durch Offenlegung von Wirkungsindikatoren und operationabler Ziel- und Zwecksetzungen 38 . Die kritischen Anmerkungen zur ex ante-Methode haben also mehr philologische, nicht aber materielle Bedeutung. Es wäre ganz gewiß der Sache dienlich, wenn zwischen beiden Methoden auch begrifflich klar unterschieden würde.
V. Die Sicht aus der Position ex post, nach Inkrafttreten des Gesetzes Es muß eingewendet werden - und das ist bereits geschehen, überdies der Sinn dieser Schrift - , daß i m Vorfeld des Gesetzes Effektivität, also Wirkung und Wirksamkeit, ebenso wie Effizienz, das heißt Wirkung und Wirksamkeit, relativiert zu den Kosten, gewiß erwartet und auch prognostiziert, keinesfalls aber nachvollziehbar gemessen werden können, kurzum: die Effektivität nicht kontrolliert werden kann. Das kann erst geschehen am gültigen angewendeten und folglich dann auch beobachtbaren Gesetz und seiner Befolgung. Diese Erkenntnis macht die ex postMethode nicht nur jener ex ante deutlich überlegen. Die ex post-Analyse steht eigentlich allein, wenn man wirklich und nachvollziehbar wissen will, was das Gesetz gebracht hat oder auch nicht 3 9 . Auch Carl Bohret 4 0 , einer der führenden Protagonisten der ex ante-Methode durch Tests, räumt als die beste Prüfungsmethode ein, das Gesetz „ i n seiner eigenen Wirklichkeit" zu untersuchen; das wären dann „Probiergesetze", von denen noch zu sprechen sein wird. Aber hier wird schon klar, daß darauf gerichtete Verfahren nur denkbar sind für eine bestimmte Gruppe bereits geltender Gesetze. Daß solche Überlegungen scheitern bei einer bestimmten Art von Gesetzen, etwa in der Großtechnik, wie beispielsweise für Kraftwerke, Bau von Straßen und Flughäfen, den Gesetzen zur modernen Medientechnik oder sogenannte große Sozialgesetze und Vorschriften zum Katastrophenschutz, liegt auf der Hand; man kann nicht ein Kernkraftwerk bauen und dann eine gewisse Zeit abwarten, ob und wie es funktioniert und welche Schadens Wirkungen behauptet werden. Das ist also das Feld der Tests und Simulationen, nicht der „eigenen Wirklichkeit". Hier hülfen auch keine „Modellversuche", die Hugger für die „idealste Testform" h ä l t 4 1 . Es gibt aber eine Reihe von Gesetzen, sogar einen ganz bestimmten Typus von Gesetzen, bei denen Experimente, das Probieren i m engeren Wortsinne, wie es eben auch der Naturwissenschaftler versteht, ohne Schaden für die Gesellschaft durchgeführt werden könnten. Das können nicht Wertgesetze und solche mit program38
Werner Hugger, Legislative Effektivitätssteigerung: Von den Grenzen der Gesetzesevaluierbarkeit zum Gesetz auf Zeit, in: Politische Vierteljahresschrift 1979, S. 214. 39 Peter Fricke, Anm. 30, 1983, S. 30. 40 Carl Bohret in: ZG (Zeitschrift für Gesetzgebung) 3/92, S. 195, vgl. dazu auch Anm. 33. 41 Hugger, Anm. 38, S. 216.
124
Edgar Michael Wenz
matischem Inhalt sein, aber immerhin Leistungsgesetze von kleiner und mittlerer Tragweite, bei denen nur partielle oder temporäre Wirkungen keinen unaufholbaren Schaden verursachen, die aber gleichwohl das soziale Gleichgewicht ärgerlich stören können. I m Anschluß an Hermann H i l l 4 2 wird man Leistungsgesetze aller A r t e n 4 3 , also Maßnahmegesetze, Lenkungs-, Steuerungs- und Umverteilungsgesetze als geeignete Gesetze orten können; dazu zählen gewiß auch Steuer- und geradezu klassisch Subventionsgesetze. Diese Leistungsgesetze 44 sind geradezu tpyisch für die Begleitung von Rechtsforschung. Roscoe Pound hat ein neues Gesetz „einen Schuß ins D u n k l e " 4 5 bezeichnet, gleichzeitig aber auch i m Gedanken eine notwendige Effektivität des Rechts ein Rechtspflegeministerium gefordert, aus dem dann in der Bundesrepublik 1973 ein Referat „Rechtstatsachenforschung" beim Bundesjustizministerium geworden ist. Auch andere Autoren sehen die Notwendigkeit und gleichzeitig das Unvermögen, zur Effektivität und Effizienz der Gesetze zuverlässige Prognosen aufzustellen, kurzum sich mit der Bewertung, dem Erfolg oder Mißerfolg des geplanten Gesetzes zu befassen. Die bislang beobachtbare Zurückhaltung gegenüber der mit dem Inkrafttreten der Gesetze erkennbaren Wirksamkeit derselben, also auch ein Abgleich zwischen dem, auf was man die Wirkungserwartung aufgebaut hatte, und dem, was man nun vorfindet, wird nur in seltenen Fällen aufgegeben. Das alles hängt wohl zusammen mit dem Respekt vor dem gültigen Gesetz und der Furcht, Kritik daran könnte die Richtssicherheit unterlaufen. Wie auch immer, es gibt durchaus Literatur, die sich mit der Wirksamkeit der Gesetze oder auch nur einzelner Normen befaßt, jedenfalls aber keine Disziplin, die solche Untersuchungen sich dezidiert zum Anliegen gemacht hätte. Es fehlt also an der Beobachtung der Effektivität - hier und künftig auch die Effizienz umfassend, jedenfalls dann, wenn Kosten bei den Motiven und Zielsetzungen des Gesetzes angesprochen sind - der Gesetze und ihrer einzelnen Normen. Ein Konstrukteur, der einen erkannten oder zumindest erkennbaren Fehler nicht gleich (durch Um-, notfalls eben auch durch totale Neukonstruktionen) ausmerzt, müßte sich Arroganz vorwerfen lassen, nicht anders als ein Heerführer, wenn seine Befehle nicht mit der Schlachtentwicklung einhergehen. Nicht nur ebenso, sondern vielmehr hätte der Gesetzgeber einzugreifen, wenn Fehlläufer erkannt und wenigstens konkret zu befürchten sind.
42 Anm. 5, S. 33 ff. 43 Zum Beispiel: Wohngeldgesetz, Wohnungsbaugesetz, Kindergeldgesetz und Bundesimmissonsschutzgesetz u. a. m. 44 Die Leistungsverwaltung im sozialen Rechtsstaat hat ohnehin die Eingriffsverwaltung an Bedeutung überholt; so jedenfalls Konrad Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 18. erg. Aufl., 1991, S. 85 ff. 45 Zitiert nach E. E. Hirsch in: JZ 1965 (484), so auch Manfred Rehbinder, Rechtssoziologie, 1989, S. 243.
Die forschungsbegleitete Gesetzgebung
125
Ein wesentlicher Bestandteil der Analyse ist die Bestimmung des Ist-Werts, also der Zustand der von dem Gesetz beeinflußten sozialen Wirklichkeit. Dieser woll mit den Methoden der empirischen Sozialforschung ermittelt werden. Die Auswahl der Kriterien und die Qualität der Methodik trägt hier entscheidend dazu bei, den Analysezweck zu erfüllen. Rechtstatsachenforschung, Implementations-, Meinungs- und andere Zweige der empirischen Sozialforschung können hier wichtige Beiträge leisten. Die Autoren Hellstern und Wollmann meinen, empirische Beobachtung zu Politikfeldern zur Vorbereitung von Gesetzentwürfen wären längst ein fester Bestandteil der legislatorischen Tätigkeit 4 6 ; das könnte auf Bevorzugung der ex anteMethode schließen lassen. Aber schon eine Seite weiter fordern die Autoren die Einsetzung von Kommissionen mit Berichtspflicht, was j a nun einmal vorhandene und gültige Gesetze voraussetzt. Wie schon dargetan, forciert Werner Hugger 4 7 eigentlich die ex post-Methode. Er versucht sie aber mit jener der ex ante zu verbinden. Der Autor ist offenbar recht geprägt von Carol Weiss 4 8 , der sich zur Evaluierungsforschung bereits 1972 geäußert hat, bezeichnenderweise für sozialreformerische Programme. Zu den Vertretern der ex post-Methode kann man jedenfalls Wolfgang Hoffmann-Riem 4 9 zählen. Er sieht in Experimentiergesetzen, die noch erörtert werden, Ankläge an die Konzepte von Carl R. Popper 5 0 und Hans Albert, den Vertretern des kritischen Rationalismus, einer Idee, der auch dieser Aufsatz folgt. In der gleichen Richtung liegt generell auch Harald Kindermann 5 1 , der zur Erfolgskontrolle den Weg durch Zeitgesetze zu gehen bereit ist. Klaus K ö n i g 5 2 erwägt auch die Wirkung auf Probe und stellt Vergleiche mit dem Sunset-Konzept an, sieht aber die ex post-Methode überwiegend unter Vollzugsaspekten. Die anderen Autoren äußern sich zu ihrer favorisierten Methode nicht ausdrücklich, lassen 46
Gerd-Michael Hellstern /Hellmut Wollmann, Wirksamere Gesetzesevaluierung. Wo könnten praktikable Kontrollverfahren und Wirkungsanalysen bei Parlamenten und Rechnungshof ansetzen?, in: Zeitschrift für Parlamentsfragen, 1980, S. 554. 47 Vgl. Anm. 38, S. 202 ff. Einerseits ist er publizistisch sehr häufig gemeinsam mit dem Protagonisten der Test-Methode Carl Bohret aufgetreten, schlägt aber auch gleichzeitig eine „Aktionsforschung" vor, die nur bei der konkreten Handhabung des Gesetzes denkbar ist, S. 214. 48 Carol Weiss, Originalausgabe: Evaluation reserch methodes for assessin program effectifenes, New Jersey, USA, 1972; deutsche Übersetzung: Evaluierungsforschung. Methoden zur Einschätzung von sozialen Reformprogrammen, 1974. 49 Wolf gang H offmann-Riem, Experimentelle Gesetzgebung, in: Festschrift für Werner Thieme, 1993. 50
Carl R. Popper, Logik der Forschung, 1976. Sinnähnlich auch Hans Albert, Traktat über kritische Vernunft, 1964, 4. Aufl. 1980, der bekannteste deutsche Vertreter des kritischen Rationalismus. Auch Edgar Michael Wenz, Anm. 20, S. 269. si Vgl. Anm. 16, S. 133 ff. 52 Klaus König, Zur Überprüfung von Rechtssetzungsvorhaben des Bundes, in: Gesetzgebungstheorie und Rechtspolitik, Jahrbuch für Rechtssoziologie und Rechtstheorie, Bd. 13, 1988, S. 179 f.
126
Edgar Michael Wenz
aber ihre Bevorzugung erkennen, so der Schweizer Luzius Mader 5 3 , Hans Schneider, Helmuth Schulze-Fielitz 5 4 , Hellmut Wollmann 5 5 oder auch Wolfgang Z e h 5 6 , wenn sie ausdrücklich von experimentellen oder Zeit-Gesetzen, beobachtbaren Wirkungen und Berichtspflichten sprechen. Effektivitätskontrolle verlangt grundsätzlich einen Abgleich zwischen den angestrebten Folgen des Gesetzes und den wirklichen und festgestellten, also eine Soll-/ Ist-Saldierung. Nun muß man wohl Werner Hugger 5 7 zustimmen, der meint, daß das Problem nicht in der Kontrolle liege, sondern bei der Effektivität der Kontrolle, womit er nicht nur die sachlich und zeitlich richtig erfaßten Erkenntnisse meint, sondern die Umsetzung der Erkenntnisse auf die Legislative. Bei der Erfolgskontrolle geht es sachlich um zwei Wirkungsweisen, nämlich die Zielerreichung einerseits und die Bestandsfestigkeit (Subsumptionsfähigkeit) andererseits 58 . Der kurze Überblick über die Literatur läßt die einhellige Meinung aller Autoren erkennen, daß die Gesetzesevaluierung nicht nur zweckmäßig, sondern notwendig ist. I m folgenden werden die Wege erörtert, mit dem vorhandenen juridischen Instrumentarium, ohne jedwede Systemerweiterung, zu einer praktischen Effektivitätskontrolle, differenziert nach Schwerpunkten, zu kommen.
VI. Die Berichterstattung an das Parlament Bislang galt und gilt noch die i m Kern richtige Überzeugung, daß der Gesetzgeber bei Bestimmung der Gültigkeit, dem Beginn und dem Ende seiner Gesetze völlig „souverän" ist. Er kann sich entscheiden, aufgrund der ihm vorliegenden offiziellen oder offiziösen Berichte, nicht weniger freilich auch anhand von Informationen, die in den Hinterzimmern der Parteilokale aufgeschnappt wurden, jederzeit ohnehin einzugreifen. Die Gesetzgeber könnten also Gesetze für ungültig erklären ebenso wie neue Gesetze auf den Weg bringen, aber auch den Weg zum 53
Luzius Mader, Experimentelle Gesetzgebung, 1988, in: Gesetzgebungstheorie und Rechtspolitik, Jahrbuch für Rechtssoziologie und Rechtstheorie, Bd. 13, S. 211 ff. 54 Helmuth Schulze-Fielitz, Zeitoffene Gesetzgebung, in: Wolfgang Hoffmann-Riehm / Eberhard Schmidt-Aßmann (Hrsg.), Innovation und Flexibilität des Verwaltungshandelns, 1984. 55
Hellmut Wollmann, Gesetzgebung als experimentelle Politik - Möglichkeiten, Varianten und Grenzen erfahrungswissenschaftlich fundierter Gesetzgebungsarbeit, in: Schreckenberg (Hrsg.), Gesetzgebungslehre, 1986; er bezieht sich auf den US-amerikanischen Sozialwissenschaftler Donald T. Campbell, der nur eine Experimentiergesellschaft als eine wissenschaftliche sehen kann. 56 Vgl. Anm. 30, S. 194 ff. 57 Vgl. Anm. 38, S. 204 f. Hugger, Anm. 38, S. 2 0 .
Die forschungsbegleitete Gesetzgebung
127
Erreichen des gesetzten Zieles schon gültiger Gesetze verfolgen und Fehlerkorrekturen einfließen lassen. Nicht minder könnten mit einzelnen Gesetzen gewonnene Erfahrungen in andere Bereiche einfließen. Wenn das Interesse und das Bedürfnis des Gesetzgebers, die Wirkung seiner Gesetze zu erkennen, qualifiziert ist, dann greift er zur Möglichkeit, das Gesetz mit einer Berichterstattungspflicht der Exekutive an den Gesetzgeber auszustatten. Die einzelnen Ministerien verfügen über formale und informelle Rückkoppelungswege auf praktisch allen Ebenen. Die formalen, die mit der Berichtspflicht verbunden sind, laufen auf der Ebene der Exekutive / Regierung. Besonderes Gewicht haben hier die punktuellen Rückmeldungen aus den vollziehenden Verwaltungen über den Gesetzesvollzug, bei denen wohl die Defizite des Gesetzes i m Vordergrund stehen dürften. Man hat schon auch in geringerem Maße Aufträge für Implementationsstudien vergeben. M i t dieser Berichterstattungspflicht befaßt sich eingehend Helmuth SchulzeFielitz 5 9 . Er konstatiert zunächst einmal eine mittlerweile beachtliche Anzahl von Berichterstattungspflichten 60 . Auch Schulze-Fielitz befürchtet eine Überlastung der Ministerialbürokratie, wenn die Berichterstattung über die Folgewirkung der Gesetze zu einer Regelanforderung erhoben würde. Unbefristete Berichterstattungspflichten „würden aber deutlich nachlässiger erfüllt werden". Aber immerhin haben die Gesetze mit Berichterstattungspflicht längst eine dreistellige A n z a h l 6 1 erreicht, was nach Meinung von Schulze-Fielitz ein „gewachsenes Bewußtsein der Politik für die Folgewirkungen ihrer Gesetze" signalisieren würde. Die Berichterstattung wird von eigentlich allen Autoren bejaht und vielfach auch als einziges praktisches Mittel gesehen, wie sich der Gesetzgeber und die jeweils zuständige Ministerialbürokratie über den Verlauf des Gesetzes informiert halten können 6 2 . Diese Informationsverschaffung zählt zunächst einmal zur externen Kontrolle, i m Unterschied zur internen, die aus den Reihen der Gesetzgebungsorgane kommt. Zur externen Kontrolle gehören die Rückmeldungen, auch wenn die Rückmelder zu den Mitgliedern des Rechtsstabs gehören. Wenn die Rückmeldung erfolgt und der Bericht erstattet ist, dann liegt die Information bei den Gesetzgebungsorganen; ab dann gehört die weitere Bearbeitung zum internen Bereich der Gesetzgebung. Ein weitergehender Zwang zum legislatorischen Handeln kann durch diesen Bericht beim souveränen Gesetzgeber freilich nicht ausgelöst werden. 59 Anm. 54, S. 165. 60
Schulze-Fielitz, Anm. 54, S. 165, insbesondere dort Fn. 135 (Bezug auf das Handbuch von Schindler und H.-U. Derlien, Anm. 28). 61 Nur 66 verschiedene Berichte (1988) nennt Wolfgang Zeh, Anm. 30, S. 196; eine lebhafte Steigerung also in relativ kurzer Zeit. 62 Da die Meinung über die generelle Zweckmäßigkeit der Berichterstattungspflicht einhellig ist, kann von einer Aufzählung der einzelnen Autoren abgesehen werden.
128
Edgar Michael Wenz
Breiten Raum widmet diesem Thema Heinrich J. Schröder 63 , so zur Effektivitätskontrolle durch institutionalisiertes Rückmeide verfahren. Die Rückmeldung vom Rechtsanwender zum Rechtssetzer soll diesen laufend informieren und zur Überprüfung anregen. A n diese Überlegung kann man heutzutage durchaus in der Gesetzgebungslehre anknüpfen. A u f welche Weise Gesetzgebungsorgane sich Informationen über die Wirkung ihrer Tätigkeit verschaffen, wie also externe Informationen zu internen Handlungsanleitungen werden, kann eigentlich gleichgültig bleiben. Es geht mehr um die Institutionalisierung und Systematisierung eines jeden auf dieses Ziel ausgerichteten Verfahrens. Daß solche Anstöße an den Gesetzgeber von jedermann kommen können, insbesondere aber wohl Wissenschaft, Verbände und Gruppen als Initiatoren erwartet werden, so daß auch die Themata übersichtlich bleiben und nicht gar zu einer weiteren „Instanz" in der Rechtssprechung werden dürfen, versteht sich von selbst. Man kann darin schon mehr als nur die Ansätze zu einer Gesetzesevaluation 64 sehen, bislang allerdings ohne einen gemeinsamen Rahmen und zumeist unsystematisch und nicht zeitlich limitiert. Die Problematik der Effktivitätskontrolle wäre mit einem geregelten und institutionalisierten Rückbericht-, das heißt also Rückmeldungsverfahren, eigentlich inhaltlich gelöst oder zumindest lösbar. Das wäre eigentlich der einfachste und am ehesten beschreibbare Weg, wenn es dem Gesetzgeber seriös um die Wirksamkeit seiner Gesetze geht. Es stünden auch keine erkennbare verfassungs- und andere gesetzestechnische Hindernisse i m Wege. Jedes interessante Gesetz, auf dessen Wirkung politische Erwartungen aufgebaut werden, könnte entsprechend ausgestattet werden. Zudem würde es sich dabei fast ausschließlich um sekundäre Normen handeln, die also an den Rechtsstab gerichtet sind; der Bürger müßte damit nicht behelligt werden. Warum das bislang nur in seltenen Fällen geschehen ist, erweckt eigentlich Besorgnis um die Rationalisierung der Gesetzgebung. Freilich muß bedacht werden - und das ist wohl auch der Grund für die relativ geringe Akzeptanz der Vorschläge, über die Berichterstattung die Qualität der Gesetze zu steuern - , daß praktisch kaum Folgen mit legislativem Ertrag zu beobachten sind 6 5 , die sich gesetzgeberisch aus den erstatteten Berichten ergeben hätten 6 6 ; sie sind ohnehin mehr Tätigkeits- statt Erfolgsberichte 67 . Man muß also andere Wege weiterhin suchen.
63
Anm. 16, S. 281 ff., der zurückgreift zum référé législatif, das erstmals 1647 in Frankreich eingeführt wurde und das zuerst in der ersten Zeit als Hilfe bei der Gesetzesinterpretation galt. Das war am Anfang der Gewaltenteilung als Montesquieu den Richter als den Mund des Gesetzes, gewissermaßen als Subsumptionsautomat sah, eine wichtige Hilfe. 64 Wolfgang Zeh, Anm. 30, S. 194 ff.; Peter Fricke, Anm. 30, S. 45 ff.; Heinz Schäffer, Anm. 30, S. 238. 65 Vgl. dazu Schulze-Fielitz, Anm. 54. 66 So Hoffmann-Riem, Anm. 49, S. 58. 67 Werner Hugger, Anm. 38, S. 205.
Die forschungsbegleitete Gesetzgebung
129
Freilich bleibt es verwunderlich angesichts der zumindest wissenschaftlichen Akzeptanz der Berichterstattungspflicht, daß die Bundesregierung nicht schon früher, als etwa die Bürokratie der Bundesrepublik einigermaßen eingelaufen war und sie sich als demokratischer Gesetzgebungsstaat verstand, eben eine Berichterstattungspflicht in einer sinnvollen Ausstattung eingeführt hat. Ihr wäre zwar dann das Klagen der Ministerialbürokratie wegen Überlastung nicht erspart geblieben, es hätte sie sicherlich noch ein paar Planstellen gekostet, aber viel wichtiger und i m Ergebnis wesentlich günstiger und sogar billiger wäre die Gesetzgebungskontrolle gekommen, freilich immer unter der Voraussetzung, daß die gewonnenen Erkenntnisse dann auch umgesetzt werden.
VII. Das Zeitgesetz - ein erster Schritt? Gesetze auf Zeit waren anfangs umstritten, sogar die Vefassungsgemäßheit wurde bezweifelt. Damit konnten keine Gesetze gemeint sein, die lediglich befristet waren; aber man hat bei diesen angenommen, daß damit lediglich ein taktisches Vorgehen zum „Einschieichen" des Gesetzes angestrebt w a r 6 8 . In der Tat, das Zeitgesetz hat auch erst Bedeutung mit der Experimentierklausel und damit auch eine ganz andere und neue stärkere Qualität gewonnen. In der Diskussion werden zu Gunsten des Zeitgesetzes genannt der damit möglicherwiese ausgelöste „Durchforstungsautomatismus" 69 von Zeit zu Zeit. Sehr wichtig ist auch im allgemeinen der dadurch ausgelöste Reaktions- und Handlungszwang des Gesetzgebers, der nicht nur bei passender Gelegenheit, sondern zu kontrollierbaren Terminen überprüfen muß. Die durch Befristung ausgelöste Wirksamkeitstrontrolle fordert die Suche nach wirksameren Steuerungsmöglichkeiten 70 . Gegen das Zeitgesetz gibt es natürlich auch eine Reihe Argumente, in denen allerdings meistens die Experimentierklausel zumindest indirekt angesprochen ist. Nicht selten taucht auch die Anhäufung des Wiederberatungsstoffes unter Hinweis auf das Sunset-Legislation-Verfahren in Alabama (USA) als Negativfaktor auf; zudem würde die Rechtsordnung immer unübersichtlicher. Die unerläßliche Zuversicht des Bürgers in die Kontinuität des Rechts würde gestört, der Bürger bekäme Schwierigkeiten, zwischen den verschiedenen Arten von Gesetzen zu unterscheiden. Als Bedenken wird auch vorgebracht, daß Zeitgesetze oberflächlicher ausgearbeitet würden, eben wegen ihrer übersehbaren Vergänglichkeit. Eher werden Rechtsbereinigungen ohne Zeitgesetze, Beispiel Bayern, als wirksamer angesehen. Freilich haben diese zunächst negativen Eindrücke bedauerlicherweise zu schnell zu einer Preisgabe der Verfolgung dieses Weges geführt. A n sich müßte 68 Wolf gang Hoffmann-Riem, Anm. 49, S. 58; das galt allerdings mehr für Zeitgesetze mit Experimentierklausel. 69 Werner Hugger, Anm. 38, S. 203. 70
Harald Kindermann, Anm. 15, S. 144.
9 Gedächtnisschrift Wenz
130
Edgar Michael Wenz
sich die Erkenntnis aufdrängen, daß die Verwertung von Analyseergebnissen zum legislatorischen Handeln nicht nur berechtigte, das gilt aufgrund der Souveränität des Gesetzgebers ohnehin, sondern gewissermaßen dazu zwingt. Damit verbundene Mehrarbeit, sicherlich auch Querelen müssen als untergeordnet gesehen werden gegenüber dem Ziel, effektive und effiziente Normen zu setzen und auf diesem Niveau, etwa auch durch schaukelnde Korrekturen, zu halten. Rechtliche Bedenken geggen Zeitgesetze gibt es schon länger nicht mehr. Die Einsicht, daß Normen zu den Variablen (Luhmann) unserer Ordnung zählen, hat sie schon längst den zugedachten Ewigkeitswert verlieren lassen; diese Erkenntnis wird somit dazu hilfreich beitragen können, Gesetze nüchterner zu sehen, eben als funktionspflichtiges Organisationsmittel unserer Gesellschaft. Auch verfassungsrechtliche Einwendungen werden grundsätzlich nicht erhoben. Es existiert schon eine Reihe von Zeitgesetzen. Jene zu Bildschirmtexte, Kabel- und Satellitentechnik und Medienerprobung haben auch schon das Bundesverfassungsgericht passiert 71 . Es ist auch schwer einsichtig zu machen, was es generell gegen ein Zeitgesetz an seriösen Bedenken vorzubringen gibt, außer der schon angesprochenen angeblichen Unterhöhlung der Rechtssicherheit. Sie kann es nicht geben, wenn ein unmißverständlich durch Zweck- und Zielsetzung definiertes Gesetz zeitlich klar begrenzt ist, der Anfang ebenso wie das Ende. Es könnte freilich sein, daß der eine oder andere Rechtsadressat sein Handeln auch ausrichtet nach dem Datum des Verfalls, wenn die Angelegenheit Aufschub duldet. Aber als generellen Ablehnungsgrund von Zeitgesetzen kann man das ebenso wenig ober ebenso sehr ansehen wie Handeln vor Erlaß eines erwartbaren oder auch schon angekündigten Gesetzes, um diesem auszuweichen. Das sind eher Manifestation und Affirmation der Rechtsgewißheit statt deren Unterhöhlung. Hellstern und Wollmann halten Zeitgesetze für geeignet zumindest als Probeläufe zur Methodenverbesserung, besonders bei sekundären Gesetzen 72 . Ein wesentlicher Vorteil des Gesetzes liegt aber darin, daß der Gesetzgeber unter Zeitdruck für seine Entscheidungen steht, und zwar einem Zeitdruck, den er sich selbst durch das Zeitgesetz verordnet hat. Das kann nur hilfreich sein. Die schon häufig beklagte „Regelungswut" des Gesetzgebers findet interessanterweise ihr Bollwerk vor Novellierungen von eigenen Gesetzen. Vor diesem Hintergrund ist recht interessant der Hinweis von Harald Kindermann 7 3 , daß es als nahezu „pervers" gelte, Zeitgesetze als Druckmittel überhaupt anzudenken. Der Gesetzgeber sei ja ohnehin zu strenger Kontrolle des Gesetzesvollzugs verpflichtet. Der Autor hält aber selbst dagegen: Kein Parlament beginnt
71
Harald Kindermann, Anm. 15, S. 144. 2 Hellstern/Wollmann, Anm. 46, S. 558. 73 Anm. 15, S. 143 f. 7
Die forschungsbegleitete Gesetzgebung
131
eine Debatte von sich aus über ein Gesetz, das es schon durchgesetzt hat. Das führt zur Erkenntnis, daß das Parlament bei der Gesetzgebung seine Kontrollpflicht eben doch vernachlässigt. Der amerikanische Weg, der mit den Stichworten „Sunset Legislation" oder „Sunrise Legislation" 7 4 zu beschreiben ist, basiert auf dem Prinzip der Zeitgesetze, allerdings ohne expliziten Experimentierzwang. Vom ersten Tag ihrer Gültigkeit bis zu einem in überschaubarer Zukunft liegenden Zeitpunkt, zu dem sie systematisch und zwingend überprüft und eben auch beendet oder geändert werden können, sind es eben gültige Gesetze. Aber nicht dieses in den USA intensiv diskutierte und häufig probierte, in Europa aber kaum beachtete Konzept soll hier behandelt werden, sondern das Titelthema, die begleitende Rechtsforschung. Es darf dennoch ein kurzer Blick auf die Sunset- und i m Gegenlauf das SunriseLegislation gewagt werden. Das Hauptargument gegen diese amerikanische Methode liegt eigentlich in der Unvergleichbarkeit beider Rechtssysteme. Und es muß auch zugestanden werden, daß die Übernahme technischer und naturwissenschaftlicher Erkenntnisse über Ozeane hinweg gemessen daran sehr einfach und schon tausendfach hinüber und herüber praktiziert worden ist, ohne daß die beiderseitigen Systeme irgendeinen Schaden genommen hätten. In den Rechts- und Geisteswissenschaften mag das durchaus etwas anderes sein. Aber man soll bedenken, daß die US-amerikanische „policy termination" Anstöße für die deutsche Implementationsforschung gegeben hat, auch konkret für das Zeitgesetz. Es ist gewiß zweierlei, ob neue Denksysteme Tradition haben oder nicht. Ohne Tradition freilich ist die Rezeption sicherlich erschwert, aber keineswegs unmöglich. Es wäre an der Zeit, sich mit den US-amerikanischen Systemen wieder engagierter zu befassen. Aber die angeblichen organisatorischen Probleme, die zu einem kaum auflösbaren Zeitdruck führen, können nicht auf Dauer greifen. Das ließe sich gesetzlich regeln, wäre i m übrigen auch eine Frage des Zeit-Managements. Das Zeitgesetz ist für das Interesse dieser Arbeit zwar überaus wichtig, aber nur in Verbindung mit einer Experimentier- oder/und Probierklausel. Damit bekommt es eine neue Qualität, die weiterhelfen kann. Freilich stellt sich hier die Frage, was denn gleich zwei Begriffe sollen. I m Sprachgebrauch werden doch Experimentieren und Probieren überwiegend sinnähnlich gebraucht. Aber man muß Luzius Mader zustimmen, wenn man, jedenfalls einmal in der Gesetzgebungslehre, Experimentiergesetze als eigene Rechtsfigur 74
Adams / Sherman, Das „Sonnenuntergangs"-Konzept als erfolgversprechendes Instrument zum Abbau des Unbehagens an der öffentlichen Verwaltung, Verwaltungswissenschaftliche Informationen, 1978; auch Langner, Zero Base Budgeting und Sunset Legislation, 1983; vgl. auch Losano Mario G., Vom Parteiprogramm zum Gesetz: Probleme der Wirksamkeit, in: Harald Kindermann (Hrsg.), Studien zu einer Theorie der Gesetzgebung, 1982; ebenda auch Dietrich Rethorn, „Sunset"-Gesetzgebung in den Vereinigten Staaten von Amerika, S. 330 ff. *
132
Edgar Michael Wenz
andenkt, jedoch Gesetzgebung auf Probe als Ausdruck gehobener rechtlicher Anforderungen an die Qualität der Gesetzes Vorbereitung sieht 7 5 . Diese Differenzierung kann man übernehmen.
VIII. Das Experimentiergesetz Die entschiedenste Ausformung der Zeitgesetze, in den weitaus meisten Fällen auch der eigentliche Anlaß, Zeitgesetze zu erlassen, ist, Erfahrungen mit der Effektivität oder/und der Effizienz des Gesetzes zu sammeln, ein zweifellos erkennbar wirksames Mittel, eigentlich Voraussetzung der Kontrolle. I m Zeitgesetz ist in aller Regel die Erfolgskontrolle inkorporiert, ausdrücklich angegeben und auch wirksam, wenn das Gesetz operationalisierbar und weiterhin die Geltungsdauer vom Erreichen des Zielbetrags abhängig i s t 7 6 . Es gibt eine Reihe Experimentiergesetze in der Bundesrepublik Deutschland. Hoffmann-Riem 7 7 führt die seinerzeit existenten Experimentiergesetze auf: - Schul- und Bildungswesen - Ausbildung - Medienpolitik - Verkehrspolitik Bauwesen - Mieterschutz. Hoffmann-Riem vermißt allerdings in der zeitlichen Abfolge Auswirkungen, sozusagen als Nachfolgegesetze, in die die gewonnenen und ausgewerteten Erfahrungen einzuordnen wären. Es hat also der Gesetzgeber nach der hier vertretenen Meinung richtig angesetzt, aber dann nicht die Konsequenzen gezogen. Experimentalgesetze können sehr gut auftreten i m Zusammenhang mit Reformen, zum mehr oder weniger widerstandsarmen Einschieichen in die Gesetzgebung, in der Hoffnung auf wachsende Durchsetzung, doch zumindest als „Innovationsventile" 7 8 . Wie auch immer, Experimentalgesetze lassen keine Angriffe auf ihre Rechtmäßigkeit zu. Es sind nichts anderes als Gesetze, eben mit Experimentierklausel; durch die Wortwahl ist der Sinn und Zweck dieser Gesetzesform dargestellt und gleichzeitig begrenzt. Es muß nur explizit im Gesetz angegeben sein, was und aus welchem Grunde Gegenstand des Experiments sein s o l l 7 9 ; da wird auch der letzte Rest von grundsätzlichen legislativen Vorbehalten schwinden. Viele Argumente, die in der Literatur gegen das Zeitgesetz vorgebracht wurden, hatten eigentlich das Experimentiergesetz i m Blick. Aber diese Bedenken sind mittlerweile zerstreut. Der vorübergehende Vorwurf der Verfassungswidrigkeit, 75 Luzius Mader, Anm. 53, S. 213 f. 76 Werner Hugger, Anm. 38, S. 214. 77 Hoffmann-Riem, Anm. 49, S. 57 f. 78 Anm. 49, S. 59 f. 79 So auch Mader, Anm. 53, S. 219, der die Prüfung der Verhältnismäßigkeit verlangt, aber der Meinung ist, daß das Experimentiergesetz zur Rationalisierung der Gesetzgebung beiträgt.
Die forschungsbegleitete Gesetzgebung
133
weil bei Experimentiergesetzen Menschen Gegenstand des Experiments sind oder sein könnten, ist nicht mehr gegeben. Wenn ein Gesetz das Design des Versuchs der Gesetzeseffektivität hat, sind solche weit gegriffenen Bedenken gegenstandslos.
IX. Das Probiergesetz - der große Schritt? Zeitgesetz und Experimentierklausel sind Schritte, die folgerichtig zum Probiergesetz führen. Zeitgesetze laufen irgendwann einmal aus, reine Experimentierklauseln werden auch Ergebnisse bringen, aber es fehlt dennoch das Resultat, nämlich der Zwang zum legislatorischen Handeln oder - noch wirksamer - eine automatische Gesetzesfolge. Es scheint j a die Crux der Gesetzgebung in Deutschland zu sein, daß es zwar nicht unbedingt an Effektivitätskontrollen fehlt, auch nicht am Berichtswesen, sondern schlicht und einfach an der Umsetzung. Deshalb soll Probiergesetz so verstanden werden, daß es nicht nur ein Zeitgesetz mit Experimentierklausel ist, sondern doch etwas Neues: ein Gesetz mit der legislativen Konsequenz des Weiterbestandes einer probierten Norm oder der streng und klar gefaßte Zwang zu einer legislatorischen Gesetzesänderung i m Sinne der Experimentieroder Probierklausel. Man mag sich erinnern: Die Bevorzugung des Weges über die „eigene Wirklichkeit" des Gesetzes 80 als die beste Methode ist damit eigentlich erfüllt. Das müßte alle Mühen und alle Risiken wert sein. Diese Zeitgesetze, die in diesem Design als „Probiergesetze" bezeichnet werden dürften und sollten, sind dennoch äußerst selten bislang gewagt worden, eben aufgrund der schon angesprochenen Bedenken oder angebotenen Auswege, mit dem Hinweis darauf, daß der Gesetzgeber ohnehin zu jeder Zeit ein Gesetz aufheben oder novellieren kann. Es bestünde, so diese Meinung, also schon aus diesem Grund kein derartiger Handlungsbedarf. Nur, die Fälle, wo der Gesetzgeber von seiner Befugnis Gebrauch macht, sind doch sehr selten, auf jeden Fall erst nach längerer Zeit der Gesetzesgültigkeit, daß es durchaus geboten erscheint, den Gesetzgeber doch häufiger und periodisch zum Nachdenken über seine Gesetze zu zwingen. Zeitdruck scheint nach den bisherigen Erfahrungen für den Gesetzgeber recht heilsam zu sein. Zwar Zeitgesetze expressiv genannt, in Wahrheit aber Probiergesetze gemeint, waren neuerdings Gegenstand von Auseinandersetzungen, die hauptsächlich in der Presse geführt wurden. Exakt um den Jahreswechsel 1 9 9 6 / 9 7 8 1 herum hat sich die politische Diskussion um Zeitgesetze wieder verstärkt. Sie wurde angeregt durch Rupert Scholz, dem Justizminister, der Schmidt-Jortzig i m wesentlichen folgte, die aber Widerspruch fanden zunächst durch den Rechtsexperten Horst Eylmann. Die so Carl Bohret, Anm. 33. In schneller Folge F.A.Z. vom 3. 1. 97, Welt am Sonntag vom 5. 1. 97, Focus (SchmidtJortzig, Wir brauchen Gesetze auf Probe) vom 6. 1. 97, S. 13, F.A.Z. vom 24. 2. 97. 81
134
Edgar Michael Wenz
Argumente waren die gleichen wie früher - Herbeiführung einer Rechtsunsicherheit, Gefahr der Abstufung der Normen in verschieden wertige Klassen. Sie sind alle schon, sowohl i m Pro wie i m Contra, abgehandelt worden. Selbst die Abwertung der Zeitgesetze durch Vergleiche mit dem Verfalldatum ist i m gleichen Bereich, bei den Milchprodukten nämlich, geblieben. Der Fortschritt war nur marginal, nämlich vom Verfalldatum von Käse immerhin zu dem von Joghurt. Schon früher hat die gehobene deutsche Presse Zeitgesetze gefordert, so beispielsweise Joachim Wagner in: „Die Z e i t " 8 2 . Der Autor hat eine spezielle Verschärfung der Straf- und Prozeßnormen gegen den damals bedrohlichen Terrorismus gefordert, für einen überschaubaren Zeitraum (der, wie sich dann herausgestellt hat, auch i m wesentlichen richtig bemessen gewesen wäre). Er wollte für die notwendige Bekämpfung einer Sondersituation die klassischen Strafrechtsnormen nicht aufblähen. Das zeigt schon der Untertitel „Befristete Normen brauchen nicht immer Ausnahmegesetze zu sein". Beachtung gefunden hat auch Roland Koch ebenfalls mit der Forderung „Gesetze nur noch auf Z e i t " 8 3 . Der Autor beklagt die Normenflut. Er schlägt vor, zwei Kategorien von Gesetzen zu schaffen: Die erste soll die grundlegenden Gesetzesänderungen mit dauerhaftem Charakter erfassen; sie bedürfen einer qualifizierten Mehrheit. Die zweite ist für die anderen Gesetze gedacht, für die dann auch eine einfache Mehrheit genügen würde; die Zeit ihrer Geltung sollte auf fünf Jahre begrenzt werden. Aus dem Text läßt sich nicht erkennen, ob die verschiedenen Mehrheiten die jeweiligen Gesetzentwürfe zu Dauer- oder nur zu Zeitgesetzen machen; oder ob Gesetze, die auf Dauer oder Zeit angelegt sind, durch die jeweiligen Quoren zur Rechtserhebung bestätigt werden müssen. Koch bezeichnet seinen Vorschlag von vorneherein als eine „Provokation", die aber geeignet wäre, die Regulierung zu beschleunigen, gemeinhin als eine rationalisierende Gesetzgebung, zum Wohle des Wirtschaftsstandortes Deutschland. Als ein Probiergesetz kann man einordnen das Entsendegesetz (Gesetz über zwingende Arbeitsbedingungen bei grenzüberschreitenden Dienstleistungen, Arbeitnehmer-Entsendegesetz; AEntG). Es könnte dies tatsächlich ein neuer Anfang sein, in der Gesetzgebungsmethodik beweglicher zu werden. Es ist das jüngste Experimentiergesetz, es wurde auch schon von 18 Monaten auf drei Jahre und sechs Monate verlängert. Erkenntnisse und Ergebnisse liegen noch nicht vor, zumindest sind solche nicht veröffentlicht worden. Das hängt ohne Zweifel mit dem Mangel zusammen, den dieses Gesetz hat, um ein Probiergesetz i m Sinne dieser Ausführungen zu sein. Da fehlt noch ein gutes Stück 8 4 . Zwar kennt man die Motive des
82
Joachim Wagner, Schafft Gesetze auf Zeit! In: Die Zeit, vom 1. 2. 80. Roland Koch in der Rubrik „Fremde Federn" in der F.A.Z. vom 12. 12. 95. Konkrete Beispiele sind darin allerdings nicht genannt worden, das Postulat wurde mehr generell aufgestellt. Es sollte wohl die deutsche Gesetzgebung insgesamt beeinflussen. Chancen zur Verwirklichung darf man bei einem aktiven Politiker (Oppositionsführer in Hessen) durchaus sehen. 83
Die forschungsbegleitete Gesetzgebung
135
Gesetzgebers aus den politischen Debatten und den Bundestagsdrucksachen. Besser wäre sicherlich gewesen, ganz exakt zu beschreiben, was das Gesetz soll und in welchem Zeitraum die Vorgaben geprüft werden müssen. Aber es ist jedenfalls der Grundstein zu einem Gebäude gelegt, das fertigzubauen sich lohnt, auch wenn sich bei der jetzigen Rechtslage das Schicksal des Gesetzes nicht, jedenfalls nicht ohne Aufwendungen, verfolgen läßt. Ein guter Anfang scheint zu sein, jedenfalls eine bemerkenswerte Absicht i m Sinne dieser Gedanken, daß schon das Entsendegesetz sich wohl als Probiergesetz i m vorgeschlagenen Sinne einreihen ließe; aber dazu fehlt es wohl noch an klaren und terminierten Fragen und Bedingungen. Man kennt wohl die Intention des Gesetzgebers. Aber ein echtes Probiergesetz sollte das, was probiert werden und warum dies geschehen soll, auch exakt beschreiben. Ein typisches Probiergesetz von weittragender Bedeutung, das eigentlich nur selten 85 vorgetragen wird, ist das englische Gesetz von 1965, das versuchsweise die Todesstrafe bis 31. Juli 1970 aufhob. Die dadurch gefundenen Erfahrungen sollten Entscheidungshilfe sein, ob man wieder zur Todesstrafe zurückkehren oder man sie endgültig - wie dann auch geschehen - abschaffen solle. Häufig zitiert wird bei grundlegenden Überlegungen der angestellten Art die „Experimentelle Rechtswissenschaft" 86 . Dem US-amerikanischen Autor Beutel geht es aber mehr um eine Anregung, Methoden der Naturwissenschaften auch auf die Rechtswissenschaft zu übertragen. Er ist sich sicher, daß auf diesem Weg, also durch systematisches Experimentieren, Streichen, Ändern, Ergänzen das Recht gewinnen wird. Seine Beispiele mit Experimenten sind Planspiele und Simulationen und dienen der Vorbereitung eines Gesetzes. Man könnte und müßte aber auch an Überprüfung gültiger Gesetze denken. Bei seiner Stufenfolge des Experiments 8 7 spricht er nämlich von " ( . . . ) 3. Man müßte beobachten und messen, wie sich die angewandte Norm in der Gesellschaft auswirkt. ( . . . ) 6. Falls die Analyse zeigt, daß das Recht unwirksam ist, so müßten neue Wege vorgeschlagen werden, um den ursprünglich gewünschten Erfolg zu erreichen. 7. Die vorgeschlagene Regel müßte in Kraft gesetzt und das Verfahren wiederholt werden." Es geht also Beutel nicht nachdrücklich um die Gesetzgebungswissenschaft, wie man prima facie anzunehmen geneigt ist, sondern eben um die ständige Überwachung der Normen durch die Rechtswissenschaft. Das alles bedeutet eine Beobachtung des Gesetzes ex post, also eigentlich ein Probiergesetz in unserem Sinne. In der Vorbereitungs-
84
Was ist nun gewollt: Erhöhung des Lebensstandards der Gastarbeiter durch Lohnanpassung oder (was allgemein angenommen wird) eine Reservierung der Arbeitsplätze für Deutsche? 85 Bemerkenswerte Ausnahme Manfred Rehbinder, Rechtssoziologie, 3. Aufl., S. 78. 86 Frederick Keating Beutel, Die Experimentelle Rechtswissenschaft. Aus dem Amerikanischen (Experimental Jurisprudence) übertragen von Uwe Krüger, 1971, herausgegeben von Ernst E. Hirsch und Manfred Rehbinder. 87 Beutel, Anm. 86, S. 35 ff.
136
Edgar Michael Wenz
phase sind j a keine Erkenntnisse dieser Art zu gewinnen. Sein Buch selbst allerdings ist doch mehr auf die Schritte ex ante angelegt, insofern verwirrend. Beutels Gedankengänge erinnern sehr stark an Carl Popper, dem wir als Zeitgenossen durchaus beim wichtigsten gesellschaftspolitischen Instrument, der Gesetzgebung, seiner „trial and error' 4 - und nicht anderes wäre ein Probiergesetz folgen dürften 8 8 . Ein sauber definierter Konditionalismus und Automatismus würde beim Erreichen oder Fehlen der definierten Vorgaben zum Fortbestand oder zum Wegfall des Gesetzes führen. Bei der Überprüfung von Gesetzen, die zu Zeitgesetzen (sunset laws) geeignet wären, sollte man auf Ausschüsse, Hearings, Sachverständigenund Enquête-Kommissionen, also das ganze parlamentarische un-ökonomische Procedere verzichten. Dieses sollten wir ebenso ausschalten wie Lust, Laune und Bequemlichkeit der Abgeordneten. Objektive Kriterien sollten dann an die Stelle von subjektiven (häufig wechselnden) Meinungen treten. Die Erkennntnis, Gesetze auf ihre Tauglichkeit zu prüfen, hat jedenfalls eine lange Tradition und bedeutende Traditionsträger. Genau ein Zeitgesetz mit Probierklauseln hat nämlich schon Charles de Montesquieu (1689-1755) so formuliert: „Oft ist es sogar angebracht, ein Gesetz zu probieren, bevor man es endgültig in Kraft setzt" 8 9 . Montesquieu als Ahne und Kronzeuge hat Gewicht. Er, der die Bedingtheit des Rechts durch die „Natur der Sache" erkannt hat, ist als Begründer der Rechtssoziologie in die Rechtswissenschaft einbezogen worden 9 0 . Es fällt bei der neueren Literatur eigentlich auf, daß Änderungen von Gesetzgebungsmethoden i m Schrifttum erwogen wurden. Es waren dann bisher, überdies auch bei dieser Thematik in ihrer Gesamtheit, nicht Gesetze i m engen Sinne gemeint. Wie sich an den in der Literatur vorgetragenen Beispielen erkennen läßt, hatte man vorrangig und überwiegend das Verwaltungsrecht 91 , also Rechtverordnungen und Verwaltungsanordnungen, i m B l i c k 9 2 . A u f diesem begrenzten Feld wäre natürlich die Durchsetzung schon deshalb relativ einfach, weil die Gesetzes-
88 Popper, Anm. 50. 89 Charles de Montesquieu, Vom Geist der Gesetze, 1748, II. Buch, 2.Kap. a. E. Interessanterweise hat Hans-Detlef Horn, Anm. 70, seinem zitierten Buch diesen Satz als Motto vorangestellt. Freilich hat Horn sich mit einer Art von Gesetzen im Blick auf die Verfassungsgemäßheit befaßt, die eine Thematisierung des Probierens im Sinne dieser Ausführungen kaum oder gar nicht erlauben. 90 Zurückhaltender in dieser Beurteilung ist Panajotis Kondylis, Montesquieu und der Geist der Gesetze, 1996; er meint, daß Montesquieu das „Tor zur Soziologie nur halb durchschritten" habe. 91 Die Implementationsforschung richtet sich hauptsächlich an Verwaltung (und Politik), greift aber auch auf Rechtssprechung und Gesetzgebung über - ein weiterer Beweis, daß Rationalisierung der Rechtsanwendung ein gemeinsames Anliegen aller Zweige ist. 92 Für diese Gesamtschau steht auch das zitierte Werk von Karpen, Anm. 12.
Die forschungsbegleitete Gesetzgebung
137
adressaten, eben die Verwaltung, ausgebildete Juristen sind, die die Motive eher verstehen, wahrscheinlich sogar begrüßen, sich jedenfalls nicht auf Nicht-Wissen berufen könnten. Aber das würde nach der hier vertretenen Meinung zu kurz greifen. Wenn die Idee in sich richtig ist, sollte sie gerade auch für an alle Rechtsadressaten gerichteten Gesetze gelten.
X. Das aktuelle Verfahren Man kann sich recht wohl auf den Einwand berufen, daß der Gesetzgeber souverän ist mit den Themen seiner Gesetzgebung, auch i m Zeitpunkt, mit dem er sie dem Parlament zur Beschlußfassung vorlegt. Diese Meinung ist durchaus richtig, übersieht aber, daß der Gesetzgeber, hier konkret der deutsche Bundesgesetzgeber, die Landesgesetzgeber i m Gefolge auch nicht anders, die ihm gegebene Möglichkeit der Gesetzesänderung oder Gesetzesbeendigung überraschend selten wahrgenommen hat, also Zweifel aufkommen läßt, ob er eine solche Möglichkeit überhaupt ernsthaft erwägt. Sie ist ihm offenbar zu selbstverständlich, so daß er sie in das jeweilige Gesetz gar nicht erst aufnehmen will. Bei dieser Selbstsicherheit gehen freilich auch Überlegungen unter, dem Gesetz könnten Mängel anhaften, es könnte geprüft werden müssen, wie wirksam es ist und ob es zum angezielten Erfolg überhaupt führt. Diese Bedenken finden Nahrung in den Anleitungen „Prüffragen für Rechtsvorschriften des Bundes" 9 3 . Dort sind zehn Punkte aufgeführt wie folgt: 1. Muß überhaupt etwas geschehen? 2. Welche Alternativen gibt es? 3. Muß der Bund handeln? 4. Muß ein Gesetz gemacht werden? 6. Ist der Regelungsumfang erforderlich? 7. Kann die Geltungsdauer beschränkt werden? 8. Ist die Regelung bürgernah und verständlich? 9. Ist die Regelung praktikabel? 10. Stehen Kosten und Nutzen in einem angemessenen Verhältnis? Alle diese Fragen 9 4 haben keinen Bezug zur Kontrolle der zu erlassenden Vorschrift. Es ist also keine verpflichtende Vorsorge geplant, die Effektivität des Gesetzes i m Auge zu behalten und gegebenenfalls einzugreifen.
93 Beschluß der BReg vom 11. 12. 84, in GMB1. 1990 Nr. 3, S. 42 (denen ein Fragenkatalog beigegeben ist). 94 Wortgleich der Katalog der österreichischen Bundesregierung zum gleichen Thema.
138
Edgar Michael Wenz
Die Ziffer 7 könnte darauf deuten, daß eine Art Zeitgesetz zumindest angedacht werden kann. Damit wäre man schon nahe bei einem experimentellen, sogar beim Probiergesetz, weil eine Befristung der Gültigkeit darauf schließen lassen könnte, daß man doch Zweifel zur Wirksamkeit des Gesetzes hegt. Aber dazu ist in der Gesetzgebung notwendig, daß der Gesetzgeber seine Souveränität ausschöpft. Die Fragestellung in Ziffer 7 zielt mehr auf Zeitgesetze in der Annahme, daß in der vorgegebenen Frist Zweck und/oder Ziel erreicht werden, eine weitergehende Reglementierung sich also erübrigt. Damit könnte die Fragestellung ihr Bewenden haben, wenn von dieser Möglichkeit häufiger Gebrauch gemacht worden wäre. A n Zeitgesetze darf also recht wohl gedacht werden, aber sie sind offenkundig als Ausnahme eingebracht. Aber die Durchsetzung aller solcher Bemühungen hängt immer davon ab, wieviel die Bundesregierung von Kontrolle hält. Ein unübersehbares Defizit läßt sich schon daraus erkennen, daß sie auf Berichterstattung durch die Bundesminister des Innern und der Justiz, die ursprünglich angeordnet war (Ziffer V.), später ausdrücklich verzichtet hat. Dabei geht es nur um die Erfahrungen mit den Prüfungsfragen. Beim beigegebenen Fragenkatalog findet sich unter Ziffer 7.2 freilich auch die Frage, ob „eine befristete »Regelung auf Probe' vertretbar" sei. Damit ist das Thema des Probiergesetzes zumindest einmal angesprochen. Ihm gilt die Aufmerksamkeit dieses Aufsatzes 95 . Das sind routinierte Selbstverständlichkeiten, die nichts aussagen über die Einführung besonderer und auf Wirksamkeit orientierter Maßnahmen, um die Wirksamkeit der Gesetzes Vorschriften zu kontrollieren. In dieser Richtung findet sich also nichts. Klaus König erörtert die Probleme der Rechtsetzung 96 . Weil eben „mehr Gesetze nicht besseres Recht bedeuten" 9 7 , muß man die Neigung beobachten, daß „nachgeordnete Behörden durch möglichst detaillierte Regelungen" gebunden werden sollen, umgekehrt allerdings auch die Vollzugsverwaltungen detaillierte Regelungen zur Erleichterung der Entscheidungen verlangen. König erörtert die Zweckmäßigkeit einer Art „Handbuch der Gesetzgebung". Basis kann nur „eine fortentwickelte Gesetzgebungslehre" sein. Vorläufer für die Legislative war der Freistaat Bayern mit seinen „Richtlinien für die Wahrnehmung und Organisation üblicher Aufgaben". Aber man muß immer bedenken, daß die Gesetzgebungslehre 95 Die Fundstelle (GMB1. 1990 Nr. 3) weist auch einen Beschluß der Bundesregierung vom 20. Dezember 1989 über Maßnahmen zur Verbesserung der Rechtssetzung aus (S. 38). Dort ist unter § 8 „Regelmäßige Überprüfung" (S. 40) der Verwaltungsvorschriften des Bundes, insbesondere ihre Ordnungssysteme, angegeben. Wenn man das großzügig auslegen will, ist damit auch eine gewisse Effektivitätskontrolle verbunden. Gänzlich fremd ist der Gedanke, der hier verfochten wird, dem deutschen Rechtssystem also nicht. 96 Klaus König, Zur Überprüfung von Rechtssetzungsvorhaben des Bundes, in: Gesetzgebungstheorie und Rechtspolitik, Jahrbuch für Rechtssoziologie und Rechtstheorie, Bd. 13, 1988, S. 176 ff. 97 Anm. 96, S. 171 ff.
Die forschungsbegleitete Gesetzgebung
139
und die Gesetzgeber den „Primat der Politik" zu akzeptieren haben. Bei der Übersicht über die oben erörterten Prüffragen für den Bund finden sich einige Anregungen, aber ansonsten die Feststellung, daß aufgrund der damals nur kurzen Erfahrungen die Wirksamkeit nicht beurteilt werden kann. Aber jedenfalls sei durch die Institutionalisierung einer Normprüfung, neben dem Nachdenken über die Regierbarkeit des Wohlfahrtsstaates unter Einschaltung der Rechtsforschung, erkennbar und erfahrbar, daß sich „erste Änderungen in der Einstellung der am Gesetzgebungsprozeß beteiligten Akteure" bemerkbar machen. Man mag daraus auch einen Fortschritt der Gesetzgebungslehre ableiten.
XI. Fazit, konkrete Vorschläge Die existente Literatur zum untersuchten Komplex erörtert eine Reihe von Vorschlägen, die aber nur angedeutet sind. Beim Versuch der Perfektionierung und Vertiefung der Ansätze sind die Schwierigkeiten erkennbar geworden. Meist ist dieses spezielle Thema der Vorschläge abgebrochen worden. Ein Überblick läßt erkennen, daß es für alle Autoren ausnahmslos essential ist, die Gesetzgebung zu rationalisieren auf dem Wege einer Evaluierung. Die dazu vorgeschlagenen Wege sind vielfältig, gelegentlich die gleichen Wege auch von mehreren Autoren vertreten oder gestützt. Es sind i m wesentlichen jene Lösungen, die in dieser Arbeit untersucht werden, so besonders Zeitgesetze, Zeitgesetze mit Experimentalklausel und Probiergesetze, vor allem Einführung eines modifzierten Berichtswesens. Der Hintergrund dieser Autoren ist offenbar die Verwaltung, freilich ein in mehrfacher Hinsicht ergiebiges Feld. Dort arbeitet man ja i m Wortsinn in einer Doppelfunktion: Einerseits ist man Rechtsadressat, andererseits Rechtssetzer, beispielsweise für Rechts- und Verwaltungsordnungen; hier einmal abgesehen davon, daß viele der hohen Regierungsbeamten nicht selten bei der Vorbereitung der Gesetze mitwirken. I m Vordergrund der Prüfung standen Organisation und Kompetenz. Einhellig lehnte man neu zu schaffende Organisationen und Behörden ab und überhaupt ein Aufblähen der Verwaltung. A n die Heranziehung des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages wurde gedacht, selbst des Bundesrechnungshofs, freilich auch die Büros der Parlamentarier, insbesondere der Ausschüsse 98 .
98
Hellstern/Wollmann, Anm. 46, S. 560 ff., befürchten das Aufkommen einer „Expertendemokratie". Wolf gang Zeh, Anm. 30, S. 207, vertritt die Auffassung, das Parlament institutionell in die Wirkungsbeobachtung einzuschalten; am besten geeignet wären hierfür die Ausschüsse. Die Gefahr, die bei der Selbstprüfung eines Apparates zu befürchten ist, steht nicht im Vordergrund. Eine stärkere Heranziehung zur Gesetzgebungskontrolle fordert Kindermann, Anm. 16, S. 148, von der jeweils zuständigen Ministerialbürokratie, weil sie am engsten mit der Materie verbunden sei.
140
Edgar Michael Wenz
A u f dem Vormarsch mindestens zu einem mittleren Ziel (Zwischenziel) und als Fundament für den nächsten großen Abschnitt zum eigentlichen Ziel, muß man folgende Überlegungen anstellen: • zunächst zur Zuständigkeit; • dann gesetzestechnisch, die Forderung zu realisieren, Gesetze operationalisierbar zu machen, um die Wirksamkeit des Gesetzes in Schritten oder ganzheitlich überhaupt verfolgen und erforschen zu können. Einen ganz anderen Gegenstand als der erörterte Prüfungskatalog 99 hat ein Vorschlag 1 0 0 , der mehr als nur Anhaltspunkte gibt und sich konkret mit der Effektivitätskontrolle befaßt: Nur überschlägig könnte das rechtspolitische Postulat an den Gesetzgeber etwa so aussehen (de lege ferenda): - Klar Zweck und Ziel des Gesetzes beschreiben müssen, - mit einer Genauigkeit, die die Aufstellung von nachprüfbaren Kriterien zuläßt, - die in einer vorgegebenen Zeit, etwa auch in Stufen, erreicht werden müssen; - welche Fakten und Kriterien - in welchen Zeitabständen und von wem kontrolliert (gemessen) werden müssen, - wobei die Meßmethoden schon im Gesetz oder in einem verbindlichen Anhang zum Gesetz festgelegt sind. Man mag entgegenhalten, daß das in die „Traumwelt der Gesetzgebung" gehört. Gewiß, gemessen an den derzeitigen, häufig geradezu schlampigen Gesetzen, die offenbar nur Interessengruppen besänftigen sollen, sich deshalb auch in Generalklauseln und unbestimmte Rechtsbegriffe flüchten, die sich den Pflichten der Idee des Rechtsstaates entziehen durch die Flucht in den Richterstaat, mag das stimmen. Das Hauptproblem freilich, an dem vermutlich die meisten Überlegungen oder auch schon praktischen Ansätze gescheitert sind, ist die Meßbarkeit von Gesetzesbefolgung und sozialen Entwicklungen. Was in den Naturwissenschaften selbstverständlich ist, nämlich die Messung als solche und dann auch deren praktische Durchführung, ist das eigentliche Problem solcher Funktionskontrollen in den Sozial- und Geisteswissenschaften. Die Lehre von Galileo Galilei, man soll alles zunächst einmal meßbar machen und dann messen und vergleichen, scheitert schon an der ersten Grundsatzforderung, der Meßbarkeit. Und dennoch läßt sich ein Weg finden, dann selbstverständlich leichter und engagierter, wenn man die Notwendigkeit erkannt hat. Daran aber hat es bislang in der Gesetzgebungslehre eigentlich gemangelt. A n diesem Punkt ist auf jeden Fall die empirische Rechtssoziologie auf den Plan gerufen. Sie ist die Wissenschaft von der Rechtswirklichkeit. Sie müßte 99 Anm. 93. 100 Wenz, Anm. 20, S. 268 f.
Die forschungsbegleitete Gesetzgebung
141
zumindest die Lösungsansätze bieten k ö n n e n 1 0 1 . Das Problem sind hier nicht die konditionalen Gesetze. Durch ihre Wenn-Dann-Automatik lassen sich die Merkmale i m allgemeinen sehr gut beschreiben, anders als bei finalen Gesetzen. U m ein finales Gesetz, also eine zielgerichtete soziale Entwicklung beobachten zu können (Planungs- oder wirklichkeitsgestaltende Gesetze), muß die empirische Sozialforschung einen zeitlichen Längsschnitt anlegen, der durch mehrere Meßpunkte, an denen vorgegebene Daten ermittelt und abgetragen werden können. Das Verfahren (Panel) scheint einigermaßen kompliziert, ist aber schon häufig in anderen Zusammenhängen, so beispielsweise bei Verbraucher- und politischen Meinungsforschungen, praktiziert worden; es ist dies eine bewährte M e t h o d e 1 0 2 . Die Mehrarbeit wird auf jeden Fall lohnen, schon allein aus dem schlichten Grund, daß es eigentlich nichts Lohnenderes gibt als funktionierende „gute" Gesetze. Diese sind eigentlich alle Mühen wert. Bei derartigen finalen Planungsgesetzen bietet nützliche Hilfestellung zur Unterscheidung in der Gesetzgebungstechnik zwischen Zweck und Ziel. Diese beiden angesteuerten Punkte unterscheiden sich; dazu folgendes Beispiel: Das Ziel, das der Gesetzgeber mit einem Gesetz verfolgt, reicht häufig über dieses hinaus. Es bezeichnet den Soll-Zustand der gesellschaftlichen Wirklichkeit, also beispielsweise Beseitigung von Wohnungsmangel und breite Streuung von Wohneigentum in allen Bevölkerungsschichten (so die Zielsetzung in § 1 I I Wohnungsbau- und Familienheimgesetz). U m diesem Ziel näher zu kommen, wird dem Gesetz die Förderung bestimmter Bauvorhaben als Zweck aufgegeben. Es wäre beispielsweise denkbar, daß nach dem Gesetz eine bestimmte Zahl an Neubauwohnungen pro Jahr zu fördern ist. Die Zwecksetzung beschreibt also, was mit den Anordnungen im Gesetz (Auszahlung der Fördermittel) unmittelbar erreicht werden soll (jährliche Marge). Aber dieser Zweck bleibt hinter dem politischen Ziel zurück, ist nur ein Schritt auf dem Weg dahin, die Verbesserung oder gar nur Herstellung von Wohnverhältnissen, wie sie einem Wohlfahrtsstaat angemessen sind. Bei der Erfolgskontrolle ist jedoch erforderlich, sich darüber klar zu werden, was Prüfungsmaßstab sein soll: Zweck oder Ziel. Die Zwecke sind also nur einzelne Schritte zum Ziel. Bei Erreichen eines definierten Zwecks könnte ein Meßpunkt am zeitlichen Längsschnitt festgemacht werden. Freilich haben die Planungsgesetze Grenzen. Es wird wohl nur ein Teil der wirklichkeitsgestaltenden Gesetzesvorhaben sich in der erörterten Methode messen lassen. Als Beispiel mag das Kindergeldgesetz dienen, ein typisches Leistungsgesetz. Der Gesetzgeber kann nur kontrollieren, ob der Antragsteller anspruchsberechtigt ist, ob ihm das Kindergeld in richtiger Höhe ausbezahlt wurde. A b dann allerdings verschwindet der Vorgang in der Privatsphäre: Der Vater kann das Kindergeld auch vertrinken. Solche finalen Planungsgesetze lassen sich i m Vorfeld sehr wirksam 101 Wegen des Umfangs solcher Überlegungen sind diese in der Arbeit Wenz, Einführung in die theoretische Rechtssoziologie, Anm. 24, vorgetragen worden; siehe auch Anm. 23. 102 Vgl. dazu Rehbinder, Anm. 85, S. 76 ff.
142
Edgar Michael Wenz
mit der ex ante-Methode auf Eignung prüfen, ebenso könnte die theoretische Rechtssoziologie 1 0 3 in dieser Phase schon ihren Teil beitragen. Was man aber nun auch gegen die Messung von wirklichkeitsgestaltenden Gesetzen vortragen mag, man muß mit Einwänden rechnen, die darauf abzielen, diese rechtspolitische Forderung aufzuweichen. Klaus K ö n i g 1 0 4 hat die Evaluationsdiskussion bereichert um die Einbeziehung der finalen Planungsgesetze. Da die Evaluation nicht nur der Vollzug des Gesetzes interessiert, sondern dessen Erfolg, kann man also nicht mit konditionalen Gesetzen arbeiten, sondern braucht Finalprogramme, deren Erfolg kontrolliert werden muß. Das bedeutet, daß die einzelnen Schritte i m Vollzug, das ganze Ergebnis dann wohl am Erfolg gemessen werden müßte. König sieht hierfür nur die ex post-Kontrolle, die sich um die richtige Wirkung der Entscheidungsprogramme kümmert; er fordert darüber hinaus die ständige Einbeziehung der Rechtssoziologie, die „bei der Evaluation von Gesetzen eine fruchtbare Rolle spielen (kann), indem sie an der sozialen Funktion der vagen, vieldimensional, ambivalent und unter sich konfligierend formulierten Ziele h i n w e i s t " 1 0 5 . Aber es ist auf jeden Fall einmal besser, auch wenn die Durchführung mängelbehaftet sein mag, neue Wege zu suchen, als daß der Gesetzgeber unbeeindruckt von der wissenschaftlichen Diskussion, unverdrossen von der Einschätzung des Zeitgeistes (dem gar nicht so selten Politiker in den Nebenzimmern ihres Wahlkreises auf die Spur gekommen zu sein wähnen), sich auf die veröffentlichte Meinung und schließlich auf Hearings und Enquête-Kommissionen verläßt. Man mißt heutzutage gewissermaßen Fieber wie noch vor der Erfindung des Fieberthermometers - durch Handauflegen. Welchem Weg man auch folgt, es ist keineswegs nötig, neue und spezielle Strukturen zu schaffen. Vielmehr besteht die Meinung, daß die Parlamentarier in Bund und Ländern sich selbst darum umtun müssen, das auch könnten. Ob dafür die Büros der Parlamentarier oder Fraktionen oder einfacher der Ausschüsse, die für das Gesetz zuständig waren oder sind, personell aufgestockt werden müßten, wäre zu überprüfen. Angesichts der Verarbeitung relativ weniger Daten - um deren numerischen Einschränkung oder Präzision sich die empirische Rechtssoziologie zu bemühen hätte - bräuchte das nicht unbedingt notwendig zu sein. Aber diese Kosten wären sicherlich unterzubringen. Wert und Wirksamkeit der Gesetze wären dieses Opfer an Zeit seitens der Parlamentarier und an Kosten seitens der Staatskasse durchaus angemessen. Vorstellbar ist durchaus bei der Herstellung des Gesetzes und der Diskussion anläßlich der verschiedenen Lesungen, daß Antragsteller und Opposition ihre Gründe
103 Vgl. dazu Wenz, Anm. 24. 104
Zur Evaluation der Gesetzgebung, in: Harald Kindermann, Studien zu einer Theorie der Gesetzgebung 1982, S. 306 ff. 105 König, Anm. 104, S. 313.
Die forschungsbegleitete Gesetzgebung
143
vortragen. Das geschieht ja ohnehin. Nur sollte der Kern dieser Gründe festgehalten und in einer Kurzfassung formuliert werden: „Das Gesetz ist nützlich und notwendig, weil . . . !" Oder die Opposition: „Völlig untauglich, weil . . . !" Und: „Bei unserem Gesetz wird dieses passieren, beim Gesetz des politischen Gegners jenes" (Prognose als mittelbarer Gesetzesbestandteil). Man könnte, sollte das aber nicht angesichts der parlamentarischen Wirklichkeit, einwenden, daß ja immerhin i m demokratischen Rechtsstaat die Motive und jeweiligen parlamentarischen Drucksachen gibt, aus denen „schon immer" derartige Erkenntnisse festgehalten und jederzeit nachlesbar sind. Aber das gilt nicht mehr. Die Ausarbeitungen und Veröffentlichungen von Motiven sind eigentlich schon seit vielen Jähen recht dürftig. Bei der hier vorgeschlagenen Methode sind Regierung und Opposition durch Gesetz gezwungen, ihre Gründe und ihre Einwände in vorgeschriebener Form darzustellen, so daß diese als - selbstverständlich klarer und gut verständlicher - Bestandteil des Gesetzes bewertet werden können. Die Bürokratie und die Wissenschaften können bei der Formulierung der Gründe durchaus Hilfe leisten. Sie sollen so aufbereitet sein, daß die Erfassung bestimmter Daten damit angesprochen und fixiert ist. Auch die Ministerialbürokratie wird daran interessiert sein, die Fragen so zu formulieren, daß die Erhebung der Fakten, also der Antworten in der Wirklichkeit, i m Inhalt rational und gleichzeitig rationell erfaßt werden können. Hier könnten nun die Ergebnisse der Prognosen und Planspiele (ex ante) sehr nützlich sein. Sie haben bei der Vorab-Untersuchung des Gesetzes schon alle denkbaren Schwachstellen, alle kritischen und sensiblen Punkte herausgearbeitet. Diese werden auch meist schon in der Diskussion umstritten gewesen sein. Dort könnte nun mit den Kontrollen angesetzt werden. Entscheidender freilich sind dann die Ergebnisse der ex post-Untersuchungen. Wenn sich die kritischen Themen wiederfinden lassen, war die Arbeit des Gesetzgebers i m Vorfeld und dann auch beim Erlaß des Gesetzes zweifellos gelungen. Die noch anstehenden Diskussionen oder gar Debatten haben dann einen Kern und eine tragfähige Basis. Das vorgeschlagene Procedere kann nur als ein erster Entwurf betrachtet werden. Das Thema bedarf der Erörterung und der Vertiefung. Aber auf jeden Fall sollte der hier vorgeschlagene und jeweils auszuarbeitende Katalog Anhang des Gesetzes sein und somit Rechtskraft haben. Das Ergebnis wird dann nach Ablauf der im Gesetz festgelegten Frist an schlichten Daten und beweisbaren Fakten überprüft. Keineswegs sind neue Debatten erforderlich. Somit würde ein sehr wichtiger Grund der Abwehr jedes Verfahrens wegfallen. Ob nun dieses numerische Ergebnis dann gesetzesautomatisch Konsequenzen vorschreibt, etwa Beendigung des Gesetzes bei Nichterreichen der Vorgaben oder aber automatische Fortsetzung des Gesetzes bei positiven Ergebnissen - beide Prämissen sind definiert - , ob das dann zu einem Beschluß des Parlaments führt oder diesen schon ersetzt als materielle Gesetzesfolge, das ist eine Frage, die generell oder zumindest fallweise je Gesetz geklärt werden kann.
144
Edgar Michael Wenz
Das Parlament kontrolliert sich also selbst. Freilich braucht es dazu ein Manual. Aber auch dieses sollten sich die Parlamentarier selbst schaffen. Die wichtigste und absolut unverzichtbare Voraussetzung für eine Änderung der Gesetzgebungsmethodik ist aber, die immer wieder beklagte Tendenz der Gesetzgebungsorgane aufzubrechen, alles beim alten zu lassen. Damit steht und fällt alles. Der Einführung dieser Gesetzgebungsmethodik werden in erster Linie - man ist fast geneigt zu sagen: ausschließlich, zumindest klar überwiegend - psychologische Bedenken gegenüberstehen, obwohl doch nur sachliche, somit der Verbesserung der Gesetzgebung dienende Überlegungen ziehen könnten. Diese werden von den „Betroffenen" artikuliert werden, nämlich den Parlamentariern selber. Es ist schwierig, dafür eine Art „Beweis" in der Vergangenheit zu finden. M i t einem solchen Verhalten der Abgeordneten und überdies auch dem ganzen organisatorischen personellen Umfeld muß man wohl rechnen. Dies wäre eigentlich sogar verständlich. Die Überlastung der Parlamente und der ihr angeschlossenen Verwaltungen werden ins Feld geführt werden. Sie werden sich jedoch die Frage gefallen lassen müssen, was schwerer wiegt, erfolgreich funktionierende Gesetze oder persönliche Belastungen der für die Gesetze verantwortlichen Parlamentarier. Es ist durchaus vorstellbar, daß man bei kritischer Durchleuchtung zu dem Ergebnis kommen wird, daß die persönlichen, insbesondere die nur mittelbar-, mehr wohl außerparlamentarischen Aufwendungen an Zeit und Kraft am ehesten abgebaut werden können, ohne daß der Gesamtheit ein Schaden entstünde. Selbstverständlich sind solche mittelbar parlamentarischen Verpflichtungen der Abgeordneten sehr ernst zu nehmen; der größte Teil der zeitlichen Aufwendungen dient gewiß der Pflege des Wahlkreises, also einer durchaus politischen Aufgabe, die den Regeln der parlamentarischen Demokratie entspricht. Da aber dieser zeitliche Einschnitt quer durch alle Parteien geht, also alle Parlamentarier erfassen würde, sind die individuellen Nachteile ganz gewiß eher hinzunehmen als nicht oder nur schlecht funktionierende Gesetze. A u f der anderen Seite wird j a auch Zeit und Kraft gespart, wenn i m Hinblick auf die Ergebnisse des vorgeschlagenen Fragenkatalogs in absehbarer Zukunft die Debatten in den Parlamenten außerordentlich sachlich verlaufen werden. Die dann sich selbst verordnete Nachprüfung der Meinungen und Prognosen wird nicht nur in der inhaltlichen Materie zu besonderer Sachlichkeit zwingen, sondern auch die Form des Vortrags und der Darstellung mäßigen. Gewiß, mit einem Gesetz kann nicht schlechthin querulatorisches Verhalten zumindest aller Abgeordneten ausgemerzt werden; es wird auch da Streitpunkte geben, etwa so, daß da und dort die Erhebungen nicht sorgfältig gemacht worden seien. Aber für den in aller Regel doch zu erwartenden Fall einer klaren numerischen Differenz werden sich solche Austreibungen eher abschaffen lassen. Anders als sonst mit offenen Diskussionen, wäre ja jetzt nur noch um geschlossene Fragen zu debattieren. Das setzt Grenzen. So könnte damit sogar eine neue „Streitkultur" in den Parlamenten ihren Anfang nehmen. Das allein wäre schon ein Grund . . .
Die forschungsbegleitete Gesetzgebung
145
Literatur Achterberg, Norbert: Rechtstheoretische Grundlagen einer Kontrolle der Gesetzgebung durch die Wissenschaft, in: Rechtstheorie 1970. Adams/ Sherman: Das »Sonnenuntergangs'-Konzept als erfolgversprechendes Instrument zum Abbau des Unbehagens an der öffentlichen Verwaltung, Verwaltungswissenschaftliche Informationen, 1978. Aubert, Vilhelm: Soziale Funktion der Gesetzgebung, in: Studien und Materialien zur Rechtssoziologie, 1967. Bechtler, Thomas: Der soziologische Rechtsbegriff, Schriftenreihe zur Rechtssoziologie und Rechtstatsachenforschung, Bd. 41, 1977. Beutel, Frederick Keating: Die Experimentelle Rechtswissenschaft. Aus dem Amerikanischen (Experimental Jurisprudence) übertragen von Uwe Krüger, 1971, hrsg. von Ernst E. Hirsch und Manfred Rehbinder. Blankenburg, Erhard: Über die Unwirksamkeit von Gesetzen, in: Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie (ARSP), Bd. 63, 1977. Bohret, Carl: in: ZG (Zeitschrift für Gesetzgebung) 3 / 92. Bohret, Carl/Hugger, Werner: Der Praxistext von Gesetzesentwürfen, 1980. - Tests und Prüfung von Gesetzentwürfen. Anleitungen zur Vorabkontrolle und Verbesserung von Rechtsvorschriften, Sonderheft 5 der Schriften der Bundesakademie für öffentliche Verwaltung, 1980. - Der Beitrag von Gesetzestests zur Optimierung der Zielverwirklichung, in: Schreckenberger (Hrsg.), Gesetzgebungslehre, Stuttgart u. a. 1985. Bundesregierungs-Beschluß vom 11.12. 1984, in: GMB1. 1990, Nr. 3. Deckert, Renate: Folgenorientierung in der Rechtsanwendung, 1995. Derlin, Hans-Ulrich: Die Erfolgskontrolle staatlicher Planung. Baden-Baden 1976. Frey, Peter: Rechtsbegriff in der neuen Rechtssoziologie. Diss. Univ. d. Saarlandes, Saarbrükken 1962. Fricke, Peter: Modelle zur Institutionalisierung einer Gesetzeskontrolle, in: Europäische Hochschulschriften, Reihe 31, Bd. 40, 1983. Geiger, Theodor: Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts, 1947. Habermas, Jürgen: Erkenntnis und Interesse, 1968. Hamm, Walter: Eine vermeidbare Fehlentwicklung, in: Orientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik, 50 (12/92). Hellstern, Gerd-Michael / Wollmann, Hellmut: Wirksamere Gesetzesevaluierung. Wo könnten praktikable Kontrollverfahren und Wirkungsanalysen bei Parlamenten und Rechnungshof ansetzen?, in: Zeitschrift für Parlamentsfragen, 1980. Hesse, Konrad: Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 18. erg. Aufl., 1991. 10 Gedächtnisschrift Wenz
146
Edgar Michael Wenz
Hill, Hermann: Einführung in die Gesetzgebungslehre, 1982. Hirsch, Ernst E.: in: JZ 1965 (484). Hoffmann-Riem, 1993.
Wolfgang: Experimentelle Gesetzgebung, in: Festschrift für Werner Thieme,
Hoffmann-Riem, Wolfgang / Schmidt-Aßmann, Eberhard (Hrsg.): Innovation und Flexibilität des Verwaltungshandelns, 1994. Horn, Hans-Detlef: Experimentelle Gesetzebung unter dem Grundgesetz, 1989. Hugger, Werner: Legislative Effektivitätssteigerung: Von den Grenzen der Gesetzesevaluierbarkeit zum Gesetz auf Zeit, in: Politische Vierteljahresschrift 1979. - Gesetze - Ihre Vorbereitung, Abfassung und Prüfung, 1983. Isensee, Josef: in: Politische Meinung, H. 237. Jellinek, Georg: Allgemeine Staatslehre, 1905. Kadelbach, Stefan: Zwingendes Völkerrecht, 1993. Kantorowicz,
Hermann 1910 auf dem ersten deutschen Soziologentag.
Karpen, Ulrich: Zum gegenwärtigen Stand der Gesetzgebungslehre in der Bundesrepublik Deutschland, in: ZG 1986 /1. - Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und Rechtssprechungslehre, 1989. - Recht und Staat, 1994, Festschrift für Herbert Hellmrich. - Beiträge zur Methodik der Gesetzgebung, in: ZG 1994/1. Kindermann: Erfolgskontrolle durch Zeitgesetze, in: Heinz Schäffer/Otto Triffterer (Hrsg.), Rationalisierung der Gesetzgebung, 1984. Koch, Roland, in der Rubrik ,Fremde Federn', in: FAZ vom 12. 12. 1995. König, Klaus: Zur Evaluation der Gesetzgebung, in: Harald Kindermann, Studien zu einer Theorie der Gesetzgebung, 1982. - Zur Evaluation der Gesetzgebung, in: Gerd-Michael Hellstern / Hellmut Wollmann (Hrsg.), Experimentelle Politik - Reformstrohfeuer oder Lernstrategie, 1983. - Zur Überprüfung von Rechtssetzungsvorhaben des Bundes, in: Gesetzgebungstheorie und Rechtspolitik, Jahrbuch für Rechtssoziologie und Rechtstheorie, Bd. 13, 1988. Kondylis, Panajotis: Montesquieu und der Geist der Gesetze, 1996. Krebs, R.: Die effektive Norm unter Berücksichtigung ihres Normzieles, in: Heinz Schäffer/ Otto Triffterer (Hrsg.), Rationalisierung der Gesetzgebung, 1984. Langner: Zero Base Budgeting und Sunset Legislation, 1983. Llewellyn, 1977.
Karl N.: Recht, Rechtsleben und Gesellschaft, hrsg. von Manfred Rehbinder,
Losano, Mario G.: Vom Parteiprogramm zum Gesetz: Probleme der Wirksamkeit, in: Kindermann, Harald (Hrsg.), Studien zu einer Theorie der Gesetzgebung, 1982. Luhmann, Niklas: Wahrheit und Ideologie (Der Staat), 1962.
Die forschungsbegleitete Gesetzgebung
147
Mader, Luzius: Experimentelle Gesetzgebung, in: Gesetzgebungstheorie und Rechtspolitik. Jahrbuch für Rechtssoziologie und Rechtstheorie, Bd. 13, 1988. Maihofer, Werner: Die gesellschaftliche Funktion des Rechts, in: Die Funktion des Rechts in der modernen Gesellschaft, Jahrbuch für Rechtssoziologie und Rechtstheorie, Bd. 1, 1970. - Gesetzgebungswissenschaft, in: Günter Winkler/Bernd Schilcher (Hrsg.), Gesetzgebung, 1981. Mayntz, Renate (Hrsg.): Implementation politischer Programme, zwei Sammelbände 1980 — 1983. Montesquieu, Charles de: Vom Geist der Gesetze, 1748, II. Buch. Noll, Peter: Gesetzgebungslehre, 1973. - Die Berücksichtigung der Effektivität der Gesetze bei ihrer Schaffung, in: Theo Öhlinger (Hrsg.), Methodik der Gesetzgebung, 1982. Nußbaum, Arthur: Die Rechtstatsachenforschung, ausgew. von Manfred Rehbinder, 1968. Öhlinger, Theo: Planung der Gesetzgebung und Wissenschaft. Einführung in das Tagungsthema, in: ders., Methodik der Gesetzgebung, 1982. Opp, Karl-Dieter: Soziologie im Recht, 1973. Popper, Carl R., Logik der Forschung, 1976. Pound, Roscoe: Sociology of Law, 1945. Raiser, Thomas: Einführung in die Rechtssoziologie, 1982. - Das lebende Recht, 1995. Rehbinder, Manfred: Rechtssoziologie, 3. Aufl. 1993. Rethorn, Dietrich: ,Sunset'-Gesetzgebung in den Vereinigten Staaten von Amerika, in: Harald Kindermann (Hrsg.), Studien zu einer Theorie der Gesetzgebung, 1982. Röhl, Klaus F.: Rechtssoziologie, 1987. Rottleuthner, Hubert: Aspekte der Rechtsentwicklung in Deutschland, in: ZfRSoz 1985. Ryffel, Hans: Bedingende Faktoren der Effektivität des Rechts, in: Manfred Rehbinder und Helmut Schelsky, Zur Effektivität des Rechts (Jahrbuch für Rechtssoziologie und Rechtstheorie, Bd. 3, 1972). Schäffer, 1988.
Heinz: Rationalisierung der Rechtssetzung, in: Schäffer, Theorie der Rechtssetzung,
Schmidt-Jortzig,
Helmut: Wir brauchen Gesetze auf Probe, in: Focus vom 6. 1. 1997.
Schneider, Hans: Gesetzgebung, 2. Aufl., 1991. Schröder, Heinrich J.: Zur Erfolgskontrolle der Gesetzgebung, in: Manfred Rehbinder und Helmut Schelsky, Zur Effektivität des Rechts (Jahrbuch für Rechtssoziologie und Rechtstheorie, Bd. 3, 1972). Schulze-Fielitz, Helmut: Zeitoffene Gesetzgebung, in: Wolfgang Hoffmann-Riem / Eberhard Schmidt-Aßmann, Innovation und Flexibilität des Verwaltungshandelns, 1984. 10*
148
Edgar Michael Wenz
Strempel, Dieter: Der Beitrag der empirischen Rechtsforschung zu einem realistischen Umgang mit dem Recht, in: Schäffer, Heinz (Hrsg.), Gesetzgebung und Rechtskultur, 1987. Voigt, Rüdiger (Hrsg.): Verrechtlichung in Staat und Gesellschaft, in: Verrechtlichung, 1980. Wagner, Joachim: Schafft Gesetze auf Zeit!, in: Die Zeit, vom 1. 2. 1980. Weber, Max: Wirtschaft und Gesellschaft, hrsg. v. J. Winkelmann, 5. Aufl., Nachdruck 1985. Weiss, Carol: Originalausgabe: Evaluation reserch methodes for assessin program effectifenes, 1972; deutsche Übersetzung: Evaluierungsforschung. Methoden zur Einschätzung von sozialen Reformprogrammen, 1974. Wenz, Edgar Michael (Hrsg.): Wissenschaftsgerichtshöfe - Mittler zwischen Wissenschaft, Politik und Gesellschaft, 1983. - Die Reaktionstheorie - rechtstheoretische Voraussetzungen für die Rechtsforschung, in: Zeitschrift für Rechtssoziologie 15 (1994). - Von der Rechtsforschung zur Gesetzgebung, in: Tagungsband zu Theodor Geiger. Soziologe in einer Zeit zwischen Pathos und Nüchternheit, hrsg. v. Siegfried Bachmann, 1995. Wollmann, Hellmut: Gesetzgebung als experimentelle Politik - Möglichkeiten, Varianten und Grenzen erfahrungswissenschaftlich fundierter Gesetzgebungsarbeit, in: Schreckenberg, Gesetzgebungslehre, 1986. Zeh, Wolfgang: Vollzugskontrolle und Wirkungsbeobachtung als Teilfunktion der Gesetzgebung, in: Gesetzgebungstheorie und Rechtspolitik, Jahrbuch für Rechtssoziologie und Rechtstheorie, Bd. 13, 1988.
4. Wissenschaftspolitik
Können Wissenschaftsgerichtshöfe dazu beitragen, Akzeptanzkrisen der Großtechnologie zu lösen?* In allen Bezügen und Beziehungen, die bei so sehr unterschiedlichen Phaenomena wie »Energie und Gerechtigkeit 4 sich herstellen und sich vorstellen lassen, ist die Rechtswissenschaft gefordert. Sie muß bei ihrem Bemühen an die Erkenntnis anknüpfen, daß sie ihre Antworten nur aus dem eigenen Fundus und aus den eigenen Quellen zu schöpfen hat. Die Rechtswissenschaft muß Vorsicht obwalten lassen, bei interdisziplinärer Aufarbeitung nicht den bequem scheinenden Verlockungen des Synkretizismus zu erliegen, die häufig nichts anderes sind als ,Methodenklau'. Alle Wissenschaften haben ihre eigenen Strukturen; nur deren Funktionen, die abzulesen sind aus den mit den eigenen Denkmethoden erarbeiteten Resultaten, lassen sich verwerten. Das Thema läßt auch einen Konflikt von kaum abzusehender Tragweite erkennen: Die soziale Akzeptanzkrise gegenüber der Technologie. Sie hat einen qualitativen Umschlag in eine Vertrauenskrise in das Recht erfahren. Niemand behauptet, daß originär eine Rechtskrise die Akzeptanzkrise der Technologie - womit i m besonderen Maße die Verfahrenstechniken zur Beschaffung von Energie gemeint sind - herbeigeführt haben könnte. Aber angesichts der Bedeutung von Recht und Gesetz - mit der Forderung der Verwirklichung des Rechtsideals der Gerechtigkeit - als weitaus bedeutendste soziale Ordnungsfaktoren äußern sich zwangsläufig soziale Akzeptanzkrisen als Fragen an die Gerechtigkeit; so können sie zu Vertrauenskrisen in das Recht führen. Wenn die Gesellschaft aber weiter existieren will, wozu sie das Staatswesen und eben Recht und Gesetz braucht, muß nach Mitteln und Wegen Umschau gehalten werden, die zur Auflösung oder doch zumindest zur Aufweichung dieser Krise geeignet sein können. Die Aufmerksamkeit der Rechtswissenschaft hat dabei ihrem eigenen Fach zu gelten; sie hat sich dabei ihrer Methoden zu bedienen. Die Rechtswissenschaft wird gefordert in ihrem jurisprudentiellen Zweig der Rechtsanwendung, also Verwaltung und Rechtsprechung. Jurisprudenz und Rechtsanwendung, Entscheidungs-, Wertungs- und Handlungslehre und -kunst sehen sich vor das Problem gestellt, einerseits einem unentrinnbaren Entscheidungszwang zu unterliegen, andererseits aber eingeengt zu sein durch Theorien und Prämissen, die sie von anderen Wissenschaften und Lehren - beispielsweise
* Erstveröffentlichung in: Edgar Michael Wenz (Hrsg.), Wissenschaftsgerichtshöfe. Mittler zwischen Wissenschaft, Politik und Gesellschaft. Frankfurt, New York, 1983, S. 73 ff.
152
Edgar Michael Wenz
Naturwissenschaften und Technik - angeliefert erhalten, denen sie gewissermaßen ausgeliefert sind. Die Rechtswissenschaft ist an Normen gebunden, findet aber nur Generalklauseln und unbestimmte Rechtsbegriffe, die sie konkretisieren muß. Sie ist gezwungen, eine Arbeit zu tun, die ihr der Gesetzgeber, aus welchen Gründen auch immer, überlassen hat. *
Nach unserer Meinung brauchen Rechtswissenschaft und Jurisprudenz keineswegs sich nur nach Hilfen umzusehen bei der Philosophie oder bei den Naturwissenschaften. Die Rechtswissenschaft muß sich Erkenntnisziele setzen, die sie auf eigenen Feldern finden kann. Die erste Frage ist zu stellen an die Rechtsphilosophie: Ist - angesichts der Vielfalt von Handlungsalternativen in unserer Industriegesellschaft - Rechtssicherheit, die sich darstellt als Rechtsgewißheit und als Rechtsvertrauen, nicht eine der wichtigsten Voraussetzungen, Gerechtigkeit zu verwirklichen? Läßt sich Rechtssicherheit anders herstellen als durch positive Normen? Ist aber damit nicht auch wieder das Tor aufgestoßen zum Rechtspositivismus, der gerade überwunden schien - um der Gerechtigkeit willen? Oder kann nur i m rationalistischen Rechtspositivismus die Idee des liberalen Rechtsstaates verwirklicht werden, eben des Rechtsstaates, ohne den ein Grundrechtsschutz nicht denkbar ist - die Erfüllung und Verteidigung von Grundrechten, die sich gerade i m Industriezeitalter Gefahren und Angriffen ausgesetzt sehen? Aus diesen Fragestellungen läßt sich die erste These ableiten: Die Rechtsphilosophie ist aufgefordert, Reflexionen erneut anzustellen zu der Fähigkeit des Rechtspositivismus, die Idealität des Rechts herbeizuführen. *
Rechtstheorie und Rechtsdogmatik sind befragt, wenn es um das Verhältnis von Sollens-Sätzen zu Seins-Sätzen geht, um die Einbindung der Erkenntnisse aus den Tatsachen- und Wirklichkeitswissenschaften in die Rechtswissenschaft und Rechtspraxis. Es gibt eine Reihe von Lehren, die sich mit dem scheinbar unüberwindlichen Gegensatz von Sollen und Sein befassen, vom Neu-Kantianismus, über NeuHegelianismus, die Phaenomenologie und die ontologischen Strömungen bis zur Erkenntnis der „normativen Kraft des Faktischen" (Georg Jellinek) und der „Normativität des Seins" (Hegel). Aber die Generalklauseln der Industriegesellschaft allgemein anerkannte Regeln der Technik, Stand der Technik, Stand von Wissenschaft und Technik (Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis), wirtschaftliche Vertretbarkeit - , die vielen unbestimmten Rechtsbegriffe, die nach den Erkenntnissen des realen Seins konkretisiert werden müssen, schließlich die anerkannten technischen Regelwerke ohne Rechtsnormcharakter - all' dies zwingt wegen ihrer Tragweite und des immensen Bedürfnisses nach Rechtssicherheit zu einer theoretischen und dogmatischen Aufarbeitung dieses Komplexes. Es geht hierbei vordergründig um die Verweisungstechniken, i m Kern aber um ein eigenes Verständnis der
Wissenschaftsgerichtshöfe und Akzeptanzkrisen der Großtechnologie
153
Rechtswissenschaft gegenüber Seins-Sätzen aus den Wirklichkeits- und Tatsachenwissenschaften. Die zweite These müßte von Rechtsdogmatik und Rechtssoziologie fordern, Erkenntnisse voranzubringen, außerrechtliche Normen, ohne Gefährdung rechtsstaatlicher Grundsätze, wirksam und gültig in das Rechts system einzubinden. Die dritte Frage ist gerichtet auf das Verhältnis der Rechtswissenschaft zu ihrer Tochter Rechtssoziologie. Man wird erkennen müssen, daß ein schlechtes Verhältnis noch besser wäre als gar kein Verhältnis. Die Ablehnung der Rechtssoziologie ließe sich freilich erklären durch die jüngere Geschichte dieses Wissenschaftszweiges. Die auffallende Beschäftigung mit der Richter- und Justizsoziologie provozierte eine Art ,Berührungsangst 4 der Juristen, die freilich häufig die Frage D i stanz oder Ignoranz'? aufkommen ließ. Darüber wurde nicht selten vergessen, daß die Rechtssoziologie die Wirklichkeitswissenschaft vom Recht ist, deren Erkenntnisinteressen angesiedelt sind i m Schnittpunkt von Sollen und Sein. Das Problem des Richters sind j a nicht die Konklusionen, sondern die richtigen Prämissen; diese aber wiederum stammen aus den empirischen Wissenschaften. Dennoch wäre ein Zurückdrängen der Rechtssoziologie auf die Rechtstatsachenforschung und auf die Mithilfe bei der Konkretisierung der Norm ein Verzicht auf die Chancen, die jede Wissenschaft zu eröffnen weiß, die sich nicht mit der Faktizität befaßt. So könnte sie auch der Rechtspolitik als Hilfswissenschaft der Gesetzgebungslehre („sociology into law") zudienen. Das Feld reicht so weit, wie Gesellschaft und Recht sich berühren. *
So könnte die dritte These also lauten, daß die Rechtswissenschaft das Verhältnis zu ihrer Tochter Rechtssoziologie aus einer Überfülle von Gründen überprüfen und neu ordnen muß. In diesem Zusammenhang lassen sich Angebote der Rechtssoziologie prüfen, so das Potential des Verfahrens, das Legitimation verschafft (Niklas Luhmann: „Legitimation durch Verfahren"), Verfahren ist hier freilich nicht zu verstehen als prozeßrechtlicher Ablauf, der durch (sekundäre) Normen geregelt ist - auch wenn deren Bedeutung, bis hin zum Grundrechtsschutz, nicht verkannt wird. Eine Vielzahl von Mißverständnissen in der Literatur müssen ausgeräumt werden, der Vorwurf des Wertnihilismus oder eines öden Gesetzespositivismus beispielsweise, obwohl wir es bei dieser Theorie mit nichts anderem zu tun haben als mit einer soziologischen Deskription und Analyse der Funktionen, die das Verfahren zu leisten vermag. Die psychologische und soziale Wirkung durch Verstrickung, Darstellung, Übernahme einer Rolle, Einleitung des Lernprozesses, Absorption von Enttäuschung, Isolierung des Protestierenden bewirken die Legitimierung durch Re-Integrierung des Gesetzesverletzers, gewissermaßen qua Einsicht. Freilich haben sich diese Überlegungen nur mit dem Individualverfahren bislang befaßt, während die Untersuchungen zum Massen verfahren noch fehlen.
154
Edgar Michael Wenz
Die vierte These also: Die Rechtswissenschaft, insbesondere die hierfür kompetente Rechtssoziologie, muß die legitimierenden Wirkungen des Verfahrens zu nützen versuchen, auch und gerade des Massen Verfahrens. Diese Erkenntnis der legitimierenden - oder doch wenigstens legitimationserhöhenden - Wirkung des Verfahrens leitet über zur fünften, i m Themenausschnitt augenblicklich am meisten interessierenden Fragestellung: Wenn das Verfahren legitimierende Funktionen hat, was kann durch Institutionalisierung eines besonderen Verfahrens erreicht werden? Wäre die Institutionalisierung eines besonderen Verfahrens, das sich in der Einrichtung eines Wissenschaftsgerichtshofes (Science Court) verkörpert, nicht ein besonders geeigneter Weg, Akzeptanzkrisen des Rechts zu lösen oder doch wenigstens aufzuweichen? Eine Bejahung müßte dann auch gelten für Fragen der Großtechnologie, i m besonderen Maße der Energiebeschaffung, vornehmlich durch Kernkraftwerke. Diese Probleme stehen ja heute gewissermaßen stellvertretend für alle Probleme des Industriezeitalters, für Gift, Gen und eben Kernkraft. Der Begriff des Wissenschaftsgerichtshofes impliziert freilich Vorstellungen, daß das Gericht über ,richtig oder falsch' in Fragen von Wissenschaft und Technik entscheiden sollte - eine Horrorvorstellung für jeden, dem die stete Offenheit der Wissenschaften ein unverzichtbares unantastbares Essentiale allein schon für den Begriff der Wissenschaften ist. Gerade Naturwissenschaftler wissen, daß sie noch nicht mehr haben leisten können, als an der Oberfläche des Kosmos herumzukratzen und sich die Beute unter dem Fingernagel anzugucken. Naturwissenschaftler liefern sich gewissermaßen jeden Tag die Beweise der Vorläufigkeit und Begrenztheit allen menschlichen Wissens. M i t dem kritischen Rationalismus Carl Poppers und allen Lehren, die sich nur in der Nähe aufhalten, stünden solche Vorstellungen i m härtesten und nie versöhnbaren Widerspruch. Vermutlich war dieser Begriff des Wissenschaftsgerichtshofes und Science Courts, der aus dem angelsächsischen Rechtskreis übernommen wurde, ursächlich dafür, daß diese Ideen - die Mißverständnisse eines wissenschaftlichen Kardinalkollegiums oder Heiligen Offizismus offenbar haben auslösen können - bislang nicht ernsthaft weiterverfolgt wurden. Dies sollte geschehen, das ist die fünfte These. *
Unsere Vorstellungen des Wissenschaftsgerichtshofes beschränken sich auf eine Technologiefachkammer i m Rahmen der ordentlichen Verwaltungsgerichtsbarkeit. Sie soll paritätisch mit Berufsrichtern und juristischen Laien besetzt sein, die aber qualifizierte Sach- und Fachkunde einbringen müssen, also als ,Experten' anerkannt sind. Es würde hier zu weit führen, auf die verfahrensrechtlichen und rechtstechnischen Einzelheiten einzugehen (siehe dazu: Wenz [Hrsg.], Die Akzeptanzkrise als Legitimationskrise. Auflösen der Krise durch neue Institutionen? Können ,Wissenschaftsgerichtshöfe' weiterhelfen? M i t Beiträgen von Dierkes, Kewenig und Roellecke. In Vorbereitung).
Wissenschaftsgerichtshöfe und Akzeptanzkrisen der Großtechnologie
155
Hier soll nun untersucht werden die sozialpsychologische Wirkung der Entscheidungen einer solchen Technologiefachkammer auf die Rechtsunterworfenen und Betroffenen. Die bisherigen Verfahren haben gewiß zu Entscheidungen geführt; diese wurden auch durchgesetzt. Man muß aber nicht lange nach Belegen suchen, um zur Feststellung zu kommen, daß doch bei einem bemerkenswerten Teil der Bevölkerung Unbehagen zurückgeblieben ist. Wir sprechen nur von Unbehagen, weil teilweise chaotische Ausschreitungen nicht generalisiert werden dürfen, nicht einmal andeutungsweise. Nichtsdestoweniger wachsen aber solche Exzesse nicht i m luftleeren Raum, sie sind nur die sichtbare Spitze; unter ihnen ist ein unsichtbarer Unterbau zumindest des Unbehagens und der Zweifel. Die Entscheidungen wurden von einem meines Erachtens nicht vernachlässigbaren Teil der Bevölkerung nicht akzeptiert'. So liegen Wechselwirkungen vor - auch zur fehlenden Akzeptanz der betroffenen Technologie. Das eine bedingt das andere. Und kein Ende ist in Sicht, solange dieser Kreislauf nicht durchbrochen wird. Wenn nun von einer Technologiefachkammer, einem ,Expertengericht', eine mehr stabilisierende und Rechtsüberzeugung schaffende Funktion erwartet wird, so setzt das natürlich voraus, daß ein Grundkonsens überhaupt vorliegt; wo dieser fehlt oder auch nur fühlbar angeschlagen ist, wird man keine vertrauensbildende Wirkung des Gerichts erwarten dürfen. Aber in Richtung jener, die den Grundkonsens verneinen, zielen die Bemühungen nicht. Sie sind nicht die Adressaten. Wo Systemvertrauen und aus ihm wachsende generalisierte Bereitschaft der Entscheidungshinnahme fehlen, dort können auch nicht einzelne Funktionen des Systems Überzeugungen schaffen, auch nicht die dritte Gewalt, auch nicht Fachgerichte, auch nicht die sie bildenden Richter. Die Erwartungen an die Technologiefachkammer sind auch nicht darauf gerichtet, daß dieses Expertengericht ,besseres' Recht und ,mehr' Wahrheit erkennen kann als etwa das »normale' Verwaltungsgericht. Das erwarten wir gar nicht. Dies ist kein Zynismus, sondern demütige Einsicht in die Begrenztheit menschlichen Wissens. Es geht nicht um ein geordnetes Verfahren, wie sich die Organe der Rechtsanwendung (Verwaltung und Rechtssprechung) sachkundig machen können; wie die Beschaffung von Sachkunde anders und besser zu organisieren und zu institutionalisieren sei. Es geht nicht um die Evaluierung des Urteils. Es geht vielmehr um die Ausschöpfung des Potentials der richterlichen Autorität; um die vertrauensbildende Kraft der dritten Gewalt; um die durch Sachkunde gestützte und aus ihr wachsende Glaubwürdigkeit der Entscheidung. Diese wichtigen Wirkungen glauben wir erreichen zu können durch die erkennbare S ach- und Fachkunde des Gerichtes, des Expertengerichtes, von dem eben »Wahrheit' des Spruchs, seiner Sach- und Fachkunde willen, erwartet wird. Richtigkeit und Wahrheit sind, zumindest ,Kommunikationsmedien' (Luhmann), die die Hinnahme der Entscheidung erleichtern. Wenn Grundkonsensus und allgemeines Systemvertrauen gegeben sind, wird dieses auch durch einen Spruch des Expertengerichtes, der mißliebig ist, nicht erschüttert und ausgehöhlt werden können.
156
Edgar Michael Wenz
U m aber Vertrauen zu gewinnen, müssen die Experten heraus aus ihrer Gutachterrolle. Das heißt freilich nicht, daß i m Verfahren vor der Technologiefachkammer es künftig keine Sachverständigen und Gutachter mehr geben würde. Der Sachverstand bleibt vor dem Gericht; er kommt allerdings auch auf die Richterbank und in das Beratungszimmer. Vorbehalte gegen Sachverständige sind i m Volk weit verbreitet („Götter in Weiß"); sie sind auch nicht unbegründet, jedenfalls sind sie nicht so leicht ausräumbar. Hier wird der Mangel an irdischer Verantwortlichkeit gesehen. Sachverständige berufen sich bei erkennbaren Fehl-Urteilen sofort auf ihre fehlende Entscheidungskompetenz - nicht anders als Staatsanwälte, die in solchen Fällen ja auch ,nur beantragt' haben. Die höchste Stufe der Verantworlichkeit, auch und gerade des Naturwissenschaftlers und Technikers, wird i m Rechtsspruch gefunden. Das ist der Weg und die Erhöhung vom Expertengeplauder („Ich würde meinen . . . " ) zum verantwortlichen Spruch des Expertenrichters („Ich erkenne für Recht..."). Die Probleme der Besetzung eines solchen gemischten Gerichtes sind recht wohl vorstellbar: Möglicherweise ein Gerangele um Richterpositionen, die eine Verlegung der Entscheidung in das Vorfeld der Berufung befürchten lasen; wahrscheinlich auch fehlende Bereitschaft von Kapazitäten, sich als Expertenrichter berufen zu lassen; dadurch könnte das Gericht diskreditiert und die erhoffte sozialpsychologische Wirkung vernichtet werden. Andererseits sind günstige Erfahrungen mit Laienrichtern gemacht worden; die Laiengerichtsbarkeit gilt sogar als unbestritten gut, wenn durch die Laienrichter S ach- und Fachkunde in das Gericht eingebracht wird, dargestellt häufig am Beispiel der Kammer für Handelssachen. Der technische Richter ist aus dem Bundespatentgericht gar nicht mehr wegzudenken; hier werden aber nur die Interessen Einzelner oder kleinerer Gruppen tangiert. Bei der Technologiefachkammer aber stehen Entscheidungen mit möglicherweise epochalen Wirkungen an. Es ist nun schwer zu sehen, was zur Bejahung des technischen Richters führt, gleichzeitig aber nur Zögern beim Expertenrichter auslöst. Bei allen diesen Überlegungen müssen auch die insgesamt positiven Erfahrungen mit dem Laienrichtertum, insbesondere in den Fachgerichten, eingebracht werden. Wir sagten es schon: Nicht die Evaluierung des Urteils ist das eigentliche Ziel; es geht vielmehr um die vertrauensbildenden Chancen des Richterspruchs, um die Glaubwürdigkeit der Entscheidung. Man mag sich der Anfänge des Laienrichtertums entsinnen, das gegen Kabinettsjustiz und den Moloch Staat gerichtet war. Das Unbehagen von heute hat einen anderen Verursacher: den Moloch Wissenschaft und Technik. Die partizipatorische Funktion des Laienrichtertums, die überholt schien, könnte wieder tragen. Die Technologiefachkammer als eine sehr spezifische Art des Wissenschaftsgerichtshofes wird sicherlich kein Wundermittel sein. Wir erwarten von ihr nur klitzekleine Schritte zur Aufweichung der Akzeptanzkrise gegenüber der Großtechnologie - so auch der technischen Methoden zur Beschaffung von Energie - , die sich zu einer Vertrauenskrise in das Recht zu entwickeln drohen.
Wissenschaftsgerichtshöfe und Akzeptanzkrisen der Großtechnologie
157
Niemand würde ernsthaft bestreiten, daß die Industriegesellschaft ihre besonderen Probleme hat, mit besonderen Gefährdungen fertig werden muß. Diese besonderen Probleme und Gefährdungen aber erfordern auch besondere Wege, sich mit ihnen auseinanderzusetzen, sie in einem erträglichen Maße zu beherrschen: Besondere Gefährdungen - besondere Maßnahmen. Man muß neue Wege gehen, man muß sie wenigstens suchen. Es darf keine Mühe zuviel sein, das drohende Auseinanderklaffen von Recht und Sittlichkeit aufzuhalten, die gestörte Harmonie wieder herzustellen. Daß das Ziel nicht gänzlich erreicht werden kann, hindert nicht daran, jedenfalls Teilstrecken zurücklegen zu müssen. Daß es Ziele, vielleicht sogar wirksamere Möglichkeiten außerhalb des Rechtswesens und ohne justizielle Institutionalisierung gibt, befreit Rechtspolitik und Rechtswesen, insbesondere den zur Aufrechterhaltung der staatlichen Ordnung berufenen Rechtsstab, nicht, auch seinen Teil beizutragen. Und daß der Weg der Vertrauensbildung über Expertengerichte möglicherweise nicht oder nur mit Irrungen und Wirrungen zum Ziel führen könnte, ist am wenigsten ein Grund, es nicht zumindest einmal damit zu probieren. Ein Trampelpfad ist dem Verirrten und Irrenden Wegweisung, wo er keine Straßen findet.
Der „Science Court" - und er nützt doch!* Die Kontroverse und Diskussion über den „Science Court" droht - an nichts anderem als an Mißverständnissen - zu versanden, somit eine konkrete Möglichkeit verlorenzugehen, sich ein Stück fortzubewegen, in irgendeine Richtung, möglicherweise also auch in die „richtige". Meinolf Dierkes und Volker von Thienen 1 beschreiben Zustand und Gefahren einer sich zusehends verstärkenden „Akzeptanzkrise". Wo die Hintergründe dafür wissenschaftlich-technologisch sind - und andere, etwa „ideologische", müßten auch auf anderer Ebene ausgetragen werden - , bieten sie als Ausweg verschiedene Lösungen an. Obgleich als „Mittler zwischen Wissenschaft, Politik und Gesellschaft" bezeichnet, taucht offenbar mit dem Begriff „Science Court" die Horrorvision einer Art wissenschaftlich-technologischen Kardinalskollegium auf, das in eschatologischen Fragen richtet, mit Anspruch und Wirkung eines Dogmas. Eine solche Vorstellung ist freilich für jeden Wissenschaftler - klassische Marxisten ausgenommen - nicht nur unakzeptabel, sie ist geradezu unerträglich, zumal Naturwissenschaftlern, die sich i m klaren sind, gerade an der Oberfläche des Kosmos herumzukratzen und jeweils dabei sind, die Beute unter dem Fingernagel zu inspizieren. Dierkes und von Thienen wollten gewiß nicht soweit gehen. Generell und tendenziell sind die Postulate freilich weit und hoch gestellt. Aber gerade die Einbeziehung der traditionellen Gerichtsbarkeit als eine sehr pragmatische Möglichkeit (Modell III) läßt erkennen, daß die ausschließlich juristiktorische Wirkung erwogen und hingenommen war. Die Tabelle zeigt selbst dem eiligen Betrachter, daß vorrangig die „Technologiekammer" angestrebt wird. Was auch hätte sonst der Begriff „Gerichtshof 4 angesichts der unverzichtbaren Gewaltenteilung bei Legislative und Exekutive zu suchen? (Man kann sich folglich dieser spezifischen Frage Sinn und Zweckmäßigkeit einer Fachkammer - zuwenden, ohne nun zu untersuchen, ob die beiden anderen Modelle nur der Vollständigkeit wegen und zur Abrundung aufgeführt wurden, oder bei dieser Gelegenheit auch eine Diskussion über Verbesserung der gesetzgeberischen Methodik, etwa i m parlamentarischen Vorfeld, und der verwaltungsrechtlichen Praxis angeregt werden sollte.)
* Veröffentlicht in: Edgar Michael Wenz (Hrsg.), Wissenschaftsgerichtshöfe. Mittler zwischen Wissenschaft, Politik und Gesellschaft, Frankfurt, New York, 1983, S. 65 ff. 1 Meinolf Dierkes und Volker von Thienen, Science Court - ein Ausweg aus der Krise?, in: Wirtschaft und Wissenschaft, Essen, Heft 4/1977 (Stifterverband der Deutschen Wirtschaft).
Der „Science Court" - und er nützt doch!
159
Das Mißverständnis läßt sich relativ schnell aufdecken, wenn man sich die „Akzeptanzkrise", den meist verwendeten Ausdruck auch in den Repliken von Reimar Lüst 2 , Gerd Roellecke 3 und Wilhelm A. Kewenig 4 näher ansieht. Heftigkeit, Häufigkeit und Bedeutung der Auseinandersetzungen machen den Begriff der „Akzeptanzkrise" zulässig, können aber nicht verdecken, daß es um Abwesenheit von Konsens geht, um Konflikte, schlicht und einfach also um einen Streit. I m Kern ist es also nichts anderes als die Auseinandersetzungen um den berühmten „verrückt gewordenen" Grenzstein, auch wenn sich darüber Familien über Generationen entzweien, das Dorf sich in Gruppen spaltet und selbst die politischen Wirkungen weit über die Wahl des Bürgermeisters hinausreichen. Streit kann nun ausgetragen werden i m disziplinierten wissenschaftlichen Disput, aber auch mit meuchlerischen Molotowcocktails. Jeder Streit hat zwei Ursachen. Und jeder Streit zeigt seine Wirkungen. Das aber ist abstrakt und pragmatisch zweierlei. So fließt dann schon das erste Mißverständnis ein: die ideale Lösung des Konfliktes wäre freilich, die Ursachen zu beseitigen und Konsens herbeizuführen. Die minimale praktische Forderung aber ist, die konkreten Wirkungen real zu dämpfen. Daraus folgert die Frage nach der eigentlichen Aufgabe einer jeden Gerichtsbarkeit. Man darf Übereinstimmung annehmen, daß sie nur in der Eindämmung, möglichst Beseitigung der Folgen und Wirkungen des Streites gesehen werden kann. Legt man diesen Maßstab auch dem Wissenschaftsgerichtshof - wohlgemerkt: Gerichtshof - an, so wird man seine Legitimation nicht in der Anmaßung suchen müssen, die wissenschaftliche Wahrheit zu suchen, zu finden und zu sanktionieren. Es ist eigentlich nicht zu erkennen, warum die Verneiner des Science Court durch die dritte Gewalt zwingend das Prinzip der unverzichtbaren Offenheit jeder Wissenschaft (was zweifellos unstreitig ist, aber auch nicht bestritten war) bedrängt sehen. Sie schienen den Sinn des Wissenschaftsgerichtshofes i m Auffinden und Beseitigen der Ursache - Aufsuchen und Verkünden der Wahrheit - zu suchen und fanden ihn prompt nicht. Für den Rechtsphilosophen Roellecke hat das einigermaßen überrascht. In Abschnitt 3 (Legitimationswirkung von Gerichtsentscheidungen) hat er „die Unterschiede zwischen wissenschaftlicher und juristischer Legitimation" klar herausgearbeitet. Gerne folgt man ihm. Nur das Resultat überrascht: „Überflüssig oder schädlich". Begründung: „Mehr als Frieden zu stiften kann ein Gericht aber nicht leisten". 2 Reimar Lüst, Vortrag vor dem Wissenschaftszentrum in Bad Godesberg am 9. 3. 1978 (Manuskript, S. 28 f.). 3 Gerd Roellecke, Wissenschaft im Kreuzverhör?, a. a. O., Heft 2/1978. 4 Wilhelm A. Kewenig, Alternativen zur Überwindung der Akzeptanzkrise, a. a. O., Heft 3/1978.
160
Edgar Michael Wenz
Roellecke und Kewenig sahen sehr schnell den Weg zur Spezialkammer (Technologiekammer), aber das Ziel des „Rechtsfriedens" scheint ihnen doch nicht hoch und hehr genug zu sein, um es konsequent weiterzuverfolgen. Man wird aber gewiß Übereinstimmung in der Auffassung herbeiführen können, daß es möglicherweise gleichrangige Sinngebungen der Gerichtsbarkeit und der Rechtsprechung geben mag, aber ganz sicher keine höhere als gerade die Friedensstiftung. Jeder „Court" hat sie zum Ziel. Er vermag freilich nicht die Ursachen eines Konfliktes zu beseitigen, aber seine - schädlichen - Folgen zumindest einzudämmen, vielleicht ganz aufzuheben. Schon allein Rechtsunsicherheit ist ein Schaden; der Spruch eines Gerichtes heilt ihn. Man kann Roellecke und Kewenig beipflichten, daß Wahrheit, Wissenschaft und Akzeptanzkrise sich auf der einer (wenn man will: höheren) Ebene abspielen, während die Rechtsprechung sich auf einer anderen bewegen muß. Aber darin liegt kein Widerspruch, weil sich die beiden Dimensionen gar nicht kreuzen; beide Linien laufen parallel nebeneinander. ( M i t diesem B i l d soll nicht gesagt werden, daß die Rechtsprechung keine objektive Wahrheit anstrebe; es soll lediglich die beiden verschiedenen funktionalen Ebenen, auf die die Verneiner zutreffend hinweisen, verdeutlichen.) Wäre dem Science Court die Rolle zugewiesen, die Ursache des wissenschaftlichen Streites - gleichzusetzen also mit dem Zwang zum Auffinden der objektiven Wahrheit - aufzuspüren und zu beseitigen, dann freilich wären alle dagegen vorgebrachten Bedenken mehr als nur berechtigt. Sieht man aber den Science Court wie jeden Gerichtshof lediglich als Organ der Rechtspflege - somit einen konkreten Tatbestand, den das Gericht nach seinen Methoden isoliert hat, nach dem derzeitigen Stand der Wissenschaft nach bestem Wissen und Gewissen zu entscheiden - , so ist ihm auch der Sinn zugewachsen, wie er einem jeden Gericht zugewiesen ist - einen konkreten Streit zu beenden, zumindest formal den Rechtsfrieden herzustellen und Rechtssicherheit insoweit einkehren zu lassen, daß jeder Beteiligte sein Verhalten danach einrichten kann. Und das ist freilich nicht alles, wenig genug, doch auch wiederum so viel, daß es aller Anstrengungen wert sein müßte - auch und gerade in Fragen möglicherweise epochaler Bedeutung. I m Kern reduzierte sich die Diskussion eigentlich nur zwischen diesen beiden Alternativen, weil der „Entscheidungszwang", auch unter Zeitdruck, nicht nur typisch für die Gerichtsbarkeit ist, sondern in der realen Welt die Politik ebenso wenig verschont lassen wie die Wissenschaft, nämlich: - Beibehaltung der bisherigen Verfahrensweisen vor den Verwaltungsgerichten; das bedeutet Zuständigkeit nach geographischen und alphabetischen Zufälligkeiten, geregelte Einflußnahme der Wissenschaft durch Sachverständige, die ihr Gutachten nach bestem Wissen und Gewissen erstellen. Oder
Der „Science Court" - und er nützt doch!
161
- Institutionalisierung einer Technologiekammer, an der Fachwissenschaftler, anteilig oder überwiegend, als verantwortliche Richter ein Urteil in einer konkreten Streitsache zu fällen haben. Die Frage konzentriert sich darauf. Bewußt kann also außer Betracht gelassen werden, wie „gut und klar" Gesetze sein müssen (oder es gerade nicht sein sollen, um wissenschaftlichen Ermessungsspielraum zu verschaffen), wie sie zustande gekommen sind und welche Rolle dabei die Wissenschaft gespielt hat (oder eben nicht), wie anerkannt oder streitig die wissenschaftlichen Methoden waren, alle jene Erwägungen, die dem Auffinden der wissenschaftlichen Wahrheit dienen und die man ohnehin, zumal in den Naturwissenschaften, erst dann kennt, wenn man sie bewiesen hat. (Und solche Beweise kann man wohl am ehesten während eines „Friedens" antreten, und sei es auch nur ein formal sanktionierter Waffenstillstand.) Die Möglichkeit der Einrichtung einer Spezialkammer für technologische Streitsachen wurden auch von Roellecke und Kewenig noch als am ehesten praktikabel in Erwägung gezogen. Den angezogenen Beispielen (Kammer für Handelssachen; Arbeitsgerichtsbarkeit) könnte jenes des Bundespatentgerichts angefügt werden, dessen Besetzung (mit technischen Mitgliedern) sogar modellhaft 5 für eine technologische Kammer werden könnte. Die Institutionalisierung solcher Fachkammern würde - und das ist ein ganz entscheidender Punkt - unser Rechtssystem nicht sprengen; ein einfaches Gesetz würde genügen. Was qualifiziert die „Technologiekammern"? Oder braucht man sie doch nicht? Da steht zunächst einmal der Einwand, die Gerichte könnten sich den zugegeben fehlenden Sachverstand auch durch Gutachter beschaffen, so daß der Umweg über eine technologische Fachkammer überflüssig sei. Der Einwand aber überzeugt nicht: Ein Sachverständiger - mag er an sein Gewissen auch nicht anders gebunden sein als ein Richter - ist eben doch kein Richter; zwischen Verantwortlichkeit eines Sachverständigen und der Verantwortlichkeit eines Richters ist eben doch ein - nicht nur systematischer / prozessualer Unterschied. Die Mentalität eines Sachverständigen ist eher wohl jener eines Staatsanwaltes zu vergleichen, der in einem Rechtsstaat dem Legalitätsprinzip i m ernsthaften Zweifel gewiß den Vorzug gäbe vor der Weisungsgebundenheit. Oder anders ausgedrückt: Er wird nichts anderes beantragen, als er in diesem Stand des Verfahrens auch als Richter erkennen würde. Und doch fühlt er sich für den Richterspruch letztlich ganz einfach nicht verantwortlich - eine Erkenntnis überdies, die nicht erst durch die Rechtfertigungs- und Entschuldigungsversuche ehemaliger Staatsan5 § 36 PatG. Patentrichterliche Entscheidungen, auch wenn sie überwiegend individuelle, seltener gesellschaftliche Interessen berührten, hatten noch nie die Wirkung, daß damit neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen und technischen Fortschritten der Weg versperrt worden wäre. Eher machte der gestiftete Rechtsfrieden den Weg frei zu neuen Höhen.
11 Gedächtnisschrift Wenz
162
Edgar Michael Wenz
wälte aus der NZ-Zeit gewonnen wurde. Sachverständige haben auch in der Überzeugung des Volkes nicht Autorität und Ansehen wie ein Richter („Götter in Weiß"); das rührt schon daher, daß die Parteien üblicherweise „ihre" Sachverständigen mitbringen. I m sachverständigen Richter wird man zuerst den Richter sehen dürfen, und man wird ihn auch so sehen. Der Frage der richterlichen Verantwortlichkeit kommt ein so hoher Rang zu, daß damit eigentlich dieses Thema schon entschieden sein könnte. Auch die Besorgnis vermag nicht zu irritieren, daß der Grundgedanke des Laienrichtertums in Fachkammern bei solchen technologischen Gremien nicht verwirklicht sei, nämlich von jeder Gruppe (beispielsweise vor dem Arbeitsgericht: Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertreter) Laienrichter zu berufen. Die Bevölkerung, die j a sich nahezu ausschließlich aus Laien zusammensetzt, sei so nicht repräsentiert (Roellecke). Hier wird übersehen, daß Laienrichter nicht nur den spezifischen Sachverstand ihrer Gruppe, ihres Berufsstandes einbringen sollen, sondern auch unter dem Gesichtspunkt der „Betroffenheit" Mitglieder des Gerichtes sind. Einmal abgesehen davon, daß bei einer technologischen Kammer diesmal die Berufsrichter Unbefangenheit und „Naivität" der Laien vertreten könnten, spielt die so wichtige Frage der Betroffenheit überhaupt keine Rolle. Schließlich sind sämtliche Mitglieder des Gerichts, die Wissenschaftler nicht ausgeschlossen, bei Fehlentscheidungen „betroffen"; die Betroffenheit ist unteilbar. (Es gibt ohnehin nichts Überzeugenderes als beispielsweise Kernphysiker, die ihr Wohnhaus i m Schatten eines Reaktors bauen). Der Hinweis von Roellecke schließlich, daß selbst Fachkammern trotz ihrer Besetzung mit (sachverständigen und betroffenen) Laien verwehrt wäre, gesellschaftspolitische Konflikte zu bereinigen, überrascht. Sein Beispiel, trotz Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretern in Arbeitsgerichten ließe sich kein sozialer Friede herstellen, macht deutlich, daß er nur die Ursachen und deren Beseitigung gemeint haben kann. W i l l (und kann) ein Science Court - das wurde oben erörtert - soweit gar nicht gehen, so bewirkt die Rechtssprechung eben doch, daß über den unmittelbar angestrebten Rechtsfrieden hinaus mittelbar auch eine Rechtsüberzeugung entsteht. Jeder Rechtsstreit endet einmal, jedes angefochtene und noch so bekämpfte Urteil wird eines Tages einmal rechtskräftig. Damit ist der Rechtsfrieden zwar nur formal hergestellt, aber er ist konkret und wirksam. Auch ein nur formaler Friede ist besser als ein offener Streit, ein Waffenstillstand jedem Krieg vorzuziehen. Die Rechtsgeschichte und das persönliche Erleben sind reich an Beispielen, da ausgewogene und fundierte Urteile als „gut und richtig" befunden wurden; sie erlangten mehr als nur formale Rechtskraft, damit auch Fortbildung des positiven Rechts. Sie schufen vielmehr echte Rechtsüberzeugung. Aus rechtsgeschichtlicher Schau ist eigentlich weitgehend so das positive und gesetzte Recht entstanden.
Der „Science Court" - und er nützt doch!
163
Es ist eigentlich kein Grund zu erkennen, warum bezweifelt werden sollte, daß das Volk, die „Gesellschaft", nicht nur die Notwendigkeit einsieht, daß eine jede Streitsache - so auch eine wissenschaftlichen Ursprungs mit technischer Wirkung - endgültig, verbindlich und verläßlich überhaupt einmal entschieden werden muß. Und dann vor allem, daß ein aus Fachwissenschaftlern gebildetes Gericht, das in Unabhängigkeit und Verantwortlichkeit Recht spricht, nicht Vertrauen gewönne. Urteile aber, die getragen sind ebenso von wissenschaftlicher Autorität wie von Wissenschaftlern in richterlicher Verantwortlichkeit, müßten die weitaus höhere Chance haben, „akzeptiert" zu werden. Und so könnte eigentlich sogar der Science Court zur Beseitigung der „Akzeptanzkrise" beitragen. Roellecke und Kewenig erkennen diese Chance, verzichten aber deshalb auf deren Wahrnehmung, weil sie - zutreffend - bei einem wie immer besetzten Gericht die Fähigkeit vermissen, die objektive Wahrheit mit der Wirkung zu finden, damit die eigentlichen Wurzeln und Ursachen des Konfliktes aufgespürt und ausgemerzt zu haben. Dies aber, was kein irdisches Gericht vermag, fordern konsequent Roellecke und Kewenig. Sie sehen die unterschiedlichen Dimensionen von Wissenschaftlichkeit einerseits und Rechtsprechung andererseits, sie können also am Unterschied zwischen Ursache eines Konflikts hier und Eindämmung seiner Wirkungen dort nicht vorbeigehen. Sie erkennen auch die Chance der Herbeiführung des Rechtsfriedens - und lehnen den Science Court dennoch ab, weil er nicht alles vermag, nämlich - berechtigte und unberechtigte - Zweifel weiter Teile des Volkes, kontroverser gesellschaftlicher Gruppen am Stand und in die Richtung der Wissenschaft - eben die „Akzeptanzkrise" - radikal zu bereinigen. Soweit aber gingen die Forderungen und Vorstellungen der Protagonisten des Wissenschaftsgerichtshofes Dierkes und von Thienen nicht. Die Vorstellungen des Modells III, die praktikabel und schnell realisierbar wären, i m Rahmen unserer existenten Rechtsordnung - die sich gar nichts anderes anmaßt als formale, freilich auch sanktionierte Friedensstiftung - läßt dies erkennen. Die Gefahr des Übergewichtes der dritten Gewalt, des „Richterstaates", wiegt dagegen gering. Die Ausgewogenheit von Gesetzen und deren - dem Sinne und dem Worte nach - überlegte Handhabung stehen in einer unleugbaren Relation zur Neigung, Gerichte überhaupt anzurufen. A u f dieser Ebene also - in der Politik, die sich schließlich durch die Gesetzgebung manifestiert, und in der Administration, die keineswegs frei sein kann von politischen Komponenten - müßte sinnvoll der Hebel angesetzt werden. Die Wissenschaften aller Disziplinen, Logik und Philologie nicht ausgeschlossen, könnten dabei hilfreich sein. Dierkes und von Thienen haben ja vorrangig auf den technologischen Sachverstand abgestellt, aber das Vorfeld und Umfeld der Justiz (im engeren Wortsinne) ausgiebig und durchaus ergiebig behandelt. Die Vorstellung der Modelle I und I I sind darauf angesetzt. Freilich sollten diese Lösungsvorschläge nicht mit dem Begriff des „Gerichtshofes" belegt werden, weil das begreifliche Assoziationen weckt, die so (!) nicht gemeint waren, aber für den richtig verstandenen Bereich wertvolle Denkanstöße geben. 11*
164
Edgar Michael Wenz
Kewenig darf man beipflichten, daß die begreiflichen Unsicherheiten infolge ihres anderen als juristischen Ursprungs wegen auch anders angegangen werden müssen. Seine konkreten Vorschläge sind einleuchtend, die Analyse der „Sprachlosigkeit der Wissenschaft" und auch der „Konzeptionslosigkeit der Politiker" ist eindrucksvoll. Der Ruf nach mehr „personalisierter Verantwortung" könnte eigentlich dem Wissenschaftler als verantwortlichen Richter gelten. Jedenfalls darf man jenen, die Verständnis für die Wissenschaften und somit eine größere Bereitschaft zur „Akzeptanz" vermitteln wollen und sollen, mehr Erfolg wünschen als beispielsweise den Verfechtern der Marktwirtschaft und des freien Unternehmertums, denen es bislang eigentlich nicht so recht gelungen ist, eine sich neuerdings verstärkende „marktwirtschaftliche Akzeptanzkrise" aufzulösen - trotz Fakten und Daten, die augenfälliger, handgreiflicher und beweisbarer waren und sind als Erkenntnisse und Spekulationen der Wissenschaften in jenen Bereichen es je sein werden, in die sie, insbesondere die Naturwissenschaften, mittlerweile vorgedrungen sind. Dem Versuch des Ministers für Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr des Landes Baden-Württemberg 6 , technische Senate bei den Oberverwaltungsgerichten einzusetzen, darf mit skeptischem Optimismus entgegengesehen werden. Die Diskussion über den Science Court nach den Anregungen Meinolf Dierkes und Volker von Thienen kann dadurch Bereicherung erfahren. Sie sollte fortgesetzt werden.
6
Für technologische Großprojekte; Pressekonferenz in Stuttgart am 23. 4. 1978.
Die Akzeptanzkrise als Legitimationskrise Können „Wissenschaftsgerichtshöfe" weiterhelfen?* I. Akzeptanz- und Rechtskrise Die Frage, ob die „Akzeptanzkrise der Forschungs- und Technologiepolitik" durch eine stärkere Sensibilisierung der Bevölkerung gegenüber Technik, Forschung und Wissenschaft - so ließe sich der Standpunkt von Meinolf Dierkes verkürzt umschreiben - oder durch eine Krise der Wissenschaft - so i m Kern Gerhard Roellecke - ausgelöst wurde, ist nicht nur theoretisch, sondern auch pragmatisch Therapie setzt Diagnose voraus - von Bedeutung. Dieser Ansatz muß freilich in Bezug auf das Thema, nämlich der Versuch der Auflösung der Akzeptanzkrise durch die Herbeiführung eines möglichst umfassenden Konsensus mittels institutionalisierter Verfahren, eben „Wissenschaftsgerichtshöfe" (Science Courts) beschränkt bleiben. Somit muß in diesem Blickfeld auf andere - möglicherweise durchaus aussichtsreiche - Wege verzichtet werden. Gerade in jüngster Zeit hat eine Studie über Technikakzeptanz 1 interessante und offensichtlich verfolgenswerte Lösungen aufgezeigt. Danach ist der „Technikpessimismus" keineswegs unheilbar groß, die Zustimmung überwiegt sogar deutlich. Die psychologisch angelegte Forschung hat das Verhältnis zwischen Akzeptanz der Technik und dem Verständnis für Technik herausgearbeitet. M i t zunehmendem Verständnis der Technik wächst die Zustimmung (Ingenieurwissenschaften); den Gegenpol bilden die Soziologen und Philosophen. Das deckt sich mit spontanen Beobachtungen. Diese Diagnose drängt eine therapeutische Patentlösung förmlich auf: Mehr und bessere naturwissenschaftliche Ausbildung, verständlichere Aufklärung. Ein solcher Vorschlag findet freilich seine Grenzen an der intellektuellen Aufnahmefähigkeit, zu der noch ideologische Barrieren, gewiß auf beiden Seiten, kommen. Aber hierfür wird nach Lösungen mit kommunikativ-informatorischen und pädagogischen Mitteln gefragt werden müssen. Aber ein anderes soziologi* Erstveröffentlichung in: Edgar Michael Wenz, Wissenschaftsgerichtshöfe. Mittler zwischen Wisssenschaft, Politik und Gesellschaft, Frankfurt, New York, 1983, S. 73 ff. 1 Vom Hause Siemens veranlaßt, vom Forschungsinstitut Infratest durchgeführt, von Reinhold Bergler geleitet und ausgewertet, in der Siemens-Zeitschrift 55, S. 2 ff., in Kurzform referiert. Eine Untersuchung des Instituts für Soziologie der Universität München in Zusammenarbeit mit dem Verein Deutscher Eisenhüttenfachleute bestätigt eine überwiegend positive Einstellung zum Ingenieurberuf (Rink, 1982). Daß die Mehrzahl der Gewerkschaftsmitglieder sich positiv zu neuen technischen Entwicklungen äußert (nur 28% dagegen), paßt in diesen Zusammenhang (iwd 10/83, S. 7).
166
Edgar Michael Wenz
sches Problem wird sichtbar: die schichtenspezifische Differenzierung, die verschiedenen Zielgruppen, die - auf durchaus unterschiedlichen Wegen - erreicht werden sollen, oder eben als nicht erreichbar zwangsläufig eliminiert werden müssen, oder zumindest für ideell und materiell aufwendige Anstrengungen vernachlässigt werden können, und sei es nur temporär. Man wird um so mehr die rezeptionswilligen Personen und Gruppen beachten müssen, die man in der deutlichen Mehrheit vermuten darf; sie sind die eigentlichen Adressaten aller Bemühungen. Ein Problem muß man in Verbindung mit Forschungsprojekten und deren Aussagekraft ansprechen, das möglicherweise die Akzeptanzkrise verstärken könnte: Die vielen wissenschaftlichen Studien, die Skepsis auslösen. „Eine Studie gefällig?" ist eine Glosse in „Die Zeit" (22. 1. 1982) betitelt. Der Untertitel „ B e i so manchen wissenschaftlichen Untersuchungen ist Vorsicht geboten" zeigt das Dilemma, das mitten hinein in die wissenschaftstheoretischen und methodologischen Auseinandersetzungen gerade in der empirischen Sozialforschung zielt; am einen Pol die „ L o g i k der Forschung" Carl Poppers und am anderen die „erkenntnisleitenden Interessen" Jürgen Habermas'. Gerade dann und dort, wo Emotionen und Intuitionen Argumente verdrängen, vielleicht sogar ersetzen müssen - etwa dann, wenn es ohnehin um Prognosen geht, deren Theorien zwar nachprüfbar dargestellt werden können, die sich aber nicht „beweisen" lassen - , sollte die Gegenposition besonders rational aufbereitet werden. Dies aber stellt hohe und kompromißlose Anforderungen an die Wissenschaftlichkeit. Man ist geneigt zu sagen: „etwas weniger (Studien) wäre mehr gewesen". Hans Ryffel spricht von „gewissen Mindestanforderungen, die an eine Demoskopie, exemplarisch bei der als erforderlich erkannten ,Giftgesetzgebung' zu stellen wäre", weil sie „nicht immer wissenschaftlichen Ansprüchen zu genügen" scheint (Ryffel, 1969, S. 524). Das hat mit Vertrauen zu tun, dem wichtigsten Pfeiler jeder Gesellschaftsordnung. Ein kultursoziologisches Phänomen kann man gar nicht übersehen, das zunehmende Besorgnis auslöst: Eine zurückhaltende bis ablehnende Einstellung gegenüber der Technik, die bis zur Angst vor der Technik 2 reicht. Manche sehen sogar den ganzen „Grundkonsens", erkennbar in der „Haltung der Gesellschaft", verloren (Haunschild, 1981, S. 145 ff.). Gerade unter Jugendlichen löst sie häufig Reaktionen aus, die man nicht nur als irrational bezeichnen kann. Vielleicht wird man diese Erscheinung eines Tages die „Jugendbewegung" unserer Epoche nennen. Die
2 Eine Untersuchung des Instituts für Demoskopie Allensbach zeigt, daß die Angst auch vor der Technik im weitesten Sinne signifikant zunimmt (Fiel, 1981). Ähnlich im Ergebnis auch die jüngste Forschung dieses Instituts; Elisabeth Noelle-Neumann (1982) zieht den Schluß, die Bundesrepublik lebe in einer Zeit der Umwertung der Werte; diese Studie verweist auch auf die Abhängigkeit der Einstellung von Ausbildung und Interessenslage, sie stützt so das Ergebnis der Siemens-Studie (siehe Anm. 1). Freilich war das grundlegende Resultat - Sensibilisierung der Bevölkerung gegenüber der Technik, Akzeptanzbereitschaft bei Technikern - ohnehin zu erwarten.
Die Akzeptanzkrise als Legitimationskrise
167
Exzesse - manche sprechen von „Jugendrevolten 4 ' 3 - werden dann vergessen sein, man wird sie in der zeitlichen Distanz wahrscheinlich als emotionale Artikulierungen an der Schwelle zu einem neuen Zeitalter sehen müssen, das man durch Verweigerung verhindern zu können glaubte. Ursachen für diesen Bewußtseinswandel sind das Wissen um die immer knapper werdenden Ressourcen unserer Erde. Die Informationsquellen, die unser technisches Zeitalter verfügbar gemacht hat, vermochten aber nicht das Unbehagen zu neutralisieren, welches das rasende, vielfach als „raserisch 44 empfundene Tempo der Entwicklung von Technik und Wissenschaft auslöste. Die immer größer werdende Unübersehbarkeit unserer Lebens- und Sozialverhältnisse steigert sich in Angst, verursacht Lähmungen - statt zur Einsicht zu führen, daß gerade diese veränderten Lebens- und Sozialverhältnisse, nicht minder als die Verknappung der Rohstoffe und Güter unseres Planeten, eine epochale Herausforderung sind; ein „moralischer Irrationalismus 44 (Lübbe, 1982) breitet sich aus, wo man sich besser rational den Gründen stellen müßte. Anscheinend mag oder kann man nicht mehr sehen, daß unser zivilisatorischer Standard die Grundlage, jedenfalls die materielle Voraussetzung des Standes und der Höhe einer Kultur ist und sich beides nicht oder nur unter Verlust trennen läßt. Die Einsicht müßte nicht nur zu Risiken zwingen, sondern auch neue Aufgaben und neue Pflichten stellen. Der Technik kann man nicht ausweichen, viel mehr „die Technik soll die Technik retten 44 (Wild, 1982). Angst und Einsicht der Notwendigkeit können dialektisch zum Fortschritt führen. Sie müssen es. Es bleibt keine andere Wahl 4 . Diese Erkenntnis aber zwingt dazu, auch nach neuen Wegen zu suchen, die zur Einsicht der Notwendigkeit führen, möglicherweise nur schmale und steinige Pfade, aber immerhin mit einem Ziel. Ob nun Akzeptanzkrise der Technik oder auch nur der Großtechnologie oder ob - viel schlimmer - eine Vertrauenskrise in das Recht entstanden ist aus einer sich zunehmend ausweitenden Aversion gegen Wissenschaft und Forschung, gegen Technik und Entwicklung - , so haben wir es doch immer nur mit einer „Krise 4 4 zu tun, nicht mit Tod und Untergang. „Krisen sind Indikatoren dafür, daß die Werte nicht mehr zu den Verhältnissen stimmen 44 (v. Heutig, 1981). Der Begriff „Krise 4 4 impliziert, daß über wichtige und grundlegende Wertvorstellungen noch immer ein Konsensus gegeben ist, freilich über andere nicht mehr. Aber das schließt ein, daß Krisen geheilt und überwunden werden können. Man muß erst einmal Wissenschaft definieren, wenn man die Behauptung aufstellen will, daß von ihr, jedenfalls unmittelbar, keine Wegweisung zu erwarten ist. 3 Exemplarisch dafür der Artikel Wolf gang Cyran (1982). Ein Zitat daraus: Bopp „Die Jugendlichen fühlen sich, als Konsumenten würden sie umworben, als Finanzier der Altersrenten würden sie benötigt und als Wähler umschmeichelt, aber als Sündenböcke seien sie unentbehrlich und als eigenständige Partner überflüssig, ja unerwünscht." 4 Das ist im Kern auch das Ergebnis der neuen Projektstudie des Kernforschungszentrums Jülich (Spez-97); danach heben sich numerisch die Besorgnis über die Risiken der Kernernergie auf mit der Einsicht in deren Notwendigkeit zur Deckung des künftigen Energiebedarfs.
168
Edgar Michael Wenz
Das gilt gewiß für jene, die dem kritischen Rationalismus anhängen, dem viele methodologischen Erkenntnisse und sinnvolle Hilfen zu verdanken sind. Er ist schließlich mit dem Merkmal der Werturteilsfreiheit angetreten. Jetzt und hier aber geht es um Werte und um Sinn, die erkannt, ausgewählt und bewahrt werden müssen. Die Hoffnung, daß der „Gang der Wissenschaften" evolutionär per se zum Fortschritt führt, hat nicht getragen. Gerade die Naturwissenschaften, aus denen Carl Popper seine Beispiele bezog, vermögen kein Ziel anzugeben, wohin die Reise gehen soll. Der Bombenabwurf von Hiroshima und Nagasaki wird Carl Poppers Forderung, Theorien anstelle von Menschen sterben zu lassen, engegengehalten. Eine größere Verneinung durch die Wirklichkeit konnte ein ethisches Postulat nicht finden. Dieses Ereignis (Max von Laue, „Physikalisch betrachtet handelt es sich um das größte Experiment, welches die Menschen bis dahin angestellt hatten; Robert Oppenheimer, „Eine Erfahrung der Sünde, die sie (die Wissenschaftler) nie wieder verlassen kann") hat den Fortschrittsoptimismus zutiefst getroffen. Die reine, freie und wertneutrale Forschung vermag sich dem Vorwurf, sie diene nur als Entlastungsstrategie, nicht erfolgreich widersetzen. Die sachliche Erörterung von Problemen - die nach Meinung von Hans Albert (1971, S. 181 ff.) möglich ist, „ohne daß man zu Werturteilen Zuflucht nimmt" - hilft nicht weiter. Werte und Sinngebung sind gefragt. Freilich, Carl Popper hat die Notwendigkeit zur moralischen Entscheidung stets gesehen und immer wieder bejaht. Aber die „ L o g i k der Forschung" und alle rationale Kritik können Entscheidungen über Werte nicht ersetzen. Was aber nun „wert" ist, was „sinnvoll", was „notwendig" oder gar „lebensnotwendig" ist und was eben nicht - das zu erkennen, darüber geht der Streit. Und i m nächsten Zug müssen aus dieser Welt der Ideen und Werte sich die Entscheidungen darüber, was nun Sinn gibt und was nicht, verfestigen i m sozialen Sein; muß die Idealität der Gerechtigkeit und Richtigkeit wirksam werden i m positiven Recht, das auch angewendet und durchgesetzt wird. So schlägt die Fragestellung qualitativ um vom Wert und Sinn zur gesetzten Norm, die gültig und wirksam sein muß. Das Recht ist als Vollstrecker der Idee auf den Plan getreten. Dieser Gedanke - das Recht als Vollstreckerin der Idee - entlastet von Überlegungen, aus welchen Wurzeln sich die konstatierte Akzeptanzkrise nährt: ob sie tatsächlich originär eine Rechtskrise ist (was man wohl verneinen darf), oder sie erst zu einer Vertrauenskrise in Staat, Recht und Gesetz sich ausgewachsen hat (wie eher zu befürchten ist). Die Rückdrängung dieser Frage kann freilich nur für den gewählten und dargestellten Kontext hingenommen werden. Die Untersuchung der Akzeptanzkrise in ihrer Gestalt und Erscheinungsform, in Ursachen und denkbaren Wirkungen, ist zweifellos drängend und Voraussetzung für das Erwägen und schließlich Bestimmen aller dagegen gerichteten Maßnahmen, von individual- und sozialpsychologischen bis dann hin zu rechtspolitischen. Aber wir müssen bei der jetzt gestellten Frage erkennen, daß die Anforderungen an Recht und Gesetz gerichtet sind, die Vorstellung von Werten und Sinnhaftigkeit i m realen sozialen Sein
Die Akzeptanzkrise als Legitimationskrise
169
zu verwirklichen. Ob der Staat, die Gesetze und der Rechtsstab 5 in die Misere einer Krise hineingezogen worden sind; ob sie sich dessen nicht erwehren können und dürfen, weil sie eben an vorderster Stelle stehen, wenn Probleme aufkommen; ob sie dies durch Tun oder Lassen verschuldet oder mitverschuldet haben oder eben nicht - das ist i m Augenblick bedeutungslos, weil die stabilisierende Funktion von Staat, Recht, Gesetz und Rechtsstab nicht nur erwartet werden darf, sondern schlicht und einfach deren genuine und unabweisbare Aufgabe ist. Die Frage nach Gehalt und Gewicht einer Rechtskrise braucht, auch wenn eine andere Aufgabenstellung erkannt wurde, nicht in eine Fußnote verbannt werden. Ernstzunehmende Stimmen bestreiten eine Rechtskrise. Dem könnte man unschwer zustimmen, wenn diese Annahme voraussetzte, daß die Rechtskrise per se existent wäre, womöglich noch die Ursache für die Akzeptanzkrise der Großtechnologie wäre. Dies freilich ist nicht gemeint. Die Rechtskrise, geschwundenes Vertrauen also in die Idealität, Normativität und Faktizität des Rechts, kann durchaus - das wurde ja schon gesagt - auch Folge der Akzeptanzkrise sein. Dies alles ist wahrscheinlich mehr eine Frage der Definition. Sicher aber ist - und dies allein ist zutiefst zu bedauern - , daß empirisches Material über ein so wichtiges Phänomen fehlt. Dies ist ein an sich unverständliches Versäumnis der Rechtssoziologie. Wenn man nun die Phänomene kurz anleuchtet, die zu einer so pessimistischen Befürchtung einer Rechtskrise geführt haben, dann kann man das Problem etwa so sehen: Von Raketen, die Terroristen gegen das Bundesverfassungsgericht installieren, geht keine Gefahr aus. Transparente und Kampfgeschrei gegen Staat und Recht wiegen kaum schwerer. Von den gewalttätigen Demonstrationen in Frankfurt, Wyhl und Brokdorf zählt schon eher die Erkenntnis, daß die Ordnungs- und Zwangsmittel der Staatsgewalt kaum mehr zu wirken in der Lage sind, der Rechtsstab scheint nicht selten rat- und hilflos. Die jeweils andere Seite fühlt sich verlassen und ungeschützt. Und schon gar nicht kann gering geachtet werden, daß ein Teil der Bevölkerung, der kein vernachlässigbares Datum mehr ist, nicht nur mehr indifferent dem Staat gegenübersteht, sondern sich von ihm losgesagt zu haben scheint. Nun meinen wir freilich nicht, daß mangelnde Bejahung des Staates gleichzusetzen ist mit der Bereitschaft oder gar Entschlossenheit, ihn zu bekämpfen. Nichtsdestoweniger wachsen aber Exzesse nicht i m luftleeren Raum, sie sind nur die sichtbare 5
Dieser Begriff Rechtsstab umfaßt in der Rechtssoziologie alle Personen, die mit der „Handhabung" des Rechts zu tun haben; im engeren Sinne ist damit aber nur jener Personenkreis gemeint, der das Recht anwendet, also Richter, Verwaltungsbeamte, Staatsanwälte, Beamte des Vollstreckungs- und Vollzugsdienstes; Polizeibeamte, somit alle Organe der Rechtspflege. Im Anschluß an den amerikanischen Rechtssoziologen Karl N. Llewellyn (1962) ist es die Hauptaufgabe der Rechtssoziologie, die Praktiken des Rechtsstab (law-men) und deren Funktionen (law-jobs) zu erforschen; nach Meinung des Rechtsrealismus (legal realism) ist nur das Recht, was der Rechtsstab effektiv gegen Rechtsadressaten und Rechtsunterworfene durchsetzt; ausführlicher dazu Manfred Rehbinder, 1977, S. 95, für den die „Verhaltensmuster, nach den der Rechtsstab in bestimmten sozialen Situationen reagiert" zu den wesentlichen Aufgaben der empirischen Untersuchung des Rechts gehört. Darauf beruht auch die Reaktionstheorie (anstatt der Zwangstheorie) des Rechts.
170
Edgar Michael Wenz
Spitze; unter ihnen ist ein unsichtbarer Unterbau zumindest des Unbehagens und der Zweifel. Man weiß auch aus der Geschichte, daß eine Minderheit eines Volkes, die klein scheint, aber entschlossen ist, mehr bewirken konnte, als nur kritische Distanz zum Staat zu artikulieren. Man darf nun nicht den Fehler machen, sich etwa nach Wahlergebnissen zu orientieren, die für bestimmte Gruppierungen eine, partiell sogar militante Verneinung des Staates erkennen lassen. Auch unter den Wählern demokratischer Parteien befindet sich ein Potential, das sich gegen die Rechtsordnung - jedenfalls gegen die uns berührenden Teilbereiche - mobilisieren ließe. Es ist für unser Interesse wirklich gleichgültig, ob nur jeder Zwanzigste oder jeder Zehnte, vielleicht aber auch jeder Achte oder Siebente sich außerhalb der staatlichen Ordnung stellen möchte oder sich stellen läßt, möglicherweise sich auch dafür zu engagieren - wie immer man das definieren mag - bereit ist. Es scheint dies jedenfalls keine vernachlässigbare Quantität mehr zu sein; diese Quantität könnte auch in Qualität umschlagen. Und der Staat, gerade der Rechtsstaat, findet seine Idee und verkörpert sein Wesen in Recht und Gesetz. Und überhaupt: Was ist denn mit jenen Menschen, die sich nicht zu einem Protest entschließen können oder zeigen wollen, obwohl auch sie von tiefem Unbehagen umfangen sind und sich ängstlich und hoffnungsvoll nach einem Halt umschauen, nach einer Orientierungshilfe, wenn sie schon keine Sicherheit finden können? Und was eigentlich vermag Orientierungshilfe und Halt eher zu bieten, von wem erwartet man es mehr als von Recht und Gesetz? Aber wie auch immer, ob Rechtskrise oder nicht, Aufgabe und Ziel ist: U m die erwarteten Leistungen der Funktionen herbeizuführen, das richtige Recht also zu finden, müssen die entscheidenden Kriterien herauspräpariert und die lebensnotwendigen Fragen zur Entscheidung gebracht werden, diese zunächst nur formallegale Entscheidung muß aber nun „legitimiert" werden - i m Sinne einer Verwirklichung des Gerechtigkeitsideals - , um sie so tragfähig und „akzeptabel" zu machen. Es geht nur um den Weg, oder noch präziser: um die Methode, einen Weg zu suchen und zu finden. Hier und heute ist aber nur nach dem Sinn und Nutzen bestimmter und schon vor-ausgewählter Institutionen gefragt, die also diese Akzeptanzkrise lösen oder realistischer - zu deren Auflockerung beitragen sollen. In diesem Kontext muß man Institutionen definieren und vordergründig als justizmäßige Einrichtung eines Verfahrens oder einer verfassungsgemäßen Behörde - eben Wissenschaftsgerichtshöfe. Die Protagonisten Dierkes und von Thienen haben dazu konkrete Vorschläge in Form von Modellen unterbreitet, die gewiß noch erweitert werden können, denen aber eines gemeinsam ist: ein Verfahren, das die Forschungs- und Technologiepolitik und deren Ergebnisse nicht nur wissenschaftlich, sondern gerade rechtlich legitimieren soll. Damit ist eine neue, eine andere Abstraktionsebene angesprochen. A u f dieser anderen Abstraktionsebene aber wird die Frage nach den spezifischen Ursachen der Akzeptanzkrise, ob die Auffassung Dierkes oder jene von Roellecke „richtig"
Die Akzeptanzkrise als Legitimationskrise
171
ist, irrelevant. Das Problem ist nun zu einem Problem des Rechts geworden; vordergründig schon einmal deswegen, weil in Recht und Gesetz j a auch die Lösungen - wie wäre „Wissenschaftsgerichtshof 4 auch anders zu definieren? - gesucht werden. Immerhin befürchtet Dierkes, daß ein Schwund i m „Vertrauen in die Institution Recht drohe 44 . Schließlich und endlich geht es, nach Meinung aller Autoren, um Rechtspolitik, somit um den „ K a m p f ums Recht 44 - die berühmte Forderung Rudolf von Jherings, die auch Helmut Schelsky (1970a, S. 87) zu einem Kernstück einer Rechtssoziologie unserer Tage gemacht hat. Man muß sich dem Einwand stellen, daß aus dieser Sicht und auf dieser Abstraktionsebene sich eigentlich alle Konflikte begreifen und beschreiben lassen, weil schließlich alle Politik Rechtspolitik ist, wie auch die Gesetzgebung nichts anderes ist als verwirklichte, festgeschriebene Politik. Eine so grob reduzierte Frage müßte man ebenso grob reduziert schlicht bejahen. Das ist j a auch i m Kern bereits mit der Erkenntnis geschehen, daß Rechtssetzung und Rechtsfindung nichts anderes sind oder sein sollen als das Setzen und Finden von Werten und Sinn. Aber in unserem Zusammenhang sind freilich rechtsspezifische, juridische Leistungen gefordert. Bei näherer Betrachtung drängen die justizmäßigen Komponenten vor wie anders als mit nüchternen gerichtsmäßigen Regeln ließe sich auch ein „Wissenschaftsgerichtshof 4 betreiben? Und in der Tat, die Lösungsvorschläge reichen bis in das Verfassungsrecht. Die Bestandsaufnahme führt zu der Erkenntnis: Die für den Konsensus über die Institution Recht unerläßliche Harmonie zwischen Sitte, Sittlichkeit und Gesetz ist gestört. Wie Fragen, die mit den Ergebnissen von Wissenschaft und Forschung auf dem Gebiet der Technologie zusammenhängen, entschieden und dann angewandt und durchgesetzt werden, wie Recht wird und wie es dann der Rechtsstab ausübt, das wird als „unsittlich 44 betrachtet. Der gesellschaftliche Wandel, das beherrschende Thema der letzten zwei Jahrzehnte nicht nur der Soziologen und Politologen, hat die Effektivität des Rechts, des am stärksten ausgeprägten gesellschaftlichen Ordnungssystems, getroffen. Schwindende Entlastung durch außerrechtliche Normen, geringer werdender Halt in den Kleingruppen haben Rechtsüberzeugungen umgebildet. Die Zweifel haben sich sogar, in verstärktem Maße, entzündet an der Frage der Zumutbarkeit, Erträglichkeit und Unverträglichkeit von Gefahren, die bei einer ständig weitergreifenden Anwendung von Technologie aufkommen könnten; nicht wenige meinen, daß Gefahren und Gefährdungen sich gar nicht vermeiden ließen. Gewandelte und schließlich fehlende Rechtsüberzeugungen führen zur Rechtsentfremdung, sie zu „Mängel der Sozialisation 44 (Rehbinder, 1977, S. 158 ff.). Das Recht vermag seine Funktion der sozialen Integration nicht mehr störungsfrei zu leisten. Nähert man sich gesellschaftlichen Problemen aus der Sicht des Individuums, so vermag der personfunktionale Aspekt des Rechts nicht mehr die Leistungen für den Aufbau der Persönlichkeit (Schelsky, 1970a, S. 87) zu erbringen. Das Recht hat sich losgelöst von der Rechtsüberzeugung, die ihm zugrunde lag. Die Wirklichkeit, das Sein, findet sich nicht mehr i m Sollen des Rechts. Diese Dysfunktionalität ist zu konstatieren, mag nun die Ursache in einem Unbehagen
172
Edgar Michael Wenz
gegenüber Forschungs- und Technologiepolitik (Dierkes) oder, noch enger, gegenüber der Wissenschaft (Roellecke) gesehen werden. Es ist kaum zu viel gesagt: ein Auseinanderklaffen von Recht und Sittlichkeit könnte eine tiefgreifende Störung der Harmonie bewirken. Auch für diese Gedankengänge steht freilich auch die Frage der beachtlichen oder vernachlässigbaren Quantität. M i t nichts soll auch nur angedeutet werden, daß sich das bundesdeutsche Volk in seiner Gänze, in Mehrheit oder auch nur in einer qualifizierten Minderheit i m Zustand der Auflösung der Rechtsüberzeugungen befinden würde. Es kann sich nur um einen kleinen, aber beachtlichen Teil handeln - nicht anders als bei den schon oben angestellten Überlegungen zur Rechtskrise. Es geht nur darum, daß der Teil der Bevölkerung, der sich in diesem kritischen Zustand befindet, nicht vernachlässigt werden darf, ebensowenig überschätzt wie übersehen. Daß Legitimationsprobleme „heute weniger aus marxistischer Indoktrination als aus einer Auflehnung des Rechtsgefühls gegen das Recht" entstehen, daß das nicht eine Funktion der Zahl schlechthin ist, darauf weist Martin Kriele in dem Aufsatz „ E i n Recht auf Widerstand? Demokratie und ,Gegengew a l t ' " mit Recht hin (Kriele, 1983). Derjenige Teil des Volkes, der für sich ein „Widerspruchsrecht" in Anspruch nimmt, ist bestimmt noch viel kleiner als jener, dessen Rechts- und Staatsverständnis durch eine ihm unbegreifliche Forschungsund Technologiepolitik gestört ist. Nach unserer Meinung verdient unser Problem doch deutlich größere Aufmerksamkeit als jenes, dessen Bedeutung auch nicht verkannt werden darf, schon gar nicht in unseren Erkenntniszusammenhängen. Man muß sicherlich davon ausgehen, daß jene, die ein Widerstandsrecht gegen die verfassungsgemäße Ordnung für sich ableiten, auch zu den militanten Bekämpfern der Forschungs- und Technologiepolitik und ihrer praktischen Ergebnisse gehören, unter den Anführern sogar eine weitgehende Personalunion erwartet werden muß.
II. Möglichkeiten der Rechtssoziologie und Rechtspolitik Man muß sich nach anderen Wissenschaften umsehen, die die vorgefundenen mißlichen, j a vermutlich gefährlichen Zustände angehen und anpacken könnten. Dabei ist nicht schwer zu sehen, daß die vorhin aufgezeigte Vielfalt von Fakten und Interessen; von Geschehnissen und Bedürfnissen; von dem, was ist, und jenem, was sein soll; vom Sein und Sollen; von Gesellschaft und Recht; Hilfe nicht nur von den Sozialwissenschaften, und nicht nur von Rechtswissenschaften benötigen, sondern vielmehr von einer Wissenschaft, die beide Disziplinen sieht, die beide Zweige integriert und aus dieser Verbindung neue und spezifisch andere Erkenntnisse gewinnen will. I m zweiten Blick aber erkennt man auch, daß die Rechtssoziologie - die immerhin als die „Wirklichkeitswissenschaft vom Recht" definiert wird, das die „wechselseitige Interdependenz und den funktionalen Zusammenhang zwischen Recht
Die Akzeptanzkrise als Legitimationskrise
173
und den anderen gesellschaftlichen Phänomenen" ergründet (.Raiser, 1973, S. 3) in den wissenschaftlichen Auseinandersetzungen schlicht und einfach vermißt wird. Dabei müßte es ihr genuines wissenschaftliches Interessenziel sein, sich mit der evidenten Divergenz zwischen der Idealität des (normativen) Rechts und der Realität der (soziologischen) Gesetzesbefolgung zu befassen. Die Phänomene zu erkennen, zu analysieren und Mittel einer Lösung zu erarbeiten und bereitzustellen, das ist zutiefst Aufgabe der Rechts- und Staatssoziologie. I m Schnittpunkt zwischen Rechts- und Sozialwissenschaften bietet sie das Instrumentarium, sich den Problemen analytisch, deskriptiv und operational zu nähern, die sich durch das Auseinanderklaffen von Recht und sozialer Wirklichkeit aufgetan haben. U m so erstaunlicher ist es deshalb, daß bisher in der - freilich nicht reichen - Diskussion mit keinem Wort die von dieser Wissenschaft 6 gebotenen Möglichkeiten zumindest der theoretischen Aufarbeitung erwähnt oder erwogen werden. Die Soziologie befaßt sich aufgabengemäß mit den „Wandlungsprozessen, deren Dynamik durch die sich überstürzenden Fortschritte von Technik und Wissenschaft in ständiger Zunahme begriffen ist" (Rehbinder, 1977, S. 122). Die Gesellschaft der Gegenwart ist nach dieser Auffassung eine Krisen- und Übergangsgesellschaft, deren Umbruch als „Interferenzstadium" zu kennzeichnen ist; folgerichtig ist davon auch das Ordnungsgefüge der Gegenwartsgesellschaft betroffen, das sich gleichfalls i m Umbruch befindet. Damit ist die Rechtssoziologie als Fachsoziologie gefordert. Ein Seitenblick läßt erkennen, daß es tieferliegende Ursachen hat, wenn die Rechtswissenschaften bisher eine auffallende Zurückhaltung gegenüber den Sozialwissenschaften im allgemeinen und Rechtssoziologie i m besonderen mehr oder weniger offen gezeigt haben. Daß die Rechtswissenschaften deshalb keine Hilfe von den Sozialwissenschaften verlangt haben, erklärt freilich nicht, warum diese dann nicht von sich aus konkrete Mitwirkung angeboten haben. Wie auch immer, man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, insbesondere bei Juristen eine Art Berührungsangst mit der Soziologie entdecken zu müssen. „Distanz oder Ignoranz?" formuliert Hans-Wilhelm Schünemann (1976, S. 2) seine Frage zu diesem Thema. Diese Arbeit ist darauf angewiesen, sozialwissenschaftliche Erkenntnisse zu verarbeiten. Sie kann nicht auf die Rechtssoziologie verzichten, deren theoretische Lehren und praktische Erkenntnisse sie explizit nicht nur verarbeiten will, sondern - angesichts der sehr komplexen Problemstellung - unabweisbar verarbeiten muß. 6 Die Rechtssoziologie wird zusammen mit Rechtsgeschichte, Rechtsphilosophie und Rechtstheorie als Wissenschaft im engeren Wortsinne definiert, während die Jurisprudenz „nur" als eine Kunst der Rechtsanwendung, als Rechtstechnik, begriffen wird (Rechtsgelehrsamkeit). Die Auffassungen spannen sich von Α. V. Lundsted (1932) bis zu Bernhard Rehfeldt, der in der Jurisprudenz „sowohl Kunst als Wissenschaft" sieht {Rehfeldt / Rehbinder, 1978, S. 161).
174
Edgar Michael Wenz
U m so mehr müssen deshalb einschlägige Ergebnisse der empirischen Sozialforschung vermißt werden, ebenfalls theoretische Erörterungen zu angesprochenen Themen - am meisten aber ist das nicht nur gestörte, mehr noch: ungeklärte Verhältnis der Rechtswissenschaften zu den Sozialwissenschaften zu beklagen. Man muß sogar fragen, ob man überhaupt noch von einem „Verhältnis" sprechen darf; ein schlechtes Verhältnis wäre immer noch besser als gar keines. Aber gerade die Rechtswissenschaft und Jurisprudenz täten gut daran, ihr Verhältnis zu den Wirklichkeitswissenschaften neu zu ordnen. „ M i t Reflexionen am Feierabend" (Opp, 1973, S. 11) ist es allerdings noch lange nicht getan. Gerade i m Zusammenhang mit dem Umweltschutz werden sie mehr und mehr in die wissenschaftliche Diskussion einbezogen. Jurisprudentiell mag sie sich - vorrangig und vordergründig mit Urteilsschelten, somit in der Interpretation vorgefundener, meist verwaltungsrechtlicher Normen - wehren können. Rechtspolitisch jedoch werden andere, auch wissenschaftstheoretisch andere Kategorien angesprochen. Bei der Gemengelage mit anderen Wissenschaften sind Rechtswissenschaft und Jurisprudenz unterschiedlich gewappnet; in Auseinandersetzungen etwa mit der Philosophie ist die Rechtswissenschaft erfahren und, nachdem sie sich nach eigenem Verständnis auch mit Sollens-Sätzen befaßt, kompetent; Erkenntnisse aus anderen Wissenschaften aber, beispielsweise den Naturwissenschaften, kann sie nach eigenem Verständnis nur als Fakten, gewissermaßen als Bausteine, verarbeiten. Das soll keineswegs beklagt werden; nur werden sich Rechtswissenschaft und Jurisprudenz i m zunehmenden Maße mit den Sein-Sätzen aus den Wirklichkeits- und Tatsachenwissenschaften systematisch und methodisch befassen müssen. Ein eigenes Verständnis, über eine praktikable Zuordnung hinausgehend, muß gefunden und auch theoretisiert werden. Solange die Sozialwissenschaften i m engeren Sinne gemeint sind, mag diese Lücke nicht so sehr bedrücken. Das wird aber sofort anders, wenn man anstelle der Sozialwissenschaften die Naturwissenschaften setzt, die eigentlich die Gruppe der Wirklichkeits- und Tatsachenwissenschaften anführen. Gerade im Industriezeitalter, das durch stürmische Entwicklungen von Wissenschaft und Technik geprägt ist, muß bewußt die Gesetzgebung „offen" bleiben, um an die Seins-Gegebenheiten anzubinden. Die Brücke zu diesen Feldern aber kann - so auch Fritz Nicklisch (1982a, S. 78) - die Rechtssoziologie bilden, als die Wirklichkeitswissenschaft vom Recht, angesiedelt i m Schnittpunkt zwischen Sollen und Sein. U m ein Beispiel zu nennen: In unserer schnellebigen Zeit und bei dem ständigen sozialen und technischen Wandel mag man bedenken, wie häufig und offensichtlich zunehmend sich die Rechtswissenschaft 7 mit Begriffen und Instrumenten zu befassen hat - Prämissen, Prognosen und Hypothesen seien hier exemplarisch genannt - , die den Wirklichkeits- und Tatsachenwissenschaften zugehören. Der
7 Dieser Begriff soll hier synonym verwendet werden auch mit Jurisprudenz; es ist nicht beabsichtigt, dem wissenschaftstheoretischen Thema der Unterscheidung von Wissenschaft und Jurisprudenz, siehe dazu auch Anm. 18, ein weiteres Kapitel anzuhängen.
Die Akzeptanzkrise als Legitimationskrise
175
Einwand, daß mit diesen Techniken und Instrumenten nur die Rechtspolitik, somit die Gesetzgebung, angesprochen sei, kann nicht gelten. Zunächst einmal wäre entgegenzuhalten, daß ja auch die Rechtspolitik ein Zweig der Rechtswissenschaft ist, der allerdings ebenso vernachlässigt wird wie eine ihr wissenschaftlich entsprechende Gesetzgebungslehre. Aber selbst wenn man sich auf die Rechtsanwendung, sprich also Rechtssprechung und Verwaltung, konzentrieren wollte, müßte man sich erst mit der beklagten Tatsache des „Richter- und Justizstaates" auseinandersetzen. Wer nur eine schnelle Änderung fordert und die Ursachen allein bei den gesetzgebenden Körperschaften suchen will, speziell in ihrer tadelnswerten Bequemlichkeit oder ihrem mangelnden M u t zur Entscheidung, würde eben den gemeinten Wandel nicht bedacht haben. Das aber würde bedeuten, die Komplexität dieser unserer Welt mit ihrer Überfülle an Handlungsalternativen nicht wahrnehmen zu können oder zu wollen. Selbst dann, wenn der Gesetzgeber einsichtig und fleißig jeden Wandel zügig nachvollziehen würde, könnte er sich nur auf einer hohen Abstraktionsebene ausdrücken. Dann fällt wiederum die konkrete Entscheidung Rechtsprechung und Verwaltung zu. Wer das Recht pflegen w i l l und wem seine Hut aufgetragen ist, der kann sich dem permanenten Wandel nicht verschließen; er kann sich den daraus schließenden Aufgaben nicht entziehen, und schon gar nicht durch eine Flucht vor der Wirklichkeit und die Welt der Begriffe. Diese Themen sind angeschnitten und bevor sie ausdiskutiert waren, gerieten sie außerhalb des Interesses. U m aber voranzukommen, stütze ich mich auf Thesen, deren Richtigkeit ich freilich nicht an dieser Stelle darlegen kann: 1. Das Verhältnis zwischen Juristen und Rechtssoziologen braucht nicht gestört zu sein, weil a) der Vorwurf der Rechtsfeindlichkeit der Sozialwissenschaften nicht mehr weiterbesteht, jedenfalls ausgeräumt werden kann; b) der Vorwurf der Unwissenschaftlichkeit der Jurisprudenz, den die Soziologie (zuerst Eugen Ehrlich) erhoben hat, bedeutungslos ist; c) die bisherige auffallende Beschäftigung der empirischen Rechtssoziologie mit der „Richter- und Justizforschung" Zweifel an der Seriosität und dem Nutzen dieser Forschung hat aufkommen lassen, wodurch andere sinnvollere Forschung bis dahin verdrängt und vergessen wurde; d) der bisherige Vorwurf der Rechtswissenschaft an die Rechtssoziologie, sie sei ideologieverdächtig und deshalb zu objektiven wissenschaftlichen Leistungen nicht fähig, nur für bestimmte Richtungen der Rechtssoziologie aufgestellt werden kann; für den überwiegenden Teil der Rechtssoziologie dieser Vorwurf indes nicht zutrifft. 2. Rechtswissenschaften und Jurisprudenz können Erkenntnisse der Tatsachenund Wirklichkeitswissenschaften, insbesondere der Sozialwissenschaften, verarbeiten, wofür i m Innenverhältnis der Wissenschaftszweig Rechtssoziologie zuständig wäre, nachdem
176
Edgar Michael Wenz
a) die Rechtswissenschaft ihr Verhältnis des Sollens zum Sein überprüft hat mit dem Ergebnis, daß das Sein kein Grund des Rechts sein kann, aber Voraussetzung für seine Geltung; die Sätze des Seins also gleiche Aufmerksamkeit verdienen wie die Sätze des Sollens. b) Wodurch schaften, wird, vor eindeutig
auch das Verhältnis zu den Tatsachen- und Wirklichkeitswisseninsbesondere den Sozialwissenschaften, neu gesehen und bewertet allem die Jurisprudenz in Rechtsanwendung und in Rechtssetzung dargelegten Sätzen den Vorzug gibt vor Alltagstheorien.
c) Was wiederum - sei es durch das Auffüllen von Gesetzeslücken, der Interpretation von Generalklauseln und der Konkretisierung unbestimmter Rechtsbegriffe; oder sei es durch Vorbereitung der Gesetzgebung - bewirkt, daß der soziale Wandel sich auf dem Boden des Rechts vollzieht. Es ist ein langer Anlauf zu der Erkenntnis, daß die klassische Disziplin innerhalb der Rechtswissenschaften für die Zuordnung der Seins-Sätze die Rechtssoziologie ist. Daß dieser Begriff allein schon zum Reizwort geworden ist, zeigt das Misere eines permanenten Mißverständnisses. Deshalb muß festgestellt werden: Rechtssoziologie, wie jedenfalls ich sie verstehe, bedeutet weder Freirechtslehre noch Wertnihilismus, noch fordert sie den „Sozialingenieur" (Roscoe Pound); in ihrer Anwendung auch nicht nur die sogenannte Justiz- oder Richterforschung, die am liebsten die deutschen Gerichtspräsidenten bis ins Schlafzimmer verfolgt hätte. „ A n die Stelle der Frage nach Recht und Unrecht" wurde die Frage gesetzt, „wessen Meinung sich von welchen Faktoren getragen in der Entscheidung" (Luhmann, 1972, S. 4) durchsetzte. Wenn man Rechtssoziologie richtig begreift als die Wirklichkeitswissenschaft vom Recht, dessen Faktizität sie allein interessiert, nicht aber seine Idealität oder Normativität; deren Erkenntnisinteressen angesiedelt sind i m Schnittpunkt zwischen Sollen und Sein - dann ergeben sich daraus ganz gewiß überaus wichtige Aspekte und Aufgaben. Die wichtigste davon müßte die Mitwirkung an der Gesetzgebung sein, ein ohnehin eindeutig soziales und somit ein spezifisch soziologisches Anliegen: Mithilfe bei der Zielformulierung; Bestandsaufnahme des faktischen Soziallebens; Prognose der Wirkungs- und Durchsetzungschancen des geplanten Gesetzes; dann das Messen der faktischen und finalen Effektivität der neuen Gesetze; schließlich Erkennen und Analysieren der Ursachen für das Verfehlen der Effektivität des Rechts. „Sociology into l a w " 8 könnte man dieses Erkenntnisziel nennen, die wichtiger Teilbereich einer Gesetzgebungslehre sein müßte, die ihrerseits aber auch noch fehlt. Wer die Meinung vertritt, die Rechtssoziologie könnte nur in ihrem empirischen Zweig als Rechtstatsachenforschung beschränkte Hilfe leisten, alles andere sei ein 8
Die deutsche Präposition „in" könnte zweifelsfrei nicht ausdrücken, was gemeint ist, eher noch lateinisch „ad leges". Rehbinder (1977, S. 12) bezieht, unter Berufung auf F. K. Beutel, bei seiner Definition „sociology in law" neben der praktischen Rechtsanwendung auch die Rechtssetzung ein; die Differenzierung gewinnt aber durch die Akkusativ-Präposition an Klarheit.
Die Akzeptanzkrise als Legitimationskrise
177
überflüssiger Theorienstreit, zumal die Jurisprudenz schon lange auf ihre Weise das reale Sein integriert hätte - probates Beispiel: Gewohnheitsrecht - , der ist dem Problem zumindest auf der Spur 9 . Häufiger allerdings hört man den Einwand, dieser Theorien- und Methodenstreit wäre ohnehin furchtlos. Hier könnte man freilich nur dann zustimmen, wenn der Anspruch auf Wissenschaftlichkeit von der Jurisprudenz autgegeben würde und sie als Handwerk der Rechtsanwendung zu begreifen man einräumte. Im Grunde geht es aber immer um das Problem, wie man Normen mit Fakten verbinden und wie man dann Normen auf den Fakten aufbauen kann. Oder anders ausgedrückt: wie aus Tatsachen Recht wird. Deshalb meinen wir j a auch, daß der Begriff der Tatsachenrechtsforschung in diesen Zusammenhängen richtiger wäre als der üblicherweise gebrauchte Begriff der Rechtstatsachenforschung umfassender, aber auch unpräziser sagt, nämlich wie aus Recht Tatsachen werden, aber auch aus Tatsachen Recht werden kann. Interdependenz von Sein und Sollen ist aber nun keine Einbahnstraße. Man sollte das auch durch einen richtigen und differenzierten Begriff deutlich machen. Die Wichtigkeit der Tatsachenrechtsforschung hat Peter Noll (1973, S. 69 f.) in die Diskussion gebracht, interessanterweise in Zusammenhängen, die uns interessieren: „Atomgesetze, Gewässerschutzgesetze usw. sind aus dem durch Faktenkenntnis vermittelten Problemdruck entstanden und von den ,Tatsachenkennern 4 maßgeblich beeinflußt worden. Was fehlt, ist nicht die detaillierte Kenntnis des Regelungsobjekts, sondern einerseits die Fähigkeit der normativen Beherrschung der Tatsachen und andererseits die Kenntnis der komplexen Zusammenhänge, die eine solche Beherrschung möglich und einleuchtend macht. Hier liegt ein weiterer unerfüllter Auftrag an den Juristen. Dabei darf noch betont werden, daß die Notwendigkeit einer interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen Juristen und Experten der Sachgebiete, aus denen die Entscheidungsobjekte stammen, in der Rechtsprechung keine andere ist als in der Gesetzgebung." Rein methodisch ist das Problem der empirischen Sozialforschung besonders groß, wenn Meinungen festgestellt werden sollen. Meinungen sind oft häufig kaum formulierbar, selten - und dann nur von erfahrenen Forschern mit korrespondierenden Kontrollfragen, die man genausogut auch als Fangfragen bezeichnen könnte zu ermitteln und auszuwerten. Anders als mit Meinungsumfragen lassen sich Rechtsüberzeugungen nicht feststellen. Man muß immer dabei den einschränkenden Hinweis von Niklas Luhmann (1972, S. 5) bedenken, daß der Sozialforscher Meinungen erforschen will, in Wahrheit Handlungsbereitschaften bräuchte, aber nur Antworten bekommt. Bei jeder Forschung, ob sozialempirische Faktenforschung, gleichgültig mit welchen Akzenten, oder theoretische Vorbereitungen und Aufarbeitungen, immer 9
Zur Rechtstheorie wären die Strömungen des Neu-Kantianismus, Neu-Hegelianismus und der Ontologie zu nennen. 12 Gedächtnisschrift Wenz
178
Edgar Michael Wenz
ist ein hoher Ausbildungsstand des Forschers erforderlich, mehr aber noch seine bedingungslose Entschlossenheit zur Objektivität. Wenn Rechtssoziologie betrieben wird als Gesellschaftstheorie - noch dazu mit der Gefahr des Überleitens zu sozialphilosophischen Erkenntnissen und aktionistischen, also politischen Zielen - , dann sind nicht nur Gefährdungen groß; die Methode allein reicht schon aus, die Ergebnisse wertlos zu machen. Es ist durchaus vorstellbar, daß solche Vorkommnisse Anlaß zur Zurückhaltung gegenüber der Rechtssoziologie abgegeben haben. Auch ohne solche Gefährdung ist die Aufgabe schwierig genug. Aber sie lohnt. Es ist die Aufgabe der Rechtssoziologie, einen Beitrag für die Auflösung oder doch wenigstens Aufweichung der allgemein konstatierten „Akzeptanzkrise" zu leisten, die - wie könnte es anders sein bei der Bedeutung des Rechts für das soziale Leben - längst zu einer Krise des Rechts geworden ist, oder zu werden droht. Der „Kampf ums Recht" ist - und das i m schlimmsten Wortsinne - zur „Schlacht ums Rechthaben" geworden. Recht und Gesetz kämpfen um ihre reale und soziale Behauptung, ihre Faktizität. Die positivistische Normativität wird energischer bestritten, als daß es nicht bekümmern könnte und man sich nicht darum zu kümmern brauchte. Und kein Ende in Sicht. U m Legitimation herzustellen, ist das Verfahren ein genuin juridischer Weg. Nun meine ich aber bei der soziologischen Schau nicht das Verfahrensrecht, sekundäre Normen also, die den Ablauf des Verfahrens regeln und die gewiß unverzichtbar sind, nicht zuletzt in ihrer Funktion als Grundrechtsschutz (Bethge, 1982, S. 1 ff.). M i t dieser Feststellung muß ich auch den Stolz der Produzenten von Vorschriften zum Verfahren dämpfen, die, insbesondere de lege ferenda, auf einen Stapel Arbeit verweisen können. Daß sich darunter auch solche befinden, die in erster Linie oder gar ausschließlich der Vereinfachung und somit Verkürzung der Genehmigungsverfahren von großtechnologischen Anlagen dienen sollen, zeigt wohl Sinn für „Zweckmäßigkeit", vielleicht sogar für Rationalität, gehört aber in meiner Sicht der Dinge - die also auf Auflösung der Akzeptanzkrise gerichtet ist - zu einer Art Schläue, die kaum vom Vormittag bis zum Nachmittag reicht. M i t Mitteln des Legalismus, der auch noch von Opportunität getragen ist, wird man schwerlich Legitimität erzielen können. Freilich muß man konzedieren, daß in Richtung Beteiligung der Öffentlichkeit in jüngerer Zeit viel getan wurde, unzweifelhaft mit der Zielsetzung, die Akzeptanz durch Einsicht zu erreichen; vielfach konnte man auch schon den Eindruck haben, daß die Rechtsanwendung sich bislang mehr um den Schutz der Einwender als um die Interessen der Antragsteller bemüht hat. Werben um diese notwendige Einsicht wird größere Bedeutung finden müssen. Das scheint erkannt worden zu sein, man scheint dies durch frühzeitige Einbeziehung der Bevölkerung in Nuklearprogramme und -projekte bewirken zu wollen. Nur durch diese Einsicht kann Vertrauen erzeugt werden, das sich letztlich stützt auch auf das Vertrauen in diejenigen, die dafür verantwortlich sind. Man muß deshalb „mehr und vor allem verständlicher über Technik reden" (Beckurts, 1982). Auch dies gehört natürlich zum Verfahren i m weiteren Sinne. Verfahren soll aber hier - unter ausdrücklicher Berufung auf Niklas Luhmann i m rechtssoziologischen Sinne verstanden werden. Damit ist freilich eine neue
Die Akzeptanzkrise als Legitimationskrise
179
Quelle des Mißverständnisses angebohrt. Manche wittern eine neue Spielart des Positivismus mit seinen nicht nur denkbaren, sondern längst überall bewiesenen Gefahren. Hier ist Verfahren gebraucht i m Sinne eines sozialen Systems. Wieder ist ein Punkt gekommen, wo auf Probleme und Fragestellungen der Rechtssoziologie und schließlich der Soziologie zurückgegriffen werden muß. Wenn Annahmen und Theorien eines Mannes von prägnantem Zuschnitt - wie Niklas Luhmann - in die Diskussion gebracht werden und darauf aufgebaut werden soll, so ist eine Auseinandersetzung mit eben diesen Theorien und Meinungen unumgänglich. Und dies bedeutet zunächst eine Beschäftigung mit der individualistischen und universalistischen Theorie der Soziologie, dann konseqent mit der funktionalstrukturellen Systemtheorie i m Recht. Beide wissenschaftlichen und theoretischen Voraussetzungen muß man kennen und geprüft haben, um eben erkennen zu können, daß die zugrundeliegenden Anschauungen durchaus mitgetragen werden können, ohne deshalb die einmalige Bedeutung des Menschen, der Person, aufgeben und in etwas unbestimmtes Kollektives eintauchen zu müssen. Das macht einen Einschub erforderlich, wie dies schon - mehr als nur andeutungsweise - i m Hinblick auf die noch nicht bewältigten Auseinandersetzungen zwischen der Jurisprudenz und der Rechtssoziologie, die bislang ein gedeihliches Zusammenwirken nicht gerade befördert haben, geschehen ist. Die Beschäftigung damit war nicht geboten, wenn die Prämissen akzeptiert waren. Es ist sicherlich überwiegend unbestritten, das Recht, das i m legalen Verfahren gefunden und gesetzt wird, stabilisierende und Rechtssicherheit schaffende Wirkungen hat. Dabei kann es unreflektiert bleiben, welche Bedeutung die Sanktionen haben, die i m gleichfalls legalen Verfahren eingerichtet wurden, oder ob sich die Rechtsüberzeugungen auf anderem psychologischen Weg gebildet haben. Die Anhänger des Rechtsrealismus sehen die Wiederherstellung des Rechtsfriedens durch die Sanktionen gegen den Rechtsverletzer als die reale Aufgabe des Rechts. Aber das ist nicht das Thema. Das Verfahren in der soziologischen Sicht Niklas Luhmanns - und ihr wollen wir folgen - hat legitimierende Wirkung. Das geschieht nicht durch den schließlich rechtskräftigen Spruch; das wäre eine verkürzte Sicht. Die Berufung auf Niklas Luhmann ist unter Juristen einigermaßen riskant. Kurzerhand wird er von manchen in die Ecke der Gesetzespositivisten gestellt; ein eingehenderes Studium wäre ratsamer. Die universalistische (soziale) Theorie stellt keineswegs das Kollektiv an die Stelle des Individuums; sie macht lediglich Gesellschaft, Volk, Staat zum Erkenntnisziel. Auch nach meiner Meinung kann man Gesetzgebungslehre, ein bisher sträflich vernachlässigter Zweig der Rechtswissenschaft, ohne diesen theoretischen Ansatz nicht betreiben. Das bedeutet aber keineswegs Verzicht auf das gegenpolige Interesse, die individualistische (personale) Theorie. Man mag dem Hauptvertreter dieser Richtung, Helmut Schelsky, der selbst die Brücke zwischen beiden Theorien schlägt, zustimmen, wenn er fordert, die Sozialwissenschaften müßten mit allen grundsätzlichen Theorieansätzen arbei12*
180
Edgar Michael Wenz
ten, mit der universalistischen ebenso wie mit der von ihm vertretenen personfunktionalen anthropologischen Theorie (Schelsky, 1970b, S. 37 ff.). Man kann wohl auch das Spannungsfeld zwischen dem Individuum und dem Ganzen nicht messen und werten, wenn man die Pole nicht alle beide kennt. Die funktional-strukturelle Systemtheorie Niklas Luhmanns - die er i m Anschluß an Talcott Parson und Robert K. Merton weiterentwickelt hat - definiert Recht als „Struktur eines sozialen Systems, das auf kongruenter Generalisierung normativer Verhaltenserwartungen beruht" (Luhmann, 1972, S. 105). Luhmann sieht also das Recht und seine Normen nur unter dem Gesichtspunkt der Funktionalität, also der Effektivität des Systems, das auf seine Selbsterhaltung hin gerichtet ist. So versteht sich auch Luhmanns Lehre von den „Grundrechten als Institution" (1967). Luhmann beschreibt die Funktion der Grundrechte, er wertet nicht deren Richtigkeitsansprüche und deren philosophischen Grundlagen. Luhmann verneint die subjektiven Rechte gegenüber dem Staat nicht; er braucht sie nur nicht bei seiner Deskription der Funktionen dieser Grundrechte; damit ändert sich nichts an deren juristischen Bedeutung als subjektive Abwehrrechte gegen den Staat wie als materiell-objektive Normen. So wurde (und wird) Niklas Luhmann häufig mißverstanden, weil man nicht den Unterschied zu machen weiß oder machen w i l l zwischen soziologischer Beschreibung und Erklärung einerseits und philosophischer normativer Wertung andererseits. Die Vielfalt von Handlungsalternativen gibt den Menschen die Möglichkeit, zwingt ihn allerdings auch dazu, um sich in dieser Welt zurechtzufinden, „Komplexität zu reduzieren". Das ausgewogene soziale Zusammenleben beruht auf Erwarten und Erwartendürfen von Erwartungen anderer. Solche erklärenden Beschreibungen haben immer zwangsläufig eine gewisse „Abstraktionshöhe" CRaiser, 1973, S. 89), wenn ein möglichst breites Erkenntnisfeld abgedeckt werden soll. Aber es scheint mir nicht notwendig zu sein, sich auf diese „Abstraktionshöhe" zu berufen, um Luhmanns Lehre für die Rechtswissenschaft akzeptabel zu machen; zweckmäßiger wäre deren richtige Einordnung. Man darf ja wohl nicht auf der einen Seite der Rechtssoziologie vorhalten, daß sie sich durch eigene Rechtstheorien auf fremden Feldern bewegen würde; sich dann auf der anderen Seite wundern, daß soziologischen Theorien vom Recht dem Juristen vertraute Begriffe fehlen. Das soziologisch-systemtheoretische Begreifen des Rechts aus der Sicht der Funktion und des Strukturierens der Gesellschaft korrespondiert mit einer Vielfalt von Möglichkeiten von Handlungsalternativen. Das Ergebnis des Ausdifferenzierens und der ständigen Anpassung des Rechts an die sozialen Veränderungen in hochdifferenzierten modernen Gesellschaften ist das positive Recht, das beliebigen Inhalt haben kann. Diese Varianz zieht unvermeidbar die Gefahr der Instabilität nach sich. Ihr zu begegnen, bedarf es einer Reihe von „Techniken", die - etwa höherrangiges Recht, das, wie Verfassungsrecht, nur schwer zu ändern ist - Stabilität zurückbringen soll. Der wichtigste Stabilisator ist das Verfahren, das reflexiv selbst strengen rechtlichen Regeln unterliegt. Die Unverzichtbarkeit eines Verfahrens ist für die Rechts-
Die Akzeptanzkrise als Legitimationskrise
181
Wissenschaft so selbstverständlich, daß sich weitere Erörterungen darüber erübrigen. Es ist dies auch die Frage nach dem „richtigen Gesetzgeber" (Roellecke, 1969). I m ordnungsgemäßen Verfahren gesetztes oder gesprochenes Recht hat dieses nach herrschender Ansicht freilich nur legalisiert, keinesfalls legitimiert.
III. Legitimation durch Verfahren? Niklas Luhmann sieht die Bedeutung des Verfahrens darin, daß es Legitimität schafft. Es ist nicht schwer zu sehen, daß der Verzicht auf den Richtigkeitsanspruch des Rechts, auf das Rechtsideal, in der klassischen Rechtswissenschaft nicht nur Bedenken, sondern eine entschiedene Gegnerschaft hervorgerufen hat. Die Kritik zum 1969 erschienenen Werk von Niklas Luhmann „Legitimation durch Verfahren" war einmütig, auch ausnahmslos seitens aller rechtswissenschaftlichen Autoren, die in dieser Arbeit zu Wort kamen 1 0 . Nicht nur absolut richtige vorgegebene Ordnungen i m Sinne des Naturrechts werden nach Luhmanns Auffassung unhaltbar, sondern die Frage nach der Richtigkeit könne sinnvoll nicht mehr gestellt werden. Da aber auf die Richtigkeitsfrage nicht mehr verzichtet werden könne, „ist die scheinbar ideologiefreie Legitimation durch Verfahren in Wirklichkeit ideologisch. Sollten Juristen zu Luhmann übergehen, so würden sie gegebenenfalls ihre bisherigen Ideologien durch eine vermeintlich wissenschaftliche Theorie verdecken und befestigen". Ideologien aber sind „äquivalent funktional", also ohne Wertverlust auswechselbar (Ryffel, 1974, S. 112 f.). So besteht wegen der politischen Indifferenz die Gefahr der „totalitären Usurpation" (Raiser, 1973, S. 89). Eine Richtigkeitsaussage kann und w i l l die Systemtheorie in ihrem funktionalen Ansatz, der jedes Recht legitimieren kann, nicht machen; „transzendentale Reflexion ist nicht gefragt" (Schünemann, 1976, S. 57). Dazu gesellten sich doch alle anderen bekannten Argumente, die gegen Rechtspositivismus vorgetragen wurden, den man gerade überwunden zu haben glaubte (hier einmal abgesehen davon, wie die alltägliche Rechtsprechungspraxis aus dieser Sicht gesehen werden muß). Alle diese Argumente richten den Blick auf die Mißverständnisse, die durch die unterschiedlichen Denkungsweisen und Erkenntnisziele der präskriptiven Rechtswissenschaft-Rechtsphilosophie hier und der deskriptiven Seins-Wissenschaft der Rechtssoziologie dort - wie schon mehrfach in dieser Arbeit bedauert werden mußte - hohe Hindernisse aufgebaut haben. Niklas Luhmann hat i m Vorwort zur 1978 erschienenen dritten Auflage seines - unveränderten - Buches „Legitimation durch Verfahren" (S. 1 - 7 ) zu den ablehnenden Argumenten Stellung bezogen. Er hat auf die ganz andere Aufgabe der funktionalen Analyse verwiesen, die ihren Gegenstand nicht zu „rechtfertigen" braucht. „Offenbar wirkt die Darstellung einer io Reinhold Zippelius (1973, S. 293 ff.). Weitere Literatur bei Luhmann (1978, Vorwort); ebenso bei Hasso Hofmann (1976, insbesondere bei Anm. 49).
182
Edgar Michael Wenz
Funktion . . . wie eine versteckte Empfehlung, eine Krypto-Normierung", stellt Luhmann richtig. Die funktionale Analyse w i l l vielmehr „schon gelöste Probleme" entdecken. Es geht ihm darum, „die für moderne politische Systeme zentrale Rechtsidee des Verfahrens die sozialwissenschaftlichen und speziell die systemtheoretischen Mittel nachzukonstruieren", was aber als „Herausforderung für die Juristen", jedenfalls für die Vertreter einer „moralgeleiteten Praxis" gesehen und behandelt wurde. Den schwerstwiegenden Vorwurf des Verzichtes auf Richtigkeit (Wahrheit, Gerechtigkeit) des Inhalts der Entscheidungen - Luhmann spielt da auf den Einwand durch Hinweis auf die Konzentrationslager (Zippelius) an, dem dadurch „Nachdruck und Plausibilität" verliehen wurde - hält er entgegen, daß „Entscheidungsinhalte . . . ihr eigenes Recht und ihre eigenen Begriffe, die mit Bezug auf grundlegende Werte und Normen der Rechtsordnung präzisiert werden können", haben. Es sei deshalb schlicht überflüssig, dafür zusätzlich noch einen weiteren Begriff bereitzustellen, nämlich den der Legitimität; „nur um dann sagen zu können, gerechte Entscheidungen seien legitim, ungerechte Entscheidungen seien nicht legitim". Luhmann betont auch, daß er mit seiner Theorie des Verfahrens nicht die ablaufenden Entscheidungsprozesse skizzieren wollte. Vielmehr: „Verfahren werden als soziales System gesehen, die mit Entscheidungsprozessen synchronisiert, aber nicht identisch sind". Dieses Begreifen als System und dieses Denken in Systemen, um sich die Welt zu erklären, das bereitet dem Juristen, der ansonsten sich nach der personalen Verantwortung orientiert, verständliche Schwierigkeiten. Luhmann vermutet als einen der „Anstoßpunkte, daß die Strukturen, die analysiert werden, sich nicht zu ,Gründen' für richtiges Entscheiden oder richtiges Verhalten kondensieren lassen". Überzeugungskräftige Argumente sind aber keinesfalls faktisch folgenlos oder belanglos. Aber „die Funktion symbolisch generalisierter Kommunikationsmedien läßt sich nicht auf eine intrinsic persuaders' reduzieren", also auf innere Überzeugungskräfte. Niklas Luhmann sieht in „katastrophalen Informationen" ein noch größeres Vermittlungspotential als in „guten Gründen"; „denn Negationen haben stärker generalisierte Effekte"; Poppers Falsifikation basiere auf diesem Grundgedanken. Macht und Wahrheit sind in Luhmanns Systemtheorie Kommunikationsmedien, die das Verfahren nicht rechtfertigen, um die es i m Verfahren auch gar nicht geht, die aber für die Entscheidungshinnahme überaus wichtige Bedeutung haben. (Die nur referierte Auffassung Luhmanns bedarf sicherlich noch Reflexionen darüber, ob er die Bedeutung der Macht - die sich eher nachvollziehen ließe als Wahrheit - als lediglich ein Kommunikationsmedium richtig eingeordnet hat.) Nach unserer Meinung ist Übereinstimmung mit der Systemtheorie und der sich darauf stützenden Rechtssoziologie Niklas Luhmanns, erst recht wenn man sie als allgemeine Rechtstheorie begreift, gar nicht erforderlich, um sich mit seiner Theorie vom Verfahren und den dort zu suchenden Hilfen und Nutzen zu beschäftigen. Das Interesse an Nutzen und Brauchbarkeit einer Theorie entbindet nicht von der Pflicht, sie auf Stimmigkeit wenigstens insoweit zu untersuchen, daß man sie tolerieren kann, ohne sich gleich mit ihr identifizieren zu müssen. Das Verständnis der
Die Akzeptanzkrise als Legitimationskrise
183
Systemtheorie erleichtert den Weg zum sozialen System des Verfahrens, das Legitimität schafft. Aber man braucht nicht Anhänger der Systemtheorie zu sein, auch nicht der universalistischen Theorie, um das zu erkennen, was das Verfahren zu leisten vermag. Und wenn nun auch sicher ist, daß diese Erkenntnisse des Leistungsvermögen des Verfahrens keineswegs gleichbedeutend sind mit Verzicht auf den Richtigkeitsanspruch des Rechts, auf das Gerechtigkeitsideal, dann ist nicht zu sehen, was entgegenstehen könnte, sich nach Hilfe bei dieser Theorie umzuschauen. Die schlichte, aber längst überfällige Erkenntnis, daß Niklas Luhmann die funktionale Bedeutung von Verfahren habe beschrieben, aber nichts habe aussagen wollen über deren rechtfertigende Bedeutung, sollte den arg verstellten Weg öffnen. Niemand wird durch die Beschreibung der Wirkungen des sozialen Systems des Verfahrens darin gehindert, Rechtsnormen deshalb zu akzeptieren, „ w e i l es Recht geben muß und es Normen sind, die als Rechtsnormen gesetzt wurden und als solche auch in den rechtlich fixierten Verfahren geändert werden können" CRyffel, 1974, S. 289). Legitimation bedeutet für Luhmann, Entscheidungen ohne Rücksicht auf deren Inhalt anzunehmen und seine eigenen Handlungen und Verhaltenserwartungen danach auszurichten; das schließt die Akzeptanz des Inhalts der Entscheidung in gewissen Grenzen ein. Ohne daß Luhmann die Theorie des Entscheidungsprozesses i m Verfahren beschreiben w i l l (Luhmann, 1978, S. 3), baut er auf den einzelnen Vorgängen und Stufen des Verfahrens auf. Der wichtigste Ansatz ist, daß das Verfahren einen sozialen Lernprozeß in Gang setzt. Das geschieht durch die Darstellung i m Verfahren, durch die Verteilung der Rollen i m Verfahren, die sich deutlich abheben von den sonstigen sozialen Rollen. Dadurch werden die Betroffenen in das Verfahren verstrickt. Dieses muß nach strengen Regeln - dem eigentlichen Prozeßrecht, nach diesem Verständnis sekundäres Recht - ablaufen. Die Betroffenen werden so methodisch an das Ergebnis herangeführt, das, jedenfalls in einem gut geführten und geleiteten Verfahren, auch i m Falle des Unterliegens, wenn ein nachteiliges Urteil gesprochen wird, nicht die katastrophale Wirkung eines Unglücksschlages hat, sondern gewissermaßen vorbereitet trifft. Das setzt den Betroffenen und Unterlegenen in die Lage, trotz Widerstrebens die Entscheidung zu akzeptieren. Ein wichtiges Moment kommt freilich noch hinzu: Der nach der Entscheidung noch unentwegt und unbelehrbar Protestierende wird durch die anderen seiner Gruppe isoliert; er hat keine Chance mehr, mit seiner Ablehnung noch bei den anderen Gruppenmitgliedern, auf die es ihm ankommt, durchzudringen. Die soziale Sanktion, der er nun unterliegt, könnte der schwerere Teil der Urteilsfolgen sein. Diese Konstruktion setzt freilich eine mindestens „generalisierende Bereitschaft" voraus. Dafür ist ein soziales Klima unverzichtbar, in welchem „die Anerkennung verbindlicher Entscheidungen als Selbstverständlichkeit institutionalisiert" ist (Luhmann, 1978, S. 34). Luhmann kommt ohne den Gedanken nicht aus, daß die Legitimität i m politischen Bereich - er führt das beim Gesetzgebungsverfahren aus - durch allgemeines Systemvertrauen besser gestützt wird. Die Bindung
184
Edgar Michael Wenz
an das Urteil bedarf als Legitimationsbasis der „sinnvermittelnden Teilnahme", so wird die Geltungschance i m Gesetzgebungsverfahren vergrößert (1978, S. 193 ff.)· Die gleiche Wirkung bringt das Recht ins Gerichtsverfahren ein, nachdem dort, anders als i m Gesetzgebungsverfahren, die aktive Teilnahme ja Voraussetzung ist. „Vermutlich ist dies die heimliche Theorie des Verfahrens, daß man durch Verstrickung in ein Rollenspiel die Persönlichkeit auffangen, umbilden und zur Hinnahme von Entscheidungen motivieren könne" {Luhmann, 1978, S. 87). Dies ist also die psychologische Wurzel des Legitimations Vorganges. Niklas Luhmann beschreibt die einzelnen Stufen und Phasen aller Verfahren recht eingehend. Die individual-psychologische Wirkung des Verfahrens auf die Betroffenen bildet sich um zur sozialen Wirkung. Legitimierung des Rechts also durch Re-Integrierung des Gesetzesbrechers qua Einsicht, mag man verkürzt sagen. Die Randbemerkung ist nicht uninteressant, daß sich Niklas Luhmann sehr eingehend auch mit der Öffentlichkeit des Verfahrens beschäftigt; dies ist ja ein Erkenntnisobjekt der Rechtssoziologie. Bezeichnenderweise hat sich auch der Deutsche Juristentag 1982 in Nürnberg mit diesem aktuell gewordenen Thema beschäftigt - überdies i m Ergebnis schließlich wie Niklas Luhmann 1 1 . Allerdings sind mit diesen Erkenntnissen die Probleme höchstens angeschnitten, die sich für die Zielsetzung dieser Arbeit gezeigt haben. Niklas Luhmann hat das individuelle Verfahren beschrieben und analysiert und daraus die sicherlich richtigen Ableitungen gefunden. Aber die Verfahren, die in Zusammenhängen mit beispielsweise der Großtechnologie oder schlechthin mit Gift, Gen und Kernkraft zu tun haben, sind selbst dann, wenn nur ein einziger Kläger erschiene, Massenverfahren. Darunter kann man alle jenen Verfahren verstehen, die sich entweder - in Prozeßstoff, Klagegrund und Ansprüchen - einigermaßen vergleichbar am gleichen oder an anderen Gerichten wiederholen; oder Verfahren, bei denen eine große Anzahl von Klägern oder Beklagten oder i m Strafverfahren Angeklagte auftreten, ohne nun „große Anzahl" numerisch definieren zu wollen; oder Verfahren, an denen eine größere, nicht genau bestimmbare Öffentlichkeit, ohne Prozeßbeteiligte zu sein, direktes oder zumindest überdurchschnittlich indirektes Interesse zeigt, nicht also nur unterschwellig und mehr gelegentlich sich dafür interessiert, sondern reges und erkennbares Interesse nach außen darstellt. Daß es über Massenverfahren keine (rechts-)soziologischen Erkenntnisse gibt, der Begriff bislang noch nicht einmal untersucht oder erst recht definiert ist, zeigt die j a unbestrittene Tatsache, daß dieses Phänomen Gesellschaft und Rechtspflege eigentlich unvorbereitet getroffen hat. Die juristischen Voraussetzungen sind gegeben, so die Vorschriften der §§ 17 ff. V w V f G , die die Vertretung vor der Verwal11 Aus den Materialien zum DJT (Gutachten C, Heinz Zipf) läßt sich nicht erkennen, daß den Teilnehmern gegenwärtig war, dies wäre ein rechtssoziologisches Thema, das schon mehrfach literarisch aufgetaucht war. Die Öffentlichkeit des Verfahrens war schon Gegenstand des DJT 1957.
Die Akzeptanzkrise als Legitimationskrise
185
tungsbehörde bei gleichförmigen Eingaben von mehr als 50 Personen regeln. A u f diesem Grundgedanken stützen sich auch die Massenverfahren vor dem Verwaltungsgericht 12 . Auch die Verbandsklage 13 gehört in diesem Sinne zu den Massenverfahren. Es handelt sich dabei um verfahrensrechtlich gewiß wertvolle Hilfen, wohl i m Sinne einer Vereinfachung, oder aus dem Ideengut der Rechtsstaatlichkeit; sie sind aber nicht geeignet, an unser soziologisches und rechtspolitisches Problem heranzuführen 14 . Bei Massenverfahren ist die Gefahr aufkommenden Mißtrauens besonders groß 1 5 . Es sind nun schüchterne Reaktionen bekannt geworden, die den nun schon einigen Jahren zu beobachtenden Aktionen folgen sollen. Nun scheint es zunächst nötig zu sein, die psychologischen und soziologischen Erscheinungsformen des Massenverfahrens sich näher anzusehen, zu beschreiben und zu analysieren - eine spezifisch rechtssoziologische Aufgabe, die ihr mit Unterstützung der Sozialpsychologie gestellt werden muß, oder sich selbst stellen müßte. Gewiß können parallel schon Überlegungen anlaufen, wie man diese für die Rechtspflege schädlichen Erscheinungen mildern oder gar auflösen kann, etwa durch von vorneherein größere Beteiligung der Öffentlichkeit schon in den Phasen der Vorentscheidung oder gar erst Meinungsbildung. M i t dem Ziel, die Genehmigungsverfahren für Kernkraftwerke zu beschleunigen, w i l l man die „Bürger-Beteiligung" verstärken, und zwar nicht nur mit dem Ziel der frühzeitigen Unterrichtung der Bürger durch die Behörde, sondern um den Rechtsschutz des einzelnen gegenüber der planenden Behörde „vorzuverlagern". Erklärtes Motiv: „Die Kernenergie darf dem Bürger nicht übergestülpt werden" 1 6 . Ob sinnvolle Maßnahmen gefunden werden können, ohne sich grundlegend mit den Problemen des Massenverfahrens zu beschäftigen, muß freilich in Zweifel gezogen werden 1 7 . 12 Neue Literatur zu diesem Thema: J. Meyer-Ladewig, in: NVwZ 82, S. 349 ff.; Michael Gerhardt und Ρ Jacob, in: DÖV 82, S. 345 ff.; Johann Schmidt, in: DVB1. 82, S. 148 ff.; H. Sendler, in: DVB1. 82, S. 812 ff. (819). 13 Wagner, Krech, Die Mitwirkung von Verbänden im atomrechtlichen Genehmigungsverfahren. Zur Frage der Verbandsbeteiligung im Verwaltungs- und Verwaltungsgerichtsverfahren, in: atw 1978, S. 18 ff.; dort wird auch empfohlen, statt der Verbandsklage die Einbeziehung der Beteiligten in die Entscheidungsfindung zu verstärken. 14 Rechtssoziologische Ansätze bietet Victor Henle (1981, S. 1 ff.); er unterscheidet dort die Vormasse, Planmasse, Beteiligungsmasse, Entscheidungsmasse und die Nachmasse, mitden jeweiligen Differenzierungen nach dem Stand des Verfahrens oder nach Interesse der „Klagemasse". 15 Michael Gerhardt, 1982, S. 489 ff. (Anm. 37). 16 So der Bundesinnenminister vor dem Kabinettsausschuß für die friedliche Nutzung der Kernenergie („Nuklearkabinett"); Tagespresse, so F.A.Z. vom 15. 10. 81. 17 Siehe dazu auch Projekt „Die Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Genehmigung von umweltrelevanten Großvorhaben - Rechtliche Grundlagen und praktische Erfahrungen", Verwaltungshochschule Speyer (noch unveröffentlicht). In Ziff. 4 des Forschungsvorhabens soll geprüft werden, ob die verstärkte Einbeziehung der betroffenen Bürger in das Verfahren die Akzeptanz getroffener Entscheidungen erhöht hat, allerdings unter Ausklammerung der Probleme der allgemeinen Technologieakzeptanz. Es ist schwer zu erkennen, wie das verwirklicht werden soll.
186
Edgar Michael Wenz
IV. Der Weg zur „Technologiefachkammer" Wenn wir zur Erkenntnis gekommen sind, daß das soziale Verfahren nicht nur eine sedierende und stabilisierende Funktion hat, sondern - in Anlehnung an Niklas Luhmann - legitimierend wirkt, dann liegt nichts näher, als eben dieses Verfahren auf sein ganzes Potential hin abzuklopfen und zu untersuchen. Alles muß getan werden, was zu einer Befriedung, was zur Rechtssicherheit und was zum Erhalt dieses Rechtsstaates beizutragen geeignet ist. Alles muß vermieden werden, was die Basis dieses Staates und den Grundkonsensus erschüttern könnte. Es müßte also ein besonderes, ein qualifiziertes Verfahren gefunden werden, das auf die anstehenden Probleme ausgerichtet ist. Die Institution Verfahren kulminiert in der Institution des Gerichtes, das die funktionale Institution gewissermaßen gegenständlich verkörpert. Wenn man nun die Möglichkeiten ausleuchten will, muß man konkreter werden: Zunächst einmal ist zu reduzieren auf die Großtechnologie, auf die sich jetzt die Untersuchungen konzentrieren sollen. Die Großtechnologie ist abgedeckt durch die Begriffe Giftstoffe und Kernkraft. Die Sorge und die Bedenken wachsen aus der gleichen Wurzel: der Umweltgefährdung, die Umweltschutz verlangt. Die meisten Angriffe richten sich ja gegen die Kernkraft, die für die ganze Technologie gewissermaßen die „Stell vertreterrolle" (Wagner, 1980a, S. 270) übernehmen mußte. M i t diesen Problemen beschäftigen sich auch die Vorschläge, die man mit dem Begriff „Wissenschaftsgerichtshöfe" („Science Courts") umschreiben kann. Es sind dazu schon eine Reihe von Vorschlägen und auch Versuche in den verschiedenen Rechtskreisen unternommen worden. Das war ja Gegenstand des Artikels von Meinolf Dierkes und Volker von Thienen „Science Court - ein Ausweg aus der Krise?", der die Diskussion ausgelöst hat (Siehe Wenz (Hrsg.) Wissenschaftsgerichtshöfe. Mittler zwischen Wissenschaft, Politik und Gesellschaft, 1983, S. 11 ff.). Von insgesamt fünf vorgestellten „Modellen zur Lösung der ,Akzeptanzkrise'" müssen bei den weiteren Überlegungen alle jene Modelle ausscheiden, die nicht der Entlastung der Rechtsprechung dienen, also nicht als „Gerichte" in einem einigermaßen generalisierbaren Verständnis zu definieren sind. So können weder die „Royal Commission", die primär dem Parlament; das „Forscherparlament", das nur dem Parlament; noch die „Science Court Modelle I und I I " , die Regierung und Parlament zuarbeiten und diese entlasten sollen, die Kriterien eines Gerichts in diesem Kontext erfüllen. Dem Wissenschaftsgerichtshof oder Science Court stünden unüberwindbare verfassungsrechtliche Bedenken entgegen, wenn hier gewissermaßen ein wissenschaftlich-technisches Bündnis der drei Gewalten miteinander und untereinander eingegangen werden soll. Die Mißachtung einer strengen Gewaltenteilung - hier ganz abgesehen davon, daß das Bundesverfassungsgericht hierzu mehr als nur ein Wörtchen zu sagen hätte! - würde auf Dauer größere „Akzeptanzkrisen" auslösen als jene nur gegenüber der Großtechnologie, die nun überwunden werden soll. Etwas ganz anderes ist es freilich, auf welche Weise sich
Die Akzeptanzkrise als Legitimationskrise
187
die Legislative und Exekutive sachkundig machen wollen und können. Dies ist notwendig, dies muß sogar geschehen. Es ist dabei auch gleichgültig, welche Wege dazu beschritten werden, ob etwa die gesetzgebenden Körperschaften EnquêteKommissionen einberufen und Hearings veranstalten; ob sich die Verwaltung Gutachten beschafft oder Techniker und Naturwissenschaftler bestellt; ob größere Gremien eingesetzt werden, die nach etwa Parlamenten abgeguckten Regeln verfahren und Voten mehrheitlich abgeben. Dies alles ist unbenommen, dies alles ist nicht die Frage. Alles dies, was auf den verschiedenen Wegen hervorgebracht wird, sind nichts anderes als Empfehlungen. Aber es sind keine Rechtssprüche, die i m Gleichgewicht der Gewalten von der dritten Gewalt ausgehen. Diese Macht kann nur Gerichten zustehen. Nichts anderes soll man auch mit diesem Begriff verbinden. Kein anderer wiegt mehr. Man kann durchaus konzedieren, daß Entscheidungen des Parlaments, also Gesetze, und der Verwaltung, also Verwaltungsakte, eher akzeptiert werden und weiter tragen, wenn diese erkennbar mit besonderer Sorgfalt vorbereitet worden sind. Ein institutionalisiertes Verfahren - sagen wir einmal exemplarisch in einem „Forscherparlament" - wird nach menschenmöglicher Voraussicht positive Wirkungen haben. Man sollte durchaus solche Überlegungen und Untersuchungen anstellen. Dies ist ein recht interessanter Komplex, der große Aufmerksamkeit verdient. Er sollte weiterverfolgt werden. Aber nach dem Verständnis- und dem Erkenntnisziel dieser Arbeit geht es um die Möglichkeiten des Gerichtsverfahrens i m engen Sinne. Dort nämlich, konkret bei den Verwaltungsgerichten, liegt zunächst der Schlüssel. Dort wird er auch künftig zu suchen - und hoffentlich auch zu finden sein. Es bedarf keines besonderen Wagemutes zu prognostizieren, daß künftig wieder zunehmend die Probleme mit der Großtechnologie bei den Gerichten förmlich aufprallen, von diesen Lösung und Klärung oder die Wiederherstellung des Rechtsfriedens gefordert wird. Der Institution Gericht gehört die Aufmerksamkeit dieser Arbeit. Das bedeutet aber ganz und gar nicht - in vielen Passagen dieser Arbeit wurde es und wird es nachdrücklich gesagt - , daß die Akzeptanzkrise vorrangig eine Rechtskrise sei; daß nur mit rechtlichen oder gar nur prozessualen Mitteln eine Lösung erwartet werden dürfe. Dieser Weg ist einer von mehreren möglichen. Diese Arbeit beschäftigt sich einzig und allein mit diesem juristischen Weg. Und sie beschränkt sich zudem noch auf einen ganz bestimmten Weg, wenn man so will: auf einen Pfad. Das Gericht, dessen Form erarbeitet werden soll, ist durch die gleichen Merkmale gekennzeichnet, von denen ein jedes Gericht getragen wird: Das Gericht spricht Recht, indem es zwischen mindestens zwei Alternativen entscheidet; es verleiht individuellen Rechtsschutz gegen Verwaltungshandeln; es schafft Rechtssicherheit; es stiftet Rechtsfrieden; es gibt verläßlich an, was ab heute Rechtens sein soll. Diese Aufgaben und Funktionen erfüllt aber ein Gericht nicht nur, weil hinter ihm der Büttel der Staatsgewalt steht, die Amtspersonen des Strafvollzugs und der Vollstreckung. Man muß und darf vielmehr davon ausgehen können, daß das Gericht Vertrauen verdient und Autorität genießt.
188
Edgar Michael Wenz
Wenn aber Gericht und Verfahren das Potential der Legitimierung, nicht nur der Legalisierung, haben, dann muß - angesichts der drohenden Gefahren für den Staat und die Gesellschaft - alles erwogen werden, was es an qualifizierten Möglichkeiten gibt, um qualifizierten Gefährdungen begegnen zu können. Und hier bietet sich eben der Wissenschaftsgerichtshof als neue Form in einem anderen Verfahren an wenigstens zur Prüfung. Die Erfordernisse zur Auflösung der Akzeptanzkrise durch Wissenschaftsgerichtshöfe - verstanden also i m Sinne von Gericht, der Trägerin der dritten Gewalt - erfüllt nur das fünfte der von Meinolf Dierkes vorgestellten Modelle, das „Science Court Modell I I I " . Seine Wesenszüge: „Verhandlung spezieller wissenschaftlich-technischer Themen vor einem ordentlichen und spezialisierten Gericht". Ausdrücklich soll die Rechtsprechung mit ihm entlastet werden. Dierkes beschreibt auch die weiteren Merkmale: Erfahrungen damit liegen noch keine vor - anders als mit der Royal Commission, die schon in Großbritannien, und dem Forscherparlament, das in Schweden versucht wurde, ebenfalls des Science Court Modells I, das sich an Regierung und Parlament wendet und für das auch schon Erprobungen in den USA durchgeführt wurden; die Verwirklichung kann unverzüglich erfolgen, die Entlastung der Gerichte würde sofort greifen können. Dieses Science Court Modell I I I kann man auch begreifen als eine Fachkammer für Angelegenheiten der Großtechnologie bei den Verwaltungsgerichten („Technologiefachkammer"). Dieser Begriff soll nun auch an die Stelle jener von Wissenschaftsgerichtshof oder Science Court treten. Er ist semantisch nicht so hoch aufgehängt; und er stammt aus unserer Rechtssprache. Allen Modellen aber ist etwas gemeinsam, das bei der eben vorgestellten Technologiefachkammer am ehesten „geglaubt" wird. Ich darf dabei daran anschließen, was ich schon in meinem ersten Beitrag (Siehe Wenz, a.a.O., S. 65) gesagt habe: Der „Science Court" ist in allen seinen Modellen als „Mittler zwischen Wissenschaft, Politik und Gesellschaft" konzipiert, nicht als „Heiliges Offizium" oder als eine Art wissenschaftlich-technologisches Kardinalskollegium, das in eschatologischen Fragen mit Anspruch und Wirkung eines Dogmas richten wollte. Das wäre eine Schreckens vision für einen jeden, zumal für Naturwissenschaftler, die sich für die Begrenztheit und Vorläufigkeit ihres Wissens j a selbst die Beweise liefern. Kein Wissenschaftsgerichtshof wird ex cathedra verkünden können und sollen, was nun naturwissenschaftlich „wahr" ist und was nicht. Eine Technologiefachkammer, die sich in unsere Gerichtsverfassung integriert, wird am wenigsten einem solchen Verdacht ausgesetzt sein. Auch die Technologiefachkammer als das Science Court Modell I I I ruht wie alle anderen Modelle auf dem entscheidenden Grundgedanken der Einbringung qualifizierten Sachverstandes in eine Entscheidung - hier einer Gerichtsentscheidung - als Ausdruck einer konstitutionellen Gewalt, gestützt auf die Macht des Staats. Aber es knüpft sich daran noch eine entscheidende Hoffnung, daß der qualifizierte Sachverstand, der in den Richterspruch eingebracht wird, Vertrauen erweckt, das Legitimation schafft. Das ist zu untersuchen. Gefragt ist ein Verfahren und ein dieses Verfahren gestaltendes und es
Die Akzeptanzkrise als Legitimationskrise
189
begründendes Gericht, von dem Urteile mit besonderer'„Qualität" erwartet werden, um der besonderen „Qualität" der Akzeptanzkrise zu begegnen. Es ist freilich gut, von vorneherein von einer Rechtsordnung ausgehen zu können, deren Gerichte und Gerichtsverfahren sich bewährt haben. Das Gerichtswesen funktioniert in diesem Staate, und zwar mehr als nur im großen und ganzen. Diese Feststellung steht keineswegs der Beobachtung entgegen oder hebt sie gar auf, daß wir gleichzeitig von einer Akzeptanzkrise des Rechts ausgegangen sind. Eine Festung, die beschossen wird, ist und bleibt eine Festung, solange sie nicht fällt. Aber auch trutzige Mauern geben keinen Freibrief, Anstürme nicht abwehren zu müssen. Daß man über das Ausmaß des Vertrauens, das Gericht und Gerichtswesen bei der Bevölkerung genießen, auf Vermutungen und spontane Beobachtungen angewiesen ist, zeigt ein weiteres mal die Absenz der empirischen Rechtssoziologie. Derartigen sozialen Fakten hätte sie sich schon lange nähern müssen, ohne daß freilich die Untersuchungsmethoden auf Personen oder das „Sozialprofil" der Richter-Personen hätten reduziert werden dürfen. Die Person des einzelnen Richters tritt zunächst zurück hinter die Institution des Gerichtes. Die Person des Richters oder der Richter tritt erst hervor, dann allerdings meist gleich ins Rampenlicht, wenn sich soziale Abweichungen von der juristischen Auffassung des Gerichtes in einer auffallenden Stärke artikulieren können. Die Schutzbestimmungen für den Richter, insbesondere seine nur bedingte Abrufbarkeit oder die unzulässige Ab- und Versetzbarkeit der Berufsrichter, gewinnen j a auch erst an Bedeutung i m pathologische Falle, wenn der Richter in eine dienstliche oder persönliche Krise geraten ist. Wenn man davon ausgeht, daß der Richter ein besonderes soziales Ansehen genießt, so basiert das vor allem auf einem Grundkonsensus, der mit unserem Verfassungsverständnis zu tun hat. Richter personifizieren die Gerichte, die ein wesentlicher Teil des Systems sind. Käme man zu einem anderen Ergebnis, bräuchte man sich den Kopf nicht mehr zu zerbrechen, welche Gerichtsformen und welche Verfahrensweisen legitimierende Wirkungen haben könnten. Fiele die dritte Gewalt und fielen die Richter in ihrem Ansehen, so verfiele der Staat. Diese grundsätzliche positive Einschätzung von Gericht und Richtern könnte zu einem Zwischenergebnis führen, daß diese dann eigentlich für jedes Gericht zutreffen müßte, es also gar keiner anderen Formen und Verfahren bedürfe. Der Einwand läßt sich hören. Er, dazu verständliche Zurückhaltung und konstitutionelle Zähigkeit, haben auch verhindert, daß man über schüchterne Diskussionsansätze überhaupt hinausgekommen ist. Man scheint zufrieden, wie es ist. Die zögernde Diskussion der Wissenschaftsgerichtshöfe findet seine - bewußte oder auch nur latente - Begründung darin, daß Recht und Richten, ein Entscheiden unter zwei Alternativen mit Rechtskraft, sich gar nicht vertragen kann mit dem Begriff von Wissenschaft, für die Offenheit ein unverzichtbares Merkmal ist. Solche Bedenken aber, so verständlich sie an sich zunächst wären, sind in diesen Zusammenhängen - das wurde schon dargetan - völlig unbegründet. Mehr noch: Ich bin
190
Edgar Michael Wenz
frei von der verwegenen Hoffnung, daß Wissenschaftler als Richter „mehr" Wahrheit kännten oder „besseres" Recht sprächen als etwa die konventionellen Gerichte. Das ist kein Zynismus, sondern demütige Einsicht in die Begrenztheit menschlichen Wissens, wenn nicht „mehr" Wahrheit und „besseres" Recht erwartet wird. Was soll dann aber dieser mit Wissenschaftlern und Technikern besetzte Wissenschaftsgerichtshof von herkömmlichen Gerichten unterscheiden? Die bisher vorgetragenen Gedanken lassen schon die Antwort erkennen: mehr Vertrauen durch größere Autorität, die der Sachverstand verleiht; mehr Vertrauen vielleicht auch durch jene Elemente, die das Laienrichtertum historisch zur Bedeutung haben anwachsen lassen. Bevor man untersuchen kann, inwieweit die Hoffnungen einer vermehrten Akzeptanz von Urteilen eines in besonderer Weise qualifizierten Gerichtes tragen und wie sie überhaupt begründbar sind, muß man sich wenigstens in Umrissen damit beschäftigen, wie diese Technologiefachkammer organisiert sein soll. Nach meinen Vorstellungen ist das Gericht - wie schon der Name sagt, eine Fachkammer beim Verwaltungsgericht - zunächst ein ganz „normales" ordentliches Verwaltungsgericht, das j a ohnehin auch mit Laienrichtern besetzt ist (§§ 5.3, 9.3 VwGO). Ob diese Technologiefachkammer personal anders, also mit insgesamt mehr Richtern, ausgestattet sein soll; ob ein bestimmtes Verwaltungsgericht für mehrere Gerichtsbezirke ausgewählt und für zuständig erklärt wird - alle diese Dinge sind gewiß in der Feinabstimmung wichtig, die richtige Entscheidung mag auch Erfolg oder Mißerfolg beeinflussen - aber doch sind bei den grundsätzlichen Erörterungen alle diese Fragen von durchaus untergeordneter Bedeutung. Alle diese Einzelheiten lassen sich ohne Schwierigkeiten so oder auch anders regeln. Für die Einrichtung einer solchen Technologiefachkammer genügt ohnehin nur ein einfaches Gesetz. Alle Werte, Rechtsideen und Normen, die unsere Rechtsordnung tragen, bleiben, vom Prinzip bis ins Detail, von der Institutionalisierung einer solchen Fachkammer ganz und gar unberührt. Dies und noch der Umstand, daß die Verwirklichung, eben durch ein einfaches Gesetz, relativ leicht und schnell geschehen könnte, sind ganz wichtige Gesichtspunkte, die man durchaus an den Anfang der Erörterungen stellen darf. Auch das unterscheidet dieses Modell von allen anderen, die jemals angeboten und diskutiert worden sind. Das Kollegialgericht setzt sich zusammen aus Berufsrichtern und Laienrichtern i m Sinne des §§ 44, 45 DRiG. Der Begriff des Laienrichters oder ehrenamtlichen Richters muß zunächst eingeführt und beibehalten werden, obwohl er eine Umwertung oder doch zumindest eine ganz entscheidende Präzisierung, die qualitativen Charakter hat, erfahren muß. Alle Richter sind, wie das unsere Rechtsordnung auch nicht anders kennt, gleich entscheidungsberechtigt. Der Begriff Laienrichter oder ehrenamtlicher Richter ist insofern richtig, weil Wissenschaftler, das heißt also Naturwissenschaftler und Techniker, zwingend dazu berufen werden müssen; diese sind nun i m Sinne des Deutschen Richtergesetzes
Die Akzeptanzkrise als Legitimationskrise
19
keine Juristen mit der Befähigung zum Richteramt, sind also juristische „Laien". In gleicher Weise sind sie „ehrenamtlich" tätig, weil bewußt die feste Bindung an die Justizverwaltung vermieden werden soll; sie sind also keine Berufsrichter. Das muß aber keineswegs besagen, daß die Tätigkeit nur mit Aufwandsentschädigung als eine Art „Richter-Ehrensold" ausgestattet zu sein braucht. Darauf wird noch zurückzukommen sein. Das Wort „Laienrichter" kennt die deutsche Gesetzessprache nicht (mehr). Die §§ 44, 45a D R i G haben die Bezeichnung „ehrenamtliche Richter" eingeführt (mit den Fachbezeichnungen Schöffe und Handelsrichter). Trotzdem wird überwiegend in dieser Arbeit von Laienrichtern die Rede sein, weil es mehr um rechtssoziologische und rechtspolitische Erkenntnisinteressen, aber nicht um streng juristische geht, die die Übernahme der korrekten Terminologie erforderlich machen würden. „Laie" sagt uns in diesem Kontext mehr als „Ehrenamt". (Wenn beide Begriffe verwendet werden, so braucht das von vorneherein keinen sinnhaften Unterschied zu machen.) Unsere Rechtsordnung kennt nun eine Reihe von Laienrichtern, die zum Teil verwandte Merkmale aufweisen: Für alle Richter gilt der Grundsatz, daß sie ehrenamtlich tätig sein müssen; freilich gilt das nicht für die technischen Mitglieder des Bundespatentgerichtes, die keine Juristen, gleichwohl aber Berufsrichter sind. Handelsrichter wiederum müssen sachkundig sein; Laienrichter an Sozial- und Arbeitsgerichten bestimmten Gruppen angehören, um deren Gruppeninteressen wahrzunehmen, aber auch gleichzeitig spezifische Kenntnisse einzubringen. Wenn wir also auf Präjudizien angewiesen wären, was wir aber nicht sind, so gäbe es wirklich keine Schwierigkeiten, eine faktische und historische Begründung für eine Fachkammer zu finden, der neben Berufsrichtern gleichrangig Naturwissenschaftler und Techniker angehören. Die Erfahrungen, die wir mit dem Laienrichtertum haben machen können, müssen in weitere Überlegungen einfließen.
V. Das Laienrichtertum - Gefahr oder Nutzen? Es muß die Frage vorangestellt werden, was von einem solchen „gemischten" Gericht - nennen wir das Kollegialgericht der Einfachheit halber einmal so - erwartet wird. Daran kann man dann messen, was man wirklich, also i m rechtssoziologischen Sinne, erwarten darf. Ein Blick auf Geschichte und Theorie des Laienrichtertums müßte wertvolle Aufschlüsse geben können, vorrangig bei unserem Erkenntnisziel, ob ehrenamtliche Richter, pointiert also Nicht-Juristen, Vertrauen in die Rechtsprechung erzeugen oder steigern könnten. Besser und aussagekräftiger wären gewiß empirische Forschungsergebnisse der Rechtssoziologie dazu, diese aber fehlen. Dies wird auch bei den Autoren der jüngeren Zeit gesehen und bedauert (So Rügeberg, 1970, S. 218). Zunächst einmal muß der klassische Begriff des Laien schärfer abgegrenzt werden, auch wenn darunter in diesen Zusammenhängen immer juristische Laien - i m
19
Edgar Michael Wenz
Gegensatz zu Juristen mit Befähigung zum Richteramt - gesehen worden sind. Die Bezeichnung „ehrenamtliche Richter" greift auch nicht, weil man von Naturwissenschaftlern und Technikern kaum erwarten darf, daß diese für Aufwendungen, wie sie bisher Laienrichtern erstattet wurden, tätig werden. Eher empfiehlt sich die Einführung des Begriffs „Experten-Richter", so angreifbar dieser auch grammatisch sein mag. Aber damit soll ausgedrückt werden, daß naturwissenschaftliche und technische Fach- und Sachkundige besonderen qualitativen Zuschnitts berufen sind. Die Assoziation zum Zivilgericht der Kammer für Handelssachen ist offensichtlich, wo Kaufleute oder gesetzliche Vertreter einer juristischen Person des Handelsrechtes als „Handelsrichter" Berufsrichtern „vollwertig" beigegeben werden 1 8 . Wendet man diesen Grundgedanken auf den Verwaltungsgerichtshof an, so ist man der Technologiefachkammer sehr nahe. Allerdings mit dem recht wichtigen Unterschied, daß an die Fach- und Sachkunde der Experten der Technologiefachkammer besondere Ansprüche gestellt werden müssen. Ein so einfaches Verfahren, wie es beispielsweise bei Handelsrichtern durch Vorschlag der zuständigen Industrie- und Handelskammer gehandhabt wird, ist - abgesehen davon, daß es ein Pendant für Wissenschaft und Technik gar nicht gibt - nicht vorstellbar. Darauf muß man zurückkommen. Das Schwergewicht der Fragestellung liegt aber nach wie vor auf dem Entscheidungsrecht und der Entscheidungspflicht von Nicht-Juristen und den damit gemachten Erfahrungen. Insoweit läßt sich die Frage, ob der Experte als Richter Gefahr oder Nutzen für das Rechtswesen und die Gesellschaft bringt, durchaus generalisieren mit der Frage nach Gefahr und Nutzen des Laienrichtertums schlechthin; aus dieser Perspektive ist auch das Expertenrichtertum nichts anderes als Laienrichtertum. Eine historisch-genetische sowie systematisch-theoretische Betrachtung des Laienrichtertums muß Parallelen erkennen lassen, die eine Analogie auf das gesteckte Erkenntnisziel des Experten als Richter zulassen. Die rechtsgeschichtliche und rechtstheoretische Literatur ist allerdings nicht gerade reich 1 9 . Der Laienrichter ist 1848 in der Strafrechtspflege, als Geschworener und dann als Schöffe, in den deutschen Rechtskreis zurückgekehrt, von England über Frankreich kommend, wo er Jahrhunderte zuvor den umgekehrten Weg nahm 2 0 . Der Gedanke der Rechtspflege durch das Volk hat sich im deutschen Rechtskreis erst zu Beginn des 16. Jahrhunderts, nach der Rezeption des römischen Rechts und dem 18 § 109 GVG; Sachkunde wird auch verlangt für die Beisitzer der Landwirtschaftsgerichte, und, im weiteren Sinne, bei den Jugendschöffen. 19 Siehe dazu Axel Görlitz, 1972, S. 265 ff.; dort auch, S. 269, Literaturnachweis, der überwiegend historisch orientiert ist. Nicht anders ausgewiesene Zitate folgen Görlitz. 20 Dazu auch Eduard Kern, 1965, S. 111 ff. Kurzgefaßt Radbruch/Zweigert, 1980, S. 188 ff.; auch bei Rehfeldt/Rehbinder, 1978, S. 195 ff. Einen interessanten Überblick der geschichtlichen Entwicklung des Laienrichtertums bei Verwaltungsgerichten geben Karlheinz Liefekett, 1965, S. 3 ff.; Gerfried Schiffmann, 1974, S. 2 ff.
Die Akzeptanzkrise als Legitimationskrise
193
Vordrängen der italienischen Rechtsgelehrsamkeit, in eine Gerichtsbarkeit für das Volk gewandelt. Das gegen das Juristenrecht nicht nur latent vorhandene Mißtrauen der Bevölkerung wurde i m aufstrebenden Bürgertum, insbesondere in der Restaurationszeit, gerade auch durch die politischen Prozesse (Demagogenverfolgung, Burschenschafter), immer stärker, bis das Vertrauen vollends zerbrach. Man suchte individuellen Schutz gegen Richterwillkür und obrigkeitsverbundener Kabinettsjustiz in einer Gerichtsbarkeit, die durch freie, politisch und ökonomisch unabhängige Laienrichter, mit „Geschworenen", repräsentiert war. „Der Konstitutionalismus sah in der Schwurgerichtsbarkeit eine Garantie bürgerlicher Freiheit." Die Volkssouveränität meldete ihren Legitimationsanspruch an. Die Laienbeteiligung fand ihre „emanzipatorische" Begründung. In der Verwaltungsrechtspflege, wo sich i m vergangenen Jahrhundert auch das Juristenprivileg durchgesetzt hatte, sah man in der Beteiligung von Ehrenbeamten die Möglichkeit der Kontrolle und Beeinflussung, die dem Bürgertum vornehmlich gegen die traditionelle Herrschaft unerläßlich schien; so war auch am ehesten die Befriedigung der „realen Ansprüche der Steuerzahler auf Teilnahme am Staate" 0Gneist, zitiert nach Görlitz, 1972, S. 265 ff.). Die ökonomische Basis des Bürgertums war die hauptsächliche Grundlage für diesen Teilhabeanspruch („partizipatorisch"). Den Sinn einer Laienbeteiligung beispielsweise bei der Arbeitsgerichtsbarkeit sieht Görlitz richtig in der paritätischen Mitwirkung von Arbeitnehmern und Arbeitgebern, die Legitimität und Sachverstand des auf eine neuartige Konfliktstruktur der industriellen Gesellschaft gerichteten besonderen Rechtspflege. Die „Selbstbindung" der beteiligten Gruppen an das Herrschafts- und Gesellschaftssystem wächst. Diese Art einer Beteiligung an der Gerichtsbarkeit hat vorherrschend „integrative" Wirkung (Görlitz, 1972, S. 265 ff.). Emanzipation, Partizipation und Integration haben in der Zwischenzeit, so Görlitz, an Bedeutung verloren; der „emanzipatorische Impetus des Bürgertums" sei durch die Justiz selbst adaptiert worden. Die partizipatorische Begründung trug immer weniger, je mehr die Komplexität der modernen Industriegesellschaften zunahm und sie ihre Regeln auf Zweck- und Konditionalprogramme reduzieren mußte. Die Normen mußten also generalisiert und schematisiert werden, so konnte sie der Laie als Rechtsanwender „nicht kontrollieren und noch weniger an (ihnen) teilhaben." Die Kontroll- und Teilhabefunktion könne sich bestenfalls i m Vorfeld der Entscheidung entfalten, also bei der Tatsachenfeststellung. Das nun sei die Chance für den sachverständigen Laienrichter, an der gerichtlichen Willensbildung zu partizipieren. Und wenn er dann als Vertreter widerstreitender Interessen handelt, „dann wirkt dieser Beitrag auf die repräsentierten Gruppen selbstbindend und legitimierend (Integrationsfunktion)". Es muß untersucht werden, inwieweit diese Integrationsfunktion sich vom Laienrichtertum auf Expertengerichte übertragen ließe, dort - abgeschwächt oder verstärkt - wirkt. Von der Antwort muß die Bewertung des Expertengerichtes i m allgemeinen und der Technologiefachkammer i m besonderen abhängen. Fiele die 13 Gedächtnisschrift Wenz
19
Edgar Michael Wenz
Antwort negativ aus, so bräuchte man kein neues spezifisches und qualifiziertes Verfahren, also auch keine neue Form eines Gerichtes. Wären keine Unterschiede nach beiden Seiten zu erkennen, bliebe also ein i m wesentlichen unveränderter Sinn und Wert des Laienrichtertums erhalten, dann müßte man sich die neue Gerichtsform und das neue Verfahren trotzdem überlegen, und zwar ganz einfach deswegen, weil die Akzeptanzkrise so schwerwiegend ist, daß nichts unversucht zu ihrer Lösung oder wenigstens Aufweichung bleiben darf. Wären aber gar Vorteile zu erkennen, dann sollte kein Tag mehr verloren werden, der Erkenntnis die Tat folgen zu lassen. Wird ein Expertengericht überhaupt andere Funktionen leisten können als jedes andere Fachgericht? Und wenn ja, inwieweit werden die Funktionen des Expertengerichts von jenen des „normalen" Fachgerichtes abweichen, beispielsweise der Kammer für Handelssachen, die man i m deutschen Rechtssystem als durchaus bewährt ansehen kann? Die partizipatorische Funktion ließe sich bei einem Expertengericht klarer darstellen als beim verglichenen Fachgericht; das hängt schon mit der viel höher angesiedelten Fragestellung zur Technologie zusammen: die Teilhabe an einer der wesentlichen Entscheidungen unserer Industriegesellschaft ist ungleich bedeutungsvoller für die gesamte Gesellschaft als die Teilhabe an Streitsachen unter Kaufleuten. I m Thema allein liegt schon das Gewicht. Ob die Integrierungsfähigkeit eines Expertengerichts größer und stärker ist als jene eines anderen Fachgerichtes, ist offensichtlich auch wieder ein Ausfluß der Bedeutung der anhängigen Streitsache: Das Bundespatentgericht ist auch ein hochrangiges Expertengericht; von ihm sind aber kaum integrierende Wirkungen zu erwarten. Ob freilich die Voraussetzung für die Integrationskraft der Laienrichter für die von ihnen vertretenen Gruppe, z. B. der Arbeitnehmer in arbeitsrechtlichen Streitsachen, gegeben sind, darf bezweifelt werden. Naturwissenschaftler und Techniker sind nicht Angehörige einer Gruppe, mit der sich ein nennenswerter Teil der Bevölkerung identifizieren könnte. Sie könnten allerdings eher als Repräsentanten des größeren Teils der Rechtsunterworfenen gesehen und geschätzt werden, die normalerweise von dem häufig mysteriös und verschlungen scheinenden Weg im Justizbetrieb ausgeschlossen sind, gleichzeitig aber auch befähigt sind, den Juristen Paroli zu bieten. Hier wären Anklänge an ein emanzipatorisches Verständnis hörbar; dieses ist aber nun nicht mehr gerichtet gegen den Feudalherren von damals, aber nunmehr gegen die Repräsentanten und Statthalter der staatsbürokratischen Herrschaft; mit veränderten Adressaten, aber i m Sinngehalt wohl vergleichbar mit den historisch-legitimierenden Bestrebungen der Emanzipation, die nun wieder, in abgeschwächter Form freilich, ins Spiel kämen. Immerhin: Das Mißtrauen ist wieder da; es geschehen Dinge, die man nicht versteht; es werden Urteile zu diesen Komplexen gefällt, für die die Legitimation des Gerichtes bezweifelt wird, sei es wegen mangelnden S ach Verstandes oder sei es wegen irgendwelcher angeblich erkannter oder versteckter und undefinierbarer „Abhängigkeiten" - nicht anders und nichts anderes als vor fünf Generationen: Wiederbeleben der emanzipatorischen Funktion also? Aber nun nicht mehr gerichtet gegen den „Moloch Staat", dafür aber gegen den noch dräuender empfundenen „Moloch Wissenschaft und Technik"?
Die Akzeptanzkrise als Legitimationskrise
195
Während diese Erörterungen zu den Funktionen des Laienrichtertums von Bedeutung für unsere Untersuchungen sind, gilt das nur sehr bedingt für die Unterscheidungen, die von anderen Autoren getroffen wurden, die nur den rechtlichen und soziologischen Grund der Berufung in das Gericht zum Gegenstand haben. So trifft Gustav Radbruch eine Unterscheidung zwischen Volks- und Fachgerichten (1980, S. 191 f.); zu diesen kann dann noch kommen das Kriterium der Vertretung von Gruppeninteressen. Die Strafgerichte erfüllen die Voraussetzungen von „Volksgerichten". Hier werden alle Komponenten am deutlichsten sichtbar, die das Laienrichtertum getragen haben: der historische Hintergrund emanzipatorischer Bestrebungen; die normative Idee der Partizipation; die soziologische Wirkung der Integration. Dies läßt sich am eindrucksvollsten erklären am Beispiel eines Landes, wo das Laienrichtertum ein nicht wegzudenkender Bestandteil der Rechtspflege ist: den USA, wo die meisten älteren Amerikaner schon einmal Mitglieder einer Jury gewesen sind. „Diese Zeit ist ihnen nicht nur eine stolze und interessante Erinnerung: Sie haben dadurch Verhältnis für die Aufgaben der Rechtspflege erworben, denn in eigener Verantwortung richtend haben sie erlebt, wie schwer Richten ist. Auch haben sie Vertrauen zu ihren Einrichtungen gewonnen, denn sie sind mit dabeigewesen" (Rehfeldt/Rehbinder, 1978, S. 202) 2 1 . Bei den Fachgerichten wird in erster Linie die Einbringung von Sachkunde und Fachwissen gesehen. Aber nach meiner Meinung ist die Komponente der „Betroffenheit" nicht minder hoch einzuschätzen, jedenfalls in jenen Spruchkörpern, in die Laienrichter als Vertreter einer Gruppe, als Wahrer - und nicht nur Kenner ihrer Interessen entsandt worden sind, also vornehmlich bei den Arbeits- und Sozialgerichten, während bei der Kammer für Handelssachen für die Berufung von Laien der Gesichtspunkt der Fachkenntnis überwiegt. Die emanzipatorisch-konstitutionelle Funktion hat völlig an Bedeutung verloren. A n deren Stelle ist eher ein mehr „technisches" Element getreten, technisch im Sinne des Beherrschens einer Kunst, der Kenntnis einer Kunde, des Besitzes von Erfahrungen und der Verfügbarkeit besonderen Wissens. Alle diese Umstände und Eigenschaften durften bei den Volksgerichten nicht vorhanden sein. Besonderes Wissen und ungewöhnliche Kenntnisse wären für die Strafrechtspflege eine Belastung; nachteilige Schlüsse könnten daraus gezogen, falsche Erwartungen gehegt werden; unerörterte und gar nicht ausgesprochene Gründe könnten in die Entscheidung, stillschweigend und unentdeckt, eingehen. Aber genau dieses Wissen und diese Kenntnis ist bei den Fachgerichten - um des gleichen Zieles der Gerechtigkeit willen - gesucht und gefordert. In Übereinstimmung mit Günther Schmidt-Räntsch (1973, S. 844) findet Jörg Rüggeberg (1970, S. 197 f.) eine „unterschiedliche Typologie der ehrenamtlichen 21 Man sollte allerdings auch die Probleme nicht gering achten, die mit dem Jury-System im angelsächsischen Raum beobachtet werden. So „Ist das Recht nicht mehr so recht in rechten Händen? Presse kritisiert Geschworene. Heute nicht nur Bürger alter Vorstellungen der Jury.", in: F.A.Z. vom 30. 11. 82.
13
19
Edgar Michael Wenz
Richter", indem er differenziert nach dem „,Jedermann-Prinzip" (Vertreter dem Allgemeinheit in den Gerichtszweigen mit umfassender Zuständigkeit)", dem „ ,Interessensgruppen-Prinzip' (Zugehörigkeit zu bestehenden Gruppen als Voraussetzung für die Berufung)" und dem „Sachverstands-Prinzip", wo er speziell die Handelsrichter aufführt. Daß mit der Vorstellung von Expertengerichten nur das „Sachverstands-Prinzip" ziehen kann, ist einleuchtend. Aber auch der Gesichtspunkt der Vertretung der Allgemeinheit (abgedeckt durch das Jedermann-Prinzip), der ohnehin jenen der Vertretung von Gruppeninteressen verdrängt, läßt sich betrachten aus der Perspektive der Betroffenheit. In der Arbeits-, Sozial- und Dienstgerichtsbarkeit findet die Wahrnehmung von Gruppeninteressen ihren sichtbaren Niederschlag. Die Gruppeninteressen sollten aber eher als Betroffenheit gesehen und definiert werden. Und das führt weiter zu der Erkenntnis, daß angesichts der schwerwiegenden, möglicherweise epochalen Probleme mit Gift, Gen und Kernkraft Gruppeninteressen und somit eingrenzbare Betroffenheit sich verlieren muß. Von den Folgen eines richtigen oder wenigstens vertretbaren Urteils sind alle betroffen, auch die Juristen-Richter. In diesen naturwissenschaftlichen und technischen Streitsachen hat i m gewissen Sinne ohnehin ein Rollentausch stattgefunden: Die Juristen sind nun die L a i e n 2 2 . A m hilfreichsten ist die Arbeit von Fritz Baur (1968, S. 49 ff.). Diese Hilfe ist freilich nicht gewollt, denn Fritz Baur kommt zu einem total ablehnenden Ergebnis. Damit hat sich Jörg Rüggeberg auseinandergesetzt; er kam dabei zu modifizierten Resultaten, zu denen er - wegen des in dieser Arbeit schon mehrfach beklagten Mangels an rechtssoziologischen Forschungsergebnissen - jedoch zunächst nichts Abschließendes sagen konnte und wollte. Die bei Fritz Baur zur Ablehnung und bei Jörg Rüggeberg zu vorsichtiger, in der Tendenz positiver Beurteilung führenden Argumente verdienen eine eingehende Untersuchung vor dem Hintergrund der Technologiefachkammer, an die weder Fritz Baur noch Jörg Rüggeberg damals gedacht haben und an die sie auch gar nicht denken konnten. Ein Jahrzehnt sind in unserer schnellebigen Zeit ein beachtliches Datum geworden, in der technischer und gesellschaftlicher Wandel seine Konsequenzen fordert. Freilich müssen auch die Gedanken von Eduard Kern einbezogen werden; für ihn ist die Mitwirkung des Volkes an der Rechtsprechung durch die Laienrichter „selbstverständlich", nur die Frage nach dem richtigen Weg stelle sich (Kern, 1965, S. 115 f.). Das hat die Schriften von Fritz Baur und Jörg Rüggeberg ausgelöst. Deren Erkenntnisziel war j a die Prüfung, ob es richtig war, das Laienrichtertum als „bewährt" zu übernehmen; ob „die historischen Gründe, die zur Beteiligung der ehrenamtlichen Richter geführt haben, heute noch in gleicher Weise die Einrichtung des Laienrichtertums rechtfertigen" (Rüggeberg, 1970, S. 198). Die weitaus meiste Literatur befaßt sich, aus historischer Sicht verständlich, mit der 22 Hellmut Wagner hält es auch für die Aufgabe des rechtsanwendenden Richters, die „Sachverständigenaussagen wissenschaftlich-technischer Experten auf ihre Plausibilität und Schlüssigkeit zu überprüfen" (Wagner, 1980a, S. 273) - eine Aufgabe überdies, die man bei gemischten Gerichten sonst den Laienrichtern zugewiesen hat.
Die Akzeptanzkrise als Legitimationskrise
19
Strafrechtspflege, die Schöffen und Geschworenen als die „typischen" Laienrichter kennt. Die demokratische Funktion des Laienrichtertums nimmt den ersten Rang bei den Untersuchungen ein. Die emanzipatorischen Ideen der Französischen Revolution standen ja an der Wiege des Volksrichters. „Demokratisierung der Justiz" lautete bis in die jüngere Zeit eine Parole. Eine breite Resonanz in der Bevölkerung, von der offenbar Eduard Kern ausgeht, hätte für Fritz Baur legitimierende Wirkung; er vermißt sie aber, weil die Laienrichter nicht als Repräsentanten des Volkes aus dem Volk gewählt würden und das Volk die Laienrichter folglich auch nicht als seine Repräsentanten anerkennt. Auch Jörg Rüggeberg erwägt die Chance einer Legitimationserhöhung der Rechtsprechung durch ehrenamtliche Richter, sieht dies aber nicht als verfassungsrechtliche, sondern als eine rechts- und gesellschaftspolitische Frage an. Beide Autoren zitieren für ihre Bedenken den Satz von Beling (1928, S. 53): „ . . . das Volk zerbricht durch die Auslieferung der Justiz an Laienrichter seine eigenen Gesetzestafeln." M i t Görlitz bin ich der Ansicht, daß die emanzipatorische Funktion des Laienrichtertums durch die demokratischen Elemente bedeutungslos geworden ist. A n seine Stelle muß man die rechtsstaatliche Ordnung setzen; sie wird für die rechtmäßige Berufung der Expertenrichter sorgen können, deren Aufgabe j a nun auch dem Wesen des Rechts entsprechende klare Entscheidung keineswegs die Darstellung demokratischer Kompromißbereitschaft ist. Dem procedere der Auswahl von Experten wird man Aufmerksamkeit widmen müssen. Aber man darf jedenfalls festhalten, daß dem Laienrichtertum generell die Chance zumindest legitimationserhöhender Wirkung zuerkannt wird. Ein interessanter Untersuchungsgegenstand ist, ob das Motiv für die Einführung ehrenamtlicher Richter noch weitertragen kann, daß diese, anders als Berufsrichter, „unabhängig" wären; hier allerdings nicht zu verstehen als die sachliche Unabhängigkeit, also Weisungsgebundenheit gemäß § 45 DRiG, die selbstverständlich sein muß, sondern als soziale und ökonomische Unabhängigkeit. Diese verlangte Unabhängigkeit ist bei Laienrichtern beispielsweise der Strafrechtspflege nicht eigentlich interessant. Dagegen wächst diesem Thema bei der Verwaltungsgerichtsbarkeit Bedeutung zu, weil Berufsrichter schließlich Beamte sind, und in allen nichtrichterlichen, jedoch dienstlichen Belangen, beispielsweise Laufbahn, der Justizverwaltung unterstehen, insoweit also „abhängig" sind - eine Rechtsrealität mehr, die die Schwierigkeiten einer absoluten Trennung der drei Gewalten aufweist, die aber nicht nur hingenommen werden muß, sondern auch eigentlich hingenommen werden kann 2 3 . Es mag bei diesen Überlegungen die historische Entwicklung der 23 Siehe dazu Fritz Ossenbühl, 1980, S. 545 ff. Seine Auffassung von der „funktionsgerechten Organstruktur" erklärt er auch am Beispiel des Atomrechts, daß ein verfassungsgerechtes Gewaltenteilungssystem auch die effiziente Verteilung der Staatsaufgaben zu berücksichtigen habe (S. 549). Keine absolute Trennung der Gewalten, sondern die gegenseitige Kontrolle, Hemmung und Mäßigung („Organisations- und Funktionsprinzip") fordert auch das Bundesverfassungsgericht (BVerfGE 34, 52).
19
Edgar Michael Wenz
Verwaltungsgerichtshöfe eine Rolle spielen; diese sind j a aus einer verwaltungsinternen Kontrollinstanz hervorgegangen und über das Gedankengut der politischen Selbstverwaltung (Baring, 1955, S. 685 ff.) zu ordentlichen Gerichten geworden; die Paulskirchen-Verfassung 1848 (§ 182: „Die Verwaltungsrechtspflege hört a u f ) wollte, um der Sicherung der Unabhängigkeit willen, die Überprüfung staatlichen Verwaltungshandelns der ordentlichen Justiz übertragen. In unserem Rechtsstaat stellen sich diese Probleme für Berufsrichter nicht. Man kann eher Fritz Baur (1968, S. 55) zustimmen, daß „die einst beklagte wirtschaftliche Abhängigkeit des Berufsrichters vom Staat heute eine Wohltat" ist, weil „der beamtete Richter wenigstens nichts für die Grundlagen seines Lebensunterhaltes zu fürchten braucht, wenn er ein nicht ,genehmes' Urteil fällt". Für die Expertenrichter der Technologiefachkammer ist aus der Sicht der Unabhängigkeit weder ein steigerndes noch ein minderndes Argument zu erwarten. Daß sie von der Justizverwaltung unabhängig sind, wird sicher nicht schaden, freilich braucht es auch nicht zu nützen. Wirtschaftliche Unabhängigkeit kann man bei Experten beruflicher Reputation voraussetzen. Freilich darf man nicht übersehen, daß Wissenschaftler und Techniker unter einer besonderen Art von Abhängigkeit stehen könnten, die sich i m weiteren Sinne vergleichen ließe mit jener der Berufsrichter gegenüber der Justizverwaltung. Das könnte beispielsweise befürchtet werden, wenn ein Techniker, der in der Energiewirtschaft tätig ist, sich mit Fragen beschäftigen muß, die auf irgendwelchen Umwegen sein Haus berühren könnten. Keineswegs gering achten darf man auch ein gewisses Gebundensein des Wissenschaftlers an seine früheren literarischen Äußerungen, die man aber sicherlich nicht als Abhängigkeit definieren darf. Nun kann man freilich solche Einbindungen und Anbindungen als Vorbelastung scheuen, wie man die spezifischen Kenntnisse eines Experten aber genauso gut auch willkommen heißen kann; das Resultat wäre dann, daß Vorteile und Nachteile sich aufwiegen, und am Ende das bleibt, was schon am Anfang stehen muß: die integre Persönlichkeit auch des Expertenrichters, nur dem Recht und seinem Gewissen unterworfen. Aber hier läßt sich noch ein anderes Regulativ einsetzen, um nicht nur persönliche Konflikte für den Expertenrichter so gut wie möglich auszuschließen, sondern auch von vorneherein Verdächtigungen - die legitimierende Effekte ja total zerstören würden - gar nicht erst aufkommen zu lassen, zumindest weitestgehend zu minimieren: das Auswahlverfahren zur Berufung der Expertenrichter. Diese Frage verdient auch in diesem Zusammenhang noch besondere Beachtung. Es gibt aber noch andere Aspekte der Abhängigkeit, die schwerer wiegen können als wirtschaftliche: moralischer Druck von außen, dem Laienrichter sicherlich nur weit schwerer widerstehen können als Berufsrichter. Diese Probleme sind von Sensationsprozessen sattsam bekannt; der dadurch auf Laienrichter ausgeübte, zumindest latent zu befürchtende Druck ist so stark, daß i m amerikanischen Strafprozeß die Mitglieder der Jury häufig zwangsweise isoliert werden. Sensationsprozesse sind heutzutage aber nicht mehr auf Kriminalfälle beschränkt. Gerade die Verfahren in Sachen der Großtechnologie haben heute eine „Öffentlichkeit", die
Die Akzeptanzkrise als Legitimationskrise
19
jene von Kriminalprozessen bei weitem übersteigt; dementsprechend groß ist das Interesse der Massenmedien. Das multiplikatorische Potential von Presse, Funk und Fernsehen ist so groß, daß man schon von einer „Gewalt" gesprochen hat, die zu den institutionellen Gewalten der Legislative, Exekutive und Judikative getreten sei. Manche sehen in den Massenmedien sogar „die erste Gewalt i m Gefüge des demokratischen Verfassungsstaates" (Bossle, 1982, S. 257 ff.). Man kann gewiß geteilter Meinung sein, ob der Begriff der „Gewalt", der an sich von der Staatsrechtslehre besetzt ist und ihr auch vorbehalten bleiben sollte, nicht besser ersetzt werden sollte durch das nicht minder aussagekräftige Wort „Kraft". Sicher ist jedenfalls, daß die soziologischen Kräfte der Massenmedien eine gefährliche Wirkung auf Laienrichter ausüben könnten. Hier läge dann tatsächlich ein Angriffspunkt, der größte Beachtung verdient. Aber gleichzeitig zeigt sich hier eine Fähigkeit des Expertenrichters, die zur Schlüsselfunktion werden könnte. Funktioniert sie, so wäre das ein großes Gewicht. Ließe sich also der Expertenrichter von den Massenmedien nicht unter eine unerträgliche Pression setzen, so wäre diese gewichtige Frage bejaht. Es ist kein Grund zu erkennen, daß man Naturwissenschaftlern und Technikern geringeres Vertrauen in deren Widerstandskraft gegen äußere Einflüsse entgegenbringen kann als Berufsrichtern. Naturwissenschaftler und Techniker sind zu der gleichen geistigen Disziplin und Verantwortlichkeit erzogen, ausgebildet und darin geübt wie Juristen und Richter; sie sind schon i m Entscheidungsgang Kritik gewohnt; sie wissen, was auf sie zukommt. Man mag sich daran erinnern, wie das Laienrichtertum in herbe Kritik geriet, als man, im Zusammenhang mit dem Contergan-Prozeß, den enormen Einfluß der Massenmedien nicht übersehen konnte 2 4 . Man war vielfach der Meinung, daß Berufsrichter diesem Druck der „öffentlichen Meinung" - ohne allerdings je gefragt oder gar bewiesen zu haben - eher standgehalten hätten. Wenn man jetzt diese Frage für Expertenrichter aufnimmt, darf man bei diesen wohl die gleiche Standhaftigkeit - oder auch Anfälligkeit - annehmen wie bei Berufsrichtern. Es ist nicht zu erkennen, daß und warum eine juristische Ausbildung zur größeren Fähigkeit und Objektivität verhilft als eine naturwissenschaftliche und technische. Die Berufserfahrungen eines Richters mögen eine gewisse Routine verleihen; es ist aber schwer zu sehen, daß diese gegenüber Experten einen so großen Vorsprung und eine so große Überlegenheit verschaffen könnten, daß diese nicht aufholbar sein könnten. Irgendeine Unterlegenheit des Expertenrichters gegenüber den Berufsrichtern läßt sich jedenfalls nicht erkennen, noch nicht einmal mit böswilliger Tendenz krampfhaft konstruieren. A n dieser Einbruchsteile, wo sich Verteidiger des Laienrichtertums tatsächlich sonst schwer tun, sammelt der Expertenrichter - sogar zahlreiche - Punkte. Hierzu gehören auch die Bedenken, Laienrichter wären schließlich Berufsrichtern nicht gewachsen, so daß sogar eine numerische Überzahl ehrenamtlicher Rich24
Siehe dazu Johann Georg Reißmüller, 1962, der eine Vielzahl zustimmender und verneinender Zuschriften auslöste, überwiegend von Berufsrichtern.
0
Edgar Michael Wenz
ter gegen beamtete nichts ausrichten könnte. Letztlich nichts anderes als „angepaßte Ja-Sager" zu sein, werden Laienrichter immer wieder verdächtigt. Laien, jetzt freilich nur i m Sinne von Nicht-Juristen, hätten i m allgemeinen nicht die erforderlichen Fähigkeiten der Sachverhalts- und Tatbestandsanalyse; kännten nicht die Technik des Isolierens und Herauspräparierens der relevanten Probleme; besäßen nicht die Fähigkeit zur Abstraktion und zur logischen Deduktion - alles Einwände, die ernsthaft gegenüber Naturwissenschaftlern und Technikern nicht aufrechterhalten werden können, und schon ganz und gar nicht auf derem ureigenen Feld. Daß Nicht-Juristen Recht und Gesetz nicht kennen, mag man konzedieren, zumal dann, wenn es sich um konkrete Normen - etwa prozeßrechtliche Paragraphen - handelt (und nicht gerade um Generalklauseln, die j a gerade die Experten erst konkretisieren sollen). Die Laienrichter werden sich dann gewiß zurückhalten, die Juristen werden sich ihr Metier nicht streitig machen lassen. Weitere Kriterien, die mit dem Laienrichtertum untersucht und kritisiert werden: Die „Wächterfunktion"; die „Plausibilitätskontrolle" ÇRüggeberg, 1970, S. 208, 212), also Einwirkungen darauf, daß ein Urteil auch verständlich formuliert wird; eine Abschirmung gegen politische Kritik einer Rechtsprechung (.Baur, 1968, S. 60). Der Experten- statt des Laienrichters wird diese Funktionen, die allerdings auch beim Laienrichter schon generell bezweifelt waren, ohne Nachteile für die Rechtsfindung leisten können. Die Wächterfunktion und die Plausibilitätskontrolle werden durch den Sachverstand abgedeckt. Ob Urteile in technologischen Streitfällen plausibel, wenn man darunter „volkstümlich" verstehen sollte, sein müssen und überhaupt sein können, darf man bezweifeln. Aber sie sollten schon „einleuchtend" sein; daß staatliches Handeln diese Erfordernis nicht immer erfüllt, hat Ernst Benda i m Zusammenhang mit dem Urteil zur Volkszählung bedauert und Abhilfe für die Zukunft gefordert (vor dem Arbeitskreis norddeutscher Union-Juristen, F.A.Z. vom 25. 4. 83; Benda, 1983a). Von Laienrichtern könnte Interesse und Fähigkeit, sich „einleuchtend" zu artikulieren, erwartet werden. Freilich soll damit nicht gesagt sein, daß das Urteil eines Gerichtes, das auch mit Experten besetzt ist, weniger Schelte zu befürchten habe. Aber diese Probleme weisen bereits in eine andere Kategorie, die sich rational nicht so leicht erfassen läßt: zum Vertrauen in das Gericht und seinem Urteil. Sachverstand allerdings muß und kann dieses Vertrauen begründen und befördern. Der Vergleich der Argumente geht meines Erachtens zu Gunsten des Expertenrichters aus. Die i m großen und ganzen schon erkannte Bewährung des Laienrichters verdichtet sich beim Expertenrichter zu bemerkenswertem Gewicht. Das braucht auch nicht zu verwundern, weil hier schon längst die Brücke geschlagen ist zum Sachverstand, aus dem der Expertenrichter seine Kenntnisse und gewissermaßen auch seine „Gelassenheit" gegenüber Öffentlichkeit, Juristen und seiner wirtschaftlichen Existenz schöpft. Es überrascht keineswegs, daß die Einbringung von Sachverstand durch juristische Laien in Gerichtsverfahren und Gericht einhellig positiv gesehen und als auch
Die Akzeptanzkrise als Legitimationskrise
1
jetzt noch tragendes Element des Laienrichtertums geweitet wird. Axel Görlitz erachtet von den verlustiggegangenen Funktionen des Laienrichtertums nur noch die Partizipation verwirklichbar, aber nur durch sachverständige Laienrichter. Ansonsten ist für ihn das Laienrichtertum ein „Anachronismus" (Görlitz, 1970, S. 269, 306). Sinn kann er aber dem Laienrichter abgewinnen in „SpeziaiSpruchkörpern oder in speziellen Sachen als Sachverständige", dann aber „auch eher als Gehilfe des Richters" für die Tatsachenermittlung. Zu einem ähnlichen ablehnenden Ergebnis kommt Fritz Baur; aber auch er sieht die Vorteile der Sachkunde des ehrenamtlichen Richters, für die er „weitere Spezialgerichte" für „denkbar" hält (1968, S. 58.) Fritz Baur verweist auf die Notwendigkeit der Auslegung von Wertentscheidungen, nach denen der Gesetzgeber häufig „sich mit allgemeinen Klauseln begnügt" (1968, S. 61). Jörg Rüggeberg bezeichnet die Rechtsprechung als ein den „komplexen Vorgang der Informationsverarbeitung, der sich nicht in juristischtechnischer Subsumtion eines festgestellten Sachverhalts und der Rechtsnormen erschöpft" (1970, S. 217). Wenn er darauf abhebt, daß in den Entscheidungsprozeß „bewußt oder unbewußt subjektive Wertungen" einfließen, so meint er damit die Konkretisierung der Norm. Man könne diese Wertungen nicht „allein den Juristen überlassen. . . . In diesem Bereich kann den Laienrichtern eine eigene, selbständige Funktion neben den Berufsrichtern zukommen". Rüggeberg hat hier die allgemeine öffentlich-rechtliche Gerichtsbarkeit angesprochen. U m so mehr müssen diese Gedanken gelten, wenn sehr spezielle Sachverhalte anstehen. Rüggeberg und Baur betonen beide nachdrücklich die Notwendigkeit, daß das Beweismittel Sachverständiger und Sachverständigengutachten durch sachverständige Laienrichter unter keinen Umständen in Frage gestellt werden darf {Baur, 1968, S. 58, Rüggeberg, 1970, S. 210). Die kontradiktorische Verhandlung nach den Regeln unseres Prozeßrechts muß aus allen Gründen - Rechtsschutz durch Verfahren - ohne jede Einschränkung, bei einem spezifisch technisch-wissenschaftlichen Prozeßstoff sogar mit besonderer Beachtung aller Beweismittel, die Sachverstand einzubringen vermag, beibehalten werden. Einen Seitenblick kann man hier noch werfen auf die Forderung nach Volkstümlichkeit, die i m Gegensatz stehen könnte zu Sachverstand. M i t „Männern und Frauen aus dem Volk" definiert die Bayerische Verfassung (Art. 88) die Voraussetzung für den Laienrichter. Die dortige Erfordernis der „Volkstümlichkeit" steht jedoch ausschließlich gegen das Berufsbild des Juristen; keineswegs aber soll damit der Weg zur Richterbank nur Hinz und Kunz reserviert bleiben, ebensowenig wie Sachverstand und berufliche Qualifikation für die Rechtsprechung ausgeschlossen bleiben sollten. Die emanzipatorische, partizipatorische und integrative Funktion des Laienrichtertums versperren nicht den Weg zu Sachverstand und zum Experten. Zu den theoretischen Erörterungen müssen auch empirische Untersuchungen angeführt werden, die sich mit dem ehrenamtlichen Richter und dem Institut des Laienrichtertums befaßt haben. Erkenntnisinteresse waren Bewährung des Laienrichtertums i m allgemeinen, daraus folgend Reform Vorschläge. Die Ergebnisse sind
0
Edgar Michael Wenz
ermutigend. Ekkehard Klausa (1970, S. I l l f., S. 214) kommt zu dem Ergebnis: „Die Bilanz für die ehrenamtlichen Richter ist nicht schlecht". Auffallend ist die klar überwiegende Bejahung dort, wo Sachverstand gefordert ist, also insbesondere bei den Handelsrichtern. Gerfried Schiffmann (1974, S. 121, 209, 254) untersucht Einzelthemen, die auch hier für wichtig gehalten worden sind. Aber beide Autoren haben die Meinung der unmittelbar Beteiligten erforscht, in erster Linie also den Berufsrichter und der ehrenamtlichen Richter und deren gegenseitige Einschätzung (.Klausa); oder das Verhältnis der Laienrichter zu allen Prozeßbeteiligten (Schiffmann); dagegen sind die Adressaten unseres Interesses die gesamte Bevölkerung. Das nimmt diesen Arbeiten den Wert für unsere Zwecke. Bezeichnend sind aber einige Teilergebnisse bei Schiffmann, so beispielsweise, daß die Mitwirkung von Laienrichtern nicht der „Demokratisierung der Verwaltungsgerichtsbarkeit" dient. Das deckt sich mit der auch von uns vertretenen Meinung, daß die emanzipatorische Funktion des Laienrichtertums stark geschwunden ist. Interessant auch, daß Berufsrichter mehrheitlich in der Mitwirkung von ehrenamtlichen Richtern eine „Stärkung des Vertrauens der Bürger in die Verwaltungsrechtsprechung" sehen. Klausa vertritt auch die Ansicht, ein „durchgängiges Fachkammer-System" einzurichten; Schiffmann dagegen verneint das, hebt aber diese Verneinung wieder auf „unter dem Gesichtspunkt der Eigenheit einiger Rechtsgebiete". Unter allen erörterten Sachgebieten befindet sich Technologie, Gentechnik, Giftstoffe und Kernkraft nicht. Dagegen wird das Baurecht als interessantes Fachgebiet behandelt. Vor einem Jahrzehnt also dachten auch Spezialisten noch nicht an diesen Problemkreis, der jetzt beherrschend geworden ist. Wenn es je eines Beweises für technischen und sozialen Wandel bedurft hätte, dies wäre einer. Daß das Recht folgen muß, keineswegs geschäftig und hurtig, aber bedächtig und zügig, das hat axiomatischen Charakter. Unter den Laienrichtern nimmt der sachverständige Richter, beispielhaft der Handelsrichter, eine besondere Position ein. Deshalb stellt Eduard Kern auch fest, daß Handelsrichter nicht als Laienrichter bezeichnet werden dürfen (1965, S. 110). Hier würde nun der Begriff „ehrenamtlicher Richter" eher passen, aber auch dieser nur mit Einschränkungen. Deshalb wurde ja der Begriff des „Expertenrichters" vorgeschlagen, der aber vor dem Hintergrund der praktischen Erfahrungen und der theoretischen Erörterungen zum Laienrichtertum untersucht werden sollte. Man mag sich erinnern, daß der Gedanke der „Legitimation durch Verfahren" zu den Vorstellungen eines neuen Gerichtes und somit eines neuen Richter-"Typs" führen sollte. Die Aspekte, die eben aus diesem Laienrichtertum für die Akzeptanz einer Entscheidung herausgestellt werden konnten, müssen gesehen und beachtet werden. Deshalb bedurfte es dieses langen Anlaufs. Bevor nun zum wichtigsten Punkt - Sachverstand als schließlich legitimierender Faktor - übergegangen wird, darf man diese Zwischenbilanz ziehen: Aus der Perspektive des bekannten Für und Wider mit Laienrichtern - Nicht-Juristen auf der Richterbank - ergeben sich entweder neutrale oder - teils sogar erheblich - aufwertende und erhöhende Faktoren; sie nehmen dem Laienrichter nichts in seiner Funktion; sie erleichtern sie ihm viel-
Die Akzeptanzkrise als Legitimationskrise mehr, indem sie die Einwände eher ins Gegenteil umkehren. Wenn also der Laienrichter Sinn, und zwar einen legitimierenden Sinn in der Rechtspflege eines Rechtsstaates hat, so hat ihn der Expertenrichter erst recht. Zu diesem Zwischenergebnis darf man kommen, noch bevor also das Hauptargument für den Expertenrichter, der qualifizierte Sachverstand, in die Überlegungen überhaupt methodisch eingebracht worden ist. Die erste - und vordergründig größte - Hoffnung ist, daß ein solches mit Naturwissenschaftlern und Technikern besetztes Gericht, sich eher und sicherer Sachkunde zu verschaffen vermag. Aber darum geht es nicht in erster Linie. Es geht darum, die richterliche Autorität noch mehr zu verstärken. Der Naturwissenschaftler oder Techniker als Richter wird in Angelegenheiten, die seine speziellen Kenntnisse betreffen, mehr Vertrauen erwarten können als andere Richter, denen man die erforderlichen Kenntnisse nicht oder nicht zureichend zutraut. Ob das objektiv begründet oder begründbar ist oder nicht, spielt bei diesem sozialpsychologischen Ansatz keine nennenswerte Rolle. Vertrauen schafft Autorität. Die höhere Sachkunde, die man vermuten darf und auch geboten wird, wird in der klar überwiegenden Mehrheit als positives und konstruktives Faktum, das nützlich sein wird, gesehen, und geschätzt. Das wird zunächst einmal gebraucht als Medium und als Vehikel zur Vertrauensbildung. Eine Frage erfährt nun besondere Wichtigkeit: Der naturwissenschaftliche oder technische Experte soll also nunmehr nur als Richter, nicht mehr als Sachverständiger oder Gutachter fungieren? Die Antwort muß lauten: Experten nicht nur als Sachverständige oder Gutachter. Diese Verfahrensbeteiligung als Sachverständiger oder als Gutachter muß selbstverständlich unangetastet bleiben. Die Sacherörterung, Beweiserhebung und Beweismittel gehören unveränderlich auch weiterhin vor den Richtertisch. Alle Sach- und Rechtsfragen werden nach wie vor öffentlich und kontradiktorisch erörtert; auch Naturwissenschaftler und Techniker werden sich als Richter auf Fragen beschränken, die allerdings vermutlich deshalb anders ausfallen werden, weil die Darlegung und Darstellung der Prämissen zu ihrem Handwerkszeug gehören. Die Erörterungen in den mündlichen Verhandlungen werden so zweifellos ganz erheblich an Sachdienlichkeit und somit Qualität gewinnen. Die Gefahr, die man wohl nicht ganz unberechtigt bei sachkundigen Laienrichtern und bei anderen Gerichten, etwa i m Strafprozeß, gewittert hat, daß unausgesprochene und auch gar nicht erörterte Gründe in die Entscheidung einfließen könnten, ist hier, soweit dies überhaupt menschenmöglich ist, gebannt. Sachverstand kommt vom Richtertisch auch in das Beratungszimmer. Die naturwissenschaftlichen und technischen Experten als ehrenamtliche Richter brauchen allerdings nicht unbedingt hochqualifiziert i m anstehenden Fach zu sein; es genügt, wenn sie ausreichend sachkundig sind. Beispiel: Selbst ein Maschinenbauingenieur ist eher in der Lage, einem physikalischen Gutachten folgen zu können als ein Jurist. Wie weit der technische Sachverstand gezogen und wie er normativ
0
Edgar Michael Wenz
beschrieben werden soll, ist in praxi freilich eine wichtige, aber doch bei den grundsätzlichen Überlegungen noch untergeordnete Frage. Die Vorteilhaftigkeit eingebrachten technisch-naturwissenschaftlichen Sachverstandes in das Gericht würde auch dadurch nicht beeinträchtigt, daß gerade in jüngerer Zeit Verwaltungsgerichte ein beachtliches Maß an technischem Sachverstand erworben und darzustellen verstanden haben 2 5 . Es wird auch künftig Juristen als Richter nicht erspart bleiben können, sich in die häufig ganz verschiedenartigen Materien einzuarbeiten. Aber dem Experten glaubt „man" eher Sachkunde, ebenso daß Rechtsfragen am besten bei Juristen aufgehoben sind. Naturwissenschaftler und Techniker müssen aus der Gutachterrolle heraus und in die richterliche Verantwortung hinein. Sachverständige und Gutachter sind nicht selten umstritten und oft schlägt sich ein Unbehagen nieder gegen Experten, die als die eigentlichen Herren des Prozesses gelten, ohne aber irgendeine irdische Verantwortung zu übernehmen. Bei Sachverständigen, die von den Parteien bestellt werden, wird weniger geschätzt, daß deren Gutachten dann wenigstens als Auftragsarbeiten erkennbar sind, sondern es wird die Parteilichkeit gesehen. Ähnliche soziale Einschätzungen erfahren auch Staatsanwälte, weil sie ja nur beantragen, nicht entscheiden, sich darauf auch bevorzugt bei erkennbaren Fehlurteilen berufen. Äußerungen i m Sachverständigengutachten sind von vorneherein bedingt („Nach meiner A n s i c h t . . . " ) . Erst im Spruch des Richters („Ich erkenne für Recht . . . " ) erfahren Erkenntnis und Satz ihre größte Bedeutung. Die höchste Stufe der Verantwortlichkeit ist erklommen. Die Menschen sehen das, die Wirkung kann nicht ausbleiben. Eine auch von Technikern und Naturwissenschaftlern gefällte rechtsverbindliche Entscheidung in Fragen zu Technik und Naturwissenschaft hat mehr Gewicht, erweckt eher Vertrauen, genießt leichter Anerkennung und findet schneller und durchgreifender Akzeptanz. Daran gemessen ist der weitere Nutzen, der von Experten i m Richterkollegium gezogen werden kann, nur ein nützlicher Nebeneffekt. Wie sich die Richter sachkundig machen könnten, ist ja neuerdings mehrfach Gegenstand literarischer Reflexionen gewesen. Die Frage, ob dem Gericht technische Berater als Gehilfen, gewissermaßen als Dolmetscher für Technik, beigegeben werden sollen (Gerhardt, M., 1982, S. 489 ff.), braucht nicht untersucht zu werden. Ebenfalls verliert das Problem an Bedeutung, ob und wie die Verwaltung sich schon in der ersten und entscheidenden Stufe, auch durch ein geordnetes Verfahren (Wagner, 1982a, S. 103 ff.), sachkundig machen kann. Gewiß können auch die Regeln für den Sachverständigen und für die Gutachtertätigkeit überarbeitet, vielleicht transparenter gestaltet werden. Das alles kann und soll i m Gespräch bleiben; nur an Bedeutung hat es mit Experten i m Richterkollegium erheblich verloren.
25
Zu erwähnen ist das Urteil des Verwaltungsgerichts Freiburg vom Oktober 1982 zum Wyhl-Prozeß, das wegen seines Aufbaus, seiner Sachkunde und seiner Diktion über die juristische Beachtung hinaus wissenschaftliche Aufmerksamkeit - man hat es mit Habitilationsschriften verglichen - gefunden hat.
Die Akzeptanzkrise als Legitimationskrise Ein Paradebeispiel bietet das Bundespatentgericht. Niemand wird sich ernsthaft die technischen Mitglieder dieses Gerichtes, qualifizierte Ingenieure, wegdenken können oder wollen. Niemand kommt auf die Idee, Juristen als Richter in geeigneter Weise technisch sachkundig zu machen und eben darauf zu verweisen, daß es nun einmal das Los des Richters ist, sich in jeden Fall und in jedes Problem hineinzudenken. Es ist nicht zu erkennen, was in Patentsachen anders oder gar komplizierter sein soll als beispielsweise in Angelegenheiten der Großtechnologie - abgesehen davon, daß Patentsachen nur private Interessen Einzelner berühren, während die Entscheidung über ein Kernkraftwerk möglicherweise nicht absehbare Dimensionen eröffnet. Wenn man glaubt, ohne technische Experten auf der Richterbank auskommen zu können, die Richterbank also nur Juristen als Berufsrichtern vorbehalten zu wollen - was in aller Welt hätten dann Ingenieure im Bundespatentgericht verloren? Diese Frage zu stellen ist auch erlaubt, wenn man durchaus richtig die unterschiedlichen Aufgaben und das ganz andere Selbstverständnis dieses extrem spezialisierten Fachgerichtes im Unterschied zum Verwaltungsgericht bedenkt. I m wesentlichen geht es aber um die Kernfrage, daß eine allumfassende richterliche Kunst und Weisheit anscheinend Juristen mit Assessorenexamen zugetraut wird, mit angemessener Hilfe allem und jedem gewachsen zu sein; man aber offenbar Bedenken hat, hochqualifizierten Fachleuten die Fähigkeit zuzusprechen, die einen Richter auszeichnen sollen.
VI. Generalklauseln und soziologische Jurisprudenz Sachverstand als tragendes Element ist nach Ansicht vieler die einzige Rechtfertigung des Laienrichtertums. Bei Handelsrichtern, dem am meisten zitierten Prototyp des sachkundigen Laienrichters, mag sich das überall dort auswirken, wo die unbestimmte Norm konkretisiert werden muß. Die Auslegung von Handelsbräuchen ist hierfür ein typisches Feld, wirksam sowohl in der S ach Verhaltsermittlung wie bei Interpretation und Subsumtion. Hier sind die Berührungspunkte von SeinsSätzen und Sollens-Normen; von dem, was ist, mit jenem, was sein soll. Das ist das Feld der soziologischen Jurisprudenz (sociological jurisprudence), der praktischen oder angewandten Rechtssoziologie als HandlungsWissenschaft 26 ; ihr Erkenntnisinteresse ist „die Erforschung des Zusammenhangs von Recht und Sozialleben für die Rechtspraxis' 4 {Rehbinden 1977, S. 12 ff.); das Erkenntnisziel ist eine soziologische Rechtslehre, die „wissenschaftliche Erkenntnisse in praktische Rechtsanwendung und Rechtssätze umsetzt und damit Entscheidungshilfen bietet". Obwohl Rechtsanwendung ohne diesen praktischen Zweig der Rechtssoziologie 26 Im Unterschied zur reinen und theoretischen Rechtssoziologie, die ein gesellschaftstheoretisches Erkenntnisinteresse mit dem Ziel einer soziologischen Theorie des Rechts verfolgt.
Edgar Michael Wenz
0
sinnvoll nicht durchführbar, nicht einmal denkbar ist, kämpft die Rechtssoziologie um ihre wissenschaftliche Anerkennung. Man mag sich dogmatisch zwar helfen mit der „Interessenjurisprudenz" des Rudolf von Jhering, der Lehre vom „Zweck i m Recht" (Heck, Tübinger Schule), mit Analogien, mit finalen Theorien, mit teleologischer Interpretation - aber es geht immer darum, den angeblich unüberwindlichen Gegensatz von Sollen und Sein zu überbrücken und sinnhaft zu verbinden. Es gilt eben nach wie vor der viel zitierte Satz: „Dogmatik ohne Soziologie ist leer, Soziologie ohne Dogmatik ist b l i n d " 2 7 . Die soziologische Jurisprudenz wird aktiv bei der Sachverhaltsermittlung: das ist einer der Bereiche des S ach Verstandes. Der weit größere Bereich ist die Normfindung; da kann und darf die Rechtssoziologie die Rechtsdogmatik freilich nicht verdrängen, muß sie aber ergänzen. Und auch hier ist wieder der Sachverstand gefordert; denn es geht i m wesentlichen um die Konkretisierung generalklauselartiger Verweisungsnormen und unbestimmter Rechtsbegriffe oder um Rechtsschöpfung, wenn und wo Rechtslücken zu erkennen sind. Sie müssen unabweisbar ausgefüllt werden. Aus dem Sein läßt sich kein Sollen ableiten. Die „normative Kraft des Faktischen" (Jellinek, 1960) und die „Normativität des Seins" (.Heinrich Henkel, 1964) können nur rechtssoziologische Beschreibungen, keine Postulate sein. Die Realitäten des sozialen Lebens, das, was „man" tut und was man von anderen zu tun erwartet - es muß erst das Sieb richterlicher Würdigung und Wertung passieren, um zur Norm zu werden. Generalklauseln und „elastische", also unbestimmte Rechtsbegriffe verwendet der Gesetzgeber dann, wenn er „bewußt Freiräume für die Rechtsentwicklung schaffen" sollte, oder sich „außerstande (sah), präzisere Entscheidungsnormen aufzustellen", oder „Auseinandersetzungen darüber i m Gesetzgebungsverfahren vermeiden" wollte. Diese „legislatorische Autorisation" (Theodor Geiger) muß der Richter ausüben. Sind Generalklauseln gesetzt, so sind keine Gesetzeslücken aufzufüllen (legislatorische Option), sondern es muß nur von Ermächtigungen Gebrauch gemacht werden - durch Sachverstand, der einschlägige Kenntnisse mobilisiert; dies impliziert, daß bei Entscheidungen von Tragweite die kompetenten Wissenschaften angerufen werden sollten. Wo der Richter diese Kenntnisse nicht hat, muß er sich durch einen Sachverständigen sachkundig machen lassen. Sachverständige Laienrichter - in unserem Beispiel die Handelsrichter - bringen, gemäß der Intention des Gesetzgebers, diesen Sachverstand ein. So verkörpert eigentlich der sachverständige Laienrichter, ohne daß dies je klar formuliert wurde, ein gutes Stück praktischer und angewandter Rechtssoziologie. Wenn der Gesetzgeber sich bei der Rechtssetzung zum Umweltschutz auf Generalklauseln und unbestimmte Rechtsbegriffe beschränkt hat, so wollte er dem technischen Wandel Rechnung tragen, der immer schneller naturwissenschaftliche Erkenntnisse in angewandte Technik umsetzt. Aber es bleibt ihm gar keine andere 27
Hermann Kantorowicz
auf dem ersten Deutschen Soziologentag, 1910.
Die Akzeptanzkrise als Legitimationskrise Wahl, wenn er nicht als Bremsklotz gegenüber Wissenschaft und Technik wirken wollte. Man mag diese Generalisierung bedauern. Das kann sich auch ändern. Konkretere und präzisere Normen werden angestrebt, sie werden eines Tages wohl auch gesetzt werden, aber sie werden nur ein neues Feld offener technischer und sozialer Probleme vor sich herschieben; das Regelungsdefizit wird immer bleiben, möglicherweise nur auf neuer Höhe. Es ist schwer zu sehen, wie Generalklauseln und unbestimmte, folglich konkretisierungspflichtige Rechtsbegriffe sich vermeiden lassen könnten. Es ist dies auch niemals behauptet worden. Die Industriegesellschaft hat i m Übermaß neue Probleme aufgeworfen, ganz spezifische Probleme, die es vor Generationen sicherlich auch gegeben hat; damals sorgte man sich um den Betrieb der Eisenbahn 28 und von Dampfkesseln. Das gesamte Anlagen- und Gerätesicherheitsrecht findet dort seinen Ursprung. In den letzten Jahrzehnten haben sich die damals erkannten Probleme entscheidend verschärft, sie sind heute zum Problem schlechthin der Industriegesellschaft geworden. Die zum Teil schon bekannten Generalklauseln - man kann das schon klassische Generalklauseln nennen, kaum anders als die häufig zitierten des BGB - sollen aus den sich abzeichnenden gesellschaftspolitischen und gesamtwirtschaftlichen Konflikten heraushelfen: • allgemein anerkannte Regeln der Technik, • Stand der Technik, • Stand von Wissenschaft und Technik (Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis), • wirtschaftliche Vertretbarkeit. Dieses bewußte Regelungsdefizit wird zum notwendigen Zugeständnis i m Industriezeitalter. Man kann es freilich auch übertreiben, worauf Peter Marburger (1981b) im Zusammenhang mit dem neuen Chemikaliengesetz hinweist, wo er diese Generalklauseln gefunden hat: Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse; Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis, gesicherte wissenschaftliche Erkenntnis; jeweiliger Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis; gesicherte sicherheitstechnische, arbeitsmedizinische, hygienische und sonstige arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse, die auch noch im Zusammenhang mit „Regeln" genannt werden. Was der Gesetzgeber damit bezweckte, haben Bundesgerichte schon mehrfach dargelegt: einen „dynamischen Grundrechtsschutz", der nicht anders zu gewährleisten ist, weil naturwissenschaftlich-technisches Wissen sich „immer nur auf dem neuesten Stand unwiderlegten möglichen Irrtums befindet" 2 9 . Es geht hier also notwendig um die Verknüpfung von Wissenschaft und Technik, also etwas genuin Dynamisches, mit dem Recht, also etwas Statisch-Konservativem.
28
Interessant dazu das 1838 erstattete Gutachten zur Einführung der Eisenbahn des Bayerischen Obermedizinalkollegiums, zitiert bei Wagner, 1982b, S. 107. 29 BVerfGE 49, 89 = NJW 1979, S. 359 ff.; sog. „Kalkar-Beschluß".
0
Edgar Michael Wenz
Das Bundesverfassungsgericht hat i m Kalkar-Beschluß 3 0 eine Abstufung der Bedeutung der verschiedenen Begriffe getroffen, und zwar nach der Nähe zur „Front der technischen Entwicklung". Danach sind die „allgemein anerkannten Regeln der Technik" am weitesten von dieser Front entfernt, der „Stand der Technik" liegt ihr näher, der „Stand von Wissenschaft und Technik" aber ist ihr am nächsten. Danach orientiert sich auch eine Sicherheitsskala, von mittlerer Sicherheit über höhere Sicherheit bis zu einem Höchstmaß an Sicherheit. Fritz Nicklisch (1983) nennt diese Rangfolge „Dreistufenthese". Das Beispiel mit der Frontnähe allerdings mag gar nicht überzeugen: die Front ist j a nun nicht gerade der Platz, wo man Erkenntnisse, die zu einer gesicherten Übersicht verhelfen, gewinnen könnte. Die Beispiele, an denen Fritz Nicklisch die mangelnde Konsequenz bei der Anwendung dieser Begriffe aufzeigt, verstärken den spontanen Eindruck, daß es sich bei der Begriffswahl doch recht wohl auch um philologische Zufälligkeiten handeln könnte. Ohne nun auf Gewichtungen, Präferenzen, Beweislasten und alle diese in der Praxis äußerst wichtigen Fragen eingehen zu können und ohne darauf für diese Untersuchungen eingehen zu brauchen, läßt sich sofort erkennen, daß der abgesteckte Rahmen konkret ausgefüllt werden muß, wenn die Norm überhaupt einen Sinn erhalten soll. Die legislatorische Autorisation auszuüben, ist unabweisbare Pflicht des Gerichts. Darin kann man nichts anderes sehen als die Verbindung vom Sein mit dem Sollen. Alles dies, was man weiß und was erörtert worden ist i m Verhältnis der Sozialwissenschaften zur Jurisprudenz, eben von der Verbindung von Sein und Sollen, wiederholt sich spiegelbildlich mit anderen Tatsachen- und Wirklichkeitswissenschaften, mit den Naturwissenschaften und der Technik 3 1 nämlich. Freilich sind auch die Sozialwissenschaften in gleicher Weise gefordert. Der Ruf ist oft ungehört verhallt, in gesellschaftlichen Zusammenhängen bei S ach Verhaltsermittlung und Normfindung nicht mit „Alltagsstheorien" (.Karl-Dieter Opp) zu arbeiten, sondern Rat bei den Sozialwissenschaften zu suchen; die Minimalforderung lautete, zumindest die zugrundegelegten Theorien und Prämissen klar darzustellen und zu beschreiben. Aber der gleiche Ruf wird gewiß eher Widerhall finden, wenn es um Naturwissenschaften und Technik geht. Die beliebte Formel von der „Lebenserfahrung", die in straf- und zivilrechtlichen Urteilen häufig, allzu häufig wiederkehrt, verliert jede Plausibilität bei technologischen Gegenständen und Problemfeldern, sie würde zur Farce. Sachverstand ist also gefragt, und zwar mit einem noch viel größeren Gewicht als etwa bei Kammern für Handelssachen, aus gesellschaftspolitischer Sicht auch noch mehr als beispielsweise beim Bundespatentgericht. Gemessen an der gesellschaftspolitischen Brisanz dieser Fragen verbietet sich eigentlich jeder Vergleich.
30 BVerfGE 49, 89, siehe NJW 1979, S. 359 ff. (363), sog. Kalkar-Entscheidung. 31 Wissenschaftstheoretische Überlegungen, wie Technik einzuordnen ist, ob sie Kriterien der Wissenschaftlichkeit erfüllt, kann man sich auf jeden Fall in diesem Kontext ersparen; oder aber eine Analogie ziehen zum Verhältnis Rechtswissenschaft : Jurisprudenz.
Die Akzeptanzkrise als Legitimationskrise
9
Rechtswissenschaft und Jurisprudenz haben zu diesem sowohl methodischen wie praktischen Problem die Lehren der Interpretation und der Konkretisierung unbestimmter Normen anzubieten. Das war seit eh und je so, das ist und wird auch wohl so bleiben. Die Einbruchsteile, das Gelenk zu den Tatsachen- und Wirklichkeitswissenschaften, haben wir als das eigentliche Feld der Rechtssoziologie erkannt. Die Rechtslehre unterscheidet zwischen „statischer" und „dynamischer" Rechtsverweisung, also entweder Verweisung des Normengebers auf eine andere konkrete Regelung, die damit die gleiche Rechtsqualität erreicht wie die verweisende Norm (statisch), oder die Normensetzung gewissermaßen delegiert mit dem Ziel, daß die lückenhaften Normen konkretisiert oder gar ergänzt werden (dynamisch). I m uns interessierenden Bereich wären damit i m allgemeinen technische Regelwerke gemeint, die in der noch zu behandelnden Literatur eine große Rolle spielen. Ob man, hier einmal abgesehen vom konkreten Anlaß dieser Reflexionen, mehr der Delegationsfunktion einer solchen Verweisungsnorm zuneigt oder mehr der Auffassung, daß diese Norm nur faktisch Vorhandenes zu rezipieren beauftragt ist (Rezeptionsfunktion), oder eine mittlere Position anstrebt, daß nämlich eine Interdependenz von Recht und Sozialleben zu beachten ist - das hängt weitgehend, vielleicht sogar ausschließlich von der wissenschaftlichen Position i m Grundsatz ab, wie man die Verbindung von Sollen und Sein wahrnimmt und zu verarbeiten bereit ist (Nicklisch, 1982a, S. 67 ff.). Wenn der Gesetzgeber bei Fragen der Technologie und des Umweltschutzes förmlich in Generalklauseln und unbestimmten Rechtsbegriffen geflüchtet ist bzw. flüchten mußte 3 2 , und wie es aussieht auch künftig flüchten wird, bedarf es - um daraus konkretes, wirkliches und sinnvolles Recht zu machen - der Beziehung hochqualifizierten S ach Verstandes. Er muß angemahnt werden von den Tatsachenund Wirklichkeitswissenschaften, und zwar nicht nur der Soziologie - Erkenntnisziel: soziale Verträglichkeit - , nicht nur des wirtschaftswissenschaftlichen Zweigs der Sozial Wissenschaften, der Volkswirtschaft - Erkenntnisziel: wirtschaftliche Vertretbarkeit - , dies gilt i m besonderen Maße für die Naturwissenschaften und Technik, die j a für zwei der drei Generalklauseln direkt angesprochen werden. Es ist also schwer zu sehen, wie man bei dieser Gesetzeslage, die den Entscheidungszwang eigentlich voll und ganz dem Rechtsanwender - zunächst also der Verwaltungsbehörde, nach den bisherigen Erfahrungen dann schließlich doch den Gerichten - aufbürdet, ohne einen der Bedeutung der Streitsache angemessenen qualifizierten Sachverstand auskommen will, der nicht nur bei den Parteien, und der nicht nur beim, am und vor dem Gericht, sondern i m Gericht, in voller Verantwortung, angesiedelt ist. Nicht schwer zu sehen dagegen ist ein Konflikt, der die theoretischen und praktischen Grundlagen der gesamten Verwaltungsrechtsprechung trifft: die Kernfrage nämlich, ob verwaltungsrichterliches Handeln - ebenso auf Individualrechtsschutz 32
In diesem Zusammenhang wird häufig Justus Wilhelm Hedemann, 1933, zitiert; er hat 1933 vor einer solchen Entwicklung gewarnt. 14 Gedächtnisschrift Wenz
10
Edgar Michael Wenz
wie auf externe Verwaltungskontrolle angelegt - sich auf Rechtmäßigkeitskontrolle beschränken muß, oder auf Zweckmäßigkeitsprüfung sich ausdehnen darf. I m Anschluß an Otto von Sarwey (1880) ist diese Frage im wesentlichen ausdiskutiert mit dem Ergebnis, daß Verwaltungsgerichte Ermessensentscheidungen der Administration nicht angreifen dürfen. Diese Beschränkung auf die Rechtmäßigkeitskontrolle gab rein formalistischen Überlegungen Auftrieb. Danach könnte die „Kontrolldichte" soweit aufgelockert werden, daß sich das Verwaltungsgericht auf Dinge beschränken könnte, die es auch tatsächlich aus eigenem Wissen beherrscht. Gewiß wird man nicht soweit gehen wollen, daß das Verwaltungsgericht nur zu prüfen habe, ob die gültigen Stempel an der richtigen Stelle und zur rechten Zeit aufgedrückt worden wären. Das ist eine bewußt überspitzte Formulierung, die in dieser Schärfe nie aufgestellt worden ist, gegen die sich aber der eine oder andere „Praktiker" wohl nicht zu sehr und zu lange wehren würde. In der Literatur, auf die gezielt noch eingegangen werden muß, zeigen sich auf der Skala vom einen zum anderen Extrem viele Auffassungen. Aber man nähert sich dem Problem der Verlagerung der Gewalten auf die Schultern des Richters. Die Gefahr des „Richter- und Justizstaates" scheint zu drohen. Jede Aufweichung der konstitutionellen Gewaltenteilung, die das Maß der nicht mehr ausdifferenzierbaren Verflechtungen überschreitet, würde die volle Aufmerksamkeit und die Mobilisierung aller Abwehrkräfte verlangen. Aber wo der Gesetzgeber die Exekutive ausdrücklich ermächtigt, leblosen Normen realen Sinn zu geben, dort kann der Judikative der Vorwurf der rechtstaatgefährdenden Kompetenzüberschreitung gewiß nicht gemacht werden. Man mag darüber streiten, ob der Gesetzgeber zu früh oder nur ohne wirklich zwingenden Grund Aufgaben delegiert; ob er nur zu einem Recht macht, was er in Wirklichkeit nicht als Pflicht zu leisten vermag - aber bei der Rechtsprechung kann in diesem Kontext kein Vorwurf hängenbleiben. Damit aber ist eines der großen Themen der Rechtssoziologie angeschnitten, überdies eines, bei dem die Divergenz der Auffassungen erkennbar geworden ist. Wenn dieses Thema allgemein aufkam, so war der Blick auf das Bundesverfassungsgericht und seine Bemühungen um das materiale Verfassungsverständnis zur aktuellen Gesetzgebung gerichtet. Die eigentliche Arena aber bildeten alle anderen Gerichte. Es ging (und es geht) darum, ob der Richter - allein gelassen vom Gesetzgeber - die politische Intention des Gesetzgebers „zu-Ende-denken und zu-Ende-entscheiden" darf oder gar muß; ob er sich als „Sozialingenieur" zu verstehen hat oder ob er „Paragraphenautomat" (Max Weber) oder „la bouche de l o i " (Montesquieu) zu sein hat. Es ist müßig, auf diese ohnehin so nur verkürzt gestellte Frage einzugehen. Man kann durchaus der Funktion des Richters als Garant des Rechts, mit der klaren Bindung an das Gesetz, folgen. Nur: Generalklauseln müssen eben ausgefüllt, unbestimmte Normen konkretisiert werden. Der Gesetzgeber hat den Richter selbst zu einer Art „Nach-Gesetzgeber" gemacht. Das positive Recht zwingt ihn, diese Aufgabe anzunehmen. Gleichzeitig ist das die Chance des Rechts, vital zu bleiben und den gegebenen Verhältnissen Rechnung zu tragen.
Die Akzeptanzkrise als Legitimationskrise
211
Seine Chance, akzeptiert zu werden, wächst dadurch entscheidend. Eine Gesellschaft ist ohne ein weiterentwickeltes und eines sich immerwährend fortentwikkelnden Rechts nicht lebensfähig. Darüber kann es ernsthaft keinen Streit geben. Es ging wohl auch eher darum, ob, inwieweit, mit welcher Methodik und unter welcher Verpflichtung der Richter in dem zu entscheidenden Einzelfall Erkenntnisse anderer Wissenschaften, insbesondere der Sozialwissenschaften, einbeziehen und verwerten muß. Realistische, also bescheidene Erwartungen begnügten und begnügen sich mit einer Darlegung der Prämissen und Theorien, mit denen das Gericht im Einzelfall gearbeitet hat, statt sich schlicht auf „Alltagstheorien 4 ' oder gar allgemeine Redensarten („Lebenserfahrung") zu berufen. Die Einsicht regiert, daß Kosten und Zeit es verbieten, möglicherweise erforderliche Sozialforschungen anzustellen; dies bleibt in Fällen von grundsätzlicher Bedeutung höheren Gerichten vorbehalten. Entscheidungen, die über das Interesse der Einzelfallgerechtigkeit hinausgehen, die präjudizielle Beachtung finden werden und die möglicherweise das wäre auch der normale Gang der Gesetzgebung - zur gesetzten Norm werden können, bilden sich nach einer anderen inneren Gesetzlichkeit. So ist bei Urteilen von solcher Tragweite alles dies zu tun, was auch der Gesetzgeber an vorbereitenden Arbeiten zu tun hätte. Bei Fragen von gesellschaftlicher Relevanz relativieren sich auch die Aufwendungen an Zeit und Geld auf ein nicht nur erträgliches, sondern auch ein zumutbares Maß. Der Richter wird zum Gesetzgeber, wie es der berühmte und vielzitierte Art. 1, Abs. 2 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches vorschreibt: „Kann dem Gesetze keine Vorschrift entnommen werden, so soll der Richter nach Gewohnheitsrecht und, wo auch ein solches fehlt, nach der Regel entscheiden, die er als Gesetzgeber aufstellen würde". Bei den Fragen um Gift, Gen und Kernkraft geht es nicht um individuelle Belange oder jene von Gruppen in überschaubarem Bereich; die gesellschaftliche Relevanz ist evident. Wir haben es auch nicht zu tun mit Verzahnungen von Realitäten und von Überschneidungen konstitutioneller Kompetenzen, die sich nur schwer ausdifferenzieren lassen. Der Gesetzgeber hat - aus welchen Gründen auch immer - sich nicht zu konkreten Normen entschließen können, Generalklauseln vorgezogen und somit die Gerichte zum eigentlichen Gesetzgeber bestimmt. Ihnen fällt nun die Pflicht zu, sich mit allen Mitteln und Möglichkeiten sachkundig zu machen - genauso wie der Gesetzgeber es hätte tun müssen. Bei dieser erhöhten Aufgabe des Gerichtes dürfte die Einsicht nicht schwer fallen, daß sich das Gericht auch Sachverstand innerhalb seines Kollegiums versichern will. Der Gesetzgeber verschafft sich zwar auch Sachkunde außerhalb des Parlaments; aber die gesetzgebende Körperschaft trägt nicht nur die Verantwortung, sie macht sich in sich sachkundig, nicht zuletzt durch geeignete personale Zusammensetzung der vorbereitenden Gremien, beispielsweise der Ausschüsse. A u f keinen Fall aber wird sie die Vorbereitung und die Beschlußfassung von Gesetzen deswegen nur Juristen überlassen, weil es sich letzten Endes um Paragraphen handelt. Die Überleitung der Gesetzgebung auf die Rechtsprechung müßte allein ausreichen, ein besonderes Verfahren und konsequenterweise ein besonderes Gericht zu 14*
1
Edgar Michael Wenz
institutionalisieren: ein Gericht von besonderer Sachkunde, mit einer bisher nicht gekannten Qualifikation; ein Gericht, bei dem sich das Gewicht des Sachverstandes von Naturwissenschaft und Technik zu dem Gewicht verdichtet, das den anstehenden Fragen innewohnt - das Expertengericht, die Technologiefachkammer. Die angestrebte legitimierende Wirkung kann aber nur dann erzielt werden, wenn dieser besondere Sachverstand auch besonderes Vertrauen zu erwecken vermag. Das war und ist die Frage. Sachverstand ist nicht Selbstzweck. Sachverstand kann nur Mittel zum Zweck sein, das Ziel der Legitimierung oder doch der Legitimationserhöhung zu erreichen - qua Vertrauen. Wird also ein Kollegialgericht, das aus Berufsrichtern und Expertenrichtern zusammengesetzt ist, dieses Vertrauen erwecken können? Verschafft gebündelter und koordinierter Sachverstand Autorität? Bildet sich diese Autorität um in Vertrauen? A u f diese Fragen läßt sich der Sinn und das Erkenntnisinteresse dieser Untersuchungen reduzieren. Es konnte bei allen Überlegungen und Erörterungen zum Laienrichtertum immer nur um das Vertrauen gehen, das die Bevölkerung - so lautet die These - ehrenamtlichen Richtern in einem Maße, das das Vertrauen in die Gerichtsbarkeit i m allgemeinen übersteigt, entgegenbringt. Nur allein i m Vertrauen kann die Wurzel der Legitimation für staatliches oder obrigkeitliches Handeln i m allgemeinen liegen. Und dies würde für jede der Gewalten und für jede Zuständigkeit gelten müssen. Es müssen gewiß noch andere Komponenten hinzukommen, um Ansprüche an die Richtigkeit, die nach allgemeiner Auffassung die stärkste legitimierende Wirkung hat, zu erfüllen. Es genügte auch schon die Wirkung der Legitimations-Erhöhung. Würde Laienrichtern - also Expertenrichtern - mehr Vertrauen entgegengebracht als Juristen - also Berufsrichtern - , dann wären wir am Ziel: Besonderes Vertrauen - das für besondere Probleme der Gesellschaft notwendig ist - durch ein besonderes Verfahren; durch Vertrauen in das Verfahren, durch Vertrauen i m Verfahren. Und weiterhin: Legitimation durch dieses besondere Verfahren. Alle Argumente und Eigenschaften, die zur rationalen Begründung zusammengetragen wurden, waren nur auf dieses eine Ziel gerichtet: Vertrauen zu bilden, Vertrauen zu festigen und Vertrauen zu erhöhen. Ob Rationalität allein Vertrauen schaffen kann, ob noch etwas anderes, emotionales, vielleicht sogar wichtigeres hinzukommen muß - es kann ununtersucht bleiben. Sachverstand war eine der wichtigsten Stufen zu diesem Ziel. Schopper hat (1982, S. 295 ff.) die „Delegation von Entscheidungen auf den Sachverstand" postuliert und darin eine „Rückkehr zum delegierten Vertrauen" gesehen. A m Beispiel der Baugenehmigung für ein Kernkraftwerk war in einem Artikel (Gerhardt, R., 1982) zu lesen: „Hier taucht, hinter dem Richter, der Schatten der Sachverständigen auf, die längst auf unauffällige Weise einen Teil der rechtsprechenden Gewalt übernommen haben". A u f „Schatten" allerdings kann man kein Vertrauen aufbauen; darum muß Sachverstand offen und voll verantwortlich in das Gericht. Das macht den Unterschied, der Vertrauen schafft. Alle anderen untersuchten Argumente - von der demokratischen
Die Akzeptanzkrise als Legitimationskrise
1
Legitimation bis zur Unabhängigkeit, die emanzipatorische, die partizipatorische und die integrative Funktion - waren gewiß nicht so stark und so überzeugend wie jenes des SachVerstandes. Aber sie haben nun viele Jahre und viele Generationen, lange Zeit sogar ganz allein, die Idee des Laienrichtertums getragen, das ein wichtiger Pfeiler einer bewährten Gerichtsverfassung ist. Es mögen Einwände vorgetragen worden sein, die dem Laienrichtertum seine frühere Bedeutung nehmen könnten. Aber es gab keinen Einwand, der die Vertrauensbasis zu erschüttern geeignet gewesen wäre. Bernd Rüthers (1983) berichtet über Vertrauensgefährdung, weil sich Laienrichter am höchsten Arbeitsgericht, nämlich Vorstandsmitglieder des DGB und der IG Metall, als Parteigänger zu erkennen gaben, durch Schelten von Urteilen jenes Senats, dem sie selbst angehören. Wenn zu befürchtender Vertrauensschwund sich nachteilig auf die Autorität eines Gerichtes auswirkt, so zwingt das zwar nicht zu dem Schluß, läßt ihn aber gleichwohl zu, daß umgekehrt ein Gericht auch an Autorität mit dem Ansehen und dem vorausgesetzten Sachverstand seiner Laienrichter gewinnt. So kann man das Fazit ziehen, daß alles, was historisch bekannt ist und was sich theoretisch erörtern läßt, mit Gewicht zum Expertenrichter als Laienrichter hindrängt. Erste Voraussetzung freilich solcher Überlegungen ist, daß überhaupt die Institution Gericht Vertrauen genießt. Man geht i m allgemeinen davon aus. Sozialempirische Forschungsergebnisse fehlen. Man könnte meinen, daß deshalb kein besonderes Erkenntnisinteresse bestand, weil die vertrauensbildende Funktion des Gerichtswesens ernsthaft nicht bestritten war. Fritz Ossenbühl stellt jedenfalls, wohl exemplarisch für viele Autoren, fest, daß der „Aufstieg der dritten Gewalt" die Verfassungskultur des Bonner Grundgesetzes nicht beschädigt habe, weil sie sich „trotz einer bedrohlichen Kompetenzausweitung Respekt und Vertrauen auf allen Seiten zu bewahren" wußte; insbesondere die Fachgerichte verdienten Beachtung und Respekt für die Pionierarbeit, die sie „beim Aufbau und Ausbau der Rechtsordnung geleistet haben und weiterhin leisten - vielfach ohne begleitende Hilfe der Rechtswissenschaft" (Ossenbühl, 1980, S. 545, 551). Niemals wurde behauptet oder auch nur angedeutet, daß mit diesen Expertenrichtern nun Probleme schlankweg gelöst würden, die die konventionellen Verwaltungsgerichte etwa nicht lösen konnten. Nochmals sei nachdrücklich gesagt: Eine solche Vorstellung wäre verwegen. Es kann nur darum gehen, Mosaiksteine einzusetzen; schrittchen weise voranzukommen - aber voran.
VII. Die Technologiefachkammer in Umrissen Für eine Technologiefachkammer sind insbesondere das Auswahl- und Berufungsverfahren von Expertenrichtern von Bedeutung. Man kann ein Gerangel um die Richterpositionen befürchten, aber ebenso eine Verweigerung der Amtsannahme und der Übernahme der schweren Pflicht. Ein
1
Edgar Michael Wenz
Drängen zum Expertenrichter würde den vorhersehbaren Verdacht erwecken, daß Einfluß gesucht wird. Niemand könnte das verdenken, sowohl das Suchen von Einfluß wie die Verdächtigung. Eine Ablehnung aber würde das Gericht möglicherweise diskriminieren. I m Stillen oder nur von wenigen überhaupt beachtet, wie das ansonsten bei der Wahl ehrenamtlicher Richter der Fall ist, wird dieses Verfahren für Expertenrichter gewiß nicht ablaufen; sogar überdurchschnittlich großes öffentliches Interesse ist zu erwarten - und wäre auch zu begrüßen, wenn die Rechnung aufgehen soll, daß Technologiefachkammern qualifiziertes Vertrauen erzeugen sollen. Vertrauen kann aber nur Tun und Lassen finden, wenn es gesehen wird; erst dann kann es überhaupt erst gewertet werden. Auch Naturwissenschaftler und Techniker, auch anerkannte Kapazitäten können eine menschlich durchaus verständliche Neigung zur Selbstdarstellung haben. So mancher könnte darin auch eine Chance zum wissenschaftlichen Durchbruch sehen. Es wäre freilich nur eine „Alltagstheorie", wenn man von einem Wissenschaftler und Techniker größere Gelassenheit und gewissermaßen vornehme Zurückhaltung erwartet. Dennoch wird man aber nicht ohne Grund davon ausgehen können, daß ein „Jahrmarkt der Eitelkeiten" nicht zu befürchten ist, auch nicht eine Neuauflage des Votums eines Landgerichtspräsidenten über die Bewährung der Schöffengerichte (anfangs der zwanziger Jahre): „Die Schöffen sind die Mannequins i m Schaufenster der Justiz" (Zitiert nach Rehfeldt/Rehbinder, 1978, S. 202). Auch wenn man naturwissenschaftlichen und technischen Experten nicht das freilich keineswegs vertrauensfördernde - Geltungsbedürfnis wie etwa bei pensionierten Verbandsfunktionären und retirierten Kaufleuten zu befürchten braucht, müßte feststehen, daß für ein Fachgericht der vorgestellten Art besondere Regeln Platz greifen. Es kann hier nicht der Ort sein, das Thema der Auswahl und Berufung von Laienrichtern i m allgemeinen, geregelt in den §§ 19 ff. V w G O , und konkret für das Expertengericht i m besonderen einzugehen. Es gibt genügend Modelle in der Bundesrepublik Deutschland; dafür sorgt schon der föderalistische Aufbau und die teilweise doch in Einzelheiten recht unterschiedlichen Regelungen der einzelnen Bundesländer (Liekefett, 1965, S. 3 ff.). Noch verschiedener als die Rechtsregelungen sind die Praktiken und Handhabungen in den einzelnen Bundesländern, in bestimmten Städten und bei den vielfältigen Gerichten {Klausa, 1970, S. 23 ff.). Das Ziel hängt hoch, deshalb soll man auch bei der Untersuchung der Möglichkeiten weit oben beginnen. Damit ist durchaus die Auswahl der Bundesrichter oder jedenfalls der Landesrichter (Art. 98 GG) gemeint. Eine Zweidrittelmehrheit ist ja generell erforderlich; das zwingt zum politischen Kompromiß. Dieser kann möglicherweise falsch sein, irgendwann wird man das wissen; aber das Ziel der Vertrauensbildung verträgt Kompromißbereitschaft, und daran wird man sowieso nicht vorbeikommen. Dies ist keine Resignation und Verzicht auf die Einsicht, daß bei ausgesprochenen Sach- und Fachfragen nicht die politisch-demokratische Repräsentanz maßgebend sein darf, sondern nur eben Sachkunde; nach diesem Gesichts-
Die Akzeptanzkrise als Legitimationskrise
1
punkt sind j a schon die Vorschlagslisten aufgestellt, so daß keine grundsätzliche Position aufgegeben werden braucht. I m Zweifel sollte man jedenfalls das Verfahren lieber etwas höher anhängen; Vereinfachung des Verfahrens aus diesen oder jenen Gründen sollte nicht so wichtig sein. Das Vorschlags- und Wahlverfahren hat sich bei Bundesrichtern i m allgemeinen bewährt; Zeichen grober Parteilichkeit mußten nicht beobachtet werden, dafür stand schon der Zwang zum politischen Kompromiß (So Fromme, 1981). Schwieriger als diese Frage dürfte jene nach dem Auswahlverfahren (§§ 25 ff. V w G O ) sein, wer also fachlich qualifiziert genug erscheint, um überhaupt auf die Vorschlagsliste gesetzt zu werden. Möglicherweise liegt hier sogar der ärgste Konfliktstoff. Aber andererseits war es bislang immer noch möglich, beispielsweise Aspiranten für das Amt eines Bundesrichters auszuwählen und vorzuschlagen. Der Vergleich ist zulässig, das Beispiel auch. Auch von Bundesrichtern erwartet man hohen Sachverstand und Ausgewogenheit, persönliche Integrität sowieso. Ob sich Sachkunde auf dem Gebiet der Rechtswissenschaften leichter objektiv beschreiben und erkennen läßt als auf den - noch weiteren - Feldern von Naturwissenschaft und Technik, kann man wohl annehmen. Das Problem kann nicht verniedlicht werden. Man erinnert sich dabei auch des förmlichen Hilferufs von Heinz Maier-Leibnitz (1982) in seinem Artikel „Vorschlag einer Glaubwürdigkeitsprüfung. Die wissenschaftlich-technische Politikberatung ist in Gefahr". Ihm müssen Vorkommnisse zugrunde liegen, die Vertrauen zerstört haben - auch wenn nur eine frühe Phase der Meinungsbildung angesprochen war, die Politikberatung im Vorfeld der Gesetzgebung. Maier-Leibnitz spricht auch von Glaubwürdigkeit; dies wäre eigentlich eine andere Kategorie als Fachwissen; aber MaierLeibnitz meint fachliche Kompetenz, die Vertrauen verdient und daß eben dieses notwendige Vertrauen erschüttert oder zerstört würde, wo und wenn eben dann doch Kompetenz in Wirklichkeit fehle. Es ist dies die bekannte Geschichte von der Ignoranz, die sich als Koryphäe und Kapazität zu gebärden weiß. Dagegen kann man sich immer oder niemals schützen. Als Sachverständige können diese Experten, die keine sind, von der interessierten Partei präsentiert werden. A u f die Vorschlagsliste der Expertenrichter zu kommen, wird schon viel schwieriger sein; dort ließen sich ja auch wissenschaftliche Nachweise, die Heinz Maier-Leibnitz fordert, systematisch einbauen. Schon das Vorschlags-, erst recht das Wahlverfahren wäre transparent. Inkompetenz ließe sich aufdecken. Unechtes als echt zu verkaufen, ist erheblich, bis nahe an die Unmöglichkeit, erschwert. Mag die Verantwortung eines Richters und eines Urteils i m Namen des Volkes einem Parteigänger oder Scharlatan - oder auch nur jemanden, der sich bloß für kompetent hält, weil er seine wahren Fähigkeiten nicht zu erkennen vermag - wenig beeindrucken: das Auswahlund Wahlverfahren würde einen Riegel vorzuschieben wissen. M i t diesen generellen Bedenken echten und unechten Experten gegenüber soll keineswegs der Eindruck erweckt werden, als ob sich vor Verwaltungsgerichten Ignoranten nur so tummeln könnten. Daß das Expertentum aber längst zu einem
1
Edgar Michael Wenz
zweischneidigen Schwert geworden ist und Unsicherheit, nicht nur Unbehagen ständig zunehmen, wird auch publizistisch häufig erörtert {Bonus, 1981). Für die Bestellung des Gerichtsgutachters bei Verfahren der Großtechnologie wird große Sorgfalt aufgewendet, dafür sorgen schon die Parteien. Aber mit den Sachverständigen scheint es doch erhebliche Probleme zu geben. Das ist unschwer zu erkennen aus der Literatur, die sich mit den fachlichen Voraussetzungen für die Sachverständigen befaßt; darauf muß man noch zurückkommen, weil aus diesem Kreis möglicherweise die Expertenrichter ausgewählt werden müssen. Aber die von Hellmut Wagner mehrfach erhobene Forderung, „der Richter muß den Sachverständigen zwingen, klar erkennbar zu unterscheiden zwischen gesichertem Erkenntnisstand, begründeter Vermutung und reiner Spekulation" (1982a, S. 112), läßt nicht nur die Verantwortlichkeit eines Sachverständigen i m Vergleich zum Richter, die hier schon beleuchtet wurde, erneut erkennen, sondern offenbart auch intellektuelle Probleme bei Beteiligten an Prozessen von größerer sozialer Tragweite. Die Schwierigkeiten bei der Berufung zum Expertenrichter sind nicht gering, vielleicht sogar größer als die des Richterwahlausschusses für die Bundesgerichte. M i t der Vielfalt und der Tragweite der von den Expertenrichtern erwarteten Entscheidungen läßt sich das erklären. Bisher glaubte man, diese nun möglicherweise epochalen Wertungen Juristen überbürden zu können, nur wenn sie sich die Befähigung zum Richteramt durch das zweite Staatsexamen erworben haben. Es werden sich Wege finden lassen, die richtigen, die jeweils bestmöglichen Expertenrichter zu finden - so schwer das auch sein mag, so sehr das auch volle Aufmerksamkeit und alle Sorgfalt erfordern wird. Man muß sich natürlich i m klaren sein, daß diesem Auswahl- und Berufungsverfahren sehr schnell von interessierter Seite untergeschoben werden wird, es wäre dies in Wahrheit die antizipierte Entscheidung. M i t der Bestimmung der Expertenrichter wäre schon, jedenfalls tendenziell, das Urteil gesprochen. Es wird nicht leicht sein, sich von diesem Geruch zu befreien. Es wird sogar schwer sein, und zwar ebenso schwer wie es wichtig ist, daß es gelingt. Nichts wäre gefährlicher als die Vorstellung von einem voreingenommenen Gericht. Von Naturwissenschaftlern und Technikern, die sich mit Giftstoffen, Gentechnik und Kernkraft oder bestimmten Projekten der Großtechnologie befaßt haben, kennt man - oder glaubt man zu kennen - deren „Einstellung"; damit wäre die Entscheidung vorweggenommen. Bei einem Schüler und Mitarbeiter von Heinz Maier-Leibnitz beispielsweise, für den „Atomgegner . . . sozusagen Antiexperten sind", wird man gewiß tendenzielle Zustimmung zum Reaktorbauvorhaben erfahren. Wenn das die „Befürchtung" wäre, dann wäre sie wohl begründet. Die sicherlich ebenso begründete Hoffnung ließe sich aber dann - um in diesem Beispiel zu bleiben - bei Kernkraft-Befürwortern als Expertenrichter hegen angesichts deren Sachkunde, die richtigen Wege zur Herstellung der erforderlichen Sicherheit beurteilen zu können. Eine gewisse Gefahr der Polarisierung läßt sich gewiß nicht verkennen, solange Technologie in Kategorien wie „gut und böse" eingeteilt wird. Käme sie, noch dazu in einem zahlenmäßig kleinerem Gremium, auf, dann würden die Schwierigkeiten sehr
Die Akzeptanzkrise als Legitimationskrise
1
groß werden. Solange damit nur die Kompliziertheit des Sachverhaltes und die Entscheidungsfindung sich widerspiegelt, solange kann man das genauso gut als Vorteil denn als Nachteil betrachten. Ein strenges „konkretes Leitbild" des Sachverständigen 33 kann ebenso erwogen werden wie ganz ernsthaft die Möglichkeit, vielleicht sogar die Bedingung, daß die Expertenrichter nicht aus wissenschaftlichen „Lagern" kommen. Es wurde schon an anderer Stelle angeregt, auf ausgesprochene und erklärte Spezialisten - zumindest teilweise - zu verzichten und auf Naturwissenschaftler und Techniker i m weiteren Sinne zu reflektieren. Ein Physiker, der nicht hochspezialisiert ist, kann auf jeden Fall den Sachvorträgen besser folgen als ein noch so naturwissenschaftlich und technisch interessierter Jurist. Selbst ein überfachlich interessierter Maschinenbauingenieur könnte schon die Kriterien des Expertentums aus dieser mehr generellen Sicht erfüllen. Man hat ja auch schon früher in die Enquete-Kommission beim Deutschen Bundestag Gutachter berufen, für die „auch die Ausgewiesenheit in anderen Fächern genügen" sollte; damit sollte Gegnern der Kernenergie die Möglichkeit zur Erstellung von Gutachten ebenfalls eröffnet werden. Weder für die Enquete-Kommission noch für das Expertengericht gibt es „Wunderwaffen". Spätestens hier muß ein Aspekt untersucht werden, den man genauso an den Anfang der Überlegungen hätte stellen können, die Frage nämlich nach der Gesetzlichkeit des Richters. Danach muß der gesetzliche Richter, also die Besetzung eines Gerichts schon feststehen, bevor eine Klage erhoben wird. Dies ist ein Verfassungsgrundsatz von unabdingbarer Bedeutung, er ist auch i m Grundgesetz in Art. 101.1.2 und ebenso in den Länderverfassungen, so in der Bayerischen Verfassung in Art. 86.1.2, geregelt. Es scheidet also aus, daß ein Gericht erst berufen wird, wenn der Gegenstand der Klage, etwa ein spezielles technologisches Problem, bekannt ist. Somit bleibt also auch die Möglichkeit verschlossen, bestimmte Experten zu bestimmten Fragen heranzuziehen. Damit aber verschwindet auch gleichzeitig die Gefahr der Manipulierbarkeit oder auch nur einer vorwerfbaren Voreingenommenheit in bestimmten wissenschaftlichen und technischen Fragen, oder sie wird zumindest auf ein hinnehmbares Maß eingeschränkt. Damit aber wächst gleichzeitig die Notwendigkeit, nicht gar zu spezialisierte Naturwissenschaftler und Techniker als Expertenrichter zu berufen, sondern eben umfassend ausgebildete und gebildete. Die hier angestellten Untersuchungen, ob hochqualifizierte Spezialisten oder eben Naturwissenschaftler und Techniker mit einem nicht so spezialisierten, dafür „allgemeineren" Wissensstand, die „besseren" Expertenrichter seien, stehen nicht mehr, freilich nicht aus wissenschaftlich-technischen Erwägungen, sondern aus rein juristischen. Das komplexe Problem hat sich auf die rechtliche Alternative reduziert - freilich auf einer verfassungsrechtlichen Ebene, die auch einen ganz bedeutenden staatsphilosophischen und rechtshistorischen Bezug hat. Ohnehin wollen wir mit der Technologiefachkammer ohne jede Verfas-
33
Hellmut Wagner, 1980c, S. 86; er lehnt eine Verrechtlichung ab, sieht aber „Leitlinien ohne originäre Rechtsnormqualität" für vorteilhaft.
1
Edgar Michael Wenz
sungsänderung, nicht einmal einer peripheren, auskommen. A m Grundsatz der Gesetzlichkeit des Richters, einem Pfeiler der Rechtsstaatlichkeit, sollte ohnehin nicht gerührt werden. In unseren bisher angestellten Überlegungen zu diesem Thema haben wir nur darzulegen versucht, daß auch ohne diesen rechtsstaatlichen Aspekt ein Expertenrichter i m untersuchten Sinne sachkundig bleibt und Sachverstand einbringt, wenn er kein qualifizierter Spezialist ist. Ein erfahrener Kaufmann als Handelsrichter bringt auch dann Sachverstand in ein Verfahren ein, bei dem es um Handelsvertreterrecht geht, ohne daß er beispielsweise je als Einzelhändler Handelsvertreter beschäftigt hätte. Ob ein Ingenieur, der nicht gerade Verkehrsfachmann ist, oder ein Physiker, der sich beruflich mit medizinaler Elektrophysik befaßt, nun noch als Experte i m strengen Wortsinne für die verkehrstechnische Angemessenheit einer Startbahn oder das Risikopotential eines Kernkraftwerkes anzusprechen ist, dürfte mehr eine semantische Frage sein. Auch wenn sich nun die Fragestellungen durch Reduzierung der Komplexität vereinfacht haben, die Aufgabe bleibt schwer. Man tut sich jedoch leichter, wenn man sich die Alternative vor Augen hält, die sonst zur Wirkung käme: die Entscheidung oder doch das Entscheidungsschwergewicht nur durch Juristen als Berufsrichter. Würde diese Lösung mehr Vertrauen in der Bevölkerung erwecken? Wir dürfen nicht fragen nach dem „idealen" Gericht. Gestattet und gefordert ist nur der Vergleich zwischen der Leistungsfähigkeit des herkömmlichen Verwaltungsgerichtes und der hier vorgeschlagenen Technologiefachkammer - leistungsfähig i m Sinne legitimationserhöhender Wirkung. Die Besoldungsregelung gehört hierher. Wir haben die Unabhängigkeit des Expertenrichters von der Justizverwaltung, unabhängig i m disziplinarischen und laufbahnmäßigen Sinne, als Vorteil gewertet, deshalb auch das Modell des Laienrichters - des ehrenamtlichen Richters in der deutschen juridischen Terminologie - , gegenüber etwa berufsmäßigen Expertenrichtern, exemplarisch den technischen Mitgliedern des Bundespatentgerichtes, vorgezogen. Konsequent müßten nun auch die Regelungen der Vergütungen, genauer gesagt die Entschädigungen für Laienrichter, zur Anwendung kommen (§ 32 VwGO). Das wäre das Gesetz über die Entschädigung der ehrenamtlichen Richter bei den Gerichten; dazu gibt es noch eine Reihe landesrechtlicher Vorschriften, bunt und vielfältig wie die Länder und die Gerichte. Das Strickmuster ist allerdings ziemlich einheitlich. In aller Regel geht es um Verdienstausfall und Reisekosten, um eine bescheidene Aufwandsentschädigung. Materiell gesehen ist das nichts Halbes und nichts Ganzes. Eine Attraktion i m wirtschaftlichen Sinne ist das Laienrichtertum jedenfalls nicht. Das war wohl aus der deutschen rechtsgeschichtlichen Tradition heraus auch bezweckt. Man kann von einem „Richter-Ehrensold" sprechen (mit mehr Akzent auf Ehre denn auf Sold). Das unübersehbar Besondere am Expertengericht der Technologiefachkammer empfiehlt aber, auch hier zumindest besondere Wege zu untersuchen. Zwei Extreme drängen sich dabei auf: Eine volle Bezahlung, gutes Geld für gute Arbeit, nach wirtschaftlichen Regeln, die die berufliche Qualifikation der Expertenrichter ebenso bedenken wie die Bezügeregelungen i m öffentlichen Dienst, insbesondere
Die Akzeptanzkrise als Legitimationskrise
19
für Richter. Oder aber das reine Gegenteil davon - überhaupt keine Vergütung; es soll ein Ehrenamt sein i m ursprünglichen Wortsinne. So ist das j a schon bei Handelsrichtern geregelt; dabei „hat sich die alte Vorstellung, ein Ehrenamt schließe eine Entschädigung aus, noch erhalten" (Liekefett, 1965, S. 85). Beide Regelungen ließen sich begründen. Die wirkliche Ehrenamtlichkeit wäre in aller Regel Expertenrichtern auch zumutbar, da diese keine wirtschaftlichen Einbußen hinzunehmen brauchen. Für Selbständige und Freiberufler, die auch in solchen Positionen denkbar sind und nicht aus wirtschaftlichen Überlegungen ausgeschlossen werden können, ergibt sich dann eine Härte. Aber ein Ehrenamt muß auch dann ein Ehrenamt bleiben, wenn es schwer zumutbar ist. Wenn es bei dem Expertengericht vorder- und hintergründig darauf ankommen soll, Vertrauen bei den Rechtsunterworfenen zu erwecken, dann möchte man der ehrenamtlichen Lösung zuneigen. Aber es gibt (fast) ebenso viel dagegen zu sagen, mit den genau umgekehrten Argumenten. In einer materiell orientierten Gesellschaft könnte Bereitschaft zum ehrenamtlichen Tun suspekt sein („Nur was nichts wert ist, kostet auch nichts"). Freilich wird es sehr schwierig sein, eine einigermaßen angemessene Vergütung zu finden. Es ist recht gut vorstellbar, daß die von den Prozeßparteien eingebrachten Sachverständigen - Berufskollegen der Expertenrichter - ansehnliche Honorare erwarten dürfen. Ein materieller Gleichstand wird sich kaum erreichen lassen. Da wahrscheinlich gerichtliche Sachverständige und Gutachter für angemessene Zeit vom Expertenrichteramt ausgeschlossen sein werden 3 4 - und umgekehrt - , könnten durchaus finanzielle Überlegungen aufkommen. Versuchte oder vollendete Ablehnung des Ehrenamts der Expertenrichter, bei dem materielle Gründe sich nicht zweifelsfrei ausschließen lassen, würden Vertrauen zerstören. Das muß man sehen. Erkannte Gefahren sind aber nur noch halbe Gefahren. Es wäre aber bedrükkend, wenn diese Frage irgendwie in den Vordergrund rückte. Die Technologiefachkammer ist ein Glied der Verwaltungsrechtsprechung; folglich gilt die Verwaltungsgerichtsordnung. Das Besondere des Entscheidungsinteresses des Expertengerichtes macht Überlegungen erforderlich, ob und inwieweit bestimmte Vorschriften eben dieser besonderen Aufgabe angepaßt werden sollten. Juristen als Berufsrichter und Expertenrichter sollten numerisch gleich vertreten sein. Der Vorsitzende des paritätisch besetzten Kollegialgerichts müßte allerdings Jurist sein; die Verhandlungsleitung erfordert spezifische Erfahrungen, die nur ein Berufsrichter in seinem Berufsleben sammeln kann. Angesichts der eingehend erörterten personalen Schwierigkeiten mit der Besetzung eines Expertengerichtes wäre zunächst zu prüfen, ob nicht die örtliche 34 In Analogie zu § 20 VwVfG und § 54.2 VwGO, wo auch der Grundsatz des Verfahrensausschlusses von bereits mit der Sache befaßten oder verbundenen Personen zugunsten ehrenamtlicher Tätigkeit aufgehoben ist.
0
Edgar Michael Wenz
Zuständigkeit von mehreren Gerichtsbezirken zusammengelegt wird, also eine örtliche Konzentration erfolgen soll. Da derartige Verfahren nicht sehr häufig sind, gibt es keine ökonomischen Einwände, etwa in Rücksicht auf die Reisekosten der Prozeßbeteiligten. Diese örtliche Konzentration ist ja i m deutschen Prozeßrecht bekannt; diese hat sich auch bewährt, wie man daraus schließen darf, daß nach diesem Muster zunehmend Zusammenlegungen des Gerichtsstandes erfolgen. Staatsschutzsachen, Wirtschaftsstrafsachen, NS-Verbrechen, Disziplinarsachen werden an bestimmten Gerichtsorten zusammengezogen. § 27 I I U W G ermächtigt die Landesregierungen, durch Rechtsverordnung mehrere Landesgerichtsbezirke in Wettbewerbsstreitsachen zusammenzuziehen, „wenn diese Rechtspflege in Wettbewerbsstreitsachen, insbesondere der Sicherung einer einheimischen Rechtsprechung dienlich ist." Man braucht wohl nicht viel Worte zu machen, wenn man diesen Grundgedanken auf technologische Angelegenheiten übertragen will. Wenn man für die Verwechslungsgefahr von Warenzeichen gebündelte Sachkenntnis glaubt organisieren zu müssen, und wenn sich diese Konzentration bewährt hat, dann sollte man bei der Großtechnologie schnell zugreifen. Das ist ja nun auch durch einen Beschluß des Bundesrates in die Wege geleitet worden (Drucksache 100/82. Entwurf einer Verwaltungsprozeßordnung). Die Sitzungsperioden müßten der vorhersehbaren Langzeitdauer des Verfahrens entsprechen. Schon aufkommende Überlegungen zu einem vereinfachten Rechtsmittelzug 3 5 müssen auch auf die Technologiefachkammer übertragen werden. Es müßte eine Tatsachen- und eine Revisionsinstanz ausreichen. Dies schlägt Fritz Ossenbühl (1980, S. 552) konkret zur Verkürzung der Gesamtprozeßdauer vor; in einem mehrjährigen Prozeß liefe man ohnehin Gefahr, daß der jeweilige Stand von Wissenschaft und Technik davonläuft. Ein grundgesetzliches Gebot eines dreistufigen Gerichtsschutzes ist auch nicht zu erkennen {Fürst, 1981, S. 70). Die Initiativen des Bundesrates zielen in erster Linie darauf. In den Koalitionsvereinbarungen 1983 3 6 ist dieser Gedanke festgehalten, so daß die Realisierung wohl in absehbarer Zukunft erwartet werden darf. Das Obergericht muß natürlich nach den gleichen Prinzipien zusammengesetzt sein wie die Technologiefachkammer in der ersten Instanz. Eine numerische Überlegenheit der Juristen wäre allerdings auch vertretbar, da in der Revision überwiegend Rechtsfragen erörtert werden. Naturwissenschaftliche und technische Sachfragen sind freilich in ihrer Wirkung schließlich Rechtsfragen. Das Potential der Expertenrichter wäre nicht ausgeschöpft, wenn diese sich ihren Eindruck aus der mündlichen Verhandlung zu gewinnen gezwungen wären, vergleichbar den Schöffen i m Strafprozeß. Das widerspräche auch dem Sinn der Beiziehung von Naturwissenschaftlern und Technikern in die Kammer. Aktenein35 Uwe Jessen, in: NVwZ 82, S. 410 ff.; H. Sendler, DVB1. 82, S. 812 ff. (820); dazu Entwurf einer Verwaltungsprozeßordnung, BJM, Febr. 1982. 36 Vom 22. 3. 1983, Abschnitt Innen- und Rechtspolitik, Ziff. 13 Verwaltungsgerichtsbarkeit: „Es besteht Übereinstimmung darüber, daß in Fällen technischer Großvorhaben das Gerichtsverfahren zweizügig (mit einer Tatsacheninstanz) gestaltet werden soll
Die Akzeptanzkrise als Legitimationskrise
1
sieht müßte in jeder Phase des Verfahrens, nicht nur theoretisch, sondern praktisch gewährleistet sein und tunlichst erleichtert werden. Den Prinzipien der deutschen Rechtsordnung und den konkreten Regeln der Verwaltungsgerichtsordnung trägt auch der Grundsatz der Ablehnung eines Expertenrichters wegen Besorgnis der Befangenheit (§ 54 V w G O ) Rechnung. M i t ihm könnten Unzulänglichkeiten bei der Richterwahl ausgeglichen werden. Diese Vorschrift kann sich natürlich auch zu einer Keule der Prozeßverschleppung entwikkeln, weil über diese Vorschrift die Expertenrichterwahl - deren Wichtigkeit und Problematik wir ja erkannt haben - ein zweites und drittes Mal, auf anderer Ebene, ausgetragen werden könnte. Die Interessenskollision (§ 54 I I I V w G O ) würde dann alsbald literarische Aufmerksamkeit finden. In der Zusammenfassung läßt sich die Technologiefachkammer wie folgt skizzieren: • Die Technologiefachkammer ist eine Fachkammer beim ordentlichen Verwaltungsgericht; sie ist sachlich zuständig für alle Sachen der Großtechnologie, die über Individualinteressen hinausgehen; ob die Kompetenzregelung durch eine Generalklausel oder/und enumerativ erfolgen soll, ist sicherlich wichtig, übersteigt aber das Erkenntnisinteresse dieser Arbeit. M i t den auslösenden Faktoren - Gift, Gen und Kernkraft - läßt sich j a auch das Feld thematisch verständlich abstecken 37 . • Die Technologiefachkammer ist ein Kollegialgericht, das sich aus Berufsrichtern und Laienrichtern (im Sinne von Nicht-Juristen) paritätisch zusammensetzt, unter Vorsitz eines Berufsrichters. Die Anzahl der Richterpersonen ist größer als bei den anderen „normalen" Kammern des Verwaltungsgerichtshofes; das gilt auf jeden Fall für die Eingangs- und Tatsacheninstanz. • Die Laienrichter sind Naturwissenschaftler und Techniker mit besonderer Qualifikation (Expertenrichter). Da ihrer Berufung besonderes Gewicht zukommt, muß dieser Frage die größte Sorgfalt beigemessen werden. Schon die Aufnahme in die Vorschlagsliste muß nach Kriterien wissenschaftlichen und beruflichen Ansehens erfolgen; diese müssen zwar nicht unbedingt reglementiert, aber offengelegt werden. Zuvor muß die Klärung herbeigeführt werden, ob Experten im engeren Sinne - worunter solche zu verstehen wären, die auch als Sachverständige berufen werden könnten - oder i m weiteren Sinne - bei denen also naturwissenschaftliche und technische Kenntnisse aus anderen Bereichen, aber mit der Fähigkeit zur globalen Sicht vorliegen - oder aus beiden Gruppen in einem bestimmten Verhältnis zu benennen sind. Die Berufung erfolgt mit qualifizierter Mehrheit der hierfür noch zu bestimmenden Gremien; es sollen dabei die Regeln angewendet werden, die für die Berufung von Landes- oder Bundes37 Hellmut Wagner (1980b, S. 666) listet sieben Bereiche auf, bei denen „Abwägungsprobleme" aufkommen: Arzneimittel, Kernenergie, Chemikalien, Datenschutz, Gen-Technologie, Immissionsschutz und Luftverkehr.
Edgar Michael Wenz lichter gelten. Die Auswahlkriterien können nur bestimmt sein vom sozialpsychologischen Effekt, der zwar ohne besonderen Sachverstand nicht erreicht werden kann, aber der auch wiederum nicht verlangt, daß dieser Sachverstand für das anhängige Verfahren spezifisch und ausgeprägt ist. Das Verfassungsprinzip der Gesetzlichkeit des Richters stünde ohnehin einer gezielten Auswahl für bestimmte Fälle entgegen. • Ein Verwaltungsgericht bestimmt werden.
soll örtlich zuständig für mehrere
Gerichtsbezirke
• Das Verfahren sollte in zwei Instanzen abgeschlossen werden, eine Tatsachenund eine Revisionsinstanz. (Diese Überlegung eröffnet auch den Weg, eine Technologiefachkammer gleich beim Verwaltungsgerichtshof als Eingangsinstanz zu installieren.) • A u f die wichtige Funktion der Laienrichter (Expertenrichter) muß durch erheblich erleichterte Akteneinsicht und durch angepaßte Sitzungsperioden Rücksicht genommen werden. Auch die Frage der Besoldung der Expertenrichter sollte überdacht werden. Aufgabe, Funktionen und Zuständigkeiten der Technologiefachkammer sind exakt die gleichen wie sie die hierfür bestimmte Kammer beim Verwaltungsgericht derzeit nach geltendem Recht hat. Insbesondere ist nicht an ein anderes und neues Genehmigungsverfahren auf justiziellem Wege gedacht. Auch die Technologiefachkammer ist lediglich eine Kontrollinstanz, und zwar die gewaltenteilig zuständige, ob die vom Gesetzgeber zuständigkeitshalber erlassenen Normen von der für die Durchführung zuständigen Verwaltungsbehörde richtig angewendet worden sind. Die Hoffnung und gar Reflexionen darüber, eine neue Genehmigungsbehörde mit der Technologiefachkammer installiert zu haben, wären nicht nur total fehlerhaft, sie wären auch schädlich. Das gilt auch und gerade für Erwartungen, daß die Technologiefachkammer zwar nicht die ausdrückliche Kompetenz als zusätzliche Genehmigungsbehörde habe, die sich dazu zwar latent, aber real entwickeln würde. Das hieße, die Technologiefachkammer in Sinn und Zweck völlig mißzuverstehen. Weitere Diskussionen würden schon unter dem Schatten eines solchen Mißverständnisses leiden müssen. Wie weit die Kontrolldichte der Technologiefachkammer beim Verwaltungsgericht verstärkt oder aufgelockert wird, kann nur davon abhängen, wie die Gesetzgebung außerrechtliche Normen zu integrieren weiß. Eine Rechtsentwicklung freilich dahingehend, daß sich das Gericht auf formale Prüfungen zu beschränken, sich Prüfungen inhaltlicher Richtigkeit zu enthalten hätte, die höchste Stufe der „Verwaltungsvereinfachung", eine solche Entwicklung kann sicherlich nicht erwartet werden, wenngleich zu hoffen wäre, daß der Normgeber präziser wird; dafür hat er auch noch genügend Freiraum, ohne sich dem Verdacht auszusetzen, er wolle Wissenschaft und Technik, den Fortschritt i m industriellen und sozialen Sein, gängeln. Käme es aber zu einer solchen Entwicklung, bräuchte man freilich keine naturwissenschaftlich und technischen Experten i m Gericht; bei einer solchen Verfassungslage wären allerdings alle Probleme am
Die Akzeptanzkrise als Legitimationskrise besten bei Juristen aufgehoben. Aber Akzeptanzkrisen, wie sie eben auch eine Verfassungskultur hervorbringt, wären dann wohl erst recht nicht gelöst. Es kann nur immer und immer wieder wiederholt werden: Ziel der Technologiefachkammer ist nicht - jedenfalls nicht in erster Linie - „besseres" Recht und „mehr" Wahrheit zu finden und zu sprechen. Vorrangiges Ziel ist die Legitimation durch Verfahren und die Legitimationserhöhung durch Vertrauen, durch Vertrauen in das Verfahren, durch Vertrauen im Verfahren. Vertrauen kann aber freilich nur gedeihen auf dem Boden eines Grundkonsensus. Wo Systemvertrauen und aus ihm wachsende generalisierte Bereitschaft der Entscheidungshinnahme fehlen, dort können auch nicht einzelne Funktionen des Systems Überzeugungen schaffen, auch nicht die dritte Gewalt, auch nicht ein Fachgericht, auch nicht die es bildenden Richter. Daß die Experten im Gericht, denen die Letztentscheidung zufällt, darüber hinaus auch Evaluierung der Richtigkeit herbeizuführen fähig wären, mögen viele als die wesentliche Aufgabe eines solchen Expertengerichts sehen. Man kann das sehr wohl verstehen, muß es auch begrüßen. Man wird diese Nebenwirkung gerne hinnehmen, erst recht wohl dann, wenn man Richtigkeit und Wahrheit, zumindest als „Kommunikationsmedien" (Luhmann) sieht. Das wird den Wert der Technologiefachkammer erhöhen. Aber das ist nicht ihr eigentlicher Sinn und Zweck. Aber Grundkonsensus und allgemeines Systemvertrauen würden auch durch einen Spruch des Expertengerichts, der mißliebig ist, nicht erschüttert und ausgehöhlt. Die Zukunft der Technologiefachkammer ist allerdings unbestimmt, denn die Diskussion über Technologiefachkammern oder überhaupt über Wissenschaftsgerichtshöfe, die 1977 sich entzündet hatte, ist eingeschlafen. Vor nicht allzu langer Zeit sah dies noch anders aus: Das Land Baden-Württemberg hatte 1978 die Einrichtung technischer Senate bei den Oberverwaltungsgerichten für technologische Großprojekte bereits erwogen und angekündigt 3 8 . Man hat diesen Versuch - Einzelheiten waren nicht bekannt - mit skeptischem Optimismus entgegensehen dürfen. Aber man bekam offenbar in Stuttgart Angst vor der eigenen Courage. Bedauerlicherweise wurde, jedenfalls zunächst, das Vorhaben abgeblasen 39 . Dabei hätte diese Pionierleistung auf dem Gebiet des Rechtswesens BadenWürttembergs sehr wohl angestanden. Das erste Verwaltungsgericht auf deutschem Boden wurde 1863 in Baden gegründet. Man betrat damals Neuland, stieß ein Tor zu einer neuen Epoche auf. Auch mit dem Laienrichtertum ist man in Baden-Württemberg neue Wege gegangen. 1950 nämlich hat man, einzig in der Bundesrepublik, Friedensgerichte eingerichtet, die allerdings 1959 einem Spruch des Bundesverfassungsgerichtes aus grundgesetzlichen Bedenken zum Opfer gefallen sind. 38
Pressekonferenz des Ministers für Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr in Stuttgart am 23. 4. 78. 39 Schreiben des Ministeriums vom 2. 11. 79 an den Autor.
Edgar Michael Wenz Mut bei Gesetzesinitiativen hat das Land Baden-Württemberg auch neuerdings wieder bewiesen, um den Rechtsstaat zu stärken: Wichtiger als die Verordnung zur Überbürdung der Polizeikosten bei rechtswidrigen Demonstrationen ist freilich die Gesetzesinitiative i m Bundesrat (die nun Berlin formuliert hat), „Massenverfahren" zu vereinfachen durch vorgezogene, tatsächlich und rechtlich identische „ M u sterverfahren". Die Verkürzung der Verfahrensdauer mit dem Effekt spürbarer Entlastung der Verwaltungsgerichtsbarkeit ist evident, ohne daß Rechtsstaatlichkeit und Rechtsweggarantie sachlich beeinträchtigt wären. Es wäre eine Fortsetzung des bewährten allemannischen Pioniergeistes, wenn man es dort - nun doch wieder - mit einem neuen besonderen Verfahren versuchen würde. A m Ende der Überlegungen, die zur Bejahung eines „Wissenschaftsgerichtshofes", freilich i m Sinne einer Technologiefachkammer, geführt haben, müssen nochmals die Gedanken angesprochen werden, die schon am Anfang der Erörterungen standen und die genaugenommen uns nie verlassen haben, gar nicht verlassen konnten: Kann man sich Themen und Problemen einer Akzeptanzkrise überhaupt justiziell nähern? Es ist einleuchtend, daß das ursprüngliche Erkenntnisinteresse - Forschungs- und Wissenschaftspolitik - sich umformieren muß in die praktizierte, existente und aktuelle Technik, Forschung und Wissenschaft; daß sie konkret dargestellt werden kann und muß an den Problemen der Großtechnologie. Es ist auch einsichtig zu machen, daß eine solche Akzeptanzkrise auch eine Krise des Rechts ist (oder dazu wird), ohne nun eine zeitliche oder substantielle Rangfolge erstellen zu brauchen; daß eine Akzeptanzkrise immer die Rechtspolitik herausfordert. Aber dennoch - ist ein Gericht und ist ein Gerichtsverfahren der richtige Weg und das richtige Mittel, eine solche Krise zu lösen oder auch nur aufzuweichen? Diese Frage nun führt uns zurück an den Ausgangspunkt der ganzen Thematik, zu den Beiträgen von Meinolf Dierkes und Volker von Thienen, von Gerd Roellecke, Wilhelm A. Kewenig und von mir. In meinem Beitrag habe ich mich mit diesen Fragen befaßt, sie waren j a Auslöser und das Motiv, die Streitfrage aufzugreifen, weil das Thema nicht ausreichend erörtert schien, nicht zuletzt angesichts dessen, wie sehr die anstehenden ungelösten Fragen unsere Gesellschaft bewegen und wie gefährlich falsche Schritte werden können. Falsch und schädlich wäre es allerdings in gleicher Weise, wenn man sich überhaupt nicht bewegte. Über ein Thema waren sich alle Autoren einig: Wissenschaftliche Richtigkeit und Wahrheit läßt sich in einem wie immer gearteten Verfahren, schon gar nicht durch ein Gerichtsverfahren i m konstitutionellen Sinne, erkennen und feststellen. „Die Horrorvision von einer Art wissenschaftlich-technologischem Kardinalskollegium, das in eschatologischen Fragen mit Anspruch und Wirkung eines Dogmas richtet" (siehe Wenz (Hrsg.), Wissenschaftsgerichtshöfe. Mittler zwischen Wissenschaft, Politik und Gesellschaft, 1983, S. 65) brauchte keine Sekunde zu drohen. Der Satz Carl Poppers, daß jeder einzelne und alle zusammen viel mehr nicht
Die Akzeptanzkrise als Legitimationskrise
5
wissen als sie wissen, bedarf bei Wissenschaftlern, die nicht gerade als Marxisten das Endziel kennen oder zu kennen glauben, keiner Begründung. Aber das, was ein Gericht und ein sinnvolles Verfahren zu leisten vermögen, schien mir damals und scheint mir auch heute gut und gerne dazu ausreichend zu sein, sich dieses Mittels zu entsinnen. Wir sehen uns ja auch mit der Tatsache konfrontiert, daß sich die Gerichte mit den technologischen Problemen beschäftigen müssen, ob sie nun wollen oder nicht. Der Entscheidungszwang gilt nicht nur für jedes Gericht, sondern auch für die Politik, und zwar ganz einfach zunächst einmal nach den Alternativen, • ob die bisherige Verfahrensweise vor den Verwaltungsgerichten - Zuständigkeit also nach geographischen, alphabetischen und organisatorischen Zufälligkeiten - beibehalten werden soll; oder • ein spezifisches Verfahren, das sich in einem speziellen Gericht verkörpert, eingerichtet werden soll, das i m besonderen Maße Vertrauen erwecken und erhalten kann. Sich auf die Erkenntnis zu berufen, daß Fragen von wissenschaftlichem Rang eigentlich nicht in ein Gericht gehören, hilft nicht weiter. Das Recht und die Gerichte suchen nicht diese Probleme. Es ist genau umgekehrt: Die Probleme kommen auf das Recht und auf die Gerichte zu, und zwar immer schneller, immer häufiger und heftiger, und von immer größerem gesellschaftlichen Interesse und Brisanz. Jedes Gericht ist gefordert, Streitigkeiten zu entscheiden. A m besten wäre es freilich, es gelänge dem Gericht, die Ursachen des Streits zu beseitigen, den verlorengegangenen Konsens wiederherzustellen. Aber wir nehmen Gerichte, aus den Erfahrungen der Geschichte und Rechtsgeschichte, nur in Anspruch, die Wirkungen des Streites zu dämpfen, vielleicht so gut wie möglich jedenfalls einmal die Folgen zu beseitigen oder auf ein erträgliches Maß herabzusetzen. Auch ohne daß die Beseitigung der Ursachen gelingt, hat damit das Gericht Frieden gestiftet. Und wenn Roellecke (siehe Wenz, a.a.O., S. 49) gemeint hat, „mehr als Frieden zu stiften, kann ein Gericht aber nicht leisten", so meine ich nach wie vor: mehr braucht es auch gar nicht zu leisten. Kein höheres Ziel als Rechtsfrieden kann, wenn man realistisch und somit bescheiden denkt, je erreicht werden. Nur wenn man vom Gericht erwartete, die Ursachen des wissenschaftlichen Streits aufzuspüren und zu beseitigen, dann freilich müßte große Enttäuschung um sich greifen. Aber man hätte dann nichts anderes verlangt, als daß das Gericht i m Auffinden und Beseitigen der Ursachen die Wahrheit aufsuchte und verkündete. Das freilich vermag ein irdisches Gericht nicht zu leisten. Wenn die geforderte Technologiefachkammer diesen Rechtsfrieden wenigstens einigermaßen herzustellen vermag, wäre das Ziel erreicht. Gewiß, auch mit den derzeitigen Verfahren der Verwaltungsgerichtsbarkeit werden Entscheidungen gefällt und durchgesetzt; auch auf diesem Weg wird es weitergehen. Aber man darf 15 Gedächtnisschrift Wenz
Edgar Michael Wenz nicht übersehen, daß die Feststellungen einer Akzeptanzkrise ja genau unter der Geltung dieser Gerichtsbarkeit und ihrer Verfahren aufgekommen sind. Sieht man die Zweifel und die Auseinandersetzungen nicht, oder glaubt man, sie vernachlässigen zu können, dann freilich bräuchte man sich andere Wege nicht zu überlegen und auszudenken. Hält man aber die Auseinandersetzungen, deren Existenz ja nun nicht bestritten werden kann, für schädlich und gefährlich, vielleicht sogar für die Rechtsstaatlichkeit, dann muß eben etwas geschehen. Es werden vielleicht viele Mittel probiert, viele Wege gegangen werden müssen, bis man einigermaßen - und gewiß auch dann nur vorübergehend - mit dem Ergebnis zufrieden sein kann. Ausgewogene und fundierte Urteile gelten i m allgemeinen als „gut und richtig". Sie haben nicht nur formale Rechtskraft erlangt. Sie konnten auch Rechtsüberzeugungen schaffen. Aus rechtsgeschichtlicher Sicht und nach rechtssoziologischen Beobachtungen ist das positive und gesetzte Recht auch weitgehend so entstanden. In hochspezialisierten Fragen wird sich Ausgewogenheit und treffende Begründung eines Urteils nicht so leicht, vermutlich gar nicht erkennen lassen. Menschen stehen dann für dieses Urteil. Richter personifizieren das Urteil. Genießen sie Vertrauen, wird auch das Urteil daran teilhaben. Es wird sich erweisen, ob man sich darauf verlassen darf. Nach den bisherigen Erfahrungen müßte man aber davon ausgehen dürfen. Beim Expertengericht der Technologiefachkammer käme aber noch - über diese wohl kaum angreifbaren Erkenntnisse hinaus - ein weiterer erheblicher Vorteil hinzu: Fortbildung des positiven Rechts durch Richterrecht, nicht durch Usurpation seitens der Justiz, sondern kraft Auftrag und Vollmacht des Gesetzgebers. Wenn schon das Recht fortgebildet und weiterentwickelt werden muß - schon allein deswegen, weil sich Wissenschaft und Technik fortentwickeln - , wenn schon der Gesetzgeber Gerichte als eine Art Ersatz-Gesetzgeber oder Nach-Gesetzgeber einsetzen muß, dann sollten diese Gerichte wenigstens mit Experten, mit Naturwissenschaftlern und Technikern besetzt sein - es sei denn, die Gerichte werden auf rein formale Prüfungen beschränkt, die Kontrolldichte wäre also extrem aufgelockert. Bei unserer Verfassungsstruktur allerdings ist eine solche Vorstellung des Verzichtes der dritten Gewalt auf ein gewisses Maß der Prüfung von materieller Richtigkeit gar nicht vorstellbar. Aber jede materielle Richtigkeit fordert Sachverstand, und zwar qualifizierten Sachverstand bei qualifizierten Problemen. Positives Recht wird so entstehen. Die Rechtssicherheit wird wachsen. Zur Legalität wird sich Legitimität gesellen, wenn zur Gewalt des Amtes die Macht des Vertrauens sich gesellen wird. A n den damaligen Erkenntnissen hat sich auch nach eingehender Beschäftigung mit diesen großen und weiten Fragen nichts geändert. Nur die Dringlichkeit der Lösung oder doch wenigstens eines Lösungsversuches ist noch größer geworden.
Die Akzeptanzkrise als Legitimationskrise
2
VIII. Die literarische Ausbeute Bei der Beobachtung der Literatur zu dem aufgeworfenen Themenkreis muß man sich auf die spezifisch rechtswissenschaftliche konzentrieren. Nur Hellmut Wagner verweist auf den Unterschied zwischen „(gesellschafts-) politischer Akzeptanz der Risiken einer gesamten Technologie (wie ζ. B. der Kerntechnik) und dem rechtlich tolerierbaren Risiko" - zwei unstreitig verschiedene Erkenntnisfelder, von denen nur der rechtliche Aspekt bei den angestellten Erörterungen Beachtung findet, aber auch finden muß, weil die „rechtliche Bewertung von Risiken großtechnischer Anlagen in den nächsten Jahren - über den Kernenergiebereich hinaus - zunehmen" wird (Wagner, 1980, S. 271, 279). Er weist auch auf das Problem hin, daß zwar durch Gesetze die Legalität („förmliche demokratische Legitimation") erreicht werden kann (für eines der von ihm vorgeschlagenen Modelle), w i l l aber auch ein „konsensförderndes gesellschaftspolitisches Spektrum" (Wagner, 1982a, S. 119) i m Gesichtsfeld behalten. Ernst Benda sieht in der Bewertung technischer Risiken („Risikoakzeptanz") zuvörderst „ein eminent moralisches Problem, das die sittliche Verantwortung des Menschen herausfordert" (Benda, 1981, S. 5), dessen rechtlicher Aspekt zunehmende Bedeutung findet. Aber auch unausgesprochen darf man davon ausgehen, daß alle Autoren diese gesellschaftspolitische Komponente sehen, auch wenn sie sich nur mit der sichtbaren juristischen Seite zuständigkeitshalber befassen. Bei dieser Arbeit sind die Akzente verschoben: Uns interessiert Recht und Gesetz, deren Handhabung und Anwendung als eines von vielen möglichen Mitteln, diese unstreitig gegebene gesellschaftspolitische Krise aufzulösen oder wenigstens aufzuweichen helfen. Alle Autoren deuten auf die Schwierigkeiten, die bei der Verknüpfung von Technik und Recht entstehen; das eine etwas Dynamisches, das gar nicht zur Ruhe kommen darf, das andere etwas Statisches und notwendig Konservatives, von dem fester Halt erwartet wird; jenes, was der Wahrheitsfindung in und durch die Wissenschaft dient, und dieses, was auf Rechtsgewinnung ausgerichtet ist. Es ist dies nichts anderes als die Dichotomie von Sein und Sollen, von gesellschaftlich und wirklich Gegebenem und normativ Gesolltem. Es ist dies das Anliegen der Rechtssoziologie, das wir während der ganzen Arbeit i m Auge behielten. Für uns ist die Rechtssoziologie jene Wissenschaft, die an vorderer Stelle für die aufgetauchten Probleme nicht nur zuständig, sondern auch kompetent ist. Aber nur ein einziger, Fritz Nicklisch, hat die Rechtssoziologie expressis verbis angezogen. Wie alle Autoren hat auch er sich diesem Problem auf der Brücke genähert, die Juristen zur Verfügung steht: über Generalklauseln und unbestimmte Rechtsbegriffe. Bei der Untersuchung der Rechtswissenschaft und Jurisprudenz zur Verfügung stehenden Methoden hat er sowohl bei der „Funktion der wechselseitigen Einwirkung" wie bei der - von ihm bevorzugten - „Rezeptionsfunktion" die rechtlich-normative Bedeutung des Faktischen gesehen und genutzt (Nicklisch, 1982a, S. 95). 15*
Edgar Michael Wenz Bei seiner Untersuchung, ob die Rechtsanwender als „Wertungssubjekt" anzusehen seien, meint Fritz Nicklisch, „daß i m Recht der technischen Sicherheit i m Zusammenhang mit den Verweisungen auf den Stand der Technik, auf den Stand von Wissenschaft und Technik usw. die zivilrechtliche, rechtssoziologische, rechtsmethodische Diskussion . . . bisher nicht ins Blickfeld getreten" sei {Nicklisch, 1982a, S. 78). Dies ist eine Feststellung, eine Kritik, für die es hoch an der Zeit war und die gewiß nicht auf den angezogenen Teilaspekt beschränkt werden kann, wer bei außerrechtlichen Normen zu werten habe, der Richter oder der Sachverständige. Es geht um das viel breitere Spektrum, wie Rechtswissenschaft und Jurisprudenz Seins-Sätze gewinnen und verwerten sollen. Würde man sich in (allerdings für den Betroffenen nicht) unwichtigen Fällen nicht mit Alltagstheorien, der Lebenserfahrung, der allgemeinen Meinung, und was „billig und gerecht Denkende" an Überzeugungen und an Rechtsgefühl entwickeln könnten, und eben alle diese nur selten definierten Formeln, häufig begnügt haben, hätte man immer präziser dargestellt und zumindest die Prämissen ausgewiesen, wäre man heute mit der grundlegenden Diskussion gewiß wesentlich weiter. Nur noch Adolf Laufs 40 spricht den „Abstand zwischen dem Sein und dem Sollen" an, der immer größer wird mit der Folge wachsender Rechtsunsicherheit. Deshalb begrüßt er ein interdisziplinäres Zusammenwirken zwischen Naturwissenschaftlern, Ingenieuren und Juristen, um „auch die Rechtstatsachenforschung voranzubringen". Der Ausdruck Rechtssoziologie wäre wohl noch treffender gewesen - hier abgesehen davon, daß nach meinem Dafürhalten es weniger um Rechtstatsachenforschung, also um aus dem Recht fließende Tatsachen, sondern mehr um Tatsachenrechtsforschung {Noll, 1973, S. 69), also aus Tatsachen gewonnenes Recht handelt. Die überwiegende Meinung aller Autoren gegenüber Wissenschaftsgerichtshöfen und Science Courts war überwiegend ablehnend. Nur Günter Hartkopf 1 sieht Vorteile in einem „ m i t der Unabhängigkeit der dritten Gewalt ausgestatteten Science Court", und zwar mit dem Ziel „einer Erleichterung der gesellschaftlichen Konsensbildung". (Aus soziologischer Perspektive glaubt auch Ortwin Renn (1980, S. 70) an eine Möglichkeit der Konfliktlösung durch Partizipation in der Einrichtung von wissenschaftlichen Gerichtshöfen; das erinnert an die partizipatorische Funktion des Laienrichtertums.) Die Diskussionen leiden darunter, daß selten ein Unterschied zwischen den verschiedenen Modellen über die Wissenschaftsgerichtshöfe gemacht wurde; einige Einwendungen wurden dadurch total wertlos, weil der Adressat der Kritik nicht 40 Als Rektor bei seiner Begrüßungsansprache der „Forschungsgruppe Technologie und Recht" an der Universität Heidelberg, abgedruckt in: Technologie und Recht, 1982 (Speyer), S. 3 (5). 41 Pressedienst des BIM vom 30. 11. 79, S. 96 ff., des Vortragsmanuskripts, Vortrag auf der Fachtagung Umweltschutz.
Die Akzeptanzkrise als Legitimationskrise
9
auszumachen war. Das läßt doch auf eine gewisse Pauschalierung, die sich den Vorwurf der Oberflächlichkeit gefallen lassen muß, schließen. Manche
Autoren
nennen konkret
die „Technologiefachkammer".
Wagner
(1980a, S. 272) sieht es „nicht immer mit der erforderlichen Deutlichkeit unterschieden, ob eine solche Einrichtung die Akzeptanz einer ganzen Technologie (durch die Bevölkerung) erleichtern oder gerichtliche Entscheidungen über die Rechtmäßigkeit von Genehmigungen i m Einzelfalle ,treffsicherer 4 machen soll". Das ist allerdings angesichts der Literatur, die er heranzieht, nicht recht verständlich. Ein Irrtum liegt auch vor, wenn er meint, die Technologiefachkammer soll „die Heranziehung jeweils einschlägiger Experten ersetzen" und die „Rollenverteilung zwischen den Sachverständigen und den Gerichten" unterlaufen. Das ist bei dem hier vorgestellten Modell - soweit ich es sehe, sind keine anderen vorgelegt worden - alles nicht zu befürchten; i m Gegenteil, selbst Gefährdungen aus dieser Ecke wird schon von allem Anfang an entschieden entgegengetreten. Aber Hellmut Wagner hat jedenfalls erkannt, daß es nicht nur um die „Treffsicherheit" geht, wohl um den Einzelfall (wie es bei der Entscheidung vor einem ordentlichen Gericht auch nicht anders denkbar ist). Er hat das Ziel der Erleichterung der sozialen Akzeptanz (mit) erkannt. Es kann unerörtert bleiben, ob nun gleich eine „ganze Technologie" angezielt werden soll. Das kann zuviel, aber auch zu wenig sein. Jedes Urteil spricht vom Einzelfall, meint aber immer das ganze Recht und die gesamte Rechtsordnung, für die es steht und für die es wirbt. Man kann aber auch sagen, wenn man die sozial-psychologische Sicht durchaus richtig in den Vordergrund stellt, daß es um das ganze Industriezeitalter geht. Die Annahme, den Hintergrund würde eine ganze Technologie bilden, kann also durchaus stehenbleiben, wenn dies einem besseren Verständnis förderlich ist. Das kann natürlich nicht bedeuten, daß die richtige „treffsichere" Entscheidung außerhalb unseres Interesses läge. Die Feststellung, daß jedes Gericht eine richtige Entscheidung zu fällen hat, wäre trivial. Würde ein Expertengericht die Gewinnung und Findung richtigen Rechts nur um einen Deut gefährden, hätte es jeden Sinn verloren. Erst dann, wenn nicht der geringste Zweifel besteht, daß ein Expertengericht das gleiche zu leisten vermag wie ein Juristengericht, kann die sozialpsychologische Komponente erwogen werden. Es darf wohl durchaus zugegeben werden, daß die Hoffnungen vieler, die Qualität der Urteile könnte, j a müßte zunehmen, gewiß nicht unberechtigt ist. Dies stellt sich jedoch nicht in den Vordergrund, wir brauchen diesen Vorteil nicht für unsere Gedankengänge. Wenn schon von „Treffsicherheit" die Rede ist, mag dieses freilich saloppe Beispiel erlaubt sein: es geht mir nicht gerade um die fabelhafte „österreichische Gebirgshaubitze", deren Wirkung „eine moralisch ungeheuere" sein sollte, auch wenn sie nicht träfe. Wir denken nicht an ein Fachgericht, das nur „scheppert und kracht"; wir glauben eher an seine Treffsicherheit. Aber dennoch, das Beispiel ließe keinen methodischen Protest zu.
0
Edgar Michael Wenz
Die Argumente von Peter Marburger (1981a, S. 29) gegen die Technologiekammer („wenig erfolgversprechend") kommen aus Zweifeln an dem technischen und wissenschaftlichen Sachverstand der Richter. Es scheint, als ob Marburger an ständige (berufsmäßige) technische Richter denkt, die freilich „nicht auf allen Gebieten der Natur- und Ingenieurwissenschaften fachlich kompetent sein" können. Bei einer Auswahl von Experten als Laienrichter müßte dieses Argument fallen, falls man nicht ohnehin auf hart spezialisierte Techniker und Wissenschaftler, aus guten Gründen, verzichten will. Der Hinweis, daß sich das Gericht durch die Heranziehung von Sachverständigen sachverständig machen kann, könnte nicht einmal dann ziehen, wenn es um die Evaluierung des Urteils ginge. Auch Ernst Benda (1981, S. 9) beschäftigt sich nur mit dem Leistungsvermögen der Technologiekammer für die Sachrichtigkeit. Er bezweifelt die finanzielle und organisatorische Realisierbarkeit; auch er verweist auf die Möglichkeit der Beiziehung sachverständiger Gutachter. Freilich: „Diesen Vorschlägen (der Technologiekammer) liegt aber die richtige Erkenntnis zugrunde, daß die Richter durch die Komplexität der Sachverhalte häufig überfordert sind, auch wenn sie sich selbst als ,Pseudo-Experten' geben". Rudolf Lukes (1978, S. 297), auf den sich Ernst Benda bei seiner generellen Ablehnung beruft, hält alle Formen von Wissenschaftsgerichtshöfen zwar für „interessante Denkanstöße"; sie „entbehren allerdings des realen Bezugs zur deutschen Rechtsordnung". Allerdings gab es zu dem Zeitpunkt, als der Artikel von Meinolf Dierkes und Volker von Thienen gerade erschienen war, die ihm folgenden Aufsätze jedoch noch nicht. Später wird Rudolf Lukes (1981, S. 126) konkreter, als er vom „Sachverstand auf der Richterbank" spricht; von „Spezialspruchkörpern", insbesondere aber von „Sachverständigen als Laienbeisitzer"; von einschlägigen Überlegungen, die wiederkehren. Seine Einwendungen: Immer weitergehende Spezialisierung, die keinen Sachverständigen mehr gesamte Bereiche übersehen läßt. Lukes hält einen sachverständigen Beisitzer, der nur auf seinem Spezialgebiet sachkundig sein kann, für eine Entscheidung, in der auch Sachkunde aus anderen Gebieten der Technik verlangt werden, für „eine größere Gefahr als den sachunkundigen Richter. Die Gefahr besteht darin, daß der spezialisierte Sachverständige auf der Richterbank einem anderen Sachverständigen, der in einem anderen Gebiet vom Gericht hinzugezogen wird, regelmäßig nicht in dem Maß unvoreingenommen gegenübersteht, wie der rechtskundige Richter". Ob Lukes die Ursache hierfür in den allgemeinen menschlichen Unzulänglichkeiten sieht oder als einen weiteren A k t i m Drama „Gelehrtengezänk", was aufs gleiche hinausliefe, ist nicht zu erkennen. Es gibt keine Belege hierfür, allerdings auch nicht für das Gegenteil. Die gleichen Probleme spielen sich natürlich auch auf anderen Ebenen ab. Auch der rechtsgelehrte Richter muß mit Voreingenommenheiten, denen er aus dem privaten Bereich - Plakate gegen den „Atomtod", die Sohn und Tochter für die nächste Demonstration in der Garage abgestellt haben? - ausgesetzt ist, auch fertig werden. Es gibt jedenfalls keinen entscheidenden Anhalt, daß die persönliche Redlichkeit
Die Akzeptanzkrise als Legitimationskrise
1
und Integrität eines Juristen von Haus aus stabiler ist als die eines Naturwissenschaftlers. Die Idee des „S ach Verstandes auf der Richterbank' 4 mit Diskussionen zur Novellierung des Verfahrens- und insbesondere des Beweisrechts führte zur Frage, ob durch sachverständige Richter sich nicht die Problematik auf elegantem Wege lösen ließe, die mit den Sachverständigen aufgekommen war. Untersucht wurde damals die Alternative, „nach dem Vorbild der Kammer für Handelssachen, des Landwirtschaftsgerichts und vor allem des Bundespatentgerichtes Kollegialgerichte sowohl mit Juristen als auch mit Fachkundigen eines bestimmten Berufsstandes zu besetzen" (Franzki, 1976, S. 98 f.). Das Beispiel hatte technischen Bezug, das Baurecht. Hier finden wir die Grundlage unserer Technologiefachkammer, jedoch mit ganz anderen Aufgaben und Zielen: Größere Richtigkeit der Entscheidung durch möglichen Verzicht auf Sachverständige als Beweismittel. Die gerichtsverfassungsrechtlichen Schwierigkeiten wurden gesehen, aber eine „Spezialisierung von berufsrichterlich besetzten Spruchkörpern auf bestimmten Fachgebieten" fanden Interesse und Empfehlung. Die Gründe, die bei Lukes und Marburger zur Ablehnung führten, lösten auch bei Helmut Pieper (1971, S. 34) erhebliche Bedenken aus, also das persönliche Unvermögen auch eines Sachverständigen, sehr viele Fachbereiche wirklich zu überblicken. Überdies hat man schon 1952 auf dem Deutschen Juristentag eine Empfehlung abgelehnt, technische Richter zu bestellen, auch nicht für umweltrelevante Rechtsstreitigkeiten. Sachverstand in das Gericht einzubinden, das könnte freilich auch auf konventionellem Wege bewirkt werden, so durch eine an den Aufgaben orientierte Geschäftsverteilung (Franzki, 1976, S. 98). Die Wichtigkeit des S ach Verstandes i m Gericht läßt sich daraus erkennen. Die Durchführung wird so leicht und so schwer sein, wie allgemein Problemlösungen qua Personalpolitik. Sachverstand braucht auch der Richter, um „als anerkannter Partner" an Erkenntnisprozessen teilhaben zu können; er müßte also „ i n erheblichem Umfang auf gleiche Kenntnisse und Erfahrungen zurückgreifen können wie die Sachverständigen selbst" (Wagner, 1982a, S. 11). Das wird ihm aus eigenem Wissen in hochspezialisierten Sachfragen kaum gelingen. Aber ist es ihm wenigstens möglich, die Gutachten des Sachverständigen in einer „wertenden Gesamtschau" beurteilen zu können? Oder gilt doch eher der skeptische Satz: „Vor Einholung des Gutachtens verfügt der Richter über keinerlei Sachkunde, danach wird ihm zugetraut, daß er sogar das Gutachten beurteilen kann?" (Arens, zitiert nach Nicklisch, 1982a, S. 74). Ungeachtet dieser an sich einhelligen Betonung notwendigen oder zumindest zweckmäßigen S ach Verstandes stößt unter Juristen die Technologiefachkammer überwiegend auf Ablehnung. Abgesehen davon, daß Zurückhaltung Neuem oder gar „reformerisch" Scheinendem gegenüber nicht gar so überraschend in den Kreisen der Rechtswahrer ist, könnte hierfür eine fehlende Definition ursächlich sein. Zwar hat sich die spärliche Diskussion vom recht allgemeinen und leicht mißverständlichen Begriff des Wissenschaftsgerichtshofes umorientiert und später ver-
Edgar Michael Wenz festigt zum Begriff der Technologiekammer. Damit wäre eine Begriffsbestimmung möglich, aber vielleicht hat die Assoziation zur „Wissenschaft" Unsicherheiten verbreitet. Es wird jedenfalls kaum ein Autor deutlich. Man muß überwiegend Verweisungen auf andere Autoren feststellen, wo dann die Spur verläuft. Eine wenig konkrete oder kaum begründete Äußerung ist aber dennoch eine Aussage, Desinteresse signalisiert Verneinung. Der Vorwurf eines Vor-Urteils wäre dann freilich gleich bei der Hand. Die hier aufgeworfene Funktion der vorgestellten Technologiefachkammer ist freilich nicht behandelt worden. Diese Seite kümmert am Rande des Augenmerks der Jurisprudenz. Deren Aufmerksamkeit liegt auf der Richtigkeit der Rechtsentscheidung. Häufig hat sie die Technologiekammer auch nur unter dem Aspekt gesehen, ob durch sie „besseres" und „wahreres" Recht zu finden ist - und sie mußte schon deshalb verneinen, da noch ein weiterer folgenschwerer Irrtum impliziert war, daß nämlich sachverständige Richter gleichzeitig die Rolle der Sachverständigen vor Gericht übernehmen sollten, der Sachverstand also nur noch auf der Richterbank und i m Beratungszimmer angesiedelt sein soll. Das sind MißVerständnisse, die sich jedoch heilen lassen. Es bestünden allerdings auch keine Bedenken, in die Erörterungen auch das Leistungsvermögen sachverständiger Laienrichter für die Richtigkeit des Urteils - für eine relative Richtigkeit freilich, für „ein noch ein bißchen besseres" Urteil - einzubeziehen. Ob das Hauptanliegen dieser Arbeit - die gesellschaftliche Akzeptanz von Urteilen in Fragen von Wissenschaft und Technik auf dem Wege zur Auflösung der Akzeptanzkrise gegen Wissenschaft und Technik - ganz außerhalb der Aufmerksamkeit der Jurisprudenz liegt oder liegen darf, kann hier außer Ansatz bleiben. Die volle Aufmerksamkeit der Rechtswissenschaft ist gefordert, konkret ihre Disziplin der Rechtssoziologie als zudienende Wissenschaft der Rechtspolitik. Solange sich alle angesprochenen Disziplinen aber nicht oder nur kaum dafür interessieren, wie die Rechtsakzeptanz i m allgemeinen und i m Zusammenhang mit den kritischen Problemkreisen aussieht, so lange muß es freilich abwegig und wenig ergiebig erscheinen, auf dieser Linie sich fortzubewegen. Wenn es bloß um die Rechtskraft eines Urteils geht, das sich auch verfassungsrechtlich einigermaßen solide abklopfen läßt, wenn das das Ziel ist, dorthin werden sich - der Gesetzgeber hat den Schlüssel dazu - Türe und Tore öffnen lassen. Nur - die Akzeptanzkrise wird dann mit höchster Wahrscheinlichkeit sich dann auf das Recht weiter ausdehnen, sie wird den Staat treffen müssen. Ein wichtiger Aspekt ist noch bei Hellmut Wagner (1980b, S. 672) behandelnswert, nach dessen Meinung „die Frage der gesellschaftspolitischen Akzeptanz einer neuen Technologie i m Rahmen eines konkreten Genehmigungsverfahrens (nicht) gestellt oder gar gelöst werden" kann. Da nach seiner Meinung kaum mehr ein Genehmigungsverfahren ohne Anrufung des Gerichts durchläuft, er Technologiekammern auch richtig als Fachkammern innerhalb der Verwaltungsgerichtsbarkeit anspricht, muß dieser Einwand hier erörtert werden. Aus dem Kontext ist zu
Die Akzeptanzkrise als Legitimationskrise erkennen, daß Wagner nicht etwa meint, durch ein konkretes Verfahren ließen sich auch Akzeptanzkrisen lösen und es gäbe jemanden, der das fälschlich erwarten könnte. Wagner glaubt, daß die uns bewegende Frage der gesellschaftlichen A k zeptanzkrise für bestimmte Technologien i m konkreten Verfahren gar nicht aufgeworfen werden darf, folglich diese Frage irrelevant wäre. Wenn dieser Einwand sich auf die Verfahren vor der Verwaltungsbehörde beschränkt - und so steht es geschrieben; aber es besteht eben Anlaß, die Unbeachtlichkeit der gesellschaftspolitischen Akzeptanz auch auf das gerichtliche Verfahren ausgedehnt zu sehen - , dann müßte man entgegenhalten, welchen Inhalt denn dann die von Wagner ebenfalls geforderte „wertende Gesamtschau4' des Richters inhaltlich haben mag. In der von Wagner sonst geforderten lockeren Kontrolldichte ist nicht zu sehen, was der Richter anderes als eben die großen Zusammenhänge werten könnte. Alle Probleme, die einer Wertung fähig sind, sind nach unserer Auffassung nicht nur eng mit den gesellschaftspolitischen Aspekten verbunden, sondern eigentlich gar nicht trennbar. Deshalb erwarten wir von einem vertrauensbildenden Urteil auch gesellschaftspolitische Signalwirkung. Sollte aber wirklich die beschränkte Wirkung eines einzelnen Urteils, nämlich eben dieses für den konkreten Fall, gemeint sein, so sei gesagt: Ein Urteil wird nur sehr wenig bewegen können, wenn damit nicht Rechtskraft und Vollzug gemeint sind, sondern ein Schritt in Richtung Akzeptanz. Es wäre aber mit Sicherheit falsch, wenn man meinte, auch ein Urteil eines Verwaltungsgerichts in der jetzigen konventionellen Besetzung würde in unserem Sinne gar nichts bewirken. Das wäre eine Verkennung der Chance, die das Recht hat, und des Potentials, das die Rechtsprechung besitzt, um Rechtsüberzeugungen zu schaffen. Diese Prozesse freilich laufen nur sehr langsam ab. Man kann nach meiner Meinung gerade bei Wissenschaft und Technik, wo der ständige Wandel und die permanente Entwicklung das „Normale" ist, nicht so lange warten, weil mit neuen Technologien auch wieder neue Krisen aufkommen könnten. Vor allen Dingen braucht man nicht so lange zu warten, wenn es dem Gericht gelingt, besondere Vertrauenswürdigkeit auszustrahlen. Die Zeit der Akzeptanz und der Internalisierung müßte sich erheblich verkürzen. Drauf beruht unsere Hoffnung, die die Chance braucht, sich zu erfüllen. Ein Widerspruch gegen den Science Court, der nicht juristische, sondern ausschließlich gesellschaftspolitische und auch rechtspolitische Bezüge hat, kann nicht unerörtert bleiben. Welches Modell Hans-Hilger Haunschild (1981, S. 145 ff.) bei seiner ablehnenden Kritik gemeint hat, ist nicht ersichtlich. Er spricht einerseits von einer „Obersten Instanz" in Form eines Wissenschaftsgerichtshofes, dann aber auch von einer „friedenstiftenden Wirkung", die auch noch „weitere politische Diskussionen" erübrigen sollte. Eine friedenstiftende Wirkung haben wir der Technologiefachkammer durchaus zugetraut. Daß es aber deshalb gewissermaßen der „Deus es machina" sein soll, ein Zauberstab, das konnte nun aus keinem der Modelle herausgelesen werden, am wenigsten aus dem Modell der Technologiefachkammer. Es ist eigentlich nicht zu verstehen, wie diese Leseart aufkommen kann. Jedes der Modelle wollte die Konsensfindung nicht ersetzen, nur erleichtern,
Edgar Michael Wenz und durch „Faktenklärung" auch und gerade politische Diskussionen fördern. Die Politik sollte damit keineswegs aus ihrer Verpflichtung entlassen werden. Schon gar nicht strebt das die Technologiefachkammer an. Allerdings beruht auch sie, wie jedes andere Gericht, auf der Erwartung, daß ihre Tätigkeit und ihr Spruch Frieden zu stiften vermag - und sei es nur um damit eine neue höhere und ebene Plattform zu finden, auf der neue und sachliche Auseinandersetzungen stattfinden können. A u f dem Pfeiler friedenstiftender Wirkung des gesamten Rechts und des Rechtsstabs, an seiner Spitze die Richter, beruht allerdings unsere rechtsstaatliche Überzeugung. Unser Wissen, wie Recht entstanden ist, bekräftigt uns darin. Alle Autoren sind sich einig: M i t der Verrechtlichung wissenschaftlicher und technischer Erkenntnisse wird zwar den Rechtsanwendern Sicherheit gegeben, ein zweifellos erstrebenswertes und hohes Ziel; aber dies müßte erkauft werden mit der Bereitschaft, die weitere technische Entwicklung, auf die unsere Industriegesellschaft angewiesen ist, zu bremsen, zu verhindern oder in eine falsche Richtung zu zwingen. Vom „Spannungsfeld zwischen Technologie und Recht", vom notwendigen „Brückenschlag" ist die Rede, niemand bestreitet das. Es gibt zahlreiche Beispiele, wie stürmisch - und unvorhersehbar - die technische Entwicklung gerade in den letzten Jahrzehnten w a r 4 2 . Dieser Gegensatz zwischen Bestimmtheit und Vorbehalt des Gesetzes, wie ihn die Verfassung vorschreibt, kollidiert mit dem wissenschaftstheoretisch und philosophisch unbestreitbaren Gebot der Offenheit der Wissenschaft. Daneben steht der Verfassungsauftrag des „dynamischen Grundrechtsschutzes", auch der einseitige Vorbehalt des „möglichen Irrtums" (siehe Wenz (Hrsg.), Wissenschaftsgerichtshöfe. Mittler zwischen Wissenschaft, Politik und Gesellschaft, 1983, S. 127). Weil man gemeinhin befürchtete, es könnte sich jemand aufwerfen, „unterschiedliche wissenschaftliche Positionen auf die simple Formel falsch oder richtig (zu) reduzieren {Kewenig zitiert nach Haunschild, 1981, S. 145 ff.), mußte man zur Ablehnung von Wissenschaftsgerichtshöfen gelangen. Wir taten uns nicht schwer, uns dieser Meinung anzuschließen, wenn und soweit damit institutionalisierte Gremien gemeint waren, wie diese von Meinolf Dierkes und Volker von Thienen in den ersten vier Modellen - also ohne die von uns favorisierte Technologiefachkammer - vorgestellt und zur Diskussion gebracht waren. Die verfassungsrechtlichen Bedenken werden überall geteilt, wenn auch Umwege sich schon vorstellen ließen. Der Respekt vor der Wissenschaft legte diese Fesseln an. Über die verfassungsrechtlichen Bedenken hinaus müßten wir natürlich in erster Linie die rechtssoziologischen erkennen. Unsere ganzen Überlegungen zielen ja in Richtung größerer Akzeptanzbereitschaft, ein soziologisches Anliegen. Wir würden aber einen Zielkonflikt schon mit vorprogrammieren, wenn ein Gremium mit legislatorischen Befugnissen nicht nach den Gesichtspunkten demokratischer Repräsentanz gesetzt wäre, also gewählt; schon die Berücksichtigung aller gesellschaftlich relevanten Gruppen wäre aus dieser Sicht unzureichend. Aber damit 42 So auch Lukes , 1978, S. 242, wo er u. a. darauf hinweist, daß „in den USA gegenwärtig die Hälfte aller Arbeitskräfte Gegenstände produziert und vertreibt, die um die Jahrhundertwende noch völlig unbekannt waren".
Die Akzeptanzkrise als Legitimationskrise kann ja nun ein Sachverständigengremium nichts anfangen, für das sich die Berufungskriterien nur nach Sach- und Fachkompetenz bestimmen können 4 3 . Das Bestreben nun um Verläßlichkeit und Rechtssicherheit, die konkreter Norm bedarf, die hier wie dort angewendet werden, scheint nun doch das Wissen um die Unverzichtbarkeit von Sachverstand auf fremde Pfade verlockt zu haben. Unisono mit der generellen Ablehnung von Wissenschaftsgerichtshöfen kamen überraschend Vorschläge auf, die aus Sachverständigen gebildete Entscheidungsgremien empfahlen oder zumindest in Erwägung zogen. Rudolf Lukes (1978, S. 246) spricht von „fachkundigen ,Unterparlamenten'", für die er zwar einen „eng begrenzen Aufgabenbereich" vorsieht, gegebenenfalls aber auch „notwendige Verfassungsänderungen" in Kauf nähme. Hellmut Wagner (1982b, S. 107) erwägt ebenfalls Änderungen des geltenden Rechts. Er denkt an zwei Modelle: einmal „ein besonders sachkundiges, unabhängiges und repräsentatives Verwaltungsgremium mit voller Entscheidungskompetenz"; dagegen hat er selbst rechts- und verfassungspolitische Bedenken; dann an ein anderes mit einem „besonders sachkundigen und unabhängigen Sachverständigengremium in fachlich repräsentativer Zusammensetzung", das „die wesentlichen Elemente der Sicherheitsstandards einer konkreten Anlage oder eines Anlagetyps festlegen" solle; dieses Gremium hat nur vorbereitende Funktion, die Genehmigung wird von der zuständigen Verwaltungsbehörde erteilt; deshalb läßt Wagner hierfür auch seine verfassungsrechtlichen sowie rechts- und verfassungspolitische Bedenken fallen. Peter Marburger (1981a, S. 29) sieht einen Ausweg durch Erteilung einer „Unbedenklichkeitsbescheinigung", die einem „unabhängigen sachverständigen Gremium" übertragen werden solle. Rudolf Lukes spricht ausdrücklich von „Fachgremien mit eigener Rechtssetzungsbefugnis" (1980, S. 79). Dagegen geht Hellmut Wagner von konkreten Genehmigungsverfahren aus; er w i l l solche konkreten Verfahren ohnehin vom Begriff des Science Court abkoppeln, den er nur „auf die kritische Bewertung einer ganzen Technologie" (Wagner, 1982a, S. 114) beziehen will. Das läßt sich an sich hören, weil alle Begriffe, die mit jenem der „Wissenschaft" in Verbindung stehen, von vorneherein andere Horizonte zu eröffnen scheinen. Es kann aber hier nicht um grammatische oder semantische Probleme gehen. Es geht hier um die Festschreibung von Seins-Sätzen als Sollens-Normen durch ein Gremium von Sachverständigen, wofür man die legale Ermächtigung voraussetzen darf. Es geht nicht um die Frage, ob diese Sachverständigen alle oder die meisten Kriterien von Wissenschaftlern erfüllen oder nicht. Die Verrechtlichung naturwissenschaftlicher und technischer Erkenntnisse - das ist die Frage, das ist das Problem. Es bleibt auch ein Problem, wenn es nicht um „ganze Technologien" geht, sondern - etwas tiefer und somit erreichbarer und vorstellbarer aufgehängt - um
43
Zunehmende Tendenzen der Berücksichtigung „demokratischer Repräsentanz" anstelle von Sachkunde befürchtet auch Lukes, 1981, S. 126 und passim.
Edgar Michael Wenz enger gefaßte naturwissenschaftliche und technische Analysen und darauf basierende Prognosen. Rein technische Fragen, die auf gesicherten naturwissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen und die mit jeder Sicherheit nach den Gesetzen der Kausalität ablaufen und somit vorhersehbar sind, mögen zur Kodifizierung geeignet sein. Aber das Problem der Abgrenzung zwischen Naturwissenschaften und Technik ist und bleibt existent, und selbst, wenn dem nicht so wäre, so schwärt immer noch die wichtigste aller philosophischen und methodischen Fragen: die Frage der Anbindung des Sollens an das Sein. Aus unserer Sicht ist bei diesem ganzen Komplex nur interessant, inwieweit diese Lösungen über Sachverständigengremien unserem Ziel der Aufweichung der Akzeptanzkrise förderlich sind. Vollkommene Übereinstimmung mit der Verfassung setzen wir ohnehin voraus, weil wir anders, bei auch nur geringsten Zweifeln, uns von unserem Ziel nur entfernen würden. Ein Sachverständigengremium, dessen sich Gesetzgebung und Verwaltung bedient, kann nicht nachteilig sein. Zu denken wäre hier wohl an die Science Court Modelle I und II, die nach den Darstellungen von Meinolf Dierkes Regierung und Parlament entlasten sollen. Es ist durchaus vorstellbar, daß eine solche Institution - die freilich nicht Wissenschaftsgerichtshof genannt werden dürfte - „mittelfristig die Akzeptanz der auf ihr fußenden politischen Entscheidungen fördert" oder die „Akzeptanz der Entscheidungen der von ihr beratenen Institutionen" erhöht. Die epochalen Krisen unserer Industriegesellschaft zwingen auch zur Beschäftigung mit diesen Chancen, sie können aber nur als Ergänzung der Technologiefachkammer erwogen werden. Das Hauptaugenmerk der Gesellschaft ist auf die Gerichte gelenkt, diese haben „gegenüber der Verwaltung einen vertrauensbildenden Vorteil: nämlich die i m Streit zwischen verhärteten Fronten und wirtschaftlichen Interessen an Bedeutung gewinnende Unabhängigkeit" {Baumann, 1982, S. 297), vor allem aber unbestrittene und unbestreitbare gewaltenteilige Kompetenz zur Letztentscheidung, und sie wird auch gefordert. Ohne gerichtliche Bestätigung ist eine Genehmigung von Kraftwerken gar nicht mehr denkbar. Unsere Präferenz liegt klar auf der Technologiefachkammer. Wir sehen aber keinen Grund, die anderen Modelle, die die transparente Verschaffung von Sachkunde für Legislative und Exekutive fördern könnte, abzulehnen. Dies gilt um so mehr, als j a nun auch die Rechtswissenschaft sich für die Lösung rechtspraktischer und rechtsdogmatischer Fragen solcher Wege - zumindest - entsonnen hat. Es ist nun allenthalben zu beobachten, daß die Rechtssprechung leistungsfähig ist, auch in Sachen von Gift, Gen und Kernkraft. Verwaltungsentscheidungen ergehen, Urteile werden gefällt; sie werden auch schließlich durchgesetzt, häufig, eigentlich immer, gegen schwere Proteste, unter manchmal chaotischen Umständen, aber eben doch durchgesetzt. So gesehen, ergäbe sich kein Anhalt für eine Rechtskrise. Die Justiz ist j a nun auch erweislich nicht nur mit Problemen der Vollstrekkung fertiggeworden, sie konnte auch, vor den Entscheidungszwang unentrinnbar gestellt, rechtstheoretische und rechtsdogmatische Schwierigkeiten in der Rechtspraxis auflösen. Es wird auch kaum jemand behaupten wollen, daß die oft kontro-
Die Akzeptanzkrise als Legitimationskrise verse Behandlung und Aufarbeitung der mehr rechtswissenschaftlichen Probleme Ursachen für die Akzeptanzkrise gesetzt haben könnten. Wissenschaftliche und theoretische Kontroversen können Vitalität und gewissermaßen Faustisches Bemühen signalisieren; das muß kein Nachteil sein. Erkennbare Unsicherheiten in der Methode können allerdings auch allgemeine Unsicherheit auslösen. Es wäre sicherlich dem Strafrecht - dem am meisten populären Rechtsgebiet, das vermutlich die meiste Akzeptanz braucht - nicht förderlich, also auch nicht der Internalisierung und Ausbildung einer übereinstimmenden Rechtsüberzeugung, wenn allgemeine und grundlegende Fragen erkennbar ungeklärt blieben und kontrovers wissenschaftlich behandelt und dann auch so in die Praxis eingebracht würden. A u f den Gebieten von Recht und Technologie - um einen sich immer mehr durchsetzenden Ausdruck zu gebrauchen - müssen die gleichen Überlegungen gelten; die Popularität dieses Rechtsgebietes nimmt zu. Damit wächst auch das Interesse an den Methoden, nicht nur am Resultat. Die Wege, wie in der bisherigen Rechtspraxis technische Daten, soziale Fakten und wissenschaftliche Prognosen Eingang in die Rechtsanwendung gefunden haben, darf hier interessieren, auch wenn dieser Aspekt nicht oder jedenfalls nicht sehr im Kreuzfeuer der sozialen Kritik bislang stand. Aber wenn man bewußt neue Wege sucht, muß man die bisher begangenen prüfen. Die Literatur ist nicht sehr ergiebig. Einen guten Überblick verschafft Peter Marburger (1981a, S. 27 ff.); aber auch die Autoren Fritz Nicklisch (1982b, S. 2633 ff.) und Hellmut Wagner (1982a, S. 107 ff.) versuchen, das gesamte Angebot an Lösungsvorschlägen aufzuarbeiten. Der erste Ansatzpunkt scheint mir rechtstheoretisch-dogmatisch zu sein, die Frage nämlich nach der originären richterlichen Kompetenz, auf Grund der internen Aufgabenverteilung; sie läßt sich ablesen an der „Kontrolldichte" des Gerichts: Überschreitet der Richter seine Kontrollfunktion, wenn er zu sehr in wissenschaftlich-technische Sachfragen eindringen will, ganz abgesehen vom Grade seines persönlichen Sachverstandes? Oder respektiert er die Eigengesetzlichkeit von Naturwissenschaften und Technik, indem er in einem bewußten judicial selfrestraint eine „Bandbreite" dem außerrechtlichen und außergerichtlichen Sachverstand offenläßt? Die Anhänger der Auffassung, daß richterliche Selbstbeschränkung der richtige Weg wäre, ein Rückzug gewissermaßen auf Verhaltens- und Verfahrenskontrolle der Entscheidungsträger geboten sei 4 4 , erfuhren Bestätigung durch den Mühlheim-Kärlich-Beschluß 4 5 und durch die Brokdorf-Entscheidung 46 . Diese Meinung schließt an die Lehre vom „behördlichen Beurteilungsspielraum und von der Vertretbarkeit der Verwaltungsentscheidung" (Marburger, 1981a, S. 30) an. Nur so läßt sich angesichts der Flexibilität von Recht und Wissenschaft ein „dynamischer Grundrechtsschutz" erreichen. Ob nun die herrschende Meinung, 44 Fritz Ossenbühl, 1978, S. 1 ff. (9), Wagner, 1982b, S. 115 f. 45 BVerfGE 49, 89. 46 VG Schleswig, in: NJW 1980, S. 1296.
Edgar Michael Wenz die ein Eingehen des Gerichts auch in die naturwissenschaftlich-technischen Sachfragen verlangt, den Richtern gewissermaßen die Rolle eines „Obergutachters" (.Nicklisch, 1982b, S. 2640) im Expertenstreit zuweisen w i l l ; oder eine Lockerung der gerichtlichen Kontrolldichte - beschränkt auf die Prüfung, ob der Rahmen der rechtlichen Wertgrundsätze, der Grundrechte und der normativen Schutzzielbestimmungen eingehalten sind - sich durchsetzt, ist für unser Erkenntnisinteresse ohne Bedeutung. Selbst bei Zurückhaltung des Gerichts und enger Auslegung der Kontrollfunktion, in Übereinstimmung mit der herrschenden Lehre von den Aufgaben der Verwaltungsgerichtsbarkeit, werden Sachverstand des Gerichts immer Wertschätzung und Anerkennung finden. Die genuine richterliche Aufgabe ist und bleibt, die von der Rechtsordnung normativ festgelegten Zwecke und Schutzziele in der Realisierung zu verfolgen; zu prüfen, ob alle Ergänzungen und Hilfen „ i m Dienste dieser normativen Zweckbestimmungen stehen" (Nicklisch, 1982b, S. 2636). Wohin und wie weit man auch gehen mag, um naturwissenschaftlichtechnischen Sachverstand aus der richterlichen Entscheidung herauszunehmen und nach außen zu verlagern, die soziale Akzeptanz von Gerichtsentscheidungen wird jedenfalls nicht gedeihen, wenn die Rechtsunterworfenen befürchten müssen, die Prüfung der Richtigkeit sei, aus welchen Gründen auch immer, zu kurz gekommen. Die legale und formale Basis der Entscheidung interessiert kaum oder gar nicht; es geht vielmehr um Legitimität. Wo die Grundrechte, die Unversehrtheit von Leib und Leben, möglicherweise für viele Generationen zumindest in der Diskussion stehen 47 , finden Zweckmäßigkeitserwägungen wenig Verständnis. Wenn die Rechtsfindung wegen der Komplexheit der Sachfragen nicht überzeugend, i m Sinne einer sichtbaren Verwirklichung des Rechtsideals, herbeizuführen ist, so soll dafür j a nach unserer Auffassung das Verfahren stehen. Eine Vereinfachung des Verfahrens, auf welcher legalen Basis auch immer, wird nicht überzeugen können. Aber um aus einem offenkundigen Dilemma herauszukommen, scheint mir eine moderate und modifizierte Selbstbeschränkung des Gerichts schon zweckmäßig zu sein. Aber dann sollten erst recht sachverständige Laienrichter diese Lücke durch ihr vertrauensbildendes Potential ausgleichen. Je lockerer die Kontrolldichte, je einfacher das Verfahren gestaltet werden soll, desto mehr braucht das Gericht moralische Stützen. Expertenrichter könnten sie bilden. Es ist nicht zu sehen, wer besser oder nur gleich gut sein könnte. Zum zweiten geht es um den Sachverstand, oder genauer: um Funktion und Kompetenz des Sachverständigen, und damit auch um seine Person. Hier sind rechtssoziologische Bezüge erkennbar. Auch diesem Thema widmen sich verständlicherweise alle Autoren. Das geht vom Richtergehilfen, Vor-Sachverständigen und technischen Berater (Gerhardt, M., 1982, S. 489 ff.) bis zum Sachverständigengremium mit Rechtssetzungsbefugnis (Lukes, 1980, S. 79). Die Kompetenzverteilung zwischen den Sachverständigen und Rechtsanwendern wird untersucht; sie 47
Dazu Hasso Hofmann, 1981; aber auch, gewissermaßen als „Anti-Hofmann": Wagner, Ziegler, Closs, 1982.
Die Akzeptanzkrise als Legitimationskrise
9
stößt sich an den fehlenden Grundlagen der theoretischen Rechtssoziologie. Das Gericht kann Risikoanalysen nicht sachverständig beurteilen, es ist auf den Sachverständigen angewiesen. Er hat „Erkenntnisse und Feststellungen über Fakten und Kausalverläufe abzuschätzen, zu beurteilen und zu bewerten" und ins optimale Verhältnis (Optimierung) zu bringen. Dafür haben Sachverstand und Sachverständiger „originäre Sachkompetenz" (Wagner, 1980b, S. 667). Ob die Sachverständigen die „allgemein anerkannten Regeln der Technik" feststellen, wobei es nach herrschender Ansicht auf die Mehrheitsmeinung unter den Experten ankommt (Nicklisch, 1982b, S. 2369); oder ob nach jüngerer Meinung die Rechtsanwender, wenn es um „Standards" (Stand der Technik; Stand von Wissenschaft und Technik) geht, in der Sache selbst zu entscheiden, also bei „Meinungsverschiedenheiten der Techniker in deren Streit einzutreten" haben - diese Frage liegt nicht in unserem Erkenntnisinteresse. M i t der Person und den Kriterien, die an einen „Experten" angelegt werden müssen, beschäftigt sich der Sachverständigenbericht, der zu einer Rechts Verordnung zum „konkreten Leitbild" des Sachverständigen führen sollte 4 8 . I m dritten Themenkreis wird versucht, den Sachverstand zu objektivieren. Das geschieht aus der Notwendigkeit heraus, zumindest technischen Regeln auf irgendeinem Wege zur Qualität einer Rechtsnorm zu verhelfen. Das ist ein geradezu klassisches rechtssoziologisches Erkenntnis- und Arbeitsfeld. Die Expertenmeinung tritt vor Gericht oft gegen eine konträre andere Expertenmeinung. Mindestens eine der beiden Meinungen ist falsch oder jedenfalls nicht ganz so richtig. Das Gericht sucht objektive Normen, findet aber nur außerrechtliche private Regelwerke - so beispielsweise die überbetrieblichen Technischen Normen privater Normenorganisationen (DIN, V D E , V D I ) ; oder nichtstaatliche Regelwerke der öffentlich-rechtlichen technischen Ausschüsse, beispielsweise i m Gewerberecht oder der Kerntechnische Ausschuß (KTA). Diese Regelwerke sind von anerkannten Sachverständigenorganisationen aufgestellt, die durchaus Vertrauen verdienen, aber eben nicht die „Legitimation durch Verfahren" besitzen, die nur die gesetzgebende Körperschaft im demokratischen Rechtsstaat haben kann. Die verfassungsrechtliche Kollision ist offensichtlich und ebenso groß wie der „Normenhunger" in der Industriegesellschaft, der ja ungleich größer ist, als er in vielen historischen Stadien der gesellschaftlichen Entwicklung war. Die Lösungsvorschläge reichen von einer Verrechtlichung auf dem Verordnungswege (Fürst, 1981, S. 70) bis zum Vorschlag, diese Regeln als „Tatsachen und somit als Grundlage für Gerichtsentscheidungen zu fixieren" (Lukes, 1981, S. 127 ff.). Der Weg hierzu ist geöffnet durch die höchstrichterliche Qualifikation der außerrechtlichen Regelungen als „vorweggenommene Sachverständigengutachten" 49 . Die Rechtstheorie hält bewährte Methoden der Verweisungstechnik bereit: die statische wird allerdings allenthalben abgelehnt, einmal aus verfassungsrechtlichen Gründen, dann aber auch, weil sie die 48 Konkret des „Atomrechtlichen Sachverständigen"; hierzu Hellmut Wagner, 1980, S. 86 ff.; die Frage wäre für uns interessant bei möglichen Kriterien für den Expertenrichter; vergi, dazu bei Anm. 33. 49 BVerwGE 55, S. 255 ff.
0
Edgar Michael Wenz
Flexibilität von Wissenschaft und Technik erstarren ließe. Dagegen wird die dynamische Verweisung favorisiert, weil sie die Norm zu konkretisieren vermag (Marburger, 1981a, S. 30), ohne das Stück „offen gelassene Gesetzgebung" zu verbauen. Eine zulässige und wahrscheinlich auch tragfähige Brücke könnte der Einbau einer Vermutungsklausel schlagen (Fürst, 1981, S. 70). Diese gesetzliche Vermutung ist nicht unwiderlegbar; als Beweislastregel schränkt sie die richterliche Kontrollfunktion nicht ein, gibt aber dennoch ausreichende Orientierungshilfe und Rechtssicherheit, da das Abweichen von der Regelhaftigkeit begründungspflichtig wäre. Ernst Benda meldet verfassungsrechtliche Bedenken (1981, S. 10) an für den Fall, daß für technische Regeln nicht entsprechende Mindestanforderungen einer rechtsstaatlichen Normierung („Verfahrenskontrolle") aufgestellt worden sind. Gegen eine „Normierung von außen", also von informellen technische Gremien und Ausschüssen, umzusetzen in eine „Normierung von oben" äußert Fritz Ossenbühl (1981, S. 50) Zweifel. Bemerkenswert ist der rechtssoziologische Lösungsvorschlag von Fritz Nicklisch (1982a, S. 95), der einer „(kontrollierten) Rezeptionsfunktion" das Wort redet. Peter Marburger allerdings sieht Realisierungsschwierigkeiten, weil derartige Erkenntnisse und Fakten empirischer Sozialforschung, die dann gefordert wäre, nicht zugänglich sind. Man wird allerdings ohnehin nicht davon auszugehen brauchen, daß Nicklisch „maßgebliche Sachverständigenauffassung durch Abzählen auf dem Wege der Repräsentativumfrage" (Marburger, 1981a, S. 29) ermitteln wollte. Nicklisch wollte aber den Blick lenken auf die noch nicht genutzte Kapazität der Rechtssoziologie, die j a Erfahrungen hat in der Verknüpfung tatsachen- und wirklichkeitswissenschaftlicher Erkenntnisse mit dem Recht. Der Ansicht von Nicklisch, daß die Rezeptionsfunktion bei der Delegationsfunktion der Verweisung überlegen ist auf Feldern, wo die „normative Kraft des Faktischen" gar nicht übersehen werden kann, mag man zustimmen. A u f den Feldern, mit denen wir uns hier mit Gift, Gen und Kernkraft beschäftigen, treiben die Fakten, jedenfalls nach meiner Ansicht, die Normen förmlich vor sich her. Auch aus rechtssoziologischer Sicht steht dem Richter die Richtigkeitskontrolle zu. Nicklisch verweist auf Carbonnier, der das richterliche „Recht zur Zensur" bejaht, ohne das es gar nicht auskommt. Außer den Möglichkeiten, die die theoretische Rechtssoziologie bietet, können nach meiner Ansicht „Normenverträge i m Verhältnis zwischen Staat und Bürger" (Krüger, 1966, S. 622) in die Überlegungen einbezogen werden. Auch die „Einstimmungstheorie" (Rehfeldt/Rehbinder, 1978, S. 112 ff.) vermag Ansatzpunkte zu bieten. Fritz Nicklisch hat in einer neueren Arbeit (1982b, S. 2633 ff.) seine Gedankengänge mit unübersehbarem rechtssoziologischen Bezug vertieft. Er macht keinen Unterschied zwischen Standards (wie Stand der Technik oder Stand von Wissenschaft und Technik) und „anerkannten Regeln der Technik"; der „Konsens i m Sinne einer Mehrheitsauffassung unter den führenden Fachleuten" ist maßgebend, ihn hat der Rechtsanwender zu ermitteln, aber nicht in die Meinungsstreitigkeiten einzutreten. Abweichende Mindermeinungen haben ja die Chance zur „dialektischen Durchsetzung"; aber erst dann, wenn dies geschehen ist, wenn dieses die
Die Akzeptanzkrise als Legitimationskrise
1
mehrheitliche Zustimmung der kompetenten Sachvertreter gefunden hat, bildet die ehemalige Mindermeinung den „Stand der Technik"; vorher ist es eine irrelevante Mindermeinung. M i t der normativen Verweisung auf die technischen Standards als rechtliche Maßstäbe eröffnet sich die Möglichkeit, dieses „außerrechtliche Ordnungsgefüge" zu rezipieren. Die Rezeption freilich muß „kontrolliert" werden durch den Rechtsanwender, ob diese technischen und wissenschaftlichen Standards sich i m Rahmen der rechtlichen Wertgrundsätze bewegen, wie diese von den Grundrechten und den gesetzlichen Schutzzielbestimmungen aufgegeben sind. Allerdings kann sich dann der Rechtsanwender auf eine „(pauschale) Evidenzkontrolle" beschränken, „ob die Unvereinbarkeit mit Rechtsnormen offensichtlich ist oder ob der Standard sonst offenbare Mängel enthält (kontrollierte Rezeption der Standards)" (Nicklisch, 1982b, S. 2644). In gleicher Weise werden auch die technischen Regelwerke rechtlich eingeordnet und bewertet. Diese stellen j a i m besonderen Maße die „Mehrheitsauffassung unter den führenden Fachleuten" dar, beruhen auf dem Konsensprinzip und sind „geradezu prädestiniert, dem Rechtsanwender bei der Ermittlung des maßgeblichen Standards sachverständige Hilfe zu leisten". Nicklisch würde es freilich begrüßen, wenn um der Rechtssicherheit willen ein Weg gefunden werden könnte, „technische Regelwerke mit möglichst hoher Verbindlichkeit zur Konkretisierung der Standards heranzuziehen". Alle Vorschläge mit unverkennbar rechtssoziologischen Bezügen vertragen sich in besonderer Weise mit unseren Vorstellungen von der Technologiefachkammer. Auch und gerade aus dieser Sicht empfiehlt sie sich. Die meisten Autoren suchen erkennbar nach neuen, freilich praktikablen Lösungen. Auch Rudolf Luhes (1978, S. 244) beklagt, daß über das Verhältnis von Technik und Recht und seiner Ausgestaltung zu wenig nachgedacht wird, obwohl neue Lösungen gefunden werden müssen. Und genau dies meinen wir auch.
IX. Zusammenfassung Ausgangspunkt der Untersuchungen war die Frage, ob Wissenschaftsgerichtshöfe („Science Courts") ein geeignetes Mittel sein könnten, die beobachtete Akzeptanzkrise gegenüber Wissenschaft und Forschung zu beseitigen oder doch wenigstens aufzuweichen. Das Interesse verlagerte und konzentrierte sich dann auf die für die Bevölkerung sichtbaren praktischen Ergebnisse aus Wissenschaft und Forschung, also auf die Probleme, die sich bei deren Anwendung in der Großtechnologie, bei Giftstoffen, Gentechnik und Kernkraft ergeben. M i t dieser Akzeptanzkrise scheint eine Rechtskrise einherzugehen, zumindest zu drohen. Keineswegs sind wir der Meinung, daß die Rechtskrise ursächlich für die Akzeptanzkrise sein könnte. Eher glauben wir, daß angesichts der Bedeutung von Recht und Gesetze für Staat und Gesellschaft Krisen dieser Art sich auch zwangsläufig in Krisen gegenüber Recht und Staat äußern. 16 Gedächtnisschrift Wenz
Edgar Michael Wenz Rechtspolitische und schließlich justizielle Überlegungen mußten aber auch schon aus dem Grunde angestellt werden, weil Wissenschaftsgerichtshöfe sich nicht anders definieren lassen als eine Institution, die mit Rechtsprechung oder mit Rechtssetzung zu tun hat; die Fragen reichen ja bis ins Verfassungsrecht. Die Aufarbeitung des Themas sowohl i m gesamten wie i m einzelnen erfordert die Einbeziehung von Rechtswissenschaft und Jurisprudenz. Aus den bereits vorgeschlagenen fünf Modellen von Wissenschaftsgerichtshöfen habe ich, den eigenen früheren literarischen Äußerungen folgend, die Technologiefachkammer (fünftes Modell) als jene Möglichkeit, die kurzfristig und ohne verfassungsrechtliche Bedenken realisierbar erscheint, herausgearbeitet. Sie soll als Fachkammer bei den ordentlichen Verwaltungsgerichten gebildet werden. Ein einfaches Gesetz würde für die Installierung ausreichend sein. Diese Technologiefachkammer wurde empfohlen als ein personal vergrößertes Gericht; an ihm sollten als Laienrichter nur qualifizierte Fachleute (Experten) aus Naturwissenschaft und Technik berufen werden. Dem Auswahl- und Berufungsverfahren wurde besondere Aufmerksamkeit gewidmet; es wurde dabei die Frage untersucht, ob die Experten aus rechtsfällig erwarteten komplizierten Sachbereichen berufen werden sollen, oder ob Naturwissenschaftler und Techniker mit globaler Vorbildung und Übersicht, die ihn zu einer schnelleren und sicheren Rezipierung der Sachfragen befähigt, zu bevorzugen wären. Überlegungen zum Verfassungsprinzip des gesetzlichen Richters haben diese Frage, ohne Wertverlust für den geforderten Sachverstand, für den „allgemein" gebildeten und ausgebildeten Experten entschieden. Die Regeln eines besonderen Verfahrens, das auch in Übereinstimmung mit dem geltenden Prozeßrecht zu bringen ist, wurden untersucht, so die Konzentrierung der Verfahren solcher Verwaltungsprozesse auf bestimmte Gerichtsbezirke, der Instanzentzug, die Besoldungsregelung für „Expertenrichter", die Akteneinsicht. Als wichtigstes Merkmal dieser Technologiefachkammer wurde immer herausgestellt, daß ihr eigentlicher Sinn nicht in der Evaluierung der Entscheidung liegen soll; daß nicht „mehr" Wahrheit und „besseres" Recht erwartet wird. Die Grenzen wissenschaftlicher Erkenntnis wurden immer gesehen. Es geht in erster Linie um „glaubwürdiges" Recht, das von den Rechtsunterworfenen eher akzeptiert wird. Die Grenzen wissenschaftlicher Erkenntnis wurden immer gesehen. Es geht in erster Linie um „glaubwürdiges" Recht, das von den Rechtsunterworfenen eher akzeptiert wird. Die Idee der Technologiefachkammer setzt also in erster Linie auf eine sozialpsychologische Wirkung. Grundkonsensus, Systemvertrauen und eine dadurch generalisierte Bereitschaft der Entscheidungshinnahme sind hierfür freilich unverzichtbare Voraussetzungen. Keineswegs wurde je erwogen, bei der Technologiefachkammer ein weiteres Genehmigungsverfahren zu installieren, weder ausdrücklich institutionalisiert noch ein faktisch-latentes Einnisten. Ebensowenig sollte der Sachverstand nur auf der
Die Akzeptanzkrise als Legitimationskrise
2
Richterbank angesiedelt werden, Sachverständige und Gutachten aus dem Gerichtssaal verbannt werden. Das Verfahren läuft nach der gleichen bewährten Weise ab. Daß Experten auf der Richterbank und i m Beratungszimmer Überlegungen überflüssig machen, den Richtern technische Berater und andere Hilfsdienste ersetzen, wird als Vorteil gesehen und akzeptiert. Die Vorstellung ist keineswegs abwegig, daß Experten auf der Richterbank, zusammen mit Berufsrichtern, sich leichter tun mit hochspezialisierten Entscheidungen - diese Vorstellung wird durchaus gehegt. Aber das ist nicht der eigentliche Sinn der Technologiefachkammer, aber ein Baustein zum vertrauensbildenden Potential des Gerichtes und ein Schritt auf dem Weg zur sozialen Akzeptanz. Dabei sind wir davon ausgegangen, daß „Legitimation durch Verfahren" verschafft wird. Diese Anleihe bei der Rechtssoziologie Niklas Luhmanns ist hilfreich. Die Beschäftigung damit zeigt, daß der theoretische Ansatz Luhmanns keineswegs zwingend dazu führt, positivistische Ansätze unter Verzicht auf das Rechtsideal hinnehmen zu müssen. Das soziale Verfahren ist geeignet, auf verschiedenen Wegen und in mehreren Schritten Rechtsüberzeugungen zu stabilisieren. Freilich mußten wir vermissen, daß Erörterungen über das Massenverfahren aus rechtssoziologischer Sicht fehlen, obwohl die Einsichten der Notwendigkeit zunehmend wachsen. Die Institution des besonderen Verfahrens, das in der speziellen Institution der Technologiefachkammer deutlich wird, hat - unter dem Aspekt vertrauensfördernder Möglichkeiten - zur Untersuchung des Laienrichtertums generell geführt; für Rechtsunterworfene und Betroffene, auf die die Wirkung dieses Verfahrens zielt, stellt sich die Technologiefachkammer als Laiengericht i m Rechtssinne, als Expertengericht i m soziologischen Sinne dar. Vorzüge und Nachteile des Laienrichtertums mußten vor diesem Hintergrund untersucht werden. Ist man i m allgemeinen der Ansicht, daß das Laienrichtertum seine emanzipatorische (demokratische) Begründung nicht mehr finden kann, so könnten gerade diese Überlegungen erneut aufgegriffen werden, allerdings nicht mehr gegen den „Moloch Staat", sondern gegen den - heutzutage nicht minder dräuend empfundenen - „Moloch Wissenschaft und Technik" gerichtet; die partizipatorischen und integrativen Funktionen wirken beim Expertengericht nicht mehr und nicht weniger als bei anderen Laiengerichten. Es wurde erkannt, daß Sachverstand als die stärkste Begründung von Fachgerichten gilt; die guten Erfahrungen mit den Kammern für Handelssachen haben Überlegungen angeregt, daß Fachgerichtswesen auszubauen. Diese Überlegungen lenken die Aufmerksamkeit auf die Technologiefachkammer. Die Auswertung der Literatur zu diesem Thema der Wissenschaftsgerichtshöfe i m allgemeinen und der Technologiekammern jetzt könnten nützlich sein. Allerdings leidet die ganze Auseinandersetzung, die überwiegend negativ ist, unter dem Mißverständnis, daß verhältnismäßig selten klare Unterscheidungen zwischen den 16*
Edgar Michael Wenz einzelnen Modellen getroffen wurden, was prompt zu einer mehr pauschalen Ablehnung führen mußte. Wo sich Autoren mit der Technologiekammer befaßten, stand die Evaluierung der Entscheidung i m Vordergrund oder war gar das einzige Erkenntnisinteresse. Überlegungen einer sozialpsychologischen Wirkung solcher Technologiefachkammern, unter der Voraussetzung eines qualitativ gleichwertigen Urteils, wurden nicht angestellt, nicht einmal am Rande. Es muß daher überraschen, daß bei manchen Vorschlägen Anklänge an die anderen Modelle der Wissenschaftsgerichtshöfe zu entdecken waren. Dabei waren diese eigentlich generell und expressis verbis abgelehnt worden; sie sind auch wegen offenkundiger verfassungsrechtlicher Bedenken hier gar nicht erst untersucht worden, von der schwierigen Realisierbarkeit sogar noch abgesehen. Soweit diese Vorschläge Parlament, Regierung und Verwaltung lediglich Sachverstand verschaffen sollen, kann ein Nachteil nicht aus dem Umstand abgeleitet werden, daß ein geordnetes Verfahren der transparenten Meinungsbildung begründet wird. Verfahren hat immer zumindest legitimationserhöhende Wirkung. Alle diese Bemühungen sind gewiß geeignet, die Akzeptanzkrise aufzuweichen. Hier bei dieser Arbeit allerdings war das Augenmerk gerichtet auf die dritte Gewalt, auch unter dem Gesichtspunkt der größeren Öffentlichkeit von wichtigen Entscheidungen der Verwaltungsgerichtsbarkeit, der von ihr ausgehenden stabilisierenden Wirkungen und auch der relativ einfachen Realisierbarkeit. Bei allen Bemühungen der Autoren, die nach Wegen effizienter Rechtsprechung, unter besonders wacher Bewahrung rechtsstaatlicher Prinzipien, suchten, waren die Probleme erkennbar, die sich schon immer in Rechtswissenschaft und Jurisprudenz gezeigt haben, wenn Sollen mit dem Sein verbunden werden muß; wenn außerrechtliche Ordnungsgefüge Charakter und Qualität einer Rechtsnorm erhalten sollen, um verläßlich wirken und so Rechtssicherheit stiften zu können. Die rechtssoziologischen Ansätze zur Lösung dieses Problems wurden nur einmal aufgezeigt (Fritz Nicklisch). Dabei mußte konstatiert werden, daß grundlegende Erörterungen zu diesem Problemkreis vermißt werden müssen. Dabei stellt sich diese Frage schon so lange, als es Generalklauseln und unbestimmte Rechtsbegriffe gibt. Sie wird jetzt nur sichtbarer und drängender, weil es nicht mehr um Treu und Glauben etwa i m Geschäftsleben oder um die Verkehrsgeltung von Warenzeichen geht, sondern um allgemeine Regeln der Technik, Stand der Technik, Stand von Wissenschaft und Technik, Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis, wirtschaftliche Vertretbarkeit geht; konkret auch um die Einbeziehung außerrechtlicher Regelwerke - aber nun in Fragen nicht nur allgemeinen Interesses, sondern möglicherweise um die juristische Beherrschung der Probleme, die das Industriezeitalter aufgeworfen hat und die es immer schneller und häufiger aufwerfen wird. Da die Absenz von Hilfen der Rechtssoziologie, sowohl bei der empirischen wie bei der theoretischen, mehrfach beklagt werden mußte, wurden Überlegungen über diesen nach der belegten Ansicht des Autors stark vernachlässigten Zweig der
Die Akzeptanzkrise als Legitimationskrise Rechtswissenschaft angestellt, deren Vitalisierung und Mobilisierung als wichtig erkannt wird, wenn man sich mit Themen und Problemen befaßt, die wir uns und denen wir uns gestellt haben. Insgesamt wurde die Institutionalisierung von Technologiefachkammern als zweckmäßiges Mittel erkannt, vertrauensbildend zu wirken und, gewiß in mühseligen kleinen Schritten, zunächst einmal die Akzeptanz der Entscheidungen zu verbessern. Durch die originäre Aufgabe jeden Gerichts, Frieden und Rechtssicherheit i m Einzelfalle zu stiften, können sich in der Summe Rechtsüberzeugungen bilden. Angesichts der besonderen Gefährdungen scheinen auch besondere Maßnahmen geboten. Die Fragestellung, ob zumindest der Versuch mit der Technologiefachkammer (die in Baden-Württemberg schon einmal erwogen war) gewagt werden soll, kann sich ja nicht danach richten, ob von diesen Fachgerichten nun in besonderer Weise und in besonderem Maße „Wahrheit und Richtigkeit" zu erwarten ist, oder ob man konzedieren muß, daß auch diese Fachkammer keine anderen Fähigkeiten hat als jedes andere irdische Gericht. Die Antwort kann nur auf die Frage erwartet werden, welche Alternativen sich zur Technologiefachkammer bieten, ob also den herkömmlichen Verfahren ein gleiches, ein minderes oder ein besseres vertrauensbildendes Potential zugerechnet werden kann - nachdem Vertrauen als wichtigste Voraussetzung zur Akzeptanz einer Entscheidung erkannt ist, akzeptierte Entscheidungen aber Mosaiksteinchen und Bausteine sind für Gebilde und Gebäude der Akzeptanz eines größeren Zielbereiches, wie dies Wissenschaft und Forschung sind; und wie Wissenschaft und Forschung Sinn darstellen an ihren Ergebnissen, ihren Leistungen und an ihrem Verhältnis zur Großtechnologie, zu Gift, Gen und Kernkraft. Wir meinen: Es soll, es muß zumindest ein Versuch der Technologiefachkammer gewagt werden.
X. Nachwort Gleich nach Abschluß dieser Arbeit ist das Thema gesellschaftlicher Akzeptanz verwaltungsgerichtlicher Entscheidungen wissenschaftlich aktuell geworden. Unser Anliegen ist damit berührt, deshalb erscheint eine spontane Aufarbeitung zweckmäßig: Ernst Benda (1983b, S. 305 ff.) hat in seinem Aufsatz „Zur gesellschaftlichen Akzeptanz verwaltungs- und verfassungsgerichtlicher Entscheidungen" die Notwendigkeit betont, daß Entscheidungen auch akzeptiert werden, obwohl sich der Gesetzgeber der „eigenen Verantwortung teilweise entzieht" und so „sich die Auseinandersetzungen in die Säle der Verwaltungsgerichte" verlagern (S. 307). Verfassungsrechtlich wäre das zwar hinnehmbar, verfassungspolitisch allerdings bedenklich. Benda verweist gerade in diesem Zusammenhang auf die uns tangierenden
Edgar Michael Wenz Themen „der Energieversorgung, der Großtechnik und des Umweltschutzes". I m Abschnitt „Akzeptanz und Vertrauen" untersucht nun Benda den Begriff der Akzeptanz. Die Berufung auf Niklas Luhmann, der in seinem Buch „Legitimation durch Verfahren" (S. 120) den Begriff des „Akzeptierens" als unklar bezeichnet, erscheint allerdings etwas zu kurz gegriffen; in dieser Passage hebt Luhmann auf das Funktionieren des sozialen Systems ab. Ohne den Grundkonsens - darauf beruft sich Benda an entscheidenden Stellen mehrfach - und ohne „Systemvertrauen" könnte Luhmann nicht auskommen. Ob man Vertrauen mit Akzeptanz gleichsetzen kann oder ob dieses nur eine unverzichtbare Voraussetzung ist, kann dahingestellt bleiben. Die Differenzierungen Bendas sind jedenfalls hilfreich, zunächst einmal zwischen inhaltlicher und formaler Akzeptanz zu unterscheiden. Denn diese ist das „ M i n i m u m " , während die inhaltliche Akzeptanz von Gerichtsentscheidungen durch die Gesellschaft sich darstellen kann als 1. sachliche Übereinstimmung, die dann den Widerspruch ausschließt, 2. trotz gegenteiliger Meinung Anerkennung der „Autorität des Gerichts", dem gegenüber Gehorsam nicht in Frage gestellt wird, und 3. Hinnahme einer als falsch oder ungerecht gehaltenen Entscheidung, jedoch mit dem gleichzeitigen Versuch, „auf anderen legalen Wegen", etwa durch parlamentarisch-politische Initiative, eine Änderung der Rechtslage zu bewirken. Die dritte Alternative kann man wohl eher zur Gruppe der formalen Akzeptanz rechnen. A m meisten interessiert in unserem Zusammenhang die zweite Gruppe, also jene, bei denen die Autorität des Gerichts etwaige ursprüngliche Zweifel oder fortwährende andere Interessenlagen auszugleichen und zu überlagern vermag. Der hier angesprochene Kreis von Gesetzes- und Entscheidungsopponenten ist die Zielgruppe, die wir durch Technologiefachkammern zu erreichen versuchen. Freilich werden die Interessenlagen immer unter den drei von Benda aufgezeigten unterscheidbaren Gruppen nicht scharf abgegrenzt sein. Die Technologiefachkammer muß nach unseren Vorstellungen geeignet sein, sowohl die sachliche Hinnahme wie auch das formale Sich-Abfinden zu befördern, ohne von dem Gefühl des Abgedrängtwerdens von der Rechtsordnung bedrückt zu werden. So könnte die Technologiefachkammer in wichtigen Fragen mitwirken, die „zerstrittenen Teile der Gesellschaft zu versöhnen, ihre Interessen auszugleichen, auch einen Kompromiß zu finden, dem ein Frieden ohne Sieger und Besiegter folgt" (Benda, 1983b, S. 305). Bezeichnenderweise hat auch der 7. Deutsche Verwaltungsrichtertag 1983 in Berlin, anstatt des sonst üblichen Schlußvortrags, eine Podiumsdiskussion zum Thema „Gesellschaftliche Akzeptanz verwaltungsgerichtlicher Entscheidungen" veranstaltet. Die Fragestellungen sind die gleichen. Akzeptanz wird als „Vertrauen" definiert (unveröffentlichtes Manuskript; wird voraussichtlich erscheinen i m Richard Boorberg Verlag). Gefragt ist das Vertrauen aus der Kompetenz der Verwaltungsgerichtsbarkeit heraus, weil man sich mit dem Vorwurf vom „Richterstaat" konfrontiert sieht; aber man erkennt freilich auch, daß der Gesetzgeber den
Die Akzeptanzkrise als Legitimationskrise Verwaltungsrichter i m Stich läßt, insbesondere bei technischen Großvorhaben, wo sich der Gesetzgeber in unbestimmte Rechtsbegriffe flüchtet, weil es auch an der allgemeinen Konsensfähigkeit i m Parlament fehlt. Hier steht nun der bemerkenswerte Satz (S. 3), daß wegen der fehlenden gesetzlichen Regelungsmuster die Gerichte „sich in der Regel durch Gutachten sachkundig machen" mußten, „was jedoch gerade zur Akzeptanz der gerichtlichen Entscheidungen in diesem Bereich (sc. Wissenschaft und Technik; der Verfasser) beigetragen habe". Wenn aber schon die Herbeiziehung von Gutachten akzeptanzerhöhend, nach dem dargelegten Verständnis also vertrauensbildend wirkt, so kann eine Technologiefachkammer - mit Gutachtern und Experten, die mit solchen Gutachten von Berufs wegen umgehen können - nur eine noch erhöhende und verstärkende Wirkung haben. Die Schlußfolgerung ist nicht nur konsequent, sie ist zwingend. Wir haben in der vorliegenden Arbeit vorrangig auf die vertrauensbildende Funktion der Technologiefachkammer abgehoben, also auf ein sozialpsychologisches wie auch individualpsychologisches Phänomen. Die gesellschaftliche Akzeptanz, die einhergeht mit der persönlichen Akzeptanz und aus ihr erwächst, wäre der Erfolg, den Ernst Benda und der 7. Deutsche Verwaltungsrichtertag gesucht haben. Daß die Verwaltungs- und sogar die Verfassungsgerichtsbarkeit mehr auf Vermutungen denn auf konkretes Wissen, etwa durch sozialempirische Untersuchungen, angewiesen ist, sich darüber zu informieren, wie es mit der generellen und in manchen wichtigen Fragen zur speziellen Akzeptanz von Entscheidungen aussieht, muß ebenso verwundern wie bedrücken. Angesichts der anfallenden Kosten hierfür müßte man Verständnis aufbringen, meint Ernst Benda (S. 310). Das freilich kann nicht überzeugen, wenn man bedenkt, wie wenig zimperlich sonst bei der Staatskasse zugegriffen wird, noch dazu in Angelegenheiten, die nicht annähernd so wichtig sein können wie die Rechtsfortbildung in Fragen von Gift, Gen und Kernkraft. Zu guter Letzt: Ernst Benda lobt zwar den Eifer, mit dem sich die Rechtswissenschaft mit den Rechtssprüchen oberster Gerichte auseinandersetzt, dies beschränke sich allerdings nur auf „vorliegende Rechtssprechungsergebnisse . . . , anstatt auch einmal vorauszudenken und neue Wege zu weisen" (S. 310). Man mag sich dieser Empfehlung entsinnen, wenn auf dem Weg zur Technologiefachkammer ein paar Steine lägen . . .
Literatur Adorno, Theodor /Popper, 1969.
Karl u. a.: Der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie,
Albert, Hans, in: Topitsch, Ernst (Hrsg.), Logik, 1971, S. 181 ff. Baring, Martin, Die politische Selbstverwaltung und die Verwaltungsgerichtsbarkeit, Deutsches Verwaltungsblatt, 1955, S. 685 ff.
Edgar Michael Wenz Baumann, Helmut, Betroffensein und die Großvorhaben - Überlegungen zum Rechtsschutz im Atomrecht, in: Bayerische Verwaltungsblätter 1982, S. 297. Baur, Fritz, Laienrichter - heute?, in: Tübinger Festschrift für Eduard Kern, 1968, S. 49 ff. Beckurts, Karl-Heinz, Technischer Fortschritt - den wir wollen müssen, in: F.A.Z. vom 14. 8. 1982. Beling, Deutsches Reichsstrafprozeßrecht, 1928. Benda, Ernst, Technische Risiken und Grundgesetz, in: Blümel / Wagner (Hrsg.), Technische Risiken und Recht, 1981, S. 5 ff. - F.A.Z. vom 25. 4. 1983 (Benda, 1983a). - Zur gesellschaftlichen Akzeptanz verwaltungs- und verfassungsgerichtlicher Entscheidungen , in: DÖV 8/83, S. 305 ff. (Benda, 1983b). Bergler, Reinhold, Studie über Technikakzeptanz, in: Siemens-Zeitschrift 55, S. 2 ff. Bethge, Herbert, Grundrechtsverwirklichung und Grundrechtssicherung durch Organisation und Verfahren, in: Neue Juristische Wochenschrift, 1982, S. 1 ff. Beutel, Frederick K., Experimental Jurisprudence and Sciencestate, 1975. Blümel, Willi / Wagner, Hellmut (Hrsg.), Technische Risiken und Recht, 1981. Bonus, Holger, Eine Expertisen-Flut schwappt durch die Bonner Amtsstuben. Bestimmen Gutachter die Richtlinien der Politik? ... Die Flucht in die Gutachterei ist nichts anderes als eine Flucht vor der Verantwortung, in; Rheinischer Merkur/Christ und Welt, 40/81. Bossle, Lothar, Massenmedien - die erste Gewalt im Gefüge des demokratischen Verfassungsstaates, in: Gabriel /Radnitzky /Schopper, Die ,i-Waffen', 1982, S. 257 ff. Cyran, Wolfgang, Jugendproteste als Beitrag zur Stabilisierung der Gesellschaft? ,Revolte4 eindeutig und undeutlich. Zahlreiche Ursachen und Aspekte. Lindauer Therapiewoche, in: F.A.Z. vom 12. 5. 1982. Dierkes, Meinolf/ v. Thienen, Volker, Science Court - ein Ausweg aus der Krise?, in: Wirtschaft und Wissenschaft, Nr. 4/77, S. 2 ff. Ehrlich, Eugen, Die juristische Logik (1918), 3. Aufl. 1966. - Grundlegung der Soziologie des Rechts, 3. Aufl. 1976. Franzki, Harald, Die Reform des Sachverständigenbeweises in Zivilsachen, in: Deutsche Richterzeitung, 1976, S. 98 f. Fromme, Karl-Friedrich, Politische Berufung und Pflicht zur Sachlichkeit, in: F.A.Z. vom 8. 9. 1981. Fürst, Walter, Der Rechtsschutz bei der Nutzung der Kernenergie, in: Atom Wirtschaft Atomtechnik. Zeitschrift für öffentliches Recht und öffentliche Verwaltung, 1981, S. 70. Gabriel, Leo/Radnitzky, Gerard/Schopper, Erwin, Die ,i-Waffen', 1982. Geiger, Theodor, Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts, 1947. Gerhardt, Michael, Richterliche Fachkunde durch »technische Berater'?, in: Bayerische Verwaltungsblätter 16/82, S. 489 ff. Gerhardt, Rudolf, Alle Macht den Richtern?, in: F.A.Z vom 27. 11. 1982. Görlitz, Axel, Verwaltungsgerichtsbarkeit in Deutschland, 1970. - Laienrichtertum, in: Handlexikon zur Rechtswissenschaft, 1972, S. 265 ff.
Die Akzeptanzkrise als Legitimationskrise
9
Hartkopf, Günter, Pressedienst des Bundesinnenministeriums vom 30. 11. 1979, Vortrag auf der Fachtagung Umweltschutz. Haunschild, Hans-Hilger, Erfahrungen und Perspektiven der Technologiebewertung, Sonderdruck aus Bulletin der Bundesregierung Nr. 17/81, S. 145 ff. Heck, Philipp, Begriffsbildung und Interessenjurisprudenz, 1932. Hedemann, Justus-Wilhelm, Die Flucht in die Generalklauseln, 1933. Helfritz,
Hans, Allgemeines Staatsrecht, 5. Aufl. 1949.
Henkel, Heinrich, Einführung in die Rechtsphilosophie, 1964. Henle, Victor, Die Masse im Massenverfahren, in: Bayerische Verwaltungsblätter 1981, Heft 1. Hentig von, Hartmut, Wo stehen wir?, in: F.A.Z. vom 31. 12. 1981. Hofmann, Hasso, Rechtsfragen der atomaren Entsorgung, 1981. iwd Informationsdienst des Instituts der deutschen Wirtschaft, Nr. 10/83. Jellinek, Georg, Allgemeine Staatslehre (1900), 3. Aufl. 1965. Kern, Eduard, Gerichtsverfassungsrecht, 4. Aufl. 1965. Kernforschungszentrum Jülich, Wahrnehmung und Akzeptanz technischer Risiken, KFA Jülich, Spez-97. Kewenig, Wilhelm Α., Alternativen zur Überwindung der ,Akzeptanzkrise', in: Wirtschaft und Wissenschaft, Nr. 3/78, S. 2 ff. Klausa, Ekkehard, Zur Typologie der ehrenamtlichen Richter. Ein Beitrag auf empirischer Grundlage, Diss. Berlin 1970. Kriele, Martin, Ein Recht auf Widerstand? Demokratie und ,Gegengewalt', in: F.A.Z. vom 1.3. 1983. Krüger, Herbert, Rechtssetzung und technische Entwicklung, in: Neue Juristische Wochenschrift, 1966, S. 617 ff. Laufs, Adolf, Rektoratsrede (Begrüßung), in: Nicklisch, Fritz / Schottelius, Dieter/Wagner, Hellmut (Hrsg.), Die Rolle des wissenschaftlich-technischen Sachverstandes bei der Genehmigung chemischer und kerntechnischer Anlagen (Reihe Technologie und Recht), 1982, S. 3. Liekefett, Karlheinz, Die ehrenamtlichen Richter an den deutschen Gerichten, Diss. Göttingen, 1965. Llewellyn, Karl N., Jurisprudence, Realism in Theory an Practice, 1962. Lübbe, Hermann, Feindschaft gegenüber Wissenschaft und Technik, in: F.A.Z. vom 12. 6. 1982. Luhmann, Niklas, Grundrechte als Institution, 1967. - Legitimation durch Verfahren (1969), 3. Aufl. 1978. - Rechtssoziologie, 1972.
0
Edgar Michael Wenz
Lukes, Rudolf, Die nach dem Stand von Wissenschaft und Technik erforderliche Vorsorge gegen Schaden. Problematik des unbestimmten Rechtsbegriffs und seiner Konkretisierung, in: Atomwirtschaft - Atomtechnik. Zeitschrift für öffentliches Recht und öffentliche Verwaltung, 1980, S. 74 ff. - Technischer Sachverstand und Rechtsentscheidung, in: Jahrbuch Bitburger Gespräche 1981, S. 126. Lundstedt, Α. V., Die Unwissenschaftlichkeit der Rechtswissenschaft, 1932. Maier-Leibnitz, Heinz, Vorschlag einer Glaubwürdigkeitsprüfung. Die wissenschaftlich-technische Politikberatung ist in Gefahr, in: F.A.Z. vom 12. 10. 1982. Marburger, Peter, Die Bewertung von Risiken chemischer Anlagen aus der Sicht des Juristen, in: Blümel/Wagner (Hrsg.), Technische Risiken und Recht, 1981, S. 27 ff. (Marburger 1981a). - Technik ohne Risiko gibt es nicht, in: F.A.Z. vom 3. 4. 1981 (Marburger 1981b). Marcuse, Herbert / Popper, Karl, Revolution oder Reform?, 1971. Nicklisch, Fritz, Zur rechtlichen Relevanz wissenschaftlich-technischer Regelwerke bei der Genehmigung technischer Anlagen, in: Nicklisch / Schottelius / Wagner (Hrsg.), Die Rolle des wissenschaftlich-technischen Sachverstandes bei der Genehmigung chemischer und kerntechnischer Anlagen (Reihe Technologie und Recht), 1982, S. 67 ff. (Nicklisch, 1982a). - Wechselwirkungen zwischen Technologie und Recht. Zur kontrollierten Rezeption wissenschaftlich-technischen Standards durch die Rechtsordnung, in: Neue Juristische Wochenschrift, 1982, S. 2633 ff. (Nicklisch 1982b). - Für Fortschritt und Sicherheit zugleich, in: F.A.Z. vom 23. 4. 1983. Νoelle-Neumann, Elisabeth, Technik-Feindlichkeit nimmt zu, in: F.A.Z. vom 6. 3. 1982. Noll, Peter, Gesetzgebungslehre, 1973. Opp, Karl-Dieter, Soziologie im Recht, 1973. Ossenbühl, Fritz, Die gerichtliche Überprüfung der Beurteilung technischer und wirtschaftlicher Fragen in Genehmigung des Baus von Kraftwerken, in: Deutsches Verwaltungsblatt, 1978, Heft 1. - Aktuelle Probleme der Gewaltenteilung, in: Die Öffentliche Verwaltung Nr. 15/80, S. 545 ff. - Die Bewertung von Risiken kerntechnischer Anlagen aus der Sicht des Juristen, in: Blümel/Wagner (Hrsg.), Technische Risiken und Recht, 1981, S. 50 ff. Piel, Dieter, Gibt es eine Ideologie der Angst?, in: F.A.Z. vom 5. 9. 1981. Pieper, Helmut, Der Richter und Sachverständiger im Zivilprozeß, in: Zeitschrift für Zivilprozeß, 1971, Heft 1. Pokatzky, Klaus, Eine Studie gefällig?, in: Die Zeit vom 22. 1. 1982. Popper, Karl, Logik der Forschung, 1976. Pound, Roscoe, Interpretation of Legal History, 1923. Radbruch, Gusta\ ! Zweigert, Konrad, Einführung in die Rechtswissenschaft (1929), 13. Aufl. 1980. Raiser, Thomas, Einführung in die Rechtssoziologie, 2. Aufl. 1973.
Die Akzeptanzkrise als Legitimationskrise
1
Rehbinder, Manfred, Rechtssoziologie, 1977. Rehfeldt, Bernhard ! Rehbinder, Manfred, Einführung in die Rechtswissenschaft (1962), 1978. Reißmüller, Johann Georg, Lüttich und die Geschworenen, in: F.A.Z. vom 16. 11. 1962. Renn, Ortwin, Die sanfte Revolution, Zukunft ohne Zwang, 1980. Rink: Schüler sind nicht technikfeindlich, in: VDI-Nachrichten Nr. 1 / 82. Roellecke, Gerd, Der Begriff des positiven Gesetzes und das Grundgesetz, 1969. - Wissenschaft im Kreuzverhör?, in: Wirtschaft und Wissenschaft, Nr. 2/78, S. 2 ff. Rüggeberg, Jörg, Zur Funktion der ehrenamtlichen Richter in den öffentlich-rechtlichen Gerichtsbarkeiten, in: Verwaltungsarchiv Heft 3/1970, S. 189 f. Rüthers, Bernd, Eine unwahrscheinliche Geschichte, Bundesarbeitsgericht unter Druck?, in: F.A.Z. vom 3. 3. 1983. Ryffel,
Hans, Rechts- und Staatsphilosophie, 1969.
- Rechtssoziologie. Eine systematische Orientierung, 1974. Sarwey von, Otto, Das öffentliche Recht und die Verwaltungspflege, 1880. Schelsky, Helmut (Hrsg.), Systemfunktionaler, anthropologischer und personfunktionaler Ansatz der Rechtssoziologie, in: Jahrbuch für Rechtssoziologie und Rechtstheorie, Bd. I, 1970, S. 37 ff. (Schelsky, 1970a). - Zur Theorie der Institution, 1970 (Schelsky, 1970b). Schiffmann, Gerfried, Die Bedeutung der ehrenamtlichen Richter bei Gerichten der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit, in: Schriftenreihe der Hochschule Speyer (53), 1974, S. 2 ff. Schmidt, Johann, in: Deutsches Verwaltungsblatt 82, S. 148 ff. Schmidt-Räntsch, Günther, Kommentar zum Deutschen Richtergesetz, 2. Aufl. 1973. Schopper, Erwin, Information und Vertrauen. Zur Entwicklung der Kernenergiepolitik in der Bundesrepublik Deutschland, in: Gabriel/Radnitzky/Schopper, Die ,i-Waffen', 1982, S. 295 ff. Schünemann, Hans-Wilhelm, Sozialwissenschaften und Jurisprudenz, 1976. Ule, Karl-Hermann, Gedächtnisschrift für W. Jellinek, 1955. Varrentrapp, Eberhard, Die Stellung der gerichtlichen Sachverständigen, in: Deutsche Richterzeitung 1969, S. 315 ff. Verwaltungshochschule Speyer, Die Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Genehmigung von umweltrelevanten Großvorhaben - Rechtliche Grundlage und praktische Erfahrungen, noch unveröffentlicht. Verwaltungsprozeßordnung, Entwurf, DBT, Drucksache 100/82. Verwaltungsprozeßordnung, Entwurf, BJM, Februar 1982. Wagner, Hellmut, Schadensvorsorge bei der Genehmigung umweltrelevanter Großanlagen, in: Die Öffentliche Verwaltung 8/80, S. 270 (Wagner, 1980a). - Die Risiken von Wissenschaft und Technik als Rechtsproblem, in: Neue Juristische Wochenschrift 13/80, S. 666 (Wagner, 1980b).
Edgar Michael Wenz - Sonderrecht für Kernenergieexperten? Zur Kritk am Sachverständigenwesen, in: Atomwirtschaft - Atomtechnik. Zeitschrift für öffentliches Recht und öffentliche Verwaltung 2/80, S. 86 ff. (Wagner, 1980c). - Neue Formen administrativer Entscheidungen der umweltrelevanten Großanlagen?, in: Zeitschrift für Rechtspolitik 4/82, S. 103 ff. (Wagner, 1982a). - Zur Rechtlichen Relevanz der Aussagen wissenschaftlich-technischer Sachverständiger bei der Genehmigung großtechnischer Anlagen, in: Nicklisch / Schottelius / Wagner, Die Rolle des wissenschaftlich-technischen Sachverstandes bei der Genehmigung chemischer und kerntechnischer Anlagen (Reihe Technologie und Recht), 1982, S. 107 (Wagner, 1982b). Wagner, Hellmut / Ziegler, Eberhard ! Closs, Klaus-Detlef, Risikoaspekte der nuklearen Entsorgung, 1982. Weber, Max, Rechtssoziologie, 1973. Wenz, Edgar M., Der ,Science Court' und er nützt doch!, in: Wirtschaft und Wissenschaft, Nr. 4/78, S. 2 ff. Wild, Wolfgang, Die Technik soll die Technik retten. Innovation und Tradition in der Naturwissenschaft, in: F.A.Z. vom 16. 1. 1982. Zipf, Heinz, Gutachten C, Deutscher Juristentag, 1982. Zippelius, Reinhold, Legitimation durch Verfahren? Festschrift Karl Larenz, 1973.
Das Mißverständnis mit den „Wissenschaftsgerichtshöfen"* I. Einleitung
Alle Autoren, die sich bislang mit den Rechtsproblemen von Wissenschaft und Technik und den Wissenschaften um die Technik, der Technologie 1 , befaßt haben, setzen sich in ihren Einleitungen mit dem sozialpsychologischen Phänomen einer schier unüberwindbar, zumindest aber sehr gefährlich scheinenden „sozialen A k zeptanzkrise 4 ' auseinander - um dann nach bewährter juristischer Manier sich dem Problem rechtstheoretisch-dogmatisch zu nähern, eigentlich kaum anders, als wenn es um eine ZPO-Novelle ginge. Diese sozialpsychologischen Phänomene lassen es angeraten erscheinen, sich auch um eine sozialpsychologische Therapie umzutun, sie zumindest zu versuchen. Dazu sollte sich die Rechtswissenschaft der Möglichkeiten entsinnen, die i m Verfahren stecken. Dieser gewiß nicht waghalsige Weg wurde auch gesehen. Nur ist die Ausbeute ebenso gering wie divergierend. Die literarischen Ergebnisse reichen von Ablehnung 2 , über vorsichtige Tastversuche zu neuen Lösungen 3 bis zu Un-Schlüssigkeiten 4 . In Erwartung der Wirksamkeit von Verfahren wurde vor einigen Jahren aus dem angelsächsischen in unseren Rechtskreis der „Science Court" 5 eingebracht, der mit „Wissenschaftsgerichtshof' weder
* Erstveröffentlichung in: Zeitschrift für Rechtspolitik 1985, S. 267 ff. 1 Ungeachtet der meist zutreffenden Vorbehalte gegen diesen Begriff der Technologie (exemplarisch die Glosse „ein Wort-Monster", F.A.Z. vom 31.3. 1984) soll er hier weiter für Großtechnik beibehalten werden, nicht nur, weil er sich mittlerweile eingebürgert hat, sondern weil in diesen Zusammenhängen auch die Technikwissenschaften angesprochen sind. 2 Exemplarisch Hasso Hofmann, in: UPR 1984, 73 ff., der „exzeptionelle Eigentümlichkeiten der zu beurteilenden Sachverhalte" und konsequent das Erfordernis anderer Verfahrensregeln verneint (S. 83); so auch Kuhnt, Schmidt, zitiert ebenda. Ähnlich auch Wagner, Marburger, Lukes, bedingt Benda, bei: Wenz, Wissenschaftsgerichtshöfe, Mittler zwischen Wissenschaft, Politik und Gesellschaft, 1983, S. 153 ff. 3 Exemplarisch Johann Schmidt, in: Festschr. f. Th. Maunz, 1983, S. 315; Gerhardt, BayVBl. 1982, 489 ff.; beide schlagen „Technische Berater" für die Gerichte vor. Vorsichtige Annäherung auch durch Lerche, zit. bei: Hofmann, UPR 1984, 73. 4 Exemplarisch Albers, DVB1. 1983, 1039 f f ; er vergleicht zwar Rechtsunsicherheit und Akzeptanzkrise mit „Scylla und Charybdis" (1049); er sieht keine Möglichkeit zur Akzeptanz der Entscheidungsinhalte, aber eine Chance, „über die Art und Weise ... wie die Entscheidungen getroffen werden", kommt aber dann überraschenderweise zu dem Ergebnis, daß zu „zielgerichteten Eingriffen in das Verwaltungsprozeßrecht ... keine Veranlassung" besteht (1050).
254
Edgar Michael Wenz
glücklich noch treffend übersetzt wurde. Der sprachlich zu hoch angesetzte Begriff führte zu Mißverständnissen. Schon das Wort „Wissenschaftsgerichtshof' implizierte Vorstellungen, daß das Gericht über „richtig oder falsch" in Fragen von Wissenschaft und Technik, womöglich noch mit dogmatischer Wirkung, entscheiden sollte - eine Horrorvorstellung für jeden, dem die stete Offenheit der Wissenschaften ein unverzichtbares und unantastbares Essentiale allein schon für den Begriff der Wissenschaften ist. Dies könnte ursächlich dafür sein, daß diese Ideen - die Befürchtungen eines wissenschaftlichen Kardinalkollegiums oder Heiligen Offiziums offenbar haben auslösen können - bislang nicht ernsthaft weiterverfolgt wurden. Dieses Vor-Verständnis sollte sich aber nun nicht zu einer Vor-Belastung durch Vor-Verurteilung einer Chance auswirken, noch dazu in einer Starre, die selbst ein vorsichtiges Untersuchen für sinnlos erscheinen läßt. Dies gilt um so mehr, als in der weiteren Diskussion sich das Augenmerk auf vertraute und begehbare Diskussionsebenen richtet, nämlich - auf Fachkammern im Rahmen der ordentlichen Verwaltungsgerichtsbarkeit, und - institutionalisierte Sachverständigenkommissionen bei der Verwaltungsbehörde.
II. Die Technologiefachkammer Vor dem Hintergrund einer aufgeregten Gesellschaft mußte vorrangig interessieren, welche Maßnahmen friedenstiftende Wirkungschancen haben und ein Potential freisetzen, den rechtsstaatlichen Konsensus zu fördern. Da nun letztlich alle Entscheidungen, die mit Großtechnologie, Gen, Gift und Kernkraft zu tun haben, vor den Verwaltungsgerichten enden, muß das Augenmerk darauf konzentriert sein. Die Überlegungen führen zu einem Fachgericht, der Verkörperung des besonderen Verfahrens, zur sog. „Technologiefachkammer" (Technologiesenat). Diese Technologiefachkammer kurz i m Umriß 6 : Das Richterkollegium dieser Fachkammer, die durch einfaches Gesetz gegründet werden könnte, setzt sich numerisch-paritätisch aus Berufsrichtern, die den Vorsitzenden stellen, und juristischen Laien zusammen, die jedoch naturwissenschaftliche und technische Fachleute („Experten") sind. Das Erfordernis des gesetzlichen Richters verbietet eine Auswahl nach den jeweils anstehenden Rechtsfällen; aber man darf erwarten, daß 5 Dierkes/v. Thienen, Science Court - ein Ausweg aus der Krise?, 1977; Wiederabdruck in Wenz, S. 11 ff. 6 Siehe dazu mehr bei Wenz. Mit Beiträgen von Dierkes, Roellecke, Kewenig und Wenz. Dort sind zwar die „Science Courts" in allen diskutierten und im Ausland auch probierten Versionen vorgestellt (Dierkes), aber die Verfassungsbedenklichkeit festgestellt und als Entscheidungsgremien abgelehnt worden. Der beschriebene und begründete Weg wies eindeutig zur verfassungskonformen Fachkammer (Wenz).
Das Mißverständnis mit den „Wissenschaftsgerichtshöfen"
255
reputierte Naturwissenschaftler und Techniker ausreichende Kenntnisse und Erfahrungen mitbringen und einbringen, den Sachvorträgen folgen und an der Tatbestandsermittlung kompetent mitwirken können, mit generellem Fachverstand, auch ohne spezifischen Sachverstand. Es wird sich eine Reihe großer und kleiner Probleme zeigen: beispielsweise bei der Aufstellung der Berufungslisten, und dies möglicherweise weniger in einem Gerangele um Richterpositionen (in denen manche antizipierte Entscheidungen sehen könnten) als mehr in negativer Tendenz, durch eine Zurückhaltung bekannter Wissenschaftler nämlich, die eine Gutachtertätigkeit vorziehen würden; dies hätte unverkennbar eine diskriminierende Wirkung auf das Gericht. Aber erkannte Gefahren sind nur noch halb so schlimm. Es würde zu weit führen, an dieser Stelle die ganze Problematik, die nicht übersehen werden darf, allerdings auch nicht die möglichen Hilfen und Lösungen, aufzuzeigen. Die justiziell-technische Seite tritt ohnehin zurück gegenüber der angestrebten sozialpsychologischen, also (rechts)soziologischen Wirkung.
7. Der sozialpsychologische
Aspekt
Es geht nämlich um dies: Würden Entscheidungen einer solchen Technologiefachkammer besondere sozialpsychologische Wirkungen auf die Rechtsunterworfenen und Betroffenen zeigen? Die bisherigen Verfahren haben zu Entscheidungen geführt; diese wurden auch durchgesetzt. Wir müssen aber konstatieren, daß die friedenstiftende Funktion der Rechtssprechung ausgeblieben ist. Diese Feststellung ist nicht etwa von der naiven Hoffnung getragen, daß nach einem fairen Verfahren und einem gelungenen Urteil die unterlegene Partei als voll befriedet den Gerichtssaal verlassen müßte. Die Wirkung der Rechtssprechung wird in diesen Zusammenhängen mehr erwartet in Richtung der am Verfahren Interessierten. Aus dieser Sicht müßte „Massenverfahren" ohnehin rechtssoziologisch neu und anders definiert werden. Auch wenn man die teilweise chaotischen Ausschreitungen nicht generalisieren darf, so bleibt doch die Erkenntnis, daß Exzesse nicht i m luftleeren Raum wachsen; sie sind nur die sichtbare Spitze; darunter ist ein unsichtbarer Unterbau zumindest - des Unbehagens und der Zweifel. Die Entscheidungen wurden und werden von einem nicht vernachlässigbaren Teil der Bevölkerung nicht „akzeptiert". So liegen Wechselwirkungen vor, auch zur fehlenden Akzeptanz der betroffenen Technologie. Das eine bedingt das andere. Und kein Ende in Sicht, so lange dieser Kreislauf nicht durchbrochen wird. Die Erwartungen an die Technologiefachkammer sind nicht darauf ausgerichtet, daß dieses Expertengericht „besseres" Recht und „mehr" Wahrheit erkennen kann als etwa das „normale" Verwaltungsgericht. Das erwarten wir gar nicht. Dies ist kein Zynismus, sondern demütige Einsicht in die Begrenztheit menschlichen Wis-
256
Edgar Michael Wenz
sens. Es geht nicht um die Evaluierung des Urteils i m Sinne naturwissenschaftlichtechnischer Richtigkeit. Selbstverständlich ist diese angestrebt, aber objektiv kaum erreichbar, jedenfalls nie beweisbar. Es ist auch weder zynisch noch ein Zeichen von Resignation, wenn wir sagen: Darum geht es gar nicht, menschenmögliche Richtigkeit setzen wir ohnehin voraus. In diesen sozialpsychologischen Zusammenhängen geht es uns vielmehr um die Ausschöpfung des Potentials der richterlichen Autorität; um die vertrauensbildende Kraft der dritten Gewalt; um die durch Fachkunde gestützte und aus ihr wachsende Glaubwürdigkeit der Entscheidung 7 . Diese wichtigen Wirkungen glauben wir erreichen zu können durch die erkennbare Fachkunde des Gerichtes, des Expertengerichtes, von dem eben „Wahrheit" des Spruchs, seiner Fach- und Sachkunde willen, erwartet wird. Richtigkeit und Wahrheit sind, zumindest, „Kommunikationsmedien" (Luhmann), die die Hinnahme der Entscheidung erleichtern. Wenn Grundkonsensus und allgemeines Systemvertrauen gegeben sind, wird dieses auch durch einen Spruch des Expertengerichtes, der mißliebig ist, nicht erschüttert und ausgehöhlt werden können. In Richtung jener freilich, die den Grundkonsensus verneinen, zielen solche Bemühungen nicht; sie sind nicht die Adressaten.
2. Sachverstand vor und auf der Richterbank U m Vertrauen zu gewinnen, müssen die Experten heraus aus ihrer Gutachterrolle. Das heißt freilich nicht, daß i m Verfahren vor der Technologiefachkammer es künftig keine Sachverständigen und Gutachter mehr geben würde. Der Sachverstand bleibt vor Gericht; er kommt allerdings auch auf die Richterbank und in das Beratungszimmer. Vorbehalte gegen Sachverständige sind i m Volk weit verbreitet („Halbgötter in Weiß"); sie sind auch nicht unbegründet, jedenfalls sind sie nicht so leicht ausräumbar. Hier wird der Mangel an irdischer Verantwortlichkeit gesehen. Sachverständige berufen sich bei erkennbaren Fehl-Urteilen sofort auf ihre fehlende Entscheidungskompetenz - nicht anders als Staatsanwälte, die in solchen Fällen ja auch „nur beantragt" haben. Nicht anders wird man „Technische Berater" des Gerichts 8 sehen können. Die höchste Stufe der Verantwortlichkeit, auch und 7 Die besondere Qualifikation des Richterspruchs, den „rechtsstaatlichen Mehrwert", beobachtet Ossenbühl, DVB1. 1978, 8: konkret fragt er, ob diese Wirkung ausginge von der Annahme der Richtigkeit der richterlichen Entscheidung, der größeren Fachkunde des Gerichtes, der Öffentlichkeit des Verfahrens, dem Edukationseffekt richterlicher Kontrolle; er sieht die Lösung in der Objektivität, Unparteilichkeit und Unabhängigkeit, den „dem Status und Habitus des Richters eigen ist". 8 Schmidt (o. Fußn. 3), S. 314 f., dem in der Beurteilung der Ausgangslage zuzustimmen ist; man kann aber nicht sehen, warum „technische Generalisten", S. 301 f., vor größeren Problemen stehen könnten als rechtskundige Richter, die schließlich „generelle Generalisten" sind. Die personalen Bedenken gegen die Einsetzung von „Technischen Beisitzern", unseren Expertenrichtern, werden geteilt, nur nicht die durchklingende Hoffnung, daß dieses Problem
Das Mißverständnis mit den „Wissenschaftsgerichtshöfen"
257
gerade des Naturwissenschaftlers und Technikers, wird i m Rechtsspruch gefunden. Die Kritiker der Technologiefachkammer 9 sehen dieses Modell nur unter dem Gesichtspunkt der Evaluierung des Urteils, i m Sinne naturwissenschaftlicher und technischer Richtigkeit, die in den hier untersuchten Zusammenhängen außerhalb unseres Interesses liegen. Aufschlußreich ist ein konkreter Einwand von Hasso Hofmann 10: Er sieht den klagenden Laien erst recht vom Prozeßgeschehen ausgesperrt bei einem „fachlichen Dialog zwischen dem Sachverständigen vor den Schranken und dem Sachverständigen auf der Richterbank", und eben das könne nicht zum Rechtsfrieden führen. Hätte Hasso Hofmann recht, würde die Fachkammer ihr Ziel verfehlen, sie wäre wertlos. Den fachlichen Dialog zwischen Sachverständigen und Expertenrichtern wird es sicherlich geben. Aber: Daß er nicht entschwebt, dafür werden die Juristen auf der Richterbank wohl sorgen. Man kann auch sehen, daß der klagende Hausmann Müller insofern befriedigt an seinen Kochtopf zurückkehrt, weil der Verwaltungsgerichtspräsident offensichtlich auch nicht mehr von der Sache versteht als er selber - ob dadurch aber rechtsstaatlicher Konsensus zuwächst? Man sollte nicht aus dem Gesichtsfeld verlieren, daß eine Entlastung der Berufsrichter schon allein aus „moralischen" Gesichtspunkten angestrebt werden müßte; denn die Überforderung 11 der Richter kann nicht länger übersehen werden, sie ist ohnehin unstreitig. Juristen werden in ihrem Verantwortungsgefühl nur begrüßen können, wenn diese ungeheuere Verantwortung mitgetragen wird. Man ist versucht zu sagen: Diese Verantwortung ist Juristen allein gar nicht zumutbar. Vielleicht auch: Kann die Gesellschaft diese Verantwortung Juristen allein überhaupt anvertrauen? Methodisch nicht erforderlich, praktisch aber vermutlich vorteilhaft wäre die Zuständigkeit einer solchen Technologiefachkammer für mehrere Gerichtsbezirke. A u f diesem Wege ließen sich auch Überlegungen zur Straffung des Verfahrens und Verkürzung der Verfahrensdauer anstellen, ohne daß deswegen die teilweise angeregte oder abgelehnte 12 Zweistufigkeit des Verfahrens bemüht zu werden brauchte. Eine gebietliche Konzentration müßte auf jeden Fall Vorteile bringen. Selbst ein Verwaltungsgericht ohne Expertenrichter würde sich durch Personalpolitik über kurz oder lang qualifizieren - und als qualifiziert darstellen - können. Was in Wett-
beim „Technischen Berater" (der sich auch nach dem Verdacht einer Art „grauen Eminenz" ausgesetzt sehen müßte) geringer sein könnte. 9 Vgl. dazu o. Fußn. 2. Einen Hinweis verdient die Ankündigung des Landes Baden-Württemberg 1978, technische Senate bei den OVG für technologische Großprojekte einzurichten; man bekam aber in Stuttgart dann offenbar große Angst vor der eigenen Courage; vgl. Wenz (o. Fußn. 2)., S. 146 f. 10 S. o. Fußn. 2, S. 83, bei Anm. 90. 11
So stellvertretend Benda, in: Blümel/Wagner, Technische Risiken und Recht, 1981, S. 5 ff. 12 Angeregt: Vgl. Wenz (o. Fußn. 2), S. 142. Abgelehnt: Vgl. Hofmann (o. Fußn. 2), S. 83. 17 Gedächtnisschrift Wenz
Edgar Michael Wenz
258
bewerbssachen 13 gut ist, kann für Entscheidungen von möglicherweise epochaler Bedeutung nicht falsch sein.
I I I . Ein Angebot der Rechtssoziologie: „Legitimation durch Verfahren"? Die Rechtswissenschaften können sich nach Hilfe bei ihrer Tochter Rechtssoziol o g i e 1 4 umsehen. Sie können dort zumindest Impulse aufnehmen. Gerade die Erkenntnisinteressen der Rechtssoziologie sind i m aufscheinenden Brennpunkt angesiedelt, i m Schnittpunkt zwischen Gesellschaft und Recht 1 5 . Die Rechtssoziologie hat ein interessantes Angebot gemacht, das zu prüfen wäre: Das Potential des Verfahrens, das Legitimation verschafft. Es würde zu weit führen, sich mit Niklas Luhmanns Theorie von der „Legitimation durch Verfahren" hier auseinanderzusetzen; sie ist ohnehin mit Mißverständnissen und Vorurteilen behaftet 1 6 . Aber es bedarf keiner weiteren Reflexionen dazu, weil diese - ohnehin soziologische - Theorie sich methodisch konsequent mit der soziologischen Wirkung von Verfahren befaßt. Und man kann sich nicht schwertun, wenn nicht gerade legitimierende, so doch wenigstens legitimationsannähernde Wirkungen zu erkennen. Auch Arthur Kaufmann sieht aus rechtstheoretischer Warte eine legitimierende Wirkung, wenn auch nicht durch das Verfahren, sondern i m Verfahren 17 . Wie auch immer, die Funktio-
13
Etwa § 27 II UWG (Ermächtigung der Landesregierungen, durch Rechts Verordnung mehrerer Landesgerichtsbezirke in Wettbewerbsstreitsachen zusammenzuziehen); ähnlich auch Staatsschutzsachen, Wirtschaftsstrafsachen, NS-Verbrechen, Disziplinarsachen. 14 Die mangelnde Präsenz der Rechtssoziologie im juristischen Wissenschaftsbetrieb kann hier nicht reflektiert werden. Aber eine der Wirkungen dieser Erscheinungen ist wohl auch, daß bei rechtspolitischen Erörterungen zu leges ferendae die Rechtssoziologie nur selten methodisch angefragt wird. 15 Interessant auch die Definition der Aufgabe der Soziologie durch Rehbinder, Rechtssoziologie, 1977, S. 122; danach befaßt sie sich mit den „Wandlungsprozessen, deren Dynamik durch die sich überstürzenden Fortschritte von Technik und Wissenschaft in ständiger Zunahme begriffen ist". Nach unserem Verständnis wäre es eine primäre Aufgabe der (theoretischen) Rechtssoziologie, bei der Einarbeitung außergesetzlichen Normen, insbesondere Regeln der Technik zum Ausfüllen unbestimmter Rechtsbegriffe, arbeitsteilig mitzuwirken. Für diese Aufgabe spricht Nicklisch auch die Rechtssoziologie an (in: Nicklisch /Schottelius/ Wagner, Reihe Technologie und Recht, 1982, S. 78, 93). Hierzu mehr bei Wenz (o. Fußn. 2), S. 163 ff. mit Literaturangaben. 16 Die Vorbehalte gegen die Theorien Luhmanns, bei denen man rechtsethische Bezüge vermißt, werden sich häufig als Mißverständnisse über Erkenntnisziele und Arbeitsweisen der Rechtssoziologie aufdecken. Luhmann versucht in der Neuauflage 1978 seiner (unveränderten) Monographie „Legitimation durch Verfahren" (1969), S. 1 - 7 , klarzustellen, daß „die Darstellung einer Funktion ... keine versteckte Empfehlung, keine Krypto-Normierung" bedeutet. 17 Einführung in die Rechtsphilosophie und die Rechtstheorie der Gegenwart, 1979, S. 290 f.
Das Mißverständnis mit den „Wissenschaftsgerichtshöfen"
259
nen, die das Verfahren zu leisten vermag, sollten genutzt oder doch zumindest zu nutzen versucht werden. Niklas Luhmann hat allerdings nur das Individualverfahren vor Gericht beschrieben und analysiert; auch Arthur Kaufmann beschäftigt sich explizit nur mit diesem. Dagegen haben wir es i m anstehenden Problemkreis ausschließlich mit „Massenverfahren" zu tun, die zwar juristisch, aber noch nicht rechtssoziologisch 18 definiert sind. Wenn die Erwartungen an das Verfahren i m Grundsatz berechtigt sind, dann muß dies auch ein geeigneter Weg sein, Akzeptanzkrisen des Rechts zu lösen oder doch wenigstens aufzuweichen. Und das muß dann auch gelten für Probleme der Großtechnologie, etwa der Energiebeschaffung beispielsweise durch Kernkraftwerke, die gewissermaßen symbolisch für zivilisatorisches Unheil und technische Missetat stehen.
IV. Die Kodifizierung technischer Regeln. Eine andere Möglichkeit des „Wissenschaftsgerichtshofes"? Das Problem des Sachverstandes auf der Richterbank könnte zumindest entschärft werden, wenn die technischen Regeln verrechtlicht würden. Hasso Hofmann hat dies auf dem Verordnungswege gefordert 19 . In diese Richtung scheint die Bundesregierung auch neuerdings zu tendieren. Die Jahrestagung „Kerntechnik 84" hat - außer der wohl angreifbaren Feststellung eines „Normalisierungsprozesses" - die Ankündigung von Verordnungen sowie die Institutionalisierung und Aufwertung von Sachverständigengremien gebracht 20 . Die Verfolgung dieses sich abzeichnenden Trends bedeutet sicherlich keinen Mangel für die Rechtssicherheit 21 . Man wird aber davon ausgehen müssen, daß auch solche Rechtsverordnungen nach aller Voraussicht nicht ohne Generalklau18 Für juristische Ansätze: Schmel, Massen verfahren vor den Verwaltungsbehörden und den Verwaltungsgerichten; Henle, BayVBl. 1981, 1 ff.; Rechtssoziologischer Definitionsversuch bei Wenz (o. Fußn. 2), S. 99 f. 19 S. o. Fußn. 2, S. 83, mit Literaturhinweisen; ferner Fürst, Atomwirtschaft - Atomtechnik, 1981, S. 70. 20 Bulletin der Bundesregierung Nr. 61/1984, S. 541 ff. BMI Zimmermann stellte fest, daß die Reaktor-Sicherheitskommission und die Strahlenschutzkommission „seit langem einen weltweiten R u f genießen. Seine Hoffnung auf einen „Normalisierungsprozeß" für die Akzeptanz kerntechnischer Anlagen stützt sich auf das bisherige Ausbleiben eines „gravierenden Stör- oder gar Unfalls". Eine lediglich von dieser Faktizität getragenen Akzeptanz wäre im hohen Maße gefährdet, wenn doch eines Tages (selbst) ein kleiner Störfall aufträte.
21 Freilich geht dann die Frage weiter an die Rechtsphilosophie in der ewigen Suche nach Gerechtigkeit und Rechtsideal. Doch wieder zurück zum Rechtspositivismus, den man gerade überwunden zu haben glaubte, um der Gerechtigkeit willen? Siehe auch Wenz, Politik-RechtGesellschaft, Bd. 6, 1984, S. 230 ff., wo eine sinngleiche Frage als die erste an die Rechtswissenschaft, vertreten durch die Rechtsphilosophie, bei den derzeitigen Unsicherheiten zu stellen ist (231). 17*
260
Edgar Michael Wenz
sein und unbestimmte Rechtsbegriffe auskommen können 2 2 . Dann können sich wiederum naturwissenschaftlich-technische Fragen ergeben, nur viel spezifischer und spitzer als zuvor. Der „dynamische Grundrechtsschutz" wäre dann nur (oder sogar?) statisch-positivistisch. Ob davon der Grundsatz tangiert wird, daß die Legislative ganz bewußt ein Regelungsdefizit in Fragen hinterläßt, die schnellem Wandel und Anpassungszwang unterliegen - und dies in einer Zeit, die durch stürmische technische Entwicklung gekennzeichnet ist - , müßte sehr kritisch untersucht werden. Aber für die Festschreibung naturwissenschaftlicher, technischer oder sozialer Regeln liegt der Zeitpunkt wohl niemals richtig. I m Kern geht es um die Präferenz der Rechtssicherheit gegenüber einem dynamischen Grundrechtsschutz durch positive Kodifikation. Hasso Hofmann modifiziert seine Vorschläge durch straffe zeitliche Begrenzung, die auch für technische Regelwerke gilt, deren Kodifizierung auch keine Opfer mangelnder Beweglichkeit, die freilich technischen Fortschritt bremsen bis blockieren können, gefordert hätten. Möglicherweise besteht auch die Auffassung, der man auch nur schwerlich widersprechen könnte, daß immerhin denkbare Opfer entweder zumutbar sind oder bewußt geringgeachtet werden. Da technische Regelwerke, die j a ohnehin bei der Urteilsfindung, auch ohne Rechtsnormcharakter zu besitzen, eine überaus wichtige Rolle spielen, ist freilich der Gedanke naheliegend bis verführerisch, diesen Rechtsnormcharakter auf dem Verordnungswege zu verschaffen 23 . Damit wäre die von Hasso Hofmann postulierte „rechtsnormative Generalisierung" 24 herbeigeführt.
V. Konstituierte Sachverständigengremien bei der Exekutive Bei den hier angesprochenen Erkenntniszielen interessiert, angesichts einer verunsicherten Bevölkerung, wie durch ein besonderes Verfahren - die rechtssoziologische Bedeutung des Verfahrens gilt j a generell, nicht nur für das Verfahren vor den Verwaltungsgerichten - eine friedenstiftende Wirkung erzielt werden kann. A u f der Suche danach kommt die Idee der Wissenschaftsgerichtshöfe wieder in 22
Auch und gerade für einen Techniker ist eine solche Vorstellung nicht recht denkbar. Das DIN-Normwerk wiederholt beispielsweise auch die bereits bekannten unbestimmten Rechtsbegriffe (Anerkannte Regeln der Technik, Stand der Technik, Stand von Wissenschaft und Technik) in: DIN 820, 1, 5, 7 und 6, 1; in: DIN 820, 4,4, mehrfach in: DIN 31 000. 23 Technische Regeln werden in einem sehr strengen nachvollziehbaren Verfahren festgesetzt. Exemplarisch sei hier genannt das DIN-Normwerk, das in DIN 820 Regeln zur Regelsetzung aufstellt, die dem Gesetzgebungsverfahren nicht unähnlich sind (und schon deswegen die Voraussetzungen mitbringen, die man bei statischer Verweisung auf untergesetzliche, also soziale Normen an deren Zustandekommen stellen muß). Bemerkenswert ist die Überprüfungspflicht alle fünf Jahre (DIN 820, 4, 4). Vgl. dazu Budde, Reihlen, in: DIN-Mitteilungen 360, 1984, S. 248 ff. 24 S. o. Fußn. 2, S. 78, bei Anm. 44.
Das Mißverständnis mit den „Wissenschaftsgerichtshöfen"
261
Greifweite, diesmal aus einer anderen Richtung, die bisher als verfassungsbedenklich erkannt wurde: die Einsetzung von Sachverständigengremien. Rudolf Lukes 25 sieht mit Recht die Notwendigkeit einer Verfassungsänderung, wenn er an ein „fachkundiges Unterparlament" denkt. Auch Hellmut Wagner 26 erkennt die Verfassungsbedenklichkeit beim ersten seiner beiden vorgeschlagenen Modelle: Ein „besonders sachkundiges, unabhängiges und repräsentatives Verwaltungsgremium", das „volle Entscheidungskompetenz" haben soll; nicht dagegen bei einem ebensolchen „Sachverständigengremium in fachlicher repräsentativer Zusammensetzung", das allerdings auch nur vorbereitende Funktion bei der Festlegung des Sicherheitsstandards einer konkreten Anlage haben soll. Peter Marburger schließlich sieht einen Ausweg durch Erteilung einer „Unbedenklichkeitsbescheinigung" 2 7 . Fritz Ossenbiihl 28 könnte sich ein „Gremium wie die ReaktorSicherheitskommission, zusätzlich verstärkt mit juristischem Sachverstand", vorstellen, freilich „mit Entscheidungskompetenz i m Genehmigungsverfahren", so daß die Kontrolle des Verwaltungsgerichtes wesentlich gelockert werden könnte. Verfassungsrechtliche Bedenken würden entfallen, wenn diese Sachverständigengremien keine Rechtssetzungsbefugnis haben. Die Exekutive kann sich fach- und sachkundig machen (lassen), wie immer sie das für zweckmäßig hält. So können, entsprechend der parlamentarischen Praxis, Hearings veranstaltet und Enquête-Kommissionen eingesetzt werden, deren Bewährung allerdings weder gesichert noch erst recht unbestritten i s t 2 9 . Die Beschaffung von Fach- und Sachverstand könnte aber auch hinter verschlossenen Türen stattfinden; dieser Eindruck könnte entstehen, wenn die zuständigen Verwaltungsbehörden, etwa das Bundesinnenministerium, die Sachverständigen einzeln benennen und sich anhören oder Gremien bilden, in die die Sachverständigen berufen werden; man kann durchaus davon ausgehen, daß sowohl die Auswahlkriterien wie diese Fachgespräche und Verhandlungen sich durch Sachlichkeit und Sachdienlichkeit auszeichnen. Aber es fehlen bei einem solchen Vorgehen alle jene Merkmale, die das ordentliche Verfahren kennzeichnen, von dem man Vertrauensbildung und schließlich Legitimation erwarten darf. Beispielhaft sei die Transparenz angesprochen. Je mehr Transparenz es bei diesen Verfahren geben wird, wie immer diese und die Gremien heißen, desto mehr Interesse und Akzeptanz wird man mit Recht voraussagen können. Diese Überlegungen öffnen den Blick auf die anderen Modelle der Wissenschaftsgerichtshöfe - bei denen genau genommen nur der hochtrabende Ausdruck stören kann, der auch noch falsch ist, weil der Begriff des Gerichtshofes ja Ent25 In: NJW 1978, S. 241 ff., neuerdings wieder 1980 und 1981. 26 In: Reihe Technologie und Recht, 1982, S. 107. 27 In : Blümel/Wagner (o. Fußn. 11), S. 27 ff. 28 S. o. Fußn. 7, S. 9. 29 Vgl. dazu Noelle-Neumann, Der Zweifel am Verstand, F.A.Z. vom 24. 7. 1984, wo sie die wissenschaftliche Politikberatung durch Eindringen irrationaler Einlassungen gefährdet sieht.
262
Edgar Michael Wenz
scheidungsbefugnis zwingend impliziert, daran aber nicht einmal gedacht w a r 3 0 . Meinold Dierkes hatte insgesamt fünf Modelle vorgestellt 3 1 . Von diesen wurde hier ausführlich nur die Technologiefachkammer (Dierkes: Science Court Modell III) behandelt, der einzige Vorschlag, der die Rechtsprechung entlasten würde, und ebenso die einzige Lösung, bei der entschieden werden darf und muß. Alle anderen vier Modelle dienen lediglich der Entlastung von Regierung und Parlament; sie haben nur feststellende, vorbereitende, beratende und empfehlende Funktion. Was dann die Regierung mit den „Beschlüssen" - oder sollte man sagen: „Ratschlüssen" - dieser Gremien macht, ist etwas ganz anderes, Funktion der politischen Willensbildung. Auch wenn diese - bleiben wir bei diesem unglücklichen Ausdruck „Wissenschaftsgerichtshöfe" ohne rechtssetzende Kompetenzen sind, muß man davon ausgehen, daß diese dennoch einen großen sozialpsychologischen Effekt, somit eine bedeutende soziale Funktion entwickeln würden. Aber eine Bedingung ist daran geknüpft: Es muß dies alles i m Rahmen eines Verfahrens geschehen, das nach generell festgelegten und nachprüfbaren Regeln, die durch Gesetz eingerichtet werden, abläuft. Die bisherige Praxis, in aller Regel also Einberufungen solcher Gremien nach Ermessen - die prompt sich dem Vorwurf ausgesetzt sahen, „interessengeleitet" (Habermas) zu sein - , mag durchaus verwaltungstechnisch effizient gewesen sein, aus sozialpsychologischer Perspektive war sie es nicht oder doch nur sehr bedingt. In solchen institutionalisierten Sachverständigen-Kommissionen wird auch der Unterschied gegenüber Enquête-Kommissionen deutlich und wirksam; diese beraten das Parlament aus globaler Sicht, so können durchaus auch Gesichtspunkte vorgebracht werden, die emotionale Wurzeln haben und häufig wissenschaftlich-rational nicht konsistent sind. Ängste vor als dräuend empfundenen Kühltürmen oder Assoziationen zu Hiroshima sind zweifellos Politika. Nur in der wissenschaftlichen Politikberatung haben sie nichts zu suchen; sie darf nur Argumenten zugänglich sein, die sich rational nach den Regeln wissenschaftlicher Methodik erörtern lassen, freilich i m Zuge eines Verfahrens, das zu einem Ergebnis in der Zeit zwingt. Verfahren versteht sich in diesem Zusammenhang nicht nach den Regeln des Gerichtsverfahrens, der Begriff des „Wissenschaftsgerichtshofes" sollte jetzt nicht mehr irreführen. Es würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen, Erörterungen über die Ausgestaltung anzustellen. Eher könnten sich die Verfahrensregeln anlehnen an jene für die Gesetzgebung, die ja auch entlastet werden soll. Man könnte also an die Modelle der „Royal Commission" und des „Forscherparlaments" denken; gewisse Anklänge sind unverkennbar. Diese beraten das Parlament, das hier vorgeschlagene Sachverständigengremium die Exekutive als Verordnungsgeberin. Beachtung verdienen die Modelle I und I I von Dierkes, deren Aufgabe es sein sollte, Parlament und Regierung zu entlasten. Eine „Grundbedingung", die Luhmann 30 Das kommt wohl von der wörtlichen Übersetzung des „Science Court", die - so gesehen - diesem im Wege stand und steht. 31 Siehe Wenz (o. Fußn. 2), S. 11 ff., insbesondere tabularische Übersicht, S. 35; beachtenswert zu diesem Thema auch Böhset-Franz, Technologiefolgenabschätzung, 1982.
Das Mißverständnis mit den „Wissenschaftsgerichtshöfen"
263
beim Gesetzgebungsverfahren beschreibt, wäre augenfällig: das „Zusammentreffen von hoher Komplexität mit hohem Spezifizierungsbedarf 432 . Das institutionalisierte, verfahrensgemäß arbeitende beratende Sachverständigengremium ließe sich, mit gleicher Begründung, erst recht dann für die Legislative erwägen, wenn diese die spezifischen Entscheidungen selber treffen wollte, statt diese an den Verordnungsgeber zu delegieren.
VI. Bürgerbeteiligung und Laiengerichtsbarkeit Ein interessantes Moment führt Klaus Michael Meyer-Abich in die Diskussion ein, indem er eine stärkere und durch Verfahren institutionalisierte „Bürgerbeteiligung' 4 fordert 3 3 . Ohne nun hier i m einzelnen auf die - gewiß diskussionswürdigen - Ausführungen des Naturphilosophen Meyer-Abich eingehen zu wollen, sind unschwer Zusammenhänge mit der rechtspolitischen Forderung nach Ausweitung und Verbesserung des Verfahrens mit sozialpsychologischer Motivation erkennbar.
1. Bürgerbeteiligung Meyer-Abich geht es bei der Bürgerbeteiligung i m Kern, wenn man abstrahiert auf Ausgangslage und Zielsetzung, um die Mobilisierung der gesellschaftlichen Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit den Risiken und Vorteilen der Großtechnologie - notwendigerweise freilich mit ungewissem Ausgang - , die Annahme („Sozialakzeptanz") selbstverständlich nicht ausgeschlossen. Das bedeutet - expressive und darstellbare / dargestellte Hinwendung zum Erkenntnisfeld der gesellschaftlichen Bewußtseinslage 34 , sowie - Ausschöpfung des Potentials, das i m Verfahren steckt.
32 S.o. Fußn. 16, S. 174 ff. (192). 33 Grundrechtsschutz heute - Die rechtspolitische Tragweite der Konfliktträchtigkeit technischer Entwicklung für Staat und Wissenschaft (ZRP 1984, 43); er beruft sich dabei auf eine Studie von Ueberhorst, Planungsstudie zur Gestaltung von Prüf- und Bürgerbeteiligungsprozessen, 1983, Anm. 6. Siehe dazu auch Dienel, Die Planungszelle, 1978. Zu früheren Aktivitäten zur Bürgerbeteiligung siehe auch Wenz (o. Fußn. 2), S. 100. 34 Hier tappt man freilich schon im dunkeln, weil man sich notgedrungen Begriffen bedienen muß, die noch nicht ausreichend präzis definiert sind. Erst recht existieren keine empirischen Materialien, wenn man nicht gerade Verhaftungen oder blutige Köpfe von Polizeibeamten und Demonstranten als statistische Größe akzeptieren will. Es wäre eine genuine Aufgabe der empirischen Rechtssoziologie, sich diesem Erkenntnisfeld zuzuwenden. Gewiß ist bekannt, wie schwierig es ist, psychische Phaenomena darzustellen und zu erfassen. Das ist das Problem der Meinungsforschung, die eigentlich Handlungsbereitschaften kennenlernen möchte, Meinungen erfragt, aber nur Antworten bekommt (Luhmann, Rechtssoziologie, 1972, S. 5). Wenn die empirische Sozialforschung dem Problem des Rechtsbewußtseins sich
264
Edgar Michael Wenz
Konkret zielt Meyer-Abich auf die Erweiterung des Verfahrens i m Vorfeld der administrativen Entscheidung. Die Gründe für dieses sein Postulat decken sich i m Kern mit genau jenen Gründen, die uns veranlaßt haben, das Verfahren in der Verwaltungsgerichtsbarkeit - durch eine Technologiefachkammer - und, gegebenenfalls ersatzweise, bei der Verwaltungsbehörde - durch ein konstituiertes Sachverständigengremium - anders zu organisieren und durch Gesetz einzuführen. Der Umweg ist nur kurz, um die Parallelen zwischen Bürgerbeteiligung und Technologiefachkammer / Sachverständigengremium ausmachen zu können. Man fühlt sich zurückversetzt i n die Zeit, als sich eine Bürgerbeteiligung regte, die schließlich in der Laiengerichtsbarkeit ihren konstitutiven Niederschlag fand. Damals, vor fünf oder sechs Generationen, ging es, was auch heutzutage die Gemüter bewegt, um ein Auflehnen gegen das Mysteriöse, damals gegen Kabinettsjustiz, heute gegen die verschlungen scheinenden Wege i m Justizbetrieb; damals gegen die Feudalherren, jetzt gegen die Repräsentanten der staatsbürokratischen Herrschaft; mit geänderten Adressaten, aber i m Sinngehalt vergleichbar mit den historischen Bestrebungen der Emanzipation. Wie auch immer: Das Mißtrauen ist wieder da; es geschehen Dinge, die man nicht versteht; es werden Verwaltungsakte erlassen und Urteile gefällt, für die die Legitimation der Behörden und der Gerichte bezweifelt wird, sei es wegen mangelnden Sachverstandes oder sei es wegen irgendwelcher undefinierbarer (allerdings auch nie bewiesener) „Abhängigkeiten". Ein Wiederbeleben der Bürger-Emanzipation also? Aber nun nicht mehr gerichtet gegen den „Moloch Staat", dafür aber gegen den noch dräuender empfundenen „Moloch Wissenschaft und Technik"? Dies meint, diese Ängste befürchtet auch Meyer-Abich, wenn er vom „parteiischen Staat" und von der „parteiischen Wissenschaft" spricht 3 5 . Die Verwirklichung der Bürgerbeteiligung, wenn sie nun gefordert wird, wird - bei unserem Verfassungsverständnis einer repräsentativen Demokratie - gelingen, wenn der Gedanke des Laienrichtertums konsequent verfolgt wird: Der Laienrichter als „beteiligter" Repräsentant des Volkes, und sei er auch nur „Verstärker" der Einrichtung der gewaltenteiligen Demokratie.
2. Die soziale Legitimation
des Laienrichters
Hier werden die Wurzeln und die soziale Legitimation der Laiengerichtsbarkeit deutlich sichtbar. Freilich lassen sich Linien zwischen Laienrichtern, insbesondere deren Urform des Schöffen i m Strafprozeß, zu den technischen und naturwissenschaftlichen Experten der Technologiefachkammer und des Sachverständigen-
mit dem gleichen Eifer gewidmet hätte wie Fragen zur Käuferpsychologie, stünde man der Problematik der Akzeptanzkrisen, die mit Rechtsbewußtsein zu tun haben, nicht mehr so fremd gegenüber. 35 S. o. Fußn. 33, S. 42 und 44.
Das Mißverständnis mit den „Wissenschaftsgerichtshöfen"
265
gremiums nicht so leicht erkennen. Wenn man den Begriff „Laienrichter" - gewiß einsehbar in Verbindung mit Rechtsentscheidungen - richtig definiert als „rechtsunkundiger Richter", so könnte ein rein semantischer Einwand nicht ziehen. Es bleibt dagegen zu fragen, ob jene Funktionen, die die Laiengerichtsbarkeit seinerzeit getragen haben, auch jetzt noch oder wieder tragen: Die emanzipatorische, die partizipatorische und schließlich die integrative 3 6 Funktion; oder ob diese Wirkungen schon längst der Rechtsgeschichte angehören. Der emanzipatorische Impetus des Bürgertums schien erloschen; mit der Verwirklichung von Demokratie und Rechtsstaat hatte er seine Bedeutung verloren. Man muß aber diese einhellige Meinung der jüngeren Zeit neu überprüfen, eben vor dem Hintergrund der geforderten Bürgerbeteiligung, die deutlich emanzipatorische Z ü g e 3 7 trägt. Wo Laienrichter Fach- und Sachverstand in das Gericht mitund einbringen, ist die Partizipation selbst dann unverkennbar, wenn man diesem fachkundigen (Laien-)Richter „nur" Hilfe bei der (normativen) Tatbestands- und (faktischen) Sachverhaltsermittlung zutraut. Das freilich wäre zunächst einmal in Fachkammern sehr viel, eigentlich gerade das, um was es vielen bei diesen Großverfahren überhaupt zu gehen scheint. Dem probaten Beispiel des Handelsrichters ließe sich das wohl noch bessere des Expertenrichters beigesellen. Die integrative Funktion erwartet man nur von jenen Laienrichtern, die nicht nur Kenner der Materie sind, sondern auch Wahrer von Gruppeninteressen - Beispiel: Beisitzer in der Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit - , die gleiche Interessen haben und in gleicher Weise „betroffen" sind; und die die hinter ihnen stehenden Gruppen „integrieren", den Spruch hinzunehmen. Bei Expertenrichtern scheint man auf diese Funktion verzichten zu müssen, weil diese nur einer verschwindend kleinen Gruppe angehören. Bei den zu entscheidenden Fragen von epochaler - nach mancher Meinung endzeitlicher - Bedeutung, ist die Betroffenheit überhaupt nicht teilbar; hier findet ohnehin ein Rollentausch insofern statt, als die Juristen nunmehr die Laien sind. Man tut sich also nicht schwer, die wichtigsten, die „klassischen" Funktionen der Laiengerichtsbarkeit i m Expertengericht wiederzufinden. So darf man also auch die positiven - ohnehin „nur" sozialpsychologisch motivierten - Funktionen und Wirkungen der Laienbeteiligung an der Rechtssprechung erwarten. Die Selbstsicherheit des Vorsitzenden Richters bei der Urteilsverkündung i m Prozeß des „Bauern M a a s " 3 8 , das Gericht habe bewiesen, mit schwierigen technischen und naturwissenschaftlichen Fragen auch auf der Grundlage des jetzigen 36
So Görlitz, in: Handlexikon zur Rechtswissenschaft, 1972, S. 265 ff. Wenn Zimmermann (o. Fußn. 20), Bemühungen und „Partizipation" mit erkennbarem Engagement ablehnt (S. 544 f.), dann meint er damit eine „zusätzliche Öffentlichkeitsbeteiligung", die recht diffus begründet und juristisch kaum zu definieren ist, die in Richtung der „Bürgerbeteiligung" von Meyer-Abich zu suchen ist - keinesfalls aber ein Verfahren auf der Grundlage der existenten Gerichtsverfassung. 3 8 VG Düsseldorf, Urt. v. 12. 4. 1984-3 Κ 3201/75, die Äußerungen der Vorsitzenden nach einem Bericht der F.A.Z. vom 14. 4. 1984. 37
266
Edgar Michael Wenz
Prozeßrechts fertig zu werden, verdient Respekt. Mehr noch: Es ist j a auch so, noch immer sind die Gerichte mit Prozessen fertig geworden. Und das letztinstanzliche Urteil wird auch vollstreckt werden, wie es immer war. Aber das ist eben nicht das Problem.
VII. Fazit Die Zustimmung zu der geforderten Technologiefachkammer/Fachsenat und/ oder Sachverständigengremium steht und fällt mit dem Verständnis von Verfahren. Man braucht keineswegs der Auffassung der legitimierenden Funktion des Verfahrens beizutreten, weder durch Verfahren (Niklas Luhmann) noch i m Verfahren (Arthur Kaufmann); erst recht nicht der utopischen Hoffnung einer „Versöhnung durch Verfahren", ebenso wenig wie der Befürchtung der „Revolution durch Verfahren" (Helmut Schelsky). Aber man muß sehen, daß die Rechtsordnung Rechtsentscheidungen garantieren muß, nicht aber auch gleichzeitig Richtigkeit und Wahrheit dieser Entscheidungen garantieren kann 3 9 . Der freiheitliche Staat verbürgt auch nur gleiche Spielregeln, nicht aber ein gerechtes Ergebnis (F. A. von Hayek). Diese Gedankengänge weisen dem Verfahren in unserer Rechtsordnung eine überragende Bedeutung zu. Wir sehen die Wirkungen des Verfahrens - somit auch der Technologiefachkammer und eines Sachverständigengremiums bei der Verwaltungsbehörde - in seiner vertrauensbildenden Kraft. Es geht um Vertrauen in das Verfahren, um Vertrauen durch das Verfahren. Niemand erwartet, durch keines der erwogenen Verfahren, eine Patentlösung für die Technologieakzeptanz. Aber es wäre eine Chance, die man immerhin probieren sollte. Der Einwand, der Anteil der Bevölkerung, der sich für technische Regeln interessiere, mit und ohne Verordnung, sei doch sehr gering, so daß ein noch so überlegtes Verfahren nichts bewirken könne, ist gewiß an der Situationsbeschreibung richtig: der Folgerung kann man jedoch nicht beitreten. Einen geringen „Informationsstand des Publikums und damit die Durchbildung der Erwartungen" erwartet auch Luhmann, aber ein „pauschales, angstloses Akzeptieren hoher Komplexität und Veränderlichkeit der Verhältnisse, das wir für den politischen Bereich Legitimität nennen, kann durch ein generalisiertes Systemvertrauen erleichtert werden". Verfahren können „zugleich S y stem vertrauen mitbilden". Auch wenn man über diese Vertrauensbildung empirisch ebenso wenig weiß wie über das Rechtsbewußtsein, das die Sozialforschung bisher weniger interessiert hat als Nylonstrümpfe, so wird man Zustimmung finden, daß viel, sehr viel geleistet ist, wenn die - objektiven, weil aufnahmebereiten - Mitbürger erreicht werden, die einer sinnvermittelten Teilnahme fähig sind, sicherlich auch meinungsbildende Kräfte freisetzen
39
So sinngemäß Luhmann (o. Fußn. 16), S. 21; auch die folgenden Zitate, S. 191 ff.
Das Mißverständnis mit den „Wissenschaftsgerichtshöfen"
267
können 4 0 . Bemühungen mit den Mitteln des Rechts, die sich nicht gleich positivistisch und dogmatisch abstützen lassen, laufen nur zu leicht Gefahr, als „Sozialhygiene" abgetan zu werden. Aber damit spricht man tatsächlich die Zielsetzung richtig an, man wertet sie sogar auf. Oder hat Hygiene jemals geschadet? Ist nicht auch und gerade der Rechtssprechung eine säubernde und heilende Funktion zuzuordnen? 41 Niemand hofft oder hat gar behauptet, daß durch dieses oder anderes Verfahren oder überhaupt auf einem einspurigen Weg sich schlankweg die Sozialakzeptanzkrise gegen Großtechnologie, Gift, Gen und Kernkraft lösen ließe. Dies gewiß nicht; aber es gibt doch eine Hoffnung der kleinen Schritte, vielleicht auch nur klitzekleiner Schrittchen. Die Dringlichkeit weist zur Tat. Das rechtspolitische Wagnis ist gewiß nicht so groß wie die gesellschaftliche Chance.
40
Möglicherweise ist die Pflege der „Gesinnung" auf diesem Wege zu erreichen, den zu begehen Albers (o. Fußn. 4), S. 1049, im Anschluß an C. F. von Weizsäcker für „weitsichtig" hält, also offensichtlich Übereinstimmung auch mit dem hier verfolgten sozialpsychologischen Aspekt. 41 Der Vorwurf einer „Mogelpackung" etwa deswegen, weil mit diesem Verfahren die Erwartung der „denkbar richtigsten" Entscheidung verknüpft ist, wird nicht treffen können. Die menschenmöglich größte Richtigkeit und Wahrheit wird selbstverständlich angestrebt. Die Hinnahme von Entscheidungen zu erleichtern, ist keine Täuschung.
5. Politisches
Abgeordneten-Diäten* Der Skandal ist die Kostenpauschale
Politiker verlieren mehr und mehr an Ansehen. Bei der nächsten Demoskopie zum Prestige der Berufe werden sie sich wohl i m unteren Drittel wiederfinden. Abgeordnete, zumeist Lokalmatadore mit der heilenden Gunst des Nah-Bildes, sind dabei meist noch relativ glimpflich weggekommen. Der Unmut kommt nun aber auch über sie. Ausgelöst haben ihn die hessischen Parlamentarier, die bei der Diätenerhöhung i m vergangenen Jahr gar zu kräftig zugelangt haben. Sie ließen die Beute freilich auf Warnruf gleich wieder fallen. Die Höhe der Diäten selbst scheint, jedenfalls mir, durchaus angemessen zu sein (Die Fakten: Bund D M 9 013, Bayern D M 7 858, Hessen D M 6 825 monatlich.) Man muß die Diäten als Quasi-Gehalt mit Alimentations-Charakter sehen. Der Abgeordnete erhält aus der Staatskasse zur Sicherung seiner Unabhängigkeit und für den Unterhalt seiner Familie eine dem Mandat angemessene Entschädigung. Die Grunddiäten werden auch ordnungsgemäß versteuert. Freilich geschah dies erst nach dem Diätenurteil von 1975. Dem Diätenurteil seinerzeit durch eigene Gesetzesinitiativen zuvorkommen - das hätte beispielsweise in der Ansehensskala Punkte gebracht.
Die Kostenpauschale Der eigentliche Skandal wird meist übersehen: Die steuerfreie Kostenpauschale. Aufwendungen in Berufs- und Amtsausübung sind freilich steuerfrei; systemkonform sollten sie es jedenfalls sein. Das Ärgernis ist die steuerrechtliche Andersbehandlung durch völligen Verzicht auf den Nachweis der Entstehung und des Zwekkes dieser Aufwendungen. Man hat Schwierigkeiten, sich die pauschalierten Aufwendungen in ihrer Höhe (die Fakten: Bund D M 5 155, Bayern D M 4 283, Hessen D M 3 500 bis D M 4 500 monatlich) überhaupt vorzustellen. Gleichwohl hat sich bisher niemand der Mühe unterzogen, diese Aufwendungen repräsentativ zu ermitteln. Als Begründung ist zu hören, daß das Sammeln von Belegen und von nachprüfbaren Abrechnungen den Abgeordneten - gänzlich anders als bei anderen Steuerbürgern, die mit Vorschriften von eben diesen Parlamentariern überreich versorgt sind - nicht zuzumuten („unproduktiv") sei, auch der besonderen Würde dieser Volksvertreter wegen. * Erstveröffentlichung in: Mainfränkische Wirtschaft 10/1988; sinngleich in: Der Steuerzahler, 5/1989, S. 91.
272
Edgar Michael Wenz
Doch die Begründung überzeugt nicht. Zumal es auch darum geht, ob die Kostenpauschalen angemessen oder zu hoch sind. Denn sie dürfen nur für den wirklich entstandenen, sachlich angemessenen und begründeten besonderen mit dem Mandat verbundenen Aufwand gewährt werden. Eine überhöhte Kostenpauschale verschafft dem Abgeordneten ein steuerfreies Zusatzeinkommen, was verfassungswidrig ist.
Vorbildfunktion Der Gleichheitsgrundsatz und die eigentlich als selbstverständlich anzusehende Vorbildfunktion eines Abgeordneten kann deshalb nur folgende Regelung dulden: die Kostenpauschale - das wäre am einfachsten - in die Diäten einzuarbeiten: sie wird dann automatisch die obere - durchaus auch noch ausweitbare - Grenze der gestatteten Amtsausstattung, deren tatsächliche Inanspruchnahme aber nach den Grundsätzen des Steuerrechts dann auch zu belegen wäre.
Einzelnachweise Ein Abgeordneter muß heute beispielsweise noch nicht einmal einen Einzelnachweis über den Betrieb eines Büros in seinem Wahlkreis führen. Da ist es freilich noch ein weiter Weg zur Vorstellung von einem Parlamentarier, der einmal nicht nur Gast beim Feuerwehrfest seines Wahlkreises ist, sondern diesen wackeren Männern selbst ein Fäßchen Bier spendiert, einen Beleg dafür verlangt und zeitgerecht abrechnet, weil es das Gesetz, sein Gesetz nämlich, so verlangt. Wenn man das nun nicht will, dann muß eben eine Änderung der Steuerrichtlinien her, die jeden Steuerpflichtigen entlastet; oder doch wenigstens eine fundierte und nachvollziehbare Ermittlung der Pauschalen, auf die dann auch andere Steuerpflichtige Bezug nehmen könnten. Man braucht die ganze Geschichte noch nicht einmal vor dem Hintergrund zu sehen, daß ab 1990 zwanzig Prozent der von Geschäftsleuten ordnungsgemäß nachgewiesenen Bewirtungsspesen als von diesen persönlich und sinnlos verpraßt steuerlich behandelt werden - auch wenn die Gäste ein Bus voller Fachschüler waren oder Afrikaner zur Ausbildung.
Sonderregelung Die Sonderregelung für Parlamentarier ist seit langem schon Gegenstand ärgerlicher Kommentare in der Literatur (zu § 12.2 AbgG; §§ 3.12, 22.4 EStG). Viele sehen darin einen Beweis für die schon immer befürchtete Selbstbedienungsmenta-
Abgeordneten-Diäten
273
lität der Volksvertreter. Über die Ablehnung in Wissenschaft und Praxis sieht man in den parlamentarischen Präsidien und Gremien großzügig hinweg. Aufgrund selbstgeschaffener Gesetze wähnt man sich sicher vor der Rechtssprechung. Selbst dem Bundesverfassungsgericht scheint mangels zugelassener Anrufung der Zugriff auf diese eklatante Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes derzeit verwehrt zu sein. Denn wo kein Kläger ist, sind auch keine Richter. Es ist schon lange Zeit, dieses Kuckucksei aus dem Nest der parlamentarischen Demokratie hinauszuwerfen. Aber vermutlich kommt nun Bewegung in die Sache: vor kurzem hat eine Repräsentativerhebung ergeben, daß dem weitaus größten Teil der Befragten die Diätenregelung gar nicht gefallen mag. Nichts aber vermag die Politiker so zu beflügeln, wie Meinungsumfragen - besonders vor den Wahlen.
18 Gedächtnisschrift Wenz
Ein „Wirtschaftswunder" kann nicht versprochen, es muß erarbeitet werden* Als Helmut Kohl vor drei Jahren die Vereinigung begrüßte, fügte er sinngemäß hinzu, das alles würde uns nichts kosten. Diesen Kanzler-Satz haben viele, insbesondere Menschen meiner Generation, die die Entbehrungen und Anstrengungen der Wiederaufbauzeit in Westdeutschland erlebt haben, als peinlich empfunden, als überflüssig und nicht zu erfüllen. Er hat auch an Kohls historischer Bedeutung genagt, seine Arbeit erschwert und noch immer nicht ganz abzusehende psychologische Wirkungen verursacht. Vor drei Jahren überdachte ich die Möglichkeiten, mit denen man die osteuropäischen Staatshandelsländer zur Marktwirtschaft führen kann 1 . Ich wählte einen globalen Ansatz aus dem Blickwinkel meiner persönlichen Lebenserfahrung als davongekommener Frontsoldat, wissenschaftlicher Assistent und Jungunternehmer, als einer der miterlebt hat, wie Ludwig Erhard die Marktwirtschaft nicht nur einforderte, sondern durchsetzte. Mein Interesse war dabei vor allem auf Phänomene „jenseits von Mark und Pfennig" gerichtet.
Historische Größe verlangt Augenmaß Wer sich am wirtschaftlichen Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg orientiert, wird als unverzichtbare Voraussetzung für ein günstiges wirtschaftliches Klima bestimmte Überzeugungen der Menschen ansehen. Hierzu gehören: - Arbeiten und Sparen lohnt wieder (der Begriff „Leistungsgesellschaft" war 1948 noch nicht geläufig, aber diese Leistungsgesellschaft war Realität); - Eigeninitiative, Eigenverantwortlichkeit und Risikobereitschaft sind Tugenden; zudem sind sie gesellschaftlich nützlich; - Unternehmerische Aktivitäten dienen allen; die verfassungsgemäße Garantie von Privateigentum sowie persönlicher und wirtschaftlicher Entfaltung sind keine Privilegien, sondern vom Gemeinwohl her gerechtfertigt. * Erstveröffentlichung in: Orientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik, 55 (1/1993), S. 20 ff. 1 Edgar Michael Wenz, Der Übergang zur Marktwirtschaft: Soziologische und sozialpsychologische Dimensionen, in: Orientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik, Heft 42, 4/1989, S. 8-12. Der Autor verfaßte den Beitrag noch vor den Ereignissen im November 1989.
»Wirtschaftswunder"
275
Wer sich an diesen Sachverhalten orientiert, mußte 1990 mit Besorgnis feststellen: - Viele Menschen, die Initiative ergreifen können, waren schon aus der D D R in den Westen abgewandert, oder sie waren gar nicht existent; es gab insbesondere einen Mangel an verantwortungsbewußten und unternehmerischen Personen. - Viele Menschen, insbesondere Politiker, hegen ein durch keinen Fehlschlag zu erschütterndes Vertrauen in „Programme" und Kredite. Man konnte damals seine Hoffnung nur gründen auf: - das schnelle Erwachen der Kleinwirtschaft, insbesondere des Handwerks und der mittelständischen Betriebe, die außerhalb gewerkschaftlichen Interesses und auch unterhalb staatlicher Einflußnahme sich eher entfalten konnten und von denen Vorbildwirkung ausgehen konnte; - die Erfahrung, daß in der Frühzeit einer wirtschaftlichen Entwicklungsphase die Gewerkschaften noch nicht so durchorganisiert sind wie in späteren Phasen und sich eher kooperativ verhalten. Nicht richtig eingeschätzt hatte ich die administrativen Schwierigkeiten. Ganz übersehen konnte man sie freilich nicht. Aber ich nahm den Gedanken, die D D R als „Nachfolgerin Preußens" in bezug auf die Eigenschaften des früheren preußischen Beamtentums zu wichtig. Dabei hatte ich das verwaltungstechnische Handeln i m Blick, folglich nur den funktionalen Prozeß. Unterschätzt hatte ich auch das Unverständnis für die neue, von Demokratie und Marktwirtschaft gar nicht abtrennbare Rechtsordnung und die daraus fließenden Eigentumsprobleme. Das marktwirtschaftliche Verständnis ist ein Lernprozeß, von dem man manchmal den Eindruck hat, daß er in der Ex-DDR länger dauern könnte als i m von Mao verlassenen China (Sollten 40 Jahre SED tatsächlich prägender gewesen sein als der Maoismus?).
Ein Aufbauwerk in den Händen von Dilettanten Drei Jahre sind vor dem Hintergrund so epochaler gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Umwälzungen eine zu kurze Zeit, um auch nur eine tragfähige Z w i schenbilanz ziehen zu können. Dazu kommt noch, daß verläßliche Materialien über die wirkliche Entwicklung in den neuen Bundesländern fehlen. Hingegen werden wir überschwemmt von politischen Absichtserklärungen und Berichten, von Meinungen, Spekulationen und Tendenzmeldungen. Heute weiß man jedenfalls, daß die wirtschaftliche Leistungskraft der ehemaligen D D R weitgehend überschätzt worden war. Wirtschaft und Umwelt befanden sich in einem desolaten Zustand. Heute läßt sich kaum mehr verstehen, daß der D D R einst Platzziffer elf in der Rangliste der Industrienationen zugewiesen wurde. 18=
276
Edgar Michael Wenz
Aber selbst Wirtschaftsfachleute, die Geschäftsbeziehungen mit dem Osten unterhielten, ließen sich täuschen von vor Ort angetroffenen Unzulänglichkeiten, die als vorübergehend oder als Ausnahmezustand ausgegeben und geglaubt wurden. Man wird sich auch daran erinnern, wie sich in den Monaten nach dem Fall der Mauer ein großer und intellektuell durchaus ernstzunehmender Teil unserer Landsleute in Mittel- und Ostdeutschland gegen den „Ausverkauf der D D R " gewehrt hat, als eigentlich eine eifrige Suche nach Investoren aus aller Welt angesagt gewesen wäre. Das zeigt das völlige Unverständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge vor dem Hintergrund der Marktwirtschaft. Unter solchen Umständen war eine sachliche Beurteilung der eigenen Wirtschaftskraft nicht zu erwarten. Der Einschätzung von 1989 entsprechend reagierten Handwerksbetriebe und Mittelständler als erste auf die neuen Verhältnisse. Sie entfalteten eine verhältnismäßig rege Investitionstätigkeit. Die Handwerksbetriebe, die sich erfolgreich gegen die Eingliederung in die „Produktionsgenossenschaft Handwerk" (PGH) zur Wehr gesetzt hatten oder die sich sehr schnell nach der Wende wieder aus den PHGs lösen konnten, waren lange Zeit überhaupt die leistungsfähigsten Produzenten in den neuen Bundesländern. Allerdings wurden die großen Investitionen vom Handel und durch westliche Gesellschaften getätigt. Kleine Produzenten gerieten langsam unter den Druck von Großbetrieben. Auch das ist eine Entwicklung, die nach 1948 i m Westen ebenfalls beobachtet werden konnte.
Finanzvolumen von 100 Marshall-Plänen ohne Wirkung Die Hoffnungen auf kooperatives Verhalten der Gewerkschaften haben sich schon nach kurzer Zeit als völlig verfehlt herausgestellt. I m Gegenteil: Was 1992 in der Tarifpolitik geschah, ist unverständlich und wird als eines der schlimmsten Beispiele für verfehlte Gewerkschaftspolitik in die Wirtschaftsgeschichte eingehen. Prompt sind auch schon bald die Forderungen nach „Programmen" und vor allem Krediten aufgetaucht. Sie wurden immer von Politikern ausgelöst, meist waren sie Westimporte. Die Forderungen sind ausgeufert. Meldungen, daß die zur Verfügung gestellten Mittel gar nicht so schnell verarbeitet werden können, wie sie verlangt und auch geleistet worden sind, scheinen zu stimmen, viele Fakten sprechen dafür. In diesem Zusammenhang wird immer wieder der Marshall-Plan genannt, der nach der Meinung vieler Ostdeutschen den Aufstieg i m Westen nahezu allein bewirkt hat. Ohne die Wirkung des Marshall-Plans geringachten zu wollen, sind von einem vergleichbaren Einsatz heute keine weitreichenden Impulse zu erwarten. Die Bundesrepublik hat von 1948 bis 1952 lediglich 6,6 Milliarden D M als Kredite
»Wirtschaftswunder"
277
erhalten, die ordnungsgemäß und pünktlich zurückgezahlt wurden 2 . Nach heutiger Kaufkraft sind das etwa 13,5 Milliarden D M in vier Jahren, auf die westdeutsche Bevölkerung gibt das einen pro-Kopf-Wert von 70 D M jährlich. Das entspräche für die fünf neuen Bundesländer pro Jahr einer Summe von ungefähr einer Milliarde D M - ein Betrag, für den es Kurt Biedenkopf vermutlich ablehnte, überhaupt in die Arena der Forderungen hinabzusteigen, da diese Summe noch nicht einmal ein hundertstel des Transfers 1992 von etwa 140 Milliarden D M ausmacht, ungefähr 8000 D M pro Person.
Das Wichtigste sind klare Perspektiven Es ist wichtig auszuloten, welche psychologischen Einflüsse auf die Entwicklung der letzten drei Jahre wirkten. Die Analyse dessen, was in den Köpfen der Menschen vorgeht, ist zwar schwierig. Dennoch läßt sich einigermaßen sicher erkennen, daß der spontane Aufbruch 1948 in Westdeutschland noch nicht einmal den Hauch einer Parallele in der jüngsten Geschichte Ostdeutschlands gefunden hat. Häufig werden verdrehtes Denken, ein über Jahrzehnte gewohntes Warten auf Weisungen, angeführt. Das stimmt wohl für einen Großteil der Bevölkerung. Auch der Mangel an Unternehmern und initiativen Führungskräften kann als bewiesen gelten. Aber man sollte diesen Gründen einen scheinbar materiellen, in Wahrheit aber psychologischen hinzufügen: 1989/90 gab es in der Ex-DDR sicherlich manchen lästigen Mangel, aber keine existenzielle Not wie 1948. Alle aufkommenden Fragen und Probleme finden vielleicht Antworten und Lösungen, wenn man sie hinter die eine stellt: Wie wäre es weitergegangen, wenn in der denkwürdigen Stunde der deutschen Einheit die Parole ausgegeben worden wäre: „ W i r stehen alle vor einer schweren Zeit. Laßt und die Gürtel enger schnallen. Wir müssen durch. Es wird lange Zeit dauern. Aber wir werden es schaffen!" . . . ? Als ein i m Osten erfahrener Unternehmer, der auch in Mitteldeutschland schnell aktiv geworden ist, konnte ich persönliche Erfahrungen sammeln. Relativ nahe an Südthüringen, das mir noch aus meiner Jugendzeit recht gut bekannt ist, wollte ich in einer Branche investieren, die Grundbedürfnisse deckt (Bäckereitechnik). Durch meine Erlebnisse von 1948 sowie meine Erfahrungen i m Ost-Geschäft hatte ich einen gewissen Vorsprung. Ich nahm mit den handwerklichen Kollegen der Bäckereitechnik Verbindung auf. Wir begründeten einige für alle Seiten erfolgreiche Kooperationen. Dabei handelt es sich fast ausschließlich um Backofenbaumeister, die es geschafft haben, zu DDR-Zeiten aufrecht ihre Selbständigkeit zu verteidigen. Die schnell einsetzende Nachfrage trieb mich zur Eile. Ich konnte innerhalb kurzer Zeit einen grenznahen Produktionsbetrieb finden, der für die Aufnahme 2
Ganz Europa hat von 1947 bis 1951 insgesamt nur zwölf Milliarden Dollar an ERP-Mitteln erhalten, die letztlich zum Erfolg beitrugen.
278
Edgar Michael Wenz
unserer Produktion gute Voraussetzungen mitbrachte. Die dortigen Facharbeiter waren tüchtig. Sie wurden innerhalb weniger Wochen eingearbeitet. Das Verhältnis zwischen unseren fränkischen Mitarbeitern und den thüringischen Kollegen war sogar außerordentlich gut. Nun passierte allerdings schon ein möglicherweise typisches Ereignis: Während die Facharbeiter bei uns schon nach kurzer Zeit unser Arbeitstempo annahmen, verfielen sie nach der Rückkehr in den thüringischen Stammbetrieb gleich wieder in den alten Trott. Aber es gelang dann doch, eine leistungsfähige Produktion, wenn auch nicht ganz auf unserer Höhe, aufzuziehen. Unsere Entlastung für den aus dem Osten kommenden Boom war fühlbar. Ursprünglich hatte ich die Absicht, einen Produktionsbetrieb zu erwerben. Nach Verhandlungen mit den zuständigen Treuhandstellen habe ich diese Absichten dort und anderswo sehr schnell aufgegeben. Es war mir nach näherer Kenntnis der Umstände klar, daß ich vor der Wahl stand, entweder sehr viele Arbeitsplätze zu vernichten oder aber - durch Neubau auf der grünen Wiese - neue Arbeitsplätze zu schaffen. Diese Wahl konnte nicht schwerfallen. Der Erwerb eines Industriegeländes machte nicht weniger Schwierigkeiten. Es schien nicht voranzugehen. Aber die Stadt Meiningen hat dann doch - wie man heute weiß - i m Vergleich mit anderen Städten relativ schnell und unbürokratisch ausreichend Gelände zur Verfügung gestellt. Rasch konnte dann mit der Produktion begonnen werden, wobei die Belegschaft aus dem bisher von uns beauftragten Betrieb stammte. Alles waren Fachkräfte, die leistungsbereit und in der Lage sind, einen Facharbeiterstamm auszubilden. Wir alle - Arbeitnehmer und Arbeitgeber - sind guten Mutes und voller Zuversicht, daß wir das haben, was unsere Landsleute in den neuen Bundesländern noch nicht alle zu sehen vermögen: Zukunft.
Die Diätenhöhe ist unbedenklich - Kostenpauschalen sind Rechtsbruch im Verfassungsrang* Plötzlich kommt eine Sache in Bewegung, die über Jahre hinweg - immer wieder einmal angestoßen - vor sich hin dümpelte: Parteienfinanzierung und Abgeordnetendiäten 1 . Die Bezüge der Abgeordneten, die Diäten, bestehen aus Vergütungen und Versorgungsansprüchen. Diäten sind somit normales Arbeitsentgelt, das nach allgemein gültigen Regeln zu versteuern ist. Das Bundesverfassungsgericht hat das 1975 in einem Urteil bestätigt. Leider hat der Deutsche Bundestag versäumt, diesem Urteil durch eine ansehensfördernde eigene Gesetzesinitiative zuvorzukommen. Der Unmut der Bevölkerung richtet sich gegenwärtig gegen die Höhe und bei manchen Länderparlamenten - gegen zu leicht und zu schnell erworbene Versorgungsansprüche.
Diäten: Viel zu hoch oder viel zu niedrig? Es scheint oft übersehen zu werden, daß die Frage, welches Entgelt für Abgeordnete angemessen ist, ausschließlich politischer, keineswegs aber rechtlicher Natur ist. Freilich laufen Abgeordnete besonders Gefahr, den hierzulande gepflegten Neidkomplex zu reizen: Sie beziehen ihr Gehalt aus der Staatskasse, in die alle Bürger aufgrund der Beschlüsse von Abgeordneten zwangsweise Steuern einzuzahlen haben, und die Arbeit der Abgeordneten - die Arbeit des Gesetzgebens wird von der breiten Bevölkerungsmehrheit keinesfalls sonderlich hoch geschätzt. Die Frage, welche Höhe das Entgelt für Abgeordnete haben sollte, kann nur subjektiv beantwortet werden. Für manchen, den man gern i m Parlament sehen würde, dürften die Bezüge nicht einmal diskutabel sein; anderen mögen sie als verlockend erscheinen. Es kommt wohl nicht von ungefähr, daß viele Beamte, Lehrer, Pfarrer und Funktionäre in die Parlamente drängen. Sicher: die intellektuelle Belastung der Abgeordneten mag nicht immer und durchwegs hoch sein, aber ihre physische Belastung ist doch stets enorm. Nur Bier* Erstveröffentlichung in: Orientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik, 53 (3/1992), S. 53 ff. 1 Vgl. Hans Herbert von Arnim, Macht macht erfinderisch, 1988, und Hans Herbert von Arnim, Die Partei, der Abgeordnete und das Geld, 1991.
280
Edgar Michael Wenz
tischstrategen können glauben, daß die vielen Einladungen, die Abgeordnete annehmen, und die vielen Verpflichtungen, die sie erfüllen müssen, reiner Genuß wären. Gerade für Unternehmer sind dies Horror-Aussichten, mit denen viele ihre Abstinenz von der aktiven Politik begründen. Bei dieser Sachlage ist von Kommissionen zur „objektiven" Festsetzung der Diäten nichts Gutes zu erwarten - auch und gerade, wenn diese Kommissionen einen Querschnitt der Bevölkerung repräsentieren: - Erstens dürfen Parlamente von Entscheidungen grundsätzlich nicht entlastet werden. Es wäre system- und verfassungswidrig, wenn die zur Entscheidung berufenen Volksvertreter ihre Souveränität auf Dritte übertragen. Die Kommissionen könnten mithin nur beraten, aber ihr Beratungsergebnis müßte i m Endeffekt unweigerlich auch dezisive Wirkung haben. - Zweitens besteht die Gefahr, daß das Diätenniveau zu stark abgesenkt werden könnte. Die Folge wäre, daß wir ein Parlament der Durchschnittlichen und Mittelmäßigen bekämen. Gute und anstrengende Arbeit ist ihren Lohn wert; verantwortungsvolle Arbeit verdient darüber hinaus eine Leistungsprämie. So kann man in der Höhe der Diäten, zumindest i m Bundestag, nichts Anstößiges sehen. Es kann jedenfalls nichts schaden, wenn die Parlamente auch wirtschaftlich attraktiv sind. Die Legislative darf keinen Weltverbesserern ausgeliefert werden, die nirgendwo vermißt werden, folglich auch billig wären. Ein „Niedriglohn-Parlament" kann keine Lösung sein. Gebraucht werden leistungsbereite und leistungsfähige Männer und Frauen, die - durchaus i m Sinne der Staatslehre Piatons - auch in ihrem Beruf schon etwas geleistet haben und schadlos dorthin zurückkehren könnten, weil sie auch dort jederzeit gebraucht werden 2 .
Sammeln von Belegen: Eine unzumutbare Last? Entscheidend ist: Diäten müssen ganz normal versteuert werden. Da sie es werden, ist insofern kein juristischer Makel erkennbar. Darüber hinaus müssen sich auch Versorgungsansprüche nach allgemeinen Regeln errechnen lassen. Gegen diesen Grundsatz ist verstoßen worden (Hamburg), und es ist richtig, daß sich daran die Diskussion erneut entzündet hat. Bei der Diskussion über die Höhe der Abgeordneten-Diäten und der Versorgungsansprüche wird der eigentliche Skandal meist übersehen: die steuerfreie Kostenpauschale. Aufwendungen in Berufs- und Amtsausübung sind steuerfrei; 2 Prüfenswert wäre eine Grundversorgung, die auf dem bisherigen Einkommen des Parlamentariers, nach unten und oben begrenzt, aufbaut. Der Gleichheitsgrundsatz würde dadurch nicht verletzt. Freilich ist es nicht allein eine finanzielle Frage, erfolgreiche Unternehmer für Parlamente zu gewinnen. In aller Regel ist deren Präsenz im eigenen Unternehmen unverzichtbar.
Die Diätenhöhe ist unbedenklich
281
das ist systemkonform. Ein Ärgernis ist jedoch die steuerrechtliche Andersbehandlung von Abgeordneten durch völligen Verzicht auf den Nachweis der Entstehung und des Zwecks solcher Aufwendungen, während es für die Betriebsausgaben und Werbungskosten „normaler" Steuerpflichtiger penible, ja in seltener Genauigkeit ausgearbeitete Vorschriften gibt. Man hat zudem Schwierigkeiten, sich die pauschalierten Aufwendungen ihrer Höhe nach überhaupt vorzustellen, nachdem denkbare Aufwendungen - Beamten, Freiberuflern und Wirtschaftenden, die zur Reisetätigkeit gezwungen sind, wohl bekannt - meistens entweder gar nicht erst entstehen oder direkt durch Sachleistungen ersetzt werden. Doch abgesehen davon: Wenn Einzelnachweise nicht erbracht werden können, dann müssen eben die gültigen Pauschalierungen, beispielsweise für Übernachtung und Verpflegung, angewendet werden. Wenn es aber wirklich - wie es vorgetragen wird - nicht zumutbar ist, sie zu erbringen, dann haben sie aus dem deutschen Steuerrecht zu verschwinden. Wenn Pauschalierungen produktiver sind, dann sind sie es immer, und zwar in der Höhe und i m Rechenmodus - sowohl für den Abgeordneten wie auch für den normalen Bürger. Der Gleichheitsgrundsatz und die als selbstverständlich anzusehende Vorbildfunktion eines Abgeordneten läßt die folgende, einfach zu organisierende Regelung empfehlen: Die Kostenpauschale wird in die Diäten eingearbeitet, sie wird dann automatisch die obere - durchaus auch noch ausweitbare - Grenze der gestatteten Amtsausstattung, deren tatsächliche Inanspruchnahme aber nach den Grundsätzen des Steuerrechts dann auch zu belegen wäre.
Steuergesetze, die nur für manche gelten? Ein Abgeordneter muß heute noch nicht einmal einen Einzelnachweis über den Betrieb eines Büros in seinem Wahlkreis führen. Da ist es freilich noch ein weiter Weg zur Vorstellung von einem Parlamentarier, der einmal nicht nur Gast beim Feuerwehrfest seines Wahlkreises ist, sondern den wackeren Männern selbst ein Fäßchen Bier spendiert, einen Beleg dafür verlangt und zeitgerecht abrechnet, weil es das Gesetz - sein Gesetz nämlich - so verlangt. Wenn man das nun nicht will, dann muß eine Änderung der Steuerrichtlinien erfolgen, die jeden Steuerpflichtigen entlastet, oder es muß eine fundierte und nachvollziehbare Ermittlung der Pauschalen gefunden werden, auf die dann auch andere Steuerpflichtige Bezug nehmen könnten. Die Sonderregelung für Abgeordnete ist seit langem schon Gegenstand ärgerlicher Kommentare in der Literatur (zu § 12 Abs. 2 AbgG; § § 3 Abs. 12 und 22 Abs. 4 EStG). Viele sehen darin einen Beweis für die lange schon befürchtete Selbstbedienungsmentalität der Volksvertreter. Über die Ablehnung in Wissenschaft und Praxis sieht man in den parlamentarischen Präsidien und Gremien großzügig hinweg. Aufgrund selbstgeschaffener Gesetze wähnt man sich sicher vor der
282
Edgar Michael Wenz
Rechtsprechung. Selbst dem Bundesverfassungsgericht ist mangels zugelassener Anrufung der Zugriff auf diese eklatante Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes derzeit verwehrt. Die Zivilrechtsprechung hat allerdings schon zugegriffen: Bei Unterhaltsansprüchen wird der nicht nachweisbare Verbrauch für mandatsbedingte Aufwendungen dem Einkommen zugeschlagen. Die Einheit der Rechtsordnung ist damit gebrochen: Das Steuerrecht beurteilt den gleichen konkreten Sachverhalt anders als das Zivilrecht 3 . Es wird argumentiert, daß die Ungleichbehandlung gleicher Sachverhalte eben doch zulässig sei. Der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages 4 sieht das Willkürverbot durch die Gleichbehandlung bzw. Ungleichbehandlung bestimmter Sachverhalte ganz und gar nicht verletzt, weil die gesamte Gruppe der Abgeordneten gleichbehandelt wird. Die Abgrenzung der Gruppe gegenüber dem „Rest der Steuerpflichtigen" beruht demnach auf sachlich nachvollziehbaren Überlegungen, die allerdings darzustellen man nicht für sinnvoll gehalten hat. Gemeint ist wohl die „Unproduktivität" des Belegsammelns und - zwar nicht ausdrücklich gesagt, aber in anderen Zusammenhängen schon gehört - die Unzumutbarkeit angesichts „der besonderen Würde des Abgeordneten". Bei der Kostenpauschalierung, wie sie bisher gehandhabt wurde, wurden also eindeutig positive Normen des Verfassungsrechts der Gleichbehandlung verletzt, und zwar zum eigenen Gunsten. Hier gibt es keinen politischen Spielraum mehr. Das ist keine Stilfrage, sondern ein Rechts verstoß.
Die Volksvertreter: Mit schlechtem Beispiel voran? Man muß diesen Sachverhalt vor dem Hintergrund des Alltags - losgelöst von der steuerrechtlichen und verfassungsrechtlichen Thematik - eines Wirtschaftenden sehen, der i m Wettbewerb steht und sich i m Markt behaupten muß. Alle paar Jahre sieht er sich Betriebsprüfungen ausgesetzt, bei denen sich recht häufig jüngere Beamte mit der Ordnung in der Zettelwirtschaft verlustieren und einzelne Belege behandeln wie Geßlers Hut, der bei Strafe zu grüßen sei. Es wird über Aufwendungen verhandelt, die ganz offenkundig entstanden sind oder sein müssen. Die Prüfer, die manchmal selbst die Peinlichkeit empfinden, berufen sich auf „die Gesetze", also auf die Gesetze jener, die sich selbst davon befreit haben. Als schlechtes Beispiel passen hierher auch die kraft Gesetzes geforderten 20 Prozent Abzug von ordnungsgemäß nachgewiesenen Bewirtungsspesen. Der Gesetzgeber unterstellt bei betrieblichen Ausgaben dieser Art durchwegs eine 3 Siehe dazu Hans Herbert von Arnim, Die Partei . . . , a. a. O., S. 183. In diesem Buch, S. 177 ff., finden sich viele Argumente und Beispiele, die die bisher mangelnde Reaktion der Parlamente - vorsichtig ausgedrückt - unverständlich erscheinen lassen. 4 Vgl. Schreiben des Wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestages, Fachbereich IV, an mich vom 8. April 1988.
Die Diätenhöhe ist unbedenklich
283
private Beteiligung des Bewirtenden - auch wenn die Gäste ein Bus voller Berufsschüler oder eine Gruppe Auszubildender aus einem Entwicklungsland waren. Vor etwa vier Jahren habe ich das zusehends und zunehmend schwindende Ansehen der Abgeordneten prognostiziert 5 : Sie würden sich bald i m unteren Drittel der Ansehensskala wiederfinden. Dabei kämen Lokalpolitiker, mit der heilenden Gunst des Nah-Bildes, noch relativ glimpflich weg. Der Unmut würde aber auch über sie kommen, und er würde durch das kräftige Zulangen bei selbstgeschaffenen Privilegien ausgelöst. Das ist eingetroffen. Daß man die Beute wie i m Fall Lafontaine auf Warnruf wieder fallen ließ, vermag nichts zu kitten. Es wird nun so langsam Zeit, auch das Kuckucksei unbegründeter Pauschalierungen aus dem Nest der parlamentarischen Demokratie hinauszuwerfen: Nicht philosophische und staatsrechtliche Überlegungen vermögen Politiker so zu beflügeln wie Meinungsumfragen und bevorstehende Wahlen. Dem Meinungstrend wird man beflissen nachhecheln, hoffentlich aber darüber nicht nachzudenken vergessen, ob nicht Vorbild, politische Wegweisung und durch keine Verlockung zu erschütternder Respekt vor der Allgemeinheit des Gesetzes und der Gleichheit vor dem Gesetz sinnvoller wären. Jeder Staatsbürger ist auf die Qualität seines Gesetzgebers angewiesen. Und doch ist man geneigt zu sagen, daß es die Wirtschaftenden in noch größerem Maße sind, weil sie sich in einem freien Markt nur i m gesetzten Rahmen bewegen können. Mißglücken die Spielregeln und die Vorgabe des Rahmens, ist der Schaden für den Wohlstand der gesamten Bevölkerung unverhältnismäßig groß. Zur Qualität der gesetzgebenden Körperschaft aber gehört an vorderster Stelle das Vertrauen, das sie genießt. Es gibt kein funktionierendes Rechtsleben ohne das Vertrauen in den Rechtsetzer. Darum ist die derzeitige Diskussion so überaus wichtig: Es geht um weitaus mehr als nur um Geld.
5
Abgedruckt unter anderem in: Der Steuerzahler, Heft 5 / 1989, S. 91.
Taumelt Europa in den Justizstaat?* Die Verschiedenartigkeit der Lebensverhältnisse und der stete gesellschaftliche Wandel erfordern heute - weit mehr als früher - eine stabilisierende, gleichwohl „elastische" Rechtsordnung. Kein moderner Rechtsstaat kommt ohne Generalklauseln und unbestimmte - also noch auszulegende, zu konkretisierende - Rechtsbegriffe aus. Die „legislatorische und judikatorische Option" (Theodor Geiger) ist unverzichtbares Instrument, Recht und Gesetz anpassungsfähig und anwendbar zu halten. Der Richter schöpft Recht aus dem Gesetz. Dieser Vorgang ist Zeichen hoher Rechtskultur. In ihm liegen Chance und Risiko für die Funktion des Rechtssystems. Das Auslegungsprivileg des Richters beruht und rechtfertigt sich aus dem ihm auferlegten Entscheidungszwang. Für den Richter muß es dabei gleichgültig bleiben, ob der Gesetzgeber mit Generalklauseln und unbestimmten Rechtsbegriffen gearbeitet hat, um sich zurückzuhalten und der Entwicklung Platz zu schaffen, oder ob die Legislative nur zu feige oder zu bequem war, Entscheidungen zu treffen. Welche Probleme daraus entstehen können und daß auf diese Weise eine Rechtsunsicherheit eintreten kann, die auch an sich feste Rechtsüberzeugungen zu unterhöhlen droht, zeigt sich in Deutschland besonders deutlich in der Sozialgesetzgebung. Man braucht sich nur an das Arbeitsrecht und insbesondere das Kündigungsschutzrecht zu erinnern, um zu sehen, in welche gefährliche Richtung Richterrecht führt, das sich schließlich auch noch in der höchstrichterlichen Rechtsprechung manifestiert 1 .
Unbestimmtheit als Verhängnis Die Maastrichter Verträge werden als Kompromiß verstanden. Voller Stolz sagt man, in ihnen dokumentiere sich „europäische Politikfähigkeit". Diese europäischen Verträge enthalten aber nicht nur Generalklauseln und unbestimmte Rechtsbegriffe, vielmehr haben sie stellenweise überhaupt nur deklamatorische Inhalte. M i t den Maastrichter Verträgen wurde keine „Flucht in die Generalklauseln" * Erstveröffentlichung in: Orientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik, 58 (4/1993), S. 28 ff. 1 Zu diesem Thema hat sich Bernd Rüthers mehrfach geäußert, unter anderem vor der Ludwig-Erhard-Stiftung am 18. Mai 1990 unter dem Thema: Die verkannte Einheit: Staatsverfassung, Wirtschaftsverfassung, Arbeitsverfassung.
Taumelt Europa in den Justizstaat? vorgenommen (Hedemann totalen Kapitulation aus.
285
1910); das Vertrags werk sieht viel eher nach einer
Die Methode der richterlichen Rechtsfindung ist in Kulturkreisen, in denen gleiche oder zumindest ähnliche Moral- und Rechtsüberzeugungen herrschen, unverzichtbar. Wenn aber i m großen Europa - in dem in manchen Regionen noch immer die Blutrache respektiert wird - auf dem Umweg über Gerichte und Richter regiert werden muß, müssen sich Konfliktstoffe aufhäufen. Das wird auch dann geschehen, wenn die Kompetenz der Jurisdiktion weitgehend den einzelnen Mitgliedstaaten vorbehalten bleibt (oder genauer: bleiben soll). Die Praxis wird nämlich bald zeigen, daß viele, sehr viele und zu viele Verfahren nach europäischem Recht was immer das werden wird - entschieden werden müssen, denn letztlich läßt sich jede Rechtsfrage auch aus der europäischen Konstitution ableiten. Flugs könnte sie dann in Luxemburg landen, und dazu muß man noch nicht einmal die spezifischen Normen des Rechts der Europäischen Union in den Blick nehmen, die allesamt von Auslegungsbedarf nur so strotzen. Augenfällig wird die Last, die wachsweiche Gesetze selbst solchen Richtern aufbürden, die sich in „vornehmer Zurückhaltung" üben wollen, wenn man sich die beiden Leitgedanken ansieht, die die Verträge von Maastricht ausweisen: das Postulat der „Subsidiarität" und die Forderung nach einem „immer enger werdenden Zusammenschluß". Von beiden Prinzipien weiß man zwar nicht genau, was sie in der konkreten Anwendung bedeuten. Aber beide Gesetzesaufträge stehen sich konträr gegenüber und schließen einander eigentlich aus. Schon die ersten Reaktionen auf das sogenannte Maastricht-Urteil des Bundesverfassungsgerichts zeigen, was auf uns zukommt. So wird die Entscheidung teilweise begrüßt 2 - aber ohne Richterspruch wird man weder beim Schutz der Währung noch mit dem Subsidiaritätsprinzip weiterkommen - , teilweise bedauert, und ein Richter am Europäischen Gerichtshof reklamiert für Luxemburg die Kompetenz zur Rechts Vereinheitlichung 3.
Europa: Spaltung durch künstliche Vereinheitlichung Zwar ist den meisten klar, daß Auseinandersetzungen unumgänglich sein werden, aber sie scheinen die Brisanz und ihre gefährlichen Folgen zu unterschätzen. Sie sprechen entweder von politischem Konfliktstoff, der normal und folglich 2 Hans D. Barbier, Gegen den Zentralismus, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Ausgabe vom 13. Oktober 1993. 3 Manfred Zuleeg, Das Bundesverfassungsgericht erschwert mit seinem Urteil die Weiterentwicklung der Gemeinschaft, in: Handelsblatt, Ausgabe vom 21. Oktober 1993.
286
Edgar Michael Wenz
gesund sei. Oder sie charakterisieren die Erschütterung der Rechtsbasis, die hier stattfindet, euphemistisch als „Rechtsfortbildung" - wobei schlicht übersehen wird, daß dieser Begriff sehr eng ausgelegt werden muß, erst recht bei einem neu entstehenden politischen Gebilde. Einige meinen gar, daß sich die kontroversen Meinungen in ihrer politischen Substanz nicht aufheben lassen, so daß eine richterliche, schlußendlich eine höchstrichterliche Entscheidung unumgänglich sei. Man könnte geneigt sein, diese gedanklichen Ansätze in das Reich der Rechtstheorie zu verweisen. Wissenschaftssystematisch wäre das durchaus richtig. Aber anscheinend theoretische Probleme i m Recht können schnell praktisch werden. Ohne ein funktionierendes Rechtssystem kann nichts gedeihen: nirgends und niemals. Und schon gar nicht kann ohne ein solches Rechtssystem ein auf Rechtssicherheit aufbauendes Vertrauen in das neu entstehende Europa heranwachsen. Taumelt Europa in den Justizstaat? Dieser Justizstaat wäre die tragische Überspitzung (manche meinen sogar: die Entartung) des Rechtsstaats. Der Gesetzgeber, entscheidungsschwach oder auch nur zu feige, zeigt nicht etwa eine gebotene Zurückhaltung bei Autorisation und Delegation. Er schiebt einfach die Verantwortung, ungeachtet des Grundprinzips der Gewaltenteilung, an die Jurisdiktion ab, die sich nicht entziehen kann. Wir müssen das sehen und fürchten. Die Auswüchse, die jeder Justizstaat zwangsläufig mit sich bringt, sind Legion. Nur ein Beispiel aus der Praxis: Wenn amerikanische und deutsche Unternehmer und Juristen sich mit Standortvorteilen und -nachteilen ihrer Staaten befassen, verweisen diese auf die amerikanische Rechtsprechung etwa i m Produkthaftungsrecht, bekommen aber von jenen prompt die deutsche Rechtsprechung in der Sozialgerichtsbarkeit, vor allen Dingen i m Kündigungsschutz, entgegengehalten, ein ständig sprudelnder Quell der Heiterkeit. Ob das aber so lustig ist? Die fehlende Spruchpraxis, die hilfreiche Rechtstatsachen hätte schaffen können, wird auf Jahre hinaus die Rechtsfindung erschweren und die Kontinuität gefährden, die Voraussetzung jeder Rechtsentwicklung ist. Nicht etwa, daß es in den einzelnen Rechtskreisen keine einschlägige Judikatur gäbe. Es gibt aber - und allein darauf kommt es an! - keine spezifisch-europäische. Die Richter sind auf „reine Hermeneutik" verwiesen: auf nichts anderes als auf eine verstehende Textauslegung und Sinndeutung, die mit allen Zufälligkeiten und Auffälligkeiten behaftet ist, die ungestützte Subjektivität mit sich bringt. Gerade an das europäische Recht und die europäische Rechtspflege müßten aber strengste Anforderungen gestellt werden. Zwar muß wohl nicht befürchtet werden, daß bei Urteilen, insbesondere solchen mit zwischenstaatlichen Auswirkungen, die nicht überall in Europa verstanden werden, der Verdacht von Nationalismen aufkommen oder daß sich schon bestehende Verdachtsmomente verstärken. Die Gefahr liegt aber darin, daß solche Urteile nationale Ärgernisse begründen und daß daraus schließlich Divergenzen erwachsen. Salbe oder Salz auf europäische Wunden?
Taumelt Europa in den Justizstaat?
287
Nur gewachsene Rechtsnormen sind verläßliches Recht Der Ausweg kann nur heißen: Nicht zusammenschnüren, was zusammenwachsen soll! Das wäre ein Plädoyer für einen modifizierten Staatenbund - der sich j a nun in Bonn als Staatsrechtsidee gegenüber dem bisher offenbar favorisierten Bundesstaat durchzusetzen scheint - mit freiem Personen- und Warenverkehr. Daneben muß alles geregelt werden, was grenzüberschreitend ist, so etwa i m Umweltschutz. Alle anderen Gesetze müssen aber unangetastet bleiben. Die unterschiedlichen Regelungen in den einzelnen Staaten müssen in Wettbewerb treten. Dann werden sich in angemessener Zeit der echte Regelungsbedarf und die wirksamsten Regeln herauskristallisieren. Nur so können gemeinsame Rechtsüberzeugungen wachsen, aus denen dann eine gemeinsame Rechtskultur entstehen kann - ein Prozeß, der wahrscheinlich schon über zwei oder drei Generationen zum Ziel führt. Die Aufgeschlossenheit der jungen Leute von heute gibt zu dieser Hoffnung Anlaß. Das überaus schlimme Beispiel des untergegangenen Jugoslawien zeigt hingegen im Extrem, welche Folgen ein nicht natürlicher gewachsener Einigungsprozeß haben kann. Trotz wesentlich engerer Rechtsüberzeugungen und vergleichbaren Kulturen - enger jedenfalls als sie zwischen einem Portugiesen und einem Skandinavier existieren - , haben sich dort blinder Haß und Zerstörungswut entwickelt. Ein abschreckendes Beispiel, aus dem gelernt werden muß. Rechtsüberzeugungen müssen wachsen, langsam und stetig, wenn sie gedeihen sollen. Ein solches Wachstum wird sofort jäh unterbrochen und ins Gegenteil verkehrt, wenn sich der Rechtsstaat selber beschädigt, weil er auf schwankendem Boden judizieren muß. Wenn die Zeit - aus welchen Gründen auch immer - für klare Normen noch nicht reif ist, die ein stabiles Fundament bilden können, dann muß man eben warten und sich dem Ziel vorsichtig und behutsam nähern, bis die Zeit gekommen ist. I m Moment hat Europa diese Stufe noch nicht erreicht.
Freiheit, Sicherheit und Eigenverantwortung* Sozialphilosophische und gesellschaftspolitische Gedanken eines selbständigen Unternehmers Wirtschaftende sind wir alle hier, jeder auf seinem Posten. Uns berührt die Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik, diese häufig genug irreführend zur Sozialpolitik i m engeren Wortsinne verkürzt. Es erscheint mir nun sinnvoll, losgelöst von der Tagespolitik, die Linien nachzuzeichnen, wie wir Wirtschaftende in die Gedankenwelt und in die Probleme geraten sind, die uns heute bewegen. Wie sind die konträren Positionen geistig entstanden, die unsere Gesellschaft, die ja bis vor kurzem eigentlich die ganze Welt in zwei Lager gespalten hat? Gelten diese unterschiedlichen Positionen noch immer? Ich befürchte: Ja. Sie existieren seit Jahrhunderten, sie spuken noch immer in den Köpfen. Und sie werden es vermutlich auch noch weiterhin tun. Zunächst ging und geht es um die Frage: Freiheit und Gleichheit? Damit freilich brauchen wir uns kaum zu befassen. Schon Urvater Karl Marx hat die Unversöhnbarkeit dieser beiden Forderungen erkannt. Sie zur Alternative Gleichheit oder Freiheit umzuformulieren, hat überall dort, wo man sich also politisch für die Gleichheit, was immer man darunter verstanden haben mag, entschieden hat, zu den größten Demütigungen der Menschen und zu tiefster Armut geführt. Die Erkenntnis, daß es keine Ergebnisgleichheit geben kann, brach dann einer sachlicheren Diskussion und auch moderneren Modellen Bahn. Aber man hat immer wieder versucht, ein Gleichheitsideal zu verwirklichen. Die Ansprüche haben sich dann reduziert zunächst auf die Gleichheit vor dem Gesetz. Dieses rechtsstaatliche M i n i mal-Postulat wurde in den parlamentarischen Demokratien schon sehr lange verwirklicht. Aber alle weitergehenden Versuche, so die Gleichheit beim Start, die schon mancher für noch am ehesten realisierbar hielt, sind schließlich, gemessen an ihrer Zielsetzung, gescheitert. Hier wäre zu nennen einmal der Versuch, über die Schulbildung gleiche oder wenigstens ähnliche Chancen zu schaffen. Das Ergebnis war und ist, die geistigen Eliten in ihrer Entwicklung zu hindern. Konsequenz: Wir haben heute keinen Patentexport mehr, sondern sind auf ausländische Patente angewiesen. Bei den Nobelpreisen spielen wir nur noch eine Rolle unter ferner liefen. Deutsch ist als wissenschaftliche Kommunikationssprache soviel wie ausgeschieden. Studentische Klausurarbeiten gleichen häufig genug philologischen * Erstveröffentlichung in: Unternehmerforum, hrsg. vom Unternehmerinstitut e.V., Bonn, 2. Auflage, 1995, S. 9 f f
Freiheit, Sicherheit und Eigenverantwortung
289
Schlachtfeldern. Ebenso wenig gangbar ist der Weg über die Zerschlagung des Erbes. Er bedeutet die Enteignung der Väter. Diese aber wüßten sich wohl dann während ihres Erwerbslebens auf diese Erwartung einzurichten, es gäbe dann nichts mehr zu vererben. I m wesentlichen hat sich eher die Erkenntnis herausgebildet, daß die Kraft der Stärkeren Hilfe und Stütze den Schwächeren bietet. Die Fragestellung Freiheit und Sicherheit? lädt eher zu einer sinnvollen und fruchtbringenden Auseinandersetzung ein. Das Bedürfnis nach Sicherheit ist i m Menschen angelegt. Welchen historischen Weg ist nun diese Forderung gegangen? Frühzeit und Mittelalter boten Sicherheit. Kirche und Feudalherren sorgten dafür. Die Zünfte waren eine geschlossene Gesellschaft, ohne jeden Wettbewerb. Orientierung und Sicherheit wurden allerdings bezahlt mit wirtschaftlichem und gesellschaftlichem Stillstand. Die beginnende Neuzeit brachte in Renaissance und Humanismus eine gewaltige geistige Bewegung, die ganz Europa erfaßte. Der Mensch wurde in den Mittelpunkt gerückt, er verlor so langsam seine Unmündigkeit, in gleicher Weise allerdings auch seine Sicherheit und seine Orientierung. Reformation und Reformationskriege prägten schließlich dieses Zeitalter. Technisch, wirtschaftlich und i m Wohlstand wurde kaum etwas gewonnen, ein Jahrhundert brachte weit weniger Fortschritt als heutzutage ein Jahrzehnt. Die aber immerhin gewonnene geistige Freiheit führte zur Aufklärung. Sie war der wichtigste Einschnitt i m Abendland, sie war der Einzug der Vernunft. M i t Immanuel Kant kam einer ihrer wichtigsten Vertreter aus Deutschland. Er lehrte die Willensfreiheit des Menschen, der aber damit auch in Verantwortung stand und Pflichten unterlag: Der „kategorische Imperativ". Der nun freie, mündige und verantwortliche Mensch fand sich dann auch wieder in einer ihm angemessenen wirtschaftlichen Tätigkeit. Das war nun die Zeit, da der Schotte Adam Smith mit seinem Buch über die „Wohlfahrt der Nationen" 1776 den Freihandel als die Quelle des Wohlstandes der Völker forderte, vor allem das individuelle Selbstinteresse als Basis wirtschaftlichen Lebens erkannte, damit i m Zusammenhang eine gesunde „Egoismusmoral". Erwerbs- und Wettbewerbsfreiheit seien die Pfeiler der Wohlstandsmehrung. Der Bäcker solle gutes Brot backen durchaus in der Absicht, damit sich und die Seinen zu ernähren, so der Schmied, so der Zimmermann. Das Beziehungsgeflecht einer freien Wirtschaft war damit konstruiert: Der freie Markt, der durch seine „invisible hand" zur Selbst-Ordnung findet. Selten ist ein Philosoph so wirkungsvoll gewesen wie Adam Smith, selten einer so sehr verleumdet worden wie er. Adam Smith war Moralphilosoph mit ungewöhnlich menschenfreundlichen Erkenntnissen, so die Sympathie als Maßstab der sittlichen Beurteilung und das Gewissen als „unparteiischer Zuschauer". Aber er hatte eben erkannt, daß die freie Wirtschaft Menschen und Nationen am weitesten voranbringt. Und er hatte recht. Die Aufgabe der Wirtschaft läßt sich aus solchen Erkenntnissen auch ablesen. Sie besteht nämlich aus nichts anderem, als die Gesellschaft mit Gütern und 19 Gedächtnisschrift Wenz
290
Edgar Michael Wenz
Dienstleistungen zu versorgen. Das ist für mich der „ökonomische Imperativ", nichts anderes sonst. Dieser schlichte Grundsatz wird freilich häufig genug vergessen. Keineswegs bedeutet diese Aufgabenstellung Verzicht auf gute Sitten, Fairneß, Nächstenliebe und Mildtätigkeit. Das sind vielmehr höchst wichtige moralische Forderungen an die Menschen, die zu leugnen Adam Smith der allerletzte gewesen wäre. Aber sie sind eben nicht Sache der Wirtschaft, sondern des Einzelnen. Folgerichtig trat eine explosionsartige Entwicklung der Wirtschaft ein. Die Macht der Zünfte war gebrochen. Arbeitsteilung, Mechanisierung und schließlich Industrialisierung brachten, wie jede stürmische Entwicklung, viele Probleme, so die Kinderarbeit, Lohndrückerei. Der üble Manchester-Liberalismus kam auf. Ein schreckliches deutsches Beispiel: der Weberaufstand als zwingende Folge der Mechanisierung. Aber das alles war, wenn man in geschichtlichen Dimensionen denkt, nur eine kurze Phase. Die gewonnene Freiheit der Wirtschaftenden führte, so verschieden eben die Menschen sind, zu verschiedenen Resultaten, zu bedeutendem Vermögen den einen und zu bitterer Armut den anderen, der kaum andere Sicherheiten kannte als jene der Mildtätigkeit. Dieses soziale Auseinanderklaffen löste notwendigerweise Gegenbewegungen aus. Das führte zur Entstehung der sozialen Ideen - gewissermaßen das Gegengewicht der Sicherheit gegen die Freiheit. Anstelle des von Adam Smith freigesetzten, freilich moralisch gebundenen gesunden Egoismus - in meinen Augen eine Auswirkung des stärksten Triebs des Menschen, des Selbsterhaltungstriebs wurde der Altruismus gesetzt. Dieses Denken an den Anderen ist zweifellos auch i m Menschen angelegt, der, so lehrte uns Aristoteles schon vor über zweieinvierteltausend Jahren, ein „gesellschaftliches Wesen" ist. Diese Bewegungen dürfen sich auf Thomas Moru stützen, der einen Idealstaat auf der „insula utopia" gezeichnet hat. Der Begriff Utopie als das Wünschbare gegenüber dem Machbaren stammt von daher. Und so ist es auch: Thomas Morus ging von einem Menschen aus, wie er sein sollte, wie er aber nun einmal nicht ist. Das war sein Problem, das ist auch das Problem aller folgenden sozialen Ideen. Sie kamen vor allem aus Frankreich und England. Rousseau war einer der führenden Theoretiker, der Graf von Saint-Simon ein überaus seriöser Verfechter, dem überdies alle Wirtschaftenden gesellschaftliche Anerkennung verdanken. Alle jene, die praktische Versuche mit ihren Ideen machten, so Bazar, Enfantin, Fourier und andere haben geradezu jämmerlich schon nach kürzester Zeit versagt. Von nichts kommt eben nichts. Und was allen gehört, gehört keinem. Diese ernüchternden Erfahrungen einer Idee, die schon theoretisch nicht durchgängig ist, bedeuteten freilich nicht das Ende der sozialen Ideen. Der Deutsche Karl Marx baute i m vergangenen Jahrhundert, sich stützend auf Louis Blanc und William Thompson, ein Gedankengebäude, dessen Fehlerhaftigkeit ihm hätte selbst auffallen müssen, wenn er es je versucht hätte, praktische und konkrete Ableitungen daraus zu ziehen. Das besorgten dann andere, vor allem Lenin und Stalin. Der Marxismus, in seinem Gefolge Leninismus und Stalinismus, erzwangen Ver-
Freiheit, Sicherheit und Eigen Verantwortung
291
breitung in der ganzen Welt. Noch nie in der Geschichte folgten so viele Menschen in so vielen Ländern eine so lange Zeit einer politischen Idee. Jedenfalls hatte noch keine soviel Gelegenheit, sich in der Praxis zu beweisen. Es war gewissermaßen der größte „Feldversuch" in der Menschheitsgeschichte. Er mußte kläglich scheitern, noch jämmerlicher als prophezeit. Armut und Berge von Leichen geben Zeugnis. Wir alle haben den Niedergang miterlebt. Schon vor dem Durchbruch dieser marxistisch-sozialistisch-kommunistischen Ideen gab es in Deutschland die ersten Zeichen der Einkehr sozialer Einsichten, etwa den sozialen Wohnungsbau von Mannesmann, Engels und anderen erfolgreichen Unternehmen, vor allem die erste Sozialversicherung in Deutschland, die der Erzkonservative Bismarck eingeführt hat. (Man darf in diesem Zusammenhang durchaus daran erinnern, das kann nicht als Lobpreisung des Frankreich-Feldzugs 1940 verstanden werden, daß die deutsche Besatzungsmacht den Franzosen die ersten Sozialgesetze brachte.) Während der Ausbreitung marxistischer Ideen nach dem ersten Weltkrieg setzten sich andere sozialistische Versionen durch, die nationalistische statt der russischen internationalistischen, allesamt totalitäre. Faschismus und Nationalsozialismus, auch hier interessiert nur (!) die Wirtschaftsform, hatten solange wirtschaftlichen und dann auch politischen Erfolg, als sie noch marktwirtschaftliche Regeln beachteten, die immerhin ein Maß von Freiheit beinhalten, schon um der Effizienz willen, die gigantische Rüstung in Gang zu setzen. Sie waren dann auch zum Untergang, mit säkularen Folgen, bestimmt. Nur einer der vielen Gründe: Die Wirtschaft hatte nicht mehr die Aufgabe, die Gesellschaft mit Gütern und Dienstleistungen zu versorgen. Gegen diese sozialistische Wirtschaft formte sich wiederum die Gegenbewegung des Liberalismus. Er kehrte wieder in einer geordneten Form, i m Ordo-Liberalismus. Bedeutende deutsche Nationalökonomen haben an seiner Ausbildung mitgewirkt (die Freiburger Schule, Müller-Armak, Röpke, Böhm usw.). Das geschah schon in aller Stille während des Nationalsozialismus. Die Wirtschaftsordnung des „Freiburger Kreises" beruhte auf den Pfeilern der Freiheit der Wirtschaft, auf Privateigentum und Erbrecht, auf Freizügigkeit für alle, also freie Arbeitsplatzwahl, aber auch ein freies Unternehmertum, mit den Folgen eines freien Wettbewerbs - alles beruhend auf einer Rechtsordnung, die i m Rechtsstaat ruht und dessen Kern die Grundrechte sind. Politische Gestalt gab dieser Idee einer gemäßigten wirtschaftlichen Freiheit schließlich Ludwig Erhard mit seiner „sozialen Marktwirtschaft". Das war der „dritte Weg", weder ein Umweg, noch ein Ausweg, schlicht und einfach der Weg auch nicht zur Versöhnung, sondern zur Vereinigung der Ideen von Freiheit und Sicherheit. M i t der sozialen Marktwirtschaft kam es zum größten wirtschaftlichen Aufschwung, den die Welt je gesehen hat, hier bei uns in Deutschland. In ein geschlagenes, zerschlagenes und ausgeblutetes Land hat sie binnen weniger Jahre bereits einen angemessenen Wohlstand zurückgebracht, als Siegermächte wie 19*
292
Edgar Michael Wenz
England noch Lebensmittelrationierung kannten, zwar unter einer demokratischen Regierung, die allerdings die Marktwirtschaft für schlechthin „unsozial" hielt. Schon wenige Jahrzehnte später war Deutschland in die ökonomische Weltspitze vorgedrungen. Der Grund ist einfach: Die soziale Marktwirtschaft hat alles berücksichtigt, was die Geschichte uns gelehrt hat: Vom Menschen auszugehen, wie er nun einmal ist, eine realistische anthropologische Grundlage zu schaffen. Und zu dieser gehört also nicht nur die wirtschaftliche Freiheit als tragender Pfeiler, sondern eben auch der soziale Gedanke der Sicherheit. Auch davon ist ein großer Teil von ihnen noch Zeitzeuge gewesen. Das gilt freilich nicht für die Jüngeren, für die alles das, was in diesem Lande geboten ist, längst zur Selbstverständlichkeit wurde, über das sich gar nicht mehr nachzudenken lohnt. Jedenfalls ich kann nicht verstehen, daß die jungen Reformstaaten des Ostens noch immer nach dem dritten Weg zu suchen scheinen. Ludwig Erhards soziale Marktwirtschaft ist dieser Weg, das ist j a nun wirklich bewiesen. Dennoch: Die Marktwirtschaft wird - wieder einmal mehr - angegriffen, und dies in einer Zeit, da sie ihre stolzesten Triumphe feiern konnte (während uns die Trümmer der verelendeten sozialistischen Wirtschaft zu erschlagen drohen). Man denke nur an die sog. „Tigerstaaten" in Südostasien, die die Industriestaaten, insbesondere die westlichen, bedrängen und deren Wohlstand in Gefahr bringen. Die politischen Reaktionen des Westens sind freilich seltsam. Statt sich auf die Regeln, die den Wohlstand gebracht haben, zu besinnen, fallen nicht wenige in das Jammern über die „Ellenbogengesellschaft" mit ein. Gewiß, die Marktwirtschaft versorgt diese Gesellschaft nicht nur mit Gütern und Dienstleistungen, sie tut es in höchster Qualität und zu billigsten Preisen. Das zwingt freilich zu einer harten Auswahl. Dabei fällt sicherlich auch der eine oder andere unverschuldet durch den Raster. Sich über Bemühungen, eine andere Wirtschaftsform einzuführen, zu wundern oder gar zu ärgern, ist müßig. Wer offenkundige Beweise nicht zu sehen vermag, erkennt auch keine Realitäten mehr. Früher nannte man das Schwachsinn. Also abhaken. Ernst ist die Frage nach der Ausgewogenheit der beiden Säulen der sozialen Marktwirtschaft, also der Freiheit und der Sicherheit. Die Frage lautet: Brauchen wir soviel Freiheit wie möglich bei so wenig Sicherheit wie nötig? Oder umgekehrt: Soviel Sicherheit wie möglich bei sowenig Freiheit wie nötig? Und bedeutet das nicht die riesengroße Gefahr des Hineinschlidderns in die Unfreiheit? Die Ausgewogenheit auszutarieren, ist freilich überaus schwierig. Jede Gesellschaft kennt nun einmal Ängstliche und Wagemutige, Sparer und Investoren, und es gibt Unternehmer, auf deren risikobereiten Aktivitäten Arbeitswillige angewiesen sind. Die Starken wollen mehr Freiheit, um den Wohlstand zu schaffen, von dem alle zehren. Die Schwachen, und sie dürften in der Mehrheit sein, werden die Sicherheit vorziehen, wobei sie allerdings, und genau das ist das eigentliche Problem, sehr gerne in den Genuß aller Vorteile einer besonders starken Wirtschaft
Freiheit, Sicherheit und Eigenerantwortung
293
(wie wir sie bei uns vor nicht allzu langer Zeit hierzulande hatten) kommen. Menschlich verständlich ist dies alles, nur sehr schwer machbar, noch dazu, wenn den Leistungsträgern noch ständig Steine in den Weg geworfen werden. Wenn man das Problem nun nüchtern angeht, sollte man sich die einzelnen kritischen Argumente so nahe wie möglich ansehen, um erkennen zu können, welche in diese oder in jene Richtung tragen und wieweit sie in der Praxis anwendbar sind, um eben doch ein nützliches Gleichgewicht für Freiheit und Sicherheit herzustellen und auf lange Sicht zu gewährleisten. Ein so komplexes und facettenreiches Thema in groben Zügen zu behandeln, ist schwierig und riskant. Aber ich hoffe doch, die Grundgedanken herausarbeiten zu können.
Die Wege zu Freiheit und Sicherheit Da ist zunächst häufig die Rede von Markt und Wettbewerb. Eine freie Wirtschaft ist ohne Markt undenkbar. Und Markt ist nichts anderes als die Zusammenkunft allen Wissens, Könnens und Schaffens aus aller Welt für alle Welt, ausgedrückt in Preisen. Er ist außerdem das größte „Entdeckungsverfahren" (von Hayek), auf dessen Erfolg die immer enger zusammengedrängte Menschheit angewiesen ist. Und Wettbewerb ist schließlich der Motor eines jeden Marktes. So stehen die Forderungen nach Markt und Wettbewerb als unverzichtbare Voraussetzungen, die ebenso unantastbar bleiben müssen wie Eigentum und Grundrechte. Wenn eingegriffen wird, dann darf das nur geschehen zur Pflege des Marktes und zum rechtsstaatlichen Schutz vor Mißbräuchen. Das ist der unverrückbare Kern. Ohne ihn wären alle anderen Überlegungen ohne jeden Sinn. Und außerdem: Wettbewerb, die angeblich so menschen verachtende Konkurrenz, findet j a nur unter den Anbietern statt. Dagegen sind die Nachfrager, die breiten Schichten der Bevölkerung, ausschließlich die Nutznießer. Wir sind zwar alle ebenso Anbieter wie Nachfrager, aber häufiger sind wir doch wohl insgesamt auf der Kundenseite der Theke zu finden. Markt und Wettbewerb sind also soziale Nutzenstifter ersten Ranges. Staats- und Planwirtschaft kennen nicht den Kunden als König. Ein stetes Reizwort ist Kapital, ein häufig falsch gebrauchter Begriff. Kapital ist etwas anderes als Geld, ist gewissermaßen Geld, das geronnen ist in Poduktionsmittel, in Grundstücke, Fabriken, Maschinen, freilich auch in Betriebskapital. Kapital selbst ist also unverzichtbar. Die Frage lautet nur: Privat- oder Staatskapital? Und auch diese Frage müßte längst entschieden sein. Der Staat hat noch immer als Eigentümer von unternehmerischem Kapital versagt. Das gilt auch und gerade dort, wo man Finanzmittel lenken will, beispielsweise in eine Industrieund Arbeitsmarktpolitik. Die vielen Dutzende von Maßnahmen sind meist kurzfristig, der Rest mittelfristig gescheitert. Der Staat hat hoheitliche Aufgaben. Die Wirtschaftsgeschichte lehrt, daß das Kapital in privaten Händen am besten aufge-
294
Edgar Michael Wenz
hoben war, weil persönliche Verantwortung noch immer der beste Ratgeber und Lehrmeister war. Unternehmer und Unternehmensleiter sehen sich auch häufig Kritik ausgesetzt, Privatunternehmer freilich seltener. Gemeinsam ist dem privaten Unternehmer und dem (angestellten) Unternehmensleiter (Manager) die Verpflichtung auf die freie Wirtschaftsordnung. Sonst trennt sie doch manches, was auch zu unterschiedlichen Resultaten geführt hat. Die Gründe sind offensichtlich: Der Privatunternehmer arbeitet meist unter Existenzrisiko, der Manager dagegen lediglich mit Karriererisiko. Es ist ein Glück für die deutsche Wirtschaft, daß das eigentliche Schwergewicht in seiner Gesamtheit bei Klein- und mittelständigen Unternehmen liegt, auch wenn diese freilich aus naheliegenden Gründen sich politisch nicht so zu artikulieren vermögen wie die Großwirtschaft. Die Ergebnisse sind bekannt. In der letzten Rezession hat auch die Klein- und mittelständige Wirtschaft die weitaus meisten neuen Arbeitsplätze geschaffen, die kreativste ist sie ohnehin schon immer gewesen. Das jugoslawische Beispiel vor etwa 20 Jahren, als „gewählte" Kollektive Unternehmer ersetzen sollten, beweist, wie unverzichtbar der verantwortliche, am besten eigenverantwortliche Unternehmer ist, und weiter, wie wenig effektiv überhaupt Kollektive sind, die ohne eigene Verantwortung und jedwede Haftung nur hineinreden wollen. I m Falle eines Konkurses wird man sie in der vordersten Reihe der privilegierten Ansprüche aus der Konkursmasse wiederfinden. Auch aus der untergegangenen D D R wissen wir in der Rückschau, daß es sehr gut ausgebildete Ingenieure und Organisationsleute gab, sehr fähige Facharbeiter ohnehin, die mehr als die westdeutschen auch die Kunst des Improvisierens beherrschten. Der wichtigste Unterschied zur westlichen Wirtschaft waren die Kernstücke der Marktwirtschaft, personifiziert i m eigenverantwortlichen Unternehmer. Eine weitere Streitfrage: Umverteilen oder Verteilen? Umverteilen würde bedeuten, daß man an die Substanz des Unternehmens, also an das Kapital i m Kern und seinen nötigen Zuwachs, herangehen müßte. Eine führende Gewerkschafterin mußte vor kurzem so verstanden werden, daß die Unternehmen ja genügend Kapital hätten, um höhere Löhne zu bezahlen. Das würde also bedeuten, daß die Firmen ihr Gelände, ihre Fabriken und ihre Maschinen veräußern müßten, um auch nichterarbeitete Löhne bezahlen zu können. Dieser Unsinn richtet sich selbst. Verteilen dagegen dessen, was neu erarbeitet wurde, ist sinnvoll und aus allen denkbaren Gründen, moralischen wie wirtschaftlichen, geboten. Was ist nun wichtiger für die Ankurbelung einer Wirtschaft, das Angebot oder die Nachfrage? Dazu diese Beispiele: Hat jemals jemand nach Hulahupp-Reifen und Computern nachgefragt, bevor diese angeboten waren? Dann aber hat die Computertechnik in aller Welt Millionen von neuen Arbeitsplätzen geschaffen. Das vermag der Konsum, den es angeblich zu stärken gilt, nie zu leisten. Die Wirtschaft wird über Neuinvestitionen angekurbelt. Stärkere Konsumnachfrage würde ohnehin nur zu weiteren Rationalisierungen führen (müssen). Freilich muß die
Freiheit, Sicherheit und Eigen Verantwortung
295
Wirtschaft durch ausreichende Kaufkraft in Gang gehalten werden. Aber das ist der zweite Schritt. Bei allen diesen Fragen geht es schließlich darum, was eigentlich richtige und gute Politik ist. Die Antwort ist sehr einfach: Gute Politik ist das reine Gegenteil von gutgemeinter Politik. Und damit sind wir beim Kernproblem der Tagespolitik. Alles, was nach populären und schon beim ersten Anblick als richtige Maßnahmen erscheint, was nahezu plausibel aussieht, das sollte man nicht nur zehnmal umdrehen und sich von allen Seiten angucken. Man muß versuchen, das Problem bis zum Ende durchzudenken. Wir alle haben es ja mit „Meinungsbildnern" zu tun, die vor allen Dingen als Politiker und Funktionäre uns gegenübertreten. Hier taucht eine Unterscheidung auf, die der berühmte Sozialphilosoph und Soziologe Max Weber gegen Ende des ersten Weltkriegs schon differenziert hat: Die Gesinnungsund die Verantwortungsethiker, die Leute also, die eine gute Gesinnung, vorzugsweise vor dem Wählervolk, demonstrieren und das Wünschbare fordern, und die anderen, die Verantwortung tragen und sich um das Machbare nach besten Kräften bemühen. Überall dort, wo Verantwortung herrscht, sind wir alle besser aufgehoben. Es soll nicht gesagt sein, daß ein häufig geäußerter Verdacht nun immer zutreffen muß, es genügt schon, wenn er in vielen Fällen berechtigt ist. Und das ist er nach meiner Meinung: Politiker und Funktionäre sind darauf angewiesen, gewählt zu werden, also als kampfstarke Träger der Interessen sich darzustellen und anzubieten. Viele stehen unter dem Zwang, daß sie bei mißlungener Wahl oder Abwahl dahin zurückfallen, wo sie hergekommen sind. Und viele, zu viele meine ich, sind am Arbeitsplatz gar nicht vermißt worden. Das ist das Risiko der parlamentarischen Demokratie. Das müssen wir sehen, das müssen wir ertragen, damit umzugehen lernen. Winston Churchill hat einmal sinngemäß gesagt, die parlamentarische Demokratie sei die mieseste Staatsform. Nur - er kenne keine bessere. Und ich möchte ergänzen: keine weniger schlechte. Freilich kann man nicht die aktuellen sozialen Probleme der Gegenwart übersehen, die allerdings eher Dauerbrenner sind, wie Arbeitslosigkeit, über Krankheits- und Altersvorsorge bis zum Wohnungsmangel. Nicht weil sie zur Tagespolitik gehören, w i l l ich sie nur kurz behandeln, vielmehr deswegen, weil sie alle nach einem gewissen Muster zu beschreiben sind. Sie haben ihre Wurzeln in der Geschichte bis ins frühe Mittelalter. Das mag auch mit der Grund sein, warum man sie nach Gründung der Bundesrepublik nicht aus staatlicher Obhut entlassen hat. Das ist überdies vergleichbar mit den problembehafteten Wirtschaftszweigen wie Landwirtschaft, Bergbau, Montanindustrie und überhaupt Großwirtschaft, die man, trotz Ludwig Erhard, nicht den Marktkräften anheimfallen lassen wollte. Und die Folge: Wir haben nunmehr nicht geringere, sondern viel größere Probleme uns herangezogen. (Und wenn die Etablierung des entarteten Wohlfahrtsstaates nicht verhindert werden kann - und vieles sieht danach aus, ungeachtet abschreckender Beispiele - , werden die Probleme derart eskalieren, daß eine Zer-
296
Edgar Michael Wenz
berstung der Wirtschaft zu befürchten ist, und dies mit der unabweisbaren Folge, daß die wirklich Bedürftigen zu kurz kommen und daß das noch eines der kleineren Übel ist.) Gemeinsam ist aber der gesamten Problematik, daß sie auch einen gemeinsamen Ansatzpunkt für die Lösungen hat. Und das ist, bei jeder Abwägung immer und stets Ausschau zu halten, ob alle Möglichkeiten der persönlichen Verantwortung geprüft und ausgeschöpft sind. Nur diese Leitidee kann uns herausführen. Eigenverantwortung ist die höchste Vollendung der Freiheit, sie ist Ausfluß der persönlichen Moral. Der Bürger muß sich in der eigenen Verantwortung sehen, sich selber in der Pflicht, zunächst einmal für sich selbst und die Seinen zu sorgen; nicht zu denken oder zu hoffen, oder noch schlimmer: einfach zu fordern, daß andere das für einen selbst tun. Alle Lösungsvorschläge, die an die Eigenverantwortlichkeit des Bürgers anknüpfen, sind richtig. Und jede Politik, die das nicht sieht und beachtet, ist eben falsch. A u f Forderungen nach Eigenverantwortlichkeit und sich selbst in die Pflicht zu nehmen, fällt häufig die Frage nach der Solidarität. Aber das kann keineswegs heißen, daß sich der eine hinter dem anderen verstecken darf. Das Leben aller auf Kosten aller - das ist noch nicht erfunden, das wird es auch nicht. M i t der dann eingeworfenen Subsidiarität, die aus der Christenlehre stammt, käme man schon weiter. Sie setzt die Selbstverantwortung nicht außer Kraft, sie verlagert diese lediglich bei wirklichem Unvermögen des Pflichtigen auf die nächste Ebene von unten nach oben, vom Individuum auf die Familie, von dort Lebenskreis um Lebenskreis nach oben. Ganz zuletzt erst kommt die gesamte Gesellschaft und der Staat. Dann aber müssen schon alle anderen Wege zuvor gegangen und alle anderen „kleineren" Mittel wirklich ausgeschöpft sein. Und bei allen Maßnahmen, die Politik und wir bei unseren eigenen Gedanken für hilfreich halten könnten, muß gesichert sein, daß der Mensch im Mittelpunkt so gesehen und betrachtet wird, wie er nun einmal ist. Er denkt nun einmal zuerst an sich und dann gleich an die Seinen. Diese „Anthropozentrik" hängt mit seinem ihm angeborenen Selbsterhaltungstrieb zusammen, das ist das Werk Gottes oder wer eben für seine Schöpfung zuständig war. Der Mensch ist aber auch gesellschaftlich angelegt, er ist von sich aus schlechterdings nicht unfair, er ist nicht „des Menschen W o l f . Der Mensch ist mit Vernunft begabt. Und diese Vernunft lehrt ihn, daß er mit anderen auskommen muß. Nach meiner Meinung bedarf es auch gar nicht so sehr viel Umerziehung. Die Rechtschaffenen, die wir haben, können Staat und Gesellschaft aufrechterhalten. Die Unfairen sind glücklicherweise in der Minderzahl. Ich bezweifle auch, ob Umerziehung etwas bringen kann. Dem Christentum ist sie in zweitausend Jahren nicht gelungen. Die Menschheit wäre wohl sonst auch untergegangen wie viele andere Arten i m Laufe der Weltgeschichte. Und Mao verkündete bei seiner Umerziehung in China, daß er es wohl in fünfzig Generationen geschafft haben werde. A n der zweiten ist er schon hängengeblieben.
Freiheit, Sicherheit und Eigenerantwortung
297
Aus den Augen darf man auf keinen Fall verlieren, daß die wirtschaftliche Freiheit - unverzichtbarer Bestandteil, Ursache und Folge der persönlichen Freiheit übersteigertem Sicherheitsdenken nicht weichen darf. Das bißchen Sicherheit, das damit vielleicht mehr gewonnen zu werden hofft, ist dann nicht mehr viel wert. Es müßte mit erheblichem Verlust von Wohlstand und Verzicht auf Fortschritt teuer, viel zu teuer bezahlt werden. Die Funktionstüchtigkeit der Wirtschaft ist die Grenze, die nicht überschritten werden darf. Das ist freilich zunächst einmal ein allgemeiner Begriff, der interpretiert werden muß. Aber wenn die wirtschaftlichen Verhältnisse des einzelnen Betriebes oder der gesamten Nationalökonomie Daten ausweisen, die auf eine Gefährdung der Funktionstüchtigkeit deuten, ist Umkehr geboten, und zwar schnellstens. Aber man muß leider Zweifel haben, ob die Politiker aus Angst vor der drohenden Abwahl die erforderliche Kraft aufbringen können. Die Demokratie im klassischen Sinne einer parlamentarischen Demokratie gewährt jedem Freiheit. Ausgerechnet Unternehmungen und Unternehmern diese Freiheit beschneiden zu wollen, wäre nicht nur verfassungswidrig, sondern i m höchsten Maße unvernünftig. Sie nützen ja mit ihrem Tun i m ganzen besonderen und unverwechselbaren Maße der ganzen Gesellschaft. Daß freilich der erfolgreiche Unternehmer und Unternehmensleiter auch recht gut verdient, sollte nicht einem geschürten Neidkomplex zum Opfer fallen, auch dann nicht, wenn er seine Gewinne, wie die meisten gut beratenen mittelständigen Unternehmer, nicht wieder in das Unternehmen zurückfließen läßt. Auch die Marktwirtschaft ist durch unser Grundgesetz nach meiner Rechtsüberzeugung geschützt. Es wäre jedenfalls nicht einzusehen, daß es ausgerechnet für insbesondere selbständig Wirtschaftende nicht die Möglichkeit der „freien Entfaltung" geben sollte - eine Forderung an Staat und Gesellschaft, die jedem Studienabbrecher flüssig über die Lippen geht. Aber wie auch immer: Wer die Regeln der menschlichen Natur nicht beachtet und wer darüber hinaus aus welchen Gründen auch immer Maßnahmen ergreift, die sich gegen die Wirtschaft „konfiskatorisch" auswirken könnten, steuert auf die Selbstzerstörung zu. Wir müssen uns die eigentliche und einzige Aufgabe der Wirtschaft stets vor Augen halten, nämlich die Gesellschaft mit Gütern und Dienstleistungen zu versorgen. Dieser banal scheinende Satz wird in der Negation deutlicher: Die Wirtschaft ist also nicht dazu da, die Unternehmer reich zu machen, Arbeitsplätze zu schaffen, dem Staat die Mittel für Krankenhäuser, Kindergärten, Polizei und für Abgeordneten-Diäten zu verschaffen. Das ist nicht die Aufgabe, sondern, so sie gut arbeitet, ihr dann konsequentes Ergebnis. Wenn wir auf den Kern unserer Überlegungen zurückkommen, so stellen wir also die eigene Verantwortung des Menschen in den Mittelpunkt. Darin liegt die Lösung. Jeder einzelne Mensch muß als mit Vernunft begabtes und mit einem eigenen Willen ausgestattetes Wesen sich darauf besinnen, daß es eine menschliche Pflicht ist, für alles das, was er tut und läßt, Verantwortung zu übernehmen - überall wo er steht. Das fängt Zuhause an, das findet auf dem Arbeitsplatz Erfüllung, auf dem Schweißstand ebenso wie i m Chefbüro.
298
Edgar Michael Wenz
Und weil ich weiß, daß Sie in Ihrer überwältigenden Mehrzahl dieses Gefühl der Verantwortlichkeit kennen und leben (das beweist allein schon, wie viele, die weitaus meisten von Ihnen Haus- und Wohnungseigentümer sind, ein unvergleichlich hoher Prozentsatz), und weil ich gerade zu dieser Stunde gerne davon rede, daß der Erfolg unseres Unternehmens diese unsere gemeinsame Verantwortlichkeit zur Grundlage hat, darum bin ich stolz auf unser Haus und i m besonderen Maße auf Sie, die Sie alle meine und unsere Mitarbeiter sind. Mit-Arbeiter. Zu guter Letzt darf ich noch sagen: Wir werden nicht nur in unserer Branche und auch weit über unsere Region hinaus schon seit geraumer Zeit beobachtet, weil wir gegen die ganze Marktentwicklung erfolgreich sind. Es werden viele Theorien aufgestellt, wie das wohl so gekommen ist und wie meinetwegen ich das gemacht haben könnte, nach welcher modernen amerikanischen oder chinesischen Methode. Ich w i l l es Ihnen hier sagen: Wir haben uns alle verantwortlich gefühlt, ich für meine Arbeit und Sie für die Ihre. Das ist eigentlich alles. Aber das ist sehr viel.
Ökologische Marktwirtschaft - Chancen und Grenzen Umweltschutz am Prüfstein der sozialen Marktwirtschaft* Wenn eine Gesellschaft den so sensiblen Komplex des Umweltschutzes mit den Regulativen der Wirtschaftsordnung „ M a r k t " zu lösen zumindest versucht, dann darf man einen bemerkenswerten Grundkonsens erkennen - und das um so mehr, wenn aus dieser „Marktwirtschaft" (und was man volkstümlich so darunter versteht) schon mit dem Agrar- und Arbeitsmarkt mächtige Pfeiler herausgebrochen sind. In Übereinstimmung mit Pareto („Irrationale Residuen") und Arnold Gehlen („Kulturelle Kristallisation") läßt sich feststellen, daß aus den Markt-Resten wirksame Kräfte erwachsen. Untersucht man ein soziales Phänomen auf seine Verträglichkeit mit einer Ordnung, dann müssen eben die Kriterien dieser Ordnung methodisch am Erkenntnisobjekt angelegt und nach ihrem Vorhandensein gewissermaßen „abgeklopft" werden. Zwei Kriterien sind davon zum Verständnis der Marktwirtschaft unverzichtbar 1 , nämlich: • Bilden sich die Preise frei für die Marktgüter, in die die Kosten des Umweltschutzes eingeflossen und einkalkuliert sind? • Findet eine freie Entfaltung und ungebundene Allokation allen Wissens und aller Kräfte, die bei der Lösung von Umweltschutzproblemen sachdienlich und hilfreich sein könnten, nach betriebswirtschaftlich-kaufmännischer Kosten-/ Nutzen-Analyse statt? Lassen sich diese Fragen bejahen, dann darf man mit kräftigen Elementen marktwirtschaftlichen Ordnungsdenkens rechnen; sie müßten auch die angestrebte - oder doch zumindest untersuchte - „Ökologische Marktwirtschaft" tragen. Ist dem nicht so, muß der Grad der faktischen Abschwächung festgestellt und - bejaht man die Marktwirtschaft - möglichst abgestellt werden. I m Kern geht es darum, die externen (sozialen) Kosten zu internalisieren; dann weiterhin, den oder die Auslöser der Kausalkette, an deren Ende die Kosten für * Schriftliche Ausarbeitung eines spontan eingeschobenen Beitrags. Erstveröffentlichung in: Edgar Michael Wenz, Hasso Hofmann, Ulrich Weber (Hrsg.), Ökologie, Ökonomie und Jurisprudenz, Band 5 der Schriftenreihe Law and Economics, Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Forschung, München, 1987, S. 125 ff. 1 Diese Kriterien sind beim Symposium bestenfalls angeschnitten, aber nicht ergiebig diskutiert worden; siehe dazu auch Anmerkung 7.
300
Edgar Michael Wenz
den Umweltschutz, einschließlich der Folgebeseitigung von Störfällen, zu finden und festzumachen. Man verläßt sich dabei häufig auf das „Verursacherprinzip"; mit einer freien Preisbildung kollidiert es nicht schlechthin. Der Begriff kommt zwar aus dem Haftungsrecht, ist also für den Störfall gedacht, ist aber, hier einmal ungeachtet der praktischen Realisierbarkeit dieser Hilfskonstruktion, geeignet, Verantwortungen zuzuweisen. Nur muß beachtet werden, inwieweit das Verursacherprinzip an der bewährten Lebensregel „Wer bestellt, der zahlt auch!" aneckt. Wenn Ausgaben für die Verhinderung oder Beseitigung von Umweltschäden als potentielle Folgekosten ungehindert in die Produktionskosten einfließen und sich dann auch in den Marktpreisen niederschlagen, dann sind keine ordnungstheoretischen Bedenken anzumelden 2 . Insofern ist der Nachfrager nach frischem Trinkwasser in diesem Sinne der Verursacher; er muß also dafür bezahlen, und bislang tut er das eigentlich in aller Regel auch. Jedenfalls sind noch so scharfsinige Überlegungen, ob diese oder jene Vorschrift mehr Produzenten- oder mehr konsumentenfreundlich ist, müßig. Die These 1 mag wie eine Binsenweisheit klingen, sie wird aber häufig genug übersehen: I m Sinne einer marktwirtschaftlichen Ordnung ist keineswegs nur die Volkswirtschaft, sondern das Individuum als Letztverbraucher oder Endabnehmer der Kostenträger für den Umweltschutz, den er auch nachfragt. Die Preisempfindlichkeit der marktwirtschaftlichen Ordnung vermag keine Verzerrungen zu dulden, weder solche durch individuelle Maßnahmen, noch als Folge regionaler oder internationaler Ungleichbehandlungen. Die Umweltprobleme sind nicht nur technisch-physikalisch, sondern auch wirtschaftlich grenzübergreifend. Preisunterschiede sind freilich sogar gewollt. Das Wettbewerbsprinzip, eine unverzichtbare Voraussetzung für Marktwirtschaft, w i l l unterschiedliche Leistungen der Anbieter belohnen, so auch i m Umweltschutz. Das ist eine systemgerechte Konsequenz, total anders als administrative Eingriffe (Verwaltungsakte), die gleiche Sachverhalte häufig „fallweise", somit unterschiedlich regeln. Somit These 2: A u f keiner Ebene und in keiner Beziehung dürfen unterschiedliche Regeln gelten, die die Kosten- und in Konsequenz die Preissituation verändern; als Ergebnis des Wettbewerbes sind Preisunterschiede nicht nur zulässig, sondern als Merkmal des Marktes und als sein wichtigstes Steuerungsmittel gefragt. Das Recht, gewiß gelegentlich sogar die Pflicht des Staates, in die Belange des Umweltschutzes einzugreifen, kann nur rechtsstaatliche, keinesfalls ökonomische Grenzen kennen, bestimmte Erfolge zu erzwingen mittels Auflagen oder / und Abgaben oder aber mittels Auslobung von Subventionen Anreize zu schaffen. Aus 2 Ein anderes Beispiel: Wer frische knusprige Brötchen, die mit Solarenergie gebacken sind, eines Tages haben will, muß eben drei Mark bezahlen, die Folgekosten für Wasserstoffexplosionen prophylaktisch einkalkuliert, dann eben möglicherweise noch mehr.
Ökologische Marktwirtschaft - Chancen und Grenzen
301
rechtsstaatlicher Sicht sind dagegen keine Bedenken zu erheben. Formell ordnungsgemäß erlassene Gesetze und Verordnungen sind materiellrechtlich immer an eine unbestimmte Vielfalt von Adressaten mit allgemeiner Verbindlichkeit gerichtet, treffen also Regionen oder Branchen i m wesentlichen gleich. Das ist das probate Mittel, Grenzwerte aufzuzeigen und, etwa durch sich verschärfende Bedingungen, Zielwerte anzugeben. Diese Eingriffe scheinen i m ersten Anblick eine Durchlöcherung marktwirtschaftlicher Prinzipien zu bedeuten, zumindest graduelle Abschwächungen. Bei näherem Hinsehen allerdings zeigen sich diese Auflagen / Abgaben und Auslobungen als Rahmenbedingungen, die freilich generell gelten müssen; sie stehen dann i m ökonomischen Datenkranz und sind somit berechenbar. Aber die Kosten durch Auflagen oder direkte Abgaben fließen ebenso belastend in die Kalkulation ein wie Subventionen entlastend. I m Ergebnis haben wir es wieder mit kalkulierten Marktpreisen zu tun, auch dann, wenn diese Kosten oder finanzielle Hilfen in Gemeinoder Vorkosten oder in einer Mischkalkulation „verschwunden" zu sein scheinen. Dieser Umstand, daß die Kosten also in den Marktpreisen enthalten sind, läßt über die Abschwächung des systematischen Prinzips hinwegsehen, um so mehr dann, wenn die Gründe für diese gesetzlichen, also generalisierten Maßnahmen einleuchten. Derartige Konstellationen sind durchaus vorstellbar, zudem bekannt und zum Teil auch bewährt. Gerade sie werden häufig - oder sollten es zumindest - eingesetzt, um marktwirtschaftliche Kräfte freizusetzen und in bestimmte Richtungen zu steuern, zu zwingen oder zu locken 3 . Aus der Sicht des Denkens in Wirtschaftsordnungen allerdings sollte dieser Umweg nur so selten wie möglich begangen werden; systematische Störungen können nur als Mittel akzeptiert werden, wo alle anderen tatsächlich versagen. Das zwingt zu besonderer Sorgfalt 4 . These 3 also: Die Auferlegung von Lasten und Abgaben sind ebenso wie Anreize durch Subventionen Rahmenbedingungen für die marktwirtschaftliche Ordnung. Sie dienen gleichzeitig der Steuerung, i m Ergebnis nicht anders als Marktpreise. Konstellationen, wo dieser Weg nötig ist, sind sehr gut vorstellbar und zum Teil auch bewährt. Die Ausbildung eines Datenkranzes ist systemtypisch. Auch in einer marktwirtschaftlichen Ordnung sind Leistungen und Maßnahmen denkbar, die keinem Individuum und keiner Gruppe auferlegt werden können. Das können dann nur Leistungen und Aufgaben sein, die dem Staat, eben als Staatsaufgabe, zuzuordnen sind. Hier sind Kriterien anzulegen, die generell das Einschalten der öffentlichen Hand notwendig machen, und nicht nur als privat- oder öffentlichrechtlicher Wirtschaftsteilnehmer, sondern als Hoheitsträger, durchaus vergleich3
Allokation des Wissens und der Kräfte (siehe These 6). Die häufig diskutierten „freiwilligen Vereinbarungen", auf die nach wie vor viele setzen (so auch der Autor), andere ihnen neuerdings mißtrauen, sind kein wesentlicher Bestandteil marktwirtschaftlicher Ordnung; sie sprächen nur für eine begrüßenswerte liberale Grundtendenz, die freilich für die Marktwirtschaft allererste Voraussetzung ist. 4
302
Edgar Michael Wenz
bar mit den Staatsaufgaben der Polizei oder der Bundeswehr. In einer Periode, in der man so langsam daran geht, die Aufgaben der öffentlichen Hand zu privatisieren, darf i m Sektor des Umweltschutzes nicht ein neues Tor für staatliche Betätigung aufgestoßen werden - es sei denn, diese Aufgaben lassen sich nur mit hoheitlicher Macht bewältigen. Diese Kosten treffen dann die Volkswirtschaft, den Konsumenten und Letztverbraucher jedoch nur mittelbar, diesmal als Staatsbürger und Steuerzahler. Eine mittelbare, weil verdeckte Überwälzung der Umweltschutzkosten via Steuerzahlungen an die Gemeinschaft der Staatsbürger findet notgedrungen auch dann und dort statt, wo der Verursacher der Umweltschäden nicht erkennbar ist oder/und die Kosten nicht ausscheidbar sind. Die Markt-Mechanismen können in diesen Fällen, die freilich recht häufig sind und denen auch bei Diskussionen eigentlich besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird, nicht greifen. Somit fällt dem Staat die Aufgabe des internen Ausgleichs zu. Das führt zu These 4: Wider die marktwirtschaftliche Ordnung spräche nicht, wenn der Staat als Hoheitsträger bestimmte Aufgaben des Umweltschutzes übernimmt, wenn und insoweit diese Aufgaben nicht privatwirtschaftlich ordnungsgemäß organisiert werden können. In diesen Fällen bestehen gegen Abwälzung der Umweltschutzkosten über Steuern keine systematischen Bedenken. Gegen das Denken in Preisen und Märkten wird häufig eingewandt, daß dies auf Dauer nicht funktionieren könne. Die Kosten für den Umweltschutz würden hoch, eines Tages kollidierten sie zwangsläufig mit der Produktion von „Sozialproduktgütern". Umweltschutzkosten bedeuteten natürlich auch insgesamt höhere Preise, geringere Einkommen und steigende Steuern. Die Kosten für den Umweltschutz ließen sich nicht auf Dauer auf den Konsumenten und Letzt Verbraucher abwälzen; er würde sonst doch zu einem schmerzlichen Konsumverzicht gezwungen. Manche sehen darin sogar das Sozialstaatsprinzip gefährdet. Aber gerade diese Einwände sprechen nicht gegen die marktwirtschaftliche Lösung. Diese Erkenntnis unterstützt sie, sie wird dadurch eigentlich erst gerechtfertigt. Gerade Konsumenten und Letztverbraucher werden so eines Tages zu einer sehr strengen und wohlüberlegten Güterabwägung gezwungen, vielleicht mit dem Ergebnis, daß nicht das letzte Rußpartikelchen ausgefiltert werden muß, vielleicht auch mit der - resignierenden - Einsicht, daß das Leben nun einmal lebensgefährlich ist. Die praktische Organisation des verbal zunehmend geforderten Umweltschutzes wird seine Grenzen aufzeigen, nicht auszuschließen mit vermindertem Konsum, dann stagnierender bis rezessiver Wirtschaft und all' dem, was sich dann zwingend anschließt. Daß „man" den Umweltschutz zahlen muß, daß viele darunter anscheinend die jeweilige Volkswirtschaft meinen, jedenfalls viele andere Adressaten als sich selbst, damit ist zu rechnen. Marktwirtschaftliche Regelungen aber werden die Kosten konkreter, sichtbarer und fühlbarer machen und so eine rationale Diskussion eröffnen und effiziente Taten viel schneller und treffsicherer
Ökologische Marktwirtschaft - Chancen und Grenzen
303
ermöglichen. Hier könnte die marktwirtschaftliche Ordnung zu einer Entlarvung der Verbal-"Grünen" und der Radikal-Verneiner dienen. Dann käme die Stunde der Einsichtigen und Besonnenen, die unleugenbaren Probleme zwar nicht lautstark, aber rational anzupacken. Hier sollte auch erkennbar werden, warum die freie Preisbildung auf möglichst direktem Wege (statt mittelbar wie bei These 4) gerade beim Umweltschutz so wichtig ist. Sie dient der Transparenz - einer Forderung, die bei diesen so wichtigen Bemühungen keineswegs ausgeklammert werden darf, eher nachdrücklich zu stellen ist. Somit These 5: Die marktwirtschaftliche Ordnung auch i m Umweltschutz wird diesen nicht „unbezahlbar" machen, sondern vielmehr die Augen öffnen für die Gratwanderung, in der sich die Gesellschaft zwischen natürlicher Lebensqualität und zivilisatorischer Zerstörung bewegt. Der Einwand wird zur Begründung. Der andere Komplex der freien Entfaltung nach Zielvorgabe beim Aufsuchen des Weges nach marktwirtschaftlichen Regeln, somit auch durch Ansetzen der betriebswirtschaftlich-kaufmännischen Kosten- / Nutzenanalyse, wird in der Literatur gesehen und diskutiert 5 . I m allgemeinen wird, in konsequenter Beachtung anthropologischer Erkenntnisse, die Chance, durch Anreize zu verlocken als effizienter gesehen als die alternative Möglichkeit, durch Vorschriften zu zwingen. Nicht ausreichend wird bei diesen Untersuchungen jedoch ein Phänomen gewürdigt, das längst zu einem echten Problem unmittelbar der Rechtssprechung, mittelbar auch der beiden anderen Staatsgewalten, der Legislative wie der Exekutive, schließlich der Politik geworden ist, die Schwierigkeiten nämlich, solche Gesetze und Verordnungen zu vollziehen. Freilich wird das „Vollzugsdefizit" (Renate Mayntz) beobachtet und diskutiert. Aber die Ursache kann man nicht mit Mitteln bekämpfen wollen, die der gesetzten Ursachen gleich sind, als Ketten-Ursachen sich nicht auflösen, sich vielmehr unentwirrbar mehr und mehr verknüpfen. Es kann kein Weg an der Erkenntnis vorbeiführen, daß der Staat durch seinen Gesetzes- und Verordnungsgeber sicherlich nichts anderes zu bieten weiß als Generalklauseln und unbestimmte Rechtsbegriffe. Überlegungen sind müßig, ob sich der Gesetzgeber damit nur legislatorischen Pflichten entziehen will, oder ob er, in richtiger Einsicht der Begrenztheit menschlichen Wissens, den Weg offenlassen w i l l für neue Erkenntnisse der Wissenschaft und technischen und sozialen Wandel. Die Heranziehung von Sachkunde und Fachwissen ist dann für die Auslegung der Gesetze unverzichtbar 6 . 5
So auch in diesem Symposium. Stellvertretend für eine reiche Literatur Edgar Michael Wenz (Hrsg.), „Wissenschaftsgerichtshöfe", mit Beiträgen von Meinolf Dierkes, Wilhelm A. Kewenig und Gerd Roellecke, 1983, mit Nachweisen; dort wird auch die Bedeutung der theoretischen und empirischen Rechtssoziologie für die juridische Aufarbeitung und Einarbeitung von Sachkunde und Fachwissen erörtert - eine Wissenschaft überdies, die für viele Juristen gar nicht existiert. 6
304
Edgar Michael Wenz
Also liegen die Gestaltungskräfte ohnehin in der Praxis bei den Produzenten. Es ist offenkundig, daß es dann doch viel sinnvoller wäre, diesen das Ziel vorzuschreiben, gegebenenfalls auch in kleinen, aber zeitlich terminierten Schritten. Innerhalb des vorgegebenen Zielkorridors müssen dann die technisch und ökonomisch günstigsten Lösungen durch freie Allokation allen irgendwie verfügbaren Wissens und aller Kräfte gesucht und gefunden werden. Die so gegebene Beweglichkeit, die freilich in den Spielregeln strengstens überwacht werden muß (was weder rechtsstaatlich noch marktwirtschaftlich angreifbar wäre), wird den effizienten Produzenten belohnen. Hierher gehören Überlegungen zu den „Umweltzertifikaten" 7 . Sie wären ein geradezu klassisches Mittel, innerhalb des vorgegebenen Zielkorridors nach marktwirtschaftlichen Methoden einen möglichst reibungslosen Weg zum Ziel zu suchen. Hier lassen sich leicht die marktwirtschaftlichen Prüfsteine erkennen. Somit die These 6: Der soziale Wandel und das Prinzip der Offenheit läßt keine präzisen Vorschriften zu. Deshalb ist es sinnvoll, dann gleich den Produzenten die Zielkorridore anzugeben und aufzugeben. Neben der freien Entfaltung bleibt auch die ungebundene Allokation allen verfügbaren Wissens und aller Kräfte so gesichert. Hierher gehören auch die „Umweltzertifikate". Diese wären ein probates Mittel, innerhalb eines vorgegebenen Rahmens sich dem angegebenen Ziel zu nähern. Der Umweltschutzdiskussion haftet noch ein auffallender, aber häufig wiederkehrender Mangel an, daß er sich nämlich auf die Groß-Wirtschaft beschränkt 8 . Die Klein-Wirtschaft und die mittelständischen Betriebe sind aber nicht nur die größten Produzenten und Arbeitgeber der deutschen Wirtschaft, sondern auch beachtliche Umweltnutzer und zwangsläufig somit Umweltbeschmutzer. Die Aufmerksamkeit, die die Großwirtschaft auf sich zieht, wird freilich verständlich durch die Ballung der Emissionen in Luft, Wasser und Boden sowie durch die meist risikoreicheren Industriezweige, beispielsweise die Grundstoffchemie und die Energiewirtschaft. Umweltnutzung und damit Umweltbeschmutzung findet aber auch bei der Herstellung und Anwendung von Produkten statt, die an sich sozial nicht nur unbestritten, sondern ausdrücklich akzeptiert sind. Beispiel: das Backen von Brot 9 . 7
Die Umweltzertifikate wurden auf diesem Symposium ausführlich diskutiert. Sie bildeten eigentlich das Schwergewicht. Freilich bieten sie auch Material für ordnungspolitische Prüfsteine. Eine Absage an Umweltzertifikate jedenfalls würde - sieht man von Schwierigkeiten in der praktischen Realisierung und Mißerfolgen möglicherweise bei der Effizienz ab - auch eine Absage an die marktwirtschaftliche Ordnung bedeuten. 8 Selbstverständlich richten sich die gesetzlichen Verordnungen auch alle gegen die mittelständische und die Klein-Wirtschaft; bei der TA-Luft und der in Beratung befindlichen Novelle zum Wasserhaushaltsgesetz ist die mittelständische Wirtschaft stark gefordert. Möglicherweise ändern sich dann die Schwerpunkte der Diskussion. Im Moment hat man aber den Eindruck, daß diese überwiegend von der Groß-Wirtschaft geführt wird und sich deshalb auch meist mit deren Problemen befaßt.
Ökologische Marktwirtschaft - Chancen und Grenzen
305
Die Kontrolle der Zehntausende von Kleinbetrieben und der mittelständischen Wirtschaft ist ungleich schwieriger als beispielsweise bei der Großindustrie; sie ist vielfach praktisch sogar unmöglich. Zu diesen Lücken, durch die ein kleinerer und mittlerer Betrieb leichter hindurchschlüpfen kann, kommt noch die unbestreitbare Effizienz i m Aufspüren von technischen und organisatorischen Möglichkeiten: es kommt nicht von ungefähr, daß diesen gewerblichen Gruppen am meisten Kreativität und Innovationskraft zugeschrieben wird. Hier sind also die Chancen der wohlverstandenen und begrenzten Beweglichkeit am größten. A u f der anderen Seite ist die Möglichkeit um so geringer, dort den richtigen Einstiegspunkt für eine Verursacherkette zu finden, auf den es aber wohl ankäme, wenn man sich auf dieses Prinzip stützen möchte 1 0 . Aus dieser Erkenntnis ergibt sich die These 7: Die Nutzung und somit Verschmutzung der Umwelt ist so vielfältig wie die Produzenten- und Konsumentengesellschaft. Kleinere und Mittelbetriebe sind nach der Lebenserfahrung effizienter beim Aufspüren technischer und organisatorischer Chancen; deren Beweglichkeit sollte man besonders bei der Öffnung von Möglichkeiten im Zielkorridor nutzen. Diese Überlegungen sollten darstellen, • daß in der Methode ökonomische und jurisprudentielle Untersuchungen zur Lösung der Umweltproblematik mit den Mitteln der Marktwirtschaft ohne Einbringung jener Elemente, die man als „klassische" der marktwirtschaftlichen Ordnung bezeichnen kann, nur schwer stattfinden kann; aber auch, • daß i m Ergebnis die so gewonnenen Erkenntnisse verstärkend wirken. Marktwirtschaft haben wir hier verstanden als natürliche, weil freiheitliche Ordnung, die die anthropologischen Gegebenheiten durchschaut und für sich ummünzt, als geläutertes, freilich auch durch positives Recht, Regeln der Ethik und Konkurrenz begrenztes Selbstinteresse, aus dem Leistungswille und die Chance der persönlichen Selbstentfaltung und Freiheit erwachsen. Nach jahrzehntelangen Beobachtungen der Wirkungen der marktwirtschaftlichen Ordnung in aller Welt gibt es keinen Anlaß zu zweifeln, daß diese Wirtschaftsordnung - die ideologisch und ordnungspolitisch befriedigt, die Mobilisierbarkeit wirtschaftlicher Interessen für den Umweltschutz (als kontrolliertes „Profit9 Der Autor hat in einer Modellrechnung die Emissionen beim Backen von Brot nachzuweisen versucht: Für sich eine bedrohliche Quantität. Siehe „Umweltbelastung durch Bäckereien. Auch Bäckereien belasten die Luft - Möglichkeiten für umweltfreundliche Technik", in: U - Technisches Umweltmagazin, 10/78, S. 18 f. 10 Am Beispiel durch Backen lassen sich wiederum die Schwierigkeiten der Verursachung von Umweltverschmutzung darstellen: Sind es die Bäckereitechniker, die Bäcker oder der Kunde, der ständig frische Brötchen nachfragt? Oder doch wieder die Energieversorger? Und warum? Daß der Autor häufiger Beispiele von Brot, Backen und Bäckereitechnik heranzieht, hat nicht nur persönliche Bezüge, beruht vielmehr auf der an sich unbestrittenen Tatsache, daß es sich hier um ein Gewerbe und Produkte handelt, die sozial im besonderen Maße akzeptiert sind.
20 Gedächtnisschrift Wenz
306
Edgar Michael Wenz
interesse") gewährleistet, die Ausbeutung externer Güter durch Einbeziehung in die Kostenrechnung verhindert (Hermann Lübbe) - nicht auch bei der Lösung der so drängenden Probleme des Umweltschutzes erfolgreicher sein wird als alle denkbaren anderen Wege, insbesondere plan- und ζwangswirtschaftliche. In einer Zeit, da alles Wissen und Können, alle Erfahrung und alle Initiative benötigt werden, um drängendste Probleme zu lösen - was könnte da hilfreicher sein als freie Entfaltung i m permanenten „Entdeckungsverfahren" (F. A . von Hayek) der Marktwirtschaft? Für diese Ordnung spricht die Vermutung der Effizienz. Nicht sie ist dafür noch beweispflichtig, andere Lösungsvorschläge wären es. Aber sie müssen sich nicht an der (meist selbstgestrickten) Theorie, sondern empirisch messen lassen. Der Umweltschutzgedanke ist nicht nur i m augenfälligen, sondern hervorstechenden Maße sozial akzentuiert. So ordnet er sich eigentlich nahtlos ein in die „soziale Marktwirtschaft" - in Übereinstimmung mit Ludwig Erhard und den ihm kongenialen Nationalökonomen und Politikern. Mag der Verfassungsrang staatsrechtlich strittig sein, ein deutlich überwiegender Konsensus mit der sozialen Marktwirtschaft wird kaum erfolgreich bestritten werden können - ein hervorragendes Umfeld und Klima, den Weg zum Umweltschutz mit ihr und über sie zu wagen.
Vom Brot und Entwicklungshilfe* Kaum einer, der die Geschichte von den Schneepflügen für die Sahara, den Eisschränken für Eskimos nicht gehört hätte; kaum einer, der nicht von den gigantischen Industrieprojekten wüßte, bei denen nur die vielen Schaltknöpfe stören, die auch noch bedient werden müßten; und wer von einem Hospital erzählte, das die Bundesrepublik Deutschland gestiftet, die Franzosen aber die Trikolore und Festredner gestellt hätten, der bräuchte nicht viel Zweifler und Zweifel befürchten . . . Ziel und Zweck jeder Entwicklungspolitik, jeder wie immer gearteten Entwicklungshilfe müßte nach diesen Kriterien sich messen lassen oder nach ihnen ausgerichtet sein: Ideelle und materielle Nutzenstiftung i m Zusammenklang von objektivierbaren Maßstäben und Erwartungen subjektiver Bedürfnisbefriedigung. Das Erfordernis der „Hilfe zur Selbsthilfe". Dieses Postulat ist in jenen Teilen der Welt unbestritten, wo man der Lebensphilosophie anhängt, das Individuum in den Mittelpunkt zu stellen. Der gesellschaftspolitische Bereich. Wo man also historische Fakten nicht hartnäckig zu leugnen fest entschlossen ist, wird man die Streuung von Produktionsmitteln in viele private Hände fördern wollen. Es gibt keinen einsichtigen Grund, daß etwa Afrikaner oder Asiaten - jedenfalls diejenigen, auf die es beim Aufbau ihrer Länder ankommen wird und die sich auch schon gezeigt haben - psychisch und mental anders angelegt wären als „die Weißen", daß Adam Smith nicht auch für sie schon vorgedacht haben würde. Es ist nur eine der vielen Überheblichkeiten des Westeuropäers und Nordamerikaners, daß eine freie Wirtschaftsordnung zwar für ihn, aber keinesfalls für „unterentwickelte" Völker tauglich sei; dort wäre der Sozialismus, gleichbedeutend mit Staatsbetrieben, nicht nur tolerierbar, sondern sogar die einzige Lösung. Man verkennt dabei schlicht, daß auch in unserer Hemisphäre wenig Menschen sind - keineswegs aber „die Weißen" schlechthin - , die Last, Bürde und Risiko des wirtschaftlichen Gestaltens auf sich nehmen (können und wollen). Die deutsche Entwicklungshilfe darf durchaus auch einen nationalen Akzent tragen, ohne deshalb in den Verdacht des Chauvinismus zu geraten. Wir haben allen Grund zur Imagepflege, ohne nun lange in unserer Geschichte herumstöbern
* Erstveröffentlichung in: Edgar Michael Wenz, Das Backen. Das Garen. Die Technik. Die Theorie vom Backofen, Arnstein, 1980, S. 109 ff. 20*
308
Edgar Michael Wenz
zu müssen. Wir haben aber auch die - ideellen und materiellen - Mittel und Möglichkeiten dazu. Selbst in der dritten Welt dürfte man mit Verständnis rechnen, wenn Entwicklungshilfe oder Privatinvestitionen sorgsam unter dem Aspekt überlegt würden, daß sie sich eines Tages nicht als Vernichtung von Arbeitsplätzen bei den Geberländern auswirken. Wie aber könnte das in der Praxis aussehen? Nehmen wir ein schlichtes Beispiel - das Brot. Keine Kraftwerke, keine Maschinenfabriken, keine chemischen Anlagen, noch nicht einmal Autos - schlicht und einfach: Brot. Aber nun nicht Brot, hygienisch fein verpackt und zum Hineinbeißen. Das wäre ja keine Hilfe zur Selbsthilfe, auch alle anderen Erfordernisse würden bei einer solchen „ H i l f e " fehlen. Selbstgebackenes Brot versteht sich, und alle Hilfen dazu, es dahin zu bringen. A n dem simplen Beispiel des Brotes lassen sich die aufgestellten Kriterien überprüfen und - leider - nur zu leicht erkennen, welche Versäumnisse bislang passiert sind und - vor allem - wie sich in Zukunft so manches besser machen ließe. Brot ist jenes Nahrungsmittel der abendländischen Menschheit, das freilich nicht am meisten besungen, aber um das ganz gewiß am meisten geweint und gebetet wurde. Ob man afrikanische und asiatische Völker nun von deren Ernährungsgewohnheiten abbringen und zum Brot „umerziehen" soll, ist angesichts der nicht nur wechselnden, sondern doch sehr angreifbaren Erfolge mit solchen „Umerziehungsaktionen" durchaus zu fragen. Die Antwort fällt allerdings nicht schwer: die Verzehrgewohnheiten zum Brot - hier verstanden als gesäuertes und vergorenes aus Getreidemehl gebackenes Nahrungsmittel - hinzulenken (weg von Brei und Fladen, hin zum Brot!), liegt i m wohlverstandenen Interesse der Menschen in der dritten Welt, • weil Brot nicht nur nahrhaft ist, sondern insbesondere sehr gesund; erweislich verhindert Brot Zahn- und Magenkrankheiten; es wird deshalb von der Weltgesundheitsbehörde empfohlen; • weil die Versorgung mit Brot administrativ und technisch verhältnismäßig leicht sichergestellt werden kann, etwa in Notzeiten; Brot ist gut zu rationieren, leicht zu portionieren und verhältnismäßig gut zu konservieren; • weil der eigentliche Sinn und Zweck der Bemühungen um die einheimische Landwirtschaft i m allgemeinen und um den Getreideanbau i m besonderen auch nur in der Versorgung der Bevölkerung mit Brot und Backwaren liegen kann; ein anderer Sinn ließe sich tatsächlich nicht erkennen; • weil ausländische Hilfeleistungen in Form von Getreide- und Mehllieferungen anders sinnvoll nicht verwertet werden könnten; • weil die Produktion von Brot sich auch bei engster Interpretation des Begriffs nur infrastrukturell auswirkte, selbst auf längere Sicht den Industriestaaten kein Schaden erwachsen könnte.
Vom Brot und Entwicklungshilfe
309
Der geringere Teil der Menschheit kennt überdies Brot als Hauptnahrungsmittel. Gewiß, es gibt darüber keine verläßliche Zahlen, nur Schätzungen, und auch da nur private. Aber Kenner räumen ein, daß in den Entwicklungsländern das Brot seine Zukunft wirklich noch vor sich hat. Und selbst in Asien, wo durch Reisanbau und -konsum die Verhältnisse etwas anders gelagert sind als etwa in Afrika, ist man Brot zu akzeptieren mehr und mehr bereit. Wenn man also Ja sagt zum Brot, dann muß man auch Ja sagen zu von Einheimischen geführten Bäckereien. Viele Stämme kennen freilich Methoden, Brot oder etwas Vergleichbares mit traditionellen Mitteln herzustellen; das sind dann meistens „Fladen", die schon eine Entwicklung über den Brei hinaus sind - aber eben doch kein Brot. Und dieses hygienisch und mit guter und sparsamer Ausbeute der Rohstoffe herzustellen, bedarf es einer bäckereitechnischen Ausrüstung, dazu ausgebildeter Bäcker. Brot kann man nun backen in kleineren und mittleren - wir würden sagen: handwerklichen - Bäckereien, natürlich auch in Brotfabriken. Die dezentralisierte, folglich also kleinere - oder mittlere Bäckereien - nach den Grundsätzen der „kleinen oder mittleren Technologie" konzipiert - hat aber, unschwer erkennbar, diese Vorteile: • Brot ist i m allgemeinen zum Frischverzehr bestimmt. Dem kann nur die dezentralisierte Bäckerei, nahe beim Brotkonsumenten, gerecht werden. Anders würden sich praktisch unüberwindbare distributive Probleme aufwerfen. • Die so wichtige gesellschaftspolitische Komponente wurde schon aufgezeigt. Auch in Afrika wird ein selbständiger Bäcker mehr Interesse an der Befriedigung seiner Kunden aufbringen. Wenn überhaupt, so lassen sich so am ehesten staatstragende Schichten heranbilden. • Ein Betrieb in überschaubarer Größe ließe sich eher technisch nach dem Anpassungsvermögen und der Wartungsbereitschaft der Einheimischen konzipieren, dadurch auch das technische Risiko erheblich vermindern. Zudem ist dieses Risiko auch noch auf viele kleine Betriebe gestreut, während der Ausfall eines wesentlich komplizierteren Großbetriebes ernsthafte Versorgungsprobleme aufwerfen würde. Auch dies ist ein Vorzug der in seiner Bedeutung gerade für die dritte Welt nicht zu unterschätzenden kleinen oder mittleren Technologie gegenüber der großen. • Die Risikostreuung hätte auch eine finanzielle Komponente, im Falle personaler und sachlicher Mißgriffe. • Ein in seiner Bedeutung kaum abzuschätzendes, häufig aber übersehenes Moment ist, daß Bäckereien sich als eine Art „Kommunikations- und InformationsZentrum" herausgestellt haben. Sie sind eigentlich immer umlagert. Selbst Verbote konnten die Menschen nicht aus dem Gesichts- und Duftbereich der Bäckereien verdrängen. Materielle Erwartungen spielen gewiß keine kleine, aber ganz sicher nur eine untergeordnete Rolle. In großen Städten, wo wohl auch
310
Edgar Michael Wenz
der Mittelpunkt fehlt - auch hier kein bißchen anders als bei uns - , kann man das am ehesten beobachten; auch dort scheint man den „Dorfbrunnen 4 ', die „Bank bei der Dorflinde" zu suchen. Die Bäckerei also ein Multiplikator - eine Erkenntnis überdies, aus der sich noch mehr machen ließe. • In der Dezentralisierung der Bäckereien könnte durchaus auch ein Politikum liegen: zentralisierte Großbetriebe könnten leicht unter Kontrolle geraten, nicht zuletzt unter illegale. Über die Beherrschung der Brotfabriken könnte ein politisch unerwünschter Druck ausgeübt werden. Es ist zu befürchten, daß diese Erkenntnis über kurz oder lang auch auf anderer Seite gewonnen wird, die daraus aber dann gewiß praktische Konsequenzen zieht, die in ihrer Bedeutung am Anfang wahrscheinlich kaum erkannt werden. Die Besetzung zentraler Brotfabriken hätte dann etwa die gleiche Bedeutung wie die Besetzung von Rundfunkstationen. Wir Deutschen haben eine besondere Affinität zum Brot. Man könnte es „Brotbewußtsein" nennen, ohne damit den ja in jüngerer Zeit sehr geplagten und mißbrauchten Begriff des Bewußtseins erneut zu strapazieren. Die deutsche Hausfrau geht ein paar Straßen weiter zu „ihrem" Bäcker, eher wechselt sie ihren Friseur. Was den Franzosen der Käse, ist den Deutschen das Brot. Nirgendwo sind auch annähernd so viele Brotsorten bekannt, nirgendwo sieht sich ein Bäcker solchen Ausbildungs- und Prüfungsstrapazen gegenüber wie schon lange in der Bundesrepublik. Von hier ausgehend - teilweise von Ausländern hier erlebt, teilweise von Deutschen als Wunsch ins Ausland getragen - haben die deutschen Brotverzehrgewohnheiten dazu beigetragen, daß sich i m Ausland der Brotteller auch quantitativ und qualitativ veränderte. In erster Linie ist es das Brot, das wir der internationalen Küche geschenkt haben. Man kann nicht in den Verdacht nationaler Überheblichkeit geraten, wenn wir feststellen, daß Brot als Nahrungsmittel nicht nur ein Zeichen zivilisatorischen Standes ist; Brot hat für uns kulturelle Höhe. M i t diesen Pluspunkten - die durchaus dazu angetan sind, das, und nicht nur gastronomisch, ramponierte Ansehen des Deutschtums i m Ausland aufzupäppeln wußte man bislang nichts anzufangen, geschweige denn hat man mit diesem ideellen Kapital gewuchert. So ist eigentlich die internationale Brotwelle aus dieser Sicht an uns spurlos vorübergegangen. Hier ein Beispiel: in Hollywood gibt es eine große Bäckerei, die mehr als 60 Brotsorten unter allerlei, meist geographischen Namen anbietet. Nicht eine einzige, die auf deutsche Herkunft schließen ließe, befindet sich darunter - obwohl man erkennbar krampfhaft versucht, deutsche Roggenmischbrote oder Roggenbrotsorten zu kopieren . . . Es kann freilich nun nicht darum gehen, mit der Einrichtung von lokalen Bäckereien auch gleich deutsche Brotsorten oder gar Weizenkleingebäck wie knusprige Brötchen oder raffinierte Feinbackwaren einzuführen. Es geht um das Brot, wie es aus den einheimischen Ressourcen sich eben herstellen läßt. Die eigenen Möglichkeiten auszuschöpfen - da liegt ein weiteres Betätigungsfeld.
Vom Brot und Entwicklungshilfe
311
In den meisten Entwicklungsländern wachsen genügend Landesprodukte, die zu Getreide- oder Stärkemehlen verarbeitet werden können. Wenn sie zu Brot und Backwaren verbacken werden sollen, bedarf es allerdings der Vermischung mit Weizenmehlen. Ein bedeutendes Landesprodukt ist in tropischen Regionen die Cassava (Maniok, Yuka, Mandioco, Tapioka [bot.: Manihot utilissima]). Botanische Landkarten weisen aus, daß ein ganzer Gürtel sich um den Erdkreis schlingt. Die Cassava, besonders stärkereich, ist auch das Hauptnahrungsmittel auf den Dörfern, meist als Brei zubereitet. In Dürre-Zonen spielen eine bedeutende Rolle (und könnte aber eine noch größere Rolle spielen) verschiedene Sorgen von Grasgetreide wie Hirse (Süßgräser, „Kaffernkorn", „Mohren-Hirse", „Sudangras" und Kaoliange (bot.: Sorghum vulgaris). Dann gibt es in vielen Zonen auch noch Früchte des Landes, die reich an Protein und Vitaminen sind, so etwa die Kerne des Johannisbrotes (bot.: Ceratonia siliqua). Durch die Verarbeitung von Landesprodukten wird zweierlei erreicht, nämlich • die Einheimischen finden den vertrauten Geschmack wieder, lassen sich dann auch leichter zum Brotkonsum hinführen, • die eigenen Getreidevorräte werden gestreckt, Devisen zum Import gespart, auf die die Entwicklungsländer durchwegs beim derzeitigen Stand der eigenen Agrikultur angewiesen sind. Die Chancen von Mischbrot unter Beimengung von Mehl/Stärke aus tropischen Knollen und Wurzeln oder aus Dürre-Gräsern sind schon häufiger erkannt worden. Es gilt nur, diesen Weg konsequent, auch gegen Widerstände, durchzusetzen. Solche Widerstände können sich auch in Hoffnungen artikulieren, durch Züchtung oder/und Gen-Manipulation könnten Weizensorten in den tropischen oder Dürre-Zonen über kurz oder lang gedeihen, die alle anderen Überlegungen überflüssig machten. Das ist sicherlich ein erstrebenswertes Ziel, das aber keineswegs so greifbar nahe ist, um andere Bemühungen deshalb zu vernachlässigen, hier einmal abgesehen davon, ob es nicht - ungeachtet der Verfügbarkeit von Weizenmehlen - durchaus sinnvoll und nicht minder erstrebenswert sein sollte, ein für die jeweiligen Entwicklungszonen typisches und regionalspezifisches Brot (das durchaus etwas anders schmecken darf als beispielsweise europäisches) zu entwickeln und zu pflegen - etwa ein „Afrika-Brot". (Dieser nun eingeführte Begriff „Afrika-Brot" ist selbstverständlich als Synonym für alle Brote gebraucht, die unter Beimischung von Landesprodukten des jeweiligen Kontinents erbacken werden.) Die Chance des Mischbrotes unter Beimengung von Mehl/Stärke aus tropischen Wurzeln ist hie und da erkannt worden. In Nigeria bemüht sich das Federal Institute of Industrial Research in Oshodi beispielsweise erfolgreich darum. In
312
Edgar Michael Wenz
Kamerun sind auch Ansätze erkennbar. In Obervolta wird der Maniokanbau in deutscher Privatinitiative gefördert, eine hervorragende Voraussetzung zum nächsten Schritt - zum Maniok- / Weizen-Brot. Flankierend müßten natürlich auch Bäcker ausgebildet werden, die mit den modernen Technologien - auch die kleinen und mittleren Technologien erfordern Fachkenntnis - umzugehen wüßten. Das würde genau in den Rahmen der „Technischen Hilfe" passen. Eigentlich ist kein vernünftiger Grund zu erkennen, warum die technische Hilfe sich überwiegend mit eisenverarbeitenden Berufen befaßt, jedoch kaum oder eigentlich nie mit dem agrikulturellen Endprodukt, dem Brot ob es nun schon Volksnahrungsmittel ist oder ob es das werden soll. Die wirtschaftliche und hygienische Herstellung von Brot zu lernen, empföhle sich die Einrichtung von Muster- und Lehrbäckereien; diese könnten i m Regelfall sich sogar durch den Verkauf von Backwaren oder die Belieferung sozialer und karitativer Einrichtungen rentieren. Diese hätten gewiß mehr Sinn, als - um nur ein beobachtetes Beispiel zu nennen - an westafrikanischen Harthölzern Schnitzer ausbilden zu wollen. Die Ausbildung zu Bäckern würde - sogar i m eigentlichen Wortsinn - zum Technologie-Transfer gehören, der sogar noch den Vorzug hätte, sich relativ problemlos praktizieren zu lassen. Technische Hilfe könnte sich auch erstrecken in besonderen Notzeiten und Katastrophenfällen auf den Einsatz fahrbarer (transportabler) Bäckereien. Gerade bei Bemühungen um Brot, Bäcker und Backen würde noch ein nützlicher Nebeneffekt für die Bundesrepublik Deutschland abfallen: nicht mehr und nicht weniger als ein Prestige-Gewinn in den Augen der einheimischen Bevölkerung. Es mag mehr Mühe sein, viele kleine Bäckereien auszurüsten und damit korrespondierend Bäcker auszubilden als etwa ein zentrales modernes Hospital einzurichten. Es soll auch hier nicht gewogen werden, was mehr „wert" ist. Aber dies dürfte sicher sein: Die weitaus meisten Einheimischen wissen in der Regel nicht, wem das neue Hospital zu verdanken ist; oder gar wer Operationssaal und Labor eingerichtet hat; aber sie kennen genau das Herkunftsland der Bäckereieinrichtung. Das haben zwar private, aber sorgfältig angestellte Ermittlungen ergeben. Hospitäler sind nicht nur in den Augen von Afrikanern ohnehin nur für den Nachbarn gedacht, weil man sich selbst mit dem Gedanken von Krankheit und Tod gar nicht erst konfrontiert sehen will. Bäckerei und Brot sind für diese Leute wesentlich interessanter, wesentlich wichtiger; sie sind gewissermaßen der Inbegriff des Lebens. Sie sind konkret, faßbar. M i t Stolz nennen manche dunkelhäutige Bäcker ihren Betrieb „Deutsche Bäckerei", auch wenn nur ein Teil derselben, etwa der Backofen als Kernstück, deutschen Ursprungs ist. Dieser Begriff steht dann für deutsche Qualität insgesamt - ein Prädikat überdies, das die deutsche Bäckereitechnik mit Recht für sich in Anspruch nehmen kann. Die Bäckereitechnik - deren Anbieter überdies auch mittelständische Betriebe zuzuordnen sind - gehört noch zu jenen internationalen Bastionen, die noch einigermaßen fest in deutscher Hand sind,
Vom Brot und Entwicklungshilfe
313
nachdem in den letzten Jahren so manches Fort deutscher technischer Überlegenheit geschleift werden mußte. Fazit: Die Forderung „Brot für die Welt!" könnte auch aus einer anderen Perspektive als jener der Barmherzigkeit gesehen werden.
Unsere Aufgabe: Die Entwicklungsländer* Schon vor Jahrzehnten fanden die Entwicklungsländer, die ärmsten darunter, unsere und meine besondere Aufmerksamkeit. Das Ergebnis waren Überlegungen, inwieweit die dort wachsenden Landesprodukte aus den tropischen (Knollen, Wurzeln und Früchten) und trockenen Zonen (Gras-Getreide) - die mancherorts reichlich gedeihen - auch zur Verwertung i m oder zum Brot gewonnen werden können. Neben Versuchen - so beispielsweise die Präsentation auf der Internationalen Bäkkerei-Fachausstellung 1971 in Berlin - sind Denkschriften zu diesem Thema an die betreffenden und eigentlich betroffenen Regierungen und Institutionen ergangen. Vereinzelt wurden diese Ideen aufgegriffen. Auch wenn sich i m Moment noch kein echter Erfolg abzeichnet, wird sich eines Tages dieser Gedanke weitertragen. Daß die stärkereichen tropischen Landesprodukte in ihrer Ausschöpfbarkeit noch gar nicht richtig erkannt worden sind, darauf konnte schon früher hingewiesen werden. Auch meine Studie ,Brot in Entwicklungsländern' ist in jener Zeit verfaßt und auch in andere Sprachen übersetzt worden. Deutsche Regierungen haben die darin steckenden Möglichkeiten nicht erkannt, andere dagegen durchaus. So ist es nach wie vor schmerzlich, daß in vielen Ländern immer noch nicht bekannt ist, daß unser Volk das gewiß stärkste ,Brotbewußtsein' besitzt - wie gerne jeder bezeugt, der länger i m Ausland gelebt hat. Ideeller und materieller Nutzen konnte i m möglichen Maße bislang aus dieser unbestreitbaren Tatsache nicht gezogen werden. Dennoch soll unverdrossen in dieser Richtung weitergearbeitet werden 1 . In den langen Jahren praktischer Entwicklungshilfe haben sich viele der Erkenntnisse, die schon vor einer Generation gewonnen wurden, sehr viele sogar, verdichtet. Es gab aber auch eine Reihe neuer Einsichten, die eigentlich die schon bekannten nur erweitert und ergänzt haben. Eine sehr wichtige Erkenntnis ist: Jede Entwicklungshilfe ist zum Scheitern verurteilt, die sich selbst und ihre Aufgaben nicht ganz klar definiert. So muß präzise unterschieden werden zwischen • Ernährungshilfe als humanitär-karitative Hilfe in den Entwicklungsländern, beispielsweise ,Welthungerhilfe'; sie ist eine karitative Maßnahme aus den reichen Ländern zugunsten der armen, insbesondere in Notlagen, ohne Rücksicht darauf, * Erstveröffentlichung in: Edgar Michael Wenz, Anmerkungen ... Eine Aufsatzsammlung, Würzburg, 1988, S. 107 ff. 1 Soweit der Text des Vorworts zum 1979 erschienenen Beitrag.
Unsere Aufgabe: Die Entwicklungsländer
315
ob die Notlagen nun unverschuldet (Erdbeben) oder verschuldet, somit vermeidbar sind (wie etwa beharrliches Verweilen in Dürrezonen, mangelnde Akzeptanz rationaler Arbeitsmethoden usw.). Die Ernährungshilfe ist situativ und entsprechend zu konditionieren; und • reale technisch-ökonomische Entwicklungshilfe als ,Hilfe zur Selbsthilfe'; sie kann nur das eigene Anliegen recht verstandener Entwicklungshilfe sein. Die Entwicklungshilfe ist auf Dauer angelegt und entsprechend zu konzipieren; Zeitpunkt und Phase für die geeigneten Maßnahmen können auch während oder nach der Selbsthilfe einsetzen. Der Entwicklungshilfe mit diesem Verständnis gilt auch unsere Aufmerksamkeit. A n diesen Kriterien, die gewiß verständlich sind 2 , sich zu orientieren und streng zu unterscheiden, ist von existenzieller Bedeutung, wenn man entwicklungspolitisch vorankommen will. Bevor die Entwicklungshilfe notwendige Rationalisierung erfährt, muß sie erst disemotionalisiert werden. Die häufig gewohnheitsmäßige, von interessierten Kreisen bewußte Vermengung zwischen der humanitären Ernährungshilfe und einer realen Entwicklungshilfe erschwert rationale Diskussionen, macht sie häufig sogar unmöglich, weil die Hilfe-Empfänger und die ,Frommen' in unserem Lande die zweifellos enge Verzahnung dazu nutzen, eigentlich mißbrauchen, um unbequemen Entscheidungen ,Appelle an die Menschlichkeit' entgegenzuhalten. Man kann durchaus häufig den Eindruck von Erpressungsversuchen haben. Argumentativ verlangt die rationale Gegenposition die unbedingte Entflechtung beider Komplexe. Das beginnt mit begrifflich-semiotischen Operationen. Es darf keine Diskussion zum Thema Entwicklungspolitik überhaupt aufgenommen werden, bevor nicht eine ganz klare Definition verlangt wird, ob nun von Ernährungshilfe oder von Entwicklungshilfe gesprochen wird. Sicherlich dient die Entwicklungshilfe dazu, auch Ernährungshilfe zu leisten, oder genauer: sie für alle Zeiten überflüssig zu machen. Aber es handelt sich um verschiedene Materien. Nur die Anlegung radikaler Maßstäbe vermag da weiterzuhelfen. Die Gefahr der Vermischung beider Ziele ist sehr groß, die Grenzen sind ja auch fließend 3 . Emotionale Gründe lassen sich auch leichter und kurzfristig wirkungsvoller darstellen. Rationalität hat es in ihrer Nüchternheit und Sachlichkeit, eigentlich auch in ihrer Strenge, viel schwerer. Die Menschen aus der Sahelzone beispielsweise umzusiedeln, ist ein weit härteres Stück Arbeit, zudem weit unpopulärer (zumal in 2
Interessant dazu das Buch von Ferdinand N. Glinz »Entwicklungsförderung am Wendepunkt', 1986; Glinz trifft auch die richtige Unterscheidung zwischen humanitär-karitativer und ökonomisch-technischer Hilfe. 3 Auch die Anhänger der ,Dependenz'-Theorie fänden keine Angriffspunkte, ebenso wenig wie die ,Strukturalisten\ weil daraus weder Abhängigkeiten noch Störungen der geplanten Abfolgen sich ableiten ließen.
316
Edgar Michael Wenz
einem Lande wie die Bundesrepublik, wo Mobilität auf dem Arbeitsmarkt nach wie vor unpopulär ist), als etwa Lebensmittel zur Verfügung zu stellen, obwohl man sicherlich schon erkannt hat, wie technisch schwierig schon deren Verteilung ist. A l l dies ist wohlbekannt, vermochte aber dennoch den Blick für das Wesentliche zu verstellen. Und das ist nun einmal die reale - man kann auch i m weiteren Sinn sagen: technische - Entwicklungshilfe. Es bedarf nur des Mutes, auf populistischen Beifall und Popularität zu verzichten. Aber offenbar ist das leichter gefordert als getan 4 . Entwicklungshilfe ist unser Erkenntnisziel, die sich allerdings auf die Aufgaben der Ernährungshilfe konzentriert. So verhalten sich die beiden Erkenntnisziele, um Begriffe aus der Wissenschaftstheorie zu gebrauchen, etwa wie Material- und Formalobjekt. Es geht also um Entwicklungshilfe mit dem Ziel, Ernährungshilfe gar nicht mehr zu brauchen. Bemühungen um eine so verstandene Entwicklungshilfe lenken den Blick auf die Methode, wie die Wirtschaft der jeweiligen Entwicklungsländer organisiert sein soll, die Gretchenfrage also nach der Wirtschaftsordnung. Nach den Erfahrungen der Geschichte bietet sich keine andere Wirtschaftsordnung an als jene der freien Wirtschaft, sicherlich in der Version der sozialen Marktwirtschaft. Die Wirtschaftsordnung des Marktes hat sich überall und immer allen anderen Ordnungen überlegen gezeigt, und zwar so deutlich und durchgreifend überlegen, daß man sich eigentlich wundern muß, warum die Frage nach der Wirtschaftsordnung immer wieder auftaucht. Wenn doch wo Ressourcen und Güter knapp sind, dann ist das doch in den Entwicklungsländern. Und wie man mit knappen Gütern am wirksamsten umgeht, das hat man in den freien Märkten sehen und lernen können. Gewiß wird ein freier Markt zu Ungleichheiten führen, am Anfang noch stärker als dann, wenn sich der Markt echt etabliert hat, wenn also auch die Kontrolle durch Konkurrenz hinzugekommen ist. Eine vielleicht aus ethischen Gründen unbefriedigende Übergangsphase muß hingenommen werden, weil nach den Erfahrungen der Geschichte eine erst einmal auf Verwaltungswirtschaft - oder gar auf sozialistische Ökonomie der Plan- und Zwangswirtschaft - aufgebaute Wirtschaftsordnung erfahrungsgemäß nicht in eine freie Wirtschaft übergeführt wird. So sicher man einem freien kleineren Gewerbetreibenden Afrikas, etwa einem selbständigen Bäcker, vertrauen darf, daß er die Kräfte des Marktes freilich zu seinem Vorteil, aber auch zu jenem der Brotkonsumenten zu nutzen weiß, so sicher muß man sich auch sein, daß aus den gleichen anthropologischen Gegebenheiten heraus die Planer und Kommandeure sich nicht selbst auflösen. 4 Nach Werner Lachmann (,Leben wir auf Kosten der Dritten Welt?', 1986) liegt die Hauptschuld des Westens darin, der Dritten Welt die ,Geheimnisse' seines wirtschaftlichen Erfolges nicht faßbar übermittelt zu haben, nämlich seine marktwirtschaftliche Konzeption.
Unsere Aufgabe: Die Entwicklungsländer
317
Bemerkenswert sind zu diesem Thema aus jüngerer Zeit: Die Untersuchungen des IFO-Instituts 1982. 5 Es wurde hier ein Nachweis geliefert, daß freie Wirtschaftsordnungen effizienter sind als dirigistische, wofür gerade die Beispiele jeweils benachbarter Staaten (Nordkorea / Südkorea, Kenia / Tansania, T a i w a n / V R China) das am eindrucksvollsten belegen 6 . Auch die Unctad ( V I I ) hat marktwirtschaftliche Elemente untersucht 7 . Auch verschiedene Weltentwicklungsberichte der Weltbank (so 1982, 1983 und 1987) lassen diese Thematik deutlich anklingen 8 . Die Empirie stützt nun auch hier die (vom Verfasser schon vor Jahrzehnten aufgestellte) Theorie. Daß auch gleichzeitig - und das ist auch bezeichnend - Kritiken an den bisherigen Praktiken laut wurden, war zu erwarten 9 . Es könnte aber durchaus auch die Forderung erhoben werden, i m Sinne einer rationalen und effizienten Verwertung von Entwicklungshilfegeldern das Postulat so zu konditionieren, daß - wenigstens in groben Zügen - eine freie Wirtschaftsordnung festgeschrieben ist und auch ausgeübt wird. In den westlichen Industriestaaten mehren sich die Forderungen, die Entwicklungshilfe nur noch jenen Staaten zu gewähren, die eine demokratische - i m Sinne der parlamentarischen Demokratie 1 0 - Verfassung haben und diese praktizieren. Das ist mit Sicherheit ein richtiger Schritt, weil in aller Regel diese Verfassungen zwar nicht zwingend, aber doch in der Praxis auch ein freies Wirtschaften zulassen.
5 Siehe Kurzfassung in: ,Mehr Markt: Ein Rezept für Entwicklungsländer? Ein empirischer Beitrag zur ordnungspolitischen Diskussion'; Ifo-Schnelldienst 10-11 /1985, S. 14 ff. Darauf aufbauend Egon Tuchtfeld, Ordnungspolitische Konzepte in der Dritten Welt, in: Marktwirtschaft draußen (Grundlage: Symposium Ludwig-Erhard-Stiftung, Stuttgart 1982). 6 In diesem Sinn auch Konrad Neundörfer, in: Die Dritte Welt und die Marktwirtschaft, in: F.A.Z. vom 8. 8. 1987. 7 So beispielsweise Wolfram van den Wyenhergh, in: Unctad entdeckt die Marktwirtschaft, in: F.A.Z. vom 4. 8. 1987. 8 Hierzu mehr bei: Hans-Peter Fröhlich, Mehr Marktwirtschaft - auch in Entwicklungsländern; siehe dort auch weitere Literaturangaben. 9 So etwa Jürgen B. Dönges, ,Hunger inmitten von Überfluß', in: F.A.Z. vom 7. 2. 1987; »Strategien zur Entlastung der Dritten Welt', in: F.A.Z. vom 4. 8. 1987; ,Zu verlustreich, zu schlecht und zu spät', in: F.A.Z. vom 25. 8. 1987. 10 Häufig wird in die Diskussion die Wahrung der Menschenrechte als Erfordernis für jede Art von Hilfe genannt. Hier geht es aber um einen politisch-moralischen Aspekt, freilich von größter Bedeutung, aber doch einer anderen Kategorie zuzuordnen. In der Praxis freilich wird dieses Kriterium keine Rolle spielen, weil für alle Staaten mit freien Wirtschaftsordnungen den Menschenrechten längst die gebührende Bedeutung kraft Gesetzes, häufig sogar kraft Konstitution, eingeräumt worden ist. (Gleiche Bedenken müßte man gegen Kriterien geltend machen, wie sie beispielsweise im NATO-Vertrag vom 4. 4. 1949, Art. 10 und 2, aufgestellt werden; danach können Mitglied nur solche Staaten werden, die die freiheitliche Demokratie und ihre Grundsätze gewährleisten und fördern. Probleme der Wirtschaft lassen sich aber am besten mit Mitteln lösen, die auf ihrem Felde gewachsen sind.)
318
Edgar Michael Wenz
Staaten mit einer einigermaßen freien Wirtschaftsordnung werden - die Erfahrungen der Geschichte, insbesondere der jüngeren Geschichte beweisen das - recht bald in parlamentarisch-demokratische Verfassungsformen übergehen. (Ein aktuelles Beispiel: I m Sommer 1987 die Hoffnungen, die man auf den neuen Wirtschaftskurs Gorbatschows für den Ostblock setzt.) Wenn Diktaturen der Überlegenheit einer relativ freien Wirtschaft wegen diese Ordnung zugelassen haben, trennten sie sich dann doch, notgedrungen, davon, weil eine freie wirtschaftliche Entfaltung auf Dauer nicht denkbar ist ohne politische Freiheit 1 1 . Umgekehrt geben parlamentarische Demokratien relativ schnell planwirtschaftliche Versuche wieder auf oder werden abgewählt, weil eben wirtschaftliche und politische Freiheit untrennbar sind 1 2 . Dem Einwand, sozialistische Gesellschafts- und Staatsformen würden einen politisch-edukatorischen Ausgleich verschaffen können für das historische Defizit der Völker und Stämme in den Entwicklungsländern, die Phase des Absolutismus zwar erlitten, nicht aber die Phase der Aufklärung durchlaufen zu haben. Darauf folgt häufig der Vorwurf, individualistisch-liberale bürgerliche und politische Rechte würden nur dem inhumanen Kapitalismus Vorschub leisten, der einer sozialen und wirtschaftlichen, auch einer kulturellen Entwicklung nur entgegenstünde. Diese Forderungen relativieren sich sehr schnell, wenn man sich die Leute näher ansieht, die sie erheben; meist sehen sie sich berufen, die Bedürfnisse zu definieren, die Weisungen zu deren Beseitigung zu erdenken und auszugeben und Kontrollen auszuüben. Wenn es also stimmt, daß die historische Entwicklung der jungen Staaten der Dritten Welt die Herausbildung politischer Meinungen und Überzeugungen nicht erlaubte, Fähigkeiten und Möglichkeiten eher gehindert statt gefördert wurden - eine Mehrheit geht davon aus - , wäre es eigentlich um so zwingender, diesen Menschen den politischen Reifeprozeß nicht zu erschweren, indem man ihnen auch noch die Entwicklung einer - freilich nicht problemlosen freien Wirtschaftsordnung vorenthält. Somit verbietet es sich auch, plan- und zwangswirtschaftliche Wirtschaftsverfassungen als die einzige Lösung anzupreisen, weil die Menschen in Afrika und Asien (und offenbar auch in Lateinamerika) nicht ,reif' seien. Sozialismus soll also die Aufklärungszeit gewissermaßen ersetzen oder sich gleich also bewährte Staats- und Gesellschaftsform, die den Nachvollzug unterbliebener historischer Prozesse vergessen läßt, überflüssig machen. Da die Absicht der Protagonisten klar und eindeutig ist, braucht man auf die Argumente nicht einzugehen. Der Beweis des Versagens - auf jeden Fall einmal wirtschaftlich - ist evident. Auch wenn die formulierten Menschenrechte expressiv die Formen der wirtschaftlichen Betätigung und Entfaltung nicht angeben, beweisen die geschichtlichen Erfahrungen die vergleichlos größere wirtschaftliche Effizienz für alle Kreise der Bevölkerung, darauf aufbauend den größeren sozialen Spielraum auch für kulturelle Entwicklungen 1 3 . 11 12
Beispiel für Deutschland: die Zeit von 1933 bis 1937. Beispiele: die Misere der französischen Planificateure und britischer Labour-Regierung.
Unsere Aufgabe: Die Entwicklungsländer
319
Es handelt sich bei dem ganzen Problem vordergründig und tatsächlich in erster Linie um ein wirtschaftliches; deshalb sollte auch bei der Wirtschaftsordnung der Hebel angesetzt werden - in der zuversichtlichen Hoffnung, daß demokratischparlamentarische Formen sehr schnell nachfolgen werden. Eine freie Wirtschaftsordnung wäre die beste Gewähr dafür, daß die Produktionsmittel auf viele freie Hände verteilt werden - nach den Erkenntnissen und Lehren der Geschichte eine eigentlich unersetzbare Voraussetzung nicht nur für eine effizient funktionierende Wirtschaft, sondern auch für die Herausbildung einer staatstragenden Mittelschicht, einer - zumindest - wichtigen Bedingung für das Gedeihen der jungen Staaten der Dritten Welt. Die Vorstellungen von vielen jungen selbständigen Bäckern und Bäckereibesitzern in Afrika beispielsweise sind sehr realistisch, solche Pläne sind längst verwirklicht. Das Beispiel steht eigentlich für alle handwerklichen Berufe und Kleingewerbetreibenden. Hier würde sich mit Gewißheit eine prägende Kraft bilden. Diese Idee hat etwas Faszinierendes, ist aber keineswegs eine Utopie. Dafür gibt es schon viel zu viele hervorragende Beispiele 1 4 . Die Frage nach den Schuldenproblemen der Entwicklungsländer - seit Jahren ein Dauerthema zwar, das sich aber offensichtlich nicht löst, sondern immer mehr verschärft - kann man nicht durch noch so kluge Entschuldungs- und Umschuldungskonzepte aufheben. Nur eine effiziente Wirtschaft vermag das zu leisten. In absehbarer Zukunft werden sich die Entwicklungsländer auch mit Fragen des Umweltschutzes befassen müssen, die sie i m Augenblick gar nicht interessieren; die Menschen dort fühlen sich von derartigen Lasten (,Wir haben andere Sorgen 4 ) nicht betroffen. Aber dieses Problem wird man, wenn einmal die Entwicklungshilfe gegriffen hat und man wirtschaftlich auf eigenen Beinen steht, mit Sicherheit anders sehen. Und wie die derzeitigen Erfahrungen lehren, lassen sich die ökologischen Aufgaben in einer freien Wirtschaft am ehesten lösen. M i t Recht wird häufig eingewandt, daß es keinen Hunger mehr in der Dritten Welt zu geben brauche. Es seien genügend Lebensmittel vorhanden, um eigentlich mehr als nur die Grundnahrungsmittel bereitzustellen. Das soll man auch bei Überlegungen zum Brot - dem Ausgangspunkt unseres Interesses - richtig sehen. Hier werden zwei weitere Probleme der Entwicklungsländer erkennbar. Zunächst sagen viele, daß die vorhandenen und erreichbaren Nahrungsmittel ohnehin verzehrt werden, so daß kein Grund zu erkennen sei, warum diese erst vermählen und gebacken werden sollen. Hier muß man sich der Grundüberlegung entsinnen, 13 Aus dieser Sicht wäre eine so konzipierte Entwicklungshilfe auch ein Anliegen für die politischen Stiftungen in der Bundesrepublik. 14 Der Autor kennt jedenfalls genügend Afrikaner, die in der Lage wären, kleinere und mittlere Bäckereien ordnungsgemäß, d. h. ökonomisch-rational zu führen und auszubauen. Eine andere Auffassung wäre auch nur ein neuer Aufguß der Hybris der Weißen, es als unabänderlich zu halten, daß die Erkenntnisse von Adam Smith und die politischen Praktiken Ludwig Erhards nicht auch dem schwarzen Mann Weisung zu geben vermöchten.
320
Edgar Michael Wenz
daß Brot eben nicht nur ein nahrhaftes, sondern auch besonders hygienisches Nahrungsmittel ist; zudem kann Brot sehr bequem als Vehikel für andere Nährstoffe, wie etwa Eiweiße, Vitamine usw., dienen. Der zweite Einwand trifft den internen Ausgleich mit Nahrungsmitteln von einem Land zum anderen, von einer Zone zur weiter entfernten. Es würde wenig nützen, daß beispielsweise in Afrika insgesamt genügend Nahrungsmittel gedeihen, diese aber nicht an die Regionen und Orte der Bedürfnisse transportiert werden können. Hier zeigt sich freilich der eklatante Mangel an Energie, besonders auch Energie für Transport, etwa Treibstoff. Die geringe verkehrstechnische Infrastruktur Afrikas erlaubt kaum andere Transportmittel. Das ist möglicherweise das eigentliche Problem der Dritten Welt: Der Energiemangel. Nicht die fehlende (oder gar nicht beischaffbare) Nahrung ist ein Mangel, unter welchem die Entwicklungsländer leiden. Es ist der Mangel an Energie, der selbst in die Ernährungsfrage hineinwirkt. Freilich wird sofort ein Versäumnis der Industriestaaten erkennbar, man sollte eigentlich sagen: eine schwere Schuld. Etwa 20% der Weltbevölkerung in den Industriestaaten verbrauchen etwa 80% der auf der Welt verfügbaren Energie. Und trotz dieses unproportionalen, geradezu rücksichtslosen Energieverbrauchs sind weite Teile der Bevölkerung in den Industriestaaten nicht bereit, Restrisiken auf sich zu nehmen, die bei der Energiebeschaffung durch Hochtechnologie 1 5 zwangsläufig entstehen. Der Mangel als Transportenergie ist allerdings nur eine Komponente des eklatanten Energiemangels. Wirkliche technische Entwicklung der Dritten Welt - wobei man noch gar nicht an Industrialisierung zu denken braucht - verlangt Energie. So ist Entwicklungspolitik auch gleichzeitig Energiepolitik. Unsere Interessen müssen sich also schwergewichtig auf Entwicklungshilfe i m bereits definierten Sinne, nicht aber nur auf Ernährungshilfe richten. Hier nur fallen die beiden Arten von Hilfe zusammen. Das beweist, daß richtig betriebene Entwicklungshilfe die humanitäre Ernährungshilfe überflüssig machen kann und machen wird. U m so mehr gilt der Aufruf, die ernährungswirtschaftliche Autarkie in den Entwicklungsländern i m allgemeinen zu fördern und die Bereitstellung von Brot aus eigener Kraft voranzutreiben. Diese Aufgabe könnte sogar zu einem Muster- und Pilot-Projekt werden. Ein weiteres Argument sollte nicht gering erachtet werden: Brot ist zum Frischverzehr bestimmt. In der Frische entwickelt es auch die höchste Geschmacksqualität; das gilt erst recht für Mischmehl-Sorten, an die die Bevölkerung erst herangeführt werden muß, obwohl der vertraute Geschmack der Landesprodukte diesen Weg erleichtert. Diese Erkenntnis allein fordert eine Vielzahl von kleinen Bäckereien in der Stadt und über das Land verteilt. 15
Den Entwicklungsländern beispielsweise ist der Betrieb von Kernkraftwerken nicht zuzumuten. Sie können ihnen auch derzeit nicht anvertraut werden.
Unsere Aufgabe: Die Entwicklungsländer
321
Zentralisierte große Bäckereien industriellen Zuschnitts können diese Leistungen gar nicht erbringen; bis zum Konsumenten verstreicht viel zuviel, kaum kontrollierbare Zeit, ganz abgesehen noch von der fehlenden Infrastruktur (Straßen und Transportmittel). Nach alledem, was man in aller Welt beobachten kann, dürften eigentlich die Vorteile einer dezentralisierten Wirtschaftsordnung (,small is beautiful') kaum mehr bestreitbar sein. Frühere und aktuelle Erfahrungen lehren, daß Bäckereien in Stadtteilen und Dörfern eine Art,Kommunikationszentrum' bilden. Die Bäckerei hat auf dem Dorf eine ähnliche Funktion wie früher bei uns die ,Bank an der Dorflinde'. Brot bedeutet Leben. Kostspielige Laboreinrichtungen oder Operationssäle für Krankenhäuser dagegen sind für die meisten weniger interessant. Krank werden ohnehin nur die anderen. Das eröffnet allen jenen, die sich in Bäckereien engagiert haben und darzustellen wissen, günstige Chancen zur »SympathieWerbung' (die wir durchaus recht gut gebrauchen könnten). In der Tat, mit Stolz nennen viele afrikanische und asiatische Bäcker mit deutscher Bäckereitechnik ihren Betrieb ,Deutsche Bäckerei'. Führt man diesen Gedanken konsequent weiter, so muß man erwarten dürfen, daß effiziente Wirtschaftsordnungen in den Entwicklungsländern nach gewisser Zeit mit ihren Produkten nach außen drängen. Und tatsächlich, eine Reihe früherer Entwicklungsländer, insbesondere aus dem asiatischen Raum, sind mittlerweile auf Exportmärkten in harte Konkurrenz mit Anbietern aus den Industriestaaten getreten. Das ist freilich eine gesunde Entwicklung. Verständnis für Marktwirtschaft fordert auch den Verzicht auf protektionistische Maßnahmen zum - ohnehin nur scheinbar - eigenen Nutzen, verlangt offene Märkte. Nur so können sich die Entwicklungsländer langsam in das System freier Wirtschaften eingliedern 1 6 . Man kann aber auch Verständnis für jene haben, die nicht gerade den Sinn ihrer Arbeit darin sehen, sich auch noch eigene Konkurrenz hochzuzüchten. Aber alle diese Überlegungen, die durchaus in Bedenken ausmünden könnten, dürfen in diesen Zusammenhängen gänzlich ausscheiden. Brot und Backwaren sind zum unmittelbaren Verzehr bestimmt, zum Exportgut völlig ungeeignet. Entwicklungshilfe für Bäckerei und Brot ist typisch wie kaum eine andere, auf infrastrukturelle Erfolge ausgerichtet. Re-Exporte sind mit Sicherheit nicht zu befürchten. Es macht durchaus Sinn, auch diesen Aspekt zu sehen. Auch ,gute Taten' fallen leichter, wenn man sie nicht gar zu teuer bezahlen muß . . . 16 Erfreulicherweise sind diese und ähnliche Gedankengänge Gegenstand der Verhandlungen und auch des Schlußprotokolls der Unctad VII in Genf, Juli 1987, gewesen. Die Erkenntnis, daß marktwirtschaftliche Grundprinzipien die beste Effizienz versprechen, auf der anderen Seite aber auch entsprechende Öffnung der Grenzen und Märkte in den Industriestaaten voraussetzen, scheint sich zusehends durchzusetzen. Der Autor registriert das mit Genugtuung, nachdem er sich schon seit den fünfziger Jahren für genau diese Ideen eingesetzt hat.
21 Gedächtnisschrift Wenz
6. Historisches
Michael Ignaz Schmidt als .erster deutscher Geschichtsschreiber"* Dies ist eine Erwiderung auf den Beitrag von Christina Sauter -Ber gerhausen „Michael Ignaz Schmidt - erster Geschichtsschreiber der Deutschen?", zugleich auch auf die verneinende Anmerkung von Prof Baumgart in seinem Schlußvortrag, die offenbar auf Erkenntnissen des Beitrages von Saute r-Bergerhausen beruht.** Zunächst stellt sich die Frage, ob wissenschaftliches Erkenntnisinteresse überhaupt besteht, welche - zeitliche - Stellung ein Historiograph einnimmt. Gerade Historiker sehen die Verhältnisse einer Zeit oder einer Epoche in ihrer Gesamtheit, in die alle geschichtlichen Gestalten, so auch Historiographen, eingebettet sind. Wer nun zuerst war und wer später, scheint in solchen Zusammenhängen unwichtig, anders als in den Naturwissenschaften und insbesondere der Technik, wo der Zeitpunkt der Einreichung, schon länger nach Minuten gemessen, für den Urheberschutz ein entscheidendes Datum ist. Die gestellte Frage nun, ob Michael Ignaz Schmidt wirklich „der erste Geschichtsschreiber der Deutschen 4 ' war oder nicht, hat eine Vorgeschichte: I m Geburtsort des Michael Ignaz Schmidt, in Arnstein, einem alten Landstädtchen i m Landkreis Main-Spessart, vormals Hochstift Würzburg, wird das Andenken an den Landsmann gepflegt. Man ist (darunter auch der Autor) der Meinung, daß sein Andenken in der deutschen Historiographie besser bewahrt werden müßte. Inwieweit da Lokalpatriotismus mitspielt, ist für die Fragestellung zweitrangig. Vielleicht ist auch der Sinn für Gerechtigkeit und Fairneß in der Landbevölkerung mehr ausgeprägt als i m nüchternen Wissenschaftsbetrieb. Nun hat man in Arnstein nie etwas anderes gehört, als daß Schmidt dieses ehrenvolle Prädikat des ersten Geschichtsschreibers der Deutschen zukommt. Man hält es auch nicht für unbedeutend, ob jemand in einer Zeitströmung mitschwimmt oder vorneweg. Die Anerkennung, der erste seiner Zunft gewesen zu sein, hätte wohl dem Landsmann das wohlverdiente Ansehen und das „Erstgeburtsrecht" zurückgewonnen. Diese Meinung von der Pioniertat Schmidts war sicherlich durch Lokalpatriotismus weitergetragen und gepflegt worden, aber nicht erst durch ihn entstanden, sondern durch belegbare Gründe. Da ist j a immerhin Franz Oberthür, der Schmidt an * Erstveröffentlichung unter dem Titel „War Michael Ignaz Schmidt nicht doch der erste deutsche Geschichtsschreiber der Deutschen?", in: Peter Baumgart (Hrsg.), Michel Ignaz Schmidt (1736-1794) in seiner Zeit, Neustadt an der Aisch, 1996, S. 91 ff. ** Die Referate, auf die sich diese Erwiderung von Edgar Michael Wenz bezieht, wurden im Rahmen eines Symposions gehalten, das vom 27. bis 29. Oktober 1994 in Würzburg stattfand [abgedruckt bei: Peter Baumgart a.a.O.].
326
Edgar Michael Wenz
mehreren Stellen seiner Biographie 1 als den „ersten und vornehmsten" Geschichtsschreiber der Deutschen genannt hat. Es wäre sicherlich vermessen, diese Aussage Oberthürs nur als von persönlicher Freundschaft getragen abzutun. Immerhin stand Oberthür dem Zeitgeschehen viel näher als seine späteren Kritiker. Und er hatte als Priester und Wissenschaftler, Professor der Theologie, auch einen Ruf zu verlieren. Daß jede Wertung, weil notwendig subjektiv, angreifbar ist, steht freilich nicht minder außer Zweifel. Aber offenbar war Oberthürs Meinung überzeugend; sie wurde ja bis in die jüngere Zeit als gültig anerkannt. Die Sekundärliteratur zu Schmidt - und insbesondere zu seiner Priorität, die am Anfang offenbar unstreitig und später nicht mehr interessant war - ist freilich sehr karg. Hier wäre zunächst einmal zu nennen die „Brockhaus Allgemeine deutsche Real-Encyklopädie für die gebildeten Stände". Dort heißt es: „Er [Schmidt] war der Erste, welcher eine Geschichte der Deutschen und deutschen Nation schrieb .. . " 2 Dieser Brockhaus ist 1827 erschienen, also vergleichbar Oberthür - zeitnah. Arnold Berney 3 untersucht, ob Johann Jacob Mascov Schmidt nicht zeitlich vorgegangen sei, vermißt aber bei Mascov Inhalte und Methode 4 , die er für eine Geschichtsschreibung für unerläßlich hielt und die er dann bei Schmidt findet. Ernst Wenz 5 sieht ihn i m gleichen Rang, so auch Erich Mende 6 . Dieser populäre Schriftsteller sagt, daß Schmidt seine Geschichte „ohne Vorbild" und für das breite Publikum schrieb; und weiter, daß durch Schmidt die Deutschen in der Vergangenheit „etwas Gemeinsames erkennen" konnten. Diese Auffassung teilte offenbar auch der Bayerische Rundfunk 7 . Eduard Fueter 8 schränkte das „Erstgeburtsrecht" des Michael Ignaz Schmidt insofern ein, als er ihn als den „tüchtigen Verfasser der lange populären Geschichte 1
Franz Oberthür, Michael Ignaz Schmidt's des Geschichtsschreibers der Deutschen Lebens-Geschichte, Hannover 1802, S. 17 und passim. 2 Brockhaus' Allgemeine deutsche Real-Encyklopädie für die gebildeten Stände, 12 Bde., Leipzig 1827, Bd. 9, S. 813 ff. Schmidt ist aus mehreren Enzyklopädien, so auch bei Brockhaus, vorübergehend verschwunden gewesen, aber in den neueren wieder aufgeführt, freilich nicht mehr in der damaligen Ausführlichkeit. 3 Arnold Berney, Michael Ignaz Schmidt. Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Historiographie im Zeitalter der Aufklärung, in: Historisches Jahrbuch 44, 1924, S. 2 f. 4 Schon allein der sehr kurze Zeitraum (abgebrochen im Jahre 752) läßt in der „Geschichte der Teutschen über den Abgang der merowingischen Könige", Leipzig 1737, wenig erkennen. 5 Ernst Wenz, Arnstein und seine Geschichte, Arnstein 1949, S. 81 f. 6 Erich Mende in: Mainpost Nr. 265 /1966: „Er verfaßte die Geschichte der Deutschen". 7 Bayerischer Rundfunk: Sendung vom 10. 12. 78, Bayern 2: „ . . . zu zeigen wie Deutschland geworden, was es wirklich ist." Autor Erich Mende, Zitate: „ . . . zum Ersten Geschichtsschreiber der Deutschen gedieh . . . . . . . ist auch einer der Ahnherren moderner populär-historischer Bestrebungen." Es erwuchs ihm allerdings dennoch „kein weiterwirkender Ruhm". Der Tenor dieser Sendung zielte auf einen besseren Geschichtsunterricht in der Schule und Wirkung in die breite Bevölkerung hinein, wofür Schmidt als historisches Vorbild stand. s Eduard Fueter, Handbuch der mittelalterlichen Geschichte, 3. Aufl., München/Berlin 1936, S. 372, 376 f.
Michael Ignaz Schmidt
327
der Deutschen" und als den „ersten deutschen Historiker der Aufklärung" erkannt hat. Otmar Seuffert 9 folgte ihm in dieser Auffassung. Aus dieser Sicht bliebe die Frage offen, auf welchen Geschichtsschreiber vor der Aufklärungszeit geachtet werden müßte. Freilich ist als „Geschichtsschreiber der Deutschen" - dabei kann man „der Deutschen" als possessiven wie auch als Objekts-Genitiv sehen - nicht jener Deutsche zu begreifen, der irgend etwas über Deutschland und die Deutschen geschrieben hat. Es genügt weder Dokumentarisches, noch der Annalistik Dienendes, weder Staatsrechtsarbeiten (die sich notwendigerweise auf eine geschichtliche Darstellung, einen casus, beziehen mußten, weshalb auch viele Geschichtsschreiber aus der Rechtswissenschaft kamen) noch Chroniken zur Rechte- und Erbfolgesicherung von Fürstenhäusern, bestimmten politischen Ereignisse, Episoden oder Epochen, über Schlachten und Feldzüge, noch über herausragende Personen; keine „Hofhistoriographie" (die Schmidt ohnehin nicht mochte), aber auch keine Geschichte der Länder, der Stämme und Regionen - das alles kann nicht zählen, wenn dezidiert ein historisches Gesamtwerk verglichen werden soll. Anders könnte man gleich Tacitus nennen, die Suche nach dem ersten deutschen Geschichtsschreiber hätte sich (bei anderer Auslegung auch richtig) erledigt. Das vorgegebene Erkenntnisinteresse aber ist eben anders und weitergehend 10 . U m die Fragestellung klar zu definieren, wurde ein Forschungsauftrag erteilt, dessen wichtigste Positionen auch i m Symposion nochmals vorgetragen waren. In Stichworten die Kriterien: Ein geschlossenes Geschichtswerk über Deutschland und die Deutschen, das - über einen längeren Zeitraum greift; - für ein breites Publikum angelegt war, auch in technischer Aufmachung (Format) gut lesbar; - methodisch konzipiert ist, Fragen stellt, sich mit Land und Leuten befaßt; - sich auf zuverlässige Quellen stützt, die mehrheitlich selbst erarbeitet wurden; - als Gesamtwerk Bedeutung gefunden hat. Diese definitorischen Kriterien eines „Geschichtsschreibers der Deutschen" sind rational und sachlich, in der gebotenen Perspektive des Erkenntnisinteresses mehr als nur akzeptabel. Michael Ignaz Schmidt erfüllt sie alle, dagegen nicht ein einziger seiner Zeitgenossen oder gar Vorläufer. Dazu kann man sich dezidiert auf Christina S auter-Bergerhausen berufen, für die alle in Frage kommen9
Otmar Seuffert, Michael Ignaz Schmidt, in: Fränkische Lebensbilder. Reihe VII A, Bd. 14, Neustadt / Aisch 1991. Sinngleich auch sein Lehrer Otto Meyer, „Bedeutendster Historiker des 18. Jahrhunderts", bei mehreren Vorträgen zu Schmidt. •o Daher ist es verwirrend, daß während des Symposions Beatus Rhenanus genannt (und von einigen Teilnehmern offenbar akzeptiert) worden ist, ein Humanist, der in lateinischer Sprache vorrangig für seine Fachkollegen geschrieben hat.
328
Edgar Michael Wenz
den „Konkurrenten" - also Mascov, Barre, Weisert/LeBret, Heinrich, Köhler, Pütter, Schlözer, Moser, die sie in der Vergleichbarkeit untersucht hat, ob für sie, den einen oder anderen, nicht der umstrittene Rang des Ersten zu beanspruchen sei, durch den aufgezeigten Raster fallen; den meisten fehlen gleich mehrere der geforderten Merkmale. Zum Thema der Konzeption der richtigen Fragestellungen, überhaupt zur kritischen wissenschaftlichen Bewertung des Inhalts, wurde und wird diskutiert. Abgesehen davon, daß solche Diskussionen und deren Resultate ohnehin immer angreifbar und strittig sind, weitgehend vom wissenschaftlichen Standpunkt abhängen, hat Michael Ignaz Schmidt sich Methoden bedient und Fragen gestellt, die durchaus als geradezu „modern" anmuten können. Beispielsweise die Leitlinien seiner Arbeit - Regententüchtigkeit, Kulturhöhe und nationale Glückseligkeit - zeigen Strukturen auf, die für die damalige Zeit beachtenswert waren, auch wenn Schmidt nicht immer allen sich selbst gestellten Ansprüchen gerecht geworden sein mag. Es sind doch zumindest Ausflüsse der nationalen Befindlichkeit, wenn Schmidt Kapitel überschreibt wie „Charakter der Deutschen. Sitten. Wissenschaften. Künste." 1 1 und weiterhin „Vergnügungen. L u x u s . " 1 2 und „Gelehrsamkeit. Deutsche Poesie." 1 3 Zwar identifiziert sich Schmidt nicht mit dem „Nationalcharakter", er wirft statt dessen mit seinem Interesse an gesellschaftlichen Wandlungen soziologische Fragen auf 1 4 . Auch seine Berufung auf Montesquieu, den man heute als den ersten Rechtssoziologen bezeichnet, zeigt eine geradezu neuzeitliche Problemempfindlichkeit. A n dessen eigentlich soziologische Erkenntnisse knüpft Schmidt seinen freilich nicht exakt definierten Kulturbegriff. Für Schmidt ist „Die Kultur des Menschen einer der Hauptgegenstände . . . , worauf der Geschichtsschreiber sein Augenmerk richten m u ß " 1 5 . Aber wie auch immer, Schmidt w i l l in die gesellschaftlichen Verhältnisse der Menschen, die da in Deutschland wohnen, im Reich, eindringen. Modern mutet auch seine Methode an, sich mit Institutionen zu beschäftigen, an die er eigentlich seine Geschichtsentwicklung rankt 1 6 . Die Freiheitsidee schlägt bei ihm, sogar engagiert, immer wieder durch. Wie auch immer, fern einer Aufwerfung, die Arbeit Schmidts nun nach 250 Jahren gar „zensieren" zu wollen, dürfte schon die Feststellung berechtigt sein, daß Schmidt mehr als nur eine brauchbare Geschichte der Deutschen geliefert hat. 11 Michael Ignaz Schmidt, Geschichte der Deutschen, 11 Bde., Ulm 1778-1783. Bd. 1, S. 15. 12 Ders., Bd. 1, S. 283. 13 Ders., Bd. 1,S. 502. ι 4 So auch Gertrud Degenhard (Lackschewitz), Das Bild der deutschen Geschichte bei Michael Ignaz Schmidt (1736- 1794), Göttingen 1954 (Phil. Diss.), S. 66 a. Weitere Dissertationen zu Schmidt gibt es nach Kenntnis des Autors nicht, bei den fränkischen Universitäten liegen keine vor. is Schmidt (wie Anm. 12), Bd. 1, S. 3 f. Vgl. Degenhard (wie Anm. 14), S. 39.
Michael Ignaz Schmidt
329
Aber nach einem kurzen Anlauf vermag Sauter-Bergerhausen Schmidt die Pionierleistung, der erste deutsche Geschichtsschreiber gewesen zu sein, doch nicht zuzuerkennen. Sie führt überraschend statt dessen ein neues Kriterium ein, nämlich Bewertung und Wert der Schmidt'sehen Geschichte, obwohl das präzise Arbeitsthema danach gar nicht fragt. In der Kernfrage beruft sie sich auf Herder, der diese Frage mit einem klaren „nein" beantwortet hat. Der Grund: Die Vorstellung über Aufgabe und Umfang der deutschen Geschichte am Ende des 18. Jahrhunderts habe sich gewandelt. SauterBergerhausen bezieht sich auf einen Aufsatz Herders mit dem Titel „Warum wir noch keine Geschichte der Deutschen haben?", der i m Jahr nach Schmidts Tod erschienen ist. Die fehlende Darstellung des deutschen Nationalgeistes in Schmidts Geschichte erschien ihm ein unverzeihlicher Mangel. Aus dem Verdikt auch eines hochangesehenen Kritikers wie Herder wird man allerdings nicht die Schlußfolgerung ziehen können, daß deswegen Schmidt nicht eine deutsche Geschichte geschrieben habe. Sie hat Herder nicht gefallen. Genügt das aber, Schmidts Geschichte - und damit auch seine Pioniertat - schlicht zu negieren, so daß man sich mit dem Status des Ersten gar nicht erst zu befassen braucht? Es war wohl schon immer das Privileg der nachgeborenen Generationen, das „richtige Bewußtsein" zu definieren. Und immerhin gab es ja auch damals schon „Schulgezänk". Abweichender Meinung zu sein, hat man auch schon früher als Ausweis des Expertentums gesehen. Aber derartige Überlegungen braucht man gar nicht anzustrengen oder zu vertiefen; denn es gibt auch noch eine weitere Äußerung von Herd e r 1 7 an gleicher Stelle. Dort heißt es: „ . . . das [Schmidts] Werk ist mit großem Fleiß, nicht ohne Wahrheitsliebe und mit einem heiteren, ordnenden Blick verfaßt". Allerdings verstärkt Herder nochmals seine Forderung an eine Geschichte der Nation, indem er fortfährt: „ . . . wer's besser machen kann, mache es besser. Er schreibe eine Geschichte unserer Nation, eine Geschichte der Deutschen." Herder taugt also nicht als Kronzeuge gegen Michael Ignaz Schmidt, oder eben nur dann, wenn man die Fragestellung umformuliert, dezidiert auf eine deutsche Nationalgeschichte, wie sie ins 19. Jahrhundert besser gepaßt hätte. Auch anderen kritischen Rezensenten gefiel weder Schmidts Orientierung nach der Reichsgeschichte noch der Mangel an ausgeprägtem National Verständnis. Diese Orientierung ist, zumal für einen ehemaligen Professor für Reichsgeschichte naheliegend. Das Zeitverständnis der Aufklärung hatte das Greifbare im Blick, und das war eben das Reich. Manche meinen ja nun auch, daß Schmidt in seiner Reichsgeschichte sehr wohl Anfänge einer Nationalgeschichte hat erkennen lassen. Das wäre sogar ein besonderer Vorzug seiner Leistung, weil er schließlich am Beginn der Romantik stand, in welcher das Nationalbewußtsein erst gleichsam in den Mittelpunkt des Interesses wuchs. Und immerhin hatte Schmidt als einen der Leitfäden in seiner Geschichte mit der „Nationalglückseligkeit" Ansätze gefunden, 17
Ebd., S. 74; J. G. Herder, Beiträge zu der neuen deutschen Monatsschrift 1975, in: Sämtliche Werke, hrsg. v. B. Suphan, Berlin 1877-1913, Bd. XVIII, S. 380.
330
Edgar Michael Wenz
die, nach Oberthür 1 8 , „tätigen Patriotismus fürs gemeinschaftliche deutsche Vaterland" erwecken konnten. Sauter-Bergerhausen sieht den Mangel der Beachtung von Schmidts Geschichte der Deutschen i m 19. Jahrhundert in den Wandlungen des Interesses, die jene Zeit erfahren hat. Mangelnde Beachtung eines Existenten vernichtet aber nicht dieses. A n einem armen Sünder kann man grußlos vorübergehen, aber es gibt ihn dann doch weiterhin. Nicht übersehen kann man freilich, daß Schmidts weitere Bedeutung nach gut einer Generation beispielsweise mit Leopold von Ranke 1 9 ein wesentlich „eleganterer" und kunstvoller Historiograph i m Wege stand, auch weitere Autoren im Geiste der Romantik. Aber man muß für die Beurteilung Schmidts und insbesondere bei der sehr konkret gestellten Frage nach seiner pionierhaften Leistung doch wohl die Zeit ab 1772 sehen, da er bereits ankündigte, eine „Geschichte von Deutschland" schreiben zu wollen, und dann seine persönliche Leistung bis zu seinem Tode 1794. Nichts anderes kann entscheidend sein. Daß Schmidt tatsächlich sehr früh aus der Geschichte der Geschichtsschreibung verdrängt war, hatte gewiß auch Gründe, die in seiner Persönlichkeit und in seinen Lebensverhältnissen zu suchen waren. Dieser Aspekt wird häufig übersehen. Schmidt hatte niemanden, keine Institution und keine Menschen, die - nach dem Tode Oberthürs - an seinem Andenken und dessen Pflege interessiert waren oder interessiert hätten sein müssen. Da war zunächst das Kaiserlich-Königliche Hausarchiv; dort hatte man offenbar kein originäres Interesse. Ein Behördenchef war ausgeschieden, ein anderer war angetreten, es ging weiter. Hinzu mag gekommen sein, daß Schmidt als Archivar nach allem, was wir wissen, nicht gerade geglänzt hatte und seine eigenen historiographisehen Interessen mehr verfolgte als seine Aufgabe als Archivar. Als Priester hatte er keine leiblichen Nachkommen, seine Brüder waren auch alle Priester, die ganze Familie war mit dieser Generation ausgestorben. Da er nicht mehr lehrte, hatte er auch keine Schüler, die sich auf ihn berufen und sein Andenken hätten weitertragen können. Die von ihm angesprochene breite Leserschaft war dazu auch kaum in der Lage. Wäre er Ordenspriester gewesen, hätte er vom Orden mit Sicherheit Unterstützung erfahren. Die Universität Würzburg sah zunächst offenbar auch keine Gründe, er hatte sie ja verlassen. Und erst recht gilt das für seinen eigentlichen früheren Schutzherrn und Förderer, den Fürstbischof von Würzburg; der Würzburger Klerus war ihm eher gram. Wenn man sich nun - und dazu gehört nicht gar zuviel Phantasie .- einmal andere und gegenteilige Verhältnisse und Umstände vorstellt, ist die Annahme nicht vermessen, daß Schmidts Andenken gepflegt worden wäre, es somit nicht zu dem tatsäch-
18 Oberthür (wie Anm. 2), S. 17 f. 19 Vorworte Schmidts und von Rankes (Geschichte der Germanischen und Romanischen Volker, 1824, Einleitung) sind nicht wortgleich, aber sinnähnlich. Wollte man darin Schmidt: stellt auf die Entwicklung, auf das Werden ab; von Ranke: ihm ging es um den jeweiligen Ist-Zustand - einen wesentlichen inhaltlichen Unterschied sehen, so ist die Aufgabe, die Schmidt sich stellte, eigentlich anspruchsvoller einzuschätzen.
Michael Ignaz Schmidt
331
liehen schnellen Vergessen gekommen wäre - sofern dieses vermocht hätte oder noch vermag, seine Pioniertat gar bis zur Unkenntlichkeit zu schmälern. Kritisiert wurde an Schmidt auch die mangelnde Eleganz der Sprache, die an Voltaire heranreichen würde, auch der gelegentlich fehlerhafte Gebrauch der deutschen Sprache 20 . Aber es ist nicht zu erkennen, was das an seinem Rang ändern könnte. Niemand hat je behauptet, Schmidt sei der perfekteste und stilistisch eleganteste Geschichtsschreiber gewesen. Die Wirkung eines Werkes, erst recht die ausgebliebene und nicht über einen längeren Zeitraum andauernde, ist allerdings kein Zeichen der Nicht-Existenz oder der Bedeutung und Beachtung in der aktuellen Zeit. Es wird auch einigermaßen schwer vorstellbar, daß Schmidts Wirkung gar so bald eingeschlafen sein könnte. Diese Gründe kann man sehen: - Schmidts persönliches Geschichtswerk hat in elf Bänden mehrere Auflagen erfahren (vergleichbar überdies dem deutschsprachigen Katechismus Schmidts in mindestens vier Auflagen). Das waren zu jener Zeit „Bestseller"-Erfolge. - Das Werk ist für wert befunden worden, es fortzusetzen. Joseph Millbiller (in Schmidts Geist und mit seinen Unterlagen und Notizen) hat neun fortsetzende Bünde herausgebracht, Leonhard von Dresch (eigenständige Leistung) hat dann für die Zeit bis 1816 drei weitere verfaßt; diese Bücher mußten j a nun alle verkauft und gelesen worden sein. - Schmidts Werk wurde 1787 ins Französische übersetzt (drei Auflagen), dann auch noch ins Holländische. - Joseph II. schützte Michael Schmidt 1783 durch Druckprivileg vor Raubdrukken, wofür es gewiß Anlaß gab. - Schmidt hatte historisch bedeutende Leser (Maria Theresia, Joseph II.) und Nutzer (Schiller). Daß Michael Ignaz Schmidt, ohnehin aus Distanz betrachtet, in einem Zeitverständnis eingebettet war, das einerseits nach einer deutschen Geschichte drängte 2 1 , 20
So verweist Arnold Berney (wie Anm. 4), S. 238, Anm. 184, darauf, daß Schmidt auch gelegentlich „Provinzialismen" unterlaufen seien, etwa „Er derfe", das Volk hat „erkennt", die Sache verhielt sich „ganz änderst". Insbesondere der Autor hat Freude an dieser landsmannschaftlichen Verbundenheit, es ist tatsächlich „ächt Arnstenerisch". Schmidt habe in der Jugend nicht richtig Deutsch gelernt (so Oberthür). Denkbar ist das, obwohl Arnstein früher sogar ein bemerkenswertes Schulwesen hatte: erste Volksschule 1434, erste Lateinschule 1573, in der ab 1635 auch Mädchen schulgeldfrei zugelassen waren. 21 Die Anmerkung mag in diesem Zusammenhang nicht uninteressant sein: Ulrich von Hutten - der durch die Grablege derer von Hutten zu Schmidts Geburtsort Arnstein (Wallfahrtskirche Maria Sondheim) enge Verbindung hatte - war nach des Autors Kenntnis der erste, der das Fehlen einer deutschen Geschichte nicht nur beklagt, sondern stürmisch gefordert hat. Am Hofe Maximilians I. in Wien hat er in seiner Exhortatio im Germanengedicht den „Gedanken einer einheitlichen deutschen Geschichte" entwickelt (nach seinem Bio-
332
Edgar Michael Wenz
andererseits vor einem solchen umfassenden Werk gewarnt wurde, mehrt die Leistung des Franken. Es gibt in der Geschichte der Technik beispielsweise kaum eine epochemachende Erfindung, die nicht schon gewissermaßen in der Luft gelegen hatte. Schmidt setzte ein Anliegen in die Tat um, gleichgültig nun, ob Verleger schon darauf gewartet haben oder nicht. Alle diese Vorkommnisse und Ereignisse, was Michael Ignaz Schmidt getan hat, und alles, was andere für ihn getan haben, zwingen zur Erkenntnis, daß der gebürtige Arnsteiner Michael Ignaz Schmidt nicht nur ein bedeutender Mann war, was i m allgemeinen - und so auch auf diesem Symposion - gar nicht bestritten wurde, sondern daß er ganz einfach auch der Zeiterste war. Er hat auch als erster Geschichtsschreiber der Deutschen ein neues Kapitel der Historiographie in Deutschland aufgeschlagen, nicht nur weil er mit M u t einen Damm durchbrach, sondern auch eine eigene Methodik und Fragestellung entwickelte. Daß Michael Ignaz Schmidt aus seiner Zeit heraus das Reich thematisierte, auch die in diesem Reich lebenden Deutschen, freilich auch nicht dezidiert das Nationalbewußtsein der Deutschen, aber auch dies aus dem Zeitverständnis heraus, forderte geradezu eine neue und weiterführende Geschichtsschreibung heraus. Und diese hat dann ihre Dienste geleistet, ebenso wie Michael Ignaz Schmidt seine Dienste zu seiner Zeit. Es war der „Wahrheit" über Michael Ignaz Schmidt nicht förderlich, daß Christina S auter-Bergerhausen zu einer verneinenden Β antwortung der gestellten Frage nach Michael Ignaz Schmidt als dem „ersten Geschichtsschreiber der Deutschen" kam und eigentlich nur deshalb kommen konnte, weil sie die aufgegebenen und dem Erkenntnisinteresse dienenden Prämissen durch andere ersetzte. A u f der Grundlage der vorgetragenen Kriterien muß die thematisierte Frage ist einen klaren Ja beantwortet werden: Michael Ignaz Schmidt war der erste Geschichtsschreiber der Deutschen.
graphen Hajo Holborn, 1929); der Gedanke fand für die Folgezeit Bedeutung, die deutsche Geschichte nämlich herauszuholen aus den mittelalterlichen Vorstellungen, bis eben Schmidt, jedenfalls nach der Meinung des Autors, diese Forderung einlöste.
Fanny von Arnstein eine bedeutende Frauengestalt* Kennen Sie eigentlich die Fanny von Arnstein? Und die Freiherren von Arnstein? Wissen Sie, daß einer der schönsten Berge Tirols „Arnstein-Spitze" heißt? Und daß er nach einer Freiherrin von Arnstein benannt worden ist? Fanny von Arnstein war immerhin zu Anfang des vergangenen Jahrhunderts eine der bedeutendsten Frauengestalten des Kaiserreiches; die Freiherren von Arnstein zählten zu den einflußreichsten und vermögendsten Familien des Reiches, sie galten damals reicher als beispielsweise die Rothschilds. Sie waren für die Finanzgeschäfte des Habsburger Kaiserhauses unentbehrlich. Ob diese Leute mit unserem Arnstein, unserem Heimatstädtchen, etwas zu tun haben? Und ob - sie haben. Aber das ist eine längere, eine seltsame Geschichte. U m 1700 herum schnürte ein junger Arnsteiner sein Bündel, sein Ziel war Wien, die Kaiserstadt. Er war ein junger Jude und hieß Isaac Aaron. Niemand hat ihn aus Arnstein vertrieben; das ist gesichert, denn gerade um jene Zeit ist die Chronik recht gesprächig. Es war ihm wohl zu eng geworden. Zudem rief ihn sein Onkel nach Wien; dies war der damals schon bei Hofe angesehene Samson Wertheimer. In Wien winkte erfolgreichen Juden die Gleichstellung. Einer der Wertheimer und der junge Arnsteiner holten auch 1710 i m kaiserliche Auftrag die an den König von Spanien verpfändeten „habsburgischen Kleinodien" aus Amsterdam nach Wien zurück, ein damals recht risikoreiches, geradezu abenteuerliches Unternehmen. Wie kam nun der Jude Isaac Aaron zum Familiennamen Arnstein? Die Juden waren j a damals und noch lange Zeit danach keine Staatsbürger, nur gegen Entgelt geduldete „Schutzjuden", sie hatten keinen Namen. Jahrzehnte nach den Judenerlassen wurden dann solche von den Behörden förmlich zudiktiert. Es mußten ohnehin Namen sein, die keine Verwechslung mit bekannten christlichen Namen zuließen. Nicht selten kam es bei der Namensgebung zu Schikanen. I m allgemeinen wurden gegenständliche zugeteilt, auch zusammengesetzte, so etwa Rosenstock, Veilchenblau oder Grünspan, auch adjektivische wie Süß. Geografisch abgeleitete Familiennamen wie etwa Sauerländer, Holländer lassen schon auf eine gewisse Bevorzugung schließen. Aber lange Zeit zuvor kam schon kurz nach seiner Auswanderung aus Arnstein Isaac Aaron zu so großem Ansehen, daß es ihm viele Privilegien einbrachte, so auch die Wahl seines Familiennamens. Es spricht für ihn und * Erstveröffentlichung in: Edgar Michael Wenz, Anmerkungen ... Eine Aufsatzsammlung, Würzburg, 1985, S. 119 ff.
334
Edgar Michael Wenz
sein offenbar ungestörtes Verhältnis zu Arnstein, daß er sich diesen Namen zulegte, zulegen ließ. Auch die Wertheimer, Oppenheimer haben so ihren Namen gefunden, überdies später weltberühmte Namen; sie gehörten alle zur Großfamilie der Arnsteiner. Die Oppenheimer beispielsweise zählen gewiß heute noch zu den reichsten Familien der Welt. In der dritten Generation wurde Nathan Adam (1749-1838) in den Freiherrenstand erhoben (1798); die auf jüdische Herkunft deutende Endsilbe "-er" wurde abgelegt. Die Familie hieß von nun an Freiherr von Arnstein. Sie war mittlerweile auch zum römisch-katholischen Glauben konvertiert. Die Frau des Nathan Adam Freiherr von Arnstein war Fanny von Arnstein (1758-1818). Ihre Familie kam aus Berlin. Ihr Stammbaum liest sich äußerst eindrucksvoll. Viele bekannte Namen des Geld-, aber auch des Geistesadels befinden sich darunter, so die schon erwähnten Oppenheimer, dann Mendelssohn, auch der bekannte Komponist Felix Mendelssohn-Bartholdy gehört dazu. Die Freiherren von Arnstein (später Pereira-Arnstein) scheinen, anders als deren Verwandte, bald an Einfluß und Reichtum verloren zu haben, die Frauengestalt der Fanny von Arnstein aber hat historische Bedeutung gefunden. Wodurch zeichnete sich nun die Baronin Fanny von Arnstein so aus, wodurch hebt sie sich von den vielen ebenso bedeutenden wie schillernden Gestalten Wiens in einem solchen Maße ab, daß die bekannte Literatin Hilde Spiel über sie ein Buch geschrieben hat: „Fanny von Arnstein"? 1 Der Untertitel des Buches zeigt es auf: „Die Emanzipation". Es gibt wenig Begriffe, die in unserer Zeit so häufig mißbraucht und fehlgedeutet worden sind wie gerade dieser. Hier ging es um die Beseitigung einer echten Unterdrückung, einer wirklichen „Unterprivilegierung", hier ging es um wenigstens die bürgerliche (rechtliche) Gleichstellung der Judenheit, möglichst auch der sozialen. Einerseits waren die Juden damals aus dem wirtschaftlichen Leben gar nicht wegzudenken, für viele regierenden Häuser unersetzlich geworden; auf der anderen Seite unterstanden sie einer geradezu diskriminierenden Gesetzgebung. I m 18. Jahrhundert begann dann die Emanzipationsbewegung der Juden, i m Gleichklang mit den Ideen der Aufklärung. Die Namen des Philosophen Moses Mendelssohn 2 , ein Verwandter der Fanny von Arnstein also, und des bedeutenden deutschen Dichters und Denkers Gotthold Ephraim Lessing, dessen 250. Geburtstag in diesem Jahr gedacht wurde, stehen dafür. Hilde Spiel sieht i m „Nathan der Weise" eine dichterische Verkörperung des Moses Mendelssohn. Unter dem aufgeklärten Habsburger Kaiser Josef II. 1
Erschienen im Verlag S. Fischer, 1962. 1936 soll aus seiner Grabstätte in Berlin sein Schädel entfernt, auf die Grabplatte gelegt, den Angehörigen einer daneben stationierten SS-Einheit als Zielscheibe gedient haben. Etwa gleichzeitig wurde das Denkmal seines Enkels Felix Mendelssohn-B artholdy in Leipzig zerstört. Seine Lieder und Kompositionen („Leise flehen meine Lieder"), nachdem man sie im deutschen Kulturgut nicht mehr missen wollte, wohl auch nicht mehr verdrängen konnte, wurden kurzerhand mit „Dichter und Komponist unbekannt" abgetan. 2
Fanny von Arnstein - eine bedeutende Frauengestalt
335
(„Josephinismus") wurde die Gleichstellung der Juden weitgehend verwirklicht, überdies lange bevor die Gleichheitsideen der französischen Revolution um sich griffen und wirken konnten. Von der deutschen Kaiserstadt Wien aus nahm dann die Emanzipation, langsam und schrittweise, von schweren und schwersten Rückschlägen erschüttert, ihren Fortgang. Das war 1782 3 . Fanny von Arnstein war eine der tragenden Gestalten dieser so entscheidenden Emanzipationsbewegung. Ihr gelang es auch persönlich, die nun einmal Juden, auch konvertierten, entgegengebrachten Vorbehalte unmittelbar für sich und ihre Familien abzubauen. Sie - die „Arnsteinerin" oder auch „die schöne Hebräerin" genannt - wurde zu einem gesellschaftlichen und kulturellen Mittelpunkt in der Kaiserstadt. Während des Wiener Kongresses veranstaltete sie Bälle für Hunderte der damals führenden Persönlichkeiten; ihretwegen kam es auch zu einem dramatischen Duell, bei dem der Fürst zu Liechtenstein fiel. Sie beschränkte sich freilich nicht nur darauf, ein großes Haus zu führen; bei ihr wurden die Künste und Wissenschaften gepflegt (die Verbindungen reichten bis Goethe); besonders der Musik in Wien galt ihre besondere Förderung. Vor allem aber: Sie wollte die Politik nicht nur den Männern überlassen, sie griff selbst ein, auch dies gewissermaßen Ausfluß ihrer emanzipatorischen, auch kämpferischen Gesinnung. Und hier ist ihr Wirken wohl für die Nachwelt am nachhaltigsten geblieben: Sie unterstützte die Freiheitskämpfe der Südtiroler gegen Napoleon Bonaparte (und die mit ihm verbündeten Bayern) ideell und finanziell. Man kann sogar davon ausgehen, daß sie die Finanzierung des Sandwirtes Andreas Hofer, der dann zu Mantua füsiliert wurde, und seiner Mitstreiter überwiegend allein bestritten hat. Sie soll auch in Männerkleidern bis in die Fronten am Berg Isel vorgedrungen sein. Sie war jedenfalls eine der großen Gegenspielerinnen von Napoleon. Gewiß, sie war darin glücklos, hat aber bewiesen, daß sie in ihrem Lebenskreis völlig aufgegangen war 4 . Die Tiroler wußten Einsatz und Hilfe der Familie von Arnstein zu schätzen. Sie benannten einen der schönsten Gipfel nach ihr, die „Arnstein-Spitze" (im Volksmund später dann kurz „Arnspitz" genannt), nahe der bayerisch-österreichischen Grenze bei Mittenwald und Scharnitz gelegen 5 . Bei der Rezension des Buches 1962 in der bekanntesten deutschen Zeitung wurde diese Tatsache an den Anfang gestellt. Es ist wohl auch eine Art Ironie der Geschichte, daß ein Mahnmal deutscher Freiheitskämpfe gerade nach einer Jüdin benannt ist. Nicht minder, eher 3
Allerdings 1776 waren die Juden schon gleichgestellt in den Vereinigten Staaten von Amerika, 1791 folgte Frankreich, 1811 Preußen und 1813 auch Bayern. Großbritannien beispielsweise kam viel später (1854), die Schweiz sogar erst 1878. 4 Bei der auf „Holocaust" vorbereitenden Sendung des WDR „Antisemitismus" nannte der Autor Erhard Klöss die Familie Arnstein, neben den Rothschilds, als eine der bedeutendsten Wiens, bezog aber die Finanzierung des Tiroler Aufstandes unter Andreas Hofer 1809 auf den Bankier Eskeles über Vermittlung Metternichs; das ist aber nur insofern richtig, als das Bankhaus Arnstein & Eskeles hieß. s Hilde Spiel, a.a.O, S. 354.
336
Edgar Michael Wenz
größer freilich sind ihre Verdienste um die Gleichberechtigung der Juden. Sie haben sich in ihr, der „Emanzipierten", verkörpert. Auch in Wien ist Fanny und die Familie von Arnstein nicht vergessen. Eine Seitenstraße des Mariahülfer Rings (XV. Bezirk) ist ihr gewidmet, genau dem „Bankier und Wohltäter" Nathan Adam Arnstein, Fanny's Mann. Eine relativ große Zahl Wiener und Österreicher kennt auch wenigstens ungefähr die Zusammenhänge 6 . Fanny von Arnstein war also eine von Napoleon nicht unterschätzte Gegenspielerin. Wohl kaum wird sie gewußt haben, daß die Familie eines der bekanntesten Marschälle Napoleons, Jean Baptist Kleber 7 , aus der Nähe Arnsteins (Altbessingen) stammte. Aber es ist anzunehmen, daß sie Michael Ignaz Schmidt in Wien kennengelernt hat. Beweise dafür fehlen (noch), aber hohe Wahrscheinlichkeit spricht dafür. Beide verkehrten am Kaiserhofe. Michael Ignaz Schmidt hat als maßgebender Befürworter des „Josephinismus" sicherlich großen Anteil auch an den Tolerenzerlassen 1782, die Zwischenstation und Voraussetzung für das Gelingen der jüdischen Emanzipation waren 8 . Die Freiherrn von Arnstein sind also nicht in schimmernder Rüstung von der Burg herabgeritten 9 . Die Freiherren von Arnstein, die historische Spuren bis heute hinterlassen haben, waren Juden aus Arnstein 1 0 . Das ist historisch gesichert. Wo sie genau wohnten, weiß man nicht 1 1 . Gewiß kann man nun fragen, ob diese bloß namentliche Verbindung einer in Wien berühmt und reich gewordenen ehemals jüdischen Familie, deren Gründer erweislich aus unserem Heimatstädtchen Arnstein kam und diesen Namen annehmen wollte und durfte, eine tragfähige Basis ist, sie in die Arnsteiner Geschichte 6 Bekannt war in Österreich auch Benedikt Arnstein; er lebte 1765 - 1840, war Dramatiker und schrieb als erster österreichischer Jude in deutscher Sprache. Eine nach Unterfranken führende Linie läßt sich allerdings nicht erkennen. (Dagegen bestehen Verbindungen des bekannten österreichischen Ski-Fabrikanten Arnsteiner, der so manchen Olympiasieger ausgerüstet hatte, zuverlässig nach eigenem Bekunden in den „Raum um Würzburg".) 7 Führer des französischen Expeditions-Korps in Afrika, 1800 in Kairo erdolcht. Viele Straßen und Plätze in Frankreich sind nach ihm benannt, so beispielsweise der große Platz um das Straßburger Münster, dann die Avenue vom Arc de Triomphe zum Eiffelturm. 8 Das gehört allerdings schon zur Würdigung von Michael Ignaz Schmidt, die an anderer Stelle behandelt werden wird. Es mehren sich die Anzeichen, daß die Bedeutung dieses in Arnstein geborenen Gelehrten noch nicht voll erkannt worden ist. 9 Dieses Geschlecht starb 1464 aus; es hatte keine Bedeutung für die Geschichte Arnsteins gewonnen. 10 Hilde Spiel, a.a.O, S. 55. (Sie hat mich auch in Verbindung gebracht mit dem letzten lebenden Freiherrn von Arnstein Pereira, der heute in Kärnten wohnt.) 11 Ich habe Anlaß zu der Annahme, daß Isaac Aaron im Hause gegenüber der (späteren) Synagoge wohnte. Die während des Krieges verschleppte Jüdin Hannah Schloß hat mir öfters erzählt, daß in ihrem Hause früher sehr reich (gewordene) Juden wohnten. Ich hielt es damals für ein von Wunsch Vorstellungen getragenes Hirngespinst einer alten Frau.
Fanny von Arnstein - eine bedeutende Frauengestalt
337
gewissermaßen einzuverleiben. Sie hat weder hier gelebt, noch gewirkt. Mag man das auch verneinen, so ist die Bedeutung der Freiherren von Arnstein, insbesondere der Fanny von Arnstein, für die deutsche Geschichte unleugbar. Zudem ist die Geschichte der Juden sehr eng verbunden mit der deutschen, über lange Phasen mit beiderseitigem Nutzen - nirgendwo anders konnte die Judenheit soviel Nobelpreise erringen als i m Verband des Deutschen Reiches, niemals Deutschland so viele wie mit seinen Juden - , freilich dann auch in einem Menschenalter in einem geschichtlich vergleichlos bitteren Zusammenhang. Der bekannte Historiker Professor Golo Mann, Sohn seines ebenso berühmten Vaters Thomas Mann, hat sich mit dieser Familie und deren Bedeutung für das Kaiserreich beschäftigt 12 . Und Hilde Spiel, die das Leben und Wirken der Fanny von Arnstein durch ihr B u c h 1 3 festhielt, hat hohen literarischen Rang 1 4 . Es klang schon mehrfach durch: M i t der Wahl des Namens Arnstein scheint Isaac Aaron ein zumindest ungetrübtes Verhältnis zu seinem Herkunftsort - vielleicht kann man sogar sagen: Heimatort - bekundet zu haben. Nichts spricht gegen diese Annahme, manches sogar dafür: Es gibt in der Arnsteiner Geschichte, die sich ja in den Chroniken sehr zuverlässig lange Zeit zurückverfolgen läßt, keinen Anhalt für eine auffallende Schlechterstellung der Juden. 1298 wurden fünf jüdische Familien erstmals erwähnt 1 5 , als „hochstiftisch würzburgische Schutzjuden' 4 . Freilich sind auch immer wieder Klagen und Beschwerden über die Juden verzeichnet 1 6 , so über die Abwicklung von Handelsgeschäften; nachdem den Juden andere Berufe versperrt waren, mußten sie sich darauf beschränken, hatten freilich auch häufig Erfolge; nichts freilich gibt auch so schnell - begründeten oder unbegründeten - Anlaß zu Streit wie gerade solche Handels-, Wechsel- und Finanzgeschäfte. Das war offenbar in Arnstein auch nicht anders als anderswo. So gab es i m 17. Jahrhundert die offenbar üblichen Reibereien auch mit den Arnsteiner Juden. Sie durften keine Häuser bewohnen, die an der Hauptstraße standen, oder dorthin Türen und Fenster hatten; man sah darin eine Beleidigung der Fronleichnamsprozession. 1687 hat man die Ausweisung sämtlicher Juden aus Arnstein 1 7 erwo12
Ihm habe ich es auch persönlich zu verdanken, mich auf die Spur gesetzt zu haben. Nun in der 2. Auflage als Taschenbuch, ebenfalls bei S. Fischer Verlag erschienen. 14 Sie ist Literaturprofessor in Österreich, war lange Jahre im PEN-Vorstand; sie zählt zu den bekanntesten Literatinnen und Kulturkritikerinnen deutscher und englischer Zunge. ι* Keyser/Stoob, Bayerisches Städtebuch Teil 1, 1971. 13
16
Balles, M., Arnstein in Vergangenheit und Gegenwart, 1913/14, S. 279 f. (vergriffen). Ob die Auswanderung des 1682 geborenen Isaac Aaron aus seinem Geburtsort Arnstein auch dadurch motiviert war, läßt sich nicht erkennen, ist aber auch nicht auszuschließen; derartige Bestrebungen wie die des Arnsteiner Magistrats waren damals aber keineswegs die Ausnahme. Es spricht so ziemlich alles dafür, daß sich die Juden an derartige Schwierigkeiten längst gewöhnt hatten. Michael Landmann unterscheidet zwischen dem „Vertreibungssemitismus" und dem „Vernichtungssemitismus", den das Deutsche Reich „durchgeführt" habe. Wenn man eine solche Differenzierung machen wollte, so müßte noch eine erste Phase vorgeschaltet werden, die in Wellen überall in der Welt auftrat und immer noch auftritt; diese Phase könnte man wohl bezeichnen als „Schikanenantisemitismus". 17
22 Gedächtnisschrift Wenz
338
Edgar Michael Wenz
gen, sie schließlich aber dann doch nicht durchgeführt. 1782 kam es zu größeren Ausschreitungen, Fenster wurden eingeworfen, Türen verbarrikadiert. Aber da erhielt die Stadt Arnstein einen strengen Verweis mit der Androhung, sie i m Wiederholungsfalle in Schadenersatzpflicht zu nehmen. 1817 wurde, um das Bayerische Judenedikt von 1813 zu vollziehen, die „Judenmatrikel" angelegt; sie wies 18 Judenfamilien mit 98 Personen aus; damals wurden auch die neuen Familiennamen zugewiesen. Die Erbauung der Synagoge 1819, die damals sogar zu den auffallenden Baukunstwerken gehörte, läßt auf einen gewissen Vermögensstand schließen. Ernsthafte Störungen zwischen, wie man seinerzeit sagte, „Christenmenschen" und Juden sind nicht aufgezeichnet. Die Toleranz, die wesentlichste Errungenschaft aus der Zeit der Aufklärung, hat offenbar auch in Arnstein gewirkt. Eine Zeit, da man wieder Anlaß hat, über die Wechsel vollen Beziehungen zwischen Deutschen und Juden nachzudenken, regt zu Überlegungen an, ob nun die Arnsteiner Verhältnisse „typisch" für Franken, Bayern oder Deutschland waren und ob man darin Anzeichen schon dafür erkennen konnte, zu welchem schweren Bruch es dann etwa ein Jahrhundert später kam. Die schweren Schatten der jüngeren Vergangenheit fielen nämlich unvermeidbar auch auf das Verhältnis der Arnsteiner zu „ihren" Juden. 1933 lebten in Arnstein noch neunundzwanzig Juden, alle angesehene Bürger, die sich durchwegs als Deutsche fühlten. Auch in Arnstein zeigte sich das geradezu als typisch beobachtete Verhältnis der Deutschen zu den Juden i m persönlichen und übersehbaren Bereich. Häufig später vom Ausland angezweifelt, nicht minder bespöttelt war j a das massen- und individualpsychologische Phänomen, daß jedes Dorf, jede Kleinstadt oder jede Straße der Großstadt gewissermaßen „ihre" Juden hatte, also die „guten" Juden, i m Unterschied zu den anderen, den „bösen" („Unser Jud' ist in Ordnung, aber die Jüden . . . ! " ) Die Verhältnisse in Arnstein waren zumindest einmal durchschnittlich „normal" typisch auch für andere (oder jedenfalls süddeutsche) Landstädtchen. Eigentlich scheint es so, daß man verhältnismäßig gut nebeneinander, j a miteinander gelebt hat. Abrupte Brüche sind nicht bekannt geworden. Die Chronik vermeldet schlicht, daß „1938 die jüdische Gemeinde aufgelöst" wurde. Dahinter verbergen sich tragische Schicksale, die auch den Arnsteiner Juden nicht erspart blieben 1 8 . Man kann diese Epoche, die man heute kaum mehr zu begreifen vermag, nicht so einfach aus der Geschichte Arnsteins auslöschen.
18
Wenz, E., Arnstein und seine Geschichte, 1949, S. 87 f. (vergriffen).
7. Beruf
Backen und Umwelt* Brot mit Umweltschmutz und Umweltschutz in Verbindung zu bringen - ist das nicht eine Gefahr für Bäcker und Bäckereien? Noch nicht einmal auf den ersten Augenschein kann ein solcher Verdacht aufkommen. Dafür stehen Brot und Bäcker in ihrem „gesellschaftlichen Nutzen" zu unangefochten. Viel eher können die Umweltbelastungen, die zwangsläufig und notgedrungen durch das Backen entstehen, zu einem Signal werden, über den Bedarf an Energie - und wie man sie sich beschaffen könnte - nachzudenken. Und in der Tat, der nachfolgende Beitrag „ v o m Brot, Backen und Umweltbelastung" - nicht zuletzt gestützt auf die Unanfechtbarkeit von Backen und Brot - hat sinnvollen Diskussionen auf vielerlei Ebenen beizutragen vermocht (1978). Wirkliche oder nur scheinbare Rückschläge bei der Kernenergietechnik können nicht von der Tatsache ablenken, daß das Problem der Energieversorgung - wie auch immer - gelöst werden muß. Bäcker und Backen gerieten bisher eigentlich nie in die Schußlinie der „Systemkritik". Auch die engagiertesten Umweltschützer und die radikalsten Systemveränderer möchten Brot und Brötchen sozial gerechtfertigten Nutzen nicht absprechen. M i t Stullen in der Tasche demonstriert es sich ja nun auch leichter. Niemand w i l l und wird ernsthaft Sinn und Notwendigkeit des Umweltschutzes bestreiten. Aber gerade, weil das ein bitterernstes Anliegen ist, muß es auch mit besonderer Sorgfalt behandelt werden. Bäcker hatten wenigstens bislang keine Rechtfertigungsprobleme. Sie blieben gewissermaßen „unentdeckt". Damit blieb unkritisiert, daß Brot auch gebacken werden muß - und noch viel schlimmer: Daß bei eben diesem Backen unabweisbar Schadstoffe anfallen, und dies nicht zu knapp. Weil eben Umweltschutz ein ernstes Anliegen nicht nur sein darf, sondern sein muß, hat man sich - Nutzenstiftung des Bäckers hin, Lebensqualität des Brotes her - gezielt damit zu befassen, die Belastungen festzustellen und Wege zu suchen, diese zu mindern oder gar ganz auszuschalten. Sehr viele Schadstoffe werden bei der Umwandlung verschiedener Energiesorten in nutzbare Wärme, wie sie zum Backen naturgesetzlich nötig ist, freigesetzt. Daß sich daran niemand stört, ist kein Grund, darüber nicht doch nachzudenken. Nicht um den Bäcker geht es, nicht um das Backen, nicht um das Brot, sondern um die Methode der Wärmegewinnung. * Erstveröffentlichung in: Edgar Michael Wenz, Das Backen. Das Garen. Die Technik. Die Theorie vom Backofen, Arnstein, 1980, S. 135 ff.
342
Edgar Michael Wenz
Wieviel Schadstoffe fallen in etwa beim Backen in deutschen Bäckereien und Brotfabriken pro Jahr an? Und welche? - Für die Beantwortung dieser Frage liegt kein verwertbares statistisches Material vor; man ist auf Schätzungen und Hochrechnungen angewiesen. So kann man davon ausgehen, daß in der Bundesrepublik Deutschland etwa 450 000 m 2 Backnutzfläche in Betrieb sind. U m nun auf den Energieverbrauch zu kommen, muß man sich einiger Arbeitshypothesen bedienen. Wir müssen den „typischen deutschen Modellbackofen" (Durchschnittsofen) finden, ebenso das „typisch deutsche Heizmedium". Begründete Schätzungen lassen auf den sogenannten Etagenbackofen mit Zwangsumwälzung der Heizgase von etwa 10 m 2 Backnutzfläche kommen. Er kann zulässig als Modellbackofen für die weiteren Berechnungen dienen. Als Heizmedium bietet sich Heizöl („extra leicht", Viskosität bis 2 E bis 20° C) als die am meisten verbreitete Energiesorte an. Gas ist in den deutschen Bäckereien tatsächlich weniger oft vertreten, Kohle (Braunkohlenbrikett) nur noch verschwindend gering. Elektrisch beheizte Backöfen, die überdies eindeutig in der Minderzahl sind, werden hier bewußt nicht aufgeführt, weil sie keine Umweltbelastung durch Schadstoffemissionen verursachen. Es ist für die Aufgabenstellung durchaus zulässig, bei solchen Ermittlungen um zu einer brauchbaren Arbeitshypothese zu kommen - von unserem „typisch deutschen Modellbackofen", also ölbeheizt, mit etwa 10 m 2 Backnutzfläche, auszugehen. Ein Erfahrungswert ist der arbeitstägliche (durchschnittlich 7 Betriebsstunden) Heizöldurchsatz von rund 35 kg. 300 Arbeitstage jährlich können ebenfalls zugrunde gelegt werden. Bevor die Schadstoffemission aufgrund dieser Arbeitshypothese errechnet wird, müssen die folgenden durchschnittlichen chemischen Kennwerte für den Brennstoff Heizöl E L benannt werden: Der Brennstoff Heizöl E L hat mm Durchschnitt folgende chemische Kennwerte: Kohlenstoff 2 Wasserstoff Hr : Schwefel S Unterer Heizwert H u
= 85,8 bis 86,3% = 13,4% = 0,3 bis 0,8% = 10 200 kcal / kg oder 11,9 k W h Rauchgasmenge feucht = 1 5 , 2 N m 3 / k g Rauchgasmenge trocken = 1 3 , 7 N m 3 / k g Unter der Voraussetzung, daß unter ausreichender Luftzufuhr die Verbrennung technisch/physikalisch und chemisch vollkommen, also stöchiometrisch, abläuft, entsteht ein Abgas, das sich zusammensetzt aus: Kohlendioxid ( C 0 2 ) , Wasserdampf ( H 2 0 ) und Schwefeldioxid ( S 0 2 ) . Von diesen sind nur das Kohlendioxid und das Schwefeldioxid sogenannte „luftfremde Stoffe". Schwefeldioxid ist dazu ein toxischer Schadstoff. Es entsteht aus dem Anteil Schwefel i m Heizöl; er läßt sich solange nicht vermeiden, als es nicht gelingt, Heizöle ohne Schwefelanteile herzustellen.
Backen und Umwelt
343
Nun ist die stöchiometrische Verbrennung i m allgemeinen technisch nicht vollkommen zu realisieren. Daraus ergibt sich nun, daß in den Abgaben bei Verbrennung von Heizöl E L neben dem Schwefeldioxid auch andere toxische Schadstoffe anfallen können, so Kohlenmonoxid (CO) und Stickoxide (NO x ). Zusätzlich können Feststoffanteile enthalten sein, bestehend aus Asche und/oder Kohlenstoff (C), der Ruß. Langjährige Meß- und Prüfergebnisse haben gezeigt, daß die Anteile der toxischen Schadstoffe i m trockenen Abgas von 1 kg verbrannten Heizöls E L i m Durchschnitt nicht über folgenden Werten liegen: Kohlenmonoxid (CO) Schwefeldioxid ( S 0 2 ) Stickoxide ( N O x ) Feststoffe (Asche und Kohlenstoff)
125 mg pro N m 3 460 mg pro N m 3 140 mg pro N m 3 30 mg pro N m 3
Unter Verarbeitung der hier aufgeführten Annahmen und Erfahrungswerte ergäbe sich eine mögliche Schadstoffemission i m Jahr beim Backen von Brot und Backwaren in der Bundesrepublik wie folgt: Kohlenmonoxid (CO) Schwefeldioxid ( S 0 2 ) Stickoxide ( N O x )
809 160 kg 2 977 700 kg 906 620 kg
Das sind - wie bereits betont - nur Schätzwerte, die auf der Hypothese einer ausschließlichen Verwendung von Heizöl E L von gleichmäßig dezentralisierten Bäckereien gleicher Kapazität beruhen. Aber Methode und Ergebnis bewegen sich i m tolerierbaren Bereich, auch wenn mit großer Wahrscheinlichkeit die Umweltbelastung etwa um 15 % insgesamt niedriger liegen dürfte, und zwar durch die teilweise Verwendung von Gas und Elektrowärme, auch durch größere Backofeneinheiten, die einen relativ geringeren Wärmebedarf haben. Es dreht sich auch nicht um die Festschreibung statistischer Werte, sondern um eine umfassendere Feststellung, deren grundsätzliche Tendenz damit erhärtet werden kann.
Keine fossilen Brennstoffe Wäre es nicht ewig schade - i m wahrsten Sinne des Wortes: ewig - , wenn die fossilen Energiesorten, wie Kohle und Öl, durch den Schornstein gejagt würden, unwiederbringlich? Schon längst weiß man, wie wichtig Kohle und Ö l als Basis für die Chemie sind, sogar für Lebensmittel. Gas, auch das Erdgas, ist bei diesen Überlegungen bewußt ausgeklammert. Das hat einleuchtende Gründe: Gas ist eine relativ umweltfreundliche Energiesorte. Bei ihm muß der Prozeß der Umwandlung des (flüssigen) Öls in Gas vor der Verbrennung und zur Verbrennung nicht erst ablaufen, er hat schon stattgefunden. Die
344
Edgar Michael Wenz
oben erwähnten Schadstoffe fallen zwar bei der Verbrennung von Gas auch an, aber in wesentlich geringerem Umfang. So ist Gas von allen Energiesorgen nach dem Strom am angenehmsten. Auch hat es weniger anderweitige Verwendungsmöglichkeiten als seine fossilen Energiegeschwister Kohle und Öl. Wir kommen jedenfalls nicht daran vorbei: Es sind sehr, sehr viele Schadstoffe, die bei der so nützlichen und nach unserer Lebensauffassung unverzichtbaren Herstellung von Brot und Backwaren in die freie Atmosphäre entlassen werden. Gewiß, sie mögen sich auf zigtausende von Schornsteinen verteilen, es bleiben aber dennoch Schadstoffe. Es gibt einen Weg, die Atmosphäre zu entlasten. Es ist sogar ein sehr einfacher, ein sicherer Weg: Das ist die Elektrowärme, das ist der elektrisch beheizte Backofen.
Aufwand an elektrischer Energie Es gilt nun - bei selbstverständlich gleichen Annahmen zur Herstellung einer fairen „Waffengleichheit" zwischen den Energiesorten: 300 Arbeitstage / 7 Betriebsstunden/450 000 m 2 Backnutzfläche in 45 000 Backofeneinheiten mit je 10 m 2 - den Aufwand an elektrischer Energie zu ermitteln, der zum Ersatz des Heizöls gebraucht würde, das bei diesen Annahmen für den hier gefundenen deutschen „Durchschnittsbackofen" verbrannt wird. Unter den genannten Voraussetzungen betrüge der Jahresverbrauch nur für das Backen etwa 472 500 t Heizöl EL. Die theoretische Wärmeleistung eines Kilogramms Heizöl E L beträgt 11,86 k W h = 10 200 kcal. Nun aber ist ein wichtiger Vorzug des Backens mit „Elektrowärme" also Freisetzung der Wärme aus dem Strom mittels Widerstände - festzustellen, der eine arithmetische Gleichung verbietet. Die „Elektrowärme" nämlich bedarf nicht des gleichen Energieaufwandes wie Heizöl, sondern nur etwa 75% davon. Diese Verhältniszahl beruht auf langjährigen Erfahrungen, die wir i m In- und Ausland gewonnen haben; sie kann als gesichert gelten. Der Grund ist recht einleuchtend: Bei der Verbrennung von Heizöl (auch von Gas) bleibt ein hoher Anteil freigesetzter Energie ungenutzt, auch bei dem als sehr rentabel erkannten System der Zwangsumwälzung von Heizgasen. Abgasverluste bilden dabei den größten Posten. Bei Elektrowärme dagegen, insbesondere bei direkter Strahlungsheizung, fallen diese Verluste nicht an. So kommt es zu dieser Relation. Nachdem wir festgestellt haben, daß für die 450 000 m 2 Backnutzfläche in allen Betrieben des Backgewerbes in der Bundesrepublik Deutschland nach der Modellrechnung 472 500 t Heizöl pro Jahr verbraucht würden, entsprechen 5603850 M W h , so daß beim Faktor 0,75 das also etwa 4,2 M i l l . M W h an Strom ausmachen würde. Folgerichtig muß nun interessieren, was auf die Umwelt zukommt, um diese Menge an Strom zu erzeugen.
Backen und Umwelt
345
Es wäre nun eine Milchmädchenrechnung, wollte man nicht auch berücksichtigen, daß auch bei der Gewinnung von Strom die Umwelt ebenfalls belastet wird, daß Schadstoffe zwangsläufig emittiert werden. So bliebe nun zu prüfen, welche Umweltbelastung, bezogen auf die vorhin genannten Schadstoffe, auf uns zukäme, wenn die Betriebe des Backgewerbes die erforderliche Menge Strom von konventionellen Wärmekraftwerken, die entweder mit Schweröl oder mit Kohle beheizt werden, bezögen. Zunächst sollte man nach dem ersten Anschein meinen, die Belastung wäre wesentlich kleiner. Große zentrale Anlagen erlauben modernste Techniken und höchste Technologien. Aber dennoch: Der Wirkungsgrad solcher konventionell beheizten Kraftwerke ist niedrig; man darf ihn wohl mit etwa 33% annehmen, was einem guten Durchschnitt entspräche. Das bedeutet aber, daß dreimal mehr Primärenergie an Kohl und Ö l aufgewendet werden muß. Hinzu kommt, daß Wärmekraftwerke vorwiegend Rohkohle und den billigeren und wenig aufbereiteten Brennstoff Schweröl benutzen, die beide für sich schon mehr Schadstoffemissionen bewirken als das in mehreren Stufen veredelte Heizöl EL, das vergleichbar zur Wärmeerzeugung in deutschen Bäckereien eingesetzt wird. Das ist also erheblich mehr als bei den dezentralen Schadstoffemissionen in den einzelnen Bäckereien. So drängt sich die Faustregel auf: Wenn schon Öl oder Gas, dann zur direkten Verbrennung dezentral an den einzelnen Backöfen statt auf dem Umweg der Verstromung. Und dennoch: Strom zeigt den Weg zum Besseren. Er kann begangen werden; denn es gibt heute ausreichend Möglichkeiten der Stromerzeugung ohne derartige schädliche Belastungen.
Strom durch Kernkraft Wenn man aber mit der Elektrowärme auf dem richtigen Weg ist, dann muß dieser Weg auch konsequent weitergegangen werden. Und er führt nach dem heutigen Stand der Technik zum Strom durch Kernkraft! Für viele ein Reizwort, für viele aber auch das Zeichen der Hoffnung, die Chance, mit den Problemen unserer Zeit fertig zu werden. Bleiben wir zunächst bei der Umweltbelastung. Auch ein Atommeiler, selbst i m Normalbetrieb, belastet freilich die Umwelt. Zu nennen wäre zunächst einmal die Emission radioaktiver Stoffe, die ja bisher die ganze Diskussion gegen die Kernspaltung getragen hat. Aber diese Belastung ist nachweislich, und seriös eigentlich unbestritten, sehr gering. Eher zu nennen wäre die Abwärme. Aber auch dieses Problem ist lösbar. Die Abwärmebelastung ist jedenfalls eine quantifizierbare Größe, die in ihren Auswirkungen klar abschätzbar, ja kalkulierbar ist. Man kann sie eigentlich vernachlässigen, also unbeachtet lassen, weil sie auf keinen Fall wesentlich größer ist als die Umweltbelastung durch die Abwärme aus anderen Energiesorten. So ist sie auch bei den abgedruckten Schadstofftabellen bewußt außer An-
346
Edgar Michael Wenz
satz geblieben, weil sie j a für die Zielsetzung dieses Beitrags unwesentlich war. Wesentlich aber ist, daß andere Schadstoffe i m eigentlichen Wortsinne, andere und weitere Umweltbelastungen bei Kernreaktoren nicht anfallen. Dieses ist unstreitig. Zudem tritt auch bei den Kernkraftwerken die Abwärme in Form von Warmwasser auf. Dieses ließe sich - anders als die Abgase aus den Schornsteinen deutscher Bäckereien - wohl eines Tages auch ökonomisch sinnvoll nutzen, so etwa für Fernheizungen (ungeachtet aller i m Augenblick bekannter Rentabilitätsprobleme). Bei den Betriebsrisiken i m Normalbetrieb ist die Belastung durch Kernreaktoren sogar niedriger als beispielsweise bei einer Verbrennung von Kohle, Gas und Öl; denn bei diesen nämlich, die eigenartigerweise als ungefährlich und „akzeptabler" gelten, fallen - außer einer Unmenge von Schadstoffen bei etwa gleicher Abwärme - auch Strahlenbelastungen an, bei der Verbrennung bestimmter Sorten von Importkohlen sogar mehr als von Kernreaktoren.
Sicherheitsrisiken So bleiben die Sicherheitsrisiken. Zu ihnen gehört die Entsorgung. Sie tritt neuerdings mehr in den Vordergrund, da offenbar die Betriebssicherheit der Kernreaktoren selbst immer weniger angezweifelt zu werden scheint. Aber auch das Entsorgungsproblem scheint in allen wichtigen Teilbereichen gelöst und wird von seriösen Fachkreisen als technisch realisierbar ausgewiesen. Niemand w i l l freilich die Risiken insgesamt verniedlichen, niemand würde das auch können. Sie sind unser Problem, sie sind unsere Herausforderung. Hier freilich scheiden sich die Geister. Es kann und soll nicht Aufgabe dieses Beitrags sein, alle guten und schlechten Gedanken, die dazu schon auf Tonnen von Papier, in durchdiskutierten Nächten und Myriaden von Worten ausgetauscht wurden, aufzugreifen. Es wird wohl keinen anderen Weg geben, als sich zur Erkenntnis aufzuraffen, daß jede Generation der Menschheit vor ihre Aufgabe gestellt wird. Unsere Aufgabe, unsere Herausforderung lautet eben, die Gefahr des Atoms zu bändigen. Wir brauchen nicht hocherfreut zu sein, daß unsere Zeit sich damit herumschlagen muß. Es genügt die Einsicht, daß wir dieser Aufgabe nicht ausweichen können. Aber auch bei Betrachtung der Risiken mit jenem Ernst, die dieses säkulare Anliegen verdient, wird man erkennen können, daß unsere Generation keineswegs in ein völlig unentdecktes und nur gefährliches Niemandsland eindringen muß. Zunächst einmal muß abgegrenzt werden das Risiko i m Normalbetrieb vom Störrisiko, das ausgedehnt werden kann, bis zum größten anzunehmenden Unfall (GAU), ja zum „Super-GAU". Was also sind die Fakten? Mittlerweile liegen die Untersuchungen amerikanischer Wissenschaftler, die auch von deren deutschen Kollegen bestätigt werden, mit dem Nachweis vor, daß die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines großen Reaktorunfalles - i m Vergleich zu „konventionellen Unfällen" mit hoher Schadensfolge - so gering ist, daß dieses „Restrisiko" getragen
Backen und Umwelt
347
werden kann. Es ist ja nun tatsächlich auch nirgendwo in aller Welt, obwohl j a schon eine große Anzahl Kernkraftwerke verschiedener Technologien seit Jahren arbeitet, kaum ein nennenswerter Schaden aufgetreten. Nur zu verständlich gehen Diskussionen über Energiebedarf und Umweltbelastung über zur Frage, ob die Produktion von Gütern, deretwegen also die Energie gebraucht und die Umwelt belastet wird, „sozialen Nutzen" bringt oder nicht. Vieles ist umstritten, nur weniges nicht. Bäcker, Backen und Brot gehören dazu. Das läßt den Schluß zu, daß die vorhandene Energie eben in diese - „sozialnützliche", was immer das sein mag und wer immer das zu bestimmen sich aufwirft - Richtungen gelenkt werden sollte. Das aber wäre nicht nur der Einstieg, sondern man wäre schon mitten drin in einem gefährlichen und erst recht - die Geschichte beweist es - ineffizienten Dirigismus. Hier freilich konfrontieren kulturund geisteswissenschaftliche Standpunkte, die dann ihren politischen Ausfluß finden. Hier verlagert sich die Auseinandersetzung auf eine andere Ebene. Das Beispiel von Bäcker, Backen und Brot zeigt erneut auf, daß auch die nützlichsten und allgemein akzeptierten Dinge Energie verbrauchen, und weiterhin, daß diese Energie auch auf eine recht umweltfreundliche Art geschaffen und beschafft werden kann.
Erfahrungen mit Stikkenöfen* I. Kennzeichnung
Der Stikkenöfen ist gekennzeichnet durch die folgenden Merkmale: ein nicht unterteilter, schrankförmiger Backraum, der ebenerdig durch einen oder mehrere fahrbare genormte „Stikken" (mittelbare Backgutträger) beschickt wird, wobei die Stikken bequem zu handhaben sein müssen und deswegen in aller Regel nur ein Backblech, meist standardisierte Lochbleche (unmittelbare Backgutträger), in einer Lage, selten zwei, aufnehmen; wodurch die Stikken am gesamten Betriebsablauf, also sowohl vor wie nach dem Backprozeß, als Transportelemente teilnehmen. Durch diese Kennzeichnung unterscheidet sich der Stikkenöfen skandinavischer Herkunft von anderen befahrbaren Backöfen, etwa den in den Beneluxländern bekannten Wagenöfen. Die Bezeichnung „Stikken", die aus dem Niederdeutschen stammt, ist freilich etwas unglücklich, weil dieser Begriff i m Sprachgebrauch der Branche nur in den nördlichen Teilen der Bundesrepublik geläufig ist. Passende Bezeichnungen, die auch der Verbreitung der wirklich neuartigen Idee des Stikkenofens förderlich wären, werden gesucht; der Name „Roll-in" dürfte die Kennzeichnung am besten wiedergeben.
II. Beheizungssystem und Heizmedien Ein bestimmtes Beheizungssystem oder bestimmte Heizmedien sind für den Stikkenöfen nicht typisch. Theoretisch wäre jedes denkbar. Die besondere Eigenart des nicht unterteilten schrankförmigen Backraumes, der eine größere Anzahl Lagen Backbleche als Backgutträger aufnehmen kann, läßt die Konvektionsheizung vorteilhaft erscheinen, die auch tatsächlich am häufigsten angewandt wird. Dann wird der zwangsweise bewegte Wärmestrom zwischen den einzelnen Backblechanlagen hindurchgeführt.
* Erstveröffentlichung in: Edgar Michael Wenz, Das Backen. Das Gären. Die Technik. Die Theorie vom Backofen, Arnstein, 1980, S. 39 ff.
Erfahrungen mit Stikkenöfen
349
Als Heizmedien werden Öl, Gas und Strom eingesetzt. Bei Verwendung von Gas wird meist die recht rentable direkte Gasbeheizung bevorzugt. Das Rotieren des Stikkens um seine vertikale Achse ist nicht typisch für den Stikkenöfen. Diese bei manchen Konstruktionen vorhandene Eigenart dient lediglich dazu, ein gleichmäßiges Wärmeangebot und somit eine gleichmäßige Backware zu erzielen. Der gleiche Effekt kann auch durch andere Methoden erzielt werden, etwa durch periodische Umkehrung des Wärmestroms, durch horizontal wirkende Lageveränderungen des Stikkens, sofern nicht von vornherein durch die Wärmeführung eine gleichmäßige Beaufschlagung gewährleistet ist. Der zu beobachtende Versuch, aus dem Rotieren des Stikkens durch Wortableitungen einen Gattungsbegriff zu machen, ist sachlich keineswegs gerechtfertigt und wohl als Wettbewerbsbemühungen zu erkennen.
I I I . Mechanik, Schwadenerzeugung, Warmwasserbereitung, Steuer- und Regelelemente Die mechanischen Elemente am Stikkenöfen entsprechen vergleichbaren Etagenbacköfen. Rotationen oder andere mechanische Bewegungen des Stikkens werden durch einen separaten Antrieb bewirkt; bei ausgereiften Konstruktionen sind nennenswerte Schäden der rotierenden Teile, die freilich i m Backraum der Wärme ausgesetzt sind, nur selten zu beobachten. Die bei mehreren Fabrikaten eingebaute ofenseitige Schwadenerzeugung ist für höhere Ansprüche nicht ausreichend; die schnelle Sättigung des j a relativ großen Backraums läßt sich nur durch ein großes Schwadenangebot bewirken. Bei schwadenbedürftigen Backwaren geht man wohl von einer Betriebsdampferzeugung aus, die j a in den skandinavischen Bäckereien auch zu den Regelausstattungen gehört. Eine ofenseitige Warmwasserbereitung ist bei den Stikkenöfen in aller Regel nicht vorhanden. Die Steuer- und Regelgeräte entsprechen jenen an modernen Etagenbacköfen. Bei mechanisch bewegten Stikken wird beim Öffnen der Türe die Bewegung ausgeschaltet.
IV. Backeigenschaften Es ist theoretisch kein Grund zu erkennen, warum die Backeigenschaften in einem Stikkenöfen a priori anders oder schlechter sein sollten als in anderen Backöfen. Die Praxis bestätigt das voll und ganz. Es wurden i m Versuch ebenso wie in der Alltagspraxis alle in der Bundesrepublik Deutschland bekannten Brotsorten erbacken, wobei die Qualität bei den ausgereiften Fabrikaten als mindestens gut, bei leichteren Backwaren sogar als sehr gut bezeichnet werden darf.
350
Edgar Michael Wenz
Das gilt jedoch nur mit einer ganz wesentlichen Einschränkung, nämlich für Backwaren mit qualifizierten Ansprüchen an die Bodenkruste, also in erster Linie Brotsorten und Brötchen, die üblicherweise direkt auf der Backsohle (Herdplatten) erbacken werden. Wenn diese Backwaren auf den Blechen, meist Lochblechen, eines Stikkenofens erbacken werden, so ist die Ausbildung der Bodenkruste zwar durchaus ausreichend, aber doch nicht mit den gewohnt kräftig ausgebildeten Böden vergleichbar. Dazu ist noch bei Brötchen eine konkave Einschnürung des Bodens zu beobachten, die als qualitätsmindernd bezeichnet werden muß. A n dieser Feststellung ändert auch nichts die Tatsache, daß Fälle mit einem sogar gut verkauften großen Brötchenausstoß bekannt sind. Die jedenfalls, verglichen mit guten Einschieß- und Etagenbacköfen, eingeschränkte Qualität der Bodenkruste läßt sich auch theoretisch leicht ergründen dadurch, daß ein Backblech als Backgutträger zwangsläufig die Umwelttemperatur, zuletzt also jene der Stückgare, hat, wenn es gemeinsam mit dem Backgut in den Stikkenöfen eingefahren wird. Naturgesetzlich braucht die Aufladung des Backbleches mit Wärme eine gewisse Zeit; das Backblech wirkt vorübergehend als gewissermaßen sogar isolierend, während die Herdplattenbacksohle beispielsweise an Etagenbacköfen spontan die Wärme an das Backgut abgibt. Die konkave Einschnürung des Bodens erklärt sich ebenfalls durch das ja noch vorübergehend relativ kalte Backblech während der Ausbundphase. Die gleichen Erscheinungen sind an sich an Ausbundwaren zu bemerken, die ebenfalls mit dem Backblech als Backgutträger auch in andere Backofensysteme eingebracht werden. Andererseits aber darf jede Blech ware als i m Backergebnis absolut optimal bezeichnet werden. Da der Backraum eine in sich geschlossene, nicht unterteilte Einheit bildet, herrschen in ihm zwangsläufig und unabänderlich die gleichen thermischen und atmosphärischen Verhältnisse. Das bedingt, daß die Backware bei jedem einzelnen Backprozeß gleichartig sein muß, gleichartig in der Temperatur, in der Backzeit und i m Schwadenbedarf.
V. Der Rationalisierungseffekt Der Vorzug des Stikkenofens liegt i m Rationalisierungseffekt, nämlich a) in der extrem hohen Bodenflächenausnützung („Wolkenkratzereffekt") und b) i m schnellen, weil „rollenden" Betriebsablauf. zu a) Die Ausnützung des Stikkenofenbackraums richtet sich nach der Höhe des jeweiligen Backgutes. Üblicherweise wird für Brot ein Abstand von Backblechlage zu Backblechlage von ca. 120 mm, für Feingebäck von ca. 60 m m gewählt. Z w i schenhöhen, etwa für Brötchen, sind möglich. Das nun garantiert die volle Ausnut-
Erfahrungen mit Stikkenöfen
351
zung des Backraumes unmittelbar und somit der Bodenfläche mittelbar. So werden auch die großen Backkapazitäten verständlich. (Beispiel: zwei Doppelstikkenöfen, somit 2 x 2 Stikken i m Backeinsatz, werden ausgewiesen mit einer Stundenleistung von ca. 6 800 Kaffeestückchen 36 Gramm oder 800 Stück Kastenbrote 500 Gramm.) I m ungünstigsten Falle (bei Brot) ergibt sich beispielsweise ein Verhältnis von Backnutzfläche zu überdeckter Bodenfläche von 3,5 m 2 : 1,4 m 2 (Faktor 2,5), i m günstigsten Falle (bei Feingebäck; Doppelstikkenofen) eine Relation von 14,0 m 2 : 3,96 m 2 (Faktor 3,54). Ein derartiger Bodenflächenausnutzungsgrad ist unerreicht. Vergleich: Ein Umwälzetagenofen mit 4 Backräumen je 1,20/1,60 m = 7,7 m 2 Backnutzfläche deckt durchschnittlich ca. 4,5 m 2 Bodenfläche (Faktor also 1,71) (Abb. 1).
75-
50-
3,SC
74,0
Î
Etagenbackofen (Urnwälzer)
100 ·/.
Stikkenöfen 7 Stikken (Brot)
• FXx 3 =
Gesamt-
IIIIII =
Gesamt - Grundfläche
I
I I
I
I
Back fläche
= Grundflächen Anteil
der
-
m2
in in
Stikkenöfen 2Stikken(Feingebäck)
S
•
u
•
m2
Nutzungsfaktor
Grundfläche
in %
der Back fläche
Abb. I Ein Durchlaufofen mit etwa 28 m 2 Backnutzfläche, in der Leistung also vergleichbar mit zwei Doppel-Stikkenöfen für Feingebäck, würde - bei einer Bandbreite von 0,80 m - ca. 53 m 2 Bodenfläche beanspruchen (Faktor also ca. 0,53); hiermit verglichen wäre also die Bodenflächenausnützung des Stikkenofens etwa 7mal so groß. zu b) Die Vorteilhaftigkeit der Ofenbeschickung durch Befahren ist augenfällig. Hier liegen die Chancen zur Rationalisierung des Betriebsablaufes (siehe auch Ziff. V I ) (Abb. 2).
352
Edgar Michael Wenz
•
tî
_0 M rkfofif*
ι
JtttL
7
Abb. 2
VI. Möglichkeiten und Grenzen der Rationalisierung - der „ideale Fall64 Die schnelle Beschickung durch Befahren kommt nur dann zur Wirkung, wenn sich die Beschickungsfolgen häufig wiederholen. Somit läßt sich der größte Effekt erzielen bei schnellbackenden Waren. Brötchen könnten an der Grenze liegen. Bei Feingebäck, das zudem auch noch die besten Backergebnisse aufweist, schlägt die Wirkung voll durch. Die Fahrbarkeit des Stikkens wird erst dann voll ausgeschöpft, wenn dieser Stikken nicht nur als mittelbarer Backgutträger und als Ofenbestandteil, allenfalls noch als ein Teil des Gärprozesses, sondern als ein ganz wesentlicher Bestandteil des gesamten Betriebsablaufes gesehen wird. Alles muß rollen, von der Teigverformung, wo die Teiglinge auf die Backbleche gesetzt werden, über den ebenfalls befahrbaren Klimaschrank (Gärunterbrecher) oder Gärschrank zum Stikkenöfen, von dort in den Kühlraum, in den Lagerraum, j a komplett auf den Transporter (wo er praktisch auf dem Weg zur Filiale auskühlen kann), in das Ladenlokal (wo der gepflegte Stikken als Lagergestell i m „open display" dient), von dort i m ständigen Kreislauf wieder zurück zum Produktionsbetrieb. Die Anschaffung eines Stikkenofens mit befahrbarem Gärschrank kann also richtig nur als der Anfang eines insgesamt „rollenden Betriebsablaufes" gesehen werden. Anders wäre der Effekt nicht ausgeschöpft. Der „ideale Fall" kann aufgrund theoretischer Überlegungen wie praktischer Erkenntnisse gesehen werden in einem Gesamtkonzept eines rollenden Betriebsablaufes, etwa einen mittleren und größeren Betrieb mit überwiegend oder ausschließlich Blechwaren und Feingebäck bei vielseitigem und häufig wechselndem Sortiment. Der Einsatz herkömmlicher Etagenöfen wäre dann zu umständlich,
Erfahrungen mit Stikkenöfen
353
eines Durchlaufofens wegen des Sortimentwechsels möglicherweise nicht empfehlenswert. Der Einsatz mehrerer Stikkenöfen als „Batterie", stets i m Rahmen eines insgesamt rollenden Betriebsablaufes, dürfte die optimale Lösung bieten.
Zusammenfassung Der Stikkenöfen, der einen einprägsameren Namen verdienen würde, ist ein vollwertiger Backofen. Alle Beheizungssysteme und Heizmedien sind möglich; Konvektionsheizung und Edelbrennstoffe werden bevorzugt. Die Regel-, Steuergerät- und Sicherheitstechnik entsprechen dem modernen Stand. Die Backeigenschaften des Stikkenofens sind für Ausbundware mit Qualitätsansprüchen an die Bodenkruste eingeschränkt, für Blechware jedoch ganz hervorragend. Eine komplette Ofenbeschickung mit gleichartigen Waren ist erforderlich. Der größte Nutzen liegt i m Rationalisierungseffekt. Der Bodenflächennutzungsfaktor ist bei Feingebäck vergleichlos günstig. Die Befahrbarkeit des Backraumes ermöglicht eine besonders schnelle Beschickung und Entleerung. Dieser Vorzug schlägt dann i m gesteigerten Maße durch, wenn schnell backende Waren dem Stikkenöfen angetragen werden und er als ein Teil, freilich der wichtigste, eines Betriebsablaufes verstanden wird, der fahrbar und rollend konzipiert ist. Einheitliche (genormte) Stikken und (standardisierte) Backbleche sind hierfür Voraussetzung. Der Stikkenöfen ist am meisten verbreitet in Skandinavien; i m übrigen Europa und in den USA ist seine Verwendung, die offensichtlich wächst, auf Spezialaufgaben beschränkt, für die er jedoch dann aber auch klar überlegen sein kann.
Schrifttum Fischer, G., Der Stikkenöfen schließt eine Lücke. Bäckerzeitung (1970) 30, 10 ff. Wenz, Ε. M., Der Stikkenöfen - was ist er und was kann er?, Weckruf (1967) 42 u. a. a. O.
23 Gedächtnisschrift Wenz
Einflußgrößen* Ermittlung von Kennzahlen für Backöfen und Backanlagen Zu einer echten Gegenüberstellung gehören vergleichbare Größen. Das gilt auch für Backöfen und Backanlagen. Die Autoren des folgenden Beitrags zeigen die Wege auf zu solchen Größen zu kommen.
I. Rentabilität ist hier verstanden i m engeren Sinne als Wirtschaftlichkeit, also das Verhältnis von Aufwendungen (Kosten) zum Nutzen. Rentabilität ist ein kaufmännischer und wirtschaftlicher Begriff. Sie ist i m freien Unternehmen unverzichtbar. Sie nicht zu beachten, sie nicht anzustreben, sie schließlich nicht zu erreichen das bedeutet in unserer Ordnung den wirtschaftlichen Tod, schlicht und einfach den Konkurs. Technische Investitionsgüter und Verfahrensweisen haben unstreitig auf diese Rentabilität einen entscheidenden Einfluß. Das gilt auch für Bäckereien und Backwarenfabriken, hier wiederum in erster Linie deren Kernstück: Backofen und Backanlage, die zudem durch nichts anderes zu ersetzen sind, in der Regel auch den größten betrieblichen Kostenfaktor darstellen. Das richtige Ziel - die Versachlichung ohne die Technik und Fortschritt undenkbar sind - zu erkennen, war leichter als den Weg dorthin zu finden. Es konnte nur so gelingen: alle Einflußgrößen auf Backofen und Backanlage aufzusammeln, zu analysieren, dann auszusondern, separat zu bewerten, einen gemeinsamen Nenner zu finden, schließlich wieder zu einem Komplex zusammenzufügen. Aus diesem Vorgehen ergaben sich Aufzeichnungen, die als Skizzen und Schaubilder vorliegen**. Für den ersten Abschnitt dieser Arbeit wurden nach sorgfältiger Prüfung die schon 1967 ermittelten Werte zugrunde gelegt, die damals erarbeiteten Tabellen, Skizzen und Schaubilder erneut zur Veröffentlichung herangezogen. (Sie wurden dann in Abschnitt I I ergänzt.) Deshalb sind aber diese ein gutes Jahrzehnt alten Werte keineswegs unrichtig. Sie gelten nach wie vor, sie gelten ebenso gut, wie ein medizinisches Handbuch der Anatomie nicht deshalb weniger „richtig" wäre, weil es aus einer älteren Auflage stammte. * Erstveröffentlichung in: Edgar Michael Wenz, Das Backen. Das Gären. Die Technik. Die Theorie vom Backofen, Arnstein, 1980, S. 41 ff. ** Siehe dazu die Schaubilder A - F auf S. 367 ff. diess Buches.
Einflußgrößen
355
Es sind freilich einige Backofensysteme untersucht, die heute an Marktbedeutung verloren haben. Aber die wesentlichsten und meisten Darstellungen und Vergleiche sind heute noch ungeschmälert richtig, haben also keineswegs nur historischen Wert. Sinn einer solchen Arbeit wird es immer und überall in erster Linie auch sein, erst recht in einer so schnellebigen Zeit wie der unsrigen, Überlegungen anzustellen, freilich an konkreten Beispielen zu messen, darauf Denkmodelle aufzubauen und dann diese eben anzuwenden, als eine Art Maßstab anzulegen. Bei solchen für die Praxis bestimmten Modellrechnungen kommt es i m hohen Maße darauf an, Beispiele auszuwählen, die konkret und praxisnah sind, einmal der besseren Verständlichkeit wegen, vor allem aber um Werte zu gewinnen, die in möglichst vielen Fällen, bei möglichst geringen Abweichungen, wieder angewendet werden können. So wurde modellhaft ein Bäckereibetrieb ausgewählt, wie er häufig anzutreffen ist, nämlich in der sog. „M-Größe". Darunter kann man einen Backbetrieb mit etwa 30 m 2 nutzbarer Backfläche verstehen. Daraus wurden nun die einzelnen Kennzahlen durch einen „gemeinsamen Nenner" objektiviert; das ist der „Quadratmeter Backnutzfläche". Durch diese Reduktion konnten weitgehend Fehlerquellen, die sich ergeben, aus dem Vergleich unterschiedlicher Backofensysteme und unterschiedlicher Betriebsgrößen oder gleicher Betriebsgrößen, aber mit unterschiedlichem Sortiment, ausgeschaltet werden. Ohne Fähigkeit zur Abstraktion wären derartige Bemühungen ohnehin zum Scheitern verurteilt. So mußte von vornherein eine Beschränkung eingeführt werden auf Backofensysteme, verstanden also als Konstruktionen, die so viele gleichartige Elemente aufweisen, um sich zusammen gegenüber einer anderen Gruppe mit ebensolchen gleichartigen Elementen deutlich zu unterscheiden. Die gemeinsamen Charakteristika bilden also ein System. Kennzeichnend dafür ist in aller Regel, daß die verschiedenen Anbieter vergleichbare Backofensysteme herstellen, deren Unterscheidungsmerkmale in mehr oder weniger typischen Besonderheiten liegen; diese Spezifika machen nun - i m Unterschied zum „System" - das „Fabrikat" aus. Innerhalb der einzelnen Fabrikate wiederum zeigen sich nochmals Unterschiede, dann allerdings nicht konzeptionelle, sondern spezifisch-konstruktive. In diesen kann man nun - zur Unterscheidung von den vorher definierten „Systemen" und „Fabrikaten" - die „Typen" erkennen. Diese Untersuchung kann sich also nur auf die hier definierten BackofenS y s t e m e " beziehen. Eine Auswertung der einzelnen Fabrikate oder gar Typen wurde bewußt außer Ansatz gelassen. Eine weitere Beschränkung auf die Marktgängigkeit, von der j a überhaupt das Interesse bestimmt wird, schien weiterhin geboten. Die dargestellte Auswahl beschränkt sich i m Teil I auf den Stand des Backofenbaus zu Ende des vergangenen Jahrzehnts. So sind noch die Auszugs-Dampfbacköfen (III) dargestellt, die aber praktisch keine Bedeutung mehr haben, ebenso wenig wie der - über Jahrzehnte den europäischen Backofenbau beherrschende - „klassische" Einschließ-Dampf23*
356
Edgar Michael Wenz
backofen, der von vornherein nicht berücksichtigt wurde, auch nicht der insbesondere damals recht weit verbreitete Etagen-Dampfbackofen (röhrenbeheizter Etagenofen). Aber gerade an diesem Beispiel zeigt sich, daß dennoch treffend mit weiterer Gültigkeit ausgewählt wurde. Das System des Auszugsofens existiert weiter, wenn auch nicht beheizt mittels Hochdruckdampfrohren. Somit gelten die meisten an diesem Beispiel ermittelten Werte auch weiterhin; nur die spezifisch auf die Dampfrohrbeheizung abgestellten Werte müßten in den betreffenden Kennzahlen korrigiert werden. Das beispielsweise könnte über das System des TermoölBackofens geschehen, der - als Beheizungssystem - nicht berücksichtigt wurde, weil nicht genügend objektive Werte zugänglich waren. Diese könnten auf der Basis des ermittelten Schemas folgerichtig eingebaut werden, zumal diese beiden Systeme physikalisch miteinander verwandt sind. Der Elektro-Etagenbackofen wurde auch nicht separat bewertet, dies aber keineswegs aus Mangel an objektiven Zahlen, sondern eigentlich wegen der nur geringen Unterscheidung zum Etagenbackofen mit Heizgasumwälzung (II), mit dem er viele Werte gemeinsam hat; jene aber, die davon abweichen, etwa die Energiekosten durch die zerklüftete Tariflandschaft, sich ohnehin nur schlecht nivellieren ließen. Aber gerade an diesem Beispiel läßt sich die prinzipielle Anwendbarkeit des ermittelten Denkmodells, des vorgelegten Schemas, beweisen. Die Kennzahlen für einen Etagenbackofen mit elektrischer Beheizung lassen sich unschwer - auch und gerade abgestellt auf Fabrikat, Typ und Region - exakt ermitteln. Aber das eigentliche Kriterium liegt auf anderer Ebene, nämlich in der Problematik der Wertung und Bewertung der einzelnen Kostenfaktoren. Hierzu sind nun weiterführende Gedankengänge unverzichtbar. Man mußte sich aus naheliegenden Gründen auf eine gleiche Wertigkeit aller Kostenfaktoren festlegen. Hier aber setzen nun die individuellen und betriebsspezifischen Unterscheidungen ein, ja der Zwang zu diesen Entscheidungen. Die einzelnen Kostenfaktoren erfahren eine unterschiedliche Rangordnung. Ein Backbetrieb mitten in einer Großstadt, der diesen Standort aus irgendwelchen Gründen unbedingt halten will, wird dem Grundflächenfaktor einen höheren Rang einräumen, j a zwingend einräumen müssen. Bei leergefegten Arbeitsmärkten in Ballungsgebieten wird der Personalkostenfaktor auch höher bewertet werden müssen. Bei diesen beiden genannten Faktoren läßt sich „Ersatz", etwa durch den beliebigen Einsatz von Geldmitteln, möglicherweise noch nicht einmal schaffen. Die Energiekosten könnten als Faktor - insbesondere bei der derzeit unsicheren und schwankenden Versorgungslage eine gewisse Rolle spielen. Es ist durchaus vorstellbar, daß der Kaufpreisfaktor gar nicht so sehr entscheidend ist; aber auch hier mag es selbstverständlich genügend Fälle geben, die man deshalb nicht als Ausnahmen bezeichnen darf. Hier nun spielt die unternehmerische Entscheidung, wie die einzelnen Faktoren bewertet werden, die ausschlaggebende Rolle. Die unternehmerische Entscheidung ist durch nichts zu ersetzen. Hier die Gewichte richtig zu setzen, ist die Sache des freien Unternehmers. Für eine glückliche Hand wird er ebenso belohnt wie für
Einflußgrößen
357
Mißgriffe bestraft. Je sorgfältiger und überlegter Unternehmer, ob nun Pächter einer handwerklichen Bäckerei oder Gesellschafter / Geschäftsführer einer großen Brotfabrik, anstellt, je objektiver, fachkundiger, sachlicher und vorurteilsfreier er an seine Aufgabe herangeht, desto eher wird er die vorhin erwähnte „glückliche" Hand haben, die mit „ G l ü c k " im profanen Sinne gar nichts zu tun haben braucht. Man kann sich nämlich auch an Fakten halten. Als wesentliche Kostenfaktoren wurden herangezogen - als investive: der Kaufpreis (E, Ziffer 1), der Platzbedarf (A) - als betriebliche: der Energiebedarf (C), der Personalbedarf (D). A Vergleich verschieden zusammengestellter Backanlagen mit etwa gleich großer Gesamtbackfläche. Feststellung der Flächendeckung. Dargestellt wurden sieben Lösungen, wie die angestrebten Quadratmeter Backnutzfläche von mehreren, nebeneinander als „Batterien" angeordneten Einheiten bis zur automatischen Backanlage erreicht werden können. Dabei stellt dar I
= sechs Einheiten als Etagenbacköfen mit 6 Backkammern je 60 χ 160 cm, System Heißluftumwälzung bei bewegter Backatmosphäre (ein Hersteller);
II
= vier Etagenbacköfen mit 4 Backkammern je 120 χ 160 cm, verfügbar i m System der Heizgasumwälzung mit ruhender Backatmosphäre (mehrere Hersteller);
I I I = zwei Auszugs-Dampfbacköfen mit 3 Backkammern je 160 χ 325 cm (wenige Hersteller); I V = zwei Reversier-Band-Etagenöfen mit 2 Backkammern je 180 χ 445 cm (wenige Hersteller); V
= ein Reversier-Band-Etagenofen mit 4 Backkammern je 200 χ 400 cm (ein Hersteller);
V I = Backanlage bestehend aus zwei Durchlauföfen je 165 χ 1000 cm (wenige Hersteller); V I I = ein Durchlaufofen 200 χ 1600 cm (wenige Hersteller). (Bemerkung: die angefügten Darstellungen V I I I und I X sind das Ergebnis einer anderen und späteren Studie, sie werden i m Abschnitt I I behandelt werden; siehe dort.)
358
Edgar Michael Wenz
Das Schaubild zeigt das Ergebnis, daß mit einem Faktor von 0,81 die Lösung V die absolut günstigste ist, weil am meisten platzsparend. Bei dieser Untersuchung wurde allerdings nicht berücksichtigt, daß Jahre später auch Etagenbacköfen mit Heizgasumwälzung (II) mit fünf Backkammern und Backraumgrößen von 180 χ 200 cm immer mehr vordrängen. Gegen fünf Backkammern kann man, wegen der zwangsläufig unbequemen Bedienungshöhen, allerhand Argumente vorbringen, auch ergometrische, möglicherweise sogar arbeitsschutzrechtliche. Bei dieser Analyse geht es aber nur um den Platzbedarf. Konkret könnte also das Beispiel I I ersetzt werden durch eine Batterie aus zwei Etagenbacköfen mit je fünf Backkammern 180 cm breit χ 200 cm tief; das ergäbe 36 m 2 Backnutzfläche bei einem Platzbedarf von 26,3 m 2 , somit einen Flächennutzungsfaktor von 0,73. Damit schöbe sich diese neue Lösung auf Platz eins. Der gesamte Platzbedarf ( = F ) ermittelt durch die Addition dieser Teilflächen + die vom Körper des Backofens direkt überbauten Flächen ( = Fk) + der auskragenden Teile, die fest mit dem Backofenkörper verbunden sind ( = Ft) + der Flächen für Bedienung, also Beschickung, Entleerung und Steuerung des Backofens ( = Fb) + der zwingend freizuhaltenden Fläche für Wartung des Backofens (= Fw). Der Nutzen, den die belegte Bodenfläche erbringt, ist die Backnutzfläche (= NF). Der Flächennutzungsfaktor ( = fn) ist die Verhältniszahl aus der Anzahl der benötigten Bodenfläche in Quadratmeter zur Erstellung und Bedienung der Backofenanlage zur effektiven Backnutzfläche errechnet sich nach dieser einfachen Formel: FN _Fk + Ft + Fb + Fw (m 2) ~~~€
F
Κ )
Je kleiner der Flächennutzungsfaktor fn, desto besser ist die Ausnützung der Gebäudegrundfläche. A u f die zwar optisch freien, aber zwingend nicht anderweitig nutzbaren Flächen konnte bei der Ermittlung des Platzbedarfs nicht verzichtet werden. Wo sich diese Teilflächen überdecken, wurden sie selbstverständlich nur einmal angesetzt. Außer Ansatz konnte hier bleiben die nur gelegentlich beanspruchte Fläche für größere Eingriffe, etwa Reparaturen (Beispiel: Auswechseln der Heizstäbe an Elektro-Etagenbacköfen). I m Arbeitsbereich hindernde Maschinen könnten da vorübergehend ortsverändert werden. Es folgen nun Vergleiche weiterer Kostenfaktoren, die graphisch dargestellt und erläutert sind, aus Platzmangel aber hier nur in den Untertiteln angedeutet werden können:
Einflußgrößen
359
Β
Vergleich des Grundflächenbedarfs bei verschieden zusammengestellten Backanlagen mit etwa gleich großen Gesamtbackflächen
C
Vergleich des Wärmebedarfs bei verschieden zusammengestellten Backanlagen mit etwa gleich großen Gesamtbackflächen
D
Vergleich des Personalbedarfs bei verschieden zusammengestellten Backanlagen mit etwa gleich großen Gesamtbackflächen
E
Vergleich der Kostenfaktoren bei verschieden zusammengestellten Backanlagen mit etwa gleich großen Gesamtbackflächen
F
Vergleich der Gesamtkostenfaktoren bei verschieden Backanlagen mit etwa gleich großen Gesamtbackflächen
zusammengestellten
In alle diese Überlegungen der Rentabilität werden in den nächsten Jahren mit hoher Wirkung hineinspielen die unübersehbaren Anzeichen einer neuen „industriellen Revolution". Unsere Generation ist ja nun vor Aufgaben gestellt, die mit Lebensqualität ebenso zu tun haben wie mit Umweltbelastung. Die sog. „dritte industrielle Revolution", die i m Ersatz menschlicher Arbeitskraft durch Mikroprozessoren den augenfälligsten Niederschlag findet, wird auch Backgewerbe und Bäckereitechnik, wenn sicherlich auch nur in Grenzen, berühren. Die Problematik der Umweltbelastung wird sich früher und einschneidender bemerkbar machen. Es ist dies ein Bündel von Problemen, die sich auch für Backgewerbe und Bäckereitechnik abzuzeichnen beginnen. Sie wird die Kostenfaktoren nicht dem Grunde, aber der Höhe nach beeinflussen. Vor allem aber wird sie zu Entscheidungen in der Gewichtung der Prioritäten führen. Eine freie und entschlossene Unternehmerschaft wird sie erfolgreich angehen können.
II. Der Stikkenöfen war 1967 an sich in der BR Deutschland kaum bekannt, obwohl er in diesem Jahr erstmals auf einer Messe i m Betrieb demonstriert wurde. Der Durchbruch des Stikkenofens geschah erst vor wenigen Jahren. Der Stikkenöfen ist das am meisten platzsparende Backofensystem der Gegenwart. Sein Durchbruch eröffnete gleichzeitig weitere konstruktive Überlegungen. Man unterscheidet nunmehr zwischen - dem „klassischen" Stikkenöfen, der gekennzeichnet ist durch die Rotation des Stikkens (Wagen zur Aufnahme von Backgutträgern/Backblechen) vertikal um die eigene Achse (rechte Skizze), und - dem Schrankofen, der dadurch gekennzeichnet ist, daß der eingefahrene Stikken stehenbleibt, dagegen die Heizluft wechselseitig eindringt (linke Skizze). Die anderen Merkmale und erforderlichen Voraussetzungen zum Betrieb (so beispielsweise gleichartige Backkammern mit gleichem Temperatur- und Schwaden-
360
Edgar Michael Wenz
bedarf; Konvektionsheizung = bewegte Backatmosphäre nach Gewinnung von Heißluft über Wärmetauscher). Es kommt also i m wesentlichen beim Vergleich dieser beiden Stikkenofensysteme (der Begriff „Stikkenöfen" soll als Sammelbegriff, sofern keine Unterscheidungen gefunden werden sollen, beibehalten werden) auf den Platzbedarf an; deshalb kann die Untersuchung darauf konzentriert werden. Die Schaubilder V I I I und I X wurden den bereits vorhandenen Schaubildern I - V I I angefügt, um die Vergleichbarkeit zu erleichtern. Die Regeln der Ermittlung der einzelnen Faktoren sind selbstverständlich gleich geblieben. Es kann bei allen Darstellungen auf die vorliegenden Ausführungen verwiesen werden. Nur deshalb hat eine separate Behandlung der Stikken- und Schranköfen stattgefunden, weil historisch die beiden Untersuchungen - 1967 und 1979 - auseinanderliegen, dieser ausdrückliche Hinweis also geboten erscheint. Der ursprüngliche Eindruck, daß ein Schrankofen mit seinen feststehenden Stikken, noch dazu mit Oben- statt Seitenheizung, wesentlich platzsparender sein müßte, findet durch diese objektive Untersuchung keine Stütze. Der Unterschied ist so minimal, daß man ihn vernachlässigen darf. Würde noch die zu einem fließenden Betrieb erforderliche Anzahl von Stikken, die j a auch - anders als beispielsweise Einschießgeräte für Etagenöfen - Bodenfläche beanspruchen, in die Flächenrechnung einbezogen werden, so würde der Unterschied bis zur zweiten oder dritten Stelle hinter dem Komma gehen. Ob bei D „Vergleiche des Personalbedarfs . . e i n e Untersuchung zusätzlich noch geboten wäre, ob eine obensitzende Heizung mehr Verrichtungseinheiten veranlaßt als eine Seitenheizung, mag hier außer Betracht bleiben. Bei Unterschieden der Stikken- und Schranköfen, die man ihrer Geringfügigkeit wegen durchaus vernachlässigen kann, läßt sich aber doch erkennen, daß das System der befahrbaren Backräume allen anderen Backofensystemen aus dem Gesichtspunkt der Kostenfaktoren eindeutig überlegen ist. M i t dieser Feststellung allerdings ist über die backtechnischen Eigenschaften und den unbegrenzten Einsatz diesen oder jenen Backofensystems - das war nicht die Aufgabenstellung - nichts gesagt. Hier sollten nur - und nichts anderes! - die einzelnen Kostenfaktoren nach strengen Regeln, die nachprüfbar und nachvollziehbar sind, untersucht und dargestellt werden. Der Nutzen eines Backofensystems oder -modells oder vielleicht auch -fabrikats kann nicht nur in der größten Vermeidung von Kosten oder i m geringsten Aufwand von Kosten gesehen werden. Es könnten auch andere Perspektiven eingebracht werden. Es genügt schon, wenn die Diskussion über Entstehen und Auswirkungen der einzelnen Kostenfaktoren durch einen Konsensus über die Ermittlung derselben - versachlicht werden kann. Das war Sinn und Zweck dieser Arbeit.
Einflußgrößen
361
Nachtrag: Vergleich und Erläuterung weiterer Kostenfaktoren Β Vergleich des Grundflächenbedarfs bei verschieden zusammengestellten Backanlagen mit etwa gleich großen Gesamtbackflächen Dieses Schaubild, als Säulenkolonne aufgefaßt, bezieht sich auf die Darstellung A, auf die sie aufgebaut ist. Dabei bedeuten in der Reihenfolge von links nach rechts die Säulen 1. Gesamtbackfläche 2. Gesamtgrundfläche 3. überbaute Grundfläche 4. Bedienungsfläche 5. Prozent-Verhältnis 1 - 4 . Die Methoden der Ermittlung der einzelnen Teilflächen wurden in Abschnitt A bei Erläuterung der Zeichnungen dargestellt; das Ergebnis ist der Bodenflächennutzungsfaktor (fn), der identisch ist mit der fünften Säulenkolonne. C Vergleich des Wärmebedarfs bei verschieden zusammengestellten Backanlagen mit etwa gleich großen Gesamtbackflächen Auch diese in Säulenkolonnen dargestellten Vergleiche basieren auf der Darstellung A. Dabei bedeuten von links nach rechts die einzelnen Säulen: 1. Installierter Anschlußwert 2. Durchschnittlicher Verbrauchswert 3. Prozentverhältnis 4. Durchschnittlicher Verbrauchswert je m 2 Backnutzfläche. Der Wärmebedarf wurde nach den allgemeinen Regeln, unter Zugrundelegung von Angaben der Hersteller und nach eigenen Beobachtungen und Messungen, ermittelt. Der Wärmebedarf des Backofens kann auf die Leistungseinheit m 2 Backnutzfläche bezogen werden, bei Backanlagen unterschiedlicher Art und unterschiedlicher Größe auch unmittelbar verglichen werden. Die Abstrahierung und Reduzierung auf den gemeinsamen Nenner m 2 Backnutzfläche ist einleuchtend. Beachten muß man den Unterschied zwischen dem installierten Wärmebedarf (theoretischer Anschlußwert) und dem tatsächlichen durchschnittlichen Verbrauchswert. Es entstehen Abgasverluste, weil die vom Material nicht aufgenommene Wärme als erhöhte Abgastemperatur ungenutzt ins Freie abgeleitet werden wird. Wärme-
362
Edgar Michael Wenz
fluß kann nur vom höheren Temperaturniveau zum niedrigeren Temperaturniveau erfolgen. Es ist deshalb nicht möglich, backofenseitig die Abgastemperatur unter die Material-Temperatur zu bringen. Die Senkung der Abgasverluste kann damit nur extern, außerhalb des eigentlichen Heizsystems des Backofens erfolgen, etwa durch Ausnutzung der Abgaswärme mittels zusätzlicher Einrichtungen für die Warmwasserbereitung. Bei den Untersuchungen wurden für die Beheizungen aller Backofensysteme Edelbrennstoffe, wie Gas oder Heizöl, vorausgesetzt. Der Abstrahierung und der Umrechnung auf theoretisch und praktisch jedes Heizmedium kommt entgegen die technische Üblichkeit, die grundsätzlichen Wärmeeinheiten (kcal; jetzt: kJ = Kilo-Joule) zu rechnen. Über den jedem Brennstoff eigenen spezifischen Heizwert kann bei Heranziehung der verbrauchten Brennstoffmenge der Bedarf an Wärmeeinheiten errechnet werden (Q = G · Hu). Ebenso kann man den Rechnungsgang umgekehrt durchführen, also aus dem angegebenen Verbrauch in Wärmeeinheiten die benötigte Brennstoffmenge errechnen (G = Daß der durchschnittliche Brennstoffverbrauch nur über mehrere Stunden an mehreren Tagen in etwa dem Verhältnis der durchschnittlich produzierten Backwaren ermittelt worden ist, versteht sich von selbst. Zur Beurteilung der Wärmewirtschaftlichkeit eines Backofens kann der Mehrverbrauch während der Aufheizzeit vernachlässigt werden, bei einer Betriebsdauer von 6 - 8 Std. wird dieser Verbrauch rechnerisch absorbiert.
D Vergleich des Personalbedarfs bei verschieden zusammengestellten Backanlagen mit etwa gleich großen Gesamtbackflächen Unter Bezug auf die Darstellung A wurde der durchschnittliche Bedarf an Personal, auf Grund von Beobachtungen in der Praxis, ermittelt. Dabei sind von links nach recht: 1. Erforderliche Verrichtungseinheiten 2. Theoretischer Personalbedarf 3. Tatsächlicher Personalbedarf mit zur Verfügung stehenden Verrichtungseinheiten 4. Auslastung des Personals am Backofen in Prozentvergleich 5. Nicht ausgelastete Personalleistung in Prozent die freigestellt bzw. nicht freigestellt werden kann. Der Vergleich der Verrichtungseinheiten wird am einfachsten sinnfällig, wenn man das Öffnen und Schließen der Einschießtüren betrachtet. A n sechs Einheiten Etagenbacköfen mit je sechs Türdeckeln ergeben sich zwangsläufig 72 Verrichtungseinheiten, bei zwei Einheiten Reversieröfen mit zwei Backkammern nur deren acht.
Einflußgrößen
363
Für Bedienung, Beschickung und Entleerung sind bei jedem Backofensystem charakteristische Verrichtungen erforderlich, die bei Einschießöfen chargenmäßig oder bei Durchlauföfen kontinuierlich ausgeführt werden. Als Grundwert wird eine Normverrichtungseinheit festgelegt und mit dieser eine bestimmte Anzahl von Verrichtungseinheiten errechnet, die eine Person in einer gewählten Zeiteinheit (Charge oder Stunde) unter normalen Umständen durchschnittlich ausführen kann. Man kann sich hierzu der REFA bedienen, die dazu entsprechende Grundlagen bietet. Für das Diagramm wurden beispielsweise die erforderlichen Verrichtungen errechnet, die bei Produktion von Brötchen zur vollen Belegung und Entleerung und Steuerung der Backofenanlage vom Personal geleistet werden müssen. Dabei ist jede Betätigung einer Einrichtung als eine Verrichtungseinheit gesetzt. Die Addition der Betätigungen ergibt die gesamte Verrichtungszahl, die zur einmaligen Benutzung der Backofenanlage erforderlich ist. Es wurde beispielhaft angenommen, daß eine Person in der Zweiteinheit einer Charge maximal 60 Verrichtungseinheiten durchführen kann. Berücksichtigt ist dabei, daß bestimmte Verrichtungen nicht von einer Person alleine, sondern von zwei gemeinsam, aus Gründen der Größe und Gewichte von Einschießgeräten oder ähnliches, ausgeführt werden müssen. Ferner ist berücksichtigt, daß zwar für die Gesamtverrichtungszahl eine Person ausreichen würde, aber wegen den Ausmaßen der Backofenanlage, ζ. B. Beschikkung und Entleerung von Durchlauföfen, mindestens zwei Personen erforderlich sind. Diese Umstände sind i m Auslastungsgrad des Personals berücksichtigt. Das Beispiel Durchlaufofen zeigt, daß der Auslastungsgrad der am Einlauf und Auslauf beschäftigten Personen hier relativ gering ist, aber die freie Kapazität anderweitig nicht genutzt werden kann. Dagegen ist bei den Beispielen Etagenbacköfen, die nicht kontinuierlich, sondern chargenweise bedient werden, die freie Kapazität des Personals anderweitig zu verwerten. Diese Bewertung ist i m Diagramm zwischen dem praktischen und theoretischen Personalbedarf berücksichtigt. Beim Beispiel Durchlaufofen ergibt sich damit, daß hier der praktische Personalbedarf einzusetzen ist, während bei den Etagenbacköfen der theoretische Personalbedarf in Ansatz gebracht ist. Nach diesen Kriterien wird die Zahl des praktischen oder des theoretischen Personalbedarfs in die Bewertung mit einbezogen und ergibt i m Verhältnis zur Backfläche gesetzt den Personalbedarf je m 2 Backfläche. Die aus dem Backofensystem ermittelte erforderliche Summe der Verrichtungen ist ins Verhältnis gesetzt zu der von einer Person möglichen Verrichtungszahlen je Zeiteinheit (60 Verrichtungen je Charge); dies ergibt den theoretischen Personalbedarf.
364
Edgar Michael Wenz
Der praktische Personalbedarf kann sich nur in ganzen Personen ausdrücken, während die Berechnung des theoretischen Personalbedarfs auch Bruchteile ergeben kann. E Vergleich der Kostenfaktoren bei verschieden zusammengestellten Backanlagen mit etwa gleich großen Gesamtbackflächen Auch hier erfolgte die Ermittlung nach dem Schema A. Dabei stehen 1. Kaufpreisfaktor 2. Grundflächenfaktor 3. Energiekostenfaktor 4. Personalkostenfaktor 5. Vergleich 1 . - 4 . (100% = Gesamtkostenfaktor) 6. Spezifischer Gesamtkostenfaktor bezogen auf m 2 Backnutzfläche Zu 1. Kaufpreis Für den Techniker ist bei der Feststellung des Kaufpreises nicht die eigentliche Höhe desselben von ausschlaggebender Bedeutung, weil diese Frage j a kaufmännische Kategorien berührt; seine Aufgabe ist es, den Leistungsumfang, was also vergleichsweise gegen Geld geboten wird, zu ermitteln. Über Bedingungen sowie die verschiedenen Interpretationen der Branchenüblichkeit, erst recht natürlich über besondere Vereinbarungen lassen sich ganz erheblich unterschiedliche Lieferungen und Leistungen festlegen. Diese können durch den Vertrieb bedingt sein (z. B. Fracht, Verpackung), durch den Zeitpunkt des Übergangs (ohne oder mit Montage), durch unverzichtbare Nebenleistungen (Anschlüsse an Energieversorgung, Abgase, Abdunst), bedingt auch durch ofenseitige oder separate Dampferzeugung und Warmwasserbereitung. Selbst die Sperrigkeit der einzelnen Konstruktionsteile, die aus technischer Sicht für die Einbringung und damit zur Montagevorbereitung wichtig ist, können Kosten- und somit Preisfaktoren darstellen. Der Kaufpreisfaktor ist also die Verhältniszahl zwischen den gesamten investiven Aufwendungen, wie hier dargetan, zu dem erreichten Nutzen, ausgedrückt in Backnutzfläche ( D M / m 2 ) . Zu 2. Grundflächen Diese Untersuchung wurde aus Abschnitt A übernommen. Hier ist noch einzufügen, daß die Bodenfläche allein keinen zuverlässigen Kostenfaktor darstellt, weil j a das Bäckereigebäude nicht zwei-, sondern dreidimensional ist. Aber das gehört nun schon zu den fallweisen Untersuchungen. I m allgemeinen kann man davon ausgehen, daß umbauter Raum in tolerierbaren Abweichungen sich proportional verhält zur überbauten Bodenfläche.
Einflußgrößen
365
Der Grundflächenfaktor ist die Verhältniszahl aus der Anzahl Quadratmeter benötigter Bodenfläche für die Erstellung und Bedienung der Backofenanlage zur effektiven Backnutzfläche. Er gibt an, wieviel Gebäudefläche je Quadratmeter Backnutzfläche benötigt wird. Zu 3. Energie Hierzu darf zunächst verwiesen werden auf Abschnitt C. Energiekosten sind freilich nicht nur allein der Aufwand für die Wärmeerzeugung, die Energie für die motorischen Antriebe (etwa Lüfter, Brenner usw.) kommen hinzu; diese aber konnten - ebenso wegen ihres ziemlich gleichmäßigen Anfalls bei den verschiedenen Systemen, wie auch wegen der Geringfügigkeit der Kosten gemessen an jenen für die Heizmedien - vernachlässigt werden. Zur Feststellung des Energiekostenfaktors wird der durchschnittliche Wärmeverbrauchswert - ausgedrückt in Wärmeeinheiten pro Stunde - ins Verhältnis zur effektiven Backnutzfläche gesetzt. Der Energiekostenfaktor bewertet die Wärmewirtschaftlichkeit der Backofenanlage unabhängig von der Art der in Frage kommenden Brennstoffe. Zu 4. Personalkosten Die aus Abschnitt D ermittelte Zahl für den Personalbedarf (theoretisch in den Diagrammen I bis V, praktisch in den Diagrammen V I und V I I ) sind i m Diagramm E auf Grund der Wertigkeiten der Diagrammsäulen mit 10 multipliziert. Eine Bewertung der einzelnen Faktoren muß i m jeweiligen Falle gesondert bestimmt werden. Hier kann nur ein allgemeines Beispiel aufgeführt sein. Der Multiplikator 10 für das Diagramm ist insofern willkürlich, als er auch höher oder niedriger lauten könnte. Damit sollte unter keinen Umständen eine Relation zwischen der Wertigkeit des Faktors Personalkosten (= Arbeit) gegenüber anderen materiellen Faktoren ausgedrückt werden. Zunächst einmal waren rein darstellende Gründe dafür maßgebend, vor allem aber der Zwang, sich ganz einfach für einen Multiplikator entscheiden zu müssen. Es bleibt hier unbenommen, schließlich für den individuellen Fall auch individuelle Faktoren einzusetzen. Das „Human-Kapital", wenn der Ausdruck „Kapital" in diesem Zusammenhang überhaupt erlaubt sein darf, i m Gegensatz zum „toten Kapital" bedarf j a nicht nur wegen seiner Knappheit besonderer Überlegungen, sondern auch - und gerade! wegen seiner menschlichen Bezüge zur Arbeitswelt, die j a aus vielerlei Perspektiven gesehen wird und gesehen werden muß. Die Begriffe von „job enlargement" von „job enrichment" oder „job rotation" stehen dafür. Diese Aspekte lassen sich bei Untersuchungen wie dieser nicht berücksichtigen, jedenfalls nicht in Zahlen und Ziffern ausdrücken. Festgelegt und eingesetzt werden kann also nur die Meßzahl der Verrichtungen, mit nachprüfbaren und nachvollziehbaren Methoden ermittelt - aber eben dann dem Zwang unterworfen, angemessene Bewertung zu finden.
366
Edgar Michael Wenz
Zu 5. Prozentvergleich Hier ist zu verstehen der Abgleich zwischen den einzelnen Kostenfaktoren in den Anteilen; der Gesamtkostenfaktor entspricht 100%; der prozentuale Anteil ist in der Grafik ausgewiesen. Hier muß nun wieder zurückgegriffen werden auf die wichtigsten Bemerkungen in der Einleitung: Die einzelnen Kostenfaktoren wurden durchwegs mit dem Faktor 1,0 angenommen. Sie wurden also gleichwertig angesetzt, ohne eine „Rangordnung der Gewichte". Bei einer unreflektierten Übernahme dieser Werte freilich ergäbe sich für die praktische Nutzanwendung eine Verzerrung, weil die Annahme eines Kostenfaktors 1,0 für alle Kostenstellen in aller Regel nur theoretisch sein kann. Hier müßte nun durch die freie unternehmerische Entscheidung die Gewichtung erfolgen. Dann erhält das ganze Gerippe Fleisch, das Modell seinen praktischen Sinn, dieser seinen praktizierbaren Nutzen. Zu 6. Spezifischer Gesamtkostenfaktor Auch hier muß auf die Vorbemerkung zurückverwiesen werden. U m Fehlerquellen möglichst auszuschalten, wurde bewußt auf den gemeinsamen Nenner des Quadratmeters Backnutzfläche reduziert. Er ist nun die einheitliche Größe, die einheitliche Meßlatte. Zur Ermittlung des spezifischen Gesamtkostenfaktors werden die Zahlen des Kaufpreisfaktors, des Grundflächenfaktors, des Energiekostenfaktors und des Personalkostenfaktors addiert und die Summe durch die Zahl der jeweiligen Quadratmeter Gesamtbackfläche geteilt. Die spezifischen Gesamtkostenfaktoren in D M / m 2 ergeben eine direkte Vergleichsmöglichkeit der Wirtschaftlichkeit verschieden zusammengestellter Backanlagen mit etwa gleich großen Gesamtbackflächen. So ist eigentlich dieses Schaubild am meisten aussagekräftig. Freilich konnte es nur erstellt werden unter der oben schon - mit allen Unsicherheiten belasteten Prämisse eines gleichen Wertfaktors für alle Kostenstellen. Der Kaufpreisfaktor (Ziffer 1) und auch der Energiekostenfaktor (Ziffer 3) haben sich, in Geld ausgedrückt, seit der Erarbeitung dieser Ziffern und Tabellen gewiß verändert, sogar nachhaltig verändert. Die absolute Zahl als solche ist insofern nicht mehr gültig. Bei der heutigen Preisentwicklung, insbesondere bei den „Bocksprüngen" des ohnehin immer mehr unübersichtlichen Energiemarktes, sind alle in Geld ausgedrückten Werte ein paar Tage später schon Makulatur. Aber da sich die Faktoren ziemlich gleichmäßig entwickelt haben, haben sich insgesamt die Kosten erhöht, aber einigermaßen gleichmäßig, so daß sie in der Relation - und auf diese nur kann es ankommen - schließlich doch wieder stimmen.
Einflußgrößen
367
Edgar Michael Wenz
Einflußgrößen
«C ce ηcu -Q ε
24 Gedächtnisschrift Wenz
369
370
fi α> ο :ce C J« w Λ JO Β οCi pfi
es
2
OD ÖD ce £
PQ
fi
OD
fi
I
ee fi
OJ
'S
t ee 'S £ TS
Ii-
a>
Oh
£ Q
Edgar Michael Wenz
Einflußgrößen
371
372
Edgar Michael Wenz
Das Sicht- und Duft-Backen* Eine neuartige Präsentation: „Producing Open Display'4 mit „Appetizing Appeal". Die Nase, bisher werblich kaum genutzt, als Reizempfänger. Erhebliche Umsatzsteigerungen, insbesondere für Brot- und Backwaren-Verkaufsabteilungen in Warenhäusern und Supermärkten sowie Kaffee-Probierstuben. Keine Bäckereieinrichtung im Ladenlokal, aber doch mehr als ein „oven-in-store". - Das gute amerikanische „Doughnouts"-Beispiel, und was daraus zu lernen wäre.
I. Das „gute Beispiel" Folgende Erfahrungen sind gegeben: 1. Der Umsatz an Hähnchen - beispielsweise - hat sprunghaft, ja explosionsartig, zugenommen, seit Hähnchen offen und für den Gast sichtbar gegrillt werden („Wienerwald" u. a. m.). Der Hähnchen-Verzehr vorher war vergleichsweise bescheiden. 2. Die für den Gast sichtbare Zubereitung von Fleischgerichten am offenen Grill hat nicht nur den Umsatz gefördert; der offene Grill wurde sogar gewissermaßen zu einem Merkmal der hohen gastronomischen Klassifizierung. 3. Für die Zubereitung von Kaffee gewissermaßen vor den Augen und der Nase des Gastes waren nicht nur Gesichtspunkte der Rationalisierung maßgebend, sondern ebenso das Erkennen der psychologischen Wirkung. Diese und ähnliche Beispiele beweisen, daß das Herstellen von Nahrungs- und Genußmitteln vor den Augen des Gastes anregend und somit umsatzsteigernd wirkt, weil die optischen Reize aufgenommen werden, insbesondere aber die kontrollierbare Reinheit und offensichtliche Frische der Ware die Qualitätsüberzeugung steigert, wobei assoziativ diese Qualitätsüberzeugung auch auf alle anderen angebotenen Waren unterschwellig übertragen wird. Das Vordringen von Konserven und Fertiggerichten gibt dem Herstellen frischer Waren dazu noch einen besonderen Akzent. * Veröffentlichung in: Edgar Michael Wenz, Das Backen. Das Gären. Die Technik. Die Theorie vom Backofen, Arnstein, 1980, S. 102 ff.
374
Edgar Michael Wenz
Ein vortreffliches Beispiel, ja einen Beweis mehr, liefert eigentlich das Backgewerbe selbst, freilich in den USA. Gemeint ist hier die amerikanische „Doughnouts-Welle". („Doughnouts" oder auch „Donuts" genannt, sind vergleichbar den deutschen Krapfen, Berliner Ballen, Pfannkuchen usw., werden aber meist mit Backpulver hergestellt.) In allen, in den letzten Jahren sich ungewöhnlich, ja mit sensationellen Zuwachsraten sich ausdehnenden USA-Franchise-Ketten werden diese Donuts offen, vor den Augen des Kunden, hergestellt und ihm ganz frisch angeboten. Darauf und auf nichts anderes beruht der Erfolg der Donuts-Welle. Diese Verzehrgewohnheit ist heute ein „americanism", der in den USA gewiß auch nicht gewachsen, sondern „gemacht" worden ist. Kein Wunder freilich in einem Land, das sonst mit Konserven und Fertiggerichten übersättigt, folglich für frische Lebensmittel mehr aufnahmefähig ist als Länder, in denen noch „zu Hause gekocht" wird. (Bemerkung: Diesem Beispiel wird entgegengehalten, daß ein groß angelegter Versuch in Deutschland vor einem Jahrzehnt schon gescheitert ist, es folglich also keinen fruchtbaren Boden für diese Idee in der Bundesrepublik gäbe. Dem kann entgegengehalten werden, daß damit der Grundgedanke verkannt wird. Es ist damit lediglich bewiesen, daß in großen Mengen hergestelltes Fettgebäck, verpackt und an Filialen und Vertreiber ausgeliefert, nur eine Bereicherung des Dauerbackwarenmarktes in Wahrheit bedeutet, aber es sich keine Sekunde um die Idee der Herstellung eines Frischproduktes vor der Kundschaft handelt, noch dazu bei einem Produkt, das von seiner Art her typisch für den Frischverzehr bestimmt ist. Es war dies die Per version der eigentlichen Idee.)
II. Angriffsziel der Werbung: Auge und Nase Es braucht nicht eigens bewiesen zu werden, daß Augen und Ohren des Werbeeinflüssen ausgesetzten Menschen häufig bis an die Grenze des Erträglichen ausgereizt und somit kaum mehr aufnahmefähig sind. Dahingegen ist der Geruchssinn, die Nase, bisher - zweifellos nur aus rein technischen Gründen - werblich noch nicht genutzt worden. Der Geruchssinn sollte also ein bevorzugtes Ziel werblicher Bemühungen sein. Der der Nase angebotene Reiz muß natürlich angenehm und animierend sein. Bei dem Beispiel der gegrillten Hähnchen und Steaks kann das nur mit erheblichen Einschränkungen gelten (hier überwiegt der optische Reiz); bei Kaffee ist das freilich konträr anders. Zu den angenehmsten Gerüchen aber gehört der Duft von Brot und Backwaren, der nahezu jedermann positiv einzustimmen vermag („Sympathische" Produktion: im Gegensatz beispielsweise zu Fleischerei-Erzeugnissen.)
Das Sicht- und Duft-Backen
375
I I I . Wo paßt es am besten? Die logische Verbindung der Gedankengänge in I. und II. zwingt förmlich die Konsequenz auf, daß die absolute Potenzierung der werbliche Gipfel für Nahrungs- und Genußmittel jeder Art die öffentliche Herstellung von Backwaren vor den Augen der Kunden und Gäste sein muß. Der Nutzeffekt beschränkt sich nur auf einen kleineren Kreis bei Ladenlokalen, die einer Bäckerei /Konditorei räumlich unmittelbar angeschlossen sind (daß die Ware frisch ist, wird in aller Regel vom Kunden unterstellt. „Der Bäcker um die Ecke". Zudem wirkt der zwangsläufig einströmende Duft aus der Backstube ohnehin stimulierend); Restaurants und Gaststätten (Spezialitäten-Restaurants, insbesondere solche mit rustikalem Charakter). Dagegen erhebt sich die Forderung nach dem Sicht- und Duft-Backen geradezu zwingend für: 1. Brot- und Backwaren-Verkaufsabteilungen von Waren- und Kaufhäusern, Supermärkten und anderen Großgeschäften (einschließlich deren Imbißstuben); hier wird ja unterschwellig vom Kunden die Frische bezweifelt; die Stimulanz des Duftes fehlt voll und ganz, meist wird sie sogar vom typischen Geruch des Hauses überlagert. „Appetizing Appeal" wird auf diesem Weg mehr bringen als noch so günstige Lockangebote aus dem Backwarensektor; 2. Kaffeehäuser, die keine angeschlossene eigene Konditorei haben; somit wäre das der typische Fall der neuen Kaffee-Probierstuben, die sich mehr und mehr durchsetzen und neue Verzehrgewohnheiten bringen. Daß verständlicherweise der Kaffee-Genuß im Vordergrund steht, schließt keineswegs aus, daß auch Backwaren dort angeboten werden sollten. Es ist dem Ansehen einer KaffeeProbierstube nicht gerade förderlich, wenn - wie häufig zu beobachten ist mitgebrachte Backwaren aus Tüte und Hand verzehrt werden. Außerdem ist das ein doppelter Umsatz-Verlust, weil der Genuß von Kaffee den Backwaren-Verzehr bedingt und fördert und umgekehrt - „die Tasse Kaffee mehr"! und „das Stückchen Kuchen mehr"! Hier wäre im besonderen Maße das „AneinanderEmporranken" gegeben. Da das traditionelle Kaffeehaus in City-Lage mehr und mehr zurückgeht, muß sich ohnehin ein neuer Stil entwickeln, die Zeit und die Umstände sind also ungewöhnlich günstig, daß sich Kaffee-Probierstuben - gewissermaßen „in einem Aufwasch" - die Idee des Sicht- und Duft-Backens zu eigen machen; 3. die auswärtigen Verkaufslokale (Filialen) von Bäckereien und Brotfabriken; dort gelten die gleichen Überlegungen wie oben in Ziffer 1. 4. die „Snackbar" in Bäckereien und Konditoreien (Schnellimbiß, „fast food"); die „Snackbars" sind im Backgewerbe eigentlich noch unbekannt, wenngleich in jüngster Zeit interessante und wirklich sehr erwägenswerte Anregungen in
376
Edgar Michael Wenz
diese Richtung gegeben worden sind. Andere Branchen, eben die Kaffee-Röstereien und Metzgereien, haben diese Idee längst erfolgreich verwirklicht. Es geht also darum, auf möglichst geringer Fläche möglichst viele Kunden und Gäste mit möglichst wenig Aufwand zu bewirten, gleichzeitig Kaufanreize zu setzen. Eine Steigerung dieser Vertriebsidee, die erfolgreich sein müßte, wäre natürlich die Verbindung mit der offenen Herstellung wenigstens einiger Backwaren (Ofenfrisch!). Es läge also eine Konkurrenz dieser Β äckerei-"S nackbar" zu Kaffee-Probierstuben innerhalb der Branche vor, aber eben mit mehr Schwergewicht auf die Backware. Ernsthaft zu überlegen wäre auch der fallweise Einsatz bei besonderen Anlässen (ζ. B. Jahrmärkten, Messen, größere Publikumsveranstaltungen usw.) als BäckereiStand, etwa montiert auf einem fahrbaren Anhänger oder auch als „Bude". Es ist eigentlich nicht einzusehen, warum dieses Feld des Verkaufs von der Straße an den Passanten Wurst- und Fisch-Bratereien, Mandelbrennern, Pommes-Frites- und Popcorn-Herstellern oder auch dem Reisegewerbe vorbehalten bleiben soll. Zunehmend ist auch hier der Trend zur frischen und warmen Ware erkennbar, der zu Gunsten des Backgewerbes noch nicht einmal an der Oberfläche angekratzt wurde. (Interessant wäre schon allein die Feststellung, wieviel potentielle Backwarenkunden allein schon die in Buden frisch hergestellten Pommes-Frites gekostet haben, immerhin Kunden, die keine Scheu vor Kohlehydraten und Kalorien haben, alles zweifellos Menschen, die auch für frisches Backwerk zu gewinnen wären.) Augenfällige Beweise für die Richtigkeit des Sicht- und Duftbackens liefert eigentlich ein Kreis, für den diese Idee ursprünglich nicht gedacht war - die „aktive Bäckerei" selbst. Ein Beispiel: Vom Laden aus den Blick in die Backstube eröffnen. Ein anderes: Neue Bäckereien gezielt mit dem Blick in die Backstube projektiert, vereinzelt auch wieder in belebte Stadtviertel, etwa Fußgängerzonen, zurückverpflanzt, von wo sie ja zuvor - die Grundfläche schien zu teuer - verdrängt worden waren. Ganz ungewöhnliche Erfolge, die die Rückverlegung der Bäckereien in hochrangige Verkaufszentren rechtfertigen, beweisen, daß selbst in der Bundesrepublik Deutschland - wo die Konserve glücklicherweise noch lange nicht für den Haushalt typisch ist, nach wie vor ein gepflegtes „Brotbewußtsein" herrscht - diese Präsentation wahrgenommen und honoriert wird.
IV. Was soll erreicht werden? Die technischen Voraussetzungen für das Sicht- und Duft-Backen sind sehr einfach, billig und somit ungewöhnlich rentabel. Einrichtungen, Hilfsmittel und Verfahrensweisen richten sich nach den gestellten Aufgaben: 1. Wird nur der Effekt - des Frischwaren-Angebots, und - der Duft-Verbreitung,
Das Sicht- und Duft-Backen
377
freilich mit allen damit verbundenen Assoziationen angestrebt, dann ist die technische Ausrüstung und Verfahrensweise wesentlich einfacher und anders als 2. dann und dort, wo zu diesen beiden Effekten noch ein weiterer angestrebt wird, nämlich die offene Produktion bestimmter Backwaren, meist hierfür besonders geeigneter Feinbackwaren; dabei ist es gleichgültig, ob diese offene Produktion stattfindet aus Gründen - rein werblicher Art, oder - der Produktionssteigerung, insbesondere zum Abfangen von Produktionsspitzen. Es bedarf selbstverständlich besonderer Kenntnisse und Erfahrungen, - die technische und zweckmäßigste Einrichtung auszuwählen, und - die wirksamste räumliche innenarchitektonische Zuordnung zu finden. Es soll nicht Aufgabe dieser Studie sein, auf diese technisch freilich sehr wichtigen Einzelheiten einzugehen; sie sollten individueller Beratung vorbehalten bleiben. Ein wesentliches Element der technischen Einrichtung wäre die Dunst- oder Dufthaube, die durchaus innenarchitektonisch akzentuiert denkbar wäre. Sie wäre über die technische Produktionseinheit angeordnet. Eine sinnvolle Zwangsabsaugungsanlage läßt, nach Belieben und Volumen steuerbar, den Dunst (besser: den Duft) über Schornstein in die freie Atmosphäre oder/und in das Ladenlokal oder/ und auf die Straße - in Richtung Passanten - strömen. Gelegentliche ortspolizeiliche Bedenken gegen die zuletzt genannte, freilich besonders wirksame Methode könnten ausgeräumt werden. Derart gezielt wirkt natürlich der Duft besonders stimulierend; es kann ständig beobachtet werden, wie Passanten spontan auf die Duft-Ein Wirkung reagieren.
Die weiterhin erforderlichen und zweckmäßigen Einrichtungsgegenstände ergeben sich aus der Betriebsweise (siehe Ziff. V.).
V. Wie macht man es am zweckmäßigsten? Die Betriebsweise wird von der Aufgabenstellung bestimmt: diese wird von Fall zu Fall verschieden sein. Aus der kleinen Backnutzfläche und dem völligen Verzicht auf Aufbereitungsund Verformungsmaschinen ergibt sich schon, daß ein leistungsfähiger Produktionsbetrieb (Bäckerei, «Konditorei, Brotfabrik) - selbstverständlich auch ein Vertrags-Zulieferer - Voraussetzung ist, dessen Sitz beliebig sein kann. Die ursprüngliche Idee war, angebackenes Brot und vorgebackene Brötchen (bei denen mindestens die Ausbundphase vollendet und der Röstungsprozeß beliebig
378
Edgar Michael Wenz
weit fortgeschritten war, so daß also der Transport unschwer erfolgen kann) im „oven-in-store" fertig zu backen. Die Forderung nach frischem Brot und nach einer angenehmen Duftentwicklung ist damit voll und ganz erfüllt. Häufig werden frisches Brot und Brötchen nicht nur als Lockmittel benützt, sondern unschwer mit Aufpreis verkauft. Wo das Schwergewicht auf Feinbackwaren (insbesondere also in den KaffeeProbierstuben und „Snackbars") liegt, können diese selbstverständlich frisch hergestellt werden; die Leistungsfähigkeit selbst eines kleinen Backofens ist für solche Ware, etwa Plunder, Butterkuchen usw., sehr groß; die Konzentrierung auf bestimmte Feinbackwaren als Haus- oder Tages-Spezialitäten empfiehlt sich. Hier erfolgt die Versorgung mit den vorgeformten und teilgegorenen Teigstücken wiederum durch den Hauptproduktionsbetrieb; die Frost- und Kühleinrichtungen sowie Gärunterbrecher nehmen auf und geben nach vorgewähltem Programm wieder an den Backofen ab. Handelt es sich um eine „aktive Bäckerei", so gelten die gleichen Regeln für die Ausrüstung wie für jede andere Bäckerei auch. Bei der Anordnung der technischen Einrichtung muß natürlich visuell auf den Blickpunkt des Beschauers geachtet werden. In aller Regel empfiehlt es sich, daß diese in einem größeren Zuschnitt konzipierten Bäckereien sich letztlich doch auf einige wenige Produkte konzentrieren, nach denen dann auch die technische Ausrüstung konzeptiert sein muß. In aller Regel sind das Brötchen oder anderes Weizenkleingebäck, auch französisches Weißbrot (baquettes). Mittlerweile werden sogar vor den Augen der Kundschaft, nur durch eine Glasscheibe getrennt, eine Verkaufstheke freilich davor gesetzt, auch auf Brötchenstraßen in stattlichen Mengen Brötchen produziert und überwiegend unverzüglich an die Kundschaft, meist Laufkundschaft, abgesetzt. Etwaige Mängel durch die Massenherstellung werden bei den Käufern überlagert durch die Vorzüge, die jedes frische Weizenkleingebäck hat, aber auch durch das „Gefühl, dabei gewesen zu sein".
VI. Donuts - warum eigentlich nicht auch bei uns? Hier soll auch noch nachdrücklichst darauf hingewiesen werden - in Anlehnung an die amerikanische Donuts-Welle (siehe I.) - auf die offene Herstellung von Krapfen, Berliner Ballen, Pfannkuchen usw., auf jene Backwaren also, die zum „Fettgebäck" zählen. (Der neuerdings mehr verwendete Ausdruck „Siedegebäck" ist überdies zutreffender und werblich weit besser. Dieses Gebäck ist gar nicht einmal so sehr kalorienreich; etwa bestehende psychologische Hemmnisse zu überwinden, dürfte eine werblich durchaus lösbare Aufgabe sein.) Geruch und Anblick von „Berliner Ballen" beispielsweise regen zu allen Zeiten an. Es läßt sich kein Grund erkennen, warum die Herstellung bisher auf typische Zeiten (z. B. Karneval) beschränkt worden ist. Das amerikanische Beispiel darf nicht übersehen wer-
Das Sicht- und Duft-Backen
379
den: Aus einem typischen Frischgebäck läßt sich keine Dauerbackware machen, erst recht läßt sich damit keine Werbeschlacht schlagen. (Recht interessant ist eine Erfahrung, die [1970] in einem großen deutschen Kaufhaus gemacht werden mußte: Der tägliche Ausstoß und Verkauf von Donuts belief sich auf durchschnittlich 34 000 Stück, solange die Herstellung vor den Augen der Kunden stattfand. Als man sich dann aus irgendwelchen Gründen entschließen zu müssen glaubte, die Produktion aus dem Verkaufsraum zum nehmen und zu zentralisieren, ging der Verkauf auf täglich 2 000 Stück zurück, wurde so unrentabel und schließlich eingestellt. Eine Geschichte also, die auch für deutsche Verhältnisse die Wichtigkeit der grundsätzlichen Aussage dieser Schrift aufs neue beweist.)
VII. Aufgabenstellungen und Lösungen Je nach Aufgabenstellung, ob also - lediglich ein Werbeeffekt erzielt werden soll (Frischwaren-Assoziation!) oder - neben dem Werbeeffekt auch eine Produktions-Anpassung und -Steigerung an das jeweils kurzfristig gegebene Marktbedürfnis so unterschiedlich sind Betriebsweise und somit technische Einrichtung; hier einige Beispiele: 1. Aufstellung von Klein- oder gar Kleinstbacköfen auf der Ladentheke, in Wandregalen, auch in Schaufenstern. Diese Lösung, die mehr demonstrativen Zwekken dienen soll und ursprünglich als ausreichend für den gedachten Zweck betrachtet wurde, konnte sich nicht so richtig durchsetzen. Die Bedienung durch das Ladenpersonal stand schließlich doch nicht in einem rentablen Verhältnis von Aufwand und Leistung. Diese Lösung kann nur „Blickfänge-Bedeutung haben, zur Rentabilität muß der Folge-Verkauf in einem höheren als zuerst angenommenen Verhältnis überwiegen. 2. Einrichtung einer Klein-Bäckerei im Laden, Kaffee-Shop usw. Das wäre dann eine Ausbaustufe, die die Bezeichnung „Stadt-Bäckerei" erlauben würde; sie stünde dann bewußt im Gegensatz zum reinen Backwaren-Laden mitten in der Stadt, weil in dieser Stadtbäckerei eben auch, wenn auch nur beschränkt und gezielt, produziert wird. Diese „Stadtbäckerei" braucht sich keineswegs von der hier vorgetragenen Idee zu lösen; auch sie kann sich durchaus auf die Vollendung des Backprozesses beschränken, also auch total auf Aufmach- und Verformungsmaschinen verzichten. Das sollte sogar der Regelfall sein. Daß natürlich eine solche „Stadtbäckerei" nicht gerade mit einem kleinen Schau-Backofen ausgestattet sein soll, versteht sich von selbst, wenngleich die Backofengröße durchaus auf dem recht engen Betriebszweck abgestimmt sein kann und soll.
380
Edgar Michael Wenz
3. Zuordnen eines kompletten Ladenteils nach der allgemein bekannten Idee des „Shop-in-Shop"; diese Idee hat ja beispielsweise das Kaufhaus- und Supermarkt-Geschäft sehr belebt und kann dem Sinn nach auch hier verwertet werden, gewissermaßen als kleiner „Bäckerei-Shop", also als ein Spezial-Stand, über den beispielsweise ofenfrische Tages-Spezialitäten angeboten werden. Ein solcher „Bäckerei-Shop" müßte natürlich recht attraktiv aufgemacht werden, wofür sich geschmacklich verschiedene Lösungen anbieten. (Gerade Kaufhäuser haben ja für Sonderaufgaben, etwa für propagandistische Einsätze für Neuheiten, meist in der Nähe des Haupteinganges, disponible Standflächen, die sich für den kleinen „Bäckerei-Shop" bestens eignen würden.) Ein Zusammenwirken von Ladenbauern, Innenarchitekten und technischen Ausrüstern erscheint hier besonders wichtig. 4. Einrichtung einer normalen Bäckerei, auf den geplanten Ausstoß hin ausgerichtet (siehe Ziffer V. letzter Absatz). 5. Einrichtung und fallweisen Einsatz eines transportablen oder demontierbaren „Bäckerei-Standes" („Bäckereibude") bei besonderen Anlässen (z. B. Jahrmärkten, Messen, größeren Publikums Veranstaltungen); siehe dazu Ziffer III. vorletzter Absatz. Hier liegt wohl in der Ideen-Lösung eine Kombination zwischen den obigen Ziffern 2 und 3 vor. Die Herstellung von Siedegebäck dürfte hier besonders lukrativ sein, insbesondere in kühlen Jahreszeiten. Der Bedarf an Personal in quantitativer und vor allem qualitativer Hinsicht richtet sich nach der Aufgabenstellung. Diese läßt sich ablesen aus dem technischen Stand der Kleinst-, Klein- und „aktiven" Bäckerei. Neben der zweckmäßigsten technischen Ausrüstung kommt es natürlich weitestgehend auf die Vefahrensweisen („know-how") an. Die bereits gesammelten Erfahrungen können gut verwertet werden. Es kann und soll nicht Aufgabe dieser Schrift sein, hier nun konkrete Lösungen anzubieten. Die individuelle Beratung, die sich nur auf die speziell gegebenen Verhältnisse und die spezifischen Zielsetzungen aufbauen kann, kann durch nichts ersetzt werden. Es geht zunächst nur darum, die Idee aufzugreifen, durchzudenken und schrittweise zu verwerten. Was schon so vielen anderen Branchen genützt hat, kann für das Backgewerbe nicht falsch sein.
V I I I . Was war, was ist und was könnte werden? Historisch gesehen ist der Gedanke des Sicht- und Duft-Backens sehr alt. In allen Ländern, wo Brot frisch (im dortigen Sprachgebrauch: „warmes Brot") verzehrt wird, steht die Beschickungsseite des Backofens häufig im Ladenlokal; von
Das Sicht- und Duft-Backen
381
ihm aus wird das Brot meist direkt verkauft. Bezeichnenderweise waren Bemühungen von Fachberatern aus Industriestaaten, aus durchaus begreiflichen Rationalisierungsgründen die Bedienungsseite des Backofens dem Arbeits- und Maschinenraum zuzuordnen, zum Scheitern verurteilt; die Befolgung dieser wohlgemeinten Ratschläge hätte zum Ruin dieser Bäckereien geführt. Neuerdings wurde der Gedanke des Sicht- und Duft-Backens zuerst aufgegriffen und verwertet in den USA und Japan, bedingt auch in Großbritannien. Der „ovenin-store", also der Klein- oder Kleinst-Backofen oder die Klein- und KleinstBäckerei im Laden, gehört dort schon zu den festen Branchenbegriffen. Auch in der Bundesrepublik Deutschland liegen die ersten, äußerst positiven Erfahrungen vor. Es wird von Umsatzsteigerungen von ca. 30-40% berichtet. Erfahrene Fachleute rechnen damit, daß das Sicht- und Duft-Backen mit seinen verschiedenen Variationen sich zunehmend auch in der Bundesrepublik Deutschland und in Europa durchsetzen wird. Platz- und Personal-Probleme, die ja ohnehin keineswegs groß sind, stehen in keinem Verhältnis zur Werbewirkung. Dieser Einschätzung kann man zustimmen.
Was es sonst noch zu sagen gäbe .. .*
Ein Blick über die Grenzen lohnt immer - umso mehr deshalb, weil das offene Backen auf Umwegen über das Ausland zu uns (zurück) kam. Aber es bedurfte vorher ausländischer - oder sagen wir besser: internationaler - Impulse. Wenn man sie näher betrachtet, wird man verstehen, warum diese Entwicklung sich ohne diese fremden Impulse schwergetan hat. In Deutschland beispielsweise sind nach wie vor die Verzehrgewohnheiten anders als in den Vereinigten Staaten. Das Leben aus der Konserve hat bei uns noch nient annähernd eine vergleichbare Bedeutung gefunden. Und das bedeutet auch, daß bei uns ein frisches Angebot von Speisen jeder Art, schlechthin überhaupt etwas zu kochen, nicht so ,aufregend' und folglich auch nicht so attraktiv ist verglichen mit jenseits des großen Teiches. Das erklärt die Verzögerung dieser rasanten Entwicklung des Außer-Haus-Verzehrs hierzulande. Die längere Zurückhaltung gegen andere Gewohnheiten, als das Brot eben im Laden des Bäckers zu kaufen, hat auch seine Wurzeln in der Tradition. Die deutsche Hausfrau ist immer, eigentlich bis heute, zu ,ihrem' Bäcker gelaufen, den sie schwerer gewechselt hat als ihren Frisör. Hier zeigt sich die Affinität des Deutschen zum Brot. Man setzt sich nicht der Gefahr eines nationalen Pathos, einer überholten Deutschtümelei' aus, wenn man den Deutschen ein besonderes Verhältnis zum Brot - ich nenne das schon seit Jahren deutsches Brotbewußtsein' bestätigt. Um so bedrückender, aber auch bezeichnend ist deshalb, daß die Deutschen sich international dennoch nicht als ,das Brotland' darstellen konnten, obwohl der deutsche Brotteller das bedeutendste Geschenk an die internationale Küche ist. Nachwirkungen eines verlorenen Krieges 1 können doch kaum mehr heute die Scheu erklären, die offenbar ausländische Bäckereien erkennen lassen, deutsche Brotsorten werblich herauszustellen, obwohl man dieses zumindest nachzubilden versucht hat. Wir Deutsche kennen unsere Beziehung zum Brot. Wir kennen die Vielfalt und wissen sie zu schätzen. Jeder, der länger im Ausland war, weiß, wovon die * Erstveröffentlichung in: Edgar Michael Wenz, Die verbrauchernahe Produktion, Würzburg, 3. Auflage, 1986, S. 85 ff. 1 Zitat aus Wenz, a. a. Ο., S. 112: ,Hier ein Beispiel: In Hollywood gibt es eine große Bäkkerei, die mehr als 60 Brotsorten unter allerlei, meist geographischen Namen anbietet. Nicht eine einzige, die auf deutsche Herkunft schließen ließe, befindet sich darunter obwohl man erkennbar krampfhaft versucht, deutsche Roggenmischbrote oder Roggenbrotsorten zu kopieren .. Λ
Was es sonst noch zu sagen gäbe .
383
Rede ist. Das Hauptnahrungsmittel eines Volkes, was es ißt, das ist eine Hervorbringung seiner Kultur, seine kulturelle Leistung. Das deutsche Brot ist - niemand kann das bezweifeln - ein Stück deutscher Kultur, gewiß nicht Gegenstand der deutschen Kulturpolitik, aber eine im besten Sinne vorzeigbare Leistung. Die deutsche Kultur ist nicht erschöpft in den deutschen Dichtern und Denkern, der deutschen Philosophie, der deutschen Musik, den hohen Domen. Wir konnten uns aber im Ausland nicht darstellen. Wir haben etwas versäumt. Die Mühen einzelner vermochten nichts auszurichten2. Was den Franzosen der Käse, das ist den Deutschen das Brot. Der deutsche Brotteller - deutsches Kulturgut und das deutsche Geschenk an die internationale Küche. Dennoch konnte sich Deutschland nicht als das Brotland darstellen. Dagegen ist es den Franzosen gelungen, sich als ,Brot-Nation Nummer eins' international zu präsentieren 3, und dies mit gerade zwei Brotsorten (und Croissants, die auch noch historisch aus Wien kommen)4. Man ist versucht zu sagen: Was den Franzosen der Käse ist, das ist den Deutschen das Brot. Und doch glaubt man zu wissen, daß auch das Brot eine französische Domäne, Ausdruck hoher französischer Eßkultur wäre. Dies ist zweifellos eine bemerkenswerte Leistung französischen Marketings, die Respekt erheischt. Freilich hat der Trend zu frischem Weißbrot die französischen Brotsorten gefördert (und umgekehrt), während die deutsche Vielfalt erst geeignete Sorten herauskristallisieren muß5. Zu finden waren sie freilich leicht, aus mehreren Sorten Weißbroten und Weizenkleingebäck; nur aufge2 Die Darstellung Deutschlands als Land des Brotes hatte sicher auch den Exportbemühungen der deutschen Bäckereitechnik genutzt. Die Bäckereitechnik war vor nicht allzulanger Zeit eine deutsche Domäne. Sie war auch ganz offenbar ausländischer Bäckereitechnik überlegen, und dies ganz einfach als Folge der Ansprüche, die der deutsche Konsument, die deutsche Hausfrau an ,ihren' Bäckermeister gestellt hat, der diesen Erwartungsdruck an die Bäckereitechnik weitergeben mußte. Die technische Überlegenheit ist objektiv nicht angegriffen. Aber wenn es anderen Ländern gelingt, sich als gewissermaßen die Bewahrer des Brotes darzustellen, dann färbt das auch auf die Marktchancen der Techniker ab. 3 Die Sowjetunion scheint sich derzeit auch mehr in Richtung einer Dezentralisierung der Bäckereien zu orientieren. Auffallend ist, daß Baquettes auf besonderes Interesse für den Frischverzehr stoßen - auch dies ist zumindest ein beträchtlicher Prestige-Gewinn Frankreichs als Brotland. 4 Solche Anmerkungen provozieren häufig Widersprüche von Laien angesichts der sehr attraktiven Schaufenster selbst kleiner und kleinster französischer Bäckereien auf dem flachen Land. Dabei wird aber dann meist übersehen, daß diese Wirkung von Feinbackwaren und Patisserie ausgeht, die in vergleichbaren Bäckereibetrieben hierzulande üblicherweise nicht so angeboten werden, von Confissene ganz zu schweigen. Hier ist aber die Rede von Bäckerei und Brot. 5 Interessant ist eine Anmerkung des bekannten (Gourmet-)Journalisten Gert von Paczenski anläßlich einer Podiumsdiskussion ,Kann die deutsche Gastronomie noch von Frankreich lernen oder hat sich der Lehrling zum Meister gewandelt?', der meinte: ,Ein Hindernis für die Entwicklung einer großen Küche war unser gutes Brot' (zitiert nach DC-Magazin 3/85, Seite 12). Dies ist eine von vielen gleichen Meinungen zu diesem Thema, aber die jüngste, die dem Verfasser bekannt geworden ist.
384
Edgar Michael Wenz
drängt hat sich von vorneherein keine Rezeptur6, keine Form, kein Gewicht, ganz anders also als bei unseren westlichen Nachbarn. Daß die Stärke dieser wenigen Brotsorten auch noch im Frischverzehr liegt, war Voraussetzung zum Erfolg und zugleich auch sein Ergebnis. Daß heute solche kleine ,offene 4 Bäckereien an den Hauptstraßen ,Croissanterien' und ,Baguetterien4 heißen - und dies in aller Welt - , ist eine ebenso logische Folge wie wohlverdienter Erfolg. Man muß das anerkennen, daran führt kein Weg vorbei. Und hier zeigt sich nun auch, daß man diese Kette - vom Erzeuger der Landesprodukte über Bäcker, Bäckereitechniker dazwischen, zum Verbraucher - nicht an einer beliebigen Stelle unterbrechen kann. In Frankreich schien der Trend von den Landesprodukten vom Weizenmehl ausgegangen zu sein. Das läßt gleichzeitig den Blick in die Entwicklungsländer wandern, wo auch interessante Bemühungen der französischen Landwirtschaft und ihrer Vermarktungsverbände zu beobachten sind; man spricht hier allerdings - seitens objektiver Beobachter mit negativem Akzent - von der französischen Weizen-Lobby4; man befürchtet, daß durch die Weizenimporte die Neigung der Afrikaner zum Weizenanbau geschmälert werden könnte. Die offizielle deutsche Entwicklungshilfe tut für Backen und Brot soviel wie nichts. Es gibt allerdings private Initiative, um - dies als Beispiel - aus afrikanischen Landesprodukten, etwa Cassava (Maniok) und Hirse eine backfähige Mehlbeimischung, zum Zwecke der Verlängerung der knappen Weizenmehle und zur Linderung der dramatischen Not, zu gewinnen. Um den chronischen Energiemangel Afrikas auszugleichen, ist ein bestimmtes deutsches Backofensystem zur (hilfsund zeitweisen) Beheizung mit Erdnußschalen7 und Abfällen umrüstbar konzipiert worden. Aber was wollen schon solche private Bemühungen gegen staatliche Aktionen viel ausrichten. Die deutsche Entwicklungspolitik ken und Bäckerei nicht tätig wird.
verfehlt
eine Chance, wenn sie bei Brot, Bak-
Dabei böte dieses Feld, Entwicklungshilfe bei Brot, Backen und Bäckereien, nicht nur die Chance, einen Prestigegewinn für unser Land zu erreichen durch 6
Bei Marketingüberlegungen sollte man nach den bisher gewonnenen Erfahrungen stärker an Kleingebäck /-Brötchen aus Roggen-/ Weizenmehlmischsorten denken, an das schon sprachlich sehr wohltuend klingende Argument mit seinen (auch das ein Beweis der Vielfalt des deutschen Brotes!) regionalen und meist rustikalen Bezeichnungen, wie beispielsweise Röggelchen, Sauerteigstölli, Krustenbrötchen. Sie dürften ,typisch' deutschen Verzehrgewohnheiten eher entgegenkommen, bleiben durch die Wasserbindefähigkeit von Roggen länger frisch und könnten gewissermaßen gegen die modernen ,französischen' Verzehrgewohnheiten kontrapunktieren. Ein Nebeneinander wäre, bei allem Verständnis für Straffung des Programms, verbraucherfreundlich, schließlich somit auch anbieternützlich. Daß bei dem als Marktführer bezeichneten Stefansbäck von seinen sieben »Rennern' an zweiter Stelle ein belegtes Roggen-Kleingebäck steht (Fast Food IV, Seite 209), stützt diese Auffassung. 7 Hier hat, als bemerkenswerte Ausnahme, die offizielle Entwicklungshilfe des Landes Niedersachsen Ansätze gezeigt, sich der Energieprobleme in den Ländern der Sahel-Zone gezielt anzunehmen.
Was es sonst noch zu sagen gäbe
385
echte ,Hilfe durch Selbsthilfe 4, die durch keine andere Politik und Methode zu ersetzen ist. Man muß auch sehen, daß Bäckereien sich in den Entwicklungsländern mehr und mehr zu Kommunikations- und Informationszentren herauskristallisieren, vergleichbar dem deutschen ,Dorfbrunnen 4 früherer Zeiten. Die Afrikaner, freilich nicht nur diese, nennen gerne neu eingerichtete Bäckereien nach dem Herkunftsland (German Bakery). Brot symbolisiert Leben. Damit lassen sich Sympathiewellen erzeugen, die dem Deutschlandbild - das doch eigentlich recht angestrengter Pflege im Ausland bedürfte - ganz gewiß zugute käme. Auch die Ausbildung von Bäckern wäre ein wirksamer und kostengünstiger Technologietransfer', mit dem ,Sympathiegruppen' sich bilden würden. Internationale Konkurrenz wäre aus diesen Ländern auf diesem Gebiet später auch nicht zu befürchten. Humanitäre Hilfe täte not. Und noch etwas, in gleicher Weise wichtig: Durch die Dezentralisierung der Bäckereien ergäbe sich die Verteilung der Produktionsmittel in viele private Hände, eine überaus wichtige gesellschaftspolitische Voraussetzung - nach meiner Auffassung ohnehin die wichtigste - , wenn diese Völker mit eigener Kraft aus ihrer Not sich heraushelfen und in eine einigermaßen gesicherte politische und wirtschaftliche Zukunft hinüberretten sollen. Privatinitiative allein reicht nicht. Deutschland als Brotland darzustellen auch ein politisches Anliegen. Der Verfasser ist mit seinen engagierten Vorstellungen in dieser Richtung nur langsam vorangekommen8. Es ist dies aber ein Anliegen, das zwar privaten Engagements bedarf, das aber auch zu einem öffentlichen und politischen gemacht zu werden wirklich verdiente. Deutschland ein Brotland - auch dies wäre eine Chance, in diesen Zusammenhängen vielleicht sogar eine Pflicht, sich zu zeigen. Was haben nun solche Anmerkungen zur Entwicklungshilfe und zur Bäckerei in Afrika oder Asien zu tun mit Fast Food und verbrauchernaher Produktion? Jedenfalls einmal ist hier an keinen ,moralischen' Hintergrund gedacht, den Gedanken um die Not dort und der Überfluß hier auslösen könnten; daß wir vor lauter Übersättigung gar nicht mehr wissen, wie raffiniert wir unsere Nahrung zu uns nehmen sollen. Vielmehr etwas ganz anderes: Die Bundesrepublik Deutschland erlebt derzeit den Anfang eines Einbruchs in ihre Verzehrgewohnheiten, streng genommen einen Angriff auf ihr Hauptnahrungsmittel. Es gibt keinen Grund, das zu dramatisieren. Aber es ist etwas geschehen, worüber man nicht einfach hinweggehen darf. Die Entwicklung war vorhersehbar. Ebenso vorhersehbar ist allerdings auch, daß die Bastion des deutschen Brotes als Kulturgut, freilich nicht als direkt verkäufliches 8 Mehr dazu siehe Wenz, a. a. Ο, ,Unsere Aufgabe: Die Entwicklungsländer', S. 107 ff. Dort steht auch eine Beobachtung aus Afrika, daß die Einheimischen viel mehr die Herkunft der Backerei interessiert und diese auch viel mehr Sympathieimpulse erzeugt als ein noch so modernes Mikroskop im Hospital; Krankheit interessiert eben zunächst einmal weniger, sie ist ja sowieso nur für die anderen bestimmt. Das ist sicherlich kein Argument für die Auswahl der Hilfsmittel, aber doch eine Überlegung wert.
25 Gedächtnisschrift Wenz
-
386
Edgar Michael Wenz
Exportgut gefährdet ist, wenn man sie nicht rechtzeitig schützen und verteidigen wird. Solche Bemühungen freilich lassen sich nicht unmittelbar in Mark und in Dollar ausdrücken. Aber es ist an der Zeit zu überlegen, ob es nicht auch noch andere Werte gibt...
Teil II
Gedächtnisbeiträge
Edgar Michael Wenz - Leben, Werk, Wirkung Edgar Michael Wenz zum Gedächtnis Von Ulrich Karpen Prof. Dr. jur. Edgar Michael Wenz wäre am 6. Juli 1998 75 Jahre alt geworden. Kurz vorher, am 13. 09. 1997, ist er gestorben. Bis zum Schluß ist er fest in die Führung seines Unternehmens eingebunden gewesen. Auch war er wissenschaftlich tätig. Wenige Wochen vor seinem Tode schickte er mir das umfangreiche, in diesem Buch abgedruckte Manuskript „Forschungsbegleitete Gesetzgebung" nach einem längeren Gespräch zur kritischen Lektüre vor der Publikation. Ein exemplarisches Leben ist zu Ende gegangen, reich, arbeitsam, erfüllt. Exemplarisch insofern, als ein Mann nach dem Weltkrieg unter schwierigen Bedingungen, auch mit starker physischer Beeinträchtigung, ein großes Unternehmen aufgebaut und zum Erfolg gebracht hat, wissenschaftlich immer wieder auf sich aufmerksam gemacht hat und - was vielleicht das Wichtigste ist - eine Familie gegründet und in ihr gelebt hat, die ein Großteil seiner Arbeit fortführt und so seiner Lebensleistung Bestand verleiht. Von diesem Leben ist im Folgenden zu berichten. Zunächst werden E. M. Wenz' Lebensdaten in die Erinnerung gerufen. Danach soll ein kurzer Überblick über sein unternehmerisches Wirken gegeben werden. Im Mittelpunkt dieser Gedächtnisschrift, die Freunde ihm, seiner Familie und der wissenschaftliche Welt darbringen, steht selbstverständlich Wenz' literarisches Oevre in Rechtssoziologie, Gesetzgebungslehre, Politik. Das soll hier in den wesentlichen Teilen skizziert werden. Ein Teil der verstreuten Schriften ist wieder abgedruckt, so daß der Leser von dieser Einführung unmittelbar zur Lektüre der Quellen übergehen kann.
I. Edgar Michael Wenz als Brückenbauer zwischen Wirtschaft und Wissenschaft - Biographisches 1. Ein „ zweispuriges Leben " Edgar Michael Wenz konnte stolz sein auf seine Lebensleistung, und er war es. Diesen Eindruck vermittelt die Selbstbiographie, die er in einen ausführlichen Bericht über Entstehung und Entwicklung der MIWE Michael Wenz GmbH, eines mittelständischen Unternehmens der Bäckereitechnik in Arnstein im Fränkischen,
390
Ulrich Karpen
eingeschlossen hat. Die Jubiliäumsschrift „Gestern. Heute. Morgen." 1 erschien 1994 zum 75. Geburtstag der Firma. Diese Darstellung (auch) seines Lebens charakterisiert zugleich den Mann. Sie ist farbig und launig geschrieben, locker, wie er eben war. Sie enthält auch historische und politische Gedanken und Bemerkungen, ist also alles andere als eine trockene Firmenchronik. In Arnstein wurde Ε. M. Wenz am 6. Juli 1923 geboren. Seine Vorfahren väterlicherseits waren Ofenbauer und Bäcker, mütterlicherseits Bauern, Posthalter, Wissenschaftler, Lehrer. Er liebte Arnstein und ist der Stadt zeitlebens treu geblieben. Das unterfränkische Städtchen hat es ihm vergolten und ihn zum Ehrenbürger ernannt. Der Betrieb für Bäckereitechnik, den er so beachtlich ausbaute, ist 1919 gegründet worden. Wenz besuchte das Humanistische Gymnasium, zunächst in Schweinfurt, dann in Münnerstadt. Dort legte er 1941 das (Kriegs-)Abitur ab. Vielleicht hätte er gern Technik studiert, war auch zeitlebens, und nicht nur notwendigerweise, an technischen Fragen interessiert. Zum Fernstudium mit Schwerpunkt in Rechtswissenschaften ließ er sich an der Universität Würzburg einschreiben und stand im Feld. Schwer verwundet kehrte er zurück und nahm 1944 in Freiburg ein Präsenzstudium auf, zunächst Philosophie und Geschichte, dann Nationalökonomie und Rechtswissenschaft. Unter seinen akademischen Lehrern hat ihm vor allem Erik Wolf großen Eindruck gemacht. Nach dem Kriege wechselte er an die Universität Erlangen. 1948 machte er das Staatsexamen. 1951 wurde er von der Juristischen Fakultät Erlangen zum Dr.iur.utr. promoviert. Seine Dissertation „Die Entwicklung der Gewerbefreiheit in Bayern. Eine historische, dogmatische und rechts vergleichende Darstellung" 2 wurde von Hans Helfritz und Hans Liermann betreut. In diesen Jahren hat Wenz an eine wissenschaftliche Laufbahn gedacht, diesen Gedanken allerdings 1951 zunächst beiseitegelegt, weil er sich mit ganzer Kraft dem Aufbau des väterlichen Unternehmens widmen mußte. Dieses Unternehmen wandelte sich im Wind der sozialen Marktwirtschaft vom Handwerksunternehmen zum Mittelstandbetrieb. Ε. M. Wenz heiratete. Seine Frau Margaretha und er haben zwei Töchter, die nach Studium, Universitätsabschluß und Magisterexamen, beide noch Industriefachwirte wurden und heute in der Geschäftsleitung tätig sind. Ab 1971, nach zwanzig Karenzjahren, kehrte Wenz auch zur wissenschaftlichen Produktion zurück. Er veröffentlichte Bücher und Aufsätze. Ab 1979 war er als Lehrbeauftragter für Rechtssoziologie an der Universität Würzburg tätig. Die Studenten schätzten seinen Unterricht wegen der Praxisnähe und Anschaulichkeit. Seine Universität ernannte ihn zum Honorarprofessor. - Wenz war sportlich erfolgreich. Nach dem Kriege betätigte er sich im Versehrtensport. Er war mehrfach Deutscher Meister. Bundespräsident Theodor Heuss zeichnete ihn 1958 mit dem „Silbernen Lorbeerblatt" aus. Die Arbeitsleistungen der letzten Jahre mußte er ι 118 S., Arnstein, 1994. Die Entwicklung der Gewerbefreiheit in Bayern. Eine historische, dogmatische und rechtsvergleichende Darstellung, jur. Diss. Erlangen, 1951, 258 Seiten. 2
Edgar Michael Wenz - Leben, Werk, Wirkung
391
einem durch eine schwere Erkrankung - Spätfolge der Verwundung - geschwächten Körper abringen. Das Sprechen fiel ihm schwer, seine Gedanken waren und blieben klar, knapp, bestimmt. So ist er am 13. September 1997 gestorben. So hat man ihn in Erinnerung.
2. Vom Brotbacken 75 Jahre MIWE-Backöfen repräsentieren mehr als ein drei viertel Jahrhundert des deutschen Backofenbaus. Handwerkliche Fertigkeit, Technik, Design, Leistungsfähigkeit und leichte Handhabbarkeit machen die Produkte des Arnsteiner Werkes und seiner Dependancen zu weltweit führenden Erzeugnissen. Das ist ganz wesentlich Edgar Michael Wenz' persönliche Leistung, in Technik, Produktion, vor allem auch Vertrieb und Werbung. Er hat - zunächst zusammen mit seinem Vater - nach dem Krieg den Betrieb aus Zusammenbruch und Bedeutungslosigkeit aufgebaut. Die Geschichte des M I WE-Werkes studieren heißt das „Wirtschaftswunder" erkennen. Wenz selbst ist in den Fünfziger Jahren viel gereist, hat die Backöfen selbst verkauft, in Deutschland, in Europa. Er hat Mitarbeiter eingestellt, den Betrieb vergrößert, gebaut, verschiedene handelsrechtliche Umwandlungen des Unternehmens bewirkt. Das Unternehmen operiert heute praktisch weltweit. Edgar Michael Wenz lag aus sozialem Engagement vor allem auch die Verfügbarkeit von modernen Backanlagen am Herzen. Darüber berichtet er selbst Beachtenswertes und auch Pittoreskes in der Firmengeschichte. Nach dem Kollaps der sozialistischen Systeme ist die Firma auch in den Nachfolgestaaten der UdSSR präsent. Eine neue große Herausforderung an sein Unternehmen brachte die Wiedervereinigung Deutschlands mit sich. Wie in jeder Branche mußte auch im Backgewerbe sofort geholfen werden. Das tat Edgar Michael Wenz in Thüringen, jenseits der fränkischen Grenze. Die Aufträge waren buchstäblich nicht zu bewältigen. Rasch erkannte Wenz, daß die Nachfrage nur durch eine Firmenausgründung befriedigt werden konnte.3 Ein neuer Betrieb wurde in Meiningen-Dreissigacker errichtet. In den neuen Bundesländern wurden mehrere Werksvertretungen aufgebaut. Die MIWE-GmbH ist auch in der Schweiz und in den Niederlanden vertreten, so daß das Unternehmen eine breite Basis für das europäische Geschäft besitzt. Wenz hat nicht nur das Unternehmen geführt, sondern auch Fachlich-Literarisches über das Backen und Backöfen produziert. Vieles ist in dem Sammelband „Die verbrauchernahe Produktion. Der Wandel der Verzehrgewohnheiten. Die andere Kundenerwartung. Das Beispiel der offenen Backstube. Eine Bäckerei- und gastrotechnische Studie"4 enthalten. Er zeigt Wenz als einen kenntnisreichen und anschaulich formulierenden Autor. Man lernt, daß Rembrandt in seinem schönen 3 Fn. 1, S. 35. 4 3. Aufl., Würzburg, 1986.
392
Ulrich Karpen
Bild „die Pfannkuchenbäckerin" (um 1635) das „offene Backen", das „Schaubakken" dargestellt hat, das die Kunden heute in Bahnhofsbäckereien u. a. Betrieben bei einer Brezel und einer Tasse Kaffee bewundern können. Der Aufsatz über „Sicht- und Duftbacken" wendet sich an Bäckereifachleute und kaufmännisch orientierte Manager. Die verbrauchernahe Herstellung ist Produktion und Werbung zugleich. Nach Art der Zehn Gebote, in knapper Form, einprägsam formuliert, gibt Wenz5 „Eineinhalb Dutzend guter Ratschläge" für's Backen. Der „Technische Anhang" dieses Buches6 verschafft dem Laien einen Eindruck von dem, was sich hinter den Glasscheiben des Ofens verbirgt, aus dem die knusprigen Brötchen entnommen werden, die er - zwischen zwei Zügen - verzehrt. Der in diesem Band wiederabgedruckte Beitrag über den „Stikkenofen" verschafft einen Eindruck von Wenz' Produktion in diesem Genre. „Und was es sonst noch zu sagen gäbe"7: Wenz macht kulturhistorische Bemerkungen über das Brot als Grundnahrungsmittel, über „Brot für die Welt" und sein auch wirtschaftspolitisches Anliegen, Deutschland als das Brotland darzustellen, was es zweifellos ist. Wieviel Backen und Öfen, Brot und Verzehr mit Psychologie zu tun hat, weiß jeder. Wenz weiß es besser und berichtet in einem kleinen Stückchen zur Werbepsychologie.8
3. Der Honorarprofessor Wie gesagt, Wenz hätte sich gern hauptberuflich der Wissenschaft verpflichtet und hat als junger Jurist eine Zeit lang als Assistent gearbeitet. Daraus ist dann zugunsten anderer Glanzleistungen - nichts geworden. Aber die Flamme erlosch nie, die wissenschaftliche Neugier blieb. Vor dem folgenden Überblick über einige Einzelschriften sei nur so viel gesagt. Wenz hatte, breit interessiert, stets folgende Grundfragen im Auge: Gesellschaft und Wirtschaft, Gesellschaft und Politik, Politik und Ethik, Akzeptanz von Norm, Recht und Gesetz, Konsens statt Konflikt. In der Systematik der Disziplinen setzte er Prioritäten zunächst in der Rechtssoziologie, sodann mehr und mehr in der Gesetzgebungslehre. Rechtshistorisches verlor er aus der Perspektive der Geschichte seiner unterfränkischen Heimat und Arnsteins nie aus dem Auge. Literarische „Politische Zwischenrufe" bezeugen seine dynamische Anteilnahme an der Gestaltung der Gesellschaft, in der er wirkte. Wissenschaft ist Forschung und Lehre. Die Lehrbeziehungen zu seiner Regionaluniversität Würzburg sind deshalb ein notwendiges und gewissermaßen selbstverständliches Element seines wissenschaftlichen Werkes. Er ist der klassische „Honorarprofessor", der aus der Fülle seiner beruflichen Erfahrung doziert, gern lehrt, schreibt, letztlich auch mäzenatisch tätig ist, denn wie sollten Universitäten 5 Fn. 4, S. 58-60. 6 Fn. 4, S. 63 ff. ι Fn. 4, S. 85 ff. s Fn. 4, S. 93 ff.
Edgar Michael Wenz - Leben, Werk, Wirkung
393
heute ohne (auch) solche Drittmittel überleben. Und auch außerhalb seines Lehrauftrages an der Universität Würzburg unterhielt Wenz eine fruchtbare und anregende Vortragstätigkeit. Er sprach gern vor interessiertem Publikum, er hatte etwas zu sagen und er redete gut. Was das Thematische seines wissenschaftlichen Wirkens angeht, so sollen im Folgenden aus der Vielzahl der Veröffentlichungen drei Komplexe herausgehoben und näher beleuchtet werden: Rechtssoziologie, Gesetzgebungslehre, Politisches. Die Reaktionstheorie Theodor Geigers fesselte ihn zeitlebens. Das Bemühen um Erkenntnis und Steigerung von Akzeptanz und Effektivität von Recht und Gesetz. Von Recht und Gesetz: Als sich in den siebziger Jahren, angestoßen durch Peter Nolls 9 Studie, „Gesetzgebungslehre", die wissenschaftliche Bearbeitung von Theorie und Praxis der ersten Staatsgewalt entfaltete, war Wenz einer der ersten, der u. a. über die „Evaluation von Gesetzentwürfen" schrieb, eine Forderung, die heute das Stadium von Verfassungsänderungen 10 erreicht hat. Im übrigen hat sich Wenz literarisch zu tagespolitischen Fragen geäußert, in Beiträgen, die immer die lebenslange Beschäftigung mit Gesellschaft und Staat erkennen lassen.
II. Effektivität und Akzeptanz des Rechts - das wissenschaftliche Werk 4. Legitimationskrise
des Rechts? - Rechtssoziologisches
Seit seinem Studium fesselte Wenz die Rechtssoziologie. Arbeiten zu diesem Forschungsfeld stehen im Mittelpunkt des Wenzschen Œvres. Sie können hier nicht in der ganzen Breite dargestellt und gewürdigt werden. Immerhin soll in die Erinnerung gerufen werden, was Wenz zu drei Themenbereichen geschrieben hat: Zur Verbesserung der Akzeptanz von Gerichtsentscheidungen, also Rechtsakten durch die Einrichtung sog. „Wissenschaftsgerichtshöfe", zu Theodor Geigers Reaktionstheorie und zum aufkommenden Umweltrecht. In den siebziger und achtziger Jahren gab es vielfältige Bemühungen, die Rationalität wissenschaftspolitischer Entscheidungen zu steigern, sie transparent zu machen, die Akzeptanz solcher Entscheidungen gegen eine immer vorhandene Technologiefurcht abzusichern. Man denke an den Boom von Planungsstäben, think tanks, Studien zur Futurologie usw. Mit seinem Vorschlag, bei Gerichten „Technologiefachkammern" - analog zu den Kammern für Handelssachen und den Arbeitsgerichten, auch dem Bundespatentgericht - einzurichten, hat Wenz damals wissenschaftliche Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Es ging ihm darum, den wissen9 Reinbek, 1973. 10 Vgl. Gesetzentwurf zur Änderung der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen, hier: Verankerung der „Wirkungsanalyse" in der Landesverfassung, Drs. 12/2667 vom 09. 12. 1997.
394
Ulrich Karpen
schaftlichen Sachverstand der Fachwissenschaftler nicht nur - unverbindlich gutachtlich - nutzbar zu machen, sondern in die Rechtsentscheidung in einer Sache einzubinden. In „Wissenschaftsfachkammern" bei den Verwaltungsgerichten sollen Wissenschaftler, anteilig oder überwiegend, als verantwortliche Richter am Urteil mitwirken. In solchen technologischen (Groß-)Verfahren wie Brokdorf, StartbahnWest, Main-Donau-Kanal, Schneller Brüter, Gorleben könnte die Akzeptanzkrise, die sich zur Legitimationskrise des Rechts auszuweiten droht, durch solche Spezialgerichtshöfe vermieden werden. Wenz hat diesen Gedanken in mehreren Beiträgen dargestellt. Das von ihm herausgegebene (und weitgehend selbstverfasste) Buch „Wissenschaftsgerichtshöfe. Mittler zwischen Wissenschaft, Politik und Gesellschaft" 11 ist heute in Bibliotheken leicht zu erhalten. Knapp dargestellt hat Wenz seine Gedanken zwei Jahre später in einem Aufsatz in der „Zeitschrift für Rechtspolitik" 12 , der in diesem Buch wieder abgedruckt ist. In den englischen Royal Commissions, im amerikanischen Office of Technology Assessment gibt es Vorbilder für die Akzeptanz- und Transparenzsteigerung im Politik-Gesellschafts-Übergangsfeld. An sie anknüpfend haben in dem von Wenz herausgegebenen Sammelband Meinolf Dierkes und Volker von Thienen den „Science Court" befürwortet. Ihnen Schloß sich Wenz mit seinem konkreten rechtspolitischen Vorschlag an. Gerd Roellecke und Wilhelm Kewenig meldeten Bedenken an. Sie verwiesen auf die unterschiedliche Legitimitätsquellen von Wissenschaft und Recht: Wahrheit dort, 'Demokratie hier. Rechtsprechung gründet letztlich im demokratisch fundierten geordneten Verfahren und kommt durch Abstimmung zustande (Luhmann), Wissenschaft in der methodisch abgesicherten Erkenntnis von Gegenständen und ihrer systematisch geordneten Darstellung zur Überzeugung der wissenschaftlichen Gemeinschaft. Immerhin spricht für Wenz' Vorschlag, daß damals (1978) der baden-württembergische Minister für Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr technische Senate beim Oberverwaltungsgericht einrichten wollte. Natürlich werden auch heute Wissenschaftler bei der Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffes „Stand der Technik und des Wissens" herangezogen, und für die begleitende Technologiebewertung ist das Fachwissenschaftlerelement unentbehrlich. In einem einhundertseitigen Essay „Die Akzeptanzkrise als Legitimationskrise - Können „Wissenschaftsgerichtshöfe" weiterhelfen?" 13 hat Wenz, im Anschluß an die Kontroverse, seine Gedanken zusammengefaßt. Mit den rechtssoziologischen Arbeiten Theodor Geigers (1891-1952) hatte Wenz früh Bekanntschaft gemacht, schon während seiner Freiburger Studienzeit. Mit dessen Reaktionstheorie hat Wenz sich in zwei Abhandlungen beschäftigt. 14 In 11 Frankfurt, New York, 1983. 12 Das Mißverständnis mit den „Wissenschaftsgerichtshöfen", ZRP 1985, S. 267-272. 13 Fn. 11, S. 73-177. 14
Die Reaktionstheorie - rechtstheoretische Voraussetzung für die Rechtsforschung, in: Zeitschrift für Rechtssoziologie, 1994, S. 58-65; Von der Rechtsforschung zur Gesetzge-
Edgar Michael Wenz - Leben, Werk, Wirkung
395
der Würzburger Universitätszeitung hat er Theodor Geiger einen Nachruf 15 gewidmet. Geiger ist der Frage nachgegangen, wie Recht wirkt. Dazu gibt es verschiedene Erklärungsansätze. Recht wirkt durch Anerkennung (Ehrlich, Kantorowicz), Zwang (Durkheim), Sanktion; Recht wirkt funktional (Merton, Krawietz), strukturell-funktional (Luhmann). Geiger (und ihm folgend Rehbinder) erklärt die Wirkung des Rechts aus der beobachtbaren Reaktion des Rechtsstabes. Eine Norm ist dann gültig und wirksam, wenn der Rechtsstab auf sie reagiert: sich mit einem Rechtsfall beschäftigt, das Recht wiederherstellt, Schaden wiedergutmacht, die „gute Ordnung" wieder einkehren läßt (etwa durch Strafe) etc. Nimmt man hinzu, daß das Recht sich vorwiegend dadurch bewährt, daß die Menschen (beobachtbar) danach handeln, es beachten, so hat man eine umfassende Erklärung für die Rechtswirkung und -anerkennung. Bekannt geworden ist Geiger - strenger Positivist, der er war - u. a. durch seinen Versuch, die Effektivitätsquote einer Norm nach Bruchzahlen zu messen. Die Effektivität als Quote e ist die Verhältniszahl der Fälle, in denen die Norm sich durch Befolgung oder Reaktion auf Nichtbefolgung als wirksam erweist, bezogen auf die Gesamtzahl der Fälle. 16 Wenz hat Geigers Beitrag zu einer wissenschaftlich fundierten allgemeinen Rechtslehre, zur Rechtstatsachenforschung als für sein Denken besonders wichtig eingestuft. Das kommt in einigen, z.T. sehr pragmatischen Beiträgen zur „Ökologischen Marktwirtschaft" zum Ausdruck, etwa in seinem Beitrag zum Verursacherprinzip im Umweltschutz in der von ihm auch herausgegebenen Aufsatzsammlung „Ökologie, Ökonomie und Jurisprudenz" 17. Im letzten größeren Abschnitt der in diesem Buch erstmals abgedruckten Schrift „Die forschungsbegleitete Gesetzgebung" faßt Wenz in zehn Punkten seine rechtssoziologischen Erkenntnisse gewissermaßen lehrbuchartig zusammen.18 Es ist eine knappe „Einführung in die Rechtssoziologie". Die Kernthemen: Aufgabe der Rechtssoziologie, Evaluierung, Reaktion, Rechtsstab, die Methodenfragen der Rechtssoziologie werden knapp und anschaulich dargestellt. bung, Gedanken zur Rechtssoziologie Theodor Geigers, in: Siegfried Bachmann (Hrsg.), Theodor Geiger. Soziologe in einer Zeit „zwischen Pathos und Nüchternheit". Beiträge zu Leben und Werk, Berlin, 1995, S. 253-270. 15 Zum 100. Geburtstag von Theodor Geiger: Der heutige Diskussionsstand zur Rechtssoziologie Theodor Geigers, in: Information der Bayerischen Julius-Maximilians-Universität Würzburg, 1 /26, vom 27. 01. 1992, S. 60-61. 16 Vorstudien zur Rechtssoziologie, 1947, Nachdruck 1987, S. 33. 17 Edgar Michael Wenz, Otmar Issing, Hasso Hofmann (Hrsg.), Ökologie, Ökonomie und Jurisprudenz, Band 5 der Schriftenreihe Law and Economics, Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Forschung, München, 1987; darin Wenz' Beitrag: Ökologische Marktwirtschaft Chancen und Grenzen. Umweltschutz am Prüfstein der sozialen Marktwirtschaft, S. 125 — 134. Auch aus seinem unmittelbaren Berufsbereich beschäftigten ihn Umweltprobleme. Siehe nur seine Befassung mit der Umweltbelastung durch Bäckereien in „U - das technische Umweltmagazin, 1978, wo er sich dafür ausspricht, daß die Erzeugung von Elektrowärme der richtige Weg sei, so daß er sich für die Stromgewinnung aus Kernkraft verwendete. is S. 139 f.
396
Ulrich Karpen
5. Evaluation von Gesetzentwürfen Die Anlehnung an Geiger ist unübersehbar. Aber auch die Weiterführung von Geigers Gedanken in die Richtung der Entwicklung einer Gesetzgebungslehre. In seinem Beitrag zu dem Geiger-Erinnerungsband 19 wird der Übergang zu der neuen Schwerpunktsetzung in der Gesetzgebung deutlich: Es ist die Notwendigkeit der Akzeptanz des Gesetzes, die die (ex ante-) Evaluation des Entwurfes verlangt. Erste Äußerungen zur Gesetzgebung liegen weiter zurück. In der Würdigung Geigers in der Würzburger Universitätszeitung 20 spricht sich Wenz für Anstrengungen zur Eindämmung der Normenflut aus, handelt von den - zum großen Teil entbehrlichen - Maßnahmegesetzen und plädiert für einen Versuch mit Zeitgesetzen. Aus weiterer Beschäftigung mit Effektivitätsproblemen in der Gesetzgebung entwikkelte Wenz ein rechtspolitisches Fünf-Punkte-Postulat 21 an den Gesetzgeber: Er müsse Ziel und Zweck des Vorhabens beschreiben, Kriterien angeben, nach denen der Grad der Zielerreichung festgestellt werden könne, auch festlegen, in welcher Zeit - und in welchen Zwischenstufen - das Ziel erreichbar sei, in welchen Zeitabständen der Grad der Zielerreichung zu messen sei und welche Meßmethoden dabei anzuwenden seien. Als heutiger Leser muß man feststellen, daß dieser Katalog detailliert werden kann - und auch detailliert worden ist - , daß die Bemühungen um den „Schlanken Staat" aber um einen Meilenschritt vorankämen, wenn der Gesetzgeber diese fünf Wenz'sehen Punkte regelhaft beachtete. Im ersten Teil 2 2 der hier erstmals abgedruckten Arbeit „Die Forschungsbegleitete Gesetzgebung" zieht Wenz eine erste Zwischenbilanz seiner Überlegungen zum Stand der Gesetzgebungslehre. Er schreitet didaktisch geschickt vom Allgemeinen zu sehr konkreten Vorschlägen voran: von der Normenflut und der beobachtbaren Qualitätseinbuße der Gesetze zur Effektivität und ihre ex ante-Erforschung durch Evaluation der Gesetzentwürfe. Test und Simulation als Prognoseinstrumente werden dargestellt. Wichtig ist auch die ex post-Bewertung der Gesetze und die Rückmeldung an den Gesetzgeber. Hier ist der Rechtsstab gefordert, nicht nur die Verwaltung und die Gerichte, sondern - was heute viel zu wenig beachtet wird - auch die Rechtsanwälte. Zeitgesetze werden empfohlen ebenso wie Experimentiergesetze (in der Schul- und Bildungspolitik, der Ausländer- und Medienpolitik, der Vekehrspolitik usw.). Wenz nennt auch die Kategorie des „Probiergesetzes", wie er es u. a. im Arbeitnehmer-Entsendegesetz sieht. Abschließend bewertet Wenz den gegenwärtigen Stand der Gesetzesevaluation und stellt den „Blauen Prüffragen" des Bundes (und ähnlichen Instrumenten der Länder) ein gutes Zeugnis aus. 19 Fn. 14. 20 Fn. 15. 21 Fn. 14, S. 268. 22 S. 113 ff.
Edgar Michael Wenz - Leben, Werk, Wirkung
6. Verantwortung für Wirtschaft
397
und Gesellschaft
Mit großem Engagement hat sich E. M. Wenz auch literarisch an den politischen Fragen seiner Zeit beteiligt. Das festzustellen, darf allerdings nicht verdecken, daß Wenz vor allem praktisch politisch wirkte. Ihm war eine Kandidatur für den 3. Deutschen Bundestag angeboten worden, er wirkte - zuletzt als Ehrenbürger in der Kommunalpolitik seiner Vaterstadt Arnstein mit, war Mitglied in Verbänden und Gesellschaften. Gleichwohl sind auch seine schriftlichen „Einmischungen4' beachtlich, zur Wirtschaftspolitik, zur - wie er es sah - Fehlentwicklung des Rechtsstaates in Richtung auf den Justizstaat und zur „öffentlichen Moral" der Politiker, sprich der Angeordneten. Aus dem Bereich der wirtschaftspolitischen Schriftstellerei sollen hier nur zwei Beiträge erwähnt werden, einer zur „Tagespolitik" und ein grundsätzlicher. „Ein Wirtschaftswunder kann nicht versprochen, es muß erarbeitet werden" 23 , meinte Wenz 1993. Ein Beitrag, der gerade wegen Wenz' beruflichen Engagements in Thüringen beachtlicher ist als vieles, was Politiker in diesen Jahren sagten und auch heute noch sagen. In der Frage, ob die Politiker damals die Situation des wiedervereinigten Landes öffentlich richtig beschrieben und das Engagement aller Bürger in angemessenem Umfang eingefordert haben, bezieht Wenz einen klaren Standpunkt. Man hätte, meint er, den Bürgern sagen müssen: „Die Wiedervereinigung ist nicht zum Nulltarif zu haben. Jahre harter Arbeit liegen vor uns. Wohlstand fällt nicht vom Himmel. Wir alle müssen zupacken, Risiken übernehmen, unsere Fähigkeiten und Erfahrungen einbringen. Dann werden wir es schaffen!" Sehr grundsätzlich hat Wenz seine Wirtschafts- und Gesellschaftsphilosophie aus Anlaß des 75jährigen Geschäfts-Jubiläums seiner Firma niedergelegt, in „Freiheit, Sicherheit und Eigenverantwortung". 24 Wenz meint, daß Eigen Verantwortung die höchste Vollendung der Freiheit sei. Den für seine wirtschaftspolitische Grundhaltung wichtigen liberalen Gedanken leitet Wenz historisch her und schließt konkrete wirtschaftspolitische Vorschläge an, von der Lohn- über die Arbeitsmarktpolitik zur Notwendigkeit der Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen. Freiheit und Gleichheit sieht er - wenn das Spannungsfeld überhaupt beherrscht werden könne - in der sozialen Marktwirtschaft verwirklicht. In zwei bemerkenswerten Beiträgen fragt Wenz, ob „Europa in den Justizstaat taumele" 25 . Wenz analysiert die Juridifizierung der Politik, von der Gesetzesflut 23 In Orientierung zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik 55 (1 /1993), S. 20-22. 24
Freiheit, Sicherheit und Eigenverantwortung. Sozialphilosophische und gesellschaftspolitische Gedanken eines selbständigen Unternehmers. Unternehmerforum, hrsg. vom Unternehmerinstitut, 2. Aufl., Bonn 1995, S. 9-23. 25 So der Titel eines Beitrages, in: Orientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik, 58 (4/1993), S. 28-30, wiederaufgenommen in „Künstliche Vereinheitlichung führt zur Spaltung und Rechtsunsicherheit in der EU", in: Epoche 127, 1994, S. 30-33.
398
Ulrich Karpen
bis zum Umstand, daß das Bundesverfassungsgericht letztlich über die Zulässigkeit der Europäischen Einigung entscheiden müsse. Hier empfiehlt er „Rückschritt". Man solle im übrigen „nicht zusammenschnüren, was zusammenwachsen soll". Man solle nicht einen Europäischen Bundesstaat mit einer einheitlichen Rechtsordnung fordern. Man solle den Wettbewerb der (nationalen) Rechtsordnungen fördern. Rechtsordnungen müßten wachsen. In einem kleineren Beitrag wendet sich Wenz der leidigen Frage der Abgeordnetendiäten zu. 26 In dieser Frage, die ein durch den Staatsrechtslehrer Hans Herbert von Arnim immer wieder geschürter, demokratieschädigender „Dauerbrenner" der deutschen Innenpolitik ist, vertritt Ε. M. Wenz einen ausgleichenden Standpunkt. Er ist zunächst der Auffassung, daß die Abgeordnetendiäten der Höhe nach in Ordnung seien. Wir könnten uns kein „Niedriglohnparlament" erlauben. Der „Skandal" sei die steuerfreie Kostenpauschale, die z.T. über 5.000,00 DM monatlich betrage. Sei es den Abgeordneten nicht - wie jedem Bürger - zuzumuten, daß er Belege sammele, auch wenn sie das bei einem Feuerwehrfest gespendete Fässchen Bier beträfen?
III. Anmerkungen zu einer Lebensleistung in drei Lebenskreisen 7. Die doppelte Lebenschance: 1945, 1990 Der Unternehmer Edgar Michael Wenz konnte, als er starb, auf eine bemerkenswerte Lebensleistung zurückblicken, in drei Lebenskreisen, in Familie und Gemeinde, in Unternehmen und Wirtschaft, in Wissenschaft und Kultur. Als Unternehmer hat er das Glück gehabt, zwei große Lebenschancen zu erhalten: 1945, 1990. Beide hat er genutzt. Unter Einsatz allen Fleißes, aller Durchhaltekraft, aller Beherrschung, ja Überwindung physischer Schwäche, hat er nach dem Kriege, zunächst mit dem Vater, das Unternehmen aufgebaut und - man muß es so sagen - zur Weltgeltung geführt. Sein Engagement für das Ausland, gerade die Entwicklungsländer, wäre nicht denkbar gewesen ohne den Umstand, daß MIWE in der Welt tatsächlich präsent war. Sein politisches Engagement in Deutschland stützte sich auf die Selbstbewußtsein vermittelnde solide Basis seines Arnsteiner Unternehmens. Das alles wurde u. a. anerkannt dadurch, daß man Wenz - neben Hermann Josef Abs und Peter von Siemens u. a. - in das Präsidium des Gremiums „Gesellschaft und Unternehmen" berief. Und Ε. M. Wenz hat, in hohem Alter schon, die zweite Lebenschance begriffen und ergriffen: die Wiedervereinigung Deutschlands. Dies tat er nicht nur - wenn26
„Abgeordneten-Diäten. Der Skandal ist die Kostenpauschale", in: Der Steuerzahler; auch: „Die Diätenhöhe ist unbedenklich - Kostenpauschalen sind Rechtsbruch im Verfassungsrang", in: Orientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik, 53 (3/1992/, S. 53-55.
Edgar Michael Wenz - Leben, Werk, Wirkung
399
gleich natürlich in erster Linie - als Unternehmer. Er investierte Kraft, Zeit, Kapital, know how, Führungskraft, Organisationsvermögen, „Beziehungen" in Thüringen und anderswo. Er tat es auch als Staatsbürger, als Deutscher. Er sah - und hat das immer wieder betont - in der unerwarteten Wiedervereinigung einen notwendigen - wenngleich nach Zeitpunkt und Art - („Fort-")Schritt der deutschen Nachkriegsgeschichte. Seine Beiträge zur Kritik am Wiedervereinigungsprozeß belegen die Feststellung, daß er sich als Akteur der Wiedervereinigung sah. Und das war er auch. 8. Der „ geistige Mehrkämpfer " - der Wissenschaftler So haben seine beiden Töchter Susanne und Sabine Wenz ihren Vater in einem „ersten Wort" zur Aufsatzsammlung „Anmerkungen" 27 von 1988 genannt. In der Tat war Wenz' wissenschaftliches Interesse weit gespannt. Von der Rechtsdogmatik, der er seine Doktorarbeit gewidmet hatte, kam er zur Rechtssoziologie, zur Gesetzgebungslehre. Die Wirtschaftswissenschaften - Volkswirtschaftslehre, Betriebswirtschaftslehre - mußten ihn als Unternehmer beschäftigen und taten es auch. Er war historisch interessiert. Er las viel, nahm jedes Angebot, zu Gesprächsfragen Material zu übersenden, gern an und studierte es dann auch, wie sich in den Fußnoten seiner Schriften feststellen läßt. Die Berufung als Honorarprofessor an die Würzburger Universität beweist, daß das auch die dortigen Kollegen so sahen, und die Wissenschaft sah es auch so. Man kannte Wenz in der Wissenschaft. Er war Mitherausgeber der „Würzburger Vorträge zur Rechtsphilosophie, Rechtstheorie und Rechtssoziologie", zusammen mit Ulrich Weber und Hasso Hofmann. In dieser Reihe wurde u. a. der bedeutende Vortrag von Niklas Luhmann über „Die soziologische Beobachtung des Rechts" 28 aufgenommen. Und er war auch ein beliebter Lehrer. Wer ihn zwar im Kolleg nicht gehört hat, aber kannte, kann das verstehen. Knapp, schnörkellos, gesättigt mit praktischer Lebenserfahrung, humorvoll: so war sein Vortrag. 9. Franken - Familie - Flora - der Mensch Edgar Michael Wenz war und blieb ein Kind seiner Heimat, ein Bürger seines Städtchens. Dort hatte er seine Wurzeln, sein Zuhause, dort „siedelte" er. Wenn es - neben der ihm (wie seinem Vater) zuerkannten Ehrenbürgerschaft von Arnstein einen Hinweis auf die Verbundenheit mit seiner Heimat gibt, so ist es seine Liebe zur Heimatgeschichte. Was Wenz liebte, darin war auch „beschlagen". So auch in der Geschichte Frankens. Zeugnis dafür ist u. a. seine interessante kleine Abhandlung „War Michael Ignaz Schmidt nicht doch der erste deutsche Geschichtsschreiber?" in einem Schmidt gewidmeten Sammelband29. Wer kennt M. I. Schmidt? 27 Würzburg, 1988, S. 7. 28 Heft 3 der Reihe, 1986.
Ulrich Karpen
400
Wenz selbst hatte die Initiative zu einem Symposion über das Werk dieses Aufklärers ergriffen. Wie so oft bei der näheren Beschäftigung mit der Lebensleistung eines Menschen, zeigt es sich, daß seine Wirkung über das Lokale und Regionale hinausgeht. In Schmidts Fall muß festgestellt werden, daß er die Universität Würzburg, die älteste Hochschule Frankens, zu einer aufgeklärten Katholischen Reformuniversität gemacht hat. Das unterstreicht Ε. M. Wenz, nicht nur dem Vornamen nach mit diesem Polyhistor verwandt. Schmidt war Theologe und hat als solcher einen in vier Auflagen erschienenen, also doch vielgelesenen Katechismus verfaßt. Schmidt war Bildungsreformer und hat als solcher das Schulwesen des Hochstiftes Würzburg im Geiste der Aufklärung erneuert. Schmidt war Historiker und hat als solcher eine in mehreren Auflagen erschienene, elfbändige „Geschichte der Deutschen" geschrieben. Ob er der „Erste Geschichtsschreiber Deutschlands" war, mag als eine scholastische Frage erscheinen. Als heuristische Frage für ein Symposion ist sie tauglich. Wenz, jedenfalls, beantwortete sie mit einem klaren „Ja". 30 Ε. M. Wenz' Vielseitigkeit prägte auch sein Familienleben. Jedenfalls bezeugen das seine Töchter. 31 In den häuslichen Gesprächen sei kein Thema ausgelassen worden, sei es auch noch so brisant gewesen. Man kann es sich vorstellen, daß das Gespräch mit ihm anregend war. Er hatte klare Meinungen. Er war offen, hielt nicht hinter dem Berg. Ihm standen Witz und Ironie zu Gebote. Das bezeugen manche zupackende Bemerkungen in seinen Schriften. „Wer bestellt, zahlt auch" 32 , „Jedenfalls kümmert sich ein Strumpffabrikant mehr um das Schicksal seiner Nylons und Socken als der Gesetzgeber um seine Gesetze"33, Was den Franzosen der Käse, ist den Deutschen das Brot" 34 . Edgar Michael Wenz wirkte nach außen, verstand es, anzuregen, zu wirken, zu führen. Aber er hatte auch eine innehaltende, betrachtende, man mag sagen: kontemplative Seite. Und wie so vieles, fast alles bei ihm läßt sich auch das literarisch nachweisen. Wenz lebte in der Natur, mit der Natur: Aus dem Eintauchen in die Natur seiner Heimat schöpfte er Kraft. In der Begegnung mit der Natur, bei einem Bergspaziergang, ist er gestorben. Er liebte die Tiere und Pflanzen seiner Heimat. Er liebte die Blumen seiner Heimat, seines Gartens. Seine vielleicht persönlichste literarische Hinterlassenschaft ist das Buch „Alle meine Blumen" 35 , zu dem 29 Peter Baumgart (Hrsg.), Michael Ignaz Schmidt (1736-1794) in seiner Zeit. Der aufgeklärte Theologe, Bildungsreformer und „Historiker der Deutschen" aus Franken in neuer Sicht. Beiträge zu einem Symposium vom 27. bis 29. Oktober 1994 in Würzburg. Quellen und Beiträge zur Geschichte der Universität Würzburg, Band 9, Neustadt an der Aisch, 1996, S. 91-98. 30 Fn. 29, S. 98. 31 32 33 34 35
Fn. 27, S.7. Fn. 17 (Ökologie), S. 126. Fn. 14 (Bachmann), S. 262. Fn. 4, S. 86. Würzburg, 1993.
Edgar Michael Wenz - Leben, Werk, Wirkung
401
wiederum seine Töchter eine anrührende Einleitung geschrieben haben. Auf dem Betriebsgelände gibt es viele Blumen, Sträucher, Bäume. Wenz hatte einen privaten Wildgarten angelegt, mit Flora aus seiner fränkischen Heimat. Für ihn gab es keine Un-Kräuter, nur eßbare und nicht eßbare Pflanzen, intensiv leuchtende und karg blühende Blumen. Seine Liebe und Sorgfalt galt auch seinen Pflanzen und der Natur. Er hegte und pflegte sie und kam dabei zur Ruhe.
26 Gedächtnisschrift Wenz
Selbstbindung absoluter Herrschermacht durch Verwaltungsgesetzgebung Eine staatssoziologische Problematik im Vorfeld der Aufklärung Von Dietmar Willoweit
I. Das liberale Prinzip der Trennung von Staat und Gesellschaft 1, hat zunächst die Einsicht erschwert, daß der Staat selbst als historisches Gebilde ein Ergebnis gesellschaftlicher Entwicklungen ist und daher auch Gegenstand soziologischer Forschung sein muß. Die Überzeugungen des politischen Liberalismus haben freilich bis in unsere Tage auch Skepsis gegenüber dem Anwachsen staatlicher Macht ermöglicht und damit eine Distanz geschaffen, die der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit staatlichen Strukturen und Mechanismen förderlich gewesen ist. Edgar Michael Wenz verband beides - liberales Denken und analysierende Beobachtung staatlicher Funktionen in der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Seine Interessen lagen im Zentrum der „Staatssoziologie"2 und damit einer Disziplin, deren zunehmende Bedeutung mit der fortschreitenden Geschichte der europäisch geprägten Staatenwelt auf der Hand liegt. Der Beobachtungszeitraum, der uns für die Untersuchung des gesellschaftlichen Phänomens „Staat" zur Verfügung steht, beginnt - wenn man von der antiken Staatenwelt einmal absieht - im späten Mittelalter. Die folgenden Ausführungen verstehen sich als ein Versuch, gewisse strukturelle Eigentümlichkeiten der frühen Staatsbildung in Europa am Beispiel der Territorien des Reiches zu erfassen. Die Forschung zum spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Staat hat sich in der Vergangenheit vor allem als „Verfassungsgeschichte" begriffen. Im Hinter1
Vgl. dazu Dieter Grimm, Entstehungs- und Wirkungsbedingungen des modernen Konstitutionalismus, in: Akten des 26. Deutschen Rechtshistorikertages, hrsg. von Dieter Simon (lus Commune, Sonderheft 30), 1987, S. 45 ff., 57 ff.; Ernst-Wolfgang Böckenförde, Die Bedeutung der Unterscheidung von Staat und Gesellschaft im demokratischen Sozialstaat der Gegenwart (1972), in: ders., Staat, Gesellschaft, Freiheit, 1976, S. 185 ff. 2 Vgl. die von Johannes Winckelmann unter dem Rubrum „Staatssoziologie" zusammengestellten Texte von Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, 5. Aufl. 1972, S. 815 ff.; Hans Kelsen, Der soziologische und der juristische Staatsbegriff, 2. Aufl. 1928; zusammenfassend Karl-Heinz Hillmann, Wörterbuch der Soziologie, 4. Aufl. 1994, S. 832 f. m. w. Nachw. 26*
404
Dietmar Willoweit
grund standen seit dem 19. Jahrhundert die aktuellen Probleme des Konstitutionalismus und Parlamentarismus. Die Zeit des endlich überwundenen Absolutismus erschien dagegen als eine Negation geordneter Verfassungsverhältnisse. Solche fanden liberale Rechtshistoriker eher schon im mittelalterlichen Reich, dessen Ordnung nach ihrer Vorstellung auf der alten deutschen Freiheit beruhte. Den Niedergang dieses älteren politischen Systems durch Abkehr vom Absolutismus und Rückkehr zu einem geordneten Verfassungswesen zu überwinden, war ein so mächtiger politischer Impuls, daß die Forschung sich ihm nicht entziehen konnte. Diese Konstellation hat allerdings ein geschichtliches Problem von weit größerer Tragweite lange Zeit verdeckt: die Entstehung des Staates. Insofern allein fixiert auf die summa potestas des absoluten Herrschers, fand die Wissenschaft lange Zeit keinen Zugang zu den historischen Rahmenbedingungen, unter denen sich die europäische Staatlichkeit überhaupt entwickeln konnte. Dazu gehört in erster Linie das überlieferte Recht, seit dem hohen Mittelalter ununterbrochen präsent sowohl in den Bibliotheken der legistischen und kanonistischen Literatur wie in den gewachsenen, durch zahllose Privilegien und Statuten abgesicherten Strukturen der sozialen Welt. Daß die von politischen Interessenten des 20. Jahrhunderts kunstvoll stilisierte höchste Gewalt des Fürsten3 vor dem Zeitalter der Konstitutionen und Kodifikationen etwas mit gesetzmäßigem Handeln zu tun haben könnte, erschien schon per definitionem ausgeschlossen. Seit geraumer Zeit jedoch hat die Frage nach der rechtlichen Gebundenheit absoluter Fürstenmacht zunehmend Aufmerksamkeit gefunden, zunächst vor allem in der Auseinandersetzung mit der zeitgenössischen Staatstheorie.4 Darüber hinaus stellt sich aber auch die Frage nach normativen Elementen der frühneuzeitlichen Staatspraxis selbst, wie sie sich ζ. B. in großem Umfang aus der zeitgenössischen Jurisprudenz ergeben5 und auch normativen Regelungen für die Verwaltungspraxis zu entnehmen sind. Nur der letztere Fragenkreis soll uns hier beschäftigen. Allein das wenig bekannte und noch viel weniger ernst genommene Faktum, daß seit dem ausgehenden Mittelalter die administrative Praxis durch eine Fülle von Verwaltungsvorschriften reglementiert wurde, zwingt zum Nachdenken. Es ist viel zu einseitig, die Entstehung des frühmodernen Staates nur auf die Herausbildung souveräner Staatsgewalt zurückzuführen. Denn zugleich wird die tägliche Herrschaftspraxis durch eine intensive Verwaltungsgesetzgebung einer rechtlichen Ordnung unterworfen. Um den Staat als wichtigsten Faktor frühmoderner Gesellschaftsentwicklung soziologisch zu verstehen, ist es daher notwendig, außer der Verfassungsgeschichte besonders auch der Verwaltungsgeschichte und den dort entstehenden, sehr dauerhaften Strukturen größere Aufmerksamkeit zuzuwenden.6 3 Carl Schmitt, Verfassungslehre, 6. Aufl. 1983, S. 48 f. 4
Christoph Link, Herrschaftsordnung und bürgerliche Freiheit. Grenzen der Staatsgewalt in der älteren deutschen Staatslehre, 1979. 5 Vgl. dazu Dietmar Willoweit, Rechtsprobleme der absoluten Monarchie, in: Festschrift für Martin Heckel zum 70. Geb., hrsg. v. Karl-Hermann Kästner, Knut Wolfgang Nörr und Klaus Schiaich, 1999, S. 641-657.
Selbstbindung absoluter Herrschermacht
405
II. Ein quellengeschichtlicher Abriß, welcher in groben Zügen das Erscheinungsbild der Verwaltungsordnungen darzustellen versucht, wird mit der Frage nach ihrem ersten Auftreten beginnen müssen und dabei bald auf ein allgemeineres Problem stoßen: die Regelhaftigkeit des Verwaltungshandelns. Denn mit der Formulierung von Ordnungen, welche die herrschaftlichen Amtsträger zu befolgen haben, muß die Frage nach der Wiederholbarkeit, kontinuierlichen Übung, Stetigkeit, ja gewohnheitsmäßigen Verfestigung des Verwaltungshandelns grundsätzlich schon vorher positiv beantwortet worden sein. Die weitläufigen, bisher kaum aufgehellten Gründe dieser Entwicklung spiegelt der mittelalterliche Amtsbegriff wider. Dieser ist entgegen einem in der älteren Forschung verbreiteten Mißverständnis nicht ohne weiteres im Sinne einer staatlichen oder hoheitlichen Tätigkeit zu verstehen. Er bezeichnet zu jener Zeit, in welcher sich der Territorialstaat herauszubilden beginnt, also im 13. Jahrhundert und auch noch später, nichts anderes als eine durch überlieferte Tätigkeitsmerkmale fest umrissene Aufgabe, eine gegenständliche Fixierung von Tätigkeitsbereichen, wie sie sich insbesondere unter den in Zünften organisierten Handwerkern, aber auch unter den verschiedenartigen Funktionsträgern eines Landesherrn oder des Königs findet. In den Quellen des 13. und 14. Jahrhunderts finden sich viele Belege für diesen weiten Amtsbegriff, den wir als Amt „im übertragenen Sinne" bezeichnen würden. Es ist vom „Amt" eines Handwerks, auch vom „Amt" des Altares, vom „Amt" des Apothekers, des Vormunds und vieler anderer Personen die Rede.7 Der Amtsgedanke ist ursprünglich also noch nicht untrennbar mit der - adäquat noch nicht verstehbaren - Staatsidee verbunden, sondern signalisiert eine Versachlichung und die soziale wie rechtliche Verfestigung bestimmter Arbeitsleistungen. Sofern diese nicht als undifferenzierter Dienst, sondern im Vollzug festliegender Pflichten zu erbringen ist, tritt der damit objektivierbare Aufgabenkreis in den Vordergrund. Eben diesem Prozeß unterliegen insbesondere auch die Ämter einer Landesherrschaft, vor allem die regionalen Ämter, aber auch verschiedene Amtspositionen am Hofe. Der jeweils von einem Amt umfaßte Aufgabenkreis wird in Urkunden, mit welchen das Amt übertragen wird, zuweilen als selbstverständlich bekannt vorausgesetzt, oft aber auch detailliert beschrieben. Die Besonderheit eines herrschaftlichen Amtes liegt in der persönlichen Beziehung zwischen dem Amtsträger und dem Landesherrn bzw. König. Der Inhaber eines Amtes ist Vertreter seines Herrn im Sinne eines alter ego. 6 Zum Stand der verwaltungsgeschichtlichen Forschung vgl. jetzt die Beiträge von Werner K. Blessing , Dirk Götschmann, Ferdinand Kramer, Hermann Rumschöttel, Wühlern Volkert und Dietmar Willoweit, in: Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte 61 (1998), S. 1 ff. 7 Reinhard Wenskus, Amt II Geschichtliches § 1, in: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, Bd. 1, 1973, S. 258; Dietmar Willoweit, Die Entwicklung und Verwaltung der spätmittelalterlichen Landesherrschaft, in: Kurt G. A. Jeserich, Hans Pohl, Georg-Christoph von Unruh, Deutsche Verwaltungsgeschichte, Bd. 1, 1983, S. 66 ff., 81 ff.; Udo Wolter, Verwaltung, Amt, Beamte, in: Otto Brunner, Werner Conze, Reinhart Koselleck, Geschichtliche Grundbegriffe, Bd. 7, 1992, S. 26 ff., alle m. w. Nachw.
406
Dietmar Willoweit
Die Frage einer willkürlichen Weisungsgewalt stellt sich dabei aber in der Regel nicht, weil die Wahrnehmung des Amtes schon im eigenen Interesse des Herrn die Einhaltung vielfältiger, oft rechtlich gebundener Gewohnheiten erfordert. Das gilt etwa für die Modalitäten bei der Einziehung von Abgaben, für die Wahrnehmung der Gerichtsherrschaft, des Geleits und anderer Rechte. Weite Bereiche hoheitlichen Handelns sind am Ende des Mittelalters in den Aufgabenkreisen der landesherrlichen Ämter - der regionalen wie der Hofämter fixiert. Darin ist bereits ein Element normativer Verbindlichkeit enthalten, von dem die frühen Verwaltungsordnungen ausgehen können. Einzelne dieser Quellen sind schon aus der Mitte des 14. Jahrhunderts bekannt geworden. Im Laufe des 15. Jahrhunderts begegnen sie häufiger. In den letzten Jahrzehnten vor der Wende zum 16. Jahrhundert schwillt ihre Zahl, etwa parallel zum Anwachsen der Polizeiund Landesordnungen in den Territorien, außerordentlich an.8 Einen auch nur annähernd vollständigen Überblick über dieses Quellenmaterial besitzen wir noch nicht. Formell handelt es sich in dieser frühen Zeit nicht stets um Gebote des Landesherrn. Nicht selten liegen vertragliche Abmachungen mit den Ständen oder Angehörigen des regierenden Hauses zugrunde. Sachlich wenden sich diese Ordnungen vor allem an die örtlichen Amtsträger. Doch kommen auch schon Rats- und Kanzleiordnungen vor. Die Vorschriften, deren Einhaltung den Adressaten eingeschärft wird, betreffen zu einem großen Teil die Güterverwaltung, wie insbesondere die Arbeit in Wald und Flur, die Ausgabe von Zinsgütern, die Einziehung von Abgaben, vor allem auch Fragen der Rechnungslegung. Es finden sich aber auch schon - aus älteren Vertragsurkunden übernommene - Verhaltensregeln allgemeiner Art. So insbesondere das Gebot der Unparteilichkeit, der Rechtshilfe für Arm und Reich, das Verbot, Geschenke anzunehmen, und die Betonung der dem Herrn gegenüber geschuldeten Treue sowie die Pflicht, Schaden von ihm abzuwenden. Nur nebenbei sei angemerkt, daß sich solche Pflichten, die wir als allgemeine Beamtenpflichten ansprechen möchten, jedenfalls zum Teil aus konkreten Amtsverhältnissen herleiten lassen. Unparteilichkeit und Unbestechlichkeit etwa sind Kennzeichen des richterlichen Amtes, die Verschwiegenheitspflicht hat ihren Ursprung im Tätigkeitsfeld der Kanzlei und der Ratspersonen. Sinn dieser Regelungen ist in eigenartig ambivalenter Weise sowohl der Schutz landesherrlicher Rechte und Interessen vor dem Eigennutz der Amtsträger wie auch andererseits der Schutz der Untertanen vor anmaßendem, eigennützigem Verhalten dieses Personals. Es scheint, es sei die Vorstellung vom Beamten als einer primär pflichtgemäß handelnden Person aus dieser Parallelität der Interessen von Herrschaft und Volk entstanden. Daß die Realität dem oft nicht entsprach, ergibt sich schon daraus, daß viele der hier gemeinten Verwaltungsordnungen sowohl des späten Mittelalters wie der frühen Neuzeit mit Rücksicht auf die unerfreulichen Verhältnisse in der Verwaltungspraxis erlassen wurden. 8 Zum folgenden Text vgl. mit ausführlichen Quellenhinweisen Dietmar Willoweit, Allgemeine Merkmale der Verwaltungsorganisation in den Territorien, in: Jeserich u. a. (wie Anm. 7), S. 289 ff.
Selbstbindung absoluter Herrschermacht
407
Im Laufe des 16. Jahrhunderts setzen sich die Verwaltungsordnungen weitgehend in den größeren, aber auch in vielen kleineren Territorien durch. Eine führende Rolle spielt dabei die seit König Maximilian I. vorbildliche Organisation des Kaiserhofes. Frühzeitig entwickelt ist auch die Verwaltungsgesetzgebung der wittelsbachischen Territorien. In der Mitte des 16. Jahrhunderts kommen ausführliche württembergische, aber ζ. B. auch badische und nassauische Ordnungen hinzu. Bescheidener nimmt sich daneben im 16. Jahrhundert noch die Verwaltungsgesetzgebung Kurbrandenburgs aus. Unter den geistlichen Landesherrschaften fällt die gute organisatorische Regelung am kurmainzer Hof auf, welche sich wiederum durch die zum Kaiserhofe bestehenden Beziehungen erklären dürfte. Alles deutet darauf hin, daß diesen nur exemplarischen Hinweisen repräsentative Bedeutung zukommt. Für viele Territorien fehlen einschlägige Forschungsarbeiten, nicht aber Indizien, die auf vergleichbare Verhältnisse schließen lassen. Hinsichtlich der geregelten Gegenstände sind erstaunliche Übereinstimmungen festzustellen. Die meisten Verwaltungsordnungen lassen sich ohne Schwierigkeiten fünf großen Gruppen zuweisen. Es gibt Ordnungen für den Hof, für den Rat, für die Kammer, für die Kanzleien und für die regionalen Ämter. Relativ selten kommen alle diese Verwaltungsordnungen nebeneinander vor. Die meisten Territorien kennen jedoch mehrere dieser Ordnungstypen. Die Vergleichbarkeit der Verwaltungsnormen hat ihren Grund in der Ähnlichkeit der Institutionen, auf welche sie sich beziehen. Es handelt sich um fünf Verwaltungsbereiche, die, wenn auch in sehr verschiedenen Größenordnungen, überall vorhanden sind. Der Hof ist nicht nur technischer Unterbau des Regiments und Plattform der Herrschaftsrepräsentation, sondern zugleich mit oft mehreren hundert Menschen und Pferden größter Verwaltungskörper, dessen Organisation viel Mühe bereitet. Der Rat, meist Hofrat, auch Oberrat genannt, bildet seit dem Ende des 15. Jahrhunderts ein nach bestimmten Regeln organisiertes und beratendes Kollegium, das den Fürsten bei der Wahrnehmung von Frieden und Recht vertritt und demgemäß sowohl die große Politik wie kleine Parteistreitigkeiten zu erledigen hat. Die Kammer verwaltet die landesherrlichen Städte und Dörfer, das „Kammergut 4', und betreut damit zugleich das gesamte Finanz- und Wirtschaftswesen. Sie ist im 16. Jahrhundert nur in den größten Territorien als Kollegium organisiert. Kleinere Landesherren betrauen mit den einschlägigen Aufgaben noch immer einen Rentmeister, dem nun freilich nach Bedarf einige Räte beigeordnet werden. Im Laufe des 17. Jahrhunderts nimmt die Bedeutung dieser Kammern übrigens ganz erheblich zu. In den Kanzleien ist das gesamte Schreib-, Protokoll- und Registerwesen zusammengefaßt. Den regionalen Ämtern, denen Mittelbehörden, ζ. B. die bayerischen Vizthume, übergeordnet sein können, obliegt ein breites Spektrum territorialer Verwaltungsaufgaben, ähnlich wie schon im Spätmittelalter, ergänzt jedoch um das für die frühe Neuzeit charakteristische polizeiliche Element. Hofordnungen, Ratsordnungen, Kammerordnungen, Kanzleiordnungen und Amtsordnungen erscheinen unter diesen oder ähnlichen Bezeichnungen vielfach als festumrissene Regelungsbereiche mit typischem Inhalt. Nicht immer, vor allem
408
Dietmar Willoweit
nicht in der älteren Zeit, also etwa bis in die Mitte des 16. Jahrhunderts, erhält jeder dieser Verwaltungsbereiche auch eine eigene Ordnung. Auch dort aber, wo es nur ein einheitliches Gesetz gibt, lassen sich die erwähnten fünf Verwaltungsmaterien klar unterscheiden. So enthält etwa die Münchener Regierungsordnung aus dem Jahre 1466 nicht nur die Organisation des Rates, sondern auch die der zugehörigen Kanzlei. Eine Kölner Ordnung von 1469 regelt sowohl Fragen des Rates, des Hofes, der Kammer und der Kanzlei. Eine sächsische Hofordnung von 1470/80 befaßt sich am Rande auch mit Kanzleiangelegenheiten. Die bekannte Hofordnung des brandenburgischen Kurfürsten Joachim II. aus der Mitte des 16. Jahrhunderts erfaßt nicht nur die Hof-, sondern die Rats-, Kanzlei-, Kammer- und Amtsangelegenheiten, also den gesamten Stoffkreis der brandenburgischen Verwaltung. In Württemberg kommt eine Folge von Kanzleiordnungen vor, die nicht nur das Schriftwesen, sondern vor allem den Rat und die Kammerangelegenheiten ordnen wollen. Derartige Zusammenfassungen verschiedener Verwaltungskomplexe in demselben Gesetz werden aber im Laufe des 16. Jahrhunderts seltener. Manche Gemeinsamkeiten dieser Ordnungen erklären sich natürlich daraus, daß gerne Vorlagen aus anderen Residenzen abgeschrieben wurden. So erklärt Landgraf Wilhelm zu Hessen im Vorspruch zu seiner Hofordnung von 1570, diese sei aus etlicher Kur- und Fürsten Hofordnungen „zusammengezogen". Auf diese Weise erklärt sich leicht die bemerkenswerte Fülle des vorliegenden Quellenmaterials. Andererseits weichen die institutionellen Formen im einzelnen doch so stark voneinander ab, daß die jeweils besonderen Organisationsvorstellungen des Gesetzgebers klar erkennbar werden. Ganz überwiegend dürften jedenfalls die Schwerpunkte der Regelungen auch verwirklicht worden sein. Es handelt sich in der Regel nicht nur um „Programme". Dies gilt jedenfalls für die einzelnen Verwaltungskörper selbst, für die hervorragenden Amtsstellen, auch für die Grundzüge der Beratungsmodalitäten und des Kanzleiwesens, wie sich aus dem vorhandenen Archivmaterial, oft aber auch aus Hinweisen in den Quellen selbst, schlüssig dartun läßt. Andererseits ist diesen Ordnungen zu entnehmen, daß viele Vorschriften oft wiederholt werden mußten, ihre Realisierung also auf Schwierigkeiten stieß. Die Spanne zwischen Norm und Realität im einzelnen auszumessen, wird Sache der Einzelforschung sein. Ein Versuch, den Quellenstoff unter gesetzgebungsgeschichtlichen Gesichtspunkten und im Hinblick auf seinen Beitrag zur Staatsbildung näher zu befragen, stößt wegen der Lückenhaftigkeit des uns zur Zeit zugänglichen Materials naturgemäß auf Schwierigkeiten. Einige Beobachtungen dürften jedoch auch bei einem besseren Quellenüberblick Bestand haben. Was schon bei oberflächlicher Beschäftigung mit diesem Stoff auffällt, ist zunächst die große zeitliche Dichte, mit welcher die Verwaltungsordnungen in vielen, auch kleineren Territorien vorkommen und aufeinanderfolgen. Eine Querschnittsbetrachtung der einzelnen Jahrzehnte und Zeiträume ergibt andererseits, daß diese Gesetzgebungsaktivitäten zwischen dem Ende des 15. Jahrhunderts und dem Beginn des Dreißigjährigen Krieges, zum Teil auch während der Kriegsjahre, kaum nachlassen. Dabei entsprach der Rhythmus,
Selbstbindung absoluter Herrschermacht
409
in dem die einzelnen Verwaltungskörper neu geordnet wurden, oft, wenn auch nicht durchgehend, der Regentenfolge. Sowohl für das 16. wie auch noch für das späte 18. Jahrhundert läßt sich feststellen, daß dem Regierungsantritt vieler, nicht nur überragender, Herrscher eine eifrige Verwaltungsgesetzgebung auf dem Fuße folgte, deren Ziel es war, den übernommenen Apparat zu reorganisieren und den eigenen Vorstellungen anzupassen. Nicht selten erschöpft sich danach die Gesetzgebungsaktivität im administrativen Bereich rasch. Damit entstand die Gefahr, daß die zunächst befohlenen Regelungen wieder vergessen oder in jahrzehntelanger Routine entsprechend den Bedürfnissen der Praxis abgeschliffen wurden. Wirksame Impulse zur Neuordnung waren am ehesten vom jeweils neuen Herrscher zu erwarten. Dieser eigenartige, von der Regierungsdauer der einzelnen Herrscher abhängige Rhythmus, nach welchem die Beamten lebten, ist ein besonders charakteristisches Merkmal der Administration einer vorkonstitutionellen Monarchie, wenngleich es auch an Beispielen für verwaltungspolitische Kehrtwendungen einzelner Regenten nicht fehlt. Über die Ziele der neu erlassenen Gesetze geben viele dieser Verwaltungsordnungen bereitwillig Auskunft. Im 16. und 17. Jahrhundert herrschte das Motiv vor, eine gute Ordnung zu schaffen und vorhandene Unordnung abzustellen. Hinzu tritt der schon aus dem hohen und späten Mittelalter geläufige Hinweis auf den „gemeinen Nutzen". Diese generellen Aspekte, welche sich nahtlos in das Gesetzgebungsdenken des Obrigkeitsstaates einfügen, finden oft ihre Ergänzung in Hinweisen auf die besonderen Sorgen, welche die einzelnen Verwaltungsangelegenheiten bereiteten. So steht hinter den Hofordnungen Jahrhunderte hindurch das Bestreben, die ausufernden Kosten der sich immer wieder vergrößernden Hoflager in den Griff zu bekommen und die Hofdisziplin zu erneuern. Die Hofratsordnungen stehen in engem Zusammenhang mit dem Umbruch des Rechtswesens im Zeitalter der Rezeption und sind vielfach als eine Antwort auf das verbreitete Unbehagen über die Zunahme von Prozessen und die Unsicherheit des Rechtsschutzes zu verstehen. Dem Kammer- und Kanzleiwesen sind die Gebrechen in einem Zeitalter mit geringer administrativer Erfahrung gleichsam verwaltungsimmanent: Sowohl die Rechnungsvorgänge wie die Bewältigung des Schriftverkehrs und die Führung von Registern erforderten systematisch angelegte, konsequent durchzuhaltende Arbeitstechniken, wie sie in der frühen Neu /.eit noch nicht überall vorhanden waren. Seit dem späten 17. und im Laufe des 18. Jahrhunderts sind in der Verwaltungsgesetzgebung Veränderungen zu beobachten, deren Charakterisierung nicht leicht fällt, weil es sich nicht um einen offenen Wandel der Gesetzgebungspraxis, sondern um Veränderungen des Regierungsstils handelt. Für viele Verwaltungseinrichtungen, die inzwischen eine große Stabilität erlangt haben und bis zum napoleonischen Zeitalter fortleben werden, setzen Ordnungen der geschilderten Art die Reihe der älteren Gesetzgebungswerke fort. Spürbar wird indessen eine verstärkte Neigung zur systematischen Anlage und äußeren Gliederung des Stoffes, wie es dem Geist dieser Jahre entspricht. Auch verschwinden nun vielfach die Hinweise auf die Wahrung von Frieden und Recht und das gute Regiment aus den Prä-
410
Dietmar Willoweit
ambeln. Es geht den Monarchen jetzt nicht mehr in erster Linie um die gute Ordnung ihrer Verwaltung, sondern um die Schaffung tauglicher Instrumente für einen politischen Gestaltungswillen, der sich neue, an der Landesentwicklung orientierte Ziele setzt. Daher wird jetzt nicht selten offen darauf hingewiesen, daß neue Regeln oder Einrichtungen zu schaffen seien. Von beispielhafter Bedeutung sind insofern die zur Förderung von Handel und Gewerbe errichteten Kollegien, mit welchen ein dynamisches Element in die Verwaltung hineingetragen wurde. Solche und andere neue Kommissionen und Amtsstellen wurden, wenn man dem aufschlußreichen Sprachgebrauch der Zeit folgt, weniger „geordnet" als „instruiert". Zwar ist der Begriff der „Instruktion" auch schon im 16. Jahrhundert bekannt gewesen und ohne sachliche Differenzierung neben dem vorherrschenden Wort „Ordnung" verwendet worden. Im 18. Jahrhundert ist jedoch umgekehrt viel häufiger von „Instruktionen" als von „Ordnungen" die Rede. Darin spiegelt sich ein gewisser Funktionswandel der Verwaltungsnormen wider. Es geht jetzt weniger um die Sicherung eines guten Regiments, als um die gewisse und unmittelbare Bindung des Beamten an den politischen Willen des Fürsten. Dabei werden auch überholte Regelungsformen aufgegeben. So sind Hofordnungen im 18. Jahrhundert nicht mehr überall anzutreffen. Statt dessen kommen nun häufiger Rangordnungen der Beamten vor. Neu sind auch die Mandate, Reskripte und ähnliche kurze Gesetze zu einzelnen beamtenrechtlichen Fragen allgemeiner Art, die im Laufe des 18. Jahrhunderts entsprechend der allgemeinen Entwicklung des Gesetzgebungsstils neben die auf das Amt oder die Institution bezogenen Ordnungen und Instruktionen treten. Solche Verwaltungsgesetze betreffen etwa die Bestrafung, die Kündigung und endlich die allgemeinen Pflichten der Beamten.9
III. Nach diesem zusammenfassenden Überblick über eine weniger bekannte Quellengattung stellt sich die Frage, was die Texte über den Prozeß der Staatsbildung auszusagen vermögen. Man könnte auch so formulieren: Ist dieses Quellenmaterial bislang nicht mit Recht unbeachtet geblieben? Kurzschlüssig wäre es sicher, mit Rücksicht auf die weitverbreiteten Verwaltungsordnungen schlicht die Gesetzmäßigkeit des Verwaltungshandelns schon in der frühen Neuzeit behaupten zu wollen. Ich möchte auch nicht dazu ermuntern, die moderne Frage nach der Entstehung des Rechtsstaats in immer frühere Jahrhunderte hineinzutragen. Doch die Forschung wird sich ein Urteil darüber bilden müssen, was die offenkundige Parallelität zwischen der landrechtlichen und polizeilichen Gesetzgebung einerseits und der Verwaltungsgesetzgebung andererseits für das frühneuzeitliche Staatswesen zu bedeuten hat. Denn niemand wird bestrei9 Hans Hattenhauer, Geschichte des Beamtentums, 1980; Dietmar Willoweit, wicklung des öffentlichen Dienstes, in: Jeserich u. a. (wie Anm. 7), S. 346 ff.
Die Ent-
Selbstbindung absoluter Herrschermacht
411
ten wollen, daß die Landrechte und Polizeiordnungen Recht und Gesellschaft nachhaltig geprägt haben. Läßt sich ein entsprechender Einfluß der Verwaltungsordnungen auf den staatlichen Regierungsapparat nicht behaupten? Diese Frage wird erst nach geduldigen Archivstudien zu beantworten sein. Schon ein flüchtiger Blick in die Archive und die Lektüre schon vorliegender Untersuchungen10 zeigen indessen, daß die Mechanismen der frühneuzeitlichen Administration ohne Kenntnis des komplizierten Regelwerks der zahlreichen Ordnungen und Instruktionen kaum zu verstehen sind. Voluminöse Protokollbände der verschiedenen Kollegialorgane belegen zudem, in welchem Umfang auch der absolute Fürstenstaat Verwaltungsroutine praktizieren mußte und diese zweifellos nur nach etwa gleichbleibenden Regeln organisieren konnte. Die summa potestas des Souveräns allein genügte nicht, um die Staatspraxis der ja recht verwaltungsaufwendigen Ständegesellschaft zu beherrschen. Die folgenden Thesen scheinen mir daher bedenkenswert. Erstens. Die Verwaltungsordnungen entstehen im Rahmen einer allgemeinen, breiten Bewegung zur Normorientierung herrschaftlichen Handelns. Ihr Ursprung ist sicher nicht allein in besonderen, verwaltungsimmanenten Ursachen zu suchen. Zweitens. Mit den Verwaltungsordnungen wird die Regelhaftigkeit des Verwaltungshandelns angestrebt. Zum Bild dieser Quellen gehört durchgängig die Weisung des Fürsten an die Beamten, sich bei Vermeidung schwerer Strafen strikt an die Ordnungen zu halten. Die Einhaltung von Regeln, die auf den Fürsten selbst oder seine engste Umgebung zurückgehen, bedeutete zugleich, daß die Beamten kontinuierlich an den einmal geäußerten und daher gleichbleibenden Willen ihres Herrn gebunden waren. Die im Spätmittelalter oft sehr große Selbständigkeit der Amtleute, die nicht selten Pfandbesitzer ihrer Ämter waren, sollte beseitigt werden. Das gilt selbst dann, wenn, wie im 17. und 18. Jahrhundert wieder praktiziert, der Amtserwerb durch ein Kaufgeschäft erfolgte. Daß die oft adeligen Amtsträger, die bis dahin mit großem Selbstbewußtsein in den regionalen Ämtern walteten, bereit waren, den nur innerhalb weniger Menschenalter entstandenen Gesetzgebungsstaat dienend zu unterstützen, wird man wohl nur mit den hohen Ansprüchen der politischen Ethik dieser Zeit erklären können. Ein Herrscher, der als Obrigkeit auch Verantwortung für das ewige Heil der Untertanen in Anspruch nimmt, hat im 16. Jahrhundert die Herrschaftskonkurrenz mit nur wirtschaftlich interessierten Grundherren für sich entschieden. Die von Michael Stolleis untersuchten Regimentstraktate spiegeln diese Einordnung des Amtsträgers in den Obrigkeitsstaat wider. 11 Erst von nun an scheint es sinnvoll, von „Beamten" zu sprechen. Drittens. Mit der Einhaltung von Regeln und der kontinuierlichen Bindung an einen gleichbleibenden Willen des Landesfürsten schreitet ein schon seit dem Hochmittelalter zu beobachtender Prozeß fort, den man als Entpersonalisierung 10
Vgl. dazu die Hinweise bei den in Anm. 7 genannten Autoren. Michael Stolleis, Grundzüge der Beamtenethik (1550-1650), in: Die Verwaltung 13 (1980), S. 447 ff. 11
412
Dietmar Willoweit
des Verwaltungshandelns bezeichnen könnte. Das heißt, der Amtsträger hat detailliert ausformulierte Amtspflichten zu erfüllen, nicht einfach undifferenzierte, von Fall zu Fall erst festgelegte Dienste zu leisten. Daraus folgt zugleich eine - zeitlich begrenzte - Selbstbindung des Herrschers, wie sie Folge eines jeden allgemeinen Gesetzes ist. Die Tragweite der angedeuteten Thesen ist freilich davon abhängig, welche Fragen in den einschlägigen Ordnungen und Instruktionen tatsächlich geregelt wurden. Es handelte sich ja im wesentlichen um Verfahrensgesetze, deren Ziel nicht die inhaltliche Festlegung der zu treffenden Entscheidungen war. Insofern aber eine Verfahrensregelung mit der Zuweisung von Kompetenzen und Vorschriften für die Sachbehandlung Entscheidungsprozesse kanalisiert und auch materiell beeinflußt, gilt dies auch für die Verwaltungsordnungen der frühen Neuzeit. So wurden etwa die Kompetenzen und Beratungsregeln der Hofratskollegien, zu deren Aufgaben sowohl politische Angelegenheiten wie Partei Streitigkeiten gehörten, regelmäßig zur Entlastung des Landesherrn geschaffen. Das Kollegium handelt „an Unser stat", wie viele dieser gesetzgebenden Fürsten ausdrücklich versichern. Der Entlastungseffekt tritt aber nur ein, wenn die Entscheidungen des Ratskollegiums endgültigen Charakter haben. Genau dies ist aber für die Masse der Geschäfte vorgesehen und schon durch die Prozedur der Umfrage gewährleistet: Die Mitglieder eines Kollegiums geben ihre Stimme nacheinander einzeln, entsprechend ihrem Rang und ihrer Anciennität ab. Grundsätzlich entscheidet das Mehrheitsprinzip. Zuweilen wird, wenn das Ergebnis dem Vorsitzenden bedenklich erscheint, eine nochmalige Abstimmung gestattet, nicht selten aber auch ausdrücklich untersagt. Selbst zu entscheiden, behält sich der Fürst im allgemeinen nur dann vor, wenn einer Angelegenheit größere Bedeutung zukommt. Vielfach scheint es üblich gewesen zu sein, daß einige Vertreter des Kollegiums ihren Herrn in größeren Abständen, etwa einmal wöchentlich, über die Beratungen informierten. Sicher ist dabei nur ein Bruchteil der verhandelten Geschäfte zur Sprache gekommen. Die Komplexität der sozialen und herrschaftlichen Verhältnisse und deren rechtliche Prägung hatten längst einen solchen Grad erreicht, daß mit allerhöchsten Resolutionen allein ein Land nicht mehr zu regieren war. Man mag die Frage stellen, ob den hier beobachteten Selbstbeschränkungen der fürstlichen Gewalt überhaupt Rechtscharakter zukommt. Haben wir es vielleicht nur mit tatsächlichen Organisationsstrukturen zu tun, weil diese doch stets vom Willen des Landesfürsten abhängig geblieben sind? Von einem modernen Rechtsund Normverständnis ausgehend, wäre die Frage zu bejahen. Es scheint paradox, daß ein Fürst Gesetze erläßt, an die er sich gebunden fühlt, solange er dies für richtig hält. Wenn der Grund der Verbindlichkeit einer Norm im Willen des Normadressaten liegt, diese Norm zu befolgen, haben wir es nicht mit Recht im heutigen Sinne des Begriffs zu tun. Zweifelhaft ist nur, ob an die frühneuzeitliche, vorkantianische Gesetzgebung der Maßstab moderner Rechtslogik angelegt werden kann, ohne den Vorwurf einer anachronistischen Begriffsverwendung zu provozieren. Solange das heteronome Rechtsgebot vom moralischen Sollen noch nicht katego-
Selbstbindung absoluter Herrschermacht
413
rial unterschieden wurde, haben die Zeitgenossen ihre Rechtsordnung anders erlebt als der moderne Mensch. Nur so erklärt es sich auch, daß die erörterten Verwaltungsordnungen eine Wirkungsgeschichte entfalteten, die ihnen als Emanation des jederzeit zu neuen Entschließungen berechtigten Willen des Fürsten eigentlich nicht zukommen konnte. Auch Gesetze, an die sich der Herrscher nur aus Gründen der Fürstenethik oder mit Rücksicht auf pragmatische Motive gebunden fühlte, haben die Geschichte von Staat und Gesellschaft beeinflußt. Vielleicht hat auch die Eigendynamik normativer Regelungen der Staatstätigkeit dazu beigetragen, daß der Weg in das Zeitalter der Kodifikationen und Konstitutionen beschritten werden konnte.
Das Werk Max Webers in der internationalen Wissenschaft Die Annäherung an einen Klassiker dargestellt in ausgewählten Beispielen Von Marcus Jaroschek Das (Gesamt-)Werk Max Webers ist nicht nur für Soziologen und Politologen interessant. Auch Wissenschaftler anderer Disziplinen haben Nutzen aus seinem Schaffen ziehen können, was nicht zuletzt aus der kaum faßbaren Bandbreite seines Denkens resultiert. Weber ist nun seit über 75 Jahren tot; die Auseinandersetzung mit seinem Werk hat seit seinem Ableben sowohl in der deutschen Wissenschaft, besonders (und früher) aber in anderen Ländern der Welt stark an Bedeutung gewonnen. Deshalb war es interessant zu untersuchen, wie Weber im Ausland gesehen wird und welche Thesen seines Werkes in welcher Gesellschaft besondere Aufmerksamkeit erregen. Die Ergebnisse fallen dabei - wenig verwunderlich höchst unterschiedlich aus.
I. Ausgangspunkt der Darstellung 1. Zum Begriff Rezeption Die Aufnahme und Umsetzung1 eines wissenschaftlichen Werks in einem anderen als seinem Entstehungsumfeld ist am besten an seiner Rezeptionsgeschichte nachzuvollziehen. Vor allem die Umsetzung und damit besonders eine Weiterentwicklung des rezipierten Werkes setzen allerdings eine gelungene Rezeption voraus, deren Verlauf man in zwei Phasen gliedern kann2. Erstes Augenmerk ist auf das Bekanntwerden eines wissenschaftlichen Werkes in einem anderen als seinem Entstehungsumfeld zu verstehen, d. h. die Bekanntschaft mit den Inhalten und Argumenten des Werkes, seinen begrifflichen, theoretischen und methodologischen Eigenheiten sowie dem Leben und der Persönlichkeit 1
Das meint insbesondere Weiterentwicklung und Anpassung auf die im Rezeptionsgebiet vorherrschenden Gegebenheiten; vgl. dazu ausführlich T. Ibaraki in: J. Weiß (Hrsg.), Max Weber heute - Erträge und Probleme der Forschung, 1989, S. 116 2 Vgl. ausführlich T. Ibaraki ebenda (Fußn. 1), S. 116 f.
416
Marcus Jaroschek
des Autors. Dies wird regelmäßig durch die Übersetzung und Lektüre des Werkes und von Schriften über den Autor zu erreichen sein. Daneben - und weit wichtiger - gehört zu einer gelungenen Rezeption wohl auch die Übertragung des bekannt gewordenen Werks auf die Verhältnisse im Rezeptionsbereich, also die Anwendung der begrifflichen, theoretischen und methodologischen Eigenheiten des Werkes auf die historische, kulturelle und gesellschaftliche Wirklichkeit in diesem Gebiet. Sind die ersten beiden Phasen adäquat verlaufen, kann von der Möglichkeit zur Weiterentwicklung des angenommenen Werkes im Rezeptionsbereich gesprochen werden. Diesem Muster wird die Darstellung in der Folge entsprechen.
2. Verspätete Auseinandersetzung mit Webers Werk Die Auseinandersetzung mit Max Weber hat in der Wissenschaft spät eingesetzt3. Die Ursachen für dieses Phänomen sind nicht leicht auf einen Nenner zu bringen 4 und können aus Platzgründen hier nur kurz angerissen werden5. Zu seinen Lebzeiten war er in Deutschland und - mit Ausnahme von Japan6 - auch in der übrigen Welt nicht oder nur einem kleinen Kreis Interessierter als politischer Publizist bekannt7. Dies hatte seinen Grund vor allem darin, daß Weber viele Jahre keinen akademischen Unterricht abhielt und sich somit auch kein Kreis von Schülern um ihn sammeln konnte, wie es wohl der „normale Weg" gewesen wäre 8. Nach seinem Tod schätzte man ihn, setzte sich aber nicht oder nur wenig mit seinen Thesen auseinander, was teils aus Unverständnis seiner Arbeit teils aber auch aus Ablehnung geschah, da die Sozialwissenschaft im damaligen Deutschland mit ihm in grundlegenden Dingen, wie etwa seiner Auffassung der Wertfreiheit nicht übereinstimmte9. Erst in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg fand man Zugang zu seinem Werk. In dieser Zeit hatte die Beschäftigung mit Webers Thesen, nicht zuletzt auch angeregt durch die amerikanische Sozio3
Vgl. grundsätzlich etwa E. Shils, Tradition, Ecology and Institution in the History of Sociology, in: ders., The Constitution of Society, 1982, S. 275-283. 4 Vgl. dazu etwa Λ. Zingerle, Max Webers historische Soziologie, 1981, S. 6 ff. 5 Ausführlich zu den Gründen für diese Entwicklung in Deutschland, s. etwa J. Weiß in ders. (Fußn. 1), S. 8 f.; Zingerle (Fußn. 4), 8 ff.; bereits früher T. W. Adorno in: O. Stammer (Hrsg.), Max Weber und die Soziologie heute (Verhandlungen des 15. Deutschen Soziologentages), 1965, S. 100. 6 Vgl. noch unten Punkt IV. 7 S. hierzu etwa die historischen Materialien in dem von R. König herausgegebenen Buch ,Max Weber zum Gedächtnis', 1963 (2. Aufl. 1985). 8 Der Heidelberger Kreis konnte dies nicht erreichen, da er zwar ein Ort des Austauschs und der Begegnung Webers mit anderen Intellektuellen war, aber nie die Konstanz einer ,Schule' erreichte, wie sie sich im Rahmen eines Lehrbetriebes etablieren würde. 9 Zu den vielfältigen Gründen s. Zingerle aaO (Fußn. 4), S. 8 ff.
Das Werk Max Webers in der Wissenschaft
417
logie 10 , weltweit ein enormes Maß an Breite und Intensität erreicht, die bis heute andauert. Insgesamt kann und will dieser Beitrag nicht beanspruchen, ein repräsentatives Bild der jüngeren Weber-Rezeption zu vermitteln. Vielmehr soll anhand einiger ausgewählter Beispiele aus der ganzen Welt gezeigt werden, wie sehr Wahrnehmung, Aneignung und Beanspruchung desselben Werkes von den jeweiligen wissenschaftlichen, kulturellen und politischen Randbedingungen des jeweiligen Rezeptionsbereichs abhängen. II. Die Max Weber-Rezeption in Europa 7. Großbritannien Die Soziologie in Großbritannien hat sich über einen langen Zeitraum entwickelt, in welchem sie von vielfältigen, häufig widersprüchlichen Einflüssen geprägt wurde. Als institutionalisierte Disziplin ist die Soziologie erst eine Erscheinung der Zeit nach 194511. a) Aneignung In der 40jährigen Zeitspanne des raschen Wachstums der Soziologie ist die Geschichte der Rezeption Webers in Großbritannien insgesamt äußerst sprunghaft verlaufen und sehr häufig überhaupt nicht als solche erkannt worden. Es ist nicht verfehlt, mit einer verbreiteten Meinung 12 zu behaupten, daß sich die Entwicklung der britischen Soziologie in idealtypischer Weise besser an Hand der Rezeption von Karl Marx entwerfen ließe, da dieser (bereits in England eingewandert) in der dortigen Landessprache schrieb und sich mit einer politischen Bewegung identifizierte. So fiel es ihm leichter, den britischen Widerstand gegen Denkweisen, die als typisch deutsch verstanden wurden, zu überwinden: Ein Großteil des Widerstandes gegen die Soziologie in Großbritannien kam von den älteren Universitäten und der Kulturelite. Es war ein Widerstand gegen deutsche Ideen, vor allem gegen die Vorstellung von einem systematischen Theoretisieren über das soziale Leben und vom organisierten Staat sowie gegen die Erforschung der transzendentalen Voraussetzungen der Moral. Max Weber ließ sich nicht in gleicher Weise mit einer politischen Bewegung identifizieren, und sein Name wurde nie zu einem derartigen Programm wie der von Marx. Auch spielte die Sprachbarriere seiner anfangs 10
Dazu noch eingehend unter Punkt III. Zur Veranschaulichung sollen folgende Zahlen dienen: Im Jahre 1948 graduierten in ganz Großbritannien nur 90 Studenten in Soziologie und verwandten Fächern. 1983 belief sich die Zahl auf 2371 ; 80 Institutionen boten akademische Grade in diesem Fach an, Im selben Jahr gab es 66000 Kandidaten für Soziologieprüfungen auf der Schulebene, wogegen 1945 ein solches Schulfach noch ganz unvorstellbar war; Nachweise bei M. Albrow, Die Rezeption Max Webers in der britischen Soziologie, in: Weiß (Fußn. 1), S. 165, 184 f. 12 Nachweise etwa bei M. Albrow aaO, S. 184 f. 11
27 Gedächtnisschrift Wenz
418
Marcus Jaroschek
kaum übersetzten Werke in England selbst für die überwiegende Mehrheit der Gebildeten eine große Rolle. Teilweise hing die Rezeption Webers in Großbritannien davon ab, was die Briten in ihn hineinlesen wollten. Daher sei kurz dargestellt 13, welche Aspekte seines Denkens und Arbeitens ihn für die britische Leserschaft (besonders) leicht zugänglich machten. Individualismus. Webers Behauptung, daß das Individuum die grundlegende Einheit der soziologischen Analyse sei und daß alle sozialen Phänomene im Grunde hinsichtlich ihrer Bedeutung für die Individuen verstanden werden müßten, steht in Einklang mit der durch Bentham, Adam Smith und anderen begründeten Tradition der britischen Sozial- und Wirtschaftstheorie. Empirizismus. Die Tatsache, daß Weber die Soziologie als strikt empirische Wissenschaft und als Kausalforschung verstand, steht im völligen Einklang mit dem Grundtenor der Sozialwissenschaften, wie ihn John Stuart Mill im 19. Jahrhundert umriß. Objektivität. Von einem sehr frühen Zeitpunkt an wurde Webers Erörterung der Wertfreiheit als klassische Darstellung des Problems der Objektivität in den Sozialwissenschaften gesehen und als moderne Version der Humeschen Unterscheidung von „is" und „ought" betrachtet. Eine Zeitlang führte dies dazu, daß Weber als ein Vorläufer des logischen Positivismus gesehen und wiederholt von Verteidigern der akademischen Freiheit und politischen Unabhängigkeit angeführt wurde. Positivismus. Daß Weber Rechts- und Machtprobleme losgelöst von moralischen Erwägungen und unter instrumenteilen und Ressourcengesichtspunkten behandelt, wurde oft mit den Vorstellungen von Thomas Hobbes und John Austin zusammengebracht. Vor allem professionelle Politiker entwickelten eine starke Sympathie für eine solche, Weber unterstellte Nüchternheit und Distanziertheit der Betrachtung. Protestantismus. Eine offenkundige Affinität besteht zwischen Webers protestantischer Herkunft und den starken Traditionen Großbritanniens. Es ist keine Frage, daß sich aus der Perspektive dieser Traditionen Webers Religionsbegriff und seine Erörterungen etwa zu Problemen religiös-ethischer Pflichten oder der Entzauberung im besonderen leichter erschließen als im Horizont einer anderen religiösen oder kulturellen Überlieferung. Anglophilie. Weber äußerte sich, wie viele Deutsche im 19. Jahrhundert, mit viel Sympatie über Englands Regierungssystem, seine politisch bewußte und verantwortungsbereite Bourgeoisie, seine pragmatische Administration und Tradition der Selbstverwaltung. Sicher spielte hier ein deutscher Respekt vor der Weltmachtrolle Großbritanniens hinein; ebenso wichtig aber war eine tiefe Vertrautheit mit den historischen und auch literarischen Traditionen Englands. 13
Die Darstellung folgt der Auflistung bei Albrow passim, S. 168 f.
Das Werk Max Webers in der Wissenschaft
419
Insofern lassen sich die genannten Ähnlichkeiten nicht als zufällig verstehen. Sie bilden vielmehr eine solide Basis für ein wechselseitiges Verständnis. Natürlich ist Webers Werk durch diese Punkte nicht hinreichend charakterisiert; andere Aspekte haben seine Rezeption durchaus behindert. Nicht zuletzt war diese Rezeption, wie bemerkt, selektiven und partiellen Charakters. Trotzdem hat sie die Fortentwicklung der britischen Soziologie ohne Zweifel gefördert, was im folgenden zu zeigen sein wird.
b) Übertragung aa) Rezeption im Umkreis der London School of Economics bis 1960 Die erste Arbeit Webers, die in bemerkenswerter Weise auf das intellektuelle Leben Englands einwirkte, war jene, deren Relevanz für Großbritannien offensichtlich ist. Es waren die Essays der Protestantischen Ethik 14 , die den sozialistischen Historiker Richard Tawney dazu veranlaßten, das Verhältnis von religiösen Ideen und sozioökonomischem Wandel in einem Buch aufs neue zu untersuchen 15 . Tawney schrieb die Einführung zu Talcott Parsons' Übersetzung der PE (1930) und widmete sich auch in der Neuauflage des Buches (1937) erneut diesem Problem. In seinem Vorwort merkte er an, daß er selbst, ebenso wie Weber von einer Wechselwirkung zwischen Religion und sozialer Ordnung überzeugt sei und daß Webers Absicht, den religiösen Quellen des Kapitalismus nachzugehen, durchaus nicht die andere Möglichkeit ausschließe, die ökonomische Basis von Religionen zu untersuchen. Tawneys wissenschaftliches Ansehen, verbunden mit seinem öffentlichen Bekenntnis zum Sozialismus, sorgten dafür, daß Weber sehr überzeugend unter den britischen Intellektuellen eingefühlt wurde. Dies hatte zur Folge, daß man Weber zumindest als bemerkenswerten Herausforderer von Marx betrachtete 16. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg wurden Webers Werke in England weiter rezipiert, was hauptsächlich den Wissenschaftlern der London School of Economics 17 zu verdanken war. Die für studentische Belange konzipierte Textauswahl von Hans Gerth und C. Wright Mills gehört bis heute zu den bekanntesten und meistgelesenen Einführungen in Webers Schriften in englischer Sprache; sie wurde 1948 veröffentlicht. Der erste Band von Wirtschaft und Gesellschaft 18, übersetzt 14
Im folgenden abgekürzt mit PE. 15 R. Tawney, Religion and the Rise of Capitalism, 1976. 16
Dies kann allerdings nicht auf die Übersetzung der Wirtschaftsgeschichte (1927) von Frank Knight zurückgeführt werden, da dieses Werk angesichts seiner Hervorhebung der Brutalitäten des Kapitalismus eher der linksgerichteten Geschichtsschreibung zuzuordnen ist. 17 Im folgenden abgekürzt mit LSE. 18 Im folgenden abgekürzt mit WG. 2
420
Marcus Jaroschek
und herausgegeben von Talcott Parsons und A. M. Henderson, erschien 1947. Parsons' Mitarbeiter E. Shils hatte u. a. zwei Aufsätze Webers über Objektivität, und Wertfreiheit in englischer Sprache herausgegeben, die für lange Zeit den einzigen Zugang zu Webers Methodologie für die englischsprechende Welt bildeten. In der Folgezeit richtete sich die Aufmerksamkeit der akademischen Welt in Großbritannien auf Weber als einen Protagonisten wissenschaftlicher Objektivität in den Sozialwissenschaften. Man suchte bei ihm eine Unterstützung für die Auffassung der Ökonomie als einer analytisch eigenständigen Wissenschaft, deren Gegenstand diejenigen Formen seien, die durch menschliches Verhalten im Prozeß der Verteilung knapper Ressourcen geeignet seien19. Lionel Robbins20 sah Weber als entscheidende Autorität. Er betonte die Kluft zwischen normativer und Tatsachen-Forschung und bekannte, er könne kaum verstehen, „wie man es für möglich halten kann, diesen Teil von Max Webers Methodologie in Zweifel zu ziehen" 21 . Trotz einiger Kritik an seinem Positivismus wurde Robbins Essay ein Standartwerk nachfolgender Generationen, und die vorherrschende Methodologie der Sozialwissenschaft ließ sich ganz vom Prinzip der Wertfreiheit bestimmen. Zwei deutsche Emigranten, Karl Mannheim und J. P. Mayer, thematisierten die größeren Zusammenhänge der Weberschen Interpretation der modernen Gesellschaft und des Staates im Kontext der britischen Sozialwissenschaften. Mannheim bezog sich auf Weber bei seinen Vorstellungen von einer rationalen Gesellschaft. Anders als Weber erwartete er allerdings, daß sich in einer geplanten und rational organisierten Gesellschaft die Freiheit wertorientierten Handelns erhalten werde 22. Mayer veröffentlichte seine erste Weber-Studie in Großbritannien im Jahre 194423, die Weber als einen führenden Kenner der deutschen Politik charakterisierte, der aber nur eine begrenzte Fähigkeit besessen habe, die angelsächsische Welt zu begreifen. Mayer verwies hier auf einen Aspekt im britischen Selbstverständnis, der tatsächlich eine Grenze der Weberschen Rezeption markierte: den traditionellen Kern in der politischen Praxis eines Landes, das sich als widerstandsfähig gegenüber dem Rationalisierungsprozeß erwies, den Weber und Mannheim für unaufhaltbar hielten. Eine wichtige Rolle im Voranbringen der Weber-Rezeption in England spielte der an der London School of Economics lehrende Soziologe Morris Ginsberg 24, der in seinem Artikel,Recent Tendencies in Sociology' von 1933 auf Max Webers WG und die Gesammelten Aufsätze zur Wissenschaftslehre hinwies. Seine knap19 L. Robbins, An Essay on the Nature and Significance of Economic Science, 1932, S. 15. 20 Oben Fußn. 19.
21 Robbins aaO, S. 148. 22 K. Mannheim, Man and Society in an age of Reconstruction, 1940. 23 J. P. Mayer, Max Weber and German Politics. 24 In der ersten Zeit nach 1945 war er der einzige Lehrstuhlinhaber für Soziologie in Großbritannien.
Das Werk Max Webers in der Wissenschaft
421
pen Zusammenfassungen der Weberschen Ansichten zur Methodologie zählen auch heute noch zu den klarsten und ausgewogensten Darstellungen dieser Art. Nach seiner Einschätzung galt Weber zu jener Zeit allgemein als der bedeutendste deutsche Beitrag zur neueren Soziologie. Trotzdem waren in seinen Schriften auch gewisse Vorbehalte gegenüber Weber zu erkennen; er thematisiert diese in seinem Buch ,Idea of Progress' (1953), in dem Weber kritisiert wird, weil er „der Rolle der Ideen in der Rechtsentwicklung keine ausreichende Beachtung" geschenkt und übersehen habe, daß die „juristische Urteilskraft auf be wußte Annahmen ethischer und politischer Natur" beruhe. Ginsbergs Empfindungen gegenüber Weber waren ähnlich ausgestaltet, wie gegenüber Mannheim: Wenn man den deutschen Ideen zuviel Bedeutung beimesse, würden sie über kurz oder lang die Oberhand gewinnen. Trotz dieser Vorbehalte war er letztlich dennoch nicht imstande, das Interesse an Weber, zu dem er Wesentliches beigetragen hatte, zu begrenzen; die LSE wurde zu einer „Brutstätte" der Weber-Forschung, was gleichbedeutend mit der ersten Phase der Rezeption seiner Ideen in der angelsächsischen Soziologie war. Auch wenn sich die Soziologen der 50er Jahre durchaus bewußt waren, daß ihr fundamentales Interesse an der Klassenproblematik auf Marx zurückging, bedienten sie sich doch eher der Weberschen Herangehensweise, und darin wurden sie von Rolf Dahrendorf und dessen Beiträgen zur britischen Soziologie wesentlich unterstützt. Die Veröffentlichung von ,Class and Class Conflict in Industrial Society' in englischer Sprache im Jahre 1950 war ein Wendepunkt in der Geschichte der soziologischen Wissenschaft in Großbritannien. Das Buch ging aus Dahrendorfs Studien an der LSE hervor und verfolgte das Ziel, die theoretischen Grundlagen der Klassenanalyse in dem Sinne umzubilden, daß die Aufmerksamkeit von den Beziehungen zwischen Kapital und Arbeit auf die Autoritätsstrukturen organisierter Kollektive gelenkt wurde. Dabei stützte sich Dahrendorf konzeptuell und methodologisch auf Max Weber, und diese Orientierung ermöglichte es ihm auch, seine positive Meinung von der Effektivität britischer Institutionen (was die Institutionalisierung von Konflikten betrifft) in die Erörterung einzubeziehen. Dies machte es ihm wiederum leichter, die oben erwähnte Abneigung der Briten gegen deutsches Gedankengut zu umgehen.
bb) Die Weber-Rezeption in den 60er und 70er Jahren Das erste britische Lehrbuch der soziologischen Theorie wurde von einem Sozialwissenschaftler verfaßt, der sich für die Fortentwicklung Weberscher Ansätze in der Soziologie einsetzte. ,Key Problems of Sciological Theory' (1961) von John Rex war ein Meilenstein in der britischen Weber-Rezeption. Als gebürtiger Südafrikaner lehrte er in Leeds, gehörte folglich nicht dem LSE-Zirkel an, und brachte in seinem Buch eine sehr unenglische und für Großbritannien jedenfalls neue Sicht Webers insofern, als er in dessen Studien eine zusammenhängende soziologische Theorie und nicht nur eine Sammlung unzusammenhängender theoretischer Ein-
422
Marcus Jaroschek
sichten suchte. Unmittelbar aus dem Weberschen Werk entwickelte Rex seinen Handlungsbezugsrahmen, und diese Konzeption gab sowohl der theoretischen Soziologie als auch der Weber-Forschung in England enormen Auftrieb. Im Jahre 1963 hatte sich die Soziologie über die LSE hinaus an einer Reihe anderer Universitäten - etwa in Leeds, Liverpool, Birmingham, Sheffield, u. a. - etabliert. Damit waren die Voraussetzungen des Durchbruchs („take o f f ) dieser Wissenschaft gegeben. Dazu paßt, daß in diesem Jahr das aus einer Vorlesungsreihe von W. C. Runciman in Cambridge hervorgegangene Buch ,Social Science and Political Theory 4 erschien, welches die erreichte Reputation des Faches in Großbritannien und die Bedeutung Webers wirkungsvoll zum Ausdruck brachte. Nach Runcimans Ansicht eignete sich Webers methodologischer Individualismus aufs beste zur Grundlegung einer Wissenschaft vom sozialen Handeln; in inhaltlicher Sicht böten insbesondere Webers Analysen zur Problematik des Staates und der sozialen Klassen für die moderne Soziologie gute Ansätze. Kritisierbar erschien Runciman allein Webers starre Trennung von Tatsachen und Werten und zwar in Form einer - angeblichen - Vermischung des verstehenden mit dem positivistischen Ansatz. Da Weber von mehreren Seiten immer wieder zustimmend zitiert worden war, wurde seine Zuordnung zum Positivismus von vielen als richtig betrachtet, sie lieferte dann der nachfolgenen Generation die Begründung für die entschiedene Ablehnung Webers. Von 1963 an stellt sich sowohl der Status der Soziologie im Allgemeinen, als auch der von Max Weber weitaus komplizierter dar. Die Soziologie erlebte ein sehr starkes Wachstum, gleichzeitig zerfiel der bis dahin existierende Konsens immer mehr, und an seine Stelle trat eine Vielfalt von miteinander konkurrierenden Perspektiven und Denkrichtungen. Dieser Prozeß der Soziologie korrespondierte mit dem Zusammenbruch des sozialdemokratischen Konsenses nach 1970 auf der politischen Ebene. In der Folgezeit galt es unter Forschern wie Studenten als anachronistisch, sich mit Weber zu befassen, da es vor allem die marxistischen, phänomenologischen und interaktionistischen Ansätze waren, die von einer Vielzahl von Strömungen, wie dem französischen Strukturalismus oder auch der Frankfurter Schule vertreten wurden. Zu bemerken ist allerdings, daß die meisten Denkrichtungen dieser Zeit in einen fortdauernden Prozeß der Kommunikation untereinander und mit dem soziologischen „Mainstream" eintraten; insofern hat sich im Ergebnis durch diese Entwicklung das Interesse an Weber nicht erledigt. Tatsächlich ist die Beschäftigung mit ihm über die ganze Zeit hinweg fortgeführt worden, so daß es gegenwärtig nicht nur eine Wiederbelebung jenes Interesses gibt, sondern auch einen großen Bestand an Arbeiten, die in vielfältigster Weise an Webers Werk anschließen25.
25
Eine größere Auswahl dieser Arbeiten ist angeführt bei: Albrow, aaO (Fußn. 11), S. 179.
Das Werk Max Webers in der Wissenschaft
423
c) Weiterentwicklung Im Hinblick auf die Reichweite des Einflusses der Weberschen Arbeiten stellt sich die Frage, ob und in welchem Maße Webers Ideen aufgenommen und fortentwickelt worden sind. Hier sind im Wesentlichen zwei Wissenschaftler zu nennen, und zwar John Rex und A. Giddens. Die empirischen Studien von Rex, der in Großbritannien als der am meisten „orthodoxe" Weberianer gilt, sind im Vergleich zu Weber in thematischer Hinsicht insofern konzentriert, als er seine Vorstellungen von Konfliktsoziologie im Wesentlichen am Problem der race relations entwickelt und exemplifiziert hat. So hat er in ,Social Conflict' (1981) eine theoretische Konzeption zur Konfliktanalyse entwickelt, die der Wechselbeziehung von individuellen und Gruppenkonflikten gerecht zu werden sucht. In ,Race and Ethnicity' (1986) tritt er den neuerdings verstärkt diskutierten rational choice-Ansätzen entgegen, deren Alleinvertretungsanspruch hinsichtlich des methodologischen Individualismus er entschieden bestreitet. In diesem Zusammenhang bezieht er sich vor allem auf einschlägige theoretische Konzepte (soziale Beziehung, Klasse, Stand) von Max Weber. Anders als Rex setzt Giddens sich mit Weber im wesentlichen auf der theoretischen Ebene auseinander. In ,Politics and Sociology in the thought of Max Weber' (1972) ziehlt er darauf ab, eine neue theoretische Synthese aus den Auffassungen und Theorien zu entwickeln, die in den 60er und 70er Jahren miteinander konkurrierten. Mit Hilfe des Konzepts der Strukturation soll die übernommene Zweiteilung von Individuum und Gesellschaft aufgehoben und gleichzeitig die zeitliche und die räumliche Dimension in die soziologische Analyse miteinbezogen werden. In neuerer Zeit beschäftigt sich Giddens verstärkt mit der Problematik des Staates, wobei er wiederum viele Fragen der politischen Soziologie Webers aufnimmt, indem er etwa Aspekte, wie den der Legitimität, Rationalität oder der Gewalt besonders hervorhebt. Für das deutsche Verständnis ungewöhnlich dürfte die Tatsache sein, daß Webers Rationalisierungsthese in Großbritannien auf sehr wenig Interesse, vielerorts sogar auf entschiedene Ablehnung stößt. Dies hat mehrere Gründe. Häufig werden Webers Überlegungen mit der Modernisierungstheorie identifiziert, und diese gilt in England bestenfalls als ethnozentrisch oder sogar als imperialistisch. Darüberhinaus werden solche Phänomene wie die fortdauernde Emotionali sierbarkeit der Massen, der Fortbestand kriegerischer Auseinandersetzungen oder das Widererstarken der Religionen als Symptome der Entrationalisierung angeführt. Diese Theorie hat für viele Briten ob ihrer umfassenden Gesamtheit den befremdenden Geruch Hegelscher Geschichtsphilosophie und deutschen Denkens allgemein an sich.
d) Ausblick Zusammenfassend läßt sich nach alledem sagen, daß die Briten zwar ein Weltreich besaßen, aber keine entsprechend umfassende Theorie; bei den Deutschen
424
Marcus Jaroschek
verhielt es sich umgekehrt. Es spricht viel dafür, daß sich die Briten nur dann mit dem Verlust ihres Empires abfinden können, wenn sie sich in ihrem historischen Bewußtsein von einer angemessenen Theorie bestimmen lassen. Die Rezeption Webers hat hierbei schon einiges beigetragen und auch für die Zukunft standen die Chancen für einen tiefergehende Austausch zwischen deutschen und britischen Gelehrten noch nie so gut wie heute26.
2. Italien a) Aneignung In keiner anderen Sprache - mit Ausnahme des Englischen und Japanischen existieren heute so viele übersetzte Schriften von Max Weber wie im Italienischen27. Die erste Übersetzung Webers in Italien, ,Die römische Agrargeschichte in ihrer Bedeutung für das Staats- und Privatrecht' erschien bereits 1907. In der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen folgten ihr u. a. die teilweise Übersetzung der PE (1932) 28 und eine Auswahl aus WG (1933) 29 , 1948 dann die Übersetzung von ,Wissenschaft als Beruf' und ,Politik als Beruf' von Delio Cantimori, 1950 ,Der Aufsatz über die Stadt' übertragen von Enzo Paci. 1977 erschien die Übersetzung des Aufsatzes ,Die protestantischen Sekten und der Geist des Kapitalismus'; 1982 wurde die vollständige Übersetzung der ,Gesammelten Aufsätze zur Religionssoziologie' herausgegeben. Aus dieser kurzen Auflistung sollte klar geworden sein, daß man heute in Italien über die grundlegenden Instrumente für eine direkte Kenntnis des Weberschen Werkes verfügt. b) Übertragung aa) Weber in der Zeit der idealistischen Hegemonie Das Interesse für Weber in Italien zwischen den beiden Weltkriegen war anfänglich auf den politischen Denker, auf den Kritiker des Bismarckschen Erbes und der imperialistischen Politik des Wilhelminischen Reichs beschränkt. So sah der Sozialwissenschaftler und Philosoph Benedetto Croce im Vorwort zur 1919 erschienenen Übersetzung von Parlament und Regierung Weber als Symbol der Krise 26
S. dazu auch die Einschätzung bei Albrow (Fußn. 11), S. 183 f. Eine ausführliche Auflistung der Weber-Übersetzungen inklusive der Sekundärliteratur ist bei Rossi, Die Rezeption des Weberschen Werks in Italien nach 1945, in: Weiß (o. Fußn. 1), S. 144 f. und 158 ff. zu entnehmen. 28 Die vollständige Übersetzung der PE wurde 1945 von E. Sestan herausgegeben. 29 1958 erscheint die komplette Übersetzung von WG, die 1968 und 1974 zwei Auflagen sowie 1980 einen Nachdruck als Taschenbuch erfahren. 27
Das Werk Max Webers in der Wissenschaft
425
Deutschlands, das sich mit dem Verrat der eigenen Kulturtradition von der liberalen europäischen Zivilisation entfernt hatte. Für ihn war das Schicksal Webers mit dem Deutschlands untrennbar verbunden, er sah Weber als Opfer der politischen Zustände. In den protestantischen Kreisen war das Interesse für Weber hauptsächlich auf die These der Beziehung zwischen protestantischer Ethik und dem Geist des Kapitalimus gerichtet. Diese These wurde jedoch meist idealistisch angewendet, u. a. auch um die größere Modernität des Protestantismus im Vergleich zur katholischen Ethik, die von antikapitalistischen Motiven durchsetzt sei, zu beweisen. Alle anderen Aspekte des historisch-soziologischen Werks von Weber blieben fast unbekannt. Auch der Versuch Roberto Michels 30 , die Theorie der Herrschaftstypen und besonders der charismatischen Herrschaft darzustellen, blieb trotz der nicht zu bezweifelnden politischen Aktualität des Themas ohne großen Widerhall. Im ganzen ist zu bemerken, daß in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen die italienische Kultur kein echtes Interesse für die wichtigsten Schriften Webers zeigte. Noch weniger kann man von einer Kenntnis dieser Schriften sprechen: weder die methodologischen Schriften noch WG und auch nicht die Aufsätze zur PE waren bekannt. Das war kein Zufall. Der italienischen Philosophie, die vom Positivismus des 19. Jahrhunderts zum Idealismus Hegelscher Prägung von Croce und Gentile übergegangen war, blieben die erkenntnistheoretischen Perspektiven immer fremd. Deshalb konnte sie eine Methodenlehre wie die von Weber, welche auf der Basis von Rickertschen Begriffen aufgebaut war, weder verstehen noch annehmen. Vor allem aber belastete in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen die Verurteilung der Soziologie, d. h. die Verneinung der Soziologie auch in der Form einer empirischen Gesellschaftswissenschaft die Rezeption Webers von Seiten der italienischen Kultur. Noch 1948 warf Croce Weber vor, „die logische Konstruktion einer Soziologie" versucht zu haben, ohne in Betracht zu ziehen, daß sie „eine Pseudowissenschaft war, die auf nicht philosophische Weise philosophische Probleme lösen wollte" 31 . bb) Die neue philosophische Situation und die Rückkehr zur Soziologie Nach dem Zweiten Weltkrieg machten einerseits eine andere philosophische Tradition, andererseits das erneuerte Interesse für die Soziologie die Rezeption Webers in der italienischen Kultur möglich. Die italienische Philosophie betrachtete das ausländische Denken nun mit neuen Augen, vor allem die philosophischen Richtungen, die sich in den vorherigen Jahrzehnten entwickelt hatten und die ihr in 30 Vgl. zunächst den Artikel zum Tode Webers in Nuova antologia 55 (1920) S. 355 ff., und dann die Einführung zu Politica ed economia (1934), deren § 2 den Werken Webers gewidmet ist. 31 B. Croce, Besprechung zu II lavoro intellektuale come professione, in: Terze pagine sparse, Bd. 1 S. 132.
426
Marcus Jaroschek
der Zeit der Vorherrschaft des Idealismus fremd geblieben waren. Im Falle des Weberschen Werks interessierte man sich nun besonders für die methodologischen Aufsätze. In Weber sah man vor allem eine Alternative zur idealistischen Geschichtsauffassung, die Möglichkeit, eine von den Voraussetzungen der positivistischen Soziologie losgelöste Gesellschaftswissenschaft zu begründen, die sich damit der Kritik Croces entziehen konnte. Entgegen der früheren Meinung, daß der Übergang vom Historizismus zur Soziologie eher rückläufig war und eine Degenerationserscheinung (gemessen an der Tradition des deutschen Idealismus) darstellte, wurde er nun als positiver Prozeß betrachtet. Unbestritten ist, daß das Interesse dieser Zeit an Weber, wie es sich im kulturellen Klima der „neuen Aufklärung" entwickelt hat, vor allem ein philosophisches war; daher rührten auch die einseitigen Interpretationen des Weberschen Werks. Diese wurde aber bald durch das erneute Interesse für die Soziologie korrigiert. In soziologischer Hinsicht handelte es sich um ein Interesse, das durch die Darlegungen vermittelt wurde, die Talcott Parsons 1937 in ,The Structure of Social Action4 gegeben hatte, einem bereits 1962 ins Italienische übersetzten Buch. Die neue Generation italienischer Soziologen, die in der unmittelbaren Nachkriegszeit ohne Lehrer und auch ohne konkrete italienische soziologische Tradition herangewachsen war, wandte sich vor allem zur amerikanischen Soziologie hin, besonders zu Werken von Parsons, Merton und Lazarsfeld. Dies geschah, weil sie das Bedürfnis hatten, die theoretischen Instrumente für die empirische Forschung, für die Untersuchung einer Gesellschaft zu finden, die - wie damals die italienische - in schneller Wandlung von einer noch vorwiegenden Agrarstruktur zur industriellen Struktur begriffen war 32 . Auf diese Weise wurde das soziologische Werk Webers früher durch die Interpretation von Parsons als durch eigene Lektüre bekannt. Das erklärt, warum man bei Weber vor allem eine allgemeine soziologische Theorie gesucht hat und warum die sachlichen Themen der Weberschen Analyse - vor allem das Thema der Rationalisierung - so lange vernachlässigt worden sind. Welchen Einfluß Weber auf die Entwicklung der italienischen Soziologie gehabt hat, ist schwer zu sagen. Sicher hat diese nie einen „Weberianismus" gekannt, obwohl dies manchmal behauptet wurde; sie hat auch keine bedeutenden Weberstudien hervorgebracht, die man mit denen in Deutschland oder in der angelsächsischen Welt vergleichen könnte. Erst im Juni 1980, auf der römischen Tagung „Max Weber sechzig Jahre später", wurden die italienischen Soziologen zu einer gemeinsamen Überlegung über das Webersche Werk aufgerufen; aber auch bei dieser Gelegenheit war ihr Beitrag im Ganzen gesehen zweitrangig im Vergleich zu dem von Gelehrten anderer Disziplinen. In der Zwischenzeit war die Gegenüberstellung zwischen Weber und dem Idealismus durch die zwischen Weber und dem Marxismus abgelöst worden, einem 32 Die Berufung auf die amerikanische Soziologie ist kein rein italienisches Problem. Derartige Parallelen sind auch in Deutschland, Frankreich oder in dem noch zu erörternden Japan erkennbar.
Das Werk Max Webers in der Wissenschaft
427
Marxismus, der auch bedingt durch die Studentenrevolten im Jahre 1968 häufig durch die Interpretation der Frankfurter Schule vermittelt wurde. cc) Die marxistische Kritik
und ihr Verfall
Ähnlich wie in England wurde auch in Italien versucht, mit Hilfe der marxistischen Ideen die Soziologie und damit auch das Gedankengebilde Webers zu widerlegen. Philosophen wie Antonio Banfi warfen der Soziologie einen „abstrakten Empirizismus" vor, die einen „radikalen Konservatismus deckt, der sich als Reformismus ausgibt." Seiner Ansicht nach besaß der Marxismus den Vorteil, eine „organische Gesellschaftstheorie" zu bieten, die fähig war, „die Richtung des dynamischen Prozesses der Sozialstruktur aufzuzeigen." 33 Der italienische Marxismus neigte auf diese Weise dazu, in neuer Form die traditionellen Einwände des Idealismus gegen die Möglichkeit der Soziologie als Wissenschaft wieder hervorzubringen. Dies erklärt, warum er so lange gezögert hat, sich mit Weber zu beschäftigen, und auch, warum, als er es schließlich tat, seine Hauptabsicht darin bestand, den historischen Materialismus gegen die Webersche Kritik zu verteidigen und im Zweifel die Überlegenheit von Marx über Weber zu beweisen. In der zweiten Hälfte der 60er Jahre, als die italienische Kultur einige grundlegende Instrumente für die Kenntnis des Weberschen Werks besaß, stellte sich der Rezeption Webers die Verbreitung der Texte und Ideen von Adorno, Horkheimer und Marcuse entgegen. Das von Marcuse erarbeitete Referat 34 wurde sehr schnell zur Grundlage einer kritischen Stellungnahme zu Weber. Die dort von ihm vorgenommene Reduktion der formalen Rationalität Webers auf die kapitalistische Rationalität, eine Verkleidung und Rechtfertigung der etablierten Herrschaft, wurde als Interpretationsmaßstab Webers und seiner Sicht vom okzidentalen Rationalisierungsprozeß angenommen. In der umfangreichen Literatur, die sich auf diesen Maßstab beruft, tritt die Analyse des Weberschen Werks zugunsten des Vergleichs zwischen Weber und Marx, aber auch zwischen Weber und Marcuse oder Habermaß, bisweilen auch Nietzsche zurück 35 . Gegen Ende der 70er Jahre erschöpfte sich diese Interpretationsrichtung rasch. Die Krise des Marxismus, vor allem in ihrer Frankfurter Fassung, nahm dem Versuch, Marx zu einer „Widerlegung" von Weber zu benutzen, jegliche Aktualität; der Vergleich der beiden Autoren hatte nicht mehr die Form einer Gegenüberstellung. Der Anspruch, die Untersuchung sozialer Prozesse in eine allgemeine Geschichtsauffassung einzuordnen, bestand nicht mehr. Die von Weber formulierten Perspektiven stellen sich in dieser neuen Lage als eine alternative (und ergänzende) Möglichkeit zu einer Analyse der Sozialprozesse dar, die ausschließlich auf der Grundlage der Klassenverhältnisse durchgeführt wird. 33
A. Banfi , Il problema Sociologico, in: Filosofa e sociologica, S. 51 ff. Mit dem Titel,Industrie und Kapitalismus', gehalten auf dem Heidelberger Kongreß im Jahre 1964. 35 Nachweise bei Rossi aaO (Fußn. 27), in Fußn. 57. 34
428
Marcus Jaroschek
c) Weiterentwicklung In dem erneuten Interesse der italienischen Kultur für Weber zeigt sich in der letzten Zeit eine deutliche Akzentverschiebung. Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht nicht länger die Methodologie der Geschichts- und Sozialwissenschaften oder die soziologische Theorie, die im Parsonschen Sinne als ein systematisches Ganzes von Idealtypen verstanden wurde. Im Mittelpunkt steht eher die Interpretation des Rationalisierungsprozesses des Okzidents, der Vergleich zwischen den spezifischen Rationalitätsformen, die sich in der modernen westlichen Welt behauptet haben und andere Formen der Kultur und der sozialen Organisation. Das Thema der Rationalität ist Gegenstand ausführlicher Untersuchungen gewesen36; dies erklärt auch, daß das am häufigsten studierte Werk Webers nicht etwa die methodologischen Aufsätze oder WG ist, sondern vielmehr die Religionssoziologie, deren vollständige Übersetzung das wichtigste Ereignis in der jüngeren WeberRezeption Italiens darstellt. Neben dem Thema der Rationalität und der Rationalisierung ist Weber als Historiker der antiken Welt in den Vordergrund getreten, d. h. es ist ein seit Beginn des Jahrhunderts bekannter Aspekt des Werkes, der erst jetzt in ein Gesamtbild eingeordnet wird, aufgegriffen worden. Auch zeigen sich Perspektiven der Weberschen Interpretation in der Orientalistik, besonders in der Indiologie. Aufmerksamkeit wendet sich schließlich auch der Rechtssoziologie zu, die schon Mitte der 70er Jahre untersucht worden und Gegenstand ausführlicher Debatten und Seminare war. Als dringendste und spannendste Aufgabe wird es angesehen37, Zusammenhänge herzustellen und zu erläutern zwischen dem oftmals wechselnden und in sich widersprüchlichen Umgang mit Webers Werk („aneignende" und „abwehrende" Strategien) und den jeweils herrschenden gesellschaftlichen Denkrichtungen. Zu dieser Fragestellung ist bereits eine Vielzahl von Ansätzen erarbeitet worden 38 . Es läßt hoffen, daß dieses für die italienische Weber-Rezeption bestimmende und hemmend wirkende Thema bald wissenschaftlich aufgearbeitet sein wird.
3. Polen a) Aneignung und Übertragung Im Gegensatz zu Max Weber waren andere Klassiker der Soziologie in Polen relativ früh bekannt. Das hat mehrere Gründe. Zum einen haben die polnischen Intellektuellen bis zur Widergewinnung der Unabhängigkeit Polens im Jahre 1918 36
Statt vieler m. w. N.: G. Duso, Vom Historismus zur historischen Sozial Wissenschaft,
1987. 37
G. Cappai, Modernisierung, Wissenschaft, Demokratie - Untersuchungen zur italienischen Rezeption des Werkes von Max Weber, 1994, S. 120 ff. 38 Vgl. nur die Übersicht bei Cappai passim (Fußn. 37) in Fußn. 337.
Das Werk Max Webers in der Wissenschaft
429
eher zur Entwicklung der Sozialwissenschaften in anderen Ländern beigetragen. Zum anderen hat sich die Soziologie als wissenschaftliche Disziplin schon sehr früh in Polen etabliert 39. Im Gegensatz dazu hat die Rezeption des Durckheimschen Werkes bereits sehr früh begonnen. Hauptprotagonist war hier vor allem Stefan Czarnowski, der in seinem Hauptwerk 40 den Denkstil Dürkheims fortsetzte. Sein Hauptarbeitsgebiet war die Religionssoziologie; es existiert allerdings kein Hinweis, daß er Webers Schriften je begegnet wäre. Ebenso kannte Ludwig Krzywicki, der vor dem Ersten Weltkrieg in der polnischen Soziologie den akademischen Marxismus vertreten und sich mit Themen befaßt hat, die auch im Interessensgebiet von Weber lagen 41 , dessen Werke nicht. Der dritte und wohl einflußreichste Klassiker der polnischen Soziologie, Florian Znaniecki, bezog sich in seinem Früh werk sehr stark auf die deutsche Tradition und war durchaus mit den damals modernen Autoren vertraut. In seiner Doktorarbeit (1907) setzte er sich mit der Wertphilosophie auseinander. Znaniecki bezieht sich dort auf Autoren, wie ζ. B. Nietzsche, Simmel, Münsterberg oder Rickert, die auch Weber in seiner Wissenschaftslehre zitiert hatte. In dieser Arbeit verwendete er zur Abgrenzung seiner „praktischen Realität" für den Bereich der Kulturwissenschaften Schlüsselbegriffe, wie „Wert" und „Handlung". Die Ähnlichkeiten mit Weber fallen ins Auge. Auch der Stil seiner frühen, noch vor der amerikanischen Periode verfaßten Arbeiten erinnern an jenen, der für Webers Aufsätze zur Wissenschaftslehre charakteristisch sind. Dennoch hat er ihn auch später kaum erwähnt. Natürlich bedeutet eine späte Rezeption nicht, daß das Webersche Werk in Polen völlig unbekannt war. Als erstes Zeichen für die Wirkung Webers in Polen kann ein Brief gesehen werden, den er selbst in seinem Aufsatz ,Deutschland unter den Weltmächten' erwähnt, in dem es unter anderem heißt: „Ich galt für einen Polenfeind. Ich verwahre noch einen mit Namen unterzeichneten Brief aus Lemberg von vor 20 Jahren, der das Bedauern aussprach, daß mein Urahne nicht von einem mongolischen Schwein gefressen sei - davor hätten mich die Polen bewahrt und nun bewähre ich mich schlecht"42. Dieser Auszug verdeutlicht, daß Weber in der „Polenfrage" nicht sonderlich milde Ansichten vertreten hatte; dieses in jenem Brief verwandte Argument ist in Polen bis heute lebendig. In den seit 1930 herausgegebenen Heften der Soziologischen Rundschau, in welcher der deutschen Soziologie überhaupt sehr viel Aufmerksamkeit gewidmet wurde und wird, finden sich relativ häufig Verweise auf Weber. Diese zeigen, daß die polnischen Soziologen 39 Bereits 1920 wurde das erste Institut für Soziologie in Posen eingerichtet, also der Stadt, in der Weber einen Teil seines Wehrdienstes ableistete. 40 Le culte des héros et ses conditions sociales, Saint Patrie, héros national de l'Irlande (1919) in: Besnard (Hrsg.), The Sociological Domain. The Durkheimians and the Founding of French Sociology, Cambridge / Paris 1983. 41 Wie etwa die Entwicklung des Kapitalismus. 42 M. Weber, Gesammelte politische Schriften, Tübingen 1971, S. 173.
430
Marcus Jaroschek
sich der Bedeutung Webers für die deutsche Soziologie wie auch allgemein seiner Position als Klassiker der Soziologie durchaus bewußt waren. Es mangelte aber an einer umfassenden Besprechung und kritischen Auseinandersetzung mit seinen Ideen und damit zwangsläufig auch an deren produktiver Fortsetzung. Eine Ausnahme in den 30er Jahren bildete Alexander Hertz. In drei seiner Aufsätze 43 zeigt er eine gründliche Kenntnis des Weberschen Werkes, insbesondere seiner Herrschaftssoziologie. Er wendet die Weberschen Kategorien und Ideen, wie beispielsweise Charisma, Parteibürokratie, Honoratioren, plebiszitäre Demokratie, usw. auf die zeitgenössischen Phänomene in der Politik an und analysiert mit deren Hilfe die faschistische wie auch die bolschewistische Bewegung. Diese wohl ersten Versuche der Analyse des modernen Totalitarismus mit Weberschen Kategorien, die Hertz im amerikanischen Exil geschrieben hat, wurden, wie auch seine späteren Werke, in Polen totgeschwiegen, und zwar bis auf den heutigen Tag. Nach dem Zweiten Weltkrieg befand sich die polnische Soziologie in einer ähnlichen Situation wie die deutsche in den Jahren 1933-1945, der sog. „Barbarei". Aus diesem Grunde wurde das Werk Webers erst nach 1956 wieder stärker rezipiert. Die ersten Anregungen für eine nicht nur historische Aufnahme des Werkes kamen aus Amerika. Diese Rezeption war allerdings sehr selektiv. Das Interesse konzentrierte sich vor allem auf Webers Stratifikationstheorie, oder besser auf das, was damals als solche gegolten hatte. Darüberhinaus hat man sich in den Diskussionen über das Verstehen, die man im Rahmen des allgemeinen methodologischen Streites um den wissenschaftlichen Status der Soziologie führte, auf Webers Autorität berufen. Diese Rezeption spiegelt die Situation in der damaligen polnischen Soziologie wider, die von zwei Strömungen beherrscht wurde. Einerseits von der marxistischen Tradition, die im Laufe der Zeit immer offener und weniger engstirnig wurde - hier bestand das Hauptthema, in dessen Rahmen auch von Weber die Rede war, in der nach und nach unorthodoxer und interessanter gestalteten Auffassung marxistischer Klassen. Auch kam sie von der Schichtentheorie her und ihrem Vergleich mit anderen theoretischen Ansätzen. Andererseits von der empirisch orientierten Soziologie, die nicht nur an die amerikanische Soziologie jener Jahre, sondern auch an die polnische Tradition der Lemberg-Warschauer Schule anknüpfte - hier wurde Weber innerhalb der mehrfach wiederaufgenommenen „Verstehens"-Kontroverse diskutiert. Überdies kam Weber natürlich immer im Zusammenhang mit der Problematik der Bürokratisierung, wie auch der Wertfreiheit, ins Gespräch. Im allgemeinen läßt sich sagen, daß Weber als „antisystematischer" Denker, als „Empiriker" und „Kritiker der Weltanschauungssoziologie" gegolten hat, wobei 43
Militarisierung des politischen Vereins, 1936; Die Mission des Führers, 1936 und Die Gefolgschaft des Führers, 1937.
Das Werk Max Webers in der Wissenschaft
431
sein Gedanke, daß Soziologie „verstehend" zu sein habe, als merkwürdige Laune verstanden wurde. Über seine Rationalisierungsthese und über die systematische Einheit seines Werkes wußte man damals wenig. Keine Schrift von Weber war im übrigen in polnischer Sprache zugänglich (außer ein paar Fragmenten und wenigen maschinenschriftlichen Übersetzungen, die für Soziologie-Studenten gedacht waren). Zwar wurde immer von der Notwendigkeit der Übersetzung von Weber ins Polnische gesprochen, doch scheiterte das Vorhaben mehrere Male an der Tatsache, daß die meisten polnischen Soziologen dieser Generation des Deutschen nicht mächtig waren. Nebenbei mangelte es auch an Büchern, die sich speziell mit Webers Denken befaßt hätten. Das erste erwähnenswerte war eine Schrift von Stanislaw Kozyr-Kowalski 44 . Sie erschien 1967 und hatte einen Vergleich der Gesellschaftstheorien von Marx und Weber zum Thema. Ihm folgten vom selben Autor u. a. die Abhandlung „Klassen und Stände". Max Weber und gegenwärtige Theorien der sozialen Schichtung (1979), und ein umfangreiches Nachwort zum 1975 in polnischer Sprache erschienenen Buch von Reinhard Bendix, ,Max Weber, Das Werk. Darstellung, Analyse, Ergebnis4. Seit Anfang der 80er Jahre kann man in Polen fast von einer „Weber-Mode", gerade unter der jungen Generation polnischer Soziologen sprechen. Die Ursachen für dieses Interesse sind neben dem Interesse, das vor allem durch neuere Interpretationen von Habermas und Schluchter geschürt wurde, auch tiefer in der Situation, einer Art Krisensituation, der polnischen Soziologie der Gegenwart zu suchen und zu finden. Für diese Situation charakteristisch ist, daß die zwei theoretischen Richtungen, die seit Kriegsende die Szene der polnischen Soziologie beherrschten, ihren Schwung verloren haben - sowohl die Linie, die sich weitgehend als Marxismus interpretieren ließ, als auch die akademische „neopositivistische" Soziologie, die den Empirizismus mit einer Art liberal-sozialistischer Einstellung verband. Die Zeiten von „Solidarnosc" waren nicht leicht für die polnische Soziologie, ihre inneren Schwächen wurden sichtbar. Es zeigte sich, daß sie im großen und ganzen eben nicht das erforscht hatte, was die Dynamik des Lebens dieser Gesellschaft bestimmte, und daß sie auch ihren Vertretern keine intellektuellen Mittel an die Hand gegeben hatte, um auf diese Dynamik Einfluß zu nehmen. Jetzt sucht die polnische Soziologie nach neuen Fragestellungen und neuen Paradigmen. Weber erscheint hier als besonders attraktiv, da er - anders als Marx sich mit Fragen beschäftigte, die in Polen eine nie zuvor dagewesene Aktualität besitzen. b) Weiterentwicklung Es gibt verschiedene Richtungen, in denen sich die Arbeit mit Webers Werk vollzieht. Vermehrt wird Webers Beitrag zur Philosophie der Sozialwissenschaften 44
Stanislaw Kozyr-Kowalski, Max Weber und Karl Marx. Die Soziologie Max Webers als positive Kritik des historischen Materialismus (dt. Übersetzung des Titels), 1967.
432
Marcus Jaroschek
und den Konsequenzen, die sich aus seinem Werk für Bestimmung und Selbstverständnis der Soziologie ergeben, Interesse entgegen gebracht. Eine Tendenz besteht dabei darin, Webers Gedanken an die klassische akademische Methodologie der Sozialwissenschaften, die in Polen auf sehr hohem Niveau betrieben wird, zu assimilieren. Als Beispiel sei hier Milowit Kuninskis Buch ,Modellhaftes Denken in Max Webers Soziologie' (1980) genannt, in welchem der Autor sich mit dem Konzept des Idealtyps befaßt, verschiedene Auffassungen vom Typus und seiner erklärenden Rolle in den Sozialwissenschaften analysiert und die Existenz von Übereinstimmungen zwischen Webers methodologischen Konzepten und seinen materiellen Analysen nachweist. Sehr stark ist auch das Interesse an Webers Religionssoziologie. Dies überrascht nicht, angesichts der großen Rolle, die Religion und Kirche in den letzten Jahren in Polen gespielt haben und immer noch spielen. So ist es auch kein Zufall, daß der erste Weber-Sammelband in polnischer Sprache die wichtigsten Schriften zur Relgionssoziologie enthält. Unter den Aufgaben, die man sich jetzt oft in der polnischen Soziologie stellt, finden sich die Fragen nach dem Einfluß des religiösen Glaubens auf das Verhalten in verschiedenen Bereichen des sozialen Lebens, nach der Evolution der Typen der Religiosität, nach den Ursachen der religiösen Erneuerung in Polen und der Säkularisierung als allgemeiner Tendenz, usw. Etwas überraschend mag die Tatsache sein, daß sich das Interesse an Weber in Polen zuweilen sehr stark auf sein politisches Denken konzentriert, da dieser Teil seines Werkes ja als am meisten veraltet gegolten hat. Das Interesse ist nicht nur auf Themen wie die Legitimation der politischen Herrschaft beschränkt, obwohl dieses momentan sehr in der Diskussion steht. Sehr oft wird von einer Legitimationskrise in Polen gesprochen; dabei bezieht man sich auf Webers Theorie und Typologie der legitimen Herrschaft und hierbei nicht nur auf Webers Soziologie der politischen Herrschaft, sondern auch auf seine Schriften zur Politik selbst45. Insofern läßt sich zusammenfassend sagen, daß die heutige polnische Soziologie sich viel mehr als früher der Einheit des Werkes von Max Weber bewußt ist. Bemühungen, wie einige Dissertationen speziell über Webers Konzepte und Übersetzungen seiner Schriften lassen hoffen, daß dieses Bewußtsein die internationale Weber-Forschung voranbringen wird.
III. Die Weber-Rezeption in den USA Die amerikanische und deutsche Soziologie standen seit jeher in einem Verhältnis von wechselseitigem Nutzen und wissenschaftlichem Austausch. Als sicher kann gelten, daß die Übersetzungs- und Editionstätigkeit in den USA Vorausset45
Beispielsweise M. Orzechowski, Politik, Macht, Herrschaft in der Theorie von Max Weber, 1984.
Das Werk Max Webers in der Wissenschaft
433
zung und Motor einschlagender Weber-Interpretationen gewesen ist, die der westlichen Soziologie wertvolle Impulse gab, wegen ihres selektiven Charakters (nicht zuletzt verursacht durch große Sprachschwierigkeiten bei der Übersetzungstätigkeit) erhebliche MißVerständnisse und weitreichende Konfusion hervorrief. Darauf wird im folgenden 46 noch einzugehen sein. 7. Aneignung 47 Ungeachtet der Verständnisschwierigkeiten bei den Editoren, die von mangelnder Kenntnis der deutschen Sprache herrührten, war die Übersetzungstätigkeit enorm. Die erste größere Übersetzung eines Werkes von Weber ist die nach seinem Tode von Schülern zusammengestellte Wirtschaftsgeschichte, ,General Economic History', übersetzt von Frank Knight 1927, erschien im selben Jahr auch in Amerika. ,The Protestant Ethic', übersetzt von Talcott Parsons (1930) wurde im selben Jahr auch in Amerika herausgegeben und ist später (1948, 1953 und 1958) jeweils als Neudruck erschienen. Sehr wichtig für die empirische Forschung wurde die 1946 herausgegebene Textsammlung zur Einführung in die Arbeit Webers von Gerth und Mills. Der erste Band von WG wurde 1947 von Parsons herausgebracht. In den Jahren 1950-58 erschien der größte Teil der Religionssoziologie übersetzt von Hans Gerth und mitherausgegeben von D. Martindale. 1958 wurden die Abschnitte über die Stadt und die rationalen und soziologischen Grundlagen der Musik veröffentlicht. Auffallend ist, daß in Europa und Amerika bis 1945 außer der ProtestantismusStudie48 keine anderen religionssoziologischen Arbeiten Webers übersetzt waren; WG erschien zuerst 1944 in spanischer Übersetzung in Mexico; erst im Jahre 1968 besorgten Günther Roth und Claus Wittich eine Gesamtausgabe dieses Werks.
2. Übertragung a) Religionssoziologie Webers Studie über die PE regte zu einer außerordentlich großen Zahl von Stellungnahmen und Untersuchungen an. Schon vor Parsons' Übersetzung von 1930 wurde sie lebhaft von Wirtschaftshistorikern diskutiert, die an der Gültigkeit seiner spezifischen These und der allgemeinen Beziehung zwischen Religion und Wirt46 Unter Punkt III. 3. 47 Die Weber-Rezeption verlief in verschiedenen Phasen außerordentlich vielgestaltig ab, da sie von einer großen Zahl von Autoren aus verschiedensten Richtungen der Soziologie sowie vielen NichtSoziologen getragen wurde. Vgl. dazu ausführlich A. Erdelyi, Max Weber in Amerika, 1992. 48 Die 1923 in ungarischer, 1930 in englischer und 1945 in italienischer Übersetzung erschien. 28 Gedächtnisschrift Wenz
434
Marcus Jaroschek
schaft interessiert waren. Die soziologische Forschung ging von Anfang an über dieses begrenzte Interesse hinaus, weil sie an den Wechselbeziehungen zwischen kulturellen und materiellen Faktoren interessiert war. Die PE übte einen besonders großen Einfluß auf die Religionssoziologie aus, während die in den 50er Jahren erschienenen anderen Teile der Weberschen Religionssoziologie wegen der inhärenten Schwierigkeiten empirisch kaum verwandt worden sind. Unter Webers Einfluß spürten Soziologen der Reichweite des Einflusses von Calvinismus, Puritanismus, Pietismus und anderen Konfessionen auf verschiedene Gesellschaftsbereiche nach 49 . Neben den historischen suchten Studien gegenwärtiger Verhältnisse mit den Methoden der modernen Sozialforschung nach den Nachwirkungen der protestantischen Ethik in verschiedenen Ländern und Sekten und nach etwaigen heutigen Zusammenhängen zwischen ihr und sozialer Mobilität 50 . Größere Aufmerksamkeit ist den Organisationsformen religiöser Gruppen gewidmet worden. Die Forschung war hier besonders an dem Wechsel Verhältnis von religiöser Organisation und politischer, sozialer und wirtschaftlicher Umwelt interessiert, wie es sich vor allem im Laufe von Industrialisierung und Verstädterung entwickelt hat. Hier ist Webers Unterscheidung von Kirche und Sekte wichtig geworden und in zahlreichen Untersuchungen ausgearbeitet worden: Kirchen suchen sich im allgemeinen an die Gesellschaft und ihre Wandlungen anzupassen und können dabei zu bloßen Macht- und Interessengruppen werden; Sekten sondern sich von ihr ab. Während Weber sich mit dem positiven Einfluß der Sektenmitgliedschaft auf wirtschaftliche Motivierung und geschäftlichen Erfolg befaßte, haben andere Studien etwa untersucht, auf welche Weise Verstädterung und sozialer Aufstieg Sekten in Kirchen verwandeln und neue Sekten als Protestreaktion sich von ihnen abspalten51. Im Zusammenhang mit dem stark gewachsenen allgemeinen Interesse an Problemen komplexer Organisationen und der Bürokratisierung sind Ende der 50er Jahre auch Kirchen als bürokratische Einrichtungen studiert worden. Diese Untersuchungen erstreckten sich von der sozialen Zusammensetzung der Mitgliedschaft und ihrem Rekrutierungsfeld bis zum Problem des Pfarrers als Verwaltungsbeamten und Akademikers, d. h. zum Problem der sog. Professionalisierung. b) Bürokratie Das Interesse in der soziologischen Literatur Amerikas an Webers Behandlung der Bürokratie besteht erst seit Ende des Zweiten Weltkrieges. In den amerikanischen Staatswissenschaften ist das Interesse an einer Verwaltungswissenschaft hin49 Merton , Science, Technology and Society in Seventeenth Century England, in: Osiris IV 1938, §§ 60 ff. 50 So etwa C. T. Jonassen, The Protestantic Ethic and the Spirit of Capitalism in Norway, in: American Sociological Review XII, S. 676 ff. 51 So etwa Β. Wilson, An Analyis of Sect Development, in: American Sociological Review XXIV, S. 3 ff.
Das Werk Max Webers in der Wissenschaft
435
gegen älter; von frühen Ansätzen abgesehen kann man von einer mehr soziologisch orientierten verwaltungswissenschaftlichen Forschung etwa seit der Weltwirtschaftskrise und dem New Deal der 30er Jahre sprechen. Webers Werk gewann auf diesem Gebiet Einfluß, als VerwaltungsWissenschaftler und industrielle Sozialpsychologen sich bewußt wurden, daß die von ihnen mehr oder weniger isoliert behandelten Probleme viele Berührungspunkte hatten. Auch verlangten die schwierigen organisatorischen Probleme des Zweiten Weltkrieges und des von da an bedeutend intensivierten Kontaktes der Weltmacht USA mit hochindustrialisierten sowie kaum entwickelten Ländern eine intensive Beschäftigung mit dem Problem der Bürokratie. Webers großer Einfluß beruht in erheblichem Maße auf der klaren Formulierung seines Idealtyps der Bürokratie. Da die meisten Studien der Bürokratie der internen Organisation galten, wurde Webers formale Analyse sehr häufig als Ausgangs- oder Kontrastpunkt verwendet. Sie wurde besonders für die Untersuchung des wechselseitigen Verhältnisses von formalen und informellen Beziehungen und Regeln benutzt. Unter dem Einfluß des Funktionalismus wurde Webers Idealtyp oft mit den manifesten Funktionen und Strukturen gleichgesetzt und mit den latenten kontrastiert. Auf diese Weise arbeitete man die einer Bürokratie innewohnenden gegensätzlichen Erfordernisse und Vorschriften heraus, welche unter anderem die Leistungsfähigkeit des Personals beeinträchtigen und zu Konflikten mit dem Publikum oder den Kunden führen 52. Webers Einfluß findet sich auch im Problembereich der typischen beruflichen und anderweitigen Befähigung und Disqualifikation des bürokratischen Personals. Er glaubte, daß nur die charismatischen Kräfte des politischen und wirtschaftlichen Lebens die Bürokratisierung durchbrechen könnten, und betrachtete etwa erfolgreiche Unternehmer als charismatische Persönlichkeiten. Webers Interessen wurden an der Harvard-Universität von Schumpeter vermittelt, für den die auf Neuerungen gerichtete Unternehmerinitiative für die Überwindung von Krisen historisch zentrale Bedeutung hatte und der die Absorbierung der Unternehmerfunktion durch die Bürokratie der Großbetriebe mit Besorgnis verfolgte. In der Betriebssoziologie sind die inhärenten Tendenzen zu größerer Bürokratisierung bei einem Personalwechsel in der Betriebsleitung mit Hilfe des säkularisierten Begriffs des Charisma und seiner Veralltäglichung untersucht worden. Dabei wurden die situationsgegebenen Spannungen beobachtet, die eine neue Betriebsleitung zu größerer Bürokratisierung drängten, wenn sie die alten informellen Verfahrensweisen und Kommunikationswege, die sich unter einem charismatischen Unternehmer entwickelten, nicht für sich verwenden kann. Dieselbe Studie verband auch die Perspektive der „human-relations"-Studien mit Webers Interesse an der Legitimität der Bürokratie und leitete aus seiner Analyse der legalen Herrschaft zwei Typen der Bürokratie ab, die in dieser Betrachtung seinem Werk impli52
Etwa R. Turner, The Navy Dibursing Officer as a Bureaucrat, in: Merton (Ed.), Reader in Bureaucracy III, S. 372 ff. 28=
436
Marcus Jaroschek
ziert erscheinen: einer repräsentativen und auf gegenseitiger Übereinstimmung und einer auf Zwang und Maßregelung beruhenden Bürokratie. Eines der Hauptprobleme der allgemeinen Bürokratie ist die Grundlage ihrer wirklichen und potentiellen Macht. Diese Macht ist zu einem erheblichen Maße abhängig von der sozialen und ideologischen Homogenität einer Bürokratie und dem Charakter des politischen Systems. Weber hatte eine sehr kritische Stellung gegenüber dem Standesbewußtsein, den sozialen Auswahlkriterien und dem politischen Machtdrang der verhältnismäßig homogenen preußischen Bürokratie eingenommen, die in einem Mißverhältnis zu ihrem eigenen Ideal der Unparteilichkeit standen. Eine mittelbar die höheren amerikanischen Bundesbeamten mit den preußischen und anderen europäischen Beamten vergleichende Studie fand, daß die amerikanischen Beamten ihrer sozialen Herkunft und ihrer Ideologie nach keine starken Tendenzen zeigen, sich zu einer homogenen und geschlossenen Gruppe zu entwickeln 53 . Wegen der Gewaltenteilung sind die Beamten jedoch unabhängiger als die europäischen, aber sie verwenden ihre Unabhängigkeit nicht zur Vorbereitung einer „Revolution der Manager", sondern für eine vermittelnde Rolle zwischen den verschiedenen Macht- und Interessengruppen 54.
c) Soziale Schichtung Eine kurze Bemerkung mag hier über Webers Einfluß auf dem Gebiet der sozialen Klassen und sozialen Schichtung angeführt werden. Webers Klassen- und Standesanalyse ist viel weniger ausgeführt als die der Bürokratie. Seine fragmentarische Analyse unterstützte jedoch eine mehrdimensionale Auffassung der sozialen Schichtung gegenüber einer eindimensionalen wie etwa der marxistischen, welche die Unterschiede zwischen sozialen Klassen und Ständen verwischt. Webers Betrachtungsweise ist im Titel des Sammelbandes über soziale Schichtung ,Class, Status and Power' 55 reflektiert, der einige der besten theoretischen und empirischen Arbeiten zusammenbringt. Obwohl jedoch Weber sehr häufig und besonders für didaktische Zwecke zitiert wird, zeigt eine Prüfung des Bandes, daß sein Einfluß auf die Forschung relativ gering war. Dies ist zum einen darauf zurückzuführen, daß amerikanische Soziologen mit Webers empirischen Werken über die Beziehungen von Ständen und Weltanschauungen - in seiner Religionssoziologie und der Analyse der Herrschaftstypen - wenig vertraut waren. Obwohl die Religionssoziologie vollständig in englischer Übersetzung vorliegt, standen und stehen ihrer wissenschaftlichen Nutzung erhebliche Schwierigkeiten im Wege, da Weber sich vorwiegend mit religiösen Entwicklungen des ersten Jahrtausends vor unserer Zeit53
R. Bendix, Higher Civil Servants in American Society, 1949. Eine bis zu einem gewisen Grade umgekehrte Situation wurde im benachbarten Kanada untersucht, als eine konservative Bürokratie ihre Machtstellung erfolgreich gegen eine radikale demokratische Partei verteidigte, die damals an die Regierung kam. 55 Herausgegeben von Bendix und Lipset im Jahre 1953. 54
Das Werk Max Webers in der Wissenschaft
437
rechnung beschäftigte, während die amerikanischen Sozialwissenschaften sich auf die unmittelbare Gegenwart konzentrieren. Erst seit Ende der 70er Jahre bringen die amerikanischen Wissenschaftler der vergleichenden Behandlung historischer Materialien verstärktes Interesse entgegen. Hier ist die wissenschaftliche Entwicklung noch sehr im Fluß. d) Die vergleichende Analyse sozialer Institutionen Diese Art der wissenschaftlichen Betrachtung wird allgemein als Webers Vermächtnis angesehen56, wobei mittlerweite anerkannt ist, daß viele alte und neue Sachprobleme der Disziplin nur durch vergleichende Studien gegenwärtiger Verhältnisse und ihrer historischen Vorbedingungen behandelt werden können. Zum Kernproblem besonders der politischen Soziologie ist dabei die Beziehung zwischen den Alternativen der Industrialisierung auf der einen und Totalitarismus und Demokratisierung auf der anderen Seite geworden. Die Literatur über diese politisch und wissenschaftlich wichtigen Probleme ist noch immer im schnellen Wachsen begriffen. Der größte Teil dieser Forschung ist zumindest implizit vergleichend, obwohl nur wenige Studien unmittelbar von Webers vergleichendem Begriffssystem beeinflußt sind. Ein gutes Beispiel für eine Weber direkt verpflichtete, die Entwicklungsphasen einer Gesellschaft behandelnde Studie ist eine Untersuchung der Entstehung von Ghana, welche die alten und neuen Institutionen mit den Begriffen des Traditionalismus und der legalen Herrschaft analysierte und mit dem Begriff des Charisma die für Traditionalismus und legale Herrschaft positiven wie negativen Konsequenzen der überragenden Stellung des damaligen Premierministers 57. Diese und eine Reihe weiterer Studien58, auf deren Nennung aus Platzgründen verzichtet wird, sind natürlich nicht als ein direktes Resultat des Weberschen Werks zu verstehen. Es entspricht eher den Tatsachen, wenn man sagt, daß sich dieses neu erwachte Interesse und der wachsende Einfluß Webers zusammen entwickelt haben, vermutlich weil die weltgeschichtlichen Probleme Amerikas seit dem Zweiten Weltkrieg zu einer geistigen Neuorientierung angeregt haben.
3. Weiterentwicklung Das Hauptverdienst der amerikanischen Soziologie ist wohl in der Tatsache zu sehen, daß sie zu einer Zeit, in der sich sonst niemand (auch nicht in Deutschland) 56
G. Roth/R. Bendix, Max Webers Einfluß auf die amerikanische Soziologie, S. 48. 57 D. Apter, The Gold Coast in Transition, 1955. 58 Vgl. R. König (Hrsg.), Max Weber zum Gedächtnis, Materialien und Dokumente zu Werk und Person, 2. Aufl. 1985; ferner R. Bendix, Könige oder Volk, (dt.) 1980; Zingerle (o. Fußn. 4), S. 45 ff. m. w. N.
438
Marcus Jaroschek
mit Weber beschäftigte, Webers Werk analysiert und weitererforscht hat. Es geschah dies in zwei Gruppen: Erstens durch „eingeborene" Amerikaner, wie der wohl bedeutendste, Talcott Parsons, der 1927 über Weber in Heidelberg promoviert wurde und später einige seiner Werke ins Englische übersetzt hat 59 . Zweitens kamen in den USA neueingebürgerte z. T. deutsche Flüchtlinge dazu, wie Günther Roth, Hans Gerth und nicht zuletzt Reinhard Bendix. Sie betätigten sich nicht nur als Übersetzer, sondern auch als Interpreten der Weberschen Arbeiten. Damit war das Werk Webers in der Folge zwar in englischer Sprache zugänglich, sein Werk als komplexes Ganzes war (und ist es in Teilen wohl immer noch) unbekannt60. Das hat seinen Grund in den durch die Übersetzungstätigkeit hervorgerufenen „Mißverständnislawinen", wie sie etwa die inkompetent zu nennende Indien-Übersetzung von Gerth und Martindale hervorrief 61, oder auch die „Parsonisierung" in der amerikanischen Soziologie62. Talcott Parsons, einer der führenden Persönlichkeiten des amerikanischen Strukturfunktionalismus begründete die erste Phase der Weber-Rezeption in Amerika, in der das Interesse von Sozialwissenschaftlern, Historikern und Religionswissenschaftlern in erster Linie auf die um späteren Studien Webers 63 verkürzte Religionssoziologie beschränkt blieb. Von dieser Basis ausgehend hob Parsons später seine Weber-Interpretation auf das allgemeinere Niveau der soziologischen Handlungstheorie. Dabei verband er in ihr Elemente der Weberschen Soziologie mit Theorieelementen von Studien Durckheims, Paretos und Marshalls zu einer Systematik, die einige Zeit später auch dem Strukturfunktionalismus als Grundlage diente 64 . Dies bedeutete einen rezeptionsgeschichtlichen Durchbruch, da Weber nunmehr nicht mehr nur als Theoretiker angesehen wurde, der zu Problemkreisen wie der ,Wertfreiheit 4 oder dem Ursprung des Kapitalismus Beiträge geschrieben hatte, vielmehr begann man seine Soziologie als unentbehrliche begrifflich-theoretische Grundlage der modernen Theorie schlechthin zu sehen. Doch barg dieser Rezeptionsanstoß auch Gefahren in sich, die eine umfassende und intensive werkimmanente Erfassung Webers für viele Jahre behinderte: Parsons Umgang mit Webers Grundkategorien, die er in sein Konzept der Struktur von sozialen Handlungen einpaßte, vermischte seine Thesen mit denen Webers, was in der Folgezeit zu großen Bedenken führte, inwieweit hier wirklich noch Weber rezipiert und nicht Parsons eigene Theorie als die von Weber angesehen wurde 65 . 59
Siehe dazu oben die Ausführungen zum Abschnitt III. 1. Es ist bezeichnend für das heutige starke Interesse an ihm, daß fast 40 Jahre nach seinem Tod der erste Versuch einer umfassenden Einführung in seine konkrete Forschungsarbeit unternommen worden ist. S. R. Bendix, Max Weber, An Intellectual Portrait, 1960. 61 Vgl. dazu etwa D. Kantowsky (Hrsg.), Recent Research on Max Weber's Studies of Hinduism, München 1986. 62 Besonders in den ersten drei Nachkriegsjahrzehnten. 63 Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen, in: Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie, Bd. I, Tübingen 1920. 64 Vgl. umfassend Zingerle aaO (Fußn. 4), Teil II. 60
Das Werk Max Webers in der Wissenschaft
439
In diesen Kontext paßt auch Reinhard Bendix' 66 Deutung des Wissenschaftlers Max Weber, die zwischen Person und Werk angesiedelt war. Er wollte Webers Soziologie entschlüsseln und zugänglich machen, indem er deren Einheit zutage förderte. Dabei machte er sich von der Reduktion auf das methodische und theoretische Konzept frei und griff auf Webers sachliche Untersuchungen zurück. Er interpretierte diese dann nicht additiv, sondern ist kontinuierlich, einer alten Vermutung über das zentrale Thema der Arbeit folgend, der Grundfrage nach der Entstehung der rationalen Kultur der westlichen Welt. Diesen Erfolg konnte er jedoch nur dadurch erzielen, indem er WG und die Gesammelten Aufsätze zur Religionssoziologie auflöste und aufs neue zusammensetzte. Nach seiner Auffassung ist Weber nur zu verstehen, wenn man seine Konstruktion des Rationalisierungsprozesses begreift. Um diesen zu erklären, hat er es unternommen, diesen Prozeß aus dem Werk zu rekonstruieren. Diese Art der Interpretation war äußerst umstritten 67. Einige Wissenschaftler warfen Bendix eine Verfälschung der Ergebnisse durch Mißachtung der zeitlichen Abfolge der Arbeiten Webers vor. Dadurch, daß er versucht habe, die einzelnen Ausführungen zum Rationalisierungsprozeß aus der schier unendlichen Vielfalt soziologischer Aspekte und Einzelprobleme in Webers Aufsätzen herauszulösen, begriff er die Werke im Ganzen als fortlaufende Entschlüsselung und vertauschte an der entscheidenden Stelle die Zeitfolge und behandelte die Wirtschaftsethik vor WG, was zwar mit den Veröffentlichungsdaten, nicht aber mit den Abfassungszeiten übereinstimmt; im Ergebnis setzte er also zeitlich später abgefaßte Aspekte zur Erklärung des Vorabgeschriebenen voraus. Nichtsdestotrotz stellt diese Arbeit einen Wendepunkt in der amerikanischen Weber-Rezeption dar, weil hier Anlage und Gehalt der historischen Soziologie erstmals in überschaubarer Form einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Sie machte in der Folgezeit eine Schließung der Lücken in den amerikanischen Textausgaben erforderlich 68 und bewirkte eine Rückbindung der Soziologie an die Werkstruktur, was für einen wesentlichen Teil der Soziologie Webers eine Rehistorierung des amerikanischen Weber-Bildes bedeutete69. Im Zuge dieser Veränderungen löste sich die Weber-Interpretation allmählich von den Interpretationsprämissen des Strukturfunktionalismus („Deparsonisierung"), die bis dahin den Zugang zu seinem Werk erschwert hatten. 65 Zu den Mißverständnissen im Rahmen der einzelnen Werkteile, die den Rahmen dieser Darstellung sprengen würde, vgl. Zingerle passim (Fußn. 4), S 16 ff. und Teil III; ferner Erdelyi (Fußn. 47), Teil I. 66 Bendix (Fußn. 60). 67 Siehe etwa die kritische Erwähnung der Bendixschen Arbeit bei F. Tenbruck, Das Werk Max Webers, KZfSS 27 (1975), 670 ff. 68 Den wichtigsten Beitrag hierzu steuerten G. Roth und C. Wittich bei, die 1968 die erste Gesamtausgabe von WG herausgaben. 69
Was seine Auswirkungen freilich erst in den 70er Jahren in größerem Maßstab - auch in Deutschland - zeigte.
440
Marcus Jaroschek
Die heutige Tendenz in der amerikanischen, wie allgemein in der westlichen Soziologie, geht dahin, die Disproportionen zwischen Werkstruktur und Wirkungsgeschichte abzubauen und auf die inhaltlichen und entstehungsgeschichtlichen Zusammenhänge stärker Bezug zu nehmen70. Fraglich bleibt es allerdings weiterhin, ob diese Art des Umgangs, der im Ergebnis die einzelnen thematischen Bereiche des Werks voneinander isoliert, und so der Frage nach der Einheit des Werks seine interpretatorische Basis entzieht („Versachlichung"), eine tiefere, auf Grundlagenforschung bedachte Soziologie gefährdet und behindert.
IV. Die Weber-Rezeption in Japan 7. Aneignung Anders als in der übrigen Welt trat die Weber-Rezeption in Japan nicht mit der Verspätung ein, die in anderen Gesellschaften zu beobachten war 71 . Der Name Max Weber tauchte hier zum erstenmal im Jahre 1905 auf, und zwar in einem Tagungsbericht über die Generalversammlung des Deutschen Vereins für Sozialpolitik. Innerhalb der einzelnen Rubriken fällt auf, daß in Japan eine Fülle von biographischen Arbeiten existieren, wohingegen bibliographische Untersuchungen eher Mangelware sind; im Bereich der Methodik herrscht ein großes Interesse zu Themen, wie Wertfreiheit und Idealtypus. Eine besonders große Bedeutung messen die Japaner der Religionssoziologie Webers zu und zwar insbesondere den Aspekten Rationalisierung, Rationalität, Kapitalismus, Geist des Kapitalismus und auch die Auseinandersetzung mit dem historischen Materialismus. Insgesamt ist zu sagen, daß die Beschäftigung mit den methodologischen und grundlagentheoretischen Arbeiten Webers gegenüber den genannten Schwerpunkten deutlich abfällt. Am Übersetzungprozeß Weberscher Werke fällt auf, daß seine eher methodologischen und allgemein-soziologischen Arbeiten in den 30er Jahren, seine Studien zur politischen Soziologie in den frühen 50er Jahren und seine Religionssoziologie in den 60er und 70er Jahren ins Japanische übertragen worden sind. Dies ergibt einen ersten Umriß des Ablaufes und des Wandels in der thematischen Orientierung in der Rezeption des Werkes 72. Bemerkenswert ist weiter, daß die Rezeption Webers in Japan stark beeinflußt wurde durch die Beachtung, die die nordamerikanische Soziologie mit den Arbeiten von Autoren wie Gerth, Bendix oder Roth der Nachkriegszeit schenkte - später auch durch die neuere deutsche Weber-Diskus70 Vgl. etwa Erdelyi 71
aaO (Fußn. 47).
Man kannte ihn dort schon zu Lebzeiten und produzierte, gefördert von einer im Vergleich zum Westen früher einsetztenden Übersetzungetätigkeit, Sekundärliteratur von außerordentlichem Umfang. Vgl. näher Y. Uchida, zit. nach A. Zingerle passim (Fußn. 4), S. 13 f. 72 Hier sei daraufhingewiesen, daß kaum eine fremdsprachige (nicht-japanische) Arbeit über die Veröffentlichungen über Max Weber in Japan existiert, weshalb eine Angabe einschlägiger Sekundärliteratur ob der Sprachbarriere wenig sinnvoll erscheint.
Das Werk Max Webers in der Wissenschaft
441
sion; dies verdeutlicht auch die Tatsache, daß sich diese in den 60er Jahren sehr verstärkt hat. 2. Übertragung Es zeichnen sich demnach zwei thematisch unterschiedliche Rezeptionsphasen Webers in Japan ab, die auf die Entwicklung der dortigen Sozialwissenschaften großen Einfluß genommen haben.
a) Die erste Phase der Weber-Rezeption in den 30er Jahren Vorauszuschicken ist hier, daß die japanischen Sozial- und Humanwissenschaften seit der Meiji-Zeit (1868-1912) daran arbeiteten, aus Westeuropa das aufklärerische Denken mit seinen Erkenntnis- und Praxisinteressen zum Nutzen der Modernisierung Japans zu übernehmen. Dabei stand im Mittelpunkt vor allem der ökonomischen und wirtschaftshistorischen Forschung das Problem des Entwicklungsprozesses des Kapitalismus und seiner Voraussetzungen - ganz im Sinne der Auffassung, daß die Meiji-Restauration als eine bürgerliche Revolution nach dem Modell der westeuropäischen bürgerlichen Revolution zu verstehen sei. Das Problem, welches sich den Wissenschaftlern hier stellte, war die Erforschung der Ursachen des japanischen Kapitalismus, einhergehend mit der eher praktischen Frage, wie die Modernisierung Japans auch im Sinne der Demokratisierung und Liberalisierung der japanischen Gesellschaft und Kultur in Anlehnung an und nach dem Vorbild der okzidentalen Entwicklung vorangetrieben werden könne. Die vorherrschende Strömung in der japanischen Wissenschaft bearbeitete die Frage, ob und inwieweit sich Webers religionssoziologischer Ansatz, wie er ihn in seinen Studien über Konfuzianismus und Taoismus, über Hinduismus und Buddhismus diesbezüglich nutzbar machen ließe. Man war schon damals zu der Erkenntnis gelangt, daß man sich bei der Bearbeitung dieser Probleme nicht nur auf die historisch-materialistische Perspektive verlassen konnte, sondern auch diesen religionssoziologischen Ansatz miteinarbeiten mußte. Allerdings wurde in der Folge die Rezeption ausländischer Gedanken und Anregungen entlang dieser Linie durch die Auswirkungen des Zweiten Weltkrieges und die Eingriffe des Faschismus behindert 73 . Insgesamt läßt sich also bis hierher sagen, daß sich das Interesse an Weber zunächst nur unter Historikern und Ökonomen herausgebildet hat. Nach Kriegsende wandte man sich der Weberschen Religionssoziologie erneut zu, und hier verstärkt den kategoralen Aspekten des soziologischen Werks, wie etwa den Fragen der Wertfreiheit, der Bildung von Idealtypen und der Verstehenslehre. Außer dem Anspruch von marxistischer Seite, Theorie und Praxis als Einheit zu sehen, sahen sich die Soziologen auch der öffentlichen und politischen Erwar73
Der Marxismus war bis zum Ende des zweiten Weltkrieges offiziell verboten.
442
Marcus Jaroschek
tungshaltung ausgesetzt, die Erträge ihrer wissenschaftlichen Arbeit in die Praxis umzusetzen und als Politik zu programmieren. Die Auseinandersetzung mit der Werturteilsfrage unter dem Aspekt der Selbstgenügsamkeit der Wissenschaft und der Wahrheit von Wissenschaft bildete einen weiteren Anlaß zu einer noch ausgreifenderen Rezeption der Schriften Webers zur politischen Soziologie und zur Wissenschaftslehre. So ging denn auch nach dem Weltkrieg unter den gegebenen Umständen der Inhalt des Interesses an Weber mehr und mehr auf ihn selbst in der Rolle als Wissenschaftler und als politisches Subjekt über, was die umfangreiche Beschäftigung mit seiner Biographie erklärt. b) Die zweite Phase der Weber-Rezeption in den 60er Jahren In der zweiten Rezeptionsphase, die entscheidend von Einflüssen des angelsächsischen Wissenschaftsraumes geprägt worden sind, wurde Weber als Sozialwissenschaftler gesehen, der nicht gegen Marx stand, sondern entscheidend zur Erweiterung der gesellschaftstheoretischen Perspektiven des Historischen Materialismus beigetragen hat, indem er diese relativiert hat. Zugleich hielt man allerdings daran fest, Webers Verdienst auf die Wirtschaftssoziologie zu beschränken und legte Wert auf die Feststellung, daß er den Weg zur Wirtschaftskritik, wie ihn der Historische Materialismus ging, nicht fand. Sein Beitrag zur Entwicklung der Sozialwissenschaften wurde darin gesehen, daß er mit seinen methodologischen und kultursoziologischen sowie kulturvergleichenden Arbeiten den Horizont der Sozialwissenschaften entscheidend erweitert hat; dieser Beitrag Webers wurde allerdings vorwiegend auf die Errungenschaften einer historisch-materialistischen Gesellschaftstheorie mit ihren gesellschafts- und wirtschaftskritischen Impulsen bezogen, die - in das Verhältnis der Ergänzung versetzt - sich wechselseitig relativieren. 3. Weiterentwicklung Zwar ist die gesellschaftlich kulturelle Wirklichkeit Japans aus dem Blickwinkel jener Weberschen theoretischen und methodologischen Konstruktionen untersucht, und auch seine Biographie ist bis ins kleinste Detail erforscht worden, doch scheint die japanische Weber-Forschung dabei stehen geblieben zu sein. Es besteht die Gefahr, daß aufgrund einer hochgradigen Identifikation mit der charismatischen Persönlichkeit Webers eine tiefergreifende Wirkung des Weberschen Werkes auf das sozialwissenschaftliche Denken in Japan abgewehrt wird. Über die bloße Anwendung der rezipierten theoretischen Gedankenwelt Webers auf die japanische Wirklichkeit müßte der Gedanken weg, mit dem Weber seine Sichtweise im Hinblick auf okzidentale Gesellschaften entwickelt hat, bis ins kleinste Detail nachvollzogen werden, um dort wiederum von ihm zu lernen 74. 74
T. Ibaraki, Probleme der Rezeption des soziologischen Werks von Max Weber in Japan, in: Weiß (o. Fußn. 1)S. 129.
Das Werk Max Webers in der Wissenschaft
443
Dieses Problem ist erkannt worden 75 . Es sind auch einige sehr ermutigende Arbeiten zu diesem Themenkreis entstanden oder in Vorbereitung. Bleibt zu hoffen, daß die Ergebnisse dieser Arbeiten, denen man schon jetzt, bedingt durch die große Sorgfalt, die japanische Wissenschaftler bei ihrer Arbeit anwenden, eine hohe wissenschaftliche Aussagekraft zusprechen kann, auch der internationalen Wissenschaft durch eine rasche Übersetzung zugänglich gemacht werden.
V. Resümee Wie punktuell zu zeigen war, ist das Interesse an Weber (an Werk und Persönlichkeit) in der ganzen wissenschaftlichen Welt präsent und aktuell Selbstverständlich wird die Diskussion nicht nur in den näher untersuchten Regionen geführt, sondern fast überall auf dem Globus, wie beispielsweise in Südamerika (besonders in Argentinien und Brasilien), aber auch in Indien und Australien (dort vor allem beeinflußt durch die wissenschaftliche Arbeit in Großbritannien) und nicht zuletzt in europäischen Nationen, wie den Niederlanden, Frankreich oder seit dem Anfang der 80er Jahre auch in Rußland (respektive der damaligen UdSSR). Zweifellos ist Weber schon zu seinen Lebzeiten im Ausland rezipiert worden, doch verwundert es angesichts der damaligen Weltlage nicht, daß in der Zeit nach seinem Tod bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges keine derart großen wissenschaftliche Erfolge in der Arbeit mit seinem Werk erzielt wurden, wie ab den 60er Jahren. Als maßgebende Linie innerhalb der Erforschung der Weberschen Arbeiten können die Unternehmungen der angelsächsische Soziologie gesehen werden, die wie zuvor bereits erwähnt, schon relativ früh die Bedeutung Webers für die Gesellschaft erkannte und versuchte, seine Thesen für die empirische Forschung nutzbar zu machen76. Ihrem Beispiel folgte in kurzem Abstand unter anderem auch die deutsche Sozialwissenschaft, die besonders in den 70er und 80er Jahren großen Einsatz auf die Weberforschung verwandte. Bemerkenswert ist, daß die Rezeption Webers über die spezifische Ausprägung des Widerstandes, den die jeweils herrschenden Theorieschulen und Denktraditionen ganz allgemein neuen Ideen entgegensetzten und trotz ihres meist nur selektiven Charakters dennoch in der ganzen Welt vonstatten ging, und bis heute einen so noch nicht dagewesenen Prozeß internationaler Forschung und interdisziplinärer Kommunikation in Gang hält.
75 Ibaraki, ebenda., S. 130. 76 Zu den Folgen und Mißverständnissen vgl. oben Punkt III. 3.
Vorlagepflichten als Auslegungsverbote Von Klaus F. Röhl I. Paradoxien und Tautologien Paradoxien bilden ein Grundthema „postmoderner 4' oder „nachpositivistischer'4 Rechtstheorie. „Die Letztfundierung in einem Paradox gilt als eines der zentralen Merkmale postmodernen Denkens. Die Paradoxie ist die Orthodoxie unserer Zeit." 1
Aus der Perspektive der Fremdbeobachtung des Rechts mag in der Tat manches widersprüchlich oder tautologisch erscheinen. An vielen Stellen läßt sich beobachten, daß in der Kommunikation Paradoxien (und Tautologien) auftauchen. Menschen reden zirkelhaft und widersprechen einander, manchmal auch sich selbst, oft, ohne es zu bemerken. In der Rechtstheorie als Selbstbeobachtung des Rechts haben Paradoxien und Tautologien jedoch keinen Platz2. Paradoxien sind im wahren Sinne des Wortes reizvoller als Tautologien. Deshalb finden sie allgemein größere Beachtung, obwohl beide logisch gleichwertig oder vielmehr gleichermaßen sinnlos sind. Ich möchte deshalb die Aufmerksamkeit hier auf rekursive Kommunikationsfiguren richten, die als reale Parallelphänomene zur Tautologie verstanden werden können. Prominente Beispiele für solche Rekursivität bilden selbstbezügliche Änderungsbestimmungen im Verfassungsrecht wie ζ. B. die „Ewigkeitsklausel44 des Art. 79 III GG. Sie sind bereits vielfach erörtert worden3. Daher will ich hier die Aufmerksamkeit auf eine andere Gruppe selbstbezüg1 Niklas Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft 1997, S. 1144. Dazu näher Röhl, Ist das Recht paradox? Über Schwierigkeiten mit der Lektüre von Luhmanns „Recht der Gesellschaft" und mit postmoderner Rechtstheorie überhaupt, in: Soziologie des Rechts, Festschrift für Erhard Blankenburg, hrsg. von Jürgen Brand und Dieter Strempel, Nomos Verlag Baden-Baden, 1998, S. 129-148. 3 Eugenio Bulygin, Das Paradoxon der Verfassungsreform, in: Werner Krawietz/Ota Weinberger, Reine Rechtslehre im Spiegel ihrer Fortsetzer und Kritiker, Wien 1988, 307; H. L. A. Hart, Self Referring Laws, in: Festskrift tillägnad Karl Olivecrona, Stockholm 1964, wieder abgedruckt in: ders., Essays in Jurisprudence and Philosophy, 1983, 170; Norbert Hoerster, On Alf Ross's Alleged Puzzle in Constitutional Law, Mind 81, 1972, 422; Douglas R. Hofstadter, Nomic: ein Spiel, das die Rückbezüglichkeit im Rechtswesen auslotet, Spektrum der Wissenschaft, August 1982, 8, mit Ergänzungen wieder abgedruckt in: Hofstadter, Metamagicum, 1991, 75; Hans Huber, Die Gesamtrevision der Verfassung, in: Festschrift für Scheuner, 1973, 183 ff.; J. Raz, Professor A. Ross And Some Legal Puzzles, Mind 81, 1972, 2
446
Klaus F. Röhl
licher Vorschriften lenken, nämlich auf die Auslegungs- und Kommentierungsverbote. Auslegungsverbote sind nämlich nicht, wie man auf Anhieb meinen könnte, ein abgeschlossenes Kapitel der Rechtsgeschichte. Im modernen Recht verbergen sie sich hinter Vorlagepflichten und haben als solche eine große praktische Bedeutung. Tautologisch oder rekursiv sind Auslegungs verböte deshalb, weil ihr Vollzug immer schon Auslegung voraussetzt, denn die Auslegungsbedürftigkeit selbst kann nur durch Auslegung ermittelt werden. Eindeutig und damit nicht auslegungsbedürftig ist ein Gesetz nur dann und solange, wie niemand, der ernst genommen wird, daran zweifelt. Im Zweifelsfall gibt es jedoch weder eindeutige noch eindeutig zweideutige Gesetze4.
II. Soziale Funktionen von Selbstreferenz Mehr oder weniger gut versteckte Paradoxien oder Tautologien haben bemerkenswerte soziale Funktionen. Als Beispiel mag die „Paradoxie des Entscheidens" dienen. Wenn eine Entscheidung zu treffen ist, so gibt es Wahlmöglichkeiten (Alternativen). Die Entscheidung selbst „ist, muß man deshalb vermuten, das durch die Alternativität der Alternative ausgeschlossene Dritte. Sie ist die Differenz, die diese Alternativität konstituiert; oder genauer: sie ist die Einheit dieser Differenz. Also ein Paradox. Entscheidungen gibt es nur, wenn etwas prinzipiell Unentscheidbares (nicht nur Unentschiedenes!) vorliegt. Denn andernfalls wäre die Entscheidung schon entschieden und müßte nur ,erkannt' werden". 5 Diese Formulierungen Luhmanns spielen auf die Vorstellung an, daß juristische Entscheidung Rechtserkenntnis sei. Wenn die Lösung jedoch schon vorgezeichnet ist und bloß erkannt zu werden braucht, gibt es nichts zu entscheiden. Ist sie dagegen nicht aus Regeln ableitbar, kann man nicht entscheiden. Darin liegt also das Paradox. Doch obwohl juristische Entscheidungen immer noch gerne als Rechtserkenntnis dargestellt werden, hat sich doch die Jurisprudenz längst von der Vorstellung verabschiedet, daß ihre Urteile kognitiver Natur seien. Luhmann beutet nur den Doppelsinn der Begriffe aus. Einmal verwendet er „Entscheidung" für den kognitiven Vorgang der Deduktion, das andere Mal gleichbedeutend mit Dezision. Auch der Zirkel, „der sich ergeben würde, wenn man zugeben müßte, daß das Gericht das Recht erst ,schafft', das es »anwendet'"6, ist keiner. Ein Zirkel ergibt sich nur, wenn man sich 415; Klaus F. Röhl, Allgemeine Rechtslehre, 1995, S. 100 ff.; Alf Ross, On Self-Reference as a Puzzle in Constitutional Law, Mind 78, 1969, 1; Hans-Peter Schneider, Die verfassungsgebende Gewalt, in: Handbuch des Staatsrechts Bd. VII, 1992, 3 ff.; Klaus Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Bd. I, 2. Aufl. 1984, § 5; Peter Suber, The Paradox of Self-Amendement, 1990; Rolf Wank, Objektsprache und Metasprache, Rechtstheorie 13, 1982, 465. 4 Röhl, Allgemeine Rechtslehre, 1995, S. 625 ff. 5 Niklas Luhmann, Das Recht der Gesellschaft, 1993, S. 308. 6
Luhmann a. a. O., S. 306.
Vorlagepflichten als Auslegungsverbote
447
über den Doppelsinn des Wortes „Recht" als vorgegebene Regel und als Fortbildung der Regel täuschen läßt. Und tatsächlich ist es ja oft so, daß Entscheider unter „Recht" etwas anderes verstehen als die Beschiedenen. Der Doppelsinn solcher Begriffe wie „Entscheidung" und „Recht" läßt sich schnell aufklären. In der realen Kommunikation bleibt die Bedeutung der Begriffe aber meistens in der Schwebe. Das führt zu der Differenz von Herstellung und Darstellung der Entscheidung. So können den Betroffenen und einem weiteren Publikum Entscheidungen als bloße Ableitungen präsentiert und damit legitimiert werden. Wenn ich mich jetzt den Auslegungsverboten zuwende, so interessiert mich weniger deren rechtstheoretische Einordnung oder rechtsdogmatische Entfaltung als vielmehr der Umstand, daß die mit solchen Auslegungsverboten verbundene Rekursivität die Verbote tendenziell wirkungslos macht, denn sie eröffnet den Juristen Freiräume, um sich ihnen zu entziehen. Und von diesen Freiräumen machen die Juristen auch Gebrauch. Abgesehen davon, daß Auslegungsverbote sich praktisch nur schwer durchhalten lassen, widersprechen sie dem Selbstverständnis der Juristen und ganz besonders Richter. Sie sehen in der selbständigen Auslegung des Rechts den Kernbereich ihrer Kompetenz. Juristen haben keine Probleme damit, wenn das Ergebnis ihrer eigenen Auslegung korrigiert wird. Anwälte müssen damit leben, daß ihre Auslegungen vor Gericht nicht stand halten. Autoren sind gewohnt, daß ihre Ansicht nicht ohne Widerspruch bleibt. Richter akzeptieren zwar, daß sie von der höheren Instanz aufgehoben werden. Aber sie akzeptieren nicht, daß sie sich kein eigenes Urteil bilden dürfen. Jedes Verbot, sich in diesem Kernbereich der Juristenkompetenz zu betätigen, stößt daher vermutlich auf Widerstand.
III. Auslegungsverbote und authentische Auslegung Aus der Rechtsgeschichte sind verschiedene Fälle bekannt, in denen der Gesetzgeber einem Gesetz eine Bestimmung beifügte, die es untersagte, das Gesetz auszulegen und zu kommentieren7. Sie gehen in der Regel einher mit Vorkehrungen für eine authentische Auslegung. Diese wiederum wird durch eine Vorlagepflicht der Gerichte abgesichert. Im Falle des Zweifels oder bei Lücken im Gesetz haben die Richter beim Gesetzgeber Rückfrage zu halten8. Authentische Auslegung und Vorlagepflichten gehen immer mit Selbstauslegungsverboten einher. Diese sind doppelt rekursiv, denn man muß ein Gesetz immer schon auslegen, um zu wissen, ob es auslegungsbedürftig ist, und auch die Auslegungsregeln selbst sind wieder auslegungsfähig und auslegungsbedürftig. 7 Hermann Conrad, Richter und Gesetz im Übergang vom Absolutismus zum Verfassungstaat, Graz 1971; Heinz Mohnhaupt, Potestas legislatoria und Gesetzesbegriff im Ancien Regime, lus Commune IV, 1997, S. 188-239, S. 220 ff. 8 Hans Müller, Zur Geschichte der bindenden Gesetzesauslegung, Berlin 1939.
448
Klaus F. Röhl
Eine Vorschrift dieser Art erließ Kaiser Justinian im Anschluß an die Sammlung des römischen Rechts im Corpus Juris Civilis. Er verbot unter Androhung von Strafe jede Kritik und jeden Kommentar. Nur Übersetzungen ins Griechische, Auszüge (indices) und die Sammlung von Parallelstellen sollten erlaubt sein. Zweifelsfragen sollten die Richter dem Kaiser zur Entscheidung vorlegen. In der Vorrede § 28, IX zum „Project des Codicis Fridericiani Marchici" von 1748, das vorläufig für alle Gerichte Preußens verbindlich war, heißt es: „Und damit die Privati, insonderheit aber die Professores, keine Gelegenheit haben mögen, dieses Land-Recht durch eine eigenmächtige Interpretation zu korrumpieren, so haben Se. Königl. Majestät bey schwerer Strafe verboten, daß niemand, wer er auch sei, sich unterstehen solle, einen Commentarium über das ganze Land-Recht, oder einen Theil desselben zu schreiben."
Ähnliche Bestimmungen gab es im französischen Recht aus der Zeit vor der Revolution. Daher stammt der international geläufige Ausdruck référé législatif. Auch Napoleon stellte die Abfassung von Kommentaren unter Strafe. Aus der deutschen Rechtsgeschichte ist besonders die preußische Gesetzeskommission bemerkenswert, die einen wichtigen Bestandteil der fridericianischen Justizreform bildete. Dieser Gesetzeskommission, einer Erfindung Johann Georg Schlossers 9, der selbst später zu ihrem schärfsten Kritiker wurde 10 , war während der zweieinhalb Jahrzehnte ihres Bestehens die authentische Auslegung von Gesetzen übertragen. Ursprünglich wurde die Kommission durch eine Kabinettsordre vom 14. 4. 1780 als Trägerin der Kodifikationsarbeiten eingerichtet. Die Auslegung des Gesetzes sollte ihr erst nach Abschluß der Kodifikation übertragen werden. Doch bereits durch das Errichtungspatent vom 29. 5. 1781 übertrug Friedrich IL der Kommission die bindende Auslegung der von den Gerichten einzureichenden streitigen Rechtsfragen. Die Voraussetzungen der Anfragepflicht der Gerichte und das hierbei einzuhaltende Verfahren wurden im selben Jahr im Corpus Juris Fredericianum geregelt, und zwar im „Ersten Buch von der Prozeßordnung". Danach hatten die Obergerichte bei der Gesetzeskommission anzufragen, 1. wenn die Mehrheit des Kollegiums der Auffassung war, daß eine Rechtsfrage, über die gestritten wurde, in den vorhandenen Gesetzen nicht oder nicht deutlich genug entschieden sei, 2. wenn Referent und Korreferent über eine Rechtsfrage verschiedener Meinung waren und das Kollegium bei der Abstimmung geteilter Meinung blieb, und 3. wenn die Beweiserheblichkeit einer streitigen Tatsache von der Entscheidung einer zweifelhaften Rechtsfrage abhing. Die unteren Gerichte waren gehalten, in Fällen dieser Art bei den Obergerichten anzufragen. 9
Vorschlag und Versuch einer Verbesserung des deutschen bürgerlichen Rechts ohne Abschaffung des römischen Gesetzbuches, Leipzig 1777. 10 Briefe über die Gesetzgebung, Frankfurt 1789 (Neudruck Glashütten im Ts. 1970).
Vorlagepflichten als Auslegungsverbote
449
Das Allgemeine Landrecht von 1794 verbot zwar nicht mehr jede Auslegung. In Einleitung § 46 gestattete es eine wortlautnahe Interpretation: „Bey Entscheidungen streitiger Rechtsfälle darf der Richter den Gesetzen keinen anderen Sinn beylegen, als welcher aus den Worten und dem Zusammenhange derselben, in Beziehung auf den streitigen Gegenstand oder aus dem nächsten unzweifelhaften Grunde des Gesetzes, deutlich erhellet."
Wollte das Gericht jedoch auf entfernter liegende Gründe abstellen, so war ein référé législatif vorgeschrieben. In Einleitung § 47 ALR hieß es: „Findet der Richter den eigentlichen Sinn des Gesetzes zweifelhaft, so muss er, ohne die prozeßführenden Parteien zu benennen, seine Zweifel der Gesetzescomission anzeigen, und auf deren Beurtheilung antragen."
Grund für solche Auslegungs- und Kommentierungsverbote war der Wunsch nach Rechtssicherheit und das Mißtrauen gegen die Willkür von Juristen im allgemeinen und Richtern im besonderen. Der aufgeklärte Absolutismus an der Wende zum 19. Jahrhundert wollte mit Hilfe umfangreicher Gesetzeswerke klare Verhältnisse schaffen. Der Wortlaut des Gesetzes sollte möglichst für sich sprechen. In diesem Sinne bestimmte § 6 Einleitung ALR: „Auf Meinungen der Rechtslehrer, oder älterer Aussprüche der Richter, soll bei künftigen Entscheidungen keine Rücksicht genomen werden."
Den Richter wollte man zum Sklaven des Gesetzes machen. Er sollte im Einzelfall nur noch nachvollziehen, was im Gesetz allgemein vorgeschrieben war. Die Vorstellung von der Herrschaft des Gesetzes war ein großer Fortschritt. Sie war getragen von der Idee der Gewaltenteilung und der Allgemeinheit des Gesetzes. Auch wenn man insoweit damals noch optimistischer war als heute, so war doch immer schon klar, daß es nicht gelingen will, Gesetze so exakt und vollständig zu formulieren, daß Anwendungszweifel oder Lücken ausgeschlossen sind. Diesen prinzipiellen Mangel des Gesetzes sollte die authentische Interpretation ausgleichen. Die Voraussetzungen dafür waren zur Zeit des Absolutismus sicher besser als im demokratischen Verfassungsstaat, weil die Konzentration der Gesetzgebung in der Hand des Monarchen viel eher eine subjektive Auslegung und bei Bedarf auch eine Ergänzung des Gesetzes gestattete. Diese Auffassung kommt in II, 13 § 6 ALR zum Ausdruck: „Das Recht, Gesetze und allgemeine Polizeiverordnungen zu geben, dieselben wieder aufzuheben und Erklärungen darüber mit gesetzlicher Kraft zu erteilen, ist ein Majestätsrecht."
Doch schon unter absolutistischen Verhältnissen funktionierte die authentische Auslegung kaum. Bereits die Zeitgenossen kritisierten die Verletzung des Prinzips der Gewaltenteilung und betonten den systematischen Unterschied zwischen der allgemeinen Gesetzgebung und der fallbezogenen Entscheidung11. Solche verfas29 Gedächtnisschrift Wenz
450
Klaus F. Röhl
sungsdogmatischen Bedenken hätten allerdings kaum genügt, um dem Gesetzgeber den Gehorsam zu versagen, wenn nicht die rekursive Struktur der bedenklichen Bestimmungen der Praxis die Möglichkeit eröffnet hätte, sich der Anwendung zu entziehen. Auslegungs- und Kommentierungsverbote können nicht auf dauerhafte Befolgung rechnen. Sie kommen einem Denkverbot gleich. Jede Stellungnahme zur Klarheit oder Lückenhaftigkeit eines Gesetzes, die irgendwelche Gründe anführt, ist selbst schon Auslegung. Die Auslegungsverbote hat man deshalb stillschweigend dahin ausgelegt, daß sie wegen praktischer Undurchführbarkeit unbeachtlich seien. Das gleiche Schicksal wäre einem Gesetz bestimmt, das die Bildung von Gewohnheitsrecht oder von Richterrecht verbieten wollte. Es wäre immer damit zu rechnen, daß dieses Gesetz seinerseits durch Gewohnheitsrecht und Richterrecht derogiert würde. Aber auch die zur Absicherung der authentischen Auslegung eingeführten Vorlagepflichten der Gerichte stoßen auf Widerstand. Entweder wird der Gesetzgeber mit Wünschen nach authentischer Auslegung überflutet, oder die Gerichte verzichten auf die Rückfrage, auch wo sie angezeigt wäre. So hat die Rechtspraxis solche Bestimmungen früher oder später ignoriert. In Preußen wurde die Anfragepflicht schon durch Kabinettsordre vom 8. 3. 1798 wieder abgeschafft und damit die § 47 f. Einleitung ALR außer Kraft gesetzt. Die offizielle Begründung des Königs ging dahin, daß durch die rückwirkende Kraft der authentischen Auslegung die angestrebte Rechtssicherheit eher gefährdet werde, denn „durch solche Entscheidungen können manche Meiner Untertanen, ohne das allergeringste Verschulden, in dem sie im Grunde nach einem neuen Gesetze, das sie vorher nicht kennen konnten, gerichtet werden, in großen Schaden und Nachteil versetzt werden". Ferner meinte der König: „Die Gesetzeskommission ist in Auslegung der Gesetze ebensogut dem Irrtum unterworfen, wie es die Gerichtshöfe bei ihren Entscheidungen sind. Dem ungeachtet aber findet gegen die ersteren gar kein Remedium statt, wenn der Irrtum auch noch so klar dargetan und der daraus entstehende Schade auch noch so groß sein sollte." Tatsächlich scheint es aber so gewesen zu sein, daß die Gerichte am Ende kaum noch vorlegten 12. Die mutmaßlichen Gründe hatte Johann Georg Schlosser in seinen „Briefen über die Gesetzgebung" (1789) angesprochen, wenn er meinte, daß ein Auslegungsverbot als „Verbot den Verstand zu gebrauchen" 11 von Rebeur, Über die neue preußische Justizreform oder Beleuchtung einer Stelle in der von dem Herrn Staatsminister von Herzberg dem 30. Jenner 1783 vor der Akademie der Wissenschaften zu Berlin gehaltenen Vorlesung über die Veränderungen des Staats. Aus dem Französischen übersetzt, Hannover 1789; differenzierter noch Karl Ludwig Wilhelm Grolmann, Ausführliches Handbuch über den Code Napoleon, Bd. 1, Gießen 1810, S. 45 f. zu Art. 4 und 5 des Code Napoléon. 12 Nach Auszählungen eines Bochumer Doktoranden {Jens Schade, Die Anfrage bei der Gesetzeskommission innerhalb des preußischen Zivilprozesses, 1998) wurden zwischen 1781 und 1798 insgesamt 251 Anfragen an die Gesetzeskommission gerichtet. In den letzten Jahren sank die Zahl bis auf vier.
Vorlagepflichten als Auslegungsverbote
451
dem Geiste der Aufklärung widerspreche, und wenn er daher die Anfragepflicht für unvereinbar mit der Würde des Richters hielt, der es als niederschlagend empfinden müsse, wenn ihm von Seiten der Gesesetzgebung und der Regierung so wenig Vertrauen entgegengebracht werde. Binnen kurzem, so fürchtete Schlosser, könnten die Richter des Fragens müde werden und die Gesetze bloß noch dem Worte nach anwenden13.
IV. Moderne Vorlagepflichten Das moderne Recht kennt Auslegungsverbote nur noch in abgemilderter Form, und zwar als Kehrseite von Vorlagepflichten. Nach Art. 100 II GG sind Zweifel hinsichtlich der Geltung und Auslegung von Völkerrecht grundsätzlich dem Bundesverfassungsgericht zur Klärung zu überlassen. Dagegen impliziert die Vorlagepflicht bei der konkreten Normenkontrolle nach Art. 100 I GG kein Auslegungsverbot, denn das vorlegende Gericht muß selbst über die Verfassungswidrigkeit des relevanten Gesetzes befinden, ihm fehlt nur die Verwerfungskompetenz. Auch für die oberen Bundesgerichte gelten Auslegungsverbote. Will ein Senat des Bundesgerichtshofs in einer Rechtsfrage von der Entscheidung eines anderen Senats abweichen, so ist die Frage nach § 132 GVG einem Großen Senat oder dem Vereinigten Großen Senat vorzulegen. Will ein oberstes Bundesgericht bei der Entscheidung einer Rechtsfrage von der Entscheidung eines anderen obersten Bundesgerichts abweichen, so ist die Frage nach dem Gesetz zur Wahrung der Einheitlichkeit der Rechtsprechung dem Gemeinsamen Senat der obersten Bundesgerichte vorzulegen. In Strafvollstreckungssachen und Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit muß ein Oberlandesgericht, daß von einer Entscheidung eines anderen Oberlandesgerichts oder von einer Entscheidung des Bundesgerichtshofes abweichen will, die Sache dem Bundesgerichtshof vorlegen (§ 121 II GVG, § 28 II FGG). Ähnliche Bestimmungen gibt es auch in anderen Zusammenhängen. Im Zivilprozeß muß ein Oberlandesgericht, das von einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs oder des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bundes abweichen will, die Revision zulassen (§ 446 I 2 Nr. 2 ZPO). Die Vorlagepflichten haben gemeinsam, daß zunächst das Gericht, das für die Hauptsache zuständig ist, über die Notwendigkeit der Vorlage entscheidet, und daß diese Entscheidung nicht mehr mit einem regulären Rechtsmittel angefochten werden kann. Allerdings gibt es als außerordentlichen Rechtsbehelf die Verfassungsbeschwerde nach Art. 93 Nr. 4a GG. Sie kann darauf gestützt werden, daß Art. 101 1 2 GG verletzt ist. Das Bundesverfassungsgericht geht nämlich davon aus, daß das Gericht, dem vorzulegen ist, der gesetzliche Richter im 13 A. a. O. S. 198 ff., 208 ff. 29=
452
Klaus F. Röhl
Sinne des Grundgesetzes sei mit der Folge, daß durch eine Verletzung der Vorlagepflicht die Entscheidung des Rechtsstreits dem gesetzlichen Richter entzogen wird. Die modernen Vorlagepflichten unterscheiden sich von den älteren Auslegungsverboten nach Zweck und Konstruktion. Ihr Zweck liegt jeweils darin, die einheitliche Handhabung einer Rechtsordnung zu gewährleisten. Rechtstechnisch kanalisieren sie die Auslegung innerhalb des Justizsystems. Das ist wohl der Grund, daß die mit den Vorlegungspflichten verbundenen Selbstauslegungsverbote einigermaßen funktionieren. Jedenfalls wird ihre Verletzung eher selten beklagt 14
V. Die Vorabentscheidungskompeteiiz des Europäischen Gerichtshofs Größere Aufmerksamkeit hat die Vermeidung oder Umgehung der Vorlagepflicht zum Europäischen Gerichtshof (EuGH) gefunden 15. Art. 177 III EGV 1 6 verbietet den nationalen Gerichten letzter Instanz, das Gemeinschaftsrecht auszulegen, und verpflichtet sie statt dessen zur Vorlage beim EuGH. Hier eröffnen sich größere Ausweichmöglichkeiten. Zunächst haben der EuGH selbst und dann auch das Bundesverfassungsgericht die aus der Rekursivität der Auslegung folgende Freiheit der vorlagepflichtigen Gerichte dadurch erweitert, daß sie einen großzügigeren Maßstab für die Auslegungsbedürftigkeit festgelegt haben. Außerdem können die Gerichte sich der Vorlagepflicht auch deshalb leichter entziehen, weil nationale Gerichte und EuGH nicht in einem einheitlichen Justizsystem verbunden sind. Um die Flut der Vorlagen einzudämmen, hat der EuGH 17 auf Vorlagen verzichtet, • wenn Gemeinschaftsrecht nicht entscheidungserheblich ist, • wenn das einschlägige Gemeinschaftsrecht bereits Gegenstand der Auslegung durch den Gerichtshof war („acte éclairé"),
14
Ζ. Β. von Bernd Rüthers, Arbeitsrecht und ideologische Kontinuitäten?, NJW 1998, 1434 f. 15 Jürgen Basedow, Vom Vorabentscheidungsverfahren zur Divergenzvorlage?, EuZW 1996, 97; Manfred A. Dauses, Vorabentscheidungsverfahren, in: ders. (Hrsg.) Handbuch des EU-Wirtschaftsrechts, 2 Aufl. 1998 (mit Statistik); Ulrich Ehricke, Die Bindungswirkung von Urteilen des EuGH im Vorabentscheidungsverfahren nach deutschem Zivilprozeßrecht und nach Gemeinschaftsrecht, Europa-Institut der Universität des Saarlandes, Nr. 364, 1997; S. 11 ff.; Hans Krück, Artikel 177 - Vorabentscheidungen, Rn. 78 in: Hans von der Groeben, Kommentar zum EU-, EG-Vertrag, 5. Aufl. 1997, Bd. 4. 16
Der EGV wird hier noch nach der alten Numerierung zitiert. 17 Slg. 1982, 3415-Cilfit-.
Vorlagepflichten als Auslegungsverbote
453
• wenn die richtige Anwendung des Gemeinschaftsrechts „derart offenkundig ist, daß für einen vernünftigen Zweifel kein Raum bleibt" („acte clair"- der EuGH selbst vermeidet diesen Begriff aus der französischen Rechtsdogmatik), • wenn nur ein Verfahrensbeteiligter Auslegungszweifel anmeldet und die Vorlage beantragt. Damit hat der EuGH erheblichen Spielraum für die Auslegung der Auslegung geschaffen. Ein Gericht kann sich der Vorlagepflicht entziehen, indem es erklärt, es sei durch Auslegung zu dem Ergebnis gekommen, daß es keine Zweifel gebe, wie das Gemeinschaftsrecht zu verstehen sei, es halte das Gemeinschaftsrecht also nicht für auslegungsbedürftig. Die Vorlagepflicht trifft nach Art. 177 III EGV das letztinstanzliche Gericht. Welches Gericht als letztinstanzliches anzusehen ist, hängt zunächst davon ab, ob man abstrakt auf den an sich gegebenen Instanzenzug oder konkret darauf abstellt, ob im Einzelfall ein Rechtsmittel gegeben ist. Vorgezogen wird die konkrete Betrachtungsweise mit der Folge, daß ζ. B. schon der Amtsrichter in einem Zivilprozeß mit einem Streitwert unter der Berufungssumme vorlagepflichtig ist. Aber die Frage ist noch immer nicht abschließend geklärt 18 . Komplizierter wird die Situation, wenn das Rechtsmittel von einer Zulassung abhängt, wie es neuerdings im Verwaltungsprozeß schon für die Berufung der Fall ist. Die Zulassung des Rechtsmittels ist regelmäßig geboten, wenn die Sache grundsätzliche Bedeutung hat. Grundsätzliche Bedeutung wird man annehmen müssen, wenn materiell Anlaß zur Vorlage besteht. Hat, wie nach § 124 VwGO, der judex ad quem über die Zulässigkeit des Rechtsmittels zu entscheiden, so schafft der judex a quo durch Unterlassung der Vorlage erst die Anfechtungsmöglichkeit. Hätte er vorgelegt, wäre er letzte Instanz. Falls er, wie das OVG, noch eine Revisionsinstanz über sich hat, könnte er aber gerade auch deshalb die Berufung zulassen, um die Vorlagepflicht auf das Bundesverwaltungsgericht zu verschieben 19. Aber auch der iudex a quo, der selbst über die Zulässigkeit des Rechtsmittels zu entscheiden hat, befindet sich in einer Zwickmühle. Er kann kaum im Hinblick auf die Vorlagebedürftigkeit die grundsätzliche Bedeutung der Sache annehmen, denn er könnte selbst vorlegen und damit den Zulassungsgrund ausräumen. Vorausgesetzt, es gibt sonst keine Zulassungsgründe, wäre er dann selbst wieder die letzte Instanz. Auch der EuGH ist gesetzlicher Richter im Sinne von Art. 101 I 2 GG, so daß auch bei Verletzung der Vorlagepflicht nach Art. 177 III EGV die Verfassungsbeschwerde nach Art. 93 Nr. 4a GG gegeben ist 20 . Soweit es die Auslegung von Gemeinschaftsrecht betrifft, ist das Bundesverfassungsgericht bei der Beurteilung der 18 Vgl. Manfred A. Dauses, Das Vorabentscheidungsverfahren nach Artikel 177 EG-Vertrag, 1995, S. 109 ff. 19 Hans Arno Petzold, Wechselwirkungen zwischen § 124 VwGO n. F. und Art. 177 EGV, NJW 1998, 123 ff., 125. 20 BVerfGE 73, 339/367.
454
Klaus F. Röhl
Vorlagepflicht jedoch milder als bei den Vorlagepflichten des deutschen Rechts. Auslegungsbedürftigkeit, die zur Vorlagepflicht führt, wird in beiden Fällen nur dann angenommen, wenn ihre Verneinung „willkürlich' 4 wäre. Geht es um die Auslegung von Völkerrecht, so begründen schon „objektiv ernstzunehmende Zweifel" die Vorlagepflicht. Solche Zweifel sind anzunehmen, „wenn das Gericht abweichen würde von der Meinung eines Verfassungsorgans oder von den Entscheidungen hoher deutscher, ausländischer oder internationaler Gerichte oder von den Lehren anerkannter Autoren der Völkerrechtswissenschaft" 21. Die Vorlagepflicht entfällt also nur bei „Evidenz". Die Vorlagepflicht nach Art. 177 III EGV entsteht dagegen erst, wenn „die entscheidungserhebliche gemeinschaftsrechtliche Norm in der Tat mehrere, für einen kundigen Juristen gleichermaßen mögliche Auslegungen zuläßt" 22 . Das Bundesverfassungsgericht nennt drei typische Willkürfälle: • Das Hauptsachegericht hat Zweifel hinsichtlich der richtigen Anwendung des Gemeinschaftsrechts, zieht aber eine Vorlage überhaupt nicht in Erwägung. • Das Gericht will bewußt von der Rechtsprechung des EuGH abweichen, legt aber gleichwohl nicht vor. • Mögliche Gegenauffassungen zu der entscheidungserheblichen Frage des Gemeinschaftsrechts sind der Auffassung des Hauptsachegerichts eindeutig (Hervorhebung vom Bundesverfassungsgericht) vorzuziehen. Damit liegt die Willkürschwelle so hoch, daß sie kaum je überschritten wird. Immerhin hat das Bundesverfassungsgericht in einem Kammerbeschluß vom 13. 6. 1997 einem ungenannten Landesarbeitsgericht ins Stammbuch geschrieben, es habe als letztinstanzliches Fachgericht Art. 177 III EGV in offensichtlich unhaltbarer Weise gehandhabt23. Die Verfassungsbeschwerde wurde dennoch nicht angenommen, da der EuGH selbst inzwischen seine Rechtsprechung im Sinne des LAG geändert hatte. Bemerkenswert ist die Begründung, mit der das LAG auf eine Vorlage verzichtete. Es meinte, der EuGH habe sein einschlägiges Urteil 24 nicht begründet; deshalb könne man sich nicht mit ihm auseinandersetzen; es habe nur für den seinerzeit konkret entschiedenen Fall Bedeutung. Deutlich zeigt diese Begründung die Verärgerung über den EuGH. Nicht nur die Notwendigkeit der Auslegung der Auslegungsbedürftigkeit erzeugt eine Rekursivitätsschleife. Zusätzliche Rekursivität ist durch die Prüfungskompetenz der nationalen Gerichte eingebaut, die sich aus dem Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung ergibt, wie es das Bundesverfassungsgericht im Maastricht-Urteil 25 formuliert hat. Letztlich hängt die Bindung der nationalen Ge21 BVerfGE 64, 1/15. 22 BVerfG NJW 1988, 1456. 23 1 BvR 2102/95, EuZW 1997, 575. 24 U. vom 14. 4. 1994, Slg. I 1994, 1311 = EuZW 1994, 374 = NZA 1994, 545 = NJW 1994, 2343 - Christel Schmidt; dazu jetzt EuGH EuZW 1997, 244 = NZA 1997, 433 = NJW 1997, 2039-Ayse Süzen. 25 BVerfG E 89, 155/175.
Vorlagepflichten als Auslegungsverbote
455
richte an europäisches Recht und damit auch die Vorlagepflicht von der Frage ab, ob sich das europäische Recht in den Grenzen der der Union übertragenen Hoheitsrechte hält 26 . Ein wichtiger Unterschied zwischen Art. 100 II GG und Art. 177 III EGV liegt darin, daß das Bundesverfassungsgericht, auch wenn es außerhalb des Rechtszuges steht, doch mit der Antwort auf Urteilsverfassungsbeschwerden nach Art. 93 Nr. 4a GG das letzte Wort behält. Dem EuGH dagegen fehlt die Kompetenz-Kompetenz. Es gibt kein Rechtsmittel gegen Urteile nationaler Gerichte zum Europäischen Gerichtshof, mit dem die Verletzung der Vorlagepflicht oder die falsche Anwendung von Gemeinschaftsrecht geltend gemacht werden könnte. Art. 173 V EGV eröffnet den Rechtsweg für natürliche und juristische Personen nur gegen Entscheidungen von Organen der Gemeinschaft selbst, nicht jedoch gegen Entscheidungen der nationalen Gerichte. Soweit wegen Verletzung der Vorlagepflicht nach Art. 177 III EGV Verfassungsbeschwerde nach Art. 93 Nr. 4a GG eingelegt werden kann, bleibt der Fall doch im deutschen Gerichtssystem. Gegebenenfalls ist auch das Bundesverfassungsgericht selbst zur Vorlage an den EuGH verpflichtet 27. Das gilt allerdings nur in „normalen" Verfahren, das heißt, in solchen, die nicht schon eine Verfassungsbeschwerde wegen Verletzung des Art. 177 III EGV in Verb, mit Art. 10112 GG zum Gegenstand haben. Wird die Verletzung gerade des Art. 177 III EGV gerügt, so ist die Entscheidungssituation doppelt rekursiv. Um zu entscheiden, ob das Fachgericht Art. 177 III EGV verletzt hat, muß das Bundesverfassungsgericht sowohl das fachliche Rechtsproblem unter dem Gesichtspunkt erörtern, ob insoweit Europarecht auslegungsbedürftig ist, als auch Art. 177 III EGV im Hinblick darauf, ob die Auslegungszweifel ein Maß erreichen, das die Vorlagepflicht auslöst. Unter beiden Gesichtspunkten kommt eine Vorlage des Bundesverfassungsgerichts an den EuGH in Bertracht. Das Bundesverfassungsgericht hat aber wohl auch die Wahl der Aufhebung der Vorentscheidung mit der Maßgabe, daß das Fachgericht dem EuGH vorzulegen habe. So viel Rekursivität kann nicht mehr vorhersehbar funktionieren. Das Bundesverfassungsgericht kann tun und lassen, was es will. Es gibt für alles Begründungen. Tatsächlich hat das Bundesverfassungsgericht bislang selbst nicht vorgelegt, obwohl es dazu durchaus Anlaß gehabt hätte 28 . Im Falle der Nichtvorlage kann der EuGH den Fall nicht an sich ziehen. Auch das Bundesverfassungsgericht fährt also in der Rekursivitätsschleife. 26
Vgl. Günter Hirsch, Europäischer Gerichtshof und Bundesverfassungsgericht - Kooperation oder Konfrontation?, NJW 1996, 2457-2466. 27 Konrad Feige, Bundesverfassungsgericht und Vorabentscheidungskompetenz des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften, AöR 1975, 531 ff.. 28 Zu einem Fall, in dem hätte vorgelegt werden sollen, vgl. Ninon Colneric, Vorlagepflicht nach EG-Recht bei Normenkontrolle über Frauenquote, Betriebs-Berater 1991, 1118; Folkmar Koenigs, Vorlagepflicht nach EG-Recht bei Normenkontrolle über Frauenquote,
456
Klaus F. Röhl
Letztlich geht es im Verhältnis zwischen den nationalen Gerichten und dem EuGH um einen „justiziellen Dialog" oder, wie das Bundesverfassungsgericht im Maastricht-Urteil 29 sagt, um ein KooperationsVerhältnis. Wenn die nationalen Gerichte einschließlich des Bundesverfassungsgerichts nicht kooperieren, gibt es für die Beteiligten keine Möglichkeit, den konkreten Fall vor den EuGH zu bringen, denn ein immerhin denkbares Vertragsverletzungserfahren nach Art. 169 f. EGV kann nur von der Kommission eingeleitet werden; ein Individualanspruch auf Einleitung eines solches Verfahrens besteht nicht 30 . Die Kommission könnte zwar von Amts wegen ein Vertragsverletzungsverfahren einleiten. Aber darauf hat sie bisher verzichtet, obwohl es durchaus Anlaß gegeben hätte, und zwar mit gutem Grund, denn das Verfahren könnte wenig oder gar nichts helfen, weil dadurch nicht der konkrete Fall zum EuGH gelangt, und weil es den Mitgliedsstaaten durch den Grundsatz der richterlichen Unabhängigkeit verwehrt ist, ihre Richter an der Auslegung von Normen zu hindern 31 . Unter diesen Umständen ist es bemerkenswert, daß es bisher keine wirklich gravierenden Konflikte zwischen den nationalen Gerichten und dem Europäischen Gerichtshof gegeben hat. Es spricht für die politische Akzeptanz Europas gerade auch innerhalb der Justiz, daß Art. 177 III EGV nicht leer läuft. Die Zahl der Vorlagen ist zwischen 1990 und 1997 von 142 auf 256 gestiegen. Erstmals 1997 ist sie geringfügig auf 239 zurückgegangen. Die Kommission kann in ihrem jüngsten Bericht über die „Anwendung des Gemeinschaftsrechts durch die Gerichte der Mitgliedstaaten" auch keine flagrante Verletzung des Vorlegungsgebots benennen. Es gibt keine Rechtsgemeinschaft ohne Rechtseinheit und keine Rechtseinheit ohne zentrale Gerichtsbarkeit 32. Wenn Recht und Staat identisch sind, kann man keine Rechtseinheit haben, ohne die eigene Staatlichkeit aufzugeben. Erst ein hierarchisch organisiertes Gerichtssystem bietet einige Gewähr für Rechtseinheit, denn es verlegt die unvermeidbare Rekursivität in die Kompetenz-Kompetenz seiner Spitze und kommt ohne interne Rekursivitätsschleifen aus. Betriebs-Berater 1991, 1634; Monika Ende, Nochmals: Vorlagepflicht des Bundesverfassungsgerichts an den EuGH bei Normenkontrolle über Frauenquote, Betriebs-Berater 1992, 489. Auch das Verfahren zur EG-Fernsehrichtlinie (BVerfG, U. v. 22. 3. 1995, EuGRZ 1995, 125) hätte wohl vorgelegt werden sollen; vgl. Thomas Trautwein, Zur Rechtsprechungskompetenz des Bundesverfassungsgerichts auf dem Gebiet des Europäischen Gemeinschaftsrechts, JuS 1997, 893. 29 BVerfG E 89, 155/175. 30 EuGH Slg. 89, 291 / 301 - Star Fruit - . 31 Im August 1990 hat die Kommission anscheinend bisher zum ersten und letzten Mal das Vorverfahren gemäß Art. 169 EGV gegen ein Mitgliedsland, in diesem Fall gegen die Bundesrepublik, Deutschland eingeleitet, weil der BGH die Revision gegen ein Urteil des OLG Köln nicht zugelassen hatte, so daß die Unterlassung der Vorlage durch die Berufungsinstanz nicht mehr zu korrigieren war {Dauses , Das Vorabentscheidungsverfahren, S. 120 bei Fn. 449; Gert Meier, Zur Einwirkung des Gemeinschaftsrechts auf nationales Verfahrensrecht im Falle höchstrichterlicher Vertragsverletzungen, EuZW 1991, S. 11 ff.). 32 Hirsch a. a. O. S. 2463.
Zum Thema „Politiker und Staatsmann". Eine Skizze Von Gerd Habermann 1. Zu den seit langem vernachlässigten Themen der politischen Wissenschaft und politischen Philosophie gehört die Frage, welche Qualitäten einen „Staatsmann" im Unterschied zum „bloßen Politiker" auszeichnen und welches spezifische „Ethos" ihn diszipliniert. Die Unterscheidung zwischen Staatsmann und Politiker ist aus dem unreflektierten Sprachgebrauch des Alltags jedem geläufig. Es ist eine Frage danach, welche Anforderungen an den Träger eines politischen Amtes zu stellen sind. Andererseits bildet sich aus entsprechenden Erwartungen ein verpflichtender Verhaltenskodex für die politische Elite. Fragestellungen dieser Art haben auch Prof. Dr. Edgar Michael Wenz im Zusammenhang seines politisch-philosophischen Nachdenkens interessiert. So beteiligte er sich an der Debatte über Demokratiereform und machte hierzu interessante praktische Vorschläge. Eine Erörterung dieser Frage erscheint umso wichtiger, als der Verfall der politischen Kunst in Deutschland - zusammen mit seiner „ordnungspolitischen Verwahrlosung" (Gerhard Schwarz) - immer deutlicher wird. Die politische Unzufriedenheit in Deutschland wächst im Gleichschritt mit dem Berg ungelöster Probleme und der offenkundigen Hilflosigkeit maßgebender Entscheidungsträger. Obwohl sie doch die wichtigsten Träger existentieller Entscheidungen über die Bürger sind, ist ihr Ansehen gegenwärtig auf einem Tiefpunkt angelangt. Als „unsichere und eingeschüchterte Geschöpfe" charakterisierte demokratische Politiker schon vor Jahrzehnten einmal der amerikanische Publizist Walter Lippman1. Sie hätten selten das Gefühl, daß sie sich den Luxus leisten könnten, dem Volk die Wahrheit zu sagen. Die entscheidende Erwägung für sie sei nicht, ob eine vorgeschlagene Maßnahme gut, sondern ob sie „populär" sei. „Ständig haben sie lachende Gesichter", schrieb der Philosoph Karl Jaspers2, „es ist, als ob die Welt erwarte, daß sie heiter sein mögen, sich in einem starren, undurchdringlichen Lächeln oder in einem jovial vergnügten, gutmütig zufriedenen oder einem erstaunt betroffenen Grinsen oder in anderen Abwandlungen verstecken". Er fährt fort: „Der Politiker heute scheint zu wollen, weil andere wollen, weil er meint, daß sie wollen und weil er sich orientiert an denen, die selber nicht 1
Walter Lippman: Philosophia Publica, München 1957, S. 35 ff. Karl Jaspers: Die Atombombe und die Zukunft des Menschen, München 1961, vgl. auch Jaspers: Wohin treibt die Bundesrepublik?, München 1966. 2
458
Gerd Habermann
wissen, was sie wollen. Niemand will eigentlich und alle wollen, weil alle meinen, daß die anderen wollen". Was die Schriften Hans-Herbert von Arnims diesen Beobachtungen hinzufügen, verdunkelt noch stärker das Bild einer „politischen Klasse", die statesmanship in bestürzendem Maße vermissen läßt. 2. Theoretiker des Liberalismus und der Demokratie haben sich auf das Thema statesmanship allenfalls beiläufig eingelassen. Für Liberale steht traditionell die Frage nach den Grenzen legitimer staatlicher Tätigkeit und der Sicherung individueller Freiheit gegen staatliche Willkür im Vordergrund. Ich erinnere an Wilhelm von Humboldts Meisterwerk eines „Versuchs, die Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu bestimmen" (1792). Dieses Buch ist in einer demokratisch legitimierten Wohlfahrtsdiktatur so aktuell wie im „aufgeklärten Absolutismus" seiner Zeit. Aber auch im Ultraminimalstaat bleiben existentielle politische Aufgaben zu lösen und stellt sich dementsprechend nicht nur die viel diskutierte Frage nach der Staatsform („Wer soll herrschen?"), die entschiedene Liberale wie Karl Popper für zweitrangig erklären, sondern auch nach der Beschaffenheit des politischen Personals, seinem „Ethos" und den Erfolgskriterien seines Handelns. Diese Frage wird nicht dadurch gelöst, daß auf demokratische Auswahlverfahren und Mehrheitsentscheidungen oder auf die Volkssouveränität verwiesen wird. Die Ansicht, es würden in einer Demokratie sozusagen alle und damit keiner herrschen, stimmt ja selbst für eine gut ausgebaute Direktdemokratie wie die Schweiz nicht, wenngleich dort die Herrschaft einer Berufspolitikerkaste durch „Volksrechte" weitgehend verhindert werden konnte. In Deutschland, wo das Repräsentativprinzip namentlich auf Bundesebene strikt durchgeführt ist, kann erst recht nicht davon die Rede sein. So bleibt auch hier die Frage nach dem „Berufsbild" der Gewählten - nach dem, was wir von ihnen erwarten und dem, was sie von sich fordern müssen, ja, es erhebt sich diese Frage gerade in einer Demokratie, in der das politische Personal, soweit es nicht verbeamtet ist, periodisch alle Jahre zur Disposition steht und zudem der politische Nachwuchs nicht - wie in einer Monarchie sorgfältig auf sein zukünftiges Amt vorbereitet wird 3 . So verfügen demokratische Politiker meistens nur über ein eher beiläufig erworbenes, verstreutes Fachwissen und allenfalls eine empirische Kenntnis des Machterwerbs und der Machtbehauptung gegen Konkurrenten. Es gibt für diesen wichtigsten Tätigkeitsbereich einer Gesellschaft keine „obligatorischen Befähigungsnachweise", wie ihn die deutsche Handwerksordnung für jeden Bäcker oder Gebäudereiniger für notwendig erklärt. Ist dies nicht ein wunder Punkt jeder Demokratie? Und doch sind die politischen Ämter heute genauso existentiell wie zu irgendeiner anderen Zeit. Sie sind es, in denen über „life, liberty und property" der Bürger, über das Schicksal des Ganzen als Gemeinsamen entschieden wird, wie wir gegenwärtig in der internationalen Finanzkrise wieder deutlich spüren. Dennoch findet eine Diskussion über Ethos und Ethik der Politiker noch nicht einmal ansatzweise, oder wenn, dann mit irre3
Aus diesem Grund u. a. plädiert ein zeitgenössischer Autor wie Erik Kuehnelt-Leddihn für die Monarchie, S. sein: Demokratie, eine Analyse, Graz - Stuttgart 1966.
»Politiker und Staatsmann"
459
führenden Akzenten, statt. Die Politiker selber fühlen meistens nicht mehr den Mangel eines solchen Diskurses. Dies steht im Kontrast zur ausführlichen Diskussion über ökonomische leadership, wie er in der Privatwirtschaft seit Jahren unter den Titeln „Unternehmensethik" und „Führungskultur" im Gang ist. So muß das Ansehen der Politiker immer weiter sinken. Die Po//f//:verdrossenheit der Bürger ist vor allem eine Politikerwerdrossenheit. Allzu enge Ansätze wie die „ökonomische Theorie der demokratischen Politiker" als Wählerstimmen - und Einkommensmaximierer, wie sie Joseph Schumpeter und zeitgenössische Amerikaner wie James Buchanan begründeten, lassen diesen Mangel nur noch deutlicher hervortreten. 3. Kein Problem gibt es in dieser Hinsicht für den amerikanischen Anarcho-Liberalismus, der die Meinung verkündet, die beste Regierung sei die, die überhaupt nicht regiere, also gar nicht vorhanden sei. Für ihn - Theoretiker wie Jay Nock, Murray N. Rothbard oder Hans Hermann Hoppe - ist der Staat an sich eine illegitime Einrichtung, da er mit Zwangsmitteln hierarchische Herrschaftsformen aufrecht erhält und mit viel Aufwand und Getöse Freiheit und Eigentum der Bürger eher gefährdet, statt, wie es sein sollte, sichert. Diese Schule betrachtet das politische Personal - gleichgültig, nach welchem von der Mehrheit für legitim gehaltenen Verfahren es sich rekrutiert - als „Räuberbande", den Steuer- und Abgabenzwang als Plünderung, den Wehrzwang als Sklaverei und den Schulzwang als „Kidnapping". Für das „Ethos" der politischen Gangster haben Theoretiker dieser Richtung allenfalls zynische Bemerkungen. Es kommt ihnen darauf an, den Staat insgesamt zu beseitigen („Abolitionismus") und das Reich der Freiheit, eine spontane Privateigentumsordnung nach dem Gesetz von Angebot und Nachfrage auch bei der „Sicherheits- und Rechtsproduktion" herzustellen4. 4. Ausgiebig diskutiert wurde das Problem der statesmanship hingegen in der älteren politischen Theorie, von der europäischen Antike bis ins 19. Jahrhundert hinein. Auch aus anderen Kulturkreisen (China, Indien) liegen zu dieser Frage gewichtige Texte vor. Schon aus der Gegenüberstellung von Perikles und Kleon bei Thukydides läßt sich eine Theorie des Staatsmannes gegenüber dem „bloßen Politiker" ziehen. Vertieft wird diese Frage bei Aristoteles erörtert. Aus seiner Gegenüberstellung der „guten" und der entarteten Staatsformen und ihrer psychologischen Dynamik, läßt sich eine Theorie des „guten" und des „schlechten" Politikers entwickeln. Auch widmet Aristoteles der staatsbürgerlichen Erziehung in seiner „Politie", wie er eine „gute" Demokratie im Unterschied zur Pöbelherrschaft nennt, breite Aufmerksamkeit (Politik VII, 14) (diese Erziehung ist heute zu einem sozialkundlichen Nichts verflacht). Ähnlich steht es bei Piaton. Sehen wir einmal von Piatons utopischer Idee der Eigentums- und Familienlosigkeit der „herrschenden Klasse" (als Mittel gegen ihre 4 Vgl. zur anarchokapitalistischen Schule Gerd Habermann: Der Liberalismus und die Libertarians, in: Ordo, Jahrbuch für die Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft, Bd. 47, S. 121 ff.
460
Gerd Habermann
Korruption) und überhaupt von seinem totalitären Ansatz ab, bleiben doch viele seiner Vorschläge für eine Erziehung der politischen Elite (Politela, VII) interessant. Sein Ideal des „Gentleman-Politikers" umfaßt Körper, Geist und Seele. Neben körperlicher Schönheit wird auf charakterliche Zucht, musische Ausbildung, umfassende Fachkenntnis in Verwaltung und Militärwesen sowie theoretisch-philosophische Schulung und Einsicht Wert gelegt. Diese Diskussion wurde in Rom fortgeführt (Polybios/Cicero). Mit dem Aufkommen der monarchischen Herrschaftsform zur Zeit des Hellenismus und später im kaiserlichen Rom verengt sich die Diskussion auf die Frage nach der idealen Beschaffenheit eines Monarchen. Der Prototyp für diese Gattung ist die Kyropädie des Xenophon. Später wird Seneca (De dementia) zu diesem Punkt schreiben. Es bildet sich die Tradition der sogenannten Fürstenspiegel, die bis ins 19. Jahrhundert reicht, als es mit diesen „Fürsten" zu Ende ging. Aus dieser reich entwickelten politischen Literaturgattung 5 läßt sich Allgemeingültiges für die Theorie des politischen Ethos und die Qualität des politischen Personals ziehen. Schon an der Kyropädie läßt sich beispielsweise zeigen, daß der Fürst sich nicht wie ein beliebiger Privatmann verhalten darf (besonders im VIII. Buch). Der gegenwärtige amerikanische Präsident mißachtete diese Lehre zu seinem Schaden. Ein Politiker darf nicht nur „Mensch wie du und ich" sein. Sein Auftrag ist eben nicht nur die Ausübung eines beliebigen Gewerbes, wie etwa eines Käsehändlers, sondern die Herrschaft über andere, die Verantwortung für „das Ganze", für die res publica. Zur Ausübung dieser Funktion sind höchste Anforderungen im Interesse aller unvermeidlich. Was in diesen und anderen Fürstenspiegeln zur Charaktererziehung, Belastbarkeit und besonders auch zu materiellen Herrschaftsidealen (Gerechtigkeit als „Eunomia" und Gleichheit vor dem Gesetz, Friedenssicherung, äußere Stärke des Gemeinwesens) gesagt wird, läßt sich ohne weiteres auf demokratisch gewählte Herrscher übertragen. Besondere Eigenschaften des exemplarischen Herrschers Kyros, auf die Xenophon in seiner Schilderung besonderen Wert legt, sind: Mäßigung in allen Dingen, die Fähigkeit, große Strapazen zu erdulden, die Kunst der Menschenführung, Besonnenheit und Selbstbeherrschung und das Vergnügen am „Geben", also eine gewisse Freigebigkeit (bei diesem Punkt sind wir wohl heute eher zurückhaltend, soweit sie sich aus Steuermitteln speist). 5. Für die antiken Theoretiker bot die Zwangsanwendung als Mittel der Politik keinen Anlaß zur moralischen Skrupeln. Das „Ethos" des Politischen wurde akzeptiert. Auch Plutarchs großartige Portraits sind sind im ganzen insoweit „moralinfrei". Oder man lese nach, wie unsentimental-wertfrei Aristoteles selbst die Mittel zur Erhaltung der Tyrannis und die Notwendigkeit einer Geheimpolizei erörtert (Politik V, 11). Dem hatte Machiavelli nur wenig hinzuzufügen. Dies ändert sich 5 Vgl. hierzu: Wilhelm Berges: Die Fürstenspiegel des hohen und späten Mittelalters, Göttingen 1938; Hans-Otto Mühleisen, Theo Stammen und Michael Phillip: Fürstenspiegel der frühen Neuzeit, Frankfurt/M., Leipzig 1997 (Bibliothek des deutschen Staatsdenkens, Bd. 6). Dank an Bengt Hofmann, Nicole Westig-Keune und Gerd Maximilian Grübel für freundliche Zuarbeit im Wintersemester 1997/98.
Politiker und Staatsmann"
461
mit dem Sieg des Christentums. Eine utopische Liebesethik mit dem Gebot der Feindesliebe und absolutem Geltungsanspruch mußte in schärfsten Widerspruch zum politischen Ethos geraten. Vergeblich kämpfte die römische Staatsräson gegen die „Entpolitisierung" der römischen Bürger an (siehe dazu namentlich Edward Gibbons berühmte Darstellung der Schicksale des Römischen Reiches). Mehr als notgedrungene, pessimistische Zugeständnisse wie bei Augustinus oder Martin Luther sind von einer solchen Lehre nicht zu erwarten. Erst Machiavelli schließt, vielfach angegriffen, wieder an die antike Tradition an. Die „Staatsräson" oder politische Erfolgslehre, deren berühmtester Theoretiker er geworden ist, hat direkte Konsequenzen für das spezifische Ethos des Staatsmannes, die Art seiner Handlungsdisziplin, wenn er, mit dem Ausdruck Bismarcks, „dienstlich an der Bresche steht". Bismarck (z. B. in seinem Briefwechsel mit E. L. von Gerlach) und später Max Weber zeigen praktisch bzw. theoretisch auf, worin dieses Ethos und seine Imperative für das politische Handeln im besonderen besteht. Max Weber stellt die politische „Verantwortungsethik" einer unverantwortlichen „Gesinnungsethik" gegenüber, die für die Folgen ihres Handelns nicht aufkommen will (sondern sie „Gott" - oder funktionalen Äquivalenten - „anheim stellt"). Die Folge dieser irrationalen Einstellung sei nur, daß „das Böse" - die ungezügelte Gewaltanwendung gegen Menschen - überhand nehmen (6). 6. Die Diskussion zum Thema „Staatsmann und Politiker" tritt im 20. Jahrhundert - nach dem Triumph der demokratischen Staatsform und fast gleichzeitig damit totalitärer Entartung politischer Herrschaft in einigen führenden Ländern mehr und mehr zurück. Sowohl Liberalismus wie Demokratie sind ja herrschaftskritisch, betrachten die Herrschaft von Menschen über Menschen als allenfalls notwendiges Übel. Dieser Standpunkt erschwerte die Diskussion und führte zum Abbrechen der Tradition der „Fürstenspiegel". Noch einmal im großen Stil wird dieses Thema bei Karl Jaspers abgehandelt und jüngstens hat Hans-Peter Schwarz in einem großartigen Wurf, der vielfach an Plutarch erinnert, eine Typologie politischen Führertums im 19. und 20. Jahrhundert gegeben6. Einen wichtigen Teilaspekt behandelt John F. Kennedy in seinem Buch „Zivilcourage" und in seinen Reden, die, ähnlich wie z. B. die Erinnerungen Margaret Thatchers (1993/95), 6 Vgl. das schon in Anmerkung 1 zitierte Buch von Karl Jaspers: Die Atombombe und die Zukunft des Menschen, S. 216 ff.; Hans-Peter Schwarz: Das Gesicht des 20. Jahrhunderts (München 1998). Dieses faszinierende Buch erreichte mich leider erst nach Fertigstellung des Essays. Schwarz greift bei seiner empirischen Typologie vielfach auf Jakob Burckhardts fragmentarische Bemerkungen über „historische Größe" (in seinen „Weltgeschichtlichen Betrachtungen") zurück. Auch die heldenverehrenden Essays von Thomas Carlyle und Ralph Waldo Emerson sind in diesem Zusammenhang anregend - wie auch die gegensätzlichen Bewertungen von Voltaire, Benjamin Constant oder Karl Popper. Ludwig Reiners in seinem lesenswerten „Roman der Staatskunst" (München 1968) gibt drei Kriterien zur Beurteilung des staatsmännischen Handelns: das praktisch-eudämonistische („Was hat dieser Staatsmann für das Glück seines Volks geleistet?"); das ethische Kriterium: ob seine Arbeit Werten wie Güte, Freiheit und Gerechtigkeit gedient hat; schließlich:
462
Gerd Habermann
eine vorzügliche Quelle für die Identifizierung des politischen Ethos sind. Was sonst zum Thema statesmanship erschien, ist fragmentarisch und eher dürftig 7. 7. Auch der indische Kulturkreis hat Betrachtungen zu diesem Thema hervorgebracht. Die Arthashastra des Kautilya ζ. B. enthält auch eine Beschreibung des Ideals des „guten4' Herrschers und seiner Erziehung und stellt diesem das schlechte Gegenbild gegenüber, ganz ähnlich wie antike Fürstenspiegel8. Hier wie in der „Bhagavadgita" (18. Gesang) wird in großer Konsequenz (mit entsprechend brutalen Ratschlägen) das Eigenethos des Staatsmannes oder die Sachlogik politischen Handelns herausgearbeitet. Die Bhagavadgita - in dem Dialog des jungen Fürsten Arjuna mit Krischna - will zeigen, daß die politische Sphäre im Rahmen allgemeiner Weltgesetzlichkeit ihre eigene Logik hat, die man nicht ungestraft mißachtet. Sie verteidigt sogar den Verwandtenmord aus „Staatsräson". Hier würde Konfuzius, dem Familienloyalität über Staatsräson geht, Einspruch einlegen. Der getreue Konfuzianer deckt auch einen Mord seines Vaters gegenüber staatlichem Verfolgungsanspruch. 8. Vielfach Brauchbares für die Debatte um die notwendigen charakterlichen Qualitäten des Staatsmannes, seiner Tugenden, im Vergleich zu einem „gewöhnlichen" Politiker sowie zu den Leitsternen des Regierens unter Beachtung der Weltgesetzlichkeit bietet die Diskussion der konfuzianischen Schule Chinas. Konfuzius ist unerschöpflich in der Gegenüberstellung der Eigenschaften des „Edlen" (des Staatsmannes) und des „Gemeinen" (des „bloßen Politikers"). Dieser Edle ist nach ihm zum Beispiel wohl wollend und mild gegen andere, gegen sich selber aber streng nach dem Gebot der Pflicht; er stellt Anforderungen an sich selbst, während der Gemeine Anforderungen an andere stellt, von denen er sich selber ausnimmt. „Ob der Glanz seiner Laufbahn, der einheitliche Stil seiner Lebensführung unser Schönheitsgefühl befriedigen" - das ästhetische Kriterium. Ich würde als das oberste Kriterium die „evolutorische Effizienz" seines Handelns herausstellen, also die Frage, ob sein Handeln geeignet war, den Erhaltungs- und Überlebensinteressen des jeweiligen Volkes in einer Welt allgemeinen Wettbewerbs zu dienen. Zum Beispiel hat sich ein Staatsmann nicht bewährt, wenn er durch „Bürokratisierung" und Umverteilung die unternehmerischen und spontanen Kräfte lähmt (Indikatoren: Staatsquote, Investitionsrate usw.). 7 Vgl. Erich Schwinge: Der Staatsmann, Anspruch und Wirklichkeit in der Politik, München 1983; Guy Kirsch, Klaus Maxscheidt: Staatsmann, Demagoge, Amtsinhaber, Göttingen 1985. Dank an Gregor Schmitz. 8 Vgl. J. J. Meyer: Das altindische Buch vom Welt- und Staatsleben, Leipzig 1926, Neudruck 1977; dazu Klaus Mylius: Geschichte der altindischen Literatur, Bern, München, Wien 1988, S. 253 ff. Siehe zum politischen Denken Alt-Indiens auch: Alfred Hillebrandt: Altindische Politik, Jena 1923 und Heinrich Zimmer: Philosophie und Religion Indiens, Frankfurt/ M. 1973, S. 89 ff. Nach Kautilya hat sich der indische Staatsmann mit Philosophie, VedaStudium, Ökonomie und Regierungskunst zu beschäftigen, wobei die Philosophie (!) wie bei Piaton als Grundlage angesehen wird. Den vollkommenen Herrscher beschreibt Kautilya u. a. als „ledig der Liebe und des Hasses, der Habgier und des Hochmuts, der Fahrigkeit, der Hitzigkeit (oder Hast) und der Verleumdungssucht, freundlich im Umgang, beim Reden mit den Leuten lächelnd und doch dabei vornehm erhaben, der Unterweisung der Erfahrenen nachlebend" (nach der Ausgabe von Meyer, S. 398).
»Politiker und Staatsmann"
463
Er bewegt sich stets so, daß sein Auftreten zu jeder Zeit als allgemeines Beispiel dienen kann. Er leidet nicht darunter, daß man ihn nicht kennt; er arbeitet ständig an seiner Verbesserung. Er sorgt dafür, „daß er eine Eigenschaft erst selber besitzt, ehe er sie von anderen verlangt, und daß er einen Fehler erst selbst abgelegt hat, bevor er ihn an anderen tadelt"9. Wie das konfuzianische Ethos in Praxis auf die besten Herrscher Chinas gewirkt hat, dafür liegen eindrucksvolle Zeugnisse vor 10 . 9. Faßt man diese Diskussion zusammen, so ergibt sich, daß eine „Theorie des Staatsmanns", die wir an dieser Stelle leider nicht geben können, besonders folgende Elemente enthalten müßte: Eine Ethik der Politik mit dem Zentrum der „Staatsräson" zunächst; sodann ein daraus entwickeltes ideales Ethos des Staatsmannes, was seine Ziele und die legitimen Mittel sowie die Disziplin seines Handelns betrifft (hier würden auch politische Klugheitslehren nach Art des „Reineke Fuchs" oder des indischen Pantschatantra hingehören); ferner einen Verhaltenskodex für die politische Elite, die auch die Erwartungen an die charakterlichen und physischen Eigenschaften der Herrschaftsanwärter umfaßt mit einer entsprechenden Pädagogik für den politischen Nachwuchs. In einer Demokratie, in der die statesmanship durch das gleiche Wahlrecht in gewissem Umfang verallgemeinert ist, müßte dem auf Seiten der Bürger eine staatsbürgerliche Erziehung entsprechen, die seine Rollen als Herrscher (im Rahmen der „Volkssouveränität") und andererseits des gesetzestreuen, loyalen und wachsamen Bürgers darstellt. Hierfür bietet die „Religion des guten Bürgers" eines modernen Konfuzianers namens Ku Hu Ming nützliche Betrachtungen 11. Es ist für mich nicht zweifelhaft, daß - wie schon in chinesischen, ägyptischen, indischen Staatslehren - die „Ordnungspolitik" oder Ordnungstheorie ein wichtiger Teil der „Staatsräson" bilden müßte. Es müßte dem Staatsmann klar werden, welche Sachgesetzlichkeiten der sozialen Ordnung und im speziellen der Ökonomie er politisch zu beachten hat. Verantwortlichen Politikern müßte bewußt sein, daß die „soziale Ordnung" das Ergebnis eines historischen Siebungsprozesses nach dem Kriterium „evolutorischer Effizienz" ist, sich daher nicht beliebig durch ein herrscherliches „fiat" gestalten läßt. „Kritischer" Rationalismus müßte so einen 9 Siehe Kung-Futse: Gespräche, Lun Yü, übersetzt von Richard Wilhelm, Köln, Düsseldorf 1980, S. 158; Li Gi, das Buch der Riten, übersetzt von Richard Wilhelm, Köln, Düsseldorf 1981, S. 51. In letzterem auch ausführliche Betrachtungen zur Erziehung des Herrschers. 10 Vgl. z. B. „Aus den neun Geboten für den Kaiser Zhu Xi" (1130 bis 1200), die in dem Katalog der Ausstellung „Europa und die Kaiser von China" abgedruckt sind, Frankfurt/M. 1985 (Insel-Verlag). Vgl. auch Franz Kuhn: Chinesische Staatskunst, Bremen 1947. 11 Vgl. Ku Hu Ming : Chinesische Verteidigung gegen europäische Ideen, Jena 1921 mit der Ansicht (S. 37) „Die Religion des guten Bürgers kann die Bevölkerung eines Landes ohne Priester, Schutzleuten und Soldaten in Ordnung halten". In der Tat wurde das chinesische Reich - im Vergleich zu europäischen Staaten - mit erheblich weniger Militär und Polizei regiert; im konfuzianisch geprägten Japan liegt die Kriminalitätsrate noch heute weit unter vergleichbaren Ziffern aus Europa oder gar den USA.
464
Gerd Habermann
wesentlichen Teil der Herrschaftslehre ausmachen. Die politische Erziehung müßte den Herrschaftsanwärtern Bescheidenheit und die Grenzen „planender Vernunft" lehren. Hierfür kann die liberale Wirtschaftslehre und der Evolutionismus Friedrich August von Hayeks Entscheidendes bieten. Die politische Ordnung kann eben immer nur einen äußeren, freilich unentbehrlichen Rahmen für eine sich im ganzen selbst regulierende spontane Ordnung der Gesellschaft bieten. Der Sozialismus scheiterte daran, daß er dies vergaß - und er hat dabei die schrecklichsten politischen Monster hervorgebracht, wie Hans-Peter Schwarz in seinem erwähnten Meisterwerk eindrucksvoll zeigt. In Zeiten „ordnungspolitischer Verwahrlosung", in denen die Politiker dieses übersehen und - im Zeichen des Versorgungs- Steuer- und Schuldenstaates - beliebig Vertragsfreiheit und Eigentum der Bürger manipulieren, muß dies nicht nur zum ökonomischen Rückgang, sondern auch zur Irritation der Bürger führen, die sich als Politikerverdrossenheit, Rückzug in die Schattenwirtschaft oder ins Privatleben, in Kapitalverbrauch, wo nicht Kapitalflucht und schließlich irrationalen politischen Wahlentscheidungen kundgibt. Das nach großen politischen Katastrophen in seinem Selbstverständnis verunsicherte deutsche Volk könnte für Letzteres besonders empfänglich sein - zumal bei Politikern ohne statesmanship, die „bloße Politiker" in den Schönwetterphasen eines fetischisierten Wirtschaftswachstums sind.
Reform der Staatstätigkeit durch experimentelle Rechtsetzung* Von Carl Bohret
„Die Wirkung eines beabsichtigten Gesetzes auf das praktische Leben im voraus zu beurteilen, wird aber auch der Ressortminister nicht im Stande sein, wenn er selbst ein einseitiges Product der Bürokratie ist, noch viel weniger aber seine Collegen." (Bismarck, 1898)
I. Zusammenhänge Es geht aber in den modernen Übergangsgesellschaften immer mehr um dieses dazu „im Stande sein4', die Auswirkungen einer Rechtsvorschrift im voraus beurteilen zu können, - weil die gewollten und unerwünschten Effekte der Normen gesellschaftlich bewertet werden, administrativ umsetzbar und verträglich sein sollten, - weil die Optimierung der Staatstätigkeit (weniger Aufgaben, aber diese besser verrichtet; effektiver Resssourceneinsatz und paßgenaue rechtliche Gestaltung) immer schwieriger wird. 1 Je besser die potentiellen Folgen eines Gesetzes bzw. von Regelungsalternativen vor dessen / deren Inkrafttreten abgeschätzt werden, desto eher können staatsreformerische Regelungsintentionen realisiert werden. Je wirkungsvoller, kostensparender und akzeptabler eine Rechtsvorschrift sein soll, desto nützlicher ist ihre testweise Erprobung (Praktikabilität) im Entwurfsstadium. Je häufiger im Vorstadium des alternativen Entwerfens ernsthaft „experimentiert 44 wird (Prüfstand), desto mehr lernen wir über die experimentellen Möglichkeiten und die Systemreaktionen. Es bildet sich immer mehr heraus, daß im Mo* Bernhard Theobald, Mag. rer. pubi., bin ich für Vorarbeiten und viele Anregungen dankbar. 1 Zu hohe Regelungsdichte und stark ausgeprägte Regelungstiefe engen eine moderate Politiksteuerung ein, verlängern (Genehmigungs-)Verfahren, bewirken „Verdrossenheit" und agieren am Gesetz vorbei. 30 Gedächtnisschrift Wenz
Carl Bohret
466
dernisierungsparadigma (vgl. Abb. 1) der Regelungsoptimierung und damit der experimentellen Rechtsetzung eine reformbedeutsame Rolle zukommt.
Verwaltungspolitik
Aufgaben
Personal
Effektierung
Regelungsoptimierung
Abb. 1 : Pentagramm - Reform von Staatstätigkeit und Verwaltungsmodernisierung
II. Experimentelle Rechtsetzung - was ist das? Edgar Michael Wenz sympathisierte mit den Ideen einer experimentellen Rechtsetzung: dem „Prüfstand für Gesetzentwürfe", einer Folgenabschätzung alternativer Regelungsvorhaben, wie der ex-post Kontrolle verabschiedeter Rechtsvorschriften (Bewährungsprüfung, Gesetzes„controlling") konnte er einiges abgewinnen. Und E. M. Wenz ermutigte die wenigen, die sich auf dieses schwierige und ungewöhnliche Gebiet wagten. Experimentelle Rechtsetzung steht für eine nicht unbestrittene Grundidee: Angesichts wachsender Schwierigkeiten wirkungsoptimale, zukunftsbeständige und praktikable Rechtsnormen zu erzeugen, sollte vor allem im intentionalen Vorraum, im rechtsförmigen Gestaltungsprozeß möglichst intensive „als-ob"-Studien durchgeführt werden. Und - auch noch immer unentschieden - bei noch verbleibender großer Unentschiedenheit müßte auch zur Terminierung ganzer oder partieller Rechtsvorschriften („Gesetze auf Zeit") gegriffen werden. Seit Gesetze im Zuge der Modernisierungsdiskussion auch als „Produkte" angesehen werden, die prozedural über mehrere Instanzen zustande kommen (vgl. Abb. 2), ist eine erprobende Vorgehensweise wie bei technischen Erzeugnissen (etwa beim Automobil) nicht mehr so seltsam.
Reform der Staatstätigkeit durch experimentelle Rechtsetzung
467
policy
Produkt
Gesetz
politics
Verfahren
Gesetzgebung
Instanzen, Rechtsstaat
Gesetzgeber, Rechtsordnung
polity
Abb. 2: Gesetzgebung in Kategorien des triadischen Politikbegriffs
Zur Markteinführung des neuen Modells kommt es cet. par. erst nach umfangreichen Marktanalysen, konstruktiven Vorüberlegungen, Prototypentests unter erschwerten Bedingungen und Kosten-Effektivitätsanalysen. Der „Elch"-Test bringt auch Extremsituationen ins Kalkül; kostentreibend und marktschädigend, wenn dieses Experiment zu spät kommt (analog: wenn das Gesetz schon „in Kraft" ist), oder nicht vom Produzenten selbst durchgeführt wird. Experimente sind planmäßig angestellte Beobachtungen und Versuche unter künstlich hergestellten, möglichst variablen Bedingungen. Der ultimative Test verbleibt im realen Wirkungsfeld, aber vorher lassen sich doch schon viele Schwierigkeiten wie Unzulänglichkeiten erkennen und reduzieren. Rechtsnormen, die vor Inkrafttreten auf erwartbare Folgen, auf Notwendigkeit, Regelungskorridor und Vollzugs-Praktikabilität geprüft wurden, sind qualitativ besser, erreichen eine höhere Akzeptanz bei den Normadressaten und sind deshalb auch rechtspolitisch wünschenswert. Werden Prüfverfahren auf allen Stufen bei wichtigen Vorhaben - zumindest „empfehlend" - eingeführt, dann läßt sich auch die Vorschriftenmenge reduzieren. Je mehr experimentelle Erfahrungen, desto
Ebene
Phase des Gesetzgebungsprozesses
Forschungsziel, Analytik und Verfahren
Methodik
GFAi.e.S. (prospektive GFA)
Regelungsintention
ex ante-Analyse und Bewertung der Auswirkungen von Regelungsalternativen
Prüfung von Regelungsalternativen mittels Folgenabschätzungen und Szenarios, Restriktionsanalysen
Gesetzestests (begleitende GFA)
Referentenentwurf
Vollzugspraktikabilität, Aufwand; Befolgbarkeit, Konsistenz; Terminierung
Praxistest, Planspiele, Kosten-Nutzen-Untersuchungen, Implementationsanalyse
Bewährungsprüfung (retrospektive GFA)
bestehende oder „historische" Regelung
ex post-Analyse, Novellierungsdruck
Evaluationsverfahren, „Gesetzescontrolling"
Abb. 3: Konkretisierungsstufen der „experimentellen Gesetzgebung" 30*
468
Carl Bohret
höher der Lerneffekt, die rechtliche Gestaltung des nächsten RegelungsVorhabens. Wir unterscheiden nunmehr die in Abb. 3 zusammengestellten Versuchsebenen; insbes. nach zeitlicher Phase und methodischem Ansatz.
Exkurs: „Gesetze auf Zeit" In jüngerer Zeit wird ein besonderer Erprobungstyp: das sog. „Gesetz auf Zeit" (auch „Zeitgesetz"; terminiertes rechtsförmiges „Programm") diskutiert. Es handelt sich hier um ein Experiment mit nahem Bezug zur Wirklichkeit. Wir kennen zwei Varianten, die unmittelbare, wirkungsunabhängige Befristung und die indirekte, vom Erreichen des Regelungszwecks abhängige Befristung von Gesetzen. Wann ist es angemessen, ein „Gesetz auf Zeit" zu wagen? Bei erheblicher Ungewißheit über die voraussichtlichen Wirkungen von Rechtsvorschriften kann es naheliegen, die Geltungsdauer a priori zu befristen, um vor einer nur „unbewußten" Verlängerung ihrer Geltung die gewonnenen Erfahrungen systematisch auszuwerten. Zeitgesetze wären aber auch dort angemessen, wo das Gesetzesziel als relativ stabiler Zustand operationalisiert werden kann, ζ. B. eine Maßnahme zur Senkung des Energieverbrauchs oder zur Kostensenkung im Gesundheitswesen. Die Geltungsdauer würde hier also vom Erreichen des Zielzustands abhängig gemacht. In diesem Fall müßte - anders als bei Rechtsvorschriften mit vorgeschriebener Geltungsdauer - in das Gesetz die Verpflichtung zur periodischen Berichterstattung über die Gesetzeswirkungen aufgenommen werden. Bei Zeitgesetzen sollte gewährleistet sein, daß kontinuierlich oder periodisch Wirkungsanalysen durchgeführt werden, auf deren Grundlage dann über Zielerreichung, Wegfall des Regelungsanlasses oder über notwendige Verlängerung des Geltungszeitraums entschieden werden kann. Um diese Entscheidung treffen zu können, ist es außerdem erforderlich, daß bei Zeitgesetzen in sehr viel stärkerem Umfang als bei unbefristeten Gesetzen die Ziel- und Zwecksetzung der Regelung verdeutlicht wird. Nur dann kann eine Evaluierung der Regelung durchgeführt werden, die Rückschlüsse für Änderung, für eine Beibehaltung der Terminierung oder für eine Geltungsverlängerung erlaubt. Beispiele für Zeitgesetze waren: - die Einführung von „Tempo 100" nach einem mehrjährigen Test, - die Experimentierklausel in § 5b DRiG (Ausbildungsmodelle zur einstufigen Juristenausbildung über eine Laufzeit von 10 Jahren), - das Investitionszulagengesetz vom 23. 12. 1974 (BGBl. I S. 3676), in dem die Anspruchsberechtigung auf Investitonsförderung befristet wird. Potentielle Schwierigkeiten mit dem „Gesetz auf Zeit" ergeben sich aus der problematischen „Beweisbarkeit", ob und wann ein postuliertes Ziel nun eigentlich erreicht ist. Sie liegen möglicherweise in einer leichtfertigen Rechtsetzung: man kann's ja mal ausprobieren, es ist ja korrigierbar. Auch ist eine gewisse „Bedro-
Reform der Staatstätigkeit durch experimentelle Rechtsetzung
469
hung" der Rechtssicherheit nicht auszuschließen: es wird spekuliert und ggfs. abgewartet, was denn „nach der Außerkraftsetzung" kommt bzw. sein wird. Alle Ebenen lassen sich schließlich nach der Stufe ihrer Realitätsnähe unterscheiden (vgl. Abb. 4).
Konkretisierungsgrad (Kriterien)
Stufe
Zeitbezug
mitwirkende Normadressaten
Testfeld
Vorgänge/ Testfälle
antizipiert
simuliert
simuliert
simuliert (Möglichkeiten)
Ο Planspiel
verkürzt
simuliert / real
simuliert
quasi-real (hypothetisch)
Ο Praxistest
verkürzt
real
real (ausgewählt)
real (beschränkt)
Gesetz auf Zeit
real
real
real
real
prospektive GFA Gesetzestests:
Abb. 4: Stufen der Realitätsnähe
I I I . Erfahrungsberichte 1. Tests von Gesetzentwürfen
(als „begleitende G FA")
Mit dem Praxistest zum Referentenentwurf eines Jugendhilfegesetzes des Bundes wurde 1977 erstmals ein rechtsförmiges Regelwerk auf den Prüfstand gestellt. Es folgten Tests in Planspielform: - Test eines Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetzes (1981),
Rheinland-Pfalz
- Test der Verwaltungsvorschriften zum Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz des Bundes (1990). Über alle Erprobungen ist hinreichend berichtet worden, alle erfuhren ein positives Echo in der politischen und administrativen Praxis.2 Die Testergebnisse führten zu wesentlichen Änderungen der jeweiligen Entwürfe. Weitere Anwendungen der Methodik der begleitenden GFA sind jetzt geplant. Nach einer Phase der Konzentration auf Tests ausgewählter Bestimmungen von Referentenenwürfen (begleitende GFA), ist nun mit der prospektiven Gesetzesfol2
Überblick bei C. Bohret: Zuerst testen - dann verabschieden: Erfahrungen mit der Prüfung von Gesetzentwürfen, in: Zeitschrift für Gesetzgebung (ZG), 7. Jg., Heft 3/1992.
Carl Bohret
470
genabschätzung (pGFA) ein neuer Prüftyp für die Frühphase von Regelungsüberlegungen dazu gekommen. Die praktischen Erfahrungen im realen Feld sind allerdings noch sehr spärlich, aber relevant, und sie drängen - weil bisher erfolgreich auf Wiederholung und Verbreitung. Was ist das Besondere an der prospektiven GFA? 2. Prospektive
GFA: prälegislativ!
a) Ansätze einer prälegislativen Analytik Alle reden über sie und viele fordern sie; aber nur wenige kennen sie - und auch das nur schemenhaft. Aber der Druck nimmt zu, wenigstens die besonders folgenreich erscheinenden Regelungsvorhaben etwas genauer vorab zu prüfen und in ihren potentiellen Wirkungen zu antizipieren - und zwar schon bevor mit der legistischen Arbeit i.e.S. (Formulierung von Rechtssätzen) begonnen wird. So sollte die prospektive GFA als eine Art prälegislative Analytik hinreichende Ansatzpunkte für Regelungsfolgen und Nebeneffekte liefern, wenn das Regelungsfeld noch „offen" ist, d. h. wenn noch überlegt wird, ob man (vorzugsweise „die Politik") überhaupt und in welcher „Denk"richtung man eine rechtsförmige Regelung erwägen könnte. Wegen der prinzipiellen Offenheit und Multivalenz des Regelungsfelds erfordert die prospektive GFA deshalb sensitive Problementwicklungsanalysen. Die abgeleiteten Regelungsoptionen müssen bewertet werden: beispielsweise hinsichtlich wünschenswerter Wirksamkeit, langfristiger Zweckerreichung, hinsichtlich der gesellschaftlichen Akzeptanz und Notwendigkeit, hinsichtlich der Belastungen der Adressaten einschließlich der Kostenentwicklung. Im Idealfall entfaltet sich die prospektive GFA in einer Abfolge analytischer und bewertender Schritte; beispielsweise - eine Darstellung des Problemfelds und des potentiellen Regelungsbedarfs (Notwendigkeitsprüfung) , - eine systemanalytische Erfassung der vernetzten Wirkungen, - eine Darstellung relevanter Regelungsalternativen (einschließlich der „Null"-Alternative als optimale Problemlösung), - die Entwicklung von Bewertungsmaßstäben (individuellen, gesellschaftlichen), - die Bewertung von Effekten und längerfristigen Folgen der Regelungsalternativen, wenn möglich bezogen auf unterschiedliche Entwicklungsannahmen („Szenarien"). Prospektive GFA's sind idealiter multidimensionale Folgenanalysen: - Wirksamkeitsprüfung:
kann der beabsichtigte Zweck erreicht werden?
- Nebenwirkungen: wie wirkt sich die potentielle Regelung über den beabsichtigten engeren Zweck hinaus in verschiedenen Bereichen aus (ζ. B. Verwaltungs-
Reform der Staatstätigkeit durch experimentelle Rechtsetzung
471
kosten, Veränderung wirtschaftlicher Rahmendaten, Substitutionseffekte, Akzeptanz). - Welche längerfristigen Folgen hätten die Regelungsalternativen (inkl. einer Nichtregelung) wahrscheinlich, wobei zusätzlich verschiedene gesellschaftliche Entwicklungskorridore („Szenarien") angenommen werden können. - Abwägung von Effekten sten-Analyse).
und Kosten im weiteren Sinne (grobe Effektivitäts-Ko-
Vorzugsweise ist ein interdisziplinärer Arbeitsansatz zu wählen, d. h. die Methoden verschiedener Disziplinen sind zusammenzuführen; vorzuziehen sind multidisziplinär zusammengesetzte Expertenteams, insbes. für die Folgenabschätzungen und die Bewertungen. Auf der Grundlage der so gewonnenen Ergebnisse - eine Regelungsalternative empfiehlt sich besonders - kann dann in der Verwaltung entsprechend dem politischen Auftrag ein Referentenentwurf als rechtsförmige Gestaltung erstellt werden. Dieser kann dann wiederum in einer weiteren Stufe (begleitende GFA) auf Praktikabilität, Vollzugsaufwand, Akzeptanz bei den Normadressaten u. ä. untersucht werden. Bislang gibt es zwei prospektive GFA-„Vor"-Experimente, die letzlich dazu dienten, die Methoden für prälegislative Analysen herauszubilden: - die prospektive GFA zum Problembereich „somatische Gentherapie" (1997), - die prospektive GFA zu einem potentiellen Zeugenschutzgesetz (1997). Das Leitprojekt ist das gemeinsam vom Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung bei der Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer und dem Forschungszentrum Karlsruhe Mitte 1994 initiierte und durchgeführte Projekt „ GFA zu Regelungsalternativen für die somatische Gentherapie u.3 In diesem Projekt wurden erstmals Konzept und Methodik einer prospektiven GFA entwickelt und getestet. Die Abschätzungen erfolgten anhand potentieller Regelungsalternativen sowie unter der Annahme differenter gesellschaftlicher Entwicklungen. Das hier praktizierte Verfahren konnte außerdem etwas vereinfacht angewandt werden auf den potentiellen Entwurf eines Zeugenschutzgesetzes und hat sich auch dabei bewährt. Im Zusammenwirken von Landtagsverwaltung Rheinland-Pfalz, Verwaltungsmodernisierungskommmission Rheinland-Pfalz und Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer konnte - unter Mitwirkung mehrerer Experten - eine richtungsweisende Vorstudie angefertigt werden.4
3 Vgl. Maleika Grün/Benedikt Morsey: Gesetzesfolgenabschätzung; am Beispiel somatische Gentherapie (= Speyerer Forschungsbericht No. 176), Speyer 1997. Projektleitung: Carl Bohret (Speyer) und Hellmut Wagner (Karlsruhe). 4 Lars Brocker: Gesetzesfolgenabschätzung, dargestellt am Beispiel eines Zeugenschutzgesetzes (= VORAN 5, Schriften zur Verwaltungsmodernisierung in Rheinland-Pfalz), Mainz 1997. Der rheinland-pfälzische Innenminister startete eine Bundesratsinitiative für ein wirksames, folgenorientiertes Gesetz.
472
Carl Bohret
In beiden Studien wurde eine relativ aufwendige und zugleich spezielle Vorgehensweise gewählt, die mehrere methodische Ansätze kombiniert. Allerdings: Noch gibt es hierzu keine verbindliche Methodik, zu vielfältig sind ihre Gegenstände und die Fragestellungen (Erkenntnisinteressen). Noch für einige Zeit wird sich das Instrumentarium aus den Experimenten mit der GFA selbst entwickeln und bewähren müssen. Und je nach Zielsetzung und Objekt mehr oder weniger aufwendig sein.
b) Die erste prälegislative „Echt-GFA" Im Auftrag des Ministeriums für Umwelt und Forsten (Rheinland-Pfalz) wurde 1997/98 erstmals eine prospektive GFA zum geplanten Regelungsvorhaben „neues Landeswaldgesetz" erprobt. Für das Vorhaben wurde eine Arbeitsgruppe mit Experten der Forstabteilung des Ministeriums sowie mit Wissenschaftlern der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer gebildet. Die Ministerin und ihr „Büro" waren in jeder Phase beteiligt: eine bedeutsame Hilfe im GFA-Prozeß! Bereits zu Beginn des Vorhabens konnte inhaltliches Wissen, methodischer Sachverstand sowie politische Unterstützung zusammengebracht werden. Die Vorgehensweise wird in Abb. 5 skizziert. Im übrigen wird auf den Arbeitsbericht „GFA WaldG" verwiesen.5 Die grobe Intention („Nachhaltige Waldentwicklung für kommende Generationen bei angemessener ökonomischer Nutzbarkeit") und die konkretisierenden politischen Ziele wurden von der Ministerin vorgegeben.6 Im ersten Arbeits schritt wurde der Regelungsbedarf (Notwendigkeitsprüfung) aus der Kombination von Gesamtentwicklung (Szenarios), Basisintention und systemanalytischen Ergebnissen abgeleitet. Im zweiten Schritt entwickelte die Arbeitsgruppe WaldG drei Programmalternativen, mit deren Hilfe eine Variantenreduzierung erzielbar war. Parallel dazu wurden Methoden zur objektbezogenen Folgenabschätzung diskutiert und empirische Untersuchungen vorbereitet. Eine erste Überprüfung der Überlegungen der „Arbeitsgruppe Waldgesetz" nahmen 16 Forstfachleute aus dem gesamten Bundesgebiet in ganztägigen Expertenrunden vor. Die Experten überprüften die Programmalternativen auf ihre interne Konsistenz (Widerspruchsfreiheit) und schätzten die Folgen der Programmalternativen für die Bereiche Ökologie, Ökonomie, Gesellschaft und Organisation ab. Die 5 Erscheint demnächst als Anlage zum Referentenentwurf eines LWaldG. Vorabinformationen in: Ministerium für Umwelt und Forsten (RP) = Gesetzesfolgenabschätzung für das neue Waldgesetz (Tischvorlage zur Pressekonferenz vom 9. 2. 98, Mainz). 6 Effiziente Waldwirtschaft, ökologische Waldentwicklung, Stärkung der Verantwortung der Waldbesitzer, Stärkung der Verantwortung der Nutzenden, Entlastung der Gemeinden. Dazu als legalistischer Grundsatz: ein schlankes, optimal aufgebautes und gut verständliches Gesetz.
Reform der Staatstätigkeit durch experimentelle Rechtsetzung
473
Abb. 5: GFA prospektiv - Beispiel: Regelungsabsicht LWaldG (RPL) hierfür gewählte Methode der Gruppendiskussion erschien angemessen, da diese offenen Fachgespräche die Beachtung unterschiedlichster Folgenaspekte zuläßt und dadurch Hinweise auf noch nicht beachtete Nebenwirkungen und Folgen gewonnen werden können. M i t Hilfe der Erkenntnisse aus den Expertengesprächen (qualitative Erhebung) wurde i m weiteren ein Erhebungsinstrument für eine schriftliche Befragung der Experten erarbeitet, mit dessen Hilfe die zu erwartenden Folgen in den genannten Bereichen ebenso beurteilt wurden wie kurz- und langfristige Kosteneffekte der Programmalternativen für verschiedene Waldbesitzer, für den Staat als Verwaltungseinheit und für die Waldnutzer. Die Arbeitsgruppe „Waldgesetz" hat zudem zur prospektiven Gesetzesfolgenabschätzung eine grobe Kosten-Effektivitäts-Abschätzung der Programmalternativen vorgenommen. Bei dieser Abschätzung wurden die Erkenntnisse aus der Expertendiskussion und der Expertenbefragung berücksichtigt (vgl. Abb. 6).
474
Carl Bohret Waldstruktur
[Organisation
Waldpädc
'Grundpflichten (Waldbesitzer)
Ausweisung Schutzgebiete (E.B.N.)
Betreten des Waldes
Betreuung durch Forstbehörden
- • - Programm 1 - · - Programm 2 - Δ - Programm 3
Abb. 6: Kosten-Effektivitäts-Verhältnis Die Abschätzung ergab, daß die Programmalternative 1 in allen Kriterien i m Kosten-Effektivitäts-Verhältnis positiver eingeschätzt wurde als die Alternativen 2 und 3. Dies legt die Aussage nahe, daß Programmalternative 1 die effizienteste Lösung darstellt. Die potentiellen Folgen der Regelungsalternativen wurden also mit einem Methodenmix zu ermitteln versucht. Da alle Methoden der Folgenabschätzungen i m Hinblick auf ihre Prognosefähigkeit notwendigerweise („Prospektion") mit Unsicherheit verbunden sind, ist ein solcher Methodenmix und die Einbeziehung möglichst vieler Experten ein praktikabler Weg zur Verminderung von Fehlerquellen und zur Erzielung zuverlässiger Forschungsergebnisse. Aus den Ergebnissen der multidimensionalen Folgenabschätzung wurden Empfehlungen für den nun anstehenden rechtsförmigen Referentenentwurf abgeleitet. Die Erprobung der weiterentwickelten prospektiven Methode auf ein „reales Vorhaben" erbrachte wichtige Erkenntnisse bezüglich der Reichweite und Anwendbarkeit der allgemeinen Folgenanalytik auf abgrenzbare Regelungsabsichten, sowie zur zweckmäßigen Abgrenzung und Überleitung in die begleitende GFA („Testverfahren"). Auch konnte die Differenzierung in bloße Kostenfolgen, Effektivitäts-Kosten-Abschätzungen und Nutzen-Kosten-Analysen verdeutlicht und ebenenspezifisch zugeordnet werden. Die generelle Nützlichkeit der prälegislativen Forschung wurde ebenso bestätigt wie die politische Zweckmäßigkeit einer prospektiven GFA bei wichtigen, neuartigen und / oder betont zukunftsorientierten Regelungsabsichten. Schließlich hilft die prospektive GFA dabei, einige „Prüffragen für Rechtsvorschriften" besser zu beantworten und überhaupt erst anwendbar zu machen (vgl. Abb. 7).
Reform der Staatstätigkeit durch experimentelle Rechtsetzung
475
Prüffragen
Gibt die prospektive GFA eine Antwort?
1. Muß überhaupt etwas geschehen?
Ja, wenn eine System- und Akeursanalyse mit Blick auf unerwünschte Entwicklungen durchgeführt wird
2. Welche Alternativen gibt es?
Es werden Programmalternativen entwickelt
3. Muß der Bund/das Larçd handeln?
siehe Antwort zu 1
4. Muß ein Gesetz gemacht werden?
siehe Antwort zu 1 und ggfs. zu 2
5. Muß jetzt gehandelt werden?
Ja, die Systemanalyse gibt Antwort auf diese Frage
10. Stehen Kosten und Nutzen in einem angemessenen Verhältnis?
soweit Kosten und Nutzen sich aus den Programmalternativen ableiten lassen und verglichen werden können
Abb. 7: Prüffragen
Abb. 8 systematisiert eine typische Vorgehensweise bei der prospektiven GFA.
(mit optimaler Alternative)
Abb. 8
476
Carl Bohret c) Exkurs: Spezielle Aspekte - Kostenfolgenabschätzungen
Überall dort, wo durch Rechtsvorschriften direkte oder indirekte (Leistungs-) Verpflichtungen bei Normadressaten - einschließlich der vollziehenden Verwaltungsebene - vorgesehen sind, besteht verständliches Interesse an den zu erwartenden Belastungen aus neuen oder novellierten Regelungen. Gesetzesfolgenabschätzungen sollen dort hauptsächlich die kostenverursachenden Effekte ermitteln und ggfs. die Belastung verhindern oder doch ausgleichen helfen. Vor allem die kommunale Ebene, aber auch die Wirtschaft, ist an solchen Abschätzungen interessiert. Jede neue Rechtsvorschrift verursacht Kosten (es entstehen eben nicht „keine Kosten"!). Viele Vorschriften belasten Gruppen von Normadressaten - beispielsweise durch die Aufwände für Steuer- oder sozialbedingte Abführungen/Leistungen oder einfach wegen der Ablieferung von Statistiken. Bei kleineren Unternehmen ist die Belastungsquote besonders hoch. 7 Kostenanalysen sollen ermitteln, wie hoch der „Wertverzehr" bei der Beschaffung, Erstellung und Abgabe einer Leistung ist. Wobei zumindest Personal-, Sach- und Finanzierungskosten auszuweisen wären. In Längsschnittbetrachtung sind außerdem die potentiellen (zeitlich erstreckten) Folgekosten zu beachten; also beispielsweise auch der höhere Personalaufwand zur Einführung einer gesetzlich festgelegten Aufgabe usw. Kostenabschätzungen im Zusammenhang mit bzw. als Teil der GFA sind also relevant und gerade in Phasen der Knappheit nicht zuletzt für das angemessen zu gestaltende Verhältnis von Kostenentstehung und Kostenträger (Konnexitätsprinzip) wichtig. Freilich, Kostenfolgenabschätzungen (KFA) stehen bei der prospektiven GFA nicht an erster Stelle 8 - dort geht es vor allem um die Generierung von rechtsförmigen Problemlösungsalternativen. Sie sind aber Sekundäranalysen höchster Priorität, weil der günstigste Mitteleinsatz zu erreichen bzw. finanzielle Überlastungen zu vermeiden sind. KFA's bleiben aber letztlich „ein"seitig, denn mit den Kosten(folgen) entstehen - wenngleich oft mit zeitlicher Verzögerung auch bewertbare Effekte und Nutzen, die letztlich in ein vergleichendes Ergebnis einzubeziehen sind: Kosten werden aufgewendet, um positive Folgen zu bewirken.
7 Vgl. dazu die frühe Studie von Wolf gang Ν old: Die Kosten der Gesetze und Verordnungen in Staat, Wirtschaft und Gesellschaft, 2. Aufl. Konstanz 1983, insbes. S. 184 ff.; ferner Christoph Tiebel: Überwälzte Kosten der Gesetze, Göttingen 1986; sowie C. Bohret/W. Hugger: Test und Prüfung von Gesetzentwürfen. Anleitung zur Vorabkontrolle und Verbesserung von Rechtsvorschriften, Köln/Bonn 1980, 274 S. 8 Es gilt: KFA's sind nur „richtig" im Rahmen einer pGFA, die Wirkungsbereiche und Folgen ermittelt und damit auch die potentiell entstehenden Kosten.
Reform der Staatstätigkeit durch experimentelle Rechtsetzung
477
IV. Wann sollten GFA's von wem angewandt werden? 1. Wann? Die dreistufige GFA kann nicht bei jedem Gesetzesvorhaben angewandt werden; mit einem ökonomisch vertretbaren Aufwand wäre dies kaum zu leisten. Aber auch nicht jedes Regelungsvorhaben ist geeignet für die GFA, ζ. B. nicht die meisten Anpassungs-Novellierungen. Kommt die GFA aber nur selektiv zum Einnsatz, dann müßten Maßstäbe entwickelt werden, um die passenden Gesetzgebungsvorhaben identifizieren zu können. Eine prospektive GFA böte sich vor allem an, - bei einem zu erwartenden hohen Veränderungspotential der Regelungsabsicht (outcome-Bezug) - a) bei zu erwartenden hohen Vollzugs- und/oder Zweckkosten: intern b) bei zu erwartenden hohen Kosten für Dritte: extern (impact-Bezug) - bei zu erwartenden irreversiblen Folgen (outcome-Bezug) - wenn sensible Bereiche berührt werden (ζ. B. Gentechnik, Bildung, bei Grundrechtsrelevanz) (impact-Bezug) - wenn nur langfristig zu steuernde Materien geregelt werden sollen (impact-Bezug) - wenn Interessen berührt werden, die sich nicht oder nur schlecht i m politischen System artikulieren können (Nachwelt i.w.S.) (outcome-Bezug).
2. Von wem? „Jede für eine hohe Entwicklungsstufe geeignete Regierung sollte als eins ihrer Grundelemente in einem kleinen Kollegium von Männern (und Frauen) deren Zahl nicht über die der Mitglieder eines Kabinetts hinausgehen dürfte, eine Gesetzgebungskommission besitzen, die speziell für den Zweck, Gesetze zu machen, ernannt werden sollte ... Sie wäre nur dazu bestimmt, bei (der) Abfassung (der Gesetze) das Element der Einsicht zu vertreten, während das Parlament das des Willens vorstellen würde." (John Stuart Mill, 1861) Bei einem methodisch doch recht aufwendigen, und zugleich Professionalität herausfordernden Verfahren wie der mehrstufigen GFA, kann die Institutionalisierungsfrage nicht gänzlich unberücksichtigt bleiben. Welche der in Abb. 9 zusammengestellten Formen letztlich gewählt und ebenenspezifisch „ausgebaut" wird, hängt auch von der erwarteten GFA-Häufigkeit, dem methodischen Niveau und der politischen Verträglichkeit ab. In jedem Fall müßte in der Startphase externer Sachverstand einbezogen werden. 9 9 Vgl. genauer C. Bohret: Gesetzesfolgenabschätzung: Soll sie institutionalisiert werden? in: K. Grupp/Ronellenfitsch (Hrsg.) Verwaltungsverfahrensrecht - Planungsrecht - Rechtsschutz, Berlin 1999.
Carl Bohret
478 Spontane Einrichtung
- interministerielle AG mit externer Hilfe - Untersuchungsausschuß des Parlaments mit exekutiver und/oder externer Hilfe
Legislative
- Legislativamt - Evaluierungseinheit (GFA-Büro, Wissenschaftlicher Dienst)
Exekutive
- Rechtspflegeministerium - Gesetzes-Controller - Normprüfstelle
Externe „Beauftragte"
- Forschungseinrichtungen - Stiftung GFA - (private) Beratungsinstitute
Abb. 9: Wer macht's, mit was? (Institutionalisierung)
V. Fazit: Wie lauten die Botschaften? 1. Die experimentelle Rechtsetzung in Form der prospektiven und begleitenden Gesetzesfolgenabschätzung hat sich bisher bewährt. Sie ist methodisch schwierig und aufwendig; insoweit also objektgerecht. 2. Die Initiierung, Durchführung und Verwertung der experimentellen Rechtsetzung benötigt überzeugende politische Führung (Wollen, Richtung geben, durchhalten, verwerten). 3. Auch wenn bis heute nur wenige Versuche der GFA wirklich „praktisch" durchgeführt wurden, so dürfen doch alle Real-Experimente als gelungen und i m Sinne des Modernisierungsparadigmas als treffend qualifiziert werden. 4. I m Reform-"Pentagramm" unterstützt die GFA als wesentlicher Anstoß zur Rechtsoptimierung auch die aufgabenanalytische und die verwaltungspolitische Steuerungspotenz. 5. A u f dem Weg in die transindustrielle Gesellschaft, in der sich viele qualitative Veränderungen ergeben, die eine gesteigerte Flexibilisierung auch der Staatstätigkeit erfordert, wird sich die experimentelle Rechtsetzung zunehmend als ein paßgenaues Instrument der Rechtserzeugung erweisen. 6. Die dem Staat zunehmend abverlangte neue Steuerungsfähigkeit erfordert auch eine Rechtsetzung, die zukünftige Entwicklungen der Gesellschaft mitbedenkt und zukunftsbeständige Regelungen folgenanalytisch zu antizipieren vermag. Gesetzesfolgenabschätzungen werden in diesem Entwicklungskorridor nötig und möglich.
Arbeitsrecht und Ökonomie Von Klaus Adomeit
Erdbeben nennt man großräumige Erschütterungen des Bodens, den wir bewohnen, auf dem wir stehen, die durch geologische Veränderungen in der Erdkruste und i m oberen Erdmantel ausgelöst werden. Der Brockhaus unterscheidet Einsturzbeben als Folge der Nachgiebigkeit von Hohlräumen, vulkanische Beben als Begleiterscheinungen von Ausbrüchen aufgestauter Kraft und, so heißt es, die an Zahl und Intensität bei weitem überwiegenden tektonischen oder Dislokationsbeben, die auf Verschiebungen oder Bruchbildungen in den Fundamenten zurückgehen. Für den Boden des Arbeitsrechts ist ein solches Beben zu erwarten. Die tektonischen Massen, die sich gegeneinander verschieben, sind Ökonomie und Recht, wobei die Ökonomie von härterer Substanz ist. Dies bedeutet, wenn man so will, eine materialistische, fast schon marxistische Erkenntnis: der Überbau bewegt sich mit der Basis. Wirtschaftlich indizierte Beben hat es in der Geschichte der Bundesrepublik West schon mehrfach gegeben, besonders spektakulär 1965/66, denn was damals zusammenstürzte, war immerhin ein Bundeskanzler. Ludwig Erhard, mit einer stabilen Mehrheit von Unionsparteien und FDP regierend, kam 1965 in politische Bedrängnis auf seinem ureigenen Gebiet, der Wirtschaftspolitik. Der Weltmarktpreis für Heizöl war stark gefallen (wahrscheinlich schon mit dem taktischen Plan der späteren drastischen Heraufsetzung), der Absatz bei der Kohle ging zurück, die Halden wuchsen, man befürchtete Zechenstillegungen i m Ruhrgebiet. Dies führte zu Protesten der Bergmänner mit Demonstrationszügen und Warnstreiks. I m beginnenden Fernsehzeitalter konnten Millionen dies mitverfolgen. Zu einer klaren Entscheidung konnte sich die Regierung nicht durchringen, Erhard erweckte Empörung mit seinem Wort vom „Gesundschrumpfen' 4 , „downsizing" hätte vielleicht moderner geklungen. Die Landtags wähl in Nordrhein-Westfalen vom Juli 1966 brachte einen politischen Erdrutsch, 49,5 % der Stimmen für die SPD. Wenige Monate später: der Rücktritt. Daraus mußte man zwei Lehren ziehen: 1. Die gemütliche Zeit der „Volkswirtschaft" oder „Nationalökonomie" war vorbei, und gegen weltwirtschaftliche Entwicklungen gibt es keine durchgreifenden einheimischen Rezepte, außer, sich anzupassen.
480
Klaus Adomeit
2. Die Staatsform der Demokratie tut sich besonders schwer, solche Anpassungen vorzunehmen. Die Kausalität ist verwickelt und schwer darstellbar. Man sucht nach Schuldigen, wo es keinen gibt. Erhard mußte den Sündenbock abgeben, ganz i m biblischen Sinne. Man konnte damals die notwendige Anpassung nicht durchführen. Bekanntlich laborieren wir noch heute am Brocken Bergbau, mit gewaltigen Kosten, die nur ein Verlängern und Weiterstrecken der Malaise bringen konnten; einstweilen, so ist die Planung, bis zum Jahre 2005. Die sinnvolle Umleitung der Gelder in Zukunftsprojekte wurde versäumt. Unsere jetzt viel weiter reichende Malaise des gesamten Arbeitsmarktes, die allgemein als dramatisch empfunden wird und ist, steht noch stärker ausgeprägt in weltwirtschaftlichen Zusammenhängen; man hat schon fast Angst, das Wort „Globalisierung" auch nur auszusprechen. Die hier angesprochene Tendenz zur Internationalisierung hat aber viele positive Aspekte, auch juristisch. Eine daraus sich ergebende Konsequenz ist unvermeidlich: die Bedeutung des deutschen Rechts relativiert sich, man fragt sich, bis zu welchem Endpunkt. Wenn V W ein Entwicklungsteam von Ingenieuren zusammenstellt, das rund um den Globus tätig ist und elektronisch verbunden („vernetzt") kooperiert, 24 Stunden, rund um die Uhr, dann wird gerade noch für die Mitwirkenden in Wolfsburg das deutsche Arbeitsrecht gelten, Tele-Arbeit, aber wieso eigentlich mit zwingender Kraft? Art. 30 Einführungsgesetz zum BGB zementiert ein Territorialitätsprinzip aus altvergangener Zeit für unser global unbeträchtliches Territorium. Nicht einmal in Europa, für die Staaten der Union, gibt es Freizügigkeit für Rechtsordnungen. Wir akzeptieren den „Cassis de D i j o n " nach französischem Lebensmittelrecht, aber nicht eine hier errichtete Produktionsstätte nach französischem Arbeitsrecht. Das deutsche Arbeitsrecht schneidet i m internationalen Vergleich aus der Sicht potentieller Investoren nicht gut ab, das bestätigen immer wieder die Fachleute. Zunächst schon quantitativ: viele und langwierige Gesetze; die jede Woche weiter anschwellende Rechtsprechung. Wir haben Einrichtungen geschaffen, die es kaum irgendwo sonst gibt, etwa die erzwingbare Mitbestimmung des Betriebsrates, dessen sanktionierten Unterlassungsanspruch gegen Maßnahmen des Managements. General Motors hat dies aktuell erfahren müssen: ein Gutachten über Möglichkeiten der Rationalisierung in Tochterunternehmen, also eine betriebswirtschaftliche Untersuchung, durfte anderswo erstellt werden, in Schweden, in Großbritannien, bei Opel nicht, angedrohte Geldbuße 500.000 D M . Es ist mir geläufig, daß viele Manager und Unternehmer sich an das BetrVG gewöhnt haben. Wenn es dieses Gesetz nicht gäbe, müßte man es erfinden, so heißt es. Daß es sich trotzdem immer noch um ein Wagnis handelt, zeigt sich am Scheitern aller Versuche, unser Modell auf europäischer Ebene durchzusetzen, und dies erschwert die Freizügigkeit für das Kapital zu uns hinein. Man kann sich in deutsches Denken schwer hineinversetzen, bei Vermittlungsversuchen hört man oft: „Are you crazy?'. Es ist eine zusätzliche Verschärfung der Lage, daß Deutsch nun gewiß nicht die Sprache des Computerzeitalters ist. Entsprechend gering ist unser
Arbeitsrecht und Ökonomie
481
Einfluß auf Entwicklungen in der EU. Der „Euro" geht andere Wege als die schon verabschiedete D M . Das Arbeitsrecht ist in die Standortdiskussion hineingezogen worden, ganz und absolut wider Willen, unvorbereitet, aber auch unschuldig? Bei keinem Gesetz, bei keiner gerichtlichen Entscheidung war bei uns die Frage relevant gewesen: vertreiben wir reale oder potentielle Arbeitgeber nach draußen? Entmutigen wir Auswärtige zu kommen? So etwas in Erwägung zu ziehen, erschien und erscheint immer noch als irgendwie unpassend. (Beim Viessmann-Fall soll der Vorsitzende Richter beim L A G Frankfurt/Main zur Begründung des Vergleichsvorschlags gesagt haben: „Der Weltmarkt nimmt auf das deutsche Tarifrecht keine Rücksicht!" - das wäre allerdings ein Durchbruch! Beim gerichtlichen Vergleich vom Februar 1998 hat die IG Metall nachgegeben. Vgl. Adomeit, Festschrift Hanau 1999, S. 356). Das „unpassend" hat tiefe Gründe, die in der spezifisch deutschen philosophischen Tradition wurzeln. Als ein aufgeweckter Schotte, Adam Smith, 1776 „The Wealth of Nations" publizierte, als perfekte, höchst praktisch angelegte Wirtschaftslehre, kreiste der deutsche Idealismus als völlig andere geistige Welt mit Goethe und Schiller, mit Kant, später Hegel, um erhabene Tugendwerte, man perhorreszierte geradezu ein rationales, eigene Interessen verfolgendes Verhalten. Der Mensch darf den anderen Menschen nie nur als bloßes Mittel ansehen oder verwenden, so Immanuel Kant in romantischer Träumerei. Nichts ist krasser dem entgegengesetzt als die fröhliche Verteidigung des Egoismus bei Adam Smith. Der Bäcker, der frisches Brot anbietet, der Fleischer mit der Wurst dazu, sind keineswegs Altruisten oder Menschenfreunde, so sagt Smith, sondern sie sehen auf ihren Vorteil. Die Ökonomie fördert nach dieser Lehre das Gemeinwohl durch ihre „invisible hand", aber dem traut der deutsche Idealismus nicht, diese Hand ist ihm allzu „invisible" oder sogar schon unrein. Karl Marx, insofern ein Erzidealist, läßt sich in seiner Lehre verstehen als einziger Wutausbruch über den britisch-schottischen Pragmatismus. Man könnte sich ein wirtschaftlich orientiertes Lehrbuch des Arbeitsrechts denken, das wie folgt beginnt: „Von den beiden Seiten des Arbeitsverhältnisses ist in erster Linie wichtig der Arbeitgeber, weil ohne seinen Entschluß einzustellen kein Arbeitsrecht beginnt. Das Motiv des Arbeitgebers wird sein, durch Zusammenarbeit mit dem Eingestellten Geld zu verdienen. Dem Arbeitgeber dazu zu verhelfen, ihn jedenfalls nicht unnötig daran zu hindern, ist eine Aufgabe des Arbeitsrechts." Jeder verspürt, daß dies nicht so gesagt werden darf: es wäre frivol, politically most incorrect. Es war aber ein Fehler unserer arbeitsrechtlichen Dogmatik gewesen, genau konträr anzusetzen: bei der Schutzbedürftigkeit des Arbeitnehmers, die schon zu seiner Definition gehören soll. Die Einstellung, die Begründung des Arbeitsverhältnisses, wird damit zu einer Art Unglücksfall; man muß eilen, dem Eingestellten Hilfe zu leisten. Die Idee von dessen permanenter Schutzbedürftigkeit verfestigt sich dann, wird durchgesetzt ohne kritisches Betrachten ihrer Vorausset31 Gedächtnisschrift Wenz
482
Klaus Adomeit
zungen. In NJW 3 5 / 9 7 habe ich dazu drei Beispiele aus der Rechtsprechung dargestellt: den Werkstudenten, der Gleichstellung begehrt; den Bewerber auf einen für Frauen ausgeschriebenen Arbeitsplatz, der sich „diskriminiert" fühlt; den profiFußballspieler, der sein Urlaubsgeld aus den Prämien für Spieltage aufgestockt sehen möchte. Das Europarecht verschlimmert die Lage sogar noch (Abbo Junker, NJW 1994, 2527). Der Student Nils Draempaehl
war fast sogar zu loben, weil er durch sein
parodistisches oder realsatirisches Vorgehen deutlicher hat werden lassen, wie unsinnig § 611a B G B ist: Entschädigung ohne Schaden. Es ist nicht nachzuprüfen, ob in den fünfzehn Staaten der E U solche Rechtsprechung wirklich - wie bei uns getreulich exerziert wird, es ist auch nicht zu erahnen, ob es demnächst in Polen, Ungarn etc. ernst genommen werden wird. Christel Schmidt, als weiteres Beispiel, war als Raumpflegerin bei ihrer Sparkasse gut aufgehoben, für die Kündigung gab es keine dringenden betrieblichen Erfordernisse, die Sparkasse hätte ihr aus Annahmeverzug den Lohn mit Sozialabgaben bis zum 65. Lebensjahr zahlen müssen; eigentlich lebenslang, weil j a Nicht-Reinigen auch noch mit 66 ff. möglich ist. Der Betriebs- oder Unternehmensübergang ist keine schlimme und zusätzliche Gefahr für den Mitarbeiter, außer wenn er selbst, aus eigenem Antrieb, partout nicht mit übergehen will. Aber seine notwendige Zustimmung zur Schuldübernahme verlangte und hütete schon das alte BGB. Ein Weiterbestehen des Betriebs mit verminderter Belegschaft hatte manch ein Konkursverwalter zu erkämpfen versucht, aber unser Recht w i l l hier nicht helfen, auch kaum das heutige Insolvenzrecht. Es ist schwer zu begreifen, daß „dringende betriebliche Erfordernisse" zwar in § 1 KSchG Eingang gefunden haben, sonst aber nicht i m Arbeitsrecht allgemein zu berücksichtigen sind. Die präziseste Lektion und Belehrung darüber hatte man in Madrid erfahren. Bis heute kann man nicht vergessen die Regierungserklärung von Felipe Gonzalez vom Herbst 1982, der für seine PSOE, die spanische Arbeiterpartei, eine absolute Parlamentsmehrheit errungen hatte, von dem nunmehr extreme sozialistische Interventionen erwartet wurden. Es kam anders. Er sagte: wir müssen interessant sein für ausländische Investoren, unsere rechtlichen Bedingungen darauf einstellen. Die Prominenz der deutschen Autoindustrie ging dann auch, mit vielen Werken, nach Spanien. Anfang der 80er Jahre ließen sich die Zusammenhänge also objektiv unideologisch verstehen. Ein Erdbeben ist zu erwarten; weniger aufregend formuliert: Veränderungen i m Arbeitsrecht. Die politische Diskussion wird beherrscht von der Steuerreform und der Rentenreform (also einer Reform des Sozialrechts). Die Verbindungen zum Arbeitsrecht sind viel enger, als die öffentliche Diskussion eingestehen will. Einstieg wie Ausstieg aus Arbeitsverhältnissen sind Gefährdungszonen für das Sozialrecht. 630-Mark-Verhältnisse oder Teilzeitarbeitsverträge sind eigentlich nicht unser Problem als Arbeitsrechtler, sie werden uns aber als problematisch aufgedrängt. Ähnlich stand / steht es mit Altersruhegeld, jetzt Altersteilzeitarbeit. Die Kündigungs-
Arbeitsrecht und Ökonomie
483
abfindung, ohne die sich die gütliche Beilegung der Massenzahl von Streitigkeiten schwerlich erreichen ließe, hat den Appetit der zuständigen Politiker des Sozialrechts erweckt, soll dem Ausgleich von Defiziten bei der Arbeitslosenversicherung dienen. Neu ist auch die Möglichkeit von Eingliederungsverträgen für Langzeitarbeitslose, die so beliebig sein können, als hätten wir gar kein Arbeitsrecht. Die Verbindungen sind also zu eng, als daß sich die Reform isolieren ließe. I m Steuerrecht, i m Sozialrecht kann man die Notwendigkeit von Veränderungen durch Zahlen belegen, aber noch nicht einmal das hat etwas bewirkt. I m Arbeitsrecht haben wir keine Zahlen, die Arbeitslosen stehen nicht i m System, sondern davor, wir wissen noch nicht einmal, ein Versäumnis der Soziologen, ob wirklich 100 % der Arbeitslosen ein Arbeitsverhältnis begehren, oder nur 95 % oder noch weniger? Die mögliche Kausalität zwischen Arbeitsrecht und Arbeitslosigkeit ist ebenso wenig streng wissenschaftlich zu ermitteln. Hanau hat geschrieben, daß das KSchG weniger Kündigungen als Einstellungen verhindert habe. Es wird also eine Arbeitsrechtsreform geben, wir sind schon mitten drin, mit heftigen, von einer Beharrungsmentalität verursachten Turbulenzen wie bei den Hin-und-Her-Veränderungen i m Recht der Fortzahlung des Arbeitsentgelts bei Krankheit. Das Beschäftigungsförderungsgesetz, das schon 1990 auslaufen sollte, dann 1995, nach der letzten Novelle Ende 2000, alsbald wann?, nimmt immer größeren Raum ein, versucht, Stück für Stück, Vertragsfreiheit wiederherzustellen, wie sie nun einmal Bedingung für eine solide Kalkulation ist. Es ist nur ein Jammer, daß in Deutschland Deregulierung durch neue, besonders verzwickte Regeln, also durch Super-Regulierung erfolgt. I m Kündigungsrecht war zu § 23 KSchG eine Zurücknahme geschehen, die Wiederherstellung des alten Zustandes zum 1.1. 1999 ist schon wieder komplizierter geworden. Es entsteht eine Gerechtigkeitslükke zwischen Betrieben mit und ohne Kündigungsschutz. Es könnte eine vernünftige „arbitration" oder „mediation" diese Lücke füllen, nach Vorbildern aus USamerikanischem Recht, das keineswegs, wie oft weitergegeben wird, nur aus den Worten „hire" und „fire" besteht. Allerdings gibt zu denken, daß man, wenn Freunde einen in den USA herumfahren, vor so vielen Firmen Schilder „We are hiring!" findet. Es fällt uns schwer, i m Recht der USA ein neues Vorbild - Paradigma - zu finden. Das Wort „Paradigmenwechsel" ist fürchterlich philosophisch. In der Fachdiskussion bezeichnet es eine Veränderung des Bezugs- und Vergleichssystems, eine neue Anknüpfung. So etwas könnte fällig sein. Man kann blicken auf die Freiheitsstatue, die ihre Fackel erhebt, man kann zurückblicken auf die Vollversorgung i m Öffentlichen Dienst, leistungsunabhängig und lebenslänglich: Schüler, Student, Lehrer, Pensionär, vielleicht das geheime Ideal unseres Arbeitsrechts. Wenn es so ist, daß durch liberale Gestaltung der Arbeitsverträge wieder freudig eingestellt wird - es stellten sich dann auch Fragen der Steuer- und des Sozialrechts anders. Wenn ein Unternehmer mit seinen Mitarbeitern besprechen darf: Welches Projekt am Markt nehmen wir uns vor? M i t welchen Preisen haben wir vermutlich Erfolg? Können wir klein anfangen, später zulegen? Welche Arbeits31
484
Klaus Adomeit
konditionen rechnen sich dann? Kann jeder von uns mit seinem Anteil leben? Dadurch kämen wir weiter. I m Steuerrecht, i m Sozialrecht, in unserem Arbeitsrecht wird sich etwas bewegen, freiwillig durch einen „Ruck" i m Sinne des Bundespräsidenten Herzog, oder unfreiwillig tektonisch. „Reform des Arbeitsrechts ist bisher kein politisches Thema. Bei durchaus ernstzunehmenden Gesprächspartnern hört man neuestens sogar, daß unsere Verfassung in Frage gestellt wird, Repräsentant ist etwa Arnulf Baring mit dem Klageruf „Scheitert Deutschland?". Verhältniswahlrecht, Föderalismus, Bundesrat, j a Bundesverfassungsgericht werden mit zweifelnden Blicken bedacht. Indiz für den Ernst der Lage! Alternativen zum Erdbeben: Wir können wohl nicht, durch einfaches Gesetz erklären: „ W i r kehren zurück zur Rechtslage vom 1.1. 1960." M i t solchem Gedanken habe ich experimentiert. Damals war der westliche Teil Deutschlands keineswegs eine arbeitsrechtliche Wüste, es galt das T V G 1949, das KSchG 1952, das erste BetrVG. Es war das Streikrecht anerkannt, durch den Großen Senat des B A G 1955, vorbereitet durch Nipperdey, der sich übrigens nicht scheute zu sagen, daß Arbeitskämpfe „ i m allgemeinen unerwünscht" sind. Es gab 1960 keine Azubis, dafür gab es Lehrstellen, es gab kein Gesetz zur „Verbesserung" der betrieblichen Altersversorgung - es ist immer riskant, wenn der Gesetzgeber Eigenlob in den Gesetzestitel aufnimmt, es gab kein Arbeitnehmerentsendegesetz. Nach meinem Urteil war das deutsche Arbeitsrecht 1960 vernünftiger und seinem Zweck entsprechender als das von 1999, aber es führt kein Weg zurück. Es ist rechtsphilosophisch wichtig und bemerkenswert, daß ein eigentlich so einfacher Gedanke der legislatorischen Rückkehr - wie gut auch immer begründet - ganz und gar ausgeschlossen ist. Zu einem aktuellen Thema hülfe noch nicht einmal Rückkehr. Tarifautonomie besteht seit dem Grundgesetz, ist also keine neuerliche Entwicklung. Muß man dann nicht auch den Flächentarifvertrag unbedingt verteidigen? Hier ist aber der Zusammenstoß mit dem wirtschaftlich Möglichen am heftigsten, besonders im Osten seit dem Stufentarifvertrag Metall von 1991 mit geradezu verheerenden Wirkungen. Wie verzweifelt die Lage ist, zeigt der Vorschlag, etwa Rostock oder Stralsund zum Freihafen, auch tarifrechtlich, zu erklären, mit der Vision eines deutschen Hongkong. Das läßt aber Art. 9 I I I GG nicht zu. Es gibt eine Untersuchung von mir von 1996: Regelung von Arbeitsbedingungen und ökonomische Notwendigkeiten (Ludwig-Erhard-Stiftung), mit einigen bescheidenen Vorschlägen zu § 77 I I I BetrVG und zur Nachwirkung. Der V D M A hat ähnliche Vorschläge gemacht bzw. sich angeschlossen. In der Chemischen Industrie ist man dagegen stolz auf den bemerkenswert flexiblen Entgelttarif. Denkt man an die immensen Schwierigkeiten der Reform von § 116 A F G (heute: § 146 Sozialgesetzbuch III), die eigentlich nur eine Richtigstellung war, dann ist politisch kaum etwas zu erwarten. Eher könnte sich in der Rechtsprechung etwas bewegen. Das B A G wird nach Erfurt umziehen, das ist gut, denn in Thüringen sind arbeits- und sozialrechtliche Notlagen
Arbeitsrecht und Ökonomie
485
besonders deutlich, etwa die leerstehenden Glasfabriken in Ilmenau (schon Goethe hatte die sozialen Verhältnisse der dortigen Glasbläser untersucht und es unternommen, Verbesserungen durchzuführen!), die immer noch bestehenden Probleme bei Jen-Optik. Es hat irritiert, daß genau jetzt, kurz vor dem Umzug, ein „Kasseler Handbuch zum Arbeitsrecht" erschienen ist. Das könnte mißverstanden werden, in dem Sinne: Was immer wir dort zu sehen bekommen, wir werden an unserer westlich bewährten Rechtsprechung festhalten. Erdbewegungen stehen an, unsere Welt wird durchgeschüttelt. Wir wissen nicht genau wann, wie und wo, es geht um juristische Seismologie. Die Richterskala, nach der sich deren Stärke bemißt, ist nach oben offen. Ergänzung 9. 6. 1999: Heute, beim Erhalt der Korrekturfahnen, meldet die Berliner Morgenpost (ein erstes Vorbeben!): „Schröder und Blair - Mehr Markt, weniger Staat". Beide Regierungschefs haben danach zu einem wirtschafts- und sozialpolitischen Kurswechsel in Europa aufgerufen. „Die Solidarsysteme müßten wettbewerbsfähig und attraktiv gemacht werden." - „Die Lohnnebenkosten seien schon jetzt jenseits des Erträglichen." - „Der Staat dürfe sich nie als Ersatz für die Wirtschaft verstehen." - Es gehe um eine „wirtschaftsfreundliche Ausrichtung" durch steuerliche Entlastung der Unternehmen, eine Reform der Sozialsysteme, um solide Staatsfinanzen, mehr Flexibilität auf den Arbeitsmärkten sowie eine „Straffung" von Sozialleistungen. Moderne Sozialdemokraten müßten sich als „Anwälte eines produzierenden Mittelstandes" verstehen. Dies sind Einsichten, die eine effektiv handelnde und sozial denkende - dieses Denken auch wieder effektiv umsetzende! - Persönlichkeit wie Edgar Michael Wenz begrüßt hätte, sie gehören zu seinem Vermächtnis, dem Vermächtnis eines tätigen Philosophen. Allen, die seine Arbeit fortsetzen, ist Glück und Segen zu wünschen.
Begrenzung des Strafrechts durch die Toleranz und Sicherung der Toleranz durch das Strafrecht Von Ulrich Weber
Edgar Michael Wenz war bei aller Festigkeit seiner Standpunkte ein Liberaler und damit ein toleranter Mensch. Dies ermutigt mich, in der ihm gewidmeten Gedächtnisschrift einige Überlegungen zur Auswirkung des Toleranzgedankens auf die Ausgestaltung und die Anwendung des Strafrechts anzustellen*.
I. Berechtigung und Begrenzung des Strafrechts Für Aussagen darüber, ob und wie der Toleranzgedanke i m Strafrecht eine Rolle spielen kann, ist es unerläßlich, sich zunächst der Aufgabe zu versichern, die das Strafrecht zu erfüllen hat.
1. Notwendigkeit
strafrechtlichen
Rechtsgüterschutzes
1
In der zeitgenössischen Strafrechtswissenschaft herrscht Einigkeit darüber, daß das Strafrecht an der Funktion allen Rechts teilnimmt, nämlich an der Regelung der äußeren Beziehungen der Menschen zueinander. I m Gegensatz zur Religion ist es für das Recht belanglos, aus welcher Gesinnung heraus der einzelne die gesetzlichen Verbote und Gebote befolgt, ob aus ethischer Überzeugung oder aufgrund von bloßen Zweckmäßigkeitserwägungen, ζ. B. um belastende Sanktionen zu vermeiden. Die spezifische Aufgabe des Strafrechts besteht i m Rechtsgüterschutz: Hochrangige Güter des einzelnen und der Allgemeinheit sollen mit einem besonders starken Schutz dergestalt versehen werden, daß für den Fall ihrer Beeinträchtigung Strafe angedroht wird. So erscheint es ζ. B. nicht ausreichend, i m Falle der Verletzung von Leib und Leben den Verantwortlichen lediglich zivilrechtlich zum Schadensersatz zu verpflichten. M i t der Strafdrohung soll erreicht werden, daß sich einzelne, die mit dem Gedanken der Rechtsgutsverletzung spielen, von der Tat* Der Beitrag geht auf ein Referat zurück, das der Verfasser im Oktober 1997 auf einem vom Institut für Fort- und Weiterbildung der Diözese Rottenburg-Stuttgart veranstalteten Symposion „Konfliktherd Toleranz4' gehalten hat. 1 S. dazu und zu den Straftheorien z. B. Baumann / Weber/Mitsch, Strafrecht Allgemeiner Teil, 10. Aufl. 1995, § 3 Rn. 10 ff., 24 ff.
Ulrich Weber
488
begehung durch die Strafdrohung abhalten lassen (negative Generalprävention). Eine moderne Spielart der Generalprävention, die sog. positive Generalprävention, setzt weniger auf die (negative) Abschreckung vor konkret in Aussicht genommenen Straftaten als auf die (positive) Stabilisierung des Rechtsbewußtseins der Bevölkerung, mit der Fernwirkung der Straftatverhinderung. Versagt die Strafdrohung - was j a massenweise der Fall ist - , soll der straffällig Gewordene durch die Verurteilung zu Strafe und - falls geboten - deren Vollstreckung von der Begehung künftiger Straftaten abgehalten werden (Spezialprävention, Resozialisierung). Seine Verurteilung soll zugleich die Generalprävention stärken, indem gezeigt wird, daß mit der Strafdrohung auch ernst gemacht wird. Voraussetzung der Strafbarkeit ist stets, daß das unter Strafe gestellte rechtswidrige Verhalten dem Täter auch persönlich vorwerfbar ist, ihm zur Schuld zugerechnet werden kann (Schuldprinzip). - Es leuchtet ein, daß die Schuldfeststellung der Teil der Strafbarkeitsprüfung ist, in dem es möglich ist, auf Ausnahmesituationen des Beschuldigten Rücksicht zu nehmen, etwa rechtswidrige Verhaltensweisen zu tolerieren, die auf einer Gewissensentscheidung beruhen; dazu unten III. In Grenzbereichen ist umstritten, welche Rechtsgüter derart bedeutsam sind, daß sie Strafrechtsschutz verdienen. Was die Rechtsgüter des einzelnen anlangt, so besteht weitgehende Einigkeit darüber, daß die als Grundrechte garantierten Interessen auch Strafrechtsschutz verdienen, also insbesondere Leib und Leben, Freiheit, Eigentum und Vermögen. A u f der anderen Seite ist anerkannt, daß auch der Bestand des Staates und die ungestörte Ausübung einzelner Staatsgewalten strafrechtlich schutzwürdig sind. Dasselbe gilt für andere überindividuelle Interessen, also Rechtsgüter der Allgemeinheit, wie etwa die Sicherheit des Geldverkehrs oder des Rechtsverkehrs mit Urkunden sowie die Umweltgüter.
2. Subsidiarität
des Strafrechtsschutzes
2
Auch wenn die prinzipielle strafrechtliche Schutzwürdigkeit eines Rechtsguts anerkannt ist, ist damit noch nicht entschieden, daß es gegen Angriff e aller Art abzuschirmen ist. So ist das Vermögen nur gegen besonders verwerfliche Angriffe, namentlich durch Täuschung oder Nötigung, also gegen Betrug und Erpressung geschützt. Kein strafrechtlicher Schutz wird gewährt gegen die schlichte Nichterfüllung von Verbindlichkeiten. - Obwohl das werdende Leben vom Bundesverfassungsgericht 3 dem Schutz der Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 GG) und der grundrechtlichen Lebensgarantie (Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG) unterstellt wird, wird die Leibesfrucht strafrechtlich nicht gleichermaßen umfassend geschützt wie der geborene Mensch, nämlich nicht gegen körperliche Verletzungen und nicht gegen 2 S. dazu z. B. BVerfGE 39, 1 (47 f.); 57, 250 (270 f.); 73, 206 (254); 88, 203 (257 f.) sowie Baumann /Weber / Mitsch, aaO. (Fn. 1) § 3 Rn. 19-23. 3 BVerfGE 39, 1 (36); 88, 203 (251).
Begrenzung des Strafrechts durch die Toleranz
489
fahrlässige Tötung sowie nicht gegen Tötung i m Anfangsstadium der Schwangerschaft. Gestützt wird diese Zurückhaltung des Strafrechts auf das in der Verfassung wurzelnde Subsidiaritätsprinzip: Da die Strafe, aber auch andere im Strafrecht vorgesehene Sanktionen, etwa die Unterbringung in einer psychiatrischen Anstalt oder das Berufsverbot, für den Betroffenen - und häufig auch seine Angehörigen - einschneidende, oft existenzzerstörende Wirkungen haben, hat das Strafrecht ultima ratio zu sein. D.h., sein Einsatz ist nur dann gerechtfertigt, wenn, entsprechend dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, nicht mildere Mittel die Aufrechterhaltung eines wirksamen Rechtsgüterschutzes gewährleisten können. Dies wird ζ. B. für das erwähnte schlichte Nichtzahlen von Schulden angenommen: Zivilrechtliche Folgen, wie die Verurteilung des Schuldners zum Schadensersatz, erscheinen als Sanktion ausreichend. - Was den Schutz des ungeborenen Lebens anlangt, wird angenommen, daß Hilfe in Gestalt von Rat und Tat für die Schwangere besser zum Schutz der Leibesfrucht geeignet sei als Strafdrohungen, so daß es hinnehmbar erscheint, den Schwangerschaftsabbruch trotz Vernichtung des werdenden Lebens in den ersten 12 Wochen nach der Empfängnis straffrei zu lassen, wenn sich die Schwangere der vorgeschriebenen Beratung unterzogen hat 4 . Fraglich erscheint allerdings, ob derartige Strafbarkeitsverzichte der Toleranz zuzuordnen sind. Die Beantwortung hängt ersichtlich davon ab, wie man den Toleranzbegriff faßt. Es wäre vermessen, den vielfältigen Bemühungen um eine Aussage zum Wesen der Toleranz hier noch einen weiteren Definitionsversuch anzufügen. I m Ergebnis meine ich, daß der Begriff überdehnt würde, wenn man jeden Verzicht des Staates auf hoheitlichen Zwang, hier in Gestalt der Strafe, als Ausfluß der Toleranz bewerten würde. Damit würde der Toleranzbegriff derart weit ausgedehnt, daß er seine Aussagekraft verlöre. Von staatlicher Toleranz wird man deshalb nur sprechen können, wenn der Strafverzicht des Gesetzgebers auf einer wohlwollenden Duldung, zumindest aber Respektierung des fraglichen Verhaltens, einschließlich der Motive des Handelnden, beruht 5 . Gerade der Verzicht auf die Bestrafung von Schwangerschaftsabbrüchen innerhalb der ersten zwölf Wochen nach der Empfängnis (§ 218a Abs. 1 StGB) bedeutet nicht eine umfassende staatliche Duldung der Tötung ungeborenen Lebens, schon 4
Dieses Beratungskonzept liegt dem geltenden § 218a Abs. 1 i.V. mit § 219 StGB i.d.F. des Schwangeren- und Familienhilfegesetzes vom 27. 7. 1992 (BGBl. I, 1398) und des Schwangeren- und Familienhilfeänderungsgesetzes vom 21. 8. 1995 (BGBl. I, 1050) zugrunde. - Zur Reformgeschichte hin zum heutigen Recht des Schwangerschaftsabbruches s. ζ. B. Schönke/Schröder/Eser, StGB, 25. Aufl. 1997, Vorbem. §§ 218 ff. Rn. 2 - 8 , und Tröndle, StGB, 48. Aufl. 1997, Vor § 218 Rn . 2-9d. 5 Zur politischen und staatsrechtlichen Toleranz vgl. insbesondere Fritz Werner, Recht und Toleranz, Verhandlungen des 44. Deutschen Juristentages, Bd. II B, 1963, Β 1 ff.; Günter Püttner, Toleranz als Verfassungsprinzip. Prolegomena zu einer rechtlichen Theorie des pluralistischen Staates, 1977; Werner Becker, Toleranz: Grundwert der Demokratie?, in: Ethik und Sozial Wissenschaften, 1997, S. 1 ff.
490
Ulrich Weber
gar nicht eine von Sympathie getragene Duldung. Vielmehr ist der Schwangerschaftsabbruch innerhalb der genannten Frist lediglich straffrei gestellt, bleibt also mit dem Makel der Rechtswidrigkeit behaftet. Maßgebend für die gesetzgeberische Entscheidung waren ausschließlich kriminalpolitische Überlegungen, vor allem die Erwägung, strafrechtliche Sanktionen zugunsten anderer lebenserhaltender Bemühungen zurückzunehmen. Man wird generell sagen können, daß der Verzicht des Gesetzgebers auf die Strafbarkeit bestimmter Verhaltensweisen ganz überwiegend nicht auf Toleranzüberlegungen beruht. Dies gilt etwa auch für Durchbrechungen des strafprozessualen Legalitätsprinzips zugunsten der Opportunität - Das Legalitätsprinzip ist in § 152 Abs. 2 StPO normiert. Danach ist die Staatsanwaltschaft grundsätzlich verpflichtet, wegen aller verfolgbaren Straftaten einzuschreiten, sofern zureichende tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen. Von diesem Verfolgungszwang werden in den §§ 153 ff. StPO ständig gewachsene Ausnahmen dergestalt statuiert, daß der Staatsanwaltschaft ein Verfolgungsermessen eingeräumt wird. Der praktisch bedeutsamste Anwendungsfall dieser Opportunität ist der Bagatellcharakter des fraglichen Vergehens, ζ. B. eines Ladendiebstahls. Das Absehen von der Verfolgung beruht nicht auf einer Duldung der fraglichen Verhaltensweisen, sondern darauf, daß eine Sanktionierung des Täters mit dem scharfen Schwert der Strafe unter dem Gesichtspunkt des Schuldprinzips und der General- und Spezialprävention verzichtbar erscheint.
II. Forderungen aus dem Toleranzgebot an den Strafgesetzgeber Daß der Verzicht auf Bestrafung bestimmter rechtswidriger Verhaltensweisen überwiegend nicht Ausfluß eines wohlwollenden Toleranzdenkens ist, sondern wie die vorstehend genannten Beispiele zeigen - eher auf Zweckmäßigkeitsüberlegungen beruht, kann aber natürlich nicht bedeuten, daß der Toleranzgedanke für den Strafgesetzgeber überhaupt keine Rolle spielt. Vielmehr ergeben sich für den staatlichen Gesetzgeber aus dem Toleranzgebot, d. h. der Rücksichtnahme auf bestimmte einzelne und auf bestimmte Gruppen von Menschen, Pönalisierungsverbote (dazu nachstehend 1), aber auch Pönälisierungs g e bote (dazu unten 2).
1. Strafbarkeitseinschränkungen
aus dem Toleranzgebot
Das sicher auch i m Toleranzdenken wurzelnde, in Art. 3 Abs. 3 GG normierte verfassungsrechtliche Verbot der Benachteiligung von Menschen u. a. wegen ihrer Rasse, ihres Glaubens oder ihrer religiösen oder politischen Anschauungen 6 richtet sich selbstverständlich auch an den Strafgesetzgeber, j a in besonderem Maße an 6 S. zum Toleranzbezug des Art. 3 GG Püttner, aaO. (Fn. 5), S. 21 -26.
Begrenzung des Strafrechts durch die Toleranz
491
ihn, weil Strafe die einschneidendste staatliche Sanktion darstellt und somit ihre Verhängung die gravierendste Diskriminierung ist.
a) Unzulässigkeit der Bestrafung bloßer Gesinnungen und der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Bevölkerungsgruppe Vorweg ist zu sagen, daß es dem Staat untersagt ist, jemand wegen seiner bloßen nicht in das herrschende Konzept passenden Gesinnung zu bestrafen. Denn Aufgabe des Strafrechts ist, wie eingangs ( I I ) gesagt, der Rechtsgüterschutz. Rechtsgüter können aber durch bloße Gesinnungen, auch durch noch so rechtsfeindliche Gesinnungen, nicht angetastet werden. Sogar totalitäre Staaten haben davor zurückgeschreckt, das bloße abweichende Denken oder das Anderssein als die Mehrheit dem Strafrecht zu unterstellen. Zur Verfolgung Andersdenkender und Andersartiger hat man weitgehend nicht strafrechtliche Sanktionen eingesetzt, sondern andere Maßnahmen ergriffen, i m Dritten Reich die Einweisung in Konzentrationslager, in der Sowjetunion und teilweise auch in der D D R die Unterbringung in psychiatrischen Anstalten. - Daß diese Maßnahmen nicht durch den Strafrichter angeordnet wurden, ändert selbstverständlich nichts an ihrer Abscheulichkeit. Anlaß für strafrechtliche Sanktionen kann also nur eine Tat, d. h. ein nach außen tretendes rechtsgutsbeeinträchtigendes, sozialschädliches Verhalten sein. Folgerichtig wurden bereits 1973 7 die früheren Sittlichkeitsdelikte umgestaltet zu Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung: Strafbar sind demnach nicht mehr bloß unmoralische Handlungen, die dem sittlichen Empfinden zuwiderlaufen, sondern nur noch Beeinträchtigungen greifbarer Rechtsgüter, namentlich des Rechts des einzelnen, nicht gegen seinen Willen zum Objekt sexuellen Begehrens anderer gemacht zu werden 8 . - Sicher läßt sich namentlich der damalige Verzicht auf die Strafbedrohung gleichgeschlechtlicher Handlungen zwischen erwachsenen Männern auch als - längst überfälliger - A k t der Toleranz gegenüber anders Veranlagten werten 9 . Wurde allerdings eine rechtsgutsbeeinträchtigende sozialschädliche Tat verübt, so können subjektive Umstände auf Täterseite, wie niedrige Beweggründe und verwerfliche Einstellungen, sehr wohl strafschärfend berücksichtigt werden. Beispiele bilden bestimmte Motive, wie Habgier, die das Unrecht und die Schuld der vorsätzlichen Tötung zum Mordunrecht steigern ( § 2 1 1 StGB); weiter gewerbsmäßiges Handeln des Täters, das zur Strafschärfung bei einer ganzen Reihe von Delik1 Durch das 4. StrafrechtsreformG vom 23. 11. 1973 (BGBl. I, 1725). 8 S. dazu und zur weiteren Reformentwicklung des Sexualstrafrechts im einzelnen ζ. B. Lackner/Kühl, StGB, 22. Aufl. 1997, Vor § 174 Rn. 1 ff.; Schönke/Schröder/Lenckner, StGB, 25. Aufl. 1997, Vorbem. §§ 174 ff. Rn. 1 ff. 9 Durch das 29. StrafrechtsänderungsG vom 31. 5. 1994 (BGBl. I, 1168) wurde § 175 StGB ganz aufgehoben und der sexuelle Mißbrauch Jugendlicher (unter 16 Jahren) durch Erwachsene einheitlich (geschlechtsneutral) in § 182 StGB unter Strafe gestellt.
492
Ulrich Weber
ten, etwa beim Diebstahl (§ 243 Abs. 1 Nr. 3 StGB) und beim Wucher (§ 291 Abs. 2 Nr. 2 StGB), herangezogen wird. Das ist kein unzulässiges Gesinnungsstrafrecht, weil der Gesinnung nur in Verbindung mit einem greifbaren rechtsgutsverletzenden Verhalten Rechnung getragen w i r d 1 0 .
b) Verbot der Poenalisierung von Verhaltensweisen nur i m Hinblick auf das Handlungssubjekt Der Vollzug des außerehelichen Beischlafs wird von Rechts wegen nicht beanstandet. Art. 3 Abs. 3 GG verbietet es, ihn nur deshalb zu bestrafen, weil er von dem Angehörigen einer bestimmten Rasse mit einer Andersrassigen vollzogen wird. - So aber geschehen in einer i m Zuge der Nürnberger Rassengesetze zu Beginn der NS-Zeit geschaffenen Strafvorschrift 11 . Was die Gegenwart anlangt, so ist es mit dem (auch) i m Toleranzgebot wurzelnden Art. 3 Nr. 3 GG unvereinbar, die Ausländereigenschaft des Angeklagten als solche strafschärfend - übrigens auch strafmildernd - zu berücksichtigen 12 .
c) Begrenzungen des Strafrechts durch die Meinungs- und Kunstfreiheit Ein besonders problematisches Feld legitimen Einsatzes des Strafrechts bilden die Äußerungsdelikte. Durch diese Straftaten wird nicht handgreiflich, wie ζ. B. durch Schlagen oder Vergewaltigen des Opfers oder durch Wegnahme von Sachen, in Rechtsgüter eingegriffen, sondern der Täter äußert sich verbal oder durch Schriften oder andere Darstellungen. Ebenfalls als Ausfluß des Toleranzdenkens garantiert Art. 5 Abs. 1 GG die Meinungsfreiheit 13. Für das Strafrecht stellt sich die Frage, wo die Grenzen der Ausübung dieses Grundrechts liegen, welche Äußerungen straffrei zu bleiben haben und welche mit den Mitteln des Strafrechts bekämpft werden dürfen.
aa) Meinungsfreiheit
und Schutz der Ehre
Zu diesem Spannungsfeld findet sich eine Regelung in Art. 5 Abs. 2 GG, wonach die Meinungsfreiheit ihre Schranken findet in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem 10 Zur Vereinbarkeit der Berücksichtigung von 7à'termerkmalen mit dem 7arstrafrecht s. ζ. B. Baumann/Weber/Müsch, aaO. (Fn. 1), § 3 Rn. 86 ff. 11 § 2 i.V. mit § 5 Abs. 2 des Gesetzes zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre vom 15. 9. 1935 (RGBl. I, 1146). 12 S. dazu Schönke/Schröder/Stree, StGB, 25. Aufl. 1997, § 46 Rn. 36 m.w.N. 13
S. zum Toleranzbezug der Meinungsfreiheit Püttner, aaO. (Fn. 5), S. 21.
Begrenzung des Strafrechts durch die Toleranz
493
Recht der persönlichen Ehre. Damit wird das Beleidigungsstrafrecht ( §§ 185 ff. StGB) prinzipiell gerechtfertigt. Allerdings ist der strafrechtliche Ehrenschutz wiederum i m Lichte der Verfassung auszulegen, so daß i m Einzelfall häufig erbittert darüber gestritten wird, ob nun die Meinungsfreiheit oder der Schutz der Ehre den Vorrang habe. Beispielshalber genannt seien Rechtsprechung und Literatur zur Bezeichnung von Soldaten als (potentiellen) Mördern 1 4 . Hier zeigt sich deutlich, daß das Strafrecht Freiheit nicht vermehren, sondern immer nur verteilen kann. Wird der Ehrenschutz verstärkt, so wird damit zwangsläufig die Freiheit der Meinungsäußerung beschränkt und umgekehrt. Ich kann die Schwierigkeiten einer befriedigenden Abwägung, aus denen nach meiner Einschätzung auch Kategorien der Toleranz schwerlich heraushelfen könnnen, hier nicht i m einzelnen darlegen, meine aber, daß die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts dem Ehrenschutz ein eher zu geringes Gewicht beimißt, also zu „tolerant" gegenüber ehrverletzenden Meinungsäußerungen i s t 1 5 .
bb) Kunstfreiheit
und
Pornographieverbot
16
Ähnliche Abwägungsprobleme stellen sich im Bereich der Kunstfreiheit, die in Art. 5 Abs. 3 S. 1 GG - anders als die Meinungsfreiheit - sogar schrankenlos gewährt wird. Die daraus resultierenden Probleme i m Hinblick auf die strafrechtliche Erfassung der Pornographie haben sich noch dadurch verschärft, daß das Bundesverfassungsgericht 17 und der Bundesgerichtshof 18 seit einiger Zeit die Auffassung vertreten, Kunst und Pornographie schlössen sich nicht aus, sondern pornographische Darstellungen könnten auch Kunst sein. Folge dieser Auffassung kann nun aber selbstverständlich nicht sein, daß jetzt die Verbreitung pornographischer Schriften, die einen künstlerischen Gehalt aufweisen, nicht mehr, wie in § 184 StGB vorgesehen, bestraft werden kann. Zutreffend steht die Rechtsprechung vielmehr auf dem Standpunkt, daß die Kunstfreiheit, obwohl nicht mit einem Gesetzesvorbehalt versehen, ihre Schranken dort findet, wo andere verfassungsrechtlich garantierte Belange, etwa der Jugendschutz, beeinträchtigt werden. In solchen Fällen ist dann Konkordanz derart herzustellen, daß jedem der auf dem Spiele stehenden Interessen möglichst wirksam Rechnung getragen w i r d 1 9 . »4 S. dazu insbesondere BVerfG, NJW 1994, 2943 f. und NJW 1995, 3303 ff.; BVerfGE 93, 266 ff. Aus der Literatur - jeweils m.w.N. - Schönke/Schröder/Lenckner, StGB, 25. Aufl. 1997, § 185 Rn. 8; Tröndle, StGB, 48. Aufl. 1997, § 193 Rn. 14n ff. 15
Kritisch zur Überbewertung der Meinungsfreiheit durch das BVerfG ζ. B. Tröndle, aaO. (Fn. 14), § 193 Rn. 14h-14m mit zahlr. Nachw. 16 S. dazu und zum folgenden eingehend Daniel Beisel, Die Kunstfreiheitsgarantie des Grundgesetzes und ihre strafrechtlichen Grenzen, 1997, insbesondere S. 167 ff. 17 BVerfGE 83, 130 (138 f.) - „Josefine Mutzenbacher". ι» BGHSt 37, 55 ff. - „Opus Pistorum". 19 S. dazu mit weiteren Nachw. Beisel, aaO. (Fn. 16), S. 155 ff.
494
Ulrich Weber
Das strafbewehrte Pornographieverbot i m Interesse des Jugendschutzes leuchtet auch für den Fall ein, daß die Darstellung einen künstlerischen Gehalt aufweist. Problematisch erscheint jedoch die Pönalisierung der Zugänglichmachung pornographischer Darstellungen an Erwachsene in § 184 Abs. 3 StGB. Es geht hier um die sog. harte Pornographie, d. h. um Darstellungen, die Gewalttätigkeiten, den sexuellen Mißbrauch von Kindern oder sexuelle Handlungen von Menschen mit Tieren zum Gegenstand haben. - Ist gegenüber solchen Produkten noch eine tolerante Haltung denkbar, oder ist Toleranz beschränkt auf Erscheinungen, denen das durchschnittliche Empfinden noch eine positive Seite abgewinnen kann? - Rechtspolitisch wird die Bestrafung der Verbreitung derartiger Darstellungen an Erwachsene mit der Gefahr gerechtfertigt, daß zu gewalttätig-sadistischem oder pädophilem Sexualverhalten neigende Personen durch einschlägiges pornographisches Material aktiviert werden können 2 0 . Freilich ist diese Einschätzung nicht unangefochten; denn die gewaltsteigernde Wirkung entsprechender Darstellungen ist empirisch nicht belegt. Seit 1993 2 1 ist sogar in § 184 Abs. 5 StGB der bloße Besitz sog. Kinderpornographie unter Strafe gestellt. Begründet wird die Strafwürdigkeit damit, daß nur durch das Besitzverbot der Anreiz für die Herstellung einschlägiger Produkte zunichte gemacht werden könne 2 2 . Auch hier stellt sich unter dem Toleranzgesichtspunkt die Frage, ob das Argument der Austrocknung des Marktes die Bestrafung eines Vorgangs rechtfertigen kann, der auf die eigenen vier Wände des erwachsenen Besitzers beschränkt ist.
cc) Kunst-/Meinungsfreiheit
und Staatsschutz
Ein weiteres Konfliktfeld i m Bereich der Meinungs- und Kunstfreiheit ist der strafrechtliche Staatsschutz. Als Beispiel sei § 90a StGB genannt, wo die Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole unter Strafe gestellt ist. Das Bundesverfassungsgericht 23 hatte 1990 die Frage zu entscheiden, ob die böswillige Entstellung des Deutschlandliedes durch die Kunstfreiheit gedeckt ist. Das Gericht bejahte diese Frage, weil es die Entstellung als satirische Nachdichtung durch die Kunstfreiheitsgarantie gerechtfertigt ansah. Ich meine, daß diese Entscheidung allzu tolerant ist. Derartige Abwägungsfragen können in der Bundesrepublik Deutschland nicht ohne einen Blick auf die jüngere Geschichte entschieden werden. Es hätte also berücksichtigt werden müssen, daß die Weimarer Republik auch daran zugrunde gegangen ist, daß die Gerichte
20 21 22 23
S. dazu Schönke/Schröder/Lenckner, StGB, 25. Aufl. 1997, § 184 Rn. 1. Durch das 27. StrafrechtsänderungsG vom 23. 7. 1993 (BGBl. I, 1346). S. dazu Schönke /Schröder/Lenckner, StGB, 25. Aufl. 1997, § 184 Rn. 2. BVerfGE 81, 298 ff. - Zur Verunglimpfung der Bundesflagge s. BVerfGE 81, 278 ff.
Begrenzung des Strafrechts durch die Toleranz
495
der Herabsetzung der Symbole und der Repräsentanten dieser Republik nicht energisch genug entgegengetreten sind. Daß die strafrechtlichen Schranken der Meinungsfreiheit nicht ohne Berücksichtigung der historischen Gegebenheiten festgelegt werden können, zeigt schließlich ein Blick auf den Volksverhetzungstatbestand des § 130 StGB, der 1994 2 4 um einen Absatz 3 ergänzt worden ist. Dort wird die zur Störung des öffentlichen Friedens geeignete öffentliche Billigung, Leugnung und Verharmlosung von NS-Gewaltverbrechen, also u. a. die Auschwitzlüge, unter Strafe gestellt. In anderen Staaten, etwa in den USA, gibt es vergleichbare Strafbestimmungen nicht. Letztlich sind sie in der Bundesrepublik Deutschland nur zu rechtfertigen mit der Verantwortlichkeit der Deutschen für die ungeheuren Verbrechen, die in der NS-Zeit vor allem an Juden verübt worden sind. - Welche Meinungsäußerungen wo noch toleriert werden können, hängt also auch von den geschichtlichen Gegebenheiten und davon ab, wie stark diese das Denken in der Gegenwart prägen.
2. Strafbarkeitsgeböte
zur Sicherung der Toleranz
Ergänzend zu der vorstehend 1 skizzierten Problematik von Strafbarkeitsemschränkungen aus Gründen der Toleranz, ζ. B. gegenüber Meinungsäußerungen, ist darauf hinzuweisen, daß es das Toleranzprinzip auch gebieten kann, durch strafrechtliche Vorkehrungen sicherzustellen, daß in der Verfassung garantierte Grundrechte ungestört ausgeübt werden können. Selbstverständlich ist das Strafrecht kaum geeignet, den Rechtsunterworfenen eine innere tolerante Haltung anzuerziehen. Was aber das Recht kann, ist die Abwehr von äußeren Störungen der Wahrnehmung grundrechtlicher Befugnisse anderer, etwa der Religionsausübung. Dabei darf - jedenfalls nach heutigem Verständnis - nicht nach dem Inhalt der jeweils ausgeübten Religion unterschieden werden, etwa der Schutz nur solchen Religionsgemeinschaften zugebilligt werden, die als Körperschaften des öffentlichen Rechts anerkannt sind. Folgerichtig wird in § 167 StGB die Störung der Religionsausübung schlechthin unter Strafe gestellt. Es läßt sich also sagen, daß auch dieser Teil des Strafrechts in doppelter Weise dem Toleranzgebot verpflichtet ist, einmal durch die Sicherung der ungestörten Religionsausübung, zum anderen durch die Gewährung von Schutz ohne Rücksicht auf die religiösen Inhalte. - Nicht maßgebend sind die Glaubensinhalte auch für § 166 StGB, wo die zur Friedensstörung geeignete öffentliche Beschimpfung von religiösen oder weltanschaulichen Bekenntnissen sowie von Kirchen, Religionsgesellschaften und WeltanschauungsVereinigungen unter Strafe gestellt ist.
24 Durch das VerbrechensbekämpfungsG vom 28. 10. 1994 (BGBl. I, 3186).
496
Ulrich Weber
III. Entschuldigung der Straftatbegehung aus Glaubens- und Gewissensgründen? Die bisherigen Ausführungen galten vornehmlich der Frage, ob sich aus dem Toleranzgebot Pflichten für den Gesetzgeber bei der Ausgestaltung des Strafrechts ergeben können. Abschließend soll die Frage aufgeworfen werden, ob tatbestandsmäßig-rechtswidrige Taten, die zweifellos grundsätzlich strafwürdig sind, namentlich Gesundheitsbeschädigungen und Tötungen, i m Einzelfall ausnahmsweise straflos sein können, weil sie aus Glaubensüberzeugung oder einer Gewissensentscheidung heraus begangen worden sind. - Diese Problematik kann schon deshalb nicht ausgeklammert bleiben, weil die Duldung von Glaubensüberzeugungen und die Hinnahme von Gewissensentscheidungen den historisch gewachsenen Kernbereich des Toleranzgebotes bilden.
7. Der entschuldigende Notstand, § 35 StGB 25 Das strafrechtliche Eingangstor für dahingehende Überlegungen bildet der in § 35 StGB geregelte entschuldigende Notstand. Danach handelt ohne Schuld, wer in einer gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren Gefahr für Leben, Leib oder Freiheit eine rechtswidrige Tat begeht, um die Gefahr von sich, einem Angehörigen oder einer anderen ihm nahestehenden Person abzuwenden. Nach der gesetzgeberischen Konzeption muß es sich dabei allerdings um reale, irdische Gefahren handeln. Schulfall ist das Brett des Karneades aus der griechischen Sage: Karneades hat sich nach einem Schiffbruch zusammen mit einem anderen Passagier auf eine Planke gerettet. Da er merkt, daß das Brett zu sinken beginnt, weil es auf Dauer nur einen trägt, stößt er den anderen Schiffbrüchigen ins Wasser, so daß dieser ertrinkt. Karneades hat einen Totschlag begangen, dabei auch rechtswidrig gehandelt, weil der andere Passagier ihn nicht angegriffen hat, Karneades also kein Notwehrrecht zur Seite stand. Aber Karneades ist entschuldigt, weil er gehandelt hat, um sein eigenes Leben zu retten. Not kennt kein Gebot! Das Strafrecht verlangt keinen Heroismus, sondern weicht bei der Rettung aus existenzbedrohenden Situationen - wenn man so will: tolerant - zurück, auch wenn zur eigenen Rettung hochstehende Rechtsgüter anderer geopfert werden.
2. Unzumutbarkeit der Normbefolgung wegen Glaubensüberzeugung oder Gewissensentscheidung ? Die in unserem Zusammenhang interessierende Frage ist die, ob an Entschuldigung auch dann gedacht werden kann, wenn nicht reale Gefahren die eigene Exi25
S. zum entschuldigenden Notstand näher Baumann/Weber/Mitsch, Rn. 19 ff.
aaO. (Fn. 1), § 23
Begrenzung des Strafrechts durch die Toleranz
497
Stenz bedrohen, sondern der in Not Befindliche um sein Seelenheil, um sein ewiges Leben fürchtet. Die Anknüpfung an den entschuldigenden Notstand des § 35 StGB zeigt, daß eine Entschuldigung von vornherein nicht in Betracht kommt für Überzeugungstäter, deren Entscheidung für die Tatbegehung nicht auf einem existentiellen Gewissenskonflikt beruht, sondern ζ. B. auf einer bestimmten politischen Anschauung. Deshalb wurde zu Recht ζ. B. die Überzeugung von Terroristen, das kapitalistische System müsse durch die Tötung wichtiger Repräsentanten dieser Wirtschaftsordnung überwunden werden, nicht strafmildernd berücksichtigt 2 6 .
a) Befreiung von der Strafbarkeit wegen aktiven Tuns? Beruht die Beeinträchtigung von hochstehenden Rechtsgütern auf einer i.S. des Art. 4 Abs. 1 G G 2 7 anerkannten echten Gewissensentscheidung, so kann jedenfalls die durch aktives Tun herbeigeführte Rechtsgutsverletzung prinzipiell nicht entschuldigt werden. Dies gilt jedenfalls für die aktive Tötung oder Gesundheitsbeschädigung anderer 28 . Allerdings ist zu erwägen, ob bei der Tötung auf Verlangen, die in § 216 StGB unter Strafe gestellt ist, nicht von Strafe abgesehen werden kann, wenn der Täter dem Wunsch des Schwerkranken um aktive Sterbehilfe schließlich nachgibt, weil er aus verzweifeltem Mitleid die Qualen des anderen nicht mehr ertragen kann 2 9 . Nur wenn weniger hochrangige Interessen auf dem Spiel stehen, wird man auch aktiv erfolgende Rechtsgutsbeeinträchtigungen entschuldigen können. So wurde das Schächten, also das rituelle Schlachten von warmblütigen Tieren ohne vorherige Betäubung durch Angehörige des jüdischen und des islamischen Glaubens, bereits im Kaiserreich nach 1871 geduldet, also Strafbarkeit wegen Tierquälerei vermieden. Nicht primär aus Gründen des Tierschutzes, sondern aus antisemitischen Motiven wurde das Schächten in der NS-Zeit faktisch verboten. Nach dem Zweiten Weltkrieg war zunächst wieder die Duldungslösung in Geltung. In einer Novelle zum Tierschutzgesetz von 1986 wurde dann das Schächten aus religiösen Gründen ausdrücklich erlaubt, allerdings nur dann, wenn dafür eine behördliche Genehmigung erteilt w i r d 3 0 . 26 Zum Ausschluß politischer Verblendung als Strafmilderungsgrund bei der Leugnung des Holocausts (Fall Deckert II) s. BGH, NJW 1995, 340. 27 Zur Festlegung des Toleranzgebots in Art. 4 GG und zu seinem verfassungsrechtlichen Verständnis s. Püttner, aaO. (Fn. 5), S. 28 ff. 2 « S. ζ. B. Schänke/Schröder/Lenckner, StGB, 25. Aufl. 1997, Vorbem. §§ 32 ff. Rn. 119 m.w.N. 29 So § 216 Abs. 2 des Aiternativ-Entwurfs eines Gesetzes über Sterbehilfe (1986); s. dazu m.w.N. Schänke/Schröder/Eser, StGB, 25. Aufl. 1997, Vorbem. §§ 211 ff. Rn. 32b und § 216 Rn. 1; Tröndle, StGB, 48. Aufl. 1997, § 216 Rn. la.
32 Gedächtnisschrift Wenz
498
Ulrich Weber b) Befreiung von der Strafbarkeit wegen Unterlassens?
Die Bereitschaft zur schuldausschließenden oder -mindernden Anerkennung von Glaubensüberzeugungen und Gewissensentscheidungen ist dann größer, wenn der Täter nicht durch aktives Tun, sondern durch Nichtstun, durch Unterlassen Rechtsgüter anderer beeinträchtigt, also ζ. B. aus religiösen Gründen nichts zur medizinischen Rettung von Angehörigen unternimmt. Die Neigung zur Rücknahme des Strafrechts bei glaubens.- und gewissensgetragenen Unterlassungstaten ist deshalb größer, weil das Unterlassen gegenüber dem aktiven Tun in der Regel der weniger energische Angriff auf fremde Rechtsgüter i s t 3 1 . Deshalb ist auch nicht jedes rechtsgutsbeeinträchtigende Unterlassen unter Strafe gestellt: Eine strafbewehrte Hilfeleistungspflicht für jedermann besteht nur bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not; vgl. § 323c StGB, der überdies eine relativ milde Strafe androht. Wegen eines Tötungs- oder Körperverletzungsdelikts kann i m Falle der Erfolgsherbeiführung durch Unterlassen nur bestraft werden, wer eine Rechtspflicht zur Erfolgsabwendung hat, ζ. B. weil er aus Gesetz (Beistandspflichten der Ehegatten untereinander oder der Elten gegenüber ihren Kindern), Vertrag oder Schaffung der Gefahr verpflichtet ist, den drohenden Schaden abzuwenden. Man ist beim Unterlassen auch eher als beim aktiven Tun bereit, über den gesetzlich anerkannten entschuldigenden Notstand hinaus von einer Bestrafung abzusehen, wenn erfolgshinderndes aktives Eingreifen dem Täter nicht zumutbar war. Die Zumutbarkeit ist bei der unterlassenen Hilfeleistung in § 323c StGB sogar ausdrücklich als Strafbarkeitsvoraussetzung genannt. A u f dieser Grundlage hat das Bundesverfassungsgericht in einer 1971 ergangenen Entscheidung 3 2 die Verurteilung eines Ehemannes wegen unterlassener Hilfeleistung (§ 323c StGB) gegenüber seiner Frau in folgendem Fall aufgehoben: Beide Ehegatten gehörten einer Glaubensgemeinschaft an, die ärztliche Behandlungen ablehnt und von der Heilkraft des Gebets überzeugt ist. Diese Überzeugung hatten sich auch die Eheleute zueigen gemacht. Die Frau litt nach der Geburt des vierten Kindes unter akutem Blutmangel. Entgegen ärztlichem Rat lehnte sie es ab, sich in eine Krankenhausbehandlung zu begeben und insbesondere eine Bluttransfussion vornehmen zu lassen. Die Frau suchte ihre Rettung im Gebet mit Glaubensbrüdern. Sie ist kurz darauf gestorben. Ihr Ehemann hatte es unterlassen, seinen Einfluß auf seine Frau im Sinne der Befolgung der ärztlichen Ratschläge geltendzumachen. Die Ablehnung strafrechtlicher Verantwortlichkeit des Ehemannes wird auf die verfassungsrechtliche Garantie der Glaubens- und Gewissensfreiheit in Art. 4
30 S. zum Schächten Axel Gerhard Röchle, Probleme und Entwicklungstendenzen des strafrechtlichen Tierschutzes, Tübinger Diss. 1996, S. 23 ff. 31 Näher zur Tatbestands Verwirklichung durch Unterlassen ζ. B. Baumann/Weber/ Müsch, aaO. (Fn. 1) § 15. 32 BVerfGE 32, 98 ff.
Begrenzung des Strafrechts durch die Toleranz
499
Abs. 1 GG gestützt. Bei der gebotenen Berücksichtigung der Glaubens- und Gewissensfreiheit sei das Verhalten des Ehemannes nicht in einem Maße vorwerfbar, daß es gerechtfertigt wäre, mit der schärfsten der Gesellschaft zu Gebote stehenden Waffe, dem Strafrecht, gegen den Täter vorzugehen. I m Ergebnis verdient die Entscheidung sicher Zustimmung. Ich meine allerdings, daß sich die Straffreiheit nicht allein auf die Glaubens- und Gewissensfreiheit stützen läßt. Vielmehr fällt für den Freispruch des Ehemanns entscheidend ins Gewicht, daß die Ehefrau in voller Kenntnis der kritischen Situation die Krankenhausbehandlung abgelehnt hat und damit selbstverantwortlich die Gefahr ihres Todes auf sich genommen h a t 3 3 . Hätte die Frau eine Krankenhausbehandlung verlangt, der Ehemann aber aus Glaubensgründen ihre Verbringung in die K l i n i k abgelehnt, so hielte ich Bestrafung für geboten; aber das ist nicht unbestritten. Strafbarkeit ist erst recht dann anzunehmen, wenn es die Eltern aus Glaubensoder Gewissensgründen ablehnen, ihr lebensgefährlich erkranktes Kind in ärztliche Behandlung zu bringen. Ist rasches Eingreifen zur Rettung des Kindes unerläßlich, so ist auf der anderen Seite ein Arzt gerechtfertigt, der das Kind kurzerhand operiert, weil keine Zeit mehr ist für die Einholung einer vormundschaftsgerichtlichen Entscheidung, die den Eltern willen hätte übespielen können. I m Ergebnis wird man sagen können, daß Entschuldigung für einen Täter, der aus Glaubens- oder Gewissensdruck handelt, auch i m Falle des Unterlassens nicht in Betracht kommt, wenn das höchstrangige Rechtsgut Leben auf dem Spiel steht. Entschuldigung ist vielmehr nur anzunehmen, wenn die Glaubens- oder Gewissensentscheidung zur Beeinträchtigung weniger hochrangiger Rechtsgüter führt. Ein Beispiel bildeten früher strafbedrohte Verstöße gegen i m Allgemeininteresse angeordnete Impfpflichten. Daß aber bei der strafbefreienden Anerkennung von Glaubens- und Gewissensentscheidungen auch dann Zurückhaltung geboten ist, wenn es um die Verweigerung von Diensten geht, die der einzelne der Gesamtheit schuldet, zeigt die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Kriegs- und Ersatzdienstverweigerung, auf die ich abschließend hinweisen möchte. Die Verweigerung des Kriegsdienstes mit der Waffe ist in Art. 4 Abs. 3 GG ausdrücklich anerkannt. Sie ist heute in Art. 12a Abs. 2 GG und i m Kriegsdienstverweigerungs-Neuordnungsgesetz so geregelt, daß Verstöße gegen die Gewissensfreiheit des Wehrpflichtigen praktisch ausgeschlossen sind. Nicht ganz so unproblematisch ist die Beurteilung der Totalverweigerung, also die Verweigerung auch des zivilen Ersatzdienstes. Zutreffend hat allerdings das Bundesverfassungsgericht bereits 1965 festgestellt 34 , daß Art. 4 Abs. 3 GG die Berücksichtigung der Gewissensentscheidung von Verweigerern abschließend dahingehend geregelt hat, daß nur der Kriegsdienst mit der Waffe ver-
33
S. zur eigenverantwortlichen Risikoübernahme ζ. B. Baumann/Weber/ M itsch, aaO. (Fn. 1), § 14 Rn. 72 ff.; § 17 Rn. 101 und § 22 Rn. 53. 3 4 BVerfGE 19, 135. 32*
500
Ulrich Weber
weigert werden kann. Daraus folge, daß ein Kriegsdienstverweigerer den Ersatzdienst nicht mit der Berufung auf die allgemeine Garantie der Gewissensfreiheit in Art. 4 Abs. 1 GG verweigern könne. - Hier wird also der juristische Auslegungsgrundsatz zur Geltung gebracht, daß die spezielle Regelung eines Sachverhalts einer allgemeinen Regelung vorgeht. Das Gericht geht jedoch von einem „Wohlwollensgebot" gegenüber Gewissenstätern aus, das gegenüber Ersatzdienstverweigerern Strafen verbiete, die durch ihre Härte geeignet sind, die Persönlichkeit des Gewissenstäters zu brechen 3 5 . Eine zu billigende Konsequenz aus diesem Verbot der Persönlichkeitsvernichtung des Gewissenstäters wurde vom Bundesverfassungsgericht 36 dergestalt gezogen, daß der Ersatzdienstverweigerer nicht jedesmal aufs Neue bestraft werden kann, wenn er einer Einberufung nach Verurteilung wegen Ersatzdienstverweigerung wiederum nicht nachkommt. Das Gericht erreicht diese Unzulässigkeit einer Mehrfachbestrafung mit der Argumentation, es liege nur eine Tat vor, wenn die wiederholte Nichtbefolgung einer Einberufung zum zivilen Ersatzdienst auf die ein für allemal getroffene und fortwirkende Gewissensentscheidung zurückgehe. Damit wird die Anwendung des Art. 103 Abs. 3 GG eröffnet, wonach niemand wegen derselben Tat aufgrund der allgemeinen Strafgesetze mehrmals bestraft werden kann. Ich meine, daß mit dieser rechtlichen Lösung ein dem Toleranzgebot entsprechender Ausgleich zwischen der Gewissensentscheidung des Individuums und den Anforderungen der Gemeinschaft an den einzelnen gefunden wurde.
35 BVerfGE 23, 127. 36 BVerfGE 23, 191.
Bibliographie Edgar Michael Wenz
A. Fachliteratur zum Beruf I. Selbständige Schriften 1. Das Backen. Das Gären. Die Technik. Die Theorie von Backofen, Würzburg, 1980 2. Die verbrauchernahe Produktion. Der Wandel der Verzehrgewohnheiten. Die andere Kundenerwartung. Eine bäckerei- und gastrotheoretrische Studie, Würzburg, 1985, 3. Auflage 1986 3. Anmerkungen ... Eine Aufsatzsammlung, Würzburg, 1988 4. Frische - Ein Qualitätsmerkmal. Leitfaden für die „Branchennachbarn" des Backgewerbes, Arnstein, 1989, 2. erweiterte Auflage 1990 5. Gestern. Heute. Morgen. 75 Jahre MIWE Michael Wenz, Arnstein, 1994
II. Aufsätze und Beiträge (Auszug) 1. Probleme des Baus, des Betriebes und der Anschaffung moderner Backöfen. Nachdruck in: Das Backen. Das Gären. Die Technik 2. Backöfen der mitsiebziger Jahre. Nachdruck in: Das Backen. Das Gären. Die Technik 3. Der Stikkenofen - was ist er und was kann er? Nachdruck in: Das Backen. Das Gären. Die Technik; Anmerkungen ... 4. Erfahrungen mit Stikkenofen. Nachdruck in: Das Backen. Das Gären. Die Technik; U. Karpen, U. Weber, D. Willoweit (Hrsg.), Rechtsforschung, Rechtspolitik und Unternehmertum. Gedächtnisschrift für Prof. Edgar Michael Wenz, Berlin, 1999 5. Stikkenofen: Bilanz. Nachdruck in: Das Backen. Das Gären. Die Technik 6. (gemeinsam mit A. Bremer) Einflußgrößen. Ermittlung von Kennzahlen für Backöfen und Backanlagen. Nachdruck in: Das Backen. Das Gären. Die Technik; U. Karpen, U. Weber, D. Willoweit (Hrsg.), Rechtsforschung, Rechtspolitik und Unternehmertum. Gedächtnisschrift für Prof. Edgar Michael Wenz, Berlin, 1999 7. Der Platzbedarf bei Stikkenofen. Nachdruck in: Das Backen. Das Gären. Die Technik 8. Wiederentdeckt: Der „Deutsche Ofen". Nachdruck in: Das Backen. Das Gären. Die Technik
502
Bibliographie Edgar Michael Wenz
9. Mittel- und Großöfen - führt dahin der Trend? Nachdruck in: Das Backen. Das Gären. Die Technik 10. (gemeinsam mit A. Bremer) Neuartige automatische Backanlage. Nachdruck in: Das Backen. Das Gären. Die Technik 11. Stets das Kernstück. Ein Überblick über in der Industrie einsetzbare Backöfen und ihrer Arbeitsweise. Nachdruck in: Das Backen. Das Gären. Die Technik 12. Ein „klassischer" Brennstoff für moderne Backöfen. Nachdruck in: Das Backen. Das Gären. Die Technik 13. Moderne Etagenbacköfen und Flüssiggas, eine bewährte Verbindung. Nachdruck in: Das Backen. Das Gären. Die Technik 14. Energieversorgung - Entwicklung und Tendenz. Nachdruck in: Das Backen. Das Gären. Die Technik 15. Modernes Gären in der Bäckerei. Nachdruck in: Das Backen. Das Gären. Die Technik 16. Moderne Gärtechniken. Nachdruck in: Das Backen. Das Gären. Die Technik 17. Das Sicht- und Duftbacken. Nachdruck in: Das Backen. Das Gären. Die Technik; Anmerkungen ... ; U. Karpen, U. Weber, D. Willoweit (Hrsg.), Rechtsforschung, Rechtspolitik und Unternehmertum. Gedächtnisschrift für Prof. Edgar Michael Wenz, Berlin, 1999 18. Vom Brot und Entwicklungshilfe. Nachdruck in: Anmerkungen . . . ; U. Karpen, U. Weber, D. Willoweit (Hrsg.), Rechtsforschung, Rechtspolitik und Unternehmertum. Gedächtnisschrift für Prof. Edgar Michael Wenz, Berlin, 1999 19. Unsere Aufgabe: Die Entwicklungsländer. Nachdruck in: Das Backen. Das Gären. Die Technik; Anmerkungen ... ; Gestern. Heute. Morgen; U. Karpen, U. Weber, D. Willoweit (Hrsg.), Rechtsforschung, Rechtspolitik und Unternehmertum. Gedächtnisschrift für Prof. Edgar Michael Wenz, Berlin, 1999 20. Exposé über die technische Realisation der Herstellung von Brot unter Beimengung von Landesprodukten. Nachdruck in: Das Backen. Das Gären. Die Technik; Anmerkungen ... 21. (gemeinsam mit A. Bremer) Einfluß der Wärme beim Backprozeß. Nachdruck in: Das Backen. Das Gären. Die Technik 22. Fehlen objektive Prüfungskriterien? Nachdruck in: Das Backen. Das Gären. Die Technik; Anmerkungen ... 23. Vom Brot, Backen und Umweltbelastung. Nachdruck in: Das Backen. Das Gären. Die Technik 24. Der Wandel der Verzehrgewohnheiten. Die andere Kundenerwartung. Beispiel: Offene Backstube. Nachdruck in: Die verbrauchernahe Produktion; Anmerkungen ... 25. Was es sonst noch zu sagen gäbe ... Nachdruck in: Die Verbrauchernahe Produktion; Anmerkungen ... ; U. Karpen, U. Weber, D. Willoweit (Hrsg.), Rechtsforschung, Rechtspolitik und Unternehmertum. Gedächtnisschrift für Prof. Edgar Michael Wenz, Berlin, 1999 26. Braucht das Bachgewerbe eine begleitende Wissenschaft? Nachdruck in: Anmerkungen ...
Bibliographie Edgar Michael Wenz 27. Umweltbelastung durch Bäckereien. In: U - das technische Umweltmagazin; Nachdruck in: Das Backen. Das Gären. Die Technik; Anmerkungen ... ; U. Karpen, U. Weber, D. Willoweit (Hrsg.), Rechtsforschung, Rechtspolitik und Unternehmertum. Gedächtnisschrift für Prof. Edgar Michael Wenz, Berlin, 1999 28. Verbrauchernah die Frische beweisen (Interview). In: Back Journal 5 / 87 u. a. 29. Perspektiven 2000. In : Back Journal 3 / 88 u. a. 30. Backen im Laden: Die Lehre wurde verstanden. In: Back Journal 10/88 u. a. 31. Klare Frische-Definition schützt vor Mißbrauch. In Back Journal 8 / 89 u. a. 32. Prädikatsstufe Ofenfrische - Methoden der verbrauchernahen Produktion. In: Brot und Backwaren 10/89 u. a. 33. Wo der Schwaden nicht absäuft (Interview). In: Brot und Backwaren 3/94
B. Rechtswissenschaftliche Literatur I. Selbständige Schriften, einschließlich Herausgabe 1. Die Entwicklung der Gewerbefreiheit in Bayern. Eine historische, dogmatische und rechtsvergleichende Darstellung, Diss. Erlangen 1951. Auszüge nachgedruckt in: Anmerkungen ... ; U. Karpen, U. Weber, D. Willoweit (Hrsg.), Rechtsforschung, Rechtspolitik und Unternehmertum. Gedächtnisschrift für Prof. Edgar Michael Wenz, Berlin, 1999 2. Edgar Michael Wenz (Hrsg.), Wissenschaftsgerichtshöfe. Mittler zwischen Wissenschaft, Politik und Gesellschaft. Mit Beiträgen von Meinholf Dierkes, Wilhelm A. Kewenig, Gerd Roellecke, Volker von Thienen und Edgar Michael Wenz, Frankfurt/New York, 1983 3. Edgar Michael Wenz, Hasso Hofmann, Ulrich Weber, Dietmar Willoweit (Hrsg.), Schriftenreihe „Würzburger Vorträge zur Rechtsphilosophie, Rechtstheorie und Rechtssoziologie", Frankfurt, 1984, fortgesetzte Reihe 4. Edgar Michael Wenz, Otmar Issing, Hasso Hofmann (Hrsg.), Ökologie, Ökonomie und Jurisprudenz, Band 5 der Schriftenreihe Law and Economics, Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Forschung, München, 1987 5. Anmerkungen ... Eine Aufsatzsammlung, Würzburg, 1988 6. Ulrich Karpen, Edgar Michael Wenz (Hrsg.), National Legislation in the European Framework, Baden-Baden, 1998.
II. Aufsätze und Beiträge (Auszug) 1. Grenzfälle beim Inkrafttreten der Handwerksordnung. Wann braucht der große Befähigungsnachweis nicht erbracht zu werden? In: Konditorei und Café vom 02. 05. 1954; Nachdruck in: Anmerkungen ... ; U. Karpen, U. Weber, D. Willoweit, (Hrsg.), Rechtsforschung, Rechtspolitik und Unternehmertum. Gedächtnisschrift für Prof. Edgar Michael Wenz, Berlin, 1999
504
Bibliographie Edgar Michael Wenz
2. Der „Science Court" - und er nützt doch! In: Wirtschaft und Wissenschaft, 4/1978; Nachdruck in: U. Karpen, U. Weber, D. Willoweit (Hrsg.), Rechtsforschung, Rechtspolitik und Unternehmertum. Gedächtnisschrift für Prof. Edgar Michael Wenz, Berlin, 1999 3. Das Mißverständnis mit den „Wissenschaftsgerichtshöfen". In : ZRP 1985, S. 267-272; Nachdruck in: Anmerkungen ... ; U. Karpen, U. Weber, D. Willoweit (Hrsg.), Rechtsforschung, Rechtspolitik und Unternehmertum. Gedächtnisschrift für Prof. Edgar Michael Wenz, Berlin, 1999 4. Fragen von Naturwissenschaft und Technik an Rechtsphilosophie, Rechtstheorie, Rechtsdogmatik und Rechtssoziologie. Nachdruck in: Anmerkungen ... ; U. Karpen, U. Weber, D. Willoweit (Hrsg.), Rechtsforschung, Rechtspolitik und Unternehmertum. Gedächtnisschrift für Prof. Edgar Michael Wenz, Berlin, 1999 5. Verfahrensänderung zur Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Genehmigung von umweltrelevanten Großvorhaben? In: Speyerer Forschungsbericht 70, Band 2, Speyer, 1988; KfKBericht 4357, Kernforschungszentrum Karlsruhe, 1989; Nachdruck in: Anmerkungen ... ; U. Karpen, U. Weber, D. Willoweit (Hrsg.), Rechtsforschung, Rechtspolitik und Unternehmertum. Gedächtnisschrift für Prof. Edgar Michael Wenz, Berlin, 1999 6. Zum 100. Geburtstag von Theodor Geiger. Der heutige Diskussionsstand zur Rechtssoziologie Theodor Geigers. In: Information der Bayrischen Julius-Maximilians-Universität Würzburg 1/26 vom 27. 01. 1992; Nachdruck in: U. Karpen, U. Weber, D. Willoweit (Hrsg.), Rechtsforschung, Rechtspolitik und Unternehmertum. Gedächtnisschrift für Prof. Edgar Michael Wenz, Berlin, 1999 7. Von der Rechtsforschung zur Gesetzgebung. Gedanken zur Rechtssoziologie Theodor Geigers. In: Siegfried Bachmann (Hrsg.), Theodor Geiger. Soziologie in einer Zeit „zwischen Pathos und Nüchternheit", Berlin, 1995; Nachdruck in: U. Karpen, U. Weber, D. Willoweit (Hrsg.), Rechtsforschung, Rechtspolitik und Unternehmertum. Gedächtnisschrift für Prof. Edgar Michael Wenz, Berlin, 1999 8. Die Reaktionstheorie - rechtstheoretische Voraussetzung für die Rechtsforschung. In: ZfRsoz 15 (1994), Heft 1, S. 58-65; Nachdruck in: U. Karpen, U. Weber, D. Willoweit (Hrsg.), Rechtsforschung, Rechtspolitik und Unternehmertum. Gedächtnisschrift für Prof. Edgar Michael Wenz, Berlin, 1999 9. Taumelt Europa in den Justizstaat? In: Orientierungen zur Gesellschafts- und Wirtschaftspolitik, Nr. 58 (4/1993); Nachdruck in: U. Karpen, U. Weber, D. Willoweit (Hrsg.), Rechtsforschung, Rechtspolitik und Unternehmertum. Gedächtnisschrift für Prof. Edgar Michael Wenz, Berlin, 1999 10. Die forschungsbegleitete Gesetzgebung. In: U. Karpen, U. Weber, D. Willoweit (Hrsg.), Rechtsforschung, Rechtspolitik und Unternehmertum. Gedächtnisschrift für Prof. Edgar Michael Wenz, Berlin, 1999 11. Einführung in die theoretische Rechtssoziologie. In: U. Karpen, U. Weber, D. Willoweit (Hrsg.), Rechtsforschung, Rechtspolitik und Unternehmertum. Gedächtnisschrift für Prof. Edgar Michael Wenz, Berlin, 1999
Bibliographie Edgar Michael Wenz
C. Allgemeinpolitische Schriften I. Selbständige Schriften 1. Freiheit, Sicherheit und Eigenverantwortung. Sozialphilosophische Gedanken eines selbständigen Unternehmers, Unternehmerforum, hrsg. vom Unternehmerinstitut e.V., 2. Auflage, Bonn, 1995
II. Aufsätze und Beiträge (Auszug) 1. Ökologische Marktwirtschaft - Chancen und Grenzen. Umweltschutz am Prüfstein der sozialen Marktwirtschaft. In: Ökologie, Ökonomie und Jurisprudenz; Nachdruck in: Anmerkungen ...; U. Karpen, U. Weber, D. Willoweit (Hrsg.), Rechtsforschung, Rechtspolitik und Unternehmertum. Gedächtnisschrift für Prof. Edgar Michael Wenz, Berlin, 1999 2. Umwelt und Markt: Ökologische Marktwirtschaft - Chancen und Grenzen. In: Umweltmagazin, 3/87 3. Abgeordneten-Diäten. Der Skandal ist die Kostenpauschale. In: Mainfränkische Wirtschaft, 10/1988; Der Steuerzahler, Nr. 5/89; Nachdruck in: U. Karpen, U. Weber, D. Willoweit (Hrsg.), Rechtsforschung, Rechtspolitik und Unternehmertum. Gedächtnisschrift für Prof. Edgar Michael Wenz, Berlin, 1999 4. Umweltpolitik: Für einen konsequent marktwirtschaftlichen Weg. In: Orientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik, Nr. 34 5. Der Übergang zur Marktwirtschaft: Soziologische und sozialpsychologische Dimensionen. In: Orientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik, Nr. 42 6. Problemfelder der Wirtschaftspolitik. Bekenntnisse zum Privateigentum in eigentumsfeindlicher Wirklichkeit. In: Orientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik, Nr. 47 7. Die Diätenhöhen ist unbedenklich - Kostenpauschalen sind Rechtsbruch im Verfassungsrang. In: Orientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik, Nr. 53 (3/ 1992); Nachdruck in: U. Karpen, U. Weber, D. Willoweit (Hrsg.), Rechtsforschung, Rechtspolitik und Unternehmertum. Gedächtnisschrift für Prof. Edgar Michael Wenz, Berlin, 1999 8. Das alles würde nichts kosten - Wie die deutsche Vereinigung 1989/90 gesehen wurde. In: Orientierungen, zur Gesellschafts- und Wirtschaftspolitik, Nr. 55 9. Ein „Wirtschaftswunder" kann nicht versprochen, es muß erarbeitet werden. In: Orientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik, 55 (1/1993); Nachdruck in: U. Karpen, U. Weber, D. Willoweit (Hrsg.), Rechtsforschung, Rechtspolitik und Unternehmertum. Gedächtnisschrift für Prof. Edgar Michael Wenz, Berlin, 1999 10. Künstliche Vereinheitlichung führt zu Spaltung und Rechtsunsicherheit in der EU. In: Epoche, Nr. 127 (1994)
506
Bibliographie Edgar Michael Wenz
D. Historische Aufsätze 1. Michael Ignaz Schmidt. In: Würzburg - heute, 47/1989, S. 75 ff. 2. Michael Ignaz Schmidt - ein Aufklärer. Nachdruck in: Anmerkungen ... 3. Fanny von Arnstein - eine bedeutende Frauengestalt. In: Anmerkungen ... ; Nachdruck in: U. Karpen, U. Weber, D. Willoweit (Hrsg.), Rechtsforschung, Rechtspolitik und Unternehmertum. Gedächtnisschrift für Prof. Edgar Michael Wenz, Berlin, 1999 4. Hat Franz Leppich wirklich Moskau angezündet? In: Anmerkungen ... 5. War Ignaz Michael Schmidt nicht doch der erste deutsche Gesichtsschreiber? Eine Erwiderung. In: Peter Baumgart (Hrsg.), Michael Ignaz Schmidt (1736-1794) in seiner Zeit, Neustadt an der Aisch 1996; Nachdruck unter dem Titel „Michael Ignaz Schmidt als »erster deutscher Geschichtsschreiber"', in: U. Karpen, U. Weber, D. Willoweit (Hrsg.), Rechtsforschung, Rechtspolitik und Unternehmertum. Gedächtnisschrift für Prof. Edgar Michael Wenz, Berlin, 1999
Personenregister Abs, Hermann Joseph 398 Albert, Hans 125, 168 Aristoteles 290,459 f. Arnim von, Hans-Herbert 398, 458 Banfi, Antonio 427 Baur, Fritz 196 f., 198, 201 Beier, Adrian 31 Benda, Ernst 227, 230, 240, 245 Bendix, Reinhard 438 ff. Berney, Arnold 326 Beutel, Frederik K. 99, 104, 135 Beyendorff 41 Biedenkopf, Kurt 277 Bohret, Carl 123 Buchanan, James 459 Cantimori, Delio 424 Churchill, Winston 295 Croce, Benedetto 424 ff. Czarnowski, Stefan 429 Dahrendorf, Rolf 421 Deckert, Renate 122 Dierkes, Meinhold 158, 164 f., 170, 186, 188, 224, 230, 234, 236, 262, 394 Dresch, von Leonhard 331 Durkheim, Emile 71, 85, 95, 395, 429 Ehrlich, Eugen 68, 71, 85, 175, 395 Erhard, Ludwig 274, 291, 295, 306, 479 Eylmann, Horst 133 Firnfaber, I. S. 31 Fricke, Ludwig 27 Frey, Peter 74, 87, 96 Gehlen, Arnold 299 Geiger, Theodor 70 f., 73, 81, 84 f., 87, 93 f., 99, 101, 106, 117, 206, 284, 393 f., 395
Gerth, Hans 419,433,438, 440 Giddens, A. 423 Giese, Friedrich 46 Ginsberg, Morris 420 f. Graf Montgelas 33 Habermas, Jürgen 166, 262 Hank, Gustav 40 Hartkopf, Günter 228 Hayek von, Friedrich August 57, 266, 293, 306,464 Hegel 71, 85, 98, 152,481 Helfritz, Hans 390 Hellstern, Gerd-Michael 125 Henderson, Α. M. 420 Hertz, Alexander 430 Hill, Hermann 115, 124 Hirsch 81 Hoffmann-Riem, Wolfgang 125, 132 Hofmann, Hasso 257, 259 f., 399 Hoppe, Hans-Herrmann 458 Hugger, Werner 126 Humboldt von, Wilhelm 459 Jaspers, Karl 457, 461 Jellinek, Georg 108, 152 Jellinek, Walter 54 Jhering, Rudolf von 171, 206 Kant, Immanuel 289,481 Kantorowicz, Hermann 67, 71, 85, 395 Karpen, Ulrich 115 Kaufmann, Arthur 57, 258, 259, 266 Kennedy, John F. 462 Kern, Eduard 196 f., 202 Kewenig, Wilhelm 160 f., 163, 224, 394 Kindermann, Harald 125, 130 Klausa, Ekkehard 202 Knight, Frank 433 Koch, Roland 134
508
Personenregister
Kohl, Helmut 274 König, Klaus 125, 138, 142 Kozyr-Kowalsky, Stanislaw 431 Krzywicki, Ludwig 429
Popper, Karl 110, 125, 136, 154, 166, 168, 224, 458 Pound, Roscoe 99, 124, 176 Quesnay, François 31
Landmann von, Robert 43 Lange, F. A. 38 Laufs, Adolf 228 Liermann, Hans 390 Lippmann, Walter 457 Llewellyn, Karl 71, 78, 85, 91, 95 Lübbe, Hermann 306 Luhmann, Niklas 57 f., 67, 72, 81, 85, 109, 130, 153, 155, 177 ff., 181 ff., 243, 246, 258, 259, 266, 394 f., 446 Lukes, Rudolf 230, 235, 241, 261 Lüst, Reimar 159 Mader, Luzius 126, 131 Maier-Leibnitz, Heinz 215 f. Maihofer, Werner 102 Mannheim, Karl 420 Marburger, Peter 207, 230, 235, 237, 240, 261 Martindale, D. 433, 438 Marx, Karl 81, 288, 290, 417, 427, 442, 481 Merton, Robert 180 Meyer-Abich, Klaus Michael 263 f. Michels, Roberto 425 Mill, John Stuart 477 Millbiller, Joseph 331 Mills, C. Wright 419, 433 Ming, Ku Hu 463 Montesquieu, Charles de 136, 210 Nicklisch, Fritz 174, 208, 227, 237, 240, 244 Nock, Joy 459 Noll, Peter 115 f., 122, 177, 393 Oberthür, Franz 325, 330 Olivecrona, Karl 73, 97 Ossenbühl, Fritz 213, 220, 240, 261 Paci, Enzo 424 Parson, Talco« 180, 419 f., 426, 433, 438 Platon 459
Radbruch, Gustav 195 Ranke von, Leopold 330 Rehbinder, Manfred 69, 75, 81, 89 Reiser, Friedrich 23 Renn, Ortwin 228 Reuß, Wilhelm 45 Rex, John 421,423 Robbins, Lionel 420 Roellecke, Gerd 159 ff., 165, 170, 224 f., 394 Röhl, Klaus F. 72, 78, 85, 91 Rohrscheidt von, Kurt 25, 28, 36, 42 Roth, Günther 433,438,440 Rothbard, Murray 459 Rudolph, Paul 24 Rüggeberg, Jörg 195 ff., 201 Runciman, W. C. 422 Rüthers, Bernd 213 Ryffel, Hans 117, 166 Sarwey von, Otto 210 Sauter-Bergerhausen, Christina 327, 329 f., 332 Schelsky, Helmut 57, 171, 179, 266 Schiffmann, Gerfried, 202 Schlosser, Johann Georg 448, 450 f. Schmidt, Johann Jacob Mascov 326 Schmidt, Michael Ignaz 325, 327 f., 331 f. Schmidt-Räntsch, Günther 195 Schneider, Hans 113, 115, 126 Schröder, Heinrich 117, 128 Schultze-Fielitz, Helmuth 126 f. Schumpeter, Joseph 459 Schünemann, Hans-Wilhelm 173 Schwarz, Gerhard 457 Schwarz, Hans-Peter 461, 464 Seuffert, Otmar 327 Shils, E. 420 Scholz, Rupert 133 Siemens von, Peter 398 Smith, Adam 30 f., 289, 307, 481
Personenregister Tawney, Richard 419 Thatcher, Margaret 462 Thienen von, Volker 158, 164, 170, 186, 224, 230, 234, 394 Tyszka von, Carl 25 f. Wagener, Joachim 134 Wagner, Hellmut 216, 227, 229, 232, 235, 237,261
Weber, Max 71, 81 f., 85, 95, 210, 295, 416 f., 422, 424, 428, 461 Weber, Ulrich 399 Wittich, Claus 433 Wolf, Erik 390 Wollmann, Helmut 125 f. Zeh, Wolfgang 126 Znaniecki, Florian 429
Sachregister Abhängigkeit 198 Abolitionismus 459 Absolutismus 403 Abwärmebelastung 345 acte éclairé 452 f. Aktionsnormen 97 aktives Tun 497 Akzeptanzkrise 61, 107, 151, 158, 163, 165, 168, 178, 186, 224, 226, 233, 236, 241, 253,394 Amtsbegriff 405 Amtsgedanke 405 Amtsordnungen 407 Anarcho-Liberalismus 459 Anerkennungstheorie 71,85 Anglophilie 418 Anthropozentrik 296 Appetizing Appeal 373, 375 Ära der Direktiven 47 Arbeitsrecht 479, 482 f. Arbeitsrechtsreform 483 Aufklärung 23, 30, 289 Aufwandsentschädigung 191, 218 Auschwitzlüge 495 Auslegungsbedürftigkeit 452, 454 Auslegungsprivileg 284 Auslegungsverbote 445, 447, 451 Ausnahmebewilligung 54 Auswahlverfahren 215, 458 Auszugs-Dampfbacköfen 356 authentische Auslegung 447, 449 f. Backeigenschaften 349 Backgutträger 348 Backkapazitäten 351 Backnutzfläche 342, 344, 351, 377 Backofensysteme 355 Bedürfnisbefriedigung 307 Befähigungsnachweis 34,42,43,48, 52,458
Befangenheit 221 Begriff der Öffentlichkeit 53 Begriff des Laien 191 Beheizungssystem 348 Beobachtbarkeit 73, 87, 96 Beobachtungsfeld 73, 87 Berichtspflicht 104, 125, 127 Berufsrichter 190, 197 f., 221, 254 Berufungsverfahren 213, 216, 242 Beschickung 352 Betriebssoziologie 435 Betroffenheit 162, 195 Bodenflächenausnutzungsgrad 351 Bodenflächennutzungsfaktor 363 Brot 308 f., 319, 341,383 Brotbewußtsein 310, 314, 382 Brotland 382, 385 Brotsorten 310, 349, 383 Bundespatentgericht 156, 191, 194, 205, 208,218, 393 Bundesstaat 287, 398 Bürgerbeteiligung 263 Bürokratie 434 Cassava 311 Chauvinismus 308 Delegationsfunktion 209 Demokratie 295, 297, 317, 458 f., 461 demokratische Funktion 197 Deparsonisierung 439 Deutsche Bäckerei 312, 321 Deutsche Gesellschaft für Gesetzgebung 115 Diäten 271, 279 f. Direktiven der US-Militärregierung 47 Doppelstikkenöfen 351 Dreidimensionalität des Rechts 67 Dreistufenthese 208
Sachregister Durchforstungsautomatismus 129 Durchlaufofen 351 Durchschnittsofen 342, 344 Effektivität der Rechtsnormen 70, 76, 82, 84, 90, 95, 116, 118 Effektivitätsbegriff 117 Effektivitätskontrolle 68, 116 f., 122, 126, 128 Effektivitäts-Kosten-Analyse 471 Effektivitätsquote 94, 395 Egoismusmoral 289 ehrenamtliche Richter 191 f., 202 Eigenverantwortlichkeit 274, 296 Eigenverantwortung 397 Einschließ-Dampfbackofen 356 Einzelnachweis 272, 281 Elektro-Etagenbackofen 356 Elektrowärme 344 Ellenbogengesellschaft 292 Emanzipation 193 f., 264, 334 Emanzipationsbewegung 334 f. emanzipatorische Funktion 197, 201, 213, 265 Empirizismus 418 Energiebedarf 357 Energiemangel 320 Enquete-Kommission 104, 136, 142, 187, 217, 261 Entpersonalisierung des Verwaltungshandelns 411 Entscheidungskompetenz 156, 261 Entscheidungspflicht 116, 192 Entscheidungsrecht 192 Entscheidungszwang 160, 284 entschuldigender Notstand 496 f. Entschuldigung der Straftatbegehung 496 Entsorgung 346 Entwicklungshilfe 307, 314, 316, 384 Entwicklungsländer 314 Erfolgskontrolle 67, 101 f., 105, 116, 119 f., 121, 132 Ernährungsgewohnheiten 308 Ernährungshilfe 315 Erörterungstermin 55 Ersatzgesetzgeber 121, 226 Erstgeburtsrecht 325 f. Erzwingungsstab 72, 86, 98
511
Etagenbackofen 342 Etagen-Dampfbackofen 356 Europa 284 f., 480 Europäischer Gerichtshof 452 Europarecht 482 European Association of Legislation 115 Evaluierung von Gesetzen 69 Ewigkeitsklausel 445 ex ante 121, 136, 143 ex ante-Erforschung 396 ex ante-Methode 122 f., 125, 142 ex post 123, 135, 143, 396 ex post-Analyse 123 ex post-Kontrolle 122, 142, 466 ex post-Methode 125 experimentelle Gesetzgebung 104 experimentelle Rechtsetzung 465, 466, 478 Experimentelle Rechtswissenschaft 135 Experimentiergesetze 125, 131 f., 134 Experimentierklausel 129, 131 f., 139 Experten 58, 154, 254 Expertengericht 155, 193 f., 212, 214, 218, 223, 226, 229, 243 Experten-Richter 156, 192, 198, 200, 202, 220 ff., 242 Fachsoziologie 173 Faschismus 291 Feinbackwaren 378 Fettgebäck 378 Flächendeckung 357 Flächennutzungsfaktor 360 Fladen 309 Folgenabschätzung 466, 474 Forscherparlament 186 ff., 262 Forschungsmethodik 70 Fortschrittsoptimismus 168 fossile Brennstoffe 343 Frankfurter Schule 422 Französische Revolution 32 f. freie Wirtschaftsordnung 319 Freigebigkeit 460 Freihandelsschule 37 Freiheit 288, 292 f., 296, 397 Freimeister 21, 27 Freirechtslehre 68, 176 Freiwirtschaftslehre 30 Freizügigkeitsgrundsatz 37
512
Sachregister
friedensstiftende Wirkung 59, 260 funktionale Rechtstheorie 72, 85 Fürstenspiegel 460 f. Fürstenstaat 411 Generalklausel 58, 65 f., 105, 108, 140, 151, 205 ff., 209, 211, 221, 227, 259, 284 Generalprävention 490 Gerichtstheorie 72, 85 Geruchssinn 374 Geschichtsschreiber 325, 399 Geschichtswerk 327, 331 Geschworener 192, 197 Gesellschaftspolitik 288 Gesetzeseffektivität 101, 118 Gesetzesevaluation 101, 104, 115 f., 119,
121, 128 Gesetzesflut 93, 397 Gesetzeskommission 448, 450 Gesetzespositivist 153, 179 Gesetzesziel 468 Gesetzgebung 99, 113, 115, 174, 390 Gesetzgebungslehre 65, 70, 76, 84, 90, 99, 102, 109, 115 f., 119, 131, 138, 175 f., 179, 390, 392, 396 Gesetzgebungstechnik 80 Gesetzgebungs verfahren 101 Gesetzlichkeit des Richters 217 Gesinnungsstrafrecht 492 Gewaltenteilung 286, 449 Gewerbefreiheit 19, 21 f., 31 f., 36, 38, 44, 50, 52, 54 Glaubens- und Gewissensfreiheit 499 Glaubwürdigkeit 256 Gleichgewicht 293 Gleichheit 288 Gleichheitsgrundsatz 272 f., 281 f. Gleichheitsideal 288 Globalisierung 480 Großtechnologie 186 ff., 205, 221, 224, 241, 254, 267 Gutachter 203 f., 256 Handelsrichter 192, 202, 205, 219 Handwerkernovelle 41 f. Handwerksgerechtigkeit 25 Handwerksordnung 52 Hauptnahrungsmittel 309, 382, 385
Heizmedium 342 Heizöldurchsatz 342 Historiograph 325 historischer Materialismus 427,440, 442 Historizismus 426 Hofordnungen 407 impact-Bezug 477 Implementationsforschung 102, 115, 119, 131 Individualismus 418,422 Industrialisierung 290 Innungen 37 ff. Innungsbegriff 42 Innungsnovelle 40 Instruktionen 410 Integration 193 Integrationsfunktion 193, 201, 213, 265 Interdependenz 172, 177 Interessengruppen-Prinzip 196 Interferenzstadium 173 invisible hand 289, 481 Jedermann-Prinzip 196 Josephinismus 335 f. Justizstaat 284, 286, 397 Kammergut 407 Kammerordnungen 407 Kanzleiordnungen 407 Kapital 293 Kapitalismus 318, 419,425, 438,440 Kaufpreis 357, 366 Kernenergietechnik 341 Kernkraft 186, 221, 241, 345 Kirchenrecht 77, 90 Klassen- und Standesanalyse 436 Klassentheorie 81 Kollegialgericht 190 f., 219, 221 Kommentierungsverbote 449 f. Kommunikationsmedien 155, 182, 223, 256 konditionale Gesetze 141 Konstitutionalismus 403 Kontrolldichte 222, 226, 237 f. Konvektionsheizung 348, 362 Konzessionssystem 32, 35 f. Kooperations Verhältnis 456 Kosten-Effektivitäts-Verhältnis 474
Sachregister Kostenentwicklung 470 Kostenfaktor 354, 356 Kostenpauschale 271, 280, 398 Kriegs- und Ersatzdienstverweigerung 499 Kriminologie 76, 89 Kündigungsschutz 483 Kunstfreiheit 493 Laiengericht 243 Laiengerichtsbarkeit 156, 263 Laienrichter 156, 190, 192, 198, 221, 242, 264 Laienrichtertum 58, 156, 162, 190 f., 192 f., 195 ff., 199, 205,213, 223, 243 Landesprodukte 311 Legalitätsprinzip 490 Legitimation 57, 59, 109, 151, 159, 178, 181, 183, 194, 202, 212, 223, 243, 258, 264 Legitimität 226 Leistungsgesellschaft 274 Leninismus 290 Liberalismus 291, 403, 438, 461 Lizenzierungsgesetz 45, 48 f. Lizensierungssystem 24, 45 f. Lochbleche 348 London School of Economics 419 luftfremde Stoffe 342 Maastricht-Urteil 285, 454, 456 Macht 436 Manchesterdoktrin 37, 43 Manchester-Liberalismus 290 Markt 293,316 Marktforschung 100 Marktwirtschaft 274, 292, 297, 299 Marshall-Plan 276 Marxismus 81, 290, 426 f., 431 Massenmedien 199 Massenverfahren 184 f., 224, 243, 255, 259 Maßnahmegesetze 71, 86, 93, 94 f., 98, 101, 124, 396 Meinungsbildner 295 Meinungsforschung 67, 69, 80, 100, 141 Meinungsfreiheit 492 f., 495 Meisterprüfung 52 Meisterstück 26 Meßzeitpunkt 104 33 Gedächtnisschrift Wenz
513
M-Größe 355 Mischbrot 312 MIWE-Backofen 391 MIWE Michael Wenz GmbH 389, 398 Modernisierungsparadigma 465 moralischer Irrationalismus 167 Moralphilosophie 30 Morgenthauplan 47 multidimensionale Folgenanalyse 470 Nationalcharakter 328 Nationalökonomie 31, 37, 390, 479 Nationalsozialismus 291 Nationalverständnis 329 Nebengesetze 43 Nebenwirkungen 470 negatio negationis 71, 82, 85, 98 negative Generalprävention 488 Neu-Hegelianismus 108, 151 Neu-Kantianismus 108, 151 Niedriglohn-Parlament 280, 398 Normenflut 114, 134, 396 Normenkosmos 82 Normentheorie 94 Normfindung 66 Notwendigkeitsprüfung 470, 472 Objektivität 417,420 Obrigkeitsstaat 409, 411 Öffentlichkeitsbeteiligung 55 f., 62 Öffentlichkeitsgrundsatz 55 f. ökologische Marktwirtschaft 299, 395 ökonomischer Imperativ 289 Operationalisierung 74, 77, 87, 90, 103, 120 Ordnungstypen 407 Orientierungshilfe 170 örtliche Zuständigkeit 219 outcome-Bezug 477 oven-in-store 373, 378 Panel-Verfahren 80, 141 Paradoxie des Entscheidens 446 Parlamentarier 271 Parsonisierung 438 Partizipation 193, 201 partizipatorische Funktion 156, 194, 201, 213, 265 Personalbedarf 357, 364
514
Sachregister
Personalkosten 367 Phaenomenologie 108, 151 Planspiele 121, 135, 143 Planungsgesetze 79, 94, 141 f. Platzbedarf 357 Plausibilitätskontrolle 200 Polenfrage 429 Politiker 447, 461 Politikerverdrossenheit 459, 464 Politikverdrossenheit 459 Polizeifreiheit 31 Polizeigewalt 34 Pornographieverbot 493 positive Generalprävention 488 Praktikabilität 465 prälegislative Analytik 470 Praxistest 469 Prestige-Gewinn 312 Privatunternehmer 294 Probiergesetze 123, 133 f., 135, 138 f., 396 Problementwicklungsanalysen 470 Producing Open Display 373 Prognose 65 prospektive Gesetzesfolgenabschätzung 469, 472, 478 Protektionismus 37 Protestantismus 418 Prüffragen 137, 396, 474 Prüfungskatalog 140 Prüfungsmaßstab 103, 120 Rationalisierung 114, 116, 119, 122 Rationalisierungseffekt 350 Rationalismus 168,464 Ratsordnungen 407 Reaktionsnormen 97 Reaktionstheorie 71 f., 74 f., 77 f., 82, 85, 88,91,96, 99, 393, 395 Rechtmäßigkeitskontrolle 210 Rechtsdogmatik 107 f., 151 f. Rechtsentfremdung 171 Rechtsforschung 65 f., 70, 74, 76, 79, 82, 84, 88 f., 94 f., 99, 119 Rechtsfrieden 159 f., 162, 179, 187, 225 Rechtsgüterschutz 487, 491 Rechtskrise 165, 169, 241 Rechtsmittelzug 220 Rechtspflegeministerium 124
Rechtspflegestatistik 76, 89 Rechtsphilosophie 81, 107, 108, 151 Rechtspolitik 172 Rechtspositivismus 108, 151, 181, 418, 420, 422 Rechtsrealismus 71, 85, 98, 179 Rechtsschutz 187 Rechtssicherheit 187, 226, 240, 259, 449 f. Rechtssoziologie 65 ff., 80 f., 107 f., 119, 122, 153, 169, 172, 174, 176, 178, 180, 205, 227 f., 258, 389, 393 Rechtsstab 72, 76 ff., 82, 86, 90 f., 96 f., 117, 169, 171,395 Rechtsstabstheorie 72 f., 77 f., 85, 87, 90 f. Rechtstatsachenforschung 66, 69, 82, 84, 95, 102, 104, 109, 124, 176 f., 228 Rechtstheorie 107, 108, 151,445 Rechtsüberzeugung 162, 171, 177, 226, 284, 287, 297 Rechtsvereinheitlichung 285 Rechtsverweisung 209 Rechtswirklichkeit 66, 69, 74, 76, 90 référé législativ 448 f. Regelhaftigkeit des Verwaltungshandelns 405,411 Regelungsdefizit 207 Regelungswut 130 rekursive Kommunikationsfiguren 445 Rekursivitätsschleifen 456 f. Religionssoziologie 433, 436,438 f., 441 Rentabilität 354 Repräsentation 58 Ressourcen 167 restitutio in harmoniam et eunomicuum 73, 83, 86, 98 Restrisiko 346 Rezeption 415 Rezeptionsfunktion 209, 227, 240 Richter-Ehrensold 218 richterliche Autorität 155 Richterstaat 105, 163 Risikoakzeptanz 227 rollender Betriebsablauf 352 Roll-in 348 Royal Commission 186, 188, 262 Rückmeldeverfahren 128
Sachregister Sachverständige 156, 161, 204, 217, 230, 238,243,256 Sachverständigengremium 59 f., 235 f., 259 f., 266 Sachverstands-Prinzip 196 Sanktionstheorie 72, 74 f., 85, 89, 96 Schadstoffe 344 Schadstoffemissionen 342 f. Schöffe 192, 197 Schrankofen 362 Schuldprinzip 488, 490 Schutzbedürftigkeit des Arbeitnehmers 481 Schutzjuden 333, 337 Schwadenerzeugung 349 science court 110, 154, 158 f., 162, 165, 186, 228, 233,241,253,394 Selbstauslegungsverbote 447 Selbstbedienungsmentalität 272, 281 Selbstbindung 403,413 Selbsthilfe 307, 315, 384 Selbstreferenz 446 Shop-in-Shop 380 Sicherheit 289, 292 f., 296, 397 Sicherheitsrisiken 346 Sicht- und Duftbacken 373, 375 f., 380, 392 Siedegebäck 378 Simulationen 68, 121, 123, 135 sociology into law 176 Sozialakzeptanz 62 soziale Gesetzgebung 43 soziale Marktwirtschaft 291 f., 306, 316, 397 Sozialismus 307, 318,419,464 Sozialpolitik 288 Sozialprofil der Richter-Personen 189 Sozialpsychologie 185 sozialpsychologische Wirkung 154, 255 sozialschädliches Verhalten 491 Sozialstaat 79 Sozialwissenschaft 416 Soziologie 421 f., 425, 427, 429, 437 soziologische Jurisprudenz 205 f. soziologische Rechtstheorien 71, 84, 95, 239 soziologischer Rechtsbegriff 67, 74, 87 Spezialprävention 488,490 spezifischer Gesamtkostenfaktor 368 Staatenbund 287 33:
515
Staatsbildung 408, 410 Staatsmann 457, 461 Staatsräson 461 ff. Staatssoziologie 403 Stalinismus 290 Standortdiskussion 481 statesmanship 458 f., 463 Stikken 348, 361 Stikkenofen 348, 361 Stikkenofensysteme 362 strafrechtlicher Staatsschutz 494 Strafrechtsschutz 488 Strukturalismus 422 strukturell-funktionale Rechtstheorie 72, 85 subjektiv-öffentliches Recht 52 Subsidiarität 285, 296, 488 Subsidiaritätsprinzip 489 Subsumtionsfähigkeit 126 Sunrise Legislation 131 sunset laws 136 Sunset Legislation 131 Super-GAU 346 Systemkritik 341 Systemtheorie 179 ff. Systemvertrauen 57, 155, 183, 223, 246, 256, 266 Szenarios 472 Tarifautonomie 484 Tarifpolitik 276 Tatsachenrechtsforschung 70, 82, 84, 95, 97, 177, 228 Technikakzeptanz 165 Technikpessimismus 165 Technologiefachkammer 60 f., 154 f., 186, 188, 190, 198, 212 f., 218, 221, 225, 229, 236, 242, 245, 254, 257, 266, 393 Technologiesenat 254 Technologie-Transfer 312, 385 Territorialitätsprinzip 480 Testverfahren 474 Theorie des Staatsmanns 463 Tigerstaaten 292 Toleranz 487, 491,495 Toleranzbegriff 489 Toleranzgebot 490, 492, 495, 501 Treffsicherheit 229
516
Sachregister
Umerziehungsgrundsatz 45 Umverteilen 294 Umweltschutz 299, 341 Umweltschutzkosten 302 Umweltzertifikate 304 Unabhängigkeit 197 f. Unterlassungstaten 498 Unternehmensleiter 294 Unzumutbarkeit der Normbefolgung 496 Verbandsklage 185 Verbandsrecht 77, 90 Verfahren 57, 60 Verfahrens- und Entscheidungsgarantie 57 Verfahrenstheorie 72, 85 Vergütung 219 Verhaltenskodex 457, 463 Verrechtlichungstendenz 83 vertrauensbildende Wirkung 155 Verursacherprinzip 300 Verwaltungsgerichtsverfahren 60 Verwaltungsgeschichte 404 Verwaltungsgesetzgebung 403, 407, 409 f. Verwaltungshandeln 405 Verwaltungsordnung 406 f., 410 f. Verwaltungsrecht 71, 74, 76, 86 f., 89, 97, 136 Verzehrgewohnheiten 308, 382 Vizthume 407 Völkerrecht 77, 90 Volksgerichte 195 Volkssouveränität 458, 463 Vollzugsdefizit 303 Vorbildfunktion 272, 281 Vorlagepflicht 447, 450 f., 452 f., 455 Wächterfunktion 200 Wahlforschung 69, 100 Wärmebedarf 363 Wärmegewinnung 341 Wärmekraftwerke 345 Weberianer 423 Weberianismus 426 Weber-Rezeption in Europa 417
Weber-Rezeption in Japan 440 Weber-Rezeption in USA 432 Weizen-Lobby 384 Welthungerhilfe 314 Werbeeffekt 379 Wertfreiheit 420, 438, 440 Werbung 374 Wertnihilismus 81, 153, 176 Werturteilsfreiheit 168 Wettbewerb 293, 398 Widerspruchsfreiheit 472 Willensfreiheit 289 Willkürschwelle 454 Wirklichkeitswissenschaft vom Recht 176 Wirksamkeitsanalyse 115 Wirksamkeitsprüfung 470 Wirkungsanalyse 116 Wirkungsauftrag 103, 120 Wirkungschance 82, 95, 117 Wirkungsgrad 345 Wirtschaftswunder 274, 391, 397 Wissenschaftsgerichtshof 110, 154, 159, 163, 165, 170, 186, 188, 224, 228, 236, 241, 253, 259, 262, 393 Wohlfahrtsstaat 295 Wolkenkratzereffekt 350 Zeitgesetz 104, 125, 129, 130, 132, 134, 138 f., 468 Zielerreichungsgrad 103, 119 Zielkontrolle 70, 84 Zunft 19 Zunftexekution 24 Zunftgerichtsbarkeit 27, 34 f. Zunftnepotismus 23 Zunftrecht 32 Zunftzwang 20, 42 Zwangs- und Bannrechte 34 Zwangsinnung 41 f., 87 Zwangstheorie 71, 73, 75, 82, 85, 89, 95 Zwangsumwälzung 342, 344 Zweckmäßigkeit 118 Zweckmäßigkeitsprüfung 210 Zwischenziel 140
![Marginale Urbanität: Migrantisches Unternehmertum und Stadtentwicklung [1. Aufl.]
9783839419380](https://ebin.pub/img/200x200/marginale-urbanitt-migrantisches-unternehmertum-und-stadtentwicklung-1-aufl-9783839419380.jpg)
![Rechtsdogmatik und Rechtspolitik: Hamburger Ringvorlesung [1 ed.]
9783428468492, 9783428068494](https://ebin.pub/img/200x200/rechtsdogmatik-und-rechtspolitik-hamburger-ringvorlesung-1nbsped-9783428468492-9783428068494.jpg)


![Datenschutz, Informationsrecht und Rechtspolitik: Gesammelte Aufsätze [1 ed.]
9783428517596, 9783428117598](https://ebin.pub/img/200x200/datenschutz-informationsrecht-und-rechtspolitik-gesammelte-aufstze-1nbsped-9783428517596-9783428117598.jpg)


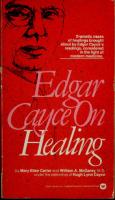
![Sidepreneurship: Nebenberufliches Unternehmertum – eine Einführung [1. Aufl.]
9783658315047, 9783658315054](https://ebin.pub/img/200x200/sidepreneurship-nebenberufliches-unternehmertum-eine-einfhrung-1-aufl-9783658315047-9783658315054.jpg)
![Migrantisches Unternehmertum in Deutschland: Afro Hair Salons zwischen Ausgrenzung und Inkorporation [1. Aufl.]
9783839433003](https://ebin.pub/img/200x200/migrantisches-unternehmertum-in-deutschland-afro-hair-salons-zwischen-ausgrenzung-und-inkorporation-1-aufl-9783839433003.jpg)