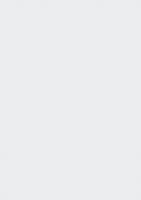Das Heilige Römische Reich deutscher Nation und seine Territorien: 1493-1806 [2 ed.] 3534270622, 9783534270620
Das Heilige Römische Reich deutscher Nation als monumentale Gesamtdarstellung der Zeit zwischen Mittelalter und Napoleon
126 9 12MB
German Pages 1672 [840] Year 2018
Front Cover
Titel
Widmung
Impressum
Inhalt
Abkürzungen
Einführung zu Band II: Vom Westfälischen Frieden zur Auflösung des Reichs 1806
I. Auferstehung und neues Leben 1648–1705: Das Reich unter Ferdinand III. und Leopold I.
1. Die Geschichtsschreibung und das Reich nach dem Dreißigjährigen Krieg
2. Die letzten Jahre Ferdinands III.: Bündnisse im Westen, Kriege im Norden
3. Von Ferdinand III. zu Leopold I
4. Leopold I. und seine Feinde im Ausland
5. Die neue türkische Bedrohung
6. Erneuter Konflikt mit Frankreich
7. Der Kaiser, der Immerwährende Reichstag, die Kreise und die Reichsjustiz
8. Kaiserliche Netzwerke: Reichskirche und Reichsstädte
9. Der Kaiserhof in Wien und dynastische Erhebungen im Reich
10. Das Wesen des Reichs: Projekte und Kultur
11. Interpretationen des leopoldinischen Reichs
II. Konsolidierung und Krise 1705–1740: Das Reich unter Joseph I. und Karl VI.
12. Zwei Kriege und drei Kaiser
13. Leopold I., Joseph I. und der Spanische Erbfolgekrieg
14. Joseph I. und die Regierung im Reich
15. Karl VI.: Vollendung oder Verfall?
16. Prioritäten im Widerstreit (circa 1714–1730)
17. Die Regierung des Reichs unter Karl VI.
18. Zurück zur Religionspolitik?
19. Das Problem der österreichischen Thronfolge
20. Schwindende Kaisermacht? (1733–1740)
21. Das Reich in der Publizistik
III. Die deutschen Territorien um 1648–1760
22. Ein deutscher Absolutismus?
23. Der Blick der Zeitgenossen: Vom Wiederaufbau zur frühen Aufklärung
24. Die kleineren Territorien
25. Österreich und Brandenburg-Preußen
26. Das Wiedererblühen des Hofs und die Entwicklung territorialer Herrschaft
27. Der Hof: seine Kultur, Funktionen und Kritiker
28. Die Entwicklung der militärischen Macht
29. Fürsten und Stände
30. Unterdrückte Bauern?
31. Regierung und Gesellschaft
32. Regierungsmacht und wirtschaftliche Entwicklung
33. Öffentliche und private Unternehmen
34. Christliche Staatsorganisation: Der barocke Katholizismus
35. Christliche Gemeinwesen: Die Territorien der Reichskirche
36. Christliche Gemeinwesen: Protestantische Orthodoxie und Erneuerung
37. Von der Koexistenz zur Toleranz?
38. Aufklärung und Patriotismus
IV. Niedergang oder Reife? Das Reich von Karl VII. bis Leopold II. (ca. 1740–1792)
39. Drei Kaiser und ein König
40. Die Schlesischen Kriege (1740–1763)
41. Reichsherrschaft ohne Habsburger: Karl VII. (1742–1745)
42. Die Rückkehr der Habsburger: Franz I. (1745–1765)
44. Erneuerung: Joseph II. (1765–ca. 1776)
45. Joseph II. und die große Reformdebatte (ca. 1778–1790)
46. Restauration: Leopold II. (1790–1792)
47. Zentrale und mittlere Institutionen des Reichs
48. Reich, Öffentlichkeit und Nation
V. Die deutschen Territorien nach 1760
49. Die Aufklärung und das Reformproblem
50. Krise und Chance
51. Neue Herausforderungen: Aufklärung und Öffentlichkeit
52. Protestantische, katholische und jüdische Aufklärung
53. Aufklärung und Regierung
54. Kameralismus, Physiokratismus und die Versorgung der Gesellschaft
55. Wirtschaftspolitik: Manufakturen, Gilden, Wohlfahrt und Steuern
56. Verwaltung, Gesetz und Justiz
57. Bildung und Toleranz
58. Höfe und Kultur
59. Die Folgen der Reformen: Immunität gegen eine Revolution?
VI. Krieg und Zerfall: Das Reich 1792–1806
60. Brüche und Kontinuitäten
61. Das Reich in den Revolutionskriegen
62. Der Widerhall der Französischen Revolution im Reich: Unruhen und Aufstände
63. Der Widerhall der Französischen Revolution im Reich: Intellektuelle
64. Pläne für eine Reform des Reichs in den 1790er Jahren
65. Der Friede von Lunéville (1801) und der Reichsdeputationshauptschluss (1803)
66. Die Transformation des Reichs (1803–1805)
67. Letzte Reformversuche und die Auflösung des Reichs (1806)
Schluss
Literatur
Register
Karten
Back Cover
Recommend Papers
![Das Heilige Römische Reich deutscher Nation und seine Territorien: 1493-1806 [2 ed.]
3534270622, 9783534270620](https://ebin.pub/img/200x200/das-heilige-rmische-reich-deutscher-nation-und-seine-territorien-1493-1806-2nbsped-3534270622-9783534270620.jpg)
- Author / Uploaded
- Joachim Whaley
File loading please wait...
Citation preview
Joachim Whaley, geb. 1954, ist Mitglied der Royal Historical Society und Professor of German History and Thought an der Universität Cambridge, wo er deutsche Geschichte und Kultur nach 1500 am Gonville and Caius College lehrt.
Joachim Whaley
Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation und seine Territorien Band II Vom Westfälischen Frieden zur Auflösung des Reichs 1648–1806 Aus dem Englischen von Michael Sailer
Die Übersetzung wurde gefördert durch den Wilhelm-Weischedel-Fonds der WBG
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Das Werk ist in allen seinen Teilen urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung in und Verarbeitung durch elektronische Systeme.
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel Germany and the Holy Roman Empire bei Oxford University Press (2012) © Joachim Whaley
wbg Academic ist ein Imprint der wbg (Wissenschaftliche Buchgesellschaft), Darmstadt © 2018 by wbg (Wissenschaftliche Buchgesellschaft), Darmstadt durchgesehene Sonderausgabe der 1. Auflage 2014 Die Herausgabe des Werkes wurde durch die Vereinsmitglieder der wbg ermöglicht. Umschlaggestaltung: Peter Lohse, Heppenheim Redaktion: Dirk Michel, Mannheim Satz: SatzWeise, Föhren Karten im Anhang: Peter Palm, Berlin Gedruckt auf säurefreiem und alterungsbeständigem Papier Printed in Germany Besuchen Sie uns im Internet: www.wbg-wissenverbindet.de ISBN 978-3-534-27062-0 Elektronisch sind folgende Ausgaben erhältlich: eBook (PDF): 978-3-534-74410-7 eBook (epub): 978-3-534-74411-4
Inhalt Abkürzungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Einführung zu Band II: Vom Westfälischen Frieden zur Auflösung des Reichs 1806
. . . . . . . . . .
9
11
I. Auferstehung und neues Leben 1648–1705: Das Reich unter Ferdinand III. und Leopold I. 1. Die Geschichtsschreibung und das Reich nach dem Dreißigjährigen Krieg .
15
2. Die letzten Jahre Ferdinands III.: Bündnisse im Westen, Kriege im Norden .
23
3. Von Ferdinand III. zu Leopold I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
4. Leopold I. und seine Feinde im Ausland . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43
5. Die neue türkische Bedrohung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59
6. Erneuter Konflikt mit Frankreich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64
7. Der Kaiser, der Immerwährende Reichstag, die Kreise und die Reichsjustiz
72
8. Kaiserliche Netzwerke: Reichskirche und Reichsstädte . . . . . . . . . .
86
9. Der Kaiserhof in Wien und dynastische Erhebungen im Reich . . . . . . .
91
10. Das Wesen des Reichs: Projekte und Kultur . . . . . . . . . . . . . . . .
101
11. Interpretationen des leopoldinischen Reichs . . . . . . . . . . . . . . .
119
II. Konsolidierung und Krise 1705–1740: Das Reich unter Joseph I. und Karl VI. 12. Zwei Kriege und drei Kaiser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131
13. Leopold I., Joseph I. und der Spanische Erbfolgekrieg . . . . . . . . . . .
134
14. Joseph I. und die Regierung im Reich . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147
6
Inhalt
15. Karl VI.: Vollendung oder Verfall? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157
16. Prioritäten im Widerstreit (circa 1714–1730) . . . . . . . . . . . . . . . .
164
17. Die Regierung des Reichs unter Karl VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
171
18. Zurück zur Religionspolitik?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
179
19. Das Problem der österreichischen Thronfolge . . . . . . . . . . . . . . .
188
20. Schwindende Kaisermacht? (1733–1740) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
194
21. Das Reich in der Publizistik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200
III. Die deutschen Territorien um 1648–1760 22. Ein deutscher Absolutismus? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
219
23. Der Blick der Zeitgenossen: Vom Wiederaufbau zur frühen Aufklärung . .
225
24. Die kleineren Territorien
236
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25. Österreich und Brandenburg-Preußen
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
248
26. Das Wiedererblühen des Hofs und die Entwicklung territorialer Herrschaft
257
27. Der Hof: seine Kultur, Funktionen und Kritiker . . . . . . . . . . . . . .
260
28. Die Entwicklung der militärischen Macht . . . . . . . . . . . . . . . . .
271
29. Fürsten und Stände . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
279
30. Unterdrückte Bauern?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
288
31. Regierung und Gesellschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
298
32. Regierungsmacht und wirtschaftliche Entwicklung . . . . . . . . . . . .
313
33. Öffentliche und private Unternehmen . . . . . . . . . . . . . . . . . .
320
34. Christliche Staatsorganisation: Der barocke Katholizismus . . . . . . . .
331
35. Christliche Gemeinwesen: Die Territorien der Reichskirche . . . . . . . .
344
36. Christliche Gemeinwesen: Protestantische Orthodoxie und Erneuerung
.
353
37. Von der Koexistenz zur Toleranz? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
371
38. Aufklärung und Patriotismus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
380
7
Inhalt
IV. Niedergang oder Reife? Das Reich von Karl VII. bis Leopold II. (ca. 1740–1792) 39. Drei Kaiser und ein König . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
399
40. Die Schlesischen Kriege (1740–1763) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
405
41. Reichsherrschaft ohne Habsburger: Karl VII. (1742–1745) . . . . . . . . . .
421
42. Die Rückkehr der Habsburger: Franz I. (1745–1765) . . . . . . . . . . . . .
435
43. Das Reich ohne Gegner? Deutschland und Europa (1763–1792) . . . . . . .
451
44. Erneuerung: Joseph II. (1765–ca. 1776) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
469
45. Joseph II. und die große Reformdebatte (ca. 1778–1790) . . . . . . . . . .
479
46. Restauration: Leopold II. (1790–1792) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
491
47. Zentrale und mittlere Institutionen des Reichs . . . . . . . . . . . . . .
497
48. Reich, Öffentlichkeit und Nation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
504
V. Die deutschen Territorien nach 1760 49. Die Aufklärung und das Reformproblem . . . . . . . . . . . . . . . . .
515
50. Krise und Chance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
522
51. Neue Herausforderungen: Aufklärung und Öffentlichkeit . . . . . . . . .
530
52. Protestantische, katholische und jüdische Aufklärung . . . . . . . . . .
541
53. Aufklärung und Regierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
559
54. Kameralismus, Physiokratismus und die Versorgung der Gesellschaft
. .
569
55. Wirtschaftspolitik: Manufakturen, Gilden, Wohlfahrt und Steuern . . . .
579
56. Verwaltung, Gesetz und Justiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
590
57. Bildung und Toleranz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
595
58. Höfe und Kultur
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
606
59. Die Folgen der Reformen: Immunität gegen eine Revolution? . . . . . . .
623
8
Inhalt
VI. Krieg und Zerfall: Das Reich 1792–1806 60. Brüche und Kontinuitäten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
639
61. Das Reich in den Revolutionskriegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
648
62. Der Widerhall der Französischen Revolution im Reich: Unruhen und Aufstände . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
670
63. Der Widerhall der Französischen Revolution im Reich: Intellektuelle . . .
680
64. Pläne für eine Reform des Reichs in den 1790er Jahren . . . . . . . . . .
692
65. Der Friede von Lunéville (1801) und der Reichsdeputationshauptschluss (1803) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
706
66. Die Transformation des Reichs (1803–1805) . . . . . . . . . . . . . . . .
716
67. Letzte Reformversuche und die Auflösung des Reichs (1806) . . . . . . .
731
Schluss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
741
Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
749
Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
812
Karten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
836
Abkürzungen ADB BWDG
Allgemeine Deutsche Biographie, 56 Bde. (München und Leipzig, 1875–1902). Biographisches Wörterbuch zur deutschen Geschichte, hg. von Karl Bosl, Günther Frantz und Hanns Hubert Hofmann, 2. Aufl., 3 Bde. (München 1973/74). DBE Deutsche Biographische Enzyklopädie, hg. von Walther Killy und Rudolf Vierhaus, 13 Bde. in 15 Tln. (Darmstadt, 1995–2003). DVG Deutsche Verwaltungsgeschichte, Band I: Vom Spätmittelalter bis zum Ende des Reiches, hg. von Kurt G. A. Jeserich, Hans Pohl und Georg Christoph von Unruh (Stuttgart 1983). HBayG Handbuch der Bayerischen Geschichte, hg. von Max Spindler, Franz Brunhölzl und Hans Fischer, 4 Bde. in 6 Tln. (München, 1967–1975). HdtBG, I Handbuch der deutschen Bildungsgeschichte, Band I: 15. bis 17. Jahrhundert, hg. von Notker Hammerstein (München 1996). HdtBG, II Handbuch der deutschen Bildungsgeschichte, Band II: 18. Jahrhundert, hg. von Notker Hammerstein (München 2005). HbDSWG Handbuch der deutschen Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Band I: Von der Frühzeit bis zum Ende des 18. Jahrhunderts, hg. von Herman Aubin und Wolfgang Zorn (Stuttgart 1978). HDR Handwörterbuch zur Deutschen Rechtsgeschichte, hg. von Adalbert Erler und Ekkehard Kaufmann (Berlin 1964–) HLB http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/base/start (letzter Zugriff am 17. September 2013). HLS Historisches Lexikon der Schweiz, hg. von Marco Jorio (Basel 2002–). IPM Instrumentum Pacis Monasteriense (Friedensvertrag von Münster 1648). IPO Instrumentum Pacis Osnabrugense (Friedensvertrag von Osnabrück 1648). LdM Lexikon des Mittelalters, 10 Bde. (München, 1980–1999). NDB Neue Deutsche Biographie (Berlin 1953–). RGG Die Religion in Geschichte und Gegenwart. Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft, hg. von Hans Dieter Betz, Don S. Browning, Bernd Janowski und Eberhand Jüngel. 4. Aufl., 9 Bde. (München, 1998–2005). TRE Theologische Realenzyklopädie, hg. von Gerhard Krause und Gerhard Müller, 38 Bde. (Berlin, 1977–2007).
Einführung zu Band II: Vom Westfälischen Frieden zur Auflösung des Reichs 1806
F
ür die Zweiteilung dieser Studie zum Heiligen Römischen Reich der frühen Neuzeit im Jahr 1648 gibt es praktische und chronologische Gründe. Der zweite Band hat in etwa den gleichen Umfang wie der erste. Jener schloss und dieser beginnt mit einem der wichtigsten Marksteine der deutschen Frühneuzeit: dem Westfälischen Frieden, der den Dreißigjährigen Krieg beendete. Dieser Friedensschluss gilt als ein entscheidender Augenblick der deutschen Geschichte und steht nach verbreiteter Ansicht auch für den endgültigen Untergang aller Hoffnungen, die die Reformation geschürt hatte, den Beginn einer langen autoritären Phase der Entwicklung in den deutschen Territorien und den Anfang vom Ende des Reichs. Im Gegensatz dazu liegt der Schwerpunkt dieser Studie auf der Kontinuität. Die Friedensverträge proklamierten das Prinzip ewigen Vergessens und allgemeinen Straferlasses (perpetua oblivia et amnestia), verkörperten jedoch zugleich die Erinnerungen der vorangegangenen hundertfünfzig Jahre. So bildeten sie den Abschluss der konstitutionellen Verhandlungen, die mit den ersten Vorschlägen zu einer Reform des Reichs im 14. Jahrhundert begonnen hatten. Bis Ende des 15. Jahrhunderts entstand aus diesen Reformplänen ein weitreichendes Programm, das während der Regierung von Maximilian I. Gegenstand intensiver Verhandlungen war. Heraus kam ein Kompromiss zwischen dem Kaiser und den Reichsständen. Diese erklärten sich bereit, das Reich nach außen zu verteidigen und den inneren Frieden zu sichern, gestanden dem Kaiser jedoch weder ein stehendes Heer noch eine permanente Institution zur Ausübung der Zentralgewalt zu. Die Reformation und verschiedene folgende politische Einigungen stellten den Kompromiss auf den Prüfstand und untermauerten ihn zugleich, insbesondere der Augsburger Religionsfriede von 1555. Aus den Konflikten erwuchsen wichtige Prinzipien bezüglich religiöser Rechte, die weitreichende Folgen für die allgemeine gesetzliche und politische Entwicklung des Reichs hatten. Aber die verfassungsrechtlichen Kernfragen blieben ungelöst. Der Westfälische Friede entschied diese Streitfragen nicht zugunsten einer der beiden Parteien, schuf jedoch ein befriedigenderes Gleichgewicht und einen Rahmen, der bis zur Zerstörung des Reichs durch Napoleon 1806 erhalten blieb. Die Verteilung der Macht zwischen Kaiser und Ständen blieb ein zentrales Problem, über das zwischen 1648 und 1806 unablässig neu verhandelt wurde. Die mächti-
12
Einführung zu Band II
gen Kurfürsten suchten sich als eine Art herrschende Oligarchie neben dem Kaiser und über den restlichen Ständen zu etablieren. Brandenburg-Preußen widersetzte sich nicht als einziges Reichsgebiet zunehmend der kaiserlichen Oberherrschaft. Wie die übrigen war es indes nie imstande, die Habsburger ernsthaft in die Schranken zu fordern. Während dieser Zeit erfreute sich das Reich einer bemerkenswerten Stabilität. Es gab keine grundstürzenden Herausforderungen für den Status quo wie die Reformation, den Pfälzischen Ritteraufstand und die Bauernkriege der 1520er Jahre. Religiösen Bewegungen und neuen intellektuellen Strömungen des späten 17. und des 18. Jahrhunderts entsprangen Ideen zur Umgestaltung des Reichs, die aber die in den eineinhalb Jahrhunderten vor 1648 gewachsenen Grundlagen des Systems nie gefährdeten. Die bedeutendsten Veränderungen spielten sich in den Ländern ab, nicht im Reich, aber auch das Reich als solches war gegen Reformen nicht immun. Das deutsche Gemeinwesen insgesamt entwickelte sich und passte sich den neuen Gegebenheiten in Europa an, den neuen Konzepten zu Charakter und Funktion von Herrschaft, neuen religiösen Gedanken, den Herausforderungen der Aufklärung und den neuen politischen Ideen, die sich nach 1789 von Frankreich aus verbreiteten. Der historiografische Rahmen dieses Buchs wurde bereits in den einführenden Worten, Darstellungen der frühneuzeitlichen Geschichte Deutschlands, in Band I umrissen. In Band II gibt es mehrere vorherrschende Themen, die zu Beginn jedes Kapitels erläutert werden. Zentrales Thema ist die Funktionsfähigkeit des Reichs und seiner Institutionen sowie die Frage nach der Herausbildung eines deutschen Nationalgefühls parallel zu oder im Widerstreit mit territorialen Patriotismen. Führte Österreichs Entwicklung zur Großmacht dazu, dass es dem Reich quasi entwuchs? Machten Brandenburg-Preußens machtpolitische Ambitionen es zum Widersacher anderer deutscher Länder und zur Bedrohung für die Zentralgewalt? Wie veränderte sich die politische Kultur des Reichs und seiner Länder und was verstand man im späten 18. Jahrhundert unter dem Schlagwort von der »Libertät« oder »Freiheit der Deutschen«? Wie war das Verhältnis der Institutionen des Reichs zu den Regierungen der deutschen Länder und inwiefern trugen die Reformen auf Landesebene zur augenscheinlichen Immunität des Reichs gegenüber den revolutionären Umbrüchen bei, die Frankreich 1789 erfassten? Und schließlich: Was bedeutete das Reich seinen Einwohnern Ende des 18. Jahrhunderts, welches Erbe hinterließ es dem 19. und 20. Jahrhundert? Die führenden deutschen Historiker des späten 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts waren überzeugt, dass das Reich 1806 bestenfalls bedeutungslos und schlimmstenfalls zum Hindernis für Fortschritt und nationale Einigung geworden war. Dieses Buch hingegen wird den Schluss nahelegen, dass seine politische Kultur und die nationale Identität, die aus ihr entstand, die Entwicklung der deutschsprachigen Teile Europas bis heute prägt.
I. Auferstehung und neues Leben 1648–1705: Das Reich unter Ferdinand III. und Leopold I.
1. Die Geschichtsschreibung und das Reich nach dem Dreißigjährigen Krieg
N
egative Bewertungen der Auswirkungen des Westfälischen Friedens auf die gesamte deutsche Geschichte hatten starke Wirkung auf die Beurteilung des Reichs in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Nationalhistoriker betonten die schandvolle Zersplitterung der deutschen Nation nach 1648: Die Stärkung der Länderrechte habe das Reich geschwächt. Passiv und ineffektiv sei es zum Spielball Europas geworden, wehrlos insbesondere gegen die unstillbare Machtgier Ludwigs XIV. Bedeutende Ländereien gingen an Frankreich verloren, französische Truppen verwüsteten Gebiete östlich des Rheins ohne nennenswerten deutschen Widerstand. Zugleich habe der französische König die Freiheit der Deutschen untergraben, indem er zahlreiche deutsche Fürsten bestach und subventionierte. Der Kaiser ließ sein Reich im Stich und kümmerte sich nur um österreichische Interessen im Südosten Europas. Im Norden begann der heroische Aufstieg Brandenburg-Preußens, dessen Hochphase, eingeleitet durch die Thronbesteigung Friedrichs des Großen 1740, in der Dominanz über ganz Deutschland gipfelte. Postnationalistische Wissenschaftler nach 1945 tendierten dazu, aus der Not eine Tugend zu machen. Die Katastrophe der jüngsten deutschen Geschichte war die Katastrophe der deutschen Nation. Ein Anknüpfen an die politischen wie die historiografischen Traditionen des Nationalstaats war ausgeschlossen. Deutsche Geschichte musste zur europäischen Geschichte werden. 1 Für viele bedeutete das eine Rückbesinnung auf die Rolle des Reichs im europäischen Staatensystem, seine Funktion als Rettungsanker oder Dreh- und Angelpunkt eines internationalen Gleichgewichts der Kräfte. Vor diesem Hintergrund ließ sich die Passivität des Reichs positiv deuten: Das pränationale Reich wurde zum Modell für die postnationale Bundesrepublik, dessen friedenssichernde Wirkung und Bedeutung innerhalb Europas deren Rolle im europäischen Einigungsprozess vorwegnahm. In Heinz Schillings einflussreicher Studie zu 1989 ist deutsche Geschichte nach 1648 europäische Geschichte, aus der das Konzept eines Gleichgewichts der Kräfte entstand, das 1720 im System der europäischen Pentarchie und eines deutschen Dualismus kulminierte. 2 Gleichzeitig, so heißt es oft, suchten die Mächtigen im Alten Reich ihre eigene Bedeutung auf Kosten des Gesamtsystems zu erhöhen. Angeblich habe der Triumph des Absolutismus in den deutschen Gebieten die letzten Überbleibsel deut-
16
I. · Auferstehung und neues Leben 1648–1705
scher republikanischer Urtraditionen ausgelöscht. Dabei hätten die größten und ehrgeizigsten Fürstentümer unvermeidlich eine Machtgier entwickelt, die die traditionellen Regeln und Konventionen des Reichs sprengte. Der Sieg des Absolutismus führte indes selbst in den kleineren deutschen Ländern zu einer allgemeinen Refeudalisierung des deutschen Gemeinwesens und zum Wiederaufstieg des Adels und adliger Werte. Die deutsche Gesellschaft der eineinhalb Jahrhunderte nach dem Westfälischen Frieden war durch und durch höfisch. Erst eine viel umfassendere Betrachtung, meint Schilling, macht die paradoxe Folge des Absolutismus sichtbar: die Entstehung eines neuen Bürgertums, einer Bourgeoisie mit vielen typischen Merkmalen einer neuen Klasse, die letztlich die Macht der Höfe untergrub. Die nationalistische und postnationalistische Darstellung des Reichs passte perfekt zu parallelen historiografischen Sichtweisen mit Blick auf Österreich und Brandenburg-Preußen. Kernthema österreichischer Historiker war und bleibt die Phase, in der Österreich als eigene, vom Reich abgesetzte Macht auf den Plan trat. Zwar bewahrte die gemeinsame Sprache bis heute ein gewisses Gemeinschaftsgefühl der »deutschen« und österreichischen Gebiete. Das hat jedoch nicht verhindert, dass man versucht, die Anfänge von »Österreich« als Staat zu ergründen. Dabei sprechen starke Argumente für fast jeden Zeitraum seit den 1520er Jahren, als Erzherzog Ferdinand (König ab 1531, Kaiser ab 1556) systematische Reformen in den Gebieten einleitete, die ihm sein Großvater Maximilian I. vermacht hatte. Als ein Wendepunkt gilt die Vereinigung der Erblande mit der böhmischen und der ungarischen Krone 1526. Andere gehen noch weiter zurück, oft motiviert durch Ereignisse wie die Feier des österreichischen Millenniums 1996, das sich auf die erste schriftliche Erwähnung des Begriffs Ostarrichi beruft. 3 Die erwähnten Reformen sind aber sicherlich von Bedeutung: In den 1520er Jahren, den 1560er Jahren und erneut nach 1648 ließen sie die Erblande als mögliches Vorbild für das gesamte Reich erscheinen. Aber schlug sich darin die Absicht der Habsburger nieder, sich vom Reich zu lösen? Für die Zeit nach 1648 sprechen hierfür gute Argumente. Dass die Ländereien der Habsburger, vor allem was die Glaubensrechte ihrer Untertanen betraf, von den Bestimmungen des Westfälischen Friedens ausgenommen waren, verstärkte den Separatismus. Der erste von Österreichs »staatsbildenden Kriegen« gegen das Osmanische Reich 1683 war der Ursprung des Aufstiegs der Monarchie zur Großmacht. 4 Wurde dadurch das Reich wirklich zunehmend irrelevant? Selbst wenn die österreichischen Länder bis zum Ende 1806 im Reich verblieben: Wurde jedes echte Interesse an seinen Belangen durch die Ambitionen der deutschen Fürsten und die dem Herrschaftssystem von »Kaiser und Reich« inhärenten Frustrationen erstickt? Wie entscheidend war die Sprach- und Kulturgemeinschaft, die Österreich an Deutschland band? Das Augenmerk auf Österreichs andauernde Zugehörigkeit zum Reich zu
1. Die Geschichtsschreibung und das Reich nach dem Dreißigjährigen Krieg
richten, stellt indirekt die bekanntere preußische historiografische Richtung infrage, die den wachsenden Gegensatz zwischen Brandenburg-Preußen und Österreich als Kernthema der deutschen Geschichte nach 1648 betrachtet. Die »Entstehung« des brandenburgisch-preußischen Staats nach 1648 wurde einer der entscheidenden »Gründungsmythen« des modernen deutschen Nationalismus. Wie im Fall Österreichs herrschte Uneinigkeit über Details und Gewichtung, insbesondere in der strittigen Frage, welcher Herrscher den Staat tatsächlich »gegründet« habe: der »Große Kurfürst« Friedrich Wilhelm (1640–1688), der erste preußische König (Kurfürst Friedrich III., 1688–1713, König ab 1701), der Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I. (1713–1740) oder Friedrich der Große (1740–1786)? Und: Wann wurden die Ziele und Interessen Brandenburg-Preußens unvereinbar mit einem weiteren Verbleiben im Reich? War das bis 1806 überhaupt je der Fall? Die brandenburgischen Herrscher vor 1740 standen bei allen Eigeninteressen stets treu zum Kaiser. Friedrich der Große selbst arbeitete als virtuoser Reichspolitiker ebenso viel innerhalb und mit dem System wie dagegen. 5 Letztlich scheiterte das Reich weder an Österreich noch an Preußen. Zudem verstellt die Übertragung der Ansichten zum Reich nach 1750 auf das Jahrhundert davor den Blick auf die tatsächlichen Gegebenheiten der Zeit nach 1648. Seit den 1970er Jahren enthüllen Forschungen ein komplett anderes Bild. Die genauen Konturen sind noch nicht deutlich zu erkennen, weitere fundamentale Arbeiten nötig. So gibt es etwa nach wie vor keine moderne Studie zum Reichstag nach 1681. Über die kaiserlichen Steuern ist wenig bekannt: Arbeiten, wie sie Winfried Schulze und Peter Rauscher für das 16. Jahrhundert unternahmen, stehen für die Zeit nach 1648 noch aus. 6 Die von nationalistischen und vielen postnationalistischen Historikern vertretene Ansicht, das Reich sei ohnmächtig und hinfällig gewesen, hat die Erforschung seiner zentralen Institutionen und ihrer Wirkungsweise lange überschattet. Erst langsam wird klar, dass das Reich um 1680 in vielerlei Hinsicht wieder an Stärke zunahm. Alte Institutionen wurden reformiert oder neu belebt. Die Monarchie selbst, beschränkt durch die Regelungen des Westfälischen Friedens, erlangte unter Leopold I. neue Autorität, real vielleicht mehr als je zuvor, und daran knüpften seine Nachfolger Joseph I. und Karl VI. an. Die Bedeutung, die diese Kaiser der Reichspolitik beimaßen, macht es kaum glaubwürdig, dass sie in Wirklichkeit das Reich »verlassen« wollten. Die Kaiserkrone war ihnen zu wichtig, um sie abzulegen. Vielmehr ist ihre Zeit von einer Rückbesinnung auf das Reich geprägt, die 1680 ihren Abschluss fand, als der Kaiser viele seiner Vorrechte als oberster Lehnsherr und höchste gerichtliche Instanz wiedererlangt hatte.Vielleicht mehr als je zuvor wurde der kaiserliche Hof in Wien zur zentralen Anlaufstelle für den gehobenen Adel des Reichs. Dies befeuerte auch das Streben nach Einrichtung »nationaler« Institutionen und Wirtschaftsmaßnahmen sowie nach einer Wiedervereinigung der christlichen Konfessionen.
17
18
I. · Auferstehung und neues Leben 1648–1705
Dass die meisten dieser Projekte scheiterten, ist weniger wichtig als die Tatsache, dass es sie überhaupt gab. Die Habsburger Interessen reichten selbstverständlich über die Grenzen des Reichs hinaus – etwa Ungarn und das Erbe der spanischen Habsburger – und Wien war ebenso Hauptstadt der diversen habsburgischen Länder und Königreiche wie Sitz des Kaiserhofs, des Reichshofrats und der Reichshofkanzlei. Aber all die auswärtigen Interessen waren über die Inhaberschaft der kaiserlichen Würde mit dem Reich verflochten und unmöglich zu trennen oder gar gegeneinander abzuwägen. Erst im späten 18. Jahrhundert wurde in Strategiepapieren über den Wert des Reichs für die Habsburger sinniert und die Frage gestellt, ob »Österreich« ohne »Deutschland« besser dran wäre. 7 Auf das späte 17. Jahrhundert lassen sich solche Überlegungen nicht übertragen. Ebenso unterschätzt der traditionelle Blick auf den Aufstieg BrandenburgPreußens die Bedeutung anderer großer Länder, etwa Sachsens, der welfischen Fürstentümer Braunschweig-Lüneburg (ab 1692 Kurfürstentum, allerdings erst 1708 vom Reichstag bestätigt) und Braunschweig-Wolfenbüttel, Bayern und der Pfalz (wieder in die Kurwürde eingesetzt und Mitstreiter der Krone). Sicherlich traten die brandenburgischen Kurfürsten nunmehr deutlich aus dem Schatten Kursachsens, dessen Führung sie während der letzten eineinhalb Jahrhunderte treu gefolgt waren, – allerdings traten sie eher in einen Wettbewerb als in ein Vakuum. Sie konkurrierten direkt mit den Welfen und Sachsen, und dass und wie der Kaiser diesen Wettstreit in den 1680er und 1690er Jahren ausnutzte und manipulierte, trug entscheidend zur Wiederherstellung seiner Autorität bei. Brandenburg-Preußen war beileibe nicht das einzige Territorium, das seinen Status durch eine Königskrone zu erhöhen versuchte: Außer Braunschweig-Wolfenbüttel taten das alle oben erwähnten, wobei Bayern und die Pfalz allerdings scheiterten. Zudem verfolgten alle wichtigen an der Reichspolitik Beteiligten im gesetzlichen und institutionellen Rahmen des Reichs und ihres feudalhierarchischen Verhältnisses zum Kaiser ihre eigenen Interessen. Die Verträge von 1648 bekräftigten das Recht der deutschen Fürsten, Allianzen mit fremden Mächten einzugehen, sei es zur Verteidigung oder aufgrund dynastischer Bestrebungen, solange sich die Bündnisse nicht gegen den Kaiser oder das Reich richteten. Indes fiel es selbst den Kurfürsten äußerst schwer, auf internationalen Friedenskonferenzen Anerkennung zu finden (schon für sich ein wichtiges Motiv, den Königsstatus zu erstreben). Tatsächlich konnten auch die mächtigsten Territorien ohne Bewilligung des Kaisers kaum etwas erreichen, ohne gegen Gesetze und Konventionen des Reichs zu verstoßen. Der Wettstreit zwischen führenden Fürsten und die erfolgreiche Manipulation dieser Konkurrenz durch die Krone war vor 1740 von größerer Bedeutung als das »Hervortreten« von Brandenburg-Preußen. In den Rivalitäten spiegelten sich wiederum andere tiefgreifende Entwicklungen wider. Die Spannungen zwischen Kur-
1. Die Geschichtsschreibung und das Reich nach dem Dreißigjährigen Krieg
fürsten und Fürsten hielten an. Spätestens in den 1680er Jahren waren die Bemühungen der Kurfürsten, ihre herausragende Stellung zu sichern und sich als herrschende Oligarchie mit königlichem oder quasiköniglichem Status im Reich zu etablieren, gescheitert. Das schwächte ihre Solidarität als Gruppe. Der Wettbewerb um Königskronen war ebenso ein Beleg dafür wie eine Reaktion auf die Vergabe einer neunten Kurwürde an die Herzöge von Braunschweig-Lüneburg als Lohn für ihre Unterstützung (und um einen Ausgleich gegen Brandenburg zu schaffen). Gleichwohl war Braunschweig-Lüneburg nicht das einzige Nichtkurfürstentum, das seine Stellung zu verbessern suchte. Der entscheidende Unterschied, der zum ersten Mal nach 1648 zutage trat, bestand zwischen armierten und unbewaffneten Territorien: denen, die über ein stehendes Heer verfügten, und jenen, die je nach Bedarf Männer oder Geld für Truppen bereitstellten, die von den kaiserlichen Kreisen unterhalten oder ausgehoben wurden. 8 Schon zehn Jahre nach dem Krieg verfügten etwa ein Dutzend Länder über Armeen zwischen 1.000 und 20.000 Mann. Dies war nach imperialem Recht zulässig, da nach 1654 jedermann verpflichtet war, sich an den Kosten der Unterhaltung von Festungen und Garnisonen zur Landesverteidigung zu beteiligen (wozu nach fürstlicher Auslegung Truppen gehörten). 9 Das hatte jedoch Auswirkungen sowohl auf das Reich als auch auf die Territorien. Die Existenz von Landesheeren prägte die Entwicklung der Kreise und regionalen Machtstrukturen.Wer über Truppen verfügte, dem gelang es oft, durchzusetzen, dass diese als Kreisheer betrachtet wurden, wodurch nichtbewaffnete Nachbarn verpflichtet waren, Quartiere bereitzustellen. Andererseits schuf die Unterhaltung von Truppen auch im eigenen Land gewisse Notwendigkeiten. Armeen waren indes nur ein Mittel im Wettstreit der Fürsten um Status und Prestige. Der kulturelle Konkurrenzkampf, vor allem der Bau von Palästen und der Aufwand für Hofhaltung und Residenzhauptstädte, war ebenso ruinös. Die finanziellen Belastungen waren enorm. Domanialeinkünfte lieferten manchmal einen wichtigen Beitrag, etwa in Brandenburg, wo sie ungefähr ein Drittel der Einnahmen der Zentralregierung ausmachten. 10 Zuschüsse von außen waren oft unverzichtbar, ein weiterer Nutzen von auswärtigen Allianzen. Dennoch konnte kein Fürst ausschließlich von seinen eigenen Domänen oder von ausländischen Wohltätern leben. Die Hauptlast trugen stets die Landstände; Steuern wurden erneut ein so wichtiges politisches Thema wie bereits in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Der »Absolutismus«, den Historiker diesen Gegebenheiten gern anheften, legt jedoch einen Grad der Kontrolle nahe, den kein frühmoderner Herrscher tatsächlich erreichte. Speziell in Deutschland mussten alle Regenten, auch die Kurfürsten von Brandenburg, mit ihren Landständen verhandeln. Pläne einiger Fürsten, sich dieser Zwänge zu entledigen, durchkreuzte der Kaiser mit seinem Veto gegen den Vorschlag, alle Beschränkungen des fürstlichen Steuermonopols abzuschaffen.
19
20
I. · Auferstehung und neues Leben 1648–1705
Einmal mehr fanden sich die Fürsten in eine gesetzliche Struktur eingebunden, die die Landstände berechtigte, den kaiserlichen Hof anzurufen, wenn ihre Rechte missachtet wurden, und es dem Kaiser gestattete, in die Innenpolitik eines Territoriums einzugreifen, um die Rechte der Untertanen durchzusetzen. Der Wettstreit um Status beschränkte sich nicht auf die armierten und mächtigeren Fürstentümer, sondern war auch in den kirchlichen und in der Vielzahl kleinerer Territorien verbreitet, im kaiserlichen Adel und unter den Reichsrittern (sowie im territorialen Adel). Investitionen in kulturelles Kapital in Form von Residenzen, Kunstsammlungen und Ähnlichem hatten bisweilen desaströse finanzielle Folgen und wurden trotzdem unverdrossen getätigt. Für die meisten kirchlichen Würdenträger, Äbte und Prälaten sowie kleinere Dynasten standen Hoffnungen auf einen souveränen Status, ein Engagement in der europäischen Politik oder die Teilnahme an internationalen Friedenskonferenzen nicht zur Debatte. Dennoch waren sie von politischer Bedeutung, bildeten sie doch kollektiv das Fundament der imperialen Klientel im Reich. Soweit sie ein Stimmrecht im Reichstag hatten, repräsentierten sie den Kern der kaiserlichen Partei. Mit oder ohne Reichstagsstimme neigten Mitglieder dieser Gruppe mehr als andere dazu, in kaiserliche Dienste zu treten, militärisch oder administrativ, und durch Anwesenheit am kaiserlichen Hof in Wien ihr Profil und ihre Reputation zu stärken. Manche strebten nach Fürstentiteln, obwohl die Kosten dieses sozialen Aufstiegs für größere Residenzen und alles, was damit verbunden war, ruinös sein konnten. Die Bindungen durch Recht und Tradition, die Mitwirkung in und die Inanspruchnahme von imperialen Institutionen sowie die Integration in ein vielfach abgestuftes aristokratisches Wertesystem trugen zum Zusammenhalt des Reichs nach 1648 bei. Dabei wirkte jedoch noch ein weiterer wichtiger Faktor. Wie im 16. Jahrhundert entstand Solidarität durch die Notwendigkeit, das Reich gegen seine Feinde zu verteidigen. Erneut spielten das Osmanische Reich und Frankreich eine Schlüsselrolle für das Zusammenwachsen des Reichs, ebenso wie in geringerem Maß und für kürzere Zeit auch Schweden. Bedrohungen von außen warfen Fragen von Loyalität und Identität auf; sie erforderten Engagement, Solidarität und grundlegende institutionelle Entscheidungen, nicht zuletzt die, wie die Verteidigung des Reichs zu organisieren war. Eine der großen Leistungen Leopolds I. war, das Reich – wohl erfolgreicher als je zuvor – gegen türkische und französische Aggressoren zu mobilisieren. 11 Das zeigte sich nicht nur in realer militärischer Gegenwehr, sondern auch an dem damit einhergehenden Reichspatriotismus. Oft als Angelegenheit einer Minderheit von Idealisten abgetan, war dieser Patriotismus, wie jüngere Forschungen gezeigt haben, ein wesentlich verbreiteteres Phänomen, das ein wachsendes Gefühl der Identifikation mit dem Reich widerspiegelte. 12 Bisweilen nahm der Nationalismus Ausmaße an, wie man sie in anderen frühneuzeitlichen Staaten findet.
1. Die Geschichtsschreibung und das Reich nach dem Dreißigjährigen Krieg
Das Schüren der Feindseligkeit gegen die Gegner des Reichs trug zur Herausbildung und Betonung seiner Eigenheit und Charakteristik bei: der Qualitäten seiner Bewohner und des umfassenden Katalogs von Rechten, die man nun mit dem Konzept der »Teutschen Freiheit« (oder ständischen Libertät) verband und überdies zunehmend als Grundrechte aller Einwohner des Reichs – nicht nur der Fürsten und unmittelbaren Untergebenen des Kaisers – verstand und explizit artikulierte. 13 Erfolge im Innern und nach außen und schiere Dauerhaftigkeit sorgten während der Herrschaft von Leopold I. (1658–1705) für nie da gewesene Stabilität. Seine Errungenschaften wurden in den Jahrzehnten nach seinem Tod jedoch in Zweifel gezogen. Das lag nicht an Österreichs Ausscheren aus dem Reich, nachdem es den Status einer Großmacht erlangt hatte, oder österreichisch-preußischen Rivalitäten. Die Gründe für das erneute Wanken der kaiserlichen Position in den ersten Dekaden des 18. Jahrhunderts sind komplex. Joseph I. neigte in mancher Hinsicht zur Selbstüberschätzung, während es Karl VI. schwerfiel, sich überhaupt durchzusetzen. Da er keine männlichen Nachkommen hatte, war seine Herrschaft zudem von Zweifeln hinsichtlich seiner Nachfolge überschattet. Auf anderer Ebene zog gerade der Erfolg Leopolds I. Probleme nach sich. Die Vergabe von Fürstentiteln an norddeutsche Adlige und ihr gleichzeitiges Ausspielen gegeneinander war ein nützliches Mittel, indes weckten die Erhebungen Ansprüche und Erwartungen, die den traditionellen Rahmen des Reichs infrage stellten. Die nach 1690 (außerhalb des Reichs) zu Monarchen gekrönten Fürsten (die Kurfürsten von Sachsen, Brandenburg, Hannover und der Landgraf von HessenKassel) veränderten ihre Einstellung zur kaiserlichen Politik, die gescheiterten Aspiranten (die Kurfürsten von Bayern und der Pfalz, der Markgraf von Baden und andere) ebenfalls. Darüber hinaus erregten die Habsburger mit der Mobilisierung einer überwiegend katholischen Klientel als Kern der prokaiserlichen Mehrheit im Reichstag zunehmend die Feindseligkeit der (größtenteils protestantischen) alten Fürstenhäuser. Zu einer Zeit, als der zweihundertste Jahrestag der Reformation (1717) und der der Augsburger Konfession (1730) an die wahren Wurzeln der »Deutschen Freiheit« gemahnten, bildete sich eine oppositionelle »Partei« gegen den Kaiser und seine übertriebene Ausnutzung imperialer Rechte. In der letzten Phase der Reichsgeschichte entstanden daraus der Widerstreit zwischen Österreich und Brandenburg-Preußen, da Friedrich der Große die Führungsrolle Kursachsens an sich zu reißen versuchte, und eine ganze Reihe von Plänen zur Reform und Erneuerung des Reichs.
21
22
I. · Auferstehung und neues Leben 1648–1705
Anmerkungen 1 Schulze, Geschichtswissenschaft, 160. 2 Schilling, Höfe, 12–15, 32–48. 3 Urbanitsch, »Landes-Bewußt-Sein«; vgl. auch Scheibelreiter, »Ostarrichi«; vgl. zur Diskussion um die österreichische Geschichtsschreibung im 20. Jahrhundert Gnant, »Reichsgeschichte«, und Fellner, »Reichsgeschichte«. 4 Hochedlinger, Wars, 1 ff.; vgl. auch Winkelbauer, Ständefreiheit I, 394–407, und II, 307– 310. 5 Klueting, Reich, 1–17. 6 Winkelbauer, Ständefreiheit I, 513 ff. 7 Whaley, »Habsburgermonarchie«. 8 Die Ursprünge der Kreise werden in Band I besprochen. 9 Press, Kriege, 339. 10 Wilson, German Armies, 30. 11 Wrede, »Kaiser«, 95–110; Wrede, Reich, 66–185, 324–463. 12 Schmidt, Geschichte, 212–233. 13 Ebd., 234–244.
2. Die letzten Jahre Ferdinands III.: Bündnisse im Westen, Kriege im Norden
D
as Fundament für die Erfolge Leopolds I. legte Ferdinand III., der 1637 zum Kaiser gewählt wurde. Das erste Jahrzehnt seiner Herrschaft war geprägt von einer erbarmungslosen Folge militärischer Niederlagen, die seine politische Autorität untergrub. Ferdinands Gesandter Graf Maximilian von Trauttmannsdorff hatte in den Friedenskonferenzen zu Osnabrück und Münster 1645–1648 das Schlimmste verhindert. Den Fürsten wurden einige Rechte zugestanden, zudem gelang es, eine Auflistung der kaiserlichen Vorrechte zu verhindern, wodurch sie zumindest nicht formal beschnitten oder eingeschränkt wurden. Das war im Wesentlichen der Grund dafür, dass es in den letzten neun Regierungsjahren Ferdinands III. nicht zu ernsthaften Rückschritten kam und einiges an Boden gutgemacht werden konnte. 1 Die Maximen der kaiserlichen Politik waren klar: strikte Befolgung der Friedensverträge (insbesondere der Verzicht auf auswärtige Einmischung) und strategische Arbeit mit den hierarchischen Traditionen des Reichs, um die föderalistischen Elemente des Friedens von 1648 wettzumachen. Die Aussichten waren zu Beginn nicht vielversprechend, das Misstrauen gegenüber den Habsburgern weiterhin stark. Zugleich führte die Sehnsucht nach Sicherheit zu vielen regionalen Allianzen, deren Grundtendenz ebenfalls gegen die kaiserliche Macht gerichtet war. In Niedersachsen, Westfalen, am Oberrhein und in Franken lebten die existierenden Kreisorganisationen neu auf, zumindest in Niedersachsen mit besonders antiimperialem Impetus. Anderswo kam es zu neuen Bündnissen. Im Frühjahr 1651 bildeten die Fürstbischöfe von Mainz, Trier und Köln mit Mitgliedern der Oberrheinischen Kreise das »Kurrheinische Bündnis« 2, im Februar 1652 die Braunschweiger Welfen mit Hessen-Kassel, dem schwedischen Bremen-Verden und anderen kleineren nordwestlichen Territorien die »Hildesheimer Allianz«. Köln und Paderborn folgten ebenfalls bald. Im Jahr darauf brachte Graf Georg Friedrich von Waldeck einen Vorschlag für eine große Koalition gegen Habsburg in Umlauf, die vom Kurfürsten von Brandenburg geführt werden und neben der Hildesheimer Allianz eine Reihe katholischer Fürsten umfassen sollte, darunter den Erzbischof von Köln. Machbar schienen auch weitere Bündnisse mit protestantischen Territorien, es erwies sich jedoch als unmöglich, sie mit den Interessen der Katholiken in Einklang zu bringen. Deshalb gründeten die Katholiken des Nordens und des Rheinlands (Köln, Trier, Münster und Pfalz-Neu-
24
I. · Auferstehung und neues Leben 1648–1705
burg) im Dezember 1654 ihre eigene »Kölner Allianz«, der sich im Jahr darauf der Kurfürst von Mainz, Johann Philipp von Schönborn, anschloss. Die diversen Allianzen, an denen sich die rheinländischen Territorien beteiligten, waren kurzlebig, aber in mancher Hinsicht erfolgreicher als die nördlichen, protestantischen Bündnisse. Das hatte drei Gründe. Erstens fühlten sich viele der Gebiete äußerst gefährdet, in den anhaltenden Konflikt zwischen Frankreich und Spanien hineingezogen zu werden. Dass sie überwiegend klein beziehungsweise zerstückelt waren, machte sie abhängiger vom Reich als größere, gefestigtere Territorien. Zweitens amtierte der wichtigste Herrscher eines derart fragmentierten Gebiets, Johann Philipp von Schönborn, der Kurfürst und Erzbischof von Mainz, als Reichserzkanzler. Als Inhaber des Reichsdirektoriums betrachtete sich Schönborn als Repräsentant sämtlicher Reichsstände und Galionsfigur des Reichs in der staatsrechtlichen Herrschaftseinheit von »Kaiser und Reich«. Seine Rolle als offizielle »Nummer zwei« im Staat machte Schönborn automatisch zum Führer aller Zusammenkünfte und Allianzen, an denen der Kaiser nicht beteiligt war. 3 Es war insofern logisch, dass er bemüht war, die verschiedenen Bündnisse zu konsolidieren, um ein Wiedererstarken der Habsburger zu verhindern und sicherzustellen, dass das Reich nicht in einen neuen Konflikt um Spanien hineingezogen wurde. Drittens wirkte die Beteiligung von Frankreich in den 1650er Jahren als stabilisierender Faktor. Bis zum Tod Mazarins 1661 war die französische Politik eher auf Einfluss im Reich als auf Expansion gerichtet. Hauptziele waren Sicherheit und Stabilität an Frankreichs Ostgrenze sowie die Verhinderung des Wiedererstarkens der habsburgischen Macht in Deutschland und einer österreichischen oder deutschen Intervention im Konflikt mit Spanien (der 1659 mit dem Pyrenäenfrieden beigelegt wurde). Die Interessen von Mazarin und Schönborn deckten sich also, was sich in der Gründung des Rheinischen Bundes 1658 niederschlug, der kollektive Sicherheit und Reichsreformen zum Ziel hatte. Unmittelbarer Anlass war das Interregnum nach dem Tod Ferdinands III. im April 1657. Die Wahl von Leopold I. im Juli 1658 sicherte die Kontinuität der Habsburgerherrschaft, der sich indes sofort ein Bündnis von Mainz, Köln, Pfalz-Neuburg, Hessen-Kassel, Braunschweig-Lüneburg und Schweden (wegen Bremen und Verden) entgegenstellte, zu dem als »Schutzmacht« auch Frankreich eingeladen wurde. 4 Brandenburg und andere schlossen sich in den folgenden Jahren an; 1665 waren alle wichtigen Fürsten beteiligt, mit Ausnahme der Kurfürsten von Bayern, Sachsen und der Pfalz. So gelang es Schönborn, Katholiken und Protestanten in einer Union zu vereinigen, um den Westfälischen Frieden aufrechtzuerhalten. Dazu stellten die Mitglieder Geld und Soldaten für ein 10.000 Mann starkes Heer zur Friedenssicherung (darunter 2.400 Franzosen) bereit, das auch die Entsendung kaiserlicher Truppen in die Niederlande verhindern sollte. Dass der Rheinische Bund durch die aggressi-
2. Die letzten Jahre Ferdinands III.: Bündnisse im Westen, Kriege im Norden
vere Außenpolitik Ludwigs XIV. nach Mazarins Tod 1661 zusehends untergraben wurde, unterstrich die Bedeutung von dessen Wirken im Westen und Nordwesten des Reichs. Zumindest bis dahin jedoch diente Frankreich als Garant des Friedens von 1648. Im Norden war die Lage trotz Bündnissen wie der Hildesheimer Allianz und der Beteiligung nördlicher Fürsten am Rheinbund weniger sicher, vor allem aufgrund der Präsenz Schwedens als neuer Territorialmacht im Norden des Reichs. 5 Weder Sachsen noch Brandenburg waren von der schwedischen Intervention nach 1630 begeistert, ebenso wenig wie von Schwedens Agieren als Nachbar und potenzieller Rivale nach 1648. Der schwedische Abzug und die Rückgabe eroberter Gebiete verliefen schleppend und unter der Auflage beträchtlicher Entschädigungen, die von den Territorien, die sie schuldeten, zähneknirschend aufgebracht wurden. Die dynastischen Ambitionen der welfischen Herzöge auf das Erzbistum Bremen scheiterten am schwedischen Territorialbesitz. Die Herzöge von Mecklenburg mussten den Verlust Wismars und Warnemündes mit seinen Zolleinnahmen verschmerzen, hinzu kamen schwedische Versuche, sich mehr zu verschaffen, als der Friedensvertrag von Osnabrück zugestand. Der Kurfürst von Brandenburg erlangte die Kontrolle über Hinterpommern, das ihm im Friedensvertrag von 1648 zugeteilt worden war, erst, als er den Kaiser dazu brachte, Königin Christina bis zur Übergabe die ihr als Lehen zugesprochenen Gebiete zu verweigern. Mit dem Ausschluss vom anstehenden Reichstag konfrontiert, fügten sich die Schweden ohne Zögern. In Brandenburg war man dennoch frustriert, weil Schweden durch Westpommern die Odermündung beherrschte, so den Zugang zum Baltikum blockierte und Anspruch auf die gesamten Zolleinnahmen der mecklenburgischen und pommerschen Küste erhob. Überhaupt verlieh Schwedens Territorialbesitz in den nördlichen (nieder- und obersächsischen sowie westfälischen) Kreisen zusammen mit einem Anteil an der niedersächsischen Kreisexekutive dem Land einen Einfluss, den es rücksichtslos ausnutzte, dabei jedoch die offene Konfrontation mit einem der größeren Territorien mied. 1653 indes griffen die Schweden die Reichsstadt Bremen an, um ihre alten Rechte auf den erzbischöflichen Sitz der Stadt wiederzuerlangen. 6 Die unverzügliche Unterstützung der Welfenherzöge und des Kaisers zeitigte einen Kompromiss: Die Stadt blieb reichsunmittelbar, erklärte sich jedoch zu einem vage formulierten Akt der Huldigung an die schwedische Krone bereit. Im Dezember 1654 war die Krise beigelegt, aber Schwedens Ansehen im Reich litt schweren Schaden und das Land verlor jegliches Interesse an Reichsangelegenheiten außerhalb seiner eigenen Territorien. Eine gefährlichere Situation ergab sich bald darauf aus der aggressiven Politik von Karl X. Gustav, dem ehemaligen Pfalzgrafen von Pfalz-Zweibrücken-Kleeburg, der seinem Cousin nach dessen Abdankung im Juli 1654 auf den schwedischen
25
26
I. · Auferstehung und neues Leben 1648–1705
Thron folgte. 7 Der neue König übernahm das Land in einer finanziellen Notlage, die sich durch die »Reduktion«, bei der er einiges von dem Kronland zurücknahm, was zur Erzielung kurzfristiger Einnahmen nach 1634 von der Regentschaft und nach 1650 von Königin Christina an den Adel verkauft worden war, nur geringfügig besserte. Zudem war ihm bewusst, dass die Armee, die er brauchte, um die schwedischen Territorien im Baltikum zusammenzuhalten, nur zu finanzieren war, wenn sie Krieg führte und von erobertem Gebiet leben konnte. Gleichzeitig rechnete er sich aus, dass ein neuer Feldzug die durch die Vielzahl entlassener Soldaten aufgeworfenen inneren Probleme des Landes und die schwelenden Spannungen zwischen Adel und Bürgertum entschärfen werde, indem sich ihre Unzufriedenheit in Patriotismus entlud. Willkommener Anlass des Angriffs auf Polen 1655 war die Krise infolge des Moskauer Einmarschs in Litauen 1654. 8 Der Beginn des Dreizehnjährigen Krieges zwischen Russland und Polen (1654–1667) führte direkt zum Ausbruch des Zweiten Nordischen Krieges zwischen Schweden und Polen (1655–1660). Karl X. Gustav suchte seine südbaltischen Besitzungen zwischen Westpommern und Livland zu sichern und wenn möglich zu erweitern, vor allem durch die Annexion des königlichen Westpreußen. Vor allem aber musste er allen Versuchen Russlands zuvorkommen, sich im Südbaltikum festzusetzen. Darüber hinaus wollte er ein für allemal die Ansprüche der polnischen Wasa-Dynastie auf den schwedischen Thron abschmettern, die anlässlich seiner eigenen Thronfolge erneuert worden waren. Diese Pläne waren eine Bedrohung für das brandenburgische Herzogtum Ostpreußen, das der Große Kurfürst als Lehensgut der polnischen Krone hielt. Um es zu verteidigen, musste er Truppen mobilisieren. Sein Versuch, Westpreußen an sich zu reißen, scheiterte daran, dass ihm Schweden zuvorkam und die wichtigen polnischen Städte Thorn und Elbing eroberte, wodurch der Kurfürst und seine Männer in Königsberg eingekesselt waren und ihnen nichts übrig blieb, als sich der schwedischen Sache anzuschließen. Durch den Vertrag von Königsberg von Januar 1656 wurde Ostpreußen, erweitert um die Enklave Ermeland, schwedisches Lehen, während Friedrich Wilhelm die Hälfte der ostpreußischen Zolleinnahmen abtrat und Hilfstruppen von 1.500 Mann für das schwedische Heer abstellte. Als es den Schweden nicht gelang, einen polnischen Aufstand niederzuschlagen, und Russland seine Offensive gegen Polen unterbrach, um schwedische Stellungen anzugreifen, suchte Karl Unterstützung beim Großen Kurfürsten und Georg II. Rákóczi von Siebenbürgen. Als Gegenleistung für weitere territoriale Konzessionen (Vertrag von Marienburg, Juni 1656) stellte der Große Kurfürst Schweden 4.000 Mann zur Verfügung, verstärkte seine eigene Armee und war umgehend an der Eroberung Warschaus Ende Juli beteiligt. Polen war indes längst noch nicht geschlagen. Russland übte weiterhin Druck
2. Die letzten Jahre Ferdinands III.: Bündnisse im Westen, Kriege im Norden
auf die schwedischen Provinzen im Baltikum aus. Nun drohte zudem noch eine zum Schutz des halbautonomen Hafens Danzig entsandte niederländische Flotte Schwedens maritime Verkehrsverbindungen zu durchtrennen, während Dänemark ebenfalls zum Angriff auf schwedisches Gebiet rüstete. Um seine Verbündeten zum Handeln zu treiben, bot Karl Brandenburg die Hoheitsgewalt über Ostpreußen (Vertrag von Labiau, November 1656) und Rákóczi das Königreich Polen sowie das Großfürstentum Litauen (Vertrag von Radnot, Dezember 1656) an. 9 Die Stellung der Polen wurde jedoch gestärkt, als Österreich seine Neutralität ablegte und im Dezember 1656 das erste einer Reihe von Abkommen mit Polen schloss, was nach dem Tod Ferdinands III. zur Zusage eines aktiven Eingreifens führte. Im Juni 1657 marschierten kaiserliche Truppen in Polen ein, gerade als Karl gezwungen war, seine Verbündeten im Stich zu lassen, um dänische Attacken auf Bremen, Jämtland und Västergötland abzuwehren. Im Februar 1658 gelang es Karl, die Dänen zu besiegen, die ihre Teilnahme am Krieg beenden sowie einige Gebiete in Schleswig in die Unabhängigkeit entlassen und der Herrschaft der Herzöge von Holstein-Gottorp unterstellen mussten. Nun war es jedoch zu spät, um in Polen rettend einzugreifen. Rákóczi kapitulierte, seine Armee wurde von den Tartaren vernichtet. 10 Derweil wechselte der Große Kurfürst in der Überzeugung, Polen werde einem »ewigen Bund« anstelle seiner Vorherrschaft über Ostpreußen zustimmen, die Seiten und änderte seine Stimme bei der Kaiserwahl zugunsten von Leopold I., der ihm die militärische Unterstützung Österreichs zusagte. Für den Umschwung hatte Karl X. selbst gesorgt. Im Juni 1658 weigerte er sich, eine brandenburgische Gesandtschaft in Flensburg zu empfangen, äußerte öffentlich seinen Missmut über Friedrich Wilhelms wankelmütige Unterstützung und schien sogar mit einer Invasion in Brandenburg drohen zu wollen. Ohne Absprache mit seinem Bündnispartner griff er dann im Juli erneut Dänemark an und hoffte auf einen endgültigen Sieg. Während eine niederländische Flotte seinen Vorstoß auf Kopenhagen vereitelte, sah sich Karl mit einer heranrückenden Armee von 30.000 Mann aus Brandenburg, Österreich und Polen konfrontiert, die der Große Kurfürst selbst anführte. Diese erneute Wende der brandenburgischen Politik begleiteten Propagandaschriften, in denen der Widerstand gegen den schwedischen König gerechtfertigt und Brandenburg als treibende Kraft der entschlossenen Verteidigung des Reichs und seiner Gesetze dargestellt wurden. Die wichtigste Schrift mit dem Titel Gedencke, daß du ein Teutscher bist! berichtete von der Abweisung der Flensburger Gesandtschaft und beschrieb Karl und die Schweden als zwanghafte Aggressoren. 11 Nach dem Angriff auf Bremen und Polen (das als Verteidiger des Christentums gegen die Türken bezeichnet wurde) und den Drohungen gegen Brandenburg sei es nun die patriotische Pflicht aller Deutschen, sich der »fremden Krone« zu widersetzen. Die deutsche Nation und Freiheit, das Gesetz des Reichs und die
27
28
I. · Auferstehung und neues Leben 1648–1705
Deutschen als Inhaber des Reichs und somit führendes Volk in Europa dienten als Argumente für eine aufrüttelnde Rechtfertigung der deutschen Sache. Die neue Krise wurde mit der »nationalen Not« des Dreißigjährigen Krieges verglichen, als Deutschland von fremden Armeen überrollt worden war. Die brandenburgische und österreichische Propaganda richtete sich in erster Linie an die Höfe und Kanzleien der deutschen Fürsten sowie an gebildete und kundige Kreise auf deutschem Gebiet und in Nachbarländern, insbesondere der Republik der Vereinigten Niederlande. Sie mag Sympathien für die deutsche Sache geweckt haben, konnte Karl jedoch nicht beirren und auch keine internationale Unterstützung herbeiführen. Das Vordringen des Großen Kurfürsten von Holstein aus nach Norden, dem sich dänische Truppen anschlossen, kam zum Erliegen, als ihnen die Niederlande den Übertritt von Jütland auf die schwedisch eroberten Inseln verwehrten. Zur gleichen Zeit schmiedete Mazarin eine Allianz zur Unterstützung Schwedens. Im Mai 1659 sicherte er sich die Hilfe Englands und der Niederlande für die »Haager Konzerte« zur Friedensvermittlung, für die er auch den Rheinbund gewann, woraufhin Schönborn anbot, zwischen dem Kaiser und seinem widerspenstigen schwedischen Vasallen zu vermitteln. Aber Karl blieb trotz erneuter brandenburgisch-österreichischer Feldzüge gegen Fünen und einer entscheidenden Niederlage bei Nyborg am 24. November ungebrochen. Nach dem Pyrenäenfrieden zwischen Frankreich und Spanien im November 1659 drohte Ludwig XIV., 30.000 Mann zu entsenden, um im Norden des Reichs Frieden herbeizuführen. Die Österreicher wollten keine Konfrontation mit Frankreich auf deutschem Boden riskieren und scheuten sich, Brandenburgs Pläne einer Invasion und Besetzung schwedischer Territorien im Reich zu unterstützen, weil das dem Frieden von 1648 zuwiderlief. Zudem hätte es die Stellung des Kaisers geschwächt, freiwillig oder unter Zwang das Vermittlungsangebot des Kurfürsten von Mainz anzunehmen. Da nun auch Polen und Dänemark Frieden schließen wollten, sah sich Österreich verpflichtet, den von Frankreich im Kloster Oliva bei Danzig vermittelten Vereinbarungen zuzustimmen. Der Tod Karls X. am 23. Februar 1660 räumte das letzte Hindernis einer Einigung aus dem Weg, die am 3. Mai beschlossen wurde. Der territoriale Status quo im Reich blieb unverändert, allerdings erhielt Brandenburg die Hoheitsgewalt über Preußen. Der am 6. Juli vereinbarte Friede von Kopenhagen beließ Schwedens Stellung weitgehend unangetastet; lediglich Bornholm und Trondheim gingen zurück an Dänemark. Schwedens Rolle als Schützling Frankreichs hatte sein Ansehen beschädigt; indes versprach der Verzicht des polnischen Königs auf den schwedischen Thron und die Anerkennung der Ansprüche Schwedens auf Livland für die Zukunft mehr Sicherheit. 12 Dänemark hingegen musste Schonland und weitere Territorien östlich der Meerenge an Schweden abtreten und zudem die Unabhän-
2. Die letzten Jahre Ferdinands III.: Bündnisse im Westen, Kriege im Norden
gigkeit der Herzöge von Schleswig-Holstein-Gottorp als Reichsfürsten und ihre Hoheit über bestimmte schleswigische Gebiete außerhalb der Reichsgrenzen anerkennen. Dass diese Situation nun nicht mehr nur von Schweden, sondern auch von einer Reihe deutscher Fürsten und den Vermittlungsmächten Frankreich, Niederlande und England garantiert wurde, machte es wahrscheinlich, dass alle zukünftigen dänischen Versuche, verlorene Vorrechte und Terrain wiederzuerlangen, in einen internationalen Konflikt münden würden. Auf kurze Sicht jedoch kam das dänisch-schwedische Machtgleichgewicht im Baltikum niederländischen und englischen Interessen entgegen. 13 Was Brandenburg und das Reich betrifft, stand der Große Kurfürst auf der siegreichen Seite, aber er hatte Glück gehabt. Trotz der Bestätigung seiner Hoheitsrechte war seine Herrschaft über Preußen alles andere als gefestigt. Er hatte sich den Schweden aus purer Notwendigkeit angeschlossen und davon profitiert, seine Stellung geriet jedoch sofort ins Wanken, als Karl X. strauchelte. Seine Sicherheit und sein Erfolg in Preußen hingen vom Beistand des Kaisers ab; durchsetzen konnte sich seine Politik nur, wenn sie von kaiserlicher Autorität gedeckt war, im gesetzlichen Rahmen blieb und der Verteidigung des Reichs diente. Der »Aufstieg« Brandenburgs geschah somit als tragende Säule des Reichs und weniger als unabhängige Macht im Norden. Schwedens Reputation war infolge seiner Bündnispolitik angeschlagen, die Friedensregelung machte alle Hoffnungen auf eine Hegemonie der Schweden im Baltikum zunichte. Aber ihre Stellung im Reich blieb dieselbe. 14 Sie bestanden auf allen Rechten in Bezug auf ihre deutschen Besitzungen und profitierten weitere fünfzig Jahre von den Zolleinkünften. 1666 versuchten sie erneut, Bremen einzunehmen. Der Zweite Nordische Krieg unterstrich die Brüchigkeit des Westfälischen Friedens, aber auch das Ausmaß des französischen Einflusses im Reich. Es läge nahe, daraus zu schließen, dass der Kaiser unbedeutend geworden war und der Kontrolle der ihm entgegenstehenden Reichsstände unterlag. Diese Sicht blendet jedoch den wichtigen Beitrag Österreichs zum Sieg über Schweden aus. Ferdinand III. hatte sich nur zögernd an den Auseinandersetzungen beteiligt, vor allem, da sie zu seinen Lebzeiten das Reich nicht betrafen. Er teilte die Abneigung vieler deutscher Fürsten gegen bewaffnete Konflikte. Das ursprüngliche Abkommen, das er am 1. Dezember 1656 mit Polen schloss, hatte keine praktischen Folgen. Erst als der Krieg das Territorium des Reichs erfasste, nahm die formelle Allianz mit Polen Form an, da Wiener Funktionäre einen Aktionsplan entwarfen, der weit fortgeschritten war, als Leopold I. am 1. August 1658 gewählt wurde. Leopold schlug keinen materiellen Gewinn aus einer kaiserlichen Intervention, die seine Ressourcen stark belastete. Aber sein Eingreifen zur Verteidigung der Gesetze und Bräuche des Reichs gegen schwedische Aggression und seine Teilnahme an den Friedensgesprächen in Oliva setzten ein wichtiges Zeichen.
29
30
I. · Auferstehung und neues Leben 1648–1705
Somit begann die Herrschaft Leopolds I. mit einer Demonstration der Kontinuität. Ferdinand III. war vor einem internationalen Konflikt zurückgeschreckt, hatte aber hart daran gearbeitet, seine Stellung im Reich neu zu stärken. 15 Die Aussichten waren 1648 düster. Die Reichsstände hatten ihm ein Ultimatum gestellt, dem Friedensvertrag zuzustimmen. Auf dem Nürnberger Kongress zur Umsetzung des Osnabrücker Abkommens 1649 standen die kaiserlichen Repräsentanten unter dem Diktat des schwedischen Generals und Thronfolgers Karl Gustav von Pfalz-Zweibrücken-Kleeburg. Die Bildung regionaler Ligen und Unionen, die deutlich antihabsburgische Haltung vieler deutscher Fürsten und der tiefgreifende Einfluss Frankreichs schienen die kaiserliche Position dauerhaft zu schwächen. All das hielt den Kaiser nicht ab, die Initiative zu ergreifen. 1651 vermittelte eine kaiserliche Kommission erfolgreich im Konflikt zwischen Brandenburg und PfalzNeuburg um die pfalz-neuburgische Bevorzugung von Katholiken bei der Zuteilung von Kirchenbesitz und Konfessionsrechten in Jülich und Berg, dem PfalzNeuburg-Anteil am Jülich-Kleve-Erbe. 16 Letztlich musste Friedrich Wilhelm zurückstecken, weil Pfalz-Neuburg über mehr Truppen verfügte und den Herzog von Lothringen auf seiner Seite hatte, während die Niederlande ihr Versprechen, Brandenburg beizustehen, nicht einhielten. Es kam lediglich zu einem langwierigen Patt, treffend als »Kuhkrieg« bezeichnet, da die aufmarschierten Soldaten mehr damit zu tun hatten, entlaufenen Rindern hinterherzujagen als gegeneinander zu kämpfen. Die dennoch angespannte und potenziell gefährliche Lage wurde schließlich durch eine kaiserliche Kommission entschärft, die die dauerhafte Einigung in sämtlichen territorialen und religiösen Streitpunkten hinsichtlich Jülich-Kleve 1666 und 1672 auf den Weg brachte. 17 1653 zwang eine kaiserliche Intervention die Schweden, Westpommern an Brandenburg zu übergeben, und mobilisierte gleichzeitig Widerstand gegen Schwedens Versuche, Bremen zu unterjochen. Ferdinand nutzte seinen Einfluss, um den Herzog von Lothringen, der mit dem Prinzen von Condé das Erzbistum Lüttich besetzt hatte, durch seinen Bruder, Erzherzog Leopold Wilhelm, den Statthalter von Brüssel, festsetzen zu lassen. 18 Das schnelle kaiserliche Einschreiten verhinderte ein militärisches Eingreifen der Kurfürsten von Brandenburg, Mainz und Trier zugunsten des Regenten des Erzbistums, des Kurfürsten von Köln. So stärkte der Kaiser seine Stellung als feudaler Oberherr und friedensstiftender Vermittler zwischen seinen Vasallen.
Anmerkungen 1 2 3
Höbelt, Ferdinand III., 295–408. Wilson, German Armies, 169. Gotthard, »Friede und Recht«, 37 ff.
2. Die letzten Jahre Ferdinands III.: Bündnisse im Westen, Kriege im Norden
4 Höbelt, Ferdinand III., 382–387. 5 Wrede, Reich, 217–222. 6 Bremen wurde nach langen Auseinandersetzungen mit den Erzbischöfen (und später mit den protestantischen Herzögen von Schleswig-Holstein) Reichsstadt; vgl. Schindling und Ziegler, Territorien III, 44–57, sowie Schilling, »Homagium«. 7 Er war ein Enkel von Karl IX. und Sohn von Gustav Adolfs Halbschwester. 8 Frost, Northern Wars, 164–183; Wilson, German Armies, 35 ff. 9 Frost, Northern Wars, 178. 10 Ebd., 179. 11 Wrede, Reich, 229–234. 12 Frost, Northern Wars, 183. 13 Ebd., 227–228. 14 Wrede, Reich, 254 f. 15 Höbelt, Ferdinand III., 305–310. 16 Engelbrecht, »Der Dreißigjährige Krieg«; Ehrenpreis, Konfessionskonflikte, 59–62. 17 Aretin, Altes Reich I, 166 f. 18 Ebd., 176 f.
31
3. Von Ferdinand III. zu Leopold I.
N
och wichtiger waren die Fortschritte in Sachen Thronfolge und Durchführung des ersten Nachkriegsreichstags. Dabei kam dem Kaiser der wieder aufflammende Konflikt zwischen Kur- und anderen Fürsten zugute. Erstere waren bestrebt, ihre herausragende Stellung zu sichern, viele der übrigen drängten auf »Parifikation«, die Abschaffung der kurfürstlichen Vorrechte, um den Weg für ein wirklich föderales System zu ebnen. 1 Den harten Kern der Opposition bildete eine Gruppe protestantischer Fürsten (Hessen-Kassel, die diversen Welfen- und Braunschweiger Herzöge sowie Württemberg) mit katholischer Unterstützung (etwa durch Pfalz-Neuburg). Ihnen missfielen die Vorrangstellung der (mehrheitlich katholischen) Kurfürsten, die Rolle des Mainzer Erzbischofs als Leiter des Reichstags und die Tatsache, dass der Vorstand des Fürstenkollegiums beim Reichstag abwechselnd von Österreich und Salzburg gestellt wurde, was in ihren Augen die katholische Übermacht im Reich untermauerte – eine Verzerrung der Machtverhältnisse, die sie nicht zu Unrecht mit dem in den Friedensverträgen festgeschriebenen Prinzip konfessioneller Gleichstellung unvereinbar fanden. Freilich ging es ihnen nicht nur um eine Stärkung des Paritätsprinzips, sondern auch um Verbesserung ihrer eigenen Position und Macht in einem reformierten Reich als echter Föderation von Gleichen. Diese grundlegende Spannung ließ Uneinigkeit in den wichtigsten konstitutionellen Belangen erwarten, deren Klärung die Friedensverträge an einen folgenden Reichstag verwiesen hatten. 2 Zwei dieser Themen waren besonders wichtig und heikel: die Beratung über die Prozedur der Wahl eines designierten Thronfolgers (des Römischen Königs) und die Formulierung einer immerwährenden kaiserlichen Wahlkapitulation (capitulatio perpetua) als Grundgesetz, auf das alle zukünftigen Kaiser vor ihrer Krönung schwören mussten. Die radikalsten Oppositionsfürsten fassten mit französischer Unterstützung ein Verbot von Wahlen zu Lebzeiten des regierenden Kaisers (vivente imperatore) ins Auge, um dessen Einflussnahme zu verhindern. Darüber hinaus argumentierten sie, da die Wahlkapitulation eigentlich ein Reichsgesetz sei, müsse sie vom gesamten Reichstag formuliert und ratifiziert werden. Das lief letztlich auf eine Teilnahme sämtlicher Fürsten an Kaiserwahlen hinaus. Den Friedensverträgen zufolge sollte der Reichstag spätestens bis 18. August 1649 eröffnet werden, aber Ferdinand III. und der Kurfürst von Mainz waren wegen der oppositionellen Fürsten auf der Hut. Die Interessen des Kaisers teilten nun auch Schönborn und die anderen Kurfürsten. Aber der Reichstag ließ sich nicht
3. Von Ferdinand III. zu Leopold I.
auf unbestimmte Zeit hinauszögern. Schließlich hing die Stabilität des Reichs davon ab, dass die Friedensverträge formell ratifiziert und ihre Bestimmungen per Reichsabschied in Reichsrecht übersetzt, das heißt in das endgültige Dekret eingebettet wurden, das sämtliche von »Kaiser und Reich« beim Reichstag in Übereinstimmung getroffenen Entscheidungen verkündete. Ende April 1652 sah sich Ferdinand unter laufend neuen Nachrichten von der Agitation der opponierenden Fürsten verpflichtet, den Reichstag für den 31. Oktober 1652 nach Regensburg einzuberufen. Aus Sorge um die Opposition war Ferdinand indes entschlossen, das Kernproblem der Thronfolge zu lösen, bevor der Reichstag zusammengetreten war. Im Herbst 1652 lud er die Kurfürsten zu einer Konferenz nach Prag. 3 Um nicht den Verdacht einer Verschwörung zur Übernahme der Herrschaft wie 1636 aufkommen zu lassen, reisten die Kurfürsten »zu Besuchen« nach Prag, wo sie Geheimgespräche untereinander und mit dem Kaiser führten. Es gab keine offiziellen Treffen und keine formellen Beschlüsse, dennoch verständigte man sich darauf, Ferdinands Sohn zum Römischen König zu wählen. Am 12. Dezember zog der Kaiser mit einem Gefolge von dreitausend Mann, darunter fünfzig Fürsten und Grafen, sechzig Musiker, drei Hofnarren und drei Zwerge, triumphal in Regensburg ein. 4 Neben anderen prachtvollen Veranstaltungen führte sein Hoforchester eine Oper auf und Schönborn veranlasste den Magdeburger Bürgermeister Otto von Guericke zur ersten öffentlichen Vorführung seiner Technik zur Erzeugung eines Vakuums mittels einer Luftpumpe zwischen zwei Kupferhalbkugeln, die zwei Gespanne von je acht Pferden nicht auseinanderreißen konnten. 5 Der Kaiser hatte es nicht eilig, die Beratungen zu eröffnen, ehe nicht eine weitere Prozedur vollzogen war: die Wahl und Krönung seines Sohnes. 6 Die Zeit drängte, da die Opposition bei informellen Treffen im März und April begonnen hatte, wichtige Reformen zu debattieren. Daher wurden die Kurfürsten nach Augsburg geladen, wo sie am 31. Mai 1653 ordnungsgemäß Ferdinand IV. wählten. Zurück in Regensburg wurde der junge Ferdinand am 18. Juni zum Römischen König und designierten Thronfolger im Reich gekrönt. Es kam zu weiteren Verzögerungen, weil die Stimme des Großen Kurfürsten mit der Zusage erkauft worden war, Ferdinand werde Königin Christina eine Belehnung mit deutschen Gebieten so lange verweigern, bis Schwedens Disput mit Brandenburg über Ostpommern und die baltischen Zölle beigelegt war. 7 Erst am 28. Juni traf die Nachricht vom schwedischen Einlenken angesichts des angedrohten Ausschlusses vom Reichstag in Regensburg ein. Drei Tage darauf wurde der Reichstag offiziell eröffnet. Die Opposition war düpiert, aber nicht unterworfen. Die Frage der Kaiserwahl anzusprechen, wurde ihr vorenthalten, weitere Beratungen zu diesem Thema auf einen zukünftigen Reichstag verschoben. Dennoch blieben dem Reichstag, der bis
33
34
I. · Auferstehung und neues Leben 1648–1705
zum 17. Mai 1654 tagte, fundamentale Probleme zu diskutieren: die Zusammensetzung der Ordentlichen Reichsdeputation und die Frage, ob Reichssteuern per Abstimmung mehrheitlich beschlossen werden sollten. Diese prozeduralen Fragen betrafen konstitutionelle Prinzipien und die Opposition zeigte Geschlossenheit, die noch untermauert wurde, als der Große Kurfürst das kaiserlich-kurfürstliche Lager im Stich ließ. Dies ging teilweise auf den Einfluss des fanatisch antihabsburgischen Organisators des Wetterauer Grafenvereins und brandenburgischen Hofrats Georg Friedrich von Waldeck zurück, aber auch auf die Enttäuschung der Brandenburger über Ferdinands Weigerung, ihnen das schlesische Herzogtum Jägerndorf abzutreten, das 1621 dem Markgrafen von Brandenburg-Ansbach entzogen worden war. 8 Die Zusammensetzung der Deputation war von Bedeutung, weil sie als eine Art ständiges Komitee alle zwischen den Reichstagssitzungen anfallenden geschäftlichen Angelegenheiten erledigen sollte. Laut Absprache war die Deputation in zwei Kollegien geteilt, eines der Kurfürsten und eines der Fürsten, Herzöge und Reichsstädte. Die oppositionellen Fürsten wussten das Recht auf ihrer Seite, wenn sie konfessionelle Parität in beiden Kollegien forderten: Schließlich war diese in den Friedensverträgen von 1648 festgeschriebenes Verfassungsprinzip. Im zweiten Kollegium fiel der konfessionelle Ausgleich relativ leicht. 9 Dafür sorgten schon die beiden beteiligten Reichsstädte (das katholische Köln und das lutherische Nürnberg). Nach langen Diskussionen kamen in Anerkennung der Bildung eines Städtekollegiums im Reichstag vier weitere Städte dazu. Die katholische 9 : 4-Mehrheit unter den Fürsten behob man durch die Hinzuziehung von vier Protestanten (aus Sachsen, Brandenburg, Mecklenburg und Württemberg) und einem Vertreter der Wetterauer Grafen, der deren kollektive Kuriatstimme im Reichstag hielt. Das wirkliche Problem war die Herbeiführung der Parität unter den Kurfürsten, bei denen eine katholische 4 : 3-Mehrheit herrschte (den Kurfürsten von Böhmen ausgenommen, der nur an der Wahl des Römischen Königs teilnahm). 10 Die radikaleren Fürsten forderten die Zusammenlegung der beiden Kollegien, scheiterten damit und schlugen nun vor, ein weiteres Kurfürstentum zu errichten. Wenige Tage vor Ende der Sitzungen akzeptierten Ferdinand und die Kurfürsten widerstrebend einen Kompromiss: Bis zu einer endgültigen Entscheidung auf dem nächsten Reichstag sollte eine vierte protestantische Stimme zwischen den drei existierenden protestantischen Kurfürsten (Brandenburg, Sachsen und Pfalz) wechseln. Was die Mehrheitsentscheidung über Reichssteuern betraf, stand Brandenburg hingegen fest auf Seiten der Fürsten. Der Kaiser konnte sich in der langen Debatte ebenso wenig durchsetzen wie seine Vorgänger im 16. Jahrhundert. Entscheidungen über Steuern waren weiterhin nur bei Einstimmigkeit gültig. Die Fürsten gingen prompt daran, ihre Rechte in diesem Bereich zu demonstrieren, als sie das Ersuchen des Kaisers um 60 Römermonate zur Finanzierung des Reichstags
3. Von Ferdinand III. zu Leopold I.
ablehnten und vereinbarten, die bereits zuvor zugesagten 100 Römermonate für die Kosten der Konferenzen in Münster und Osnabrück müsse nur entrichten, wer der Zahlung zugestimmt habe.11 Hingegen gewährten sie Karl II. einen Zuschuss von vier Römermonaten für seinen Kampf um die englische Krone. Solidarität fiel bei einem fernen Monarchen leichter. Die Kontroverse um die Kaiserwahlen köchelte während der Diskussion über die Bedingungen der Wahlkapitulation für den neuen Römischen Kaiser weiter. Die Einigung orientierte sich letztlich an früheren Kapitulationen, mit kleinen Konzessionen an die Fürsten, etwa dem Zusatz, sie sei »im Namen aller Kurfürsten und aller Fürsten und Stände« zustandegekommen. 12 Andere grundlegende Streitpunkte blieben ungeklärt. Die Debatte zur Verteidigung scheiterte an der Weigerung der Stände, die Bildung einer Reichsarmee mitzutragen: Stattdessen sollte es jedem Reichsstand gestattet sein, Steuern für seine eigene Verteidigung zu erheben, wodurch die Fürsten das Recht erhielten, ohne Zustimmung ihrer Territorialstände Steuergelder einzutreiben. 13 Streitigkeiten über Zölle (die die Fürsten ohne die traditionell nötige Erlaubnis des Kaisers und der Kurfürsten festsetzen wollten) und die Stapelrechte der Reichsstädte (die die Fürsten auf ihre eigenen Städte ausweiten wollten) blieben ebenfalls ungelöst. Ganz allgemein erwiesen sich Unstimmigkeiten über Rechte und Privilegien, die von konstitutioneller Tragweite waren beziehungsweise widerstreitende materielle Interessen betrafen, als unlösbar. Hingegen einigte man sich in einigen Punkten, die allen zugutekamen, etwa auf neue Regeln für das Reichskammergericht, an denen eine Deputation ab 1641 gearbeitet hatte, eine Erneuerung der Exekutionsordnung von 1555 mit allen späteren Revisionen und Erweiterungen sowie auf die Wiedereinführung der alten Kreise. Ebenso wichtig war die Frage der während des Krieges aufgelaufenen Schulden. 1648 waren so gut wie sämtliche Reichsstädte und viele andere Reichsstände bankrott. 14 Einige Fürsten hatten bereits in den 1620er Jahren regionale Schuldzinszahlungen ausgesetzt, aber die meisten (auch Brandenburg) zögerten, lokale Maßnahmen zu ergreifen, die gegen Reichsgesetze verstießen. In anderen Ländern Europas wäre die Lösung gewesen, den Bankrott zu erklären und alle Schulden zu streichen. In der Debatte über die Schulden im Reich nach 1648 herrschte der Konsens, dass zumindest das Kapital der Kreditgeber garantiert sein musste. Das Ergebnis war ein dreijähriges Moratorium auf Kapitalrückzahlungen und eine 75prozentige Kürzung aller bis 17. Mai 1654 anfallenden Zinsen, ab diesem Zeitpunkt waren alle alten und neuen Anleihzinsen auf höchstens fünf Prozent begrenzt. 15 Der Fall der Pfalz, deren Schulden katastrophal waren, wurde an den Reichshofrat und damit den Kaiser verwiesen, der ein zehnjähriges Moratorium und eine 50-prozentige Kürzung der Zinszahlungen für weitere zehn Jahre zugestand.
35
36
I. · Auferstehung und neues Leben 1648–1705
Wie wichtig diese Vereinbarungen für die Territorien waren und auf welche Weise sie manipuliert und missbraucht wurden, werden wir noch sehen. 16 In zweierlei Hinsicht indes waren sie als Reichsgesetze von Bedeutung. Alle Reichsstände erkannten die Notwendigkeit klarer Regeln für »öffentliche« Schulden und erklärten sich bereit, Kapital als unantastbar zu betrachten. Zweitens wiesen sie dem Reichsgerichtshof eine Schlüsselrolle in Disputen über die aktuelle Schuldenkrise und zukünftige Probleme zu. Damit waren derartige Angelegenheiten künftig Sache des Kaisers, dessen Vorrechte somit implizit um die Gewährung der Aussetzung von Zinszahlungen und die Einsetzung von Schuldenkommissionen (effektiven Konkursverwaltungen) zur Rettung bankrotter Reichsstände erweitert wurden. 17 Zusammen mit dem existierenden (1648 formulierten) Recht, kaiserliche Kommissionen zur Klärung von Streitigkeiten innerhalb und zwischen Reichsständen zu entsenden, bedeutete die neue Rolle des Kaisers als eine Art »finanzieller Wachhund« mit vielen Befugnissen eines Treuhänders eine klare Stärkung seiner Autorität. Die Reichsstände trugen solcherart zur »Modernisierung« der traditionellen feudalhierarchischen Funktionen des Kaisers und zu ihrer Einbettung in den gesetzlichen Rahmen des Reichs bei. Der Kaiser wiederum zögerte nicht, seine Vorrechte auf dem Reichstag auszuüben. Ohne die Reichsstände auch nur zu konsultieren, verkündete er am 16. März 1654 eine neue Verfassung für den Reichshofrat und sorgte für die Ernennung protestantischer Räte 18, wobei er sich ausdrücklich nicht an das Prinzip der strikten Parität hielt. Proteste der Oppositionsfürsten fegte er einfach beiseite: Der Hof sollte des Kaisers persönlicher Hof bleiben, ohne jeden Einfluss der Stände. Zweitens berief Ferdinand acht ehemalige Grafen und einen früheren Reichsritter, den er in den Fürstenstand erhoben hatte, in den Reichstag. Sie waren treue Diener der Krone und mit einer Ausnahme sämtlich katholisch. 19 Dieser Schritt löste solche Empörung aus, dass er versprechen musste, zukünftige Berufungen nur mit Zustimmung der Fürsten vorzunehmen. Aber er zeitigte den gewünschten Erfolg: Der Kaiser hatte seine feudale Oberherrschaft wiederhergestellt. Drittens setzte Ferdinand seine dynastischen Interessen durch und wehrte Versuche von Brandenburg und anderen ab, die Misere der Protestanten in seinen eigenen Erblanden aufs Tapet zu bringen. Dadurch bestätigte er ihren Ausschluss von der Gesetzgebung des Reichs und beschleunigte dessen Rekatholisierung. 20 Zudem behielt er alle Besitz- und Feudalherrschaftsrechte in Bezug auf die Landvogtei Ober- und Niederschwaben als wichtiges Machtinstrument der Habsburger im schwäbischen Kreis. 21 Die pompöse Krönung von Kaiserin Eleonora am 4. August 1653 schließlich war zwar verfassungsrechtlich bedeutungsloses Theater, stärkte aber die Aura kaiserlicher Majestät und rückte die Fürstäbte von Kempten, Fulda und Corvey ins
3. Von Ferdinand III. zu Leopold I.
Rampenlicht, die traditionell bei solchen Anlässen anstelle der Kurfürsten amtierten. 22 Der am 17. Mai 1654 verlesene Jüngste Reichsabschied (so benannt, weil er der letzte vor dem Zusammentreten des Immerwährenden Reichstags 1664 blieb) dokumentierte das Scheitern an der von den Friedensverträgen für den Reichstag vorgegebenen Agenda.Viele Kernfragen blieben offen, was indes für alle Beteiligten besser war als ein Beschluss zu ihren Ungunsten. Zum Verdruss vieler Fürsten ging der Kaiser gestärkt aus den Verhandlungen hervor. Schwedens Einfluss war infolge der Aggressionen gegen Bremen und Pommern geschwächt, Frankreich immer noch hauptsächlich mit heftigen inneren Unruhen (der Fronde) beschäftigt. Die meisten deutschen Fürsten wollten Frieden. Selbst die formelle Einführung konfessioneller Corpora beim Reichstag wirkte zugunsten von Ferdinand. 23 Das von Kurmainz geleitete und von einer Mehrheit katholischer Bischöfe und Prälaten dominierte Corpus Catholicorum war grundsätzlich kaisertreu. Das Corpus Evangelicorum wiederum wählte nach langer Debatte den Kurfürsten von Sachsen zu seinem Führer und vermied damit eine direkte Opposition zur Krone. Die feindseligen Absichten Brandenburgs und der oppositionellen Fürsten wurden in Regensburg 1653/54 und in den Jahrzehnten danach durch den traditionellen Loyalismus der sächsischen Kurfürsten im Zaum gehalten. Letztlich gereichte es Ferdinand zum Triumph, dass er persönlich präsidiert, eine Reihe bedeutender Gesetzesreformen eingeleitet und vor allem die Thronfolge gesichert hatte. 24 Die Wende kam bald. Sechs Wochen nach Ende des Reichstags, am 9. Juli 1654, starb König Ferdinand im Alter von zwanzig Jahren. Diesmal war eine schnelle Kaiserwahl unmöglich, da der nächste Habsburger, Erzherzog Leopold, noch minderjährig war. Der Tod seines Bruders machte Leopold zum österreichischen Thronfolger, 1655 wurde er König von Ungarn, 1656 König von Böhmen. Das Reichsgesetz schrieb jedoch vor, dass ein Römischer König und ein Kaiser wie ein Kurfürst achtzehn Jahre alt sein musste, um ins Amt gewählt werden zu können. 25 Leopold war am 9. Juni 1640 geboren und hatte somit vorläufig keine Aussichten auf die Kaiserkrone. Während die Reichsregierung vorübergehend lahmgelegt war, organisierte sich die Opposition weiter. Die »alten Fürsten« trugen ihren Groll in die Deputation, die in Frankfurt zusammentrat, um die Verhandlungen über die beim Reichstag offen gebliebenen Punkte fortzusetzen. 26 Katholische und protestantische Fürsten führten hektische Gespräche über Ligen zur gegenseitigen Absicherung und Verteidigung. Dass der Kaiser Truppen nach Italien entsandt hatte, verunsicherte viele.Vordergründig diente der Einsatz der Verteidigung des kaiserlichen Lehens Modena, aber sowohl französische als auch deutsche Fürsten glaubten, Ferdinand unterstütze damit heimlich Spanien, was gegen den Vertrag von 1648 verstieß. Zugleich war mit der erfolgreichen Niederschlagung der Fronde 1656 die französi-
37
38
I. · Auferstehung und neues Leben 1648–1705
sche Politik wieder erstarkt. Kriegsdrohungen gegen Österreich für den Fall einer Fortsetzung der kaiserlichen Militäroperationen in Norditalien verstärkten die Spannungen dramatisch, während erneute diplomatische Avancen Frankreichs an diverse deutsche Fürstenhöfe die latente Opposition gegen Habsburg und das Misstrauen gegenüber Ferdinands Absichten befeuerten. 27 Dem Tod Ferdinands III. am 2. April 1657 folgte ein fünfzehnmonatiges Interregnum. Die Frankfurter Deputation, ohnehin gelähmt durch die Spannungen zwischen Kurfürsten und Fürsten sowie Katholiken und Protestanten, verwickelte sich in eine Debatte darüber, ob sie überhaupt weitertagen konnte. 28 Jegliche Hoffnung auf wirksame Führung durch die in der Goldenen Bulle als provisorische Herrscher vorgesehenen Reichsvikare (der Kurfürst von Sachsen für den Norden, der pfälzische Kurfürst für das »Rheinland«, das heißt den Süden) zerschlug der bittere Zwist zwischen der Pfalz und Bayern über die Frage, ob Bayern das Vikariat 1623 zusammen mit der pfälzischen Kurwürde ererbt hatte. 29 In dieser verwirrten Lage bemühte sich der Kurfürst von Mainz, das Problem der Thronfolge zu lösen und ein dauerhaftes System zu etablieren, das die Habsburger einband und zugleich ihre Vorherrschaft im Reich verhinderte. Trotz einer Reihe anderer Kandidaten und obwohl Mazarin, Karl X. von Schweden und Cromwell einen weiteren habsburgischen Kaiser ablehnten, war Leopold der einzige ernsthafte Anwärter. 30 Mazarin setzte zunächst auf den jungen Kurfürsten Ferdinand Maria von Bayern, der jedoch sofort absagte, dann auf den Bruder des verstorbenen Kaisers, Erzherzog Leopold Wilhelm, bis 1656 Statthalter in den Spanischen Niederlanden, und auf Erzherzog Ferdinand von Tirol, der schon älter war und zumindest eine weitere Wahl in nicht allzu ferner Zukunft ermöglicht hätte, bei der vielleicht sogar Ludwig XIV. selbst als Kaiser infrage gekommen wäre. Philipp Wilhelm von Pfalz-Neuburg (1653–1690) war ebenfalls im Gespräch. Die Habsburger Erzherzöge lehnten es aber ab, dem designierten Thronfolger ihrer Dynastie im Weg zu stehen, und die nichthabsburgischen Kandidaten waren schlichtweg ungeeignet. Der Kurfürst von Bayern sah ein, dass es ihm an Ressourcen und Macht fehlte, um Kaiser zu werden. Pfalz-Neuburg war in dieser Hinsicht noch weniger qualifiziert und aufgrund des Disputs über das Jülich-Kleve-Erbe für den Kurfürsten von Brandenburg sowieso inakzeptabel. Schönborn war mehr oder weniger von Beginn an überzeugt, dass nur Leopold infrage kam. Er sicherte sich bald auch die bayerische Stimme und die des Kurfürsten von Brandenburg, der auf Beistand aus Wien im Nordischen Krieg hoffte. Die neue türkische Bedrohung 1657 ließ die alten Hoffnungen auf einen habsburgischen Kaiser als Garanten der Sicherheit an der Südostgrenze des Reichs wieder aufleben. Ebenso zufällig vertrieb die Geburt eines männlichen Erben für den spanischen Thron im selben Jahr alle Befürchtungen, Leopold könne nach seiner beabsichtigten Heirat mit der Infantin Maria The-
3. Von Ferdinand III. zu Leopold I.
resia, der ältesten Tochter Philipps IV., den spanischen Thron besteigen und das Imperium Karls V. wiedererrichten. Dem Kurfürsten von Mainz ging es darum, die Wahl zu verzögern, bis Leopold alt genug war, und diesen Aufschub zu nutzen, um sicherzustellen, dass Leopolds Möglichkeiten als Herrscher strikt beschränkt sein würden. Ersteres war ein Leichtes, das Zweite führte zu heftigem Geschacher um die Wahlkapitulation. Am Ende musste Leopold zusichern, auf jedes Hilfsangebot an Spanien in Burgund und Italien zu verzichten, seine Truppen aus Italien abzuziehen und die Maßnahmen seines Vaters gegen italienische Lehen wie Savoyen, dessen Herzog ein französischer Verbündeter war, außer Kraft zu setzen. 31 Den Unwillen der Wiener Repräsentanten dämpfte nur eine Klausel, die umgekehrt Frankreich und seinen Verbündeten untersagte, Feinden des Kaisers und seiner deutschen Dynastie, des Reichs und irgendeines Reichsstandes Hilfe zu leisten. Diese Geste war im Grunde bedeutungslos, weil der König von Frankreich sich schwerlich auf die Wahlkapitulation des deutschen Kaisers verpflichten ließ. Andere Klauseln verdeutlichten die Entschlossenheit der Kurfürsten: Der Reichshofrat wurde des Rechts enthoben, Beschwerden von Untertanen wegen Steuern für militärische Zwecke anzuhören, die Mitgliedschaft im Reichshofrat und im Geheimen Rat wurde auf Einwohner des Reichs beschränkt und der Kaiser durfte ohne Zustimmung der Kurfürsten weder Allianzen bilden noch über irgendjemanden die Reichsacht verhängen. Erst als Leopold allen Bedingungen zugestimmt hatte, wurde er am 18. Juli 1658 gewählt und am 1. August gekrönt, nur knapp zwei Monate nach seinem achtzehnten Geburtstag. Für notwendig erachtet wurden zwei weitere Versicherungen gegen erneuerte Ansprüche der Habsburger. Die Chance auf eine österreichische Thronfolge in Spanien wurde weiter geschmälert. Leopold musste auf die Heirat mit Maria Theresia verzichten; nach dem Pyrenäenfrieden und dem Frieden von Oliva ehelichte sie 1660 Ludwig XIV. 32 Zwar verpflichtete Philipp IV. beide Partner, zukünftigen Ansprüchen auf die spanische Thronfolge abzuschwören, versäumte es jedoch, die Kompensation von 500.000 Kronen zu entrichten, was die Vereinbarung etwas glaubwürdiger, wenn auch noch lange nicht rechtlich durchsetzbar gemacht hätte. Dass Philipp Leopold seine zweite Tochter Margarita Theresa versprach, war eine gewisse Entschädigung; sie war jedoch bei der offiziellen Verkündung der Verlobung 1663 erst zwölf Jahre alt. Ihren Ehemann, den sie durch bevollmächtigte Vertretung 1666 in Spanien heiratete, nannte sie bis zu ihrem Tod 1673 »Onkel« (Maria Theresia überlebte sie bis 1683). Als Leopold die Herrschaft antrat, konnte Frankreich deshalb eher Ansprüche auf den spanischen Thron erheben als die Österreicher – eine Gefahr, die konkret zu werden schien, als Philipps Thronerbe Philipp Prosper 1661 dreijährig starb. Die Geburt eines weiteren Thronfolgers fünf Tage später brachte wenig: Karl II. (»der Verhexte«) war schwach und kränklich
39
40
I. · Auferstehung und neues Leben 1648–1705
und litt mehr unter den genetischen Folgen der seit Generationen herrschenden Inzucht der Habsburger als die meisten anderen Mitglieder der Großfamilie. Dass Karl bis 1700 am Leben blieb, war ein kleines Wunder, vor allem, da die Teufelsaustreibungen und andere »Kuren«, denen er sich zur Heilung seiner Impotenz unterzog, sein Ableben empfindlich beschleunigten. Bis dahin überschattete das Erbfolgeproblem die europäische Politik. Mit dem Tod Philipps IV. 1665 schien tatsächlich auch das Aussterben der Habsburger zu drohen, da der fünfundzwanzigjährige Junggeselle Leopold und der kränkliche Infant Karl die einzigen männlichen Überlebenden waren. Leopold zeugte 1678 (Joseph) und 1685 (Karl) zwei männliche Erben, die allgemein habsburgfeindliche Stimmung in Europa begünstigte aber die französischen Ansprüche und stärkte die politische Macht Frankreichs. Obendrein verkomplizierte sich die Lage in Deutschland, da Kaiserin Margarita 1673 ihren eigenen Anspruch auf den spanischen Thron an das einzige überlebende ihrer vier Kinder vererbte: Maria Antonia, die 1684 den Kurfürsten Max II. Emanuel von Bayern heiratete. 33 Erbfolgeansprüche auf die spanische Krone zu erheben, war ein auf lange Dauer angelegtes Spiel auf der europäischen Bühne. Schönborn und Mazarin suchten nach einem zweiten, kurzfristigeren Mittel zum Schutz gegen kaiserliche Ambitionen. In diesem Sinn bildete der Rheinische Bund den Höhepunkt der regionalen Allianzen der 1650er Jahre und eine einheimische Lösung für die Probleme, zu denen die Thronfolge eines weiteren Habsburgers führte. Aber der Bund verlor seinen wesentlichen Zweck schon kurz nach der Gründung. Zwar wurde er 1661 und 1663 erneuert, 1665 schloss sich Brandenburg an. Der Enthusiasmus verflog jedoch, als klar wurde, dass er kaum mehr als ein Instrument französischer Politik im Reich war. 34 Nach dem Pyrenäenfrieden 1659 und dem Frieden von Oliva 1660 ließ die Furcht, in einen europäischen Krieg zwischen den Habsburgern und ihren Gegnern hineingezogen zu werden, nach. Die Spannungen zwischen Kurfürsten und Fürsten, eines der Kernthemen der deutschen Politik jener Zeit, prägte auch die Verhandlungen des Rheinischen Bundes, und erneute konfessionelle Konflikte nagten an der Solidarität der Union. Der Kurfürst von Mainz trug 1663 dazu bei, indem er die Truppen des Bundes heranzog, um das Freiheitsstreben der Stadt Erfurt niederzuschlagen, einer protestantischen Enklave von Mainz, deren gewaltsame »Reduktion« viele protestantische Fürsten empörte. Bei anderen wesentlichen Themen, etwa dem Streit über die Braunschweiger Thronfolge 1665, gelang es dem Bund schlichtweg nicht, zu einer einheitlichen Politik zu finden. 1665 griff Mainz gar gegen die Pfalz zu den Waffen, als diese die Lehnsherrschaft über bestimmte Einwohner des Territoriums ihrer Nachbarn beanspruchte; das Vorgehen der geistlichen Kurfürsten führte schnell zur Bildung einer breiten Koalition protestantischer Fürsten. 35 In beiden Fällen blieben kaiser-
3. Von Ferdinand III. zu Leopold I.
liche Vermittlungsversuche vergeblich; entschärft wurde die Krise erst, als Frankreich einschritt. So weit erfüllte Frankreich seine Rolle als Garant des Friedens von 1648. Der Angriff Ludwigs XIV. auf die Spanischen Niederlande 1667 signalisierte jedoch eine aggressivere Haltung, die mit der friedenserhaltenden Zielsetzung des Rheinischen Bundes und den Interessen seiner Mitglieder nicht zu vereinbaren war.Viele fürchteten, der neue französische Feldzug gegen Spanien auf einem Gebiet, das rechtlich zum Reich gehörte, werde die Deutschen in den Konflikt hineinziehen. Eine Distanzierung von Frankreich schien daher ratsam. Im August 1668 wurde der Bund aufgelöst. Inzwischen stand ohnehin der Reichstag, der seit 1663 permanent tagte, im Blickpunkt der deutschen Politik und viele Fürsten betrachteten wieder eher den Kaiser als den französischen König als Schlichter und Lenker des Reichs. Jene, die Leopold I. gewählt hatten, weil sie sich einen schwachen Kaiser wünschten, wurden enttäuscht. Am Ende der siebenundvierzig Jahre seiner Herrschaft übertraf seine Macht im Reich womöglich die seiner sämtlichen Vorgänger und Nachfolger, was zu einem Großteil auf sein geschicktes Vorgehen in der Reichspolitik und die clevere Ausnutzung kaiserlicher Vorrechte zurückzuführen war. Er verdankte seine Autorität im Wesentlichen dem Triumph über zwei Gegner, die seine Herrschaft von außen infrage stellten: die Ottomanen im Osten und Frankreich im Westen. Diese Herausforderungen und seine Reaktionen darauf werden indes oft eher in österreichischem Kontext als dem des Reichs gesehen. 36 Ohne Zweifel hatte Österreich um 1705 als Verbund von Territorien innerhalb und außerhalb des Reichs den Status einer europäischen Großmacht erreicht. Es war der größte Nutznießer der Kämpfe mit den Türken und des Krieges gegen Frankreich, an das das Reich hingegen Gebiete abtreten musste. Aber das Reich war mehr als nur das Opfer eines Kollateralschadens in einem weitläufigeren Machtkampf. Die von seinen traditionellen Feinden geführten Angriffe während Leopolds Herrschaft hatten auch tiefgreifende Folgen für das Reich selbst.
Anmerkungen 1 3 5
6 7 8 9
Gotthard, Säulen, 750–760. 2 Vgl. Band I, S. 758 f. Gotthard, Säulen, 409–413. 4 Aretin, Altes Reich I, 173. ADB X, 93; BWDG I, 965 f.; Guericke führte sein Experiment später auch in Wien (1657) und Berlin (1663, mit 24 Pferden) vor. Die Oper (l’inganno d’amore vom kaiserlichen Kapellmeister Antonio Bertali) allein kostete 13.218 Gulden für eine einzige Aufführung: Müller, Regensburger Reichstag, 71; Brockpähler, Barockoper, 11. Höbelt, Ferdinand III., 310–315. Vgl. Frost, Northern Wars, 198 f., 201 f. BWDG I, 870 f. Schnettger, Reichsdeputationstag, 15–18, 25–29. 10 Ebd., 19–25.
41
42
I. · Auferstehung und neues Leben 1648–1705
11 Ein Römermonat war die Verrechnungseinheit für die Beiträge der Stände zur Verteidigung des Reichs. Ursprünglich stand er für die monatlichen Kosten des Unterhalts der Truppen, die den neu gewählten Kaiser zur Krönung durch den Papst nach Rom begleiteten. Der 1521 beschlossene Nominalbetrag, bezogen auf 4.202 Mann Kavallerie und 20.063 Infanteristen, belief sich ursprünglich auf etwa 128.000 Gulden. Bis zum 17. Jahrhundert sank er durch den Wegfall von Territorien und Städten, die ihre Unabhängigkeit verloren, und unter Berücksichtigung geschuldeter Zahlungen von diversen habsburgischen Territorien auf etwa 64.000 Gulden. Wilson, Reich, 162 ff. 12 Müller, Regensburger Reichstag, 139. 13 Ebd., 387–406. 14 Hattenhauer, Schuldenregulierung, 30; vgl. zu diesem Themenkomplex auch Müller, Regensburger Reichstag, 407–427, und Blaich, Wirtschaftspolitik, 225–234. 15 Die 5-Prozent-Deckelung für Zinsen blieb bis zur Liberalisierung öffentlicher Anleihen im Norddeutschen Bund 1867 in Kraft; vgl. Hattenhauer, Schuldenregulierung, 101. 16 Vgl. S. 83 f., 229, 232, 630–634. 17 Schindling, Anfänge, 45 f. 18 Müller, Regensburger Reichstag, 233 ff.; Aretin, Altes Reich I, 183. 19 Schlip, »Fürsten«, 265 ff.; einige davon waren schon von Ferdinand I. erhoben worden, wurden jedoch nun erst anerkannt. Die Neuzugänge waren Hohenzollern-Hechingen, Lobkowitz, Eggenberg, Salm, Dietrichstein, Piccolomini, Auersperg, Nassau-Hadamar-Siegen und Nassau-Dietz-Dillenburg. Die meisten davon hatten sich ihre Erhebung durch Dienste im Dreißigjährigen Krieg verdient, manche besaßen kein Land im Reich, was den Widerstand der »alten Fürsten« gegen ihre Erhebung verschärfte. Die auf der Liste vertretene Hohenzollernlinie war ein schwäbisch-katholischer Zweig der Dynastie, der auf die Teilung der Ländereien von Herzog Karl I. von Hohenzollern 1575/76 zwischen drei Söhnen zurückging, die in Hechingen, Haigerloch beziehungsweise Sigmaringen residierten; vgl. Köbler, Lexikon, 293 f. 20 Müller, Regensburger Reichstag, 262–266. 21 Ebd., 245–248. 22 Aretin, Altes Reich I, 67 f., 176; Conrad, Rechtsgeschichte II, 78. 23 Müller, Regensburger Reichstag, 256–260. 24 Höbelt, Ferdinand III., 315–320. 25 Conrad, Rechtsgeschichte II, 72. 26 »Alte Fürsten« waren jene, deren Titel auf die Zeit vor etwa 1550 zurückging. 27 Aretin, Altes Reich I, 186–189. 28 Schnettger, Reichsdeputationstag, 244–268. 29 Der Disput wurde erst 1724 beigelegt, als man sich einigte, gemeinsam als Vikare zu fungieren; 1745 wurde dies zu einem abwechselnden Amt geändert, was 1752 Eingang ins Reichsrecht fand; vgl. Conrad, Rechtsgeschichte II, 70. 30 Aretin, Altes Reich I, 191. 31 Aretin, Altes Reich I, 194. 32 Spielman, Leopold I, 44–47; Ingrao, Monarchy, 57 f.; die beste Einführung in die komplexe Familiengeschichte der Habsburger mit Details zu allen Eheverträgen bietet als biografisches Nachschlagewerk Hamann, Habsburger. 33 Vgl. auch S. 55, 93 f., 135. 34 Gotthard, »Friede«, 25–44. 35 Blickle, Leibeigenschaft, 107. 36 Hochedlinger, Wars, 57–75; Winkelbauer, Ständefreiheit I, 423–448.
4. Leopold I. und seine Feinde im Ausland
D
ie externen Anfechtungen der Jahrzehnte nach 1660 brachten das Reich wieder in Bewegung. An entscheidenden Punkten scharten sich die Reichsstände um die Krone, die einmal mehr als ihr Beschützer auftrat. Nicht, dass Leopold selbst ein begabter Heerführer oder Militärstratege gewesen wäre – seine Siege verdankte er einer Reihe brillanter Feldherren: Graf Raimondo Montecuccoli, Herzog Karl von Lothringen, König Johann III. Sobieski von Polen, Markgraf Ludwig Wilhelm von Baden-Baden (»Türkenlouis«) und Prinz Eugen von Savoyen. 1 Dass er so gute Leute für sich gewinnen konnte, ging auf sein zunehmendes Ansehen als Kaiser zurück. Seine eigenen Glanzleistungen lagen auf politischem Gebiet; großes Geschick zeigte er im Umgang mit internen Konflikten und bei der Ausnutzung militärischer Erfolge. Ende der 1650er Jahre trat das Türkenproblem erneut auf den Plan. 2 Seit dem Frieden von Zsitvatorok herrschte eine unsichere Waffenruhe. Sporadische Scharmützel und wiederholte Versuche der unter osmanischer Oberherrschaft stehenden siebenbürgischen Rákóczy-Fürsten, ihre Position zwischen österreichischen, polnischen und osmanischen Territorien auszunutzen, unterstrichen die Verwundbarkeit der Habsburger im Osten. Sie hielten lediglich ein paar westliche Provinzen von Ungarn und die Loyalität der überwiegend protestantischen ungarischen Stände war gering: Der Pressburger Landtag war stets verpflichtet, sich an Siebenbürgen oder die Hohe Pforte zu wenden, wenn er seine traditionellen Rechte durch Wien bedroht sah. Während der Herrschaft der schwachen Sultane Murad IV. (1623–1640) und Ibrahim (1640–1648) blieb die Lage in Südosteuropa relativ stabil. Bis 1639 hatte die Hohe Pforte ohnehin mit anhaltenden Konflikten in Persien zu tun, ab 1645 und bis 1669 engagierte sie sich stark in den Kämpfen gegen Venedig um Kreta. 3 Nach Ibrahims Absetzung, der Thronfolge seines siebenjährigen Sohnes Mehmed IV. und nachdem die Mutter des jungen Sultans ihre Autorität durchgesetzt hatte, trat 1656 mit der Ernennung von Mehmet Köprülü zum Großwesir ein neues, dynamisches Regime auf den Plan, das ein weitreichendes Reformprogramm mit dem Bestreben verband, das osmanische Herrschaftsgebiet nach Nordwesten auszudehnen. Köprülü verurteilte die Allianz von Georg II. Rákóczy mit Karl X. von Schweden und seinen Alleingang gegen Polen 1658 als Verstoß gegen Rákóczys Pflichten als türkischer Vasall und entsandte Truppen, um den Fürsten abzusetzen und durch Ákos Barcsay zu ersetzen. Rákóczys Beschwerden in Wien blieben ver-
44
I. · Auferstehung und neues Leben 1648–1705
geblich; er starb 1660 auf dem Schlachtfeld. Die Siebenbürger wählten nun János Kemény, der sich mit Barcsay zwar einigen konnte, aber ins habsburgische Königliche Ungarn fliehen musste, als die Türken erneut einmarschierten und Apafy Mihály als Fürsten installierten. Während Wien auf Rákóczys Bitten um Beistand wegen seines Angriffs auf Polen nicht reagiert hatte, fand man nun, Kemény sei eine Unterstützung wert. Die Entsendung von 15.000 Mann unter Feldmarschall Montecuccoli erwies sich jedoch als Fehlschlag. Kemény wurde getötet, Apafy 1662 als Fürst des nun vollkommen unter türkischer Herrschaft stehenden Siebenbürgen bestätigt. Im Jahr darauf begann eine gewaltige osmanische Armee den Vormarsch durch das Königliche Ungarn nach Mähren und auf Wien. Ein Großteil der Wiener Bevölkerung flüchtete, in Süd- und Ostdeutschland brach Panik aus. 4 Die Bedrohung Wiens und des ganzen Reichs sorgte für ungleich mehr Furcht als die türkische Eroberung von Kreta und für ein unverzügliches Wiederaufleben der Schlagworte und Schreckensbilder aus den Türkenkriegen des zurückliegenden Jahrhunderts. 5 Rein technisch war die neue Krise tatsächlich eine Fortsetzung der früheren Feldzüge: Der neue osmanische Angriff war ein Bruch der lange anhaltenden Waffenruhe. Es bestand daher keine Notwendigkeit einer Kriegserklärung. Der Kaiser appellierte an die europäischen Regierungen, ihn als Retter des Christentums zu unterstützen; die deutschen Fürsten bat er als Beschützer des christlichen deutschen Reichs um Hilfe. Er gemahnte sie an ihre historische Pflicht als Angehörige der deutschen Nation, sich um ihren Kaiser zu sammeln und den Ungläubigen entgegenzustellen. Die meisten von ihnen stimmten überein, es sei christliche Pflicht, zu handeln, aber wie im Jahrhundert zuvor folgten sie nicht bedingungslos, sondern behielten die politischen Folgen ihrer Unterstützung im Inland im Auge. Es erwies sich als Glücksfall, dass die osmanischen Truppen nach dem Einmarsch ins Königliche Ungarn ihr Winterquartier aufschlugen, um sich für einen neuen Feldzug 1664 vorzubereiten. Dies gab den Österreichern die Möglichkeit, ihr eigenes Heer neu zu sammeln und die Verhandlungen mit den deutschen Fürsten abzuschließen, was sich schwierig gestaltete, da einige Fürsten nun über stehende Heere verfügten, der Rheinische Bund militärisch autonom organisiert war und vor allem weil die Reichsverteidigung und die Steuererhebung zwei der wichtigsten Punkte waren, die der Reichstag nicht geklärt hatte. Als ersten Schritt verlangte Erzkanzler Schönborn daher dessen Einberufung, die Leopold aus anderen Gründen sowieso bereits im August 1661 erwogen hatte. 6 Die Türkenkrise machte die Sache nun dringlich und beherrschte den Beginn der Tagung im Januar 1663. Das Ergebnis, das über ein Jahr später vorlag, spiegelte die politische Situation im Reich wider. 7 Der Reichstag beschloss, den Kaiser für die Dauer des Krieges finanziell zu unterstützen und eine Reichsarmee von 30.000 Mann aufzustellen.
4. Leopold I. und seine Feinde im Ausland
Allerdings weigerten sich Brandenburg, Sachsen und Bayern, Truppen beizusteuern, schlossen lieber separate Abkommen mit Wien und entsandten ihre Soldaten gegen zusätzliche Zahlungen. Auch der Rheinische Bund bestand auf einem eigenen Heer von 10.000 inklusive einem französischen Kontingent von 2.400 Mann, das Ludwig XIV. auf 6.000 verstärkte, um die Beschämung des Kaisers angesichts seiner Abhängigkeit von Frankreich zu unterstreichen. Da seine Truppen Teil der Armee des Rheinischen Bundes waren, wurde Ludwig seinem Titel Allerchristlichster König gerecht und vermied zugleich den offenen Bruch mit dem Sultan. 8 Als alle unter anderer Führung stehenden Truppen zusammengeführt waren, fehlten noch um die 21.000 Mann, die als eigentliche Reichsarmee von den Kreisen ausgehoben werden mussten. Letztlich verstärkten nur gut 32.000 deutsche Soldaten die 51.000 Österreicher und 9.000 Ungarn, die sich am 1. August 1664 nahe dem Kloster St. Gotthard am Raab dem 50.000–60.000 Mann starken osmanischen Heer stellten. Den Triumph der kaiserlichen Armee schmälerte der neue zwanzigjährige Waffenstillstand, den Leopold neun Tage darauf in Eisenburg schloss. 9 Die Türken blieben in Besitz wichtiger Festungen, während die Österreicher einwilligten, eine zu zerstören. Zudem verzichteten sie auf Siebenbürgen, erkannten Apafy als dessen Fürsten an und verpflichteten sich, sich aus seinen inneren Angelegenheiten herauszuhalten. Leopold sagte zu, dem Sultan als Gegenleistung für standesgemäße Geschenke 200.000 Gulden zu zahlen. Für einen Sieg war das ein schmaler Lohn. Dennoch ist die verbreitete Ansicht, der Waffenstillstand sei ein übereilter, beschämender Verrat an den deutschen Fürsten gewesen, nicht angebracht. Tatsächlich waren die meisten deutschen Fürsten erleichtert, dass der Konflikt und damit auch ihr eigener Einsatz so rasch endete. 10 Auch aus österreichischer Sicht ergaben sich Vorteile. Es fehlte an Geld und Gewissheit, wie lange die Deutschen weiterkämpfen würden, außerdem war man daran interessiert, dass die Franzosen Ungarn verließen, um nicht zu riskieren, dass sie sich mit der ungarischen Opposition verbrüderten. Wenn überhaupt, waren es die Ungarn, die die Waffenruhe als »Schandfrieden von Eisenburg« schmähten, da der Kaiser nicht einmal versucht hatte, in den türkischen Teil des Landes vorzudringen. Führende Magnaten strebten sodann nach einer Wiedervereinigung ihres Landes im Bund mit Versailles oder der Hohen Pforte, nicht unter der Patronage des »fremden« Kaisers. 11 Die Aufdeckung der Magnatenverschwörung leitete die »zehn dunklen Jahre« ab 1671 ein, in denen die Opposition mit brutaler Gewalt bekämpft wurde, um Ungarn umfassender in die Monarchie zu integrieren. 12 Die polnischen Königswahlen 1669 und 1673 erweiterten diese anhaltende Krise auf internationale Dimensionen. Die Versuche Ludwigs XIV., einen französischen Kandidaten wählen zu lassen, scheiterten 1669; König wurde Michał Wiśniowiecki. 1673 jedoch setzte sich die »französische Partei« mit Jan III. Sobieski
45
46
I. · Auferstehung und neues Leben 1648–1705
durch, der seine Wahl und die Möglichkeit, Truppen für den Krieg aufzustellen, den eine türkisch-kosakische Allianz 1672 gegen Polen begonnen hatte, französischen Zuschüssen verdankte. 1674 machte Frankreich dann auch weitere Finanzhilfen von der Unterstützung der ungarischen Opposition durch Sobieski abhängig und vermittelte einen Frieden zwischen Polen und der Hohen Pforte, damit beide in Ungarn mitmischen konnten. Mit dem Tod von Ahmet Köprülü, dem als Großwesir ebenbürtigen Sohn Mehmets, scheiterte dieser Plan noch im selben Jahr. Sobieski war ohnehin mehr an einem Waffengang gegen Brandenburg zur Wiedergewinnung des Herzogtums Preußen als an einem Eingreifen in Ungarn interessiert und spielte später eine Schlüsselrolle bei der Befreiung Wiens 1683. 13 Auch ohne große Hilfe von außen führte der Aufstand der ungarischen Kuruzen beinahe zum Verlust von Oberungarn, wo ihr Führer, der Calvinist Emmerich Thököly, sogar zum König ausgerufen wurde. 14 Während die Habsburger in Ungarn weiterhin alle Hände voll zu tun hatten, erwuchs ihnen im Westen eine neue Bedrohung. Das Reich als Ganzes spielte in den Plänen Ludwigs XIV. keine wesentliche Rolle.15 Ende der 1660er Jahre wollte er aber die Rolle als Hüter der deutschen Freiheit ablegen, die Frankreich seit den 1640er Jahren spielte. Die Erfahrungen mit dem Rheinischen Bund hatten seine Geduld überstrapaziert und nach dessen Auflösung im August 1668 kam die neue Aggression seiner Außenpolitik auch gegenüber dem Reich zum Tragen. Bilaterale Abkommen mit einzelnen deutschen Fürsten schienen ihm nun zweckmäßiger als die Mitgliedschaft in einer Liga, die Ludwig zu Frieden und Gesetzestreue zwang. Die ersten Ziele des Königs waren die Spanischen Niederlande und die Niederländische Republik, aber deren unmittelbare Nähe zum Reich machte dessen Verwicklung in den Konflikt unausweichlich. Spanien und die Niederländer ersuchten das Reich um Hilfe gegen Frankreich, während Frankreich wichtige Fürsten als Unterstützer zu gewinnen und andere von einer möglichen Opposition abzuhalten versuchte. Dass Ludwig XIV. nach dem Pyrenäenfrieden auf eine Heirat mit der Infantin Maria Theresia drängte, verstärkte die Befürchtung, er wolle sich Spanien und dessen europäisches und koloniales Reich einverleiben. Zuerst bat er seinen Schwiegervater Philipp IV., ihm die Spanischen Niederlande abzutreten, dann verhandelte er mit den Niederländern über eine Teilung. Als Philipp IV. 1665 starb, berief sich Ludwig auf ein lokales Gesetz aus Brabant (das »Devolutionsgesetz«), das Kinder aus erster Ehe zu bevorzugten Erben erklärte, und erhob Besitzansprüche im Namen seiner Frau, des einzigen überlebenden Kindes aus Philipps erster Ehe. Während England und die Niederlande seit März 1665 Krieg führten und Spanien durch die Feindseligkeiten mit Portugal abgelenkt war, marschierten französische Truppen im Mai 1667 in den Spanischen Niederlanden ein. 16 Diese schnelle Operation und die folgende französische Invasion in der
4. Leopold I. und seine Feinde im Ausland
Franche-Comté im Februar 1668 führten zur Bildung einer Dreierkoalition aus England, der Republik der Vereinigten Niederlande und Schweden, um Ludwig zu bremsen und Vermittlung anzubieten, allerdings unter Androhung militärischer Gewalt, falls er ablehnte. Da Spanien nun mit Portugal Frieden schloss und seine Unabhängigkeit anerkannte, blieb Ludwig nichts übrig, als im Mai 1668 in den Frieden von Aachen einzuwilligen, Franche-Comté, Cambrai, St. Omer und Aire abzutreten und nur bestimmte Festungen im Süden der Spanischen Niederlande zu behalten. Der französische Einmarsch in Lothringen 1670 war eine gewisse Entschädigung für diese Schmach, aber auch Anzeichen für Ludwigs Entschlossenheit, sich durchzusetzen – weil dadurch ein Keil französisch kontrollierter Territorien zwischen der spanischen Franche-Comté und den Spanischen Niederlanden entstand – und die Niederländische Republik zu vernichten, die er hauptsächlich dafür verantwortlich machte, dass es ihm nicht gelungen war, sich die spanischen Ländereien an Frankreichs Nordgrenze zu verschaffen. Die Haltung des Kaisers und der deutschen Fürsten war für die französischen Pläne von entscheidender Bedeutung. Angesichts der Probleme in Ungarn fiel es nicht schwer, die Österreicher zum Verzicht auf eine Unterstützung Spaniens im Krieg von 1668 zu bewegen. Leopolds Erster Minister, Fürst Wenzel von Lobkowicz, handelte mit den Franzosen sogar einen geheimen Teilungsvertrag aus: Wenn Karl II. starb, sollte Leopold den spanischen Thron mit dem amerikanischen Reich und den norditalienischen Territorien erben, die französischen Bourbonen Navarre, die südlichen Niederlande, Franche-Comté, Neapel, Sizilien und die Philippinen. 17 Das Abkommen wurde nie offiziell unterzeichnet und war aufgrund der Langlebigkeit Karls II. sowieso irrelevant, obwohl sogar Madrid es stillschweigend akzeptierte. Wichtiger waren Leopolds ausbleibende Reaktion auf die Besetzung Lothringens 1670/71 sowie seine Neutralität im Hinblick auf den geplanten Angriff auf die Niederlande. Die österreichische Willfährigkeit angesichts der französischen Aggression fand viel Kritik. 18 Leopold und seine Ratgeber trafen jedoch lediglich in einer Zwangslage realistische Entscheidungen. Wie stets musste Leopold mit mehreren Rollen jonglieren: König von Ungarn, Reichsfürst, Kaiser und wichtiges Mitglied der spanisch-österreichischen Habsburgerdynastie. In den 1670er Jahren wollte er vorrangig mit Ungarn fertigwerden und seine österreichischen Territorien festigen. 19 Das Reich zu verteidigen, war problematisch, weil nicht geklärt war, wie die Verteidigung organisiert werden sollte. Dynastische Ansprüche in Spanien wurden nicht akut, solange Karl II. lebte, und hätten ohnehin einen Konflikt mit Frankreich nach sich gezogen, für den Karl die Mittel fehlten. Und nicht zuletzt war es angesichts des verbreiteten Misstrauens gegen die Habsburger im Reich unwahrscheinlich, dass Leopold seine kaiserliche Autorität wirksam zur Geltung bringen konnte, ehe er sich gegen die Türken oder Frankreich durchgesetzt hatte:
47
48
I. · Auferstehung und neues Leben 1648–1705
Die deutschen Fürsten fürchteten einen starken Kaiser, aber das hieß nicht, dass sie einen schwachen begrüßen würden. Im Idealfall sollte er das Reich gegen seine Feinde verteidigen, ohne innenpolitisch übermäßig tätig zu werden. So weit war Leopold noch nicht; die Herausforderungen der kommenden Jahre brachten ihn einer solchen Position jedoch viel näher. Die Haltung der deutschen Fürsten war ebenso komplex. In unzähligen Kombinationen, allesamt abhängig von ständig wechselnden regionalen Sicherheitsund dynastischen Interessen, schlossen die deutschen Territorien Allianzen, die ihnen scheinbare Sicherheiten boten, zumindest finanziell in Form von Subsidien. Die einzelnen Gruppierungen sind schwer auszumachen, weil sich die Politik laufend den Ereignissen anpasste und oft auf mehrere Verbündete gleichzeitig setzte, um auf Nummer sicher zu gehen, in unterschiedlicher Offenheit und selbst, wenn die Optionen einander widerstrebten. In Bayern setzte sich eine von Hofmarschall Hermann Egon zu Fürstenberg-Heiligenberg organisierte französische Fraktion durch, die heimlich die Heirat der Tochter des Kurfürsten mit dem Dauphin sowie, im Fall von Leopolds Tod, die Wahl Ludwigs XIV. zum Kaiser des Heiligen Römischen Reichs und von Kurfürst Ferdinand Maria zum Römischen König in die Wege leitete. Fürstenbergs Bruder, der Kölner Domprobst Franz Egon, gewährleistete offensive Allianzen des Wittelsbacher Kurfürsten Max Heinrich und des auf territoriale Zugewinne auf Kosten der Niederlande sowie auswärtige Subsidien für seinen Kampf gegen die Stadt Münster begierigen münsterischen Bischofs Christoph Bernhard mit Frankreich. 20 Pfalz-Neuburg, Württemberg, Hannover und Osnabrück verpflichteten sich in unterschiedlichem Maß zur Neutralität oder stillschweigenden Unterstützung Frankreichs. Erzkanzler Schönborn suchte mit diversen anderen Fürsten, die im Kriegsfall eine französische Invasion befürchteten, eine Allianz zu gründen, die neutral bleiben und überdies Frieden vermitteln sollte. Schönborns erster Anlauf zu einer solchen Union im Jahr 1670 zielte darauf ab, den Herzog von Lothringen wiedereinzusetzen und seine Armee zum Kern einer neuen Rheinlandallianz zu machen. Dieser Plan schloss Leopold nicht als Kaiser, sondern als König von Böhmen und Herrscher der Erblande ein (dementsprechend mit doppeltem Stimmrecht). Führen sollte die Liga der Mainzer Kurfürst von Frankfurt aus, Leopolds Rolle wäre weitgehend auf die Abwehr der Türken beschränkt gewesen. 21 Der Plan wurde von dem jungen Leibniz, der von 1668 bis 1676 dem Mainzer Kurfürsten diente, elegant niedergelegt, war jedoch nicht umsetzbar. Alles, was Leibniz seinen Auftraggebern 1672 anbieten konnte, war sein Concilium Aegyptiacum: der Vorschlag, das Reich zu verschonen und den europäischen Frieden zu wahren, indem Ludwig XIV. seine Aggression auf die Eroberung Ägyptens richtete. 22 Brandenburgs Ansatz war realistischer. 1670 hatte der Große Kurfürst zugesagt, Ludwig XIV. in der Frage der spanischen Erbfolge beizustehen. 1672 erhielt er
4. Leopold I. und seine Feinde im Ausland
niederländische Subsidien für die Verpflichtung, die Niederlande gegen jegliche Aggression zu verteidigen. Die preußische Hagiografie pries diese Zusage als Beleg für Friedrich Wilhelms selbstlosen Einsatz für die protestantische Sache und die deutsche Freiheit, allerdings flankierten materielle und politische Kalkulationen die calvinistische und familiäre Solidarität mit der Heimat seines Urgroßvaters Wilhelm von Oranien und seiner verstorbenen ersten Frau Luise Henriette von Oranien. 23 Die Subsidien kamen dem Herrscher, der stets knapp bei Kasse war, sehr gelegen. Ein französischer Sieg über die Niederlande mochte die deutsche Freiheit bedrohen, gefährdete aber auch seine eigene Freiheit und seine kaum geschützten Territorien in Jülich und Kleve am Niederrhein. Französische Intrigen mit seinem Rivalen Pfalz-Neuburg bei der polnischen Wahl 1669 hatten ihm klargemacht, welche Gefahr ein französischer Triumph für Brandenburgs Gebiete in Preußen darstellte. Zudem war eine Allianz mit den Niederlanden eine möglicherweise nützliche Versicherung gegen Schweden. Wie pragmatisch der Große Kurfürst dachte, unterstreicht die Tatsache, dass er sich schon 1673 der französischen Forderung fügte, die Unterstützung der Niederlande aufzugeben (Friede von Vossem). Ein Jahr später folgte die nächste Wende: ein Bündnis mit Wien zugunsten der Niederlande, obgleich die brandenburgischen Truppen tatsächlich nach Südwestdeutschland entsandt und bald zurückbeordert wurden, um Brandenburg selbst 1675 gegen schwedische Angriffe zu verteidigen. Der lang erwartete französische Überfall auf die Niederlande im Frühjahr 1672 schien reibungslos zu verlaufen. 24 Die Angreifer kamen schnell voran, die niederländische Führung war sofort zu Friedensgesprächen bereit. Die allgemeine Unzufriedenheit mit derartigem Defätismus mündete indes in einen Aufstand gegen die Regierung des Ratspensionärs Johan de Witt; Wilhelm III. von Oranien wurde zunächst als Generalkapitän und Admiral, dann als Statthalter der Republik eingesetzt. 25 Die Rückkehr des Hauses Oranien an die Macht verstärkte den Widerstand gegen Frankreich und sorgte für Hilfe aus dem Ausland. Binnen eines Jahres wechselten mehr oder weniger alle deutschen Verbündeten des französischen Königs die Seiten und schlossen sich England, Spanien und Österreich in einer Koalition gegen Frankreich an. Der neue Bund durchkreuzte Ludwigs Pläne, aber deutschen Truppen gelang es im Januar 1675 nicht, ins Elsass vorzudringen. Zugute kamen Frankreich außerdem Rebellionen, in die wichtige Partner verwickelt waren: Spanien und Teile der niederländischen Flotte in Sizilien, Österreich in Ungarn; ein von Frankreich angeregter schwedischer Angriff auf Brandenburg 1675 tat ein Übriges. So gelang es den Franzosen, ihre anfänglichen Gebietsgewinne zu behaupten und sogar noch zu erweitern. Ludwig XIV. ging als Sieger in die Friedensverhandlungen und diktierte viele der Bedingungen. Wie erwartet, hatte Frankreich zu Beginn des Krieges 1672 die Neutralität des Reichs verletzt, indem es Lüttich als Einmarschroute nutzte. 1674 begannen fran-
49
50
I. · Auferstehung und neues Leben 1648–1705
zösische Truppen zu allem Überfluss das südliche Rheinland systematisch zu verwüsten, um den deutschen Beistand für die Niederlande zu untergraben. Mit einer Flut von Pamphleten blühte die antifranzösische Propaganda neu auf, Forderungen nach einem Vorgehen gegen den Aggressor wurden laut. 26 Aus Leopold Sicht freilich war die ganze Angelegenheit mit Schwierigkeiten befrachtet. Einen Krieg mit Frankreich wollte er vermeiden, um genügend Kräfte für Ungarn zur Verfügung zu haben. Andererseits konnte er es sich politisch nicht erlauben, einem oder mehreren deutschen Fürsten das Kommando für einen Feldzug des Reichs gegen Frankreich zu überlassen. 1670 bis 1672 verstärkte sich der Ruf von Schönborn und anderen nach kaiserlicher Führung: Die im August 1671 gegründete Marienburger Allianz etwa umfasste den Kaiser, die Kurfürsten von Mainz und Trier und den Bischof von Münster. Die praktische und militärische Bedeutung dieses Verteidigungsbündnisses war minimal, aber dass Schönborn Leopold als Leiter akzeptierte, zeigte dessen schrittweise erfolgenden Wiederaufstieg als Führungsfigur. Die kurzlebige Braunschweiger Union von Leopold mit Brandenburg, Dänemark, Braunschweig-Celle, Braunschweig-Wolfenbüttel und Hessen-Kassel setzte im September 1672 ein weiteres Zeichen der Solidarität, war jedoch militärisch ebenfalls von geringer Bedeutung. Für einige Zeit hielten die Österreicher an ihrer Strategie fest, die Konfrontation mit Frankreich zu meiden. Als sich im Mai 1672 12.000 brandenburgische Soldaten am Niederrhein sammelten und in das für die Franzosen strategisch immens wichtige Köln einrückten, unterschrieb Leopold eine Militärkonvention mit dem Kurfürsten. 27 Montecuccoli wurde mit 15.000 Mann und dem Befehl, ausschließlich defensiv vorzugehen, zur Führung des gemeinsamen Heeres entsandt, während Leopolds Berater Wenzel Lobkowicz Ludwig XIV. versicherte, es gebe keinerlei Anlass zur Sorge. Im Jahr darauf war solche Passivität nicht mehr haltbar, da die Franzosen erneut den Niederrhein unter ihre Kontrolle brachten. Brandenburg schloss Frieden mit Frankreich, um seine dortigen Territorien von den Invasoren zurückzuerhalten, während Wien eine offensivere Haltung einnahm. Leopold schmiedete einen neuen Bund mit Spanien, den Niederlanden und dem abgesetzten Herzog von Lothringen, dem sich Dänemark, die Pfalz und die Herzöge von Braunschweig-Lüneburg anschlossen und der untermauert wurde, als das englische Parlament Karl II. zwang, seine Allianz mit Frankreich aufzukündigen und im Februar 1674 mit den Niederlanden Frieden zu schließen. Inzwischen hatte sich die enorm verstärkte Reichsarmee mit spanisch-niederländischen Truppen unter Wilhelm III. vereint und die Kontrolle über den Niederrhein wiedererlangt. Frankreichs wichtigster regionaler Verbündeter, der Kölner Erste Minister Wilhelm Egon von Fürstenberg, wurde entführt, die in Köln tagende Friedenskonferenz war damit ge-
4. Leopold I. und seine Feinde im Ausland
platzt. Ein Mordanschlag auf den Bischof von Münster schlug fehl, aber Köln und Münster waren nun gezwungen, ihren Bund mit Frankreich aufzulösen. Die Pattsituation am Niederrhein ermutigte Ludwig nur, seine Truppen weiter nach Süden zu dirigieren und 1674 Trier und die Pfalz anzugreifen. Es gab keine förmliche Kriegserklärung, aber einen breiten Konsens, dass das Reich verteidigt werden musste. Auf Ersuchen des Reichstags erklärte Leopold, Frankreich habe sich zum Feind des Reichs gemacht, bat um Beistand und untersagte jede Unterstützung des Gegners. 28 Der französische Botschafter wurde des Reichstags verwiesen und so gut wie alle Reichsstände schlossen sich nun der gemeinsamen Sache an. Brandenburg kündigte eilends den im Vorjahr mit Frankreich geschlossenen Frieden von Vossem auf, der dem Kurfürsten ausdrücklich untersagt hatte, seine Pflichten gegenüber dem Reich zu erfüllen. Der Große Kurfürst wollte nicht von Kaiser und Reich isoliert oder gar in Gegnerschaft dastehen. 29 Zudem motivierte ihn die Ausdehnung der französischen Macht über Europa und die mögliche Bedrohung brandenburgischer Interessen durch die Wahl des französischen Kandidaten Jan Sobieski auf den polnischen Thron 1673. Im Januar 1675 eröffnete sich eine neue Front im Norden, als Frankreich Schweden überredete, Brandenburg anzugreifen. Die Schweden wurden im Juni 1675 bei Fehrbellin entscheidend geschlagen, aber die Feindseligkeiten in der Region hielten bis 1678 an, da Brandenburg sich den Bemühungen von Dänemark, Münster und den Braunschweiger Herzögen anschloss, die Schweden von ihren deutschen Besitzungen zu vertreiben. 30 Die Entscheidung, das Reich gegen einen Angreifer zu verteidigen, anstatt ihm offensiv den Krieg zu erklären, war kein Detail, sondern von weitreichender politischer Bedeutung. Zum einen blieb die Frage umstritten, wer das Recht auf eine Kriegserklärung und zum Beschluss von Friedensbedingungen hatte. Der Westfälische Friede erlaubte allen Reichsständen, an der Formulierung und Ratifikation von Friedensverträgen teilzunehmen, sofern das Reich als Ganzes Krieg führte. 31 Ab den 1630er Jahren hatten die Kurfürsten ihr traditionelles Recht, in Fragen von Krieg und Frieden konsultiert zu werden, mit dem Anspruch auf den Status von Königen und Zulassung zu internationalen Friedenskonferenzen verknüpft. Ab den 1640er Jahren stellten die Fürsten allgemein die Exklusivrechte der Kurfürsten infrage und einige, die über Armeen verfügten, erhoben dieselben Forderungen wie die Kurfürsten. Durch die Vermeidung einer Kriegserklärung ging Leopold diesem umstrittenen Problem aus dem Weg. Als dann der Reichstag 1675/76 erwog, das Angebot Ludwigs XIV. anzunehmen, eine Delegation zu den Friedensgesprächen in Nimwegen zu entsenden, schritt Leopold sofort ein. 32 Damit machte er sein alleiniges Recht geltend, im Namen des Reichs zu verhandeln, und schuf einen Präzedenzfall, der bis 1806 gültig blieb. Bedenklicher für die unmittelbare Verteidigung des Reichs war die Uneinigkeit
51
52
I. · Auferstehung und neues Leben 1648–1705
in der Frage, wie diese zu organisieren sei – die vielleicht wichtigste aller negotia remissa von 1648. 33 Da es zu keiner Einigung auf eine Verteidigungsreform gekommen war, konnte der Reichstag lediglich in traditioneller Manier die Kräfte der Reichskreise mobilisieren. In den Kreisen nahe der Front funktionierte das einigermaßen, da sie überwiegend aus kleinen, wehrlosen Gebieten bestanden. Folgerichtig waren Schwaben und Franken, die gefährdetsten der sogenannten Vorderen Kreise, sofort bereit, ihren Beitrag an Truppenkontingenten zu leisten. In Kreisen, wo einer oder mehrere »armierte Fürsten« ansässig waren, klappte das nicht so gut, anfänglich, weil einige dieser Prinzen mit Frankreich sympathisierten, dann weil sie es vorzogen, ihre Truppen als Söldner für dringend benötigtes Geld abzustellen, nicht als reguläre Kreiskontingente. Einige argumentierten gar, diese Kontingente sollten insgesamt abgeschafft und als offizielle Reichsarmee durch ihre Söldnertruppen ersetzt werden. Befreit von der Pflicht, selbst Truppen aufzustellen, würden die unbewaffneten Territorien dann für die Soldaten ihrer bewaffneten Nachbarn bezahlen. Die Kreise musterten 1675, 1676 und 1677 jeweils zwischen 15.000 und 20.000 Mann, die Gesamtzahl der von den acht großen armierten Fürsten im selben Zeitraum ausgehobenen Soldaten belief sich indes auf 50.000 bis 60.000. Ihre Kosten waren zudem nicht ausreichend durch Subsidien gedeckt, selbst dort, wo die Zahlung nicht verspätet erfolgte. Der wesentlich größere Beitrag der armierten Fürsten und ihr unermesslich höherer Aufwand führten zu Klagen über eine ungerechte Verteilung der Verteidigungslasten und zu Forderungen nach Quartieren und Spenden von ihren Nachbarn. Da er dringend Truppen brauchte, musste Leopold das Vorgehen der armierten Fürsten dulden. Die Initiative konnte er nur behalten, indem er sein Recht ausübte, Unterkünfte zuzuweisen und in zwischenterritorialen Disputen zu vermitteln. Begrenzt war sein Handlungsspielraum allemal. Es kam nicht zu der Form von Anarchie, die während des Dreißigjährigen Krieges geherrscht hatte, Streitigkeiten wegen des unbarmherzigen Verhaltens einiger anmaßender Fürsten ließen sich jedoch nicht vermeiden. Im Norden wetteiferten Celle, Wolfenbüttel, Münster und Braunschweig um die Vorherrschaft und nutzten Quartiere als Mittel zur Stärkung ihres regionalen Einflusses, wobei jeder hoffte, ein Stück von Schwedens deutschen Besitzungen zu ergattern. Vor allem in Mitteldeutschland setzte eine wachsende Anzahl mittelgroßer Territorien auch auf die Entwicklung ihrer eigenen Streitkräfte, um den Zumutungen von Kontingenten und Quartieren zu entgehen. All das belastete die kleineren Territorien in Schwaben und Franken zunehmend. Angehörige beider Kreise sahen sich mit einer Neuauflage der Beiträge konfrontiert, die sie im Dreißigjährigen Krieg bezahlt hatten. Die Kriegskosten des schwäbischen Kreises beliefen sich auf 21 Millionen Gulden, davon allein 8 Millionen für
4. Leopold I. und seine Feinde im Ausland
Quartiere. Der Unterhalt des Kreiskontingents von 3.000 Mann kostete hingegen lediglich 500.000 Gulden pro Jahr. 34 Darüber hinaus entstand ab 1675 ein neues, enorm kostspieliges Verteidigungssystem östlich des Rheins: die sogenannten Linien – Feldbefestigungen, die Flussübergangspunkte und Schwarzwaldpässe blockieren sollten. 35 Ihre ausgefeilte Form erhielten die Linien ab 1690 mit Aussichtsposten, Gräben, Dämmen und so weiter; manche erstreckten sich über 90 Kilometer. Schon die Konstruktion der ersten Versionen in den 1670er Jahren erforderte einen ungeheuren Aufwand an Material und Arbeitskräften sowie erkleckliche Milizen als Besatzung. Kein Wunder, dass sich die schwäbischen und fränkischen Kreise 1667 aus dem Konflikt zurückzogen und einseitig ihre Neutralität erklärten. Es war eine günstige Fügung, dass die größere antifranzösische Koalition zu ermüden begann, als die deutschen Verteidigungsbemühungen nachließen. Der Friede von Nimwegen, ein Komplex von neun Verträgen, die den Krieg 1678/79 beendeten, brachte jedoch nur eine kurze Ruhepause. Dass Ludwig XIV. separate Friedensabkommen mit all seinen Gegnern abschließen konnte, unterstrich das Ausmaß seiner militärischen Erfolge und seine unumstrittene Stellung als Gebieter von Europa. 36 Frankreich behielt die Festungen im Süden der Spanischen Niederlande und Franche-Comté. Was das Reich betraf, wurden die Verträge von 1648 bekräftigt, unter dem Vorbehalt, dass Frankreich als Gegenleistung für die Aufgabe der Festung Philippsburg von Brandenburg Freiburg und Breisach erhielt. Leopold musste seine eigenen Truppen unverzüglich nach Österreich zurückziehen. Dem Herzog von Lothringen bot man die Wiederherstellung seiner Territorien an, aber unter derart demütigenden Auflagen, dass er ablehnte, und so blieben sie bis zum Frieden von Rijswijk 1697 in französischer Hand. Obwohl das Ergebnis für Frankreich positiv ausfiel, blieb Ludwig unzufrieden und machte sich nunmehr an die vollständige Unterwerfung des Elsass. 37 In Metz, Besançon, Breisach und Tournai wurden spezielle Kollegien gegründet, die Chambres de Réunion, die die Territorien, die Frankreich im Norden und Osten des Landes 1648 und 1678/79 gewonnen hatte, mit anderen, die früher von ihnen abhängig waren, »wiedervereinigen« sollten. Die legale Grundlage dieses Vorgehens war oft höchst dubios – aber wohl nicht mehr als die Abtretung einer »Landgrafschaft Ober- und Niederelsass« (die als solche nie existiert hatte) von Brandenburg an Frankreich 1648 und die Versuche diverser deutscher Fürsten, die Autonomie von Städten in ihren Territorien zu »reduzieren«. Alte säkulare und kirchliche Rechtsakte in Territorialrechte zu transformieren, war gängige Praxis vieler aufstrebender frühmoderner Regierungen. Das effektive Ergebnis der Reunionen waren die Annexion der nicht bereits unter französischer Herrschaft stehenden Teile des Elsass und einige signifikante Übergriffe auf Gebiete deutscher Fürsten westlich des Rheins. Den Höhepunkt bildete die Reduktion, das heißt im Grunde An-
53
54
I. · Auferstehung und neues Leben 1648–1705
nexion der Reichsstadt Straßburg im September 1681, die französischen Aneignungen setzten sich jedoch bis zur Eroberung von Luxemburg 1684 fort. Wirksamen deutschen Widerstand dagegen verhinderten andere Bedingungen des Friedens. Die Befriedung des nördlichen Reichs hinterließ Unzufriedenheit, weil Frankreich durchsetzte, dass Münster, Brandenburg, die Herzöge von Braunschweig und Dänemark den Schweden sämtliche Territorien zurückgeben mussten. Besonders wütend zeigte sich der Münsteraner Fürstbischof Christoph Bernhard von Galen. Nach seiner Wahl 1650 ging er daran, der Stadt seinen Willen aufzuzwingen, und vertrieb die verbliebenen Besatzungstruppen von seinem Territorium. Ihm war jedes Mittel recht: 1665 schloss er eine Allianz mit England, 1667 unterstützte er Frankreichs Angriff auf die Niederlande in der Hoffnung, seinem Land Zugang zur Nordseeküste zu verschaffen. Da er für den Türkenkrieg 1663 und 1664 Truppen abstellte, selbst als Militärführer (Reichskriegsdirektor) erfolgreich war und 1675 dem Kaiser im Elsass gegen die Franzosen beistand, durfte er generell auf Wohlwollen aus Wien zählen. Die Brutalität seiner regionalen Aktivitäten mit einer Armee von bis zu 20.000 Mann brachte ihm jedoch die Spitznamen »Kanonenbischof« und »Bommen Berend« (»Bomben-Bernhard«) ein. Für viele Untertanen und Nachbarn endete mit seinem Tod 1678 ein übles Terrorregime. 38 Die anderen Fürsten des Nordens hatten sich dem Kaiser entfremdet und warfen ihm vor, ihre Interessen nicht vertreten zu haben. Vor allem Dänemark grollte wegen der internationalen Garantie der Rechte von Schleswig-Holstein-Gottorp. Brandenburg hatte im Krieg eine wichtige Rolle gespielt, gewann jedoch nur einen schmalen Streifen Land am Ostufer der Oder und die schwedische Hälfte der Zolleinkünfte aus Ostpommern. Leopold weigerte sich, den Großen Kurfürsten für seine Dienste zu belohnen, nicht einmal durch die Zuerkennung irgendeines der vor 1648 von den Habsburgern erworbenen schlesischen Territorien oder die von Brandenburg beanspruchte Thronfolge in Ostfriesland. Kein Wunder, dass sich Brandenburg prompt wieder nach Frankreich ausrichtete und damit zeitweise eine allgemeine Umorientierung einleitete. Die Pfalz und Sachsen, dann auch Bayern, versprachen 1679–1680, Ludwig zum nächsten Kaiser zu wählen. In Straßburg folgte auf den profranzösischen Erzbischof Franz Egon von Fürstenberg 1682 sein ebenso frankreichfreundlicher Bruder Wilhelm Egon, was die Durchsetzung der französischen Politik im Elsass beträchtlich erleichterte. 39 Obwohl alle sieben nichthabsburgischen Kurfürsten sich 1679 entweder aus Unzufriedenheit oder im Fall der Kurbischöfe aus Furcht vor der französischen Militärmacht nach Frankreich wandten, erlangte Leopold binnen Kurzem eine stärkere Position im Reich als je zuvor. Bis 1682 konstruierte er ein neues System prokaiserlicher Bündnisse und schaffte den Durchbruch in der Reform der Reichsverteidigung. Seine sture Weigerung, die französischen Reunionen zu billigen, hinterließ einen günstigen Eindruck im Reichstag, der zum wichtigen Forum für die
4. Leopold I. und seine Feinde im Ausland
öffentliche Meinung im Reich geworden war. 1680 verstärkte Leopold die durch seine Heirat mit der Tochter von Philipp Wilhelm von Pfalz-Neuburg 1676 geknüpfte Verbindung zu den Wittelsbachern, indem er der Heirat seiner Tochter aus erster Ehe mit dem neuen bayerischen Kurfürsten Max II. Emanuel (1679– 1726) zustimmte. Dass die junge Braut von ihrer verstorbenen Mutter einen Anspruch auf den spanischen Thron geerbt hatte, machte diese Ehe zu einem besonders verlockenden Argument für Bayern, seine Loyalität von Paris wieder nach Wien zu verlagern. Die Thronbesteigung neuer, prokaiserlicher Herrscher in Hannover und Sachsen 1680 war für Leopold ebenfalls günstig.40 Von entscheidender Bedeutung waren auch die Bande, die Leopold mit den niederen Ständen knüpfte, dem im Westen und Südwesten konzentrierten Netzwerk minderer Herrscher, die durch französische Angriffe ebenso gefährdet waren wie durch die aggressiven und expansiven Tendenzen der armierten Fürsten. Der Schlüssel war in diesem Fall die Gründung der Frankfurter Allianz von zehn Herrschern kleiner Territorien, deren Länder von Frankreich beziehungsweise dem Bischof von Münster angegriffen worden waren. 41 Die Union fasste die Schaffung einer zentralen Streitmacht unter dem Kommando von Waldeck ins Auge und erwies sich als so attraktiv, dass sich andere anschlossen, zuerst Protestanten, dann auch Katholiken, und Waldeck 1681 vorschlug, sie auf das ganze Reich zu erweitern. Vor dem Hintergrund der anhaltenden Krise durch die Reunionen und deutscher Agitation dagegen führten Waldecks Aktivitäten zu zwei erfolgreichen Reichsinitiativen. Die erste war ein neuer Anlauf zu einer Reform der Reichsverteidigung im Reichstag. 42 Die Diskussion war festgefahren, es gab drei einander widersprechende Ansichten. Das monarchische Lager befürwortete eine stehende Reichsarmee, finanziert von den Ständen und unter Führung des Kaisers. Die armierten Fürsten wollten ihre eigenen Heere nicht auflösen. Sie bevorzugten die Ad-hoc-Aufstellung einer Reichsarmee als Reaktion auf spezifische Krisen, zusammengesetzt aus den Streitkräften der bewaffneten Fürsten, bezahlt von den unbewaffneten. Der dritte Weg, den die unbewaffneten Fürsten favorisierten, war eine Reichsarmee aus Kontingenten aller Stände. Anfang 1681 legte Leopold Vorschläge vor, die seinen ursprünglichen Ansatz über Bord warfen, die armierten Fürsten überflügelten und eine modifizierte Version der dritten Lösung einschlossen. Eine Armee aus Kontingenten aller Stände hätte eine gründliche Revision der Reichsmatrikel von 1521 erfordert, um den gegenwärtigen Größen und Ressourcen der Stände Rechnung zu tragen. Da hierfür Verhandlungen mit jedem einzelnen Stand nötig gewesen wären, war eine solche Revision undenkbar. Stattdessen schlug Leopold vor, die Kontingente auf die Kreise zu übertragen und sie entscheiden zu lassen, welchen Anteil ihre jeweiligen Angehörigen zu leisten hätten.
55
56
I. · Auferstehung und neues Leben 1648–1705
Nach sechzehn Monaten Verhandlungen und obwohl sich Brandenburg nach Kräften gegen eine Einigung sträubte, fand man zu einem Kompromiss. Die Grundstärke der Armee sollte 40.000 Mann betragen; dieses Simplum konnte, wenn nötig, verdoppelt (Duplum) oder verdreifacht (Triplum) werden. Die Gesamtanzahl der Soldaten wurde auf die zehn Kreise und von diesen auf ihre Mitglieder verteilt, nach der Reichsmatrikel von 1521, vorbehaltlich einer Revision. Man beschloss, dass Territorien auf Wunsch anstelle von Soldaten Geldzahlungen (Reluitionen) leisten konnten. Zentral wie auf Kreisebene wurden Behörden eingerichtet, um die laufende Finanzierung der Armee nach ihrer Aufstellung zu organisieren. Man war sich einig, dass die Armee unter dem Gesamtbefehl des Kaisers stehen sollte, die Frage der Ernennung von Generalen blieb jedoch offen. Zu guter Letzt wurde die Steuerpflicht territorialer Untertanen zur Finanzierung der Streitkräfte bekräftigt, wie bereits in § 180 des Jüngsten Reichsabschieds von 1653 festgelegt. Das so entstandene System der Reichsverteidigung ist oft kritisiert worden. Das Reich verfügte nicht über eine stehende Armee und die geplante Streitmacht war, selbst verdoppelt oder verdreifacht, mühselig zu mobilisieren und für kompliziertere Aufgaben ungeeignet. Zudem waren größere Fürsten, die oft Territorien in mehr als einem Kreis besaßen und deshalb verpflichtet gewesen wären, mehrere Kontingente abzustellen, geneigt, das System insgesamt zu ignorieren. Sie zogen es weiterhin vor, mit dem Kaiser bilaterale Abkommen über die Entsendung ihrer Truppen als eigene, direkt aus dem Staatssäckel bezahlte Streitmacht zu schließen. Den von niederen Ständen dominierten Kreisen Schwaben und Franken bot das neue System keine ausreichende Sicherheit, und so waren sie stets darauf angewiesen, zusätzliche Mittel zu ihrer Verteidigung zu mobilisieren. Das Fehlen einer Regelung für Generale vermied kurzfristig Streitereien zwischen dem Kaiser und den Reichsständen, wirkte aber tatsächlich zugunsten des Kaisers. Ihm fiel automatisch das Recht zu, Reichsgenerale und Feldmarschalle zu ernennen, wobei er, um den Vorwurf der Parteilichkeit zu vermeiden, die konfessionelle Parität beachten musste, weshalb Reichsarmeen stets von zwei Generalen kommandiert wurden, einem katholischen und einem protestantischen. 43 Die militärischen Schwächen des Systems sollten sich zeigen, als französische Armeen das Reich 1688/89 erneut angriffen. 1681/82 indes war die Reform von immenser politischer Bedeutung. Dass sie überhaupt zustande kam, bezeugte die neue Qualität der Kommunikation zwischen Kaiser und Reichstag. Unterstrichen wurde dies, als Leopold 1681/82 Reichstagsmitglieder zu den Frankfurter Verhandlungen mit den Franzosen über die Reunionenkrise einlud. 44 Der Versuch scheiterte, aber die Stände würdigten es, dass sie die Möglichkeit bekommen hatten, an internationalen Gesprächen über Reichsinteressen teilzunehmen, wie dies die Verträge von 1648 vorsahen. Der Kompromiss in Sachen Armee ebnete auch den Weg für eine neue Reichs-
4. Leopold I. und seine Feinde im Ausland
allianz. Im Juni 1682 einigte sich Georg von Waldeck mit Leopold auf die Laxenburger Allianz. 45 Leopold wurde zum Oberhaupt einer Union aller Stände des Oberrheinkreises und Frankens ernannt, die sich bis dahin Waldecks Frankfurter Allianz angeschlossen hatten. Der Bund sollte der Verteidigung des Reichs gegen französische Aggression dienen und bis zu einem akzeptablen Friedensschluss mit Frankreich in Kraft bleiben. Geplant war eine gemeinsame Armee aus drei Kontingenten zur Verteidigung der Westgrenze des Reichs. Man suchte weitere Mitglieder und fand sie bald in Sachsen, Hannover, Bayern, Sachsen-Gotha und Sachsen-Eisenach. Eine internationale Dimension erhielt das Bündnis durch die Einbettung in die niederländisch-schwedische Allianz von 1681. Die familiären Verbindungen von Wilhelm III. von Oranien mit dem Wetterauer Grafenverein (zu dem Waldeck zählte) waren anfangs hilfreich, um die unterschiedlichen Elemente der neuen Vereinbarungen auf einen Nenner zu bringen. Mit ihrem Fortschreiten übernahm Leopold zunehmend die Führungsrolle. Der Kaiser war zum Reich zurückgekehrt. Indes zerschlug eine neue Krise im Osten jede Hoffnung auf eine entschlossene Gegenoffensive gegen Frankreich. Einige Fürsten, etwa Max Emanuel von Bayern, forderten lautstark ein militärisches Vorgehen. Im September 1684 blieb Leopold jedoch keine andere Wahl, als den Frieden von Regensburg zu schließen, der die Réunions Ludwigs XIV., die Reduktion von Straßburg und die Besetzung Luxemburgs für zwanzig Jahre anerkannte.
Anmerkungen 1 Hochedlinger, Wars, 112 f. 2 Neumann, »Developments«, 48 ff.; Shaw, Ottoman Empire I, 188–215; Goffman, Ottoman Empire, 213–222; Duchhardt, Altes Reich, 67–72. 3 Der letzte venezianische Außenposten, Spinalonga, fiel erst 1718, der größte Teil der Insel war jedoch nach der erfolgreichen einundzwanzigjährigen Belagerung von Candia (Iraklio) 1669 in türkischer Hand. 4 Wilson, German Armies, 40. 5 Wrede, Reich, 72–110. 6 Aretin, Altes Reich I, 214; vgl. auch S. 72–75. 7 Die verlässlichsten Zahlen liefert Wilson, German Armies, 40–43. 8 Duchhardt, Altes Reich, 69. 9 Wagner, Türkenjahr, 439–442. 10 Wrede, Reich, 126 f. 11 Ebd., 127. 12 Ingrao, Monarchy, 67–71; Spielman, Leopold I, 61–73. 13 Stone, Polish-Lithuanian State, 237 f. 14 Evans, Making, 263 f. 15 Duchhardt, Altes Reich, 16 ff., 53–62.
57
58
I. · Auferstehung und neues Leben 1648–1705
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45
Vgl. für das Folgende Lynn, Wars, 105–159; McKay und Scott, Rise, 23–33. Spielman, Leopold I, 56. Duchhhardt, Altes Reich, 53–62; Burkhardt, Vollendung, 98–105. Spielman, Leopold I, 60–73. Vgl. S. 54, 272, 347. Wilson, German Armies, 174; Press, Kriege, 415 ff. Wrede, Reich, 337. Duchhardt, »Friedrich Wilhelm«, 97, 104–107. McKay und Scott, Rise, 28–31. Israel, Dutch Republic, 791–802. Wrede, Feinde, 330 ff. Wilson, German Armies, 46. Burkhardt, »Verfassungsprofil«, 172. Aretin, Altes Reich I, 248, 253 f. Duchhardt, Altes Reich, 19. Ebd., 7 f. Wilson, German Armies, 47; Duchhardt, Altes Reich, 19; Gotthard, Säulen II, 750–799. Vgl. für das Folgende und Hinweise auf die relevante deutschsprachige Literatur Wilson, German Armies, 47–57. Wilsons Studie ist die einzige detaillierte überhaupt. Wilson, German Armies, 51. Ebd., 55 f. Aretin, Altes Reich I, 265–271. Duchhardt, Altes Reich, 20; Lynn, Wars, 161–171. Lahrkamp, Krummstab, 20–29, 35 f.; Wilson, German Armies, 29; vgl. auch S. 48, 272, 347. Press, »Fürstenberg«, 147 ff. Ernst August (1679–1698) von Hannover war ab 1662 Fürstbischof von Osnabrück, 1692 wurde er zum Kurfürsten erhoben. In Dresden war der Thronfolger Johann Georg III. (1680–1691). Menk, Waldeck, 65 ff. Schindling, Anfänge, 208–215; Papke, Miliz, 241–3, 241–243. Vgl. Neuhaus, »Problem«. Schindling, Anfänge, 200–208; Aretin, Altes Reich I, 286–294; Plassmann, Krieg, 32–38. Wilson, German Armies, 180 f.; Aretin, Altes Reich I, 298–302; Schindling, Anfänge, 216 f.; Papke, Miliz, 248.
5. Die neue türkische Bedrohung
I
m Juli 1683 waren die Türken ins Reich vorgedrungen und belagerten zum ersten Mal seit 1529 Wien. 1 Unmittelbar bedroht waren diesmal offenbar auch Prag, Dresden und München. In diesem Angriff auf Leopolds Hauptstadt gipfelte eine Krise im Osten, die seit einigen Jahren am Köcheln war. Da der Friede von Eisenburg 1684 auslief, hatte Leopold 1681 über einen Sondergesandten in Istanbul um eine Verlängerung ersucht, was das Osmanische Reich jedoch ablehnte. Die Strategie des Großwesirs Kara Mustafa, des Schwagers von Ahmet Köprülü, stützte sich auf die Thököly-Rebellion in Ungarn, die 1682 ihren Höhepunkt erreichte, und stillschweigende Ermutigung aus Frankreich. Wie bei den Krisen des 16. Jahrhunderts gab es keine formelle französisch-türkische Allianz, aber Frankreich mischte durch die Duldung im Osten und die Ablenkung im Westen durch den Einmarsch in Luxemburg im September 1683 erheblich mit. Österreich hatte die Bedrohung erwartet und 1681 sein Heer auf 60.000 Mann verdoppelt. Ab Januar 1683 wurden zudem diverse andere Streitkräfte mobilisiert. Der Reichstag beschloss ein Triplum, aber die Kreise stellten 1683 lediglich 10.000 Mann ab, viel weniger als ein Simplum. 2 Der Rest der deutschen Streitkräfte von etwa 33.000 Mann bestand aus bayerischen und sächsischen Soldaten, die aufgrund separater bilateraler Abkommen im Namen der Kreise und teilweise als Hilfstruppen ausgehoben wurden, wofür jeder Herrscher bedeutende Konzessionen aushandelte. Auch Brandenburg wurde um Beistand gebeten, forderte jedoch für 12.000 Mann den unverschämten Preis von 600.000 Talern sowie eine Reihe territorialer Zugeständnisse und religiöser Garantien für die ungarischen Calvinisten, was eine Einigung unmöglich machte. 3 Brandenburgs Widerspenstigkeit und Loyalität zu Frankreich veranlasste auch die Braunschweiger Herzöge in Hannover, Celle und Wolfenbüttel zur Passivität. Ein entscheidender Faktor in der wachsenden Krise war, dass der Papst ein Abkommen zwischen Leopold und seinem einstigen Feind Jan III. Sobieski über die Bereitstellung von 40.000 polnischen Soldaten vermittelte. Am 12. September 1683 trafen die österreichischen, deutschen und polnischen Streitkräfte in Wien ein, wo die Verteidigungstruppen auf nur noch etwa 4.000 Mann geschrumpft waren. 4 Das christliche Entsatzheer besiegte die türkische Armee am Kahlenberg, vertrieb sie aus dem Königlichen Ungarn und eroberte die türkisch besetzte Stadt Gran (Esztergom), den einstigen Sitz des katholischen Primas von Ungarn. Zunächst schielte Leopold dann erneut auf einen Waffenstill-
60
I. · Auferstehung und neues Leben 1648–1705
stand. Papst Innozenz XI. war nun jedoch entschlossen, ein für alle Mal mit den Türken fertig zu werden. Mit einem Zuschuss von 1,2 Millionen Gulden trug er wesentlich zur Bildung der Heiligen Liga von Österreich, Polen und Venedig im März 1684 bei. Damit begann eine lange und letztlich erfolgreiche Reihe von Feldzügen von der Eroberung Budas 1686 bis zum Frieden von Karlowitz 1699. 1688 kontrollierte die Liga das gesamte türkische Ungarn und Siebenbürgen; im Oktober 1687 verzichteten die in Pressburg zusammengetretenen ungarisch-kroatischen Stände auf ihr Widerstandsrecht, erkannten die Habsburger als Erbmonarchen Ungarns an und ließen Leopolds Erben Joseph zu ihrem neuen König krönen. 5 Der französische Angriff auf das Rheinland brachte den Krieg im Osten ins Stocken; Wilhelm III. und andere drängten Leopold zum Friedensschluss mit den Türken, um sich den Kämpfen im Westen widmen zu können. 6 In den Jahren 1690–1696 kam es zu einigen schweren Rückschlägen, nicht zuletzt wegen der Unfähigkeit des Heerführers, des jungen Kurfürsten Friedrich August von Sachsen. Dessen Wahl zum polnischen König nach Sobieskis Tod ermöglichte die Ernennung Eugens von Savoyen, dem 1697 und 1698 entscheidende Siege gelangen, die Österreich eine führende Position in den bereits im Oktober 1688 unter englischer und niederländischer Vermittlung begonnenen Friedensgesprächen verschafften. Während Polen und Venedig so gut wie leer ausgingen, konnte Österreich massive Gewinne verbuchen. Der Friede von Karlowitz besiegelte den österreichischen Sieg über die Türken, beendete die türkische Herrschaft in Ungarn und legte erstmals eine dauerhafte Grenze zwischen österreichischem und osmanischem Gebiet fest. Wien war keine Grenzstadt mehr, sondern lag nun inmitten eines gewaltig erweiterten Komplexes habsburgischer Länder. Im 18. Jahrhundert kam es zu weiteren Türkenkriegen – zuletzt 1788–1791 –, aber der Friede von 1699 markierte für beide Seiten das eigentliche Ende der Epoche der Religionskriege und der osmanischen Bestrebungen, das Christentum zu vernichten, die in den 1520er Jahren begonnen hatte und seither nur von begrenzten Waffenruhen unterbrochen worden war. 7 Der Beitrag des Reichs zum Sieg der Habsburger ist schwer einzuschätzen. 8 Die Bedeutung des letzten Türkenkriegs für das Reich ist noch nicht vollständig erfasst. Dies liegt zum Teil an der widersprüchlichen Quellenlage, aber auch an der tief verwurzelten Ansicht vieler deutscher und österreichischer Historiker, das Reich habe keine Rolle gespielt, Österreichs »Staatsbildungskriege« hätten es als Großmacht etabliert und somit aus dem Reich herausgehoben. 9 Ohne Zweifel lag ein großer Teil der zentraleuropäischen Habsburgergebiete außerhalb des Reichs; zwischen 1686 und 1699 wurde die Möglichkeit diskutiert, Ungarn zum Reichsfürstentum zu machen, jedoch ohne Ergebnis. 10 Gleichzeitig entstanden durch die
5. Die neue türkische Bedrohung
Ausdehnung des österreichischen Herrschaftsbereichs neue strategische Probleme, die nichts mit dem Reich zu tun hatten. Andererseits übergeht, wer auch nur grob von den habsburgischen Territorien als »österreichischem Imperium« spricht, die Tatsache, dass der imperiale Titel vom Reich ausging, nicht von den Gebieten der Habsburger. In mancher Hinsicht lässt sich die Situation nach 1699 als Variante der Lage deuten, die seit den ersten Versuchen der Habsburger herrschte, einen Sonderstatus im Reich zu erlangen. Wie die Habsburger, was den Kaisertitel anbelangte, vom Reich abhängig waren, sprechen starke Indizien dafür, dass sie auch auf die Beiträge des Reichs zu den Türkenkriegen angewiesen waren. Die Kämpfe gegen die Türken waren nicht allein eine Sache der Habsburger. 11 Vielmehr handelte es sich um einen Krieg des Reichs, der nicht offiziell erklärt werden musste, weil die Verteidigung des Reichs und des Christentums als immerwährende Pflichten betrachtet wurden, insbesondere in Kombination. Die wichtigsten Befehlshaber waren Deutsche und Reichsfürsten: Markgraf Ludwig Wilhelm von Baden, die Kurfürsten Max Emanuel von Bayern und Friedrich August von Sachsen. Auch Herzog Karl von Lothringen und Prinz Eugen von Savoyen waren Fürsten des Reichs, wenn auch im erweiterten Sinn und nicht qua Teilnahme am Reichstag. Deutsche Truppen spielten stets eine Schlüsselrolle. Dass deutsche Fürsten diese Truppen oft im Rahmen bilateraler Abkommen zur Verfügung stellten, spricht für den Aufstieg der armierten Territorien nach 1648; ihre Vorfahren im 16. Jahrhundert hätten Soldaten aufgrund von Reichstagsbeschlüssen gemäß der Matrikel von 1521 entsandt. Leopold hatte es nun mit einer Reihe von Fürsten mit stehenden Heeren zu tun, die auf Finanzierungsmöglichkeiten aus waren. Für das sächsische Kontingent etwa bezahlte er 1683, indem er den Kurfürsten ermächtigte, die Beiträge der anderen Mitglieder des obersächsischen Kreises einzubehalten. 12 Herzog Ernst August von Hannover gestattete er, 16.000 Taler monatlich von den unbewaffneten Territorien Niedersachsens und 50.000 Taler Erstzahlung von Österreich einzutreiben. Die Kreise Franken und Schwaben entsandten von 1683 bis 1688 jedes Jahr Soldaten, der Kreis Bayern ebenfalls, obwohl der bayerische Kurfürst im Rahmen eines bilateralen Vertrags separat eigene Truppen bereitstellte. 13 Als sich Brandenburg 1686 wieder an die Seite des Reichs stellte, schickte es sofort 8.000 Mann an die ungarische Front und stellte von 1693 bis 1698 ein reguläres Kontingent. Mit der Krise im Westen 1688 endete die reguläre Beteiligung der Kreise Bayern, Franken, Schwaben und Oberrhein an der Ostfront. 14 Ihre Streitkräfte wurden nun dringend zur Verteidigung gegen Frankreich benötigt und blieben bis Kriegsende ununterbrochen im Einsatz. Die Truppen der deutschen Fürsten schrumpften zwischen 1689 und 1691 ebenfalls. Einige überstellten ihre Männer zunehmend direkt an die österreichische Armee, anstatt das finanzielle Risiko selbst zu tragen.
61
62
I. · Auferstehung und neues Leben 1648–1705
Dennoch entsandten die deutschen Fürsten nach 1691 bis zum Ende der Auseinandersetzungen weiterhin 15.000 bis 24.000 Mann pro Jahr. Zusätzlich leistete der Reichstag auch einen finanziellen Beitrag. Über diesen Aspekt des Krieges ist weitaus weniger bekannt. Zumindest 1686 gewährte er eine Summe von 2,76 Millionen Gulden, wovon offenbar zwei Drittel tatsächlich bezahlt wurden. 15 Lokale Studien legen nahe, dass selbst kleine Territorien wie Lippe in Westfalen, das in keiner Weise direkt von den Türken bedroht war, sich in den 1680er Jahren redlich mühten, beträchtliche Geldsummen beizusteuern. 16 Ihre Motivation war zumindest zum Teil die Hoffnung, die gewissenhafte Bezahlung von Reichssteuern werde ihnen Abgaben an benachbarte armierte Territorien ersparen, die schwerwiegende Folgen für ihre Unabhängigkeit nach sich ziehen konnten. Leopolds Unterhändler übten sogar Druck auf die Hansestädte Bremen, Hamburg und Lübeck aus, ihren Anteil zu leisten. 17 Die Erfolge des Kaisers untermauerten die neue Bindung zwischen ihm und den Reichsständen, die sich nach 1679 entwickelte. Leopold selbst erschien nicht auf dem Schlachtfeld, aber Propagandabilder zeigten ihn dennoch in Triumphpose im Sattel vor wütenden Schlachtszenen. 18 Die meisten deutschen Stände erachteten ihre Kriegsteilnahme als patriotische Pflicht. Die armierten Fürsten führten darüber oft harte Verhandlungen, aber keiner von ihnen schlug tatsächlich Profit aus seinem Engagement. Auch die unbewaffneten Stände suchten nach Wegen der Beteiligung, die ihnen zumindest nicht schadeten. Mochten manche, etwa der Stadtrat von Lübeck, auch jammern, sie könnten überhaupt keine Zahlungen leisten, so stritten doch selbst sie nicht ab, dass sie, soweit dies möglich war, das gemeinsame Anliegen von »Kaiser und Reich« unterstützen mussten. Der Krieg vereinte das Reich.
Anmerkungen 1 2 3 4 5 6 7 8
Hochedlinger, Wars, 153–173; Ingrao, Monarchy, 75–83; Wilson, German Armies, 68–86. Hochedlinger, Wars, 156 f.; Wilson, German Armies, 68 ff. Aretin, Altes Reich I, 303 f. Hochedlinger, Wars, 157–160. Ingrao, Monarchy, 84. Hochedlinger, Wars, 160–164. Wrede, Reich, 185–210. Hüttl, »Beitrag«, insb. 148 ff. und 154–158, bietet eine ausgewogene Einschätzung; vgl. auch Hochedlinger, Wars, 92–95. 9 Klueting, Reich, 76; Duchhardt, Altes Reich, 20 f., 67–70; Hochedlinger, Wars, 7–77; Winkelbauer, Ständefreiheit I, 514 f. 10 Klueting, Reich, 37. 11 Lorenz, Türkenjahr, 312 f.; Goloubeva, Glorification, 143–154. In diesem Sinn auch Schumann, Sonne.
5. Die neue türkische Bedrohung
12 13 14 15 16 17 18
Wilson, German Armies, 70. Hartmann, Reichskreis, 427–432. Wilson, German Armies, 72 f. Lorenz, Türkenjahr, 314. Benecke, Society, 5–26; Gschließer, Reichshofrat, 297 f. Jörn, »Versuche«, 418–423; vgl. auch Jörn, »Steuerzahlung«, 340–355, 387 ff. Wrede, Reich, 161 f.; vgl. ebd., 135–185, für eine detaillierte Analyse der Pamphletliteratur zu dem Konflikt; Bilder von Leopold in den Türkenkriegen finden sich bei Goloubeva, Glorification, 143–154.
63
6. Erneuter Konflikt mit Frankreich
D
er erfolgreiche Kampf gegen den alten Feind im Osten trug innenpolitisch Früchte und stärkte Leopold bei seinen Versuchen, Brandenburg wieder in eine Allianz einzubinden. Dessen Beziehungen zu Frankreich lockerten sich durch den Friedensvertrag mit den Niederlanden von 1685 und die darin festgeschriebenen Subsidien, die Brandenburgs Abhängigkeit von französischen Zahlungen verringerten. Gleichzeitig reagierte der Große Kurfürst auf die Widerrufung des Edikts von Nantes durch Ludwig XIV. am 18. Oktober 1685 mit dem Edikt von Potsdam vom 8. November, das den von Ludwig Ausgewiesenen Schutz und Zuflucht bot. Nachdem Leopold der Ehre des Großen Kurfürsten durch die Übertragung des schlesischen Distrikts Schwiebus Genugtuung geleistet hatte, besiegelte ein Subsidienangebot von 100.000 Gulden im März 1686 den Bund von Brandenburg und Österreich. 1 Angesichts wachsender Furcht vor einem neuen französischen Angriff und da Brandenburg 1684 und 1685 jede Diskussion über Verteidigung im Reichstag blockierte, ergriff Leopold die Gelegenheit, die ihm die notwendige Erneuerung der Laxenburger Allianz 1685 bot, um ein neues, erweitertes Bündnis zu bilden. Die Augsburger Assoziation von Juli 1686 umfasste die Kreise Bayern, Franken, Burgund und Oberrhein sowie die thüringischen Herzogtümer. Schweden und Spanien waren ebenfalls angeschlossen, wenn auch nur im Hinblick auf ihre deutschen Territorien, da die Abgeordneten des Kaisers ausschließen wollten, dass einzelne Kreise das 1648 den Fürsten verliehene Recht reklamierten, Verträge mit auswärtigen Mächten zu schließen. 2 Wie die Laxenburger Allianz war das Bündnis rein defensiv ausgerichtet, und obwohl eine Armee geplant war, wurde nie eine aufgestellt. Die von Österreich und Bayern zugesagten Truppen waren bereits in Ungarn im Einsatz und somit für die Verteidigung im Westen nicht verfügbar. Obwohl die Augsburger Assoziation also im Grunde nur ein Zeichen der politischen Solidarität darstellte, lehnten der Schwäbische Kreis und die rheinländischen Kurbischöfe einen Beitritt ab und warnten, eine solche Union werde Frankreich erst recht provozieren. Die an vorderster Front von einem möglichen französischen Angriff Betroffenen hofften, behutsame Neutralität werde ihnen über die Runden helfen, bis die Ambitionen der Franzosen erlahmten. Der pfälzische Kurfürst hegte solche Hoffnungen nicht, da Ludwig XIV. im Namen seiner Schwägerin, der Herzogin von Orléans, bereits Anspruch auf einen wesentlichen Teil seines Territoriums erhoben hatte. Rechtlich war der Fall so du-
6. Erneuter Konflikt mit Frankreich
bios wie jedes derartige Ansinnen Ludwigs seit dem Devolutionskrieg 1667. 3 Die Herzogin war das zweite Kind von Kurfürst Karl Ludwig. Ihr Bruder Karl II. folgte 1680 auf den Thron, starb jedoch fünf Jahre darauf kinderlos. Die Kurwürde ging an Philipp Wilhelm von Pfalz-Neuburg, einen Katholiken und standhaften Bundesgenossen des Kaisers seit 1676. Im Namen der Herzogin Elisabeth Charlotte (»Lieselotte«) von Orléans beanspruchte Ludwig den gesamten Privatbesitz ihres verstorbenen Bruders und sämtliche Allodialländereien des Kurfürstentums (das heißt die direkt im Besitz der Kurfürsten stehenden Gebiete hauptsächlich am linken Rheinufer) als privates »Familienerbe«. Nach langem Hin und Her gestand Kurfürst Philipp Wilhelm Ersteres 1687 zu, blieb jedoch stur, was den zweiten Punkt betraf. Ludwig sandte eine offizielle Eingabe an »Kaiser und Reich«, was zu endlosen unnützen Debatten im Reichstag führte. Lediglich der französische Vorschlag, den Papst um Vermittlung zu ersuchen, erfuhr eine klare und sofortige Antwort: Der Papst habe kein Stimmrecht in Reichsangelegenheiten. Der Scheitern der französischen Politik bei der Wahl des neuen Kölner Kurfürsten ließ die pfälzische Erbfolge 1688 brandaktuell werden. Nach dem Tod des Wittelsbacher Kurfürsten Max Heinrich war Ludwig entschlossen, in Köln wie auch in Max Heinrichs weiteren Bischofssitzen Lüttich und Hildesheim den damaligen Bischof von Straßburg, Wilhelm Egon von Fürstenberg, wählen zu lassen. Der bayerische Kurfürst wiederum setzte mit Unterstützung des Kaisers ebenso unnachgiebig auf seinen eigenen Bruder Joseph Clemens. Eine verworrene Doppelwahl, bei der keiner der beiden Kandidaten die notwendige Zweidrittelmehrheit im Kölner Domkapitel erreichte, endete damit, dass Fürstenberg aufgrund einer einfachen Mehrheit den Sieg für sich reklamierte; Joseph Clemens (erst siebzehn, aber bereits Bischof von Freising und Regensburg) wurde jedoch vom Papst bestätigt und von Leopold und allen anderen Kurfürsten anerkannt. Nicht zu Unrecht empfand Ludwig die Wahl eines Minderjährigen anstelle seines Kandidaten, immerhin ein erfahrener Theologe von neunundfünfzig Jahren, Bischof seit 1682 und Kardinal seit 1686, als Affront. 4 Am 24. September 1688 beorderte er seine Truppen nach Köln und in die Pfalz. 5 Der französische König hatte offenbar einen günstigen Augenblick erwischt. Leopolds Streitkräfte waren noch immer in Ungarn gebunden. Die Krise der Stuart-Monarchie und der Aufstand gegen Jakob II. nötigten Wilhelm III. zur Fahrt nach England, um dort den Thron zu besteigen, während gleichzeitig französische Truppen das Rheinland überrannten. Wilhelms zügige Machtübernahme in England wandte das Blatt indes bald gegen Frankreich: Ende Dezember war der französische Botschafter ausgewiesen und England schloss sich den Niederlanden in der Koalition gegen Frankreich an. Im Mai stand die Wiener Große Allianz von England, den Niederlanden, Spanien, Österreich und Savoyen. Die englische Krise eröffnete eine kostspielige neue
65
66
I. · Auferstehung und neues Leben 1648–1705
Front. Ludwigs Versuche der folgenden Jahre, die Wiedereinsetzung Jakobs II. herbeizuführen, blieben vergeblich. Die Schlacht am Boyne im Juli 1690 und der Fall von Limerick im Oktober 1691 beendeten alle Hoffnungen auf Unterstützung für James durch einen irischen Aufstand. Die entscheidende Niederlage der französischen Flotte bei La Hogue im Mai 1692 zwang James ins Exil, verstärkte den Fokus auf den Landkrieg und ließ Wilhelm freie Hand, den Niederländern bei der Abwehr des französischen Angriffs auf die Spanischen Niederlande zu helfen. Derweil entstanden kleinere Fronten in den Pyrenäen und in Norditalien, da Frankreich gegen Spanien und das kaum geschützte spanisch-habsburgische Herzogtum Mailand vorging. Entschieden wurde der Konflikt im Wesentlichen anderswo, gleichwohl waren die Ereignisse in Deutschland von Bedeutung. Als Reaktion auf die französische Invasion bildeten im Oktober Sachsen, Brandenburg, Hannover, Osnabrück und Hessen-Kassel das Magdeburger Konzert, das eine Armee zum Schutz der Niederlande an den Niederrhein schickte, während Wilhelm nach England reiste. Hinzu kam der Entschluss, die Franzosen aus Köln und mit einer weiteren Streitmacht aus der Region am Mittelrhein zu vertreiben. Zwar konnten die Deutschen einige Erfolge bei der Zurückdrängung der französischen Truppen feiern, nun aber setzten die Franzosen auf schonungslose Verwüstung: Wenn sie die eroberten Gebiete nicht halten konnten, sollten diese auch den Deutschen keinen Nutzen mehr bringen.Von der Gegend um Köln den Rhein entlang bis Heidelberg wurden Festungen geschleift, Städte niedergebrannt und Paläste niedergerissen. Heidelberg selbst wurde wie Worms, Speyer und Mannheim so gut wie komplett zerstört. 6 Im Februar 1689 erklärte der Reichstag Frankreich zum »Reichsfeind«, der das Reich ohne Provokation »mehr als unchristlichen Feindseligkeiten« unterzogen habe.7 Die formelle Kriegserklärung folgte am 4. April. Das Problem war, wie dieser Beschluss umgesetzt werden sollte. Beim Einmarsch der Franzosen 1688 waren die Truppen der Kreise in Ungarn stationiert, daher musste das Reich anfangs auf Streitkräfte der armierten Fürsten des Nordens setzen. Die Frage der Bereitstellung von Quartieren führte indes schon im ersten Kriegswinter zu solchen Spannungen zwischen den Truppen und lokalen Autoritäten, dass Leopold im Januar 1689 die Verantwortung für die Zuweisung von Unterkünften und Zuschüssen übernehmen musste. 8 Die während der nächsten Monate gebildete Reichsarmee unter dem Oberbefehl von Karl von Lothringen konnte im September 1689 Mainz zurückerobern. Bonn fiel im folgenden Monat an den Kurfürsten von Brandenburg. Keinem der beiden gelang es jedoch, von den Siegen zu profitieren und die Franzosen weiter zurückzudrängen. Die nächsten sieben Jahre brachten ein fruchtloses Hin und Her der gegnerischen Streitmächte. Beide Seiten erlitten schwere Verluste und die von Schlachten betroffenen deutschen Territorien beklagten erhebliche Opfer unter
6. Erneuter Konflikt mit Frankreich
der Zivilbevölkerung und schwere Schäden an Städten, Dörfern und Land. Im Mai 1693 verwüsteten die Franzosen Heidelberg erneut: Diesmal wurden Stadtmauern und Erdbauten systematisch niedergerissen, während eine Abteilung von mehreren Hundert französischen Soldaten das Schloss des Kurfürsten in die Ruine verwandelten, die bis heute das Bild der Altstadt dominiert. 9 Die Reichspolitik war nun in erster Linie damit befasst, die Verteidigungsbemühungen zu organisieren und das weite Spektrum mit dem Konflikt verbundener politischer Interessen auf einen Nenner zu bringen. Einerseits schuf der Krieg – zumindest zu Beginn – eine solche Solidarität, dass Leopold 1690 ohne Weiteres die Wahl seines Sohnes Joseph zum Römischen König durchsetzen konnte. 10 Den Kurfürsten wurden die üblichen Geldsummen bezahlt, aber keiner von ihnen zögerte, seine Stimme zugunsten des Habsburgers abzugeben. Die widerstreitenden Interessen der Reichsstände in Einklang zu bringen, war allerdings eine größere Herausforderung. Die meisten armierten Fürsten sahen sich beträchtlich überfordert. Das Magdeburger Konzert entsandte Truppen zur Verteidigung des Rheins, seine Mitglieder mussten jedoch auch Männer zur Verstärkung der englischen, niederländischen und spanischen Armeen westlich der Maas abstellen. 11 Andere armierte Fürsten versuchten ihre Verpflichtungen gegenüber dem Reich zu erfüllen und gleichzeitig Hilfstruppen bereitzustellen. Diskussionen über die Verteilung von Quartieren und die Ernennung militärischer Führer führten zu Drohungen, Truppen aus dem Reichsdienst zurückzuziehen, und zu Forderungen nach speziellen Vergünstigungen. Leopold sah sich laufend zu Zugeständnissen gezwungen, um die Loyalität wichtiger Fürsten zu erkaufen. Im Dezember 1691 musste er den Kurfürsten von Bayern zum Statthalter der Spanischen Niederlande ernennen, um seine Treue zu erhalten. Da dieser sich nun Hoffnungen auf die spanische Erbfolge machen durfte, verlegte er einen Großteil seiner Truppen nach Luxemburg und einige später sogar nach Katalonien. Ernst August von Hannover 1692 als Unterstützer bei der Stange zu halten, war noch teurer. 1691 hatte er mit Sachsen, Münster, Schweden und Dänemark die Gründung einer bewaffneten dritten Partei erwogen und von Frankreich ein günstiges Friedensangebot erhalten. Als Leopold einschreiten wollte, forderte Ernst August postwendend seine Erhebung zum Kurfürsten. 12 Obwohl zweifelhaft war, ob Leopold überhaupt das Recht dazu hatte, sagte er im Gegenzug eine »immerwährende Union« zwischen Hannover und dem Haus Habsburg zu. Dies führte zu bitteren Protesten der anderen Kur- und vieler weiterer Fürsten. Ernst Augusts eigener Verwandter, Anton Ulrich von Braunschweig-Wolfenbüttel, führte ein Bündnis von Fürsten an, die sich gegen die Schaffung einer neuen Kurwürde wehrten. Selbst ein Loyalist wie der Reichsgeneralfeldmarschall Ludwig Wilhelm von Baden schloss sich der Opposition an. Die Kurwürde Hannovers wurde schließlich
67
68
I. · Auferstehung und neues Leben 1648–1705
erst 1708 anerkannt, entscheidend war indes Leopolds Beschluss zu ihrer Schaffung von 1692. 13 Der Krieg belastete auch die Beziehungen zu den unbewaffneten Reichsständen. Die Abhängigkeit der Reichsverteidigung vom Beitrag der armierten Fürsten bürdete den unbewaffneten Territorien von Anfang an die Kosten für Quartiere und Unterhalt der Truppen auf. Das Problem blieb auch nach der Rückkehr der schwäbischen und fränkischen Soldaten von der ungarischen Front 1689 auf der Tagesordnung. Im Herbst des Jahres sandten beide Kreise dem Kaiser lange Listen mit Beschwerden und Vorschlägen zur Organisation ihrer Verteidigung. 14 Anfangs zeigten sie keine Bereitschaft, mehr Geld oder Männer aufzubringen, mit der Zeit wurden sie aber doch aktiver. 1691 schlossen sie ein 1692 erneuertes Bündnis gegen die Bereitstellung weiterer Quartiere; stattdessen wollten sie ein Korps von 20.000 Mann aufstellen, um weniger abhängig von den armierten Fürsten zu sein. 1693 sorgte die Ernennung von Ludwig Wilhelm von Baden, dem Helden des Türkenkriegs (»Türkenlouis«), zum Reichsgeneralfeldmarschall für eine weitere Konzentration der Bemühungen der beiden Kreise, die nun Verteidigungslinien durch den Schwarzwald initiierten. 15 1695 folgte die offizielle Gründung des Bundes der Vorderen Kreise. Hauptziel war die Verteidigung, daneben ging es jedoch auch um die Aufrechterhaltung ihrer Unabhängigkeit im Reich und um die Mitsprache in der Reichspolitik. Die Bewegung gewann rasch an Boden. Nachdem sich der Kurfürst von Mainz, Lothar Franz von Schönborn, für den Bund engagierte, schlossen sich im Januar 1697 der bayerische, kurrheinische, oberrheinische und westfälische Kreis an. 16 Oberbefehlshaber blieb Ludwig Wilhelm von Baden. Zur effektiven Bildung einer dritten Partei kam es während des Konflikts nicht. Die Brutalität der Kriegsführung machte es Frankreich unmöglich, nützliche Allianzen unter den deutschen Ständen zu initiieren. Die armierten Fürsten standen ebenso wie das Bündnis der Kreise bis zuletzt zur Großen Allianz und zum Reich. Jede der Gruppen verfolgte eigene Interessen, aber keiner gelang es, ihr politisches Hauptziel zu erreichen, an den Friedensgesprächen teilzunehmen. Während der gesamten Dauer des Krieges bemühten sich Leopold und seine Berater, dies zu verhindern und Angehörigen und Institutionen des Reichs keine offizielle Mitgliedschaft in der Großen Allianz zuzugestehen. So blieben sie auch von den Verhandlungen von Mai bis Oktober 1697 ausgeschlossen, die in den Frieden von Rijswijk mündeten. Das Reich spielte bei der Beendigung des Krieges keine Rolle. 17 Im August 1696 hatte Ludwig XIV. für einen ersten Riss in der Großen Allianz gesorgt, indem er den Herzog von Savoyen zu einem Separatfrieden in Italien überredete. Im Oktober stimmte Leopold ebenfalls einer Waffenruhe in Italien zu. Dies verhalf Frankreich zu neuerlichen Erfolgen in Katalonien und den Spanischen Niederlanden. Mit diesen Siegen im Rücken und angesichts tiefer Risse in der Großen Allianz
6. Erneuter Konflikt mit Frankreich
bewilligte Ludwig Anfang 1697 die Wiederherstellung von Luxemburg und Lothringen und erkannte Wilhelm III. als rechtmäßigen König von England an. Die Friedensgespräche in Rijswijk konnten beginnen. Leopold nahm die Bedingungen als Letzter an, mehr als einen Monat nach dem allgemeinen Friedensschluss am 20. September. Die Herzöge von Lothringen und Luxemburg erhielten ihre Territorien zurück, die pfälzischen Forderungen der Herzogin von Orléans wurden zur Vermittlung an den Papst überwiesen. 18 Ludwig sagte zu, die Ansprüche von Wilhelm Egon von Fürstenberg auf Köln nicht weiter zu verfolgen, dem Leopold wiederum seine Rechte als Reichsfürst zurückgab. Darüber hinaus verzichtete Ludwig auf die eroberten pfälzischen Gebiete und seine Festungen am rechten Rheinufer, sodass Freiburg und Breisach wieder in habsburgischen Besitz kamen und Kehl und Philippsburg Reichsfestungen wurden. 19 Andererseits erreichte Ludwig sein Hauptkriegsziel: die Anerkennung seiner Besitzrechte am Elsass und an Straßburg; nicht einverstandene Bewohner sollten das Land beziehungsweise die Stadt binnen eines Jahres verlassen. Der umstrittenste Punkt des Abkommens war eine im Geheimen zwischen dem katholischen Kurfürsten der Pfalz und Ludwig ausgehandelte Klausel: Artikel 4 sah vor, dass Katholiken in allen von Frankreich abgetretenen Gebieten der Pfalz weiterhin Glaubensfreiheit genossen. 20 Dieser klare Bruch des Friedens von 1648, in dem die Pfalz als protestantisches Land festgeschrieben war, löste zwanzig Jahre später eine schwere politische Krise im Reich aus. 1697 sorgte er dafür, dass führende protestantische Fürsten bei der Vorlage des Abkommens im Reichstag ihre Unterschrift verweigerten. Die Kontroverse wurde zwei Jahre später hochaktuell, als die französische Regierung eine Liste von fast zweitausend Orten übergab, in denen der katholische Glaube zulässig sein sollte. 21 Die Verluste des Reichs in Rijswijk 1697 stehen in scheinbarem Widerspruch zu den Gewinnen Österreichs in Karlowitz 1699. Das unterschiedliche Ergebnis der beiden Abkommen spiegelt den Ablauf der Konflikte und das Wesen des jeweiligen Gegners wider. Die türkische Bedrohung hatte klare Priorität, weil sie eine unmittelbare Gefahr für Wien sowie Prag, Dresden und München darstellte. Zudem herrschte nach dem Feldzug 1683 Chaos im Osmanischen Reich. Die unerbittliche Konzentration auf den Türkenkrieg bedeutete nicht, dass sich das Interesse der Habsburger vom Reich abwandte. Die Entscheidung, beide Kriege zu führen, war auch kein Zeichen von Heroismus. Tatsächlich begannen erste Verhandlungen mit den Türken bereits 1689, aber der Streit zwischen »Reichsfraktion« und »Ungarnfraktion« in Wien sorgte für Verzögerungen und zwang Leopold, an beiden Fronten zu kämpfen. 22 Aus Sicht einer Regierung, die fast zwei Jahrhunderte lang mit der türkischen Bedrohung umgehen musste, war es nur logisch, die Gelegenheit zu ergreifen, ein für alle Mal damit fertig zu werden. Der Friede von Karlowitz brachte die Habs-
69
70
I. · Auferstehung und neues Leben 1648–1705
burger einer solchen Lösung näher als je zuvor. Der nächste Ungarnaufstand, die Rebellion von Franz II. Rákóczi 1703–1711, war für die habsburgische Herrschaft die letzte große Herausforderung, begünstigt durch Österreichs Beteiligung am Spanischen Erbfolgekrieg – sobald die Reichsinteressen in Deutschland und Italien gesichert waren, wurde der Aufstand niedergeschlagen. 23 Der nächste Türkenkrieg (1716–1718) machte deutlich, wie viel sich geändert hatte: Österreich nutzte den türkischen Angriff auf venezianisches Gebiet in Morea und Dalmatien, um die letzten osmanischen Teile Ungarns zu erobern. Ungarn selbst war dabei nie bedroht, weder von den Türken noch durch eine Rebellion im Inneren. 24 Im Westen war die Situation grundlegend anders. Frankreich konnte nicht ganz Europa erobern, aber es konnte auch keine andere Macht oder Machtkonstellation Frankreich erobern. Das Beste, was man erhoffen durfte, war eine Eindämmung. In Folge der Reunionen hielt Frankreich bereits das Elsass, sein Hauptziel war also erreicht, bevor die Feindseligkeiten überhaupt begannen. Zudem hatten führende deutsche Fürsten Leopold wiederholt gedrängt, sämtliche Reunionen anzuerkennen. Unter diesen Umständen war es für den Kaiser ein Triumph, Frankreich zu zwingen, die pfälzischen Ländereien und anderen rechtsrheinischen Besitz zurückzugeben. Noch bevor das Abkommen von Rijswijk beschlossen war, wurde das französische Problem in anderer Form erneut aktuell. Als Karl II. von Spanien 1696 schwer erkrankte, rückte die spanische Thronfolge ins Zentrum der europäischen Politik. Das Thema hatte Leopolds gesamte Regierungszeit überschattet und führte 1701 zu einem neuen europäischen Krieg, der ihn die letzten vier Jahre seines Lebens beschäftigen sollte. 25 Aber obwohl sich in diesem Konflikt erneut Frankreich und eine Koalition inklusive Österreich gegenüberstanden, unterschied er sich von seinen Vorgängern. Die Idee eines Gleichgewichts der Kräfte, die Wilhelm III. ins Spiel gebracht hatte, prägte nun die Strategie aller Beteiligten. Zudem verband sich das Problem der Thronfolge neuerdings mit maritimen Interessen und wirtschaftlichen Einflusszonen, weshalb England und die Niederlande ebenso betroffen waren wie Frankreich und Österreich. Drittens schließlich eröffnete die spanische Erbfolge den österreichischen Habsburgern neue Möglichkeiten in Italien. All das hatte umfassende Folgen für Leopolds Nachfolger Joseph I. und Karl IV. Nach vier Jahrzehnten Herrschaft als Kaiser hatte Leopold zumindest dafür gesorgt, dass seine Nachfolger angesichts der Herausforderungen, die sich ihnen bieten sollten, gut aufgestellt waren.
6. Erneuter Konflikt mit Frankreich
Anmerkungen 1
2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
Die Betonung liegt hier tatsächlich auf »Ehre«, da der Handel eine Geheimklausel enthielt, in der sich der Erbe des Großen Kurfürsten verpflichtete, das Territorium wieder an den Kaiser abzutreten, sobald er den Thron bestieg. Aretin, Altes Reich II, 19 f. Aretin, Altes Reich II, 23; Burkhardt, Vollendung, 128. Erdmannsdörffer, Geschichte I, 723 f.; ein Teil des Problems war, dass der Herzog von Orléans im Fall der Durchsetzung des Anspruchs als Pfalzgraf von Simmern und Lautern ein Stimmrecht im Reichstag erhalten hätte. ADB VII, 297–306. Lynn, Wars, 193–199. Vetter, »Heidelberg«, 39; Vetter, Zerstörung, 21–28. Burkhardt, »Verfassungsprofil«, 172 f. Wilson, German Armies, 89. Press, Kriege, 437 f.; Vetter, Zerstörung, 113–126. Aretin, Altes Reich II, 54 f. Wilson, German Armies, 183 f. Aretin, Altes Reich II, 54–66. Vgl. auch S. 93–96, 152 f. Plassmann, Krieg, 129. Plassmann, Krieg, 244–269; vgl. auch S. 52 f. Wilson, German Armies, 187 ff.; Gotthard, »Friede«, 44–63. Lynn, Wars, 253–266. Der Papst legte 1702 fest, dass ihr 300.000 Scudi Entschädigung zu zahlen seien. Hochedlinger, Wars, 173. Der Fürstbischof von Speyer und der Markgraf von Baden wurden als rechtmäßige Besitzer von Philippsburg bzw. Kehl anerkannt, ihre Rechte jedoch fortan vom Reich ausgeübt, wobei die Kreise und Österreich Garnisonen stellten. Aretin, Altes Reich II, 41–51. Press, Kriege, 441; vgl. auch S. 180–184. Klueting, Reich, 80. Vgl. S. 141 f. Ingrao, Monarchy, 110 f., 115 ff., 119 f.; Ingrao, In Quest, 123–160. Vgl. S. 134–146.
71
7. Der Kaiser, der Immerwährende Reichstag, die Kreise und die Reichsjustiz
D
ie Bedrohungen durch Frankreich und das Osmanische Reich stärkten die Einigkeit des Reichs, die mit einer Flut von Pamphletliteratur untermauert wurde. Der Triumph über die Türken ließ den Kaiser in den Augen vieler als Helden erscheinen. Mochten manche murren, weil er gegen Frankreich nicht mehr herausgeholt hatte, so fand seine Verteidigung des Reichs im Westen doch breite Anerkennung und festigte seine Stellung. Es war zugegebenermaßen schwer, die deutschen Stände zur Solidarität zu bewegen, schon gar ohne Bedingungen. Aber selbst der Große Kurfürst von Brandenburg gab letztlich seine Allianz mit Ludwig XIV. auf und stand zum Reich. Wie viele andere verfolgte er unentwegt eine unabhängige Politik und machte vollen Gebrauch von seinem in den Verträgen von 1648 festgeschriebenen Recht, Bündnisse mit fremden Mächten zu schließen. Dennoch war undenkbar, dass er sich wirklich gegen »Kaiser und Reich« gestellt hätte oder in einer Union mit einem Kriegsgegner des Reichs verblieben wäre. Tatsächlich erwies sich sein 1686 geschlossenes Bündnis mit dem Kaiser, das letzte vor seinem Tod 1688, als dauerhaftestes überhaupt; es hielt über seinen Sohn und Enkel bis in die 1730er Jahre. Ein wichtiger Grund für die grundsätzliche Loyalität war Leopolds Auftreten als Kaiser und der effektive Einsatz der ganzen Palette seiner Befugnisse. Die auffälligste konstitutionelle Neuerung seiner Herrschaft war, dass der Reichstag, der aufgrund politischer, steuerlicher und militärischer Notwendigkeiten zusammentreten musste, von da an permanent tagte. Eine von Leopolds ersten Amtshandlungen war die Verlegung der Deputation, die die Arbeit des Reichstags von 1654 fortsetzen sollte, von Frankfurt nach Regensburg. 1 Berater des Kaisers glaubten, die räumliche Nähe der Deputation zum Direktorat des Rheinbunds verleihe den Kurfürsten zu viel Macht und eröffne zu viel Spielraum für französischen Einfluss. Regensburg lag näher bei Österreich. Die Deputation war ohnehin gelähmt durch den Disput über die Frage, ob sie während des Interregnums weitertagen durfte, und nun entstand die absurde Situation, dass in Regensburg auf Einladung des Kaisers eine neue Deputation tagte, während die dezimierte Tagung in Frankfurt weiterging. Beide Körperschaften erkannten einander nicht an. Der einzige Weg aus der festgefahrenen Lage war die Einberufung des Reichstags, um die Deputation insgesamt überflüssig zu machen. Im Herbst 1661 sprach vieles
7. Der Kaiser, der Immerwährende Reichstag, die Kreise und die Reichsjustiz
dafür, dass der Kaiser um Hilfe gegen die Türken ersuchen würde, und so trat schließlich im Januar 1663 in Regensburg ein Reichstag zusammen. Es gab eine Reihe weiterer Unterschiede zu den »Türken-Reichstagen« des 16. Jahrhunderts. Leopold wohnte den Sitzungen von Dezember 1663 bis Mai 1664 bei, um Beschlüsse hinsichtlich Geld und Soldaten für den Krieg voranzutreiben. Zur Eröffnung und nach 1664 vertrat ihn jedoch der Erzbischof von Salzburg als Prinzipalkommissar, ein Amt, das Rudolf II. 1603–1608 zu diesem Zweck eingeführt hatte. Auch die Reichsstände entsandten Vertreter, statt persönlich zu erscheinen, was den Reichstag zu einem Kongress von Botschaftern machte. Ein weiterer Unterschied war, dass der Reichstag nach der Bewilligung der Kriegszuschüsse weiterging, weil die in den Friedensverträgen von 1648 offen gebliebenen Punkte nach wie vor auf der Tagesordnung standen. Das schwierigste Problem blieb die kaiserliche Wahlkapitulation, die Gegenstand einer anhaltenden Kontroverse zwischen Kurfürsten und Fürsten war. 2 Im Grunde kreiste die ganze Debatte um die Frage, wer das Recht hatte, Gesetze zu formulieren; in den 1660er Jahren forderten die Fürsten, der ganze Reichstag müsse am Entwurf einer Kapitulation beteiligt werden, die für alle zukünftigen Kaiser gültig bleiben sollte (capitulatio perpetua), während die Kurfürsten auf ihrem Vorrecht beharrten, für jeden Kaiser einen neuen Kontrakt auszuhandeln. 1671 kam es zu einem Kompromissentwurf, der für beide Seiten akzeptabel war, da er alle Interessen berücksichtigte, strittige Punkte überging und man beschloss, ihn zu einem zukünftigen Zeitpunkt endgültig auszuformulieren. Tatsächlich kam erst 1711 ein endgültiges Rahmendokument zustande, und selbst dieses wurde nicht Gesetz, weil es der Kaiser nicht ratifizierte. 3 Als zweites Schlüsselthema stand die Verteidigung auf der Liste der 1648 ungelösten Fragen. 4 Den Kern der Diskussion bildeten zwei Probleme: das Verteidigungssystem selbst und die Verpflichtung der Untertanen, es zu finanzieren. Im ersten Punkt musste entschieden werden, ob man die 1555 eingeführten Mechanismen zur Friedenssicherung lediglich reformieren und das System der Mobilisierung bei Angriffen von außen auf die Kreise erweitern oder etwas Neues schaffen sollte. Die kleineren Fürsten zogen eine Reform vor, die ihre weitere Teilhabe an politischen Prozessen sicherstellte. Die armierten Fürsten wollten ein neues System, in dem ihre Truppen eine kollektive Armee bildeten, bezahlt von ihren eigenen Untertanen und den unbewaffneten Territorien, deren politische Stellung entsprechend reduziert würde. Der Wunsch des Kaisers und seiner Berater war eine ständige Reichsarmee unter zentraler Befehlsgewalt, die aus Steuern von allen Untertanen des Reichs bezahlt werden sollte. Wie bei der Wahlkapitulation wurde die Entscheidung mehrmals verschoben. Nach der Türkenkrise 1663/64 verlor das Thema für einige Zeit an Bedeutung. Als die Franzosen 1667/68 die Spanischen Niederlande angriffen, brachte Leopold es
73
74
I. · Auferstehung und neues Leben 1648–1705
wieder auf die Tagesordnung und drängte auf eine Revision des bestehenden Systems. Im Januar 1669 einigte man sich auf eine nominelle Stärke von 30.000 Mann für die aufzustellende Reichsarmee, aber nun erwirkte eine Gruppe von Fürsten, die zu klären forderten, wie die Truppen bezahlt werden sollten, eine Vertagung der Diskussion über die Reform der Durchführungsregelungen von 1555. 1654 und 1658 war beschlossen worden, die Untertanen müssten für die Kosten aller zur Verteidigung und Friedenssicherung »notwendigen« Festungen und Garnisonen aufkommen. Die Gruppe der sogenannten Extensionisten, im wesentlichen Fürsten mit Streitkräften, wollten diese Einschränkung streichen. Ihre Untertanen sollten die gesamten Militärausgaben tragen, auch im Fall von Bündnissen mit auswärtigen Mächten laut den Verträgen von 1648. 5 Was das bedeutete, war klar: Die Kosten stehender Heere würden auf die Allgemeinheit abgewälzt. Der Antrag der Extensionisten, den der Reichstag in seiner Gesamtheit im Oktober 1670 annahm, hätte sämtliche Restriktionen für die Besteuerung in den Territorien beseitigt. Daher weigerte sich Leopold strikt, ihn zu ratifizieren. Der Schutz der Untertanen vor ungerechter Besteuerung gab ihnen das Recht, vor den Reichsgerichten Beschwerde einzulegen, was wiederum bedeutete, dass es dem Kaiser vorbehalten blieb, im Fall eines für sie günstigen Urteils in den Territorien zu intervenieren. 6 Mit der Ablehnung des Vorschlags der Extensionisten bekräftigte Leopold seine Pflicht, die Gesetze und Traditionen des Reichs zu wahren, und sein Recht, als Hüter der Verfassung zu wirken. Dass die Reichstagsmehrheit seine Entscheidung sofort akzeptierte, zeigte, wie sich sein Status verbessert hatte. Es war aber auch typisch für den Gang der Angelegenheiten im Reichstag, dass 1673 ein revidierter Entwurf des Durchführungsedikts vorbereitet, aber nicht weiter bearbeitet wurde. 7 Die 1681 unter dem anhaltenden Druck französischer Aggression erreichte Einigung war ein weiterer Kompromiss. Es gab keinen Versuch einer systematischen Reform des Systems, sondern lediglich eine Vereinbarung über die Größe der Armee und die Übertragung der Verantwortung für ihre Aufstellung auf die Kreise. Einmal mehr siegte die Tradition über die Erneuerung. Paradoxerweise wuchsen dem Reichstag selbst im Scheitern einer Einigung über konstitutionelle Themen schrittweise wichtige neue Funktionen zu. Eine Entscheidung, die Sitzungen auf unbestimmte Zeit zu verlängern, gab es nie. 8 Über die Jahrzehnte wurde wiederholt erwogen, die Sache zu einem Abschluss zu bringen, und bis ins 18. Jahrhundert fanden es viele Kommentatoren höchst abnormal, dass eine Versammlung derart lange dauerte. 9 Anfangs lag das daran, dass es zu keinem Beschluss in Sachen Reichskapitulation und Verteidigung kam. In den 1670er Jahren sorgte die zunehmende Bedrohung aus Frankreich für die Fortsetzung der Beratungen. Dann erkannte Leopold die konstitutionelle Rolle des Reichstags als repräsentierende Institution von »Kaiser und Reich« an, als er sich an die Ver-
7. Der Kaiser, der Immerwährende Reichstag, die Kreise und die Reichsjustiz
sammlung wandte, um den Frieden von Nimwegen 1679 und den Waffenstillstand von Regensburg 1684 ratifizieren zu lassen. Inzwischen nahm man die permanente Versammlung des Reichstags mehr oder weniger als gegeben hin und die Obrigkeit in Wien würdigte ihn als Vermittlungsinstanz in der Reichspolitik. Durch seinen Bevollmächtigten, den Prinzipalkommissar, hatte der Kaiser nun in Notfällen direkten Zugang zu den Reichsständen, ohne mühsam einen Reichstag einberufen und mit den Kurfürsten über die Tagesordnung verhandeln zu müssen. Tatsächlich wurde die Position der Kurfürsten, die im Dreißigjährigen Krieg nach Mitregentschaft getrachtet hatten, ein wenig geschwächt, indem sie ihren Platz in einer hierarchischen Institution unter dem Vorsitz des Kaisers einnahmen. 10 Durch seinen zweiten Vertreter im Fürstenkolleg – den er in seiner Funktion als Herrscher von Österreich stellte – konnte Leopold auch direkt Einfluss auf die Debatten nehmen. Die Kritiker des Kaisers mussten ihre Ansichten in Regensburg darlegen; Missverständnisse und Dispute, die vordem zu ernsten politischen Problemen auswachsen konnten, ließen sich nun in Diskussionen lösen. Streitigkeiten zwischen Reichsständen oder zwischen Kurfürsten und Fürsten verlagerten sich zunehmend auf den Reichstag, wobei der Kaiser als Vermittler wirkte und seine eigene Macht stärken konnte, indem er die Parteien gegeneinander ausspielte. Die versammelten Repräsentanten der Stände bildeten zudem eine unschätzbare Informationsquelle und dienten als Mitteilungsweg für die kaiserlichen Behörden. Der Reichstag wurde zum Forum der »öffentlichen Meinung«, an das Pamphlete gerichtet und in dem über sie diskutiert wurde. 11 Diese Neuerung war so bemerkenswert, dass manch einer in Versuchung geriet, den Immerwährenden Reichstag als Europas erstes ständiges Parlament zu bezeichnen. 12 Diese Überspitzung gilt nur eingeschränkt. Die im Reichstag Versammelten vertraten die Reichsstände – Fürsten, Stadtmagistraten und so fort – und nicht deren Untertanen; diese Idee tauchte erst in aufklärerischen Reformvorschlägen um 1760 auf. 13 Dass der Reichstag permanent tagte, ging zudem darauf zurück, dass man in den entscheidenden konstitutionellen Punkten zu keiner Entscheidung fand. Wiederholt gab es Diskussionen darüber, ob ein Abschluss wünschenswert sei, aber die Debatte im Reich war von anderem Charakter als in England. Dort markierte der Triennial Act von 1694 den Abbruch früher Experimente mit ständigen Parlamenten, die die Machtstellung des Königs begünstigten, zugunsten einer Regelung, die den König verpflichtete, das Parlament nach einer festgelegten Zeitspanne aufzulösen (und einzuberufen). Dadurch entwickelte das englische Parlament eine institutionelle Unabhängigkeit von der Monarchie, die der Reichstag nie erreichte. Die oppositionellen Fürsten hatten nach 1640 immer wieder zwei- oder dreijährliche Reichstagsversammlungen gefordert, eben um oligarchische und monarchische Tendenzen zu verhindern. Tatsächlich wirkte der
75
76
I. · Auferstehung und neues Leben 1648–1705
ständige Reichstag nach 1663 oligarchischen und aristokratischen Tendenzen entgegen, jedoch zum Vorteil der Krone. 14 Dennoch entwickelte sich der Reichstag langsam vom konstitutionellen Kongress zu einem frühmodernen Parlament der Reichsstände. 15 Es fällt schwer, ein klares Bild seiner legislativen Tätigkeit zu zeichnen. Die 1740 von Joseph Pachner von Eggersdorf veröffentlichte Sammlung von Gesetzen (Reichsschlüssen) führt etwa zweitausend Resolutionen auf. Davon fand nur ein Zehntel Niederschlag in formellen Gesetzen, viele weitere hatten indes Gesetzeskraft, obwohl sie aus diversen technischen Gründen nicht offiziell verkündet wurden. So wurden etwa von 1701 bis 1711 keine Gesetzesvorlagen (Reichsgutachten) an den Kaiser geschickt, weil dessen seit 1699 amtierender Prinzipalkommissar, der Passauer Bischof Johann Philipp von Lamberg, zum Kardinal ernannt wurde und die protestantischen Stände sich nicht einigen konnten, wie er anzusprechen sei. 16 In den ersten Jahrzehnten des Immerwährenden Reichstags wurden die Verhandlungen häufig von Disputen über zeremonielle Angelegenheiten, Rangordnung und Ablauf unterbrochen. 17 Die Beratungen verliefen generell schleppend, da die Abgeordneten auf Grundlage schriftlicher Instruktionen arbeiteten und sich ständig rückversichern mussten. Es dauerte bis zu einem Monat, bis ein der Kanzlei in Mainz vorgelegter Entwurf die drei Kollegien erreichte, und dann noch einmal sechs bis acht Wochen, bis die Abgeordneten von den Höfen, die sie repräsentierten, instruiert worden waren. Jedes Kollegium musste zu einer Entscheidung finden, die drei schriftlichen Beschlüsse wurden sodann verglichen. In weiteren Gesprächen brachte man Differenzen in Einklang und formulierte ein Reichsgutachten, das nach Wien geschickt wurde, woraufhin der Kaiser nach eingehender Beratung und Abwägung das Gesetz bestätigte. Wenn seine Zustimmung Regensburg erreicht hatte, wurde das Gesetz offiziell verkündet. Erschwert wurde die Arbeit einiger Abgeordneter dadurch, dass sie mehrere Höfe vertraten, weil nicht alle Fürsten für eigene Repräsentanten bezahlen wollten. Die Reichsstädte wurden generell von Regensburger Magistraten vertreten. Waren alle Instruktionen angekommen, verlief die Diskussion in den drei Kollegien, die für gewöhnlich zweimal die Woche zusammentraten, oft recht konzentriert. Das Kurfürstenkollegium war bis 1708 mit sieben aktiven Stimmen ohnehin klein. 18 Im Fürstenkollegium übten zwanzig bis fünfundzwanzig Abgeordnete das Stimmrecht für etwa sechzig Fürsten aus, die um die hundert Stimmen hielten. Das Städtekollegium bestand aus zehn bis fünfzehn Regensburger Magistraten. Zwar konnte es Jahre dauern, ein triviales prozedurales Problem zu lösen, hingegen wurde der Boykott auf französische Importe 1676 in vier Monaten beschlossen. 19 In den Jahrzehnten nach 1664 zeigte sich der Reichstag im Allgemeinen sehr
7. Der Kaiser, der Immerwährende Reichstag, die Kreise und die Reichsjustiz
aktiv. Während zu jener Zeit gut 70 Prozent aller ins englische Parlament eingebrachten Gesetzesentwürfe scheiterten, war der Reichstag auf einigen entscheidenden Feldern erfolgreich. 20 Die umfassenden ordnungspolitischen Ansätze des 16. Jahrhunderts mit allgemeinen Rechtsvorschriften wie Polizei- und Münzordnungen wurden nicht wieder aufgegriffen. Diese Statuten blieben gültig, abgesehen von Ergänzungen und Anpassungen, und bildeten weiterhin den Rahmen für einen Großteil der entstehenden territorialen Gesetzgebung. Die Einigung auf neue Generalstatuten erwies sich als schwierig: Ein 1671 von den Reichsständen vorgelegter Entwurf für eine verbesserte Regelung der Handwerksgilden, einen Teilbereich früherer Polizeiordnungen, wurde erst 1731 endgültig verabschiedet, allerdings beschränkte ein 1672 verkündetes Gesetz die Autonomie der Gilden und erleichterte den Beitritt. 21 Die anhaltende Diskussion über den erweiterten Entwurf führte zu Verhandlungen zwischen Einzelherrschern, einem beträchtlichen Korpus an Territorialgesetzen und schließlich einer Vielzahl regionaler Initiativen zur Angleichung der Gesetzgebung über Ländergrenzen hinweg. Ein Großteil der Aktivitäten des Reichstags war natürlich von den fast ständigen militärischen Konflikten der Zeit geprägt. Die Reform der Reichsverteidigung 1681/82 lieferte einen übergreifenden rechtlichen Rahmen, der bis 1806 in Kraft blieb.22 Mit beträchtlichem Aufwand widmete man sich darüber hinaus ökonomischen Initiativen. Die Ausarbeitung merkantilistischer Pläne zur Förderung von Produktivität und Wachstum und zur Stärkung des »gemeinsamen Marktes« im Reich war ein wichtiger Bestandteil der Reichstagsverhandlungen ab 1664. Viele Initiativen gingen auf Eingaben der Territorien zurück. Das von Sachsen zum Schutz seiner einheimischen Farbstoffindustrie betriebene Importverbot für Indigofarben fand 1671 nicht genügend Unterstützung. Hingegen führte eine breiter getragene Kampagne gegen neue Maschinen zur Herstellung von Schleifen 1685 und 1714 zu entsprechenden Verboten. 23 Es war indes bezeichnend, dass derartige spezifische Probleme nun zunehmend vor dem Hintergrund einer umfassenden Wirtschaftspolitik diskutiert wurden, unter maßgeblicher Beteiligung kaiserlicher Berater wie Johann Joachim Becher (* 1635, † 1682; besonders aktiv von 1670 bis 1676) und Philipp Wilhelm von Hörnigk (* 1640, † 1714), zwei der wichtigsten merkantilistischen Theoretiker der Zeit, sowie Christoph de Royas y Spínola (* ca. 1626, † 1695), formal ab 1664 spanischer Gesandter in Regensburg, ab 1660 indes ständiger Berater Leopolds und Autor mehrerer Entwürfe zur ökonomischen und religiösen Einigung des Reichs. 24 Spínola und Hörnigk (ein Schützling Spínolas sowie Schwager und Mitarbeiter von Becher) blieben die 1680er Jahre hindurch richtungweisend. 1667 beriet der Reichstag ein umfassendes Paket von Vorschlägen zur »Emporbringung der Gewerbe und Manufakturen im Reich«. 1671 lag ein groß angelegter Gesetzeskatalog zur Abschaffung illegaler Binnenzölle, Beschneidung
77
78
I. · Auferstehung und neues Leben 1648–1705
des Stapel- und Umschlagrechts der Städte, zum Ausbau von Straßen und Wasserwegen (inklusive der Regulierung von Preisen und Dienstleistungen der an den Wegen gelegenen Gasthäuser) und zur Festlegung von Preisen und Praktiken auf Märkten und Messen vor. Die Diskussion über die Förderung des Binnenhandels erhielt vor dem Hintergrund des Konflikts mit Frankreich eine neue Dimension. 25 1674 verhängte Frankreich ein Einfuhrverbot für deutsche Waren. 1676 befürworteten Österreich und Brandenburg ein Importverbot für französische Güter. 1689 beschloss der Reichstag ein umfassendes Embargo gegen Frankreich. Es wurde 1697 aufgehoben, galt jedoch erneut von 1702 bis 1714. Die Boykotte wurden stetig verfeinert, waren aber nie gänzlich wirksam. Die Schweizer Kantone waren berüchtigt dafür, Pfade für Schmuggelwaren bereitzustellen, und so trieben wirtschaftliche Zentren wie Hamburg und Lübeck ohne effektive Überwachung über alle Kriege hinweg Handel mit Frankreich. 26 Es fällt schwer, die Auswirkungen der Embargos präzise einzuschätzen. Während jedoch noch 1648 Kommentatoren bitter über die Allgegenwart französischer Produkte klagten, konnte das Reich binnen fünfzig oder sechzig Jahren eine ausgeglichene Handelsbilanz mit Frankreich vorweisen. Das Scheitern einer Einigung auf eine gemeinsame Währung wird oft als Beleg für die Handlungsunfähigkeit des Reichs angeführt. 27 Außer Zweifel steht, dass nach den Reformen von 1559 und 1566 zwei Währungen Gültigkeit besaßen: der Gulden im Süden, der Taler im Norden. Andererseits löste sich die Trennung zwischen einer südlichen Kreuzer- und einer nördlichen Groschenzone langsam auf, da der Kreuzer zunehmend als gemeinsame Verrechnungswährung Verwendung fand. Die Übertragung der Verantwortung für die Münzqualität auf die Kreise hatte zudem eine monetäre Infrastruktur geliefert, die einigermaßen gut funktionierte, auch in der Währungskrise von 1618–1623 (der Kipper- und Wipperzeit). Andererseits sorgte eine neue Währungsinstabilität nach 1650 für eine Vielzahl von Reformvorschlägen zur Einführung einer Leitwährung für das Reich und zur Einschränkung der Herstellung minderwertiger Münzen. Das größte Hindernis war, dass die Anzahl der Münzstätten nach 1648 erneut zunahm, da fast alle Territorien eigene haben wollten und die größeren Länder Reformen zu verhindern versuchten, die ihren Interessen abträglich waren. Leopold selbst ließ minderwertige Münzen prägen, um Geld für seine militärischen Unternehmen zu beschaffen; viele andere taten es ihm gleich. Der Wert der größten Münzen blieb stabil und war lediglich periodischen, allgemein anerkannten Anpassungen unterworfen, hingegen betraf die Entwertung in hohem Maß kleinere Münzen (10 Kreuzer und weniger), die bei alltäglichen Transaktionen verwendet wurden – die sogenannten Land- oder Scheidemünzen, deren Herstellungskosten oft höher waren als ihr Metallwert. Bei mehreren Hundert tätigen Münzstätten überrascht es nicht, das um 1692 etwa 1.200 Münzsorten in Umlauf waren. 28 Viele davon fanden ausschließ-
7. Der Kaiser, der Immerwährende Reichstag, die Kreise und die Reichsjustiz
lich im lokalen und regionalen Alltag Verwendung, trugen also nicht zum »Münzwirrwarr« bei, den nationalistische Gelehrte in ihrer Leidenschaft für Symbole nationaler Einheit später beklagten. Von größerer Bedeutung war jedoch die Stabilität des Systems insgesamt. 1665 ersuchten der schwäbische, fränkische und bayerische Kreis den Reichstag um eine Revision der Währung. Die Idee einer allgemeinen Inspektion aller umlaufenden Münzen (»Universalprobationstag«) scheiterte aber, weil nicht klar war, wer die Autorität besaß, ein solches Unternehmen zu leiten. Während der Reichstag ergebnislos beriet, wie man die Währung über mehrere Jahrzehnte regulieren konnte, wirkten die beiden regionalen Systeme von Gulden und Taler weiterhin stabilisierend. Vorbehaltlich einer Einigung für das Reich insgesamt schlossen Brandenburg und Sachsen 1667 in Zinna einen Währungspakt, dem sich auch Braunschweig und die Länder des westfälischen Kreises anschlossen. 1690 wurde er durch den Leipziger Münzvertrag ersetzt, der bis 1738 gültig blieb. Derweil schloss Leopold, der dem Zinnaer Pakt nicht beigetreten war, 1681 einen Finanzvertrag mit Salzburg und Bayern. 1695 entstand ein drittes System in Niedersachsen, wo einige Münzstätten Taler von leicht abweichendem Wert prägten, die sich nach der niederländischen Norm richteten. In einigen Gegenden entwickelten sich relativ stabile Verhältnisse, »Währungskonferenzen« traten selbst dort zusammen, wo die Kreise selbst nicht tätig wurden, etwa im Norden und Osten, wo sich das Leipziger System durchsetzte, und in Österreich. In Süddeutschland hingegen brach die Kooperation der Kreise Schwaben, Franken und Bayern nach 1700 zusammen, mit besonders schlimmen Folgen für die kleineren schwäbischen und fränkischen Territorien. 1736 richteten sie eine neue Petition an den Reichstag und 1738 einigte man sich, die Leipziger Regelungen auf das gesamte Reich auszudehnen, was allerdings nie offiziell Gesetz wurde. Folgerichtig hielten Österreich, Brandenburg, Sachsen und Bayern an ihrer abweichenden Politik fest. 1806 gab es sieben unterschiedliche Währungszonen im Reich. 29 Indes richtete sich jede dieser Zonen in ihrer Geldpolitik nach dem 1559 und 1566 festgelegten Rahmen und definierte ihre Währung in Relation zu den zwei offiziellen »Leitwährungen« Gulden und Taler, für die wiederum feste Wechselkurse galten. Manche Gesetzgebungsversuche scheiterten also und die Tragweite beschlossener Gesetze war manchmal unsicher, aber der legislative Prozess als solcher war von größter Bedeutung. In jenen Jahrzehnten war der Reichstag das Forum für Debatten zu allgemeinen Problemen. Die kontinuierlichen Verhandlungen verliefen geordnet und führten bisweilen zu ausgewogenen Beschlüssen. Durch die Tätigkeit der Kreise und Territorien wurden beschlossene Gesetze oft effektiv umgesetzt. Der im Reichstag entworfene gesetzgeberische Rahmen prägte die legislative und regulatorische Praxis der Länder. Selbst gescheiterte Gesetze zogen Konsulta-
79
80
I. · Auferstehung und neues Leben 1648–1705
tionen nach sich – zwischen Regensburg und den Territorien und Kreisen, zwischen den Reichstagsabgeordneten, zwischen Regensburg und Wien –, die für eine Verbreitung allgemeiner Handlungsnormen sorgten und oft zu regionalen Kooperationen und Angleichungsversuchen führten. Das Fehlen von Gesetzen auf Reichsebene schloss Regulierungen in Kreisen und Territorien nicht aus. Daran änderte auch die unterschiedliche Entwicklung der Kreise nichts: So entstanden etwa in Schwaben und Franken, die aus zahlreichen kleineren Territorien bestanden, kommunale legislative Funktionen; in Nieder- und Obersachsen hingegen, die von größeren Territorien dominiert waren, übernahmen Landesregierungen die legislativen Aufgaben der Kreise, manchmal in Kooperation über Territorialgrenzen hinweg. Natürlich gab es dabei Meinungsverschiedenheiten und Konflikte, die jedoch meist in Regensburg beigelegt wurden. Vor allem jedoch kam es bis etwa 1700 im Reichstag nicht zu konfessionellen Auseinandersetzungen, und als solche Probleme dann doch wieder auftauchten, waren sie eingebettet in einen seit Jahrzehnten institutionalisierten politischen Prozess. Die Dauertagung des Reichstags verschaffte dem Kaiser eine neue Präsenz im Reich. Leopold selbst unternahm während seiner siebenundvierzig Herrschaftsjahre nur fünf Reisen von seinen österreichischen Erblanden ins Reich. Keine führte ihn weiter als bis nach Frankfurt, wo er 1658 gewählt und gekrönt wurde. 30 Seine Vertreter in Regensburg hielten ihn jedoch über die offiziellen Papiere hinaus, die seine Entscheidung erforderten, stets auf dem Laufenden. Flankiert wurde die Arbeit der Regensburger Abgeordneten durch ein wachsendes Netzwerk von Vermittlern überall im Reich. 31 Die ersten Reichsgesandten wurden als Reaktion auf Schwedens Eingreifen in die norddeutsche Politik in Hamburg (1628), Bremen (1640) und Lübeck (1653) ernannt. Französische Aktivitäten an vielen deutschen Höfen in den 1650er und 1660er Jahren veranlassten die Bestellung von Gesandten in Dresden und Berlin (1665), Mainz (1673) und München (1674). So entstand ein offizielles Geflecht ständiger Botschafter auch in den schwäbischen und fränkischen Kreisen und in wichtigen Reichsstädten wie Nürnberg, Köln, Frankfurt, Ulm und Augsburg. Mit Frankreichs Krieg gegen die Niederlande 1672 kam es zu Versuchen der Postüberwachung im Reich: Der Leiter des Hamburger Postamts erhielt die Anweisung, »schädliche Korrespondenz« abzufangen. 32 All diese Initiativen waren Stückwerk, ihre Wirksamkeit zweifellos begrenzt. Das Netzwerk von Botschaftern erreichte erst nach 1700 mit einer systematischen Abdeckung der wichtigsten Höfe und Städte und der regulären Ernennung von Gesandten in den Kreisen seine größte Ausdehnung. Auch die verdeckte Postüberwachung wurde erst durch die Einrichtung von »Postlogen« in den Sortierzentren in Frankfurt, Augsburg und Nürnberg besser organisiert und engmaschig.
7. Der Kaiser, der Immerwährende Reichstag, die Kreise und die Reichsjustiz
All diese Vorgänge muss man jedoch in Relation zu der geringen Größe der zentralen Reichsinstitutionen in Wien betrachten. In den 1670er Jahren etwa beschäftigte die Reichshofkanzlei nicht mehr als um die fünfzehn Angestellte (und weitere achtzehn in der österreichischen Kanzlei); der Reichshofrat hatte etwa fünfundzwanzig Mitglieder (die praktisch Richter waren, aber keineswegs alle eine juristische Ausbildung besaßen), unterstützt von einer Kanzlei mit gut dreißig Mitarbeitern. 33 Die Anzahl der Initiativen zur Verbesserung der Kommunikation während der Herrschaft Leopolds I. macht einmal mehr das wachsende Ausmaß der kaiserlichen Regierungstätigkeit im Reich deutlich. Ebenso auffällig wie neue Formen der Informationsbeschaffung und politischen Einflussnahme war, wie ältere Instrumente monarchischer Herrschaft den neuen Gegebenheiten angepasst wurden. Ständige Vertreter ins Reich zu entsenden, war aufgrund chronischen Geldmangels nur begrenzt möglich und noch immer war man es gewohnt, dass das Reich – oder vielmehr: die kaiserlichen Vasallen – zum Kaiser kam. Die Beziehungen zwischen dem Kaiser als oberstem Lehnsherrn und Adel sowie Städten als Vasallen bildeten während Leopolds Herrschaft die Grundlage der Reichsregierung. Dabei spielte der Reichshofrat in Wien eine Schlüsselrolle. 34 Vor 1648 war er hauptsächlich eine Kombination aus Staatskanzlei und oberstem Gericht. 35 In seiner juristischen Funktion konkurrierte er mit dem Reichskammergericht in Speyer, das von den Reichsständen finanziert und besetzt wurde. Die vielen Funktionen des Reichshofrats hatten auch dazu geführt, dass folgende Kaiser, vor allem Rudolf II. und Ferdinand II., ihn als Werkzeug der katholischen Politik im Reich einsetzten. Tatsächlich wurden Gerichtsentscheidungen zu wichtigen und empfindlichen Themen generell dem Kaiser übergeben (votum ad imperatorem) und von seinen Hofräten begutachtet, bevor er sein letztgültiges Urteil fällte. Folglich misstrauten die meisten protestantischen Fürsten dem Reichshofrat; seine Tätigkeit war ein Hauptgrund für ihre Klagen vor und während des ersten Jahrzehnts des Dreißigjährigen Krieges. 1648 hatten die Fürsten versucht, die Macht des Hofs einzudämmen und seine Besetzung dem Paritätsprinzip zu unterwerfen. Ferdinand III. indes hatte 1654, ohne die Stände zu konsultieren, ein neues Statut für den Hof beschlossen, das solche Forderungen schlichtweg ignorierte. Obwohl der Reichshofrat der Hof des Kaisers blieb und immer überwiegend aus Katholiken bestand, wuchs seine Bedeutung in den Jahrzehnten nach 1648 stetig, hauptsächlich weil sich Ferdinand III. und Leopold I. dem konstitutionellen Rahmen der Friedensverträge verpflichtet fühlten. Hinzu kamen Probleme beim Reichskammergericht, dessen Verfahren oft dadurch behindert wurden, dass die Stände mit ihren Zahlungen in Rückstand gerieten. Nach der französischen Invasion wurde es 1689 ganz geschlossen und erst 1693 in Wetzlar wieder eröffnet, von 1704 bis 1711 ruhte seine Tätigkeit erneut, diesmal wegen eines Disputs über
81
82
I. · Auferstehung und neues Leben 1648–1705
die Entlassung des katholischen Gerichtspräsidenten durch Leopold. 36 Insgesamt war seine Kernkompetenz, die Erhaltung des Landfriedens, nun auch weniger gefragt. Selbstverständlich aber spielte das Reichskammergericht weiterhin eine wichtige Rolle. Besonders attraktiv scheint es für bestimmte Sorten von Klägern aus Norddeutschland gewesen zu sein, während sich süddeutsche Appellanten offenbar instinktiv nach Wien wandten. Klar ist indes, dass die Bedeutung des Reichshofrats auf Kosten des Reichskammergerichts zunahm. 37 Obwohl mehrheitlich katholisch besetzt, hielt sich der Reichshofrat im Großen und Ganzen an das Prinzip der Unparteilichkeit. Von 1663 bis 1788 gingen wegen seiner Urteile vierundsiebzig Beschwerden beim Reichstag ein; in keinem Fall konnte eine konfessionelle Voreingenommenheit festgestellt werden. Verfahren wurden im Reichshofrat im Allgemeinen schneller entschieden und waren daher kostengünstiger als vor dem Reichskammergericht. Oft wurden seine Urteile auch wirkungsvoller umgesetzt, weil er regelmäßig kaiserliche Kommissionen entsandte, um Probleme im lokalen Umfeld zu lösen. Diese Kommissionen, die oft mehrere Jahre vor Ort blieben, waren für den Kaiser ein wichtiges Werkzeug zum Eingriff in die inneren Angelegenheiten von Territorien und Städten. Der Hof vereinte die Funktionen eines obersten Verfassungs- und Feudalgerichts und einer Kontrollbehörde für alle Stände, deren direkter oberster Lehnsherr der Kaiser war, etwa Reichsstädte, Reichsritter und die italienischen Lehen. Mittels dieser Befugnisse entwickelte er auf vielen wichtigen Feldern der Politik hohe Kompetenz. Am geläufigsten waren sieben Klassen von Verfahren: Untertanen gegen ihre Herrscher, Territorialstände gegen Fürsten, Domkapitel gegen Bischöfe und Prälaten, Erbstreitigkeiten in Adelsfamilien (wobei es auch um Vormundschaft und illegitime Nachkommen ging), Verschuldung und Bankrott von Fürsten und Adligen, Bürger gegen Magistrate von Reichsstädten und schließlich konfessionelle Konflikte, oft in Form von Klagen von Untertanen gegen ihre Herrscher. 38 Für einige dieser Felder gab es Reichsgesetze, an denen sich die Urteile orientieren konnten. Viele Auseinandersetzungen indes, besonders wenn es um widerstreitende Argumente in Sachen Tradition und Privilegien ging, musste das Gericht so lösen, dass alle Beteiligten den im Namen des Kaisers ergangenen Erlass als bindend betrachten konnten. Natürlich gab es Beschränkungen. Die größeren Territorien, auch die Länder der Habsburger selbst, waren in der Praxis von der Rechtsprechung des Hofrats ausgenommen – meist jene Länder, für die dasselbe am Reichskammergericht galt (durch ein privilegium de non appellando oder weil sie von allen Reichsgesetzen ausgenommen waren). 39 Viele Adelsfamilien lösten interne Zwistigkeiten und Probleme mit anderen Dynastien weiterhin lieber durch ad hoc eingesetzte Schlichtungstribunale.40 Auch Reichsstädte griffen häufig auf diese traditionelle Form der
7. Der Kaiser, der Immerwährende Reichstag, die Kreise und die Reichsjustiz
Rechtsprechung zurück. Die Tribunale wurden gemäß dem für das Reichskammergericht gültigen Statut oder aufgrund dynastischer oder regionaler Übereinkünfte zwischen zwei oder mehr Familien beziehungsweise Städten gebildet. Ihre Arbeit war indes mühsam und kostspielig, und obgleich sie bis 1806 existierten, übernahm mit der Zeit der Reichshofrat viele ihrer traditionellen Aufgaben. So wurde es außer in den größten Territorien zum gängigen Mittel der politischen und juristischen Praxis, sich an den Reichshofrat zu wenden. In einigen Fällen griff er entscheidend ein. Kaiserliche Schuldenkommissionen setzten die Herrschaft eines Fürsten außer Kraft, während seine Finanzen und seine Administration ein Beirat von »Treuhändern« übernahm, oft unter Leitung eines benachbarten Fürsten. Die ungeheure Fülle an Verfahren, die die thüringische Adelsfamilie der Ernestiner aufgrund ihrer vielen Nachkommen über mehrere Generationen und ihrer Abneigung gegen die Primogenitur am Reichshofrat anstrengte, zeigt, welch wichtige »Regierungsrolle« der Hofrat erfüllte. 41 Die Region wurde befriedet und stabilisiert. Konflikte, die sich vordem gewalttätig entladen hätten, klärte man nun in Verhandlungen. Der Reichshofrat regelte die Besteuerung, löste Fälle von Bankrott und restrukturierte Landesfinanzen, entschied über die Verteilung von Besitztümern und das Erbe von Dynastien und vermittelte bei Konflikten zwischen deren Angehörigen. Viele Verfahren wurden nie durch ein offizielles Urteil abgeschlossen, sondern durch lokale Vermittlung gelöst, manchmal von kaiserlichen Gesandten, deren Auswahl sich weniger nach irgendeinem Patronagesystem richtete als nach ihrer Eignung für einen speziellen Fall. Insgesamt gab man sich offenbar alle Mühe, Streitigkeiten auf rechtlicher, nicht politischer Grundlage beizulegen. Beschwerden von Landständen wegen ungerechter Besteuerung, begünstigt durch Leopolds Weigerung, den Reichstagsvorschlag einer Erweiterung der steuerlichen Macht der Fürsten von 1671/72 zu billigen, führten immer wieder zu kaiserlichen Interventionen zugunsten der Stände. Dass mehr als ein Viertel der zwischen 1648 und 1806 vor dem Reichshofrat verhandelten Klagen Beschwerden von Untertanen gegen ihre Herrscher betraf, war ein starkes Motiv für die Fürsten, umsichtig und maßvoll zu regieren. Im schlimmsten Fall konnte der Kaiser einen Fürsten auch absetzen lassen, was zwischen 1683 und 1698 fünfmal geschah. 42 Derartige Fälle waren relativ selten, aber dass sie überhaupt vorkamen, spornte die meisten Territorien und Städte an, eine externe Einmischung in ihre Angelegenheiten tunlichst zu vermeiden. So trug der Hofrat dazu bei, dass sich gängige Traditionen, Gesetze und Werte im ganzen Reich durchsetzten. Am meisten zu tun hatte der Reichshofrat mit weniger mächtigen Angehörigen des Reichs: Bischöfen und Prälaten, kleineren Fürsten, Reichsgrafen, -rittern und -städten. Die Jahrzehnte nach 1648 kennzeichnete eine Intensivierung der Beziehungen zwischen dem Monarchen und diesen Gruppen auch auf andere Wei-
83
84
I. · Auferstehung und neues Leben 1648–1705
se. Insbesondere Leopold I. förderte den Adel des Reichs ganz allgemein. Auch dies unterstreicht die Bedeutung des Wiener Hofs als Bezugspunkt für die Nobilität der habsburgischen Länder und viele andere Adlige im Reich.
Anmerkungen 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18
19 20
21
Schnettger, Reichsdeputationstag, 269–280. Neuhaus, Reich, 12 ff.; Schindling, Anfänge, 91–96, 134–156. Kleinheyer, Wahlkapitulationen, 78–99; vgl. S. 152 f. Aretin, Altes Reich I, 219–222. Wilson, German Armies, 31. Erdmannsdörffer, Geschichte I, 428 ff.; es war bezeichnend, dass Köln, Bayern, Brandenburg, Pfalz-Neuburg und Mecklenburg-Schwerin umgehend eine »ewige Verteidigungsallianz« gründeten, um das Dekret des Kaisers zu untergraben, indem sie einander Beistand für den Fall zusicherten, dass ihre Untertanen sich einer Besteuerung zu militärischen Zwecken widersetzten. Schindling, Anfänge, 180 ff. Ebd., 7. Burkhardt, »Verfassungsprofil«, 152–159. Press, »Kaiserliche Stellung«, 68. Burkhardt, Vollendung, 90–98. Kampmann, »Reichstag«, fasst die Diskussion zusammen; vgl. auch Burkhardt, »Verfassungsprofil«. Burgdorf, Reichskonstitution, 39 ff., 475–486, 507. Gotthard, Reich, 115 f. Aretin, Altes Reich I, 130. Burkhardt, »Verfassungsprofil«, 164. 1678 war der Reichstag monatelang wegen des »Legitimationsstreits« lahmgelegt, der ausgelöst wurde, weil ein neuer Abgeordneter von Braunschweig-Celle seine Zeugnisse und Bescheinigungen über einen seiner Beamten ans Direktorium des Mainzer Kurfürsten senden ließ, das die Annahme mit der Begründung verweigerte, nur Vertreter neuer Kurfürsten dürften ihre Papiere auf diese Weise vorlegen, Abgesandte von Fürsten hingegen müssten persönlich erscheinen; Gotthard, Säulen II, 810 f. Aktive Wähler waren 1648 Mainz, Köln, Trier, Sachsen, Brandenburg, Bayern und die Pfalz. Hannover wurde 1692 erhoben, aber erst 1708 zum Kollegium zugelassen, im selben Jahr wie Böhmen, das traditionell von allen Geschäften außer der Kaiserwahl ausgeschlossen war. Böhmens Zulassung verschaffte den Habsburgern eine zusätzliche Reichstagsstimme und ihre erste aktive Stimme im Kurfürstenkolleg. Burkhardt, »Verfassungsprofil«, 162 f. Hoppit, Failed Legislation, 4; der Anteil abgewiesener Anträge lag 1660–1688 bei 71,8 und 1689–1714 bei 49 Prozent. Der Anteil gescheiterter sozialer und ökonomischer Gesetzentwürfe belief sich 1660–1705 auf etwa 80 Prozent; ebd., 7. Schon der Westfälische Friede verbot die Nichtzulassung zu einer Gilde aus religiösen Gründen (IPO § 35); die folgenden Regelungen beschnitten das Recht der Gilden, die Nachkommen jener, deren Tätigkeiten als unehrenhaft angesehen wurden, und illegitime Kinder auszuschließen, und begründeten das Berufsausübungsrecht religiöser Flüchtlinge
7. Der Kaiser, der Immerwährende Reichstag, die Kreise und die Reichsjustiz
22 23 24 25 26 27
28 29 30
31 32 33 34 35 36
37 38 39 40
41 42
(Réfugiés), die per definitionem keine formelle Qualifikationen für eine Gilde besaßen. Blaich, Wirtschaftspolitik, 171–182; vgl. auch Winzen, Handwerk. Vgl. S. 55 f. Blaich, Wirtschaftspolitik, 214–225. Bog, Reichsmerkantilismus, 7–18; vgl. auch S. 101–109. Ebd., 76–148. Ebd., 150–166. Christmann, Bemühungen, 89–124; Blaich, Wirtschaftspolitik, 27–66; Gömmel, Wirtschaft, 51 ff.; Dotzauer, Reichskreise, 448–454; Conrad, Rechtsgeschichte II, 151–154; Schneider, Währungspolitik, 38–44. Wilson, Reich, 196. Dotzauer, Reichskreise, 454; Gömmel, Wirtschaft, 53. Schindling, »Leopold I«, 178. Nach der Frankfurter Wahl und Krönung 1658/59 besuchte er 1663–1666 Regensburg, um am Reichstag teilzunehmen, 1676 Passau zur Hochzeit mit Eleonore von Pfalz-Neuburg, 1681 Altötting, um den bayerischen Kurfürsten zu treffen, 1683 während der Belagerung von Wien erneut Passau und 1689–1690 Augsburg zur Wahl und Krönung seines Sohnes zum Römischen König. Müller, Gesandtschaftswesen, 69–80. Grillmeyer, »Habsburgs langer Arm«, 56. Duindam, Vienna, 81; vgl. zum Problem der Definition von »Angestellten« des Reichs Wendehorst und Westphal, »Reichspersonal«. Press, »Reichshofrat«; Press, »Kaiserliche Stellung«, 69–75; Hughes, Law, 32–59; HaugMoritz, »Reichshofrat«. Vgl. Band I, S. 451 f., 513 f. Franz Adolf von Ingelheim war der Neffe des Kurfürsten von Mainz, dessen Suspendierung eine umfangreiche und erbitterte Debatte über die Arbeit des Hofrats nach sich zog; vgl. Aretin, Altes Reich II, 175–179; vgl. zu den allgemeinen Problemen des Reichskammergerichts Feine, »Verfassungsentwicklung«, 94–97; vgl. auch Baumann und Ortlieb, »Netzwerk«; vgl. auch S. 151 ff. Sellert, Zuständigkeitsbegrenzung, 124–127. Press, »Kaiserliche Stellung«, 70 f. Conrad, Rechtsgeschichte II, 159 f., 164, 166; Sellert, Zuständigkeitsbegrenzung, 22–45; Jessen, Einfluß, 33–40. Westphal, Rechtsprechung, 97–103; Conrad, Rechtsgeschichte II, 160; HDR I, 273 f.; die Kammergerichtsordnung von 1555 legte fest, dass Dispute zwischen Prälaten, Grafen, Adligen sowie Städten und Kurfürsten und Fürsten in erster Instanz an eine Schlichtungskommission (das Austrägalgericht) verwiesen wurden, von dessen neun Mitgliedern wenigstens fünf mindestens den Grad eines Ritters besitzen mussten. Westphal, Rechtsprechung, 433–443. Marquardt, »Aberkennung«, 87; drei Fälle betrafen die Grafen von Hohenems, die anderen beiden waren der Graf von Neuwied (1687) und der Graf von Sayn-Wittgenstein-Wittgenstein (1698); vgl. zu Fällen aus dem 18. Jahrhundert Trossbach, »Fürstenabsetzungen«.
85
8. Kaiserliche Netzwerke: Reichskirche und Reichsstädte
D
ie Fürstbischöfe und Prälaten der Reichskirche waren die natürlichsten Verbündeten des Kaisers im Reichstag, ihre Stellung ab 1648 durch Reichsgesetze gesichert. Die vierundzwanzig Fürstbistümer und sechsundzwanzig reichsunmittelbare Abteien bildeten eine Schlüsselmacht im Rheinland (wegen der Kette von Bistümern am linken Ufer von Chur und Konstanz bis Trier und Köln gern als »Pfaffengasse« bezeichnet), in Süd- und Mitteldeutschland sowie in Westfalen. Die Fürstbistümer waren vom Adel dominierte Institutionen mit Kurwürde, meist besetzt mit Reichsrittern oder Nachfahren von Grafen. Auch die von ihnen Gewählten entstammten fast immer dem Hochadel, entweder Dynastien oder Fürstenhäusern. Die Habsburger hatten versucht, ein Netzwerk von Bistümern mit Familienangehörigen zu besetzen, aber ab den 1660er Jahren erforderte der Mangel an männlichem Nachwuchs andere Strategien. Die erfolgreichste Dynastie in der Reichskirche waren die bayerischen Wittelsbacher. Ihre jüngeren Söhne amtierten von 1583 an zwei Jahrhunderte lang als Erzbischöfe und Kurfürsten von Köln, zudem beherrschten sie eine Reihe kleinerer Bistümer in Westfalen und Nordwestdeutschland. Ihr größter Pfründensammler, Clemens August (* 1700, † 1761), vereinte die Ämter in Münster, Paderborn, Köln, Hildesheim und die Würde eines Hochmeisters des Deutschen Ordens auf sich. 1 Die Macht der Wittelsbacher in der Reichskirche dehnte Bayerns Einfluss bis in den Norden aus; das machte die Beziehungen zu Österreich besonders heikel, vor allem angesichts der bayerischen Neigung, sich durch Allianzen mit Frankreich der habsburgischen Dominanz zu entziehen. Da es keine Kandidaten aus seiner eigenen Familie gab, setzte Leopold oft auf Verwandte seiner Frau Eleonore von Pfalz-Neuburg. Die Dynastie hielt wichtige Territorien am Niederrhein und erbte 1685 die Pfalz. Kurfürst Philipp Wilhelms vierter Sohn, Franz Ludwig (* 1664), wurde Hochmeister des Deutschen Ordens, Bischof von Breslau, Kurbischof von Trier und schließlich Kurbischof von Mainz. 2 Später spielte das Haus Lothringen eine ähnliche Rolle als quasi adoptierte Verwandtschaft der Habsburger. 3 Parallel zu den Dynastien Pfalz-Neuburg und Lothringen wirkte auch die Familie Schönborn zugunsten Habsburgs und besetzte über mehrere Generationen wichtige Positionen in der Reichskirche. 4 Ursprünglich ein Ministerialgeschlecht mit Ämtern in Mainz und Trier, schafften sie den Durchbruch mit der Wahl von Johann Philipp von Schönborn zum Erzbischof von Kurmainz 1647. 5 Es folgte die
8. Kaiserliche Netzwerke: Reichskirche und Reichsstädte
Erhebung auch seiner Verwandten; der Dynastie entstammten im folgenden Jahrhundert ein weiterer Kurfürst von Mainz und eine Reihe kirchlicher und kaiserlicher Würdenträger. Obwohl Johann Philipp anfangs gemeinsam mit Frankreich gegen den habsburgischen Einfluss im Reich arbeitete, wurde er nach der Auflösung des Rheinischen Bundes 1668 ein verlässlicher Mitstreiter des Kaisers und begründete damit eine Familientradition für folgende Generationen. 6 Während Leopolds Herrschaft wurden kaiserliche Bevollmächtigte zu sämtlichen kirchlichen Wahlen entsandt, selbst in so entlegene Gegenden wie Lüttich und das protestantische Bistum Lübeck, wo nur Angehörige des Hauses HolsteinGottorp gewählt werden konnten. Auch in dieser Hinsicht hatte der Dreißigjährige Krieg die Habsburger in Berührung mit Gebieten des Reichs gebracht, mit denen sie zuvor wenig zu tun hatten, und ihnen Kenntnisse der örtlichen Bedingungen sowie Kontakte verschafft, auf die sie bauen konnten. Der Kaiser hatte kein formelles Vetorecht, aber seine Gesandten waren oft in der Lage, die Wahl von Gegnern der Habsburger zu verhindern. Ihre Anwesenheit demonstrierte die imperiale Dimension derartiger Wahlen und ein damit verbundener entscheidender Teil des Zeremoniells war die Verleihung der Regalien an den neuen Amtsinhaber. Sie erlaubte einem neu gewählten Fürstbischof, noch vor der päpstlichen Bestätigung zum Abschluss der Wahl die weltliche Herrschaft über sein Land anzutreten, und diente dem Kaiser als Druckmittel gegen unwillkommene Kandidaten. 1688 informierte der kaiserliche Bevollmächtigte bei der Wahl des neuen Kölner Erzbischofs das Domkapitel, im Fall der Wahl des französischen Kandidaten Wilhelm Egon von Fürstenberg werde ihm der Kaiser die Kurwürde verweigern. 7 Fürstenbergs Kandidatur war damit erledigt. Im Fall Lübecks hingegen stieß der Einfluss der Habsburger an seine Grenzen, da die Niederländische Republik entschlossen war, ihre Ostgrenze zu sichern. Nach den katastrophalen Erfahrungen mit dem kriegslüsternen Bischof Bernhard von Galen († 1678) nahmen die Niederländer regen Anteil an allen Wahlen in niederrheinischen und westfälischen Bistümern. 8 1706 gelang es ihnen sogar, den kaiserlichen Kandidaten, Karl Joseph von Lothringen, Bischof von Osnabrück und Erzbischof von Olmütz, auszuschalten und die Wahl von Franz Arnold Josef Wolf von Metternich durchzusetzen, der bis 1718 regierte. 9 Solche Fehlschläge sowie gelegentliche Konflikte zwischen einzelnen Fürstbischöfen und der Krone unterstrichen, dass der Kaiser eher Einfluss auf als Kontrolle über die Reichskirche hatte. Diesen machte er auch in den Domkapiteln geltend, indem er auf das alte Recht zurückgriff, nach jeder auf die Krönung eines neuen Kaisers erfolgten Kirchenstiftung den ersten neuen Domherrn oder Pfründner zu nominieren. 10 Der kaiserliche Einfluss auf Abteien und nichtbischöfliche Stifte war eher indirekt. Viele Prälaten waren einfache Bürger und daher nicht in die auf den Kaiser ausgerichteten aristokratischen Netzwerke eingebunden, die die Domkapitel beherrschten. 11
87
88
I. · Auferstehung und neues Leben 1648–1705
Andererseits waren sie wie Reichsstädte und Reichsritter auf den Schutz des Kaisers angewiesen. Die starke Konzentration solcher Stiftungen in Schwaben bildete eine weitere Verbindung mit der Krone. Nach dem Erlöschen der Tiroler Linie der Habsburger 1665 fielen die zersplitterten schwäbischen und Breisgauer Territorien Vorderösterreichs, die seit 1651 von Freiburg aus regiert worden waren, an Leopold, der somit als Territorialherrscher einer Region, in der der kaiserliche Einfluss traditionell stark war, ins Reich »zurückkehrte«. 12 Das Verhältnis zwischen Kaiser und schwäbischen Prälaten war nun in der Tat ein anderes als im 16. Jahrhundert. Damals waren sie bereit gewesen, ungeheure Geldmengen vorzustrecken, die nie zurückgezahlt wurden. Nun blieben die Prälaten ohne entsprechende Gegenleistungen eher zurückhaltend, und wenn sie sich auf anspruchsvolle Bauvorhaben einließen, was viele von ihnen nach 1648 taten, trugen sie finanziell oft gar nichts bei. 13 Dennoch stärkten diese kleinen kirchlichen Territorien die religiöse und kulturelle Präsenz der Reichskirche. Im Reichstag trugen die schwäbischen und rheinländischen Prälaten (also alle, die nicht dem schwäbischen Kollegium angehörten) stets zuverlässig die kaiserliche Politik mit. Ihr informeller Koordinator und Sprecher im Reich war der schwäbische Abt von Weingarten, der gewöhnlich das schwäbische Kollegium leitete. Eine kirchliche Institution verband direkt die Sphären von Kirche, Reichsrittern und den österreichischen Erblanden mit einem Führer, der entweder Habsburger oder ein Kandidat des Kaisers war 14: Der Deutsche Orden mit seinem Hauptquartier im fränkischen Mergentheim umfasste die acht Vogteien des Reichs, die die Säkularisierung des Herzogtums Preußen und anderer norddeutscher Besitzungen überlebt hatten. Den Verlust der Vogtei Utrecht im Dreißigjährigen Krieg glichen Landkäufe in Mähren und Schlesien aus, wodurch zu den existierenden Ländereien in Österreich und Besitzungen in Wien (insbesondere dem deutschen Haus hinter dem Stephansdom) eine neue Basis auf österreichischem Territorium entstand. Die Bestätigung der Besitzungen des Ordens 1648 sicherte das Überleben seines verstreuten Patrimoniums und des Bundes von Priestern und Rittern, die es besaßen. Die fest katholische Ausrichtung wurde nur in Hessen aufgeweicht, wo der Landgraf auch reformierte und lutherische Adlige zum Orden zuließ. Die kaisertreue Haltung änderte sich dadurch jedoch nicht, sondern wurde noch gestärkt durch die Rolle des Ordens im Kampf gegen die Türken nach 1663. Im Allgemeinen war das Verhältnis der Krone zur Reichskirche geprägt von der Rückbesinnung auf traditionelle Vorrechte und guter Kommunikation mit den Fürsten und fürstlichen Institutionen. Das galt auch für die Beziehungen zu den Reichsstädten. Bezeichnenderweise ließ Leopold den alten Brauch wieder aufleben, kaiserliche Abgesandte in die Städte zu schicken, um Huldigungen zu seiner Krönung entgegenzunehmen. 15 Dies untermauerte die traditionelle kaiserliche
8. Kaiserliche Netzwerke: Reichskirche und Reichsstädte
Schirmherrschaft über die urbanen Kommunen und bot eine willkommene Gelegenheit, ansehnliche finanzielle Tribute einzufahren. Vor allem jedoch trugen die Huldigungsakte zur Begründung eines Netzwerks von kaisertreuen Kommunen bei, das sich über das ganze Reich erstreckte.16 Gleichzeitig sorgte die Ausweitung der Tätigkeiten des Reichshofrats dafür, dass kaiserliche Gesandte immer häufiger in die internen Konflikte und finanziellen Krisen der Städte in den hundertfünfzig Jahren nach 1648 involviert wurden. Selbst eine so weit von Wien entfernte Stadt wie Hamburg, dessen Status als Reichsstadt überhaupt erst 1768 formell bestätigt wurde, beging kaiserliche Geburten, Hochzeiten, Krönungen und Todesfälle oft mit kostspieligen Zeremonien und ließ seine inneren Turbulenzen im späten 17. Jahrhundert von 1708 bis 1712 durch eine kaiserliche Kommission klären. 17 Kirche, Ritter und Städte bildeten die angestammte Klientel des Kaisers im Reich. Der traditionelle geografische Schwerpunkt im Süden und Südwesten galt nach wie vor, aber das Netz von Kontakten reichte nun bis zur Nordsee und an die baltische Küste. Ebenso blieb der Katholizismus ein wichtiges Band zwischen der Krone und manchen Netzwerken, aber weder protestantische Adlige noch protestantische Städte wurden aus religiösen Gründen ausgeklammert.
Anmerkungen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14
Wilson, Reich, 203; Weitlauff, Reichskirchenpolitik. Reinhardt, »Reichskirchenpolitik«. Wolf, Reichskirchenpolitik, 296–303; vgl. auch S. 346. Schraut, Haus Schönborn, 15–19; Forster, Catholic Germany, 106 f. Gotthard, »Friede«, 21–44. Vgl. S. 23 ff. Klueting, Reich, 91 f. Vgl. S. 54, 272, 347. Duchhardt, Altes Reich, 64 f.; Aretin, Altes Reich II, 185 ff.; Press, »Großmachtbildung«, 141; Klueting, Reich, 92. Press, »Kaiserliche Stellung«, 63; Klueting, Reich, 91. Neuhaus, Reich, 30 f.; Reden-Dohna, »Problems«; Braunfels, Kunst III, 353–422, untersucht eine Auswahl solcher Stiftungen. Die Institutionen für Frauen, meist im rheinländischen Kollegium, waren in der Regel aristokratisch. Press, »Schwaben«, 54–58; Quarthal, »Vorderösterreich«,44–47. Reden-Dohna, Reichsstandschaft, 36 f. Evans, Making, 280 f.; Schindling und Ziegler, Territorien VI, 224–228; Boockmann, Deutscher Orden, 229 ff., 291; von 1591 bis 1664 waren alle Hochmeister Habsburger; Johann Kaspar von Ampringen (aktiv 1664–1684) war ein treuer Diener der Habsburger aus einer Breisgauer Familie, seine Nachfolger bis 1806 zwei Pfalz-Neuburger, ein bayerischer Wittelsbacher, ein Fürst von Lothringen und weitere Habsburger; vgl. zu Ampringen BWDG II, 1316 f.
89
90
I. · Auferstehung und neues Leben 1648–1705
15 Aretin, Altes Reich I, 105–112. 16 North, »Integration«. 17 Whaley, Toleration, 19, 179–185; Berbig, »Kaisertum«.
9. Der Kaiserhof in Wien und dynastische Erhebungen im Reich
F
ür Teile des deutschen Adels wurde der Hof in Wien während der Herrschaft Leopolds I. auf neue Weise attraktiv. Ihn Kaiserhof zu nennen, ist etwas problematisch, da er drei Rollen in sich vereinte. 1 Erstens war er das Zentrum des Erzherzogtums Österreich, zweitens nahm Wien als österreichische Gesamthauptstadt eine besondere Stellung unter den diversen Zentren der Habsburger ein. Residenzen unterhielten sie in Graz, Innsbruck, Prag, Brünn und Pressburg (später auch die Höfe der Statthalter in Brüssel und Mailand), wobei Graz, Prag und Innsbruck wichtige Administrationszentralen blieben; offizielle Höfe gab es dort um 1700 jedoch nicht. Drittens war Wien als Sitz des Reichshofrats und der Reichskanzlei in gewissem Sinn auch die »Hauptstadt« des Reichs, obwohl es nicht im Sinn von Regensburg, Augsburg und Frankfurt Reichsstadt war. Als administrativer Knotenpunkt mit diesen drei Funktionen erlebte Wien einen gewaltigen Anstieg der Anzahl der Funktionäre und Beamten. Aber die Zunahme von etwa 225 auf gut 400 in den diversen Zentralbehörden und Kanzleien um 1700 war moderat in Relation zu der Vielzahl der Bereiche, für die sie theoretisch zuständig waren. 2 Zwar spielten sich die meisten administrativen und regierungsamtlichen Geschäfte auf territorialer Ebene ab sowie, was das Reich betraf, im Reichstag und in den Kreisen. Dennoch ist der Unterschied zur Anzahl der Hofbeamten eklatant, von denen es um 1700 über tausend gab – eine immer noch bescheidene Anzahl im Vergleich zum Hof Ludwigs XIV. in Versailles, der ungefähr zehnmal größer war. Ab den 1620er Jahren dominierte am Hof der österreichisch-böhmische Adel. Den Kern bildeten Familien, die in der großen Krise von 1618 Loyalität gezeigt hatten und mit von protestantischen Rebellen konfiszierten Ländereien reich belohnt worden waren. Ihre Hauptzentren lagen außerhalb des Reichs, aber die Erhebung in den Reichsfürstenstand stärkte die Stellung von Dynastien wie Liechtenstein, Auersperg, Dietrichstein, Eggenberg, Portia und Schwarzenberg. 3 Dagegen wie gegen die Ernennung einer Reihe von Reichsgrafen erhob sich beträchtlicher Widerstand von älteren Fürstenfamilien, die durchsetzen konnten, dass neu Nobilitierte durch angemessenen Besitz im Reich qualifiziert sein mussten, um zum Reichstag zugelassen zu werden. Das dauerte manchmal Jahrzehnte und erforderte bisweilen den rechtlichen Kniff, im Reich gekaufte Ländereien mit quasifürstlichem Status auszustatten. Die Liechtensteins erwarben ihren Fürstentitel im frühen 17. Jahrhundert, kauften Vaduz aber erst 1699 und Schellenberg 1712. 4 Ent-
92
I. · Auferstehung und neues Leben 1648–1705
scheidend blieb die ursprüngliche Verleihung des Titels, den die Begünstigten von Anfang an führten, durch den Kaiser. Weniger Probleme gab es mit Grafen und Freiherren, da sie überhaupt kein Land im Reich besitzen mussten und als sogenannte Personalisten erhoben werden konnten. Manche brauchten aber auch gar kein zusätzliches Motiv, um in Ländereien im Reich zu investieren, galten diese doch lange Zeit als sicherer als Land in Ungarn oder selbst Böhmen. In manchen Fällen war Grundbesitz im Reich auch die einzige Möglichkeit, Kolonisten für von den Türken übernommenes neues Territorium zu finden, vor allem in Zeiten, da deutsche Fürsten sich alle Mühe gaben, ihre eigene Bevölkerung zu vergrößern und Auswanderung zu verhindern. 5 Zwar dominierten österreichisch-böhmische Magnaten den Wiener Hof, er bot jedoch auch eine Fülle von Möglichkeiten für Adlige aus dem Reich. 6 Besonders wichtig waren in dieser Hinsicht der Dienst in der Reichsarmee sowie hohe Positionen im Reichshofrat und den verschiedenen Kanzleien. Sowohl die Reichsarmee als auch der Reichshofrat beschäftigte Protestanten, wenn auch in letzterem Fall nicht getreu dem Prinzip konfessioneller Parität. Wie manche Österreicher Land im Reich erwarben, so akquirierten nach 1650 einige schwäbische, fränkische und rheinische Familien, begünstigt durch die Eroberungen im Südosten, Besitztümer auf habsburgischem Gebiet. Deutsche Familien wie Salm-Neuburg, Salm-Reifferscheidt, Löwenstein-Wertheim-Rochefort, Oettingen, Fugger und Fürstenberg etablierten sich in Österreich und Böhmen. 7 Deutsche Adlige mit Ländereien in Kroatien und anderswo waren ab dem späten 17. Jahrhundert ein gängiges Merkmal des Systems der Habsburger. Reichsdeutsche waren auch unter der wachsenden Anzahl von überwiegend ehrenamtlichen Geheimräten und adligen Kammerherren gut vertreten. Die Anzahl der Geheimräte stieg von zehn im 16. Jahrhundert auf 110 um 1700; nur wenige davon dienten tatsächlich im inneren Rat, der Konferenz. Ebenso entscheidend für die wachsende Größe des Hofs war nach 1600 die zunehmende Unterscheidung zwischen bezahlten und unbezahlten Amtsträgern. Eine kleinere Gruppe entlohnter Beamter leistete die notwendigen Dienste (etwa in den Gemächern, in der Kirche, bei Tisch – sogenannte Kammerherren ohne Schlüssel), während der Titel Kammerherr und der Schlüssel, der den Zugang zum Monarchen symbolisierte, wesentlich mehr Adligen verliehen wurde: Allein von 1654 bis 1685 ernannte Leopold I. mehr als 600. 8 Ehrentitel wie der eines Erzmarschalls der Kaiserin, der 1683 dem schwäbischen Fürstabt von Kempten, Rupert von Bodman, verliehen wurde, stärkten zudem bestehende Loyalitäten. Das galt auch für das Prädikat »adlig« und für das 1697 bestätigte Recht, neue Familien ins Patriziat von Nürnberg zu kooptieren. 9 Ob der Hof unter Leopold I. auf Kosten der protestantischen Adligen katholischer wurde, ist schwer zu sagen. Die Bedeutung der katholischen Frömmigkeit
9. Der Kaiserhof in Wien und dynastische Erhebungen im Reich
für den Kaiser persönlich wie für seine Herrschaft in den eigenen Ländern ist kaum zu bezweifeln. 10 1684 gab das päpstliche Sekretariat eine kommentierte Liste der Reichsfürsten in Auftrag, in der Hoffnung, einzelne davon für eine Konversion vom Luthertum zum Katholizismus zu gewinnen. 11 Es gibt jedoch keine Belege dafür, dass dieses Dénombrement je ernsthaft durchgeführt wurde. Die wenigen, manchmal politisch heftig umstrittenen Übertritte von Fürsten fanden eher in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts statt, nicht unter Leopolds Herrschaft. 12 Die Bikonfessionalität zog in der Reichspolitik einige Zwänge nach sich. Leopold scheint die daraus folgenden Regeln respektiert zu haben, ebenso der Erzbischof von Mainz als Erzkanzler und andere führende Amtsträger. Der Kaiser und der Kurmainzer Bischof setzten auf die Fürsten der Reichskirche und die säkularen Reichsfürsten, aber sie brauchten stets auch protestantische Verbündete. Deutsche Adlige am Wiener Hof und österreichisch-böhmische im Reich verflochten die Habsburger und ihre Länder mit dem Reich. Es war charakteristisch für Leopolds aktive Herrschaft im Reich, dass er bestrebt war, die Übertragung von Titeln zum Vorteil der Krone zu nutzen und seine Vorrechte als oberster Lehnsherr auszuüben. Nicht immer mit Erfolg: Die Erhebung der Heiligenberg-Linie der Grafen Fürstenberg zu Fürsten 1664 brachte die Brüder Franz Egon und Wilhelm Egon nicht von ihrem lebenslangen Eintreten für die französische Sache ab. 13 Der Fall Ostfriesland hingegen ist ein Beispiel für den meisterhaften Einsatz kaiserlicher Privilegien. 1662 wurden die lutherischen Grafen der Cirksena-Dynastie im Zuge der gleichzeitigen Erhebung der katholischen Fürstenbergs nobilitiert und ins Fürstenkollegium aufgenommen. 1678 verlieh Leopold dann den gemischt lutherischen und reformierten ostfriesischen Ständen ein Wappen, was ihren Rang erhöhte und ihnen kaiserliche Protektion verschaffte. 1681 wurde der Kurfürst von Brandenburg beauftragt, im reformierten Emden eine kaiserliche Garnison zu errichten. Zehn Jahre später verweigerte Leopold einem Erbvertrag der Cirksenas und Welfen die Anerkennung und 1694 übertrug er die ostfriesische Thronfolge an den brandenburgischen Kurfürsten. Das Ergebnis dieser Vorgänge war ein fein austariertes Gleichgewicht innerer Kräfte und auswärtiger Interessen mit endlosen Möglichkeiten für zukünftige Eingriffe des Kaisers als Richter und oberster Lehnsherr in einem bis dahin randständigen Territorium. Dass Karl VI. nicht fähig war, dieses Potenzial in der Krise der 1720er Jahre zu nutzen, zeigt seine eher eingeschränkte Kompetenz auf bestimmten Feldern der Reichspolitik im Gegensatz zu Leopolds Selbstsicherheit. 14 Wie die meisten Adligen benutzte Leopold schließlich auch seine eigene Familie als Herrschaftsinstrument und schmiedete per Verheiratung Allianzen mit dem Hochadel. 15 Das letzte Ehebündnis der Habsburger mit einer Fürstendynastie war das des späteren Ferdinands II. mit der Tochter des bayerischen Herzogs im Jahr 1600 gewesen. Damals war Ferdinand Erzherzog von Innerösterreich; niemand
93
94
I. · Auferstehung und neues Leben 1648–1705
ahnte, dass er jemals Kaiser werden könnte. Die Habsburger hatten lange generell jede Verbindung vermieden, aus der dem deutschen Adel ein Anspruch auf den Kaiserthron erwachsen konnte. Leopold selbst tat es seinem Vater nach, indem er erst eine spanische Prinzessin und dann eine Habsburgerin aus Innsbruck heiratete. Seine dritte Ehe, mit Eleonore von Pfalz-Neuburg, Ausgangspunkt einer Allianz mit einer bedeutenden katholischen Dynastie, bezeichnete eine signifikante Wende. Die Pfalz-Neuburg-Höfe in Neuburg an der Donau, Düsseldorf am Niederrhein und nach ihrer pfälzischen Erbfolge 1685 in Heidelberg wurden zu tragenden Säulen der kaiserlichen Politik. 16 Ebenso wichtig waren die Verknüpfungen mit den bayerischen Wittelsbachern: Kurfürst Max Emanuel wirkte als treuer kaiserlicher Befehlshaber in Ungarn und war ab 1686 durch die Ehe mit Leopolds ältestem Kind, der Erzherzogin Maria Antonia, sein Schwiegersohn. Dies war nicht nur in Sachen Reichspolitik sinnvoll, sondern für Habsburg die Grundlage für eine eventuelle spätere Übernahme von Bayern. 17 Aus geopolitischer Sicht genauso bedeutend war die Heirat von Leopolds Erben Joseph mit Ernst Augusts Nichte Wilhelmine Amalie von Braunschweig-Lüneburg. Ihr folgte die Ehe von Leopolds zweitem Sohn Karl mit Elisabeth Christine von Braunschweig-Wolfenbüttel, jener Linie also, die wegen der Verleihung der Kurwürde an das verwandte Haus Hannover gekränkt war. Die Hochzeit fand 1708 statt, zur gleichen Zeit wie die Aufnahme des Kurfürsten von Hannover ins Kurfürstenkolleg. Egal, was tatsächlich dabei herauskam (Maria Antonia starb 1692 und Max Emanuel schloss sich im Spanischen Erbfolgekrieg Frankreich an) – Heiraten mit fürstlichen Dynastien dienten jedenfalls dem Zweck, die kaiserliche Stellung im Reich zu stärken. Die Verbindung mit Braunschweig-Lüneburg ist als Beispiel für die Disparität zwischen Motiv und Ergebnis besonders signifikant. Josephs Braut war Katholikin, Karls Braut konvertierte vor der Eheschließung. Beide gehörten jedoch der überwiegend protestantischen Dynastie an, die Leopold als mögliches Gegengewicht zu Schweden und Brandenburg in Norddeutschland ins Auge gefasst hatte. 18 Das verhieß einiges an Problemen, weil die Familie historisch gespalten war und die Linien, die seit dem 13. Jahrhundert in diversen Kombinationen die Fürstentümer Wolfenbüttel, Calenberg, Grubenhagen und Lüneburg besessen hatten, in heftigem Widerstreit standen. 19 Durch die letzte Umverteilung von Territorium nach dem Aussterben der Linie Wolfenbüttel 1634/35 war Lüneburg in den Besitz aller vier Fürstentümer gelangt; man einigte sich indes bald auf eine weitere Gebietsneuverteilung zwischen dem verminderten Fürstentum Wolfenbüttel auf der einen und Calenberg (Hannover) sowie Lüneburg (Celle) auf der anderen Seite. 20 In Calenberg und Lüneburg regierten ab 1641 die vier Söhne von Herzog Georg (1636–1641), sie blieben aber dessen letztem Willen gemäß separat. Zur dominanten Figur entwickelte sich der jüngste Sohn Ernst August, ab 1661 Fürstbischof
9. Der Kaiserhof in Wien und dynastische Erhebungen im Reich
von Osnabrück und ab 1679 Herzog von Calenberg. Zu Beginn seines Aufstiegs hatte er sich die Hand der eigentlich zur Braut seines älteren Bruders Georg Wilhelm von Celle erwählten Sophie von der Pfalz gesichert, der Enkelin von James I., wodurch die Linie Hannover schließlich Anspruch auf die englische Thronfolge erwarb. Bis in die späten 1690er Jahre war dies kein ernsthaftes Thema; bis dahin bemühte sich Ernst August, seiner Linie Calenberg (Hannover) die drei älteren Braunschweiger Fürstentümer und die Primogenitur zu sichern sowie den Status seiner Länder in einer Region zu stärken, die dominiert war von Brandenburg und seinen Beziehungen zur Niederländischen Republik. 21 Ein Kernelement dieser Strategie war strikte Loyalität zur Krone; 1688 führte er persönlich eine beträchtliche Streitmacht zur Verteidigung des Reichs gegen die Franzosen. Aus seinem Streben nach der Kurwürde machte Ernst August zu dieser Zeit kein Hehl mehr. 22 Die in der Goldenen Bulle festgeschriebene Anzahl von sieben Kurfürsten war 1648 ohnehin durchbrochen worden. Die Erbfolge einer katholischen Linie in der Pfalz lieferte dann 1685 gute Argumente für die Schaffung einer weiteren protestantischen Kurwürde zur Wiederherstellung des konfessionellen Gleichgewichts. Brandenburg brachte das Thema 1690 bei der Wahl von Joseph I. zum Römischen König auf die Tagesordnung, zeigte sich aber ebenso wie Sachsen skeptisch. Leopold selbst reagierte anfangs zurückhaltend. Der gewaltsame Griff Georg Wilhelms von Celle nach den Ländereien des 1689 erloschenen Hauses Sachsen-Lauenburg stellte einen schwerwiegenden Bruch des kaiserlichen Rechts dar, das vakante Lehen an die Krone heimfallen oder den Reichshofrat einen Bewerber dafür auswählen zu lassen. 23 Ernst August liebäugelte offen mit einem Bündnis mit Frankreich und unternahm Schritte zur Gründung einer dritten Partei gegen den Kaiser. Gleichzeitig versprach er 6.000 Soldaten für die ungarische Front, deutete an, den Katholiken in Hannover Glaubensfreiheit zu gewähren, und wollte für seine Erhebung auf das Amt des Fürstbischofs von Osnabrück verzichten. 1692 einigte man sich und Leopold gab seine Einwilligung. Die Lösung war in gewisser Weise genial. Leopold gewann einen Partner in Norddeutschland und einen »ewigen« Verbündeten im Reich, der den österreichischen Anspruch auf die spanische Thronfolge zu unterstützen und den Katholiken in seinen eigenen Ländereien Glaubensfreiheit zu gewähren versprach. Andererseits erregte die Erhebung von Ernst August heftige Gegenwehr unter dessen Wolfenbütteler Verwandten und im Reich allgemein. 1700 wollte Anton Ulrich von Wolfenbüttel gar Frankreich und Schweden als Garantiemächte des Westfälischen Friedens anrufen, um die Verleihung der Kurwürde an Hannover zu verhindern. Der Herzog von Württemberg protestierte wütend, die Übertragung des Ehrenamts eines Erzbannerträgers an Hannover beraube seine eigene Dynastie eines Titels, den sie seit unvordenklichen Zeiten trage. 24 Es gelang erst 1708, Hannovers Zulassung zum Kurfürstenkolleg zu erreichen (zugleich mit der »Wiederaufnahme«
95
96
I. · Auferstehung und neues Leben 1648–1705
von Böhmen, die die kaiserliche Stellung weiter stärkte), und Wolfenbüttel und andere Fürsten akzeptierten die Würde erst viel später. Dann dauerte es nicht mehr lang, bis die Beziehungen zwischen Wien und Hannover problematisch wurden: Als Kurfürst Georg Ludwig 1714 als George I. den englischen Thron bestieg, entstand eine neue Situation, in der tiefe Interessensgegensätze zutage traten, obwohl beide Seiten bemüht waren, gemeinsame Ziele im Auge zu behalten. Kern des Problems war, dass der Kurfürst von Hannover zum souveränen Monarchen wurde. Was Leopolds Nachfolger gut zwanzig Jahre nach der Schaffung der neunten Kurwürde mit George I. erleben mussten, erfuhr Leopold mit einigen von Ernst Augusts Zeitgenossen am eigenen Leib. Einerseits war die Enttäuschung der Hoffnungen der Kurfürsten auf monarchischen Status nie ganz verflogen. Andererseits wurde die wachsende Macht der armierten Fürsten immer deutlicher.Wie entscheidend ihr militärischer Beitrag für das Reich und auswärtige Mächte war, von denen sie enorme Subsidien bezogen, wussten sie nur zu gut. Die meisten von ihnen zürnten, weil sie von europäischen Friedensverhandlungen ausgeschlossen blieben oder zumindest nicht auf einer Ebene mit den gekrönten Häuptern verhandeln durften. In Zeiten, da die Republiken Venedig und Niederlande entschiedene Forderungen nach Gleichwertigkeit mit Europas Monarchien erhoben, war es für die mächtigeren deutschen Fürsten nur logisch, ebenso zu handeln. Ende des 17. Jahrhunderts kam es zu einer Reihe von Versuchen, königlichen Status zu erlangen, befeuert auch durch Leopolds inflationären Umgang mit Titeln, vor allem die Schaffung der hannoverschen Kurwürde und die Ernennung des Großherzogs der Toskana (1691) und des Herzogs von Savoyen (1693) zu »Königlichen Hoheiten«. 25 Eheschließungen deutscher Fürstendynastien und ausländischer Königshäuser waren bestenfalls eine unsichere Langzeitstrategie. Aufgrund ihrer niedrigeren Stellung heirateten deutsche Fürsten kaum je in die direkte Erbfolgelinie. Dennoch war ein Pfalzgraf von Pfalz-Zweibrücken-Kleeburg als Karl X. schwedischer König geworden, ebenso wie 1720 ein Landgraf von Hessen-Kassel, und den Ehen der Kinder von Peter dem Großen von Russland mit verschiedenen norddeutschen Dynastien entsprangen Peter III. (von Holstein-Gottorp) und Katharina die Große (von Anhalt-Zerbst und Holstein-Gottorp). 26 Für die dringenderen Bestrebungen der 1690er Jahre mussten andere Wege gefunden werden. 1696 zeigten mehrere deutsche Fürsten Interesse an einer Wahl auf den polnischen Thron, so etwa Ludwig Wilhelm von Baden-Baden (der Brandenburger Kandidat) und der Kurfürst von Bayern, neben den ursprünglichen Kandidaten aus den Häusern Pfalz-Neuburg und Lothringen. 27 In Wien einigte man sich schließlich auf Friedrich August von Sachsen, dessen Wahl mit hohen Schmiergeldsummen und dem Übertritt des Kurfürsten zum Katholizismus erkauft wurde. Das Problem der gleichzeitigen Wahl des französischen Kandidaten Fürst
9. Der Kaiserhof in Wien und dynastische Erhebungen im Reich
Conti löste man, indem der Sachse eilends die Residenz besetzte, ehe Conti auch nur Frankreich verlassen hatte. Für sein sächsisches Kurfürstentum hatte Friedrich Augusts Konversion keine Konsequenzen; vielmehr würdigte die Kongregation in Dresden die Erhöhung ihres Herrschers durch lautstarkes Absingen von Luthers Hymne Ein’ feste Burg ist unser Gott. Sachsen blieb lutherisch und der Kurfürst behielt sogar den Vorsitz des Corpus Evangelicorum im Reichstag. 28 Entgegen katholischen und lutherischen Befürchtungen veränderte sich durch seine Herrschaft als katholischer König August II. von Polen im Reich zunächst kaum etwas – ein weiteres Anzeichen für die Stabilität des gesetzlichen Rahmens von 1648, der es Herrschern ausdrücklich untersagte, die konfessionelle Identität ihrer Territorien zu ändern. Auf lange Sicht jedoch schwächte der Übertritt unweigerlich die traditionelle sächsische Führungsmacht unter den Protestanten und begünstigte die Kurfürsten von Brandenburg, die bis zur Herrschaft des Großen Kurfürsten (1640–1688) für gewöhnlich der sächsischen Linie gefolgt waren. Um die gleiche Zeit strebten drei weitere Fürsten nach der Königswürde. Die Träume des Kurfürsten Johann Wilhelm von der Pfalz von einem Königreich in den Spanischen Niederlanden, in Armenien (1698–1704) oder am Mittelmeer (Sizilien, Sardinien und die Balearen) waren eher Hirngespinste. 29 Brandenburg und Bayern hatten ernster zu nehmende Pläne; im September 1696 schlossen die beiden Kurfürsten ein Abkommen zur gegenseitigen Unterstützung ihres Strebens nach einem Königsthron. 30 Max Emanuel von Bayern scheiterte in Polen. Karl II. setzte 1698 seinen Sohn Joseph Ferdinand als Thronfolger ein, aber dessen Tod im Jahr darauf durchkreuzte seinen Plan. Die Statthalterschaft der Spanischen Niederlande, die er 1691 erhielt und die ihm in Brüssel wie ein Monarch zu leben gestattete, war kein echter Trost. Dass sich Leopold 1701 weigerte, Max Emanuels Forderung nach einem Anteil am spanischen Erbe (etwa Neapel und Sizilien oder die Spanischen Niederlande), verbunden mit einem Königstitel, zu erfüllen, trieb ihn schließlich in die Arme der Franzosen. Das Versprechen Ludwigs XIV., den neuen Territorien im Reich die Königswürde zu übertragen, führte Bayern im Spanischen Erbfolgekrieg jedoch in die Katastrophe. 31 Mehr Erfolg hatte Brandenburg. 32 Der Kurfürst regierte bereits seit 1660 souverän im Herzogtum Preußen und seit 1683 in der kleinen brandenburgischen Kolonie Groß Friedrichsburg an der afrikanischen Goldküste. 33 Von Beginn seiner Herrschaft 1688 an machte Friedrich III. aus seinem Streben nach einem Königstitel kein Geheimnis. Er war der erste deutsche Fürst, der ein ausgeklügeltes Programm »königlicher« Bauvorhaben in Angriff nahm. Bei seinem Regierungsantritt bremste er unverzüglich die Erweiterungspläne seines Vaters für die Berliner Residenz zugunsten eines völlig neuen Palasts und begann mit den Planungen für die Akademien der Künste (1696) und der Wissenschaften. 34
97
98
I. · Auferstehung und neues Leben 1648–1705
Der Königstitel selbst war schwerer zu erlangen. 1694 hatte Leopold Friedrichs Antrag abgeschmettert. Beim zweiten Anlauf 1700 betonte er, die Erhebung von Monarchen werde Leopolds eigene Stellung verbessern. Schließlich beschloss Friedrich seine Krönung im Alleingang voranzutreiben, achtete jedoch strikt auf legale Korrektheit, was das Reich betraf, indem er sich nicht »König von Preußen«, sondern »König in Preußen« nannte, weil das Herzogtum Preußen ein ehemaliges polnisches Lehen außerhalb der Reichsgrenzen war. 35 Als Kurfürst von Brandenburg – den Titel behielten er und seine Nachfolger bis 1806 bei – ersuchte er dennoch um Leopolds rückwirkende Anerkennung, die er als Lohn für seinen Bund mit dem Kaiser 1686 sowie für seine Zustimmung zur neunten Kurwürde (Hannover) und der Wiederaufnahme Böhmens ins Kurfürstenkolleg auch erhielt. Friedrich der Große schrieb später, sein Großvater habe die Krone lediglich aus persönlicher Eitelkeit und seinem Hang zur protzigen Selbstdarstellung gewollt.Vor dem Hintergrund der Brandenburger Politik ab 1648 und ähnlicher Bestrebungen anderer deutscher Fürsten jener Zeit war die Entwicklung indes nur logisch, ebenso wie die von vielen anderen, auch den Habsburgern, übernommenen Investitionen in neue »programmatische« Bauvorhaben, die Status und Aspirationen des Herrschers so wirkungsvoll zeigten wie irgendein Brief, Kommuniqué oder Pamphlet. Nicht, dass Friedrich III. von Brandenburg (König Friedrich I. in Preußen) sich vom Reich oder aus der Lehnherrschaft des Kaisers lösen wollte. Im Reich blieb er ein treuer Vasall des Kaisers, ersuchte sogar um dessen Anerkennung für seine Unternehmungen außerhalb. Die kaiserliche Legitimation des Königstitels war für Brandenburg absolut entscheidend. Ebenso wichtig war für Wien, dass der Kaiser weiterhin als oberster Lehnsherr anerkannt wurde. Zugleich veränderten der erhöhte Status des Kurfürsten und die neu erworbenen Königstitel anderer Fürsten auf subtile Weise das Verhältnis zwischen dem Kaiser und seinen Vasallen. Der größte Störenfried im Reich um 1700 war nicht der Kurfürst von Brandenburg, sondern der von Bayern. Dessen auf der Zusage eines im Reich zu schaffenden Königreichs beruhendes Abkommen mit Frankreich führte zu einem Verfahren wegen Hochverrats; mehrere Jahrzehnte später erhob sein Nachfolger erfolgreich, wenn auch nur kurzfristig, Anspruch auf den Kaiserthron. 36 Brandenburg hingegen blieb zumindest vorläufig loyal. Alles in allem stärkte die Titelinflation während der Herrschaft Leopolds I. dessen Macht über das Reich und war sicherlich ein wesentliches Element seiner Politik als oberster Lehnsherr. Der Aufstieg einiger Fürsten zu Königen machte es seinen Nachfolgern indes schwer, die Dinge auf ähnliche Weise zu regeln. Selbst die Solidarität der Kurfürsten untereinander litt unter den Versuchen der königlich Gekrönten, ihren neuen Status im Reich geltend zu machen. 37 Leopolds Nachfolger fanden das Reich weniger lenkbar als er auf dem Zenit seiner Macht, und keiner von ihnen erreichte je die Autorität, die er einer siebenundvierzigjährigen, von
9. Der Kaiserhof in Wien und dynastische Erhebungen im Reich
bedeutenden militärischen Erfolgen im Osten und der Verteidigung des Reichs im Westen geprägten Herrschaft verdankte. Ihre Ansprüche waren nicht geringer, aber der Hintergrund, vor dem sie sie durchzusetzen versuchten, weniger günstig.
Anmerkungen 1 Klueting, Reich, 94 f. 2 Winkelbauer, Ständefreiheit I, 183. 3 Press, »Kaiserliche Stellung«, 61; Schlip, »Fürsten«; Evans, Making, 169–174; Winkelbauer, Ständefreiheit I, 194 ff.; Wilson, Reich, 44 f.; im Fall der Thurn und Taxis 1753 galt das Reichspostwesen als kaiserliches Lehen, von Kaiser Matthias 1615 verliehen und 1621 von Ferdinand bestätigt; allerdings qualifizierten sie sich 1786 durch den Erwerb der unmittelbar darauf gefürsteten Grafschaft Friedberg-Scheer, deren Herrscher somit in den Kreis der Reichsfürsten erhoben wurde; Philipp IV. von Spanien hatte dem Haus Taxis um 1635 das Recht verliehen, sich Grafen de la Tour et Valsassina zu nennen, und damit die behauptete Abstammung der Familie von den Mailänder Torriani bestätigt, den Hauptgegnern der Visconti im 12. und 13. Jahrhundert. 1649 durften sie in Spanien den Doppelnamen Thurn und Taxis verwenden, 1650 auch im Reich. Zu dieser Zeit waren sie bereits zu erblichen Freiherren (1608) und Reichsgrafen (1624) erhoben worden. Vgl. Köbler, Lexikon, 712, und Grillmeyer, Habsburgs Diener, 26 ff., 32 f. 4 Noflatscher, »Liechtenstein«, 149 ff. 5 Schilling, »Ansiedlung«, 46–49. 6 Schindling, »Leopold I.«, 178 f.; Pečar, Ökonomie, 31–41, betont, dass während der Herrschaft Karls VI. nur 15 Prozent aller adligen Kammerherren am Kaiserhof, 26 Prozent der Geheimräte und 33 Prozent der Mitglieder des Reichshofrats aus dem Reich stammten. 7 Winkelbauer, Ständefreiheit I, 196, 199, 407; Klueting, Reich, 92–95. 8 Winkelbauer, Ständefreiheit I, 189 f.; Ferdinand II. ernannte von 1617 bis 1637 670 Kammerherren, Ferdinand III. zwischen 1615 und 1657 deren 280; Duindam, Vienna, 69–89, bietet ebenfalls einen Überblick. 9 Schindling, »Leopold I.«, 177. 10 Evans, Making, 283–286, 419–446; Winkelbauer, Ständefreiheit II, 185–239; auf unterschiedliche Weise widmen sich dem Thema auch: Coreth, Pietas; Goloubeva, Glorification; Pons, Herrschaftsrepräsentation; Schumann, Sonne. 11 Peper, Konversionen, 30–44 (35–44 zum Dénombrement). 12 Christ, »Fürst«, sowie S. 182. 13 Mauerer, Reichsadel, 309–315. 14 Schindling, »Leopold I.«, 177; Wilson, German Armies, 223 f.; Hughes, Law, 123–155, 240– 258, 265–268; Kappelhoff, Regiment. 15 Klueting, Reich, 89 f.; Schindling, »Leopold I.«, 174 f. 16 Schnettger, »Kurpfalz«; vgl. auch S. 86 f. 17 Bernard, Joseph II., 7; Hanfstaengl, Amerika, 15–35. 18 Press, »Kurhannover«, 53–57; Römer, »Kaiser«, 43–52. 19 1345–1495 gab es ein fünftes Fürstentum, Göttingen, das dann in Calenberg aufging. 20 Grubenhagen wurde 1617 mit Lüneburg und sodann 1665 mit Calenberg vereint. Die Stadt Braunschweig hielten alle Linien gemeinsam bis 1671, dann ging sie an Wolfenbüttel. Ab
99
100
I. · Auferstehung und neues Leben 1648–1705
21 22 23 24
25 26 27 28 29
30 31
32 33 34 35 36 37
1635 lag Wolfenbüttels Kodirektorat des Kreises Niedersachsen beim jeweils ältesten regierenden Fürsten der Dynastie.Vgl. Köbler, Lexikon, 88–92; Sante, Geschichte, 366–369. Celle fiel 1705 an Hannover. Aretin, Altes Reich II, 54–66; vgl. auch S. 67. Ansprüche erhoben in diesem Fall auch Mecklenburg, Anhalt, Baden und Schweden. Der neue Kurfürst erhielt schließlich den Titel »Kaiserlicher Erzschatzmeister«, da die Pfalz ihren ursprünglichen (1623 an Bayern verlorenen) Titel »Kaiserlicher Erztruchsess« zurückerhielt, als Bayern 1706 die Kurwürde entzogen wurde. Mit Bayerns Restitution 1714 musste Hannover den Titel abtreten und erhielt keinen Ausgleich, weil die Dynastie das Amt eines Erzstallmeisters als unwürdig ablehnte. 1779 erhielt sie den Titel des Erzschatzmeisters zurück, als der Kurfürst der Pfalz Bayern erbte und sich mit dem einzelnen (und ursprünglichen) Amt der Wittelsbacher als Erztruchsess zufriedengab. Die Titel hatten ausschließlich zeremoniellen Gehalt, bedeuteten den Kurfürsten aber dennoch viel, weil sie in dieser Funktion an Kaiserkrönungen teilnahmen. Die Rangordnung begann mit dem Reichserzkanzler (Mainz), gefolgt von den Erzkanzlern für Italien (Köln) und Burgund (Trier), dem Erzmarschall (Sachsen), Erzkämmerer (Brandenburg), dem Erzmundschenk (Böhmen), dem Erztruchsess (1648 für die Pfalz eingeführt). Conrad, Rechtsgeschichte II, 95; Aretin, Altes Reich I, 66 f.; die Ansprüche Württembergs beleuchtet Burr, »Reichssturmfahne«. Tatsächlich wurde der Herzog von Savoyen 1713 König; Duchhardt, Altes Reich, 26 f. Allerdings musste Katharina die Große ihren Gatten Peter III. absetzen und ermorden, um den Thron besteigen zu können. Erdmannsdörffer, Geschichte II, 86–95, bietet eine anschauliche Darstellung; vgl. auch Stone, Polish-Lithuanian State, 247 f. Das Stimmrecht Kursachsens in Regensburg wurde von einer Gruppe lutherischer Räte aus Dresden ausgeübt. Meyer, Rhein, 35–40; Müller, »Kurfürst Johann Wilhelm«, 10 f., 13 f., 20; das armenische Projekt kam durch einen armenischen Militärzulieferer in Gang, der 1695 in der Pfalz in Haft kam und den Kurfürsten überredete, ihn als Botschafter nach Armenien zu schicken. Er kehrte mit dem Gesuch einer Gruppe armenischer Malik-Adliger um Beistand zur Befreiung von der türkischen Herrschaft zurück. Der Kurfürst plante mehrere Tausend Mann über Böhmen, Polen, Moskau und das Kaspische Meer nach Tabriz zu entsenden. 1704 wurde das Vorhaben mangels Unterstützung von Leopold, der Armenien zum russischen Einflussgebiet zählte, fallen gelassen. Aretin, Altes Reich II, 70. Herzog Eberhard Ludwig von Württemberg wollte sich 1711 mit französischer Hilfe ebenfalls zum »König von Franken« krönen lassen und griff damit ähnliche Pläne aus der schwedischen Periode der 1630er Jahre auf; Wilson, War, 22; vgl. auch S. 140 f., 143, 148 ff. Duchhardt, »Königskrönung«, 82–85. Duchhardt, »Afrika«, 122 f.; vgl. auch S. 314. Benedik, »Architektur«, 103–106; Braunfels, Kunst I, 109–117. Duchhardt, »Königskrönung«. Vgl. S. 97, 140 f., 148 ff. Pečar, »Höfische Gesellschaft«, 188–197.
10. Das Wesen des Reichs: Projekte und Kultur
I
n der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts entstand eine große Bandbreite an Literatur zur Reform und weiteren Entwicklung des Reichs. Die Debatte wurde nun kontinuierlicher geführt und mehr Autoren als in zurückliegenden Epochen nahmen daran teil. Die Konfessionsspaltung überwand man dabei bewusst, wobei protestantische Autoren weiterhin überwogen. Öffentliches Recht wurde an katholischen Universitäten nicht vor 1720 unterrichtet und in Wien blieb die alte Idee der translatio imperii, die Theorie vom Übergang des römischen Kaisertitels via Byzanz auf die Franken und dann die Deutschen, bis ins 18. Jahrhundert prägend. 1 Dennoch begannen katholische Autoren nun an der breiteren Debatte über Reformen teilzunehmen und zeichneten verantwortlich für einige der gewagteren Entwürfe zur weiteren Entwicklung des Reichs. Wichtige Initiativen zur Förderung der Reichseinheit entstanden in Mainz und dann in Wien. Einige der Reformer, die in der Zeit vor 1665 am Hof von Johann Philipp von Schönborn in Mainz begonnen hatten, tauchten nun in Wien wieder auf oder ihre Schüler und Mitarbeiter trugen ihre Ideen weiter. Der Friede von 1648 machte mit einer Liste zukünftig zu bearbeitender Themen – den negotia remissa – eine breite Debatte über eine Reichsreform fast unausweichlich. Drei weitere Faktoren kamen hinzu. Die Diskussionen fanden ein Forum im Reichstag, der ab 1663 zur ständigen Institution wurde und für dessen Beratungen Pamphlete eine wesentliche Rolle spielten. 2 Die zweimal wöchentlich stattfindenden Sitzungen waren recht kurz und weniger von Debatten bestimmt als vom Abgleich von Instruktionen und Meinungen aus den Reichsständen. Die Abgeordneten konnten nur arbeiten, soweit sie instruiert waren, und mussten sich immer wieder bei ihren Auftraggebern rückversichern. Dabei wurde das gedruckte Pamphlet zum wichtigen Mittel der Kommunikation zwischen den Regierungen. Zweitens brachten die auswärtigen Kriege spezifische Reformvorschläge und fundamentale konstitutionelle Fragen hervor. Drittens war die Selbstdarstellung des Kaisers in Wien und im Reich schon für sich Teil eines Reformprogramms. Die Präsentation des Kaisers als einigende Kraft im Reich zog eine Reihe führender Intellektueller und schöpferischer Geister nach Wien und ließ viele in ihm und seinem Hof das Zentrum eines erneuerten und erweiterten imperialen Systems sehen. 3 Die Themen der Reformdebatte nach 1648 reichten über die naheliegenden politischen und konstitutionellen Probleme hinaus und betrafen auch Militär und
102
I. · Auferstehung und neues Leben 1648–1705
Wirtschaft, die Frage der Wiedervereinigung der Konfessionen und Pläne zur Bildung nationaler oder kaiserlicher Akademien. Viele Autoren zeigten Interesse an mehr als einem dieser Punkte. Leibniz, einer der produktivsten Kommentatoren seiner Zeit, führte sie in seinen weitreichenden Reflexionen alle zusammen. 4 Er war bei Weitem nicht der Einzige, der glaubte, die diversen Reformfragen seien allesamt Aspekte der generellen Frage nach dem Wesen des Reichs und seinen Möglichkeiten. Wegen ihrer auffallenden Neuartigkeit sind die ökonomischen, religiösen und akademischen Ansätze jedoch eine separate Betrachtung wert, bevor wir uns den allgemeinen Interpretationen des Reichs und seiner Verfassung zuwenden, die auf ihnen beruhten. Vorschläge für Wirtschaftsreformen waren direkt mit Wien und der Frühzeit der Herrschaft von Leopold I. verbunden. Die Notwendigkeit, die Wirtschaft nach drei Jahrzehnten Krieg wieder in Gang zu setzen, und die Erörterung breit angelegter Maßnahmen zum Wiederaufbau nach dem Krieg bildeten ab Mitte der 1660er Jahre den Hintergrund der intensiven Auseinandersetzung mit dem sogenannten Reichsmerkantilismus. 5 Führende Figuren dieser Bewegung waren Johann Joachim Becher (* 1635, † 1682), Philipp Wilhelm von Hörnigk (* 1640, † 1714) und Wilhelm von Schröder (* 1640, † 1699). Alle drei kamen aus Mitteldeutschland nach Wien; allerdings zog Hörnigk später nach Wien, als sein Arbeitgeber, Graf Lamberg, dort zum Fürstbischof gewählt wurde. Alle drei waren vom Luthertum zum Katholizismus konvertiert. Ein wichtiger Patron in Wien, besonders für Becher, aber auch für die anderen, war der spanische Franziskanerbischof Christoph de Royas y Spínola, seit 1660 Beichtvater am Kaiserhof und mehrmals als kaiserlicher Bevollmächtigter in politischen, ökonomischen und religiösen Angelegenheiten an verschiedene deutsche Höfe entsandt. 6 Becher war der produktivste aller Reformer. Es gab kaum einen Aspekt der menschlichen Existenz, für den er keine Verbesserungsvorschläge parat hatte: eine Währungsreform, Pläne für Manufakturen, Handelsfirmen und Kolonien, Rezepte für Elixiere, Entwürfe für U-Boote und ein Perpetuum mobile, einen Vorschlag zur Umwandlung von Donausand in Gold, Erziehungsreformen und neue Sprachen. 7 Becher verfasste dazu nicht nur umfangreiche Schriften, sondern trieb die Umsetzung aktiv voran, erst in den 1660er Jahren an verschiedenen deutschen Höfen, dann ab 1670 in Wien, bis er 1677 in Ungnade fiel. In den 1660er Jahren war er zum Beispiel verantwortlich für die ersten deutschen Kolonialprojekte. 8 Ein Münchner Plan zum Kauf von Land in Guyana von der Niederländischen Westindienkompanie 1664 führte zu keinem Ergebnis. 1669 ermutigte Becher Graf Friedrich Casimir von Hanau-Münzenberg, Land von der Kompanie zu erwerben, um zwischen Amazonas und Orinoco eine deutsche Küstenkolonie zu errichten, die gewaltige Geldsummen verschlang, bis die Verwandten des Grafen diesen absetzten und das Projekt zusammenbrach. 9 Derartige Vorhaben waren von vorn-
10. Das Wesen des Reichs: Projekte und Kultur
herein zum Scheitern verurteilt, ebenso wie das Unternehmen, das 1660/61 im Auftrag des Kaisers und des Kurfürsten von Brandenburg durch Markgraf Hermann von Baden, Spínola und Admiral Gijsel van Lier in die Wege geleitet wurde und vorsah, auf spanischem Land in Südamerika eine Kolonie zu gründen. Ihr Scheitern spornte Becher und seine Schüler indes nur noch mehr an, das Problem anzugehen, in dem sie zunehmend die Wurzel aller Schwierigkeiten sahen: den Mangel an Einheit und Koordination im Reich. Angesichts der Schwäche des deutschen Außenhandels hatten der Schutz und die Förderung einheimischer Manufakturen oberste Priorität. Solche Ideen und Unternehmen gewannen vor dem Hintergrund der Reichstagsdiskussionen über die Regulierung der Gilden und den Status von Produzenten und Händlern zwischen 1666 und 1672 an politischer Bedeutung. Der Konflikt mit Frankreich nach 1672 und die Verhängung des ersten Boykotts auf französische Waren verliehen den Plänen von Becher, Spínola und anderen echte nationale Dringlichkeit. 1677 wurde Becher auf Reisen durchs Reich geschickt, um zu versuchen, ein komplettes Embargo gegen Geschäfte mit Frankreich durchzusetzen. 10 Das Versprechen, durch Konfiskation französischer Güter fünf Millionen Gulden für den Kaiser einzutreiben, wurde sein Ruin. 11 Als das Geld ausblieb, beschuldigten Bechers Gegner in Wien ihn der Untreue und er musste gehen. Seine Arbeit setzte er in den Niederlanden fort, landete dann in England und starb 1682 in London. Bechers Platz in Wien hatten mittlerweile Spínola, Hörnigk und von Schröder eingenommen. Vor allem Spínola verfügte über unerreichte Erfahrungen in der Ausarbeitung imperialer Reformvorhaben: 1665 hatte er in München sein »Projekt zur wirtschaftlichen Vereinigung des Reichs« vorgestellt, in dem es im Grunde um eine protektionistische Zollunion ging. 1674/75 schickte ihn Leopold auf ausgedehnte Reisen durchs Reich und zu den größeren Höfen; 1677 weilte er in Berlin, um Heiratspläne der Häuser Habsburg und Brandenburg zu erörtern. 12 Ihren Höhepunkt erreichten Spínolas Unternehmungen im September 1678, ein Jahr nach Bechers Scheitern, als er auf einer fast zwölfmonatigen Mission um Unterstützung für neue Vorschläge warb, um die Steuereinnahmen zu erhöhen und die ökonomische und religiöse Einheit voranzutreiben. Die Idee einer allgemeinen Erbschaftssteuer zur Sicherstellung dauerhafter Erträge war nach dem Türkenkrieg 1663/64 aufgekommen. 1678 holte man den Plan wieder hervor, verbunden mit einem Programm zur Koordination von Rohstoffförderung und Industrie, zur Errichtung staatlich finanzierter Fabriken wie der Seidenspinnerei Sinzendorf im niederösterreichischen Walpersdorf und Bechers Fabrik in der Taborstraße in Wien sowie zur Importkontrolle und Exportförderung. 13 Sogar die Bildungsreisen junger Adliger ins Ausland (die Kavalierstour, ein Vorläufer der Grand Tour des 18. Jahrhunderts) sollten eingeschränkt werden, um den Abfluss von Kapital zu
103
104
I. · Auferstehung und neues Leben 1648–1705
verhindern. Der Tyrannei wechselnder Moden, insbesondere der unersättlichen Gier nach französischer Kleidung, wollte man durch die Einführung von Uniformen für Frau und Mann entgegenwirken, die allen Höfen genehm sein und dann nicht mehr ohne allgemeine Zustimmung verändert werden sollten. Spínola stieß auf großes Interesse, vor allem in Reichsstädten wie Augsburg, aber auch unter den rheinischen Kirchenfürsten, in Franken und Hessen und bei den Herzögen von Braunschweig und Sachsen. In Bamberg steuerte Bischof Peter Philipp von Dernbach den Vorschlag bei, die Warenproduktion generell unter Lizenz des Reichs zu stellen. Das werde alle Länder veranlassen, nur Güter herzustellen, für die sie über die Rohstoffe verfügten. Bei allem Respekt und Enthusiasmus, mit dem Spínolas Pläne bedacht wurden – sie führten doch zu nichts. Die erneuerte Allianz des Großen Kurfürsten mit Frankreich verhinderte seine Reise nach Berlin. Die geplante Erbschaftssteuer fiel bald wieder unter den Tisch, ebenso wie die ambitionierten Vorhaben zur Reichsökonomie. In den folgenden Jahrzehnten führten die Kriege gegen Frankreich zu weiteren Handelssperren, manchmal weitergehend als die erste von 1676. Der Übergang von Kriegsrestriktionen zu einer Regulierung in Friedenszeiten gelang jedoch nie. Das Scheitern dieser Initiativen regte Hörnigk zu seinem Traktat Österreich über alles, wann es nur will (1684) an, das in den folgenden hundert Jahren vierundzwanzig Auflagen erreichte. Spätere Generationen verstanden es oft als Manifest des österreichischen Nationalismus, als Behauptung einer österreichischen Identität jenseits des Reichs. 14 Aber Hörnigk ging es vielmehr um das Reich selbst und den Beitrag, den Österreich dazu leisten konnte. Der Titel verwies auf das kurz zuvor erschienene anonyme Pamphlet Teutschland über Frankreich, wenn es klug seyn will. 15 Hörnigks Kernargument war, dass bislang alle Versuche eines umfassenden Handelsembargos gegen Frankreich erfolglos geblieben waren. Es sei an der Zeit, dass Österreich den Weg weise. »Österreich« stand dabei für alle Länder der österreichischen Habsburger innerhalb und außerhalb des Reichs, auch Ungarn. Das Gleichgewicht zwischen Landwirtschaft in Ungarn und kommerzieller Industrie in Böhmen und Österreich sollte als Vorbild einer integrierten Ökonomie dienen, als Primum mobile, dessen Beispiel die anderen deutschen Territorien nacheifern könnten. 16 Die Wirkung der Reichsmerkantilisten ist schwer abzuschätzen. Ihre großen Pläne für das Reich scheiterten. Selbst in Österreich überlebten nur wenige ihrer Projekte. 17 Aber ihre rastlose Projektarbeit und die unermüdlichen Missionsreisen trugen zweifellos viel zur Verbreitung ökonomischen Denkens im ganzen Reich bei. 18 Becher war vielleicht der radikalste Propagandist eines deutschen Nationalstaats seiner Zeit. 19 Er und die anderen Reformer waren maßgeblich an der Schaffung eines gesellschaftlichen Klimas beteiligt, in dem Territorialregierungen ihre Politik auf die Förderung des Wirtschaftswachstums richteten. Sie machten be-
10. Das Wesen des Reichs: Projekte und Kultur
wusst, was man mit einer Regelung und Förderung von Industrie und Handel erreichen konnte. Auf Reichsebene fanden ihre Argumente nur in Verbindung mit der Kriegsgesetzgebung Widerhall. In den Kreisen, Territorien und Städten zogen viele daraus Schlüsse für die Wirtschaftspolitik in Friedenszeiten. Die Pläne für eine religiöse Wiedervereinigung waren ebenso unergiebig, obwohl die Gespräche länger dauerten. Ideen dieser Art kursierten seit der Reformation und hatten in den diversen religiösen Kolloquien des 16. Jahrhunderts stets eine Rolle gespielt. Im Dreißigjährigen Krieg hatte der lutherische Theologe Georg Calixt (* 1586, † 1652) aus Helmstedt eine Glaubenslehre entwickelt, die die christlichen Konfessionen auf Grundlage der apostolischen Lehren zu versöhnen versuchte. 20 Sein Ziel war gegenseitige Anerkennung und Akzeptanz der Unterschiedlichkeit auf der Basis eines gemeinsamen Korpus christlicher Glaubensgrundsätze. Während es Calixt ganz allgemein um Versöhnung und Toleranz ging, waren die Initiativen der Zeit nach 1648 eher auf Wiedervereinigung in einer einzigen Reichskirche gerichtet. Die konstitutionelle Grundlage solcher Ideen lieferte eine Klausel im Vertrag von Osnabrück (IPO Art 5 § 1), wonach die Bestimmungen zum Normaljahr in Kraft bleiben sollten, »bis man sich durch Gottes Gnade über die Religionsfragen verglichen haben wird«. Die Initiativen gingen größtenteils von Katholiken aus, und obwohl sie darauf abzielten, die Protestanten in die katholische Kirche zurückzuführen, waren sie zu Konzessionen bereit. Es ging dabei im Grunde um Politik und kaum um Theologie. Treibende Kraft waren führende Mitglieder der Reichskirche, im Großen und Ganzen gegen den Willen und ohne Billigung des Papstes, der seine Vorrechte gefährdet sah. Für Leopold I. hingegen war die religiöse Einheit ein Weg zur politischen Einheit und eine Möglichkeit zur Ausübung der traditionellen kaiserlichen Rolle des Advocatus ecclesiae. 21 Die ersten Pläne formulierte Johann Philipp von Schönborn am Mainzer Hof vor dem Hintergrund der allgemeinen Reform- und Einheitsprojekte, an denen sein Minister Johann Christian Boineburg (* 1622, † 1672) in den Jahren 1650 bis 1664 arbeitete. 22 Boineburg hatte bei Conring und Calixt in Helmstedt studiert und war 1656 vom Luthertum zum Katholizismus konvertiert. In Mainz rückte er ins Zentrum der Vereinigungsideen des Kurfürsten für das Reich, insbesondere des Rheinischen Bundes von 1658, und der Pläne zur Wiederherstellung konfessioneller Einheit, die nicht zuletzt die Unterstützung eines Netzwerks von gleichfalls zum Katholizismus Konvertierten fanden. Ein wichtiger Verbündeter war der Wittelsbacher Kurfürst Max Heinrich von Köln, Frankreichsympathisant und bekannter Befürworter einer Beschneidung des päpstlichen Einflusses, was ihn in Rom in Ungnade gebracht hatte. Im Reich indes war er mächtig und fand Gehör in Bayern und Wien. Weitere Unterstützung kam von idealistischen Befürwortern einer konfessio-
105
106
I. · Auferstehung und neues Leben 1648–1705
nellen Versöhnung wie dem Landgrafen Ernst von Hessen-Rheinfels (* 1623, † 1693), der 1651 auf seiner Burg Rheinfels, 1652 in Kassel und 1653 in Gießen religiöse Kolloquien veranstaltete. 23 Landgraf Ernst gilt allgemein als Autor von Der discrete Catholische, einem von Gelehrten viel zitierten, aber weitgehend wirkungslosen Vereinigungstraktat. 24 Gedruckt wurden nur achtundvierzig Exemplare und an ausgewählte »gebildete und angesehene Personen« versandt. Als Katholiken wie Protestanten wütend über die Schrift herzogen, tat der Landgraf, was er konnte, um die verteilten Exemplare zurückzubekommen. Neben allem anderen setzten seine Vorschläge von 1666 die Säkularisierung der Reichskirche voraus, was die Kirchenfürsten, die katholischen Fürsten und der Adel allgemein nie akzeptieren konnten, selbst wenn die Idee das Interesse protestantischer Herrscher geweckt hätte. Die wirkliche Bedeutung von Landgraf Ernst liegt eher in seiner Schlüsselrolle in einem Netzwerk von Politikern und Theologen, dem auch Boineburg und Leibniz angehörten. Vor allem war er es, der den sogenannten Mainzer Plan von 1660 formulierte. 25 Darin wurde unter Rückgriff auf entsprechende Vorschläge aus der Mitte des 16. Jahrhunderts die Verlesung der Messe auf Deutsch, das Abendmahl in beiderlei Gestalt, die Abschaffung der Beichte und des klerikalen Zölibats (jedoch nicht für Mönche und Nonnen) empfohlen. Die Vorrechte des Papstes im Reich sollten auf ein Minimum reduziert werden. Einstweilen sollte eine Synode von vierundzwanzig Katholiken und Protestanten über die Vorgehensweise bei der vollständigen Versöhnung und Vereinigung aller deutschen Christen beraten. Aus den Mainzer Plänen wurde nichts. Die unversöhnliche Opposition des Papstes war eine nicht zu überwindende Hürde. Mit Boineburgs Entlassung 1664 endete die Kontinuität auf verschiedenen politischen Feldern, etwa in der Diskussion konfessioneller Themen. Der schrittweise erfolgende Zusammenbruch des Rheinischen Bundes und die Mainzer Neuorientierung auf Wien verschob zudem die Basis für die Formulierung politischer Ziele und Ansätze, und mit Regensburgs Aufstieg zum politischen Zentrum verschoben sich die Gewichte. Dann trat Spínola als neue, vielversprechende Lichtgestalt der Vereinigung auf den Plan. 1677 reiste er nach Rom und sicherte sich zumindest die stillschweigende Unterstützung des Heiligen Stuhls, auch wenn er keinen offiziellen Auftrag hatte, im Namen des Papstes zu handeln, den Protestanten keinerlei Zusicherungen machen durfte und seine Bemühungen geheim halten musste. 26 Er fand Gehör beim Kaiser, für den er mehrere Male als Abgesandter in Regensburg und anderswo aufgetreten war. Spínolas tatsächliche Instruktionen umfassten anfangs nicht einmal die Förderung der religiösen Einheit; der Inhalt seiner ersten Missionen war im Wesentlichen politischer und ökonomischer Natur, aber Leopold scheint die religiöse Dimension insgeheim impliziert zu haben. In den Instruktionen für Spínolas große Reise 1678/79 wurde der Auftrag der Werbung für ökonomische und mi-
10. Das Wesen des Reichs: Projekte und Kultur
litärische Reformen dann auf die Förderung einer religiösen Einigung ausgeweitet. 27 Spínola wandte sich an eine ganze Reihe von Fürsten. Die protestantischen Stände waren im Allgemeinen geneigt, ihn anzuhören, vor allem, da ihre gemeinsam mit England und den Niederlanden 1676 an Leopold gerichteten Gesuche um eine gemäßigtere Politik gegenüber den ungarischen Protestanten erfolgreich gewesen waren. Auch auf das Interesse des Herzogs Johann Friedrich von Braunschweig-Lüneburg, eines frühen und einflussreichen Konvertiten zum Katholizismus und Patrons der Universität Helmstedt, wo synkretische Traditionen auch in den Jahrzehnten nach Calixts Tod 1656 lebendig blieben, konnte der Kaiser setzen. 1673 hatte Herzog Johann Friedrich einen Schüler von Calixt und Conring, Gerhard Molanus (* 1633, † 1722), zum Oberhaupt seiner lutherischen Kirchenadministration und 1677 zum Abt des lutherischen Klosters Loccum ernannt. 28 Leibniz, den der Herzog 1674 als Bibliothekar und Rat in Hannover anstellte, brachte aus Mainz sein Interesse an sämtlichen Reform- und Einigungsvorhaben mit. 1678/79 erhielten Molanus und Leibniz den Auftrag, mit Spínola Gespräche über die Möglichkeiten einer protestantisch-katholischen Union zu führen. Es gab jedoch profunde Differenzen, sogar zwischen Spínola, Leibniz und Molanus. Spínola arbeitete auf die Wiedervereinigung der Protestanten mit der katholischen Kirche hin. Der Ansatz von Leibniz war in dieser Phase im Wesentlichen politisch; seine Vision einer globalen Vereinigung entwickelte er erst in den 1690er Jahren. 29 Molanus verspürte die christliche Pflicht, Spínolas Ideen zu entgegnen; sein Beharren auf den Grundsätzen der protestantischen Theologie verurteilte das Projekt letztlich zum Scheitern. 30 Trotz ausführlicher und leidenschaftlicher Diskussion fanden die Drei 1683 nicht zu einer Einigung. Spínolas Vorbedingung für eine Wiedervereinigung war die Anerkennung der Dekrete des Konzils von Trient und der Vorrangstellung des Papstes aufgrund göttlicher Gnade. Molanus bestand auf der Aufhebung der Trienter Erlasse und Einberufung eines neuen Konzils unter päpstlicher Leitung. Eine Aussicht, dass Rom Molanus’ Forderungen oder protestantische Höfe im Reich Spínolas Voraussetzungen akzeptieren würden, bestand nie. Die Beteiligung von Bossuet, mit dem Leibniz 1679 erstmals korrespondiert hatte und den er nun auf Spínolas Anregung hin erneut ansprach, ab 1683 änderte daran nichts. Bossuet war ebenfalls überzeugt, dass die Protestanten Kompromissbereitschaft zeigen mussten. Leibniz gegenüber äußerte er: »On est ou on n’est pas catholique« (Man ist entweder Katholik oder nicht). 31 Neben dem außer Zweifel stehenden Engagement der Hauptprotagonisten gab es eine Reihe weiterer Gründe, die Diskussionen bis um 1700 fortzuführen. Schon 1679 wurde Spínola klar, dass protestantische Fürsten nur bereit sein würden, die Gespräche zu bezuschussen, wenn für sie etwas dabei herausspränge. Der pfälzische Kurfürst forderte die Säkularisation von Worms und Speyer. 1679 kamen
107
108
I. · Auferstehung und neues Leben 1648–1705
die Diskussionen durch den Tod des Herzogs Johann Friedrich zum Erliegen. 1681 führte eine neue Anfrage an die Höfe in Berlin und Hannover zu weiteren langwierigen Gesprächen, vor allem in Hannover. Herzog Ernst Augusts Interesse war indes rein weltlich: Er wollte die Gespräche unterstützen, deutete sogar die Bereitschaft zum Konvertieren oder zumindest zur Unterstützung des Wiedervereinigungsprojekts an, aber nur solange er einen Vorteil daraus ziehen konnte. Leibniz und Molanus waren für ihn kaum mehr als zwei Schachfiguren in seinem Streben nach der Kurwürde. Zwischen 1683 und 1688 stockte das Projekt, nahm jedoch um 1690 wieder Fahrt auf. Leibniz trat erneut an Spínola heran und weilte 1688/89 mehrere Monate lang in Wien. Auch der Kaiser selbst schien nun mehr Interesse zu zeigen. Der Austausch einer reformierten Dynastie gegen eine katholische Linie in der Pfalz und der Widerruf des Edikts von Nantes im selben Jahr erregten erneut das Misstrauen der deutschen Protestanten, deren Befürchtungen durch die Thronfolge von Jakob II. in England und Gerüchte über seine angeblichen militanten Pläne für eine Rekatholisierung verstärkt wurden. Um 1690 hatte sich die Lage durch die Glorreiche Revolution, den Krieg mit Frankreich und die Gründung der Wiener Großen Allianz geändert. Jetzt war auch Spínola bereit, über die Grenzen des Reichs hinaus zu blicken und die ungarischen Protestanten sowie möglicherweise die polnische und schwedische Krone in seine Pläne einzubeziehen. Die Gespräche blieben ohne Ergebnis. Ernst August verlor das Interesse, sobald 1692 das Thema Kurwürde erledigt war. Die Päpste Alexander VIII. (1689–1691) und Innozenz XII. (1691–1700) waren frankreichfreundlicher eingestellt als ihr Vorgänger Innozenz XI. (1676–1689) und standen dem Kaiser folglich kritischer gegenüber. In Wien setzte der Krieg gegen Frankreich andere Prioritäten. Dass zu einer geplanten Konferenz in Frankfurt 1693 keine sächsischen Theologen eingeladen wurden, bestärkte viele in dem Glauben, dass es Spínola in Wirklichkeit nur um eine Spaltung der Protestanten ging. In den zwei Jahren vor seinem Tod 1695 warb Spínola in umfangreichen Korrespondenzen mit Molanus und Leibniz weiterhin für seine Mission. Angesichts des kaiserlichen Zögerns, die Wiedervereinigungspläne öffentlich zu unterstützen, mag es überraschen, dass die Sache nach Spínolas Tod nicht einfach fallen gelassen wurde. Zwar wurden die Papiere des Bischofs versiegelt, damit niemand ihre sensiblen Inhalte missbrauchen konnte; der Vorschlag Hannovers im Sommer 1695, die Gespräche wieder aufzunehmen, blieb unbeantwortet. Drei Jahre später indes wurde Spínolas Nachfolger als Bischof der Wiener Neustadt, Graf Franz Anton von Buchheim, zu weiteren Gesprächen entsandt. 32 Sie fanden unter strikter Geheimhaltung statt, Buchheim reiste sogar unter falschem Namen. Anfangs war er skeptisch, dann beeindruckt von der Kompromissbereitschaft der Protestanten, aber das Treffen führte zu nichts. Nachdem Leopold Leibniz 1700 nach Wien eingeladen
10. Das Wesen des Reichs: Projekte und Kultur
hatte, wurde das Projekt schließlich aufgegeben. Der Spanische Erbfolgekrieg ließ keine Zeit für weitere Anläufe. Aus Leopolds Sicht war die religiöse Wiedervereinigung immer Teil einer umfassenderen Strategie zur Einigung des Reichs. Offene Unterstützung fanden die Pläne bei ihm kaum, wiederholt verpflichtete er Spínola und andere Beteiligte zur Geheimhaltung. Angesichts der Schwierigkeit der zugrunde liegenden theologischen Probleme war das wohl vernünftig. Dass Mainz in den 1650er Jahren und Wien später jahrzehntelang zahlreiche prominente Konvertiten anzogen, ließ manche Hoffnung keimen. Es blieb jedoch undenkbar, dass die deutschen Protestanten in ihrer Gesamtheit jemals zur katholischen Kirche zurückkehren würden. Auch Leopolds eigene Position war eingeengt. Er war tiefgläubig und dem Katholizismus treu. Ein neues Kirchenkonzil einzuberufen, wozu ihn Spínola verschiedentlich drängte, hätte ihm vielleicht den Beifall der deutschen Protestanten eingebracht, aber auch eine Zusammenarbeit mit Ludwig XIV. und eine offene Herausforderung des Papstes bedeutet. Ersteres verbot ihm die Politik, Letzteres die Pietät. Dass überhaupt Diskussionen stattfanden, eröffnete jedoch zumindest der Kommunikation zwischen Wien und den wichtigen Fürstenhöfen eine neue Dimension. Die Verbindungen zwischen dem Kaiser und den diversen Akademieprojekten waren eher spärlich. Leopold hatte mit ihrer Gründung wenig zu tun, erteilte jedoch seine Bewilligung und zeigte sich bereit, ihnen Privilegien zu übertragen. Viele dieser Vorhaben trugen nie Früchte und keines reichte an ausländische Vorbilder wie die Royal Society in London (1660) und die Académie des Arts et des Sciences in Paris (1666) heran. Aber die Anzahl und Fruchtbarkeit der Projekte zeigt die magnetische Anziehungskraft, die Wien während der Herrschaft Leopolds I. auf viele deutsche Intellektuelle ausübte, und markiert eine neue Phase im Denken über das Reich als einheitliches Gemeinwesen nach dem Dreißigjährigen Krieg. Um dieses Phänomen begreifen zu können, sind ein paar Bemerkungen zum Schicksal der Sprachgesellschaften und zur Rolle der Universitäten im Reich nach 1650 nötig. Der Krieg hatte viele frühere Entwicklungen abgerissen. Einige Sprachgesellschaften überlebten und arbeiteten nach 1648 weiter, ein paar neue wurden gegründet. Ohne den breiteren politischen Hintergrund der konstitutionellen Krisen des frühen 17. Jahrhunderts verloren sie jedoch die umfassende patriotische Bedeutung, wie sie etwa der Fruchtbringenden Gesellschaft einst zugekommen war. 33 Der Krieg hatte auch die Netzwerke zerstört, die die mystischen, philosophischen und wissenschaftlichen Ideen von Andreae und seinen Briefpartnern hervorgebracht und bis in die 1620er Jahre weitergetragen hatten. 1623 hatte Joachim Jungius (* 1587, † 1657) die Societas ereunetica sive cetetica (Forschende oder untersuchende Gesellschaft) gegründet, die dem Vorbild der Accademia dei Lincei
109
110
I. · Auferstehung und neues Leben 1648–1705
folgte und stark von Andreaes pansophischen Idealen sowie Wolfgang Ratkes pädagogischen Verfahren beeinflusst war. Ihr Ziel war, die Philosophie der Jesuiten zu entkräften, die Mathematik zu fördern und die Natur zu erforschen. 34 Existiert hat sie indes wohl nur, bis Jungius 1625 nach Helmstedt ging; im Jahr darauf kehrte er nach Rostock zurück, zog jedoch 1629 als Rektor des Johanneums und des Akademischen Gymnasiums auf Dauer nach Hamburg und gründete keine weitere Gesellschaft. Viele andere, die das hätten tun können, flohen vor den Anfeindungen und trieben anderswo Entwicklungen voran. Andreaes Schüler Samuel Hartlib aus Elbing und der pfälzische Comenius-Anhänger Theodor Haak gingen nach England und beteiligten sich an der Gründung der Royal Society. Deren erster Sekretär Henry Oldenburg aus Bremen (* 1619, † 1677) besuchte England vermutlich erstmals 1653 als Diplomat, war jedoch bereits in den 1640er Jahren als Lehrer und Reisebegleiter junger Engländer tätig gewesen. 35 Die in London geknüpften Kontakte, unter anderen zu Hartlib und Boyle, ermutigten ihn, sich dauerhaft dort niederzulassen. In den Jahrzehnten um 1600 trugen Deutsche beträchtlich zum Fortschritt der Naturphilosophie und neuer Wissenschaften bei. Mitte des 17. Jahrhunderts fruchteten ihre Anstöße allerdings hauptsächlich im Ausland. Das Reich war keine akademische oder wissenschaftliche Wüste und nicht abgeschnitten von der intellektuellen Welt Westeuropas. Die intellektuelle Szene im Nachkriegsdeutschland wird oft als desolat und unheilbar provinziell dargestellt, es gibt jedoch viele Belege für anhaltende Vitalität und Schaffenskraft. Als Sekretär der Royal Society korrespondierte Oldenburg lebhaft mit vielen Deutschen, insbesondere ab 1670 mit dem jungen Leibniz, ebenso wie mit Wissenschaftlern aus anderen europäischen Ländern. 36 Der Briefverkehr der Royal-Society-Mitglieder überschritt Landes- und Konfessionsgrenzen und umfasste auch das Reich. Mit mehr als tausend Briefpartnern an 169 Orten in Europa und Asien war Leibniz sicher eine Ausnahme, aber auch für andere Gelehrte war eine umfangreiche Korrespondenz unverzichtbar. 37 Die pansophischen Traditionen überlebten den Krieg ebenso wie das deutsche Universitätssystem. Ihre unabhängige Entwicklung und Interaktion schuf einen intellektuellen Nährboden und trug zur Konsolidierung der imperialen Idee während Leopolds Herrschaft bei. Das Ansehen deutscher Universitäten nach 1650 litt unter den durch Thomasius’ ätzende Kritik der akademischen Welt des späten 17. Jahrhunderts geförderten Mythen ebenso wie unter der Bedeutung, die man der Neugründung in Halle 1694 für die deutsche Aufklärung beimaß, und der Glorifizierung von Humboldts Reformen um 1800. 38 Tatsächlich blühten die deutschen Universitäten auf, während die in England, Frankreich, Spanien und Italien im 17. Jahrhundert an Bedeutung verloren. 39 Vom Krieg erholten sie sich rasch: Die Gesamtanzahl der Studenten, die 1618 etwa 8.000 betrug, erreichte in den 1650er Jahren 6.000 bis 7.000 und 1660
10. Das Wesen des Reichs: Projekte und Kultur
7.800. Das Attribut »provinziell« trugen viele zweifellos zu Recht, schließlich waren sie territoriale Institutionen, eingebunden in eine Herrschaftsstruktur, die in erster Linie auf eine Dynastie und ihre Ländereien ausgerichtet war. Die meisten Universitäten waren mit 150 bis 300 Studenten und etwa 20 Professoren relativ klein – mehr als 1.000 Studenten hatte keine – und in Kleinstädten angesiedelt. Nur Leipzig und Königsberg (das geografisch außerhalb des Reichs lag) waren mit Handelszentren verbunden, nur Wien lag in derselben Stadt wie der Hof eines Herrschers. Andererseits wäre es falsch, die deutsche Universitätslandschaft als Ansammlung isolierter Institute oder gar als Diaspora in einer unwirtlichen, feindseligen Umgebung zu sehen. Auch die konfessionelle Trennung in sechzehn katholische, dreizehn lutherische und sechs calvinistische beziehungsweise deutsch-reformierte Anstalten wird gern überbewertet. 40 Obwohl sie der Kontrolle von Fürsten (und im Fall der Kölner und der Nürnberger Universität in Altdorf von Stadtmagistraten) unterstanden, galten für alle dieselben kaiserlichen Privilegien. Fachlich führend waren die lutherischen Institute in Leipzig, Wittenberg, Jena und Helmstedt, wobei die protestantischen Universitäten allgemein das neue Gebiet des öffentlichen Rechts dominierten. 41 Den Nachkriegsaufschwung Heidelbergs stoppte die erneute Zerstörung der Stadt 1689 und 1693; Halle erlangte unmittelbar nach der Gründung 1694 Bedeutung. Die katholischen Universitäten folgten der gleichen Aufteilung in vier Fakultäten wie die protestantischen und hielten an den im 16. Jahrhundert etablierten humanistischen Forschungsidealen fest. Der Austausch zwischen den Universitäten blieb rege, obwohl es in dieser Hinsicht doch gewisse Gräben zwischen den Konfessionen gab, die für die Entstehung zweier paralleler Kommunikationswege sorgten, jeder mit eigenen internationalen Verbindungen. Die studentische Grand Tour blieb weiterhin üblich, ebenso wie Bildungsreisen und Briefverkehr. 42 Von Professoren wurde erwartet, dass sie die offizielle Religion ihres Territoriums stützten; öffentliche Abweichung führte zur Entlassung. 43 Aber die für den akademischen Austausch in Deutschland im 16. Jahrhundert typischen nicht- und überkonfessionellen Tendenzen hielten sich hartnäckig. Die Geschichte der deutschen Universitäten nach 1650 ist im Grunde eine Geschichte der gegenseitigen Annäherung. 44 Thomasius und andere beklagten, dass die deutschen Universitäten an der lateinischen Sprache und dem traditionellen Curriculum festhielten. Und sie spotteten über den fast anarchischen Enzyklopädismus eines Großteils der späthumanistischen Gelehrten: die Produktion ungeheurer Kompendien aller Arten von Wissen oder gar allen Wissens überhaupt. Daniel Georg Morhof (* 1639, † 1691) prägte für sie den Begriff Polyhistor. 45 Bei aller Besessenheit von der Anhäufung von Faktenwissen, offenbar um ihrer selbst willen, waren die Polyhistoren dennoch fähig und offen für neue Erkenntnisse aus dem Ausland und den Naturwissenschaften.
111
112
I. · Auferstehung und neues Leben 1648–1705
Tradition und Erneuerung prägten die Acta Eruditorum (Verhandlungen von Gelehrten), die erste deutsche Gelehrtenzeitschrift, die Professor Otto Mencke 1682 in Leipzig gründete. Ihr Vorbild war das wissenschaftliche und medizinische Journal des Sçavans (1665 gegründet; in Deutschland erschien ab 1667 eine lateinische Version). Beiträge und Material lieferten anfangs Kollegen von Mencke in den Niederlanden, England, Frankreich und Italien, die Rezensionen wurden in Leipzig geschrieben, es gab aber auch einige externe Korrespondenten, etwa den englischen Astronomen John Flamsteed und den französischen Arzt Jacques Spon. Die Bandbreite der Acta Eruditorum war universell; 30 Prozent aller Rezensionen und 94 Prozent aller Originalartikel behandelten naturwissenschaftliche Themen. 46 Besprochen wurden Schriften aus ganz Europa von Protestanten und Katholiken; 70 Prozent der Bücher waren nicht auf Deutsch. 47 Allein unter Otto Menckes Herausgeberschaft (1682–1706) erschienen mehr als 4.000 Beiträge, davon gut 300 Originalschriften und über 150 Übersetzungen, von fast 200 Mitarbeitern in 69 Städten wie London, Leiden und Paris. Leipzig stach in vielerlei Weise heraus. Dass es ab den 1670er Jahren Frankfurt am Main als Zentrum der Buchproduktion ablöste, trug zu Menckes Erfolg bei und war eine Spätfolge der Kriegsschäden im Rheinland. Aber die Acta Eruditorum fanden weite Verbreitung und wurden bald zur Pflichtlektüre an Universitäten im ganzen Reich. Die deutschen Universitäten blieben lebendig und spielten eine entscheidende Rolle in der Entwicklung vom Humanismus des 16. zur Aufklärung des 18. Jahrhunderts. Die Begegnung mit neuen Erkenntnissen aus dem Ausland verstärkte ihr Bestreben, Teil einer grenzüberschreitenden Gelehrtenrepublik zu werden. Gleichzeitig bildeten sie ein zunehmend eigenständiges deutsches Subsystem der Kommunikation. Die protestantischen Universitäten hatten besondere überregionale Bedeutung als meinungsbildende theologische und juristische Zentren und waren zunehmend gefragt, da die Territorialregierungen ihre administrativen Strukturen festigten und ab den 1530er Jahren ihre Zuständigkeit für Belange der Gesellschaft und Kirche zu erweitern suchten. Die protestantischen juristischen Fakultäten entwickelten im späten 16. und frühen 17. Jahrhundert die Grundlagen des öffentlichen Rechts im Reich. Akademische Juristen spielten aber auch eine wichtige Rolle an den Reichsgerichten und im Reichstag, wo sie regelmäßig bei der Formulierung von Regelungen, zur Schlichtung und Beurteilung der fürstlichen Tätigkeiten herangezogen wurden. Daneben berieten sie Regierungen, kommentierten politische Vereinbarungen, Erlässe und Abkommen. So entstand etwa im Jahrhundert nach 1648 eine umfangreiche Literatur – juristisch, politisch, theologisch – zur Interpretation des Westfälischen Friedens und seiner Folgen für Staat, Kirche und Gesellschaft. 48 Die Kritik an den Universitäten begann nicht erst mit Thomasius. Schon immer
10. Das Wesen des Reichs: Projekte und Kultur
gab es Klagen über das Benehmen der Studenten, ihren mangelnden Fleiß, über Unmoral und Gottlosigkeit, die die Universitäten angeblich ausbrüteten. Ebenso beständig wurde ihnen vorgeworfen, sie erforschten und lehrten nichts von praktischem Nutzen. Darin hallten in gewisser Weise Johann Valentin Andreaes pansophische Ideale nach. 49 Die Klagen rührten auch von den Fortschritten her, die man in England und Frankreich beobachtete. Deutsche Versuche, dem Vorbild ausländischer Akademien nachzueifern, gerieten höchstens halbherzig. Die Anfänge der ersten Reichsakademie, der Academia Naturae Curiosorum, waren bescheiden. 1651 lud der Stadtphysicus der Reichsstadt Schweinfurt, Johann Lorenz Bausch, einen kleinen Kreis von Naturae Curiosi ein, sich einer an den italienischen Akademien und der Fruchtbringenden Gesellschaft orientierten Gemeinschaft anzuschließen. 50 Anfangs beteiligten sich nur drei weitere Schweinfurter Ärzte, im folgenden Jahrzehnt stieg die Anzahl auf zwanzig, die meisten waren aus Süddeutschland und keine Akademiker. Was die Gesellschaft genau tat, ist nicht bekannt; Bausch nannte sich Jason und verglich die Arbeit seiner Gesellschaft mit der Reise der Argonauten. Hinderlich waren jedoch sicherlich die weite geografische Verteilung, Geldmangel und das Fehlen direkter Kontakte zu den medizinischen Fakultäten von Universitäten. Die Wende kam erst nach Bauschs Tod, als sein Nachfolger Johann Michael Fehr (* 1610, † 1688) und der Breslauer Arzt Philipp Jacob Sachs von Lewenhaimb (* 1627, † 1672) sich an den Wiener Hof wandten. 1669 gab sich die Akademie ein neues Statut, das Experimente und Entdeckungen in Aussicht stellte. Im folgenden Jahr erschien erstmals eine Zeitschrift mit dem Titel Miscellanea Curiosa sive Ephemerides Medico-physicae Germaniae Academiae Naturae Curiosorum. 1677 wurde die Gesellschaft vom Kaiser bestätigt und gab sich den Namen Sacri Imperii Academia Naturae Curiosorum (Reichsakademie der Naturneugierigen). 1686 hatte sie mehr als hundertfünfzig Mitglieder, 1687 erhielt sie ein offizielles kaiserliches Privileg. Der Präsident und der Director Ephemeridum wurden zu kaiserlichen Leibärzten und Comites palatinae ernannt, was die Akademie berechtigte, Adoptionen zu bestätigen, uneheliche Kinder zu legitimieren und »Ehrlose« zu rehabilitieren. 51 1712 erhielt die Akademie nach einer Geldspende von Karl VI. ihren endgültigen Namen: Kaiserlich Leopoldinisch-Carolinische Deutsche Akademie der Naturforscher. 52 Das Ausmaß der kaiserlichen Beteiligung und die Stellung der Akademie in ihrem ersten Jahrhundert sollte man nicht überbewerten. Vor 1750 wechselte sie fünfmal den Standort, kam jedoch nie nach Wien, und so etwas wie eine wirkliche Nationalakademie wurde sie erst in den 1870er Jahren. Zwar strebte sie nach dem Prestige kaiserlicher Anerkennung, erreichte aber nie zentralen Status im Reich. Ihr wissenschaftliches Profil war ebenfalls bescheiden. Bausch kannte immerhin Bacons Werke, auf die sich die Korrespondenz der Akademie ab den 1670er Jahren
113
114
I. · Auferstehung und neues Leben 1648–1705
gern bezog. Ihr Hauptanliegen war die öffentliche Gesundheit, aber die Miscellanea Curiosa enthüllen wesentlich breitere Interessen und eine Leidenschaft für Wunder, Alchemie und andere Geheimlehren. Darin unterschied sie sich nicht so sehr von der Royal Society und anderen wissenschaftlichen Gemeinschaften ihrer Zeit. 53 Alchemie war kein rein deutsches Betätigungsfeld, aber die Vielzahl deutscher Höfe, die daran Interesse zeigten, sorgte für eine seltene Vorrangstellung in einem »Fach«. 54 Und in Deutschland warf sie zumindest ein greifbares Ergebnis von enormem Wert ab: Porzellan. Zweifellos war die Akademie ein wichtiges Vehikel für die Verbreitung wissenschaftlicher Entdeckungen und ihre imperialen Ambitionen zeigen die Attraktivität der Reichsidee und den Umfang des Austauschs unter diesem Vorzeichen. Leibniz hielt indes 1671 fest, keine ausländische Körperschaft habe bislang groß Kenntnis von ihr genommen und es geschehe dort sowieso nichts Besonderes. 55 Leibniz war aber natürlich ein Konkurrent, der selbst eine Reihe ambitionierter Projekte verfolgte. Von den späten 1660er Jahren bis zu seinem Lebensende warb er unermüdlich für geplante Gesellschaften, die die Verbindungen zwischen deutschen Intellektuellen und den neuen philosophischen und wissenschaftlichen Bewegungen in Europa verstärken sollten. 56 Die Bandbreite reicht von der religiöswissenschaftlichen Societas Philadelphica von 1669 bis hin zu Akademieprojekten für Forschung, Kunst, Sprache beziehungsweise Mathematik. Begeistert unterstützte er auch Hiob Ludolfs Plan für ein Collegium Imperiale Historicum in Wien, lehnte es jedoch ab, selbst Mitglied zu werden. 57 Die Societas – eher ein utopischer Entwurf als ein praktisches Projekt – sollte eine wirklich internationale Gemeinschaft in den Niederlanden werden. Für ein viel späteres Vorhaben war St. Petersburg ins Auge gefasst. Die 1700 gegründete Berliner Akademie war die einzige mit Substanz, aus der 1704 geplanten Reichsakademie in Wien wurde nichts, obwohl sich der einflussreiche Prinz Eugen dafür engagierte. Aufschlussreich waren indes schon die Planungen an sich. Leibniz versicherte später Peter dem Großen, er sei nicht seinem Vaterland oder irgendeiner bestimmten Nation zugeneigt, und viele seiner Vorhaben verfolgten letztlich übergreifend universelle christliche Absichten. Die Vereinigung der Welt durch Wissen war ein beständiges Thema seines Denkens, was mit zunehmendem Alter wohl noch deutlicher wurde. 58 Aber Leibniz widmete einen Großteil seines Lebens der Stärkung der Deutschen und ihres Beitrags zur Welt und konzentrierte sich dabei auf das Reich. Als er 1668 bis 1672 in Diensten des Mainzer Kurfürsten stand, schlug er diesem vor, eine Societas eruditorum Germaniae (Gesellschaft der Gelehrten Deutschlands) zur Förderung echter Bildung im Reich zu gründen. Sein Aufenthalt in Paris 1672–1676 festigte seine Überzeugung von der Notwendigkeit einer nationalen Akademie. In Hannover entwickelte er ab 1677 einen Entwurf für eine solche Institution, finanziert von den Erträgen der
10. Das Wesen des Reichs: Projekte und Kultur
fürstlichen Minen im Harz, zu deren Aufbesserung er ebenfalls detaillierte Vorschläge machte. Von da an hatte Leibniz anscheinend ein Netzwerk derartiger regionaler Akademien zur Förderung der Bildung in ganz Deutschland im Auge. 59 Noch deutlicher tritt sein Engagement für Deutschland in seinen Essays zur deutschen Sprache von 1682–1683 und 1697 zutage, in denen er die linguistischen Anliegen der Fruchtbringenden Gesellschaft mit dem Wunsch nach Förderung neuer Wissenschaften und deren praktischer Anwendung verknüpfte. Der Dreißigjährige Krieg, so Leibniz, habe Deutschland zurückgeworfen und zur Herrschaft der »Franzgesinnten« geführt. 60 Nun müssten sie für die Verbesserung ihres Wohlstand sorgen und eine rein deutsche Sprache kultivieren, um voranzukommen. Die Deutschen, schrieb er 1682/83, hätten sich bis dahin mehr für Latein und Kunst interessiert als für Deutsch und die Natur. 61 Ihre Gelehrten hätten nur füreinander geschrieben, die alten Sprachgesellschaften lediglich Sonette und Pastoralen verfasst. 62 Was sie wirklich bräuchten, seien Werke der praktischen Wissenschaft. Dem Reich fehle nichts, »so groß nun des Kaisers Majestät, so gelind und süß ist seine Regierung […], und Leopold hat auch die Ungläubigsten und Argwöhnigsten zu erkennen gezwungen, daß er’s mit dem Vaterland wohl gemeine«. 63 So verband er Sprache und Wissenschaft mit patriotischen Absichten. Dass so gut wie alle Pläne von Leibniz scheiterten, ist so bezeichnend wie ihre Motivation. Obwohl der Kaiser Interesse zeigte, war offenbar kein Geld dafür übrig. Schließlich ging Wien 1683 beinahe an die Türken verloren, und während seiner gesamten Herrschaft gab es kaum ein Jahr wirklichen Friedens. Selbst ein anfangs bescheidenes Projekt wie die 1692 in Wien gegründete Akademie der Künste musste mit einem minimalen Budget auskommen. Zudem nannte sie sich »kaiserliche« und nicht »Reichsakademie«; ihre öffentliche Kundmachung 1705 betonte ihr Anliegen, die Kunst der Zeichnung, der Skulptur, des Festungsbaus und der Architektur in »Erbkönigreich und Landen« Österreichs zu fördern, ohne das Reich auch nur zu erwähnen. 64 Obwohl sie nie zustande kam, war die Idee einer nationalen Reichsakademie ein weiterer Indikator für die wachsende Reichsbegeisterung in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Darin spiegelte sich auch der Wille, die politischen Institutionen auszugestalten, die so effektiv zu funktionieren begannen. Wie Leibniz sagte, fehlte dem Reich nichts, es musste sich nur weiterentwickeln. Dass die erste Akademie 1700 in Berlin realisiert wurde, ist ebenfalls ein Zeichen, wenn auch nicht so offensichtlich. Sie war geprägt von Leibniz’ Ideen, etwa der Kultivierung der deutschen Sprache. 65 Und sie war die erste von vielen Gründungen auf deutschem Boden im 18. Jahrhundert, was oft als Beleg für die Entstehung der preußischen Vorherrschaft beziehungsweise den Triumph der Fürsten über das Reich gedeutet worden ist. Mit Sicherheit spiegelt sich darin ein typischer Zug des Reichs
115
116
I. · Auferstehung und neues Leben 1648–1705
seit dem Mittelalter wider: die Abwicklung vieler wichtiger Regierungsfunktionen auf regionaler Ebene.
Anmerkungen 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Stolleis, Öffentliches Recht I, 248–251; Aretin, Altes Reich I, 38 f. Burgdorf, Reichskonstitution, 30–37. Evans, Making, 287–308. Schneider, »Leibniz«; Haase, »Leibniz«; Totok, »Leibniz«; Hammerstein, »Leibniz«; Dreitzel, »Zehn Jahre«, 395–475. Vgl. S. 77. BWDG III, 2712–2714; ADB XXXV, 202 ff.; sein vollständiger spanischer Name lautete Cristóbal de Gentil de Rojas y Spínola. Hassinger, Becher, 246 f.; eine gute moderne Übersicht über Bechers Unternehmungen bieten Frühsorge und Strasser, Becher, sowie Smith, Business. Zur Einschätzung von Bechers Patriotismus vgl. Dreitzel, »Zehn Jahre«, 475–534. Bog, Reichsmerkantilismus, 13 f. ADB XXIII, 38–41; Duchhardt, »Afrika«, 120 ff. ADB II, 201 ff.; Hassinger, Becher, 216–230. Bog, Reichsmerkantilismus, 93 f. Ebd., 100 f. Ebd., 102 f. Klueting, Reich, 74 f.; Heiss, »Ökonomie«. Wrede, Reich, 608. Winkelbauer, Ständefreiheit I, 399 f. Evans, Making, 163 f. Dammann, »Modernität«; Krauth, »Gemeinwohl«. Dreitzel, »Zehn Jahre«, 496–500, 521–534. Wallmann, »Union«; vgl. zum Folgenden, wo nicht anders angegeben: Aretin, Altes Reich I, 323–338; Peper, Konversionen, 44–48; Heckel, »Wiedervereinigung«. Schnettger, »Kirchenadvokatie«, 167 f. Peterse, »Boineburg«. Raab, »Discrete Catholische«. Burgdorf, Reichskonstitution, 65–68; Aretin, Altes Reich I, 325. Raab, »Sincere et ingenue«. Schnettger, »Kirchenadvokatie«, 145 f. Ebd., 146 f. Ohst, »Molan«. Rudolph, »Reunionskonzept«, 229 f., 240 ff. Ohst, »Molan«. Rudolph, »Reunionskonzept«, 237. Schnettger, »Kirchenadvokatie«, 166. Hardtwig, Genossenschaft, 207–224; Evans, »Learned Societies«; vgl. auch Band I, S. 575– 578.
10. Das Wesen des Reichs: Projekte und Kultur
34 Die Bezeichnungen im Titel gehen auf die griechischen Wörter ρευνάν = »ausspüren, untersuchen« und ζητείν = »nachforschen, erforschen« zurück; Wollgast, Philosophie, 426 f.; Hardtwig, Genossenschaft, 261 ff.; Dickson, Tessera, 91–101; vgl. auch S. 538. 35 Hall, Oldenburg, 5–8, 10 f.; vgl. auch Evans, »Learned Societies«, 134, 140. 36 Ebd., 223–233; vgl. zum Briefverkehr allgemein Gierl, »Korrespondenzen«, und Schindling, Bildung, 90 f.; zu Korrespondenz und wissenschaftlichen Verbindungen nach England vgl. Kempe, Wissenschaft, 73–87, eine Studie über den Züricher Gelehrten und Forscher Johann Jakob Scheuchzer (* 1672, † 1733). 37 Gerber, »Leibniz«; Gierl, »Korrespondenzen«, 426–429. 38 Vgl. S. 204 f., 600 ff. 39 Vgl. die Übersicht in Hammerstein, »Relations«; vgl. für das Folgende Evans, »German Universities«, 169–173. 40 Die katholische Universität Erfurt lag in einer überwiegend lutherischen Gegend und nahm einige lutherische Studenten auf. 41 Stolleis, Öffentliches Recht I, 237–252. 42 Asche, »Peregrinatio«; Dickerhof, »Traditionen«, 195–198; Siebers, »Bildung«, 180, 183 f.; Gierl, »Korrespondenzen«. 43 Einige Beispiele finden sich in Maurer, Kirche, 20 f. 44 Schindling, Bildung, 49. 45 Grimm, Literatur, 223–232, 303–313; Grafton, »World«. 46 Vgl. für eine vollständige statistische Analyse: Evans, »Learned Societies«, 140 f.; Evans »German Universities«, 180 f.; ADB XXI, 312 f.; Fläschendräger, »Rezensenten«; Laeven, »Acta Eruditorum«, 241–246, 267–374. In den folgenden hundert Jahren erschienen 117 Ausgaben; Besitz und redaktionelle Verantwortung blieben bei Menckes Familie. 1712 wurde parallel dazu die Zeitschrift Deutsche Acta eruditorum oder Geschichte der Gelehrten, welche den gegenwärtigen Zustand der Litteratur in Europa begreiffen gegründet. Sie setzte sich hauptsächlich mit historischen und literarischen Texten auseinander und erschien bis 1759. 47 31 Prozent waren deutsch, 28,5 Prozent niederländisch, 15,5 Prozent britisch, zwölf Prozent französisch und neun Prozent italienisch; zu den Autoren zählten Leibniz, Boyle, Huygens und Newton. 48 Kremer, Friede, liefert zahlreiche Beispiele; vgl. auch Gantet, Paix, 301–364. 49 Vgl. Band I, S. 569 ff. 50 Berg und Parthier, »Leopoldina«; Toellner, »Leopoldina«; Winau, »Frühgeschichte«; Hardtwig, Genossenschaft, 264 ff.; Evans, »Learned Societies«, 135–138; Herrlinger, »Collegium«. 51 Zu den Rechten dieser »Pfalzgrafen« vgl. Conrad, Rechtsgeschichte, 78 f.; Trunz, »Späthumanismus«, 151. 52 Heute trägt die Gesellschaft den Namen Leopoldina – Nationale Akademie der Wissenschaften, siehe www.leopoldina-halle.de (Zugriff 5. Oktober 2013). 53 Dickson, Tessera, 241–245; dem widerspricht Evans, »Learned Societies«, 137. 54 Vgl. Smith, Business; Nummedal, Alchemy; Moran, Alchemical World; vgl. zur Porzellanherstellung S. 324. 55 Hardtwig, Genossenschaft, 265 f. 56 Vgl. für das Folgende Totok, »Leibniz«; Hardtwig, Genossenschaft, 267–271. 57 Evans, Making, 289. 58 Vgl. Dreitzel, »Zehn Jahre«, 395–475.
117
118
I. · Auferstehung und neues Leben 1648–1705
59 Es handelt sich um die Aufsätze Unvorgreiffliche Gedancken betreffend die Ausübung und Verbesserung der Teutschen Sprach (um 1697) und Ermahnung an die Teutsche, ihren verstand und sprache beßer zu üben, samt beygefügten vorschlag einer teutsch=gesinten gesellschafft (um 1682/83). 60 Leibniz, Unvorgreiffliche Gedanken, 15. 61 Ebd., 63. 62 Totok, »Leibniz«, 311. 63 Leibniz, Unvorgreiffliche Gedanken, 51 f. 64 Wagner, Akademie, 17–21. Die Akademie wurde nach dem Tod ihres Gründers Peter Strudel (Freiherr von Strudeldorff) 1714 geschlossen und 1726 unter anderen Modalitäten neu gegründet. 65 Totok, »Leibniz«, 311.
11. Interpretationen des leopoldinischen Reichs
U
nter der Herrschaft Leopolds I. widmeten sich große neue Interpretationen des Reichs der Beschreibung und Definition des politischen Systems, aber auch seiner Reformierung. Die Überfülle derartiger Literatur ist keine Überraschung. Der Dreißigjährige Krieg hatte Texte hervorgebracht, die schonungslos die widersprüchlichen Standpunkte darlegten. 1619 hatte Dietrich Reinkingk eine eindringliche Analyse des Reichs als Monarchie vorgelegt. Seine Ansichten waren umso einflussreicher, da er Lutheraner war, und sein Buch wurde während des Krieges dreimal neu aufgelegt (1622, 1632 und 1641). 1 Seinen Argumenten entgegnete Bogislaus Philipp Chemnitz (unter dem Pseudonym Hippolithus a Lapide), dessen entschieden gegen Habsburg gerichtete Streitschrift für das Reich als Aristokratie 1640 erschien und während der Friedensverhandlungen 1647 neu aufgelegt wurde. 2 Reinkingk veröffentlichte 1651 eine vierte, revidierte Ausgabe seine Buchs, aber der Westfälische Friede, dessen Bedingungen eine echte Monarchie bewusst ausschlossen, machte seine Argumente hinfällig. Da sie sich zu den tatsächlichen Befugnissen des Kaisers ausschwiegen, provozierten die Verträge indes zweifellos weitere Debatten über die aristokratische Theorie von Chemnitz. Zugleich stimmten die Teilnehmer der Diskussion nach 1648 in vielen Punkten überein. Hermann Conrings 1643 publizierte Erforschung der Ursprünge deutschen Rechts bestätigte, was bereits viele andere politische Autoren verfochten hatten: Obwohl es das Wort »römisch« im Namen führte, gab es keine Verbindung des Deutschen Reichs zum Römischen Imperium. Das römische Recht hatte also für das Reich auch keine zwingende Geltung, und angemessen verstehen ließ sich das Reich nur durch die Untersuchung der Eigentümlichkeiten seiner Traditionen und Bräuche.3 Damit befreite Conring das Reich von einigem Ballast und richtete das Interesse auf seine Funktion als Gemeinwesen. 4 Er selbst trug zu diesem Studiengebiet nichts weiter bei. 1650 wechselte er von seiner naturphilosophischen Professur zum Lehrstuhl für Politik in Helmstedt und konzentrierte sich bis zu seinem Tod 1681 auf die Geschichte der einzelnen Territorien. Die superioritas des Kaisers wies er nicht ausdrücklich zurück, aber dass es ihm nicht gelang, die Beziehungen zwischen Territorien und Reich zufriedenstellend zu erläutern, zeigt deutlich die Ambivalenz des Westfälischen Friedens und der frühen Versuche der Nachkriegszeit, die Macht des Kaiser zu beschränken. In den folgenden Jahrzehnten gab es eine Reihe neuer Ansätze. Den wichtigs-
120
I. · Auferstehung und neues Leben 1648–1705
ten akademischen Beitrag lieferte wohl Conrings Schüler Ludolf Hugo (* 1632, † 1704) 1661 mit De Statu regionum Germaniae (Zur Stellung der Gebiete Deutschlands), worin er das Reich als Bundesstaat definierte. 5 Wie andere vor ihm zeigte Hugo die Unterschiede zum schweizerischen oder niederländischen Modell einer Konföderation aufgrund von Verträgen unter Gleichen auf. Im Reich, argumentierte er, sei die Macht zwischen Imperium und Territorien geteilt. Die Fürsten übten auf einigen Gebieten die höchste Macht aus, auf anderen seien sie Gesetzen unterworfen, auf die sich Kaiser und Reich geeinigt hätten. Zu Lebzeiten genoss Hugo beträchtliches akademisches Ansehen, sein Werk fand jedoch nicht den Widerhall der Schriften und Beiträge zur Reformdebatte von Pufendorf und Leibniz. Allerdings bildete Hugos Definition später die Grundlage für die von Johann Stephan Pütter nach 1750 entwickelte Theorie. 6 Wenige Abhandlungen zum Reich wurden häufiger zitiert als Samuel Pufendorfs unter dem Pseudonym Severinus de Monzambano Veronensis 1667 veröffentlichtes Buch De statu imperii Germanici (Über die Verfassung des deutschen Reichs). Die als Werk eines italienischen Deutschlandbesuchers ausgegebene, in unakademischem Stil gehaltene Kritik am Reich löste eine flammende Debatte aus. 7 Die Redewendung, auf die viele seiner Zeitgenossen ihr Augenmerk richteten – die Bezeichnung des Reichs als monstro simile – lieferte auch das Leitmotiv vieler moderner Darstellungen. Tatsächlich verstanden die meisten Historiker seiner und späterer Zeiten Pufendorfs Absichten schlichtweg falsch. Seine Kritiker warfen ihm vor, das Reich zu schmähen, aber Pufendorf bestand darauf, es sei ihm nur darum gegangen, seine Einzigartigkeit herauszustellen. Um Missverständnisse zu vermeiden, änderte er die Stelle zu tantum non monstro simile (beinahe einem Monstrum ähnlich) und tilgte sie schließlich gänzlich. 8 Das Buch, das während Pufendorfs Professur der Jurisprudenz in Heidelberg (1661–1668) entstand, wollte das Reich untersuchen, wie es war. Unter Verweis auf Conring bot es eine umfassende Darstellung seiner Historie und suchte Antworten auf die Fragen, die die Sichtweise von Bodin und Hobbes, Souveränität sei unteilbar, aufgeworfen hatte. Laut Pufendorf ging das gegenwärtige deutsche System auf die Entscheidung der Herzöge nach dem Erlöschen der karolingischen Dynastie zurück, einen der Ihren zum König zu wählen. Im Feudalsystem hatte ein König Rechte an Adlige verliehen, die ihm untertänig blieben; der deutsche Adel hingegen hatte seinem König Rechte übertragen und seine Würde und Macht behalten. Das Reich, argumentierte Pufendorf, sei weder eine echte Monarchie noch eine wirkliche Föderation. Seine angeborene Schwäche habe sich über die Jahrhunderte verschärft, indem die königliche Macht durch Kapitulationen, Gesetze, Bräuche und die immer lautstärkeren Machtansprüche der Fürsten eingeschränkt worden sei, was die Probleme der Gegenwart erkläre. Das Reich verfügte weder
11. Interpretationen des leopoldinischen Reichs
über Einkünfte noch über eine Armee. 9 Kaiser und Fürsten standen einander misstrauisch gegenüber; die Reichsstände waren gespalten, viele verfolgten ihre Ziele durch Bündnisse mit fremden Mächten. Verstärkt wurden all diese Zerwürfnisse durch die religiöse Zwietracht. Die innere Sicherheit war gefährdet, die Bedrohungen durch Türken und Franzosen hatten offenbart, wie wehrlos das Reich Angriffen gegenüberstand. Aus seiner Analyse zog Pufendorf zwei Schlüsse. Der erste war eine definitive Antwort auf die Frage nach dem Wesen des deutschen Staates. Für Pufendorf war klar, dass das Reich nicht in die üblichen Kategorien von Demokratie, Aristokratie oder Monarchie hineinpasste. In diesem Sinn war es monstro simile, ein irreguläres Gebilde. Von Hobbes übernahm Pufendorf den Begriff systema irregularis für eine Vereinigung von Teilen ungleicher Macht im Gegensatz zu einem »regulären« System, in dem »ein Mensch oder eine Gruppe von Menschen alle Menschen verkörpern«. 10 Das Reich war ein einzigartiges Gemeinwesen oder, wie er später erklärte, etwas zwischen einer Monarchie und einer Föderation. 11 Mit der Schweizer Eidgenossenschaft oder der Niederländischen Republik hatte es ebenso wenig gemein wie mit der französischen Monarchie. Pufendorfs zweites Anliegen war, Mittel gegen die Malaise des Reichs zu empfehlen. Hierbei fällt auf, dass er die antiimperialen Vorschläge von Chemnitz energisch zurückwies. Zwar kritisierte er die Habsburger, lehnte aber Chemnitz’ Forderung ab, sie davonzujagen, weil jeder andere gewählte Kaiser mit Sicherheit einfach ihre Länder übernommen und sich zum Herrscher über das Reich aufgeschwungen hätte.Viel besser sei es, alles zu unternehmen, um die innere Einheit zu stärken. Alle Reichsstände sollten eine generelle Garantie genießen, zukünftige Konflikte durch unabhängige Vermittler beigelegt werden. Das grundlegende Prinzip sei, dass »jeder in seinen Rechten geschützt werde und dass es niemandem möglich ist, den Schwächeren zu unterdrücken, damit so trotz der Ungleichheit der Macht die gleiche Sicherheit und Freiheit aller hergestellt werde«. 12 Allianzen zwischen deutschen Fürsten und fremden Mächten seien zu vermeiden. Da es unwahrscheinlich war, dass die Habsburger ein zentrales Beratungsgremium der Länder akzeptierten, sollten die Fürsten an sie appellieren, die ihnen verliehene Macht selbst zu beschränken; hingegen müssten die Fürsten jedem Versuch widerstehen, ihre eigenen Rechte zu schmälern. Die Angst vor Ausweitung oder Missbrauch der kaiserlichen Macht ließ Pufendorf jeden Vorschlag der Schaffung eines stehenden Reichsheers strikt ablehnen. Sein Hinweis, so etwas sei nicht nötig, solange sich das Reich ausschließlich auf Verteidigung beschränke, wurde im 18. Jahrhundert ein gängiges Thema der Literatur zum Reich. 13 Was die Verteidigungsdebatte betraf, stand Pufendorf eindeutig auf der Seite der Befürworter von Ad-hoc-Streitkräften, die im Notfall mobilisiert und aus von den Ländern gestellten Kontingenten zusammengesetzt sein sollten. 14
121
122
I. · Auferstehung und neues Leben 1648–1705
Pufendorfs Diagnose und seine Lösungsvorschläge unterschieden sich nicht sehr von denen anderer Reformer seine Zeit. Was die Lage der Konfessionen anging, zeigte er sich jedoch antikatholischer als die meisten. So gut wie alle reformerischen und interpretierenden Werke nach 1648 sahen die Glaubensspaltung als gegeben an, auch wenn die Möglichkeit ihrer Überwindung ein wichtiges Thema war. Auch Pufendorf zielte auf Harmonie, machte jedoch die Katholiken hauptverantwortlich für den herrschenden Zwiespalt und wollte sie zur Heilung des Reichs an die Kandare nehmen. Es sei kein Wunder, schrieb er, dass die Kirche für viele zu dem Leviathan geworden sei, von dem das Buch Ijob erzählt. 15 Sie habe Reichtümer für ihren Klerus angehäuft, den Laien die göttliche Wahrheit vorenthalten und einen päpstlichen Herrscher mit gottgleicher Autorität eingeführt. Die Klöster sollten nunmehr aufgelöst und die Jesuiten aus Deutschland vertrieben werden; mit den dabei abfallenden Geldern lasse sich ohne Weiteres eine Armee finanzieren, die Deutschlands Nachbarn fürchteten. Die Bischöfe zu beseitigen, schaffe jedoch möglicherweise mehr Probleme, als es löse, da ihre Ländereien in die Hände von Kaiser oder Fürsten fallen könnten, was das Gleichgewicht im Reich stören würde. Sie sollten sich lieber darauf besinnen, dass sie ihre Bistümer Deutschland verdankten, und als deutsche Fürsten Deutschland mehr lieben als Rom. 16 Am besten, schloss Pufendorf, wären alle Deutschen während der Reformation zum Protestantismus konvertiert, denn an Luthertum und Calvinismus sei nichts, was den Lehren der Politik und somit der harmonischen Koexistenz von Kaiser und Ständen im Reich zuwiderlaufe. 17 Pufendorfs höhnischer Antikatholizismus war der Hauptgrund für den Aufruhr um sein Werk. Manch einer richtete sein Augenmerk auch auf die Beleidigung des Reichs durch das Wort monstro. Andere strebten nach Wiederherstellung der theoretischen Grundlagen der monarchischen Autorität des Kaisers. Aber Pufendorfs Wirkung dauerte fort. Das lag auch daran, dass sein Buch so leicht zu lesen war. Zudem überarbeitete er es mehrmals, tilgte unverhohlen antikatholische und antihabsburgische Passagen. In der letzten Auflage, die er besorgte und die nach seinem Tod erschien, ließ er die Maske des italienischen Reisenden fallen, mäßigte den satirischen Ton und aktualisierte den Text, indem er etwa darauf hinwies, dass der Immerwährende Reichstag die Stelle des zentralen Beratungsgremiums eingenommen habe, das er ursprünglich vorgeschlagen habe. 18 Vor allem aber machte die entschiedene Absage an Chemnitz, das Bekenntnis zum Reich als Rechtsordnung und die Behauptung seines einzigartigen Charakters, der keinen theoretischen Kategorien entspreche, sein Werk zu einem der bedeutendsten patriotischen Traktate des späten 17. Jahrhunderts. Seine Beschreibung des Reichs als »System« blieb bis 1806 Teil des politischen Vokabulars. 19 Johann Georg Kulpis (* 1652, † 1698) war der einflussreichste der vielen pro-
11. Interpretationen des leopoldinischen Reichs
testantischen Kritiker, die Pufendorf Verunglimpfung des Reichs vorwarfen. An Conring anknüpfend, erarbeitete er eine historische Darstellung von imperialem Recht und Traditionen als Basis für die gegenwärtige Verfassung des Reichs. Sein De observantia Imperiali, vulgo Reichs-Herkommen von 1685 wurde schnell zum Standardwerk. Kulpis trat 1686 in den Dienst des Herzogs von Württemberg und startete eine Reihe von Initiativen zur Wiederbelebung des Reichs, vor allem durch die militärische Organisation und Assoziation der süddeutschen Kreise im Pfälzischen Erbfolgekrieg ab 1688. 20 Die Werke von Kulpis und anderen, etwa Gabriel Schweder (* 1648, † 1745) aus Tübingen, verknüpften Conrings bahnbrechende Befunde der 1640er Jahre und die systematische Analyse des deutschen Reichsrechts von Johann Jacob Moser (* 1701, † 1785), der als Student von Schweder geprägt worden war. 21 Zu Pufendorfs Kritikern zählte auch der wohl produktivste aller Kommentatoren des Reichs im späten 17. Jahrhundert: Gottfried Wilhelm Leibniz (* 1646, † 1716). Der damals erst einundzwanzigjährige Doktor beider Rechte verurteilte Pufendorfs Schrift, weil er der Meinung war, sie mache das Reich zu einem bedeutungslosen und leeren System. Pufendorf sei »zu wenig Jurist und am allerwenigsten ein Philosoph«. 22 Besonders erregt hat Leibniz offenbar Pufendorfs Trennung des Rechts von der Moral und dass er anscheinend darauf hinauswollte, das Reich sei kein Staat. Seine eigenen diesbezüglichen Schriften waren durchzogen von Versuchen, die Differenzen zwischen Kaiser und Fürsten zu schlichten und das Reich als Einheit darzustellen. Zugleich sah Leibniz im Gegensatz zu vielen, wenn nicht den meisten deutschen Kommentatoren nach 1648 das Reich immer unter europäischem Blickwinkel und als möglichen Ausgangspunkt für die Vereinigung des Christentums und die Schaffung einer neuen Weltordnung. In dieser Hinsicht verfocht er eine idealisierte Version der mittelalterlichen Universalidee des Reichs, von der er vielleicht glaubte, sie lasse sich in ein neues rationales Weltbild der Zukunft übertragen. 23 Der Anlass für Leibniz’ Betrachtungen war der gleiche wie bei Pufendorf und anderen. Zu seinen Lebzeiten war das Reich ständig von Frankreich bedroht und viele seiner Vorschläge entsprangen der Sorge um die Verteidigung gegen die Franzosen. 24 Zugleich schrieb Leibniz generell aus der Perspektive seiner fürstlichen Dienstherren; 1668 bis 1672 war das der Kurfürst von Mainz, von 1677 bis zu seinem Tod 1716 diverse Herrscher aus dem Haus Hannover. Während seiner langen Anstellung dort warb er unermüdlich für die Belange des Herrscherhauses und schrieb eine Flut von Pamphleten, die schamlos für solche Anliegen wie die Schaffung einer Kurwürde für Hannover eintraten. Zugleich beteuerte er wiederholt die Identität der Interessen von Kaiser und Fürsten, so etwa schon in Mainz: »Ich gehe von der Annahme aus, dass Kurmainz und das Reich ein gemeinsames Interesse teilen.« 25
123
124
I. · Auferstehung und neues Leben 1648–1705
Der Versuch, die Interessen von Kaiser und Fürsten in Einklang zu bringen, prägte seine zahlreichen Reformprojekte und, weniger erfolgreich, seine konstitutionelle Analyse der politischen Ordnung. Die Sehnsucht nach Einheit führte zu Initiativen auf sechs Feldern: Militärreform, politische Einheit, religiöse Versöhnung, ein neues Gesetzbuch, wirtschaftliche Reformen und kulturelle Erneuerung. Die religiösen, ökonomischen und kulturellen Dimensionen dieser Agenda haben wir bereits betrachtet. 26 Leibniz’ rechtliche Vorschläge gediehen nicht sehr weit. 27 Schon 1666 hatte er eine gründliche Revision des justinianischen corpus juris civilis angeregt, um alle Kontroversen auszuräumen und dem Reich ein modernes Gesetzbuch zu geben. Der revidierte Text sollte ins Deutsche übersetzt werden. Dreimal (1671, 1677 und 1688) schrieb Leibniz dem Kaiser und bot ihm an, einen solchen Codex Leopoldinus zu erstellen. 28 Die Antwort war immer negativ. Abgesehen von der Ablenkung durch militärische Krisen, wäre es extrem schwergefallen, alle Länder dazu zu bringen, eine solche Generalreform anzunehmen. Nicht einmal die Habsburger selbst waren scharf darauf, ihre Ländereien einem einheitlichen Reichsgesetzbuch zu unterwerfen. Schließlich zog Leibniz die Schlussfolgerung, eine neue Rechtsordnung werde es erst geben, wenn die größeren Territorien ein auf dem Naturrecht basierendes System vorlegten. Eine Synthese dieser Systeme werde dann vom gesamten Reich übernommen werden.Vorschläge von Leibniz für eine umfassende Rechtsreform in Hannover und Brandenburg wurden als erster Schritt in diese Richtung gedeutet. Als Militärreformer wurde Leibniz erstmals 1670 mit dem Vorschlag einer Allianz deutscher Fürsten zur Bildung eines 20.000 Mann starken Heeres zur Verteidigung im Westen tätig. 29 1681 sprach er sich für die Schaffung einer Reichsarmee aus Bürgerwehren und Söldnern unter dem Befehl eines vom Kaiser ernannten Generals aus. Das Reich, meinte er, könne nur überleben, wenn sich der Kaiser mit den mächtigeren Fürsten verbündete. Diese Ideen reflektierten die Position seines Dienstherren Herzog Ernst August von Hannover, eines der armierten Fürsten, die von unbewaffneten Ländern die Bereitstellung von Quartieren und Geld für ihre Streitkräfte erwarteten. 30 Die politischen und verfassungsrechtlichen Probleme, die Leibniz’ Ansatz innewohnten, machte sein eigenes Werk zum öffentlichen Recht deutlich, das 1677 erschien und die Forderung seines damaligen Dienstherren Herzog Johann Friedrich von Braunschweig-Lüneburg geltend machte, vollständig anerkannte Botschafter zu den Friedensgesprächen in Nimwegen zu entsenden. In seinem Caesarini Fürstenerii tractatus de jure suprematus ac legationis principum Germaniae (Über das Landesherrschafts- und Gesandtschaftsrecht der Fürsten Deutschlands) suchte Leibniz nach Rechtfertigung in Form einer föderalen Theorie des Reichs, die die Interessen von Kaiser und Fürsten in Einklang brachte. 31 Einerseits definierte er den Kaiser als Gottes Stellvertreter und Beschützer der Kirche auf Erden, der im
11. Interpretationen des leopoldinischen Reichs
Reich volle Majestät genoss. Andererseits sprach er den Kurfürsten und mächtigeren Fürsten etwas zu, was er Supremat oder echte souveräne Macht über ihre Länder nannte. Daher, argumentierte er, sollten die Kurfürsten den gleichen Status haben wie gekrönte Häupter, sollten die Niederländische Republik oder Venedig und umgekehrt die anderen deutschen Fürsten als den italienischen Fürsten gleichgestellt anerkennen. Der Kompromiss zielte darauf ab, die Konflikte zwischen Kurfürsten und Fürsten beizulegen, die sich nach 1648 wie ein roter Faden durch die deutsche Politik zogen, und beiden das Recht zuzusprechen, bei internationalen Friedensverhandlungen vertreten zu sein. Das warf zwei Probleme auf. Leibniz zog eine Trennungslinie zwischen den Reichsständen, die er als souverän und im Besitz des Supremats betrachtete, und den weniger mächtigen Ländern, die höchstens innere Suprematie und Rechtsprechung ausübten, was er als superioritas territorialis bezeichnete. Zweitens musste er die Idee einer Souveränität der Kurfürsten und Fürsten mit ihren Verpflichtungen gegenüber dem Kaiser unter einen Hut bringen. Seine Lösung war, Hobbes zu widersprechen und Souveränität für teilbar zu erklären. 32 Das Reich, fand er, war nicht nur ein Staatenbund, sondern eine Union, die eine Persönlichkeit entwickelt hatte, die mehr als die Summe ihrer Teile war. Der Kaiser war der oberste Lehnsherr; er genoss Autorität, übte jedoch keine absolute Macht aus. Die Kurfürsten und Fürsten waren ursprünglich in eine Lehnsbeziehung mit ihm eingetreten und schuldeten ihm daher Gefolgschaft. Die Quadratur des Kreises gelang Leibniz nicht.Von 1677 bis 1691 produzierte er ganze sechzehn revidierte Entwürfe der (leicht vereinfachten) französischen Version des Traktats. 33 Mit jeder neuen Ausarbeitung verstärkte er die Autorität des Kaisers und betonte die Verpflichtungen der Fürsten gegenüber dem Reich, die aus ihrem Lehnseid an den Kaiser und der Vernunft entsprangen: In internationalen Angelegenheiten agierten sie souverän, im Reich sollten sie treue Untertanen des Kaisers sein. Letztlich sei es für die Fürsten und andere schlicht vernünftig und logisch, loyal zum Reich zu stehen, weil es das beste Modell einer christlichen Gemeinschaft darstellte. Das war auch einer der Gründe für die Befürwortung einer Überwindung der Glaubensspaltung und nationaler Akademien für Sprache und Wissenschaft: das Reichsethos zu festigen und die Überzeugung seiner Einwohner zu stärken, im Zentrum von etwas zu leben, aus dem sich irgendwann wieder eine christliche Weltordnung entwickeln mochte. Leibniz’ Analyse des Reichs richtete ihren Blick nur auf die Beziehung der kleinen Anzahl »souveräner« Fürsten zum Kaiser. Über die Rechte weniger mächtiger Stände, etwa der Reichsstädte, der Reichsprälaten und Reichsritter, schwieg er sich aus; auch über die Kreise, die in Süddeutschland eine so wichtige Rolle spielten, wusste er nichts zu sagen. Auffallend ist zudem, dass in seiner Vision
125
126
I. · Auferstehung und neues Leben 1648–1705
Züge der Mystik des mittelalterlichen Universalismus bewahrt blieben und er unbeirrt am mitteleuropäischen Enzyklopädismus festhielt. 34 Bei all ihren Unzulänglichkeiten und Eigenarten bildeten Leibniz’ Ansätze, insgesamt betrachtet, dennoch eine Bekräftigung der Einheit des Reichs und seiner anhaltenden Bedeutung in der modernen Welt. Seine tatsächliche Wirkung ist schwer einzuschätzen. Viele seiner Projekte wurden nie publiziert, sondern nur unter Freunden diskutiert, fast nichts davon erfolgreich umgesetzt. 35 Zweifellos diente er den politischen Interessen seiner Auftraggeber, aber das Haus Hannover wäre wohl auch ohne ihn zur Kurwürde gelangt. In mancher Hinsicht trugen Leibniz und Pufendorf dazu bei, den Blick auf die historischen Ursprünge der Rechte der Territorien zu richten, was um 1690 in einer Reihe wichtiger Beiträge diverser Autoren Früchte trug. 36 Langfristig beförderten beide die Herausbildung der deutschen Naturrechtstheorien des Staates. Auf kurze Sicht, über knapp sechzig Jahre, war Leibniz’ markante Stimme ein beständiger Faktor in der Reichspolitik, der zum Wiedererstarken des Reichs nach 1648 sowie zu seiner Entwicklung zu mehr als nur einem losen Staatenbund beitrug.
Anmerkungen 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Stolleis, Öffentliches Recht I, 218–221. Ebd.; Burgdorf, Reichskonstitution, 56–62. Stolleis, Öffentliches Recht I, 231 ff.; Gross, Empire, 255–286. Willoweit, »Conring«, 144. Gross, Empire, 359–362; 2004 erschien eine moderne Ausgabe: Hugo, Rechtsstellung. Vgl. S. 507–511. Vgl. für das Folgende Hammerstein, »Pufendorf«, 188–195; Aretin, Altes Reich I, 346–350; Stolleis, Öffentliches Recht I, 233–237; Burgdorf, Reichskonstitution, 68–77; Gross, Empire, 311–328; Roeck, Reichssystem, 24–74. Gross, Empire, 322. Pufendorf, Verfassung, 122. Roeck, Reichssystem, 36. Gross, Empire, 324 ff. Pufendorf, Verfassung, 128. Dies hatte zuvor bereits Reinkingk vorgeschlagen: Link, »Reinkingk«, 96. Pufendorf, Verfassung, 129 f.; vgl. auch S. 55 ff., 73 f., 124. Pufendorf, Verfassung, 138. Ebd., 143 f. Ebd., 133 f., 144. Schmidt, Geschichte, 189. Roeck, Reichssystem, 30–36; 64–67. Ebd., 88–101; Burgdorf, Reichskonstitution, 100 ff.; Gross, Empire, 288 ff.; Plassmann, Krieg, 292–330.
11. Interpretationen des leopoldinischen Reichs
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35
36
Gross, Empire, 290 ff., 400; ADB XXXIII, 323 ff.; Walker, Moser, 16 ff., 25 f. Gross, Empire, 327; Roeck, Reichssystem, 41–45. Hammerstein, »Leibniz«, 94 f.; Gross, Empire, 350 f. Vgl. für das Folgende Hammerstein, »Leibniz«; Schneider, »Leibniz«; Gross, Empire, 329– 353; Wolf, »Idee«, 133–168; Dreitzel, »Zehn Jahre«, 395–475. Schmidt, Geschichte, 190. Vgl. S. 101–118. Gross, Empire, 331–334. Ebd., 332 f. Ebd., 335–340. Vgl. S. 55 ff., 73 f. Gross, Empire, 341–348. Das Pseudonym Caesarinus Fürstenerius verbindet die Bezeichnungen für die beiden Parteien unter Staatsrechtlern, die das Reich als Monarchie (»Caesariner«) bzw. Aristokratie (»Fürstenerianer«) betrachteten. Gross, Empire, 344. Ebd., 348. DaCosta Kaufmann, Court, 258 f. Dreitzel, »Zehn Jahre«, 475. Ein großer Teil von Leibniz’ philosophischen Arbeiten, die teils als Artikel erschienen, teils Manuskripte blieben, war bis lange nach seinem Tod 1716 nur jenen bekannt, mit denen er korrespondierte. Einige Kernideen fanden Verbreitung, als Christian Wolff sie in den 1720er Jahren zur Grundlage seines eigenen Systems machte. Obwohl seine Theodizee 1710 und die Monadologie 1721 publiziert wurden, begann die ernsthafte Auseinandersetzung mit Leibniz’ Ideen in Deutschland erst nach dem Erscheinen der ersten Ausgaben seiner Essays 1765 und 1768; vgl. Wilson, »Reception«, 442 ff. Vgl. S. 225–235.
127
II. Konsolidierung und Krise 1705–1740: Das Reich unter Joseph I. und Karl VI.
12. Zwei Kriege und drei Kaiser
I
n den letzten Jahren Leopolds I. († 1705) kam es zu zwei großen internationalen Konflikten, die tiefgreifende Auswirkungen auf die Regierung seiner Söhne Josephs I. (1705–1711) und Karls VI. (1711–1740) hatten. Deutschland stand weder im Spanischen Erbfolgekrieg (1701–1714) noch im Großen Nordischen Krieg (1700–1721) im Mittelpunkt: In Spanien ging es um die Zukunft des Landes und seiner Besitzungen nach dem Tod Karls II. im November 1700; der Krieg im Norden war der letzte Akt in Schwedens Bemühungen, Hegemonie über das Baltikum zu erlangen. In beiden Konflikten kulminierten Auseinandersetzungen, die die europäische Politik seit 1648 überschattet hatten und deren Lösung einen neuen internationalen politischen Rahmen schuf – wovon auch das Reich betroffen war. Am spanischen Krieg war es infolge der formellen Kriegserklärung gegen Frankreich im September 1702 beteiligt. Am Nordischen Krieg nahm es nicht offiziell teil, eine Schlüsselrolle spielten jedoch die norddeutschen Mächte Hannover, Brandenburg-Preußen sowie Sachsen und der Kaiser wirkte zeitweise als Vermittler. In beiden Kriegen traten zudem Grundzüge des Status quo im Reich zutage. Der spanische Krieg war geprägt von den Spannungen zwischen den verschiedenen Rollen der Habsburger: als Herrscher Österreichs, als Kaiser der Heiligen Römischen Reichs und als Angehörige der Dynastie. 1 Der Krieg im Norden markierte das Ende der schwedischen Präsenz in Norddeutschland und den Auftritt Russlands als europäische Macht; in ihm spiegelten sich zudem die Probleme des Kaisers mit den Aktivitäten der mächtigen Fürsten, deren deutsche Reichslehen mit fremden Kronen verbunden waren. 2 Das Ergebnis all dieser Ereignisse war eine weitere Konsolidierung der kaiserlichen Macht. Leopold hatte weitgehend auf Einflussnahme und auf die Autorität gesetzt, die ihm seine langen Jahre auf dem Thron und die erfolgreiche Abwehr der Türken und Franzosen verschafft hatten. Vor verändertem internationalem und militärischem Hintergrund versuchten Joseph I. und Karl VI. ihre Macht direkter und druckvoller auszuüben. Dabei spielte auch ihre unterschiedliche Persönlichkeit eine Rolle: Die kaiserliche Herrschaft gewann mit Joseph an Schwung und Kraft; der Übergang zu Karl veränderte die Perspektiven erneut. Vielsagend ist schon das neue Bild der imperialen Majestät: Leopold setzte auf Symbole, die ihn als Vermittler zwischen Himmel und Erde, zwischen Gott und der Menschheit erscheinen ließen. Joseph hingegen zog das Bild der Sonne vor, das er von seinem
132
II. · Konsolidierung und Krise 1705–1740
Erzrivalen Ludwig XIV. übernahm, und Karl die Säulen des Herakles, das einst von Karl V. verwendete Symbol der habsburgischen Macht. 3 Manche meinen, Leopolds Söhne seien von anderen Notwendigkeiten getrieben worden und das Reich für sie nicht mehr so wichtig gewesen wie für Leopold, da die Spannungen zwischen der österreichischen Monarchie und dem Reich nun zugunsten Österreichs gelöst waren. 4 Die Konsolidierung der habsburgischen Stellung in Italien ließ sicherlich Visionen eines größeren Imperiums aus der Zeit Maximilians I. und Karls V. wiederaufleben, von dem das Deutsche Reich nur einen Teil bildete. Zugleich aber eröffnete die Akquisition der Spanischen Niederlande durch die erstmalige Präsenz im Nordwesten seit Karl V. Möglichkeiten für andere Initiativen im Reich selbst. Joseph und Karl knüpften in vielerlei Weise an Leopolds Politik an. Ihre Rollen als Herrscher Österreichs und heilig-römische Kaiser ließen sich verbinden. Nur in Bezug auf Spanien waren sie wie Leopold gezwungen, sich während des Krieges für ihre Rolle in Österreich und dem Reich oder als habsburgische Dynasten zu entscheiden. Jede Festigung der habsburgischen Autorität im Reich war unausweichlich problematisch, da sie zum Widerstand gegen eine starke deutsche Monarchie führte. Verschärft wurde dies nach 1720 durch die zunehmende Selbstsicherheit der »königlichen« Fürsten, vor allem der Kurfürsten von Hannover (König von Großbritannien) und Brandenburg (König in Preußen). Deutsche Historiker konzentrierten sich traditionell auf die beginnende Herausforderung Habsburgs durch Preußen im Zuge der Annexion Schlesiens durch Friedrich den Großen 1740. In den 1720er Jahren indes war der Fall Preußen einer unter mehreren, eine deutsche Manifestation eines breiteren europäischen Problems für die Kaiser. Seit 1648 zeigten sich andere europäische Herrscher zunehmend unwillig, die Vorrangstellung des Kaisers anzuerkennen. Der englische Hof war nicht der einzige, der kaiserlichen Botschaftern und Abgesandten ein ausgefeilteres Zeremoniell als anderen verweigerte; das Beharren des Kaisers auf den herkömmlichen zeremoniellen Formen in Wien konterten Großbritannien, Schweden, Dänemark und Frankreich, indem sie überhaupt keine Botschafter schickten. 5 Solche Probleme waren auch realpolitisch von Belang. Man sollte daraus indes nicht schließen, die Stellung des Kaisers sei untergraben oder gar ernsthaft gefährdet gewesen. Der Anspruch auf Vorrang wurde in den 1720er Jahren nach wie vor druckvoll und glaubwürdig vertreten. Der Kaisertitel war für die Habsburger weiterhin wesentlich und von Gewichtigkeit im Reich wie, wenn auch in geringerem Maß als im 16. Jahrhundert, in Europa. Karl VI. geriet in den 1730er Jahren ins Straucheln und am Ende des Jahrzehnts war von seiner beherrschenden Stellung in den 1720er Jahren wenig übrig. Dies wurde traditionell gern seinen Fehlern vor allem in der Außenpolitik zugeschrieben. 6
12. Zwei Kriege und drei Kaiser
Sein Engagement im Polnischen Erbfolgekrieg 1773–1778 war sicherlich unklug, aber nicht die Art nationaler Krise, von der seine Vorgänger oft profitiert hatten: Gefahr drohte dem Reich weder von den Türken noch von den Franzosen. Wichtiger war die simple Tatsache, dass Karl keinen männlichen Erben vorweisen konnte. Seine Regierung blieb effektiv, aber die Versuche, die Thronfolge seiner Tochter in Österreich und seinen anderen Territorien sicherzustellen, zeigten das Grundproblem seiner Herrschaft nur zu deutlich. Ab den frühen 1720er Jahren wurden die Erbfolge und ihre Sicherung durch die Unterstützung erst seiner eigenen Länder, dann der Reichsfürsten und anderer europäischer Mächte politisch zunehmend dominant. Das änderte freilich nichts daran, dass die Kaiserkrone, die laut der Goldenen Bulle nur ein Mann tragen durfte, unweigerlich verloren gewesen wäre. Ironischerweise zeigte die kurze Zeit des Wittelsbachers Karls VII. (1742–1745) auf dem Kaiserthron, dass es keine Alternative zu den Habsburgern gab, auf die die Kurfürsten dann erneut setzten.
Anmerkungen 1 2 3 4 5 6
Hochedlinger, Wars, 174–193; McKay und Scott, Rise, 54–63. Duchhardt, Altes Reich, 73–78; McKay und Scott, Rise, 77–93; Frost, Northern Wars, 226–300. Schmidt, Geschichte, 262 f.; Ingrao, Monarchy, 122 f.; DaCosta Kaufmann, Court, 289–303; O’Reilly, »Lost Chances«, 68. Vgl. etwa Klueting, Reich, 97–123, der seine Ansicht durch Zitate anderer belegt. Pečar, »Symbolische Politik«, 291 f. Aretin, Altes Reich II, 333–350.
133
13. Leopold I., Joseph I. und der Spanische Erbfolgekrieg
D
ie spanische Thronfolge beschäftigte die europäischen Höfe bereits seit den 1650er Jahren. 1 Dass der kränkliche Karl II. unerwartet lange lebte, hatte das Thema nur aufgeschoben und die Optionen vervielfacht. Am gewichtigsten waren die Ansprüche Österreichs und Frankreichs. Für Österreich sprach das Prinzip des dynastischen Einheit des Hauses Habsburg und Leopolds erste Ehe mit der Infantin Margarita Theresa, der jüngeren Tochter Philipps IV., für Frankreich die Ehe Ludwigs XIV. mit ihrer älteren Stieftochter Maria Theresia. Ludwig hatte zwar im Ehevertrag offiziell auf das Thronfolgerecht verzichtet, Frankreich konnte aber darauf verweisen, die Vereinbarung sei nichtig, weil Philipp die vertraglich zugesicherte Mitgift nicht bezahlt hatte. Die geheime französisch-österreichische Übereinkunft von 1668 sah eine Teilung vor, wobei Spanien und die norditalienischen Ländereien an die Habsburger fallen sollten und Frankreich die Franche-Comté, Navarre, Neapel und Sizilien sowie die spanischen Gebiete in Nordafrika und den Philippinen bekäme. In den 1690er Jahren distanzierten sich beide von diesem Plan, prinzipiell hatte Österreich jedoch einer Teilung zugestimmt. In Spanien fand die Idee wenig Gefallen. Bis in die frühen 1690er Jahre neigte Karl II. dazu, das ganze spanische Erbe seinen österreichischen Verwandten zu überlassen, dann kam in Gestalt des Kurfürsten Max Emanuel von Bayern, der die Erzherzogin Maria Antonia, das einzige Kind aus Leopolds spanischer Ehe, geheiratet hatte, eine vielversprechende Kompromisslösung ins Spiel. Dass auch sie auf die spanische Thronfolge verzichtet hatte, dämpfte Max Emanuels Ambitionen nicht. 1691 wurde er zum Statthalter der Spanischen Niederlande ernannt und durch die Geburt seines Sohns Joseph Ferdinand im Oktober 1692 trat ein neuer Anwärter auf die spanische Krone auf den Plan. Österreichs Beharren auf seinem Recht auf das ungeteilte Erbe machte alle Bemühungen um eine akzeptable Lösung zunichte. Nach dem pfälzischen Krieg kam es 1697 zu einem neuen Einigungsversuch, wobei Wilhelm III. als Vermittler auftrat, um einen weiteren internationalen Konflikt abzuwenden. Selbstlos war sein Einsatz nicht: Spanien und das spanische Westindien waren wichtige Exportmärkte für Großbritannien und die Niederlande, die beide schützen und, wenn möglich, erweitern wollten. Ludwig XIV. war nun ebenfalls kompromissbereit, solange Frankreich in Anerkennung seiner Rechte entschädigt würde. Im Oktober 1698 unterzeichneten Wilhelm III. und Ludwig XIV. den ersten Teilungsvertrag,
13. Leopold I., Joseph I. und der Spanische Erbfolgekrieg
der die spanische Krone Joseph Ferdinand von Bayern zusprach, Leopolds jüngerem Sohn Karl die spanischen Besitzungen in Italien (Mailand, Neapel, Sizilien, Toskana und das Marquisat von Finale) und Frankreich die spanische Provinz Guipúzcoa südlich der Pyrenäen. Nur vier Monate später machte Joseph Ferdinands Tod diesen Plan hinfällig. Ein zweiter Teilungsvertrag, den England, die Niederlande und Frankreich im Juni 1699 schlossen, schlug Erzherzog Karl das bayerische Erbe zu, überließ Frankreich jedoch zusätzlich zu den Erbansprüchen des Dauphin in Italien auch Mailand. Der Hintergedanke war, Ludwig XIV. könne mit Mailand den Herzog von Lothringen entschädigen, dessen Territorium dann endlich ganz ins französische Königreich eingefügt werden könnte. Dies war für Wien gänzlich inakzeptabel. Erzherzog Karl hatte Aussichten auf die spanische Krone und Leopold war überzeugt vom Anrecht seines Sohns auf das Erbe, aber sein eigener Interessenschwerpunkt als Herrscher von Österreich lag in Italien. Dort hatte Leopold seit den 1660er Jahren ausgeklügelte Vorbereitungen für die spanische Erbfolgekrise getroffen; überhaupt war er in Italien politisch aktiver als jeder Kaiser seit Rudolf II. in den 1580er Jahren. Im vergangenen Jahrhundert hatte sich das Problem nicht verändert. In Italien gab es ein Netzwerk von 250 bis 300 Reichslehen, Überresten des Regnums des Heiligen Römischen Reichs aus seiner Blütezeit im 13. und 14. Jahrhunderts, bei dem es immer wieder zu Überlappungen und Konflikten mit dem feudalen Netzwerk des Heiligen Stuhls gekommen war. Als weitere Komplikation trat hinzu, dass Karl V. seine italienischen Besitzungen 1556 an Spanien abgetreten hatte, wodurch der König von Spanien als kaiserlich Vasall Neapel, Sizilien, Mailand und Genua hielt. Nach dem Zwist zwischen Rudolf II. und Philipp II. über Einflussbereiche in Italien hatten die Österreicher die spanische Präsenz akzeptiert. 2 Sie gestanden Spanien zudem die Hauptlast der Verteidigung Italiens gegen Frankreich im Dreißigjährigen Krieg zu. Erst 1678 ernannte Leopold den Statthalter von Mailand zum Generalbevollmächtigten von Italien – ein seit der Herrschaft von Kaiser Matthias nicht mehr vergebenes Amt, dessen Funktionen eher planlos vom Reichshofrat ausgeführt worden waren. Rechtlich standen die italienischen Territorien nach wie vor unter dessen Autorität und viele kleinere Lehen betrachteten Wien weiterhin als ihren Behüter gegen größere Mächte wie den Heiligen Stuhl, Neapel, die Toskana, Mailand und Savoyen. Der zunehmende Schwund der spanischen Macht und anhaltende französische Einmischung in Norditalien führten zu neuen Versuchen, die österreichische Kontrolle wiederherzustellen. Spanische Beamte legten Listen von Lehen an, 1687 wurde ein neuer Generalbevollmächtigter ernannt. 1690 bis 1691 erhob Prinz Eugen erstmals in Italien Reichssteuern, um den Krieg zu finanzieren. 3 1696 befahl ein Edikt allen Vasallen, ihre Belehnungsurkunden vorzuweisen und ihren Lehnseid bei Androhung des Verfalls binnen Jahr und Tag zu erneuern. Gleichzeitig ge-
135
136
II. · Konsolidierung und Krise 1705–1740
lang es ein Jahr vor Ende des pfälzischen Kriegs, ohne England und die Niederlande zu konsultieren, Frankreich und Savoyen zur Anerkennung der Neutralität Italiens zu bewegen. Dieser Vertrag erzürnte Wilhelm III., der wollte, dass Leopold den Krieg gegen Frankreich in Italien fortführte. Die Erneuerung der Lehen wiederum ergrimmte den Papst, weil nun einige seiner Vasallen uralte, von Otto IV. oder Karl IV. unterzeichnete Urkunden ausgruben, die sie als Vasallen des Kaisers auswiesen. Noch wichtiger und direkt relevant für die spanische Thronfolge war die Frage vakanter Lehen. In Wien nämlich wuchs die Entschlossenheit, Mailand, das mit dem Tod von Karl II. vakant würde, für die Krone zurückzugewinnen. Daher lehnte Leopold den zweiten Teilungsvertrag ab und strebte nach einem direkten Abkommen mit Ludwig XIV., das für die Abtretung der italienischen Territorien an Österreich fast alles übrige dem Dauphin überließ. All diese Gedankenspiele warf Karl II. selbst über den Haufen, indem er kurz vor seinem Tod am 1. November 1700 ein geheimes Testament aufsetzte. In Anerkennung der spanischen Haltung, das Königreich müsse ungeteilt und mit sämtlichen abhängigen Territorien vereint bleiben, übergab er alles an Ludwigs Enkel Philipp von Anjou, den zweiten Sohn des Dauphins. Erzherzog Karl kam demnach als Erbe nur infrage, falls Philipp und sein jüngerer Bruder, der Duc de Berry, ohne Nachkommen sterben sollten. Schock und Wut in Wien hielten sich die Waage mit der offensichtlichen Zustimmung anderswo, als der junge Prinz im Februar 1701 als Philipp V. den Thron bestieg. Bestärkt durch die unerwartete Wende in Spanien ließ sich Ludwig XIV. hinreißen, alle Beteiligten herauszufordern. Er verstieß gegen die Bedingungen des Testaments, das eine Vereinigung Spaniens mit Frankreich untersagte, indem er dem neuen spanischen Monarchen die französische Thronfolge zusagte. Bald darauf vergab Philipp Konzessionen an französische Kaufleute, was Großbritannien und die Niederlande alarmierte, die eine französische Dominanz über den spanischen Binnen- und Kolonialhandel fürchteten. Ludwig ließ seine Truppen gegen die Spanischen Niederlande und Mailand aufmarschieren und erkannte obendrein im September 1701 nach dem Tod von Jakob II. im französischen Exil dessen Sohn James Edward Stuart als König Jakob III. von England an. Inzwischen hatte sich die Große Allianz gebildet, deren Gründungsabkommen Leopolds italienische Vorrechte respektierte. Philipp V. sollte Spanien behalten dürfen, aber die Spanischen Niederlande und die italienischen Territorien würden an Erzherzog Karl gehen. Großbritannien und die Niederlande wollte man mit Handelskonzessionen von Philipp V. und mit allen Eroberungen im Westen und Westindien entschädigen. 1701 überließ der Allianzvertrag Spanien Philipp V., aber der Kriegseintritt Portugals auf Seiten der Großen Allianz 1703 sorgte für einen Kurswechsel, da König Peter II. auf der Vertreibung der Franzosen bestand. Leopold schlug einen dynastieinternen Teilungsvertrag (pactum mutuase succes-
13. Leopold I., Joseph I. und der Spanische Erbfolgekrieg
sionis) vor, der Joseph und Karl zu Oberhäuptern zweier neuer Habsburg-Linien mit gegenseitigem Nachfolgerecht machen sollte, wobei Josephs Tochter im Fall des Ausbleibens männlicher Erben Karls Tochter vorgezogen werden sollte. Leopold und Joseph verzichteten auf ihre Ansprüche auf Spanien und seine Subsidiarterritorien, behielten aber Mailand und das Marquisat von Finale als heimgefallene Reichslehen. Nach Abschluss des Abkommens wurde Erzherzog Karl nach Spanien entsandt. Im März 1704 langte er in Portugal an, konnte jedoch erst über ein Jahr später nach Barcelona reisen, von wo er dann die labile Herrschaft über ein Reich ausübte, das tatsächlich nie über Katalonien und Valencia hinausreichte. 4 Leopold hatte beschlossen, in den Krieg zu ziehen, und die Strategie festgelegt. Deren Umsetzung verdankte sich indes zum großen Teil der Energie seines Erben Joseph. Zu Beginn der spanischen Krise war zwar die österreichische Reaktion klar, Verkrustungen in den entscheidenden Kreisen um den Kaiser, administrative und fiskalische Inkompetenz und die allgemeine Ansicht, es werde schon alles gut gehen, standen ihr jedoch im Weg. Erst das Scheitern der ersten militärischen Initiative von Prinz Eugen in Italien 1701/02 und der Beginn eines Feldzugs in den Niederlanden und entlang dem Rhein riefen eine Gruppe auf den Plan, die energische Reformen und entschiedenes Handeln vorantrieb. Joseph war der anerkannte Führer dieses »jungen Hofs« und Leopold ernannte ihn zum Leiter einer Mitteldeputation, die Geld für neue Kriegsbemühungen aufbringen sollte. Im Sommer 1704 erlitten die Reformer einen Rückschlag; Joseph wurde von den Sitzungen des Kriegskonzils ausgeschlossen und bei allen politischen Entscheidungen übergangen. Als er im Mai 1705 seinem Vater auf den Thron folgte, sammelte er jedoch ein Kabinett führender Reformer um sich, dem er als Erster unter Gleichen vorsaß. 5 Die steuerlichen und administrativen Reformen der ersten Monate von Josephs Herrschaft stellten keine revolutionäre Modernisierung des HabsburgerSystems dar, zudem starb er vor ihrer Vollendung. Zweifellos aber trugen sie entscheidend dazu bei, eine Katastrophe abzuwenden, ehe der kriegsbedingte Aufschwung neue Einkünfte aus Italien und anderswo brachte. 6 Derweil ermöglichten es die Reformen Joseph und seinen Beratern, an den diversen Fronten koordiniert vorzugehen. Die Kriegsgeschehnisse in Italien, Spanien und den Spanischen Niederlanden verschärften sich 1703 durch einen Volksaufstand in Ungarn und den Angriff des bayerischen Kurfürsten auf Österreich. Art und Ausmaß des österreichischen Engagements auf den verschiedenen Schauplätzen waren unterschiedlich, und was die Bedeutung Deutschlands und des Reichs betrifft – gemessen an Österreichs Interessen als Großmacht –, sind sich die Gelehrten sehr uneins. 7 Josephs früher Tod 1711 im Alter von dreiunddreißig Jahren schließt eine definitive Bewertung aus, da er das Reich nie zu Friedenszeiten regierte. Die Konstruktion eines Gegensatzes von Österreich und dem Reich führt wohl in die Irre. Josephs
137
138
II. · Konsolidierung und Krise 1705–1740
Herrschaft war geprägt von einem energischeren Herangehen an die Regierungsarbeit, nicht von schwindendem Interesse. Josephs Bündnispartner haben seine Politik häufig kritisiert. Die maritimen Mächte hielten im Großen und Ganzen an den ursprünglichen Kriegszielen in Frankreich und Spanien fest. Joseph war wiederholt durch andere Belange abgelenkt und kam in ihren Augen manchmal seinen Verpflichtungen gegenüber der Großen Allianz nicht nach. Aus Wiener Sicht indes stellte jeder Kriegsschauplatz eigene Anforderungen. Das Reich war nur eine von mehreren Fronten. Die wichtigste war Italien. 8 Dort unternahm Prinz Eugen 1701/02 seinen ersten erfolgreichen Feldzug. Als dieser mangels Nachschub ins Stocken geriet, richtete sich die Aufmerksamkeit auf deutsche Probleme im Norden. Die Lage in Italien besserte sich im November 1703, als Herzog Viktor Amadeus von Savoyen gegen umfangreiche Gebietsgewinne die Seiten wechselte und ein Bündnis mit dem Kaiser schloss. Neue Probleme in Deutschland ermöglichten es Philipp V. jedoch, Mailand und Neapel in seine Hand zu bekommen. Nötig war nun eine große Gegenoffensive. Im September 1706 nahm Prinz Eugen Turin ein und bis März 1707 wurden die bourbonischen Truppen aus ganz Norditalien vertrieben, mit Ausnahme von Savoyen, das die Franzosen bis Kriegsende hielten. Nach dem Fall von Turin drängten die Seemächte Joseph, Toulon anzugreifen, Wien zögerte jedoch, da der Kaiser darauf beharrte, ein umfangreiches Kontingent für den Sturm auf Neapel abzustellen. Mit dem Fall von Neapel war die österreichische Hegemonie in Italien perfekt. Inzwischen hatte die Reichsregierung bereits Schritte eingeleitet, um ihre Herrschaft in Norditalien auf eine Weise zu festigen, die an die französischen Reunionen der 1680er erinnerte. Alte Rechtsansprüche wurden erneuert, Strafmaßnahmen gegen jene ergriffen, die anfangs zu Philipp V. gestanden hatten. 1708 wurde der Herzog von Mantua wegen Verrats bestraft und sein Land konfisziert, die Territorien anderer geächteter oder des Hochverrats für schuldig befundener Herrscher verkauft. Selbst der Papst blieb nicht verschont: 1708 besetzten kaiserliche Truppen das zum Reichslehen erklärte Comacchio, was zu Feindseligkeiten führte, die bis 1711 anhielten. 9 Die italienischen Feldzüge zielten klar darauf ab, Österreichs Macht durch die Schaffung eines territorialen Blocks entlang den Erblanden, Böhmen und Ungarn zu stärken. Die Erneuerung kaiserlicher Vorrechte geschah jedoch auch im Namen des Reichs, die Kurfürsten unterstützten die Neubegründung kaiserlicher Lehen und die Durchsetzung der Autorität des Reichshofrats in Norditalien. Ihre Architekten waren Reichsvizekanzler Friedrich Karl von Schönborn, der österreichische Hofkanzler Seilern und der einflussreiche Obersthofmeister Fürst Salm; ihre aggressive Haltung gegenüber dem Heiligen Stuhl erregte indes den Widerstand der katholischen Kurfürsten und Fürstbischöfe sowie einer Mehrheit der kaiserlichen
13. Leopold I., Joseph I. und der Spanische Erbfolgekrieg
Räte. Sich auf Reichsrecht und den Krönungseid des Kaisers zu berufen, der ihn verpflichtete, alle abspenstigen Lehen für das Reich zurückzugewinnen, war Vorwand für die Schaffung einer neuen österreichischen Interessensphäre. Andererseits hätte es Österreich als »Großmacht« und Rettungsanker des Deutschen Reichs empfindlich geschwächt, Philipp V. Italien für die Bourbonen zu überlassen. Viel weniger Bedeutung maß man Spanien und der Zukunft von Erzherzog Karl als Karl III. von Spanien bei. Für Joseph war wichtig, dass sich Karl in Spanien durchsetzte, weil ihm Leopold für den Fall eines Scheiterns Tirol und Vorderösterreich versprochen hatte, womit das alte Problem wettstreitender Dynastien in Österreich in neuer Form die Konsolidierung der habsburgischen Länder behindert hätte. Andererseits überließen Joseph und seine Berater offenbar gern Großbritannien, den Niederlanden und Portugal die Hauptlast der Unterstützung Karls in Spanien. 1707 eroberten sie lieber Neapel, als Karl durch einen Einmarsch in der Provence beizustehen. Josephs Beharren auf der Ernennung des böhmischen Adligen Graf Martinitz zum Vizekönig unter Missachtung von Karls Kandidaten Kardinal Grimani zeigte einmal mehr seine Geringschätzung der Rechte seines Bruders in Süditalien. 10 Die österreichische Streitmacht, die unter dem Kommando von Graf Guidobald von Starhemberg schließlich doch nach Spanien entsandt wurde, war zu klein und kam zu spät. Im Januar 1711 hatten französische Truppen Gerona erobert und Katalonien umzingelt. 11 Karl rettete nur der Tod seines Bruders, der ihn nach Wien zwang, um sein österreichisches Erbe zu beanspruchen. Ein Jahr später machten britische und niederländische Waffenstillstandsabkommen Starhembergs Position vollends unhaltbar. Im September 1714 kapitulierte Barcelona, womit die Epoche der Habsburgerherrschaft in Spanien endgültig endete. Manche meinen, die Konzentration auf Italien habe zur Vernachlässigung Deutschlands und des Reichs geführt; Joseph sei es nicht gelungen, dessen Westgrenze zu sichern und an Frankreich verlorenes Gebiet zurückzugewinnen. Das war wohl ohnehin nie eine realistische Option, aber die deutsche Situation war von Anfang an komplizierter. Eine aggressive Politik wie in Italien war hier nicht denkbar: Gegen Frankreich hätte sie nicht viel bewirkt und die deutschen Länder hätten sie sowieso nicht akzeptiert. Viel Aufhebens wurde um den Umgang mit Reichsvizekanzler Friedrich Karl von Schönborn gemacht, dem einundzwanzigjährigen Neffen des Mainzer Kurfürsten Lothar Franz von Schönborn, der ihn im Januar 1705 für den Posten nominierte. 12 Zunächst verweigerte Leopold seine Ernennung, die Joseph dann doch bestätigte, ihn jedoch schrittweise von allen Entscheidungen ausschloss, die nicht unmittelbar Deutschland betrafen. Schönborns Enttäuschung über die offensichtliche Herabwürdigung seines Amts sollte indes nicht über seinen anhaltenden Einfluss in der deutschen Politik hinwegtäuschen. Auf lange Sicht nahm die Bedeutung der österreichischen und böhmischen
139
140
II. · Konsolidierung und Krise 1705–1740
Kanzleien sicherlich zu. Während Josephs Herrschaft und zu Beginn der von Karl spielten der Reichsvizekanzler und der Erzkanzler in Mainz aber weiterhin eine entscheidende Rolle. Die meisten deutschen Fürsten hatten sich dem Kaiser angeschlossen, auch wenn sich einige anfangs sträubten, in einen vermeintlich österreichischen Krieg hineingezogen zu werden. Die armierten Fürsten zogen es wie üblich vor, ihre Truppen gegen Subsidien in den Dienst verschiedener Bündnispartner zu stellen. Hannover und Brandenburg schlossen sich in eigenem Namen der Großen Allianz an. Aufgrund der Verleihung der Kurwürde beziehungsweise der Anerkennung des Königstitels in Preußen waren beide dem Kaiser verpflichtet. Zudem wollte Hannover seine Aussichten auf den britischen Thron verbessern, falls Königin Anne ohne Erben stürbe, während Brandenburg zumindest auf einige niederländische und deutsche Ländereien Wilhelms III. hoffte. 13 Sachsen war weiterhin mit Polen beschäftigt; um sich dort den Thron zu sichern, unternahm der Kurfürst mehrere Anläufe, die schwedische Macht im Baltikum zu untergraben. 1705 wurde er selbst aus Polen verdrängt und kehrte erst 1709 zurück, woraufhin es noch mehrere Jahre dauerte, das Königreich zu befrieden. 14 In Süd- und Mitteldeutschland bildeten die Vorderen Kreise mit dem österreichischen Kreis 1702 die Nördlinger Assoziation, die Markgraf Ludwig Wilhelm von Baden (den »Türkenlouis«) zu ihrem Kommandeur ernannte und der Großen Allianz beitrat. 15 Dieser Bund beruhte auf dem Modell seiner Vorgänger, war jedoch viel umfassender. Sein Hauptziel war die Verteidigung gegen Frankreich, viele traten ihr indes bei, weil sie Schutz vor den Zumutungen der armierten Fürsten suchten. Überhaupt waren viele kleinere Fürsten, die ehedem den armierten Fürsten nacheifern und eine unabhängige militärische Rolle spielen wollten, nun auf Schutz und Sicherheit in einer bewaffneten Allianz aus. Zugleich war von vornherein klar, dass die Assoziation nicht nur militärisch unabhängig sein, sondern auch ihre Interessen in eventuellen Friedensverhandlungen direkt vertreten wollte. So bildeten die kleineren Länder einen Block mit Zielen und Erwartungen ähnlich denen der mächtigeren Fürsten, außer dass ihre Ausrichtung grundsätzlich defensiv und nicht expansiv war. Dies führte zu Spannungen mit dem Kaiser. Während der Bund von Anfang an davon ausging, dass er unter dessen Protektion stand (sub auspiciis caesaris), misstraute er Österreich als Territorialmacht. Dass er sich mit dem Reich und nicht mit dem Kaiser als österreichischem Herrscher identifizierte, unterstrich die Tatsache, dass Kurfürst Lothar Franz von Schönberg de facto als sein Anführer auftrat, wenn auch in seiner Funktion als Fürstbischof von Bamberg und nicht als Reichserzkanzler oder Erzbischof von Mainz. Wer sich weigerte, am Krieg teilzunehmen, wurde als ebenso bedrohlich wie Frankreich selbst betrachtet. Die Wittelsbacher Kurfürsten Max Emanuel von Bayern und Joseph Clemens von Köln verhandelten mit Frankreich, der katholische
13. Leopold I., Joseph I. und der Spanische Erbfolgekrieg
Konvertit Herzog Anton Ulrich von Braunschweig-Wolfenbüttel verweigerte dem Kaiser die Unterstützung, weil er immer noch wütend über die Schaffung einer Kurwürde für seine Verwandten in Hannover war. Mit Anton-Ulrich wurde Leopold leicht fertig, indem er seinen Vettern Georg Ludwig von Hannover und Georg Wilhelm von Celle gestattete, dessen Länder zu besetzen. Die Wittelsbacher waren gefährlicher. Der Kölner Kurfürst gewährte im Mai 1702 französischen Truppen Zutritt zu Köln und Lüttich, auch um eine Besetzung durch niederländische und norddeutsche Streitkräfte zu verhindern. Dies brachte Max Emanuel von Bayern, der in seiner Funktion als Statthalter der Spanischen Niederlande darauf hoffte, ein Scherflein vom spanischen Erbe aus der Hand Leopolds oder andernfalls Ludwigs XIV. zu ergattern, in Zugzwang. Sein Versuch, Leopold durch die Eroberung einiger schwäbischer Städte im September 1702 unter Druck zu setzen, führte nur dazu, dass sich die Mehrheit der deutschen Länder hinter den Kaiser stellte und der Reichstag Frankreich am 30. September den Krieg erklärte. Die Militäroperationen gegen Frankreich im Westen begannen günstig. Britische und niederländische Streitkräfte nahmen Roermond, Venlo und Lüttich ein, Joseph selbst führte die kaiserlichen Truppen im September 1702 gegen die französische Festung Landau. 16 Ansonsten aber bezogen die Kräfte von Ludwig Wilhelms Nördlinger Assoziation Verteidigungsstellungen hinter den Landfestungen und Linien, die ab den 1670er Jahren am Oberrhein errichtet worden waren. 17 Finanzielle Probleme, politische Dispute in Wien und der Vorrang anderer Schauplätze zogen die Aufmerksamkeit von Deutschland ab. Als Bayern und Frankreich das ausnutzen wollten, änderte es sich schnell wieder. Im September 1703 überschritten die Franzosen den Rhein, nahmen Breisach ein und schlugen gemeinsam mit Bayern eine kaiserliche Armee bei Schwenningen-Höchstädt an der Donau. Dann eroberte Max Emanuel Augsburg, besetzte Passau und drang bis Linz nach Oberösterreich vor. Die alliierte Reaktion entschied den Krieg. Marlborough führte eine englischniederländische Armee den Rhein hinab und schloss sich an der Donau den kaiserlichen und Kreistruppen unter dem Befehl von Prinz Eugen und Ludwig Wilhelm von Baden an; gemeinsam schlugen sie die französisch-bayerische Streitmacht am 13. August bei Höchstädt. Max Emanuel floh in die Spanischen Niederlande, die Franzosen zogen aus Deutschland ab und kehrten nur noch zweimal kurz zurück, im Mai 1707 und im September 1713. Bayern fiel unter ein hartes Besatzungsregime, das dem Land so viel Geld und Männer abpresste, dass es 1705 zu einem großen Bauernaufstand kam. 18 Der Sieg in Süddeutschland ließ Wien freie Hand, mit einer Rebellion fertigzuwerden, die im Sommer 1703 in Ungarn losgebrochen war. 19 Franz II. Rákóczi, der Stiefsohn von Emmerich Thököly, dem Anführer des Kuruzenaufstands der
141
142
II. · Konsolidierung und Krise 1705–1740
1670er Jahre, hoffte auf französischen Beistand, um die Ablenkung durch den spanischen Krieg zu nutzen. Nach der Niederlage von Höchstädt konnte weder Ludwig XIV. noch Max Emanuel Hilfe schicken, aber Rákóczi gewann dennoch an Boden. Sein Programm eines toleranten Katholizismus stachelte die gesamte ungarische Opposition auf; es drohte der Verlust von Siebenbürgen sowie Ungarn und 1704 machten ungarische Raubzüge nahe Wien die eilige Errichtungen von Festungen zum Schutz der Vorstädte nötig. Großbritannien und die Niederlande boten Vermittlung an und waren irritiert, als Joseph einen Kompromiss ablehnte. Er teilte zwar den dogmatischen Katholizismus seines Vaters nicht, wollte aber nichts aufgeben, was Leopold erworben hatte, und konnte Rákóczis Forderung nach internationalen Garantien und einem unabhängigen Siebenbürgen keinesfalls akzeptieren. 1707 wurde die Bedrohung einer Abspaltung real, als eine Gruppe aufständischer siebenbürgischer Länder Rákóczi zum Fürsten von Siebenbürgen ernannte, das ungarische Parlament in Ónod Joseph formell absetzte und den ungarischen Thron für vakant erklärte. Die Seemächte und die deutschen protestantischen Fürsten beanstandeten Habsburgs Vorgehen gegen seine protestantischen Untertanen. Hinter Josephs kompromissloser Haltung standen jedoch entscheidende konstitutionelle Aspekte und nicht die Religion, was dadurch unterstrichen wurde, dass er eine Verknüpfung des nordeuropäischen Konflikts mit den Problemen in Ungarn und dem Spanischen Erbfolgekrieg vermied. 1704 hatte Karl XII. von Schweden König August aus Polen in sein Kursachsen vertrieben, Stanislaus Leszczynski als polnischen König eingesetzt und war dabei durch Schlesien marschiert. Die ungarischen Rebellen hofften auf ihn, während der Kurfürst von Brandenburg die Chancen einer Allianz von Schweden, Hannover und Brandenburg auslotete. Joseph wollte kein Risiko eingehen und bestach Karl XII. mit dem zweiten Friedensvertrag von Altranstädt vom 1. September 1707. 20 Entscheidend waren seine erheblichen Zugeständnisse an die schlesischen Protestanten, die ihre Rechte aus dem Westfälischen Frieden wiederherstellten und die illegale Rekatholisierung des Landes durch die Habsburger nach 1648 rückgängig machten. Nicht einmal die Türken wollten den ungarischen Rebellen beistehen. Eine vernichtende Niederlage gegen kaiserliche Truppen im August 1708 schwächte Rákóczis Bewegung und schließlich endete der Konflikt 1711, kurz nach Josephs Tod, mit dem Frieden von Szatmár. Um die Erbfolge in Ungarn und Siebenbürgen zu sichern, erklärten sich die Habsburger bereit, die Gesetze des ungarischen Königreichs zu achten. Obwohl Ungarn einen gewaltigen Aufwand erforderte, ging der Feldzug in Italien unerbittlich voran. Der Schwerpunkt des spanischen Kriegs hatte sich derweil in die Spanischen Niederlande verlagert. Marlboroughs Sieg bei Ramillies im Oktober 1706 beendete Max Emanuels Statthalterschaft. Brabant, Malines und der größte Teil von Flandern waren Ende des Jahres eingenommen. Achtzehn Monate
13. Leopold I., Joseph I. und der Spanische Erbfolgekrieg
später schlugen Marlborough und Prinz Eugen eine neue französische Gegenoffensive bei Oudenaarde (11. Juli 1708) zurück und eroberten Lille. Ein endgültiger Sieg gegen Frankreich gelang jedoch nicht; ein weiterer Versuch nach dem Abbruch der ersten Friedensverhandlungen endete mit dem alliierten Sieg bei Malplaquet (11. September 1709), der so kostspielig war, dass er die Verhandlungsposition der Allianz eher untergrub. 21 Nach Oudenaarde zeigte sich Frankreich jedoch offen für Friedensgespräche, wodurch die widerstreitenden Interessen der Großen Allianz zutage traten. 22 Die Franzosen schienen 1709 in La Hague bereit, den kompletten Rückzug aus Spanien, Barrierefestungen zu den Niederlanden, die britische Thronfolge Hannovers und die Ausweisung des Old Pretender aus Frankreich zu akzeptieren, ebenso wie den Rückfall Straßburgs und der während der Reunionen von 1679 bis 1681 besetzten elsässischen Gebiete an das Reich. Die Verpflichtung, militärisch gegen Philipp V. vorzugehen, falls er seine Ländereien nicht aufgeben wollte, lehnten sie jedoch ab. Eine zweite Verhandlungsrunde in Geertruidenberg kam nicht weiter und bald darauf begann die alliierte Solidarität zu bröckeln, als die neue, friedfertig gesinnte britische Tory-Regierung Marlborough zurückrief und geheime Verhandlungen mit Frankreich aufnahm. Josephs plötzlicher Tod am 17. April 1711 machte alle Kalkulationen hinfällig. Da er nur zwei Töchter hatte, ging sein Erbe an Karl, wodurch das Schreckgespenst einer Vereinigung spanischer und österreichischer Länder zu einem Imperium, größer als das Karls V., aktuell wurde. Der Widerstand von Ludwig XIV., Papst Clemens XI. und den beiden geächteten Wittelsbacher Kurfürsten (die nicht zur Wahl zugelassen wurden) konnte die relativ problemlose Wahl Karls zum Kaiser am 12. Oktober 1711 nicht verhindern. Er war der letzte verbliebene männliche Habsburger; schon das genügte manch einem Kurfürsten, für ihn zu stimmen. Großbritannien und die Niederlande unterstützten Karls Wahl, betrachteten das mögliche Ausmaß seiner Territorien – von den Westindischen Inseln bis Ungarn und von Spanien und Italien bis zu den Spanischen Niederlanden – jedoch mit großer Besorgnis. Aber die britische Regierung drängte auf Frieden und nach einer verheerenden Niederlage gegen Frankreich bei Denain am 24. Juli 1712 schlossen sich die Niederlande an. Binnen eines Jahres schlossen Großbritannien, die Niederlande, Savoyen, Portugal und Preußen mit Frankreich in Utrecht Frieden. Entscheidend war dabei die Untermauerung der Herrschaft Philipps V. in Spanien, während die Habsburger in den Spanischen Niederlanden und einem Großteil von Italien bestätigt wurden; lediglich Sizilien ging mit einem Königstitel an Savoyen und Sardinien wurde für Max Emanuel von Bayern reserviert. Britische Handelsinteressen wurden mit Gibraltar und Menorca sowie einem dreißigjährigen Monopol auf den spanisch-
143
144
II. · Konsolidierung und Krise 1705–1740
amerikanischen Sklavenhandel befriedigt. Den Niederlanden sagte man Barrierefestungen zu, hauptsächlich auf Kostens Habsburgs, deren genaue Bedingungen jedoch offen blieben. Brandenburg-Preußen erhielt Neuchâtel, Moers, Lingen und einen Teil von Geldern (fortan Oranien genannt). Friedrich Wilhelm I. bekam dazu Titel und Wappen eines Prinzen von Oranien zugesprochen, verzichtete indes auf alle Ansprüche auf Franche-Comte und das französische Fürstentum Oranien selbst. Erfolgreich war auch Frankreichs Forderung nach Sizilien mit einem Königstitel für Savoyen und Wiedereinsetzung der Wittelsbacher in ihre Länder und Titel. Max Emanuel behielt bis dahin Luxemburg, Namur und Charleroi. Der Kaiser lehnte den Frieden ab, weil die Vereinbarung in Bezug auf Spanien nicht akzeptabel war. Zudem blieben die Anliegen des Reichs unberücksichtigt. Die Forderung nach einer Reichsbarriere zum Schutz gegen Frankreich und das Ersuchen der protestantischen Fürsten nach Widerruf des infamen Artikels 4 des Friedens von Rijswijk wurden ignoriert. 23 Eine weitere militärische Auseinandersetzung mit Frankreich, bei der französische Truppen erneut die Verteidigungslinien im Schwarzwald durchbrachen, änderte die Substanz des Abkommens nicht. Im März 1714 setzte Österreich in Rastatt die Rückgabe von Breisach, Freiburg und Kehl sowie die Zerstörung aller französischen Festungen am rechten Rheinufer durch. Karl VI. musste Max Emanuel vollständig wiedereinsetzen, inklusive der Rückgabe der Oberpfalz, die 1706 dem loyalen Pfalz-Neuburger Kurfürsten von der Pfalz übertragen worden war. 24 Da Max Emanuel nicht weiter entschädigt werden musste, ging Sardinien an die Habsburger, die Bayern vergaßen jedoch nicht, dass man ihnen damit einen Königstitel vorenthalten hatte. Was die Reichsbarriere und die Bestimmungen von Rijkswijk betraf, gab es keine weiteren Fortschritte; der im September 1714 im schweizerischen Baden mit Frankreich für das Reich geschlossene Vertrag bestätigte nur, was in Utrecht und Rastatt beschlossen worden war. Übten Joseph und Karl Verrat am Reich, indem sie ihre eigene Erhöhung in Italien und den Spanischen Niederlanden betrieben? Offiziell war das Reich nicht Teil der Großen Allianz, durfte also eigentlich überhaupt keine Forderungen stellen, und 1714 scherte sich international sowieso kaum jemand um die Haltung des Reichstags zum Krieg. Die Nördlinger Assoziation gehörte der Allianz jedoch an und ging als einziges Mitglied ohne Gewinn aus dem Krieg hervor. In weiterem Umfeld betrachtet, erscheint die österreichische Politik in anderem Licht. 25 Im Grunde stimmten Joseph und Karl mit den Niederlanden und der Nördlinger Assoziation überein, dass eine Barriere gegen zukünftige französische Aggressionen von der Nordsee bis zur Schweiz wünschenswert war. Zugleich wollte Österreich die Sicherheit Lothringens garantieren, was nach Meinung mancher nur möglich war, wenn man das Elsass mit Straßburg, aber auch Metz, Toul und Verdun zurückgewann.
13. Leopold I., Joseph I. und der Spanische Erbfolgekrieg
Das ging viel weiter als ein bloßes Bestehen auf der Unantastbarkeit des Westfälischen Friedens: Die Bistümer waren seit 1552 in französischer Hand und 1648 offiziell abgetreten worden. Der Herzog von Lothringen erhob sogar Anspruch auf die Franche-Comté und andere Gebiete zur Bildung einer Schutzbarriere gegen französische Angriffe. Die Nordgrenze war recht unkompliziert. Hier einigten sich Großbritannien und die Niederlande 1709 und 1713 in Verträgen, die im Grunde an eines der Ziele der Großen Allianz von 1701 anknüpften: eine Barriere aus größtenteils spanischniederländischen Gebieten (und teilweise auch von dort finanziert). Es wurde im dritten Barrierevertrag umgesetzt, den die Niederlande und Wien 1715 schlossen und Großbritannien garantierte und der im Gegenzug die Rückgabe der Spanischen Niederlande in habsburgische Hände zuließ. Pläne für eine Reichsbarriere gab es seit den 1690er Jahren, sie waren jedoch sämtlich extrem kompliziert und setzten die französische Zustimmung zur Rücknahme von Entwicklungen der letzten eineinhalb Jahrhunderte voraus. 26 Nichts wäre der kaiserlichen Regierung lieber gewesen als ein Frankreich, umgeben von einem Ring aus Savoyen, Lothringen und den Niederlanden. 27 Schönborns Anläufe zu einer Allianz mit den Niederländern erregten unweigerlich den Widerspruch der Reichsregierung, hätten aber wohl sowieso kaum etwas ergeben. Es gab schlicht zu viele gegensätzliche Interessen und Frankreich war zwar vom Krieg erschöpft, aber nicht gänzlich besiegt. Andererseits hatte die Nördlinger Allianz immerhin ihr Hauptkriegsziel erreicht: das Überleben sämtlicher Mitglieder ohne Verluste. 28 Für das Reich war das Ergebnis des Spanischen Erbfolgekriegs die Wiederherstellung des Status quo, Österreich konnte hingegen mit den Spanischen Niederlanden, Neapel, Mailand und Sardinien beträchtliche Gewinne verbuchen. Sizilien und andere Teile des Herzogtums Mailand gingen an Savoyen, das 1718 noch Sardinien erhielt. In der Folge mussten den Bourbonen in Italien einige Zugeständnisse gemacht werden, aber im Norden entstand letztlich ein gefestigter Block habsburgischer Territorien. Von direkter Bedeutung für das Reich war der Erwerb der Spanischen Niederlande, und zwar in zweierlei Hinsicht. Sie galten von Anfang an als Aktivposten, den man irgendwann gegen Bayern tauschen konnte, was unter Joseph II. hochaktuell wurde. 29 Zudem verschaffte dieser Zugewinn der imperialen Politik einen neuen Blickwinkel und Einfluss im Nordwesten in den 1720er und 1730er Jahren. Nicht zuletzt hatten die Habsburger nun ein ureigenes Interesse am Reich als Transitroute für ihre Streitkräfte zwischen den österreichischen Erblanden und Flandern: Eine »österreichische Straße« ersetzte somit die »spanische Straße«. 30
145
146
II. · Konsolidierung und Krise 1705–1740
Anmerkungen 1 Den besten kurzen Abriss des Konflikts bietet Hochedlinger, Wars, 174–193; vgl. auch Aretin, Das Reich, 119–127. 2 Ebd., 106–111. 3 Aretin, Altes Reich II, 87. 4 O’Reilly, »Lost Chances«, 54–61; Aretin, Das Reich, 255–322; Klueting, Reich, 97–111. 5 Ingrao, In Quest, 15–23. 6 Ebd., 28 f. 7 Schmidt, »Joseph I«, 194–198; Klueting, Reich, 97–111. 8 Aretin, Altes Reich II, 128–34, 194–215. 9 Press, »Josef I.«, 287. 10 Ebd., 286; laut dem Erbfolgepakt von 1703 stand Neapel Karl zu. 11 Hochedlinger, Wars, 185 f. 12 Ingrao, In Quest, 34–38; Klueting, Reich, 106 f. 13 Wilhelm III., der im März 1702 starb, hatte Graf Johann Wilhelm Friso von Nassau-Dietz als seinen Erben eingesetzt und die niederländische Regierung zu seinem Vollstrecker ernannt. Das hielt König Friedrich I. nicht ab, unter Berufung auf die Erbrechte seiner Mutter Louise Henriette von Oranien, Tochter von Friedrich Heinrich von Oranien (* 1584, † 1647) und Tante Wilhelms III., die Grafschaften Lingen und Moers zu besetzen. Später verschaffte er sich das Fürstentum Neuchâtel im Schweizer Jura. Der Versuch, sich in den Friedensverhandlungen nach 1709 auch Oranien zu sichern, scheiterte jedoch.Vgl. Köbler, Lexikon, 383, 433, 461, 497. 14 Stone, Polish-Lithuanian State, 249–253. 15 Vgl. für das Folgende Plassmann, Krieg, 366–473; Gotthard, »Friede«, 56–63; Wilson, German Armies, 192–201; Wines, »Imperial Circles«, 13–29. 16 Hochedlinger, Wars, 180. 17 Wilson, German Armies, 55 f. 18 Ebd., 116 f. 19 Ingrao, In Quest, 123–160; Hochedlinger, Wars, 174–193. 20 Press, »Josef I.«, 281 ff. 21 Lynn, Wars, 331–335. 22 Aretin, Altes Reich II, 229–248. 23 Artikel 4 des Vertrags von Rijswijk (1697) gestand Katholiken religiöse Rechte in Gebieten am rechten Rheinufer (hauptsächlich der Pfalz) zu, die im Krieg von Frankreich besetzt waren. Dies widersprach dem Westfälischen Frieden und stieß auf erbitterten Widerstand deutscher Protestanten.Vgl. S. 69, 179–185, 197. 24 1623 war sie von der Pfalz an Bayern abgegeben worden. 25 Aretin, Altes Reich II, 150–161; Wilson, German Armies, 125 ff., 199 ff. 26 Plassmann, Krieg, 343 ff. 27 Aretin, Altes Reich II, 157 f. 28 Plassmann, Krieg, 473. 29 Hochedlinger, Wars, 187; vgl. S. 457 f., 485 f. 30 Hochedlinger, Wars, 186 f. Zur »spanischen Straße« vgl. Parker, Army of Flanders.
14. Joseph I. und die Regierung im Reich
J
osephs Regierungszeit war so beherrscht vom Spanischen Erbfolgekrieg, dass seine Verwaltung des Reichs oft lediglich als eine weitere Facette des Kriegs gesehen wird. Sicherlich war der langwierige Kampf gegen die »teuflischen Franzosen«, wie er sie gern nannte, seine Hauptbeschäftigung. 1 Aber wie Joseph in Italien eine sehr eigene Politik entwickelte, so auch im Deutschen Reich. Seine Ansätze waren in Deutschland vielleicht weniger deutlich als in Italien. Die »österreichischen« Interessen mögen die »imperialen« Belange in Italien überwogen haben, aber der politische Rahmen in Deutschland verlangte ein nuanciertes Herangehen. Hier waren die Hindernisse für eine uneingeschränkte kaiserliche Machtausübung viel stärker, weil im Recht und den Bräuchen des Staates selbst verankert. Die Spannung zwischen »österreichischen« und »kaiserlichen« Interessen und Rollen im Reich war indes nicht neu; sie bildete seit der Herrschaft von Maximilian den Kern vieler politischer Probleme. Mit dem Wachsen der habsburgischen Ländereien und der zunehmenden Festigkeit ihrer Herrschaft wurde sie jedoch prekärer. Viele im Reich wurden sich langsam des krassen Ungleichgewichts zwischen Größe und Macht der Habsburger Territorien und der Mehrheit der Länder im Reich bewusst.Verstärkt wurden diese Ängste durch die Erneuerung und Erweiterung der kaiserlichen Macht unter Ferdinand III. und Leopold I. Es ist bezeichnend, dass viele Zeitgenossen glaubten, die kaiserliche Macht habe unter Joseph I. eine neue Qualität entwickelt. Rupert von Bodman, der Fürstabt von Kempten, der Leopold dreißig Jahre lang treu gefolgt war und dann in Josephs Dienste trat, hielt dessen Herrschaft für einen Höhepunkt der Reichsgeschichte. 2 Andere äußerten sich kritischer und argwöhnischer bezüglich der kraftvollen Ausübung royaler Vorrechte. Aber auch ihre Reaktion bezeugt den neuen Elan, mit dem Joseph das Amt des Kaisers versah. Joseph, Reichvizekanzler Friedrich Karl von Schönborn und Reichserzkanzler Lothar Franz von Schönborn hatten bei aller Unterschiedlichkeit viel gemeinsam. Der Reichsvizekanzler beklagte seinen Ausschluss von allen Entscheidungen, bei denen es nicht allein um Deutschland ging, aber er stand dem Kaiser bei dessen Bemühungen bei, das Reich mit neuem Leben zu erfüllen. Die Probleme zwischen Joseph und Lothar Franz entsprangen dessen Einsatz für die Länder, insbesondere jene, die der Nördlinger Assoziation angehörten. Aber beide waren sich einig, dass das Reich funktionieren und fähig sein sollte, sich gegen Angriffe zu verteidigen.
148
II. · Konsolidierung und Krise 1705–1740
Joseph profitierte von den Erfolgen Ferdinands III. und Leopolds I., wollte seine Macht jedoch weniger zurückhaltend und diskret ausüben als diese. Darin schlug sich auch die Einstellung einer neuen Generation nieder. Anders als Ferdinand und Leopold litt Joseph nicht unter dem Trauma des Dreißigjährigen Krieges. Ihn prägte die Erinnerung an die Flucht der Dynastie aus Wien 1683 und die französische Bedrohung. 3 Leopold hatte in den 1690er Jahren die Türken besiegt. Für Joseph und viele Mitglieder des »jungen Hofs« bot der spanische Krieg die Gelegenheit, mit den Franzosen ebenso endgültig fertig zu werden. Das, glaubten sie, sei für den Kaiser entscheidend, um echte Macht ausüben zu können. Wie Josephs Lehrer Hanns Jacob Wagner von Wagenfels 1691 in seinem Ehren-Ruff Teutschlands, der Teutschen und ihres Reichs gepredigt hatte, beruhte die kaiserliche Erhabenheit auf Macht und Territorium; sie war nichts, wenn ihr Träger sie nicht durchsetzen konnte. 4 Wagenfels’ Appell richtete sich an Deutschland und die Deutschen und verdeutlichte Joseph seine Vorrechte im Deutschen Reich wie in anderen Teilen seines weitläufigen Erbes. Die Macht im Reich auszuüben war nie einfach. Die Anerkennung des Rechts der Fürsten von 1648, Verträge mit fremden Mächten zu schließen, der Auftritt »armierter« Fürsten, die dieses Recht für komplizierte Subsidienabkommen nutzten, und das Streben einiger von ihnen nach Königstiteln und Teilhabe an internationalen Friedensverhandlungen in eigenem Recht (und zum eigenen Vorteil) machten die alten Probleme noch komplexer. Dennoch gelangen Joseph einige entscheidende Schritte, die sowohl die Bewunderung als auch das Misstrauen, das er erregte, rechtfertigten. Auch ohne den Krieg waren die Voraussetzungen für eine zielgerichtete Politik nicht günstig.Während des ersten Jahrzehnts des 18. Jahrhunderts spaltete ein bitterer Streit zwischen Protestanten und Katholiken über die religiösen Implikationen des Vertrags von Rijkswijk den Reichstag. 5 Als der Vertrag ratifiziert wurde, hatten der Kaiser und die katholischen Fürsten ihr Wort gegeben, keine religiösen Bedingungen zu applizieren; dennoch gewährte der pfälzische Kurfürst katholischen Gemeinden Glaubensfreiheit – ein klarer Bruch des Westfälischen Friedens. Johann Wilhelms Vorgehen stellte einen eklatanten Versuch der Rekatholisierung der Pfalz dar und besaß nach 1701 keine gesetzliche Basis mehr, weil der Spanische Erbfolgekrieg den Vertrag von Rijswijk praktisch annulliert hatte. Lautstarke Beschwerden der protestantischen Länder bewirkten die Einsetzung einer wenig wirkungsvollen Enquetekommission, bis der Streit schließlich durch Vermittlung des brandenburgischen Kurfürsten im November 1705 beigelegt wurde. Die Rechte der konfessionellen Gemeinden in der Pfalz und ihre Ansprüche auf Kirchenbesitz waren damit zumindest vorübergehend geklärt. Das Thema war jedoch nicht vom Tisch. Die protestantischen Länder stritten noch während der Ver-
14. Joseph I. und die Regierung im Reich
handlungen um die Beendigung des spanischen Kriegs für die Rücknahme des Vertrags von Rijswijk, als diese längst nicht mehr zu erwarten war. Das Problem war von einiger Wichtigkeit, zumindest für die Gemeinden, deren Glaubensrechte und Kirchenbesitz auf dem Spiel standen. Vor dem Hintergrund der Reichstagspolitik hatte es auch symbolische Bedeutung.Weder Leopold I. noch Joseph I. wagten es, Kurfürst Johann Wilhelm (ihren Schwager beziehungsweise Onkel) in die Schranken zu weisen. Nach der Einigung von 1705 verweigerte Joseph auf Anfrage eine Garantie der Rechte der pfälzischen reformierten Gemeinden und verpasste damit eine Gelegenheit, seine Neutralität in der Reichspolitik zu beweisen. 6 Joseph war bekanntermaßen weniger fromm und dogmatisch als sein Vater; seine Lehrer waren allesamt Gegner der Jesuiten gewesen, ein weiteres Merkmal des »jungen Hofs«. Hier indes schien er ebenso dem Katholizismus zugeneigt wie Leopold. Gleichzeitig ging es mehr als nur um Religion. Die erfolgreiche Vermittlung des brandenburgischen Kurfürsten war ein kleiner Geniestreich. Er übernahm die traditionelle Rolle des sächsischen Kurfürsten als Beschützer der deutschen Protestanten und die des Kaisers als Mittler zwischen den offiziell anerkannten Konfessionen des Reichs – ein frühes Beispiel für die brandenburgisch-preußische Mimikry der kaiserlichen Rolle, auf die sich Friedrich der Große später spezialisierte. Josephs Haltung beruhte zudem auf handfesten machtpolitischen Berechnungen. Der pfälzische Kurfürst war ein naher Verwandter sowie katholisch und zudem einer seiner verlässlichsten deutschen Verbündeten, ein entscheidendes Mitglied der kaiserlichen Klientel im Reich. Von katholischer Solidarität ließ Joseph im Umgang mit den Wittelsbachern nichts erkennen. Durch ihre Parteinahme für Frankreich nach der Kriegserklärung des Reichstags hatten Joseph Clemens von Köln und Max Emanuel von Bayern Reichsrecht gebrochen. Im November 1702 beriet deswegen der Reichshofrat und empfahl, die Kurfürsten zu ersuchen, ihrer Ächtung zuzustimmen, womit man allerdings warten wollte, bis Max Emanuel besiegt war; dann gab es einen weiteren Aufschub, weil Brandenburg sich zu handeln weigerte, ehe der Religionsstreit in der Pfalz beigelegt war. Im November 1705 stimmten die Kurfürsten (ohne Köln und Bayern) zu und der Reichstag wurde unterrichtet, dass der Kaiser die Rebellen geächtet hatte. Der Kontrast zwischen dem, was in Deutschland folgte, und dem Ergebnis ähnlicher Vorgehensweisen gegen den Herzog von Mantua und andere in Italien ist aufschlussreich. Der Fall Köln wurde dadurch verkompliziert, dass der Kaiser lediglich Joseph Clemens’ Ländereien konfiszieren konnte. Den Bischofstitel konnte nur der Papst aberkennen, wozu es nie kam. Die Territorien des Geächteten waren verschiedentlich von diversen Streitkräften besetzt, ihre Verwaltung blieb jedoch in den Händen des Domkapitels. Bayern war für die Habsburger von wesentlich direkterer
149
150
II. · Konsolidierung und Krise 1705–1740
Bedeutung.Während Leopold relativ milde Kapitulationsbedingungen gestellt hatte, griff Joseph unverzüglich hart durch, was bald zu einem großen Bauernaufstand führte. Während der Phase österreichischer Verwaltung wurden dem Kurfürstentum etwa 22 Millionen Gulden abgepresst. 7 Eine dauernde österreichische Besetzung Bayerns stand als Drohung im Raum. 8 Diskutiert wurden aber auch andere Lösungen des bayerischen Problems. Man fasste ins Auge, es den österreichischen Erblanden einzuverleiben; derartige Überlegungen bildeten die Grundlage späterer Pläne Josephs II. 9 Aber die Ratgeber Josephs I. befürchteten offenbar, ein solches Vorgehen werde auf starken Widerstand stoßen. Es war klar, dass der bayerische Kurfürst irgendwann wiedereingesetzt werden musste. Wenn Österreich Bayern übernommen hätte, hätte man den Kaiser für den Verlust entschädigen müssen. Die Idee eines wittelsbachischen Königreichs in Neapel und Sizilien war zweifellos abstrus. Ludwig XIV. half unwissentlich, ihr den Boden zu bereiten, indem er Max Emanuel im Januar 1712 zum Souverän der südlichen Niederlande machte, aber dieses »Königreich« war lediglich eine Mogelpackung aus Luxemburg und Namur, von Max Emanuel gemütlich von einer Residenz bei Versailles aus regiert. 10 Jedenfalls hatten Ludwig und Max Emanuel auf mehr als die Restitution Bayerns gehofft, aber das war alles, was sie erreichten. Parallel zu den Spekulationen über die Zukunft des bayerischen Kernlands wurden andere Teile von Max Emanuels Territorium einer »Dismembration« unterworfen. 11 Die 1623 von der Pfalz abgetretene Oberpfalz ging zurück an den Kurfürsten Johann Wilhelm, einen der entschiedensten Befürworter einer Auflösung des bayerischen Kurfürstentums. Andere zuvor unabhängige Graf- und Grundherrschaften wurden ebenfalls Favoriten der Habsburger und hohen Hofbeamten zugesprochen. Die kleine Grafschaft Leuchtenberg, die die Wittelsbacher 1646 geerbt hatten, erhielt Graf Leopold Matthias Lamberg, ein notorischer Liebling des Kaisers. 12 1705 ging Mindelheim an Marlborough, der dadurch Reichsfürst wurde. 13 Donauwörth wurde wieder Reichsstadt. Es ging darum, Bayern zu erniedrigen und die territoriale Konsolidierung umzukehren, in deren Zuge seine Herrscher sich ehemals unabhängige Enklaven und kleinere Nachbargebiete einverleibt hatten. Einige dieser Territorien (etwa Mindelheim und Donauwörth) gehörten zum schwäbischen Kreis, aber größtenteils lagen sie im bayerischen Kreis, wo neue unabhängige Ländereien mehr Stimmen in den Kreisversammlungen bedeuteten, was Bayerns Dominanz unterminiert hätte. Kein Wunder, dass die Fürsten, speziell die »alten«, die traditionell den Kern der Opposition gegen die Krone bildeten, fürchteten, Joseph wolle ihre Stellung untergraben, indem er aus seiner Klientel neue Fürsten erhob. 14 Der Friedensvertrag von Utrecht warf all diese Veränderungen ohne Kompensation über den Haufen. Marlboroughs Tage als deutscher Fürst endeten 1713. In
14. Joseph I. und die Regierung im Reich
Deutschland konnte der Kaiser anders als in Italien nicht einfach Territorien konfiszieren. In Mantua wurde die Herrscherfamilie einfach weggefegt, der Anspruch der jüngeren Linie ignoriert und der Kaiser übernahm das Herzogtum selbst. 15 Das jagte den deutschen Fürsten einen Schrecken in die Glieder. Aber in Deutschland mit seinem wesentlich robusteren Rechtssystem war so etwas undenkbar. In Italien fanden die Erlasse des Reichhofrats ihre Grenzen dort, wo sie nicht militärisch durchsetzbar waren. In Deutschland waren die Vorrechte des Kaisers nicht klar definiert, aber zumindest in wichtigen Punkten durch Recht und Brauch beschränkt. Zudem waren die armierten Fürsten, die selbst so gern kleinere Territorien unterjochten, jederzeit bereit, diese zu verteidigen, wenn es gegen den Kaiser ging. Dennoch wurde die kaiserliche Macht unter Joseph energischer ausgeübt als je zuvor. Angesichts der Widerspenstigkeit und Zersplitterung des Reichstags zögerte er nicht, diesem mit der Auflösung nach Kriegsende zu drohen. 16 Im Februar 1708 kündigte er Strafen für Reichsstände an, die nicht vollständig für ihre Kontingente im Krieg gegen Frankreich gezahlt hatten, beginnend mit deren Erscheinen vor einer Kommission, um für die Nichterfüllung ihrer Pflichten gegenüber dem Kaiser geradezustehen. Josephs Umgangston gegenüber den deutschen Fürsten war im Allgemeinen außergewöhnlich schroff: Selbst der Preußenkönig war nicht gegen Rügen gefeit, wenn er seinen Beitrag nicht leistete. 17 Damit einher gingen zahlreiche Initiativen, verfallene kaiserliche Vorrechte neu zu beleben. Viele davon waren geringfügig, die meisten betrafen kleinere – vor allem kirchliche – Territorien in Süd- und Mitteldeutschland. 18 In Betracht gezogen wurde eine weitere Ausnutzung des kaiserlichen Rechts, Laienbenefiziate zu vergeben, die Klöster zu lebenslangen Stipendien für vom Kaiser (per Panisbrief oder panis littera) nominierte Laien verpflichteten. 19 Das ebenso obskure Traditionsrecht des Kaisers, in jedem Bistum und jeder Stiftung das erste nach seiner Krönung frei werdende Benefizium neu zu vergeben (preces primariae), wurde reaktiviert. Im Oktober 1705 erhielt Christian Julius Schier von Schierendorf den Auftrag, weitere fiskale Vorrechte zu ermitteln, die man neu beleben konnte. 20 Er stellte fest, die Reichseinnahmen seien zweihundert Jahre lang vernachlässigt worden, und zwar in solchem Ausmaß, dass an den Brandenburger Universitäten Rechtsgelehrte die These vertraten, »Regalien und Rechte des Kaisers« seien »nur mehr ein Hirngespinst«. Allein die Juden hätten mehrere Millionen Gulden Schulden; diesem Bereich angemessene Aufmerksamkeit zu widmen, befand Schierendorf, könne bis zu einer Million Gulden pro Jahr einbringen. Tatsächlich wurden sogar die zuletzt geschätzten 20.000 Gulden nicht eingezogen. Das Lahmliegen des Reichskammergerichts zwischen 1703 und 1711 verstärkte die Bedeutung des Wiener Reichshofrats als Instrument von Recht und kaiser-
151
152
II. · Konsolidierung und Krise 1705–1740
licher Herrschaft. 21 Obwohl während des Krieges das Ausmaß der Italien betreffenden Geschäfte massiv anstieg, befasste sich der Reichshofrat weiterhin auch mit deutschen Belangen. 1707 setzte er Wilhelm Hyacinth von Nassau-Siegen ab; das Domkapitel von Köln wurde beauftragt, den katholischen Fürsten seines Territoriums zu verweisen, da sich reformierte Untertanen über Unterdrückung, Intoleranz und außerordentlich harte Besteuerung beklagt hatten. 22 Im Jahr darauf griff der Hofrat ein, um Recht und Ordnung in Hamburg wiederherzustellen, wo der Senat im Dauerstreit mit der Bürgerschaft lag. Truppen des niedersächsischen Kreises besetzten die Stadt, dann machte sich eine kaiserliche Kommission unter Damian Hugo von Schönborn an eine umfassende Reform der städtischen Verwaltung; 1712 trat eine neue Verfassung in Kraft. 23 Ein starker Reichshofrat war sehr im Interesse des Kaisers, problematisch war aber das Fehlen einer Alternative. 24 Der Wiener Hof galt vielen zu sehr als Werkzeug des Kaisers und prokatholisch. Große und kleinere Territorien gingen unterschiedlich mit dieser Situation um.Viele größere nutzten die Abneigung gegen den Wiener Hof und die Lähmung des Reichskammergerichts in Wetzlar, um Druck auf ihre Untertanen auszuüben, ihre Klagen lieber an den eigenen territorialen Gerichten einzureichen. 25 Etliche solche waren um 1700 gegründet worden und profitierten von den Problemen in Wetzlar, auf das viele kleinere Territorien dennoch setzten. Die Krise begann damit, dass Leopold I. 1703 den Gerichtspräsidenten Franz Adolf Dietrich von Ingelheim wegen dessen Streitigkeiten mit seinem protestantischen Kollegen Graf Friedrich Ernst von Solms-Laubach suspendierte. Ingelheim war der Neffe des Mainzer Kurfürsten, der das Recht des Kaisers auf Eingriffe am höchsten Gericht der Reichsstände infrage stellte. Der Konflikt war auch symptomatisch für die jahrzehntelange Dauermisere des Gerichts, die daher rührte, dass viele Territorien ihre Beiträge zu seiner Unterstützung nicht leisteten; hinzu kam die Unterbrechung seiner Arbeit durch den Pfälzischen Erbfolgekrieg sowie Klagen über Inkompetenz und Korruption. Die in der Ordonnanz von 1654 festgeschriebenen regelmäßigen Überprüfungen des Gerichts fanden nie statt. Verständlicherweise war dem Kaiser daran gelegen, das Gericht wieder zum Arbeiten zu bringen, um die Stärke und Neutralität seiner Herrschaft zu demonstrieren. 1707 begann eine kaiserliche Kommission unter Rupert von Bodman, dem Fürstabt von Kempten, mit der Inspektion des Gerichtshofs, der dann im Januar 1711 wiedereröffnet werden konnte. Die von Bodman empfohlenen Reformen kamen nicht zustande, aber schon die Instandsetzung des Gerichts während des Kriegs war ein wichtiger Erfolg. Infolge der Krise verlor es jedoch einen Teil seiner Unabhängigkeit und wurde fortan als dem Kaiser unterstellt wahrgenommen. In Josephs Regierungszeit fielen zwei weitere wichtige Entwicklungen. 1708 gelang die Beilegung des sechzehn Jahre dauernden Disputs über die Aufnahme
14. Joseph I. und die Regierung im Reich
von Hannover ins Kurkollegium, die zur Bildung einer opponierenden Fürstenpartei geführt hatte, angeführt von Herzog Ernst Augusts eigenen Verwandten in Braunschweig-Wolfenbüttel.Verkompliziert wurde die Sache dadurch, dass sie seit 1693 mit der »Wiederaufnahme« Böhmens verknüpft war. 26 Der König von Böhmen (das heißt der Kaiser selbst oder sein Erbe) hatte traditionell nur an Wahlen zum Kaiser und Römischen König als Thronfolger zu Lebzeiten des Kaisers teilgenommen, nicht aber an den normalen Geschäften des Kollegs. Der Vorschlag, ihn »wiederzuzulassen«, war eine Reaktion auf das Argument, die Erhebung Hannovers schaffe ein protestantisches Übergewicht. Statt die Einführung einer weiteren katholischen Kurwürde ins Auge zu fassen, ergriff Leopold die Gelegenheit, seine eigene Macht zu stärken, indem er sich selbst einen Platz im Kurkolleg sicherte. Das missfiel den anderen Kurfürsten, weil ihre Beratungen mit einem kaiserlichen »Spion« in der Kammer nicht länger geheim gewesen wären. Köln und Bayern wehrten sich viele Jahre lang, aber mit ihrer Ächtung war dieses Hindernis beseitigt. Das verbliebene Unbehagen wegen der konfessionellen Parität revidierte die Zusage, falls die Pfalz zum Katholizismus zurückkehre, werde Mainz eine zusätzliche zweite Stimme erhalten. Am 7. September 1708 wurden beide Kurfürsten offiziell ins Kollegium in Regensburg aufgenommen. Wie üblich spielten Symbolik und Zeremonie eine große Rolle: Joseph selbst leitete das vierzehnstündige Ritual, das mit dem Eintritt von Graf Franz Ferdinand Kinsky als Botschafter des Königs von Böhmen (das heißt Josephs) begann, der als erste offizielle Handlung seine Zustimmung zur Aufnahme des neuen Kurfürsten von Hannover erteilte. 27 Selbst mitten in einem großen Krieg war es wichtig, auf die genaue Einhaltung von Rangfolge und Hierarchie zu achten. Der zweite Punkt betraf die Fortsetzung der Arbeit an der Ständigen Wahlkapitulation (capitulatio perpetua), eine der im Westfälischen Frieden an den Reichstag überwiesenen unerledigten Aufgaben. Die Ächtung der Wittelsbacher Kurfürsten und die Kurwürden für Hannover und Böhmen waren von grundsätzlicher konstitutioneller Bedeutung. Die Fürsten missbilligten die Ächtung, nicht aus Sympathie für die Betroffenen, sondern weil sie nicht konsultiert worden waren.Viele Kritiker der Erhebung Hannovers wechselten von offener Ablehnung des spezifischen Antrags zu einer Protesthaltung, weil man sie nicht anhörte. Mehr als ein Jahrzehnt nach der offiziellen Verleihung des Titels war die Aufnahme des Kurfürsten von Hannover nur folgerichtig. Aber man wollte zumindest eine Wiederholung der Vorgänge vermeiden und sicherstellen, dass daraus kein Präzedenzfall für die Einführung eines neuen kaiserlichen Privilegs wurde. 1707 kam Joseph der Opposition in dieser Hinsicht zuvor, indem er eine Wiederaufnahme der Gespräche über die Ständige Wahlkapitulation vorschlug und versprach, in Zukunft Fürsten und Kurfürsten vor einer Ächtung und vor der Schaffung neuer Kurwürden zu konsultieren. 1711 lag ein endgültiger Entwurf vor, der diese Zu-
153
154
II. · Konsolidierung und Krise 1705–1740
geständnisse enthielt. Josephs Tod kam dazwischen, ehe alle Parteien zugestimmt hatten, und so wurde die Kapitulation nie formelles Gesetz. Dennoch diente sie als Vorlage für alle folgenden Wahlkapitulationen. 28 Trotz seiner energischen Herangehensweise konnte Joseph jedoch die natürlichen Grenzen der kaiserlichen Autorität nicht überwinden. Den größten Einfluss hatte er in den kleineren Territorien in Schwaben und Franken. Zwar wurden auch im Norden Abgaben für den Krieg erhoben, aber oft unter beträchtlichen Schwierigkeiten, und seine politische Macht war dort weit geringer. In vollem Umfang kamen diese Hindernisse erst unter Karl VI. zum Tragen. Während Josephs Herrschaft zeigte sich das Problem daran, dass es ihm nicht gelang, eine der letzten niederländischen Einmischungen in die Reichspolitik zu unterbinden. Sein Versuch, 1706 die Wahl eines neuen Bischofs von Münster zu beeinflussen, war ein spektakulärer Fehlschlag. 29 Nach erbittertem Ringen setzte sich der niederländische Kandidat Franz Arnold von Wolff-Metternich, Bischof von Paderborn, gegen den von Habsburg nominierten Karl Joseph von Lothringen, den Bischof von Osnabrück und Olmütz, durch, wozu auch die Parteinahme Brandenburgs beitrug. 30 Ein verzweifelter Appell an den Papst konnte Clemens XI. nicht zum Eingreifen bewegen und zwei Jahre nach der Wahl blieb Joseph nichts übrig, als Franz Arnold in sein Amt einzusetzen. Die Empfindlichkeit des Kaisers in diesem Fall spiegelte eine tief sitzende Angst vor niederländischen Einflüssen. Das führte zu Spannungen, als die Nördlinger Assoziation in ihrem Streben nach einer Reichsbarriere ein Bündnis mit der Niederländischen Republik eingehen wollte und als die Niederländer Anstalten machten, die Nördlinger Assoziation zu einem Abkommen zu bewegen, das über den Friedensschluss hinaus gelten sollte. Graf Sinzendorfs Behauptung, die Niederländer zielten auf eine Umwandlung der zehn Kreise in Kantone und ihre Abspaltung vom Reich ab, war absurd und sicherlich eine Fehldeutung der grundsätzlich loyalistischen Haltung von Lothar Franz von Schönborn. 31 Lothar war ebenso wenig Republikaner wie Joseph. Aber der Verdacht belegt die Wiener Sorge zu einer Zeit, da der Kaiser, was viele Mitglieder der Nördlinger Assoziation betraf, seine Rolle als Beschützer des Reichs offenkundig nicht erfüllt hatte. 32 Die Niederländer zeigten indes nicht viel Interesse an der Sache und nach Utrecht verzichteten sie auf jede Einmischung, was Karl VI., da er nun auch die Spanischen Niederlande besaß, im Nordwesten eine viel stärkere Stellung verschaffte. 33 Josephs früher Tod macht eine endgültige Einschätzung seiner Herrschaft unmöglich. Vieles, was er tat, war vom Krieg erzwungen oder geprägt. Zu Friedenszeiten hat er nie regiert und viele seiner Initiativen hatten keine Zeit, Früchte zu tragen. Sein großes Monument in Wien ist Schloss Schönbrunn, allerdings eine verkleinerte Version des grandiosen Plans von Johann Bernhard Fischer von Erlach um 1692, der von Leopold I. in Auftrag gegeben worden war, dessen Umsetzung
14. Joseph I. und die Regierung im Reich
nach 1696 jedoch klar mit den in den jungen Thronerben gesetzten Hoffnungen verbunden war. Aber selbst die reduzierte Form verkörperte den Anspruch, Versailles zu übertreffen, nicht als Kopie des französischen Vorbilds, sondern mit ausgeprägt italienischen Anspielungen. 34 Der »Imperialstil« erreichte seine Blüte unter Karl VI., verdankte seine Anfänge jedoch ganz allein Joseph. Einer der ersten »imperialen« Entwürfe Fischers von Erlach war eine Reihe von Triumphbögen nach römischem Vorbild für den Einzug des jungen Joseph in Wien nach seiner Wahl zum Römischen König 1690. Neben Wagner von Wagenfels war er Josephs Architekturlehrer, 1705 ernannte ihn Joseph zum Oberinspektor sämtlicher Hof- und Lustgebäude. In seinem Auftrag erweiterte er die Palette habsburgischer Symbole um Herkules und die Sonne, eine direkte Reaktion auf die französische Bildsprache mit ihren Anspielungen auf die Sonne und eine Herkunft vom »gallischen Herkules«. Seine größten Werke schuf Fischer von Erlach erst unter Josephs Nachfolger. Selbst Schönbrunn war nicht ganz fertiggestellt, als Joseph starb. Doch stehen diese Projekte für Josephs Herrschaft insgesamt. Die Hoffnungen von Wagner von Wagenfels, Fischer von Erlach und dem »jungen Hof« auf einen österreichischen »Sonnenkönig« wurden enttäuscht.
Anmerkungen 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
NDB X, 614. Press, »Schwaben«, 60. Ingrao, In Quest, 31 ff. Gross, Empire, 95 f., vgl. für andere imperialistische Argumente der 1690er Jahre ebd., 353–356. Aretin, Altes Reich II, 163–172; vgl. auch S. 179–186. Aretin, Altes Reich II, 170. Aretin, Das Reich, 235 (Anm. 70); HBayG II, 449–453. Max Emanuel unterstützte die aufständischen Adligen in Ungarn, zeigte sich jedoch gleichgültig gegenüber der Rebellion seiner eigenen Bauern, auch wenn er später seiner Frau schrieb, sein Herz habe geblutet, als er hörte, was sie ihm zuliebe erlitten hatten. Press, »Bayern«, 510 f.; Press, »Josef I.«, 292 f. Vgl. S. 457 f., 463, 466, 485 f. Aretin, Das Reich, 234 f. Press, »Josef I.«, 292 f. Aretin, Altes Reich II, 182. Press, »Schwaben«, 60. Aretin, Altes Reich II, 182. Ebd., 183. Feine, »Verfassungsentwicklung«, 87. Ebd., 106 f.
155
156
II. · Konsolidierung und Krise 1705–1740
18 Müller, »Reichscamerale«, 158; Feine, »Verfassungsentwicklung«, 80; Feine, »Erste Bitten«, 84–89. 19 Dickel, Reservatrecht, 154 ff.; allen Behauptungen antiker Ursprünge zum Trotz scheint diese Praxis eine Erfindung von Karl V. oder seiner Regierung zwischen 1521 und 1530 gewesen zu sein.Weder er noch seine Nachfolger wandten sie systematisch an, 1648 geriet sie ganz außer Gebrauch. Offenbar folgte Karl VI. diesem Vorschlag des Reichsvizekanzlers Friedrich Karl von Schönborn nicht; vgl. ebd., 135–156. Vgl. auch Reden-Dohna, »Reichsprälaten«, 160 f. 20 Müller, »Reichscamerale«, 153 ff. 21 Feine, »Verfassungsentwicklung«, 94–97. 22 Marquardt, »Aberkennung«, 86; Troßbach, »Fürstenabsetzungen«, 430–441. Die Absetzung des Fürsten löste die Probleme nicht. Wenn überhaupt, verschlimmerten sie sich unter einer ganzen Reihe von Administratoren zusehends. Dieser unglückliche Zustand hielt bis 1739 an, als Wilhelm Hyacinth wiedereingesetzt wurde, die Stabilität verdankte sich indes zum Großteil der Tatsache, dass er tatsächlich nie in seine Ländereien zurückkehrte. 1742 setzte er Wilhelm IV. von Oranien als seinen Erben ein, der 1743 auf den Thron folgte und Nassau-Siegen in sein Territorium Nassau-Diez-Oranien integrierte. Vgl. auch Köbler, Lexikon, 451, 453 f. 23 Whaley, Toleration, 16–21. Graf Damian Hugo von Schönborn war der Bruder des Reichsvizekanzlers Friedrich Karl von Schönborn.Vgl. S. 168, 171 f., 350. 24 Aretin, Altes Reich II, 175–179; Feine, »Verfassungsentwicklung«, 94 ff. 25 Hughes, Law, 37 ff. 26 Begert, Böhmen, 442–476, bietet einen vollständigen Überblick über diesen Komplex; vgl. auch Gotthard, Säulen I, 467–475. Zu Hannover vgl. S. 67 f., 94–98. 27 Aretin, Altes Reich, 181. 28 Conrad, Rechtsgeschichte II, 71 f., 359; Kleinheyer, Wahlkapitulationen, 86–99. 29 Duchhardt, Altes Reich, 64 f.; Aretin, Altes Reich II, 185 ff.; Press, »Österreichische Großmachtbildung«, 141; Klueting, Reich, 92; Feine, »Verfassungsentwicklung«, 98 f.; Press, »Josef I.«, 293 f. 30 Press, »Josef I.«, 293 f. 31 Wines, »Imperial Circles«, 24. 32 Plassmann, Krieg, 469 ff.; Gotthard, »Friede«, 56–63; Ingrao, In Quest, 203 f.; Wines, »Imperial Circles«, 22–25; Aretin, Altes Reich II, 188–194. 33 Vgl. S. 174 f. 34 DaCosta Kaufmann, Court, 289–294; Spielman, City, 188; Braunfels, Kunst I, 74 ff.; Aurenhammer, Fischer von Erlach, 46–57, 107 f.; das Gebäude wurde später unter Maria Theresia weitläufig umgebaut.
15. Karl VI.: Vollendung oder Verfall?
K
arl VI. war zu Beginn ein zögerlicher Kaiser. Obwohl er nie wirklich die Kontrolle über sein spanisches Königreich erlangt hatte und nach 1711 nicht dorthin zurückkehrte, beschäftigte ihn die Vorstellung, was daraus hätte werden können. Noch 1736 hielt er den dreißigsten Jahrestag der Aufhebung der Belagerung von Barcelona in seinem Tagebuch fest, und »Barcelona« war auch sein letztes Wort. 1 In Wien erbte er mannigfaltige strategische Dringlichkeiten, aber auch eine schlimme Finanzlage und eine chaotische Verwaltung, die in keiner Weise den Herausforderungen gewachsen war, denen er sich stellen musste. An seinem Scheitern ist letztlich nicht zu zweifeln. Als er 1740 starb, war die Monarchie praktisch bankrott, die Armee demoralisiert, die Territorien in Italien und Ungarn wesentlich verkleinert, die kaiserliche Autorität im Reich geschwächt und das System der Bündnisse in Deutschland und Europa ein einziges Durcheinander. Aber war das sein Fehler? Manche haben Karls Scheitern seinem schwierigen Charakter zugeschrieben, seiner Unentschlossenheit, die er durch Mut, Enthusiasmus und Pflichtgefühl nicht wettmachen konnte. Andere meinen, er sei schlichtweg überfordert gewesen. Zu den Herausforderungen in Italien und Ungarn kam der Erwerb der Spanischen Niederlande, der zwar den Zugang zur Nordsee öffnete, aber auch potenzielle Konflikte mit den Seemächten Großbritannien und Niederlande nach sich zog. Neben einer neuen Front zu Frankreich boten sich den Habsburgern damit indes auch neue Möglichkeiten im Nordwesten des Reichs. Karls frühe Thronfolge in Spanien führte dazu, dass er viel von dem Symbolismus Karls V. übernahm. 2 Es gab jedoch entscheidende Unterschiede. Er genoss nie auch nur annähernd dessen Macht und Autorität, und obwohl er auf einer vergleichbaren Bandbreite von Schauplätzen agierte, waren seine Ressourcen beschränkt und die Begleitumstände wesentlich ungünstiger. Der Spanische Erbfolgekrieg mag das Ziel verfolgt haben, Frankreich in die Schranken zu weisen, die Idee eines europäischen Machtgleichgewichts ließ sich aber ebenso leicht gegen Österreich richten. Im Reich verkomplizierte der neue, mit der polnischen beziehungsweise britischen Krone verbundene Status von Sachsen und Hannover sowie Brandenburg die Dinge. Die größeren Territorien waren immer weniger bereit, Anweisungen des Kaisers zu folgen; die deutsche Politik war mittlerweile untrennbar mit der europäischen verbunden. Kehrte Karl deshalb dem Reich den Rücken? Hatte die österreichische Groß-
158
II. · Konsolidierung und Krise 1705–1740
machtpolitik nun Vorrang vor dem zunehmend unergiebigen Engagement im Reich? Zweifellos waren Entscheidungen gefragt. Karl war umgeben von verschiedensten Ratgebern, die unterschiedliche Prioritäten setzten. Sein Favorit aus der Zeit in Barcelona, Graf Johann Michael Althann, und die auf Italien und den Mittelmeerraum fokussierten spanischen Berater, die er mit nach Wien brachte, strebten nach Versöhnung mit Philipp V. in Madrid. Prinz Eugen und die von seinem Bruder übernommenen österreichischen Ratgeber stellten generell rein österreichische Interessen in den Vordergrund und warben für einvernehmliche Beziehungen zu Großbritannien. Eugen hatte daran als Generalgouverneur der Niederlande von 1716 bis 1724 auch ein persönliches Interesse. Reichsvizekanzler Friedrich Karl von Schönborn plädierte weiterhin für eine aktive Politik im Reich und den Einsatz kaiserlicher Privilegien, wenn nötig auch gegen Hannover und Berlin. 1719 wurde Schönborns Ausschluss von allen Geschäften, die nicht das Reich betrafen, formell bestätigt. Die österreichische Hofkanzlei wurde neu organisiert, zwei Kanzler für diplomatische und interne Angelegenheiten ernannt und der Reichsvizekanzler von der Mitgliedschaft ausgeschlossen. Damit kulminierte die seit einem Jahrhundert in Gang befindliche Trennung zwischen der kaiserlichen Kanzlei und dem, was um 1620 als interne österreichische Abteilung seinen Anfang genommen hatte. Die Entwicklung einer eigenen österreichischen Kanzlei ging nicht auf ein Bestreben nach Ablösung vom Reich zurück, sondern sollte die Möglichkeiten des Mainzer Kurfürsten einschränken, sich als Reichserzkanzler und offiziellen Vorgesetzten des Reichsvizekanzler in interne Belange der habsburgischen Länder einzumischen. 3 Die persönlichen Ambitionen des Reichsvizekanzlers kollidierten ab den 1720er Jahren bisweilen mit seinen Verpflichtungen in Wien. 4 1729 wurde er zum Fürstbischof von Würzburg gewählt und erbte mit dem Tod seines Onkels Lothar Franz, des Mainzer Erzbischofs, das Bistum Bamberg, wo er seit 1709 Koadjutor mit Nachfolgerecht war. Der Plan, seine neuen Ämter für einen weiteren Anlauf zur Wiederbelebung des Reichs einzusetzen, stieß jedoch nicht auf Gegenliebe. 1730 lehnte Karl Schönborns Vorschlag eines neuen Bündnisses zur Errichtung einer Kette von Festungen von Wien bis in die österreichischen Niederlande als Grundlage für eine Restauration der kaiserlichen Macht im Reich ab. 5 Die häufige und lange Abwesenheit des Reichsvizekanzlers nutzten seine Wiener Widersacher, die auch seinen Versuch unterliefen, sich 1732 nach der dreijährigen Amtszeit von Franz Ludwig von Pfalz-Neuburg zum Erzbischof von Mainz wählen zu lassen. 1734 schließlich zwang ihn der Kaiser zum Rücktritt. Sein Nachfolger in Wien, der zweiundsechzigjährige Johann Adolf Graf von Metsch, vormals Vizepräsident des Reichshofrats, war träge und erfolglos. Obwohl er von 1737 an
15. Karl VI.: Vollendung oder Verfall?
in Rudolf Joseph von Colloredo einen Stellvertreter hatte, spielte die Reichskanzlei bis zu Metschs Tod 1740 keine bedeutende Rolle mehr. 6 Dass die »österreichische« Politik des Kaisers manchmal in Widerstreit zur »Reichspolitik« geriet, war unvermeidbar. Jede Gruppe von Funktionären pflegte eigene Kontakte im ganzen Reich, hatte eine unterschiedliche Ausrichtung und wetteiferte um die Gunst des Kaisers. Karls notorische Unentschlossenheit verschärfte das Problem. Es ist indes unwahrscheinlich, dass er oder irgendeiner seiner Berater »österreichische Politik« und »Reichspolitik« als Alternativen betrachtete. Das Reich blieb wichtig, sein Verlust hätte Österreich empfindlich getroffen. Das Reich bildete aber auch den Kern des vielleicht größten Problems: Karl hatte keinen männlichen Erben. Das war in zweierlei Hinsicht gefährlich. Um das Schreckgespenst eines Erbfolgekriegs zu bannen, bekräftigte die Pragmatische Sanktion zugunsten von Karls Tochter Maria Theresia die weibliche Thronfolge. Die Bestrebungen der sächsischen und bayerischen Ehemänner der Töchter Josephs I. waren damit jedoch nicht gänzlich beerdigt, ebenso wie die seit langer Zeit bestehenden, wenn auch dubiosen Ansprüche Bayerns, die auf der falschen Auslegung eines habsburgisch-wittelbacherischen Ehevertrags von 1546 und einem Nachtrag zum Testament Ferdinands I. von 1547 basierten. 7 Zudem betraf die Pragmatische Sanktion nicht den Kaiserthron. Manche gingen selbstverständlich davon aus, die Krone werde an Maria Theresias Gatten gehen, und lehnten die Pragmatische Sanktion allein deshalb ab, aber das war alles andere als sicher. 8 Um 1724/25 stand die allgemeine Durchsetzung der Pragmatischen Sanktion im Reich im Mittelpunkt der Wiener Politik. Nichts beschädigte die Autorität des Kaisers mehr. Gleichzeitig profitierte Karl VI. nicht wie seine beiden Vorgänger vom »Solidaritätseffekt« einer elementaren Bedrohung des Reichs, die die Länder zur Verteidigung der deutschen Freiheit um die Krone sammelte und die habsburgischen Kaiser an entscheidenden Punkten der zurückliegenden zwei Jahrhunderte vor wachsendem Widerstand bewahrt hatte. Letztlich war das Reich eine Verteidigungsgemeinschaft. Das Fehlen eines ernst zu nehmenden Feindes Mitte des 18. Jahrhunderts war einer der Faktoren, die das System destabilisierten. 9 Wenn Verteidigung nicht mehr vonnöten war, traten politische Ambitionen in den Vordergrund. Karl VI. wurde mehr als Joseph I. im Licht späterer Entwicklungen beurteilt. Sein Tod 1740 stürzte Monarchie und Reich in eine Krise und die Kampfansage Friedrichs des Großen an die Habsburger gilt seit jeher als entscheidender Moment der deutschen Geschichte, an dem Brandenburg-Preußen seinen Anspruch auf die Herrschaft in Deutschland anmeldete und das Reich angeblich keine Zukunft mehr hatte. Aber die negative Bewertung von Karls Regierungszeit durch Historiker ist schwer mit zeitgenössischen Einschätzungen in Einklang zu bringen. So berichtete etwa der venezianische Botschafter in Wien 1733, kein Fürst des Hauses Österreich habe je eine solche Macht genossen wie der gegenwärtige Kaiser. 10
159
160
II. · Konsolidierung und Krise 1705–1740
Karl VI. lebte mit Sicherheit fürstlicher als sämtliche Vorgänger. Der Hofstaat wuchs unter ihm auf gut zweitausend Bedienstete, die Anzahl der jährlich mit Ehrentiteln wie dem eine Hofkämmerers versehenen Adligen erreichte nie dagewesene Höhen. 11 Das Hofritual mit saisonalen Aufenthalten in der Wiener Hofburg (Oktober bis April), Laxenburg (Mai/Juni) und Favorita (Juli bis Oktober) kam an Pracht jedem anderen in Europa gleich. 12 Herausragend war indes Karls Bautätigkeit. Seit Leopold I. um 1660 die Hofburg um den sogenannten Leopoldinischen Trakt erweitern hatte lassen, hatten die Habsburger auffallend wenig gebaut. 13 Auch nach 1683 entstanden die meisten prächtigen neuen Gebäude in Wien im Auftrag adliger Dynastien, die um eine repräsentative Präsenz in Wien wetteiferten, die den prunkvollen Palästen auf ihren Ländereien in Böhmen und anderswo angemessen war. Bis 1730 wurden etwa 240 solcher Paläste errichtet; der vielleicht beeindruckendste ist Prinz Eugens Belvedere (1716–1723) mit seinem Oberen und Unteren Schloss und der verbindenden Gartenanlage. 14 Abgesehen vom ersten Bauabschnitt von Schloss Schönbrunn planten die Habsburger in dieser Zeit viel, wovon jedoch kaum etwas umgesetzt wurde. Karl übernahm die Pläne und gab ihnen neues Gewicht. 15 Wie seine Vorgänger ließ er den Kern der Hofburg unangetastet. Mit einem Palastneubau im Zentrum von Wien hätten sich die Habsburger auf einen Wettstreit mit den anderen Höfen im Reich und Westeuropa herabgelassen. Der mittelalterliche Kern der Hofburg symbolisierte besser als jedes neue Schloss ihren Anspruch auf Vorrang vor allen anderen Herrschern. Karl ließ ihn mit einer neuen Bibliothek (teils nach dem Vorbild der Escorial-Bibliothek), einer Winterreitschule und einem Flügel für neue Büros der Reichshofkanzlei ausbauen. Zudem entstand eine Reihe von Zweckbauten wie Krankenhäuser (etwa das spanische Spital für die zahlreichen Spanier an Karls Hof), Heime für Kriegsinvaliden, Kirchen und klösterliche Institute. Sein imperiales Empfinden machen zwei andere Projekte deutlich. Karls größtes Wohnbauvorhaben war die Umwandlung des Stifts Klosterneuburg in Niederösterreich in einen »österreichischen Escorial«. 16 Der Plan wurde nur zum Teil verwirklicht, ein Triumph war hingegen die Errichtung der Wiener Karlskirche von 1716 bis 1739. 17 Die Kirche entstand als Weihgabe zum Dank für die Verschonung Wiens und des Kaisers vor der Pestepidemie von 1712/13. Ihr Name erinnert an Karl Borromäus, den Mailänder Gegenreformator des 16. Jahrhunderts und Schutzheiligen gegen die Pest, der der Legende zufolge zahlreiche Erkrankte heilte, verknüpft aber auch Karls Namen mit dem Heiligen und der traditionellen Frömmigkeit der Habsburger. Außergewöhnlichstes und programmatisches Merkmal ist das zwischen 1724 und 1730 errichtete Säulenpaar. Ursprünglich sollte es mit Szenen aus dem Leben Karls des Großen und Karls des Kühnen ausgeschmückt werden, wie
15. Karl VI.: Vollendung oder Verfall?
auch der Zentralbau der Kirche an die Pfalzkapelle Karls des Großen angelehnt ist. 18 Die tatsächliche Ausführung vereint mehrere Anspielungen: auf die Säulen des Salomonischen Tempels und des Herkules, die römischen Säulen des Trajan und Marcus Aurelius, selbst die Minarette von Konstantinopel. Die Vermischung von Symbolen alttestamentarischer Könige, der griechischen Mythologie und des Römischen Reichs erinnert an die Wappen Karls V. und macht klar, dass Karl VI. an die universelle Reichsidee des einzigen anderen Kaisers, der sowohl die spanische als auch die heilig-römische Krone getragen hatte, anknüpfen wollte. 19 Dies ist unterschiedlich interpretiert worden. Manche deuten die kaiserlichen Bauten als Manifestationen eines »Friedensstils«. 20 Dafür spricht, dass die überragenden Bauherren der Jahre 1680–1720 eher Adlige als Habsburger waren.Wahr ist auch, dass der erste Bauboom der Befreiung von Wien 1683 folgte und der Friede der 1720er Jahre nach dem Ende des Spanischen Erbfolgekriegs und der neuen Kämpfe gegen die Türken von 1716 bis 1719 für eine neue Hochkonjunktur sorgte. Aber eine Deutung der kaiserlichen Vorhaben als Teil eines vom Adel dominierten Trends oder gar als verspäteten Versuch der Krone, dem Adel nachzueifern, übersieht die mit den Plänen Fischers von Erlach aus den 1690er Jahren und Karls Aufträgen an diesen, seinen Sohn und ihren Konkurrenten Lucas von Hildebrandt verbundenen politischen Absichten. Weitaus passender wären die Begriffe Reichsstil oder Kaiserstil. Ersterer wurde 1938 von Hans Sedlmayr geprägt und oft kritisiert, weil darin die »Anschlussideologie« jener Zeit mitschwingt und Sedlmayr ihn in der Zeit nach 1683 ansetzt, als so gut wie keine kaiserlichen Bauten entstanden. 21 Der Begriff Kaiserstil vermeidet Naziassoziationen, ist jedoch wegen der Betonung des Kaisers und nicht des Reichs von irreführender Zweideutigkeit. Franz Matsche, der Hauptvertreter des Kaiserstilkonzepts, argumentierte, der Stil sei eine Reaktion Karls VI. auf die veränderte Stellung der Habsburger: Er spiegele ihre eingeschränkte Autorität im Reich und die Minderung ihres Ansehens in Europa infolge des Gleichgewichts der Mächte. 22 Die Habsburger hätten auf die Herausforderungen durch Frankreich, Sachsen und Brandenburg-Preußen mit einer aggressiven territorialen oder österreichischen Großmachtpolitik geantwortet, wenn auch flankiert von der Anmaßung einer Vorrangstellung, die real nicht mehr existierte. Diskussionen über den Kaiserstil übersehen indes gern das Ausmaß, in dem er nicht nur in Österreich, sondern im ganzen Reich übernommen und nachgeahmt wurde. In Österreich dienten die Pläne für Klosterneuburg als Vorbild für die Neugestaltung zahlreicher Klosterbauten, etwa Göttweig, Kremsmünster, Melk und St. Florian. 23 So gut wie alle umfassen Abwandlungen des Kaisersaals und der Kaiserstiege sowie eine Zimmerflucht für eventuelle Besuche des Kaisers und eine an die neue Bibliothek in der Hofburg angelehnte Büchersammlung. Den prachtvollen Kaisersaal zierten meist eine Ahnengalerie der Habsburger und dekorative Darstel-
161
162
II. · Konsolidierung und Krise 1705–1740
lungen des Kaisers als Apollo, Sonnengott und Bewahrer der Künste und Wissenschaften, als Jupiter der Türkenbezwinger und als neuer Konstantin. Dieses bauliche und dekorative Muster verbreitete sich im Reich. Brandenburg-Preußen und Sachsen-Polen freilich entwickelten wie schon im späten 16. Jahrhundert ihre eigenen Stile, Bayern und die Wittelsbacher zeigten ihre Zwietracht mit den Habsburgern und die anhaltenden Flirts mit Frankreich durch die Aufnahme französischer Einflüsse. 24 In süddeutschen Kirchenbauten in den großen Fürstbistümern, insbesondere denen, die in den 1720er und 1730er Jahren Angehörige der Familie Schönborn hielten, aber auch in säkularen Territorien wie Baden-Baden (Rastatt) und der Pfalz (Mannheim) setzten sich wichtige Elemente des Stils durch, den man treffend als Reichsstil bezeichnen sollte. 25 Die Schwerpunkte unterschieden sich: Im Reich betonte die Ahnengalerie die Abfolge der heilig-römischen Kaiser und ihrer Vorläufer in Rom und nicht einfach die Dynastie der Habsburger. 26 Aber der Stil war bewusst ähnlich gehalten und die Botschaft ebenso klar: Identifikation mit den habsburgischen Kaisern und Identifikation mit dem Reich. Allen Problemen und Meinungsverschiedenheiten zum Trotz war die Verpflichtung auf das Reich nach wie vor unverbrüchlich. Die Herrschaft Karls VI. markiert in vielerlei Weise den Gipfelpunkt des kaiserlichen Wiederaufstiegs, der unter Ferdinand III. und Leopold I. begonnen hatte. Die Loyalität der traditionellen Klientel im Süden spiegelte die konfessionelle Solidarität wider, aber die Autorität des Kaisers respektierten auch viele protestantische Höfe im Norden, die ihre Paläste teilweise ebenfalls mit einem Kaisersaal ausstatteten. Protestantische Fürsten standen dem Kaiser militärisch bei, nutzten die Dienste des Reichshofrats und betrachteten den Kaiser als oberste juristische Instanz. Als Herzog Ernst August von Sachsen-Weimar den Ritterorden de la Vigilance (der Wachsamkeit) stiftete, schrieben die Statuten vor, dass niemand den Orden tragen durfte, der »nicht recht patriotisch gesinnet und für allerhöchst-besagte Ihro Röm. Kayserl. Majestät Carl VI. aufzuopfern gesonnen« war. 27 Fertigwerden musste Karl natürlich auch mit den zunehmend problematischen Folgen der Unterstützung königlicher Ambitionen Sachsens, Brandenburg-Preußens und Hannovers durch Leopold I. Als das Fehlen eines habsburgischen Thronerben zum zentralen politischen Thema wurde, kam noch die durch den Wettstreit um die Findung eines nichthabsburgischen Kaisers erzeugte Unsicherheit hinzu. Darin kam jedoch lediglich Feindseligkeit gegen das Haus Habsburg zum Ausdruck, nicht gegen das kaiserliche Amt als solches. Über die Zukunft der Habsburger als heilig-römische Kaiser mag es 1740 ernsthafte Zweifel gegeben haben, über die Zukunft des Reichs selbst aber sicher nicht.
15. Karl VI.: Vollendung oder Verfall?
Anmerkungen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Redlich, »Tagebücher«, 145, 147; Ingrao, Monarchy, 149. O’Reilly, »Lost Chances«, 54, 68 f. Fellner und Kretschmayr, Zentralverwaltung, 150–167; Hughes, Law, 25 f. Hantsch, Schönborn, 313. Hughes, Germany, 137; Hantsch, Schönborn, 329 f. Aretin, Altes Reich I, 126 ff., sowie II, 332. Hartmann, Karl Albrecht, 164 ff. Aretin, Altes Reich II, 296 f. Wrede, »Der Kaiser«, 110–115. NDB XI, 216. Duindam, Vienna, 73; Müller, Fürstenhof, 30. Pečar, Ökonomie, 158–161. Benedik, »Architektur«, 98–102. Ingrao, Monarchy, 125. Belvedere ging nach Eugens Tod 1736 an seine Nichte Anna Viktoria von Savoyen (später Sachsen-Hildburghausen). Maria Theresia kaufte es 1752, Joseph II. richtete 1775 dort die Kaiserliche Gemäldegalerie ein (die ab 1781 der Öffentlichkeit zugänglich war). Von 1899 bis 1914 diente Belvedere als Residenz des Thronfolgers, seit 1903 beherbergt es ein Kunstmuseum. 1955 wurde dort der Österreichische Staatsvertrag unterzeichnet. Vocelka, Glanz, 222 ff.; Pečar, Ökonomie, 255–265; Braunfels, Kunst I, 76–82; Benedik, »Architektur«, 109–112. Matsche, Kunst I, 13 f., 40 f., 184 f.; Braunfels, Kunst I, 26 ff., 80 f. DaCosta Kaufmann, Court, 300 ff.; Matsche, Kunst I, 201–205. DaCosta Kaufmann, Court, 301 f. Zu Karl VI. als »Novus Carolus V.« und Erbe Karls des Großen vgl. Matsche, Kunst I, 242– 248. Braunfels, Kunst I, 47–64; vgl. auch S. 154 f. Sedlmayr, »Bedeutung«; Lorenz, »Reichsstil«. Matsche, Kunst I, 25 f. Vocelka, Glanz, 195–208; DaCosta Kaufmann, Court, 303 ff. DaCosta Kaufmann, Court, 307–333. Ebd., 316–323; Müller, »Kaisersäle«. Braunfels, Kunst I, 79. Schmidt, Geschichte, 263.
163
16. Prioritäten im Widerstreit (circa 1714–1730)
D
ie visuelle Propaganda Karls VI. suggerierte ein allumfassendes Imperium. In Wirklichkeit musste er mit seinen ohnehin überlasteten Mitteln und Kräften ständig zwischen diversen Fronten und Zwängen jonglieren. Oft waren das scheinbar rein österreichische Angelegenheiten, in die das Reich jedoch in unterschiedlichem Maß verwickelt war. 1 Zudem wirkten sich Erfolg und Scheitern des Kaisers unweigerlich auf seine Stellung im Reich aus. Die erste Herausforderung war ein neuer Konflikt mit den Türken, die im Dezember 1714 Venedig den Krieg erklärten. 2 Bis September 1715 war das venezianische Imperium in Griechenland zerstört. Die Türken bemühten sich, die Österreicher aus dem Konflikt herauszuhalten, aber die Aussicht, Belgrad und das Banat, die in türkischer Hand verblieben waren, erobern zu können, war zu verlockend. 1716 war ein Bündnis mit Venedig geschlossen, woraufhin die Türken von Belgrad aus angriffen. Prinz Eugen stoppte ihren Vormarsch bei Peterwardein (5. August 1716) und belagerte dann Temesvár, das im Oktober fiel. Binnen eines Jahres baten die Türken um einen Waffenstillstand und so wurde unter Vermittlung der Seemächte im Juli 1718 der Friede von Passarowitz geschlossen. Österreich kontrollierte nun erstmals ganz Ungarn und verschob seine Grenze südöstlich über die Donau nach Serbien. Der Konflikt betraf das Reich nicht direkt, weil es sich um einen Angriffskrieg handelte, aber die Hoffnung, die Türken ein für alle Mal aus Europa zu vertreiben, sorgte für einiges Wohlwollen für das Anliegen des Kaisers in Deutschland. Offiziell kam es nicht zur Mobilisierung von Kreiskontingenten, der Reichstag beschloss jedoch einen Zuschuss von 6 Millionen Gulden. Acht Fürsten entsandten zudem Truppen, auch der Kurfürst von Bayern, der sein Verhältnis zum Kaiser verbessern wollte. Zwar war die Wiedereinsetzung des Kurfürsten im Frieden von Rastatt (6. März 1714) beschlossen worden, aber Karl lehnte es wegen des erneuerten bayerisch-französischen Bündnisses von 1714 ab, ihm seine Länder wiederzugeben. Gleichzeitig plante Max Emanuel bereits die Verheiratung seines ältesten Sohnes mit einer Tochter Josephs I. Zu diesem Zweck begleiteten Max Emanuels Erbe Karl Albrecht und dessen jüngerer Bruder Ferdinand Maria das bayerische Kontingent von 5.000 Mann nach Ungarn, um unterwegs Karl in Wien ihren Respekt zu erweisen. 3 Der Sieg über die Türken stärkte Karls Stellung im Reich beträchtlich und machte Prinz Eugen zum Volkshelden, den das beliebte Lied vom Prinzen Eugen als »edlen Ritter« der Schlacht um Belgrad pries. 4 Karl
16. Prioritäten im Widerstreit (circa 1714–1730)
selbst fand neben seinem Vater Leopold I. Aufnahme in den Pantheon der Türkenbezwinger. Zum Zeitpunkt des Friedensschlusses im Osten hatte sich die kompliziertere Lage im Mittelmeerraum zugespitzt. Die spanischen Bourbonen weigerten sich, ihre Ansprüche auf die ehemals spanisch-italienischen Territorien aufzugeben, Karl wiederum wollte nicht formell auf die spanische Krone verzichten. Die Entschlossenheit der zweiten Frau Philipps V., Elisabetta Farneses, ihren Söhnen Don Carlos (* 1716) und Don Felipe (* 1720) italienischen Besitz zu verschaffen, brachte das Fass zum Überlaufen. Zunächst versuchte die britisch-französisch-niederländische Tripelallianz zwischen Wien und Madrid zu vermitteln, aber Karls fester Wille, Spanien aus Italien herauszuhalten, machte alle Hoffnungen auf Einigung zunichte. 1717 griff Spanien Sardinien und dann Sizilien an und versuchte Frankreich und die Briten abzulenken, indem es hier unzufriedene Adlige und dort eine neue Initiative des Thronprätendenten Jakob III. unterstützte. Die Folge war lediglich eine Aufstockung der Tripel- zur Quadrupelallianz mit Österreich und die Ausarbeitung eines Friedensplans, der Madrid nach der Vernichtung der spanischen Flotte durch Großbritannien und der Rückeroberung von Sizilien und Sardinien durch den Kaiser aufgezwungen wurde. Karl verzichtete auf den spanischen Thron und erhielt Sizilien im Austausch gegen Sardinien, das mit einem Königstitel an Savoyen fiel. Parma-Piacenza und die Toskana wurden als Reichslehen bestätigt und Karl stimmte der Nominierung von Karl III. als Erben im Fall des (baldigst erwarteten) Aussterbens der zwei herrschenden Herzogshäuser zu. Da es sich um Reichslehen handelte, wäre eine Konsultation des Reichstags über die Nachfolgeregelung logisch gewesen. 5 Obwohl Karl III. eilends als Thronfolger bestätigt wurde, unternahm Karl VI. weiterhin alles in seiner Macht Stehende, um eine spanische Rückkehr nach Italien zu verhindern. Seine Renitenz trieb Frankreich und Großbritannien auf die Seite von Madrid. Zugleich verstärkte der britische Widerstand gegen die Gründung der Kaiserlichen Ostender Kompanie in den Spanischen Niederlanden im Dezember 1722 die Isolation Wiens. 6 Eine Konferenz in Cambrai 1724 konnte das Thronfolgeproblem in Parma und der Toskana nicht lösen, aber eine unerwartete Wende der spanischen Politik lockerte die Isolation kurzfristig. Der spanische Plan einer Heirat von Karl III. und Maria Theresia (sowie ihrer jüngeren Schwester und Karls Bruder Philipp), um Spanien mit der kaiserlichen Krone und den österreichischen Erblanden zu verbinden, versprach eine viel größere Ausbeute als das italienische Erbe. Geheimverhandlungen führten 1725 zu einer Reihe österreichisch-spanischer Abkommen, etwa über die spanische Unterstützung der Ostender Kompanie und Subventionen von 3 Millionen Gulden in spanischem Silber; der Heiratsplan selbst wurde jedoch mit keinem Wort erwähnt.
165
166
II. · Konsolidierung und Krise 1705–1740
Die Abkommen des Jahres 1725 zwischen Wien und Madrid waren unrealistisch. Spanien konnte das Geld nicht bezahlen. Es war unvorstellbar, dass je ein Bourbone in Wien gekrönt würde, schon gar nicht in Frankfurt. Karl VI. blieb entschlossen, eine spanische Rückkehr nach Italien zu verhindern, wenn dies irgend möglich war. Aber die wenigen veröffentlichten Details – das meiste blieb geheim – waren Provokation genug für eine sofortige Reaktion der Briten (mit Hannover) und Franzosen in Form der Allianz von Herrenhausen mit Brandenburg-Preußen im September 1725. Damit wurde der Konflikt am Mittelmeer zum politischen Problem des Reichs. Eine Weile stand Europa am Rand eines weiteren großen Krieges und das Reich vor einer Aufspaltung in protestantische Territorien und die Klientel des Kaisers. Dass Graf Sinzendorf offen von einer großen katholischen Allianz mit Frankreich und den katholischen Kurfürsten sprach, um den Protestantismus niederzuringen, goss neues Öl ins Feuer und machte die Behauptung Georgs I. glaubhaft, Wien und Madrid hätten sich verschworen, die Stuarts in Großbritannien wieder auf den Thron zu bringen. 7 Frankreich stand derweil fest an Großbritanniens Seite. Das alarmierte Karl so sehr, dass er 1727 den Reichsvizekanzler drängte, die Truppen der Frankfurter Allianz der Kreise zu mobilisieren, um das Reich gegen einen französischen Überfall am Rhein zu verteidigen. 8 Es gelang Karl, einen Bund mit Russland zu schließen und Brandenburg-Preußen zum Austritt aus der Allianz von Herrenhausen zu bewegen, aber die Lage blieb prekär. Sie entspannte sich erst durch den Tod von Katharina I., der Russlands Blick für eine Weile von Europa abwandte, und von Georg I., was eine Wiederannäherung an Großbritannien möglich machte. 9 Spaniens Interesse an der Allianz mit Österreich schwand, als klar wurde, dass Wien nicht die Absicht hatte, den Heiratsplan zu realisieren. Zudem wurde immer deutlicher, dass Karl nicht auf die Loyalität Bayerns, der Pfalz und Sachsens rechnen konnte. Da ihm nun nichts dringlicher am Herzen lag als Friede und Stabilität, um die Pragmatische Sanktion durchsetzen zu können, war Karl gewillt, die Ostender Kompanie aufzulösen, um seine Isolation zu beenden. Das ebnete den Weg für eine neue Gesprächsrunde unter französischer Vermittlung in Soissons 1728. 1731 stimmte er der endgültigen Schließung der Ostender Kompanie zu, im Gegenzug sollte Großbritannien die weibliche Thronfolge in Österreich garantieren. Zudem gestattete er spanische Garnisonen in der Toskana, Parma sowie Piancenza und übergab Parma-Piacenza, dessen herzogliche Linie mit dem Tod von Graf Antonio im selben Jahr erloschen war, an Karl III. 1732 war Wien mehr oder weniger zum »alten System« der Großen Allianz gegen Frankreich zurückgekehrt und hatte die österreichische Führungsstellung in Italien behauptet. Der Verlust von Parma, das Versprechen der Toskana und
16. Prioritäten im Widerstreit (circa 1714–1730)
die Aufhebung der Ostender Kompanie waren große Zugeständnisse, beeinträchtigten die generelle Stellung der Habsburger in Europa aber nicht. Im Norden stellte sich die Lage anders dar. Dort waren Einfluss und Autorität des Kaisers immer schon schwach, aber während des Großen Nordischen Kriegs von 1700 bis 1721 entstand eine neue Situation. Österreich hatte an diesem Konflikt keine territorialen Interessen, aber der Weiterbestand des Reichs und die Autorität des Kaisers standen und fielen mit seiner Fähigkeit, es gegen Aggression von außen zu verteidigen und die ehrgeizigen Nordländer im Zaum zu halten. Im Großen und Ganzen gelang ihm das, der Konflikt befeuerte aber auch die politischen Ambitionen von Hannover und Brandenburg-Preußen. Anfangs betraf der Konflikt das Reich gar nicht direkt. 10 Er entzündete sich am gemeinsamen Angriff von Dänemark, Sachsen-Polen und Russland auf Schweden. Die Dänen wollten die Verluste wettmachen, die sie in den 1660er Jahren erlitten hatten, der sächsische König von Polen sein Reich vor einer möglichen schwedischen Aggression schützen und durch den Erwerb von Livland als Erbherzogtum seine Dynastie in Polen etablieren. Peter der Große strebte nach einem Zugang zum Baltikum, der durch die schwedischen Besitzungen Karelien, Ingermanland und Estland versperrt war. Brandenburg-Preußen hatte ein natürliches Interesse an der Koalition, weil es ebenfalls auf einen Zugang zum Baltikum aus war und seit Langem Anspruch auf Westpommern erhob. Der Berliner Kurfürst war jedoch verpflichtet, die Habsburger zu unterstützen, weil sie 1701 seiner Annahme des Titels König in Preußen zugestimmt hatten, und beteiligte sich daher nicht an dem Konflikt vor seiner eigenen Tür. Kurzfristig konnte Brandenburg dadurch die Politik verfolgen, wegen der der Kurfürst überhaupt auf den Königstitel erpicht gewesen war: Sachsen, das vom Kurfürstentum zum Königsthron in Polen aufgestiegen war, dabei zuzusehen, wie es bis zur Erschöpfung Ressourcen nach Polen pumpte, war eine bequeme Art, Brandenburgs regionale Sicherheit zu gewährleisten. Auch Hannover schaute gern zu, wie sich Sachsen übernahm, und war wegen seiner (1692 zugesagten, aber erst 1708 bestätigten) Kurwürde ebenfalls dem Kaiser verpflichtet. Die antischwedische Koalition ruhte auf der Annahme, dass Schweden seinen Zenit überschritten hatte und besonders verwundbar war, seit der fünfzehnjährige Karl XII. 1697 den Thron bestiegen hatte. Die dreigleisige Offensive auf HolsteinGottorp, Livland, Riga und Ingermanland war zunächst erfolgreich, dann aber startete Karl XII. einen auf Polen konzentrierten Gegenangriff. 1707 schloss er Frieden mit Joseph I. und zog seine Truppen aus dem Reich ab.11 Der Frieden im Westen gab dem schwedischen König freie Hand im Osten. Peter der Große hatte den sächsisch-polnischen Krieg genutzt und war in Ingermanland einmarschiert, wo er 1703 mit der Errichtung seiner neuen Hauptstadt St. Petersburg begann. Die Atempause für Deutschland hielt einige Jahre an, weil
167
168
II. · Konsolidierung und Krise 1705–1740
Karl im Juli 1709 bei Poltava eine vernichtende Niederlage erlitt und bis 1714 ins türkische Exil entfliehen musste. Während dieser Zeit veränderte sich die politische Landschaft in Norddeutschland gründlich. Hannover und Brandenburg schickten sich an, das Machtvakuum zu füllen, das Sachsens Wegfall als führende Regionalmacht hinterlassen hatte. Dann nahmen 1711 dänische, sächsische und russische Streitkräfte den Kampf gegen die Schweden wieder auf und griffen Mecklenburg und Westpommern an. Die Bemühungen kaiserlicher Autoritäten – allen voran Prinz Eugen –, die Neutralität Norddeutschlands zu wahren, hatten zunächst Erfolg. Der Versuch einer internationalen Einigung auf der langwierigen Friedenskonferenz in Braunschweig 1712 unter Vorsitz von Graf Damian Hugo von Schönborn, dem Bruder des Reichsvizekanzlers, der kurz zuvor den internen Konflikt in Hamburg geschlichtet hatte, scheiterte jedoch. 12 Das Wiedererscheinen Karls XII. in Stralsund im November 1714 führte nicht zu seiner Zulassung am Verhandlungstisch. Seine Weigerung, die Niederlage einzugestehen oder wenigstens einen Kompromiss zu akzeptieren, machte einen Frieden unmöglich, solange er lebte. Sein Angriff auf preußische Truppen auf der Insel Usedom zog Friedrich Wilhelm I. (1713–1740) in den Konflikt hinein. Das dänische Vorgehen gegen schwedische Besitzungen in Bremen und Verden im Nordwesten provozierte Hannover, das seit Langem auf diese Gebiete schielte. Gleichzeitig erhöhte die Nachfolge des Kurfürsten auf dem britischen Thron 1714 Hannovers politische Bedeutung und gab ihm als König einer großen europäischen Nation und Kommandeur der britischen Flotte zusätzliches politisches Gewicht. Peter der Große schmiedete derweil ein Bündnis mit Herzog Friedrich Wilhelm von Mecklenburg (1692–1713) und seinem Nachfolger Karl Leopold (1713–1747). Ihr Drang, ihr Territorium zum Schutz vor räuberischen Nachbarn zu bewaffnen, hatte zu schweren Konflikten mit Adligen wegen ungesetzlicher Besteuerung geführt; jetzt fürchteten sie ungünstige Urteile vom Reichshofrat in Wien und Eingriffe von Hannover und Brandenburg, die seit Langem Anspruch auf ihr Herzogtum erhoben. Auf französische Vermittlung hin verließen die russischen Truppen 1717 Mecklenburg und Georg I. suchte jenseits der Koalition nach Wegen, Russlands Vordringen im Baltikum zu bremsen. Die erweiterte antischwedische Koalition war jedoch stabil genug, um die Position von Karl XII. unwiderruflich zu untergraben. 13 Zwei letzte Angriffsversuche auf Norwegen konnten das Blatt nicht mehr wenden und der Tod des Schwedenkönigs während der Belagerung der Festung Fredriksten im Herbst 1718 ebnete den Weg zu Friedensverhandlungen. Fast gleichzeitig wurde Russland an Schwedens Stelle zum Hauptproblem: Da russische Truppen im ganzen Südbaltikum von Jütland bis St. Petersburg standen, erschien der vormalige Verbündete nun allen Koalitionspartnern als Bedrohung. Im Vertrag von Wien im Januar 1719 beschlos-
16. Prioritäten im Widerstreit (circa 1714–1730)
sen Großbritannien, Österreich und Sachsen, Russland in seine alten Grenzen zurückzudrängen und Preußen zum Frieden zu zwingen. 14 Der neue Status quo im Norden des Reichs verdankte sich der Kooperation von Hannover und Brandenburg und nicht kaiserlicher Vermittlung. Entscheidend war auch, dass nun Friedrich I. von Hessen-Kassel die schwedische Politik bestimmte, der deutsche Gemahl von Ulrika Eleonora, der Nachfolgerin Karls XII., die im Februar 1720 zu seinen Gunsten auf den Thron verzichtete. Als deutscher Fürst war Friedrich wohl geneigt, den schwedischen Einfluss im Reich zu dämpfen. Die entscheidenden Gespräche initiierte Georg I. nach den Wiener Verträgen. Im November 1719 schloss der britische König in seiner Funktion als Kurfürst von Hannover gegen die Herausgabe von Bremen und Verden Frieden mit Schweden; ein paar Wochen später folgte Friedrich Wilhelm von Brandenburg, der Westpommern bis zur Peene und Stettin übernahm. Schweden behielt Wismar, Riga und Stralsund (bis 1806), aber seine Stellung in Deutschland war so gut wie zunichte. Kurz darauf musste Dänemark einen Frieden akzeptieren, der die Annexion von Holstein-Gottorp und den Verzicht auf alle Ansprüche auf Territorien jenseits des Sunds umfasste. August der Starke, der 1709/10 von russischen Streitkräften wiedereingesetzt worden war, wiederholten russischen und schwedischen Übergriffen auf sein Königreich aber machtlos gegenüberstand, einigte sich nun ebenfalls mit Schweden. 15 Damit war es Georg I. gelungen, Russland zu isolieren, er unterschätzte jedoch die militärische Stärke Peters des Großen, die es ihm im August 1721 ermöglichte, mit Schweden den Frieden von Nystad zu schließen. Für den Rückzug aus Finnland erhielt er Estland, Livland, Ingermanland, Kexholm und einen Großteil von Karelien. 16 Aus Deutschland war der Zar somit verdrängt worden, sein Reich hatte sich indes als europäische Macht etabliert, mit Zugang zur Ostsee und effektiver Hegemonie über Polen, dessen König sein Überleben der russischen Streitmacht verdankte. 1707 hatte das kaiserliche Eingreifen den Konflikt vom Reich abgewendet. Danach verdankte sich die Erhaltung von Frieden und Stabilität im Norden nach zwei Phasen schwerer Kämpfe 1712/13 und 1715 mehr dem Bemühen von Hannover und Brandenburg-Preußen um ihre eigenen Interessen als einem Einsatz des Kaisers. Ihre gestärkte regionale Macht war beiden sehr bewusst. Sie konnten den Kaiser unter Druck setzen und ihre gemeinsame Opposition gegen die kaiserliche Religionspolitik in den frühen 1720er Jahren bedrohte empfindlich dessen Autorität im Norden. 17 Andererseits wollte keines der beiden Länder riskieren, sich den Anweisungen des Kaisers offen zu widersetzen. Binnen weniger Jahre bot die MecklenburgFrage Wien erneut die Möglichkeit, die alte Politik des gegenseitigen Ausspielens von Hannover und Berlin zu revidieren, und Ende der 1720er Jahre standen beide wieder treu zum Kaiser. Trotz ihrer wachsenden Macht und internationalen Ver-
169
170
II. · Konsolidierung und Krise 1705–1740
flechtungen hielten sich Hannover und Brandenburg weiter an die Regeln eines Systems, das ihren eigenen Interessen am besten diente. Im Nordischen Krieg hatte Georg I. versucht, britische Macht und britisches Prestige zugunsten seines deutschen Kurfürstentums einzusetzen. Danach kam es jedoch zu einer zunehmenden Trennung; der einheimische Adel hielt an seiner Loyalität zu Habsburg und dem Reich fest. 18 In Brandenburg-Preußen blieb die Politik Friedrich Wilhelms I. in Einklang mit seinen Pflichten als Reichsfürst und bis Ende der 1730er Jahre stand Brandenburg wie eh und je seit 1686 grundsätzlich treu zu den Habsburgern. 19
Anmerkungen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19
Vgl. z. B.: Hochedlinger, Wars; Ingrao, Monarchy; Vocelka, Glanz. Hochedlinger, Wars, 194 ff.; Vocelka, Glanz, 154–159; Wilson, German Armies, 214–218. Wilson, German Armies, 215 f. Wrede, Reich, 188–193. Aretin, Altes Reich II, 361. Vgl. S. 191. Aretin, Altes Reich II, 302 f. Wilson, German Armies, 201–214. Aretin, Altes Reich II, 311. Vgl. für einen vollständigen Überblick Frost, Northern Wars, 226–300. Vgl. S. 140, 142. Wilson, German Armies, 142 f. Frost, Northern Wars, 295 f. Ebd., 296. Stanislaus Leszczynski hatte eingewilligt, nach Frankreich ins Exil zu gehen; im Gegenzug erhielt er beträchtlichen Schadenersatz von Sachsen und das Recht, sich »König« zu nennen. Stone, Polish-Lithuanian State, 252 f. Frost, Northern Wars, 296. Duchhardt, Altes Reich, 27; vgl. S. 68–187. Press, »Kurhannover«, 59 f. Baumgart, »Friedrich Wilhelm I.«, 155–158.
17. Die Regierung des Reichs unter Karl VI.
V
iele der von Leopold I. und Joseph I. eingeleiteten Initiativen setzte Karl VI. energisch fort. Der Reichshofrat blieb äußerst aktiv. Es gab neue Versuche, die Einkünfte aus dem Reich zu erhöhen. Der Kaiser unterstrich mit einer ganzen Reihe von Erlassen seine Entschlossenheit, seine Rechte auszuüben und die Ordnung im Reich zu erhalten. 1 So berichtete etwa der preußische Generalbevollmächtigte Cocceji im Januar 1715 nach Berlin, der Kaiser wolle seine Autorität und alle ihm durch Reichsgesetze übertragenen Rechte in vollem Umfang ausüben. Insbesondere habe er offenbar beschlossen, in der Rechtsprechung des Reichs keine Rücksicht auf Einzelne zu nehmen, die Länder, die in den letzten Jahren einseitig vorgegangen seien, zur Gesetzestreue zu zwingen und die Opfer solcher Exzesse zu unterstützen. 2 Ein erstes Signal für das energische Wiederaufleben der kaiserlichen Politik nach dem Frieden von Rastatt war ein Dekret zu Büchern und Zeitschriften im Juli 1715. Es bestätigte nicht nur die geltenden Einschränkungen gegen Publikationen, die den Religionsfrieden störten oder in irgendeiner Weise verleumderisch waren. Nun verbot der Kaiser sämtliche Schriften, die »gegen die Staatsregierung und Grundgesetze des heiligen röm. Reichs« gerichtet waren, und untersagte darüber hinaus, »auf Universitäten über das jus. civile u. publicum sehr schädliche des heil. röm. Reichs Gesetze und Ordnungen anzapfende verkehrte neuerliche Lehren, Bücher, Theses und Disputationes« zu verbreiten, die geltende Gesetze und Statuten des Reichs untergraben und so Unordnung herbeiführen könnten. 3 In »kaiserlicher Machtvollkommenheit« Dekrete zu erlassen, war ja schön und gut. Wie wirkungsvoll seine Bemühungen waren und wie lange er sie weiterverfolgte, ist jedoch umstritten. Manche glauben, sein Interesse am Reich sei von Anfang an begrenzt gewesen, andere meinen, er habe bis etwa 1730 die kaiserliche Macht erfolgreich ausgeübt und dann Einfluss und Interesse verloren. 4 Das hängt größtenteils davon ab, wie man den langsamen Rückzug von Friedrich Karl von Schönborn aus Wien nach 1729 interpretiert. 5 Sicherlich wurde er gedrängt, sein Amt als Reichsvizekanzler 1734 aufzugeben, seine Aufgaben in Wien waren aber auch nur selten mit seinen Pflichten in den Bistümern Bamberg und Würzburg in Einklang zu bringen. 6 Es gibt indes keinen Beleg für einen Streit zwischen Schönborn und dem Kaiser. Die 1720er Jahre hindurch war er mit Ländereien in Österreich und Ungarn belohnt worden; umfängliche Zuschüsse ermöglichten ihm den Bau eines Sommer-
172
II. · Konsolidierung und Krise 1705–1740
palasts bei Göllersdorf nahe Wien. Die Wende kam offenbar mit seiner Bewerbung für das Erzbistum Mainz 1732: Der Kaiser hatte gute Gründe, eine Wahl zu verhindern, die ihm einen dynamischen Führer der deutschen Länder eingebracht hätte. Den Habsburgern als Kaiser blieb Schönborn auch nach dieser Abfuhr treu, in erster Linie jedoch dem Reich als Institution: Im Österreichischen Erbfolgekrieg nach 1740 beharrte er auf Neutralität und brachte andere kleine Länder dazu, ihm zu folgen. 7 Die diversen Initiativen vor 1730 hatten nur teils Erfolg. Die kaiserlichen Eingriffe in die internen Belange der Reichsstädte Hamburg (1708–1716) und Frankfurt (1712–1732) waren sicherlich dramatisch und entscheidend. Die Kombination kaiserlicher Kommissionen und Erlasse stabilisierte eine möglicherweise revolutionäre Situation und trug zur Modernisierung der oligarchischen oder aristokratischen Verfassungen bei, die Anlass der Unruhen gewesen waren. 8 Das machte es jedoch nicht unbedingt leichter, von diesen Städten Gelder zu kassieren. Hamburg etwa hatte nach einem antikatholischen Aufruhr, bei dem 1719 das Haus des Botschafters samt der katholischen Kapelle zerstört wurde, allen Grund, sich dem Kaiser zu fügen. 1720 indes verweigerte der Senat die Bezahlung von Steuern auf Juden und eines Beitrags zur Erhaltung der Reichsfestungen Kehl und Philippsburg am Rhein. 9 Die Judensteuer war eine von mehreren traditionellen kaiserlichen Einnahmequellen, die Wien wiederbeleben wollte. Karl VI. hatte nach seiner Krönung angeordnet, dass ihm die Frankfurter Juden formell ihre Ehrerbietung erweisen und damit seine Oberherrschaft anerkennen. Der nächste Schritt, die Einführung einer allgemeinen Steuer für alle Juden in den Reichsstädten und den Ländern der Reichsritter, erwies sich aber als undurchführbar. In der Mehrheit der Territorien hatten längst die lokalen Herrscher die Verantwortung für die Juden und das Recht, sie zu besteuern, übernommen. Darauf beriefen sich Reichsstädte und Ritter nun auch in eigener Sache. So weigerten sich etwa 1721 die Ritter rigoros, den Juden in ihren Ländern kaiserliche Steuern aufzuerlegen, und nach längeren Diskussionen lenkte Wien schließlich ein. 1733 wurden die Reichsritter als Territorialherrscher wie Fürsten anerkannt; der Kaiser konnte sich dem nicht widersetzen, weil er von ihrer Bereitschaft abhängig war, weiterhin die sogenannten subsidia charitativa zu bezahlen. 10 Neue Anläufe zur Durchsetzung kaiserlicher Vorrechte bei kirchlichen Wahlen blieben ebenso erfolglos. So wie es Joseph I. nicht gelungen war, 1706 in Münster seinen Kandidaten durchzusetzen, konnte auch Karl VI. 1724 die Wahl von Reichsvizekanzler Friedrich Karl von Schönborn in Würzburg nicht herbeiführen. 11 Sobald das Domkapitel Wind von den kaiserlichen Plänen bekam, wählten die Domherren eilends Christoph Franz von Hutten, bevor der kaiserliche Wahlbeauftragte Graf Wurmbrand auch nur in der Stadt eingetroffen war.
17. Die Regierung des Reichs unter Karl VI.
Der Reichshofrat prüfte daraufhin die Rechte des Kaisers auf Empfehlung, Ausschluss und Verweigerung der Einsetzung eines gewählten Bischofs in sein Territorium. Man kam zu dem Schluss, diese Rechte existierten nach wie vor, riet jedoch, in Zukunft äußerst behutsam damit umzugehen. Sie kamen tatsächlich nie wieder zur Anwendung. Informelle Einflussnahme erwies sich als wirkungsvoller. Friedrich Karl von Moser notierte 1787, es gebe »Beispiele, daß zuweilen die Wahl auf einen kundbaren Dummkopf gelenkt und durchgesetzet worden, bloß weil er sich mit Leib und Seel zu Dienst, Willen und Absichten des kaiserlichen Hofes oder vielmehr des Hauses Österreich ergeben.«. 12 Im Allgemeinen dominierten auf diesem Gebiet jedoch die Wittelsbacher bis zum Aussterben ihrer zwei Hauptlinien nach 1750. Die Habsburger hatten mehr Erfolg auf der niedrigeren Ebene der Vergabe von Kanonikaten, womit sich auch Netzwerke gegenseitiger Begünstigung knüpfen und die prokaiserliche Tendenz der Reichskirche aufrechterhalten ließen. Die Auffrischung lange erloschener Privilegien erwies sich als unmöglich. Andere Initiativen trugen eher Früchte. 1731 gelang die Einführung einer neuen Reichshandwerksordnung. Die Initiative zur Regulierung der Zünfte von 1672 war 1680 aufgegeben worden, neue Anläufe (zum Beispiel 1707) waren gescheitert. 13 Der Aufstand der Augsburger Schuhknechte 1726 führte zu Forderungen des Stadtrats nach raschem Handeln. 1727 bat der Kaiser den Reichstag um Prüfung des Reichsgutachtens von 1672. Als er nach drei Jahren noch keine Antwort erhalten hatte, drohte er mit einem Erlass ohne vorherige Konsultation. Am 4. September 1731 wurde schließlich ein Kommissionsdekret ratifiziert, das im Wesentlichen auf dem Entwurf von 1672 beruhte, mit der wichtigen Ergänzung, dass reisende Gesellen nicht mehr in benachbarten Territorien Zuflucht suchen durften und alle Landesherren verpflichtet waren, Missetäter auszuliefern – die Augsburger Rebellen hatten sich durch Flucht nach Bayern dem Zugriff der Strafbehörden entzogen. Auch die erfolgreichen Verhandlungen über eine neue Reichswährungsordnung zwischen 1732 und 1738 stehen für die anhaltenden Bemühungen um Reformen im Reich. 14 Die endgültigen Regelungen wurden zwar nie formell publik gemacht, lieferten aber den Rahmen für regionale Vorschriften zwischen zwei oder mehr Herrschern sowie innerhalb und zwischen verschiedenen Kreisen. Auch in den Kreisen selbst zeigte Karl VI. neues Engagement. Wegen der Militäreinsätze anderswo in Europa war der Kaiser zur Sicherung des Rheins auf die Vorderen Kreise angewiesen und pflegte daher behutsam die Beziehungen zu ihnen: Der schwäbische Kreis wurde hinsichtlich habsburgischer Territorien direkt involviert, andere durch Korrespondenz und Konsultation. 15 Der bayerische Kreis war problematisch, weil der Kurfürst von Bayern dem Reich eher gleichgültig und bisweilen – im Bund mit Frankreich – offen feindselig gegenüberstand. Sein Mitoberhaupt, der Kurfürst von Salzburg, sorgte jedoch für Ausgleich. Als der bayerische Kreis 1727 eingeladen wurde, sich der Nördlinger
173
174
II. · Konsolidierung und Krise 1705–1740
Allianz zur Verteidigung gegen Frankreich anzuschließen, lehnte er ab; Karl Albrecht von Bayern schloss stattdessen gegen Subsidien ein Geheimabkommen mit Frankreich. 16 Die anderen Kreise hingegen standen zum Reich, wobei die größte Loyalität gegenüber dem Kaiser meist die zeigten, die nicht von einer größeren Macht dominiert waren. Im schwäbischen Kreis hielt die kaiserliche Unterstützung der Thronfolge in Mömpelgard Württemberg bei der Stange, im Oberrheinkreis führten Bemühungen um eine Beilegung der Streitigkeiten zwischen Ernst Ludwig von Hessen-Darmstadt (1678–1739) und Pfalz-Neuburg 1722 zu seiner Wahl zum Kreisoberst. 17 Im fränkischen Kreis sorgten die Mitglieder selbst für Viabilität und Treue zum Kaiser, indem sie Brandenburgs Versuch abwehrten, durch Besetzung der Grafschaft Limpurg nach dem Erlöschen von dessen Herrscherlinie im Jahr 1713 Aufnahme in den Kreis zu finden. Auf einen Appell an den Reichshofrat hin erfolgte ein Urteil gegen Brandenburg, dem sich der König fügte, nachdem der Kaiser angekündigt hatte, es mit militärischer Gewalt durchsetzen zu lassen. 18 1726 trugen die Kreismitglieder finanziell dazu bei, Bayreuth einer jüngeren Kulmbacher Nebenlinie und nicht Brandenburg zu übertragen, als das herrschende Hohenzollerngeschlecht erlosch. 19 Die Übernahme der Spanischen Niederlande 1714 brachte den Habsburgern neue Einflussmöglichkeiten in Norddeutschland, besonders in den westfälischen und niedersächsischen Kreisen. Die Spanischen Niederlande bildeten offiziell immer noch den burgundischen Kreis, der allerdings seit dem Vertrag von Burgund 1548 von Verpflichtungen gegenüber dem Reich und von seiner Jurisdiktion befreit war. Unter spanischer Herrschaft hatten sie sich von einer Reichsregion zu einer Art selbstständigem Staat entwickelt und im 18. Jahrhundert fragte sich manch einer, ob sie überhaupt noch zum Reich gehörten. 20 Vom genauen legalen Status der westlichen Bereiche von Flandern und Brabant abgesehen, grenzte das Herzogtum Luxemburg im Osten zumindest an Kernterritorien des Reichs. Die dortige Präsenz der Habsburger und ihr Wille, die neuen Territorien vor Frankreich, den Niederlanden und den Ambitionen mächtiger Länder wie Brandenburg und Hannover zu schützen, machten den benachbarten westfälischen Kreis interessant. Umgekehrt wollten viele von dessen Mitgliedern die Vorherrschaft von Brandenburg-Preußen, das acht der Territorien im Kreis hielt, abschütteln. 21 Im Mai 1715 setzten sich die minderen Herrscher in der Kreisversammlung gegen Brandenburg durch und beschlossen, ihre Selbstverteidigung durch eigene Truppen zu organisieren, anstatt für brandenburgische Streitkräfte zu bezahlen. Selbst die Äbtissin von Essen kündigte nun ihre Absprachen mit Berlin und stellte vierundvierzig Soldaten bereit. 22 Im Dezember 1715 verpflichtete der Kaiser den Erzbischof von Lüttich, dem Kreis wieder beizutreten, den er 1713 verlassen hatte, um sich die Kosten für die gemeinsame Verteidigung zu sparen.
17. Die Regierung des Reichs unter Karl VI.
Weiter gestärkt wurde der habsburgische Einfluss dadurch, dass einige kleinere westfälische Grafschaften von österreichischen Dynastien wie Kaunitz und Sinzendorf beziehungsweise Familien wie den katholischen Grafen von Salm, Arenberg und Löwenstein, die zur Klientel der Habsburger zählten, ererbt worden waren. 23 Einige davon, etwa die Grafen von Gronfeld, Aspremont-Linden und de Ligne, besaßen auch Ländereien in den Spanischen Niederlanden und dienten nun eben dem Kaiser und nicht mehr dem König von Spanien. Andere, wie die Grafen von Lippe, stärkten die kaiserliche Autorität durch regelmäßige Anrufung des Reichshofrats bei internen Konflikten. Zwar gingen wesentlich mehr Fälle ans Reichskammergericht, aber auch dessen Urteile wurden im Namen des Kaisers verkündet. 24 Das Verhältnis zwischen dem Kaiser und dem Herrscherhaus von Lippe wurde durch dessen Erhebung in den Fürstenstand 1720 weiter gefestigt. 25 Das übergreifende strategische Ziel der kaiserlichen Politik war, den Einfluss Brandenburgs zu begrenzen, nicht zuletzt durch Ausnutzung der Spannungen zwischen dessen Interessen an Kleve und Mark und den pfälzischen Ansprüchen auf Jülich und Berg, die bestanden, seit die zwei Dynastien diese Länder 1614 gemeinsam ererbt hatten. Andererseits gab es auch Bemühungen, Berlin nicht gänzlich zu verprellen. Im langwierigen Streit um die Grafschaft Tecklenburg etwa stellte sich der Kaiser letztlich auf die Seite von Friedrich Wilhelm I., der das Territorium 1729 vom Grafen von Bentheim erwerben konnte. 26 Die Sicherung der Unterstützung des Kurfürsten für die Pragmatische Sanktion überwog alle Bedenken bezüglich der Rechte der Grafen von Bentheim und Solms, die seit dem 16. Jahrhundert Tecklenburg für sich reklamierten. 27 In diesem Fall wurde das Urteil des Reichshofrats politischem Opportunismus und den dynastischen Interessen der Habsburger geopfert. Im niedersächsischen Kreis war der habsburgische Einfluss weniger direkt; dort war der Kaiser wie eh und je auf Hannover angewiesen, um Brandenburgs Ambitionen zu bremsen. Auf österreichisch-hannoverschen Druck zog sich Brandenburg aus der Reichsstadt Nordhausen zurück, die es unter dem Vorwand des Schutzes gegen Sachsen seit 1703 besetzt hielt. 28 Die kaiserliche Autorität fand jedoch ihre Grenzen im wachsenden Durchsetzungsvermögen Hannovers selbst, vor allem nach der Thronfolge in Großbritannien 1714. Der Versuch, Hannover durch Verzögerung der formellen Einsetzung in neu erworbene Gebiete wie Lauenburg, Hadeln sowie Bremen und Verden zu zügeln, machte die Sache nur noch schlimmer: 1722 erklärte Georg I., er werde seine neuen Ländereien behalten, »ob der Kaiser die Investitur bewilligt oder nicht«. 29 Das Einschreiten des Reichshofrats in Mecklenburg (Kreis Niedersachsen) und Ostfriesland (westfälischer Kreis) zeigt Möglichkeiten und Hindernisse der Ausübung kaiserlicher Macht im Norden nach 1715 auf. In Mecklenburg verschärfte das tyrannische Gehabe des seit 1713 regierenden Herzogs Karl Leopold einen seit
175
176
II. · Konsolidierung und Krise 1705–1740
1664 anhaltenden Disput über Steuern. Der Reichshofrat fällte eine lange Reihe von Urteilen gegen den Herzog, der sich indes mit Peter dem Großen verbündete, was die Durchsetzung erschwerte. 30 Umso mehr war kaiserliches Einschreiten geboten. Der Plan, Hannover mit der Exekution der Anweisungen des Hofs zu beauftragen, verzögerte sich, weil der preußische König beharrlich seine Mithilfe anbot und dies als sein Recht beanspruchte, weshalb der Reichshofrat umso hartnäckiger darauf bestand, ihn nicht zu beteiligen. 1719 schließlich marschierten Truppen aus Hannover und Wolfenbüttel in das Herzogtum ein und eine Kommission aus Hannover übernahm die Regierungsgeschäfte. Mehrere Jahre lang herrschte eine unbehagliche Pattsituation, da Karl Leopold von seinen verbliebenen Hochburgen Schwerin und Dömitz aus die Herrschaft wiederzuerlangen suchte, während die Besatzungstruppen die Hannoversche Kommission schützten, die von den meisten Territorialständen unterstützt wurde. Die Kommission wurde schnell selbst zum Problem, weil sie Befürchtungen weckte, ihre Verlängerung könne zur Annexion des Herzogtums führen. Aufgelöst wurde sie erst nach dem Tod von Georg I. 1727; der Absetzung von Karl Leopold 1728 folgte dann die Einsetzung seines Bruder Christian Ludwig als Übergangsherrscher. 31 Nun wurde Brandenburg-Preußen beauftragt, die Rechte des Adels zu garantieren, was einmal mehr der Reichshofrat bestätigte. Dies war ein klarer Versuch Österreichs, Brandenburg für die Pragmatische Sanktion zu gewinnen, gegen den Georg II., Herzog von Braunschweig-Wolfenbüttel, und andere Fürsten protestierten, während die Mecklenburger Stände beklagten, dass keine dauerhafte territoriale Einigung erzielt worden war. Dass sich Karl Leopold 1733 zum Führer eines Bauernaufstands aufschwang, führte zum Eingreifen von Hannover, Wolfenbüttel und Brandenburg. Zur Deckung der Kosten dieses Schritts (und im Fall Hannovers der gesamten Affäre) reklamierten Hannover und Brandenburg Teile des Mecklenburger Territoriums für sich. 1735 gelang es Christian Ludwig (der bis 1756 regierte), seinen Bruder aus Schwerin zu vertreiben; Karl Leopold floh in den schwedischen Hafen Wismar, kehrte 1741 nach Dömitz zurück und lebte dort zurückgezogen bis zu seinem Tod 1747. Ironischerweise entwickelte Christian Ludwig, sobald er die Nachfolge seines Bruders angetreten hatte, ebenfalls tyrannische Züge. 1755 schritt schließlich Friedrich der Große ein und konnte den Konflikt beilegen, indem er die bereits 1701 von kaiserlichen Beratern empfohlenen Regelungen durchsetzte. 32 In Ostfriesland wurde der ebenso langwierige Streit der Cirksena-Dynastie mit ihren Ständen verschärft durch die Verwicklung von Truppen aus den Niederlanden, Münster, Celle und Brandenburg vor 1700. Eine Phase relativer Ruhe und Prosperität endete mit einer Reihe von Naturkatastrophen nach 1715, die 1717 in einer Sturmflut gipfelte, bei der viele Seefestungen zerstört wurden. Im Zuge der folgenden Finanzkrise gingen Fürst Georg Albrecht (1708–1734) und sein Kanzler
17. Die Regierung des Reichs unter Karl VI.
Enno Rudolph Brenneysen wegen deren Haushaltschaos gegen die Stände vor. Nicht ganz zu Unrecht warfen sie ihnen vor, das Land durch regelmäßige Inanspruchnahme fremder Militärhilfe in den Ruin getrieben zu haben. Dahinter stand eine kleine Gruppe von größtenteils Bürgern der Stadt Emden, die nach wie vor Althusius’ revolutionären Ideen folgte und eine despotische Oligarchie errichten wollte, der alle, auch der Fürst, untertan sein sollten. 33 Während sich der Reichshofrat um eine Lösung bemühte, bewaffneten sich beide Seiten. Brandenburg-Preußen hielt zu den Ständen, weil diese den brandenburgischen Kurfürsten als Nachfolger der Cirksena anerkannten. Zur gewaltsamen Konfrontation kam es nur deswegen nicht, weil weder Brandenburg noch die Niederlande einen Krieg mit Österreich riskieren wollten. Karl ließ 1727 dänische Truppen zugunsten Georg Albrechts für Recht und Ordnung sorgen, die Rebellen behielten jedoch Emden und seine Umgebung unter Kontrolle. Dieses labile Gleichgewicht führte zu langwierigen Verhandlungen zwischen dem Reichshofrat, dem Fürsten, den Ständen, den Niederlanden und Brandenburg, die erst 1744 nach dem Tod von Carl Edzard (1734–1744) ein Ergebnis fanden. Die Dynastie erlosch und Ostfriesland ging an Friedrich den Großen, der die verfassungsrechtliche Situation von vor 1721 wiederherstellte. 34 Letztlich scheiterten die kaiserlichen Initiativen in Mecklenburg und Ostfriesland. Aber wichtiger als das Ergebnis war wohl das rechtliche Verfahren als solches. Mecklenburg zeigte, dass Untertanen gegen ihre Fürsten klagen konnten, Ostfriesland belegte umgekehrt, dass Herrscher gegen übermächtige Untertanen vorgehen konnten. Die kaiserliche Justiz kam gegen die Tyrannei der Masse ebenso zur Geltung wie gegen den Despotismus Einzelner. In diesen speziellen Fällen scheint es nicht zu politischer Einflussnahme auf die Justiz gekommen zu sein, die Umsetzung der Entscheidungen hing indes zwangsläufig von den österreichischen Beziehungen zu den beteiligten Fremdmächten ab. Die Tyrannei der mecklenburgischen Herzöge wurde beendet, die Beschwerden der ostfriesischen Fürsten endeten mit Carl Edzards Tod. Karl VI. hätte es nicht gefallen, dass in beiden Fällen Brandenburg profitierte, da er sich stets – und innerhalb der durch die Entfernung von Wien bedingten Grenzen einigermaßen erfolgreich – bemüht hatte, durch kaiserliche Rechtsprechung einen Ausgleich zwischen den widerstreitenden Ambitionen der großen Regionalmächte zu schaffen.
Anmerkungen 1 2 3 4
Müller, »Reichscamerale«, 156, 167. Feine, »Verfassungsentwicklung«, 81. Eisenhardt, Aufsicht, 39 ff. Klueting, Reich, 113–123; Hughes, Germany, 136.
177
178
II. · Konsolidierung und Krise 1705–1740
5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
32 33 34
Hantsch, Schönborn, 325–345. Aretin, Altes Reich II, 332. ADB XXXII, 269 f. Duchhardt, Verfassungsgeschichte, 206 f.; Lau, »Reichsstädte«; Feine, »Verfassungsentwicklung«, 101–104. Der Reichshofrat griff zwischen 1706 und 1784 in nicht weniger als 221 Streitigkeiten in Frankfurt ein; vgl. Lau, »Reichsstädte«, 151. Ramcke, Beziehungen, 89. Duchhardt, Verfassungsgeschichte, 207 f.; Duchhardt, »Karl VI.«. Feine, »Verfassungsentwicklung«, 99 f.; Aretin, Altes Reich II, 386 f. Feine, »Verfassungsentwicklung«, 100. Winzen, Handwerk, 177–183; Stürmer, Herbst, 54–71, 153 f., 184–196; Conrad, Rechtsgeschichte II, 149 ff.; Dotzauer, Reichskreise, 453 f.; North, Kommunikation, 85 f. Schneider, Währungspolitik, 85–108; vgl. auch S. 77 ff. Wilson, German Armies, 210–214. Hartmann, Reichskreis, 454–458. Dotzauer, Reichskreise, 237. Marquardt, »Aberkennung«, 88. Dotzauer, Reichskreise, 129. Ebd., 390–439. Ebd., 298 ff., 325–329; vgl. auch Just, »Grenzsicherungspläne«, sowie ders., »Westpolitik«. Wilson, German Armies, 219. Arndt, Reichsgrafenkollegium, 265–286. Einige waren auch durch jüngere Söhne in der Reichskirche in das imperiale System eingebunden; vgl. ebd., 286–307. Benecke, Society, 260 f., 332 f. Klein, »Erhebungen«, 183 f.; die für diese Prozedur erhobenen Gebühren waren so immens, dass der Titel erst 1789 offiziell beurkundet werden konnte. Klueting, Reich, 119 f.; Klueting, »Grafschaft«. 1577 hatte das Reichskammergericht drei Achtel Solms zugesprochen, den Rest Bentheim. Der Streit flammte 1694 erneut auf, als Brandenburg erst zugunsten Bentheims und dann Solms intervenierte, dem Friedrich I. die Grafschaft 1707 abkaufte. Brandenburgs ursprüngliches Interesse war, dass weder Bentheim noch Solms Anspruch auf die Grafschaft Lingen erheben konnte, die bis ins 16. Jahrhundert mit Tecklenburg verbunden war und die Brandenburg zusammen mit den anderen Ländereien des Hauses Oranien am Niederrhein zu erwerben hoffte. Nachdem das erreicht war, ging es Brandenburg um Tecklenburg selbst. Wilson, German Armies, 133 f., 220. Hatton, George I, 243, 360–1, und Wilson, German Armies, 221. Hughes, Law, 102 ff.; vgl. auch S. 168, 230, 284. Christian Ludwig regierte zunächst als mutmaßlicher Thronfolger und kaiserlicher Landesadministrator und nach Protesten, dies widerspreche dem Reichsrecht, ab 1732 als kaiserlicher Kommissarius an seines Bruders statt. Entgegen der Bekanntmachung von 1728 wurde Karl Leopold nun nicht mehr für dauerhaft regierungsunfähig erklärt, was seine Wiedereinsetzung zumindest theoretisch ermöglichte; vgl. Hughes, Law, 206 ff., 239 f.; Feine, »Verfassungsentwicklung«, 111 f.; Troßbach, »Fürstenabsetzungen«, 441 ff. Hughes, Law, 95, 264 f. Ebd., 125–135; Kappelhoff, Regiment, 151–175. Hughes, Law, 267 f.
18. Zurück zur Religionspolitik?
D
ie Bemühungen Karls VI., seiner Funktion als oberster juristischer Instanz gerecht zu werden, fanden den Beifall der mittleren und weniger mächtigen Reichsstände, die mehr oder weniger sicher sein konnten, dass der Kaiser ihre Unabhängigkeit garantierte. Die mächtigeren Fürsten indes empfanden ihn als lästig und bedrohlich. Schon 1716 glaubte Friedrich Wilhelm I. von Brandenburg-Preußen zu wissen, worauf der Kaiser aus war: »Er will uns alle unterdrücken und sich souverän machen, das will er, und Schweden muss wieder gerufen werden, dem Kaiser das Gebiss ins Maul zu legen.« 1 Friedrich Wilhelms Geringschätzung des kaiserlichen Rechts brachte ihn in dauernden Konflikt mit den kaiserlichen Autoritäten. Am Reichshofrat waren bis zu vierzig Verfahren gleichzeitig gegen ihn anhängig und seine Einstellung zu dessen Urteilen machte die Sache nicht besser: »… ich mache es wie Wallenstein,« schreibt er einmal, »wenn der eine ordre von Kaiser kriege, so küßte er sie und steckte versiegelt aus dem Fenster.« 2 Hannovers Haltung war kaum positiver; der englische Botschafter in Wien berichtete spöttisch, Karl wolle »Caesarum Augustum und die grandeur der ersten römischen kaiser imitieren«. 3 Es fiel Karl leicht, Friedrich Wilhelm I. 1720 vorzuwerfen, »im Reich statum in statu zu formieren, Ihren [des Kaisers] Mitständen Gesetze vorzuschreiben, endlich auch dem Kaiser selbst zu wiederstehen und dessen Amt außer Acht und Gehorsam setzen zu können«. 4 Indes war es zur Zeit von Karls Regierungsantritt offenkundig undenkbar, mit dem Kurfürsten von Brandenburg oder Hannover ebenso umzugehen wie mit dem Abt von Ellwangen oder dem Grafen von Nassau-Siegen. Die deutschen Fürsten, die außerhalb des Reichs Königswürden bekleideten, ließen sich schlichtweg nicht länger wie pflichtvergessene Vasallen des Kaisers behandeln und ihr Vorbild ließ auch bei anderen Widerstand keimen. In den 1720er Jahren forderten Württemberg und Hessen-Kassel für ihre weitere Unterstützung der Krone die Verleihung der Kurwürde. 5 Nirgendwo traten die so entstehenden Spannungen deutlicher zutage als in den religiösen Kontroversen, die das Reich in den frühen 1720er Jahren an den Rand eines Krieges brachten. Den Anlass der Krise lieferte der katholische Kurfürst der Pfalz, Karl Philipp (1716–1742). Im April 1719 belegte er den calvinistischen Heidelberger Katechismus von 1563 mit dem Kirchenbann, weil dieser die katholische Messe als »vermaledeyte Abgötterey« verunglimpfte. Im September ordnete er den Abriss der Mauer an, die seit 1706 die Heiliggeistkirche in Heidel-
180
II. · Konsolidierung und Krise 1705–1740
berg zur gemeinsamen Benutzung durch Calvinisten (im Kirchenschiff) und Katholiken (im Chor) teilte, und verwies die Calvinisten aus dem Gebäude. Viele europäische Protestanten empfanden im späten 17. und frühen 18. Jahrhundert ein neues Aufleben der konfessionellen Spannungen und sahen den Protestantismus in Gefahr. 6 Die Vertreibung der Hugenotten aus Frankreich 1685, die brutale Niederschlagung des Kamisardenaufstands 1702 bis 1705, katholische Pogrome in den habsburgischen Ländern und die ständige Bedrohung durch die Jakobiten in Großbritannien schürten Unsicherheit und Furcht vor einem katholischjesuitischen Umsturz des Status quo. Im Reich selbst erlangte eine Reihe anhaltender Streitereien über die Auslegung der Bedingungen des Westfälischen Friedens im Hinblick auf bestimmte Städte und Bezirke nach 1697 breitere Bedeutung. Das hatte vier miteinander verknüpfte Gründe. Erstens konvertierte der sächsische Kurfürst 1697 zum Katholizismus. Das hatte zunächst kaum Folgen; laut geltendem Reichsrecht blieb sein Territorium lutherisch, sein Amt als Leiter des Corpus Evangelicorum ging einfach auf die protestantische jüngere Weißenfels-Linie über und die Geschäfte führte der sächsische Staatsrat. 7 Die Konversion des Kurfürsten und seine Übernahme des polnischen Throns bedrohte jedoch seine regionalen Nachbarn Braunschweig und Brandenburg und ließ sie ebenfalls nach einer Statuserhöhung streben. Vor allem Brandenburg focht die sächsische Führung des Corpus Evangelicorum an und übernahm das Vizedirektorium. Dabei ging es nicht nur um den Titel, sondern auch um die Art der Führung. Sachsen hatte die politischen Möglichkeiten seiner Position nie ausgeschöpft, sich aber stets loyalistisch verhalten, während die Kurfürsten ihren Einfluss nutzten, um religiöse Spannungen zu entschärfen und Agitation im Keim zu ersticken. Brandenburg war nach 1648 eine der treibenden Kräfte, nach 1700 schloss sich Hannover an. Damit ging die Politik Leopolds I., Hannover als regionale Macht gegen Brandenburg aufzubauen, nach hinten los. Georg I. blieb zwar mit Wien verbündet, bildete jedoch gleichzeitig mit Brandenburg eine gemeinsame Speerspitze der deutschen Protestanten. Aus Sorge, durch einen neuen Aufstand der Jakobiten des britischen Throns enthoben zu werden, wandte er sich noch entschiedener als sein Berliner Kollege gegen die jesuitische Verschwörung, die angeblich plante, erst das Reich und dann das ganze protestantische Europa zu unterwandern. Französische Diplomaten sprachen von zwei Parteien: den von Hannover und Brandenburg angeführten zélés (Zeloten) und den politiques, die loyal zum sächsischen Direktorium standen. 8 Die Bedingungen des Friedens von Rijswijk gossen neues Öl ins Feuer der Streitigkeiten in der Pfalz und gaben ihnen weiterreichende politisch-konstitutionelle Bedeutung. Über den konfessionellen Status quo in der Pfalz diskutierte man bereits seit der Wiedereinsetzung eines calvinistischen Kurfürsten in einem Ge-
18. Zurück zur Religionspolitik?
biet, das durch die bayerische Besetzung nach 1623 umfassend rekatholisiert worden war. Als die katholische Neuburg-Linie die Kurwürde 1685 erbte, gab es bald Klagen von Protestanten über Benachteiligungen. Der brandenburgische Kurfürst Friedrich III. sah darin die Chance, einen Herrscher zu schwächen, mit dem er immer noch wegen der Folgen der gemeinsamen Ererbung und widerwilligen Teilung des Herzogtums Jülich-Kleve 1614 im Streit lag. 9 Unter französischer Besatzung gewannen die pfälzischen Katholiken 1688 bis 1697 weiter an Boden und in Artikel IV des Vertrags von Rijswijk setzte Frankreich die formelle Anerkennung aller neuen Rechte der Katholiken in rechtsrheinischen Territorien durch, die nun zurück ans Reich gingen. Die protestantischen Fürsten protestierten energisch gegen diesen vermeintlich klaren Bruch des Westfälischen Friedens. Die »Rijswijker Klausel« wurde zur Kampfparole der Protestanten. Sie gingen davon aus, dass sie ebenso wie der gesamte Vertrag mit dem Ausbruch des Spanischen Erbfolgekriegs nichtig war, und behaupteten später, sie hätten den Kaiser im Krieg nur aufgrund dieser Annahme unterstützt. Erzürnt mussten sie feststellen, dass der Kaiser ihre Aufhebung im Frieden von Baden 1714 nicht durchsetzen konnte. Dass der Heilige Stuhl, der den Westfälischen Frieden nach wie vor nicht anerkannte, bekanntermaßen für die Beibehaltung der Klausel gestritten hatte und Clemens XI. alle Bemühungen, den Katholizismus zu fördern, entschlossen unterstützte, verschlimmerte die Sache. 10 Was eine Annullierung der Klausel bewirkt hätte, ist nicht gänzlich klar. 1714 aber stand sie symbolisch für eine ganze Reihe regionaler und nationaler Streitpunkte. Der dritte Faktor entsprang regionalen Entwicklungen. Wieder an der Macht, hielt sich Kurfürst Johann Wilhelm von der Pfalz (1690–1716) nicht nur an die Rijswijker Klausel, sondern ging noch darüber hinaus und setzte katholische Glaubensrechte durch, wo immer es ging. Im Oktober 1698 dekretierte er, alle Kirchen auf seinem Gebiet sollten von den drei Konfessionen gemeinsam genutzt werden, sofern sie nicht laut dem Abkommen von Rijswijk Katholiken vorbehalten waren. Der Kurfürst von Brandenburg, der bereits 1694 den pfälzischen Calvinisten seinen Schutz offeriert hatte, versuchte wiederum zu vermitteln und drohte nach der erneuten Abfuhr mit Vergeltung an den Katholiken seiner eigenen Territorien Magdeburg, Minden und Halberstadt. 11 Diese wiederum appellierten an den pfälzischen Kurfürsten, sich mit Brandenburg zu einigen, und so wurde im November 1705 der Vertrag von Düsseldorf geschlossen, der das Simultaneum abschaffte, Religionsfreiheit für alle garantierte und die Verteilung der Kirchensteuer zwischen Calvinisten (fünf Siebtel) und Katholiken (zwei Siebtel) festlegte; die Lutheraner gingen leer aus. In den folgenden Jahren kam es zu erbitterten Kontroversen zwischen Lutheranern und Calvinisten, während der Kurfürst sein Versprechen von 1705, die calvinistische Universität Heidelberg unangetastet zu lassen, brach und systematisch jesuitische Professoren ernannte. 12
181
182
II. · Konsolidierung und Krise 1705–1740
Sein Beispiel ermutigte andere katholische Herrscher der Region. So erbte etwa der Erzbischof von Mainz, nachdem die örtliche Ritterdynastie 1704 ausgestorben war, die Stadt Kronberg, die Philipp von Hessen 1526 nach der Vertreibung von Hartmut XII. von Cronberg im Ritterkrieg reformiert hatte. 1541 ging die Stadt zurück an die (katholische) Familie, unter der Bedingung, dass sie protestantisch blieb. 1626 wurde der Katholizismus wiedereingeführt, da dies jedoch nach dem Normaljahr 1624 geschah, ordnete die Reichsdeputation die Rückkehr zum Protestantismus und die Beschränkung katholischer Gottesdienste auf die Burgkapelle an. Als der Erzbischof von Mainz sein Erbe antrat, begann er sofort, den Katholizismus zu fördern. 13 Nach dem Frieden von Baden verstärkte er seine Bemühungen und war insbesondere bestrebt, die Rijswijker Klausel in seinen Ländern und in den Fürstbistümern Worms und Speyer umzusetzen. 14 Die katholischen Herrscher behaupteten nun, Artikel 3 des Friedens von Baden sehe vor, sämtliche Kirchen an Orten, wo während der französischen Besatzung katholische Gottesdienste abgehalten wurden, allen drei Konfessionen zu öffnen. Praktisch bedeutete das die Einführung eines Simultaneums, das Katholiken an vielen Orten zugutekam, die dem Westfälischen Frieden gemäß bislang exklusiv calvinistisch oder lutherisch gewesen waren. 15 In der Häufung solcher Fälle, oft mit langwierigem juristischem Nachspiel, sahen viele Protestanten ein wachsendes und ernstes politisches und konstitutionelles Problem, was sich zum vierten Faktor für die Krise nach 1700 entwickelte. Die gesamte Ausrichtung der deutschen Politik erschien zunehmend ominös. Das imperiale Wiederaufleben im Allgemeinen, der wachsende Einfluss des Reichshofrats im Besonderen und die offenbar steigende Anzahl von Fürsten, die zum Katholizismus konvertierten, lieferten Indizien für eine massive, tiefgreifende katholische Gegenoffensive. 16 Der Protestantismus, so schien es, war im ganzen Reich bedroht und protestantische Herrscher setzten alle verfügbaren Mittel ein, um sich zu wehren. Immer häufiger legten sie beim Reichstag Beschwerde gegen Entscheidungen des Reichshofrats ein. 17 In praktisch jeder Art von Reichsinstitution, von den Kreisen aufwärts, bestanden sie zunehmend vehement auf konfessioneller Parität. Diskussionen auf regionaler Ebene, die mit Religion nichts zu tun hatten, erlangten plötzlich konfessionelle Bedeutung. 18 Das Corpus Evangelicorum im Reichstag verstärkte seine Aktivitäten und seine stellvertretenden Leiter Hannover und Brandenburg setzten sich über das moderate sächsische Direktorium hinweg. Eine Liste der religiös begründeten Klagen (Gravamina), die an die Reformationszeit erinnerte, wurde zusammengestellt und veröffentlicht. Die erste gedruckte Sammlung mit 432 Fällen erschien 1719 in Regensburg. 19 Wir schlecht das Verhältnis zwischen Protestanten und Katholiken war, zeigte sich daran, dass sie sich nicht einmal auf die Vorgaben für eine gemischte Kommis-
18. Zurück zur Religionspolitik?
sion einigen konnten, die 1699 zur Untersuchung der Klagen wegen der Rijswijker Klausel vorgeschlagen wurde. Nach sechs Jahren Gezerre zogen sich die Protestanten 1705 aus den Verhandlungen zurück. Immer deutlicher zeigte sich, dass beide Seiten sehr unterschiedliche Ansichten hatten, was ein religiöses Problem war. Die Protestanten meinten, so gut wie jedes Thema könne als konfessionell betrachtet werden, wenn es Individuen betraf, die protestantisch oder katholisch waren. Das wiederum hieß, dass sie zu jeder diskutierten Frage die Anwendung des konstitutionellen Prinzips der itio in partes fordern konnten, jener Klausel im Westfälischen Frieden (IPO Art V, § 52), die Mehrheitsentscheidungen über religiöse Belange untersagte und jeder Partei zusicherte, getrennt beraten zu können, bevor eine einvernehmliche Lösung gesucht wurde (amicabilis compositio). Die itio in partes bedeutete natürlich auch, dass eine Entscheidung ausbleiben konnte, was im Großen und Ganzen die protestantische Einstellung um 1700 war. Angedroht wurde die Itionsbefugnis oft, zur Anwendung kam sie erstmals 1712 beim Ersuchen des Abts von St. Gallen um Reichshilfe bei der Wiederbeschaffung von Land, das bei einem Aufstand in Toggenburg verloren gegangen war, den die Kantone Bern und Zürich unterstützt hatten. Dass geholfen werden sollte, stellte niemand infrage, aber die Protestanten bestanden darauf, dass jeder entsandten Kommission ein katholischer und ein protestantischer Fürst angehören mussten. Fünf Jahre später beantragte die Reichsstadt Köln, ihre Abgaben an das Reich zu reduzieren, weil sie sie nicht mehr bezahlen konnte. Die Katholiken stimmten zu, aber die Protestanten lehnten mit der Begründung ab, der katholische Stadtrat diskriminiere die calvinistischen Kölner Kaufleute. 20 In der Ausweitung der Problembereiche, bei denen konfessionelle Solidarität gefragt war, verhielten sich die Protestanten eher wie eine politische Partei als wie die lockere religiöse Verbindung, die das Corpus-System vorsah. Die treibenden Kräfte hinter der Radikalisierung der protestantischen Taktik waren in der Tat genau die alten Fürstenhäuser, die in den 1660er und 1670er Jahren den Kern der Opposition im Reich gebildet hatten. Insofern war die neue konfessionelle Opposition, die sich nach 1700 herausbildete, nur eine Neuauflage der antikaiserlichen Strömungen, die über einen Großteil des vergangenen Jahrhunderts die deutsche Freiheit verteidigt hatten. Nur waren sie nun unversöhnlicher als je zuvor seit dem Dreißigjährigen Krieg. Zudem brannten sie auf einen Kampf gegen die wiedererstarkte Habsburger-Monarchie. 1717 spitzte sich die Lage zu. Der Disput über die Kölner Abgaben geriet in die Sackgasse, als Karl VI. das Verhalten des protestantischen Corpus für verfassungswidrig erklärte. Nachdem die Restitution des bayerischen Kurfürsten wirksam wurde, verstrickten sich die Kurfürsten in eine Kontroverse über ihre Ehrenämter. 21 Besonders bitter war, dass sich dabei die Pfalz und Hannover wegen des Titels des Erzschatzmeisters in die Haare gerieten. Die Blamage des Verlusts stei-
183
184
II. · Konsolidierung und Krise 1705–1740
gerte den Hass Georgs I. auf den pfälzischen Kurfürsten; der Disput legte den Reichstag für zwei Jahre lahm. Der Reichshofrat verstärkte die Krise, indem er den protestantischen Landgrafen von Hessen-Kassel anwies, die Festung Rheinfels an den katholischen Landgrafen von Hessen-Rheinfels abzutreten, was das Corpus Evangelicorum als neuen Beweis seiner Parteilichkeit deutete. Als 1712 bekannt wurde, dass der Kronprinz von Sachsen heimlich zum Katholizismus konvertiert war und Maria Josefa, die ältere Tochter des verstorbenen Joseph I., heiraten wollte, war das Corpus noch irritierter, da viele seiner Mitglieder über die wahren Absichten des sächsischen Direktoriums zu spekulieren begannen. Im Oktober 1717 begingen Deutschlands Protestanten den zweihundertsten Jahrestag der Reformation mit trotzigen Erklärungen militanter Solidarität gegen die dunklen Mächte des Katholizismus. 22 Das Vorgehen des pfälzischen Kurfürsten gegen den Heidelberger Katechismus und die calvinistische Gemeinde der Heiliggeistkirche im April 1719 brachte das Fass zum Überlaufen. 23 Nur Wochen später versetzte die Zerstörung der katholischen kaiserlichen Residenzkapelle in Hamburg alle Regierungen in höchste Alarmbereitschaft. 24 Hannover und Brandenburg forderten eine sofortige Reaktion des Corpus Evangelicorum, sandten eine Liste mit Klagen nach Wien und stimmten überein, dass es höchste Zeit war, das sächsische Direktorium abzusetzen und selbst abwechselnd die Leitung zu übernehmen. Derweil setzten sie gemeinsam mit Hessen-Kassel ihre Drohung mit Vergeltungsmaßnahmen in die Tat um und verstießen damit klar gegen den Westfälischen Frieden, der den Griff zur Gewalt nur zuließ, wenn alle friedlichen Möglichkeiten erschöpft waren. Georg I. ließ die katholische Kirche in Celle schließen, Hessen-Kassel sämtliche katholischen Kirchen in der Grafschaft Katzenelnbogen. 25 Friedrich Wilhelm von Preußen verweigerte hierfür eine Abstellung von Truppen, ging dann jedoch selbst noch weiter: Er ließ die Mönche des Klosters Hamersleben im Fürstbistum Halberstadt und dreier weiterer Klöster von Grenadieren vertreiben und schloss die katholische Kathedrale in Minden. Eine schriftliche Maßregelung durch den Kaiser beantwortete Friedrich Wilhelm derart unverblümt, dass Prinz Eugen anmerkte: »Wenn ich Kaiser wäre, und der König von Preußen hätte nun einen solchen Brief geschrieben, würde ich ihm sicher den Krieg erklären, wenn er mir keine Genugtuung gäbe.« 26 Am 23. April 1723 informierte Eugen die Geheimkonferenz in Wien, man müsse entweder den Protestanten gestatten, die Gesetze nach Gutdünken zu diktieren, oder ihnen mit Waffengewalt entgegentreten. 27 Die Suppe wurde nicht so heiß gegessen wie gekocht. Der pfälzische Kurfürst gab die Kirche den Calvinisten zurück und verlegte seine Hauptstadt nach Mannheim. Hannover und Brandenburg-Preußen widerriefen ihre antikatholischen
18. Zurück zur Religionspolitik?
Maßnahmen. Dennoch blieb das Verhältnis der Konfessionen noch einige Jahre lang gespannt. 1724 sorgte die Hinrichtung von zehn Lutheranern nach antijesuitischen Unruhen in der polnischen Stadt Thorn für hitzige Diskussionen in den deutschen protestantischen Ständen. 28 Die Allianz zwischen Wien und Madrid 1725 weckte neue Befürchtungen einer katholischen Verschwörung. 29 1727 bestand das Corpus Evangelicorum im Streit um die Eigentumsrechte an Zwingenberg zwischen dem pfälzischen Kurfürsten und den Angehörigen des letzten Besitzers auf einer weiteren Itionsentscheidung. 30 Der Disput hatte mit Religion wirklich nichts zu tun: Der Besitz war 1634 annektiert worden, wogegen die mutmaßlichen Erben bereits seit 1651 prozessierten. 1725 entschied der Reichshofrat zu ihren Gunsten, der Kurfürst legte jedoch beim Reichstag Berufung ein. Die Katholiken wollten mit der Sache nichts zu tun haben, die Protestanten verfolgten sie wegen ihres Hasses auf den pfälzischen Herrscher. Nach einem Jahr Stillstand löste sich die Krise in Luft auf; 1728 ging Zwingenberg zurück an seine rechtmäßigen Eigentümer, die es 1746 an die Pfalz verkauften. Zum befürchteten Krieg kam es nicht, die Kluft war zu keiner Zeit unüberbrückbar. Im August 1716 stimmte der Reichstag geschlossen für die Finanzierung des Krieges gegen die Türken. Die Verhandlungen über den Unterhalt des Reichskammergerichts und der kaiserlichen Festungen am Rhein verliefen während der gesamten Phase von 1717 bis 1724 recht einvernehmlich. 31 Der Versuch der Gründung einer konfessionellen Partei blieb erfolglos. Hannover und Brandenburg sorgten mit ihrem Extremismus für Zwietracht und Unbehagen im Corpus Evangelicorum. Ende 1721 drängten viele kleinere protestantische Herrscher auf Frieden mit dem Kaiser, einen bewaffneten Konflikt wollten sie keinesfalls riskieren. Das wollten auch die Hauptbeteiligten nicht. Frankreich, das für die verhasste Klausel von Rijswijk verantwortlich war, bestand nicht mehr auf deren Anwendung, wenn es dadurch zu Konfessionsstreitigkeiten käme. 1723 wurde der französische Botschafter in Regensburg angewiesen, den Westfälischen Frieden zu unterstützen, um den habsburgischen Einfluss zu begrenzen. 32 Mit Walpoles Amtsantritt in London 1721 änderte sich Hannovers Politik. 33 Georg I. blieb militant, ebenso wie sein Vertreter in Regensburg bis 1726, Rudolf Johann von Wrisberg, der in den frühen 1720er Jahren zur Hassfigur in Wien wurde. 34 Von 1726 an setzte sich in London ein versöhnlicherer Tonfall durch. Dass Hannover und Brandenburg 1723 den Charlottenburger Vertrag zur gegenseitigen Verteidigung schlossen und 1725 der Allianz von Herrenhausen beitraten, war ein Beleg ihrer Solidarität aufgrund gemeinsamer politischer und konfessioneller Interessen. Allerdings versuchte Walpole zunehmend Abstand zwischen London und Hannover zu schaffen, was dessen Position im Reich neutralisierte oder vielmehr der traditionellen prokaiserlichen Politik, die ihm überhaupt erst
185
186
II. · Konsolidierung und Krise 1705–1740
die Kurwürde verschafft hatte, den Rücken zukehren ließ. Brandenburg war ab 1726 wieder mit Wien verbündet, wenn auch bis 1728 geheim. Und bei allen Unzulänglichkeiten der kaiserlichen Politik war Karl VI. doch sehr bewusst, dass konfessioneller Friede eine entscheidende Grundlage seiner Autorität im Reich war. Seine Funktion als oberster Richter und Vermittler bei Konflikten setzte voraus, dass Protestanten und Katholiken grundsätzlich gewillt waren, eine übergeordnete Macht zu akzeptieren. Außerdem brauchte er die Zustimmung des Reichs zur Pragmatischen Sanktion.
Anmerkungen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Feine, »Verfassungsentwicklung«, 108. Hughes, Law, 62; Erdmannsdörffer, Geschichte II, 377. Hughes, Law, 10. Feine, »Verfassungsentwicklung«, 109. Wilson, German Armies, 209. Ward, Awakening, 15–26. Haug-Moritz, »Parität«, 467. Haug-Moritz, Ständekonflikt, 159 f. Haug-Moritz, »Parität«, 468; vgl. auch Thompson, Britain, 61–96. Ward, Awakening, 17 f. Borgmann, Religionsstreit, 27. Erdmannsdörffer, Geschichte II, 380 f. Die Kampagne gipfelte im Abriss des Rathauses 1737 und der Errichtung einer katholischen Kirche neben der lutherischen; Mainz verpflichtete die Protestanten sogar dazu, die Kosten mitzutragen. Das Reichskammergericht untersagte das Projekt 1768, woraufhin die Kirche in ein Gästehaus umgewandelt wurde. Die Streitigkeiten setzten sich bis in die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts fort. Ward, Awakening, 19 f.; Ward nennt die Stadt »Cronenberg«, Kronberg (oder Cronberg) ist die üblichere Schreibweise. Daten zur Kirchenbauepisode liefert Sante, Handbuch, 279. Aretin, Altes Reich II, 272, 518. Ebd., 275. Das Problem des Simultaneums erörtert Schäfer, Simultaneum, 9–23. Vgl. zur politischen Bedeutung von Konversionen: Christ, »Fürst«; Schmidt, »Konversion«; Peper, Konversionen, 29–44. Haug-Moritz, »Parität«, 473. Vann, Swabian Kreis, 120–131; vgl. zu anderen Kreisen Luh, Reich, 70–79. Luh, Reich, 27 f.; zwei weitere große kommentierte Ausgaben folgten in den nächsten drei Jahren: Hoffmann, Gründliche Vorstellung, und Struve, Ausführliche Historie. Luh, Reich, 97, zu St. Gallen und Köln. Vgl. S. 95. Whaley, Toleration, 189–192. Details finden sich bei Schmidt, Karl Philipp, 114–149. Borgmann, Religionsstreit bietet einen gründlichen Abriss der Krise von 1719. Whaley, Toleration, 55–63. Borgmann, Religionsstreit, 55.
18. Zurück zur Religionspolitik?
26 27 28 29 30 31 32 33 34
Aretin, Altes Reich II, 281. Borgmann, Religionsstreit, 129. Weintraub, »Tolerance«; Whaley, Toleration, 64 f. Vgl. S. 165 f. Luh, Reich, 97 f.; Aretin, Altes Reich II, 298 f.; Marquardt, »Aberkennung«, 88; Köbler, Lexikon, 750. Luh, Reich, 106. Ward, Awakening, 28. Press, »Kurhannover«, 60 f. Borgmann, Religionsstreit, 23 f.
187
19. Das Problem der österreichischen Thronfolge
D
as Fehlen eines männlichen Erben belastete die Dynastie Habsburg schon lange bevor es zum politischen Problem wurde. 1 Im 1703 geschlossenen pactum mutuae successionis, dessen Bedingungen teilweise geheim blieben, vereinbarte Leopold I. mit seinen beiden Söhnen, dass Joseph Österreich und Karl Spanien erben sollte. Falls beide keinen männlichen Nachkommen und Joseph keinen dritten Sohn hätte, ginge das Erbe an weibliche Linien über, wobei Josephs Töchter bevorzugt werden sollten. Die drei Schwestern von Joseph und Karl waren von der Erbfolge ausgeschlossen, wovon ihre Mutter, die nach Josephs Tod bis zu Karls Rückkehr aus Spanien als Regentin herrschte, allerdings nichts wusste. Karl musste sich mit dem Thema befassen, weil die ungarischen Magnaten andeuteten, eine weibliche Thronfolge bedeute die Wiederherstellung ihres Wahlrechts, weil ihre Vereinbarung mit den Habsburgern auf dem verfassungsrechtlichen Status quo von 1687 beruhe, der eine Monarchin ausschloss. Zudem verlangte Josephs Witwe kurz vor dem Eintreffen von Karls Gattin Elisabeth Christine in Wien Auskunft über die zukünftige Stellung ihrer Töchter am Hof. Falls sie als Erbinnen anerkannt würden, sollten sie den Schwestern des Kaisers vorgezogen werden. Am 19. April 1713 bestimmte Karl per Dekret, dass seine weiblichen Erben bei Ausbleiben eines Sohnes Vorrang genossen. Vorläufig war dies alles hypothetisch, da Karl noch keine Kinder hatte. Ein im April 1716 geborener Sohn starb indes nach nur sieben Monaten und die Geburt zweier Töchter (Maria Theresia im Mai 1717, Maria Anna im September 1718) machte eine weibliche Thronfolge denkbar. Nach zähen Verhandlungen mit den Ständen der habsburgischen Länder stimmten diese zwischen 1720 und 1725 einer solchen Regelung zu. Als Maria Josepha den Kronprinzen von Sachsen-Polen, Friedrich August, heiratete, musste sie gemäß den Bedingungen der erstmals so genannten Pragmatischen Sanktion auf ihre Rechte verzichten. 2 1722 heiratete Maria Amalia Karl Albrecht von Bayern, und auch hier mussten Braut, Bräutigam und Kurfürst Max Emanuel allen Ansprüchen auf eine Thronfolge abschwören. Für die Bayern war das kein Problem, weil ihre eigenen möglichen Rechte auf den österreichischen Thron auf viel älteren Vereinbarungen beruhten. In mancher Hinsicht folgte die Pragmatische Sanktion einer Zeitströmung. Um 1700 suchten zahlreiche deutsche Herrscherhäuser das Bestehen ihrer Territorien zu sichern, indem sie Vereinbarungen zur Primogenitur trafen. 3 Dass diese vom
19. Das Problem der österreichischen Thronfolge
Reichshofrat anerkannt wurden, galt ebenfalls als entscheidend; tatsächlich hatte der Rat zu jener Zeit sehr viel mit der Schlichtung von Disputen zu tun, die auf derartige Vereinbarungen zurückgingen. 4 Im späten 16. Jahrhundert hatte die Aufteilung der Länder Ferdinands I. unter seine Söhne den Habsburgern geschadet. 5 Die Pragmatische Sanktion sollte eine weit schlimmere Zersplitterung bei Ausbleiben eines männlichen Erben vermeiden. Langfristig ließ diese Festigung der Einheit der habsburgischen Länder die Trennung zwischen den Interessen der Habsburgermonarchie und denen des Reichs deutlicher hervortreten, aber das war nicht ihr vorrangiger Zweck. Prinz Eugens viel zitierte Feststellung, Karl müsse seine »weitläufige und herrliche Monarchie zu einem totum machen«, scheint passend, wird aber gern aus ihrem Kontext gerissen. Tatsächlich wollte er damit den Kaiser im Januar 1726 überzeugen, wöchentliche gemeinsame Sitzungen der Geheimkonferenz und der Räte von Spanien und Flandern einzuführen, um den zur Finanzierung der Armee nötigen Einnahmefluss der verschiedenen Länder zu koordinieren. 6 In mancher Hinsicht indes unterschied sich der Fall Habsburg von anderen deutschen Dynastien. Erstens sah er eine Abweichung vom Prinzip der männlichen Thronfolge vor, die im Reich die Norm war. Eine weibliche Thronfolge war generell nur zulässig, wenn sie im ursprünglichen Lehensvertrag ausdrücklich niedergelegt war. Zweitens fielen Lehen, die wegen des Aussterbens einer männlichen Linie vakant wurden, üblicherweise ans Reich zurück oder gingen mit kaiserlicher Genehmigung an die nächstverwandte Dynastie. 7 Drittens wiesen viele im Reich darauf hin, wenn der Reichstag die Pragmatische Sanktion garantiere, gewährleiste er damit auch Vereinbarungen über Territorien außerhalb des Reichs, etwa Ungarn oder Sizilien. Hier kam die traditionelle Abneigung der deutschen Fürsten, zur Verteidigung habsburgischer Interessen jenseits der Reichsgrenzen herangezogen zu werden, ins Spiel. Und schließlich konnte die Reichstagsgarantie bedeuten, sich in der Frage der Nachfolge auf dem Kaiserthron von vornherein auf einen zukünftigen Gatten von Maria Theresia festzulegen – vorausgesetzt, er wäre Deutscher. Prinz Eugen mahnte, nur eine gut gefüllte Schatzkammer und ein starkes Heer könnten die Pragmatische Sanktion wirklich absichern. 8 Andere waren überzeugt, zur Vermeidung eines österreichischen Erbfolgekriegs wie in Spanien seien internationale Garantien nötig. Zudem brauchte Maria Theresia die ausdrückliche Garantie des Reichstags, um gegen alle Tradition und Sitte die österreichischen Länder halten zu können. Das war jedenfalls die Meinung der »österreichischen Partei« in Wien, die insbesondere der aufstrebende Johann Christoph Bartenstein vertrat, ab 1724 Kanzler, ab 1727 Sekretär der Geheimkonferenz und von 1733 an als Geheimer Rat für die gesamte Außenpolitik zuständig. 9 Als erster Garant wurde 1725 Spanien gewonnen, im Rahmen der vagen Abmachungen über die spanisch-österreichischen Heiratsprojekte. 1726 kam Russ-
189
190
II. · Konsolidierung und Krise 1705–1740
land dazu, dem Österreich zusagte, seine Expansionspläne im Südosten zu unterstützen. Die anderen Kandidaten warfen wesentlich mehr Probleme auf. 1726 kam ein geheimes Abkommen mit Brandenburg-Preußen zustande, 1728 sagte Friedrich Wilhelm I. offiziell zu, die Pragmatische Sanktion im Reichstag zu unterstützen und seine Stimme bei der nächsten Kaiserwahl Maria Theresias künftigem Gatten zu geben. Er zog die Habsburger auf dem Kaiserthron allen anderen Möglichkeiten vor: Eine Wahl des sächsischen oder bayerischen Kurfürsten hätte Brandenburgs Stellung im Norden gefährdet. Auch ein großer internationaler Krieg würde Brandenburg bedrohen, ebenso wie die Akquisition wichtiger habsburgischer Territorien durch Sachsen-Polen und irgendeine Erhebung in eine Position wie Hannover-Großbritannien. Eigennutz, nicht Patriotismus machte den preußischen König zum Habsburg-Loyalisten. Im Gegenzug verpflichtete sich Karl VI., Brandenburgs Ansprüche auf die Erbfolge in Jülich-Berg zu unterstützen. Dieses für Brandenburg und die Pfalz enorm wichtige Problem zeigt die Schwierigkeiten und Gefahren, die das Erlöschen einer männlichen Linie mit sich brachte. 10 Es ging zurück auf die gegenseitige Erbfolgeklausel in dem 1666 zwischen beiden Herrscherhäusern geschlossenen Abkommen über die Regierung von Jülich-Kleve-Berg, das sie gemeinsam geerbt und 1614 geteilt hatten. Da der Große Kurfürst zwei Töchter und sechs Söhne hatte und der pfälzische Kurfürst sechs Söhne und sechs Töchter zurückließ, schien unvorstellbar, dass die Klausel je relevant werden würde. Als jedoch Karl Philipp (* 1661, † 1742) 1716 seinem Bruder Johann Wilhelm auf den Thron folgte, war er praktisch der letzte überlebende männliche Neuburg, da seine beiden Brüder Bischöfe waren (Franz Ludwig in Trier und später Mainz, Alexander Sigismund in Augsburg), was bedeutete, dass das Kurfürstentum und andere Länder auf die verwandte Sulzbach-Linie übergehen würden, mit deren Thronfolger er seine Tochter verheiratet hatte. 1733 waren jedoch sie, ihr Gatte und dessen jüngerer Bruder tot und Pfälzer Thronfolger war nun der neunjährige Karl-Theodor von Pfalz-Sulzbach. Aus pfälzischer Sicht sprach für Karl Theodors Anspruch auf Jülich-Berg, dass auch er von Anna von Neuburg abstammte, einer der vier weiblichen Erben von Jülich-Kleve nach dem Tod von Johann Wilhelm von Jülich-Kleve 1609. Gegen Karl Philipps zahlreiche Versuche, Jülich-Berg zu halten, führte Brandenburg ins Feld, der Vertrag von 1666 sehe eine gegenseitige Erbfolge der zwei Hauptlinien vor und erwähne verwandte Dynastien nicht. Ob Karl VI. je ernsthaft vorhatte, die preußischen Ansprüche auf dieses überwiegend katholische Territorium zu begünstigen, ist eine andere Frage. Schon im Sommer 1732 wurde Friedrich Wilhelm erklärt, der Kaiser werde doch keine Übereinkunft bezüglich Jülich-Berg vermitteln. Dass er in dieser Hinsicht gar nichts unternahm, führte letztlich dazu, dass Berlin 1739 mit Frankreich ein Abkommen schloss und Friedrich der Große sich nach seiner Thronbesteigung 1740 gegen
19. Das Problem der österreichischen Thronfolge
Österreich wandte. 1728 jedoch sicherte sich der Kaiser mit seinem Versprechen die unschätzbare Hilfe des preußischen Königs für seine eigenen Erbfolgepläne. Bei Hannover-Großbritannien stand mehr zur Verhandlung. London betrachtete nicht nur die Ostender Kompanie als Bedrohung seines Handels. Der Kaiser machte Ausflüchte, was die Versprechen gegenüber Spanien von 1725 betraf, und erlaubte aufgrund der Vereinbarungen mit dem Reichstag von 1722 nach wie vor keine spanischen Garnisonen auf Reichsterritorium in Parma und der Toskana. Folglich sah er sich mit dem Vertrag von Sevilla vom 9. November 1729 mit einer feindlichen Liga aus Großbritannien, Spanien, Frankreich und den Niederlanden konfrontiert. 11 1731 erklärte sich Wien bereit, den von London verlangten Preis zu bezahlen. Die Ostender Kompanie wurde aufgelöst und, noch schmerzlicher, Karl gestattete die spanischen Garnisonen. Dafür garantierte Großbritannien die Pragmatische Sanktion; die Niederlande und Dänemark schlossen sich an. Das Abkommen mit dem Reichstag, der erste Vertrag zwischen dem Reich und den Habsburgern überhaupt, trat mit der kaiserlichen Bestätigung am 3. Februar 1732 in Kraft. Für die Opposition, um deren Vergrößerung sich Bayern sehr bemühte, bedeutete das eine Niederlage. 1724 hatte Max Emanuel die Wittelsbacher Hausunion mit den Kurfürsten der Pfalz, von Trier und Köln ausgehandelt. 12 Ein Ziel war, den Disput zwischen Bayern und der Pfalz beizulegen, wer im Fall eines Interregnums als Vikar das südliche Reich vertreten sollte; man einigte sich auf eine gemeinsame Administration. Darüber hinaus ging es um die Gründung einer katholischen Liga im Reich, um dem Corpus Evangelicorum entgegenzutreten. Die Vertragspartner vereinbarten gegenseitigen Schutz, koordinierte Kontakte zum Reichstag sowie zu anderen Körperschaften und die gemeinsame Verteidigung der Vorrechte aller Kurfürsten. Ausgeschlossen blieben protestantische Linien des Hauses, allerdings unterschrieben neben den vier Kurfürsten auch die wittelsbachischen Bischöfe von Regensburg und Augsburg. Eine Ausweitung der Union verhinderte die vorherrschende Rolle der prohabsburgischen Schönborn-Dynastie in der Reichskirche der 1720er Jahre. Angesichts der geringen Unterstützung im Reich und des Misstrauens von Wien blieb Bayern und der Pfalz keine andere Wahl, als erneut zu versuchen, sich mit Frankreich zu verständigen, und zumindest die interne Solidarität zu wahren. Franz-Ludwig von Pfalz-Neuburg unterstützte jedoch nach seiner Versetzung von Trier nach Mainz 1729 die Pragmatische Sanktion. 13 Und obwohl die Hausunion 1728 erneuert wurde, litt ihr Zusammenhalt darunter, dass Karl Philipp von der Pfalz grundsätzlich kaisertreu und mehr als alles andere von der Frage der Erbfolge in Jülich-Berg besessen war. 14 Bayern weigerte sich, die Pragmatische Sanktion mitzutragen, die Pfalz ebenso, obwohl Karl Philipps Forderung – die Verleihung eines Fürstentitels an seine morganatische dritte Frau (offiziell seine »Mätresse«), die Gräfin Violanta von
191
192
II. · Konsolidierung und Krise 1705–1740
Thurn und Taxis – 1733 erfüllt wurde. 15 Auch Sachsen protestierte gegen die Reichstagsentscheidung, aber die Unterstützung von Brandenburg und Hannover gab den Ausschlag. In deutlichem Kontrast zu ihrer Taktik bezüglich des Religionsstreits in der Pfalz 1719 bemühten sich Berlin und Hannover nun sehr, zu verhindern, dass ein weiteres und womöglich ernsteres konfessionelles Problem der Pragmatischen Sanktion im Weg stand. Die Nachricht, dass der Salzburger Erzbischof beschlossen hatte, seine protestantischen Untertanen des Territoriums zu verweisen, erreichte den Reichstag wenige Wochen nach der ersten Diskussion der Sanktion im Oktober 1731. 16 Obwohl sein Handeln grundsätzlich vom Westfälischen Frieden gedeckt war, sorgte die Ausweisung von etwa zwanzigtausend Einwohnern für außerordentliches Aufsehen. Unter Protestanten herrschte Empörung, aber Brandenburg und Hannover gelang es, die Krise zu bewältigen, indem Brandenburg selbst die meisten der Flüchtlinge aufnahm. Natürlich profitierte der preußische König wirtschaftlich von diesem Zustrom an Bevölkerung, die größtenteils auf kaum oder gar nicht besiedeltem Land in Brandenburg und Ostpreußen angesiedelt wurde. Aber das Tempo, mit dem die beiden führenden protestantischen Regierungen die Krise entschärften, verdankte sich ihrer Entschlossenheit, die Tauglichkeit des neuen Einverständnisses mit Wien unter Beweis zu stellen. Die Reichstagsresolution selbst betonte, wie wichtig die dauerhafte Einheit der habsburgischen Länder für die Sicherheit des Reichs insgesamt sei. 17
Anmerkungen 1 Rill, Karl VI., 177–187; Klueting, Reich, 120 ff.; Kunisch, Staatsverfassung, 41–62; Kunisch, »Hausgesetzgebung«, 50–70; Schulze, »Hausgesetzgebung«, 267–270. 2 Der Begriff sanctio pragmatica bedeutet schlicht »sachkundig geprüfte Verordnung«. Römische Kaiser der Spätantike verwendeten ihn für feierliche Gesetzgebungsakte; in ähnlicher Bedeutung war er ab dem späten Mittelalter gebräuchlich (so wurde etwa der Osnabrücker Vertrag von 1648 als pragmatica imperii sanctio bezeichnet). 3 Neuhaus, »Chronologie«, 388 f. 4 Westphal, Rechtsprechung, 88–96. Eine diesbezügliche Analyse zu den niederrheinischen und westfälischen Grafen findet sich bei Arndt, Reichsgrafenkollegium, 208–217. 5 Fichtner, Protestantism, 48 f. 6 Braubach, Prinz Eugen IV, 116, sowie V, 212 f. 7 Conrad, Rechtsgeschichte II, 238–241. 8 Hochedlinger, Wars, 207 f.; interessanterweise sah Prinz Eugen sich selbst für einen zu sehr »Fremden«, um sich zur Pragmatischen Sanktion zu äußern; vgl. Braubach, Prinz Eugen V, 212. 9 Ebd., 204–208; Klueting, Reich, 121 f.; Aretin, Altes Reich II, 333 ff. 10 Schmidt, Karl Philipp, 155–159.
19. Das Problem der österreichischen Thronfolge
11 12 13 14 15 16
Auer, »Vertrag von Sevilla«, 64 f. Aretin, Altes Reich II, 317–325. BWDG I, 729 f.; ADB VII, 307 f. Schmidt, Karl Philipp, 155, 161. Schmidt, Karl Philipp, 221 ff.; Violanta von Thurn und Taxis starb im April 1734. Walker, Salzburg Transaction, 107–143; Aretin, Altes Reich II, 330 f.; Leeb, »Emigration«; vgl zu Großbritanniens Rolle Thompson, Britain, 133–167. 17 Kunisch, Staatsverfassung, 56 f.
193
20. Schwindende Kaisermacht? (1733–1740)
D
ie Garantie des Reichs für die Pragmatische Sanktion markierte den Höhepunkt der kaiserlichen Macht Karls VI. In den folgenden Jahren wurde über weitere Garantien verhandelt. 1733 sagte Friedrich August von Sachsen seine Unterstützung zu, wofür ihm der Kaiser Rückendeckung für seinen eigenen Wunsch versprach, seinem am 1. Februar verstorbenen Vater auf den Königsthron von Polen nachzufolgen. 1738 schloss sich auch Frankreich an. Nur Bayern und die Pfalz blieben ausweichend. Ende 1732 brach die Korrespondenz mit Karl Philipp in Mannheim ab. Karl Albrecht von Bayern versuchte Wien 1734 mit dem Vorschlag zu locken, die siebzehnjährige Maria Theresia solle seinen achtjährigen Sohn Maximilian heiraten. Selbst unter den oft ungewöhnlichen Umständen dynastischer Heiraten war dieses Angebot bizarr und trug nichts dazu bei, den Eindruck zu vertreiben, Bayern sei grundsätzlich nicht vertrauenswürdig. 1 1732 war die Pragmatische Sanktion durch Garantien so gut abgesichert, dass die wankelmütigen Wittelsbacher kaum noch eine Rolle spielten. Wichtig war nur die Zustimmung Frankreichs. Dass sie als Teil des Wiener Friedens nach dem polnischen Erbfolgekrieg erreicht werden konnte, unterstreicht deutlich die grundsätzlichen Fehler der Politik, die Österreich mehr als ein Jahrzehnt lang so vehement betrieben hatte. Die Entwicklungen nach 1733 zeigten auch, dass Prinz Eugen mit seiner Ansicht, üppige Geldmittel und eine gute Armee seien mehr wert als Versprechen auf Papier, nicht falsch gelegen hatte. So wichtig die Garantien auch waren, letztlich waren sie ohne das zu ihrer Sicherung notwendige Kapital wenig wert. Die neue Machtposition des Kaisers war nicht von Dauer. Der Wiener Vertrag von 1731 zwischen Österreich und Großbritannien markierte zwar die Rückkehr zum »alten System« einer Allianz zwischen Österreich und den Seemächten, brachte aber keine Stabilität. Frankreich, das durch den Vertrag isoliert worden war, verfolgte den Fortgang der Heiratspläne zwischen Maria Theresia und Franz Stephan von Lothringen, der 1729 Herzog wurde, zunehmend beunruhigt. 2 Damit hätte sich die französische Hoffnung auf dauerhafte Übernahme dieser Gebiete zerschlagen. Lothringen war praktisch eine Enklave auf französischem Gebiet und seine Vereinigung mit Österreich hätte eine starke habsburgische Präsenz an der Westgrenze des Reichs geschaffen, die Frankreich bedrohte. Im Lauf des Jahres 1731 kam der französische Premierminister Kardinal Fleury zu der Überzeugung, dass die Gefahr nur durch einen Krieg gegen Österreich abzuwenden war. Bis
20. Schwindende Kaisermacht? (1733–1740)
1732 wurde die Strategie entworfen, Spaniens Begehren nach Neapel und Sizilien zu unterstützen, in der Hoffnung, Lothringen werde im Rahmen einer umfassenden territorialen Neuordnung an Frankreich fallen. Den Vorwand für einen Konflikt lieferte die Krise in Polen nach dem Tod Augusts des Starken im Februar 1733. In den 1720er Jahren bildeten Russland, Österreich und Polen eine Art Schutzgemeinschaft für das polnische Königreich, die im Dezember 1732 in der Entente cordiale der drei Schwarzen Adler gipfelte. 3 Anfangs waren sie unwillig, den Königssohn Friedrich August zu unterstützen, Preußen wollte vor allem die Verbindung zwischen Sachsen und Polen kappen. Bald wurde indes klar, dass ihr bevorzugter Kandidat Prinz Emanuel von Portugal nicht wählbar war, und so wurde zu Preußens Verdruss doch der Sachse vorgeschlagen. Gleichzeitig warb Frankreich, das seit dem späten 16. Jahrhundert »freie« Wahlen in Polen befürwortete, für seinen eigenen Kandidaten Stanislaus Leszczynski, der von 1704 bis 1709 König gewesen und während seines anschließenden Exils in Frankreich der Schwiegervater Ludwigs XV. geworden war. Heimlich aus Frankreich angereist, lieferte Leszczynski am 8. September einen dramatischen Auftritt in Warschau, bei dem er nicht europäische Kleidung, sondern einen polnischen Kaftan trug. Eine Woche darauf wurde er von 13.000 versammelten Adligen zum König ausgerufen. Dies führte zum sofortigen Eingreifen russischer Streitkräfte, die eine zweite Wahl am 5. Oktober erzwangen, in der lediglich 1.000 polnische Adlige Friedrich August von Sachsen als August II. akklamierten. Der Krieg war schnell vorbei: Die russischen Truppen besetzten den größten Teil Polens im Namen von August, Frankreich entsandte eine Abteilung zur Verteidigung Danzigs, wo Stanislaus kurz als König regierte. Bald jedoch war er wieder im französischen Exil. Frankreich machte wenig Anstalten, Polen zu halten, sondern konzentrierte sich auf den Rhein und Italien, die wahren Objekte seiner Interessen. Da es angekündigt hatte, keine Militäroperation in Polen zu dulden, erklärte es im Oktober dem Kaiser den Krieg, eroberte Lothringen und nahm die Festung Kehl am Rhein. Zugleich griffen französische, spanische und sardische Truppen Stellungen der Habsburger in Italien an. Wien wartete vergeblich auf die erhoffte britische und niederländische Hilfe – beide boten an, zu vermitteln, aber nicht zu kämpfen – und so mussten die Österreicher auf ihre beschränkten eigenen Mittel vertrauen. In Italien unterschätzten sie die Bedrohung total; ihre Verteidigung im Norden brach schnell zusammen und binnen Jahresfrist hatte Spanien Neapel und Sizilien erobert. Die Abwehr im Westen war wirkungsvoller. Die Assoziation der Vorderen Kreise war im Herbst 1733 mobilisiert. Im April 1734 erklärte der Reichstag Frankreich den Krieg. Unter den bilateralen Abkommen zwischen Wien und den deutschen Höfen wurden etwa 50.000 Mann ausgehoben, weitere 35.000 bildeten die Reichsarmee der Kreise. 4 Behindert wurden die Kriegsanstrengungen durch die
195
196
II. · Konsolidierung und Krise 1705–1740
Verweigerung der Unterstützung durch Bayern, die Pfalz und Köln. Prinz Eugens Bewegungen an der Rheinfront 1734 litten an der Furcht vor dem bayerischen Feind im Rücken, obwohl die bayerische Armee nicht in der Lage war, große Schwierigkeiten zu machen. Rein defensiv war die Verteidigung des Rheins im Ganzen erfolgreich. Die Franzosen durchbrachen die deutschen Linien nur einmal ernsthaft, und obwohl Frankreich Kehl und Philippsburg besetzt hielt, gelangen den deutschen Streitkräften einige beeindruckende Vorstöße. Da sich Frankreich zum Großteil auf Italien konzentrierte, war auch ihr Feldzug an der Reichsgrenze überwiegend defensiv. 5 Das verspätete Eintreffen unter dem österreichisch-russischen Beistandspakt von 1726 widerwillig abgestellter russischer Truppen in Schwaben sorgte für die Entscheidung, aber Deutschland blieb ein Nebenschauplatz. 6 Wichtiger war, dass im Herbst 1735 in Italien nur noch die Festung Mantua in österreichischer Hand blieb und die hoffnungslos unterlegene kaiserliche Armee nordwärts ins Trentino zurückweichen musste. 7 Die russische Bedrohung Frankreichs und die französisch-spanisch-sardische Bedrohung der Habsburger zwang beide Seiten an den Verhandlungstisch. Das Ergebnis war der Wiener Vorfrieden vom 3. Oktober 1735. Österreich trat Neapel, Sizilien und die strategisch wichtigen Häfen des toskanischen Stato dei Presidi an den spanischen Thronfolger Karl ab, die Lombardei fiel wieder an Wien, wobei zwei Provinzen – Novara und Tortona – an Sardinien gingen. Dazu erhielt Österreich Parma und Piacenza, das Erbfolgerecht in der Toskana wurde jedoch von Karl auf Franz Stephan von Lothringen übertragen. Er musste dafür sein Herzogtum (ohne das Stimmrecht im Reichstag) Stanislaus Leszczynski überlassen, der dazu Metz, Toul, Verdun und das Herzogtum Bar bekam. Nach seinem Tod sollten alle seine Ländereien an den französischen König fallen. 8 Friedrich August wurde als polnischer König August II. bestätigt, Stanislaus durfte jedoch den Titel »König von Polen und Herzog von Litauen« behalten. Frankreich schließlich gab Kehl und Philippsburg an das Reich zurück und bestätigte die Pragmatische Sanktion. Die schwersten Folgen hatte dieser Friede in Italien. Die Habsburger hatten es nicht geschafft, die Spanier aus dem Land fernzuhalten; ihre dramatischen Verluste wurden indes durch die Festigung der Herrschaft über Norditalien aufgewogen. Langfristig war ein habsburgischer Block von größerem Nutzen als ein Haufen verstreuter Territorien, getrennt durch den Kirchenstaat. Die Konsequenzen für das Reich waren weniger tiefgreifend. Lothringen war verloren, aber hier hatten seit 1648 sowieso meist die Franzosen geherrscht, und sein Verhältnis zum Reich war schon seit dem 15. Jahrhundert zwiespältig. Ob das Reich durch die offizielle Abtretung angreifbarer wurde, ist zweifelhaft. Sicherlich gab es nun keine Hoffnung auf eine wirksame linksrheinische militärische Barriere gegen Frank-
20. Schwindende Kaisermacht? (1733–1740)
reich mehr. In dieser Hinsicht fühlten sich Angehörige der Vorderen Kreise, die immer noch an das Barrierensystem aus der Zeit vor 1715 glaubten, erneut verraten. Aber das von französischen Territorien förmlich umzingelte Lothringen war selbst höchst verwundbar. Die rechtsrheinischen deutschen Verteidigungslinien, in den letzten fünfzig Jahren unter immensen Kosten errichtet, erwiesen sich hingegen als weitgehend wirksam und hinderten Frankreich, so verheerende Schäden auf deutschem Gebiet anzurichten wie in allen vorangegangenen Kriegen. 9 Zu einem Wiederaufleben der antifranzösischen Propaganda der Vergangenheit führte der Konflikt offenbar nicht. Frankreich dominierte die Friedensverhandlungen und die folgenden Jahre, hatte aber seine Ambitionen mit der Akquisition von Lothringen befriedigt, die die Basis für eine Phase der Normalität und Stabilität an der französisch-deutschen Grenze zu bilden schien. 10 Die deutschen Protestanten allerdings waren irritiert, weil die Bedingung ihrer Teilnahme am Krieg gewesen war, dass der Kaiser das Problem der Rijswijker Klausel löse, und er das Thema nicht einmal angeschnitten hatte. Das war in den 1730er Jahren aber von kaum mehr als symbolischer Bedeutung; das angeblich unter ihrem Schutz begangene Unrecht lag Jahrzehnte zurück und ließ sich nicht mehr gutmachen. Dennoch schwelte das Problem weiter. 1738 protestierte das Corpus Evangelicorum gegen die endgültige Fassung des Friedensvertrags. Als er im März 1740 dem Reichstag vorgelegt wurde, weigerten sich die Protestanten, zu unterschreiben. Da Karl VI. am 20. Oktober 1740 starb, wurde das Abkommen nie ratifiziert. 11 Verschlimmert wurden die Probleme des Kaisers durch eine Folge katastrophaler Ereignisse im Osten. Da die Russen Truppen nach Schwaben entsandt hatten, konnte er ihre Bitte um Beistand gegen den Sultan nicht abschlagen. Dieser hatte 1735 einen Invasionsversuch auf der Krim zurückgeschlagen und Russland im Mai 1736 den Krieg erklärt. Die habsburgischen finanziellen wie militärischen Mittel erwiesen sich jedoch als deutlich zu gering. Der Reichstag gewährte Beihilfe in Höhe von 50 Römermonaten (etwa 3 Millionen Gulden); bilaterale Abkommen verstärkten die Streitkräfte und die kaiserliche Regierung nutzte ihr Recht, im ganzen Reich Soldaten zu rekrutieren. So kam eine Streitmacht von etwa 30 Prozent der in Ungarn stationierten Truppen zusammen. 12 Letztlich jedoch war der Kaiser nicht in der Lage, die politischen und finanziellen Schulden, die er sich dadurch auflud, zu begleichen. Das Reich trug wesentlich zum Türkenkrieg von 1736–1739 bei, aber der Konflikt entfachte nicht die patriotische Begeisterung zurückliegender Feldzüge. 13 Wie viel von dem Geld, das der Reichstag zugesagt hatte, tatsächlich bezahlt wurde, ist nicht bekannt, aber selbst einige loyale Fürstbischöfe der Schönborn-Dynastie hielten diesen Krieg für eine rein habsburgische Angelegenheit, die nichts mit dem Reich zu tun hatte. Meldungen von österreichischen Niederlagen ver-
197
198
II. · Konsolidierung und Krise 1705–1740
stärkten die verhaltene Einstellung der deutschen Fürsten: Glorreiche Siege waren diesmal nicht zu feiern. 14 Als der Trierer Kurfürst Franz Georg von Schönborn von der Panik der Wiener Bevölkerung vor einem neuen türkischen Angriff erfuhr, fiel ihm dazu nur ein, das geschehe dem Kaiser recht, nachdem er das Reich im Polnischen Erbfolgekrieg im Stich gelassen habe.15 Was war schiefgelaufen? Prinz Eugen, der wichtigste österreichische Militärkommandeur, war 1736 gestorben und es fand sich kein angemessener Nachfolger. Vor allem aber waren den Österreichern die türkischen Militär- und Verwaltungsreformen seit 1718 verborgen geblieben. 16 Ihre eigenen finanziellen und militärischen Mittel hatten sich verschlechtert, die des Sultans verbessert. 1738 war Österreich bereit, französische Vermittlung zu akzeptieren, und schloss im Jahr darauf einen Separatfrieden mit den Türken, der deren Eroberungen in Nordserbien und der Kleinen Wallachei bestätigte. Die Serie von taktischen Fehlern der Militärführung verschlimmerte der österreichische Chefunterhändler Graf Neipperg, indem er es fertigbrachte, Österreich zu verpflichten, die praktisch unbezwingbaren Festungen von Belgrad und abac zu schleifen, für deren Erhalt er um jeden Preis sorgen sollte. Ein Großteil der Gewinne von 1718 war damit verloren. In Wien lastete man die Niederlage den Generalen an und – eher zu Recht – Neipperg den Verlust von Belgrad. Dass die Kommandeure verhaftet und vor Gericht gestellt wurden, konnte jedoch nicht über die tieferen Probleme der Habsburger und ihrer übergroßen, aber unterversorgten Gebiete hinwegtäuschen. Selbst Prinz Eugen wäre es Ende der 1730er Jahre schwergefallen, das Blatt der unausweichlichen Niederlage zu wenden. Die Folge von Rückschlägen seit 1733 trübte das Ansehen Karls VI. und ließ seine Autorität bröckeln. Die traditionelle Sichtweise, nur die Habsburger könnten das Reich gegen seine Feinde verteidigen, war untergraben. Der Niedergang der Reichskanzlei nach dem Rücktritt Friedrich Karl von Schönborns 1734 trug dazu bei. Schlimmer noch war jedoch der Zynismus, mit dem Wien Abkommen traf und Versprechungen machte, um sie gleich darauf zu widerrufen. Die Pfalz und Brandenburg-Preußen erhielten bezüglich der Erbfolge in Jülich-Berg so viele widersprüchliche Zusicherungen, dass der Kaiser 1739 einen Geheimvertrag mit Frankreich einging, in dem beide Parteien vereinbarten, Pfalz-Sulzbach solle für zwei Jahre die Besitzrechte erhalten, während der Reichshofrat die Rechtslage klärte. 17 Es ist typisch für die Treibsanddiplomatie jener Jahre, die mit Finten, doppeltem Spiel, Zusicherung und Rückversicherung die gesamte europäische Politik prägte, dass Fleury umgehend einen weiteren Geheimvertrag mit Brandenburg abschloss, in dem er ihm Berg und ein kleines Stück Land (»une lisière«) am Rhein garantierte. War Karl VI. am Ende? Hätte die Kontinuität der habsburgischen Thronfolge im Reich bewahrt werden können, wenn er zehn Jahre länger gelebt hätte? Sein plötzlicher Tod im Alter von fünfundfünfzig Jahren am 20. Oktober 1740 und das
20. Schwindende Kaisermacht? (1733–1740)
militärische Desaster, das dem preußischen Angriff auf Schlesien am 16. Dezember folgte, waren klare Vorboten einer tiefen Krise der Dynastie und hatten umfassende Folgen für Deutschland. Aber dies war auf keinen Fall der Anfang vom Ende des Reichs. Ein längeres Leben und ein männlicher Nachkomme hätten dem Gewicht der habsburgischen Tradition im Reich weiterhin die gewohnte Geltung verschafft. Tatsächlich kam es 1745 mit der Wahl von Karls Schwiegersohn und Maria Theresias Gatten Franz Stephan von Lothringen zum Kaiser Franz I. genau so. Einstweilen jedoch führte die Entschlossenheit der Kritiker Österreichs, die Pragmatische Sanktion infrage zu stellen, zu einer kurzen Phase nichthabsburgischer Herrschaft, die das Reich, das Franz Stephan regieren sollte, grundlegend veränderte. Nicht wenige sahen in der Thronfolgekrise von 1740 die Chance zu Reform und Erneuerung.
Anmerkungen 1 2 3 4 5 6 7 8
9
10 11 12 13 14 15 16 17
Aretin, Altes Reich II, 341. Ebd., 335; Hochedlinger, Wars, 208. Stone, Polish-Lithuanian State, 259 ff. Wilson, German Armies, 227–231. Ebd., 233 f. Ebd., 225, 232. Hochedlinger, Wars, 211. Die Hochzeit von Maria Theresia und Franz Stephan fand im Februar 1736 statt, der Gebietstausch nach dem Tod des toskanischen Großherzogs Gian Gastone de’Medici im Juli 1737. 1765 wurde die Toskana habsburgische Sekundogenitur. In Lothringen übertrug Stanislaus Verwaltung und Einkünfte 1738 an die französische Krone, konnte jedoch dank einer üppigen Pension in Nancy und Lunéville eine ausgiebige Bautätigkeit entfalten; nach seinem Tod im Februar 1766 fiel das Territorium an Frankreich. Vgl. Köbler, Lexikon, 392, 717. Wilson, German Armies, 55 f., 210–214, liefert die beste Analyse deutscher Verteidigungslinien, greift aber in der Einschätzung des Verlusts von Lothringen als schwerer Schlag (ebd., 233) eher auf die Sichtweise deutscher nationalistischer Historiker vor 1945 zurück, als die geopolitischen Gegebenheiten des 18. Jahrhunderts zu reflektieren. Vgl. für eine ältere Darstellung Just, »Lothringen«. Wrede, Reich, 489–494. Erdmannsdörffer, Geschichte II, 458 f.; vgl. auch S. 179–185. Wilson, German Armies, 236 f. Wrede, Reich, 193–200. Vocelka, Glanz, 159–162; Ingrao, Monarchy, 147 ff.; Hochedlinger, Wars, 212–218. Aretin, Altes Reich II, 347. Hochedlinger, Wars, 212–217; Wilson, German Armies, 239 f. Aretin, Altes Reich II, 349.
199
21. Das Reich in der Publizistik
K
arl VI. ließ seine Vorstellung des Reichs in Architektur umsetzen. 1 An deutschen Universitäten und in Kanzleien definierten und beschrieben andere sie in Publikationen, die während seiner Herrschaft eine neue Qualität erlangten und die weitere Evolution des öffentlichen Rechts ebenso widerspiegelten wie die Entwicklungen seit 1648. Tatsächlich wirkte der anhaltende Boom der Druckkultur in Recht und Politik schon für sich stabilisierend auf das politische System. Eine Schlüsselrolle kam den Universitäten zu. 2 In erster Linie waren sie natürlich territoriale Institutionen zur Schulung des Verwaltungspersonals ihrer Schutzherren. Der Bedarf an juristisch gebildeten Beamten war so hoch wie nie nach 1648, da praktisch jeder Aspekt des territorialen Lebens in Gesetze verstrickt war, von den Erbregelungen des Herrscherhauses bis zum konfessionellen Status des Landes in Bezug auf den Frieden von 1648. Aber die Universitäten arbeiteten auch unter imperialen Satzungen, was sie zu Teilen eines Systems machte, das eng mit den Reichsinstitutionen verwoben war. Ihre juristischen Fakultäten bildeten nicht nur Beamte aus, sondern äußerten sich auch zu politischen Themen. Sie gestalteten die Innenpolitik, berieten die territorialen Vertreter beim Reichstag in Regensburg, bereiteten Verfahren an den Reichsgerichten vor, die wiederum bei Prozessen häufig Universitätsprofessoren zurate zogen. Manche Akademiker verlegten sich auf akademische Karrieren. 3 Viele indes wechselten zwischen universitären Posten und Anstellungen als Kanzler, Botschafter, Syndikus und Richter, oft in mehreren Territorien, sowie solchen in Diensten der Reichsregierung und kaiserlicher Gerichte. Dabei verbanden viele zwei oder mehrere Aufgaben gleichzeitig. Im Krieg der Worte und Papiere, der Dispute auf allen Ebenen des Reichs begleitete, spielten Universitätsprofessoren eine Schlüsselrolle. So wurden Akademiker unweigerlich ins tagespolitische Geschäft verwickelt und das Studium der Rechte war ein hochpolitisches Fach. Der große juristische Kommentator der Zeit nach 1750, Johann Stephan Pütter, drückte das so aus: Wenn jemand römisches Recht studiert, ist es egal, wann ein bestimmter Autor gelebt hat. Studiert man jedoch deutsches Recht, muss man wissen, ob ein Autor vor oder nach 1648 lebte, Akademiker oder Laie und Katholik oder Protestant war, sein Wissen aus Büchern oder anderen Quellen bezog, für den Kaiser, einen Kurfürsten oder Fürsten arbeitete. 4
21. Das Reich in der Publizistik
In den Jahrzehnten nach 1648 blieben die verfassungsrechtlichen Fakultäten von Protestanten dominiert. Es herrschte ein allgemeiner Konsens über die deutschen Ursprünge des Reichs; um 1700 hing nicht ein einziger ernsthafter Jurist mehr der alten Idee von einer Kontinuität zwischen Rom und dem zeitgenössischen Reich an. Man war sich auch weitgehend über die Gültigkeit des Friedens von 1648 und die in den 1650er Jahren getroffenen politisch-konstitutionellen Absprachen einig, den Jüngsten Reichsabschied von 1654, die Wahlkapitulationen von Ferdinand IV. (1653) und Leopold I. (1658) sowie die neue Ordonnanz des Reichshofrats von 1654, die anerkannt wurde, obwohl sie auf ein kaiserliches Dekret ohne vorherige Konsultation der Stände zurückging. Zwei wesentliche Themen bestimmten die rechtspolitische Literatur bis in die 1730er Jahre. Die Frage, wie viel kaiserliche Autorität die Verfassung zuließ, gewann durch den Aufschwung der kaiserlichen Macht unter Ferdinand III. und Leopold I. an Gewicht. Der unverblümte Regierungsstil von Joseph I. und Karl VI. erntete ebenso unumwundene Stellungnahmen. Die zweite, in gewisser Weise in der ersten enthaltene Frage war, wie viel Spielraum der Westfälische Frieden gestattete. Kaiserliche Privilegien waren weder 1648 noch danach im Einzelnen benannt worden, der Umfang der kaiserlichen Autorität stand demnach zur Debatte. Der konfessionelle Status quo wiederum war 1648 festgeschrieben worden, aber nun gewann die Frage an Bedeutung, ob es zulässig war, vom Buchstaben des Gesetzes abzuweichen. Durften Herrscher religiöse Rechte verleihen, die im Friedensvertrag nicht näher beschrieben waren, zum Beispiel im Dienste echter religiöser Toleranz? Hatte ein Herrscher, der die eigene Konfession wechselte, das Recht, seinen neuen Glaubensbrüdern Privilegien zu gewähren? War das Paritätsprinzip (die aequalitas exacta mutuaque, das Itionsrecht und die amicabilis compositio) generell politisch-konstitutionell anwendbar, oder betraf es nur Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Corpus Evangelicorum und dem Corpus Catholicorum zu spezifisch religiösen Themen? Die meisten dieser Fragen betrafen vorrangig Protestanten. Die Zunahme der kaiserlichen Macht begünstigte den Katholizismus. Herrscher, die den Glauben wechselten, konvertierten fast immer zum Katholizismus. Die ehrgeizigsten deutschen Fürsten nach 1648 und die, die am meisten Grund hatten, ihr Verhältnis zum Kaiser und ihre Rolle im Reich rechtlich zu definieren, waren die protestantischen Dynastien des Nordens, insbesondere Hannover und Brandenburg-Preußen. Das heißt nicht, dass es katholischen Herrschern an Ehrgeiz gemangelt hätte. Die bayerischen Kurfürsten Max II. Emanuel (1679–1726) und Karl Albrecht (1726–1745) sowie ihre pfälzischen Zeitgenossen Philipp Wilhelm (1685–1690), Johann Wilhelm (1690–1716) und Karl Philipp (1716–1742) waren genauso ehrgeizig wie irgendein Herrscher von Hannover oder Brandenburg, ebenso wie die Kurbischöfe von Mainz, Köln und Trier.Viele hatten ernsthafte Auseinandersetzungen mit dem
201
202
II. · Konsolidierung und Krise 1705–1740
Kaiser; Bayern und Köln führten 1701 sogar Krieg gegen ihn. Aber die politischkonstitutionellen Probleme traten am deutlichsten bei religiösen Fragen zutage und hier stimmten die Katholiken im Großen und Ganzen mit der kaiserlichen Politik überein. Für die Protestanten hingegen erforderten solche Fragen die ständige Verteidigung der deutschen Freiheit. Professor Johann Peter Ludewig aus Halle (* 1668, † 1743) meinte, die seit antiken Zeiten blühende »deutsche Libertät« habe Deutschland vor einem imperialen Absolutismus bewahrt. Die Beliebtheit des Studiums öffentlichen Rechts in Deutschland sei lediglich der aktuelle Niederschlag des Strebens der Deutschen nach ihrer Freiheit. 5 Jakob Brunnemann († 1735), der in Frankfurt an der Oder und Halle studierte und kurze Zeit in Halle lehrte, ehe er Präsident der Gerichtshöfe in Stargard (Mecklenburg-Strelitz) wurde, stellte das Phänomen in einen internationalen Zusammenhang. Die öffentliche Rechtskultur in Europa floriere, wo immer Stände in politischen Spannungsverhältnissen zur Krone standen, in Deutschland ebenso wie in Großbritannien und Polen. Frankreich, eine absolutistische Monarchie ohne Kultur des öffentlichen Rechts, sei die Ausnahme, die die Regel bestätige. 6 Themen und Rhetorik waren dieselben wie um 1600, aber die akademischen Disziplinen hatten sich weiterentwickelt. Um 1700 kristallisierten sich zwei gegensätzliche Tendenzen heraus. Einige Universitäten führten ein Studium des Naturrechts ein, das auf Hugo Grotius’ bahnbrechendem Werk De iure belli ac pacis (Über das Kriegs- und Friedensrecht) von 1625 fußte. Das Studium dessen, was als universelles öffentliches Recht bekannt wurde, konzentrierte sich zunehmend auf die Territorien und weniger auf das Reich. Damit umging man die logischen Probleme, die entstanden, wenn man den komplexen Charakter des Reichs insgesamt erläutern wollte. Die Anwendung des Naturrechts erlangte für den weiteren Rahmen des Reichs erst nach 1750 Relevanz. Zuvor diente es hauptsächlich der Festigung und Intensivierung territorialer Herrschaft. Zweitens bemühten sich andere weiterhin um ein Verständnis des Reichs aus historischer Sicht. Dazu waren weitere Forschungen und neue Interpretationen seiner Entwicklung nötig. Dies führte auch zur Publikation neuer Sammlungen von Dokumenten und Kompendien zum kaiserlichen Recht und seiner Umsetzung. Bis in die 1720er Jahre wurden die frühen Handbücher, die Melchior Goldast von Haiminsfeld und andere um 1600 veröffentlicht hatten, durch neue Sammlungen ergänzt und teilweise ersetzt, die bis zum Ende des Reichs 1806 in Gebrauch blieben. 7 Diese beiden Strömungen überschnitten und beeinflussten sich gegenseitig, und obwohl sie sich im frühen 18. Jahrhundert zu getrennten Disziplinen mit je eigenen Interessen und Schwerpunkten entwickelt hatten, gab es zwischen 1700 und 1720 eine Reihe wichtiger Versuche, die Früchte ihrer Arbeit zu verbinden.
21. Das Reich in der Publizistik
Der überwiegend politische Charakter der akademischen Erforschung des Reichs und seiner Geschichte schließlich führte zwangsläufig zu Reaktionen auf das zunehmend empfundene Ungleichgewicht. Herausragendes Resultat war das Werk von Johann Jacob Moser (* 1701, † 1787), der sich vom Naturrecht wie auch von der Historie abwandte und das Reich beschrieb, wie es war. Sein dreiundfünfzigbändiges Teutsches Staatsrecht (1737–1754), nur ein kleiner Teil seines monumentalen Œuvres von gut 500 bis 600 Büchern, zeichnete die Stabilisierung des Reichs ab 1648 und seine Entwicklung zu einem komplexen und individuellen Rechtssystem nach. »Teutschland«, erklärte Moser später, »wird auf teutsch regiert, und zwar so, daß, bereits erwehnter maßen sich kein Schulwort, oder wenige Worte, oder die Regierungsart anderer Staaten, darzu schicken, unsere Regierungsart begreiflich zu machen.« 8 Das Studium des öffentlichen Rechts florierte an mehreren protestantischen Universitäten. Jena, eines der wichtigsten Zentren des Politik- und Rechtsstudiums um 1600, blieb auch nach 1648 prägend, unter anderem ab 1674 mit Vorlesungen zu Grotius und diversen wichtigen Vertretern des historischen Ansatzes. Dass die Universität Jena von den reformatorischen ernestinischen Fürsten Sachsens und Thüringens gefördert wurde, trug zu ihrer Offenheit für Einflüsse von außen und zur relativen Freiheit der Lehre dort bei. In vielen anderen Institutionen blieben Lehrpläne und Forschungsarbeiten eher konservativ. Vor allem Leipzig und Wittenberg in Kursachsen widersetzten sich Neuerungen und hielten an demselben Traditionalismus fest, der die Reichspolitik der Kurfürsten bestimmte. 9 In Helmstedt sorgten die persönlichen Bildungsinteressen der Wolfenbütteler Herzöge August II. (1635–1666), Rudolf August (1666–1705) und Anton Ulrich (1685–1714, bis 1705 Mitregent) dafür, dass Theologie, Philosophie und Politik eine wichtigere Rolle spielten als Jura. 10 Die erstaunlichsten Entwicklungen im öffentlichen Recht allgemein und auf das Reich bezogen und die fruchtbarsten Interaktionen beider Fächer fanden an den Universitäten in Brandenburg-Preußen statt: erst in Frankfurt an der Oder, dann ab 1694 an der neuen Universität Halle, die in Sachen imperiales Recht bald reichsweit führend wurde und blieb, bis Göttingen diese Rolle Mitte der 1730er Jahre übernahm. 11 Die beiden anderen verdienten kaum die Bezeichnung Landesuniversität. Königsberg in Ostpreußen, 1544 gegründet, blieb klein, abgelegen (technisch außerhalb des Reichs) und fest in der Hand traditionalistischer Lutheraner. Die 1655 gegründete calvinistische Uni Duisburg in Kleve am Niederrhein war akademisch eng mit den Niederlanden verbunden. Obwohl sie als erste deutsche Universität die kartesianische Lehre vertrat, blieb sie klein und ihre Entwicklung dadurch gehemmt, dass sie von katholischen Territorien umgeben war. 12 Die Bemühungen des Großen Kurfürsten konzentrierten sich auf die Frankfurter Universität, für die er eine lange Liste herausragender Persönlichkeiten ge-
203
204
II. · Konsolidierung und Krise 1705–1740
wann, insbesondere 1690 Heinrich von Cocceji (* 1644, † 1719), der seine Erfahrungen aus Leiden, Oxford, Heidelberg (wo er Pufendorf abgelöst hatte) und Utrecht in das historische Studium des öffentlichen Rechts des Reichs einbrachte. Wie es sich für einen Angestellten des Kurfürsten von Brandenburg geziemte, war sein Hauptziel die Darlegung der Ursprünge, der aktuellen Bedeutung und der Privilegien der besonderen Stellung der Kurfürsten im System. 13 Er führte die Kreise auf die alten Territorien der deutschen Stämme zurück und stellte die These auf, die Kurfürsten seien ursprünglich Herrscher dieser Provinzen gewesen, die von Heinrich I. (919–936) mit besonderen Vorrechten ausgestattet worden seien. In Halle war das Spektrum breiter und moderner, aber nicht weniger politisch ausgerichtet. Die wichtigste Persönlichkeit der frühen Jahre war dort Christian Thomasius (* 1655, † 1728) und das Personal wie auch der Lehrplan spiegelten sein weitläufiges Interesse an öffentlichem Recht, Naturrecht, Politik und allgemeiner Staatstheorie, Weltgeschichte, Reichsgeschichte sowie Literaturgeschichte. 14 Das Grundprinzip aller Tätigkeiten war, den Bedürfnissen der Verwaltung von Brandenburg-Preußen zu dienen. Schon die Gründung erfolgte aus dem Wunsch, eine moderne lutherische Institution zu schaffen, die Kandidaten für klerikale Positionen in Brandenburg von den militant orthodoxen kursächsischen Universitäten Leipzig und Wittenberg fernhielt. 15 Thomasius’ Grundsatz lautete, das Studium des Rechts müsse zwar auf einem soliden naturrechtlichen Fundament gründen, sei jedoch sinnlos, wenn es die Geschichte ausblende. 16 Insbesondere das Studium des imperialen Rechts müsse ein historisches sein und sich auf die Analyse der Quellen zur Geschichte des Reichs stützen. Wie in anderen Bereichen des Curriculums setzten Thomasius und sein juristischer Kollege und ehemaliger Lehrer in Frankfurt an der Oder, Samuel Stryk (* 1640, † 1710), auf eine grundsätzlich empirische Herangehensweise. Die Ergebnisse der Studien tatsächlicher menschlicher Erfahrungen wurden dann anhand der Grundregeln natürlicher Vernunft erklärt. Thomasius, Stryk und ihre Schüler Johann Peter Ludewig, Nicolaus Hieronymus Gundling (* 1671, † 1729) und Justus Henning Boehmer (* 1674, † 1747) machten Halle zum führenden Zentrum einer neuen, historiografisch geprägten deutschen Rechtswissenschaft. Ihr Erfolg wurde zum Vorbild für andere Universitäten wie Frankfurt an der Oder und Jena. Um 1700 begann selbst die ultrakonservative Universität Leipzig, die Thomasius noch 1690 suspendiert hatte, die neuen Methoden und Themen zu übernehmen. 17 Was die Gelehrten in Halle von anderen unterschied, war ihr Fokus auf das Territorium. Ohne feige Unterwürfigkeit gegenüber dem Herrscherhaus und mit sehr unterschiedlichen Interpretationen der Historie blieben sie doch alle in besonderer Weise den Interessen Brandenburg-Preußens und seiner Regierung verpflichtet. Thomasius war kein gewöhnlicher Propagandist, aber ein Großteil seiner
21. Das Reich in der Publizistik
Arbeit widmete sich der Ausarbeitung der Rechte und Pflichten des souveränen Staats, den er als Territorium verstand und dessen Aufgabe es in seinen Augen war, für Frieden, Ordnung und das Glück seiner Untertanen zu sorgen. Folglich sah er im Reich wenig mehr als einen rechtlichen Rahmen, in den sich die Territorien fügten, weil das in ihrem eigenen Interesse lag. Seine Gesetze seien folglich Vereinbarungen zwischen souveränen Herrschern, befand er, und keine ihnen auferlegten Statuten. Dem Kaiser gestand er keine höhere oder souveräne monarchische Macht zu; er war an dieselben grundlegenden Gesetze des Reichs gebunden wie die Fürsten. 18 Thomasius betonte, er sei nicht »krank vor Hass auf den Kaiser« wie frühere Autoren, etwa Limnaeus und Chemnitz. Sein historisches Verständnis der Entwicklung des Reichs habe ihn ganz einfach die Vorrangstellung des Territorialstaats in der modernen Zeit erkennen lassen. Andere in Halle übersetzten diese Erkenntnis in eher polemische Formen historischer Studien zur »Reichshistorie«. Den Begriff prägte Stryks Schüler Johann Peter von Ludewig. 19 Er war von 1695 bis 1743 Professor in Halle, ab 1704 Hofhistoriograf und hielt eine Reihe juristischer und administrativer Posten. 1719 wurde er in den Adelsstand erhoben. Im Zuge seiner vielen administrativen und politischen Ämter schrieb Ludewig Traktate, deren historische Argumentation so gut wie jedem Aspekt der brandenburg-preußischen Politik zur Rechtfertigung dienen konnte. In seinen größeren akademischen Schriften knüpfte er an Coccejis Arbeiten an, ging jedoch darüber hinaus, indem er feststellte, die gegenwärtige Stellung der Kurfürsten beruhe darauf, dass mit dem Ende der karolingischen Dynastie 911 die Souveränität an sie zurückgefallen sei und die Herrscher der Stammesherzogtümer oder Provinzen dem daraufhin gewählten deutschen König nur beschränkte Macht übertragen hätten. Selbst in Halle blieb Ludewigs einzelkämpferische Sicht der antiken Verfassung nicht ohne Widerspruch. Nicolaus Hieronymus Gundling zum Beispiel mokierte sich über Ludewigs allzu lässigen Umgang mit Quellen, gelangte indes in seiner eigenen Geschichte der evolutionären Entwicklung territorialer Souveränität zu den gleichen Schlussfolgerungen für das Reich der Gegenwart. 20 Unter Gelehrten in anderen Territorien sorgten die offen prokurfürstlichen und probrandenburgischen Tendenzen der halleschen Reichshistorie für eine Vielzahl unterschiedlicher Ansätze. In Leipzig entwickelte Johann Jacob Mascov, der in Halle Jura studiert hatte, die Sichtweise, das Reich sei ein Einheitsstaat, der sich einzigartig entwickelt habe, in einer Weise, die dem »Geist« des deutschen Volkes mit seinem parteiübergreifenden Interesse an der Bewahrung des politischen Gemeinwesens und seiner Libertät entspreche.21 In Helmstedt benutzte Johann Wilhelm von Goebel (* 1683, † 1745) die neue historische Herangehensweise, um die Pragmatische Sanktion im Rahmen des »Reichsherkommens« zu rechtfertigen. 22
205
206
II. · Konsolidierung und Krise 1705–1740
Wie die Argumente anderer Vertreter der Reichshistorie stimmte auch Goebels Sicht vollkommen mit der Politik seines Dienstherren Herzog Ludwig Rudolf von Braunschweig-Wolfenbüttel überein, dessen Schwester Elisabeth Christine die Ehefrau Karls VI. und Mutter von Maria Theresia war. Wenn man sie kreativ einsetzte, konnten historische Quellen so gut wie jeden tagespolitischen Standpunkt rechtfertigen. Die Debatte und die anhaltende politische Relevanz der Rechtswissenschaft im Reich wie in den Territorien sorgten für große Nachfrage nach Handbüchern, Literaturführern und Dokumentationen. 23 1722 veröffentlichte Johann Jakob Schmauss (* 1690, † 1747), ein weiterer Alumnus aus Halle, sein Corpus juris publici Germanici academicum, die erste klare Einführung in das öffentliche Recht des Reichs für Studenten mit Texten grundlegender Gesetze und Reichsabschiede. Das Buch erlebte bis 1794 sieben Auflagen. 24 Daneben erschienen Unmengen Kompendien mit fundamentalen Gesetzen, Verhandlungen des Reichstags und der Kreise, Verträgen, insbesondere des Westfälischen Friedens und Materialien zu seiner Interpretation, und jeder denkbaren Art politischer Dokumente. 1697 startete Christian Leonhard Leucht (* 1645, † 1716) seine Europäische StaatsCantzley: jährlich erschienen zwei Bände, bis 1803 mehr als 200. 25 Leucht sammelte mehr oder weniger wahllos Material, hauptsächlich aus Deutschland, obwohl sein Abriss ganz Europa mit einbezog. Das vierundzwanzigbändige Teutsche Reichsarchiv (1710–1722) von Johann Christian Lünig (* 1662, † 1740) war wählerischer. 26 Noch spezifischer war das fünfteilige historische und politische Archiv, das Burkhard Gotthelf Struve (* 1671, † 1738) 1718 herausgab. Es umfasste unveröffentlichte Dokumente zu »Kirchen-Staats-Lehen- und übrigen Rechten/Auch überhaupt zur Gelehrsamkeit dienliche bissher noch ungedruckte Schrifften« sowie eine zweibändige historische Dokumentation der Dispute zwischen Katholiken und Protestanten, die 1722 erschien und den rechtshistorischen Kontext der religiösen Kontroverse in der Pfalz beleuchten sollte. 27 Die Anzahl der Publikationen war so groß, dass sie selbst Experten überforderte. Es gab einige Führer für Studenten und kurze Überblicke, aber immer wieder wurden Rufe nach einem unparteiischen, praktischen Handbuch laut. Das wollte Johann Jacob Moser liefern. 28 Moser war gebürtiger Württemberger und studierte in Tübingen bei Gabriel Schweder (* 1667, † 1731), einem Absolventen der Universität Jena, und Christoph Matthäus Pfaff (* 1686, † 1760), einem halleschen Schüler von Thomasius und, wie Justus Henning Böhmer, Kirchenrechtsexperten. Ein erster Anlauf zu einer akademischen Karriere in Tübingen schlug fehl und Moser verbrachte mehrere Jahre in Wien, wo er Reichsvizekanzler Friedrich Karl von Schönborn auffiel und den Reichshofrat aus erster Hand kennenlernte. Moser war von Schönborn so beeindruckt, dass er sein erstes Kind, den späteren Reformator Friedrich Karl, nach ihm benannte. 29
21. Das Reich in der Publizistik
1726 kehrte Moser nach Württemberg zurück, wo er einige Verwaltungs- und Lehrposten innehatte. Seine Karriere verlief zu Beginn ruhelos und wenig erfolgreich, obwohl er seit 1722 regelmäßig Berichte über die Literatur zum öffentlichen Recht und einen dreibändigen geschichtlichen Überblick (1729–1734) sowie eine allgemeine Einführung und eine Reihe technischer Arbeiten zu speziellen Themen veröffentlichte. Zwischen 1728 und 1738 konvertierte er zum Pietismus und nach seiner Entlassung in Frankfurt zog er mit seiner Familie in eine pietistische Gemeinde in Ebersdorf in der Grafschaft Reuß im Vogtland (Obersachsen). Dort arbeitete er an der Vollendung des dreiundfünfzigbändigen Teutschen Staatsrechts, mit dessen Veröffentlichung er 1737 begonnen hatte. Seine Produktivität war derart hoch, dass er eine eigene Druckerei für seine Werke gründete. 30 Die ersten veröffentlichten Bände machten Moser über Nacht zum führenden Experten in Sachen Reichsrecht; seine Leistung blieb unerreicht. Mosers Ansatz steht für einen Paradigmenwechsel. Anders als die Hallesche Schule stützte er sich nicht auf Naturrecht und Geschichte. 31 Die theoretische Debatte über Formen der Herrschaft interessierte ihn nicht. Darstellungen des Reichs anhand des Naturrechts waren in seinen Augen entweder abstrakte Formulierungen gängigen Rechts oder unverhohlen politische Argumente. 32 Ebenso kritisierte er die mangelnde Unterscheidung zwischen Recht und Geschichte. 33 Historische Thesen, fand er, hätten allzu oft die Auslegung des imperialen Rechts verzerrt. Er zielte vielmehr darauf ab, das umfassendste Brevier des gegenwärtig gültigen Rechts zu erstellen. Dazu durchkämmte er die vorliegende Literatur gründlichst; in seinem Werk wimmelt es vor Verweisen auf die Arbeit anderer. Wo immer es möglich war, legte er zu einem bestimmten Thema eine ausgewogene Zusammenfassung aller vertretenen Standpunkte vor. Moser ging systematisch vor. Er begann mit einer Diskussion der Quellen des öffentlichen Rechts, inklusive des Reichsherkommens, die er vollständig in seine detaillierte Beschreibung des imperialen Systems selbst integrierte. Diese organisierte er in Abteilungen (die jeweils mehrere Bände umfassten) zum Kaiser, den einzelnen Reichsständen und dem Reichstag. Als ihn seine Ernennung zum Konsulenten in Württemberg zum Abbruch der Arbeit zwang, blieben viele Themen unbehandelt. Diese fanden dann Eingang in sein vierzigbändiges Neues Teutsches Staatsrecht (1766–1782), das sich unter anderem den kaiserlichen Gerichten, dem territorialen Rechtssystem und den Rechten minderer Stände und Untertanen widmete. Diese Themen waren indes bereits in Mosers 1731 erschienenem Grund-Riss der heutigen Staats-Verfassung des Teutschen Reichs enthalten, der bis 1754 siebenmal überarbeitet und neu aufgelegt wurde. Mosers Reich war eine hierarchische, von Gesetzen bestimmte Feudalordnung. Die Frage der Souveränität interessierte ihn nicht sehr, jedoch lehnte er die in Halle vertretenen föderalistischen Ansichten entschieden ab. Andererseits stand die
207
208
II. · Konsolidierung und Krise 1705–1740
Frage, wie die Rechte und Privilegien einzelner Teile des Systems voneinander abhingen, im Mittelpunkt seiner Arbeit. In der Garantie dieser Masse von individuellen und kollektiven Rechten sah er die urtümliche Funktion des Gesetzes. Er sei, betonte er, »kein Partisan«, sondern versuche, die Stellungen von Kaiser, Reichsständen, Landständen und Untertanen abzuwägen und gleichwertig zu respektieren. 34 Die Rechte der kleinsten Reichsstände – der Reichsritter und Reichsstädte – interessierten ihn ebenso wie die Privilegien der Kurfürsten. Die Rechte der Untertanen des preußischen König lagen ihm ebenso am Herzen wie die des Königs selbst. Mosers Sicht des Reichs war grundsätzlich konservativ. Die Möglichkeit von Veränderungen und Reformen schloss er indes nicht aus. Das ergab sich aus der Bedeutung, die er dem Gewohnheitsrecht beimaß: Jede einzelne Handlung des Kaisers oder irgendeiner anderen Autorität, die von den Ständen entweder stillschweigend hingenommen oder ausdrücklich gutgeheißen werde, sei hinreichend, um eine Regel oder Sitte zu begründen; einmal eingeführt, könnten solche Regeln weitere nach sich ziehen, ältere ändern oder ergänzen und sogar alte Reichsgesetze verändern. 35 Ebenso erkannte Moser bei der Untersuchung von Institutionen wie dem Reichstag Probleme und deutete an, dass Verbesserungen wünschenswert seien. 36 In seiner Autobiografie stellte er fest, er habe immer danach gestrebt, die deutsche Verfassung so darzustellen, wie sie den Reichsgesetzen gemäß sein sollte, zu zeigen, inwiefern sie davon abwich und tatsächlich funktionierte, und zu bedenken, wie das Deutsche Reich in seinem gegenwärtigen Zustand erhalten werden konnte und wie seine Fehler zu beheben waren. 37 Selbstverständlich schlugen sich in seinem Werk auch persönliche Neigungen nieder, etwa seine württembergische Herkunft und seine politischen Interessen als Vertreter der Rechte der württembergischen Landstände. Dass er das Corpus Evangelicorum als rechtlich etablierte und als dauerhafte Einrichtung betrachtete, was Katholiken in Zweifel zogen, verrät seine grundsätzliche Sympathie für die protestantische Sache. 38 Generell galt Moser jedoch als unparteiisch, sein Werk fand Verwendung bei Katholiken und Protestanten. Es bleibt bis heute die umfassendste Darstellung des imperialen Systems um 1750. Die historischen und naturrechtlichen Prämissen der Juristen in Halle lehnte Moser ab; hingegen fanden die Ansichten seines frühen Förderers in Wien, des Reichsvizekanzlers Friedrich Karl von Schönborn, Eingang in sein Werk. Moser teilte seinen Patriotismus und die Überzeugung, die »deutsche Freiheit« hänge vom Kaiser ab. Ohne ihn und die Institutionen des Reichs, ohne das feudalhierarchische System, dem der Kaiser vorstand, bliebe eine chaotische Masse von Fürsten und Adligen, die ständig Krieg gegeneinander führten. 39 Mosers Verbindung zu Schönborn setzte sich fort. 40 1735 erhielt er eine Einladung nach Bamberg, dann wurde er zu Friedrich Karls Brüdern Damian, dem
21. Das Reich in der Publizistik
Bischof von Speyer, und Franz Georg, dem Trierer Erzbischof und Kurfürsten, entsandt. 41 1741 nahm er als Mitglied der Trierer Delegation an der Kaiserwahl nach dem Tod von Karl VI. in Frankfurt teil. 1745 wiederum gehörte Moser auf Einladung von Gerlach Adolph von Münchhausen der hannoverschen Delegation an. Das ging möglicherweise darauf zurück, dass Franz Georg von Trier die Wahl 1745 aus Ärger über den anhaltenden Einfluss von Schönborns großem Rivalen, Johann Christoph von Bartenstein, in Wien boykottierte. 42 Wichtig war die Beziehung zwischen Moser und Friedrich Karl von Schönborn auch in anderer Hinsicht. Die Dominanz der Halleschen Schule unterstrich, dass das öffentliche Recht in Deutschland größtenteils eine protestantische Disziplin war. Als Bischof in Würzburg begann Schönborn dies ab 1729 zu ändern. 1731 leitete er eine radikale Reform des Curriculums ein, die von der jesuitischen Tradition abwich und das Studium von Geschichte und öffentlichem Recht einführte. 43 Getreu dem Modell von Halle wurde großes Gewicht auf Geschichte als Mittel zur Ergründung der Ursprünge und der Entwicklung der Grundgesetze des Reichs gelegt. Johann Adam Ickstatt (* 1702, † 1776), der in Paris und bei Newton in London studiert hatte, wurde als Professor für Natur- und öffentliches Recht berufen und hielt während seiner zehnjährigen Lehrtätigkeit (1731–1741) Vorlesungen, die das gesamte Spektrum der zeitgenössischen Rechtspolitik umfassten. Wie die Juristen in Halle maß auch Ickstatt aufgrund seiner naturrechtlichen Studien den Rechten der Territorien größeres Gewicht bei als Moser. 44 1734 schloss sich Ickstatt dem Würzburger Alumnus und Schönborn-Schützling Johann Peter Banniza (* 1707, † 1775) an, der ein Handbuch zum Reichskammergericht und seinen Verfahrensweisen verfasste und nach 1755 das Studium des öffentlichen Rechts in Wien einführte. Ebenso wichtig wie Ickstatt und bedeutender als Banniza war Johann Caspar Barthel (* 1697, † 1771), ein Würzburg-Absolvent, der auch kanonisches Recht in Rom bei Kardinal Prosper Lambertini, dem späteren Papst Benedikt XIV., studiert hatte. Seine wichtigste Leistung war die Ausarbeitung eines dem protestantischen ius ecclesiasticum entsprechenden deutschen katholischen Kirchenrechtssystems. 45 Es verankerte das katholische Kirchenrecht auf den Grundlagen der Reichsverfassung und setzte es vom kanonischen Recht der römischen Kirche ab. Barthel arbeitete theoretisch heraus, was Friedrich Karl von Schönborn praktisch erfahren hatte: die Spannungen zwischen Rom und Wien wegen Italien und wegen der Weigerung Karls VI., die päpstliche Bulle gegen den Jansenismus (Unigenitus) in Lüttich umzusetzen. 46 In Würzburg entwickelte Barthel die Grundzüge eines deutschen Gegenstücks zum Gallikanismus: Loyalität zu Rom in Fragen von Glauben und Moral, aber Unabhängigkeit in administrativen Belangen. Es gab jedoch einen entscheidenden Unterschied. Das gallikanische System stattete den König mit umfänglichen Rechten gegenüber der Kirche aus, besonders, was die Ernennung von Bischöfen an-
209
210
II. · Konsolidierung und Krise 1705–1740
ging. In Deutschland wurden die Bischöfe von den Domkapiteln gewählt, daher betrachtete die deutsche Theorie den Mainzer Erzbischof und Reichserzkanzler als angenommenen Kopf der deutschen Kirche. Von der Stärkung seiner Position und der der übrigen Erzbischöfe erhoffte man sich eine autochthone Führung und das Schwinden des Einflusses der päpstlichen Nuntien in Köln, Wien und Luzern auf die deutschen Bischöfe. In solchen Ideen klangen grundlegende Gravamina der Reformation aus den 1520er Jahren nach und lebte die Hoffnung wieder auf, ein nationales Konzil der deutschen Kirche könne die Spaltung der deutschen Christen überwinden. Zugleich aber akzeptierte Barthel im Gegensatz zu Rom den Westfälischen Frieden, womit er die katholische Kirche fest in die bikonfessionelle Verfassung integrierte und eine Wiedervereinigung weniger wahrscheinlich machte. Barthels Ideen bildeten die Grundlage der episkopalischen Bewegung, die in den späteren Jahrzehnten des Jahrhunderts eine Reform der deutschen Kirche anstrebte. 47 In den 1730er Jahren lag ihre Bedeutung eher darin, dass sie in ähnlicher Weise wie Halle und Moser die imperiale Verfassung bestätigten. Die Schriften zum deutschen öffentlichen Recht zeigen Differenzen bezüglich des Systems – in Halle betonte man dessen föderativen Charakter, Leipzig und Moser legten mehr Gewicht auf die ständische Ordnung –, aber alle Autoren waren sich im Grunde einig, dass das Reich eine spezifisch deutsche Institution war. Damit legten sie die Grundlage für weitere Arbeiten zu Geschichte und öffentlichem Recht, vor allem an der Universität Göttingen nach 1750, und für eine Reihe von Debatten über eine Reform des Systems, die mit der Wahl von Karl VII. ihren Anfang nahmen und bis zur Auflösung des Reichs 1806 anhielten. Das Studium des öffentlichen Rechts prägte die Haltungen zur politischen Kultur des Reichs. Weniger offensichtlich, aber dennoch wichtig sind die Verbindungen zu zwei anderen Erscheinungen. Einerseits schuf das Nachdenken über Deutschlands konstitutionelle Ursprünge als Basis der zeitgenössischen Politik einen wichtigen Bestand an historischen Schriften und sorgte für weite Verbreitung des Wissens über die deutsche Vergangenheit. Dazu zählten Werke wie der Abriss einer vollständigen Historie des Römisch-Teutschen Reichs bis auf die gegenwärtige Zeit (1722) von Johann Jacob Mascov (* 1689, † 1761) und andere Versuche einer vernakulären Historiografie von Heinrich von Bünau (* 1697, † 1762), beginnend mit seiner Biografie von Friedrich Barbarossa. 48 Beide betrieben Geschichtsschreibung um ihrer selbst willen, nicht als bloßes Hilfsmittel zum Verständnis des öffentlichen Rechts, und wollten die historischen Ursprünge des »Geistes« oder Charakters des deutschen Volks ergründen. Bald begannen Autoren wie Johann David Köhler (* 1684, † 1755) in seiner Kurtzgefaßten und gründlichen Teutschen Reichshistorie (1736), zwischen der Geschichte des Reichs und der Geschichte der Nation zu unterscheiden. 49 1754 iden-
21. Das Reich in der Publizistik
tifizierte der Ingolstädter katholische Rechtsprofessor Benedikt Schmidt (* 1726, † 1778) drei Arten deutscher Geschichte: die Geschichte von Deutschland als geografischer Einheit, als ethnischem Kontinuum sowie die Geschichte der Kaiser und des Reichs als »eine der mächtigsten und ansehnlichsten Republiquen in Europa«. 50 Interessanterweise mündete auch die katholische Erforschung des öffentlichen Rechts einige Jahrzehnte später in ein bedeutendes historisches Werk, die Geschichte der Deutschen (1778–1783) von Michael Ignaz Schmidt (* 1736, † 1794), die erste mehrbändige Darstellung ihrer Art. 51 Eine Generation vor der viel gepriesenen »Wiederentdeckung« der deutschen Vergangenheit durch den jungen Herder und seine Sturm-und-Drang-Genossen in den 1770er Jahren und lange vor dem Aufblühen der historischen Wissenschaften im frühen 19. Jahrhundert entwickelten die Historiker der deutschen Schulen des öffentlichen Rechts ein Bewusstsein für die geschichtliche Herausbildung der deutschen Kultur, Gesellschaft und politischen Institutionen. 52 Die Beziehung zwischen den neuen Strömungen im öffentlichen Recht und dem neuen Denken über die deutsche Sprache war wohl eher eine Art kreative Synergie als eine direkte Verbindung zwischen Sprachreform und Reichsreform wie im 17. Jahrhundert von Ratke bis Leibniz. Dennoch sollte nicht übergangen werden, dass Johann Burkhard Mencke (* 1674, † 1732) einige entscheidende Tendenzen kombinierte. Als Geschichtsprofessor in Leipzig förderte Mencke ab 1699 die neue historisch-juristische Lehre und veröffentlichte selbst 1707 eine (loyalistische) Biografie Leopolds I. Nach dem Tod seines Vaters Otto Mencke im selben Jahr übernahm er die Herausgeberschaft der Acta Eruditorum, die sich der Publikation und Popularisierung neuer Forschungen in allen Disziplinen widmeten. 1724 schließlich war er die treibende Kraft hinter der Umwandlung des kleinen, unbedeutenden Collegium Poeticum Gorlicense in die Teutschübende Poetische Gesellschaft (Societas Philoteutonico Poetica), die sein Schüler Johann Christoph Gottsched wiederum 1727 in die Deutsche Gesellschaft überführte, was zur Gründung einer ganzen Welle »deutscher Gesellschaften« führte, die dramatischeren und greifbareren Erfolg hatten als ihre Vorgänger. 53 Gottscheds Tätigkeit als Autor und Lehrer begünstigte die Entstehung neuer überregionaler Standards und half das Deutsche nach 1750 als wichtige literarische Sprache durchsetzen. In einem durchaus umstrittenen Bruch mit der Tradition verwarf Gottsched den höchst formalisierten Kanzleistil, den die Sprachgesellschaften des 17. Jahrhunderts so verehrten, als sperrig und unverständlich. 54 Damit folgte er dem Rat von Leibniz und Thomasius und dem Vorbild von Christian Wolff. Leibniz predigte, obgleich er selten mit praktischem Beispiel voranging, wie wichtig es für Gelehrte sei, auf Deutsch zu schreiben, um die Sprache weiter zu verfeinern. Thomasius hatte dies mit seiner Ankündigung einer Vorlesung über Baltasar Gracián auf
211
212
II. · Konsolidierung und Krise 1705–1740
Deutsch in Leipzig 1687 in die Tat umgesetzt. 55 In Halle setzte er seine deutsche Vorlesungsreihe fort, flankiert von einem regelmäßigen Stilkurs für Jurastudenten. Das Studium der Grammatik sollte sie lehren, korrekt zu sprechen, Dichtung die Fähigkeit zu »scharfsinnigen Fiktionen« bilden, die sie für Plädoyers vor Gericht brauchten. Ihren rednerischen Stil schulten sie in Rhetorikkursen. 56 Die Betonung der gesprochenen wie geschriebenen deutschen Sprache fand zahlreiche Nachahmer. 1717 konnte Thomasius als sein Verdienst reklamieren, dass neben Halle viele andere protestantische Universitäten Lehrveranstaltungen auf Deutsch anboten. Darüber hinaus stand Thomasius’ Ideal eines eleganten, heimatbezogenen und nützlichen Wissens auch Pate für zunehmende Bemühungen um Verbesserung des Deutschen, Zurückdrängung französischer Einflüsse (und die Angewohnheit, deutsche Sätze mit lateinischen Wörtern und Phrasen zu spicken) sowie Förderung der deutschen Kultur im Allgemeinen. Ab 1710 stand ihm Wolff zur Seite, der seine philosophischen Grundprinzipien in der Landessprache formulierte, das erste deutsche philosophische Vokabular entwickelte und dauerhafte Maßstäbe für akademisches Deutsch setzte. 57 Manche Initiativen waren kurzlebig, so etwa die 1715 in Hamburg gegründete Teutschübende Gesellschaft. Sie hatte lediglich sechs Mitglieder und bestand nur drei Jahre. Ihre Mitglieder gehörten jedoch der städtischen Elite an und einige von ihnen waren an der einflussreicheren, obwohl ebenfalls kurzlebigen Patriotischen Gesellschaft (1724–1726) beteiligt, die sich den dringenderen Problemen städtischer Erneuerung nach der langen Krisenphase widmete. 58 Die Ursprünge der Deutschen Gesellschaft waren bescheidener. 59 Gegründet wurde sie von drei Studenten aus Görlitz in der Oberlausitz, die Vorlesungen über Dichtung bei Johann Burkhard Mencke besucht hatten; ihre Zwecke waren Freundschaft, Konversation und Poesie. Die Gesellschaft veränderte sich, als sie sich zunächst für Studenten jeder geografischen Herkunft und dann auch für Nichtstudenten öffnete. 1717 wurde Mencke selbst zum Präsidenten gewählt und war wohl verantwortlich für die Erweiterung der Ziele der Verbindung. Für neues Leben und eine ambitioniertere Ausrichtung sorgte indes Johann Christoph Gottsched, der Verbindungen zur Preußischen Akademie in Berlin und der 1730 in Jena gegründeten Deutschen Gesellschaft knüpfte. 60 Die Initiative zur Schaffung einer wahrhaft standardisierten deutschen Sprache geht auf die Berliner Gesellschaft zurück, die sich in ihrem Gründungsstatut von 1701 unter anderem der Förderung des Deutschen verschrieb. Die Zusammenarbeit zwischen Berlin, Jena und Leipzig blieb fruchtlos, aber Gottsched ließ sich nicht beirren. Er war leidenschaftlich davon überzeugt, das nur Studium und Praxis des Einheimischen dem Deutschen die Möglichkeit eröffnen konnten, gleichberechtigt neben Französisch als führende Sprache der Kultur und Literatur zu stehen. In einem Grußwort an die Deutsche Gesellschaft erklärte er 1728: »Wer aber
21. Das Reich in der Publizistik
das Glück hat, in Deutschland gebohren zu seyn, der sollte sich schämen, durch die Verachtung seiner wortreichen, männlichen, und wohlklingenden Muttersprache seinen groben Unverstand zu verrathen.« 61 Sein eigenes theoretisches Werk ist umfangreich und weitläufig; er schrieb über Literatur (Critische Dichtkunst, 1729– 1730), Philosophie (Erste Gründe der gesammten Weltweisheit, 1733–1734), Rhetorik (Ausführliche Redekunst, 1736), Theater (Die Deutsche Schaubühne, 1741– 1745) und die deutsche Sprache (Deutsche Sprachkunst, 1748) und war stets bestrebt, neue Maßstäbe zu setzen und die Maximen der jüngsten wolffschen Philosophie einem breiten Publikum nahezubringen. Viele schreiben Gottsched eine Schlüsselrolle in der Schaffung einer literarischen Öffentlichkeit in Deutschland zu und betonen die antihöfischen Tendenzen, die sich aus seiner Ablehnung der Oper herauslesen lassen. Führende Figuren der nächsten Generation wie Lessing überschütteten seinen Dogmatismus und seine sklavische Treue zu den Normen der französischen Klassik, die er deutschen Autoren ans Herz legte, um dieselbe Höhe der Kunst zu erlangen, mit Hohn und Spott. Dabei übersahen sie sein Interesse an der deutschen Literatur des Mittelalters und dem Drama der Epoche ab 1450 ebenso wie seine moderne Prosaausgabe von Hinrek van Alckmers Reinke de vos (1487, gedruckt 1498 in Lübeck, 1752 von Gottsched übersetzt), die Goethe später als Grundlage für sein episches Gedicht diente. Die moderne Sicht ist ebenfalls einseitig. Gottsched erreichte ein breiteres Publikum als fast alle Autoren vor ihm. Seine vielen Bücher und sonstigen Beiträge sprachen die Leserschaft der Nation tatsächlich an. Es wäre jedoch falsch, ihn als selbstbewussten Pionier der modernen Vorstellung des Autors zu betrachten, der nur dem freien Markt der Geschmäcker und Ideen verpflichtet ist. 62 In Wirklichkeit war er sehr auf Anerkennung bei den Dresdner Autoritäten und die Patronage eines mächtigen Fürsten oder eines »sächsischen Richelieu« erpicht. Dass er das Drama der Oper vorzog, lag an seiner Überzeugung, das Genre sei dienlicher für die ethisch-moralische Erziehung von Herrschern und ihren Untertanen, ob aristokratisch oder nicht. 63 Er verschickte eine Unmenge von Publikationen mit blumigen persönlichen Widmungen an einflussreiche Angehörige des Dresdner Hofs. 1730 schrieb er ein Poem zur Feier des Geburtstags von August dem Starken, das mit musikalischer Begleitung in der Universitätskirche aufgeführt wurde. Aber seine unermüdlichen Bemühungen um offizielle Anerkennung und finanzielle Unterstützung der Deutschen Gesellschaft blieben vergeblich; die kurfürstliche Regierung sandte jeden übrigen Pfennig nach Polen. 64 Kein Wunder, dass ein Mitglied der Jenaer Gesellschaft 1733 feststellte, eine deutsche Standardorthografie könne nur mit der Hilfe eines »unbesiegbaren deutschen Helden« wie Karl VI. erreicht werden. 65 Nach seinem Zerwürfnis mit der Deutschen Gesellschaft 1738 richtete Gottsched ähnliche Hoffnungen auf den kaiserlichen Hof. Schon 1727 pries seine Ode
213
214
II. · Konsolidierung und Krise 1705–1740
Das Lob Germaniens Karl VI. als deutschen Helden, der von Wien (»das neue Rom«) aus über ein Reich herrschte, das sich in Industrie, Wissenschaft, Philosophie, Literatur und Kunst auszeichnete und sogar Monarchen für andere Nationen (Schweden, Polen, Großbritannien) hervorbrachte. 66 Dieser patriotische Grundton zog sich durch viele seiner Gedichte und Reden der nächsten Jahrzehnte. 1749 reiste Gottsched nach Wien, um den Hof für die Gründung einer deutschen Akademie der Künste zu gewinnen. 67 Obwohl ihm und seiner Frau die Ehre einer Privataudienz bei Maria Theresia und Franz I. zuteilwurde und die Wiener Gesellschaft sie umschwärmte, zerschlugen sich seine Hoffnungen. Seine Vorschläge fanden großes Interesse, aber die Diskussionen erstickten im Keim, als er deutlich machte, er werde unter keinen Umständen zum Katholizismus konvertieren. Ein prägender Zug von Gottsched Patriotismus war von Anfang an seine grundsätzliche Treue zum Luthertum; noch auf dem Weg nach Wien 1749 pries er die sächsischen Gesandten in Regensburg, die »das Recht des Volks der Protestanten« schützten. 68 Gottscheds Bemühungen um eine deutsche Normsprache entfachten eine umfangreiche, oft hochpolemische Debatte mit den Schweizer Autoren Johann Jakob Bodmer und Johann Jakob Breitinger, die behaupteten, Gottscheds Wunsch nach Tilgung aller fremden, provinziellen und archaischen Wörter zwinge die Deutschen lediglich, die »nervenlose« Sprache der »sächsischen Akademiker« anzunehmen. 69 Auf scharfen Widerstand stieß er auch in Süddeutschland, besonders bei dem Benediktinermönch Augustin Dornblüth. 70 Bezeichnenderweise stimmten Dornblüth und jene, die die vorgeschlagene Akademie in Wien diskutierten, mit Gottsched überein, was die Notwendigkeit einer standardisierten Sprache betraf. Dornblüth wetterte gegen die drohende Tyrannei der meißen-sächsischen Orthografie und rühmte die Vorzüge der Kanzleitradition des Oberdeutschen, die auf Maximilian I. und seine Beamten zurückging. Um jeden Preis wollte er verhindern, ein Deutsch übernehmen zu müssen, das von Luther stammte. Am Wiener Hof wiederum war man überzeugt, die Gründung einer Akademie unter Leitung eines Protestanten sei schlichtweg ausgeschlossen. Von Wien enttäuscht, wandte Gottsched seine Aufmerksamkeit der Gründung einer neuen Gesellschaft der Freien Künste 1752 in Leipzig zu. Das ambitionierte Projekt nach dem Vorbild der Académie Française und der Académie des Inscriptions et des Médailles fand jedoch ebenfalls nicht die Unterstützung des Kurfürsten und scheiterte nach wenigen Jahren. Viele seiner linguistischen Vorschläge hingegen wurden stillschweigend, aber stetig in den folgenden Jahrzehnten in Deutschland und Österreich angenommen. 71 Den diversen Deutschen Gesellschaften gehörten um die dreitausend Mitglieder 72 an. Die meisten waren Kleriker, Professoren, Lehrer, Beamte und Studenten – allesamt irgendwie bei der Regierung angestellt oder bestrebt, es zu werden. An-
21. Das Reich in der Publizistik
ders als die Sprachgesellschaften des frühen 17. Jahrhunderts fanden sie beim Adel kaum Anklang. 73 Sie repräsentierten ein breiteres Spektrum als die früheren Gesellschaften, waren jedoch der offiziellen Welt der Territorien sowie des Reichs ebenso eng verbunden und spiegelten die Ausweitung und Verfeinerung dieser Strukturen über einen Zeitraum von hundert Jahren wider. Darüber hinaus belegen ihre Aktivitäten wie die von Vertretern des öffentlichen Rechts, Verfassungskommentatoren und frühen Historikern (von denen viele selbst Angehörige der Gesellschaften waren) eine zunehmende Identifikation mit dem Reich und bildeten die Basis anhaltender Reflexionen über Reich, Nation und Kultur, die zum Grundcharakteristikum des deutschen öffentlichen Lebens in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wurden.
Anmerkungen 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Matsche, Kunst; Braunfels, Kunst I, 76–81; vgl. S. 160 ff. Stolleis, Öffentliches Recht I, 252–255; Schindling, »Universität«. Stolleis, Öffentliches Recht I, 255–258. 4 Ebd., 257. 5 Ebd., 254. Ebd.; ADB III, 445. Whaley, »German Nation«, 320 f. Moser, Neues Teutsches Staatsrecht I, 550. Schindling, Bildung, 31 f. Ebd., 25 f.; Stolleis, Öffentliches Recht I, 238. Hammerstein, Jus, 149 f. Ebd., 151, 153; Stolleis, Öffentliches Recht I, 240; Schindling, Bildung, 37 f. Gross, Empire, 363–367; Hammerstein, Jus, 181–184. 14 Ebd., 148. Schindling, Bildung, 38 f. Hammerstein, Jus, 139. Ebd., 267–91. Luig, »Thomasius«, 237–241. Hammerstein, Jus, 169–204; Gross, Empire, 367–372. 20 Ebd., 373 ff. Ebd., 375–381; Hammerstein, Jus, 284–288; Stolleis, Öffentliches Recht I, 307. Roeck, Reichssystem, 108 ff.; ADB IX, 297 ff. Gross, Empire, 396 ff.; Stolleis, Öffentliches Recht I, 308 f., 360 f.; Pütter, Litteratur I, 305– 324. ADB XXXI, 628–631; Stolleis, Öffentliches Recht I, 309. ADB XVIII, 475; Gross, Empire, 396. ADB XIX, 641. ADB XXXVI, 671–676; Gross, Empire, 392–395. Vgl. zum Folgenden: Walker, Moser; Rürup, Moser, 96–152; Gross, Empire, 399–422; Roeck, Reichssystem, 114–121; Stolleis, Öffentliches Recht I, 258–267. Hammerstein, Jus, 300. Walker, Moser, 127 ff. Vgl. S. 204 ff. Stolleis, Öffentliches Recht I, 266 f.
215
216
II. · Konsolidierung und Krise 1705–1740
33 34 35 36 37 38
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 51 52 53 54 56 58
59 60 61 62 63 64 65 66
67 68 69 70 71 72 73
Gross, Empire, 420 f. Stolleis, Öffentliches Recht I, 266. Gross, Empire, 415 f.; Roeck, Reichssystem, 114–121. Burgdorf, Reichskonstitution, 47 f. Rürup, Moser, 119; vgl. auch S. 226, 508. Die Katholiken argumentierten, der Reichstag selbst stelle eine unteilbare Einheit dar und das Corpus Evangelicorum komme nur sporadisch zustande, wenn eine Itionsentscheidung gefordert werde. Moser verfasste auch eine Abhandlung zur »Klausel von Rijswijk«, um deren Illegalität aufzuzeigen; vgl. Walker, Moser, 71 ff. Hantsch, Schönborn, 356 ff. Walker, Moser, 78, 113–119. Rürup, Moser, 130. Ebd., 131–138; Walker, Moser, 152–162; Kleinheyer, Wahlkapitulationen, 132. Hammerstein, Jus, 295–308; Hammerstein, Aufklärung, 33–73; Haaß, Haltung, 75 f. Aretin, Altes Reich I, 41; Pütter, Litteratur I, 458–463. Aretin, Altes Reich II, 396–400; Hammerstein, Jus, 305; Whaley, »Tolerant Society?«, 183; Pütter, Litteratur I, 463 ff.; Raab, Concordata, 79–96. Hantsch, Schönborn, 91–120, 183–207. Vgl. S. 484. Gross, Empire, 379 f.; Hammerstein, Jus, 284–288. Mühlen, »Reichstheorien«, 143. 50 Ebd. Printy, »Church History«. Hammerstein, Jus, 378 ff.; vgl. zu Sturm und Drang die S. 517, 532, 564. Mitchell, Gottsched, 19 ff.; Van Dülmen, Society, 45–51. Blackall, Emergence, 178–187. 55 Ebd.,11 ff. Ebd., 16. 57 Ebd., 26–48. Petersen, »Teutsch-übende Gesellschaft«; Döring, Deutsche Gesellschaft, 123 ff.; Hardtwig, Genossenschaft, 225 f.; vgl. zu beiden Gesellschaften und ihrem Hintergrund Krieger, Patriotismus. Döring, Deutsche Gesellschaft. Vgl. auch S. 391 ff. Schmidt, Geschichte, 261. Killy, Lexikon IV, 291; Mitchell, Gottsched, 98 f. Killy, ebd.; Mitchell, ebd., 36 f. Döring, Deutsche Gesellschaft, 281–291. Ebd., 299. Gottsched, Werke I, 12–17 (er reklamierte sogar die seefahrerischen Heldentaten der Niederländer für Deutschland; schließlich hatten sie bis 1648 offiziell dem Reich angehört); Mitchell, Gottsched, 5, 15, 62. Waniek, Gottsched, 551–566; Mitchell, Gottsched, 95 ff. Ebd., 61 f.; Gottsched, Werke I, 415. Wells, German, 323. Blackall, Emergence, 137–148; Wells, German, 313, 324–327. Polenz, Sprachgeschichte II, 169–177. Hardtwig, Genossenschaft, 237; Van Dülmen, Society, 46 f. Vgl. S. 109 und Band I, S. 576–579.
III. Die deutschen Territorien um 1648–1760
22. Ein deutscher Absolutismus?
1739,
im Jahr bevor er als Friedrich II. den Thron bestieg, äußerte sich der preußische Kronprinz mit vernichtender Geringschätzung über die minderen Fürsten im deutschen Reich: »Noch der allerjüngte Sproß einer apanagierten Linie«, schrieb er in seinem Antimachiavell, »hält sich in seiner Einbildung für einen kleinen Ludwig XIV.: er baut sein Versailles, küßt seine Maintenon und hält sich seine Armee.« 1 Dieses zeitgenössische Urteil eines Mannes, der sich zum Archetyp einer neuen Art von reformierendem Herrscher proklamieren sollte, passt zur Einschätzung der deutschen Herrscher um 1650 bis 1740, die man in Geschichtsbüchern häufig findet. Angeblich war dies eine Epoche des Absolutismus, in der die deutschen Fürsten eine neue Stufe der Kontrolle und Macht erreichten. Sie traten die Rechte ihrer Untertanen mit Füßen, pressten so viel Geld aus ihnen heraus wie nur möglich, verprassten riesige Summen für Armeen, die oft an fremde Mächte vermietet wurden, und verschleuderten Vermögen für gewaltige neue Paläste und extravaganten Luxus. 2 Ludwig XIV. galt als ihr Vorbild und ihre sklavische Zuneigung zu allem Französischen machte man für die Ausrottung der deutschen Freiheit und den moralischen Niedergang der gesamten Gesellschaft verantwortlich. 3 Nach dem Dreißigjährigen Krieg, so hieß es, sei Deutschland den vielfältigen Übeln der Kleinstaaterei erlegen: extreme Zersplitterung am Rand der Anarchie, die Ausbreitung tyrannischer Regime, die nichts zur nationalen Entwicklung beitrugen, selbstsüchtiger Partikularismus, von dem Deutschland erst durch den Untergang des Reichs 1806 befreit wurde. Als einzige Ausnahme von der trostlosen Regel galt Brandenburg-Preußen, wo eine Folge herausragender Herrscher zwischen 1640 und 1786 – vor allem Friedrich Wilhelm I. (1713–1740) und Friedrich der Große (1740–1786) – eine weitblickende und bahnbrechende »nationale« Politik verfolgten, die die Grundlagen für das zweite deutsche Reich von 1871 bildete. Seit den 1950er Jahren jedoch macht sich unter Historikern zunehmend Unsicherheit über die Brauchbarkeit des Begriffs Absolutismus breit und seit den frühen 1990er Jahren meine manche, man solle ganz auf ihn verzichten. Der wachsende Skeptizismus hat mehrere Gründe. Zum einen ist der Begriff an sich anachronistisch. Er entstand in den 1820er Jahren in Frankreich, tauchte um 1830 erstmals in Deutschland auf und war ein Produkt der liberalen Debatte über die unterdrückerischen monarchischen Herrschaften der Zeit nach 1815. 4 In der Frühmoderne wurde er nie benutzt. Zweitens darf als erwiesen gelten, dass frühmoder-
220
III. · Die deutschen Territorien um 1648–1760
ne Monarchien ebenso sehr an der Tradition festhielten, wie sie Veränderungen beförderten, und dass kein Herrscher tatsächlich eine Macht genoss, die in irgendeiner Hinsicht als absolut zu bezeichnen wäre. Selbst Ludwig XIV., der oft als Idealbild eines absoluten Monarchen in Europa dargestellt wird, war von der Kooperation einer ganzen Reihe traditioneller Institutionen und sozialer Gruppen abhängig. In mancher Hinsicht war der Entwurf monarchischer Macht, zu dem Ludwig XIV. und andere Regenten zweifellos einiges beitrugen, Teil der Erschaffung eines Mythos, dessen Herrlichkeit lediglich über die eher weniger beeindruckende Realität hinwegtäuschen sollte, die außerhalb des Hofs herrschte, wo »Harmonie durch Konsens, nicht durch Gewalt hergestellt wurde«. 5 Nur ein deutsches Territorium kam der Macht und Größe Frankreichs, das um 1700 knapp über 500.000 km 2 und 20 Millionen Einwohner umfasste, annähernd nahe: Österreich (einschließlich Böhmen, Mähren und Schlesien) mit etwa 240.000 km 2 (weitere 120.000 kamen durch das habsburgische Ungarn hinzu, 120.000 durch das 1719 erworbene türkische Ungarn sowie Siebenbürgen mit 60.000, die Spanischen Niederlande mit 25.000 und etwas über einer Million Einwohnern). 6 Die Gesamtbevölkerung aller habsburgischen Länder in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts betrug jedoch nicht mehr als 8,1 Millionen. Brandenburg, das oft als das einzige Land genannt wird, in dem tatsächlich Absolutismus herrschte, war nur 112.524 km 2 groß; etwa 1,65 Millionen Einwohner lebten in verschiedenen, nicht zusammenhängenden Gebieten, von denen Ostpreußen formal gar nicht zum Reich gehörte. 7 Österreich und Brandenburg-Preußen waren hinsichtlich ihrer Größe und anderen, noch zu besprechenden Aspekten Ausnahmen im Reich. Die Masse der anderen Territorien bietet ein extrem vielfältiges Bild. 8 Sachsen, Hannover und Bayern hatten je etwa 40.000 km 2, so viel wie auch das ursprüngliche Kurfürstentum Brandenburg, der pfälzische Kurfürst nur etwa 20.000. Die Fürstbistümer Mainz, Köln und Trier waren mit je etwa 7.000 km 2 wesentlich kleiner. Nur etwas größer, etwa 7.000–10.000 km 2, waren Württemberg, Hessen-Kassel und Mecklenburg-Schwerin, ebenso wie die Fürstbistümer Salzburg und Münster. Die meisten übrigen Territorien umfassten weniger als 5.000 km 2, das größte ernestinisch-sächsische Herzogtum Gotha nur etwa 1.500, und zahlreiche Grafen und Äbte herrschten über Länder mit weniger als 100 km 2. 9 Die Zahlen für die Territorien der Reichsritter sind noch weniger durchschaubar: Ihre ungefähr 1.730 Ländereien gehörten etwa 350 Familien und umfassten um 1790 eine Gesamtfläche von lediglich 5.000 km 2 mit 350.000 Einwohnern, im Durchschnitt also nicht mehr als 2,9 km 2 pro Territorium. 10 Manche der etwa fünfzig Reichsstädte hatten mehr Land und Einwohner als viele Grafschaften. Größe war wichtig, aber ihre Bedeutung hing von anderen Faktoren ab. Die Stellung des Herrschers der Pfalz wurde durch die Kurwürde erhöht, seine Macht
22. Ein deutscher Absolutismus?
jedoch durch die Zerrissenheit seiner Gebiete, durch den Verlust von 7.000 km 2 in der Oberpfalz an Bayern 1648 und durch die Anfälligkeit der rheinischen Stammlande für französische Angriffe gemindert. Auch der Wert der 3.576 km 2 des Bischofs von Bamberg sank durch extreme Zersplitterung und die administrative Unterteilung in etwa 150 separate Gerichtsbezirke und Vogteien. 11 Das albertinische Kursachsen hingegen profitierte von einem kompakten Territorium mit reichlich wertvollen Rohstoffen. Im Allgemeinen übernahmen Adelsdynastien, insbesondere die protestantischen, nun die Primogenitur, um die für das 16. Jahrhundert typische territoriale Instabilität zu verhindern. Selbst dort, wo sich das als schwierig erwies, etwa bei den sächsischen Herzögen in Thüringen, von denen Sachsen-Meiningen die Primogenitur erst 1802 einführte, bemühten sich die Dynastien um Formen eines gemeinsamen Umgangs mit Familienbelangen. 12 Sie teilten sich die Verwaltung wichtiger Ländereien und gemeinsamer Institutionen, etwa der Universität Jena, die über vier sogenannte Nutritoren (Geldgeberterritorien) verfügte. 13 Kam es zu Streitigkeiten oder Schuldenkrisen, wandten sich die Herzöge stets an den Reichshofrat, der solcherart zur Stabilisierung der Region beitrug. Natürlich verhinderte die Verflechtung von Administrationen und Besitz Veränderungen. Stabilisierung stand oft neuen Entwicklungen im Weg; Jena jedoch ermöglichte die Unfähigkeit seiner vier Schirmherren, sich auf irgendeine bestimmte Linie zu einigen, eine der liberalsten Universitäten des späten 18. Jahrhunderts zu werden. Vergleiche mit Frankreich sind außer Österreich keinem deutschen Territorium angemessen. Selbst die Gegenüberstellung einzelner Gebiete ist problematisch. Zwar festigte sich das Reich nach 1648, aber zwischen seinen Teilen, vor allem kleinen und großen, bildeten sich zunehmende Unterschiede heraus. Fürsten mit stehenden Heeren ragten aus der Masse »unbewaffneter« Herrscher heraus, unter denen wiederum die mittelgroßen mehr Möglichkeiten für effektives politisches Vorgehen hatten als die, die Friedrich der Große als principini, Herrscher von »Zwerg-« und »Duodez«-Territorien, bezeichnete. Vielen Ähnlichkeiten zum Trotz unterschieden sich auch katholische und protestantische Territorien sowie – je nach Größe, Lage, Konfession und so weiter – die etwa fünfzig Reichsstädte. Dennoch hatten die Reichsstände vieles gemeinsam und standen vor ähnlichen Problemen. Grundsätzlich existierten sie alle in demselben konstitutionellen Rahmen, schuldeten dem Kaiser Loyalität und waren verpflichtet, seine oberste juristische Autorität anzuerkennen. Gleichzeitig war die Eigenverantwortlichkeit für ihre Länder (ius territoriale) im Westfälischen Frieden festgeschrieben; allerdings stellte diese Landeshoheit oder, wie sie in der Literatur bezeichnet wurde, superioritas territorialis keine volle Souveränität dar. Die maiestas realis verkörperten die Reichsstände nur gemeinsam, die maiestas personalis blieb dem Kaiser vorbehalten. Die Herrscher durften untereinander und mit fremden Mächten Allianzen
221
222
III. · Die deutschen Territorien um 1648–1760
bilden, solange sie sich nicht gegen den Kaiser oder das Reich richteten. 1654 verlieh der Reichstag allen Herrschern das unumschränkte Recht, Steuern für die Reichsverteidigung zu erheben. 1658 wurde dies durch die Wahlkapitulation Leopolds I. bekräftigt, die die Rechte der Territorialstände auf unabhängiges Handeln beschränkte und es Untertanen untersagte, gegen die Erhebung solcher Steuern vor den Reichsgerichten zu klagen. Diesen Rechten stand indes eine Reihe von Einschränkungen gegenüber. 1670 verweigerte Leopold I. den Fürsten eine Ausweitung ihrer Steuerhoheit, was dem Kaiser und den Reichsgerichten die Möglichkeit gab, die Rechte von Territorialständen vor »absolutistischen« Herrschern zu schützen. 14 Viele andere Aspekte der Abkommen von 1648, vor allem die zahlreichen Bestimmungen hinsichtlich des konfessionellen Status quo, schränkten über den Korpus anerkannter Grundgesetze aus der Zeit vor 1648 hinaus ebenfalls die Landeshoheit ein. Die territorialen Übereinkünfte in Territorien und Städten, im Großen und Ganzen eine Mischung aus alten Gesetzen und Bräuchen, kaiserlichen Privilegien und spezifischen Statuten jüngeren Ursprungs, waren höchst unterschiedlich, aber im Allgemeinen durch die Reichsverfassung abgestützt. Das hinderte manche Herrscher nicht an Versuchen, die wichtigste Garantie von allen zu unterlaufen, den Schutz der territorialen Stände. 1769 schimpfte Johann Jacob Moser über die Bestrebungen von Friedrich Wilhelm I. († 1740) und Friedrich dem Großen († 1786), eine »despotische, willkürliche und unumschränkte Herrschaft« zu errichten, deren Recht einzig darauf beruhe, dass »sie 100.000 Mann auf den Beinen halten, und keinen Richter über sich, oder doch selbigen nicht zu fürchten haben«. 15 Mochten andere Herrscher auch davon träumen, ihnen nachzueifern, blieben die brandenburgischen Kurfürsten doch die Ausnahme. Denn, wie Moser betont, selbst jene Herrscher, die gar nicht mit Ständen ringen mussten, waren an das Reichsrecht gebunden. Es möge wahr sein, schrieb er, dass Reichsstände ohne Landstände etwa in der Gesetzgebung freiere Hand hätten als jene mit Landständen, das heiße aber nicht, dass ihre Macht unbeschränkt sei: »Probire es ein solcher Fürst, Prälat, oder Graf, schreibe Steuren aus so vil er will, halte Soldaten nach Gefallen, usw. und lasse es zur Klage an einem höchsten Reichs-Gerichte kommen, man wird ihm bald nachdrücklich zeigen, dass und wie eingeschränckt seine Landes-Hoheit seye.« 16 1786 stellte Johann Stephan Pütter fest, dass unter der 1648 eingeführten Reichsverfassung »ein jeder Landesherr Mittel und Wege genug hat, in seinem Lande Gutes zu thun, und, wenn er hingegen Böses thun möchte, entweder Landstände dagegen treten, oder auch alle und jede Unterthanen noch bey einem höhern Richter Hülfe suchen können«. 17 Schließlich standen nach 1648 alle deutschen Territorien vor denselben Aufgaben des Wiederaufbaus, der Wiederherstellung der Ordnung, Anpassung an den
22. Ein deutscher Absolutismus?
veränderten konstitutionellen Rahmen und die neuen politischen und wirtschaftlichen Bedingungen, die internationalen Konstellationen des späteren 17. Jahrhunderts. Ihr Umgang damit war geprägt von der gemeinsamen Erfahrung des konstitutionellen Prozesses seit den Reformvorschlägen Maximilians I. um 1500 und den Veränderungen im Zuge der Reformation in den 1520er Jahren. Diese Kontinuität der Gesetze, Bräuche und Institutionen war von grundlegenderer Bedeutung als irgendwelche französischen Vorbilder. Aber auch als übertragbares Etikett wird der Begriff »Absolutismus« der komplexen Entwicklung der deutschen Territorien nach 1650 nicht gerecht. Bestenfalls vermittelt er einen Eindruck einer bestimmten Phase energischerer Regierungstätigkeit, umreißt aber nicht den bemerkenswerten Aufschwung der deutschen Territorien nach 1648, das Wiederaufleben der höfischen Gesellschaft und der territorialen Regierungen, deren Tätigkeitsbereich sich deutlich erweiterte.
Anmerkungen 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10
11 12
Pečar, »Gesellschaft«, 192 f. Wilson, Absolutism, 8 f. Wolgast, »Sicht«; Faulenbach, Ideologie, 38–42. Henshall, Absolutism, 1–5, 207–210; Willoweit, Verfassungsgeschichte, 174. Henshall, »Early Modern Absolutism«, 53. Hochedlinger, Wars, 13–26. Kretschmer, Geographie, 600. Die folgenden Zahlen beruhen auf den Listen bei Wilson (Reich, 364–377), Wallner (»Reichsterritorien«) und (mit Einschränkungen) Kretschmer, Geographie, 613–616. Wallner und Wilson beziehen sich etwa auf das Jahr 1800, Kretschmer auf 1770. Für diesen Überblick über die Situation um 1700 wurden die Zuwächse und Verluste von 1700 bis 1800 berücksichtigt. Keine der in den genannten Werken enthaltenen Zahlen ist mehr als eine grobe Annäherung anhand zeitgenössischer Schätzungen in deutschen Meilen (ca. 7,4 km). Ungenauigkeiten sind nicht zuletzt auf die unterschiedliche Länge der Meile in unterschiedlichen Gegenden zurückzuführen. Zum Vergleich: London war zur gleichen Zeit etwa 1.500 km 2 groß, die Grafschaft Cambridgeshire 3.000 km 2. Sutter, »Kaisertreue«, 284 f.; einige Territorien waren im Besitz von Kollektiven, Fürsten, Reichsstädten, Reichsabteien und Institutionen (wie der Universität von Würzburg), die somit stimmberechtigte Mitglieder der diversen Kantone und regionalen Verbindungen von Reichsrittern waren, in denen sie es mit tiefen Ressentiments alter Familien zu tun bekamen. Wilson, Reich, 41 f., führt 10.000 km 2 mit 450.000 Einwohnern auf; Godsey, Nobles, 8, spricht von etwa 5.000 km 2 mit 400.000 Untertanen, verteilt auf circa 1.500 Territorien; Hartmann, »Bevölkerungszahlen«, 347 f., der hierzu die verlässlichsten Zahlen liefert, schätzt die Bevölkerung dieser Gebiete um 1800 auf 250.000. Berbig, Bamberg, 6–10. Westphal, Rechtsprechung, 24–39; Fichtner, Protestantism, 14. Eine Liste deutscher und anderer Primogenituranordnungen findet sich bei Neuhaus, »Chronologie«.
223
224
III. · Die deutschen Territorien um 1648–1760
13 14 15 16 17
Die vier waren Weimar, Coburg, Gotha und Meiningen. Schindling, Bildung, 32 f. Vgl. S. 73 f. Willoweit, Rechtsgrundlagen, 169 f. Volckart, »Zersplitterung«, 21 f. Pütter, Entwickelung II, 183; vgl. auch Marquardt, »Aberkennung«, 74.
23. Der Blick der Zeitgenossen: Vom Wiederaufbau zur frühen Aufklärung
S
o etwas wie eine Theorie des Absolutismus gab es im Reich nicht. Seit dem frühen 17. Jahrhundert arbeiteten deutsche Autoren mit dem neuen Vokabular und den Konzepten der gängigen europäischen politischen Theorien. Bei allen Unterschieden gab es einige Hauptströmungen. Fast alle Richtungen lehnten Machiavelli ab. Bodins Theorie der Souveränität bekam vor dem deutschen Hintergrund durch die Unterscheidung zwischen der Souveränität des Reichs und der Übertragung von Regierungsgewalten auf die Stände eine ganz andere Bedeutung. Den Theorien von Hobbes und Spinoza ging es später ebenso wie denen von Machiavelli; deutsche Autoren verdammten sie fast unisono als gottlos und unmoralisch. Selbst vermeintlich weltlich ausgerichtete Vorläufer der Aufklärung wie Pufendorf und Thomasius distanzierten sich von Hobbes’ Theorien, die sie als grausame und brutale Willkürherrschaft empfanden. 1 Am empfänglichsten zeigten sich deutsche Autoren für die Vorstellungen von Justus Lipsius. Katholiken und Protestanten lasen sie in ihren jeweiligen konfessionellen Vorlieben angepassten unterschiedlichen Ausgaben, dennoch fanden Lipsius’ Schriften zu den Techniken der Herrschaft in Berlin und Hannover ebenso Anklang wie in München und Wien. 2 Kitzligen Themen wie der Volkssouveränität wich Lipsius aus und präferierte klar eine Wahl- oder Erbmonarchie. Sein Interesse konzentrierte sich auf die Voraussetzungen einer effektiven Regierung. Das Gewicht, das er dem Gehorsam der Bevölkerung, der Loyalität der Bürokratie und einer disziplinierten Armee beimaß, schien ein perfektes Rezept für Stabilität und Zusammenhalt zu liefern. Lipsius’ anhaltende Beliebtheit in Deutschland wurde in den 1650er Jahren durch das Interesse vieler Deutscher am Wohlstand der Niederlande noch verstärkt. Wie sich die niederländischen Erfolge auf Deutschland übertragen ließen, war ein Kernthema deutscher Autoren. Über Frankreich hingegen wussten nur sehr wenige etwas Positives zu sagen; die dortige Monarchie wurde meist als militärische Despotie dargestellt, die im Vergleich mit der Freiheit im Reich schlecht abschnitt. 3 Zwar mag die französische Sprache, Kultur und Mode die vornehme Gesellschaft in Deutschland um 1700 im Sturm erobert haben, wie Thomasius beklagte. 4 Was das Regieren anging, war das niederländische Beispiel jedoch prägender. Das vielleicht wichtigste Charakteristikum der deutschen Tradition, selbst
226
III. · Die deutschen Territorien um 1648–1760
wenn sie einem Fürsten umfängliche, göttlich verliehene Macht zuschrieb, war ihr Interesse an den Grenzen dieser Macht. 5 Die meisten Autoren bevorzugten die Monarchie, bemühten sich jedoch um deren klare Unterscheidung von Despotie und Tyrannei. Es ging ihnen darum, Fürsten zu befähigen, effektiv im Dienst des Gemeinwohls zu regieren. Dazu banden sie deren Macht an grundlegende Gesetze und Konzepte individueller Rechte und Freiheiten. Diese Ansätze spiegelten die eigene Situation politischer Autoren in Deutschland wider. Einerseits waren sie als Professoren an territorialen Universitäten oder Regierungsbeamte zumeist Angestellte von Fürsten und beruflich verpflichtet, die Macht ihrer Dienstherren zu unterstreichen. Andererseits gehörten sie Verbänden an (zum Beispiel Universitäten oder Ständen), die Privilegien und Rechte forderten. Darüber hinaus gab das Reich selbst auf verschiedenen Ebenen einen gesetzlichen Rahmen vor, der 1648 formalisiert wurde. Der Westfälische Friede bekräftigte die Landeshoheit der Fürsten und ihre Regierungsgewalt in den Ländern, ihr Recht, an Entscheidungen teilzuhaben, die das Reich betrafen, und Allianzen mit fremden Mächten beizutreten, aber Souveränität gestand er ihnen nicht zu. Zwar erhielten die Fürsten 1654 das Recht, zur Reichsverteidigung Steuern zu erheben, aber der Kaiser verhinderte mit seinem Veto von 1670 die Ausweitung dieses Rechts auf alle Arten der Verteidigung. 6 Weitere Einschränkungen der Herrschaft ergaben sich aus den Rechten Einzelner aufgrund der religiösen Abkommen: aus der grundsätzlichen Glaubensfreiheit und dem Schutz vor religiöser Diskriminierung, dem Recht, ohne Zahlung überhöhter Gebühren auszuwandern und jede Art von Besitz in dem verlassenen Territorium zu veräußern. Diese Rechte dienten zur Absicherung, nachdem man den Fürsten das Recht zugestanden hatte, die Konfession ihrer Länder festzulegen (ius reformandi). Aber die Idee, dass alle Deutschen Freizügigkeit und Besitzrechte genossen, wurde schnell verallgemeinert. Mitte des 18. Jahrhunderts bildete sie den Kern der von Johann Jacob Moser definierten Grundrechte des Einzelnen im Reich. 7 Das deutsche Denken über Regierung und Herrschaft in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts war größtenteils von den gesetzlichen und konstitutionellen Problemen geprägt, die die Krise des Verhältnisses zwischen der Krone und den Reichsständen aufgeworfen hatte. Nach 1648 verlagerte sich die Gewichtung. Traditionell galt die Aufrechterhaltung von Frieden und Gerechtigkeit als wesentlichste Aufgabe der Regierung. Im 16. Jahrhundert nahm die Betonung der Verantwortung für Wohlstand und Gemeinwohl zu, die sich im Zuge der Reformation auf den religiösen Bereich ausweitete. Durch die praktischen Notwendigkeiten des Wiederaufbaus nach dem Krieg stand nun der materielle Wohlstand im Mittelpunkt. Zugleich erforschten Autoren, die sich mit den neuen naturrechtlichen Theorien befassten, die Folgen der Abkommen von 1648 für die Territorien.
23. Der Blick der Zeitgenossen: Vom Wiederaufbau zur frühen Aufklärung
Ein Buch, das die Stimmung unmittelbar nach dem Krieg beispielhaft einfing, war Veit Ludwig von Seckendorffs Teutscher Fürsten-Stat (1656), mit zwölf Auflagen einer der wenigen Bestseller des Genres und bis etwa 1750 ein Standardwerk an deutschen Universitäten. 8 Es gilt auch als grundlegende Schrift des Kameralismus, der deutschen Variante des Merkantilismus. 9 Zwar schöpft Seckendorffs Werk aus den Traditionen des 16. Jahrhunderts, es eröffnete jedoch auch neue Perspektiven. Während der Merkantilismus Förderung und Schutz des Handels betonte, lag der Schwerpunkt des Kameralismus auf Landwirtschaft und Bevölkerungswachstum und hierbei in erster Linie auf der Verteilung von Rohstoffen und Erträgen. Kameralistische Schriften deckten jedoch das gesamte Spektrum an Regierungsaktivitäten ab und bildeten ein Genre, das seine Blüte im 18. Jahrhundert an deutschen Universitäten in der systematischen akademischen Befassung mit Herrschaft erreichte. Seckendorff (* 1626, † 1692) diente Herzog Ernst von Sachsen-Gotha als Kanzler; sein Handbuch war teils eine Beschreibung der administrativen Strukturen des Herzogtums, teils eine Art Ratgeber zur weiteren Förderung des Wohlergehens des Territoriums für seinen Dienstherren und andere Herrscher, erfüllt von einem zutiefst konservativen lutherisch-christlichen Ethos in der Tradition lutherischer Autoren wie Melchior von Osse, Georg Obrecht und Dietrich Reinkingk. Seine Ideen hatten auch viel mit dem Genre der Hausväterliteratur gemein, das vom frühen 17. Jahrhundert bis um 1730 florierte. Derartige Ratgeber für Haushaltsvorstände richteten sich an Väter, Grundbesitzer und Fürsten und enthielten Informationen zu sämtlichen denkbaren Bereichen von Gesundheit über Bienenzucht bis hin zum Getreideanbau. 10 Aber Seckendorffs Werk war umfassender als das seiner Vorgänger und es ging über sie und die Hausväterliteratur hinaus. Er beschrieb die deutschen Territorien als in zweierlei Weise beschränkt: Sie waren dem Reich untergeordnet, seinen Gesetzen und Bräuchen unterworfen und an Verpflichtungen gegenüber ihren Ständen und Untertanen gebunden. Letztere, mahnte er die Fürsten, waren keine Sklaven, ihre religiösen Traditionen, ihr Besitz und ihre Rechte mussten respektiert werden. 11 Das letzte Ziel guter Herrschaft sei nicht materieller Reichtum oder das Wohlergehen des Herrschers, sondern die »Verherrlichung Gottes«. 12 Neuartig war an Seckendorffs Werk vor allem die Konzentration auf Wirtschaftspolitik im weitesten Sinn, weit über die Verwaltung von Ländereien und die fiskalischen Interessen früherer Autoren hinaus. Detailliert widmete er sich der Ausbeutung natürlicher Rohstoffe, Förderung von Handwerk und Handel, Regulierung des Ausbaus der Wasserwege und Straßen, empfahl Maßnahmen zur Erhöhung der Attraktivität eines Territoriums für Zuwanderer und zur Verbesserung der Arbeitsleistung: Versorgung mit Hebammen, Ärzten, Krankenhäusern und Hospizen für Alte und Kranke, Betreuung und Erziehung der Jugend, Sauber-
227
228
III. · Die deutschen Territorien um 1648–1760
keit von Wasser und Luft, Eindämmung des Alkohol- und Tabakkonsums. Besonders in diesen Punkten griff Seckendorff auf seine Kenntnisse über die Niederlande und vor allem die Sozialpolitik von Amsterdam zurück. 13 Seine Vorschläge überstiegen alles, was selbst die bestorganisierte deutsche Territorialregierung umsetzen konnte, wie er in den Anmerkungen zur Neuauflage von 1665 zugab. Sein letztes großes Werk widmete sich dem Thema Christen-Stat (1685), was man als Zeichen nachlassender Ambitionen, aber auch seiner Entschlossenheit zur Bewahrung der seiner Ansicht nach wichtigsten religiösen Prinzipien der Herrschaft deuten könnte. Sein Einfluss blieb indes ungebrochen. Er wurde 1663 Geheimer Rat und Kanzler in Gotha, ärgerte sich aber bald über die ständigen Einmischungen von Herzog Ernst in alle Regierungsgeschäfte und dessen herrischen Umgang mit Beamten, auch mit Seckendorff selbst, wenn sie andere Meinungen vertraten als er. 14 Daher verließ Seckendorff Gotha 1664 und wurde Geheimrat, Kanzler und Konsistorialpräsident bei Herzog Moritz von Sachsen-Zeitz, Herrscher einer 1656 begründeten Sekundogenitur des albertinischen Kurfürsten von Sachsen. 1681 legte Seckendorff fast alle seine Ämter nieder und zog sich zum Schreiben auf sein Gut zurück. 1691 jedoch nahm er das Angebot an, Geheimrat in Berlin zu werden, und war dann Gründungskanzler der Universität Halle. Dort hielt Thomasius auf ausdrücklichen Wunsch von Friedrich Wilhelm I. die erste Vorlesung zu Seckendorffs Werk. 15 Die Reflexion der Regierungsarbeit in den katholischen Territorien, insbesondere in Österreich, war generell geprägt vom Werk des Jesuiten Adam Contzen (* 1571, † 1635). 16 Sein Politicorum libri decem (Zehn Bücher der Politik) von 1621 projizierte die praktische politische Philosophie von Lipsius auf die deutschen Territorien und enthielt Empfehlungen zur Steuer- und Wirtschaftspolitik, die Seckendorffs Kameralismus sehr ähnlich waren. 17 Worin er sich unterschied, war sein bedingungsloses Bekenntnis zur religiösen Einheit, speziell zur Rekatholisierung. Contzen zufolge war sie am besten in einer Erbmonarchie zu erreichen, deren Macht nur eingeschränkt war durch das Gewissen des Herrschers und seine Pflicht, sich den Gesetzen von Gott und Natur zu unterwerfen. 18 Es sei sinnvoll, meinte er, das Volk und den Adel in gewissem Maß an der Regierung zu beteiligen und Entscheidungen über Steuern, Gesetze, Krieg und Frieden in Absprache mit dem Adel, den Städten und anderen Ständen zu treffen. 19 Letztlich aber seien die Grenzen der Herrschaft eher moralischer als konstitutioneller Natur; jegliches Recht, sich einem ungerechten Monarchen zu widersetzen, bestritt er energisch. Contzen schrieb sein Buch als Kanzler der Universität Mainz und widmete es Ferdinand II.; seine Ideen fanden Eingang in die Regierungsarbeit von Bayern unter Herzog Maximilian I., dessen Beichtvater er 1623 wurde. In katholischen Territorien blieben sie bis Mitte des 18. Jahrhunderts einflussreich. Das Engagement von Contzen und anderen katholischen Jura- und Politiklehrern für das deutsche
23. Der Blick der Zeitgenossen: Vom Wiederaufbau zur frühen Aufklärung
Territorium als Teil des Reichs formte ihr Denken ebenso wie das ihrer protestantischen Kollegen. Ihren Glauben an die göttliche Bestimmung der Monarchie dämpfte die Sicht der politischen Struktur von Reich und Territorien als beschränkten Monarchien. Zugleich aber verhinderte das jesuitische Monopol auf höhere Bildung und das Fehlen einer umfangreichen Klasse von Akademikern und Funktionären, wie sie in den protestantischen Territorien entstand, dass diese Ideen ähnlich genau beleuchtet und öffentlich debattiert wurden. Der Ausgangspunkt für Seckendorff und Contzen war die Erfahrung des Dreißigjährigen Krieges und seiner unmittelbaren Folgen. Die österreichischen Kameralisten oder Merkantilisten Johann Joachim Becher, Philipp Wilhelm von Hörnigk und Wilhelm von Schröder verbanden Elemente von Seckendorff und Contzen, interessierten sich aber besonders für die Bedrohung des Reichs durch Frankreich in den 1670er Jahren. Jeder von ihnen war an Projekten zur Förderung des Reichs insgesamt beteiligt und alle lassen sich mit Plänen für die Entwicklung der österreichischen Monarchie im Speziellen in Verbindung bringen. 20 Andererseits arbeitete Becher zu verschiedenen Zeiten auch für die Regierungen in Mainz und Bayern und anderswo. Alle drei glaubten wie Seckendorff, die Ideen, die sie im Dienst einer bestimmten Dynastie formulierten, ließen sich auf andere Dynastien übertragen, ungeachtet der konfessionellen Differenzen. Für sie war das Territorium ein untergeordnetes Element des Reichs, auch wenn das im Fall Österreichs durch den Ausnahmestatus der Territorien der Habsburger und deren Herrschaft über Gebiete außerhalb des Reichs etwas komplizierter war. Dennoch betrachteten sie die Habsburger als beispielhafte deutsche Herrscher, die anderen Fürsten den Weg weisen konnten. Die Vorschläge der österreichischen Kameralisten zur Stimulation und Regulierung von Produktion und Handel wiederholten die Lehren ihrer Vorgänger. Sie erweiterten sie um merkantilistische Maßnahmen nach dem Vorbild neuerer französischer, englischer und niederländischer Denker. Die frühen Kameralisten waren von praktischen Problemen des Regierens ausgegangen, die nächste Generation fokussierte eher auf die Wirtschaft als solche. Ihre Schriften enthielten die typische merkantilistische Mischung widersprüchlicher Prinzipen von freiem Handel, Protektionismus und Autarkie: Mal empfahlen sie die Schaffung von Monopolen, mal deren Abschaffung, mal die Förderung und mal die Unterbindung wirtschaftlicher Neuerungen. 21 Der originellste und am meisten dem Reich verschriebene von ihnen war wohl Becher. 22 Er glaubte fest an die Erbmonarchie unter einem starken Herrscher zur Verhinderung interner Konflikte. Andererseits musste der Herrscher auf den Rat seiner territorialen Stände hören. Aber Becher dachte über die traditionelle Ständeordnung hinaus. Die zivile Gesellschaft bestand für ihn aus zwei Teilen: einem wichtigen, der aus seiner Sicht aus den produktiven Ständen der Bauern (wozu er
229
230
III. · Die deutschen Territorien um 1648–1760
auch Bergleute und andere Rohstoffproduzenten zählte), der Handwerker und der Händler bestand, unter denen die Händler am wichtigsten waren, und einem unproduktiven Teil, der Kleriker, Akademiker und Lehrer, Ärzte, Soldaten und die Regierung (samt dem Adel) umfasste; ihre Aufgabe war es, den produktiven Klassen zu dienen. In mancher Hinsicht nahm Becher die Idee der Zivilgesellschaft des späten 18. Jahrhunderts vorweg.23 Seine futuristische Vorstellung war sicherlich utopisch in einer der Erhaltung ihrer traditionellen Ordnung verpflichteten Gesellschaft, und seine Ideen von Staat und Gesellschaft, die er nie systematisch formulierte und teilweise auch nicht veröffentlichte, zeigten keine Wirkung. Seine spezifisch ökonomischen Empfehlungen, die die Effektivität der produktiven Klasse fördern sollten, wurden jedoch von Hörnigk und Schröder in einer Weise aufgegriffen, die die persönliche Freiheit, die Becher den Produzenten implizit zuschrieb, ausschloss oder zumindest überging. 24 Die Einsichten, die Hörnigk 1673 auf seiner gescheiterten Mission zur Förderung des Handwerks in den österreichischen Erblanden gewann, legte er 1684 in dem merkantilistischen Traktat Österreich über alles, wann es nur will nieder, das den Kaiser mahnte, als ersten Schritt im Kampf gegen den ökonomischen Einfluss Frankreichs auf das Reich die Wirtschaft seiner eigenen Länder zu optimieren. Schröders Fürstliche Schatz-und Rentkammer (1686) verband ein ähnliches Spektrum von Vorschlägen mit der klaren und im deutschen Kontext seltenen Feststellung der Prinzipien göttlich verliehener Macht. 25 Tatsächlich war Schröder einer der wenigen eingeschworenen deutschen Anhänger von Hobbes, den er in England kennengelernt hatte. 26 Anders als Becher mit seiner weitläufigen Vorstellung der Verbesserung der menschlichen Existenz als Endziel von Staat und Gesellschaft betonte Schröder nur ein Ziel der Regierungsarbeit: Reichtum und Einkommen des Herrschers zu steigern. Auch er wies jedoch darauf hin, dass die Verknüpfung zwischen dem Wohlstand des Herrschers und dem seiner Untertanen bedeutete, dass Unterdrückung und Tyrannei zu vermeiden waren. 27 Wie radikal Schröder vom Mainstream deutschen Denkens abwich, unterstreicht die parallele Entwicklung der Naturrechtstheorien im protestantischen Lager. 1719 veröffentlichte der Helmstedter Professor Gottlieb Samuel Treuer (* 1683, † 1743) eine Ausgabe von Schröders Werk, die seinen Kameralismus pries, seine Ansichten zur Regierung jedoch als Rechtfertigungsversuch der barbarischsten Form von Despotismus verdammte. 28 Treuer selbst stach als kompromissloser Vertreter der Rechte der Territorialstände und Kritiker der sogenannten Preußischen Schule des Naturrechts aus der protestantischen Welt heraus. Er schrieb seine Werke zur Unterstützung der Mecklenburger Stände in ihrem Kampf gegen den tyrannischen Herzog Karl Leopold und fand nur Lob für die Rolle Karls VI. in der Bewahrung der Rechte des mecklenburgischen Adels im Gegensatz zur Feind-
23. Der Blick der Zeitgenossen: Vom Wiederaufbau zur frühen Aufklärung
seligkeit von Ferdinand II. und Ferdinand III. gegenüber den Ständen ihrer eigenen Länder und des Reichs. 29 Dennoch stand Treuer auch entschieden in der Naturrechtstradition, die sich in den protestantischen Territorien seit dem Dreißigjährigen Krieg herausgebildet hatte und deren prominenteste Vertreter der Preußischen Schule verbunden waren. Der Begriff ist etwas missverständlich. Zum einen entwickelte der erste große deutsche Naturrechtstheoretiker, Samuel Pufendorf (* 1632, † 1694), seine Ideen zur Regierung in Diensten des pfälzischen Kurfürsten und der schwedischen Krone; er kam erst 1688 nach Berlin, wo er bis zu seinem Tod 1694 überwiegend historische Werke verfasste. Zweitens wurden seine Ideen zwar in einflussreicher Weise an der brandenburgischen Universität Halle von Christian Thomasius und Christian Wolff weiterentwickelt, sie standen aber beispielhaft für einen viel breiteren Trend an vielen protestantischen Universitäten außerhalb Brandenburgs, die die herausragende Stellung von Herrschern und Regierungen betonten. Zugleich aber begrenzten sie die Privilegien von Herrschern, wenn sie auch nicht so ausdrücklich wie Treuer die Rechte der Territorialstände bekräftigten. Um 1740 wurde die anfängliche Betonung von Frieden und Ordnung als Hauptfunktionen der Regierung verdrängt durch die liberale Unterstreichung individueller Rechte und die Überzeugung, die Regierung habe die Pflicht, einen gesetzlichen Rahmen zu schaffen, der es den Menschen ermöglichte, ihr Potenzial in vollem Umfang zu realisieren. Die ganze naturrechtliche Bewegung stand für den Versuch, nach dem Vorbild geometrischer Methoden (des mos geometricus) in Mathematik und Naturwissenschaft die Prinzipien der Politik unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten neu zu denken. Religiöse, politische und philosophische Kontroversen sollten durch die Herausarbeitung rationaler Prinzipien gelöst werden, die Ordnung und Sicherheit wiederherstellten. Gleichzeitig wehrte sich Pufendorf gegen die mechanistische und gottlose Sicht des Staates, die Hobbes vertrat, für den es nur die Entscheidung zwischen Chaos oder bedingungslosen Absolutismus gab und der nicht zwischen Monarchen und Tyrannen unterschied. 30 Die traditionelle Sozialethik der aristotelischen Tradition nahm Pufendorf auf, indem er behauptete, die Welt und alles, was in ihr entstehe, seien gottgewollt. Er betrachtete den Staat als Ergebnis zweier Kontrakte, die als Resultat von drei menschlichen Entscheidungen bewusst und frei eingegangen würden. Im Staat der Natur nach dem Sündenfall seien menschliche Wesen sowohl gut als auch böse, schwach und stark. Menschen bilden demnach Gesellschaften, weil sie Hilfe und Schutz brauchen, dann entscheiden sie über die Art der Regierung und schließlich schaffen sie diese Regierung durch ein weiteres Abkommen. Dieser Kontrakt ist unumkehrbar, aber er gilt für Herrscher wie für Untertanen. Herrscher haben die Pflicht, dafür zu sorgen, dass Gesetze gerecht sind (also mit den Gesetzen von Gott und Natur in Einklang stehen), dass Friede und Gerechtigkeit gewahrt bleiben und
231
232
III. · Die deutschen Territorien um 1648–1760
sie ihre Macht maßvoll gebrauchen. Regierung, lehrte Pufendorf, müsse stets die Zustimmung des Volkes genießen und ihre Rechte und Würde als Menschen respektieren; Gehorsam wiederum beruhe auf der Voraussetzung, dass die Gesetze auf Recht und Wahrheit fußten. Während Pufendorf an der Gültigkeit des göttlichen Gesetzes festhielt, verwarf Thomasius die Idee eines ius divinum zugunsten des Naturrechts, das Gottes Willen widerspiegele. 31 Er legte auch mehr Gewicht auf die Rechte der Herrscher und ihre Pflicht, neben der Garantie von Frieden und Sicherheit die Wohlfahrt zu fördern. Begonnen hatte er als Optimist, entwickelte dann aber eine viel pessimistischere Sicht des von Willen und Leidenschaft getriebenen Menschen. 32 Deshalb, fand er, gebe die Gesellschaft und insbesondere der Staat dem Menschen die Fähigkeit, seine guten Anlagen zu entwickeln. Der Kontrakt mit dem Staat sei darüber hinaus ein einmaliges Ereignis und nicht umkehrbar, und Untertanen hätten kein legales Recht, sich der Obrigkeit zu widersetzen. Selbst Territorialständen kämen keine angeborenen Rechte zu, wenn diese nicht in einem konstitutionellen Grundgesetz spezifiziert würden. Schärfer als Pufendorf bestand Thomasius des Weiteren darauf, Kleriker hätten keine Rechte in Bezug auf die Regierung. Religion und Ethik waren für ihn rein persönliche Angelegenheiten. Dennoch sah Thomasius moralische und vernunftgemäße Beschränkungen der Herrschaft vor, insbesondere durch Beamte, zu denen in Deutschland selbstverständlich auch die Universitätsprofessoren zählten. In mancher Hinsicht versuchte sich Thomasius an der Quadratur des Kreises: Er stritt für eine starke Regierung ohne legale Einschränkungen und postulierte zugleich die Existenz einer Art öffentlichen Sphäre, bevölkert von Beamten und Gebildeten, die Prinzipien formulierten, Strategien vorschlugen und als diskursive Regulatoren der Autorität wirkten. Die alte Allianz von Thron und Altar sollte durch eine neue von Thron und Hörsaal ersetzt werden. 33 Mehr als Pufendorf schließlich integrierte Thomasius die Förderung der Wohlfahrt in sein Regierungsprogramm. In Halle hielt er selbst die erste Vorlesung zu Seckendorffs Handbuch der Regierungskunst. Die Betonung blieb auf Frieden und Gerechtigkeit und Thomasius gewichtete Stabilität, Ordnung und die Erhaltung des Status quo stärker als die letztgültige Perfektion der menschlichen Gesellschaft. Seiner Ansicht nach waren Erlösung und ethische Vollkommenheit Privatsache. Die Kulmination dieser Tradition in der Philosophie von Christian Wolff brachte paradoxerweise sowohl die weiteste Ausdehnung der Ziele der Regierung als auch die ersten Hinweise auf ihre Beschränkung durch unveräußerliche individuelle Rechte mit sich, die durch die Schaffung des Staats nicht außer Kraft gesetzt würden. Wolff integrierte das gesamte Spektrum des Kameralismus in sein System und übertrug der Regierung die Verantwortung für das Wohlbefinden des Einzelnen und seine Möglichkeiten, sich vollständig und frei zu entfalten, ebenso wie für
23. Der Blick der Zeitgenossen: Vom Wiederaufbau zur frühen Aufklärung
seine Sicherheit. 34 Gleichzeitig bestand er darauf, alle Rechte und Gesetze müssten auf die Natur der Menschen zurückzuführen sein. Wie Thomasius betonte Wolff die entscheidende Bedeutung der Klasse der Beamten und Gelehrten, der er selbst angehörte: War ein Herrscher nicht selbst Philosoph, musste er die Formulierung von Gesetzen jenen überlassen, die Weisheit und Wissen besaßen, und diese Gesetze dann bestätigen. Faszinierenderweise deutete Wolff außerdem an, die beste Form der Regierung sei die »freie Republik«. Er war vernünftig genug, daraus später eine respublica mixta zu machen, legte aber nie den Glauben an angeborene Rechte (iura connata) ab, die nicht im Staat aufgingen: Gleichheit, Freiheit, Sicherheit, Selbstverteidigung und das Recht, einem Herrscher Widerstand zu leisten, der seinen Kontrakt mit dem Volk brach. 35 Aber selbst hier blieb Wolff ausweichend. Die unveräußerlichen Rechte sind bei ihm im Wesentlichen allgemeingültige Prinzipien. Andere, mehr aktive Rechte (Selbstverteidigung, Selbstvervollkommnung) werden schrittweise zu Aufgaben der Regierung, die in so umfassender Weise agiert, dass dem Einzelnen nur noch bleibt, seine Pflicht zu erfüllen, indem er für das Wohl der Gesellschaft als Ganzer arbeitet und produziert. Die Ambivalenz von Wolffs Denken zwischen starkem Staat und freien Menschen macht ihn zur Schlüsselfigur. Er wird uns später als Ausgangspunkt der Kritik des Staats nach 1750 wieder begegnen. 36 Hier markierte er den Gipfel der naturrechtlichen Regierungsphilosophie zwischen dem Dreißigjährigen Krieg und der frühen Aufklärung. Wolffs Bedeutung liegt darin, dass er das Naturrecht mit dem Kameralismus in einer Weise verband, die die dynamische Entwicklung des Einzelnen in der Gesellschaft begünstigt. Es ist daher kein Zufall, dass die ersten Lehrstühle für Kameralismus 1727 an den brandenburgischen Universitäten Halle und Frankfurt an der Oder entstanden. 37 Die Einführung einer neuen akademischen Disziplin brachte die diversen Strömungen ökonomischen Denkens zusammen, die sich ab dem frühen 16. Jahrhundert entwickelt hatten, ihre Vertreter betonten jedoch die Distanz zwischen ihren eigenen systematischen Lehren und den schwerfälligen und hausbackenen Kompendien der Hausväterliteratur. Der akademische Kameralismus verwarf das traditionelle Bild des Fürsten als »Landesvater« zugunsten der Beschreibung des Staats als Maschine. Im Ganzen herrschte jedoch eher Kontinuität als radikaler Wandel. Die scheinbare Säkularisierung der Regierungstheorien war in Wirklichkeit nur die Ablehnung rigider konfessioneller Orthodoxie zugunsten einer eher heterodoxen christlichen Religiosität: Das Naturrecht galt nach wie vor als Ausdruck des göttlichen Willens, Gesellschaft und Staat als von Gott gestiftet. Das Gottesgnadentum monarchischer Herrschaft stellte niemand infrage, auch wenn göttliche Rechte im Sinn von James I. und einigen französischen Theoretikern nie wirklich Eingang ins deutsche Denken fanden. 38
233
234
III. · Die deutschen Territorien um 1648–1760
Wichtiger war in Deutschland, wie die Entwicklung und Ausweitung der Auffassungen der Funktionen der Herrschaft von Gerechtigkeit, Frieden und Wohlfahrt hin zur Förderung von »Glück« zur Heiligung der Policey und der für sie zuständigen Institutionen führte. Ihren konfessionellen Charakter mag die Administration verloren haben, aber sie behielt ihre grundlegend christliche Aura und die erhabene Mission, Menschen in der Gesellschaft zu verbessern. Die anscheinend innovativen Züge der neuen Wirtschaftspolitik wurden durch die grundsätzlich konservativen Vorgaben der Sozialpolitik egalisiert. Die Erzielung höherer Einkünfte und selbst das generelle Ziel der Förderung menschlicher Zufriedenheit wurden für gewöhnlich mit der klaren Ausrichtung auf Erhaltung der bestehenden hierarchischen Ständeordnung verbunden. Soziale Mobilität war in der Theorie nicht vorgesehen und in der Praxis die Ausnahme. Individuelle Rechte hingegen gab es, sie waren im Westfälischen Frieden in der Garantie der Rechte auf Religionsfreiheit und Besitz enthalten, strittig blieb jedoch die Beziehung zur herrscherlichen Gewalt. Bis Mitte des 18. Jahrhunderts genossen die Privilegien und Pflichten der Regierung Vorrang vor den Ansprüchen des Einzelnen. Auch hier erwies sich die Gewichtigkeit des Herkömmlichen: Die alte Tradition der Wohlfahrt und der hierfür vorausgesetzten Bevormundung des christlichen Untertanen wurde in eine neue Sprache übersetzt, aber nicht fallen gelassen.
Anmerkungen 1 Dreitzel, »Hobbes-Rezeptionen«, 263–277, 282–294; Malcolm, Aspects of Hobbes, 520– 535. 2 Oestreich, Antiker Geist, 190 f. 3 Dreitzel, Absolutismus, 79. 4 Barnard, »Thomasius«, 432. 5 Weber, »Theoretical Limits«. 6 Vgl. S. 35, 73 f. 7 Schmidt, »›Deutsche Freiheit‹ und der Westfälische Friede«, 341–346; Weber, »Theoretical Limits«, 906; Feller, »Bedeutung«, 50. 8 Maier, Staats-und Verwaltungslehre, 139–151; Stolleis, Öffentliches Recht I, 352 ff.; Brückner, Staatswissenschaften, 9–32; Stolleis, »Seckendorff«. Der Begriff Staat ist missverständlich: Seckendorff betrachtete die deutschen Territorien nicht als souveräne Staaten und sein Buch befasste sich in erster Linie mit guter Herrschaft. 9 Braeuer, »Kameralismus«. 10 Brückner, Staatswissenschaften, 51–56; Stolleis, Öffentliches Recht I, 338–342; Maier, Staats- und Verwaltungslehre, 173 f.; Brunner, Landleben, 237–312; Haushofer, »Literatur«, 131–140. 11 Schmidt, Geschichte, 240. 12 Stolleis, Öffentliches Recht I, 353. 13 Maier, Staats-und Verwaltungslehre, 146. 14 Klinger, Fürstenstaat, 95 ff.
23. Der Blick der Zeitgenossen: Vom Wiederaufbau zur frühen Aufklärung
15 Maier, Staats-und Verwaltungslehre, 147 f. 16 Bireley, Counter-Reformation Prince, 136–161; Seils, Staatslehre, 191–228; Bireley, Maximilian, 33 ff.; Weber, Prudentia, 117 ff. 17 Seils, Staatslehre, 148–156. 18 Bireley, Maximilian, 33 f. 19 Dreitzel, Absolutismus, 90 f. 20 Winkelbauer, Ständefreiheit I, 454–459; Sommer, Kameralisten II, 1–149; Dittrich, Kameralisten, 58–68; Brückner, Staatswissenschaften, 43–51. 21 Heiss, »Ökonomie«, 216 f. 22 Dreitzel, »Zehn Jahre«, 475–534; Brückner, Staatswissenschaften, 43–47; Sommer, Kameralisten II, 1–78; Heitz, »Folgen«, 346. 23 Schmidt, Geschichte, 239 f. 24 Brückner, Staatswissenschaften, 47–51. 25 Sommer, Kameralisten II, 79–123; Dreitzel, Absolutismus, 80–84. 26 Stolleis, Öffentliches Recht I, 211 f.; Malcolm, Aspects of Hobbes, 512 ff. 27 Brückner, Staatswissenschaften, 50. 28 Dreitzel, Absolutismus, 80 ff., 92–99. 29 Vgl. auch S. 175 f. 30 Hammerstein, »Pufendorf«; Stolleis, Öffentliches Recht I, 282 ff.; Blickle, Leibeigenschaft, 279–292, bietet einen höchst aufschlussreichen Einblick in die Entwicklung von Pufendorfs Denken und dessen Beziehung zur pfälzischen Regierungspolitik. 31 Stolleis, Öffentliches Recht I, 284–288; Luig, »Thomasius«. 32 Brückner, Staatswissenschaften, 179. 33 Luig, »Thomasius«, 232 f.; Barnard, »Thomasius«, 437; Link, Herrschaftsordnung, 346; Schröder, Thomasius, 36–98. 34 Brückner, Staatswissenschaften, 211–228. 35 Klippel, »Aufklärung«, 93–210; Garber, »Menschenrechtstheorien«. 36 Vgl. S. 559 f. 37 Maier, Staats-und Verwaltungslehre, 177 f.; Brückner, Staatswissenschaften, 60–73. 38 Dreitzel, Absolutismus, 9, 84 f.
235
24. Die kleineren Territorien
I
n mancher Hinsicht ging jedes Territorium im Reich seinen eigenen Weg. Lokale und regionale legale und administrative Traditionen sorgten für eine Unzahl von Varianten, die sich in eigenwilligen Sprachgebräuchen niederschlugen. Die offensichtliche linguistische und substanzielle Anarchie zeigte sich auch in der außerordentlichen Vielfalt so grundlegender Dinge wie Münzen, Gewichte und Längenmaße. 1 Dennoch zeigten sich ab dem späten 15. Jahrhundert gemeinsame Grundzüge, die man fast so etwas wie eine Norm nennen könnte. Die meisten Territorien entwickelten ähnliche Institutionen und reagierten mit ähnlichen Reformversuchen auf die Herausforderung von religiösen und politischen Unruhen. Gleichzeitig wichen einige Territorien in wichtigen Punkten von der allgemeinen Tendenz ab; die Betrachtung ihrer Eigenheiten erhellt die Gemeinsamkeiten der Masse. Auf der einen Seite waren Österreich und Brandenburg-Preußen deutlich größer und mächtiger als irgendeines aus der nächsten Gruppe von Territorien, den übrigen säkularen Kurfürstentümern Hannover, Sachsen, Bayern und Pfalz. Im 18. Jahrhundert, so heißt es oft, waren Brandenburg-Preußen und Österreich schlicht zu groß und mächtig, um Angehörige des Reichs zu bleiben. Manche österreichischen Historiker meinen, Österreich sei im 17. Jahrhundert »dem Reich entwachsen«, habe sich zur Großmacht gemausert und das Interesse am Kuddelmuddel der deutschen Politik verloren. Deutsche Historiker sprechen ebenso gern vom »Aufstieg Preußens« als Herausforderung der österreichischen Hegemonie im Reich, als Kraft, die für Werte und Perspektiven stand, die angeblich nicht mit dem Reich vereinbar waren, und als Macht, die »deutscher« war als die habsburgischen Länder. Am anderen Ende standen Reichsritter, -grafen, -prälaten und -städte. Sie hatten im 16. Jahrhundert eine wichtige Rolle gespielt und sich in diversen Institutionen des Reichs etabliert, aber vielen von ihnen fiel es schwer, mit den Herausforderungen der hundertfünfzig Jahre nach dem Westfälischen Frieden umzugehen. In einer von Fürsten mit Anspruch auf Königswürden bevölkerten Welt standen der niedere Adel und vor allem die Kommunen zunehmend im Schatten. Sie entwickelten nicht die neuen, intensiveren Formen der Administration, die zum Charakteristikum der Mehrheit der Territorien wurden, galten als nicht mehr zeitgemäß, und im 19. Jahrhundert meinten Historiker, ihr Überleben wie das der
24. Die kleineren Territorien
kirchlichen Territorien belege, dass das Reich selbst nicht mehr in das Zeitalter des Nationalismus gepasst habe und zum Untergang verurteilt gewesen sei. Unter den weniger Mächtigen nahmen die Reichsritter eine Sonderstellung ein, weil sie weder »mit Sitz und Stimme« im Reichstag noch in den Kreisversammlungen vertreten waren. Im 16. Jahrhundert hatten die Ritter zunehmend formale Standesgremien gebildet, die in den drei Ritterkreisen (in Schwaben, Franken und dem Rheinland) gipfelten. Sie waren unterteilt in Kantone mit je eigenem Generaldirektor, Direktorat und nichtadligen juristischen und klerikalen Bediensteten. Das Amt des Generaldirektors, der die Interessen sämtlicher Reichsritter in Wien vertrat und ein wachsames Auge auf die höheren Gerichte des Reichs hatte, rotierte zwischen den drei Ritterkreisen. In gewisser Weise erfüllten diese Institutionen zumindest einige der administrativen Bedürfnisse der Ritterdynastien. Zudem boten sie die Möglichkeit eines gemeinsamen Auftretens gegenüber dem Kaiser und der Organisation der kollektiven Zahlungen an ihn. Dass diese Gelder nicht im Reichstag oder den Kreisversammlungen beschlossen wurden, setzte die Reichsritter noch weiter von den Reichsständen ab, da die Ritter darauf beharrten, es handle sich nicht um Steuern, sondern um freiwillige Beiträge (Charitativsubsidien). Versuche der Ritter, als Reichsstände anerkannt zu werden, scheiterten in den 1650er, 1680er und 1770er Jahren. Unter ihnen selbst herrschte oft Uneinigkeit, was ihre Optionen anging, und die nachfolgenden Kaiser zeigten aufgrund der Vorteile ihrer direkten Abhängigkeit von der Krone wenig Neigung, den Status quo zu ändern. 2 Die periodischen Initiativen hatten unterschiedliche Motive. In den 1650er Jahren argumentierten einige führende Fürsten, so etwa der Kurfürst von Mainz, die fortdauernde Existenz einer Gruppe Adliger, die direkt der Krone untertan waren, eröffne zu viele Möglichkeiten für ein direktes kaiserliches Eingreifen im Reich. Aus Sicht der Ritter selbst stellte die anhaltende Feindseligkeit vieler Territorialfürsten die Verlässlichkeit kaiserlichen Schutzes infrage, die man durch eine Vertretung im Reichstag und den Kreisversammlungen eher gewährleistet sah. Als besonders beharrliche Gegner zeigten sich die Grafen von Württemberg, deren Territorien infolge des »Ausscheidens« der Ritter im Spätmittelalter dezimiert und fragmentiert worden waren. In zahlreichen Verfahren vor dem Reichshofrat ging es um Land, Rechtsprechung, Zölle und Steuern, wobei in jedem einzelnen Fall ausgiebig juristisch dargelegt wurde, weshalb die Reichsritter keine echten Herrscher waren. 3 1702 wandte sich der Herzog von Württemberg an den Reichstag und bildete bis 1713 eine Allianz mit der Pfalz, Hessen-Darmstadt, den brandenburgischen Markgrafen von Kulmbach und Ansbach und dem Bischof von Würzburg, um die Privilegien der Ritter ein für alle Mal abzuschaffen. Der Kaiser reagierte auf diese Drohungen stets mit einer Bestätigung der Rechte der Ritter und betonte dabei insbesondere das Recht der Kantone und General-
237
238
III. · Die deutschen Territorien um 1648–1760
direktoren, in gleicher Weise wie die Fürsten Steuern für das Reich zu erheben und gewaltsam gegen Zahlungsverweigerer vorzugehen. 1718 ließ Karl VI. die Fürstenallianz abblitzen und bekräftigte offiziell die Privilegien der Ritter. Die juristische Debatte war damit endgültig beigelegt, fortan widmete sich eine wachsende Anzahl von Schriften der Auflistung und Auslegung der solcherart bestätigten Rechte. Ein neuer Anlauf von Württemberg, Brandenburg-Bayreuth und Sachsen-Meiningen 1750–1753 änderte daran nichts mehr. 4 Die Sicherheit hatte freilich ihren Preis. In den 1680er Jahren boten die Reichsritter an, ihre bisher je nach Anlass pauschal bezahlten Beiträge in eine reguläre Steuer umzuwandeln, die sich nach den vom Reichstag verabschiedeten Steuersätzen richten würde. Leopolds Ablehnung des Angebots stärkte im Endeffekt die Verbindungen zwischen Reichsrittern und Krone, weil er dadurch die Möglichkeit hatte, weiterhin auf ihre beträchtlichen finanziellen Mittel zuzugreifen, die im Gegensatz zu den vom Reichstag beschlossenen Steuern direkt an ihn bezahlt wurden. 5 Die zwischen 1653 und 1718 beschlossenen Privilegien sicherten nicht nur die direkte Untertanenschaft der Reichsritter, sondern auch ihre ökonomische Basis. Ein weiterer wichtiger Aspekt war die Ermächtigung der Direktoren und Konzile der Ritterkreise und Kantone, gegen Untertanen vorzugehen, die Steuerzahlungen verweigerten, und die Finanzen von Rittern zu ordnen, deren Schulden ihren Bankrott befürchten ließen. Aus kaiserlicher Sicht war diese Politik im Großen und Ganzen erfolgreich; die Ritter leisteten substanzielle Abgaben an die Krone. Die Auswirkungen auf einzelne Familien sind weniger klar. Es gibt keine vollständige Liste der Ritter und schon gar keine umfassende Aufstellung ihrer Besitztümer und Schulden. Die Anzahl von 350 Familien mit 1.500, insgesamt 10.455 km 2 umfassenden Ländereien und etwa 400.000 bis 450.000 Untertanen beruht auf ihren Entschädigungsforderungen während der Revolutionszeit. In Wirklichkeit waren es wahrscheinlich mehr als 400, vielleicht auch 500 Familien, wenn man die ohne Landbesitz berücksichtigt. 6 Ihre Situation war je nach Region höchst unterschiedlich. Die katholischen Ritter um Mainz und die anderen kirchlichen Territorien waren oft in der Lage, ihre Einkünfte durch Kanonikate und andere kirchliche Benefizien aufzustocken. Der Mainzer Hof bot zudem Stellen für Protestanten, ebenso wie der kaiserliche Hof und die Administration sowohl für katholische als auch protestantische Ritter. 7 Neuere Forschungen zu den Reichsrittern von Mainz und anderswo legen nahe, dass das traditionelle Bild ihrer hoffnungslosen Verschuldung und Abgesondertheit einer gründlichen Revision bedarf. Natürlich kam es vor, dass die Kantone einschreiten mussten oder der Reichshofrat Kommissionen (meist aus Mitgliedern des Kantonsdirektorats) einsetzen musste, um die Schulden eines so gut wie bankrotten Ritters zu ordnen. Die spektakulärsten Fälle gingen eindeutig auf leichtfer-
24. Die kleineren Territorien
tige Extravaganz oder gar Kriminalität zurück. Oft waren erhebliche Schuldenberge auch durch ebenso beträchtliche Vermögenswerte abgesichert. Bedenklicher als das Thema Schulden war die geringe Effektivität der ritterlichen Korporationen in Belangen, die über finanzielle Schurkereien hinausgingen. So beklagten etwa die Kreise wiederholt, dass die Kantone nicht gegen Zigeuner und Vagabunden vorgingen, und überhaupt scheinen sie sehr zurückhaltend gewesen zu sein, was den Einsatz administrativer Mittel anging. Eine vermittelnde Autorität wie die Kreise entwickelten sie nie wirklich. Daher wirkten die Ländereien der Ritter zunehmend altmodisch und regellos. Es fehlte auch an einer Form der Solidarität und Gemeinsamkeit, die ihnen ermöglicht hätte, auf der Bühne des Reichs politisch mitzuspielen. Wie ihre Geschichte nach 1750 zeigt, waren sie zu echter Reichspolitik nicht fähig. 8 Bei den Reichsgrafen war das nicht so viel anders. Allerdings hatten sie Stimmrechte im Reichstag, wenn auch nur kollektiv für die diversen regionalen »Bänke« der Regionen in Schwaben, der Wetterau, Franken, am Niederrhein und in Westfalen. 9 Ihr höherer sozialer Rang eröffnete ihnen am Kaiserhof mehr Arbeitsmöglichkeiten als den Rittern, obwohl viele von ihnen auch Kurfürsten und mächtigeren Fürsten dienten. 10 Aber der höhere Status und die Nähe zu den Fürsten brachten auch Probleme mit sich. Das Streben nach Erhebung und der Wunsch, wie Fürsten zu leben, trieb einige an den Rand des Ruins. Der hohe Aufwand führte allzu oft zu halsbrecherischer Verschuldung und zum Einschreiten kaiserlicher Schuldenkommissionen. Die graduelle Einführung der Primogenitur schien die Zersplitterung der Territorien nicht aufzuhalten. Die Geschichte vieler Grafendynastien unterscheidet sich kaum von der der kinderreichen sächsischen Ernestinen, die ihre Ländereien in Weimar-Gotha-Eisenach so oft teilten, dass die Familie im 18. Jahrhundert praktisch ruiniert war. Die benachbarten Grafen von Reuß waren ein Extrembeispiel: Die beiden überlebenden der 1564 begründeten drei Linien zerfielen bis 1700 in zehn Territorien. 11 Selbst die Identifikation der jeweiligen Herrscher fällt schwer, weil ab 1200 (und ab 1668 gemäß einem formellen Familienvertrag) sämtliche männlichen Nachkommen auf den Namen Heinrich getauft wurden (zu Ehren des Stifters der Dynastie, des Hohenstaufenkaisers Heinrich IV.). Die »ältere« ReußLinie nummerierte ihre Söhne bis 100 durch und fing dann wieder mit einem Heinrich I. an, die »jüngere« begann jedes Jahrhundert mit einem neuen Heinrich I. Um 1700 war die Primogenitur weit verbreitet, Apanagen für jüngere Söhne und die Mitgift der Töchter blieben jedoch eine enorme finanzielle Bürde. 12 Wie im Fall der Reichsritter war ernsthaftes politisches Engagement nur einer winzigen Minderheit möglich. Die meisten Grafen waren Klienten, keine unabhängigen Akteure. Das ursprünglich reichsritterliche, ab 1701 gräfliche Geschlecht der Schönborns war mit seiner Prominenz in der Reichskirche zwischen 1650 und 1740 eher eine Ausnahme als die Regel. 13 Ihre Herkunft vom unteren Ende der
239
240
III. · Die deutschen Territorien um 1648–1760
Rangfolge erwies sich indes als Vorteil, weil sie ihre familiären und sozialen Beziehungen zu den niederen Adligen, die in den Domkapiteln saßen und Bischöfe wählten, aufrechterhielten. Wie für Reichsritter war die Reichskirche auch für katholische Nachkommen von Grafen ein wichtiges Karrieresprungbrett. Andere dienten an allen möglichen Höfen. Für Katholiken, aber auch für einige Protestanten, war Wien stets ein bevorzugtes Ziel. Den imperialen Charakter der ganzen Gruppe untermauerten die österreichischen Familien, die sich vor allem in Schwaben (Harrach, Traun und Abensberg, Auersperg) und in der niederrheinischwestfälischen Region (Kaunitz) als Grafen etabliert hatten. Der Große Kurfürst von Brandenburg und Friedrich I. bemühten sich um den Aufbau einer Klientel gehobener Adliger, zu der die Grafen von Dohna, Solms, Waldeck, Wittgenstein und Wartenberg zählten, und nutzten ihre verwandtschaftlichen Verbindungen zu den Grafen von Nassau (über das Haus Oranien). Auch der bayerische Kurfürst Max Emanuel (1679–1726) setzte in seinem Streben nach einem höheren Rang in den 1670er Jahren auf die Heiligenberg-Linie der Fürstenbergs. Die Nassauer Grafen und ihre Wetterauer Nachbarn, beide vor dem Krieg mit Heidelberg verknüpft, profitierten nach 1648 von ihren Verbindungen in die Niederlande und dann mit der Oranien-Monarchie in England. Graf Heinrich Trajektin von Solms-Braunfels etwa half seinem Vetter Wilhelm III. bei der Eroberung von England und Irland und starb 1693 in der Schlacht von Neerwinden gegen die Franzosen. 14 Die Grafen waren sehr auf ihre regionalen Ständeorganisationen angewiesen und engagierten sich in Angelegenheiten ihres Kreises, der den Hintergrund eines Großteils ihrer ökonomischen und politischen Aktivitäten bildete. Als Herrscher wesentlich größerer Territorien als die meisten Reichsritter boten sich ihnen mehr Möglichkeiten aktiver Regierungsarbeit und einige wirkten an dem Prozess der Rationalisierung und Bürokratisierung mit, den die Fürstentümer vorantrieben. Die Vielfalt war beträchtlich. Der durchschnittliche Landbesitz eines Reichsritters belief sich auf etwa 7 km 2, die Ländereien der Grafen hingegen lagen zwischen 100 km 2 und bis zu 1.000 km 2. 15 Manche Grafen lagen auf Augenhöhe mit niederen und mittleren Fürsten; einige Grafschaften waren in den Händen fürstlicher Dynastien, etwa der Häuser von Kurbrandenburg und Sachsen. Das Gesamtbild der Unabhängigen war gekennzeichnet von zunehmenden Problemen, mit den Anforderungen moderner Verwaltung fertig zu werden. Das gilt für Reichsgrafen mit kleinen Territorien und für Dynastien wie die Familie Reuß in Thüringen und die Fugger in Schwaben, die ihre Länder zwischen vielen Linien aufteilten, wodurch stets einige Gebiete gemeinsam regiert werden mussten. Dabei kam es zu endlosen Streitereien über Rechte und Ansprüche, manchmal führte allseitige Sturheit auch dazu, dass überhaupt keine Entscheidungen mehr getroffen wurden. Zudem konnten Teilungen mit völliger Trennung der Verwal-
24. Die kleineren Territorien
tungsfunktionen zu erheblichen finanziellen Belastungen führen, da jedes einzelne Territorium neben Residenzen, Jagdschlössern etc. auch kostspielige Administrationsstrukturen brauchte. Nur allzu oft endete der Versuch, die Einkünfte zu erhöhen und die Rechtsprechung zu erweitern, in primitivem und kurzsichtigem Fiskalismus. Die Probleme verstärkten sich in vielen Grafschaften, wo der Herrscher selbst alleiniger oder hauptsächlicher Grundbesitzer war, da es keine Landstände gab, die ihn finanziell unterstützten und Schulden mittrugen. Nicht zufällig kam es unter anderem in den schwäbischen Grafschaften im späten 17. und frühen 18. Jahrhundert zu Bauernaufständen und von Untertanen angestrengten Prozessen. 16 Die Gerichte standen im Allgemeinen auf Seiten der Grafen als Stand, behielten dabei jedoch auch die Rechte der Untertanen nach imperialen Gesetzen im Blick und zeigten ein gesundes Empfinden für die Prinzipien tragfähiger Herrschaft. Urteile gegen Grafen waren zwar recht selten, aber die Einsetzung einer kaiserlichen Kommission zur Schlichtung erschien fast ebenso demütigend und war eine höchst unwillkommene Erinnerung an die prekäre Stellung eines Grafen als Herrschers. Zugleich stürzte der Druck, seinem Status als Reichsstand gerecht zu werden, manch einen Grafen in tiefe Verschuldung. Der Prozess verlief kumulativ. Die Probleme der 1684 aus einer Zweiteilung hervorgegangenen Grafen von YsenburgBüdingen begannen mit der Vierteilung der neuen Grafschaft 1687, wobei jeder Teil etwa 150 km 2, 4.500 Untertanen und ein Einkommen von knapp 20.000 Gulden umfasste. 17 Die lange Kriegsphase von 1672 bis 1714 belastete sie alle und die landwirtschaftliche Krise des späten 17. Jahrhunderts schmälerte ihre Einkünfte erheblich. Zudem mussten sich alle Territorien an zwei kostspieligen Prozessen über Besitzstreitigkeiten beteiligen. Einer ging bis 1601 zurück und endete 1670 mit einem abschlägigen Urteil, das 80.000 Gulden kostete. Der andere, von 1670 bis 1710 gegen Hessen-Darmstadt, hatte ebenfalls eine substanzielle Entschädigungszahlung zur Folge. Auch das Erlöschen einer der vier Linien 1725 brachte wenig Erleichterung: Die verbleibenden drei mussten die Schulden von Ysenburg-Marienborn übernehmen, unter anderem die immensen Kosten des Umbaus eines Zisterzienserklosters in einen prächtigen Palast für das kurzlebige Territorium von Graf Karl August (1667–1725). Zwar wurde 1713 die Primogenitur eingeführt, die Teilungen blieben jedoch bestehen und in mehreren Linien kam es im 18. Jahrhundert zu weiteren Sekundogenituren. 1730 fiel Ysenburg-Meerholz unter die Verwaltung von Ysenburg-Büdingen und Ysenburg-Wächstersbach, die beide selbst am Rand des Bankrotts standen. Die allgemeine Währungs- und Finanzkrise um 1750 und die wirtschaftlichen Folgen des Siebenjährigen Kriegs 1756–1763 brachten schließlich alle drei Grafschaften für den Rest des Jahrhunderts in die Hände kaiserlicher Schuldenkommissionen.
241
242
III. · Die deutschen Territorien um 1648–1760
Vielen Nachbarn der Ysenburgs in der Wetterau ging es nicht besser. Hof- und Militärdienst machten zumindest die Aufwendungen für ein eigenes höfisches Leben überflüssig. Wer jedoch zu Hause blieb, stand vor fast unüberwindbaren Problemen und wurde unweigerlich abhängig von Kaiser und Reich. Totale Insolvenzen wurden abgewendet, da der Kaiser am Überleben der Grafen ebenso interessiert war wie an dem der Reichsritter. Oft alarmierten Familienmitglieder, die sich um ihr Erbe oder die finanziellen Belastungen der ganzen Dynastie sorgten, den Reichshofrat, der eine Kommission zur Klärung der Lage entsandte. 18 Dabei kamen alle nur denkbaren Mittel zum Einsatz: Haushaltskürzungen, straffe Buchführung, Umschuldungen; hoffnungslos verschuldeten Dynasten entzog man sämtliche Geldquellen. Es ging weniger um moralische Prinzipien von Transparenz und Ehrlichkeit als darum, die Liquidität adliger Familien zu erhalten. Da die Kommissionen meist mit Standesgenossen der Schuldner besetzt wurden, umfassten sie oft Angehörige ihrer eigenen Verwandtschaft. Die diversen Ysenburg-Grafen wirkten allesamt in den sie und andere Wetterauer Grafschaften betreffenden Kommissionen mit; man machte quasi den Einäugigen zum König der Blinden. Die rechtlichen und institutionellen Mechanismen zielten in erster Linie darauf, adlige Familien liquid zu halten. Es war im Interesse aller Beteiligten, großzügig mit den Schuldnern umzugehen und sicherzustellen, dass die überwiegend nichtadligen Gläubiger weiterhin Kredite vergaben. Dass die Zinsen nach 1648 mehr oder weniger dauerhaft unter fünf Prozent lagen, begünstigte die Entstehung eines stabilen Marktes für private Anleihen und langfristige Kredite. 19 Eine Insolvenz führte selten zum Verzicht auf ein luxuriöses Leben. Das ganze System war eine logische Erweiterung der Regeln, die 1648 für während des Dreißigjährigen Kriegs aufgelaufene Schulden von Adligen festgesetzt worden waren. 20 Hauptziele waren Stabilität und das Überleben aller Dynastien; der Kaiser sorgte solcherart für den Erhalt seiner eigenen Klientel und bewahrte sie davor, in die Hände benachbarter Fürsten zu fallen. Ein ernsthaftes unabhängiges Engagement in der Reichspolitik war unter diesen Umständen praktisch unmöglich. Wer sich um die Aufstellung einer kleinen Streitmacht bemühte, stürzte sich nur in weitere Schulden. Viele protestantische Grafen, denen der Zugang zur Reichskirche verwehrt blieb und die kaum Aussichten auf eine Karriere in Wien oder an anderen Höfen hatten, wandten sich offenbar bewusst von der Machtpolitik ab. Nur in der Religionspolitik kamen einige zur Geltung. Die Reußen verfolgten seit der Einführung der Reußisch-Schönburgischen Konfession 1567 eine unabhängige (lutherische) Glaubensrichtung. 21 Nach 1648 folgten viele andere Herrscher ihrem Beispiel mit einer eigenständigen konfessionellen Politik, die die im Westfälischen Frieden festgelegten Richtlinien über-
24. Die kleineren Territorien
schritt. Wie viele Reichsritter konnten die Grafen ihre Landeshoheit geltend machen und ihre Kassen füllen, indem sie religiösen Flüchtlingen und Minderheiten eine Heimat boten. Zugleich kamen sie durch Einheiratungen in die oberen Ränge des Adels von Brandenburg, Sachsen und Schlesien in Berührung mit den pietistischen und separatistischen Bewegungen dieser Regionen. Die Häuser Reuß, Waldeck, Wied, Solms und Ysenburg zählten zu den Förderern des Pietismus und von Organisationen wie der Herrnhuter Brüdergemeine von Zinzendorf. 22 Pietät bedeutete freilich nicht automatisch Sparsamkeit und Gebete waren kein probates Mittel gegen die zunehmenden finanziellen Probleme, vor denen die »frommen Grafen« ebenso standen wie ihre verschwenderischen Kollegen. Die Reichsprälaten, mit zwei Stimmen für die schwäbische und die rheinische Bank sowie einer Handvoll individueller Stimmen ebenfalls im Reichstag vertreten, hatten mehr oder weniger den gleichen Status wie die Reichsgrafen. 23 Deren finanzielle Misere konnten sie indes offenbar vermeiden, obwohl Frömmigkeit für die begeisterten Kirchen- und Palastbauer, die auch sonst das gute Leben zu schätzen wussten, nach 1648 definitiv nicht gleichbedeutend mit Sparsamkeit war. 24 Äbte zeigten sich in Sachen Prestige und Luxus ebenso spendierfreudig wie weltliche Herrschaften, vor allem, wenn es ums Bauen ging. Dennoch könnte beinahe der Eindruck entstehen, die Mitgliedschaft in der Reichskirche habe die Prälaten vor den Konsequenzen ihrer Extravaganz behütet. Freilich mussten sie weder jüngere Söhne versorgen und sich um die Mitgift von Töchtern kümmern noch kostspieligen Nepotismus betreiben wie manche Bischöfe.Viele Stifte genossen umfangreiche Wohltaten, hinzu kamen Schenkungen von Schätzen und Ländereien aus der Verwandtschaft von Mönchen und Nonnen. Außerdem fiel es Klöstern offenbar leichter als weltlichen Herrschern, sich zu günstigen Zinsen Geld zu leihen. Ihre Verwaltung blieb im Allgemeinen archaisch und patriarchal, und so entgingen sie dem Teufelskreis wachsender Kosten aufgrund komplizierter administrativer Modernisierung und den wirtschaftlich schädlichen Auswirkungen des Fiskalismus. 25 Im schlimmsten Fall schlüpfte die Gemeinschaft der Mönche beziehungsweise Nonnen selbst in die Rolle eines Landstandes, um die Extravaganz eines verschwenderischen Prälaten zu bremsen. Politisch allerdings waren die Prälaten ebenso vom Kaiser abhängig wie Reichsritter und Grafen. Das Benediktinerkloster Wiblingen bei Ulm verzichtete 1701 sogar auf seinen freien und unmittelbaren Status und unterstellte sich österreichischer Lehnsherrschaft, wodurch es de facto Mitglied des österreichischen Kreises und österreichischer Landstand wurde. 26 Die übrigen Prälaten blieben meist lieber auf Distanz zu Wien. Dabei konnten sie auf die Solidarität der Reichskirche und den Schutz der kirchlichen Herrscher von Salzburg, Bamberg, Würzburg und insbesondere Mainz zählen, die ihre ständige Furcht vor einer Säkularisierung teilten.
243
244
III. · Die deutschen Territorien um 1648–1760
Die etwa fünfzig 1648 verbliebenen Reichsstädte bilden die letzte Gruppe der »weniger mächtigen« Reichsstände. 27 Auch sie waren ab 1648 im Reichstag vertreten, ihre Stimme besaß allerdings weniger Gewicht als die der Kur- und anderen Fürsten, da sie von vielen wesentlichen Beratungs- und Verhandlungsebenen ausgeschlossen waren und in manchen Angelegenheiten gar nicht gefragt wurden. 28 Die Bestätigung ihrer Freiheit 1648 schien die übrigen Organisationen von Gemeinden überflüssig zu machen; der Städtetag trat 1671 zum letzten Mal zusammen, die von mehr als siebzig auf neun Mitglieder geschrumpfte Hanse 1669. Alle Versuche ihrer Wiederbelebung scheiterten ebenso wie eine geplante Zusammenlegung. 29 Zugleich aber machten die Städte nicht viel aus ihrer Vertretung im Reichstag. Um das Jahr 1700 wurden fast alle Städte, abgesehen von Nürnberg, Ulm und Regensburg selbst, durch Regensburger Magistrate und Beamte vertreten und das Mainzer Reichstagsdirektorium klagte, es sei unmöglich, mit ihnen Geschäfte zu tätigen. 1713 löste der Beschluss, keine Städtevertreter zur Amtseinführung des Duke of Marlborough als Fürsten von Mindelheim einzuladen, heftige Proteste der Städte aus. 30 Sie blieben jedoch abwesend und bildeten auch in sonstigen politischen Fragen nie eine geschlossene Gruppe oder Einheit, selbst wenn ihre eigenen Interessen betroffen waren. Gründe hierfür waren die Kosten, aber auch die Ansicht, für die Reichsstädte sei in Regensburg wenig zu holen. Hingegen ließen sich immer mehr Städte durch Agenten beim Reichshofrat in Wien vertreten, wo ihr Vermögen und ihre Freiheit viel mehr gefährdet waren, falls ein ungünstiges Urteil die Entsendung einer kaiserlichen Kommission oder eine Intervention von Kreisstreitkräften nach sich zog. 31 Dass kaiserliche Kommissionen im 17. und 18. Jahrhundert in mehr als dreißig Konflikten zwischen Magistraten und Bürgerschaften tätig wurden, zeigt die Bedeutung der kaiserlichen Gerichte für die Reichsstädte. 32 Wie auch beim Adel gab es selten Urteile gegen Magistrate, aber oft feste Richtlinien, um Probleme zu lösen und ihr erneutes Auftreten zu vermeiden. Das offenbar geringe Interesse der Städte am Reichstag wird gern als Symptom ihres endgültigen Niedergangs in der letzten Phase des Reichs gedeutet. Zweifellos spielten die Städte nicht länger eine Schlüsselrolle in der deutschen Politik wie noch in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Hamburg, Bremen, Frankfurt und Nürnberg prosperierten nach 1648 und Zentren wie Augsburg konnten ihre Position zwar nicht verbessern, aber immerhin halten. Viele kleinere Städte hingegen stagnierten. 33 1790 hatten dreiundzwanzig der schwäbischen Reichstädte weniger als 4.000 Einwohner, das rheinische Friedberg gar nur mehr 2.000. 34 Gustav Schmoller brachte die verbreitete Kritik des 19. Jahrhunderts auf den Punkt, indem er die Städte einen »Schutzwall für kleinliches, borniertes, verzopftes Spießbürgertum mit starken klassenherrschaftlichen Missbräuchen aller Art« nannte. 35
24. Die kleineren Territorien
Solche Urteile sind vielleicht etwa streng, schließlich blieben viele Städte bis Ende des 17. Jahrhunderts wohlhabend, relativ stabil und kulturell lebendig. Dass sie ihre eigenen Territorien oft als »Reich« bezeichneten (etwa das Aachener, Nürnberger oder Frankfurter Reich), schien indes ihre Absurdität zu untermalen. 36 Wie andere Körperschaften, die nach 1806 in den erweiterten Territorialstaaten aufgingen, wurden die Städte zum Hassobjekt für Historiker, die den Fortschritt priesen und alles verdammten, was ihnen als fossiles Relikt vergangener Epochen erschien. 37 Desinteresse am Reichstag hieß jedoch nicht Desinteresse am Reich. Mehr als andere Gruppen waren die Städte pedantisch genau, was die Bezeugung ihrer Loyalität zum Kaiser anging. Betont wurde die Beziehung durch die modernisierte Huldigungsprozedur nach 1648, wobei der neu gekrönte Kaiser Botschafter entsandte, die die sogenannte Lokalhuldigung entgegennahmen und selbstverständlich angemessene Abgaben kassierten. 38 Zudem wurden sämtliche Krönungen, Todesfälle, Geburten und Heiraten innerhalb der kaiserlichen Familie entsprechend begangen; die jeweiligen Zeremonien fanden Eingang in die offizielle Stadtchronik und wurden in Zeitungen und Pamphleten kundgetan. 39 Für Städte mit direkter zeremonieller Bedeutung im Reich – Frankfurt als Krönungsort, Nürnberg als Depot der Kronjuwelen und des Kronschatzes, Regensburg als Reichstagssitz, Wetzlar als Sitz des Reichskammergerichts – waren diese Höflichkeiten selbstverständlich. Aber auch andere Reichstädte scheuten weder Kosten noch Mühen für derartige Festlichkeiten. Viele Historiker sehen die Reichsstädte noch immer als eine Art rührenden republikanischen Gegenpart zum dominanten adligen Ethos des Reichs, das Verhalten der Städte legt jedoch eine andere Interpretation nahe. Mit ihrem Engagement meldeten sie vielmehr eigene Ansprüche auf adligen Status als vollwertige, den Fürsten ebenbürtige Reichsstände an. Dabei mussten sie gegen starke Vorurteile ankämpfen, gegen die Ritter, die in den 1640er Jahren (erfolglos) nach zeremoniellem Vorrang strebten, und gegen Fürsten und deren Propagandisten, die in Stadtbewohnern generell nur »von Mauern umgebene Bauern« (rustici muro inclusi) sahen. 40 Die Ansprüche der Städte überraschen nicht, wenn man bedenkt, dass die Magistrate von allen außer vier Reichsstädten über extramurale Territorien mit manchmal doppelt so vielen Bewohnern wie die Stadt selbst herrschten. 41 Das größte war Nürnberg mit mehr als 1.500 km 2, fünf Städten und 35.000 Untertanen bei 25.000 Bürgern; Hamburg hatte etwas mehr als 400 km 2 mit 19.000 Untertanen bei circa 100.000 Bürgern; bei den meisten anderen waren es weniger als 200 km 2. Aber der Besitz von Land und die Herrschaft über Untertanen waren prinzipiell hinreichende Gründe. Zudem handelten die Stadtmagistrate, die sich ab dem späten 16. Jahrhundert vermehrt als »Senatoren« und »Konsuln« bezeichneten, ab 1648 zunehmend wie
245
246
III. · Die deutschen Territorien um 1648–1760
Fürsten, was ihre Steuern betraf. Die Administrationen blieben unterentwickelt und Gildeordnungen hemmten die wirtschaftliche Entwicklung, aber die Besteuerung wurde strenger und die Kluft zwischen Bürgern und Untertanen tiefer. Das bewahrte die Reichsstädte jedoch nicht vor einem ähnlichen Schicksal wie Ritter und Grafen: Im späten 18. Jahrhundert hatten viele von ihnen langfristige Schulden. 42
Anmerkungen 1 Evans, Austria, 117. Verdenhalven, Alte Maße, bietet einen exzellenten Überblick; hilfreich ist auch Trapp, Handbuch; vgl. zur Terminologie von Verwaltung und Gesetzgebung Haberkern und Wallach, Hilfswörterbuch. 2 Sutter, »Kaisertreue«, 291 ff. 3 Willoweit, Rechtsgrundlagen, 307–338. 4 Haug-Moritz, »Organisation«, 16–20; vgl. auch S. 446 f. 5 Sutter, »Kaisertreue«, 274–277; Press, »Kaiser und Reichsritterschaft«, 172 ff. 6 Wilson, Reich, 41 f.; Godsey, Nobles, 8. 7 Ebd., 9. 8 Vgl. auch S. 631 f., 718 f. 9 Die Bezeichnung rührt daher, dass sie im Reichstag auf derselben Bank saßen. 10 Arndt, Reichsgrafenkollegium, 265–330. 11 Köbler, Lexikon, 563 ff.; bis Ende des 18. Jahrhunderts ging die Anzahl der Linien wieder auf fünf zurück. 12 Apanagen bestanden aus der Zuteilung der Einkünfte eines Stücks Land oder eines Vermögens, solange der Begünstigte lebte; Paragien hingegen waren eine Abfindung mit Grundbesitz mittels Teilung, durch die eine neue Erblinie entstand; Haberkern und Wallach, Hilfswörterbuch, 43, 467 f. 13 Schraut, Haus Schönborn; Press, »Reichsgrafenstand«, 127 f. 14 Ebd., 128. 15 Die Zahlen zu den Rittern beruhen auf einem Mittelwert von 10.455 km 2, geteilt durch 1.500 Stände. Keine dieser Zahlen ist präzise; die tatsächliche Größe der Gebiete schwankte beträchtlich. Für die Zahlen zu den Grafen vgl. z. B. die Listen in Wilson, Reich, 364– 377. Blanning, Mainz, 49–59, und Godsey, Nobles, 16–47, liefern Informationen zu einzelnen Rittern, die die Vielfalt belegen. 16 Wilson, Reich, 297–300. 17 Ackermann, Verschuldung, 12–86. 18 Ebd., 206–210, findet sich ein Überblick über die Regeln und Prozeduren; Hattenhauer, Reich als Konkursverwalter, ist eine nützliche Studie der legalen Probleme infolge der Verschuldung niederer Herrscher, speziell der Grafschaft Pappenheim in den 1770er Jahren. 19 HbDSWG, 535; North, Aktie, 445; North, Kommunikation, 94 f. 20 Vgl. S. 35 f. 21 Schindling und Ziegler, Territorien IV, 32 f.; Schmidt, Geschichte, 105 f. 22 Press, »Reichsgrafenstand«, 131; vgl. auch S. 363–367. 23 Die wichtigsten waren Ellwangen, Kempten, Berchtesgaden, Weißenburg, der Johanniterorden und der Orden der Hoch-und Deutschmeister; vgl. allgemein den Eintrag »Reichs-
24. Die kleineren Territorien
24 25 26 27
28 29
30 31 32 33
34 35 36 37 38 39 40 41 42
prälatenkollegium« im HLB und die Liste in Hartmann, Kulturgeschichte, 32. Zu den schwäbischen Prälaten vgl. Reden-Dohna, »Zwischen Vorlanden und Reich«. Schaffer, »Klosterlandschaft«, bietet einen Überblick der wichtigsten Stifte im Rheinland, allerdings in Verbindung mit der weit größeren Anzahl mittelbarer territorialer Stiftungen; Gatz, Atlas, 215 ff., verzeichnet die in der Erzdiözese Köln. Braunfels, Kunst III, 409–422, behandelt die prominentesten weiblichen Angehörigen der Rheinischen Prälatenbank. Press, Kriege, 305; Reden-Dohna, »Problems«, 82 ff. Ebd., 83. Köbler, Lexikon, 787; Braunfels, Kunst III, 427–432; Oberndorfer, Wiblingen, 169–177. Die in der Reichsmatrikel von 1521 aufgeführte Anzahl von fünfundachtzig Reichsstädten schrumpfte im 16. und 17. Jahrhundert durch Verluste an Frankreich und die Schweiz sowie »Reduktionen« durch Fürsten erheblich. Bremen und Hamburg wiederum wurden erst 1741 bzw. 1770 offiziell anerkannt. Von den nun 51 Reichsstädten gehörten 14 (im Wesentlichen alle nördlich von Frankfurt am Main) der »rheinischen Bank« und 37 der »schwäbischen Bank« an. Johann Jacob Moser listet 52 auf, zählt jedoch Gelnhausen dazu, das seit dem 14. Jahrhundert (zunächst an die Krone) verpfändet war und 1736 per Erbschaft an Hessen-Kassel fiel, womit sein freier Status endete.Vgl. Krischner, Reichsstädte, 46 f.; Köbler, Lexikon, 211. Conrad, Rechtsgeschichte II, 99 f. Die verbliebenen Mitglieder der Hanse waren Lübeck, Hamburg, Bremen, Danzig, Rostock, Braunschweig, Hildesheim, Osnabrück und Köln; die ersten drei blieben lose verbunden und verwalteten die Besitztümer der Hanse in Antwerpen, Bergen und London; vgl. Schmidt, »Städtehanse«, 42 ff. Krischner, Reichsstädte, 56 f. Noël, »Reichshofrat«. Friedrichs, »Revolts«; Hildebrandt, »Verfassungskonflikte«; nützliche Informationen finden sich auch in Schultz, Auseinandersetzungen, 11–44. Mauersberg, Städte, ist eine exzellente Studie zu Frankfurt und Hamburg; Braunfels, Kunst III, 13–276, bietet einen Überblick mit ungewöhnlichen Perspektiven; informativ ist auch Gerteis, Städte, 65–71. Braunfels, Kunst III, 14. Hildebrandt, »Verfassungskonflikte«, 223. Braunfels, Kunst III, 13. Borst, »Kuhschnappel«; Borst, »Kulturbedeutung«; Borst, »Verfassung«; Borst, »Kulturfunktionen«. Krischner, Reichsstädte, 346–364. Whaley, Toleration, 179–185; Berbig, »Kaisertum«; Berbig, »Krönungsritus«; Krischner, Reichsstädte, insb. 369–379. Krischner, Reichsstädte, 81–90. Gmür, »Städte«, 179–186; Braunfels, Kunst III, 15 f.; die vier ohne Landbesitz waren Köln, Friedberg, Goslar und Worms. Vgl. S. 630–633.
247
25. Österreich und Brandenburg-Preußen
A
lle »weniger Mächtigen« erkannten die Bedeutung des kaiserlichen Hauses an, das ihr sehr realer oberster Lehnsherr und Beschützer gegen Feinde von außen und inneres Ungemach blieb. Die Autorität des Kaisers wiederum rührte in hohem Maß von seiner territorialen Basis in Österreich her, oder vielmehr von dem Komplex habsburgischer Gebiete in Ober- und Niederösterreich, der die deutlichste Ausnahme von fast jeder Regel im Reich darstellte. Das lag an seiner Größe und dem Erwerb ausgedehnter Ländereien, die an das Reich grenzten, ihm aber nicht angehörten. Darüber hinaus hatten die Habsburger für das Erzherzogtum Österreich im 12. bis 15. Jahrhundert Privilegien erworben, die es in ein quasi unabhängiges Königreich verwandelten, obwohl es formal Reichslehen blieb. Eine ähnliche Sonderstellung nahm ab dem 14. Jahrhundert Böhmen ein, das die Habsburger 1526 erbten und damit ihren Einfluss im Reich weit nach Norden ausdehnten. In der Folge vertiefte sich durch die Dynastie-, Konfessions-, Sozial- und Administrationspolitik der Graben zwischen den Habsburgern und den übrigen deutschen Fürsten. 1 Die Einigung der Enkelsöhne Ferdinands I. auf den jungen Ferdinand von Innerösterreich als Thronfolger 1618 führte praktisch die Primogenitur ein, Teilungen wurden danach durch Apanagen an jüngere Söhne vermieden. 2 Zweitens nutzten die Habsburger ihre Freistellung von den Gesetzen des Reichs, um den Katholizismus als einzige Konfession in ihren Ländern festzulegen. Die im Reich geltenden Regeln zum Normaljahr 1624 und dem Prinzip der Parität, für dessen Umsetzung und Überwachung die Kaiser zuständig waren, wurden schlicht ignoriert. Drittens ging mit der systematischen Beseitigung des Protestantismus in sämtlichen habsburgischen Ländern außer Schlesien nach der Schlacht am Weißen Berg eine noch konsequentere Cliquenwirtschaft zugunsten loyaler Adliger als je zuvor einher. Der Adel der Erblande erwarb Land und Titel in Böhmen und im Reich, einige loyale Adlige des Reichs ebenso in den Erblanden, Böhmen und den im späten 17. Jahrhundert den Türken abgenommenen Gebieten. Der Hof in Wien wurde zum Zentrum einer weitläufigen adligen Klientel, die die habsburgischen Länder umfasste und sich weit ins Reich hinein ausdehnte. Viertens waren die Habsburger ab dem frühen 16. Jahrhundert Vorreiter der deutschen Fürsten, was Verwaltung und Finanzen anging. Nach dem Trauma des Dreißigjährigen Krieges und den folgenden Konflikten mit Frankreich und den Türken führten sie die Modernisierung der Regierung in Österreich mit der Aus-
25. Österreich und Brandenburg-Preußen
arbeitung einer kohärenten und umfassenden Zentralverwaltung fort. Sie umfasste die Einführung von Kanzleien für jedes Territorium, eine im späten 17. Jahrhundert begonnene merkantilistische Politik, die Gründung von Staatsbanken (1706 und 1714) sowie Handels- und Steuerkommissionen im frühen 18. Jahrhundert. Und schließlich brachte der militärische Erfolg gegen die Türken nach der Belagerung von Wien einen weiteren Stützpfeiler der österreichischen Macht mit sich: eine starke Armee und Militärverwaltung. 3 Infolgedessen konzentrierten sich die Habsburger zunehmend auf ihre eigenen Länder und deren Einheit. Aber das Reich blieb die Quelle ihres prestigeträchtigen Kaisertitels und seine Lehen versorgten sie mit Geld und Soldaten. Es gibt keine stichhaltigen Belege für ein Dilemma zwischen Reich und Österreich. Der Verlust der Kaiserkrone nach dem Tod Karls VI. 1740 indes fokussierte den Blick auf die Bedeutung des Reichs für die Politik der Habsburger. Vieles von dem zu Österreich Gesagten findet sich auch in den bekannten Darstellungen des Aufstiegs von Brandenburg-Preußen: territoriale Expansion, markante Religionspolitik, effektiver Umgang mit dem Adel, administrative Modernisierung und die Entwicklung außerordentlicher militärischer Kapazitäten. Die verherrlichende Mythologie der preußisch-deutschen Geschichtsschreibung ist jedoch seit den 1960er Jahren ziemlich in sich zusammengefallen; Brandenburg wird seither eher wieder im geografischen und institutionellen Rahmen des Reichs angesiedelt. Die Anfänge waren kaum verheißungsvoll. Im 16. Jahrhundert war Brandenburg das größte und territorial kompakteste Kurfürstentum, wohl aber auch das unbedeutendste. Es lag an der nördlichen Peripherie des Reichs, seinem Herrscher mangelte es ständig an Geld, weshalb sie stets mit der Zahlung von Steuern (und Beiträgen zur Protestantischen Union) in Rückstand waren. Im Allgemeinen zeigten sie sich loyal und marschierten stets in Sachsens Fußstapfen. Das Aussterben der Markgrafen von Ansbach 1603 erweiterte Brandenburgs Herrschaftsbereich durch die Thronbesteigung der beiden jüngeren Brüder des Kurfürsten in Ansbach und Bayreuth in den ursprünglichen Kern der Hohenzollerngebiete hinein. Der erbliche Erwerb von Kleve, Mark und dem nicht zusammenhängenden Territorium Ravensberg 1614 brachte zunächst mehr Probleme als Vorteile. Wichtiger war die Ererbung des Herzogtums Preußen als Lehen der polnischen Krone 1618/19. Kurzfristig indes drohte der Übertritt des Herrscherhauses vom Luthertum zum Calvinismus 1613, zur gleichen Zeit wie die Pfalz, das Reich zu zerstören, isolierte das Kurfürstentum und schuf schwere interne Probleme mit der lutherischen Bevölkerung der Kernländer. Die von seinen Ständen unterstützte Entscheidung des Kurfürsten Georg Wilhelm, im Fall eines Krieges neutral zu bleiben, war verständlich, führte jedoch in die Katastrophe, als Brandenburg 1626 Opfer der ersten von mehreren Invasionen wurde, und leitete eine Periode des unentschlos-
249
250
III. · Die deutschen Territorien um 1648–1760
senen Schwankens zwischen protestantischen Mächten (vor allem Schweden) und dem Kaiser ein. Als Georg Wilhelm 1640 starb, hielten führende brandenburgische Berater das Kurfürstentum für erledigt. 4 Als Schlüssel zur Gesundung und seinem folgenden Aufstieg zur führenden Macht im Reich erwies sich das, was treffend als »legendäre Reihe von vier hyperaktiven Herrschern« bezeichnet wird: Friedrich Wilhelm, der Große Kurfürst (1640–1688), Friedrich III. (1688–1713, ab 1701 als König), Friedrich Wilhelm I. (1713–1740) und Friedrich II. (1740–1786). 5 Die Probleme, vor denen sie standen, und ihre Lösungsversuche hatten viel mit denen anderer deutscher Herrscher ihrer Zeit gemein. Weitere territoriale Zugewinne in Minden, Halberstadt, Magdeburg (1680) und einigen kleineren westfälischen Grafschaften erhöhten die Ausdehnung, aber auch die Zersplitterung. Jede Gegend hatte eigene Traditionen, die ständig Kompromisse und Anpassungen erforderten. Erschwert wurde dies durch die Spannungen zwischen dem reformierten Herrscherhaus und den lutherischen Ständen. Die größten Probleme gab es dort, wo die lutherische Kirche am stärksten verankert war, wie im Herzogtum Preußen; der regionale Widerstand musste letztlich gewaltsam überwunden werden. In Brandenburg war der lutherische Adel ein harter Verhandlungspartner; das Verhältnis zum Herrscherhaus blieb bis Mitte des 18. Jahrhunderts gespannt. In Kleve und Mark hingegen, wo die Stände überwiegend reformiert waren, kam es leichter zu Einigungen. Aus purer Notwendigkeit baute der Große Kurfürst nach 1648 eine militärische Streitmacht auf, um sein Land zu schützen und den Eiertanz zwischen den verfeindeten Mächten des südlichen Ostseeraums zu bestehen. 6 Er schloss je nach Lage der Dinge und der brandenburgischen Interessen Bündnisse mit dem Kaiser, den Niederlanden, Frankreich und Schweden, fand aber letztlich stets zu einer grundsätzlich imperialen Linie zurück. 7 Der Aufbau einer eigenen Streitmacht war die logische Folge. Der Kurfürst konnte sich nicht darauf verlassen, dass das Reich seine Interessen verteidigte. Zugleich gab ihm seine Armee die Möglichkeit, im Reich Druck auszuüben, um Subsidien zu feilschen und eine Art Protektorat über kleinere Territorien auszuüben, indem er ihre militärischen Verpflichtungen gegenüber dem Reich übernahm. Und er profitierte davon, dass Wien immer wieder auf Brandenburg als Gegenmacht zu Schweden und Sachsen im Norden setzte. Wie die anderen Kurfürstentümer hegte Brandenburg bitteren Zorn, weil es nicht an internationalen Friedens- und Vertragsverhandlungen teilnehmen durfte, und strebte nach Souveränität, die es erreichte, als das Herzogtum Preußen 1660 aus der polnischen Lehnsherrschaft entlassen und ein zusätzliches souveränes Territorium in Westafrika gewonnen wurde. Aber Sachsen überholte Brandenburg beim Erwerb der polnischen Königswürde 1696 erneut; zugleich bemühten sich Bayern und die Pfalz um ausländische Kronen und Hannover, neuerdings Kurfürs-
25. Österreich und Brandenburg-Preußen
tentum, stand als Erbe des britischen Throns so gut wie fest. Der Ausschluss vom Frieden von Rijswijk (1697) lieferte schließlich den Anlass zu Verhandlungen mit dem Kaiser und Wien erteilte der Krönung Friedrichs III. als »König in Preußen« 1701 seinen Segen. Bald bezeichnete man die brandenburgischen Territorien insgesamt als »Preußen«, so wie ihr Herrscher meist als »preußischer König« oder gar – rechtlich nicht ganz korrekt, da Westpreußen polnisch und Brandenburg ein Kurfürstentum im Reich blieb – als »König von Preußen« bezeichnet wurde. 8 Die Krönung war alles andere als eine billige Angelegenheit. Dreißigtausend Pferde waren nötig, um die Kavalkade des Kurfürsten zum Krönungsort in Königsberg zu ziehen, wo er sich selbst die juwelenbesetzte Goldkrone, das Symbol der Einheit all seiner Länder, auf den Kopf setzte. 9 Aber wie vereint waren die brandenburgisch-preußischen Territorien tatsächlich? Jeder Teil behielt seine eigenen Landstände, dennoch konnte für etwa ein Jahrhundert ab 1640 ein relativ hoher Grad der zivilen wie militärischen Integration erreicht werden. Wie in den meisten anderen größeren Territorien gab es ab 1604 einen regierenden Staatsrat, der jedoch von 1627 an zunehmend vom Kriegskommissariat kaltgestellt wurde, das eingerichtet worden war, um die von Wallensteins Besatzungstruppen verlangten »Spenden« einzutreiben. Als sich die Lage verschlechterte und die brandenburgischen Territorien so gut wie verwüstet waren, gab es praktisch keine Verwaltung mehr, bis der Große Kurfürst ab 1640 zaghafte Versuche eines Wiederaufbaus einleitete. Gern wird auf Friedrich Wilhelms Ausbildung in den Niederlanden, den Eindruck, den die Disziplin der niederländischen Armee auf ihn machte, und die Effizienz der dortigen Finanzverwaltung hingewiesen. Anfangs jedoch setzte er den Geheimen Rat wieder ein und erstrebte eine Einigung mit den Ständen, um ein stehendes Verteidigungsheer durch Steuern zu finanzieren. Die Verhandlungen waren derart schwer, dass er einen neuen Ansatz versuchte. 1651 wurde der Geheime Rat zu einem internen Kabinett für Finanzen, Militär und Außenpolitik umgebaut, die Hofräte waren nun für neunzehn Unterabteilungen verantwortlich. Die Steuerquellen der Kurfürsten sprudelten reichhaltiger, zuerst in Brandenburg; 1689 schließlich wurde eine für alle Territorien zuständige zentrale Steuerbehörde eingerichtet. Ab 1655 lag die Eintreibung von Steuern für die Armee in den Händen eines Generalkriegskommissars; aus diesem Amt entwickelte sich eine Behörde mit weitreichenden finanziellen und ökonomischen Befugnissen. 10 Die Einführung der Akzise ist ein typisches Beispiel für die neue Herangehensweise mit Steuerkommissaren nach Art der französischen Intendants im Auftrag der Regierung. Erhoben wurde die neue Steuer indes nur in den Städten, die damit unter direkter Aufsicht der Steuerkommissare standen. In ländlichen Gegenden gab es ab 1702 das Amt des Landrats, meist ein örtlicher Adliger, der die Krone und die Stände zugleich repräsentierte. Die dritte Zuständigkeit, die dem Gehei-
251
252
III. · Die deutschen Territorien um 1648–1760
men Rat mehr und mehr entzogen wurde, war die Justizverwaltung; als Meilenstein gilt hier die Schaffung des höheren Kammergerichts für alle brandenburgisch-preußischen Territorien 1703. 11 Höhepunkt all dieser Bemühungen um Strukturen, die sämtliche Territorien der Dynastie umfassten, war das Hausgesetz Friedrich Wilhelms I. vom 13. August 1713, das ihre Unveräußerlichkeit und Unteilbarkeit festschrieb. 12 Die Zuständigkeiten der diversen Stellen und Beamten wurden nie wirklich genau definiert, was immer wieder zu Missverständnissen, internen Querelen und Spannungen mit den Landständen führte. Der Versuch Friedrich Wilhelms I., dies nach 1713 im Zuge des Wiederaufbaus nach dem Großen Nordischen Krieg in den Griff zu bekommen, war beeindruckend, aber nur teilweise erfolgreich. Das 1723 eingerichtete Generaldirektorium hatte vier Abteilungen, von denen jede für eine bestimmte Region oder Gruppe von Territorien und zugleich, alle Territorien betreffend, für ein Feld der Politik verantwortlich war. Der König und sein Kabinett behielten die ausschließliche Kontrolle über Finanzen, Militär und Außenpolitik. Die Domänenkammer, zuständig für Einkünfte aus Grundbesitz, und die Steuerkommissariate mit diversen Beamten und Landräten vertraten die Regierung auf lokaler Ebene. Dass Friedrich Wilhelm I. darauf bestand, dass die Beamten ausgebildet wurden, war ebenso typisch für seinen systematischen Ansatz wie die Einrichtung von Lehrstühlen für Kameralwissenschaft in Halle und Frankfurt an der Oder. Wie der hallesche Kanzler Johann Peter von Ludewig prahlte, verfügte man nun über Professoren, die tatsächlich wussten, ob Mais auf Feldern oder Bäumen wuchs. 13 Der letzte wichtige Schritt war die Reform des militärischen Rekrutierungswesens. Die Einführung des kantonalen Systems, in dem Soldaten nach Distrikten rekrutiert wurden und dort mit jährlichem Heimaturlaub verblieben, trug zur Lösung personeller und finanzieller Probleme bei. 14 Externe Aushebungen waren jedoch weiterhin nötig, vor allem wegen der Vorliebe des Königs für besonders hochgewachsene Soldaten in seinem Potsdamer Grenadierregiment (die »Langen Kerls« oder »Riesengarde«). 15 Bei allen anhaltenden internen Querelen funktionierte das System bemerkenswert gut und erleichterte die dramatische Vergrößerung der Armee von etwa 40.000 auf 80.000 Mann von 1713 bis 1740. Die merkantilistische Wirtschaftspolitik, auf die preußische Historiker gern stolz verweisen, war nicht so effektiv. Brandenburgs Erfolg beruhte weiterhin auf der Stärke seiner Landwirtschaft: 1740 warfen die königlichen Domänen 3,5 Millionen Taler ab, das Steueraufkommen lag lediglich bei 3 Millionen. 16 Die Rücknahme von Friedrich Wilhelms Plänen, königlichen Besitz zu verkaufen, und seine Bemühungen, mehr Grundbesitz unter direkte königliche Kontrolle zu stellen, zeigten mehr Wirkung als jegliche merkantilistischen Maßnahmen zur Förderung anderer ökonomischer Bereiche als der Landwirtschaft.
25. Österreich und Brandenburg-Preußen
So erfolgreich die Entwicklung der brandenburgischen Verwaltung auf lange Sicht war – sie verlief in sehr kleinen, oft quälenden Schritten, erforderte Verhandlungen und Kompromisse mit regionalen und lokalen Interessen und war mit Zwang nicht durchzusetzen. Andererseits entwickelte das entstehende Zentralherrschaftssystem als Konsequenz der konfessionellen Spannungen zwischen Herrscherhaus und lutherischer Mehrheit eine gewisse Unabhängigkeit und Übersicht. Nur zehn Prozent der Ernennungen zu oberen Gerichten und diplomatischen und militärischen Stellen zwischen 1640 und 1740 entstammten dem brandenburgischen Adel; die meisten waren reformierten Glaubens, viele mindere Fürsten, Reichsgrafen und -ritter. 17 Die Förderung der Pietisten diente dem gleichen Zweck. Ganz abgesehen vom offensichtlichen Nutzen von Franckes diversen Projekten unter sozial- und wirtschaftspolitischen Aspekten, waren die Pietisten gerade deshalb attraktiv, weil sie in Opposition zu den orthodoxen Lutheranern standen, die das Herrscherhaus als Rückgrat des einheimischen Widerstands betrachteten. 18 Die Beschäftigung von Calvinisten aus anderen Territorien verfolgte noch einen anderen Zweck. Ab den 1640er Jahren versuchten die brandenburgischen Herrscher mit einigem Erfolg, ein Klientelnetzwerk im Reich zu knüpfen. 19 Damit folgten sie gewissermaßen dem Vorbild des Wiener Hofs und hofften vielleicht auch die Rolle des reformierten Hofs in Heidelberg vor dem Dreißigjährigen Krieg zu übernehmen. Zudem zeigte die Anstellung von Adligen aus dem Reich die fortdauernde Sorge der Hohenzollern um die Sicherheit ihrer Territorien, ihren eigenen Status und, nach 1701, ihren Königstitel. Unter dem Nachfolger des Großen Kurfürsten, Friedrich III., verlagerte sich der Schwerpunkt auf die Bildung eines Hofs, der dem königlichem Status angemessen war. Dem dienten auch die beträchtlichen Investitionen in kulturelle Projekte: die Ernennung Pufendorfs zum Hofhistoriker 1691, die Gründung der Universität Halle 1694, der Akademien der Künste 1696 und der Wissenschaften 1701, die Stiftung des Hohen Ordens vom Schwarzen Adler unmittelbar vor der Krönung und eine ganze Reihe prachtvoller Bauprojekte in Berlin. 20 Der praktische Erfolg dieser Initiativen war begrenzt und so wählte Friedrich Wilhelm I. ab 1713 einen neuen Ansatz. Zwei Drittel der Hofbediensteten wurden entlassen, der Rest musste Gehaltskürzungen von bis zu 75 Prozent hinnehmen. Der neue König leitete administrative und militärische Reformen ein. Er ersetzte die Allongeperücke durch einen kurzen Zopf zur schlichten blauen Uniform und setzte dies auch für seine Familie und die Beamtenschaft durch. Theater, Ballett, Konzerte und Maskenbälle missfielen ihm, lieber verbrachte er seine Abende mit alten Kameraden und großen Mengen Alkohol im sogenannten Tabakskollegium. 21 Seine Ländereien erklärte er für unteilbar und unverkäuflich, in einer neuen Rangordnung standen die militärischen über den zivilen Bediensteten. 22 Friedrich Wilhelm bevorzugte wie seine Vorgänger Calvinisten in Führungs-
253
254
III. · Die deutschen Territorien um 1648–1760
positionen, aber weniger aus anderen als seinen eigenen Territorien. Das bedeutet nicht, dass seine Ambitionen im Reich geringer waren: Wie alle preußischen Herrscher pflegte er eifrig Kontakte zu den niederen Herrschern benachbarter Territorien sowie zu Hohenzollern-Verwandten in Süddeutschland (Hechingen und Sigmaringen), Ansbach und Bayreuth. 23 Auch die Mitgliedschaft in den drei nördlichen Kreisen (Obersachsen, Niedersachsen und Westfalen) setzte er gewinnbringend ein und war sehr bemüht, seine Repräsentationsrechte im 1653 gegründeten »Niederrheinisch-Westfälischen Reichsgrafenkollegium« geltend zu machen, die er dem Erbe einiger kleiner westfälischer Grafschaften verdankte. Stets war er bereit, in Problemgebieten wie Mecklenburg einzugreifen, und unterstützte, zeitweise im Bund mit Hannover, das protestantische Anliegen eines Ausschlusses von Sachsen. Als Rückversicherung gegen Hannover knüpfte er dynastische Beziehungen zu den Welfenherrschern von Braunschweig-Wolfenbüttel, die immer noch wegen der Verleihung der hannoverschen Kurwürde an ihre jüngeren Verwandten grollten. Immer wieder aber bemühte sich Friedrich Wilhelm wie seine Vorgänger um Kooperation mit Wien und habsburgische Unterstützung der brandenburgischen Interessen im Reich, insbesondere in der Frage der Erbfolge in Jülich und Berg, die ihm Karl VI. 1739 schließlich verweigerte. 24 Darauf reagierte er enttäuscht und ernüchtert; auf Empörung stieß auch die Wiener Neigung, den preußischen König wie einen lästigen und launischen niederen Fürsten zu behandeln. 25 Letztlich war klar, dass Berlin in dieser Epoche mit Wien nicht ernsthaft konkurrieren konnte, aber Brandenburg stärkte seine Stellung beträchtlich und knüpfte ein komplexes Netzwerk von Gefolgsleuten im Norden des Reichs und anderswo. Aus dem Schatten Sachsens zu treten, fiel jedoch schwer, und als es mit dem Übertritt des sächsischen Kurfürsten zum Katholizismus 1697 möglich schien, trat Hannover als neuer potenzieller Rivale auf den Plan. 26 Hannover und Brandenburg gelang es auch gemeinsam nicht, Sachsen von der Führung des Corpus Evangelicorum im Reichstag zu verdrängen. Andererseits wurde Brandenburgs Stellung langfristig durch den Niedergang seiner beiden Rivalen aus dem 17. Jahrhundert sicherer, da Schweden und Polen unter internen Problemen und dem Aufstieg Russlands im späten 17. und frühen 18. Jahrhundert litten. Und obwohl sich die Herrscher von Sachsen und Hannover erhabenere und »authentischere« Königstitel verschafften, standen die Dinge auch in dieser Hinsicht günstig für Brandenburg, da die beiden Konkurrenten von ihren neuen Königreichen in Anspruch genommen wurden. Natürlich war auch Brandenburgs Krone eine auswärtige, die Hohenzollern mussten sich jedoch nicht mit der Innenpolitik und den strategischen Interessen eines fremden Königreichs auseinandersetzen, sondern konnten sich mit ganzer Kraft der Stärkung ihrer Stellung im Reich widmen.
25. Österreich und Brandenburg-Preußen
Wien gelang es dennoch weiterhin, die norddeutschen Territorien gegeneinander auszuspielen, indem es sich die Loyalität Brandenburgs regelmäßig mit Versprechungen erkaufte, die selten eingehalten wurden. Immerhin gestand man den brandenburgischen Kurfürsten 1701 den Königstitel zu, obwohl Prinz Eugen dies nicht als einziger kaiserlicher Berater bald für höchst unnötig und einen gravierenden taktischen Fehler hielt. Freilich waren Habsburger und Hohenzollern in mancher Hinsicht voneinander abhängig: Der Kaiser brauchte die preußische Armee und wollte definitiv keinen offenen Widersacher in Norddeutschland. Durch die Kaiserkrone und seine Rolle als oberster Richter über Gesetze, die letztlich kein preußischer Herrscher vor 1740 zu missachten wagte, saß Wien jedoch am längeren Hebel. Ging Brandenburg einen »Sonderweg«? Alte Mythen einer »deutschen Bestimmung« kann man getrost vergessen. Jüngere Thesen, Preußen sei »dem Reich entwachsen«, sind ebenfalls kaum haltbar, weniger noch als im Fall Österreichs, das ernsthafte auswärtige Interessen verfolgte. Brandenburg hegte in vielerlei Hinsicht die gleichen Ambitionen wie andere große Territorien im Reich und setzte innenpolitisch auf ähnliche Methoden der Machtsicherung. Bürokratisierung und Rationalisierung waren keine Spezialitäten der Hohenzollern, ebenso wie das kantonale Rekrutierungswesen. Andererseits verzeichneten Zeitgenossen häufig die Schroffheit und Respektlosigkeit der königlichen Emporkömmlinge gegenüber der Würde des Kaisertitels und den konstitutionellen Traditionen des Reichs. Auch andere Herrscher griffen leicht zu Zwangsmitteln, Brandenburg verfügte jedoch über mehr davon, die weiter reichten. Die Priorität der Armee und ihre erheblich größere Stärke als in vergleichbaren Territorien wurden indes dadurch aufgewogen, dass die Herrscher bis 1740 die Reichsgesetze grundsätzlich respektierten. Der Sinneswandel Friedrichs des Großen nach 1740 ging auf die neue Lage zurück, nachdem die Habsburger die Kaiserkrone verloren hatten und sich das Verhältnis zu den anderen weltlichen Kurfürstentümern verändert hatte. 27 Schon 1720 kontrollierte Preußen ein etwa so großes Gebiet wie die übrigen vier säkularen Kurfürsten zusammen. 28 Zudem konsolidierte sich das zersplitterte Territorium zwischen 1640 und 1740 verwaltungstechnisch zu einem einheitlichen Ganzen. Dadurch hoben sich die Hohenzollern-Länder zunehmend von den anderen Territorien ab und setzten in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts neue Maßstäbe für die Reichspolitik.
Anmerkungen 1 2
Evans, Making (passim); Evans, Austria, 56–98. Fichtner, Protestantism, 49, 51.
255
256
III. · Die deutschen Territorien um 1648–1760
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Siehe Winkelbauer, Ständefreiheit I (passim); Hochedlinger, Wars, 5–150. Gotthard, »Luthertum«, 87–92; Schindling und Ziezler, Territorien I, 54–57. Burkhardt, Vollendung, 175. Duchhardt, »Friedrich Wilhelm«. Clark, Iron Kingdom, 48–53. Neugebauer, »Friedrich III./I.«. Clark, Iron Kingdom, 67 ff. Ebd., 43 f., 85 f.; vgl. auch den Überblick in DVG I, 872–887. Willoweit, Verfassungsgeschichte, 180. Ebd.; der Text findet sich unter www.heraldica.org/topics/royalty/HGPreussen_urkunden.htm#XIV_1 (Zugriff 29. Oktober 2013). Burkhardt, Vollendung, 181. Wilson, »Militarisation«, 371–375. Die Soldaten mussten mindestens sechs Rheinfuß (1,88 m) groß sein, die Mitglieder einer speziellen Leibgarde sogar über 2 m. Vogler, Absolutistische Herrschaft, 136. Clark, Iron Kingdom, 62. Vgl. S. 357 f. Czech, »Brandenburg«. Clark, »Culture«. Baumgart, »Friedrich Wilhelm I.«, 145 f. Vogler, Absolutistische Herrschaft, 135. Press, »Reichsgrafenstand«, 129. Baumgart, »Friedrich Wilhelm I.«, 156 ff. Feine, »Verfassungsentwicklung«, 105–110. Göse, »Nachbarn«, 45–57; Thompson, Britain, 1–43. Vgl. S. 399 f. Wilson, Reich, 325.
26. Das Wiedererblühen des Hofs und die Entwicklung territorialer Herrschaft
N
ichts symbolisiert die Gesundung der Regierungsmacht nach dem Dreißigjährigen Krieg, die Suche nach einer neuen Ordnung und ihre triumphale Durchsetzung besser als das Wiedererstarken der Höfe als Herrschaftszentren der deutschen Territorien. Die vielen neuen Residenzen, die in dieser Zeit erbaut wurden, verkörperten Reichtum und kulturelle Hegemonie. In der Ordnung des Lebens in ihrem Inneren spiegelte sich die Hierarchie, über die ein Herrscher waltete und dabei auch seinen Anspruch auf einen Platz in der Hierarchie des Reichs und des europäischen Hochadels insgesamt geltend machte. Demonstrativer Konsum war Selbstzweck und, als Demonstration kultureller Macht, ein Kernelement monarchischer Herrschaft. Für die Fürsten, die um 1700 Königswürden anstrebten, war die Entfaltung höfischer Pracht ein entscheidender Bestandteil ihrer Strategie, ihre Ebenbürtigkeit mit anderen Monarchen zu demonstrieren und sich von minderen Angehörigen des Hochadels abzusetzen. Anderen dienten Hofhaltung und prächtige Residenzen als Zeichen ihrer Unabhängigkeit und ihres fürstlichen Rangs. Zugleich machten die immensen Kosten dieser Aktivitäten die wachsenden Unterschiede zwischen den Reichsständen deutlich. Einige Fürsten konnten tatsächlich auf europäischer Ebene mithalten, andere versanken hoffnungslos in Schulden. Ebenso gelang es einigen, fein gegliederte bürokratische Strukturen zu etablieren, die sich immer weiter vom Hof entfernten, während andere mit einem einzigen Regierungsgremium auskamen, dessen Mitglieder Kompetenz und Verantwortung für spezifische Felder der Politik entwickelten. Auf unterster Ebene hielten manche an den alten Sitten der Verwaltung aus dem Herzen des erweiterten aristokratischen Haushalts fest und entwickelten keinerlei höfische Züge. Die regionalen Varianten von Struktur und Terminologie trotzen jeder übersichtlichen Zusammenfassung. Einigermaßen klar sind jedoch die Grundlinien der Entwicklung an den 300 bis 350 deutschen Höfen. Der Adel, dessen traditionelle Rolle in den Machtzentren juristisch gebildete Nichtadlige an sich gerissen hatten, hatte die Krise des späten 16. Jahrhunderts überwunden. Viele Adlige ließen sich nun für amtliche Tätigkeiten ausbilden, an einer Universität oder einer der sogenannten Ritterakademien oder Schulen für adligen Nachwuchs, die in den späteren Jahrzehnten des Jahrhunderts einen Aufschwung erlebten. 1 Nach 1650 kam es auch zu einer zunehmenden Spezialisierung in der Organi-
258
III. · Die deutschen Territorien um 1648–1760
sation der Höfe, die dadurch weiter wuchsen. Um 1700 umfasste der Hof eines Grafen etwa 120 bis 150 Personen, ein mittleres Fürstentum vielleicht 200 bis 300; jetzt brachten es die Höfe der wichtigeren Fürsten und Kurfürsten auf 600 bis 800. Der Kaiserhof hatte 1674 um die 1.000 Angehörige, 1750 waren es doppelt so viele. 2 Die tatsächlichen Regierungsgeschäfte entfernten sich immer mehr von den zeremoniellen Strukturen der höfischen Gesellschaft, auch wenn Mitglieder des Hofs weiterhin Ämter innehatten, vor allem auf höchster Ebene. 3 Die traditionellen administrativen Strukturen wurden verfeinert, das im späten 15. und 16. Jahrhundert entstandene dreiteilige System aus Rat, Hofrat oder Gericht und Kammer wurde komplexer. Viele Fürsten erwählten zunächst aus dem Rat einen Geheimen Rat und dann ein noch erleseneres Kabinett oder eine Geheime beziehungsweise Engere Konferenz. Der ursprüngliche Rat selbst blieb oft als Ehrengremium aus Höflingen erhalten, von denen sich die neuen arbeitenden Räte durch den Titel Wirklicher Geheimer Rat unterschieden. In manchen Fällen entstand der Geheime Rat aus der Kammerkanzlei des Fürsten oder bestand parallel zu dieser, die ihm bei der Alltagsarbeit assistierte und sich oft zu einer formal eigenen Institution entwickelte, die eine breite Palette von Regierungsgeschäften übernahm, etwa die Verwaltung der Finanzen und Einkünfte. 4 Wichtigste Beamte waren die Kammerschreiber und Kammerräte. Die Gerichte, oft ursprünglich als juristische Abteilung des Rats entstanden, entwickelten sich ebenfalls weiter. Die meisten größeren Territorien richteten reguläre Berufungsgerichte ein, nicht zuletzt, um zu verhindern, dass ihre Untertanen vor den kaiserlichen Gerichten Berufung einlegten. 5 Die Finanzverwaltung machte einen ähnlichen Prozess der Spezialisierung und Verfeinerung durch. Die Anstellung von immer mehr Finanzspezialisten (manchmal Kaufleuten) beschleunigte die Einführung kommerzieller Buchhaltung auf Regierungsebene. Manchmal kam es zur Trennung von Regierungsfinanzen (in der Hofrentei) und den privaten Geldgeschäften des Fürsten (in der Kammerkasse), später entstanden auch separate Ämter für Einnahmen (Steuern, Zölle und andere Abgaben sowie diverse Zinsen) und zur Förderung der Aktivitäten, denen sie entstammten. Die mit dem Einzug von Geldern betrauten Beamten entwickelten ein feineres Gespür für die finanzielle Gesamtlage und finanziell-fiskalische Planung, um mittels Budgets und einer Ausgabenkontrolle, die sich zumindest vage an den zu erwartenden Einnahmen orientierte, das traditionelle Chaos der fürstlichen Kassen in den Griff zu bekommen. Eingeführt wurden schließlich auch spezielle Ämter zur Überwachung oder Förderung bestimmter Sektoren wie Bergbau, Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei sowie in einigen größeren Territorien ein Kriegsrat. 6 Praktisch alle protestantischen Territorien bildeten eine Behörde zur Aufsicht über die Kirche und manchmal auch
26. Das Wiedererblühen des Hofs und die Entwicklung territorialer Herrschaft
ihren Besitz (das Konsistorium), ebenso wie einige katholische Territorien, etwa Bayern, das damit der Autorität von Rom sowie von auswärtigen Bischöfen und Erzbischöfen eine gewisse weltliche Kontrolle entgegensetzen wollte. 7 Alle höheren administrativen Organe waren mit adligen und nichtadligen Beamten besetzt; durch ihre wachsende Anzahl und Größe stieg im 17. Jahrhundert auch der Anteil an nichtadligen Bediensteten stetig. Die meisten waren Akademiker und trafen ihre Entscheidungen aufgrund von Konsultationen und Beratungen. Die sozialen Unterschiede zwischen Adligen und Nichtadligen blieben trotz gleichberechtigter Zusammenarbeit groß. Oft entwickelten Nichtadlige in den oberen Rängen der Beamtenschaft eine ähnlich elitäre und oligarchische Einstellung und Exklusivität gegenüber anderen nichtadligen Gruppen; bald bildeten sich ebenso wie in Landeskirchen und Universitäten Dynastien und verwandtschaftliche Zirkel. Viele ältere Bürokraten erhofften sich eine Erhebung in den Adelsstand, die ihnen jedoch meist verwehrt blieb, wobei die etablierte Nobilität die Befugnis der größeren Stände (vor allem der Kurfürsten und Träger ausländischer Kronen), solche Erhebungen durchzuführen, als Beispiel für inakzeptable Machtwillkür anführte. 8 Der Oligarchisierung zum Trotz erlangte dieser Briefadel oder Landesadel nie die rechtlich etablierte Position der französischen noblesse de robe; er blieb von seinen fürstlichen Förderern abhängig. Die notwendige konfessionelle Konformität und die in vielen Territorien geltende Vorschrift, dass Beamte im Territorium geboren sein mussten (Indigenatsrecht), verstärkten die oligarchischen Tendenzen. Andererseits gab es eine beträchtliche interterritoriale Mobilität, speziell unter Aristokraten, und manche Territorien waren auf auswärtige Rekrutierungen angewiesen, weil ihre Bevölkerung zu gering war, um die benötigte Anzahl qualifizierter Beamter hervorzubringen.
Anmerkungen 1 2 3 4 5 6 7 8
Conrads, Ritterakademien, 105–220, 273–322; Bleeck, Adelserziehung, 11–16, 35–130; Vierhaus, Deutschland, 63, 100. Müller, Fürstenhof, 30. Den besten Überblick bietet Willoweit in DVG I, 289–387. Bis ins späte 14. Jahrhundert lag die Verwaltung der Einkünfte in den Händen eines Rentmeisters oder Landschreibers; vgl. DVG I, 330–346. Hughes, Law, 37 ff.; Conrad, Rechtsgeschichte II, 159 f., 164. Stolleis, Öffentliches Recht I, 368. Müller, Fürstenhof, 29. Conrad, Rechtsgeschichte II, 208 f., 215; Wilson, Reich, 243 f.
259
27. Der Hof: seine Kultur, Funktionen und Kritiker
N
ichts zeigte den Wiederaufstieg der Höfe und Territorialregierungen dramatischer als der Bau neuer Residenzen und Paläste im Jahrhundert nach dem Westfälischen Frieden. Der außerordentliche Aufwand, der hierbei betrieben wurde, steht außer Frage. Er erreichte seinen Höhepunkt zwischen 1690 und 1730; bis 1750 waren so gut wie alle fürstlichen und aristokratischen Residenzen umfassend modernisiert (die hierfür gängige Bezeichnung ist Barockisierung).Viele wichtige Zentren hatte man gänzlich umgebaut oder neu errichtet. Im 19. Jahrhundert betonten Kritiker der kleinen Höfe und des angeblichen Übels der Kleinstaaterei oft, deutsche Fürsten hätten sklavisch den französischen Baustil nachgeäfft, ebenso wie sie die französische Sprache und Manieren übernahmen. Zweifellos war der Einfluss von Versailles und dem französischen Hof ab dem späten 17. Jahrhundert stark, in Deutschland wie in ganz Europa. Aber Frankreich war keineswegs das einzige Vorbild und die deutschen Fürsten entwickelten einen durchaus eigenen Stil, der sich nicht so einfach kategorisieren lässt. Lothar Franz von Schönborn, Fürstbischof von Bamberg und Angehöriger einer vom »Schönborn-Bauwurm« oder »Teufelsbauwurm« getriebenen Dynastie eifriger Bauherren und Kunstförderer, stellte fest: »Um die Wahrheit zu sagen hat man hier sicherlich einen besseren und vortrefflicheren Geschmack als in Frankreich selbst.« Der »theutsche Gusto« sei dem französischen überlegen, meinte er, weil er eklektischer und freier sei. 1 Tatsächlich ist Vielfalt eher typisch als konformistische Frankomanie. Die Fürsten hatten im 16. Jahrhundert ihre bewehrten Bergkuppen verlassen und städtische Burgen und Paläste im Renaissancestil bezogen. Viele Merkmale der alten Festungen fanden sich nun im Schloss wieder, allerdings schmückten die traditionelle Viereckform mit Ecktürmen nun reich ornamentierte Fassaden. 2 Manche ließen zunächst Holzgebäude errichten, die bisweilen erst Jahrzehnte später in Stein umgebaut wurden, andere setzten von Anfang an auf monumentale Stein- oder Ziegelgemäuer. Festungen verloren an Bedeutung, und wo es überhaupt noch Burggräben gab, füllte man sie mit Wasser oder verwandelte sie in Gärten. Die zunehmende Verbreitung von Gärten und Parks als Bestandteil von Palästen bewegte viele, die engen Städte zu verlassen und auf der grünen Wiese neu zu bauen. Einige Fürsten gründeten neue Residenzstädte, die sich in einen baulichen Gesamtplan einfügten.
27. Der Hof: seine Kultur, Funktionen und Kritiker
Versailles war durchaus einflussreich, aber es gab keinen vorherrschenden Stil. Viele deutsche Fürsten und Adlige ließen einachsige Paläste errichten, deren Flügel dreiseitig einen Ehrenhof umschlossen. Aber es gab eine ganze Reihe von Abwandlungen. Französische Muster wurden etwa in Schönbrunn um Elemente des Wiener Stils erweitert. Italienische Vorlagen blieben während der gesamten Epoche äußerst prägend; Höfe erweiterte man häufig mit Kolonnaden im Stil von Berninis Petersdom in Rom. 3 In solchen ausgedehnten Ensembles fanden weitere Gebäude wie Kapellen, Theater und Residenzen für Familienmitglieder Platz. Der italienische Einfluss setzte sich auch in anderer Weise durch, etwa vermittelt durch die Burgen und Paläste des böhmischen und österreichischen Adels. Er zeigte sich auch im Fortwirken eines anderen wichtigen Vorbilds. Die geschlossene Hofgestaltung (cour carrée) des 1624 fertiggestellten Louvre war in Deutschland bis ins frühe 18. Jahrhundert verbreitet und Berninis Pläne zur Verschönerung der östlichen Front, die Ludwig XIV. abgelehnt hatte, fanden Eingang in viele berühmte deutsche Bauwerke. Einzug ins Reich hielt der »Louvrestil« über Stockholm, wo der monumentale Palast von Nicodemus Tessin dem Jüngeren zumindest einige von Berninis Ideen übernahm. Wichtig war zuletzt auch der Einfluss der Niederlande auf Architektur und Gartengestaltung nicht nur in Norddeutschland bis Brandenburg, sondern auch rheinaufwärts bis in die Pfalz und darüber hinaus. Die Bauprojekte der fünf weltlichen Kurfürsten zeigen die ganze Vielfalt. Ihre Bautätigkeit florierte in Phasen, in denen sie gemeinsam oder als Einzeldynastien nach mehr Bedeutung im Reich oder einer Krone im Ausland strebten. Die Wittelsbacher erweiterten ihre alte Münchner Residenz auf sehr ähnliche Weise wie die Habsburger die Hofburg ausbauten, ohne sie grundlegend zu verändern. 4 Allerdings ließ der ehrgeizige Kurfürst Max Emanuel (1679–1726), ein Held der Türkenkriege, der eine Königswürde und möglicherweise auch die Kaiserkrone im Auge hatte, zuerst den »Gartenpalast« Lustheim (im italienischen Stil) erbauen, dann die Residenzen in Schleißheim (nach dem Vorbild von Schönbrunn und Berninis Plänen für den Louvre) und Nymphenburg (eher an Versailles orientiert) weitläufig ausbauen. Sein leitender Architekt für alle drei Projekte war der Schweizer Enrico Zucalli (* 1642, † 1724); lediglich die Gärten wurden in rein französischem (Versailler) Stil von André Le Nôtres Schüler Dominique Girard angelegt. In der Pfalz verzögerten sich die Planungen durch die Thronfolge der katholischen Pfalz-Neuburg-Linie 1685 und die Zerstörung des Schlosses (1689) und der Stadt (1693) Heidelberg durch die Franzosen. Philipp Wilhelm (1685–1690) und sein Sohn Johann Wilhelm (1690–1716) residierten in Düsseldorf, dem Zentrum ihres niederrheinischen Herzogtums Berg. 5 Sie behalfen sich mit dem alten Düsseldorfer Schloss aus dem frühen 16. Jahrhundert; allerdings ließ Johann Wilhelm bei Bensberg nahe Köln ein Jagdschloss bauen (mit Anklängen an Schönbrunn und Versailles, aber fünf Kuppeltürmen). Der Versuch von Karl Philipp (1716–1742),
261
262
III. · Die deutschen Territorien um 1648–1760
die Residenz wieder nach Heidelberg zu verlegen, vor allem sein Bemühen um die dortige Einführung des katholischen Glaubens, erregte so heftigen Widerstand der calvinistischen Stadtherren, dass er 1720 den Umzug nach Mannheim beschloss. 6 Auch diese Stadt war von den Franzosen zerstört worden und wurde dann von dem niederländischen General und Militäringenieur Menno van Coehoorn nach geometrischem Muster neu angelegt. Der neue Palast, um einen kolossalen Ehrenhof am Standort einer alten Festung in der Nähe des Zusammenflusses von Rhein und Neckar erbaut, fügte sich in van Coehoorns Planung. Finanzprobleme und Streitereien mit nachfolgenden Architekten überschatteten den Bau. Erst 1731 konnte der Kurfürst einen Flügel beziehen; der Gesamtkomplex war noch immer unvollendet, als Kurfürst Karl Theodor (1742–1799) die bayerische Kurwürde erbte und 1777 mit seinem Hof nach München zog. In Sachsen sollte die Bautätigkeit vor allem Dresdens Ruf als prächtiges Zentrum eines dominanten Musterterritoriums stärken, dessen Herrscher sowohl Kurfürst als auch führender Protestant und (1711) Reichsvikar war, zudem war sie ein Mittel im Wettbewerb mit Brandenburg und Hannover und im Hinblick auf den erhofften Erwerb der polnischen Krone sowie eventuell auch der Kaiserkrone. Mitglieder der Herrscherfamilie reisten nun zwar eher nach Frankreich als nach Italien, aber ihre Bauten zeichnen sich eher durch stilistische Hybridität als sklavische Frankophilie aus. 7 Der monumentale Barockpalast im Großen Garten, den die Kurfürsten Johann Georg II. (1656–1680) und Johann Georg III. (1680–1691) 1678–1683 erbauen ließen, war klar von den Erweiterungen des Louvre durch Berninis Nachfolger Claude Perrault 1665–1680 inspiriert. 8 Der lokale Geschmack und Anregungen durch die Arbeit französischer und italienischer Architekten und Künstler im benachbarten Böhmen sorgten jedoch für so viele dekorative Zusatzdetails, dass das Gebäude allgemein als Originalwerk des »deutschen Barock« gilt. Der Erwerb der polnischen Krone 1697 lenkte die Aufmerksamkeit des Kurfürsten nach Polen und stürzte August den Starken (1694–1733 sowie 1697–1704 und 1709–1733 in Polen) in die Katastrophe des Großen Nordischen Kriegs (1700– 1721). Schon vor Ende der Kämpfe wurde indes in Dresden schon wieder gebaut, und zwar ab 1709 der Zwinger, eine Reihe hölzerner Anlagen um einen Festplatz zwischen innerer und äußerer Festungsmauer. 9 Matthäus Daniel Pöppelmann erhielt den Auftrag, dort Steingebäude zu errichten, und wurde zur Anregung nach Prag, Wien, Venedig und Rom geschickt. Als die Pavillons dann Form annahmen, sandte man ihn nach Paris, um Ideen für die Innendekoration zu sammeln. Die feierliche Eröffnung fand 1719 anlässlich der Hochzeit von Augusts Sohn mit Erzherzogin Maria Josepha statt. Ursprünglich mag die fertige Anlage vom Trianon de Porcelain in Versailles inspiriert gewesen sein, in Rom, Prag und dem SchönbornSchloss bei Göllersdorf in Niederösterreich gesammelte Anregungen veränderten die Gestaltung jedoch enorm. Trotz weiteren Nebengebäuden, umfangreichen Pla-
27. Der Hof: seine Kultur, Funktionen und Kritiker
nungen und Vorbauten (etwa der sogenannten Brühlschen Terrasse) wurde der große Palast nie errichtet. Dresden beherbergte die berühmte kurfürstlich-königliche Kunst- und Porzellansammlung; August kam zu Besuch und hielt Empfänge, residierte aber nie hauptsächlich dort. Auch in Brandenburg spielten die 1701 mit dem Erwerb der preußischen Krone verwirklichten königlichen Ambitionen eine wesentliche Rolle. Der Stil war eklektisch, unterschied sich aber deutlich von dem in Wien. Hier kamen die prägenden Einflüsse aus den Niederlanden, und auch Stockholm diente als Vorbild einer protestantischen Hauptstadt. Charlottenburg, ab 1695 von dem schwedischen Architekten Johann Friedrich Eosander als Landschloss entworfen, integrierte niederländische Gartengestaltung in einen Gebäudekomplex, der mit dem offenen Hof an Versailles erinnerte, allerdings überragt von einem entschieden unfranzösischen Zentralturm. Dies wird gern als Ausdruck des protestantischen Glaubens des Kurfürsten gedeutet, könnte jedoch ebenso als Beispiel für das Festhalten an der Tradition des mittelalterlichen Burgturms dienen. 10 Noch dramatischer geriet Andreas Schlüter einige Jahre später das neue Schloss in Berlin. 11 Andere Meister, etwa der Italiener Domenico Martinelli und Nicodemus Tessin der Jüngere, hatten den Auftrag abgelehnt. Schlüter war eigentlich Bildhauer, hatte aber zumindest am Bau des Königspalasts in Warschau mitgewirkt und wusste deshalb, wie ein König wohnen sollte. Sein gewaltiger rechteckiger Entwurf mit Kolonnaden, Risaliten und aus der Frontfassade ragenden Blöcken folgte französischen und italienischen Vorbildern, ohne diese zu kopieren. Bei der Fertigstellung durch Eosander als Nachfolger des 1708 entlassenen Schlüter (dessen technische Fähigkeiten zu wünschen übrig ließen) war der später als Stadtschloss bezeichnete Palast einer der größten in Europa, zugleich ornamentierter und von massiverer Nüchternheit als Versailles und Schönbrunn. Die hannoverschen Paläste waren vergleichsweise eher bescheiden, drückten aber nicht weniger Ehrgeiz aus. Schon als Fürstbischof von Osnabrück hatte Ernst August von Braunschweig-Lüneburg mit einem neuen Palast ein Zeichen gesetzt. 12 Als Herzog von Calenberg trieb er energisch die von seinem Bruder ererbten Baupläne für Schloss und Gärten in Herrenhausen bei Hannover voran. Die Gärten waren überwiegend in niederländischem Stil gehalten, auf drei Seiten von Kanälen umgeben; angelegt wurden sie von niederländischen, französischen und italienischen Gestaltern unter Leitung von Herzogin Sophie, ständig beraten von Leibniz. Obwohl weniger ehrgeizig als vergleichbare Bauten, war der Palast doch ein mehr als angemessener Schauplatz für die Zeremonie der britischen Thronfolge 1714, der Marlborough und Prinz Eugen von Savoyen beiwohnten. Damit endete Herrenhausens große Zeit: Nachdem Georg II. es 1755 ein letztes Mal besucht hatte, verfiel das Holzgebäude; 1806 war es nur noch eine Ruine. Im Übrigen entwickelte sich jedes Territorium stilistisch und zeitlich unter-
263
264
III. · Die deutschen Territorien um 1648–1760
schiedlich. Manche Fürsten bauten früh, weil ihre Residenzen im Krieg zerstört worden waren. Andere warteten damit fünfzig Jahre oder länger, weil sie zunächst ihre Finanzen ordnen und ihr Territorium wieder in den Griff bekommen mussten. Auch die Kriege mit Frankreich waren für viele ein Hindernis, und so erreichte der Bauboom seinen Höhepunkt erst in den 1720er und 1730er Jahren nach dem Spanischen Erbfolgekrieg, dessen Ende eine lange Phase von Frieden und Sicherheit einleitete. Herzog Ernst von Gotha begann bereits 1643 mit dem Bau seines monumentalen Schlosses Friedenstein, das 1655 fertiggestellt war. Dass er die gesamte Anlage finanzieren konnte, ohne eigens eine Steuer dafür zu erheben, führte zu Gerüchten, auf dem Schlossberg sei ein Schatz gefunden worden. Die Wahrheit war prosaischer: Etwa ein Viertel der 53.000 Gulden stammte aus dem Erbe seines 1639, ein Jahr vor der Aufteilung des Herzogtums Weimar unter den drei (von acht) überlebenden Brüdern, verstorbenen Bruders, des Renegaten Bernhard von Weimar. 13 Den Rest brachte er durch sorgfältige Verwaltung und ein sparsames Leben auf; die Kosten hielten sich zudem im Rahmen, da Baumaterial aus dem 1567 zerstörten alten Schloss und Kriegsruinen aus der Gegend um Gotha wiederverwendet wurde. Die Motive des Herzogs waren klar: Seit der Teilung verfügte Gotha nicht mehr über eine »komfortable fürstliche Residenz«. Irgendwo musste er schließlich wohnen. In vielen Fällen waren die Absichten programmatisch. Am deutlichsten wird das bei den schwäbischen Äbten, die fast alle zwischen 1648 und 1750 neue barocke Residenzen, Klöster und Kirchen errichten ließen. 14 Die meisten proklamierten mit einem sogenannten Kaisersaal und anderen Einrichtungen ihren Katholizismus, ihren unabhängigen Status im Reich und ihre Kaisertreue. 15 Das trifft offensichtlich auch für die schöpferische Schönborn-Dynastie, deren »Teufelsbauwurm« anschaulich den Reichtum und die Extravaganz des deutschen Geschmacks demonstrierte. 16 Allein zwischen 1693 und 1729 schlossen fünf Familienmitglieder zwölf größere Bauvorhaben ab, neben zahlreichen anderen weltlichen Gebäuden und Kirchen, darunter die monumentale Wallfahrtsbasilika Walldürn in Kurmainz, die Platz für 5.000 Menschen bot. Diese fünf hielten die Kurwürden von Mainz und Trier, die Bistümer Bamberg, Konstanz, Speyer, Würzburg und die Fürstpropstei Ellwangen, zählten also definitiv zur »kaiserlichen Partei«, auch wenn sie politisch oft nicht mit dem Kaiser übereinstimmten. 17 Gleichzeitig waren die Schönborns auf die langfristige Sicherung der Zukunft ihrer Dynastie und die Wirkung ihrer Taten bedacht. Vor allem scheinen sie geradezu besessen davon gewesen zu sein, Wien zu beeindrucken. Lothar Franz von Schönborn wollte den Wiener Hof überzeugen, es gebe in Wien »nichts Besseres oder Schöneres«. 1715 schrieb er seinem Neffen Friedrich Karl über sein luxuriöses Bauprojekt Schloss Weißenstein in Pommersfelden (1711–1718), »die herren
27. Der Hof: seine Kultur, Funktionen und Kritiker
Österreicher« sollten »sehen, dass wier hieraus im reich eben nicht so kahle kerl seien, gleichwie wier gemeiniglich bei ihnen davor passiren, da dann, wann die Pommersfelldische galerie dazu kommet, vielleicht bei diesen prallhansen nichts dergleichen zu finden sein derfte«. 18 Was Stil, Dekoration und Symbolismus betrifft, zeigten sich die Schönborns entspannt und freigeistig. Sie sicherten sich die Dienste des Wiener Meisters Johann Lucas von Hildebrandt, des jüngeren Fischers von Erlach sowie deren deutschen Schülers Balthasar Neumann und bedienten sich ungeniert bei den Vorbildern, die österreichische und böhmische Magnaten in Wien, Prag und anderswo gesetzt hatten. In Bamberg indes beauftragte Franz Lothar 1705 den italienischen Künstler Andrea Pozzo, »eine römische Historie, oder sonsten etwas von seiner invention, so in das morale einlauffet«, vorzuschlagen, und 1701 störte es ihn wenig, dass Melchior Stein in einem Deckengemälde mehr oder weniger exakt das des achtzig Jahre alten Goldenen Saals im Augsburger Rathaus kopierte. Er wünschte lediglich, dass die vier Ecken anstatt der vier Erdteile die vier Weltreiche zeigten. Wichtiger als die bildliche Botschaft war ihm das Budget. 19 Lothar Franz’ Neffe, Kardinal Damian Hugo, der Bischof von Speyer, plante in Bruchsal 1720 zunächst einen Bau nach französischem Vorbild, änderte seine Meinung jedoch nach der Teilnahme am Konklave in Rom 1721 und entschied sich für eine Mischung aus französischen, italienischen, englischen und niederländischen Elementen. Der Zweck des ganzen Projekts war nicht, Versailles zu imitieren, sondern die von den Franzosen zerstörte Residenz zu ersetzen, und dass er auf dem Land in Bruchsal bauen ließ, lag daran, dass ihm der Rat der protestantischen Reichsstadt den Wiederaufbau der Stadtresidenz nicht gestatten wollte. Bruchsal war somit auch eine hochtrabende Geste des Trotzes gegenüber den Herren von Speyer. Es täte ihm leid, bemerkte er bissig, »wenn er tot, geschweige denn lebendig in Speyer sein müßte«. 20 Auch protestantische Projekte entfernten sich oft von der ursprünglichen Planung. Markgraf Friedrich Magnus von Baden-Durlach (1677–1709) wollte einen »protestantischen« Palast wie Schlüters Berliner Schloss als Gegensatz zu der Mischung aus Versailles und Schönbrunn seines Baden-Badener katholischen Verwandten Ludwig Wilhelm in Rastatt. Letztlich blieb seinem Nachfolger Karl Wilhelm (1709–1738) jedoch nichts anderes übrig, als denselben italienischen Architekten (Domenico Egidio Rossi) wie Ludwig Wilhelm mit dem 1715 begonnenen Bau des Palastes und der Stadt Karlsruhe zu beauftragen. Der ursprüngliche Plan eines Monumentalbaus mit vier Flügeln wurde fallen gelassen; stattdessen entschied man sich für einen achtkantigen Zentralturm, von dem zweiunddreißig Alleen abgingen, je fünfzehn in den Park und in die Stadt sowie zwei als Hauptachse durch das Achteck, das Park und Stadt verbindet. 21 Politische und dynastische Ambitionen, persönlicher Geschmack, Familien-
265
266
III. · Die deutschen Territorien um 1648–1760
traditionen, regionale Stile, regionale und internationale Politik, Rivalitäten zwischen und innerhalb von Dynastien, konfessionelle Vorlieben, Finanzen – all das wirkte sich darauf aus, was und wie gebaut wurde. Die fast unendliche stilistische Vielfalt ist eine Art Markenzeichen des deutschen Barock, aber die Gliederung der Innenräume verfolgte im Allgemeinen stets das gleiche Ziel: eine Schaubühne für die zunehmend verfeinerten höfischen Zeremonien zu bieten, in denen Rangordnungen und Hierarchien Ausdruck fanden. 22 Dem zentralen Abschnitt des Gebäudes mit seiner prächtigen Treppe und dem großen Saal maß man in praktisch allen neuen Bauten der Zeit besondere Bedeutung bei. Der stattliche erste Stock, das Piano nobile, war stets höher und reicher verziert als die anderen Stockwerke. Treppen waren für zeremonielle Empfänge besonders wichtig. Auch in der Möblierung spiegelte sich die Hierarchie, etwa in Stühlen für niedere und Armsesseln für höhere Ränge, ebenso wie in den Logen, Rängen und Galerien der neuen Theater und Opernhäuser, auf die kaum ein Hof mehr verzichtete. Die Kapelle, einst ein abgeschiedener Gebetsort für die Herrscherfamilie, wurde zur öffentlichen Schlosskirche, wo wichtige familiäre Ereignisse der Herrscher begangen wurden. Ebenso sorgfältig inszeniert war der Außenbereich, der mit Gärten und Parks im niederländischen oder französischen Stil die architektonische Gliederung des Schlosses buchstäblich bis zum Horizont erweiterte. Wie die Paläste selbst waren Gärten und Parks Theaterbühnen, auf denen Feuerwerke und Illuminationen, Maskenbälle und »Bauernfeste«, Schießwettbewerbe, Turniere und »Täntze zu Ross« stattfanden und man im Winter Schlittschuh lief und Schlitten fuhr. 23 Dort vergnügte man sich auch mit der Jagd, auf die sich viele Fürsten im Lauf des 17. Jahrhunderts ein Monopol gesichert hatten, insbesondere für Hochwild (Hirsche und Rehe) und Schwarzwild (Wildschweine). 24 In den 1680er Jahren erfreute sich die aus Frankreich übernommene Parforce- oder Treibjagd besonderer Beliebtheit, außer in den österreichischen Erblanden, wo Leopold I. sie 1701 untersagte. 25 Die zunehmende Komplexität des höfischen Lebens ließ eine Flut von Handbüchern und Führern entstehen. Um 1700 erschienen in einigen größeren Territorien die ersten Hofkalender, nach 1770 waren sie überall gängig. 26 Für das Jahrhundert zuvor war eher die systematische Darstellung zeremonieller Prozeduren samt Rangtafeln, Titulationen und korrekten Anredeformen typisch. Das erste wichtige Werk hierzu war Johann Christoph Becmanns Notitia dignitatum illustrium civilium, sacrarum, equestrium (Verzeichnis berühmter ziviler, religiöser, ritterlicher Würdenträger), 1670 in Frankfurt an der Oder erschienen. Seinen Höhepunkt erreichte das Genre im frühen 18. Jahrhundert mit Johann Christian Lünigs monumentalem zweibändigen Theatrum Ceremoniale Historico-Politicum, oder Historisch- und Politischer Schau-Platz Aller Ceremonien (Leipzig 1719). Lünig war Leipziger Stadtschreiber und als Autor zu Reichsrecht und Geschichte bekannt.
27. Der Hof: seine Kultur, Funktionen und Kritiker
Sein Leipziger Zeitgenosse Julius Bernhard von Rohr erweiterte sein kameralistisches und juristisches Werk um das 1729 in Berlin gedruckte systematische Handbuch Einleitung zur Ceremoniel-Wissenschafft der großen Herren. Praktisch die gesamte nach 1648 veröffentlichte Hofliteratur und die Entwicklungen auf allen Feldern des höfischen Lebens fasste Friedrich Karl von Mosers zweibändiges Teutsches Hof-Recht (1754/55) zusammen, von detaillierten Informationen zur Palast- und Gartengestaltung über die Tischordnung an adligen Tafeln bis hin zu Benimmregeln für jedermann vom Hofprediger bis zum »Kammermohr«. 27 Die Rolle der Höfe in der Entwicklung der deutschen Kultur war Thema vieler nationalistischer Mythen, aber kaum stichhaltiger moderner Forschung. Liberale wie preußische Historiker des 19. Jahrhunderts, die die Kleinstaaterei kritisierten, prangerten auch Gallomanie (übertriebene Begeisterung für alles Französische) als eines der vielen Verbrechen deutscher Fürsten nach 1648 an. 28 Der hofzentrierten, frankophilen Adelskultur setzten sie das Ideal einer entstehenden, einheimisch orientierten »bürgerlichen« Kultur entgegen, die frühe Vertreter der Aufklärung wie Thomasius befürworteten. Zweifellos schlug sich der französische Einfluss nirgendwo so nieder wie in Sprache, Gehabe und Kultur der Höfe. 29 Friedrich Karl von Moser stellte um 1650 fest, die protestantischen Höfe in Deutschland seien bereits »französisch«, die katholischen »österreichisch und spanisch«. Das spanische Hofritual hielt sich in Wien und an anderen katholischen Höfen bis weit ins 18. Jahrhundert, in Drama und Dichtung überwogen jesuitische Traditionen. 30 Hier machte sich der Einfluss der französischen Sprache und Kultur auf die aristokratische und gebildete Elite langsamer bemerkbar, wurde aber letztlich ebenso prägend wie in den protestantischen Territorien. 31 1687 konnte Christian Thomasius feststellen: »Frantzösische Kleider/Frantzösische Speisen/Frantzösischer Haußrath/Frantzösische Sprachen/ Frantzösische Sitten/Frantzösische Sünden, ja gar Frantzösische Kranckheiten sind durchgehends im Schwange.« 32 Angesichts der Flut antifranzösischer Propaganda im Reich, die Frankreich als westliches Gegenstück zur despotischen Türkei, als Nation von »Huren«, »Idioten«, »mörderischen Brandstiftern« und »Eseln« charakterisierte, ist dies doch erstaunlich. 33 Dass Schriftsteller wie Johann Michael Moscherosch (* 1601, † 1669) und Friedrich von Logau (* 1605, † 1655) die Alamode-Tendenzen der Epoche nach 1650 brandmarkten und die Anleihen bei der französischen Sprache, den Sitten und der Mode missbilligten, ist ebenso sehr auf diesen politischen Kontext zurückzuführen wie auf die anhaltende Sorge um Zustand und Reinheit des Deutschen in der Tradition der Sprachgesellschaften. Dass Thomasius 1687 seinen Schülern riet, den Franzosen nachzueifern, erscheint vor diesem Hintergrund außerordentlich kühn und gewagt.
267
268
III. · Die deutschen Territorien um 1648–1760
Die Debatte über französische Vorbilder muss jedoch in einem breiteren Umfeld gesehen werden. Die meisten wichtigen literarischen (und künstlerischen) Genres entstanden an den Höfen oder im Schatten von Höfen und Regierungen. Die Autoren waren überwiegend Adlige, Regierungsbeamte, Lehrer und Gelehrte. Anderen gelang es nur äußerst selten, vom Schreiben zu leben: August Bohse (* 1661, † 1730, bekannt als »Talander«) und Christian Friedrich Hunold (* 1680, † 1721, »Menantes«) als Prosaautoren sowie Johann Christian Hallmann (* 1640, † 1704) als Dramatiker waren Ausnahmen, aber auch Bohse und Hunold arbeiteten verschiedentlich als Lehrer. Auch die Leserschaft beschränkte sich größtenteils auf Höfe, Adel und Bildungsbürgertum. Die allgemeine Entwicklung war einerseits kontinuierlich und erlebte andererseits ab den späten 1670er Jahren einen Umschwung. 34 Dass die Höfe das kulturelle Leben dominierten, führte nicht automatisch zu Unterwürfigkeit und Konformismus. Ab dem 16. Jahrhundert existierte neben der affirmativen, von Baldassare Castiglione (* 1478, † 1529) geprägten Schule eine kritische Tradition, die sich auf Castigliones Zeitgenossen Fray Antonio de Guevara (* 1480, † 1545) zurückführen lässt. Im 17. Jahrhundert erlebte sie einen Aufschwung durch die deutsche Begeisterung für John Barclays Argenis (1621) und das Criticón von Baltasar Gracián (1651–1657). 35 Der Salon im Pariser Hôtel de Rambouillet inspirierte ebenfalls Ideen von einer noblesse d’esprit als Gegensatz zur grossièreté de ton des höfischen Lebens – vielleicht noch mehr, weil sein konzeptuelles Vokabular von bedeutenden Köpfen wie Thomasius übernommen wurde. 36 Mehr als ein halbes Jahrhundert nachdem Molière den Salon in Les Précieuses ridicules (1659) verspottet hatte, übten die Ideale der précieux in Deutschland starken Einfluss aus. Der Schwerpunkt lag im Allgemeinen auf Reform und Fortschritt, nicht auf Opposition und Ablehnung. Selbst als oppositionell eingeordnete Literatur wie die Stücke des protestantischen »Schultheaters« wollte meist zu guter Herrschaft ermuntern und betonte die Zwecklosigkeit und die schlimmen Folgen einer Rebellion. Die 1683 entstandene Tragödie über den neapolitanischen Rebellenführer Masaniello von Christian Weise (* 1642, † 1708), eine von vielen deutschen Verarbeitungen des Aufstands in Neapel, die die Inkompetenz, Grausamkeit und Scheinheiligkeit des Herrschers und seiner Berater hervorhoben, unterstreicht zugleich die noch übleren Folgen der Revolte. Gute und besonnene Herrschaft, die eine Rebellion erst gar nicht provoziert, meint Weise, sei bei Weitem am besten. 37 Weise selbst war mitverantwortlich für den Einstellungswandel in den 1670er Jahren. Ab 1678 Rektor des Gymnasiums im sächsischen Zittau, ließ er die meisten seiner Stücke von seinen Schülern aufführen, um ihre Ausbildung zu Beamten der Territorialregierung zu fördern. Seine Werke richteten sich somit eher an die Beamtenschaft als an Höflinge. Sie standen stellvertretend für eine neue Welle fran-
27. Der Hof: seine Kultur, Funktionen und Kritiker
zösischer Einflüsse in der deutschen Kultur ab den 1680er Jahren. Eine entscheidende Inspirationsquelle war der Glaube an Reinheit und Originalität der französischen Sprache, den Autoren wie François Charpentier zum Ausdruck brachten.Vor allem aber erarbeitete Weise Anstandsregeln – für zurückhaltendes, gutes, gerechtes und moralisches Benehmen – für adlige wie nichtadlige Regierungsbeamte sowie Lehrer und Akademiker. Es war daher kein Widerspruch, dass Thomasius gleichzeitig das Nachahmen der Franzosen empfahl und seine ersten deutschsprachigen Vorlesungen – die ersten überhaupt an einer deutschen Universität – ankündigte. Die deutsche Jugend, erklärte er, könne von Haltung, Selbstvertrauen und Stolz der Franzosen lernen; bezeichnenderweise behandelten seine Kurse Graciáns Grundregeln für ein vernünftiges, weises und bescheidenes Leben. Wie Weise wollte Thomasius die Tugend der »politischen Klugheit« fördern – die Fähigkeit, sich anständig zu benehmen, zu konversieren und akzeptiert zu werden. 38 Dadurch ließen sich vielleicht sogar Hof und Adel reformieren, wenn Nichtadlige in der Lage wären, durch Anerkennung ihrer selbst und ihrer Ideen auf gleicher Ebene zu partizipieren. Die bis in die 1720er Jahre höchst beliebte »galante« Literatur – Poesie und vor allem Dichtung – vertrat dieselben Werte, allerdings meist gewürzt mit oft anzüglicher amouröser Gefühligkeit. Wie wir noch sehen werden, stand die Literatur und Moralphilosophie von Weise und Thomasius Pate bei der Entwicklung der Frühaufklärung. 39 In diesem Kontext trugen sie zur Evolution einer nichtadligen Ideologie bei, die sich Mitte des 18. Jahrhunderts gegen die Höfe wandte. Friedrich Karl von Mosers Teutsches Hof-Recht von 1754/55 war ebenso sehr Anklageschrift wie Führer. Bis etwa 1740 aber blieb die Verbindung zwischen Hof und Regierung, zwischen Adel und Nichtadel, stabil. Die neue Moralphilosophie drängte auf eine Reform von Hof und Regierung, wollte den Adel zivilisieren und den Ansichten gebildeter Bürgerlicher Gewicht verleihen.
Anmerkungen 1 2 3 4 5 6 7 8 9
DaCosta Kaufmann, Court, 318. Schütte, Schloss, 274–291; Müller, Schloss, 119 f., 393–400; vgl. auch Band I, S. 643 ff. Müller, Fürstenhof, 65. Braunfels, Kunst I, 186–200; vgl. S. 160 f. Braunfels, Kunst I, 302–312; Miller und Taddey, Handbuch, 502 f.; Petri, Handbuch, 60 f., 285–288. Vgl. S. 179–184. Watanabe-O’Kelly, Court Culture, 204–207. DaCosta Kaufmann, Court, 278; Braunfels, Kunst I, 258. Ebd., 259–265; DaCosta Kaufmann, Court, 325 ff.
269
270
III. · Die deutschen Territorien um 1648–1760
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Braunfels, Kunst I, 117 f. Ebd., 109–114. Braunfels, Kunst II, 357 f. Klinger, Fürstenstaat, 21–25, 125–132. Vgl. die Überblicke in: Braunfels, Kunst III, 353–456; Luh, Reich, 113–117; Beales, Prosperity, 58–83. Matsche, »Prachtbau und Prestigeanspruch«; Müller, »Kaisersäle«. Schraut, Haus Schönborn, 201. Einer von ihnen, Graf Rudolf Franz Erwein von Schönborn (* 1677, † 1754), war kaiserlicher Rat und Gesandter in Frankfurt sowie später Kammerherr am Hof von Mainz. Zitiert nach Schraut, Haus Schönborn, 204. Erichsen, »Kaisersäle«, 283. Engelberg, »Reichsstil«, 296 f.; Braunfels, Kunst II, 309–314. Braunfels, Kunst I, 297–301. Die Straßen wurden nach den Mitgliedern eines vom Markgrafen gestifteten neuen Ordens der Treue benannt, dessen einunddreißig Angehörigen er als Großmeister vorstand. Müller, Fürstenhof, 68–74. Vgl. zu Pferdeballetten Watanabe-O’Kelly, »Equestrian Ballet«. Schunka, Soziales Wissen, 105 f.; Conrad, Rechtsgeschichte II, 143 f. Knoll, Umwelt, 48, 51 f. Vgl. zum Folgenden Bauer, Hofökonomie, 71–134. Bauer schreibt Becmanns Namen »Beckmann«, auch die Schreibweise »Bekmann« ist verbreitet; ADB II, 240, und andere folgen Becmanns eigener Schreibung. Müller, Fürstenhof, 83; vgl. auch Bauer, Hofökonomie, 102–106. Müller, Fürstenhof, 90. Vgl. zur Sprache Wells, German, 265–272. Pečar, Ökonomie, 196–200. Schattenhofer, »Kultur Münchens«, 203 f. Barnard, »Thomasius«, 432. Wrede, Reich, 349–357, 537–545. Žmegač, Geschichte I/1, 28 f. Kiesel, Bei Hof, 129–136, 176–187. Žmegač, Geschichte I/1, 26. Kaiser, Mitternacht, 134–144, 153–162, 170 f.; Emrich, Literatur, 212 ff. Žmegač, Geschichte I/1, 23 ff. Vgl. S. 383 f.
28. Die Entwicklung der militärischen Macht
H
and in Hand mit der Entfaltung kultureller Macht ging die Entwicklung militärischer Macht. Im Jahrhundert nach dem Westfälischen Frieden bildeten die meisten führenden deutschen Territorien stehende Heere; dies gilt allgemein als ein Kernelement des »absolutistischen Zeitalters«. Militärmacht, so heißt es, half den Fürsten, die Kontrolle über ihre Territorien zu festigen.Viele von ihnen »kommerzialisierten« ihre Streitkräfte, sodass das Reich zum Zentrum eines »Söldnerhandels« wurde, der Truppen zu Konflikten in ganz Europa und schließlich auch nach Nordamerika exportierte. 1 In diesem Wettbewerb galt Brandenburg-Preußen, das sich bis Mitte des 18. Jahrhunderts zur europäischen Großmacht entwickelte, als klarer Führer. Die Entwicklung seiner Militärmacht wird oft als beispielhaft für ganz Deutschland betrachtet, kleinere Territorien hingegen als blasse, bisweilen geradezu drollige Nachahmer. Tatsächlich war Preußen herausragend, aber auch Teil einer Entwicklung, in der sich die Evolution der Höfe widerspiegelt. Vielen gilt dies als natürliche Folge des ungeheuren Anwachsens der Streitkräfte im Dreißigjährigen Krieg, aber diese Armeen blieben nach dem Krieg nicht einfach im Sold. 2 Außer den Habsburgern lösten praktisch sämtliche deutschen Territorien ihre Heere nach 1648 auf und behielten zunächst einmal höchstens kleine Truppen. Brandenburg etwa verfügte 1650 über lediglich 700 Soldaten. 3 Meist dienten sie nur dem Herrscher als Leibgarde oder persönliche Schutztruppe. Dass der Ausbau der Militärmacht bald wieder als dringlich empfunden wurde, hatte politische und militärische Gründe. Das Reichsrecht begünstigte und beschränkte die Bildung militärischer Kräfte. Im Westfälischen Frieden war das Recht der Fürsten festgeschrieben worden, auswärtige Allianzen einzugehen, solange sie nicht gegen den Kaiser gerichtet waren. Der kaiserliche Rezess von 1654 (§ 180) erlaubte die Erhebung von Steuern zur Finanzierung der »nöthigen Vestungen/Plätzen und Guarnisonen«. 4 Andererseits legte Leopold I. 1671 sein Veto gegen den Vorschlag ein, Herrschern unbeschränkte Steuermacht für jederlei Verteidigungszwecke zu verleihen. Die Reform der Reichsarmee 1681/82 wiederum schien das Recht der Herrscher zur Aufstellung von Truppen zu bestärken. Die Entscheidung gegen ein stehendes Reichsheer und zugunsten einer nach Bedarf aus Kontingenten der Territorien zusammengestellten Streitmacht verpflichtete die Reichsstände zu deren Unterhaltung, die zur Bedingung für die »Vollmitgliedschaft im Reich (Reichsstandschaft)« wurde: Wem es
272
III. · Die deutschen Territorien um 1648–1760
nicht gelang, sein Kontingent beizusteuern oder einen anderen Fürsten zu bezahlen, damit er ihn vertrete, der riskierte den Verlust der politischen Autonomie. 5 Jene Herrscher, die auf eine »Extension« von Leopolds Entscheidung von 1671 drängten und daher Pläne für eine Reichsarmee unter kaiserlicher Kontrolle blockierten, handelten aus verschiedenen Motiven. Der Einsatz militärischer Macht im eigenen Land war sicherlich eines davon. In den Jahrzehnten nach dem Krieg, als die Regierungen ihre Autorität wiederherzustellen suchten, herrschte verbreitete Furcht vor Unruhen in vielen Teilen des Reichs. Die Debatte über die Reaktion auf das Hilfsgesuch Karls II. an den Reichstag unterstrich, wie nötig Bewaffnung und Solidarität für die Fürsten waren. Weil Unzufriedene in vielen Territorien das Vokabular des englischen Konflikts übernahmen, ersuchte Braunschweig-Wolfenbüttel um ein Verbot der Schriften von Milton im ganzen Reich. 1658 hatte sich die Lage so weit beruhigt, dass der Reichstag ein Verbot für unnötig erachtete und beschloss, eine Botschaft des guten Willens an Karl II. sei hinreichend. 6 Dennoch griffen manche Fürsten noch jahrzehntelang zur Lösung innerer Probleme auf Waffengewalt zurück. Zwischen 1655 und 1672 unterwarfen sie auf diese Weise eine Reihe von Städten in ihren Territorien. Der Münsteraner Bischof Bernhard von Galen entsetzte Münster seiner Autonomie (nach vier Angriffen 1657–1661). Der Kurfürst von Mainz ging ebenso gegen Erfurt vor (1664), der Kurfürst von Braunschweig gegen Magdeburg (1666) und die Herzöge von Braunschweig gegen die Stadt Braunschweig (1671). 7 Andere Herrscher setzten Truppen gegen renitente Stände und Steuerverweigerer ein. Andererseits bestärkte das kaiserliche Veto von 1671 die Stellung der Territorialstände, wodurch der Einsatz von Militär im Inneren zunehmend unpraktikabel wurde, weil bei einem Appell an die Reichsgerichte ein bewaffnetes Einschreiten gegen den Aggressor drohte. Das galt indes nicht unbedingt für jede Anwendung von Waffengewalt gegen weniger mächtige Nachbarn. Eine Streitmacht konnte relativ kleinen Territorien sicherlich zur Abschreckung dienlich sein. Ebenso konnte jeder Herrscher und Territorialstand, dessen Land besetzt wurde, die Reichsgerichte anrufen und im Falle eines günstigen Urteils darauf hoffen, dass kaiserliche Gesandte und Kreistruppen es durchsetzten. Dennoch kam es häufig, wenn auch oft nur vorübergehend, zur Besetzung kleiner Territorien, etwa um Erbansprüche durchzusetzen. Typisch ist der Fall der ansonsten unscheinbaren Westerwaldgrafschaften von Sayn-Hachenburg und Sayn-Altenkirchen im niederrheinisch-westfälischen Kreis. Mit dem Tod von Herzog Wilhelm Heinrich von Sachsen-Eisenach 1741 fiel Sayn-Altenkirchen an Karl Wilhelm Friedrich von Brandenburg-Ansbach, einen Schwager Friedrichs des Großen. Die Grafen von Sayn-Wittgenstein, die obendrein auch noch einen Großteil von Sayn-Hachenburg beanspruchten, bestritten seinen Anspruch. Sie sicherten sich den Beistand der Pfalz, die während des Interregnums nach dem Tod von
28. Die Entwicklung der militärischen Macht
Karl VI. das Reichsvikariat ausübte und prompt 700 Soldaten entsandte, zunächst unter dem Vorwand, man überführe nur die Kronjuwelen zur anstehenden Krönung. Preußen drohte damit, den Anspruch Brandenburg-Ansbachs auf Altenkirchen militärisch zu unterstützen; der Herrscher von Hachenburg wiederum, der Lutheraner Georg Friedrich Burggraf von Kirchberg, wurde mehr oder weniger von seinen eigenen (reformierten) Untertanen im Stich gelassen, die Witttgenstein ihre Ehrerbietung erwiesen. Appelle an den neuen Kaiser und andere Autoritäten erwirkten schließlich den Rückzug der pfälzischen Truppen, die Wittgensteins ließen ihren Anspruch fallen, als jedoch Kirchberg von seinen Untertanen eine offizielle Entschuldigung und die Zahlung einer hohen Strafe forderte, sah er sich mit einem Aufstand konfrontiert. Zu dessen Niederschlagung entsandte er zunächst lediglich dreizehn Soldaten; schließlich bekam er 150 Mann zusammen, um seine Autorität wiederherzustellen. 8 Selbst in diesem kleinen Rahmen diente militärische Gewalt häufig als verlängerter Arm der innerdynastischen »Diplomatie« und territorialen Herrschaft. Georg Friedrich von Kirchbergs winziges Heer reichte aus, um in seinem etwa 110 km 2 umfassenden Territorium die Ordnung wiederherzustellen. Daneben gab es zwei weitere wichtige Motive für den Aufbau militärischer Macht. Erstens leitete der Niederländische Krieg 1672–1679 eine Reihe internationaler Konflikte ein, an denen das Reich beziehungsweise Truppen aus dem Reich beteiligt waren und die erst mit dem Spanischen Erbfolgekrieg und dem Großen Nordischen Krieg zu Ende gingen. Bis in den 1720er Jahren wieder einigermaßen Friede im Reich einkehrte, blieb militärische Verteidigung für viele Territorien lebenswichtig, entweder unmittelbar oder weil sie Truppen für die Kreisund Reichsarmee bereitstellen mussten. Zweitens gaben die Kriege ehrgeizigen Fürsten Gelegenheit, sich für die Einschränkungen, die ihnen die Reichsgesetze auferlegten, durch Subsidiarabkommen mit fremden Mächten schadlos zu halten. Dadurch konnten sie zusätzliche Truppen finanzieren, ohne Steuern zu erheben und Konflikte mit ihren Territorialständen zu riskieren. Die energischsten armierten Fürsten waren jene, die im späten 17. Jahrhundert nach Königswürden strebten. 9 Der entscheidende Faktor war natürlich die Souveränität selbst, aber eine bedeutende Armee war Vorbedingung, um in fremden Allianzen und bei internationalen Friedenskonferenzen ernst genommen zu werden. Der Geheime Rat von Hessen-Darmstadt hielt 1711 in einem Abkommen über die Forderung seines Herrschers fest: »Die Armee ist das einzige Mittel, mit dem sich ein Reichsfürst in diesen ohnehin schwierigen Zeiten angemessenen Respekt verschaffen kann. Es ist auch das einzige souveräne Recht und Privileg, dessen Ausübung eine solche Persönlichkeit von anderen, minderen Ständen unterscheidet.« 10 Ganz abgesehen vom tatsächlichen militärischen Nutzen wurde ein eigenes Heer wie Palast und Hof zum Statussymbol. 11
273
274
III. · Die deutschen Territorien um 1648–1760
Seine Aufstellung und Unterhaltung war nicht immer einfach. Die Verteidigungsmilizen im Dreißigjährigen Krieg hatten kläglich versagt. Auch der schwedischen Armee (und anderen, die an den in den 1590er Jahren vom Haus Nassau entwickelten Grundsätzen von Disziplin und Taktik ausgerichtet waren) und den Söldnerheeren von Wallenstein und Bernhard von Weimar war es nicht gelungen, ihre kurzfristigen Erfolge langfristig in politisches Kapital umzumünzen. 12 Aber ihr Vorbild und das des reformierten französischen Militärs der 1650er Jahre wies den deutschen Territorien den Weg. Zugleich machte das Beispiel Wallensteins und Weimars deutlich, wie wichtig es war, die Armee effektiv im Griff zu haben. Anfangs versuchten viele, ihre Milizen wiederzubeleben oder neue zu schaffen, die wiederum auf den alten feudalen Verpflichtungen der Nothilfe von Untertanen für ihre Herrscher (Landfolge) beruhten. Es waren im Allgemeinen keine territorialen oder Bürgerwehren wie im späten 16. Jahrhundert mehr, nur dazu gedacht, Invasoren zurückzuschlagen und den Krieg vom eigenen Land fernzuhalten, sondern reguläre Regimenter. Insbesondere für die kirchlichen und kleineren Territorien, die sich kein stehendes Heer leisten konnten, blieben sie das 18. Jahrhundert hindurch die gängige Form militärischer Organisation; viele haben bis heute als Schützenvereine überlebt, wenn auch mit gänzlich anderer Funktion. 13 In manchen Territorien bestanden Milizen neben regulären Söldnertruppen. So hatte etwa die Stadt Hamburg um 1700 eine Bürgerwehr von stattlichen 10.000 Mann neben einer stehenden Miliz von 1.500. Militärisch waren solche Initiativen jedoch selten effektiv. Die Hamburger Bürgerwehr galt in Krisen als unzuverlässig, nicht zuletzt wegen ihrer »ständigen Besäufnisse«. Bei der Bevölkerung waren die Milizen generell nicht gut angesehen und ihre starke kommunale Bindung machte ihren Einsatz jenseits der Grenzen oder gar im Ausland wenig sinnvoll. Die Markgrafschaft Brandenburg-Bayreuth unter Markgraf Christian Ernst (1661–1712) war eines der wenigen Territorien, denen es gelang, ihre traditionelle Landesverteidigung in eine effektive stehende Armee aus Leibgarde und Landregiment umzuwandeln. Ehrgeizigere Territorien verlegten sich bald auf stehende Armeen und griffen zur Rekrutierung auf ihre Milizen zurück. Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg, von Anfang an ein Verfechter regulärer Armeen, gab seinen Untertanen die Möglichkeit, sich gegen Geldzahlungen dem Militärdienst zu entziehen. Auch andere bauten ab Mitte der 1650er Jahre ihre Leibgarden und Garnisonen aus. Um 1700 unterhielten alle größeren Fürstentümer stehende Heere von etwa 10.000 Mann; nur Habsburg und Preußen übertrafen diese Anzahl mit mehr als 40.000 beziehungsweise 110.000. Die mittleren Herzogtümer und Fürstbistümer hielten normalerweise zwischen 1.000 und 3.000 Soldaten. Der Unterschied zwischen Brandenburg-Preußen und einem Fürstbistum wie Bamberg mit weniger als 1.000 Mann relativiert sich, wenn man bedenkt, dass
28. Die Entwicklung der militärischen Macht
Preußen 110.000 km 2 groß war, Bamberg nur 3.575 km 2. 14 Aber auch einige kleinere Herrscher bildeten dank Subsidien wesentlich größere Streitkräfte: Herzog Friedrich II. von Sachsen-Gotha-Altenburg (1693–1732) etwa konnte sich dank der Zahlungen, die er bis 1702 von Frankreich und danach von Preußen, den Niederlanden und Großbritannien erhielt, bei 1.400 km 2 großem Gebiet gut 6.000 Mann leisten. 15 Die Bildung stehender Armeen ging einher mit der Übertragung der französischen Reformen des 17. Jahrhunderts in Organisation und Administration auf die deutschen Staaten. Disziplin und Ausbildung wurden verbessert, die Rekrutierung geregelt. Manche Territorien integrierten ihre Milizen in reguläre Regimenter; Befehlsketten und militärische Rangordnungen nahmen klarere Formen an. Die größeren Territorien führten administrative Organe ein (Kriegsrat, Kriegskanzlei, Defensionsrat usw.). In erster Linie waren die neuen Streitkräfte ihrem jeweiligen Herrscher zur Treue verpflichtet. Die überwiegend adligen Berufsoffiziere rekrutierte man bisweilen irgendwo anders im Reich, der unabhängige Söldnerkommandeur, der »Militärunternehmer« der Zeit vor 1650, verschwand von der Bildfläche – oder vielmehr übernahmen die Fürsten selbst diese Rolle. 16 Die Position des gemeinen Soldaten, ob zwangsverpflichtet oder inner- beziehungsweise außerhalb des Territoriums frei rekrutiert, ähnelte der des Söldners der vergangenen Epoche. Die strengere Disziplin in einem formelleren Dienstverhältnis erzeugte jedoch auch einen Druck, der die Desertionsproblematik aktuell machte, sowohl praktisch als auch in der theoretischen Literatur. Die scharfen Strafen, mit denen man dagegen vorzugehen versuchte, wirkten oft gegenteilig. 17 Die neuen Armeen erforderten auch neue Formen der Finanzierung. Regierungstruppen mussten von der Regierung bezahlt werden. Einnahmen aus dem eigenen Herrschaftsbereich deckten ebenso wie reguläre Steuern einen Teil der Kosten ab. Traditionelle Regalien (Rechte an Mineralien, Wäldern und Ähnlichem) blieben wichtig; in einigen Territorien kamen neu eingeführte Monopole auf Tabak und Kaffee hinzu, in Bayern die Biersteuer. Grund-, manchmal auch Vermögens-, Herd- und Gebäudesteuern wurden nun nicht mehr nach Bedarf, sondern regelmäßig erhoben. Das führte jedoch oft zum Widerstand der Territorialstände, die selten Lust hatten, Streitkräfte zu finanzieren, die ihre eigenen Rechte und Privilegien bedrohten. Zudem konnten sie sich jederzeit an den Kaiser oder die Reichsgerichte wenden, wenn sie die Steuern für überhöht oder ungerechtfertigt hielten. Brandenburg-Preußen wies den Weg und umging die Stände 1667 mit der Erhebung einer Verbrauchssteuer in den kurmärkischen Städten. Bis 1720 wurde sie in ganz Brandenburg-Preußen eingeführt und im Lauf des 18. Jahrhunderts von den meisten anderen Territorien übernommen. 18 Trotz solcher neuer Einnahmequellen reichten die territorialen Erträge nicht aus, um moderne Streitkräfte in einem Umfang zu finanzieren, der dem politischen
275
276
III. · Die deutschen Territorien um 1648–1760
Rang entsprach, den viele Herrscher nun für sich beanspruchten. Möglich wurde das jedoch durch zwei neuartige Phänomene. 19 Für eine große Anzahl regulärer Armeen waren die Subsidien, die ab den 1660er Jahren aus Frankreich, den Niederlanden, England und Spanien ins Reich flossen, und die Zahlungen von großen Territorien an kleinere lebenswichtig. Profit schlugen nur wenige aus den Subsidien. Hessen-Darmstadt machte im Spanischen Erbfolgekrieg durch die Bereitstellung von Truppen für Hannover und Braunschweig einen Verlust von 420.320 Gulden, weit mehr als die Steuereinnahmen eines Jahres. Bayern erhielt von 1670 bis in die 1740er Jahre riesige Summen von Frankreich, das für die militärische Kooperation zudem zusagte, das Streben der Kurfürsten nach einem Königsthron und der Kaiserkrone zu unterstützen. Im hoffnungslosen Kuddelmuddel der bayerischen Finanzen wusste indes niemand je genau, ob das Geld in die Armee oder in irgendein Bauprojekt gesteckt oder einfach für den Hof und das verschwenderische Leben der Herrscherfamilie ausgegeben wurde. 20 Andere Regierungen führten gewissenhafter Buch und gingen sparsamer mit ihren Ausgaben um. Aber selbst in Bayern trugen die Subsidien zum Gesamteinkommen des Kurfürstentums und damit unter anderem zum Ausbau der Streitkräfte bei. Das einzige größere Territorium, das das Problem der Heeresfinanzierung lösen konnte, war Brandenburg-Preußen. Dort sorgte die Einführung des kantonalen Rekrutierungssystems 1733 dafür, dass die Soldaten in den einzelnen Provinzen ausgehoben und unterhalten wurden, was eine auswärtige Finanzierung überflüssig machte. Dennoch blieben die preußischen Militärfinanzen prekär. 1717 überließ Friedrich Wilhelm I. (1713–1740) August dem Starken von Sachsen seine gesamte Porzellansammlung für die Bereitstellung von 600 Mann. 21 Sowohl er als auch Friedrich II. (1740–1786) betrachteten die silbernen Kerzenhalter und Spiegelrahmen im Berliner Stadtschloss als Teil ihres Wehretats (und Friedrich der Große ließ 1745 und 1757 große Teile davon einschmelzen). Zwischen 1758 und 1761 erhielt Preußen erneut Subsidien in Höhe von 28 Millionen Talern von Großbritannien. 22 Selbst wenn Steuern und Subsidien angemessen waren, flossen die Einkünfte oft unregelmäßig. Einen Palastbau konnte man unterbrechen, aber Armeen mussten versorgt und bezahlt werden. Als zweite neue Entwicklung nach 1648 übernahm der jüdische Hoffaktor (oder Hofjude) die Rolle eines Söldnervermittlers. 23 Praktisch jeder deutsche Hof vertraute auf die Dienste eines solchen Hofjuden (oft »unser Jude« genannt) als Handelsbankier, Versorger und Lieferant von Heer und Hof; selbst niedere Adelsdynastien verließen sich lieber auf sogenannte Hausjuden, manchmal Schankwirte, als auf die reichen Handelsbankiers der Fürsten. 24 Die Hoffaktoren besorgten Darlehen, gaben Vorschüsse auf Subsidien, belieferten das Militär (jedoch nur in Österreich mit Waffen) und wurden in Krisen oft beauf-
28. Die Entwicklung der militärischen Macht
tragt, die Währung zu manipulieren. So ermöglichten sie Herrschern, ihre Territorialstände zu umgehen. Gemäß dem sogenannten Judenregal unterstanden sie persönlich dem herrschenden Fürsten; ihren Status regelten Schutzbriefe (daher die Bezeichnung Schutzjuden). Herrscher, die sich wegen aufgelaufener Schulden an ihre Stände wenden mussten, sahen sich oft mit Forderungen nach Einschränkung ihrer Macht und Ausgaben konfrontiert. Juden fehlte dieses Druckmittel; es war in ihrem eigenen langfristigen Interesse, einfach immer mehr Geld zu leihen. Politisch involviert wurden sie nur selten. Eine Ausnahme war Joseph Süß Oppenheimer (1698–1738), Hof- und Kriegsfaktor bei Herzog Karl Alexander von Württemberg, der wichtige Ämter wie das des Münzdirektors ausübte und 1736 zum Geheimen Finanzrat und Fiskaladjutant ernannt wurde. 25 Sein Schicksal illustriert, wie sehr Juden persönlich von Herrschern abhängig waren: Nach dem Tod des Herzogs 1737 wurde Oppenheimer noch am selben Tag festgenommen, wegen Hochverrats und anderem angeklagt und ohne Beweise irgendeiner Schuld 1738 hingerichtet. Sein »Verbrechen«, begangen mit voller Unterstützung des Herzogs und seiner Beamtenschaft, bestand darin, die Finanzverwaltung im merkantilistischen Sinn zu rationalisieren und den Herzog bei seinem Streben nach Unabhängigkeit von den Ständen zu unterstützen. Sein luxuriöser Lebensstil und seine vielen Amouren erzürnten die württembergischen Honoratioren der nichtadligen Ehrbarkeit nur noch mehr. Er wurde in einem eisernen Käfig öffentlich gehängt. Insgesamt indes kam das Verhältnis zwischen Juden und Herrschern beiden Seiten zugute, auch wenn mit dem Herrscher oft auch der Hoffaktor wechselte. Dass reguläre stehende Heere oft zusätzlich zu den substanziellen Beiträgen zu Kreisstreitkräften und Reichsarmee gebildet wurden, unterstreicht die zunehmende Bedeutung des Militärs in den Territorien des Reichs nach 1648. Für manche Herrscher wurde ein Heer zum ebenso unverzichtbaren Statussymbol wie Palast, Hof und ein imposanter Regierungssitz. Auch die Stabilisierung des Reichs in den nächsten siebzig Jahren war in vielerlei Hinsicht ein »bewaffneter Friede« als Resultat des Wettrüstens zwischen mittleren und großen Territorien. Dass die juristischen Instanzen des Reichs umso mehr respektiert wurden, lag wohl auch daran, dass der Einsatz militärischer Mittel undenkbar wurde. Entscheidend war zudem, dass das Reich ab den 1670er Jahren kontinuierlich als Ganzes bedroht wurde. 26 Das Schreckgespenst innerer Anarchie und Vernichtung von außen sorgte dafür, dass dem Reichsherkommen als Richtschnur höchste Bedeutung beigemessen wurde.
277
278
III. · Die deutschen Territorien um 1648–1760
Anmerkungen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26
Wilson, »Soldier Trade«. Burkhardt, Krieg, 213–224; Burkhardt, Vollendung, 132–143. Wilson, Reich, 225 f. Wilson, German Armies, 31; vgl. auch S. 35, 74. Wilson, »Soldier Trade«, 774; vgl. auch S. 54 ff., 73 f. Berghaus, Aufnahme, 85–98; vgl. S. 35. Wilson, German Armies, 31 f. Müller, Gemeinden, 121, 162 ff., 171 f., 187 f. Wilson, »Soldier Trade«, 778–782. Ebd., 776. Papke, Miliz, 176. Siehe Band I, S. 692 ff., 734–739, 742 f. (orig. 570 ff., 605–610, 612 f.) Papke, Miliz, 100–109. Die meisten heutigen Schützenvereine sind ihrem Namen zum Trotz rein gesellschaftliche Gemeinschaften, die bei Volksfesten und ähnlichen Veranstaltungen eine zeremonielle Rolle spielen; Mitte des 19. Jahrhunderts hatten sie oft einen nationalpatriotischen Anstrich. Caspary, Bamberg, 307, 306–325. Papke, Miliz, 231 f. Redlich, Military Enterpriser II, 77–111. Sikora, Disziplin, 52 f., 216–236, 363–376. Papke, Miliz, 216 f.; Boelcke, »Accise«. Wilson, »Soldier Trade«, 771. Hartmann, Geld, 36–46, 140–149, 222–228. Papke, Miliz, 199. Preisendörfer, Staatsbildung, 28 f.; Papke, Miliz, 221. Papke, Miliz, 232–6; North, Kommunikation, 40 ff., 94; Battenberg, Juden, 42–45, 107– 112; Israel, European Jewry, 101–118; Schnee, Hoffinanz I–IV, bietet den verlässlichsten und umfassendsten Überblick. Schnee, Hoffinanz III, 160 ff. Wilson, »Favorit«. Vgl. S. 43–71.
29. Fürsten und Stände
V
erbreiteter Ansicht zufolge stärkten das Wiedererstarken der Höfe und die Bildung stehender Heere Herrscher und Regierungen auf Kosten der ständischen Körperschaften und repräsentativen Institutionen. Darüber hinaus machte es der Finanzbedarf der Herrschaft selbst in Friedenszeiten notwendig, regelmäßig und dauerhaft Steuern zu erheben und Geldquellen zu erschließen, die nicht von der Zustimmung der Untertanen abhängig waren. Daraus wird gern auf einen Abstieg der Territorialstände oder ihren völligen Untergang nach 1648 geschlossen. Dem scheint jedoch ganz und gar nicht so gewesen zu sein. Die Rolle dieser Gremien veränderte sich in vielen Fällen nach dem Krieg, aber sie bestanden weiterhin. 1769 stellte Johann Jacob Moser in einer Erhebung zu 136 Territorien in dreiundneunzig Fällen ständische Aktivitäten fest. 1 Die Liste war in keiner Weise vollständig, da Moser die weniger formellen Institutionen der kleineren und die Domkapitel der kirchlichen Territorien, die dort ähnliche Funktionen innehatten, ausblendete. Der Krieg markierte einen tiefen Bruch in den Beziehungen zwischen Herrschern und Ständen. 2 Die Gründung ständischer Organisationen in den meisten Territorien im 16. Jahrhundert beziehungsweise ihre Entstehung aus bereits existierenden Institutionen waren Folgen der Umwälzungen im Zuge der Reformation. Territorialregierungen brauchten mehr Geld für sich und um Reichssteuern zu bezahlen. Regionale Unterschiede hatten eine breite Palette institutioneller Formen entstehen lassen. Manche Stände umfassten bis zu fünf separate Kammern für Kleriker, Hochadel, Universitäten, Ritter und Städte; normal waren drei, in denen Adlige, Kirchenmänner, Städte und Bauern vertreten waren. Wo die Adligen das Territorium »verlassen« hatten und Reichsritter geworden waren, bildeten Klerus und Bürgerschaft zwei Kammern. Manche bestanden nur aus Bauern. Der Schlüssel zur Stärke der Ständeschaft lag in ihrer Fähigkeit, große Geldsummen für Steuern aufzubringen und für die Schulden ihres Herrschers aufzukommen. Das wiederum war das Ergebnis jahrzehntelang steigender Preise für Agrarprodukte im späten 16. Jahrhundert. Die Finanzkraft der Stände spiegelte sich in den prächtigen Häusern wider, die viele sich bauen ließen, sowie in ihrem Selbstgefühl als eine Art Mitregenten ihrer Territorien. Der wirtschaftliche Niedergang vor dem Krieg gefährdete diese Stellung, viele Stände fanden es zunehmend schwer, die Schulden zu bedienen, für die sie die Verantwortung übernommen hatten. Der Krieg untergrub ihre Kreditfähigkeit
280
III. · Die deutschen Territorien um 1648–1760
endgültig, da in den 1630er und 1640er Jahren die Landwirtschaft zum Erliegen kam. Zudem erhoben deutsche Regierungen und fremde Mächte nun Steuern in nie dagewesener Höhe, und zwar regelmäßig statt wie bisher sporadisch; in vielen Territorien wurden erstmals Verbrauchssteuern eingeführt. Einige Regierungen besorgten sich die Anleihen, die sie zuvor von ihren Untertanen erhalten hatten, auf internationalen Geldmärkten. Am Ende des Kriegs lösten die Fürsten das Problem, indem sie Zinszahlungen kürzten oder einstellten; nicht wenige zahlten einfach ihre Kriegsschulden nicht zurück. 3 Das verbesserte ihre Lage, aber nicht die der Stände, die mit Schulden aus der Vorkriegszeit in Rückstand waren. Ein herrschender Fürst konnte sich immer leicht neues Geld besorgen, bankrotte Stände nicht. Irgendwann erholten sich auch die Stände vom Krieg und ab dem späten 17. Jahrhundert übernahmen viele wieder ihre traditionelle Funktion als Bürgen für die Schulden ihrer Herrscher. In vielen Fällen war indes das Intervall nach dem Krieg entscheidend, da Fürsten alternative Geldquellen fanden, die ihre Abhängigkeit von den Ständen minderten. So besorgten etwa die Hoffaktoren weiterhin zumindest einen Teil der benötigten Gelder auf internationalen Finanzmärkten, wodurch viele Stände ihr Druckmittel gegen Fürsten verloren. Am stärksten blieben sie dort, wo die Herrscher mangels ausreichender eigener Einkünfte am schwächsten waren. Zugleich verstärkte die Bestätigung der Landeshoheit der Fürsten 1648 deren Abneigung gegen Tagungen des traditionellen Landtags. Die rituelle Inszenierung der gegenseitigen Abhängigkeit von Herrschern und Ständen, bei der die Stände die von ihnen beanspruchte Rolle als Mitregenten oft bis zum Äußersten ausreizten, war mit den autoritären Ambitionen der Nachkriegszeit nicht mehr in Einklang zu bringen. Nach 1648 beriefen viele Fürsten keinen Landtag mehr ein und verhandelten stattdessen lieber mit kleineren Komitees, die wiederum zunehmend oligarchisch wurden und sich von ihren nominellen Wahlkreisen entfernten. Andererseits belegt die fortdauernde Existenz dieser Komitees, meist unterstützt von einem kleinen Stab fester Mitarbeiter und einem Archivar, das Überleben der Institution und ihrer Funktionen. Manche Kommentatoren sind der Ansicht, der Aufschwung der Höfe und insbesondere die Wiedereingliederung der Aristokratie in den Hof habe die Stellung der Stände durch die Zähmung ihres einflussreichsten Elements geschwächt. Christian Wolff stellte 1721 fest, dass »wenn die hohe Landes-Obrigkeit die vornehmsten und mächtigsten Familien im Lande nach Hoffe ziehet, dieses zugleich ein Mittel ist ihre Macht und Gewalt zu befestigen, indem sich niemand eher mit Nachdruck als diese wiedersetzen können«. 4 Sicherlich war das die Strategie der Habsburger. Die Territorialstände ihrer Länder existierten weiterhin, aber nach den 1620er Jahren zerstörten die Habsburger systematisch die Machtposition, die sie
29. Fürsten und Stände
im späten 16. Jahrhundert genossen hatten und die zu der großen konstitutionellen Krise geführt hatte, die dem Dreißigjährigen Krieg vorausgegangen war. Die Eliminierung der protestantischen Nobilität und ihrer Privilegien hinterließ die Habsburger nach 1648 mit einer Reihe grundsätzlich loyaler Stände, dominiert vom Hochadel, der im Allgemeinen am Hof vertreten war oder hohe Hofämter besetzte. In den Provinzen repräsentierten sie die Krone, am Hof die Provinzen (oder vielmehr ihre eigenen diesbezüglichen Interessen), und so wurde der Hof der Habsburger zu einer Art inoffiziellem Parlament ihrer Länder. 5 Das Beispiel fand jedoch kaum Nachahmer im Reich und in den meisten Territorien, in denen sie weiterhin aktiv waren, blieb die Aristokratie das Rückgrat der Stände. Auch andere Faktoren schwächten die Stellung der Stände. Die Kosten der kontinuierlichen Kriegführung im großen Stil ab den 1670er Jahren und die Bildung stehender Heere erforderte regelmäßige Steuern. Auch wenn die Abgaben in der Praxis jährlich neu festgesetzt werden mussten, wurde ihre Regelmäßigkeit mit der Zeit akzeptiert. Es war nicht mehr nötig, sie wie noch im 15. Jahrhundert unter Konzessionsangeboten der Herrscher neu zu verhandeln. Das Reichsrecht verpflichtete zur Zahlung von Steuern für Garnisonen und Festungen (Jüngster Reichsabschied, § 180), aber Leopold I. verweigerte den Fürsten das einseitige, unbeschränkte Recht, ihre Untertanen zu besteuern. 6 Folgerichtig nahmen die Auseinandersetzungen wegen Steuern und die Eingaben der Stände bei den Reichsgerichten im späten 17. Jahrhundert offenbar zu. Den Kaisern war sehr wohl bewusst, welches Prestige ihnen daraus erwuchs, dass sie Territorialstände gegen deren Herrscher unterstützen konnten.Wann immer das Anliegen gute Aussichten hatte – eine wichtige Voraussetzung –, schritten sie nur zu gern ein. 7 Finanzen und Steuern blieben das Hauptanliegen der Territorialstände, sie hatten jedoch auch andere Funktionen; so standen sie etwa für die Einheit des Territoriums. Daher blieben, wenn ein Territorium unter zwei oder mehreren Erben aufgeteilt wurde, die Stände vereint. Und wenn ein Herrscher über mehr als ein Territorium verfügte, musste er sich unweigerlich mit den jeweiligen Ständen separat auseinandersetzen. Allein das sorgte für Unduldsamkeit und Frustration bei den ehrgeizigen Herrschern, die ab dem späten 17. Jahrhundert unablässig Territorien hinzuerwarben. Das beste Beispiel hierfür ist Brandenburg, das in all seinen Territorien mit Ständen zu tun hatte: Die Kurfürsten waren weniger darauf aus, sie gänzlich zu eliminieren, als sie von einer gemeinsamen Politik abzuhalten und auf rein regionale Belange ihrer jeweiligen Territorien zu beschränken. Als Hüter der Integrität und Einheit eines Territoriums gewannen die Stände an Bedeutung, wenn ein (meist protestantischer) Herrscher zu einer anderen Religion konvertierte, wie Kurfürst Friedrich August von Sachsen 1697. Dem Westfälischen Frieden zufolge durfte er seine Untertanen nicht zwingen, es ihm gleichzutun, und musste sich daher durch die Unterzeichnung von sogenannten
281
282
III. · Die deutschen Territorien um 1648–1760
Reversalien verpflichten, die Rechte seiner Untertanen nicht anzutasten. Die Verwaltung wichtiger kirchlicher Institutionen lag nun in den Händen der Stände. Garantiert wurden solche Abkommen stets von einer Gruppe mächtiger Fürsten, und natürlich konnten die Stände bei Verstößen dagegen beim Kaiser Beschwerde einlegen. 8 Auch im Fall einer Abwesenheit des Herrschers übernahmen die Stände die administrative Verantwortung. Deshalb wurde etwa Hannover praktisch von den adligen Ständen regiert, nachdem der Kurfürst 1714 den britischen Thron bestiegen hatte; das Gleiche gilt für Holstein, dessen Herrscher König von Dänemark war, jedoch trotz ähnlicher Lage nicht für Hessen-Kassel: Nach dem Tod von Landgraf Karl (1670–1730) akzeptierte sein Erbe Friedrich I. (1730–1751), der seit 1720 schwedischer König war und auf Geheiß der schwedischen Stände vom Calvinismus zum Luthertum konvertiert war, seinen Bruder Wilhelm VIII. als Regenten (1731–1751, 1751–1760 selbst als Landgraf). 9 Wie so oft in der Geschichte des Reichs führten ähnliche Ausgangssituationen zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen. 10 Sieben Bistümer hatten Stände, sieben nicht. Manche Domkapitel, vor allem in Norddeutschland, legten ihren Bischöfen strenge Regeln auf, anderen gelang das nicht. Die von Johann Jacob Moser beispielhaft beschriebenen Prozeduren eines Landtags waren einerseits die Summe vieler tatsächlicher Szenarien und andererseits ein Idealbild, an das Moser leidenschaftlich glaubte, das jedoch, wie er selbst eingestand, in der Realität selten zu finden war. 11 Ein paar ausgewählte Beispiele verdeutlichen die extreme Unterschiedlichkeit und das Fehlen jeglicher Normen. In Bayern teilte Kurfürst Ferdinand Maria (1651–1679) die Abneigung seines Vorgängers Maximilian I. (1598–1651) gegen Parlamente und berief nur ein einziges Mal eines ein, als ihm 1669 seine Finanzprobleme über den Kopf wuchsen. 12 Es war die erste Tagung seit siebenundfünfzig Jahren und die letzte überhaupt. Jedoch mussten sich Ferdinand Maria und seine Nachfolger in Steuer- und gesetzgeberischen Fragen mit einem Komitee aus zwanzig Abgeordneten (der Verordnung) auseinandersetzen. Den oligarchischen Charakter der Verordnung verstärkte deren Recht, nach Todesfällen oder Rücktritten selbst neue Mitglieder zu bestimmen. Da der Nachfolger stets demselben Stand wie sein Vorgänger entstammen musste, hielt der Adel immer 50 Prozent der Posten, die beiden anderen Stände teilten sich den Rest. Das heißt nicht, dass die Stände ihre Macht verloren hatten. Als Kurfürst Karl Albrecht (1726–1745) den Abgeordneten das Recht abzusprechen versuchte, Steuern zu bewilligen, drohten sie mit einer Beschwerde beim Reichshofrat, woraufhin er sein Ansinnen eilends zurückzog. 13 In Hessen-Kassel erschwerten neuerliche Streitigkeiten zwischen Kassel und Darmstadt über den Besitz von Oberhessen in den letzten Jahren des Dreißigjährigen Krieges die Wiederherstellung der Ordnung. Zwar drängten die Stände bei Kriegsende erfolgreich auf die Auflösung des Heeres, sahen sich jedoch umgehend
29. Fürsten und Stände
mit neuen Kontroversen über die Verteidigungskosten konfrontiert, weswegen sie sich bereits 1647 ans Reichskammergericht gewandt hatten. Die anhaltenden Spannungen zwischen Städten und Adel stärkten die Position von Landgraf Wilhelm VI. (1637–1663) und so konnte er 1655 einen Kompromiss erreichen, der ihm selbst sehr zugutekam. Der Landtag bewilligte Zahlungen für das Heer, der Adel verzichtete auf sein Recht, unabhängig vom Herrscher zusammenzutreten, und musste akzeptieren, dass Bauern weiterhin vor Gericht gegen ihre Lehnsherren klagen durften. 14 Danach gab es keine weiteren Plenarsitzungen und Einmischungen in die Außenpolitik der Herrscher mehr. Regelmäßig traten ständische Deputationstage zusammen, die über Steuern abstimmten und zu allgemeinen legislativen Fragen konsultiert wurden. Dass es nicht zu spektakulären Konflikten zwischen Herrschern und Ständen kam, zeigt indes, wie sehr beide Seiten die Privilegien der jeweils anderen respektierten und auf Kooperation statt Konfrontation setzten. Die Beispiele Bayern und Hessen-Kassel verdeutlichen, dass der Verzicht auf Plenarsitzungen nicht unbedingt auf einen Funktions- oder Machtverlust schließen lässt. Wie sich die Untertanen an regelmäßige Steuerzahlungen gewöhnten, lernten auch die Herrscher, mit den traditionellen Prozeduren zu deren Erhebung zu leben. Nur wenigen gelang es, die Stände gänzlich zu eliminieren; meist waren das Fälle, in denen der Adel nicht vertreten war, so etwa in der Pfalz, Zweibrücken, Baden, Würzburg und Fulda. Die meisten anderen Herrscher arbeiten in dieser oder jener Form mit den Ständen zusammen. Selbst die pfälzischen Kurfürsten verhandelten weiterhin mit Ständen in den Territorien Jülich und Berg, die sie 1614 geerbt hatten und mit denen sie nach jahrzehntelangen bitteren Konflikten 1675 zu einer geregelten Arbeitsbeziehung fanden. 15 Die Herrscher von Brandenburg-Preußen richteten ihre Kooperation mit den diversen Ständen ihres Herrschaftsbereichs je nach den lokalen Gegebenheiten aus. 1653 einigten sie sich mit den brandenburgischen Ständen darauf, dass der Adel im Gegenzug für mehr Autorität über seine Bauern 650.000 Reichstaler zu einer stehenden Armee beisteuerte. Danach wurden die Stände einfach nicht mehr einberufen; der Adel übte jedoch weiterhin politische Macht aus und bekräftigte seine soziale Identität durch Regionalversammlungen. Die ostpreußischen Stände (außerhalb des Reichs im Königreich Polen gelegen) wurden bis Mitte der 1670er durch Einschüchterung zur Unterwerfung gezwungen. Mit den Ständen in den neu erworbenen Territorien Ostpommern und Magdeburg ging man behutsamer um, das Resultat war aber letztlich das gleiche. In den westbrandenburgischen Territorien Kleve, Mark und Ravensberg traten jedoch weiterhin Vollversammlungen der Stände zusammen und übten das ganze 18. Jahrhundert hindurch ihr Recht aus, Steuern zu bewilligen. 16 Das ist zumindest zum Teil unpolitisch zu erklären: Der katholische Adel der rheinischen Provinzen
283
284
III. · Die deutschen Territorien um 1648–1760
kämpfte für die Beibehaltung der Parlamente, weil ihm die Zugehörigkeit zur Ritterschaft die Wählbarkeit für die lukrativen Pfründe der rheinischen und westfälischen Domkapitel sicherte. Die Nähe der Herzogtümer zu den Niederlanden und das schwindende Interesse der preußischen Herrscher an ihnen spielte zweifellos ebenfalls eine Rolle. 17 Die drei bedeutenden Fälle, in denen in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts die Beziehungen abbrachen, unterstreichen die Wichtigkeit von Kooperation und Koexistenz sowie die fortdauernden staatlichen Funktionen der Territorialstände. In Mecklenburg widersetzte sich der Adel den Versuchen der Herzöge Christian Ludwig (1658–1692), Friedrich Wilhelm von Mecklenburg-Schwerin (1692–1713) und Karl Leopold (1713–1728), die Steuerverwaltung unter ihre Kontrolle zu stellen. 18 Als Karl Leopold russische Truppen ins Land rief, suchten die Stände Unterstützung bei den führenden norddeutschen Fürstentümern. 19 Auf eine Beschwerde beim Reichshofrat hin wurde der Herzog 1728 abgesetzt; 1755 kam es zum Kompromiss mit Christian Ludwig II. (Regent ab 1728, Herzog 1747–1756). Die Einigung, die bis 1918 Grundlage der mecklenburgischen Verfassung blieb, bestätigte die Privilegien des Adels und sein Recht, sich an die Reichsgerichte zu wenden. In Württemberg, wo es keinen Adel gab, dominierte die Ehrbarkeit – hauptsächlich Repräsentanten der Städte – die Ständeschaft. 20 Die Herzöge Eberhard Ludwig (1693–1733) und Karl Alexander (1733–1737) beriefen ab 1699 keine Landtage mehr ein. Dass Karl Alexander während seines kaiserlichen Militärdienstes zum Katholizismus übergetreten war, verschärfte die Streitigkeiten über die Besteuerung. Ein vom Kaiser vermittelter Kompromiss stellte die Rechte der Stände 1738 wieder her, beseitigte die katholische Regentschaft und sorgte für einen Ausgleich zwischen Hofräten und Ständevertretern. Als jedoch Herzog Karl Eugen (1737–1793) 1744 volljährig wurde, begann er umgehend, erneut die Rechte der Stände zu untergraben, was in dem Versuch ihrer gänzlichen Abschaffung 1758 gipfelte. Letztlich sah er sich gezwungen, 1763 eine Plenarsitzung einzuberufen, und schloss auf Druck Berlins und des Reichshofrats in Wien 1770 ein Abkommen mit seinen Untertanen (den Erbvergleich). Danach trat siebenundzwanzig Jahre lang kein weiterer Landtag zusammen. Karl Eugen und seine Berater verhandelten lieber mit Ständevertretern. 21 In Ostfriesland widersetzten sich die Stadt Emden und die Vertreter der Bauernschaft gemeinsam den Versuchen von Graf Georg Albrecht (1708–1734) und seinem Kanzler Enno Rudolph Brenneysen, die Rechte der Stände zu untergraben. 22 Die Truppen des Grafen besiegten sie 1727, aber der Kaiser schritt ein, setzte eine Amnestie für die Anführer des Widerstands durch und bestätigte die Gültigkeit der territorialen Grundgesetze. Zwar gab es auch während der Herrschaft des Grafen Carl Edzard (1734–1744) weiterhin Probleme, aber die Gesetze
29. Fürsten und Stände
wurden erneut bestätigt, als das Territorium 1744 an Brandenburg-Preußen fiel; inzwischen waren die Stände jedoch sehr darauf bedacht, mit jeder vernünftigen Regierung zusammenzuarbeiten, die lokale Sitten und Privilegien respektierte. Das Besondere an den ostfriesischen Ständen war, dass dort Bauern mit denselben Rechten wie Adlige und Stadtmagistraten vertreten waren. Durch die Hilfe der Niederlande und ein von Leopold I. 1678 verliehenes Wappen hatten sich die ostfriesischen Stände effektiver als die meisten anderen als Mitregenten etabliert. 23 Die Bauern partizipierten in vielen kleineren Territorien bis ins 18. Jahrhundert. Wo es keine Adligen und Städte gab, entwickelten sich oft rein bäuerliche Körperschaften – vorübergehend, teilweise aber auch mehr oder weniger kontinuierlich während der gesamten Frühmoderne. Im Fürststift Kempten etwa hatte es 1496 und 1526/27 eine Landschaft gegeben. Erst durch das ehrgeizige Bauprogramm des Abts Roman Giel von Gielsberg (1636–1673) sowie seiner Nachfolger Rupert von Bodman (1678–1728) und Anselm von Reichlin-Meldegg (1727–1747) wurde die Institution dauerhaft wiederbelebt. Die Landschaft vertrat die Interessen der Untertanen des Abts in steuerlichen und feudalrechtlichen Fragen. Im 18. Jahrhundert übernahm sie gar die Funktion einer Handelsbank, indem sie durch Investitionen im Inland und Anleihen auf auswärtigen Geldmärkten Vorschüsse auf Reichs- und Kreissteuern organisierte. 24 Die meiste Aufmerksamkeit galt traditionell den Bauernständen in den kleineren Kirchenländern und Grafschaften des Südwestens und einiger dortiger Reichsstädte, die viel Land besaßen. 25 Einige andere, die weniger Beachtung fanden, aber ebenso funktionsfähig waren und oft länger existierten, überlebten in Nordelbien (dem heutigen Schleswig-Holstein): in Norderdithmarschen, Stapelholm und Eiderstedt in Gottorp, auf diversen nordfriesischen Inseln wie Nordstrand, Pellworm, Osterland Föhr und Sylt, auf Fehmarn vor der Ostseeküste, in der Kremper Marsch und der Wilster Marsch am Nordufer der Elbe in Holstein. 26 Für die meisten von ihnen war indes der Zustand der Damm- und Abflusssysteme an der Küste wichtiger als irgendwelche Vorgänge in Gottorp oder gar anderswo im Reich. Ständeschaften waren keine Parlamente. Sie vertraten das Territorium als Ganzes (Land und Leute) und verteidigten die Rechte und Privilegien der Bewohner, aber ihre Mitglieder waren Repräsentanten der Stände und keiner Ortschaft gegenüber verantwortlich. Selbst die bäuerlichen Abgeordneten gehörten eher der reicheren Bauernschaft an und genossen oft keinerlei Sympathie bei ärmeren Bauern und Landlosen. Zudem neigten die in der Ständeschaft Vertretenen dazu, die Bürde der Besteuerung an jene weiterzureichen, die nicht direkt vertreten waren. Insgesamt waren sie eher konservativ als oppositionell eingestellt. Wie repräsentativ und bedeutend, wenn überhaupt, die diversen Ständekörperschaften als parlamentarische oder vorparlamentarische Institutionen auf lange Sicht historisch waren, ist seit 1945 immer wieder heftig diskutiert worden. 27 Der
285
286
III. · Die deutschen Territorien um 1648–1760
offenbar demokratischere Charakter einiger Bauerngemeinschaften in Holstein und im Südwesten wird dabei gern überinterpretiert. Dass dazu mitunter die Argumente hinsichtlich einer Kontinuität herangezogen werden, die Politiker des 19. Jahrhunderts formulierten, um unter den politischen Gegebenheiten der Zeit nach 1815 für die Erhaltung traditioneller Freiheiten oder deren Umsetzung in die Sprache des demokratischen Liberalismus zu kämpfen, macht die Sache noch wirrer. Die frühmodernen Stände führten nicht die Kämpfe der Liberalen und Demokraten des 19. Jahrhunderts. Zwischen den kooperativen Strukturen einer abgelegenen Nordseeinsel oder einem kleinen ländlichen Provinznest in Südwestdeutschland und der komplexen Gesellschaft eines großen Territoriums lagen Welten. Der Versuch, aufzuzeigen, dass eine dieser beiden Seiten die Norm war, von der die andere abwich, läuft Gefahr, den Kern der Sache zu vernebeln. Ständeschaften waren Teil eines breiten Spektrums repräsentativer beziehungsweise quasirepräsentativer Gremien, mit denen sich Herrscher im ganzen Reich auseinandersetzen mussten. Ihre Rolle um 1700 mag weniger heroisch als im späten 15. und 16. Jahrhundert gewesen sein, wichtig war sie dennoch. Wie die Stände in Württemberg, Mecklenburg und Ostfriesland zeigten, verfügten die Hüter eines Territoriums nach wie vor über Machtmittel, ebenso wie das Reich die Fähigkeit besaß, gegen Herrscher zu intervenieren, die die Grundgesetze und Traditionen eines Territoriums mit Füßen traten. Viele andere, weniger spektakuläre Dispute wurden durch Verhandlungen gelöst, oft unter Vermittlung der Reichsgerichte. In Zeiten, da Herrscher stärker nach Kontrolle über ihre Länder strebten als je zuvor und ihre Ausgaben ihre eigenen Ressourcen und die ihrer Untertanen überstiegen, nahmen die Stände weiterhin aktiv an den Regierungsgeschäften teil. Das Recht, Steuern zu bewilligen, blieb von entscheidender Bedeutung, und dass es ab 1671 im Reichsrecht verankert war, nötigte viele Herrscher zur Zurückhaltung. Der Einwand vieler Kommentatoren, die Drohung einer kaiserlichen Intervention habe auf die mächtigeren Fürsten wenig Eindruck gemacht, ist freilich richtig. 28 Aber auch in diesen Fällen war es ein Gebot vernünftigen Regierens, unangemessene Steuerbelastungen zu vermeiden. Selbst in Brandenburg-Preußen war man auf das Einverständnis der »gezähmten« Stände angewiesen.
Anmerkungen 1 2 3
Krüger, Verfassung, 13–26. Ebd.; hilfreich sind zudem: Press, »Steuern«; Press, »Ständewesen«; Press, »Landtage«; Vierhaus, »Land«; Lange, »Dualismus«. Vgl. S. 35 f.
29. Fürsten und Stände
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Müller, Fürstenhof, 34. Asch, »Estates«, 117 ff. Vgl. S. 55, 74. Schwennicke, Steuer, 187–195, 283–288. Haug-Moritz, Ständekonflikt, 172–214. ADB VII, 522 ff., und XLIII, 60–64. Krüger, Verfassung, 31. Ebd., 13–17. Carsten, Princes, 407–415. Vierhaus »Land«, 44. Carsten, Princes, 180–186; Krüger, Verfassung, 27 f.; Friedeburg, »Making«, ist eine wichtige Studie zu den patriotischen Diskursen, die die Kontroversen begleiteten. Carsten, Princes, 289–318. Asch, »Estates«, 122 f. Vierhaus, Deutschland, 133 f. Hughes, Law, 62–67. Vgl. S. 175 f. Haug-Moritz, Ständekonflikt, 3–121. Vierhaus, »Land«, 52 f. Hughes, Law, 67–74; Kappelhoff, Regiment, 17 f., 32–71; Luebke, »Signatures«, 504–518; vgl. S. 176 f. Schindling, »Leopold I.«, 177. Blickle, Landschaften, 342–350, 375–378, 476 f.; Petz, »Ökonomie«. Blickle, »Landschaften«; Weber, »Landschaften«. Krüger, »Nordelbien«; Lorenzen-Schmidt, »Kremper-Marsch-Commüne«, 121–128. Krüger, Verfassung, 61–84, gibt einen klaren und ausgewogenen Überblick über die Historiografie. Schwennicke, Steuer, 284.
287
30. Unterdrückte Bauern?
D
as Thema der Repräsentativität der Stände und ihres Beitrags zur Verteidigung von Freiheiten wirft die Frage auf, ob dies auf Kosten der breiten Masse der Bevölkerung geschah. Schließlich versuchten viele Adlige, im Gegenzug für die Zustimmung zu Steuern und allgemeine Kooperation mehr Kontrolle über ihre Bauern zu erlangen. Die bäuerlichen Landschaften, die es vor allem in sehr kleinen Territorien gab oder die wie in Holstein kleinere Bevölkerungen zwischen 1.700 und 20.000 Menschen repräsentierten, deckten nur einen kleinen Teil des Reichs ab. 1 Außerdem waren die meisten Herrscher an ihnen nur insoweit interessiert, als sie Steuern ablieferten. Vom 19. bis ins späte 20. Jahrhundert kamen viele Historiker zu der Ansicht, die Erholung nach dem Dreißigjährigen Krieg sei der neuerlichen Unterwerfung der Bauernschaft geschuldet. 2 Damit war nicht nur die ökonomische Ausbeutung gemeint, sondern auch der Verlust ihrer persönlichen Freiheit. Dies, so heißt es oft, sei in erster Linie in den gutsherrschaftlichen Gegenden östlich der Elbe der Fall gewesen, aber auch in einigen Gebieten westlich davon und in anderer Form in den Gegenden der Grundherrschaft, in denen sich vom späten 16. bis zum frühen 18. Jahrhundert Elemente einer »zweiten Leibeigenschaft« herausbildeten. Neuere Forschungen zeichnen ein differenzierteres Bild. Die traditionelle Sicht der Elbe als Grenze zwischen einem nordöstlichen System unfreier Arbeit (Gutsherrschaft) und einem westlichen System von Pacht zahlenden Landwirtschaftsbetrieben ist gründlich modifiziert worden. An die Stelle der These, sklavische Arbeit habe sich auf das System der Gutsherrschaft beschränkt, trat die Erkenntnis, dass feudale Knechtschaft in wesentlich größerem Umfang erhalten blieb und es in vielen Gegenden im späten 16. und 17. Jahrhundert wiederholte Versuche gab, sie wieder einzuführen. Drittens bleibt die Bedeutung des Dreißigjährigen Krieges für die weitere Entwicklung des Systems der Arbeitsknechtschaft beziehungsweise die Bestrebungen, sie wieder einzuführen, umstritten, auch wenn klar zu sein scheint, dass sich nach Ende des Kriegs der Fokus mehr auf Fragen der Arbeit und der Arbeitskräfte in ländlichen Gegenden richtete. Viertens hat die traditionelle Ansicht, die Bauern seien diesen Entwicklungen gegenüber mehr oder weniger hilflos gewesen, der Erkenntnis Platz gemacht, dass Bauerngemeinschaften auf verschiedenste Weise gegen solchen Zumutungen vorgingen, oft erfolgreich, und dass ab etwa 1650 das ganze System der Knechtschaft zunehmend infrage gestellt wurde.
30. Unterdrückte Bauern?
Erschwert wird die Debatte zu diesem Themenbereich durch die extreme Vielfalt regionaler und lokaler Gegebenheiten und die Tatsache, dass so gut wie jede Gegend ein eigenes Vokabular verwendete. Der Begriff Leibeigenschaft wurde je nach Region sehr unterschiedlich ausgelegt. So versicherte etwa der Abt von St. Blasien im Schwarzwald 1701 seinen Leibeigenen, er habe nicht die Absicht, sie »in die Sklaverei zu zwingen wie in Böhmen und anderen Gegenden«. 3 Begriffe wie Untertänigkeit, Erbuntertänigkeit, Hörigkeit und Schollenpflichtigkeit bezeichneten sehr schwerwiegende Grade persönlicher Knechtschaft, während Leibeigenschaft ab Mitte des 17. Jahrhunderts zunehmend pejorativ mit Elend und Sklaverei verbunden wurde. 4 Zudem trugen die diversen Klassen von Bauern verblüffend vielfältige Bezeichnungen für das Ausmaß ihres Besitzes, ihr Lehns- oder Pachtverhältnis, den Grad ihrer Verpflichtung zu alten oder »neuen« Lehnsabgaben oder Diensten gegenüber einem Grundherrn oder Herrscher: Es gab (freie) Bauern, Vollbauern oder Hufe; Bauern mit gutem Besitz, aber Verpflichtungen hießen Freisassen, Meier, Schulzen, Fester, Grundholde, Hintersassen, Hörige, Hintersättler, Hintersiedler, Kleinbauern wurden Kossäten, Gütler, Gärtner, Seldner, Köbler, Kötter oder Hintersiedler genannt, Landlose Brinksitzer, Insitzer, Häusler, Büdner, Hüttner oder Tagelöhner, die höchstens eine kümmerliche Behausung besaßen. 5 Klarer war die Situation in gutsherrschaftlichen Gegenden. Das System war ursprünglich als Reaktion auf ökonomische Möglichkeiten entstanden. In deutlichster Form bestand es in den Küstenterritorien von Holstein, Mecklenburg, Pommern und Westpreußen (bis 1772 polnisch), wo Grundbesitzer günstigere Voraussetzungen hatten, Nahrungsmittel auf die immer gierigeren westeuropäischen Märkte zu exportieren. In Brandenburg gab es eine Mischung aus Ständen und freien bäuerlichen Betrieben; Gutsherrschaft und Leibeigenschaft konzentrierten sich in der Uckermark und Neumark im Norden und Osten, und der Grad, zu dem Bauern zu Fronarbeit verpflichtet waren, variierte stark. 6 In den 1648 beziehungsweise 1680 erworbenen Halberstadt und Magdeburg hielt sich mit wenigen Ausnahmen die Grundherrschaft. In Ostpreußen gab es adlige Stände mit gebundenen Leibeigenen neben umfänglichen königlichen Ländereien ebenso wie freie Bauern und Fischer. Weitere Gegenden mit Leibeigenschaft waren die Lausitz (ab 1635 im Besitz von Sachsen) und Böhmen. Im habsburgischen Schlesien ließ der Adel den Nachwuchs der Bauern, die selbst unabhängig blieben, für sich arbeiten oder verpflichtete Kleinbauern als Gärtner oder Dreschgärtner. 7 In Sachsen, das sich bis an die Elbe erstreckte, gab es viele Gegenden mit Formen der Gutswirtschaft, westlich der Elbe stellenweise auch in Paderborn, dem südlichen Hannover und Braunschweig-Wolfenbüttel. In Teilen von Bayern existierte ein ähnliches System. 8 Ökonomische Möglichkeiten, aber auch politische Konstellationen und Über-
289
290
III. · Die deutschen Territorien um 1648–1760
legungen trieben die Entstehung einer Ständewirtschaft an, am meisten und brutalsten dort, wo der Adel am stärksten war, etwa in Holstein und Mecklenburg. Auch der böhmische Aufstand führte ab 1672 direkt zur Einführung einer systematischeren Form der Hörigkeit. 9 Der bäuerliche Adel wurde vertrieben und die neuen Landbesitzer und Loyalisten erhielten fast unumschränkte Macht über ihre Bauern, die sie in den folgenden Jahrzehnten des Arbeitskräftemangels noch auszubauen suchten. In der Lausitz gelang es dem Adel, dessen Landstände in die bevölkerungsreichen Städte Sachsens und Brandenburgs exportierten, seine relative Unabhängigkeit von dem neuen sächsischen Herrscher auszunutzen und 1652 für seine Bauern die Schollenpflicht einzuführen. 10 In Brandenburg galt das Abkommen zwischen Kurfürst und Ständen von 1653 traditionell als historischer Kompromiss, der den preußischen Absolutismus begründete: Der Kurfürst erhielt seine Steuern, der Adel unterwarf die Bauern einer vollständigen Leibeigenschaft. 11 Dies stellt sich nun anders da. Der Adel ging geschwächt in die Verhandlungen und war enttäuscht, vom Kurfürsten nicht die Macht zugestanden zu bekommen, die er wollte. Zwar konnten die vom Krieg verwüsteten und entvölkerten Landstände wieder aufgebaut werden, aber die Bauern hatten nach wie vor die Möglichkeit, bei den höheren territorialen Gerichtshöfen gegen unangemessene Ausbeutung zu klagen. Zudem durften Dienstherren nur begrenzt Bauernland in Standesbesitz umwandeln und dadurch neue Leibeigenschaft schaffen; schließlich brauchte der Herrscher möglichst viele steuerzahlende Bauernbetriebe und ein Reservoir an Soldaten für seine Armee. Das System der Gutswirtschaft blieb in Brandenburg Stückwerk und war für die Grundherren weniger günstig, als frühere Historiker dachten. Wie in vielen Gegenden westlich der Elbe, wo sich das System oder Varianten davon etablierten, war das wichtigste Ziel der Jahrzehnte nach dem Krieg, als der Arbeitskräftemangel den Bauern einen natürlichen Vorteil verschaffte, den Wegzug von Arbeitskräften zu vermeiden. Dies versuchte der Adel auf politischen und juristischen Wegen mit Gesindeordnungen in Sachsen und Brandenburg (1651), Magdeburg (1652) sowie Bayern und Mecklenburg (1654) durchzusetzen. 12 Die auffälligsten Charakteristiken der Gutswirtschaft beruhten darauf, dass der Adlige sowohl Landbesitzer als auch juristische Autorität war. Die bäuerliche Knechtschaft wurde vererbt (Gutsuntertänigkeit). Zudem war der Bauer an den Stand gebunden, für den er arbeitete (Schollenpflicht oder Bindung an die Scholle). Er durfte ohne Zustimmung seines Dienstherrn nicht heiraten; seine Kinder mussten ebenfalls Bauern werden und bis zur Volljährigkeit für eine bestimmte oder unbegrenzte Zeit für den Grundherrn arbeiten (Gesindezwang), der das Recht hatte, seine Untergebenen für »Insubordination, fortdauernde Faulheit und absichtliche Vernachlässigung ihrer Pflichten« zu bestrafen und Bauern gegen eine saftige Gebühr in die Freiheit zu entlassen. Solche Bauern mussten für ihren Grundherrn
30. Unterdrückte Bauern?
arbeiten und erhielten das Land, das sie für sich selbst bewirtschaften durften, auf rein persönlicher Basis ohne Eigentums- und Vererbungsrechte.13 Es überrascht nicht, dass viele Grundherren ihre Leibeigenen als eine Art von Besitz betrachteten, den sie verschenken, übereignen und sogar ohne Land wie eine Handelsware verkaufen konnten. Legal war dies eine dubiose Sache, die Herrscher generell missbilligten; das hielt jedoch einen ostpreußischen Adelsmann nicht davon ab, in einer Königsberger Wochenzeitung im Mai 1744 Untertanen zum Verkauf zu annoncieren. 14 Dass es die Autoren des Allgemeinen Landrechts von 1794 für nötig befanden, solche Verkäufe zu untersagen, deutet darauf hin, dass sie weiterhin üblich blieben. 15 Die Bedingungen waren in einigen nördlichen Teilen des Reichs deutlich härter als anderswo: Selbst der habgierigste und repressivste schwäbische Abt hätte wohl gezögert, seine Bauern zum Verkauf anzubieten. Im Grundherrschaftssystem herrschte mehr Vielfalt und im Allgemeinen weit größere Sicherheit von Pacht und Besitz. Aber auch hier hielten sich feudale Verpflichtungen und gab es Versuche, sie wieder einzuführen oder neue zu erfinden. 16 Dabei spielten ökonomische Motive eine wichtige Rolle. In Bayern, Salzburg und Tirol versorgte der Adel durch Erweiterung feudaler Pflichten die Landwirtschaft um seine Ländereien und Betriebe wie Mühlen, Gießereien und Ziegeleien mit billigen Arbeitskräften. Manche Adlige ließen ihre neuen Residenzen im späten 17. und 18. Jahrhundert in bäuerlicher Fronarbeit errichten. 17 Herrscher waren oft auch aus politischen Gründen an feudalen Rechten interessiert. In den kleinen Territorien des Südens und Südwestens nutzten sie deren Erhaltung oder Wiedereinführung zur Bildung einer kohärenten Masse von Untertanen aus den vielen gerichtlichen Zuständigkeitsbereichen, die sie hielten oder teilten. Das ging bis ins 18. Jahrhundert so. Der Abt von St. Blasien im Schwarzwald versuchte noch 1720, die Bauern der Grafschaft Hauenstein der Leibeigenschaft zu unterwerfen; ebenso verfuhr die Äbtissin von St. Fridolin in Säckingen, allerdings weniger erfolgreich. 18 Auch wichtigere Herrscher gingen in solcher Weise vor. So entsandte etwa der pfälzische Kurfürst in den 1660er Jahren Bevollmächtigte in Nachbarterritorien, um alle, die keinen anderen Herrn hatten (sogenannte Wildfänge), als seine Leibeigenen zu beanspruchen. 19 Das unmittelbare Ziel war das gleiche wie in den gutsherrschaftlichen Gebieten: die Mobilität der Arbeitskräfte zu unterbinden und Herrschaft und Kontrolle über Bauern in Gegenden zu erlangen, wo die territoriale Autorität aufgrund der Überschneidung diverser Grundherrschaften mit unterschiedlicher Rechtsprechung zerfallen war. 20 Zweifellos war die Leibeigenschaft im grundherrschaftlichen System bei Weitem nicht so streng wie unter der Gutswirtschaft. In den meisten Gegenden nahm die Sicherheit der Stellung der Bauern zu. Der Anteil der von einer »zweiten Leibeigenschaft« in den grundherrschaftlichen Regionen Betroffenen ist schwer in Zahlen zu fassen. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts bestand die Bevölkerung von
291
292
III. · Die deutschen Territorien um 1648–1760
Württemberg zu etwa zehn Prozent aus Leibeigenen, in Bayern waren es zwei Prozent. 21 Für das Jahrhundert nach 1650 gibt es keine verlässlichen Zahlen; die hohe Anzahl der Klagen von Bauern gegen kleinere Territorialherrscher am Reichshofrat lässt jedoch auf eine weite Verbreitung des Phänomens schließen. Wesentlich mehr Menschen – praktisch die gesamte bäuerliche Bevölkerung vieler Gegenden – waren von der inflationären Nachfrage nach anderen Frondiensten betroffen, die auf mittelalterliche Vogteirechte zurückgingen – die Pflicht der unter Schutz und Schirm der Vogte Stehenden, deren Burgen zu erhalten und ihre Bewohner zu ernähren. 22 In sehr ähnlicher Weise konnten Frondienste auch auf Jagdrechten eines Herrschers (Jagdfron oder Jagdfolge laut Jagdregal) beruhen. 23 Der historische Ursprung solcher Dienstpflichten war oft unklar und ihre juristische Grundlage dubios. Verlangt wurden sie dennoch, sei es beim Bau (nun eher neuer Paläste und Kirchen als Burgen), in der Feldarbeit oder bei der Jagd, und sie erhöhten die ohnehin beträchtliche Belastung der meisten Bauern noch mehr. 24 Wie umfangreich die Verpflichtungen waren, ist umstritten; wahrscheinlich unterschieden sie sich von Ort zu Ort. Für den einzelnen Bauern und seine Familie erhöhten jährliche Zahlungen in Naturalien oder Geld, Arbeitsdienste, Gebühren für Heiraten und Todesfälle die ohnehin drückende Belastung durch Steuern erheblich. 25 Jedes Jahr mehrere Hühner oder (beim Tod eines Bauern) die beste Kuh abgeben zu müssen, schmälerte das Einkommen vieler bäuerlicher Haushalte enorm. Sich die Freiheit zu erkaufen, wo das möglich war, kostete oft ebenfalls eine Menge. Fronarbeiten waren indes oft eine größere Zumutung als Abgaben in Geld oder Naturalien, weil sie andere wichtige Tätigkeiten verzögerten. 26 Ebenso belastend war die Unfreiheit, wenn man für Heiraten oder Umzüge um Erlaubnis ersuchen musste oder an eine Örtlichkeit gebunden war. Solche Restriktionen führten oft zu großer Verbitterung, nicht zuletzt, weil sie die Rechtssicherheit der Bauern auch in anderer Hinsicht infrage stellten. Abgesehen von einer kleinen Fraktion reicher Bauern (den oberösterreichischen Bauernkönigen des frühen 17. Jahrhunderts und ihren Pendants in Westfalen, Bayern, Holstein und anderen Teilen der Ostseeküste), lebte die überwältigende Mehrheit unter prekären Bedingungen am Rand der Gesellschaft. 27 Das scheint die These zu unterstreichen, dass Erholung und Wiederaufbau nach dem Krieg auf Kosten der Bauern gingen. Die Bauern waren jedoch beileibe keine hilflosen Opfer und ihre Gesamtsituation erfuhr während dieser Epoche wichtige Veränderungen. Auch wenn sie unter Einschränkungen ihrer persönlichen Freiheit, strenger Behandlung unter Gutsherrschaft, drückenden Kosten und grundherrschaftlicher Fronarbeit litten, nahm die Rechtssicherheit in Bezug auf ihren Grund für die meisten Bauern während dieser Epoche zu. Selbst die Lassiten, die überhaupt keinen Grund besaßen, sondern ihn nur zu eigenen Leb-
30. Unterdrückte Bauern?
zeiten nutzen durften, hatten im Allgemeinen das Recht, ihn ihren Nachkommen zu übergeben, solange er in der Familie blieb. Innerhalb dieser Gruppe bildeten Zeitpächter mit begrenzten Verträgen und solche, die überhaupt keine Besitzsicherheit genossen, vermutlich eine sehr kleine Minderheit. 28 Darüber hinaus stand der Bauernschaft eine Reihe von Möglichkeiten zur Verfügung, sich zu widersetzen und zu ihrem Recht zu gelangen. In den gutsherrschaftlichen Gebieten versuchten viele die Bürde der Leibeigenschaft durch Flucht abzuwerfen. Wie ernst das Problem war, zeigen wiederholte Dekrete über die Bestrafung flüchtiger Leibeigener und der regelmäßige Abschluss von Auslieferungsabkommen zwischen Territorien zur Rückführung von Entflohenen. Die marxistische Geschichtsschreibung der DDR spricht hier von einer der »minderen Formen des Klassenkampfs«. 29 Allein das zwang viele Grundeigentümer zu gewissen Mindeststandards. Eine weitere Einschränkung lag darin, dass Herrscher in gutsherrschaftlichen Gebieten immer wieder garantierten, dass sich Bauern im Fall unvernünftiger Forderungen oder einer nicht mehr hinnehmbaren Behandlung durch Grundherren an die höheren Territorialgerichte wenden konnten. Brandenburgische Adlige beschwerten sich wiederholt über solche von ihren Bauern angestrengten Verfahren, die manchmal als Sammelklagen ganzer Dörfer vorgebracht wurden. 30 Die Regierung mahnte die Bauern regelmäßig zu Gehorsam und harter Arbeit, weigerte sich jedoch, ihr Recht auf juristische Eingaben zu beschneiden. Dieselbe Haltung herrschte auch in Sachsen und Hessen, wo der Zugang zu den Gerichten gegen den Widerstand der Grundherren gesichert wurde. 31 In Extremfällen war stets ein direktes Einschreiten möglich, wurde jedoch öfter angedroht, als es tatsächlich vorkam. In grundherrschaftlichen Gebieten waren die Behelfsmittel vielfältiger. Das Entkommen fiel leichter, weil die Restriktionen und Kontrollen weniger scharf waren. Am Ende des Dreißigjährigen Krieges wurden viele Leibeigene in Württemberg schlicht als »vermisst« geführt, was allerdings auch neue Versuche nach sich zog, die Arbeitskräfte wieder besser unter Kontrolle zu bringen. 32 Gleichzeitig aber nahm die Tendenz zu, es Individuen und Gruppen zu ermöglichen, sich freizukaufen. Mitte des 18. Jahrhunderts war diese Praxis offenbar so verbreitet, sodass sich Johann Jacob Moser veranlasst sah, die Freizügigkeit unter die Grundrechte aller Deutschen aufzunehmen, mit Ausnahme der Gegenden, in denen »strenge Leibeigenschaft üblich ist«. 33 Viele Territorien druckten Zertifikate, die belegten, dass jemand seine Freiheit erkauft hatte. 34 Die Entwicklung solcher Routinetransaktionen bedeutet, dass viele Bauern ihren Status als Leibeigene und ihre Verpflichtungen als legal akzeptierten. Manche indes taten das nicht. Als einige der Bauernführer von Hauenstein in den 1720er Jahren mit dem Abt von St. Blasien ein gemeinsames Freikaufabkommen schlossen, widersetzten sich andere gewaltsam, weil sie die Rechte des Abts von
293
294
III. · Die deutschen Territorien um 1648–1760
vornherein nicht anerkannten. 35 Der folgende zwanzigjährige »unbürgerliche Krieg« zwischen verfeindeten Bauernfraktionen in Hauenstein belegte eine tiefsitzende Gegnerschaft zu den diverse Formen der Leibeigenschaft, die vielleicht charakteristischer ist als ihre passive Hinnahme.Viele suchten gegen die Forderungen der Grundherren und Herrscher Beistand bei den territorialen und Reichsgerichten. Die Historie zahlreicher Gemeinden und Regionen im Jahrhundert nach 1648 war eine Geschichte langwieriger juristischer Streitereien und periodischer Aufstände, da sich Bauern neuen Forderungen nach Fronarbeit oder Steuern widersetzten oder ihre Rechte auf Allmendeland und Wälder bewahren wollten. Die Forschung der letzten Jahrzehnte hat eine Fülle von Belegen erbracht, die die alte Vorstellung einer durch das Scheitern im Bauernkrieg 1525 gebrochenen deutschen Bauernschaft infrage stellen. Selbst in Gegenden am Niederrhein, traditioneller Sicht zufolge an der Peripherie gelegen und von einer schwachen Identifikation mit dem Reich gekennzeichnet, kam es zu Formen des Bauernprotests, die vollumfänglich von den juristischen Institutionen des Reichs Gebrauch machten. Die Bauern der Abtei Kornelimünster etwa, eines winzigen Territoriums von 100 km 2 südlich von Aachen, ließen 1699 ihren Grundherrn ermorden, stritten aber auch mehr als hundert Jahre lang in zahlreichen Verfahren vor dem Reichskammergericht gegen die Forderungen, die er und seine Vorgänger und Nachfolger an sie stellten. 36 Die Auferlegung und Wiedereinführung alter feudaler Pflichten nach 1648 blieb nicht zuletzt wegen des hartnäckigen Widerstands der Bauernschaft relativ begrenzt und wurde selten kommerziell ausgenutzt. Die Juridifizierung des Reichs, die Herausbildung gesetzlicher Strukturen, die Rechte und Freiheiten garantierten und Gewalt vermeiden halfen, spielte dabei eine Schlüsselrolle. Gewalttätige Konflikte gab es weiterhin, aber sie waren zunehmend in rechtliche Prozeduren eingebettet: Wenn Bauern oder Grundherren auf Gewaltmittel zurückgriffen, berücksichtigten sie nun eher deren Wirkung auf die langwierigen Verhandlungen und Vermittlungen, die unweigerlich folgten. Zudem wurden die Bauern mit zunehmender Sicherheit ihrer Besitzrechte vorsichtiger mit offener Rebellion; ebenso griffen ihre Herrscher nur als letztes Mittel auf das Militär zurück, vor allem, wenn sie dazu Soldaten von Nachbarn »borgen« mussten, die daraus gern Vorteile schlugen. 37 In ihren juristischen Schlachten standen die Bauern nicht allein, sondern hatten zunehmend die Justiz und die öffentliche Meinung auf ihrer Seite. Ab etwa 1648 war der Begriff Leibeigenschaft zunehmend deutlich abwertend besetzt. 38 Juristische Autoritäten, so etwa die Anwälte, die die Bauern vor Gericht vertraten, beriefen sich häufig auf die natürliche Freiheit und die unveräußerlichen Rechte ihrer Klienten. Die Ansicht, Leibeigenschaft sei etwas ganz anderes als Sklaverei, gewann stetig an Boden. 39 So widersetzten sich etwa 1661 die Repräsentanten der
30. Unterdrückte Bauern?
sächsischen Städte und ihre Rechtsberater von der Universität Wittenberg der Einführung von Zwangsarbeit für Bauernkinder. Dies, argumentierten sie, sei eine Form der Leibeigenschaft, die es in Sachsen nie gegeben habe und die »der angestammten Libertät der Deutschen, der natürlichen Freiheit und Gleichheit [aller] sowie dem im Westfälischen Frieden festgeschriebenen Auswanderungsrecht« (ius emigrandi) zuwiderlaufe. 40 Die Rechtsvertreter der Bauern argumentierten immer öfter unter der Prämisse der Gleichheit und Freiheit aller. Territorial- und Reichsgerichte neigten dazu, auf Basis einer praesumptio pro libertate vorzugehen, die die Grundherren zwang, die Legalität ihrer Forderungen zu beweisen, statt dass zuerst die Bauern ihren Widerstand rechtfertigen mussten. 41 Wie alle derartigen rechtlichen Vorgänge im Reich zog diese Art von Prozessen eine umfangreiche Literatur nach sich. Ende des 17. Jahrhunderts hatte sich das Bauernrecht zum etablierten Genre entwickelt. Ein wachsender Korpus publizierter Präzedenzfälle begleitete gelehrte Debatten zur Frage, ob ein Sklavenrecht altrömischer Art in der deutschen Geschichte je existiert habe.42 Manche Autoren verteidigten die Rechte der Grundherren. Die meisten aber folgten den einflussreichen Werken von David Mevius, der bestritt, dass römische Rechtskonzepte auf Deutschland anwendbar seien, und die Ansicht vertrat, selbst jene, die Pflichten als Halbeigene unterlagen, seien gleichzeitig grundsätzlich frei. 43 Sein Schluss, es sei nicht möglich, die genaue Natur der Verpflichtungen und Freiheit der Bauern zu bestimmen, ließ die Sache ungeklärt. Thomasius indes knüpfte 1701 mit der These, Bauern seien im Grunde ebenso frei oder unfrei wie Reichsritter und Bürger von Reichsstädten, daran an. 44 Thomasius’ provokante Gleichsetzung von Adligen und Bauern bekräftigte Mevius’ Ansicht, lokale Gesetze und Traditionen hätten Myriaden von Variationen erzeugt, die man jeweils nur aus sich selbst heraus verstehen könne und von denen keine dazu dienen dürfe, den Bauern sämtliche Rechte abzusprechen. Im frühen 18. Jahrhundert war das Vokabular der späteren Debatte über eine Emanzipation der Bauern bereits vollständig entwickelt. Die polemische Gleichsetzung von Leibeigenschaft und Sklaverei belegt eine bemerkenswerte Änderung der Einstellungen nach 1648. 45 Ohne Zweifel trug die Bauernschaft die Hauptlast von Steuern und Verpflichtungen gegenüber ihren Grundherren, konnte sich aber in vielen Teilen gegen weitere Bürden wehren. Darüber hinaus erfuhren sie zunehmend juristische Unterstützung. Auf die Grundbesitzer im gutsherrschaftlichen System machte das freilich wenig Eindruck. Wenn überhaupt, änderten sie ihre Auffassung nur, wenn sie glaubten, ihre Landstände in einigen Gegenden auf andere Weise besser organisieren zu können. Dazu kam es vor allem nach 1750, als das Bevölkerungswachstum wieder für ein ausreichend großes Angebot an verfügbaren Arbeitskräften gesorgt hatte. Inzwischen aber stand die juristische und gelehrte Meinung der
295
296
III. · Die deutschen Territorien um 1648–1760
Leibeigenschaft entschieden ablehnend gegenüber. Damit war der Boden bereitet für die Debatte um die Befreiung der Leibeigenen, die eines der Kernthemen der zweiten Hälfte des 18. und der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts werden sollte. 46
Anmerkungen 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14
15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Krüger, »Nordelbien«, 223 f. Vgl. etwa Sugenheim, Leibeigenschaft, 369–375; Heitz, »Folgen«, 351 ff. Luebke, »Erfahrungen«, 187. Ebd., 177; vgl. auch die Einträge in Haberkern und Wallach, Hilfswörterbuch. Münch, Lebensformen, 91; Conrad, Rechtsgeschichte II, 217 ff.; Troßbach, Bauern, 36–44; Haberkern und Wallach, Hilfswörterbuch I, 297 und andere Einträge zu den jeweiligen Bezeichnungen. Enders, »Pervertierung«, 45–51; Melton, »Gutsherrschaft«, 306–315. Dipper, Geschichte, 119; Haberkern und Wallach, Hilfswörterbuch I, 341. Troßbach, Bauern, 14 f. Maur, Gutsherrschaft, 189–201. Dipper, Geschichte, 119. Hagen, »Crisis«, 304 ff.; eine Fallstudie zur Grundherrschaft der Familie Kleist in Stavenow findet sich bei Hagen, Ordinary Prussians, 26–122. Heitz, »Folgen«, 354; Dipper, Geschichte, 125 f. Ebd., 122 f. Schmidt, Geschichte, 265; Schieder, Friedrich, 79; Klußmann, »Leibeigenschaft«, 217 ff., 227 f.; Blickle, Leibeigenschaft, 129. Franz, Quellen, 202, 213 f., dokumentiert eine Transaktion auf Rügen 1723 und den Königsberger Fall von 1744. Conrad, Rechtsgeschichte II, 219; zu Verkäufen kam es auch in anderen Gegenden. Vgl. den Vertrag über den Verkauf eines Leibeigenen samt Frau und Kindern von Bernhard von Plettenberg an den Paderborner Bischof Ferdinand von Fürstenberg vom 29. Oktober 1680, zu finden unter www.attendorn.de/stadtinfo/historisch/archiv/?id=598 (Zugriff 30. November 2013). Troßbach, »Leibeigenschaft«; Andermann, »Leibeigenschaft am Oberrhein«; Blickle, Leibeigenschaft, 198–243. Dipper, Geschichte, 115; Blickle, Leibeigenschaft, 239 f., 242 f. Luebke, Rebels, 35–53. Blickle, Leibeigenschaft, 108; vgl. auch S. 303 f. Andermann, »Leibeigenschaft am Oberrhein«; Andermann, »Leibeigenschaft im pfälzischen Oberrheingebiet«; Troßbach, »Leibeigenschaft«, 79 f. Blickle, Leibeigenschaft, 161 f. Ebd., 236–243; Blickle, »Scharwerk«; Zückert, »Barockbau«, 454 f., 457, 464 ff. Eckardt, Jagd, 112–126. Vgl. zur Fronarbeit am Bau (Baufron) Zückert, »Barockbau«, 464–467. Troßbach, »Leibeigenschaft«, 80–84. Gagliardo, Pariah, 14. Troßbach, Bauern, 36–44; reiche Bauern waren eher in Gegenden zu finden, wo Grundherrschaft mit der Unteilbarkeit des Erbes verbunden war.
30. Unterdrückte Bauern?
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Dipper, Geschichte, 123 f.; Gagliardo, Pariah, 12 f. Blickle, Leibeigenschaft, 243. Hagen, »Crisis«, 317 ff. Carsten, Princes, 203 f.; Schulze, »Widerstand«, 136. Blickle, Leibeigenschaft, 160. Ebd., 210; Feller, »Bedeutung«, 50; zitiert bei Moser, Neues Teutsches Staatsrecht, XIII, S. 347 Blickle, Leibeigenschaft, 161; Blickle, »Willkür«, 162 ff. Luebke, Rebels, 54–89. Gabel, Widerstand, 116–307; Gabel und Schulze, »Peasant Resistance«, 128–132; Blickle, Leibeigenschaft, 155 ff.; Troßbach, Bauern, 78–87. Schmidt, Geschichte, 243. Blickle, »Willkür«, 167–171; Enders, »Pervertierung«, 51. Blickle, Leibeigenschaft, 124, 163, 259 f., 272, 276 f., 290, 308. Schmidt, Geschichte, 241 f. Schulze, »Widerstand«, 136; Schulze, »Bauernrecht«, 150–153; Blickle, »Willkür« 164–167. Schulze, »Bauernrecht« 145–163. Ebd., 146 ff.; Blickle, Leibeigenschaft, 271 ff. Bader, »Dorf«, 22 ff. Blickle, »Willkür«, 168–171. Vgl. S. 573 ff.
297
31. Regierung und Gesellschaft
E
s ist unumstritten, dass das Ausmaß der gesetzgeberischen Aktivität in den deutschen Territorien im Jahrhundert nach dem Dreißigjährigen Krieg erheblich zunahm. Ab etwa 1680 produzierten fast alle Territorien eine stetige Flut von Regeln, die erst in den Jahrzehnten nach 1750 übertroffen wurde. In gewisser Weise setzte sich damit einfach das Streben nach umfassender Regulierung der Gesellschaft fort, das im 16. Jahrhundert aufgekeimt war, aber es gab auch neue Ansätze. Die Notwendigkeit, nach dem Krieg Ordnung und Kontrolle wiederherzustellen, war ein starker Ansporn, in höherem Maß als je zuvor »soziale Disziplin« zu erzwingen. Wirtschaftliche Belange gewannen an Wichtigkeit und merkantilistische oder kameralistische Ideen zielten darauf ab, ökonomische Aktivitäten zu stimulieren und zugleich zu regulieren. Zudem kam es zu einer generellen Verlagerung von allumfassender Ordnung hin zu einer stetigen Flut spezifischer Edikte, Mandate, Reskripte, Dekrete und Privilegien. Das lag zum Teil an vermeintlichen Nachteilen und Problemen der traditionellen Polizeiordnung, die mit den jeweiligen Territorialständen ausgehandelt und unter großem Zeitaufwand formuliert und beschlossen werden musste. Zudem enthielt sie meist viele überflüssige Klauseln, die einfach weitergeführt wurden, und oft hatten sich bei ihrer Verkündung bereits neue Probleme aufgetan. Individuelle Regelungen konnte man ohne Konsultation der Stände treffen, um Probleme direkt zu lösen. Andererseits wurden viele territoriale Gesetze weiterhin im Hinblick auf den rechtlichen Rahmen oder Verhandlungen über dessen Ausgestaltung im Reich und in den Kreisen formuliert. Das war besonders wichtig, wenn es um Fragen der Währung und um Landstreicherei ging.1 Ebenso führten Zusammenarbeit und Wettbewerb zwischen Territorien zu rechtlichen Ähnlichkeiten. Das verhinderte selbstverständlich nicht, dass die Schwerpunkte in verschiedenen Regionen und bei verschiedenen Konfessionen unterschiedlich gesetzt wurden. Die umfangreichen legislativen Aktivitäten werden oft dahingehend gedeutet, die Regierungen seien effektiver und »moderner« geworden. Herrscher, die Paläste bauen ließen und stehende Heere bildeten, so heißt es, hätten auch mehr Kontrolle über ihre Ressourcen nötig gehabt. »Absolutistische« Fürsten erstrebten Kontrolle um ihrer selbst willen und brauchten sie, um ihr Herrschaftsideal zu verwirklichen. Neuere Forschungen haben indes alte Annahmen zur Gesetzgebung und ihrer Wirksamkeit infrage gestellt.
31. Regierung und Gesellschaft
Es gibt wenig Hinweise auf eine höhere Effektivität der Gesetzgebung insgesamt. Die regelmäßige Erneuerung von Regeln könnte darauf hindeuten, dass viele davon missachtet oder ignoriert wurden. Andererseits wurden Gesetze generell neu aufgelegt, wenn ein neuer Herrscher an die Macht kam, vor allem nach Wahlen in kirchlichen Territorien. 2 Manche meinen, die Wiederholungen seien eine natürliche Begleiterscheinung einer Gesellschaft, die überwiegend aus Analphabeten bestand, deren Gedächtnis regelmäßig aufgefrischt werden musste, um Ungehorsam aus Unkenntnis zu vermeiden. Andere weisen darauf hin, die Wiederholung von Gesetzen habe sich zum Teil an straffällige Beamte gerichtet und nicht an das Volk allgemein. Dennoch drängt sich der Eindruck einer zu weiten Teilen ineffektiven Gesetzgebung auf, auch wenn ihr schierer Umfang vom Optimismus der politischen Elite zeugt. Im Grunde betrifft die Frage die »Reichweite« der Regierungsmacht in den deutschen Territorien. Inwieweit trafen die Differenzierung von Hof und Administration und die Herausbildung zentraler Verwaltungsstellen auf ein angemessenes Regierungssystem auf regionaler und örtlicher Ebene? Hier wird schnell deutlich, dass das effektive Funktionieren der Regierung in den meisten Territorien davon abhing, bis zu welchem Grad Kompromisse mit Körperschaften wie Adel, Städten, Gilden und Dorfgemeinden zustande kamen. Deren Stellung und die Durchsetzung ihrer Privilegien und Autonomie wurden durch die Zersplitterung vieler Territorien gestärkt. In vielen Territorien herrschte große Unsicherheit, ob die von einem Herrscher verkündeten Edikte in den Unterherrschaften durchsetzbar waren, deren Grundherren der Landeshoheit des Herrschers unterworfen, ansonsten aber autonom und im Besitz unabhängiger juristischer Befugnisse waren. 3 Die deutschen Territorien waren gemeinhin »korporative Staaten«, Konglomerate solcher privilegierter Institutionen, und erfolgreiche Regierungstätigkeit hing davon ab, wie effektiv man mit diesen verhandelte. 4 Die meisten waren in administrative Distrikte oder Ämter unterteilt, deren jeweiliger Amtmann vom Fürsten selbst oder vom Regierungsrat ernannt wurde. Er residierte in einer Amtsstadt, meist in einem kleinen Schloss oder einer Burg, und war oft adlig, sein städtisches Pendant, der Stadtschreiber, indes im Normalfall nicht. In gutsherrschaftlichen Gebieten wurden viele dieser Funktionen vom Adel ausgeübt; dort übten Grundeigentümer auch die juristische Gewalt über ihre Bauern aus: Der »Staat … endete an den Toren des Anwesens«. 5 Die einzigen weiteren zentral ernannten Beamten in protestantischen Gegenden waren die Pastoren, Diakone und Schulmeister, die vom Konsistorium oder Kirchenrat erkoren wurden. In Bezug auf katholische Gebiete betont die jüngere Forschung einen beträchtlichen Grad an Freiheit der örtlichen kirchlichen Einrichtungen gegenüber der weltlichen Regierung: Der niedere Klerus war alles andere als bloß Agent einer disziplinierenden weltlichen Macht. 6 Eine erfolgreiche Regierung sah ein, wie abhängig sie vom guten Willen der
299
300
III. · Die deutschen Territorien um 1648–1760
örtlichen Funktionäre war. 7 Gesetzgebung war nur dann effektiv, wenn die Administratoren eines Herrschers geschickt mit lokalen Beziehungen arbeiteten. Der Schlüssel war das Zusammenspiel der normativen Ansprüche der Regierung und deren Praxis mit der örtlichen Gemeinde. Die Autoritäten standen in dauerndem Dialog mit den Kommunen, die Art und Ausmaß der Umsetzung der Politik bestimmten und zukünftige Gesetzesinitiativen anregten. An ihre Grenzen stieß die Regierungsmacht überdies in Gebieten, wo die Dörfer ihre eigenen Normen festsetzten und über die Mittel verfügten, sie ohne Rückgriff auf Gerichte durchzusetzen. Andererseits war die Kommune auf das Justizsystem des Territoriums angewiesen. Wenn die Autorität eines lokalen Gerichts oder Beamten zum Beispiel durch Interessenskonflikte untergraben wurde, wandten sich Kläger und Bittsteller mit ihren Anliegen oft an höhere Beamte, was der Zentralverwaltung wiederum die Möglichkeit gab, auf lokaler Ebene Einfluss zu nehmen. Vor allem scheint klar zu sein, dass auf vielen Feldern Normen in Reaktion auf Forderungen von unten nach »guter Policey« in Sachen Sicherheit, Ordnung, Moral und so weiter formuliert wurden. Am effektivsten durchzusetzen waren sie in Zusammenarbeit mit den Gemeinden, besonders dort, wo Verstöße »die Interessen des obersten Lehnsherrn oder der Dorfelite bedrohten, die die kommunale Verwaltung dominierte«. 8 Die Dorfeliten waren im Allgemeinen von überragender Bedeutung. Eine Bauerngemeinde war alles andere als eine undifferenzierte Masse, deren Solidarität auf einem gemeinsamen »Klasseninteresse« beruhte. Starke Kommunen waren oft die, die von einer »Oligarchie begüterter männlicher Haushaltsvorstände dominiert waren, die ein starkes Interesse daran hatten, das Verhalten der niederen sozialen Schichten, der Außenseiter, Frauen, Migranten, Abweichler und anderer randständiger Individuen zu kontrollieren«. 9 Zwei wichtige Fragen bleiben offen. Wir wissen nicht, wie viel »soziale Disziplin« in großen Teilen des Reichs tatsächlich erzwungen wurde. Auf lange Sicht scheint die in Zusammenarbeit von Regierungen und Kommunen entstandene Gesetzgebung zumindest einen normativen Rahmen geschaffen zu haben, der Einstellungen und Verhalten prägte. Zweitens: Waren die katholischen, insbesondere die kirchlichen Territorien weniger streng als protestantische Territorien, vor allem die mit militärischen Ambitionen? 10 Eine detaillierte Analyse der Gesetzgebung in Kurmainz (1648–1729) und Köln (1723–1761) legt ein Muster nahe, das mit katholischen und protestantischen weltlichen Territorien vergleichbar ist. 11 Die Herausbildung höchst unterschiedlicher konfessioneller Kulturen nach 1648 schlug sich nicht in der allgemeinen Gesetzgebung nieder. Die ungeheure Vielfalt der von der Gesetzgebung betroffenen Gegenstände und Fragen hielt die bereits im 16. Jahrhundert evidente Neigung zur Reichhaltigkeit aufrecht. Die ab 1996 im Druck erscheinenden Gesetze und Mandate der
31. Regierung und Gesellschaft
deutschen Territorien überspannen die gesamte Frühmoderne, aber ihre Gliederung bietet einen guten Eindruck für das 17. Jahrhundert, das in vielerlei Hinsicht die klassische Periode der deutschen Territorialgesetzgebung einleitete. Fünf breite Themengebiete teilen sich in siebenundzwanzig Gruppen und etwa zweihundert Untergruppen mit insgesamt mehr als 1.200 Gegenständen von Moral und Sexualität über Privat- und Familienleben, Alltags- und Luxuskonsum, Vormundschaft und Erbe, Arbeitsbedingungen und Grundbesitz bis hin zu Verbrechen, Zensur und Justizverwaltung. 12 Die Sozialpolitik war durch die Regelung der Armenfürsorge und öffentlichen Gesundheit vertreten. Die Kulturpolitik umfasste auch die Erziehung und Aspekte der Regulierung von Gottesdienst und Religionspraxis sowohl »offizieller« oder öffentlicher Religionen als auch der zu unterschiedlichen Graden geduldeten Minderheiten. Infrastrukturelle Regelungen umfassten Mandate hinsichtlich der Straßen und Wasserwege, die Regelung des Handels, der Nebenleistungen und Finanzierungsdienste sowie des Bauwesens. Der Verwaltung der wichtigsten Ressourcen widmete sich eine Masse von Verordnungen zu Land- und Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei. In vielen Bereichen wiederholte oder erweiterte die Gesetzgebung des späten 17. Jahrhunderts lediglich frühere Maßnahmen. Vielleicht mehr als zuvor führte die Spezialisierung der Mandate dazu, dass die Gesetzgebung aktuelle Probleme widerspiegelte. Zwei Drittel der zwischen 1723 und 1761 in Köln erlassenen Vorschriften betrafen militärische Belange (den Durchzug »fremder« Truppen, die Versorgung des Heers und Rekrutierungen durch »fremde« Mächte), den Handel (insbesondere die Nahrungsversorgung, aber auch Zölle, Straßen und Wasserwege), die Währung, Landstreicher und Bettler. Auf diese vier Bereiche folgten gerichtliche Regelungen, Vorschriften für Jagd, Land- und Forstwirtschaft, gefolgt von Mandaten bezüglich Glücksspiel, Alkohol, Musik und Tanz an Sonn- und Feiertagen. 13 Dem Umgang mit den Armen und der Kontrolle von Migranten und Landstreichern kam eine weit gewichtigere Rolle in den Regierungsgeschäften zu. Im späten 17. Jahrhundert führten die meisten großen deutschen Städte nach dem Vorbild der Niederlande und der vier großen norddeutschen Häfen von Anfang des Jahrhunderts Zuchthäuser ein. Protestantische Städte gingen voran, allerdings hatte Wien schon 1670 ein Zuchthaus. München und Köln folgten 1682 beziehungsweise 1696. 14 In den katholischen Territorien scheinen in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts im Großen und Ganzen die traditionellen Formen der Armenfürsorge erhalten geblieben zu sein. Aber auch dort wurde das Problem der Armut oder vielmehr der armen Migranten ab dem frühen 18. Jahrhundert ein Hauptanliegen der Regierungen. 15 Um zwischen Notleidenden und kriminellen Landstreichern zu unterscheiden, kam es zu einer Masse von Gesetzen gegen Bettler, Vagabunden, Zigeuner und
301
302
III. · Die deutschen Territorien um 1648–1760
umherziehende jüdische Straßenhändler (»Pack- und Trödeljuden«). An erster Stelle stand die öffentliche Ordnung, aber auch die Seuchenbekämpfung erlangte immer wieder Bedeutung. Besonders anfällig waren die drei rheinischen Kurfürstentümer. Köln zum Beispiel war nur 20 km breit, was eine echte Kontrolle der Migranten und des fahrenden Volks so gut wie unmöglich machte. 16 Ähnliche Probleme in Mainz und Trier führten schon früh zur Zusammenarbeit der Kurfürsten, etwa zur Ausstattung der Notleidenden mit Pässen und Abzeichen sowie zu gemeinsam organisierten Deportationen verbannter Zigeuner und Landstreicher auf venezianische Galeeren im frühen 18. Jahrhundert. In Köln wurde die Bestrafung durch Verschickung auf Galeeren ab 1736 durch die Haft im Zuchthaus Kaiserswerth ersetzt und durch unbegrenzte Haftzeiten verschärft, was das Elend der Einkerkerung durch Verzweiflung noch verstärken sollte. 17 In den 1730er Jahren entstanden Zuchthäuser in Münster, Paderborn, Fulda und Würzburg; Mainz folgte 1742. Die Beharrlichkeit der Mendikanten und anderer Mönchsorden, die Arme mit Speisung versorgten, egal, ob sie das »verdienten«, untergrub jedoch weiterhin offizielle Versuche, mit fahrendem Volk fertigzuwerden. 18 Mitte des 18. Jahrhunderts verfuhr man indes in den katholischen Territorien ebenso »modern« und streng mit kriminellen Armen wie in den protestantischen. 19 Auch die Politik und die Institutionen zum Umgang mit dem beschleunigten Bevölkerungswachstum in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts glichen sich in ihrer Unzulänglichkeit. Während die Polizei sich weitgehend der inneren Ordnung widmete, zielte der Kameralismus auf die Erhöhung der Einkünfte des Herrschers durch Steigerung der Produktivität und des »Glücks« der Untertanen. Dass der Kameralismus in erster Linie die Einkünfte des Herrschers im Auge hatte, markiert den Unterschied zwischen dieser entstehenden deutschen Lehre und den merkantilistischen Diskussionen in Großbritannien, Frankreich und den Niederlanden. 20 Darin spiegeln sich die eigentümlichen Regierungstraditionen der deutschen Territorien. Englische und niederländische Autoren übten starken Einfluss auf die wichtigsten deutschen Theoretiker der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts aus, niederländische Institutionen und Vorschriften wurden weitgehend übernommen. 21 In Deutschland blieben jedoch ökonomische Interessen letztlich den Bedürfnissen der Regierung untergeordnet; die Wirtschaft war neben dem Ziel der Sicherung und Stärkung der Macht des Herrschers zweitrangig. Die grundsätzlich politische Ausrichtung des Kameralismus beseelte viele in seinem Namen durchgeführte Projekte. Geprägt war er von den Notwendigkeiten des Wiederaufbaus nach dem Dreißigjährigen Krieg – einer Erfahrung, die viele Gegenden vor allem im Westen und Norden des Reichs in den bis in die 1720er Jahre anhaltenden Konflikten mehrfach durchmachen mussten. Unmittelbar nach 1648 war die Wiederbevölkerung vordringlich. Einige der im
31. Regierung und Gesellschaft
Krieg erlittenen Verluste ließen sich durch Migration wettmachen; viele Regierungen boten Zuzüglern verlassene Ländereien und Häuser an und versprachen ihnen kurzfristige Steuererleichterungen sowie Privilegien für Handwerker. 22 Schweizer Bauern, Hirten und Arbeiter, vor allem aus Bern und Zürich, ließen sich im Elsass und in Baden nieder, ihnen folgten bald flämische und wallonische Wollweber. Die Saarregion zog Einwanderer aus Lothringen und den verwüsteten Ländern in der Pfalz und Trier an, ebenso wie Siedler aus der Schweiz und Straßenhändler, Krämer und Kaufleute von den oberitalienischen Seen. In Württemberg ließen sich Siedler aus der Schweiz, Vorarlberg, Bayern und Tirol nieder, in Franken und Schwaben religiöse Flüchtlinge aus den österreichischen Ländern, in Magdeburg Einwanderer aus Niedersachsen. Kursachsen und in geringerem Maß Brandenburg profitierten von mehr als 150.000 religiösen Flüchtlingen aus Böhmen. 23 Die Wanderungsbewegungen hielten mehrere Jahrzehnte an. Zu stabilen Verhältnissen kam es kaum, da viele Migranten sich nur kurzzeitig ansiedelten und dann in attraktivere Gegenden oder zu großzügigeren Herrschern weiterzogen. Selbst Opfer von Verfolgung und Vertreibung zeigten sich wählerisch und verhandelten mit örtlichen Regierungen. Und nicht alle Migrationen erwiesen sich für das Reich als Nettogewinn: Manche Ströme bewegten sich nur zwischen Regionen, verursacht auch durch den Wettstreit um neue Untertanen. Im späten 16. Jahrhundert neu gegründete Städte profitierten von den Wanderungen. So hatten etwa die Grafen von Hanau-Münzenberg 1596 Neuhanau gegründet, um flämische und wallonische Flüchtlinge unterzubringen, die in der Reichsstadt Frankfurt am Main keinen Platz mehr fanden, und von ihnen zu profitieren. Dort ließen sich ab 1648 leicht neue Migranten integrieren. 24 Die Grafen von Wied-Neuwied gründeten 1653 nach einem dynastischen Disput über ihre Residenz Dierdorf, die letztlich an die ältere Linie Wied-Runkel fiel, Neuwied als neue Residenz, für die von Anfang an alle Arten von Flüchtlingen und Minderheiten angeworben wurden. 25 Manche Herrscher gingen aggressiver an die Sache heran. Eine der umstrittensten Wiederbevölkerungsinitiativen war der Versuch der Pfalz, die angeblich von Maximilian I. erteilte Vollmacht auszunutzen, jedem Schutz zu gewähren, der in einer Region, die weit über die zersplitterten Territorien der Pfalz selbst hinausreichte, keinen rechtmäßigen Herrn hatte. 26 1651 beauftragte der Kurfürst seine Beamten, Listen dieser sogenannten Wildfänge anzulegen. Da von der ursprünglichen Bevölkerung am Ende des Kriegs nur ein Viertel übrig war, war Ersatz dringend nötig. Flüchtlinge und Migranten aus der Schweiz und Flandern schienen hierfür ideal. Bis 1665 fanden die Beauftragten des Kurfürsten 17.053 Wildfänge, die für ein Steueraufkommen von 50.000 Gulden oder zwölf Prozent aller Einnahmen sorgen würden; ihr Kapitalwert wurde auf etwas über eine Million Gulden geschätzt. Das Problem war, dass diese Leute in den Ländern der Fürstbischöfe von
303
304
III. · Die deutschen Territorien um 1648–1760
Worms und Speyer, der Wild- und Rheingrafen (von Salm) und verschiedener Reichsritter ansässig waren, die das angebliche kaiserliche Privileg als Fälschung bezeichneten – der Kurfürst konnte das Originaldokument nicht vorlegen – und den ganzen Vorgang als Diebstahl betrachteten. Tatsächlich wurden nicht weniger als 98,2 Prozent der ohnehin schwer dezimierten Territorialbevölkerung von Worms als Wildfänge geführt. 27 1665 drohte der Streit zu einem regionalen Krieg zu eskalieren; eine kaiserliche Kommission konnte die Sache nicht klären, sie wurde erst durch eine Reihe bilateraler Abkommen zwischen 1693 und 1749 beigelegt. Der Pfalz gelang es indes mit dieser und einer Reihe weiterer Maßnahmen, ihre Steuereinnahmen von 1659 bis 1671 zu verdoppeln. 28 Die Kriege, die die Pfalz von 1673 bis zum Ende des Jahrhunderts erneut verwüsteten, schmälerten diesen Erfolg. Und langfristig wurden die Bemühungen der pfälzischen Regierung und ihrer Nachbarn um Wiederbevölkerung untergraben, als nach den Missernten der Jahre 1708/09 50.000 Menschen die Region verließen und vor allem in Amerika und Ungarn eine bessere Zukunft suchten. So landeten im Winter 1709 etwa 15.000 Pfälzer Protestanten in London in Zeltstädten in Blackheath, Greenwich und Camberwell. 29 Zugute kam die Peuplierungspolitik auch religiösen Minderheiten und Flüchtlingen wie Juden und diversen protestantischen Opfern katholischer Verfolgung. Ihre Geschichte illustriert die Ansprüche, praktischen Probleme und Einschränkungen des kameralistischen Populationismus. Die Anweisung des Großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm an seine Wiener Vertreter von 1671, vierzig bis fünfzig jüdische Familien zu finden, die sich in Brandenburg niederlassen wollten, wird gern als Beispiel der brandenburgischpreußischen Fortschrittlichkeit angeführt. 30 Tatsächlich war sie Teil einer breiteren Entwicklung. Die Ausweisung der etwa 3.000 Juden aus Wien war die Ausnahme, zu der es auf Anraten des Bischofs der Wiener Neustadt kam, nachdem die Bevölkerung der Stadt sich bereit erklärt hatte, den Kaiser für den Verlust zu entschädigen. Selbst für Österreich waren die Ereignisse von 1669/70 nicht typisch; in den späten 1670er Jahren, als Genehmigungen für neue jüdische Gemeinden in Böhmen, Schlesien, Ungarn, Tirol und Triest erteilt worden waren, bildete sich auch in Wien eine inoffizielle neue kleine Gemeinde. Im Reich allgemein wurde das Muster jüdischer Ansiedlungen komplexer. 31 Nur wenige der Reichsstädte, die im 16. Jahrhundert ihre Juden vertrieben hatten, nahmen sie nun wieder auf. Die große jüdische Gemeinde in Frankfurt überlebte, ebenso wie die kleineren in Worms, Friedberg und Regensburg. Zur Gründung einer bedeutenden neuen Gemeinde kam es nach 1650 nur in Hamburg. Die meisten Reichsstädte erlaubten Juden lediglich die Teilnahme an Märkten, aber keine dauerhafte Ansiedlung.32 Einige Territorien blieben Juden gänzlich verschlossen, vor allem Bayern, Sachsen, Mecklenburg, Pommern und Württemberg.
31. Regierung und Gesellschaft
In vielen Territorien wiederum hatten Herrscher nach Kriegsende die Bildung kleiner Gemeinden jüdischer Händler in den Hauptstädten gefördert und taten dies nun auch auf dem Land. 33 Die Pfalz sticht hierbei mit der Unterstützung einer florierenden Gemeinde in der neuen Stadt Mannheim heraus, die 1699 etwa 150 Familien umfasste. In Berlin siedelten sich auf Anweisung des Kurfürsten hin lediglich neun Familien an, von denen nur sieben aus Wien stammten. Bis 1688 waren es um die vierzig Familien, ein starker Anstieg in den 1690er Jahren erhöhte die Anzahl bis 1700 auf 117 (davon siebzig mit Genehmigung), die nur zwei Prozent der Gesamtbevölkerung der Stadt ausmachten. Mittlerweile lebten im ganzen Land verstreut kleine Gemeinden, allein in Brandenburg etwa 2.500. 34 Selbst in den tolerantesten und liberalsten Zentren blieben die Juden vom Herrscher abhängig und in ihren Aktivitäten eingeschränkt. Sie durften nicht Mitglied in Handwerksgilden werden und im 18. Jahrhundert wurden »die neuen Seiden- und Tabakhersteller in Berlin, Hannover und Mannheim … verpflichtet, in erster Linie christliche und keine jüdischen Arbeiter zu beschäftigen«. 35 Die wichtigsten Gegenden, in denen sich Juden auf dem Land ansiedelten, waren Südwest- und Mitteldeutschland, die klassischen Gebiete kleiner und fragmentierter Territorien, wo Reichsritter und -grafen Juden protegierten, um ihre Einkünfte zu steigern und ihren Status als reichsunmittelbare Herren zu behaupten, die das Recht hatten, Juden Schutz zu gewähren. 36 In etwa dreißig Territorien bildeten sich nun offizielle jüdische Landschaften, strukturierte Organisationen mit Verfassungen, die das Gemeindeleben regelten, mit der Territorialregierung verhandelten und Kontakte zu anderen Verbänden im Reich und im Ausland pflegten. 37 Die »Hofjuden« waren demnach nur der Gipfel einer ganzen Pyramide jüdischer Gemeinden im Reich. Ihre Anzahl scheint im Krieg nicht gravierend zurückgegangen zu sein und stieg durch jüdische Flüchtlinge aus der Ukraine im Zuge von Bohdan Chmelnyzkyjs Aufstand 1648 noch an. 38 Ohne Österreich lebten um 1650 etwa 60.000 Juden im Reich, um 1750 gut 70.000, die meisten »am Rande der Gesellschaft in Armut als Hausierer, Bettler und Diebe«; jene oberhalb dieser Schicht, im Allgemeinen Schutzjuden mit offizieller Aufenthaltsgenehmigung oder Vertrag, spielten jedoch eine lebenswichtige Rolle. 39 Die »Hofjuden« beschafften »Geld, Kredite, Militärnachschub, Pferde und knüpften Kontakte zu den wichtigsten europäischen Handelszentren wie Amsterdam und Hamburg«, importierten aber auch exotische Güter wie Gewürze, Juwelen und orientalisches Porzellan. 40 In Städten agierten Juden als Händler, Geldwechsler und Kommissionäre, auf dem Land als Klein- und Straßenhändler, Einkäufer, aber auch Kleinbauern, oft nebenberuflich. Die Verbindungen zwischen diesen Gemeinden sind nicht gänzlich klar und über das Verhältnis zwischen Juden und ihren christlichen Nachbarn, insbeson-
305
306
III. · Die deutschen Territorien um 1648–1760
dere auf dem Land, ist nach wie vor wenig bekannt. Einerseits prüften Herrscher, die jüdische Ansiedlungen förderten, generell das Umfeld jener, denen sie den Aufenthalt gestatteten, aufs Genaueste. Auch die Siedler selbst waren oft ebenso wie die Obrigkeit darauf aus, keine Papierlosen und fahrenden Betteljuden zuzulassen. 41 Andererseits ist es unwahrscheinlich, dass die »Hofjuden« ohne Kontakte nach ganz unten und ins Ausland so effektiv als Kommissionäre und Beschaffer von Alltagsgütern und Luxuswaren wirken konnten. 42 In ländlichen jüdischen Siedlungsgebieten gab es eine enge Zusammenarbeit zwischen Juden und Christen ebenso wie andauernde Konflikte über Themen wie die Nutzung kommunaler Weiden. Zwar ging jede Gemeinde öffentlich ihrer jeweiligen Religion nach und führte ein separates Gemeindeleben, aber das Dorf als Ganzes wurde von den Christen repräsentiert, obwohl die Juden in manchen Dörfern bis zu zwei Drittel der Bevölkerung ausmachten. 43 Eine Ausnahme bildete die vom Bamberger Dompropst und dem Markgrafen von Brandenburg-Ansbach gemeinsam regierte Stadt Fürth, die den Juden, die 20 Prozent der Bevölkerung ausmachten, gestattete, zwei Vertreter in den Stadtrat zu entsenden. Hier profitierten die Juden vom Wettstreit der beiden Herrscher um Schutzherrschaft über sie, was ihnen gegenüber den Restriktionen der Gilden eine beträchtliche berufliche Unabhängigkeit garantierte. Eine weitere Ausnahme war Sulzbach, wo Herzog Christian August von Pfalz-Sulzbach (1656–1708) 1666 eine jüdische Gemeinde in eine ungewöhnlich tolerante Stadt aufnahm. 1720 war sie auf etwa 150 Familien angewachsen und Sulzbach war einer der wenigen Orte, an denen für einen Zeitraum von mindestens etwa fünfzig Jahren Versuche unternommen wurden, nicht nur kommerziell von den Juden zu profitieren, sondern sich auch intellektuell mit ihnen auseinanderzusetzen. 44 Solche Inseln echter Toleranz, wo es zumindest zu Ansätzen einer begrenzten Integration kam, waren rar und gingen stets auf die Initiative eines einzelnen Herrschers zurück. Im Großen und Ganzen lebten Juden weiterhin eingeschränkt und strikt getrennt von der christlichen Umwelt, die sie mit bewohnten. Im Jahrhundert nach dem Dreißigjährigen Krieg erfuhr das jüdische Gemeindeleben eine bedeutende Erweiterung und die Juden erlangten eine wirtschaftliche Bedeutung, die sie seit dem 14. Jahrhundert nicht mehr gehabt hatten. Dennoch blieben sie eine Randgruppe, deren gesellschaftliche Stellung stets prekär war. Erfolgreicher verlief die Integration der diversen protestantischen Flüchtlingsgruppen. Aus ihnen ließ sich nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch Kapital schlagen. Die nach der Widerrufung des Edikts von Nantes 1685 aus Frankreich vertriebenen Hugenotten waren die bedeutendste Gruppe; etwa 40.000 von 200.000 aus Frankreich Geflohenen ließen sich im Reich nieder. Niemand nutzte die politischen Möglichkeiten der Krise besser als der Große Kurfürst in Berlin. Das Edikt von Potsdam, das ihnen Zuflucht in Brandenburg bot, war großzügiger als
31. Regierung und Gesellschaft
vorherige Angebote aus Braunschweig-Lüneburg-Celle und Hessen-Kassel. Zudem wurde es in gedruckter Form in Frankreich verbreitet, während Beauftragte des Kurfürsten in Amsterdam, Frankfurt am Main, Köln und Hamburg an Neuankömmlinge herantraten und ihnen Geld, Pässe und die Überführung nach Berlin anboten. 45 So kamen fast 20.000 Hugenotten nach Brandenburg-Preußen. Um 1700 lebten 6.000 bis 7.000 allein in Berlin und stellten etwa ein Drittel der Stadtbevölkerung; sie gründeten neue Betriebe, die Kleidung und Luxusgüter für den Hof produzierten, und bereits 1704 entstand die erste Leihbücherei für die colonie française. 46 Viele weitere protestantische Territorien warben um hugenottische Siedler: Hessen-Kassel, Hessen-Darmstadt und die Grafschaften der Wetterau, vor allem Wied und Hanau, Baden-Durlach, Württemberg und die Pfalz, die Markgrafschaften Ansbach und Bayreuth, Braunschweig-Lüneburg und Braunschweig-Wolfenbüttel. Alle boten großzügige Steuernachlässe und Wohnrechte, manche gründeten neue Städte und Dörfer. Die Grafen von Wied hatten 1653 Neuwied gegründet, der Landgraf von Hessen-Kassel 1699 Karlshafen am Zusammenfluss von Diemel und Weser, das dem landgebundenen Hessen als Tor zur Welt dienen sollte. 47 Die meisten Herrscher waren jedoch an wohlhabenden Kaufleuten und gut ausgebildeten Handwerkern interessiert; und so beschlossen Hessen-Kassel (1688) und Brandenburg (1692) temporäre Moratorien für weiteren Zuzug, als sich erwies, dass viele Zuwanderer arme Leute ohne Vermögen und besondere Fähigkeiten waren. 48 Andere indes, vor allem in Südwest- und Mitteldeutschland, waren selbst auf diese Siedler aus, um ihre verlassenen Dörfer zu bevölkern. Typisch für die kleineren Territorien waren kleine ländliche Gemeinden, in denen die vielen Bauern unter den Flüchtlingen untergebracht wurden. Die Bedeutung der Rolle der Territorien unterstreicht die Tatsache, dass die Reichsstädte Frankfurt am Main, Hamburg und Lübeck den französischen Kaufleuten und Händlern viel strengere Beschränkungen auferlegten. 49 Politische und konfessionelle Faktoren führten zu ähnlichen Restriktionen in Sachsen, wo die (ab 1697 katholischen) Kurfürsten sich mehr als willig zeigten, die Feindseligkeit ihrer lutherischen Städte gegen die potenziellen neuen calvinistischen Konkurrenten zu unterstützen. 50 Die Mehrheit der etwa 3.000 Waldenser, die in den 1680er und 1690er Jahren aus Frankreich und Savoyen vertrieben wurden, fanden Zuflucht in Württemberg, nachdem bereits in den 1660er Jahren einige von ihnen nach Hessen-Kassel, Hanau, Bayreuth, Brandenburg und in die Pfalz gekommen waren. 51 Ihre Ansiedlung in Württemberg nach der Ausweisung aus Savoyen 1699 wurde teilweise durch Kirchenkollekten in England und den Niederlanden finanziert; die »englische Rente« trug noch jahrzehntelang zum Überleben dieser Gemeinden bei. 52 In vielen Gegenden betrachtete man sie einfach als Teil der anhaltenden Hugenottenzüge. Ähnliches gilt für die 3.000 französischen Calvinisten, die nach dem Tod Wil-
307
308
III. · Die deutschen Territorien um 1648–1760
helms III. Oranien verlassen mussten. Der preußische König war unter denen, die Anspruch auf das Fürstentum erhoben, und suchte seine Position zu stärken, indem er die Flüchtlinge aufnahm, was ihn jedoch nicht davon abhielt, von den englischen Diözesen gesammeltes Geld als Entschädigung für seine Großzügigkeit anzunehmen. 53 Als 1713 eine zweite, kleinere Gruppe vertrieben wurde, war die Erbfolge in Oranien bereits durch den Vertrag von Utrecht zugunsten Frankreichs geregelt. Da der preußische König nun von weiterer Barmherzigkeit nichts mehr zu erwarten hatte, schrieb er lediglich an die protestantischen Schweizer Kantone und Genf, sie möchten gnädig sein, und kümmerte sich nicht weiter um die Angelegenheit. 54 Politik war auch ein beherrschendes Motiv für die Umsiedlung von etwa 16.000 Salzburger Protestanten in die brandenburgische Provinz Litauen. 55 Die dortige Bevölkerung war 1709–1711 durch Pest und Typhus dezimiert worden, den Verlust von 40 Prozent hatten jedoch bereits größtenteils Flüchtlinge aus dem gesamten Reich, der Schweiz und von anderswo ausgeglichen, die der König ab 1718 in ganz Europa als Kolonisten anwarb. 56 Wirkliches Interesse hatte er nun typischerweise nur noch an Gesessenen, den kleinen Bauern, und scherte sich wenig um die Misere der 4.000 Arbeiter und Knechte, die im Winter 1732 vertrieben wurden und größtenteils in Memmingen, Ulm und Württemberg landeten. 57 Die »Sättigung« von Preußisch-Litauen dämpfte Preußens Begeisterung für weitere Zuwanderung. Der Versuch der radikalen Teschener Erweckungsprediger, die Umsiedelung von bis zu 20.000 versteckten Protestanten aus Böhmen zu erreichen, indem sie einen Aufstand gegen die österreichische Herrschaft anzettelten, scheiterte an Berlins Weigerung, zu kooperieren. 58 Auch hierbei spielten politische Überlegungen eine Rolle, da der König Wien versicherte, er hege nicht den Wunsch, »seinem besten Freund, dem Kaiser, zu schaden«. Ebenso wichtig war wohl der Widerwille, in die revolutionären Umtriebe der Teschener Prediger hineingezogen zu werden oder sie gar auf brandenburgisch-preußischem Territorium wirken zu lassen. Im Winter 1732 fanden etwa 350 böhmische Weber Aufnahme, um in einem Berliner Textilbetrieb zu arbeiten, und im folgenden Jahrzehnt sickerten stetig Weber ins Land, bis die preußische Eroberung von Schlesien potenziellen Flüchtlingen ein Ziel bot, das ihrer Heimat näher gelegen war. Jedes Ansinnen einer Massenmigration wurde indes ausgeschlossen und so zählte die böhmische Gemeinde in Berlin Mitte der 1740er Jahre nicht mehr als 1.200 Angehörige. 59 Die preußischen Herrscher wählten penibel aus, wer von der so erfolgreichen »Politik der religiösen Rechte« von den 1680er Jahren bis in die 1730er Jahre profitieren durfte. 60 In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts siedelten sich grob geschätzt 300.000 bis 400.000 Migranten in Deutschland (ohne Österreich) an; die Gesamtbevölkerung des Reichs stieg in dieser Zeit von etwa 16 auf 21 Millionen. 61 Die
31. Regierung und Gesellschaft
Hoffnungen der kameralistischen Planer wurden jedoch mit einiger Sicherheit enttäuscht. Das kameralistische Mantra, die Stärke eines Staates entspringe der Anzahl seiner Bewohner, ließ sich kaum je in wirksame Politik umsetzen. 62 Brandenburg-Preußen fällt durch seine konsistente Einwanderungs- und Kolonisationspolitik aus der Reihe: Von der Herrschaft des Großen Kurfürsten bis zum Ende des 18. Jahrhunderts zog es etwa 430.000 Zuwanderer aus anderen deutschen Territorien und von außerhalb des Reichs an. 63 Der größte Teil dieser Migration fällt ins 18. Jahrhundert, ihre Grundlagen wurden jedoch in den Jahrzehnten nach 1648 gelegt, gegen rege Konkurrenz anderer Territorien wie Bayreuth, Ansbach und Sachsen. Eine gezielte Ausrichtung auf einzelne Branchen war dennoch selten erfolgreich. Ab 1720 ließ die Berliner Regierung nach Tätigkeiten geordnete Statistiken aufstellen, war jedoch nicht in der Lage, die dadurch gewonnenen Erkenntnisse in eine effektive, gezielte Migrationspolitik umzusetzen. 64 Lediglich beim Bemühen um bäuerliche Migranten traf die Nachfrage offenbar relativ regelmäßig auf ein Angebot. Es bleibt noch viel Forschungsbedarf, was die Migrationsmuster im Reich und Europa betrifft. Klar scheint indes, dass sich Regierungen dieser Bewegungen bewusst waren und viele glaubten, davon profitieren zu können. Darüber hinaus setzten viele Agenten ein, um potenzielle Migranten zu rekrutieren, und manche, etwa die Regierung von Brandenburg im Fall der Salzburger Flüchtlinge von 1732, waren in der Lage, effizient geführte Transporte über beträchtliche Entfernungen sicherzustellen. 65 Welche Auswirkungen hatte die Migration wirtschaftlich? Im Allgemeinen waren relativ wenige Flüchtlinge wohlhabend, dynamisch und innovativ, die meisten waren Bauern, Arbeiter und niedere Handwerker. In einigen Bereichen spielten viele dieser Gruppen jedoch eine wichtige Rolle. Brandenburg profitierte vom periodischen Zufluss neuer Bauern. In Gebieten im Südwesten sowie an Mittel- und Oberrhein, die vom Dreißigjährigen Krieg und den späteren Konflikten schwer getroffen worden waren, waren Migranten zur Neubesetzung verlassener Bauernhöfe und Dörfer ebenfalls von enormer Bedeutung. Andere brachten Spezialwissen und Geschick in Handel und Finanzen, in Textilproduktion, Wasserbau, Bergbau und Metallverarbeitung mit. Zuwanderer aus Italien importierten Zitrusfrüchte und künstlerische Fertigkeiten etwa als Stuckateure und Maler. 66 Protestantische Flüchtlinge aus Berchtesgaden trugen zwischen 1708 und 1733 entscheidend zur Entwicklung der Nürnberger Spielwarenherstellung bei. 67 Und die waldensischen Bauern machten, abgesehen von ihrem »demografischen Potenzial«, die Kartoffel und die Blaue Luzerne in Südwestdeutschland heimisch. 68
309
310
III. · Die deutschen Territorien um 1648–1760
Anmerkungen 1 Härter, »Kurkölnische Policeygesetzgebung«, 212. 2 Hersche, Muße, 668; Schlumbohm, »Gesetze«. 3 Conrad, Rechtsgeschichte II, 318; Haberkern und Wallach, Hilfswörterbuch II, 630; Härter, »Kurkölnische Policeygesetzgebung«, 222. 4 Ogilvie, »State«, 182–199; Press, Kriege, 330. 5 Ogilvie, »Social Disciplining«, 71. 6 Forster, Catholic Revival, 9, 15. 7 Holenstein, »Gute Policey«, und Härter, Policey, sind exemplarische Studien zu BadenDurlach bzw. Mainz; eine wertvolle Fallstudie zum Kurfürstentum Köln liefert Härter, »Kurkölnische Policeygesetzgebung«. 8 Ogilvie, »Social Disciplining«, 72. 9 Ebd., 74. 10 Hersche, Muße, 244. 11 Härter, »Gesetzgebung«; Härter, »Kurkölnische Polizeygesetzgebung«. 12 Härter und Stolleis, Repertorium (passim): Die kurzen Einführungstexte zu jeder Region spiegeln den unterschiedlichen Blickwinkel der diversen Bearbeiter wider; die Klassifikation von Gesetzen ist mehr oder weniger konsistent. Eine exzellente Einführung auf Englisch bietet Raeff, Well-Ordered Police State, 11–179. Wakefield, Police State, liefert nützliche Belege für die Unzulänglichkeit der kameralistischen Praxis, was indes die Ansprüche nicht entkräftet und den speziellen Charakter deutscher Territorialherrschaft im europäischen Umfeld nicht beeinträchtigt. 13 Härter, »Kurkölnische Policeygesetzgebung«, 208 f. 14 Jütte, »Poverty«, 399; Hippel, Armut, 50 f.; Wolter, Armenwesen, 330–334, 338–361 (mit Fokus auf Eisenach). 15 Härter, »Gesetzgebung«, 110–121. 16 Härter, »Kurkölnische Policeygesetzgebung«, 222. 17 Ebd., 224. 18 Hersche, Muße, 785 f. 19 Ebd., 791 f.; Hersche datiert die Veränderung auf die 1760er Jahre, aber die Belege bei Härter lassen die Zeit zwischen 1720 und 1740 plausibler erscheinen: Härter, »Gesetzgebung«, 110–121; Härter, »Kurkölnische Policeygesetzgebung«, 212–229. 20 Tribe, »Cameralism«, 272 f. 21 Vgl. S. 221 f. 22 Pfister, Bevölkerungsgeschichte, 49 f. 23 Schunka, Gäste, 18–35. 24 Dölemeyer, Hugenotten, 129–135; Gerteis, Städte, 21. 25 Köbler, Lexikon, 787 f.; Gerteis, Städte, 22 f.; Grossmann, »Toleration«, 121 ff.; Grossmann, »Neuwied«, 22–25. 26 Blickle, Leibeigenschaft, 106–111; HDR V, 1421 ff.; Dotzauer, »Wildfangstreit«. 27 Dotzauer, »Wildfangstreit«, 95; in Speyer lag der Anteil bei 59,95 Prozent, die Reichsritter erlitten einen Verlust von 87,56 Prozent, der Wild- und Rheingraf 75,38 Prozent. 28 Dipper, Geschichte, 284. 29 Pfister, Bevölkerungsgeschichte, 57 f.; Schulte Beerbühl, »Flüchtlingshilfe«, 303, 310–315; Otterness, Becoming German, 19–77; Fenske, »Migration«, 336 f.; die Londoner »Pfälzer« kamen tatsächlich auch aus Hessen, Nassau und Württemberg; die Motivation ihrer Aus-
31. Regierung und Gesellschaft
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
54 55 56 57 58
59 60 61 62 63 64
wanderung lieferte das sogenannte Goldene Buch, ein Pamphlet von Joshua Kocherthal, in dem behauptet wurde, Königin Anne biete Überfahrt und kostenloses Land in Amerika. Dorthin gelangten nur wenige: Manche wurden in Irland angesiedelt, viele kehrten einfach wieder heim. Jersch-Wenzel, Juden und »Franzosen«, 26 f.; Israel, European Jewry, 120 f. Vgl. auch Band I, S. 666–669. Friedrichs, »Jews«; Whaley, Toleration, 80–84. Battenberg, Juden, 97 ff. Jersch-Wenzel, Juden und »Franzosen«, 44 f., 58–64. Israel, »Germany«, 302 f.; Jersch-Wenzel, Juden und »Franzosen«, 181. Battenberg, Juden, 33–36; Ullmann, Nachbarschaft, 36–40, 473–481. Battenberg, Juden, 39 ff., 105 ff.; Israel, European Jewry, 157 ff. Battenberg, Juden, 33. Israel, »Germany«, 303. Ebd., 300. Jersch-Wenzel, Juden und »Franzosen«, 68 f. Israel, »Germany«, 300. Ullmann, Nachbarschaft, 467–472; Battenberg, Juden, 98; Häberlein, »Grenzen«. Israel, European Jewry, 124, 189; Wappmann, Durchbruch, 229–248. Jersch-Wenzel, Juden und »Franzosen«, 32–42; Dölemeyer, Hugenotten, 84–98. Dölemeyer, Hugenotten, 92. Ebd., 104. Lachenicht, »Freiheitskonzession«. Dölemeyer, Hugenotten, 157–160. Ebd., 154–157. Duchhardt, »Glaubensflüchtlinge«, 283 f.; Dölemeyer, Hugenotten, 12 f., 30 f.; TRE XXXV, 396 ff. Dölemeyer, Hugenotten, 110. Die anderen Anspruchsteller waren Johann Wilhelm Friso von Nassau-Dietz, der Statthalter von Friesland und Groningen und der König von Frankreich; das Territorium wurde im Vertrag von Utrecht Frankreich zugesprochen, die preußischen Hohenzollern und das Haus Oranien erhoben jedoch weiterhin Anspruch auf den Titel »Fürst von Oranien«; vgl. Felix, Ausweisung, 20–23, 30, 51–55. Felix, Ausweisung, 114 f. Vgl. S. 192, 336 f. Ward, Awakening, 80; Winter, Emigration, 99. Pfister, Bevölkerungsgeschichte, 53; Florey, Salzburger Protestanten, 137–144. Winter, Emigration, 101–110; Ward, Christianity, 97 f.; zeitgenössische Schätzungen sprachen von 30.000 versteckten Lutheranern in Böhmen, andere behaupten, es seien mehr als 100.000 gewesen. Ward, Awakening, 73–77, 80–83; Winter, Emigration, 111–130. Clark, Iron Kingdom, 139–144. Die Zahlen sind sehr ungenau, da die Schätzungen deutscher Historiker traditionell auf dem Territorium des Zweiten Reichs von 1871 beruhten. Fenske, »Migration«, 334. Ebd., 343. Jersch-Wenzel, Juden und »Franzosen«, 125 f.
311
312
III. · Die deutschen Territorien um 1648–1760
65 Die Salzburger Bauern wurden von Führern begleitet, die sicherstellen sollten, dass sich den Kolonnen keine Eindringlinge anschlossen; Hauer, »Experiment«, 76. 66 Schindling, »Bei Hofe«. 67 Florey, Salzburger Protestanten, 201. 68 Dipper, Geschichte, 281; Gundlach, »Einführung«, 49.
32. Regierungsmacht und wirtschaftliche Entwicklung
G
rundsätzlich hing das Potenzial der Migranten von der Umgebung ab, in der sie siedelten. Selbst die dynamischsten Gruppen, etwa die Hugenotten, fanden in Brandenburg weniger Möglichkeiten für unternehmerische Aktivitäten als in Großbritannien und den Niederlanden vor. 1 Der Grund hierfür lag zum einen an der Gesamtentwicklung des Reichs und zweitens an der Politik der deutschen Territorien nach dem Dreißigjährigen Krieg. Obwohl die jüngere Forschung die relativ schnelle Erholung vieler Regionen und Sektoren betont, war die ökonomische Situation insgesamt nicht mehr so günstig wie im 16. Jahrhundert. Zumindest verstärkte der Krieg die Auswirkungen eines langfristigen Abschwungs der deutschen Wirtschaft, der bis weit nach 1700 anhielt. In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts wurden zunehmend Anzeichen für einen ebenso anhaltenden Aufschwung sichtbar, der sich nach 1750 deutlich beschleunigte. 2 Die Auswirkungen der fortgesetzten Kriege an der Ostsee, im Westen, Osten und Norden verlängerten den Abschwung teilweise bis in die 1720er Jahre. In den 1690er Jahren wurden die Folgen der diversen regionalen Konflikte verschärft durch besonders harte klimatische Bedingungen, die folgenden zwei Jahrzehnte erlebten eine Reihe außerordentlich harter Winter. 3 All dies spielte sich vor einem gesamteuropäischen Hintergrund ab, dessen ökonomische Entwicklung sich auch auf die Stellung des Reichs auswirkte. Die Verlagerung des europäischen Handels nach Westen an den Atlantik begünstigte Großbritannien, die Niederlande und die französischen Atlantikhäfen, die nun die Führungsrolle im Handel von Spanien und Portugal übernahmen. Die höchst lukrativen Handelskompanien, die zuerst den orientalischen, dann den atlantischen Handel beherrschten, saßen in London (1600), Amsterdam (1602) und Bordeaux (1669). Kopenhagen (1616) und Stockholm (1731) hatten ebenfalls einen Anteil, allerdings in viel geringerem Umfang. 4 Das Reich und seine Territorien waren an der kommerziellen Revolution, der Akkumulation von Kapital und dem unternehmerischen Boom nicht beteiligt. Lediglich Hamburg war in der Lage, zumindest direkt am neuen Handel mitzuwirken, jedoch nicht mit den britischen, niederländischen und französisch-indischen Kompanien zu konkurrieren. Bemerkenswert waren die Beteiligung von Jakob Kettler, dem Herzog von Kurland, am westindischen Handel ab 1638, der vom ihm errichtete Posten auf St. Andrew’s Island in der Mündung des Gambia 1651 und sein Erwerb von Tobago 1652. Die Kolonien waren jedoch kurzlebig, ebenso wie die
314
III. · Die deutschen Territorien um 1648–1760
Herrschaft seiner Familie über das Herzogtum Kurland, sowieso ein Lehen der polnischen Krone, das in den 1730er Jahren verloren war. 5 Johann Joachim Bechers erste Kolonialprojekte mit Mainz und Bayern scheiterten. Der von ihm vermittelte Kontrakt, der Graf Friedrich Casimir von Hanau-Lichtenberg den Besitz von etwa 140 Meilen Küste und 460 Meilen Hinterland in Guyana verschaffte, brachte nichts als Schulden und führte dazu, dass der Geisteszustand des Grafen infrage gestellt und er fünf Monate später abgesetzt wurde. 6 Herzog Jakobs Schwager, der Große Kurfürst, war erfolgreicher. 7 Verhandlungen mit Frankreich über eine französisch-brandenburgische Ost-Westindien-Kompanie, ein Versuch, die dänische Kolonie Tranquebar in der Bucht von Bengalen zu erwerben, und eine Mission zur Erkundung der Möglichkeiten einer Beteiligung an der persischen Seidenindustrie blieben fruchtlos. 1682 wurde jedoch die Brandenburgisch-Afrikanische Compagnie gegründet, die bald weitere Investoren fand, so etwa den Kurfürsten von Köln. Im November 1682 besetzten vierhundert brandenburgische Soldaten Emden, vorgeblich um die ostfriesischen Landstände davor zu bewahren, zu niederländischen Satelliten zu werden, in Wirklichkeit aber vor allem, um sich den Nordseehafen als Sitz der brandenburgischen Admiralität und der neuen Compagnie zu sichern. 8 Am 1. Januar 1683 wurde die Kolonie Groß Friedrichsburg an der Küste von Ghana gegründet, wo sich bald ein Netzwerk von Stützpunkten über 50 km erstreckte. Innerhalb weniger Jahre wurden die Insel Arguin vor Mauretanien von den Niederlanden und St. Thomas in den Antillen von den Dänen erworben. Brandenburg schien auf dem besten Weg, in den triangulären Handel zwischen Europa, Afrika und Amerika einzusteigen. An Interesse mangelte es nicht. Der Erwerb von Territorium, in dem der brandenburgische Kurfürst vollständige Souveränität genossen hätte, scheint bis zur Annahme des preußischen Königstitels 1701 ein starkes Motiv gewesen zu sein. Der Profit war nicht zu vernachlässigen: Um 1694 wurde er auf 96.000 Taler pro Jahr geschätzt und über dreißig Jahre wurden neben Zucker, exotischen Hölzern, Kakao, Indigo und Tabak 15.000 Sklaven nach Emden transportiert. Letztlich aber wurde das Unternehmen von der Übermacht der Konkurrenz und militärischem Druck aus Großbritannien und den Niederlanden untergraben. 1717 ging Groß Friedrichsburg für 7.200 Dukaten und »zwölf Mohren« an die Niederländer, ebenso wie ein Jahr darauf Arguin, das 1721 von den Franzosen erobert wurde. Die brandenburgische Handelsstation auf St. Thomas wurde 1731 von den Dänen konfisziert. Letztlich war Brandenburgs Flotte schlichtweg zu klein: Sie umfasste nie mehr als sechzehn Schiffe, fünfzehn gingen verloren, zehn davon wurden von Franzosen gekapert. Österreichs Bemühungen, in das maritime Kartell einzudringen, waren nicht erfolgreicher. 9 Die 1667 gegründete erste Orientkompanie errichtete eine Handels-
32. Regierungsmacht und wirtschaftliche Entwicklung
stelle in Istanbul, brach aber zu Beginn des Kriegs gegen die Türken 1683 zusammen. 1719, im Jahr nach dem Frieden von Passarowitz, wurde die Privilegierte Orientalische Kompanie gegründet, deren Arbeit jedoch durch die Feindseligkeit der osmanischen Bürokratie und die Konkurrenz venezianischer und griechischer Kaufleute behindert wurde. Dennoch handelte sie mit Stützpunkten in Wien und Belgrad sowie Fabriken in Linz, Schwechat und Triest einige Zeit erfolgreich mit Baumwolle, ehe sie 1734 bankrottging. Neue Möglichkeiten eröffnete der Erwerb der Spanischen Niederlande 1713. Antwerpen war durch die im Vertrag von Münster 1648 bestätigte Blockade der Schelde ruiniert. 1714 verlieh Karl VI. indes dem Iren Thomas Ray das Privileg, Schiffe vom Stapel laufen zu lassen und Österreich im Fernen Osten zu etablieren. 1719 wehte die kaiserliche Standarte über Covelong an der Koromandelküste; zwei Jahre später wurde ein kaiserlicher Stützpunkt in Baleswar im Golf von Begalen errichtet und 1722 die Ostender Kompanie mit einem Kapital von 6 Millionen Gulden gegründet. Aus Handelsstationen wurden nun Festungen und es entwickelte sich ein höchst profitabler Tauschhandel von Edelmetallen, Blei, Quecksilber und Stoffen gegen Baumwolle, Rohseide, Tee, Gewürze, Diamanten und Porzellan. Das Unternehmen scheiterte jedoch bald an der Politik: Die niederländische und britische Opposition nahm zu und Karl VI. brauchte die Zustimmung von London und Den Haag zur Pragmatischen Sanktion. 10 1727 erklärte er sich bereit, die Kompanie für sieben Jahre stillzulegen, 1731 wurde sie aufgelöst. Kolonialhandel war selbstverständlich nicht die einzige Art von Handelsverkehr und Fehlschläge auf diesem Gebiet schmälern nicht den anhaltenden Erfolg deutscher Kaufleute auf anderen Feldern. Der deutsche Handel passte sich der internationalen Entwicklung an. Im 16. Jahrhundert hatte Süddeutschland dominiert, nun florierten Norddeutschland, Mittel- und Niederrhein und Westfalen dank der Belieferung der niederländischen und englischen Märkte. 11 Hamburg wurde zum wichtigsten deutschen Hafen, gefolgt von Bremen, und um 1700 überholte Leipzig Frankfurt am Main als führende deutsche Messestadt. Frankfurt blieb als Bankzentrum wichtig, Leipzig hatte jedoch den Vorteil seiner Lage an den profitabelsten Handelsrouten – dass der sächsische Kurfürst 1697 den polnischen Thron bestieg, öffnete sein Land zudem für polnische und russische Kaufleute, die mit begehrten Gütern wie Räucherware und Pelzen handelten. 12 Der alte Nord-Süd-Handel mit Italien und die Route von dort über Nürnberg nach Amsterdam war nun von geringerer Bedeutung. Ebenso blieb Augsburg für den Süden ein wichtiges Bankzentrum, konnte aber nie mehr die Stellung erreichen, die es im 16. Jahrhundert innegehabt hatte. So zogen sich auch die Fugger nun aus dem Bankgeschäft zurück und konzentrierten sich ganz auf ihre Rolle als niedere Territorialfürsten. 13 Zweitens machte der Außenhandel wohl höchstens 20 Prozent des gesamten
315
316
III. · Die deutschen Territorien um 1648–1760
deutschen Handels aus. 14 Das riesige Gebiet des Reichs selbst bot umfangreiche Märkte für landwirtschaftliche, handwerkliche und industrielle Produkte. Der Binnenhandel erholte sich recht schnell vom Krieg und erlangte noch größere Bedeutung, als im frühen 18. Jahrhundert die Bevölkerung wieder zunahm. Welchen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung die Regierungsarbeit leistete, ist schwer festzustellen. Oft ist zu hören, das unternehmerische Engagement vieler Regierungen sei eines der charakteristischen Merkmale des Jahrhunderts nach dem Dreißigjährigen Krieg. 15 Merkantilistische und kameralistische Theorien betonten die Schlüsselrolle der Regierungen für die Förderung des Wohlstands – durch Regulierung von Import und Export, Ausbau der Wasserwege und Straßen, Förderung von Post und Kommunikationssystemen, durch die Regelung der Produktion und Vermarktung von Waren und des Arbeitsmarkts sowie durch direkte Aktivitäten in Land- und Forstwirtschaft, Bergbau und Industrie. Über die ökonomische Bedeutung der Bautätigkeit von Adligen, Kirchenstiften und Fürsten, des damit verbundenen Handels mit Luxusgütern und über die Wichtigkeit der Territorialarmeen für die Textil- und Metallindustrie sind die Meinungen geteilt. Eine Kernfrage ist, in welchem Ausmaß die Befriedigung von kurzfristigen Nachfragen nach Produkten oder Arbeitskräften zur langfristigen wirtschaftlichen Entwicklung beitrug. Waren Regierungen aktiv daran beteiligt, die Grundlagen für die spätere Industrialisierung und den Wirtschaftsaufschwung zu schaffen? Dabei ist zu bedenken, wie begrenzt die Möglichkeiten der Regierungen waren, sinnvolle und zielgerichtete Politik zu betreiben oder auch nur traditionelle, etablierte Ansätze neu auszurichten. In den Territorien wurden auf gut Glück Maßnahmen ergriffen, die den Rahmendiskussionen und gelegentlichen Beschlüssen entsprangen, die nach 1648 die Arbeit des Reichstags und der Kreise charakterisierten und mal funktionierten, mal nicht. 16 Der Umgang mit Zöllen zeigt, wie schwer es den meisten Territorien fiel, alte Systeme an neue Gegebenheiten anzupassen. Es gab zahlreiche Versuche einer Regelung auf Reichsebene. Der Westfälische Friede beseitigte die vielen während des Krieges ohne Erlaubnis des Kaisers und der Kurfürsten errichteten Zollstellen. 17 Zehn Jahre später ließen die Fürsten in Kaiser Leopolds Wahlkapitulation eine Klausel einfügen, die vorschrieb, dass für neue Zollstellen auch die Konsultation aller benachbarten Territorien erforderlich war, was in der Wahlkapitulation Karls VI. 1711 dahingehend geändert wurde, dass nur noch der betroffene Kreis zustimmen musste. Gleichzeitig empfahl die neue kameralistische Theorie Exportverbote für Rohstoffe und Importverbote für Produktionsgüter. Die ersten Versuche in dieser Richtung hatten keinen Erfolg. Der Reichstag einigte sich auf ein Exportverbot für Wolle, ließ jedoch jedes Territorium für sich entscheiden, ob das Verbot insgesamt oder nur teilweise gelten sollte. 18 Ähnliches versuchten Kaiser und Reichstag vor dem Hintergrund der französischen Kriege
32. Regierungsmacht und wirtschaftliche Entwicklung
nach 1672, aber das Import- und Exportverbot zeigte wenig Wirkung. 19 Zu viele Parteien hatten ein ureigenes Interesse, von dem allgemeinen Verbot ausgenommen zu werden, und was sich legal nicht liefern ließ, wurde eben einfach geschmuggelt. Ein von Köln und Brandenburg als Antwort auf den niederländischen Boykott deutscher Importe gefordertes Einfuhrverbot für niederländische Waren wurde erst 1711 beschlossen, als die Lage aller Beteiligten eine vollständig andere war. 20 Das Dekret, mit dem Leopold I. 1685 die Einführung einer neuen Maschine zur Herstellung von Bändern und Schleifen untersagte, war nur dort effektiv, wo die Gilden Druck auf ihren Herrscher ausübten, etwa in Sachsen, aber selbst dort wurden die neuen Methoden nur verzögert, nicht verhindert. 21 Echte kameralistische Zollpolitik setzte »geschlossene« Territorien voraus, die aus einer durchgehenden Landmasse bestanden, an deren Grenzen man Gebühren kassieren konnte. Abgesehen davon, dass viele Territorien zahlreiche nicht zusammenhängende Provinzen oder Distrikte umfassten, lief das der traditionellen Praxis entgegen. Zölle waren traditionell eine wichtige Einkommensquelle, deren Bedeutung zwar im 17. Jahrhundert abnahm, die jedoch für viele Herrscher wichtig blieb. Vor allem blieb die Mentalität hinter ihrer Erhebung bis Mitte des 18. Jahrhunderts weitgehend unverändert. Erhoben wurden im Allgemeinen Transit- und Marktzölle. Transitabgaben waren jedoch auch im Landesinneren fällig, da beim Transport nicht zwischen einheimischen und »fremden« Waren unterschieden wurde. Haupteffekte waren folglich eine Behinderung des Handels und steigende Preise, weil Zölle gut 50 Prozent der Transportkosten ausmachten. Auf der Elbe zwischen Hamburg und Dresden wurde an dreißig Zollposten kassiert, an siebzehn weiteren von Dresden bis Prag. Auf der Donau zwischen Ulm und Wien gab es mindestens sechsunddreißig solche Posten, auf dem Rhein von Basel bis Rotterdam alle zehn Kilometer einen. 22 Viele Wasserwege, etwa Ruhr und Lippe, waren (bis in die 1780er Jahre beziehungsweise 1815) für Handelszwecke ungeeignet, weil sie schlichtweg zu viele Grenzen und Gerichtsbezirke mit diversen Mühlund Dammrechten passierten. 23 Die Herzöge von Braunschweig-Wolfenbüttel arbeiteten zwei Jahrzehnte lang an der Schiffbarmachung des Oker. Als das Projekt 1741 endlich fertiggestellt war, hatte es keine wirtschaftliche Grundlage mehr und so wurde der Betrieb 1775 eingestellt. 24 Andererseits wurde 1668 der 1558 begonnene Müllroser Kanal fertiggestellt, der die Oder mit der Spree und somit über die Elbe mit Hamburg verband – gerade zur rechten Zeit, als eine Verbindung zwischen Schlesien, Brandenburg und der Nordsee dringend benötigt wurde, da Schweden immer noch die Ostseemündung der Oder besetzt hielt. 25 In manchen extrem fragmentierten Gebieten hielt eine Art negativer Wettbewerb die Zölle niedrig. Ein Territorium wie Württemberg fürchtete ständig, Opfer eines Tarifkriegs seiner vielen Nachbarn zu werden. Das scheint sich in einigen
317
318
III. · Die deutschen Territorien um 1648–1760
Gegenden dämpfend auf die Höhe der Gebühren ausgewirkt zu haben. 26 Andererseits führte die gleichzeitige Entwicklung von Grenzzöllen aufgrund kameralistischer Prinzipien in Sachsen und Brandenburg ab etwa 1700 zu Spannungen, die sich nach 1740 in einem offenen Zollkonflikt entluden, als Sachsen sich im Ersten Schlesischen Krieg auf Habsburgs Seite schlug. Preußen gelang es, den Leipziger Messen kurzfristig zu schaden, aber nicht, sie zu zerstören; die anhaltende Feindseligkeit schädigte jedoch Handel und Produktion beider Territorien, bis sich die Beziehungen mit dem Tod Friedrichs des Großen besserten. 27 Zwar spielten Zolleinnahmen in den gut hundert Jahren nach 1648 eine immer geringere Rolle, ernsthafte Versuche zur Umorientierung auf ein kameralistisches System der Import- und Exportkontrolle wurden aber erst in der Zeit nach 1750 unternommen. Eine wichtigere Einnahmequelle waren die diversen traditionellen Regalien. Wo die Ressourcen dies zuließen, gruben manche weiterhin nach Metallen beziehungsweise Salz, andere förderten die Landwirtschaft in ihrem Herrschaftsbereich für einheimischen Konsum und Export. So gut wie alle Herrscher beuteten das wichtigste »neue« Regal aus: die um 1700 überall eingeführte Verfügungsgewalt über die Wälder. 28 In ihm fand der im späten 15. Jahrhundert eingeleitete Prozess der Ausweitung fürstlicher Kontrolle über die Forste seine Vollendung. Die Sicherung von Jagdrechten auch in Wäldern war symbolischer Ausdruck des Zugriffs der Herrscher auf diese wichtige Ressource. Für Bau und Industrie war Holz der entscheidende Rohstoff. 29 Gewaltige Mengen davon benötigte man für die Gewinnung von Salz, Eisen, Kupfer, Silber und Pottasche zur Herstellung von Glas und Seife sowie für die Textilindustrie. Nadelholz lieferte Pech, Teer und Terpentinöl, die Rinde benutzte man zum Dachdecken; aus Eichenrinde wurden Gerbstoffe für Leder gewonnen. Praktisch alle Alltagsutensilien bestanden aus Holz, ebenso wie die Behausungen eines Großteils der Bevölkerung. Im Haushalt brauchte man ungeheure Mengen Holz zum Kochen und Heizen. Balken und Faschinen dienten zur Konstruktion von Deichen, Dämmen und Straßen. Die Nachfrage nach Holz war in ganz Europa gewaltig, nicht zuletzt aufgrund der Ausweitung der Flotten: Für ein einziges großes Schiff benötigte man etwa 4.000 Bäume. Das Ergebnis war weniger eine »Energiekrise«, wie man einst glaubte, als eine von vielen Herrschern ergriffene Möglichkeit zur Kontrolle einer höchst profitablen strategischen Ressource. Das zeigen auch die häufigen Hinweise auf Mängel in der zeitgenössischen Gesetzgebung: Sie rechtfertigten eine immer umfassendere herrschaftliche Kontrolle auf Kosten traditioneller kommunaler Rechte und Bräuche. Die Regulierung und Begrenzung der Anzahl der gefällten Bäume und systematischer Neu- und Wiederanbau dienten dazu, die Preise hoch zu halten. Einer echt rationalen Planung kam keine dieser Maßnahmen nahe. Dennoch zeigt die wachsende Anzahl der Schriften zur Forstwirtschaft als Unterdisziplin der Kame-
32. Regierungsmacht und wirtschaftliche Entwicklung
ralwissenschaft die Bedeutung, die man einer Ressource beimaß, die einen substanziellen Anteil an dem grob geschätzten Drittel lieferte, das Regalien und andere Besitzrechte zu den Einkünften der meisten Territorien beitrugen. 30 In vielen kleineren Territorien des Südens, Westens und der Mitte des Reichs konnten Wälder bis zu drei Viertel der Einnahmen eines Herrschers ausmachen. 31
Anmerkungen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30
Jersch-Wenzel, Juden und »Franzosen«, 117. Kriedte, »Trade«, 121 f.; Dipper, Geschichte, 183–188. Dipper, Geschichte, 10–18. Morineau, Compagnies, 7–56. Duchhardt, »Afrika«, 120; Mattiesen, Überseepolitik (passim); Berkis, Courland, 75–99, 190–219; Redlich, »Unternehmer«, 23–26, 102 ff.; ADB XIII, 540–546. ADB XXIII, 38–41; Duchhardt, »Afrika«, 121. Nagel, Abenteuer, 141 f.; Duchhardt, »Afrika«, 127–131. Hughes, Law, 73 f. Vocelka, Glanz, 70 f.; O’Reilly, »Lost Chances«, 62 ff.; Nagel, Abenteuer, 136 ff.; Morineau, Compagnies, 64 ff. Vgl. S. 188–192. North, Kommunikation, 13–23. Ebd., 20 ff., 66. Hersche, Muße, 471. Kriedte, »Trade«, 101. Press, Kriege, 281. Vgl. S. 77–80. Vgl. für das Folgende Falke, Zollwesen, 229–269, und HbDSWG, 621–624. Gömmel, Wirtschaft, 46. Vgl. S. 103. Gömmel, Wirtschaft, 48. Lehmann, »Herausbildung«, 383; Blaich, Wirtschaftspolitik, 214–225. Stolz, »Entwicklungsgeschichte«, 26 f.; Kriedte, »Trade«, 104. Henning, Handbuch, 875. North, Kommunikation, 10. Henning, Handbuch, 874. Volckart, »Zersplitterung«, 33 f. Kriedte, »Trade«, 122; Falke, Zollwesen, 269–320. Vgl. zum Folgenden: Dipper, Geschichte, 29–41; Henning, Handbuch, 804–807; Warde, »Forests«; Schenk, »Forest Development Types«; Radkau, »Energiekrise«; Allen, »Timber Crisis«; Ernst, »Forstgesetze«. Reininghaus, Gewerbe, 18–47, bietet einen umfassenden Überblick über die diversen Zweige von Industrie und Handwerk. Henning, Handbuch, 905–908; Gömmel, Wirtschaft, 70. In Trier entfielen auf die Forstwirtschaft im 18. Jahrhundert zehn Prozent der gesamten Regierungseinnahmen; vgl. Warde, »Forests«, 596. 31 Ebd., 594.
319
33. Öffentliche und private Unternehmen
D
ie wirtschaftlichen Möglichkeiten der Territorien hingen von ihrer Größe, geografischen Lage, von natürlichen Rohstoffen und der innenpolitischen Konstellation ab. So oder so waren die meisten Regierungen in der Lage, unternehmerische Traditionen aus dem 15. und 16. Jahrhundert zur Ausbeutung ihrer Besitz- und Regalrechte weiterzuentwickeln. Einige begannen sich nun jedoch auch direkt in der Industrie zu engagieren. Staatliche Manufakturen entstanden in Sachsen, Brandenburg, Wien, München und anderen Zentren. Sachsen ging mit der Gründung zehn solcher Betriebe zwischen 1649 und 1685 voran, darunter waren eine Seidenfabrik in Leipzig (1674) und eine Seiden- und Wollfabrik in Ostra bei Dresden (1678). 1 Andere Territorien folgten bald. Die meisten Manufakturen waren im Textilbereich tätig, es entstanden aber auch Fabriken für Fayencekeramik in Hanau (1661), Frankfurt am Main (1666), Berlin, (1678), Kassel (1680) und bis 1740 in fünfundzwanzig weiteren Städten. 2 Die Anzahl der Gründungen stieg in den letzten zwei Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts merklich an: Viele Territorien, die flüchtige Hugenotten als Siedler angelockt hatten, förderten diese nun bei der Ausübung ihrer traditionellen Berufe in der neuen Heimat. Ursprung, Ausmaß und Bedeutung der staatlichen Industrien für die langfristige Entwicklung der deutschen Wirtschaft bleiben umstritten. Peter Hersche und andere halten die Religion für einen Schlüsselfaktor. Katholische, insbesondere kirchliche Territorien, argumentiert Hersche, verfolgten letztlich andere Ziele als protestantische. Profit habe bei ihnen keine Rolle gespielt und sie hätten keine Arbeitsethik entwickelt. Ihre ökonomischen Aktivitäten seien von einer Denkweise der Subsistenz bestimmt gewesen; groß investiert hätten sie nur in Repräsentation, Erlösung und (gottesdienstorientierte) Muße. 3 Daher hätten die kirchlichen Territorien Landwirtschaft und Weinbau mehr Bedeutung beigemessen als der Förderung der Industrie. Ähnliches ist bis Mitte des 18. Jahrhunderts für weltliche katholische Herrscher festgestellt worden: Auch sie hätten sich auf Landwirtschaft und die Nutzung von Regalien beschränkt und erst später die Industrie gefördert. In Bayern zeigte nur Kurfürst Max Emanuel zwischen 1680 und 1700 großes Interesse an der industriellen Produktion und erst ab 1760 richtete sich die Politik systematisch auf diesen Bereich. 4 Hersche zufolge gilt das Gleiche für die habsburgische Ökonomie, die zwar ab den 1670er Jahren im Reich offenbar ein führendes Beispiel war, aber
33. Öffentliche und private Unternehmen
erst während der Herrschaft von Maria Theresia wirklich Früchte trug. 5 Protestantische Territorien hingegen betrieben demnach eine aktivere Wirtschaftspolitik und kultivierten die Ideale von Disziplin und persönlicher Erfüllung im Diesseits, die zum entscheidenden Ansporn für Innovation und die Anhäufung von Vermögen wurden. 6 In gewissem Maß entsprang die Politik der kirchlichen Territorien deren verfügbaren Ressourcen und der Tatsache, dass bis zu 90 Prozent der Arbeitskräfte in der Landwirtschaft tätig waren. 7 Gleichzeitig war es für Weinanbaugebiete – die zum Großteil in den kirchlichen Territorien an Rhein, Main und Mosel lagen – nur logisch, dafür zu sorgen, dass genügend Personal für den außerordentlich arbeitsintensiven Weinbau zur Verfügung stand. 8 Hersches Verallgemeinerung ist aber auch insgesamt zu pauschal gefasst, weil sie weder die fortdauernde Ausbeutung von Regalien etwa im Bergbau noch die Existenz von Handwerk und Industrie in manchen katholischen Territorien berücksichtigt. Was für Mainz, Trier und Fulda gilt, lässt sich nicht unbedingt verallgemeinern. 9 Textilindustrie und Bergbau spielten in Basel, Salzburg und Lüttich eine Rolle. In Paderborn förderten die Bischöfe ländliches Handwerk (hauptsächlich im Textilbereich) und »industrielle« Glasherstellung ebenso wie Salz-, Eisen-, Kupfer- und Bleiminen. Berchtesgaden konkurrierte im Salzbergbau mit Salzburg. Im Fürstbistum Augsburg überlebte die traditionelle ländliche Textilherstellung und erlebte ab Mitte des 18. Jahrhunderts mit der Entwicklung der neuen Baumwollstoffe einen neuen Aufschwung. 10 In der Reichsabtei Kempten – um ein Beispiel eines kleineren kirchlichen Territoriums von etwa 880 km 2 anzuführen – bildeten Land- und Fortwirtschaft die wirtschaftliche Basis. 11 Gefördert wurden indes auch die Glasherstellung, sowohl für den Bedarf der Abtei bei Neubauten als auch für den Export, sowie Salpeter- und Papierproduktion (überwiegend für liturgische Werke lokaler Verlage). Daneben gab es erfolgreiche Versuche, die traditionelle Textilherstellung im Wettbewerb mit der Industrie in der Reichsstadt Kempten zu stärken. In den Jahren 1680 bis 1760 beschäftigten die drei Glasereien nicht mehr als etwa 80 Leute, dabei ist jedoch der Beitrag zur Forstwirtschaft und zum Lebensunterhalt der Fuhrleute und Flößer zu berücksichtigen. Für ein Territorium, dessen »Hauptstadt« um 1700 nur etwa 800 Einwohner hatte (gegen 2.000 in der benachbarten Reichsstadt), waren selbst so kleine Unternehmen von beträchtlicher wirtschaftlicher Bedeutung. 12 Auch die Ökonomie vieler protestantischer Territorien beruhte weiterhin zum Großteil auf Landwirtschaft. Einige indes betrieben nun eine Wirtschaftspolitik, die in ihren Ansprüchen innovativ, wenn auch nicht immer erfolgreich war. Die Vorreiterrolle Sachsens in der Förderung von Manufakturen hatte klare Wurzeln in Vorläufern des 16. Jahrhunderts, als es das führende protestantische und das wohl reichste und fortschrittlichste Territorium nach den habsburgischen Ländern
321
322
III. · Die deutschen Territorien um 1648–1760
war. Diese Stellung geriet erst Ende des 17. Jahrhunderts ins Wanken, als die herrschende Dynastie zum Katholizismus konvertierte und sich in den kostspieligen Kampf um die Bewahrung der polnischen Krone verstrickte. Zweifellos profitierten die protestantischen Territorien insgesamt von der Intoleranz der katholischen Herrscher im Reich und anderswo. Viele Hugenotten waren gut ausgebildet, erfindungsreich und wohlhabend. Ihr Beitrag sollte indes nicht überbewertet werden. 13 Die frühen Fabriken glichen eher großen Handwerksbetrieben als der Industrie des 19. Jahrhunderts. Obwohl die Regierung sie mit der Zuteilung von Subventionen, Gebäuden und Gelände förderte, scheiterten viele hugenottische Unternehmen, was auch dazu führte, dass viele Familien ihr ursprüngliches Ansiedlungsgebiet wieder verließen. Die 1686 in Berlin von Jean Biet mit 5.000 Talern kurfürstlicher Unterstützung gegründete erste Seidenfabrik musste bereits 1690 wieder schließen. Eine 1694 eröffnete große Stoffmanufaktur unter Leitung des Züricher Geschäftsmannes Joseph Orelly brach nach fünf Jahren unter erdrückenden Schulden zusammen. 14 Die Autoritäten in Berlin und anderswo betonten wiederholt, sie hätten die Bevölkerung vergrößert, den Konsum gesteigert und für Exporte gesorgt. In Wirklichkeit warfen die meisten dieser frühen Unternehmen minimale Profite ab und scheiterten regelmäßig; das Importvolumen der vielen Luxusgüter, die sie herstellten, übertraf weiterhin alle erzielten Exporte. 15 Die ersten Generationen von Hugenotten in Brandenburg trugen wenig dazu bei, die ökonomische Kluft zwischen Brandenburg und den besser entwickelten Gegenden in England, den Niederlanden und Frankreich zu schließen. Die beträchtlichen staatlichen Investitionen in ihre Ansiedelung trugen erst auf lange Sicht Früchte. Brandenburg-Preußen allerdings gelang es durch beharrliche Förderung von Unternehmen und dank der Größe seiner Märkte für Militärgüter sowie der Umgebung von Berlin und dem Hof, im Lauf des 18. Jahrhunderts eine neue industrielle Region zu schaffen. Die Politik von Brandenburg-Preußen wird oft als Beispiel für die innovative Modernität einer entstehenden Großmacht herangezogen. Zumindest in der Zeit vor 1740 muss man sie jedoch im Kontext der umfassenderen Frage betrachten, ob deutsche Höfe und Regierungen selbst Motoren ökonomischer Aktivität waren. Brandenburg-Preußen war größer als die meisten und verfügte über ein wesentlich größeres Militär, ähnelte jedoch den anderen, was den Umfang der Investitionen in Gebäude, Hof und Regierung anbelangt. Wie wirksam stimulierten der Bauboom in den hundert Jahren nach 1648, der Repräsentationsaufwand der Höfe und – in katholischen Gegenden – Klöster und Stifte die Wirtschaft tatsächlich? Kameralistische Theoretiker zeigten wenig Zweifel, dass Palastbauten Arbeitsplätze schufen und Handwerk und Industrie beflügelten, während der Hof und sein regierungsamtliches Umfeld eine Schlüsselrolle als kollektive Konsumenten landwirtschaftlicher und industrieller Produkte spielten. Selbst Voltaire betonte
33. Öffentliche und private Unternehmen
1770 in einem Brief an Friedrich den Großen, einen prächtigen Palast zu erbauen, sei die beste Art, Geld im Land zu behalten und Arbeit zu bieten; viele andere Herrscher konterten Beschwerden über die Kosten ihrer Bauprojekte mit dem Argument, in Wirklichkeit förderten sie den Wohlstand ihrer Länder. 16 Die zugänglichen Belege legen eine etwas zurückhaltendere Bewertung nahe. Höfe konnten zwar Arbeit und Möglichkeiten schaffen, aber auch die Ökonomie eines Territoriums aus dem Gleichgewicht bringen, indem sie Geld und Möglichkeiten auf Kosten abgelegenerer Gebiete im Zentrum konzentrierten. Der Bau vieler neuer Schlösser, klerikaler Residenzen und großer Kirchen ging einher mit wachsenden Schulden, Zahlungsverzögerungen und -ausfällen. Bezahlt wurde oft aus Steuergeldern, was ein Territorium an den Rand des Ruins bringen und Aufstände auslösen konnte. Als der preußische König Friedrich I. 1706 Johann Friedrich von Eosander beauftragte, das soeben erst von Andreas Schlüter fertiggestellte Berliner Schloss auf die doppelte Größe zu erweitern, gerieten die Finanzen sehr bald außer Kontrolle. Steuererhöhungen trugen maßgeblich zur Subsistenzkrise in Ostpreußen 1709/10 bei und der kaiserliche Botschafter Graf Schönborn-Buchheim stand nicht allein mit der Vermutung, Friedrich I. habe mehr Geld für Bauten, Möbel und anderen Luxus ausgegeben als für den Krieg.17 Je kleiner ein Territorium war, desto größer war das relative Ausmaß des Problems. Ernst Ludwig von Hessen-Darmstadt (1678–1739) häufte mit dem Bau seines neuen Palasts in Darmstadt ab 1716 mehr als 5 Millionen Gulden Schulden an; der Rohbau stand bis ins frühe 19. Jahrhundert sinnbildlich für seine Extravaganz. 18 Kleinere kirchliche Territorien wie Kempten und andere schwäbische Abteien hatten nicht weniger hochtrabende Pläne. Wie die weltlichen Territorien verließen sie sich bei den Einnahmen ihrer Ländereien auf Steuern und Schulden. Weltliche wie kirchliche Herrscher setzten in großem Umfang auf Baufrondienste beziehungsweise Zahlungen von Gemeinden, die sich diesen Diensten entziehen wollten oder zu abgelegen waren, um zum Bau und Materialtransport beizutragen. Diese Praktiken sind in Bezug auf Süddeutschland gut erforscht, waren jedoch auch anderswo beim Palastbau gängig, etwa in Hessen, Kursachsen und dem Herzogtum Sachsen-Meiningen. 19 Die zum Arbeitsdienst Verpflichteten erhielten Kost und Logis, was man als eine Art von Bezahlung werten könnte. Den angestellten Arbeitern wurden jedoch die Kosten für Verpflegung und Wein vom Lohn abgezogen. 20 Offenbar hatte die Tätigkeit im herrschaftlichen Bauwesen in jeder Hinsicht ihren Preis. Wenn sich ein Hof einmal etabliert hatte, war er definitiv ein wesentlicher Arbeitgeber und Konsument, der der jeweiligen Stadt sehr zugutekam. Nach der Ernennung von Kurfürst Max II. Emanuel von Bayern (1679–1726) zum spanischen Statthalter in Brüssel klagten Münchner Ladeninhaber und Händler zehn Jahre lang über den Verlust ihrer wichtigsten Kunden.Wolfenbüttel brauchte mehr
323
324
III. · Die deutschen Territorien um 1648–1760
als ein Jahrhundert, um sich vom Umzug der Herzöge von Braunschweig-Wolfenbüttel nach Braunschweig 1753 zu erholen. 21 Düsseldorf litt nach dem Tod von Kurfürst Johann Wilhelm von der Pfalz 1716 darunter, dass sein Nachfolger Karl Philipp lieber in Mannheim residierte. 22 Ebenso ging es Mannheim, als der pfälzische Kurfürst Karl Theodor (1742–1799) die bayerische Kurwürde erbte und 1777 nach München zog. Düsseldorf und Mannheim blieben zwar wichtige regionale Verwaltungszentren, aber der Verlust der Höfe erwies sich als kostspielig. Höfe waren Großkonsumenten von Lebensmitteln und anderem, etwa Luxusprodukten. 23 Den Alltagsbedarf eines Hofs und seiner Beamten an Essen und Getränken lieferte im Allgemeinen die Landwirtschaft des jeweiligen Territoriums, bezahlt von den durchschnittlich etwa 25 Prozent ihrer Einkünfte, die deutsche Fürsten für ihre Höfe ausgaben. Hofschneider und -tischler waren von der üblichen Gildenregel von zwei Gesellen pro Meister ausgenommen, was vielen die Möglichkeit gab, Firmen mit mehr als zwanzig Handwerkern zu führen. Der Ansbacher Hofschneider beschäftigte in den 1720er Jahren zwischen zwölf und sechzehn Handwerker, mehr als fünfzig Tischler, der Schlosser gut 40 Prozent der gesamten Branche in der Stadt. In Mainz gab es 1752 vierundvierzig Möbelschreiner mit insgesamt vierundneunzig Gesellen, von denen siebenundzwanzig für den Hofschreiner arbeiteten. Die ersten Fabriken in Dresden, München, Berlin und Wien waren Seidenfabriken und viele Herrscher förderten die Glasherstellung, nicht nur für die riesigen Fenster ihrer neuen Bauten, sondern auch für Spiegel. 24 Die Jagd nach dem Geheimnis des Porzellans beschäftigte viele Höfe, da sich die Sammelleidenschaft für chinesisches Porzellan verbreitete und die zunehmende Beliebtheit von Tee, Kaffee und Kakao entsprechendes Geschirr im Alltag unverzichtbar werden ließ. 25 In chinesischem Stil gestaltete Fayencekeramik aus niederländischer und deutscher Produktion war ein schlechter Ersatz; auch das von Johann Joachim Becher bei Experimenten in München, die Kurfürst Ferdinand Maria (1651–1679) sponserte, produzierte Milchglas konnte nicht viele überzeugen. Der Durchbruch gelang Johann Friedrich Böttger, der zuerst als Entdecker der »Alltinktur« bekannt wurde, von der er behauptete, sie heile alle Krankheiten und verwandle unedle Metalle in Gold, und Ehrenfried Walther von Tschirnhaus, der ab Mitte der 1670er Jahre Versuche zum Schmelzpunkt von Kaolin und anderen Substanzen unternommen hatte, in Dresden. Es gelang ihnen um 1707, rotes Jaspissteingut und (am 15. Januar 1708) echtes Porzellan herzustellen; der kommerzielle Erfolg blieb zunächst jedoch aus. Bei Böttgers Tod 1719 war die in Meißen ansässige Manufaktur in beklagenswertem Zustand. Durchsetzen konnte sie sich erst mit den von dem Maler Johann Gregorius Höroldt, der in der nach Meißener Vorbild gegründeten Wiener Manufaktur gearbeitet hatte, eingeführten ChinoiserieServices und Kopien japanischen Kakiemon-Porzellans, die in den späten 1720er
33. Öffentliche und private Unternehmen
und 1730er Jahren groß in Mode kamen. Die Wiener Manufaktur hingegen kämpfte noch jahrzehntelang mit finanziellen Problemen. Die brandenburgisch-preußische Textil-, Waffen- und Tabakindustrie verdankte ihr Überleben größtenteils staatlichen Subventionen, ihrer Monopolstellung und der Armee als sicherem Abnehmer. Zudem war sie hauptsächlich um Berlin und Potsdam angesiedelt und erreichte kaum Kunden außerhalb von Brandenburg-Preußen. Die Rüstungsindustrie in Potsdam, wo das Unternehmen Splitgerber & Daum in seiner Hochzeit in den 1760er Jahren um die 400 Arbeiter beschäftigte, konnte mit der traditionellen Waffenproduktion in Suhl, Zella und Mehlis in Kursachsen sowie Solingen und Essen im Herzogtum Berg nicht mithalten. 26 Selbst staatliche Versuche, von bestehenden erfolgreichen Industrien zu profitieren, blieben ohne Erfolg. Vom späten 16. bis ins 19. Jahrhundert war der Thüringer Wald eine von Europas führenden Glasregionen, aber einige der von Territorialregierungen im späten 17. und 18. Jahrhundert dort gegründeten Glashütten scheiterten mangels ausreichendem Nachschub an Brennmaterial. 27 Die kameralistischen Theorien ließen sich nur selten effektiv in die Praxis umsetzen, was in gewisser Weise auch zeigt, wie eingeschränkt Regierungen in ihrem Handeln durch das politisch-soziale System waren, von dem sie abhingen, insbesondere den Körperschaften, deren politische Unterstützung sie benötigten. Ihre Einstellung zu den Gilden und ihren restriktiven Praktiken war daher ambivalent. Sie zielten eher darauf ab, sie zu regulieren (meist als Reaktion auf Missbrauchsbeschwerden anderer Körperschaften) als sie abzuschaffen. Ebenso zeigt die Praxis der Vergabe von Monopolen und die Förderung der Gründung neuer Gilden und Handelskompanien den Willen, den Wettbewerb zu beschränken und das Auskommen jener zu sichern, die Steuern zahlten und die Regierung politisch unterstützten. 28 In Württemberg beispielsweise war die florierende Kammgarnindustrie, die sich seit den 1560er Jahren im ländlichen Raum entwickelt hatte, vollständig in den Händen von Gilden. Innerhalb von fünfzig Jahren hatten sich die Weber in Distriktnetzwerken organisiert und ersuchten bei der Regierung erfolgreich um Gildenprivilegien. 29 Gleichzeitig begannen sich auch die Händler, die ihre Produkte auf den Markt brachten, zu organisieren und gründeten 1650 die Calwer Zeughandelscompagnie mit offizieller Charta und Privilegien. Sie regulierte Preise, stellte Meisterbriefe aus, inspizierte Werkstätten und setzte bis 1797 in gemeinsamen Verhandlungen mit den Gilden Kontingente fest. 30 Zu ihren Hochzeiten beschäftigte die Compagnie um die 7.000 Arbeiter in ländlichen Werkstätten. Ähnliche Handelskompanien gab es im Herzogtum Berg und im nördlichen Rheinland, allerdings bei schwächeren Gildestrukturen. In Lennep setzten sich die Händler mit Unterstützung der Regierung gegen die Webergilden durch, und als diese dagegen juristisch vorzugehen versuchten, löste die Administration in
325
326
III. · Die deutschen Territorien um 1648–1760
Düsseldorf sie auf. In Barmen und Elberfeld kontrollierte bereits ab 1527 die Handelskompanie Garnnahrung die Leinenweberei. Es gelang ihr zwar nicht, die Bildung einer Webergilde 1738 zu verhindern, allerdings sorgte sie dafür, dass deren Statuten den Interessen der Händler entgegenkamen. 31 Ein Bericht von 1729 beschreibt Elberfeld als »kleines Amsterdam« und vergleicht die dortigen Händler mit denen in den Niederlanden. Hinter ihrer scheinbaren Modernität steckte indes ein fundamentaler Traditionalismus: Sie standen fest zu Monopolen, von Regierungsseite erteilten Privilegien und deren Unterstützung zur Ausschaltung von Wettbewerb, was letztlich der Industrialisierung im Weg stand. Protoindustrie, die Produktion in ländlichen Gebieten durch Arbeiter, die auch in der Landwirtschaft tätig waren, war die Norm in den meisten deutschen Industrieregionen. Fabriken gab es relativ wenige, noch weniger von Fürsten und Regierungen gegründete. Zudem behinderte das Eingreifen der Regierung durch die Erteilung von Privilegien an Gilden und Handelskompanien die langfristige Entfaltung dieser Industrien. Protoindustrie führte nicht zwangsläufig zur Bildung von Industrie, wie man einst glaubte. 32 Dennoch spielte Protoindustrie in der Epoche des Wiederaufbaus und beginnenden neuen Wachstums bis 1750 in vielerlei Weise eine entscheidende Rolle, indem sie Tausenden Gemeinden den Lebensunterhalt sicherte und oft für beträchtlichen Wohlstand und sogar Reichtum sorgte. Zudem passte sie sich der Entwicklung neuer Techniken an, soweit diese allgemein angenommen wurden. Aber der korporative Rahmen, in dem sie wirkte, behinderte Veränderungen und sicherte die Rechte und das Einkommen jener, die den Körperschaften angehörten. Das territoriale System im Reich war ein grundsätzlicher Feind der Marktkräfte. Dies konnte sich nachteilig auswirken, als Mitte des 18. Jahrhunderts neues Bevölkerungswachstum einsetzte und die Konkurrenz der frühen britischen Fabrikindustrie spürbar wurde. Die Bedeutung dieser Einschränkungen unterstreicht der schon im Jahrhundert vor 1750 vergleichsweise größere Erfolg von Unternehmen und Regionen ohne Gilden, Handelskompanien und Regierungsunterstützung. Dies wirft auch ein Licht auf die Frage nach der Beziehung zwischen Religion und Wirtschaft. Die dynamischste Region war nicht von ungefähr das nördliche Rheinland, vor allem das Territorium der Herzogtümer Jülich, Berg und Kleve mit den Grafschaften Mark und Ravensberg, bis 1614 ein Territorialverbund, der dann von der Pfalz (Jülich und Berg) beziehungsweise Brandenburg (Kleve, Mark und Ravensberg) regiert wurde. Unter abwechselnd irenischen und schwachen Herzögen waren die Territorien vor 1614 eine Mischung aus katholischen, lutherischen und calvinistischen Gemeinden mit einer beträchtlichen Anzahl von Mennonitengruppen – wie viele Lutheraner und Calvinisten ursprünglich niederländische Flüchtlinge der 1560er Jahre. In Jülich und Berg begünstigten nach 1648 die Einschränkungen
33. Öffentliche und private Unternehmen
der herzoglichen Politik durch die Territorialstände und nach 1716 der Umzug des Herrschers nach Mannheim ihre Entwicklung. Dass die Regierung in Berlin ihre westlichen Provinzen als »Ausland« betrachtete, sorgte in Kleve, Mark und Ravensberg dafür, dass es nicht wie in Brandenburg und anderen Mitte- und Ostprovinzen zur Auferlegung merkantilistischer Strukturen kam. Das nördliche Rheinland profitierte insgesamt von »freundlicher Vernachlässigung«. 33 Entscheidend waren auch lokale Faktoren. Der Druck intoleranter lokaler politischer Eliten, restriktiver Gilden und örtlicher Unterherren, die gewillt waren, Privilegien zu verleihen, verbunden mit losen oder nicht vorhandenen Gildestrukturen und schwachen Gemeinden, ließ einige der dynamischsten und produktivsten Wirtschaftszentren entstehen. 34 Die Rekatholisierung von Aachen und die Restauration des alten Gildesystems 1614 beendete eine Zeit dynamischen Wachstums der Wirtschaft in der Stadt. Die Protestanten verlegten daraufhin ihre Geschäfte an andere Orte: nach Stolberg in Jülich, wo bis Mitte des 18. Jahrhunderts Europas wichtigste Messingindustrie angesiedelt war, und in die neuen Textilzentren Monschau (ebenfalls in Jülich) und Burtscheid (ein winziges, von einer Äbtissin regiertes Territorium). 35 Alle drei neuen Zentren boten Vorteile, die ab dem späten 15. Jahrhundert für die Entstehung wichtiger Handwerksbetriebe und Teile von Produktionsprozessen geführt hatten, entscheidend war jedoch der Zuzug der wichtigsten Unternehmerfamilien nach 1614. Auf ähnliche Weise führte die Vertreibung der Mennoniten aus Gladbach (1654) und Rheydt (1694) in Jülich dazu, dass sich Krefeld (in der bis 1702 vom Haus Oranien und danach von Brandenburg-Preußen regierten Grafschaft Moers) als Zentrum der Produktion und des Handels von Leinen etablieren konnte. Wegen der Ausweisung von Mennoniten aus Radevormwald 1656 ging Adolf von der Leyen, der Begründer der Seidenindustrie, nach Krefeld, das dadurch im 18. Jahrhundert zum europäischen Marktführer wurde. 36 Die Einführung strenger Restriktionen für protestantische Kaufleute in der Reichsstadt Köln nach jahrzehntelangen heftigen Beschwerden von katholischen Händlern führte zum gruppenweise erfolgenden Wegzug nach Mülheim am Rhein, Barmen und Elberfeld im Herzogtum Berg. 37 Der Kontrast zwischen protestantischem Unternehmergeist und katholischer Intoleranz scheint augenfällig. Die großen Kirchenterritorien Köln und Münster lagen in ihrer Entwicklung hinter Jülich und Berg zurück. Es gab auch in Münster Textilweber, aber kaum Kaufleute und Vertreter. In (der Reichsstadt) Köln gab es katholische Händler, die jedoch durch die Vertreibung ihrer protestantischen Rivalen und damit auch deren Handelsverbindungen in die Niederlande ihren eigenen Erfolg untergruben. 38 Aber der scheinbare Zusammenhang zwischen Religion und Unternehmertum führt in die Irre und die enge Verbindung zwischen Calvinismus und Unternehmer-
327
328
III. · Die deutschen Territorien um 1648–1760
geist, die Max Weber suggerierte und Peter Hersche in jüngerer Zeit näher ausführte, hat es so mit Sicherheit nicht gegeben. 39 Herrscher von Jülich und Berg war der katholische Kurfürst der Pfalz. Lutherische Gilden und calvinistische Stadtmagistraten zeigten sich oft ebenso intolerant gegeneinander und gegenüber anderen Minderheiten wie Katholiken. Die einzige durchgehend unternehmerische Gruppe waren die Mennoniten, eine Glaubensgemeinschaft von Wiedertäufern, die ab den 1540er Jahren in Deutschland und den Niederlanden verfolgt wurde, nirgendwo politische Autorität erlangte und 1648 keine Rechte zugesprochen bekam. Wichtiger war indes, dass diese Gruppen aus den wirtschaftlich am weitesten fortgeschrittenen Gegenden Europas im 16. Jahrhundert stammten. Von der politischen Macht ausgeschlossen, verlegten sie sich zwangsläufig auf ökonomische Aktivitäten und ließen sich dabei über Jahrzehnte von den Niederlanden inspirieren, mit denen sie handelten und konkurrierten. Die Krefelder Seidenhändler Friedrich und Heinrich von der Leyen berieten 1767 eine preußische Kommission zur Förderung von Produktion und Handel, und was die Kommission daraufhin auf Grundlage von Theorien vorschlug, praktizierten die von der Leyens bereits seit Langem; über viele Jahre hatten sie ihre Techniken von den Niederländern erlernt, die sie schließlich überholten und damit die niederländische Seidenverarbeitungsindustrie so gut wie zerstörten. 40 1768 betrieben sie in Krefeld und seiner weiteren Umgebung zwei Färbereien und 724 Maschinen verschiedenster Art mit mehr als 3.000 Beschäftigten (die Kinder nicht mitgerechnet, die oft in Teilzeit an den Webstühlen arbeiteten). 41 Die von der Leyens waren typische mennonitische Unternehmer, aber auch den erfolgreichen lutherischen und calvinistischen Unternehmern des nördlichen Rheinlands und den Calvinisten in der lutherischen Reichsstadt Frankfurt am Main nicht unähnlich. 42 Die höchst rührigen Monschauer Wollwarenhändler etwa waren allesamt Lutheraner und von der Politik ausgeschlossen, da nur Katholiken in den Stadtrat gewählt werden durften, aber durch Privilegien des Herrschers geschützt, und profitierten davon, dass es keine Gilden gab. 43 Bis 1765 baute der erfolgreichste von ihnen, Johann Heinrich Scheibler, einen Konzern mit mehr als 4.000 Arbeitern auf; seine beiden Söhne beschäftigten noch einmal 2.000. Der wirtschaftliche Erfolg dieser Gruppen hatte mit ihrer Herkunft und ihren Kontakten in die Niederlande zu tun, mit ihrem Status als Minderheit und einem starken Familiennetzwerk. Zudem suchten sie sich absichtlich Standorte aus, an denen es nur schwache oder gar keine Gilden gab. Da die Mennoniten von einer politischen Partizipation ausgeschlossen waren, gerieten sie auch nicht in die Spannungen zwischen Territorialständen und Regierungen. Ihre Stellung sicherten sie durch Vereinbarungen mit Territorialherrschern; so erhielt etwa die Krefelder Mennonitengemeinde 1738 ein offizielles
33. Öffentliche und private Unternehmen
Privileg von Friedrich Wilhelm I. von Preußen. »Die Mennoniten«, äußerte der König, »wollen zwar nicht in den Krieg gehen, ich muss aber auch Leute haben, die mir Geld schaffen.« 44 Im Gegensatz zur staatlichen geförderten Seidenindustrie in Berlin, deren Geschichte mit spektakulären Bankrotten gespickt ist, erzielten die Krefelder Hersteller nach und nach immer größere Erfolge; um 1750 versorgten sie ganz Europa. Deutsche Territorialregierungen hatten weder den Willen noch die Macht, ernsthafte ökonomische Innovationen durchzusetzen. Es ging ihnen in erster Linie um die Erhöhung ihrer eigenen Einkünfte und weniger um die Wirtschaft als solche. Gleichzeitig waren die Herrscher von Körperschaften abhängig, die Steuern zahlten und sie politisch unterstützten und deren fest verwurzelten Privilegien und Forderungen nach weiteren Vorrechten sie sich nicht widersetzen konnten. Der Kameralismus mag in bescheidenem Umfang zum Wiederaufbau beigetragen haben, wichtiger waren letztlich aber andere Faktoren: neues Bevölkerungswachstum, das die Binnennachfrage wiederbelebte, die anhaltende Viabilität des traditionellen Handwerks und die Beharrlichkeit derer, die dort arbeiteten und die Produkte auf den Markt brachten. Echte Neuerungen kamen nicht von Regierungen, sondern von Minderheiten, denen es gelang, gildefreie Zonen zu besetzen, um neue Methoden und Produkte für den einheimischen Markt und den Export zu entwickeln. Wenn es in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts ein »Wirtschaftswunder« der deutschen Fürsten und Adligen gab, bezahlte dafür das Volk mit einer wachsenden Steuerlast und nicht die Unternehmerschaft, die am meisten davon profitierte. 45
Anmerkungen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14
Heitz, »Folgen«, 342 f.; Forberger, »Crafft«. HbDSWG, 548 f. Hersche, Muße, 490–666. HBayG II, 710–713. Hersche, Muße, 445. Ebd., 442–448. Härter und Stolleis, Repertorium I, 603 f., und Härter, »Gesetzgebung«, 92, bestätigen die Verallgemeinerung für Trier und Mainz. Hersche, Muße, 461 f. Die folgenden Informationen entstammen dem kurzen allgemeinen Überblick mit detaillierter Zusammenfassung für das Fürstbistum Augsburg in Wüst, Augsburg, 356–370. Hersche, Muße, 479 f.; Reininghaus, Gewerbe, 29 ff.; Wüst, Augsburg, 362. Vgl. zum Folgenden: Walter, Kempten, 87–90, 147–210. 12 Ebd., 79 f. Ein nützliches Verzeichnis von Fehlschlägen findet sich in Wakefield, Police State. Jersch-Wenzel, Juden und »Franzosen«, 80 f.; ähnliche Erfahrungen machte die Markgrafschaft Brandenburg-Ansbach, wo z. B. 1696 fünfundzwanzig bis dreißig Familien in der
329
330
III. · Die deutschen Territorien um 1648–1760
15 16 18 19 20
21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
38 39 40 41 42 43 45
Teppichherstellung tätig waren, 1716 jedoch nur noch sieben Personen; vgl. Blaufuß, »Hugenotteneinwanderung«, 14 f. Jersch-Wenzel, Juden und »Franzosen«, 87. Braunfels, Kunst I, 117; Zückert, »Barockbau«, 460 f. 17 Ebd., 459. Ebd., 451 ff.; Braunfels, Kunst I, 313 f. Zückert, »Barockbau«, 460. Ebd., 459; Roeck, »Baukunst«, Gömmel, »Probleme«, und andere Aufsätze im selben Band bewerten die Auswirkungen der Bauwirtschaft ebenso wie Hersche, Muße, 371–375, positiver, bleiben aber ebenfalls zurückhaltend. Zückert, Grundlagen, liefert mehr Beispiele und Details. Bauer, Hofökonomie, 52 f. Müller, »Düsseldorf«, 86 f.; bis 1722 gingen die Einnahmen der Stadt um 22 Prozent zurück. Vgl. zum Folgenden Bauer, Hofökonomie, 46–70. Müller, Fürstenhof, 59 ff.; Reininghaus, Gewerbe, 43 ff. Ducret, Porcelain, 18–22; Gleeson, Arcanum, 126–165. Wilson, Reich, 270 f.; Kaufhold, »Gewerbelandschaften«, 131 ff., 159 f., 163; die Produktion in Solingen und Essen war um 1800 abgeflaut; Suhl, Mehlis und Zella lagen in der Grafschaft Henneberg, die nach dem Tod des letzten Grafen von den Ernestinen und Kursachsen gemeinsam verwaltet wurde, 1660 an Kursachsen fiel, zum Teil in das neue Territorium Sachsen-Zeitz einverleibt wurde und 1718 nach dem Tod des letzten Herzogs von Zeitz in das Kurfürstentum Sachsen integriert wurde; vgl. Köbler, Lexikon, 267, 602; Zedler, Universal-Lexicon LXI, 937 ff. Kaufhold, »Gewerbelandschaften«, 131 f. Ogilvie, »Industrialisation«, 292 f.; Volckart, Wettbewerb, 136–179. Ogilvie, »Institutions«, 225, 233 f. Ebd., 234; Ogilvie, State Corporatism, 77 ff., 86–112, 378–383. Lehmann, »Herausbildung«, 414. Ogilvie, »Institutions«, 221–226, 248 ff. Müller, »Kurfürst Johann Wilhelm«, 1–6; Kisch, »Mercantilism«, 385. Kisch bezieht sich auf Jülich-Berg, seine Schlüsse gelten jedoch auch für Kleve-Mark. Nagel, »Standortkonkurrenz«, 168–172. Schilling, »Innovation«, 25–30; Kaufhold, »Gewerbelandschaften«, 150–153; Braunfels, Kunst III, 418 ff. Kaufhold, »Gewerbelandschaften«, 153 f.; Kriedte, »Aufstieg«, 88–92; Kisch, »Mercantilism«, 15–27. Schwering, »Entwickelung«, 16–42, und Schwering, »Auswanderung«; Kisch, »Monopoly«, 351 und passim. 1929 wurden Barmen und Elberfeld mit anderen angrenzenden Siedlungen zur Stadt Wuppertal zusammengelegt. Engelbrecht, »Unternehmer«, 431 f. Hersche, Muße, 94–111, 442–489. Kriedte, »Aufstieg«, 87. Kisch, »Mercantilism«, 25. Schilling, »Innovation«, 20–25. Barkhausen, »Aufstieg«, 152–160. 44 Kriedte, »Aufstieg«, 89. Dreitzel, Absolutismus, 15; Schwennicke, Steuer, 289–296; Bauer, Hofökonomie, 55 ff.; Wilson, Reich, 254–258.
34. Christliche Staatsorganisation: Der barocke Katholizismus
1734
bezeichnete Johann Jacob Moser das gegenseitige Misstrauen der christlichen Konfessionen als »die Pest des Teutschen Reiches« und noch in den 1750er Jahren machte er dafür in erster Linie den Fanatismus der Katholiken verantwortlich. 1 Für deutsche Regierungen indes blieb auch nach 1648 die Überzeugung grundlegend, die christliche Religion sei die einzige tragfähige Bindung der menschlichen Gesellschaft (religio vinculum societatis). Dietrich Reinkingk erklärte 1653 in seiner Biblischen Policey, »Das Gesetzbuch Gottes und dessen Observantz / ist die beste Ratio Status / oder Versicherung des Staats.« 2 Dieser Sicht schloss sich so gut wie jeder Autor, egal welchen Glaubens, im folgenden Jahrhundert an. Selbst Thomasius, der oft als einer der ersten Fürsprecher eines der Religion übergeordneten weltlichen Staats dargestellt wird, betonte die Bedeutung stabiler christlicher Institutionen, stellte jedoch das Recht des Klerus infrage, weltlichen Autoritäten Befehle zu erteilen. 3 Der Westfälische Friede sollte den Konflikt der Konfessionen beenden, er schuf aber auch einen Rahmen, der die Entstehung christlicher politischer Ordnungen zuließ. In vielen Gegenden machte die Stabilisation nun zum ersten Mal eine Konfessionalisierung möglich. Die Art und Weise, wie dies geschah, und die dauernden Verhandlungen über den Status bestimmter Territorien, Bezirke und Orte führten zu weiteren konfessionellen Spannungen, die das politische Leben im Reich bis ins 18. Jahrhundert belasteten. Der Konflikt im Reich war letztlich eine politische Auseinandersetzung über das Gleichgewicht der Kräfte zwischen Kaiser und Ständen, aber geprägt von religiösen Zwischentönen. Die katholischen Kaiser betrieben in ihren eigenen Ländern einen unbeirrbaren Konfessionalismus; die Aura ihrer Höfe erklärt zumindest einen Teil der Übertritte protestantischer Fürsten zum Katholizismus, und dass sie sich im Reichstag eine katholische Klientel kirchlicher und weltlicher Herrscher heranzogen, gab den überwiegend protestantischen fürstlichen Familien das Gefühl, an den Rand gedrängt zu werden. 4 Mosers Deutung der Ursache dieses Zustands spiegelt natürlich seinen eigenen protestantischen Glauben und seine Loyalität wider. Tatsächlich erlebten Katholizismus und Protestantismus in dieser Zeit einen Aufschwung; die Entwicklung im katholischen Deutschland mag kontroverser erscheinen, sie muss jedoch vor dem Hintergrund der Entwicklung beider Konfessionen nach 1648 betrachtet werden. Nichts ließ die Wut der Protestanten im Reich so hochkochen wie Nachrichten
332
III. · Die deutschen Territorien um 1648–1760
aus den habsburgischen Ländern über die bedrängte Lage ihrer Glaubensbrüder. 5 Selbst Moser, der im Herzen Loyalist und grundsätzlich vom Anrecht der Habsburger auf die Kaiserkrone überzeugt war, ließ sich dazu hinreißen, sie zu kritisieren, weil sie im Umgang mit dem Protestantismus in ihren eigenen Territorien so wenig Mäßigung zeigten. 6 Dies war ein wesentliches Merkmal der habsburgischen Politik vom späten 16. Jahrhundert bis zu den Toleranzpatenten Josephs II. von 1781/82. 7 Nirgends war politische Loyalität so augenfällig mit dem Katholizismus verbunden und nirgends wurde diese Gleichsetzung so kompromisslos umgesetzt wie in den habsburgischen Ländern. Die trostlose Wahrheit über die habsburgische Rekatholisierung erfuhren Protestanten im Reich immer wieder von Flüchtlingen. Schätzungen zu deren Zahlen sind nicht sehr verlässlich; sie enthalten oft auch Todesopfer aus dem Dreißigjährigen Krieg und beruhen nicht selten auf Schätzungen der Zahlen männlicher Flüchtlinge, die dann auf »durchschnittliche« Familien hochgerechnet werden.Vor, während und nach dem Krieg waren viele Flüchtlinge, ob protestantisch oder nicht, eher Wirtschaftsmigranten auf der Suche nach besseren Gegebenheiten. Dass viele behaupteten, Verfolgte zu sein, um bevorzugt behandelt und von protestantischen Herrschern bei der Vergabe von Ansiedelungsrechten begünstigt zu werden, trug indes noch zum Eindruck grausamer Verfolgung bei, der bei so vielen deutschen Protestanten Mitleid erregte. 8 Der größte Teil der Auswanderungen fiel in die Zeit vor 1660: etwa 100.000 Nieder- und Oberösterreicher zwischen 1598 und 1660, einige Zehntausende allein zwischen 1647 und 1653, gut 150.000 aus Böhmen bis 1650, etwa 200.000 aus Schlesien von 1618 bis 1670 – umgerechnet etwa ein Fünftel der gesamten Vorkriegsbevölkerung. 9 Aber auch danach hielt der Flüchtlingsstrom bis ins 18. Jahrhundert an, nicht quantifizierbar, aber hie und da gut dokumentiert und ständig in protestantischen Pamphleten und Zeitungen publiziert. Die Politik, die die Migrationen auslöste, war in allen habsburgischen Ländern weitgehend die gleiche.10 In den 1620er Jahren wurde Oberösterreich im Namen des Kaisers von den Streitkräften des bayerischen Kurfürsten rekatholisiert. 1624 wurden alle protestantischen Priester und Lehrer ausgewiesen; im Jahr darauf wies man sämtliche Protestanten an, zum Katholizismus zu konvertieren oder nach Bezahlung einer Steuer von zehn Prozent ihres Vermögens ihre Heimat zu verlassen. Bleiben durften nur adlige Familien, die seit mindestens fünfzig Jahren ansässig waren und ihre Religion nicht ausübten. In Niederösterreich griff man zwischen 1627 und 1631 zu den gleichen Maßnahmen, da aber der niederösterreichische Adel Ferdinand II. seine Huldigung erwiesen hatte (was die Oberösterreicher verweigerten), wurden die religiösen Rechte der »Grafen, Barone und Adeligen« von Niederösterreich 1648 garantiert (IPO § 39). In Innerösterreich allerdings, wo die Autorität des Kaisers außer Frage stand, wurden zwischen 1625 und 1628 drakonische Gesetze gegen den Protestantismus eingeführt.
34. Christliche Staatsorganisation: Der barocke Katholizismus
In Böhmen und der Grafschaft Glatz war die Rekatholisierung ein wesentlicher Bestandteil der Wiederherstellung der habsburgischen Herrschaft nach der Schlacht am Weißen Berg 1620. 11 Dort gipfelte die Ausrottung des rebellischen Adels und die Übertragung seiner Länder an Anhänger der Habsburger und Jesuiten in der Verneuerten Landesordnung von 1627, mit der der Katholizismus Staatsreligion wurde. Für die Masse der Bauern bedeutete das bittere Fronarbeit, die in den folgenden Jahrzehnten viele über die Grenzen nach Sachsen, Brandenburg und Nordfranken trieb. Die brutale Niederschlagung eines allgemeinen Bauernaufstands 1679/80 verstärkte den Druck noch einmal und es kam weiterhin zu Auswanderungswellen, hauptsächlich nach Sachsen, aber auch nach Schlesien und nach 1700 nach Brandenburg. 12 Vom Westfälischen Frieden blieben diese breiten religiös-politischen Kampagnen unberührt. Mit Ausnahme des niederösterreichischen Adels gelang es dem Kaiser größtenteils, seine Länder und Untertanen von den Regelungen des Abkommens auszunehmen. In zweierlei Hinsicht indes hatten die Habsburger nicht gänzlich freie Hand. Der Friedensvertrag gestand den meisten Untertanen der Habsburger keine Rechte zu, erwirkte aber eine Art Schutzpflicht für die deutschen Protestanten: Der König von Schweden und die protestantischen Reichsstände behielten sich vor, beim Kaiser zugunsten einer großzügigeren Behandlung seiner protestantischen Untertanen zu intervenieren. Noch direkter involviert waren die protestantischen Stände in die religiösen Belange Schlesiens, wo die Habsburger an ausdrückliche Vorschriften des Friedensvertrags gebunden waren. 13 Der vom sächsischen Kurfürsten vermittelte Dresdner Akkord von 1621, in dem sich die schlesischen Stände bereit erklärten, ihren Eid auf Ferdinand II. zu erneuern und ihm im Gegenzug für eine Generalamnestie 300.000 Gulden zu zahlen, schützte Schlesien vor Vergeltungsmaßnahmen. Das Territorium unterschied sich auch strukturell, da es ein Lehen des Königreichs Böhmen war und aus einer Reihe von Fürsten- und Herzogtümern bestand, von denen einige in den Händen einheimischer (und protestantischer) Dynastien blieben, die durch eine Vielzahl von Ehen mit den protestantischen Fürstenfamilien des Reichs verbunden waren. 1648 ergab sich aus dieser Kombination von rechtlichem Sonderstatus und externen Familienallianzen eine Reihe spezieller, von der schwedischen Krone und den protestantischen Reichsständen ausgehandelter Vorschriften. Die Grafen von Brieg, Liegnitz und Münsterberg-Oels sowie ihre Untertanen und die Stadt Breslau genossen in ihren eigenen Territorien Religionsfreiheit. Zudem sollten Lutheraner (aber nicht Calvinisten) in anderen Teilen Schlesiens ihren Gottesdienst in drei neuen Kirchen verrichten dürfen, die sie auf eigene Kosten erbauen sollten. Der Bau dieser »Friedenskirchen« begann bald nach dem Rückzug der schwedischen Truppen 1650. Aus dem ganzen Reich flossen Spenden von Protestanten,
333
334
III. · Die deutschen Territorien um 1648–1760
mit denen drei riesige Gebäude errichtet wurden, in reichstem Barockstil geschmückt, mit hohen Altaren, prachtvollen Kanzeln und später auch Orgeln. Die größte der Kirchen war die in Schweidnitz mit 3.000 Sitz- und 4.500 Stehplätzen; in die Kirche in Jauer passten 6.000 Gläubige. Die Habsburger, die den Baugrund zur Verfügung gestellt und den Bau betreut hatten, entsandten indes zugleich eine »Reduktionskommission«, die fast 700 protestantische Kirchen schloss und gut 500 Priester auswies. Wie in Böhmen gingen Titel und Ländereien an loyalistische Adlige aus den Erblanden wie die Dynastien Auersperg, Liechtenstein und Lobkowitz beziehungsweise an Jesuiten und Kirchenstifte. 14 Erledigte Lehen wie Brieg, Liegnitz und Wohlau (nach dem Erlöschen der Piastendynastie 1675) fielen an die Krone zurück. Begünstigt wurden auch einheimische Landeigentümer, etwa die Familien Dohna und Schaffgotsch, die katholisch geblieben oder konvertiert waren. Nach 1675 blieb nur das Herzogtum Oels protestantisch. Sein Herrscher, Sylvius Nimrod von Württemberg-Weitlingen, hatte die Tochter des letzten heimischen Herzogs geheiratet und die Erlaubnis erhalten, nach dessen Tod 1647 eine neue Dynastie zu begründen. 15 Der kumulative Effekt der habsburgischen Politik war wachsender Druck auf die schlesischen Protestanten. Leopold I. lehnte ein gewalttätiges Vorgehen ab und schien bestrebt, die negativen wirtschaftlichen Auswirkungen der Verfolgung zu begrenzen. Als der Grüssauer Abt Bernhard Rosa im Herzogtum Schweidnitz-Jauer 1687 beinahe tausend Protestanten aus ihrer Heimat in seinen Ländereien vertrieb, handelte er sich eine schwere Rüge ein. Er wollte sogar verstorbene protestantische Mitglieder der Familie Schaffgotsch exhumieren lassen – ein Affront gegen den Regenten der Habsburger in Schweidnitz-Jauer, der Leopold erzürnte. 16 Ungeachtet dessen trieb der Kaiser selbst die Verfolgung von Protestanten in Oberschlesien voran und so weitete sich die offizielle Diskriminierung stetig aus. Der Zugang zu den verbliebenen protestantischen Kirchen war Gegenstand dauernder Auseinandersetzungen; neue Vormundschaftsgesetze schrieben vor, alle Waisen katholisch zu erziehen, Mischehen wurden verboten, der Übertritt zum Protestantismus als crimen apostasiae betrachtet. All dies hatte zweierlei Auswirkungen. Zum einen erfreuten sich die in Gegenden wie Oels verbliebenen etwa hundert protestantischen Kirchen großen Zuspruchs und in den Nachbarländern Polen, Brandenburg (im vormals schlesischen Crossen) und der sächsischen Lausitz wurden Grenzkirchen errichtet. Die Reise zu den Sonntagsgottesdiensten – für die manche drei Tage brauchten – entwickelte sich zu einer Art Massendemonstration und protestantischen Wallfahrt. Zudem siedelten sich Vertriebene und Emigranten oft in grenznahen schlesischen Gemeinden an, die von ebenfalls ausgewiesenen Priestern und Lehrern betreut wurden. Zweitens machte die unermüdliche Propaganda vieler Flüchtlinge (die sich gern als »arme Fremde und wegen unseres Glaubens Verfolgte« bezeichneten)
34. Christliche Staatsorganisation: Der barocke Katholizismus
den Regierungen von Sachsen und Brandenburg sowie Protestanten im gesamten Reich die Zustände in Schlesien schmerzhaft bewusst. 17 Da es ein Lehen der böhmischen Krone war, gehörten schlesische Stände nicht dem Reichstag an und 1653/54 versuchte die Krone, Schlesier auch als Beobachter nicht mehr zu den Sitzungen zuzulassen. Einige waren dennoch anwesend und ab 1663 hatten die protestantischen Vertreter im Immerwährenden Reichstag andauernd mit der schlesischen Frage zu tun. Zwischen 1663 und 1750 machte das Corpus Evangelicorum bei 154 Anlässen von seinem Recht Gebrauch, zugunsten der schlesischen Protestanten beim Kaiser zu intervenieren; bis 1714 wurden vierunddreißig Gravamina (Listen mit Beschwerden und Klagen) publiziert, begleitet von kommentierenden Pamphleten und Zeitungsartikeln. 18 Den deutschen Fürsten blieb nicht viel anderes übrig, als Fürsprache einzulegen. Sie brauchten den guten Willen des Kaisers für ihre eigenen politischen und dynastischen Ambitionen. Zudem hegte der Klerus von Sachsen, dessen Herrscher an der Spitze des Corpus Evangelicorum stand, ein gewisses Misstrauen gegenüber den radikalen Tendenzen, die man unter den schlesischen und böhmischen Flüchtlingsgemeinden feststellte. Der Übertritt des Kurfürsten zum Katholizismus 1697 machte die Dinge noch komplizierter; als König von Polen zeigte er sich aus ökonomischen und bevölkerungspolitischen Gründen jedoch gern bereit, wie schon als Kurfürst von Sachsen schlesischen und böhmischen Emigranten Zuflucht zu gewähren. Die Kurfürsten von Hannover und Brandenburg, die sich zu Wortführern der protestantischen Sache aufschwangen, waren ebenso eingeschränkt. Anders Schweden als eine der Garantiemächte des Westfälischen Friedens, und Karl XII. nutzte 1707 nach dem Sieg über Sachsen die Gelegenheit, dem Kaiser in Altranstädt Zugeständnisse abzuringen. 19 Joseph I. sagte die Rückgabe von 125 seit 1648 konfiszierten Kirchen und die Einrichtung lutherischer Kirchenräte in Liegnitz, Brieg und Wohlau zu. Als »Gnadenakt« gestattete er zudem sechs neue Kirchen, darunter eine im südlichen Teschen – die erste protestantische Kirche in Oberschlesien seit 1660. Wie im Fall der »Friedenskirchen« mussten die »Gnadenkirchen« außerhalb der Stadtmauern errichtet werden; erbaut wurden sie wie ihre katholischen Gegenstücke in feinstem Barockstil, diesmal drei davon (Hirschberg, Landeshut und Teschen) aus Stein. Obwohl die katholische Bevölkerung in Schlesien wuchs, überlebten lutherische und andere protestantische Gemeinden. Einige wollten lieber konvertieren als wegziehen, andere besuchten einfach weiterhin die territorialen und außerterritorialen Kirchen, die es noch gab, oder praktizierten ihre Religion im Geheimen. Diskriminierung und Verfolgung radikalisierten die Übriggebliebenen, die ohne disziplinierenden Einfluss kirchlicher Strukturen und meist oft auch ohne ausgebildete Kleriker eigentümliche Formen des Glaubens und Gottesdienstes ent-
335
336
III. · Die deutschen Territorien um 1648–1760
wickelten. 20 Wie in Böhmen und den österreichischen Erblanden erwies es sich in Schlesien als unmöglich, den Protestantismus ganz auszurotten. In beiden Territorien überlebten Sekten wie die Hussiten, Israeliten und Adamiten bis ins 18. Jahrhundert. 21 In Ober- und Niederösterreich sowie in der Steiermark gelang es mehr als fünfzig Gemeinden mit insgesamt vielleicht 100.000 Mitgliedern, sich unter den Toleranzedikten Josephs II. von 1781/82 als Gruppen mit hundert oder mehr Familien als anerkannte Konfessionsgemeinschaften zu konstituieren. 22 Das katastrophale Scheitern der Versuche Salzburgs und Berchtesgadens, konfessionelle Konformität zu erzwingen, führte dazu, dass die Habsburger das Problem ab den 1730er Jahren anders angingen, um einheimische Arbeitskräfte im Land zu halten und negative Berichterstattung in anderen Territorien zu vermeiden. Salzburg wollte das »deutsche Rom« werden. Die Erzbischöfe waren Fürsten des Reichs, seit 1529 Primates von Deutschland, Vorstände einer Erzdiözese, die vier Subsidiarbistümer umfasste, deren Bischöfe sie ernannten, und Metropoliten einer Kirchenprovinz, die sich östlich bis Wien erstreckte, im Norden die Diözese Regensburg und im Westen ganz Bayern mit seinen Bistümern einschloss. 23 Daher rührten ihr Prestige und ihre Autorität, aber auch die Furcht, von den weltlichen Herrschern von Bayern und Österreich erdrückt zu werden, die danach strebten, die Bistümer ihrer Länder in ihre Gewalt zu bekommen. Deshalb hatte sich etwa Salzburg im späten 16. Jahrhundert für die Benediktiner als hauptsächlichen Reformorden entschieden (und beheimatete ab 1622 die einzige benediktinische Universität im Reich) und nicht für die Jesuiten, die in Bayern und Wien vorherrschten. 24 Dennoch nahm der österreichische Einfluss im Erzbistum ab 1650 deutlich zu, da böhmische und österreichische Adlige nun das zuvor mit einer Mischung aus Tirolern, Österreichern, Schwaben und Bayern besetzte Domkapitel dominierten. Ab dieser Zeit kamen die Erzbischöfe selbst meist aus der Elite der Habsburger. 25 Von den frühen 1670er Jahren an wurde versucht, die saisonale Migration von Arbeitern nach Sachsen und Württemberg zu kontrollieren und insbesondere sicherzustellen, dass sie keine protestantische Literatur mit zurückbrachten. 26 Unter Erzbischof Ernst von Thun (1687–1709) durften Saisonarbeiter nur in anderen katholischen Territorien arbeiten, mussten sich dort Bescheinigungen ausstellen lassen und diese bei ihrer Rückkehr den Salzburger Behörden vorlegen. Proteste der Minenarbeiter aus dem Deferegger Tal gegen die unbarmherzige Überwachung führten zur Ausweisung von 600 Männern. Ihre Kinder wurden in Salzburg festgehalten und ihnen erst 1691 nach dem Einschreiten des Corpus Evangelicorum in Regensburg zurückgegeben. Der benachbarte Fürstpropst von Berchtesgaden begann nun ebenfalls nach heimlichen Protestanten zu fahnden. Die Berchtesgadener Behörden versuchten Emigration zu verhindern, indem sie alle Bergarbeiter zu Leibeigenen erklärten, andererseits verwiesen sie zwischen 1686 und 1691 den Minenarbeiter und Laien-
34. Christliche Staatsorganisation: Der barocke Katholizismus
prediger Joseph Schaitberger (* 1658, † 1733) und siebzig Beschäftigte der fürstpröpstlichen Salzminen des Landes. 27 Schaitberger wurde als Autor zahlreicher Erbauungsbücher berühmt, was den Protestanten von Berchtesgaden und Salzburg ein echtes Gefühl von Solidarität und Bestimmung gab. 28 Die Angelegenheit spitzte sich zu, als Erzbischof Leopold Anton Freiherr von Firmian (1727–1744) gegen den Willen seines Domkapitels und der Benediktiner an der Universität eine jesuitische Gesandtschaft beauftragte, die Häretiker ein für alle Mal auszurotten. 29 Der Appell der Pongauer Protestanten an das Corpus Evangelicorum in Regensburg hatte ihre Massenausweisung und sofortige Rettung durch den Kurfürsten von Brandenburg zur Folge, unterstützt von Spenden aus dem ganzen Reich, den Niederlanden, der Schweiz und England. Auf der langen Reise in ihre neue Heimat in Ostpreußen und Polnisch-Litauen wurden viele von ihnen Augenzeugen der katholischen Verfolgung armer protestantischer Leute, angezettelt und unterstützt vom Kaiser selbst. 30 Während Berchtesgaden eilfertig 700 weitere Protestanten auswies, wollten die Habsburger das Risiko eines Ansehensverlusts, wie ihn Erzbischof Firmian erlitten hatte, lieber nicht eingehen. Die Hexenjagd ging weiter; schon der Besitz eines Buchs oder der Genuss von Fleisch an Fastentagen wurde als Zeichen eines heimlichen Protestantismus gedeutet. 31 Emigration war ausgeschlossen. Für schuldig Befundene brandmarkte man als Ketzer und Rebellen, um einen öffentlichen Aufschrei im Reich zu verhindern; Bücher und Besitz wurden konfisziert, die Flüchtlinge selbst nach Siebenbürgen deportiert. Schon im Juli 1733 beklagte das Corpus Evangelicorum, das Verhalten des Kaisers sei mit dem gesamten System des deutschen Reichs nicht vereinbar. Die »Transmigrationen« wurden dennoch bis 1774 fortgesetzt. 32 Etwa 4.000 Personen waren davon betroffen – für den Einzelnen ein hartes Schicksal, für die Zurückbleibenden ein deutliches Beispiel. Erzwungene Rekatholisierung mit Vertreibungen und Zwangsumsiedelungen war im Jahrhundert nach dem Westfälischen Frieden eine habsburgische Spezialität. Dadurch wurde deutlich, wie schwierig es für die Dynastie war, ihre ausgedehnten und verstreuten Territorien im Griff zu behalten. Ihre ersten Versuche zur Untermauerung der katholischen Orthodoxie vor 1618 litten unter Phasen der Mehrdeutigkeit und konstitutionellen Kompromissen mit verschiedenen adligen Fraktionen; zudem musste man vermeiden, die protestantischen Reichsstände zu verprellen. Nun konnten sie freier handeln. Andere, nicht durch die Anforderungen der Kaiserkrone eingeschränkte katholische Territorien hatten ihre konfessionellen Probleme größtenteils vor 1648 gelöst, so etwa Bayern, das seine protestantische Opposition 1564 niederrang, und Würzburg, wo Julius Echter von Mespelbrunn von 1573 bis 1617 mit Gewalt durchgriff, Köln 1583 bis 1612 unter Ernst von Bayern, Bamberg in den 1590er Jahren unter Neithard von Thüngen, Paderborn unter Dietrich von Fürstenberg
337
338
III. · Die deutschen Territorien um 1648–1760
von 1585 bis 1618, Münster 1612 bis 1650 unter Ferdinand von Bayern. Einer nach dem anderen machten die führenden katholischen weltlichen und kirchlichen Fürsten ihre Autorität wieder geltend. In einigen Landesteilen unterbrach der Krieg den Prozess, in anderen – vor allem den nördlichen Bistümern Münster, Osnabrück, Paderborn und Hildesheim – gab er einer Reihe bayerischer Fürsten und Thronfolgekandidaten die Gelegenheit, Versäumtes nachzuholen. Nach 1648 war das Potenzial für echte Veränderungen eingeschränkt durch die Garantie der Rechte der Gemeinschaften von 1624. Eben deshalb hatten die Habsburger so dafür gekämpft, dass die allgemeinen Regeln für ihre Territorien nicht galten. Wer sein Territorium nach 1648 rekatholisieren wollte, stand vor beträchtlichen Problemen. Selbst mit französischer Hilfe gelang es den katholischen Kurfürsten der Pfalz nicht, ihren Ländern ihre Religion aufzuzwingen; die Katholiken blieben mit etwa 30 Prozent in der Minderheit. 33 Auch in anderen Territorien waren die Möglichkeiten für Herrscher, die Religion ihrer Untertanen zu ändern, nun äußerst begrenzt. Einunddreißig Fürsten konvertierten zwischen 1648 und 1769 zum Katholizismus, aber das Höchste, was sie erreichen konnten, war ein Simultaneum, also gleiche Glaubensrechte für katholische Gemeinden, was protestantische Juristen als Bruch des Westfälischen Friedens vehement ablehnten. 34 Die einzige erfolgreiche Rekatholisierung nach 1648 führte Bayern in der Oberpfalz durch. Den Boden hierfür bereitete die Abschaffung der Adelsrechte 1628, die zur Emigration von vierundvierzig Familien, der Hälfte des oberpfälzischen Adels, führte. Da es an Klerikern mangelte, verlief die Entwicklung zur Einheitlichkeit schleppend. Allein in Bamberg wurden zehntausend Bücher verbrannt und Tausende Untertanen wegen Verstößen bestraft. 1675 jedoch, nach dauerndem Druck über zwei Generationen hinweg, ergab eine Erhebung, dass nur noch fünfundzwanzig Nichtkatholiken übrig waren. 35 Katholische Herrscher in Regionen ohne klare geografische Demarkationslinien zwischen den Konfessionen, die zudem mit religiösen Minderheiten zu tun hatten, deren Rechte in Reichsgesetzen verankert waren, mussten neben roher Gewalt auf die ganze Palette von Methoden katholischer Reformen zurückgreifen, derer sich auch die Habsburger bedienten. Die Schlacht um Herzen und Hirne wurde an zahlreichen Fronten ausgefochten. Der eklatante Mangel an Klerikern in den Jahrzehnten nach dem Krieg führte fast überall dazu, dass religiöse Orden zum Einsatz kamen. Die Jesuiten blieben die wichtigste und einflussreichste Organisation, außer in Salzburg, wo Benediktiner als politische Berater wirkten, die Reformen koordinierten und die höhere Bildung leiteten. 36 Neue Orden wie die Kapuziner spielten ebenfalls eine Schlüsselrolle beim Wiederaufbau der Seelsorge in Städten und vor allem auf dem Land, neben anderen neuen und reformierten alten Orden, etwa reformierten Franziskanern, Barnabiten, Benediktinern, Augustinern, Zisterzien-
34. Christliche Staatsorganisation: Der barocke Katholizismus
sern, Dominikanern, Karmelitern, Prämonstratensern, Barmherzigen Brüdern, Ursulinen und Englischen Fräulein. 37 Die Bildung eines Netzwerks neuer Klöster, oft unter Einbindung herrenloser oder verlassener Institutionen, war ein gängiges Mittel zur Wiederherstellung der Autorität über ein Territorium. Die Habsburger etwa entwickelten in Vorderösterreich ein Netzwerk von Kapuzinerklöstern; deren Einbindung in eine separate Provinz Vorderösterreich 1668 sollte die Beziehung zwischen der Tiroler Regierung und ihren süddeutschen Territorien stärken. 38 Die neue Präsenz des reformierten Katholizismus zeigte sich auch auf andere Weise. Die Zeit nach 1648 erlebte einen erstaunlichen Anstieg katholischer Kirchenbauten im ganzen Reich. Vor dem Krieg hatten viele gezögert, sich in große Bauprojekte zu stürzen. Danach, als der Status quo in Reichsgesetzen festgeschrieben und außerdem mehr wiederaufzubauen, zu reparieren und zu renovieren war, flossen ungeheure Summen in Bautätigkeiten. Für die kleinen unabhängigen schwäbischen Stifte war dies auch eine Möglichkeit, ihren freien Status zu untermauern: Statt dem Kaiser Geld zu leihen, investierten sie nun in ihre Selbstdarstellung. 39 In vielen Fällen wurden alte Gebäude erhalten, manchmal ausdrücklich zur Pflege von Tradition und Kontinuität, aber unter großem Aufwand im Barockstil renoviert. 40 Es wäre zu einfach, eine direkte Verbindung zwischen Stil und Glauben herzustellen, da auch Lutheraner den Barockstil pflegten, vor allem in der Nähe katholischer Kirchen und Stifte. 41 Die Beliebtheit des Stils bei Katholiken wie Protestanten in konfessionell gemischten Gegenden legt nahe, ihn vielmehr als allgemeinen deutschen Stil zu betrachten, der sich ideal für die demonstrativ pompöse Zurschaustellung konfessioneller Identität in Verbindung mit Reichtum und Macht eignete. Der barocken Hofkirche in Dresden stand die noch gewaltigere protestantische Frauenkirche (1726–1743) im gleichen Stil gegenüber. Nur die reformierte Kirche verzichtete gänzlich auf Barock. Für Katholiken und Protestanten lag der Schlüssel in der Aufteilung des Kirchenraums: Protestanten stellten eher die Kanzel in den Mittelpunkt, während Katholiken mehr Wert auf Hochaltar und Tabernakel sowieso die zahlreichen Altäre in Seitenkapellen legten, die dazu dienten, dass alle Pfarrer ihre tägliche Messe halten konnten. 42 Neue Klöster und Gemeindekirchen in Stadt und Land erhöhten die Dichte der katholischen Präsenz und ihre Reichweite. Verstärkt wurde die Wirkung der Gebäude und ihrer Ausschmückung durch Reliquien, die sich nun einer massiv verstärkten Nachfrage erfreuten und in ebenso beeindruckenden Mengen verfügbar wurden. Dazu hatte die Kirche selbst durch die zunehmende Anzahl von Heiligsprechungen im 16. Jahrhundert beigetragen. Der Schrein der heiligen Ursula und der elftausend Jungfrauen in Köln und die Gräber frühchristlicher Märtyrer in den römischen Katakomben brachten Tausende »neuer« Heiliger hervor. Der angeblich von den Hunnen getöteten Märtyrerin St. Ursula huldigte man in Köln bereits seit
339
340
III. · Die deutschen Territorien um 1648–1760
dem Frühmittelalter, allerdings stieg die Anzahl ihrer vermeintlichen Helferinnen (ursprünglich nur eine) von elf auf 11.001. Ab dem 16. Jahrhundert übernahmen die Jesuiten die Verantwortung für den Schrein und die Verteilung der Reliquien daraus. 43 Die nach 1578 nach und nach freigelegten Katakomben boten noch mehr Nachschub und so begann in den 1620er Jahren ein umfangreicher Exporthandel mit Reliquien dort begrabener christlicher Märtyrer – ein Fachmann behauptete, es seien nicht weniger als 174.000. 44 Tausende dieser römischen Reliquien landeten in Bayern, der katholischen Schweiz und den habsburgischen Territorien. Allein Bayern gab die Überführung von etwa tausend vollständigen Heiligenleichen in Auftrag, die mit Juwelen geschmückt (etwa mit großen Edelsteinen in den Augenhöhlen) und in kostbare Stoffe gehüllt in gläsernen Särgen auf Altaren aufgestellt wurden. Besondere Aufmerksamkeit galt der Verbringung solcher Reliquien in die Oberpfalz, die Bayern in den Jahrzehnten nach 1648 vollständig rekatholisierte. Die wichtigste Kultfigur überhaupt war die Jungfrau Maria. Wittelsbacher und Habsburger machten sie zu ihrer Schutzheiligen und widmeten ihr je eine große Wallfahrtskirche (im bayerischen Altötting und in Mariazell in der Steiermark). Ähnliche Zentren entstanden zum Beispiel auch in Kevelaer im spanisch-niederländischen Herzogtum Geldern (1713 von Brandenburg-Preußen erworben), dessen 1641 nach einer Erscheinung begründete Marienbasilika Wallfahrer aus der gesamten Erzdiözese Köln sowie aus der Diözese Roermond, in der Kevelaer lag, anzog. Die zahlreichen Loretokapellen, oft nach einer Wallfahrt zum »Heiligen Haus« in Loreto erbaut, sind allesamt Maria gewidmet. 45 Ziele von Marienwallfahrten wurden zudem zahlreiche Kirchen mit Kopien von Cranachs Gnadenbild Mariahilf (nach 1537) im Hochaltar des Innsbrucker Doms. Mehr als tausendmal kopiert wurde die Holzskulptur des »gegeißelten Heilands« in der bayerischen Wieskirche, die im Jahr 1738 Tränen vergossen haben soll. Solche Kult- und Weihestätten waren lediglich herausragende Wahrzeichen in einer zunehmend dichten »sakralen Landschaft«. Wallfahrtsorte jeder Art wurden neu belebt oder errichtet und erfreuten sich besonders zwischen 1680 und 1770 großen Zuspruchs. Tausende von Wegkapellen und -kreuzen markierten katholische Gegenden im ganzen Reich. 46 Die Religion mag »universell« gewesen sein, aber die Betonung lag nun zunehmend auf dem regionalen oder territorialen Bereich. Ein großer Wallfahrtsort wie Walldürn, wo sich die Verehrung des »Blutwunders« im 18. Jahrhundert zu einer vierzehntägigen Pilgerreise entwickelt hatte, die alljährlich bis zu 300.000 Wallfahrer anzog, war für die Kurfürsten von Mainz ein wichtiges kommerzielles Unternehmen. 47 Auch vielen kleineren kirchlichen Territorien dienten solche Stätten als Einkommensquelle und Instrument der territorialen Integration. 48 Mit Wallfahrten und speziellen Formen wie dem Marienkult verbunden waren
34. Christliche Staatsorganisation: Der barocke Katholizismus
auch die zahlreichen Laienbruderschaften und -verbindungen für Frauen und Männer. 49 Während der Reformation hatten diese Organisationen eine schwere Krise durchgemacht, in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts lebten sie dann wieder auf und zwischen 1670 und 1730 stieg ihre Anzahl beträchtlich an. Zusätzlich zu Verbindungen, die sich speziellen Zwecken widmeten, entstand in den meisten katholischen Gegenden ein dichtes Netzwerk von konfessionellen Gemeinschaften, Rosenkranz-, Skapulier- und anderen Bruderschaften. Manche, wie etwa die ab dem späten 16. Jahrhundert von Jesuiten gegründeten marianischen Vereinigungen, wandten sich in erster Linie an die städtischen und territorialen Eliten. Viele andere indes waren weitgehend autonome Organisationen von Laien unter Einschluss einfacher Leute oder repräsentierten einen Querschnitt der lokalen Bevölkerung inklusive des Adels. Viele Laien gehörten mehr als einer Gesellschaft an und offenbar stieg die Anzahl der Mitgliedschaften Einzelner im 18. Jahrhundert. Zugleich häuften viele dieser Verbindungen durch Vermächtnisse beträchtliche Reichtümer an. In der katholischen Gesellschaft spielten sie eine so herausragende Rolle, dass sie zu den ersten Institutionen zählten, die aufgeklärte Fürsten nach 1750 zu reformieren (und kontrollieren) suchten. Solche Unternehmen standen stellvertretend für viele Bestrebungen weltlicher und kirchlicher Mächte, die katholische Kirche nach 1648 in den deutschen Territorien neu zu verankern. Den konzeptuellen und theologischen Rahmen lieferten die Dekrete des Konzils von Trient, das Ergebnis war indes kein Triumph für die tridentinische Kirche. Offizielle Versuche, die Laienschaft zu »disziplinieren«, stießen oft auf Widerstand und so ergänzten die Laien selbst die Bemühungen der tridentinischen Reformer. 50 Dabei überlebten zahlreiche vorreformatorische Traditionen, so etwa der Wunsch nach kommunaler Kontrolle über die Kirche, das Streben nach Intensivierung und Differenzierung der religiösen Erfahrung und das Wiederaufleben von Wallfahrten und Heiligenverehrung. Die Gemeinden forderten mehr ortsansässige Priester, die gewissenhafter ihren religiösen Pflichten nachgingen und sich dem neuen tridentinischen Schwerpunkt auf Seelsorge fügten, zugleich jedoch protestierte die Laienschaft oft und gern gegen klerikale Verfehlungen und vermeintliche Verstöße gegen Gemeinderechte. Der barocke Katholizismus war geprägt von der Anpassung der tridentinischen Kirchenhierarchie an die religiöse Weltsicht der überwiegend ländlichen Laienschaft. Dabei war der volkstümliche Beitrag zur religiösen Praxis von größerer Bedeutung, als man meint. Lokale Traditionen und kommunale Praktiken prägten die Umsetzung der von den Eliten konzipierten Reformen und Neuerungen. Die Jesuiten, alles andere als Verfechter einer von oben diktierten Disziplin, agierten eher als Vermittler zwischen Kirche und Volk. Die Wiederrichtung der kirchlichen Infrastruktur von Pfarreien, Schulen und kirchlichen Gerichten in den Fürstbistümern verlief weitgehend erfolgreich. In vielen Teilen war die »sakrale
341
342
III. · Die deutschen Territorien um 1648–1760
Landschaft« nun sogar sichtbarer als je zuvor und danach. Dass ein Herrscher wie der bayerische Kurfürst jedoch 1718 jesuitische Missionare in alle Bezirke entsandte, um die Leute aus »Dunkelheit und Ignoranz« zu erretten, unterstreicht die Distanz zwischen offizieller Doktrin und volkstümlicher Praxis. 51
Anmerkungen 1 Rürup, Moser, 143, 149. 2 Kremer, Friede, 51. 3 Hunter, Secularisation, 113–141; Schröder, Thomasius, 109–134; Ahnert, Religion, 43–56; Luig, »Thomasius«, 249 ff. 4 Christ, »Fürst«. 5 Ward, Awakening, 1–10, 18–21. 6 Rürup, Moser, 143. 7 Herzig, Zwang, 17–26, 68–75. 8 Bahlcke, »Freiheitsvorstellungen«, 384 f.; Schnabel, »Glaubensflüchtlinge«; Schunka, »Glaubensflucht«, 554 f.; Schunka, »Exulanten«; Schunka, Gäste, 20–31. 9 Winkelbauer, Ständefreiheit II, 61; Dipper, Geschichte, 272; Conrads, »Schlesien«, 284; Prinz, »Geschichte«, 220; Rusam, Exulanten, 112 f. 10 Winkelbauer, Ständefreiheit II liefert eine Fülle von Details zu den individuellen Territorien. 11 Louthan, Bohemia, 16–46. 12 Winter, Emigration, 51–77. 13 Herzig, Konfession, 13–36; Deventer, »Konfrontation«; Winkelbauer, Ständefreiheit II, 67–70; Ward, Awakening, 54–92. 14 Evans, Making, 299 ff. 15 Weber, Verhältnis, 206–214. 16 Herzig, Konfession, 45 f. 17 Bahlcke, »Freiheitsvorstellungen«, 385. 18 Weber, Verhältnis, 268–280, 421–426. 19 Herzig, Konfession, 24 f.; Wagner, Mutterkirche, 60–96. 20 Herzig, Konfession, 37–70, 79–114; Ward, Awakening, 67–73, 77–83. 21 Ward, Awakening, 78; Benedikt, Sporck, 160. 22 Herzig, Zwang, 75; Winkelbauer, Ständefreiheit, 184. 23 Gatz, Bischöfe 1448–1648, 828 f.; Gatz, Bischöfe 1648–1803, 622 ff.; Dopsch, »Legatenwürde«, 277–281; Gatz et al., Bistümer, 646 f. 24 Winkelbauer, Ständefreiheit, 33; Schindling und Ziegler, Territorien I, 82 ff.; Meid, Literatur, 363–373. 25 Winkelbauer, Ständefreiheit, 36. 26 Vgl. auch S. 191 f. 27 Kissling, »Konfessionalisierung«, 95–99; vgl. zu Berchtesgadens Geschichte als reichsunmittelbares Kirchenterritorium Köbler, Lexikon, 59. 28 Ward, Awakening, 96 ff. 29 Walker, Salzburg Transaction, bietet die beste Darstellung dieser Vorgänge; Thompson, Britain, 148–164, beleuchtet die Affäre und die britische Politik insgesamt ebenfalls; vgl. außerdem Leeb, »Emigration«.
34. Christliche Staatsorganisation: Der barocke Katholizismus
30 Ward, Awakening, 101–107. 31 Rusam, Exulanten, 100. 32 Buchinger, »Ländler«, 20–68; Reingrabner, Protestanten, 165 f.; Mecenseffy, Geschichte, 186–202; Ward, Awakening, 107 ff.; Aretin, Altes Reich Bd. II, 331 f.; Pörtner, »Migration«, 346–354. 33 Herzig, Zwang, 75. 34 Schäfer, Simultaneum, 9–28; Schneider, Ius reformandi, 465–482; Christ, »Fürst«; Maurer, Kirche, 72. 35 Herzig, Zwang, 75 ff. 36 Ebd., 95–119. 37 Forster, Catholic Germany, 128–143; Hersche, Muße, 318–334. 38 Winkelbauer, Ständefreiheit I, 43. 39 Beales, Prosperity, 58–83; Hersche, Muße, 369–374; Press, Kriege, 139–143; Hartmann, Kulturgeschichte, 136–144. 40 Engelberg, Renovatio, 215–350, 496–624. 41 Ebd., 189–214. 42 Hartmann, Kulturgeschichte, 102–105, 182–190, 234–241; Hersche, Muße, 534–556 (aus europäischer Perspektive). 43 Johnson, »Fabrications«, 277 f. 44 Ebd., 278–282; Krausen, »Verehrung«; Achermann, Katakombenheiligen; Louthan, Bohemia, 141 f. 45 Das Haus der Jungfrau Maria war angeblich von Engeln in den 1290er Jahren von Epirus nach Ancona getragen worden; vgl. Louthan, Bohemia, 63–66. 46 Hersche, Muße, 556–568; Forster, Revival, 61–105. Hantsche, Atlas, 82 f., zeigt die dichte Verteilung von Pilgerstätten im Niederrheingebiet. 47 Die Ursprünge waren mittelalterlich: 1330 hatte ein Priester einen geweihten Kelch verschüttet, woraufhin das »Blut Christi« auf dem Altartuch das Bild des Gekreuzigten und elf Christusköpfe mit Dornenkrone zeigte; Miller und Taddey, Handbuch, 833 f. 48 Hersche, Muße, 806–816; Forster, Revival, 218 f.; Lederer, Madness, 99–144, bietet einen ausgezeichneten Überblick über Wallfahrten in Bayern. 49 Hardtwig, Genossenschaft, 70–97; Brandmüller, Kirchengeschichte II, 928–935; Hersche, Muße, 396–419. 50 Holzem, Religion, 458–464; Forster, Revival, 185–207. 51 Ward, Christianity, 68.
343
35. Christliche Gemeinwesen: Die Territorien der Reichskirche
I
n vielerlei Hinsicht betrieben die Fürstbistümer eine ähnliche Politik wie weltliche Herrscher. Dennoch war das Überleben der unabhängigen kirchlichen Territorien als Reichskirche oder Germania sacra neben den weltlichen Territorien eine Besonderheit des deutschen Katholizismus. In welchem Ausmaß trug die Existenz der Reichskirche zur Entwicklung des Katholizismus im Reich bei? War sie wirklich nur eine Ansammlung »kurioser konstitutioneller Fossilien … aus der frühen Feudalzeit« oder eine »Art Dritte Welt im föderalen Deutschland des 18. Jahrhunderts«? 1 Die eigentümliche Struktur und Verfassung der Reichskirche und die Tatsache, dass sie mit der Auflösung des Reichs 1806 verschwand, hat viele Fragen zu ihrer Funktionsfähigkeit aufgeworfen. Inwieweit war die Reichskirche reformfähig und stand ihre Konstitution in irgendeiner Weise der Erneuerung des deutschen Katholizismus im Weg? Grundsätzlich verankerte die Existenz der Reichskirche die Stellung des Katholizismus im Reich und gab der katholischen und kaiserlichen Partei in der Reichspolitik Gewicht. Die Stimmen ihrer führenden Mitglieder im Reichstag bildeten einen beständigen katholischen Block. Protestantische Fürsten sahen dies natürlich mit Misstrauen und fanden, ihr Einfluss stehe in keinem Verhältnis zu den gerade einmal 14 Prozent der Fläche des Reichs und etwa 12 Prozent seiner Bevölkerung, die sie vertraten. Dass die Fürstbischöfe und andere führende Kirchenmänner als Fürsten im Reichstag saßen und nicht als Geistliche, unterstreicht, dass die Reichskirche grundsätzlich die Kirche des höheren Adels war. Dies war in Frankreich und anderswo ähnlich, im Reich waren die Bischöfe jedoch zugleich Führer großer Diözesen und Herrscher darin liegender Territorien, die keine Theokratien waren, sondern – rein rechtlich betrachtet – weltliche Territorien mit kirchlichen Herrschern. 2 Die größere Reichweite der Diözesengrenzen sorgte regelmäßig für Konflikte zwischen Fürstbischöfen und weltlichen Herrschern oder zwischen Metropoliten und anderen Fürstbischöfen in ihren Regionen. Dass die Reichskirche in vielerlei Hinsicht die gleichen Interessen verfolgte wie weltliche Herrscher, führte außerdem zu Spannungen zwischen den deutschen Bischöfen und dem Heiligen Stuhl und seinen Nuntien im Reich. 3 Mit einigen namhaften Ausnahmen, etwa der Fürstpropstei Ellwangen und der Reichsabtei Kempten, waren die Prälaten der Reichsabteien meist keine Adligen, ebenso wie die Mönche, die sie wählten. Darüber hinaus waren sie wie andere,
35. Christliche Gemeinwesen: Die Territorien der Reichskirche
etwa Berchtesgaden, Fulda und Corvey, an einen religiösen Orden gebunden und daher etwas weniger anfällig dafür, von einer Dynastie beherrscht zu werden. Aber die meisten Prälaten waren eben auch Territorialherrscher und hatten dieselben Interessen wie ihre bischöflichen und weltlichen Pendants. Bischöfe, Fürstäbte und Fürstpropste verteidigten ihre Autonomie gegen Einmischungen von außen. Dasselbe gilt auch für die Domkapitel und Mönchsgemeinschaften, die sich oft als die wahren Hüter der Institutionen betrachteten, nicht selten die Rolle von Territorialständen übernahmen und in Zeiten eines Interregnums als Regenten wirkten. 4 Die Doppelrolle der Fürstbischöfe und Prälaten sprach gegen jegliches gemeinsame Handeln der deutschen Kirche. Die diözesane Struktur war noch die gleiche wie im späten Mittelalter, auch wenn sich die Grenzen des Reichs seither verändert hatten, viele Bistümer säkularisiert worden waren und viele weltliche Herrscher im 16. Jahrhundert die sinnvolle Ausübung diözesaner Rechte und Rechtsprechung in ihren Ländern abgeschafft hatten. Es gab auch keine echte kirchliche Gesamtführung. Die Metropoliten und kirchlichen Provinzen hatten keine Bedeutung mehr und die gewöhnlichen Fürstbischöfe betrachteten sich längst nicht mehr als Suffragane der Erzbischöfe und somit deren Untergebene. 5 Salzburg machte mit kaiserlicher Unterstützung seinen alleinigen Anspruch auf den Titel des Deutschen Primas geltend, nachdem das Erzbistum Magdeburg in den 1560er Jahren protestantisch geworden war, was 1750 von der Reichskanzlei bestätigt wurde. 6 In der Praxis wurde jedoch der Erzbischof von Mainz als tatsächlicher Metropolit von Deutschland betrachtet, da er Kurfürst und Erzkanzler des Reichs war, und diese Stellung sollte nach 1806 große Bedeutung erlangen. Die Fürstbischöfe von Eichstätt gaben sich den Titel Sanctae Moguntinae Sedis Cancellarius (Kanzler des Bistums Mainz) und betrachteten sich als zuständig für die Wahrung der Rechte des Reichs und seiner katholischen Kirche. In Wahrheit bedeuteten die Titel Primas und Kanzler des Primas jedoch wenig. Wenn die deutsche Kirche ein Oberhaupt hatte, war das der Kaiser selbst als advocatus ecclesiae. Nach 1648 wurden diese institutionellen Eigenheiten durch andere Faktoren verstärkt. Zum einen erkannte der Heilige Stuhl im Gegensatz zu den deutschen Bischöfen den Westfälischen Frieden nicht an. Zweitens lief die deutsche Praxis der Anhäufung von Episkopaten der päpstlichen Politik nach dem Konzil von Trient zuwider. Drittens legte auch die Aushandlung von Wahlkapitulationen zwischen Domkapiteln und Elekten mehr Gewicht auf territoriale Interessen als auf die der Kirche im weiteren Sinn oder gar des Heiligen Stuhls in Rom.Viertens hatte das Konzil von Trient darauf abgezielt, die Autorität der (reformierten) Bischöfe zu stärken und daher die Abschaffung des Auxiliarbischofsamts verlangt, die deutsche Kirche behielt jedoch das alte System bei. Die Zugehörigkeit der Reichskirche zum Reich wurde schließlich noch dadurch unterstrichen, dass sie formal auch ein
345
346
III. · Die deutschen Territorien um 1648–1760
lutherisches Bistum (Lübeck, allerdings wie 1624 mit vier katholischen Kanonikern im Kapitel) und drei religiöse Häuser für Adelsdamen (Gandersheim, Quedlinburg und Herford) umfasste. 7 Die Fortdauer der alten rechtlichen und konstitutionellen Strukturen führte zu einer Vielzahl unterschiedlicher Gegebenheiten. Dass die Habsburger und andere führende Dynastien die Reichskirche weiterhin als Mittel zur Erweiterung von Macht und Einfluss sowie zur Versorgung jüngerer Söhne nutzten, sorgte für einige Fälle von krassem Missbrauch. Zwischen 1680 und 1750 wurden für praktisch jedes vakante Episkopat im Reich Kandidaten der Herrscherhäuser von Bayern, der Pfalz und Lothringen nominiert. 8 In dieser Zeit hielten neun Fürsten aus fünf Dynastien neben anderen kirchlichen Pfründen vierzehn Bistümer. Von diesen Fürsten war einer zeitweise wahnsinnig, fünf ließen sich nur zwangsweise vom Papst weihen, zwei überhaupt nicht. Kurfürst Philipp Wilhelm von der Pfalz (* 1615, † 1690, 1685–1690) ließ sechs seiner Söhne im Kirchendienst Karriere machen, Max Emanuel von Bayern (* 1662, † 1726, 1679–1706 und 1714–1726) seinen Bruder und vier Söhne. Die Habsburger, die selbst nicht genügend männliche Nachkommen hatten, förderten die Ansprüche ihrer engen Verwandten in Lothringen und der Pfalz. Gewählt wurden die Kandidaten von den Domkapiteln, oft flossen dabei beträchtliche Bestechungssummen. Der Kaiser und Rom mussten die Gewählten bestätigen. Obwohl die Praktiken in eklatanter Weise den Prinzipien des Konzils von Trient zuwiderliefen, sträubten sich die Päpste selten gegen Kandidaten großer Dynastien. Zu einer echten Änderung kam es erst, als Habsburgern und Wittelsbachern nach 1750 der Nachwuchs ausging. Unter den anderen aus dem Adel gewählten Bischöfen standen die Dinge wesentlich besser. Die zu Bischöfen gewählten Sprösslinge von Reichsrittern und Reichsgrafen versahen ihr Amt meist gewissenhaft. Dynastien spielten auch hier eine Rolle, vor allem die gebärfreudigen Schönborns, ursprünglich eine Familie protestantischer Reichsritter, die ab Ende des 16. Jahrhunderts dem Mainzer Domkapitel angehörten. 9 Zwischen 1680 und 1750 hielten sechs Mitglieder der Familie neun Bistümer und die Fürstpropstei Ellwangen. Als seines Amts unwürdig erwies sich nur Johann Philipp, 1719–1724 Bischof von Würzburg, der ermordet wurde. Damian Hugo hingegen, 1719–1743 Bischof von Speyer und 1740–1743 von Konstanz, wurde Kardinal und galt unter Zeitgenossen als Heiliger. Abgesehen von der Pfründenhäufung einiger Schönborns residierten die meisten adligen Fürstbischöfe nun in ihren Diözesen und viele bemühten sich nach Kräften, Herrscher und Bischof zugleich zu sein. Der Adel beherrschte auch eine komplexe Masse niederer kirchlicher Institutionen. Einige der insgesamt 720 Kanoniker umfassenden Domkapitel, die die Bischöfe wählten, verlangten bis zu sechzehn adlige Vorfahren als Voraussetzung für eine Mitgliedschaft. Zudem gab es zahlreiche Stifte, von denen einige ebenso ex-
35. Christliche Gemeinwesen: Die Territorien der Reichskirche
klusiv waren. 10 Ein paar genossen unabhängigen Status im Reich (Immediatstifte), so etwa Ellwangen und Berchtesgaden, aber die große Mehrheit unterstand einem Territorialherrscher (Mediatstifte). Auch diese Institutionen standen oft im Zeichen von Dynastie- sowie Familienpolitik und häufig kam es zur Anhäufung von Pfründen. Die Kanonikate von Mainz, Trier, Würzburg und Bamberg lagen in den Händen von 166 Familien, überwiegend Reichsrittern. Es war nicht ungewöhnlich, dass ein Einzelner eine ganze Sammlung solcher Ämter innehatte, etwa als Propst oder in den vielen innerterritorialen Stiften. 11 Auch hier hinterließ die eigenartige Konstitution des Reichs mit seinem konfessionellen Normaljahr 1624 ihre Spuren: In mehreren Domkapiteln saßen protestantische und katholische Kanoniker, das Frauenstift Schildesche bei Bielefeld in der Grafschaft Ravensberg wiederum hatte sechs katholische und elf protestantische Kanonissen und wählte abwechselnd katholische, lutherische und reformierte Äbtissinnen. 12 Zusätzlich existierten weiterhin der Deutsche Orden und der Johanniterorden als unmittelbare »Fürstentümer« mit Sitz im Reichstag, weit verstreuten Ländereien und ausschließlich adliger Mitgliedschaft. 13 Die katholische Prägung dieser adligen Orden wie auch der verschiedenen unabhängigen reichskirchlichen Stifte war eingeschränkt, da sie in Gegenden, in denen die Normaljahrbestimmungen des Westfälischen Friedens dies vorsahen, lutherische und calvinistische Mitglieder hatten. Dennoch war ihre Ausrichtung in der Reichspolitik insgesamt zweifellos katholisch und überwiegend prohabsburgisch. Aufgeklärte Kritiker im späten 18. Jahrhundert und protestantische Nationalhistoriker lehnten die Reichskirche wegen ihres aristokratischen Charakters ab. Aber die Folgerung, sie sei mehr weltliche Institution als geistliche Kraft gewesen, ist ungerecht. Die Reichskirche als ganze lieferte eine ganze Reihe wichtiger und markanter Beiträge zur Entwicklung des deutschen Katholizismus nach 1648. Im 18. Jahrhundert richtete sich der durchschnittliche adlige Bischof mehr oder weniger nach dem tridentinischen Ideal. Die geistliche Qualität des Episkopats verbesserte sich ohne Zweifel und der im 16. Jahrhundert übliche schamlose Amtsmissbrauch starb aus. Figuren wie der Münsteraner Bischof Christoph Bernhard von Galen (1650–1678, der »Kanonenbischof« oder »Bomben-Bernd«), der seine Diözese und sein Territorium mit eiserner Faust regierte und eine große Armee aufstellte, die er selbst in die Schlacht führte, wurden zur raren Ausnahme. 14 Zudem waren bereits lange zuvor die von einem Bischof ernannten Weihbischöfe und Generalvikare in fast allen Fürstbistümern mit pastoralen und diözesanen Aufgaben betraut worden. Sie wurden zur treibenden Kraft religiöser Reform und Erneuerung. Vor allem die Weihbischöfe und in geringerem Maß auch die Generalvikare glichen die stark aristokratische Besetzung des Reichsepiskopats und der Domkapitel aus, weil sie überwiegend nicht dem Adel entstammten. 15
347
348
III. · Die deutschen Territorien um 1648–1760
In Münster zum Beispiel wurde die Diözese nach 1648 im Wesentlichen von einer Abfolge nichtadliger Generalvikare neu aufgebaut, die in den achtundzwanzig Jahren von Galens Herrschaft dreiundvierzig Diözesansynoden organisierten. Damit legten sie die Grundlage für die Ernennung des dänischen Konvertiten Niels Stensen (Nicolaus Steno, * 1638, † 1686) zum Weihbischof durch Galens Nachfolger Ferdinand von Fürstenberg (1678–1683, zuvor ab 1661 Bischof in Paderborn). 16 Stensen war als Theologe vielleicht nicht so originell wie als Arzt, Anatom und Naturforscher, verfügte aber über ausgezeichnete Verbindungen und galt weithin als Idealbeispiel eines geradezu heiligen religiösen Führers. 17 Durch seine Korrespondenz mit Leibniz, Antoine Arnauld, Spinoza und den Medici, die 1666/ 67 und 1670–1672 in Florenz seine Patrone waren, verband Stensen kosmopolitisches savoir faire mit tiefer persönlicher Frömmigkeit und scharfsinnigem Verständnis der Traditionen und Institutionen der Diözese. Diese Vorzüge kamen ihm auch als Apostolischer Vikar des Nordens 1676–1680 und 1683–1686 zugute und machten ihn zum willkommenen Gast an den Höfen von Braunschweig-Lüneburg und Schwerin. Stensens Weggang von Münster veranlasste seine Empörung über die enormen Geldsummen, die die Domkanoniker für die Wahl des Wittelsbacher Kurfürsten Max Heinrich von Köln (1650–1688 in Köln, 1683–1688 in Münster) forderten. Weihbischöfe und Vikare spielten generell auch anderswo eine ebenso wichtige Rolle. In Mainz und Köln trugen die Brüder und Weihbischöfe Peter und Adrian van Walenburch wesentlich zum neuen religiösen Aufschwung bei, ebenso wie der Konvertit Adolf Gottfried Volsoius in Mainz, Kaspar Zeiler in Augsburg (1645– 1681) und Thomas Henrici in Basel (1648–1660). 18 Zudem bemühten sich die kirchlichen Territorien um eine Alternative zu den Jesuiten. Im späten 16. Jahrhundert hatten die Fürstbischöfe begonnen, mit den Jesuiten zusammenzuarbeiten, und signifikant zur Gründung des Collegium Germanicum in Rom beigetragen. Nach 1648 weiteten viele ihren Blick. Salzburg hatte sich bereits vor 1618 für die Benediktiner entschieden, zumindest teilweise zur Sicherung der Unabhängigkeit des Territoriums und der Erzdiözese von den von Jesuiten dominierten Höfen in Wien und München. In Nordwestdeutschland kam es zu verstärkten Aktivitäten der Franziskaner, in Würzburg und Mainz erfuhr der 1640 im salzburgischen Tittmoning gegründete Weltpriesterorden der Bartholomiten starke Förderung. 19 Ein Grund dafür war der Mangel an Klerikern jeder Art unmittelbar nach dem Krieg. Es gab jedoch auch deutlich antijesuitische Strömungen in vielen kirchlichen Territorien, die große Auswirkungen hatten. Zum einen ließen sich einige einflussreiche Protagonisten der kirchlichen Erneuerung von den Jansenisten inspirieren, denen die Jesuiten absolut unversöhnlich gegenüberstanden. Oft ist zu lesen, der Jansenismus habe vor dem frühen 19. Jahrhundert kaum Wirkung im Reich gezeitigt, in erster Linie die Entwicklung
35. Christliche Gemeinwesen: Die Territorien der Reichskirche
einer episkopalischen Ideologie geprägt und spirituell hauptsächlich Pietisten und ihre radikalen Ableger beeinflusst. 20 Sicherlich bekämpften in Trier die Weihbischöfe wie Johannes Petrus Verhorst (1687–1708) entschieden die Ausbreitung des Jansenismus von seinen Zentren in Juvigny-sur-Loison und Orval in den Westen der Erzdiözese. 21 Eine ähnliche Gegenoffensive fand um 1700 in der Erzdiözese Köln statt. 22 Es war wohl unvermeidlich, dass die antiepiskopalischen Tendenzen des Jansenismus unter kirchlichen Fürsten ebenso auf Misstrauen stießen wie auf die Gegenwehr Roms und der Jesuiten. Jeder Anflug von Richerismus kam im Reich schlecht an: »Alle Macht dem niederen Klerus und den Laien« war kein Motto nach dem Geschmack der aristokratischen Reichskirche. Andererseits war weder die jansenistische Frömmigkeit noch ihr Antijesuitismus mit dem barocken deutschen Katholizismus unvereinbar. Die Orden der Augustiner, Dominikaner, Benediktiner und Prämonstratenser standen lange vor der Zerstörung des Klosters Port-Royal durch Ludwig XIV., die zur Entstehung der schismatischen Kirche in Utrecht führte, unter dem Einfluss der jansenistischen Frömmigkeit. Ebenso wichtig, aber noch wenig erforscht, sind die Kontakte zwischen Antoine Arnauld und Katholiken im Reich während seiner Jahre in Port-Royal und von 1679 bis 1694 im niederländischen Exil. Niels Stensen, der konvertierte Landgraf Ernst von Hessen-Rheinfels und der Mainzer Kurfürst Johann Philipp von Schönborn (1647–1673) korrespondierten mit ihm. 23 Die Verbindung zu Hessen-Rheinfels und Schönborn weist zweitens auf eine weitere wesentliche Entwicklung in der Reichskirche nach 1648 hin. Die Beziehungen zwischen Rom und den deutschen Bischöfen waren dadurch belastet, dass Letztere die päpstliche Ablehnung des Westfälischen Friedens ignorierten, Eingriffe päpstlicher Nuntien in die Belange der Reichskirche missbilligten und nicht zuletzt für die Bestätigung von Wahlen und damit verbundene Angelegenheiten erhebliche Gebühren an Rom zu entrichten hatten. Zudem brachte das Engagement Schönborns und anderer für die Wiedervereinigung der christlichen Konfessionen im Reich ab den frühen 1660er Jahren manche in Rom zu der Überzeugung, die Deutschen seien im stillen Kämmerchen längst vom Glauben abgefallen. 24 Dass der Kölner Kurfürst 1660 ein nationales Konzil zur Untersuchung missbräuchlicher Eingriffe des Heiligen Stuhls im Reich vorschlug, war begleitet von Gerüchten, er wolle so etwas wie ein »Patriarchat in Deutschland« errichten und in der Reichskirche die »Praktiken und den Stil der gallikanischen Kirche« einführen. 25 1673 schließlich legten die drei rheinländischen Kurfürsten dem Reichstag eine neue Liste von Gravamina gegen Rom vor und verlangten die Neuverhandlung des Wiener Konkordats von 1448. Die Krise konnte entschärft werden. Die Argumente für ein neues Konkordat wurden jedoch durch die gallikanische Deklaration von 1682 und die katholische
349
350
III. · Die deutschen Territorien um 1648–1760
Rezeption der Werke des protestantischen Rechtshistorikers Johannes Schilter verstärkt, die den mittelalterlichen Investiturstreit wieder aufgriffen. Dadurch wurde der Konflikt zwischen Reich und Rom für die gegenwärtige Situation wieder relevant. 26 Als sich der Heilige Stuhl mit Ludwig XIV. gegen die Jansenisten verbündete, öffneten sich diese nun auch der Sache der Gallikaner, die sie zuvor abgelehnt hatten. Die daraus entstandenen jansenistischen Schriften zur Geschichte der Frühkirche und Texte wie Zeger Bernard van Espens Jus ecclesiasticum (Kirchenrecht) von 1700 verstärkten den wachsenden bischöflichen Widerstand gegen Rom im Reich. Das wieder auflebende Interesse an Kirchengeschichte und kanonischem Recht traf auf einen bemerkenswerten Anstieg historischer und juristischer Schriften aus den diversen älteren religiösen Orden. Während die erst in jüngerer Zeit gegründeten Jesuiten ein relativ »unhistorischer« Orden waren, zeigten Augustiner, Benediktiner, Dominikaner, Franziskaner, Prämonstratenser und andere ein substanzielles und kompetitives Interesse an der Erforschung ihrer Ursprünge. 27 Quantitativ wie qualitativ blieb die jesuitische Wissenschaft dominierend, aber eher diffus. Als Antiquare, Hofhistoriografen und Zeitgeschichtler blieben die Jesuiten unübertroffen, ihrer eigenen Geschichte wandten sie sich jedoch viel später zu als ihre Rivalen. Eine neue Dimension bekam der Wettstreit zwischen Jesuiten und alten Orden dadurch, dass Letztere die Scholastik ablehnten und neue Methodologien wie die historisch-kritischen Ansätze von Pierre Bayle und der kartesianischen Wissenschaft begrüßten. 28 Was dabei entstand, waren meist Historiografien, die die Unabhängigkeit von Rom und die Zugehörigkeit zum Reich betonten, um letztlich zu beweisen, dass sie »deutscher« als die Jesuiten waren. Wie viele Verfechter einer Versöhnung der christlichen Konfessionen waren sie fasziniert vom consensus quinquesecularis, der Einigkeit des Glaubens, der in den ersten fünf Jahrhunderten der Kirche geherrscht hatte. 29 All diese wahrscheinlich nur durch ihre gemeinsame antijesuitische Haltung vereinten Strömungen sammelten sich in den Vorhaben von Friedrich Karl von Schönborn, dem Reichsvizekanzler (1705–1734) und Bischof von Bamberg und Würzburg (1729–1746), sowie in den Werken von Johann Casper Barthel (* 1697, † 1771) an der reformierten Universität Würzburg ab 1727. Schönborn strebte danach, das Reich zu sammeln und einen Kurs zwischen Rom und Wien zu steuern; Barthel entwickelte eine umfassende episkopalische Ideologie, die die historisch herausgebildete Verflechtung spiritueller und weltlicher Macht in der Reichskirche zur Geltung bringen und die Veritas, Justitia, Aequitas, Integritas Germaniae (Wahrheit, Gerechtigkeit, Gleichheit, Reinheit Deutschlands) verteidigen sollte. 30 Wie bedeutend Barthels Schriften, die über einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten entstanden, tatsächlich waren, zeigte sich erst in der Febronianismus-
35. Christliche Gemeinwesen: Die Territorien der Reichskirche
kontroverse der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, als deren Vorläufer er oft angesehen wird. 31 Seine Ideen sind jedoch auch als Höhepunkt des barocken Katholizismus im Reich signifikant. Der grundlegende Beitrag der Jesuiten zum Wiederaufleben der deutschen Kirche steht außer Zweifel und sie blieben in den meisten Bereichen dominant, an denen die soziale und intellektuelle Elite beteiligt war: Erbauungsliteratur, Choral und Drama, wo sie ihren wichtigsten Beitrag zur deutschen Literatur der Frühmoderne leisteten. 32 Dennoch war die deutsche Reform in wichtigen Gesichtspunkten »untridentinisch«, indem sie die tridentinischen Prinzipien eher locker umsetzte, als den Dekreten als päpstlichen Edikten Gehorsam zu leisten. 33 Was dabei entstand, war eine deutsche Parallele zum Gallikanismus: eine entschiedene Geltendmachung der Unabhängigkeit und eine Erneuerung der vorreformatorischen und reformatorischen Forderungen nach Erneuerung der Kirche, nach Beseitigung der Gravamina und nach Verhandlungen über ein neues Konkordat mit Rom, das die Rechte der Reichskirche gegen Papst und Kaiser sicherstellen sollte.
Anmerkungen 1 Anderson, Lineages, 151; Benecke, »Reichskirche«, 78. 2 Kremer, Herkunft, 30–50; weitere nützliche Informationen finden sich bei Schraut, Haus Schönborn, 19–33. 3 Die Nuntiaturen waren in Köln, Wien und Luzern; eine biografische Liste der Amtsinhaber bietet Gatz, Bischöfe 1648–1803, 635 f. 4 Quarthal, »Krummstab«. 5 Conrad, Rechtsgeschichte II, 179 f. 6 Schindling und Ziegler, Territorien I, 73 ff., und II, 79 ff.; Conrad, Rechtsgeschichte II, 179 f.; Seehase, »Religionsfrieden«. 7 Conrad, Rechtsgeschichte II, 181; Braunfels, Kunst III, 409. 8 Reinhardt, »Dynastien«; Feine, Besetzung, 68 f., 317–326; Aretin, Altes Reich II, 390–395. 9 Forster, Catholic Germany, 106 f. 10 Allein in der Diözese Mainz waren dies 65, 36 in Trier, 31 in Köln, 26 in Passau, 20 in Augsburg, 18 in Würzburg und 12 in Regensburg. Eine vollständige Liste der Institutionen in jeder Diözese liefern Wendehorst und Benz, Säkularkanonikerstifte, 207–211. 11 Blanning, Mainz, 49–56. 12 Schindling und Ziegler, Territorien VI, 114–128; Nottarp, »Communicatio«, 432 ff. 13 Brendle und Schindling, »Reichskirche«, 10. 14 Lahrkamp, Krummstab, 11–29; Holzem, Konfessionsstaat, 187–219. 15 Weihbischöfe und Vikare finden sich in Gatz, Bischöfe 1648–1803, den besten Zugang bieten die Diözesanlisten auf S. 592–632; vgl. auch Kremer, Herkunft, 50–58, 72 ff. 16 Gatz, Bischöfe 1648–1803, 486 ff.; Holzem, Konfessionsstaat, 224–232. 17 Er wurde erst 1988 seliggesprochen; wissenschaftlich beschäftigte sich Stensen hauptsächlich mit der Physiologie von Herz und Gehirn. Informative Studien hierzu sind Mussinghoff, »Stensen«, und Sobiech, Herz.
351
352
III. · Die deutschen Territorien um 1648–1760
18 Einen kurzen Überblick bietet Raab, »Reconstruction«, 153 ff.; vgl. zu Franken: Brandmüller, Kirchengeschichte, 417–428, zu Würzburg und Mainz unter Johann Philipp von Schönborn 1642–1673: Jürgensmeier, Schönborn, 167–177. Vgl. auch die Einträge bei Gatz, Bischöfe 1648–1803 (etwa für die Walenburchs auf S. 554 ff.). 19 Brendle und Schindling, »Reichskirche«, 9; Lanczkowski, Lexikon, 54. Jürgensmeier, Schönborn, 186–208, beleuchtet die Spannungen zwischen kirchlichem Herrscher und religiösen Orden in Würzburg und Mainz. 20 Hersche, Spätjansenismus, 45–50. 21 Gatz, Bischöfe 1648–1803, 534 f. 22 Raab, »Episcopalism«, 450. 23 Ebd., 449 f.; Neveux, Vie spirituelle, 712, 722, 814. 24 Raab, »Attempts«, 509–516; Jürgensmeier, Schönborn, 130–136, 262–290, 324–327; vgl. S. 105–109 25 Raab, »Episcopalism«, 446 f. 26 Raab, Concordata, 46–78. 27 Benz, Tradition, 146–159, 529–591, 678–681; Van Dülmen, Töpsl, 2–6. Was Benz als »Segmentierung der katholischen res public litteraria« bezeichnet, hatte politische wie theologische Gründe, die auf das Gerangel um kirchlichen Besitz zurückgingen, der unter dem Restitutionsedikt (1629) und unmittelbar nach 1648 zurückgefordert wurde. 28 Raab, Concordata, 81 ff. 29 Neveux, Vie spirituelle, 45, 702. 30 Raab, Concordata, 79–92 (Zitat auf S. 86). 31 Vgl. S. 484 f. 32 Meid, Literatur, 338–363. 33 Molitor, »Reform«.
36. Christliche Gemeinwesen: Protestantische Orthodoxie und Erneuerung
D
em Katholizismus gelang es, die volkstümliche Religiosität einzubinden. Deren Erneuerung und Wiederaufleben hatten auf die protestantischen Kirchen sehr unterschiedliche Auswirkungen. Zum einen waren die Strukturen andere. Die lutherischen Territorialkirchen waren eng verflochten mit einem Netzwerk ähnlicher organisatorischer Strukturen und gleicher Glaubensgrundsätze und -prinzipien, die jedoch von den theologischen Fakultäten der territorialen Universitäten auf verschiedene Weise »lokal« ausgelegt werden konnten. Dadurch entstanden zahlreiche regionale Unterschiede und eine beträchtliche allgemeine Flexibilität. Noch größer waren die lokalen Abweichungen und der Mangel an umfassendem Zusammenhalt bei den deutschen reformierten Kirchen, die im Westfälischen Frieden endlich Anerkennung und legale Beglaubigung gefunden hatten. Es gab sie in achtundzwanzig Territorien, meist kleinen Grafschaften an Mittel- und Niederrhein, in Hessen-Kassel, Ostfriesland und Bremen. Sie arbeiteten unabhängig voneinander, geprägt vom Geist des ersten Beschlusses der Synode von Emden 1571: »Keine Gemeinde soll über andere Gemeinden, kein Pastor über andere Pastoren, kein Ältester über andere Älteste, kein Diakon über andere Diakone den Vorrang oder die Herrschaft beanspruchen, sondern sie sollen lieber dem geringsten Verdacht und jeder Gelegenheit aus dem Wege gehen.« Lutheraner und Calvinisten waren gegeneinander nicht unbedingt toleranter als in Bezug auf den Katholizismus, weder auf der Ebene der jeweiligen Orthodoxie noch im kommunalen Bereich. 1 Das Corpus Evangelicorum war fest in der Hand der Mehrheitslutheraner, von denen viele nach wie vor die Legitimität des reformierten Glaubens bestritten. Dennoch sorgte die Bandbreite an theologischen Richtungen und regionalen Neigungen beider Kirchen in manchen Gegenden speziell unter Laien für ein gehöriges Maß an Überschneidungen. Dies galt besonders für den Oberrhein, wo sich Luthertum und reformierte Kirchen auf das gemeinsame Erbe Melanchthons beriefen. Das Ritual der dortigen lutherischen Kirche hatte viel mit den Reformierten gemein. Straßburg wurde eine der Hochburgen der lutherischen Orthodoxie, pflegte jedoch auch ein von Kirchvätern betriebenes System gemeindlicher Disziplin nach reformierten Richtlinien. 2 In Jülich-Kleve und Berg verwischten die Grenzen noch mehr. Dort hatte die Rückkehr der Herrscher zum Reformkatholizismus 1567 die Annahme der Konkordienformel verhindert und die lutherische Kir-
354
III. · Die deutschen Territorien um 1648–1760
che ohne territoriale Verfassung und somit ohne die übergreifende Autorität einer Synode oder eines Konsistoriums sowie ohne theologische Fakultät an einer Universität als Hüter der Doktrin zurückgelassen. 3 Es kam regelmäßig zu erbitterten Konflikten zwischen Lutheranern und Reformierten; dass die Lutheraner viele typische reformierte kommunale Strukturen übernahmen, machte sie aber letztlich beide nach 1648 empfänglich für die gleichen Erneuerungs- und Wiederbelebungsbewegungen. 4 1648 war die lutherische Kirche in Universitäten und den Territorialkirchen selbst fest verankert. Bis zum 17. Jahrhundert hatten mehrere Generationen von Klerikern und Akademikern familiäre und berufliche Netzwerke aufgebaut, die in praktisch allen protestantischen Territorien mächtige eigennützige Interessen mit stark oligarchischen Tendenzen vertraten. Wo es infolge des Krieges an Personal mangelte, sorgten die theologischen Fakultäten für Nachschub und die Kirchen bildeten integrale Bestandteile des territorialen bürokratischen Systems. Das bedeutete nicht unbedingt, dass sie sich den Fürsten bedingungslos unterwarfen. 5 Vielmehr bewahrte das Luthertum eine gesunde Tradition der Kritik und, wenn es der Anlass erforderte, der offenen Opposition. Als Hüter der Wahrheit und Vertreter der Erlösung ihrer Mitmenschen setzte sich der lutherische Klerus von den übrigen Staatsdienern ab. Die theologischen Fakultäten gewannen ebenfalls an Prestige und Unabhängigkeit, da sie von ihren eigenen herrschenden Fürsten sowie anderen Herrschern und Magistraten zu einer ganzen Palette regierungstechnischer und gesellschaftlicher Themen konsultiert wurden, weil akademische Theologen und Klerus die Repräsentanten der systematischen Theologie der lutherischen Orthodoxie waren, die sich aus den im Konkordienwerk (1574–1580) festgelegten lutherischen Glaubensgrundsätzen entwickelte. 6 Dies geschah in Reaktion auf die Bedrohung durch den Katholizismus und speziell in Jena und Wittenberg auf zwei vermeintliche Gefährdungen des wahren lutherischen Glaubens durch die Theologen in Helmstedt, deren Patron, der Herzog von Braunschweig, sich geweigert hatte, die Konkordienformel zu unterzeichnen. Die von Daniel Hoffmann (* 1538, † 1611) aufgestellte These, theologische und philosophische Wahrheit seien zwei verschiedene Dinge, veranlasste Johann Gerhard (* 1582, † 1637) zur Zusammenstellung der Loci theologici (Orte theologischer Erkenntnis, 1610–1622), eines umfassenden Verzeichnisses der Lehren des Luthertums nach dem Vorbild von Melanchthons aristotelischen Prinzipien. Zum zweiten behauptete Georg Calixt (* 1586, † 1656) kurz darauf, alle christlichen Konfessionen verkörperten im Kern dieselben grundlegenden Wahrheiten, und beteiligte sich daraufhin an einer Reihe von Konferenzen, die eine Wiedervereinigung der christlichen Kirchen herbeiführen sollten. Andere wiederum reagierten darauf mit der Entwicklung eines theologisch-philosophischen Systems des
36. Christliche Gemeinwesen: Protestantische Orthodoxie und Erneuerung
Luthertums, das ebenfalls auf aristotelischen Prinzipien beruhte. Ein Kernpunkt dieser Bemühungen war die These, Theologie sei eher eine praktische als eine spekulative Disziplin. Wie die Medizin der körperlichen Gesundheit des Menschen diene, so widme sich die Theologie der Gesundheit seiner Seele, da sie Zugang zu Wahrheiten besitze, die Ursprung und Wesen der Welt erklären könnten. Das wichtigste Werk, das die Synkretismuskontroverse hervorbrachte, die Calixts Schriften von den 1640er Jahren bis Ende der 1680er Jahre auslöste, war das zwölfbändige Systema locorum theologicorum (Zusammenstellung der Orte theologischer Erkenntnis), das Abraham Calov (* 1612, † 1686) aus Wittenberg 1655 bis 1677 herausbrachte. 7 Für orthodoxe Theologen stellten die Welle von Übertritten zum Katholizismus nach 1648, die Attraktivität des Kaiserhofs in Wien und die wiederholten Anläufe zu einer Wiedervereinigung der christlichen Konfessionen eine ebenso große Bedrohung dar wie alle Gefahren, denen das Luthertum im Jahrhundert vor 1648 gegenüberstand. Spätere Kritiker der Aufklärung und manche Historiker belächelten die Orthodoxie gern als dogmatisch, intolerant, engstirnig und entfernt von den Menschen, deren spirituelle Bedürfnisse sie nicht stillen konnte. In mancherlei Hinsicht trifft diese Sicht nicht zu. Zunächst war die Orthodoxie eine durchaus liberale Kirche. Verschiedene Universitäten entwickelten unterschiedliche Traditionen; selbst innerhalb der Fakultäten herrschte oft eine beträchtliche Vielfalt, da Ideen aus Debatten über Dissertationen oder als Reaktion auf theologische Anfragen entstanden. 8 Zum Zweiten spielten orthodoxe Theologen und Kleriker eine Schlüsselrolle in der Herausbildung einer lutherischen Geschichtsschreibung. Im späten 16. Jahrhundert entstanden wichtige Schriften zu Luthers Leben und der Historie der Reformation. Die Feier zu deren hundertstem Jahrestag 1617 – die erste »Hundertjahrfeier« überhaupt – trug ebenfalls zur Entwicklung einer historisch fundierten lutherischen Identität bei. 9 Damit begann eine Tradition solcher Gedenkfeiern, die sich 1630 und 1655 fortsetzte sowie 1717, 1730 und 1755 wiederholt wurde. Das hundertste Jubiläum des Westfälischen Friedens kam 1748 als weiterer Meilenstein hinzu und spielte eine Schlüsselrolle für die Stärkung des Zusammenhalts eines ansonsten »territorialisierten« Glaubens. Drittens entstand im späten 16. und 17. Jahrhundert eine Fülle von Erbauungsliteratur und Bibelexegesen für »gewöhnliche« Christen (die des Lesens mächtig waren). Zudem wurde die orthodoxe Theologie in Predigten popularisiert, die in der lutherischen Liturgie eine Schlüsselrolle spielten: Prediger wie Johann Balthasar Schupp (* 1610, † 1661) trugen signifikant zur Entwicklung der Tradition volkstümlicher, mundartlicher Predigten bei; ihr direkter, bisweilen derber Stil brachte mit schlagendem Witz kompromisslose Morallehren an den Mann. 10 Auch die Entstehung einer reichen musikalischen Tradition erweiterte das Spektrum des Luthertums. Luther selbst hatte zahlreiche Kirchenlieder verfasst, und sein Ein’
355
356
III. · Die deutschen Territorien um 1648–1760
feste Burg ist unser Gott wurde in den Jahren nach seinem Tod zu einem der populärsten Choräle im Gottesdienst wie für den Hausgebrauch. Den Höhepunkt im 17. Jahrhundert bildeten die Musik von Heinrich Schütz (* 1585, † 1672) und die Kirchenlieder von Paul Gerhardt (* 1607, † 1676), die beide streng orthodox waren. Ihre Fortsetzung fand die Tradition im 18. Jahrhundert durch Johann Sebastian Bach (* 1685, † 1750), Georg Philipp Telemann (* 1681, † 1767) und den Pastor Erdmann Neumeister (* 1671, † 1756), der eine große Anzahl von Kirchenliedern schrieb. Das lutherische Verständnis der Kommunion unterschied sich grundlegend vom katholischen Ritus und die Predigt spielte eine wesentlich wichtigere Rolle im Gottesdienst, aber die lutherische Liturgie behielt viele katholische Elemente bei, etwa die liturgischen Gewänder und bis etwa 1700 das lateinisch gesungene Eingangslied. 11 Solcherart verband die Orthodoxie hohe Theologie, volkstümliche Exegese, liturgische Traditionen mit vorreformatorischen Ursprüngen und einer Kultur der Frömmigkeit als Gruppe wie auch als Einzelner. Obwohl sie für ein Establishment stand, das viel zur Definition der lutherischen Identität beitrug, war die Orthodoxie von Furcht durchdrungen. Durch die sozialen Krisen und Kriege des Jahrhunderts vor 1648 war der Optimismus der frühen Generationen von Reformatoren verflogen, nun herrschte ein schleichendes Gefühl des Scheiterns. Ab dem späten 16. Jahrhundert reagierten viele Pastoren und Laien auf die anscheinend endlosen Bedrohungen durch Türken, Katholiken und Calvinisten mit apokalyptischen Visionen, die diese Heimsuchungen als Strafe Gottes für eine Gesellschaft betrachteten, die es nicht geschafft hatte, sich zu bessern. Das Rezept dagegen war für viele naheliegend: Der Klerus musste für eine moralische Wende sorgen, wo möglich mithilfe der Regierungsinstitutionen; viele Pastoren wie Schupp erkannten jedoch, dass die vordringlichste Aufgabe darin bestand, sich um die Moral der Fürsten und Magistraten selbst zu bemühen. Am Ende des Krieges wirkte der Klerus in vielen lutherischen Territorien an Kampagnen wie jener mit, die im November 1648 in Rostock gestartet wurde, um das moralische und geistliche Leben der Stadt zu reformieren. Der erste Schritt der Pastoren war die Exkommunikation eines Ehebrechers, in den folgenden zweieinhalb Jahrzehnten wetterten sie gegen die Sündhaftigkeit der Laien und proklamierten trotzig, es sei ihr Recht und ihre Pflicht, Sünder zur Ordnung zu rufen. 12 Für andere jedoch war diese Reformorthodoxie nur ein weiteres Beispiel für das Scheitern des lutherischen Establishments, das sich zu sehr auf Äußerlichkeiten konzentrierte. Erzwungene göttliche Disziplin machte aus Sündern keine Heiligen. Der Einsatz der Regierung als Mittel der Reform konnte keine echte Erneuerung ersetzen, die beim Einzelnen beginnen musste, um schrittweise eine neue Gemeinschaft wahrer Christen zu schaffen. Dies war der Anspruch von Philipp Jakob Spener (* 1635, † 1705), dem in Straßburg ausgebildeten Pastor in Frankfurt
36. Christliche Gemeinwesen: Protestantische Orthodoxie und Erneuerung
am Main, der 1670 damit begann, Gebetskreise in seinem Haus abzuhalten, und dessen Pia desideria (Fromme Sehnsüchte) von 1675, ursprünglich das Vorwort zu einer Predigtsammlung von Johann Arndt, zum Schlüsseltext des Pietismus wurde. 13 Spener stellte persönliche Frömmigkeit über Dogmen, gute Taten über formellen religiösen Gehorsam und das Studium der Bibel über den Dienst an der weltlichen Kirche: praktische Christlichkeit und Erneuerung der Kirche durch die spirituelle Wiedergeburt ihrer Mitglieder. Die Ursprünge von Speners Ideen waren Gegenstand vieler Debatten. Manche sahen sie in den niederländischen und deutschen Rufen des späten 17. Jahrhunderts nach einer »weiteren Reformation« oder einer »Reformation des Lebens«, andere im englischen Puritanismus. 14 Manche insistieren, der Pietismus sei bereits vor dem Dreißigjährigen Krieg entstanden (als Präpietismus), andere betrachten ihn als Reaktion auf die Verwüstungen des Krieges. Manche machten geltend, er habe sich ausschließlich in der lutherischen Kirche entwickelt, als Reaktion auf die dogmatische und rituelle Erstarrung infolge der Verankerung des Luthertums als Staatsreligion. Jüngeren Datums ist die These, die Vertreter der Reformorthodoxie hätten ein entscheidendes Beispiel gesetzt, das sich Spener und seine Nachfolger zum Vorbild genommen hätten. Manche betonen den Einfluss mystischer Spiritualisten wie Jakob Böhme (* 1575, † 1624) und Einzelgänger, etwa des Rosenkreuzers Johann Valentin Andreae (* 1586, † 1654) und seines weiten Kreises von lutherisch-calvinistischen Millenaristen, Pansophisten und Alchemisten. Spener selbst zollte Johann Arndt (* 1555, † 1621) Tribut, dessen Vier Bücher vom wahren Christentum (1606–1609) auf den mittelalterlichen und zeitgenössischen deutschen und spanischen Mystizismus zurückgriffen. 15 Obwohl er die Ideen jener bewunderte, die abseits der allgemeinen Strömungen standen oder von den Orthodoxen abgelehnt wurden, war Spener selbst kein Separatist. Er stellte sich eine »Kirche innerhalb der Kirche« (ecclesiola in ecclesia) vor, um einer besseren Welt auf Erden den Boden zu bereiten, die auf den Fall von Rom und die Konversion der Juden folgen würde. Diese Vision verschob den Schwerpunkt weg von den Lehren zur Gerechtmachung und Vorherbestimmung, die bis dahin die Grundlage des Luthertums gebildet hatten. Was Spener am meisten beschäftigte, war nicht das Jenseits, sondern die wirkliche Welt und ihre Verbesserung durch engagierte und wiedergeborene Christen. Spener fand viele Anhänger. Bald gab es pietische collegia, Schulungsgruppen und Konventikel in den meisten deutschsprachigen lutherischen Städten von Bern bis Hamburg und Stockholm. Spener selbst wurde 1686 zum Oberhofprediger in Dresden ernannt, ein Amt, das dem eines Primas der deutschen lutherischen Kirchen am nächsten kam. 16 Auch dort verbreiteten sich Konventikel, zuerst unter Studenten, dann auch unter Laien. Unter den Studenten waren August Hermann Francke (* 1663, † 1727) und Paul Anton (* 1661, † 1730), die zu Schlüsselfiguren
357
358
III. · Die deutschen Territorien um 1648–1760
der Gründung des Collegium Philobiblicum wurden und Speners Ideen in konkrete Projekte umsetzten. Das Establishment der Dresdner orthodoxen Lutheraner ergriff strenge Maßnahmen gegen Spener, eingefädelt von dem Leipziger Theologieprofessor Johann Benedict Carpzov (* 1639, † 1699), dessen eigene Ambitionen, Hofprediger zu werden, Spener durchkreuzt hatte. Hier wie anderswo wurde die Reaktion indes geschürt durch wachsende Sorgen wegen der Unabhängigkeit und des häretischen Potenzials der Konventikel. Zum Retter der Bewegung wurde der Kurfürst von Brandenburg, der Spener 1691 zum Propst von Sankt Nikolai in Berlin ernannte und seinen Freunden Schutz bot, vor allem Francke, der in Halle Professor für Griechisch und Hebräisch wurde. 1695 gründete Francke ein Waisenhaus, danach weitere Schulen und Institute, die er mit einer ehrgeizigen Palette kommerzieller Aktivitäten finanzierte. Als er 1727 starb, unterrichteten 175 Lehrer und Inspektoren etwa 2.200 Kinder und 250 Studenten erhielten als Assistenten Kost und Logis. Franckes wirtschaftliche Unternehmen, die er gemeinsam mit seinem Mitarbeiter Heinrich Julius Elers (* 1667, † 1728) betrieb, reichten vom Verkauf von in der eigenen Apotheke hergestellten Medikamenten bis zur Massenproduktion von Bibeln und religiöser Literatur in zahlreichen Sprachen. 17 Einen Großteil davon vertrieben Franckes eigene Missionare in Europa und in der Neuen Welt sowie in Missionsstationen wie die, die Francke in Zusammenarbeit mit der dänischen East India Company im südostindischen Tranquebar gegründet hatte. Als Francke Elers 1717/18 auf einer neunmonatigen Reise durch Süddeutschland begleitete, wurde er an Höfen und in Reichsstädten gefeiert. Überall wollte das Volk seine Ansichten zur Erneuerung des christlichen Lebens und der Frömmigkeit erfahren. Der Pietismus blieb jedoch umstritten und seine Rezeption hing stark von der Einstellung der Herrscher und Magistraten sowie von den örtlichen Gegebenheiten ab. Ohne die Unterstützung des brandenburgischen Kurfürsten wäre die Bewegung in den späten 1680er Jahren wohl untergegangen. Für die calvinistischen Herrscher in Berlin war der Pietismus eben deswegen attraktiv, weil er als volkstümliche lutherische Bewegung den Graben zwischen Lutheranern und Calvinisten zu überbrücken versprach und dadurch den Einfluss der orthodoxen lutherischen Kirche schwächte, die der Innenpolitik der Dynastie so oft im Weg stand. Das war einer der Gründe, weshalb auch Christian Thomasius die Pietisten unterstützte, wobei er sich anfangs auch für ihre Ideen zu einer inneren Erneuerung begeisterte. 18 Darüber hinaus versprachen die erzieherischen und ökonomischen Pläne, die die Pietisten in Halle entwickelten, zur Sicherung der Kontrolle der Hohenzollern über das ehemalige Erzbistum (inzwischen Herzogtum) Magdeburg beizutragen, das 1648 an Brandenburg gefallen war, aber erst 1680 tatsächlich in Besitz genommen werden konnte. Zu Beginn der Herrschaft Friedrich Wilhelms I. waren die Pietisten derart erfolgreich, dass der König bestrebt war, das
36. Christliche Gemeinwesen: Protestantische Orthodoxie und Erneuerung
disziplinierte christliche Pflichtgefühl, das Francke und seine Kollegen lehrten, auf sein ganzes Regierungssystem zu übertragen, vor allem, was die Ausbildung seiner Bürokraten und Soldaten anging. 19 Der Schutz, den Berlin bot, sicherte das Überleben des halleschen Projekts und die weitere Arbeit seiner missionarischen Netzwerke im Reich und außerhalb. Anderswo war die Wirkung eine andere und der Pietismus musste viele Fehlschläge wegstecken. In Württemberg konnte er sich nur mühsam gegen den anfänglichen Widerstand der streng orthodoxen Tübinger theologischen Fakultät etablieren. 20 Unter dem Einfluss pietistischer Lehrer wie Johann Albrecht Bengel (* 1687, † 1752) bildete das reformierte Luthertum indes schrittweise eine wesentliche Strömung der frühen Opposition gegen die absolutistischen und katholischen Bestrebungen der herrschenden Dynastie. 1743 schließlich erkannte auf Druck des pietistisch gesinnten Juristen Johann Jacob Moser und anderer ein Edikt die Konventikel ausdrücklich als legitime religiöse Versammlungen an. 21 Zwar löste sich die Solidarität des württembergischen Pietismus nach der offiziellen Anerkennung auf und manche wandten sich gänzlich von der Politik ab, dennoch blieb das Territorium die einzige deutsche Region, wo sich der Pietismus bis ins 20. Jahrhundert halten konnte. Ohne fürstlichen Schirmherrn und gemeinsame politische Sache entfaltete der Pietismus in verschiedenen lutherischen Territorien überhaupt keine Wirkung. 22 Dies gilt besonders für Gegenden, wo es nötig war, eine geschlossene Front gegen die reformierte Kirche und die Bedrohung durch den Synkretismus oder den Einfluss Brandenburg-Preußens zu bilden. In den Herzogtümern Bremen und Verden etwa, dem Hinterland der reformierten Reichsstadt Bremen, bemühten sich zuerst die Schweden und ab 1712 die Hannoveraner sehr um Unterstützung des orthodoxen Establishments. Im benachbarten Oldenburg, das an Ostfriesland grenzte, wo es lutherische Herrscher mit pietistischen Neigungen und eine starke reformierte Kirche gab und wo ab den 1680er Jahren Preußen militärisch präsent war, was 1744 zur preußischen Übernahme führte, förderten die dänischen Autoritäten ebenfalls die Orthodoxie, in krassem Gegensatz zu den pietistischen Tendenzen der dänischen Krone selbst. Im Kurfürstentum Hannover lehnte Georg II. den Pietismus konsequent ab, mit der Begründung, seine Vertreter seien praktisch sämtlich in Halle ausgebildet und somit mögliche Agenten des Hauses Brandenburg sowie Mitglieder einer einzigen antikirchlichen Sekte, der auch alle anderen Arten von Ketzerei angehörten, die der Protestantismus seit der Reformation hervorgebracht habe. Antipathie gegen den Pietismus herrschte auch im lutherischen HessenDarmstadt und im reformierten Hessen-Kassel: Die verfeindeten Dynastien dort wollten sich nicht in den Sumpf des Synkretismus oder irgendwelcher anderen religiösen Fanatismen hineinziehen lassen, die die konfessionellen Unterschiede zwischen ihren Territorien aufweichen konnten.
359
360
III. · Die deutschen Territorien um 1648–1760
In Anbetracht der urbanen Ursprünge von Speners Bewegung mag die Feindseligkeit vieler Reichsstädte gegen den Pietismus überraschen. In Hamburg, Frankfurt am Main, Nürnberg und einer Reihe kleinerer Städte unterstützten jedoch die Stadträte den Klerus in einem oft als verzweifelt dargestellten Kampf gegen religiöse Neuerungen. Dies waren die Zentren, in denen Spener über ein Netzwerk enger Verbindungen verfügte, und darunter fanden sich viele Orte, in denen Francke auf seiner Reise durch Süd- und Mitteldeutschland 1717/18 so warm empfangen wurde. In all diesen Zentren übernahm die Orthodoxie letztlich viele der Methoden und Ansichten des Pietismus, obwohl die Pietisten selbst besiegt worden waren. Hamburg war ein Spezialfall, aber in diesem Kontext wichtig, weil es eine Art Zion der Orthodoxie wurde und das übrige lutherische Deutschland stark beeinflusste. Hier verband sich das Thema Pietismus mit einem dauernden konstitutionellen Konflikt zwischen Senat und Bürgerschaft zwischen 1648 und 1712. 23 Das politische Problem war die Autorität des Senats, die von der Bürgerschaft und den von den Diakonen der fünf Stadtpfarreien ernannten intermediären Körperschaften infrage gestellt wurde. Die Verflechtung von politischem System und Pfarrverwaltung verlieh dem Klerus beträchtlichen politischen Einfluss, weil seine Stellung nicht durch irgendein Konsistorium geregelt war und er im Grunde unabhängig agieren konnte, nur vage konstituiert durch ein Ministerium, das ein weitgehend machtloser Senior leitete. Die Ernennung von Speners Freunden Anton Reiser (1679) und Johannes Winckler (1684) sowie seines Schwagers Johann Heinrich Horb (1685) schien auf eine pietistische Übernahme der Stadt hinzudeuten. Reiser wurde jedoch 1686 durch den strengen Orthodoxen Johann Friedrich Mayer versetzt, was zu einer offenen Konfrontation führte. Der Grund der Streitigkeiten war oft schwer zu durchschauen. Die Pietisten führten eine erbitterte Kampagne gegen die 1678 in der Stadt gegründete Oper. Deren Initiatoren waren auswärtige Diplomaten, die Schirmherrschaft übernahmen jedoch Mitglieder der städtischen Elite, von denen viele auch die Pietisten unterstützten oder zumindest mit ihnen sympathisierten. Auf der Tagesordnung stand gleichzeitig die Duldung der Reformierten, wofür der Senat vorsichtig plädierte, während die intermediären Körperschaften, die Gilden und der Klerus und vor allem die Orthodoxen strikt dagegen waren. Paradoxerweise fochten die Orthodoxen zugleich öffentlich gegen die Argumente der Pietisten gegen die Oper, sorgten sich jedoch auch um das Engagement der städtischen Elite für die lutherische Orthodoxie und fürchteten, die neuen Ideen könnten indifferente Haltungen fördern und für eine Verbreitung dessen sorgen, was der orthodoxe Pastor Erdmann Neumeister später als »politischen Antichristen« bezeichnete. 1693 führte der Konflikt innerhalb des Klerus zu Ausschreitungen, die Horb aus der Stadt vertrieben. Pietistische Collegia wurden verboten, Luthers Katechismus zur aus-
36. Christliche Gemeinwesen: Protestantische Orthodoxie und Erneuerung
schließlichen Basis aller religiösen Lehren erklärt. Die Verbindung zwischen dem orthodoxen Klerus und der Kommunalpolitik blieb stark, als die Stadt 1708 in die totale Anarchie stürzte. Die durch eine kaiserliche Kommission vermittelte und 1712 bekannt gemachte Verfassung, in der die Macht geteilt wurde, bestätigte das Luthertum als Basis der Bürgerschaft und so blieb die Hamburger Kirche bis in die 1760er Jahre beherrscht von der Orthodoxie. In Frankfurt war der Schlüsselfaktor die strikte Trennung zwischen Luthertum und Reformierten. Das lutherische Establishment war entschlossen, die reformierte Gemeinschaft der Kaufleute von jeder politischen Teilhabe auszuschließen. Speners zwanzigjähriges Wirken in der Stadt hatte tiefe Eindrücke hinterlassen und wirkten nachhaltig auf Gottesdienstpraxis und Bildungswesen. Seine Nachfolger blieben jedoch allem gegenüber skeptisch, was den von Spener geförderten Konventikeln ähnelte. Spätere Führungsgestalten wie Johann Philipp Fresenius (Pastor ab 1743 und Senior 1748–1761) standen ebenfalls unter Franckes Einfluss, hielten jedoch an der Orthodoxie fest und waren unermüdliche Widersacher des Calvinismus und Zinzendorfs Herrnhuter Brüdergemeine, die sich in der Nähe der Stadt ansiedelte. 24 In Straßburg, das 1681 an Frankreich fiel, hielt der Kampf gegen katholische Infiltration und für die Bewahrung der lutherisch-deutschen Universität die Stadt als Ganze im Griff der Orthodoxie. 25 In Franken und den südlichen Reichsstädten – neben Nürnberg auch in kleineren Städten wie Windsheim, Rothenburg und Schweinfurt – übten Pietisten ebenfalls starken Einfluss aus. 26 Ihre Ideen und Taten bereicherten die Orthodoxie, ohne jedoch die vorherrschenden Strömungen und die grundsätzliche Verpflichtung auf die orthodoxe Tradition zu verändern. Erst in den 1750er Jahren geriet die orthodoxe Stellung ins Wanken. 1690 erhöhte das orthodoxe Lager in Hamburg den Einsatz mit der Forderung, alle Angehörigen des Geistlichen Ministeriums müssten eine öffentliche Erklärung gegen Chiliasmus und »Fanatiker« wie Jakob Böhme sowie »alle Neuerung, sie habe Namen, wie sie wolle, ob sie gleich das Ansehen gewinne der Verbesserung des Christenthums«, unterschreiben. 27 Ähnliche Töne begleiteten auch anderswo die antipietistischen Maßnahmen. In Hamburg war die »demokratische« die orthodoxe Partei, aber anderswo fürchteten städtische Magistrate und Herrscher die Umsetzung der demokratischen Prinzipien pietistischer Kollegien in politische Forderungen: Kirchenzucht und politische Macht. In vielen Fällen wurden die Ängste in polemischer Absicht aufgebauscht, aber dass es Separatismus gab, steht außer Zweifel. Tatsächlich entstand aus Speners erstem Hauskreis der separatistische Saalhofkreis, der nach dessen erstem Besuch in Frankfurt 1677 Kontakte zu William Penn pflegte, 15.000 Acre Land in Pennsylvania erwarb und 1683 die Gründung von Germantown finanzierte. 28 Die Entwicklung der Frankfurter Saalhofgemeinde macht die Bedeutung des Separatismus klar. Ihre Mitglieder waren zunächst Pietisten. Eines ihrer prominen-
361
362
III. · Die deutschen Territorien um 1648–1760
ten Mitglieder, der Jurist Johann Jakob Schütz (* 1640, † 1690), hing der mittelalterlichen Mystik an und war tief geprägt von den Lehren des calvinistischen Separatisten Jean de Labadie (* 1610, † 1674), der die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist über das Bibelstudium stellte und lehrte, Wiedergeborene bräuchten die etablierten Kirchen nicht. 29 Die Abkehr der Saalhofgruppe von der offiziellen Kirche forcierten die schwärmerischen Vorstellungen und pietistischen Bekehrungspraktiken von zwei ihrer Mitglieder, Johanna Eleonora von Merlau und Maria Juliana Baur von Eyseneck, die den Kreis gemeinsam initiiert hatten. Teilnehmer der spirituellen Odyssee war auch der Theologiestudent Johann Wilhelm Petersen, den Merlau 1680 heiratete; die Trauung vollzog Spener. Das religiöse Leben im Saalhof erregte einiges Aufsehen durch Publikationen wie die 1681 von Schütz besorgte Ausgabe der Predigten von Johannes Tauler und sein anonym veröffentlichter Diskurs zur Frage, ob die Auserwählten einer offiziellen Gemeinde oder Kirche angehören müssen. Es gab auch eine Verbindung zu den Quäkern, den Philadelphiern und den religiösen Hoffnungen der nordamerikanischen Kolonien. Letztlich war die Saalhofgruppe nicht von Dauer. Schütz starb 1690, Petersen hatte mit seiner Frau die Stadt längst verlassen, 1688 wurde er Superintendent in Lüneburg. Zu den Gruppen und Einzelnen, die aus dem Saalhof hervorgingen, ließen sich zahlreiche andere hinzufügen: Jakob Böhme, der vielgestaltigste aller deutschen Mystiker, den Hegel als »ersten deutschen Philosophen« bezeichnete, Johann Arndt (vor allem seine Vier Bücher vom wahren Christentum mit fünfundneunzig deutschen Auflagen allein bis 1740), die katholischen Quietisten Miguel de Molinos (* 1628, † 1697) und Madame Guyon (* 1648, † 1717), die flämische Mystikerin Antoinette Bourignon (* 1616, † 1680), der kartesianisch-hugenottische Mystiker Pierre Poiret (* 1646, † 1719), der Werke von Guyon und Bourignon herausgab, die englischen Böhmisten John Pordage (* 1607, † 1681) und Jane Leade (* 1624, † 1704), die englischen Philadelphier und nicht zuletzt die während der blutigen Niederschlagung des Kamisardenaufstands 1702–1705 geflohenen französischen Hugenotten-»Propheten«. Deren Berichte von den wunderlichen prophetischen Trancezuständen der Kinder der Cevennen zogen ähnliche Vorfälle bis im weit entfernten Schlesien nach sich und spornten Erweckungsbewegungen in der Schweiz, Deutschland und den Niederlanden an. Die Liste ließe sich noch lang fortsetzen. 30 Viele der erwähnten Referenzen finden sich auch in der intellektuellen und religiösen Weltsicht von Spener und Francke wieder. Der entscheidende Unterschied ist, dass sie ausdrücklich innerhalb der offiziellen Kirche blieben. Angefangen mit Leuten aus Speners eigenem Kreis, entfernten sich viele andere von dieser oder traten ganz aus. Dies begann oft mit Erlebnissen religiöser Ekstase, Visionen (vor allem bei Frauen) und (bei vielen Laien und Frauen) Predigten in der »Sprache Kanaans«, der von biblischen Referenzen und Zitaten geprägten Redeweise der englischen und amerikanischen Puritaner. 31 Intensiviert wurden solche Ausbrüche
36. Christliche Gemeinwesen: Protestantische Orthodoxie und Erneuerung
durch die Erwartung des bevorstehenden Weltendes, für das Vorbereitungen getroffen werden mussten. Von den späten 1680er Jahren an richtete sich der Blick auf die kommende Jahrhundertwende, deren Nahen für erhöhte Aktivitäten sorgte. 32 Zwei Gestalten sind in Zusammenhang mit diesen radikalen Tendenzen besonders wichtig: Johann Wilhelm Petersen (* 1649, † 1726) und Gottfried Arnold (* 1666, † 1714). Nachdem er Frankfurt verlassen hatte, wirkte Petersen zehn Jahre als Hofprediger und Superintendent im Fürstbistum Lübeck. 33 Kurz nach seinem Amtsantritt als Superintendent in Lüneburg führten seine unorthodoxen Ansichten jedoch zu einer Untersuchung. Die offiziellen Befürchtungen verstärkten sich, als die Visionärin Rosamunde Juliane von Asseburg nach Lüneburg kam, eine der vielen Prophetinnen, die 1691 für Aufsehen sorgten. 1692 wurde Petersen seines Amtes enthoben. Seine Frau und er fanden Zuflucht auf einem Anwesen bei Magdeburg, das ihnen der Kurfürst von Brandenburg zur Verfügung stellte und wo er sich mit Unterstützung großzügiger Gönner der Abfassung zahlreicher theologischer Werke widmete. Als Arnold 1688 Spener kennenlernte, war er bereits sehr versiert in früher Kirchengeschichte und mystischer Tradition. 34 Seine hingebungsvolle Suche nach den Wurzeln wahren Glaubens, für die er der Ehe abschwor und den Priesterstand mied, mündete in seine monumentale dreibändige Unparteyische Kirchen- und Ketzer-Historie (1699–1703), die den langfristigen Verfall der Kirche seit dem 1. Jahrhundert nachzeichnet und die lange Tradition von Spiritismus und Mystik als Geschichte des wahren Glaubens entgegenstellt. Bezeichnenderweise endet Arnolds Historie im Jahr 1688, weshalb Johann Georg Gichtel (* 1638, † 1710) lobend feststellte, Arnold habe »eine klugmütige That gethan, sich nicht allein aus der Aegyptischen Sclaverey Pharaonis (nemlich des Welt-Geistes) heraus zu ziehen, sondern auch das greuliche Thier mit der Huren aufzudecken«. 35 Thomasius hielt Arnolds Werk »nach der heiligen Schrift für das beste und nützlichste Buch«, die Orthodoxen aber verurteilten es als Häresie und Volksverhetzung. Überraschenderweise wandte sich Arnold selbst gleichzeitig von der geistlichen Liebe zu Böhmes androgyner »göttlichen Sophia« ab und heiratete, ließ sich zum Priester weihen und wurde Schlosspfarrer im thüringischen Allstedt. Da er sich weigerte, den Eid auf die Konkordienformel zu leisten, musste er 1705 nach Brandenburg ziehen, wo ihn der König 1702 zum Hofhistoriografen ernannt hatte. Schließlich wurde er Superintendent in Perleberg und verfasste unter dem Schutz des Königs bis zu seinem Tod 1714 weiterhin pietistische Schriften. Die weite Verbreitung der Werke von Petersen und Arnold genoss offenbar das Wohlwollen vieler Herrscher, die die Einwände des orthodoxen Klerus verwarfen. Sie dienten auch als wichtige Quelle der Inspiration und Motivation für die zahlreichen Gruppen von christlichen Erneuerern, die von Schleswig-Holstein
363
364
III. · Die deutschen Territorien um 1648–1760
bis hinunter nach Württemberg aktiv waren. Manche nannten sich (nach Psalm 35:20) »die Stillen im Lande«. 36 Andere gerieten in Konflikt mit den Kirchenautoritäten und wurden sogar von den »offiziellen« Pietisten abgelehnt und viele Gruppen florierten einige Zeit in der Oase, die ihnen einige der kleinen Grafschaften der Wetterau nördlich von Frankfurt boten. Unter den überwiegend reformierten Herrschern von Hanau, Nassau, Solms, Stolberg, Wied, Sayn-Wittgenstein und Ysenburg beließen es einige nicht bei lediglich merkantilistischer Populationspolitik. In Wied hatte Graf Friedrich III. († 1698) 1680 ein Toleranzedikt erlassen, das weit über den Westfälischen Frieden hinausging. Auch seine Nachfolger betrieben eine außerordentlich liberale Politik. 37 In Ysenburg-Büdingen erließ Graf Ernst Casimir (1693–1749) 1712 ein Dekret, das allen Gewissensflüchtlingen Asyl zusicherte, wenn sie bereit waren, eine Wohnsitzgebühr zu bezahlen, sich durch Arbeit zu ernähren und sich ehrbar und christlich zu verhalten. 38 In Sayn-Wittgenstein-Berleburg nahmen Gräfin Hedwig Sophie (1694–1712) und Graf Johann Casimir (1712–1741) ebenfalls religiöse Radikale und Freidenker jeder Art auf. Am Hof des nahegelegenen Laasphe unterhielt ihr Verwandter, Graf Heinrich Albert von Sayn-Wittgenstein-Hohenstein (1701– 1723), eine Anzahl kleiner Gemeinden, darunter die kuriose quietistische Blockhüttengruppe des hugenottischen Marquis de Marsay und seiner Begleiter, die dort ein schlichtes Leben bei Arbeit und Gebet führten. 39 Diese »frommen Grafen« waren vielfach verwandt mit Adelsfamilien im Reich bis Sachsen und Thüringen, und viele, etwa die Wittgensteins, dem Haus Brandenburg durch Heirat beziehungsweise Dienst eng verbunden. Ihre neue Rolle als Unterstützer der nonkonformistischen Diaspora war weit weniger dramatisch als ihre vorhergehende Verwicklung in den niederländischen Aufstand und die Krise, die dem Dreißigjährigen Krieg vorausging, für die Entwicklung der deutschen Gesellschaft aber möglicherweise ebenso wichtig. In der Wetterau kamen alle möglichen Gruppen zusammen. 40 1699 versammelten sich am Hof Solms-Laubach schwärmerische Spiritualisten, die die organisierte Kirche abschaffen und in Erwartung des Weltendes im folgenden Jahr eine überkonfessionelle Kirche ohne Priester errichten wollten. Ende 1700 lösten sie sich wieder auf und bildeten neue Zusammenschlüsse. 41 1703–1705 gewährte Wittgenstein der berüchtigten Buttlarschen Rotte Zuflucht, einer Sekte um Eva von Buttlar (* 1670, † 1721) und zwei Gefährten, die sich als Heilige Dreifaltigkeit bezeichneten und eine Form der sexuellen Religion praktizierten, die selbst in der liberalen Wetterau für Skandale sorgte. Nach ihrer Ausweisung und Buttlars Übertritt zum Katholizismus versuchten sie sich in der Paderborner Enklave Lügde anzusiedeln, ein dauerndes Refugium fanden sie jedoch erst in der heterodoxen holsteinischen Stadt Altona bei Hamburg, wo die Kommune bis zu Buttlars Tod lebte. 42
36. Christliche Gemeinwesen: Protestantische Orthodoxie und Erneuerung
Beständiger war eine Separatistengruppe unter Führung von Alexander Mack (* 1679, † 1735), die sich in Schwarzenau in Wittgenstein niederließ und Elemente der Wiedertäuferbewegung aufgriff, was ihnen den Spitznamen Tunker einbrachte. Ihre Mitglieder emigrierten zwischen 1719 und 1733 in den Süden von Pennsylvania und gründeten Kirchen, die heute noch bestehen. In Ysenburg-Büdingen erfuhren der Prediger Eberhard Ludwig Gruber (* 1665, † 1728) und der Sattler Johann Friedrich Rock (* 1678, † 1749), beide 1706/07 aus Württemberg ausgewiesen, die Gabe der »wahren Inspiration« von Leuten, die in direktem Kontakt mit exilierten Hugenottenpropheten aus den Cevennen gestanden hatten. Mit dem Liebesmahl am 16. November 1714 trat die neue Bewegung der Inspirierten ins Leben, die als Freikirche in der Region aktiv blieb, bis die gesamte Gemeinde 1842 in die USA auswanderte. 43 In Berleburg gewährte Graf Johann Casimir auch dem radikalen Pietisten Johann Konrad Dippel (* 1673, † 1734) Asyl, förderte das Erscheinen der ersten pietistischen Zeitschrift, Geistliche Fama (1730–1744), und arbeitete mit dem Straßburger Flüchtling Johann Heinrich Haug, dem Spinozisten Johann Christian Edelmann und anderen an der Berleburger Bibel (8 Bände, 1726–1742). 44 Dieser Meilenstein der Bibelwissenschaft gründete auf Heinrich Horches Werk Mystische und prophetische Bibel sampt Erklärung der Sinnbilder und Weissagungen (Marburg 1712) und erforschte die wörtlichen, spirituell-moralischen und geheimen Bedeutungen des Texts, um seine »innere« Botschaft zu deuten. 45 Die Wetterau war auch Schauplatz einer wichtigen Stufe in der Entwicklung von Graf Nikolaus von Zinzendorfs Herrnhuter Brüdergemeine, die enorme Wirkung im Reich, in Großbritannien und den amerikanischen Kolonien entfaltete. 46 Ihre Ursprünge lagen in den unterdrückten protestantischen Gemeinden von Böhmen und Schlesien und den Bemühungen der Protestanten in den benachbarten Gebieten Sachsen, Sachsen-Lausitz und Brandenburg, ihnen Kircheneinrichtungen auf sicherem Boden zur Verfügung zu stellen und mittels Missionen wie der »Gnadenkirche« der halleschen Pietisten in Teschen für sie zu sorgen. Zinzendorf selbst entstammte einer Familie österreichischer Flüchtlinge in Sachsen mit starken Verbindungen zum sächsischen Adel und zu den frommen thüringischen Grafen von Reuß, die sich ab 1600 der Konkordienformel verschrieben hatten, aber ihre eigene flexible lokale Auslegung des lutherischen Glaubens pflegten. 47 Zinzendorfs Schulzeit in Halle, wo er beim Abendessen Berichte von Missionaren aus Ostindien hörte, hinterließ einen bleibenden Eindruck, ebenso wie Begegnungen mit Pietisten und Orthodoxen während seines Jurastudiums in Wittenberg. Auf Reisen in die Niederlande und nach Paris 1719/20 knüpfte er ein weites Netzwerk von Kontakten zu Reformierten und Katholiken, etwa zu Kardinal Louis-Antoine de Noailles (* 1651, † 1729), mit dem er regelmäßig korrespondierte.
365
366
III. · Die deutschen Territorien um 1648–1760
Nachdem er durch die Heirat mit einer Gräfin von Reuß-Ebersdorf 1722 zu Geld gekommen war, kaufte Zinzendorf das Gut Mittelberthelsdorf in der Oberlausitz, um eine philadelphische Gemeinde zu gründen. Zu Anfang siedelten sich etwa 300 deutschsprachige Mähren und andere Flüchtlinge unter Leitung des katholischen Apostaten Christian David (* 1691, † 1751) in der neuen Gemeinde Herrnhut an. 1727 geriet die Gemeinde durch die Visionen eines elfjährigen Mädchens in den Sog der Erweckungsbewegung. Zinzendorf bemerkte bald die Ähnlichkeit zwischen den von ihm formulierten Gemeinderegeln zur Wiederherstellung der Ordnung und den alten Lehren der Hussiten, und so gelang es ihm, die mährischen Siedler zu überzeugen, sie erneuerten in Wahrheit die Tradition der hussitischen Böhmischen Brüder. Da Luther selbst die Böhmen gepriesen hatte, hoffte man, einer Erneuerung ihrer Bruderschaft werde Herrnhut davor bewahren, von den Orthodoxen als häretisch verurteilt zu werden. 48 Obwohl Zinzendorf also nicht als Separatist begann, führten die Notwendigkeit, die rasche Entwicklung in Herrnhut unter Kontrolle zu behalten, und sein turbulentes Verhältnis zu Halle bald zum Konflikt. 1734 wurde er zum lutherischen Pastor ordiniert und von Comenius’ Enkel, dem Berliner reformierten Hofprediger und Bischof der Böhmischen Brüder in Polen, Daniel Ernst Jablonski (* 1660, † 1741), zum Bischof geweiht. Halle wollte dennoch nichts mit ihm zu tun haben. 1737 musste er Sachsen verlassen, zumindest teilweise infolge des Drucks, den die Habsburger im Zuge der Salzburger Krise auf die sächsische Regierung ausübten, indem sie behaupteten, Zinzendorf werbe ihre Untertanen ab. Im Jahr darauf konnte Zinzendorf den größten Teil seiner Organisation in Herrnhaag in der Wetterauer Grafschaft Ysenburg-Büdingen neu gründen. Abgesehen von der launischen, dominanten und streitsüchtigen Persönlichkeit des Grafen selbst hatte auch die außerordentlich rührige missionarische Tätigkeit der Brüder in Halle Argwohn erregt. In den 1730er Jahren entsandten sie Missionare in die Karibik, nach Grönland, Lappland, Surinam und Südafrika, gründeten eine Gesellschaft in London und Siedlungen in Georgia, Delaware und Pennsylvania. In Dänemark und Schweden waren sie verboten, Friedrich Wilhelm I. hingegen gestattete die Ansiedlung von Kommunen in seinen Ländereien. Der organisatorische und kommerzielle Erfolg, aber auch Exzesse von religiöser Schwärmerei und Streitigkeiten mit bestehenden Gruppen wie den Inspirierten sorgten bald auch in Herrnhaag für Probleme. Als Graf Ernst Casimirs Nachfolger Gustav Friedrich (1749–1768) verlangte, die Brüder sollten ihm einen Treueeid leisten, weigerten sie sich und wurden ausgewiesen. Zinzendorf selbst verbrachte sechs Jahre in London und kehrte dann auf seine Familiengüter in der Oberlausitz zurück, wo ein kleiner Ableger der Brüdergemeine überlebt hatte. Das administrative Zentrum der Kirche von 1748 bis 1808 war jedoch Barby in Sachsen, östlich von Magdeburg, wo Zinzendorfs Schwager, Graf
36. Christliche Gemeinwesen: Protestantische Orthodoxie und Erneuerung
Heinrich XXIX. von Reuß-Ebersdorf, den Brüdern die Burg vermietete. Die Siedlungen und Gemeinden in diversen Ländern entwickelten sich weiter, aber die Herrnhuter Brüdergemeine brauchte Jahrzehnte, um sich aus dem finanziellen Chaos zu befreien, in das Zinzendorfs ehrgeizige Pläne sie gestürzt hatten. Spätere Generationen betrachteten die letzten Jahre in Herrnhaag rückblickend als eine »Zeit der Sichtung«. 49 Folgerichtig wurden viele zinzendorfsche Eigenheiten schrittweise abgelegt, während sein Nachfolger August Gottlieb Spangenberg (* 1704, † 1792) die verstreuten Siedlungen unter einen Hut zu bringen versuchte und in Idea Fidei Fratrum oder kurzer Begrif der Christlichen Lehre in den evangelischen Brüdergemeinen (1779) eine abgemilderte Version von Zinzendorfs Theologie zusammenfasste. Das Wetterauer Schutzgebiet war von reformierten Fürsten geschaffen worden, auch die reformierten Herrscher von Brandenburg-Preußen unterstützten zeitweise viele der dortigen Gemeinden und wichtigen religiösen Gestalten. Neben politischen Erwägungen zeigte sich darin, wie sehr der strenge Pietismus die reformierten Kirchen ganz allgemein geprägt hatte. 50 In dieser Hinsicht fällt es oft schwer, Lutheraner und Reformierte zu unterscheiden: Viele radikale Pietisten pendelten zwischen den beiden Konfessionen und bemühten sich verschiedentlich, sie zusammenzuführen; der Philadelphianismus beruhte auf der Idee der Vereinigung aller Glaubensrichtungen zur Einleitung des Tausendjährigen Reichs. Es war ein Lutheraner, Hochmann von Hohenau (* 1670, † 1721), der den reformierten Elberfelder Textilfabrikanten Elias Eller (* 1690, † 1750) zur Gründung der Ronsdorfer Sekte der Zioniten anregte. 51 Andererseits blieb die Ronsdorfer Gemeinde wie andere reformierte pietistische Gruppen Teil der Kirche und wurde lediglich 1750–1765 kurzzeitig ausgeschlossen. Insgesamt waren die reformierten Kirchen noch dezentraler organisiert als die lutherischen. Sie verfügten über starke kommunale Strukturen und es gab kaum ein Establishment, gegen das man aufbegehren musste. Zudem ging die Tradition von Konventikeln und Hauskreisen als Ergänzung zum sonntäglichen Gottesdienst zumindest in den Niederlanden bis ins späte 16. Jahrhundert zurück und ließ sich leicht auf die deutschen Territorien übertragen. Auch die Idee einer »weiteren Reformation« (nadere reformatie) entstand vor 1600. Nach 1648 standen die reformierten Gemeinden der nordrheinischen Territorien Kleve und Mark unter brandenburgischer Herrschaft; das Recht der reformierten Gemeinden auf Selbstherrschaft wurde bestätigt und die Gründung der reformierten Universität Duisburg 1655 stärkte ihre Stellung. Zugute kam den reformierten Gemeinden der Region auch die Unterstützung des Kurfürsten für seine Cousine Elisabeth von der Pfalz als Fürstäbtissin von Herford in Ravensberg (1667–1680), wo Jean de Labadie 1670–1672 Zuflucht fand und wo sie Besucher wie 1677 William Penn und Robert Barclay willkommen hieß. 52 Auch die Übernahme weiterer kleiner Territorien wie
367
368
III. · Die deutschen Territorien um 1648–1760
der westfälischen Grafschaften Lingen (1702) und Tecklenburg (1707) sicherte dem reformierten Pietismus neue Stützpunkte. All diese frühen Entwicklungen trugen zur Entstehung einer reformierten Erweckungsbewegung bei, lange bevor Spener seine Arbeit in Frankfurt aufnahm. Der wichtigste neue Ansatz, angeregt von Jean de Labadie, waren ab 1661 die Predigten von Theodor Undereyck (* 1635, † 1693) in Mülheim an der Ruhr. 53 Seine Arbeit setzten Schüler wie Friedrich Adolf Lampe (* 1683, † 1729) in Kleve und Duisburg (1703–1709) und vor allem Gerhard Tersteegen (* 1697, † 1769) fort, dessen dreibändige Auserlesenen Lebensbeschreibungen Heiliger Seelen (1733– 1753) fünfundzwanzig katholische Mystiker (hauptsächlich der Gegenreformation) als Vorbilder für fromme Reformierte vorstellten. Dieselben Figuren trieben offenbar auch pietistische Bewegungen in Hessen-Kassel, Emden, Ostfriesland, den diversen brandenburgischen Besitzungen und Bremen an, obwohl in letzterem Fall der Stadtrat wie seine Pendants in den lutherischen Reichsstädten streng gegen jeden Anflug von Separatismus vorging. In all diesen Gegenden begründete die reformierte Erweckungsbewegung des 17. und frühen 18. Jahrhunderts Traditionen, die lange über das Ende des Reichs hinaus wirksam blieben. Zu Feindseligkeiten zwischen Reformierten und Lutheranern kam es auch weiterhin regelmäßig, besonders zwischen den Orthodoxen beider Lager; man stritt über dogmatische Fragen und den Besitz und die Benutzung von Kirchen unter den Bedingungen des Westfälischen Friedens. Die gleichzeitige Erneuerung beider Glaubensrichtungen bereitete indes den Boden für die verschiedenen Vereinigungen und Zusammenschlüsse im Lauf des 19. und 20. Jahrhunderts.
Anmerkungen 1 Mayes, Christianity, 207–337. 2 Ward, Awakening, 58. 3 Schindling und Ziegler, Territorien III, 98–101; vgl. auch Spohnholz, Tactics, eine Studie zur Situation in Wesel im Herzogtum Kleve. 4 Ward, Awakening, 200–203; Ehrenpreis, Konfessionskonflikte, 85–97. 5 Strom, Orthodoxy, 65–81; Whaley, »Obedient Servants?«. 6 TRE XXV, 464–485, bietet einen guten Überblick, ebenso Gawthrop, Pietism, 80–103. 7 Maurer, Kirche, 7 f. 8 Appold, Orthodoxie, 3 f., 310 f. 9 Leppin, »Memoria«. 10 Schauer, Schupp, 48–62. 11 Hartmann, Kulturgeschichte, 117–120; Geschichte des Pietismus I, 188–194. 12 Strom, Orthodoxy, 85–100; Geschichte des Pietismus I, 166–187. 13 Die umfassendste Darstellung zum Pietismus bietet das Werk Geschichte des Pietismus;
36. Christliche Gemeinwesen: Protestantische Orthodoxie und Erneuerung
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
47 48
den besten kurzen Überblick liefert Wallmann, Pietismus; vgl. hierzu auch: Ward, Christianity, 74–82; Ward, Awakening, 57–63; Gawthrop, Pietism, 104–49. Greyerz, Religion, 122–127; Wallmann, Pietismus, 28–32, 48 f. Wallmann, Pietismus, 32–44. Ward, Christianity, 77. Böhme, »Elers«; Gawthrop, Pietism, 176–193; Ward, Awakening, 61 ff.; Geschichte des Pietismus IV, 584–591. Ahnert, Religion, 14 f. Gawthrop, Pietism, 200–269; Fulbrook, Piety, 164–173. Ebd., 130–152; Lehmann, Pietismus, 22–94; Maurer, Kirche, 27 f.; Wallmann, Pietismus, 204–235. Vgl. zu Moser S. 206–210. Vgl. zum Folgenden Ward, Awakening, 207–210, 212–216, und, wesentlich detaillierter, die regionalen Überblicke in Geschichte des Pietismus II, 198–471. Rückleben, Niederwerfung, 50–131; Whaley, Toleration, 13–34. ADB VII, 353 f.; Bautz, Kirchenlexikon II, 119 f.; Schindling, »Wachstum«, 253–259. Ward, Awakening, 217. HBayG III, 421 ff., 1005 f. Whaley, Toleration, 31; vgl. Rückleben, Niederwerfung, 379–80. Schindling, »Wachstum«, 258; Goertz, Bewegungen, 47 f. Ward, Awakening, 204 ff.; Wallmann, Pietismus, 137–143. Ward, Awakening, 47–52. Geschichte des Pietismus I, 400 ff., und IV, 404–427; sie beruhte auf dem Glauben, die Bibel liefere die Wörter und Bilder, die es allen Christen ermöglichen werde, im Tausendjährigen Reich nach der Wiederkunft Christi dieselbe Sprache zu sprechen. Ebd., 400 f., 406–421. Bautz, Kirchenlexikon VII, 267–273; ADB XXV, 508–515; Wallmann, Pietismus, 143–151; Geschichte des Pietismus I, 402–405, und II, 114 f. Bautz, Kirchenlexikon XX, 46–70; Dixon, »Faith«, 40–43; Goertz, Bewegungen, 48 f.; Wallmann, Pietismus, 151–160. Geschichte des Pietismus I, 415. Maurer, Kirche, 30; Greyerz, Religion, 129; Wallmann, Pietismus, 169 f. Grossmann, »Neuwied«, 23–34. Grossmann, »Gruber«, 368 f.; North, Pietismus, 84–90. Rowell, »Marsay«, 66–71; Geschichte des Pietismus II, 128 f. Vgl. den Überblick in Geschichte des Pietismus II, 123–167. Hoffmann, Radikalpietismus, 56–82. Ebd., 20–54. Grossmann, »Origins«, und ders., »Gruber«, 363–378; North, Pietismus, 84–90, 101–114, 272–302. Wallmann, Pietismus, 162–166. RGG VI, 312 f.; Grossmann, Edelmann, 87–107; Sheehan, Bible, 73–85. Ward, Awakening, 116–159; Greyerz, Religion, 164 ff.; Goertz, Bewegungen, 53 f.; Maurer, Kirche, 30–33; Bautz, Kirchenlexikon XIV, 509–547; Knox, Enthusiasm, 389–421; Wallmann, Pietismus, 81–203; Geschichte des Pietismus II, 3–106. Schmidt, Geschichte, 105 f. Wallmann, Pietismus, 190.
369
370
III. · Die deutschen Territorien um 1648–1760
49 Ward, Awakening, 155–158; zu ›Zeit der Sichtung‹ vgl. (NT) Lukas 22:31: »DEr HErr aber sprach / Simon / Simon / sihe / Der Satanas hat ewer begert / das er euch möcht sichten / wie den weitzen«. 50 Ebd., 204 ff., 220–240. 51 Goertz, Bewegungen, 51; Wallmann, Pietismus, 179 f. 52 Bautz, Kirchenlexikon I, 367 f., 1494 f., und V, 905 ff.; das Stift Herford war neben Gandersheim, Quedlinburg und Gernrode eine von vier protestantischen Reichsabteien, die ihre Territorien verloren. Rein rechtlich blieben sie unter einer Fürstabtei unabhängig, ihr Stimmrecht in Regensburg wurde jedoch von den weltlichen Herrschern ausgeübt, die ihre Ländereien übernommen hatten; vgl. Braunfels, Kunst III, 409. 53 Wallmann, Pietismus, 50–59; Geschichte des Pietismus I, 241–277; Ward, Awakening, 220–240.
37. Von der Koexistenz zur Toleranz?
D
ie richtungsweisenden Veränderungen, die den deutschen Protestantismus erschütterten, und die grundlegenden Entwicklungen im deutschen Katholizismus erklären viel von den Spannungen zwischen den Konfessionen im Jahrhundert nach dem Westfälischen Frieden. Sie waren weniger dramatisch als die Umbrüche von Reformation und Gegenreformation, aber ebenso bedeutsam. Die habsburgische Rekatholisierung animierte Protestanten im ganzen Reich; die Erregung hielt noch lange an, nachdem das Jahr 1700 ohne Anzeichen eines Weltuntergangs verstrichen war. Die protestantischen Erneuerungs- und Erweckungsbewegungen verstörten viele Katholiken, die neue Formen wie den Pietismus mit Argwohn und Sorge betrachteten, obwohl solche Sekten im Westfälischen Frieden nicht berücksichtigt waren. 1 Der Pietismus und seine radikalen Ableger bedrohten in ihren Augen den sorgfältig austarierten religiösen Frieden im Reich und die hierarchische Ordnung der deutschen Gesellschaft. In Wirklichkeit waren die Prediger, Propheten und Propagandisten der protestantischen Erneuerung zu so etwas natürlich nicht fähig. Aber die Ängste beider Seiten wurden von einem Krieg der Schriften verstärkt. Jeder warf dem jeweils anderen Lager schwere Brüche des Westfälischen Friedens vor. Zur offenen Konfrontation kam es indes nicht. Die Revolution, die Johannes Kelpius 1699 vorhersagte, wurde absorbiert und intern ausgetragen. 2 Der radikale Eifer ließ nach, als das Tausendjährige Reich zur Jahrhundertwende 1699/1700 doch nicht anbrach. Der Chiliasmus verlor langsam an Boden. Unzufriedene und entfremdete Gruppen, die keinen Schutzherrn fanden, richteten ihr Augenmerk auf die Möglichkeiten, die Pennsylvania und die anderen amerikanischen Kolonien boten. Spener und seine Anhänger waren nie Chiliasten im eigentlichen Sinn und von Anfang an überzeugt, dass ein besseres Leben für Christen im Diesseits möglich war. Seine Lehren fanden schrittweise Eingang in die offizielle lutherische Kirche, obwohl die Orthodoxie weiterhin gegen Separatisten, Schwärmer und »Fanatiker« vorging und Halle als Quelle von Instabilität und Volksverhetzung brandmarkte. Unter Franckes Leitung wurde der hallesche Pietismus in Brandenburg-Preußen institutionalisiert. Unter wesentlich weniger turbulenten Umständen nahmen auch die reformierten Kirchen die Erweckungsbewegungen des Jahrhunderts nach 1648 in sich auf. Auch in der katholischen Welt kam es nach 1720 zu Umbrüchen. Vor einem
372
III. · Die deutschen Territorien um 1648–1760
Krieg wegen der Rekatholisierungskrise in der Pfalz schreckten sowohl der Kaiser als auch die führenden Reichsstände zurück. 3 Während die Habsburger ihre Bemühungen, mit dem Protestantismus in Schlesien und Böhmen fertigzuwerden, unermüdlich fortsetzten, unterstrich die brutale Vertreibung der Salzburger Protestanten am Ende des Jahrzehnts, wie anachronistisch und kontraproduktiv ein solches Vorgehen inzwischen war. Jede Politik, die zu Bevölkerungsverlusten führte, stand in vollkommenem Widerspruch zu allen Prinzipien vernünftiger Herrschaft. Die Salzburger Episode demonstrierte auch, dass die »öffentliche Meinung« solches Verhalten nicht mehr akzeptabel fand und zumindest im Geist als Bruch der Gesetze von 1648 empfand. Kein katholischer Herrscher im Reich griff je wieder zum Mittel der gewaltsamen Vertreibung, und wie wir gesehen haben, taten sogar die Habsburger ihr Bestes, ihre Politik als »Transmigration« von Protestanten in ihre östlichen Grenzländer zu bemänteln. 4 Die Verfassungsstruktur des Reichs trug ebenfalls zur Stabilisierung bei. Katholiken befürchteten eine drohende Säkularisierung der unabhängigen reichskirchlichen Institutionen, Protestanten den Übertritt von Herrschern zum Katholizismus. Die Dispute über konfessionelle Belange setzten sich auf fast allen Ebenen bis zum Ende des Reichs fort, oft kam es dabei zu kleineren Gewaltausbrüchen und Machtmissbrauch. Immer wieder aber landeten diese Angelegenheiten im Reichstag, bei den regionalen Kreisversammlungen und den Reichsgerichten und wurden letztlich entweder durch ein Urteil zugunsten einer der Parteien oder durch Kompromisse gelöst, oder aber die Diskussionen und Prozeduren fanden so lang kein Ende, dass die Konfliktparteien irgendwann das Interesse verloren oder die Sache nicht mehr von Belang war. Die Veröffentlichung aufrührerischer konfessioneller Traktate war nach Reichsrecht strikt untersagt. 5 Vor allem aber sorgte eigennütziges Interesse an der Beteiligung am Gemeinwesen dafür, dass konfessionelle Animositäten nicht in dem Armageddon der Glaubensrichtungen gipfelten, das viele Zeitgenossen fürchteten. Zugleich erweiterte und lockerte die Aufnahme von Minderheiten in zahlreichen, meist protestantischen Territorien den 1648 errichteten politischen Rahmen. In einigen Fällen war dies das Ergebnis echter Toleranz, in anderen steckten populationspolitische und wirtschaftliche Motive dahinter; das blieb sich in der Wirkung gleich. Man gelangte durch solche Erfahrungen zu der Einsicht, dass der christliche Staat kein konfessioneller Staat sein musste. In den protestantischen Territorien war diese Einsicht in den 1740er Jahren weit verbreitet und sie bildete auch die Grundlage der Politik vieler katholischer Herrscher über konfessionell gemischte Untertanen; die Habsburger schlossen sich ihr jedoch erst mit den Toleranzedikten Josephs II. von 1781/82 an. In vielen Gegenden war die konfessionelle Trennung ohnehin nie sehr deutlich. Zwar spielten konfessionelle Spannungen und Konfrontationen zweifellos weiter-
37. Von der Koexistenz zur Toleranz?
hin eine wichtige Rolle, aber wo die Konfessionen sich stark vermischten, war die Lage weniger überschaubar. In Regionen mit einer Vielzahl katholischer und protestantischen Territorien konnten sich Herrscher eine harte Linie nicht leisten, um nicht Untertanen und letztlich Steuerzahler zu vergraulen. Von den zehn Kreisen waren nur drei zur Gänze katholisch (der bayerische, der habsburgisch-österreichische und der burgundische), zwei protestantisch (Nieder- und Obersachsen). Von den übrigen war einer zu 75 Prozent katholisch (der Kurrheinkreis), ein anderer zu 75 Prozent protestantisch (der Oberrheinkreis), drei mehr oder weniger ausgeglichen (der westfälische, fränkische und schwäbische). 6 Diese Koexistenz auf Kreisebene garantierte nicht automatisch gegenseitigen Respekt und Harmonie, band die katholischen und protestantischen Territorien jedoch in einen institutionellen Rahmen ein, in dem ein gewisser Grad der Kooperation unerlässlich war. Wichtige Gegenden des Reichs waren nach 1648 konfessionell gemischt. Im Nordrheingebiet hatten Jülich und Berg katholische Herrscher, die Bevölkerung hingegen war lutherisch, reformiert und katholisch. In Osnabrück war das Verhältnis mit achtundzwanzig katholischen und achtzehn protestantischen sowie acht bikonfessionellen Pfarreien annähernd ausgeglichen, was sich in der 1648 beschlossenen abwechselnden Besetzung des Postens des Fürstbischofs niederschlug. 7 Klare konfessionelle Grenzen gab es auch in Franken, Schwaben, am Oberrhein und in der Pfalz nicht. In diesen Regionen herrschte große Vielfalt: eine Masse kleiner Territorien, Territorien aus verstreuten, nicht zusammenhängenden Distrikten, Kirchenterritorien wie Würzburg, die 1648 plötzlich lutherische Pfarreien zu verwalten hatten, Kondominate zweier Herrscher unterschiedlichen Glaubens, bikonfessionelle Reichsstädte, Reichsstädte mit katholischen Kirchenresidenzen direkt vor der Tür. Letzteres war der Fall bei der Reichsstadt und der Reichsabtei Kempten, die sich nie auf eine genaue gemeinsame Grenze einigen konnten. Im nahegelegenen schwäbischen Allgäu gab es sogar eine reformierte Enklave in den Ländereien der Reichserbmarschälle von Pappenheim, die alle Versuche der Fugger und der Fürstäbte von Kempten überlebte, den Katholizismus wieder einzuführen, selbst nachdem die Besitzungen 1692 an die Kemptener Abtei verkauft worden waren. 8 1706 appellierten die reformierten Einwohner der ehemaligen Pappenheim-Herrschaft Theinselberg erfolgreich an den Reichstag und die Könige von Preußen und Schweden, um eine Kirche zurückzuerhalten, die Abt Rupert von Bodman konfisziert hatte. Er änderte seine Meinung schnell, als Friedrich I. von Brandenburg-Preußen anordnete, sämtliche Klöster und Kirchen in seinen Ländereien in Beschlag zu nehmen, bis die Theinselberger ihre Kirche zurückbekämen. 9 Selbst die Habsburger mussten in ihren verstreuten süddeutschen Territorien von Vorderösterreich den Fortbestand protestantischer Adelshäuser und Dörfer akzeptieren. 10
373
374
III. · Die deutschen Territorien um 1648–1760
Auf lokaler Ebene lieferten Vorschriften wie das Normaljahrprinzip, das alle Rechte von Katholiken, Lutheranern und Calvinisten auf der Basis der Gegebenheiten im Januar 1624 sicherte, Kriterien zur Lösung von Konflikten. Zu Disputen kam es dennoch, manchmal erbittert über ein Jahrhundert oder länger ausgetragen. Aber für jeden Unruheherd gab es andere Orte, wo Koexistenz und gegenseitige Anerkennung von zwei oder mehr Konfessionen alltägliche Realität waren. 11 In Osnabrück spiegelte die wechselnde Abfolge frei gewählter katholischer Fürstbischöfe und der Mitglieder des Hauses Hannover die katholisch-protestantische Ausgeglichenheit in der Bevölkerung wider. 12 In den schwäbischen Städten Augsburg, Biberach, Dinkelsbühl und Ravensburg sorgte das konfessionelle Gleichgewicht für konstitutionelle und politische Parität. Katholiken und Protestanten erhielten gleiches Gewicht im Stadtrat, alle öffentlichen Ämter waren einfach stets zugleich mit einem Katholiken und einem Protestanten besetzt, die Stadtkirchen nach dem 1624-Prinzip aufgeteilt und die Pfarrkirche in Biberach sowie den Ravensberger Friedhof benutzten beide Gemeinden zu gleichen Teilen. 13 Viele kleine Territorien, so etwa die der Reichsritter in Franken und Schwaben, aber auch den Rhein entlang bis in die Herzogtümer Jülich, Berg, Kleve und die gesamte Region Westfalen, waren effektiv multikonfessionell. Selbst ein Herrscher wie der Erzbischof von Mainz verfügte in Teilen seines Territoriums nur über eingeschränkte Macht, etwa in der thüringischen Exklave Eichsfeld, wo eine protestantische Nobilität die berüchtigte Rekatholisierung des späten 16. Jahrhunderts überlebte und die von überwiegend protestantischen Territorien umringt war. 14 Zweifellos spielte die konfessionelle Konfrontation eine große Rolle in der Vorstellung vieler Zeitgenossen, aber die Vielzahl von Beispielen für Koexistenz darf darüber nicht vergessen werden. Einige Teile des Reichs erlebten nach 1648 eine Konfessionalisierung, wie es sie vor dem Krieg kaum je gegeben hatte.Viele andere Teile indes, katholische wie protestantische, machten Erfahrungen, die in keiner Weise mit der Art von Konfessionalisierung zu tun haben, wie sie deutsche Gelehrte der letzten fünfzig Jahre beschrieben haben. In welchem Ausmaß stand diese Lockerung zwischenkonfessioneller Spannungen für eine zunehmend tolerante Gesellschaft? Die Belege sind alles andere als eindeutig. Zum einen war das Jahrhundert nach 1648 von einer zunehmenden Verwurzelung konfessioneller Kulturen gezeichnet. 15 Systeme von Dogmen und Ritualen stabilisierten sich, das tägliche Leben wurde konfessionalisiert. Die Jubelfeiern der Jahrestage 1717, 1730, 1748 und 1755 stärkten die lutherische, die Wallfahrten und zahlreichen Prozessionen des liturgischen Jahres die katholische Identität. 16 Lehren und disziplinarisches Wirken der Kirchen prägten so gut wie jeden Aspekt des Lebens des Laienstandes. Familienstrukturen, Einstellungen zu Bildung, Arbeit und Freizeit, Medizin, Versicherung gegen Naturkatastrophen, zu
37. Von der Koexistenz zur Toleranz?
Tod und Begräbnis entwickelten sich in charakteristisch katholischer beziehungsweise protestantischer Weise. 17 Selbst die Wahl des Vornamens war von der Konfession bestimmt. Protestanten bevorzugten Namen wie Johann, Jakob und Georg, Pietisten zudem Ehregott, Fürchtegott, Gotthelf, Gotthilf, Leberecht, Thurecht und andere, Katholiken hingegen Joseph, Peter, Franz, Anton, Aloys, Ignaz und Xaver; aus Gottlieb machten sie Amadeus, aus Erdmann Adam; nach der Heiligsprechung von Johann Nepomuk 1729 verbreitete sich auch sein Name. Die Sitte, Jungen auf den Mittelnamen Maria zu taufen, entstand ebenfalls im 18. Jahrhundert. 18 Offenbar war die konfessionell geprägte Namensgebung am deutlichsten im höheren Adel ausgeprägt, üblich war sie jedoch in allen sozialen Schichten. Die Koexistenz war oft geprägt von Reibungen und Konflikten. Die bikonfessionellen schwäbischen Städte Augsburg, Biberach, Dinkelsbühl und Ravensburg entwickelten eine regelrechte »Paritätsmanie«, die noch die trivialsten Kleinigkeiten des städtischen Alltags erfasste. In Augsburg kam es sogar bei der Ernennung des Kirchenhausmeisters (und seiner Helfer) zu langen Diskussionen über Präzedenz und Parität. 19 Allerdings gab es zwischen 1648 und 1806 nur einen einzigen ernsten Aufruhr aus Gründen religiöser Animosität: eine Revolte im Jahr 1718, deren mühelose Beilegung den Erfolg der Paritätsregeln unterstrich. Besonders belastet war die Koexistenz auch in anderen Reichsstädten, etwa in Hamburg, wo es enge Verbindungen zwischen Gemeinwesen und Kirche gab und wo Kleriker mit dem Argument, Tolerierung werde das Gemeinwesen zersetzen, bei jedem Zugeständnis an Minderheiten Widerstand mobilisieren konnten. Obwohl sich die urbanen Eliten tolerant gaben und nichtlutherische Zuwanderer maßgeblich zum spektakulären wirtschaftlichen Erfolg der Stadt nach 1648 beitrugen, blieben solche Einwände bis 1785 ausschlaggebend. 20 Auch anderswo waren die Reaktionen auf die Koexistenz gemischt. Die einheimische Bevölkerung akzeptierte nicht alle Neulinge, denen ihre Herrscher die Ansiedelung gestatteten. Als 1718 in Magdeburg Häuser von Hugenotten brannten, stellten sich Anwohner der Feuerwehr in den Weg und skandierten: »Lasst die Franzosen brennen!« 21 Pastoren oder Priester und ihre Gemeindemitglieder protestierten regelmäßig gegen die Verleihung von Glaubensrechten an Zuzügler, gegen die Erlaubnis, unter Verstoß gegen die Verträge von 1648 Kirchen und Kapellen für einheimische konfessionelle Minderheiten zu errichten, und gegen angebliche Verletzungen der Übereinkünfte zur gemeinsamen Benutzung von Kirchengebäuden. In vielen Gemeinden stritt man darüber, ob Angehörige anderer als der »offiziellen« Konfession an den örtlichen Priester oder Pastor Pfarrbeiträge oder Stolgebühren zahlen mussten, wie es die Gesetze von 1648 vorsahen. 22 Bis zum Ende des 17. Jahrhunderts erschwerte es die Koexistenz, dass sich Protestanten, selbst wenn sie Untertanen katholischer Herrscher waren, ausnahmslos weigerten, den
375
376
III. · Die deutschen Territorien um 1648–1760
gregorianischen Kalender anzuerkennen, und oft demonstrativ an katholischen Feiertagen ihren gewöhnlichen Tagesgeschäften nachgingen. 23 Als die protestantischen Stände schließlich en bloc den neuen Kalender akzeptierten, entschieden sie sich für eine »verbesserte« Version, bei der das Datum des protestantischen Osterfests in den Jahren 1724 und 1744 vom katholischen abwich. 24 Es gab also eine umfangreiche zeitgenössische Literatur, die die Missbräuche und Beschwerden, die aus diesen konfessionell motivierten Streitigkeiten resultierten, dokumentierte. Indes gab es viel mehr Beispiele für stille, friedvolle Koexistenz, die nicht aufgezeichnet wurden. Wie das Reich insgesamt, kamen Tausende Gemeinden im Alltag gut zurecht. In Wetzlar beispielsweise nahmen Katholiken an der Berufung protestantischer Pastoren teil, die dann von einem katholischen Dekan ins Amt eingeführt wurden, der feierlich den Treueeid auf den wahren protestantischen Glauben überwachte, der vor einem katholischen Diakon in voller liturgischer Kluft abgelegt wurde. 25 In der Pfalz trennte in den meisten Kirchen eine Mauer das von den Reformierten benutzte Schiff vom Chor, der den Katholiken vorbehalten war. 26 In Goldenstedt an der Grenze zwischen Bremen und Münster kam es nach 1650 de facto zu einem Simultaneum, nachdem Katholiken und Lutheraner jahrzehntelang um die Dorfkirche gekämpft und sie dabei mehrere Male zerstört hatten. Lutheraner besuchten das katholische Hochamt, der katholische Organist begleitete Lieder aus dem lutherischen Gesangsbuch, von denen die Katholiken nur einige mitsangen, während die Lutheraner bei den lateinischen Kehrversen einfach stumm blieben. Der katholische Pfarrer wurde von seinen Vorgesetzten angewiesen, die Dogmen nicht zu betonen, die seine lutherischen Pfarrkinder verärgern mochten. Diese Übereinkunft hatte Bestand, bis 1850 schließlich ein neues protestantisches Gotteshaus errichtet wurde. 27 Goldenstedt mag eine Ausnahme gewesen sein, aber ähnliche Beispiele für Kooperation finden sich in den gesamten westlichen und südlichen Regionen des Reichs, wo es keine vorherrschende Konfession gab. In den zahlreichen Kondominaten katholischer und protestantischer Herrscher galten von Anfang an klare rechtliche Angrenzungen. Selbst in der Pfalz unterstrich die Rekatholisierungspolitik des Kurfürsten, die das Reich 1719/20 um ein Haar in einen Krieg gestürzt hätte, die Notwendigkeit einer friedlichen Koexistenz der Kirchen, auch wenn die Stellung der Katholiken deutlich privilegiert war. Detailliert erforscht sind die damit einhergehenden Folgen für die kleine trikonfessionelle Winzerstadt Oppenheim, deren Status im Westfälischen Frieden (IPO IV, § 19) festgeschrieben war. Die Bevölkerungszahl sank von 2.000 vor 1618 auf 300 nach 1648, stieg bis 1700 auf etwa 600 und erreichte 1740 1.500 (darunter 22 Juden). 28 Die konfessionelle Zusammensetzung der Einwohnerschaft änderte sich durch die Regierungspolitik. Die Anzahl der Katholiken stieg von 21 (1698) auf 38,2 Prozent (1741), die reformierte Gemeinde schrumpfte von 46,5 auf
37. Von der Koexistenz zur Toleranz?
31,5 Prozent, die lutherische von 32,5 auf 27,6 Prozent. Beide protestantischen Gruppen wurden im weiteren Verlauf des 18. Jahrhunderts noch kleiner. Jede der Gemeinden besaß offenbar einen starken Sinn für konfessionelle Identität und von Zeit zu Zeit gab es Reibereien etwa wegen der Begehung der katholischen Feiertage. Die einzigen ernsthaften konfessionellen Konflikte während dieser Zeit wurden durch die regelmäßigen polemischen Kampagnen der Pfarrer und Pastoren der verschiedenen Kirchen ausgelöst. Auch das Phänomen der Mischehen enthüllt einige überraschende Perspektiven. 29 Theologen aller Konfessionen lehnten sie ab, außer bei Zusage einer Konversion, und die regierungsamtliche Verwaltung favorisierte generell die vorherrschende oder offizielle Konfession. Genaue Zahlen liegen nicht vor, Studien zu Städten und Pfarreien in konfessionell gemischten Gegenden wie Osnabrück und der Pfalz haben jedoch ergeben, dass Mischehen einen Anteil von etwas über 20 Prozent der gesamten Eheschließungen ausmachten. Sie kamen in allen sozialen Schichten vor, am häufigsten zwischen Lutheranern und Reformierten, weitaus seltener zwischen Protestanten und Katholiken. Die Hypothese, die Anzahl der Mischehen habe gegen Ende des 18. Jahrhunderts abgenommen und um 1800 habe es solche Verbindungen so gut wie gar nicht mehr gegeben, scheint eine langfristige Verhärtung der konfessionellen Identitäten nahezulegen, bedürfte aber einer systematischen Strukturanalyse, die die verfügbaren Quellen oft gar nicht zulassen. Auffallend an solchen Heiraten nach 1648 sind die Verträge, in denen die zukünftigen Partner ihre Gewissensfreiheit garantieren und sich über die Erziehung ihrer Kinder verständigen. Die pfälzische Regierung stellte eine Vorlage für solche Kontrakte in Form eines Dekrets zur Verfügung. Ebenso bemerkenswert sind die unvermeidlichen Konflikte über solche Vereinbarungen und die Dispute über die Erziehung von Waisen und Halbwaisen. Dabei kam es oft zu langwierigen Beschwerden gegen die Urteile regionaler Gerichte, die manchmal bei den Reichsgerichten oder dem Corpus Evangelicorum in Regensburg landeten. Bei zahlreichen Fällen von angeblicher Kindesentführung und Verführung Minderjähriger ging es um die Frage des annus discretionis – des Alters, ab dem ein Kind als fähig betrachtet wurde, sich für eine Konfession zu entscheiden. Wie in vielen Bereichen des Reichsrechts genossen Frauen in diesen Belangen die gleichen Rechte wie Männer. Der Westfälische Friede garantierte allen Gewissensfreiheit und das Recht auf Auswanderung. Männer wie Frauen strengten Prozesse gegen ihre Herrscher an, wenn Kinder aus der ersten Ehe eines der beiden Partner von der Obrigkeit als Waisen in der vorherrschenden Religion des jeweiligen Territoriums erzogen werden sollten. Zudem klagten viele Frauen erfolgreich gegen ihre Ehegatten wegen Bruchs der ehelichen Vereinbarung über die Kinder sowie gegen männliche Verwandte, die nach dem Tod des Vaters Anspruch auf ein
377
378
III. · Die deutschen Territorien um 1648–1760
Kind erhoben. Diese außerordentliche Ermächtigung von Frauen gegen die patriarchalische Autorität ihrer Ehemänner endete 1806. So gut wie sämtliche deutschen Staaten ordneten diese Belange als Probleme von Recht und Ordnung und nicht als konfessionelle Angelegenheiten ein. Folgerichtig hatte die Autorität des Haushaltsvorstands (patria potestas) Vorrang vor der Gewissensfreiheit von Frauen. Im Jahrhundert nach 1648 wurde die Konfessionalisierung der Gesellschaft von einer Entsakralisierung des Gemeinwesens begleitet. Die Regierungspraxis richtete sich nach der Realität eines christlichen, nicht eines konfessionellen Staats. Im späteren 18. Jahrhundert entstanden daraus Vorstellungen von einem überkonfessionellen Staat, religiöser Toleranz und einer Politik, die über die Beschränkungen des Westfälischen Friedens hinausreichte. Die wichtigste Einschränkung war, dass der Vertrag nur für Katholiken, Lutheraner und Reformierte galt und das Recht auf öffentliche Ausübung ihres Glaubens nur denjenigen einräumte, die dieses Recht bereits 1624 besessen hatten. Der Wert der Gesetze von 1648 sollte nicht unterschätzt werden. Das Recht auf öffentliche Religionsausübung galt zwar nur für Gemeinden, das Grundrecht der Gewissensfreiheit stand jedoch jedem Einzelnen zu, Männern wie Frauen aller drei offiziellen Konfessionen. So schuf der Friedensvertrag effektiver als alle im 16. Jahrhundert erreichten religiösen Übereinkünfte einen stabilen und haltbaren Rahmen, in dem gesetzliche Prozesse an die Stelle gewaltsamer Konflikte traten. In vielen Gemeinden führte dies zu pedantischem Legalismus, Engstirnigkeit und leidenschaftlicher Haarspalterei in Bezug auf die Klauseln von 1648. Aber die Verteidigung des Status quo war ein Grundprinzip in praktisch allen Bereichen der Reichspolitik. Die Auffassung des legislativen Rahmens veränderte sich mit der Zeit. Anfangs standen die Rechte der Herrscher und das Ziel, die Koexistenz der Territorien zu organisieren, klar im Vordergrund. Immer mehr jedoch betrachtete man die Rechte des Einzelnen als ebenso wichtig. 30
Anmerkungen 1 2 3 4 5
6 7 8
Press, Kriege, 300 f. Ward, Awakening, 51; Kelpius (* 1673, † 1708) stammte aus Siebenbürgen und siedelte 1694 von Europa in die Wildnis von Pennsylvania über. Vgl. S. 179–186. Vgl. S. 337. Eisenhardt, Aufsicht, 55–8, 134; die Katholiken waren mit ihren Klagen über antikatholische Traktate und Forderungen nach deren Verbot durch kaiserliche Dekrete besonders erfolgreich. Hartmann, »Bevölkerungszahlen«, 353–369. Schindling und Ziegler, Territorien III, 142 ff.; Penners, »Konfessionsbildung«, 40–49. Häberlein, »Grenzen«, 156 f.
37. Von der Koexistenz zur Toleranz?
9 HBayG III, 1059. 10 Häberlein, »Grenzen«, 157 f. 11 Schindling, »Reichsinstitutionen«, 265 ff., 281–285; Häberlein, »Grenzen«; Penners, »Konfessionsbildung«, 40–49. 12 Ebd.; wenn ein protestantischer Fürstbischof amtierte, wurden die katholischen bischöflichen Pflichten dem Metropoliten übertragen, dem Erzbischof von Köln. 13 Häberlein, »Minderheiten«, liefert eine Vielzahl von Beispielen. 14 Duhamelle, »Confession«, und ders., »Frontière«; die Nachbarn waren das reformierte Hessen-Kassel und das lutherische Herzogtum Braunschweig-Lüneburg (Kurfürstentum Hannover), die Grafschaft Schwarzburg, die Reichsstadt Mühlhausen und das Kurfürstentum Brandenburg. 15 Vgl. zu den Lutherischen und reformierten Gemeinden von Oberhessen Mayes, Christianity, 207–341; vgl. auch François, »Frontière«. 16 Whaley, Toleration, 186–96; François, Grenze, 153–167. 17 Hersche, Muße, gibt einen interessanten Einblick in diese Differenzen, ebenso Möller, Familie, 214–230. 18 Duhamelle, »Prénom«; Seibicke, Personennamen, 138 f.; Bahlow, Vornamen, 70; François, Grenze, 167–79; Zschunke, Konfession, 109 ff. 19 François, Grenze, 21. 20 Whaley, Toleration, 145–168. 21 Schmidt, »Mehrkonfessionalität«, 48. 22 Nottarp, »Communicatio«, 426 f. 23 Duhamelle, »Frontière«, 178. 24 Luh, Reich, 41; Grotefend, Zeitrechnung, 26 f.; Conrad, Rechtsgeschichte II, 184; die »verbesserte« Version hatte den Vorzug, dass Protestanten den Begriff »gregorianisch« nicht verwenden mussten, und die volle Annahme des neuen Kalenders 1775, durch die weitere unterschiedliche Ostertermine 1778 und 1798 vermieden wurden, geschah »unter ausdrüklichem Vorbehalt allerseitiger landesherrlichen Hoheitsrechte im geist- und weltlichen, besonders aber des Iuris liturgici, welche hiedurch nach ihrem ganzen Umfang auf das feyerlichste verwahret werden«. 25 Nottarp, »Communicatio«, 431. 26 Schindling, »Reichsinstitutionen«, 286. 27 Welker, Rechtsgeschichte, 250; Nottarp, »Communicatio«, 445 f. 28 Zschunke, Konfession, 23 ff., 73–139. 29 Freist, »Glaubensfreiheit«; Freist, »Mixed Marriages«; Freist, »Rechtsstreitigkeiten«; Häberlein, »Grenzen«, 180 f.; Mayes, Christianity, 299 f.; Safley, Children, 244–248. 30 Whaley, »Toleranz«, 405–416.
379
38. Aufklärung und Patriotismus
Ü
ber die deutsche Aufklärung ist oft zu lesen, sie sei als Bewegung hinter ihren Pendants in anderen europäischen Ländern zurückgeblieben, zudem im Grunde eine Nachahmung und wesentlich weniger kritisch und radikal gewesen. 1 Dennoch gilt sie auch als wichtiger Impulsgeber für die Schaffung einer neuen Gesellschaft, als rationalistische Bewegung des Bürgertums oder der gebildeten Mittelschicht, die dem Reich gleichgültig gegenüberstanden und deren Denken im Zeichen einer neuen Nation stand. Dass diese Nation im 18. Jahrhundert nicht zustande kam, wird gern als Beleg für die tragische Schwäche der deutschen Bourgeoisie im Angesicht eines erstarrten, aber beständigen Ancien Régime gedeutet. Das Verdienst der Aufklärung sei jedoch, dass sie die Grundlage für den kulturellen Aufschwung des 18. Jahrhunderts geschaffen habe, aus dem nach 1750 die deutsche Kulturnation hervorging. Wie viele Langzeitbetrachtungen der deutschen Geschichte, die als Erklärung für den deutschen »Sonderweg« dienen sollen, die angeblich eigentümliche oder gar abweichende Entwicklung Deutschlands im 19. und 20. Jahrhundert, verzerrt diese Sichtweise der Aufklärung die Wirklichkeit des frühmodernen Reichs. 2 Neue Forschungen seit den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts haben viel dazu beigetragen, alte Metaerzählungen zu korrigieren; in vielen Handbüchern und Allgemeingeschichten haben sie jedoch überlebt. Die zunehmende Spezialisierung der historischen Forschung war hier wenig hilfreich. Studien zur Aufklärung sind höchst selten in die Geschichte des Reichs eingebettet. Tatsächlich schien die vordringliche Beschäftigung mit der Neuartigkeit der Bewegung oft lokal auf die Unvereinbarkeit einer rationalistischen Modernisierungsbewegung mit einem irrationalen, historisch entstandenen und letztlich zum Untergang verurteilten Reich hinzudeuten. Was man später Aufklärung nannte, war in der Tat neu und oft radikal. Die Strukturen des Reichs, die in mancher Hinsicht hemmend wirkten, trugen jedoch andererseits maßgeblich zur Entstehung der Aufklärung bei. Viele führende Gestalten der Bewegung hatten einflussreiche Positionen in wichtigen deutschen Territorien inne. Die Welt, über die sie schrieben, war die Welt der Jahre nach 1648. Sie erforschten die Möglichkeiten der neuen konstitutionellen und konfessionellen Strukturen im Licht des neuen Denkens über Mensch und Natur, das sich seit den 1650er Jahren an den protestantischen Universitäten verbreitete. Als Professoren, territoriale Beamte und politische Berater sind uns einige davon bereits in
38. Aufklärung und Patriotismus
vorhergehenden Abschnitten begegnet: Leibniz, Thomasius, Wolff und Gottsched gelten allgemein als führende Gestalten der Frühaufklärung. Hier sollen sie im Umfeld der breiteren Strömungen betrachtet werden, denen sie angehörten, der neuen Medien, auf die sie setzten, und des Publikums, mit dem sie kommunizierten. Dies wirft unvermeidlich auch Fragen zu Perspektive und Identität auf, zu ihrer Einstellung zur Gesellschaft allgemein, zu Territorium und Reich sowie zu den Gebilden »Nation« und »Deutschland«, die in vielen ihrer Schriften auftauchen. Kann eine Bewegung existieren, bevor sie einen Namen hat? In dem achtundsechzigbändigen Großen vollständigen Universal-Lexikon aller Wissenschaften und Künste, das Johann Heinrich Zedler 1732 bis 1754 in Leipzig veröffentlichte, der umfangreichsten und umfassendsten Enzyklopädie in ganz Europa im 18. Jahrhundert, ist der Begriff Aufklärung nicht verzeichnet. Eine Hamburger Zeitung aber stellte 1741 fest, man lebe in »aufgeklärten Zeiten«, da Experten erstmals die Wissenschaften dem allgemeinen Verständnis zugänglich machten. 3 Das Nomen Aufklärung benutzte Wieland erstmals 1770. 4 Erst 1784 appellierte die Berlinische Monatsschrift an ihre Leser, den Begriff zu erklären, der so oft verwandt und so wenig verstanden werde. Kants Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? war eine von vielen, gilt heute indes als programmatische Erklärung der Aufklärung insgesamt. 5 Seine These, Aufklärung sei »der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit«, ist den Bestrebungen vieler früher Vertreter tatsächlich sehr eng verwandt. Sie benutzten den Begriff selbst nicht, er erscheint jedoch hin und wieder als Adjektiv. Ausdrücke wie »Klarheit«, »vernünftig« oder »Vernünftigkeit«, »freie und unabhängige Gedanken«, »unvoreingenommenes Urteil« waren zu jener Zeit wichtiger. Was war gemeint? Es gab keine einheitliche Bewegung, vorherrschende Ideologie, kein Programm.Von den 1660er Jahren an traten eine Reihe von Tendenzen und neuen Denkungsarten hervor. Sie trafen zusammen, beeinflussten einander, oft in scharfer gegenseitiger Opposition, und mit der Zeit verschmolzen sie zu einem zunehmend deutlichen und selbstbewussten Spektrum von Attitüden und einer neuen Sicht der Welt. Im Ferment der Ideen und neuen Ansätze, das die deutsche intellektuelle Szene des späten 17. Jahrhunderts kennzeichnete, lassen sich fünf breite Tendenzen ausmachen. Die religiöse Reformbewegung, die Philipp Jakob Spener ins Rollen gebracht hatte und sein Schüler August Hermann Francke fortsetzte, sowie die diversen radikalen Pietisten forderten die vorherrschende Orthodoxie in der lutherischen Kirche heraus und legten neues Gewicht auf die Religiosität des Individuums und die Rolle des einzelnen Christen in der Gesellschaft. Auch das Reich erwies sich als fruchtbarer Boden für die Verbreitung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse. Leitfiguren wie Leibniz und der sächsische Forscher und Philosoph
381
382
III. · Die deutschen Territorien um 1648–1760
Ehrenfried Walther von Tschirnhaus (* 1651, † 1708) nahmen als Mitglieder der Royal Society (1673) beziehungsweise der Pariser Académie des Sciences (1682) aktiv am europäischen Diskurs und an der Anwendung der Resultate neuer Forschungen auf alle Lebensbereiche teil. 6 In der praktischen Philosophie und Jurisprudenz prägten Samuel Pufendorf und Christian Thomasius die Parameter einer neuen Herangehensweise an Politik und Gesellschaft, die eine Reihe von Reformen der Universitätslehrpläne und eine breite öffentliche Debatte über diese Belange nach sich zog. Der fünfte Punkt hat mit vielen der vorangegangenen zu tun: Eine verstreute Vielzahl materialistischer Pantheisten, Materialisten und Deisten forderte sowohl die traditionellen Autoritäten als auch viele Vertreter des neuen Denkens heraus. 7 Die zahlreichen in- und ausländischen Vorläufer und die Einflüsse ihrer Ideen schließen eine eindeutige Kategorisierung der Frühaufklärung als derivativ oder abhängig von englischen, französischen oder niederländischen Vorbildern aus. 8 Der postreformatorische Protestantismus (vor allem seine radikalen und häretischen Tendenzen), die Wissenschaft des späten 16. und frühen 17. Jahrhunderts, der deutsche Späthumanismus allgemein und der sozinianische Antitrinitarismus oder Unitarismus, die Ideen von Johann Arndt, Jakob Böhme und vielen anderen übten weiterhin Einfluss aus. Zusätzlich zu den einheimischen Traditionen von Mystik, Pantheismus, den Rosenkreuzern und Sozinianern kamen Impulse von Lipsius, Edward Herbert von Cherbury und seiner Naturreligion, Francis Bacon, Hobbes, Descartes und Gassendi mit seiner gegen Descartes in Stellung gebrachten Lehre des Atomismus und einer mechanistischen Deutung der Natur. Spinoza war für manche von großem Einfluss, allerdings gelangten viele durch empirische wissenschaftliche Studien zu ähnlichen Ansichten. Ebenso ließen sich viele maßgeblich von späteren englischen Denkern inspirieren: erst von Herbert, dann auch von Hobbes und Newton, William Derham und seiner Physikotheologie, Locke, Shaftesbury und anderen. 9 Von überragender Bedeutung war auch Pierre Bayle, als eigenständiger Denker wie auch als Vermittler von Wissen und Ideen mit seinem Dictionnaire historique et critique von 1695 (erweitert 1702). 10 Dass Spinoza bisweilen wichtiger erscheint als andere, hat auch damit zu tun, dass sich »Spinozismus« und »Spinozist« als stigmatisierende Bezeichnungen für Träger von Ideen einbürgerten, die als gefährlich und subversiv galten. 11 Insbesondere Anhänger materialistischer und deistischer Tendenzen wurden so gebrandmarkt. Auch wenn sie oft ausgegrenzt und vom akademischen Betrieb ausgeschlossen wurden, waren sie doch wichtig, weil sie der Debatte eine essenzielle Dimension verliehen, die für den Rahmen, in dem sich die philosophischen, religiösen und wissenschaftlichen Debatten der Zeit abspielten, ebenso wertvoll war wie die Wahrheiten der Orthodoxie. Grob umrissen hatten die diversen Strömungen vier gemeinsame Merkmale.
38. Aufklärung und Patriotismus
Erstens betonten sie das unabhängige »Selbstdenken« und die individuelle Verantwortlichkeit, oft in Verbindung mit kritischem Urteilsvermögen, fast immer frei von traditionellen und auf traditionelle Weise gerechtfertigten Autoritäten. Kritik bedeutete nicht zwangsläufig, dass man sich schlicht dem kartesianischen Rationalismus verschrieb; auch Empirismus und Sensualismus spielten in der Frühaufklärung eine Rolle und waren in Deutschland das gesamte 18. Jahrhundert über von herausragender Bedeutung. Zweitens war man der Überzeugung, die Resultate solch reflektierenden Räsonierens müssten auf das Leben der Menschen in Anwendung gebracht werden und Veränderungen im Leben des Einzelnen trügen zur Verbesserung der Gesellschaft insgesamt bei. Drittens wurden die neuen Gedanken eifrig kommuniziert, weil man glaubte, der Austausch von Ideen und deren Prüfung in öffentlicher Diskussion sei ein wesentliches Element der Suche nach neuem Wissen und der Durchsetzung der Wahrheit. Und schließlich stand die generelle Tendenz des neuen Denkens sowohl an den Universitäten als auch in den diversen religiösen Bewegungen im Widerspruch zur Autorität der lutherischen Orthodoxie sowie, was die Universitäten anging, zu den aristotelischen Prinzipien, auf die deren Forschung und Lehre gründeten. Dass die Religion im Mittelpunkt stand, ist kein Zeichen für die Ferne der Deutschen von Politik und wirklichem Leben, sondern eher dafür, dass sich die deutschen Intellektuellen vorrangig mit den Kernthemen ihrer Zeit befassten. 12 Die Situation im Reich nach 1648 warf diese Probleme in besonders akuter Form auf. In vielen Territorien war es praktisch unmöglich, die Auswirkungen der Abkommen von 1648 auf das Verhältnis von Kirche und Staat zu klären und die Rechte der Regierung über die Kirche gegen das von Thomasius so genannte »politische Papsttum« des lutherisch-orthodoxen Klerus durchzusetzen. Ein paralleler Streit entfaltete sich an den Universitäten, wo die Einführung neuer Fächer und die Diskussion neuer Lehren die Rolle der orthodoxen lutherischen Theologie als Hauptfach, dem alle anderen untergeordnet waren, infrage stellte. Auch hieraus entstanden Forderungen nach Gedankenfreiheit und dem Recht, neue Fächer ohne theologische Kontrolle zu unterrichten. Wenn Vertreter der Frühaufklärung wie Thomasius sich als Eklektiker bezeichneten, reklamierten sie damit für sich das Recht, jedes Wissen und jede Idee zur Bildung eigener Grundsätze heranzuziehen. 13 Eklektizismus stand für den Willen, die von Thomasius so genannte »Gelahrtheit« (praktische Philosophie) mit »Gelehrtheit« (akademischem Lernen) zu verbinden. 14 Außerdem bedeutete er, unabhängig von traditionellen orthodoxen, aristotelisch-theologischen und philosophischen Autoritäten die Gültigkeit von Vorstellungen und Erkenntnissen festzustellen. 15 Zugleich zeigten Eklektiker größtenteils keine Neigung zur Begründung neuer Dogmen oder »Sekten«. Die praktische Philosophie bestand darauf, sie leiste Beiträge zu einer fortlaufenden Debatte oder Diskussion. Ihre
383
384
III. · Die deutschen Territorien um 1648–1760
Schlussfolgerungen beruhten wissenschaftlich und unparteiisch auf dem neuesten verfügbaren Wissen, seien jedoch immer nur vorläufig und im Licht neuer Erkenntnisse der Prüfung und Revision unterworfen. Das Bestehen auf Debatte und Diskussion war selbst ein Kernelement dessen, was als Aufklärung bekannt wurde. Kommunikation setzt Medien und ein Publikum voraus. In beider Hinsicht kam es im späten 17. Jahrhundert zu bedeutenden Veränderungen. Um 1700 hatte sich im Reich der aktivste Zeitungs- und Zeitschriftenmarkt in ganz Europa entwickelt. Die potenzielle Leserschaft indes war noch relativ klein: Die fünfzig oder sechzig deutschen Zeitungen erreichten bei einer Bevölkerung von 15 bis 16 Millionen vielleicht 250.000 bis 300.000 Leser. Bis 1750 stieg die Anzahl der Zeitungen auf etwa 100 oder 120 und die der Leser auf rund eine Million. 16 Veröffentlicht wurden natürlich in erster Linie politische Neuigkeiten; erst 1712 führte eine Hamburger Zeitung eine Rubrik für kulturelle und wissenschaftliche Berichte ein. Der Zeitschriftenmarkt war begrenzter, aber auch er erblühte in dieser Zeit. Manche Publikationen waren rein akademisch, etwa die ab 1682 in Leipzig erscheinenden Acta Eruditorum und ihr deutschsprachiger Schwestertitel Deutsche Acta Eruditorum oder Geschichte der Gelehrten, welche den gegenwärtigen Zustand der Litteratur in Europa begreiffen (ab 1712). Zuvor war eine Vielzahl von Periodika, einige mit Berichten aus der Welt des Lernens, andere bibliografisch oder biobibliografisch, in verschiedenen norddeutschen protestantischen Zentren erschienen. 17 Manche waren kurzlebig, viele erschienen in sehr geringen Auflagen. Die Fülle an veröffentlichten Informationen wuchs so stetig, dass erste Rezensionszeitschriften sich um Orientierung bemühten. Die erste erschien 1714–1717 in Leipzig und versprach unter ihrem anonymen Herausgeber, dem Thomasianer Christian Gottfried Hoffmann, Aufrichtige und Unpartheyische Gedancken, Über die Journale, Extracte und Monaths-Schrifften. 18 Bald darauf erschien mit den »moralischen Wochenschriften« nach Vorbild der Londoner Zeitschriften Spectator und Tatler ein neuer, erfolgreicherer und volkstümlicher Typ aufgeklärter Zeitschriften. Sie enthielten nicht mehr Berichte und Auszüge von Texten aus anderen Publikationen, sondern moralisierende, unterhaltsame Aufsätze über das menschliche Leben im Licht der modernen Philosophie. Am namhaftesten war Der Patriot, der 1724–1726 in Hamburg in einer Auflage von fast 6.000 Exemplaren wöchentlich erschien und in ganz Norddeutschland verbreitet wurde. 19 Die Kernleserschaft der Fachpresse umfasste zweifellos akademisch Gebildete aller Richtungen. Die Zahlen hierzu sind noch weniger verlässlich. Um 1700 hatten etwa 80.000 Deutsche einen Universitätsabschluss. 20 Keineswegs waren sie allesamt Beteiligte einer aufkeimenden aufgeklärten Szene; darunter waren auch katholische Kleriker und Laien, die von den Debatten, die größtenteils an protestantischen Universitäten geführt wurden, weitgehend unberührt blieben, sowie das lutherisch-orthodoxe Establishment von Kirche, Universitäten und ihren Unter-
38. Aufklärung und Patriotismus
stützern. Dennoch sind die Schätzungen signifikant, wenn man bedenkt, dass die Gesamtzahl der in Reichsverwaltung, -institutionen und -territorien Beschäftigten in den Jahrzehnten nach 1648 unter 10.000 lag. 21 Geografisch waren die gebildeten potenziellen Teilnehmer an der entstehenden Öffentlichkeit nicht auf die Grenzen des Reichs beschränkt, sondern umfassten auch im Reich studierte Deutsche, die in anderen deutschsprachigen Gegenden lebten, von Riga und Reval (Tallinn) im östlichen Baltikum bis zu den Schweizer Städten Basel und Zürich im Südwesten. Ihren Anfang nahmen die Debatten im institutionalisierten Ritus der Disputationen an den Universitäten. 22 Die Wittenberger Disputationsregeln von 1580 gestatteten Studenten ausdrücklich, in die Rolle von »Häretikern« zu schlüpfen, um die Logik einer These zu prüfen. Dies sollte ursprünglich dazu dienen, akademische Sorgfalt zu garantieren und die Orthodoxie auf triftigen Argumenten zu gründen. Allerdings ließ sich so auch das Wissen über ansonsten verbotene Werke verbreiten und die Prozedur gab Einzelnen die Möglichkeit, solche Ideen zu entwickeln, während sie vorgaben, sie zu verleugnen. Wenn der Disputant geschickt vorging, konnten sich die häretischen Argumente als die besseren herausstellen. Ergänzt wurden die Debatten an den Universitäten durch Debatten zwischen Universitäten. Um 1700 gab es eine Vielzahl von Diskussionen zwischen den etwa zwanzig protestantischen Universitäten im Reich, angespornt vom Wettstreit der Ideen, akademischer Rivalität und echter Neugier. Die umfangreiche Korrespondenz führender Vertreter wie Leibniz, Thomasius und Gottsched mit relativ unbedeutenden Randfiguren unterstreicht, wie sich aus der akademischen Praxis eine allgemeine Diskussionskultur entwickelte. 23 Leibniz zum Beispiel stand ab 1696 über zehn Jahre in regelmäßigem Briefwechsel mit dem radikalen Experimentalforscher und Theologen Gabriel Wagner und machte bei mehreren Gelegenheiten seinen Einfluss geltend, um Wagner Anstellungen zu verschaffen, die dieser dann stets durch hitzköpfige Schmähungen von Aristokraten und Fürsten wieder untergrub.24 Wiederholt äußerte sich Leibniz verärgert über Wagners Verhalten. Ihre Korrespondenz über theologische und philosophische Themen setzten sie dennoch in aller Höflichkeit und mit profundem Engagement fort, und es ist offensichtlich, dass Leibniz die Herausforderung durch einen so radikalen Kritiker seiner Ideen durchaus schätzte. Auch Thomasius war ein Freund und Förderer Wagners, obwohl sich dieser mit einer funkelnden Kritik an Thomasius’ Methodologie und Lehrpraxis einen Namen gemacht hatte. In ähnlicher Weise unterstützten Gottsched und viele seiner Kollegen eine Reihe von Radikalen, die mit Autoritäten in Konflikt geraten waren. 25 Am anderen Ende des Spektrums sahen sich auch die orthodoxen Gegner von Radikalismus und neuem Denken in die breitere öffentliche Debatte verwickelt. In gewisser Weise trugen sie solcherart wohl sogar zur Verbreitung der Ideen bei, die
385
386
III. · Die deutschen Territorien um 1648–1760
sie so leidenschaftlich bekämpften. Das Wissen über Atheismus und alle Arten von Häresien, die unter diesem Begriff liefen, systematisierten und verbreiteten Werke wie Valentin Ernst Loeschers Praenotiones et notiones theologicae (Vorbegriffe und Begriffe der Theologie, 1708), Zacharius Grapius’ Systema novissimarum controversarium (Verzeichnis der jüngsten Kontroversen, 1709) und Johann Franz Buddeus’ De Atheismo et superstitione (Über Atheismus und Aberglauben, 1717). 26 Weniger öffentlich, aber in vieler Hinsicht ebenso wirkungsvoll sorgte auch die beliebte Sammlung von »Geheimnissen« in Form von Manuskripten und Büchern für die Verbreitung von »verbotenem« Wissen. 27 Die Suche nach solchem Material erstreckte sich oft auf ganz Europa und ging mit Reisen in diplomatischer und politischer Mission sowie Formen der peregrinatio academica von Gelehrten zwischen Universitäten einher. Den akademischen und theologischen Markt dominierten lateinische Schriften, aber der Inhalt solcher Handbücher wurde bald ins Deutsche übersetzt. Christian Thomasius und andere hatten erste ernsthafte Anläufe zur Kommunikation mit der Öffentlichkeit außerhalb der Universitäten unternommen. Die Einführung von Lehrveranstaltungen in deutscher Sprache 1687 war ein entscheidender Schritt zu mehr Offenheit. 28 Von da an war die allgemeine gebildete Öffentlichkeit stets in akademische und gelehrte Kontroversen mit einbezogen. Bezeichnenderweise legte Thomasius gegen Ende seines Lebens sein Werk in Form einer Sammlung von Kontroversen vor. Die vier Bände seiner Außerlesenen Juristischen Händel (bis 1721) und die dreibändigen Gemischten Philosophischen und Juristischen Händel (1723–1726) sind eine Art Autobiografie und zugleich ein Bekenntnis zum grundsätzlichen objektiven Wert von Debatte und Kontroverse. 29 Dass sein Prinzip allgemeinere Akzeptanz fand, zeigte sich 1736 an Gerlach Adolph von Münchhausens Statuten für die neue Universität Göttingen. Die akademische Freiheit (der nur den Reichsgesetzen verpflichteten Lehre und Publikation) wurde damit gerechtfertigt, dass »alle Lehre, deretwegen die wissenschaftlichen Universitäten geschaffen sind, auf das öffentliche Wohl abzielt« (doctrina omnis, cujus causa universitates literariae constitutae sunt, ad felicitatem publicam referatur). 30 Jüngere Forschungen zeigen ein Bild der Reichhaltigkeit und Vielfalt mit wichtigen Entwicklungen in verschiedenen Bereichen – akademische Debatte, wissenschaftliches Denken, Druckwerke – und oft beiderseitig fruchtbaren Wechselwirkungen. Ältere Darstellungen der Frühaufklärung als verspätet, derivativ und begrenzt sind überholt, die breite Chronologie bleibt dennoch gültig. Die diversen Strömungen des neuen wissenschaftlichen Denkens erreichten um 1700 in Wechselwirkung mit neuen religiösen Bewegungen im Protestantismus das Reifen von Ideen und Reformansätzen. Männer wie Leibniz und Thomasius waren dabei von entscheidender Bedeutung. Leibniz war ein einflussreicher internationaler Intellektueller von großem politischem Einfluss im Reich; zu Lebzeiten publizierte er
38. Aufklärung und Patriotismus
wenig, entwickelte aber seine Ideen in einer umfangreichen Korrespondenz mit illustren Koryphäen ebenso wie mit eher übel beleumdeten Versagern. Thomasius war ein rühriger universitärer Lehrmeister, Territorialberater und unternehmerischer Förderer von Debatte und neuen Ideen in Druckwerken; zudem liebte er die öffentliche Diskussion und beteiligte sich eifrig an verschiedensten Auseinandersetzungen. Die neuen Ideen schlugen sich bald in konkreten Reformen an der Universität Halle nieder. Sie spiegelten sich auch in der Entstehung gebildeter Kreise in Städten wie Hamburg und Zürich wider, die sich um eine Erneuerung ihrer Gemeinwesen bemühten. In beiden Städten kam es zu Zeiten tiefgreifender politischer Unrast zur Bildung zunächst informeller Gruppen von Magistraten, Professoren und Doktoren und später offizieller Verbindungen. Zürich lag außerhalb des Reichs, stand jedoch wie andere deutschsprachige Schweizer Städte in enger Kommunikation mit der deutschen Öffentlichkeit. Der Züricher Aufstand von 1713 geht klar auf die Aktivitäten dreier Gesellschaften zurück – der Collegien der Insulaner (1679–1681), der Vertraulichen (1686–1696) und der Wohlgesinnten (1693–1709) –, denen eine breite Vielfalt von Mitgliedern der gebildeten städtischen Elite und sogar einige Handwerker angehörten. 31 Die Bandbreite der in den Gesellschaften diskutierten Themen war enorm. Der atemraubende Radikalismus der Debatten widerspricht traditionellen Darstellungen Zürichs im 17. Jahrhundert als konservative Oligarchie im festen Griff des orthodoxen Calvinismus. Es gab anscheinend keine Tabus, weder in der Politik noch in der Religion. So stellten etwa die Vertraulichen im August 1686 fest, es könne gerechtfertigt sein, einem absoluten Herrscher aufgrund religiöser Verfolgung Widerstand zu leisten. Am 22. Februar 1698 diskutierten die Wohlgesinnten, ob die Werke von Pierre Bayle und Spinoza gefährlich seien, und kamen zu dem Beschluss, sie sollten Ungebildeten nicht zugänglich sein, könnten Gebildeten jedoch nicht schaden. Weitere Diskussionen betrafen die Rechtfertigung von Präventivkriegen, Neutralität, Naturrecht, die Geschichte der Schweizer Eidgenossenschaft, Alchemie, Kopernikus und den Heliozentrismus, Descartes’ These, Tiere hätten keine Seele, und Spinozas Versuche, die Prinzipien der Naturwissenschaft auf das Bibelstudium anzuwenden (die sie verwarfen). Eine der führenden Figuren der Züricher Gesellschaften und des Aufstands von 1713 war der Doktor und Wissenschaftler Johann Jakob Scheuchzer, der mit Gleichgesinnten im Reich, den Niederlanden und England korrespondierte. 32 Scheuchzer unterstrich die Verbindung der Diskussion neuer Ideen und politischer Unruhen, indem er erklärte, ein viele Jahrhunderte lang in Unwissenheit gehaltenes Volk habe die Augen geöffnet, den blinden Gehorsam abgeschüttelt, sei ins Licht der Freiheit getreten und habe von seinen Herrschern bessere Regierung gefordert. 33 Zudem fanden die Unruhen in Zürich ebenso wie die in Hamburg
387
388
III. · Die deutschen Territorien um 1648–1760
große Aufmerksamkeit in der Presse des Reichs, die ausführlich über die Forderungen der Unzufriedenen wie auch über Maßnahmen gegen die Ausschreitungen berichtete. 34 In Hamburg führte die Beilegung eines langwierigen internen Bürgerkriegs durch eine kaiserliche Kommission 1711/12 und ein schwerer Ausbruch der Pest 1713/14 zur Bildung einer Gruppe, die sich der Reform und Erneuerung des städtischen Gemeinwesens verschrieb. Die Mitglieder der 1724 gegründeten Patriotischen Gesellschaft umfassten den Kern der literarischen und linguistischen Teutschübenden Gesellschaft (1715–1717), Gelehrte und Akademiker sowie politische Experten. Einer ihrer prominentesten Angehörigen war der Senator und Dichter Barthold Heinrich Brockes, dessen zwischen 1721 und 1742 veröffentlichte Gedichtsammlung Irdisches Vergnügen in Gott eine monumentale poetische Interpretation der Physikotheologie darstellt, die ihn und viele seiner engen Freunde faszinierte. 35 Die Gesellschaft widmete sich anfangs vor allem der Veröffentlichung der außerhalb von Hamburg weitverbreiteten Zeitschrift Der Patriot (1724–1726), die zu Diskussion und Debatte anregen sollte. 36 Danach arbeitete sie offenbar innerhalb des Gemeinwesens, dessen Establishment ihre Mitglieder repräsentierten, und traf sich bis 1748 regelmäßig als Gruppe, deren öffentliches Wirken, etwa ihr toleranter Umgang mit religiösen Minderheiten in Hamburg, in den Augen des orthodoxen Klerus von demselben »unreinen Geist« infiziert war wie Thomasius und andere Erfüllungsgehilfen des »politischen Antichristen«. 37 Der Durchbruch dieser neuen Ideen in Universitätsreformen und Politik wurde um 1720 überholt vom rapiden Aufstieg von Christian Wolff zum dominierenden progressiven Philosophen im Reich. Wolffs System verdrängte andere Formen des neuen Denkens nicht vollständig und es war auch nicht zur Gänze originär. Er übernahm viel von Leibniz, mit dem er seit seinem Studium in Leipzig korrespondierte, und von Thomasius’ praktischer Philosophie. Im Grunde war es die Kombination von Metaphysik und Praxis zu einem anscheinend perfekten System, die Wolff so viele Bewunderer einbrachte, mit der er sich jedoch auch Feinde machte. Er selbst und seine Schüler wurden nicht nur von orthodoxen Lutheranern angegriffen, sondern auch von Thomasianern und Pietisten, die Wolff 1728 zum Weggang aus Halle zwangen. 38 Was die Pietisten erboste, war Wolffs Determinismus und dass er 1721 öffentlich feststellte, der Konfuzianismus habe ohne Offenbarung eine rühmenswerte Ethik erreicht. 39 Ihre Warnung an Friedrich Wilhelm I., Wolffs Determinismus könne Angehörige seiner geliebten »Langen Kerls« zum Desertieren bewegen (wer konnte einen Mann bestrafen, dem keine Wahl blieb?), gab den Ausschlag gegen ihn, wobei allerdings auch sein Eintreten für eine »freie Republik« als ideale Staatsform (1721) nicht eben hilfreich war. 40 Auch die Thomasianer zeigten sich erfreut über Wolffs Ausweisung, ihre Genugtuung war indes von kurzer Dauer, weil seine
38. Aufklärung und Patriotismus
umfassende Reichhaltigkeit Wolffs System einfach zu attraktiv machte. Die Vertreibung aus Halle, in der Presse ausgiebig vermeldet und diskutiert, machte ihn zum Helden, stärkte seine Reputation und fachte die Debatte über Gedankenfreiheit und Autonomie der Philosophie neu an. Durch die sofortige Anstellung an der Universität Marburg in Hessen-Kassel erhielt er eine neue Plattform. In den 1720er Jahren zeigten seine Ideen auch an einigen katholischen Universitäten Wirkung. 41 Zudem entwickelte Wolff ein allumfassendes mathematisches System, das Studenten und andere ansprach, die im Labyrinth der Ideen nach Klarheit suchten. In Christoph Gottsched fand er einen energischen Popularisator, der sich als Student für das wolffsche System begeisterte und es ab 1724 in Leipzig unermüdlich propagierte, sowohl offiziell als auch informell in seinem Bekanntenkreis und durch die Societas Conferentium, die er 1731 als Forum für private Diskussionen mit Studenten, gleichgesinnten Freunden und Kollegen gründete. 42 Nur ein paar Jahre später waren einige ihrer Mitglieder maßgeblich an der wolfffreundlichen Entstehung der Gesellschaft der Alethophilen (Freunde der Wahrheit) in Berlin beteiligt, deren Kopf, der ehemalige sächsische Diplomat Ernst Christoph von Manteuffel, sich für Wolffs Wiedereinstellung einsetzte. 43 Durch Gottscheds raschen Aufstieg zum unternehmerischen Dreh- und Angelpunkt eines reichsweiten Netzwerks von Zeitschriften, Verlegern und Buchhändlern fanden Wolffs Ideen noch weitere Verbreitung. 44 Zudem gab Gottscheds Anwendung dieser Ideen auf neue Bereiche des Wissens und der Praxis, etwa Sprache und Literatur, Wolffs eigener Behauptung, er habe einen neuen Rahmen für Leben und Denken geschaffen, zusätzliches Gewicht. Der preußische König musste einsehen, welchen Schaden er seiner Universität zugefügt hatte, und es gab Versuche, Wolff zurückzulocken, die allerdings erst im September 1740 nach der Thronfolge Friedrichs II. fruchteten. Mittlerweile hatte eine ganze Reihe von Kontroversen und Skandalen das progressive Denken in einer zunehmend selbstbewussten Öffentlichkeit fest verankert. Bemühungen des lutherisch-orthodoxen Klerus und einiger Territorialautoritäten, das Blatt zu wenden, blieben vergeblich. Ein Verbot in einem Territorium führte lediglich zur Veröffentlichung anderswo, hartes Durchgreifen an einer Universität verschaffte anderen Vorteile im Wettbewerb um gute Lehrer und Studenten. Selbst Ausgestoßene fanden im Allgemeinen einen Patron, wenn keinen niederen Herrscher, dann jemanden wie Gottsched und seine Gefährten, die Radikale finanziell und moralisch unterstützten. Dazu zählten der Deist Theodor Ludwig Lau und der deistische und kabbalistische Spinoza-Schüler Johann Georg Wachter, deren Ideen auch unter Gottscheds Freunden und Studenten in der Societas Conferentium diskutiert wurden. 45 Tatsächlich hatte Gottsched selbst sich in den frü-
389
390
III. · Die deutschen Territorien um 1648–1760
hen 1730ern vom orthodoxen Christentum abgewandt und dies in seinen Werken verhehlt, bis er sich in den 1750er Jahren als Deist offenbarte; seine Beziehung mit den häretischen Außenseitern könnte aber viel tiefer gewesen sein. Vielleicht war einer der Gründe seines Erfolgs, dass er die Spielregeln kannte: Seine Übersetzungen von Bayles Dictionnaire, von Leibniz, Claude Adrian Helvétius und Bernard le Bovier de Fontenelle versah er mit Fußnoten, in denen er sich scheinbar von den darin vertretenen Ideen distanzierte. 46 Nichts illustriert die Ohnmacht der Orthodoxen und den Durchbruch des Radikalismus zu einem gewissen Grad von Salonfähigkeit sowie die von regen und gegensätzlichen Strömungen gekennzeichneten intellektuelle Szene der 1730er Jahre so gut wie der Skandal um die Wertheimer Bibel. 47 Zur Frankfurter Buchmesse 1735, die mit der 200-Jahr-Feier von Luthers Bibelübersetzung zusammenfiel, erschien eine reichhaltig illustrierte neue deutsche Übertragung des Pentateuch mit umfangreicher Einführung und Anmerkungen des Übersetzers. Sie war das Werk von Johann Lorenz Schmidt, ursprünglich Pietist und seit 1725 Tutor der Kinder der verwitweten Gräfin Amöne Sophie Friederike von Löwenstein-Wertheim-Virneburg. Schon die ersten Sätze von Schmidts Übersetzung zeigen, wie weit er sich von seinen pietistischen Mentoren in Jena wie Johann Franz Buddeus entfernt hatte und weshalb sein Werk einen solchen Sturm der Entrüstung entfachte. Gottes allmächtige Aufsicht über die ersten Tage des Universums ist hier verschwunden. An die Stelle des Schöpfungswunders treten, wie Jonathan Sheehan schreibt, »dieselben Gesetze von Druck, Bewegung und Temperatur, die alle natürlichen Prozesse beherrschen«. 48 In eine Passage nach der anderen lässt Schmidt Einsichten der Naturreligion einfließen und an einer zentralen Stelle der Genesis zerstört er die gesamte Grundlage der vorherrschenden Ansicht, das Alte Testament enthalte prophetische Spuren des Neuen Testaments. Theologen aller drei offiziellen Konfessionen verurteilten Schmidts Arbeit. Viele sahen darin die Begründung einer neuen Religion und somit einen Bruch des Westfälischen Friedens. In zahlreichen Territorien wurde das Buch verboten und 1737 dekretierte der Kaiser persönlich, es sei zu beschlagnahmen und der Autor einzusperren. Der katholische Koregent von Wertheim, Fürst Karl Thomas zu Löwenstein-Wertheim-Rochefort, sollte dafür sorgen. 49 Schmidt wurde festgenommen und inhaftiert, im April 1738 verhalfen ihm jedoch zwei der jungen protestantischen Grafen zur Flucht. Er lebte von den Einnahmen seiner Bibel und weiteren Übersetzungen der Werke von Tindal und Spinoza unter dem Pseudonym Schröder oder Schröter in Altona bei Hamburg, wo der Herzog von Holstein (und König von Dänemark) in der Hoffnung, mit seinem Hafen Hamburg auszustechen, eine außerordentlich tolerante Politik betrieb. Später wurde Schmidt Mathematiklehrer für die Pagen am Hof von Wolfenbüttel; dort starb er, nach wie vor unter falschem Namen, 1749. 50
38. Aufklärung und Patriotismus
Persönlich mag Schmidt gescheitert sein, aber der Aufruhr um sein Werk stellt in gewisser Weise einen Durchbruch dar. Die Jahre des Streits um die Wertheimer Bibel, der sich allein bis 1739 einundneunzig Publikationen sowie zahlreiche Pamphlete und Tausende Artikel in Zeitungen und Zeitschriften widmeten, markierten einen entscheidenden Durchbruch. Führende Intellektuelle wie Gottsched verteidigten Schmidt und proklamierten das Grundrecht auf Gedanken- und Diskussionsfreiheit. Gottsched wusste sehr gut, dass die Angriffe auf Schmidt auch Wolff galten, dessen umstrittene Wiedereinsetzung in Berlin 1736 die Pietisten entschieden zu vereiteln suchten. Die ganze Affäre trug außerordentlich zur Verbreitung von Wolffs Ideen, der Philosophie von Leibniz und Newtons Lehren bei. Wolff selbst distanzierte sich während seiner Audienz beim preußischen König im April 1736 wohlweislich von Schmidts Häresien. 51 Zweifellos war er jedoch letztlich der Nutznießer des Skandals. Kein Wunder, dass der orthodoxe und pietistische Klerus, Lutheraner wie Calvinisten, um 1740 am Zustand der Welt verzweifelten. Manche Katholiken konnten ihre Schadenfreude über den offenbar bevorstehenden Untergang des Protestantismus kaum verbergen. Die wesentliche Auswirkung der Frühaufklärung war die Schaffung einer öffentlichen Sphäre für Debatten über Religion und Gesellschaft im protestantischen Reich. Bildete sie auch ein neues Identitätsgefühl oder legte sie vielleicht die intellektuellen und kulturellen Grundlagen für eine neue Vision nationaler Einheit, die über das Reich hinauswies? Das scheint wenig plausibel. Wenn sich die Bindung zwischen Thron und Altar lockerte, wurde die zwischen Thron und Katheder umso stärker. Die frühen Aufklärer wollten das Christentum weniger abschaffen oder ins Abseits drängen als es neu gestalten. Verändert hatte sich zweifellos auch die Beziehung zwischen den Territorien und dem Reich. Aber die führenden Vertreter der neuen intellektuellen Bewegung blieben in die etablierten Organe der deutschen Territorien eingebettet. Ihre Bestrebungen richteten sich zu einem großen Teil darauf, der territorialen Verwaltung im Rahmen der Verträge von 1648 eine neue philosophische Basis zu geben. Ihr Eintreten für Reform und Fortschritt floss auch in den Patriotismus ein, der ab den 1720er Jahren viele Städte und Territorien kennzeichnete. Dies ist oft als neuer Aufbruch gedeutet worden. 52 Es stand jedoch auch für eine Erneuerung der patriotischen Diskurse des 15., 16. und 17. Jahrhunderts. 53 Allerdings sorgten die neuen Philosophien für einen neuen Tonfall und neue kulturelle und intellektuelle Referenzen. Anders waren auch der soziale Charakter und die Reichweite des Patriotismus im frühen 18. Jahrhundert. Die acht Deutschen Gesellschaften, die zwischen 1730 und 1762 nach dem Vorbild von Gottsched Leipziger Deutscher Gesellschaft in diversen Städten entstanden, unterschieden sich grundlegend von den Sprachgesellschaften des 17. Jahrhunderts. 54 Ihre etwa 3.000 Mitglieder waren überwiegend Nichtadlige. Ihre Kritik
391
392
III. · Die deutschen Territorien um 1648–1760
an der Übernahme französischer Kultur und Sprache und den dafür verantwortlichen Fürsten und Adligen war entschieden antihöfisch. Stillschweigend zielten sie darauf ab, den Status der Gebildeten zu stärken, was deren zunehmende Bedeutung in Regierung und Verwaltung widerspiegelt, die sie weiter ausbauen wollten, weil sie meinten, die Deutschen seien sprachlich und kulturell hinter andere Nationen zurückgefallen. Nur sie allein, behaupteten sie, konnten die Nation wieder in eine Position bringen, die den Erfindern der Druckkunst und ursprünglichen Schöpfern der Modernität zukam. So erklären sich die verschiedenen Strömungen in der patriotischen Rhetorik der Deutschen Gesellschaften. Man pochte darauf, jedes Mitglied müsse das »Muster eines aufrichtigen Bürgers, eines redlichen Patrioten, aber auch eines ehrlichgesinnten Redners« sein. 55 Vorausgesetzt wurden Bildung und Intellekt sowie die Fähigkeit, sich klar auszudrücken. Echte Patrioten sollten bestrebt sein, eine gemeinsame hochdeutsche Sprache frei von Dialekt und provinziellen Elementen zu sprechen. Die Kultivierung dieser gemeinsamen Sprache sollte der erste Schritt zur Förderung der »Ehre der Deutschen« sein und sie befähigen, mit ihren westlichen und südlichen Nachbarn gleichzuziehen. Das waren alte humanistische Themen. Neu war der Eindruck, die Deutschen hätten es nicht geschafft, mit ihren europäischen Konkurrenten Schritt zu halten. Diese Idee findet sich schon in Leibniz’ Gedanken über die deutsche Sprache und in Thomasius’ Aufforderung an die Jugend, von den Franzosen zu lernen, ihre Sprache und Kultur zu lieben. Gottsched machte daraus ein Kernelement seiner Vision einer kulturellen Erneuerung des Reichs. Der neue Patriotismus blieb somit nicht nur den Territorien, sondern auch den Territorien im Rahmen des Reichs ebenso untrennbar verbunden wie frühere Formen. Leibniz widmete einen Großteil seines Lebens der Förderung der Interessen diverser Territorialherrscher und des Reichs. Dass weder Thomasius noch Wolff viel über das Reich schrieben, sollte nicht als Gleichgültigkeit oder gar Geringschätzung gedeutet werden. Thomasius entwickelte Themen, die, orientiert an Pufendorf, die philosophischen Grundlagen territorialen Rechts erkundeten; viele seiner Schüler waren ebenso am Reich interessiert. 56 Seine beharrliche Ablehnung radikaler oder »spinozistischer« Ideen einer rationalen Religion spiegelt im Grunde seine Weigerung wider, den 1648 geschaffenen Rahmen der drei zugelassenen Konfessionen zu verlassen. 57 Die spätere philosophische Tradition behauptete, Wolff habe Thomasius verdrängt, aber tatsächlich blieb die thomasianische Tradition an den juristischen Fakultäten stark. Trotz aller erhobenen Ansprüche Wolffs und seiner Schüler für sein System blieb die Philosophie eines der grundlegenden oder vorbereitenden Fächer der Geisteswissenschaften, die immer noch im Schatten von Theologie, Recht und Medizin stand, unter denen wiederum Jura im frühen 18. Jahrhundert
38. Aufklärung und Patriotismus
eine klare Vorrangstellung erreicht hatte. 58 Dort wurde das Reich studiert und darüber geschrieben, nicht in der philosophischen Fakultät. Dennoch entwickelte Wolff wie Thomasius seine Ideen innerhalb einer Welt, in der das Reich als selbstverständlich betrachtet wurde. Ein großer Bewunderer von Wolffs Werk, der Schweizer Philosoph Emer de Vattel (* 1714, † 1767), einer der Begründer des von wolffschen Prinzipien inspirierten modernen internationalen Rechts, beklagte, dass Wolffs Idee, alle Staaten müssten sich einer höheren allgemeinen Autorität unterordnen, weder »vernünftig … noch gut begründet«, aber im Kontext des Reichs absolut sinnvoll sei. 59 Wie Leibniz vor ihm entwickelte Gottsched sein kulturelles Reformprogramm für die deutsche Nation über drei Jahrzehnte hinweg in der Hoffnung, das Reich werde den institutionellen Rahmen für eine Akademie der Künste schaffen. Diese Hoffnung ließ er offenbar erst nach seinem Besuch in Wien 1749 fallen, da die dortigen Autoritäten als Voraussetzung ihrer Kooperation bei dem Projekt verlangten, dass er zum Katholizismus übertrete. 60 Selbst ein radikaler Sonderling wie Gabriel Wagner, der Thomasius wiederholt scharf angriff und Leibniz beständig von den Irrtümern seiner philosophischen Ansätze um 1700 zu überzeugen versuchte, blieb dem Reich verbunden. Wagner war ein unverblümter Kritiker sämtlicher Fürsten und Aristokraten, überzeugt von der kulturellen und intellektuellen Überlegenheit der Deutschen, und er glaubte innig daran, dass Deutschlands Probleme gelöst werden konnten, wenn der Kaiser seine volle Autorität wieder durchsetzte. 61 Das bedeutet nicht, dass vor 1740 allgemeine Loyalität oder Konsens herrschte, was das Reich betraf. Viele religiöse Radikale standen ihm zweifellos so gleichgültig gegenüber, wie sie die meisten Territorialregierungen anfeindeten. Manche widmeten sich mehr oder weniger ausschließlich den Forderungen und Ansprüchen führender Territorialregierungen auf eine Quasiunabhängigkeit vom Reich. Andere standen aus politischen Gründen zum Reich. Die Hamburger Magistrate, die der Patriotischen Gesellschaft angehörten, erstrebten die Sicherung der kaiserlichen Anerkennung ihres »Vaterlands« als Reichsstadt, um sie vor den räuberischen Neigungen der benachbarten dänischen Könige zu schützen. 62 Gottscheds Eintreten für das Reich begleitete sein ebenso streitbarer lutherischer Eifer, der ihn 1730 dichten ließ: »Wie lange soll auf den Altären / Das trübe Licht der Kerzen währen, / Das aller Welt des Irrthums Leitstern war?«, weswegen er 1749 vor der Idee eines Übertritts zum Katholizismus zurückschreckte.63 In der katholischen Welt hatte das Reich wohl noch immer eine andere Bedeutung und stand in einem anderen Verhältnis zum Kaiser. Es herrschten Misstrauen und Verachtung gegenüber dem Pietismus und der Verbreitung gottloser Häresien in den 1720er und 1730er Jahren. Auch Gottscheds kulturelles Programm stieß auf Feindseligkeit, insbesondere sein Eintreten für eine reformierte Version von
393
394
III. · Die deutschen Territorien um 1648–1760
Luthers Deutsch. Viele verteidigten nach wie vor die süd- oder oberdeutsche Orthografie, die die Tradition des »gemeinen Deutschen« als echtes »Reichsdeutsch« gegen Luthers »modernisierten« Meißener Stil hochhielt. 64 Noch 1755 brandmarkte der Benediktinerpater Augustin Dornblüth von Gengenbach am Oberrhein Gottscheds schlechtes »lutherisches« Deutsch. 65 Dass sich die Orthografien nicht wesentlich unterschieden und verschiedene Schreibweisen jedem belesenen Deutschen absolut verständlich waren, ließ die konfessionellen Motive des Widerstreits umso deutlicher hervortreten. Allen politischen, konfessionellen und regionalen Unterschieden zum Trotz war die Identität der Einwohner des Reichs von denselben Strukturen geprägt, die mindestens seit dem späten 15. Jahrhundert bestanden. Ihre Welt war von zwei Ebenen bestimmt: dem Territorium, in dem sie lebten, und dem Reich, in das dieses Territorium eingebettet war. Besonders in den größeren Territorien hatte die Regierung, die ihnen am nächsten war – die ihres Fürsten –, neuen Schwung aufgenommen, jedoch nicht die Kommunen und Stände sowie die Loyalitäten, die diese lokalen und regionalen Gebilde erhielten, ausgelöscht und auch nicht den alles überwölbenden Rahmen des Reichs durchbrochen. In den kleineren Territorien, vor allem den katholischen Ländereien der Reichskirche, aber auch denen der Reichsgrafen und Ritter, und in den Reichsstädten blieb die Loyalität zum Reich ungetrübt. Der Wiederaufstieg der Kaiserkrone nach 1648 erneuerte vielmehr alte Bindungen und schuf neue Beziehungen. Selbst die größeren Territorien, nicht nur Brandenburg-Preußen, sondern auch führende weltliche Territorien protestantischer und katholischer Konfession, deren Herrscher sich zunehmend der kaiserlichen Autorität entzogen, lehnten weder Kaiser noch Reich ab. Ein bevorstehender fundamentaler Wandel war 1740 nicht absehbar, noch weniger die Ablösung des Reichs der deutschen Nation durch eine Nation des deutschen Bildungsbürgertums.
Anmerkungen 1 2 3 4 5 6 7 8
Müller, Aufklärung, 63–76; Borgstedt, Aufklärung, 1–10; Whaley, »Transformation«, 158– 163. Vgl. S. 540 (Fußnote 15). Zu Zedler siehe Möller, Vernunft, 24; vgl. zu Zedler Quedenbaum, Zedler; zu »aufgeklärte Zeiten« siehe Pütz, Aufklärung, S. 12 Pütz, Aufklärung, 12. Vgl. S. 533 f. Beck, Philosophy, 189–194; Wollgast, Tschirnhaus; Israel, Radical Enlightenment, 502– 514, 637–641; Breger, »Leibniz und Tschirnhaus«. Hunter, Rival Enlightenments. Mulsow, Moderne, 1–37; Israel, Enlightenment Contested, 164–200.
38. Aufklärung und Patriotismus
9 Vgl. zu Hobbes Malcolm, Aspects of Hobbes, 518–535, und Dreitzel, »Hobbes-Rezeptionen«, zur Physikotheologie Philipp, Werden, 33–47, zum Einfluss des englischen Deismus Berg, »English Deism«, vor allem S. 50 f., und Wild, »Freidenker«. 10 Dingel, »Rezeption«. 11 Für Spinoza als primäre Quelle der radikalen Aufklärung plädiert Israel, Radical Enlightenment, 628–653, und ders., Enlightenment Contested, 164–200. Was für Spinoza spricht, lässt sich in allen Einzelpunkten modifizieren, allein durch die Feststellung, dass man zu ähnlichen Ideen auch auf anderen Wegen gelangen hätte können. Der vielleicht einzige wahre Spinozist um 1700 war Spinozas Freund Ehrenfried Walther von Tschirnhaus, der diesen Vorwurf, den ihm Christian Thomasius in seiner Zeitschrift Monats-Gespräche machte, jedoch vehement bestritt. Mulsow, Moderne, 441, und Wollgast, »Frühaufklärung«, 55 f., betonen die Vielfalt der Einflüsse, ebenso Martin Pott in seiner Einführung zu Lau, Meditationes, 30–34. 12 Wollgast, »Frühaufklärung«, 26 f.; Goldenbaum, Appell, 32–79; Saine, Problem, 13–60. 13 Dreitzel, »Entwicklung«; Hochstrasser, Natural Law Theories, 121–129. 14 Barnard, »Practical Philosophy«, 224 ff. 15 Dreitzel, »Entwicklung«, 338. 16 Welke, »Lektüre«, 29. 17 Böning, Welteroberung, 188–198; vgl. S. 112. 18 Böning, Welteroberung, 185; Habel, »Rezensionszeitschriften«, 48 f. 19 Böning, Welteroberung, 220–264. 20 Martino, »Barockpoesie«, 111. 21 Repgen, »Westfälischer Friede«, 80 f. 22 Israel, Enlightenment Contested, 175–187; Mulsow, Gelehrtenrepublik, 191–215. 23 Gierl, »Korrespondenzen«. 24 Vgl. Siegfried Wollgasts Einführung zu Wagner, Ausgewählte Schriften, 15–36. 25 Mulsow, Freigeister, 11–14. 26 Israel, Radical Enlightenment, 633 ff.; Buddeus war Anhänger von Thomasius und Widersacher von Leibniz und Wolff, sein Werk war jedoch auch Wasser auf die Mühlen der Orthodoxie und sehr hilfreich für den lutherischen Klerus bei der Identifikation von Häretikern.Vgl. auch Assmann, Religio duplex, 16–21; Schröder, Ursprünge; Wild, »Freidenker«. 27 Mulsow, Gelehrtenrepublik, 232–236; Israel, Radical Enlightenment, 684–703. 28 Schiewe, Öffentlichkeit, 136 f.; vgl. auch S. 211, 269. 29 Vgl. Goldenbaum, Appell, 165; vgl. auch Gierl, Pietismus. 30 Hammerstein, »Universitäten«, 222. 31 Kempe und Maissen, Collegia der Insulaner, 9–14, 249–293; der Name der »Insulaner« geht auf ihren Treffpunkt zurück, ein Haus auf einer Insel im Fluss Limmat. 32 Kempe, Wissenschaft, 22–25. 33 Kempe und Maissen, Collegia der Insulaner, 9. 34 Würgler, Unruhen, 202–226. 35 Kopitzsch, Grundzüge, 265–297; Zelle, »Das Erhabene«; Philipp, Werden, 33–47. 36 Böning, Welteroberung, 233–264. 37 Whaley, Toleration, 34, 39. 38 Saine, Problem, 146–152; Hunter, »Multiple Enlightenments«; vgl. auch Wilson, »Reception«, 442 ff. 39 Israel, Enlightenment Contested, 652–657.
395
396
III. · Die deutschen Territorien um 1648–1760
40 41 42 43
44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58
59 60 61 62 63 64
65
Thomann, »Wolff«, 268. Hammerstein, »Wolff«, 270–276; Stolleis, Öffentliches Recht I, 289 f. Muslow, Freigeister, 14. ADB XX, 256 f.; Döring, »Beiträge«, 99–105; die Alethophilen gingen nach Leipzig, nachdem Friedrich II. Manteuffel 1740 wegen Spionage ausgewiesen hatte; Ableger der Gesellschaft gab es in Weißenfels und Stettin. Meid, Literatur, 893 f. Mulsow, Freigeister, 11–19; Saine, Problem, 163; Assman, Religio duplex, 17–20. Saine, Problem, 163; Quéval, »Gottsched und Bayle«. Sheehan, Enlightenment Bible, 121–131; Israel, Enlightenment Contested, 188–194; Spalding, Seize the Book; Goldenbaum, Appell, 175–508. Sheehan, Enlightenment Bible, 122. Spalding, Seize the Book, 131–150; Wertheim wurde ab 1648 von zwei Linien (Virneburg und Rochefort) gemeinsam regiert; die katholischen Grafen wurden 1712 zu Fürsten erhoben, die protestantischen erst 1812 durch den König von Bayern. Goldenbaum, Appell, 482 f. Goldenbaum, Appell, 320; Wilson, »Reception«, 444–453. Vierhaus, »Patriotismus«. Schmidt, Vaterlandsliebe; Dreitzel, »Zehn Jahre«. Hardtwig, Genossenschaft, 224–238. Vgl. Hardtwig, Genossenschaft, 230. Luig, »Thomasius«, 237–241. So etwa seine Ablehnung von Tschirnhaus (1688) und Theodor Ludwig Lau (1717); vgl. Lau, Meditationes, 20–24; vgl. auch Gawlick, »Thomasius«, 270–273. Hammerstein, »Wolff«, 267 ff.; Hunter, Rival Enlightenments, 265–273; Hunter, »Multiple Enlightenments«. Hunters Arbeit ist die beste Dekonstruktion der bei der deutschen Philosophiehistoriografie so beliebten Leibniz-Wolff-Kant-Tradition und liefert starke Argumente für eine Kontinuität der von Pufendorf und Thomasius begründeten Traditionen. Hochstrasser, Natural Law Theories, 179. Vgl. S. 212 ff. Wagner, Schriften, 63 ff. Whaley, Toleration, 16, 35 f., 62 f., 129, 179 f. Gottsched, Werke I, 42; Mitchell, Gottsched, 61 f. Mattheier, »Reichssprache«; es ging um Luthers Beibehaltung des unbetonten Schluss-e gegen den Trend zu Synkope und Apokope im »gemeinen Deutsch«, der sich in der deutschen Literatur rasch verbreitete – die »moderne« Orthografie mischte Elemente des »Oberdeutschen« und der (lutherischen) Meißener Tradition, was nichts daran änderte, dass sich die konfessionelle Kontroverse bis ins 19. Jahrhundert fortsetzte; vgl. Raab, »Lutherisch-deutsch«. Blackall, Emergence, 139–148; Blackall, »Observations«.
IV. Niedergang oder Reife? Das Reich von Karl VII. bis Leopold II. (ca. 1740–1792)
39. Drei Kaiser und ein König
D
en reich geschmückten Sarkophag Karls VI., von Maria Theresia in Auftrag gegeben und 1742 von Johann Nikolaus Moll (* 1708, † 1743) fertiggestellt, zieren vier Vanitasschädel mit den Kronen des Reichs, Kastiliens, Böhmens und Ungarns sowie die einsame Figur der Göttin Austria in zeremoniellem Trauergewand. 1 1750 gab Maria Theresia bei Molls Neffen Balthasar Ferdinand einen weiteren Sarg für sich und ihren Gatten in der Kapuzinergruft in Auftrag, die sie kurz nach ihrer Thronbesteigung erweitern ließ. Den von den Schwingen eines riesigen Adlers getragenen Sarkophag krönen Figuren von Maria Theresia selbst und ihrem Ehemann Franz Stephan von Lothringen, halb liegend einander in entzückter Zuneigung betrachtend. An den vier Ecken sitzen trauernde Göttinnen mit Kronen, die die gegenwärtigen Zuständigkeitsbereiche und historischen Titel des Herrscherpaars repräsentieren: die Kronen Ungarns, Böhmens, des Heiligen Römischen Reichs und Jerusalems. 2 Die Symbolik war klar und wohldurchdacht. Die eheliche Verbindung war auch eine politische Partnerschaft, in der beide unterschiedliche Titel trugen, sich aber die Regierungsämter teilten, die nun auch wieder das Reich umfassten. Später fügte ihr Sohn Joseph II. seine eigene Darstellung hinzu. Neben dem prunkvollen Sarg seiner Eltern ließ er einen schlichten Bronzesarkophag aufstellen, nur geschmückt mit einem versilberten Kreuz. Die Symbolik der Gräber war programmatisch und spiegelt einige der entscheidenden Entwicklungen im Heiligen Römischen Reich nach 1740 wider. Nach dem Tod Karls VI. und einem zweijährigen Interregnum ging die Kaiserkrone an Karl Albrecht von Bayern. Seine Herrschaft als Karl VII. (1742–1745) erwies sich jedoch als katastrophal und nach seinem frühen Tod 1745 wurde Maria Theresias Gatte Franz Stephan von Lothringen als Franz I. zum Kaiser gewählt. Das Haus Habsburg-Lothringen stellte die zuvor seit 1438 ungebrochene Kontinuität der Habsburger auf dem Kaiserthron wieder her; auf Franz folgten seine Söhne Joseph II. (1765–1790) und Leopold II. (1790–1792) sowie schließlich dessen Sohn Franz II. (1792–1806), der 1804 vor der Auflösung des Heiligen Römischen Reichs 1806 den Titel Kaiser Franz I. von Österreich annahm. War die Wiederherstellung der Kontinuität echt oder nur scheinbar? Wie verpflichtet war das Haus Habsburg-Lothringen dem Reich? Übte es je die gleiche Autorität aus wie das Haus Habsburg zuvor? Lässt sich der schmucklose Sarg Josephs II. als Verleugnung der Tradition und somit des Reichs deuten, als Aus-
400
IV. · Das Reich von Karl VII. bis Leopold II. (ca. 1740–1792)
druck der zunehmenden Wertlosigkeit für die Dynastie, die sich nun mehr als je zuvor als österreichisch und nicht als deutsch empfand? Zweifellos wurde die Frage nach Österreichs fortdauernder Rolle in Bezug auf das Heilige Römische Reich ab 1745 zunehmend offen gestellt. Und während zunächst klar zu sein schien, dass Österreich das Reich ebenso sehr brauchte wie umgekehrt, führten spätere Diskussionen des Themas zu eher ambivalenten Schlüssen. 3 In gewisser Weise war die zunehmend offene strategische Reflexion über Österreichs Beziehung zum Reich nur eine unvermeidliche Folge von Österreichs Aufstieg zur Großmacht. 4 Die Konsolidierung der Macht über die Länder, die die Dynastie direkt regierte, machte in dieser Zeit weitere, in vielerlei Hinsicht entscheidende Fortschritte. Dass Maria Theresia allein über diese Gebiete herrschte, während Franz I. und Joseph II. (bis 1780) lediglich heilig-römische Kaiser waren, trug zur Entstehung separater Verwaltungen bei. Es gab nun österreichische Institutionen, die ausschließlich dem österreichischen Staat dienten. In noch größerem Ausmaß führten die Vorgänge in Brandenburg-Preußen zu strategischen Reflexionen über Österreichs Rolle im Reich. Der Schock der Invasion Friedrichs II. in Schlesien 1740 und das wiederholte Scheitern von Versuchen einer Rückgewinnung standen für einen signifikanteren Umschwung in der deutschen politischen Landschaft. Preußisch-deutsche nationalistische Historiker deuteten den Aufstieg Preußens als Anfang vom Ende des Reichs und ersten Schritt zur »nationalen« Vereinigung unter preußischer Führung 1871. Zwar behielt Österreich die Kaiserkrone, aber der preußische König wurde eine Art »Anti-Cäsar« oder Gegenkaiser, wie ihn Kaunitz 1764 nannte, mit mehr Macht und Einfluss als der Kaiser selbst. 5 Friedrich der Große wurde zweifellos mächtiger als sämtliche protestantischen Reichsfürsten vor ihm. Obwohl er Deist war und sich wiederholt skeptisch über organisierte Religion äußerte, nutzte er die protestantische Sache geschickt aus und übernahm die Rolle, die traditionell Sachsen und später Hannover gespielt hatte. Für das Reich hatte er anfangs nur Verachtung übrig, wurde indes zum virtuosen Vertreter seiner Politik und hielt von den späten 1770er Jahren bis zu seinem Tod 1786 ohne Zweifel Joseph II. in Schach. 6 Er erreichte in Norddeutschland eine politische Dominanz, die seine Nachfolger Friedrich Wilhelm II. (1786–1797) und III. (1797–1840) ebenfalls beibehielten, wenn auch unter einigen Schwierigkeiten. In diesem Sinn legte die Herrschaft Friedrichs des Großen in Preußen eindeutig das Fundament für spätere Entwicklungen. Nicht umsonst verehrte ihn die preußisch-deutsche Tradition wie keinen anderen vormodernen deutschen Herrscher. 7 Seine militärischen Kampagnen dienten Generationen preußischer Generale und Militärplaner bis ins frühe 20. Jahrhundert als Vorbild. Historiker wie Hans Delbrück (* 1848, † 1929) beschrieben Friedrichs präventiven Einmarsch in Sachsen 1756 als moralische Fabel mit politischen Lehren für ihre eigene Zeit. Wie
39. Drei Kaiser und ein König
andere sah auch Thomas Mann in Friedrichs Überleben des Siebenjährigen Kriegs eine Inspiration für den Umgang mit Deutschlands Umzingelung 1914. 8 Friedrich blieb bis zum Zusammenbruch 1945 eine nationale Ikone. Danach wurden die Urteile negativer. In der DDR herrschte offene Ablehnung und Verdammung, bis es in den späten 1970er Jahren zu einer Neubewertung kam, die ein differenzierteres Bild der Leistungen des preußischen Königs zeichnete, vor allem was Innenpolitik und Reformen anging, seine militärischen Methoden indes weiterhin missbilligte. In der Bundesrepublik hatten es zögernd positive Bewertungen von Konservativen wie Gerhard Ritter (* 1888, † 1967), dessen 1936 veröffentlichte Biografie Friedrichs 1954 mit neuem Vorwort in dritter Auflage erschien, schwer gegen eine Flut der Preußenfeindlichkeit, die die Historiker der Sonderweg-Schule in den 1960er und 1970er Jahren lostraten; indes kam es auch hier in den 1980er Jahren zu einer Neubewertung. 9 Die wechselnde Interpretation des Charakters und der langfristigen historischen Rolle Friedrichs II. hatte kaum Auswirkungen auf die Wahrnehmung seiner Bedeutung für das 18. Jahrhundert. Die Einschätzung, der Angriff auf Schlesien 1740 stelle den Beginn der Ära des österreichisch-preußischen »Dualismus« dar, erwies sich als bemerkenswert beständig. Selbst wer 1740 nur als Vorspiel von 1748 (Ende des Österreichischen Erbfolgekriegs), 1763 (Ende des Siebenjährigen Krieg) oder der späten 1770er Jahre (Bayerischer Erbfolgekrieg) betrachtete, tat dies unter klarem Vorzeichen: Der »Dualismus« galt als Anfang vom Ende des Reichs. 10 Die beiden dominanten Staaten Österreich und Preußen, die beide ausgedehnte Territorien außerhalb des Reichs besaßen und sich als unabhängige Großmächte etablierten, gingen vollständig in ihrer gegenseitigen Feindseligkeit auf. Im Reich, so ist zu lesen, sahen sie nicht mehr als ein Mittel zum Zweck der Durchsetzung ihrer eigenen Ambitionen. Lässt man Hagiografie und Dämonisierung Friedrichs des Großen ebenso beiseite wie alle teleologischen Betrachtungen der langfristigen Ursprünge der deutschen Einigung 1871, so zeigt sich ein anderes Bild. Zeitgenossen waren sich der Rivalität zwischen Preußen und Österreich und der Feindschaft ihrer Herrscher zweifellos bewusst. Goethe etwa erinnert sich in seinen Memoiren Dichtung und Wahrheit (1811–1833), dass seine eigene Familie in Frankfurt in ein kaisertreues Lager und jene, die die Siege Friedrichs II. im Siebenjährigen Krieg bejubelten, gespalten war. 11 Der Streit ging auf die politische Situation nach dem Tod Karls VI. 1740 zurück: Goethes Großeltern standen unerschütterlich auf Seiten Habsburgs, während die Generation seiner Eltern, vor allem sein Vater, den Wittelsbacher Kaiser Karl VII. und den König von Preußen, der bei seiner Wahl eine Schlüsselrolle spielte, unterstützte. Der Krieg nach 1756 verstärkte ihre Differenzen so sehr, dass Familienmitglieder, die sich auf der Straße begegneten, in handgreifliche Auseinandersetzungen »wie in Romeo und Julie« gerieten. Goethe selbst erinnert sich,
401
402
IV. · Das Reich von Karl VII. bis Leopold II. (ca. 1740–1792)
wie er als Siebenjähriger 1756 heimlich seinen großen Helden verehrte, den preußischen König: Er sei »denn auch preußisch oder, um richtiger zu reden, Fritzisch gesinnt« gewesen, »denn was ging uns Preußen an!« Die Unterscheidung ist bezeichnend. Es war möglich, die Energie des preußischen Königs zu bewundern, wie man auch Karl VII. unterstützen konnte, ohne damit viel über eine Einstellung zum Reich zu sagen, noch weniger zum »Dualismus«. Gegen die Habsburger zu sein, ihrer Macht zu misstrauen und ihnen übelzunehmen, dass und wie sie das Reich in internationale Konflikte hineingezogen hatten, bedeutete nicht unbedingt eine Ablehnung des Reichs. Den König von Preußen zu unterstützen oder zu bewundern, hieß nicht, dass man selbst Preuße werden oder ihn als Kaiser sehen wollte oder gar als Anführer einer Abspaltung Norddeutschlands vom Reich. Vor dem neuen Hintergrund der österreichisch-preußischen Spannungen hielt sich das Reich recht gut. Die beiden Mächte hielten einander in Schach und sorgten so für einen stabilen Gesamtrahmen. Tatsächlich meinte der Bischof von Würzburg, als er im Dezember 1791 erfuhr, ein österreichisch-preußisches Abkommen stehe kurz vor dem Abschluss: »Wenn Österreich und Preußen einig sind, so ist das Ende des Reiches gekommen.« 12 Ab 1763 waren Österreich, Preußen und das Reich als Ganzes in eine internationale Konstellation eingebettet, die ebenfalls Stabilität garantierte. Der Niedergang Frankreichs und der Aufstieg Russlands schuf ein neues Gleichgewicht in Europa. Beobachter wie Rousseau und Gabriel Bonnot de Mably sahen im Reich gar den Kern eines neuen, stabilen Europas, das nun die föderalen Strukturen entwickeln konnte, die nötig waren, um den Frieden dauerhaft zu sichern. Solche Vorstellungen waren natürlich utopisch, sie erschienen indes wesentlich realistischer als das Projet de paix perpétuelle des Abbé de Saint-Pierre von 1712 und übten in den 1790er Jahren starken Einfluss auf Kant aus. 13 In dieser Phase wurde außerdem eine Vielzahl von Reformplänen für das Reich formuliert. Manche waren klar unrealistisch, andere eher praktikabel, aber ziemlich alle scheiterten. Reformen fielen jetzt nicht leichter als zu irgendeinem Zeitpunkt seit den 1490er Jahren und es gab keine existenzielle Krise wie den Religionskonflikt Mitte des 16. Jahrhunderts und den Dreißigjährigen Krieg, die eine Neuorientierung des Gemeinwesens erfordert hätte. Dennoch belegen die Pläne das anhaltende Interesse an dem System und dessen Lebensfähigkeit. Die Fülle an Literatur zum Reich, die im Vergleich zur ersten Jahrhunderthälfte noch zugenommen hatte, schuf allein für sich neue politische Fakten, einen neuen konzeptuellen Rahmen, innerhalb dessen politische Themen diskutiert und geklärt wurden. Die Debatte über das Verhältnis von Reich und Nation entwickelte sich weiter. Das alte Thema der »deutschen Freiheit« oder Libertät bekam unter dem Einfluss der Administration der Reichsjustiz nach dem Westfälischen Frieden und
39. Drei Kaiser und ein König
des neuen Tonfalls von Freiheit und Rechten der späteren Aufklärung eine neue Ausrichtung. Die ursprüngliche Bedeutung der Libertät als Freiheit der Stände wurde immer lockerer und verschwommener und so verstanden sie viele schließlich als Freiheit aller Deutschen. 14 Die Reformpläne scheiterten, nicht aber die Institutionen des Reichs. Der Reichstag, die Gerichte und Kreise erfüllten weiterhin Schlüsselfunktionen und entwickelten in einigen Fällen neue. Parallel dazu und innerhalb des Rahmens des imperialen Systems erfuhren die deutschen Territorien in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts signifikante Veränderungen. Konsolidierung und Reform in Österreich und Preußen sind hierbei entscheidend. Wurden sie nunmehr beide zu groß und zu gierig nach weiteren Territorien, um im Reich Platz zu finden? Die Masse der mittleren und kleineren Territorien mit etwa 14–15 Millionen der rund 27 Millionen Bewohner des Reichs um 1800 entwickelte sich mäßiger und traditioneller. 15 Einerseits gab es Reformen, oft ambitionierte Reformprogramme, manchmal motiviert durch spezifische Notwendigkeiten oder Probleme, aber nun geprägt vom Denken der Aufklärung. Andererseits kam es zu signifikanten Verschiebungen in der politischen Debatte und Kultur, ebenfalls im Zeichen aufklärerischer Ideen. Wenn das Reich in den 1780er Jahren eine Krise erlebte, dann wurde sie ausgelöst durch Joseph II., nicht durch neue Ideen oder irgendeine tödliche Krankheit des Reichs insgesamt. Zudem wurden in der kurzen Regierungszeit seines Nachfolgers Leopold II. viele der Schäden wieder behoben. Weder Österreich noch Preußen verließen das Reich. Ihre Rivalität zerstörte es nicht. Auch die politische Eruption in Frankreich 1789 setzte nicht derart moderne Ideen frei, dass ein sklerotisches, traditionsversessenes Reich durch ihre Verbreitung in Deutschland einfach zerfallen wäre. Die finale Krise des Reichs begann 1792 mit dem unglückseligen Krieg gegen Frankreich und der Frage, wie die, die Territorien am linken Rheinufer verloren hatten, entschädigt werden sollten. Das Reich war nicht das einzige Opfer dieser Kriege. Der größte Teil von Kontinentaleuropa litt an ihren Folgen. Aber ihre Auswirkungen auf die deutsche Geschichte waren nach einhelligem Urteil vom frühen 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart tiefgreifender als in allen anderen Ländern.
Anmerkungen 1 2
Braunfels, Kunst I, 82 f.; Hawlik-Van de Water, Kapuzinergruft, 51, 152–158; vgl. zum Folgenden ebd., 38, 46, 166–178, 179–181. Die österreichischen Habsburger waren unter mehreren Bewerbern um die Krone von Jerusalem, die an Karl VI. ging, nachdem er im Wiener Vorfrieden von 1735 auf das Königreich Neapel verzichten musste. Das Haus Habsburg-Lothringen erneuerte seinen An-
403
404
IV. · Das Reich von Karl VII. bis Leopold II. (ca. 1740–1792)
3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
spruch und so blieb die Krone von Jerusalem von 1804 bis 1918 Teil der österreichischen Kaisertitels. Aretin, Altes Reich III, 539, zeigt, dass in den späten 1740er Jahren in Reaktion auf die Frage, was Österreich nach 1745 vom Reich erwarten konnte, allgemeine taktische Themen erkundet wurden; die Frage nach dem Wert des Reichs für Österreich und ob es sich lohnte, daran festzuhalten, kam in den 1760er Jahren auf. Die wohl beste Darstellung ist Hochedlinger, Wars. Aretin, Heiliges Römisches Reich I, 19–23. Press, »Friedrich«; Haug-Moritz, »Friedrich«; Wilson, »Prussia’s Relations«. Hahn, Friedrich, bietet einen umfassenden Überblick. Burkhardt, Vollendung, 437 f. Blanning, »Death«; Clark, Iron Kingdom XX–XXI; Anderson, Historians, 131–157; Kocka, »Sonderweg«. Vgl. z. B. Aretin, Altes Reich III, 41. Neuhaus, »Hie österreichisch«, 57–60. Aretin, Heiliges Römisches Reich I, 250. Dietze, »Abriß«, 35–42. Klinger, »Freiheit«. Die Gesamtzahl umfasst auch Schlesien, Böhmen und Mähren und rechnet mit etwa 9 Millionen österreichischen bei nur etwas mehr als 4 Millionen preußischen Untertanen; vgl. Hartmann, »Bevölkerungszahlen«, 345–349; Wilson, Reich, 364–377; Wallner, »Reichsterritorien«.
40. Die Schlesischen Kriege (1740–1763)
D
as Ringen zwischen Österreich und Preußen um Schlesien betraf das Reich anfangs nicht direkt. Die ersten zwei Schlesischen Kriege (1740– 1742 und 1744/45) waren Teil eines umfassenderen Konflikts über das habsburgische Erbe; der Reichstag weigerte sich beständig, den Reichskrieg zu erklären. Der Dritte Schlesische Krieg (1756–1763) war eine größere Auseinandersetzung für sich, in die das Reich mit einbezogen wurde, und umgekehrt Teil einer internationalen Konfrontation, die auch als »erster echter Weltkrieg« bezeichnet wurde. 1 Die Konflikte hatten signifikante Auswirkungen auf die Innenpolitik des Reichs und seine Stellung im internationalen System in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Karl VI. war kaum begraben, als es zur Anfechtung der Pragmatischen Sanktion kam. Der Plan, die Integrität der habsburgischen Länder und die Erbfolge seiner Tochter als deren Herrscherin zu sichern, geriet schnell ins Wanken. Großbritannien und Hannover blieben bei der Stange, ebenso wie die meisten anderen deutschen Fürsten. Auch Frankreich hielt sich zunächst an die Verpflichtungen aus dem Wiener Vorfrieden von 1735, allerdings erhoben die spanischen Bourbonen umgehend Anspruch auf Gebiete in Norditalien, die sie als rechtmäßigen Besitz der spanischen Krone betrachteten, und auch Sardinien stellte Forderungen. 2 Kardinal Fleury konnte es sich zu Beginn leisten, passiv zu bleiben, weil er wusste, dass das Abkommen von anderen infrage gestellt wurde; er versicherte lediglich dem österreichischen Botschafter Fürst Liechtenstein, Grund für die Verzögerung der Anerkennung von Maria Theresias Erbfolge sei die Bestimmung des korrekten Zeremoniells für diesen Anlass. Sachsen, Bayern und Brandenburg indes erhoben sofort Ansprüche auf habsburgische Gebiete. Sachsen und Bayern taten dies im Namen der Töchter Josephs I., die in ihre Dynastien eingeheiratet hatten, obwohl beide bei ihrer Heirat auf sämtliche derartigen Ansprüche verzichtet hatten. Sachsens Forderung waren relativ bescheiden: ein schmaler Landkorridor entlang der Nordgrenze des habsburgischen Schlesien als Verbindung nach Polen. 3 Der sächsische Premierminister Graf Heinrich von Brühl hielt dies auf dem Verhandlungsweg für durchsetzbar. Den Erbfolgeanspruch der Gattin seines Herrschers, Josephs I. älterer Tochter Maria Josepha, wollte er eher als Schachfigur zu diesem Zweck einsetzen, als sich eine realistische Chance auf weitere Landgewinne von den Habsburgern auszurechnen.
406
IV. · Das Reich von Karl VII. bis Leopold II. (ca. 1740–1792)
Sein durchgehendes, für Sachsen letztlich ruinöses Bestreben war, die sächsische Herrschaft über Polen zu stärken. Die bayerischen Ansprüche im Namen der Kurfürstin Maria Amalia waren komplizierter. Zum einen hatte Karl Albrecht der Reichstagsgarantie der Pragmatischen Sanktion 1732 nicht zugestimmt. 4 Zweitens beruhten die bayerischen Forderungen weitgehend auf ihrer Auslegung des 1546 abgefassten, 1547 per Nachtrag veränderten Testaments von Ferdinand I. bezüglich der Heirat seiner ältesten Tochter Anna mit Albrecht V. von Bayern. Die Bayern legten eine angebliche Kopie aus ihren Archiven vor, laut derer die Wittelsbacher auf den Thron folgen sollten, wenn es keinen männlichen Erben gab. 5 Im Wiener Original indes war vom Fehlen eines »legitimen Erben« ohne Spezifizierung des Geschlechts die Rede. Dennoch malten sich die Wittelsbacher aufgrund des fingierten Letzten Willens eine glorreiche Zukunft aus. Schon 1732 hatte ihr Kanzler Franz Xaver Unertl (* 1675, † 1750) Ansprüche auf das habsburgische Erbe geltend gemacht. 6 Dies weckte durch zwei mittelalterliche Vorgänger genährte Hoffnungen, der Kurfürst von Bayern könne Kaiser werden. 7 Geografische Nähe zu den Habsburgern, Familienband und mittelalterliche Vorläufer befeuerten die bayerischen Ansprüche, aber auch die Verbitterung über den schroffen Umgang mit Bayern und Köln im Spanischen Erbfolgekrieg.8 Die Ansprüche des neuen Preußenkönigs Friedrichs II. auf Schlesien waren noch dürftiger und dubioser begründet. Ein Zweig der Hohenzollern hatte einst das Herzogtum Jägerndorf besessen; es war 1621 nach dem Böhmenaufstand konfisziert und 1648 nicht zurückerstattet worden. Eine weitere Verbindung lieferte ein Erbabkommen mit den Subsidiarherzogtümern Brieg, Liegnitz und Wohlau, das Ferdinand I. für illegal erklärt hatte, weshalb die Herzogtümer 1675 an die Habsburger fielen. Nach einigem Ringen hatte sich der Große Kurfürst 1686 mit der Zuteilung des Distrikts Schwiebus zufriedengegeben, den sein Nachfolger 1695 als Teil der brandenburgischen Zahlungen für die kaiserliche Anerkennung der preußischen Königskrönung 1700 an Österreich zurückerstattet hatte. 9 Die nun vorgelegten legalen Argumente liefen darauf hinaus, die Rückgabe von Schwiebus habe den Verzicht Brandenburgs auf seine Ansprüche aufgehoben. Im politischen Vermächtnis Friedrich Wilhelms I. war Schlesien jedoch nicht einmal erwähnt und so waren sämtliche legalen Rechtfertigungen Preußens nur ein Vorwand für das, was bald folgte. Während Sachsen und Bayern verhandelten und Ränke schmiedeten, entsandte Friedrich am 16. Dezember 1740 eine Armee von 30.000 Mann nach Schlesien. 10 Sie stieß kaum auf Widerstand der begrenzten österreichischen Streitkräfte, die sich in die Festungen Brieg, Glatz, Glogau und Neiße zurückzogen und den Preußen den Rest des Landes samt der Hauptstadt Breslau überließen. Der preußische König erklärte London, er sichere sich nur seine Rechte und verteidige dabei zu-
40. Die Schlesischen Kriege (1740–1763)
dem die Habsburger gegen Sachsen und Bayern. Gleichzeitig bot er Maria Theresia seine volle Unterstützung in allen anderen Belangen an, auch seine Stimme für die Wahl ihres Gatten zum Kaiser, falls sie ihm Schlesien offiziell überließe. Einige ihrer Berater drängten sie dazu, aber Maria Theresia war empört, ließ Truppen zur Wiedereroberung Schlesiens ausheben und appellierte an alle, die die Pragmatische Sanktion garantiert hatten. Die habsburgische Schwäche rüttelte letztlich die Gegner der Dynastie wach, die sich in einer besseren Lage als je zuvor sahen. In Frankreich wurde die vorsichtige und im Grunde pazifistische Stimme von Kardinal Fleury zunehmend übertönt von dem kriegerischen Marshall von Belle-Isle, der die Gelegenheit gekommen sah, zu erreichen, was Ludwig XIV. im Spanischen Erbfolgekrieg nicht erreicht hatte. 11 Nur Großbritannien erfüllte seine Pflicht als Garantiemacht der Pragmatischen Sanktion und brachte bis Februar 1741 auch die Niederlande und Russland dazu, Maria Theresia zu unterstützen. Das sächsische Problem wurde einstweilen beigelegt, indem der gerissene Graf Brühl zusicherte, wenn Preußen besiegt sei, werde Sachsen seine Landbrücke nach Polen in Form eines grenznahen Streifens der preußischen Lausitz erhalten. Gleichzeitig bemühte sich Frankreich um die Sammlung einer Gegenallianz im Reich, um die Forderungen Sachsens und Bayerns durchzusetzen und den bayerischen Herrscher auf den Kaiserthron zu bringen. 12 Das preußische Angebot einer Defensivallianz wurde abgelehnt, weil Friedrich zu viel verlangte. Im Juni 1741 schloss sich jedoch auch Preußen im Vertrag von Breslau der Koalition gegen Habsburg an. Der Konflikt entflammte an mehreren Fronten und weitete sich bald auf Norditalien und die österreichischen Niederlande aus. Ein größerer Krieg war wohl unvermeidlich, nachdem der erste österreichische Versuch einer Rückeroberung Schlesiens in der knappen Niederlage von Maria Theresias Truppen unter Neipperg bei Mollwitz am 10. April 1741 endete. 13 Obwohl die Lage in Schlesien unentschieden war, gab Mollwitz den Initiativen von Belle-Isle Vorschub und rückte Preußen in Richtung der französischen Allianz. Zugleich wurden Österreichs Verbündete vorsichtiger, da sie ahnten, dass sich Österreich nicht durchsetzen würde und sie sich mit seinen Feinden verständigen müssten. Inmitten dieser Unsicherheit hoffte Großbritannien immer noch, Preußen und Sachsen in einer großen Allianz gegen Frankreich zu vereinen. Sachsen missfiel indes zunehmend der Vorrang bayerischer Interessen, zudem fühlte es sich von Preußen bedroht. Das hielt die Sachsen aber nicht ab, am 19. September 1741 mit Bayern und Preußen ein Abkommen über die Aufteilung der österreichischen Gebiete zu schließen. Bayern sollte Böhmen, Oberösterreich, Tirol und Vorderösterreich bekommen, Sachsen Oberschlesien und Mähren. 14 Eine neue Phase begann am 11. September 1741, als bayerische Streitkräfte mit französischer Unterstützung über das Fürstbistum Passau nach Oberösterreich
407
408
IV. · Das Reich von Karl VII. bis Leopold II. (ca. 1740–1792)
vordrangen und Linz besetzten, woraufhin Maria Theresia am 9. Oktober in Kleinschellendorf einen Waffenstillstand mit Friedrich II. schloss. 15 Die Preußen waren mehr als zufrieden, sich gegen die Zusage von Niederschlesien aus dem Konflikt zurückziehen zu können. Ob der König wirklich mehr im Sinn hatte als eine kurze Erholungspause für seine müden Truppen, ist eine andere Frage, da er sich bald erneut der Offensive gegen Österreich anschloss. Den Bayern war es nicht gelungen, ihren anfänglichen militärischen Vorteil zu nutzen. 16 Statt Wien zu erobern, wandten sich Karl Albrechts Truppen nach Prag, wo er sich am 19. Dezember zum König von Böhmen ausrufen ließ. Unter dem Gesichtspunkt der Ansprüche des bayerischen Kurfürsten auf sämtliche österreichischen Länder und Titel war das verständlich, strategisch jedoch ein Fehler. So hatte Österreich Zeit, sich neu zu sammeln und Pläne für die Wiederbehauptung der Dynastie zu schmieden, gestärkt durch die Geburt eines männlichen Erben, des zukünftigen Joseph II., am 13. März 1741. Maria Theresia wandte sich an Ungarn, dessen Stände ihrer Krönung als Königin am 25. Juni 1741 zustimmten. Als legitime Monarchin entsandte sie Graf Ludwig Khevenhüller, um die Bayern aus Oberösterreich zu vertreiben (Januar 1742) und Bayern einzunehmen. Gerade als der Kurfürst in Frankfurt zum Kaiser gekrönt wurde, musste München kapitulieren. Preußens Wiedereintritt in den Krieg führte zur Besetzung Mährens durch sächsische, preußische und französische Truppen. Sie konnten jedoch ihre Stellung nicht sichern, die Lage blieb selbst nach einem erneuten preußischen Sieg bei Chotusitz am 17. Mai 1742 unentschieden und so willigten beide Seiten in Friedensverhandlungen unter britischer Vermittlung ein. Der Friede von Berlin vom 28. Juli sprach Preußen Niederschlesien, Glatz und einen Großteil von Oberschlesien zu; Österreich blieben Teschen, Troppau und Jägerndorf. Sachsen, dessen Armee und Finanzen ruiniert waren, zog sich ohne Gewinn und Verlust aus dem Konflikt zurück. Der Ruf des preußischen Königs war damit gesichert: Am 8. Oktober 1742 wurde er erstmals als »Friedrich der Große« bezeichnet. 17 Nun, da Preußen und Sachsen vorläufig neutralisiert waren, wurde die Lage für Frankreich und Bayern prekär. Im Winter 1742/43 vertrieben österreichische Streitkräfte die französischen Truppen und Marshall de Broglie aus Böhmen westwärts in die Oberpfalz und schließlich in die Rheinpfalz. Bayern wurde erneut österreichisch besetzt und im Frühjahr 1743 fegte die Pragmatische Armee aus britischen, niederländischen, österreichischen und hessischen Truppen unter persönlichem Befehl von Georg II. den Rhein hinab und brachte den Franzosen am 27. Juni bei Dettingen eine wichtige Niederlage bei. Dennoch konnten weder die Österreicher noch die Pragmatische Armee das Elsass und Lothringen zurückerobern. Derweil verhandelte Karl VII. fieberhaft, um Bayern wiederzuerlangen, und schmiedete derweil Pläne für dessen Erhöhung zum Königreich. Die Folge war, dass Frankreich Österreich und Großbritannien im März beziehungsweise April
40. Die Schlesischen Kriege (1740–1763)
den Krieg erklärte und am 22. Mai 1744 Preußen, die Pfalz und Hessen die Frankfurter Union gründeten, um dem angeschlagenen Kaiser beizustehen, wobei Preußen Schlesien versprochen wurde, falls es Friedrich gelang, Böhmen für Karl VII. zu erobern. Preußens Wiedereintritt in den Konflikt zwang Österreich, die Offensive Karls von Lothringen gegen das Elsass abzubrechen und alle Kräfte auf Böhmen zu konzentrieren, das nun zum Hauptkriegsschauplatz wurde. Im September 1744 nahmen preußische Streitkräfte erneut Prag ein, litten aber unter den gleichen Nachschub- und Verpflegungsproblemen wie 1742. Zwei Monate später hatten sie sich wieder nach Schlesien zurückgezogen, wo sie von österreichischen Truppen bedrängt wurden, die von Böhmen aus nordwärts nach Oberschlesien vordrangen. Brühl gelang es, Österreich, Sachsen, Großbritannien und die Niederlande in der Warschauer Allianz »zur Befriedung Deutschlands« zusammenzubringen. 18 Zuvor griff Österreich erneut Bayern und die Oberpfalz an und nach dem Tod von Karl VII. am 20. Januar 1745 kapitulierte der neue bayerische Kurfürst. Kurz darauf widerrief Maximilian III. Joseph im Vertrag von Füssen (22. April) alle Ansprüche auf österreichisches Territorium und die Kaiserkrone; im Gegenzug wurde Bayern ohne weitere Sanktionen restituiert, was wiederum die Wahl von Franz Stephan von Lothringen zum Kaiser am 13. September 1745 ermöglichte. Der Zusammenbruch der bayerischen Stellung und das Scheitern der französischen Politik im Reich setzte Friedrich unter neuen Druck. Eine österreichische Offensive gegen Schlesien endete in der Konfrontation mit preußischen Truppen bei Hohenfriedberg am 4. Juni, wobei Preußen siegte, aber beide Seiten schwere Verluste erlitten. Friedrich wollte den Sieg in einen Friedensschluss ummünzen, aber Österreich weigerte sich selbst nach einer weiteren Niederlage bei Soor am 30. September, zu verhandeln, obwohl die Lage in Italien und den Niederlanden prekär war. Gemeinsam mit Sachsen, das zu Recht einen gestärkten preußischen Nachbarn fürchtete, setzten die Österreicher den Krieg mit einer Offensive durch Sachsen in die Lausitz fort, um einen Keil zwischen Berlin und Schlesien zu treiben. Friedrich vereitelte diesen Plan, indem er in Sachsen einmarschierte und Leipzig, Torgau, Meißen und schließlich – nach dem entscheidenden Sieg bei Kesseldorf am 15. Dezember – Dresden besetzte. An Weihnachten 1745 wurde der Friede von Dresden unterzeichnet. Preußen behielt Schlesien, Franz Stephan wurde als Kaiser anerkannt. Sachsen machte keine Gewinne, sondern musste Preußen eine Million Taler Entschädigung zahlen. Außerhalb des Reichs ging der Krieg weiter. 1742 hatten sich die Feindseligkeiten nach Italien ausgeweitet, wo Elisabetta Farnese und ihr Sohn Karl VII. von Neapel und Sizilien und auf der anderen Seite Karl Emanuel von Sardinien ihre jeweiligen Familieninteressen verfolgten. 19 Diesen Konflikt wollte Frankreich nutzen, um Österreich ein für alle Mal aus Italien zu vertreiben, und so formulierte der
409
410
IV. · Das Reich von Karl VII. bis Leopold II. (ca. 1740–1792)
französische Außenminister, der Marquis d’Argenson, einen Gesamtplan zur Umwandlung Italiens in einen Staatenbund wie die Schweiz und die Niederlande. Wenn das in Italien geschafft wäre, käme das Reich an die Reihe. Sein auf französische Hegemonie in Europa gerichteter Ehrgeiz führte jedoch zu nichts, da die meisten italienischen Herrscher die relativ inkompetente habsburgische Oberlehnsherrschaft einem effektiveren französischen Regime vorzogen. 20 Der bereits erwähnte zweite Schauplatz waren die österreichischen Niederlande, wo britische und niederländische Streitkräfte den Franzosen gegenüberstanden. Die ersten Zusammenstöße führten zu keinem Ergebnis und selbst der Triumph Georgs II. bei Dettingen am 27. Juni 1743 brachte nicht den Durchbruch. Während Österreich die Lage in Italien offenhielt, versuchten die Franzosen einen Aufstand der Stuarts 1745 in Schottland zu finanzieren und siegten mehrmals in Flandern und gegen die Niederlande, denen Louis XV. 1747 den Krieg erklärte. 21 Der Konflikt zwischen Frankreich und Großbritannien wurde auch in Kanada und Indien ausgetragen, wobei die Briten Cape Breton besetzten (Juni 1745), die Franzosen Madras (September 1746). 22 Als entscheidend erwies sich letztlich, dass Großbritannien den Franzosen signifikante Niederlagen in Seeschlachten in der Biskaya beibrachte und damit die Versorgungslinien nach Kanada und Indien unterbrach, was sich auch auf die französischen Finanzen katastrophal auswirkte. Ein Patt an allen Fronten zwang Großbritannien und die Niederlande im März 1748 in Aachen an den Verhandlungstisch. Österreich suchte den Krieg mit russischer Unterstützung weiterzuführen, aber der Wunsch der Briten und Niederländer nach Frieden war stärker. Die Bedingungen der Vereinbarung zwischen Großbritannien, den Niederlanden und Frankreich verpflichteten Spanien und dann auch Sardinien und Österreich, den Frieden zu akzeptieren. Hauptnutznießer war Preußen, dessen Besitzrecht auf Schlesien und Glatz bestätigt wurde, während Friedrichs eklatanter Bruch von Reichsgesetzen ungestraft blieb. Sardinien erhielt Nizza, Savoyen und einen kleinen Streifen der Lombardei, Spanien gab sich mit der Übertragung von Parma und Piacenza an Karls jüngeren Bruder Philipp zufrieden. Was Flandern und die Niederlande betraf, änderte sich nichts. Großbritannien gab Cape Breton in Nova Scotia an Frankreich zurück, das im Gegenzug Georg II. als britischen König anerkannte. In Deutschland wurde Georg II. für seine standhafte Unterstützung der Habsburger nicht belohnt. Wie Sachsen war Hannover nun noch mehr als zuvor durch Preußen bedroht. Schließlich wurde vorbehaltlich territorialer Veränderungen in Schlesien und Italien noch die Pragmatische Sanktion garantiert und Franz I. als rechtmäßig gewählter Kaiser anerkannt. Nach 1746 herrschte zehn Jahre Ruhe im Reich. Aber die Schlesischen Kriege hatten in Österreich dauerhafte Verbitterung zurückgelassen, was Preußen nur zu gut wusste; zudem waren die Dinge zwischen Großbritannien und Frankreich alles andere als geklärt. Vor allem für Österreich und Preußen war der Friede ein »Sitz-
40. Die Schlesischen Kriege (1740–1763)
krieg«, eine Phase des politischen Manövrierens, der Reform, Aufrüstung und strategischen Planung. Während Bayern keine Rolle mehr spielte, strebten auch Hannover und Sachsen auf eine Absicherung gegen einen neuen preußischen Angriff. Großbritannien-Hannover gab sich zwischen 1748 und 1753 alle Mühe, die alte Allianz mit Österreich zu erneuern. Andererseits wurden diese Versuche untergraben, als es 1750–1752 nicht gelang, Joseph II. zum römischen König zu wählen, nicht zuletzt, weil Österreich fürchtete, von Großbritannien abhängig zu werden, falls die Wahl hauptsächlich von britischem Geld abhinge. 23 In Sachsen drehte Graf Brühl wie seit 1740 weiterhin seine Kreise, ohne große Wirkung, allerdings steuerte er Sachsen nun tatsächlich auf die totale Katastrophe zu. Im Fall eines neuen Konflikts, so viel war klar, würde das gesamte Reich unweigerlich in einen Reichskrieg hineingezogen. Das Kernproblem blieb Schlesien, das Maria Theresia unbedingt zurückhaben wollte, obwohl der Reichstag 1751 ausdrücklich die Übertragung an Preußen anerkannte. Friedrich war ebenso entschlossen, Schlesien zu halten; in einer Geheimklausel des Testaments, das er 1752 schrieb, legte er zudem seine Ambitionen auf weitere Territorialzugewinne in Sachsen, dem polnischen Westpreußen und dem schwedischen Pommern dar. 24 Sachsen war dabei entscheidend, weil es den relativ schmalen Korridor von Niederschlesien signifikant verbreitert und mit Brandenburg und Schlesien eine massive norddeutsche Landmasse gebildet hätte, vergleichbar mit dem habsburgischen Block im Südosten. Reichtum und Ressourcen Sachsens, so rechnete er, wären ein Ausgleich für die relativ unterentwickelten brandenburgischen Kernländer, die die ständig wachsende Armee kaum noch versorgen konnten. 25 Der sächsische Kurfürst, dachte er, konnte mit Böhmen entschädigt werden, wodurch zusätzlich ein solider Puffer zwischen seinen eigenen und den habsburgischen Territorien entstünde. So gut wie alle anderen Probleme, die die Konflikte von 1740–1748 geprägt hatten, waren ebenfalls nach wie vor von großer Bedeutung und führten in den frühen 1750er Jahren zu einem grundlegenden Umschwung in der europäischen Bündnisstruktur. Die Niederlande und Spanien spielten keine ernsthafte Rolle in der europäischen Politik mehr. Der Konflikt zwischen Großbritannien und Frankreich blieb jedoch ungelöst; es ging um gewaltige Territorien in Nordamerika und in London wuchs die Sorge um die Sicherheit der Barriere in den Südniederlanden, die niederländische und britische Interessen zur See schützte. Russland, das Mitte der 1740er Jahre an eher unverbindlichen antipreußischen Allianzen mit Großbritannien und Österreich beteiligt war, aber mit innerer Instabilität haderte und geografisch für ein ernsthaftes militärisches Engagement einfach zu weit entfernt war, suchte nun zunehmend ebenfalls seine eigenen Interessen gegen Preußen abzusichern. 26 Frankreich verhielt sich nach dem Zusammenbruch der Herrschaft der Wittelsbacher im Reich, dem Scheitern aller Pläne
411
412
IV. · Das Reich von Karl VII. bis Leopold II. (ca. 1740–1792)
für Italien und wegen des Zerwürfnisses mit den spanischen Bourbonen passiv. Neue Geheimpläne zur Wahl eines französischen Fürsten auf den polnischen Thron und zur Schaffung einer Ostbarriere aus Schweden, Polen und den Osmanen, um Russland und Österreich im Zaum zu halten, wurden eher halbherzig verfolgt. 27 Preußen schließlich war mehr mit der Konsolidierung der Herrschaft über Schlesien beschäftigt als mit weiteren Vorhaben. Zwei Dinge veränderten sich. Die britischen Versuche, das »alte System« einer gemeinsamen Linie von Großbritannien, den Niederlanden und Österreich gegen Frankreich zu erneuern, zerschlugen sich. Nach dem gescheiterten Versuch, Joseph II. zum römischen König zu wählen, suchten die Briten zunehmend nach anderen Wegen, sich abzusichern. Ein Beihilfeabkommen mit Russland (1755) sollte beide Seiten gegen preußische Aggression schützen. 28 Friedrich der Große war von der Vorstellung einer feindlichen anglorussischen Partnerschaft so schockiert, dass er am 16. Januar 1756 eilends ein Bündnis mit Großbritannien schloss. Das wiederum beunruhigte Russland und Frankreich so sehr, dass es die Bildung einer weiteren Konstellation einleitete, die 1749 erörtert worden war und in den frühen 1750er Jahren Gestalt annahm. Die Idee einer österreichischen Allianz mit Frankreich hatte Graf Wenzel Anton von Kaunitz (* 1711, † 1794) im März 1749 entworfen. Im Jahr zuvor war er der österreichische Repräsentant in Aachen gewesen und hatte dort erleben müssen, wie seine Position durch geheime britisch-französische Gespräche untergraben worden war. Das überzeugte ihn von Großbritanniens Unzuverlässigkeit; Österreich musste neue Optionen suchen. 29 In Wien wie in Paris gab es Vorbehalte und Befürchtungen, aber die anglopreußische Verständigung 1755 führte am 1. Mai 1756 zu einem österreichisch-französischen Abkommen. 30 Der erste Vertrag von Versailles war eine Defensivallianz, dem die Zusage Russlands, sich einer antipreußischen Koalition anzuschließen, jedoch ein offensives Element beimischte, da die Russen sofort unverhohlen aufzurüsten begannen. Diese »diplomatische Revolution« markierte das Ende des »alten Systems« einer antifranzösischen Koalition, das seit der Jahrhundertwende die europäische Politik bestimmt und das Reich stabilisiert hatte, und sie brachte Preußen in eine sehr anfällige Position. Friedrich sah sich nun von Österreich wie von Russland bedroht und konnte nicht mehr auf eine von Frankreich beförderte Instabilität im Reich setzen. Als es ihm nicht gelang, von Österreich garantiert zu bekommen, dass Schlesien nicht angegriffen würde, eröffnete er selbst die Feindseligkeiten und marschierte in Sachsen ein. Dies brachte ihn umgehend in Schwierigkeiten, weil der Konflikt Preußens Ressourcen bis zum Äußersten belastete und ihn beinah vernichtet hätte. Die preußische Invasion in Sachsen Ende August machte aus der defensiven österreichisch-französischen Allianz durch den zweiten Versailler Vertrag vom
40. Die Schlesischen Kriege (1740–1763)
1. Mai 1757 ein Angriffsbündnis, dem sich Russland mit einer Armee von 80.000 Mann anschloss, ebenso wie mehrere deutsche Fürsten, so auch Sachsen (und das mit ihm vereinte Polen), sowie schließlich Schweden. Manche, etwa die Pfalz und Bayern, verfolgten in erster Linie finanzielle Ziele, andere fürchteten eine Annexion durch Brandenburg-Preußen. Für viele war entscheidend, dass Preußen in krasser Weise Reichsrecht gebrochen hatte. Am Ende beschloss der Reichstag, der noch 1740 eine Verwickelung vermieden hatte, innerhalb eines Monats, offiziell den Reichskrieg gegen Preußen zu erklären. Das von Kaunitz formulierte österreichische Ziel war, dass Preußen »in die Mittelmäßigkeit gesetzet« werde, damit »es wieder ein Staat vom andern Range, und den übrigen weltlichen Churfürsten gleich, würde«. 31 Schlesien wiederzugewinnen, war nun Teil umfassenderer Ambitionen, das Problem, das zu seinem Verlust geführt hatte, endgültig zu lösen. Letztlich wurde keines der Ziele erreicht. Preußen überstand den Krieg, aber aus Gründen, die nicht gänzlich Friedrichs militärischen Fähigkeiten und auch nicht der Stärke des preußischen Staats zuzuschreiben sind. Österreich konnte seine anfänglichen Vorteile nicht nutzen, um eine Ächtung des Königs von Preußen zu erreichen: Das Beharren des Kaisers auf der Einbeziehung des Kurfürsten von Hannover und britischen Königs erregte den Widerstand des Corpus Evangelicorum. 32 Weder Österreich noch Russland wollten dem jeweils anderen Vorteile bei der Verteilung von Gebieten gönnen. Frankreich war durch große Verluste in Kanada abgelenkt und zog sich immer mehr aus den Vorgängen im Reich zurück. Auch Großbritannien verlor nach seinen Siegen gegen Frankreich 1757 in Indien, 1759/60 in Nordamerika und am 1. August 1759 bei Minden, wo seine Truppen unter Ferdinand von Braunschweig de Broglies Streitmacht vernichteten, das Interesse an dem Krieg. 33 Der Übergang von Georg II. zu Georg III. im Oktober 1760 veränderte ebenfalls die Politik, da Hannover und das Reich aus dem Blick gerieten, der sich zunehmend auf die amerikanischen Kolonien richtete. 34 Der Verlust der britischen Subsidien von 670.000 Pfund pro Jahr von 1758 bis 1761 und der Rückzug der britisch finanzierten westlichen Observationsarmee setzte Preußen stark unter Druck, den Krieg zu beenden. 35 Die russische Beteiligung endete nach dem Tod der Zarin am 5. Januar 1762. Die kurze Herrschaft von Peter III. brachte Friedrich zeitweilige Unterstützung, nach der Thronfolge von Katharina II. am 28. Juni 1762 wurde die österreichisch-russische Allianz nicht erneuert. Die langwierige militärische Konfrontation in Europa hatte derweil keine eindeutige Lösung ergeben. Die preußisch-deutsche nationalistische Historiografie deutete Friedrichs Feldzüge in frühe Kriege zur deutschen Einigung um. 36 Es kam jedoch nur zu relativ wenigen überwältigenden Siegen. Der wirkliche Triumph bestand darin, dass Friedrichs Armee den langjährigen Konflikt überhaupt überlebte. Nach der erfolgreichen Invasion in Sachsen feierte er am 6. Mai 1757 bei Prag einen signifikanten Erfolg gegen Österreich, den jedoch der österreichische
413
414
IV. · Das Reich von Karl VII. bis Leopold II. (ca. 1740–1792)
Sieg bei Kolin am 18. Juni wieder wettmachte. Im Herbst schien Friedrich so gut wie geschlagen, wendete jedoch das Blatt durch seine Siege über das (von der kleinen Reichsarmee verstärkte) französische Heer bei Roßbach (5. November) und über die Österreicher bei Leuthen (5. Dezember). Nach Roßbach bewerteten die Franzosen ihre Politik im Reich neu und begannen sich aus dem Krieg zurückzuziehen. Maria Theresia indes blieb unversöhnlich. Mit diesen Siegen konnte sich Friedrich im Krieg halten, ihn aber nicht gewinnen. Im folgenden Jahr sahen sich seine Truppen schweren Angriffen Russlands im Osten und österreichischer Streitkräfte in Sachsen gegenüber. Ein bemerkenswerter Erfolg im Westen gelang nur den Briten, die die französische Armee unter Marschall de Broglie über den Rhein zurückdrängten. 1759 wurden die Kämpfe bis zum Sommer nicht wieder aufgenommen, dann brachte ein besser koordinierter russisch-österreichischer Angriff den preußischen Kräften schwere Verluste bei, die in der Vernichtung der gesamten Hauptarmee bei Kunersdorf nahe der Oder in der Brandenburger Neumark am 12. August gipfelten. Friedrich fürchtete um Berlin und glaubte am Abend der Schlacht, alles sei verloren. Er dachte sogar daran, zugunsten seines jüngeren Bruders und erfolgreichsten Militärkommandanten, Prinz Heinrich von Preußen, abzudanken. Das erste »Mirakel des Hauses Brandenburg« war, dass die Russen nicht auf Berlin vordrangen, teils weil Österreich keine militärische Unterstützung bot, da weder Österreich noch Frankreich wollten, dass Russlands Einfluss in Deutschland zunahm. 37 So war Friedrich in der Lage, seine verbliebenen Streitkräfte nach Südwesten gegen die österreichischen und Reichstruppen zu richten, die nach Sachsen eingedrungen waren. Die Österreicher gänzlich zurückzuwerfen und Dresden einzunehmen, gelang ihm nicht, obwohl im Juli 1760 sein Geschützfeuer große Teile der Innenstadt in Trümmer legte. 38 Folgende Siege über Österreich bei Liegnitz (15. August) und Torgau (3. November) verbesserten Friedrichs Lage jedoch und stellten sicher, dass Preußen Schlesien behielt. 1760 trat langsam die Diplomatie gegenüber dem Militär in den Vordergrund. Die Kämpfe hielten an, vor allem zwischen Preußen, Österreich und Russland. Besonders Preußen und Österreich waren bestrebt, den Konflikt in siegreicher Position zu Ende zu bringen. Eine Reihe österreichischer und russischer Erfolge 1761 setzte Friedrich erneut stark unter Druck; wieder drangen österreichische Truppen in Sachsen und Teilen Schlesiens ein, während Russland das preußische Pommern besetzte. Auch diesmal wurde Friedrich von einem »Mirakel« gerettet: dem Tod der Zarin Elisabeth am 5. Januar 1762. Ihr Nachfolger Peter III. schloss im Mai 1762 Frieden mit Preußen, ebenso wie bald darauf Schweden. Zwar wurde Peter nur ein paar Monate später von seiner Gattin Katharina der Großen abgelöst, die den Vertrag mit Preußen nicht ratifizierte; Russland blieb jedoch für den Rest des Kriegs neutral. Zugleich geriet die anglorussische Allianz ins Wanken, da Groß-
40. Die Schlesischen Kriege (1740–1763)
britannien Gespräche mit Frankreich aufnahm, die zum Vorfrieden von Fontainebleau (3. November) und zum Pariser Friedensabkommen vom 10. Februar 1763 führten. 39 Frankreich musste große Gebiete in Nordamerika und Indien abtreten, ohne in Europa entschädigt zu werden, während sich Großbritannien mit der Wiederherstellung des Status quo im Reich einverstanden erklärte. Der Rückzug der französischen Truppen aus den preußischen Niederrheingebieten Kleve, Guelders und Moers nahm den Druck von der Westfront. Im Krieg standen nun noch Österreich und Preußen. Friedrich gelangen im Herbst 1762 weitere militärische Erfolge gegen die österreichischen und Reichstruppen, aber tatsächlich waren beide Kontrahenten erschöpft und vereinbarten Ende November 1762 einen Waffenstillstand. Die vom sächsischen Kronprinzen Friedrich Christian initiierten Verhandlungen führten recht schnell zum Abschluss des Friedens von Hubertusburg am 15. Februar 1763. 40 Preußen behielt Schlesien und Glatz sowie die im Vertrag von Dresden festgelegten Grenzen und sicherte in einer Geheimklausel zu, die Wahl von Maria Theresias Sohn Joseph zum römischen König und die Thronfolge eines Habsburgers im Herzogtum Modena zu unterstützen. Sachsen wurde zur Gänze wiederhergestellt und erlangte ein Durchmarschrecht für seine Streitkräfte durch Schlesien. Welche Rolle spielte bei all dem das Reich? Anfang Februar 1763 beendete der Reichstag den Reichskrieg offiziell und erklärte das Reich für neutral, was der preußische Abgeordnete Erich Christoph von Plotho zu respektieren zusagte. 41 Damit endete eine lange Phase zunehmender Ambivalenz und Unsicherheit. Die Befreiung Sachsens blieb das einzige Kriegsziel des Reichstags. Während andere Mächte immer weitreichendere Kriegsziele entwickelten, begannen die deutschen Fürsten ihre Beteiligung an dem Konflikt infrage zu stellen. 42 Sie waren nicht daran interessiert, bloße Hilfstruppen in einem österreichisch-russischen Krieg um die Aufteilung Preußens oder in einem britischen Krieg gegen Frankreich zu werden. Für manche war die Schlacht von Roßbach (5. November 1757) der Wendepunkt, weil die Reichsarmee in einem Kampf gegen Frankreich verfangen war, der mit der Rettung Sachsens kaum zu tun hatte. Bayern und die Pfalz zogen ihre Truppen im folgenden Frühjahr zurück. Andere waren besorgt über die Ausweitung des Konflikts zu einem Religionskrieg; vor allem die protestantischen Fürsten waren fassungslos, weil sie sich auf der »falschen« Seite wiederfanden. 43 Die Reichsarmee selbst war bei Weitem nicht so ineffektiv wie die nationalistische Geschichtsschreibung meinte, aber zugegebenermaßen nie groß genug, um als unabhängige Kraft aufzutreten. Hauptverlierer in Roßbach waren die Franzosen, deren 24.000 Mann sich nur 11.000 deutsche anschlossen, von denen 4.000 Österreicher waren. 44 In den weiteren Schlachten waren die Reichstruppen auf Gedeih und Verderb von einer österreichischen Hauptstreitmacht abhängig. Ihr letzter Auftritt war eine schwere Niederlage gegen Prinz Heinrich von Preußen
415
416
IV. · Das Reich von Karl VII. bis Leopold II. (ca. 1740–1792)
bei Freiberg am 29. Oktober 1762. Da war die Reichsarmee von ihrer anfänglichen nominellen Stärke von etwas mehr als 32.000 Mann bereits auf 16.000 geschrumpft. Nach dem österreichisch-preußischen Waffenstillstand im November standen sie als Letzte im Feld, verlassen von Frankreich und Österreich. Die Reichstagsentscheidung zur Beendigung des Kriegs war unausweichlich; am 24. Februar ordnete der Kaiser die Auflösung der imperialen Armee an. Militärisch hatte die Reichsarmee während des gesamten Konflikts wohl kaum etwas bewirkt. Ihre Teilnahme gemahnte jedoch an die eigenen Interessen des Reichs abseits von Österreich und Preußen. Ihr kontinuierlicher Bestand war vor allem die Errungenschaft der Abgeordneten im Reichstag, die immer wieder dafür stritten. Nicht zum ersten Mal demonstrierte die oft unterschätzte Versammlung von Gesandten, dass sie einen Gemeinschaftsgeist entwickelt hatte und sich mit den Interessen des Reichs identifizierte, was den einzelnen Repräsentanten half, den einen oder anderen wankelmütigen Fürsten auf Kurs zu halten. 45 Obwohl es bei den Friedensverhandlungen nicht vertreten war, erreichte das Reich denn auch als einziger Beteiligter alle seine Kriegsziele: die Restitution Sachsens und den Status quo im Reich selbst. 46 Darin zeigte sich auch, dass die Mehrheit der deutschen Fürsten und ihre Gesandten in Regensburg die Einflüsterungen beider deutschen Kriegsgegner ignoriert hatten. Kriegspropaganda betrieben alle Seiten mit großem Aufwand. 1756 behauptete Friedrich, es handle sich um einen von seinen katholischen Feinden Österreich und Frankreich entfesselten Religionskrieg gegen die Protestanten im Reich, das Wien in eine habsburgische Erbmonarchie umwandeln wolle. 47 Die russische Propaganda stellte Friedrich wahlweise als den Angegriffenen, als Verteidiger der deutschen Libertät, Schutzherrn aller deutschen Protestanten und Kämpfer gegen katholische Unterdrückung und habsburgische Tyrannei dar. Betont wurde auch die österreichische Allianz mit Deutschlands ewigem Feind Frankreich, obwohl Preußen kaum in einer Position war, hier moralisch zu argumentieren. Wien gab den Vorwurf zurück: Friedrich unternehme einen protestantischen Anschlag auf die Katholiken im Reich, sein Ziel sei letztlich die Abspaltung. Hinter der Propaganda standen einfachere Wahrheiten. Friedrich wollte Schlesien behalten und möglichst weitere Territorien dazugewinnen. Tatsächlich erwog er während des Kriegs eine Reihe von Vorhaben zur Säkularisierung norddeutscher Bistümer und zu ihrer Aufteilung zwischen Preußen und Hannover. 48 Österreich wollte Schlesien zurück und Preußen zerschlagen. Versuche des Heiligen Stuhls, Wien den Krieg als Gelegenheit zur Rekatholisierung des Reichs schmackhaft zu machen, blieben vergeblich. 49 1764 indes beurteilte ein in Wien erstellter Bericht die Kämpfe der Zeit seit 1740 als »Prüfung der Kräfte der protestantischen Nation gegen jene der catholischen«. 50 Der Streit ließ Leidenschaften hochkochen, während es gleichzeitig im Reichs-
40. Die Schlesischen Kriege (1740–1763)
tag wegen anderer Probleme zu konfessionellen Spannungen kam. 51 Im Grunde gab sich dort jedoch niemand Illusionen hin. Ein Versuch, die Debatte über eine geplante Friedenskonferenz in Augsburg 1761 zur religiösen Auseinandersetzung umzufunktionieren, scheiterte, da sich sogar einige protestantische Fürsten der sächsischen Meinung anschlossen, dies sei schlicht nicht die Art von Thema, bei der das Prinzip der itio in partes anwendbar sei. 52 Dass die Konferenz nie stattfand, lag an Ausflüchten und mangelndem Engagement der großen ausländischen Mächte, von denen einige immer noch auf einen entscheidenden militärischen Sieg hofften, um eine starke Verhandlungsposition zu erreichen. Den meisten Angehörigen des Reichstags war die wahre Natur des Konflikts klar. Schlesien war für sie nicht von größerem Interesse als es 1740 gewesen war. Fast alle fürchteten die rastlose und unberechenbare Aggression des expansionistischen preußischen Monarchen. Schließlich waren die habsburgischen Kaiser bei vielen Anlässen gezügelt worden; den Kaiser in Schach zu halten, war eine viel geübte Tradition des Reichs. Das Durchhalten der Reichsarmee und die Beständigkeit der Reichstagspolitik bildeten auch einen Kontrapunkt zu einer weiteren bemerkenswerten Erscheinung des Konflikts. Die Dreistigkeit des preußischen Königs, seine bisweilen geniale militärische Führerschaft und Sturheit im Angesicht widrigster Umstände ließen ihn zum Helden aufsteigen. In Preußen selbst fand Friedrich II. außerordentlichen Zuspruch und erreichte schnell ein Maß an persönlicher Popularität, wie es nie ein Vorgänger genossen hatte. Mit Ausbruch des Kriegs kam es zu einer erstaunlichen Flut an patriotischer Literatur. 53 Der Dichter Christian Ewald von Kleist (* 1715, † 1759), ein Offizier, der seinen Verwundungen aus der Schlacht von Kunersdorf erlag, gab mit der Ode an die preußische Armee im Mai 1757 den Ton vor, gefolgt von jüngeren Autoren: Karl Wilhelm Ramler (* 1725, † 1798) mit Gedichten wie Auf ein Geschütz, Johann Wilhelm Ludwig Gleim (* 1719, † 1803) mit seinen Preußischen Kriegsliedern in den Feldzügen 1756 und 1757 von einem Grenadier und einigen anderen. Die patriotischen Kanzelreden des Berliner Hofpredigers August Friedrich Wilhelm Sack fanden begierige Hörer und Leser. Der Patriotismus der gebildeten Schichten in Berlin war so frappant, dass der Schweizer Schriftsteller Johann Georg Zimmermann (* 1728, † 1795), der in seinem Traktat Von dem Nationalstolz (1758) die Meinung vertrat, Patriotismus sei eine republikanische Tugend, 1760 eine zweite Auflage mit einem zusätzlichen Kapitel über Patriotismus in Monarchien veröffentlichte. 54 In Preußen selbst inspirierte die Reflexion über diese neuen Anwandlungen Thomas Abbt 1761 zu seiner Schrift Vom Tode für das Vaterland. Auf eher profane Weise nutzten Hersteller von Kleinkram die patriotische Stimmung zum Verkauf von emaillierten Tabakdosen mit Schlachtszenen oder Porträts des Königs und
417
418
IV. · Das Reich von Karl VII. bis Leopold II. (ca. 1740–1792)
seiner Befehlshaber, Keramik, Tüchern, seidenen Vivatbändern, Drucken und Kalendern. 55 Der neue preußische Patriotismus wandte sich ab von Sorge, Leid und Reue und begrüßte den Krieg aus vollem Herzen. Das Vaterland galt nun als höchstes Gut. Friedrich wurde zum Helden und Befreier stilisiert und für seine Taten im Krieg so gepriesen wie vormals der mythische Heerführer des ersten Jahrhunderts, Arminius. Man glorifizierte den Krieg, sehnte den Tod des Feindes herbei, segnete das patriotische Opfer von Leben für den Sieg. Das Phänomen blieb nicht auf Literaten der hinteren Ränge beschränkt. Kein Geringerer als Lessing veröffentlichte Gleims Grenadierlieder; auch Johann Gottfried Herder (* 1744, † 1803) pries die Lebendigkeit und Energie der neuen preußischen Dichtung. Ihnen kam es so vor, als hätten die deutschen Dichter endlich ein würdiges deutsches Thema gefunden. Das hieß aber nicht unbedingt, dass sie die Begeisterung der Autoren für die preußische Sache teilten. Lessing distanzierte sich bald von Gleims politischer Einstellung. Herder wiederum machte deutlich: »Cabinette mögen einander betrügen; politische Maschinen mögen gegen einander gerückt werden, bis Eine die andre zersprengt. Nicht so rücken Vaterländer gegen einander, sie liegen ruhig nebeneinander, und stehen sich als Familien bei. Vaterländer gegen Vaterländer im Blutkampf ist der ärgste Barbarismus der menschlichen Sprache.« 56 Wie Goethe schrieb, konnte man »fritzisch« sein, ohne sich um Preußen zu scheren. 57 Diese Art Literatur als ersten Ausdruck eines neuen deutschen Nationalismus zu interpretieren, wäre verfehlt. Das zufällige Zusammentreffen eines kriegerischphilosophischen Königs, eines langen, grimmigen Bürgerkriegs im Reich und des Aufschwungs auf dem Buchmarkt sorgte für eine bemerkenswerte Vielzahl von Schriften. Die Betonung der Aufopferung, in Ewald Christian von Kleists Worten aus seiner Ode an die preußische Armee: »bereit zum Siegen oder Sterben«, war in der Tat neu im deutschen literarischen Kanon und macht klar, weshalb diese Texte in den im 19. und frühen 20. Jahrhundert gebildeten Kanon der nationalpatriotischen Literatur eingingen. Um ihre zeitgenössische Bedeutung historisch richtig zu bewerten, muss man das ganze Phänomen jedoch im Kontext der galoppierenden Entwicklung des Patriotismus im Reich in der ersten Hälfte des Jahrhunderts und der durch Montesquieus Esprit des Lois (1748) ausgelösten internationalen Debatte über Nationalcharakter betrachten. 58 Diese Hintergründe waren bedeutender als irgendwelche dürftigen Verbindungen mit dem späteren preußischen Nationalismus, wie sie nationalistische Gelehrte des 19. Jahrhunderts zu konstruieren versuchten. Selbst in Preußen konzentrierte sich der neue Patriotismus offenbar auf den König und nicht auf eine preußische »Nation« oder den Staat insgesamt. Spätere Patrioten wie Ernst Moritz Arndt sahen die Dinge klarer als viele spätere Literaturhistoriker: Der König hasste alles wirklich Nationale und »alles Föderative an den
40. Die Schlesischen Kriege (1740–1763)
Teutschen«; der Nationalcharakter stand grundsätzlich gegen Despotismus und die absolute Herrschaft einer Monarchie. 59 Der Siebenjährige oder Dritte Schlesische Krieg, wie er im Reich überwiegend genannt wurde, war in mancher Hinsicht in seiner Wirkung so grundlegend wie der Dreißigjährige. Er war kürzer, aber in vielen Gegenden ebenso verheerend. 60 Zudem fand er tiefer greifende Resonanz als jeder andere Konflikt seit 1648. In Österreich und Preußen, aber auch in zahlreichen kleineren Territorien leitete das Ende des Kriegs eine neue Phase des Wiederaufbaus und der Erneuerung ein, deren Signifikanz ohne Weiteres mit jeder vorhergehenden Erneuerungsbewegung seit dem späten 15. Jahrhundert vergleichbar ist. Im Reich sorgte der Friede von 1763 zudem für breit gefächerte Debatten über Reform und Erneuerung, deren Signifikanz jeder solchen Diskussion seit den 1490er Jahren gleichkam. Diese Auswirkungen werden wir in späteren Kapiteln untersuchen. Eine weitere Folge des Siebenjährigen Kriegs war die Wandlung der Stellung des Reichs in Europa und des Rahmens, in dem sich die deutsche Politik abspielte. Zunächst ist jedoch die Verwaltung des Reichs unter Karl VII. und Franz I. zu betrachten. Auch hier kam es zu einer Art von Erneuerung, wenn auch nicht zu der, die jene im Auge hatten, die die Krise des Hauses Habsburg 1740 auszunutzen trachteten.
Anmerkungen 1 Scott, Birth, 96; einen umfassenden Überblick bietet auch Szabo, Seven Years War. 2 Diese Ansprüche gingen auf Dispute zwischen den spanischen und österreichischen Habsburgern im späten 16. Jahrhundert zurück; Karl VI. war König von Spanien gewesen. 3 Burkhardt, Vollendung, 374 f. 4 Aretin, Altes Reich II, 319 f., 331. 5 Kunisch, Staatsverfassung, 63 f. 6 Hartmann, Karl Albrecht, 164; Aretin, Altes Reich II, 413 f. 7 Ludwig IV., der Bayer (* 1283, † 1347), und Ruprecht von der Pfalz (* 1352, † 1410), 1400 zum König gewählt, aber nie zum Kaiser gekrönt. 8 Vgl. S. 140 f., 149 ff. 9 Vgl. S. 34, 64. 10 Kunisch, Staatsverfassung, 64. 11 Scott, Birth, 54. 12 Aretin, Altes Reich II, 422–430. 13 Kunisch, Absolutismus, 150. 14 Burkhardt, Vollendung, 382. 15 Ebd. 16 Hartmann, Karl Albrecht, 189–212. 17 Schmidt, Geschichte, 266. 18 Burkhardt, Vollendung, 390. 19 Hochedlinger, Wars, 254 ff. 20 Aretin, Altes Reich II, 458–467.
419
420
IV. · Das Reich von Karl VII. bis Leopold II. (ca. 1740–1792)
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
56 57 58 59 60
Simms, Three Victories, 339 ff. Ebd., 344–351. Horn, »Origins«; Simms, Three Victories, 371–378. Bosbach, Rêveries politiques, 81–108. Cegielski, »Polenpolitik«, 22. Scott, Birth, 70 f. Ebd., 82; Duchhardt, Altes Reich, 36. Pyta, »Allianzbeziehungen«. Aretin, Altes Reich III, 43 f. Scott, Birth, 92. Kunisch, Absolutismus, 153 f. Aretin, Altes Reich III, 100–103. Scott, Birth, 106–118. Simms, Three Victories. Scott, Birth, 107; Pyta, »Allianzbeziehungen«, 33 f. Burkhardt, Vollendung, 428–438. Der Ausdruck Mirakel stammt von Friedrich selbst; der Begriff wurde jedoch später oft auf den Tod der Zarin Elisabeth umgemünzt; vgl. Szabo, War, 234–240, 426 f.; Koser, Geschichte Friedrichs des Großen, III, S. 38 und IV, S. 87. Burkhardt, Vollendung, 424. Scott, Birth, 115 f. Arendt, »Friede«. Aretin, Altes Reich III, 107. Wilson, German Armies, 264–280. Aretin, Altes Reich III, 104. Wilson, German Armies, 272. Fürnrohr, Reichstag, 46–50. Burkhardt, Vollendung, 439. Vgl. zur preußischen Kriegspropaganda Burgdorf, Reichskonstitution, 131–170. Volz, »Plan«. Schmidt, Geschichte, 274. Haug-Moritz, »Friedrich der Große«, 33. Vgl. S. 439–442. Schmid, »Friedenskongress«; Szabo, War, 325, 327, 338, 355. Herrmann, »Individuum«; Bohnen, »Nationalsinn«; Clark, Iron Kingdom, 219–230; Schmidt, Geschichte, 278–281; Planert, »Nationalismus«, 48 ff. Schmidt, Geschichte, 279. Burgdorf, »Reichsnationalismus«, 161 f.; Hellmuth, »Wiedergeburt«; Clark, Iron Kingdom, 223 f.; in Großbritannien waren auch propreußische Keramiken populär, etwa Teller mit Porträts und der Aufschrift »Long live the King of Prussia«. Mittenzwei, »Auseinandersetzungen«, 458. Vgl. zum Patriotismus S. 391–394. Vgl. S. 471. Bohnen, »Nationalsinn«, 121. Szabo, War, 433 f.; Schroeder, Transformation, 3 ff.
41. Reichsherrschaft ohne Habsburger: Karl VII. (1742–1745)
A
m 24. Januar 1742 wählten die Kurfürsten einstimmig einen ihrer Kollegen, Karl Albrecht von Bayern, zum ersten nichthabsburgischen Kaiser seit drei Jahrhunderten. Damit erfüllten sich lange gehegte Ambitionen des Hauses Wittelsbach und viele sahen darin die Chance einer Neugründung des Staates. Manche standen dem povero Signore, wie ihn der Würzburger Erzbischof Karl Friedrich von Schönborn nannte, von Anfang an skeptisch gegenüber. 1 Seine Herrschaft scheiterte und endete mit seinem plötzlichen Tod am 20. Januar 1745. Am Ende war er wenig mehr als eine Marionette des Königs von Frankreich und hatte keine Überlebenschance; selbst seine engsten Verbündeten hatten ihn größtenteils im Stich gelassen. Zudem hatte er sich seinen Niedergang weitgehend selbst zuzuschreiben: Mit geradezu absurdem Ehrgeiz verfolgte er Pläne, Österreich Gebiete abzunehmen, und ließ sich zu einer Politik hinreißen, die letztlich viele verprellte, die zu seinen wichtigsten Unterstützern hätten zählen können. Dennoch war die Wahl Karls VII. in vieler Hinsicht wichtig. Erstens ist der Kampf der Wittelsbacher um die Kaiserkrone interessant, weil er die Ambitionen einer großen Adelsdynastie über die gesamte Frühmoderne hinweg aufzeigt. Zweitens enthüllen das Interregnum, die Wahl und Karls kurze Herrschaft wichtige Tatsachen über das Reich, über seine Fähigkeit, zu überdauern und sich zu verändern, über das Verhältnis zwischen Kaiser und Reichsständen und die Rolle der Habsburger in Deutschland. Die kaiserlichen Ambitionen der Wittelsbacher reichten weit zurück. Zwei mittelalterliche Vorläufer (Ludwig der Bayer und Ruprecht von der Pfalz) hatten den Thron besetzt, seither hielt sich die Dynastie immer für »kaiserfähig«. Das wechselhafte Schicksal und die Rivalitäten zwischen den beiden Linien der Wittelsbacher trugen ebenfalls zu diesem Ehrgeiz bei. Die pfälzische Linie hielt eine der in der Golden Bulle 1356 festgeschriebenen Kurwürden, hatte jedoch bedeutende Teile ihrer territorialen Basis im Landshuter Erbfolgekrieg (1504/05) an die Habsburger, an Württemberg und Nürnberg verloren. Die folgende Vereinigung der bayerischen Herzogtümer schuf ein konzentrierteres und potenziell mächtigeres Territorium, dessen herzogliche Herrscher ihren Pfälzer Verwandten den höheren Rang zunehmend neideten. Weiter angeheizt wurde der bayerische Ehrgeiz im 17. Jahrhundert dadurch, dass Maximilian I. (1598–1651) maßgeblich zur Rettung von Krone und Reich im Dreißigjährigen Krieg beigetragen und hatte und Bayern
422
IV. · Das Reich von Karl VII. bis Leopold II. (ca. 1740–1792)
dafür 1623 zum Kurfürstentum erhoben worden war. Die Rivalität zwischen den Linien war im späten 17. Jahrhundert erneut aufgeflammt, da die unter dem Herrscherhaus Pfalz-Neuburg seit 1685 wieder katholische Pfalz engere Bande zu den Habsburgern knüpfte. 2 Die prokaiserliche Politik der pfälzischen Kurfürsten war jedoch hauptsächlich Ausdruck ihrer Schwäche infolge der Zerstörung ihrer Territorien im Dreißigjährigen Krieg und den Franzosenkriegen des späten 17. Jahrhunderts. Die Bayern waren von habsburgischen Territorien und Einflussbereichen umringt: Böhmen, die österreichischen Herzogtümer, Tirol und die schwäbischen Vorlande grenzten auf drei Seiten an Bayern. In Schwaben im Westen und in Franken im Norden wetteiferten die Bayern mit Pfalz-Neuburg und den Habsburgern, die bestrebt waren, die Autorität der Kaiserkrone wieder zu errichten und in eben diesen Gebieten eine kaisertreue Klientel aufzubauen. Die Furcht vor einer vollständigen Einkreisung wuchs ab 1715 durch den österreichischen Zugewinn der Spanischen Niederlande, der die Möglichkeiten der Wittelsbacher einschränkte, ihren Einfluss im Nordwesten von Köln aus, wo sie von 1583 bis 1761 durchgehend den Stuhl des Erzbischofs besetzten, zu erweitern. Aus diesem geopolitischen Käfig suchte sich München zu befreien und durch Allianzen mit Frankreich eine unabhängige Position im Reich zu erlangen. Mal offen, mal heimlich, immer begleitet von enormer finanzieller Unterstützung aus Paris, mündeten diese Bündnisse im frühen 18. Jahrhundert in die Katastrophe, als der bayerische Kurfürst und der wittelsbachische Kurfürst von Köln wegen der verräterischen Unterstützung Frankreichs im Spanischen Erbfolgekrieg geächtet und ihre Territorien zeitweise sequestriert wurden. 3 Solang Frankreich jedoch mit Österreich im Zwist lag und seinen Status als Garantiemacht des Westfälischen Friedens auszunutzen trachtete und solange Bayern unter chronischem Geldmangel litt und weiteren Ehrgeiz hegte, blieb die unheilvolle Anziehungskraft zwischen München und Paris wirksam. Maximilian I. und seine beiden Nachfolger schienen keine kaiserlichen Ambitionen zu haben. Ferdinand Maria (1651–1679) konzentrierte sich auf den Wiederaufbau seiner Ländereien nach dem Dreißigjährigen Krieg und wollte lieber ein starker Kurfürst sein als ein schwacher Kaiser. Max Emanuel (1679–1726) war ruheloser und teilte den Wunsch der meisten anderen Kurfürsten nach einem Königstitel im Reich oder anderswo. 4 Seine Versuche in dieser Richtung scheiterten und seine Allianz mit Frankreich brachte ihn beinah zu Fall. Das dämpfte seinen Ehrgeiz jedoch nicht. Nach seiner Restitution 1715 investierte er außerordentliche Summen in Bauten und Kultur, um sein Profil im Reich und darüber hinaus zu stärken. 5 Die Kontakte nach Frankreich blieben eng, aber für einige Zeit steuerte Bayern nun einen etwas versöhnlicheren Kurs im Reich. Die Beziehungen zu den Habsburgern besserten sich 1722 durch die Heirat von Max Emanuels Sohn mit
41. Reichsherrschaft ohne Habsburger: Karl VII. (1742–1745)
Maria Amalie, der jüngeren Tochter von Joseph I., allerdings unter Verzicht auf jegliches Erbrecht in den habsburgischen Ländern. 1724 vereinte er die Wittelsbacher Familie in der Hausunion, womit die Kurfürsten der Pfalz und Bayerns sowie der Kölner Kurfürst Clemens August von Bayern (1723–1761) und sein Trierer Kollege Franz Ludwig von Pfalz-Neuburg (1716–1729) den Streit zwischen Bayern und der Pfalz über das rheinische Reichsvikariat beilegten und ihre Politik im Reich zu koordinieren beschlossen. 6 Der Block der Wittelsbacher kontrollierte etwa 15 Prozent des Reichsterritoriums mit 3 Millionen Einwohnern, gut 3.400 km 2 mehr als Preußen innerhalb des Reichs besaß. 7 Karl Philipp von der Pfalz richtete diese Konstellation wieder nach Frankfurt aus. In seiner bitteren Enttäuschung über die doppelzüngigen Händel Karls VI. mit der Pfalz und Preußen bezüglich der Zukunft von Jülich und Berg bewog er den jungen Kurfürsten Karl Albrecht von Bayern und die anderen wittelsbachischen Fürsten, 1729 dem Vertrag von Marly beizutreten. 8 Für Karl Albrecht wurde dies zum Rettungsanker für sein Streben nach dem spektakulärsten Erfolg, den je ein Angehöriger seiner Dynastie erreicht hatte. Während die Wittelsbacher enger zusammenrückten, steuerten die Habsburger auf die Katastrophe zu, die sie eine Zeit lang durch die internationale Zustimmung zur Pragmatischen Sanktion abwenden zu können schienen. 1732 hatte auch der Reichstag der weiblichen Thronfolge in den habsburgischen Ländern zugestimmt. Bayern schien in seiner Weigerung, sich dem Votum anzuschließen, isoliert, vor allem da Sachsen, dessen Kurfürst die ältere Tochter Josephs I., Maria Josepha, geheiratet hatte, seine Einwände 1733 nach dem Ausbruch des polnischen Erbfolgekriegs zurückzog, da es die Unterstützung der Habsburger brauchte. 9 Die Aussichten für Bayern schienen sich 1736 erneut zu verschlechtern, da durch die Heirat von Maria Theresia mit Franz Stephan von Lothringen die Gründung einer neuen Dynastie Habsburg-Lothringen in Aussicht stand, die den Habsburgern nachfolgen würde. Karl Albrecht schien all dies nicht zu beirren. Seine Juristen und Berater eruierten alte Ansprüche der Habsburger, aus denen sie Forderungen der Wittelsbacher nicht nur auf Teile der habsburgischen Länder, sondern auf jedes einzelne davon konstruierten. Dieses Erbe, glaubte Karl Albrecht, rechtfertigte auch seine Wahl zum Kaiser. Um nichts dem Zufall zu überlassen, versuchte er zur Sicherheit eine Ehe zwischen einem Wittelsbacher Prinzen und der zweiten Tochter Karls VI. zu arrangieren, um gegebenenfalls eine Teilung der habsburgischen Territorien herbeizuführen. 10 Wien scheute vor diesem eklatanten Versuch, die Pragmatische Sanktion auszuhebeln, zurück und zog eine solche Verbindung nicht in Betracht. Nicht einmal Karl Albrechts Erscheinen bei einem wittelsbachisch-habsburgischen Familienfest in Melk im Juni 1739 konnte die harte Wiener Haltung aufweichen. Folglich sah er sich genötigt, alles auf eine Karte zu setzen, als Karl VI. am 20. Oktober 1740 starb.
423
424
IV. · Das Reich von Karl VII. bis Leopold II. (ca. 1740–1792)
Seine Mittel hierfür waren jämmerlich unzureichend. Er hatte Schulden von mehr als 26 Millionen Gulden geerbt und die ersten Jahre seiner Herrschaft finanziellen und administrativen Reformen gewidmet. Um 1730 war jedoch von Sparsamkeit keine Rede mehr. 11 Ungeheure Geldsummen flossen in den Hof und in Residenzen in München und Nymphenburg, zudem wurde die Armee von einer kümmerlich bewaffneten Streitmacht von etwa 5.000 Mann 1726 bis Mitte der 1730er Jahre auf 43.000 Mann ausgebaut. 1739 betrug der Schuldenstand trotz Reformen immer noch etwa 20 Millionen Gulden. Die Armee wurde 1737 in den Türkenkrieg geschickt, auch um Karl Albrechts Glaubwürdigkeit als Verteidiger des Reichs zu stärken und, da das Reich während der Zeit die Rechnungen bezahlte, um Geld zu sparen. Der Einsatz auf Seiten der Habsburger löste jedoch eine neue finanzielle Krise aus, da keine französischen Subventionen mehr nach München flossen. Zudem wurde die bayerische Armee bei Belgrad beinahe vernichtet; 1739 blieben dem Kurfürsten nur noch 10.000 Mann und ein neuer Schuldenberg. Dass er überhaupt zahlungsfähig blieb, verdankte er größtenteils französischen Subventionen, die im Vertrag von Marly 1729 auf 900.000 Livre festgesetzt worden waren. 12 Die Krise im Herbst 1740 entfaltete sich auf mehreren Ebenen.Während Friedrich II. Schlesien angriff, erhob Karl Albrecht Anspruch auf das habsburgische Erbe und besetzte Böhmen, wo er sich zum König erklärte. 13 Derweil bot die Situation im Reich selbst neue Aussichten für Kritiker der Habsburger, den deutschen Staat auf eine neue Grundlage stellen zu können. Als er vom Tod Karls VI. erfuhr, spielte der hannoversche Kanzler Gerlach Adolph von Münchhausen gar mit dem Gedanken, den Kaisertitel insgesamt abzuschaffen. 14 Zunächst jedoch führte die Anmeldung von Rechten und Privilegien zu chaotischen Debatten, die die Zerrissenheit des Reichs während des fünfzehnmonatigen Interregnums noch verschärften. Der Mainzer Kurfürst war als Reichserzkanzler durch die Goldene Bulle verpflichtet, ein Datum für die Wahlversammlung festzusetzen, die unter Berücksichtigung der Zustellzeiten drei Monate nach dem mutmaßlichen Zugang der letzten Einladung stattfinden sollte. In diesem Fall fiel der Termin, der am 31. Oktober verkündet wurde, auf den 1. März 1741. Erzbischof Philipp Carl von Eltz war derweil mit anderen Dingen beschäftigt. Als Erstes reichten der pfälzische und der bayerische Kurfürst Vollmachten für die gemeinsame Ausübung des rheinischen Reichsvikariats ein, die nicht akzeptiert werden konnten, weil die diesbezügliche Vereinbarung Kaiser und Reichstag nie bekannt gemacht worden war. 15 Das hatte unmittelbare Folgen für das Reichskammergericht, das die Siegel beider Reichsvikare benötigte und nicht arbeiten konnte, solange Eltz und der sächsische Kurfürst das gemeinsame Wittelsbach-Siegel nicht akzeptierten. Ungeachtet des Fehlens jeglicher echten Autorität eröffneten sie in Augsburg ihren eigenen Vikariatshof, das Pendant zum Reichshofrat wäh-
41. Reichsherrschaft ohne Habsburger: Karl VII. (1742–1745)
rend eines Interregnums, wo sie nicht nur Fälle verhandelten, sondern auch die Erneuerung von Lehen forderten, die während dieser Zeit vakant wurden. Mehrere Kurfürsten protestierten vehement dagegen, dass Eltz den Kurfürsten von Böhmen zur Wahl eingeladen und dann akzeptiert hatte, dass Maria Theresia, die zwar gewählte böhmische Königin war, als Frau jedoch nicht als Kurfürstin auftreten durfte, ihrem Gatten Franz Stephan ihre Stimme übertrug. Man beschuldigte Eltz, seine Autorität überschritten zu haben und parteiisch für die Habsburger zu sein, was beides zutraf. In ähnlicher Weise sorgte später sein noch mehr den Habsburgern zugeneigter Nachfolger Johann Friedrich Karl von Ostein (1743–1763) für wütende Reaktionen, als er eine Klage der Habsburger gegen Karl VII. wegen des Umgangs mit ihren Territorien während der Wartezeit annahm. Manche stellten gar das Recht des Reichserzkanzlers infrage, den Reichstag überhaupt fortzusetzen, da sie meinten, seine Position sei während eines Interregnums null und nichtig. Der Streit über den Reichstag hatte eine lange Vorgeschichte; nun schlug ein Pamphlet vor, den Immerwährenden Reichstag aufzulösen und zukünftig nur noch alle fünf Jahre eine relativ kurze Versammlung einzuberufen. 16 Die Tagungen wurden jedoch fortgesetzt, allerdings entsandten die Kurfürsten von Köln, Bayern, Sachsen, Brandenburg und der Pfalz keine Abgeordneten mehr und wegen der anhaltenden Kontroversen war ein normaler Geschäftsablauf kaum mehr möglich. Die Wahl selbst ging ebenfalls quälend langsam voran, gebremst von den diversen militärischen und anderen Konflikten, aber auch vom Wunsch aller Beteiligten, die seltene Gelegenheit einer freien Ausübung ihres Stimmrechts in vollem Umfang zu nutzen. Dabei ging es einerseits um die Auswahl eines neuen Kaisers, andererseits um die Formulierung der Wahlkapitulation. Schließlich wurde Karl Albrecht von Bayern gewählt; die dreißig hierfür nötigen Sitzungen waren Rekord und kein leichtes Unterfangen. 17 Die Kandidatur von Franz Stephan von Lothringen fand anfangs die Unterstützung von Mainz, Trier und Hannover. Friedrich II. kündigte an, seine Stimme zu verkaufen; Sachsen wollte ihn für 12 Millionen Taler, einen Königstitel und ein Stück von Schlesien ebenfalls wählen. Manche stellten jedoch infrage, dass Franz Stephan wirklich ein deutscher Fürst sei, obwohl er für das Territorium Nomeny (zwischen Metz und Nancy) eine Reichstagsstimme hielt. 18 Andere befürchteten, er werde als Kaiser Lothringen zurückzugewinnen versuchen, das er 1735 gegen die Toskana eintauschen musste. Das hätte das Reich in einen Krieg gegen Frankreich verwickelt, genau die Art von internationalem Konflikt, von der man hoffte, der neue Kaiser werde sie verhindern. Die Kandidatur des sächsischen Kurfürsten war kurzlebig. Mainz favorisierte ihn, weil er sowohl Katholik als auch Titularleiter des Corpus Evangelicorum war.
425
426
IV. · Das Reich von Karl VII. bis Leopold II. (ca. 1740–1792)
Dass er bereits König von Polen war, weckte Zweifel an seiner Eignung, weil Brandenburg die dadurch bewirkte Stärkung Sachsens (das es irgendwann einzuverleiben hoffte) niemals akzeptiert hätte – und nicht zuletzt wegen der offenkundigen Untauglichkeit von Friedrich August II. für irgendetwas anderes als seine Leidenschaften, Jagd und Kunst. 19 Somit war Karl Albrecht von Bayern der einzige brauchbare Kandidat. Manche zweifelten auch an ihm, weil sie dachten, er werde kaum mehr als ein »französischer Statthalter« des Reichs sein. 20 Das war nicht ganz falsch. Habsburgische Territorien oder die Kaiserkrone konnte Karl Albrecht nur mit finanzieller und vor allem militärischer Hilfe aus Frankreich erlangen. Im Dezember 1740 bestätigte Fleury die Pragmatische Sanktion, bezahlte Geld und erkannte Maria Theresia als rechtmäßige österreichische Thronfolgerin an. Im Frühjahr 1741 allerdings lag die französische Politik in den Händen des Herzogs von Belle-Isle und eine französisch-bayerisch-preußische Allianz im Juni ließ Bayerns Ambitionen machbar erscheinen. Im Monat darauf kandidierte Karl Albrecht offiziell, und als die Wahlversammlung am 20. November wieder zusammentrat, schien seine Wahl unausweichlich. 21 Die Sorge um Karl Albrechts Abhängigkeit von Frankreich gab der Frage der Formulierung der Wahlkapitulation umso mehr Bedeutung. Die Kurfürsten waren von Anfang an entschlossen, das Interregnum zu nutzen, um ihre eigenen Rechte und Privilegien zu sichern und, wenn möglich, zu erweitern. Ein Treffen von Fürsten, vor allem Angehörigen alter protestantischer Dynastien, in Offenbach hatte dasselbe Ziel. Sie forderten eine Beteiligung an der Ausarbeitung der Wahlkapitulation und protestierten energisch gegen die katholische Übermacht im Reich: Nicht nur waren die Kaiser katholisch, sondern zudem genossen Bischöfe und Prälaten Vorrang vor weltlichen Herrschern. Auch das Vorrecht des Kaisers, neue Fürsten zu erheben, missfiel ihnen, weil es in ihren Augen ihre exklusive Stellung untergrub. Die Kurfürsten lehnte all diese Forderungen ab und bestritten, dass den Fürsten eine Rolle bei der Wahl zustand. 22 Indes entwarfen sie selbst die weitreichendste Wahlkapitulation, die es je gegeben hatte. Dies war von Anfang an beabsichtigt und einige Kurfürsten hatten die besten Fachleute für die Arbeit an dem Projekt ausgewählt. 23 Johann Jacob Moser, der führende Experte für Gesetze und Bräuche des Reichs, erschien im Auftrag des Kurfürsten von Trier und verfasste während der Prozeduren nicht weniger als 114 Berichte und Artikel. 24 Das Resultat war eine umfassende Diskussion der wichtigsten Probleme des Reichs und der Frage eines Neubeginns mit einem neuen Kaiser, von dem viele hofften, er werde die Reichsstände weniger unter Druck setzen, als das die Habsburger so oft getan hatten. Erörtert wurde zwangsläufig auch die Stellung der Kurfürsten selbst und man erweiterte das Recht der Reichsvikare auf Einberufung eines Reichstags um even-
41. Reichsherrschaft ohne Habsburger: Karl VII. (1742–1745)
tuelle Minderheiten, Zeiten der Abwesenheit des Kaisers und Interregna. Das stärkte die Position der Reichsvikare gegenüber der Krone und minderte in gewisser Weise die Bedeutung des Mainzer Erzbischofs als Reichserzkanzler. Die Entschlossenheit, externe Konflikte zu vermeiden, führte dazu, dass die traditionelle Klausel, die den Kaiser verpflichtete, die Wiedergewinnung des Elsass anzustreben, gestrichen wurde. Karl VII. wurde jedoch angewiesen, die Rechte des Reichs in Italien zu wahren. Des Weiteren musste er vor der Erhebung und Absetzung von Fürsten den Reichstag konsultieren, die Concordata nationis Germaniae aufrechterhalten, die deutsche Kirche gegen die zunehmenden Anfechtungen durch päpstliche Nuntien und direkt aus Rom verteidigen; zudem gab es Pläne für eine formelle Prozedur des Einspruchs gegen Entscheidungen von Reichshofrat und Reichskammergericht. Der gute Wille, den die Kurfürsten während der Verhandlungen über die Wahlkapitulation bekundeten, konnte die grundsätzlichen Befürchtungen und gegenseitigen Verdächtigungen nicht kaschieren. Der preußische Abgeordnete gab die Stimmung gut wieder, als er am 7. Dezember 1741 schrieb: »Niemand will mehr sprechen, man erhebt Augen und Hände zum Himmel, als ob man die Ankunft unseres Herrn zum jüngsten Gericht erwartete und seine Entscheidung hören wollte, ob er denn noch etwas wie Treue und Glauben auf dieser Erde finden könne.« 25 Die Fortsetzung war weniger dramatisch, aber alles andere als ein Erfolg. Am 12. Februar 1742 fand in Frankfurt die Kaiserkrönung statt, wobei der neue Monarch die Krone nicht vom Mainzer Kurfürsten aufgesetzt bekam, sondern von seinem wittelsbachischen Verwandten, dem Kurfürsten von Köln. 26 Er krönte am 8. März auch die Kaiserin, begleitet von ihrem Erzkanzler, dem Fürstabt von Fulda, und ihrem Erzmarschall, dem Fürstabt von Kempten. Es war die erste solche Krönung seit 1690 und die letzte im Heiligen Römischen Reich, und sie sollte dem Beginn der neuen Herrschaft Pracht und Macht verleihen. Die Krönung in Frankfurt folgte der Tradition, aber die folgende »Frankfurter Geiselhaft« des Kaisers unterstrich die bittere Wirklichkeit der Stellung Karls VII. 27 Zwei Tage nach seiner Krönung wurde München von österreichischen Truppen besetzt. Damit war er ein Kaiser ohne Territorium und ohne die 4 Millionen Gulden pro Jahr, die es ihm eingebracht hatte. Nach einer kurzen Rückeroberung im Januar 1743 erlangte er erst Ende Oktober 1744 die Macht über Bayern zurück, nur drei Monate vor seinem Tod. Da war seine Stellung als Kaiser längst unhaltbar, er war kaum mehr als ein »Schattenkaiser«. 28 In Frankfurt bemühte sich Karl um die Einrichtung einer kaiserlichen Regierungsverwaltung. Der Reichstag wurde aus Regensburg dorthin verlegt, angeblich aus Gründen der Sicherheit, tatsächlich aber, weil die österreichische Militärführung ihre Bereitschaft erklärt hatte, die Unabhängigkeit der Stadt zu respektieren und sie aus dem österreichischen Einfluss zu entlassen. Nach einer kurzen Unter-
427
428
IV. · Das Reich von Karl VII. bis Leopold II. (ca. 1740–1792)
brechung trat der Reichstag wieder zusammen, obwohl der Kaiser ihn nicht persönlich eröffnete, weil er in Diskussionen über Rangordnung und Priorität verwickelt zu werden fürchtete. 29 Österreich weigerte sich, überhaupt einen Abgeordneten zu entsenden; der österreichische Gesandte in Regensburg nahm nicht einmal ein Einladungsschreiben entgegen, das – in seinen Augen beleidigenderweise – an »Maria Theresia, Herzogin zu Lothringen und Saar, Großherzogin zu Toskana, geborener königlichen Prinzessin zu Hungarn und Böheim und geborener Erzherzogin Oesterreichs« adressiert war. 30 Viele andere delegierten ihre Stimme an einen der wenigen Gesandten. Die Kollegien der Kurfürsten und Fürsten umfassten nicht mehr als elf Abgeordnete. Nur drei davon waren Katholiken, sie repräsentierten vier Kurfürsten und siebenunddreißig Fürsten. 31 Die Reichsgrafen und Reichsstädte andererseits waren als typische vom Kaiser abhängige niedere Reichsstände relativ gut vertreten. Die kleinere Anzahl der Abgeordneten war nicht unbedingt ein Nachteil: Sie waren besser in der Lage, die Politik zu koordinieren und einen steten Kurs zu steuern. Trotz ihrer durch den Umzug nach Regensburg bedingten Nähe zum Kaiser bemühten sie sich um Unabhängigkeit, ließen sich nicht in kriegerische Auseinandersetzungen wegen der territorialen Ansprüche Karls VII. verstricken und sprachen ihm sogar das Recht ab, die böhmische Kurwürde auszuüben und den Titel Erzherzog von Österreich anzunehmen. Es war ihnen wichtig, in dem, was sie als dynastischen Konflikt zwischen Wittelsbachern und Habsburgern betrachteten, neutral zu bleiben. Im Übrigen wurde das ambitionierte Reformprogramm, das in der Wahlkapitulation umrissen war, nie umgesetzt: Die anhaltenden militärischen Konflikte machten ernsthafte gesetzgeberische Aktivitäten unmöglich. 32 Andererseits waren die Stände gewillt, Karl als Kaiser zu unterstützen und ihm bei der Sicherung seiner Regierung zu helfen. Sie gestanden ihm nie dagewesene 50 Römermonate für allgemeine Ausgaben anstatt militärischer Ziele zu. Das hätte umgerechnet 2.674.000 Gulden bedeutet, von denen fast 2 Millionen tatsächlich recht bald eingingen. Die Reichsritter gewährten ihren üblichen »milden Zuschuss« für einen frisch gekrönten Kaiser und sagten eine weitere Abgabe für 1743 zu. Der Verlust von Karls Einnahmen aus Bayern – 4 Millionen Gulden pro Jahr – war damit nicht wettzumachen, weshalb er auf fast 9 Millionen Gulden Subventionen aus Frankreich von 1742 bis 1745 angewiesen war. 33 Andere mögliche Einnahmequellen blieben aus. Die Erneuerung kaiserlicher Lehen, die normalerweise innerhalb eines Jahres nach der Krönung stattfand und signifikante Zuwendungen (»Laudemien«) für den Kaiser und Honorare für den Reichsvizekanzler einbrachte, kam nicht zustande. Im Fall Brandenburgs hatte Karl vor seiner Wahl zugestimmt, dass Brandenburg seine Lehen nicht länger im Kniefall erneuern musste, dass Friedrich für keines seiner Territorien mehr Gebüh-
41. Reichsherrschaft ohne Habsburger: Karl VII. (1742–1745)
ren zahlen und nicht mehr um Verzeihung ersuchen musste, weil er nicht persönlich erschien. Damit verbunden waren die Anerkennung von Friedrichs Recht, Adelspatente zu verleihen, und die Freistellung all seiner Territorien, nicht nur der Kurländer, von der Rechtsprechung der Reichsgerichte. 34 Viele andere nutzten die Gelegenheit, die Erneuerung ihrer Lehen zu verschleppen, in manchen Fällen bis zu einem Jahrhundert. Die einzigen verzeichneten Erneuerungen waren die der Häuser Schwarzburg und Thurn und Taxis im Februar beziehungsweise November 1743. Thurn und Taxis bezahlte eine Million Gulden für die Umwandlung des Reichspostgeneralats in ein Thronlehen. Weder Schwarzburg noch Thurn und Taxis wurden zu diesem Zeitpunkt Mitglied des Fürstenkollegiums, ebenso wenig wie die übrigen dreizehn zu Reichsfürsten erhobenen Reichsgrafen und die vierundzwanzig neuen Reichsgrafen. Keiner davon durfte wegen seines neuen Rangs am Reichstag teilnehmen. 35 Dennoch bezahlten sie beträchtliche Summen für ihre Erhebung, was jedoch angesichts von Karls enormen Schulden keine große Rolle spielte. Auch andere Themen erwiesen sich als problematisch. Karl musste einen neuen Reichshofrat ernennen, für den er auch eine Reihe respektvoller Mitglieder gewinnen konnte; behindert wurde die Arbeit des Rats jedoch durch die Weigerung Maria Theresias, das Archiv aus Wien zu verlegen. Für die Arbeit eines Gerichts, die vor allem auf der sorgfältigen Prüfung von Präzedenzfällen beruhte, war dies entscheidend. Im Großen und Ganzen war der Reichshofrat offenbar nicht in der Lage, in dieser Phase eine hinreichend unabhängige und maßgebliche Rolle zu spielen. Als die Grafen von Württemberg und die Markgrafen von Baden Klagen wegen der Reichsritter in ihrer Umgebung einreichten, stellte er sich nicht auf Seiten der Ritter. 36 Der unverfrorene Versuch, die Reichsritter zu untergeordneten Territorialadligen zu degradieren, hätte eigentlich dazu führen müssen, dass der Kaiser seiner Pflicht nachkam, die Schwachen gegen die Starken zu verteidigen. Einem schwachen Kaiser blieben jedoch nichts als Ausflüchte; in diesem Fall erwies sich der Reichstag als effektiverer Bewahrer traditioneller Rechte. Mit ähnlichen Schwierigkeiten verbunden war die Einrichtung einer kaiserlichen Kanzlei in Frankfurt. Dabei kam es zu Spannungen mit dem Mainzer Kurfürsten, der sein eigenes Amt als Reichserzkanzler beschädigt sah, da der Kaiser und seine Beamten über den neuen Prinzipalkommissar Alexander Ferdinand von Thurn und Taxis direkt mit dem Reichstag kommunizierten. Zudem war der Kurfürst von Mainz wie viele andere nach wie vor grundsätzlich den Habsburgern verbunden und hatte Verständnis für ihre Klagen über das Unrecht, das Karl VII. ihnen zuzufügen entschlossen sei, wenn sich seine Streitkräfte nur durchsetzen konnten. Eine noch größere Herausforderung als die Einrichtung der Regierungsverwaltung in Frankfurt stellte der Aufbau eines Netzwerks von Gesandten, Repräsen-
429
430
IV. · Das Reich von Karl VII. bis Leopold II. (ca. 1740–1792)
tanten in den Kreisen sowie Botschaftern und Diplomaten im Ausland dar, wie es die Habsburger besessen hatten. Brauchbare Vertreter waren alles andere als leicht zu finden. 37 Die Habsburger konnten auf die umfangreiche Administration ihrer eigenen Territorien und ein seit 1648 intensiv gepflegtes Klientelnetzwerk zurückgreifen. Karl VII. hatte nur wenig Personal aus Bayern, und ein Herantreten an andere Kandidaten wurde oft durch alte Loyalitäten zu den Habsburgern und Furcht vor Maria Theresias Rache erschwert. 38 Das Interesse Karls VII. an der Reichspost, sein Einsatz für den Inhaber des Generalats und die Ausweitung seiner Befugnisse und Privilegien sollte dem Aufbau eines eigenen Kommunikationsnetzwerks im Reich dienen; zugleich wollte er die Ressourcen eines reichen Opportunisten anzapfen. 39 Es war jedoch unmöglich, über Nacht zu erreichen, was die Habsburger über Jahrhunderte hinweg aufgebaut hatten. Tatsächlich hatte Karl VII. nicht viel anzubieten. Beamte zu bezahlen, war ein permanentes Problem und seine Patronage war begrenzt. Das Reich stand nicht im Krieg, daher konnte er keine Generalsposten anbieten. Jede Beleihung mit Ländereien, etwa des Marschalls von Belle-Isle mit dem Herzogtum Mindelheim, beschränkte sich auf bayerisches Territorium, über das er für einen Großteil seiner Herrschaft keine Kontrolle hatte. Die Verleihung von Fürsten-, Grafen- und Rittertiteln sowie schlichter Adelspatente war eher ein Geschäft als eine Gunst. Zum Kaiserlichen Rat ernannt zu werden, wie etwa Goethes Vater, erhöhte die soziale Stellung und stärkte die prokaiserlichen Neigungen, trug aber wenig zur Verbesserung der materiellen Lage des Kaisers bei. 40 Entscheidend war der Mangel an Ressourcen, insbesondere Ländereien. Andererseits war vielen von Karls Hauptverbündeten von Anfang an klar, dass seine territorialen Ambitionen unrealistisch waren. Bayern mit Böhmen und den österreichischen Gebieten zu verbinden, war pure Fantasterei. Die Habsburger hätten das niemals akzeptiert. Selbst ihre Feinde, etwa Friedrich von Preußen, wollten sie nicht vollständig ausgerottet sehen, nur um durch ein potenziell ebenso mächtiges größeres Bayern ersetzt zu werden. Aus dem gleichen Grund setzten Großbritannien-Hannover und andere auf Bayerns Überleben, um den österreichischen Einfluss im Reich zu mindern. 41 Dass Karl VII. seine Ziele nicht durch militärische Eroberungen erreichen konnte, war bald klar; daher kam es zu einer Reihe von Vermittlungsvorschlägen, um das Problem des kaiserlichen Territoriums zu lösen.Viele Pläne sahen vor, Bayern gegen andere Territorien, etwa das Elsass, die Niederlande, sogar Gebiete in Italien einzutauschen. Karl indes weigerte sich beharrlich, den Verlust seines Stammlands auch nur in Betracht zu ziehen. Offenbar feilschte er einen Großteil des Jahres 1742 um ein signifikant vergrößertes Königreich Bayern mit einem jährlichen Ertrag von mindestens 6 Millionen Gulden. 42 Maria Theresia verweigerte ebenso vehement jegliches Entgegenkommen in
41. Reichsherrschaft ohne Habsburger: Karl VII. (1742–1745)
Bezug auf habsburgische Territorien. Ihr Gatte Franz Stephan war konzilianter und sandte dem Bischof von Würzburg 1742 einen verblüffenden Friedensplan. Bayern sollte an Karl VII. zurückgehen, mit kleineren Abtretungen am Inn an Österreich. Für seine Erbansprüche sollte Karl mit dem habsburgischen Vorderösterreich entschädigt werden und zudem als Kaiser das noch in französischen Händen befindliche Elsass erhalten. Böhmen, Mähren und Oberschlesien sollten wieder an Maria Theresia fallen. Alle Unterzeichner des Friedensvertrags würden dann eine gemeinsame Armee von 271.000 Mann bilden, um das Elsass für den Kaiser zurückzuerobern. 43 Bemerkenswert an dem Plan war seine Ausgewogenheit und Versöhnlichkeit sowie der Versuch, einen »nationalen« Konsens gegen Frankreich herzustellen. Karl VII. und Maria Theresia hätte er jedoch kaum zufriedengestellt und so blieb er wie viele andere Vorschläge auf der Strecke. Für den Kaiser wurden derartige Pläne gefährlich, als er die Idee von Friedrich von Preußen aufgriff, seine Territorien auf Kosten der Reichskirche und der niederen Reichsstände zu erweitern. 44 Säkularisation war eine fixe preußische Idee, als jedoch der Kaiser selbst daran anknüpfte, führte das zum Skandal. Bereits Karls Einmarsch in das Fürstbistum Passau zu Beginn seines Feldzugs gegen Österreich hatte für Empörung gesorgt. Nun wollte er anscheinend Kernländer der Kirche konfiszieren, die er seinem Krönungseid zufolge zu schützen hatte. Anfang 1743 verfasste der preußische Minister von Podewils ein Memorandum, das vorsah, Bayern die Fürstbistümer Passau, Augsburg und Regensburg sowie die Reichsstädte Augsburg, Ulm und Regensburg zu übergeben. »Ajoutez-y Salzbourg«, notierte Friedrich der Große in einer Randbemerkung; Karl VII. selbst fügte der Liste Eichstätt und Freising hinzu. Der Plan sorgte für Empörung bei Fürstbischöfen, Reichsstädten und anderen kleineren Reichsständen. Dem Kaiser gelang es derart sogar, eine signifikante Anzahl deutscher Bischöfe zu Gesprächen mit dem päpstlichen Nuntius zu bewegen, dem sie ansonsten mit tiefem Misstrauen begegneten. Obwohl die Idee nicht von Karl selbst kam, machte sie ihm viele Feinde und war Wasser auf die Mühlen der österreichischen Propaganda. Zu Habsburgs Beschwerden und patriotischen Pamphleten, die Österreichs Rolle bei der Verteidigung des Reichs gegen Türken und Franzosen rühmten und Karl VII. vorwarfen, den französischen Erzfeind ins Reich gebracht zu haben, kam nun noch der Schlachtruf zur Verteidigung der deutschen Kirche gegen den wittelsbachischen Kaiser hinzu. Die Forderung nach seiner sofortigen Abdankung verhallte ungehört, aber im Frühjahr 1743 berieten die Kirchenfürsten über die Aufstellung einer 40.000 Mann starken Armee zum Schutz gegen ihren kaiserlichen Lehnsherrn. 45 Unterstrichen wurde die feindliche Haltung gegenüber den Kaiser kurz darauf durch die absolute Entschlossenheit, die Wahl seines Bruders Johann Theodor, des Fürstbischofs von Regensburg (ab 1719) und Freising (ab 1727), zum Erzbischof von Mainz zu vereiteln. Erfolgreicher Kandidat war der entschieden prohabsbur-
431
432
IV. · Das Reich von Karl VII. bis Leopold II. (ca. 1740–1792)
gische Graf Johann Friedrich Karl von Ostein. Weitere Versuche, Johann Theodor in Speyer, Konstanz und Basel wählen zu lassen, scheiterten ebenfalls, ehe er sich 1744 in Lüttich durchsetzte. 46 Dazu war massive französische Unterstützung gegen österreichisch-britischen Widerstand nötig; seine Ernennung zum Kardinal durch den Papst musste bis nach seiner Wahl verheimlicht werden. 47 Der totale Zusammenbruch der Herrschaft Karls VII. wurde 1744 vermieden, indem ihm Preußen wieder zu Hilfe kam. Friedrichs erneuter Angriff auf Böhmen ermöglichte es der Reichsarmee, die Österreicher aus Bayern hinauszudrängen. 48 Aber bald wandte sich das Blatt militärisch; im Januar stand zu befürchten, dass er erneut aus München fliehen musste. Im Reich, notierte Friedrich Karl von Schönborn im August 1744, herrschte Chaos: Niemand scherte sich mehr um Gesetze und Traditionen, viele hatten offenbar ausschließlich ihren eigenen Vorteil im Sinn und griffen zu diesem Zweck »zu theilung deren länderen im Reich, zu gottlosen Saecularisationen und mehr solchem grund verderblichen zeug«. 49 Als der Kaiser schließlich im Oktober 1744 nach München zurückkehrte, stellte der Reichstag die Arbeit ein. Das für jede sinnvolle Regierungstätigkeit und juristische Arbeit unerlässliche kaiserliche Archiv war immer noch nicht aus Wien eingetroffen, sondern saß auf drei Schiffen auf dem Main bei Hanau fest, näher an Frankfurt als an München, als Karl am 20. Januar 1745 starb. 50 Der Traum von einem reformierten, nichthabsburgischen Reich war geplatzt. Karl, der anfangs Beobachter wie Johann Jacob Moser durch Ernsthaftigkeit, Hingabe und Pflichteifer beeindruckt hatte, starb als gebrochener Mann. 51 Er hatte Schulden von 26 Millionen Gulden geerbt und hinterließ 35 Millionen Gulden Schulden, die seine Erben bis ins frühe 19. Jahrhundert hinein abstotterten. 52 Die bayerischen Ambitionen waren zerstört. Karls unmittelbarer Erbe, Maximilian III. Joseph, verzichtete im Gegenzug für die volle Restitution seiner bayerischen Ländereien und die Bestätigung seiner Kurwürde nur zu gern auf jeglichen Anspruch auf österreichische Gebiete und die Kaiserkrone. Im Reich hatte Karl nichts erreicht. Die österreichische Propaganda konnte von Anfang an seine Fehler nutzen und die Rhetorik von Nation und Patriotismus so beeindruckend gegen ihn in Stellung bringen, dass sie zum Vorbild der preußischen Propaganda gegen Österreich im Siebenjährigen Krieg wurde. 53 Wenn die Herrschaft Karls VII. ein Experiment war, brachte es die Mehrheit im Reich endgültig von solchen Versuchen ab. Als der französische Außenminister, der Marquis d’Argenson, im Frühjahr 1745 den Vorschlag ins Spiel brachte, das Reich in eine Föderation ohne Kaiser wie die Schweiz und die Niederlande umzuwandeln, zeigte nicht einmal Friedrich von Preußen Interesse an der Idee. 54 So war es ironischerweise Karls größter Erfolg, die Wahl eines Habsburgers als logischen Schritt nach vorn erscheinen zu lassen.
41. Reichsherrschaft ohne Habsburger: Karl VII. (1742–1745)
Anmerkungen 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18
19 20 21 22
Aretin, Altes Reich II, 451. Press, »Versailles und Wien«, 231–236; Schnettger, »Kurpfalz«, 67–74. Vgl. S. 140, 149 ff. Hartmann, Karl Albrecht, 105–108. Vgl. S. 261. Das rheinische Reichsvikariat, das Amt des Regenten während eines Interregnums, lag traditionell bei der Pfalz, ging jedoch 1623 auf Bayern über, weil Friedrich V. nach dem böhmischen Aufstand seine Länder und seine Kurwürde verlor. Bayern verweigerte die »Rückgabe« des Amts, nachdem der pfälzische Kurfürst 1648 wieder eingesetzt worden war; der Streit der beiden Dynastien wurde erst 1724 mit der Einigung auf gemeinsame Ausübung des Amts beigelegt. Das Abkommen wurde jedoch nie offiziell dem Kaiser zu Kunde gebracht und daher auch weder von ihm bestätigt noch vom Reichstag anerkannt. Das wurde zum Problem, als sich der Mainzer Kurfürst 1740 weigerte, das gemeinsame Vikariat anzuerkennen. Ein weiteres Abkommen von 1745 sah einen Wechsel zwischen beiden Häusern vor. Es wurde 1752 offiziell vom Reichstag bestätigt, die Ausübung des Amts durch Maximilian Joseph von Bayern 1745 informell hingenommen. Indes fand die Vereinbarung bis zum Erlöschen der bayerische Linie 1777 keine Anwendung mehr und der pfälzische Kurfürst Karl Theodor übernahm als Alleinerbe beide Territorien und Titel; vgl. Conrad, Rechtsgeschichte II, 70 f.; Schlösser, Erzkanzler, 5–11, 43 f. Hartmann, Karl Albrecht, 104 f. Aretin, Altes Reich II, 322. Ebd., 331; vgl. S. 188–192. Press, »Wittelsbachisches Kaisertum«, 207 f. Hartmann, Karl Albrecht, 94. Ebd., 127 f. Ebd., 163–166, 175–205. Aretin, Altes Reich II, 431. Schlösser, Erzkanzler, 174–182. Burgdorf, Reichskonstitution, 119; Schlösser, Erzkanzler,76–87. Die häufig genannte Zahl von vierundfünfzig Sitzungen enthält die Treffen der Kurfürsten bis zwei Monate nach der tatsächlichen Wahl am 24. Januar 1742, die offiziell zum selben »Wahltag« gerechnet wurden; vgl. Koch, »Wahl«, 212. Er musste das Territorium mit dem Rest von Lothringen nach dem Wiener Vorfrieden von 1735 im Austausch für die Toskana abtreten; der Vertrag von Wien, der diesen Tausch 1738 bestätigte, räumte ihm jedoch weiterhin das Stimmrecht für Nomeny im Reichstag ein, in Hinblick auf sein verbliebenes Reichslehen, die Grafschaft Falkenstein am Donnersberg in der nördlichen Pfalz, die aus der Burg und dem winzigen Ort Winnweiler, der verfallenen Burg Falkenstein und ein paar Dörfern (insgesamt 8.000 Bewohner im Jahr 1787) bestand; vgl. Köbler, Lexikon, 181, 473; vgl. generell zu seiner Kandidatur Gotthardt, Kaiserwahl, 82–145. BWDG I, 813; ADB VII, 784 ff.; Gotthardt, Kaiserwahl, 47–81. Burgdorf, Reichskonstitution, 117; Gotthardt, Kaiserwahl, 146–201. Schlösser, Erzkanzler, 32 f. Aretin, Altes Reich II, 432, 439; Meisenburg, Reichstag, 27 f.; Kleinheyer, Wahlkapitulationen, 99.
433
434
IV. · Das Reich von Karl VII. bis Leopold II. (ca. 1740–1792)
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Vgl. zum Folgenden Aretin, Altes Reich II, 432–439. Rürup, Moser, 131 ff.; Walker, Moser, 113–119; vgl. zu Moser S. 206–210. Meisenburg, Reichstag, 33. Koch, »Wahl«, 213–218. Herbers und Neuhaus, Reich, 265–269. Wagner, Karl VII., 635. Meisenburg, Reichstag, 38. Ebd., 36; Wien bezeichnete Karl VII. als »sogenannten Herrscher des Reichs«; vgl. Wagner, Karl VII., 222. Aretin, Altes Reich II, 441. Schlösser, Erzkanzler, 95 f. Aretin, Altes Reich II, 441 f.; Hartmann, Geld, 216–221. Noël, »Reichsbelehnungen«, 115; Feine, »Verfassungsentwicklung«, 74–77; Fürnrohr, Reichstag, 45, 73. Die neuen Fürsten, die sich durch Landbesitz qualifizierten, wurden einfach zu »gefürsteten Reichsgrafen«. Thurn und Taxis wurde erst 1754 zugelassen, und auch da nur unter der Bedingung, ein Fürstentum zu erwerben. Der Disput wurde erst 1785 durch den Kauf der schwäbischen »gefürsteten Grafschaft« Friedberg-Scheer gelöst; vgl. Grillmeyer, Habsburgs Diener, 46–51, 141–155; vgl. auch Schlip, »Fürsten«. Press, »Angriff«, 340–345; Sutter, »Kaisertreue«, 397 f.; Haug-Moritz, »Ritterschaftliche Organisation«, 16–19; Willoweit, Rechtsgrundlagen, 322–338. Wagner, Karl VII., 216 ff. Press, »Wittelsbachisches Kaisertum«, 221 f. Schmid, »Karl VII.«, 228; Grillmeyer, Habsburgs Diener, 50 f., 54 f. Hartmann, Karl VII., 255. Press, »Wittelsbachisches Kaisertum«, 225, 228. Ebd., 226. Schwerdtfeger, »Denkschrift«, 366–369; Wagner, Karl VII., 225 f.; Schmid, »Vermittlungsbemühungen«, 180 ff. Wolgast, »Säkularisationen«, 41 f.; Aretin, Altes Reich II, 449–453; Press, »Kaisertum«, 225 ff.; Hartmann, Karl Albrecht, 287–290; Schlösser, Erzkanzler, 121–124. Burgdorf, Reichskonstitution, 121 f. Schlösser, Erzkanzler, 107 f.; Hartmann, Karl Albrecht, 292 f.; Bautz, Kirchenlexikon III, 183–188. Deutsche Domkapitel zeigten wenig Neigung, Kardinäle zu wählen, weil sich der Heilige Stuhl das Recht vorbehielt, ihre Nachfolger zu nominieren; Aretin, Altes Reich II, 454. Hartmann, Karl Albrecht, 296–301. Schlösser, Erzkanzler, 131. Ebd., 165. Mosers Urteil findet sich bei Schmid, »Karl VII.«, 225 f. Hartmann, Karl Albrecht, 94 f. Burgdorf, Reichskonstitution, 121. Aretin, Altes Reich II, 462–467, und III, 15, 40; die italienischen Fürstentümer waren ebenso wenig begeistert von einem parallelen Vorschlag einer italienischen Föderation; sie zogen die relativ lockere Feudalherrschaft der Habsburger jedem moderneren, von Frankreich dominierten System vor.
42. Die Rückkehr der Habsburger: Franz I. (1745–1765)
»G
leichwie das Römische Reich ohne den Beistand des allerdurchlauchtigsten Erzhauses nicht wohl aufrechterhalten werden kann, gleichfalls dieses allerhöchste Haus bei Trennung von dem Römischen Reich von den bekannten Feinden großen Gefahren ausgesetzt bleiben dürfte«, so stellte Reichsvizekanzler Rudolf Joseph von Colloredo Anfang 1746 zu Österreichs möglichen Erwartungen an die Herrschaft von Franz I. fest und verwies damit auf die Erneuerung der Beziehung zwischen Habsburg und dem Reich, die durch das wittelsbachische Intermezzo kurz unterbrochen worden war. 1 Seiner Ansicht nach war der Hauptfeind Österreichs und des Reichs Frankreich, das wichtigste Ziel die Wiederherstellung der Solidarität von Krone und Reichsständen. Nach den hitzigen Diskussionen von 1740–1742 war das Interregnum 1745 weniger dramatisch. Dass zwischen dem Tod Karls VII. und der Neuwahl erneut siebeneinhalb Monate vergingen, unterstrich die Entschlossenheit der Kurfürsten, ihr Wahlrecht frei auszuüben. Die Reichsvikare vergeudeten keine Zeit und machten ihre Autorität geltend. Pfalz und Bayern legten ihren Streit über das rheinische Vikariat im März 1745 bei und einigten sich auf dessen abwechselnde Ausübung, was zur Einrichtung des Vikariatshofs in München führte, da die Pfalz das Amt 1711 innegehabt hatte. Diese Vereinbarung wurde erst 1752 offiziell anerkannt, aber anders als 1740–1742 kam es diesmal hierüber nicht zu Zwistigkeiten. Die Kaiserwahl war vordringlich. Maximilian III. Joseph von Bayern und Friedrich August II. von Sachsen zogen ihre Kandidatur schnell zurück; intensive Diskussionen richteten sich auf Franz Stephan von Lothringen als einzigen plausiblen Kandidaten. Selbst französische Beobachter stellten im Juni 1745 niedergeschlagen fest, es gebe keine Alternative, Österreich werde die Kaiserkrone wiedererlangen und der neue Kaiser für Frieden zwischen Österreich und Preußen sorgen. Alle Bemühungen der letzten paar Jahre seien vergeblich gewesen. 2 Allerdings wollten ihn weder die Pfalz noch Preußen unterstützen und so wurde Franz Stephan am 13. September ohne deren Stimmen gewählt. Zehn Tage nach der Wahl unterstrich Maximilian III. Joseph von Bayern die Bedeutung der Reichsvikare, indem er in einem rechtlich sehr dubiosen Akt die Belehnung Brandenburgs mit dem Herzogtum Ostfriesland zusagte. Dies geschah zum Teil aus Groll: Er musste einsehen, dass er seine eigene Stimme zu billig ver-
436
IV. · Das Reich von Karl VII. bis Leopold II. (ca. 1740–1792)
kauft hatte, und nahm es übel, dass dies als Bedingung seines Friedens mit Österreich geschehen war. Nun argumentierte er, seine Amtsgewalt als Reichsvikar bleibe in Kraft, bis Franz tatsächlich gekrönt sei. Seine Einmischung in die ostfriesische Frage verschärfte das Problem, das auf das Erlöschen der Cirksena-Dynastie mit dem Tod von Graf Carl Edzard im Mai 1744 zurückging. 3 Brandenburgische Truppen hatten aufgrund eines von Leopold I. zugestandenen Anwartschaftsrechts umgehend das Fürstentum besetzt und waren damit konkurrierenden Forderungen auf die Nachfolge vonseiten Hannovers und des Grafen von Wied Runkel zuvorgekommen. 4 Betroffen waren auch habsburgische Interessen: Die Errichtung einer brandenburgischen Präsenz in Nordwestdeutschland mit einem Handelshafen in Emden bedrohte die nach der Aneignung der Spanischen Niederlande sorgfältig geknüpften regionalen habsburgischen Netzwerke. Die bayerische Initiative sorgte für Wut und Empörung, schuf jedoch neue Fakten, die schließlich zur Bestätigung der preußischen Besitzrechte führten. Die Kaiserkrönung am 3. Oktober schob weiteren derartigen Machenschaften einen Riegel vor. Kurz darauf beendete der Friede von Dresden die Feinseligkeiten zwischen Preußen und Österreich, indem Friedrich II. Franz als Kaiser anerkannte und Österreich im Gegenzug Schlesien abtrat. Im April des folgenden Jahren erklärten Preußen und die Pfalz ihre »Einwilligung« in die Wahl und schufen damit vollendete Tatsachen. 5 Derweil hatte Franz den Reichstag von Frankfurt zurück nach Regensburg verlegt, die kaiserliche Kanzlei in Wien mit einem neuen Reichsvizekanzler wiedereröffnet und dort auch einen neuen Reichshofrat zusammengestellt. Der bayerische Reichsvizekanzler Johann Georg von Königsfeld wurde umgehend durch Graf Rudolf Joseph von Colloredo ersetzt, der 1737 zum Assistenten und erwarteten Nachfolger von Johann Adolf von Metsch ernannt worden war und nach Metschs Tod im November 1740 kurze Zeit amtiert hatte. Bayerische Angehörige wurden weitgehend aus dem Reichshofrat entfernt, der von Karl VI. ernannte Präsident Johann Wilhelm von Wurmbrand wieder eingesetzt. 6 Das Ziel war, die Kontinuität der habsburgischen Herrschaft im Reich wiederherzustellen. Aber der Eindruck der Kontinuität war trügerisch. Das wittelsbachische Zwischenspiel mag durch den Bau institutioneller und personeller Brücken zur Herrschaft Karls VI. begraben worden sein, die Wiedererrichtung der kaiserlichen Position erwies sich jedoch als weniger leicht. Drei grundlegende Probleme verhinderten, dass Franz I. zur Gänze zu der Art kaiserlicher Herrschaft zurückkehren konnte, die die Epoche von 1648 bis 1740 gekennzeichnet hatte. Erstens hatte die Phase der Wittelsbacher, so kurz sie auch war, die Wiener Autoritäten gezwungen, klarer zwischen dynastischen und Reichsbelangen zu unterscheiden. Dazu hatten auch die Bemühungen um Trennung der Archive der kaiserlichen Kanzlei und des Reichshofrats von der Masse an Papieren bezüglich der habsburgischen Ländereien beigetragen. Die darauf resultierende Einrichtung
42. Die Rückkehr der Habsburger: Franz I. (1745–1765)
von Institutionen, die für habsburgische Angelegenheiten zuständig waren, wurde Teil einer weitreichenden administrativen Reform, die Graf Friedrich Wilhelm von Haugwitz zwischen 1744 und 1749 in Angriff nahm. 7 Da nun rein österreichische Institutionen mehr Aufmerksamkeit genossen, bis hin zur Abschaffung der separaten böhmischen und österreichischen Hofkanzleien und der Schaffung eines obersten Directorium in publicis et cameralibus (Direktorat für öffentliche und finanzielle Angelegenheiten) nach dem Vorbild des preußischen Generaldirektoriums von 1723, traten Reichsinstitutionen aus dem Rampenlicht. 8 Ebenso etablierte sich während der Abwesenheit der Reichskanzlei in Frankfurt 1742–1745 die Staatskanzlei, das 1742 gegründete österreichische Außenministerium, zur bestimmenden Kraft der österreichischen Politik. Dass Maria Theresia sich einer Krönung zur Kaiserin widersetzte, war vielleicht Ausdruck des wachsenden Selbstbewusstseins der österreichischen Monarchie. 9 Ihr Empfinden, das Reich habe sie verraten, weil es ihr 1740 nicht beigestanden hatte, spielte wohl ebenfalls eine Rolle. Beim Anblick ihres Gatten in seinem Krönungsornat soll sie vor Lachen gebrüllt und die Kaiserkrone als »Narrenhäubl« bezeichnet haben. Sie selbst hatte eine deutsche Krönung nicht nötig; ihre eigenen (männlichen) ungarischen und böhmischen Königskronen und österreichischen Titel galten auch so. Das Reich tauchte jedoch in dem von ihr geführten Titel Kaiserin-Königin und in der Bezeichnung ihrer Administration und Armee als kaiserlich-königlich (k. k.) auf. 10 Darüber hinaus genoss ihr Mann am Hof Vorrang vor ihr, alle Botschafter wurden zuerst vom Kaiser empfangen. 11 Die Spannung zwischen Hauspolitik und Reichspolitik zeigte sich langsam auch in der Verwaltung habsburgischer Interessen in den schwäbischen Territorien Vorderösterreichs. Die Versuche einer Reform der Regionalverwaltung ab 1753 sorgten für anhaltende Konflikte zwischen Wien und dem schwäbischen Kreis, wobei sich Wien (Maria Theresia) auf eine Weise als oberster territorialer Lehnsherr gerierte, die oft im Widerspruch zu Franz Stephans Rolle als Beschützer der niederen Reichsstände stand. 12 Andererseits sollte diese Spaltung nicht überbewertet werden. In der Praxis befassten sich Staatskanzlei und Reichskanzlei weiterhin mit dem Reich. Es gab keine klare Trennung der Arbeit und der Hierarchien. Graf Wenzel Anton von Kaunitz versuchte eine solche 1755 einzuführen, aber die Zuständigkeitsbereiche überschnitten sich weiterhin. Seine Anweisung, die Interessen der Dynastie Habsburg betreffende Papiere sollten nicht in Kopie an die Reichskanzlei gehen, weil sie der Reichsvizekanzler als Mitglied der Geheimkonferenz ohnehin zu Gesicht bekomme, spiegelte seinen zunehmenden persönlichen Rang. 13 Aber auch nachdem er den Staatsrat 1760/61 als neues oberstes Gremium etabliert hatte, betrieben die Reichskanzlei und andere Stellen weiterhin politische Geschäfte im Reich und berieten den Kaiser und die Kaiserin-Königin. Dass viele kaiserliche Agenten und
437
438
IV. · Das Reich von Karl VII. bis Leopold II. (ca. 1740–1792)
Gesandte im Reich eigentlich österreichische Beamte waren, unterstrich zudem die Überschneidung der Interessen. 14 Die politischen Unterschiede zwischen Haus und Reich traten wesentlich deutlicher zutage, wenn es um die globale Ausrichtung der Reichsverwaltung ging. Franz I. war ein überzeugter Anhänger des »alten Systems« von Bündnissen mit den Seemächten gegen Frankreich. Die neuen Kräfte, die sich nun in Wien durchsetzten, allen voran ab 1749 Kaunitz, waren der Meinung, das alte System sei gescheitert und die Zukunft liege in einer Allianz mit Frankreich. In Bezug auf das Reich hieß das, dass Franz I. bereit war, den Verlust von Schlesien hinzunehmen, Maria Theresia aber ganz und gar nicht. Es wäre falsch, zu behaupten, die Kaiserkrone sei als »bloßes Anhängsel der habsburgischen Macht« betrachtet worden. 15 Wien schien jedoch zeitweise in zwei unterschiedliche Richtungen zu steuern. Dass Kaunitz und Maria Theresia die globale Strategie bestimmten, ließ Franz Stephan weniger Spielraum für eine Einflussnahme im Reich. Noch 1757 notierte Graf Khevenhüller-Metsch: »Wir haben zwei Herren, den Kaiser und die Kaiserin, und beide wollen regieren.« 16 Das zweite grundlegende Problem war, wie man mit Friedrich dem Großen umgehen sollte. Die Strategien waren unterschiedlich: Franz Stephan wollte Preußen wieder integrieren und in seine Pläne für einen Krieg gegen Frankreich einbinden, während Maria Theresia und Kaunitz bestrebt waren, den Kampf gegen Preußen wieder aufzunehmen und verlorenes Territorium zurückzugewinnen. Friedrich selbst zeigte sich für Franz Stephans Pläne nicht empfänglich und widmete einen Großteil seiner Energie dem Schutz vor Zweiterem. Obwohl er später gern als skrupelloser Kriegstreiber dargestellt wurde, der das Reich im Grunde verachtete, war Friedrich tatsächlich ein brillanter Reichspolitiker. 17 Sein strategisches Denken galt immer zwei Zielen: Preußens Platz im Gleichgewicht der Mächte in Europa und dem Gleichgewicht der Mächte im Reich. 18 Das zeigte sich bereits in seiner Entscheidung, Schlesien anzugreifen, statt an Brandenburgs Beschwerden aus den 1730er Jahren wegen der Nachfolge in Jülich und Berg anzuknüpfen. Jede Initiative in dieser Richtung hätte einen Konflikt mit der Pfalz nach sich gezogen und sein Verhältnis mit dem bayerischen Kurfürsten beeinträchtigt, dessen Wahl zum Kaiser er gegen die habsburgischen und sächsischen Kandidaten befürwortete. Bayerns Abhängigkeit von Frankreich kam ihm ebenfalls sehr entgegen, ebenso wie die bayerischen territorialen Ambitionen in Böhmen und Österreich, wodurch Schlesien ihm überlassen blieb. Nach 1745 versuchte Preußen die Wiederherstellung der habsburgischen Macht im Reich zu blockieren oder zumindest zu bremsen. Gerüchte sprachen immer wieder davon, Preußen wolle selbst nach der Kaiserkrone greifen, dazu kam es jedoch nie. 19 Friedrich nutzte den Reichstag als Forum der Opposition
42. Die Rückkehr der Habsburger: Franz I. (1745–1765)
und drängte sofort darauf, neben den Stimmen seiner anderen Länder auch das ostfriesische Stimmrecht ausüben zu dürfen. Auch die Vertretung Preußens in drei Kreisen nutzte er zu seinen Gunsten. Im obersächsischen Kreis, der ohnehin nicht wirklich funktionierte, dominierte Brandenburg ohne Mühe; Sachsen als einziger Konkurrent war durch die polnische Krone abgelenkt. Im niedersächsischen Kreis ging es darum, Hannover in Schach zu halten, was durch die zunehmende Zurückhaltung der britischen Politik immer leichter fiel. Die größte Herausforderung war der westfälische Kreis, wo die preußischen Interessen auf die der Pfalz, des wittelsbachischen Kirchenfürsten Clemens August von Köln und der Habsburger trafen. Wo Preußen nicht selbst infolge von Landbesitz vertreten war, nutzte der König seine weitverzweigten dynastischen Verbindungen. Seine eigene Ehe war eine Katastrophe, umso größer war sein Interesse an seinen acht verheirateten Geschwistern und deren Kontakten mit einer Reihe mittel- und norddeutscher Dynastien. Ebenso wichtig waren die Beziehungen zu den jüngeren Hohenzollernlinien von Ansbach, Bayreuth und Schwedt. Diese zahlreichen Familienverbindungen wurden in vielen Fällen durch finanzielle Unterstützung gefestigt, was insbesondere jenen zugutekam, die ihre Streitkräfte ausgebaut hatten, um an den diversen Kriegen Karls VI. in den 1730er Jahren teilzunehmen, und sich deren Unterhaltung nach 1740 nicht mehr leisten konnten. Das Netzwerk von Kontakten und Klienten stärkten auch die Rekrutierung von Verwandten und anderen als Kommandeure der preußischen Armeen, die Vergabe hoher administrativer Ämter an nichtpreußische Adlige, oft Reichsgrafen, und nicht zuletzt die Rekrutierung einer großen Anzahl Nichtadliger von anderswo im Reich, für die es attraktiv war, im Dienst Preußens zu stehen, weil Friedrich Karl VII. überredet hatte, in Preußen verliehene Adelspatente anzuerkennen. 20 In vieler Hinsicht begann die preußische Reichspolitik unter Friedrich jener der Habsburger zu ähneln, indem sie deren traditionelle Methoden der Einflusserweiterung und systematischen Nutzung regionaler Präsenz und dynastischer Verbindungen übernahm und sich schließlich sogar – trotz der fixen Idee der Säkularisierung – um Einfluss bei kirchlichen Wahlen bemühte. Möglichkeiten auf diesem Gebiet eröffneten sich so richtig nach dem Tod des Wittelsbachers Clemens August von Köln, des Monsieur de Cinque Eglises (»Herrn der fünf Kirchen«), 1761, durch den die Pfründe von Münster, Osnabrück, Paderborn und Hildesheim sowie Köln frei wurden, was auch enorme Ambitionen der Habsburger weckte. Zuvor waren protestantische Interessen von größerer Bedeutung. Bereits Friedrichs beide Vorgänger hatten sich bemüht, den Übertritt des sächsischen Kurfürsten zum Katholizismus zu nutzen, um die traditionelle Führungsrolle Sachsens im Protestantismus des Reichs und im Corpus Evangelicorum im Reichstag zu
439
440
IV. · Das Reich von Karl VII. bis Leopold II. (ca. 1740–1792)
übernehmen. Friedrich Wilhelm I. hatte sich diese inoffizielle Rolle mit Hannover geteilt und sich ebenso wie Hannover gescheut, den Habsburgern offen entgegenzutreten. Solche Hemmungen waren Friedrich fremd; er zögerte nicht, auf die protestantische Karte zu setzen. 1744 intervenierte er nach Thronbesteigungen zuvor konvertierter Erben in Württemberg und 1754 in Hessen-Kassel als Garant protestantischer Rechte. In beiden Fällen war sein Einschreiten mit Militärallianzen, der Annahme beziehungsweise Vergabe von Subventionen für Streitkräfte und die Aktivierung familiärer Beziehungen verbunden. Geschickt verknüpfte Friedrich die Wahrung protestantischer Interessen mit der Einbeziehung der beteiligten katholischen Fürsten in das preußische Klientelnetzwerk. Durch diese Interventionen in Südwest- und Mitteldeutschland erweiterte sich der preußische Einflussbereich im Reich erheblich. Zudem zeigte sich darin das dritte signifikante Problem, mit dem Franz I. zurechtkommen musste: die anhaltenden konfessionellen Spannungen im Reich. 21 Dieses komplexe Phänomen ist bis heute nicht gänzlich entschlüsselt. Die konfessionellen Probleme der ersten paar Jahrzehnte des Jahrhunderts hatten größtenteils mit den Auswirkungen des Friedens von Rijswijk zu tun. Nun waren die Streitpunkte vielfältiger; dass es in den 1740er und 1750er Jahren zu einer Reihe von Konflikten kam, sorgte für eine neue Krisenstimmung. Manche Probleme gingen auf Dispute in Gemeinden über den Besitz von Kirchen oder über die Zulassung neuer religiöser Gruppen, die laut dem Westfälischen Frieden keine Rechte genossen, durch einen örtlichen Herrscher zurück. Solche lokalen Kontroversen wurden wohl auch durch die Ängste des protestantischen Klerus insbesondere vor der Ausbreitung religiöser Toleranz (die sie abfällig als »Indifferentismus« bezeichneten) und vor den Auswirkungen der zunehmend dominierenden »pragmatischen Tolerierung« durch viele Herrscher geschürt. 22 Ein dafür typischer Fall beschäftigte 1755 das Corpus Evangelicorum: Der calvinistische, aber mit dem Katholizismus liebäugelnde Graf von Wied-Runkel beschloss, die Gründung eines Kapuzinerklosters in Dierdorf zu gestatten; seine protestantischen Untertanen waren strikt dagegen. 23 Sie appellierten an das Corpus Evangelicorum, das den König von Preußen um ein Einschreiten ersuchte. Der Graf wandte sich an den Reichshofrat, worauf das Corpus den preußischen König um den Einsatz militärischer Mittel bat. Abgewendet wurde dies nur durch den Ausbruch des Siebenjährigen Kriegs; der Disput setzte sich jedoch fort, bis der Graf schließlich 1787 einlenkte. Andere Konflikte erwuchsen aus der Thronfolge eines Fürsten anderer Konfession als der im Territorium vorherrschenden und aus der Konversion von Herrschern, meist vom Protestantismus zu Katholizismus. Problematisch wurde die Sache unter dem Aspekt das Vertrags von Osnabrück (1648), wenn ein solcher Herrscher Gottesdienste für sich und seinen Haushalt oder Hof und Gefolge (ein
42. Die Rückkehr der Habsburger: Franz I. (1745–1765)
Simultaneum) einzurichten wünschte. 24 Seit der Thronfolge eines katholischen Kurfürsten in der Pfalz 1685 und dem Übertritt des sächsischen Kurfürsten zum Katholizismus 1696 war es zu einer Reihe solcher Fälle gekommen, die eine Fülle gelehrter und volkstümlich-polemischer Literatur sowie eine Masse von Gerichtsurteilen und Präzedenzfällen nach sich zogen, die bei der Aushandlung sämtlicher folgenden Vereinbarungen berücksichtigt werden mussten. Dispute über das Recht zur Abhaltung öffentlicher Gottesdienste, über die Rechte protestantischer Stände und Untertanen im Fall der Thronfolge eines katholischen Herrschers oder einer Konversion ihres Herrschers zum Katholizismus waren nicht neu. Zudem gab es bewährte Mechanismen, um damit umzugehen: Man konnte sich an die Reichsgerichte wenden und auf interne Verträge berufen, die Rechte garantierten. Wie bereits früher im Jahrhundert verwandelten sich nun indes rechtliche in politische Konflikte, da Beschwerden weniger durch reguläre Prozesse gelöst wurden als durch direkte Appelle an den Reichstag, vor allem an das Corpus Evangelicorum, das sich wiederum das Recht anmaßte, direkt einzugreifen, um Urteile höherer Gerichte durchzusetzen, und somit endgültige Entscheidungen des Kaisers beziehungsweise das Reichstags vorwegnahm. Nach einer Ruhepause von etwa dreißig Jahren trat das Corpus 1750 wieder in Aktion, indem es den Markgrafen von Ansbach beauftragte, die Rechte der Protestanten im fränkischen Hohenlohe durchzusetzen. Der Konflikt ging dort auf einen langwierigen Disput zwischen den protestantischen Grafen von Hohenlohe und den katholischen Fürsten derselben Dynastie zurück. 1744 weitete sich ein Streit um den Termin des Osterfests in einen allgemeinen Zwist über Feiertage und die Rechte der Protestanten in den von katholischen Fürsten regierten Gebieten Schillingsfürst, Bartenstein und Pfedelbach aus. Als sie ein Urteil des Reichshofrats ignorierten, übernahm es das Corpus Evangelicorum selbst, Ansbach zu beauftragen, das Urteil durchzusetzen, woraufhin 104 Grenadiere dorthin entsandt wurden. Brandenburg, Hannover, Hessen-Kassel und Sachsen-Gotha wurden gebeten, Truppen bereitzuhalten. 25 Diese Militäroperation war beispiellos und wurde nie wiederholt, sie schuf jedoch einen neuen Rahmen für eine langwierige Phase militanter Aktivitäten des Corpus. 26 Die von den Disputen angefachten konfessionellen Empfindlichkeiten in diesen Angelegenheiten verstärkten sich durch die österreichische Allianz mit Frankreich, die viele als katholisches Bündnis betrachteten. Zudem wurden während des Siebenjährigen Krieges konfessionelle Themen allgemein intensiv zu Propagandazwecken genutzt und die Besetzung und Ausbeutung signifikanter Gebiete des Reichs durch Streitkräfte unterschiedlichen Glaubens erzeugte konfessionelle Ressentiments. 27 Für viele an diesen Disputen beteiligte Fürsten ging es um mehr als nur um Religion. Manch einer fragte sich, ob Religion überhaupt eine Rolle spielte: Kaunitz
441
442
IV. · Das Reich von Karl VII. bis Leopold II. (ca. 1740–1792)
etwa notierte 1787: »Meiner Meinung nach ist seit geraumer Zeit schon in Deutschland der Religionsunterschied dergestalt bloß zum politischen Vorwand und Losungswort geworden, dass, wenn heute der kaiserliche Hof und die mächtigen [katholischen] Reichsstände sich zur Augsburger Konfession bekennten, morgen die Protestanten die katholische Religion annehmen würden.« 28 Die religiösen Dispute jener Zeit wurden zum Bestandteil breiterer politischer und konstitutioneller Konflikte. Bezeichnenderweise bildeten den Kern der Aktivisten sogenannte alte Fürsten – Dynastien, die auf die Zeit vor 1582 zurückreichten. 29 Sie betrachteten sich als ursprüngliche Fürsten des Reichs und den »neuen«, von den Habsburgern erhobenen Fürsten übergeordnet. Den meisten von ihnen missfielen Privilegien und Status der Kurfürsten. Einige, wie der Landgraf von Hessen-Kassel und der Herzog von Württemberg – beide katholische Herrscher protestantischer Territorien, die ab etwa 1750 unter preußischem Schutz standen –, strebten selbst Kurwürden an. 30 Die Mehrheit der »alten Fürsten« war protestantisch und wütend über ihren Minderheitsstatus im Fürstenkollegium, wo sie neben den Vertretern der Reichskirche saßen, von denen die meisten Sprösslinge niederrangiger Adelsdynastien von Reichsgrafen und -rittern waren. Sie waren leicht davon zu überzeugen, dass ihre Interessen die Interessen des Reichs insgesamt und sie selbst die wahren Verteidiger der deutschen Freiheit gegen die Habsburger waren. Wie viele zeitgenössische Beobachter feststellten, bildeten sie ebenso eine »Partei der Freiheit« oder »politische Partei« wie eine »Partei des Protestantismus«. 31 Sie waren die Anhängerschaft, die Friedrich der Große gegen jeden Versuch der Wiederrichtung einer habsburgischen Hegemonie im Reich zu mobilisieren suchte. Obwohl ihm viele Hindernisse im Weg standen, betrieb Franz I. eine umfangreichere Reichspolitik als oft behauptet. Er stand traditionell immer im Schatten von Maria Theresia. Laut den Titeln zweier moderner Biografien »sitzet« er »zur linken Hand« der Kaiserin-Königin und »an der Seite einer großen Frau«, und keine der beiden hat über ihn als Kaiser viel zu sagen. Einen ausgewogeneren Ansatz verfolgt eine der jüngsten Studien, die ihn als »Monarch, Manager, Mäzen« bezeichnet. 32 In gewisser Weise spiegelt die Vernachlässigung die zeitgenössische Sicht wider, die von Maria Theresia fasziniert und von ihrem Gatten wenig beeindruckt war. Sie ist aber auch eine Folge der systematischen Aussortierung von Akten zu Maria Theresias Befehlen, der sämtliche Spuren von Entscheidungen, die ihr missfielen oder sie in ein schlechtes Licht rücken mochten, zum Opfer fielen. Jüngere Studien zu Franz Stephan als Sammler, höchst erfolgreicher Administrator und als Mann, der für seine Dynastie ein außerordentliches Vermögen anhäufte, zeigen einen fähigeren und regsameren Charakter. 33 Das belegen auch die – wenngleich unvollständigen – Dokumente seiner Aktivitäten im Reich. Auf übergreifend strategischer Ebene blieb Franz I. bemerkenswert beständig.
42. Die Rückkehr der Habsburger: Franz I. (1745–1765)
Sein Ansatz nach 1745 beruhte auf Elementen des Friedensplans, den er 1741/42 formuliert hatte. Sein erstes kaiserliches Dekret vom 17. Oktober kündigte einen neuen Kurs an: Die Kreise sollten ihre Truppenaushebungen verdreifachen, um eine Reichsarmee von 120.000 Mann zu bilden, der Reichstag sollte dringlich über die Sicherheit des Reichs beraten. 34 Was der Kaiser dabei im Schilde führte, war ein sofortiger Krieg gegen Frankreich, um das Reich gegen seinen Erzfeind zu vereinen. Der Reichstag stimmte dem Triplum bereitwillig zu und übte in den folgenden Jahren beträchtlichen Druck auf die Vorderen Kreise aus, die Art von Verbindung zu erneuern, die sie früher im Jahrhundert gehabt hatten. 35 Andererseits zierten sich die Kreise so beharrlich, zur Tat zu schreiten, dass überhaupt nichts passierte, bis der Friede von Aachen die Feindseligkeiten mit Frankreich im Oktober 1748 beendete.Wie so oft zögerten die Reichsstände, sich in etwas verwickeln zu lassen, was sie für eine Angelegenheit der Habsburger hielten. Die Feldzüge Karls VI. in den 1730er Jahren waren bitter in Erinnerung geblieben. Das offensichtliche Scheitern dieser Politik führte im Frühjahr 1749 zu einer Neubewertung. Maria Theresia bat Franz und ihre wie seine engsten Berater um eine Einschätzung der Lage der Dynastie und politischer Optionen im Reich und Europa. 36 Man war sich einig, was die symbiotische Beziehung zwischen Österreich und dem Reich anging, jedoch nicht über das weitere Vorgehen. Der Reichsvizekanzler und jene, die Franz näherstanden, stritten für ein Festhalten an der alten Politik. Ein Krieg gegen Frankreich erschien nach wie vor wünschenswert. Die alte Allianz mit Großbritannien war immer noch von Nutzen, nicht zuletzt, weil Hannover protestantische Fürsten für die kaiserliche Sache gewinnen konnte. Maria Theresias Seite war skeptisch; manche empfahlen, Österreich solle mit Frankreich kooperieren, anstatt es zu bekämpfen. Die alten Bündnisse mit den Seemächten, fanden sie, hatten nichts von Bedeutung erbracht. Schlesien war verloren und konnte auch mit Unterstützung von Hannover nie zurückgewonnen werden; in Aachen hatten die Seemächte zur internationalen Anerkennung der Annexion durch Friedrich den Großen beigetragen. Das Resultat war eine modifizierte Version der früheren Politik des Kaisers. Mit britischer Hilfe sollte die Wahl des jungen Joseph zum römischen König und designierten Thronerben sichergestellt werden. 37 Der Plan fand Unterstützung in Den Haag und London; vor allem Großbritannien war bereit, signifikante Geldsummen für die Stimmen anderer Kurfürsten und die Schaffung eines Netzwerks von kaisertreuen Territorien zu investieren. Schließlich aber scheiterten die Gespräche. Kurfürsten, die ihre Wahlfreiheit nicht aufgeben und sich nicht den Habsburgern verpflichten wollten, wiesen zu Recht darauf hin, dass die Wahl eines Achtjährigen etwas verfrüht war. Der vielleicht einzige Erfolg der ganzen Initiative war die Verteilung von britischem Geld, das viel dazu beitrug, die Lage im Reich in den frühen 1750er Jahren zu festigen.
443
444
IV. · Das Reich von Karl VII. bis Leopold II. (ca. 1740–1792)
Nach diesem Rückschlag lag die Initiative bei Kaunitz, der 1753 das Amt des Staatskanzlers antrat, und bei den Unterstützern einer Neuausrichtung der Politik auf eine Allianz mit Frankreich. Der Ausbruch des Siebenjährigen Krieges unterstrich das Scheitern der kaiserlichen Versuche, das Reich zu einen und Preußen wieder zu integrieren. Aber Franz wandte sich umgehend einer neuen Version seiner alten Politik zu, parallel zu Kaunitz’ neuer Strategie, und versuchte das Reich gegen Preußen zu mobilisieren. Zwar verweigerte der Reichstag eine Ächtung Friedrichs des Großen, aber für den Kaiser war es ein signifikanter Erfolg, das Parlament für eine offizielle Kriegserklärung und die Entsendung einer Reichsarmee (unter dem Befehl seines Bruders Karl von Lothringen) ins Feld zu gewinnen. Angesichts der zwiespältigen Resultate des Kriegs für Österreich, das sein Hauptziel, die Rückgewinnung Schlesiens, verfehlte, ist fraglich, ob Kaunitz oder Franz die bessere Politik verfolgte. Tatsächlich gibt es Belege für die Annahme, beide seien sich bewusst gewesen, dass sich ihre Strategien im Kampf gegen Preußen gegenseitig ergänzten. Sicherlich trugen beider Bemühungen gleichermaßen zur erfolgreichen Wahl Josephs zum römischen König im März 1764 bei. Kaunitz hatte seit 1752 hart daran gearbeitet, die Stimme der Pfalz zu sichern und alle französischen Widerstände gegen eine glatte habsburgische Thronfolge aus dem Weg zu räumen. 38 Franz selbst hatte ebenfalls von Anfang an unentwegt dafür gearbeitet. In den abschließenden Diskussionen gelang es ihm, eine übertrieben beschwerliche Wahlkapitulation zu vermeiden, indem er pathetisch erklärte, die Interessen des Reichs könnten nicht Gegenstand von Eigennutz getriebener Verhandlungen sein. 39 Auf Schwierigkeiten stieß Franz auch in anderer Hinsicht, dennoch gelangen ihm zumindest moderate Erfolge. Eines der auffälligsten frühen Ereignisse seiner Herrschaft war die Weigerung der Kurfürsten, ihre Lehen zu erneuern und dem neuen Kaiser traditionsgemäß persönlich die Huldigung zu erweisen. 40 Preußen ging dabei voran und berief sich auf die Vereinbarung mit Karl VII. Als die anderen weltlichen Kurfürsten Wind davon bekamen, weigerten sie sich ebenfalls, desgleichen der wittelsbachische Kurfürst von Köln. Nur die Erzbischöfe von Mainz und Trier fügten sich der traditionellen Prozedur. Dem Beispiel der Kurfürsten folgten viele weltliche Fürsten, vor allem die »alten Fürsten«, die sich als den Kurfürsten ebenbürtig ansahen. Es gab Ausnahmen. 1752 erneuerte Dänemark seine Lehen Oldenburg und Holstein-Glückstadt. Zwei Jahre später erwies Schweden seine Ehrerbietung im Namen Pommerns und bezahlte sogar Gebühren für die neunzig Jahre seit der letzten Erneuerung des Lehnseids. 41 Allerdings übernahm die Zeremonie der Huldigung in Wien in beiden Fällen ein Botschafter und nicht der Herrscher selbst. Die »schwänzenden« Fürsten dachten wahrscheinlich, eine Investition in gute Beziehungen zum Kaiser sei ein Mittel, ihre Territorien vor raublustigen Nachbarn zu
42. Die Rückkehr der Habsburger: Franz I. (1745–1765)
schützen. Die einzige Gruppe, die sich einigermaßen geschlossen dem alten Ritual unterwarf, waren die Kirchenfürsten, ausgenommen Clemens August von Köln und seine fünf Territorien. Zwar verwandte man viel Zeit für Überlegungen zur Wiederherstellung alter Traditionen, aber der Kaiser selbst war nicht immun gegen Anwandlungen, den Status seiner Familie zu erhöhen. Bei der Begründung eines Hofs für seinen siebenjährigen Sohn Joseph 1749 bestand er auf königlichem statt lediglich erzherzoglichem Protokoll. 1754 wurde die Anrede seiner Kinder von »Erzherzogliche Durchlaucht« zu »Königliche Hoheit« geändert, um die Situation in Ungarn und Böhmen und die Zuerkennung desselben Titels an die Herzöge von Lothringen durch Leopold I. 1703 zu dokumentieren. 42 Problematisch waren auch andere frühe kaiserliche Initiativen. Der Versuch, den Bruder des Kaisers, Karl von Lothringen, als erstrangigen katholischen Reichsfeldmarschall zu etablieren, führte zu einer ermüdenden Debatte über Parität, die mit dem Vorschlag eines sechzehnköpfigen Oberkommandos endete – in einem Reich, das nicht im Krieg stand und keine reguläre Armee besaß! Auf Karls Ernennung – und keine weitere – einigte man sich im Mai 1746, aber die langwierige Diskussion war ein schlechtes Omen. 43 Andererseits hatte Franz keine andere Wahl, als 1751 die Anerkennung der Besitzrechte Friedrichs des Großen in Schlesien durch den Reichstags zu billigen; allerdings konnte er die preußische Forderung abwehren, Friedrich zum »souveränen Herrscher« Schlesiens zu erklären, und die Klausel »vorbehaltlich der Rechte des Reichs« in der Vereinbarung durchsetzen. 44 Die preußischen Ansprüche auf Ostfriesland musste Franz 1753 bewilligen, obwohl seine Abneigung dagegen nun noch dadurch verstärkt worden war, dass Kaunitz im Namen seiner Frau, einer Gräfin von Riedberg, ebenfalls Anspruch auf das Territorium erhob.45 Die aufsässige Haltung der »alten Fürsten« unterstrichen 1754 einmal mehr ihre Proteste gegen den Antrag, den Fürsten von Thurn und Taxis, seit 1748 Prinzipalkommissar in Regensburg, zum voll stimmberechtigten Mitglied des Reichstags zu machen, und ihr Misstrauen gegen die Erhebung und Einsetzung des protestantischen Grafen von Schwarzburg-Rudolstadt. 46 Beide wurden dann doch aufgenommen, aber Thurn und Taxis erfüllte erst 1787 die Voraussetzung, dass er Land besitzen musste, das als fürstliches Reichslehen durchging. 47 Die Erhebung von Thurn und Taxis war der Lohn für seine Dienste nicht nur im Reichstag, sondern auch – noch wichtiger – als Reichsgeneralpostmeister. Sein Nachrichtennetzwerk spielte eine Schlüsselrolle für die Kommunikation des Reichs sowie seiner Stände und stellte eine unschätzbare Quelle von Neuigkeiten und heiklen Informationen zur politischen Atmosphäre dar. 48 Offenbar wurde der Wiederherstellung der Beziehungen zu den traditionellen Unterstützern der Kaiserkrone und zu den Reichsstädten und -rittern viel Auf-
445
446
IV. · Das Reich von Karl VII. bis Leopold II. (ca. 1740–1792)
merksamkeit gewidmet. Das Verhältnis zu wichtigen Reichsstädten wie Regensburg, Augsburg und Nürnberg scheint sich nach 1745 intensiviert zu haben. 49 Hamburg, dessen Status noch ungeklärt war, stand zu jener Zeit ebenfalls in engem Verhältnis zu den kaiserlichen Autoritäten. 1745 wurde ein neuer kaiserlicher Botschafter in die Stadt entsandt; man sammelte ein don gratuit von 100.000 Gulden und tat alles, um eine kaiserliche Präsenz in diesem wichtigen Handelszentrum zu errichten, dessen Bedeutung auf Handel, Finanzen und seiner Rolle als Nachrichtenzentrum beruhte. 50 Kaiserliche Protektion half Hamburg, seine Unabhängigkeit gegen Dänemark zu wahren, und Hamburg spielte als kaiserliche Bastion und Verbreitungspunkt hilfreicher Nachrichten und Meinungen im ansonsten von Preußen dominierten Norden des Reichs eine strategische Rolle. Insgesamt blieb die traditionelle Rolle des Kaisers als Schutzherrn der Reichsstädte von Bedeutung. Das unterstrich die Entsendung der üblichen Botschafter, die die Huldigung der Reichsstädte für den neuen Kaiser entgegennahmen und selbstverständlich die üblichen Gebühren kassierten. 51 Betont wurde es auch durch die fortdauernde Bedeutung des Reichshofrats als eines höchsten Gerichts, das den Städten gegen aggressive territoriale Nachbarn, rebellische Bürgerschaften und zunehmend auch gegen überaktive Kreditgeber beistand, die jene süddeutschen Reichsstädte bedrängten, die seit dem frühen 18. Jahrhundert erdrückende Schuldenberge angehäuft hatten. Im Fall der Reichsritter engagierte sich Franz in einem langwierigen und oft bitteren Kampf mit führenden Fürsten um die Wahrung der Rechte der Ritter und ihres Überlebens als Gruppe. 52 Die Pfalz und Württemberg hatten gegen die korporativen Privilegien der Reichsritter seit dem späten 16. Jahrhundert protestiert. In beiden Territorien hatte das »Ausscheiden« der Ritter im Spätmittelalter zu zersplitterten Ländereien mit zahlreichen Enklaven geführt. Das Ziel, sie zu konsolidieren, abzurunden und zu rationalisieren, hatte unausweichlich Konflikte mit den Rittern zur Folge. Die Kernthemen waren die Ausnahme der Ritter von Quartierpflichten und Reichssteuern sowie Beschränkungen beim Erwerb von Land, das Rittern gehörte, die dazu führten, dass Fürsten praktisch kein Land kaufen konnten, das auf irgendeinen ritterlichen Kanton eingetragen war. Die Bestätigung und Ausweitung dieser Privilegien durch Karl VI. brachte diese Themen während der Diskussion der Wahlkapitulationen in den 1740er Jahren auf die Tagesordnung und schon 1741 deutete Friedrich der Große an, sich an die Seite der Fürsten zu stellen. Das Ende vom Lied war, dass eine Reihe kleinerer Probleme zu einer lautstarken Kampagne im Reichstag für die endgültige Annullierung der Rechte der ritterlichen Korporationen führte. Der Zeitpunkt schien gekommen, als Württemberg die Verabschiedung eines Reichsgesetzes, eines normativum imperii, forderte, das alle korporativen Privilegien der Ritter annullierte. Obwohl die Maßnahme viel
42. Die Rückkehr der Habsburger: Franz I. (1745–1765)
Unterstützung fand, tat sich indes nichts. Mainz verzögerte die Anhörung des württembergischen Antrags bis Juni 1752. Franz erklärte, er werde keine Maßnahme ratifizieren, die die Rechte der weniger mächtigen Stände beeinträchtigte. Eine von Wien gestartete diplomatische Offensive sorgte für aufkeimende Zweifel bezüglich der württembergischen Klage und Karl Eugen von Württemberg tat sich keinen Gefallen, als er direkt zu handeln drohte. Als die Angelegenheit schließlich im Juli 1753 diskutiert wurde, einigte man sich, sie an den Kaiser und den Reichshofrat weiterzureichen. Württemberg musste 1754 mit den Rittern einen Kompromiss schließen; endgültig beigelegt wurde der Streit jedoch erst 1770. Die Schwachen zu beschützen, war eine der traditionellen Aufgaben der Krone und die Quelle ihrer fortdauernden Stärke. Obwohl sie keine wirkliche Macht hatten, waren Reichsstädte und -ritter von entscheidender wirtschaftlicher und politischer Bedeutung. Andere Gruppen wie die Reichsgrafen und Äbte waren ebenso loyal. Die Masse der niederen Lehen, weltlich wie christlich, die am Reichshofrat erneuert wurden, scheint vom »Streik« der Inhaber großer Kronlehen nicht betroffen gewesen zu sein. 53 Dasselbe gilt für die Verbindungen zwischen der Krone und den Repräsentanten der Reichskirche. Die kirchlichen Fürsten und Grundherren blieben der Tradition treu, als die weltlichen Kurfürsten und Fürsten sich weigerten, die üblichen Huldigungen zu erweisen und ihre Lehnseide zu erneuern. Das Verhalten von Clemens August von Köln zeigte jedoch, welchen Schaden ein widerspenstiger Inhaber mehrerer Pfründe anrichten konnte: Er allein brachte eine Kurwürde, vier Bistümer und eine Reihe weiterer Pfründe mit unterschiedlichen Graden der Repräsentation im Reichstag in Opposition. Kein Wunder also, dass die Aufmerksamkeit wieder der Sicherung günstiger Ergebnisse bei kirchlichen Wahlen galt. 54 In den 1750er Jahren sahen die bis dahin dominierenden Wittelsbacher ihren Kandidaten immer häufiger habsburgischen Nominierungen gegenüber, etwa Raymund Anton Graf von Strasoldo, der nach sechs Wahlrunden 1757 in Eichstätt gewählt wurde. 55 1761 wurde der habsburgische Kandidat Max Friedrich von Königsegg-Rotenfels Nachfolger des Wittelsbachers Clemens August als Kurfürst von Köln. 56 Damit bereitete Franz Stephan einem späten Aufschwung der habsburgischen Kirchenpolitik den Weg, der möglich wurde, als seine eigenen Kinder groß genug waren, um für solche Posten zu kandidieren. Bei allem Bemühen um die Wiederherstellung der Position der Krone im Reich gelang es Franz I. jedoch nicht, die juristische Schlüsselrolle einzunehmen, die das entscheidende Merkmal des kaiserlichen Wiedererstarkens nach 1648 gewesen war. Das lag nicht an mangelndem Bewusstsein. 57 Innerhalb eines Monats nach seiner Krönung erließ Franz ein Dekret, indem er erklärte, das Reichskammergericht reformieren zu wollen. Colloredo drängte den Kaiser 1746 und, gemeinsam mit Khevenhüller und Kaunitz, 1749, sich um die Verwaltung von Reichskammer-
447
448
IV. · Das Reich von Karl VII. bis Leopold II. (ca. 1740–1792)
gericht und Reichshofrat zu kümmern. Unter dem vom Kaiser nominierten Präsidenten Graf Philipp von Hohenlohe-Bartenstein litt das Reichskammergericht jedoch unter einer korrupten Führung, während der Reichshofrat gleichzeitig in Arbeit förmlich erstickte, weil es nicht gelang, genügend Richter zu ernennen. Die Gründe hierfür sind unklar, aber die Konsequenzen für das Ansehen beider Gerichte und des Kaisers waren beträchtlich. Die sehr realen Probleme an den zwei höchsten Gerichten gab jenen, die Schwierigkeiten machen wollten, Gelegenheit dazu. Wie zu Beginn des Jahrhunderts wurde das Problem direkter Appelle an das Corpus Evangelicorum und den Reichstag akut, ebenso wie das der zunehmenden Häufigkeit von Fällen, in denen Fürsten und andere das Heft des Handelns mit oder ohne legale Grundlage direkt in die Hand nahmen. Manchen gefielen die Urteile nicht, die gefällt wurden. Andere wollten keine ungünstige Entscheidung riskieren. Wieder andere waren frustriert, weil Entscheidungen zu ihren Gunsten nicht umgesetzt wurden. Viele Probleme dienten lediglich als Vorwand für politischen Protest und direktes Handeln. Das unterstrich jedoch nur den von einigen ausgenutzten und von anderen gefürchteten Eindruck, dass das Reich nicht zu bändigen war und der Kaiser keine Kontrolle darüber hatte. Die traditionelle Sicht von Franz’ Herrschaft als gescheitert und enttäuschend berücksichtigt kaum die persönlichen Handicaps, mit denen er sich abmühte. Er war ein niederer Fürst ohne eigenes Vermögen und territoriale Autorität, verheiratet mit einer starken Herrscherin, die unbedingt Schlesien zurückgewinnen wollte und entschlossen war, dafür notfalls ganz Europa umzubauen. Dennoch erreichte Franz eine Menge. Er trug enorm zur Sanierung der österreichischen Finanzen nach den beiden ersten Schlesischen Kriegen und dem Siebenjährigen Krieg bei. Es gelang ihm nicht, die Währung des Reichs zu reformieren, aber seine Währungsreformen in Österreich waren sehr effektiv. 58 Darüber hinaus war er ein Finanzgenie und häufte ein gewaltiges Vermögen für das Haus Habsburg-Lothringen an. 59 Im Reich konnte er nie die Position erlangen, die Leopold I. oder selbst Karl VI. innegehabt hatte. Die Herrschaft Karls VII. hatte das Reich verändert. Dennoch bereitete er der Erneuerung der habsburgischen Herrschaft und den Reformversuchen der Zeit nach 1765 den Boden. Nicht das geringste seiner Verdienste war die Sicherung der Wahl seines Sohnes Joseph zu seinem Nachfolger. 60
Anmerkungen 1 2 3 4
Zitiert nach Aretin, Altes Reich III, 33. Ebd., 21 f. Vgl. S. 93, 176 f., 436. Meisenburg, Reichstag, 105 f.; Ostfriesland blieb Reichsgrafschaft, gehörte aber als gefürstete Grafschaft ab 1677 dem Fürstenkollegium an und wurde seither meist als Fürstentum behandelt; vgl. Köbler, Lexikon, 508.
42. Die Rückkehr der Habsburger: Franz I. (1745–1765)
5 6 7 8
9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
34 35 36 37 38
Meisenburg, Reichstag, 95 ff. Aretin, Altes Reich III, 59 f.; Zedinger, Franz Stephan, 199. Hochedlinger, Wars, 267–271. Das Directorium wurde 1761/62 durch die vereinte österreichische und böhmische Kanzlei ersetzt, die für die lokale Verwaltung zuständig war, jedoch nicht für die Finanzen; diese blieben der Hofkammer vorbehalten, deren Bedeutung und Macht nach einigen Schwierigkeiten zu Beginn des Jahrhunderts nach 1740 zunahmen; vgl. Dickson, Finance II, 1. Zedinger, Franz Stephan, 188 ff. Das besser bekannte k. u. k. entstand, nachdem die Anerkennung des Ausgleichs von 1867 Ungarn denselben legalen Status wie Österreich verliehen hatte; fortan bezog sich k. k. auf Österreich, königlich auf Ungarn und k. u. k. auf jene Institutionen, die für beide zuständig waren. Benna, »Durchlaucht«, 15 f. Kulenkampff, Österreich, 18–22, 68–73; Quarthal, »Vorderösterreich«, 47–52; Press, »Schwaben«, 69–73. Kulenkampff, Österreich, 41 f. Aretin, Altes Reich III, 30 f. Hochedlinger, Wars, 271. Schmid, »Vermittlungsbemühungen«, 189. Vgl. zum Folgenden: Press, »Friedrich«; Haug-Moritz, »Friedrich«; Wilson, »Prussia’s relations«. Ebd., 344. Duchhardt, Kaisertum, 284–295. Wilson, »Prussia’s relations«, 352 f. Vgl. zum Folgenden: Haug-Moritz, »Kaisertum«; Haug-Moritz, »Corpus Evangelicorum«; Stievermann, »Politik«; Carl, »Konfession«. Vgl. S. 371–378. Luh, Reich, 60 f.; Arndt, Reichsgrafenkollegium, 69. Schäfer, Simultaneum, 9–28, 40–43, 85–106; Haug-Moritz, Ständekonflikt, 172–214; Stievermann, »Politik«. Luh, Reich, 62 f. Haug-Moritz, Ständekonflikt, 138–198. Carl, »Konfession«, 114–122. Stievermann, »Politik«, 194. Haug-Moritz, Ständekonflikt, 155. Pelizaeus, Aufstieg (passim). Gotthard, Säulen, 749 (Anm. 88). Hennings, Franz Stephan; Schreiber, Franz I. Stephan; Zedinger, Franz Stephan. Schmid, »Vermittlungsbemühungen«, 171–174; Schmid, »Kaiser Franz«; Schmid, »Franz I.«; Zedinger, Franz Stephan (passim); Gnant, »Franz Stephan«; vgl. auch Aretins Kommentar zur Historiografie in Altes Reich III, 536 f., auch wenn Aretin ebenfalls der Meinung ist, Franz I. sei zumindest teilweise mangels Willen und Tatkraft gescheitert. Meisenburg, Reichstag, 83–93. Kulenkampff, Österreich, 15–25; Aretin, Altes Reich III, 34–39. Aretin, Altes Reich III, 42–45. Horn, »Origins«; Aretin, Altes Reich III, 45–48. Kulenkampff, Österreich, 28–31, 52–55.
449
450
IV. · Das Reich von Karl VII. bis Leopold II. (ca. 1740–1792)
39 Schmid, »Franz. I«, 244. 40 Vgl. zum Folgenden Noël, »Reichsbelehnungen«, insb. die Tafel auf S. 120; vgl. auch S. 428 f. 41 Die Zeremonien beschreibt Schreiber, Franz Stephan, 240 f.; vgl. zur schwedischen Erneuerung Moser, Neues Teutsches Staatsrecht IX, 893 f. 42 Dies folgte der Verleihung des Titels König von Jerusalem durch die französische Krone an Herzog Leopold von Lothringen zu seiner Heirat mit Mademoiselle de Chartres, der Tochter von Philippe von Orleans und Liselotte von der Pfalz; vgl. Benna, »Durchlaucht«, 12 f., 16–28. 43 Meisenburg, Reichstag, 93 ff. 44 Ebd., 101–105. 45 Kulenkampff, Österreich, 37–40; Meisenburg, Reichstag, 105 f.; vgl. auch S. 93, 176 f., 436. 46 Aretin, Altes Reich III, 57 f. 47 Grillmeyer, Habsburgs Diener, 141–156. 48 Ebd., 51–61; Grillmeyer, »Habsburgs langer Arm«, 63–66. 49 Schmid, »Franz I.«, 237. 50 Ramcke, Beziehungen, 151–166; Whaley, Toleration, 183 f. 51 Berbig, »Kaisertum«, 268 f. 52 Vgl. zum Folgenden Haug-Moritz, »Organisation«, 16–20; Sutter, »Reichsritterschaft«, 297 ff.; Aretin, Altes Reich III, 53–57, 542 f.; Willoweit, Rechtsgrundlagen, 322–338. 53 Noël, »Reichsbelehnungen«, 119 f. 54 Schmid, »Franz I.«, 243 f. 55 Gatz, Bischöfe 1648–1806, 493 ff.; Strasoldo (1757–1781) stammte aus Graz und wurde am Kaiserhof in Wien ausgebildet; sein Vorgänger Johann Anton II. von Freyberg (1736– 1757) hatte sich als Kandidat Karls VI. gegen Marquard Wilhelm von Schönborn durchgesetzt. 56 Gatz, Bischöfe 1648–1806, 129–130. 57 Aretin, Altes Reich III, 26, 33, 49, 59–63; Gnant, »Franz Stephan«, 127. 58 Dickson, Finance II, 34, 370; Mikoletzky, »Franz Stephan«. 59 Mikoletzky, Familienvermögens. 60 Liebel, »Election«; Gnant, »Franz Stephan«, 182.
43. Das Reich ohne Gegner? Deutschland und Europa (1763–1792)
V
om späten 15. bis Mitte des 18. Jahrhunderts war das Reich geprägt durch die Notwendigkeit, sich gegen äußere Feinde zu verteidigen. Frankreich im Westen und die Osmanen im Osten hatten es wiederholt gezwungen, gegen sie mobilzumachen, und so zur Herausbildung vieler wichtiger Institutionen beigetragen. Damit hatten sie auch für ein Gefühl der Solidarität und gemeinsamen Identität gesorgt, das immer wieder religiöse und politische Gräben überwinden half. 1 Nach der Mitte des 18. Jahrhunderts war dies nicht mehr der Fall. Der Friede von Hubertusburg (1763) markierte das Ende einer langwierigen Entwicklung. Beschleunigte das Fehlen äußerer Feinde auch den Untergang des Reichs? Traten mit der Entstehung des österreichisch-preußischen Dualismus zwei innere Feinde auf den Plan, deren wahres Ziel es war, sich gegenseitig und damit schrittweise auch das Reich zu zerstören? Ausmaß und Beständigkeit der österreichisch-preußischen Feindschaft sind nicht zu bezweifeln. Schwieriger zu beantworten ist die Frage ihrer Folgen für das Reich. Generationen von Historikern sahen in dem Dualismus den Anfang vom Ende. Selbst Karl Otmar von Aretin, der seit den 1960er Jahren mehr als andere zur Erforschung des Reichs beigetragen hat und dessen zwei monumentale Werke dazu, in den 1960er und 1990er Jahren erschienen, die vielleicht detaillierteste Darstellung der späteren Reichsgeschichte überhaupt bieten, übernimmt im Wesentlichen die alte Version. 2 Dasselbe gilt für andere Zusammenfassungen der Forschungen der letzten fünfzig Jahre. 3 Selbst neuere revisionistische Werke, etwa Georg Schmidts Geschichte des Reichs als »Staat und Nation« in der Frühmoderne (1999) folgen der alten Erzählstruktur bis zu einem gewissen Grad. 4 Das Argument, das Reich habe keine Zukunft gehabt, das die deutsche Historiografie ab dem frühen 19. Jahrhundert geprägt hat, ist grundsätzlich hypothetisch. Das Ende des Reichs 1806 kam anders zustande. Wie sehr es durch die Entwicklungen des vorangegangenen halben Jahrhunderts geschwächt war und wie die Geschichte ohne Napoleons Eingreifen verlaufen wäre, ist unwägbar. Nicht alle Belege weisen in ein und dieselbe Richtung. Der Friede von Hubertusburg markiert die Wasserscheide zwischen zwei europäischen Systemen. Die frühen Jahrzehnte des 18. Jahrhunderts waren gekennzeichnet durch die Feindseligkeiten der drei Hauptmächte (Großbritannien, Niederlande und Österreich) gegen Frankreich. Später koexistierten fünf »Großmäch-
452
IV. · Das Reich von Karl VII. bis Leopold II. (ca. 1740–1792)
te« (Frankreich, Großbritannien, Österreich, Preußen und Russland) in einem oft fließenden, instabilen System, das viele zeitgenössische Betrachter als »Gleichgewicht der Mächte« betrachteten. Dieses System wirkte eher wie ein Club widerstreitender, aber voneinander abhängiger Mitglieder, bestimmt von einigen einfachen Regeln: Ein Staat muss für Zugewinne eines anderen entschädigt werden, die Kosten eines Krieges bezahlt der Feind oder ein Verbündeter, Bündnisse sind für jeden Staat lebenswichtig, allerdings schreibt die Notwendigkeit, den Wohlstand des Staats zu sichern, Flexibilität und kurzfristige Abkommen vor. 5 Rationale Berechnung genoss Vorrang vor dem Respekt vor Traditionen, Pläne zur Neuordnung Europas durch die Großmächte griffen um sich. Der wichtigste Moment im Übergang von einem System zum anderen war die Gründung der französisch-österreichischen Allianz 1756. Einige der wichtigsten während des folgenden Konflikts gebildeten Bündnisse brachen jedoch schon vor dem Friedensschluss zusammen: Österreich und Russland, Frankreich und Russland, Großbritannien und Preußen beendeten den Krieg nicht als Partner. 6 Nur die französisch-österreichische Allianz überlebte, ihre Bedeutung schwand jedoch nach 1763. Der Krieg hatte alle Mächte erschöpft; man konzentrierte sich nun auf inneren Wiederaufbau sowie auf Reformen und hielt sich mit neuen militärischen Konflikten zurück. Keine der europäischen Großmächte hatte ein Interesse, Österreich oder Preußen zu begünstigen – Bündnisse mit ihnen waren daher im Allgemeinen defensiv und halbherzig und zahlten sich oft nicht aus, wenn es um die Unterstützung spezifischer Initiativen ging, die ihre Macht vergrößert hätte. Niemand hatte das geringste Interesse an einem vierten schlesischen Krieg. Das Reich selbst konnte keinen Krieg erklären, weil die Reichsarmee nicht außerhalb der Grenzen operieren durfte. Daher waren Rousseau und Mably im Recht: Das Reich stabilisierte sich und bildete das Zentrum der europäischen Ordnung. In der unmittelbaren Nachkriegszeit mussten sich Herrscher und ihre Berater in einer Weise neu orientieren, die das Reich direkt betraf. Die auffälligste Änderung war, dass Frankreich nun keine aktive Rolle in der deutschen Politik mehr spielte, weil es zunehmend von schweren ökonomischen, fiskalischen und politischen Problemen geplagt und durch die anhaltenden Konflikte mit Großbritannien in Nordamerika abgelenkt war. Diesen Trend verstärkte das Scheitern Frankreichs und Österreichs, die polnische Königswahl 1764 zugunsten eines weiteren sächsischen Prinzen zu beeinflussen. 7 Auch die Versuche, die Osmanen nach 1766 zu einer Kriegserklärung gegen Russland zu bewegen, führten zu nichts. Die französische Allianz mit Österreich blieb mangels Alternative bis 1792 in Kraft, im Wesentlichen jedoch passiv. Während Vergennes’ Zeit als Außenminister (1774–1787) wurde sie praktisch zum Mittel »gegenseitiger Eindämmung«. 8 Frankreich hegte keine auf Deutschland gerichteten expansionistischen Bestrebungen
43. Das Reich ohne Gegner? Deutschland und Europa (1763–1792)
mehr. Lothringen fiel 1766 nach dem Tod von Stanislaus Leszczynski an Frankreich, wie im Wiener Vorfrieden von 1735 vorgesehen. Im Übrigen gab sich Frankreich damit zufrieden, eine Reihe von Austauschvereinbarungen mit benachbarten deutschen Territorien zu schließen, um Grenzen zu begradigen und die Anzahl der Exklaven auf beiden Seiten zu verringern. 9 Für das Reich insgesamt bedeutete dies das Verschwinden des traditionellen »Beschützers und Organisators der deutschen Opposition« gegen Habsburg und die Neutralisierung von Frankreichs Status als Garant (mit Schweden) des Westfälischen Friedens, der seit 1648 wiederholt als Rechtfertigung für französische Eingriffe im Reich gedient hatte. 10 Für viele deutsche Territorien fielen dadurch zudem französische Subventionen weg, mit denen Streitkräfte und einiges andere finanziert worden waren. An Kontakten zu und tatsächlichen oder geplanten Subsidien an Zweibrücken, Pfalz und rheinländische Kurfürsten war Paris weiterhin interessiert, um so etwas wie eine von Frankreich abhängige »dritte Partei« zu erhalten, aber diese Aktivitäten erreichten nicht mehr das frühere Ausmaß. 11 Andererseits blieb das französische Interesse am Reich aktuell. Systematisch blockierte Frankreich habsburgische Kandidaten bei Kirchenwahlen und jeden Versuch der Habsburger, sich Bayern anzueignen. Trotz der fortdauernden Allianz mit Österreich unterstützte es zudem vor allem in den 1780er Jahren insgeheim die antikaiserlichen und antiösterreichischen Aktivitäten Friedrichs des Großen. 12 So trug Frankreich dazu bei, dass Preußen die Rolle des Hauptwidersachers des Kaisers übernahm, die es einst selbst gespielt hatte. Auch Großbritannien schraubte seine Aktivitäten im Reich nach 1763 zurück. Nach Siegen an zahlreichen Fronten im Siebenjährigen Krieg konzentrierte sich die Politik unter Georg III. ab 1761 auf Nordamerika. Versuche, nach 1763 mit Russland und Österreich Bündnisse zu schließen, verliefen im Sand. Großbritannien blieb in der europäischen Politik zwei Jahrzehnte lang isoliert und suchte erst nach dem katastrophalen Ende des amerikanischen Unabhängigkeitskriegs mit dem Pariser Frieden von 1783 wieder europäische Bündnispartner. 13 Was Hannover betraf, blieb die Londoner Regierung politisch neutral. Die aktive Rolle im Reich, die Georg I. und Georg II. gespielt und damit Großbritannien-Hannover zum Gegengewicht Preußens gemacht hatten, übernahm Georg III. nicht. Die Beziehungen zu den drei rheinländischen Kirchenfürsten blieben wichtig, wenn auch nur, um französische Bestrebungen zu durchkreuzen. Hierbei kam es zu einer begrenzten Zusammenarbeit mit Großbritanniens früherem Verbündeten, den Niederlanden, die jedoch ihre neutrale Politik der 1740er Jahre fortsetzten und nicht als Großmacht zählen konnten. Diese Aktivitäten führten jedoch nicht zur Schaffung einer von Großbritannien abhängigen »freien deutschen Partei« als Gegengewicht gegen die gleichzeitigen Bestrebungen der Franzosen beziehungsweise österreichische und preußische
453
454
IV. · Das Reich von Karl VII. bis Leopold II. (ca. 1740–1792)
Einflüsse. Britische Subsidien spielten in Territorien wie Hessen-Kassel, die Truppen für den Dienst in Amerika bereitstellten, weiterhin eine Rolle.14 Aber die Kontrolle über die Politik im Kurfürstentum Hannover verschob sich zu den adligen lokalen Administratoren und Regenten. Ihr Hauptziel war die Verteidigung der Unabhängigkeit des Kurfürstentums und seiner Vorrechte gegen Österreich und Preußen. Im Reich allgemein neigten die Regenten von Hannover ebenfalls dazu, die kirchlichen Territorien gegen eine Monopolisierung durch Österreich und preußische Säkularisierungsbestrebungen zu verteidigen. Schließlich waren deren Herrscher wie Reichsritter und andere kleinere Reichsstände in gewissem Sinn Symbole des Status quo im Reich. Ansonsten hatten die Regenten keinerlei Absicht, eine heroische Rolle zu spielen, aber ihr Bemühen um den Status quo ließ sie gegenüber der Politik Josephs II. in den 1770er Jahren misstrauisch werden und trieb ihren Reichstagsabgeordneten Baron Ompteda so weit auf die Seite Preußens, dass Österreich offiziell bei Georg III. protestierte. 15 Erst die Krise der frühen 1780er Jahre führte Großbritannien-Hannover wieder aus der Isolation; Georg III. lehnte es jedoch ab, den Fürstenbund anzuführen, was in frühen Diskussionen 1782 und 1783 vorgeschlagen worden war. 16 Im Allgemeinen wurde Großbritannien wie Frankreich nur aktiv, wenn Österreich wieder einmal die Oberhand im Reich zu erlangen drohte. Der relativen Passivität Frankreichs und Großbritanniens im Westen standen der Aufstieg Russlands zur Großmacht im Osten und die wachsende Bedeutung der Beziehungen zwischen Russland, Österreich und Preußen entgegen. Russlands Rolle im Siebenjährigen Krieg hatte es als starke Kraft etabliert, die ein wachsendes Interesse an deutschen Belangen an den Tag legte. Dies wurde bis zu einem gewissen Grad durch die innere Unsicherheit nach dem Tod von Elisabeth und während der kurzen Herrschaft Peters III. gedämpft. Katharinas Bemühen war anfangs in erster Linie auf Konsolidierung gerichtet und so bildete die Überzeugung, entscheidend sei eine lange Epoche des Friedens, mehr als ein Jahrzehnt lang die Leitlinie der russischen Politik. Der Architekt der russischen Politik war Nikita Panin, dessen »nordischer Akkord« ein umfassendes Geflecht von Allianzen mit Preußen, Dänemark und Großbritannien vorsah, mit Schweden, Polen und Sachsen als angeschlossenen Mitgliedern mit garantierter Neutralität. 17 Zustande kamen jedoch nur Bündnisse mit Preußen und Dänemark. Vor allem Ersteres betrachtete man als entscheidend, um Frankreichs traditionelle Barriere im Osten zu brechen, die Schweden, Polen und das Osmanische Reich umfasste. Preußen konnte jedoch nicht viel tun, um Russland im Süden strategisch und im Hinblick auf seine potenzielle Verwundbarkeit an der Grenze zum Osmanischen Reich beizustehen. So wuchs die russische Beteiligung im Reich und gipfelte im Abkommen von Teschen (1779), das Russland in
43. Das Reich ohne Gegner? Deutschland und Europa (1763–1792)
gewisser Weise indirekt zur Garantiemacht des Westfälischen Friedens machte. Andererseits erwies sich Russlands Bemühen in den frühen 1780er Jahren, gemeinsam mit Österreich Nutzen aus dieser Position zu ziehen, als kontraproduktiv. 18 Anfangs profitierte Preußen am meisten von den russischen Interessen im Reich. Friedrich dem Großen kamen sie sehr gelegen. Am Ende der Feindseligkeiten 1763 war der fünfzigjährige »Alte Fritz« erschöpft, seine Ländereien am Rand des Ruins und in mancherlei Hinsicht strategisch ebenso verwundbar wie vor 1756. 19 Friedrich hatte gute Gründe, in seinem zweiten politischen Testament von 1786 an Preußens Großmachtstatus zu zweifeln, und noch in den Jahren vor seinem Tod 1786 stellte er die Fähigkeit seiner Nachfolger infrage, diesen zu erhalten. Was Land, Bevölkerung und Ressourcen anging, war Preußen weit weniger sicher als andere Großmächte. Darüber hinaus hatte der Siebenjährige Krieg gezeigt, wie sehr Preußen international und im Reich isoliert war. Der Erhalt der Kontrolle über Schlesien bereitete Sorgen, und auch wenn eine Übernahme Sachsens nicht mehr möglich erschien, blieb es doch ein wichtiges Ziel, Sachsen zu isolieren und es durch die Wiederaufnahme des Zollkriegs, den Preußen seit den 1740er Jahren gegen Dresden geführt hatte, zu schwächen. 20 Preußens militärische Stärke stand auf tönernen Füßen. Friedrich der Große wusste, wovon er sprach, als er scherzte, statt eines Adlers sollte besser ein Affe das preußische Wappen zieren, weil man kaum mehr tat, als andere Großmächte nachzuäffen. 21 Eine Lösung für die aus der potenziellen Schwäche Preußens erwachsenden Probleme wurde auf mehreren Ebenen gesucht. Ein Kernziel blieb die kontinuierliche Entwicklung der Armee, aber sie allein konnte keine Sicherheit garantieren, deshalb suchte man einen großen internationalen Partner und beteiligte sich daneben aktiv an der Politik im Reich selbst. Das Verhältnis zu Großbritannien hatte sich durch den Zusammenbruch des Subsidienabkommens 1762 verschlechtert. Eine Verständigung mit Österreich erwies sich als aussichtslos. Somit blieb nur Russland als Bündnispartner. Im Reich zeigte Friedrich zunehmend aktives Interesse an der Dynastiepolitik zahlreicher kleiner Territorien, insbesondere jener, mit denen er familiär verbunden war. Wichtig war ihm vor allem der erbliche Erwerb der Markgrafschaften Ansbach und Bayreuth von Hohenzollernverwandten, deren Linien nach 1763 erlöschen würden. 22 Zudem nutzte er den Umstand, dass Preußen wegen seiner zersplitterten Territorien in drei Kreisen vertreten war. Und schließlich weitete er seine Rolle als De-facto-Führer der deutschen Protestanten im Corpus Evangelicorum aus, in dem er nun in Großbritannien-Hannover keinen Konkurrenten mehr hatte. In Reaktion auf die Politik Josephs II. gelang es ihm, sich von den späten 1770er Jahren an als Verteidiger der Reichsverfassung darzustellen.
455
456
IV. · Das Reich von Karl VII. bis Leopold II. (ca. 1740–1792)
Österreichs Position war in vielerlei Hinsicht ebenso heikel wie die preußische. Wien verfügte über mehr Ressourcen, die aber oft nicht leicht zu mobilisieren waren, weil dazu Verhandlungen mit den Ständen der diversen Territorien der Monarchie geführt werden mussten. Das Bündnis mit Frankreich blieb in Kraft, war jedoch im Grunde defensiv ausgerichtet und angesichts der geringen Ambitionen der Franzosen in der deutschen Politik und ihrer Tendenz zur Zusammenarbeit mit rheinländischen Territorien und später mit Preußen gegen Österreich im Reich wenig belastbar. Eine Wiederkehr des »alten System« war unmöglich, solange die Allianz mit Frankreich bestand. Die defensiven Interessen der Briten in Hannover machten sie letztlich zum stillen Teilhaber Frankreichs bei dessen Bemühungen, österreichische Anläufe zur Ausweitung der habsburgischen Macht im Reich zu unterbinden. Eine Allianz mit Russland kam wegen dessen Abkommen mit Preußen von 1764 nicht infrage. Das änderte sich erst um 1780, als es zu einer österreichisch-russischen Wiederannäherung kam, die durch die Erneuerung der preußischen Beziehungen zu Großbritannien und Frankreich ausgeglichen wurde. 23 Mehr als je zuvor begannen die treibenden Kräfte der österreichischen Politik nach 1763 die Vorzüge einer weiteren Beteiligung am Reich abzuwägen. Gleichzeitig setzten sie auf Optionen, die letztlich unvereinbar, wenn nicht gänzlich gegensätzlich waren. Einerseits gab es wiederholte Versuche, die Stellung der kaiserlichen Krone wieder geltend zu machen und sogar eine substanzielle Reform des Reichs in Angriff zu nehmen. Andererseits führte die Suche nach territorialem Ausgleich für den Verlust von Schlesien stets zurück ins Reich und dort vor allem zu Plänen zur teilweisen oder vollständigen Übernahme von Bayern. Das ließ Österreich noch unverfrorener räuberisch als Preußen erscheinen und machte es unerlässlich, dass sich die Reichsstände vereinten, um sich und das Reich zu verteidigen. Dass die Österreichische Politik vor allem zwischen 1765 und 1780 oft inkohärent und unentschlossen wirkte, lag teilweise am komplizierten Verhältnis zwischen Maria Theresia (Herrscherin der habsburgischen Länder), Joseph II. (Mitregent der habsburgischen Länder und heilig-römischer Kaiser) und Wenzel Anton von Kaunitz (Staatskanzler der österreichischen Territorien mit Ausnahme von Böhmen). 24 Zweifellos lag ihnen allen die Förderung der habsburgischen Monarchie am Herzen, dennoch stritten sie häufig und heftig, wie dies zu erreichen sei. Zumindest bis 1780 war es am Ende Kaunitz, der sich meistens durchsetzte und dessen Strategien aber wiederum des Öfteren im Widerspruch zu Gesetzen und Bräuchen des Reichs standen, während Joseph sich redlich bemühte, seine Position als Kaiser zu behaupten. 25 In diesem wirren Gestrüpp von Interessen und Allianzen, in dem Österreich und Preußen territoriale Zugewinne anstrebten, erschienen die kleineren Territorien zunehmend verwundbar. Manche verloren Subsidien, andere befürchteten
43. Das Reich ohne Gegner? Deutschland und Europa (1763–1792)
den Wegfall des kaiserlichen Schutzes oder fühlten sich durch den habsburgischen Expansionismus bedroht. Wieder anderen war Preußens Nähe unbehaglich. Zweifellos vertiefte sich der Graben zwischen den beiden größten Territorien und dem Rest beträchtlich. Sie allein waren nun in der Lage, bedeutendes militärisches Potenzial zu entwickeln. Ihre Konzentration auf die Entwicklung dieses militärischen Potenzials wurde wiederum zur treibenden Kraft hinter inneren Reformen, die sie ebenfalls weiter von den kleineren Territorien absetzten. Die Zeiten, in denen ein Bischof von Münster glaubwürdig als Kriegsherr auftreten konnte, waren vorbei. 26 Indes fanden viele Wege, sich in der neuen Situation zurechtzufinden, was zu ungewöhnlichen neuen Kombinationen führte. In Teilen Süddeutschlands, insbesondere in Bayern, wurde Friedrich der Große zu einer Art Idol, das in Gedichten und volkstümlichen Drucken und Bildern gefeiert wurde. 27 In Teilen des Nordens entdeckten Orte wie Hamburg eine neue Verbundenheit mit Österreich und dem Reich. 28 Die Landschaft veränderte sich, die Regeln der Reichspolitik nicht. Bei allem Zynismus Friedrichs des Großen über das Reich blieb sein Abgeordneter Erich Christoph von Plotho (* 1707, † 1788) doch auch nach 1763 im Reichstag und wurde ersetzt, als er 1766 in Ruhestand ging. Friedrich und sein Minister Ewald Friedrich von Hertzberg (* 1725, † 1795) entwickelten fortlaufend neue Pläne zur Expansion mittels Tausch oder Kompensation, die jedoch zu nichts führten, manchmal wegen Behinderungen aus Wien, manchmal, weil der Moment, auf den sie ausgerichtet waren, zu schnell verstrich, manchmal, weil sie schlicht zu fantastisch waren, um ernsthaft in Betracht gezogen zu werden. Nach Friedrichs Tod wurden Hertzbergs Pläne sogar noch grandioser. Sein plan de pacification von 1787 sah gleichzeitige Annexionen und Kompensationen durch und für Preußen, Österreich und Russland auf Kosten des Reichs, Polens und des Osmanischen Reichs vor. 29 Ebenso verfolgten auch Franz I. und Joseph II. Pläne zum Austausch von Territorien. In gewissen Maß trieb sie dabei der Wunsch nach Kompensation für den demütigenden Verlust von Schlesien, aber auch nach Konsolidierung und Ausdehnung der habsburgischen Kernländer. Das beständigste Objekt ihrer Begierde war Bayern, auf das sich seit 1680 diverse Pläne der Habsburger richteten. 30 Die österreichische Besetzung Bayerns während des Spanischen Erbfolgekriegs (1704– 1715) und erneut unter der Herrschaft von Karl VII. (1742–1745) hielt diese Ideen am Leben. 31 An verschiedenen Punkten, als eine Konfiszierung oder Annexion nicht infrage kam, erwog man einen Tausch Bayerns, zusammen mit dem Versprechen einer Königskrone für andere, weiter entlegene habsburgische Territorien. Solche Pläne wurden ab den 1760er Jahren plausibler, da klar wurde, dass der bayerische Kurfürst keinen direkten Erben hinterlassen würde, ebenso wie sein nächster männlicher Verwandter, der pfälzische Kurfürst. Unter diesen Umstän-
457
458
IV. · Das Reich von Karl VII. bis Leopold II. (ca. 1740–1792)
den war es nur logisch, Bayern als heimgefallenes Lehen zu betrachten und für die Krone zu reklamieren. Ebenso klar war, dass dies nur möglich war, wenn man Preußen ein Kompensationsangebot machte. Die Verknüpfung der österreichischen Ansprüche auf Bayern und der preußischen Ansprüche auf die fränkischen Markgrafschaften Ansbach und Bayreuth schien naheliegend. Als Preußen 1772 einen Handel ablehnte, war das ganze Projekt jedoch mehr oder weniger zum Scheitern verurteilt. 32 Österreichs weitere Versuche, etwas zu unternehmen, führten 1777 ebenso zu nichts wie 1783/84 und 1790–1792 nach dem Tod Josephs II. 33 Das Scheitern der österreichischen Pläne für Bayern unterstreicht einen wesentlichen Punkt. Die niederen Herrscher des Reichs, zeitweise von Frankreich, Großbritannien beziehungsweise Preußen unterstützt, waren wiederholt in der Lage, ernsthafte Brüche des Systems zu verhindern. Es wurde allzu leicht, das Reich gegen etwas zu mobilisieren, was sich als vom Kaiser selbst geführter Anschlag auf die Verfassung darstellte. Preußens Pläne für eine Expansion im Reich waren ebenso aussichtslos, weil auch sie sofort heftigen Widerstand von jenen hervorriefen, die es verteidigen wollten (und numerisch die Mehrheit stellten). Hätte sich Österreich oder Preußen durchgesetzt, wären die Folgen tiefgreifend gewesen. Besaß einer der beiden – oder beide gemeinsam – die Macht, alle anderen Stände im Reich zu überwältigen? Hätte dies das Ende des Reichs in einer Orgie von Annexionen der beiden großen deutschen Mächte und anderer, die sich möglicherweise angeschlossen hätten, bedeutet? Bedeutete die bloße Verfolgung solcher Pläne, dass Österreich und Preußen nicht mehr am Reich interessiert waren? Es entsprach absolut dem Zeitgeist, dass beide Machtpolitik und Reichspolitik zugleich betrieben, Letztere mit etwas mehr Erfolg. In Österreich hatte die Verquickung von Reichspolitik und Hausmachtpolitik eine lange Tradition. BrandenburgPreußen war spät dran, lernte aber schnell. Die Wechselwirkung zwischen den Großmächten mit ihren diversen Interessen, soweit sie das Reich betrafen, lässt sich am besten in einem kurzen Überblick über die wesentlichen Phasen aufzeigen. Nach 1764 ergriff Preußen die Initiative, als Friedrich der Große Zarin Katharina zu einem Bündnis überredete. 34 Friedrich hatte klugerweise nahegelegt, die Alternative könne eine preußische Allianz mit den Osmanen sein. Ein unmittelbareres gemeinsames Interesse Preußens und Russlands war die Thronvakanz in Polen nach dem Tod von August III. Die Diskussion dieses Themas half die Allianz zu besiegeln und den von Russland bevorzugten Kandidaten (Stanislaus Poniatowski, einen von Katharinas ehemaligen Liebhabern) auf den polnischen Thron zu bringen. 35 Als er und seine Unterstützer eine umfassende Reform des polnisch-litauischen Staats in die Wege leiteten, die dessen Abhängigkeit von Russland zu mindern drohte, stand Katharina hinter der konservativen Opposition, ohne jedoch Poniatowskis Absetzung zuzulassen. Das
43. Das Reich ohne Gegner? Deutschland und Europa (1763–1792)
rief eine neue Opposition auf den Plan, die Konföderation von Bar, die sich den Versuchen russischer und polnisch-litauischer Truppen, Poniatowskis Herrschaft aufrechtzuerhalten, heftig widersetzten. Als die Widerständler im Juni 1768 auf osmanisches Gebiet vertrieben wurden, erklärten die Türken Russland den Krieg. Dass es Russland gelang, bis 1771 mit Polen und der türkischen Herausforderung fertigzuwerden, alarmierte Berlin und Wien und verstärkte eine kurze Phase der Wiederannäherung von Österreich und Preußen, die die Krönung Josephs II. zum Kaiser eingeleitet hatte. Während seine Mutter Maria Theresia den »bösen Mann in Sanssouci« verabscheute, hegte Joseph mehr als heimliche Bewunderung für den Erzfeind seiner Dynastie.Vielleicht noch grundlegender war die wachsende Überzeugung Kaunitz’, dass irgendeine Form der Einigung mit Preußen entscheidend war, um Russland in Schach zu halten. 1766 hatte er Friedrichs Vorschlag eines Treffens der beiden Monarchen verschmäht; drei Jahre später indes, im August 1769, kamen Friedrich und Joseph informell im schlesischen Neiße zusammen, eine zweite Begegnung folgte im September 1770 im mährischen Neustadt. Die Treffen blieben ohne konkrete Resultate, ebenso wie eine Vielzahl von Kontakten 1772. Kaunitz präsentierte einen ausgefeilten Vorschlag, der die Rückgabe von Glatz und Teilen Schlesiens vorsah; im Gegenzug sollte Friedrich einen beträchtlichen Teil von Polen erhalten. Friedrich antwortete, er habe vielleicht die Gicht in den Füßen, Wien scheine aber anzunehmen, er habe sie im Kopf. 36 Im September ließ Joseph einen Gesandten das Angebot überbringen, Ansbach und Bayreuth sollten an Preußen und Bayern an Österreich gehen, aber auch daran war der König nicht interessiert. Kaunitz war ebenfalls gegen einen Handel und zog es vor, den König in Preußen aus dem Spiel zu halten.37 Dennoch nahm er offenbar weiterhin am Austausch mit Berlin teil, der sich fruchtlos bis Frühling 1773 fortsetzte. 38 Jeglicher Gedanke an eine österreichisch-preußische Allianz gegen Russland war derweil verflogen und Kaunitz hatte weder Maria Theresia noch Joseph überzeugt, dass Österreich allein gegen Russland Krieg führen sollte. Die Debatte zwischen den Dreien führte nur zur Besetzung von Zips (ungarisch Szepes) mit der Begründung, es sei einst ungarischer Besitz gewesen, der 1412 teilweise an die polnische Krone verpfändet worden sei, und einem halbherzigen Zugeständnis von Subsidien für die Türken gegen Russland. Schließlich aber blieb ihnen keine Wahl, als dem Plan einer Teilung Polens zuzustimmen, den Preußen bereits 1769 vorgelegt hatte. Das Abkommen der drei Mächte im September 1772 sprach Preußen Westpreußen, Österreich Galizien und Russland den Rest des polnischen Livland sowie Gebiete in Weißrussland zu. Polen verlor etwa 30 Prozent seiner Landmasse und 35 Prozent seiner Einwohner. 39 Die Teilung Polens schockierte ganz Europa. Im Reich alarmierte die Teilnahme der zwei führenden deutschen Mächte an dieser bösartigen Verkleinerung eines
459
460
IV. · Das Reich von Karl VII. bis Leopold II. (ca. 1740–1792)
souveränen Staats die meisten anderen Territorien. Die bekannten Spekulationen um die Erbfolge in Bayern und Ansbach-Bayreuth schürten Ängste, das Reich sei als nächstes dran. Im Sommer 1772 hatte der bayerische Kurfürst die Bildung einer Fürstenliga unter dem Schutz Ludwigs XV. vorgeschlagen. Trotz französischem Interesse wurde daraus nichts, aber in den Jahren 1772–1774 näherten sich Sachsen, Bayern, die Pfalz und Zweibrücken an, die das größte materielle Interesse an der bayerischen Frage hatten.40 Allen Befürchtungen und Gerüchten zum Trotz, die an den deutschen Höfen kursierten, wäre ein Abkommen wie das über Polen im deutschen Kontext wohl nicht möglich gewesen. Prinz Heinrich von Preußen schrieb 1777 an Friedrich: »Wenn du, mein lieber Bruder, und der Kaiser es wolltet, ihr würdet Deutschland haben, ehe irgendeiner etwas dagegen tun könnte«. 41 Dem standen zwei Probleme im Weg. Wenn eine der Parteien das Thema einer Aufteilung des Reichs zwischen ihnen angeschnitten hätte, wäre das ein gefundenes Fressen für die Propaganda der anderen gewesen, sie als Verräter hinzustellen. Zweitens hatten die Hauptstreitpunkte im Reich mit Erbfolgen zu tun, die nur relevant wurden, wenn einer der Fürsten tatsächlich starb. Die Herrscher von Ansbach-Bayreuth, der Pfalz und Bayern waren achtunddreißig, siebenundvierzig beziehungsweise fünfzig Jahre alt. Für Preußen war die Erneuerung der russischen Allianz von unmittelbarerer Bedeutung; sie wurde 1769 und 1777 erreicht. Österreich versprach sich mehr davon, weitere Zugewinne von der Türkei anzustreben, die Kaunitz erreichen zu können glaubte, wenn die Türken mit Russland Frieden schlossen. 42 Nach dem drakonischen Frieden von Küçük Kaynarca, der Russland Zugang zum Schwarzen Meer verschaffte, fiel die Bukowina an Österreich. 43 Im Reich wurde derweil die Frage der bayerischen Thronfolge drängender. Im Dezember 1772 hatte Joseph gegen Kaunitz’ Skrupel beschlossen, nach dem Tod des Kurfürsten werde zunächst er selbst Bayern übernehmen und dann mit dem Reichstag über seine Zukunft beraten. Nach außen hin war dieser Vorschlag völlig angemessen; er entsprach dem Reichsrecht und der Tradition. Es war indes vielleicht unrealistisch, zu glauben, der Reichstag werde je einem Verbleib Bayerns im Besitz der Habsburger zustimmen. Zudem ignorierte der Plan die anderen potenziellen Ansprüche auf Teile oder das gesamte bayerische Erbe: Mit Karl Theodor von der Pfalz hatte Maximilian III. Joseph zwischen 1761 und 1774 nicht weniger als vier Erbverträge geschlossen; in Sachsen hegte die Kurfürstinmutter, eine Tochter von Karl Albrecht von Bayern und ältere Schwester der verstorbenen Kaiserin Josepha, Ansprüche auf die sächsischen Allodialen (hauptsächlich Ländereien im Königreich Böhmen); Mecklenburg konnte einen Anspruch auf die Grafschaft Leuchtenberg geltend machen, der bis 1502 zurückreichte. 44 Nicht berücksichtigt worden war zudem der Herzog von Zweibrücken, der mutmaßliche Erbe des kinderlosen pfälzischen Kurfürsten.
43. Das Reich ohne Gegner? Deutschland und Europa (1763–1792)
Tatsächlich hatte Karl Theodor wenig Interesse an Bayern. Er wollte lieber ein Königreich am Rhein und Sicherheit vor preußischen Plänen bezüglich seiner niederrheinischen Territorien Jülich und Berg. In Wien hatte Kaunitz derweil Joseph überzeugt, das Reich werde dem Kaiser nie erlauben, Bayern heimfallen zu lassen, und in jedem Fall würden die Reichsstände keine Verbindung der Länder der Pragmatischen Sanktion mit einem Reichslehen akzeptieren. Kaunitz entwarf einen neuen Plan, der darauf beruhte, dass Kaiser Sigismund angeblich Niederbayern 1426 an Herzog Albrecht V. von Österreich verliehen hatte, was einen bestehenden Anspruch auf das Territorium rechtfertige. Die Lösung war, ganz einfach eine Einigung mit Karl Theodor herbeizuführen, die ihm im Tausch gegen Teile Bayerns Sicherheit in Jülich und Berg garantierte. Später konnte man sich dann über einen Tausch der verbliebenen Teile Bayerns gegen die Österreichischen Niederlande verständigen. Der Handel war so gut wie klar, als der Kurfürst von Bayern am 30. Dezember 1777 – wie Joseph zu Kaunitz meinte – uns »den Streich spielte, zu sterben«. 45 Den Abschluss der Vereinbarung verhinderte das nicht und Österreich besetzte Niederbayern und das westlich davon gelegene Herzogtum Mindelheim. 46 Die Freude über den schnellen und leichten Erfolg des Unternehmens war verfrüht. Das Verhältnis zwischen Wien und Karl Theodor verschlechterte sich rapide, weil Joseph nun, da er ein Missverhältnis von 3 bis 4 Millionen Gulden zwischen den Einkünften der zwei Territorien feststellte, nicht mehr daran dachte, Bayern einfach so gegen die Österreichischen Niederlande zu tauschen. Als er die zersplitterten schwäbischen Territorien Vorderösterreichs anbot, beschuldigte ihn der Kurfürst, die ursprüngliche Übereinkunft gebrochen zu haben. Anderswo nahm der Widerstand gegen die Transaktion rasch zu. Die bayerischen Stände appellierten unverzüglich an Herzog Karl August von Zweibrücken, Karl Theodors Thronfolger. Er wiederum protestierte offiziell beim Reichstag und appellierte an den König von Preußen. Der patriotische Aufschrei des beamteten bayerischen Adels gegen die Aussicht auf habsburgische Herrschaft war ein Schlüsselmoment in der Entstehung der modernen bayerischen Identität und erwies sich als erhebliches Hindernis. 47 Preußen erklärte den Krieg und mobilisierte eine Armee, die am 5. Juli 1778 in Böhmen einmarschierte und die öffentliche Meinung im Reich mit einer Flut von Pamphleten aufrüttelte, die das Ziel proklamierten, das Reich gegen österreichischen Expansionismus zu verteidigen. Beide Seiten mobilisierten substanzielle Streitkräfte: Preußen 154.000 Mann mit 22.000 Sachsen; Österreich standen gut 260.000 Mann zur Verfügung. 48 Die Kämpfe blieben jedoch begrenzt und ergebnislos. Die beiden Seiten zwangen einander auf immer kargeres Gelände. Am Ende gruben die Preußen unreife Kartoffeln aus gefrorenen Feldern, die Österreicher pflückten Pflaumen. Etwa 30.000 Soldaten starben in dem Konflikt, aber Helden kannte der »Kartoffelkrieg« nicht. 49
461
462
IV. · Das Reich von Karl VII. bis Leopold II. (ca. 1740–1792)
Weder Russland noch Frankreich waren geneigt, aufseiten ihres jeweiligen Bündnispartners in den Konflikt einzugreifen. Beide zogen Frieden im Reich einem Wiederaufflammen der Feindseligkeiten zwischen Österreich und Preußen vor. Gelöst wurde die Sache durch eine Intervention von Maria Theresia und Kaunitz, die von Anfang an gegen den Krieg waren. 50 Erst versuchten sie im Juli 1778 direkt an Friedrich heranzutreten, dann wollten sie den Reichstag als Vermittler einschalten. Sie boten sogar an, alle Ansprüche auf Bayern fallen zu lassen, wenn Preußen auf alle Ansprüche auf Ansbach-Bayreuth verzichtete. Als Friedrich auf diese Annäherungen nicht einging, nahmen sie Gespräche mit Frankreich und Russland auf, erneut ohne Joseph zu konsultieren. Die Bedingungen des im Mai 1779 geschlossenen Friedensvertrags von Teschen spiegelten den Wunsch von Maria Theresia und Kaunitz wider, eine Konfrontation mit Preußen zu vermeiden. Die Habsburger ließen alle Ansprüche auf Bayern fallen und behielten nur die Bezirke östlich von Inn und Salzach, das »Innviertel«, etwa 2.200 km 2 bergiges Gebiet mit rund 120.000 Einwohnern. Joseph erkannte offiziell Preußens Nachfolgerecht in Ansbach und Bayreuth an. Sachsen erhielt 6 Millionen Gulden Entschädigung für seine Ansprüche; auch Mecklenburg wurde entschädigt. Am wichtigsten war, dass die Garantie des Vertrags durch Frankreich und Russland Letzteres zu einer der Mächte machte, die im Reich mitmischten: Artikel 12 bekräftigte den Westfälischen Frieden, wodurch Russland neben Frankreich und Schweden Garantiemacht wurde.Weil Schweden nicht mehr in der Lage war, einzugreifen, und Frankreich nun nur noch inoffiziell operierte, wurde Russland zum potenziellen Lenker des politischen Lebens im Reich. 51 Teschen schuf eine neue Lage. Katharina behielt ihre Allianz mit Preußen bei. Unter dem Einfluss Potemkins traten jedoch ab Mitte der 1770er Jahre Panin und der »nordische Akkord« zugunsten einer Strategie der Expansion in den Süden in den Hintergrund. 52 Das ließ eine Kooperation mit Österreich attraktiver erscheinen. Katharina kam zu der Überzeugung, das Reich könne ohnehin besser mit als gegen den Kaiser kontrolliert werden, und nahm Gespräche mit Österreich auf, die 1781 zu einem Geheimabkommen zwischen ihr und Joseph führten, das erst 1783 bekannt wurde. 53 Auch Joseph war überzeugt, dass Bayern nur mit Russlands Hilfe zu gewinnen war. Maria Theresia und Kaunitz zogen andere Schlüsse aus dem Debakel und wandten sich Initiativen zu, die die kaiserliche Position im Reich stärken sollten. Sie planten ein neues Engagement in Kirchenwahlen, um Habsburgs Einfluss im Reich wieder geltend zu machen, und zielten darauf ab, das Corpus Evangelicorum im Reichstag zu organisieren, um sicherzustellen, dass die Kirchenterritorien, wenn sie säkularisiert wurden, in die Hände katholischer Fürsten fielen. Während Joseph immer noch von Bayern träumte, dachten seine Mutter und ihr Kanzler an die zehn jungen Erzherzöge, die in die Schuhe von Fürstbischöfen schlüpfen konn-
43. Das Reich ohne Gegner? Deutschland und Europa (1763–1792)
ten, mit oder ohne Orden. Von den beiden Strategien hatte die in Hinblick auf kirchliche Beförderungen mehr Erfolg: Im Mai 1780 wurde Maria Theresias jüngster Sohn Maximilian Franz (* 1756, † 1801) zum Koadjutor des Erzbischofs in Köln und des Bischofs in Münster gewählt. Die russische Allianz erbrachte Joseph nicht die erhofften Vorteile, ebenso wie die fortgesetzte Allianz mit Frankreich. Mangelnde französische Unterstützung und niederländischer Widerstand führten zum Scheitern seiner Versuche, die Position der Österreichischen Niederlande zu verbessern. Zwar konnte er die Niederländer 1782 zum Abzug von den belgischen Grenzfestungen bewegen, wodurch die Bestimmungen der Grenzverträge von 1709 und 1715 umgekehrt wurden, aber die Wiederöffnung der seit dem Frieden von Münster 1648 für den Schiffsverkehr gesperrten Schelde gelang ihm nicht. 54 Das weitere Ziel der Förderung des Wohlstands von Antwerpen scheiterte und Josephs Demütigung wurde nur teilweise durch kleinere Konzessionen zum Befahren des Unterlaufs des Flusses und 10 Millionen Florine Entschädigung gelindert. Darüber hinaus scheiterte, obwohl Preußen in den frühen 1780er Jahren isoliert war, 1784/85 ein erneuter Anlauf zur Übernahme Bayerns. 55 Trotz der anhaltenden Disparität zwischen den Einkünften Bayerns und der Österreichischen Niederlande war Joseph nun bereit, den vollen Austausch anzubieten, und dazu den Titel »König von Burgund« – oder beinah. Diesmal wurde der Handel dadurch erschwert, dass er nun auch die kirchlichen Territorien Salzburg und Berchtesgaden zu erwerben suchte. Zum Tausch wurden hierfür Limburg, Namur und Luxemburg reserviert. Joseph kalkulierte, es könne bald möglich sein, den Erzbischof selbst in Lüttich wählen zu lassen, wodurch sich die Abtretung von Namur vermeiden ließe. Karl Theodor gefiel es nicht, dass die Territorien ausgeschlossen werden sollten, dennoch war er bereit, zuzustimmen. Seine Thronerben, Herzog Karl August von Zweibrücken und sein Bruder Maximilian Joseph, waren weniger fügsam. 56 Der Kern des Problems waren die Schulden des verschwenderischen Karl August. Der Herzog hatte den Kaiser um finanzielle Entschädigung ersucht, aber Joseph machte Ausflüchte. Frankreich schmetterte den Tausch nicht kurzerhand ab, machte ihn jedoch von der Zustimmung Preußens abhängig. Zugleich bemühten sich Vergennes und seine Agenten sehr, Karl August eine Anleihe aus Genua in Höhe von 6 Millionen Gulden sowie jährliche Subventionen von 500.000 Gulden zu beschaffen. Katharina von Russland machte ihr Einverständnis davon abhängig, dass auch Karl August zustimmte, und zeigte guten Willen, indem sie im Oktober 1784 ihren Sonderbeauftragten im Reich, Graf Nikolaj Rumjancev, nach Zweibrücken sandte, um dem Herzog für seine Einwilligung ein Schmiergeld von einer Million Gulden zu übergeben. Dieser taktlose Wink an den Herzog, der Tausch werde so und so stattfinden, führte jedoch zum Abbruch der Gespräche Anfang
463
464
IV. · Das Reich von Karl VII. bis Leopold II. (ca. 1740–1792)
Januar. Als Berichte über den Versuch, den Herzog in Zugzwang zu bringen, und die vermeintlich geheimen Gespräche die Runde machten, standen Russland und Österreich als Betreiber illegaler Bestrebungen gegen Gesetze und Interessen des Reichs da. Im Reich war man daraufhin derart alarmiert, dass es 1785 zur Bildung eines Fürstenbunds aus Protestanten und Katholiken kam, was Preußen für sich nutzen konnte.Viele andere Themen der Reichspolitik der letzten beiden Dekaden trugen dazu bei. Davon wird noch die Rede sein, ebenso wie von der Geschichte des Bundes als Reforminitiative für sich. 57 In diesem Kontext ist der Bund wichtig, weil er die Isolation Preußens, die 1783 durch das Bekanntwerden des österreichisch-russischen Vertrags von 1781 unterstrichen wurde, aufhob oder zumindest kompensierte. Es dauerte indes nicht lang, bis der Fürstenbund in dieser Hinsicht überflüssig wurde. Kurz nach dem Tod Friedrichs des Großen reagierte der neue König Friedrich Wilhelm II. auf einen Appell seiner Schwester, in der Niederländischen Republik zugunsten des Statthalters Wilhelm V. gegen die rebellischen Patrioten einzuschreiten. Dies entsprach britischen Interessen und führte zur Gründung der defensiven britisch-niederländisch-preußischen Tripelallianz von 1788. 58 Dass Friedrich Wilhelm II. den wichtigsten außenpolitischen Ratgeber seines Vorgängers, Hertzberg, übernahm, bedeutete, dass eine Détente mit Österreich höchst unwahrscheinlich blieb. Aber Hertzbergs Tausch- und Kompensationspläne gerieten zu kompliziert, um die Grundlage einer geradlinigen Politik zu bilden. So gelang es Preußen nicht, die Katastrophen auszunutzen, die in Josephs letzten Jahren über Österreich hereinbrachen. Die Allianz des Kaisers mit Russland verwickelte ihn ab August 1787 in einen kostspieligen Konflikt mit der Türkei. Der Krieg war anfangs äußerst unpopulär. Nach einigen bemerkenswerten Siegen 1789 wandelte sich die öffentliche Meinung, aber ein Ende war nicht in Sicht und es schien absehbar, dass Preußen aufseiten der Türkei eingreifen würde. Die Österreichischen Niederlande begehrten gegen Josephs administrative Reformen auf und erklärten sich 1789 zur Republik. Im selben Jahr drohte auch der magyarische Adel in Ungarn mit einem Aufstand gegen seine Reformen und exzessive Steuerforderungen. Josephs Reiche standen am Rand des Zusammenbruchs, als er am 20. Februar 1790 starb. Friedrich Wilhelm II. zögerte jedoch, die Situation auszunutzen; er hoffte auf britischen Beistand und glaubte nicht, dass Russland Österreich unterstützen würde. Andererseits konnte er von seinen Vereinbarungen mit der Türkei und Polen nicht viel erwarten. Schicksalhafter war noch, dass er mit seiner Intervention in Lüttich einen Großteil seiner potenziellen Partner im Reich verschreckte. Ein Aufstand gegen Fürstbischof Cäsar Constantin Franz von Hoensbroech zwang diesen, zunächst freie Wahlen der Stadtmagistratur zuzulassen und dann nach Köln zu fliehen. Dort bewegte der Kurfürst das Reichskammergericht, die Direktoren des
43. Das Reich ohne Gegner? Deutschland und Europa (1763–1792)
westfälischen Kreises mit einer Intervention zu beauftragen: Köln (für Münster), Preußen (für Kleve und Mark) und Pfalz-Bayern (für Jülich). Preußen verlegte sich auf Verhandlungen, auch in der Hoffnung, mit einer moderaten Linie die Rebellen in den benachbarten Österreichischen Niederlanden zu ermutigen. Die Krise lieferte nebenbei auch eine gute Gelegenheit, die Rückwärtsgewandtheit eines kirchlichen Fürstentums zu demonstrieren und war somit Wasser auf die Mühlen der preußischen Säkularisationsideen. Die Vermittlungsbemühungen blieben vergeblich. Köln und Bayern waren empört über Preußens offensichtliche Unterstützung der Revolutionäre und verlangten gemeinsam mit führenden Angehörigen des Fürstenbunds wie Mainz, Hannover und Sachsen die Annullierung der Konzessionen. Friedrich Wilhelm zog daraufhin seine Truppen zurück und schreckte andere Herrscher davon ab, zu intervenieren. Das Reichskammergericht musste seine Exekutionsanordnung um den fränkischen, schwäbischen, kurrheinischen und oberrheinischen Kreis erweitern, wobei jedoch nur 6.800 Soldaten zusammenkamen, die im Juni 1790 von der 20.000 Mann starken Rebellenarmee zurückgeschlagen wurden. 59 Im Januar 1791 indes wurde die Ordnung durch den Einmarsch von Truppen aus dem benachbarten Österreich, nominell im Namen des burgundischen Kreises, wiederhergestellt. Der Erfolg und die strenge Restauration waren von kurzer Dauer: Bischof Cäsar Constantin starb im Juni 1792; im November 1792 marschierte die französische Revolutionsarmee in Lüttich ein, das im Juli 1794 dauerhaft besetzt und 1795 von Frankreich annektiert wurde. 60 Die Affäre um Lüttich kostete Preußen viel von dem im Fürstenbund erarbeiteten Wohlwollen und Prestige. 61 Sie fiel jedoch auch mit einer wichtigen Veränderung in der österreichischen Politik zusammen. Nach dem Tod Josephs II. wurde sein Bruder Leopold II. zum heilig-römischen Kaiser gewählt. Leopold, der langjährige Erfahrungen als Großherzog der Toskana (seit 1766) gesammelt hatte, machte sich sofort und energisch an die Lösung der diversen Krisen in den habsburgischen Ländern und die Restauration der konstitutionellen Stellung des Kaisers. Dabei widerstand er allen Bestrebungen der Kurfürsten, die territorialen Rechte der Fürsten in der Wahlkapitulation zu stärken; zugleich gelang es den Fürsten, die Aktivitäten der päpstlichen Nuntien, sofern sie über eine rein diplomatische Vertretung hinausgingen, für ungesetzlich erklären zu lassen. Die einstimmige Wahl Leopolds zum Kaiser kam dadurch zustande, dass mangels einer plausiblen Alternative auch der preußische König bereit war, für ihn zu stimmen. Dies wiederum steht für den Beginn einer Wiederannäherung zwischen Wien und Berlin. 1790 drohte ein neuer bewaffneter Konflikt, als Preußen im April, Mai und Juni seine Streitkräfte mobilisierte, um in den österreichischen Krieg gegen die Türkei einzugreifen. Friedrich Wilhelm II. distanzierte sich jedoch zunehmend von Hertzbergs hochfliegenden Plänen, nicht zuletzt, weil er am Beistand seiner
465
466
IV. · Das Reich von Karl VII. bis Leopold II. (ca. 1740–1792)
Verbündeten und Russlands zweifelte. Stattdessen nahm er das britische Vermittlungsangebot an, das zur Reichenbacher Konvention vom 27. Juli 1790 führte. Österreich erklärte sich zum Frieden mit der Türkei und zur Rückgabe der im Krieg besetzten Territorien an der Donau bereit. Preußen ließ seine Ansprüche auf Danzig, Thorn und Posen fallen und verzichtete auf weitere Unterstützung der Rebellen in den Österreichischen Niederlanden und Ungarn. Gemeinsam mit Großbritannien und den Niederlanden garantierte Preußen nun den Status quo zwischen der Türkei und Österreich. Dreizehn Monate später wurde diese eher unsichere Vereinbarung, die keine Seite zufriedenstellte, in Pillnitz bekräftigt, wo sich Leopold II. und Friedrich Wilhelm II. in allgemeinen Worten darauf verständigten, den belagerten König von Frankreich zu unterstützen und die Interessen aller europäischen Monarchen zu schützen. 62 Von den Auswirkungen der Ereignisse in Frankreich auf das Reich wird noch zu sprechen sein. 63 Signifikant ist hier, dass für eine gewisse Zeit viele im Reich zur Tagesordnung übergingen. Hertzberg warb für immer umfangreichere europaweite Tausch- und Kompensationspläne, die darunter litten, dass er das Vertrauen des Königs verloren hatte und es nicht lassen konnte, seine »geheimen« Vorschläge jedermann mitzuteilen. 64 Kaunitz schmiedete immer unwahrscheinlichere Pläne für einen Tausch Bayerns gegen die Österreichischen Niederlande. 65 Und Berlin und Wien betrieben ihre Politik der Wiederannäherung aus weitgehend eigennützigen Motiven. Friedrich Wilhelm hoffte, ein von Österreich geführter Krieg gegen Frankreich werde Leopold binden und Preußen ermöglichen, für seinen Beistand Entschädigung im Osten zu erhalten. Leopold hoffte darauf, Russland in eine allgemeine Allianz zur Verhinderung eines Krieges einzubinden. 66 Das volle Ausmaß der Herausforderung, die die französische Krise darstellte, wurde nur langsam erkennbar. Als Leopold am 1. März 1792 unerwartet starb, zogen am Horizont Sturmwolken auf.
Anmerkungen 1 2 3 4 5 6 7
Wrede, Reich, 546–560; ders., »Der Kaiser«, 115. Aretin, Heiliges Römisches Reich; ders., Altes Reich. Vgl. z. B. Neuhaus, Das Reich, 54 f.; Gotthard, Altes Reich, 119–167; Duchhardt, Altes Reich, 33–51; Herbers und Neuhaus, Reich, 265–287. Schmidt, Geschichte, 264, 277–285, 295–300; eine aufschlussreiche Diskussion aktueller Trends bietet Wilson, »Still a Monstrosity?«. Schroeder, Transformation, 6–8; die beste Untersuchung des internationalen Systems im 18. Jahrhundert bietet Scott, Birth, 116–42. Ebd., 149. Cegielski, Teilung, 30 ff., 52 ff.; der Erbe Augusts III., Friedrich Christian, starb Wochen nach seinem Vater; der nächste, der dreizehnjährige Friedrich August, war nicht wählbar
43. Das Reich ohne Gegner? Deutschland und Europa (1763–1792)
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42
und eine Einigung auf einen von Augusts vier weiteren Söhnen als Kandidaten erwies sich als schwierig. Buddruss, Deutschlandpolitik, 140. Ebd., 180–210. Duchardt, Altes Reich, 36. Cegielski, Teilung,44 f.; Wilson, German Armies, 290 ff. Buddruss, Deutschlandpolitik, 153–179. Blanning, »George III«, 316; Harding, Hanover, 194–206; Scott, Birth, 214–243. Wilson, »Soldier Trade«, 789; Wilson, »Military Recruitment«, 565 f.; Simms, Three Victories, 592 f.; Ingrao, Mercenary State. Press, »Kurhannover«, 71 f. Blanning, »George III«; vgl. auch S. 485–489. Scott, Birth, 152–156. Aretin, Das Reich, 325–400. Schieder, Friedrich, 221 f. Cegielski, »Polenpolitik«, 22 f. Scott, »Aping«, 289. Bayreuth erbte 1769 Markgraf Karl Alexander von Ansbach, der beide Grafschaften 1791 an Preußen verkaufte; Preußens Ansprüche wurden im Vertrag von Teschen 1779 anerkannt; vgl. S. 481 f. Scott, »Aping«, 303–306. Josephs Verhältnis zu Reichsvizekanzler Rudolf Graf Colloredo war schwierig; er spielte nicht mehr die zentrale Rolle in der kaiserlichen Politik, die Friedrich Karl von Schönborn vor 1734 innegehabt hatte; vgl. Aretin, Altes Reich I, 128 f. Beales, Joseph II, I, 134–149, 393 f., 439–491; die komplexen Beziehungen der drei durchziehen das gesamte Buch, besonders die Kapitel zur Außenpolitik und zum Reich. Vgl. S. 48, 54, 272, 347 (orig. 33, 38, 235, 302). Press, »Bayern am Scheideweg«, 306 f.; Aretin, Bayerns Weg, 84–93, 113 ff. Ramcke, Beziehungen, 201–254. Cegielski, »Polenpolitik«, 27; Maks, »Preußen«, 166 f. Bernard, Joseph II, 1–15; Hanfstaengl, Amerika, 119–276. Vgl. S. 97, 145, 150, 430 f. Cegielski, Teilung, 74 f. Kulenkampff, Österreich, 132–150. Scharf, Katharina II., 371–395; Scott, »Aping«, 289–299. Stone, Polish-Lithuanian State, 268–288. Aretin, Altes Reich III, 179. Beales, Joseph II, I, 286–294, 390 f. Cegielski, Teilung, 75. Stone, Polish-Lithuanian State, 273 f.; Scott, Birth, 157–173, 201 f.; das Territorium, das Österreich gewann, war das ehemalige ukrainische Fürstentum Halytsch-Wolodymyr, das in Galizien und Lodomerien umbenannt wurde. Die Namensgebung hat auch damit zu tun, dass das Territorium im 14. Jahrhundert kurzzeitig unter ungarischer Herrschaft stand; seit damals enthielt die ungarische Königstitulatur die Namen »Galicia et Lodomeria«. Cegielski, Teilung, 152. Aretin, Altes Reich III, 178. Beales, Joseph II, I, 300 ff.
467
468
IV. · Das Reich von Karl VII. bis Leopold II. (ca. 1740–1792)
43 Wie Galizien wurde auch dieses neue Territorium von Österreich offiziell so benannt; es war ursprünglich das nordwestliche Drittel des zum Fürstentum Moldau gehörigen Ţara de Sus (»Oberland«). 44 Die sächsischen Ansprüche bezogen sich weitgehend auf die direkt zu Bayern gehörenden Ländereien, nicht jene, die sie offiziell als Reichslehen hielten; vgl. Beales, Joseph II I, 391. Herzog Heinrich I. von Mecklenburg war von seinem Neffen Maximilian I. die Anwartschaft auf Leuchtenberg zugesagt worden; als die Leuchtenberger Landgrafen 1636 ausstarben, war dies indes entweder vergessen oder die Erbfolge kam infolge der Zerrüttung des Hauses Mecklenburg im Dreißigjährigen Krieg nicht zustande; vgl. Zedler, Lexikon XVII, Sp. 546; HBayG II, 1048. 45 Beales, Joseph II, I, 392; Hanfstaengl, Amerika, 54–65. 46 Bayern hielt Mindelheim als Lehen des Königreichs Böhmen; es unterstand daher rein formal sowieso der Rechtsprechung von Maria Theresia. 47 Press, »Bayern am Scheideweg«, 306 f.; Aretin, Bayerns Weg, 84–93, 113 ff. 48 Wilson, German Armies, 288. 49 Hochedlinger, Wars, 367. 50 Beales, Joseph II, I, 386–419. 51 Ebd., 419–22; Aretin, Das Reich, 325–336; in manchen Lagern herrschte Zweifel, ob der Vertrag Russland wirklich den legalen Status einer Garantiemacht verlieh; Katharina die Große kümmerte das nicht; sie verhielt sich so, als wäre sie offiziell ernannt worden, nicht inoffiziell »eingeschrieben« durch die Bestätigung des Westfälischen Friedens im Jahr 1779. 52 Scott, Birth, 187–190; Scharf, Katharina II., 395–416. 53 Dafür war die ungewöhnliche Form eines Briefwechsels statt eines offiziellen Vertrags nötig, weil Österreich sich nach wie vor weigerte, den russischen Kaisertitel anzuerkennen. 54 Demel, Reich, 276; Beales, Joseph II, II, 374 ff., 390–393. 55 Aretin, Altes Reich III, 306–310; Beales, Joseph II II, 388 ff., 393–398; Hanfstaengl, Amerika, 119–276. 56 Karl Augusts einziger Sohn war am 21. August 1774 gestorben. 57 Vgl. S. 486 ff. 58 Schama, Patriots, 121–132; Scott, Birth, 239–243. 59 Neugebauer-Wölk, »Preußen«; Aretin, Altes Reich III, 354–361; Wilson, German Armies, 301 f.; Gatz, Bischöfe 1648 bis 1803, 185–188, 304–308. 60 »Nominell«, weil der burgundische Kreis normalerweise von allen Aktivitäten in Bezug auf das Reich ausgenommen war. 61 Maks, »Preußen«, 173. 62 Scott, Birth, 244–251. 63 Vgl. S. 491–495, 648–667. 64 Maks, »Preußen«, 166, 180–183. 65 Kulenkampff, Österreich, 132–150. 66 Schroeder, Transformation, 90.
44. Erneuerung: Joseph II. (1765–ca. 1776)
I
n Erwartung seiner Wahl zum römischen König und voraussichtlichen Erben der Kaiserkrone nannte Erzherzog Joseph die Krönungszeremonie in einem Brief an seinen Schwiegervater »cette desegreable et inutile fonction« (»diese widerwärtige und unnütze Veranstaltung«). Auf dem Weg nach Frankfurt klagte er im März 1764 unentwegt, wie lästig und beschwerlich die Reise und wie überdrüssig er der Würdenträger und Fürsten sei, die er treffen musste. Seiner Mutter indes berichtete er, er habe die Zeremonie am 3. April 1764 »superbe et auguste« (»prachtvoll und majestätisch«) gefunden, überschattet nur von seiner anhaltenden Trauer über den Tod seiner geliebten ersten Frau Isabella von Parma am 27. November 1763. 1 Die Zeremonie selbst war getrübt vom Fernbleiben der weltlichen Kurfürsten und Fürsten von der Krönungsfeier. 2 Aber selbst das schien Josephs positive Stimmung als neuer römischer König nicht zu dämpfen. Sein Sinneswandel zeugt nicht nur von seinem sprunghaften und launischen Temperament. Unter dem Einfluss der politischen Berater seiner Eltern hatte er offenbar tatsächlich begriffen, wie signifikant die kaiserliche Krone und die günstigen Umstände, unter denen er zu ihrem Träger gewählt wurde, waren. In seinen jüngeren Jahren hatte ihn zweifellos die skeptische Haltung seiner Mutter zum Reich geprägt und zwischen 1754 und 1759 hatte ihm sein Lehrer Christian August Beck (* 1736, † 1780) beigebracht, das Reich sei eine anachronistische, zum baldigen Zusammenbruch verurteilte Institution. 3 Im Frühjahr 1764 stellte sich die Lage jedoch ganz anders dar. Zum einen war die politische Situation im Reich günstig. Josephs Wahl selbst war ein Grund für Optimismus: Zum ersten Mal seit der Wahl Josephs I. zum Thronfolger Leopolds I. 1690 war die Zukunft der Kaiserkrone für die nächste Generation gesichert. Prosaischer betrachtet, zeigte die Unterstützung des Königs von Preußen und anderer zuvor feindseliger Fürsten den allgemeinen Wunsch, Konflikte zu vermeiden. Heikel war lediglich die Haltung Großbritanniens, das an seiner im Siebenjährigen Krieg eingeschlagenen Linie der Opposition gegen die französisch-österreichische Allianz festhielt und keine Gelegenheit ausließ, die Rechte der Protestanten im Corpus Evangelicorum geltend zu machen. Damit hinderten die Briten zudem für einige Jahre Preußen und Sachsen daran, sich offen mit dem Kaiser zu verbünden, weil sie fürchten mussten, ihren Einfluss im Corpus zu verlieren. 4 Alle anderen jedoch zeigten 1763 eine neue Einstellung. Preußen
470
IV. · Das Reich von Karl VII. bis Leopold II. (ca. 1740–1792)
und Österreich waren vom Siebenjährigen Krieg erschöpft und um Ausgleich bemüht; ihre zunächst zögerliche Wiederannäherung gipfelte in einer Phase der Kooperation zwischen 1769 und 1773. Auch Sachsen brauchte Frieden und Stabilität, um sich von den Verwüstungen des Kriegs zu erholen, zumal der neue Kurfürst Friedrich Christian nach dem Verlust der polnischen Krone mit dem Tod von August III. 1763 ohnehin in die mittleren Ränge der deutschen Fürsten abstieg. Als Entschädigung für den Verlust Polens versuchten er und seine Frau (die Schwester des bayerischen Kurfürsten) nun, dem jüngeren Bruder des Kurfürsten, Clemens Wenzeslaus, eine kirchliche Laufbahn zu sichern. 5 Durch die Hilfe der Habsburger und Wittelsbacher wurde er zuerst Bischof von Freising und Regensburg und schließlich Kurbischof von Trier. Die offensichtlichen Ambitionen des sächsischen Kurfürsten in der Reichskirche ließen ihn als formellen Kopf des Corpus Evangelicorum umso suspekter erscheinen, obwohl das katholische Haus Wettin hier längst die Initiative an die protestantischen Kurfürsten in Hannover und BrandenburgPreußen verloren hatte. Bayern und die Pfalz, Anlass zahlreicher Krisen seit dem späten 17. Jahrhundert, waren durch die französisch-österreichische Allianz neutralisiert und geneigt, sich wieder der (habsburgischen) kaiserlichen Linie unterzuordnen. Österreichs eigene Schwäche nach dem Siebenjährigen Krieg wurde zum Ausgangspunkt innerer Reformen und einer neuen Strategie im Reich in Bezug auf die Wahl des jungen Erzherzogs. 6 Die Kurfürsten selbst hatten solche Überlegungen ermutigt, indem sie Franz Stephan eine Reihe von Vorschlägen für die zukünftige kaiserliche Politik vorlegten. Sie wünschten eine Lösung der anhaltenden konfessionellen Dispute, den Ausbau von Handelswegen und eine weitere Reform der Gilden sowie die Verteidigung der Reichskirche gegen Rom. Vor allem sollte der Kaiser eine Überprüfung von Reichshofrat und Reichskammergericht einleiten und das Rechtssystem wieder auf ein solides Fundament stellen. 7 So weit die Zukunftspläne. Zunächst starteten die kaiserlichen Berater eine Propagandakampagne, um den günstigen Augenblick auszunutzen. Während der Wahlverhandlungen hatte Graf Johann Anton von Pergen, der für die Organisation des Verfahrens zuständige kaiserliche Beamte, Friedrich Karl von Moser kennengelernt, den Sohn des angesehenen Juristen, zu jener Zeit Repräsentant der verschiedenen hessischen Dynastien. 8 Moser hatte zunächst für die preußische Sache geworben, die Lage im Jahr 1756 mit der vor Ausbruch des Dreißigjährigen Kriegs verglichen und Friedrich den Großen als neuen Gustav Adolf und Retter der deutschen Libertät gepriesen. Aus verschiedenen Gründen, unter anderem wegen der religiösen Gleichgültigkeit des preußischen Königs, wandte sich Moser ab 1761 gegen Preußen. Eine zufällige Begegnung führte 1762 zu einer Korrespondenz mit den Drahtziehern der Gründung der Helvetischen Gesellschaft und regte ihn an, über eine ähnliche patriotische Verbindung in Deutschland nachzudenken.
44. Erneuerung: Joseph II. (1765–ca. 1776)
Diskussionen mit führenden Angehörigen der Wiener Administration während Erzherzog Josephs Wahl führten im Dezember 1764 dazu, dass Moser eine geheime Pension von 1.500 Gulden pro Jahr angeboten wurde. Ohnehin zur kaiserlichen Sache bekehrt, wurde Moser nun zum ideenreichen und enthusiastischen Propagandisten; sehr bald empfahl Kaunitz, sein Gehalt auf 2.000 Gulden pro Jahr zu erhöhen. Mosers erste Salve war sein Neujahrswunsch an den Reichstag zu Regensburg von 1765, der an die Abgeordneten als »Deutschlands erlauchte National-Versammlung« und darüber hinaus an alle Fürsten, Intellektuellen und Bürger des Reichs appellierte, den Nationalgeist neu zu beleben. Bald darauf arbeitete er auf Anregung von Pergen und Reichsvizekanzler Colloredo, die bereits vor Mosers Anstellung diesbezügliche Diskussionen geführt hatten, seine Gedanken in Von dem Deutschen Nationalgeist weiter aus, einem verblüffend innovativen Werk, das Montesquieus Vorstellung eines esprit général in den deutschen Neologismus Nationalgeist übersetzte und auf das Reich bezog. »Wir sind Ein Volk«, erklärte er in der Einleitung, »von Einem Nahmen und Sprache.« Die Deutschen seien »ein in der Möglichkeit glückliches, in der That selbst aber sehr bedauernswürdiges Volk«. Ein Grund der Misere sei die religiöse Spaltung, die Neigung mancher »mächtig gewordenen Deutschen Provinzen und Häuser«, ihre eigenen Belange über »das getheilte und schwächere Interesse des Ganzen« zu stellen. Die Lösung sah er in der Neubelebung eines nationalen Geistes und in der Sammlung des Volks um den Kaiser als Schutzherrn des Reichs und seiner Untertanen. Diese Gedanken führte er in den Schriften Was ist: gut kayserlich, und: nicht gut kayserlich? (1766) und Patriotische Briefe (1767) weiter aus. Es gab jedoch zwei Probleme. Moser selbst war nicht gewillt, die Rolle eines bloßen Mitläufers oder Lohnschreibers zu spielen. Seine enthusiastische Loyalität galt dem Kaisertum, nicht den Habsburgern. Dass er zwischen »gut kaiserlich« und »gut österreichisch« unterschied, wenn auch mit dem Eingeständnis signifikanter Überschneidungen, erregte Unmut in Wien. 9 Ebenso irritiert waren seine Geldgeber davon, dass er zumindest einige Probleme des Reichs auf die kaiserliche Politik zurückführte. Zweitens waren die Reaktionen auf Moser mehrdeutig. Manche, so etwa der dänische Minister Johann Hartwig Ernst von Bernstorff und der hannoversche Minister Gerlach Adolph von Münchhausen, beglückwünschten ihn zu seinem Patriotismus, andere waren vehement dagegen. Propagandisten der Territorialregierungen in Berlin und anderswo wiesen seinen Appell an das Reich, sich um den Kaiser zu scharen, in Bausch und Bogen zurück. In etwas moderaterer Form pries der Osnabrücker Geheime Justizrat Justus Möser den echten Patriotismus, wie man ihn in den Territorien fand, als wahre Quelle der deutschen Identität und Libertät. 10 Dass nach der Ernennung Mosers zum Reichshofrat und Mitglied des höchsten
471
472
IV. · Das Reich von Karl VII. bis Leopold II. (ca. 1740–1792)
kaiserlichen Gerichts im April 1767 bekannt wurde, dass er von Wien bezahlt worden war, untergrub seine Glaubwürdigkeit. 11 Schon zuvor waren Josephs Berater Colloredo, Pergen und Kaunitz zu der Ansicht gelangt, Mosers Agitation sei in mancher Hinsicht kontraproduktiv. Statt das Reich zu einen, rief er lediglich Opposition hervor und fachte insbesondere die Animosität zwischen Preußen und Österreich an, die den meisten aktuellen Problemen zugrunde lag. In der Vergangenheit hatten die Habsburger das Reich gegen Türken und Franzosen mobilisiert; es gegen Preußen zu mobilisieren und dabei zu behaupten, die Interessen des Reichs insgesamt im Sinn zu haben, war schlichtweg widersinnig.Viel besser sei es, schlossen die habsburgischen Minister, eine weitere Polarisierung zu vermeiden und lieber die katholischen Universitäten zu ermutigen, ihre Kenntnisse der Reichsgesetze und -politik zu erweitern, um das akademische Meinungsmonopol der Protestanten in Sachen deutscher (protestantischer) Libertät zu brechen. Mosers Entlassung aus dem Reichshofrat 1770 kam nicht überraschend; nach einer glücklosen Zeit als Verwalter der oberrheinischen Grafschaft Falkenstein wurde ihm seine Pension 1772 schließlich entzogen. Die Überlegungen, die zur Aufgabe der Propagandakampagne führten, begleitete eine Verlagerung auf weniger ambitionierte Politik. Dies begann schon kurz nach der Wahl. Franz Stephans Berater betrachteten Josephs zweite Heirat mit Maria Josepha von Bayern im Januar 1765 als potenzielle Grundlage für eine neue katholische Liga, die auch für die Kirchenfürsten und sogar für Württemberg attraktiv sein mochte. Tatsächlich aber ließ Josephs miserabler Umgang mit seiner zweiten Frau, die ohnehin im Mai 1767 einer Erkrankung an Pocken erlag, wenig politische Vorteile erhoffen. 12 Die entscheidende Initiative kam von Joseph selbst, nachdem Maria Theresia einem Versuch der Einmischung in die Angelegenheiten der österreichischen Länder eine entschiedene Abfuhr erteilt hatte und er sich im August 1765 nach dem Tod von Franz I. als heilig-römischer Kaiser durchgesetzt hatte. Im Dezember erklärte Joseph gegenüber Colloredo, er wolle ein kleines Gremium bilden, das regelmäßig tagen solle, um über die aktuelle Entwicklung im Reich zu beraten. Colloredo äußerte Bedenken, auch weil er um das Gewicht seines eigenen Amts als Reichsvizekanzler bangte, dennoch traf sich die sogenannte Reichskonferenz ab Januar 1767 wöchentlich. Allerdings wurde sie bald wieder aufgelöst, weil sie nichts zu besprechen fand. 13 Signifikantere Folgen hatte ein Katalog von einundzwanzig Fragen zur zukünftigen Regierungspraxis im Reich, den Joseph im November 1766 an Pergen, Colloredo und Kaunitz sandte. 14 Er ersuchte sie um Vorschläge von Prinzipien, auf denen sich ein système für eine effektive Regierung des Reichs errichten ließe. Die kaiserliche Autorität sollte gestärkt, die Schwäche der vergangenen Jahrzehnte überwunden werden; die Protestanten mussten überzeugt werden, dass ihre beständige Opposition eine Dummheit und es besser war, sich von der »diktatori-
44. Erneuerung: Joseph II. (1765–ca. 1776)
schen Sprache des Berliner Hofs« abzunabeln. Die katholischen Fürsten mussten besser organisiert werden, ihre Streitkräfte gestärkt, ihre Territorien reformiert, um Wohlstand und Stabilität zu erhöhen. Joseph stellte sich eine Reform der kaiserlichen Höfe vor, um die Rolle des Kaisers als höchsten Richters wieder zur Geltung zu bringen; seine feudale Oberlehnsherrschaft und alle damit verbundenen Rechte mussten in Deutschland und Italien wiederhergestellt werden. Die traditionellen Klienten der kaiserlichen Krone – Grafen, Ritter, Prälaten und Städte – sollten neu verpflichtet, katholische Gelehrte ermutigt werden, das Reichsrecht zu studieren. Wie war das alles zu erreichen? Josephs Fragen zeigten den klaren Wunsch, das imperiale System neu zu aktivieren, und fassten das System klar nach seinen eigenen Begriffen auf. Nichts an dem Dokument weist darauf hin, dass er das Reich untergraben oder es für rein österreichische Zwecke ausnutzen wollte. Die Antworten, die Joseph erhielt, waren in dreierlei Hinsicht signifikant. 15 Erstens zeigten sie einen Konsens über die meisten großen politischen Themen im Reich. Zweitens äußerte niemand Zweifel am enormen Wert des fortdauernden Besitzes der Kaiserkrone. Sie verlieh dem Haus Österreich Einfluss und Vorrang in Europa insgesamt und verschaffte ihm natürliche Verbündete in Kriegszeiten. Wie Pergen anmerkte, hingen die Privilegien der habsburgischen Länder im Reich zur Gänze von der kaiserlichen Krone ab. Nur wenn der Kaiser die deutschen Stände missachtete, konnte die Kaiserkrone möglicherweise zum Nachteil werden, weil das Preußen die Möglichkeit gab, katholische und protestantische Verbündete im Reich und außerhalb zu gewinnen. Drittens waren sich alle einig, dass die bisherige Politik der Feindseligkeit gegen Preußen gescheitert war. Kaunitz selbst, der Architekt des »neuen Systems«, betonte nun, wie notwendig ein neuer Ansatz sei, der auf der »reichsväterlichen Liebe« des Herrschers gründe. Das Ziel sei: »Vertrauen, Gesetzmässigkeit, Unpartheilichkeit, patriotischer Geist, majestätische Unerschrockenheit, wahre Begierde, die Bedranckten zu schützen, die Schwachen aufzurichten, die Gerechtigkeit auf die mildeste Art handzuhaben, den Ruhestand zu befördern, Trennungen zu vermeiden, die Nothwendigkeit eines Haupts zu Schutze und Ruhe des Ganzen werkthätig zu bestättigen, das allgemeine Band zwischen Haupt und Glieder enger zusammen zu ziehen«. Das grundlegende Ziel kaiserlicher Herrschaft, erklärte er, sei es, das Wohlergehen des Reichs zu fördern und dies mit dem »Wohlergehen des erhabenen erzherzoglichen Hauses« zu verbinden; beider Versöhnung weise den Weg zum richtigen System der Herrschaft über das Reich. 16 Wenn Kaunitz hinzufügte, dies dürfe nicht mit dem System des Reichs selbst verwechselt werden, gab er wiederum nur einem jahrhundertealten Gemeinplatz der Wiener Politik Ausdruck: Das Reich zu beherrschen, bedeutete nicht, an seine Regeln gebunden zu sein; wie der Westfälische Friede und die vielen fortdauernden Ausnahmen in
473
474
IV. · Das Reich von Karl VII. bis Leopold II. (ca. 1740–1792)
Bezug auf die habsburgischen Länder bestätigten, blieb die Stellung Österreichs im Reich eine besondere. Die Notwendigkeit, die Konsequenzen der österreichisch-preußischen Feindschaft zu überwinden, lieferte den unmittelbaren Anlass zum Handeln; die Probleme der kaiserlichen Krone wiederum wurden bald unterstrichen durch die Reaktionen auf das Ersuchen um Erneuerung aller kaiserlichen Lehen. Nun schlossen sich die Kirchenfürsten ihren weltlichen Kollegen an und weigerten sich ebenfalls rundheraus, sich zu fügen. 17 Zudem verlangten 1767 die »alten Fürsten« eine Gleichbehandlung mit den Kurfürsten. Jedoch fügten sich wiederum nur Schweden (1773 für Pommern) und Dänemark (1777 für Oldenburg, 1788 für Holstein), und das ohne jede Eile. Was den Rest betraf, erkannten nur die wenigen neu erhobenen weltlichen Fürsten, die Kirchenfürsten und Prälaten, Reichsstädte und andere niedere Reichsstände offiziell die Rolle des Kaisers als obersten Lehnherrn an. Selbst auf dem Höhepunkt der österreichisch-preußischen Wiederannäherung, als Joseph 1769 in Neiße mit Friedrich II. zusammentraf, widersetzte sich Friedrich einem Kompromiss, der ihm gestattet hätte, seinen Lehnseid auf einem Stuhl sitzend zu erneuern, anstatt vor dem Kaiser niederzuknien. Trotz seiner Enttäuschung über diese öffentliche Brüskierung machte sich Joseph daran, das neue Denken in die Tat umzusetzen, indem er sich dem Schlüsselbereich des Reichsrechts zuwandte. Mit dem Tod eines Kaisers wurde der Reichshofrat offiziell aufgelöst und Joseph nutzte seine Neueröffnung, um die Mängel zu beseitigen, die sich in den vorhergehenden Jahrzehnten entwickelt hatten. 18 Eine vollzählige Besetzung von Ratsmitgliedern wurde ernannt, die Anzahl der wöchentlichen Sitzungen erhöht, Schritte zur Unterdrückung von Korruption wurden eingeleitet und ein Dekret schrieb vor, dass alle Fälle innerhalb von zwei Jahren erledigt sein mussten. Die Reform zog die üblichen Beschwerden nach sich: Der Reichsvizekanzler beklagte, seine Vorrechte würden beeinträchtigt, die Räte behaupteten, sie müssten für weniger Geld mehr arbeiten, und so weiter.Vor allem zeigten sich die Kritiker des Hofs, überwiegend protestantische Fürsten, unzufrieden: Es werde nicht genug unternommen, um ihre Rechte zu wahren und unparteiisches Vorgehen sicherzustellen. Überzeugt hätte sie wohl nur die Gewährung einer gewissen Autorität über den Hof durch den Kaiser, was dieser entschieden ablehnte. Dennoch bildete das Corpus Evangelicorum ein eigenes Komitee zur Prüfung religiöser Dispute, das bis 1784 tagte und sich mit zwanzig Fällen befasste, von denen nur sechs vor Gericht landeten. Bei allen praktischen Problemen und der unversöhnlichen Feindseligkeit der Kritiker des Hofs scheint die Reform doch Wirkung gezeigt zu haben: Der Rückstau von etwa 4.000 Verfahren (von denen sich viele ohnehin von selbst erledigt hatten) wurde langsam abgearbeitet und Belege weisen darauf hin, dass der Hof
44. Erneuerung: Joseph II. (1765–ca. 1776)
wieder einigermaßen zu funktionieren begann. Die Anzahl der Verfahren, mit denen er sich jährlich befasste, stieg von 2.088 (1767) auf 3.388 (1779). Auch bei der Sicherstellung der gerechten Behandlung protestantischer Kläger scheint Joseph erfolgreich gewesen zu sein, und zwar so sehr, dass sich nun Katholiken über Diskriminierung beklagten. 19 Für Reichsstädte und andere niedere Reichsstände sowie den mittleren Reichsadel blieb der Reichshofrat ohne Zweifel die nächstliegende Adresse für Beschwerden. 20 1770, auf dem Höhepunkt der österreichischpreußischen Wiederannäherung, war es sogar möglich, eine Lösung für den Disput zwischen dem Herzog von Württemberg und seinen Territorialständen, den wohl erbittertsten und potenziell gefährlichsten Konflikt jener Zeit, auszuhandeln. 21 Ein schwierigeres Problem war das Reichskammergericht. Hier kam zu den üblichen Herausforderungen höherer Gerichte im Umgang mit (sehr weit ausgelegten) religiösen Belangen noch hinzu, dass der Kurfürst von Mainz dem Kaiser generell das Recht absprach, sich in die Arbeit des Gerichts einzumischen, und dass die Fürsten – aus rein konstitutioneller Sicht zu Recht – dieses als »ihr« Gericht betrachteten. 22 Markgraf Karl Friedrich von Baden appellierte im Oktober 1766 an mehrere protestantische Fürsten, sich dem zu widersetzen, wovon er behauptete, es sei nicht mehr als ein Versuch, die Landeshoheit der Fürsten zu schmälern und die Macht des Gerichts und des Kaisers zu erweitern. 23 Dennoch konnte niemand bestreiten, dass eine Reform nötig war. Goethes Behauptung, es gebe 50.000 unerledigte Fälle, war schlicht falsch, die oft zitierte noch höhere Zahl von 60.000 reine Fantasie. 24 Beide Zahlen werden gern herangezogen, um den völligen Bankrott des Reichs in seinen letzten Jahrzehnten zu belegen. Laut eigenen Aufzeichnungen des Gerichts von 1769 waren seit 1701 14.416 Verfahren eröffnet worden; zwischen 1750 und 1762 waren 838 Fälle einem nicht spezifizierten Überhang hinzugefügt worden. Es war klar, wie dem abzuhelfen war: Die Reichsstände sollten ihre Abgaben leisten, diese mussten erhöht werden, zudem brauchte es mehr Richter, um mit dem Überhang und den jährlich etwa 230 bis 250 neuen Verfahren fertig zu werden. 25 1776 gelang es, die Zahlungen der Reichsstände zu erhöhen, um das Gericht zu finanzieren und mehr Richter einzustellen. Ungelöst blieb jedoch das Problem der Berufungen gegen ihre Urteile. Das Ergebnis war noch zwiespältiger als beim Reichshofrat. Einerseits wurde genug unternommen, um sicherzustellen, dass das Gericht wieder effektiv arbeiten konnte, was es in den 1780er und 1790er Jahren offenbar auch tat. Andererseits wurden Josephs weitergehende Reformvorstellungen durch politische Kräfte vereitelt, die gar nicht darauf aus waren, die Probleme zu lösen, die sie beklagten: Die Anschuldigungen gegen die höchsten Gerichte des Reichs waren politisch viel zu nützlich für die protestantische Sache, um sie zu beseitigen. Neben diesen großen Reformen gelang es Joseph – mit unterschiedlichem
475
476
IV. · Das Reich von Karl VII. bis Leopold II. (ca. 1740–1792)
Erfolg –, eine Reihe weiterer Initiativen in die Wege zu leiten, die auf die Vorschläge der Kurfürsten von 1764 zurückgingen. Eine umfassende Währungsreform stieß auf wenig Begeisterung, da auf diesem Gebiet längst regionale Lösungen gefunden waren. Die Reichshandwerksordnung indes wurde 1771 um weitere Maßnahmen gegen das restriktive Vorgehen der Gilden ergänzt. Darüber hinaus einigte man sich auf Schritte zur Förderung des Handels und eine Regulierung der Getreidezölle. 26 Ob die Schwierigkeiten bei der Einigung auf bestimmte Maßnahmen auf die Inkompetenz des Reichstags oder seine mangelnde Eignung als nationale politische Institution zurückgingen, ist eine andere Sache. Ein Haupthindernis war natürlich die Sorge der Fürsten um ihre Macht. Ebenso wichtig war, dass territoriale Reformen und in manchen Regionen die Aktivitäten der Kreise eine Gesetzgebung auf höchster Ebene unnötig machten. 27 Zugleich verteidigte Joseph 1769/70 energisch die Rechte und Privilegien der Reichsritter gegen neuerliche Anläufe Württembergs und der Pfalz, sie zu untergraben. 28 Entscheidend war wohl, dass Preußen sich nicht auf die Seite der Aggressoren schlug, aber die Energie des Kaisers und seine Detailgenauigkeit sind dennoch beeindruckend. Joseph fand sogar Zeit, sich im Einzelnen um die Belange der Kaiserlichen Bücherkommission in Frankfurt zu kümmern und in den frühen Jahren seiner Herrschaft dafür zu sorgen, dass Werke von Montaigne, Voltaire und Montesquieu verboten wurden. Sein Eifer auf diesem Gebiet brachte ihm eine Rüge seines eigenen Reichshofrats ein, dem verfassungsgemäß das Recht zustand, bei Verboten konsultiert zu werden. 29 Die Wirkung kaiserlicher Verbote war begrenzt, da die beanstandeten Bücher meist einfach von Frankfurt zur konkurrierenden Buchmesse (und Zensurbehörde) nach Leipzig verbracht wurden. Joseph dachte jedoch, sein Vorrecht sei den Aufwand wert, die Kommission in Einklang mit seiner eigenen, zunehmend liberalen Einstellung zu reformieren: 1780 löste er die Verknüpfung zwischen kaiserlicher Zensur und der katholischen Kirche, indem er einen protestantischen Bücherkommissar in Frankfurt ernannte. Im Großen und Ganzen scheinen diese Aktivitäten ebenso wie seine Bemühungen auf dem Gebiet der Justizreform das öffentliche Ansehen des Kaisers beträchtlich gestärkt zu haben. Friedrich Karl von Moser stand mit seiner Bewunderung für Joseph und den Hoffnungen, die er in ihn setzte, nicht allein. In den frühen 1770er Jahren lebte das Interesse an der Einrichtung einer deutschen Akademie wieder auf. Klopstock zum Beispiel widmete dem Kaiser sein Drama Hermanns Schlacht (1769) und sandte ihm einen Plan zur Gründung einer nationalen Akademie, den er 1772/73, 1783 und 1784 erneut aufgriff. 30 1772 hoffte auch Wieland auf die Unterstützung des kaiserlichen Hofs für eine solche Akademie.31 1780 bat Herder in seiner Ode An den Kaiser diesen inständig: »Gib uns, wonach wir dürsten, / ein Deutsches Vaterland, / Und Ein Gesetz und Eine schöne Sprache / und redliche
44. Erneuerung: Joseph II. (1765–ca. 1776)
Religion.« 32 Der Kirchenreformer Johann Nikolaus von Hontheim sah Joseph als potenziellen Reformer der Reichskirche. 33 Selbst Friedrich der Große zeigte sich beeindruckt von dem jungen Kaiser, dem er 1769 und 1770 in Neiße beziehungsweise Mährisch-Neustadt begegnete: »Mit einem Wort, es ist ein Fürst, von dem man nur Großes erwarten darf und der in der Welt von sich reden machen wird, sobald er die Ellenbogen frei hat.« 34 Zweifellos erwies sich Joseph in seinem ersten Jahrzehnt auf dem Thron als fähiger Kaiser. In einem Memorandum von 1768 demonstrierte er ein klares Bewusstsein der Schwierigkeiten, auf die jede Reform stoßen musste, und einen gewitzten Sinn dafür, wie damit umzugehen war. 35 Seine Ziele verfolgte er bemerkenswert beharrlich und geschickt. Als die Reform des Reichskammergerichts 1776 schließlich scheiterte, reagierte er ebenso unverblümt.
Anmerkungen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22
Beales, Joseph II, I, 114 f. Stollberg-Rilinger, Verfassungsgeschichte, 240–244. Beales, Joseph II, I, 48, 57–62; Conrad, Recht, 430–434. Aretin, Altes Reich III, 115 und 113–119 für die allgemeine Situation im Reich nach 1763. Ebd., 116. Vgl. zu den inneren Reformen Kap. 49 und 50, insb. S. 625–629. Aretin, Altes Reich III, 119. Das Folgende beruht weitgehend auf der Darstellung bei Burgdorf, Reichskonstitution, 184–226; hilfreich sind außerdem Vazsonyi, »Montesquieu«, und Gagliardo, Reich, 49–65. Burgdorf, Reichskonstitution, 215. Vgl. zu Möser S. 563 f. Burgdorf, Reichskonstitution, 226. Aretin, Altes Reich III, 117. Ebd., 120. Khevenhüller-Metsch, Zeit VI, 479–482; vgl. auch Beales, Joseph II, I, 19–23; Aretin, Altes Reich III, 121 f.; Burgdorf, Reichskonstitution, 227–230, 236–239; Düwel, Diskussionen, 66–69; Haug-Moritz, Ständekonflikt, 273–282. Die Antworten von Colloredo und Kaunitz zitiert Khevenhüller-Metsch, Zeit VI, 482–518; Pergens Antwort findet sich bei Voltelini, »Denkschrift«, 152–168. Khevenhüller-Metsch, Zeit VI, 504 f. Noël, »Reichsbelehnungen«, 115 ff.; vgl. auch Stollberg-Rilinger, Verfassungsgeschichte, 287–297. Aretin, Altes Reich III, 124–135; Düwel, Diskussionen, 74–77; Rauscher, »Recht«, 299–303. Beales, Joseph II I, 129. Vgl. z. B. Noël, »Reichshofrat«; Westphal, Rechtssprechung, 433–443; Aretin, Altes Reich III, 160–165. Haug-Moritz, Ständekonflikt, 391–453. Burgdorf, Reichskonstitution, 236–247; Aretin, Altes Reich III, 135–159; Düwel, Diskussionen, 78–86; Rauscher, »Recht«, 303 ff.; Haug-Moritz, Ständekonflikt, 288 ff.
477
478
IV. · Das Reich von Karl VII. bis Leopold II. (ca. 1740–1792)
23 Aretin, Altes Reich III, 138 f. 24 Die Gesamtanzahl der über drei Jahrhunderte verzeichneten Verfahren beträgt nur etwa 75.000. 25 Die Zahlen sind Smend, Reichskammergericht, 230 f., entnommen. 26 Blaich, Wirtschaftspolitik, 171–182; Kluge, Zünfte, 414 ff. 27 Vgl. S. 497–500 und Kap. 49–59. 28 Vgl. auch S. 446. 29 Beales, Joseph II, I, 130 f.; Eisenhardt, Aufsicht, 136–142. 30 Das Drama handelt vom Sieg des Arminius (Hermann) gegen die Römer in der Schlacht im Teutoburger Wald im Jahr 9 n. Chr. 31 Sahmland, Wieland, 41 f., 44–48; Hurlebusch und Schneider, »Die Gelehrten«; Dann, »Herder«, 328, 330; Wangermann, »Patriotismus«, 61–65; Burgdorf, Reichskonstitution, 341. 32 Beales, Joseph II, I, 132. 33 Aretin, Altes Reich III, 240. 34 Baumgart, »Joseph II.«, 261. 35 Abgedruckt bei Conrad, »Verfassung«, 165–185.
45. Joseph II. und die große Reformdebatte (ca. 1778–1790)
E
s gelang Joseph nicht, das Reich für die kaiserliche Sache zu mobilisieren. Ironischerweise trug er in den 1780er Jahren vielmehr dazu bei, es gegen sich zu mobilisieren. Seine Politik war so instinktlos und provokativ, dass sein eigener Reichshofrat sie 1787 missbilligte. Noch ironischer war, dass dies in eine Zeit fiel, als Kaunitz sich tapfer bemühte, eine Reichspolitik zu betreiben, die auf subtile und weitsichtige Weise Pergens Programm von 1766 umzusetzen trachtete. Der Kaiser indes verprellte mit seinen diversen Plänen viele traditionelle Verbündete, und selbst jene, die treu zur Krone standen, wünschten von Herzen, ein anderer Kaiser möge sie tragen. Seine Politik trieb viele Protestanten zur offenen Opposition im 1785 gegründeten und von Preußen dominierten Fürstenbund. Josephs Beharren auf politischen Kernzielen brachte zudem andere dazu, Pläne für eine Reform des Reichs zu ersinnen. Die Interessen der kirchlichen und der protestantischen Fürsten waren selbstverständlich andere, aber letztlich fanden ihre Reformvorschläge Eingang in die Pläne, die Karl Theodor von Dalberg, damals Koadjutor mit Nachfolgerecht in Mainz und später eine der wichtigsten Gestalten der letzten Phase des Reichs, in den späten 1780er Jahren vorlegte. 1 Keine der geplanten Reformen gelang. Aber auch Österreich und Preußen schafften es nicht, dem Reich ihren Willen aufzuzwingen. Josephs gescheiterte Versuche, sich Bayern zu sichern, zeigten die Grenzen der österreichischen Macht im Reich auf, während Preußen in den 1780er Jahren immer noch fürchtete, von Österreich angegriffen zu werden. Darüber hinaus schreckten die Reichsstände zwar vor dem Kaiser zurück, scheuten aber auch die preußische Alternative. Die österreichischen Beziehungen zum Reich während dieser Phase werden meist unter dem Gesichtspunkt des Konflikts zwischen Josephs Politik als Herrscher von Österreich seit dem Tod von Maria Theresia 1780 und seiner Rolle als Kaiser betrachtet, aber dieser Kontrast erscheint zu extrem. Offenbar erwog Joseph 1784 ernsthaft eine Abdankung, als es so aussah, als könne er einen Tausch Bayerns gegen die Niederlande zuwege bringen. 2 Das Scheitern seiner Pläne hielt die Verknüpfungen Österreichs mit dem Reich jedoch weitgehend aufrecht. Wie bei früheren Epochen lässt sich kaum eine klare, durchgängige Grenze zwischen österreichischen und imperialen Interessen ziehen. Joseph verfolgte Ziele, die das Reich zu bedrohen schienen, während Kaunitz sich um eine Wieder-
480
IV. · Das Reich von Karl VII. bis Leopold II. (ca. 1740–1792)
belebung der traditionellen Reichspolitik bemühte. In der vieldeutigen, nicht immer kompatiblen Politik zeigte sich teilweise auch die Sprunghaftigkeit und Unüberlegtheit des Kaisers. Sie spiegelte jedoch auch etwas Grundsätzliches wider. Der Kaiser und Österreich wurden im Regensburger Reichstag von diversen unterschiedlichen Agenten vertreten: dem kaiserlichen Prinzipialkommissar, dem österreichischen und dem böhmischen Gesandten. Die kaiserliche Politik wurde durch verschiedene Kanäle vermittelt: vom Kaiser direkt, durch den Reichsvizekanzler und durch den Mainzer Kurfürsten, neben anderen. Die Entwicklungen in Süddeutschland zwischen den frühen 1750er und den frühen 1770er Jahren sind ein gutes Beispiel für die Spannung zwischen österreichischen und Reichsinteressen. Im Rahmen der umfassenden Reform der österreichischen Territorien nach dem Frieden von Aachen richtete sich die Aufmerksamkeit auch auf die drei Ballungen habsburgischer Territorien in Süddeutschland: den Breisgau, die Landvogtei Schwaben (»österreichisches Schwaben«) und Vorarlberg. 3 1752 wurden sie der Grafschaft Tirol entzogen; an die Stelle des Innsbrucker Guberniums trat eine neue Administration, die 1759 von Konstanz nach Freiburg verlegt wurde, wo sie infolge der französisch-österreichischen Allianz von 1756 sicherer war. 1780 umfassten sie etwa 8.535 km 2, mehr als Württemberg (8.000 km 2), aber mit lediglich 400.000 Einwohnern (Württemberg: 650.000). 4 Wie alle habsburgischen Länder waren diese Territorien vom Kreissystem ausgenommen. Weil sie so zersplittert waren und viele Prälaten und Reichsritter der Region neben den »unmittelbaren« Besitztümern, die sie direkt unter dem Kaiser hielten, auch Ländereien unter habsburgischer Oberlehnsherrschaft besaßen, hatte Österreich Interesse an einer Vertretung im schwäbischen Kreis. Dies wurde durch den Zugewinn der kleinen Grafschaft Hohenems (1765) erreicht; weitere Kreisstimmen kamen durch den Erwerb von Fugger-Kirchberg (1775) und Montfort-Tetnang (1780) hinzu. Zugleich verstärkten Landkäufe führender österreichischer Adelsfamilien den österreichischen Einfluss. Das Ziel dieser im Wesentlichen administrativen Veränderungen war es, eine kohärentere und produktivere Einheit zu konsolidieren und so weit wie möglich abzurunden, die nun erstmals offiziell Vorderösterreich hieß. Für das Verhältnis zu den lokalen Korporationen und dem schwäbischen Adel hatte das heftige Konsequenzen. Die Rechte der drei Ständegruppen wurden eingeschränkt. Alle Städte erhielten neue Verfassungen und unterstanden nun regionalen Autoritäten, neue Stadträte wurden ernannt. Im Rahmen einer Peraequation oder Neuverteilung der Steuerlast zur Erhöhung der Einkünfte der hoch verschuldeten Wiener Machthaber wurden etwa Steuern für die Besitztümer schwäbischer Prälaten und Reichsritter erhöht. 1766 wurden auch dem schwäbischen Kreis hohe Abgaben auferlegt, inklusive Sonderzahlungen der Besitzer von Ländereien, die den Habsburgern unterstanden, was einen Konflikt nach sich zog, der erst 1774 gelöst werden konnte.
45. Joseph II. und die große Reformdebatte (ca. 1778–1790)
Der Preis des Modernisierungsschubs war die Entfremdung einer der loyalsten Gruppen kaiserlicher Klienten im Kern des alten Reichs. Das Bild ist jedoch unvollständig ohne drei weitere Aspekte. Erstens ärgerten sich die niederen süddeutschen Reichsstände zwar über den habsburgischen Territorialismus, verließen sich aber bei Verschuldung und Disputen nach wie vor auf die Hilfe des Kaisers. Die Region war eine von denen, in denen der Reichshofrat am aktivsten war, um Herrscher und Korporationen vor aggressiven Fürsten und vor den lautstarken Forderungen von Kreditoren zu schützen. Zweitens mag der Adel durch seine Behandlung verprellt worden sein, viele seiner Untertanen jedoch spendeten den Reformbemühungen des Kaisers Applaus. Als Joseph nach 1780 als Alleinherrscher mit Agrarreformen und Ähnlichem so richtig in Schwung kam, zeigte sich der Kontrast zwischen »moderner« Regierung und den altmodischen Methoden traditioneller Herrscher in seiner ganzen Schärfe. Drittens gelang es entscheidenden Institutionen wie dem Hofgericht Rottweil und dem schwäbischen Landgericht Altdorf in Weingarten ebenso wie dem schwäbischen Kreis selbst, ihre Rechte gegen die habsburgischen Reformen zu verteidigen. 5 Auch hier stieß die Macht der Habsburger an ihre Grenzen. Die Unruhe, die die habsburgische Politik regional verursachte, übertrug sich durch Josephs Politik als Kaiser nach 1776 auf das Reich insgesamt. Seine Unzufriedenheit mit dem Reichstag leistete dessen vollständiger Lähmung für fast fünf Jahre ab 1780 Vorschub. 6 Der Disput war trivial und typisch. Die Reichsgrafen hielten sechs kollektive Kuriatstimmen im Reichstag: normalerweise drei katholische und drei protestantische. Seit 1648 hatte sich die protestantische Mehrheit unter den westfälischen Grafen in eine katholische Mehrheit verwandelt. Ursprünglich übten die katholischen und protestantischen Abgeordneten die Reichstagsstimme gemeinsam aus, seit 1702 wechselten sie sich ab. 1778 waren die Katholiken dran, aber der protestantische Graf Alexander von Neuwied nahm die Sache selbst in die Hand. Kurz darauf kam es im fränkischen Kreis zu einem ähnlichen Streit, der sich schnell zu einer weiteren allgemeinen Kontroverse über die Rechte der Konfessionen und das Prinzip der Parität auswuchs. Beide Seiten benahmen sich, als wäre dies eine große konstitutionelle Krise; zu einer Lösung kam es erst 1784, als sich eine Gruppe katholischer und protestantischer Fürsten gegen den ausdrücklichen Wunsch des Kaisers auf einen Kompromiss einigte. 7 Josephs Sabotage des Reichstags war einer der Faktoren, die Kaunitz’ Bemühungen um eine neue, konstruktive Politik im Reich nach dem Frieden von Teschen 1779 zunichtemachten. Diese Politik, die Maria Theresias Einverständnis fand und nach ihrem Tod weitergeführt wurde, zielte darauf ab, die Demütigung der kaiserlichen Krone durch das Scheitern der Übernahme Bayerns wettzumachen. Als Erstes sollte für neue Präsenz in der Reichskirche gesorgt werden, was durch die Wahl von Erzherzog Max Franz zum Koadjutor mit Nachfolgerecht im
481
482
IV. · Das Reich von Karl VII. bis Leopold II. (ca. 1740–1792)
Erzbistum Köln gelang. Der zweite Schritt zielte strategisch auf den Reichstag: Es ging darum, die katholischen Stände zu einen, die protestantischen zu spalten und das Corpus Evangelicorum und das noch nicht vollständig organisierte Corpus Catholicorum durch ein einziges Corpus zu ersetzen, das die Glaubensspaltung überwinden und die konfessionelle Politik beenden sollte. Die festgefahrene Situation im Reichstag machte diese Politik unmöglich. Was als kühner Aufbruch begann, endete in wenig mehr als einer Lektion in Schadensbegrenzung. In unzähligen kleinen Punkten verprellte Joseph weiterhin die traditionellen kaiserlichen Klienten und untergrub die informellen Netzwerke, auf denen die kaiserliche Macht traditionell gründete. 8 So schaffte er etwa im Januar 1782 sämtliche Pensionen im Reich ab. Hunderte von Empfängern wurden in tiefe Armut gestürzt oder waren zumindest verbittert über den kapriziösen Geiz des Kaisers, viele wurden in die Arme der preußischen Abgeordneten getrieben und der Verlust an Wohlwollen war beträchtlich. Dem Kaiser schien bei seinen Reformen nichts heilig: 1787 schlug er offenbar ernsthaft vor, den Reichshofrat, das wichtigste kaiserliche Einflussinstrument im Reich, abzuschaffen, um Geld zu sparen. Selbst Initiativen zur Wiederbelebung kaiserlicher Vorrechte sorgten für Unmut, wenn ihr einziges Ziel darin bestand, Protégés zu fördern und Geld aufzubringen. Dazu zählte die Reaktivierung des Rechts eines neu gewählten Kaisers, nach seiner Wahl den ersten Pfründner in kirchlichen Institutionen zu ernennen (Recht der ersten Bitte oder preces primariae). 9 Für Empörung sorgte 1781 die Neubelebung der Panisbriefe (auch litterae panis oder Laienherrpfünde) – des Rechts, eine kirchliche Stiftung zu verpflichten, einen bedürftigen Laien auf Lebenszeit zu unterstützen, zuletzt vorgeschlagen in den 1720er Jahren von Friedrich Karl von Schönborn, damals aber nicht umgesetzt. 10 In dem neuen Klima bedeutete »bedürftiger Laie« nur allzu oft einen alles andere als notleidenden kaiserlichen Beamten, ein Mitglied des Hauses HabsburgLothringen oder eine der Patentöchter von Amts wegen der Kaiserin-Königin. Hundertdreiundvierzig solche Anordnungen wurden zwischen 1781 und 1783 verschickt. Als die Äbtissin von Adersleben im preußischen Halberstadt im Februar 1783 eine davon erhielt, leitete sie sie einfach an den König von Preußen weiter. Sein energischer Protest in Wien schürte die wachsende Entrüstung vieler vor allem in Norddeutschland und bestärkte seine Rolle als Verteidiger der Rechte der Adligen gegen einen tyrannischen Kaiser. Andere Initiativen warfen grundlegende Fragen zur Zukunft des Reichs auf. Das bedeutete, dass Kaunitz’ Plan selbst bei einem normalen Funktionieren des Reichstags kaum durchzusetzen gewesen wäre. Zum einen waren viele katholische Fürsten der Reichskirche durch Josephs Versuche einer Reorganisation der Diözesengrenzen verprellt, was sich durch die bayerische Politik noch verschärfte. Zweitens trieben Josephs Versuche, sich Bayern anzueignen, von 1777 und 1784
45. Joseph II. und die große Reformdebatte (ca. 1778–1790)
viele protestantische und einige katholische Fürsten in die Opposition. Diese beiden Aspekte erfordern eine nähere Betrachtung. Die Reform der Diözesengrenzen war typisch für die Art von Maßnahmen, die große deutsche Territorialfürsten schon seit dem 15. Jahrhundert im Schilde führten. Als Fürsten des Reichs waren die deutschen Bischöfe Territorialherrscher wie andere Fürsten auch. Als Bischöfe indes waren sie für viel größere Gebiete verantwortlich, die in die Ländereien benachbarter weltlicher Fürsten hinein und darüber hinaus reichten. Dabei ging es nicht nur um kirchliche Aufsicht und Seelsorge. Da ihre tatsächlichen Territorien normalerweise sehr klein waren, holten sich die Fürstbischöfe einen beträchtlichen Teil ihrer Einkünfte gern aus ihren Diözesen. Josephs eigene Ländereien etwa lagen in den Diözesen von nicht weniger als zehn Fürstbistümern des Reichs. Zwei Drittel der Diözese Passau lagen in Ober- und Niederösterreich; Salzburg war eine weitere wichtige Präsenz. Die relativ neuen österreichischen Bistümer Wien und Wiener Neustadt hingegen, beide im späten 15. Jahrhundert gegründet, hatten nur kleine Diözesen. Joseph behandelte das Problem unumwunden. 11 Im Fall der Bistümer außerhalb des Reichs, etwa Krakau, hatte er den Tod des Amtsinhabers genutzt, um Grenzen neu zu ziehen und jeglichen Besitz auf habsburgischem Territorium schlicht zu konfiszieren. Als er dasselbe jedoch mit deutschen Bistümern versuchte, waren die Folgen katastrophal. 1783 nutzte er den Tod des Passauer Bischofs, um Teile der Passauer Diözese den neu geschaffenen österreichischen Diözesen Linz und St. Pölten einzuverleiben. In diesem Fall konnte sich Joseph durchsetzen und einen offenen Konflikt vermeiden, obwohl die protestantischen Kurfürsten anboten, die Sache des Passauer Domkapitels im Reichstag zu unterstützen. Mit den anderen deutschen Bistümern tat er sich weniger leicht. 1785 weigerte sich der Erzbischof von Salzburg rundweg, eine Verkleinerung seiner Diözese zu akzeptieren. Die Bischöfe von Regensburg und Freising taten es ihm später gleich. Dass Josephs Politik so begrenzten Erfolg hatte, schreckte ihn nicht ab. Er arbeitete weiterhin Pläne aus, bot Verhandlungen an, verkündete hin und wieder per Dekret die Begradigung der einen oder anderen Grenzlinie. Die Gewinne waren minimal, die politischen Konsequenzen hingegen tiefgreifend, da er systematisch einige der wichtigsten Unterstützer der Habsburger im Reich verprellte. Die zur gleichen Zeit vom bayerischen Kurfürsten betriebene Politik verschärfte die Situation und sorgte für ein weiteres Problem. 12 Auch er wollte seine Territorien den sieben fürstbischöflichen Diözesen entziehen, zu denen sie gehörten, und ein territoriales Kirchensystem errichten. Einige seiner Beamten wollten noch weiter gehen als Joseph und sämtlichen kirchlichen Besitz in Bayern säkularisieren. Anläufe zur Beschneidung der Rechte der Bischöfe zogen ab den späten 1770er Jahren eine Reihe von Konflikten nach sich. Dass es kein bayerisches Lan-
483
484
IV. · Das Reich von Karl VII. bis Leopold II. (ca. 1740–1792)
desbistum gab, führte 1784 zu dem Vorschlag, in München eine päpstliche Nuntiatur einzurichten. Das Ergebnis war somit eine eher unwahrscheinliche Allianz zwischen München und Rom: Der Heilige Stuhl hoffte, mit der Nuntiatur gegen die allzu unabhängigen deutschen Erzbischöfe und Bischöfe seine Autorität über die Kirche zu bewahren; der Kurfürst von Bayern betrachtete die Nuntiatur als eine Art Landesbistum unter anderem Namen, das die Kirche in all seinen bayerischen und pfälzischen Territorien (auch Jülich und Berg am Niederrhein) konsolidieren würde. Potenziell waren die Rechte von nicht weniger als achtzehn deutschen Bischöfen bedroht. 13 Schon das hätte genügt, die fürstlichen Köpfe der Reichskirche aufs Höchste zu alarmieren. Ihre Reaktion auf diese Bedrohung und Josephs vorgeschlagene Grenzreformen war jedoch auch geprägt von wichtigen Entwicklungen innerhalb der deutschen Kirche seit den 1760er Jahren. Auch hier sorgte das Ende des Siebenjährigen Kriegs für eine Reformbewegung. Die Fürstbischöfe fürchteten eine drohende Säkularisation, die Karl VII. in den frühen 1740er Jahren vorgeschlagen hatte und seitdem ein wiederkehrendes Thema preußischer Planspiele war. Zudem verbreitete sich die Ansicht, die deutschen Katholiken hätten Nachholbedarf im Bereich Bildung, besonders auf dem Feld des Reichsrechts, das protestantische Autoren seit 1648 dominierten. Manche gelangten zu der Überzeugung, es sei an der Zeit, die Reichskirche auf Reichsrecht zu gründen, statt am Primat des kanonischen Rechts festzuhalten. Das hätte der deutschen Kirche ermöglicht, den Westfälischen Frieden offiziell anzuerkennen, ihre Standpunkte in der Reichspolitik wirkungsvoller zu vertreten und sich gegen die Drohung der Säkularisierung zu verteidigen. Und es hätte die Kritik aus Rom hinfällig gemacht, päpstliche Eingriffe in deutsche Kirchenwahlen beschränkt und die Autorität des päpstlichen Nuntius in Köln geschmälert. Ein wichtiger Impuls zu dieser Reformbewegung kam von den akademischen Reformen, die die Schönborn-Bischöfe von Würzburg und Bamberg in den 1720er Jahren eingeleitet hatten. 14 Die Ausrichtung der Reichskirche am Reichsrecht unternahmen Johann Caspar Barthel in Würzburg ab 1727 und in den 1740er Jahren Georg Christoph Neller in Trier. Sie fand ihren Höhepunkt in Barthels maßgeblichen Opera juris publici ecclesiastici ad statum Germaniae accommodata (Werke des öffentlichen kirchlichen Rechts, angepasst an den Staat Deutschlands, 1765), die sofort zum Standardwerk wurden. Diese neue Art des Denkens über die Reichskirche ergänzte der insgesamt eher politisch ausgerichtete Trierer Kleriker Johann Nikolaus von Hontheim 1763 mit seinem umfangreichen Traktat De statu ecclesiae et legitima potestate Romani pontificis (Über den Rang der Kirche und die rechtmäßige Macht der römischen Oberpriester) unter dem Pseudonym Justinius Febronius. Sein Werk bekräftigte die
45. Joseph II. und die große Reformdebatte (ca. 1778–1790)
Rechte der deutschen Bischöfe, bestritt, dass der Papst mehr als ein primus inter pares war, und argumentierte, nationale Kirchen könnten nur von nationalen Konzilen konstituiert und reguliert werden. Der zugrunde liegende Anspruch von Hontheims Werk war, die deutschen Christen wieder zu vereinen und die durch die Reformation aufgebrochenen Gräben zu schließen. Die Reichskirche zu reformieren und vor allem Roms Griff zu entziehen, so glaubte er, sei der erste Schritt, um die deutschen Protestanten zu einer Rückkehr zu bewegen. 15 Hontheims Werk wurde von Rom umgehend verdammt. Unter Protestanten stieß es auf wenig Interesse und die grundlegende Agenda einer Wiedervereinigung war unrealistisch, da sie auf der Annahme beruhte, die deutschen Protestanten würden sich von der Reformation und ihrer gesamten folgenden Geschichte distanzieren, um sich erneut der Autorität katholischer Bischöfe zu unterwerfen. Auch Joseph II. zeigte kein Interesse, seine Rolle als Advocatus ecclesiae geltend zu machen, um eine solche Reform der deutschen Kirche anzuführen. Im Gegenteil lieferten Hontheim und Barthel dem Kaiser und dem bayerischen Kurfürsten Argumente, die deren eigene Bestrebungen territorialer Kontrolle über die Kirche bestärkten. Hontheims Ideen wurden zuerst von den Erzbischöfen von Mainz, Trier, Köln und Salzburg aufgegriffen und auf einer Konferenz in Koblenz 1769 diskutiert, um Mittel zu erwägen, die jüngsten Initiativen des Kölner Nuntius abzuwehren, die in ihren Augen ihre Rechte und Privilegien beeinträchtigten. Verschärft wurden ihre Probleme dadurch, dass sie die Bischöfe generell nicht konsultieren wollten.Was ihnen am meisten Sorgen bereitete, waren Angelegenheiten, von denen sie glaubten, sie griffen widerrechtlich in ihre Autorität als Metropoliten ein; diese wiederum stellten die meisten Bischöfe infrage, die unter dem Aspekt einer rein episkopalen Doktrin die Autorität von Metropoliten ebenso verneinten wie die von Päpsten und Nuntien. Als Reformbewegung erreichte der Febronianismus in den 1770er und frühen 1780er Jahren wenig. Der bayerische Vorschlag zur Errichtung einer Nuntiatur in München gab ihm zeitweilig neuen Aufschwung. Bemerkenswerterweise unterstützte Joseph zunächst den Protest der Erzbischöfe. Möglicherweise wollte er verhindern, dass sich Mainz dem Fürstenbund anschloss, vielleicht wollte er auch selbst mit Salzburg über Diözesangrenzen verhandeln oder einfach Bayern ausbremsen. Mitleid mit den Erzbischöfen hatte er sicherlich nicht. Sie beriefen sodann eine weitere Konferenz in Ems 1786 ein, auf der ein Plan zur Reform der Reichskirche formuliert und in einer Punctatio dargelegt wurde, der ein Programm zur seelsorgerischen Erneuerung und Maßnahmen zum Schutz vor Rom und weltlichen Herrschern umfasste. So beeindruckend die Punctatio auch war, Wirkung zeigte sie kaum. 16 Die Bischöfe lehnten sie ab, weil sie den Erzbischöfen zu viel Macht verlieh. Der Mainzer Erzbischof selbst distanzierte sich 1787 davon, der Erzbischof von Trier 1790.
485
486
IV. · Das Reich von Karl VII. bis Leopold II. (ca. 1740–1792)
All diese Beratungen und die Flut an Pamphleten, die sie nach sich zogen, trugen wenig zur Steigerung des Ansehens der Reichskirche im Reich allgemein bei. 1786 löste die Ankündigung eines Aufsatzwettbewerbs durch den Fuldaer Kanoniker und Regierungsbeamten Philipp Anton von Bibra, Herausgeber des aufgeklärten Journals von und für Deutschland, eine umfangreiche Diskussion aus. Wieso waren kirchliche Territorien nicht mit den besten Regierungen gesegnet, wo ihre Herrscher doch gewählt wurden? Lag der Fehler bei den Herrschern oder in ihrer grundlegenden inneren Verfassung? 17 Viele Autoren meinten, die Antwort sei einfach: Die Kirchenterritorien seien ein Anachronismus, die einzige Reform, der man sie unterziehen solle, sei die Säkularisation. Derweil hatte sich das Thema der Kirchenreform, wenn auch in etwas dürftiger Weise, mit der gleichzeitigen Reaktion überwiegend protestantischer Fürsten auf andere Bereiche der von Joseph verfolgten Politik verknüpft. Auslöser waren Josephs Bemühungen der Jahre 1777–1779 und 1784, Bayern an sich zu reißen. Die zweite dieser Initiativen führte 1785 zur Gründung des Fürstenbunds. 18 Die Idee eines solchen Bündnisses war nicht neu. Das Reich blickte auf eine lange Geschichte regionaler und konfessioneller Selbstverteidigungsbünde zurück, manche mit dem Kaiser gegen regionale oder auswärtige Feinde, andere gegen den Kaiser. 19 Der Westfälische Friede ließ diese ausdrücklich zu, solange sie sich nicht gegen das Reich selbst richteten. Was also war anders am Fürstenbund und weshalb wird er so oft als Beleg für den bevorstehenden Untergang des Reichs herangezogen? Die traditionelle Geschichtsschreibung sah ihn schlicht unter dem Gesichtspunkt des österreichisch-preußischen Konflikts: als Zeichen der Zunahme von Macht und Führungspotenzial Preußens, Beweis für Josephs Verrat am Reich, Symptom des Dualismus, der angeblich das Reich zerstörte. Die Wahrheit ist weniger geradlinig. Die Idee eines solchen Bundes war schon 1764 erörtert worden; 1772 und 1779 wurde sie erneut aktuell. Ursprüngliches Ziel war die Gründung einer Union zum Schutz der Interessen jener, die abseits der österreichisch-preußischen Rivalität standen. Niedere Fürsten wie Markgraf Karl Friedrich von Baden, Herzog Karl August von Sachsen-Weimar und Graf Franz von Anhalt-Dessau entwickelten das Konzept einer dritten Partei in der deutschen Politik. Wie das Weimarer Geheime Consilium, dem Goethe angehörte, im Februar 1779 festhielt, wollten sie, dass »eine mit andern neutralen, sowohl protestantischen als catholischen, Höfen zu treffende Verbindung während des jetzigen Kriegs gleichsame einen Part mitoyen formirte, welcher sich dahin vereinigte, die Zudringlichkeiten und Bedrückungen der Krieg führenden Mächte durch dargegen gemeinschaftlich zu nehmende Maas-Regeln von sich abzuhalten.«. 20 Über die folgenden Jahre zeigte sich jedoch, dass es wenig Einigkeit gab, wie ein solcher Bund zu bilden war und wer ihn führen sollte. Manche bevorzugten Hannover, aber Georg III. war abge-
45. Joseph II. und die große Reformdebatte (ca. 1778–1790)
neigt; die meisten lehnten eine preußische Führung ab, nicht zuletzt, weil sie Preußen für ebenso bedrohlich hielten wie Österreich. Abgesehen von dem allgemeinen Ziel, die Reichsverfassung zu bewahren und ihre eigenen Rechte als Fürsten des Reichs zu sichern, gab es kaum Konsens, ob der Bund irgendwelche weiteren Ziele verfolgen sollte, etwa die Verteidigung der Rechte des Herzogs von Zweibrücken als mutmaßlichen bayerischen Thronfolgers. Diese Punkte wurden geklärt, verlagerten sich aber, als der Kaiser 1784 seinen zweiten Anlauf auf Bayern startete. Immer mehr setzte sich die Erkenntnis durch, dass das Reich gegen den Kaiser selbst verteidigt werden musste; das war Wasser auf die Mühlen der preußischen Administration. Indem er seine bayerischen Pläne derart blindwütig verfolgte, spielte Joseph Friedrich dem Großen direkt in die Hände und schwächte seine eigene Position im Reich noch mehr. Da Georg III. es weiterhin ablehnte, einen Bund der »Blockfreien« zu führen, ergriff Friedrich die Initiative umso eifriger, weil er von einer solche Allianz eine Lösung für seine eigene Isolation in der imperialen und europäischen Politik erhoffte. Die niederen Fürsten betrachteten die Entwicklung mit Sorge. Der radikale Satiriker Ludwig Wilhelm Wekhrlin brachte die Sache 1784 auf den Punkt: »Der König in Preußen ist gegenwärtig der einizge Fürst, sagt man, welchem die mindermächtigen Reichsstände ihre Freiheit und ihr Schiksal mit Grund anvertrauen können. Gut! Diß verdient unsere Verehrung. Aber das Haus Oesterreich ist die einzige Macht, die sich den Vergrößerungen der Krone Brandenburg entgegen sezen kann, wann solche dem teutschen Reich gefährlich werden wollten. Ist diß eine minder erhebliche Betrachtung?« 21 Das Dilemma der niederen Fürsten verschärfte sich, als Friedrich der Große mit den Kurfürsten von Hannover und Sachsen ein Abkommen schloss. Offizielles Ziel war die Verteidigung des Reichs und seiner Institutionen und der Schutz der Rechte und Besitztümer aller Reichsstände. Gegen Brüche der Reichsverfassung sollte sofort vorgegangen werden. Geheimklauseln verpflichteten die Mitglieder, Josephs Pläne zur Übernahme Bayerns und andere »territoriale Tauschvorhaben oder Säkularisationen oder Teilungen von deutschen Kirchenterritorien« mit politischen Mitteln zu durchkreuzen, wenn nötig aber auch mit militärischer Gewalt. 22 Zudem verpflichteten sie sich, weitere Mitglieder anzuwerben, vor allem unter den niederen Fürsten. Über das folgende Jahr schlossen sich elf Fürsten an. Der größte Coup war der Beitritt des Mainzer Kurfürsten am 18. Oktober 1785, aber die Hoffnung, weitere Kirchenfürsten würden ihm folgen, zerschlug sich. Bald stellte sich Ernüchterung ein. Preußen verlor das Interesse, da es 1786 mit Großbritannien eine antiniederländische Allianz schloss, die seine Isolation zu beenden versprach. Die Gespräche liefen fieberhaft weiter. Die Wahl des bekannten Reformers Karl Theodor von Dalberg zum Koadjutor in Mainz im Juni 1788 und sein folgender Beitritt zum Fürs-
487
488
IV. · Das Reich von Karl VII. bis Leopold II. (ca. 1740–1792)
tenbund wurden von vielen als Triumph verbucht. In Wahrheit aber war der Fürstenbund zu diesem Zeitpunkt so gut wie erledigt (auch wenn er sich noch bis 1791 dahinschleppte und nie offiziell aufgelöst wurde). Die Kurfürsten hatten das Interesse daran verloren; die Fürsten fühlten sich verraten, konnten jedoch allein nichts ausrichten. Tatsächlich wollten die meisten gar nicht wirklich viel erreichen. Dalbergs Observations sur la Ligue von Juli 1787 versuchten den Fürstenbund mit dem patriotischen Eifer von Friedrich Karl von Mosers Nationalgeist-Traktat zu erfüllen. Seine Vorschläge zum Besten des Deutschen Reiches, die er im August 1787 dem Kaiser nach Wien schickte, enthielten einen umfassenden Plan zur Erneuerung des Reichs mit einem Reformprogramm in Einklang mit den Reformdiskussionen der 1490er und 1640er Jahre. 23 Sein Ausgangspunkt war die Gründung eines Bundes, dem der Kaiser und die Fürsten angehören sollten. Seine Ideen stießen jedoch in beiden Lagern auf wenig Begeisterung. Der letzte Versuch von Dalberg und Karl August von Weimar, die Zustimmung zu einer Visitation des Reichskammergerichts zu erlangen, wurde von den übrigen Mitgliedern abgelehnt. In anderen Worten: Sie erfuhren die gleiche Reaktion wie Joseph II., als er zwanzig Jahre zuvor versucht hatte, sie zur Zustimmung zu einer ebensolchen Bestandsaufnahme zu bewegen. Zwar erreichte der Fürstenbund nichts Konkretes, seine Auswirkungen waren dennoch signifikant. 24 So gut wie jeder politische Kommentator trug zu der außerordentlich weitläufigen öffentlichen Debatte über den Bund und seine Implikationen bei. Nie zuvor hatte irgendein politisches Thema so viele Hunderte von Pamphleten und Artikeln hervorgebracht. Unter den Protagonisten des Bundes waren die führenden Publizisten der Zeit, etwa der Historiker Johannes von Müller, der mit Darstellung des Fürstenbundes (1787) und Deutschlands Erwartungen vom Fürstenbunde (1788) programmatische Schriften vorlegte. Die Tätigkeit des Fürstenbunds regte den damals beim Herzog von Weimar angestellten Herder an, einen neuen Anlauf zur Gründung einer deutschen Akademie zu starten.25 Auf kaiserlicher Seite war Christoph Ludwig Pfeiffer die wichtigste Figur mit dem herausragenden Werk Der teutsche Fürstenbund: Noli me tangere! Staatsrechtlich durchs politische Fernglas betrachtet (1786). Beide Seiten sahen sich als Befürworter der »deutschen Freiheit«, aber die Debatte nahm nun eine überraschende Wendung, die den Einfluss der modernsten libertären Ideen auf das Reich in seiner letzten Phase widerspiegelt. Die Propaganda des Bundes lebte größtenteils von den traditionellen Themen des protestantischen Konstitutionalismus, verbunden mit dem neuen Denken über ein Gleichgewicht der Mächte und die Freiheit der Staaten gemäß den Gesetzen der Natur und der Nationen. »Deutsche Freiheit« war in diesem Sinn die Freiheit der Fürsten, deren wachsames Auge auf die imperiale Verfassung sie vor habsburgischer Tyrannei bewahrte.
45. Joseph II. und die große Reformdebatte (ca. 1778–1790)
In Wien hingegen verstand man unter »deutscher Freiheit« nun die Freiheit des Volkes, die von der Tyrannei der Fürsten unterdrückt wurde. Diese Sichtweise ging auf die Schriften von Johann Heinrich Gottlob von Justi aus den 1760er Jahren zurück, die statt der alten Vorstellung gemeinsamer Freiheiten der Stände die neue Idee einer Freiheit individueller Bürger als letztliches Staatsziel postulierten. 26 Beide Seiten stellten den Freiheitsbegriff der jeweils anderen infrage und die Forderungen radikalisierten sich im Verlauf der Debatte, obwohl es in Wirklichkeit allen schlicht darum ging, die eigenen Machtforderungen zu untermauern. Keine Seite war daran interessiert, der Logik der eigenen Argumente bis zu einem Punkt zu folgen, an dem das alte Reich in etwas ganz Neues verwandelt würde: eine föderale Union beziehungsweise eine auf Volkssouveränität gegründete Monarchie. Diese nationalpatriotische Debatte markierte den Höhepunkt der Herrschaft Josephs II. als heilig-römischer Kaiser. Seine Reichspolitik indes lag mittlerweile in Trümmern. Als Herrscher war er bedrängt von Problemen, auf die er keine Antwort hatte und die größtenteils direkt von seiner eigenen Politik herrührten. Die Intervention des Reichs zur Niederschlagung des Aufstandes gegen den Fürstbischof von Lüttich 1789 ging nicht auf den Kaiser zurück, sondern im Wesentlichen darauf, dass der Bruder des Kaisers, Kurfürst Max Franz von Köln, als Direktor des Westfälischen Kreises und einer von vielen Herrschern, die sich durch die Rebellion gefährdet sahen, die Initiative ergriff. Tatsächlich hatte sich Max Franz von Wien distanziert und glaubte: »Der eigentliche Grund für die Krise im Reich liegt in dem Verfassungskonflikt zwischen meinem kaiserlichen Bruder und dem Reich. Solange mein Bruder sein System dem Reich gegenüber nicht ändert, wird das Reich nie zur Ruhe kommen.« 27
Anmerkungen 1
2 3
4 5
6 7
Karl Theodor von Dalberg (* 1744, † 1817) wurde 1787 zum Koadjutor ernannt und 1802 Kurfürst von Mainz; danach war er ab 1806 Fürstprimas des Rheinbunds, ab 1810 Großherzog von Frankfurt und ab 1814 Erzbischof von Regensburg. Aretin, Heiliges Römisches Reich I, 13 f., und II, 101–107. Quarthal, »Vorderösterreich«, 21–27, 47–55; Kulenkampff, Österreich, 68–73; Press, »Schwaben«, 69–73; Reden-Dohna, »Reichsprälaten«, 85–91; Press »Vorderösterreich«, 36–41. Quarthal, »Vorderösterreich«, 25. Die Gerichtshöfe in Rottweil und Weingarten waren Überbleibsel aus dem Mittelalter mit sorgfältig gehüteter Bedeutung als regionale Berufungsgerichte. Zwei weitere Gerichte gleichen Ursprungs in Ansbach und Würzburg unterstanden mittlerweile der Rechtsprechung des Markgrafen von Brandenburg-Ansbach bzw. des Würzburger Erzbischofs; vgl. Conrad, Rechtsgeschichte II, 167–170. Aretin, Altes Reich III, 217–225. Ebd., 208 f., 218, 225 f.
489
490
IV. · Das Reich von Karl VII. bis Leopold II. (ca. 1740–1792)
8 Aretin, Heiliges Römisches Reich I, 15 ff. 9 Feine, »Erste Bitten«, 97–101. 10 Dickel, Reservatrecht, 16 f., 48 f., 93 ff., 155 ff.; Reden-Dohna, »Laienpfründen«, 162–166; vgl. zur früheren Geschichte dieser kuriosen Institution Dickel, Reservatrecht, 135–154. 11 Gnant, »Diözesanregulierung«. 12 Aretin, Altes Reich III, 233 f., 241 f., 253–257, 287–292. 13 Wo nicht anders gekennzeichnet, beruhen die folgenden Passagen auf den umfangreichen Darstellungen in Aretin, Heiliges Römisches Reich I, 375–427, und Aretin, Altes Reich III, 226–292. 14 Vgl. S. 208 ff. 15 Klueting, »Wiedervereinigung«. 16 Blanning, Reform, 220–225. 17 Andermann, »Geistliche Staaten«, 601–605. 18 Wo nicht anders gekennzeichnet, beruhen die folgenden Passagen auf: Aretin, Heiliges Römisches Reich I, 164–218; Aretin, Altes Reich III, 299–330; Burgdorf, Reichskonstitution, 256–351; Gagliardo, Reich, 66–98; Umbach, Federalism, 161–187. 19 So etwa der prokaiserliche Schwäbische Bund (1488–1534), der antikaiserliche Schmalkaldische Bund (1531–1547) und die zahlreichen anderen in diesem Werk besprochenen Bündnisse. 20 Flach, Goethes Amtliche Schriften, Bd. 1, S. 50; vgl. auch Umbach, Federalism, 165. 21 Stievermann, »Fürstenbund«, 224. 22 Kohler, »Reich«, 90. 23 Burgdorf, Reichskonstitution, 323–338. 24 Die jüngste umfassende Darstellung bietet Burgdorf, Reichskonstitution, 256–351; hilfreich sind auch Gagliardo, Reich, 80–98, und Umbach, Federalism, 161–187. 25 Dann, »Herder«, 334; Blanning, Culture, 258. 26 Burgdorf, Reichskonstitution, 300 f. 27 Aretin, Altes Reich III, 356; vgl auch Aretin, Heiliges Römisches Reich I, 218–229, und S. 406 f.; vgl. zu Reaktionen auf Josephs Tod Engel-Jánosi, »Josephs II. Tod«.
46. Restauration: Leopold II. (1790–1792)
»E
uer Majestät müssen unverzüglich von sich Begriffe eines gerechten, billigen, mäßigen, von gefährlichen Absichten ganz entfernten, empfindungsund freundschaftsfähigen [Monarchen] gegen alle anderen Souveräne und Staaten von Europa geben.« 1 Den Rat, den der neunundsiebzigjährige Kaunitz für ihn aufsetzte, bekam Leopold II. nie zu hören, aber es war ein guter Rat und tatsächlich handelte der neue Kaiser danach. Seine Herrschaft war von kurzer Dauer; er starb am 1. Mai 1792 nach kaum siebzehn Monaten auf dem Thron. In der kurzen Zeit gelang es ihm jedoch, das Reich wieder auf sicheren Kurs zu steuern. In fünfundzwanzig Jahren als Großherzog der Toskana hatte Leopold das Schicksal seines Territoriums umgestaltet und sich als wichtigster italienischer Reformer der Aufklärung im 18. Jahrhundert etabliert. Als heilig-römischer Kaiser verfolgte er ebenso neuerungsträchtige Ansätze. Im Januar 1790 hatte er an seine Schwester Marie Christine geschrieben: »Je crois que le souverain, même héréditaire, n’est qu’un délégué et employé du peuple pour lequel il est fait … ; que le pouvoir exécutif es dans le souverain, mais le législatif dans le peuple et ses représentants …« (»Ich glaube, dass der Souverän, selbst der erbliche, nur der Delegierte des Volkes ist, für das er bestellt ist … ; daß die ausübende Gewalt dem Souverän, die gesetzgebende aber dem Volk und seinen Vertretern zusteht …« 2 Diesen Prinzipien als Kaiser zu folgen, hätte zu außerordentlichen Ergebnissen führen können. Es ist wohl müßig, zu spekulieren, ob dieser höchst fähige Mann das Reich retten oder es so reformieren und umwandeln hätte können, dass es das 19. Jahrhundert überstanden hätte. Das Ausmaß dessen, was er erreichte, lässt diese Frage dennoch aufkommen und macht es schwer, seine Herrschaft als irrelevant für den unaufhaltsamen Ablauf der Ereignisse zu erachten, der so oft als charakteristisch für die Entwicklung des Reichs zu seinem angeblich unausweichlichen und unrühmlichen Untergang herangezogen wird. Leopolds erste Herausforderung war, überhaupt zum Kaiser gewählt zu werden. Als Joseph II. starb, drohte ein neues Interregnum. 1787 hatte ein radikaler Pamphletist gefragt: Warum soll Deutschland einen Kayser haben?, und gemeint, das kaiserliche Amt sei ein unnötiger Anachronismus, den man enden lassen solle. 3 Die Kurfürsten und Fürsten zeigten keine Neigung, so weit zu gehen, als sie von Josephs Tod erfuhren, wollten jedoch eine gründliche Diskussion darüber, welche
492
IV. · Das Reich von Karl VII. bis Leopold II. (ca. 1740–1792)
Art von Kaiser ihm folgen sollte. Zwei Themen erlangten unmittelbare Bedeutung und standen im Zentrum einer Debatte, die die konstitutionellen Kontroversen der letzten Jahre wieder aufgriff. Zum einen warf das Interregnum erneut die Fragen auf, die nach dem Tod Karls VI. 1740 debattiert worden waren. 4 Sachsen und Bayern-Pfalz machten sofort ihre Rechte als Reichsvikare geltend und unternahmen Schritte zur Verwaltung des Reichs. Gegen viele ihrer Forderungen wandte sich der Kurfürst von Mainz, der als Erzreichskanzler auf seinem Recht bestand, die Durchführung der Kaiserwahl in Angriff zu nehmen. Die übrigen Kurfürsten blieben zurückhaltend, wollten indes sicherstellen, dass ihre eigenen Rechte als Kurfürsten nicht dadurch beeinträchtigt wurden, dass die Reichsvikare für sich in Anspruch nahmen, als »Vikarii des Kaisers aber nicht als Reichsstände« zu wirken. Die Fürsten standen den Ansprüchen der Reichsvikare und der Kurfürsten skeptisch gegenüber und teilten die 1790 in einem anonymen Pamphlet zum Ausdruck gebrachte Ansicht, das Deutsche Reich sei »eine aristokratische und souveräne Republik« der »auf dem Reichstag versammelten Reichsstände«. 5 Diese Sichtweise wiederum beantwortete die Kernfrage, ob der Reichstag nach dem Tod des Kaisers überhaupt weiterarbeiten konnte oder ob man ihn nicht auflösen und nach der Wahl neu konstituieren sollte. Zweitens betrachteten viele das Interregnum als Möglichkeit zu einer neuen Diskussion der kaiserlichen Wahlkapitulation, zur Formulierung der lange geplanten ständigen Kapitulation und zu ihrer Einführung als Grundgesetz des Reichs vor der nächsten Krönung. 6 Damit sollten dem nächsten Kaiser die Hände gebunden werden. Wäre es nach den lautstärksten Befürwortern dieser Richtung gegangen, wäre der Kaiser kaum mehr gewesen als ein primus inter pares, ein konstitutioneller Monarch mit kaum unabhängiger Macht. Wie 1740 Johann Jacob Moser um Unterstützung gebeten wurde, konsultierte man nun gelehrte Größen wie Johann Stephan Pütter aus Göttingen und Johann Ludwig Klüber aus Erlangen. Viele andere steuerten in einer Flut von Pamphleten und Artikeln in Zeitungen und Zeitschriften ihre Meinung bei. Da man sich nicht einig wurde, wer das Recht hatte, ein so grundlegendes Gesetz zu verfassen, wurde weder 1790 noch nach Leopolds Tod 1792 etwas beschlossen, die Debatte setzte sich jedoch bis Mitte der 1790er Jahre fort. Die Leopold II. vorgelegte Wahlkapitulation betonte schlicht das Recht der Reichsstände, an der Formulierung sämtlicher kaiserlicher Dekrete teilzuhaben, und sprach dem Kaiser das Recht ab, ohne deren Zustimmung im Reich Geld einzutreiben und Truppen auszuheben. Was die Wahl selbst anbelangt, gab es schon 1788 erste Gerüchte und Absprachen. 7 Manche setzten sich für den bayerisch-pfälzischen Kurfürsten Karl Theodor ein. Andere meinten, Karl Theodor habe sich mit dem Debakel des bayerischen
46. Restauration: Leopold II. (1790–1792)
Tauschprojekts diskreditiert und sein mutmaßlicher Erbe, der Herzog von Zweibrücken, sei der bessere Kandidat, aber nur falls er zum Zeitpunkt der Wahl bereits Kurfürst in München sei. Die durch die Zusammenlegung Bayerns und der Pfalz 1777 vakant gewordene neunte Kurwürde besetzten einige im Geist bereits mit dem protestantischen Haus Hessen-Kassel, wodurch ein ungefähres Gleichgewicht von vier protestantischen und fünf katholischen Kurfürsten entstanden wäre. 8 Joseph II. starb zu früh, um solche Szenarien umzusetzen. Zudem kamen zu Beginn des Interregnums neue Gerüchte auf, Preußen strebe nach der Kaiserkrone, was manche in Erregung, viele andere jedoch in Furcht versetzte. 9 Mainz, Hannover und Sachsen beschlossen bald, Leopold sei der einzige plausible Kandidat. Bis Ende September einigte man sich und am 9. Oktober wurde Leopold gekrönt. Einen Großteil seiner Energie musste Leopold sofort Problemen der österreichischen Länder widmen: den Aufständen in den österreichischen Niederlanden und Ungarn, der Unzufriedenheit der österreichischen Stände, dem Konflikt mit den Türken. Die Brände zu löschen, die Josephs radikal-aufklärerische Reformen der 1780er Jahre und seine Außenpolitik entfacht hatten, stand ganz oben auf der Tagesordnung. Im Reich waren die Ziele des neuen Kaisers eindeutig: erstens dem Haus Habsburg den Kaiserthron zu sichern und zweitens den Fürstenbund aufzulösen. 10 Der zweite Plan war zum Zeitpunkt seiner Wahl schon ziemlich weit fortgeschritten. Sein Treffen mit Friedrich Wilhelm II. in Reichenbach im Juli 1790 war der Beginn einer bemerkenswerten Phase der Kooperation zwischen Österreich und Preußen. 11 Preußens Wunsch, seine Isolation zu überwinden, war hierfür ein wesentliches Motiv. Es ist nicht klar, was Leopold II. im Sinn hatte: echte Versöhnung mit Preußen als Grundlage einer neuen Reichspolitik oder nur ein taktisches Manöver, das seinen Zweck erfüllt hätte, sobald die habsburgische Position im Reich vollständig wiederhergestellt war? Jedenfalls setzte sich die Phase der Entspannung fort und führte zur Konvention von Pillnitz 1791 und zur österreichisch-preußischen Defensivallianz im Februar 1792. Beides waren Reaktionen auf die Entwicklungen in Frankreich, die sich in jenen Jahren auf zweierlei Weise auf das Reich auswirkten. 12 Zunächst schaffte die französische Nationalversammlung am 4. August 1789 alle Zehntabgaben in Frankreich ab, auch im Elsass. Sieben Monate später wurden speziell im Elsass sämtliche verbliebenen feudalen Besitzrechte abgeschafft. Zweitens verschärfte sich die Empörung über diese Vorgänge durch die Ankunft der ersten Auswanderer in den westlichen Territorien des Reichs, adliger Flüchtlinge, die nur zu gern ihre Geschichten von Gesetzlosigkeit und Anarchie erzählten. Wie wir noch sehen werden, überschattete die Debatte darüber, wie das Reich auf die Ereignisse in Frankreich reagieren sollte, Leopolds Herrschaft. 13 Vor diesem Hintergrund ist die Haltung des Kaisers signifikant, insofern sie auf seine Einstellung zur Monarchie allgemein schließen lässt. Anfangs reagierte
493
494
IV. · Das Reich von Karl VII. bis Leopold II. (ca. 1740–1792)
Leopold auf die Revolution eher begeistert als angewidert. Sein persönlicher Glaube an Verfassungen und Rechtsstaatlichkeit, ausführlich dargelegt in einem Brief an seine Schwester Marie Christine vom 25. Januar 1790, machte ihn anfällig für das, was er wie viele andere als notwendigen Reformprozess in Frankreich betrachtete. 14 Von den Fähigkeiten seines Schwagers Ludwig XVI. hielt er wenig, hoffte aber dennoch auf dessen Vernunft. Leopold war nicht geneigt, seiner Schwester Marie Antoinette oder dem Grafen von Artois, dem inoffiziellen Führer der französischen Emigranten, Gehör zu schenken. Selbst sein Rundschreiben von Padua vom 6. Juli 1791, das an die europäischen Monarchen appellierte, den französischen König zu unterstützen, beruhte auf der Annahme, Ludwig selbst werde mit vernünftigen Verfassungsreformen einverstanden sein. 15 Bis Ende Januar 1792 blieb Leopold unwillig, einen Krieg gegen Frankreich zu erwägen. Diese Haltung stützte Kaunitz, der eher pragmatisch glaubte, der Umsturz in Paris werde Frankreich als dominierende Macht in Europa beseitigen. Selbst als sich die Sache zuspitzte, widersetzte sich Leopold einer Intervention. Die ständigen Klagen des Reichstags zwangen Wien, den Abzug der französischen Armee von der Westgrenze des Reichs, die Rückgabe aller enteigneten Besitztümer, auch von Avignon und Venaissin an den Papst, sowie Freiheit und Sicherheit für den König zu fordern. 16 Als Ludwig XVI. am 15. Februar 1792 antwortete, ein Zurück zum Status quo ante sei unmöglich, aber Frankreich wolle weiter über Entschädigungen verhandeln, stellte Reichsvizekanzler Fürst Franz Gundaker von Colloredo-Mansfeld vertraulich fest, ein Krieg sei unvermeidlich. Leopold indes teilte Paris am 17. Februar lediglich mit, er hoffe auf Mäßigung, und äußerte sein Mitgefühl für den unglücklichen Zustand Frankreichs. Sein Mitleid stieß in Paris auf Entrüstung. Leopolds überraschender Tod am 1. März 1792 warf jedoch alle Berechnungen über den Haufen. In seiner Trauerpredigt für den verstorbenen Kaiser am 22. April 1792 beklagte Georg Christian Bocris, der lutherische Pfarrer der kleinen Gemeinde Neukirchen und Odensachsen im Norden des Fürstbistums Fulda, die vielen Kinder, die ihren Vater verloren hatten. 17 Der Kaiser, erklärte er, sei für die Einheit des Reichs eingestanden, habe alle Christen darin beschützt und es beherrscht, wie Hiskija über Juda geherrscht habe; er habe dazu beigetragen, den »Geist der Unruhe und Empörung in dem Reich der Franken« aus dem Reich herauszuhalten. Was Deutschland jetzt brauche, sei die schnelle Wahl seines Sohnes Franz, des nächsten Nachkommen der steirischen Dynastie der Habsburger, die dem Reich sechs Kaiser in 174 Jahren geschenkt habe. 18 Entsprach Bocris’ Lobpreisung Leopolds II. in irgendeiner Weise der Wirklichkeit? Die Frage berührt erneut die Bedeutung des österreichisch-preußischen Dualismus und seiner Folgen, wenn überhaupt, für den Untergang des Reichs. Die österreichisch-preußische Wiederannäherung der Jahre nach 1790 ist oft als zeit-
46. Restauration: Leopold II. (1790–1792)
weilige Abweichung von der allgemeinen Entwicklung dargestellt worden. Sie ließe sich jedoch auch als weitere Variante des Dualismus deuten und sie unterstreicht die positiven Seiten der Machtstruktur im Reich. Der wachsende Wunsch der Fürsten, ihre Unabhängigkeit oder Souveränität geltend zu machen, und die anhaltende konfessionelle Spaltung im Reich machten jeden Versuch der Wiederherstellung der traditionellen feudalen Rolle des Kaisers und der Schaffung einer Einheit von »Kaiser und Reich« so gut wie aussichtslos. Kaiserliche Berater in Wien beklagten dies ab den 1760er Jahren beständig und zerbrachen sich den Kopf, wie man eine Einheit wiederherstellen konnte, die in ihren Augen verloren war. 19 Den Schuldigen all ihrer Probleme sahen sie meist in Preußen. Aber im Grunde benahmen sich Preußen und Österreich gleich und hielten sich mit ihrem gegenseitigen Argwohn in Schach. Ansonsten hätte Österreich möglicherweise die österreichischen Länder und einen großen Teil von Süddeutschland oder Preußen so viel wie möglich von Norddeutschland vom Reich abgetrennt. In beider Hinsicht spielten das Reich selbst sowie seine zahlreichen anderen Angehörigen und Institutionen eine Schlüsselrolle beim Ausbremsen solcher Versuche. Der protestantische preußische König bildete zudem ein natürliches Gegengewicht zum katholischen Kaiser und dem katholischen Erzreichskanzler. 20 Der Dualismus war die machtpolitische Manifestation des Paritätsprinzips und überbrückte die konfessionelle und die Nord-Süd-Spaltung im Reich. Dass ein solches Reich hätte weiterbestehen können, ist denkbar. Selbst die Integration kleinerer Territorien in größere Nachbarländer oder die Säkularisierung der Reichskirche hätte dieses System nicht zwangsläufig zerstört, ebenso wenig wie die großen Säkularisierungen im 16. Jahrhundert das Reich zerstört hatten. Hätten Österreich und Preußen das Reich einfach unter sich aufteilen sollen? Die Geschichte Deutschlands nach 1815 lässt dies nicht naheliegend erscheinen. Das Ende war 1792 nicht unvermeidlich.
Anmerkungen 1 2 3 4
5 6 7 8
Mikoletzky, »Leopold II.«, 282 f. Wandruszka, Leopold II., II, 217. Gagliardo, Reich, 99 ff. Burgdorf, Reichskonstitution, 352–383; Burgdorf widmet sich auch der weiteren Debatte zu diesem Thema nach dem Tod Leopolds II.; nützlich ist hierzu auch Gagliardo, Reich, 98– 113; vgl. zudem S. 423–427. Burgdorf Reichskonstitution, 370 und 371. Burgdorf, Reichskonstitution, 384–443. Aretin, Altes Reich III, 361–370. Pelizaeus, Aufstieg, 404–441.
495
496
IV. · Das Reich von Karl VII. bis Leopold II. (ca. 1740–1792)
9 Duchhardt, Kaisertum, 304–308. 10 Wie im Fall von Franz I. haben die Biografen Leopolds II. seiner Rolle als Kaiser wenig spezifische Beachtung geschenkt. Das Standardwerk, auf dem weitere volkstümliche Darstellungen beruhen, ist immer noch Wandruszka, Leopold II.; II, 249–383, befasst sich mit seiner Zeit als »König und Kaiser«. 11 Vgl. S. 464 ff. 12 Die beste Darstellung zu diesem Komplex bietet Härter, Reichstag, 69–166. 13 Vgl. S. 648–653. 14 Wandruszka, Leopold II., II, 215–218. 15 Schroeder, Transformation, 90. 16 Aretin, Altes Reich III, 387 f. 17 Polley, »Dorftrauer«, 164–175; vgl. auch Hattenhauer, Wahl, 81 f. 18 Polley, »Dorftrauer«, 174; er rechnete von der Thronbesteigung Ferdinands II. 1619 an und überging den Bayern Karl VII. und Franz I. (aus dem Haus Lothringen). 19 Haug-Moritz, »Krise«, 78 ff. 20 Stievermann, »Fürstenbund«, 225.
47. Zentrale und mittlere Institutionen des Reichs
D
ie Frage der Funktionsfähigkeit und -weise des Reichs zwischen etwa 1740 und 1806 lässt sich nicht einfach unter Verweis auf das Problem des Dualismus und der größeren Machtstrukturen im Reich beantworten. Ebenso wichtig ist die Leistung der Gerichtshöfe und der Kreise. Der Umfang ihrer fortdauernden Arbeit und deren weiterreichende Wirkung geben Aufschluss über populäre Sichtweisen des Systems und sein »Ausgreifen« in die deutsche Gesellschaft. In den vorangegangenen Abschnitten spielten diese Institutionen eine große Rolle; ein paar generelle Bewertungen sind hier angebracht. Trotz wiederkehrenden Klagen über Reichskammergericht und Reichshofrat in politischen Streitigkeiten scheinen beide bis zum Ende effektiv funktioniert zu haben. 1 Obwohl die Reformen Josephs II. größtenteils scheiterten, arbeiteten die Höfe nach den 1770er Jahren eher noch besser. Der Prozess der Juridifikation kann um die Mitte des Jahrhunderts als abgeschlossen betrachtet werden: Gewalttätige Konfliktlösungen waren extrem selten geworden, der normale Weg war der juristische. Beide Gerichte hatten mit Tausenden von Prozessparteien zu tun; eine Vertrauenskrise aufseiten potenzieller Kläger scheint es nicht gegeben zu haben. Zwischen 1765 und 1790 landeten etwa 10.000 Fälle beim Reichshofrat in Wien, an denen etwa 4.000 circa 8.000 Personen (Einzelne und Gruppen) niederer sozialer Herkunft beteiligt waren. In der gleichen Zeit waren schätzungsweise etwa 7.000 Personen niederer sozialer Herkunft an Fällen beim Reichskammergericht in Wetzlar beteiligt. 2 Klagen von Untertanen gegen ihre Herrscher standen dort weiterhin regelmäßig auf der Tagesordnung und wurden nach 1789 sogar noch signifikanter. Dies war den Richtern bewusst, und vieles deutet darauf hin, dass sie auf das veränderte Klima im Zuge der Französischen Revolution reagierten, indem sie ihre eigene Position als Schlichter und Garanten der Stabilität im Reich auszuweiten versuchten. 3 Ebenso wichtig waren adlige Kläger, die den Reichshofrat zur Beilegung dynastischer Streitigkeiten über Erbe oder Vormundschaft und zur Abhilfe von Schuldenkrisen nutzten, wodurch dem Gericht eine fortdauernde Rolle in der regionalen Stabilisierung zukam. Die sieben Linien der ernestinisch-sächsischen Herzöge in Thüringen (Weimar, Gotha und andere) etwa standen während der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts fast ständig in Korrespondenz mit dem Wiener Gericht. 4 Manche Kritik an den Gerichten beruht auf mangelndem Verständnis ihrer
498
IV. · Das Reich von Karl VII. bis Leopold II. (ca. 1740–1792)
Prozeduren und ihrer Rolle im imperialen System. Gemessen an modernen hohen Gerichten oder Berufungsgerichten waren sie natürlich langsam und inkompetent. Im Vergleich mit deutschen hohen Gerichten des 19. und frühen 20. Jahrhunderts arbeiteten sie unerhört zufriedenstellend. Es ist allerdings nicht klar, ob sie sich sehr von anderen europäischen höchsten Gerichten des 18. Jahrhunderts unterschieden. 5 Was Zugang und Effektivität angeht, scheinen sie besser als einige gewesen zu sein. Dass Verfahren langsam vorangingen, zeigt, wie wichtig es war, kein rasches Urteil, sondern ein akzeptables Resultat für lange Zeit zu erreichen. Letztlich war der Prozess oft wichtiger als das Urteil. Die meisten Verfahren waren langwierig und viele wurden nie abgeschlossen, nicht zuletzt weil die Kläger selbst die Klagen fallen ließen. Der entscheidende Punkt war oft nicht das abschließende Urteil, sondern die Entscheidung, überhaupt vor Gericht zu gehen. Im Hinblick auf die Stabilität des Reichs war es unendlich günstiger, den rechtlichen Weg einzuschlagen als zu unmittelbarer Gewalt zu greifen. Ein Prozess unterwarf beide Parteien gemeinsamen, einvernehmlichen Regeln, die ein direktes Vorgehen einer Seite unter Strafe stellten. Als lokale oder regionale Nachbarn hatten die Auftraggeber im Allgemeinen ein eigennütziges Interesse, ihre Streitigkeiten in Verhandlungen beizulegen. Langwierige Konsultationen, Korrespondenz und die Aushandlung des Wortlauts von Einigungen entschärfte Konflikte und sorgte oft für Ergebnisse, die alle Parteien akzeptierten und die keine Anhörung vor einem zentralen Gerichtshof erreichen konnte. Konsultation als Mittel zur Vermeidung überstürzter Entscheidungen – das »Schieben auf die lange Bank«, wie man diese Praxis nannte, war zudem in vielen Streitigkeiten ein effektives gerichtliches Instrument. Ein günstiges Urteil gab einem Kläger einen Trumpf in die Hand, löste aber nicht zwangsläufig das Problem, wenn sein Gegner es nicht anerkannte. Die Durchsetzung fiel oft schwer, nicht zuletzt, wenn die damit Beauftragten mit dem Urteil nicht einverstanden waren. Gleichzeitig aber wollten es die meisten Herrscher und Autoritäten vermeiden, vor Gericht bloßgestellt zu werden, was ebenfalls ein Ansporn zu konstruktiven Gesprächen und Kompromissen war. Die zweite große Institution, die eine Brücke zwischen dem Reich und den Ortschaften bildete, war der Kreis. 6 Das Kreissystem hatte sich ungleichmäßig entwickelt; im Süden und Westen des Reichs blieb es tätig, im Norden weniger. Selbst im Norden aber blieben die ursprünglichen Funktionen des Kreissystems, regionale Friedenssicherung und die Umsetzung der Urteile der höheren Gerichte, wichtig. Diese Gebiete erlebten jedoch nicht die für die Entwicklung des Systems in anderen Landesteilen typische Diversifikation der Kreisfunktionen. In manchen Fällen wurden die ursprünglichen Funktionen der Anwendung imperialer Statuten auf Polizei oder die Arbeit der Gilden nun erweitert zu einer zunehmend vielfältigen und anspruchsvollen regionalen Wirtschafts- und Sozialpolitik.
47. Zentrale und mittlere Institutionen des Reichs
Das Gesamtbild ist uneinheitlich. Von den zehn ursprünglichen Kreisen hatten fünf als solche im 18. Jahrhundert keine Funktion mehr, da diese nun von Territorialfürsten ausgeübt wurden, die damit ihre Unabhängigkeit geltend machen wollten und ihre prinzipielle Abneigung zum Ausdruck brachten, Anordnungen aus Wien entgegenzunehmen. Die Wirkung war jedoch dieselbe, da sie ihre Politik im Reich allgemein durchsetzen wollten. Der burgundische Kreis war ab 1648 nicht mehr Teil des Reichs und kehrte 1716 in Form der Österreichischen Niederlande, deren Bestand als Kreis manche infrage stellten, nur teilweise zurück. Auch der österreichische Kreis war effektiv redundant geworden, da er zum Großteil aus habsburgischen Territorien bestand, die nicht dem Reich angehörten (die kleineren Fürstbistümer Trient und Brixen spielten kaum eine Rolle). Im obersächsischen Kreis herrschte eine etwas ungleiche Balance zwischen Preußen und Sachsen; da beide gemeinsame regionale Aktivitäten mit niederen Fürsten scheuten, wurde der Kreis als solcher jedoch kaum aktiv. Ebenso übernahmen im niedersächsischen Kreis die Territorialfürsten alle potenziellen Aufgaben des Kreises. Kreisaktivitäten gab es dennoch, sie beschränkten sich jedoch auf Korrespondenz, Gespräche über die gemeinsame Politik und gemeinsame Reaktionen auf spezifische Probleme wie Wirtschaftskrisen, Seuchen und das beständige Problem der Landstreicherei. Der westfälische Kreis umfasste zahlreiche Territorien von Grafen und minderen Fürsten, seine Tätigkeit war jedoch paralysiert durch die Präsenz von Österreich und Preußen als Territorialherrschern; dort wirkte sich der Dualismus mit all seinen konfessionellen und pseudokonfessionellen Erscheinungsformen auf regionaler Ebene aus. In den anderen Kreisen, besonders den Vorderen Kreisen (im Süden und Westen gelegen und daher besonders gefährdet durch französische Angriffe), kam es Mitte des 18. Jahrhunderts zu weiteren Veränderungen. 7 Das langsame und nach 1756 vollständige Schwinden der französischen Bedrohung lockerte den Zusammenhalt unter diesen Kreisen und ihre Verbindung zur Krone. Franz I. gelang es nicht, den Bund, der von den 1650er Jahren bis in die 1730er Jahre die Verteidigung dieser Gebiete gegen französische Angriffe organisiert hatte, wiederherzustellen. 8 Andererseits scheinen die Kreise ihre Zusammenarbeit ohne direkte Eingriffe des Kaisers fortgeführt zu haben. Die aktive militärische Kooperation zwischen dem kurrheinischen Kreis und dem oberrheinischen Kreis setzte sich bis in die 1790er Jahre fort; dann wurden die gemeinsamen Streitkräfte der beiden Kreise durch einen Krieg von bis dahin nie dagewesenen Ausmaß überwältigt. 9 Auch andere Aktivitäten entwickelten sich. In manchen Fällen umfassten sie Kooperationen innerhalb des Kreises, in anderen Fällen kam es zu neuen Formen interregionaler Kooperation. Dass die meisten dieser Kreise aus einer Vielzahl kleinerer, zersplitterter Territorien bestanden, ist zweifellos signifikant, kann ihre anhaltende Aktivität aber nur zum Teil erklären. Auch der bayerische Kreis war von
499
500
IV. · Das Reich von Karl VII. bis Leopold II. (ca. 1740–1792)
zwei Territorialmächten dominiert – Bayern und Salzburg –, ihr Verhältnis war jedoch offenbar einigermaßen gut und stand ähnlichen Entwicklungen wie im schwäbischen und fränkischen Kreis nicht entgegen. 10 In den aktiven Kreisen gab es mehr oder weniger funktionierende Kreiszusammenkünfte (im 18. Jahrhundert im Allgemeinen jährlich), deren Teilnehmer untereinander korrespondierten; zudem unterhielten sie Kanzleien, Archive, Finanzämter und Münzprüfungsanstalten mit diversen zuständigen Beamten. Zu den Kreisversammlungen erschienen auch Gesandte aus Wien und von anderswo, etwa aus anderen Kreisen. Der schwäbische Kreis delegierte viele seiner Aufgaben und die Umsetzung in der Versammlung getroffener Beschlüsse an lokaler orientierte Institutionen namens Viertel mit jeweils eigenem Direktor und Verwaltungsapparat. Ab den 1750er Jahren arbeiteten der schwäbische und der fränkische Kreis im Straßenbau zusammen. 11 Der schwäbische Kreis, wohl der fortschrittlichste von allen, unternahm Anläufe zur Regulierung des Handels mit Getreide und anderen Gütern mit seinen Nachbarn, der Schweizer Eidgenossenschaft und Frankreich. Auch die Regulierung der Währung war ein beständiges Anliegen. Der bayerische Kreis arbeitete mit dem benachbarten schwäbischen wie fränkischen Kreis zusammen und bildete eine Art inoffizielle süddeutsche Währungsunion, die sich um Stabilität und feste, verlässliche Wechselkurse bemühte. 12 Auch im Oberrheinkreis betrieb man besonders aktive Währungspolitik; im 19. Jahrhundert entstand aus der Kooperation mit dem kurrheinischen Kreis eine weitere inoffizielle Währungsunion am Rhein. 13 Der kurrheinische Kreis und der Oberrheinkreis standen in ständiger Korrespondenz mit dem schwäbischen Kreis, und zwar in solchem Umfang, dass man von einem inoffiziellen Bund sprechen kann. 14 Aktiv wurden die meisten dieser Kreise zumindest in Ansätzen, entweder individuell oder in Zusammenarbeit mit ihren Nachbarn, was Landstreicherei und Armut anging; zudem unterhielten sie Haftanstalten und kümmerten sich unter anderem um Verbote der Abwerbung von Untertanen und der Ausfuhr von Edelmetallen, die Regulierung der Gilden sowie um Regulierung oder Verbot von Lotterien. 15 Ein kaiserliches Auswanderungsverbot von 1768 zeigte, dass das System wie beabsichtigt funktionierte: Der Kaiser erließ ein Dekret, die Kreise nahmen es entgegen; ihre Angehörigen, die Reichsstände, setzten es um; allerdings ist nicht bekannt, ob es Wirkung zeigte. 16 Ein noch auffälligeres Beispiel für die Aktivität der Kreise war die Reaktion der südlichen und westlichen Kreise auf die Nahrungskrise von 1770–72: Rigorose Regulierung des Getreidehandels, Kontrolle der Brotpreise und Bemühungen um die Sicherstellung der Versorgung der Kommunen mit Lebensmitteln trugen offenbar zur Linderung einer ansonsten möglicherweise katastrophalen Lage bei. 17 Anstatt zu verkümmern, florierten einige dieser Kreise bis in die 1790er Jahre. 18 Der
47. Zentrale und mittlere Institutionen des Reichs
fränkische Kreis unternahm sogar noch 1788 eine systematische Reform seiner Finanzorganisation und 1791 trat seine Versammlung zu einer dauerhaften Tagung zusammen. Der Hauptgrund hierfür war die neue Bedrohung durch Frankreich. Tatsächlich begann für die südlichen und westlichen Kreise in den frühen 1790er Jahren eine neue Phase militärischer und defensiver Aktivität. In Franken wurde sie untergraben, als Preußen als neuer Besitzer von Ansbach-Bayreuth (ab 1791) erst das Direktorat des Kreises für sich beanspruchte und ihn dann schwächte, indem es die Beteiligung Ansbach-Bayreuths an der Aufstellung von Truppen und anderen Belangen zurückzog. Die Effektivität des Kreissystems ist nach wie vor schwer zu beurteilen. Einerseits konnten die Aktivitäten der Kreise leicht durch politische Dispute unterbrochen und durch die Verweigerung einer wichtigen Regionalmacht sabotiert werden. Andererseits kommen immer mehr Belege für das Ausmaß der Kreisaktivitäten ans Licht. Natürlich heißt Aktivität nicht zwangsläufig Effektivität. Das kollegiale System mit seinen langwierigen Konsultationsmechanismen erstickte oft jede Initiative, die nicht aus aktuellem Anlass erforderlich war. Kein Kreis konnte das Problem der Landstreicherei je lösen. Die inoffiziellen Währungsunionen waren in keiner Weise mit der modernen Eurozone vergleichbar, keine Chaussee mit einer Autobahn. Der Graben zwischen Anspruch und Wirklichkeit war für Kreisbeamte ebenso weit wie für Regierungen überall in Europa. Offenbar spielten die Kreise im Gegensatz zur Sicht früherer Gelehrter jedoch eine Rolle; durch sie griff das Reich bis zu seinem Ende in die Regionen und Gemeinden hinein. Vor allem bestätigen die Aktivitäten der Kreise die Annahme, dass das Reich möglicherweise weitaus »gegenwärtiger« war, als viele Forscher annahmen. Belege für eine solche »Präsenz« sind schwer aufzutreiben und nicht leicht zu bewerten, aber die folgenden Fragen lassen das Ausmaß des zeitgenössischen Bewusstseins vom Reich im späten 18. Jahrhundert erahnen. Welche Wirkung hatten zum Beispiel die Gebete und Predigten, Kommemorationen und Feierlichkeiten zur Krönung und beim Tod von Kaisern, die regelmäßigen Gebete für den Kaiser ohne besonderen Anlass oder die Referenzen im Gottesdienst an Geburt, Heirat und Tod von Mitgliedern der kaiserlichen Familie? Solchen Praktiken ging man besonders eifrig in den Reichsstädten, den kleinsten Territorien und den Ländereien der Reichskirche nach, sie finden sich jedoch auch anderswo. 19 Noch 1835 ordnete der Herzog von Nassau eine dreimonatige Trauerzeit für das »ehemalige Reichsoberhaupt«, Franz I. von Österreich, an. 20 Im 18. Jahrhundert schaffte nur Friedrich der Große (im Juni 1750) die Gebete für den Kaiser ab, da diese ein »alter und dummer Brauch« seien, aber selbst er schien zu zögern, da er befahl, das Dekret stillschweigend umzusetzen, es jedoch ansonsten nicht groß publik zu machen. 21 Wie viele Menschen bekamen den Kaiser auf seinen langen Krönungsfahrten
501
502
IV. · Das Reich von Karl VII. bis Leopold II. (ca. 1740–1792)
und weiteren Reisen durch das Reich leibhaftig zu Gesicht? Wie viele trafen die vierundzwanzig Gesandten des Reichskammergerichts mit ihrem großen silbernen Amtsabzeichen auf ihren ständigen Dienstfahrten durch das Reich oder hatten geschäftlich mit ihnen zu tun? 22 Inwiefern trugen imperiale Symbole auf Gebäuden, Münzen, Briefmarken und Siegeln auf öffentlichen Urkunden dazu bei, das Gefühl zu stärken, Untertan des Reichs zu sein? Wie signifikant ist Wielands Erinnerung, er sei während seiner Jugend in der Reichsstadt Biberach »von Zeit zu Zeit« über seine Pflichten gegenüber dem Kaiser unterrichtet worden? 23 Wieso erinnerte der Stadtrat der kleinen Stadt Brakel im Fürstbistum Paderborn, die seit dem frühen 16. Jahrhundert keine Reichsstadt mehr war, seinen Herrscher in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts so beharrlich an deren früheren Status und warnte ihn, seine jetzige Autorität über die Stadt, die er prinzipiell nicht infrage stellte, unterliege den von der Verfassung des Reichs gesetzten Begrenzungen? 24 Und schließlich: Was bedeutete es für Einzelne, wenn sie ihre Anträge beim Reichshofrat in Wien mit Worten wie »Ich bin Untertan des Reichs unter dem Grafen von Reuß« einleiteten oder sich bei Joseph II. über den Herzog von Mecklenburg beschwerten, weil der Kaiser »der oberste Lehnsherr und Herrscher des ganzen deutschen Landes« sei? 25
Anmerkungen 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Sellert, »Reichsjustiz«. Noël, »Conscience«, 124 f. Sailer, Untertanenprozesse, 467–479; Härter, »Unruhen«, 97–103. Westphal, Rechtssprechung, 433–443. Scheurmanns (Hrsg.) »Frieden« enthält Aufsätze zu sechs anderen Ländern. Wenn nicht anders angegeben, beruht das Folgende auf der umfassenden Darstellung in Dotzauer, Reichskreise; einen aktuelleren Kurzüberblick zu den Kreisen bietet Müller, Entwicklung, 27–36. Vgl. S. 173 ff. Wilson, German Armies, 212 ff. Müller, Entwicklung, 173–276. Hartmann, Reichskreis, 498. Wunder, »Chausseebau«; Wunder, »Kaiser«; ders., »Chausseestraßennetz«. Hartmann, Reichskreis, 476 f. Müller, Entwicklung, 173–276; Schneider, Währungspolitik. Müller, »Beziehungen«. Endres, »Reichskreis«; Sicken, »Leitungsfunktionen«; vgl. zum interregionalen Umgang mit Landstreichern S. 583 ff. Wunder, »Emigrationsedikt«. Magen, Reichsexekutive; Schmidt, »Hungerrevolten«, 267–275. Vgl. auch S. 697 f. Berbig, »Kaisertum«; Whaley, Toleration, 179–185.
47. Zentrale und mittlere Institutionen des Reichs
20 21 22 23 24 25
Polley, »Dorftrauer«, 162. Feller, »Bedeutung«, 169. Mader, »Soldateske«. Noël, »Conscience«, 123. Ströhmer, »Landstädtisches Reichsbewusstsein«; Köbler, Lexikon, 83. These und weitere Beispiele bei Noël, »Conscience«, 129 ff.
503
48. Reich, Öffentlichkeit und Nation
D
ie Frage nach dem Verhältnis zwischen dem Reich und der Vorstellung einer »Nation« ist komplex und umstritten. Die Signifikanz des Reichspatriotismus in der deutschen Politik des 18. Jahrhunderts wurde oft bestritten; viele meinen, er habe gar nicht wirklich existiert. Dennoch ist es möglich, einige unverbindliche Aussagen zu der Bedeutung zu treffen, die viele gebildete Deutsche dem Reich beimaßen. Das Publikum an gebildeten und belesenen Deutschen wuchs im Lauf des Jahrhunderts beträchtlich. Es gibt keine verlässlichen Schätzungen zur Anzahl der Universitätsabsolventen nach etwa 1770, aber die gedruckten Medien – Bücher, Pamphlete und vor allem Zeitungen und Zeitschriften – erlebten einen explosionsartigen Aufschwung. Die Vielfalt an Veröffentlichungen war derart enorm, dass Rezensionszeitschriften, in denen Bücher und andere Zeitschriften besprochen wurden, zum wichtigen Genre wurden, das selbst hoch Gebildeten und Belesenen als Orientierungshilfe diente, da es schlicht nicht möglich war, die Fülle an Neuerscheinungen zu überblicken. 1 Das Ausmaß an Neuerungen und Veränderungen lässt die konservative Schätzung erahnen, dass in den 1790er Jahren etwa 200 deutsche Zeitungen mit 300.000 Exemplaren wöchentlich rund 3 Millionen Leser fanden (bei einer Gesamtbevölkerung von knapp 24 Millionen um 1800). Eine andere, auf der angenommenen Anzahl von etwa 80.000 gebildeten Lesern um 1700 beruhende Schätzung lässt vermuten, dass deren Anzahl bis 1800 auf 350.000 bis 500.000 stieg. 2 Die viel zitierte zeitgenössische Feststellung von Friedrich Nicolai, um 1780 habe es lediglich 20.000 gebildete Leser gegeben, erscheint vor diesem Hintergrund überaus konservativ. Nicolai dachte vermutlich hauptsächlich an literarische Leser. Wenn man das stetige Wachstum der territorialen Administrationen und die inflationäre Zunahme der Anzahl der an den diversen kaiserlichen Institutionen Beschäftigten während des Jahrhunderts berücksichtigt, muss der Markt für politisch-juristische Publikationen und für Bücher und Pamphlete zu praktischen Themen und aktuellen Entwicklungen größer gewesen sein. Wer was las und welche Wirkung es hatte, ist letztlich nicht festzustellen, aber die Zahlen liefern den breiten Hintergrund zum Verständnis der aufblühenden Literatur zum Reich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Diese Literatur umfasste das weiterhin wachsende Feld des öffentlichen Rechts, Handbücher zur universitären Ausbildung, Pamphlete und Kommentare zu aktuellen politischen,
48. Reich, Öffentlichkeit und Nation
insbesondere konstitutionellen und reformbezogenen Themen sowie Artikel in Zeitungen und Zeitschriften zu den gleichen Bereichen. Diese immer weitläufigeren Genres definierten das Reich als nationales System der Deutschen. Manche benutzten den Begriff »Staat«, etwa in Reichsstaat, andere die nunmehr eingeführten Begriffe Reichsverfassung und Reichssystem. Die komplizierte Terminologie geht auf die eigentümlichen Strukturen des Reichs zurück. Was gemeint war und dass die überwältigende Mehrheit der gebildeten Deutschen das Reich mit der »Nation« verband, stand jedoch außer Zweifel. Auch hier waren die Bedeutungen vielfältig. Zwei spezielle Denkweisen, die bereits in der Literatur früherer Generationen evident sind und in scharfem Gegensatz zueinander standen, setzten sich nun zunehmend durch. Auf der einen Seite standen die Verfechter einer Stärkung des Reichs, auf der anderen jene, die für die Rechte der Territorialherrscher stritten und teilweise das Reich insgesamt ablehnten. Tatsächliche Reformen wurden ausnahmslos von der Unnachgiebigkeit der Reichsstände verhindert, Meinungsverschiedenheiten über die Verfassung waren jedoch schon ab dem späten 15. Jahrhundert ein Merkmal der politischen Kultur des Reichs. Im frühen 17. Jahrhundert hatte die konstitutionelle Debatte zu Lähmung und Krieg geführt. Im 18. Jahrhundert wurde sie ein wesentlicher Bestandteil der Öffentlichkeit des Reichs. Erhalten blieben auch andere tiefe kulturelle und religiös-ideologische Gräben. Die Nord-Süd-Spaltung aus dem späten Mittelalter, die Differenz zwischen denen, die den Zentren des alten Reichs der Staufer nahe waren, und den Ferneren, gab es auf gewisser Ebene immer noch. Die jüngere konfessionelle Spaltung fiel nur teilweise mit der Nord-Süd-Differenz zusammen. Protestantische Gebiete waren über die Mitte und den Süden des Reichs verstreut und hauptsächlich lutherisch, allerdings gab es auch reformiert-calvinistische Inseln. Katholische Territorien erstreckten sich nordwärts bis zum Niederrhein und dann weiter nach Westfalen; das Fürstbistum Münster grenzte im Norden an das halb reformiert-calvinistische, halb lutherische Ostfriesland und das lutherische Oldenburg. Insgesamt waren Ende des 18. Jahrhunderts etwa 58,6 Prozent der 24 bis 25 Millionen Einwohner des Reichs katholisch, circa 40,4 Prozent protestantisch; Juden und andere bildeten das übrige eine Prozent. 3 Die Nord-Süd-Spaltung und Differenzen der konfessionellen Kultur spiegeln sich auch darin wider, dass in den 1780er Jahren etwa 70 Prozent aller deutschen Bücher im Norden des Reichs (30 Prozent allein in Halle und Leipzig) und nur 19 Prozent im Süden, 7 Prozent in Österreich und 3 Prozent in der Schweiz publiziert wurden. 4 Andererseits sagen diese Zahlen wenig über die geografische Verteilung dessen aus, was veröffentlicht wurde: Explizit katholische Werke wurden in den protestantischen Kerngebieten zweifellos kaum gelesen; in protestantischen Ge-
505
506
IV. · Das Reich von Karl VII. bis Leopold II. (ca. 1740–1792)
bieten erschienene Werke fanden hingegen spätestens in den 1770er Jahren weite Verbreitung im ganzen Reich. Nach dem Siebenjährigen Krieg wirkte sich die konfessionelle Spaltung nicht mehr so stark auf die Politik des Reichs aus. Während des Krieges selbst spielte Religion kaum eine Rolle, obwohl Friedrich der Große damit um Unterstützung warb und dabei an die Rhetorik des frühen 18. Jahrhunderts anknüpfte. Die Kontroversen über die Politik von Joseph II. und dem Fürstenbund in den 1780er Jahren waren zweifellos konfessionell geprägt, aber im Grunde ging es dabei nicht um Religion, sondern um kaiserliche Macht. Tatsächlich mündete der Fortschritt der katholischen Aufklärung in den 1760er und 1770er Jahren in eine Phase der echten Wiederannäherung zwischen Katholiken und Protestanten. Ein Produkt dieser Epoche war die erste katholische Darstellung der deutschen Geschichte von Michael Ignaz Schmidt (* 1736, † 1794). 5 Seine ab 1778 publizierte Geschichte der Deutschen stellte das Reich in den Mittelpunkt einer Erzählung, die den Fortschritt der Aufklärung und die Entwicklung der Nation umriss. Die Reformation, meinte er, sei zwar aus berechtigter Kritik an Missständen in der Kirche entstanden, stehe jedoch tatsächlich dem Reformprozess im Weg, indem sie konfessionelle Konflikte erzeuge; die katholischen Herrscher seien gerade erst dabei, aufzuholen. Schmidts Geschichte verzichtete auf Dogmatik und konzentrierte sich auf den Fortschritt der Aufklärung, zu dem alle deutschen Herrscher wesentlich beigetragen hätten. Sein Anspruch, eine Nationalgeschichte zu schreiben, die alle aufgeklärten Menschen ansprach, stieß bei manchen Protestanten auf Empörung. Karl Leonhard Reinhold (* 1757, † 1823), bekannt als Verbreiter von Kants Philosophie, suchte die Aufklärung als protestantisches Projekt zu reklamieren, indem er geltend machte, Luther selbst habe den ersten Schritt zur Gedankenfreiheit getan. Als Reinhold 1786 Schmidts Werk rezensierte, erschienen bereits Friedrich Nicolais negative Schilderungen seiner Reise durch das katholische Deutschland im Druck. 6 Das Wiederaufleben konfessioneller Polemik auf dieser Ebene konnte der bis zum Ende unbestrittenen praktischen Koexistenz im Reich jedoch nichts anhaben. Protestantische wie katholische Territorien waren sehr um die Loyalität ihrer Bürger und territorialen Patriotismus bemüht. Gleichzeitig entschärften jedoch zahlreiche Verbindungen zwischen den Territorien die Gefahr von Spaltung und Zerfall. Geografische Regionen, die sich in gewissem Maß, jedoch nicht gänzlich, mit dem Kreissystem deckten, bildeten ebenfalls größere Bestandteile des Reichs oder »Deutschlands«. Landkarten des 18. Jahrhunderts zeigten im Allgemeinen die Kreise und nicht das heillose Durcheinander kleiner und kleinster Territorien, das Publizisten des 19. Jahrhunderts so gern darstellten. 7 Gruppen von Territorien unter Herrschaft unterschiedlicher Linien derselben Dynastie wie die ernestinischsächsischen Herzogtümer in Thüringen teilten sich wichtige Institutionen und ei-
48. Reich, Öffentlichkeit und Nation
nige Gebiete und tauschten ständig Besitztümer aus, wodurch sie ebenfalls kleine politische Regionen bildeten. Ähnliche Aufgaben erfüllten die Gruppen von Territorien, die sich im Reichstag eine einzelne Stimme teilten (die Kuriatstimmen), durch regionale Verbände von Reichsgrafen, durch die Kreise und Kantone der Reichsritter und die familiären Netzwerke von Rittern und Grafen, die die Domkapitel der rheinischen Bistümer der Pfaffengasse dominierten. Die Reichspost, das Netzwerk der Universitäten, die kaiserlichen Gerichte, unzählige Korrespondenzen zwischen Fürsten, Städten, Beamten, Abgeordneten des Reichstags und der Kreise – all das trug zur Schaffung eines gemeinsamen Rahmens und einer öffentlichen Sphäre im Reich bei. Die Vielfalt und Komplexität stand dem Gefühl, einem größeren System anzugehören und dieses System mit der weiteren nationalen Gemeinschaft zu identifizieren, nicht entgegen. Man mochte unterschiedlicher Ansicht sein, was dessen gegenwärtigen Zustand und seine Zukunft anging, das schloss jedoch einen Sinn für Ort und Identität ebenso wenig aus, wie politische, konstitutionelle und regionale Differenzen in Ländern wie Großbritannien, Frankreich und den Niederlanden die Entstehung einer britischen, französischen und niederländischen Identität verhinderten. Die gedruckte Literatur des Reichs ist selbst als nationale Literatur zu betrachten, die kontinuierlich die Bedeutungen des imperialen Systems definierte und artikulierte. Auch in dieser Funktion trug sie einfach zur Entwicklung einer langen Tradition bei, in der das Reich die Nation definierte. 8 Im frühen 16. Jahrhundert lieferte das kaiserliche Sekretariat die Vorbilder für die deutsche Frakturschrift, die bis ins 20. Jahrhundert im Buchdruck gängig blieb. 9 Gesetze und Edikte des Reichs wurden fortan in Fraktur gedruckt. Im späten 16. Jahrhundert empfahl man Sammlungen von Gesetzen und Konstitutionen des Reichs als Vorbilder für gedruckte deutsche Prosatexte. Im 18. Jahrhundert war diese Literatur bereits so umfangreich und ständig entstand derart viel neues Material, dass immer mehr neue, vielbändige Sammlungen erschienen. Es folgten unweigerlich ebenso zahlreiche Handbücher, Kurzeinführungen und Auszüge daraus. 1774 unterstrich Herder die Bedeutung der urkundlichen Geschichte des Reichs als Quelle des Wissens zu den linguistischen und literarischen Ursprüngen der Deutschen, indem er die Werke von Melchior Goldast von Haiminsfeld empfahl, dem großen Sammler und Herausgeber solchen Materials des frühen 17. Jahrhunderts, der als einer der Ersten die deutsche Vergangenheit erhellt habe.10 Ab etwa 1770 kam es zu wichtigen neuen Entwicklungen in der Literatur zum deutschen öffentlichen Recht. Zuvor war dieses Gebiet von der Universität Halle dominiert gewesen, an der eine Masse oft parteiischer Werke entstand, die im Wesentlichen die protestantische und territoriale Interpretation der imperialen
507
508
IV. · Das Reich von Karl VII. bis Leopold II. (ca. 1740–1792)
Verfassung stützten. Neben dieser Tradition und weitgehend unabhängig davon war Johann Jacob Moser mit seinem dreiundfünfzigbändigen Teutschen StaatsRecht (1737–1754) als führende Autorität im Reich hervorgetreten. 11 Moser schrieb und sammelte bis zu seinem Tod 1785 eifrig weiter. Sein vierzigbändiges Neues Teutsches Staatsrecht (1766–1782), in dem er sein früheres Werk überarbeitete, erweiterte und aktualisierte, wurde bald ebenso unverzichtbar. Mosers Darstellung des Reichs als Produkt gesetzlicher Traditionen und Präzedenzentscheidungen, als im Lauf der Zeit auf einmalige Weise entstandenes feudales System, wurde nun jedoch immer mehr durch eine »modernere« Sichtweise des Reichs als in Göttingen entwickeltes System verdrängt, die insbesondere Johann Stephan Pütter vertrat, der dort von 1746 an fast sechzig Jahre lang lehrte. 12 Als Pütter mit knapp einundzwanzig Jahren zum außerordentlichen Professor berufen wurde, galt Göttingen bereits als modernste und fortschrittlichste deutsche Universität. Sie war 1737 eröffnet worden und profitierte von ihrer Lage in Hannover: Da der Herrscher in London weilte, konnten die Autoritäten in Hannover im territorialen Interesse relativ frei schalten und walten. 13 Der Gründer und erste »Kurator« der Universität, Gerlach Adolph von Münchhausen, erkannte die Chance, Jena und Halle, wo er selbst studiert hatte, zu übertrumpfen. Während sich deutsche Professoren meist regelmäßig über politische Einmischungen beschwerten, legte Münchhausen fest, dass die Lehrer in Göttingen völlige akademische Freiheit der Lehre und Forschung ohne externe Eingriffe genießen sollten. Seinen Versuch, führende Professoren abzuwerben, durchkreuzte Friedrich Wilhelm I., indem er Professoren in Halle untersagte, Angebote aus Göttingen anzunehmen, was der sächsische Kurfürst (für Leipzig und Wittenberg) und die ernestinischen Grafen (für Jena) umgehend nachmachten. Dennoch gelang es Münchhausen, die Elite der Professorenschaft von Halle zu gewinnen. Sein größter Coup war jedoch die Entdeckung des talentierten jungen Pütter, der in Marburg studiert hatte, während Wolff dort lehrte. Pütter etablierte sich bald als führender akademischer Experte für öffentliches Recht des 18. Jahrhunderts. Er schrieb fast hundert große Werke zu zahlreichen thematischen Aspekten. Das Interesse an seinen Schriften war so groß, dass sie zu seinen Lebzeiten insgesamt 849 Auflagen erlebten; sein Buch über die Historische Entwicklung der heutigen Staatsverfassung des Teutschen Reichs wurde sogar ins Englische übersetzt. Er wurde zum bedeutendsten deutschen Lehrer für öffentliches Recht. Seine Vorlesungen lockten Hunderte von Studenten aus dem ganzen Reich nach Göttingen, und anders als die Kollegen in Halle zog er auch eine signifikante Anzahl von Katholiken an. 1774 hatte Göttingen 894 Studenten, davon 563 im Rechtsfach, die zum Großteil seine Vorlesungen besuchten, denen regelmäßig mehr als 200 Studenten lauschten. So gut wie jede wichtige Gestalt der deutschen Politik im späten 18. Jahrhundert war zu seinen Füßen gesessen und
48. Reich, Öffentlichkeit und Nation
die meisten Verfassungsrechtler, die dieses Gebiet in den frühen Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts dominierten, waren seine Schüler. Pütter bot eine historische Darstellung der Genese des Reichs, verbunden mit einer klaren Erläuterung des systema imperii, die eine Analyse der Regierung und Administration des Reichs sowie eine Beschreibung seiner traditionellen feudalen Strukturen umfasste. Wie die Rechtshistoriker der Halleschen Schule und Moser betrachtete Pütter das Reich als einzigartiges, historisch entstandenes Gebilde. Um 1500 habe seine mittelalterliche Entwicklung mit der Umwandlung der zahlreichen individuellen Territorialrechte (iura territorialia) der Fürsten in ein einziges Territorialrecht (ius territorialis), das jeder von ihnen genoss, eine Wasserscheide erreicht. Dieses Recht der Fürsten war im Westfälischen Frieden, der somit die endgültige Form des Reichs einführte, offiziell bestätigt worden. Das so entstandene System, lehrte Pütter, sei weder widersprüchlich noch (wie Pufendorf meinte) »monströs«. Es lasse sich nicht nach anachronistischen aristotelischen Kriterien klassifizieren, sondern müsse an anderen zeitgenössischen Staaten in Europa gemessen werden. Diese unterteilte Pütter in einfache und zusammengesetzte Staatskörper und weiter in Monarchien und Republiken. Es gab ihm zufolge zwei Haupttypen von zusammengesetzten Gemeinwesen: erstens Assoziationen oder Föderationen wie die sieben niederländischen Provinzen und die dreizehn Schweizer Kantone, in denen jeder konstituierende Teil seine Souveränität unter internationalem Recht behalte, die jedoch auf bestimmten Gebieten eine gemeinsame Politik verfolgten, und echte Zusammensetzungen aus separaten Staaten, die nicht völlig unabhängig seien, sondern einer höheren Autorität oder obersten Macht unterstanden. Das Reich fiel klar in die zweite Kategorie, da es »einen aus mehreren besonderen Staaten zusammengesetzten, aber doch wieder einen Staat zusammen ausmachenden Staatskörper vorstellet«. Deutschlands historische Entwicklung sei individuell verlaufen, dennoch bleibe das Reich ein einheitlicher Staat, auch wenn es sich deutlich von Frankreich, Spanien und Großbritannien unterscheide. Der Unterschied manifestierte sich in der Tatsache, dass das Reich mehrere verflochtene Systeme öffentlichen Rechts hatte. Es gab ein System des öffentlichen Rechts für das Reich als Ganzes, das die Rechte und Pflichten des Kaisers wie des Reichs definierte und die generellen Prinzipien umfasste, die die Rechte und Pflichten der einzelnen Territorien definierten, die generell für sie alle galten. Dann hatte jedes Territorium sein eigenes System öffentlichen Rechts, das sich je nach lokalen und regionalen Traditionen unterscheiden mochte, aber insgesamt mit dem öffentlichen Recht des Reichs übereinstimmte. Von diesem Ansatz her entwickelte Pütter eine umfassende Analyse des Systems auf allen Ebenen. Der Kaiser genoss maiestas in einer begrenzten Monarchie. Zwar war er »in Teutschland die einzige ganz unabhängige Person«, aber seine
509
510
IV. · Das Reich von Karl VII. bis Leopold II. (ca. 1740–1792)
maiestas unterscheide sich von der kaiserlichen Autorität: »Die kaiserliche Autorität war eine Kompetenz, die der Verfassung des Reichs entspringt … und nicht der Persönlichkeit des Kaisers.« 14 Den Reichstag beschrieb er als Parlament, das die »Nation« und nicht nur die Fürsten vertrete und der Ergänzung und Kontrolle der Kompetenz des Kaisers diene. Er regiere selbst nicht, auch nicht mit, und habe keine Befehlsgewalt. Pütter schätzte seinen Anteil an der Regierung des Reichs auf nicht mehr als drei Achtel, wodurch, schloss er, jedem Vollmitglied des Fürstenkollegs lediglich ein Anteil von einem Achthundertstel an der Gesamtregierung zukomme.15 Pütters Werk zur Herrschaft des Kaisers und der Fürsten lieferte eine perfekte Beschreibung der aktuellen Verteilung der Verantwortung im Reich: Der Kaiser übte manche Gewalten aus, andere waren an die Fürsten delegiert. Zwar war die Autorität des Kaisers in mancher Hinsicht durch den Reichstag eingeschränkt, die der Fürsten aber ebenso durch ihre Unterordnung im gemeinsamen Bund des Reichs. Indem sie diese Beschränkungen (servitutes) akzeptierten, durch ihre Teilnahme am Reichstag und an den Kreisen, durch die Anerkennung der Prinzipien des Reichsrechts und ihre Bereitschaft (niedergelegt in IPO Art. VIII § 2 im Westfälischen Frieden), unter keinen Umständen einem Bündnis gegen den Kaiser, das Reich oder den öffentlichen Frieden beizutreten, bildeten sie Teile eines größeren Staats. Pütters Ansehen litt im 19. Jahrhundert, weil sein gesamtes Werk dem Verständnis eines Reichs gewidmet war, das nicht mehr existierte. Manche fanden, ein Mann, der 1795 als sein letztes größeres Werk Geist des Westphälischen Friedens: nach dem innern Gehalte und wahren Zusammenhange der darin verhandelten Gegenstände historisch und systematisch dargestellt veröffentlicht hatte, müsse wohl den Bezug zur Realität verloren haben. Es war jedoch im Gegenteil Pütters große Leistung, die Theorie des Reichs systematisch zu modernisieren. Mosers gesetzlichem Positivismus fügte er das neue Verständnis des Naturrechts hinzu. Tatsächlich war für ihn das Naturrecht eine Art Philosophie des positiven Rechts. 16 Dem gesamten systema imperii legte er die nach 1750 zunehmende Überzeugung deutscher Kommentatoren von den notwendigen Einschränkungen der Regierungsmacht bei, eine gesteigerte Betonung der vordringlichen Pflicht der Regierung, Schutz und Sicherheit zu bieten, und einen wachsenden Sinn für die Notwendigkeit der Vermeidung ihrer Ausstattung mit uneingeschränkter Macht im Namen der Förderung von Wohlfahrt und Glück. In den 1790er Jahren betrachtete er den Westfälischen Frieden aus der Sicht von Montesquieu. 17 Obwohl er manche Aspekte des Systems scharf kritisierte und die Rechte der Territorien klar favorisierte, war Pütter kein Reformer. Dass er keine eigennützigen Ziele verfolgte, verstärkte seine Wirkung. Dass die Ereignisse der 1790er Jahre seine Einstellung nicht änderten, kann bei jemandem, der 1789 vierundsechzig
48. Reich, Öffentlichkeit und Nation
Jahre alt war und auf eine mehr als vierzigjährige berufliche Laufbahn zurückblickte, kaum überraschen. Die Modernität seines Systems wurde jedoch dadurch unterstrichen, dass sein Jünger Karl Friedrich Häberlin und sein Schüler Nikolaus Thaddäus Gönner seine Lehren auf die revolutionären politischen Theorien dieses Jahrzehnts übertrugen. 18
Anmerkungen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Brandes, »Marketplace«, 94–97. Welke, »Lektüre«, 30; Brandes, »Marketplace«, 80. Hartmann, »Bevölkerungszahlen«, 368 f. Weigl, Schauplätze, 25. Printy, Enlightenment, 185–211; vgl. zum Folgenden auch Carl, »Konfession«, 122–131. Möller, Aufklärung, 115–120; vgl. S. 595. Schmidt, »Mappae Germaniae«. Burkhardt, Vollendung, 442–460. Kapr, Fraktur, 13–36. Whaley, »German Nation«, 321. Vgl. S. 206–210. Vgl. zum Folgenden: Gross, Empire, 440–455; Link, »Pütter«; Stolleis, Öffentliches Recht I, 312–316. Die ersten Vorlesungen fanden 1734 statt; 1745 gab es etwa 600 Studenten; vgl. Schindling, Bildung, 26–29; Gross, Empire, 441–444. Ebd., 450. Ebd., 451; vgl. Gross, Empire, S. 448 und 450. Link, »Pütter«, 317. Herdmann, Montesquieurezeption, 229 f. Vgl. S. 706 ff.
511
V. Die deutschen Territorien nach 1760
49. Die Aufklärung und das Reformproblem
D
er selben Unruhe, die die Nationalgeistdebatte der mittleren 1760er Jahre und danach die endlosen Diskussionen über eine Reform des Reichs erzeugte, entsprang auch ein paralleles Phänomen in den deutschen Territorien. Tatsächlich war in vielen Fällen das gleichzeitige Bemühen um Reformen in Reich und Territorium Teil eines politischen Programms. »Verbesserung« wurde im späten 18. Jahrhundert zum Leitmotiv territorialer Herrschaft, zum meistbenutzten Begriff zur Beschreibung der Bestrebungen und Programme von Herrschern und ihren Beamten. Die Signifikanz dieser Reforminitiativen ist allgemein anerkannt, wichtige Fragen dazu bleiben indes umstritten. Motivation, Art, Ausmaß und Wirksamkeit der Reformaktivitäten jener Zeit waren Gegenstand zahlreicher historiografischer Debatten, ebenso wie die Bedeutung der Reformen des späten 18. Jahrhunderts für die langfristige Entwicklung der deutschen Geschichte. 1 Die Begriffe aufgeklärter Absolutismus und aufgeklärter Despotismus, die meist als typisch für die Epoche herangezogen werden, sind auch am problematischsten. Mehr als hundert Jahre lang haben Historiker debattiert, ob Aufklärung mit irgendeiner Art von Absolutismus kompatibel sei. Aufgeklärter Despotismus besitzt immerhin eine gewisse Authentizität, weil er auf Pierre-Paul Le Mercier de la Rivières despotisme légal von 1767 und Diderots Vorstellung eines despotisme juste et éclairé von 1773 zurückgeht, aber diese Begriffe waren schon zur Zeit ihrer Entstehung umstritten. Wenn der Begriff Aufklärung irgendetwas mit Emanzipation oder Fortschritt zu tun haben soll, ist seine Verbindung mit Absolutismus und Despotismus unweigerlich problematisch. Aus diesem Grund ziehen manche den Begriff Reformabsolutismus vor, aber die Argumente gegen die Brauchbarkeit des Begriffs Absolutismus gelten natürlich auch für alle späteren Varianten. 2 Die unbarmherzigste Darlegung der logischen Probleme kam oft von marxistischen Historikern, die in den reformwilligen Fürsten des späten 18. Jahrhunderts Manifestationen des späten Feudalismus sahen. Auch die Verfechtung aufklärerischer Ideen wurde verschiedentlich als Ablenkungstaktik interpretiert, als Versuch, neue bürgerliche Ideen und Bewegungen zu integrieren, um die alte Ordnung zu stärken, oder schlicht als Rationalisierung der alten feudal-absolutistischen Ordnung, als betrügerischen Einsatz moderner politischer Redensarten zur Vertuschung der unveränderten brutalen Realität. Selbst jüngere Studien betonen im Allgemeinen eine zeitweilige Allianz der
516
V. · Die deutschen Territorien nach 1760
grundsätzlich nicht zu vereinbarenden Kräfte traditioneller monarchischer Herrschaft und der modernisierenden, emanzipatorischen Bewegung der Aufklärung. Das Gleichgewicht der Mächte in dieser Allianz war jedoch oft unklar. Waren Reformen ein Produkt der Aufklärung? Oder standen dahinter vielmehr die traditionellen Anliegen von Herrschern, nur oberflächlich geprägt von Ideen der Aufklärung oder in deren Redeweise ausgedrückt? Die Frage nach der langfristigen Bedeutung der Reformen des späten 18. Jahrhunderts für die deutsche Geschichte ist ebenso umstritten. Manche sehen sie als entscheidende erste Schritte zur Entwicklung des modernen Verfassungsstaats, eine weit zurückreichende Tradition in Deutschland betont indes die Priorität der angeblich wichtigeren »deutschen« Reformen der »Reformepoche« nach 1806, insbesondere in Preußen. 3 Die nationalistischen Konnotationen dieses Themas spielen heute keine Rolle mehr, für die Diskussion der Idee eines deutschen »Sonderwegs« im 19. und 20. Jahrhundert, die viele Historiker des modernen Deutschlands beschäftigt, bleibt die Frage jedoch wichtig. Begann dieser Sonderweg mit dem Ausbleiben einer Revolution in Deutschland Ende des 18. Jahrhunderts? Wenn, lässt sich das dann auf die Fähigkeit der deutschen Territorialregierungen zurückführen, rechtzeitig Reformen einzuleiten, um eine drohende Revolution abzuwenden? Waren die Zustände in Deutschland nicht schlimm genug, um eine Revolution auszulösen? Oder war das deutsche ancien régime schlicht zu fest verankert, seine Kontrolle über die Gesellschaft so vollständig, dass es jegliche Opposition unterdrücken und die kritischen intellektuellen Kräfte, die dem ancien régime in Frankreich so lautstark entgegentraten, für seine eigenen Zwecke einspannen konnte? In den 1980er Jahren formulierten zwei führende Historiker die alten Alternativen neu und unterstrichen zugleich die anhaltende Bedeutung der letzten Jahrzehnte des Reichs und der Art und Weise seines Endes für die nachfolgende deutsche Geschichte. 1983 eröffnete Thomas Nipperdey seine Geschichte Deutschlands im 19. Jahrhundert mit der Feststellung: »Am Anfang war Napoleon.« 4 Vier Jahre später antwortete Hans-Ulrich Wehler: »Im Anfang steht keine Revolution.« 5 Ihr Dissens, der auch auf Nipperdeys Ablehnung der These eines Sonderwegs, die Wehler leidenschaftlich verfocht, beruht, wurde durch die Publikation einer dritten großen Darstellung der deutschen Geschichte von Heinrich August Winkler (2000) nicht gegenstandslos. Sie begann mit der Feststellung: »Im Anfang war das Reich« und diagnostizierte den Mythos des Reichs und die deutsche Frühmoderne generell als Ursprung der Differenzen zwischen Deutschland und dem Westen, die die Deutschen auf den »langen Weg nach Westen« zwangen, der erst mit der Wiedervereinigung 1990 endete. 6 Wie Nipperdey und Wehler sah Winkler den Ausgangspunkt eines deutschen Sonderwegs in den speziellen deutschen Umständen Ende des 18. Jahrhunderts.
49. Die Aufklärung und das Reformproblem
Mit diesen Kontroversen verbunden und in gewisser Weise ihr Nährboden ist eine ebenso signifikante Tradition der Interpretation der deutschen Aufklärung. Auch hier lag die Betonung im Allgemeinen auf den vermuteten grundsätzlichen Differenzen zwischen deutschem und »westlichem«, vor allem französischem und englischem Denken im 18. Jahrhundert. 7 Die Debatte zu diesen Themen in den letzten beiden Jahrhunderten war ebenso politisch wie die Kontroverse um die Bedeutung der Reformen des 18. Jahrhunderts und der deutschen Geschichte seit der Reformation ganz allgemein. Tatsächlich begann die Debatte über die Aufklärung bereits im späten 18. Jahrhundert. Es war eine spezifisch deutsche Diskussion ohne Parallele in anderen Ländern und begann mit der Auseinandersetzung über die Ziele und Absichten in den 1780er Jahren, mit der Frage »Was ist Aufklärung?«, die Kant und andere zu beantworten suchten. 8 Fortgesetzt wurde sie dann mit der »konservativen« Reaktion gegen die Aufklärung im Licht der Ereignisse in Frankreich nach 1789 und mit der radikalen Übersteigerung der Aufklärung, die als »Aufklärung der Aufklärung« durch eine neue Generation von Idealisten und postrevolutionären Philosophen wie Hegel Mitte der 1790er Jahre ihren Anfang nahm. Die zwischen 1770 und 1830 folgende Erhebung des Idealismus und der philosophischen und literarischen Formen dessen, was als »Deutsche Bewegung« bekannt wurde, zu Quellen »wahrer« deutscher Kunst und Denkungsart führte dazu, dass progressive Verfechter der Aufklärung im Allgemeinen Außenseiter blieben, intellektuell wie politisch. Dass eine solche deutsche Bewegung existierte, erörterte erst der Philosoph Wilhelm Dilthey in seiner Antrittsvorlesung in Basel 1867. Um 1900 knüpften zahlreiche deutsche Gelehrte daran an und betrachteten die Jahre zwischen 1770 und 1830 als die Epoche, in der die intellektuellen und kulturellen Grundlagen für den späteren (preußischen) deutschen Nationalstaat gelegt worden seien. 9 Die »Deutsche Bewegung«, so hieß es, repräsentierte eine überschwängliche Explosion künstlerischer und philosophischer Aktivitäten, die mit dem Niedergang des Reichs einherging und ihn kompensierte. Die Begeisterung für Kunst und ästhetische Erfahrung war in gewisser Weise ein Substitut für den Mangel an politischem Engagement oder besser für den andauernden Ausschluss der deutschen gebildeten Klasse von politischer Teilhabe. Folgerichtig wurden Gestalten wie Johann Georg Hamann (* 1730, † 1788), Johann Gottfried Herder (* 1744, † 1803) und andere mit Bewegungen wie dem Sturm und Drang verbundene Schriftsteller als Pioniere identifiziert, die die Aufklärung und den Westen, der sie hervorgebracht hatte, ablehnten. Kant wurde als Idealist gepriesen, dessen Ideen die Aufklärung überwunden und damit Deutschland auf den Weg zu einem höheren, profunderen, wesenhaft deutschen kulturellpolitischen Stand gebracht hätten, der fundamental vom Rationalismus und Materialismus des Westens abwich. Die reifen Werke von Goethe und Hegel galten als
517
518
V. · Die deutschen Territorien nach 1760
höchste Errungenschaften eines ausdrücklich nichtwestlichen und unverwechselbar deutschen Denkens und Seins. Dieser Tradition der Interpretation zufolge lässt sich der gesamte literarische Aufschwung des 18. Jahrhunderts als enttäuschte Protest- und Befreiungsbewegung deuten, die, anstatt eine politische Nation zu prägen, in der Konstruktion eines Reichs von Kunst und Ideen endete. Schiller scheint das geahnt zu haben, als er 1801/02 seinen Gedichtentwurf Deutsche Größe schrieb: Das Reich der Ideen, schrieb er, erblühe in Deutschland, während das politische Reich zerfalle; deutsche Kultur werde dereinst die Welt führen. Der Titel stammt nicht von Schiller, auch nicht von den Gelehrten, die das Fragment 1871 erstmals veröffentlichten und es als »Geschenk der Germanistik an das deutsche Volk zur Reichsgründung« empfanden, sondern wurde erst 1902 anlässlich einer Neuausgabe hinzugefügt. 10 Tatsächlich waren Schillers Überlegungen nicht untypisch für eine kosmopolitische Strömung unter deutschen Intellektuellen seiner Zeit. Sie demonstrieren nicht seine Vorahnung der Gründung eines zukünftigen deutschen Nationalstaats, sondern beschreiben das komplexe Verhältnis zwischen Reich und Nation um 1800. Die rückwirkende nationalistische Rekrutierung führender literarischer und philosophischer Figuren für die »Deutsche Bewegung« im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert wurde bald von einer negativen Version des deutschen »Sonderwegs« verdrängt. In den 1940er Jahren entwickelten Theodor Adorno und Max Horkheimer aus der Erfahrung der Katastrophe des Faschismus ihre vernichtende Kritik an den ironischen, aber desaströsen Konsequenzen der Aufklärung: Deren Rationalismus habe nicht zu Emanzipation geführt, sondern zur Tyrannei von Kapitalismus und Faschismus. 11 Dieses bemerkenswerte Urteil war auf die Aufklärung insgesamt gemünzt, beruhte jedoch auf der Diagnose der spezifischen Probleme der deutschen Gesellschaft und auf Adornos und Horkheimers düsteren Folgerungen über die Möglichkeit einer Erlösung der Gesellschaft. Ihr wichtigster intellektueller Nachfolger, Jürgen Habermas, war optimistischer, aber die grundlegenden Annahmen zum Charakter der Aufklärung blieben dieselben. Die vorherrschende Sicht der Aufklärung unter deutschen Gelehrten spiegelt bis heute viel von dieser komplexen, ideologisch aufgeladenen Interpretationsschule wieder. Dem einflussreichsten deutschen Historiker der Gegenwart zufolge begann die Aufklärung als intellektuelle Bewegung mit Thomasius in den 1680er Jahren. 12 Durch englische und französische Einflüsse gewann sie an Boden, gelangte um 1720 zur Reife und erlebte ab den frühen 1760er Jahren ihren Niedergang. Als ihre führenden Vertreter in den 1780er Jahren die Bedeutung der Aufklärung debattierten, war das Ende in Sicht. Kants Ideal einer selbstkritischen Vernunft zog die Preisgabe von Kernprinzipien der Aufklärung nach sich und der folgende Streit zwischen Kantianern und Antikantianern verlagerte die intellek-
49. Die Aufklärung und das Reformproblem
tuelle Debatte entscheidend. In den 1790er Jahren hatten konventioneller Sicht zufolge Idealismus, Klassizismus und Romantik die Aufklärung als vorherrschende philosophische und künstlerische Methode vollständig verdrängt. Ihre zunehmend konservative Ausrichtung dominierte die kulturelle und intellektuelle Entwicklung Deutschlands in den nächsten eineinhalb Jahrhunderten, in denen oft in Vergessenheit geriet, dass auch Deutschland ein Land der Aufklärung war. 13 Als kompromittiert gilt die Aufklärung, weil sie offensichtlich unter dem Patronat deutscher Territorialregierungen entstand. Bei aller Aufnahme fremder Einflüsse heißt es doch, sie habe radikale Ideen lediglich auf dem Gebiet der Theologie umgesetzt. Sie entwickelte sich im Bund mit den oder vielmehr im Dienst der herrschenden Fürsten. Deutschland, so wird daher argumentiert, entwickelte nie eine kritische liberale Tradition, geschweige denn eine streitbare demokratische Bewegung im 18. Jahrhundert. Die meisten dieser verbreiteten Ansichten zur Entwicklung Deutschlands im späten 18. Jahrhundert gehen auf den Versuch zurück, dessen spätere Geschichte zu verstehen, insbesondere Nationalsozialismus und Judenvernichtung. Jüngere Forschungen von Historikern der deutschen Frühmoderne, die den Versuch unternehmen, das späte 18. Jahrhundert vor seinem frühmodernen Hintergrund zu betrachten, legen Revisionen der traditionellen Sicht des Staats und der gängigen Einschätzung der Aufklärung nahe. Sie zeigen eine vielfältigere, lebhaftere und politischere Bewegung, die keineswegs unterwürfig oder rückgratlos war. Liberale und demokratische Tendenzen sind bereits vor 1789 nachweisbar. Vor allem geraten die traditionellen Chronologien zunehmend ins Wanken. Die Behauptung, die Aufklärung habe sich bereits vor 1789 im Niedergang befunden und sei durch die Reaktion verdrängt worden oder sei einer »Deutschen Bewegung« ab den 1770er Jahren oder dem Idealismus und der Romantik der 1790er Jahre zum Opfer gefallen, ist angesichts einer wachsenden Fülle von Belegen für die anhaltende Wirkung der Aufklärung bis ins 19. Jahrhundert kaum noch haltbar. Sicherlich hatte die Aufklärung knallharte Gegner. 14 Lange vor den 1790er Jahren ließen orthodoxe Lutheraner, Pietisten und andere keine Gelegenheit aus, den verderblichen Einfluss der neuen Ideen anzuprangern und vor ihrer zersetzenden Wirkung auf die Gesellschaft zu warnen. Aber nicht jeder Kritiker der rationalistischen Theologie und Philosophie war ein Gegner der Aufklärung. Viele von denen, die Gelehrte des späten 19. Jahrhunderts zu den Angehörigen der vermeintlich antirationalen, antiwestlichen »Deutschen Bewegung« zählen, waren tatsächlich eher aufgeklärte Kritiker der Aufklärung. Sie wandten sich gegen deren übertrieben oder ausschließlich rationalistische Ausrichtung, verfolgten jedoch selbst die gleichen Ziele, allerdings mit einer in ihren Augen runderen, trefflicheren Sicht des Menschen und seiner Umwelt. Ein Schlüsselthema ist die Frage, ob die Aufklärung als Phase oder als Prozess
519
520
V. · Die deutschen Territorien nach 1760
zu betrachten ist, als spezifisches Programm mit mehr oder weniger eindeutigem Inhalt, das für eine bestimmte Zeitphase typisch ist, oder als Ansatz des Nachdenkens über Natur und Gesellschaft ohne spezifische Definition der Ergebnisse solchen Denkens, abgesehen davon, dass am Ende der Verbesserung der menschlichen Gesellschaft die Perfektion der Menschheit stehen sollte. Weitere Forschungen haben eine größere Vielfalt innerhalb der deutschen Territorien aufgezeigt und erlauben eine ernsthafte Betrachtung der Aktivitäten der mittleren und kleinen Territorien ebenso wie von Österreich und Preußen. Das neue Interesse an »Kleinstaaten« liefert wichtige Einsichten zur Funktionsfähigkeit und zum politischen und kulturellen Profil der kleineren deutschen Territorien. 15 Darüber hinaus führte die neue Wertschätzung der politischen und kulturellen Möglichkeiten der kleineren Territorien zur Einbettung regionaler und lokaler Historien in die Geschichte des Reichs. Neben Österreich und Preußen entwickelten auch viele andere Herrscher Regierungsprogramme, die vom Kontext des Reichs, seinem gesetzlichen Rahmen und politischen und juristischen Institutionen geprägt waren. Manchen lieferte die Übernahme der breiteren politischen Agenda im Sinn der Ideale der Nationalgeistdebatte die logische imperiale oder deutsche Dimension der Politik, die sie als Territorialherrscher lokal und regional betrieben. In manchen Territorien setzten Herrscher, die wenig oder keine Neigung zum neuen Denken der Aufklärung zeigten, unter Einfluss aufgeklärter Minister und Beamter dennoch auf »aufgeklärte« Reformen. In anderen waren solche Reformen das Resultat der Initiative von Territorialständen, Einzelner oder Gruppen von Einzelnen. In vielen Gegenden unternahmen adlige Grundbesitzer, die sich der neuen ökonomischen Realität stellten und nicht etwa bewusst Ideale der Aufklärung umsetzten, den ersten Schritt zur Abschaffung der diversen verbliebenen Formen von Leibeigenschaft. In den frühen 1760er Jahren schätzte Melchior Grimm, dass etwa zwanzig deutsche Fürsten mit der Aufklärung sympathisierten. 16 Nach Ansicht eines modernen Historikers verdient diese Einschätzung nur ein Herrscher: Friedrich der Große, der eine rationalistische Sicht des Staats und der Staatsmacht entwickelte, an der öffentlichen literarisch-politischen Debatte teilnahm und systematisch aufgeklärte Reformen umsetzte. 17 Diese Definition ist ohne Zweifel übertrieben eng. Wichtiger ist die Einsicht, dass deutsche Gelehrte traditionell sehr auf die Rolle der Herrscher eingehen und dabei oft andere Faktoren aus dem Blick verlieren, die es ihm erst ermöglichten, irgendetwas zu erreichen. Zudem ist mit der in der gesamten Diskussion des aufgeklärten Absolutismus spürbaren Betonung auf dem Staat eine Einschätzung des Staats als solchen verbunden, die in Verbindung mit dem 18. Jahrhundert anachronistisch ist, weil sie von den Machtstaatideen des 19. und 20. Jahrhunderts geprägt ist. 18 Die Vielfalt der Reformen in kleineren Territorien war in Wirklichkeit ebenso
49. Die Aufklärung und das Reformproblem
charakteristisch für Deutschland im späten 18. Jahrhundert wie die Entwicklung in den mächtigeren Staatskörpern Österreich und Preußen. Gemeinsam standen diese kleineren Territorien für mehr als 15 Millionen der etwa 24 Millionen Einwohner des Reichs um 1800. Sie leisteten einen entscheidenden Beitrag zur Geschichte des europäischen Staats und prägten die weitere Entwicklung Deutschlands nach der Auflösung des Reichs 1806.
Anmerkungen 1 Einen guten Überblick bieten Demel, Reformstaat, 57–92, und Borgstedt, Aufklärung, 18– 34. 2 Birtsch, »Aufgeklärter Absolutismus«, und ders., »Reformabsolutismus«, vgl. auch S. 219– 223. 3 Demel, Reformstaat, 93–128. 4 Nipperdey, Geschichte, 11. 5 Wehler, Gesellschaftsgeschichte I, 35. 6 Winkler, Weg I, 5. 7 Vgl. auch S. 380–394. 8 Nisbet, »Concept«; Schneiders, Wahre Aufklärung. 9 Whaley, »Transformation«, 169 ff.; Gretz, Bewegung; Dann, »Herder«; Sternhell, Tradition, 141–166. 10 Schmidt, »Universalismus«, 11 ff. 11 Whaley, »Transformation«, 160 f. 12 Schneiders, »Aufklärungsphilosophien«; Whaley, »Transformation«, 163–167. 13 Schneiders, Lexikon, 17 f. 14 Borgstedt, Aufklärung, 90–94; Müller, Aufklärung, 94–100. 15 Langewiesche, »Kleinstaat«; Schnettger, »Kleinstaaten«; Schnettger, »Kleinstaaterei«. 16 Borgstedt, Aufklärung, 18. 17 Birtsch, »Idealtyp«, 12 f. 18 Neugebauer, »Absolutismus«, 36–39.
521
50. Krise und Chance
D
ie Reformen des späten 18. Jahrhunderts können als Reaktion auf zwei große Herausforderungen gesehen werden. Die erste war die Verbindung von ökonomischer Krise und neuen Wachstumsmustern in den Jahrzehnten nach 1763, die zweite erwuchs aus dem sich verändernden intellektuellen Klima und neuen Einstellungen der gebildeten Schichten sowie der Herausbildung einer selbstbewussteren Öffentlichkeit. Am Ende des Siebenjährigen Krieges lag das Reich finanziell darnieder, in vielen Regionen waren die Manufakturen verwüstet, der Handel schwer getroffen. 1 Das war zum Teil eine Folge der schweren Versorgungskrise nach den Missernten in weiten Teilen Deutschlands 1755 und 1762. 2 Der Krieg selbst richtete in vielen Gegenden weitere Schäden an und brachte die Ökonomie weiter Teile des Reichs zum Erliegen. Nach Ende des Kriegs setzte eine wirtschaftliche Depression ein, verschärft und teilweise erst hervorgerufen durch die preußische Regierungspolitik. Friedrich der Große versuchte seine Währung zu stabilisieren, indem er abgewertete Münzen einziehen und neue mit höherem Metallgehalt prägen ließ. Diese Aufwertung der preußischen Währung wirkte unmittelbar bremsend auf den Handel. Die Spekulation mit Waren an den Börsen in Amsterdam und Hamburg setzte praktisch aus; Banken konnten Gutschriften aus der Zeit vor der Aufwertung nicht mehr auszahlen, viele mussten Bankrott anmelden. Dem Hamburger Ökonomen und Adam-Smith-Schüler Johann Georg Büsch zufolge gab es in den 1760er Jahren keine Erholung, stattdessen folgten bis 1770 mehrere weitere Rezessionen. 3 Diese Phase wiederkehrender Depressionen war kaum zu Ende, als schlimme Missernten 1771/72 neue Unbill brachten. In manchen Gegenden zog sich die Krise bis 1774 hin. Die Regierungen reagierten mit Handelsbeschränkungen für Getreide und bekamen so offenbar die schlimmsten Folgen der Knappheit in den Griff. Kaum etwas ausrichten konnten sie jedoch gegen den folgenden stetigen Anstieg der Preise. Weitere Missernten von 1787 bis 1789 trafen Deutschland ebenso wie Frankreich, ohne jedoch in Deutschland eine revolutionäre Krise herbeizuführen. Einige Regierungen, etwa die von Preußen, gingen effektiv mit Getreidevorräten um und unterboten die Märkte, als die Preise übermäßig anzusteigen drohten. Die schleichende Inflation der 1780er Jahre wurde nach 1789 zu einer galoppierenden Entwertung, die bis 1805/06 anhielt. Während sich die Getreidepreise zwischen 1750 und 1800 fast verdoppelten, stiegen die Löhne nur um ein Drittel oder die Hälfte. 4
50. Krise und Chance
Zur gleichen Zeit nahm die Bevölkerung im Reich wie im übrigen Europa zu. 5 Aus Gründen, die noch nicht vollständig klar sind, sank die Sterblichkeitsrate stetig. Trotz der schweren Versorgungskrisen der Jahre 1771/72 und 1787–1789 nahm die Häufigkeit zuvor endemischer Krankheiten ab, und zwischen 1763 und 1800 kam es zu keinen kriegsbedingten Auswirkungen auf die demografische Entwicklung. Die Wachstumsstrukturen waren ungleichmäßig, in manchen Gegenden auch aufgrund von Migrationen. Der scheinbar dramatische Anstieg der preußischen Bevölkerung von 3,48 Millionen um 1750 auf 6,22 Millionen um 1800 ist zum Teil durch den Zugewinn neuer Territorien und in geringerem Maß durch die von der Regierung geförderte Einwanderung von etwa 285.000 neuen Untertanen zu erklären. Dennoch wiesen mehrere preußische Provinzen Wachstumsraten von jährlich über 10 Prozent auf; damit lag das preußische Wachstum weit über dem aller anderen Territorien. In Westpreußen sorgten zuvor dünn besiedelte, ausgedehnte Landreserven ab seiner Abtrennung von Polen 1772 bis Ende des Jahrhunderts für ein jährliches Wachstum von 17 Prozent. In anderen Teilen Deutschlands war das Wachstum geringer, aber dennoch stetig. Im relativ dicht besiedelten Südwesten kam Württemberg zwischen 1750 und 1800 auf Wachstumsraten von durchschnittlich 6,9 Prozent pro Jahr und erreichte zum Ende des Jahrhunderts einen Spitzenwert von 12,4 Prozent. Dies schuf die Voraussetzungen für die demografische Krise der Region im frühen 19. Jahrhundert, die in den Missernten von 1817 und der ersten Welle deutscher Auswanderer in die USA gipfelte. In der weit weniger dicht besiedelten Region Braunschweig betrug die jährliche Wachstumsrate ebenfalls 6,8 Prozent. Abweichungen hatten im Allgemeinen spezifische Ursachen. Die anscheinend geringe Wachstumsrate von 3 Prozent in Sachsen verschleiert spektakuläre Anstiege in den gebirgigen Gebieten, wo viele Manufakturen angesiedelt waren, während das agrarische Flachland nur ein minimales Wachstum aufwies. Die einzige echte Ausnahme war offenbar Bayern, wo die Bevölkerung zwischen 1771 und 1794 jährlich um 5,9 Prozent zurückging. Das scheint zwei Gründe gehabt zu haben. Einerseits zeigte die Agrarkrise der frühen 1770er Jahre anhaltende Nachwirkungen, andererseits widersetzten sich die adligen Grundbesitzer in Bayern gemeinsam den beiden Maßnahmen, die anderswo der Expansion am förderlichsten waren: dem Übergang von Getreide- und Weidewirtschaft zum Kartoffelanbau und der Förderung oder wenigstens Duldung der Entwicklung von Teilzeitheimarbeit oder Protoindustrie. Das deutliche allgemeine Bevölkerungswachstum hatte tiefgreifende Wirkung. Die Landwirtschaft wurde durch steigende Preise profitabler. Fast überall konnten die bewirtschafteten Flächen die Nachfrage nicht stillen und so wurden neue Grenzertragsböden urbar gemacht. Signifikante Fortschritte in der Steigerung der
523
524
V. · Die deutschen Territorien nach 1760
landwirtschaftlichen Produktivität wie Fruchtwechselsysteme vermieden lange Brachperioden. Neue Feldfrüchte wie die Luzerne als Viehfutter und vor allem Kartoffeln erhöhten in den späten Jahrzehnten des Jahrhunderts ebenfalls signifikant die Produktivität der meisten Gebiete. Eine weitere »natürliche« Reaktion auf das Bevölkerungswachstum war der Ausbau der ländlichen Industrie. Bauern, die nicht mehr genug Land hatten, um ihre Familien zu ernähren, wandten sich dem oft sehr einträglichen Arbeitsangebot in den Hauptproduktionsgebieten zu. Sie konzentrierten sich am Niederrhein und vor allem entlang der deutschen Mittelgebirgsschwelle ostwärts bis Sachsen, Thüringen und Schlesien. Um 1800 waren in einigen Gegenden von Sachsen regelrechte »Fabrikdörfer« mit florierenden Bevölkerungen von mehreren Tausend Einwohnern entstanden. Das merkantilistische Denken hatte seit dem 17. Jahrhundert dafür gesorgt, dass das Hauptaugenmerk auf der Handelsbilanz lag und deutsche Kommentatoren ihre Gesellschaft im Vergleich mit anderen als rückständig betrachteten. Justus Möser beklagte, dass die Nachkommen der Gründer der Hanse nun »gleichsam in der Karre schieben, oder Austern fangen, Citronen aus Spanien holen, und Bier aus England einführen«. 6 Die letzten Anläufe, durch die Gründung asiatischer Handelskompanien in den Überseehandel einzugreifen, hatten nicht mehr Erfolg als früher. Preußens Versuche, den Besitz von Emden seit 1744 durch die Gründung einer Königlich-Preußischen Asiatischen Compagnie in Emden nach Canton und China (1751) auszunutzen, scheiterten innerhalb weniger Jahre; 1765 wurde die Kompanie aufgelöst. Eine preußisch-bengalische Kompanie hielt nur deshalb eine Weile durch, weil sie von korrupten britischen Beamten in Kalkutta für heimliche Exporte nach Europa auf eigene Rechnung benutzt wurde. Die österreichischen Ostindienprojekte wurden ebenfalls mit großen Hoffnungen gestartet, aber bald abgebrochen. 7 Versuche von Regierungen, den Handel zu fördern, scheiterten fast immer.Von den 1740er Jahren an ermöglichten es indes neue Entwicklungen der Ökonomie des Reichs, aus dem Schatten des Dreißigjährigen Kriegs zu treten, und wogen den Nachteil der geografischen Randlage durch die Verlagerung des europäischen Wirtschaftssystems auf eine Nordsee-Atlantik-Achse auf. Zwar betrug Deutschlands Anteil an der europäischen Handelsschifffahrt nach Tonnage nur 3,7 Prozent, aber das Reich lag im Vergleich wohl nur hinter Großbritannien zurück. 8 Deutschlands Exporte machten bis zu 20 Prozent seines gesamten Handelsvolumens aus, dasselbe gilt allerdings auch für Frankreich. 9 Tatsächlich scheint das Reich insgesamt besser als Frankreich abgeschnitten zu haben. Das Bevölkerungswachstum stimulierte die Nachfrage nach Lebensmitteln und anderen Produkten. Das Wachstum der britischen Wirtschaft schürte die Nachfrage nach Textilien, Rohstoffen und Getreide und trug zu einer signifikanten Kommerzialisierung des Agrar- und Textilsektors im späten 18. Jahrhundert bei. 10
50. Krise und Chance
Und der zwanzigjährige Krieg, der in den 1790er Jahren begann, half der deutschen Wirtschaft langfristig eher, als dass er ihr schadete. Die Handelsembargos minderten Deutschlands Abhängigkeit vom Handel mit Großbritannien und Frankreich und sorgten im frühen 19. Jahrhundert für eine strukturelle Verlagerung vom atlantischen Handelssystem zum Rhein als großem Handelsweg und dem Binnenmarkt als Basis der kommerziellen Aktivität. 11 Das Scheitern der Handelskompanien und die Begrenztheit der Handelsflotte schloss eine Beteiligung am Außenhandel nicht aus. Deutsche Produzenten und Händler strebten stets nach Zugang zu auswärtigen Märkten, und wichtige Regionen des Reichs standen zunehmend in Verbindung zum atlantischen Wirtschaftsraum. Oberdeutschland blieb von der traditionellen Rheinroute, den Alpenpässen und der Donau abhängig. Augsburg blieb neben Frankfurt am Main das wichtigste süddeutsche Bankenzentrum und auch sein Fernhandel, vor allem mit Italien, blieb wichtig. Nürnberg behielt seine Bedeutung als Knotenpunkt zwischen Norden, Süden, Osten und Westen. Im Südosten wuchs Wien zum internationalen Handelszentrum heran, wichtig nicht nur für die habsburgischen Länder, sondern auch für das Reich insgesamt. Wien war das Tor zu den Häfen von Triest und Fiume, zur Donau-Schwarzmeer-Route, zu den türkischen und anderen Mittelmeermärkten. Über Land erstreckte sich Wiens Handelsnetzwerk nach Böhmen, Ungarn, ganz Oberdeutschland und, für viele Güter und Finanztransaktionen, bis nach Hamburg. 12 Zu den wichtigeren Außenhandelsrouten im Reich wurden jedoch zunehmend die nord-westlichen Flussverbindungen, die Hamburg, Bremen, Lübeck und in geringerem Maß Emden ebenso wie Amsterdam als Zielhäfen deutscher Güter begünstigten. Präzise Zahlen gibt es nicht und die meisten Schätzungen beziehen sich auf ein »Deutschland«, das in etwa dem Reich von 1871 und nicht dem des 18. Jahrhunderts entspricht. Einigermaßen sicher scheint, dass die Handelsbilanz negativ blieb, um 1800 hatten die Exporte jedoch ein nie da gewesenes Ausmaß erreicht; sie bestanden zu 60 Prozent aus produzierten Gütern, 24 Prozent Rohstoffen und zehn Prozent Lebensmitteln (hauptsächlich Getreide). Deutschlands Importe hingegen umfassten 43 Prozent Rohstoffe, 24 Prozent Fertigwaren, acht Prozent Halbfertigprodukte, 19 Prozent Kolonialwaren (Tee, Kaffee, Zucker etc.) und acht Prozent Lebensmittel. 13 Während dieser gesamten Phase überwog der Binnenhandel klar den Außenhandel. Auch hier gab es signifikante Entwicklungen. Die alten Wirtschaftsregionen – die hanseatische oder norddeutsche Region, das Rheinland, Mittel- und Oberdeutschland – blieben tragende Säulen. Die zunehmende Bedeutung der atlantischen Ökonomie spiegelt sich wohl in der Konkurrenz wider, die Frankfurt in Leipzig erwuchs, das von seiner Position als eine Art Nachschubzentrum und Marktplatz für Hamburg profitierte. 14 Die Entstehung neuer Handelsmessen in
525
526
V. · Die deutschen Territorien nach 1760
Braunschweig, Naumburg und Frankfurt an der Oder entspricht demselben Trend. Erfolgreich war aber auch die 1748 in Mainz gegründete Messe, und während Leipzig wuchs, kollabierte Frankfurt am Main keineswegs. Es blieb die Anlaufstelle für das Rheinland und Oberdeutschland. In den 1780er Jahren setzte die Frankfurter Messe Waren im Wert von 4 Millionen Talern jährlich um, zur Hälfte Baumwolle, Wolle und Leinen. 15 Frankfurt blieb ein überragendes Bankenzentrum und entwickelte ab etwa 1750 einen höchst signifikanten Handel mit Luxus- und Kolonialwaren, der hauptsächlich die Höfe der Region belieferte. 16 Dass die wichtigste Überlandhandelsroute weiterhin die zwischen Frankfurt am Main und Leipzig war, sorgte ebenfalls dafür, dass Frankfurt seine Position als großes Zentrum behaupten konnte. Die Entwicklung des interregionalen Handels im Reich war ebenso wichtig wie der Impuls, den das atlantische System manchen Gegenden gab. Der Markt für Grundnahrungsmittel (und ihren Konsum) teilte sich grob zwischen den Fleisch und Gemüse konsumierenden Regionen des Nordens und den Milch und Mehl konsumierenden südlichen Regionen. Die Handelsrouten für Rohstoffe und verarbeitete Güter, vor allem Kleidung und Metallwaren, liefen kreuz und quer durchs Reich und die zunehmende regionale Spezialisierung verstärkte die Dichte und das Ausmaß des Austauschs zwischen den Regionen. Handelsmessen verlagerten sich von tatsächlich vorhandenen Waren auf den Handel mit Mustern und Proben, was die Suche nach Rohstoffquellen und Absatzmärkten für Fertigprodukte zunehmend spekulativ werden ließ. 17 Die wachsende Bedeutung des interregionalen Handels spiegelt sich im Erscheinen von Handbüchern wie dem beliebten Handbuch Topographisches Reise-, Post- und Zeitungslexikon von ganz Deutschland (1756) und einem Versuch eines allgemeinen Handlungs- und Fabrikenaddreßbuches von Deutschland und einigen damit verwandten Provinzen (1798), die beide zahlreiche Auflagen erlebten. Wie die neuen Zeitschriften für Händler, etwa die Hamburgischen Addreß-ComtoirNachrichten (1767–1824) verstärkten solche Publikationen das Denken in Kategorien des Marktes. Friedrich Heinrich Jacobi sah 1773 gar im »Commerz eben so gewiß das eigentliche wahre Band der Gesellschaft, als die Festsetzung des Eigenthums ihr erstes nothwendigstes Bedingnis war«. 18 Die Entwicklung des Handels und speziell die Integration vieler deutscher Regionen in das atlantische System hatte eine Reihe weiterer Folgen. Verbindungen zu internationalen Märkten schufen auch neue Wege für die Verbreitung von Nachrichten und Ideen, Einstellungen und Lebensweisen. So wurden etwa Neuigkeiten von der amerikanischen Revolution und dem Aufstand der niederländischen Patriotten 1781–1787 eifrig diskutiert, ebenso wie etwas später die Ideen von Adam Smith. Der Handel verband die nördlichen Regionen des Reichs, etwa Mecklenburg, Brandenburg, Pommern sowie außerhalb des Reichs West- und
50. Krise und Chance
Ostpreußen mit der geistigen, kulturellen und politischen Welt des Atlantikraums. 19 Diese Entwicklungen legten die Grundlage für Deutschlands Aufstieg nach 1850 zu einer der »großen Metropolen des kapitalistischen Weltsystems«. 20 Unmittelbar indes verliehen Zeitschriften, Leitfäden und Handbücher der mentalen Landkarte des Reichs neue Konturen. Ebenso bedeutend waren die tatsächlichen gedruckten Landkarten des Reichs, bei deren Produktion es während des 18. Jahrhunderts zu einem zunehmenden Wettbewerb kam. In den 1740er Jahren hatte sich die Firma Homanns Erben in Nürnberg als führender mitteleuropäischer Verlag für Landkarten etabliert; sie druckte Karten von Straßen, Post- und Handelsrouten, Wasserwegen sowie Karten des Reichs, die die geografische Verteilung konfessioneller Zugehörigkeiten zeigten. 21 Die territoriale Zersplitterung des Reichs zu jener Zeit kompensierten die meisten Karten durch Betonung der Kreise, die farblich oder durch klar markierte Kreisgrenzen voneinander abgesetzt wurden. Auch separat gedruckte Regionalkarten zeigten meist die Kreise. Wie die Marktkräfte, die sie ansprechen und gewinnbringend nutzen wollten, überschritten Druckwerke die Territorialgrenzen und verstärkten so den Eindruck des Reichs als ökonomische Nation. 22 All diese Strömungen in Landwirtschaft, Produktion und Handel gingen größtenteils darauf zurück, dass sich Individuen und Gemeinschaften den neuen Bedingungen unterwarfen. Der einzige Bereich echter Neuerungen – allerdings auch hier mit Vorläufern im 16. und 17. Jahrhundert – entstand aus der wachsenden Einsicht von Regierungen in die Notwendigkeit der Verbesserung der Handelsinfrastruktur. Von den 1730er Jahren an begannen zahlreiche Regionen mit Ausweisung und Ausbau großer Handelsstraßen und führten Wegweiser ein, die die Entfernung zu den nächsten Zielen anzeigten.Vor allem in Süddeutschland kam es beim Straßenbau zu beträchtlicher interregionaler Kooperation und koordinierten Aktivitäten innerhalb der Kreise. Die Auswirkung dieser Initiativen lässt sich nicht quantifizieren. Einerseits erhöhte sich die bereits um 1700 beeindruckende Geschwindigkeit der Postzustellung weiter; die französische Post konnte erst nach Turgots Reformen von 1774 mit der deutschen mithalten. Andererseits funktionierte der Transport der meisten Waren im großen Stil nach wie vor nur per Schiff; für einen Großteil des Reichs blieben die großen Flüsse die wesentlichen Verkehrsadern. Kanäle zu bauen, war im Wesentlichen nur im Flachland und wegen der hohen Kosten nur in großen Territorien möglich. In Süddeutschland entstanden kaum Kanäle. In Norddeutschland verfügte Preußen über das Terrain, die territoriale Weite und die Ressourcen, um ein Netzwerk von Kanälen anzulegen, deren Bedeutung für den Transport landwirtschaftlicher und produzierter Güter die der Straßen überwog. 23 Im Übrigen war die Rolle der Regierungen oder vielmehr die Auswirkung ihrer
527
528
V. · Die deutschen Territorien nach 1760
Aktivitäten auf langfristige ökonomische Trends ebenso eingeschränkt wie im Jahrhundert nach dem Dreißigjährigen Krieg.24 Das heißt nicht, dass nicht auch Regierungen von den veränderten Umständen betroffen waren und durch Regeln und aktives Vorgehen darauf zu reagieren versuchten. Vor allem drei Dinge riefen offenbar nach regierungsamtlichem Eingreifen. Erstens mussten Regierungen als Grund- und Lehnsherren eine angemessene Versorgung mit Lebensmitteln sicherstellen und letztlich die Flächennutzung regeln. Zweitens erhöhte sich durch das Bevölkerungswachstum die Anzahl der Armen, was Kontrolle und Regulierung ebenso erforderte wie die Schaffung von Arbeitsplätzen und ein Vorgehen gegen »Müßiggang«. Im Jahrhundert nach 1648 hatte das langsame Wachsen der Bevölkerung für erweiterte Möglichkeiten gesorgt; nun landete ein signifikanter Anteil der schneller wachsenden Bevölkerung im Lager der Landlosen und gildefreien Armen, die in der traditionellen Gesellschaftsordnung keinen Platz fanden. Drittens fanden es Regierungen nun mehr als je zuvor notwendig, Arbeitsstrukturen zu regeln, Arbeiter zu disziplinieren und die Autorität der Gilden und anderer Körperschaften über Methoden und Ebenen der Produktion in vielen Bereichen zu untergraben oder zumindest zu überwachen. Mit Ausnahme des Straßenbaus war keines dieser Ziele neu. Alle hatten ihren Ursprung in einer langen Tradition regulatorischen Bemühens von Fürsten und Magistraten im Reich. Einige widmeten sich diesen Aktivitäten weiterhin aus den gleichen religiösen Gründen wie ihre Vorgänger in früheren Jahrhunderten. Nach 1750 wurden jedoch zwei Merkmale immer wichtiger. Das erste war die zunehmende Betonung wirtschaftlicher Kriterien, der Versuch, ökonomische Prinzipien anzuwenden und natürliche wie menschliche Ressourcen nach ökonomischen Begriffen zu quantifizieren. Das zweite, mit dem ersten zusammenhängende Merkmal war die Tatsache, dass die Arbeit der Regierungen in vielen Bereichen auf die eine oder andere Weise vom neuen Denken der Aufklärung bestimmt oder geprägt war. Das konnte bedeuten, dass ein Fürst ganz offen aufklärerische Ideen übernahm. Im Großen und Ganzen war indes wohl wichtiger als die Aktivitäten der relativ wenigen klassischen »aufgeklärten Despoten«, dass Regierungen aller Art ihre Politik nun vor einem neuen intellektuellen Hintergrund und in Reaktion auf neue Erwartungen formulierten, die die gebildeten Klassen ihnen entgegenbrachten. Diese Erwartungen konnten von gebildeten Beamten vermittelt werden, die Reformen formulierten und umsetzten, oder aber sie wurden Herrschern wie ihren Beamten von dem neuen und zunehmend mächtigen Phänomen der öffentlichen Meinung aufgedrängt.
50. Krise und Chance
Anmerkungen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24
Liebel, »Enlightened Despotism«, 154 f. Dipper, Geschichte, 59 ff. Liebel, »Enlightened Despotism«, 154. Ebd., 155, 157. Die folgenden Ausführungen beruhen auf Dipper, Geschichte, 67–70, und Pfister, Bevölkerungsgeschichte, 18–24, 35–39. Möser, Werke IV, 217 f. Nagel, Abenteuer, 141 f.; Schui, »Moment«; Houtman-de Smet, »Ambitions«. Kriedte, »Trade«, 124. Ebd., 101. North, Kommunikation, 23. Kutz, »Entwicklung«. HbDSWG, 558, 561; North, Kommunikation, 9 f.; Demel, Reich, 116 f.; Hassinger, »Außenhandel«. Dipper, Geschichte, 181; Demel, Reich, 116; Kriedte, »Trade«, 113, 116. North, Kommunikation, 65–68. Dipper, Geschichte, 174. North, Kommunikation, 20. Kriedte, »Trade«, 106 f. Dipper, Geschichte, 177. Neugebauer, Politischer Wandel, 152–194. Kriedte, »Trade«, 124. Schmidt, »Mappae Germaniae«, 20 f.; vgl. auch Neugebauer, Kreise; dort finden sich ein Faksimile einer um 1741 von Homanns Erben veröffentlichten Kreiskarte und viele weitere Karten der Epoche. Garnier, »Question«, 48–52 (zum Reich als »Nation« in Bezug auf Zollgrenzen). Vgl. zu Straßen: Wunder, »Chausseestraßennetz«; Wunder, »Kaiser«; Wunder, »Chausseebau«; Behringer, Merkur, 528–549; vgl. zu Kanälen Teuteberg, »Kanalwesen«, 9–13, 25 f. Vgl. S. 313–329; Ogilvie, »Beginnings«, 290–296; Kaufhold, »Gewerbelandschaften«, 197 f.
529
51. Neue Herausforderungen: Aufklärung und Öffentlichkeit
U
m 1750 hatte sich das neue Denken, das zuerst im späten 17. Jahrhundert als akademische Reformbewegung um Figuren wie Christian Thomasius aufgetreten war, zu einer ergiebigen und komplexen intellektuellen Strömung entwickelt. 1 Die langfristige Verlagerung von Latein als üblicher Kommunikations- und Lesesprache der meisten gebildeten Deutschen hin zum Deutschen war mittlerweile deutlich spürbar. Der Ausstoß an Druckwerken hatte ein solches Ausmaß erreicht, dass selbst der beflissenste Intellektuelle den Überblick über das Spektrum wichtiger Entwicklungen, den einige fünfzig Jahre zuvor noch behalten hatten, verlieren musste. Lesen, Schreiben und die Diskussion von Schlüsselthemen beschränkten sich nun nicht mehr auf von Regierungen betriebene Institutionen. Zum ersten Mal konnte von einer echten Öffentlichkeit die Rede sein, mit der ein neuer Typ von Autor durch das Medium der Literatur und über Zeitschriften, Pamphlete und nichtliterarische Bücher kommunizierte. Gebildete Leser konsumierten die wachsende Masse an Gedrucktem, gründeten aber auch freie Gesellschaften und Vereine oder schlossen sich solchen an, in denen das Gelesene diskutiert und darüber debattiert wurde, wie sich ihre Ideen zur Förderung des großen Ziels der Verbesserung der menschlichen Gesellschaft einsetzen ließen. Der Schlüsselbegriff, der die soziale Bandbreite der Bewegung und ihre Kernansprüche umriss, war Bürgerlichkeit. 2 Gemeint war damit eher eine geistige Einstellung und Weltsicht als die Zugehörigkeit zu einer Klasse. Als bürgerlich im neuen Sinn des Begriffs bezeichneten sich gewöhnliche gebildete Stadtbürger (also Bürger im klassischen und legalen Sinn), aber auch Adlige und sogar herrschende Fürsten, die sich den breiteren Idealen der »bürgerlichen Gesellschaft« verschrieben. Bürgerlichkeit hatte mit Tugend und tugendhaftem Benehmen zu tun, mit einer aufgeklärten moralischen Disposition, ziviler Verantwortung und Verpflichtung auf die Verbesserung der menschlichen Gesellschaft. Der Bürgerlichkeitskult trug nicht zur Auflösung sozialer Unterschiede bei und sollte das auch nicht. Er ließ es jedoch vorstellbar erscheinen, dass Nichtadlige einen ebenso wertvollen Beitrag zur menschlichen Gesellschaft leisten konnten wie Adlige, Schriftsteller ebenso wie Fürsten. In diesem Sinn war er der Entwicklung der Kultur im Deutschland des 18. Jahrhunderts förderlich, die bis heute bür-
51. Neue Herausforderungen: Aufklärung und Öffentlichkeit
gerlich genannt wird und hauptsächlich von nichtadligen Autoren und Künstlern getragen wurde. Die facettenreiche kulturelle und intellektuelle Strömung der mittleren Jahrzehnte des 18. Jahrhunderts zog keine Ablehnung von Tradition und Vergangenheit nach sich. Sie trug jedoch dazu bei, dass sich die Sicht auf viele traditionelle Institutionen wandelte, und begünstigte eine radikal neue Einstellung zu Regierung und Gesellschaft. Die Betonung der Vielfalt weist darauf hin, dass es keine einheitliche Bewegung gab. In Berlin und einigen anderen Zentren hatte sich der wolffsche Rationalismus durchgesetzt. In den 1760er Jahren gab es indes selbst in Berlin konkurrierende Gruppen von Wolffianern, französisch geprägten Materialisten, sogenannten Popularphilosophen, die verschiedentlich die Ideen von Locke und Thomasius, die neuesten Äußerungen der schottischen Common Sense-Philosophen und von Rousseau übernommene Vorstellungen von Natur und Tugend vertraten. 3 Auch in Halle gab es in den 1740er und 1750er Jahren konkurrierende Schulen der Aufklärung mit bürgerlicher und thomasischer, wolffianischer und pietistischer Ausrichtung. 4 Neben Halle und Berlin entstanden weitere Gruppen und Strömungen in Zürich, Braunschweig, Leipzig, Königsberg und vielen anderen Zentren im ganzen Reich. Die Bedeutung der großen intellektuellen und literarischen Zentren des späten 16. Jahrhunderts in der Region um Köln, Frankfurt am Main, Heidelberg, Tübingen und Augsburg war geschwunden. Nun wurde die nördlichere Gegend um Hannover, Berlin, Dresden, Erfurt und Göttingen mit Halle und Leipzig als dynamischem kreativem Kern zum Brennpunkt der intellektuellen Aktivität im Reich. Städte wie Königsberg, Hamburg und Zürich, die an der Peripherie lagen, florierten nur im Rahmen ihres jeweiligen intellektuellen Austauschs mit Gelehrten, Autoren und Verlegern in Halle und Leipzig. 5 Trotz der evidenten Vorrangstellung von Mitteldeutschland gewann an den Universitäten und dann auch außerhalb eine zuerst auf den in den protestantischen Teilen des Reichs etablierten wolffschen Traditionen gründende katholische Aufklärung an Boden. Die Auflösung des Jesuitenordens 1773 markierte einen Durchbruch für die Verfechter einer aufgeklärten Theologie und einer Reform des Bildungssystems. Etwa um die gleiche Zeit entwickelte sich hauptsächlich in Berlin, aber mit Verbindungen zu anderen Zentren im Reich und anderswo, eine jüdische Aufklärung. 6 Das Gefühl, Teil einer internationalen Strömung zu sein, war ein wichtiger Quell für das Selbstbewusstsein; die Inspiration großer Denker in England und Frankreich – Locke, Shaftesbury und Hume, Bayle, Diderot, Voltaire und Rousseau – hatte enorme Bedeutung. Aber die deutsche Aufklärung war weit mehr als ein Echo heroischer Trends von anderswo und nicht einfach ein blasses Derivat des westeuropäischen Mainstreams.
531
532
V. · Die deutschen Territorien nach 1760
Wie in anderen Teilen Europas ging eine weitläufige Tendenz zum strikten Rationalismus einher mit einem ebenso breitgefächerten Netzwerk von Supranaturalismus und aufgeklärtem Vitalismus. Im deutschen Kontext schienen diese Tendenzen zunehmend Antworten auf die Einwände der Anhänger Humes und anderer auf den reduktiven Rationalismus des frühen Wolff zu geben. 7 Solche Ideen sind oft als Teil einer Gegenaufklärung bezeichnet worden, die als düstere Vorahnung des späteren antiwestlichen deutschen Irrationalismus verstanden wurde, wie bereits in der Diskussion der Idee einer »Deutschen Bewegung« erwähnt. 8 Tatsächlich sollten all die frühen Helden der »Deutschen Bewegung« als Mitwirkende einer breiteren Debatte betrachtet werden. Die jungen Autoren des Sturm und Drang in den 1770er Jahren zum Beispiel lehnten die literarischen Konventionen, die Gottsched in den 1720er und 1730er Jahren definiert hatte, entschieden ab; sie protestierten auch gegen den strengen Rationalismus von Lessing und anderen führenden Figuren der 1750er und 1760er Jahre. 9 Ihr Anliegen waren Natur und Gefühl, sie misstrauten Regierung und »Gesellschaft«. Aber die Wiederentdeckung der Natur ging einher mit der Wiederentdeckung der Sprache, eines »authentisch« deutschen Stils und Charakters sowie der wahren Geschichte der Deutschen und des Reichs. 10 Vor allem verschrieben sich diese frühen künstlerischen Rebellen bei aller Kritik am reduktiven Rationalismus und vermeintlich naiven Optimismus den Kernidealen der Aufklärung insgesamt. Ihre Position stimmte im Grunde mit der jener Kritiker der 1780er Jahre überein, die fanden, die Aufklärung müsse begrenzt sein und eine verfrühte Aufklärung der Massen werde zur Katastrophe führen. Es gab freilich auch einige, die die Aufklärung insgesamt ablehnten, und zweifellos wurde ihre Opposition nach 1789 lautstärker. Schon zuvor entwickelten einige Jesuiten die Idee, die Aufklärung, speziell in der von einer bayerischen Geheimgesellschaft von Freidenkern, dem Illuminatenorden, betriebenen Form, sei schlicht eine Verschwörung, die darauf abziele, die Welt zu zerstören. 11 Insgesamt jedoch traten die ersten wirklich politischen antiaufklärerischen Gruppen erst Mitte der 1790er Jahre auf den Plan. Eine der prominentesten war 1795–1798 mit der Zeitschrift Eudämonia verbunden. Das wirkliche Hassobjekt solcher Gruppen war 1789 und alles, wofür dieses Datum stand. 12 Charakteristisch für praktisch alle Strömungen der Aufklärung war die Überzeugung von der Möglichkeit des Fortschritts, der Glaube, die Erweiterung von Wissen und Einsicht sei der Verbesserung der menschlichen Gesellschaft förderlich und diese Verbesserung sei am besten schrittweise als Teil eines evolutionären Prozesses zu erreichen, nicht durch abrupte oder revolutionäre Veränderungen. Die alten Wissenssysteme, basierend auf den Lehren christlicher Konfessionen, sollten überprüft und wo nötig durch jedermann, egal welchen Glaubens, zugäng-
51. Neue Herausforderungen: Aufklärung und Öffentlichkeit
liches Wissen ersetzt werden. Der Bildung kam somit eine Schlüsselrolle in allen Strömungen aufgeklärten Denkens zu. Wahre, nachhaltige Verbesserung der menschlichen Angelegenheiten konnte nicht einfach dadurch erreicht werden, dass man Strukturen und Regeln änderte. Das Denken der Menschen zu verändern, ihnen mehr Einsicht zu verschaffen, mehr richtiges Wissen und mehr Vernunft, bildete das wahre Fundament eines besseren Zusammenlebens. Dies war das Thema von Kants berühmter Antwort auf die Klage des (antiaufklärerischen) Pastors Johann Friedrich Zöllner in der Berlinischen Monatsschrift (1783), er habe die Frage, was Aufklärung sei, noch nirgends beantwortet gefunden. Kant definierte Aufklärung als Prozess, als »Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit«. 13 Was gemeint war, war recht simpel, aber keineswegs leicht zu erreichen. Menschen würden mit der Begabung zur Vernunft geboren; aus Faulheit und Feigheit hätten sie sich Autoritäten unterworfen, die versprachen, sie zu schützen und zu führen, und so schrittweise die Fähigkeit zum Denken und selbstbestimmten Leben verloren. Um ihre Möglichkeiten als menschliche Wesen in der Gesellschaft zu erkennen und wirklich menschlich in dem Sinn zu werden, dass sie in vollem Umfang von den Fähigkeiten Gebrauch machten, mit denen die Natur sie beschenkt habe, mussten sie lernen, wieder selbstständig zu denken. Um den Prozess der menschlichen Entwicklung zu fördern, sollten Herrscher zu freien Debatten zunächst in bestimmten Bereichen und dann in größerer Breite ermuntern. Solche Debatten mochten zunächst religiöse Belange sowie Kunst und Wissenschaft allgemein betreffen – Bereiche, an denen Herrscher kein Interesse hätten. Ein weiser Herrscher werde jedoch weitergehen und das freie, offene Gespräch über die Gesetzgebung und ihre Verbesserung zulassen. Solange die Öffentlichkeit indes noch nicht vollauf gebildet sei, glaubte Kant, müsse der freie Gebrauch der Vernunft in der öffentlichen Sphäre mit Gehorsam gegen den Staat in der Ausübung der beruflichen Pflichten, etwa als Kleriker oder Regierungsbeamter, beziehungsweise in der Erfüllung der Pflichten gegenüber der Regierung, Steuern zu zahlen und die Gesetze zu achten, einhergehen. Es gebe Anzeichen, glaubte Kant, dass die Art von Debatte, die er für unerlässlich für den Fortschritt und die daraus folgende zunehmende Reife der Öffentlichkeit hielt, sich in seiner Zeit und vor allem im Preußen Friedrichs des Großen zu entwickeln begann. Daher fand Kant, man könne berechtigterweise von einem Zeitalter der Aufklärung sprechen, wenn auch noch nicht von einem aufgeklärten Zeitalter, und bezeichnete es als »Jahrhundert Friederichs«, zu Ehren des Monarchen, der so viel zur Förderung der Werte der Aufklärung beigetragen habe. Auf kurze Sicht brauchten die Menschen nach wie vor die Autorität eines Vorgesetzten, um die Ordnung zu bewahren und sie falls nötig zu zwingen, sich richtig zu verhalten. Letztlich jedoch, schloss Kant, könnten sie erwarten, dass die Regierung
533
534
V. · Die deutschen Territorien nach 1760
selbst ihre Fortschritte bei der Wiedererlangung ihrer Reife zu autonomen Menschen anerkennen und Gesetze entsprechend formulieren werde. Kants Ausführungen sind gelegentlich als zutiefst konservativ oder zumindest als Beispiel für eine äußerst mangelhafte Art von deutschem Liberalismus verstanden worden. 14 Sein offenbar bedingungsloser Glaube an den Staat, sein Beharren auf der Notwendigkeit eines strengen Herrschers und der Einschränkung der Freiheit während des langwierigen Lernprozesses der Gesellschaft galt manchen als Beleg für die intellektuellen Grundlagen eines deutschen Sonderwegs. 15 Im Kontext des späten 18. Jahrhunderts haben Kants Überlegungen jedoch eine andere Bedeutung. Wenn er von Herrschern sprach, dachte er an das 18. Jahrhundert und weniger an den starken Staat der posthegelianischen politischen und gesetzgeberischen Theorie. Zudem beschrieb er sowohl einen Prozess als auch eine geistige Strömung, die tatsächlich zu seiner Zeit entstanden war: die Herausbildung eines lesenden Publikums, einer Kultur der Debatte sowie einer neuen, oft sehr kritischen Sicht des Staates und seiner gesellschaftlichen Funktion. Die Entwicklung von Leserschaft und Öffentlichkeit haben wir in Zusammenhang mit der Diskussion der Reform des Reichs bereits erwähnt. 16 Für die Territorien galt das Gleiche: Die Menge an Druckwerken nahm explosionsartig zu. Am dramatischsten stieg die Anzahl und Auflage von Zeitungen und Periodika. Zwischen 1750 und 1789 verdoppelte sich die Anzahl der Zeitungen auf mehr als 200. Die meisten erschienen wöchentlich, manche nun auch täglich. Die durchschnittliche Auflage lag wohl bei 600 bis 700; Ende des Jahrhunderts hatte sich jedoch der Hamburgische Correspondent mit regelmäßig 30.000 und manchmal auch 50.000 gedruckten Exemplaren als Europas größte Zeitung etabliert. 17 Um 1789 lag die wöchentliche Gesamtauflage der Zeitungen bei etwa 300.000 Exemplaren, die um die 3 Millionen mehr oder weniger regelmäßige Leser fanden.18 Der Anstieg bei den Periodika war trotz ihrer häufigen Kurzlebigkeit ähnlich dramatisch. Die Anzahl von 4.200 deutschen Periodika im 19. Jahrhundert ist wohl eher eine konservative Schätzung, allein in den Jahren 1781–1790 erschienen mindestens 1.225. Die Auflagen waren gering und viele bestanden nur aus ein paar Seiten mit wenig Inhalt; kaum eines erreichte eine Auflage von 4.000 bis 5.000 wie der Hamburger Patriot in den 1720er Jahren oder die 4.000 Exemplare der Chronik (ursprünglich ab 1774 Teutsche Chronik, später unter verschiedenen Titeln), die Christian Friedrich Daniel Schubart 1791 drucken ließ. Charakteristisch für die Jahrhunderte nach 1750 war auch eine Erweiterung des Themenspektrums. Die meistenteils moralisierende Unterhaltungsliteratur in den Periodika der 1720er Jahre wurde nun verdrängt durch ein differenzierteres Feld von Zeitschriften zu spezifischen Interessengebieten. Manche widmeten sich ökonomischen Belangen, der Forst- oder Landwirtschaft, andere persönlichen Problemen und Psychologie oder der Damenmode. Eine neue Erscheinung der 1770er
51. Neue Herausforderungen: Aufklärung und Öffentlichkeit
Jahre waren politische Magazine, das vielleicht bemerkenswerteste Beispiel Schubarts Teutsche Chronik. 19 Die ebenfalls florierenden Literatur- und Rezensionszeitschriften spielten eine wichtige Rolle als Wegweiser durch die Masse der Neuerscheinungen. In der wichtigsten, der Allgemeinen Deutschen Bibliothek, 1765 von Friedrich Nicolai in Berlin gegründet, besprachen bis 1806 433 Autoren mehr als 80.000 Bücher. Ernsthafte Konkurrenz bot ab 1785 die Allgemeine Literatur-Zeitung (bis 1803 in Jena, dann in Halle), die bald zum meistgelesenen und verbreitetsten deutschen Rezensionsorgan wurde. 1788 folgte die Salzburger (ab 1800 Münchner) Oberdeutsche allgemeine Litteraturzeitung, in der bis 1811 mehr als 19.000 Kritiken erschienen. Die Jenaer Zeitschrift publizierte als bibliografische Beilage zur täglichen Ausgabe eine enzyklopädische Zusammenfassung neuer Schriften und ein Beiheft mit Neuigkeiten zu Autoren und Verlegern. Ihr Ziel war es, schlichtweg alles zu besprechen und zu systematisieren sowie kritische Kommentare zu Entwicklungen in jedem Bereich von Wissen und Kultur zu liefern. Die außerordentliche Bandbreite der Rezensionszeitschriften spiegelt das phänomenale Wachstum des Verlagswesens insgesamt wider. Zwischen 1763 und 1805 erschienen etwa zehnmal mehr Bücher als zwischen 1721 und 1763. 20 Die Verlagsbranche expandierte, um den anscheindend unerschöpflichen Nachschub an Manuskripten zu bewältigen und den unersättlichen Hunger der Leser zu stillen. In den 1770er Jahren gab es im Reich mehr als 200 seriöse Verlage, die etwa 22 Millionen Bücher druckten. Johann Georg Meusels biografisches Autorenlexikon, das ab 1772 regelmäßig erschien, listete anfangs mehr als 3.000 Schriftsteller auf; 1788 schätzten die Herausgeber die Anzahl auf mehr als 6.000, 1806 auf 10.648. 21 Freilich schrieben viele der von Meusel Aufgelisteten nicht mehr als ein oder zwei Pamphlete. Es lagen Welten zwischen ein paar bescheidenen Gedanken zum Kleeanbau und den gelehrten juristischen Traktaten von Johann Jacob Moser und Johann Stephan Pütter, den großen philosophischen Werken von Kant und den Stücken von Goethe und Schiller. Auch die Auflagen waren meist gering. »Bestseller« wie Rudolf Zacharias Beckers Noth-und Hülfsbüchlein für Bauersleute, das sich von 1788 bis 1813 eine Million Mal verkaufte, und Friedrich Eberhard von Rochows Der Kinderfreund (2 Bände, 1776–1780) mit 100.000 Exemplaren in mehreren Auflagen waren rar. Große Autoren wie Goethe und Schiller konnten auf dem Höhepunkt ihrer Beliebtheit mit Einzelauflagen zwischen 2.000 und 3.000 rechnen, die die meisten anderen niemals erreichten. 22 Aber die Masse und Themenvielfalt der Veröffentlichungen und die steigende Anzahl von Schriftstellern jeder Art belegen die Entwicklung einer zunehmend vielgestaltigen öffentlichen Sphäre. Selten genossen Dialog und Diskussion, Debatte und Kontroverse, schriftlich und öffentlich, solche Wertschätzung. Was Adolph Freiherr von Knigge als Dialog zwischen Autoren und ihrem Publikum bezeichne-
535
536
V. · Die deutschen Territorien nach 1760
te, fand auch im Theater statt. 23 In den 1750er und 1760er Jahren wandte man sich von der an Höfen bevorzugten Form des Dramas ab und neuen Formen zu. Französischsprachiges Theater und traditionelle tragische Formen mit aristokratischen Helden wurden von deutschsprachigen Dramen und Tragödien mit bürgerlichen Figuren verdrängt. Gotthold Ephraim Lessings bürgerliches Trauerspiel und sein ebenso neuartiges Genre des rührenden Lustspiels sollten die Tugend adeln und über das Theater als erzieherisches Medium Schlüsselwerte der Aufklärung vermitteln. 24 Lektüre und Diskussion waren die Kernbeschäftigung vieler der Klubs und Gesellschaften, die in dieser Zeit florierten. Das galt natürlich am meisten für die Lesegesellschaften selbst, von denen etwa 430 mit insgesamt etwa 15.000 bis 20.000 Mitgliedern bekannt sind. 25 Ähnlich viele Angehörige dürften zur gleichen Zeit die 250 bis 300 Freimaurerlogen in vielen deutschen Städten gehabt haben. 26 4.000 bis 5.000 schlossen sich den fünfzig oder sechzig patriotischen beziehungsweise ökonomischen Gesellschaften nach 1760 an. In diesem Bereich fallen besonders die vielen Vereine auf, die sich der Landwirtschaft und sogar speziellen Themen wie der Imkerei widmeten. 27 Gleichzeitig kamen zu den relativ wenigen gelehrten Akademien stetig weitere neue Stiftungen hinzu, in erster Linie in diversen Hof- und Regierungszentren. 28 Die meisten dieser Organisationen waren fundamentalen Prinzipien und Zielen der Aufklärung verpflichtet: der offenen Diskussion neuer Ideen oder aktueller Themen mit vernünftigen und intelligenten Menschen in »demokratischer« Umgebung ohne Rücksicht auf sozialen Status, geografische Herkunft und religiösen Glauben; das letztliche Ziel war der Einsatz »richtiger« Ideen und neuen Wissens zum Wohl der Gesellschaft, für Fortschritt und Reformen. Die Freimaurer waren eine Geheimgesellschaft, ihre Ziele indes grundsätzlich öffentlich; nur in der geschlossenen Gesellschaft der Loge konnte man seine Meinung frei äußern und spekulativ debattieren. Manche, vor allem die Akademien, sprachen mit Aufsatzwettbewerben zu aktuellen Kernthemen direkt die Öffentlichkeit an; das gilt auch für einige patriotische und ökonomische Gesellschaften, die in Preisausschreiben nach Meinungen zu öffentlicher Gesundheit, Fruchtwechsel und Kleeanbau oder nach den Vorteilen der Stallhaltung von Vieh im Vergleich mit Freilandhaltung fragten. 29 Die offiziellen Klubs und Gesellschaften waren nur die sichtbarste Erscheinungsform eines umfangreichen neuen sozialen Mediums. Andere wurden inoffiziell organisiert oder entwickelten ein geheimnisvolles, in mancher Augen bedrohliches Wesen. In Berlin gab es eine Vielzahl kleiner Kreise wie die 1749 gegründete Montagsgesellschaft und die 1783 gegründete Mittwochsgesellschaft. 30 Erstere war auf vierundzwanzig Mitglieder beschränkt und widmete sich der Diskussion literarischer und philosophischer Themen; ihr Pendant war ebenso exklusiv, aber ent-
51. Neue Herausforderungen: Aufklärung und Öffentlichkeit
schieden politisch mit dem Ziel, Reformen in Preußen zu fördern. Beide repräsentierten die künstlerische und regierungspolitische Elite inmitten einer, wie die Berlinische Monatsschrift 1784 meinte, Überfülle an Klubs, ähnlich wie in England und Genf, wo »gesprochen, geschwatzt, gegessen, wohl auch vorgelesen« werde, »man findet Zeitungen, Journale, Schachspiel, Billard, Karten, u. s. w.«. Von ganz anderer Art waren zwei diametral gegensätzliche Geheimorganisationen, die in den 1770er und 1780er Jahren begrenzt Fuß fassten. Der Orden der Illuminaten entstand 1776 in Ingolstadt. Sein Gründer Adam Weishaupt, Professor für Kirchenrecht, hatte mit den Freimaurern nichts zu tun, hoffte aber, deren Krise ausnutzen zu können, um Mitglieder für seine eigene Gesellschaft zu gewinnen. 31 Eine weitere Verbreitung schien möglich, als der hannoversche Freimaurer Adolph Freiherr von Knigge 1781 beitrat und sofort daran ging, Netzwerke in Nord- und Westdeutschland zu knüpfen. Weishaupt und Knigge überwarfen sich jedoch bald, zudem zerstritt sich Weishaupt auch mit der Areopag genannten Münchner Führungsgruppe. Eine Reihe von regierungsamtlichen Verboten gegen den Orden ab 1784, die in der exemplarischen Veröffentlichung von Weishaupts vermeintlich aufwieglerischen Schriften durch die bayerische Regierung 1786/87 gipfelte, führte zu seinem Ende in jeder organisierten Form. Schätzungen der Mitgliederzahl des Illuminatenordens auf seinem Höhepunkt schwanken zwischen 600 und 4.000; eine niedrigere Zahl ist eher wahrscheinlich. Ob seine Ziele wirklich aufrührerisch waren, ist zweifelhaft. Der Orden war bestrebt, sein Netzwerk auszuweiten, seine aufklärerischen Ideale intern (nie öffentlich) zu diskutieren und über seine hochrangigen Mitglieder die Regierungspolitik auf höchster Ebene zu beeinflussen. Seine Wirkung ist kaum einzuschätzen, auch wenn man davon ausgeht, dass unter seinen Angehörigen herrschende Fürsten, Männer wie Goethe, Herder, Nicolai und Pestalozzi, aber auch wichtige Beamte, etwa führende Richter des Reichskammergerichts, waren. 32 Zugleich ist leicht einzusehen, weshalb dieses geheimniskrämerische Netzwerk mit den Autoritäten des Reichs in Konflikt geriet. Noch undurchsichtiger war der Orden der Gold- und Rosenkreuzer, 1756 mit entschieden pietistischer, antirationalistischer Agenda gegründet, der sich in Opposition zu den Illuminaten Mitte der 1770er Jahre politisierte. 33 Die Gruppe berief sich auf eine unklare intellektuelle Herkunft von den Rosenkreuzern des frühen 17. Jahrhunderts und deren angeblicher Vorläufer, und einige Mitglieder standen sicherlich in der Tradition von Jakob Böhme. Den Einfluss des Ordens verstärkte 1781 die Rekrutierung des preußischen Kronprinzen, des späteren Friedrich Wilhelm II. Seine herausragende Leistung soll die Durchsetzung von Johann Christoph von Wöllners preußischem Religionsedikt 1788 gewesen sein, das das Christentum in den etablierten Kirchen stärken sollte und in gewissem Maß die intellektuelle Freiheit einschränkte. Das macht den Orden indes nicht automatisch zu einem Teil
537
538
V. · Die deutschen Territorien nach 1760
der Gegenaufklärung, schließlich hielt sich Wöllner selbst für aufgeklärt. Man sollte ihn daher besser als Teil des breiten und heterodoxen Meinungsspektrums betrachten, das nach 1750 im Reich entstand und dem scharfen Rationalismus pansophische, naturalistische, vitalistische und mystische Strömungen entgegensetzte. Trotz der außerordentlichen Vielfalt und Intensität der Aktivitäten war die soziale Reichweite der Aufklärungsbewegung nach wie vor begrenzt. Mit Sicherheit zählten bei Weitem nicht alle der geschätzt 3 Millionen Zeitungsleser dazu. Die Schätzung von etwa 100.000 Gebildeten, die dann und wann Mitglieder der diversen Klubs und Gesellschaften waren, oft mehrerer gleichzeitig, gibt einen besseren Anhaltspunkt. 34 Dazu zählten Adlige, Kleriker, Professoren und Lehrer, Staatsbeamte und Studenten. Neben einem kleinen Anteil von Kaufleuten war die Mehrheit in dieser oder jener Weise mit der Infrastruktur der Regierung oder mit Institutionen unter Regierungskontrolle verbunden oder bereitete sich als Studenten auf eine solche Laufbahn vor. 35 Die Konzentration der Mitglieder von Gesellschaften in diesen Bereichen verlieh ihnen beträchtlichen potenziellen Einfluss. In Relation zur Größe der Regierungsadministrationen der Zeit ist ein Spektrum von 100.000 aufgeklärten Einzelnen sicherlich beeindruckend. 1762 gab es nicht mehr als etwa 20.000 »öffentliche« Beamte in ganz Österreich-Böhmen, Tirol und Vorderösterreich, von denen nur 7.421 bei der Regierung angestellt waren (zum Vergleich: für Adel und Städte arbeiteten 11.669 Angestellte, für die Stände 1.494). 36 1786 gab es nicht mehr als 3.000 »Staatsdiener« in Preußen. 37 Kleriker, Professoren, Lehrer und Studenten sind damit freilich nicht erfasst; die Zahlen zeigen jedoch, dass selbst eine relativ kleine aufgeklärte Elite in einer begrenzten bürokratischen und regierungsamtlichen Struktur etwas bewirken konnte. Es ist jedoch vielleicht heilsam, sich an die ständigen Klagen der Aufklärer zu erinnern, sie seien zu wenige und ihre Position sei immer unsicher. 38 Zudem litten sie unter Behinderungen durch politische Autoritäten und Zensur. Durch anonyme Autorschaft und die Verlagerung von Publikationen in ein anderes Territorium konnte man lokalen Einschränkungen oft entgehen. Aber die Risiken offener Rede waren nur zu real. Als Christian Friedrich Daniel Schubart die Gleichberechtigung der Juden, Abschaffung der Sklaverei und ein Ende des Söldnerhandels forderte und das Verbot der Folter und die Aufhebung der Leibeigenschaft durch Joseph II. pries – alles in seiner weitverbreiteten Teutschen Chronik – ließ ihn der Herzog von Württemberg 1777 verhaften und ohne Prozess für zehn Jahre einsperren. 39 Schubarts Fall war eine Ausnahme, aber viele andere wurden wegen ihrer unorthodoxen, unpassenden oder einfach kritischen Äußerungen eingeschüchtert, behindert oder zu geringeren Haftstrafen verurteilt. Die Anzahl derer, die mit der Obrigkeit in Konflikt gerieten, war hoch genug, um dafür zu sorgen, dass man sich selbst zensierte oder Botschaften zwischen den Zeilen verbarg.
51. Neue Herausforderungen: Aufklärung und Öffentlichkeit
Zunehmende Forderungen nach Pressefreiheit in den 1780er Jahren und negative Berichterstattung über das unbarmherzige Vorgehen von Herrschern bei der Unterdrückung von Meinungen, die ihnen nicht passten, verschoben das Gleichgewicht wohl ein Stück. 1780 zum Beispiel verlangte das Bistum Eichstätt von den Autoritäten in Hannover, den Göttinger Professor August Ludwig Schlözer zu bestrafen, weil er einen angeblichen Justizirrtum in Eichstätt 1780 kritisiert hatte. Hannover weigerte sich nicht nur, sondern blieb auch tatenlos, als Schlözer seine Briefe nach Eichstätt publizierte, in denen er das Verhalten des Bischofs in der Affäre mit Hohn und Spott überschüttete und darauf bestand, Öffentlichkeit und Offenheit seien grundlegend für jedes juristische System. 40 Einzelne Herrscher konnten bloßgestellt werden, andere überlegten lieber zweimal, bevor sie eine schlechte Berichterstattung riskierten. Die Rufe nach Pressefreiheit hatten indes keinen Erfolg. Tatsächlich häuften und intensivierten sich nach 1789 die Bestrebungen der Regierungen nach Kontrolle und richteten sich in vielen Fällen ausdrücklich gegen die Verbreitung aufklärerischer Ideen, die nun als aufwieglerisch galten. Ebenso erfuhren viele aufgeklärte Beamte und Kleriker Widerstand von unten. Oft lehnten genau die Gemeinden ihre Ideen ab, die sie zu überzeugen versuchten, sich neue Regeln und Regulierungen oder im Fall von Klerikern neue Formen des Gottesdienstes und traditioneller Rituale anzunehmen. Solche volkstümlichen Reaktionen bekräftigten zwangsläufig die Argumente der Aufklärungsgegner und schürten bei manchen Zweifel, inwieweit es überhaupt möglich und wünschenswert war, das breite Volk aufzuklären. 41
Anmerkungen 1 Wertvolle Überblicke bieten: Borgstedt, Aufklärung; Müller, Aufklärung; Pütz, Aufklärung; Beutel, Aufklärung; Möller, Vernunft; vgl. für eine weitere Diskussion und Hinweise Whaley, »Transformation«; vgl. auch S. 380–391. 2 Umbach, »Culture«. 3 Pinkard, Philosophy, 89. 4 Hunter, »Multiple Enlightenments«. 5 Weigl, Schauplätze, 16 ff.; François, »Network«, 87 ff., 93–99. 6 Feiner, Jewish Enlightenment; Graetz, »Enlightenment«; Borgstedt, Aufklärung, 48–53. 7 Vgl zur Orientierung Borgstedt, Aufklärung, 90–98; Müller, Aufklärung, 94–100; vgl. auch Sternhell, Tradition. 8 Vgl. S. 517 ff. 9 Vgl. die Aufsätze in Hill, Literature; Dann, »Herder«; Žmegač, Geschichte I/1, 194–256. 10 Fink, »Patriotisme culturel«. 11 Vgl. zu den Illuminaten Hardtwig, Genossenschaft, 336–343; Van Dülmen, Society, 104– 118.
539
540
V. · Die deutschen Territorien nach 1760
12 Voss, »Die Eudämonia«; vgl. auch Kraus, »Gegenaufklärung«, sowie Albrecht und Weiß, »Gegenaufklärung«. 13 Kant, Aufklärung, 55–61. 14 Vgl. z. B. Krieger, Freedom, 86–125. 15 Sonderweg ist der von vielen deutschen Historikern seit den 1960er Jahren benutzte Begriff für eine vermeintlich spezielle Entwicklung in der deutschen Geschichte, die angeblich im Holocaust gipfelte; vgl. Kocka, »Sonderweg«, und Sheehan, »Paradigm«. 16 Vgl. S. 504 f. 17 Böning, Welteroberung, 22 f. 18 Welke, »Lektüre«, 30. 19 Einen umfangreichen Überblick über deutsche Periodika bietet Fischer, Haefs und Mix, Handbuch, auf dem, wo nicht anders erwähnt, die folgenden Absätze beruhen; vgl. zur Allgemeinen Deutschen Bibliothek Möller, Aufklärung, 197–206. 20 Demel, Reich, 147. 21 Kopitzsch, »Sozialgeschichte«, 60 ff. 22 Kiesel und Münch, Gesellschaft, 159 f.; Bruford, Germany, 279–284. 23 Knigge, Umgang, 8, 429. 24 Kiesel und Münch, Gesellschaft, 82 ff.; Nisbet, Lessing, 246–293; Lamport, »Lessing«. 25 Van Dülmen, Society, 83–92. 26 Ebd., 52–65. 27 Abel, Landwirtschaft, 276–278. 28 Hardtwig, Genossenschaft, 271. 29 Vgl. für ein Beispiel zu Letzterem Abel, Landwirtschaft, 277 f. 30 Möller, Vernunft, 265 ff.; Hardtwig, Genossenschaft, 301 ff.; Keeton, »Montagsklub«; Schmidt, »Enlightenment«, 272 ff.; Birtsch, »Mittwochsgesesellschaft«; Haberkern, Aufklärung, 163–214. 31 Hardtwig, Genossenschaft, 336–343; Van Dülmen, Society, 104–118. 32 Vgl. zu Letzterem Neugebauer-Wölk, »Altes Reich«, 304–325. 33 Hardtwig, Genossenschaft, 334 ff. 34 Demel, Reich, 143. 35 Zaunstöck, Sozietätslandschaft, 183–187, 275. 36 Demel, Reform, 248. 37 Ebd., 227. 38 Möller, Vernunft, 285 f. 39 Breuer, Zensur, 133–139. 40 Laursen, »Publicity«, 118 f. 41 Schneiders, Wahre Aufklärung, 70–80.
52. Protestantische, katholische und jüdische Aufklärung
D
ie Aufklärung wird oft als säkulare oder säkularisierende Bewegung beschrieben. Sicherlich kam es in bestimmten Gruppen zu signifikanten Veränderungen der Einstellung zum Glauben und zu Kirchen, aber es gab auch starke Linien der Kontinuität. Selbst die gebildeten Gruppen, deren Einstellung sich am deutlichsten änderte, lehnten nur selten religiösen Glauben und organisierte Religion gänzlich ab. Eine Minderheit entwickelte ein neues Verständnis von Religion und neue Formen des Christentums, manche gar Ideen von einer ganz neuen Religion. Aber die Mehrheit der Bevölkerung lebte weiterhin im Gefüge der etablierten Kirchen. Dennoch waren deren Position in der Gesellschaft und ihr Verhältnis zur Macht von wichtigen innerkirchlichen Entwicklungen betroffen. Während die Aufklärung solcherart grundlegend auf die protestantische und die katholische Kirche einwirkte, waren ihre Spuren auch in den jüdischen Gemeinden im Reich zu spüren. In der Phase intensiver Diskussion des Charakters und der Ziele der Aufklärung wurden die Juden nicht nur zum Thema der Debatte über Toleranz und Fortschritt, sondern wirkten erstmals als vollwertige Teilnehmer an einer »christlichen« Debatte mit. Religion und religiöse Debatten standen weiterhin im Vordergrund. Kant setzte »den Hauptpunkt der Aufklärung … vorzüglich in Religionssachen«, weil Herrscher von diesem Bereich nichts zu befürchten hatten und daher unbesorgt völlige Freiheit gestatten konnten. 1 In den Augen vieler seiner Zeitgenossen war die Sache bei Weitem nicht so einfach. Der Westfälische Friede mit seinen detaillierten Regelungen zu konfessionellen Streitpunkten in den Territorien blieb gültig. Zwar verlor die göttliche Begründung des Königtums während des 18. Jahrhunderts viel von ihrer überwältigenden Kraft, aber die Regierungsgewalt ruhte fast überall weiterhin auf den Grundlagen des christlichen Glaubens. Andererseits hatte die Entschlossenheit vieler Protestanten im späten 17. Jahrhundert, ihre Autorität über die Kirchen geltend zu machen, nun eine Reihe gewollter und ungewollter Folgen. Zunehmend versuchten Herrscher aus pragmatisch ökonomischen Anliegen, wenn schon nicht der christlichen oder – viel seltener – weltlichen Toleranz zuliebe, die Duldung auf Minderheiten auszudehnen. Dabei waren es dieselben Herrscher gewesen, die zur Kritik an den Kirchen ermutigt hatten, um die Autorität des Klerus zu untergraben. Nun sahen sie sich oft mit der Notwendigkeit konfrontiert, radikale Kritik an der Religion einzuschränken und sicherzustellen, dass der Klerus den Zielen der Regierung diente. Es zeigte sich
542
V. · Die deutschen Territorien nach 1760
jedoch bald, dass es nicht möglich war, die wachsende Anzahl jener Intellektuellen in Schranken zu halten, die jede Form orthodoxer Religion aufgaben. 1783 mahnte Herder Herzog Karl August von Weimar, wenn der Herrscher selbst sich von der organisierten Religion abwende, gefährde er seine Autorität über seine territoriale Kirche und letztlich über sein Territorium. 2 Und schließlich konnte die Zunahme an Toleranz in vielen Territorien und das Eintreten vieler Aufklärer und anderer für irenische Ansichten nicht gänzlich über die anhaltende Spannung zwischen Protestanten und Katholiken im Reich hinwegtäuschen. Die Aussicht auf eine Wiedervereinigung der Christen im Reich war gering. Wie das Corpus Evangelicorum und das Corpus Catholicorum über ihre jeweiligen Rechte wachten, so wurden orthodoxe Kleriker etwa in den lutherischen Territorien oft Experten für imperiales Recht und eifrige Hüter einer buchstabengetreuen Auslegung des Westfälischen Friedens. Hoffnungen auf eine Wiedervereinigung setzten voraus, dass beide Lager grundlegende Dogmen ablegten; keine konfessionell geprägte Regierung war letztlich bereit, auf ihr substanzielles Eigeninteresse an einer wohlgeordneten kirchlichen Struktur mit loyaler Priesterschaft zu verzichten. Im protestantischen Deutschland wurden die Ideen der Aufklärung von jenen verfochten, die die rationalistischen Ideen der Wolffianer aus den 1740er Jahren weiterentwickelten. Später verspottete man sie oft als »Neologen« – ein Beiname, der unter Gelehrten des 20. Jahrhunderts üblich wurde. 3 Die Neologie war keine echte Bewegung, da es weder eine Fraktion mit klar erkennbarer Mitgliedschaft noch ein gemeinsames Programm gab, sondern eher eine breite, uneinheitliche Strömung, die zwischen 1740 und dem Ende des Jahrhunderts ihre Blütezeit erlebte, mit einzelnen Vorläufern im 17. Jahrhundert und Nachwirkungen bis ins 19. Jahrhundert. Neologie stand für die Ablehnung sowohl der Orthodoxie als auch extremer pietistischer Vorstellungen von Bekehrung und Erlösung. Zugleich distanzierten sich Neologen von dem in ihren Augen unfruchtbaren Szientismus der Wolffianer. Sie lehnten den Deismus ab, befürworteten die Moralphilosophie der CambridgePlatonisten (vor allem Tillotson, Shaftesbury und Hutcheson) und die pragmatische Toleranz, die sie in Großbritannien und den Niederlanden verwirklicht sahen. Während den Wolffianern vor allem daran gelegen war, Vernunft und Offenbarung in Einklang zu bringen, betonten die Neologen die Vereinbarkeit von Vernunft und Empfindung und konzentrierten sich auf das religiöse Leben des Einzelnen. Ahnherren der Neologie waren Johann Franz Buddeus (* 1667, † 1729) und Christoph Matthäus Pfaff (* 1686, † 1760). Beide verbanden Elemente traditioneller Orthodoxie mit neuen pietistischen Ideen; ihr Hauptziel war die Bekämpfung jeglicher Form von Atheismus. Ihre »rationale« oder »aufgeklärte« Orthodoxie
52. Protestantische, katholische und jüdische Aufklärung
setzte Siegmund Jakob Baumgarten (* 1706, † 1757) in eine rückhaltlose Form von systematisierendem Wolffianismus um. Voltaire pries Baumgarten als »Krone der deutschen Gelehrten«, andere nannten ihn das »Orakel der Theologen«. 4 Baumgartens Wolffianismus war stets von pietistischen Elementen geprägt; letztlich suchte er zu erklären, wie Gefühl und Vernunft einander in der Bildung von Glauben und Urteilen ergänzten. Das wesentliche Interesse des erstaunlich vielseitigen Denkers war die Theologie, er arbeitete jedoch auch mit seinem Bruder zusammen, Alexander Gottlieb Baumgarten (* 1714, † 1762), der den Begriff »Ästhetik« prägte und damit die Grundlage für die weitere Entwicklung der deutschen literarischen Kultur schuf. 5 Vor allem veränderte Siegmund Baumgarten ab 1734 als Theologieprofessor in Halle das Zentrum des norddeutschen Pietismus und die Quelle der protestantischen Aufklärung oder Neologie, die die lutherische Theologie für das nächste halbe Jahrhundert dominierte. Die führenden Figuren der Neologie waren Baumgartens Schüler Johann Salomo Semler (* 1725, † 1791) und Johann Gottlieb Töllner (* 1724, † 1774) sowie Johann Friedrich Wilhelm Jerusalem (* 1709, † 1789) und Johann Joachim Spalding (* 1714, † 1804). Der Buchhändler, Journalist und Romanautor Friedrich Nicolai (* 1733, † 1811) spielte ebenfalls eine wichtige Rolle für die Verbreitung der Werke und Ideen der Neologen, vor allem durch seine einflussreiche Rezensionszeitschrift Allgemeine Deutsche Bibliothek (1765–1806). Ihre theologischen Schriften flankierte das Werk von Kirchen- und Bibelhistorikern wie Johann Lorenz von Mosheim (* 1693, † 1755), Johann August Ernesti (* 1707, † 1781) und Johann David Michaelis (* 1717, † 1791). Im Allgemeinen maßen die Neologen alles an der Vernunft. Die Idee der Offenbarung lehnten sie nicht ab, betrachteten jedoch alles, was nicht mit der Vernunft vereinbar war, als historischen Zufall oder schlichte Täuschung. Ohne die Göttlichkeit Christi zu verleugnen, betrachteten sie ihn indes nicht als Sohn Gottes oder Erlöser, sondern eher als noblen Lehrer der Menschheit wie Sokrates: den Sokrates von Galiläa. Als Verfechter einer philosophischen Theologie sahen sich die Neologen in der Tradition von Melanchthon. Sie stellten traditionelle Dogmen nicht infrage, maßen ihnen jedoch weniger Gewicht bei als die orthodoxe Tradition. Dies und eine streng historische Herangehensweise sorgten für eine starke Befürwortung religiöser Toleranz und neues Interesse an einer Wiedervereinigung der christlichen Kirchen. Das praktische Verständnis der Heiligen Schrift, das auf Textanalyse zur Unterscheidung des Wortes Gottes von historischen Beschreibungen menschlicher Taten beruhte, verband sich mit einem praktischen Interesse für den Christen in der Gesellschaft und der Betonung sozialer Ethik. Diese Prinzipien, in Predigten umgesetzt, riefen eine Reihe von Interessen wach, die später für den Vorwurf
543
544
V. · Die deutschen Territorien nach 1760
sorgten, die Neologen hätten die Religion so gut wie zerstört und die Theologie ihrer Bedeutung und ihres Inhalts beraubt. Regelmäßige Predigten zu Themen wie Impfungen, Essgewohnheiten, selbst Forstverwaltung und Viehzucht, schienen die Verspottung ihrer weltlichen Ausrichtung zu rechtfertigen. Andererseits sprechen Predigten gegen Sklaverei, Duelle, Folter, Todesstrafe und schlichtweg schlechte Herrschaft dagegen, dass die aufgeklärten Kleriker einfach nur unterwürfige Konformisten gewesen seien. Programmatische Schlüsselwerke von Johann Joachim Spalding waren Betrachtung über die Bestimmung des Menschen (1748) und seine Gedanken über den Werth der Gefühle in dem Christentum (1761). 6 Die Neologen verfügten über eine starke akademische Basis, aber sie erreichten auch ein breiteres Publikum. Zu ihnen zählten führende Kirchenmänner, Angehörige von Konsistorien, Superintendenten territorialer Kirchen und gewöhnliche Pastoren. Sie veröffentlichten nicht nur akademische Werke, sondern spezialisierten sich auf volkstümliche Theologie für den literarischen Markt, und viele von ihnen verbreiteten ihre Ideale über die Presse ebenso unermüdlich wie von der Kanzel. 7 Die Zentren der Bewegung lagen in Brandenburg, vor allem in Halle und Berlin, wo führende Neologen der Mittwochsgesellschaft und dem ausgedehnten Netzwerk der Mitarbeiter von Friedrich Nicolais Allgemeiner Deutscher Bibliothek angehörten. Tatsächlich waren ihre Lehren von denen der »Alltagsaufklärer«, der Popularphilosophen, bald kaum noch zu unterscheiden. In Brandenburg umfasste die Bewegung Lutheraner und Reformierte; Versuche zur Vereinigung beider Konfessionen blieben jedoch bis 1817 fruchtlos. 8 Anderswo war die Bewegung in erster Linie lutherisch; weitere wichtige Zentren waren Leipzig, Jena und Göttingen. Gerlach Adolph von Münchhausen, der Gründer der Göttinger Universität, rekrutierte nur Männer, die weder »zum Atheismo und Naturalismo leiten« oder »den Enthusiasmum einführen« noch »ein evangelisches Pabsthum mitsamt der damit verbundenen intoleranten Beschneidung der Confessionsfreiheit aufrichten« wollten. 9 Obwohl sie bis in die 1790er Jahre vorherrschend blieben, waren die Neologen ständig Angriffen pietistischer und orthodoxer Theologen ausgesetzt. In dem orthodoxen Vorkämpfer Pastor Johann Melchior Goeze in Hamburg und dem pietistischen Autobiografen und Schriftsteller Johann Heinrich Jung, bekannt als JungStilling (* 1740, † 1817), fanden die Neologen mehr als ebenbürtige Gegner, was literarische und polemische Fähigkeiten und Gespür für Öffentlichkeitswirkung anging. 10 In Brandenburg selbst erregten Gespräche über die Vereinigung oder Versöhnung der lutherischen und reformierten Kirchen besonders heftigen Widerstand von Pietisten und Orthodoxen beider Lager. Die Kritik aus anderen Bereichen unterstrich die Vielfalt an Auslegungen der Aufklärung und wie sie zu erreichen sei. Justus Möser zum Beispiel stellte fest,
52. Protestantische, katholische und jüdische Aufklärung
keine Religion solle »nur auf bloßen Vernunftschlüssen« beruhen: »Denn dieses kann nicht geschehen, ohne eines jeden Menschen Vernunft zum Richter zu machen.« 11 Herder spottete, Spalding wolle die Kirche in eine »Bildungsakademie für Bürger und Unterthanen Sr. Majestät« verwandeln. Er missbilligte die »Civilpriesterei unsrer Zeit« und fragte sarkastisch: »Wozu ist der Mensch allenfalls gut, als Geburts- und Todtenlisten einzuschicken, Edikte zu verlesen und den Teufel zu predigen, damit die Edikte auch gehalten werden …« 12 Herder mag entgangen sein, dass Spalding meinte, Priester sollten ebenso Lehrer des Volks wie Diener des Staats sein; aber sogar viele Kleriker, die grundsätzliche Glaubenslehren der Neologen teilten, lehnten es ab, von Regierungen als quasibürgerliche Funktionäre eingesetzt zu werden. 13 In Braunschweig-Wolfenbüttel und Kurhannover befürwortete der lutherische Klerus aufklärerische Ideen und entwickelte sich zum Rückgrat der antizentralistischen Opposition. Nicht zuletzt missfiel vielen Kongregationen die Reform von Liturgien und Gesangsbüchern, der alte Favoriten zum Opfer fielen. Ein 1780 in Brandenburg erschienenes neues Gesangsbuch erregte solchen Widerstand, dass es eilends zurückgezogen wurde. 14 Es erwies sich, dass die Laienschaft nicht mit dem Denken progressiver Pastoren Schritt gehalten hatte. Ein Hauptgrund der Feindseligkeit gegenüber den Neologen war die Ansicht, Aufklärung führe schlicht zu Indifferentismus und Atheismus. Im Allgemeinen war der Vorwurf falsch, wurde jedoch geschürt durch die Entwicklung einer radikaleren Strömung neben den Neologen. Wirkliche Atheisten gab es kaum. Einzelfiguren wie der hallesche Theologe und Dozent Friedrich Karl Bahrdt (* 1741, † 1792), der den Schutz Friedrichs des Großen genoss und nach 1786 in Konflikt mit der preußischen Obrigkeit geriet, und der brandenburgische Pastor Johann Heinrich Schulz (* 1739, † 1823), der 1791 entlassen wurde, weil er predigte, Gott sei nicht mehr als eine »Schimäre«, waren isolierte Ausnahmen. 15 Der strenge Materialismus des aus Deutschland nach Paris emigrierten Baron d’Holbach (* 1723, † 1789) fand im Reich kaum Anhänger; Spinoza hingegen war eine beständige Quelle radikaler theologischer Inspiration. Das wirkliche Ausmaß des Radikalismus ist unklar, da viele ihren wahren Glauben verbargen, während sie geheime Literatur lasen und verbreiteten. Eine wachsende Anzahl von Intellektuellen scheint jedoch orthodoxe protestantische Positionen zugunsten der einen oder anderen Form von Rationalismus aufgegeben haben und offenbar waren viele nun in der Lage, privaten Radikalismus mit einer erfolgreichen literarischen oder Beamtenlaufbahn zu verbinden, in einigen Fällen sogar im Klerus. Nach Johann Christian Edelmann (* 1698, † 1767) und Johann Lorenz Schmidt (* 1702, † 1749), dem Herausgeber der Wertheimer Bibel, gewann der Rationalismus stetig an Boden. Hermann Samuel Reimarus (* 1694, † 1768) arbeitete von 1736 bis zu seinem Lebensende an der bahnbrechenden Apologie
545
546
V. · Die deutschen Territorien nach 1760
oder Schutzschrift für die vernünftigen Verehrer Gottes, die er zu Lebzeiten nicht veröffentlichte. Seine Ideen erreichten indes ein breiteres Publikum, als Lessing 1774–1778 seine Fragmente eines Ungenannten publizierte. Wahrscheinlich teilte Lessing grundsätzlich Reimarus’ Einstellungen, seine Haltung war aber wohl auch komplizierter. Sein wahres Interesse galt der Debatte, der Gegenüberstellung einander widerstreitender Ansichten in der Hoffnung auf mehr Klarheit. Als der »Fragmentstreit« losbrach und er von dem Hamburger Pastor Johann Melchior Goeze (* 1718, † 1786) angegriffen wurde, dem überragenden Verfechter lutherischer Orthodoxie seiner Zeit, erklärte er seinem Bruder, er wolle nichts mehr, als dass jedermann rational über Religion nachdenke, er wolle jedoch nicht das »unreine Wasser« der Orthodoxie gegen die »Mistjauche« der »neumodischen Theologie«, das »Flikwerk von Stümpern und Halbphilosophen« eintauschen. 16 Hinter Lessings Interesse an Debatten – ganz im Sinn der Aufklärung – verbarg sich mit Sicherheit eine profunde Neigung zu spinozistischen Ideen. Sein angebliches Geständnis gegenüber Friedrich Heinrich Jacobi von 1780, er sei Spinozist, löste vier Jahre nach seinem Tod die aufsehenerregendste theologisch- philosophische Debatte des Jahrhunderts aus. Jacobis Über die Lehre des Spinoza in Briefen an den Herrn Moses Mendelssohn (1785) war ein umfassender Angriff auf den spinozistischen Rationalismus und die Aufklärung insgesamt. 17 Der Konflikt zwischen Vernunft und Glauben, schrieb er, sei unlösbar; Vernunft führe zwangsläufig zum Atheismus, Aufklärung werde unausweichlich die Gesellschaft zerstören. Der einzige Weg, eine Entwicklung zum Nihilisten zu vermeiden, sei der Salto mortale in das Bewusstsein freien Handelns und den Glauben. Jacobis Polemik untergrub jedoch ganz und gar nicht die Aufklärung, sondern leistete neuen Ausprägungen Vorschub. Lessing soll gegenüber Jacobi geäußert haben, die Leute redeten von Spinoza wie von einem »toten Hund«. Tatsächlich war Spinozas Einfluss auf die heimliche radikale Strömung ab etwa 1750, in der man ihn als großen Vorläufer verehrte, beträchtlich. 18 Jacobis Angriff ließ Spinoza zum Helden werden und verlieh seinen Ideen eine gewisse Respektabilität. Es ließ sich nicht als Schande darstellen, Lessing zu bewundern, die meistverehrte Gestalt der Aufklärung der Jahrhundertmitte. Wenn Lessing Anhänger Spinozas gewesen war, musste doch auch dieser über Kritik erhaben sein? 19 Jacobis Buch und der Streit, den es auslöste, wurden zu einer Art Katalysator. Lange vor Jacobis Breitseite entworfene, oft im Stillen, zögernd und unsicher entwickelte Ideen traten nun klar und gestärkt hervor und fanden überzeugte Anhänger. Am größten war die Wirkung offenbar bei jenen, die in den 1760er und 1770er Jahren Rousseau gelesen hatten. Seither hatte etwa Herder gegen den in seinen Augen sterilen Rationalismus der Neologie reagiert; 1774 prangerte er in An Prediger. Funfzehn Provinzialblätter Spaldings Sicht des Priesters als praktischen
52. Protestantische, katholische und jüdische Aufklärung
Lehrers der Aufklärung an. Danach jedoch begann er Grundlehren der Neologie in seinen persönlichen Glauben zu übernehmen. Jacobi regte ihn an, Spinoza genau zu studieren. Das Ergebnis war Herders Gott. Einige Gespräche (1787), worin er Spinoza als pantheistischen Vitalisten, nicht als Deisten darstellte, als einzige verlässliche Quelle moralischer und religiöser Überzeugungen, die mit Vernunft und wissenschaftlichem Naturalismus vereinbar sei. 20 Goethe brach früher und entschiedener mit jeder Art von orthodoxem Christentum. Im Juli 1782 hatte er Johann Caspar Lavater mitgeteilt, er sei »zwar kein Widerkrist, kein Unkrist, aber doch ein dezidirter Nichtkrist«, und während er es eher überheblich ablehnte, sich in die Polemik gegen Jacobi hineinziehen zu lassen, vertiefte und verstärkte sich sein Interesse an Spinoza und seine Neigung zu dem, was nun als spinozistischer Pantheismus galt. 21 Die Wirkung auf Kant war eine andere. Er war zwanzig beziehungsweise fünfundzwanzig Jahre älter als Herder und Goethe und sein erstes großes Werk, die Kritik der reinen Vernunft (1781), hatte noch kaum Wirkung entfaltet. Kant wurde Jacobis nächstes Ziel, was immens zur Verbreitung seiner Ideen beitrug, vor allem durch die volkstümlichen Werke von Karl Leonhard Reinhold (* 1758, † 1823). Ein Ergebnis dieser polemischen Auseinandersetzung war Kants Die Religion in den Grenzen der bloßen Vernunft (1793), das auch die wesentlichen Lehren der neologischen Theologie mit dem verband, was Kant den »moralischen Beweise des Daseins Gottes« nannte, für den keine Offenbarung und auch nicht die durch die Bibel und kirchliche Traditionen vermittelten vermeintlich göttlichen Gesetze nötig waren. 22 Im Großen und Ganzen schienen sich die Kritiker der Neologen allesamt von jeder Form von traditionellem organisiertem Christentum oder besser vom Christentum selbst zu entfernen und zur Erfindung einer gänzlich neuen Religion zu tendieren, oft beruhend auf einer neuen Version von Spinozas Ideen. 23 Die Implikationen dieser Strömung unter Vertretern der intellektuellen und künstlerischen Elite sind faszinierend. Jeder der drei Zitierten hatte eine offizielle Stellung inne: Kant war Professor und somit Angestellter der preußischen Regierung, Herder Kleriker und ab 1776 Generalsuperintendent der lutherischen Kirche in Weimar sowie Oberpfarrer der Stadtkirche; Goethe war dort 1776 von Herzog Karl August zum Mitglied des Geheimen Consiliums ernannt worden. Nur Kant hatte während der Phase der konservativen Reaktion in den 1790er Jahren kurzzeitig Schwierigkeiten mit den preußischen Autoritäten. Für Herder und Goethe hatte ihr persönlicher Glaube keine negativen Folgen – besonders bemerkenswert bei Herder, schließlich war er in Weimar so etwas wie ein Bischof. Man ist versucht, sie als Heuchler zu bezeichnen. Tatsächlich aber unterschied sich ihre Position kaum von früheren religiösen »Avantgardisten« wie den Erfurter Humanisten um 1500 und Justus Lipsius im späten 16. Jahrhundert. Sie waren Teil
547
548
V. · Die deutschen Territorien nach 1760
einer langen Tradition von Intellektuellen, die sich der öffentlichen Funktionen organisierter Religion bewusst waren: Das Prinzip religio vinculum societatis (Religion ist das Band der Gesellschaft) schloss die Suche nach höheren und besseren Wahrheiten nicht aus. 24 Zudem muss man die Einstellung dieser Intellektuellen im Verhältnis zu den zunehmend heterodoxen Ansichten in den Werken der zeitgenössischen rechtlichen und politischen Theorie betrachten. Johann Jacob Moser bestand nach wie vor auf den christlichen und biblischen Ursprüngen des Rechts. Johann Stephan Pütter hingegen erklärte, zwar leite sich jedes Recht von einer höheren Quelle her, er sei jedoch bereit, neben der Bibel auch Talmud und Koran anzuerkennen. 25 Der katholische Wolff-Anhänger Johann Adam von Ickstatt (* 1702, † 1776) war der Meinung, selbst ein Atheist könne ein guter Bürger sein. 26 In diesem Sinn waren die Kritiker der Neologen auch echte Aufklärer. Jacobi täuschte sich jedoch grundlegend, wenn er glaubte, Vernunft werde zur Zerstörung und Revolution führen. Kant und Herder sympathisierten mit der Französischen Revolution, schreckten jedoch vor der Gewalt und dem Chaos zurück, das sie nach sich zog. Goethe lehnte die Revolution aus diesem Grund strikt ab. Es gab keine zwangsläufige Verbindung zwischen dem Spinozismus des späten 18. Jahrhunderts und revolutionärer Politik. Die philosophische und literarische Avantgarde war eine Minderheit. Konventionellere Ideale der Aufklärung blieben auf pastoraler Ebene und in der historisch-kritischen Theologie bis weit ins 19. Jahrhundert einflussreich, ebenso in Regierung und Verwaltung. Die Berliner Aufklärung war weiterhin von starken Strömungen des lockeschen Denkens (der Popularphilosophie) und des Wolffianismus geprägt. Daneben indes gewannen neue Strömungen an Bedeutung und zogen Jüngere an. Im katholischen Deutschland waren die Folgen der Aufklärung in vielerlei Weise überschaubarer. Aber obwohl sie nicht die Grundlagen des katholischchristlichen Glaubens selbst infrage stellte, waren ihre Auswirkungen ebenso tiefgreifend und in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts nachhaltiger. Der Hintergrund war ein grundlegend anderer. Der barocke Katholizismus war von einer Erneuerung des Kirchenlebens in den katholischen Territorien nach 1648 gekennzeichnet gewesen. 27 Zusammen mit weltlichen Autoritäten hatten Orden wie die Jesuiten und die Kapuziner eine dynamische Synthese aus mittelalterlicher Tradition und tridentinischer Strenge geprägt.Viele Merkmale dieses katholischen Wiederauflebens entwickelten sich bis weit ins 18. Jahrhundert weiter. Der Marienkult und der Kult um die Katakombenheiligen waren um 1700 fest etabliert, aber der Kult um das Abendmahl, der die wesentliche Unterscheidung zwischen Katholizismus und Protestantismus reflektierte und bestärkte, erreichte seinen Zenit erst im späten 18. Jahrhundert. 28
52. Protestantische, katholische und jüdische Aufklärung
Allerdings kamen manche immer mehr zu der Überzeugung, dass die Pilgerfahrten, Prozessionen, Schreine, die florierenden Gottesdienste und Feiertage mit den Anforderungen des Alltags kollidierten. Ab Mitte des 18. Jahrhunderts begannen vier Entwicklungen wachsende Unzufriedenheit mit dem Status quo und Forderungen nach Reform unter Katholiken zu schüren. Erstens gewann der Jansenismus an Boden – und mit ihm Vorstellungen von einer schlichteren, bescheideneren Frömmigkeit und persönlich-innerlichen Religiosität. 29 Zweitens verbreiteten sich die Ideen des italienischen Reformers Ludovico Antonio Muratori (* 1672, † 1750) auch jenseits der Alpen. Wie die Jansenisten predigte Muratori Schlichtheit des Glaubens und der Frömmigkeit, die sich auf wohltätiges Wirken und nicht auf augenfällige Investitionen in die Erlösung konzentrieren sollte. 30 Muratoris Hirtenbriefe erinnerten an die Reformideale der tridentinischen Epoche selbst und es ist signifikant, wie häufig er den größten tridentinischen Reformer zitierte, Carlo Borromeo. Seine Absichten ähnelten in vieler Hinsicht denen der protestantischen Neologen und sein wichtigster deutscher Schüler im späten 18. Jahrhundert, Johann Michael Sailer (* 1751, † 1832), war im Grunde ein »katholischer Neologe«. Drittens wurde die in Würzburg von Friedrich Karl von Schönborn in den 1720er Jahren begonnene Reform der katholischen Universitäten durch die Begeisterung vieler katholischer Gelehrter für den Wolffianismus ab den 1740er Jahren weiter und breiter vorangetrieben. Nicht eben zur Begeisterung des entschiedenen, wenn auch unorthodoxen Protestanten Wolff selbst erwies sich sein perfektes, in sich geschlossenes System als idealer Ersatz für die neoscholastischen jesuitischen Lehren, die die höhere katholische Bildung über ein Jahrhundert dominiert hatten. 31 Viertens schürte ein zunehmendes Gefühl der Unterlegenheit gegenüber den protestantischen Territorien den Wunsch, aufzuholen und mitzuhalten. Protestantische Autoren und Kommentatoren von Gottsched bis Nicolai betonten unablässig die Überlegenheit und »Modernität« der protestantischen Territorien im Gegensatz zur Rückständigkeit der katholischen Territorien, auf deren Altären, wie Gottsched 1730 dichtete, noch immer »das trübe Licht der Kerzen« währte, das »aller Welt des Irrthums Leitstern war«. 32 Der Schock der Niederlage 1740 und das erneute Scheitern 1756–1763 war in Österreich ein mächtiger Impuls für Reformen. In den 1770er Jahren griffen zahlreiche katholische Autoren das Thema der katholischen Rückständigkeit auf. Schon der Titel des 1772 von »Christian Friedrich Menschenfreund« (möglicherweise der Reformer der Universität Ingolstadt, Johann Adam von Ickstatt) publizierten Pamphlets traf den Nagel auf den Kopf: Untersuchung der Frage: Warum ist der Wohlstand der protestantischen Länder so gar viel größer als der catholischen? Die Selbstkritik der katholischen Länder war verblüffend und nachhaltig. Eine der meistbeachteten Debatten war die, die 1786
549
550
V. · Die deutschen Territorien nach 1760
der Fuldaer Kapitular und Kammerpräsident Philipp Anton von Bibra, Mitglied der Illuminaten und Herausgeber des aufgeklärten Journal von und für Deutschland, auslöste. In einem Leitartikel fragte er, weshalb die kirchlichen Territorien, obwohl sie »größtentheils die gesegnetesten Provinzen von ganz Deutschland sind«, nicht »der weisesten und glücklichsten Regierung genießen«. Wenn der Fehler nicht bei ihren Regenten und ihrer »innern Grundverfassung« lag, wo dann? 33 Den entscheidenden Impuls zur Veränderung gaben gelehrte Laien, katholische Herrscher, aber auch religiöse Orden wie die Benediktiner, insbesondere ihre großen Häuser in Zwiefalten und anderswo sowie ihre Universität in Salzburg, die zunehmend attraktiver wurde als die jesuitischen Institutionen in Ingolstadt und Dillingen. 34 Selbst der Berliner Aufklärer Friedrich Nicolai war beeindruckt von der Gelehrsamkeit und Frömmigkeit, die er im Schwarzwaldkloster St. Blasien vorfand, dem der »große Gelehrte« Abt Martin Gerbert, ein »wahrer Menschenfreund«, vorstand. 35 Auch die Mauriner, ursprünglich ein Ableger der Benediktiner, waren wichtig für die Verbreitung jansenistischer Ideen, während die Augustiner-Chorherren in manchen Gegenden den Benediktinern in Gelehrtheit und pastoraler Aktivität nicht nachstanden. 36 Die Jesuiten hingegen wurden zum Hauptangriffsziel der Reformer und die Aufhebung des Ordens 1773 wurde als historischer Durchbruch betrachtet. Die jesuitischen Missionen, die ein wichtiges Merkmal des barocken Katholizismus geworden waren und viel dazu beigetragen hatten, die Kirche wieder in den Städten und ländlichen Regionen zu verankern, wurden nun oft dafür kritisiert, Aberglauben und Auswüchse zu fördern. Viele andere religiöse Stiftungen wurden ebenfalls einer kritischen Prüfung unterzogen, vor allem jene, die in den etwa hundert Jahren nach 1648 durch aufwendige Bauvorhaben erdrückende Schulden angehäuft hatten oder denen Prälaten wie der absurd herrschaftliche, selbsternannte Excellentissimus Anselm II. Schwab, Zisterzienserabt in Salem von 1746 bis 1778, vorstanden. 37 Viele Auswirkungen der katholischen Aufklärung wurden bereits unter verschiedenen Gesichtspunkten erörtert. Neben erzieherischen und seelsorgerischen Reformen war die Ausweitung der Regierungskontrolle über die Kirche in Österreich und Bayern ein Hauptziel. Gleichzeitig war ein wichtiges Anliegen in der deutschen Reichskirche der Episkopalismus oder Febronianismus. Die Unvereinbarkeit der beiden Zielsetzungen zeigte sich in vollem Umfang im Streit über die Reform der Diözesengrenzen und in der Frage der apostolischen Nuntiatur in München. 38 Den Attacken gegen Klöster in Österreich und anderswo zum Trotz war die aufgeklärte katholische Opposition gegen den barocken Katholizismus nicht insgesamt antiklerikal oder säkularistisch. Die Rationalisierung sollte die Religion voranbringen, nicht zerstören. Die Reaktion auf diese neuen Ideen und Initiativen war in mancher Weise ebenso mehrdeutig wie die Reaktion auf die Neologen in den protestantischen
52. Protestantische, katholische und jüdische Aufklärung
Territorien. Grob gesagt, unterstützten die gebildete Stadtbevölkerung und viele Regierungen Veränderungen. Elitäre Splittergruppen wie der Kreis um Franz Friedrich Wilhelm von Fürstenberg und Fürstin Amalie Gallitzin in Münster widersetzten sich dem, was sie als Angriff auf wahre Frömmigkeit und Religiosität betrachteten, und verfochten einen sogenannten romantischen Katholizismus. 39 In den meisten ländlichen Gegenden hielt die Bevölkerung an den traditionellen Mustern des barocken Katholizismus fest, und was die Reformer anging, weigerten sich die ländlichen Laien hartnäckig, ihre alten »irrationalen« und »abergläubischen« Formen des Gottesdienstes abzulegen. In Südwestdeutschland etwa strömten in den 1770er Jahren Tausende zu den Massenexorzismen des traditionalistischen Pfarrers und Wunderheilers Johann Joseph Gaßner (* 1727, † 1779) – zu einer Zeit, da die aufgeklärten Reformer rationale Ordnung in die Kirche zu bringen suchten. Kein Geringerer als der schwäbische »Wissenschaftler« Franz Anton Mesmer, dessen magnetische Experimente und Vorführungen bald darauf in der Pariser Gesellschaft für Furore sorgten, erklärte Gaßner zum wahrhaften Träger eines außergewöhnlich starken animalischen Magnetismus. 40 Wie anderswo kamen bereits vor 1789 Zweifel an der Aufklärung auf, verstärkten sich jedoch nach diesem Jahr, da einige »progressive« Reformen und Reformer den Bemühungen der Obrigkeit zum Opfer fielen, eine Revolution im französischen Stil in Deutschland abzuwenden. Andererseits prägten die pastorale Reformbewegung und die Initiativen zur Rationalisierung des Verhältnisses zwischen Kirche und Staat die Entwicklung des deutschen Katholizismus bis weit ins 19. Jahrhundert. Dass gerade spätere katholische Gelehrte bestritten, es habe je so etwas wie eine katholische Aufklärung gegeben, bezeugt die tiefgreifende Wirkung der Bestrebungen, den barocken Katholizismus zu zerstören, und die Stärke späterer Versuche, ein neobarockes Äquivalent zu errichten. 41 So wie man die protestantische Aufklärung als »zweite Reformation« mit langfristigen Implikationen, die bis nach 1945 umstritten blieb, betrachten kann, so war die katholische Kirche geprägt vom Streit zwischen tridentinischen und neotridentinischen Modellen auf der einen und barocken sowie neobarocken Modellen auf der anderen Seite, zumindest bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil 1962 bis 1965. Die jüdische Aufklärung oder Haskala war ebenfalls eine parallele, allerdings eigenständige Bewegung. Gelehrte, die sie überhaupt anerkannten, verbanden sie früher mit der Einzelfigur Moses Mendelssohn. In jüngerer Zeit fand sie Anerkennung als Strömung, die sich über ein Jahrhundert hinweg mit einer Reihe wichtiger Zentren und Denker entwickelte. Die Juden verfügten nicht über einen politischen und territorialen Rahmen; ihre Aufklärung befasste sich indes mit den religiösen und kommunalen Strukturen des jüdischen Lebens und zunehmend mit der Beziehung zwischen der jüdischen Gemeinde und der Außenwelt. Ihren Ursprung hatte sie im »Durst eines Netzwerks junger Männer um 1700 nach neuem Wissen« und –
551
552
V. · Die deutschen Territorien nach 1760
wie bei Thomasius und Wolff – im wachsenden Glauben an die nichtreligiöse Natur des Wissens. 42 Parallel zur Erfahrung vieler Aufklärer gerieten die Maskilim (die Aufgeklärten) in Widerstreit mit dem traditionellen Rabbinat, nur wenige allerdings verleugneten ihren Glauben und manche hielten selbst an ihrer Stellung als Rabbiner fest. In den 1760er Jahren jedoch brachte die verführerische Kraft neuen Wissens und rationalistischen Denkens ein immer selbstbewussteres Netzwerk von Maskilim in offene Konfrontation mit den Autoritäten. Die Bewegung wurde nun vielfältiger. Mendelssohn war die herausragende Gestalt unter einer wachsenden Anzahl von Juden, die als etablierte Ärzte, Intellektuelle und Philosophen starke intellektuelle und soziale Verbindungen zur nichtjüdischen Welt knüpften und dabei aber der jüdischen Welt treu blieben. 43 Andere jedoch wichen bereits vor der Erfahrung von Anpassung, Apostasie und Toleranz zurück. Sie fürchteten, die Juden müssten einen zu hohen Preis für den »Nektar« der Wissenschaft und Philosophie bezahlen – für den verlockenden Reiz der »fremden Frau«, wie Rabbi Jacob Emden das neue Wissen nannte –, und flüchteten sich in die Orthodoxie. 44 Ende der 1770er Jahre etablierte sich die gereifte Haskala als dritte Strömung. Ihre Zentren waren Berlin und Königsberg, ihre Helden Hartwig Wessely (* 1725, † 1805) und Isaac Euchel (* 1756, † 1804). Ihr Bestreben war, die Juden zu reformieren und in deutscher Sprache und Kultur zu erziehen. Ihr Auftreten fiel mit einem entscheidenden Wendepunkt zusammen. 1778 gründeten Isaac Daniel Itzig und David Friedländer mit Unterstützung anderer Wohlhabender in Berlin eine freie Schule, was für viele der echte Beginn der Haskala war. Ein Jahr später demonstrierte die feindselige Reaktion der Rabbiner auf Mendelssohns Übersetzung des Pentateuchs ins Deutsche einmal mehr die Stärke der Opposition gegen die Art von Aufklärung, für die die freie Schule stand. Zugleich erhielten die Reformer Unterstützung von außen durch die viel diskutierte Abhandlung des preußischen Archivars Christian Wilhelm Dohm über den Fortschritt der Juden und das Toleranzedikt Josephs II., das jüdische Gemeinden zur Gründung weltlicher Schulen aufrief. 45 Wesselys Divrei Shalom we-Emet (1782, deutsch als Worte der Wahrheit und des Friedens an die gesammte jüdische Nation) war eine Kriegserklärung an die Rabbiner. Die Fronten verhärtete Isaac Euchels Gründung der Gesellschaft der hebräischen Litteraturfreunde in Königsberg im selben Jahr. Sie fing mit einer Schule und organisatorischen Struktur an und gab dann die Zeitschrift Hame’assef (Der Sammler) heraus. 1787 verlegte sie ihren Sitz nach Berlin und nannte sich Gesellschaft zur Beförderung des Edlen und Guten. 46 Spätere jüdische Kritiker warfen Wessely und Euchel vor, ihren Glauben abgelegt zu haben. Tatsächlich strebten beide aber eher nach Erneuerung als nach Auflösung. Bei all seinem radikalen Eifer beschwor Euchel seine Verbündeten, direkte
52. Protestantische, katholische und jüdische Aufklärung
Konfrontationen mit den Rabbinern zu meiden. Stattdessen sollten sie sich auf die Heranziehung einer neuen Generation von Führern konzentrieren. 1784 bat er sogar den König von Dänemark um Beihilfe für eine neue Schule und ein Institut zur Ausbildung von Lehrern und Rabbinern in Kiel. Binnen zehn Jahren, versprach Euchel, werde eine neue Avantgarde aufgeklärter Juden antreten, die gesamte jüdische Nation zu verändern. Aus dem Projekt wurde nichts, aber Euchels Reformeifer blieb ungeschmälert. Unterstützer seiner Kampagne waren etwa Moshe Hirschel, dessen Kampf der jüdischen Hierarchie mit der Vernunft 1788 in Breslau erschien, und Saul Berlin, der 1789 eine funkelnde Attacke, gedruckt in der Druckerei der freien Schule, auf den angesehenen Hamburger Rabbi Raphael Kohen losließ. Diese offene Kampfansage an die traditionelle Elite – begleitet von detaillierten Kommentaren in Hame’assef zu den revolutionären Ereignissen in Frankreich – bezeichnete den Höhepunkt der Haskala, ihre »weltliche Revolution«. Anders als die französische Monarchie blieb das rabbinische Ancien Régime im Angesicht seiner Kritiker jedoch unbeugsam. Die Maskilim verloren den Mut, waren indes in den 1790er Jahren auch zunehmend alarmiert von zunehmenden Anzeichen der Freizügigkeit und Akkulturation der Jugend in Berlin und anderswo. 1794 zog die Hame’assef nach Breslau um und wurde 1797 eingestellt. Einer nach dem anderen gaben die Anführer der Revolution entweder auf oder starben ohne Nachfolger; ein Gefühl des Scheiterns griff um sich. David Friedländer ging 1799 so weit, zu verkünden, er löse sich offiziell vom Judentum und trete der protestantischen Kirche bei. Andere verzweifelten einfach. Es war ihnen nicht gelungen, die jüdische Nation zu reformieren. Gleichzeitig beklagten sie die zunehmende Verweltlichung und Anpassung um sich herum. Sie waren Vorreiter einer weltlichen Revolution gewesen, dabei verabscheuten sie die Verweltlichung. Es war ihnen darum gegangen, die jüdische Nation von jenen zu befreien, die sie als ihre unaufgeklärten, unterdrückerischen Gralshüter betrachteten, um den Juden zu ermöglichen, als aufgeklärte Nation unter anderen zu leben. Ein fundamentales Problem der jüdischen Aufklärung und ihrer Annäherung an die christliche Welt war der Widerwille der christlichen Aufklärer, die Juden als Juden zu akzeptieren. 47 Eine tolerante Haltung gegenüber den Juden, die Auseinandersetzung mit ihrem Glauben und ihren philosophischen Traditionen, war in den meisten Fällen Teil einer Strategie, sie zu bekehren. 1769 etwa forderte Lavater Mendelssohn auf, die Glaubenslehren des Christentums zu widerlegen oder sich taufen zu lassen. Lessing und Reimarus sprangen Mendelssohn in der folgenden Debatte bei, aber die Mehrheit der deutschen öffentlichen Meinung blieb ambivalent. 48 1775 druckte Wielands Teutscher Merkur die anonymen Gedanken über das Schicksal der Juden, in denen aufgeklärte Christen aufgefordert wurden: »Verstattet ihnen Freyheit, und bindet sie durch eure Gesetze! Thut an
553
554
V. · Die deutschen Territorien nach 1760
ihnen, was ihr wolltet, daß man an euch thäte!« Es ging dabei jedoch nicht um Toleranz gegenüber anderen, sondern darum, »sie auch zu der Erkenntniß desjenigen zu bringen, durch den wir dereinst der höchsten Glückseligkeit theilhaftig zu werden versichert sind«. 49 Selbst diese Strategie erschien dem Göttinger Orientalisten Johann David Michaelis zu riskant; er führte gegen Christian Wilhelm Dohms Vorschlag, die bürgerliche Stellung der Juden zu verbessern, das Argument ins Feld, die Gesetze Moses selbst sähen eine separate Existenz der Juden vor und schlössen daher ihre Integration in die christliche Gesellschaft aus. 50 Dohms Abhandlung Über die bürgerliche Verfassung der Juden unterschied sich durch ihre liberalere Sicht von anderen Schriften über die Juden. 51 Sein Ziel war es, die bürgerliche Stellung der Juden und im Zuge dessen diese selbst zu verbessern. Dohm argumentierte, staatliche Nötigung habe die Juden deformiert und gezwungen, Händler zu werden. Er glaubte, wenn man ihnen das Bürgerrecht zugestehe, könnten sie ihre beruflichen Aktivitäten erweitern und so nützlichere Beiträge für Staat und Gesellschaft leisten. Dies wiederum werde ihren moralischen Charakter bessern. Dohm hatte mehr Probleme damit, Atheisten bürgerliche Rechte zuzugestehen als Juden. Mendelssohn selbst, obwohl als archetypischer Vertreter der Aufklärung vollauf in die Berliner Salons integriert und weithin bewundert, missbilligte den anhaltenden moralischen Bekehrungsdruck. Sein Werk Jerusalem oder über religiöse Macht und Judentum von 1783 war ein klares Bekenntnis der Loyalität zum Judentum und Auslöser von Jacobis Attacke auf den Pantheismus. 52 Das Judentum, fand Mendelssohn, sei tatsächlich eher mit der Vernunft vereinbar als das Christentum, denn es »wisse von keiner geoffenbarten Religion« und kenne »keine Lehrmeinungen[,] keine Heilswahrheiten, keine allgemeinen Vernunftsätze. Diese offenbaret der Ewige uns, wie allen übrigen Menschen, allezeit durch Natur und Sache, nie durch Wort und Schriftzeichen.« Das Judentum kenne keinen Konflikt zwischen Vernunft und Religion. »Unter allen Vorschiften und Verordnungen des Mosaischen Gesetzes lautet kein einziges: Du sollst glauben! oder nicht glauben; sondern alle heißen: du sollst thun, oder nicht thun!« 53 Mendelssohn forderte somit praktisch die Trennung von Kirche und Staat und Gewissensfreiheit für Juden ebenso wie für Christen. Vertraute und Gratulanten wie Kant und Nicolai applaudierten Mendelssohns bewegender Verteidigung des Judentums und dessen Interpretation als ursprünglicher Vernunftreligion. Sie bewunderten seine standhafte Haltung gegenüber christlichen Kritikern wie rabbinischen Widersachern. Es war jedoch klar, dass er eine kleine Minderheit repräsentierte, die kaum Aussichten hatte, sowohl die einen als auch die anderen zu überzeugen. Das galt auch für andere, die ihm folgten. Der vielleicht wichtigste war Salomon Maimon, der in den 1790er Jahren eifrig Kants Ideen popularisierte. Auch er widerstand Forderungen christlicher
52. Protestantische, katholische und jüdische Aufklärung
Theologen, zu konvertieren, und fand, er habe keine andere Wahl als ein »verstockter Jude« zu bleiben. Die jüdische Religion »befiehlt mir, nichts zu glauben, sondern die Wahrheit zu denken und das Gute auszuüben«. 54 Auf den ersten Blick mag die Beschäftigung mit den Juden ab der Mitte der 1770er Jahre überraschen. Schließlich bildeten sie im Reich eine kleine Minderheit von nicht mehr als einem Prozent der Gesamtbevölkerung. 55 Die schriftliche Debatte und das Toleranzedikt Josephs II. vom 2. Januar 1782 waren indes Reaktionen auf eine neue Situation, die nach der ersten Teilung Polens 1772 entstand. Die jüdische Bevölkerung in Preußen stieg durch die Aneignung polnischer Gebiete auf das Zwei- bis Dreifache; gleichzeitig gewann Österreich etwa 250.000 Juden dazu, hauptsächlich in Galizien. 56 Die Notwendigkeit, mit einer signifikanten Anzahl neuer jüdischer Untertanen umzugehen, erklärt die der Debatte zugrunde liegende fundamentale Frage: Wie konnte man am besten erreichen, dass die Juden nützliche Beiträge zu Staat und Gesellschaft leisteten? Abgesehen von Dohm, waren die meisten Autoren der Ansicht, die Juden sollten früher oder später einfach zum Christentum konvertieren. Dies wiederum lieferte den Rahmen für die Debatten des 19. Jahrhunderts über Assimilation und Emanzipation. 57 Insgesamt ging die »religiöse« Aufklärung über die Beschäftigung mit Theologie und eine Art Flucht aus oder Ablenkung von der politischen Sphäre hinaus. Die Kernthemen der Debatten – Vernunft und Glaube, die Natur Gottes, Bestimmung und Schicksal der Menschheit und so weiter – lagen jeder Betrachtung des Charakters und der Zukunft der menschlichen Gesellschaft zugrunde. Sie betrafen die fundamentalen Voraussetzungen, auf denen die westliche christliche Gesellschaft ruhte, die Rahmenbedingungen, die ein gemeindliches Leben ermöglichten. Die Anzahl der Denker, die diese Voraussetzungen vollständig verwarfen, war unerheblich, selbst die der Urheber einer »gänzlich weltlichen« literarischen Kultur in Weimar in den letzten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts. 58 Wesentlich mehr, so etwa auch Goethe und Schiller, experimentierten mit neuen Formen der – nicht mehr zwangsläufig christlichen – Religion, die zunächst bei der Elite Anhänger fanden und sich dann mit dem allgemeinen Fortschreiten der ästhetischen und moralischen Bildung schrittweise weiterverbreiteten. Die Saat dieser Ideen entstand vielleicht schon vor 1789, dennoch waren sie im Grunde Reaktionen auf die Geschehnisse in Frankreich, wie wir noch sehen werden. Wie signifikant war die Entwicklung irenischer Ansichten im Rahmen dessen, was als transnationale und überkonfessionelle religiöse Aufklärung gilt? 59 Spielte die Religion im Reich und in der deutschen Gesellschaft endlich keine Rolle mehr? Ab Mitte der 1760er Jahre mochte es so erscheinen. Die konfessionell aufgeladene Atmosphäre im Reich verflog nach dem Siebenjährigen Krieg. 60 Viele Reformer betonten die überkonfessionellen Aufgaben der Regierungsgewalt. Die Differenzen zwischen Protestanten und Katholiken schienen zu erodieren, als die
555
556
V. · Die deutschen Territorien nach 1760
deutschen Katholiken die Prinzipien der protestantischen Aufklärung übernahmen. Andererseits blieben konfessionelle Kulturen in der Gesellschaft allgemein stark, zunehmend verwurzelt und verinnerlicht, während der Konflikt zwischen den Konfessionen durch die praktische Umsetzung der Parität und Koexistenz auf lokaler und territorialer Ebene wie im Reich insgesamt entschärft wurde. Die Grenzen der Akzeptanz traten jedoch leicht zutage. Als der Berliner Verleger und Aufklärer Friedrich Nicolai 1781 auf Deutschlandreise ging, löste seine erste eingehende Begegnung mit der katholischen Gesellschaft Schock und intolerante Verblüffung aus. Wie Fichte später sarkastisch kommentierte, entdeckte Nicolai, als er Kreuze am Wegesrand sah und Katholiken traf, die glaubten, nur ihre Religion sei seligmachend: »es giebt, o es giebt Katholiken, die da katholisch sind«. 61 Nicolais Einsicht, ein Leitmotiv der zwölfbändigen Beschreibung seiner Reisen durch das katholische Reich, die er 1783 bis 1796 veröffentlichte, zeigte für viele Leser einmal mehr die fundamentalen Unterschiede zwischen Protestanten und Katholiken auf. Manche Protestanten waren mit Nicolais scharfem Antikatholizismus nicht einverstanden, andere fanden ihre Vorurteile bestätigt.Viele Katholiken schreckten vor einer intoleranten nördlichen Aufklärung zurück, eine Tendenz, die sich nach 1789 verstärkte, als die Gleichsetzung von Aufklärung und Revolution in Wien, München und anderswo zum vorherrschenden Thema wurde. Den Status quo im Reich destabilisierte all das nicht. Tatsächlich stellte 1806 der Leiter der österreichischen Kanzlei beim Reichstag in Regensburg fest, die konfessionellen Spannungen, von denen Kommentatoren im Reich drei Dekaden zuvor mehr besessen gewesen seien als von jedem anderen Thema, seien seit Langem vergessen. 62 Erst nach der Auflösung des Reichs wurde die konfessionelle Spaltung als nationales Problem wiederentdeckt. Dann empfand man auch die Juden in einer Weise als Problem, wie das im Reich niemals der Fall gewesen war. 63
Anmerkungen 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Goldenbaum, »Debatte«, 32–79; Kant, Writings, 59. Schmidt, »Jahr 1783«, 143, 153 f.; vgl. auch Schmidt, »Luthertum«. Beutel, Aufklärung, 248; die folgenden Absätze beruhen im Wesentlichen auf diesem exzellenten Überblick. Goldenbaum, »Debatte«, 67–71. Hammermeister, »Enlightenment Thought«, 47 f. Beutel, Aufklärung, 257 ff.; Maurer, Biographie, 208–212, 609–613. Beutel, Aufklärung, 251, 282–287. Maurer, Biographie, 217. Beutel, Aufklärung, 279.
52. Protestantische, katholische und jüdische Aufklärung
10 Ebd., 390–394; Jung fügte »Stilling« unter Berufung auf Psalm 35:20 (»die Stillen im Lande«) seinem Namen hinzu, war jedoch alles andere als still in seiner Missbilligung der Neologen. 11 Möller, Vernunft, 72. 12 Maurer, Biographie, 208. 13 Stroup, »Churchmen«; Stroup, Struggle. 14 Borgstedt, Aufklärung, 41. 15 Bahrdt, Edict, 1–14; Finger, »Schulz«; Saine, Problem, 294–309. 16 Möller, Vernunft, 85. 17 Beiser, Fate, 44–48; Saine, Problem, 224–227. 18 Zammito, »Pantheist Current«. 19 Beiser, Fate, 59. 20 Ebd., 159; Beiser, Imperative, 174–184; Beutel, Aufklärung, 330–334. 21 Boyle, Goethe I, 351 ff. 22 Beutel, Aufklärung, 334–337. 23 Beiser, Fate, 44 f. 24 Im 18. Jahrhundert wurde diese Einstellung, die nun zwischen natürlicher und offenbarter Religion unterschied (der »Religion der Philosophen« und der »Religion der Väter«), verstärkt durch die begeisterte Diskussion um die Wiederentdeckung der angeblichen religio duplex im antiken Ägypten durch Ralph Cudworth (* 1617, † 1688). Cudworths Arbeiten fanden aufgrund ihrer Übersetzung ins Lateinische durch Johann Lorenz von Mosheim 1733 weitere Verbreitung; vgl. Assmann, Religio duplex, 14–21, 63–202. 25 Link, Herrschaftsordnung, 272. 26 Ebd., 289 f. 27 Vgl. S. 331–342. 28 Forster, Catholic Germany, 146–153. 29 Deinhardt, Jansenismus, 66–95. 30 Marri, »Muratori«. 31 Bachmann, Staatslehre, 50 f.; Hammerstein, Aufklärung, 41–53; Hammerstein, »Wolff«. 32 Gottsched, Werke I, 42. 33 Wende, Geistliche Staaten, 9 f.; Vorbild der Zeitschrift war das Gentleman’s Magazine, und obgleich katholisch, berichtete es über Vorkommnisse im gesamten Reich und suchte auch protestantische Leser zu erreichen. 34 Lehner, »Ecumenism«, XV–XIX. 35 Pfeilschifter, Briefwechsel, 6–9; Nicolais Wertschätzung von Gebert tritt in Band XII seines Reisetagebuchs zutage (S. 64–74), abgedruckt in Nicolai, Beschreibung VI. 36 Müller, Aufklärung, 83 f.; Beales, Prosperity, 80 f. 37 Forster, Catholic Germany, 132, 135. 38 Vgl. S. 482 ff. 39 Sudhof, Aufklärung, 52–169. 40 Midelfort, Exorcism. 41 Hersche, Muße, 952–1078; Borgstedt, Aufklärung, 42 f., 47 f.; Müller, Aufklärung, 76–80. 42 Feiner, Jewish Enlightenment, 16 f.; vgl. auch Graetz, »Enlightenment«. 43 Sorkin, Enlightenment, 165–213. 44 Feiner, Jewish Enlightenment, 36–84. 45 Vgl. S. 602 ff. 46 Kennecke, »Hame’assef«; vgl. auch ders., Euchel, 60–81, 122–127, 130 f.
557
558
V. · Die deutschen Territorien nach 1760
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
Feiner, Jewish Enlightenment, 112–119. Borgstedt, Aufklärung, 52. Kopitzsch, »Sozialgeschichte«, 91 f. Borgstedt, Aufklärung, 51 f. Liberles, »Toleration«, 10 ff. Vgl. S. 546. Möller, Vernunft, 104–107. Ebd., 103 f. Hartmann, »Bevölkerungszahlen«, 369. Liberles, »Toleration«, 4, 30 ff. Vgl. die Beiträge in Meyer, German-Jewish History II. Reed, Classical Centre, 194. Sorkin, Enlightenment, 5–21. Vgl. zum Folgenden Carl, »Konfession«. Möller, Aufklärung, 115–120. Walter, Zusammenbruch, 144. Altgeld, Gegensätze, 125–137, 181–194.
53. Aufklärung und Regierung
N
eben der Religion waren Probleme der Regierung und Politik ebenfalls vordringliche Themen der öffentlichen Debatte der Aufklärung. Auch hier kam es ab den 1750er Jahren und mit neuer Intensität und Vielfalt im Zuge der Französischen Revolution zu einer grundlegenden Veränderung der Einstellungen. Der in der ersten Hälfte des Jahrhunderts ausgearbeitete Rahmen an Ideen blieb das dominante politische Modell, in mancherlei Hinsicht bis ins 19. Jahrhundert, aber gerade das machte die Explosion von neuen Ideen in den 1790er Jahren umso herausfordernder. Fachkundige Abhandlungen von Universitätsgelehrten blieben eine wichtige Quelle neuer Ideen. Zunehmend wichtig war jedoch auch die öffentliche Diskussion in der Presse. Manche betrachteten allein die Idee einer solchen Diskussion als fundamentalen Teil des politischen Lebens, als grundsätzlich politische Aktivität und als Ausübung eines fundamentalen Bürgerrechts. Auswärtige Ereignisse heizten die Diskussion an, lieferten neue Parolen und gaben alten Parolen neue Bedeutung. Besonderes Interesse weckte die zunehmende Krise in den amerikanischen Kolonien, die manche an ähnliche Dispute in Deutschland gemahnte. 1 Die mehrheitliche Einstellung der deutschen Aufklärung zu Herrschern und Regierungen um 1750 war im Grunde ziemlich einfach. Die alte Schule deutscher Naturrechtstheoretiker sah ihre Hauptaufgabe in der Bestärkung der Stellung von Herrschern und Regierungen gegen Stände und Kirchen in der langen Wiederaufbauphase nach dem Dreißigjährigen Krieg.2 So gut wie alle von ihnen waren überzeugt, der Mensch gebe seine natürliche Freiheit mit dem Eintritt in die Gesellschaft auf. Herrscher mochten dem Einzelnen einige Freiheiten zurückgeben, waren dazu jedoch nicht verpflichtet. Der deutschen Tradition zufolge legitimierte der Gesellschaftsvertrag politische Macht, anstatt sie einzuschränken. Man war sich einig, dass die Macht durch grundlegende Rechte, Traditionen und territoriale Institutionen wie die Stände begrenzt war; es hatte jedoch keine zwangsläufigen praktischen Folgen, diese Begrenzungen zu missachten. Natürlich konnten extreme Verstöße zu Aufständen führen und diese Implikation war unter Naturrechtstheoretikern ebenso anerkannt wie unter protestantischen politischen Autoren seit Luther. Ein wie auch immer geartetes Recht auf Widerstand war indes generell ausdrücklich ausgeschlossen. 3 Das zweite Hemmnis für Herrscher war ihre allgemein anerkannte Pflicht, das Gemeinwohl zu fördern, die Wohlfahrt und das Glück ihrer Untertanen. Das hatte
560
V. · Die deutschen Territorien nach 1760
keine zwangsläufigen Implikationen für die Rechte des Einzelnen oder für die Schaffung irgendeiner Art von Bereichen der persönlichen Freiheit ohne Regierungsintervention oder Regulierung. Zudem gab es keinerlei Garantie, dass ein Herrscher tatsächlich das Gemeinwohl anstrebte oder Sanktionen befürchten musste, wenn er das nicht tat. Christian Wolff beispielsweise hatte 1721 betont, es gebe einen Vertrag zwischen Herrschern und Beherrschten, dem beide verpflichtet seien. Ein Herrscher, der seine Pflichten ignoriere, werde zum »Tyrannen«. Wolff äußerte sich jedoch nicht dazu, was gegen eine solche Person zu unternehmen ist. 4 Die verbreitete Vorstellung vom Staat als Maschine betonte eindeutig die technische Seite der Regierungsmacht. Das einzige Problem war, zu entscheiden, was machbar war; der Einzelne war nicht mehr als ein kleines Rädchen im Mechanismus. 5 Elemente dieser Einstellung blieben bis zum Ende des Jahrhunderts einflussreich. Die wichtigsten Vertreter der Berliner Aufklärung zum Beispiel verzichteten darauf, formelle Einschränkungen der herrscherlichen Macht zu fordern. Selbst die lockeschen Popularphilosophen teilten offenbar nicht Lockes Sorge um eine wie auch immer geartete Definition der individuellen Freiheit. Einflussreiche Autoren wie Friedrich Nicolai, Johann Georg Sulzer und Christian Garve (* 1742, † 1798) vertrauten letztlich auf die Selbstbeherrschung der Mächtigen. 6 Garve fand gar mancherlei Vorteil an einem starken Monarchen, der aufgeklärte Reformen gegen den Widerstand unaufgeklärter Stände und anderer durchsetzen konnte. Viele Aufklärungsdenker sahen Vorteile darin, dass Herrscher umfangreiche Macht und Autorität ohne formelle oder institutionelle Kontrolle besaßen, sie missbilligten jedoch so gut wie einstimmig Autokratie und Despotismus im Sinn einer Tyrannei. Dennoch hatten sie, auch wenn sie sich wie Friedrich Nicolai bitter über Zensur und über in ihren Augen unangemessene Aspekte der Herrschaft beklagten, kein Mittel gegen einen tyrannischen Herrscher anzubieten. Das gilt auch für die anderen einflussreichen Mitglieder der Berliner Mittwochsgesellschaft, etwa Ernst Ferdinand Klein, und für Kant, dessen Optimismus auf der Annahme beruhte, Herrscher selbst würden aufgeklärte Ansichten befürworten. Klein und Kant trugen dazu bei, eine Ansicht zu verbreiten, die man als typische Aufklärungssicht der Monarchie betrachten könnte und die sich Friedrich der Große selbst zu eigen machte. Sie unterschied zwischen dem Herrscher und seiner Regierung und machte den Herrscher zum ersten Diener des Staats. Der Herrscher sollte der Maschinerie der Regierung unterworfen sein. Ähnliche Ansichten über die notwendige Beschränkung königlicher Macht kennzeichneten die Schriften des einflussreichen Autors Johann Georg Schlosser aus Baden und anderer in anderen Teilen des Reichs. 7 Unterstrichen und bestärkt wurde die zunehmende Betonung von Beschränkungen der Macht innerhalb dieser Reihe von übernommenen Annahmen durch
53. Aufklärung und Regierung
neue Entwicklungen ab 1750. Das Nachdenken über Herrscher und ihre Höfe nahm zu dieser Zeit eine neue entscheidende Wende. Autoren wie der Thomasius-Student und Goethe-Onkel Johann Michael von Loen mit Der Redliche Mann am Hofe (1742) und Friedrich Karl von Moser mit Der Herr und der Diener (1759) waren bestimmend für eine neue Generation, die der Institution Hof kritisch gegenüberstand. 8 Lessings Emilia Galotti (1772, in Arbeit ab 1754) und Schillers Stücke wie Die Räuber (1781), Kabale und Liebe (1784) und Don Carlos (1783–1787) waren die literarischen Glanzlichter eines entstehenden neuen Genres. 9 Die zunehmende nichtliterarische Diskussion um Verschwendungssucht und Korruption der Höfe in den 1770er und 1780er Jahren gipfelte in August Hennings’ Vorschlag von 1792, ein Zivillistensystem einzuführen. 10 Ungewöhnlich an Hennings war, dass er bestritt, die Höfe hätten je viel zum Fortschritt der Menschheit beigetragen: Wahre »Urbanität«, glaubte er, habe sich früher und in größerem Umfang in Städten entwickelt, in denen der Handel florierte. Christian Garves Betonung des lebenswichtigen Beitrags der Höfe zum Prozess der Zivilisierung war eher typisch. In seinem Essay Ueber die Maxime Rochefaucaults: Das bürgerliche Air verliehrt sich zuweilen bei der Armee, niemahls am Hofe (1792) argumentierte er, Vornehmheit könne sich nur aus dauerhafter Übung in Höflichkeit und Geselligkeit entwickeln, wie man sie im Adel und vor allem am Hof finde. 11 Die allgemeine Tendenz ging eher in die Richtung einer Reform der Höfe als ihrer Abschaffung. Gleichzeitig zeigte sich in Schriften zu Regierung und Politik eine neue Betonung der Idee unveräußerlicher Menschenrechte, die der Staat unter keinen Umständen antasten durfte. 12 Kameralisten wie Johann Heinrich Gottlob von Justi (* 1717, † 1771) vertraten die Meinung, die Regierungsmacht habe ihre Grenzen und der Einzelne das Recht auf einen Bereich persönlicher Freiheit, in den die Regierung nicht eingreifen dürfe. 13 »Die Freiheit des Bürgers und alle Mitglieder des Staats«, schrieb er, »ist gleichsam die erste und wesentliche Eigenschaft aller bürgerlichen Verfassungen.« Zugleich gebe es für Regierungen keine Notwendigkeit, den Handel und die produktiven Klassen zu fördern; es genüge, Hindernisse für produktive Tätigkeiten zu beseitigen, die in der Verfassung stecken konnten: »Wenn die Menschen Freiheit haben, nach ihren Einsichten zu handeln und dabei keine Hindernisse vorfinden, so sind sie selbst geneigt, ihre Glückseligkeit zu fördern.« Alle vernünftigen Menschen mit »Freiheit und Erkenntnis« müssten sich als Einzelne und als Volk selbst regieren; die Regierung müsse somit für Repräsentation sorgen, frei gewählt von jeder Stadt und jedem Distrikt, um die legislative Macht auszuüben. 14 Um die Integrität der Repräsentanten zu garantieren, müsse sich jeder, der in den Staatsdienst eintrete, einer Wiederwahl unterwerfen. Anders als die Physiokraten glaubte Justi nicht an die übergeordneten Kräfte einer natürlichen Ordnung, auch nicht an die invisible hand (unsichtbare Hand), die
561
562
V. · Die deutschen Territorien nach 1760
Adam Smith 1759 in The Theory of Moral Sentiments als Begriff geprägt hatte. Nach wie vor war eine Überwachung der Gesellschaft durch die Regierung nötig, um sicherzustellen, dass die menschliche Neigung zum Machtmissbrauch in ökonomischen Beziehungen wie in der Politik dem Fortschritt nicht im Weg stand. Nicht jeder stimmte Justi zu, am wenigsten sein ehemaliger Kollege in Wien, Joseph von Sonnenfels, der zweite einflussreiche Autor der Mitte des 18. Jahrhunderts, der weiterhin die gängige regierungsorientierte Ideologie lehrte. 15 Elemente der alten Tradition überlebten bis ins 19. Jahrhundert, die Mehrheit folgte jedoch Justi. 1782 unterschied Samuel Simon Witte (* 1738, † 1802) klar zwischen Staat und Gesellschaft. Witte zufolge war die bürgerliche Gesellschaft eine frei funktionierende Verbindung von Eigentümern und Produzenten, die miteinander im Wettbewerb standen; der Staat habe die Aufgabe, ihre Ziele zu fördern, und daher kein Recht, in ordnungsgemäße Aktivitäten des Einzelnen und der Gesellschaft zu intervenieren. 16 In den 1790er Jahren hatte die Verbreitung solcher Ansichten dazu geführt, dass Autoren beim Thema Polizei, auch Kant und andere führende Schriftsteller, die einzige echte Funktion der Regierung darin sahen, für Schutz und Sicherheit zu sorgen. Die Meinung, die Regierung sei verpflichtet, das Glück der Menschen zu fördern – notfalls mit Gewalt –, hatte man mehr oder weniger vollständig aufgegeben. 17 Seinen vielleicht radikalsten Niederschlag fand dieses neue Denken in einer Abhandlung des jungen Humboldt, Ideen zu einem Versuch, die Gränzen der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen (1792), in der er die Aufgaben des Staats ausschließlich darauf beschränkte, Schaden von seinen Bürgern abzuwenden. Der Aufsatz blieb unveröffentlicht, spiegelte aber zweifellos die progressive Stimmung der Zeit wider. 18 Die praktischen Implikationen waren alles andere als klar. Das neue Denken schien sich im preußischen Allgemeinen Landrecht von 1794 niederzuschlagen, das erklärte: »Die nöthigen Anstalten zur Erhaltung der öffentlichen Ruhe, Sicherheit, und Ordnung, und zur Abwendung der dem Publico, oder einzelnen Mitgliedern desselben, bevorstehenden Gefahr zu treffen, ist das Amt der Polizey.« 19 Derselbe Gesetzestext ermächtigte den Staat indes auch, Gesetze zu erlassen, um möglicherweise gefährliche Umstände und den Missbrauch von Eigentum zu verhindern, Schaden von der Gemeinschaft abzuwenden und Maßnahmen zu ergreifen, um den Bürgern zu ermöglichen, nicht nur ihre Grundbedürfnisse zu erfüllen, sondern auch ein angenehmeres, freudvolleres Leben zu führen. In gewisser Weise fasste das Allgemeine Landrecht lediglich die traditionellen Kernaufgaben deutscher Territorialherrschaft seit dem späten Mittelalter in moderne Sprache. Selbst wenn ein Katalog grundlegender, unveräußerlicher Rechte gegen den Staat für unantastbar erklärt wurde, gab es noch weite Bereiche für staatliche Eingriffe und Regulierungen. Das letzte große Werk zu diesem Thema
53. Aufklärung und Regierung
im Reich, das siebenbändige Handbuch des Teutschen Policeyrechts (1799–1809) von Günther Heinrich von Berg (* 1765, † 1843), schaffte es nur durch Spitzfindigkeit, der neuen Theorie gerecht zu werden, etwa durch die Unterscheidung des unveräußerlichen Rechts, zu denken, vom Recht, seine Gedanken zu äußern, das den Bedürfnissen des Staats untergeordnet sei. 20 Zudem führte das neue Denken nicht zwangsläufig zu Forderungen nach politischer Teilhabe. Die Unterscheidung zwischen Staat und Gesellschaft bedeutete, dass der Staat dem Menschen zu dienen habe, nicht umgekehrt. Die Gesellschaft betrachtete man als Summe aller freien und gleichen Bürger als Privatpersonen, die im Streben nach Besitz oder Reichtum, Bildung oder Kultur miteinander wettstreiten und interagieren durften. Die Gesetze und Konstitutionen des Staats sollten so gestaltet werden, dass sie die Freiheit der Bürger sicherstellten; Gewaltenteilung erlegte der Regierung Beschränkungen auf. 21 Nicht impliziert war jedoch, dass die Bürgerschaft den Staat kontrollierte oder beherrschte. Die deutsche Reaktion auf die Französische Revolution nach 1789 sorgte endlich für eine klare Unterscheidung zwischen bürgerlicher Freiheit und politischer Partizipation. Letztlich verließen sich die meisten deutschen Autoren darauf, dass Monarchen selbst den Sinn guter Gesetzgebung erkannten. »Wer also in einer Monarchie, worin die bürgerliche Freyheit gehandhabt wird«, schrieb Ernst Ferdinand Klein 1790, »wird kein Verlangen tragen, ein Republicaner zu werden.« 22 Ebenso auffällig ist, mit welchem neuen Elan die traditionellen Argumente gegen den Absolutismus sich der Sprache der Aufklärung bedienten. 23 Johann Jacob Moser listete 1769 im dreizehnten Band seines Neuen Teutschen Staatsrechts acht fundamentale individuelle Rechte der Deutschen auf: Religionsfreiheit, Freizügigkeit, das Recht auf die Vererbung von Eigentum, das Recht auf freie Durchfahrt, das Recht, in fremden Armeen zu dienen, Zugang zu Gerichten, das Recht der Appellation gegen Herrscher, die Freiheit der Person und des Eigentums. 24 Zwar meint Moser auch, es sei möglich, auf diese Rechte zu verzichten, etwa indem man sich in Leibeigenschaft begab; es stand jedoch keinem Herrscher zu, diese Grundfreiheiten anzutasten. Andere Bände dieses außerordentlichen Kompendiums widmeten sich den Gesetzen und Bräuchen, die Mosers leidenschaftliche Überzeugung von den Rechten der Stände im Reich wie in den Territorien und seinen unerbittlichen Widerstand gegen Despotismus und Tyrannei nährten. Sein Sohn Friedrich Karl von Moser (* 1723, † 1798) zeigte sich in seinen Schriften zu diesem Themenbereich noch kompromissloser und radikaler. Beide waren beseelt von pietistischer Religion, Hochachtung vor der rechtlichen und konstitutionellen Tradition als Grundstein deutscher Freiheit und den aufklärerischen Idealen von Freiheit, Gerechtigkeit und Öffentlichkeit. Ähnliche Wege, ebenfalls geprägt von Pietismus und Aufklärung, beschritt in Norddeutschland Justus Möser (* 1720, † 1794), ab 1763 Regent für den Osnabrücker Fürstbischof
563
564
V. · Die deutschen Territorien nach 1760
Friedrich Herzog von York, dessen Arbeit als Historiker Herder, Goethe und die anderen jungen Sturm-und-Drang-Autoren beeinflusste. Als Vertreter der »gesellschaftlichen Aufklärung« beschäftigte sich Möser vor allem mit den historischen Ursprüngen der deutschen Freiheit, die er im Kampf der Territorialstände gegen rationalistischen Zentralismus weiterwirken sah. 25 Das Erscheinen physiokratischer Ideen in Deutschland ab den 1760er Jahren stellte ebenfalls die alten Naturrechtslehren infrage. Nach dem Vorbild des französischen Theoretikers François Quesnay (* 1694, † 1774) entwarfen die Physiokraten eine natürliche Ordnung, der Staat und Herrscher unterworfen waren. Der wichtigste deutsche Vertreter war Johann August Schlettwein (* 1731, † 1802), der eine Reihe einflussreicher theoretischer Werke verfasste und die Theorien als Kammer- und Polizeirat des badischen Markgrafen zwischen 1763 und 1773 praktisch umzusetzen versuchte. 26 Die Anliegen der Physiokraten waren in erster Linie wirtschaftlicher Natur, ihr Konzept der ordre naturel zeigte jedoch erstaunliche Wirkung auch auf Politik und Zivilgesellschaft. Quesnay selbst bestand darauf, die natürliche Ordnung sei die allerhöchste Richtlinie aller menschlichen Gesetzgebung und allen zivilen, politischen, ökonomischen und politischen Tuns. Schlettwein pflichtete ihm bei: »[A]lle positive Gesetze, wenn sie wahr und gut seyn sollen, müssen im Materiellen nur Bekanntmachungen der natürlichen Gesetze seyn.« 27 Das vordringliche Ziel der bürgerlichen Gesellschaft müsse sein, »daß ein jeder die vollkommenste Garantie aller seiner MenschenRechte, und des Genusses derselbigen darinnen findet«. 28 Das fundamentale physiokratische Prinzip von Produktion und Freiheit des Handels stand in direktem Widerspruch zu den alten merkantilistischen Methoden einer dirigistischen Wirtschaftsorganisation. Kameralistische Autoren und Verfechter der Rechte der Territorialstände widersetzten sich oft der Tendenz zu physiokratischen Ideen. Auch auf diesem Gebiet gab es eine Vielfalt und Bandbreite aufgeklärter Ansichten, die dasselbe Ziel – Wohlstand – im Auge hatten, es jedoch auf unterschiedliche Weise erreichen wollten. In Baden selbst war Goethes Schwager Johann Georg Schlosser ein früher Vertreter physiokratischer Ideen, wurde dann jedoch zu deren entschiedenem Kritiker und lehnte viele der dort eingeführten Reformen ab. 29 Schlosser ist oft als Gegner der Aufklärung dargestellt worden, die Bezeichnung »aufgeklärter Kritiker der Aufklärung« trifft seine Einstellung jedoch eher. 30 Kameralisten bestanden im Allgemeinen auf der vorrangigen Bedeutung der Regierung und der Notwendigkeit, Grenzen und Ausmaß des freien Handels zu definieren. 31 Andere bezweifelten, dass das Volk in der Lage war, Freiheit angemessen und sinnvoll zu nutzen. Johann Jacob Moser und andere fürchteten, die physiokratische Idee, aufgeklärte Herrscher könnten erwünschte Reformen gegen den Widerstand gemeinschaftlichen Eigeninteressen durchdrücken, verstoße gegen die Rechte der Territorialstände. Weitere Verbreitung in Deutschland
53. Aufklärung und Regierung
fanden physiokratische Ideen erst in den 1790er Jahren, dann verstärkt durch die intensive Auseinandersetzung mit den Ideen von Adam Smith kurz vor 1800, die wiederum zur frühen Entwicklung des süddeutschen Liberalismus als treibender politischer Kraft im frühen 19. Jahrhundert beitrugen. 32 Das vielleicht wichtigste Merkmal der Entwicklung politischer Ideen in jener Zeit war die öffentliche Debatte selbst.Viele der führenden Kommentatoren gaben eigene Zeitschriften heraus. So gut wie alle übrigen lieferten eifrig Beiträge für Zeitungen und Periodika. Ihre kollektive Wirkung scheint bereits um 1770 deutlich spürbar gewesen zu sein. 1786 erinnerte die Berlinische Monatsschrift: »Jedermann weiß, daß es nach dem Jahre 1770 in Deutschland Mode ward, und bei einer zwar sehr kleinen Partei noch ist, ein wildes, dumpftönendes Geschrei von Freiheit! Freiheit! zu erhalten.« 33 In den 1770er und 1780er Jahren erschien eine große Anzahl neuer Titel. Unter den wichtigsten Publikationen waren Wielands Teutscher Merkur (1773–1789), die von Christian Friedrich Daniel Schubart unter verschiedenen Titeln ab 1774 herausgegebene Deutsche Chronik, der Briefwechsel meist historischen und politischen Inhalts (1778–1782) und die Staats-Anzeigen (1782–1793) des Göttinger Historikers August Ludwig Schlözer sowie die Chronologen und andere, die Wilhelm Ludwig Wekhrlin von 1779 an publizierte. 34 Zweck dieser Flut an Information und Kommentaren war die Debatte. Die Bildung einer öffentlichen Meinung galt per se als wichtige Beschränkung der Regierungsmacht. Herausgebern und Mitarbeitern war sehr daran gelegen, schlechte Herrscher öffentlich bloßzustellen. Manche kümmerte eine schlechte Presse natürlich kaum. Selbst in den heikleren Zeiten nach 1789 scherte sich August von Limburg-Stirum, 1770–1797 Fürstbischof von Speyer, wenig um die Empörung über seine Schrift Die Pflichten der Untertanen gegen ihren Landesherrn. Zum Gebrauch der Trivialschulen im Hochstift Speyer, in der er Kindern ihre Pflichten erklärte, ohne sich zu ihren Rechten zu äußern. 35 Friedrich Karl von Moser spottete, »die ganze Schrift könnte eben so leicht Lehrbuch des Christ-fürstlichen Sultanismus heißen und in den trivial-Schulen der Moldau und Wallachey eingeführt werden«. Die verbreitete und vernichtende Ablehnung der Regierungsweise des Bischofs selbst unterstreicht, für wie unerhört und lebensfremd man ihn hielt. Große öffentliche Aufmerksamkeit und ähnliche Entrüstung erregten zwischen 1770 und 1793 sieben Fälle der Absetzung oder Inhaftierung von Herrschern durch den Reichshofrat aus Gründen, die von tyrannischem Machtmissbrauch bis Wahnsinn reichten. 36 Der Unterschied zu Friedrich dem Großen hätte nicht eklatanter sein können. 1784 etwa ordnete Friedrich an, Auszüge aus dem Gesetzentwurf, dem späteren Allgemeinen Landrecht, zur öffentlichen Prüfung und Diskussion zugänglich zu machen. 37 Die übliche Prozedur der Einholung gelehrter Meinungen wurde um einen Aufsatzwettbewerb erweitert, der ebenso heftigen Widerspruch wie Zustim-
565
566
V. · Die deutschen Territorien nach 1760
mung erhielt. Die tatsächlichen Motive des Königs sind unklar. Mag sein, dass er vorhatte, die Aufklärer gegen den reaktionären Adel zu mobilisieren. Es war jedoch auch ein weiteres Beispiel für seinen beständigen Einsatz der Öffentlichkeit und der Presse zur Rechtfertigung seiner Außen- wie Innenpolitik. Zumindest in dieser Hinsicht war er ein durch und durch »moderner« Monarch. Kants These von 1784, es sei realistisch, an die Möglichkeit eines von Monarchen geförderten Fortschritts zu glauben, weil sie im Großen und Ganzen eitel seien und als gute Herrscher in die Geschichte einzugehen trachteten, war möglicherweise recht scharfsinnig. 38 Zeitungen und Periodika gaben vorherrschende Ideen wieder und waren im Allgemeinen achtsam gegenüber der Zensur. Die Art von Anmerkungen, die Schlözer angeblich in seinen Vorlesungen äußerte, erschien nie gedruckt. Selbst in der relativ liberalen Atmosphäre von Göttingen hätte die Obrigkeit niemals die Erklärung geduldet, dass man einen König, »der seine Schuldigkeit nicht thue, wie den Thorschreiber im ähnlichen Falle absetzen müsse«. 39 Wirkliche politische Radikale und Demokraten scheinen selten und weit verstreut gewesen zu sein. Figuren wie der Autodidakt Johann Michael Afsprung aus Ulm, dessen Beobachtungen zur Niederländischen Republik (1782) entschieden demokratische Ansichten enthielten, blieben Außenseiter ohne wirklichen Einfluss und erlangten ihre ohnehin geringfügige historische Bedeutung erst nach 1789. 40 Die Betonung der Beschränkungen herrscherlicher Macht war wohl am stärksten in den mittleren und kleineren Territorien. In Preußen änderte sich die Atmosphäre nach dem Tod Friedrichs des Großen. Unter seiner Regierung gab es wohl eher die Tendenz, auf den guten Willen eines aufgeklärten Herrschers zu vertrauen. Nach seinem Tod indes wurden die Argumente für die Limitierung königlicher Macht lauter. Ein Merkmal der vielen lobenden Reverenzen an die Herrschaft des verstorbenen Königs war, wie weise er angeblich seine Macht eingesetzt habe. Zugleich folgte Kant, als er seine Unterscheidung zwischen Herrscher und Regierung darlegte, einer allgemeineren Strömung, indem er die repräsentativen Aufgaben des Monarchen betonte und auf die Beschränkungen hinwies, die jedes gesunde Gemeinwesen unvermeidlich der Ausübung monarchischer Macht auferlege. 41 Was die Bedeutung der politischen Ansichten der Aufklärung betrifft, sind die Urteile höchst unterschiedlich. Die Meinung, die Deutschen seien im Grunde unoder apolitisch gewesen, hat eine lange Tradition und hält sich bis heute. 42 Die positivere Einschätzung jüngerer Jahrzehnte geht davon aus, dass die Deutschen um 1780 eine Position erlangt hatten, die mit jener der preußischen Revolutionäre von 1848 vergleichbar sei; nur hätten die Französische Revolution und Napoleon zur Wiederbelebung absolutistischer Modelle einer Herrschaft von oben geführt und damit die stetige Entwicklung zum modernen Verfassungsstaat in Deutschland verzögert. 43
53. Aufklärung und Regierung
Diese Alternativen erscheinen zu extrem. Die öffentliche Debatte der Zeit vor 1789 war nicht unpolitisch, eine politische Teilhabe stand indes, abgesehen von den Reichsstädten, nicht in Aussicht; begrenzte Monarchie war nicht dasselbe wie konstitutionelle Monarchie. 44 Die unterschiedlichen Einstellungen zur Regierung, die im Reich des späten 18. Jahrhunderts ihre Blüte erlebten, bildeten ein Amalgam traditioneller Maximen und moderner Prinzipien: Respekt vor einer starken Herrschaft als Voraussetzung für Stabilität und Sicherheit, Betonung der Notwendigkeit der Selbstbeschränkung von Herrschern, das Beharren auf dem Recht der Bürger, als Stände an der Regierung zu partizipieren, Anerkennung unveräußerlicher Rechte des Einzelnen und sein Recht, innerhalb eines vom Staat garantierten Bereichs sein wirtschaftliches und kulturelles Potenzial auszuschöpfen. Man könnte sich in der Tat fragen, ob die informellen Beschränkungen und die Konzentration auf bürgerliche statt auf politische Freiheit oder Partizipation der meisten Aufklärer ihren langfristigen Zielen förderlich waren. Wie viele deutsche Kommentatoren der Ereignisse nach 1789 betonten, hätte man aber ebenso auch die Revolutionäre in Frankreich fragen können, ob ihre Methoden ihrem eigenen Streben nach Freiheit dienlich waren.
Anmerkungen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18
Dippel, Revolution, 3–70. Fuhrmann und Klippel, »Staat«, 225–229; vgl. auch S. 225–234. Bachmann, Staatslehre, 185–194; Lutterbeck, Staat, 192–203, 207 ff. Möller, Vernunft, 199 f. Fuhrmann und Klippel, »Staat«, 235 ff. Zande, »Popular Philosophy«. Zande, Bürger, 79–85, 105–120, 129–137. Kiesel, Bei Hof, 199–220; Dreitzel, Monarchiebegriffe I, 285–293; vgl. zu Moser Mühleisen et al., Fürstenspiegel, 618–652; Valjavec, Entstehung, 89 f. Kiesel, Bei Hof, 220–261; Reed, »Talking«; Valjavec, Entstehung, 129–132. Bauer, Hofökonomie, 247–250. Ebd., 224. Klippel, »Aufklärung«; Garber, »Menschenrechtstheorien«. Stolleis, Öffentliches Recht I, 379–382; Dreitzel, »Justis Beitrag«, 170 ff.; vgl. zu Justis glückloser Laufbahn als praktischer Arzt, die zu seiner Verurteilung und Inhaftierung wegen Betrugs führte, Wakefield, Police State, 81–110. Zitiert nach Dreitzel, »Justis Beitrag«, 169. Tribe, Economy, 55–90; Stolleis, Öffentliches Recht I, 382 f. Klippel, »Aufklärung«, 207. Maier, Staats-und Verwaltungslehre, 207–219; Ritter, »Kant«, 338–342; Fuhrman und Klippel, »Staat«, 238–243. Humboldt, Limits, 42 ff.; Stolleis, Öffentliches Recht I, 385; Humboldts Aufsatz erschien erstmals 1852.
567
568
V. · Die deutschen Territorien nach 1760
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Frühwald, Ruhe, 16; Maier, Staats-und Verwaltungslehre, 163. Ebd., 200–219, hier 216. Klippel, Politische Freiheit, 135–158. Maier, Staats-und Verwaltungslehre, 287. Nach wie vor hilfreich ist Parry, »Government«. Moser, Staatsrecht XIII, 937 ff.; XVII, S. 83-f., 487; XVII, S. 73; XXIII, S. 38; vgl. auch S. 206–210. Parry, »Government«, 185–191; Knudsen, Möser, 94–186; Schröder, »Möser«; Rudersdorf, Möser, 53–72; Welker, Rechtspolitik I, 277–322; Sheldon, Development, 108–118, argumentiert, Mösers Traditionalismus sei in Wahrheit antiaufklärerisch gewesen, was die Arbeiten von Knudsen und Welker widerlegen. Liebel, »Bureaucracy«, 40 f., 44 f., 48–52; ADB XXXI, 467–471; Klippel, »Liberty«, 456 f.; Tribe, Economy, 119–131; Valjavec, Entstehung, 58–63. Klippel, »Aufklärung«, 202. Möller, Vernunft, 207. Liebel, »Bureaucracy«, 68–112. Diesen Begriff verwendet Porter, Enlightenment, XVII, bezieht ihn jedoch nicht auf Schlosser. Klippel, »Liberty«, 457 f. Tribe, Economy, 133–148; Carpenter, Dialogue, 44–47, 78 f. Valjavec, Entstehung, 96. Ebd.; Fischer, Haefs und Mix, Handbuch, 303–315. Sailer, Untertanenprozesse, 338 f.; ADB XVIII, 655–658; Volker Press nennt ihn »Intellektueller und Psychopath«: Press, »Oberrheinlande«, 17. Marquardt, Reich, 382. Möller, Vernunft, 303 ff. Kant, Aufklärung, 54. Valjavec, Entstehung, 102. Riethmüller, Anfänge, 65–71; ADB I, 136 f. Dreitzel, Monarchiebegriffe, 293–300. Vgl. die Diskussion bei Klippel, »Theorien«, 57–65, 84–87; Blanning, Reform, 15–23. Ries, Obrigkeit, 458. Dreitzel, Monarchiebegriffe, 786–881.
54. Kameralismus, Physiokratismus und die Versorgung der Gesellschaft
U
nter der ungeheuren Masse zeitgenössischer Schriften zur Aufklärung entwarfen kein einziges Buch und kein Artikel je ein ideales Programm einer aufgeklärten Reform für die deutschen Territorien. Aufklärung war im Grunde eher eine Denkweise als ein umfassendes, detailliertes Programm zum Handeln. Sie war eine Methodologie, die sich auf praktisch jeden Aspekt menschlichen Lebens und Verhaltens anwenden ließ. Aufgeklärte Ideen konnten das menschliche Befinden beleuchten und Einsichten in das mögliche Schicksal der Menschheit liefern. Aufgeklärte Prinzipien ließen sich auch auf praktischen Gebieten anwenden, etwa bei der Planung von Straßen in Städten, der Hebammenausbildung und Viehhaltung. Ebenso gab es nie so etwas wie ein archetypisches aufgeklärtes Territorium, höchstens in der kollektiven Vorstellung jenes Teils der gebildeten Öffentlichkeit, der sich für aufgeklärt betrachtete. Dennoch lässt sich ein »ideales« Programm aufgeklärter Reform oder Praxis zumindest versuchsweise umreißen. Ein Großteil dieses Programms war im Grunde kaum mehr als eine Fortsetzung der Politik früherer Generationen. Die Reformen der Jahrzehnte nach 1750 waren Teil einer Abfolge von Reformbewegungen, die die Geschichte der deutschen Territorien seit dem 15. Jahrhundert geprägt hatte. Natürlich gab es wie in früheren Reformphasen einige gänzlich neue Elemente, die aufgeklärtes Denken widerspiegelten, und andere, eher traditionelle Elemente mit neuem, aufgeklärtem Unterton. Das ganze Programm war eine Mixtur aus Innovation und Tradition.Vor allem war es ein Programm, dessen Umrisse von den Strukturen und Traditionen der deutschen Territorien geformt wurden. Dies schränkte die Resonanz in manchen Territorien ein und erlaubte anderen, in neuartiger, beeindruckender Weise loszulegen. Was die Regierungsstruktur anging, war das Hauptziel die Rationalisierung der Administration und die Verbesserung ihres Personals. Das zog die Einführung zentraler administrativer Stellen und, wo nötig, sowohl im Zentrum als auch auf regionaler Ebene die Schaffung eines Gremiums von Regierungsbeamten nach sich, die unabhängig von den Beamten und Agenten der Stände und anderer Körperschaften agierten oder diese in beträchtlichem Ausmaß ersetzten. In größeren Territorien hielt man oft die Schaffung eines inneren Kabinetts oder Konzils im Herzen der Regierung für nötig. Auf allen Ebenen sollte die Aufmerksamkeit der
570
V. · Die deutschen Territorien nach 1760
angemessenen Qualifikation der Beschäftigten gelten. Die Idee unabhängiger Einstellungsprüfungen, um Kräfte für verantwortliche Positionen zu finden, kam in dieser Phase erstmals auf. Niemand sollte allein aufgrund seiner Herkunft als qualifiziert gelten und eine simple Universitätsausbildung reichte nicht mehr aus. 1 Die vordringliche Aufgabe einer Regierung war die Erzielung von Einkünften. Dies geschah durch Wirtschaftspolitik oder Besteuerung. Im 18. Jahrhundert hielt die Mehrheit der deutschen Autoren zu ökonomischen Themen an den Doktrinen des Kameralismus fest, der im Grunde eine modernisierte Form des Merkantilismus war. 2 Dies umfasste die Förderung von Manufakturen, den allgemeinen Schutz der einheimischen Wirtschaft und eine positive Handelsbilanz. Ein Grundanliegen blieb das Wachstum der Bevölkerung, wenn nötig durch Anwerbung neuer Siedler. Andererseits verschob sich das Gewicht von der nun als unausgegoren betrachteten Peuplierungspolitik früherer Generation hin zu einer umfassenderen Sicht auf die gesamte ökonomische Entwicklung eines Territoriums. Die großen Theoretiker der Zeit vor den 1790er Jahren waren sich einig, dass das breitere Ziel von Regierungen im ökonomischen Bereich die Förderung des Glücks der Bürger war. 3 Das bedeutete zunächst die Förderung ihres materiellen Wohlstands, hatte aber auch Folgen für die allgemeinere Gesundheits- und Wohlfahrtspolitik. In den einflussreichen Schriften von Joseph von Sonnenfels entsprang aus dem Ziel der Förderung von Glück ein spezifischeres Programm der Verbesserung der Sicherheit, Befriedigung der Grundbedürfnisse und des Sorgens für Freizeit und Wohlbefinden der Bevölkerung. Der erste Schritt war laut Sonnenfels die Erhöhung der Bevölkerung, weil mehr Menschen die Verteidigungsfähigkeit verstärkten, die Menge und Vielfalt an Produkten erhöhten und geringere individuelle Beiträge zu den öffentlichen Ausgaben bedeuteten. 4 Während Kameralisten wie Justi der Landwirtschaft große Bedeutung beimaßen, sich jedoch auf Handel und Manufakturen konzentrierten, waren die Physiokraten überzeugt, der Schlüssel zum Wohlstand liege ausschließlich in der Verbesserung der Landwirtschaft. 5 Ihre Modelle zur Besteuerung und Förderung des Wohlstands richteten sich auf Grundbesitzer und die Förderung der landwirtschaftlichen Produktion. Landwirtschaft war die Grundlage eines Systems, das eine einzige Grundsteuer, die impôt unique, als Hauptquelle der Staatseinnahmen vorsah. Im Denken des wichtigsten deutschen Physiokraten, Johann August Schlettwein (* 1731, † 1802), war der Pachtbauer entscheidender als der adlige Grundbesitzer, der im französischen Physiokratismus eine so herausragende Rolle spielte. 6 Das überrascht nicht unbedingt, schließlich entstanden Schlottweins Ideen vor dem Hintergrund der Markgrafschaft Baden-Durlach in Südwestdeutschland, einer typisch grundherrschaftlichen Gegend von Bauern, die feudale Abgaben bezahlten, nicht von adligen Ständen.
54. Kameralismus, Physiokratismus und die Versorgung der Gesellschaft
Selbst nach dem Schwinden des Einflusses des Physiokratismus in Frankreich nach Quesnays Tod 1774 inspirierten Elemente des Systems weiterhin das deutsche ökonomische Denken und prägten die deutsche Beschäftigung mit den Ideen von Adam Smith um 1800. 7 Tatsächlich war nichts von dem, was Smith zur Landwirtschaft sagte, grundsätzlich unvereinbar mit dem Physiokratismus: Sein Bestehen auf freiem Getreidehandel und der Liberalisierung des Systems ländlicher Arbeit folgte fundamentalen Dogmen des Physiokratismus. Zwar lehnte Smith die Idee einer einzigen Steuer als restriktiv ab und war nicht der Meinung, Wohlstand hänge von einer hohen Bevölkerungszahl ab. Sein Interesse an der Erhöhung der Profitabilität der Landwirtschaft schien jedoch alle Unterschiede wettzumachen. Der Physiokratismus und Smiths Ideologie mögen mit ihrer Marktorientierung für das Aufkommen eines letztlich »moderneren« ökonomischen Denkens stehen, aber auch die vorherrschenden kameralistischen Strömungen beeinflussten das Verständnis der Ideen von Kant und Smith in Deutschland. Smiths Vision von freiem Handel ohne staatliche Eingriffe wurde zumeist in die Vorstellung freien Handels innerhalb der Grenzen des Staats übersetzt. Um 1800 erwuchs aus der kameralistischen Tradition eine neue Sicht der Aufgaben des Staats. Seine Pflicht zur Förderung des Glücks wurde nun neu definiert als Berufung des Staats zur Förderung des Wohlstands der Nation im Sinn der Summe aller Aktivitäten auf dem privaten Sektor, der Kern dessen, woraus im 19. Jahrhundert die Nationalökonomie entstand. 8 Das Auftreten bürokratischer Reformbewegungen in der Zeit Napoleons verstärkte die Zentralität der Disziplin weiter. Noch lange nach 1815 florierte sie unter der zunehmend verbreiteten Bezeichnung »gesamte Staatswissenschaften« als Rückgrat der liberalen Bewegung, als Lehre vom Rechtsstaat. Aber auch abseits der spezifischen Interessen der Kameralisten und Physiokraten war die Verbesserung der Landwirtschaft ein wesentliches Anliegen der Aufklärung. Debatten wurden gefördert, Themen durch die diversen patriotischen und ökonomischen Gesellschaften popularisiert, von denen sich einige fast ausschließlich landwirtschaftlichen Belangen widmeten. 9 Der erste Impuls zu einer neuen Welle von Gründungen kam 1753 von der Londoner Society for the Encouragement of Art, Manufacture and Commerce. Die erste deutsche Verbindung war 1757 die Physikalisch-Ökonomische Gesellschaft in Zürich. In den folgenden Jahrzehnten entstanden im ganzen Reich zahlreiche ähnliche Gruppen, manche auf Initiative von Herrschern, manche von Privatleuten. Die 1765 im bayerischen Altötting gegründete Patriotische Gesellschaft der sittlichen und landwirtschaftlichen Wissenschaften und die Seefeldische Feldbausozietät von 1789 waren typisch für die Vielfalt der Gründungen, die auch so spezialisierte Gruppen wie die Fränkische Physikalisch-Ökonomische Bienengesellschaft (1770) umfasste. Die 1764 in Celle gegründete Hannöversche Landwirtschaftsgesellschaft war eine der aktivsten Sozietäten in der Förderung der jüngsten englischen Fruchtwechselsysteme und
571
572
V. · Die deutschen Territorien nach 1760
später Ausgangspunkt der Karriere des Arztes Albrecht Thaer (* 1752, † 1828) als Agrarreformer. Die Arbeit der Gesellschaften wurde oft von Herrschern gesponsert. Manche, etwa Friedrich II. von Preußen und Karl Friedrich von Baden, sandten Agenten nach England, um über die neuesten Praktiken zu berichten, und einige folgten dem Beispiel Georgs III. und unterhielten Modellbauernhöfe. Unterwegs zu einem Treffen mit Friedrich dem Großen im August 1769 war sich Kaiser Joseph II. bekanntermaßen nicht zu schade, an der Straße zwischen Brünn und Olmütz in Mähren seine eigenen Fähigkeiten am Pflug unter Beweis zu stellen. 10 Viele Akademien nahmen nun die Förderung der Landwirtschaft in ihr Lehrprogramm auf. 11 Die einflussreichste Gestalt in diesem akademischen Bereich war Johann Beckmann (* 1739, † 1811), Professor der Philosophie in Göttingen. Seine Grundsätze der teutschen Landwirthschaft (1769) erlebten bis 1806 sechs Auflagen; von 1770 an gab er eine »physikalisch-ökonomische« Rezensionszeitschrift heraus, die ihren Lesern mehr als hundert neue Publikationen jährlich vorstellte. Beckmann war ein typischer aufgeklärter Kameralist, da er Neuerungen in der Landwirtschaft als Teil einer allgemeinen Tendenz zur Anwendung von Technologie (ein Begriff, den er 1772 prägte) auf praktisch jedem Gebiet menschlicher Tätigkeit betrachtete. Er verbreitete seine Ideen in Seminaren, Vorlesungen und durch die Zusammenstellung aktueller Neuerungen auf allen Gebieten in seinen fünfbändigen Beyträgen zur Geschichte der Erfindungen (1780–1805), die unter dem Titel A History of Inventions and Discoveries (1797, 4. Auflage 1846) auch in England Resonanz fanden. 12 Beckmanns landwirtschaftliches Handbuch blieb bis zur Veröffentlichung von Albrecht Thaers dreibändiger Einleitung zur Kenntniss der englischen Landwirthschaft (1798–1804) und der vierbändigen Grundsätze der rationellen Landwirthschaft (1809–1812) maßgeblich. Dann lieferten diese den Rahmen der landwirtschaftlichen Praxis bis zur Einführung von Kunstdüngern im späten 19. Jahrhundert. 13 Der Fokus all dieser Initiativen war fast immer regional, dennoch bildeten sie eine nationale, tatsächlich sogar internationale Bewegung. Sie förderten auch den Austausch von Wissen durch Aufsatzwettbewerbe und Publikationen. 1803 listete ein dreibändiges bibliografisches Handbuch zu landwirtschaftlichen Themen mit Angaben zum Preis und inhaltlichen Wert jedes Werks etwas mehr als 6.000 Publikationen auf, von denen die meisten ab etwa 1760 erschienen waren. 14 Das wichtigste Anliegen der »Agrarbewegung« war die Erhöhung der Produktivität. Die Gesellschaften förderten die Abwendung vom alten Dreifeldersystem und vor allem Versuche, das ihm zugrundeliegende »verschwenderische« Brachliegenlassen von Land zu eliminieren. Sie warben für neue Feldfrüchte wie Klee, Runkelrüben und Kartoffeln (besonders intensiv nach der Hungersnot von 1771/ 72) und den wechselnden Anbau von Getreide und Hülsenfrüchten nach zuneh-
54. Kameralismus, Physiokratismus und die Versorgung der Gesellschaft
mend ausgeklügelten Plänen. Der Zeitzer Bauer Johann Christian Schubart (* 1734, † 1787), Mitglied der 1764 gegründeten Ökonomischen Gesellschaft in Leipzig und Hauptverfechter des Kleeanbaus, wurde 1784 von Joseph II. in Anerkennung seiner Leistungen als Schubart von Kleefeld geadelt. Viel Erfindergeist widmete man der Verbesserung des »englischen« Systems der Fruchtfolge nach Siebenjahresplänen. Der Erfurter Saatguthändler Christian Reichardt (* 1685, † 1775) berichtete 1753, er habe ein Fruchtfolgesystem über achtzehn Jahre entwickelt, für das weder Brachjahre noch zusätzlicher Dünger nötig seien. 15 Ähnlich einfallsreich und experimentell war die Entwicklung landwirtschaftlicher Maschinen. 1798 beschrieb ein Aufsatz in den Leipziger Oekonomischen Heften nicht weniger als vierundzwanzig Typen von Dreschmaschinen. 16 Neue Futterpflanzen und effektivere Fruchtfolge bewirkte eine intensivere Nutzung des Bodens und bedeutete auch, dass das Vieh, das zuvor auf Brachen weidete, nun im Stall gehalten werden konnte. Gleichzeitig richtete das englische Vorbild die Aufmerksamkeit auf Zuchttechniken, Experimente mit neuen Tierarten und den Import besserer Rassen. 17 Um 1770 übergab der Fürst von Liechtenstein dem pfälzischen Kurfürsten eine Herde Angoraziegen. In Brandenburg experimentierte Franz Balthasar von Brenkenhoff (* 1723, † 1780) mit einer Büffelherde. Einige seiner Nachbarn importierten Herden von schweizerischen sowie holsteinischen Rindern und Friedrich selbst importierte Holsteinbullen zur Verbesserung der Herden auf seinen Landgütern. Um den Erfolg der zunehmend sorgfältigen Zuchtprogramme auf den königlichen und adligen Ländereien zu sichern, drohte die Regierung 1765 mit einem neuen Gesetz, Stiere zu konfiszieren, die frei herumlaufen. Die Einführung einer Herde spanischer Merinoschafe in Sachsen 1765 markierte den Beginn eines höchst erfolgreichen Kreuzungsprogramms, das sich nach Preußen ausweitete und höchst gewinnträchtige Edelwolle hervorbrachte. In den Sümpfen und Moosen in Bayern, Brandenburg, an der Nordseeküste und anderswo stieg die Produktivität durch Neulandgewinnung und die Errichtung neuer Siedlungen und Kolonien. Verbliebene Reste des Systems der Leibeigenschaft waren in vielen Gegenden das Hauptproblem der Agrarreformen. Neue Ideen von Freiheit und Grundbesitz auf Grundlage des Naturrechts prägten nun zunehmend die Diskussion über die Stellung des Bauern, deren Misere in vielen Gegenden von aufgeklärten Kommentatoren als Art von Sklaverei betrachtet wurde. 18 Die Diskussion verlief auf nationaler Ebene, gehandelt wurde lokal und häufig ebenso sehr unter Marktgesichtspunkten wie aufgrund aufgeklärten Denkens. Es war eher der Profitgedanke als die Aufklärung, der Adlige in Schleswig-Holstein dazu brachte, traditionelle Formen der Bindung zugunsten flexiblerer Lohnarbeit zu lockern. Dasselbe galt für Brandenburg und Pommern gegen Ende des Jahrhunderts; begonnen hatte der Trend indes in den 1730er Jahren auf königlichen Gütern. 19
573
574
V. · Die deutschen Territorien nach 1760
Anderswo sorgte die Abschaffung der Leibeigenschaft durch Joseph II. 1781 für Aufmerksamkeit und ausgiebige Diskussion. Die Inkraftsetzung des Dekrets im habsburgischen Territorium Breisgau führte zu einem ähnlichen Dekret im benachbarten Baden, wo Markgraf Karl Friedrich und seine Berater Bauernunruhen und die Flucht unfreier Untertanen fürchteten, wenn sie es dem Kaiser nicht gleichtaten. Wie im Fall der österreichischen Reform waren die in Baden eingeführten Maßnahmen unvollständig. Die zutiefst verhasste persönliche Knechtschaft wurde im Grunde in Geldzahlungen umgewandelt. Diese Zahlungen wurden in der Folge reduziert und ab 1785 war es möglich, sich für den Gegenwert der Zahlungen von fünfundzwanzig Jahren aus dem System der Lehnszinsen herauszukaufen. 1786 wurden bäuerliche Pachten vererbbar. Die Umwandlung der Pachten in freien Grundbesitz begann jedoch ernsthaft erst nach 1820 (und war erst 1848 abgeschlossen) und in den 1790er Jahren wurde die Fronarbeit für alle Untertanen in Baden sogar wieder eingeführt. 20 Zudem wurden Aspekte der Agrarreformen Josephs II., vor allem jene, die auf die Abwicklung des Feudalsystems in seinen Ländern abzielten, von seinem Nachfolger Leopold II. 1790 widerrufen. Wie in Baden dauerte die Umwandlung ländlicher Strukturen in den habsburgischen Gebieten viele Jahrzehnte. Der Prozess der bäuerlichen Emanzipation zog sich auch in anderen Gegenden hin, manchmal sogar noch mehr, und fast überall waren Herrscher und Adel die ersten und manchmal einzigen Profiteure. Die Idealvorstellung, dass dem Bauern grundsätzlich Freiheit und Besitz zustünden, wie der preußische Beamte Ernst Ferdinand Klein in einem viel diskutierten Beitrag 1790 feststellte, geriet nur allzu leicht in Vergessenheit. 21 Oft wurde der Bauer schlicht zum Lohnarbeiter gemacht, gebunden an das Land, auf dem er arbeitete, mit keinem oder unzureichendem eigenem Besitz. Viele Agrarreforminitiativen waren lokal begrenzt. Unterschiedliche Bodenbeschaffenheit und klimatische Bedingungen, rechtliche Strukturen, Besiedelung und Landnutzung verlangten unterschiedliche Ansätze für jede Region und oft für jeden einzelnen Bezirk. Was in Brandenburg funktionierte, konnte in Hannover, Franken, Baden oder Bayern fehl am Platz sein. Die Anläufe mancher Herrscher, die Bauern gesetzlich vor Einhegungen und Verkoppelungen zu schützen (»Bauernschutz«), waren ohne Marktanreize selten wirksam. Und obwohl steigende Preise allgemein Impulse zur Veränderung gaben, widersetzten sich viele.Während Adlige in Schleswig-Holstein und Brandenburg ihre Geschäftspraktiken auf den Markt einzustellen begannen, kam es im nahegelegenen Mecklenburg zu einer neuen Welle von Einhegungen, die das alte System der Fronarbeit verfestigten. 22 Die Reformhindernisse waren in mancherlei Hinsicht in den grundherrschaftlichen Gebieten noch größer, wo kleine bäuerliche Betriebe und nicht adlige Land-
54. Kameralismus, Physiokratismus und die Versorgung der Gesellschaft
güter vorherrschten. Die Gegend um Erfurt war in ihrer neuerungsträchtigen Progressivität eine Ausnahme. In anderen Regionen widersetzten sich Dorfgemeinden vehement Maßnahmen wie der Auftrennung von Allmenden, Umverteilung gemeinschaftlicher Felder und der Einführung von Bodennutzungs- und Fruchtfolgesystemen, die traditionelle Muster der Bewirtschaftung zu untergraben drohten. Neue Feldfrüchte wurden regelmäßig abgelehnt: Der Kleeanbau verstieß gegen traditionelle Weiderechte, Kartoffeln ersetzten Getreide und gefährdeten so den Lebensunterhalt von Müllern. 23 Viele Bauern fügten sich indes der Macht des Markts und den von der Obrigkeit aufgezwungenen Reforminitiativen. Die Reformen der 1760er und 1770er Jahre in Baden krempelten offenbar bis Ende des Jahrhunderts die Systeme der Flächennutzung um. 24 Wirklich aufgeklärte Bauern gab es kaum und sie waren weit verstreut. Einzelne wie der »Bauernphilosoph« Jakob Gujer (* 1716, † 1785) aus Katzenrüti bei Rümlang im Kanton Zürich, dem Goethe und Herzog Karl August von Weimar 1775 und 1779 einen Besuch abstatteten, waren im Reich so gut wie ohne Beispiel. 25 Die extreme Vielfalt bäuerlicher Kulturen im Reich verbietet eine simple Verallgemeinerung. In vielen Gegenden bewirtschafteten adlige Landbesitzer und Bauern ihre Ländereien weiterhin auf traditionelle Weise; Bauern litten unter der Last substanzieller Zahlungen an ihre Lehnsherren, Adlige wie Reichsritter unter zunehmender Verschuldung. Klar zu sein scheint indes, dass Marktkräfte ab etwa 1750 schrittweise Veränderungen der Bodennutzung und landwirtschaftlichen Praxis bewirkten. Im Norden des Reichs war der wichtigste Faktor die zunehmende Nachfrage der schnell wachsenden westeuropäischen Bevölkerungszentren, aber die wachsende Bevölkerung des Reichs wirkte sich überall aus. Die allgemeine Diskussion über landwirtschaftlichen Fortschritt begünstigte den Wandel und in einigen Fällen sorgte neues Denken tatsächlich für Neuerungen. Die Änderungen gingen im Großen und Ganzen im Rahmen der traditionellen Sozialstruktur vor sich, davon profitierte hauptsächlich der Adel. Dieses Muster blieb für die diversen Regierungsreforminitiativen der ersten Dekade des 19. Jahrhunderts prägend. Der Vorrang, den die Landwirtschaft bei Regierungen und in der aufgeklärten Reform genoss, beeinträchtigte nicht die anhaltenden Bemühungen um die breitere ökonomische Organisation, die Förderung von Manufakturen und Maßnahmen zur Regulierung des öffentlichen Wohlstands und der öffentlichen Ordnung unter dem umfassenden Schlagwort »Polizei«. Auf diesen Gebieten fällt es oft nicht leicht, spezifisch »aufgeklärte« Initiativen zu identifizieren. Aber die Entwicklung traditioneller politischer Vorgehensweisen im späten 18. Jahrhundert war ausnahmslos vom Denken der Aufklärung und vom aufgeklärten Eifer nach Verbesserung und Neuerung durchdrungen. Gekennzeichnet ist diese Phase von einer wachsenden Vernunftgläubigkeit in Sachen Herrschaft, die verschiedene Ursprünge hatte. Es gab den kumulativen
575
576
V. · Die deutschen Territorien nach 1760
Effekt der merkantilistischen ökonomischen Erfahrungen seit 1648. Mitte des 18. Jahrhunderts begannen viele Regierungen statistische Daten zu sammeln, zu vergleichen und politisch nutzbar zu machen. 26 Bis zu den 1760er Jahren entstanden in Anknüpfung an traditionelle kameralistische Schriften höchst verfeinerte Betrachtungen von Autoren wie Justi zu Wirtschaft, den Märkten sowie der Rolle der Regierungen und diese Themen fanden nun auch Eingang in die öffentliche Diskussion in der Presse. Diese Diskussion prägte die von Regierungsbeamten und der wachsenden Anzahl privater Einzelner als Unternehmer beziehungsweise »patriotische« Freiwillige in diversen Wohlfahrtsinitiativen formulierte Politik. Natürlich führten Erfahrung und Wissen nicht zwangsläufig zum Erfolg. Tatsächlich lagen gerade der Regierungspolitik oft fiskalische Überlegungen und der Wunsch, um jeden Preis für Stabilität zu sorgen, zu Grunde, was angesichts der langsam anbrechenden Freisetzung der Macht des Markts viele Initiativen zum Scheitern verurteilte. Diese Probleme zeigen sich an den unterschiedlichen Reaktionen auf die schlimmen Missernten von 1770–1772, die Auslöser vieler Reformen der folgenden Jahrzehnte waren. Die Krise erfasste praktisch das gesamte Reich sowie einen Großteil von Nordeuropa. 27 Engpässe und hohe Preise betrafen sämtliche Territorien, aus vielen Gegenden wurde von verheerenden Hungersnöten berichtet. Allein im Erzgebirge zwischen Sachsen und Böhmen starben 1772 etwa 50.000 Menschen. 28 Verlässliche Zahlen gibt es nur für Sachsen; sie zeigen einen Bevölkerungsrückgang um sechs Prozent als direkte Folge der Krise. In manchen südwestdeutschen Gegenden wanderten vier Prozent der Bevölkerung aus. Viele gingen nach Ungarn und ins Banat, wo der anfängliche Zuzug so zahlreich war, dass das Gebiet im Januar 1771 vorübergehend für neue Siedler gesperrt wurde. 29 Die meisten Territorialregierungen, ob weltlich oder kirchlich, reagierten offenbar mit traditionellen Exportverboten, Marktregulierung und Maßnahmen zur Preisfestsetzung. Das Ziel war, zu zeigen, dass man etwas unternahm, da die Bürger erwarteten, dass ihre Regierung auf die Misere reagierte. Tatsächlich führten die Maßnahmen jedoch oft zur Behinderung der gleichmäßigen Verteilung von Getreide. Die Städte litten; in Sachsen verloren die protoindustrialisierten Regionen im Erzgebirge und Vogtland fast zehn Prozent ihrer Bevölkerung, während es den landwirtschaftlichen Flächenländern mit Verlusten von zwei oder drei Prozent besser erging. In Württemberg rief die Festsetzung der Preise durch die Regierung den Widerstand der Hersteller hervor. 30 Ein strenges Verbot der Verlagerung von Lebensmitteln führte dazu, dass Städte nicht mit Waren beliefert werden konnten, die sie anderswo bestellt hatten. Die Getreideeinkäufe der Regierung in Köln, Amsterdam und anderswo und ihre Anweisung, alle über den persönlichen Bedarf hinausgehenden Bestände auf den Markt zu bringen, empörte Produzenten und Getrei-
54. Kameralismus, Physiokratismus und die Versorgung der Gesellschaft
dehändler. Die oberdeutschen Reichsstädte, die nun vom Nachschub aus Württemberg und anderen nahegelegenen Territorien abgeschnitten waren, mussten Getreide in Amsterdam oder Mantua und Venedig einkaufen. In vielen Fällen stürzten sie sich damit in hohe Schulden, die unbezahlt blieben, als sie 1803 ihre Unabhängigkeit verloren. Im Februar 1772 beschloss der Reichstag schließlich ein Dekret, das alle inneren Zollgrenzen für Getreide aufhob und ein Getreideexportverbot einführte. 31 Weiterreichende Vorschläge zur Einführung eines freien Markts für Getreide unter den Vorderen Reichskreisen (Franken, Schwaben, Oberrhein und Kurrhein) oder gar im ganzen Reich führten indes zu nichts. Die Furcht, es könne zu Aufständen kommen, wenn Herrscher nicht auf die Not ihrer Untertanen reagierten – das anhaltende Trauma des Bauernkriegs von 1525 –, verhinderte eine »rationale«, marktorientierte Lösung. Wo 1525 nicht so tiefe Schatten warf, mögen flexiblere Reaktionen wirkungsvollere Ergebnisse gezeitigt haben. In Brandenburg-Preußen nahm die Krone ihre übliche Politik der Freigabe von Beständen aus militärischen Getreidelagern wieder auf, um die Preise unter Kontrolle zu halten und für gleichmäßige Verteilung zu sorgen. 32 Entscheidend war auch, dass Preußen nach der ersten Teilung Polens auf seine Militärmacht und Kontrolle über die Weichsel (Polens wichtigste Getreideexportroute) setzen konnte, um Polen billiges Getreide abzupressen. 33 Belege zeigen, dass es auch vielen anderen Territorien gelang, die Krise mit eher konventionellen Mitteln effektiv zu bewältigen, und dass sie daraus Lehren zogen. 34 In Hannover unternahm die Regierung Schritte zur Sicherung des ungehinderten Getreidehandels innerhalb des Landes. Die Regierung von Braunschweig-Wolfenbüttel, die die Bedürfnisse von neun Bezirken und weitgehend unzusammenhängenden Landesteilen befriedigen musste, ging mit einer Reihe von lokalen Ad-hoc-Regulierungen behutsamer vor. Münster beschloss ein Exportverbot, beschränkte den Handel im Land und schrieb hohe Belohnungen und strafrechtliche Immunität für die Anzeige von Schmugglern aus. In allen drei Territorien führte die Erfahrung der Krise von 1770–1772 zur kontinuierlichen Überwachung der Getreidepreise durch die Verwaltung und zur Orientierung auf einen eher marktorientierten politischen Rahmen für die Zukunft. Als im Herbst 1789 von steigenden Getreidepreisen berichtet wurde, richtete Hannover sogar eine Art Freihandelszone für Getreide mit seinen Nachbarn Braunschweig-Wolfenbüttel und dem Fürstbistum Hildesheim ein.
Anmerkungen 1 2
Bleek, Kameralausbildung, 45–49, 69–82. Braun, »Economic Theory«; Tribe, Economy, 55–118; vgl. S. 227, 301 ff.
577
578
V. · Die deutschen Territorien nach 1760
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Vgl. auch S. 225–234, 686 ff. Lindenfeld, Practical Imagination, 37. Vgl. zu Justi über Landwirtschaft Abel, Landwirtschaft, 282 f. Vgl. S. 564. Tribe, Strategies, 24–30; ders., Economy, 119–131; Gagliardo, Pariah, 123–135; Lindenfeld, Practical Imagination, 59–67. Vgl. S. 561 ff.; Lindenfeld, Practical Imagination, 55–88. Vgl. zum Folgenden Hardtwig, Genossenschaft, 286 f., und Abel, Landwirtschaft, 277 f. Beales, Joseph II I, 338; Liebel, »Crisis«, 158 f.; der Kaiser demonstrierte sein Geschick im Pflügen erneut 1779 im böhmischen Reichenberg. Abel, Landwirtschaft, 278–289. ADB II, 238 f.; NBD I, 727 f.; Abel, Landwirtschaft, 278 f.; Ulbricht, Landwirtschaft, 98– 101, 118–133, 186–189. Ebd., 142–186, 263–276; Lindenfeld, Practical Imagination, 76–79; Achilles, »Georg III.«, betont, englische Einflüsse seien lange vor der Publikation von Thaers Werk spürbar und die wesentliche Auswirkung der englischen Praktiken in Hannover sei die Reform der rechtlichen Struktur gewesen, insbesondere die stetige Abschaffung von Frondiensten. Abel, Landwirtschaft, 286–289; Ulbricht, Landwirtschaft, 72–77. Abel, Landwirtschaft 311 f. Ebd., 321. Ebd., 314–319. Blickle, Europa, 175 f. Blickle, Leibeigenschaft, 241 f.; Dipper, Bauernbefreiung, 46–49; Neugebauer, »Preußen«, 478 f.; vgl. auch Lütge, Agrarverfassung, 201–213, und Gagliardo, Pariah, 50–118. Liebel, »Bureaucracy«, 52 f., 98; Dipper, Bauernbefreiung, 82–85; ders., Geschichte, 126 ff. Blickle, Leibeigenschaft, 164 ff. Dipper, Geschichte, 126. HbDSWG, 520 f. Dipper, Geschichte, 128–140; Abel, Landwirtschaft, 299–303. Hauser, »Kleinjogg«. Volckart, Wettbewerb, 214. Abel, Massenarmut, 191–257; vgl. auch S. 522 f. Falls nicht anders angegeben, stammen die folgenden Zahlen aus Blaschke, Bevölkerungsgeschichte, 126–129. Schmidt, »Hungerrevolten«, 268. Ebd., 269–72. Blaich, Wirtschaftspolitik, 204–208. Schmidt, »Hungerrevolten«; Neugebauer, Zentralprovinz, 119; Behrens, Society, 147 f. Abel, Massenarmut, 216 f.; Atorf, König, 222–231. Vgl. zum Folgenden Gerhard, »Handelshemmnisse«, 67–71.
55. Wirtschaftspolitik: Manufakturen, Gilden, Wohlfahrt und Steuern
I
n der Bewältigung der Krise der frühen 1770er Jahre spiegelte sich ein allgemeineres Muster wider. Regierungen hielten gern an traditionellen Formen der Regulierung fest, weil sie für die Erhaltung der Stabilität und als Einnahmequellen wichtig waren. Selbst wenn sie den Willen zu Veränderungen hatten, fehlte es ihnen fast ausnahmslos an Macht, den Widerstand aufgrund adliger Privilegien und gemeinschaftlicher Interessen sowie den von Bauerngemeinden zu brechen. Ob diese Interessen in Territorialständen organisiert waren oder schlicht auf regionalem und lokalem Gemeinschafts- und Gemeinderecht beruhten, spielte keine große Rolle. Sie waren in jedem Fall fast unüberwindliche Hemmnisse für radikale Veränderungen. So blieben in vielen Landesteilen Zölle und Gebühren bis ins 19. Jahrhundert erhalten, lange nachdem aufgezeigt worden war, dass ihre hindernde Wirkung den fiskalischen Nutzen überwog. 1 Darüber hinaus war der potentielle Erfolg ökonomischer Initiativen nach 1750 nach wie vor von zugrundeliegenden strukturellen Faktoren geprägt. 2 Ein kleines, von Land umschlossenes Territorium wie Ansbach konnte kaum eine sinnvolle Wirtschaftspolitik betreiben. Das Fürsterzbistum Salzburg war durch seine Lage zwischen Bayern und den österreichischen Ländern gehemmt, die beide von den 1760er Jahren an eine aggressive Wirtschaftspolitik betrieben. Das Fürstbistum Fulda litt daran, dass die Grenzen seines zersplitterten Territoriums von Nachbarn infrage gestellt wurden. Zersplitterte Territorien wie Mainz, die Pfalz, Württemberg und Baden (wo Baden-Durlach 1771 Baden-Baden erbte, wodurch die Teilung von 1535 endete) konnten ihre Politik nicht so gut koordinieren wie kompakte territoriale Blöcke wie Bayern und Sachsen. Im Südwesten des Reichs war die große Anzahl kleiner Territorien ein Hindernis, in Thüringen wirkte sie als Stimulans für den Wettbewerb. Insgesamt wirkte das Kreissystem wahrscheinlich immer noch förderlich für einen gewissen Grad an praktischer Gleichheit innerhalb von Regionen. Territorien glichen ihre Gesetzgebung und Wirtschaftspolitik einander an und schlossen gelegentlich interterritoriale Abkommen, selbst wenn Pläne zur Koordinierung der Aktivitäten innerhalb eines gesamten Kreises im Allgemeinen scheiterten. Waren die kirchlichen Territorien die Ausnahme von der Regel? Manche meinen, sie hätten sich an anderen Regeln der Investition, in Erlösung statt in irdischen Fortschritt, orientiert und verfolgten daher eine Politik der »bewussten
580
V. · Die deutschen Territorien nach 1760
Verzögerung«. 3 Offensichtlich gab es kulturelle Differenzen, die aufgeklärte Beobachter wie Friedrich Nicolai kommentierten: etwa die kirchlichen Rituale, Namenstage, Wallfahrten. Aber die deutschen Fürstbischöfe, Prälaten und Äbte hatten mehr mit ihren weltlichen Nachbarn gemein als mit der Welt des südeuropäischen Katholizismus. Religion allein war definitiv nicht das Kriterium: Die katholischen Wittelsbacher und Habsburger kamen den aggressivsten protestantischen Herrschern in ihren weltlichen Ambitionen und Zielen ohne Weiteres gleich. Friedrich Karl von Moser hielt es für einen Vorzug kirchlicher Herrscher, dass sie keine dynastischen Ansprüche zu verfolgen hatten. 4 Dadurch konnten sie sich zumindest potenziell ganz auf die ordnungsgemäße Regierung ihrer Länder konzentrieren. Unterschiede in Größe, Lage und bei natürlichen Rohstoffen waren offenbar wichtiger als heilige Regeln, wenn es um Politik ging, und nicht ein ausgeprägt nichtunternehmerischer und nichtprofitorientierter »ökonomischer Stil«. Die oberschwäbischen Klöster etwa konzentrierten sich auf Landwirtschaft, weil sie keine Städte zum Besteuern hatten und Land ihre Haupteinnahmequelle darstellte. 5 Heilige Regeln hielten sie nicht davon ab, geschickt mit Getreide zu spekulieren und Glasmanufakturen und andere Tätigkeiten zu betreiben, wenn sich die Gelegenheit ergab. Tatsächlich zeigt der Rückzug des Fürstabts von Kempten aus dem Glashandel in den 1760er Jahren, als seine Beamten feststellten, dass die Wälder weitgehend abgeholzt waren, ein ebenso hohes Maß an rationaler Kalkulation wie anderswo im Reich. 6 Im Fall der Fürstbistümer gibt es in den Jahrzehnten nach etwa 1770 kaum einen wirtschafts- und wohlfahrtspolitischen Aspekt, den sie nicht ebenso berücksichtigten wie die meisten protestantischen und weltlichen katholischen Territorien. 7 So gut wie alle Regierungen setzten auf Manufakturen. Die gelegentlichen Fabrikgründungen des späten 17. und frühen 18. Jahrhunderts weiteten sich sodann zu einer Welle aus, die sich im ganzen Reich ausbreitete. Unter den aktivsten Territorien war Sachsen mit mehr als siebzig Gründungen allein zwischen 1760 und 1784. 8 In Niederösterreich stieg die Anzahl der Fabriken von elf im Jahr 1762 bis 1783 auf mindestens 90. Diese offensichtlich drastischen Zahlen sind jedoch mit einiger Vorsicht zu genießen, weil das Wort Manufaktur nicht für eine moderne Fabrik steht. 9 Meistens bezeichnete es schlicht einen Ort, an dem eine Gruppe von Leuten ein Produkt herstellte. Das konnten zehn Frauen am Webstuhl sein oder – seltener – eine viel größere Anzahl. Manche Fabriken waren tatsächlich neuerungsträchtig und in den industriell fortgeschrittenen Gegenden am Niederrhein, in Sachsen und Thüringen wurden ab den frühen 1780er Jahren neue Maschinen eingeführt.Viele frühe Manufakturen waren indes als Zusammenlegung von Handwerkern nur Erweiterungen des ländlichen protoindustriellen Systems. Die größte staatseigene Wollmanu-
55. Wirtschaftspolitik: Manufakturen, Gilden, Wohlfahrt und Steuern
faktur in Linz beschäftigte etwa 5.000 Weber, wurde aber von geschätzt 30.000 meist südböhmischen Wollspinnern mit Garn beliefert. 10 Mitte der 1780er Jahre wurden neue Technologien auch in der Textil- und Metallverarbeitungsindustrie eingeführt. Die Produktpalette umfasste Metallwaren, alle Arten von Stoffen und neue Produkte wie Chicorée (der medizinisch und als Kaffee-Ersatz Verwendung fand). 11 Eine besondere Betonung lag auf Luxusgütern wie Seide, Spiegeln, Lackwaren und Porzellan. Fabriken, die Fayence, Majolika und Porzellan herstellten, waren außerordentlich populär, aber offenkundig schwer zu betreiben. 12 Viele Herrscher wurden Opfer von Scharlatanen, die behaupteten, das Geheimnis einer neuen Tonmischung oder einer effizienteren Herstellungsweise zu besitzen. Weder der Senat von Hamburg noch der Augsburger Fürstbischof konnten der Versuchung widerstehen und beide blieben auf den Kosten sitzen. Zwischen 1740 und 1800 wurden im Reich etwa fünfundfünfzig Fayencefabriken gegründet, dann ließ die Einführung von billigem Porzellan den Markt kollabieren. Porzellanfabriken waren weniger zahlreich und bedienten meist einen begrenzteren Luxusmarkt. Mitte der 1770er Jahre steckten die meisten – etwa Meißen – in großen Schwierigkeiten und einige führende Fabriken konnten nur noch durch den Verkauf von Kaffeebechern in die Türkei Profit erzielen, bis der österreichisch-türkische Krieg 1788 auch dies unmöglich machte. 13 Die dreizehn von diversen thüringischen Territorien zwischen 1760 und 1800 gegründeten Porzellanfabriken waren die Ausnahme. Signifikant ist, dass staatlich kontrollierte Porzellanfabriken wie die in Ilmenau in Sachsen-Weimar kaum prosperierten. Obwohl man zur Verkaufsförderung eine Markierung mit einem gekreuzten »I« oder »J« verwendete, das dem gekreuzten Schwert von Meißen verdächtig ähnlich sah, stellte sich der Erfolg erst lange nach der Verpachtung der Fabrik an einen sächsischen Unternehmer 1786 ein. 14 Neue Technologie, reichlich örtliche Verfügbarkeit von kaolinhaltigem Rotliegend von hoher Qualität und der Wettbewerb zwischen den Fabriken machten Thüringen insgesamt zu einem Produktionszentrum von europäischer Bedeutung, das den wachsenden bürgerlichen Markt für feines Geschirr beherrschte. 15 Die Zahl von mehr als tausend bis 1800 meist von Regierungen oder mit deren signifikanter Unterstützung im Reich gegründeten Fabriken spricht für Fortschritt, aber die Wirklichkeit war weniger beeindruckend.Viele Fabriken überlebten nicht lang; relativ wenige waren profitabel. Manche erfüllten wichtige Bedürfnisse, etwa die Uniformhersteller und Munitionsmanufakturen in und um Berlin. Viele indes taten sich schwer, signifikante Profite zu erzielen oder zumindest zu überleben. Am meisten Erfolg hatten sie dort, wo Exportmärkte zugänglich waren und die Unternehmen, wie etwa die niederrheinischen Textilmanufakturen, internationale Märkte bedienen konnten.
581
582
V. · Die deutschen Territorien nach 1760
Regierungen waren bestrebt, neue Produkte und Produktionsmethoden einzuführen, indem sie Privilegien und Monopole, Grund und bevorzugten Zugang zu Brennstoff vergaben. Die Profitabilität wurde jedoch oft dadurch untergraben, dass sich Beamte bei den Subventionen bedienten, und das gesamte System ermöglichte es Unternehmern, Risiken zu vermeiden, wobei die Regierung meist der Hauptleidtragende des vorhersehbaren Scheiterns von Unternehmen war. Insgesamt ist es unwahrscheinlich, dass irgendeine Manufaktur mehr als lokal etwas bewirkte. Die Manufakturen in Bayern etwa machten nicht mehr als ein Prozent des bayerischen Bruttonationaleinkommens aus. Anderswo dürfte der Anteil nicht signifikant höher gewesen sein. 16 Im größten Teil des Reichs blieb die protoindustrielle Produktion außerhalb der Städte bis ins frühe 19. Jahrhundert vorherrschend. Die Förderung von Manufakturen umfasste regelmäßig die Vergabe von Monopolen. In ihren Versuchen, die städtischen Handwerkszünfte unter Kontrolle zu bekommen, stritten Reformer indes dafür, restriktive Praktiken abzuschaffen und den Wettbewerb zu fördern. 17 Zur Vereinbarung einer komplett neuen Version der Reichshandwerksordnung von 1731 kam es nicht, der Reichstag beschloss jedoch eine Reihe von Maßnahmen, die im Mai 1772 per Dekret in Kraft traten. 18 Beabsichtigt war, die Produktivität zu steigern, Zulassungsvoraussetzungen zu lockern und die gemeinsame rechtliche Autorität der Zunftmeister zu untergraben. Der »blaue Montag« wurde wie bereits 1731 und 1764 erneut verboten. Frauen durften nun bestimmten Zünften beitreten, vor allem in der Weber- und Textilbranche. Die Beschränkung der Anzahl von Gesellen und Lehrlingen, die ein Meister haben durfte, wurde aufgehoben, die Nichtzulassung der Kinder von Abdeckern aufgrund ihres »unehrenhaften« Status untersagt. In unterschiedlichem Grad fanden diese Maßnahmen Eingang in umfangreiche territoriale Handwerksordnungen. Preußen hatte bereits die Reichshandwerksordnung von 1731 als Grundlage für ein hartes Vorgehen gegen die Zünfte benutzt. 19 Zahlreiche andere Territorien schritten unmittelbar nach Inkrafttreten des kaiserlichen Dekrets von 1772 zur Tat. 20 Eine wichtige Ausnahme bildeten die Reichsstädte, in denen die Zunftstrukturen oft Teil der Verfassung waren und die Zünfte eine aktive Rolle in städtischen politischen Institutionen spielten. Die generelle Tendenz zielte darauf ab, Monopole der Zünfte zu untergraben und den Wettbewerb zu fördern. Ökonomische Strömungen kamen solchen Initiativen zugute. In vielen Gegenden bedrohte die gewaltige Expansion der ländlichen Handwerksproduktion die Stellung der städtischen Zünfte. Wo ländliche Zünfte entstanden (die es wahrscheinlich in größerem Umfang gab, als Gelehrte traditionell anerkannten), wirkten sie weniger restriktiv als ihre städtischen Pendants und ihre Existenz war nicht in gleichsam konstitutionellen genossenschaftlichen Privilegien verankert. 21
55. Wirtschaftspolitik: Manufakturen, Gilden, Wohlfahrt und Steuern
Auch die Zulassung sogenannter Hofhandwerker umging die Zünfte und begünstigte unternehmerische Neuerungen, da sie ihre Werkstätten in kleine Fabriken umwandeln konnten. 22 In der Stadt Braunschweig wurden so viele Konzessionen an Nichtangehörige der Zünfte, etwa Katholiken und Juden, vergeben, dass die Territorialregierung ein spezielles Gericht gründete, um mit ihren Problemen umzugehen und sie vor der zunftdominierten Stadtobrigkeit zu schützen. 23 Einer der spektakulärsten Erfolge dieser Art war die 1753 in Neuwied von Abraham Roentgen gegründete Kunstschreinerei, die unter seinem Sohn David (ab 1772) etwa 300 Handwerker beschäftigte und Verkaufsstellen in Paris, St. Petersburg und Berlin eröffnete. 24 Gesetzgebung und Konkurrenz durch ländliche Industrie, Manufakturen, Hofhandwerker und andere durch Regierungen privilegierte Außenstehende zerstörten das Zunftsystem nicht. Es überlebte bis Mitte des 19. Jahrhunderts. 25 Allerdings wurden von den 1770er Jahren an die Rahmenbedingungen für die Zünfte deutlich ungünstiger. Der daraus resultierende Druck sorgte für erhebliche Unzufriedenheit unter Gesellen, deren Aufstieg zum Meister zunehmend gefährdet schien. 26 In den 1790er Jahren erreichte ihr Unmut den Höhepunkt, und die Aufstände, zu denen es nun in vielen deutschen Territorien und Reichsstädten kam, wirkten umso gefährlicher, da ihre Anführer die Parolen der Französischen Revolution übernahmen. 27 Die Reaktion der Regierungen auf die Unruhen wiederum zeigte ihre zwiespältige Einstellung zu den Zünften als Körperschaften und ihr Vertrauen in sie als Garanten von Ordnung und Stabilität. Wenn Zunftmitglieder Recht und Ordnung infrage stellten, gingen Regierungen stets eilends dazu über, die Ordnung wiederherzustellen und die Zunftmeister in ihrem Bemühen, ihre Autorität wieder geltend zu machen, zu unterstützen. Den Wettbewerb zu fördern, war nicht dasselbe, wie einen freien Markt zu schaffen.Vorläufig blieben die Zünfte Teil des Gefüges von Regeln, das alle deutschen Regierungen für unverzichtbar erachteten. Das umfangreiche Feld der Wohlfahrtspolitik war ebenfalls von Kontinuität und Veränderung gekennzeichnet. Aufgeklärte Reformen konnten das Problem der Armut nicht lösen und viele Schriften zu diesen Themen wurden erst ab etwa 1850 ernsthaft umzusetzen versucht. Die Einrichtung von Armenhäusern setzte sich mit einer Welle neuer Gründungen ab etwa 1750 fort, gehäuft in den 1770er und 1780er Jahren. 28 Zwei typisch »aufgeklärte« Institutionen waren die »Militärarbeitshäuser« in Mannheim und München, 1789 beziehungsweise 1790 gegründet von Benjamin Thompson (* 1753, † 1814, ab 1791 Graf Rumford), dem amerikanischen Erfinder, Wissenschaftler und Berater des bayerischen Kurfürsten. Dort sollten die Armen inhaftiert und zur Arbeit gezwungen werden, um Uniformen und andere Dinge für die Armee des Kurfürsten Karl Theodor zu liefern. 29 Ende des 18. Jahrhunderts ging man jedoch zunehmend dazu über, den Armen
583
584
V. · Die deutschen Territorien nach 1760
beizubringen, sich selbst zu helfen, ihnen Anreize zu geben, anstatt sie einzusperren. Tatsächlich fand Rumford selbst, Arbeitshäuser sollten »Industrieschulen« oder gar »Zufluchtsorte« heißen, um das mit dem traditionellen Begriff »Arbeitshaus« verbundene Stigma zu vermeiden und ihren neuen Auftrag zu unterstreichen, die Armen wieder in die Gesellschaft einzugliedern. 30 Seine berühmte Armenspeise (als Rumfordsuppe in ganz Europa bekannt geworden) war eine typische »wissenschaftliche« Neuerung der Aufklärung: Inspiriert von einer wässrigen Mischung aus Kartoffeln, Kleie, Hafermehl und Steckrüben, von der er festgestellt hatte, dass sie ein gutes Schweinefutter war, glaubte Thompson, die Suppe sei das ideale kostengünstige Nahrungsmittel für seine Soldaten und Arbeitshausinsassen, denen sie mehrmals am Tag vorgesetzt wurde. 31 In den katholischen Territorien allgemein, vor allem in den Fürstbistümern, ging man von den frühen 1770er Jahren an zunehmend dazu über, den Kirchen die Fürsorge für die Armen zu entziehen und die Verantwortlichkeit für sie der Regierung zu übertragen. So untersagte etwa Joseph II. 1781 per Dekret den Klöstern im Breisgau die Verteilung der traditionellen »Bettelsuppe«; viele andere katholische Territorien folgten dem Beispiel. 32 Die Armen sollten angespornt werden, sich an Behörden zu wenden, die ihnen nützliche Arbeit zuwiesen, und sich nicht weiterhin in traditioneller Barmherzigkeit zu suhlen, die nur dem Müßiggang Vorschub leistete. Nicht alle »rationalen« Methoden zur Kontrolle der Armen waren zwangsläufig der Abhilfe ihrer Misere dienlich. Die verbreitete Praxis der Repatriierung von Mittellosen bedeutete schlicht, dass sie aus einem Territorium abgeschoben und zum Problem eines anderen wurden. Joseph II. etwa initiierte die Organisation regelmäßiger »Bettelschübe«. 33 Bettler aus dem Reich wurden in einem Lager bei Linz »interniert« und zweimal jährlich schickte man schwer bewachte Konvois von mehreren Hundert Menschen, auch Frauen und Kinder, auf vier Routen nach Schlesien, Luxemburg und den Niederlanden, in die Pfalz und nach Frankreich, Schwaben und Württemberg. Einer dieser Elenden – ein Hausierer, der vierzig Jahre in Österreich gelebt hatte, brachte zehn Jahre damit zu, mit jedem Konvoi nach Coburg zu marschieren, nur weil er dort als Sohn eines Soldaten geboren war, was sich die Stadtbehörden hartnäckig als Grund anzuerkennen weigerten, ihn als einen der Ihren zu akzeptieren. Viele Territorien unternahmen Versuche, umherziehende Arme von der Einreise abzuschrecken. 1770 tauchten an den offiziellen Zollposten der Grafschaft Lippe-Detmold Warntafeln auf: »Allen fremden Bettlern, Collectanten, Bettel-, Pack- und Polnische Juden, Gauklern, Bärenleitern und Vagabunden ist der Aufenthalt in dieser Grafschaft bei Zuchthausstrafe denen Zigeunern aber, bei Strafe des Aufhängens und Erschießens, verboten.« 34 Drei Felder der Neuerung waren besonders auffällig und typisch für die neue
55. Wirtschaftspolitik: Manufakturen, Gilden, Wohlfahrt und Steuern
Herangehensweise. Erstens führte eine weitläufige Debatte über öffentliche Gesundheit zu einer Reihe von Verbesserungen. Die Idee, Friedhöfe aus dem Stadtzentrum weg zu verlegen, tauchte in der aufgeklärten Literatur ab den 1760er Jahren auf und wurde ab den 1770er Jahren in vielen Gegenden gesetzlich umgesetzt. 35 Es kam zu einer Ausweitung der Impfprogramme und anderer Maßnahmen gegen die Ausbreitung der Pocken. Die Ausbildung von Ärzten und Hebammen wurde von einer Vielzahl lokaler und regionaler regierungsamtlicher und privater Initiativen öffentlich diskutiert und reformiert. 36 Die Stellung akademisch ausgebildeter Ärzte stärkte man, indem Arme verpflichtet wurden, sich von ihnen behandeln und Atteste zum Beweis ihrer Arbeitsunfähigkeit ausstellen zu lassen. 37 Zudem unternahm man Schritte zur Verbesserung der Qualität von Apotheken und zur Regulierung ihrer Branche. Viele Territorien gründeten Krankenhäuser oder reformierten bestehende Institutionen. Frühe Gründungen wie die Berliner Charité (1727) dienten dabei als Vorbild.Viele katholische Territorien folgten dem Beispiel des Wiener Allgemeinen Krankenhauses (1783/84). Diese Einrichtung, angeblich in der Lage, fünftausend Patienten aufzunehmen, setzte neue Maßstäbe durch die Einführung von fünf separaten Abteilungen für Kranke, Mütter, Geisteskranke (die in einen Turm gesperrt wurden), für unheilbar Kranke und für Findelkinder. 38 Dass Joseph II. ein Institut für Taubstumme und mit dem Josephinum eine medizinisch-chirurgische Akademie für die Armee gründete, etablierte Wien als Zentrum auf dem Gebiet der öffentlichen Gesundheit. 39 Ebenso einflussreich, wenn auch letztlich überall erfolglos, waren Josephs Versuche, die Kinderarbeit einzuschränken oder die Verhältnisse zu verbessern, unter denen Kinder arbeiteten und zur Schule gingen. 40 Zweitens gewann die Idee der Armutsprävention bei Regierung und Privatinitiativen an Bedeutung. Feuerversicherungen nach frühen Vorbildern in Hamburg (1676) und Berlin (1718) wurden von den 1730er Jahren an in protestantischen und ab den 1770er Jahren auch in katholischen Territorien üblich. 41 Noch einen Schritt weiter gingen Rentenfonds für Witwen. Um 1700 war eine kleine Anzahl davon nach dem Modell englischer und niederländischer Vorläufer im späten 16. Jahrhundert entstanden. 1725 waren sie alle wieder verschwunden, ab den frühen 1740ern begann eine neue Welle von Gründungen und von den 1770er Jahren an gab es ähnliche Institutionen auch in den meisten katholischen Territorien. 42 Lizensiert waren diese Fonds ausnahmslos von den Territorialregierungen, oft unter persönlicher Schirmherrschaft der Herrscher. Die meisten kümmerten sich um bestimmte Berufsgruppen, etwa der 1743 gegründete Göttinger Fonds für Professorenwitwen und der 1746 gegründete Baden-Durlacher Fond für Pastorenwitwen. 43 Das Prinzip der Berufsrenten für Witwen wurde sehr bald auf die Unterstützung von Waisen ausgedehnt, zudem entstanden in einigen Städten und in vielen der neuen Manufakturen ab den 1780er Jahren Kranken- und »Ruhe-
585
586
V. · Die deutschen Territorien nach 1760
stands«-Versicherungen sowie in bestimmten Territorien Modelle von Ernteversicherungen. 44 Einige katholische Witwen- und Waisenfonds, etwa in Bayern und Westfalen, wurden von Klöstern auf karitativer Basis finanziell unterstützt oder zumindest garantiert. 45 Ungleich anspruchsvoller waren Pläne, der Allgemeinheit umfassendere Leistungen anzubieten, und sie hingen vom Interesse der Öffentlichkeit an ihrem Bestand ab.46 In Hamburg waren die Hamburgische beeidigte Christen-Mäckler Wittwen- und Waysen-Casse von 1758 und die von der Patriotischen Gesellschaft gesponserte Hamburgische Allgemeine Versorgungs-Anstalt von 1779 Vorreiter einer öffentlich-privaten Zusammenarbeit und informierten in einer Weise, die vielen modernen Lesern bekannt vertraut erscheinen dürfte, laufend über verfügbare Fonds. Die Calenbergische Wittwen-Verpflegungs-Gesellschaft, 1766 in der hannoverschen Grafschaft Calenberg gegründet, fand bis 1781 mehr als 5.000 Zeichner in ganz Europa; 1779 hatte sie 3.700 Subskribenten und bezahlte 723 Pensionen aus. Die Versorgungs-Anstalt und der Calenberg-Fonds gerieten in akute finanzielle Schwierigkeiten, was zu bis zu sechzigprozentigen Beitragserhöhungen und Kürzungen der Pensionen führte. Probleme hatten auch andere Projekte, dennoch war die Idee von Versicherung und Vorsorge um 1800 überall im Reich fest etabliert. Versicherungsprojekte zielten auf die Unterstützung derer ab, die harte Zeiten durchmachten. Die Masse der Armen war das Anliegen einer dritten Art von Initiativen zur Verbesserung der Lage jener, die durch das Netz gefallen waren. Um sie entstand in den späteren Jahrzehnten des Jahrhunderts eine weitläufige öffentliche Debatte. Die patriotischen und ökonomischen Gesellschaften veranstalteten regelmäßig Aufsatzwettbewerbe zur Armut, ihren Ursachen und Möglichkeiten der Abhilfe. Diverse Zeitschriften widmeten sich ausschließlich diesem Thema, etwa das Göttingische Magazin für Industrie und Armenpflege (1789–1803) und die Schwäbischen Provinzialblätter über Armenversorgung (1796–8). 47 Als Konsequenz der zunehmend getroffenen Unterscheidung zwischen bedürftigen Armen und kriminellen Armen oder »schlimmen Bettlern« entstanden Ideen für Alternativen zu den gefängnisähnlichen Werk- und Zuchthäusern. Sogenannte Arbeitshäuser waren nicht auf Profit ausgerichtete Werkstätten oder kleine Fabriken, bei denen die Löhne teilweise subventioniert wurden, um das Ideal von Ausbildung zur Wiedereingliederung der Unglückseligen in die reguläre Arbeiterschaft zu fördern. Die an manchen Orten von den 1770er Jahren an gegründeten öffentlichen »Spinnstuben« waren oft im Grunde kommunale Arbeitsplätze für Frauen und Mädchen. 48 Waisenhäuser wurden reformiert, um den Arbeitsfleiß zu fördern und eine familiäre Umgebung zu replizieren, und als diese Zielsetzung 1784 zum finanziellen Kollaps des Eisenacher Waisenhauses führte, etablierte Graf Karl August von Sachsen-Weimar-Eisenach (1775–1828) ein System von Zahlungen an Familien, um seine Unterstützung der Waisen fortzusetzen. 49
55. Wirtschaftspolitik: Manufakturen, Gilden, Wohlfahrt und Steuern
Die neuerungsträchtigste Institution der Armenfürsorge, die großen Widerhall im Reich fand, war die Allgemeine Armenanstalt, 1788 gegründet von der Reichsstadt Hamburg. 50 Sie markierte den Höhepunkt der anhaltenden öffentlichen Diskussion des Armutsproblems und wiederholter Initiativen der Patriotischen Gesellschaft, der städtischen Freimaurer und anderer in kleinem Maßstab. Die Armenanstalt beruhte auf einer neuen Definition von Armut, die die Armen als Opfer wirtschaftlicher Fluktuationen betrachtete. Es ging nicht mehr um Almosen, sondern darum, die Armen in ihrem eigenen Heim aufzusuchen und ihnen zu helfen, der Armut zu entkommen. Die zweihundert traditionellen Beamten der Armenfürsorge in den Stadtpfarreien waren gewöhnliche Freiwillige, deren Dienste kostenlos angeboten wurden. Studien sollten die Höhe der notwendigen Unterstützung anhand einer Zusammenstellung von Grundnahrungsmitteln und Gütern eruieren. Ärzte bewerteten die Arbeitsfähigkeit der Klienten, Lehrer ihren Ausbildungsstand. Man gründete eine Spinnhalle und eine Schule zur Ausbildung der Armen; 1796 wurde eine Wöchnerinnenstation eröffnet. Zur Abhilfe der Wohnungsnot während der Blütezeit in den frühen 1790er Jahren wurden probeweise fünfzig bescheidene Behausungen erbaut und andere Unterkünfte zur Verfügung gestellt. Die Institution legte auf allen Stufen großes Gewicht auf Transparenz und Verantwortlichkeit und veröffentlichte nicht nur ihre Bilanzen, sondern Details praktisch sämtlicher Aspekte ihrer Tätigkeit und umfangreiche Analysen zur Misere der Armen. Die Hamburger Armenfürsorge nahm für sich in Anspruch, die Armut während der 1790er Jahre um etwa 40 Prozent reduziert zu haben. Die Wirtschaftskrisen von 1799 und 1803 trafen die Organisation jedoch schwer, und während der französischen Besatzung von 1811 bis 1815 musste sie ihre Tätigkeit einstellen. Die Krisen sorgten wieder für einen harscheren Umgang mit den Armen und 1831 konnte der Bankier Amandus Augustus Abendroth behaupten, die Wohltätigkeit hätte nur die Unfähigkeit der Armen verstärkt, sich selbst zu helfen. 51 Der patriotische Geist, der die Allgemeine Armenanstalt und viele andere Initiativen in Hamburg nach 1750 trug, verflog in den frühen Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts. Maßnahmen zur Förderung des Wohlstands und zur Verhütung von Armut sollten letztlich auch die Steuereinnahmen steigern. Im 18. Jahrhundert gab es beträchtliche Diskussionen über eine Reform der Besteuerung und die Entwicklung neuer Grundsätze. 52 Das alte Steuersystem änderte sich jedoch tatsächlich kaum. Die im späten 17. Jahrhundert entwickelte Kombination aus Kopf- und indirekten Steuern blieb die Norm. Direkte Steuern wurden weiterhin nach Anleitungen und Besitzregistern aus dem 16. oder 17. Jahrhundert erhoben und der Adel verteidigte mehrmals erfolgreich seine Ausnahme von der Besteuerung. In den größeren zusammengesetzten Territorien, etwa Sachsen und Brandenburg, gab es bis ins frühe 19. Jahrhundert multiple Steuersysteme – für jedes Teil-
587
588
V. · Die deutschen Territorien nach 1760
territorium wurde ein eigenes ausgehandelt. Anläufe zur Einführung radikal neuer Steuern oder zur Systematisierung der bestehenden waren selten erfolgreich. Die physiokratische »einzige Steuer« auf Grund, 1770 in drei badischen Dörfern eingeführt, scheiterte nicht zuletzt, weil sie zusätzlich zu den traditionellen Feudalabgaben der Bauern erhoben wurde. 53 Der Versuch Friedrichs II., das preußische System von Verbrauchssteuern auszuweiten und es einer zentralen, mit französischen Experten besetzten Behörde (der Régie) zu unterstellen, hatte fiskalisch nur mäßigen Erfolg, war jedoch zutiefst unpopulär, und sofort nach dem Tod des Königs wurde die Behörde wieder abgeschafft. 54 Vorschläge von Justi und anderen, eine Produktionssteuer einzuführen, die nützlicher und gerechter sei als Verbrauchssteuern, führten zu nichts. Die zunehmend hartnäckigen Diskussionen über die wirklich neue Idee einer Einkommenssteuer ab den 1770er Jahren scheiterten wiederholt an der extremen Schwierigkeit ihrer Durchsetzung. Wie der Verwaltungsbeamte Georg Gottfried Strelin (* 1750, † 1833) aus Oettingen 1790 feststellte, war es so gut wie unmöglich, an genaue Informationen über Einkünfte zu gelangen, und noch schwerer, das präzise Verhältnis zwischen Einkommen und Steuer festzulegen. 55
Anmerkungen 1 Walter, »Handelshemmnisse«, 213. 2 Die folgenden Beispiele entstammen Demel, »Absolutismus«, 82 ff.; vgl. auch Volckart, Wettbewerb; ders., »Zersplitterung«, und Walter, »Handelshemmnisse«. 3 Hersche, »Rückständigkeit«; ders., Muße, 442–489. 4 Weber, »Wahrnehmung«, 80 ff. 5 Göttmann, »Wirtschaftspolitik«, 344–349. 6 Walter, Kempten, 180 f.; vgl. auch S. 321. 7 Wüst, Augsburg, 356–382, bietet auch zahlreiche Beispiele aus anderen Kirchenterritorien. 8 Vogler, Herrschaft, 255. 9 Henderson, Manufactories, 9–14; vgl. auch S. 320–329. 10 Demel, Reich, 110; Henderson, Manufactories, 148 ff.; Vocelka, Glanz, 302 f.; vgl. zu den österreichischen Manufakturen allgemein Hassinger, »Stand«. 11 Albrecht, Förderung, 529–537. 12 Vgl. S. 320–329. 13 Henderson, Manufactories, 54, 75, 90, 101, 151 f. 14 Ventzke, Herzogtum, 213–218. 15 Lange, »Kleinstaatlichkeit«, 192 f., 201; Scherf und Karpinski, Porzellan, 16–26. 16 Göttmann, »Wirtschaftspolitik«, 362; Albrecht, Förderung, 518 f. 17 Kluge, Zünfte, 418–424. 18 Blaich, Wirtschaftspolitik, 171–182; Kluge, Zünfte, 414 ff. 19 Kluge, Zünfte, 408 ff. 20 Zum Beispiel Bayern: Puschner, Handwerk, 199–214. 21 Reininghaus, Gewerbe, 71 f. 22 Stürmer, Herbst, 250 ff.
55. Wirtschaftspolitik: Manufakturen, Gilden, Wohlfahrt und Steuern
23 Albrecht, Förderung, 570–577. 24 North, Genuss, 97; Stürmer, Herbst, 255 f.; Bauer, Hofökonomie, 50 f. 25 Barnowski-Fecht, Handwerk, 353–359; Kluge, Zünfte, 389–398, 425 f.; Walker, Home Towns, 73–107; Sheehan, History, 107–112. 26 Barnowski-Fecht, Handwerk, 136–157. 27 Vgl. S. 673. 28 Eine umfassende Liste der Zuchthausgründungen findet sich bei Stier, Fürsorge, 218–221. 29 Krauß, Armenwesen, 33 ff.; vgl. zu Thompsons Tätigkeiten allgemein in Mannheim und München Brown, Thompson, 98–203; sein vielleicht auffälligster und nachhaltigster Erfolg war die Anlage des Englischen Gartens in München 1789. Im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg war Thompson Loyalist gewesen; danach ging er nach London und später nach München, wo er 1784–1799 Kavallerieoberst, Adjutant und Kammerherr des Kurfürsten war. 30 HBdtG II, 433. 31 Brown, Thompson, 160 f.; Brown, Scientist, 110–113; die Suppe verbreitete sich schnell in ganz Europa; um 1800 lebten in London bei einer Bevölkerung von 1 Million 60.000 von ihr; in der Schweiz gaben Fürsorgeverbände Suppengutscheine mit Rumfords Namen und Porträt heraus. Es zeigte sich jedoch bald, dass Rumfords Überzeugung, Wasser sei der Hauptnährstoff in der Mischung, ein Irrtum war, und die immer wässrigere Speise wurde zum Objekt des Spotts. 32 HBdtG II, 425. 33 Endres, »Armenproblem«, 230 f., 241. 34 HBdtG II, 428; vgl. zu Zigeunern in jener Zeit Fricke, Zigeuner, und Opfermann, Sinti. 35 Whaley, »Symbolism«, 103 ff. 36 Eine detaillierte Studie dieser Probleme in Braunschweig-Wolfenbüttel bietet Lindemann, Health. 37 HBdtG II, 429. 38 Beales, Joseph II II, 448–451; Demel, Reich, 253; Müller, Aufklärung, 59 f. 39 Beales, Joseph II II, 448, 451 ff.; Vocelka, Glanz, 345 ff.; in Leipzig wurde 1778 ein Institut für Taubstumme gegründet. 40 Demel, Reich, 215, 252 f. 41 Hersche, Muße, 768 f. 42 Rosenhaft, »Secrecy«, 221 ff. 43 Müller, Aufklärung, 60; Wunder, »Pfarrwitwenkassen«; Henning, Handbuch, 891 f. 44 Ein Beispiel aus Mannheim 1781 beschreibt Krauß, Armenwesen, 39 f.; weitere Fälle: Henning, Handbuch I, 896–900. 45 Demel, Reich, 118. 46 Vgl. zum Folgenden Rosenhaft, »Secrecy«, und ders., »Origins«. 47 HdtBG II, 434. 48 Eisenbach, Zuchthäuser, 118–133. 49 Wolter, Armenwesen, 295–329. 50 Vgl. zum Folgenden Lindemann, Patriots, 93–176, und Kopitzsch, Grundzüge, 550–557, 686 ff. 51 Lindemann, Patriots, 196. 52 Vgl. zum Folgenden Schwennicke, Steuer, 315–343; Zachlod, Staatsfinanzen, 183–213, bietet einen ausgezeichneten vergleichenden Überblick. 53 Liebel, »Bureaucracy«, 48 ff. 54 Schui, »Figures«. 55 Schwennicke, Steuer, 338 f., Anm. 197.
589
56. Verwaltung, Gesetz und Justiz
D
ie spezifischen Probleme der Besteuerung waren mit jenen der Verwaltung allgemein verknüpft. Das Ideal einer rationalisierten, zentralisierten Verwaltung wurde nie in die Wirklichkeit umgesetzt. Verwaltungsstellen sahen sich bei der Ausführung ihrer Aufgaben nach wie vor mit echten Hindernissen konfrontiert. Selbst die preußische Administration war im 18. Jahrhundert zu klein, um ein ernsthaftes Maß an Kontrolle zu erreichen. Erschwert wurde eine Zentralisierung dadurch, dass Preußen ein »zusammengesetzter« Staat war, in dem jeder einzelne Teil gemäß seinen eigenen Gesetzen und Traditionen regiert wurde. Ein weiteres Hindernis war das Fortbestehen der regionalen Stände im 18. Jahrhundert. Dass die Krone Steuern und Gesetzesänderungen mit jedem untergebenen Territorium separat aushandeln musste, war ein mächtiges Hindernis für die Entwicklung zentraler Regierungsgewalt. 1 Die oft gewaltsamen Konfrontationen, die das Verhältnis zwischen Herrschern und Ständen im 17. Jahrhundert gekennzeichnet hatten, waren eine Sache der Vergangenheit. Das ermöglichte es den Ständen jedoch, eine insgesamt wirkungsvollere Verhandlungsmacht aufzubauen. Die einzige wirklich »nationale«, für alle Regionen zuständige Stelle in Preußen war die Régie. Und genau das war der Grund, weshalb diese 1766 gegründete Verbrauchssteuerbehörde so verhasst war und 1786 abgeschafft wurde. 2 Verglichen mit anderen Verwaltungen war das preußische System in bestimmten Bereichen, etwa der Finanzverwaltung, Landkultivierung, internationalen Kolonisierung und Militärorganisation, effektiv und »moderner« als die meisten. Das lag zumindest teilweise an der rigoroseren Kontrolle der Regierungsbeamten und an konstanten Bemühungen, ihre Qualität zu verbessern. Die Einführung von Prüfungen für Bewerber 1770 war bezeichnend für die relative Professionalität des preußischen Systems. 3 Damit verbunden war die Reform der Gesetzgebung und des Rechtssystems, ein Kernziel der Aufklärung. Das allumfassende Ziel war die Herstellung von Ordnung und Systematik, die Anwendung der Prinzipien des Naturrechts auf die Gesetze der Gesellschaft, die Einführung von Gleichheit vor dem Gesetz und bei seiner Anwendung.Viele betrachteten die Kodifizierung von Gesetzen als Voraussetzung für eine gerechte Gesellschaft. Aufgeklärte Kommentatoren predigten die Notwendigkeit, gegen Aberglauben und irrationale Bräuche vorzugehen, ebenso
56. Verwaltung, Gesetz und Justiz
wie gegen barbarische Praktiken wie Folter und Todesstrafe. Für Herrscher waren Rechtsreformen aus offensichtlichen Gründen attraktiv. Neue Gesetze, die alle Bürger gleich behandelten, waren ein naheliegender Weg, die Privilegien des Adels, des Klerus und anderer Körperschaften zu untergraben. Neue juristische Prozeduren und auf Gesetzen beruhende Strukturen waren auch ein möglicher Weg, endlich den Wettstreit der juristischen Kompetenzen zwischen grundherrlicher und kirchlicher Rechtsprechung zu eliminieren. In mancherlei Weise knüpften solche Unternehmungen lediglich erneut an die frühere Praxis in den deutschen Territorien an. Die Publikation von Sammlungen territorialer Gesetze oder eines formalen Landrechts, das die Masse an regulären Edikten und Dekreten zusammenfasste, war schließlich im Reich schon seit dem späten 15. Jahrhundert gängig. Ebenso üblich war jedoch der regelmäßige Widerstand von ländlichen und städtischen Gemeinden, Adel und Kirchen gegen solche Unternehmungen, der vielerorts immer noch wirksam war. Paradoxerweise zeigten sich Herrscher selbst oft zwiespältig, was die letztlichen Folgen der Kodifizierung von Gesetzen anging, vor allem deswegen, weil sie selbst an einmal veröffentlichte Gesetzestexte gebunden waren. Die Umsetzung rechtlicher Reformen verlief nicht einheitlich. Was Kodifizierung angeht, wird Preußen oft als Vorbild genannt. Andererseits war die Ausarbeitung von Gesetzestexten ein langwieriger Prozess. 4 Frühe Projekte unter Friedrich Wilhelm I. verliefen im Sand. 1746 wurde Großkanzler Samuel von Cocceji (* 1679, † 1755) beauftragt, ein Bürgerliches Gesetzbuch zu entwerfen. Es war noch unvollendet, als Cocceji starb, und bis 1780 geschah nicht viel. Der entscheidende Wendepunkt war die Rechtskrise von 1779, die dadurch ausgelöst wurde, dass der König in einem Prozess, den der Graf von Schmettau gegen seinen Pächter, den Müller Arnold, angestrengt hatte – weil dieser Pachtzahlungen verweigerte, nachdem ein regionaler Landrat sein Wasser für einen Karpfenteich abgezweigt hatte –, das Urteil des Gerichts verwarf. Friedrich entließ die mit dem Fall betrauten Richter (und verurteilte sie zu einem Jahr Festungshaft, begnadigte sie jedoch bald darauf) und feuerte obendrein seinen Großkanzler von Fürst und Kupferberg. Der König witterte Korruption – Schmettau war selbst Gerichtsherr an dem Patrimonialgericht, das er gegen Arnold anrief –, sein Eingreifen entsetzte indes seine eigenen Beamten und die aufgeklärte Berliner Öffentlichkeit. Nach diesem viel beachteten Skandal wurde der neue Großkanzler Johann Heinrich von Carmer (* 1720, † 1801) beauftragt, das Verhältnis zwischen Krone und Justiz zu überdenken und das Kodifizierungsprojekt fortzuführen. Den größten Teil der Arbeit übernahmen Carl Gottlieb Suarez (* 1746, † 1798) und Ernst Ferdinand Klein (* 1743, † 1810). Bis 1784 trugen sie die Gesetze der diversen Regionen zusammen; die Konsultationen, die teilweise auch in der Öffentlichkeit stattfanden, waren zum Zeitpunkt von Friedrichs Tod weit fortgeschritten. Der
591
592
V. · Die deutschen Territorien nach 1760
finale Entwurf wurde im Dezember 1789 von Friedrich Wilhelm II. abgesegnet und im März 1791 wurde das Allgemeine Gesetzbuch für die Preußischen Staaten veröffentlicht. Bevor es in Kraft treten konnte, setzte es der König jedoch auf unbestimmte Zeit aus, weil er fürchtete, was manche bereits als »Gleichheitsgesetz« bezeichneten, werde einer Anarchie französischen Stils in Preußen Tür und Tor öffnen. Die unermüdliche Lobbyarbeit von Suarez, Klein und ihren Verbündeten führte schließlich zur Einführung des Allgemeinen Landrechts für die Preußischen Staaten im Februar 1794. Das Gesetzbuch war in vieler Hinsicht bahnbrechend, vor allem indem es versuchte, fundamentale Prinzipien als Basis für so gut wie alles zu etablieren. Es spiegelte indes auch essenzielle traditionelle Merkmale des preußischen Systems wider. Die Privilegien des Adels wurden dadurch gerechtfertigt, dass der Adel die Pflicht hatte, das Königreich zu verteidigen. Der Plural »Staaten« im Titel unterstrich einmal mehr den zusammengesetzten Charakter der preußischen Monarchie. Als das Allgemeine Landrecht in Preußen publiziert wurde, hatten Bayern und Österreich längst signifikante Rechtsreformen eingeführt. In Bayern wurde die Kodifizierung von Kurfürst Maximilian III. Joseph (1745–1777) gefördert und von seinem Kanzler Wiguläus Xaverius Aloysius von Kreittmayr (* 1705, † 1790) durchgeführt, der zwischen 1751 und 1756 Gesetze zum Straf-, Prozess- und bürgerlichen Recht erstellte. Erleichtert wurde Kreittmayrs Arbeit durch seinen eher bescheidenen Anspruch, existierendes Recht zu sammeln und zu klären, anstatt ein komplett neues System auf Grundlage naturrechtlicher Prinzipien zu entwickeln. Seine Gesetzbücher sind insofern eher der krönende Abschluss der Initiativen des 16. und 17. Jahrhunderts, territoriales Recht zu systematisieren, als ein neuer Ansatz in konstitutionellem Sinn. Auch die Kooperation der bayerischen Stände war entscheidend für die rasche Inkraftsetzung der neuen Gesetze. 5 Die österreichischen Kodifikationsprojekte begannen später, gingen jedoch weiter. Maria Theresias Strafrecht von 1768 wurde 1787 durch das Josephs II. ersetzt. Im Rahmen des 1753 begonnenen Projekts hatte Joseph bereits ein Prozessrecht (1781) und den ersten Teil eines Zivilrechts (1786) herausgegeben. All das war ein Vorspiel für das Allgemeine Gesetzbuch für alle deutschen Erblande der habsburgischen Monarchie, das 1812 in Kraft trat. Wichtige Voraussetzungen jeder erfolgreichen Kodifizierung waren die Entschlossenheit des Herrschers und hochqualifiziertes Personal. Das Bestreben, die Teile eines zusammengesetzten Territoriums enger aneinander zu binden, war ebenfalls eine signifikante Motivation. Kodifikationsinitiativen in Baden (1754 und erneut in den frühen 1780er Jahren), Hessen-Darmstadt und Hessen-Kassel, Hannover, Mecklenburg, Sachsen und in Köln unter Kurfürst Max Franz (1785– 1801) scheiterten. 6 Viele andere Herrscher gaben sich mit nur teilweise durch-
56. Verwaltung, Gesetz und Justiz
geführten Kodifizierungen (etwa mit dem Nassau-Saarbrückener Prozessrecht von 1778 und dem Bamberger Strafrecht von 1795) oder mit der Publikation von Gesetzessammlungen (etwa Hildesheim 1782 und Sachsen-Altenburg 1786) zufrieden. 7 Ein Schlüsselmerkmal der neuen Strafgesetzbücher, aber auch zahlreicher einzelner Dekrete von beträchtlicher »Meilenstein«-Bedeutung und Öffentlichkeitswirkung, waren Maßnahmen wie die Abschaffung der Folter als Teil von Strafprozessen und der Todesstrafe. Friedrich II. ging 1740 mit der Abschaffung der Folter in allen Fällen außer Mord, Aufwiegelung und Verrat voran. 1755 galten auch diese Ausnahmen nicht mehr. Andere Territorien zogen schrittweise nach, vor allem die Pfalz und Österreich 1776, auch wenn in Gotha offiziell bis 1828 weiter gefoltert werden durfte. 8 Selbst das liberale und aufgeklärte Hamburg hielt bis 1790 an der Folter fest und schaffte sie erst nach der französischen Phase 1806 offiziell ab. 9 Joseph II. war der einzige Herrscher, der die Todesstrafe 1787 offiziell abschaffte, im übrigen Reich wurde ihre Anwendung jedoch ab den 1770er Jahren zunehmend eingeschränkt. 10 Die Abschaffung beziehungsweise Einschränkung der schlimmsten Strafen bedeutete jedoch nicht zwangsläufig einen humaneren oder milderen Umgang mit Straftätern. Joseph II. bestand darauf, Missetäter scharf zu bestrafen.Vorsätzliche Mörder sollten gebrandmarkt und eingesperrt werden, um im Gefängnis elendig zu sterben. Der englische Strafreformer John Howard wies zurecht darauf hin, dass die von Joseph II. anstelle der alten eingeführten neuen Strafen in jeder Hinsicht brutal waren. Im Juli 1787 zum Beispiel protestierte Josephs eigenes höchstes Gericht gegen den Einsatz von Sträflingskolonnen zum Ziehen von Schleppkähnen auf der Donau. Mehr als die Hälfte der dazu Verurteilten kam ums Leben. Da viele Todesurteile gewohnheitsmäßig abgemildert wurden, waren solche Sträflingskolonnen der sicherere Weg in den Tod. Dass Joseph dekretierte, jeder derart Verurteilte müsse zunächst von Ärzten für geeignet erklärt werden, die Strafe zu erleiden, war sicherlich kein großer Trost. 11
Anmerkungen 1 2 3 4 5 6
Neugebauer, »Preußen«, 471–475; ders., Zentralprovinz, 157–160; ders., Wandel, 65–125. Schui, »Figures«. Bleek, Kameralausbildung, 73–79. Vgl. zum Folgenden Merten, »Landrecht«; Hattenhauer, »ALR im Widerstreit«; Conrad, Rechtsgeschichte II, 387–391. Press, »Reformabsolutismus«, 420. Dölemeyer, »Kodifikationspläne«, 201–208, 213–222; vgl. zu Baden auch Conrad, Rechtsgeschichte II, 400 f.
593
594
V. · Die deutschen Territorien nach 1760
7 8 9 10 11
Demel, »Absolutismus«, 91; Neugebauer, »Absolutismus«, 34. Evans, Rituals, 115; Conrad, Rechtsgeschichte II, 445; Müller, Aufklärung, 61. Kopitzsch, Grundzüge, 694, 700. Evans, Rituals, 127–40; Beales, Joseph II. II, 548–551; Conrad, Rechtsgeschichte II, 443 f. Beales, Joseph II. II, 549–552, 655.
57. Bildung und Toleranz
D
ie Aufklärung betrachtete sich vielleicht mehr als die meisten ähnlichen europäischen Bewegungen als Bildungsbewegung. Schließlich stand schon der Begriff für einen Prozess der individuellen Selbsterziehung, ein Programm für die Bildung der Gesellschaft und, noch weiter ausgelegt, eine Vision der »Bildung der Menschheit«. Die Anwendung rationalen Denkens für die Verbesserung des individuellen Lebens, der Gesellschaft und der Menschheit insgesamt war das beständige Thema der Debatten. Die Notwendigkeit der Erziehung der gegenwärtigen Gesellschaft schlug sich in dem Bestreben nieder, jedem in seiner jeweiligen Stellung und gemäß seinen Aufgaben praktische Bildung zu vermitteln, anstatt die Idee der sozialen Emanzipation durch Bildung voranzutreiben. Aber auch dieses begrenzte Ziel wurde als Beitrag zur »Bildung der Menschheit« betrachtet. Tatsächlich gab es von den 1780er Jahren an eine intensive Diskussion über Volksaufklärung und Popularaufklärung, die sich auch gegen Zweifel und antiaufklärerische Polemiken im Zuge der Reaktionen auf die Ereignisse in Frankreich während der 1790er Jahre durchsetzte, und die aus der Diskussion entstandene Literatur prägte die Einstellung zur Massenbildung bis Mitte des 19. Jahrhunderts. 1 Gleichzeitig entstanden jedoch auch neue Ideale der Bildung um ihrer selbst willen, der Bildung als persönlicher Entwicklung des Einzelnen in der Gesellschaft. Sie entsprangen in gewissem Maß der wachsenden Unzufriedenheit mit der universitären Ausbildung und der Krise des Universitätswesens um 1800 in der Folge der französischen Revolutionskriege. Ideen einer Bildungsreform sahen sich auf jeder Ebene mit traditionellen Strukturen und eigennützigen Interessen konfrontiert. Das seit der Reformation im Reich entstandene Netzwerk von Grundschulen war verschiedentlich in der Hand von kirchlichen Autoritäten, Städten und ländlichen Gemeinden oder adligen Grundbesitzern und anderen Einzelnen. Friedrich Nicolai hielt 1781 während seiner Reise durch Deutschland und die Schweiz fest, der Zustand der Schulen und des Schulsystems sei sowohl in protestantischen als auch in katholischen Gebieten mehr oder weniger allgemein miserabel. 2 Eine umfassende, systematische Reform auf diesem Gebiet war so gut wie unmöglich. Nur wenige Regierungen, wie effektiv und aktiv sie auch waren, unternahmen mehr, als eine Handvoll Modellschulen zu gründen. In Preußen zum Beispiel führte die Einführung der Grundschulpflicht 1763 und des zentralen Oberschulkollegiums 1787 nicht zu einer wirklich fundamentalen Reform des Schulsystems. Die Grün-
596
V. · Die deutschen Territorien nach 1760
dung eines Lehrerinstituts in Berlin 1748 änderte auch nicht viel, obwohl es 1753 nominell eine königliche Institution wurde. 3 Finanzielle Schwierigkeiten waren ein großes Hindernis, ebenso aber auch die Tatsache, dass die Regierung über die meisten Schulen gar keine Kontrolle hatte. Viele der signifikanten Veränderungen waren das Werk adliger Grundbesitzer, die pietistische oder aufgeklärte Erziehungsprinzipien umsetzten, und Teil eines sozialen und ökonomischen Modernisierungsprozesses, der von denselben Kräften angetrieben wurde, die in vielen Gegenden zur Erosion der Lehnsherrschaft beitrugen. 4 Die österreichischen Reformen der 1770er Jahre, die bald von vielen kirchlichen und anderen katholischen Territorien im Reich übernommen wurden, hatten eine viel größere Reichweite und Wirkung. 5 Dafür waren mehrere Faktoren entscheidend. Maria Theresia war es in den 1750er Jahren gelungen, ein effektives System lokaler Verwaltungsbehörden zu schaffen und in bestimmten Gegenden begann die Reform des Primarschulsystems in den 1760er Jahren. Die Reformansätze waren vor allem geprägt von den Ideen von Johann Ignaz von Felbiger, dem Abt des Augustiner-Chorherrenstifts Sagan im preußischen Schlesien, der sich pietistische Erziehungsprinzipien zu eigen gemacht hatte, um mit den örtlichen Protestanten mitzuhalten. 6 Ein Bericht des Passauer Fürstbischofs Leopold Ernst von Firmian, der vor der Verbreitung von Häresie und Unglauben in seiner Diözese warnte, die Teile von Ober- und Niederösterreich umfasste, veranlasste Maria Theresie 1769 zum Handeln. Nach Beratungen des Staatsrats 1769–1770 und Konsultationen mit den Provinzadministrationen wurde Felbiger 1774 nach Wien gerufen und setzte seine Erfahrungen in Sagan in der Allgemeinen Schulordnung um. Diese Schaffung eines Netzwerks staatlicher Schulen mit staatlich bezahlten Lehrern ging viel weiter als alle preußischen Reformen. Die – in manchen Gegenden beträchtliche – lokale Opposition wurde durch das Geld beschwichtigt, das durch die Aufhebung des Jesuitenordens 1773 zur Verfügung stand. Felbiger selbst beaufsichtigte das stetig expandierende System der »Normalschulen«, wie die neuen Primarschulen genannt wurden, bis 1781. Allein in Böhmen stieg die Anzahl der Grundschulen von etwa 1.000 im Jahr 1775 bis 1789 auf 2.294, und die Schülerzahl wuchs von 30.000 auf fast 170.000. Die Entwicklungen in Österreich und Passau fanden bald überall in den kirchlichen Territorien des Reichs Nachahmer.Von den Jesuiten konfisziertes Geld wurde zur Gründung von Lehrerseminaren und Normalschulen nach den von Felbiger entworfenen Richtlinien benutzt. Selbst in Gegenden am Mittelrhein und an der Mosel, wo es bereits gute Schulnetzwerke gab, verbesserten sich Lehrerausbildung und Erziehungspraxis in den 1780er Jahren signifikant. Ende des 18. Jahrhunderts verfügte das Rheinland über eines der besten Schulnetzwerke in Europa. Ähnliche Reformen fanden in Bayern statt. Anfangs wurde der Fortschritt
57. Bildung und Toleranz
behindert durch einen Konflikt zwischen dem Schulkommissar Heinrich Braun (* 1732, † 1792), der die Ideen Felbigers und der Dessauer Philanthropen favorisierte, und Johann Adam von Ickstatt (* 1702, † 1776) mit seinem eher praktisch orientierten Erziehungsprogramm. 7 Dennoch war das bayerische Schulsystem am Ende des Jahrhunderts fortschrittlicher als das preußische. Zumindest in dieser Hinsicht reichten die Reformen im katholischen Deutschland weiter als in weiten Teilen des protestantischen Deutschlands. Andere »moderne« erzieherische Neuerungen der Aufklärungsepoche waren insgesamt vereinzelte, kurzlebige Initiativen mit wenig Wirkung. Trotz ihrer langfristigen Bedeutung bis heute war die beruflich orientierte Realschule des 18. Jahrhunderts ein Misserfolg. 8 Der Versuch der Formulierung einer neuen Methode der praktischen, beruflichen Ausbildung hatte Vorläufer im 17. Jahrhundert und die erste Realschule – die von dem lutherischen Oberdiakon Christoph Semler (* 1669, † 1740) gegründete Mathematische und Mechanische Realschule (1708– 1710) beziehungsweise Mathematische, Mechanische und Ökonomische Realschule (1738–1740) in Halle – beruhte auf pietistischen Prinzipien. Auch sie war mit nur zwei mal zwei Jahren Laufzeit ein Fehlschlag. Eine zweite Schule, die der Prediger Johann Julius Hecker (* 1707, † 1768), ein Schüler von Hermann August Francke, 1747 in Berlin gründete, schlug sich mit karger privater Finanzierung gerade so durch. Andere Gründungen in Wittenberg, Chemnitz und Mainz überlebten nur ein paar Jahre. Anderswo gab es in existierenden Lateinschulen und Gymnasien eine einzelne Realschulklasse. Auch von den vielen Handels-, Industrie- und Zeichenschulen, Bergbau- und Bauakademien sowie Schifffahrtsschulen, darunter auch einige für Mädchen, hatten nur weniger dauerhaften Erfolg. 9 Selbst dort, wo solche Institutionen von der Regierung unterstützt wurden, florierten sie selten und scheiterten ebenso oft an Schüler- wie an Geldmangel. Dasselbe Schicksal erlitten die letzten Versuche, Hohe Schulen als Alternative zum traditionellen Lateingymnasium und der traditionellen Vier-Fakultäten-Universität zu etablieren. 10 Das Ziel war eine eher »weltliche« als akademische Ausbildung; im späten 17. und frühen 18. Jahrhundert richteten sich solche Initiativen auf die Söhne des Adels, nach 1770 auf Nichtadlige. Manche bemühten sich einfach um eine Erweiterung des traditionellen gymnasialen Curriculums um moderne Sprachen und diverse naturwissenschaftliche Fächer, andere stellten die »modernen« Fachgebiete in den Mittelpunkt. Die bedeutendsten Gründungen lagen in den höfischen Zentren der kleineren Territorien, wo es keine Universität gab, etwa in Braunschweig, Bayreuth, Kassel, Lippe und Stuttgart in Württemberg. Manche waren technische Akademien, so etwa die 1761 von Graf Wilhelm Friedrich Ernst von Schaumburg-Lippe (* 1724, † 1777) gegründete Militärakademie, an der der spätere preußische Feldmarschall Gerhard von Scharnhorst (* 1755, † 1813) von 1773 bis 1778 studierte.
597
598
V. · Die deutschen Territorien nach 1760
Die 1770 in Stuttgart gegründete Hohe Karlsschule war im Grunde auch eine Militärakademie, der Lehrplan wurde jedoch bis 1782 erweitert, um ihre Reorganisation in sechs Fakultäten (Recht, Medizin, Philosophie, Kunst, Ökonomie und Militärwissenschaft) zu rechtfertigen. Obwohl sie von Joseph II. zur Universität erhoben wurde, scheiterte die Umwandlung und 1794 wurde sie von Herzog Ludwig Eugen (1793–1795) aufgelöst. Ihre prominente Rolle in der deutschen Bildungsgeschichte verdankte sie allein der Tatsache, dass Schiller dort von 1773 bis 1780 Schüler war. 11 Zwar erwarb er dort nützliche Kenntnisse in Philosophie und Sprachen, aber Christian Friedrich Daniel Schubarts Bezeichnung der Schule als »Sklavenplantage« spiegelte Schillers eigene unglückliche Erfahrungen mit der strengen Disziplin und systematischen Unterdrückung der persönlichen Freiheit in vollem Umfang wider. Die Experimente des 18. Jahrhunderts auf dem Feld praktischer Ausbildung wurden allesamt abgebrochen. Technische Universitäten und Hochschulen konnten sich erst nach 1850 vollständig etablieren. Selbst die technische und berufliche Ausbildung auf niedrigerer Ebene setzte sich erst im Zuge der kommerziellen und industriellen Entwicklung des frühen 19. Jahrhunderts durch. Die Versuche einer Bildungsreform auf Grundlage der Ideen von Locke und vor allem Rousseau hingegen zeitigten mehr greifbare Resultate. Die von Johann Bernhard Basedow (* 1724, † 1790) angeführte philanthropische Bewegung strebte danach, Ideale der Aufklärung wie humanes und rationales Denken sowie Toleranz in Methode und Inhalt ihrer Lehren umzusetzen. 12 Die erste philanthropische Schule wurde von Friedrich Eberhard von Rochow (* 1734, † 1805) auf dem Gut Reckahn nahe der Stadt Brandenburg gegründet. Das Flaggschiff der Bewegung war jedoch das von Basedow 1774 in Dessau gegründete Philanthropinum. Basedow versprach nicht weniger als den Beginn einer gesamteuropäischen Bildungsreform und verbreitete seine Ideale unermüdlich in Druckwerken. Selbst Kant war beeindruckt und empfahl den Lesern der Königsbergischen Gelehrten und Politischen Zeitung, diese »Pflanzschule der guten Erziehung« zu unterstützen: Schulen müssten »umgeschaffen werden, wenn etwas Gutes aus ihnen entstehen soll«, schrieb er. »Nicht eine langsame Reform, sondern eine schnelle Revolution kann dieses bewirken. Und dazu gehöret nichts weiter, als nur eine Schule, die nach der ächten Methode vom Grunde aus neu angeordnet, von aufgeklärten Männern … bearbeitet, … aber auch durch den vereinigten Beytrag aller Menschenfreunde … unterstützt und fortgeholfen würde.« 13 Die Dessauer Schule wollte den »Staub der Jahrhunderte« wegblasen, die Flamme der Genügsamkeit und der Liebe zum Mitmenschen in den Herzen der Jugend entzünden und für ein Jahrzehnt wurde sie zum Brennpunkt aller Diskussionen über Bildungsreformen in der blühenden Periodikaliteratur ihrer Zeit.
57. Bildung und Toleranz
Versuche einer Nachahmung des Dessauer Modells hatten indes zwiespältige Erfolge. Die 1775 im schweizerischen Marschlins gegründete Schule scheiterte innerhalb von zwei Jahren. Die Gothaer Schule in Schnepfenthal bei Gotha, 1784 von Christian Gotthilf Salzmann (* 1744, † 1811) mit Unterstützung der Gothaer Freimaurer und einflussreicher Illuminaten gegründet, bestand unter Leitung von Salzmanns Erben bis 1945, blieb jedoch ein Einzelfall. Wichtiger als die philanthropischen Schulen – die Dessauer Schule selbst wurde 1793 geschlossen – war die öffentliche Debatte, die Basedow und seine Mitarbeiter entfachten, und die Umsetzung seiner Ideen in zahlreichen bestehenden Schulen im Reich. Den Höhepunkt ihrer Ausarbeitung, Verfeinerung und Verbreitung fand die philanthropische Pädagogik in der sechsbändigen Allgemeinen Revision des gesammten Schul-und Erziehungswesens von einer Gesellschaft praktischer Erzieher (1785–1792), herausgegeben von Joachim Heinrich Campe (* 1746, † 1818). Eine auf die Bedürfnisse katholischer Gegenden zugeschnittene Version erschien von 1798–1803. Zudem prägten philanthropische Ideen diverse regionale Schulreformen der 1770er und 1780er Jahre, etwa in Braunschweig-Wolfenbüttel (unter dem späteren preußischen Reformer Karl August von Hardenberg, * 1750, † 1822, und Campe) sowie in Anhalt-Dessau und Lippe-Detmold. Sie beeinflussten auch die Arbeit von Heinrich Braun in Bayern und Leopold Ernst von Firmian in Passau. 14 Eine europäische Bildungsreform konnten Basedow und Campe nicht herbeiführen, aber ihre Ideen schufen einen neuen Rahmen für das Denken über Erziehung und Ausbildung im 19. Jahrhundert. Das durch sie geweckte Interesse an pädagogischen Belangen wurde zum Nährboden für die außerordentliche Wirkung der philanthropischen Theorien des Schweizer Autors Johann Heinrich Pestalozzi (* 1746, † 1827) nach 1800. Pestalozzis Novellen Lienhard und Gertrud (1781– 1787) und Wie Gertrud ihre Kinder lehrt (1801) sowie andere Schriften wirkten unmittelbarer und nachhaltiger als sämtliche Schriften von Basedow und Campe. Im Kontext der Auseinandersetzung mit Frankreich ließ sich Pestalozzis rousseauistische Vorstellung einer »natürlichen« Erziehung leicht in Ideen einer »nationalen« Erziehung und Erneuerung übersetzen, zuerst in der Schweiz (1798–1803), dann in Berlin in der Arbeit von Wilhelm von Humboldt (* 1767, † 1835) und Johann Gottlieb Fichte (* 1762, † 1814). 15 Obwohl der Aufklärung so viel an pädagogischen Neuerungen lag, blieb die traditionelle Struktur der Sekundarausbildung im Gymnasium und der höheren Schulung an der Universität vorherrschend. Die Kontinuität in der Geschichte der beiden am meisten durch die Reformation veränderten Erziehungsinstitutionen ist verblüffend. In protestantischen Gegenden führte die Kontinuität häufig zum Stillstand. Die größeren Territorien, allen voran Brandenburg-Preußen, konzentrierten sich auf Finanzen und Ökonomie, verzichteten jedoch auf eine Reform des Gym-
599
600
V. · Die deutschen Territorien nach 1760
nasiums. Dasselbe gilt für Sachsen und Württemberg, die im 16. Jahrhundert in der Sekundarausbildung führend waren. Wo eine Schule verbessert wurde, ging die Initiative in der Regel von Lehrern und Rektoren aus, die nach pietistischen Richtlinien den Lehrplan erweitern oder neue Methoden und Ansätze vorantreiben wollten. In katholischen Gegenden wiederum sorgte die Auflösung des Jesuitenordens 1773 ebenfalls für Neuerungen und Verbesserungen auf diesem Gebiet. Nach einer anfänglichen Phase der Krise bestanden die meisten jesuitischen Schulen als staatliche Institute weiter, die oft teilweise durch konfisziertes Geld des Ordens finanziert wurden und ehemalige Jesuiten beschäftigten. Die spätere preußisch-deutsche Mythologie schrieb Wilhelm von Humboldt als dem für Kultur und Erziehung zuständigen Leiter im preußischen Innenministerium von 1809 bis 1810 die Erfindung des modernen neohumanistischen Gymnasiums als Reaktion auf den Schock der preußischen Niederlage gegen Frankreich zu. In Wirklichkeit verliefen Humboldts Bildungsreformen in Preußen parallel zu den praktisch identischen Reformen von Friedrich Immanuel Niethammer (* 1766, † 1848) in Bayern ab 1808. Darüber hinaus suchten Humboldt und Niethammer nicht eine ganz neue Art von Sekundarschule zu erfinden, sondern zur älteren gymnasialen Tradition zurückzukehren, indem sie die neuen praktischen und »modernen« Fächer wieder abschafften, die die Philanthropen und andere seit etwa 1770 gefördert hatten. 16 Auch die Entwicklung der Universitäten in dieser Phase war von grundsätzlicher Kontinuität mit einigen Verlagerungen der Gewichtung geprägt. Die Kritik der Verfechter praktischer Fächer auf jeder Ebene, die Universitäten seien überholt und nicht mehr zeitgemäß, die vor allem in den 1790er Jahren laut wurde, beeinträchtigte die wichtige Rolle nicht, die die Universitäten seit der Reformation spielten. Insgesamt sank die Studentenzahl zwischen 1740 und 1800 wohl von etwa 8.500 auf ungefähr 6.000. Ein Großteil dieses Rückgangs fiel indes wahrscheinlich in die Zeit nach 1792 und spiegelt eher Druck von außen wider als eine Minderung der Attraktivität des Universitätsstudiums. 17 Während der französischen Kriege wurden alle alten Universitäten links vom Rhein geschlossen, die Säkularisierung kirchlicher Territorien führte zu weiteren Schließungen und die Schrumpfung hielt bis in die 1820er Jahre an. Allein zwischen 1789 und 1810 wurden siebzehn Universitäten aufgelöst. 18 Dieser scharfe Bruch verschleiert die Kontinuitäten und ließ wie im Fall der Gymnasien Humboldts Gründung der Berliner Universität 1810 wie einen dramatischen Neuanfang erscheinen. 19 Tatsächlich entwickelte sich das traditionelle System weiter. Unter den protestantischen Universitäten blieben Halle und Göttingen in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts die herausragenden »modernen« Universitäten. In den 1780er Jahren führte Halle mit mehr als 1.000 Studenten; Göttingen kam auf mehr als 800, Leipzig über 700. Auch Jena legte nach 1780 stetig an Popularität zu und hatte in
57. Bildung und Toleranz
den Jahren 1791–1795 mehr als 860 Studenten. Etwa 40 Prozent aller Studenten besuchten diese vier führenden Universitäten. Am anderen Ende der Skala hatten Universitäten wie Altdorf, Duisburg, Herborn und Rostock nur jeweils um die 50 Studenten. 20 Überraschen mag, dass Straßburg, das ab 1681 zu Frankreich gehörte, Teil des »deutschen« Universitätssystems blieb und als Ausbildungsstätte künftiger Juristen (speziell des Reichsrechts), Politiker und Diplomaten Göttingen Konkurrenz zu machen begann. Mit einer Durchschnittsanzahl von etwa 250 Studenten konnte es mit Göttingen nicht mithalten, aber Straßburg war besonders attraktiv für Adlige. Der spätere bayerische Reformer Maximilian von Montgelas (* 1759, † 1836) studierte dort ebenso wie Clemens Wenzel von Metternich (* 1773, † 1859), Herder und Goethe.21 Mit der möglichen Ausnahme Wien hatten die katholischen Universitäten des Reichs generell weniger als jeweils 300 Studenten. 22 Unter ihnen taten sich Ingolstadt, Mainz, Würzburg, Wien und Innsbruck schon früh als Reformuniversitäten hervor, die eifrig mit den führenden protestantischen Institutionen konkurrierten. Allerdings hatten die Jesuiten stets ihren Einfluss, ihre traditionellen Lehrpläne und Methoden geltend gemacht. Dass Kurfürst Friedrich Karl Joseph von Erthal (1774–1802) sofort nach der Auflösung des Jesuitenordens daran ging, Mainz zum katholischen Äquivalent von Göttingen zu machen, indem er die juristische Fakultät stärkte und eine Reihe von Göttinger Absolventen – darunter ab 1784 auch Protestanten – als Professoren einstellte, war durchaus bezeichnend. Mainz wurde zum Vorbild für eine Reihe weiterer katholischer Universitätsreformen und inspirierte Neugründungen in Münster (1780) und Bonn (1784). Das Verschwinden der Jesuiten gab auch der Benediktineruniversität in Salzburg neue Bedeutung, wo ab den 1770er Jahren etwa Lesegesellschaften und Freimaurer florierten und die Rezeption der Gedanken von Wolff und Gottsched verschiedenen Studiengebieten neue Impulse gab. 23 Die wichtigsten Ausnahmen der allgemeinen Modernisierungsströmung unter katholischen Universitäten von den 1770er Jahren an waren Wien und die kleineren habsburgischen Universitäten: Freiburg im Breisgau, Graz, Innsbruck, Olmütz und Prag. 24 Die Nachahmung des Göttinger Modells unter Maria Theresia schlug unter Joseph II. in Opposition um. In seiner Vorstellung von einer aufgeklärten Universität war kein Platz für Ideen von Forschungsfreiheit und Studium um seiner selbst willen. Gottfried van Swieten (* 1733, † 1803) erklärte dem Kaiser im Februar 1785 in einem Vortrag, Göttingen trage nichts zur »Nationalerziehung« bei; es sei im Grunde eine Akademie der Wissenschaften und ziehe Studenten aus einer solchen Bandbreite von Territorien und Ländern an, dass es unmöglich sei, einen einzigen Studiengang vorzuschreiben. Wien, meinte van Swieten, müsse sich der »Nationalerziehung« widmen, um die patriotischen Administratoren und Politiker heranzuziehen, die der Staat zum Gedeihen brauche. 25
601
602
V. · Die deutschen Territorien nach 1760
Körperschaftliche Privilegien der Universitäten waren oft ein Hindernis für alle außer den entschlossensten reformorientierten Herrschern. Die traditionelle Vierfakultätenstruktur (Theologie, Recht, Medizin, Kunst) herrschte weiterhin vor, aber die traditionelle Hierarchie veränderte sich. Die Theologie verlor ihre Vorrangstellung an das Recht, besonders stark in den Jahrzehnten nach 1770. 26 Viele Universitäten führten neue Fächer ein, etwa klinische Medizin, Tiermedizin, Naturwissenschaften und Kameralismus, manchmal außerhalb der traditionellen Fakultätsstruktur als Teil dessen, was »außerordentliche« Universität genannt wurde. 27 Die dramatischste Entwicklung dieser Jahrzehnte war der Aufstieg der Philosophie. Traditionell hatte Philosophie lediglich als Vorbereitung für das ernsthafte Studium an den höheren Fakultäten gegolten. Seit Christian Wolffs Auftreten in den 1720er Jahren indes fanden viele, die traditionelle Hierarchie der Fakultäten müsse verändert werden, um der neuen Bedeutung der Philosophie gerecht zu werden. Der Durchbruch gelang im Zuge der Wirkung von Kants Werken aus den 1780er Jahren, insbesondere nach der Publikation von Reinholds Briefen über die Kantische Philosophie im Teutschen Merkur 1786/87. 28 Neben Königsberg entstanden Zentren des Kantianismus in Göttingen, Tübingen und vor allem in Jena sowie in Würzburg, Bamberg (und dem nahegelegenen Benediktinerkloster Banz), Bonn, Ingolstadt, Dillingen, Fulda und Salzburg. 29 Die Debatte darüber, was Kants Schriften tatsächlich bedeuteten, ihre leidenschaftliche Propagierung beziehungsweise Denunzierung, beherrschte die öffentliche und akademisch-philosophische Debatte während der zwei letzten Jahrzehnte des Jahrhunderts. In seinem Streit der Fakultäten (1798) plädierte Kant selbst dafür, der Philosophie nun die traditionell von der Theologie besetzte Vorrangstellung einzuräumen. Kant hatte die Philosophie tatsächlich in eine Art Ersatzreligion verwandelt, die Priorität vor allen anderen Formen des Wissens forderte. 30 Der Schlüssel zu dieser Entwicklung war die neue politische und intellektuelle Atmosphäre, die nach der Revolution im Reich entstand, wie wir noch sehen werden. Erst dann entwickelte sich die Debatte über Kants Bedeutung zu einer weitreichenden und außerordentlichen intellektuellen Diskussion, die die Philosophie und mit ihr die Universitäten als ausschließliche Quelle des letzten Sinns stärkte. 31 Erziehung und Bildung im weiteren sozialen Sinn war das Ziel von Argumenten für religiöse Toleranz, die überall ein Hauptanliegen der Aufklärung wurde. Unter protestantischen Autoren waren die theoretischen Argumente für Toleranz Mitte des 18. Jahrhunderts allgemein anerkannt. 32 Was genau toleriert werden sollte, war jedoch oft umstritten. Die meisten schlossen Freidenker und Atheisten aus und entwickelten Argumente für praktische Toleranz im Rahmen des Westfälischen Friedens. Rechte genossen demnach Lutheraner, Katholiken und Reformierte, Sektierer jedoch nicht. Ausgeschlossen waren auch die Juden, deren Tolerie-
57. Bildung und Toleranz
rung im Allgemeinen von Verträgen mit Herrschern abhing, was als rein weltliche Angelegenheit betrachtet wurde. Unter katholischen Autoren waren die Argumente für Toleranz an sich oder auf Grundlage des Naturrechts problematischer, aber ab etwa 1750 begannen auch katholische Rechtstheoretiker eine Tolerierung innerhalb der Bedingungen des Westfälischen Friedens als Vorrecht von Herrschern zu betrachten. Trotz der Verbreitung oft bewegender Plädoyers für Toleranz als Tugend war die Wirklichkeit durch diese rechtlichen Abwägungen eingeengt. In der Praxis waren viele protestantische Herrscher freilich längst weit über den strikten Wortlaut der Vereinbarungen von 1648 hinausgegangen. 33 Die Notwendigkeit der Gewinnung neuer Untertanen und neuer wirtschaftlicher Fähigkeiten lieferte mächtige ökonomische Argumente für die Ausweitung der Toleranz. Diese ließen sich in den Territorien durch fürstliche Anordnung umsetzen. In Reichsstädten wie Hamburg oder Frankfurt am Main hingegen konnte der etablierte lutherische Klerus die Bürgerschaft gegen eine Aufweichung der Haltung der Stadträte mobilisieren. Aber auch in den Territorien gab es Grenzen. Friedrich der Große erklärte bekanntlich, er werde mit Freuden Heiden und Türken begrüßen und Tempel und Moscheen für sie bauen, solange sie gute und arbeitsame Untertanen seien. 34 Tatsächlich aber kam es dazu nie; er ging mit Minderheiten ebenso um wie seine Vorgänger und weitete dieses System auf seine neuen, überwiegend katholischen Ländereien in Schlesien aus. 35 Seine persönliche Toleranz gegenüber Deisten und Freidenkern schlug sich nicht in einem Laissez-faire an der Basis nieder. Anläufe zu einer systematischeren Form der Toleranz gab es erst in den 1780er Jahren. Joseph II. ging mit einem Edikt für Lutheraner, Reformierte und griechisch-orthodoxe Christen 1781 sowie mit einem bahnbrechenden Edikt zugunsten der Juden 1782 voran. Typischerweise hatten diese Maßnahmen mehr mit praktischen und pragmatischen Belangen als mit religiöser Freiheit als solcher zu tun. 36 Tatsächlich führte die limitierte religiöse Freiheit nicht vor 1811 zu vollständigen gesetzlichen und bürgerlichen Rechten für die betroffenen Gruppen. Joseph wollte die Stellung des Staats stärken, indem er andere Kirchen unter Kontrolle bekam. Schon das Zugeständnis begrenzter Freiheit war ausreichend, um den Ruch katholischer Intoleranz zu vertreiben. Die Juden zu tolerieren, hieß, die Aktivitäten ihrer Gemeinden kontrollieren und die Zulassung von Juden nach Wien regulieren zu können. Die fundamentale Bedeutung der Toleranz und religiöser Reformen im österreichischen Kontext unterstreicht die Tatsache, dass zwischen 1767 und 1796 mehr als 6.000 Edikte dazu erlassen wurden. 37 Die österreichischen Toleranzedikte fanden direkte Nachahmer in Mainz, Trier und anderen katholischen weltlichen und kirchlichen Territorien. Das Beispiel des Kaisers verschob auch das Gleichgewicht in dem langwierigen Streit über Toleranz
603
604
V. · Die deutschen Territorien nach 1760
in Hamburg, das seit 1785 Calvinisten und Katholiken duldete. 38 In Preußen bestätigte das wöllnersche Religionsedikt von 1788 die Rechte der drei »Hauptkonfessionen« und ließ andere Sekten und religiöse Gruppen zu, solange sie friedlich blieben. In Verbindung mit einer strengen Zensurgesetzgebung sollte das wöllnersche Edikt restriktiv wirken und die staatliche Kontrolle sichern. 39 1794 fand dieselbe Gesetzgebung Eingang in das Allgemeine Landrecht, nun allerdings in Verbindung mit einer Lockerung der Zensur, nach wie vor jedoch mit dem Gesamtziel der Sicherung der staatlichen Kontrolle. 40 Karl Ferdinand Hommels Argument, Atheismus könne nicht als Verbrechen betrachtet werden und bedrohe weder Staat noch Gesellschaft, und Johann Adam von Ickstatts Ansicht, Atheismus sei vollständig vereinbar mit gutem Bürgertum, fanden nirgendwo im Reich Widerhall in der Gesetzgebung und Regierungspraxis. 41 Für Joseph war die Geltendmachung seines Rechts zur Duldung Teil eines anderen fundamentalen Problems: der Trennung von Kirche und Staat oder vielmehr der Durchsetzung der Rechte des Staats über die Kirche. Auf die gleiche Weise bemühten sich auch die kirchlichen Fürsten mehr als je zuvor, die Verwaltung ihrer Territorien von den kirchlichen Machtsystemen zu trennen, denen sie ebenso vorsaßen. Auch in dieser Hinsicht übernahmen die katholischen Territorien nach 1750 zunehmend Ideen, die in den protestantischen Territorien in der ersten Jahrhunderthälfte etabliert worden waren. 42
Anmerkungen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Borgstedt, Aufklärung, 58 ff. Möller, Vernunft, 136 f. Neugebauer, Staat, 378–396. Neugebauer, »Preußen«, 478 f.; Melton, Absolutism, 171–199; Neugebauer, »Schulreform«. Vgl. zum Folgenden, wo nicht anders vermerkt, HdtBG II, 237–243. Melton, Absolutism, 91–105. NBD II, 551; NDB X, 113 ff. HdtBG II, 245 ff. Ebd., 202–205, 401–414. Ebd., 355–368. Alt, Schiller I, 81–188. Vgl. zum Folgenden (mit umfangreichen bibliografischen Referenzen) HdtBG II, 262–277. Ebd., 263. Vgl. S. 596. HdtBG II, 106 ff., 118 f., 194–197; Osterwalder, Pestalozzi, 24–60; Oelkers, »Pädagoge«; Hinz, Pestalozzi. Schnabel, Geschichte I, 408–433; Ruegg, »Antike«. Die Schätzungen beruhen auf den 1904 von Franz Eulenburg veröffentlichten Berechnungen, die nach wie vor gültig sind. Eulenburg fokussierte auf die »deutschen« (d. h. auf dem
57. Bildung und Toleranz
18 19
20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Territorium des deutschen Nationalstaats von 1871 liegenden) Universitäten, liefert aber auch Informationen zu einigen österreichischen (jedoch nicht Wien, Prag und Olmütz) sowie zur Universität Basel, die rechtmäßig zum akademischen System des Reichs gehörte; vgl. Eulenburg, Frequenz, 130–188. HdtBG III, 222. Die Universität wurde nach ihrem königlichen Sponsor Friedrich Wilhelm III. (1797–1840) benannt und trug seinen Namen bis 1946. Seit 1949 heißt sie Humboldt-Universität. Die Gründung einer zentralen preußischen Universität war nach dem Verlust von Halle an das Königreich Westfalen im Frieden von Tilsit 1807 dringend nötig. 1815 fiel Halle an Preußen zurück, die Universität erreichte jedoch nie wieder ihre vorherrschende Stellung und blieb kleiner als Berlin, Leipzig und München; vgl. Baumgarten, Professoren, 200 ff. Eulenburg, Frequenz, 164 f. Vgl. S. 648. Rosa di Simone, »Admission«, 304 f., nimmt für das 18. Jahrhundert für Wien ein stetiges Wachstum an; Mühlberger, »Absolventen«, 169, 185 f., erklärt, weshalb es keine präzisen Zahlen gibt, und gibt eine Zahl von 400 oder weniger Studenten an. HdtBG II, 393. Hammerstein, Aufklärung, 210–240. Ebd., 200–201. McClelland, State, 117. Eine Diskussion dieser Entwicklungen in Jena ab den 1780er Jahren findet sich bei Müller, Regieren, 396–417; vgl. auch Hammerstein, »Universitäten«, 230 f. Sie erschienen 1790–1792 als zweibändige Buchausgabe. Vgl. zur Rezeption allgemein Vleeschauwer, Development, 138–198; Reininger, Kant, 263–297; Schindling, Bildung, 11, 36, 42; ders., »Bischöfe«, 168 f.; Haaß, Haltung, 35 ff., 43 f., 73 f., 84–87, 90 f., 136 ff., 163 f., 173 ff.; Lehner, »Ecumenism«, XVII; vgl. zu Jena Hinske, Aufbruch; zu Tübingen: Henrich, Grundlegung; zur katholischen Rezeption von Kant: Hinske, »Kant«; zur Rezeption in Bern und der Interaktion zwischen Bern und diversen Zentren des Kantianismus im Reich: Bondeli, Kantianismus. Hunter, Rival Enlightenments, 274–376. Baumgarten, Professoren, 12–15; vgl. auch S. 683–690. Vgl. zum Folgenden Fritsch, Toleranz, und Forst, Toleranz. Vgl. S. 371–378. Kiesel, »Toleranz«, 380. Whaley, »Tolerant Society?«, 184 f. Forst, Toleranz, 438–442, zur Diskussion des Kontexts 352–437. Vocelka, Glanz, 411. Whaley, Toleration, 165 f. Vgl. S. 537 f. Forst, Toleranz, 437 f. Link, Herrschaftsordnung, 289 f. Schneider, Ius reformandi, 505–532.
605
58. Höfe und Kultur
B
ei vielen Reformtätigkeiten in der Epoche der Aufklärung verfolgten Regierungen traditionelle Absichten auf eine Weise, die sie unter Bezugnahme auf das neue Denken rechtfertigten. Ob sie tatsächlich Reformen einleiteten oder einfach nur die Initiativen von Gruppen aufgeklärter Patrioten unterstützten oder guthießen – die Wirkung war die gleiche: Die deutsche Territoriallandschaft des späten 18. Jahrhunderts machte einen oft täuschend »modernen« Eindruck. Das gilt auch für die Entwicklung der Höfe und ihr kulturelles Engagement, in dem viele Gelehrte ebenfalls neue Ansätze erkannt haben. Die Vorstellung des »Musenhofs« hat eine lange Geschichte, ebenso wie die Ansicht, manche deutschen Herrscher hätten eine Schlüsselrolle in der Entwicklung einer neuen, bürgerlichen und zum ersten Mal wirklich deutschen Kultur in diesen Jahrzehnten gespielt. Die Diskussion ist durch historische Mythen und Interpretationsprobleme verzerrt. Das Konzept des »Musenhofs« war im Wesentlichen eine Konstruktion des 19. Jahrhunderts, entsprungen aus dem Wunsch, einen historischen Kontext für Goethe und andere zu schaffen, in dem der Weimarer Hof als Prototyp und Höhepunkt einer fruchtbaren Umgebung für die Entstehung der Hochkultur des modernen Zeitalters dastand. 1 Der Begriff bürgerlich ist aufgrund seiner ziemlich nebulösen Bedeutungen problematisch. Er hatte keinen klaren Bezug zu einer Klasse und ließ sich, insofern Bürgerlichkeit die neue moralische Einstellung und den Individualismus der Aufklärung bezeichnete, auch auf Adlige und Fürsten beziehen, je nach dem Ausmaß, in dem sie sich das neue Denken zu eigen machten. 2 Traditionelle Werke zur deutschen Kultur und Literatur betonen oft das Hervortreten einer modernen »bürgerlichen Kultur« und einer Literatur, die sich von den Fürstenhöfen emanzipiert habe.3 Tatsächlich lagen wichtige Zentren der Aufklärung gerade dort, wo es keinen Hof gab: etwa in der Reichsstadt Hamburg, der sächsischen Stadt Leipzig und im preußischen Halle. 4 Leipzig und Halle waren bei aller städtischen Autonomie jedoch nach wie vor von der jeweiligen Territorialregierung beherrscht. Hamburg florierte als wichtiges Zentrum der praktischen Aufklärung, versagte jedoch als kultureller Standort komplett, als Konrad Ackermann und Johann Friedrich Löwen (* 1727, † 1771) dort 1766 das erste deutsche Nationaltheater zu gründen versuchten und im Jahr darauf gemeinsam mit Lessing erneut scheiterten. 5 Im 18. Jahrhundert konnte die Stadt eine bedeutende literarische Kultur vorweisen, als Gestalten wie Barthold Heinrich Brockes (* 1680,
58. Höfe und Kultur
† 1747) und später Friedrich Gottlob Klopstock (* 1724, † 1803) dort arbeiteten, aber die berühmte, mit Unterbrechungen seit 1678 aktive Oper wurde größtenteils von der vorwiegend adligen diplomatischen Gemeinschaft der Stadt getragen. Das Nationaltheaterprojekt, das ein Publikum gebildeter Bürger voraussetzte, konnte nicht allein von der relativ kleinen kulturellen Elite der Stadt leben. 6 Die Höfe und Regierungen blieben als Sponsoren, Protektoren und Förderer kultureller Unternehmungen entscheidend und prägten zumeist auch die öffentliche Sphäre, die um sie zu entstehen begann, sowohl in den Residenzstädten als auch in anderen Städten und Adelsresidenzen in ihren Territorien. Neu war am Ende des 18. Jahrhunderts nicht der Niedergang der Höfe, sondern neu waren eher deren Umgestaltung und die kulturellen Werte. Es gab keinen Zwiespalt zwischen den Territorialregierungen der Fürsten und der bürgerlichen Kultur und schon gar keine bürgerliche Nation. 7 Wie bei so vielen Aspekten der Geschichte des Reichs ist der hauptsächliche Eindruck jeder Gesamtschau der deutschen Höfe nach etwa 1750 der einer extremen Vielfalt. Selbst der Versuch einer Typologie – fromme Höfe, soziale Höfe, Höfe der Musen und so weiter – kann nicht überzeugen, da so gut wie keiner nur einer Kategorie zuzuordnen ist. 8 Unter den etwa dreihundert Höfen waren viele, an denen sich nicht viel änderte und schlichter Geldmangel die Anmaßungen der Herrscher ad absurdum führte.Viele hatten sich den Spott der radikaleren Aufklärung über kleinkarierte und despotische Fürsten als Schandflecken des Reichs redlich verdient. Manche Höfe hielten bis zum Ende an der Tradition barocker Selbstdarstellung oder Pietät fest; an vielen der kleinsten Höfe blieb das Leben von den aristokratischen Grundfreuden der Jagd und Schlemmerei geprägt. Aber die deutschen Höfe hatten neben und mit den Grundbeschäftigungen auch andere Bräuche kultiviert. Wie überall in Europa waren viele Höfe Zentren der Bildung und der kulturellen Macht. Ihre kulturellen Aktivitäten konnten für vieles stehen: politische Ambitionen, Werbung für sich selbst, Geltendmachung der Stellung des jeweiligen Herrschers in der Hierarchie des Reichs, Geschichte und konfessionelle Identität eines Territoriums. Der Stil war nun jedoch ein anderer und an vielen Höfen entsprachen zumindest Sprache und angestrebte Ziele denen der Aufklärung, wenn auch nicht immer im gleichen Sinn. Die Kritik an Höfen und Herrschern spricht nicht zwangsläufig für deren grundsätzliche Ablehnung, sondern eher für den Wunsch, sie zu verbessern und zu reformieren. Im 16. und 17. Jahrhundert hatten zunächst die burgundischen, dann die italienischen und schließlich die spanischen Höfe das Vorbild für Herrscher in Deutschland wie anderswo in Europa geliefert. 9 Vom 16. Jahrhundert an war Versailles ein wichtiges Beispiel, aber auch Wien übte im Reich starken Einfluss aus. Französische Einflüsse blieben im ganzen 18. Jahrhundert prägend, aber zunehmend war es nicht Versailles, sondern eher das weltstädtische Paris als Zentrum
607
608
V. · Die deutschen Territorien nach 1760
der Künste, Wissenschaften und der Philosophie, das Paris der Intellektuellen und Salons, das als Vorbild diente. Ebenso auffällig ist die Verlagerung von französischen Stilrichtungen auf einheimische durch die Gründung von »Nationaltheatern« durch diverse deutsche Herrscher nach 1770. 10 Diese weitere Entwicklung ging zudem einher mit der Übernahme von englischen Stilelementen, insbesondere englischen Landschaftsparks oder »englischen Gärten«, von denen viele mit komplexen wissenschaftlichen und politischen Bedeutungen und einer eklektischen Mischung aus Besonderheiten versehen waren, von prähistorischen Megalithen bis hin zu griechischen Tempeln und chinesischen Pagoden. 11 All das war Teil einer extrem komplexen Menge paralleler Entwicklungen in Stil und Geschmack, die man mit dem Phänomen des Klassizismus verbindet. Die Bewegung entstand in Großbritannien und Frankreich und breitete sich in den 1760er Jahren in ganz Europa aus. Im Wesentlichen war sie eine Reaktion gegen Barock und Rokoko im Sinn einer Rückbesinnung auf die schlichteren Formen und Muster Griechenlands oder, häufiger, römischer Kopien von griechischen Mustern. Es ging dabei um mehr als nur den hohlen Pastiche, der den Neoklassizismus im 20. und 21. Jahrhundert oft als architektonischen Stil ohne profunde philosophische Bedeutung kennzeichnet. Der Klassizismus des 18. Jahrhunderts zog eine neue Deutung der Antike, ihrer Kunst und Literatur nach sich. Das wiederum führte zur Annahme einer neuen Lebensweise, eines neuen Denkens über Leben, Kunst und Politik. Im Großbritannien des frühen 18. Jahrhunderts, wo der kontinentale Barock nie wirklich Fuß gefasst hatte, beruhte der klassizistische Stil in der Architektur auf der Rückbesinnung auf die Ideen des venezianischen Architekten Andrea Palladio aus dem 16. Jahrhundert durch Architekten des späten 17. und 18. Jahrhunderts wie Colen Campbell, den dritten Earl of Burlington, William Kent und Robert Adam. Ihre Arbeiten wurden in ganz Europa ausgiebig imitiert, aber mittlerweile hatte der Klassizismus durch die Wiederentdeckung der Ruinen von Palmyra im späten 17. Jahrhundert und vor allem durch die Ausgrabungen in Herculaneum (ab 1738) und Pompeji (ab 1748) einen neuen Schub bekommen. In Architektur, Inneneinrichtung und bildender Kunst wurde der Klassizismus zur vorherrschenden Norm. Ob inspiriert von englischen Architekturhand- und Musterbüchern, vom Adam- oder dem ähnlichen französischen Louis-Seize-Stil oder direkt von griechischen und römischen Ruinen und Artefakten, die klassizistischen Tendenzen zeigten sich praktisch überall im Reich. Diese ästhetischen Tendenzen wiederum wurden durch den parallelen Aufschwung der klassischen Philologie an deutschen Universitäten verstärkt, der seinen Höhepunkt im Werk von Friedrich August Wolf (* 1759, † 1824) fand. 12 Wie der deutsche Barock, eine überströmende Fülle von italienischen, franzö-
58. Höfe und Kultur
sischen, niederländischen und anderen Elementen nach dem Geschmack des jeweiligen Auftraggebers, war auch der Klassizismus im Reich geprägt von üppigem Eklektizismus. 13 In Preußen etwa beendete Friedrich der Große die strenge Schlichtheit der Herrschaft seines Vaters, unter dem der Berliner Palast verfallen war. 14 Er bestellte einen neuen Flügel für das Schloss Charlottenburg, ließ das Potsdamer Stadtschloss wiederaufbauen und die neue Residenz Sanssouci im Potsdamer Park errichten. Sein Architekt bei diesen Projekten war Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff (* 1699, † 1753), der 1740 Italien und Paris bereist hatte. Das Ergebnis war eine Art Rokokoklassizismus, der die zurückhaltenden klassischen palladianischen Fassaden, die Knobelsdorff favorisierte, mit der verspielten Rokokoinnengestaltung verband, die der König vorzog. Während Sanssouci deutlich in Richtung Klassizismus ging, kehrte das danach von Carl Philipp Christian Gontard (* 1731, † 1791) zwischen 1763 und 1770 im Potsdamer Park errichtete Neue Palais zum schwereren Stil des Barock zurück. 15 Das scheint politische Gründe gehabt zu haben. Obwohl bereits vor dem Siebenjährigen Krieg geplant, sollte die Ausführung nach Ende des Konflikts klarstellen, dass der König überlebt hatte, seine Ansprüche auf Schlesien beibehielt und durch den Krieg nicht finanziell ruiniert war. Diese Fanfaronade, wie Friedrich es nannte, verlangte einen herrischeren Stil; die Botschaft wurde durch ausgiebigen Gebrauch von schlesischem Marmor im Inneren des neuen Palasts deutlich gemacht. Eine ähnliche Mischung findet sich in Friedrichs Berliner Projekten, etwa dem Opernhaus (1741–1743) und in den anderen Bauten des nie ganz fertiggestellten Forum Fridericianum im Herzen der Hauptstadt. Ein späterer Bau, die königliche Bibliothek (1775–1780), beruhte sogar auf dem Michaelertrakt der Wiener Hofburg von Joseph Emanuel Fischer von Erlach. Unterschiedliche Gebäude verlangten unterschiedliche Stile. Alles hing von der Funktion eines Baus und der Botschaft ab, die er der Welt übermitteln sollte. 16 Friedrichs stilistischer Geschmack war eklektisch, seine intellektuellen und literarischen Ansprüche indes klar von französischen Idealen bestimmt. Mehr als alles andere sehnte er sich danach, als philosophe französischen Stils anerkannt zu werden. 17 Das war die Rolle, die er in der Zeit vor 1763 in Sanssouci auslebte, wo er sich mit gleichgesinnten Intellektuellen umgab: Francesco Algarotti, Pierre-Louis Moreau de Maupertuis, Jean Baptiste d’Argens, Julien Offray de la Mettrie und zwischen 1750 und 1753 Voltaire. 18 Die Geringschätzung der deutschen Kultur und die Pflege der französischen Sprache und Literatur brachte dem preußischen König scharfe Kritik ein. Die Publikation seines abfälligen Essays über deutsche Literatur 1780 mit seiner Kritik am Deutschen, »einer halbbarbarischen Sprache« (une langue à demi barbare), und sein Spott über den Götz von Berlichingen des jungen Goethe provozierte offene Antipathie gegen seine leidenschaftliche Hingabe an französische Ideen und Literatur. 19
609
610
V. · Die deutschen Territorien nach 1760
Obwohl der Klassizismus nach Knobelsdorffs Tod 1753 stetig an Boden gewann, widersetzte sich Friedrich der Große bis zuletzt der rigorosen und systematischen Umsetzung klassizistischer Prinzipien bei den von ihm in Auftrag gegebenen Bauten. Erst seine Nachfolger Friedrich Wilhelm II. (1786–1797) und vor allem Friedrich Wilhelm III. (1797–1840) ließen alle vor 1786 geschaffen Interieurs klassizistisch neu gestalten. Erst sie eröffneten Berlins wahrhaft klassizistische Phase mit Meilensteinen wie dem Brandenburger Tor (1788–1791) von Karl Gotthard von Langhans (* 1733, † 1808) sowie der Neuen Wache (1816–1818) und dem Alten Museum (1825–1828) von Karl Friedrich Schinkel (* 1781, † 1841). Ein ähnlicher anfänglicher Eklektizismus, später – manchmal viel später – gefolgt von strengem Klassizismus, kennzeichnet die Entwicklung der Architektur in München und vielen anderen Hauptstädten von der Mitte des 18. bis ins frühe 19. Jahrhundert. 20 Der Klassizismus als breite kulturelle Bewegung weit über die Architektur hinaus nahm eine ziemlich andere Entwicklung. In dieser Form prägte er den höfischen Stil und die Kultur der Generation deutscher Herrscher nach Friedrich dem Großen. Der deutsche Autor, der die verschiedenen Elemente dieser Strömung zu verknüpfen schien, war Johann Joachim Winckelmann (* 1717, † 1768), dessen Werke Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke in Malerei und Bildhauerkunst (1755) und Geschichte der Kunst des Alterthums (1764) enormen Einfluss entfalteten. 21 Das verhinderte indes natürlich nicht das gleichzeitige Aufkommen von Kritik. Lessing etwa wies Winckelmanns Forderung nach einer Hierarchie der künstlerischen Formen, angeführt von der Bildhauerei, zurück und wandte ein, Kunst und Poesie folgten unterschiedlichen Regeln. Damit trug er zur Durchsetzung von Philhellenismus und Klassizismus bei und legte zugleich das Fundament für deren spätere Verdrängung durch die Romantik. 22 Die ästhetischen Prinzipien von Alexander Gottlieb Baumgarten (* 1714, † 1762) und Johann Georg Hamann (* 1730, † 1788) sowie die Ideen von Johann Gottfried Herder (* 1744, † 1803) und Johann Caspar Lavater (* 1741, † 1801), die alle die sinnliche Reaktion auf die Natur betonten, untergruben implizit ebenfalls Winckelmanns Kernlehren und schufen die Grundlagen für die spätere Romantik. Aber Winckelmanns These, griechische Skulpturen seien durch »edle Einfalt und eine stille Größe« gekennzeichnet, wurde dennoch zur Maxime des deutschen Geschmacks im späten 18. Jahrhundert. Grob umrissen, lassen sich die gleichen klassizistischen Tendenzen von Hamburg und Berlin im Norden bis hinunter nach Stuttgart, München und Wien feststellen. Betrachtet man den Klassizismus, speziell seine Vorliebe für Griechenland, indes als Bewegung mit weiteren ideologischen und politischen Konnotationen, so wird eine einigermaßen klare konfessionelle Trennlinie erkennbar. Bei aller Übernahme des klassizistischen Stils blieben die katholischen Territorien, auch Österreich, grundsätzlich Rom und damit eher der römischen als der griechischen Tradi-
58. Höfe und Kultur
tion verbunden. 23 Der Wiener und Münchner Klassizismus in der Architektur schlug sich nicht in einem neuen kulturell-politischen Paradigma als solchem nieder. Hier wich die Liberalisierung der 1770er und 1780er Jahre in den 1790er Jahren neuen reaktionären Kräften, auch um die vermeintliche Bedrohung durch die Ideen der Französischen Revolution abzuwenden. 24 In den protestantischen Gebieten des Reichs hingegen nahmen Winckelmanns Ideen viel breitere Bedeutung an und trugen zu einer wichtigen und spezifisch deutschen Entwicklung bei. Ironischerweise war Winckelmann selbst 1754 zum Katholizismus konvertiert, aber wer ihn las, stellte ihn sich eher als neuen Heiden vor, wie Goethe, oder als jemanden, dessen Ideen einen neuen Rahmen für einen modernisierten, »vernünftigen« Protestantismus lieferten. 25 In diesem Kontext spielte Winckelmann eine Schlüsselrolle in der Ablehnung der römischen Ideale, die Gottsched verfocht, und von dessen Idee, die Deutschen könnten ihre literarische Kultur verbessern, indem sie die Franzosen nachahmten. So wurde Griechenland als neues kulturell-politisches Vorbild eine Alternative zu Rom und Frankreich. 26 Winckelmanns Einfluss war vielgestaltig. Sein eigener Philhellenismus war erfüllt von Andeutungen der Rebellion gegen monarchische Herrschaft, von der Ablehnung französischer kultureller Werte und französischer politischer Dominanz, von Individualismus und Emanzipation zu der Art von Freiheit, die er für die Grundlage der griechischen Kunst hielt. Dies waren zweifellos Kernfaktoren seiner Attraktivität für junge Autoren, die seine Werke in den 1770er Jahren mit Begeisterung lasen. Winckelmanns Ideale wurden in der Folge unterschiedlichen Umständen angepasst. Der Individualismus blieb ein Leitmotiv, aber unterschiedliche Kontexte und Protagonisten prägten neue Varianten. Der generelle Rahmen der klassizistischen Ästhetik und klassisch-philologischer Studien blieb allen Strömungen gemein, es gab jedoch Unterschiede zwischen dem Weimarer und dem Berliner Klassizismus. Unter dem gemeinsamen Eindruck der Gefahren der revolutionären Vorgänge in Frankreich akzeptierten beide den Staat als notwendigen Rahmen, sahen seine Aufgaben aber ziemlich unterschiedlich. Die von Goethe und Schiller entwickelte Weimarer Klassik legte das Hauptgewicht auf ästhetischen Individualismus als erste Stufe der persönlichen Selbsterfüllung des Menschen. 27 In Berlin fokussierten Gestalten wie der reife Wilhelm von Humboldt und seine Zeitgenossen um 1800 eher auf die Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft und die Erziehung einer neuen »athenischen« Bürgerschaft, die durch eigene Bemühungen zur Erfüllung gelangen und die Gesellschaft vervollkommnen konnte. Ebenso signifikant ist – ganz im Unterschied zu Weimar – die erneuerte Bedeutung Roms in den gelehrten Bestrebungen des Berliner Klassizismus: Der Baustil mag griechisch gewesen sein, aber das hauptsächliche wissenschaftliche Denkmal für die Antike – neben
611
612
V. · Die deutschen Territorien nach 1760
der griechischen Philologie von Friedrich August Wolf und ebenso bedeutend – war Barthold Georg Niebuhrs dreibändige Römische Geschichte (1811–1832). 28 Die Differenzen ergaben sich in erster Linie aus dem Kontext. Weimar war mit etwa 6.000 Einwohnern die kleine Hauptstadt eines kleinen Herzogtums mit etwa 100.000 Einwohnern, Berlin mit einer Bevölkerung von etwa 170.000 um 1800 das dynamische, weltstädtische Zentrum eines Territoriums mit etwa 8 Millionen Einwohnern (im Reich und außerhalb). Nur Wien war mit ungefähr 230.000 Einwohnern (und bei einer Gesamtbevölkerung aller österreichischen Territorien innerhalb und außerhalb des Reichs von etwa 25 Millionen) größer. 29 In Berlin verband sich ein Gefühl der Befreiung von der langen Herrschaft Friedrichs des Großen (1740– 1786) mit dem Widerhall der Französischen Revolution und inspirierte überschwängliche Ideen von Emanzipation und Erneuerung des Gemeinwesens. Die Erfahrung der Niederlage 1806 verlieh diesen Ideen neue Dringlichkeit und brachte viele ihrer Protagonisten erstmals in Positionen echter politischer Autorität. 30 Zweifellos hatten die Entwicklungen in Weimar und Berlin eine wichtige politische und breitere kulturelle Dimension, aber ihre unmittelbaren Auswirkungen auf das Reich als Ganzes sollte man nicht überschätzen. Das Hervortreten von Weimar und Berlin als Zentren von Klassik und Klassizismus und die Affinität zwischen Philhellenismus, Protestantismus und postprotestantischem neuem Heidentum bestimmte nicht das zukünftige Schicksal eines protestantischen preußisch-deutschen Nationalstaats. Die in Deutschland im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert kultivierten historisch-kulturellen Traditionen überschatteten oft die offenere Wirklichkeit der Zeit um 1800. Das Fehlen einer »Wiener Klassik« deutet weder auf einen »Abschied« Österreichs vom Reich noch auf die Ablehnung österreichischer Führung durch das Reich hin. Die Krise der österreichischen Führung in »Deutschland« entstand erst nach 1815. 31 Die umfassenden kulturellen Verschiebungen in Stil und Geschmack im Zusammenhang mit dem Klassizismus umrahmten die Entwicklung der mit ihnen verbundenen Hofkulturen und öffentlichen Sphären im Reich während dessen letzter Jahrzehnte. Auffallend waren auch andere Merkmale Es fällt schwer, Prestigekonsum in Graden zu messen, es ist jedoch überall eine Neigung zu mehr Zurückhaltung und Simplizität festzustellen – oder zumindest der Anschein davon. Die relative Schmucklosigkeit des Berliner Hofs unter Friedrich Wilhelm I. lockerte sich unter Friedrich dem Großen etwas, man trug jedoch weiterhin Militäruniformen und verzichtete auf eine Rückkehr zur barocken Festkultur. In Wien verzichtete Joseph II. auf Krönung und Huldigung und vereinfachte die höfische Kleidung, indem er die Uniform als Norm einführte. 32 Nach etwa 1760 stürzten sich nur noch wenige Höfe in große Bauprojekte, wie sie für die Zeit um 1700 typisch gewesen waren. Unter den weltlichen Territorien waren Mecklenburg-Schwerin, Württemberg und Kassel auffällige Ausnahmen. In
58. Höfe und Kultur
Mecklenburg-Schwerin hatten innere Unruhen im frühen 18. Jahrhundert Bautätigkeiten verhindert, danach wurde die Errichtung eines neuen Palasts erneut bis 1772–1776 verschoben, weil das Herzogtum von Preußen ausgeplündert wurde, nachdem der Herzog beschlossen hatte, sich im Siebenjährigen Krieg auf Österreichs Seite zu schlagen. 33 Die Herzöge von Württemberg und die Landgrafen von Hessen-Kassel strebten nach einer Kurwürde. 34 In Württemberg investierte Herzog Karl Eugen (1737– 1793) große Summen, um Stuttgart wieder zur Hauptstadt zu machen und seine Residenz und Bibliothek aus Ludwigsburg zu verlegen, wohin sie Herzog Eberhard Ludwig (* 1676, † 1733) verbracht hatte, um die württembergischen Stände für ihren erbitterten Widerstand gegen ihn zu bestrafen. 35 Sobald er 1744 für mündig erklärt worden war, ließ Karl Eugen in Stuttgart eine neue (1791 vollendete) Hauptresidenz erbauen. 1770 folgte die Hohe Karlsschule, 1775 eine herzogliche Bibliothek und ein neues Gebäude für die fünf Jahre zuvor auf Schloss Solitude – Jagdschloss und Sommerresidenz des Herzogs – gegründete Militärakademie. In Kassel betrieben die Landgrafen Friedrich II. (1760–1785) und Wilhelm IX. (1785–1821, ab 1803 als Kurfürst Wilhelm I.) eine Vielzahl von Projekten, die an die Vorhaben des ersten preußischen Königs in Berlin um 1700 erinnerten. 36 Die Stadt selbst wurde durch den Bau neuer Alleen umgestaltet, die die drei neuen Hauptplätze verbanden. Der Weiterbau des Bergparks und der Gärten auf dem Steilhang über der Stadt gipfelte in der Errichtung einer neuen Residenz auf der nun so benannten Wilhelmshöhe (1786–1803). Bildung, Kunst und Wissenschaft fanden ein herrschaftliches Zuhause im Museum Fridericianum (1769/70) dem erweiterten Collegium Carolinum, der Militäracademie, der Kunsthochschule, der Société des Antiquités und weiteren Institutionen. 37 Hier blieb der französische Einfluss so dominant, dass mindestens eine Zeitung und manche der örtlichen Kaufleute sogar Werbung auf Französisch betrieben. Zum Ende von Friedrichs Herrschaft hatte sich Kassel zum wichtigen kulturellen Zentrum in Mitteldeutschland gemausert. Unter den Kirchenterritorien waren Münster und Trier die Ausnahmen. In Münster blieb die gewaltige Zitadelle und die Festungsanlagen, die Bischof Christoph von Galen (1650–1678) errichten ließ, nachdem er die Rechte der Stadt getilgt hatte, bis nach dem Siebenjährigen Krieg bestehen.38 Der Krieg zeigte einmal mehr, dass starke Befestigungen Feinde ebenso anzogen wie abschreckten. Deshalb waren die Stände mehr als froh, das Projekt zu unterstützen, dieses Symbol ihrer Unterwerfung einzureißen und einen neuen Palast nach Plänen von Johann Conrad Schlaun (1695–1773) errichten zu lassen. Damit war ein Programm vollendet, an dessen Beginn bereits 1703 das Landschloss Nordkirchen stand, entworfen von Gottfried Laurenz Pistorius (1663–1729) und 1734 ebenfalls von Schlaun fertiggestellt.
613
614
V. · Die deutschen Territorien nach 1760
Die Hoffnungen der Stände von Münster, mit dem neuen Stadtschloss ihren Fürstbischof dazu zu bewegen, in seinem Territorium zu residieren, erwiesen sich als vergebens. Clemens August von Köln (1719–1761) blieb ebenso fern wie seine Nachfolger als Kurfürsten von Köln, Maximilian Friedrich zu Königsegg-Rothenfels (1761–1784) und Maximilian Franz von Habsburg (1784–1801). Zum Glück war ihr Ministerpräsident und (ab 1770) Generalvikar Franz Friedrich Wilhelm Freiherr von Fürstenberg (* 1723, † 1810) ein mehr als gleichwertiger Ersatz. Unter seiner Verwaltung entwickelte Münster außerordentliche Reformfreudigkeit und Fürstenbergs Freundschaft mit Fürstin Amalie von Gallitzin bildete den Kern einer der wichtigsten Ansammlungen katholischer Literaten und Intellektueller des späten 18. Jahrhunderts. 39 Die zweite Ausnahme unter den Kirchenterritorien war das Kurfürstentum Trier. 40 Langwierige französische Besatzung und die Verwüstungen durch die Kriege des frühen 18. Jahrhunderts verzögerten den Bau eines barocken Schlosses auf der Festung Ehrenbreitstein bis 1738–1748, während der Herrschaft von Franz Georg von Schönborn (1729–1756). Der Nachfolger seines Nachfolgers, Clemens Wenzeslaus von Sachsen (1768–1803), ließ in der Hauptstadt Koblenz unter Leitung von Michel d’Ixnard (* 1723, † 1795) und Antoine-François Peyre (* 1739, † 1823) gegen starken Widerstand der Territorialstände eine neue Residenz errichten. Dies waren Fälle, in denen sich Bauprogramme, wie man sie um 1700 erwartet hätte, bis nach 1750 verzögerten. Außer Münster, wo die Stände die Errichtung eines neuen Schlosses unterstützten, sorgten sie auch für Konflikte mit Territorialständen wegen der Finanzierung, wie sie für die frühere Epoche typisch gewesen waren. Der pfälzische Hof in Mannheim steuerte einen anderen Kurs auf einen »deutschen« Stil zu. 41 Dass der Hof katholisch war, lässt vermuten, dass es keine zwangsläufige Verbindung zwischen Neuerungen und Protestantismus gab. Dass der Kurfürst nach seinem Umzug nach München 1777 den Mannheimer Stil ablegte, unterstreicht jedoch die Bedeutung lokaler Umstände. Entscheidend für den Umschwung war die unterschiedliche politische Situation in München und ein ebenfalls andersartiges Kirchensystem. Nach seiner Thronbesteigung 1742 machte der achtzehnjährige Kurfürst Karl Theodor, frisch verheiratet mit seiner Sulzbacher Cousine Elisabeth Augusta, den Hof in Mannheim zu einem schillernden Zentrum für musikalische und theatralische Vergnügungen. Unter Anleitung seines ehemaligen Lehrers, des Marquis Albert Joseph d’Ittre, und seines jesuitischen Beichtvaters ließ er das gewaltige, von Kurfürst Karl Philip 1720 in Auftrag gegebene Mannheimer Schloss fertigstellen. Es wurde zur Kulisse für zahlreiche Festlichkeiten zu Ehren des Herrschers
58. Höfe und Kultur
und seiner Gemahlin, deren Glanz an die Feste seiner Vorfahren in Heidelberg in den Jahrzehnten vor dem Dreißigjährigen Krieg erinnerte. Nach fast zwanzig Jahren Oper, Theater, Galadiners und Bällen, Feuerwerken und Jagden, die dem Mannheimer Hof einen prominenten Platz in der europäischen Hoflandschaft gesichert hatten, kam es zu einem merklichen Umschwung. Die zunehmende Begeisterung des Kurfürsten für moderne Ideen war hierfür entscheidend, aber auch drängende interne Probleme. Die niederrheinischen Territorien erlebten eine außerordentliche Blütezeit. Der Kurfürst suchte sie jedoch kaum auf, sondern betonte ihre Randlage, indem er Nicholas de Pigage (* 1723, † 1796) beauftragte, ein Jagd- und Lustschloss in Benrath südlich von Düsseldorf zu errichten (1756–1770) und keinen Palast in der Regionalhauptstadt selbst. Das mittelrheinische Kernterritorium hingegen bereitete eine Reihe grundsätzlicher Probleme. Einerseits beschränkte die extreme Zersplitterung der Pfalz, die von zahlreichen benachbarten Kirchenterritorien durchsetzt war, die Bewegungsfreiheit des Kurfürsten. Andererseits waren seine Optionen auch wegen anhaltender Konflikte mit lutherischen und reformierten Untertanen begrenzt. Reformen versprachen einen Ausweg aus dieser Position relativer Schwäche. In den 1750er Jahren hatte Karl Theodor zweimal Voltaire zu Gast, 1753 in Mannheim und 1758 Schwetzingen, und beim zweiten Mal blieb Voltaire lang genug, um dort seinen Candide zu schreiben. 42 Nach 1760 ging Karl Theodor die Sache ernsthafter an. Die Gründung der Kurpfälzischen Akademie der Wissenschaften in Mannheim 1763 war einer der ersten Schritte seiner systematischen Auseinandersetzung mit neuem Denken. 43 Es folgte ein umfangreiches Reformprogramm, das Landwirtschaft und Manufakturen ebenso einschloss wie Verwaltungsreformen sowie zaghafte Anläufe zu einer Reform der Zünfte und zur Errichtung eines liberalen Religionssystems. Die langsame Abwendung von der vorherrschenden französischen Kultur, die offenbar eine Reise nach Italien 1774/75 besiegelte, war ebenso auffällig. Nach seiner Rückkehr gründete der Kurfürst die Kurfürstliche Deutsche Gesellschaft, die an der Förderung und Modernisierung der deutschen Sprache arbeiten sollte. Im Jahr darauf wurde erstmals eine deutsche Oper am Hof aufgeführt: Günther von Schwarzburg von Anton von Klein (* 1746, † 1810) und Ignaz Holzbauer (* 1711, † 1783). 44 1777 gründete Karl Theodor dann die Deutsche Nationalschaubühne, für die er Lessing als Leiter zu gewinnen suchte. 45 Neu war hieran nicht nur die Betonung von »deutsch« und »national«, sondern auch, dass jeder, der eine Karte kaufte, das Theater besuchen durfte. Auch die Gärten des Kurfürsten in seiner Sommerresidenz Schwetzingen standen der Öffentlichkeit offen. Auch hier war die Sendung ebenso sehr pädagogisch wie vergnüglich. Einem französischen Garten folgte ein englischer Garten, ein Badehaus, Tempel für Merkur, Minerva und Apollo sowie ein Tempel der Waldbota-
615
616
V. · Die deutschen Territorien nach 1760
nik (Botanicae Silvestris), der die Harmonie der Rhythmen der Natur mit der modernen Wissenschaft feierte. 1779 begann die Arbeit am Herzstück des Jardin Turc: der sogenannten roten Moschee, die mit zwei Minaretten 1795/96 fertiggestellt wurde und insgesamt 120.000 Gulden kostete. Sie sollte selbstverständlich nie als Moschee genutzt werden, sondern diente als programmatische Darstellung des Ideals religiöser Toleranz. Als der Bau der Moschee in Schwetzingen begann, hatte Karl Theodor Mannheim bereits Richtung München verlassen, da er 1777 die bayerische Kurwürde geerbt hatte. Der Mannheimer Hof verkümmerte, obwohl die nun von ihrem ständig untreuen Gatten getrennte Fürstin dort blieb und einer verkleinerten Version vorstand. Karl Theodor wiederum gelang es nicht, das schillernde Mannheimer Vorbild in der konservativeren, mehr von der Kirche geprägten Münchner Atmosphäre zu reproduzieren, wo er viele ähnliche Reformen einleitete, sich etwa um das Jahr 1785 jedoch zum Gegner der Aufklärung der Freimaurer und Illuminaten gewandelt hatte. 46 Auch ohne den Haupthof und das berühmte Orchester florierte das Theater in Mannheim bis in die 1790er Jahre. 1780 gestattete Karl Theodor sogar die Aufführung von Shakespeares King Lear samt den »anstößigen« Teilen, die die Münchner Zensoren offenbar verboten hatten. Wie der Kurfürst auf die Vorhaltungen seines Beichtvaters entgegnete, waren die Dinge in Mannheim nun mal anders. Vollendet wurde die Entwicklung eines neuen »deutschen« Stils der Hofkultur vielleicht von einer bemerkenswerten Ansammlung kleiner Höfe in Thüringen. Im späten 18. Jahrhundert erlangten Anhalt-Dessau und die ernestinischen Grafschaften Meiningen, Gotha-Altenburg und vor allem Weimar-Eisenach einmaligen Status. Ihre Herrscher, Leopold III. Friedrich Franz von Anhalt-Dessau (* 1740, † 1817), Georg I. von Sachsen-Meiningen (* 1761, † 1803), Ernst II. von SachsenGotha-Altenburg (* 1745, † 1804) und Karl August von Sachsen-Weimar-Eisenach (* 1757, † 1828), ragen als Schirmherren und kulturelle Neuerer aus der Masse heraus. 47 Angespornt wurden sie von interterritorialer Konkurrenz, aber auch von der Erneuerung regionaler Traditionen. Die Territorien waren allesamt recht klein, ihre Herrscher zählten jedoch zur Elite der »alten Fürsten« des Reichs. 48 Die ernestinisch-sächsischen Grafschaften zum Beispiel legten viel Wert darauf, dass ihr Gebiet das Kerngebiet der Reformation gewesen war. 49 Im frühen 17. Jahrhundert hatten sie zu den Vorreitern der protestantischen patriotischen Bewegung gezählt, aus der die Fruchtbringende Gesellschaft hervorgegangen war, deren Ideale sich in den Initiativen nachfolgender Generationen bis ins 18. Jahrhundert niederschlugen. Diese Traditionen zeigten sich nun an einem neuen Aufklärungsidiom und verknüpften sich einmal mehr mit patriotischen politischen Zielen, erst im Fürstenbund der 1780er Jahre, dann im Kampf um die Erhaltung ihrer territorialen Unabhängigkeit in der Zeit der französischen Kriege.
58. Höfe und Kultur
Jeder Herrscher hatte persönliche Präferenzen und leicht unterschiedliche Interessen, aber es gab gemeinsame Themen. Sie gründeten Hoftheater, erwarben beeindruckende Sammlungen zeitgenössischer Kunst, sponserten Musiker, unterstützten Künstler und Autoren und verwendeten signifikante Ressourcen auf die Gestaltung von Landschaftsparks im englischen Stil. Diese Parks waren mehr als nur Grünflächen. Sie waren erfüllt von historischen wie geologisch-wissenschaftlichen Elementen und jeder davon umfasste ein komplexes Tableau verschlüsselter Bedeutungen. Der aufwendigste war der Park bei Wörlitz, den Franz von Anhalt-Dessau 1769–1773 anlegen und bis 1813 kontinuierlich ausbauen und erweitern ließ. 50 Die Inspiration dazu kam aus England, vor allem von den Besuchen des Fürsten in Painshill und Stourhead. Die verschiedenen Teile des Gartens enthielten »germanische« Ruinen, ein gotisches Haus, einen geologischen Themenpark, eine »Rousseau-Insel« mit einer Urne, die dem Grab des Philosophen in Ermenonville nachgebildet war, eine palladianische Villa und eine Kopie der gusseisernen Brücke von Coalbrookdale, ein funktionierendes Modell des Vesuvs (den Stein) und einen Villa Hamilton genannten Pavillon, der das Haus von Sir William Hamilton in Neapel darstellte und eine Sammlung von Wedgwood-Vasen und Vulkangestein enthielt. Das waren nur die Hauptbestandteile einer programmatischen Landschaft, die bilden und zur Diskussion anregen, amüsieren und Freundschaften stiften sollte.Vor allem war in die Parkgestaltung auch die breitere politische Agenda des Fürsten eingeschrieben. Englische Elemente machten deutlich, dass Franz den Fürstenbund als eine Art Erneuerung des Kampfs um die Verteidigung alter Freiheiten im Geist der Opposition um Walpole im Großbritannien der 1720er und 1730er Jahre verstand. 51 Die von Franz von Anhalt-Dessau für Wörlitz und andere Ländereien in Auftrag gegebenen Landschaftsgestaltungen waren das neuartigste und außerordentlichste aller Projekte in dieser Region im späten 18. Jahrhundert. Den meisten Ruhm erntete jedoch Karl August von Weimar, weil er seinen Hof zu der Bühne machte, auf der sich Goethes Leben von 1775 bis zu seinem Tod 1832 abspielte. Die traditionelle Darstellung dieser Beziehung und ihrer Bedeutung ist zu einem großen Teil als Mythos entlarvt worden, aber was bleibt, ist bemerkenswert genug. Bis Karl August – Herzog ab 1758, als er ein Jahr alt war – 1775 mündig wurde, führte seine verwitwete Mutter Anna Amalia, geborene Prinzessin von Braunschweig-Wolfenbüttel, die Regentschaft, so gut es angesichts der Beschränkungen durch die alten regierenden Eliten auf der einen Seite und die Territorialstände andererseits ging. 52 Ihre künstlerischen Interessen und ihr Mäzenatentum waren für eine Prinzessin ihres Hintergrunds und Standes eher durchschnittlich, ihr Kunst- und Literaturgeschmack konventionell und von der Mode der Zeit geprägt. Ihre bedeutendste Tat war, wie sich später herausstellte, die Ernennung von Chris-
617
618
V. · Die deutschen Territorien nach 1760
toph Martin Wieland (* 1733, † 1813) zum Erzieher ihrer beiden Söhne 1772. Dass Wieland im Jahr darauf den Teutschen Merkur gründete, eine selbstbewusst »nationale« Literatur- und Rezensionszeitschrift nach dem Vorbild des Mercure de France, setzte Weimar erstmals auf die größere intellektuelle Landkarte. 53 Sein zweiter wichtiger Beitrag war, die Prinzen auf eine ausgedehnte Reise durch das Reich zu schicken, auf der es im Dezember 1774 zur schicksalhaften ersten Begegnung des siebzehnjährigen Karl August mit dem fünfundzwanzigjährigen Goethe kam. 54 Das Ergebnis war die Einladung, nach Weimar zu ziehen, wo Goethe im November 1775 eintraf. Es war ein kritischer Zeitpunkt in der Geschichte des Herzogtums. Karl August wurde 1775 mündig, ein Jahr nachdem ein Brand die herzogliche Residenz so gut wie zerstört hatte. Die Verlegung von Anna Amalias Hof nach Tiefurt ermöglichte den Wiederaufbau und Reformen in der Hauptstadt. Im Frühjahr 1776 überredete Goethe Karl August, Herder zum Generalsuperintendenten der lutherischen Territorialkirche zu ernennen, im Juni 1776 wurde Goethe selbst Mitglied des dreiköpfigen Geheimen Consiliums des Herzogs. Die alten Minister, die Karl August nun ins Abseits drängte, hatten nichts als Spott für ihre Nachfolger übrig. Der frustrierte Höfling Karl Siegmund von Seckendorff, dessen Karriere nun ins Stocken geraten war, meinte sarkastisch: »Es ist beschlossen worden, allen denjenigen bedeutende Stellen zu verleihen, die bisher zur Unterhaltung des Hofes da waren.« 55 Die Zyniker hatten nicht ganz unrecht. Die Versuche, das Herzogtum zu reformieren, zeitigten nur bescheidene Erfolge und vieles, was auf dem Papier geplant war, wurde nie umgesetzt. Chronischer Geldmangel sorgte dafür, dass selbst die neue Residenz erst 1803 fertiggestellt werden konnte. Einer der prophetischsten frühen Beiträge zur Reform- und Erneuerungsdebatte kam nicht von Goethe, sondern von dem Autor, Verleger und Unternehmer Friedrich Justin Bertuch (* 1747, † 1822). Ein Territorium wie Weimar, fand er, sollte sich auf Publizistik und Kunst konzentrieren, weil dafür als Rohstoffe nur »Genie und Lumpen« (letztere zur Papierherstellung) nötig seien. 56 Bertuchs Vorschlag fand 1774 keinen Anklang; stattdessen startete die Verwaltung ein ganz konventionelles Programm aufgeklärter Reformen. Goethe selbst verlor sehr bald jegliche Hoffnung, er könne in der Regierung des Herzogtums etwas ausrichten, und war zugleich zutiefst skeptisch, was Karl Augusts Ambitionen im Fürstenbund betraf. 57 Die Frustrationen der Regierung trugen zu der Krise bei, die Goethe dazu bewegte, 1786 nach Italien zu reisen, wo er zwei Jahre verweilte und den Herzog bat, ihm zu gestatten, sich nach seiner Rückkehr dem zu widmen, »was Niemand, als ich, thun kann«. 58 Was er dabei im Sinn hatte, war die Aufsicht über die Universität Jena und eine ganze Reihe kultureller Initiativen, die Weimar bald zum literarischen und kulturellen Zentrum des Reichs machten.
58. Höfe und Kultur
Bereits 1785 hatte Bertuch mit Wieland und anderen die Allgemeine LiteraturZeitung gegründet, die sich bald als beliebteste und einflussreichste deutsche Literaturzeitung etablierte und zu deren Autoren Goethe, Kant, Schiller, Fichte und Wilhelm von Humboldt zählten. Nach seiner Rückkehr aus Italien 1788 partizipierte Goethe in zweierlei entscheidender und einander ergänzender Weise an dem Kurs, den Weimar steuerte. Zum einen wandte er sich entschieden gegen den literarischen Dilettantismus, der den Hof während der Regentschaft von Anna Amalia gekennzeichnet hatte und in ihrer Residenz in Tiefurt immer noch vorherrschte. In enger Zusammenarbeit mit Schiller entwickelte er ab 1794 die Prinzipien, auf denen ihr ästhetisches Programm klassischer Literatur beruhte. Diese Zusammenarbeit war in gewissem Sinn die Frucht des zweiten Kerngebiets seiner Tätigkeit: der Aufsicht über die Universität. Trotz der anfänglichen Kühle und Zögerlichkeit ihrer Bekanntschaft hatte Goethe 1789 empfohlen, Schiller als Professor für Geschichte dorthin zu berufen. 59 Der Universitätsreformer, als den ihn manche Hagiografen hingestellt haben, war Goethe ganz und gar nicht. Zum einen teilte sich Weimar die Leitung der Universität mit den anderen ernestinischen Dynasten in Gotha, Meiningen und Coburg (die vier Herrscher waren als »Nutritoren« der Universität bekannt). Weimar profitierte jedoch davon, dass Jena in seinem Territorium lag und die anderen Sponsoren oft noch weniger Geld zur Verfügung hatten als Karl August. 60 Folglich wurde Jena zum Großteil unter Goethes Einfluss zum frühen Zentrum der Verbreitung der kantschen Philosophie. 1793 wurde Fichte zum Professor für Philosophie berufen und eine ganze Reihe neuer Fachgebiete der Wissenschaft und Forschung eingeführt. Goethe selbst schrieb 1825, er habe von Anfang an Jena und Weimar, die nur zwanzig Kilometer voneinander entfernt waren, »wie zwei Enden einer großen Stadt« angesehen, »welche im schönsten Sinne geistig vereint, Eins ohne das Andere nicht bestehen konnten«. 61 Die Nähe von Hof und Universität war in der Tat von Beginn an ein Anreiz für Goethe; er selbst trug dazu bei, die Nähe in eine Symbiose zu verwandeln. Wie viel begriff Karl August von dem, was sich während seiner langen Herrschaft entwickelte, und wie sehr war er daran interessiert? Zweifellos hatte er als junger Mann Goethe entdeckt und schenkte ihm weiterhin Unterstützung und Vertrauen. 62 Ihr Verhältnis war jedoch nicht frei von Spannungen. Er befürwortete Goethes Förderung des Kantianismus in Jena; als Karl August indes später fand, Fichtes Radikalität und Atheismus brächten sein Herzogtum in Misskredit, entließ er Fichte umgehend und plädierte für einen moderateren Kurs. Daraufhin erhitzten sich die Gemüter und der Herzog erklärte verärgert, er finde Goethes Begeisterung für die kantschen Lehren ziemlich kindisch und dumm. 63 Letztlich galt das Hauptinteresse des Herzogs der Politik, nicht der Ästhetik, und er ging lieber jagen, als über die Perfektionierung des Menschen durch die Kunst zu konversieren. 64 Er
619
620
V. · Die deutschen Territorien nach 1760
hatte jedoch ebenso wie Goethe ein eigennütziges Interesse daran, Weimars kulturelles Profil und Prestige zu festigen, um seine fortdauernde Unabhängigkeit im Reich zu sichern, umso mehr als voll souveräner Staat nach der Auflösung des Reichs. 65 Deutsche Schriftsteller, so ist oft zu lesen, seien im Grunde unpolitisch gewesen und hätten im kulturellen Bereich einen Ersatz für das politische Leben und eine nationale Identität gesucht, die ihnen im Reich und in seinen Territorien vorenthalten wurden. 66 Für die thüringischen Fürsten, aber auch für viele andere, blieb die Kultur sicherlich ein Medium für politische Zwecke. Die Autoren, die sie sponserten, mussten ihre Ziele nicht bis ins Detail teilen. Ihre Schriften standen jedoch für eine liberale Gesamteinstellung, die politisch verstanden werden konnte, ob in Form der Kritik am Hof selbst, in der Zielsetzung, ein »klassisches Zentrum« zu etablieren, oder in den vielen Ideen zur Zukunft der Gesellschaft im Allgemeinen – und speziell der deutschen Nation –, die in den 1790er Jahren und danach entwickelt wurden. 67 Was Weimar letztlich wichtig machte, war die Verbindung der Aktivitäten von Goethe, Wieland, Herder und später Schiller zu einem gemeinsamen Unternehmen. Bei all ihrer politischen und kulturellen Bedeutung war es Wien und Berlin nie gelungen, die Rolle einer nationalen Hauptstadt zu übernehmen. Die Vitalität von Mannheim und zahlreichen anderen Zentren war letztlich vorübergehend. Weimar profitierte von seiner Nähe zu den Zentren der Aufklärung in Leipzig und Halle und von der symbiotischen Beziehung zwischen dem Hof und der Universität Jena, die in den 1790er Jahren zur beliebtesten Universität im Reich geworden war. Der entscheidende Faktor war jedoch die gegenseitig bereichernde Beziehung zwischen einem Herrscher und einer Gruppe begabter Autoren, die entschlossen waren, ein literarisches und intellektuelles Zentrum der Nation zu schaffen.
Anmerkungen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Schmidt, »Kulturbedeutung«, 361–366; Berger, Anna Amalia, 12–18. Umbach, »Culture«, 188, 190; Daniel, Hoftheater, 123 ff. Vgl. z. B. Balet, Verbürgerlichung. Vgl. die relevanten Kapitel in Weigl, Schauplätze. Sosulski, Theater, 16–20; Nisbet, Lessing, 472–510. Wolff, »Barockoper«; Marx, »Barockoper«. Möller, Fürstenstaat, führt den Zwiespalt bereits im Titel und legt ihn in voller Breite dar. Vgl. z. B. Bauer, Gesellschaft, 55–80. Müller, Fürstenhof, 11–17; Daniel, »Höfe«, 21–26; DaCosta Kaufmann, Court, 392–459. Sosulski, Theater, 16–28. Vgl. für einen allgemeinen Überblick zu Gärten und ihrer Symbolik Niedermeier, »Germanen«.
58. Höfe und Kultur
12 Marchand, Olympus, 16–24. 13 Vgl. zum Barock S. 260 f., 266, 339. 14 Vgl. zum Folgenden Braunfels, Kunst I, 119–140; Möller, Fürstenstaat, 388 ff.; Giersberg, Friedrich, 78–106, 120–133. 15 Braunfels, Kunst I, 124, 128 ff.; Giersberg, Friedrich, 120–133. 16 DaCosta Kaufmann, Court, 405 f. 17 Kraus, »Friedrich der Große«, 111. 18 Mittenzwei, Friedrich II., 93–100. 19 Ebd., 197–204; Steinmetz (Hrsg.), Friedrich II., 60–99, insb. 62, 81 f. (die Sammlung enthält auch einige Reaktionen auf Friedrichs Essay). 20 Möller, Fürstenstaat, 387 f.; Braunfels, Kunst I, 200–205. 21 DaCosta Kaufmann, Court, 441–454; Marchand, Olympus, 7–16; Fuhrmann, »Winckelmann«; Chytry, State, 11–37. 22 Nisbet, Lessing, 399–434. 23 Marchand, Olympus, XXIII. 24 Bodi, Tauwetter, 395–432; Schaich, Staat, 321–460. 25 Fuhrmann, »Querelle«, 134–149. 26 Wiedemann, »Staatsnation«. 27 Chytry, State, 38–105. 28 In Bezug auf diese oft übergangene Dimension des preußischen Klassizismus ist immer noch anregend: Yavetz, »Why Rome?«; vgl. zu Niebuhr ADB XXIII, 646–661, und NDB XIX, 219 ff.; außerdem Gooch, History, 14–24. 29 Vgl. zu unterschiedlichen Schätzungen der Bevölkerungszahlen: Wilson, Reich, 323; Hochedlinger, Wars, 280 f.; Rosseaux, Städte, 8–11. 30 Den besten kurzen Abriss des Berliner Klassizismus bietet Conrad Wiedemanns Einführung zum Forschungsprojekt »Berliner Klassik« unter http://www.berliner-klassik.de/ projekt/conrad-wiedemann (Zugriff am 8. Januar 2014). 31 Whaley, »Thinking«, 68–71. 32 Beales, Joseph II, II, 438 f.; Vocelka, Glanz, 292. 33 Braunfels, Kunst I, 350 ff. 34 Pelizaeus, Aufstieg (passim). 35 Wilson, War, 217 f.; Vann, Making, 259–263. 36 Ingrao, Mercenary State, 164–174; Braunfels, Kunst I, 320–323; Wegner, »Stadtbild«, 152– 159. Erhellend sind auch Schweikhart, »Antikenrezeption«, und andere Aufsätze in demselben, zum zweihundertsten Jubiläum des Museums Fredericianum erschienenen Band. 37 Das erste öffentliche Museum auf dem europäischen Festland war das 1754 in Braunschweig nach dem Vorbild des im Jahr zuvor eröffneten British Museum gegründete Herzog-Anton-Ulrich-Museum. 38 Braunfels, Kunst II, 322–327, 335 ff.; Holzem, Konfessionsstaat, 251; vgl. S. 54, 272. 39 Ebd., 455–466; Sudhof, Aufklärung. 40 Braunfels, Kunst II, 111–116. 41 Vgl. zum Folgenden Mörz, »Palatinate«, 336–353; Press, »Reformabsolutismus«, 246–262; Braunfels, Kunst I, 302–312; Ebersold, Rokoko, 33–45. 42 1753 und 1758; vgl. Mörz, Absolutismus, 77, und Besterman, Voltaire, 334, 393. 43 Mörz, Absolutismus, 351–355; vgl. zu Karl Theodors Verbindung zum Denken der Aufklärung S. 93–108, 265–269. 44 Hermand, »Nationaloper«; Günther von Schwarzburg (* 1304, † 1349) war ein deutscher
621
622
V. · Die deutschen Territorien nach 1760
45 46
47
48
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
62 63 64 65 66
67
Gegenkönig – von Unterstützern der Wittelsbacher 1349 gegen Karl IV. aufgestellt –, dessen Lebensgeschichte zum beliebten patriotischen Sujet des späten 18. Jahrhunderts wurde. Daniel, Hoftheater, 83–101, 180–269; Sosulski, Theater, 25–28. Vgl. zu den bayerischen Reformen, auch zur Trockenlegung des Donaumooses und zu den Landgewinnungsprojekten, sowie zur Schlüsselrolle, die der illegitime Sohn des Kurfürsten, Stephan Freiherr von Stengel, spielte: Groening, Revolution, insb. 132–160, und Press, »Reformabsolutismus«, 252–262; Karl Theodors antiaufklärerische Politik analysiert Schaich, Staat, 173–178. Vgl. zu diesen Fürsten: Zaunstöck, »Leben«; Schneider, »Herzog Georg«; Greiling, »Ernst«; Tümmler, Carl August; die beiden weiteren ernestinischen Dynastien Coburg und Hildburghausen waren so gut wie bankrott und standen ab etwa 1770 unter Verwaltung kaiserlicher Schuldenkommissionen; vgl. Westphal, Rechtssprechung, 277–428 (zu Hildburghausen), und ADB VI, 317 (zu Coburg). Weimar etwa umfasste nicht mehr als 1.760 km 2 bei etwa 100.000 Einwohnern, von denen vielleicht 6.000 in der Stadt Weimar selbst und 4.000 in Jena lebten. Anhalt-Dessau kam auf 1.100 km 2 mit ungefähr 55.000 Einwohnern und einer etwa so großen Hauptstadt wie Weimar. Müller und Maatsch, »Weimar-Jena«, 19–24. Umbach, Federalism, 59–127; ders., »Visual Culture«. Ders., »Politics«; Schmidt, »Reichspatriotische Visionen«; vgl. auch S. 486 ff. Berger, Anna Amalia, 614–620. Schmidt, »Ereignis«, 19 f. Boyle, Goethe I, 194 f. Ventzke, Herzogtum, 41. Ebd., 245; Seifert, »Entwürfe«, 291–295. Umbach, »Politics«, 686 ff.; Schmidt, »Goethe«, 206–210. Müller, Regieren, 302. Alt, Schiller I, 592, und II, 160–163; Boyle, Goethe I, 545 ff. Müller, Regieren, 39–57. Müller und Maatsch, »Weimar-Jena«, 16; die gemeinsame Gesamtbevölkerung lag 1790 bei etwa 10.600 (6.300 in Weimar, 4.300 in Jena) plus etwa 860 Studenten; Alt, Schiller I, 531, 595. Müller, Regieren, 306 f. Ebd., 388. Schmidt, »Mäzene«, 42. Vgl. zur Weimarer Kulturpolitik allgemein: Müller, »Kultur«; Ries, »Kultur«; speziell zur Phase 1806–1813 Schmidt, »Prestige«. Vgl. zum Beispiel Minder, Kultur, 5–25 (insb. S. 9: »In Deutschland ist der Dichter, der Künstler in erster Linie Bürger einer anderen Welt; in Frankreich ist er in weit größerem Ausmaß ›citoyen‹, eingebürgert.«); die Ursprünge dieser Sicht diskutiert Craig, Politics, XI–XII. Reed, Classical Centre, 17 ff.; vgl. S. 685–690.
59. Die Folgen der Reformen: Immunität gegen eine Revolution?
B
ei der Vorlage des ersten Bandes der Protokolle der kurfürstlichen deutschen Gesellschaft in Mannheim 1784 erklärte ihr Sekretär, der ehemalige Jesuit Anton von Klein: »Der Geist der Aufklärung ist der Geist des Vaterlandes.« 1 Solche Stellungnahmen waren nichts Ungewöhnliches. So gut wie alle Aufklärer und ihr gleichgesinntes Publikum glaubten, das neue Denken sei patriotisches Denken. Ihr vorrangiges Ziel war die Reform der Gesellschaft, ihrer Regierung und der Institutionen. Breiter gefasst zielten sie auf die Verbesserung der Menschen oder, um Lessing zu zitieren, die »Erziehung des Menschengeschlechts« ab. Dieser Anspruch führt unvermeidlich zu der Frage, was sie mit ihren Bemühungen bewirkten. Unterschieden sich die Reformen des späten 18. Jahrhunderts qualitativ von denen irgendeiner früheren Reformphase? Trugen Reformen zur Modernisierung der deutschen Territorien bei, und wenn ja: Wie sind sie im Verhältnis zu dem einzuschätzen, was die deutsche Überlieferung stets als die »großen Reformen« der napoleonischen Epoche betrachtet hat? War territorialer Reformpatriotismus mit einer loyalen Einstellung zum Reich unvereinbar? Und schließlich: Machten die Reformen der Zeit vor 1789 die deutschen Territorien nach 1789 immun gegen eine Revolution? Die Beantwortung dieser Fragen ist schwierig, da es weder zur Aufklärung noch zu den Reformen so etwas wie eine umfassende Topografie gibt, geschweige denn einen umfassenden Überblick über die Ergebnisse der Reforminitiativen. Das Eintreten für die Aufklärung allein war keine Erfolgsgarantie. Unter den sechs Linien des Hauses Hohenlohe gab es nur einen Verfechter der Aufklärung. Die Herrschaft des Fürsten Friedrich Ludwig von Hohenlohe-Ingelfingen (* 1746, † 1818) war jedoch im Vergleich zu den praktischen Verbesserungen seines Cousins, der an die Tradition christlicher Herrschaft anknüpfte, ein Misserfolg. 2 Aufklärung war noch nicht einmal eine notwendige Voraussetzung für Reformen: Einige strenggläubige und patriarchalische Herrscher, die weiterhin nach alter Tradition regierten, führten viele derselben Veränderungen ein wie ihre modisch aufgeklärten Zeitgenossen. Manche verbanden sogar alte und neue Elemente, etwa Markgraf Karl Friedrich von Baden, der zahlreiche aufgeklärte Reforminitiativen betrieb und Aufklärer wie Johann Georg Schlosser unterstützte, die Abschaffung der Lehnsherrschaft jedoch mit profund christlichen Motiven recht-
624
V. · Die deutschen Territorien nach 1760
fertigte und unverbrüchlich von seinem göttlichen Machtanspruch überzeugt war. 3 In Sachsen wurden die Reformen nach 1762 von Amtsträgern vorangetrieben, deren Denken nicht von aufgeklärtem Rationalismus, sondern von Zinzendorf und dem Pietismus geprägt war. Selbst in Berlin fühlten sich die Aufklärer oft als bedrängte Minderheit, die in den Straßen um den Königspalast und im nahegelegenen Viertel Friedrichstadt lebten, umgeben von Pietisten, Zinzendorfianern und orthodoxen Lutheranern. Friedrich Nicolai zufolge hatten 1775 »die Gärtner und Viehmäster in den Berlinischen Vorstädten noch alle löbliche Anlage auf einen Ketzer mit Fäusten loszuschlagen«, und er warnte, »nur ja nicht wenige Schriftsteller und ihre wenigen Freunde mit den Einwohnern Berlins« zu vermengen. 4 In den 1790er Jahren gab es vielleicht 1.000 Schriftsteller, Gelehrte und Künstler in Berlin, einer Stadt mit 170.000 Einwohnern. Dass diese Gruppe eine signifikante Anzahl von Beamten und Offizieren umfasste, verlieh ihr überproportionalen Einfluss auf Regierung und Gesetzgebung, aber Nicolais Beobachtungen zeigen, dass man die Beständigkeit tief verwurzelter traditioneller Werte als Hürde für Veränderungen nicht unterschätzen sollte. Die entscheidenden Faktoren jeder erfolgreichen Reform, egal wie begrenzt, waren generell der Wille eines Herrschers und die Verfügbarkeit von Beratern und Beamten, die die Gesetzgebung gestalteten und sie im möglichen Ausmaß umsetzten. Der spezifische Beitrag aufgeklärten Denkens lässt sich nicht präzis ermitteln. Die Reformen dieser Zeit waren Reaktionen auf eine Krise, die so gut wie alle Territorien durchmachten. Die meisten von ihnen orientierten sich dabei an gesetzgeberischen Traditionen aus dem späten 15. und 16. Jahrhundert. Während die Aufklärung in dem einen Territorium die Reformen geprägt haben mag, konnten interterritorialer Wetteifer und Wettstreit dafür sorgen, dass dieselben Reformen anderswo von Herrschern und Beamten umgesetzt wurden, deren Denken weniger »progressiv« war. Reformen zielten oft auf die Verbesserung der finanziellen Lage einer Regierung, aber wenn ein Territorium praktisch bankrott war oder gar unter Verwaltung einer kaiserlichen Schuldenkommission stand, war das selten möglich. Ebenso ließen sich Reformen selten gegen die Opposition der Territorialstände durchsetzen und wurden oft in Verhandlungen mit diesen gestaltet beziehungsweise entschärft und abgemildert. Simpler allgemeiner Widerstand an der Basis reichte oft aus, noch die sorgfältigst durchdachten Gesetzespläne zu durchkreuzen. Viele religiöse Reformen – etwa Anläufe zur Einführung neuer Gebets- und Gesangsbücher – wurden auf diese Weise verhindert, und wie üblich sahen viele Gesetze auf Papier beeindruckend aus, wurden aber schlicht ignoriert. 5 Das extrem beschränkte Personal der meisten Regierungen ist ein weiteres Indiz dafür, dass man ihre Handlungsfähigkeit nicht überschätzen sollte. Präzis
59. Die Folgen der Reformen: Immunität gegen eine Revolution?
beziffern lässt es sich wohl nicht. 1762 verfügte der gesamte österreichisch-böhmische Territorienverbund (außer Tirol und Vorderösterreich) über lediglich 20.584 Beamte, von denen 7.421 der Krone, 11.669 Grundherren und Städten sowie 1.494 den Ständen dienten; die Bevölkerung lag bei annähernd 5 Millionen. 6 In Brandenburg-Preußen verwalteten 1786 etwa 3.000 Beamte der Krone Territorien mit einer Gesamtbevölkerung von gut 8 Millionen Menschen. Selbst diese Zahl zeichnet wohl ein zu positives Bild, weil sie sicherlich auch Sekretäre und Schreiber umfasst. 1753 zum Beispiel lag die Verantwortung für die Administration sämtlicher preußischer Territorien inklusive Schlesien bei ungefähr 200 Beamten; das Generaldirektorium, die zentrale Koordinationsstelle, beschäftigte 1740 nicht mehr als 69 und selbst 1805 nur 149 Beamte. 7 In den kleineren und vor allem den weniger militarisierten Territorien waren die Zahlen bedeutend geringer. Der Weimarer Hofkalender von 1780 listet etwa 1.500 Leute auf, von denen die meisten jedoch höfische Funktionäre waren, die mit Regierung und Verwaltung nichts zu tun hatten. 8 Die südwestdeutsche Grafschaft (ab 1779 Fürstentum) Leiningen mit etwa 228 km 2 (plus gemeinsamem Besitz von weiteren 59 km 2) und ungefähr 20.000 Bewohnern wurde von der Hauptstadt Dürkheim aus von etwa zwanzig Beamten regiert. 9 Es überrascht daher nicht, dass Regierungen oft am erfolgreichsten waren, wenn sie Initiativen ihrer Territorialstände, der städtischen Gemeinden, der aufgeklärten oder patriotischen Gesellschaften aufgriffen oder auf allgemeine Strömungen in Landwirtschaft, Manufaktur und Handel reagierten. Zumindest konnten Herrscher dann den Erfolg für sich reklamieren und sich von der Allgemeinheit als »weise« und »vorausschauende« Regenten preisen lassen. Es ist kaum zu bezweifeln, dass die Regierung der habsburgischen Territorien in dieser Phase am aktivsten und in vielerlei Hinsicht »modernsten« war. 10 Maria Theresia (1740–1780, ab 1770 als Koregentin mit Joseph II.), Franz I. (Franz Stephan von Lothringen, obwohl rein formal nur Gatte der Herrscherin und heiligrömischer Kaiser 1745–1765) sowie Joseph II. (Koregent 1770–1780, Alleinherrscher 1780–1790 und heilig-römischer Kaiser 1765–1790) walteten mit ihren führenden Ministern Haugwitz in den 1740er und 1750er Jahren sowie Kaunitz von den 1760er Jahren bis in die 1790er Jahre über eine wahrhaftige Revolution der Regierungstätigkeit. Dabei bauten sie selbstverständlich auf weit zurückreichende habsburgische Traditionen: Seit dem frühen 16. Jahrhundert hatten die österreichischen Habsburger in dieser Hinsicht wiederholt neue Maßstäbe für die Territorien des Reichs insgesamt gesetzt. Früher Herrscher hatten ebenfalls zur fortschreitenden Konsolidierung der habsburgischen Länder beigetragen, vielleicht niemand mehr als Leopold I., Joseph I. und Karl VI. Die Pragmatische Sanktion von 1713, die Maria Theresias Thronfolge und ihre Macht über die Länder der österreichischen Habsburger im Reich und außerhalb
625
626
V. · Die deutschen Territorien nach 1760
sicherstellte, war der Höhepunkt einer über fast zwei Jahrhunderte unregelmäßig, aber beharrlich betriebenen Politik der Konsolidierung.Von 1740 an verursachten der Verlust von Schlesien und die anhaltende militärische Bedrohung durch Preußen ein systematisches Reformprogramm. Nach der ersten Niederlage leitete Haugwitz eine grundlegende Reform der administrativen Strukturen ein, ab 1744 im österreichischen Schlesien, ab 1747 in Innerösterreich und allgemein ab 1748. Sie umfasste die Schaffung neuer Zentralbehörden, neuer Regionalverwaltungen und eines umfassenden Systems von Kreisen oder Bezirken in den Regionen. Charakteristisch für diese Reformen war, dass sie in Zusammenarbeit mit den Ständen durchgeführt und nicht von oben oktroyiert wurden. Das Hauptziel war die effektivere Mobilisierung von Ressourcen, daraus ergab sich eine Masse weiterer Reformmaßnahmen. Der Wunsch, in Sachen Kultur und Bildung zu den protestantischen Regierungen aufzuschließen, führte zu Universitätsreformen und ersten Schritten zur staatlichen Kontrolle über die Kirche. Ökonomische und steuerliche Reformen zur Erhöhung der Einnahmen durch Maßnahmen wie die Schaffung eines einheitlichen Zollgebiets in den österreichischböhmischen Territorien (außer Tirol und Vorderösterreich) 1775 stechen ebenfalls heraus. 11 Die diversen Anläufe zu einer Volkszählung ab 1753 dienten den gleichen Zwecken: einerseits einer besseren Basis für die Einberufung zum Militär, andererseits der Maximierung der Steuereinnahmen. Bis 1770–1772 waren die Pläne dazu derart anspruchsvoll geworden, dass dekretiert wurde, jedes Haus in den habsburgischen Territorien solle eine eigene Hausnummer haben, um die fortlaufende Erhebung für die Zukunft zu erleichtern. 12 Wie bei so vielen Reformen dieser Zeit entsprach das Ergebnis nicht den Erwartungen: Lokaler Widerstand, unfähige Beamte und das schiere Ausmaß des Unternehmens verhinderte die Schaffung eines sinnvollen und akkuraten Datenbestands, von der Einrichtung eines regulären Verfahrens für die Zukunft ganz zu schweigen. Das vielleicht bemerkenswerteste Resultat war die Einführung von Hausnummern, weil zumindest sie auf Dauer bestehen blieben. Obwohl in der Praxis eine klare Kontinuität festzustellen ist, entwickelte sich das Denken hinter den österreichischen Reformen mit der Zeit. Maria Theresia und Haugwitz waren nicht von den Anliegen der Aufklärung motiviert, einige ihrer Mitarbeiter bei Bildungs- und Kirchenreformen jedoch durchaus. Franz I. könnte man als typischen Herrscher der frühen Aufklärung beschreiben, was jedoch vielleicht nicht mehr bedeutet, als dass er vielen der Prinzipien von Regierung und Verwaltung, die in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts »modern« waren, aufgeschlossen gegenüberstand und sie anwandte. 13 Insbesondere Franz I. war ein außerordentlich effizienter und einfallsreicher Verwalter der habsburgischen Besitztümer; unter ihm entstand der private Reichtum, den seine Nachfolger bis heu-
59. Die Folgen der Reformen: Immunität gegen eine Revolution?
te genießen. Dass sich Joseph II. an Prinzipien der Aufklärung orientierte, steht außer Zweifel, und viele seiner Reformen, vor allem sein Toleranzedikt und Kirchenreformen, dienten anderen Herrschern im Reich als Anregung und Vorbild. Die schiere Energie von Josephs Herrschaft war außerordentlich. Als Alleinherrscher von 1780 bis 1790 erließ er durchschnittlich 700 Dekrete pro Jahr, zwischen 1765 und 1780 waren es nur 100 jährlich gewesen. 14 Andererseits stießen viele der Rationalisierungsreformen, die eingeleitet wurden, nachdem Joseph nach dem Tod seiner Mutter 1780 Alleinherrscher geworden war, auf signifikanten Widerstand, vor allem die kirchlichen Reformen und Maßnahmen zur Umwandlung der Monarchie in ein einheitlich regiertes Gemeinwesen. 15 Leopold II. nahm viele der anstößigen Maßnahmen wieder zurück, um die Lage zu beruhigen, die Spannungen zwischen Zentralismus in Josephs Sinn und Regionalismus prägten die habsburgische Geschichte jedoch bis ins 20. Jahrhundert. Allein das zeigt, wie sehr Joseph II. in zehn Jahren als Alleinherrscher »an allen Säulen gerüttelt und den Staat beweget« hat, wie Herder schrieb. 16 Das lässt sich wahrscheinlich von keinem anderen deutschen Herrscher seiner Zeit behaupten. Joseph selbst sorgte sich in den letzten Wochen seines Lebens, er habe als Herrscher versagt. Dass er eine zu Kriegszeiten 400.000 Mann starke Armee hinterließ, das größte stehende Heer in Europa seit Ludwig XIV., spiegelt den Erfolg der Initiativen aller habsburgischen Herrscher seit Leopold I. wider. 17 Aber die erfolgreiche Entwicklung der habsburgischen Territorien wirft die Frage auf, ob »Österreich« an deren Ende dem Reich entwachsen war. Die Antwort ist nicht eindeutig. Die Pragmatische Sanktion und die diversen Versuche zur Vereinheitlichung unter Maria Theresia und Joseph II. stärkten zweifellos die österreichische Identität. Maria Theresia und in der Folge ihre Dynastie und deren Regierungen betonten die Verbindungen zwischen Österreich und dem Reich oder zumindest dem Kaisertitel durch die Annahme des Titels »Kaiserin-Königin« und die Einführung des Attributs kaiserlich-königlich (k. k.) für die administrativen Behörden und die Armee. 18 Man sprach jedoch nun zunehmend von der »österreichischen Monarchie« anstatt den Erbkönigreichen, -fürstentümern und -landen, wie sie seit dem späten Mittelalter genannt worden waren. Zugleich erhob die Änderung der Anrede der habsburgischen Erzherzöge und Erzherzoginnen und im 18. Jahrhundert aller männlichen und weiblichen Mitglieder der Dynastie von »erzherzogliche Durchlaucht« zu dem prestigeträchtigeren »kaiserliche Hoheit« sie ein Stück über den symbolischen Rang der Kurfürsten im Reich. 19 Und schließlich propagierten Autoren wie Joseph von Sonnenfels (* 1732, † 1817) in den 1770er Jahren die gleiche Art patriotischer Ideologie für Österreich wie andere für viele andere Territorien des Reichs. Österreich als »Vaterland« oder »Nation«, der die
627
628
V. · Die deutschen Territorien nach 1760
Vaterlandsliebe galt, war Thema eines zunehmenden Korpus an Literatur zwischen 1760 und 1788. 20 Die Verbreitung solcher Stimmungen schloss jedoch ebenso wie anderswo nicht das Gefühl aus, zum Reich zu gehören, und bedeutete nicht zwangsläufig eine Ablehnung des Reichs. Die österreichische Monarchie des späten 18. Jahrhunderts blieb in Hinblick auf einige Territorien im Reich, in Bezug auf andere, insbesondere Ungarn, außerhalb des Reichs. Was dem modernen Betrachter befremdlich oder gar widersprüchlich erscheint, war eine Realität, an die Zeitgenossen seit Langem gewöhnt waren. Österreich und Joseph II. in den Vordergrund zu stellen, widerspricht einer langen Tradition der deutschen Geschichtsschreibung, die Preußen und Friedrich dem Großen die erste Stelle einräumt. Tatsächlich sind beide miteinander verbunden. Die österreichischen Reformen waren letzten Endes eine Reaktion auf die nicht unberechtigte Angst vor Preußen ab 1740. Die preußischen Reformbemühungen wurden größtenteils von Sorge um Preußens Schwäche und Furcht vor Österreich angetrieben. Beide Monarchien waren selbstverständlich auch bestrebt, ihre Position als europäische Mächte zu erhalten, was – wie Friedrich der Große erkannte – Preußen mehr Sorge bereiten musste als Österreich. Wie Österreich existierte Preußen im Reich und außerhalb, was nicht zu einer Ablehnung des Reichs führte. Zudem strebte auch die preußische Krone wie die österreichische Monarchie die Schaffung einer geschlossenen Union ihrer grundverschiedenen Territorien an. Obwohl der Herrscher von Brandenburg formal nur König »in Preußen« war, sprach man beständig von der »preußischen Monarchie«. Zudem umfassten die neuen Residenzen des ostpreußischen Adels ab etwa 1710 immer häufiger »Königsstuben« nach dem Vorbild der »Kaisersäle«, die südwestdeutsche Äbte ab der Mitte des 17. Jahrhunderts in ihren neuen Residenzen einrichten ließen. 21 Diese liebevoll gestalteten, aber kaum genutzten Räume bildeten den zeremoniellen Kern der Residenz und belegten den wachsenden Sinn für Loyalität zur Monarchie. Preußen blieb jedoch an das Reich gebunden und selbst Friedrich der Große, der zu Anfang Österreich angriff und Verachtung für das Reich an den Tag legte, wurde mit seiner labyrinthischen Politik zu einem der größten Taktiker. 22 Auch der viel erforschte preußische Patriotismus während des Siebenjährigen Kriegs brachte keine grundlegende Veränderung. Der preußische Patriotismus ließ sich mit Treue zum Reich verbinden; aus der Unterstützung der preußischen Sache gegen Österreich, einem Gefühl der Überlegenheit der protestantischen Territorien und Stolz auf die preußische Führerschaft erwuchs keine Ablehnung des Reichs. 23 Zweifellos war Friedrich der Große für viele Zeitgenossen der archetypische aufgeklärte Herrscher und bleibt dies für viele Historiker. 24 Seine Ansichten zu Religion und Gedankenfreiheit, seine weitläufigen kulturellen Interessen und sein
59. Die Folgen der Reformen: Immunität gegen eine Revolution?
rationales Denken über Regierung, Außen- und Innenpolitik fand die Bewunderung vieler Zeitgenossen im Reich insgesamt und führender französischer wie auch preußischer Philosophen. 25 Zugleich ist nicht zu leugnen, dass die im Großen und Ganzen brutale Politik der preußischen Monarchie Friedrich und seinem Königtum herbe Kritik einbrachte. Lessing schimpfte bitter über die »Berlinische Freiheit zu denken und zu schreiben«, die eine Freiheit des Wortes zu politischen Belangen ausschließe: »Sie reducirt sich einzig und allein auf die Freiheit, gegen die Religion so viel Sottisen zu Markte zu bringen, als man will.« In Wirklichkeit, erklärte Lessing, sei Preußen »das sklavischste Land von Europa«. 26 Johann Joachim Winckelmann, der im Gegensatz zu Lessing aus Preußen stammte, schrieb 1763 an einen Schweizer Freund: »Es schaudert mich die Haut vom Haupte bis zu den Zehen, wenn ich an den Preußischen Despotismus und an den Schinder der Völker gedenke, welcher [das] von der Natur selbst vermaledeyte und mit Lybischen Sande bedeckte Land zum Abscheu der Menschheit machen und mit ewigen Fluche belegen wird.« Sein Hass, erklärte er in einem weiteren Brief, sei »nur persönlich und wider den König«. 27 Solche Ansichten waren nicht ungewöhnlich, allerdings gab man ihnen lieber in privaten Briefen als öffentlich Ausdruck. Unterm Strich jedoch sprechen genug Belege für die Ansicht, dass Friedrich mit der Proklamation der Religionsfreiheit und in seinen gesetzgeberischen und juristischen Reformen sowie in anderen Bereichen Ideale der Aufklärung zur Anwendung brachte. Vor allem war er ein Herrscher, der sich während seiner gesamten Regierungszeit mit den Ideen und Debatten der Aufklärung befasste; 1784 ordnete er sogar die Publikation von Entwürfen für Gesetze an, um sie öffentlich diskutieren zu lassen. 28 Verglichen mit Joseph II. war Friedrich zweifellos ein moderater und vorsichtiger Reformer. Die »Modernität« der preußischen Regierung konzentrierte sich auf die Aspekte, die für die Erhaltung der preußischen Macht entscheidend waren: Finanzverwaltung, Ansammlung von Vorräten, interne Kolonisation und Ansiedlung von Einwanderern, das Militärsystem. 29 Die relativ kleine, aber vergleichsweise moderne Verwaltung der Monarchie, gut ausgebildet und weitgehend frei von Korruption, fokussierte vor allem auf diese Aspekte. Friedrichs zentrale Regierungsführung war größtenteils alles andere als neuerungsträchtig; er arbeitete weiterhin mit dem unter seinem Vater geschaffenen Generaldirektorium, dem er lediglich neue Abteilungen hinzufügte, wenn neues Territorium dazugewonnen wurde. Die einzige neue Behörde, die 1772 eingeführte Régie, war relativ profitabel, aber so unbeliebt, dass sie zu Beginn der Herrschaft von Friedrich Wilhelm II. 1786 abgeschafft wurde. 30 Auch seine Wirtschaftspolitik folgte der Tradition, vertraute auf merkantilistische Import- wie Exportverbote und unternahm kaum Anstrengungen, eine Einheit der Territorien herzustellen,
629
630
V. · Die deutschen Territorien nach 1760
wie Joseph II. das 1775 versuchte. Zu einer Zollunion der preußischen Territorien kam es erst 1818. 31 Die Territorien, die im späten 18. Jahrhundert am meisten florierten, waren die am Niederrhein, in denen die Regierung am wenigsten intervenierte und die Beamte in Berlin als »Ausland« betrachteten. 32 Die Handelsmesse in Frankfurt an der Oder hingegen war infolge typisch kameralistischer Maßnahmen wie Transitzöllen und einer speziellen Messesteuer im Jahr 1775 praktisch gelähmt. 33 Im Allgemeinen neigte Friedrich zum Kompromiss mit traditionellen Institutionen und gesellschaftlichen Gruppen: Adelsprivilegien etwa blieben unangetastet und seinen Proklamationen religiöser Freiheit zum Trotz setzte er die Politik seiner Vorgänger in Bezug auf religiöse Minderheiten fort. 34 Mit innerem Widerstand, wie ihn Joseph bis 1790 erregte, sah sich Friedrich nie konfrontiert. Er vergrößerte seine Ländereien signifikant und hinterließ ein Guthaben von mehr als 50 Millionen Talern. 35 Seine Herrschaft prägte die preußische Monarchie ebenso grundlegend wie Joseph die österreichische. Aber seine Erfolge waren nicht stabil. 1797 hatte sich das von ihm hinterlassene Plus in Schulden von 32 Millionen Talern verwandelt und 1806 erlitt die preußische Armee, nur Jahrzehnte zuvor als eine der besten in Europa bewundert, eine demütigende Niederlage gegen Frankreich. Richtet man den Blick auf die mittleren und kleineren Territorien im Reich, bietet sich ein weniger klares Bild, zumal der Mangel an präzisen Informationen zu vielen von ihnen keine genaue Einschätzung zulässt. Die Bewertung des Zustands dieser Territorien am Ende des 18. Jahrhunderts wird oft dadurch überschattet, dass die meisten davon zwischen 1803 und 1815 von der Landkarte verschwanden. Als Grund dafür gilt, dass sie Anachronismen waren und daher keine modernisierenden Reformen durchführen konnten. Zweifellos waren viele der kleinsten Territorien eklatant verschuldet, was große Reformprogramme so gut wie unmöglich machte. Die schwäbische Grafschaft Montfort ging 1780 bankrott und wurde von den Habsburgern aufgekauft; der letzte Graf lebte bis zu seinem Tod 1787, mit dem die Linie erlosch, von einer bescheidenen Pension der Habsburger. Offenbar trugen die Habsburger jedoch selbst zu der finalen Krise von Montfort bei: Weil sie die Grafschaft wegen deren Stimmrecht im schwäbischen Kreis übernehmen wollten, vereitelten sie alle Anläufe zur Klärung der dortigen finanziellen Lage in den 1770er Jahren. 36 Die Grafschaft Waldeck wäre um ein Haar an Hessen-Kassel gefallen, an das sie ihre sämtlichen Ländereien verpfändet hatte. Ihre Unabhängigkeit rettete zum Teil die Intervention einer Kommission des Reichshofrats und die effektive »Außenpolitik« der Dynastie, wodurch Waldeck-Pyrmont überleben und nach 1815 unabhängiges Mitglied des Deutschen Bundes werden konnte. 37 In Territorien, die im späten 18. Jahrhundert unter Verwaltung kaiserlicher Schuldenkommissionen standen, führten oft die externen Administratoren selbst signifikante Veränderungen durch.
59. Die Folgen der Reformen: Immunität gegen eine Revolution?
Die Lage der Reichsstädte war gemischt. Viele, insbesondere in Oberdeutschland, die im 16. Jahrhundert eine so wichtige Rolle gespielt hatten, versanken nun in Schulden und innerer Lähmung. Die kleine Stadt Wimpfen am Zusammenfluss von Jagst und Neckar mit etwa 2.000 Einwohnern und ungefähr 33 km 2 Territorium zum Beispiel erholte sich nie von der Versorgungskrise von 1770–1772. 38 Selbst Ulm und Nürnberg standen in den letzten Jahrzehnten des Jahrhunderts am Rand des Bankrotts. 39 Andererseits konnten Nördlingen, Esslingen und Isny bis 1790 mithilfe kaiserlicher Schuldenkommissionen den größten Teil ihrer Schulden abbezahlen. 40 Andere, etwa Zell am Harmersbach und Aalen, blieben schuldenfrei. Heilbronn erlebte eine neuen Blütezeit, ebenso wie Lindau, das zum internationalen Zentrum des Textilhandels wurde und vom anhaltenden Aufschwung des schwäbischen Textilsektors profitierte. Große, florierende, weltstädtische Zentren wie Frankfurt am Main und Hamburg waren jedoch zweifellos die Ausnahme. Die meisten Reichsstädte waren klein und provinziell; manche, etwa Buchau, hatten kaum mehr als 1.000 Einwohner. Wenn es aber eine allgemeine Krise der süddeutschen Reichsstädte gab, dann erst in den letzten Jahren des Jahrhunderts als Folge der substanziellen Kosten der französischen Kriege. 41 Dennoch verhinderten die zunehmend schwierige Situation, wachsende innere Probleme und hohe Schulden nicht die Entwicklung einer Debatte über die Schlüsselthemen der Aufklärung. In Nürnberg zum Beispiel waren freier Handel und die Stadtverfassung selbst in den 1780er Jahren Gegenstand einer höchst wortgewandten und weitläufigen öffentlichen Diskussion. 42 Noch verblüffender ist der Fall der Kirchenterritorien. Hier stand die Bewertung oft unter dem Einfluss nicht nur ihrer Auflösung 1804, sondern auch der kritischen Debatte, die der von Philipp Anton von Bibra im Journal von und für Deutschland 1786 ausgeschriebene Aufsatzwettbewerb ausgelöst hatte, in dem nach Diagnosen der Schwächen dieser Territorien und Vorschlägen zur Abhilfe gefragt wurde. 43 Trotz Friedrich Karl von Mosers Lob der konstitutionellen Mechanismen, die eine Despotie in diesen Wahlgemeinwesen verhinderten, zeigte seine Kritik an ihrem Mangel an intellektueller Freiheit und Toleranz und sein Vorschlag, diese in weltliche Wahlgemeinwesen umzuwandeln, mehr Wirkung auf spätere Historiker. Tatsächlich waren die in vielen Kirchenterritorien in den 1770er und 1780er Jahren eingeleiteten Reformen genauso »modern« wie die in ihren weltlichen Pendants. Das Gleiche scheint auch für die kleineren klösterlichen Territorien zu gelten. 44 Die Situation der Reichsritter, von denen es um 1800 bis zu 500 mit etwa 10.000 km 2 Land und ungefähr 350.000–400.000 Bewohnern gegeben haben mag (unter zwei Prozent der Reichsbevölkerung), war ebenfalls unterschiedlich. 45 Im Rheinland waren sie überwiegend wohlhabend, auch wenn es einigen gelungen war, durch Extravaganz und Misswirtschaft spektakuläre Schuldenberge anzu-
631
632
V. · Die deutschen Territorien nach 1760
häufen. Ihre Verbindungen zu den großen rheinischen Kirchenterritorien, in denen sie Domkapitulare, Bischöfe und Erzbischöfe stellten, sorgten für Einkünfte und machten sie mit der Praxis aufgeklärter Reformen vertraut. Die schwäbischen und fränkischen Ritter hingegen litten offenbar stärker an Verschuldung und viele wurden von den zusätzlichen Kosten der militärischen Krisen der 1790er Jahre überwältigt. 46 Am akutesten waren die Probleme der protestantischen Ritter, die keine Aussichten auf eine Karriere in der Kirche hatten. Offenbar brachten ökonomische Schwierigkeiten viele von ihnen dazu, in den Dienst benachbarter Territorien wie Württemberg zu treten, was letztlich ihre Unabhängigkeit schwächte. Zahlreiche Familien fielen offenbar nach Klagen beim Reichshofrat in die Hände kaiserlicher Schuldenkommissionen. Zur Verschuldung der rheinischen und einiger schwäbischer Ritter gibt es detaillierte Analysen, dennoch ist über die Verwaltung ihrer Territorien und das Ausmaß ihrer Reformbemühungen wenig bekannt. 1789 indes appellierte Otto Heinrich von Gemmingen (* 1755, † 1836) anlässlich der Einführung eines neuen Ritterordens im Kanton der fränkischen Ritter im Odenwald an alle Reichsritter, in ihren Ländereien die Reformen durchzuführen, denen Joseph II. den Weg bereitet hatte. 47 Gemmingen wollte die Zukunft der Ritter sicherstellen, indem er deren traditionelle Verbindung zur Krone stärkte. Es ist bezeichnend, dass dies nun von einem Appell zu »moderner« Verwaltung der ritterlichen Länder begleitet war. Der Appell erschien 1790 im Journal von und für Deutschland. Andere Kantone der Reichsritter führten den exklusiven neuen Orden mit seinem Stern und den Worten Caesari et Imperio und Libertas ebenfalls ein. Wir wissen jedoch nicht, wie viele Ritter geneigt oder in der Lage waren, Gemmingens Aufruf zu Reformen in ihren Ländern zu folgen. Innerhalb weniger Jahre war die Unabhängigkeit der fränkischen Ritter erneut durch Preußen bedroht, das 1792 Ansbach und Bayreuth erwarb und sich sofort um regionale Hegemonie bemühte. Württemberg, Baden und Bayern zogen nach 1800 nach und bis 1805/06 verschwanden sämtliche ritterlichen Territorien von der Landkarte. 48 Das Ausmaß der Reformen in den mittleren Territorien ist besser belegt. Das gilt insbesondere für die, die bis ins 19. Jahrhundert überlebten und historiografische Traditionen einer Landesgeschichte entwickelten, um die Vorgeschichte ihrer erfolgreichen Wiedergeburt als souveräne Staaten zu dokumentieren. Abrisse zu Territorien wie Hannover, Sachsen, der Pfalz und Bayern zeigen sie auf je verschiedene Weise fest in der allgemeinen Tendenz aufgeklärter Staatsführung verankert, die in Deutschland kurz vor der Französischen Revolution vorherrschte. 49 In dieser Kategorie von Territorien stechen vielleicht nur die Herzogtümer Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg-Strelitz, die sich ab 1755 Verfassung und Landtag teilten, als Territorien mit minimalen Reformbemühungen heraus.
59. Die Folgen der Reformen: Immunität gegen eine Revolution?
Nach Generationen bitterer Konflikte schuf die konstitutionelle Einigung einen Status quo zwischen Herrschern und Adel, der im Wesentlichen bis 1918 erhalten blieb. Die beiden Herzöge besaßen zusammen etwa 85 Prozent der gesamten Landmasse und beide hüteten sorgfältig ihre Privilegien vor Eingriffen des anderen. Nicht einmal Napoleon gelang es, das gesetzliche System von Mecklenburg zu modernisieren. Das heißt jedoch nicht, dass Herrscher und Adel in den mecklenburgischen Herzogtümern unbeeinträchtigt von neuen Ideen und den Impulsen des internationalen Getreidehandels geblieben wären. Die Herrscher Friedrich (1756–1785) und Friedrich Franz I. (1785–1837) von Mecklenburg-Schwerin sowie Adolf Friedrich IV. (1752–1794) und Karl II. (1794–1816) von MecklenburgStrelitz beispielsweise waren alle auf ihre Art Reformfürsten und darauf aus, ihre Territorien nach den ruinösen inneren Konflikten der Jahrzehnte vor 1755 zu erneuern. Die Unveränderlichkeit des neuen konstitutionellen Status quo bremste jedoch alle daraus folgenden Veränderungen. 50 Im Reich insgesamt gab es sicherlich genug Belege für Reformtätigkeiten, um die positive Sicht vieler deutscher Beobachter auf die Welt, die sie bewohnten, zu rechtfertigen. Die Verteidigung des Reichs als Garant der Freiheit und die Behauptung, die deutschen Herrscher hätten die Reformen, die die Franzosen 1789 zu verlangen begannen, bereits in Angriff genommen, waren keine unrealistischen Antworten auf die Situation in den frühen 1790er Jahren. Freilich sah sich kein deutsches Territorium mit der Art von revolutionärer Krise konfrontiert, die sich in Frankreich in den 1780er Jahren entwickelte. Die Schulden deutscher Fürsten waren im Vergleich zu denen der französischen Monarchie unerheblich. Regelmäßige Interventionen kaiserlicher Schuldenkommissionen, vor allem in den kleineren Territorien, mögen für die betroffenen Dynastien demütigend gewesen sein und gefährdeten bisweilen deren Fortbestand. Sie trugen jedoch auch dazu bei, potenziellen Krisen zuvorzukommen und in vielen Regionen anhaltende Stabilität zu sichern. 51 Auffällig ist an der letzten Reformära im Reich im Allgemeinen die Zusammenarbeit zwischen Herrschern und Beamten, Regierungen und »aufgeklärten« Gruppen sowie die fortdauernde aktive Partizipation der Territorialstände und städtischer wie ländlicher Gemeinden. Es wäre übertrieben optimistisch, zu behaupten, die deutschen Territorien hätten um 1780 bereits die Art von reformierter Konstitutionalität erreicht gehabt, die sich die preußischen Revolutionäre 1848 vorstellten, und die Reaktion der 1790er Jahre und der napoleonischen Zeit hätte eine Kehrtwende zu der früheren absolutistischen Tradition von oben verordneter Politik bewirkt. 52 Diese Sichtweise würde der unsicheren Koexistenz von grundsätzlich autoritären Regierungen und körperschaftlichen Strukturen nicht gerecht. Zudem wäre die Gleichsetzung frühmoderner körperschaftlicher Partizipation mit moderner politischer Partizipation ziemlich fragwürdig. Die Reformen der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts
633
634
V. · Die deutschen Territorien nach 1760
symbolisieren eine natürliche Weiterentwicklung des deutschen Territorialregierungssystems, das sich ab dem 15. Jahrhundert herausgebildet hatte. Die allgemeine Betonung von wirtschaftlicher Entwicklung, Minderung der Armut, Bildung und gesetzgeberischen Reformen war eine Fortführung traditioneller Politik im Idiom des neuen Denkens. Bei aller Kritik an Kerninstitutionen wie Adel, Kirchenterritorien und Reichsstädten blieb die alte Ordnung im Reich funktionsfähig. Ihre erneute erfolgreiche Anpassung an veränderte Umstände vor 1806 legte die Grundlage für die Reformepoche, die der Auflösung des Reichs folgte. Die Erfolge deutscher Regierungen im späten 18. Jahrhundert mögen begrenzt gewesen sein, der Zustand ihrer Territorien veranlasste ihre Untertanen jedoch nicht zur Suche nach radikalen Alternativen. Das Verhältnis zwischen Untertan und Monarch war nicht von demütiger Unterwerfung, unpolitischem oder apolitischem Traditionalismus geprägt. Die öffentlichen Rituale der Monarchie um 1800 waren nach wie vor Ausdruck des frühmodernen Dialogs zwischen Herrschern und Beherrschten. Tatsächlich stießen die Versuche einiger Herrscher – oft aus Kostengründen –, traditionelle Rituale wie Huldigungen und Zeremonien zur Eröffnung von Landtagen zu straffen, oft auf Widerstand aus dem Volk. Kollektive Huldigungen verpflichteten einen Herrscher ebenso sehr, wie sie die Loyalität seiner Untertanen demonstrierten. Letztlich waren solche Rituale Ausdruck gegenseitiger Verpflichtungen, an die Herrscher ebenso gebunden waren wie Untertanen. Ihre Inszenierung bekräftigte eine funktionierende Beziehung. 53 Im Januar 1776 schrieb Christian Friedrich Daniel Schubart, wenn auch mit einer gewissen Ironie: »Aber es ist gewiß: weder Dummheit noch Phlegma, sondern reife Überlegung und Ordnungsliebe ist’s, die uns zur Subordination so geschmeidig macht.« 54 Im Jahr darauf hätte Schubart Grund genug gehabt, seine Ansicht zu revidieren, als ihn Herzog Karl Eugen von Württemberg für seine freimütigen kritischen Ansichten ohne Prozess für zehn Jahre ins Gefängnis werfen ließ. Seine Analyse der Einstellung der meisten seiner Zeitgenossen zu der Welt, in der sie lebten, traf jedoch weitgehend zu.
Anmerkungen 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Mörz, Absolutismus, 229. Fischer, Hohenlohe, 16–37, 214 f., 218–221. Neugebauer, »Absolutismus«, 33 f. Ders., Zentralprovinz, 146 ff. Borgstedt, Aufklärung, 41. Dickson, Finance I, 306–310, 438 f.; vgl. auch S. 248 f. Demel, Reich, 227; Wilson, Reich, 323; Neugebauer, »Preußen«, 466 f. Ich danke Stefanie Freyer (Jena) für diese Information. Kell, Leiningen, 20, 32 f.
59. Die Folgen der Reformen: Immunität gegen eine Revolution?
10 Vgl. zum Folgenden, wo nicht anders vermerkt: Hochedlinger, Wars, 267–290; Scott, »Reform«; Ingrao, Monarchy, 159–172, 178–219; Borgstedt, Aufklärung, 30–34. 11 Demel, Reich, 116. 12 Tantner, Ordnung, 34–57, 67–172. 13 Zedinger, Franz Stephan, 79–95, 224–231, 241–249. 14 Demel, Reich, 247. 15 Beales, Joseph II II, 688; vgl. auch S. 482 ff. 16 Beales, Joseph II II, 689. 17 Ingrao, Monarchy, 219. 18 Hochedlinger, Wars, 271; vgl. auch S. 437. 19 Benna, »Durchlaucht«, 2 f., 11–27. 20 Vocelka, Glanz, 277 f.; Bodi, Tauwetter, 63–67; Klueting, »Patriotismus«. 21 Braunfels, Kunst V, 283 f. 22 Press, »Friedrich«; Haug-Moritz, »Friedrich«. 23 Clark, Iron Kingdom, 219–230. 24 Vgl. Blanning, »Frederick the Great and »Enlightened Absolutism«; ders., »Frederick the Great and German Culture«; Borgstedt, Aufklärung, 24–30; Clark, Iron Kingdom, 183–189, 239–246. 25 Eine detaillierte Diskussion dieser Ansichten bietet Schröder, »Siècle de Frédéric«. 26 Nisbet, Lessing, 440. 27 Baeumer, »Klassizität«, 199; vgl. auch Sichtermann, »Winckelmann«, 130. 28 Möller, Vernunft, 303 f.; vgl. S. 565 f. 29 Neugebauer, »Preußen«, 481; vgl. zur preußischen Landgewinnung und Kolonisation Blackbourn, Conquest, 21–70. 30 Schui, »Figures«; vgl. auch S. 588. 31 Dipper, Geschichte, 176. 32 Demel, Reich, 244 f.; vgl. S. 326–329, 581. 33 North, Kommunikation, 67. 34 Whaley, »Tolerant Society?«, 184 ff. 35 Demel, Reich, 230 f. 36 NDB XVIII, 51–54; Demel, Reich, 208 f.; Schnettger, »Mediatisierung«, 43. 37 Murk, »Waldeck«; einen umfassenderen Überblick zu Waldecks Verschuldung und Politik zwischen 1792 und 1806 bietet Murk, Reichsterritorium, 33–139. 38 Schmidt, »Hungerrevolten«, 272 f.; Schroeder, »Finanzlage«, 296–301. 39 Schroeder, Reich, 14–17, 203–210, liefert einen nützlichen Abriss der Situation einer Reihe oberdeutscher Reichsstädte am Ende des 18. Jahrhunderts. 40 Schnettger, »Mediatisierung«, 43, 49. 41 Ebd., 48 f. 42 Seiderer, Formen, 142–191, 335–362, 485–541. 43 Vgl. S. 485, 549 f. 44 Schnettger, »Mediatisierung«, 44–48. 45 Vgl. zum Folgenden mit Angaben zur deutschen Forschungsliteratur Godsey, Nobles, 16– 47, 190–197. 46 Kollmer, Reichsritterschaft, und ders., »Reichsritterschaft«, liefern eine Fülle von Belegen. 47 Schmidt, »Adel«, 88 ff.; vgl. zu Gemmingen ADB VIII, 557 f.; er war Mitglied der pfälzischen Deutschen Gesellschaft. 48 Gagliardo, Reich, 227–241.
635
636
V. · Die deutschen Territorien nach 1760
49 Ingrao, »Introduction«, 286, und die vier folgenden Artikel zu Hannover, Sachsen, Pfalz und Bayern; vgl. auch Buchholz, »Ende«, und die sechs seinem Aufsatz vorangehenden Artikel zu Bayern, Hannover, Mecklenburg, Pommern, Rheinland und Sachsen. 50 Rudert, »Mecklenburg«, 53–63; DVG I, 793–798, 800–803; Karge, Geschichte, 105 ff., 109 ff.; ADB VII, 558 ff., und XV, 310 f.; Braunfels, Kunst I, 350–353. 51 Westphal, Rechtsprechung, 265–277; Ackermann, Verschuldung, 242–245; Hattenhauer, Reich als Konkursverwalter. 52 Diese Ansicht vertritt Ries, Obrigkeit, 456 ff. 53 Büschel, Untertanenliebe, 91–118, 347–352. 54 Dippel, Revolution, 359; vgl. auch Killy, Lexikon X, 408 ff.
VI. Krieg und Zerfall: Das Reich 1792–1806
60. Brüche und Kontinuitäten
I
m Juni 1789 erhielt Fürst Anton von Thurn und Taxis (1773–1805) ein Memorandum von seinem Hofmeister Josef Karl Theodor von Eberstein. Es enthielt detaillierte Vorschläge zur Konsolidierung und Erweiterung der schwäbischen Grafschaft Friedberg-Scheer, durch deren Erwerb 1786 die Familie Thurn und Taxis endlich ins Fürstenkollegium aufgerückt war. Nach jahrzehntelangen Einwänden der alten Fürstendynastien waren die bereits 1695 von Leopold I. erhobenen Thurn und Taxis nun im Besitz unumstritten »unmittelbaren« Territoriums. Nun, so Ebersteins Rat, musste es durch Zukäufe oder Gebietstausch erweitert werden, selbst um den Preis einer zeitweiligen substanziellen Verschuldung. Die Beamten des Fürsten sollten eine Liste von Ländereien erstellen, die die Dynastie erwerben konnte, mit Angaben zu ihren Einkünften und ihrem rechtlichen Status, damit zukünftige Thronfolger handeln konnten, wenn sich die Gelegenheit ergab. Ein solcher Plan müsse langfristig angelegt sein, erklärte Eberstein, er werde »vielleicht erst in 60 – 100 – 200 und mehreren Jahren zur Vollkommenheit gedeihen«. 1 Innerhalb von zwanzig Jahren wurde Friedberg-Scheer zahlreiche Male von französischen und österreichischen Truppen überrannt, zum Reichsfürstentum Buchau erweitert, dann mediatisiert und zwischen dem 1806 geschaffenen neuen Königreich Württemberg und dem Fürstentum Hohenzollern-Sigmaringen aufgeteilt. Das Haus Thurn und Taxis wurde somit Untertan der Herrscher der beiden Staaten, die dem 1806 geschaffenen Rheinbund angehörten, in dem ihre Ländereien lagen. Die Auflösung des Reichs im selben Jahr schien die Familienresidenz überflüssig zu machen, die zur Ernennung von Alexander Ferdinand von Thurn und Taxis zum Prinzipalkommissar im Reichstag 1748 begründet worden war. Das Ende des Reichs zog auch das Ende des lukrativen Postsystems der Dynastie nach sich. Es überlebte nur als Privatbetrieb in einigen südlichen Staaten; die Einnahmen wurden geschmälert, als Bayern es 1808 zum staatseigenen Monopol machte. Da sich das Verhältnis zu Württemberg und Bayern verschlechterte, erwog die Dynastie einen Umzug nach Frankfurt oder an einen der hessischen Höfe. Geklärt wurde die Lage erst, als Regensburg 1810 an Bayern fiel. Nun bemühte sich die bayerische Regierung, die Dynastie im Land zu halten, schließlich gab der Fürst 200.000 Gulden jährlich aus und sicherte das Einkommen von etwa hundert Familien. Als Anreiz zum Bleiben und Kompensation für den Verlust des Postmonopols erhielt Thurn und Taxis die Gebäude des ehemaligen Klosters St. Emmeram sowie
640
VI. · Krieg und Zerfall: Das Reich 1792–1806
die Herrschaften Wörth und Donaustauf. Das Wiener Abkommen von 1815 bestätigte schließlich den Verlust seiner Unabhängigkeit, er blieb jedoch Fürst mit dem Titel Durchlaucht und musste für sich und seinen gesamten Besitz keine Steuern bezahlen. Es fällt schwer, die Thurn und Taxis als Opfer der Geschichte darzustellen, obwohl sie selbst in zahlreichen Briefen mit der Bitte um Unterstützung nach 1806 genau das taten. Trotz Fürst Karl Alexanders Befürchtung, künftig nicht mehr als ein »armer Edelmann« zu sein, gelang ihm der Wiederaufbau eines höchst lukrativen Postbetriebs im Deutschen Bund nach 1815, der die Dynastie zusammen mit ihren diversen Ländereien zu einer der reichsten Familien des 19. Jahrhunderts in Europa machte. Obwohl sie 1918 ihre Privilegien und 1945 signifikante Ländereien in Böhmen und anderswo verloren, sind die Thurn und Taxis noch heute sagenhaft reich und residieren nach wie vor in dem gewaltigen Palast, der auf den Grundmauern des Klosters St. Emmeram errichtet wurde.Vielen anderen Fürsten erging es weniger gut, ganz zu schweigen von der Masse des Volks, Soldaten wie Zivilisten, den wahren Opfern dieser Epoche. Die Geschichte der Thurn und Taxis zeigt die schiere Geschwindigkeit und Komplexität der Veränderungen in den Territorien des Reichs ab den 1790er Jahren. Fürst Anton und sein Sohn Karl Alexander († 1827) wurden ständig von den Ereignissen überholt und waren nie sicher, welche Ländereien sie halten konnten und zu welchen Bedingungen. Ihr Leben war von Verhandlungen mit den Leuten geprägt, von denen ihr Schicksal abhing: dem Kaiser in Wien, den Herrschern von Württemberg und Bayern, Napoleon und zahlreichen anderen. Die Korrespondenz der Familie strotzt nur so vor besorgten Verweisen auf »stürmische Zeiten«, den »bevorstehenden Untergang« und einen »losbrechenden Sturm«. Die Welt schien beherrscht von Naturgewalten, gegen die menschliche Wesen machtlos waren. Das Schicksal von Millionen Deutschen dieser Zeit spiegelt die Erfahrungen der adligen Dynastie wider. Das Empfinden, die Welt werde ununterbrochen erschüttert, die Zeit eile plötzlich außerordentlich schnell dahin, nichts werde je wieder sein, wie es war, ist das Leitmotiv vieler Briefe und Erinnerungen aus dieser Epoche. »[U]nsere Zeit aber hat das völlig Unvereinbare in den drei jetzt gleichzeitig lebenden Generationen vereinigt«, schrieb der Gothaer Buchhändler und Verleger Friedrich Perthes (* 1772, † 1848) 1818. »Die ungeheuren Gegensätze der Jahre 1750, 1789 und 1815 entbehren aller Uebergänge und erscheinen nicht als ein Nacheinander, sondern als ein Nebeneinander in den jetzt lebenden Menschen, je nachdem dieselben Großväter, Väter oder Enkel sind.« 2 Immerhin überlebte Perthes und erlebte in der neuen Ära nach 1815 wie Thurn und Taxis eine Blütezeit. Für viele Teile Deutschlands waren die fünfundzwanzig Jahre zuvor schlichtweg verheerend. In den ersten Kriegsjahren nach 1792 war das Rheinland Hauptleidtragender der Kämpfe. Ab 1796 litt Süddeutschland grausam
60. Brüche und Kontinuitäten
unter fast durchgehenden Gefechten und Besetzungen mit besonders schlimmen Verlusten 1796, 1799, 1805, 1809 und 1813–1815. Nach 1806 waren auch andere Gegenden in Mittel- und Norddeutschland betroffen. In ganz Europa kamen in den Kämpfen von 1792 bis 1815 etwa fünf Millionen Soldaten und eine Million Zivilisten ums Leben. 3 Wer überlebte, hatte noch lange an den Kosten zu tragen. Zahlungen an das Reich, für Truppen und Selbstverteidigung in den Territorien, Quartiere, Bedarfsanforderungen und die Erhebung von »Kontributionen« durch eigene und feindliche Armeen sowie schlichte, oft regelmäßige Plünderungen und Brandschatzungen bürdeten Regierungen, Gemeinden und Einzelnen enorme Belastungen auf. Die Kleinstadt Stockach im Hegau am Bodensee zum Beispiel musste bei gerade 880 Einwohnern zwischen 1792 und 1815 mehr als 1,1 Millionen Soldaten versorgen. Die dadurch aufgelaufenen Schulden zahlte sie fast ein Jahrhundert lang ab.4 Zeitgenossen brauchten keine Statistiken, um zu erkennen, dass dies ein Konflikt von einem seit dem Dreißigjährigen Krieg nicht mehr erlebten Ausmaß war. Friedrich von Gentz (* 1764, † 1832) nannte ihn 1800 den »grausamsten Weltkrieg, der je die Gesellschaft erschütterte und auseinander riß«. 5 Inmitten dieser Wirren mag die Auflösung des Reichs am 6. August 1806 relativ irrelevant erscheinen. Das Auftreten neuer souveräner Staaten und des reformierten, vergrößerten Königreichs Preußen sowie die frühen Anfänge einer deutschnationalen Bewegung schienen letztlich wichtiger, vor allem da sie offenbar zur Bildung des deutschen Nationalstaats von 1871 führten. Ab den 1850er Jahren war man sich weitgehend einig in dem Mythos, das Reich sei einfach zusammengebrochen und sang- und klanglos untergegangen. Selbst heute noch meinen viele Historiker, kaum ein Deutscher habe dem Reich eine Träne nachgeweint, man habe es mit einem Schulterzucken hinter sich gelassen. 6 Die Frage, wie die Menschen tatsächlich auf die Auflösung des Reichs reagierten und mit seinem Erbe umgingen, wird uns noch beschäftigen. 7 Im gegenwärtigen Kontext ist eine andere Einschätzung über die Auflösung des Reichs 1806 von Bedeutung: Man habe darauf nicht weiter reagiert, weil des Ende des Reichs unvermeidlich gewesen sei. Die Gründe für das Ende des Reichs sind umstritten. 8 Selbst die deutschen Historiker, die im letzten halben Jahrhundert am meisten darum bemüht waren, sein Ansehen wiederherzustellen, haben die Bandbreite der Argumente nicht sonderlich erweitert. Die meisten meinen nach wie vor, das Verschwinden des Reichs sei unvermeidlich gewesen, weil es der Entwicklung Deutschlands zu einer modernen Nation (nach Ansicht von Treitschke und anderen seit den 1870er Jahren) beziehungsweise einer modernen Gesellschaft (in der Sicht von Karl Otmar von Aretin und anderen seit den 1960er Jahren) im Weg stand. 9 Eine andere Lehrmeinung aus dem 19. Jahrhundert, die sich bis heute hält, macht in erster Linie die Feindseligkeit und Konkurrenz zwischen Österreich und Preußen ab etwa 1740
641
642
VI. · Krieg und Zerfall: Das Reich 1792–1806
verantwortlich für den Zusammenbruch des Reichs. Beide Argumentationslinien, die in vielen Werken verbunden sind, werfen Probleme auf, vor allem, wenn sie auf die 1790er Jahre und die Zeit danach fokussieren. Seit dem frühen 19. Jahrhundert ist die meistverwendete Bezeichnung für der Zustand des Reichs in seiner letzten Phase »morsch«. Auch zeitgenössische Kritiker beschrieben das Reich allzu oft als alt oder »gotisch«; Schiller schrieb bekanntlich 1802 von den »gotischen Ruinen einer alten barbarischen Verfassung«. 10 Dass es sich als unmöglich erwies, das Reich zu reformieren, ist unbestreitbar, obwohl in den letzten fünfzehn Jahren seiner Existenz weiterhin viele Vorschläge dazu vorgelegt wurden. Problematischer ist aus Sicht der Argumente, die den vermeintlich endgültigen Niedergang des Reichs betonen, indes die Tatsache, dass das Reich und seine Institutionen während der 1790er Jahre einen bemerkenswerten Aufschwung erlebten. Vielversprechender scheint auf den ersten Blick eine andere Variante der These vom todgeweihten Anachronismus. Wenn das Reich im Grunde eine überholte feudale Ordnung war, die sich an die Tradition klammerte und ewig zurück-, aber nie nach vorn blickte, erscheint es logisch, dass die Kräfte der Modernisierung, die sich nach 1789 aus Frankreich ausbreiteten, es hinwegfegen mussten. So sei es dann zum Triumph des modernen Staats in Deutschland gekommen. Österreich und Preußen hatten lange vor 1789 den Weg bereitet. Nach 1805 zogen dann Württemberg, Baden, Bayern und die anderen nach, die zwischen 1806 und 1815 souverän wurden und von der Neuverteilung der Gebiete der enteigneten kirchlichen und weniger bedeutenden weltlichen Herrscher profitierten. Diese Entwicklungen waren jedoch eher Folgen der Kriege als Auswirkungen irgendeines unaufhaltsamen Modernisierungsprozesses. Wie wir gesehen haben, waren die kirchlichen und anderen Territorien, die zwischen 1803 und 1806 verschwanden, nicht per se funktionsunfähig. 11 Zumindest anfangs war der Konflikt zwischen Frankreich und dem Reich nicht einer zwischen einem modernen Staat und einem Relikt aus der Vergangenheit. Tatsächlich war das Reich einige Zeit in der Lage, sich recht wirkungsvoll zu verteidigen. 12 Der Konflikt steht auch nicht für den Zusammenprall einer dynamischen, sich modernisierenden kapitalistischen Gesellschaft und einer rückwärtsgewandten Feudalordnung. Einige Gegenden des Reichs waren, was die Produktion angeht, wirtschaftlich ebenso dynamisch wie die dynamischsten Regionen Frankreichs. In Sachsen, Böhmen, Berg und anderen Teilen des Niederrheins sowie Südwestdeutschlands waren gegen Ende des 18. Jahrhunderts die Fundamente für eine industrielle Revolution bereits gelegt. 13 In großen Teilen Norddeutschlands erwies sich die feudale Ordnung als bemerkenswert empfänglich für die internationalen Getreidemärkte und ländliche Produzenten anderswo im Reich scheinen ebenfalls in höherem Maß marktorientiert und kommerziell eingestellt gewesen zu sein, als
60. Brüche und Kontinuitäten
traditionelle Darstellungen der alten Ordnung nahelegen. Der Fortbestand eines starken Rahmens herrschaftlicher Regulierung war vor dem Hintergrund des Kriegs nicht unbedingt eine Quelle der Schwäche, sondern erleichterte vielmehr die Mobilisierung von Ressourcen. In den meisten Belangen ähnelte das Reich dem Rest von Zentraleuropa und teilte seine letztliche Machtlosigkeit gegenüber der französischen Militärmacht mit den Niederlanden, der Schweiz, Italien, Spanien und selbstverständlich Österreich und Preußen. Auch die Rolle von Österreich und Preußen ist alles andere als eindeutig. Zweifellos hatte ihre Feindschaft die Politik des Reichs seit der Thronbesteigung Friedrichs des Großen 1740 geprägt. Der Kampf um Schlesien beschäftigte sie mehr als zwanzig Jahre bis 1763. Danach wandelte sich die gegenseitige Feindseligkeit zwischen Österreich und Preußen in einen Wettstreit um Einfluss im Reich. Preußen setzte alle Hebel in Bewegung, um seine Hegemonie in Norddeutschland durchzusetzen und zugleich jeden Anlauf Josephs II. zu blockieren, die kaiserliche Macht über das Reich und seine Institutionen wiederherzustellen und die habsburgischen Territorien durch die Aneignung von Bayern zu erweitern. Aber das Gleichgewicht der Kräfte im Reich war wohl recht stabil. Der Fürstenbund, gegründet von einer Gruppe weniger bedeutender Fürsten und praktisch aufgelöst, als Preußen ihn zu übernehmen versuchte, belegte eine neue Art von Balance. Weder Österreich noch Preußen allein konnte das Reich gegen den Widerstand der anderen Territorien untergraben. Wenn sie kooperiert hätten, wäre es ihnen freilich möglich gewesen, das Reich zu zerstören, aber eine solche Zusammenarbeit war in der Vergangenheit kaum je denkbar gewesen. Abgesehen von allem anderen waren beide zu besorgt, der andere könne die Gelegenheit ergreifen, ihn in ein schlechtes Licht zu stellen, und die deutschen Stände gegen ihn mobilisieren. Tatsächlich sorgte die Uneinigkeit der beiden über eine Intervention zur Wiederherstellung der Ordnung in Lüttich 1789, wobei die Preußen Wien ausmanövrierten und damit die österreichische Macht in Belgien zu untergraben drohten, erneut für eine Krise. Das Ergebnis war jedoch, dass Wien und Berlin vor einem offenen Konflikt zurückschreckten und im Juli 1790 die Reichenbacher Konvention schlossen. 14 War die österreichisch-preußische Wiederannäherung 1790 eher eine Bedrohung für das Reich als ihre Feindschaft? Viele deutsche Fürsten dachten sicherlich so. Unter den Bedingungen der Konvention gaben Wien und Berlin ihre Pläne für eine Expansion im Osten auf, die der eigentliche Grund der wachsenden Spannungen gewesen waren. Es war jedoch nur eine Frage der Zeit, dass diese Pläne wieder aufgegriffen würden. Im Osten war dann ein neuer Konflikt unvermeidlich, wobei beide versuchen würden, Russland auf ihre Seite zu bringen. Wenn die Pläne im Osten scheiterten, war absehbar, dass sie sich nach Westen richten würden, wodurch das Reich bedroht gewesen wäre. Schließlich hatten beide Mächte unerfüllte
643
644
VI. · Krieg und Zerfall: Das Reich 1792–1806
Ambitionen im Reich: Österreich schielte auf Bayern, Preußen auf Jülich und Berg sowie die Säkularisierung kirchlicher Territorien. Ab 1792 veränderte der Krieg all diese Optionen. Wien und Berlin arbeiteten Pläne aus, sich für die Kosten des Krieges schadlos zu halten. Zugleich blieb Preußen entschlossen, sich neue Gebiete in Polen zu sichern, wenn sich die Möglichkeit ergab. Das erneute Eingreifen von Russland dort zwang Preußen 1793 zum Handeln. Der Ausschluss Österreichs von der zweiten Teilung verstärkte Wiens Misstrauen gegenüber Berlin und die Entschlossenheit von Franz II. und seinen Beratern, nicht wieder den Kürzeren zu ziehen. Österreichs Beteiligung an der Niederschlagung des Kościuszko-Aufstands 1794 sicherte seine Einbeziehung in die dritte und letzte Teilung 1795. 15 Das Problem im Osten war damit gelöst, was die teilenden Mächte betraf, indem Polen für mehr als ein Jahrhundert von der Landkarte verschwand. Das hatte für das Reich mehrere Folgen. Karl Otmar von Aretins Deutung besagt, dass Wien und Berlin nach dem Tod Leopolds II. von schwachen, inkompetenten Monarchen regiert wurden, die den Ernst der Lage nicht begriffen, sich nicht um Deutschland und das Reich scherten und nur an territorialen Zugewinnen interessiert waren. 16 Beide Mächte verwandten signifikante Ressourcen auf Polen. Vor allem Preußen war so überlastet, dass es bereits 1793 versuchte, sich seinen Verteidigungspflichten im Reich zu entziehen. 1795 hatte sich Berlin völlig aus dem Krieg gegen Frankreich zurückgezogen und nach dem Frieden von Basel blieben Preußen und ein Großteil des nördlichen Reichs ein Jahrzehnt lang neutral. Österreich trug die Hauptlast des Kriegs gegen Frankreich und lud sich damit enorme Kosten auf. Anders als Preußen beharrte es auf dem Krieg, obwohl im Reich wiederholt Stimmen für einen Frieden mit Frankreich laut wurden. Was waren die Motive? Aretin meint – und viele folgten dieser These –, Österreichs Kriegführung habe mit dem Reich nichts zu tun gehabt und sich in mancher Hinsicht sogar gegen das Reich gerichtet. Das Reich, argumentiert er, sei ab 1763 kaum mehr als ein Mittel zum Zweck im Machtkampf zwischen Österreich und Preußen gewesen. 17 Joseph II. sei mit guten Vorsätzen angetreten, habe letztlich eine Politik betrieben, die auf irrationalen Annahmen beruhte. Leopold II. habe es gut gemeint, sei jedoch zu früh gestorben. Sein Nachfolger, der vierundzwanzigjährige Franz II., sei unfähig und am Reich nicht interessiert gewesen, habe den alten Kaunitz beiseitegeschoben und auf Berater vertraut, die dem Reich feindlich gesinnt waren. Insbesondere Franz Maria von Thugut (* 1736, † 1818), von März 1793 bis 1801 für Österreichs auswärtige Angelegenheiten zuständig, »sah in der Vergrößerung Österreichs das eigentliche Ziel seiner Politik«. 18 Unter der mal verzagten, mal ungestümen Führung von Franz II. und Thugut habe Österreich das Reich nicht nur aufgegeben, sondern in Wirklichkeit zerstört. Franz II. und Thugut sind seit dem 19. Jahrhundert umstritten. Treitschke be-
60. Brüche und Kontinuitäten
schrieb den Kaiser als schwachen Charakter, der »mit der ganzen Starrheit eines gedankenleeren Kopfes« an »das althabsburgische AEIOU« glaubte. 19 Viele Zeitgenossen beneideten und verachteten Thugut und hielten ihn für einen zweitklassigen Emporkömmling. Der propreußische Historiker beschuldigte Thugut 1853 in seiner Geschichte der Revolutionszeit, Deutschland dem Ungetüm des revolutionären Frankreich geopfert zu haben, da Österreich verzweifelt nach territorialen Zugewinnen strebte. Sybel zufolge war Thugut Preußen so feindlich gesinnt, dass sich Berlin 1795 aus dem Krieg gegen Frankreich zurückziehen musste, um Preußen vor den Habsburgern zu schützen. 20 Sybels bizarre Rechtfertigung des Friedens von Basel hat sich nicht bewährt. Aber obwohl insbesondere einige österreichische Historiker versuchten, Thugut gegen Sybels Anschuldigungen in Schutz zu nehmen und Franz II. in ein günstigeres Licht zu rücken, blieb die negative Meinung über den Kaiser und seine Berater zum Großteil bestehen. 21 Gelehrte des 19. Jahrhunderts verurteilten sie auf moralischer Grundlage als Verräter der deutschen Sache. Moderne Gelehrte brandmarken sie als bürokratisch, inkompetent, desorganisiert, kurzsichtig, starrköpfig und chronisch unentschlossen. Beide Fälle sind weniger eindeutig, als ihre Kritiker behaupten. Wie seine beiden Vorgänger aus dem Haus Habsburg-Lothringen, Joseph II. und Leopold II., begriff Franz möglicherweise sehr genau, wo Österreichs letztliche Interessen lagen. Seine Erziehung und Bildung hatten ihn jedoch auf die Kaiserkrone und die Verantwortung für das Reich vorbereitet. 22 Sein hauptsächlicher Lehrer war Franz Karl Graf von Colloredo-Waldsee (* 1736, † 1806), dessen Familie die beiden letzten Reichsvizekanzler stellte, Joseph und Franz Gundakar von Colloredo. Michael Ignaz Schmidt, der Autor der ersten Geschichte der Deutschen, sorgte für seine historische Bildung. 23 Es ist bezeichnend, dass Franz dafür sorgte, dass sein jüngerer Bruder, Erzherzog Anton Viktor (* 1779, † 1835), von Franz von Zeiller 1795 bis 1797 fachkundig über das Reich unterrichtet wurde. Die Einweisung begann mit der Feststellung: »Das deutsche Reich ist eine beschränkte Monarchie«, und erklärte das Reich Pütters moderner Doktrin gemäß als »zusammengesetzten Staat«, der »aus kleinen Staaten besteht«. 24 Zudem erinnerte sich Franz nach dessen Auflösung stolz an das Reich. Im Thronsaal seiner 1801 bis 1836 erbauten romantisch-mittelalterlichen Franzensburg im Park von Laxenburg sind Bilder seiner Krönung in Frankfurt 1792 und der anschließenden Feierlichkeiten zu sehen. 25 Die Vorwürfe gegen Thugut erscheinen auf den ersten Blick plausibler. Zweifellos verfolgte er zahlreiche Pläne zur Aneignung weiteren Territoriums; tatsächlich kam er genau deshalb an die Macht, weil dies seinem Vorgänger bei der zweiten Teilung von Polen nicht gelungen war. Zudem formulierte er 1793 einen außerordentlichen Plan für eine grundlegende territoriale Umgestaltung des
645
646
VI. · Krieg und Zerfall: Das Reich 1792–1806
Reichs. Österreich, Preußen und die Pfalz sollten die Verteidigung des Reichs auf der ganzen Länge des Rheins von Basel bis Luxemburg übernehmen und einen »ewig schützenden Brustharnisch« gegen Frankreich schaffen. Den drei kirchlichen Kurfürsten am Rhein sollten Bistümer im Osten übertragen werden. Das hätte das Reich zerstören können, wenn irgendjemand zugestimmt hätte. 26 Der radikale Plan wurde jedoch nie umgesetzt und mit Sicherheit spielte das Reich in Thuguts Denken über den Krieg während seiner gesamten Amtszeit eine Schlüsselrolle. Erstens war die französische Nation nun ein formidabler Feind, der »nicht nur selbst äußerst fanatisch geworden, sondern auch die andern Völker mit sich zu reißen sucht und ihr dermaliges Unternehmen durch Stimmung der Geister in ganz Europa schon längstens vorbereitet, sich an allen Höfen, in allen Armeen, in allen Kabinetten geheime Anhänger verschafft«. 27 Thugut war von Anfang an unbeirrbar davon überzeugt, dies sei eine ideologische Konfrontation, und glaubte die ganzen 1790er Jahre hindurch, Friede sei nicht möglich. Zweitens glaubte er, Österreichs Schicksal sei untrennbar mit dem des Reichs verstrickt: Falls das Reich nicht willens oder in der Lage sei, sich zu verteidigen, müsse es reformiert werden, um seine Auslöschung zu verhindern. Franz II. und Thugut waren in ihrer Haltung zum Reich wesentlich mehrdeutiger, als viele, die Österreich und das Reich als Optionen betrachten, die sich gegenseitig ausschlossen, nahelegen. Im August 1796 schrieb Franz II. an seinen Bruder Joseph, den ungarischen Palatin: »Ein gutes und ehrbares Ende dieses Kriegs« hänge »von der Herstellung der Dinge im Reich« ab. Wiederholt allerdings vereitelten französische Siege ein erfolgreiches Ende. Nach der erneuten Niederlage seiner Armeen bei Hohenlinden im Dezember 1800 notierte Franz erschöpft: »Wir sind zweifellos verpflichtet, uns den Umständen zu beugen.« 28 Jenseits aller politischen Fehler und ungeschickter Kommunikation mit den Verbündeten im Reich führte letztlich die Verbindung zweier Faktoren zum Untergang des Reichs. Erstens schuf die französische Konfiszierung deutscher Rechte und Besitztümer im Elsass 1789 und 1790 einen neuen, instabilen Rahmen, zumal zunehmend klar wurde, dass der Verlust endgültig war und Entschädigung nur aus dem Reich selbst kommen konnte. Zweitens schwächte mehr als ein Jahrzehnt der militärischen Konfrontation mit Frankreich die Mehrheit der deutschen Territorien, darunter Preußen und sogar Österreich, derart, dass sie gegen die Zerstörung des Reichs durch Frankreich letztlich machtlos waren.
Anmerkungen 1 2
Grillmeyer, Habsburgs Diener, 160 ff.; Schlip, »Fürsten«, 287 ff.; die folgenden Passagen beruhen auf Grillmeyers Buch, insb. Kap. 2 und 3. Wehler, Gesellschaftsgeschichte I, 546.
60. Brüche und Kontinuitäten
3 Planert, Mythos, 67–96. 4 Vgl. zu den Kriegskosten Planert, Mythos, 212–227 (zu Stockach S. 220); Stockach gehörte bis 1805 zu Vorderösterreich, dann bis 1810 zu Württemberg und danach zu Baden. 5 Planert, Mythos, 96. 6 Burgdorf, »Untergang«, 567 f., 573; ders., Weltbild, 154 f. 7 Vgl. S. 741–744. 8 Einen guten, konzisen Überblick bietet Mader, Priester, 26–32. 9 Diese Argumentation vertrat zuletzt Stollberg-Rilinger, Verfassungsgeschichte, insb. 314– 318. 10 Schiller, Werke I, 474; vgl. zur Datierung von Schillers unveröffentlichtem Gedichtentwurf, der nach seiner Entdeckung 1871 den Titel Deutsche Größe erhielt, Schmidt, »Universalismus«, 20 ff. 11 Vgl. S. 630 ff. 12 Blanning, Origins, 69 f., 120–123; Hochedlinger, Wars, 416. 13 Blanning, »Modernization«, 123 f.; Ogilvie, »Industrialisation«; vgl. S. 522–528, 576–582. 14 Simms, Struggle, 56, bezeichnet dies als »the real revolution in German politics«. 15 Scott, Birth, 209 ff. 16 Aretin, Heiliges Römisches Reich I, Reich zum Bund sowie Altes Reich III. 17 Ders., »Europäische Politik«, 26. 18 Ders., Reich zum Bund, 71; in der deutschen Literatur wird oft der Name Johann Amadeus Franz de Paula von Thugut genannt, tatsächlich benutzte er jedoch während seiner gesamten Karriere den Namen Franz Maria; vgl. Roider, Thugut, 7. 19 Ziegler, »Franz II.«, 289; Roider, Thugut, 118 f.; vgl. auch Ziegler, »Kaiser Franz II. (I.)«. 20 Roider, Thugut, XIV–XV. 21 Vgl. z. B. Aretin, Heiliges Römisches Reich I, 274–277, 505 f.; Aretin, Altes Reich III, 404 ff. 22 Ziegler, »Franz II.«, 292 f. 23 Vgl. S. 211, 506; vgl. auch Hattenhauer, Wahl, 68 f. 24 Wagner, Staatsrecht, 7–21, 43, 49. 25 Ziegler, »Franz II.«, 292 f. 26 Aretin, Heiliges Römisches Reich I, 277 f., und II, 249–255; Roider, Thugut, 128 ff. 27 Aretin, Heiliges Römisches Reich II, 254 f. 28 Ziegler, »Franz II.«, 296, 300.
647
61. Das Reich in den Revolutionskriegen
D
ie Hoffnung Leopolds II., eine zurückhaltende Politik gegen Frankreich werde einen Konflikt vermeiden, erwies sich als illusorisch. Ob es ihm gelungen wäre, die Lage zu kontrollieren, wenn er noch gelebt hätte, ist zweifelhaft. Sowohl er als auch seine Berater unterschätzten stets die Bedeutung der Ereignisse in Frankreich. Kaunitz bezeichnete die Revolution anfangs als »französischen Unsinn«, ein lokales Gerangel, in das Außenstehende nicht eingreifen mussten. 1 Kaunitz und Leopold empfanden beträchtliche Sympathie für jene, die in Frankreich etwas verändern wollten. Sie glaubten, Ludwig XVI. sei ganz allein selbst schuld an seinen Schwierigkeiten, und hielten eine Verfassungsreform für die beste Abhilfe. Als Ludwigs Lage zunehmend prekär wurde, ignorierte Leopold die Bitten des Comte d’Artois und anderer, zu handeln, und glaubte, strenge Mahnungen an die Revolutionäre reichten aus, ihre radikaleren Anhänger in Schach zu halten. Tatsächlich verschärften Leopolds öffentliche Erklärungen und Warnungen an die Revolutionäre die Lage in Paris. Zur gleichen Zeit ließen zwei Probleme eine Konfrontation zwischen Frankreich und dem Reich zunehmend wahrscheinlich erscheinen: die Konfiszierungen deutschen Besitzes im Elsass und die Aktivitäten französischer Emigranten in Deutschland. Die Konfiskation der Besitztümer und Gerichtsbarkeiten deutscher Herrscher im Elsass sorgte für Druck auf deutscher Seite. Schließlich hatte der Vertrag von Münster 1648 diesen Besitz auf ewig garantiert, ebenso wie die religiösen Klauseln des Vertrags von Osnabrück. Es ist richtig, dass Ludwig XIV. den französischen Zugriff in der Gegend verstärkt hatte, besonders durch die Einverleibung der zehn elsässischen Reichsstädte im Zuge der Reunionen zwischen 1679 und 1688. Obwohl das Reich aber diese Verluste im Frieden von Rijswijk 1697 akzeptierten musste, blieben viele Bestimmungen der Vereinbarung von 1648 das ganze 18. Jahrhundert über in Kraft und trotz der Ansiedlung französischer Beamter hatte die Region ihren deutschen Charakter behalten. An der Straßburger Universität etwa wurde französisches wie deutsches Recht unterrichtet und es gab Vorlesungen auf Deutsch und Latein. 1770/71 studierte Goethe dort, entwickelte, angeregt von Herders Gesellschaft, eine Leidenschaft für die Sprache und Literatur der Deutschen und entdeckte den authentisch deutschen Stil der Gotik in der dortigen Kathedrale. Auch Metternich war 1788–1790 dort Student und ging nur wegen der Revolution weg. 2
61. Das Reich in den Revolutionskriegen
Die Maßnahmen nach 1789 gingen weit über die Reunionen Ludwigs XIV. hinaus. Unter Bruch aller vertraglichen Verpflichtungen beschlagnahmte Frankreich, eine der Garantiemächte des Westfälischen Friedens, einfach Besitz und Rechte. Anfangs rechnete man damit, dass die Besitzer entschädigt würden, und Ludwig XVI. wurde um eine Liste der Betroffenen ersucht. Kompliziert wurde die Sache, da es um zwei recht unterschiedliche Arten von Rechten ging. Rechte weltlicher Herrscher auf Besitz, der Pacht und Ähnliches abwarf, waren leicht zu entschädigen. Diözesane Rechte von Bischöfen waren problematisch, weil sämtlicher Kirchenbesitz in Frankreich am 2. November 1789 konfisziert worden war und die Nationalversammlung nicht geneigt war, deutsche Bischöfe für etwas zu entschädigen, was man als antiquierte Privilegien betrachtete. Anfängliche Kompensationszusagen an einzelne deutsche Adlige wurden nie erfüllt und im Dezember 1792 erklärte die Nationalversammlung alle solchen Vereinbarungen für ungültig. Die deutschen Fürsten waren uneins, wie sie reagieren sollten.Viele, die Besitz verloren hatten, verlangten lautstark militärisches Eingreifen, um ihn wiederzuerlangen. Andere hingegen betonten, dass die französische Nationalversammlung Kompensation versprochen hatte und die Kläger das Ergebnis ihrer Anträge abwarten sollten. Erschwert wurde die Debatte durch die Frage, ob das Reich überhaupt ein Recht hatte, im Elsass beschlagnahmten Besitz zurückzufordern. Schließlich hatte es das Elsass 1648 offiziell an Frankreich abgetreten und seither hatte kein Kaiser dort die Gerichtsgewalt ausgeübt. Viele nicht direkt Betroffene hielten die Sache für recht trivial und nicht wert, deswegen in den Krieg zu ziehen. Preußen etwa war nicht im Geringsten daran interessiert, Leuten wie dem Bischof von Speyer beizustehen. In Gesprächen mit Österreich ging es Berlin vor allem darum, welche Kompensationen Preußen erwarten durfte, wenn es einem Waffengang zu irgendeinem Zeitpunkt zustimmte. Das offensichtliche Desinteresse der zwei größten Mächte im Reich an ihren Klagen führte dazu, dass sich die Betroffenen im September 1791 an Russland wandten, die einzige verbliebene Garantiemacht des Reichs, deren Hilfe vorstellbar war. Aber Russland fiel es schwer, sich wegen eines Problems zu engagieren, das man dort als relativ trivial und fern dem eigenen Einflussbereich betrachtete. Die kirchlichen Fürsten, am lautstärksten der hitzköpfige Fürstbischof von Speyer, August von Limburg-Stirum, verlangten ein sofortiges Handeln des Reichstags und ein Eingreifen zur Wiederherstellung ihrer Rechte. Die Mehrheit der betroffenen weltlichen Herrscher sah ein, dass die »die Reichsständischen Rechte der der französischen Konstitution« unvereinbar waren, und zog es vor, eine Entschädigung anzustreben, anstatt eine Niederlage in einer Militäraktion gegen Frankreich zu riskieren, die so gut wie keine Erfolgsaussichten hatte. 3 Am 6. August 1791 schließlich beschloss der Reichstag, die Wiederherstellung des Status quo ante im Elsass gemäß den Bedingungen des Westfälischen Friedens zu
649
650
VI. · Krieg und Zerfall: Das Reich 1792–1806
verlangen, überließ es jedoch dem Kaiser, zu entscheiden, wann und wie dies zu tun sei. 4 Wie wir gesehen haben, zog Leopold es vor, sich zurückzuhalten und auf eine friedliche Lösung zu hoffen. 5 Zugleich jedoch versuchte der Kaiser, den Bund der Vorderen Kreise zu reaktivieren, und wies alle Kreise an, ihre Sicherheitsmaßnahmen zu überprüfen. Im schwäbischen Kreis war Baden zur Kooperation bereit, Württemberg jedoch blockierte in der Hoffnung, die Region aus dem Konflikt herauszuhalten, jedes Handeln. 6 Wie andere war Württemberg zudem auf der Hut, sich in einen österreichischen oder preußischen Krieg hineinziehen zu lassen. Gleichzeitig wurden die Aktivitäten der Emigranten im Reich aus französischer Sicht zunehmend ärgerlich. Das wurde 1791 nach der Flucht der Tanten des Königs nach Rom (wobei sie angeblich gewaltige Schulden hinterließen und ein Vermögen mitnahmen) und dem Fluchtversuch des Königs selbst am 20. Juni zum akuten Problem. Die Situation eskalierte nun. Für viele Deutsche bewiesen die versuchte Flucht der französischen Königsfamilie am 21. Juni 1791, ihre Inhaftierung in Varennes und Rückverschaffung nach Paris die zunehmende Radikalisierung der Revolution. In Frankreich war Ludwig XVI. überzeugt, nur eine Intervention von außen könne ihn retten, und seine Weigerung, mit der Nationalversammlung in Bezug auf die Verfassung von September 1791 zu kooperieren, trug zur zunehmenden Vorherrschaft der radikalen Jakobiner bei, die zu der Überzeugung kamen, ein revolutionärer Krieg sei der einzige Weg, ihre Errungenschaften zu sichern. Vor diesem Hintergrund wurden die Emigranten zur Zielscheibe der Schmähpropaganda und von mehr als zweihundert Dekreten, die ihre sofortige Rückkehr und Beschlagnahmung ihres Besitzes forderten. 7 Aus französischer Sicht waren die Deutschen verantwortlich. Seit Juli 1789 hatte ein steter Strom von Adligen Frankreich verlassen; die meisten waren ins Rheinland gegangen. Die Mehrheit davon ließ sich zunächst nicht fest dort nieder, ab Februar 1791 entstanden jedoch substanzielle Emigrantengemeinden. 8 Der pfälzisch-bayerische Kurfürst Karl Theodor reagierte behutsam, ebenso Markgraf Karl Friedrich von Baden; keiner der beiden wollte die Franzosen provozieren und bis 1793/94 sorgten beide dafür, dass ihre Emigrantengemeinden nicht wuchsen. Solche Zurückhaltung war den kirchlichen Herrschern fremd. Der Kurfürst von Mainz gewährte den französischen Fürsten Artois und Condé Gastfreundschaft und ihre Anwesenheit lockte zahlreiche andere an. Der Kurfürst von Trier bot ebenfalls seine Gastfreundschaft und im Sommer 1791 sprach man von Koblenz als »Klein-Versailles«, nachdem es zum Hauptquartier der Brüder des französischen Königs geworden war, der Comtes de Provence und d’Artois, denen der Kurfürst Schloss Schönbornlust zur Verfügung stellte. Die Emigrantengemeinde umfasste bald gut 20.000 Personen. Hier sannen die
61. Das Reich in den Revolutionskriegen
Exilanten auf den Sturz der Pariser Revolutionäre und planten ihre triumphale Rückkehr. Die einheimische Bevölkerung war von ihrer Arroganz und Extravaganz befremdet und alarmiert durch Gerüchte, die Franzosen könnten in einer Weise Vergeltung üben, die die Verwüstung der Pfalz durch Ludwig XIV. in den Schatten stellte. Das wurde zunehmend wahrscheinlich, da die Emigranten Vorräte anlegten und Truppen aushoben und der Vicomte de Calonne, der »Premierminister der Emigration«, Botschafter ins Reich entsandte, um Verbündete zu gewinnen. Ihr Auftrag war die Verbreitung seines Ansinnens an Leopold II., er möge den Comte de Provence zum Regenten von Frankreich erklären (aufgrund der offensichtlichen Unfähigkeit Ludwigs XVI., die Lage zu meistern) und österreichische Truppen ins Elsass und Hennegau einmarschieren lassen. Leopold selbst blieb unbeeindruckt und mitleidlos gegenüber den Emigranten. Wie vor ihm Joseph II. weigerte er sich, sie in seinen eigenen belgischen Territorien zu dulden, und versuchte im Dezember 1791 den Kurfürsten von Trier zu überzeugen, Vernunft anzunehmen und alle Fremden seines Territoriums zu verweisen. Ein gleichzeitiges Sendschreiben von Kaunitz nach Paris ging jedoch nach hinten los. Einerseits versicherte Kaunitz den Franzosen, der Trierer Kurfürst habe zugesagt, dem Beispiel des Kaisers zu folgen und die Emigranten abzuschieben. Andererseits informierte er sie, der Kaiser habe versprochen, Trier beizustehen, wenn Frankreich es angreife. Frankreich, warnte Kaunitz, habe nicht nur den Zorn des Kaisers und der Fürsten des Reichs zu fürchten, sondern auch den »anderer Monarchen, die zur Erhaltung der öffentlichen Ruhe und für die Sicherheit und Ehre der Kronen gemeinschaftlich verbunden seyen«. 9 Für die dominierenden Gruppen in Paris, die bereits einen Krieg forderten, war diese Drohung der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Sie erzwangen ein Ultimatum an Paris, das den Kaiser aufforderte, alle Abkommen zu kündigen, die sich gegen die Souveränität, Unabhängigkeit und Sicherheit Frankreichs richteten. Kaunitz reagierte auf dieses und weitere Sendschreiben mit höflichen Zusicherungen, Wien hege überhaupt keine Pläne gegen Frankreich. Die eigenen offiziellen Botschaften Leopolds II. waren ebenso höflich und unverbindlich, allerdings empörte sein (ehrlicher) Ausdruck des Mitgefühls mit den unglückseligen Zuständen in Frankreich vom 17. Februar 1792 die Pariser Radikalen und machte alles noch schlimmer. Obwohl der Kaiser zögerte, einen Krieg in Betracht zu ziehen, bewilligte er ein Verteidigungsabkommen zwischen Österreich und Preußen, das auch eine Kooperation gegen innere Unruhen im Reich und eine Allianz zur Intervention in Frankreich zugunsten Ludwigs XVI. umfasste. Österreich wollte mit dem am 7. Februar 1792 mit Preußen geschlossenen Vertrag vor allem sicherstellen, dass Preußen nicht im Alleingang ohne Österreich handelte. 10 Das bedeutete zwangsläufig die Bereitstellung einer Entschädigung im Fall eines Konflikts. Wien und Berlin plan-
651
652
VI. · Krieg und Zerfall: Das Reich 1792–1806
ten das Elsass zu erobern und es zwischen Österreich und der Pfalz aufzuteilen. Die Pfalz würde dann Jülich und Berg an Preußen abtreten. Der Tod Leopolds II. am 1. März unterbrach die Korrespondenz zwischen Wien und Paris kaum. Er hatte jedoch die beiläufige Auswirkung, dass die Franzosen am 20. April dem König von Böhmen und Ungarn und Herrscher von Österreich den Krieg erklärten, weil Franz erst im Juli zum heilig-römischen Kaiser gewählt und gekrönt wurde. Folgerichtig war Preußen zwar durch das im Februar geschlossene Abkommen verpflichtet, Franz beizustehen, aber das Reich war rein formal an dem Krieg gar nicht beteiligt. Die französische Kriegserklärung an Frankreich verpflichtete Preußen unmittelbar, seine Verpflichtungen aus dem im Februar getroffenen Abkommen zu erfüllen. Die Franzosen rechneten jedoch damit, dass die Preußen nicht in den Kampf ziehen würden, obwohl Berlin Paris am 20. Februar mitgeteilt hatte, die preußische Regierung werde jeden Angriff auf Deutschland als Angriff auf Preußen betrachten. 11 Anfangs indes schienen die Franzosen mit ihrer Kalkulation richtig zu liegen. Obwohl Österreich und Preußen einen Krieg erwartet hatten, trafen sie kaum Vorbereitungen und zeigten nun wenig Neigung, sich in dem Konflikt zu engagieren. Tatsächlich hatte Österreich seine Armee nach Ende des Konflikts mit der Türkei im August 1791 verkleinert. 12 Beide Mächte unterschätzten die Situation und wollten partout nicht glauben, dass die französische Armee eine ernsthafte Bedrohung darstellte. Österreichische Offiziere scherzten, der Feldzug werde nicht mehr als ein Spaziergang; ein Angehöriger des Kriegsministeriums meinte, es sei nicht nötig, die ganze Armee zu mobilisieren, weil zwei Regimenter ungarischer Husaren leicht in der Lage seien, die Revolutionäre mit ihren Lanzen zu vertreiben. Kaunitz andererseits warnte davor, Frankreich (die parti violent) zu unterschätzen und beharrte darauf, ein entscheidendes militärisches Eingreifen sei nun zwingend notwendig, um die Monarchie vor der französischen »Seuche« zu schützen und sicherzustellen, dass sich der »Freiheitsschwindel« nicht verbreite. Seine Warnung, ein Erfolg sei nur durch unverzügliches und gemeinsames Handeln zu erreichen, verhallte jedoch ungehört. 13 Erst im Mai 1792 einigte man sich auf einen von dem preußischen Feldmarschall Karl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig-Wolfenbüttel ausgearbeiteten Kriegsplan. Preußen sollte mit 50.000 Mann von Koblenz aus die Mosel entlang nach Luxemburg und Nordfrankreich vorrücken, die habsburgische Armee in Belgien an der Maas südwärts vorstoßen, um die rechte Flanke zu decken. Andere habsburgische Streitkräfte aus Vorderösterreich sollten die linke Flanke der preußischen Truppen decken und die französische Armee im Elsass angreifen. Dass ein Überraschungsangriff der französischen Truppen auf Belgien Anfang Mai ohne Schwierigkeit zurückgeschlagen werden konnte, verstärkte die Haltung, es sei
61. Das Reich in den Revolutionskriegen
nicht dringlich, schnell mit diesem desorganisierten und unfähigen Gesindel fertigzuwerden. Eine Reihe substanzieller Probleme verzögerte die österreichisch-preußische Reaktion. Erstens mussten die Kaiserwahl und Krönung am 7. beziehungsweise 14. Juli in Frankfurt vorbereitet werden. Die Wahl verlief unproblematisch und die Festlichkeiten galten als großer Erfolg. 14 Das darauf folgende Zusammentreffen von Franz II. mit Friedrich Wilhelm II. und anderen deutschen Herrschern schien eine neue Einigkeit der Absichten zu demonstrieren. Die offensichtliche Verbindlichkeit des jungen Kaisers bei der Krönung sorgte für Optimismus und Kaunitz wie andere glaubten, Zeugen des Beginns einer neuen Ära habsburgischer Führung im Reich zu sein. Hinter den Kulissen waren die Diskussionen über die Kriegsvorbereitungen jedoch höchst problematisch. Österreich und Preußen ersuchten die deutschen Stände um Beihilfe zu ihren Kriegsaufwendungen. Die Antworten fielen enttäuschend aus: Niemand wollte einen finanziellen Beitrag leisten, lediglich Mainz und Hessen-Kassel entsandten kleine Kontingente. 15 Bayern und Hannover (das heißt: praktisch auch England) stritten für strikte Neutralität. Österreich und Preußen waren an diesem Punkt auch deshalb gegen eine offizielle Verwicklung des Reichs, weil ihnen das Beschränkungen in ihrer Kriegsführung und vor allem in der Zeit danach auferlegt hätte. Tatsächlich gab es parallele Diskussionen darüber, wie die letztlichen Sieger für ihre Bemühungen entschädigt werden sollten. Schnell trat das alte Misstrauen wieder zutage. Preußen verknüpfte die französische Frage sofort mit dem polnischen Problem und schlug preußische Zugewinne in Polen, russische in der Ukraine und österreichische im Elsass vor. Um nicht das Odium tragen zu müssen, einziger Nutznießer neu gewonnenen französischen Territoriums zu sein, griffen die Österreicher die Idee eines Tauschs von Belgien gegen Bayern wieder auf und erhoben überdies Ansprüche auf die preußischen Markgrafschaften Ansbach und Bayreuth. Preußen indes wollte diese protestantischen Stammländer der Hohenzollern nicht den katholischen Habsburgern überlassen. 16 Wien und Berlin konnten sich nicht einigen, aber die Diskussionen selbst hatten ernsthafte Folgen. In Wien bestimmten Philipp Cobenzl und Anton Spielmann, die von der alten Idee eines Tauschs der Österreichischen Niederlande gegen Bayern besessen waren, die Politik. Beide Minister waren Schützlinge von Kaunitz und seine Untergebenen, aber beide planten für die Zukunft nach dem Tod des einundachtzigjährigen Staatskanzlers und wollten daher beim neuen Kaiser Eindruck schinden. Den Tausch zustande zu bringen, wäre der größte Coup gewesen, auch wenn Kaunitz, in der Vergangenheit stets ein Verfechter des Tauschs, nun glaubte, er würde lediglich die Autorität des Kaisers im Reich untergraben. Dass Cobenzl und Spielmann beharrlich an dem Plan festhielten, führte zu Kaunitz’ Rücktritt am 2. August 1792. 17 Dass im Reich Gerüchte über den geplanten Tausch die Runde
653
654
VI. · Krieg und Zerfall: Das Reich 1792–1806
machten, bestärkte zudem Hannover und Sachsen in ihrer Neutralität, weil eine Kriegsteilnahme diesen inakzeptablen Vorschlag nur wahrscheinlicher machen würde. Der Kurfürst von Bayern protestierte energisch in Berlin und ersuchte um Preußens Unterstützung. Die Frage stellte sich dann gar nicht. Nachdem der frühe französische Angriff auf Belgien gescheitert war, gerieten bald die Alliierten in Bedrängnis. Das preußische Vorrücken zum Rhein belehrte die Franzosen, die geglaubt hatten, Berlin werde den Österreichern nicht beistehen, eines Besseren. Die Entscheidung des Herzogs von Braunschweig, dem Einmarsch in Frankreich am 25. Juli 1792 ein von einem Emigranten in Brüssel verfasstes Manifest vorauszuschicken, hatte in der Öffentlichkeit katastrophale Folgen. 18 Das Versprechen, alle Franzosen, die sich vernünftig verhielten, würden gut behandelt, jeder Versuch, dem König etwas zuleide zu tun, ziehe jedoch die Zerstörung von Paris nach sich, sorgte in Paris für Empörung und brachte den König in eine unmögliche Position. Ironischerweise führte ausgerechnet der Übereifer eines Emigranten zum Sturm auf den Tuilerienpalast durch die aufständische Pariser Bevölkerung am 10. August, zur Verhaftung des Königs, der Abschaffung der Monarchie im September und schließlich dazu, dass der König im Dezember 1792 angeklagt und im Januar 1793 hingerichtet wurde. Der militärische Feldzug scheiterte. Die Preußen besetzten Longwy und Verdun, rückten jedoch so langsam vor, dass der französische Oberbefehlshaber Charles François Dumouriez der Umzingelung in den Argonnen entgehen und sich mit dem zweiten Hauptheer unter François Christophe de Kellermann vereinen konnte. Am 20. September trafen die beiden gegnerischen Armeen bei Valmy aufeinander, nach stundenlangem Artilleriefeuer mit sehr wenigen Opfern auf beiden Seiten zogen sich die Preußen jedoch zurück. Goethe, der die Schlacht im Gefolge des Herzogs von Weimar miterlebte, wollte am Tag nach der Kanonade gesagt haben: »Von hier und heute geht eine neue Epoche der Weltgeschichte aus, und ihr könnt sagen, ihr seyd dabei gewesen.« 19 Tatsächlich ist es wenig wahrscheinlich, dass er das wirklich äußerte und dass das zu diesem Zeitpunkt überhaupt klar sein konnte. Die französische Armee war im Grunde noch immer das Heer der Monarchie; die regulären Regimenter hatten zwar Offiziere verloren, die ausgewandert waren, aber die Artillerie war immer exzellent gewesen, geführt von bestens ausgebildeten, größtenteils nichtadligen Offizieren und daher von der Emigration nicht betroffen. 20 Die revolutionäre Armee der Levée en masse entstand erst im Jahr darauf und erreichte den Höhepunkt ihrer Leistungsfähigkeit erst 1795. Dennoch erwies sich der preußische Rückzug von Valmy als entscheidend. Er diente der Kriegspartei in Paris zur Rechtfertigung und leitete das Ende der Monarchie und die Ausrufung der französischen Republik am 22. September 1792 ein.
61. Das Reich in den Revolutionskriegen
Aus guten Gründen wurde Valmy zum Kernstück des revolutionären Geburtsmythos der Republik. 21 Unmittelbar zog Valmy zwei französische Angriffe auf das Reich nach sich. 22 Im Oktober besetzte der Comte de Custine Speyer, Worms, Mainz und Frankfurt. Gleichzeitig führte Dumouriez einen Angriff auf Belgien und erreichte am 6. November bei Jemappes einen entscheidenden Sieg gegen die Österreicher, die über Aachen hinaus hinter die Flüsse Erft und Rur zurückweichen mussten. Zwar vertrieben die Preußen Custine Anfang Dezember aus Frankfurt, aber ein Großteil des linken Ufers des Rheins, Mainz, Aachen und Brüssel blieben den Winter über in französischer Hand. Dies hatte drei wichtige Konsequenzen. Erstens radikalisierte sich in Frankreich selbst die Revolution weiter. Am 15. und 17. Dezember kündigten Dekrete an, Frankreich werde alle Länder »befreien«, die seine Truppen besetzten, und jeden als Feind behandeln, der sich der Freiheit entgegenstelle, ihr entsage oder mit irgendeinem Fürsten ihre Untergrabung aushandle. Sämtlicher Besitz ehemaliger Herrscher und ihrer Unterstützer werde »Schutz und Sicherung« durch die Republik unterworfen. Gleichzeitig lieferte die ausführliche Diskussion der »natürlichen« Grenzen Frankreichs starke Argumente für die offizielle Annexion des gesamten linken Rheinufers. 23 Im Sommer 1793 hatten Robespierre und die radikalen Jakobiner die Macht an sich gerissen, gingen energisch gegen »Aufruhr« in der Heimat vor und mobilisierten weiterhin Ressourcen zur Verteidigung der Republik gegen ihre äußeren Feinde. Das Levée-en-masse-Dekret vom 23. August erhöhte die Stärke der französischen Armee auf fast eine Million Mann. 24 Zum Zweiten führten die offensichtliche Aggression und der Expansionismus der Republik sowie der Schock über die Exekution von Ludwig XVI. am 21. Januar 1793 nun auch zur Bildung einer internationalen Koalition, in der sich Spanien, Piemont, die Niederlande und Großbritannien Österreich und Preußen anschlossen. Drittens versetzte das französische Vordringen ins Reich viele deutsche Fürsten in akute Alarmbereitschaft und rückte das Reich näher an eine Verwicklung in den Krieg.25 Schon vor Valmy hatte Franz II. den Reichstag um substanziellen Beistand ersucht, Hannover hatte jedoch den beherzten Widerstand gegen dessen Forderung nach etwa 13 Millionen Gulden angeführt. Im November einigte man sich, eine signifikante Verteidigungsstreitmacht zu mobilisieren (ein Triplum, das heißt 120.000 Mann), und im Februar darauf beschloss der Reichstag die Zahlung von fast 4 Millionen Gulden in eine Reichsoperationskasse. Am 22. März 1793 schließlich erkannte der Reichstag den Krieg, den Frankreich dem Reich aufgezwungen hatte, als Reichskrieg an. 26 Offizielle Kriegsziele waren die Wiederherstellung der Rechte deutscher Fürsten im Elsass, wie im Westfälischen Frieden spezifiziert, und Reparationen für die Kosten des Kriegs. Zur Bestürzung mancher bedeutete das, dass das Reich letztlich verpflichtet war, Entschädigungen für Österreich und Preußen sicherzustellen.
655
656
VI. · Krieg und Zerfall: Das Reich 1792–1806
In Wirklichkeit indes hatte ein Bruch im Verhältnis zwischen Österreich und Preußen wegen Polen bereits alle Hoffnungen untergraben, die Kriegserklärung des Reichstags werde eine einheitliche Front in Deutschland schaffen. Selbst nach dem preußischen Rückzug von Valmy forderte Berlin einmal mehr, Österreich solle zur Kompensation für die Kosten des Feldzugs gegen Frankreich weiterem preußischem Zugewinn von polnischem Territorium zustimmen. 27 Am 26. Oktober erklärte Friedrich Wilhelm II. den österreichischen Gesandten, Preußen könne sich nicht länger im selben Ausmaß und zu denselben Bedingungen an dem Konflikt beteiligen. 28 Eine kleine Streitmacht von vielleicht 20.000 Mann werde den Österreichern beistehen, aber selbst dafür forderte der preußische König sofortige Abfindung in Polen. Nachdem die österreichischen Truppen jedoch Anfang November 1792 aus Belgien verdrängt worden waren, wurde Cobenzl und Spielmann klar, dass sie für den nun absehbar langwierigen Konflikt mit Frankreich preußische Unterstützung brauchten. Daher stimmten sie einer Kompensation für Preußen in Polen noch vor Kriegsende zu, ohne fest zu vereinbaren, was dann für Österreich herauskäme. Kaunitz’ Warnung, Preußen sei nicht zu trauen, bewahrheitete sich bald, als Berlin und St. Petersburg Gespräche über eine weitere Teilung Polens aufnahmen. Nun lag Polens Schicksal in den Händen von Katharina der Großen, deren Truppen im Juli 1792 den größten Teil des Landes kontrollierten. 29 1790 hatten sich die Russen gesorgt, weil Preußen durch das Verteidigungsbündnis von März 1790 anscheinend Stanislaus Augustus Poniatowski in seinen Bemühungen um eine Stärkung der polnischen Monarchie unterstützte. Zudem fürchteten die Russen, die von Poniatowski am 3. Mai 1791 auf Veranlassung des vierjährigen Sejm (einer der beiden Kammern des polnischen Parlaments) eingeführte Verfassung könne zu einer generellen Erneuerung führen und konstitutionelle Anwandlungen auch in Nachbarländern populär machen. In Österreich hingegen bewunderte Leopold II. die neue polnische Verfassung sehr und Kaunitz hoffte, ein wiedererstarktes Polen könne eine Barriere zwischen Österreich und Russland bilden. Österreichs Krieg gegen Frankreich und das Ende des russischen Kriegs gegen die Türkei im Januar 1792 ermöglichten eine russische Militärintervention in Polen im Mai 1792. Trotz der erdrückenden Übermacht der russischen Streitkräfte machte die Zarin Preußen gewisse Zugeständnisse, um es im Krieg gegen Frankreich zu halten. Preußens weitere Beteiligung an diesem Konflikt war eine der Bedingungen des Abkommens über Polen. Russland und Preußen rechtfertigten ihr Eingreifen in Polen mit der Behauptung, sie wollten eine revolutionäre Ideologie ähnlich jener ausmerzen, die Frankreich erschüttert hatte. Tatsächlich war ihr Motiv schlichter Expansionismus. Durch den am 23. Januar 1793 unterzeichneten Teilungsvertrag gewann Russland etwa 250.000 km 2 mit mehr als drei Millionen Bewohnern hinzu, Preußen
61. Das Reich in den Revolutionskriegen
58.000 km 2 mit einer Million neuen Untertanen. Polen verlor die Hälfte seines Territoriums und seiner Bevölkerung. Österreich erfuhr offiziell erst im März von der Teilung und war rundum gedemütigt. Inzwischen hatten die Briten mit der Ankündigung, sie würden keiner Allianz gegen Frankreich beitreten, die einen zukünftigen Tausch der Österreichischen Niederlande gegen Bayern vorsehe, der Karriere von Cobenzl und Spielmann einen weiteren Schlag versetzt. Großbritannien wollte um jeden Preis eine Großmacht an Frankreichs Nordgrenze halten, um eine französische Expansion die Nordseeküste hinauf zu verhindern. 30 Das klägliche Scheitern von Cobenzl und Spielmann war die Gelegenheit für Thugut. Die Staatskanzlei wurde in zwei Hälften geteilt, Thugut übernahm das neue Ministerium für auswärtige Angelegenheiten. Cobenzl blieb für die italienische Innenpolitik verantwortlich, Spielmann sandte man als zweiten Delegierten für Österreich und Burgund zum Reichstag nach Regensburg. Unter Thuguts Führung verwarf Wien alle Hoffnungen auf eine dauerhafte Verständigung mit Preußen und richtete seine Aufmerksamkeit wieder auf den Krieg gegen Frankreich. Dort schienen die Aussichten gut. Am 18. März 1793 besiegten die österreichischen Truppen die Franzosen unter Dumouriez bei Neerwinden und zwangen sie zum Abzug aus Brüssel. Bis zum Frühsommer folgte eine Reihe weiterer Erfolge. Preußen, durch das Abkommen mit Russland zur Fortsetzung des Kriegs im Westen verpflichtet, befreite am 23. Juli Mainz. Die Österreicher stürmten die französischen Festungen Condé und Valenciennes. Noch vielversprechender war das Überlaufen des französischen Befehlshabers Dumouriez nach seiner Niederlage. Thugut war so überzeugt von der bevorstehenden französischen Niederlage, dass er Dumouriez’ Angebot ablehnte, mit seiner Armee gegen Paris zu marschieren. Thuguts Misstrauen gegenüber den Franzosen, seine Überzeugung, alle Franzosen seien hoffnungslos mit »der Lehre von den Menschenrechten und der unbeschränkten Souveränität des Volkes« infiziert, saß so tief, dass er anordnete, weder Dumoriez selbst noch einer der 800 Männer, die mit ihm desertiert waren, dürften irgendeine Position in den österreichischen Streitkräften besetzen. 31 Ab September 1793 begannen indes die Reformen des französischen Militärs Wirkung zu zeigen. Ein erfolgreicher Angriff gegen britische Truppen bei Hondeschoote an der belgischen Küste am 8. September leitete eine weitere Folge französischer Siege ein. Das gleiche Muster wiederholte sich 1794. Österreich und Preußen feierten anfänglich Siege an der belgischen Grenze und am Mittelrhein, dann folgten systematische französische Gegenoffensiven. Ende 1794 war das linke Rheinufer fest in französischer Hand, nur Mainz wurde nicht von Frankreich kontrolliert. Welchen Beitrag leistete das Reich zum Kampf gegen Frankreich? Die Kriegs-
657
658
VI. · Krieg und Zerfall: Das Reich 1792–1806
erklärung des Reichstags im März 1793 führte zur Diskussion über weitere Zahlungen und die Mobilisierung dessen, was die Reichsstände zugesagt hatten. Die Mobilisierung von Soldaten und Ressourcen verlief jedoch langsam und zögerlich. 32 Die traditionellen Mobilisierungsmechanismen des Reichs behinderten schnelles, gemeinsames Handeln; erschwerend kam nun noch der Wettstreit zwischen Österreich und Preußen hinzu. Zugleich hatte der unablässige Druck der französischen Streitkräfte in einigen Gegenden schwere Auswirkungen. Die westlichen Kreise hatten bereits 1792 Verteidigungstruppen mobilisiert. Das setzte sich 1793 fort, da sich nun auch der schwäbische und fränkische Kreis beteiligten. Dass Truppen aus Würzburg und Bamberg seit 1790 als österreichische Hilfskontingente dienten, schmälerte die fränkischen Bemühungen. Die Entscheidung der zwei hessischen Landgrafen, nicht als Teil eines Kreiskontingents, sondern unabhängig zu agieren, minderte die Anzahl der Soldaten, die der Oberrheinkreis bereitstellen konnte. Der kurrheinische Kreis konnte überhaupt nichts beitragen, weil seine Territorien größtenteils von Frankreich besetzt waren. In anderen Teilen des Reichs, vor allem Mitteldeutschland, stellten viele Fürstentümer Kontingente direkt an die österreichischen beziehungsweise preußischen Streitkräfte ab. Im Norden bestand die gängigste Form der Partizipation in Geldzahlungen (sogenannten Reluitionen). Ein Teil davon floss in die Reichsoperationskasse, der größte Teil indes direkt an Österreich und Preußen, die Zahlungen für 10.000 beziehungsweise 12.000 Mann erhielten. Im Lauf des Jahres 1793 begannen auch die Briten für Hilfstruppen zu zahlen. Das ermöglichte einigen Fürsten eine Beteiligung am Krieg, ohne unter dem Befehl von Österreich oder Preußen zu stehen. Der Beitrag dieser Truppen endete jedoch mit dem Zusammenbruch der britischen Stellungen in den Niederlanden 1795. Die Spannungen zwischen Österreich und Preußen behinderten die Mobilisierung einer Reichsarmee deutlich. Österreich suchte unter allen Umständen die Gesamtführung zu behaupten. Trotz der Berufung eines Protestanten – Friedrich Josias von Sachsen-Coburg – zum Feldmarschall war unter den von Franz II. am 8. April 1793 ernannten Generalen kein einziger Preuße. 33 1794 löste der Onkel des Kaisers, Albrecht von Sachsen-Teschen, Friedrich Josias ab. Die Ernennung des preußischen Generals Heinrich August von Hohenlohe-Ingelfingen zum zweiten kaiserlichen Feldmarschall 1794 war ein kleines Zugeständnis, nach seinem Tod zwei Jahre darauf folgte ihm der Bruder des Kaisers, Erzherzog Karl. Anläufe zu einer Reform der militärischen Strukturen des Reichs stießen auf entschiedenen Widerstand des Reichstags. Die Reichsstände lehnten Thuguts Vorschlag vom Januar 1794, die zentrale Autorität zu stärken und den Kaiser zu ermächtigen, Truppen und Geld direkt im Reich einzutreiben anstatt über Kreise und Fürsten, rundherum ab. Den Fürsten war nicht daran gelegen, die Monarchie in
61. Das Reich in den Revolutionskriegen
einer Weise zu stärken, die es Österreich ermöglichen würde, Bayern und das übrige Süddeutschland nach Ende des Kriegs zu annektieren. Andererseits zeigten sich die Territorien zu beeindruckenden Leistungen in der Lage, wenn ihre Sicherheit direkt bedroht war. Zwischen 1790 und 1794 wurden die traditionellen Verteidigungsmilizen an der gesamten Rheingrenze erneuert. Neben der Rekrutierung von Truppen für die Kreiskontingente stellten auch Territorien wie Baden und Württemberg Milizen zusammen, die zwei bis drei Prozent der Bevölkerung umfassten. Der österreichische Vorschlag einer Generalmobilmachung der Bewohner des Reichs vom Januar 1794 führte jedoch erneut zu nichts. In diesem Fall mischte sich Argwohn gegenüber Österreichs Motiven mit grundlegendem Unbehagen angesichts einer Bewaffnung von Untertanen. Das Trauma von 1525 lebte wieder auf in der Erklärung von Karl August von Weimar: »Ich zahle lieber meinen letzten Écu an den Kurfürsten von Sachsen, damit er ein paar seiner guten Regimenter in Marsch setzt, als fünfhundert meiner Bauern zu bewaffnen.« (J’aimerais mieux payer mon dernier écu à l’Electeur de Saxe pour faire marcher un couple de ses bons régiments que d’armer cinq cents de mes paysans.) 34 Die Milizen funktionierten nur im Südwesten richtig, wo es eine lange Tradition der Selbstverteidigung gegen französische Übergriffe gab. Das Scheitern der Reformpläne machte es unausweichlich, auf die üblichen Methoden zur Aufstellung einer Reichsarmee zurückzugreifen. Angesichts der außerordentlichen Umstände forderte der Kaiser eine Erhöhung der Stärke der Reichsarmee auf ein Quintuplum, also 200.000 Mann. Es mag auf den ersten Blick überraschen, dass dies im Oktober 1794 gewährt wurde. 35 Zwei miteinander verbundene Erwägungen bewegten die Fürsten zur Zustimmung. Erstens glaubten manche, die Schaffung einer substanziellen Reichsarmee werde ihnen ermöglichen, sich der Kontrolle Österreichs oder Preußens zu entziehen, und dem Reich und seinen Fürsten in Friedensverhandlungen eine gute Ausgangslage sichern. Zweitens gewann der Wunsch nach einem Frieden mit Frankreich an Boden. Im Sommer 1794 gab es diverse Vorschläge, die die Verhandlungsmacht der Fürsten stärken sollten. 36 Einige schlugen die Gründung eines neuen Fürstenbunds vor, um eine von Österreich unabhängige Armee aufzustellen. Mainz schlug eine Allianz von Kurfürsten mit Köln, Trier und Pfalz-Bayern vor, die 45 Millionen Taler Kredit aufnehmen sollte, um 79.000 Mann zu unterhalten. Das war freilich so gut wie unmöglich, da französische Truppen außer Bayern alles besetzt hielten. Ende September 1794 nahmen Baden und Hessen-Kassel in Wilhelmsbad Gespräche auf, um eine Liga niederer Fürsten zu schaffen, die mit Krediten in Höhe von 24 Millionen Taler eine Armee von 24.000 Mann finanzieren sollte. Das sofortige und bedingungslose Angebot vom Würzburger und Bamberger Erzbischof Franz Ludwig von Erthal, 10.000 Mann bereitzustellen, war indes leicht beschämend, weil Baden und Kassel fest damit gerechnet hatten, dass potenzielle
659
660
VI. · Krieg und Zerfall: Das Reich 1792–1806
Teilnehmer durch Säkularisierungen entschädigt würden, während Hessen-Kassel seinen Anspruch auf eine Kurwürde bekräftigte. 37 Russland zeigte ein gewisses Interesse an der Liga von Wilhelmsbad, die Pläne zerschlugen sich jedoch, als der Kaiser dem Markgrafen von Baden mitteilte, eine solche Liga sei inakzeptabel und eine erneuerte Assoziation der Kreise eher hilfreich. 38 An einer unabhängig operierenden deutschen Armee hatte Wien keinerlei Interesse. In der hektischen Korrespondenz zwischen den deutschen Höfen über Pläne für Allianzen und unabhängige Armeen während des Jahres 1794 wurde die Ausgestaltung eines zukünftigen Friedens immer mehr zum beherrschenden Thema. Kurz nachdem die Reichstag Anfang Oktober die Aufstellung einer Reichsarmee von 200.000 Mann beschlossen hatte, legte Mainz die ersten konkreten Friedensvorschläge auf den Tisch. Der Erzkanzler schlug vor, den Status quo von 1792 wiederherzustellen, die französische Republik offiziell anzuerkennen und beide Seiten zu verpflichten, sich aus den inneren Angelegenheiten des anderen herauszuhalten. Am 22. Dezember 1794 forderte der Reichstag den Kaiser offiziell auf, auf Grundlage der Verträge von 1648 einen Frieden mit Frankreich auszuhandeln. 39 Ganz abgesehen davon, dass der Kaiser und Thugut absolut gegen einen Frieden mit Frankreich waren, lief Preußens Vorgehensweise auch den Zielen der minderen Fürsten zuwider. Preußen konnte es sich schlichtweg nicht leisten, im Westen Krieg zu führen und gleichzeitig die Kontrolle über die Lage in Polen zu behalten.40 Ende Oktober 1793 gab Berlin bekannt, Preußen könne seinen Verpflichtungen im Westen nicht länger nachkommen und werde daher sein Engagement auf die vertraglich zugesicherten 20.000 Mann reduzieren. Im November wurde angedeutet, das Problem könne mit einem Zuschuss von 22 Millionen Écu (9 Millionen aus Großbritannien, 10 aus dem Reich und 3 von Österreich) gelöst werden. Im Januar 1794 schlug Berlin dann vor, die sechs westlichen Kreise sollten Sold und Versorgung des preußischen Feldheers in Höhe von 2 bis 3 Millionen Gulden monatlich finanzieren. Der britische Botschafter in Wien kommentierte, die Preußen seien wie »die Leute in Deal, die sich die gefährliche Lage der Reisenden an den Goodwin-Sandbänken zunutze machen, um unverschämten Schacherhandel zu treiben« (»the Deal men, who avail themselves of the perilous situation of the passengers on the Goodwins to drive a most unconscionable bargain«). 41 Die Vorschläge ernteten nichts als Entrüstung, die Thugut weidlich ausnutzte. Das Problem lösten im April 1794 Großbritannien und die Niederlande, indem sie einsprangen und die Kosten einer preußischen Armee von 62.400 Mann an der Westfront übernahmen. Die Einigung war eine Demütigung für Preußen, da die britischen und niederländischen Zahlmeister darauf bestanden, über den Einsatz dieser Truppen zu bestimmen, und jegliches erobertes Gebiet für sich beanspruchten. Die Armee konnte aber letztlich nicht viel gegen die Serie von Misserfolgen ausrichten, die mit der vollständigen französischen Eroberung des linken Rhein-
61. Das Reich in den Revolutionskriegen
ufers und der Umwandlung der Niederlande in den Satellitenstaat Batavische Republik im Januar 1795 endete. 42 Aus preußischer Sicht trat ohnehin die Lage in Polen dringlich in den Vordergrund, als dort am 24. März 1794 ein allgemeiner Aufstand gegen Russland und Preußen begann. 43 Die anfänglichen Erfolge der Rebellen unter dem Kommando von Tadeusz Kościuszko erforderten eine rasche Reaktion beider Mächte. Friedrich Wilhelm II. wandte sich vom Krieg im Westen ab und trat mit 50.000 Mann gegen die Rebellen an, die bis Jahresende erbitterten Widerstand leisteten. Dass die Preußen Warschau nicht erobern konnten, sondern sich schmachvoll zurückziehen mussten, unterstrich erneut die chronische Schwäche der preußischen Position. Zwar trug die preußische Intervention entscheidend zum Entschluss Katharinas II. bei, das, was von Polen noch übrig war, ein drittes und letztes Mal zu teilen, aber die Preußen konnten Russland nicht davon abhalten, Österreich in einem Geheimvertrag von Januar 1795 zu beteiligen. Letztlich musste sich Preußen bei der endgültigen Einigung im Oktober 1795 mit einem kleineren Teil des polnischen Territoriums abfinden. Preußens Probleme in den Jahren 1793 und 1794 überzeugte viele in Berlin, dass der ruinöse Krieg gegen Frankreich beendet werden musste, auf den man sowieso nie erpicht gewesen war. 44 Gleichzeitig schien es möglich, den allgemeinen Friedenswunsch im Reich gegen Österreich auszunutzen. Wenn Preußen voranging, mochte das Reich folgen, womit das kriegerische Österreich isoliert wäre. Im November trat Preußen aus der Koalition aus und schloss einen Waffenstillstand mit Frankreich. Die folgenden Gespräche führten im April 1795 zum Abschluss des Basler Friedens. Mit dem Vertrag endeten die Feindseligkeiten zwischen Frankreich und Preußen offiziell. Frankreich erklärte sich zum Rückzug aus allen Gebieten östlich des Rheins bereit, sollte jedoch das linke Ufer und damit die preußischen Herzogtümer Kleve und Obergeldern sowie das Fürstentum Moers behalten, vorbehaltlich eines allgemeinen Friedensvertrags mit dem Reich. Eine Geheimklausel hielt fest, dass Preußen, wenn der französische Besitz dieser Gebiete bestätigt würde, mit säkularisierten Ländereien (das heißt auf Kosten der kirchlichen Territorien) für alle Verluste entschädigt werden sollte. Die Handelsbeziehungen wurden wieder aufgenommen und ein Folgevertrag definierte eine neutrale Freihandelszone zwischen Ems, Issel und Rhein. 45 Die preußischen Hoffnungen auf eine Ausweitung des Friedens auf das gesamte Reich wurden enttäuscht, als die Franzosen klarmachten, sie seien lediglich daran interessiert, dass Preußen direkte Gespräche mit weiteren Einzelterritorien vermittle, die sich vielleicht anschließen mochten; sie wollten aber nicht mit dem Reich insgesamt verhandeln. Im Lauf des folgenden Jahres trat mit Hessen-Kassel sowie den thüringischen und sächsischen Territorien der Großteil des restlichen
661
662
VI. · Krieg und Zerfall: Das Reich 1792–1806
Reichs nördlich des Mains bei, außerdem die preußischen Territorien Ansbach und Bayreuth im Süden, also etwa zwei Drittel des nichtösterreichischen Reichs. 46 Überwacht wurde die Waffenruhe größtenteils von preußischen Truppen, allerdings widersetzten sich die neutralen Territorien erfolgreich allen preußischen Versuchen, die neutrale Zone in eine preußische Hegemonie im nördlichen Reich zu verwandeln. 47 Tatsächlich schlug Preußen Angebote von anderen Territorien ab, etwa von Mainz, der Reichsstadt Frankfurt am Main und Hessen-Darmstadt. Berlin konzentrierte sich darauf, mit Frankreich eine Liste der Kirchenterritorien zu erstellen, die es entweder selbst erwerben oder – wie im Fall der Fürstbistümer Bamberg und Würzburg – an das Haus Oranien abgetreten sehen wollte, das die Franzosen aus den Niederlanden vertrieben hatten. Obwohl die genauen Bedingungen des Basler Friedens nicht weithin bekannt waren, sorgte Preußens Vorgehen für Bestürzung, die Österreich tüchtig ausnutzte. Thuguts tiefsitzender Hass auf die Revolution machte eine Einigung mit Frankreich von vornherein unmöglich. Aber Österreich hatte tatsächlich keine andere Möglichkeit, als den Konflikt fortzusetzen. Nach dem Frieden von Basel war klar, dass Preußen bei jeglichen Friedensverhandlungen bevorzugt behandelt würde, und Österreich hatte keinerlei Vereinbarungen bezüglich einer Entschädigung getroffen, die ihm zugestanden hätte. Der Rückzug Preußens und die Schaffung einer neutralen Zone bedeuteten, dass sich der Konflikt fortan auf Süddeutschland konzentrierte. Der Norden genoss zehn Jahre Frieden und Stabilität bis 1806. Für den Süden fing die Zeit des Leidens und der Verwüstung gerade erst an. Thugut hoffte auf die Bildung einer Allianz mit Großbritannien und Russland (Spanien war an den Verhandlungen in Basel ebenfalls beteiligt und zog sich im Juli 1795 aus dem Konflikt zurück), um Frankreich zu vernichten und Preußen zu isolieren. 48 Der erste Schritt war die Zusage der britischen Regierung im Mai 1795, eine Anleihe von 4,6 Millionen Pfund bereitzustellen; weitere 1,7 Millionen folgten 1797. Russland hingegen zögerte bis Sommer 1796, bot lediglich Hilfstruppen von 60.000 Mann und zog das Angebot nach dem Tod von Katharina II. im November zurück. 49 Trotz der britischen Hilfe blieb die finanzielle Situation desolat, wodurch eine substanzielle Bürde auf das Reich fiel. Da viele in Betracht zogen, sich der neutralen Zone anzuschließen, machte dies die Beziehungen zwischen der kaiserlichen Krone und den verbliebenen verbündeten Territorien problematisch. Die Kosten, die auf diese Territorien entfielen, sind nicht abzuschätzen. Bis 1795 hatten sie bereits enorme Geldsummen an das Reich abgeführt und die Verteidigung im lokalen Bereich und im Kreis war teuer. Von nun an trugen sie die Hauptlast der weiteren vom Reichstag erteilten Zuweisungen von Geld und Männern. Da der Konflikt zudem immer wieder über ihre Gebiete hinwegwogte, verlangten sowohl Frankreich als auch Österreich Kosten für Quartiere. 50 Die tatsächlich ausbezahlten Summen sind wahrscheinlich nicht zu vergleichen mit den geschätzten
61. Das Reich in den Revolutionskriegen
500 Millionen Gulden, die Österreich zwischen 1793 und 1798 in den Krieg investierte. 51 In Relation zur Größe und zum Status der Territorien wurden die Kosten des Kriegs dennoch erdrückend. Die Friedensgespräche verzögerten die Feldzüge des Jahres 1795, bis französische Streitkräfte gegen Ende des Sommers erneut bei Niedrigwasser Mainz, Mannheim und Heidelberg angriffen. Da sie eine Invasion im großen Stil befürchteten, erwogen die Regierungen von Baden und Württemberg ernsthaft einen Separatfrieden mit Frankreich. Der österreichische Gegenangriff im Oktober vertrieb die Befürchtungen, legte jedoch auch Beweise für die Gespräche offen, wodurch sich die österreichische Haltung weiter verhärtete. Der strenge Umgang mit dem für die Kapitulation von Mannheim verantwortlichen Minister, der wegen Verrats verhaftet und zur Zahlung von 400.000 Gulden in die Kriegskasse verpflichtet wurde, war hierfür typisch. 52 Im Jahr darauf bekamen Österreich und Süddeutschland die ganze Stärke der nun vollständig reformierten französischen Revolutionsarmee zu spüren. Der französische Vormarsch unter Napoleon in Italien beanspruchte und schwächte die Österreicher, die an der deutschen Front bis nach Franken zurückgedrängt wurden. Erneut den französischen Armeen ausgeliefert, schlossen Baden und Württemberg separate Waffenstillstandsabkommen und vereinbarten beträchtliche Zahlungen an die französischen Streitkräfte. Als diese Übereinkünfte im August 1796 in offizielle Verträge verwandelt wurden, sicherte eine Klausel beiden Regierungen für den Fall eines Friedensschlusses Entschädigungen mit säkularisierten Territorien zu. 53 Sie ahnten nicht, dass Erzherzog Karl seine Truppen sofort wieder in die Schlacht führen und die Franzosen erneut über den Rhein zurückdrängen würde. Die Verträge mit Frankreich wurden aufgekündigt, was einerseits die Österreicher nicht abhielt, Baden, Württemberg und Bayern als Feinde zu betrachten, und andererseits eine weitere Stärkung des Prinzips einer Säkularisierung als Form der Entschädigung oder Belohnung von Territorien nicht verhinderte. Der entscheidende Wendepunkt kam nicht in Deutschland, sondern in Italien. Eine weitere heftige Offensive von Napoleon an der italienischen Front führte die französischen Streitkräfte ins österreichische Landesinnere und löste in Wien Panik aus. Da er sich mit einer zunehmend lautstarken Friedenspartei konfrontiert sah, blieb Thugut nichts anderes übrig, als Frieden mit Frankreich zu schließen. Der am 18. April 1797 vereinbarte Vorfriede von Leoben sah vor, die Integrität des Reichs zu erhalten; allerdings sollte Österreich Belgien abtreten. Eine Geheimklausel präzisierte, dass Österreich in Italien die Lombardei verlieren und Teile von Venetien als Entschädigung erhalten sollte. 54 Tatsächlich kam es am 17./18. Oktober 1797 in Campo Formio zum Austausch der Lombardei gegen Venetien, in einer Geheimklausel wurden die Österreicher nun jedoch verpflichtet, für das Reich die gleichen Bedingungen wie Preußen zu
663
664
VI. · Krieg und Zerfall: Das Reich 1792–1806
akzeptieren. Der offizielle Friede zwischen Frankreich und dem Reich sollte bei einer Konferenz in Rastatt beschlossen werden. Weitere Geheimklauseln legten jedoch fest, dass Frankreich das gesamte linke Rheinufer von der Grenze der Schweiz bis Andernach bei Koblenz – und somit auch Mainz – und Österreich als Entschädigung für die habsburgische Grafschaft Falkenstein in der Pfalz Salzburg, Berchtesgaden und das bayerische Innviertel erhalten sollte. 55 Auch das Haus Oranien sollte im Reich entschädigt werden, ebenso wie jeder deutsche Fürst, der Ländereien links vom Rhein verloren hatte. Die preußischen Territorien am linken Niederrheinufer, das Kurfürstentum Köln, ein Teil von Trier und das Herzogtum Jülich blieben beim Reich. Der Zweck der Bewahrung der preußischen Territorien war, Preußen von weiteren Gebietsaneignungen abzuhalten. 56 Am 9. Dezember 1797 trat die Konferenz, die über die Form der Vereinbarungen im Reich entscheiden sollte, in Rastatt zusammen. 57 Über die Besetzung dessen, was im Grunde eine Deputation oder ein Subkomitee des Reichstags war, hatte man sich bereits 1795 geeinigt; vertreten waren Österreich, Bayern, Mainz, Sachsen, Bremen (Hannover), Würzburg, Hessen-Darmstadt, Baden, Augsburg und Frankfurt am Main. Die meisten anderen großen Territorien, so auch Preußen, entsandten Beobachter. Offiziell wussten die Delegierten nichts von den Geheimklauseln, die Preußen in Basel und Österreich in Campo Formio vereinbart hatten; den meisten dürften sie jedoch bekannt gewesen sein. Unter dem Druck neuer französischer Angriffe auf Mainz und andere Orte blieb nichts anderes übrig, als den Rhein als Grenze zu akzeptieren. Schwieriger war es, sich zu einigen, was das für das Reich bedeutete. An den Diskussionen über das Prinzip der Säkularisierung beteiligten sich mittlerweile so gut wie alle deutschen Fürsten. Es fiel jedoch unendlich schwer, den Wert dessen, was verloren gehen sollte, auszutüfteln und zum Zweck der Kompensation in Landfläche umzurechnen. Manche akzeptierten das Prinzip der Säkularisierung generell nicht. Es überrascht nicht, dass Mainz die völlige Säkularisierung aller kirchlichen Territorien abzuwenden versuchte und forderte, selbst für den Verlust seiner Territorien mit dem Fürstbistum Fulda entschädigt zu werden. Mainz machte schließlich auch den Vorschlag, der am 4. April 1798 allgemein akzeptiert wurde: Säkularisiert wurden demnach alle kirchlichen Territorien außer den Kurfürstentümern Mainz, Köln und Trier, die ans rechte Ufer des Rheins verlegt werden sollten. 58 Weitere Fortschritte gab es kaum, bis Frankreich nach der Gründung einer neuen antifranzösischen Koalition aus Großbritannien, Österreich, Russland, Portugal, Neapel und dem Osmanischen Reich im März 1799 Österreich erneut den Krieg erklärte. Am 6. Dezember 1798 hatte Frankreich in Rastatt eine Resolution zu erzwingen versucht und der Konferenz sechs Tage Zeit gegeben, einen Frieden auf Grundlage der Säkularisierung sämtlicher Kirchenterritorien, auch der drei
61. Das Reich in den Revolutionskriegen
Kurfürstentümer, zu akzeptieren. Auf Drängen des Mainzer Delegierten, der argumentierte, die Annahme des Ultimatums werde eine bessere Verhandlungsposition schaffen, stimmte der Kongress tags darauf zu. Als jedoch die Kämpfe in Süddeutschland wieder aufflammten, löste sich die Konferenz in Rastatt ohne Beschluss auf. Die Ermordung von zwei französischen Gesandten durch ungarische Husaren, so gut wie sicher nicht auf offiziellen Befehl aus Wien, verhärtete die Haltung von Paris und sorgte für Empörung im Reich. Preußische Kommentatoren hatten es besonders eilig, ihre Betroffenheit über diesen offensichtlich krassen Bruch internationalen Rechts durch kaiserliche Kräfte zum Ausdruck zu bringen. Dass Franz II. die Morde in einem Dekret an den Reichstag vom 5. Juni 1799 verurteilte, trug wenig dazu bei, das Misstrauen gegenüber dem Kaiser und seinen Beratern zu vertreiben. 59 Die letzte Runde der Gefechte war erneut ruinös teuer und außerordentlich brutal für Süddeutschland. Österreich zwang Baden und Württemberg, sich der Koalition anzuschließen, und eroberte vorübergehend Bayern. Im Vertrag von Gattschina erneuerte Russland am 1. Oktober 1799 die 1779 in Teschen vereinbarte Garantie der territorialen Integrität von Bayern und sagte zu, Großbritannien zur Unterstützung Bayerns zu gewinnen. Nach der Niederlage der russischen Armee unter General Korsakow und dem Schweizer Generalfeldmarschall von Hotze in der zweiten Schlacht von Zürich am 25./26. September trat der Zar jedoch aus dem Krieg aus. Die Österreicher hingegen waren entschlossen, bis zu Ende zu kämpfen. Für einige Zeit gaben die Probleme von Frankreich selbst Anlass zu einigem Optimismus. 60 Rückschläge in Ägypten und dem östlichen Mittelmeerraum leiteten eine innenpolitische Krise ein, die schließlich im November 1799 Napoleon an die Spitze des Konsulats brachte. Angesichts der schweren inneren Probleme setzte der Erste Konsul indes alles auf die militärische Karte und gewann. Eine französische Armee unter Jean Victor Moreau zog durch Süddeutschland nach München und erzwang am 15. Juli einen Waffenstillstand; Napoleon selbst führte eine weitere Armee nach Norditalien, wo er die Österreicher im Juni 1800 bei Marengo besiegte. Als Thugut immer noch nicht zu Friedensverhandlungen bereit war, griff Moreau erneut an und vernichtete die österreichische Armee unter Befehl von Erzherzog Johann am 3. Dezember bei Hohenlinden östlich von München. Österreich stand bereits im Sommer 1796 am Rand des Bankrotts. 1800 hatte die Monarchie Schulden von mehr als 600 Millionen Gulden und gab etwa doppelt so viel aus, wie sie einnahm. Mit dem Druck von 200 Millionen Gulden Papiergeld wurden fällige Rechnungen bezahlt, dadurch kam es jedoch zu einer Inflation, in deren Verlauf sich die Lebenshaltungskosten von 1801 bis 1805 verdreifachten. 61 Die finanzielle Lage vieler verbliebener Verbündeter im Reich war ähnlich. Der schwäbische Kreis, der die Hauptlast der Kriegsanstrengungen im Reich trug, steuerte mehr als 9 Millionen Gulden für die Kreistruppen und die kaiserliche Armee
665
666
VI. · Krieg und Zerfall: Das Reich 1792–1806
bei. Diese Summe enthielt noch nicht die Kosten der einzelnen Territorien für die Quartiere und Waffen ihrer Kontingente und für die diversen Heimwehren und Milizen. Mitte der 1790er Jahre waren sowohl die Territorien als auch der Kreis selbst tief verschuldet. 62 Wien blieb nichts anderes übrig, als die Bedingungen der Vereinbarung von Campo Formio wieder anzuerkennen. Der Friede von Lunéville (9. Februar 1801) verpflichtete Österreich und das Reich, die von Frankreich diktierten Bedingungen zu akzeptieren. Die Österreichischen Niederlande und das gesamte linke Ufer des Rheins fielen an Frankreich, die Batavische und die Helvetische Republik wurden anerkannt; Fürsten, die Ländereien an Frankreich verloren, sollten später gemäß dem Ergebnis der Beratungen einer neuen kaiserlichen Deputation entschädigt werden. Am 7. März stimmte der Reichstag dem Friedensvertrag offiziell zu. In Wien herrschte bittere Enttäuschung und Thugut verlor sein Amt. Unterdessen verhandelte Bayern mit Paris über Zusicherungen für seine eigene Zukunft und sicherte sich zugleich Unterstützung von Russland. Schließlich machte Österreich bereits Pläne, bayerisches Territorium bis zur Isar und die böhmischen Lehen in der Oberpfalz zu annektieren. Der neue Zar Alexander I. war auch an der Unterstützung von Baden und Württemberg interessiert, mit deren Dynastien er durch seine Gattin beziehungsweise seine Mutter verbunden war. Am 10. Oktober einigten sich Napoleon und der Zar als Herrscher der zwei verbliebenen Großmachtgaranten des Westfälischen Friedens (der dritte, Schweden, spielte nun keine Rolle mehr) heimlich auf eine Kooperation bei der Neuorganisation des Reichs. 63 Die französische Politik gegenüber dem Reich blieb während der Kriege seit 1792 konstant, abgesehen von kurzfristigen Unschlüssigkeiten und periodischen Inkohärenzen innerhalb der französischen Regierung. Das Ziel, Frankreichs natürliche Grenzen durchzusetzen, war für die Republik grundlegend, allerdings wurde die reine Lehre fallen gelassen, als Frankreich die Niederlande eroberte und 1795 die Batavische Republik gründete. Im Reich blieb die Rheingrenze das entscheidende Ziel, sowohl aus strategischer Sicht als auch als bedeutender Handelsweg, der Frankreich Zugang zu den prosperierenden Region Westfalen, Franken, Schwaben und Bayern verschaffte. Die gängige Antwort auf die Frage, wie deutsche Herrscher für den Verlust von Territorien entschädigt werden sollten, war, dass sie im Zuge der Säkularisierung kirchlicher Territorien Ländereien anderswo im Reich erhalten sollten. Ebenso konstant war die gegenseitige Feindschaft der Republik gegenüber Österreich. Gleichzeitig war Frankreich darauf aus, Frieden mit Preußen und einzelnen Territorien im Reich zu schließen. Preußen war aus finanziellen Gründen besonders wichtig, da gute Beziehungen zu Berlin Zugang zur Freihandelszone im nördlichen Reich bedeuteten. Ein allgemeiner Friede mit dem Reich war anfangs kein Ziel, da hierfür mit dem Kaiser verhandelt werden musste. 64
61. Das Reich in den Revolutionskriegen
Möglicherweise herrschte in Paris der Gedanke vor, Preußen müsse gegen Österreich gestärkt werden, um ein plausibleres Machtgleichgewicht im Reich herzustellen, das Frankreich dann ausnutzen konnte, indem es je nach Situation oder Notwendigkeit eine Macht gegen die andere ausspielte. 65 Der radikalere Plan zur Gründung einer schwäbischen Republik 1796 nach dem Vorbild der niederländischen (Batavischen) Republik und (1798) der schweizerischen (Helvetischen) Republik wurde nicht ernsthaft verfolgt. Das lag zum Teil daran, dass dies die Idee des unzuverlässigen französischen Agenten Marquis de Poteratz war; zudem war klar, dass eine solche Republik wenig einheimische Unterstützung finden würde. 66 Etwa um die gleiche Zeit gab es Annäherungen von Gesandten des fränkischen Kreises in Paris zur Gründung einer fränkischen Republik, die ebenfalls zu nichts führten. 67 Die französische Regierung dachte grundsätzlich im Sinn der fortdauernden Existenz des Reichs, wobei Österreich jedoch eine weit geringere Rolle spielen sollte. Ein anderer Ansatz, der die Rheingrenze und das Kompensationsprinzip mit der traditionellen französischen Haltung zum Reich kombinierte, entwickelte sich nur schrittweise: die Schaffung eines von Frankreich abhängigen oder finanzierten »dritten Deutschlands« aus den mittelgroßen Territorien zwischen Preußen und Österreich. Diesen Kurs steuerte man ab 1797, die Konferenz in Rastatt erbrachte jedoch keine konkreten Ergebnisse. Der gleiche Ansatz war das zentrale Motiv von Napoleons Deutschlandpolitik ab 1801 und seine Ausarbeitung führte dann direkt zum Ende des Reichs.
Anmerkungen 1 Hochedlinger, Wars, 401; vgl. auch S. 493 f. 2 Müller, Regieren, 85 f.; Boyle, Goethe I, 89–104; BWDG II, 1891; vgl. zur Situation des Elsass allgemein Matz, »Elsass«, 85 ff., 92–98; vgl. auch S. 601. 3 Härter, Reichstag, 102 f. 4 Ebd., 160 ff. 5 Vgl. auch S. 493 f. 6 Wilson, German Armies, 305 f. 7 Diezinger, Emigranten, 49–58. 8 Vgl. zum Folgenden Rowe, Rhineland, 44 f., und Biro, German Policy I, 42–45. 9 Ebd., 51. 10 Schroeder, Transformation, 93–97. 11 Biro, German Policy I, 67 f. 12 Hochedlinger, Wars, 407. 13 Kulenkampff, Österreich, 146; Roider, Thugut, 94 f.; vgl. auch Wilson, German Armies, 306. 14 Ziegler, »Franz II.«, 293; Hattenhauer, Wahl, 120–126, 130–138, 152–201. 15 Wilson, German Armies, 306.
667
668
VI. · Krieg und Zerfall: Das Reich 1792–1806
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Aretin, Altes Reich III, 392. Aretin, Heiliges Römisches Reich I, 268 f.; Kulenkampff, Österreich, 132–136, 145–150. Hochedlinger, Wars, 408. Boyle, Goethe II, 128 f. Erbe, Erschütterung, 66 f. Wilson, German Armies, 306 f. Hochedlinger, Wars, 409. Sahlins, »Frontiers«, 1443–1446. Scott, Birth, 270 f.; Erbe, Erschütterung, 301. Aretin, Altes Reich III, 395–400. Wilson, German Armies, 307. Kittstein, Politik, 32–64, bietet eine exzellente Einführung in die preußische Politik. Roider, Thugut, 100 ff.; Aretin, Altes Reich III, 412. Scott, Birth, 203–209; Stone, Polish-Lithuanian State, 277–285. Roider, Thugut, 103. Ebd., 130 f. (Thugut an Collorado, 2. Juni 1793). Das Folgende beruht auf dem ausgezeichneten Überblick bei Wilson, German Armies, 308–319. Neuhaus, »Problem«, 334 ff. Wilson, German Armies, 318. Aretin, Altes Reich III, 417. Ebd., 421–424. Aretin, Heiliges Römisches Reich I, 308. Ebd., 310. Roider, Thugut, 169; Wilson, German Armies, 321. Demel, Reich, 307 f. Roider, Thugut, 138. Demel, Reich, 309. Scott, Birth, 210 ff. Dwyer, »Politics«, 353 f.; Kittstein, Politik, 65–75. Scott, Birth, 267. Biro, German Policy I, 381–385. Wilson, German Armies, 322 f. Aretin, Altes Reich III, 442. Hochedlinger, Wars, 425 f. Härter, Reichstag, 435 f.; Wilson, German Armies, 323 f. Hochedlinger, Wars, 425. Wilson, German Armies, 323. Vgl. zu den diversen Abkommen Biro, German Policy II, 631–649. Ebd., 750–758. Härter, Reichstag, 539. Biro, German Policy II, 937 ff. Härter, Reichstag, 539–557; Gagliardo, Reich, 188 ff. Aretin, Altes Reich III, 465. Tschirch, Geschichte I, 385–415; Auszüge aus dem Dekret finden sich bei Fuchs, »Briefentwurf«, 325 f. Scott, Birth, 296–299.
61. Das Reich in den Revolutionskriegen
61 62 63 64 65 66
Hochedlinger, Wars, 432; Ingrao, Monarchy, 233. Borck, Schwäbischer Reichskreis, 124–127. Scott, Birth, 301; Schroeder, Transformation, 215, 222 f. Biro, German Policy I, 316 f., 408 f. Ebd., 467. Biro, German Policy II, 568–581; vgl. zu Poteratz’ Unzuverlässigkeit und einer kuriosen Mission nach Wien 1795, um Thugut zu erpressen und zu bestechen, Biro, German Policy I, 459, und Roider, Thugut, 42 ff. 67 Neugebauer-Wölk, »Verfassungsideen«, 77.
669
62. Der Widerhall der Französischen Revolution im Reich: Unruhen und Aufstände
A
ls eine Kompanie französischer Soldaten im Sommer 1796 auf das Dorf Lauben im südschwäbischen Unterallgäu vorrückte, lief ihr ein junger Mann zur Begrüßung entgegen. Der Sohn des Pfarrers hatte seinen Sonntagsanzug angelegt und wollte die Soldaten mit einer sorgfältig auf Französisch einstudierten Rede begrüßen, in der er sie als Befreier des Volkes pries, die Krieg den Palästen und Friede den Hütten brächten. Man kannte ihn im Ort als jemanden, der glaubte, die Franzosen seien »freiheitsliebende, aufopferungsfähige, aufgeklärte, tolerante Leute: wenn die einmal nach Deutschland kommen, so müsse man sie als die Bahnbrecher einer neuen, glorreichen Zeit mit Begeisterung empfangen«. Als er jedoch die »unaussprechliche Art ihrer Bekleidung« sah, begann er anders über die Republikaner zu denken, und bevor er zu seiner Rede ansetzen konnte, wurde er umzingelt; man raubte ihm seinen Sonntagsrock, Uhr, Geldbeutel, Stiefel und Weste. Mit Glück entkam er in Unterwäsche und verfluchte die Spitzbuben, die »den Namen der Freiheit zum Deckel ihrer Räubereien benutzten«. 1 Diese Geschichte sagt viel über die schreckliche Erfahrung des Kriegs und der französischen Besatzung für viele Gemeinden im Reich. Plünderungen und Ausbeutung waren an der Tagesordnung und trugen zu den immensen Kosten dieser Phase und zu der Verbitterung bei, die solchen Erfahrungen entsprang. Die Notlage des Pfarrerssohnes steht jedoch auch symbolisch für die gängige Sicht der Wirkung der Französischen Revolution auf Deutschland allgemein. Begeisterung gab es zweifellos, aber eher für die Idee der Revolution als für die Wirklichkeit. Trotzdem geben solche Verallgemeinerungen die zahlreichen Auswirkungen der Revolution im Reich und die Reaktion vieler Deutscher auf die Vorgänge in Frankreich nicht angemessen wieder. Diese reichten von deutschen revolutionären Bewegungen ab 1789 über Reaktionen gegen die französische Invasion und Besatzung während der 1790er Jahre bis hin zur Debatte über die Revolution und ihre Auswirkungen, die in zahlreiche unterschiedliche intellektuelle und kulturelle Strömungen der späten 1790er Jahre mündete. Schon vor Ausbruch der Französischen Revolution war die Grundlage für ihre Rezeption und Wirkung gelegt worden. Wie sich der preußische Feldmarschall Hermann von Boyen (* 1771, † 1848) später in Bezug auf die Stimmung in Königsberg 1790 erinnerte, lösten die erfolgreiche Amerikanische Revolution von 1776
62. Der Widerhall der Französischen Revolution im Reich: Unruhen und Aufstände
und der gescheiterte Aufstand der Patriotten gegen den Statthalter Wilhelm V. in den Niederlanden 1783–1787 eine breite öffentliche Diskussion politischer Probleme aus. 2 Dies galt auch für andere Gegenden des Reichs, die den Vorgängen in den Niederlanden und dann dem Aufstand in den Österreichischen Niederlanden 1788 sowie der Französischen Revolution selbst im Jahr darauf näher waren. An Teilen des Niederrheins hatten die turbulenten Ereignisse im Fürstbistum Lüttich zwischen August 1789 und Februar 1791 eine ähnlich stimulierende Wirkung. 3 Die Unruhe verbreitete sich während der 1790er Jahre wahrscheinlich weiter und länger, als oft behauptet wird. Es ist jedoch oft notwendig, zwischen Vorkommnissen, die im Grunde eine Fortsetzung der Dispute und Protesttraditionen aus der Zeit vor 1789 waren, und solchen, die man tatsächlich als revolutionär bezeichnen könnte, zu unterscheiden. Die Nachahmung spezifischer Formen des Protests, über die im Sommer 1789 aus Frankreich berichtet wurde, etwa die Übernahme französischer Parolen und das Tragen von Kokarden, machte nicht zwangsläufig alle Unruhen im Reich zu etwas radikal Neuem. Das Problem der Interpretation der Unruhen nach 1789 beschäftigte auch die deutschen Herrscher selbst. Von Sommer 1789 an beriet der Reichstag über eine Reihe von Vorschlägen, um das Reich vor einer Revolution zu schützen. 4 Im August 1791 wurde ein neuer Rahmen des Zensurrechts verabschiedet, um die Ausbreitung »demokratischer Prinzipien« zu verhindern. Im Februar 1793 erließ der Reichstag ein Dekret gegen revolutionäre Aufwiegler und »Jakobiner«. Als problematischer erwies sich ein geplantes Verbot aller Geheimgesellschaften, weil viele keinen Sinn darin sahen, die Freimaurer und andere zu verbieten oder straffällige junge Studenten auf Dauer von Karrieren in Regierungsämtern auszuschließen. Die Mehrheit gab sich im Juni 1793 mit einem Verbot geheimer Studentenverbindungen und der Ermächtigung zur Relegation radikaler Studenten zufrieden. Dass sich diese Debatten so lange hinzogen, zeigt, dass die Sache nicht als dringend notwendig empfunden wurde. Die Forderung, die Umsetzung jeglicher Vereinbarungen individuellen Territorien und keiner zentralen Behörde unter Aufsicht des Kaisers zu übertragen, spiegelt nicht nur die anhaltende Opposition gegen eine Ausweitung der kaiserlichen Macht, sondern auch die Ansicht wider, dass es sich bei den Unruhen um lokale Phänomene handelte. Wichtig ist, dass es zwar zu vielen Unruhen in Deutschland, aber nie zu einer deutschen Revolution kam. Die Nähe lokaler und regionaler Dispute zu den revolutionären Entwicklungen in Frankreich sorgte oft für zusätzlichen Druck. In einige der Unruhen waren Einzelne verwickelt, die wohl tatsächlich »Jakobiner« waren. Bei den meisten handelte es sich jedoch um traditionelle Akteure in herkömmlichen Disputen, die regelmäßig auf die übliche Weise durch Anrufung des Reichskammergerichts oder des Reichshofrats, durch regionale oder lokale Schlichtungsverfahren beigelegt wurden. 5
671
672
VI. · Krieg und Zerfall: Das Reich 1792–1806
Zu verbreiteten Unruhen kam es zuerst im Rheinland. 6 Berichte über die Ereignisse im Elsass und in Straßburg schürten den bestehenden Unmut in der österreichischen Grafschaft Ortenau und in einigen Bezirken von Baden, wo die Obrigkeit Kanonen auffahren ließ, um die Archive von Rastatt zu schützen, in denen Urkunden zu Grundbesitz und territorialem Recht aufbewahrt wurden. Die Unruhen breiteten sich bald in die benachbarten Territorien der Benediktinerklöster Schwarzach und Frauenalb sowie in die Straßburger Enklave Renchtal aus. Weiter nördlich gab es Unruhen in Zweibrücken, dem Fürstbistum Speyer und NassauSaarbrücken sowie in den linksrheinischen Territorien der Kurfürstentümer Mainz und Trier. Noch weiter nördlich kam es zu Unruhen in den Gebieten der Reichsabteien Stablo und Malmedy sowie im pfälzischen Herzogtum Berg und dem weiter von den Grenzregionen entfernten Hessen-Kassel. 7 Die Probleme, um die es in diesen Disputen ging, waren selten neu: Beschwerden über Pachtzahlungen und Arbeitsdienste, Schäden durch Wild, das unter dem Schutz der herrscherlichen Jagdrechte stand, Streitereien über den Zugang zu Wäldern. In manchen Gegenden wurden diese seit jeher gängigen Spannungen durch die Großzügigkeit des Herrschers gegenüber den Emigranten verschärft, die man wegen ihrer Verachtung des gemeinen Volks ausnahmslos verabscheute und hasste. Die Äußerung eines Badeners, die französischen Adligen behandelten die Deutschen »wie Negersklaven«, hätte wohl fast überall am Mittel- und Oberrhein Anklang gefunden. 8 Die erste Welle von Unruhen war spätestens im Frühjahr 1790 beigelegt. Kleinere militärische Eingriffe und lokale Vermittlung sorgten meist für eine Lösung. In manchen Fällen dauerten die Dispute länger, wie in Nassau-Saarbrücken, wo man erst 1792 zu einer Lösung fand. 9 Dort und anderswo war das politische Leben in den 1790er Jahren weiterhin von periodischen Unruhen geprägt, ebenso wie in früheren Jahrhunderten. Anspielungen auf 1789 wurden in lokalen Disputen jeder Art üblich. Als sich der lange Streit zwischen den Bauern von Gesmold im Fürstbistum Osnabrück mit ihrem Gutsherrn, dem Freiherr von Hammerstein, im Sommer 1794 gewalttätig entlud, forderten sie »Freiheit und Gleichheit wie in Frankreich« und rissen die »famöse Bastille« nieder, als die sie den Gefängnisturm von Schloss Hammerstein betrachteten. Hammerstein selbst bezeichnete das Ganze als »jakobinische Verschwörung«. Dass beide Seiten 1789 beschworen, kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass es sich wie in den meisten Fällen in den 1790er Jahren im Grunde eher um einen traditionellen Konflikt als um eine neue Form der Revolution handelte. 10 Parallel zu den ländlichen Unruhen auf der gesamten Länge des Rheins von Basel bis zur niederländischen Grenze setzte sich auch eine Vielzahl städtischer Konflikte fort oder brachen neu aus. 11 In Kurtrier starteten die Repräsentanten
62. Der Widerhall der Französischen Revolution im Reich: Unruhen und Aufstände
von Trier und Boppard, wo sich die Bürgerschaft 1786 der neuen Forstordnung des Kurfürsten widersetzt hatte, 1790 und 1791 im Landtag eine Reihe von Protesten gegen die Steuerprivilegien des Adels. Das gleiche passierte in Köln, wo die Städte 1790 im Landtag gegen die Steuerprivilegien von Adel und Klerus protestierten. In Aachen bekam ein langer Konflikt zwischen Bürgerschaft und herrschender Oligarchie durch die Einführung von Parolen und Symbolen der Revolution in Frankreich neue Schärfe. In Aachen wie in Köln war die Gründung politischer Vereine 1792 eine weitere Form der Aneignung politischer Praktiken aus Paris. Eine weitere Variante städtischer Unruhen war die erste Welle von Lehrlingsstreiks, die im November 1790 in Braunschweig begann und im Juni beziehungsweise August 1791 nach Bremen und Hamburg übersprang. Diese Art von Protest setzte sich in anderen Reichs- und Territorialstädten bis weit in die 1790er Jahre fort. 12 Zu Lehrlingsaufständen kam es 1794 in Nürnberg, dann in Augsburg, Ulm, Esslingen, Reutlingen, Stuttgart und München. 1795 gab es eine neue Welle des Unmuts in Hamburg, Lübeck, Rostock, Dresden und Berlin. Zwei ländliche Aufstände fallen durch ihr Ausmaß aus der Reihe. In Sachsen hatte die Modernisierung der Stände nach dem Siebenjährigen Krieg den Bauern mehr Arbeitsdienste aufgebürdet und viele Grundbesitzer dazu verleitet, ihr Recht auf Rekrutierung von Arbeitskräften aus den Dörfern (Gesindezwangsrecht) intensiv auszunutzen. 13 Eine einer Trockenperiode folgende Missernte 1789 führte zu Protesten, die sich im Mai 1790 in direktem Vorgehen gegen die übermäßigen Wildbestände in den Wäldern des Kurfürsten entluden. Entschärft wurde die Lage, indem der Kurfürst eine große Anzahl von Tieren töten ließ. Anfang August kam es zu einem neuen Gewaltausbruch, bis Monatsende wuchs die Anzahl der Rebellen auf etwa 10.000. In vielen Gegenden brach die Autorität des Kurfürsten völlig zusammen und eine Streitmacht von 2.000 Bauern befreite die Gefangenen aus dem Gefängnis in Meißen. Die Entsendung von 5.600 Soldaten nach Meißen stellte die Ordnung wieder her und Ende Oktober waren die letzten Reste des Widerstands niedergeschlagen. Die Deklarationen der Rebellen zeigten deutlich, dass sie der Ereignisse in Frankreich gewahr waren. Regierungsagenten berichteten, die Rebellen hätten ihnen mitgeteilt, dass sie »daß sie schon seit Jahr und Tag durch das Lesen der Zeitungen und anderer öffentlicher Blätter auf die Gedanken geraten, daß dasjenige, was an anderen Orten zum Vorteil des Bauernstandes geschehen, auch wohl in Sachsen stattfinden könne.« Andere erklärten, die Dinge müssten »wie in Frankreich sein«. Zugleich glaubten die Bauern offenbar, der Kurfürst sei in Wirklichkeit auf ihrer Seite und werde, wenn man ihn von seinen schlechten Ratgebern befreie, sich ihrer Sache annehmen. Diese Sicht zeigt sich deutlich in den Manifesten des Liebstädter Seilers Christian Benjamin Geißler, der die Bauern aufrief, das »unerträgliche Joch der Edel-
673
674
VI. · Krieg und Zerfall: Das Reich 1792–1806
leute« abzuschütteln. So wie die Pariser nach Versailles marschiert waren, sollten sächsische Bauern Friedrich August III. von seinem Schloss in Pillnitz nach Dresden zurückbringen, damit er die Regierung wieder in guten Zustand versetze und Reformen einführe, etwa durch die Aufstellung einer Nationalgarde. Zahlreiche Rebellen übernahmen Geißlers Worte; er selbst wurde indes verhaftet, bevor der Aufstand richtig losbrach: Ein Dresdner Arzt diagnostizierte, er sei von fixen Ideen beherrscht; in Anerkennung seines Patriotismus ersparte man ihm das Gefängnis und sperrte in für fünfzehn Jahre ins Irrenhaus von Torgau. Beruhigt wurde die Lage in Sachsen durch eine Senkung der Lebensmittelpreise und regierungsamtlichen Druck auf Grundbesitzer, die Arbeitsdienste abzumildern und die Weiderechte von Gutsherren einzuschränken. Obwohl der Adel diese Empfehlungen zurückwies, schienen die Bauern davon auszugehen, die Regierung sei ebenso gewillt, ihr Wohl zu fördern als ihnen mit militärischer Gewalt zu drohen. 14 Die Kenntnis der Ereignisse in Frankreich spielte auch in der noch ausgedehnteren schlesischen Bauernrebellion von 1792/93 eine signifikante Rolle. 15 Der dirigierende Minister Graf Karl von Hoym (* 1739, † 1807) war überzeugt, »durch Lesung von Zeitungen und Zeitschriften« hätten »blendende Sätze von Freiheit und Gleichheit eben unter den niederen Volksklassen, die das Wahre vom Falschen nicht unterscheiden können, Wurzel gefaßt«. 16 Ebenso wichtig war wohl der Triumph der Reformpartei in Polen. Die Abschaffung der Leibeigenschaft in Polen am 3. Mai 1791 und die neue polnische Verfassung vom selben Monat weckten offenbar Hoffnungen auf Veränderungen in Preußen. Dies verschärfte eine Situation, die sich seit den 1780er Jahren zusehends verschlechtert hatte. Weberdörfer begannen sich den Forderungen von Gutsbesitzern nach Arbeitsdiensten zu widersetzen und ein Einbruch der Nachfrage nach Leinentuch in den frühen 1790er Jahren, der die lange Phase des Wachstums nach dem Siebenjährigen Krieg zu beenden drohte, löste im Herbst 1792 eine Massenbewegung von alarmierendem Ausmaß aus. Im Frühling 1793 betrug die Anzahl der Rebellen um die 20.000. Neben Gerüchten, die Franzosen würden einmarschieren und alle Schlesier befreien, gab es eine ähnliche Ansicht wie 1790 in Sachsen: Friedrich Wilhelm II. sei den Dorfbewohnern wohlgesinnt. Ein erstes militärisches Einschreiten schürte die Spannungen nur noch mehr, aber bis Sommer 1793 stellte Hoym die Ordnung wieder her. Klugerweise verzichtete er auf Vergeltungsmaßnahmen gegen die Rebellen, als er daranging, die Weber zu beschwichtigen. Im Jahr darauf führte das Gerücht, das Allgemeine Landrecht werde Bauern von allen Verpflichtungen befreien, jedoch zu weiteren Unruhen und auch in den Folgejahren gab es Probleme. Die schlesischen Rebellen von 1793 erklärten: »Wir wollen Könige, aber sie müssen uns auch helfen.« 17 Ihr Protest richtete sich eher gegen das repressive
62. Der Widerhall der Französischen Revolution im Reich: Unruhen und Aufstände
Regime der adligen Gutsbesitzer in Reaktion auf Marktkräfte als gegen das System als solches. Die Frage, ob irgendwelche Rebellen irgendwo im Reich eine revolutionäre Umwandlung der Gesellschaft wollten, sorgt seit den 1960er Jahren für Kontroversen. 18 Es scheint klar, dass die sogenannten deutschen Jakobiner eine kleine Minderheit ohne großen Widerhall im Volk waren und viele, die nervöse zeitgenössische Regierungen beziehungsweise fortschrittliche Historiker jüngerer Zeit so bezeichneten, waren tatsächlich nur enthusiastische aufgeklärte Reformer. Das Schicksal derer, die mehr wollten als lediglich das bestehende System reformieren, unterstreicht, wie unbedeutend sie für jene waren, die sich tatsächlich an den umfangreichen Protesten und Rebellionen im Reich während der 1790er Jahre beteiligten. Zum bemerkenswertesten Versuch eines Neubeginns kam es 1792/93 in Mainz. 19 Zwei Tage nach der Eroberung der Stadt durch General Custine am 21. Oktober gründeten etwa zwanzig Begeisterte die Gesellschaft deutscher Freunde der Freyheit und Gleichheit (den Klub). Bis Ende November fand sie fast fünfhundert Mitglieder, darunter allerdings auch eine Gruppe französischer Offiziere und andere aus Frankreich und Belgien, die im Tross von Custines Armee nach Mainz gekommen waren. 20 Die Aktivitäten des Klubs waren deutlich geprägt von denen des Klubs in Straßburg; der Mainzer Klub wiederum inspirierte andere, kleinere Klubs in Worms und Speyer. Anfangs setzte Custine auf bestehende Regierungsinstitutionen, am 19. November begründete er indes eine neue »Munizipalität«, der zwei führende »Klubisten« vorstanden, der Philosoph Anton Joseph Dorsch (* 1759, † 1819) und der Wissenschaftler und Forscher Georg Forster (* 1754, † 1794), ehemals Bibliothekar des Kurfürsten. Die Lage änderte sich erneut, als die Nationalversammlung am 15. Dezember 1792 dekretierte, alle regionalen Kommandeure sollten das Feudalsystem abschaffen und demokratische Verfassungen einführen. Die Bevölkerung von Mainz hatte andere Vorstellungen. Als die Zünfte nach ihren Wünschen für die Zukunft gefragt wurden, zögerten sie und überließen die Initiative den Händlern. Deren Sprecher Daniel Dumont war unentschieden: Unter Berufung auf die »ersten Grundsätze der Französischen Revolution« schlug er vor, die Mainzer Regierung solle »auf ihre ursprüngliche Reinheit zurückgebracht« werden. 21 Damit sprach er zwar der Mehrheit aus der Seele, Custine und der Klub richteten sich jedoch nach etwa vierhundert Handwerkern (etwa 17 Prozent), die in einer Petition eine »gänzliche Umänderung der Verfassung« forderten. Diesen Wunsch teilten offenbar neunundzwanzig der vierzig ländlichen Gemeinden in der Region. Trotz außerordentlicher Publizität und beträchtlichem Druck waren die Wahlen im Februar eine Enttäuschung. In Mainz selbst wählten nur 372 (acht Prozent der Wahlberechtigten); in den ländlichen Gebieten waren die Ergebnisse nicht viel besser: Von neunhundert Gemeinden in der Besatzungszone wählten nur
675
676
VI. · Krieg und Zerfall: Das Reich 1792–1806
etwas über hundert. 22 Die Mitgliederzahl des Klubs war unterdessen auf sechsunddreißig geschrumpft. Die hundert Abgeordneten, die am 17. März als Rheinisch-deutscher Nationalkonvent zusammentraten, repräsentierten kaum die »Mainzer Nation«. Forster, zum Vizepräsidenten des Konvents unter dem Philosophen Andreas Joseph Hofmann (* 1753, † 1849) berufen, hatte das Vertrauen in den Wunsch der Deutschen nach Freiheit und Unabhängigkeit inzwischen verloren. Die Deutschen, hatte er im Dezember in einem Brief geschrieben, seien nicht reif für eine Revolution: »Unser rohes, armes, ungebildetes Volk kann nur wüten, aber nicht sich konstituieren.« 23 Drei Tage nach Ausrufung der freien und souveränen Republik beschloss man, beim Nationalkonvent in Paris um Aufnahme in die Französische Republik zu ersuchen. Das erwies sich als unerheblich: Am 14. April 1793 wurde die Stadt von österreichischen und preußischen Truppen umzingelt, am 23. Juli kapitulierten die französischen Streitkräfte und zogen ab. Streng genommen war die Mainzer Republik die dritte im Reich. Vorangegangen waren die Raurakische Republik, am 17. Dezember 1792 im Fürstbistum Basel ausgerufen, und die Ende Januar 1793 in der Zweibrücker Exklave Bergzabern gegründete Südpfälzische Republik. Beide wurden im März 1793 in die Französische Republik aufgenommen, österreichische Truppen eroberten Bergzabern indes im Herbst zurück, ehe Frankreich es 1794 endgültig einnahm. 24 In beiden Fällen fand die ursprüngliche Erklärung der Republik offenbar echte Unterstützung. In der vierten deutschen Republik, die am linken Ufer des Rheins gegründet wurde, das Frankreich ab Ende 1794 mehr oder weniger vollständig erobert hatte, lagen die Dinge etwas anders. 25 Hier nahmen die Franzosen zunächst mit den bestehenden administrativen Strukturen vorlieb und improvisierten dann bei dem Versuch, so viele Ressourcen wie möglich für ihre Kriegsanstrengungen aufzutreiben. Die Mehrheit der Bevölkerung stand der französischen Besatzung bald sehr ablehnend gegenüber, aber eine kleine Minderheit glaubte immer noch an die Möglichkeit der Schaffung einer Cisrhenanischen Republik mit etwa 1,3 Millionen Einwohnern, die Frankreich angegliedert, aber unabhängig sein sollte. Die Cisrhenanier waren Radikale, die von den Exzessen des jakobinischen Terrors schockiert waren und eine moderate, eher an der französischen von 1795 orientierte Verfassung einführen wollten, basierend auf Kants Ethik: Sie strebten eine Moralisierung der Französischen Revolution an. Ermutigt durch die Gründung der Cispadanischen Republik in Bologna (1796), der Ligurischen Republik in Genua und der Cisalpinen Republik in Mailand, hielten die Cisrhenanier ihre Zeit 1797 für gekommen. 26 Zu ihrem Unglück beschloss das französische Direktorium genau zur Zeit der Ausrufung der Cisrhenanischen Republik im September 1797 die Annexion. Wie in Mainz war die Deklaration der Unabhängigkeit und Souveränität (13. November 1797) gleichzeitig eine Erklärung des Anschlusses an Frankreich.
62. Der Widerhall der Französischen Revolution im Reich: Unruhen und Aufstände
Im Jahr darauf wurde die Region in vier Départements aufgeteilt (Ruhr, RheinMosel, Saar und Donnersberg). Bis September 1802 ersetzte das französische System von Präfekturen, Arrondissements und Stadtverwaltungen die letzten Reste der traditionellen Regierungsstrukturen, die vier Départements standen nun auf derselben Basis wie alle anderen in Frankreich. Die Nähe zu Frankreich verschaffte deutschen Revolutionsbegeisterten Möglichkeiten, die es anderswo nicht gab. In Hamburg und Schleswig-Holstein waren die meisten »Jakobiner« in Wirklichkeit radikale Journalisten. Einer der prominentesten, Georg Conrad Meyer (* 1774, † 1816), ab 1796 Herausgeber der Zeitschrift Der neue Mensch, war ein leidenschaftlicher Befürworter von Reformen, Verfechter der gleichmäßigen Verteilung von Reichtum, solange keine Besitzrechte angetastet wurden, Kritiker der Despotie und Bewunderer von »Friedrich dem Einzigen«. 27 Die Jakobiner, deren Verschwörung 1794 in Wien aufgedeckt wurde, waren ebenfalls im Grunde eher Reformisten als Revolutionäre. Sie bestanden aus einer geheimen Gruppe von Propagandisten, die Leopold II. rekrutiert hatte, um seine eigenen konstitutionellen Pläne gegen die Opposition des Adels durchzusetzen. Nach Leopold Tod sahen sie sich unter dem zunehmend reaktionären Regime von Franz II. isoliert und planten 1794, durch einen allgemeinen Volksaufstand einen Staatsstreich einzuleiten. Rädelsführer der etwa achtzig Verschwörer waren der Ungar Ignaz Martinovics (* 1755, † 1795), die Wiener Mathematiker Andreas Riedel (* 1748, † 1837) und der Böhme Franz Hebenstreit (* 1747, † 1795), der wie Marinovics zum Tod verurteilt wurde, als der Plan aufflog. Riedel erhielt sechzig Jahre Festungshaft. 28 Nach 1795 verlegte sich der Brennpunkt radikaler Aktivitäten nach Süddeutschland, wo zwischen 1796 und 1800 mehrere Pläne zur Schaffung einer Republik entstanden. 29 1796 gab es den Plan einer süddeutschen Republik in Basel und einer fränkischen Republik von Adligen (Reichsrittern), frei von österreichischem und preußischem Einfluss. 1797 kam es zum Versuch, den württembergischen Landtag zu radikalisieren, und einem weiteren Plan, einen Bauernaufstand in Baden anzuzetteln, der die Friedenskonferenz in Rastatt aufheben und zur Proklamation einer Republik führen sollte. 1798 regte die Gründung der Helvetischen Republik den Plan eines süddeutschen Pendants an. 1800 schließlich veröffentlichte ein jakobinischer Klub in München eine Deklaration, datiert auf den »1. August im letzten Jahr deutscher Versklavung«, die die Selbstbestimmung des bayerischen Volks forderte, nachdem es Gerüchte gegeben hatte, der neue Kurfürst Maximilian IV. Joseph (1799–1825, ab Dezember 1805 als König) wolle möglicherweise sein Territorium im Austausch gegen andere Ländereien an Österreich abtreten. Sechs Monate zuvor hatte jedoch Napoleon als Erster Konsul die Revolution für beendet erklärt; eine neue Republik in Bayern
677
678
VI. · Krieg und Zerfall: Das Reich 1792–1806
war für Paris nicht von Interesse. Die Idee einer bayerischen Republik war sowieso eher Ausdruck des bayerischen Patriotismus und der Sehnsucht, die Unabhängigkeit von Österreich zu bewahren, als von revolutionärem Denken. Der Führer der Bewegung, Joseph Utzschneider (* 1763, † 1840), trat bald als tragende Säule des neuen Königreichs Bayern hervor: nacheinander als Vorstand der Staatsschuldentilgungsanstalt, Zweiter Bürgermeister von München und Leiter der Münchner polytechnischen Zentralschule. 30 Alle süddeutschen Republikpläne waren im Grunde Reaktionen kleiner Gruppen ohne Unterstützung aus dem Volk auf die immer desolatere militärische Situation. Vor allem fehlte es ihnen meist an dem ideologischen Eifer, der die diversen jakobinischen Gruppen vor 1795 antrieb. Man ist versucht, die deutschen Jakobiner als Randfiguren abzutun. Aber auch wenn sie die Massen nicht bewegten, spielten sie sicherlich eine signifikante Rolle in der Bildung der allgemeinen öffentlichen Meinung in den frühen 1790er Jahren. Tatsächlich nahm der Begriff Jakobiner vor dem Hintergrund dieser Debatten eine sehr unklare Bedeutung an, die nicht einfach auf eine Nähe zu den französischen Jakobinern oder Robespierre hindeutete. Meist war er eine abfällige Bezeichnung der konservativen Presse für jeden, der sich für soziale Veränderungen einsetzte oder als Unruhestifter galt. Um 1795 hatte der Begriff eine noch viel breitere Bedeutung angenommen und konnte sogar für »Aufklärer« stehen. 31
Anmerkungen 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15
Planert, Mythos, 134 f. Neugebauer, Politischer Wandel, 157 f. Vgl. S. 464 f., 489. Vgl. zum Folgenden Härter, Reichstag, 287–377. Wegert, »Patrimonial Rule«, 455–464. Vgl. zum Folgenden, wo nicht anders angegeben: Rowe, Rhineland, 39–45; Blanning, Revolution, 47–58; Reichardt, »Volksbewegungen«, 16–20; Scheel, »Revolution«, 25–32; Julku, Bewegung, 254–276. Speitkamp, »Unruhe«. Diezinger, Emigranten, 89; einen guten Beitrag zur deutschen Haltung gegenüber den Emigranten liefert Saine, Black Bread, 66–78. Fehrenbach, »Unruhen«; Ries, Obrigkeit, 439–449. Reichardt, »Volksbewegungen«, 24; Heuvel, »Politisierung«; Herzig, »Einfluß«. Gerteis, »Konfliktpotential«, setzt sich mit den hier erwähnten Fällen auseinander; vgl. zu Aachen und Köln Julku, Bewegung, 62–78. Press, »Reichsstadt«, 23–53, bietet einen exzellenten Überblick. Wagner, »Bauernaufstand«; Scheel, »Revolution«, 30 f.; Franz, Geschichte, 245 ff.; Stulz und Opitz, Volksbewegungen, 43–123. Fehrenbach, Ancien Régime, 70. Franz, Geschichte, 247–250; Ziekursch, Hundert Jahre, 226–241.
62. Der Widerhall der Französischen Revolution im Reich: Unruhen und Aufstände
16 Wehler, Gesellschaftsgeschichte I, 358; vgl. auch Neugebauer, »Preußen«, 473 f. 17 Zitiert nach Raumer und Botzenhart, Deutschland, 77. 18 Blanning, »Jacobins«, und in jüngerer Zeit Schlott, »Aufklärung«, geben einen guten Überblick; Cottebrune, »Freiheitsfreunde«, findet, streng genommen sei keiner der deutschen Radikalen ein echter »Jakobiner« gewesen. 19 Blanning, Reform, 267–302; Rowe, Rhineland, 61–65; Fehrenbach, Ancien Régime, 65 ff.; Wegert, Radicals, 17–41. 20 Blanning, »Jacobins«, 994. 21 Fehrenbach, Ancien Régime, 66 f. 22 Blanning, Reform, 299 f. 23 Fehrenbach, Ancien Régime, 63. 24 Neugebauer-Wölk, »Reich«, 33–37, 39; das Fürstbistum war tatsächlich eine Exklave des Reichs und umfasste die Teile des ursprünglichen Territoriums, die nach der Reformation in der Stadt Basel und ihrem unmittelbaren Umkreis katholisch blieben, insgesamt 1.100 km 2 mit etwa 60.000 Einwohnern; vgl. Köbler, Lexikon, 44 f.; Bergzabern war nicht mehr als eine sehr kleine Stadt und einige Dörfer; vgl. auch Rowe, Rhineland, 39, 64. 25 Ebd., 65 ff.; Blanning, Revolution, 200 ff., 305 ff.; Biro, German Policy II, 838–907; Wegert, Radicals, 42–53. 26 Neugebauer-Wölk, »Reich«, 41 f. 27 Grab, Strömungen, 38–131, 239–246; Grab, Jakobiner; Fehrenbach, Ancien Régime, 65. 28 Wangermann, Jacobin Trials, 82–117, 133–152, 166 f. 29 Neugebauer-Wölk, »Reich«, 43–50; ders., »Verfassungsideen«, 77; Scheel, Jakobiner, 229– 241, 291–352, 589–697; Fehrenbach, Ancien Régime, 65, 68 f.; Wegert, Radicals, 54–74. 30 Fehrenbach, Ancien Régime, 69; Press, »Bayern und die Französische Revolution«, 203– 206; ADB XXXIX, 420–440. 31 Saine, Black Bread, 282–290.
679
63. Der Widerhall der Französischen Revolution im Reich: Intellektuelle
D
ie Reaktion gebildeter Deutscher auf die Französische Revolution wird oft als rein intellektuelle Angelegenheit dargestellt. Manchen dient sie als Beleg für die politische Ohnmacht der deutschen Intelligenzija oder für das unpolitische Wesen des deutschen Denkens im späten 18. Jahrhundert. Andere bringen die Reaktionen deutscher Autoren auf die Ereignisse in Frankreich mit einer Reaktion gegen die Aufklärung und ihre Ideale und mit frühen Formen eines nationalen Erwachens in Verbindung, das sowohl Frankreich als auch das Reich zugunsten einer neuen Vision von einem durch das Volk konstituierten Nationalstaat ablehnte. Die Gedankengänge hinter solchen Ansätzen sind unterschiedlich. Eine lange Tradition der Interpretation berief sich auf eine Reihe vermeintlich bezeichnender deutscher intellektueller und kultureller Entwicklungen um 1800, die angeblich ein neues Gefühl deutscher Identität im späten 18. Jahrhundert schufen: die »Erfindung« des Historismus durch Herder und andere, die Literatur der Goethezeit und die Werke der sogenannten deutschen Bewegung der Zeit zwischen 1770 und 1830. 1 Parallel dazu gab es eine radikalere Tradition, die, Heine und Marx folgend, ein deutsches Äquivalent zur Französischen Revolution in der Philosophie erkannte, speziell in der Entwicklung dessen, was Heine als »eigne Wahlverwandtschaft« zur Französischen Revolution bezeichnete, die sich in der Entwicklung der deutschen Philosophie von Kant bis Hegel widerspiegle. 2 Nach 1945 führte die Beschäftigung mit dem Konzept eines deutschen Sonderwegs dazu, dass die 1790er Jahre oft als Jahrzehnt herausgehoben wurden, in dem die Opposition gegen Frankreich und seine Revolution dem Antirationalismus, einer Abwendung von der Politik und Flucht in die Künste, insbesondere die Literatur, Vorschub geleistet habe. Dagegen betonten Historiker in der DDR und ihre überwiegend marxistischen Pendants im Westen den politischen Aktivismus der deutschen »Jakobiner«. Manche Historiker überhöhten deren Anzahl, indem sie so gut wie jeden mit einbezogen, der der Französischen Revolution gewogen war, und stellten sie in den Mittelpunkt einer angeblichen Volksbewegung, die von den Kräften der Reaktion brutal niedergeschlagen wurde. Diese Sichtweise ist schwer zu belegen. Zweifellos gab es verbreitete Unruhen im Reich, aber die »Jakobiner« nahmen dabei keine Führungsrolle ein. Deutsche Intellektuelle interpretierten die Ereignisse in Frankreich durch die Brille ihrer
63. Der Widerhall der Französischen Revolution im Reich: Intellektuelle
eigenen sozialen und politischen Einstellungen. Manche begannen die Aufklärung abzulehnen oder zumindest einige ihrer nun als allzu grob vereinfachend empfundenen Annahmen infrage zu stellen, die meisten jedoch nicht. Das verbreitete Unbehagen über die zunehmende Brutalität der Französischen Revolution und die Bestürzung über die Hinrichtung Ludwigs XVI. im Januar 1793 führten nicht zu einer allgemeinen Preisgabe der Ideale der Aufklärung oder einem Rückzug aus der Politik. Manche strebten nun in unterschiedlicher Weise, von der sie glaubten, sie trage tatsächlich zur Verwirklichung der Ideale bei, die sie weiterhin mit 1789 verbanden, nach einem Engagement bei den bestimmenden aktuellen Problemen. Nach 1792 verkomplizierte auch der Krieg deutsche Reaktionen auf die Revolution und dies trug zu der weitläufigen Debatte über Frieden ab 1794 bei. In der zweiten Hälfte der 1790er Jahre erweiterten sich die Diskussionen über Frieden und die Prinzipien von 1789 zu einer Reihe von Reflexionen über Kultur und Identität. Diese letzten Debatten des Jahrhunderts versuchten die Revolution als prägende historische Erfahrung zu verstehen, die den Deutschen eine einzigartige Position am Scheitelpunkt der Moderne verschaffte. Die Lektion der Revolution und die Erfahrung des Kriegs erzeugten ein neues und selbstbewussteres Gefühl der Identität. Viele Historiker sehen darin die ersten Regungen einer neuen Form von deutschem Nationalismus, aber das Gefühl einer deutschen Mission, das in den späten 1790er Jahren hervortrat, entstand innerhalb des Rahmens des Reichs. Es gab keine einzelne Debatte, sondern eher eine ganze Reihe von Reaktionen und Diskussionen, die sich unter dem Eindruck der laufenden Ereignisse entwickelten und aufeinander einwirkten. Unterschiedliche Gruppen reagierten zu unterschiedlicher Zeit auf unterschiedliche Weise.Verallgemeinerungen deutscher Reaktionen insgesamt fallen wegen der höchst unterschiedlichen und veränderlichen Reaktionen Einzelner oft schwer. Jene, die von Anfang an ihrer Haltung treu blieben, bilden die Ausnahme. Goethe zum Beispiel schwankte nie in seiner Gegnerschaft zur Revolution und vernichtenden Kritik an den Pariser Revolutionären. Er verabscheute Gewalt und bezweifelte die Fähigkeit der Massen, ihr Schicksal selbst zu bestimmen. Aber auch er beschäftigte sich von Anfang an mit den Ereignissen in Frankreich. Seine aufgeklärten Überzeugungen legte er nicht ab und versuchte vielleicht mehr als irgendein anderer Autor die Revolution zu verstehen und literarisch auf den Punkt zu bringen. 3 Der Fall zweier anderer, die als erbitterte deutsche Kritiker der Französischen Revolution im Gedächtnis blieben, illustriert ein üblicheres Muster sich verändernder Reaktionen. Friedrich von Gentz (* 1764, † 1832) war anfangs begeistert und ließ sich 1791 von seinem Ärger über Beiträge in der Berlinischen Monatsschrift, die die natürlichen Rechte des Menschen verächtlich zu machen schienen, zu sei-
681
682
VI. · Krieg und Zerfall: Das Reich 1792–1806
ner ersten Schrift inspirieren, Ueber den Ursprung und die obersten Prinzipien des Rechts. Im Lauf des Jahres 1791 kamen ihm jedoch angesichts der zunehmenden Gewalt in Paris und der Anzeichen für das Scheitern der konstitutionellen Partei Bedenken. Die Lektüre von Edmund Burkes Reflections on the Revolution in France (1790) verstärkte seine Zweifel; Ende 1792 war Gentz einer der eloquentesten und leidenschaftlichsten Gegner der Revolution und blieb dieser Haltung bis zu seinem Lebensende treu. 4 Der in Koblenz geborene Joseph Görres (* 1776, † 1848) sah in Paris das neue Jerusalem und sehnte nichts mehr herbei als den Anschluss des Rheinlands an die Französische Republik. Wie viele Gleichgesinnte glaubte er, die Synthese französischer Politik und deutscher Moral werde die Menschheit in ein neues Zeitalter führen. In Der allgemeine Frieden: Ein Ideal schrieb er über 1789: »Dann wird das französische Phlogiston, mit dem deutschen Oxyde cementirt, einen philosophischen König bilden, wie ihn die Welt noch nie sah; und der gleich dem Steine der Weisen, die Existenz der Nation, die ihn besitzet, auf Ewigkeiten verlängert.« 5 Die Erfahrung der französischen Besetzung und vor allem der Annexion des Rheinlands veränderte Görres’ Haltung. Zum Ende des Jahrzehnts schrieb er, Frankreich habe »den Abschaum des Zeitalters über sie [die Rheinländer] hergespieen, Recht und Billigkeit mit dem eisernen Fuße des Koloßen seiner Willkür zerstampft«. 6 In den frühen 1790er Jahren bildete der »Jakobiner« einen Teil eines breiten Spektrums wohlwollender deutscher Haltungen zur Revolution. Die allgemeine Ansicht, Reformen könnten die Probleme der französischen Monarchie lösen, ließ optimistische Hoffnungen auf einen friedvollen Fortschritt zu einer neuen Form von aufgeklärter Gesellschaft keimen. Informationen über die Ereignisse in Paris erreichten das Reich über Zeitungen und Zeitschriften sowie vor allem über detaillierte Berichte von deutschen Intellektuellen, die nach Paris reisten, um sich selbst ein Bild zu machen, etwa Prominente wie Joachim Heinrich Campe, Alexander und Wilhelm von Humboldt, Konrad Engelbert Oelsner und Friedrich Christian Laukhard. Der einflussreichste der frühen »Revolutionstouristen« war wohl Campe, dessen gesammelte Berichte über die Revolution 1790 unter dem Titel Briefe aus Paris zur Zeit der Revolution erschienen. Wie Campe schrieb, genoss er den Vorzug, Zeuge eines großen Dramas zu sein, das von grundlegender Bedeutung für die ganze Welt war. 7 Deutsche Zeitschriften wie A. L. Schlözers Stats-Anzeigen bis 1793, ab 1792 Minerva – Ein Journal historischen und politischen Inhalts sowie die Berlinische Monatsschrift, der Teutsche Merkur und viele andere kommentierten die Lage ebenfalls detailliert. 8 Positive Berichte überwogen jegliche Kritik, zumindest in den ersten paar Jahren. Schon im Vorfeld der tatsächlichen Krise in Frankreich gab Schlözer den Tenor zukünftiger Kommentare vor. »Die öffentlichen Affairen«,
63. Der Widerhall der Französischen Revolution im Reich: Intellektuelle
schrieb er im Januar 1789, »stellen hier ein schönes Schauspiel dar: die Menschheit ist auf dem Puncte, in Frankreich die süssesten Früchte der Philosophie einzuerndten; die Nation ist auf dem Puncte, wieder in ihre natürliche Rechte einzutreten; die opinion publique hat solche bereits wieder erobert.« 9 Der Widerhall dieser Ereignisse unter deutschen Intellektuellen wurde sehr bald spürbar. Die Neuigkeiten aus Frankreich führten zur Gründung politischer Gesellschaften, zur Übernahme von Symbolen der Revolution und zu endlosen privaten Diskussionen. In Hamburg beispielsweise gab der Kaufmann Georg Heinrich Sieveking am 14. Juli 1790 auf seinem Landsitz ein Fest zur Feier des ersten Jahrestages der Erstürmung der Bastille. Man tanzte um einen Baum der Freiheit, die Damen trugen Schärpen in den Farben der Trikolore; Klopstock verlas zwei Oden an die Freiheit. Die versammelte Festgesellschaft beschloss die Gründung eines Clubs, der sich fortan am 14. jedes Monats treffen sollte. 10 Über dieses Ereignis wurde weithin in der Presse berichtet, nicht zuletzt wegen der Anwesenheit von Klopstock, der vordem ein Kritiker Frankreichs gewesen und nun einer der prominentesten literarischen Lobredner der Revolution war. Andere feierten und debattierten weniger öffentlichkeitswirksam. Die Wirkung auf Studenten, die sich oft von der Begeisterung ihrer Lehrer anstecken ließen, war offenbar besonders markant und Universitätsverwaltungen im ganzen Reich sahen sich in den frühen 1790er Jahren mit Unruhen und überschwänglichen Zurschaustellungen prorevolutionärer Stimmung konfrontiert. 11 Die Barbiere in Universitätsstädten zählten zu den ersten Leidtragenden dieser Begeisterung, da Studenten die Perücken ablegten und sich nicht mehr täglich rasieren, sondern ihr Haar im neuen Pariser Stil einfach wachsen ließen. 12 Schlözer brachte die frühen deutschen Reaktionen auf die Lage in Frankreich im September 1789 mit der Frage auf den Punkt: »Und welcher Menschenfreund wird dann das nicht sehr schön finden? Eine der größten Nationen in der Welt, die erste in allgemeiner Cultur, wirft das Joch der Tyrannei, das sie, anderthalb hundert Jare lang, komisch-tragisch getragen hatte, endlich einmal ab: zweifelsone haben Gottes Engel im Himmel ein Te Deum laudamus darüber angestimmt!« 13 Deutschen Beobachtern gefiel es, wenn große Redner wie Mirabeau das Wort an die Nationalversammlung richteten und zu Themen sprachen, die das Schicksal der Menschheit betrafen. Fasziniert verfolgten sie, wie die Nationalversammlung daranging, mit einer außerordentlichen Reihe von Dekreten am 4. August 1789 die Ketten des Feudalismus zu brechen. Das Schauspiel der Pariser Revolution sorgte für fesselnde, erbauliche Unterhaltung, aber nur wenige deutsche Beobachter sahen eine Notwendigkeit, dieses Theater im eigenen Land nachzuspielen. Wenn Autoren ihre Herrscher mit schmeichlerischen Bemerkungen bedachten und im selben Atemzug die Revolution lobten, wollten sie zweifellos einer Bestrafung durch die Obrigkeit zuvorkom-
683
684
VI. · Krieg und Zerfall: Das Reich 1792–1806
men. Selbst Klopstock hatte, wie der Gastgeber des Fests am 14. Juli 1790 festhielt, nicht vor, seine bei dieser Gelegenheit verlesenen Oden an die Freiheit zu publizieren, denn die Freiheitsfeinde »sind stark, und es gibt noch Despoten«. 14 Die meisten gebildeten Deutschen waren indes durch ihre intellektuelle und soziale Einstellung schon vor 1789 für eine positive Haltung prädisponiert. Was sich in Frankreich abspielte, war in ihren Augen zunächst ein aufregendes Reformprogramm, angetrieben von den Prinzipien von Recht und Gerechtigkeit auf Grundlage des Ideals der Freiheit. Sie erkannten darin eine Form des Entwicklungsprozesses der Erneuerung, über den führende Aufklärer bereits in den vorangegangenen Jahrzehnten geschrieben hatten. Kant war um 1789 der führende Vertreter dieser Theorie und es ist Zufall, aber sehr bezeichnend für die Bildung der öffentlichen Meinung, dass seine kritische Philosophie Ende der 1780er Jahre ihren Durchbruch erlebte. 15 Seine Ideen wurden an einer Reihe protestantischer und katholischer Universitäten gelehrt und diskutiert, und selbst, wo man sie ablehnte, begannen sich Studenten dafür zu interessieren. 1795 hielt der französische Diplomat Karl Friedrich Reinhard (* 1761, † 1837) fest: »Die Begriffe ›Anhänger der kantschen Philosophie‹ und ›Freiheitsfreund‹ sind Synonyme geworden.« 16 Kants Anhänger sahen in seinen Kritiken und zugänglicheren Aufsätzen eine umfassende Philosophie der Freiheit. Kant bot eine Analyse der menschlichen Natur und Gesellschaft, er zeigte, dass die Menschheit bereits auf dem Weg zu ihrer Selbstbefreiung war, lieferte einen Satz rationaler Prinzipien für ein moralisches Leben in der Gesellschaft. Unter begeisterten Studenten wurde Kants kategorischer Imperativ, das Gebot, stets den Prinzipien gemäß zu handeln, die man als allgemeine Gesetze für die gesamte Menschheit akzeptiert sehen wolle, so etwas wie ein Mantra. 17 Ein Recht auf Widerstand erkannte Kant nicht, noch billigte er zu irgendeinem Zeitpunkt den Eingriff des Pöbels in den revolutionären Prozess. Seine Form von Republikanismus blieb bis zuletzt eine weise Monarchie, die die Beteiligung ihrer Bürger an der Gesetzgebung schrittweise ausweitete, die Masse der Untertanen aber nicht vorzeitig befreite. Wenn die menschliche Gesellschaft am Ende keine Regierung mehr nötig haben würde, weil sich alle Menschen dem Gesetz der Moral entsprechend verhielten, so lag dieses Ziel in so ferner Zukunft, dass es für die Gegenwart nur als Orientierung relevant war und Herrscher wie Untertanen ermutigen mochte, so zu handeln, als wäre es ein mögliches Ergebnis. Kant stellte weder sein Interesse an Frankreich noch seine Überzeugung, 1789 sei ein Ereignis von welthistorischer Bedeutung gewesen, in Abrede. Trotz der stetigen Verschärfung der Zensur in Preußen bekräftigte er seinen grundsätzlichen Glauben an die Freiheit und seine Sympathie für die moralischen Prinzipien der Revolution 1793 in seinem Aufsatz Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft. Zudem verurteilte er zwar die Exekution Ludwigs XVI. als unverzeih-
63. Der Widerhall der Französischen Revolution im Reich: Intellektuelle
liches Verbrechen und verabscheute die Brutalität der jakobinischen Tyrannei von 1793/94, aber sein Aufsatz Zum ewigen Frieden gab 1795 erneut seinem Optimismus bezüglich der Menschheit insgesamt Ausdruck. In Der Streit der Facultäten verteidigte Kant 1798 die Revolution abermals, trotz all ihrer Irrtümer. »Die Revolution eines geistreichen Volks … mag gelingen oder scheitern«, schrieb er, »sie mag mit Elend und Greuelthaten dermaßen angefüllt seyn, daß ein wohldenkender Mensch … das Experiment auf solche Kosten zu machen nie beschließen würde«, aber »diese Revolution, sage ich, findet doch in den Gemüthern aller Zuschauer (die nicht selbst in diesem Spiele mit verwickelt sind) eine Theilnehmung dem Wunsche nach, die nahe an Enthusiasm grenzt, und deren Aeußerung selbst mit Gefahr verbunden war, die also keine andere, als eine moralische Anlage im Menschengeschlecht zur Ursache haben kann.« 18 Andere gerieten ins Schwanken, wurden zu offenen Gegnern oder entwickelten neue Richtungen und ließen Kant und sein System hinter sich. Für die Mehrheit waren die Ereignisse in Paris in den Jahren 1792 und 1973 entscheidend. Die Kriegserklärung hatte zunächst wenig Auswirkungen, aber der Tuileriensturm, die Septembermassaker, der Prozess gegen den König im Dezember 1792 und seine Hinrichtung im Januar 1793 markierten den Abstieg in Gewalt und Gesetzlosigkeit und die Preisgabe der Ideale von 1789. Die Reaktionen verstärkten sich angesichts von Berichten über den jakobinischen Terror der Jahre 1793/94. Je weiter die Ereignisse von 1789 zurücklagen, desto reicher und vielfältiger wurden die Debatten. Eine Minderheit begeisterter Aktivisten stand treu zur französischen Sache und in den Jahren 1792–1795 erlebte »jakobinisches« Schrifttum in Deutschland seinen Höhepunkt. 19 Speziell 1794/95 gab es ein bescheidenes Wiederaufleben radikaldemokratischer Schriften und die Autoren solcher Werke wurden nun nicht mehr automatisch mit den ständigen Berichten über revolutionäre Gräueltaten in Verbindung gebracht. 20 Die Mehrheit indes begann zwischen den Idealen von 1789 und der bitteren Realität im revolutionären Paris zu unterscheiden. Die Ansicht, dass diese Vorgänge die Revolution nicht insgesamt entwerteten, gewann an Boden. Selbst Wilhelm von Humboldt, der die Verfassung von 1791 kritisierte, weil sie ein leeres rationales Konstrukt sei, das dem Volk aufgezwungen werde, schrieb am 9. November 1792 in einem Brief: »Denn die Wahrheiten der französischen Revolution bleiben ewig Wahrheiten, wenn auch 1200 Narren sie entweihen.« 21 Humboldt selbst war in vielerlei Hinsicht typisch für jene, die Fortschritt durch »Aufklärung und Kultur« für unendlich wünschenswerter hielten als durch das »gezückte Schwerdt«. 22 Für eine Weile konzentrierte sich die Debatte auf Diagnosen, was in Frankreich falsch gelaufen war, und Versuche, die Revolution in einen historischen Kontext zu stellen. Nach dem Sturz von Robespierre im Juli 1794 und der Einrichtung des Direktoriums 1795 konstatierten viele deutsche Beobachter eine Rückkehr zum
685
686
VI. · Krieg und Zerfall: Das Reich 1792–1806
ursprünglichen moderaten Konstitutionalismus der frühen Phase, die in Frankreich eine Art von Normalität wiederherstellte. 23 Neben der Entstehung von Haltungen, die entweder begeistert prorevolutionär oder im weiteren Sinn positiv gegenüber den Entwicklungen in Frankreich seit 1789 waren, gab es bereits früh offene Gegner. Manche lasteten Gewalt und anarchische Zerstörung von Institutionen der Obrigkeit den Idealen an, die andere so hoch schätzten. Dabei sahen sie oft in der Aufklärung die Wurzel aller gegenwärtigen Probleme. »Der Philosoph formt Systeme«, schrieb Friedrich von Gentz 1793, »der Pöbel schmiedet Mordgewehre daraus.« 24 Andere warnten vor den Auswirkungen »des gefährlichen Wahns … daß ein Volk seine Souverainität halten und selbst ausüben könne«, die »Pest«, »Manie« und den »Wahnsinn« der Aufklärung an. 25 1795 sprach der preußische Offizier Karl Friedrich von dem Knesebeck im Titel des Pamphlets Etwas über den Krieg in der öffentlichen Meinung von den »Kreuzzügen des achtzehnten Jahrhunderts«. 26 Der Krieg der Worte und Ideen in den polemischen Schlachten der 1790er Jahre führte zur Herauskristallisierung politischer Positionen und Haltungen, die die Politik der 19. Jahrhunderts prägen sollten. 27 Die Flut der Publikationen hielt ungebrochen an. Neben Zeitungen und Zeitschriften hielt eine Masse von Übersetzungen französischer Pamphlete und Kommentare die deutsche Öffentlichkeit auf dem Laufenden. Mehr als 2.000 Werke wurden zwischen 1789 und 1799 übersetzt; in Leipzig erschienen 1794 bis 1798 etwa 1.100 Texte. 28 Gut 70 Prozent der Übersetzungen vertraten die bürgerliche Position der Girondisten, die am ehesten der Mentalität deutscher Reformer entsprach. 29 Die Themenlage änderte sich, als die Umschwünge von 1794 neue Perspektiven schufen. Analysen der Folgen der »Fehlschläge« der Jahre 1792–1794 und historische Analysen des Gesamtprozesses seit 1789 traten an die Stelle direkter Kommentare zur französischen Politik. Dann polarisierte die Literatur zum Thema Frieden in den Jahren 1795 bis 1802 erneut zwischen gemäßigten Republikanern, radikalen Demokraten und konservativen Autoren und veränderte den Rahmen der Diskussion. 30 Manche junge Autoren begannen nun Kants Ideen zu verwerfen und die Vorstellung einer neuen oder höheren Aufklärung zu formulieren. Wilhelm von Humboldt etwa lehnte sowohl die alten Aufklärer als auch Kant ab. In Reaktion auf das rationalistische Experiment in Frankreich entwickelte Humboldt eine radikalere, vitalistische Form der Entwicklung des Individuums. Der Staat, schloss er, musste seinen Auftrag ändern, weg von der Kontrolle, hin zur Befreiung und Förderung sinnlicher Wesen. Wie andere deutsche Zeitgenossen wollte Humboldt den Staat darauf begrenzt sehen, Sicherheit zu gewährleisten, die er als »Gewissheit der gesetzmässigen Freiheit« definierte. 31 Auch die Entwicklungen in Jena und Tübingen ab den frühen 1790er Jahren
63. Der Widerhall der Französischen Revolution im Reich: Intellektuelle
erzeugten radikale Vorstellungen davon, was der Staat sein und tun solle. Fichte versuchte zunächst Kants System zu vervollständigen und verwarf es dann als unpassend. Wie Humboldt lehnte Fichte einen maschinellen, kontrollierenden Staat ab und bestand auf der Grundfreiheit des Menschen. 32 In Tübingen ließen sich auch der junge Hölderlin, Schelling und Hegel vor allem von der radikalen Form von Kants Lehren inspirieren, die ihnen Immanuel Carl Diez vermittelte, an den sich einer ihrer Zeitgenossen als »diesen besessenen Kantianer« erinnerte. 33 In Interaktion mit Fichte und anderen in Jena entwickelten sie dann ihre eigene Vorstellung von Aufklärung in dem von der Hand Hegels 1797 niedergeschriebenen, aber vermutlich von seinen Freunden Hölderlin oder Schelling verfassten sogenannten Ältesten Systemprogramm des deutschen Idealismus. 34 Auch darin wird der traditionelle Staat verworfen, insbesondere der Staat als »Maschine« im Sinn der Aufklärung. Die Idee des »ewigen Friedens« übersehe, dass es darum gehe, die letztendige Befreiung der Menschheit anzustreben; die Welt brauche eine neue »Mythologie der Vernunft« und (wahre) Philosophie müsse das Leben aller Menschen durchdringen. Die Tübinger Studenten kritisierten Schiller und die Ikonen des Weimarer Denkens für ihre Vernachlässigung der kollektiven Dimension der Gemeinschaft. 35 Aber auch der ganz und gar nicht unpolitische Schiller konstruierte aus seiner Kant-Lektüre eine Antwort auf die großen Probleme der Zeit. Schillers beständiges politisches Engagement führte zur Publikation seines Werks Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen (1795). In Schillers Ankündigung der Zeitschrift Die Horen, in der die Briefe zuerst erschienen, war von dem Wunsch die Rede, dem »allverfolgenden Dämon der Staatscritik« zu entkommen. 36 Seine Briefe waren dennoch ein Bekenntnis der politischen Treue: ein Versuch, über die unmittelbaren Wirren der französischen Politik und des Kriegs hinauszublicken und die letztliche Bedeutung dessen zu enthüllen, was sich in Europa insgesamt entwickelte. 37 Schiller wollte sich keiner bestimmten Partei seiner Zeit anschließen, sondern auf Grundlage der Geschichte für die Vergangenheit und der Philosophie für die Zukunft die Prinzipien verdeutlichen, von denen eine Verbesserung der Lage der Menschheit abhing. Von Anfang an hatte Schiller geahnt, dass die Französische Revolution Barbarei in einer Weise begünstigte, wie das die niederländische und die Amerikanische Revolution nie getan hatten. 1795 standen seine Ansichten voll in Einklang mit den politischen Ansichten, die seine Schriften ab den 1780er Jahren durchzogen. Einerseits hatte er stets eher auf den Missbrauch eines gesellschaftlichen Systems fokussiert als auf das System selbst. Reformen und Verbesserungen durch liberale Monarchen erschienen ihm stets wünschenswerter als durch eine Revolution bewirkte Veränderungen. Die Aufgabe, die Schiller in den Briefen umriss, bestand darin, zu erkennen, dass »die physische Gesellschaft in der
687
688
VI. · Krieg und Zerfall: Das Reich 1792–1806
Zeit keinen Augenblick aufhören darf, indem die moralische in der Idee sich bildet«. Das »lebendige Uhrwerk des Staats muß gebessert werden, indem es schlägt«, Freiheit indes werde letztlich durch Schönheit erreicht. Seine Vorstellung war individualistischer als die der jungen Idealisten, aber ebenso mit den politischen Kernproblemen der Zeit beschäftigt. 38 Auf unterschiedliche Weise hatten all diese Programme ein gemeinsames Thema. Erstens repräsentierten sie Ausläufer der Aufklärung, oft unter Ablehnung der pedantischen Aufklärung der 1770er und 1780er Jahre, dennoch aber im Bemühen, die Aufklärung durch eine »Aufklärung der Aufklärung« weiterzuentwickeln. Zweitens führte ihre Ansicht, die Französische Revolution sei in mancher Hinsicht gescheitert, ihre Ideale blieben jedoch gültig, zu der Überzeugung, der letztendlichen Befreiung der Menschheit müsse eine Revolution des menschlichen Geistes vorausgehen. Nur wenn man besser zu denken beginne, hieß es, könne man wirklich frei sein; jede allgemeine Befreiung vor diesem Schritt führe – dies hätten die Franzosen deutlich gezeigt – nur zu Gewalt und Anarchie. 39 Politische Freiheit sei keine wahre Freiheit. Bürgerliche Freiheit in Verbindung mit Bildung, ob ästhetisch oder philosophisch, werde die Menschheit in die richtige Richtung führen. Dies sei nicht einfach das deutsche Äquivalent der politischen Revolution der Franzosen, sondern letztlich eine für die Zukunft der Menschheit wichtigere Revolution. Nach etwa 1794/95 fand die Diskussion eines alternativen deutschen Weges zur Freiheit Eingang in eine neue Debatte über deutsche Identität. Die Ereignisse in Frankreich öffneten den Deutschen wieder den Blick auf ihr eigenes Land; der Krieg mit Frankreich ließ den Patriotismus wiederaufleben. Der Friede von Basel (1795) und Campo Formio (1797), der Kongress von Rastatt (1798) und der Friede von Lunéville (1801) führten zur weiteren Reflexion der Situation Deutschlands und der Deutschen in Europa. Sympathisanten der Revolution wie Wieland verwandelten angesichts der fehlenden Notwendigkeit einer Revolution in Deutschland ihren Stolz in eine leidenschaftliche Verteidigung des Reichs, der »deutschen Libertät«, die es verkörpere, und die reiche und vielfältige Kultur, die seine dezentralen Strukturen begünstigten. 40 Schon 1792 spürte Herder neuen Optimismus nach der Wahl von Franz II.: »Doch was kümmert uns Frankreich! uns Deutsche, die wir jetzt ein neues Oberhaupt, und also den Kranz und Gipfel der besten Constitution haben.« 41 Zwei Jahre später stellte Karl Friedrich Häberlin fest, eine der vielen guten Auswirkungen der Französischen Revolution auf Deutschland sei, dass »der Teutsche angefangen hat, sich mehr, als sonst, um seine vaterländische Verfassung zu kümmern«. 42 1795 erklärte Wieland: »Die dermahlige teutsche Reichsverfassung ist, ungeachtet ihrer unläugbaren Mängel und Gebrechen, für die innere Ruhe und den Wohlstand der Nazion im ganzen ohne alle Vergleichung zuträglicher und
63. Der Widerhall der Französischen Revolution im Reich: Intellektuelle
ihrem Karakter und dem Grade von Kultur, worauf sie steht, angemessener, als die französische Demokratie.« 43 Dieser Aufschwung des Patriotismus löste auch eine neue Phase der Reflexion über die kulturelle Beziehung zwischen Frankreich und Deutschland aus. In vorangegangenen Generationen hatten die Deutschen einräumen müssen, dass Deutschland Frankreich hinterherhinkte, jetzt herrschte die Meinung vor, das Verhältnis habe sich umgekehrt. 44 Argumente für diese Sicht finden sich in den Werken so unterschiedlicher Autoren wie Herder und Schiller, Novalis und Hölderlin, der Brüder August Wilhelm und Friedrich Schlegel sowie Fichte. In der Reformation hätten die Deutschen die erste Lanze für die wahre Freiheit gebrochen. Wenn es so wirke, als wären sie in kultureller Hinsicht hintendran, hätten sie die Zeit genutzt, von allen anderen Nationen stets das Beste zu lernen. Folgerichtig seien sie nun bereit, die Welt in die Moderne zu führen. Woran die Franzosen gescheitert waren, so hieß es, das werde den Deutschen gelingen, da ihre Kultur und Philosophie sie für die wahre Freiheit qualifizierten. Deutsche Autoren führten nun zum Beginn einer neuen allgemeinen Reformation die grundsätzlich protestantische Maxime innerer spiritueller Erneuerung oder Wiedergeburt ins Feld, die in den drei Jahrhunderten zuvor so viele Reformbewegungen geprägt hatte. Heine beschrieb dies später als zweite oder philosophische Revolution, die der ersten, theologischen Revolution folgte und wiederum der dritten und endgültigen Revolution den Weg bereiten werde. Indem sie die Französische Revolution zu begreifen versuchten und in einen weltgeschichtlichen Kontext stellten, entdeckten deutsche Intellektuelle sich selbst als die wahren Vorläufer der Moderne. Was, wenn überhaupt, hatte das mit dem Reich zu tun? Viele Kommentatoren folgen Meineckes Argumentation, das neue Denken habe mit der Annahme begonnen, dass das Reich in den 1790er Jahren so gut wie tot war und die Konturen einer neuen, kosmopolitischen Kulturnation der Deutschen darstellte. 45 Andere sahen in diesen Schriften die ersten Regungen eines neuen deutschen Nationalismus, einer deutschen Reaktion auf die Krise des Ancien Régime, die in der Auflehnung gegen die französische Hegemonie nach 1806 explodierte. Tatsächlich spielte das Reich – oder irgendeine Version davon – eine Schlüsselrolle in den meisten Theorien einer deutschen kulturellen Führungsrolle. Schließlich hatte das Reich die einzigartige Entwicklung der deutschen Kultur und des deutschen Denkens geprägt. Es ist vielleicht auch signifikant, dass die meisten dieser Ideen in den protestantischen Kernländern formuliert wurden, die zufällig auch die neutrale Friedenszone zwischen 1795 und 1806 bildeten, den Bereich, der dem Krieg entging, der den Süden verwüstete, und in dem Ideen einer Kontinuität realistischer erschienen. Bezeichnend zudem, dass eines der Kernthemen der Debatte war, dass der deutsche Beitrag zur Moderne sich von der offen nationalistischen Führung
689
690
VI. · Krieg und Zerfall: Das Reich 1792–1806
Frankreichs über die letzten eineinhalb Jahrhunderte unterschied: Die Nation sei überflüssig geworden, fanden viele Deutsche, da sich die Menschheit auf eine wahrhaft universale menschliche Identität zubewegte. 46 Solch entschieden nichtnationalistische Ideen über die vergangenen und gegenwärtigen Funktionen des Reichs und das Potenzial der Deutschen als Lehrer der Menschheit durchzogen das Werk, das vielen als Ausgangspunkt des modernen deutschen Nationalismus gilt, Fichtes Reden an die deutsche Nation von 1807/ 08. 47 Spätere Generationen interpretierten Fichte und andere Teilnehmer der Identitätsdebatte um 1800 als Propheten einer glorreichen neuen nationalen Zukunft. Tatsächlich bezogen sich Fichtes Ideen auf den Kontext des Reichs, wie es sich seit dem Mittelalter entwickelt hatte und weiterhin die Gegenwart prägte, in der er lebte.
Anmerkungen 1 Oergel, Culture, 2 f.; Gretz, Bewegung; vgl. auch S. 517 ff. 2 Eberle und Stammen, Revolution, 27; Mah, Phantasies, 167–180. 3 Gooch, Germany, 174–207; Saine, Black Bread, 1 ff., 380–391; Boyle, Goethe I, 590 f., und II, 179, 315, 330, 487, 499, 759; Kerry, Enlightenment Thought (passim). 4 Gooch, Germany, 91–103; der Aufsatz von Gentz erschien 1791, genau zu der Zeit, als sich die Ansichten änderten. 5 Kemiläinen, Auffassungen, 60 f.; Gooch, Germany, 482–487. 6 Gooch, Germany, 485; Der Rübezahl, eine Monathsschrift (1799), S. 6 (Krauss Reprint, Nendeln, 1972) 7 Eberle und Stammen, Revolution, 20. 8 Kemiläinen, Auffassungen, 52. 9 Eberle und Stammen, Revolution, 40. 10 Gooch, Germany, 435 f. 11 Kuhn und Schweigard, Freiheit, 430–438. 12 Riethmüller, Anfänge, 157. 13 Kemiläinen, Auffassungen, 52 f. 14 Gooch, Germany, 122; die Praxis der Selbstzensur betonen Kuhn und Schweigard, Freiheit, 5 f. 15 Vgl. S. 533 f., 547. 16 Kuhn und Schweigard, Freiheit, 68; Reinhard war in Württemberg geboren und hatte in Tübingen Philosophie studiert; nach einer Anstellung als Lehrer in Bordeaux 1787–1791 wurde er ein Protegé von Sièyes und verbrachte den Rest seiner beruflichen Laufbahn im französischen diplomatischen Dienst; vgl. ADB XXVIII, 44–63; in den 1790er Jahren unternahm er mehrere Anläufe, Kants Ideen in Frankreich zu verbreiten. 17 Kuhn und Schweigard, Freiheit, 74 f. 18 Eberle und Stammen, Revolution, 13. 19 Stammen und Eberle, Deutschland, 23. 20 Eberle und Stammen, Revolution, 43 f. 21 Kemiläinen, Auffassungen, 54; Sauter, Humboldt, 324.
63. Der Widerhall der Französischen Revolution im Reich: Intellektuelle
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Humboldt, Limits, 11. Pelzer, Wiederkehr, 319–326. Klippel, »Aufklärung«, 210. Klippel, »Aufklärung«; Voss, »Aufklärungsdiskussion«, 237 f. Eberle und Stammen, Revolution, 35; die Publikation war anonym, als Erscheinungsort war »Palästina« angegeben. Die Themen stecken folgende klassische Werke ab: Valjavec, Entstehung; Epstein, Genesis; Aris, Political Thought, und in jüngerer Zeit Beiser, Enlightenment. Demel, Reich, 302; vgl. auch Reichardt, »Probleme«. Pelzer, Wiederkehr, 323. Dietze, »Friedensdiskussion«, 512–515. Sauter, Humboldt, 184–191, 316, 347; Beiser, Enlightenment, 111–137; vgl. auch S. 516, 611. La Vopa, Fichte, 312 f.; ders., »Revelatory Moment« (passim). Henrich, Grundlegung, 89 und 891; Nauen, Revolution VIII, 1–7, 23 f., 46–49. Beiser, Writings, 3 ff. Chytry, State, 69. Stammen und Eberle, Deutschland, 21. Wilkinson und Willoughby, Introduction (in Schiller, Aesthetic Education, XV–XX); High, Rebellionskonzept (passim); Schmidt, »Liberty«; ein späterer Biograph hingegen betont Schillers angeblich selbstauferlegten Verzicht auf politische und nationalistische Äußerungen: Alt, »Aufklärung«, 229, und ders., Schiller (passim). Aesthetic Education, S. 12 (3. Brief). Das Thema führt Vierhaus, »Revolutionizing«, insb. 561–573, weiter aus. Sahmland, Wieland, 177–189; vgl. auch Gooch, Germany, 142–160. Dreitzel, »Konzepte«, 277. Schindling, »Osnabrück«, 221. Aretin, Altes Reich III, 297. Vgl. zum Folgenden Kemiläinen, Auffassungen, 83–273; Oergel, Culture (passim); Whaley, »Thinking«, 61 ff. Meineckes Ideen und ihre Rezeption diskutiert Schmidt, »Meineckes Kulturnation«. Oergel, Culture, 5, 152, 282, 288. Kemiläinen, Auffassungen, 195–207; Oergel, Culture, 136–152; Reiß, Fichtes »Reden«, 143–168; vgl. von See, Freiheit, 18–25; Whaley, »Transformation«, 175–178; ders., »Thinking«, 68 ff.
691
64. Pläne für eine Reform des Reichs in den 1790er Jahren
I
n der Vorrede zum ersten Band seines Handbuchs des Teutschen Staatsrechts (1794) schrieb der Helmstedter Professor Karl Friedrich Häberlin (* 1756, † 1808), er gehöre »in die Classe der Lobredner unserer Constitution … weil ich wirklich glaubte, und noch immer lebhaft davon überzeugt bin, daß unsre Verfassung eine der vorzüglichsten ist«. 1 Häberlin stand mit seiner Sicht nicht allein. Neben patriotischen Dichtern und Teilnehmern der Debatte um Identität und kulturelle Sendung der Deutschen schrieben die akademischen Experten des imperialen Rechts während der 1790er Jahre weiterhin fleißig über die imperiale Verfassung und Möglichkeiten einer Reform.Viele andere, anonyme Autoren und Namen, die ansonsten kaum Spuren in der Geschichte hinterließen, steuerten eine Masse von Büchern, Pamphleten und Artikel zu jedem nur denkbaren Aspekt des Reichs bei. Dies mag mit Blick auf das plötzliche Ende 1806 überraschen. Die schriftlichen Debatten und Kontroversen über das Reich setzten sich wie in den zwei Jahrhunderten zuvor kontinuierlich fort.Wenn das Ende wirklich unvermeidlich und bereits so früh abzusehen gewesen wäre, wie viele spätere Historiker meinten, müsste man diesen Aufwand in der Tat als Verschwendung betrachten. Diese letzten Debatten enthüllen in Wirklichkeit viel über die Entwicklung der Haltungen zum Reich und seinen Institutionen sowie zur empfundenen Notwendigkeit, es zu reformieren.Vor allem machen sie deutlich, wie sehr viele Leute überzeugt waren, das Reich werde in irgendeiner Form weiterleben, oder dass sie sich vielmehr keine Situation vorstellen konnten, in der das Reich oder etwas ihm sehr Ähnliches nicht existierte. Diese Sichtweisen beruhten nicht nur auf übertriebenem Respekt vor der Tradition, sondern auch auf positiven Zukunftserwartungen. Und sie waren mit realen Ereignissen verknüpft: Kaiserwahlen, Verteidigungsproblemen nach 1792, Hoffnungen auf und Plänen für einen allgemeinen Friedensvertrag nach 1794/ 95. Auf anderer Ebene freilich scheint klar, dass eine zunehmende Anzahl von Regierungen, allen voran Wien und Berlin, entschlossen war, als Entschädigung für das, was sie an Frankreich verloren und im Krieg aufgewendet hatten, sich Territorium anzueignen. Aber für die Umsetzung dieser Ambitionen war ein Anlass nötig. Noch zögerten Wien und Berlin, sich als Zerstörer des Reichs gebrandmarkt zu sehen. Dass sich Berlin 1795 aus dem Krieg zurückgezogen und dafür gesorgt hatte, dass seine Schützlinge in Norddeutschland folgen konnten, untergrub si-
64. Pläne für eine Reform des Reichs in den 1790er Jahren
cherlich die Einigkeit des Reichs, zerstörte es jedoch nicht. In der nördlichen »Friedenszone« spielte Preußen weiterhin nach den alten Regeln, und das nicht nur aus Furcht vor Frankreich. Dies änderte sich erst 1801 nach den wiederholten militärischen Erfolgen Frankreichs und als Napoleon die 1797 festgelegte Politik der Zerstörung des Reichs durch den Ausschluss von Österreich und Preußen in die Tat umsetzte. Zeitgenössische Kommentatoren waren nicht blind für die Gefahren, die dem Reich drohten. 1786 schrieb Johann Stephan Pütter, jeder ehrliche Deutsche müsse über die Krise, die das Reich in den zurückliegenden Jahrzehnten erschüttert habe, und seine Zukunft besorgt sein. 2 Die Einheit des Reichs, meinte er, sei nur am kaiserlichen Hof in Wien sichtbar, im Reichstag zu Regensburg und beim Reichskammergericht in Wetzlar. Friedrich Karl von Moser sah das Reich nach der dritten Teilung Polens 1793 bedroht: »Ist aber einmal Polen vollends getheilt, dann kommt auch die Reihe des Fressens an unsere deutschen Fürsten …« 3 Der Mann, der 1765 so eloquent für einen neuen Nationalgeist plädiert hatte, sah nun wenig Sinn in Verbesserungsversuchen: Über die nächsten hundert Jahre würden die Kleinen und Schwachen erlöschen und dann vielleicht das Reich selbst untergehen. Solche Befürchtungen wurden indes aufgewogen durch die Ansichten jener, die immer noch an die Zukunft des Reichs dachten. Sie machten weiterhin Reformvorschläge und fokussierten regelmäßig vor allem auf das »dritte Deutschland«; auch Preußen und Österreich blieben jedoch stets feste Faktoren in ihren Plänen. 1802 gab Pütter einer allgemeinen Ansicht Ausdruck, als er schrieb, er bleibe den vielen Veränderungen der 1790er Jahre zum Trotz überzeugt, das Verfassungsrecht des Reichs werde das unerschütterliche Fundament für die zukünftige Entwicklung der Deutschen bleiben. 4 Das war mehr oder weniger die Haltung der Autoren der führenden akademischen Handbücher nach 1790. Pütter selbst schrieb weiterhin viel, sein Denken in den 1790er Jahren entwickelte sich jedoch nicht über den normativen deskriptiven Rahmen hinaus, den er in den 1780er Jahren entwickelt hatte. Nun machte sich Karl Friedrich Häberlin an eine Darstellung des Reichs auf Grundlage der »Menschenrechte und der Würde des gesunden Menschenverstands«. 5 Im Grunde folgte er Pütters These, das Reich sei ein aus mehreren unterschiedlichen Staaten zusammengesetztes Gemeinwesen, das insgesamt dennoch einen einzigen Staat bilde, versuchte sie jedoch mit dem Geist der neuen revolutionären Philosophie zu stützen. Sein Leitmotiv war, das Reich schütze die Schwachen vor Unterdrückung, und das in den Beziehungen zwischen Kaiser und Fürsten verankerte System der gegenseitigen Kontrolle sei ideal geeignet, die wesentlichen Funktionen des Staats, nämlich den Schutz von Leben, Ehre und Gütern, zu gewährleisten. Das Reich, argumentierte Häberlin, sei auf den Säulen eines Gesellschaftsvertrags und der Souveränität des Volks gegründet. Das Gemeinwesen sei durch das
693
694
VI. · Krieg und Zerfall: Das Reich 1792–1806
gegenseitige Übereinkommen einer ursprünglich ungleichen Gesellschaft von Familien und Gemeinden entstanden, die sich einer höheren Autorität unterworfen hätten, um die Wohlfahrt aller Betroffenen zu befördern. Diesem Vertrag seien die grundlegenden Gesetze entsprungen, die die Struktur des Reichs und das Verhältnis zwischen Kaiser und Fürsten definierten. Letzterer Macht sei beschränkt, da sie Teil eines umfassenden Staats und daher an dessen Regeln gebunden seien. Übertretungen würden klar geahndet; Fürsten und Untertanen hätten das Recht, den Kaiser und die höheren Gerichte anzurufen. Die Macht des Kaisers übertreffe die der Fürsten, die Souveränität, die er ausübe, sei letztlich aber nicht seine eigene, sondern die der Nation. Der Kaiser verfüge zu seinen Lebzeiten über souveräne Rechte, sei im Grunde aber nur deren Hüter und übe sie im Namen des Volks oder der Nation aus. Wie zuvor Moser und Pütter ergriff Häberlin für keine bestimmte Seite Partei. Seine Haltung zum Reich unterstützte jedoch implizit die kaiserliche Position: Er hielt einen starken, von allen als oberste Macht anerkannten Monarchen für unerlässlich. Zugleich beschränkten die grundlegenden Gesetze des Reichs die Macht der Krone und bestimmten, dass die ordentliche Gesetzgebung Ergebnis der Verständigung zwischen Kaiser und Ständen sei. Das wichtigste Element im System seien die höheren Gerichte, da nur sie sicherstellten, dass die Rechte niederer Herrscher und Untertanen respektiert würden. Daher trat er dafür ein, kein Territorium von der Rechtsprechung der höheren Gerichte des Reichs auszunehmen. Letztlich wollte Häberlin zeigen, wie Reformen des Reichs den Deutschen ohne Gewalt und Leid alle Vorteile der Französischen Revolution zukommen lassen konnten. Wenn das Volk erst den wahren Charakter der Konstitution des Reichs erkenne, glaubte er, werde es sich für seine Reform engagieren. Die gleiche Ansicht prägte die zahlreichen anderen Teilnehmer der Reformdebatten der 1790er Jahre. Die Wahlen von Leopold II. 1790 und Franz II. 1792 lösten die erste Debatte aus. 6 Zu beiden Anlässen gab es weitläufige Diskussionen über die Rechte der Reichsvikare während eines Interregnums, über die Notwendigkeit, die kaiserliche Wahlkapitulation zu reformieren, und über die Kandidaten selbst. Die diesbezügliche Literatur griff die Probleme der Fürstenbundepoche wieder auf. Die zahlreichen Publikationen führten die ganze Bandbreite an bekannten Argumenten ins Feld, von Ansichten zum Charakter der deutschen Monarchie (die prokaiserliche Fraktion) bis hin zu Bekräftigungen der überragenden Notwendigkeit, die deutsche Libertät zu bewahren (die Fraktion der Stände). Alle Lager der Debatte suchten aufzuzeigen, dass ihre speziellen Argumente die wahren Interessen und Sichtweisen der Einwohner des Reichs widerspiegelten. Ohne explizite Anspielungen auf die gleichzeitigen Ereignisse in Frankreich wandten sich die Teilnehmer der deutschen Debatte über die Zukunft des Reichs nun direkter als je zuvor an die öffentliche Meinung. 7
64. Pläne für eine Reform des Reichs in den 1790er Jahren
Im Kern betrafen die Debatten über die Wahlen 1790 und 1792 die Macht der Monarchie und die Stellung der Habsburger im Reich. 8 Dem Anspruch der Kurfürsten von Pfalz-Bayern und Sachsen auf die Macht als Reichsvikare während des Interregnums standen der Kurfürst von Mainz als Erzkanzler und die kaiserliche Partei entgegen. Die formale Frage, ob der Reichstag ohne Kaiser weitertagen und die Vikare durch die Ratifikation von Dekreten monarchische Macht ausüben konnten, verband sich mit dem Problem, ob die Macht der Monarchie weiter eingeschränkt werden sollte. Dass bei der Frage, wer Kaiser werden sollte, die Wittelsbacher und das sächsische Haus Wettin als mögliche kaiserliche Dynastien ins Spiel kamen, zeigt, dass die Habsburger die Krone nicht länger als selbstverständlich betrachten konnten. 9 Tatsächlich aber gab es weder 1790 noch 1792 eine plausible Alternative zu Habsburg-Lothringen. Angesichts der unvermeidlichen Kürze des Interregnums und da es keine realistische Option neben den Habsburgern gab, war das wichtigste Thema die kaiserliche Wahlkapitulation. Dabei flammte die alte Diskussion wieder auf, ob eine ständige Wahlkapitulation zweckmäßig sei. 10 Eine solche war 1711 aufgesetzt, aber nicht verabschiedet worden, obwohl sie Eingang in die Kapitulationen von Karl VI. (1711), Karl VII. (1742) und Franz I. (1745) gefunden hatte. Das Grundproblem, das eine Einigung zunichtemachte, war, dass die Kurfürsten ihre Macht zur Aufstellung der Kapitulationen behalten und die Fürsten daran beteiligt werden wollten. Diese traditionellen Hindernisse kamen nun erneut ins Spiel. Andererseits wurde die bestehende Form der Kapitulationen öffentlich kritisiert wie nie zuvor. Während führende Experten wie Häberlin weiterhin die fundamentale Bedeutung dieser »Quint-Essenz aller Reichsgesetze« betonten, geriet ihre Sprache, Organisation und Kohärenz unter Beschuss. Viele forderten nun ein gänzlich neues Verfassungsgesetz, das die Macht des Kaisers und die Rechte von Territorialherrschern und Untertanen klar definierte, und unterwarfen die Wahlkapitulation denselben Regeln, die für Gesetze der Territorien galten. Das traditionelle System sollte rationalisiert, gestrafft und modernisiert werden; viele Autoren argumentierten, die exekutive Macht des Kaisers müsse gestärkt werden, um eine effektive Verwaltung des Reichs zu gewährleisten. 11 Die Diskussion über die Reform der Wahlkapitulation dauerte mehrere Jahre. Dabei gewann die Ansicht, die Kapitulation sei der Inbegriff des Verfassungsrechts, durch die leidenschaftliche deutsche Diskussion über die Verfassungen von Frankreich und Polen von 1791 und die französischen Verfassungen von 1793 und 1795 an Boden. Auch in dieser Hinsicht waren deutsche Kommentatoren ganz auf der Höhe der jüngsten Entwicklungen anderswo und fähig, ihre eigenen Institutionen unter modernsten Gesichtspunkten zu überdenken. Sämtliche Reformpläne scheiterten zwar, sie verstärkten aber das öffentliche Interesse an der Reichsverfassung in den frühen 1790er Jahren. Dies war auch das
695
696
VI. · Krieg und Zerfall: Das Reich 1792–1806
Ziel eines bemerkenswerten Aufsatzwettbewerbs, den die Churfürstlich-Mayntzische Gesellschaft oder Academie nützlicher Wissenschaften in Erfurt im April 1792 ausschrieb. Die Anregung dazu kam von Karl Theodor von Dalberg, seit 1771 Statthalter der mainzischen Exklave Erfurt und seit 1787 Koadjutor des Erzbischofs mit dem Recht der Nachfolge des Kurfürsten von Mainz. Die Frage, die er stellte, lautete, wie das deutsche Volk am besten zu unterrichten sei, die Vorzüge seiner Verfassung zu schätzen, und wie man es vor den Gefahren warnen solle, die »überspannte Begriffe von unangemessener Freyheit und idealischer Gleichheit« heraufbeschwören würden. Vier zusätzliche Fragen galten Erziehung und Zensur, der korrekten Definition und dem Ausmaß der »bürgerlichen Freiheit« sowie der besten Art der Umsetzung vorgeschlagener Veränderungen »ohne auffallenden Zwang«. 12 Die Akademie ernannte keinen der dreiundzwanzig Teilnehmer zum Sieger, wählte aber einige der Aufsätze aus, die besonders gelobt und in der Folge auszugsweise veröffentlicht wurden. Alle betonten, wie wichtig es sei, dass Regierungen eine aufgeklärte Politik verfolgten. Pastoren sollten an ihre Rolle als Lehrer des Volks gemahnt werden; durch Unterrichtung in Naturrecht wollte man die Gefahren von Tyrannei, Despotie und der Zügellosigkeit des Volks verdeutlichen; Territorialstände sollten erhalten bleiben, das Volk sollte jedoch die Möglichkeit erhalten, an der Regierung zu partizipieren. Mehrere Teilnehmer betonten die Notwendigkeit eines deutschen, kurzen und verständlichen Gesetzbuchs, was wiederum zur lebhaften Diskussion um ein neues Gesetzbuch für das Reich während der 1790er Jahre beitrug. 13 Bürgerliche Freiheit wurde als Freiheit des Rechts und Eigentums unter dem Schutz des Staats definiert. Mehrere Teilnehmer unterstrichen, wie notwendig es sei, dass die Deutschen sich mehr für ihre Verfassung und deren Reform einsetzten. Einer meinte, Deutschland sei »kein gemeinsames Vaterland« und, »außer in den Kompendien des Staatsrechts, kein einziger Staat mehr!« Das Reich sei von einer Aufteilung zwischen Österreich und Preußen bedroht, verhalte sich jedoch als passiver Zuschauer im Krieg dieser beiden Mächte und Frankreichs, »als ob es um das Wohl und die Rechte von Californien gälte«. 14 Solche Überspitzungen, verknüpft mit heftiger Kritik am Reich, waren der Akademie nicht willkommen, daher wurden dieser und ein weiterer Beitrag nicht veröffentlicht. Der Autor gab ihn selbst als Pamphlet heraus, sicherlich als Beitrag zur Diskussion über eine Beteiligung des Reichs am Krieg gegen Frankreich. Im März 1793 trat das Reich in den Krieg ein. Wichtige Aspekte der Erfolge seiner Kriegsbemühungen führten indes bald zu neuen Reformvorschlägen, während die Demonstration seiner Schwäche in der zweiten Hälfte der Dekade zu zahlreichen weiteren Forderungen nach einer allgemeinen Reform beitrug. Angesichts der offensichtlichen Schwierigkeiten des Kriegs und der Teilung des Reichs durch die Friedenslinie von 1795 schlugen sich die Schlüsselinstitutionen des
64. Pläne für eine Reform des Reichs in den 1790er Jahren
Reichs insgesamt bemerkenswert gut. Der Reichstag debattierte die Probleme effektiv, widersetzte sich einer Beteiligung am Krieg unter Bedingungen, die ihm nicht genehm waren, und machte seinen Wunsch nach Frieden deutlich. Zugleich fand er zu bedächtigen Entschlüssen zur Abwehr der ideologischen Bedrohung des Reichs und seiner Territorien durch revolutionäre Ideen. Vorschläge für eine Militärreform im Reich, die darauf abzielten, die kollektive Sicherheit zu stärken und eine effektivere Reichsarmee zu schaffen, scheiterten; Letzteres hätte fast zwangsläufig bedeutet, dem Kaiser und seinen Kommandeuren mehr Macht zu verleihen. 15 Dies wiederum weckte das traditionelle Misstrauen der Territorien gegenüber der Krone. Karl Theodor von Dalbergs aussichtsloser Appell an den Reichstag im März 1797, Erzherzog Karl mit einer Levée en masse (Massenaushebung) gegen Frankreich zu beauftragen, entstand aus purer Verzweiflung. Die Fürsten hätten niemals einen österreichischen Erzherzog als eine Art römischer Diktator oder George Washington des Reichs akzeptiert, wie Dalberg nahelegte. 16 Schließlich war es nie gelungen, auch nur die Matrikel von 1521 gründlich zu revidieren, die nach wie vor die Verpflichtungen von Territorien auflistete, die es nicht mehr gab, und die Schwankungen von Macht und Reichtum anderer nicht berücksichtigte. Das militärische System, mit dem das Reich in den 1790er Jahren Frankreich entgegentrat, war noch dasselbe, auf das man sich unter Leopold I. 1681 geeinigt hatte. Eine Militärreform erwies sich als unmöglich, weil sie eine umfassende konstitutionelle Reform bedeutet hätte. In den Jahren 1792–1799 bewilligte der Reichstag jedoch nie zuvor dagewesene Summen für die Kriegskosten: theoretisch insgesamt etwas mehr als 19 Millionen Gulden. Da Österreich und Preußen ihre Kriegskosten selbst trugen (und Preußen ab 1795 nichts mehr bezahlte), besetzte Territorien gar nichts beisteuern konnten und die theoretische Summe sich dadurch erhöhte, dass die Listen der verpflichteten Territorien äußerst ungenau waren, war das tatsächliche Ergebnis von 6,3 Millionen Gulden (33 Prozent) ziemlich beeindruckend. 17 Das meiste trugen die süddeutschen Territorien bei, aber auch Hamburg, Lübeck, Goslar sowie die Fürstbistümer Münster, Paderborn und Hildesheim. 18 Die Aufgabe, die Zahlungen einzutreiben, fiel den Kreisen zu, vor allem denen, die durchgehend am Krieg beteiligt waren, namentlich dem fränkischen, schwäbischen und bayerischen Kreis. 19 Sie waren das ganze 18. Jahrhundert am aktivsten gewesen und blieben es auch jetzt. Ab Ende des Jahrzehnts spielte der schwäbische Kreis keine große Rolle mehr, wurde jedoch formell erst 1809 aufgelöst. Der fränkische Kreis tagte seit 1791 ununterbrochen und wurde 1806 aufgelöst. Der bayerische Kreistag trat 1793 letztmals zusammen, blieb jedoch in Korrespondenz tätig, bis er durch die französische Besetzung 1800 praktisch aufgehoben und 1803 abgeschafft wurde.
697
698
VI. · Krieg und Zerfall: Das Reich 1792–1806
Auch der Oberrheinkreis überlebte und wurde 1803 mit dem stark verkleinerten kurrheinischen Kreis zusammengelegt. Weiter nördlich setzten sich ebenfalls gewisse Kreisaktivitäten fort. Der niederrheinische Kreis versammelte sich letztmals 1793, führte seine Geschäfte jedoch brieflich fort. Im niedersächsischen Kreis kam es in den 1790er Jahren zu keinen offiziellen Vollversammlungen mehr, aber zu Treffen, und selbst im obersächsischen Kreis erfüllte die kleine regionale Bürokratie in den 1790er Jahren nützliche Aufgaben der Informationsverbreitung und Koordination der regionalen Politik. Obwohl man sich nicht auf eine offizielle Assoziation der Kreise einigte, führte der Krieg manche Regionen zeitweise zusammen. Im Süden und in der Mitte kooperierten in Krisenzeiten die Kreise Oberrhein, Kurrhein, Schwaben, Franken, Bayern und Franken. Im Norden nahmen die Westfälischen und Niedersächsischen Kreise am Hildesheimer Kongress von 1796/97 teil, der sich darum bemühte, ein neues Verteidigungssystem für die neutrale Zone zu entwerfen, das sie nicht gänzlich Preußen auslieferte. 20 Kein Kreis konnte sich allein verteidigen und selbst ein Kreisbündnis hätte den französischen Streitkräften nicht standgehalten; letztlich wurden alle Kreise von der militärischen Lage überwältigt. In der juristischen Literatur des Reichs im 18. Jahrhunderts fanden die Kreise wenig Aufmerksamkeit und die Historiker sind sich über ihre Rolle in dieser Phase uneins. 21 Andererseits macht die anhaltende Aktivität zumindest einiger Kreise in den 1790er Jahren verständlich, weshalb fast alle Projekte zur Reform des Reichs von der grundlegenden Bedeutung dieser regionalen Organisationen ausgingen. Das zweite gemeinsame Element so gut wie sämtlicher Reformvorschläge war ein zentraler Gerichtshof. Fast alle Kommentatoren betonten, der Reichshofrat in Wien und das Reichskammergericht in Wetzlar seien die besten Merkmale des Reichs. 22 Häberlin nannte sie »das Palladium der teutschen bürgerlichen Freyheit«. Beide blieben bis 1806 tätig, bemerkenswerterweise kaum behindert durch den Krieg. Das Reichskammergericht verdankte dies der französischen Anerkennung der Neutralität Wetzlars sowie seines Gerichts und später einer französisch-russischen Garantie. 23 Weitere Aufgaben der Kreise waren die Erhebung von Beiträgen (dem Kammerzieler) für das Reichskammergericht und die Organisation der Nominierung von Richtern. Die meist lasche Zahlungsmoral beim Kammerzieler besserte sich in den 1790er Jahren, und Preußen, das unter Friedrich II. Zahlungen generell verweigert hatte und auf das 1785 mehr als die Hälfte aller Schulden entfiel, zahlte nicht nur die aufgelaufenen Rückstände, sondern unter Friedrich Wilhelm II. (1786–1797) auch pünktlich. 24 Nichts spricht dafür, dass das Reichskammergericht seine respektierte Rolle während der 1790er Jahre verloren hätte; tatsächlich stieg die Anzahl der Verfahren nach 1800 noch an. Klar scheint auch, dass das Gericht mit Verhandlungen relativ zügig vorankam. Das gilt offenbar auch für den Reichshofrat in Wien, über
64. Pläne für eine Reform des Reichs in den 1790er Jahren
dessen letzte Jahre allerdings weitaus weniger bekannt ist. Der Wert der Arbeit der beiden höchsten Gerichte ist einer der wenigen Punkte, über die sich fast alle Kommentatoren einig sind. Häberlin und die meisten Reformer gingen von der Annahme aus, das Reich werde überleben. Eine andere Strömung des Reformdenkens indes kam zu dem Schluss, das Reich habe nach dem Frieden von Basel (1795) aufgehört, effektiv zu funktionieren, und der Friede von Campo Formio (1797) habe es paralysiert. Vor allem drei Kommentatoren fassten nun einen radikalen Umbau des Reichs ins Auge; zwei von ihnen wollten es in eine Republik verwandeln. Von den diversen Plänen der deutschen »Jakobiner« unterschieden sie sich dadurch, dass sie nicht einfach das französische republikanische Modell auf deutschen Boden übertragen wollten, sondern, jeweils von einer Analyse des Scheiterns des Reichs ausgehend, ein neues Gemeinwesen auf seinen Fundamenten entwarfen, das auf viele Elemente des traditionellen Systems baute. Die Grundlinien zu einer allgemeinen deutschen Republik, gezeichnet von einem Märtyrer der Wahrheit, die wahrscheinlich Wilhelm Traugott Krug 1797 in Altona veröffentlichte, gingen von der Annahme aus, Preußen habe sich 1795 aus dem Reich zurückgezogen. 25 Nun solle sich auch Österreich zurückziehen. Die sieben verbleibenden Kreise sollten sich als pazifistische Republik neu gründen, der Frankreich selbstverständlich bereitwillig die linksrheinischen Gebiete zurückgeben werde. Das deutsche Volk werde die Rückkehr zu seiner ursprünglichen Freiheit fordern und an die Fürsten appellieren, es aus ihrer »Sklaverei« zu entlassen; dies werde keine Revolution nach sich ziehen, da sich die »Stimme der Vernunft« durchsetzen werde. Sobald sie befreit seien, würden die Bürger in ihren Kreisen Repräsentanten in eine Nationalversammlung wählen, die Krugs Vorschlag zufolge in Erfurt tagen sollte. Das Ziel der Verfassung müsse es sein, Rechte, Person und Eigentum der Bürger zu sichern. Die wahrscheinlichste Regierungsform werde eine Gruppe von Direktoren sein, die gewählt würden und nicht länger als vier oder fünf Jahre amtieren sollten. Alle tauglichen Bürger sollten in einer Miliz unter bürgerlichem Befehl dienen, die rein defensiv organisiert sein sollte, weil die Republik keinen Krieg beginnen werde. Kants Aufsatz Zum ewigen Frieden (1795) gemäß meinte Krug, Krieg werde ohnehin seltener, da sich der »Geist des Handels« unter allen Nationen verbreiten und alle die Vorzüge friedlicher Beziehungen zu ihren Nachbarn erkennen würden. Der anonyme Autor von Teutschlands neue Konstituzion, 1797 in Frankfurt und Leipzig erschienen, schrieb der bestehenden Verfassung des Reichs größere Verdienste zu, beschuldigte jedoch die mächtigen Fürsten, sie untergraben zu haben. 26 Die jüngsten Ereignisse hätten gezeigt, dass das Reich als Staat nicht mehr funktioniere. Dem Autor schwebte eine Wahlmonarchie zur Restauration dessen vor, was er für die ursprüngliche Freiheit der Deutschen hielt. Das Reich sollte
699
700
VI. · Krieg und Zerfall: Das Reich 1792–1806
durch ein neues Verständnis von Freiheit im Zuge von Aufklärung und Französischer Revolution wiederbelebt werden. Da die Deutschen jedoch grundsätzlich daran interessiert seien, ihren Besitzstand zu wahren, und nichts mehr fürchteten als einen gewalttätigen Umsturz, scheuten sie den revolutionären Weg der Franzosen. Sie würden eine neue, »für die Denkungsart, Sitten, Meinungen, Empfindungsvermögen« des eigenen Volks angemessene Verfassung errichten. Die Reform des Reichs werde natürlich eine Reform der Territorien nach sich ziehen. Auch dieser Autor glaubte, der Adel könne überzeugt werden, auf seine Rechte zu verzichten, wie das der französische Adel am 4. und 5. August 1789 getan hatte. »In dem nemlichen Augenblicke, da alle Menschen, alle Staatsbürger über den wahren Adel, über den wahren Werth des menschlichen Wesens und dessen moralische Bestimmung und Höhe aufgeklärt sind«, schrieb er, »werden die Grafen, Freyherren und Edelleute, ihre Diplomen und Stammbäume willig auf den Altar des Vaterlands legen.« Versuche von Herrschern, durch Milderung ihrer despotischen Prinzipien den losbrechenden Sturm abzuwenden, seien zwecklos. Es liege in ihrem eigenen Interesse, sich an der nun nötigen allgemeinen Reform zu beteiligen. Ohne ins Detail zu gehen, schloss sich der Autor Krugs Vorschlag an, das Reich zu verkleinern. Bleiben sollte nur, wer fähig war, in einer derart beschränkten Wahlmonarchie zu existieren; das Reich sollte nur so groß sein wie nötig, um seine Unabhängigkeit zu sichern, der Kaiser mit ausreichend Einkommen und Macht ausgestattet werden, dass er ein wirkliches Interesse an der Wohlfahrt des Reichs habe. Große Territorien, die mit Monarchien verbunden waren, die Interessen außerhalb des Reichs hegten, waren implizit ausgeschlossen, was wiederum effektiv ein Reich ohne Österreich und Preußen bedeutete. Ähnliche Themen durchziehen die dreibändige Kritik der Regierungsform des Deutschen Reichs (1796–1798). 27 Der Autor, wahrscheinlich ein kaiserlicher oder eher territorialer Beamter, beginnt mit einer detaillierten Darstellung der gegenwärtigen Verfassung des Reichs und seines Militärsystems. Im dritten Bändchen indes zeigt er sich überzeugt von der Notwendigkeit einer republikanischen Erneuerung des Reichs. Das bedeutete nicht die Einführung einer Republik, sondern eher eine »Republikanisierung« seiner Institutionen im Sinn Kants: die Trennung von Legislative, Exekutive und Jurisdiktion. Der letzte Vorschlag, die Exekutive solle demokratisch legitimiert sein, ging allerdings über Kant hinaus. Das Grundproblem des deutschen Systems, fand der Autor der Kritik, war, dass es zur »Pantokratie« geworden sei, in der zu viele Leute in chaotischer Weise Autorität ausübten. Zur Abhilfe wollte er die Regierungs- und Gesetzgebungsrolle der Territorien abschaffen. Ihre einzige verbleibende Aufgabe sollte sein, als Wahlbezirke zu dienen, deren Bürger die Mitglieder eines »gesetzgebenden Areopag« wählen sollten. Den Fürsten bliebe als einziges Privileg, dass die Repräsentanten des Volks einen der Ihren zum Kaiser wählen würden. Er wäre praktisch ein de-
64. Pläne für eine Reform des Reichs in den 1790er Jahren
mokratisch legitimierter Präsident, der einzige Repräsentant einer Exekutive, an die von der Legislative verabschiedeten Gesetze gebunden und mit einem Vetorecht ausgestattet, das sich auf Maßnahmen beschränkte, die die Gleichheit und Freiheit der Bürger bedrohten. Ein einziger oberster Gerichtshof sollte über alle anderen im Reich walten, eine Armee unter Befehl des Kaisers die Durchsetzung seiner Urteile und die Treue zu den Gesetzen sicherstellen. Hauptaufgabe der Regierung sollte sein, die Wirtschaft zu fördern: Die Abschaffung innerstaatlicher Zollschranken sollte einen freien Markt schaffen, Ländereien von Fürsten und Adel an Bauern verteilt werden. Den Ideen von Adam Smith folgend, betonte der Autor, der Markt werde sich selbst regulieren. Andererseits sah er die Schaffung einer Kriegsflotte in Ost- und Nordsee vor, um den Exporthandel gegen andere Mächte zu schützen. Er schloss mit einem Appell an die deutschen Fürsten, sich aus der Politik zurückzuziehen und der Gesetzgebung eines Reichstags zu unterwerfen, der aus gewählten Volksvertretern bestünde. Das war selbstverständlich absolut unvorstellbar. Welchen Einfluss, wenn überhaupt, die Kritik und die beiden Reformpamphlete von 1797 hatten, ist unbekannt. Sie bezeugen aber Reichhaltigkeit und Breite der politischen Debatten im Deutschland der 1790er Jahre und zudem, dass sich die Reformideen mit der Nation und mit republikanischen Prinzipien verbinden ließen, die aus deutschen Traditionen schöpften. Sie fassten eine evolutionäre Reform des Reichs ins Auge, die es unter Bewahrung seiner essenziellen Merkmale modernisieren sollte. Unter Rückgriff auf Montesquieu und Kant statt Robespierre und die Französische Republik schlugen sie eine Rekonstruktion des Gemeinwesens auf Grundlage von Volksherrschaft, Gewaltenteilung und eine unabhängige Gesetzgebung und Justiz vor. Aus der antiken deutschen Libertät sollte eine neue deutsche Freiheit erstehen. Die rapiden Veränderungen der militärischen und politischen Lage sorgten dafür, dass solchen Ideen bald keine direkte politische Relevanz mehr zukam. Später jedoch prägte das Vokabular der deutschen Freiheit, das sie modernisierten, das Denken jener, die von den 1820er Jahren an für eine konstitutionelle Reform eintraten. Tatsächlich war der einzige Reformbereich, in dem es in den 1790er Jahren zu Fortschritten kam, die Idee der Säkularisierung der kirchlichen Territorien. Signifikanterweise hatte dies kaum mit irgendwelchen patriotischen Bemühungen um Erneuerung und Bewahrung des Reichs zu tun. Im Gegenteil: Das Verschwinden dieser Territorien konnte, wie viele Kommentatoren unterstrichen, das Reich selbst ins Wanken bringen. 28 Seit der ersten Welle von Säkularisierungen zur Zeit der Reformation waren die verbliebenen kirchlichen Territorien bedroht. Der Westfälische Friede hatte weitere Säkularisierungen ausgeschlossen, aber der Vorschlag Karls VII., die
701
702
VI. · Krieg und Zerfall: Das Reich 1792–1806
Reichskirche zu säkularisieren, um seine unglückselige Herrschaft zu finanzieren, brachte das Thema wieder auf den Tisch. Im späten 18. Jahrhundert schwächten drei Entwicklungen die Stellung der Reichskirche schwer. 29 Aufgeklärte Denker prangerten die bloße Existenz dieser Territorien zunehmend als Relikt aus dem Mittelalter an. 30 Zweitens befremdete das Eintreten der kirchlichen Kurfürsten für den Febronianismus und sein Streben nach Sicherung der Rechte einer deutschen Nationalkirche gegen Roms Autorität ironischerweise einerseits den Papst und brachte andererseits die Erzbischöfe in Konflikt mit den größeren weltlichen Herrschern. 31 Und zum Dritten regten gallikanische Ideen auch weltliche Herrscher, insbesondere Joseph II. und den bayerischen Kurfürsten, an, die Kirche in ihren Territorien in eine Territorialkirche umzuwandeln, ähnlich dem System in den protestantischen Territorien. Das brachte sie in Konflikt mit den Kurfürsten, die als Erzbischöfe kirchliche Autorität über die Bistümer außerhalb der Territorien beanspruchten, die sie selbst regierten. 32 Nach einer langwierigen politischen Kampagne setzten die Erzbischöfe schließlich durch, dass ihre Rechte 1792 in der Wahlkapitulation von Franz II. bekräftigt und die Autorität der Nuntien beschränkt wurden. Es war indes ein Pyrrhussieg. Die Erzbischöfe waren machtlos dagegen, dass die weltlichen Herrscher ihre Macht über die Kirche in ihren Territorien weiter ausbauten. Zudem verscherzten sie sich mit ihrem politischen Triumph die letzten verbliebenen Sympathien in Rom, wo man ihre fortdauernde Funktion als Fürsten des Reichs nun als das wahre Hindernis für die päpstliche Autorität über die deutsche Kirche betrachtete. Die Krise des Heiligen Stuhls 1798, als die Franzosen Pius VI. aus Rom vertrieben und absetzten, änderte wenig, weil mittlerweile wohlbekannt war, dass der Papst die Reichskirche sowieso nicht mehr unterstützte. Selbst wenn er gewollt hätte, ist unwahrscheinlich, dass der Papst die Reichskirche gerettet hätte, weil die Ereignisse nach 1789 die Idee der Säkularisierung wieder auf die Tagesordnung setzten. Die Konfiskation von Rechten und Gerichtsbarkeiten durch Frankreich und die folgende Annexion von Territorien machten die Frage dringlich, wie die Betroffenen entschädigt werden sollten. 33 Dies wurde zum Thema einer langwierigen Debatte in Pamphleten, der Presse, politischen Briefwechseln innerhalb und zwischen Territorien und im Reichstag. Manche fanden es unfair, dass die kirchlichen Territorien allein die Kosten der Entschädigung tragen sollten; andere hielten sie für ideale Opfer, weil sie ohnehin nur noch Relikte der Vergangenheit waren. Wer die kirchlichen Territorien verteidigte, wies auf die Vorzüge hin, die sie ihren Untertanen boten, bestand auf der ungebrochenen Gültigkeit ihrer gesetzlichen und konstitutionellen Rechte oder warnte, die Absorption dieser Staaten durch ihre weltlichen Nachbarn werde das Reich insgesamt zerstören. Dies war die Haltung von Hannover und Sachsen – protestantischen Territorien, die sich beharrlich einer Säkularisierung widersetzten, nicht aus Res-
64. Pläne für eine Reform des Reichs in den 1790er Jahren
pekt vor der katholischen Kirche, sondern weil sie die Vergrößerung von Preußen, Österreich und Pfalz-Bayern fürchteten. Preußen wiederum trat beständig für Säkularisierungen ein, während Österreich eine begrenzte Säkularisierung bevorzugte, die die drei kirchlichen Kurfürsten verschonte. Das Ergebnis war von den Ereignissen bestimmt. Zum Ende des Jahrzehnts war klar, dass das linke Rheinufer auf unabsehbare Zeit verloren war. Das Prinzip eines gewissen Grades von Säkularisation war in mehreren Friedensabkommen festgehalten und wurde im April 1798 vom Kongress in Rastatt abgesegnet. Im Februar 1801 bekräftigte der Friede von Lunéville, worauf man sich in Rastatt geeinigt hatte. Nach Österreichs erneuter Niederlage blieb keine Wahl, als diese große Reform des Reichs weiter voranzutreiben. 34 Wie realistisch war Ende der 1790er Jahre die Vorstellung, das Reich habe noch eine Zukunft? Das Scheitern aller Reformvorschläge außer des einen, der dem Reich durch auswärtige Mächte praktisch aufgezwungen worden war, wird oft als Beleg dafür herangezogen, dass das System schlichtweg zum Untergang verurteilt war. Auch der Verlust des linken Rheinufers soll angeblich bewiesen haben, dass das Reich unfähig war, sein Territorium zu verteidigen. Sicherlich empfanden viele Zeitgenossen den Verlust als schweren Schlag und blickten besorgter denn je in die Zukunft. Die Annexion der linksrheinischen Ländereien inspirierte den jungen Joseph Görres zu seinem berühmten höhnischen »Nachruf«, den er am 7. Januar 1798 vor der Patriotischen Gesellschaft in Koblenz vortrug und im Roten Blatt veröffentlichte: »Am dreißigsten Dezember 1797, am Tage des Überganges von Mainz, nachmittags um drei Uhr, starb zu Regensburg, in dem blühenden Alter von neunhundertfünfundfünfzig Jahren fünf Monaten achtundzwanzig Tagen sanft und selig an einer gänzlichen Entkräftung und hinzugekommenem Schlagflusse bei völligem Bewußtsein und mit allen heiligen Sakramenten versehen, das Heilige Römische Reich schwerfälligen Angedenkens … Jener Hang zum sitzenden Leben, verbunden mit seinem leidenschaftlichen Eifer für die Religion, schwächte immer mehr seine ohnehin wankende Gesundheit … [Es] bewahrte seine Tugend so rein von den Flecken der Afteraufklärung und des Verderbs …« In seinem Testament habe der Verschiedene »die Fränkische Republik als einzige rechtmäßige Erbin des ganzen linken Rheinufers« ernannt. 35 Diese viel zitierten, triumphal sarkastischen Worte schossen sicherlich ein gutes Stück über das Ziel hinaus; Görres war kaum zweiundzwanzig Jahre alt, als er sie schrieb – drei Jahre bevor er angesichts der dort herrschenden Despotie seiner Bewunderung für Frankreich abschwor. Ernster zu nehmen sind die am selben Tag an einen der Abgesandten in Rastatt, Franz Xaver von Zwack, geschriebenen Worte: »Daß dem alten Gebäude der teutschen Reichsverfassung der Einsturz drohe, fällt jedem in die Augen, ein neuer Bau oder eine aufs nämliche hinauslaufende Totalreparatur ist unvermeidlich.« 36 Wie bei vielen anderen verband sich bei die-
703
704
VI. · Krieg und Zerfall: Das Reich 1792–1806
sem unbekannten Kommentator die Empfindung von Besorgnis und Krise mit dem Gefühl, dass etwas Neues entstehen musste, und sei es nur, weil unvorstellbar war, dass es gar nichts mehr geben sollte. Selbst in Wien und Berlin, wo Politiker in den 1790er Jahren die Brauchbarkeit und Zukunft des Reichs infrage gestellt hatten, setzte sich die Erkenntnis durch, dass es nicht leicht war, sich eine Struktur vorzustellen, die das Reich ersetzen könnte. 37 Obwohl ihm manche kaum mehr Respekt entgegenbrachten und viele nun den Zusammenbruch befürchteten, schien das Reich für die Organisation der deutschen Territorien immer noch unerlässlich. Ebenso blieben viele der Überzeugung, das Reichskammergericht sei ein lebenswichtiger Hüter der Rechte und Freiheiten der Deutschen. 38 Das machte die Frage seines Umbaus nach 1801 umso dringlicher.
Anmerkungen 1 Stolleis, Öffentliches Recht I, 319; die ersten beiden Bände erschienen 1794, ein dritter folgte 1797. 2 Walter, Zusammenbruch, 33. 3 Burgdorf, Reichskonstitution, 343; Gagliardo, Reich, 139 f. 4 Walter, Zusammenbruch, 33. 5 Vgl. zum Folgenden Gross, Empire, 455–464 (hier 458). 6 Burgdorf, Reichskonstitution, 352–383; Gagliardo, Reich, 103 f. 7 Burgdorf, Reichskonstitution, 383. 8 Vgl. auch S. 491 f. 9 Burgdorf, Reichskonstitution, 444–451 (das Häberlein-Zitat 393); Gagliardo, Reich, 104– 108. 10 Vgl. auch 73, 153 f., 426 f. 11 Burgdorf, Reichskonstitution, 384–443; Gagliardo, Reich, 108–111. 12 Burgdorf, Reichskonstitution, 452–474; die Dahlberg-Zitate S. 454. 13 Ebd., 460; Schöler, Reichseinheit, 11–45. 14 Burgdorf, Reichskonstitution, 465. 15 Härter, Reichstag, 403–438; Wilson, German Armies, 309–321; Gagliardo, Reich, 35–39. 16 Burgdorf, Reichskonstitution, 473 f. (Anm. 112) 17 Hartmann, »Reichskreise«, 315–319. 18 Aretin, Altes Reich III, 456. 19 Vgl. zum Folgenden Dotzauer, Reichskreise, 79, 137 f., 175 ff., 247, 292, 330 f., 379; Hartmann, Bayerischer Reichskreis, 485 ff.; Müller, Entwicklung, 298–304; vgl. auch S. 498– 501. 20 Aretin, Altes Reich III, 455 f. 21 Weber, »Reichskreise«, 69 f. 22 Aretin, Heiliges Römisches Reich I, 102 f.; Härter, »Unruhen«; Walter, Zusammenbruch, 16–20. 23 Hahn, Wetzlar, 179 f., 215 f. 24 Hartmann, »Reichskreise«, 311 ff.
64. Pläne für eine Reform des Reichs in den 1790er Jahren
25 Der Text ist abgedruckt bei Dippel, Anfänge, 114–146; vgl. auch Gagliardo, Reich, 173 ff.; Neugebauer-Wölk, »Verfassungsideen«, 72–77. 26 Dippel, Anfänge, 147–176; Neugebauer-Wölk, »Verfassungsideen«, 73 ff. 27 Burgdorf, Reichskonstitution, 475–501; Gagliardo, Reich, 175–183. 28 Dippel, Anfänge, 31. 29 Einen detaillierten Überblick dieser Entwicklungen bietet Aretin, Heiliges Römisches Reich I, 375–435. 30 Gagliardo, Reich, 197–205. 31 Vgl. S. 484 f. 32 Vgl. S. 482 ff. 33 Gagliardo, Reich, 206–221. 34 Vgl. S. 716–729. 35 Gooch, Germany, 516. 36 Mader, Priester, 23. 37 Aretin, Heiliges Römisches Reich I, 367–371. 38 Mader, Reichskammergericht, 12–15.
705
65. Der Friede von Lunéville (1801) und der Reichsdeputationshauptschluss (1803)
»M
öge der Friede von Lunéville werden, was der Westfälische Friede nicht wurde.« 1 Dieser Wunsch, den der Rechtsanwalt Christian Daniel 1802 äußerte, stellt den Friedensvertrag des vorangegangenen Jahres in eine Perspektive, die nur wenige Historiker des Reichs teilen. Den Frieden als Neubeginn zu betrachten, als Einleitung einer neuen Ära der Reichsgeschichte, die sich vielleicht als dauerhafter als jene erweisen würde, die mit dem Westfälischen Frieden 1648 begann, erscheint angesichts der Tatsache, dass er nur vier Jahre hielt, geradezu pervers. Daniels Haltung war jedoch ganz typisch für die optimistische Stimmung vieler seiner Zeitgenossen. Die Jahre nach 1801, von Historikern allgemein als Jahre des unaufhaltsamen Niedergangs dargestellt, brachten eine Fülle von Literatur über das Reich und seine Zukunft hervor. Wie ihre Vorläufer waren die akademischen Kommentatoren dieser Jahre bestrebt, das Reich zu beschreiben und die ihm seit 1801 aufgezwungenen Veränderungen zu dokumentieren, und wie andere vor ihnen interpretierten sie das System unter den Aspekten des neuesten gesetzlichen und politischen Denkens. Der Geist von Johann Jacob Moser und Johann Stephan Pütter lebte in diesen Werken weiter. Dennoch zwangen die Ereignisse die Autoren der Jahre nach 1800 zu mehr als nur Beschreibungen und Bestandsaufnahmen. Viele von ihnen stritten energisch für weitere Reformen, griffen dabei Vorschläge aus der Fürstenbunddebatte der 1780er Jahre wieder auf und bauten sie aus, indem sie darauf zielten, Österreich und Preußen im Reich zu halten und gleichzeitig die Unabhängigkeit des dritten Deutschlands, der Masse von mittleren und kleinen Territorien dazwischen, zu bewahren. 2 Der Friede von Lunéville grenzte die Umrisse des neuen Rahmens ab. Er konzedierte den Verlust der linksrheinischen Gebiete; wer dort Verluste erlitten hatte, sollte anderswo im Reich entschädigt werden. Der Großherzog der Toskana und der Herzog von Modena sollten ebenfalls im Reich für den Verlust ihrer Ländereien in Italien entschädigt werden. Der Vertrag legte nicht exakt fest, wie das Reich neu organisiert werden sollte, es lag jedoch auf der Hand, dass eine größere Reform nötig war, um sicherzustellen, dass das alte Gleichgewicht zwischen Kaiser und Reich und die traditionellen Funktionen der obersten Gerichtshöfe Eingang in die neue Ordnung fanden. Zugleich bestanden die meisten Kommentatoren darauf, man müsse sich allen
65. Der Friede von Lunéville (1801) und der Reichsdeputationshauptschluss (1803)
Versuchen widersetzen, das Reich in eine Föderation zu verwandeln. In unterschiedlichen Zusammensetzungen dominierte eine Reihe allgemeiner Themen: Die alte Verfassung des Reichs müsse den neuen Umständen angepasst werden, aber um jeden Preis weiterbestehen; die kaiserlichen Gerichte müssten neu gestaltet und ihre finanzielle Grundlage gesichert, die Rechte der Bürger, nun regelmäßig als Reichsbürgerrecht oder Reichsbürgerschaft definiert, garantiert werden. Nikolaus Thaddäus Gönner (* 1764, † 1827) benutzte sogar Rousseaus Terminologie, um nahezulegen, die letztendliche Souveränität liege beim Volk und der Kaiser vertrete den allgemeinen Willen, allerdings begrenzt durch die Reichsstände. Andere bestanden auf der Rekonstitution der Kreise und plädierten dafür, Österreich und Preußen zu vereinen, um das Reich wiederzubeleben. Graf Julius von Soden (* 1754, † 1831) etwa schlug sieben Kreise vor; je einen sollten Österreich und Preußen bilden, die übrigen fünf eine Art »Liga der Kreise« mit einer Versammlung in Erfurt, in der alle fünf vertreten sein sollten. 3 Professor Johann Reitemeier (* 1755, † 1839) aus Frankfurt an der Oder schlug einen Umbau des Reichs auf der Grundlage einer kleineren Anzahl vergrößerter Territorien vor, der die besten Elemente der schweizerischen, niederländischen und amerikanischen Föderationen vereinen sollte. 4 Zwar erkannten manche Kommentatoren an, dass das Reich als Staat nicht mehr funktionierte, sie machten jedoch fast ausnahmslos Vorschläge, um zu gewährleisten, dass es seine Funktion wieder aufnahm. Die meisten waren sich der Spannung bewusst, die zwischen dem Streben der größeren Territorien nach Unabhängigkeit und der traditionellen hierarchischen Feudalstruktur des Reichs entstanden war. Immer wieder aber betonten Kommentatoren wie Theodor von Schmalz (* 1760, † 1831), Adam Christian Gaspari (* 1752, † 1830) und Gönner, das Reich sei keine Föderation, sondern in Gasparis Worten »ein einziger Staat; keine Aristokratie, sondern eine durch Stände eingeschränkte Monarchie: ein Königreich«. 5 Gaspari und andere bestanden darauf, dass die Territorien dem Reich untergeordnet blieben und der Kaiser die Pflicht habe, imperiale Gesetzgebung durchzusetzen, insbesondere soweit individuelle Rechte betroffen waren. Eine seltene Ausnahme von dieser allgemeinen Strömung war der Wittenberger Professor Karl Salomo Zachariae (* 1769, † 1843), der 1800 und 1804 argumentierte, das Reich sei zu einer Liga unabhängiger Staaten geworden, für deren Herrscher die Autorität des Kaisers nicht mehr viel bedeute. Aber selbst Zachariae wollte das Reich als föderale Union der deutschen Länder gestärkt sehen, anstatt seine Aufteilung in zwei oder drei getrennte Verbünde oder einen Zerfall in eine Masse von miteinander wetteifernden Einheiten hinzunehmen. 6 Die akademische Debatte setzte sich bis zum Ende fort. Das letzte Lehrbuch zum deutschen öffentlichen Recht von Andreas Joseph Schnaubert (* 1750, † 1825) aus Jena erschien 1806. Schnaubert berücksichtigte sogar den Frieden von Pressburg (1805) und meinte, die »Souveränität«, die der Vertrag Baden,
707
708
VI. · Krieg und Zerfall: Das Reich 1792–1806
Württemberg und Bayern einräumte, unterscheide sich nicht von jener, die Österreich und Preußen vor langer Zeit verliehen worden sei. Im Grunde, behauptete er, beeinträchtige selbst diese Entwicklung nicht die Tatsache, dass das Reich ein Staat sei, dessen Bürger die »Nation« bildeten und in imperialen Gesetzen verankerte Rechte genössen. 7 Diese Schriften sind oft als irrelevant verworfen worden, als Beweis für die kollektive Kurzsichtigkeit ihrer Autoren angesichts der endgültigen Krise des Reichs, die offenkundig war. Tatsächlich aber spiegeln sie anscheinend ein breites Spektrum der öffentlichen Meinung ihrer Zeit wider. Man war sich einig, dass sich das Reich seit Mitte der 1790er Jahre verändert hatte. Manche stellten Preußens Rückzug aus dem Krieg gegen Frankreich 1795 als Wendepunkt heraus; andere wiesen auf die Folgen des Rastatter Kongresses und das Problem der Entschädigungen hin, das nach dem Frieden von Lunéville geklärt werden musste. Es herrschte Einigkeit, dass Deutschland eine Zukunft hatte, und so gut wie alle Zeitgenossen dachten immer noch im Rahmen des Reichs, in dem die Deutschen fast tausend Jahre lang als Nation gelebt hatten. Was das im Detail bedeutete, war nicht klar. Für die meisten war das Reich das System, das sich in den drei Jahrhunderten seit der Reformation entwickelt hatte. Das gilt sicherlich für Hegels Reflexionen über die deutsche Verfassung, die er 1799 kurz nach dem Rastatter Kongress begann und 1802 abbrach und die erst nach seinem Tod veröffentlicht wurden. »Deutschland ist nicht länger ein Staat«, schrieb er, da das Reich sich nicht mehr gegen innere Opposition durchsetzen und gegen Feinde von außen verteidigen könne. Das führte ihn jedoch nicht zu dem Schluss, die Gesetze des Reichs seien nicht mehr gültig. Im Gegenteil – er formulierte Vorschläge zur Reform, fasste eine neue Militärverfassung ins Auge, die eine einzige Armee schaffen sollte, und wollte das Kollegium der Reichsstädte in einen Rat von Repräsentanten der Bürger des Reichs umwandeln, der die Kollegien der Kurfürsten und Fürsten ergänzen sollte, die er erhalten wollte. Die Reform des Reichs, glaubte Hegel, könne nur unter der Herrschaft eines starken Kaisers gelingen, wofür für ihn in dieser Phase seiner Entwicklung nur die Habsburger infrage kamen. 8 Wer mit Hegel dem ›dürren‹ preußischen Staat misstraute oder mit Novalis die »maschinelle Administration« des modernen Staats verabscheute, begann nun im Sinn einer neuen Version des mittelalterlichen Reichs zu denken, einer stark idealisierten Vision eines vereinigten christlichen Universalreichs, das als Antithese zum rationalistischen absolutistischen Staat und den Idealen der Französischen Revolution gesehen wurde. 9 1807 wollte etwa Friedrich Schlegel mittelalterliche und religiöse Traditionen des Reichs mit einer Erneuerung des Reichs Karls V. durch die Habsburger zu einer großen europäischen Föderation unter österreichischer Führung verbinden. 10
65. Der Friede von Lunéville (1801) und der Reichsdeputationshauptschluss (1803)
In den Jahren von Napoleons Aufstieg rechneten manche mit einer napoleonischen Reform des Reichs, im Großen und Ganzen im Sinn des Rheinbunds – der 1806 zustande kam –, entweder unter Beibehaltung der grundlegenden Merkmale und Traditionen des Reichs oder nach französischen konstitutionellen Prinzipien neu gegründet. 11 Andere, etwa 1804 Herzog Karl August von Weimar und seine Berater, setzten ihre Hoffnungen auf Russland, seit 1779 Garantiemacht des Reichs, und hofften, Alexander I. werde eine neue Version des Fürstenbunds anführen, um das Reich vor Napoleon und den beiden führenden deutschen Mächten, Österreich und Preußen, zu retten. 12 Die Situation war unklar. Jedes Jahr, jeder Monat, jede Woche brachte dramatische neue Entwicklungen, die die Perspektiven veränderten, deren Folgen untersucht und verarbeitet werden mussten und die manche Optionen ausschlossen und andere eröffneten. Der größte Unsicherheitsfaktor war Napoleon selbst. Was waren seine tatsächlichen Ziele? Würde es irgendeiner Koalition gelingen, ihn zu bezwingen? Würde ein Sieg Österreichs allein eine bessere Regelung für Deutschland und das Reich bringen? Napoleons Haltung veränderte sich. Im Mai 1797 hatte er geschrieben, wenn das Reich nicht existierte, müsste man es erfinden. 1806 war er entschlossen, es zu zerstören. 13 Dazwischen spielte er mit diversen Plänen einer Teilung Deutschlands und der Schaffung von drei deutschen Reichen (Österreich, Preußen und Mitteldeutschland). Österreichischen Beamten gefiel es bisweilen, Gerüchte über Napoleons angebliche geheime Absichten im Reich zu streuen, tatsächlich aber wussten sie nicht mehr als irgendjemand sonst und konnten nur raten, was er vorhatte. Das lag auch daran, dass er und sein Außenminister Talleyrand unterschiedliche Signale aussandten: 1805 etwa wollte Talleyrand eine neue französisch-österreichische Allianz schmieden, die ein neues Gleichgewicht der Kräfte in Europa herstellen sollte. Napoleon hingegen wollte Frankreichs Einfluss im Südosten erweitern und eine französische Hegemonie in Mitteleuropa errichten. 14 Im Rückblick scheinen Napoleons Ambitionen klar, aber viele im Reich glaubten, er wolle in Wirklichkeit selbst heilig-römischer Kaiser und ein neuer Karl der Große werden. Zu bestätigen schien er dies durch eine pompöse Visite in Aachen, wo er den Botschafter von Franz II. empfing, und in Mainz, wo er Dalberg traf und im September 1804 einer Versammlung der deutschen Fürsten vorsaß, ehe er sich im Dezember in Paris zum Kaiser von Frankreich krönen ließ. 15 Es gibt jedoch keinen Beleg dafür, dass Napoleon etwas anderes wollte als das Reich zu zerstören und es durch eine lockere Allianz souveräner Staaten unter Ausschluss von Österreich und Preußen zu ersetzen. Typisch für die Ungewissheit dieser Jahre ist, dass viele Beobachter ihre Einschätzung der Situation immer wieder änderten und mal hinter dem Reich, mal hinter Österreich oder Preußen, Napoleon, Russland standen, da sich die Ereignisse
709
710
VI. · Krieg und Zerfall: Das Reich 1792–1806
erst in die eine, dann in eine andere Richtung entwickelten. Für viele Herrscher war das Ergebnis ein Zustand neurotischer Furcht und chronischer Unentschlossenheit. Wilhelm IX. von Hessen-Kassel (1785–1821, ab 1803 als Kurfürst Wilhelm I.) verbrachte einen großen Teil des entscheidenden Juni 1806 unter Tränen. Maximilian IV./I. von Bayern (1799–1825, ab 1806 als König) zögerte so lang, dem Rheinbund beizutreten, dass sein Botschafter schließlich für Bayern unterschrieb, nur um festzustellen, dass der König ein paar Tage zuvor seine Meinung geändert hatte. 16 Beide Herrscher waren hin- und hergerissen, ob sie sich Napoleon anschließen oder treu zum Reich stehen sollten, und konnten sich nicht entscheiden, wo die Zukunft lag. In diesen letzten Jahren suchten sämtliche Herrscher, von Franz II. in Wien bis hin zu dem unbedeutendsten Reichsritter in Schwaben oder Franken, so viel wie möglich für ihre Dynastien und Territorien herauszuholen. Für viele war das Territorium letztlich wichtiger als das Reich. Das Gefühl, in Vergangenheit und Zukunft einem größeren deutschen Gemeinwesen anzugehören, blieb stark und nur wenige legten es mit Leichtigkeit ab. Aber der Fluss der Ereignisse, bestimmt von Napoleons anhaltender militärischer Überlegenheit, stellte die Frage der Überlebensfähigkeit des Reichs immer wieder aufs Neue. Der Friede von Lunéville war Chance und Bedrohung zugleich, weil jede größere Umstrukturierung des Reichs Gefahren mit sich brachte. 17 Die nun notwendigen Veränderungen waren unendlich umfangreicher als die 1648 in Osnabrück ausgehandelten. Der Verlust der linksrheinischen Gebiete und die geplante Säkularisierung der Kirchenterritorien zur Entschädigung von Herrschern, die dort Verluste erlitten hatten, waren hart genug. Dass im Reich Ländereien gefunden werden mussten, um den Großherzog der Toskana und den Herzog von Modena für den Verlust ihrer Gebiete in Italien zu entschädigen, erhöhte den Druck und schuf ein potenzielles Problem mit dem Anwachsen der österreichischen Macht, da sie beide Habsburger waren. Die Regelungen des Friedens von Lunéville implizierten auch, dass die Bedingungen des Vertrags von Campo Formio nun umgesetzt würden und das Reich Ländereien finden musste, um das Haus Oranien für den Verlust der Erbstatthalterschaft der Niederlande zu entschädigen (Artikel 8 des geheimen Zusatzabkommens). Der Vertrag von Lunéville sagte nichts dazu, wie all dies zu schaffen sei. Er präzisierte auch nicht, was eine Säkularisierung nach sich ziehen würde: Formal bedeutete der Begriff die Aberkennung der Würde eines Herrschers als Reichsstand und seine Unterwerfung unter die Herrschaft eines anderen, samt Land und Leuten.Von einer Säkularisierung von Besitztümern – der Übertragung kirchlichen Besitzes auf andere – war offiziell nicht die Rede. Der Vertrag schrieb ausdrücklich vor, dass der Großherzog der Toskana Zeit haben sollte, seinen Besitz in der Toskana zu verkaufen; den deutschen Herrschern, die nun eventuell ihr Terri-
65. Der Friede von Lunéville (1801) und der Reichsdeputationshauptschluss (1803)
torium verlieren würden, wurde eine solche Regelung nicht eingeräumt. Zugleich ließ der Vertrag eine Reihe von Möglichkeiten offen, indem er bestimmte, die Kompensation müsse vom Reich kollektiv organisiert werden, was bedeutete, dass alle Reichsstände zu dem Prozess beitragen sollten. Es gab keinen Hinweis auf die konstitutionellen Implikationen dieser umfänglichen territorialen Reorganisation, bei der sich die Anzahl der Kurfürsten und Fürsten verändern würde. Vereinbart wurde, die Formel zur Entschädigung solle »in der Folge genauer bestimmt werden«. Als der Reichstag den Vertrag im April 1801 ratifizierte, überließ er die Sache dem Kaiser, behielt sich jedoch die letztliche Entscheidung vor. Der Kaiser zögerte, die Verantwortung für eine umfängliche Reorganisation des Reichs zu übernehmen. Er saß in der Zwickmühle zwischen dem Wunsch, den Habsburgern im Reich eine angemessene Entschädigung zu verschaffen und zugleich so viel von der Reichskirche zu bewahren, wie nötig war, um die Mehrheit der katholischen Kaiserpartei im Kurfürsten- und Fürstenkollegium weiterhin zu sichern. Die Entlassung von Thugut nach dem Scheitern der österreichischen Kriegsbemühungen 1800 gab der Friedenspartei in Wien Aufwind; die Interessen der Dynastie mit denen des Reichs in Einklang zu bringen, erwies sich indes als extrem problematisch, zumal Frankreich nun der Gebieter deutscher Belange war. Der am 7. November 1801 besiegelte Kompromiss erkannte dies implizit an. Das Problem der Kompensation wurde an eine Deputation des Reichstags verwiesen, der Vertreter von Österreich, Preußen, Mainz, Sachsen, Bayern, Württemberg, Hessen-Kassel und der Großmeister des Deutschen Ordens angehören sollten. 18 Grundlage aller Beratungen der Deputation sollte die Erhaltung des Reichs sein, Frankreich würde als »Vermittler« agieren. Unter den acht Mitgliedern waren vier Verfechter einer radikalen Säkularisierung und viele argwöhnten, Mainz werde alle anderen kirchlichen Territorien opfern, um sich selbst zu retten. Weder die Reichsstädte noch die Reichsgrafen und -ritter waren vertreten: Obwohl ihre Stellung offiziell nicht auf der Tagesordnung stand, verhieß ihr Ausschluss nichts Gutes für ihre Chancen auf ein Weiterbestehen. Tatsächlich sah ein vom österreichischen Repräsentanten am 1. November vorbereitetes Papier vor, dass zum Zweck der Kompensation der Habsburger und des Hauses Oranien sowie aller anderen berechtigten Herrscher Österreich seine Zurückhaltung in Sachen Säkularisation ablegen und Wege suchen sollte, das Reservoir an Kompensationsmöglichkeiten zu erweitern. Erhalten werden könne nur ein Kirchenterritorium (Mainz). Aller kirchliche Besitz solle säkularisiert werden, auch die Reichsabteien. Ebenfalls geopfert werden sollten nun alle bis auf sechs Reichsstädte, da die meisten durch den Krieg hoch verschuldet und aufgrund ihrer dauernden inneren Probleme nur noch eine Bürde für die Krone waren. Nur die Reichsgrafen und -ritter, traditionelle Schützlinge der Krone und eine dauerhafte Einnahmequelle, sollten vorläufig verschont bleiben. 19
711
712
VI. · Krieg und Zerfall: Das Reich 1792–1806
Diese Stellungnahmen spiegelten nicht nur das Ausmaß und die Problematik des ganzen Unternehmens wider, sondern ebenso das Eingeständnis, dass alle bedeutenden Territorien, auch Österreich, von der territorialen Reorganisation zu profitieren hofften. Das wurde schon dadurch deutlich genug, dass Österreich die Einberufung der Kommission ein Jahr lang hinauszögerte, sodass mehrere Territorien, darunter Preußen, sich ihre Entschädigung durch direkte Abkommen mit Frankreich sichern konnten. Napoleon selbst war dieses Kommen und Gehen relativ gleichgültig, aber sein Außenminister Talleyrand vertiefte sich in die Einzelheiten und füllte eifrig sein Säckel mit den Bestechungsgeldern der deutschen Delegationen. Frankreich war vor allem bestrebt, die zweite Reihe der Territorien zu stärken, insbesondere Baden, Württemberg, Bayern und Hessen-Kassel. Ein Geheimvertrag vom 10. Oktober 1801 bekräftigte dies, indem Russland – das neben Schweden eine der Garantiemächte des Reichs war (obwohl von Letzterem nie offiziell anerkannt) – angeboten wurde, sich an der Entscheidung über die deutschen Belange zu beteiligen. Dem Zar war weniger daran gelegen, das Reich zu erhalten, als sicherzustellen, dass seine diversen deutschen Verwandten in Baden, Württemberg, Hessen-Darmstadt, Oldenburg und Mecklenburg-Schwerin gut abschnitten. 20 Bis Juni 1802 hatte Paris einen Entwurf formuliert, dem Russland zustimmte. Mit kleineren Änderungen wurde dieser Plan im November 1802 dem Reichstag vorgelegt. Dann handelte Österreich mit Frankreich aus, die Kompensation der Habsburger zu erhöhen. Nach der Einigung in diesem Punkt in der Pariser Konvention vom 26. Dezember konnte die Reichstagsdeputation ihre Beratungen am 25. Februar 1803 mit dem Reichsdeputationshauptschluss beenden. All diese hektischen Diskussionen und folgenden Geheimverträge hatten das Prinzip der Entschädigung enorm erweitert. Der Gedanke, die Kompensation strikt auf entstandene Verluste zu beziehen, spielte keine große Rolle mehr. Zudem war nun das gesamte Vermögen der katholischen Kirche im Reich betroffen: der Besitz von Domkapiteln, Fürstbistümern und Reichsabteien sowie aller Kirchenstifte in den diversen Territorien, der den Herrschern zur Verfügung gestellt wurde, um »Gottesdienste, Schulen und andere wohltätige Einrichtungen zu unterhalten und ihre Finanzierung zu erleichtern«. Ebenfalls enthalten war zur Erhöhung der verfügbaren Kompensation die Mediatisierung der Reichsstädte, über die seit 1799 anhaltend spekuliert wurde. 21 Das Ergebnis war die umfangreichste Neuverteilung von Besitztümern in der deutschen Geschichte vor 1945. Etwa 73.000 km 2 Kirchengebiet mit etwa 2,36 Millionen Einwohnern und 12,72 Millionen Gulden jährlichen Einkünften wurden auf neue Herrscher übertragen, die zusätzlich zusammen 2,87 Millionen Gulden kirchliche Einnahmen aus ihren eigenen Territorien dazugewannen. Überdies verloren alle bis auf sechs Reichsstädte ihre Unabhängigkeit; einundvierzig Städte mit
65. Der Friede von Lunéville (1801) und der Reichsdeputationshauptschluss (1803)
4.330 km 2 Territorium und 350.000 Einwohnern wechselten so den Herrscher. Die Gesamtsumme an Grund war mehr als dreimal so hoch wie die der offiziell an Frankreich abgetretenen linksrheinischen Gebiete (23.850 km 2 mit 800.000 Einwohnern und 5,43 Millionen Gulden Jahreseinkünften). Nur drei Kirchenterritorien blieben bestehen. Das Erzbistum Mainz wurde an Regensburg übertragen und mit den Fürstentümern Aschaffenburg (den ostrheinischen Überresten von Kurmainz) und Regensburg sowie der Grafschaft (ehemals Reichsstadt) Wetzlar dotiert; der Erzbischof verlor die Fürstbistümer Konstanz und Worms, die er zusätzlich hielt. Der Deutsche Orden und der Malteserorden überlebten ebenfalls und wurden großzügig entschädigt. Dies geschah laut dem Reichsdeputationshauptschluss in Anerkennung der militärischen Dienste ihrer Angehörigen. Österreich setzte sich tüchtig für die beiden Orden ein, da sie Hunderten von enteigneten adligen Mitgliedern von Domkapiteln den Lebensunterhalt zu sichern versprachen. Schließlich stellten diese katholischen Adligen die loyalste Klientel der Habsburger im Reich. 22 Die bemerkenswertesten Bestimmungen des Reichsdeputationshauptschlusses sind jene, die Baden mehr als siebenmal so viel Territorium zusprachen, wie es verloren hatte, Preußen nahezu das Fünffache und Württemberg das Vierfache. Hannover erhielt das Fürstbistum Osnabrück, obwohl es überhaupt nichts verloren hatte. Erfolgreich verhandelt hatte auch Österreich, dem die Fürstbistümer Brixen und Trient zufielen. Der Großherzog der Toskana bekam das Erzbistum Salzburg, die Propstei Berchtesgaden, das Fürstbistum Eichstätt und Teile von Passau, wobei seine Ländereien vom bayerischen Kreis abgetrennt und in den österreichischen Kreis aufgenommen wurden. Der Herzog von Modena erhielt den Breisgau von Österreich. Ebenso verschaffte Preußen dem Haus Oranien eine großzügige Entschädigung: Es erhielt die Fürstbistümer Fulda und Corvey, die wohlhabende Reichsabtei Weingarten am Bodensee und die Reichsstadt und Grafschaft Dortmund. 23 Am unteren Ende der Skala waren die Zugewinne und Verluste eher ausgeglichen. So verloren etwa die Grafen von Quadt, eine sehr unbedeutende Dynastie praktisch ohne politischen Einfluss, die Fürstentümer Wickrath und Schwanenberg (85 km 2 mit 3.000 Einwohnern) südwestlich von Düsseldorf. Im Gegenzug erhielten sie die schwäbische Reichsabtei und Reichsstadt Isny (Letztere mit 4 km 2 und 2.000 Einwohnern) plus 11.000 Gulden jährlich von der Reichsabtei Ochsenhausen, die in den Besitz der Fürsten Metternich überging. 24 Der Fürst von Bretzenheim, ein leiblicher Sohn des Kurfürsten von Pfalz und Bayern, verlor 82,5 km 2 und 3.000 Untertanen an der Nahe zwischen Bingen und Kreuznach und gewann eine ähnliche Fläche sowie etwa 5.000 bis 6.000 Untertanen mit dem Damenstift und der Reichsstadt Lindau am Bodensee, beklagte sich jedoch bitterlich, die Einkünfte seines neuen Territoriums seien geringer als die von Bretzenheim, ganz zu
713
714
VI. · Krieg und Zerfall: Das Reich 1792–1806
schweigen von den Schulden der Stadt Lindau, die er übernehmen musste. 25 Die meisten Besitzübertragungen an unbedeutendere Herrscher waren ähnlich kompliziert. Insgesamt verschwanden 112 Reichsstände. Abgesehen von den an Frankreich abgetretenen Gebieten wurden ihre Länder und ihr Besitz unter den 72 kompensationsberechtigten Herrschern verteilt. Der Reichsdeputationshauptschluss betraf auch die politische Struktur des Reichs und die Rechte der Bürger. Karl Theodor von Dalberg, ehemals ab Juli 1802 Kurfürst von Mainz, wurde als Kurfürst, Reichserzkanzler und Metropolitan-Erzbischof bestätigt und erhielt den zusätzlichen Titel Primas von Deutschland. Sein Machtbereich als Metropolit erstreckte sich über das gesamte Reich außer den Ländern des Königs von Preußen und der österreichischen Erzherzöge (sowie, wie später argumentiert wurde, dem habsburgischen Salzburg). Die Schaffung vier neuer weltlicher Kurfürstentümer machte den Verlust von zwei kirchlichen Kurwürden (Köln und Trier) wett. Württemberg erreichte sein lange gehegtes Ziel der Erhebung ebenso wie Baden und das neue weltliche Territorium Salzburg. 26 Die Fürsten, die Stimmen im Reichstag verloren hatten, erhielten neue, ebenso neu geschaffene Fürstentümer. Die Stimmrechte der ehemaligen Kirchenterritorien gingen auf ihre neuen Besitzer über. Es gab extrem detaillierte Vereinbarungen zur finanziellen Entschädigung ehemaliger kirchlicher Kurfürsten wie Fürsten und ihrer Beamten, Militärs sowie Diener und von Gruppen wie den Begünstigten der von Klöstern im Reich bezahlten Pensionen. Detailliert beraten wurden auch die Pensionsvereinbarungen jener, die Stellungen in den linksrheinischen Territorien verloren hatten, für die Frankreich jegliche Zuständigkeit zurückwies. Überdies gab es präzise Leitlinien »um so viele Gläubiger zu beruhigen«, für den Umgang mit den Schulden übertragener Territorien und für Verbindlichkeiten, die während des Kriegs bei den schwäbischen, fränkischen, kurrheinischen und oberrheinischen Kreisen aufgelaufen waren. 27 Soweit möglich, sollten die Rechte der ehemaligen Reichsstädte respektiert werden, vor allem, wo bestehende gottesdienstliche Rechte betroffen waren: Herrscher durften den konfessionellen Status quo in ihren neuen Territorien nicht antasten. Und schließlich bekräftigte der Reichsdeputationshauptschluss die religiösen Rechte der Bürger des Reichs, die durch einen Herrscherwechsel nicht berührt werden sollten.
Anmerkungen 1 2 3
Zitiert bei Aretin, Heiliges Römisches Reich I, 453. Kurze Überblicke bieten Stolleis, Öffentliches Recht II, 53–57; Grzeszick, Reich, 120–135; Walter, Zusammenbruch, 35–42; Gagliardo, Reich, 242–264. Gagliardo, Reich, 250 ff.; Grzeszick, Reich, 123; Borck, Reichskreis, 188 f.; Gagliardo und Grzeszick identifizieren den Autor als Karl von Soden (* 1783, † 1858); es ist jedoch un-
65. Der Friede von Lunéville (1801) und der Reichsdeputationshauptschluss (1803)
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18
19 20 21 22
23 24 25 26 27
wahrscheinlich, dass Graf Julius’ neunzehnjähriger Sohn, der später Vorsteher der bayerischen Forstwirtschaft wurde, sich schriftlich zu einem Thema äußerte, zu dem sein Vater ein landesweit anerkannter Experte war; vgl. Hanke, Bürger, 76; ADB XXXIV, 533. Grzeszick, Reich, 125. Ebd., 131; vgl. zu Gönner Gross, Empire, 465–475. Grzeszick, Reich, 133 ff. Stolleis, Öffentliches Recht II, 56. Pape, »Revolution«, 57 f., 79 f.; Walter, Zusammenbruch, 43 f.; Pöggeler, »Hegels Option«; Hegel, Political Writings, XII–XIV, 6, 98–101. Pape, »Revolution«, 76. Ebd., 78. Ebd., 62–74; ders., »Karlskult«, 150–161. Pape, »Revolution«, 74 ff. Kraus, Ende, 55. Bernstein, Balance, 58–63. Pape, »Karlskult«, 146 ff. Kittstein, Politik, 317; Mader, Priester, 133–137; vgl. zu der ähnlich zögerlichen Haltung von Waldeck Murk, Reichsterritorium, 139–158. Wo nicht anders vermerkt, beruht das Folgende auf Hufeld, Reichsdeputationshauptschluss (mit dem Protokoll im Volltext auf S. 69–119); Härter, »Umbruch«; ders., »Hauptschluss«; ders., Reichstag, 570–597; Gagliardo, Reich, 187–206; Klueting, »Zweihundert Jahre«. Erzherzog Karl von Österreich (* 1771, † 1847) war 1801–1804 Großmeister; ihm folgte Erzherzog Anton Viktor (* 1779, † 1835), der 1801 zum Kurfürsten von Köln und Fürstbischof von Münster gewählt worden war, aber keines der beiden Ämter antrat, da beide Territorien 1804 säkularisiert wurden. Härter, Reichstag, 584 f. Vgl. zu Russlands dynastischen Verbindungen im Reich Scharf, Katharina II., 272–332. Schroeder, Reich, 67–74. Der Großmeister des Deutschen Ordens war ein Habsburger, der Großmeister (Fürstprior) der deutschen Sektion des Malteserordens der schwäbische Reichsritter Balthasar Rinck von Baldenstein; vgl. Kurowski, Deutscher Orden, 326 f.; Wienand, Johanniter-Orden, 342 f. Rudolf, »Haus Oranien-Nassau«. Einen detaillierten Abriss der Verhandlungen bietet Schroeder, Reich, 434–439. Ebd., 427–433. Vgl. zur Entstehung und weiteren Geschichte der »Subdelegationskommission für das transrhenanische Sustentationswesen« Burgdorf, »Untergang«. Hufeld, Reichsdeputationshauptschluss, 115.
715
66. Die Transformation des Reichs (1803–1805)
V
iele der im Reichsdeputationshauptschluss niedergelegten territorialen Vereinbarungen führten zu neuen juristischen Disputen. Andere wurden nicht umgesetzt oder durch weitere territoriale Angleichungen zwischen 1805 und 1815 hinfällig. So wurden zum Beispiel von den 15 schwäbischen Reichsstädten bis 1810 zehn auf einen anderen Herrscher übertragen, Lindau sogar zweimal. Zahlreiche kleinere Territorien verschwanden bei weiteren Reorganisationen zwischen 1805 und 1815. 1 Die Hauptlinien des Abkommens blieben dennoch bestehen und hatten auf drei Ebenen grundlegende Auswirkungen. Erstens war die Reichskirche zerstört. Es gab zwar noch einen MetropolitanErzbischof und Primas von Deutschland, aber nicht viel mehr. Die deutsche katholische Kirche hatte ihre konstitutionelle Rolle im Reich verloren. Die meisten katholischen Universitäten wurden geschlossen, Tausende Klöster aufgelöst. Die Absetzung der Fürstbischöfe fegte auch die alten Diözesen hinweg. Der Reichsdeputationshauptschluss bewirkte für das Reich, was die Revolution in Frankreich bewirkt hatte. Während Napoleon 1801 ein Konkordat schloss, das auch die linksrheinischen Territorien umfasste, verhinderte der Bruch zwischen dem Papst und der deutschen Kirche ein neues Konkordat für das Reich. Das Bestreben von Bayern und Württemberg, eigene territoriale Konkordate zu schließen, durchkreuzte außerdem Dalbergs Bemühungen in dieser Richtung. Der Status der verbliebenen Bischöfe (1811 gab es nur noch neun, von denen einige im Exil lebten; Dalberg war mit einem Alter von siebenundsechzig Jahren der jüngste) war unklar. Neue diözesane Strukturen in allen deutschen Territorien bestanden erst wieder 1825. Ihrer politischen Funktionen, Ländereien und ihres Vermögens entledigt, verlor die deutsche Kirche zudem ihre dominierende Position im deutschen Gemeinwesen an den Protestantismus, wodurch der deutsche Katholizismus in der Folge rasch seinen Charakter veränderte. In diesem Sinn war der Reichsdeputationshauptschluss für die Kirche ebenso eine Chance wie in anderer Hinsicht eine Katastrophe. Während sich die adlige Elite zurückzog und von den im Reichsdeputationshauptschluss vereinbarten Pensionen lebte, traten nichtadlige Kleriker, die Rom im Allgemeinen näher standen und oft von missionarischem Eifer nach einer Erneuerung des Glaubens in Deutschland getrieben waren, an ihre Stelle. Viele dieser Impulse gingen auf die Neudefinition des Katholizismus in der Aufklärung zurück, die die Bedeutung der seelsorgerischen Praxis und angewandten Moraltheologie betonte. 2 Gleichzeitig wurde der deutsche Katholizismus einmal mehr
66. Die Transformation des Reichs (1803–1805)
durch das verstärkte Wiederaufleben der volkstümlichen Religiosität bereichert, die zu kontrollieren und unterdrücken sich viele in der Hierarchie während des 18. Jahrhunderts bemüht hatten. All das machte die neuen Führer der Kirche keineswegs den josephinischen Klerikalreformern ebenbürtig, die die religiösen Bereiche der deutschen Territorialregierungen dominiert hatten. Aber es ermöglichte die Herausbildung einer echten Volkskirche, die den sozialen und politischen Herausforderungen des 19. Jahrhunderts gewachsen war: Verstädterung und Industrialisierung, Umgang mit dem »weltlichen« Staat und Kulturkampf. Auf lokaler Ebene führte die von vielen Regierungen energisch umgesetzte radikale Säkularisierung zu großen Verlusten und signifikanter Zerstörung kultureller Strukturen. Die Säkularisierung des oberbayerischen Augustinerchorherrenklosters Rottenbuch ist ein typisches Beispiel. 3 Der Inspektor der kurfürstlichen Kunstgalerien ließ 31 Gemälde der Gotik und Renaissance, 9.213 Drucke und 345 Zeichnungen sowie einige wertvolle Bücher mit Drucken und Holzschnitten in die Münchner Sammlungen überführen, der Rest wurde verkauft oder einfach zerstört. Im Mai 1803 übernahm die von Johann Christoph von Aretin geleitete Bibliothekskommission 285 Manuskripte, 1.582 Inkunabeln und 6.545 Bücher für die Münchner Bibliothek, 1.264 Bände für die Universität Landshut und 1.152 Bücher für diverse Schulen. Ein Papierhändler kaufte den Rest für etwas mehr als 400 Gulden und transportierte ihn in acht Wagenladungen zur Weiterverwertung ab. Die klösterlichen Gebäude wurden an einen Schweizer Unternehmer verkauft, der behauptete, eine Fabrik errichten zu wollen, tatsächlich aber lediglich an den Baumaterialien interessiert war. Auch der Grundbesitz des Klosters wurde veräußert. Nur die Kirche blieb auf Anweisung des Kurfürsten erhalten und diente als neue Pfarrkirche. Selbst ein so herausragendes Denkmal wie die Wallfahrtskirche auf der Wies, die heute zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt, wurde zwar vor dem Verkauf und Abbruch bewahrt, allerdings nur wegen der wirtschaftlichen Bedeutung der Wallfahrt für eine gewerbearme Gegend und nicht wegen ihrer religiösen oder kulturellen Bedeutung. 4 Zweitens war die Übertragung von Territorien und die Säkularisierung von Kirchenbesitz für die kompensationsberechtigten weltlichen Territorien eine enorme Chance und Herausforderung. Die meisten hatten es eilig, sich ihren neuen Besitz anzueignen.Viele entsandten in den ersten Monaten des Jahres 1802 Truppen und Kommissionen, fast ein Jahr bevor der Reichsdeputationshauptschluss offiziell verkündet wurde. Schnelligkeit und Gründlichkeit waren von entscheidender Bedeutung. Niemand wusste, ob sich die politische Lage nicht ändern würde; eine Inbesitznahme stärkte zumindest die eigene Verhandlungsposition und ließ sich bestenfalls in dauerhaftes Eigentum umwandeln. Grenzmarkierungen mussten geändert, Gesetze im Namen der neuen Machthaber verkündet werden. Man legte Inventare von Besitztümern und Vermögen an und listete zu veräußern-
717
718
VI. · Krieg und Zerfall: Das Reich 1792–1806
des Vermögen auf. Die neuen Besitzer ehemaliger Reichsstädte beeilten sich, sämtliche Symbole des Reichs zu entfernen; der vergoldete Bronzeadler am Augsburger Rathaus wurde eingeschmolzen. 5 Wichtig war vor allem, so bald wie möglich Einkünfte von den neuen Untertanen zu erzielen. Häufig ähnelte die Übernahme einer gewalttätigen militärischen Invasion, manchmal im Schutz der Dunkelheit. Der neue Kurfürst von Württemberg ging bei seiner »Integrationspolitik« so brutal vor, dass manche ihn als »schwäbischen Sultan« und »schwäbischen Zar« bezeichneten; dieser Ruf begleitete ihn in den folgenden Jahren. 6 Aber Württemberg war nur ein Extremfall, auf Gewalt setzten auch andere und nahmen dabei, was sie kriegen konnten. Auch Österreich bediente sich bei der Rekonstruktion seiner süddeutschen Ländereien dubioser Praktiken. Da es den Breisgau an den Herzog von Modena abtreten musste, verlegte es seine Administration von Freiburg nach Günzburg nordöstlich von Ulm. 7 Dort versuchten die Habsburger aus verstreuten Fürstentümern durch den Erwerb der Ländereien diverser Reichsgrafen und durch Tausch ein zusammenhängendes Territorium zu schaffen. So erwarben sie etwa im April 1803 Lindau vom Fürsten von Bretzenheim im Austausch gegen die nordungarischen Fürstentümer Sárospatak und Regéc; auch der Graf von Königsegg-Rothefels stimmte einem Tausch seiner deutschen Ländereien gegen die ungarischen Fürstentümer Pruské und Illava zu. Bei der Erweiterung ihres Besitzes bedienten sich die Habsburger außerdem einer ziemlich dubiosen Auslegung des Reichsdeputationshauptschlusses auf Grundlage einer Vorbehaltsklausel im Pariser Vertrag zwischen Österreich und Frankreich vom 22. Dezember 1802. Darin wurde Franz II. beauftragt, den Entschädigungsprozess zu unterstützen, soweit dadurch nicht seine Rechte als Kaiser und Herrscher der Erblande beeinträchtigt wurden. Aus dieser Vereinbarung leiteten die Anwälte der Wiener Hofkammer das Prinzip des Droit d’épave (wörtlich: das Recht der Küstenbewohner, sich angeschwemmte Schiffswracks anzueignen) ab, unter dem sie Anspruch auf jeglichen Besitz der säkularisierten Territorien und Institutionen erhoben, der auf österreichischem Territorium lag. Das betraf Grund in substanziellem Ausmaß, investiertes Kapital und Einlagen in Wien selbst. Wie viel die Österreicher sich dadurch verschafften, ist nicht klar, sie bemühten sich jedoch 1804 und 1805 sehr um die Beanspruchung der betroffenen Vermögen. In der schwäbischen Region konnten sie ihr Territorium sicherlich vergrößern, sowohl durch direkte örtliche Zugewinne als auch durch den Tausch kirchlicher Güter anderswo gegen den Besitz schwäbischer Reichsritter und Reichsgrafen. Diese Politik brachte jedoch auch Probleme mit sich. Die neuen Besitzer der relevanten kirchlichen Ländereien und Stifte waren empört, als sie feststellten, dass sich die Österreicher Vermögen angeeignet hatten, mit dem sie die Schulden hätten begleichen können, die mit dem Besitz verbunden waren. 8
66. Die Transformation des Reichs (1803–1805)
1805 musste selbst der für das Unternehmen zuständige Beamte einräumen, dass die Anwendung dieses Prinzips das neue habsburgische Kurfürstentum Salzburg so gut wie ruiniert hatte; verärgert war auch der habsburgische Herzog von Modena im Breisgau, ein entfernter Verwandter des Kaisers. 9 Die Beziehungen zu Bayern erreichten wegen dieses Vorgehens, das besonders die Bayern als versuchten Diebstahl betrachteten, einen kritischen Punkt. Dass Österreich gegenüber weniger bedeutenden Territorien, deren Herrscher es als seine Klientel und zukünftige Verbündete sah, milder vorging, machte die Entrüstung in München nur noch größer. Kurzfristig mussten Bayern und die anderen einsehen, dass die Vorteile, die sie aus der Situation ziehen konnten, begrenzt waren. Ab 1802 versuchten Bayern, Württemberg und Kassel die Territorien der Reichsritter zu übernehmen – was dem Reichsdeputationshauptschluss zuwiderlief, der ihre fortdauernde Unabhängigkeit ausdrücklich garantierte. Wie die Klöster wurden die Ritter Ziel wohlüberlegter Militäroperationen, wobei die bruchstückhaften Grenzen in manchen Gegenden für beträchtliche Verwirrung sorgten. Ende 1803 marschierten die Streitkräfte von nicht weniger als vier benachbarten Herrschern (Leiningen, Baden, Hessen-Darmstadt und Bayern) in die Ländereien des Freiherrn von Massenbach ein und beanspruchten die Oberherrschaft; im Mai 1807 fielen die Gebiete schließlich an Württemberg. 10 Ein Sturm von Protest und Appellen an den Reichshofrat nötigte Franz II. im Januar 1804 zum Erlass eines Dekrets, das die Rückgabe aller illegal eroberten Territorien anordnete; Österreich, Mainz, Sachsen und Baden wurden ermächtigt, es durchzusetzen. Die Drohung mit Gewalt wirkte, da Frankreich mit dem erneuten Konflikt mit Großbritannien im Ärmelkanal beschäftigt war; einige Ländereien blieben indes dennoch besetzt. Auch hier war Wiens Politik ambivalent. Österreich selbst hatte erwogen, Territorien von Reichsrittern zu übernehmen, um ein zusammenhängendes schwäbisches Territorium um Günzburg zu schaffen. Dass er den Rittern im Januar 1804 beistand, schien zu zeigen, dass der Kaiser wieder für die Reichsverfassung eintrat und zugleich eine Gruppe imperialer Klienten unterstützte, die 5,7 Millionen Gulden zu Österreichs Kriegskosten beigetragen hatte. Andererseits diente dies zwei weniger ehrenvollen Zielen. Erstens war es eine nützliche Gelegenheit, die Konsolidierung von Bayern und Württemberg zu blockieren. Zweitens kalkulierten die Minister des Kaisers, es sei nur eine Frage der Zeit, dass die Ritter ihre Unabhängigkeit sowieso verlieren würden, und wenn Franz jetzt einschritt, um jene zu vertreiben, die sieben Achtel der Gebiete der schwäbischen Ritter erobert hatten, werde Österreich bei einer endgültigen Verteilung letztlich mehr Land zufallen. So gut wie alle Empfängerterritorien übernahmen nicht nur Vermögen, sondern auch die substanziellen Schulden der jeweiligen Länder und Städte. Für man-
719
720
VI. · Krieg und Zerfall: Das Reich 1792–1806
che Administrationen war dies die erste Erfahrung einer Konsolidierung und des Umgangs mit »nationalen« Schulden. Manche bekamen es auch erstmals mit einer signifikanten Anzahl von Untertanen unterschiedlichen Glaubens zu tun und mussten ihre Gesetzgebung und Verwaltung entsprechend anpassen. Bayern etwa übernahm eine große protestantische Bevölkerung in Franken; Baden und HessenDarmstadt, beide protestantisch, waren nun mehrheitlich katholisch. Die Zerstörung der katholischen Universitäten machte neue Hochschulen dringend nötig. Für diese Aufgaben brauchte man eine Masse von Experten und Ministern, die in den gut zehn Jahren nach dem Reichsdeputationshauptschluss eine außerordentliche Welle von Reformen in den deutschen Territorien umsetzten. Die Reformbewegung wird oft als Neubeginn dargestellt, bei dem zu guter Letzt die Territorien modernisiert wurden, die sich als Gewinner der Reorganisation herausstellten, und die Fundamente für das deutsche Staatssystems des 19. Jahrhunderts gelegt wurde. 11 Betrachtet man Bayern, Baden und Württemberg sowie die preußischen Reformen nach 1806, mag das so erscheinen. In Württemberg zum Beispiel löste Friedrich II. (1797–1816, ab 1803 als Kurfürst, ab 1806 als König Friedrich I.) die Stände seiner ursprünglichen herzoglichen Lande 1805 auf und integrierte nach anfänglicher Trennung der alten und neuen Gebiete durch eine Zollgrenze und andere Maßnahmen beide 1808 in eine neue, einheitliche administrative Struktur. Das neoabsolutistische Regime des Königs von Württemberg modernisierte den Staat auch mit anderen Maßnahmen. Friedrich ordnete ein strenges Durchgreifen gegen Pietisten und sämtliche anderen Einzelnen und Gruppen an, die er für abergläubisch und potenziell aufwieglerisch hielt, etwa Magnetisten und Mesmeristen. Im März 1815 versuchte er sogar eine neue Verfassung einzuführen, unter Vorwegnahme der Bedingung des Deutschen Bundes, alle Mitgliedsstaaten müssten eine landständische Territorialverfassung haben. 12 Dies stieß jedoch auf Widerstand der alten Stände, die ihre traditionellen Rechte und Privilegien durch Friedrichs Pläne bedroht sahen. Es blieb Friedrichs Nachfolger, dem populäreren und liberalen König Wilhelm I. (1816–1864), überlassen, die repräsentative Verfassung auszuhandeln, die schließlich 1819 eingeführt wurde. Friedrich von Württemberg war ein Extremfall. Der Graf von Waldburg-Zeil erklärte, er wolle »lieber Sauhirt in der Türkei als Standesherr in Württemberg« sein. 13 Aber die Rücksichtslosigkeit von Friedrichs Vorgehen spiegelt auch die Unsicherheit der Zeit und seine Entschlossenheit wider, die Gelegenheit beim Schopf zu greifen und seine Zugewinne für die Zukunft zu sichern. Vor allem waren seine Reformen der Zeit nach 1803 auch eine Fortsetzung der Reformen des 18. Jahrhunderts, wenngleich beschleunigt, intensiviert und geprägt vom Vorbild der napoleonischen Reformen. In gewissem Sinn bildeten die ganze Säkularisierung und die territorialen Veränderungen, die sie begleiteten, den Gipfel eines Pro-
66. Die Transformation des Reichs (1803–1805)
zesses territorialer Reformen und Entwicklungen, der mit der Reformation begonnen hatte. Es ist schwer zu sagen, ob diese Veränderungen für sich den Weiterbestand des Reichs unmöglich machten. Die Konsolidierung einer kleinen Anzahl größerer Territorien stärkte unausweichlich deren Wunsch nach Freiheit von Eingriffen von außen. Das deutete auf die Entwicklung des Reichs zu einem Föderalsystem ohne sinnvolle Rolle für den Kaiser als der eines Aushängeschilds hin. Andererseits wurde die Signifikanz dieser Entwicklung erst rückblickend aus der Perspektive von 1815 und danach wirklich klar. 1803/04 blieben zahlreiche kleinere Territorien bestehen. In dieser Phase standen die größeren zweitrangigen Territorien wie Bayern, Baden, Württemberg und Hessen-Darmstadt erst am Beginn ihrer Konsolidierung und Selbstbehauptung. Die kaiserliche Autorität störte sie zwar, sie hatten aber keine Sehnsucht, das Reich zu verlassen oder es zerstört zu sehen. Die bayerische Identität war durch den patriotischen Widerstand gegen die diversen Tauschprojekte und die Thronfolge zweier auswärtiger Dynastien (der pfälzischen Wittelsbacher 1779 und deren Zweibrücker Verwandten 1799) gestärkt. Die nun von Graf Maximilian Montgelas (* 1759, † 1838) eingeleiteten Reformen brachten Bayern auf einen Kurs, der es zu einer fast überzeugenden zweitrangigen europäischen Macht machen sollte. Die anderen mittleren Territorien blieben im Grunde große deutsche Territorien, die ohne das Reich oder etwas Vergleichbares wenig Zukunftsaussichten hatten. Selbst Bayerns souveräne Ambitionen wurden indes erst nach der erneuten Niederlage Österreichs 1805 und der Niederlage Preußens 1806 deutlicher und im Entferntesten plausibel. Die Entwicklungen des 19. Jahrhunderts waren 1803/04 noch alles andere als abgesteckt. Die Offenheit der Situation 1803/04 unterstreicht die Bedeutung der dritten Ebene, auf der der Reichsdeputationshauptschluss einen neuen Rahmen schuf: des Reichs und seiner Institutionen. Während der Reichsdeputationshauptschluss eine umfassende Zusammenstellung territorialer Vereinbarungen umfasste, blieben Schlüsselprobleme ungelöst. Die neuen territorialen Vereinbarungen mussten im Reichstag in funktionierende Strukturen umgesetzt, die Kreise rekonstruiert, die finanzielle und personelle Organisation am Reichskammergericht angepasst werden. Die Hauptfrage war, ob das Reich überhaupt weiterhin funktionieren konnte. Die neue Dotierung des Mainzer Erzbischofs war sicherlich dazu gedacht, dies zu ermöglichen. Er hatte Regensburg und Wetzlar erhalten, womit garantiert war, dass beide Städte strikt neutral blieben. Das stellte sicher, dass Reichstag und Reichskammergericht bestehen bleiben konnten, und machte Dalberg Hoffnung, seine Schlüsselrolle im Reich als Reichserzkanzler weiterhin ausüben zu können. Aber Reformen fielen nun nicht leichter als in der Vergangenheit. Die obstruktive Haltung der Fürsten, besonders jener, die gerade große territoriale Zugewinne gemacht und sich Kurwürden gesichert hatten, durchkreuzte jeden Versuch, die
721
722
VI. · Krieg und Zerfall: Das Reich 1792–1806
Kreise neu zu organisieren und ein neues Durchsetzungssystem für die Gesetzgebung des Reichstags und Urteile der Reichsgerichte zu errichten. Das Reichskammergericht litt unter gekürzten Zahlungen und musste nach dem Verlust der linksrheinischen Gebiete an Frankreich auf vier beisitzende Richter verzichten. Aber zumindest arbeitete das Gericht weiter und es gibt Belege dafür, dass seine Beamten in diesen Jahren ein neues Gefühl ihrer Bedeutung als Diener des Reichs entwickelten. 14 Die Situation im Reichstag wurde verkompliziert durch die Implikationen des Reichsdeputationshauptschlusses für die politische Stellung des Kaisers, vor allem indem er eine klare protestantische Mehrheit schuf. Die Rekonstitution der Kollegien der Kurfürsten und Städte verlief relativ geradlinig. Es gab nun zehn Kurfürsten, von denen nur vier katholisch waren. Manche spekulierten, dies könne das Ende des Anspruchs der Habsburger auf die Kaiserkrone bedeuten, aber das war alles andere als sicher. Schließlich war Österreichs Position gestärkt, da es nun zwei Stimmen hielt (Salzburg und Böhmen). Zudem wurde das neue konfessionelle Ungleichgewicht durch Spannungen und gegenseitigen Argwohn unter den Protestanten und durch allgemeine Rivalitäten unter den acht nichthabsburgischen Kurfürsten abgemildert. Es war höchst unwahrscheinlich, dass Hannover oder Sachsen je für einen preußischen Kaiser stimmte; die ehedem dominanten »alten« Kurfürsten im Norden (Preußen, Sachsen und Hannover) mussten mit den Ambitionen der neuerdings gestärkten süd- und mitteldeutschen Kurfürsten fertigwerden. Tatsächlich rechneten österreichische Beamte damit, dass Österreich teilen und herrschen konnte. 15 Das konfessionelle Ungleichgewicht spielte für die sechs verbliebenen Reichsstädte überhaupt keine Rolle, von denen lediglich Augsburg wenigstens halb katholisch war. Im August 1803, nach der Einführung der neuen Kurfürsten, hatten sich Kurfürsten und Städte neu konstituiert. Als problematischer erwies sich das Fürstenkollegium. 16 Hier wandelten der Verlust der linksrheinischen Gebiete und die Säkularisation eine katholische Mehrheit von 53 zu 45 Stimmen in eine protestantische von 53 zu 29. Zudem kontrollierten die Kurfürsten 45 der 82 verbleibenden Stimmen, während der Kaiser nur auf 20 bis 22 katholische Stimmen vertrauen konnte. Der Reichsdeputationshauptschluss sah vor, die Stimmrechte der ehemaligen Kirchenterritorien auf ihre neuen, oft protestantischen Herrscher zu übertragen und für andere neue Stimmrechte zu schaffen, aber selbst dann wäre es bei einer protestantischen Mehrheit von 78 zu 53 geblieben. Zudem hätten die Kurfürsten 78 von 131 Stimmen kontrolliert und der Kaiser hätte sich nach wie vor nur auf ungefähr 40 Stimmen verlassen können, da sich Bayern mit seinen 12 Stimmen immer gern der protestantischen Opposition anschließen würde. Obwohl die konfessionellen Spannungen früherer Zeiten nun abgeebbt waren, brachte dies den Kaiser in eine nie dagewesene Position der Schwäche. Den Reichstag über die Stimmen seiner katholischen Klienten zu be-
66. Die Transformation des Reichs (1803–1805)
herrschen, war nun nicht mehr möglich. Zudem war die neue Situation in rein repräsentativer Hinsicht ungerecht: Die Bevölkerung des Reichs war Ende des 18. Jahrhunderts zu 58 Prozent katholisch und nur zu 41 Prozent protestantisch (plus ein Prozent Juden, Zigeuner und andere). 17 Wiens Vorschläge zur Bereinigung dieser Situation durch Streichung der Stimmen der ehemals kirchlichen Territorien oder Schaffung neuer katholischer Stimmrechte scheiterten. Die Kurfürsten und Fürsten waren nicht gewillt, ihre Stimmrechte, die sie als mit den neuen Gebieten rechtmäßig erworben betrachteten, aufzugeben. Es gab schlichtweg nicht genug katholische Herrscher mit Territorien, aus denen sich plausible Fürstentümer machen ließen, und Einzelne ohne Land als »Personalisten« zu erheben, wie das im 16. Jahrhundert geschehen war, war nun nicht mehr akzeptabel. Folgerichtig weigerte sich der Kaiser ganz einfach, diesen Teil des Reichsdeputationshauptschlusses zu ratifizieren. Die Diskussion kam im April 1804 zum Stillstand, als der französische Botschafter im Namen Napoleons erklärte, es solle nichts unternommen werden, bevor Frankreich einen Kompromissvorschlag unterbreitete. Daraufhin waren die einzigen Maßnahmen, die Franz II. im Reichstag gestattete, die Vereinbarung der Kurfürsten zur Festlegung des präzisen Verlaufs der Zollgrenze am Rhein und die Beilegung einiger kleinerer territorialer Streitigkeiten, unter dem Vorbehalt, dass jede endgültige Einigung von der Ratifikation durch ein ordnungsgemäß rekonstituiertes Fürstenkollegium abhing. 18 Die Kontroverse spiegelte grundlegende Differenzen wider. Der Kaiser sah das Reich immer noch unter dem Blickwinkel des traditionellen hierarchischen Systems, in dem er sich auf die Loyalität einer substanziellen Anzahl von Klienten aus den kleineren Territorien verlassen konnte. Die Kurfürsten und Fürsten sahen es zunehmend unter dem Blickwinkel eines eher föderalen Systems und wollten weder die Autorität eines Kaisers noch den gleichwertigen Status minderer Fürsten und Assoziationen von Reichsrittern mit Kollektivstimmrechten akzeptieren. Adam Christian Gaspari stellte in seinem Kommentar zum französisch-russischen Entschädigungsplan ganz richtig fest: Die weltlichen Fürsten »sind durch diese Revolution viel mächtiger, sowohl an Stimmen auf dem Reichstage als an Kräften im Felde« geworden: »Es wird also dem Kaiser unmöglich seyn, irgend Etwas durchzusetzen; es wird selbst die Verweigerung seiner Ratificationen nur dazu dienen, den Verfall seines Ansehens noch deutlicher zu zeigen, ohne die Beschlüsse der Majorum aufhalten können, und das teutsche Reich sich noch mehr, als bisher, einem Föderal-System nähern.« 19 In seiner 1797 erschienenen Schrift Deutschland und Polen, 1802 auszugsweise in Häberlins Staats-Archiv nachgedruckt, warnte Johann Reitemeier, Deutschland werde, »wofern nicht außerordentliche Mittel zur Rettung desselben angewendet werden, … einer Artischocke gleich, allmählig Blatt für Blatt aufgezehrt« und zer-
723
724
VI. · Krieg und Zerfall: Das Reich 1792–1806
rissen, wenn nicht »durch Koncentrirung der Kräfte der einzelnen deutschen Staaten eine einzige Macht« geschaffen werde. Reitemeier glaubte nicht an eine unmittelbare Gefahr; es werde nicht zum sofortigen Kollaps wie in Polen kommen, sondern zu einem langsamen Untergang über hundert oder mehr Jahre. Zwei Jahre darauf kam ein anderer Autor zu einem anderen Schluss. Das Reich, meinte er, sei nur noch »eine interimistische Scheidewand zwischen Russen und Franken [das heißt Franzosen] in Europa«, eine »Null zum Auslande, im Innern eine ächte Societas leonina«; seine Regierungsform sei »eine putrescirende Wahlmonarchie, die von der reichsständischen Souverainitäts-Essenz verzehrt wird«, das Reichsoberhaupt »dem Namen nach der Kaiser, aber der That nach die jetzige Stimmenmehrheit auf dem Reichstage unter dem Schutze von Frankreich, also Frankreich«. 20 Die Wünsche beider Autoren gingen in Richtung einer föderalen Lösung und beide warfen implizit dem Kaiser vor, eine Modernisierung des Reichs zu blockieren. Ihre Appelle und die vieler anderer werfen die Frage auf, ob eine Reform des Systems in dieser Phase tatsächlich noch möglich war und ob Franz II. sie ermöglichen hätte können. Die Mehrheit der Kurfürsten und Fürsten war mehr mit inneren Belangen beschäftigt als mit der zukünftigen Gestalt des Reichs. Viele gaben ihren Gesandten im Reichstag nun keine neuen Instruktionen mehr und versäumten es, ausscheidende Abgeordnete zu ersetzen. Im August 1806 waren nur noch sechzehn Abgeordnete übrig, die sechsunddreißig Fürsten vertraten. 21 Andere Perspektiven schienen wichtiger. In Preußen schmiedete Hardenberg Pläne für eine föderale Reform des Reichs, die den Reichstag überflüssig machen sollte. Vorläufig jedoch nahm Friedrich Wilhelm III., der vor allem an der Bewahrung seiner Neutralität und guten Beziehungen zu Frankreich interessiert war, sie nicht ernst. 22 Die anderen Kurfürsten hatten damit zu tun, ihre neuen Ländereien zu sichern und zu integrieren. Zudem waren auch sie beständig um ihr Verhältnis zu Frankreich besorgt, dem eigentlichen Lenker der Politik im Reich. Unter diesen Umständen ist schwer zu erkennen, was eine starke österreichische Führung hätte ausrichten können. Einerseits fanden sich Franz II. und seine Minister in der gleichen Situation wie viele ihrer Vorgänger in den vergangenen Jahrhunderten. Sie mussten die Interessen der Dynastie ebenso wahren wie die Rechte der Krone. Der Versuch, ein schwäbisches Territorium um Günzburg zu errichten, brachte sie in Konflikt mit Bayern und Württemberg, aber die habsburgische Stellung als Kaiser hatte immer auf einem Territorium im traditionellen Kern des Reichs beruht. 23 Effektive kaiserliche Herrschaft hing auch von einer vernünftigen finanziellen Basis ab: Der Krieg hatte die Monarchie praktisch ruiniert und ihr Geldquellen wie die Reichsstädte und Reichsabteien im südlichen katholischen Reich entzogen; daher wurde die Beschlagnahmung von säkularisiertem Besitz unter dem Droit
66. Die Transformation des Reichs (1803–1805)
d’epave als unverzichtbar betrachtet. 24 Wenn die Reichsritter und Grafen sowieso von größeren Territorien aufgesaugt würden, erschien es sinnvoll, dass Österreich davon ebenso profitierte wie andere Herrscher. Wenn Franz jedoch ein glaubwürdiger Kaiser werden wollte, brauchte er unbedingt einen Reichstag, in dem er zumindest eine Chance hatte, die Politik zu formen. Ansonsten waren auch das Reichskammergericht und noch mehr der Reichshofrat zwecklos – oberste Gerichtshöfe mit Autorität über die Fürsten, die Urteile sprachen, deren Durchsetzung der Kaiser überwachte. Der Streit über die Reichstagsstimmen der Fürsten spiegelte eine Spannung wider, die seit dem 15. Jahrhundert und in zunehmend akuter Form seit 1648 bestand. Keine Seite konnte einfach so nachgeben; eine schnelle Lösung war unwahrscheinlich. Wie in zurückliegenden Krisen des 18. Jahrhunderts gab es Diskussionen darüber, wie viel die Kaiserkrone Österreich bedeutete und unter welchen Umständen man sie abtreten könnte. 25 Wenn ansonsten alles gleich blieb, war die Entscheidung klar, die Krone zu behalten. Wenn dies jedoch unmöglich würde, musste man den bestmöglichen Ausweg finden; vor allem mussten die österreichischen Lande, ohne die die Dynastie nichts war, erhalten bleiben. Und nicht zuletzt wurde Franz II. wie alle anderen deutschen Herrscher seiner Zeit beständig von dem Schreckgespenst Napoleon heimgesucht. 1804 wurde diese Bedrohung klarer als je zuvor. Im Norden und im Süden unterstrichen französische Operationen die Machtlosigkeit des Reichs und seiner Herrscher. Im Mai 1803 waren französische Truppen in Hannover einmarschiert, hatten damit die Neutralitätszone verletzt und eine Reihe von Übergriffen eingeleitet, die in der Entführung des britischen Gesandten in Hamburg im Oktober 1804 gipfelte. Alle preußischen Hoffnungen, etwas vom Reich zu bewahren, waren damit als reines Wunschdenken entlarvt. 26 Am 15. März 1804 verschleppten französische Soldaten auf deutschem Boden den Duc d’Enghien (* 1772, † 1804), den Sohn des letzten Prinzen von Condé, in Ettenheim in Baden, unterzogen ihn einem Schauprozess und richteten ihn am 21. März in Vincennes hin. In Deutschland sorgte dies für Empörung und Russland wie Schweden forderten als Garantiemächte, dass das Reich offiziell protestierte. Franz II. weigerte sich jedoch und wurde weithin für die Demütigung des Reichs verantwortlich gemacht. 27 Aus Wiens Sicht wurden die Ereignisse in Deutschland überschattet von Napoleons auch durch Enghiens angebliche royalistische Verschwörung motivierte Ankündigung vom 12. Mai, er wolle den Titel eines französischen Erbkaisers annehmen. Franz blieb keine andere Wahl, als den Reichstag anzuweisen, den Titel anzuerkennen, und pompös zu verkünden, er betrachte diesen Akt als »Vollendung der von den koaliserten Mächten fruchtlos versuchten und dem bisherigen ersten Consul glücklich unternommenen Unterdrückung der Ruhe störenden anarchischen und Religions widrigen Revolutions Grundsätze …«. 28
725
726
VI. · Krieg und Zerfall: Das Reich 1792–1806
Lindernde Worte im Angesicht von Vorgängen, auf die Franz keinen Einfluss hatte, kaschierten für eine Weile eine andere, schlauere Reaktion Wiens auf Napoleons Zusicherung, er werde den Titel nicht führen, ehe ihn sowohl der Reichstag als auch der heilig-römische Kaiser anerkannt hätten. Am 11. August verkündete Franz, er werde fortan selbst den Titel eines Erbkaisers von Österreich führen. Gemäß dem imperialen Recht war der neue österreichische Titel selbstverständlich illegal: Der Kaiser genoss ebenso wenig volle Souveränität über seine Länder im Reich wie der König von Preußen oder irgendein anderer Reichsstand. Die Sorge über Napoleons wahre Ziele überwog jedoch solche Bedenken. Dass Napoleon einen kaiserlichen und keinen königlichen Titel erwählt hatte, schien einmal mehr zu bestätigen, dass er sich als der neue Karl der Große ansah, der Italien ebenso wie Deutschland und die Niederlande beherrschen und die Habsburger ihrer traditionellen Stellung in sämtlichen Gebieten berauben wollte. Denkbar war zudem, dass Napoleon erklärte, sein Erbtitel sei allen lediglich wählbaren Kronen übergeordnet; er mochte die deutsche Krone entweder selbst an sich reißen oder sie einem der nachgiebigeren Kurfürsten übergeben; die Habsburger stünden dann ganz ohne Kaiserkrone da und müssten zusehen, wie es Großbritannien, Spanien und andere Frankreich nachtaten. 29 So schienen die Habsburger verpflichtet, die Gelegenheit beim Schopf zu ergreifen und ihren eigenen erblichen Kaisertitel zu schaffen. Das Wappen war ein Durcheinander (der deutsche Reichsadler wickelt den österreichischen Adler ein), der Titel ein Kuddelmuddel (»Seine Römisch- und Oesterreichisch-Kaiserlich-, auch Königlich-Apostolische Majestät, Franz II. und I.«); die juwelenbesetzte Krone Rudolfs II. wurde neben der deutschen Kaiserkrone aus dem 11. Jahrhundert zur österreichischen Kaiserkrone erklärt. 30 Aber Napoleon hatte sich am 7. August einverstanden erklärt, und so geschah es. Russland und Großbritannien erkannten den neuen österreichischen Kaisertitel einige Monate lang nicht an. Gustav IV. von Schweden, Fürst und einer der Garanten des Reichs, forderte, dass der Reichstag protestiere, aber letztlich sagte der Reichstag lediglich zu, den neuen Titel zu vermerken. Der König von Preußen und andere deutsche Fürsten erkannten ihn mit unterschiedlichem Wohlwollen an. Manche Kommentatoren waren entschieden kritisch und stellten fest, das bedeute, dass sich die Habsburger endgültig vom Reich abgewandt hätten. Aber wieder einmal waren die Dinge nicht so eindeutig und klar. Das parallele Bestehen einer deutschen und einer österreichischen Kaiserkrone mochte in der Zukunft für Probleme sorgen. Zwischen 1804 und 1806 war das nicht der Fall und der neue österreichische Kaisertitel verhinderte nicht, dass bis 1806 weiter über die Reform des Reichs und in den Jahren danach über die Rolle Österreichs in Deutschland nachgedacht wurde. Kurzfristig überschattete die Eskalation des dritten Koalitionskriegs die Frage
66. Die Transformation des Reichs (1803–1805)
nach Österreichs wahren Absichten und das ganze Problem der Zukunft des Reichs. 31 Nach einer Reihe von beängstigenden Vorstößen Napoleons flammte im Mai 1803 der Konflikt zwischen Großbritannien und Frankreich wieder auf. Napoleons Eingriffe in die Belange der niederländischen Batavischen Republik seit 1801 gipfelten im Mai 1805 in der Installation von Rutger Jan Schimmelpenninck (* 1761, † 1825) als Ratspensionär. Sein Umgang mit Spanien, seit seiner Niederlage 1795 ein Klientelstaat, war ebenso harsch. 1802 hatte er in der schweizerischen Helvetischen Republik interveniert, das Wallis annektiert, eine neue Schweizer Konföderation gegründet und ihr ein fünfzigjähriges Defensivbündnis mit Frankreich aufgezwungen. Bekannt war auch, dass Napoleon Pläne für eine Hegemonie in Italien hegte, die tatsächlich in seiner Selbstkrönung zum König von Italien in Mailand im Mai 1805 gipfelten. Wiederholte französische Eingriffe im Reich und insbesondere die Entführung des Duc d’Enghien schienen Teil desselben Musters unerbittlicher Aggression und eines unstillbaren Hungers nach Vorherrschaft zu sein. Großbritannien, das weitere napoleonische Vorstöße im östlichen Mittelmeerraum und eine Bedrohung seiner Position in Indien fürchtete, zog in den Krieg zur Verteidigung von Malta, seiner einzigen verbliebenen Mittelmeerstellung außer Gibraltar. Diese Entwicklungen alarmierten auch Alexander I., der über den Umgang mit den Schweizern, das Schicksal des Duc d’Enghien und Napoleons Annahme eines Kaisertitels empört und wegen der französischen Vorhaben in Italien und dem Mittelmeerraum in tiefer Sorge war. 32 Nur Gustav IV. von Schweden, im Reich Herrscher von Westpommern und Rügen, schloss sich unverzüglich der am 11. April 1805 begründeten britisch-russischen Allianz an. Preußen machte Ausflüchte. Friedrich Wilhelm III. hielt nervös an seinem 1795 beschlossenen neutralen Kurs fest und konnte sich nicht entscheiden zwischen französischen Avancen inklusive des Angebots einer norddeutschen Kaiserkrone sowie einer eventuellen Aneignung von Hannover und andererseits einem Bündnis mit den antinapoleonischen Kräften. Auch Österreich zögerte bis August 1805. Zwar alarmiert durch die Vorgänge im Reich, den Niederlanden, der Schweiz, Italien und dem Mittelmeerraum, waren sich Franz II. und seine Minister doch sehr bewusst, wie schwach Österreich militärisch und finanziell dastand, was sich jetzt deutlicher als je zuvor an Nahrungsmittelknappheit zeigte, die im Juli 1805 Unruhen in Wien auslöste. Manche in Wien warben leidenschaftlich dafür, Napoleon nachzugeben und sich die Macht in Italien lieber zu teilen als zu versuchen, die österreichische Hegemonie wiederherzustellen; selbst Erzherzog Karl, der erfolgreichste österreichische Militärbefehlshaber, war ein entschiedener Verfechter des Friedens. Als Architekt der laufenden Militärreform wusste er nur zu genau, dass Österreich Zeit brauchte, um sich zu erholen. Eine Erhöhung der britischen Subventionen an Österreich
727
728
VI. · Krieg und Zerfall: Das Reich 1792–1806
gab schließlich den Ausschlag zum Beitritt zur Koalition. Als entscheidend erwies sich jedoch, dass es Napoleon gelang, Österreich von seinen Ressourcen in Süddeutschland abzuschneiden. Ende August schloss Bayern ein Bündnis mit Frankreich. Baden und Württemberg folgten im September beziehungsweise Oktober. Schnell wurde klar, dass Österreich für einen Krieg nicht bereit und seine Taktik ungeeignet war. Während sich die britische Flotte bei Trafalgar am 21. Oktober entscheidend gegen die französische durchsetzte, wurde der Landkrieg zur Katastrophe für Russland und vor allem für Österreich. Die Kämpfe begannen, bevor die zugesagte russische Unterstützung eingetroffen war, und der Hauptteil der österreichischen Armee unter Erzherzog Karl wandte sich nach Italien, wo man eine entscheidende Schlacht erwartete. Der Einzug österreichischer Truppen in Bayern am 8. September provozierte einen schnellen französischen Vorstoß; am 14. Oktober wurden die Österreicher bei Ulm geschlagen. Zehn Tage später erreichte Napoleon München, wo man ihn als Befreier eines unterdrückten Volks feierte; am 13. November hielt er triumphalen Einzug in Wien, das die Österreicher so gut wie ohne Verteidigung zurückgelassen hatten. Anstatt in Italien zuzuschlagen, wie es die Österreicher erwarteten, wandte sich Napoleon dann nach Norden gegen die österreichischen und russischen Streitkräfte in Mähren. Sein entscheidender Sieg bei Austerlitz (Slavkov) nahe Brünn (Brno) am 2. Dezember beendete den Krieg. Russland zog sich zurück und Österreich musste die Bedingungen akzeptieren, die Napoleon diktierte. Im Frieden von Pressburg vom 26. Dezember 1805 wurde Österreich aus Italien ausgeschlossen und musste Napoleon als italienischen König anerkennen; seine süddeutschen Länder wurden zwischen Baden, Württemberg und Bayern aufgeteilt; Bayern erhielt zudem Eichstätt von Salzburg sowie Vorarlberg, Tirol und die Reichsstadt Augsburg. Im Gegenzug fielen Salzburg und Berchtesgaden an Österreich. Großherzog Ferdinand von Salzburg wurde (immer noch als Kurfürst) in das neue, von Bayern abgetretene Herzogtum Würzburg versetzt. Die Großmeisterschaft des Deutschen Ordens sowie dessen Besitz und Einkünfte wurden für einen habsburgischen Erzherzog reserviert, den der Kaiser auswählen sollte. 33 Der Herzog von Modena hingegen verlor den Breisgau an Baden und Württemberg, und Napoleons Versprechen einer Entschädigung wurde nie eingehalten. 34 Vor allem wurden Bayern und Württemberg zu souveränen Königreichen erklärt. Zudem garantierte Frankreich, dass die Herrscher von Bayern, Württemberg und Baden fortan die gleiche »plénitude de la souverainité et de tous les droits qui en dérivent« (Fülle an Souveränität und sämtliche daraus folgenden Rechte) wie der Kaiser und der König von Preußen genossen (Art. 14). Sie würden jedoch weiterhin der »Confédération Germanique« angehören (Art. 7). 35 Gleichzeitig war es Napoleon gelungen, das preußische Problem zu lösen. Trotz des Drucks aus Russland hatte sich Friedrich Wilhelm III. der Koalition nicht an-
66. Die Transformation des Reichs (1803–1805)
geschlossen, selbst als er erfuhr, dass französische Truppen unter Graf Bernadotte die Grenze seines Territoriums in Ansbach verletzt hatten. 36 Statt Frankreich anzugreifen, beorderte er ganz einfach die zur Verteidigung seiner Länder mobilisierten Truppen, Hannover zu erobern, das die Franzosen so gut wie geräumt hatten. Dann wiederum versuchte er den britischen Zorn zu beschwichtigen, indem er am 2. November in Potsdam ein Abkommen mit Russland schloss, das festlegte, Preußen solle als bewaffneter Vermittler zwischen Frankreich auf der einen und Russland und Österreich auf der anderen Seite wirken. Napoleons Sieg bei Austerlitz untergrub alle preußischen Hoffnungen auf eine Vermittlerrolle; isoliert und Großbritannien ausgeliefert, hatte es keine andere Wahl, als am 15. Dezember den Vertrag von Schönbrunn zu unterzeichnen. Im Gegenzug für den Anspruch auf Hannover musste Preußen Ansbach an Bayern und Neuchâtel an Frankreich abtreten. Napoleon übernahm zudem das Herzogtum Kleve von Preußen, ebenso wie das Herzogtum Berg von Pfalz-Bayern (im Tausch gegen Ansbach), das einem Fürsten seiner Wahl übergeben wurde (seinem Schwager Joachim Murat). So gewann Preußen zwar zumindest Hannover, was jedoch Preußens Isolation vertiefte, weil es seine europäischen und deutschen Nachbarn erzürnte. Viele Zeitgenossen hielten Austerlitz für einen Wendepunkt von welthistorischer Tragweite. Friedrich von Gentz meinte, es sei das wichtigste Ereignis seit 1789 und stehe für Europas Abstieg in Gesetzlosigkeit und Barbarei, weil der Vertrag von Schönbrunn im Gegensatz zu Napoleons früheren Friedensabkommen von Campo Formio, Lunéville und Amiens nicht die übliche Klausel enthielt, die alle vorangegangenen Verträge bekräftigte. Metternich glaubte, 1805 vollende, was 1789 begonnen habe: »Die Welt ist verloren«, schrieb er, »Europa brennt nun ab, und aus der Asche erst wird eine neue Ordnung der Dinge entstehen.« 37 Mit Sicherheit verwandelte Napoleon sich mit den Verträgen von Dezember 1805 endgültig vom Garanten des Reichs zum Lenker seines Schicksals. Was das für das Reich bedeutete, war jedoch noch alles andere als klar.
Anmerkungen 1 2 3 4 5 6 7 8
Einen guten Überblick über die Implikationen des Reichsdeputationshauptschlusses bieten die Aufsätze in Klueting, Reichsdeputationshauptschluß, und Himmelstein, Klöster. Forster, Catholic Germany, 194–198; Printy, Enlightenment, 212–220; Hersche, Muße, 1029–1061. Breuer, Zensur, 126 f. Dietmar Stutzer / Alois Fink: Die irdische und die himmlische Wies, Rosenheim, 1982. Burgdorf, Weltbild, 239. Schindling, »Ende«, 90 f.; vgl. auch S. 720. Quarthal, »Vorderösterreich«, 55 ff.; Aretin, Heiliges Römisches Reich I, 467 ff. Aretin, Heiliges Römisches Reich I, 466–469; Press, »Droit«, 562–570.
729
730
VI. · Krieg und Zerfall: Das Reich 1792–1806
9 Herzog Hercules von Modena starb im Oktober 1803, ohne je einen Fuß in den Breisgau gesetzt zu haben; er vermachte das Territorium seinem Schwiegersohn, Erzherzog Ferdinand von Österreich-Este, der es von dem früheren österreichischen Verweser Hermann von Greiffenegg verwalten ließ; vgl. Quarthal, »Vorderösterreich«, 55. 10 Walter, »Treue«, 865. 11 Exzellente Überblicke bieten: Hahn, »Staatenwelt«; Siemann, Deutschland, 21–71; Demel, Reformstaat; Raumer und Botzenhart, Deutschland, 265–481; Aaslestad und Hagemann, »1806«, 559–564; Sheehan, German History, 251–274. 12 Ebd., 263–266, 411 ff., 416 f. 13 Endres, »Mediatisierung«, 852. 14 Meier, Reichskammergericht, 15–20. 15 Schindling, »Scheitern«, 313; Härter, Reichstag, 600, 611. 16 Ebd., 606, 611–617; Aretin, Heiliges Römisches Reich I, 456, 462–465. 17 Hartmann, »Bevölkerungszahlen«, 368 f. 18 Härter, Reichstag, 629. 19 Ebd., 600 f. 20 Borck, Reichskreis, 188 ff.; Häberlin, Staats-Archiv VIII, 3–38, und XII, 32–42. 21 Burgdorf, Weltbild, 131. 22 Kittstein, Politik, 280–292. 23 Aretin, Heiliges Römisches Reich I, 465–469. 24 Press, »Droit«, 571 f.; vgl. auch S. 718. 25 Srbik, Kaisertum, 18 f. 26 Simms, Impact, 159–168. 27 Härter, Reichstag, 625 f. 28 Ebd., 627. 29 Srbik, Kaisertum, 16–38. 30 Die Kaiserkrone und die Insignien waren 1796 aus Nürnberg abtransportiert und 1800 zur Aufbewahrung nach Wien gebracht worden; sie kehrten erst 1938 nach Deutschland zurück und wurden 1946 wieder nach Wien geschafft; vgl. Kubin, Reichskleinodien, 15–41, 101–140, 239–267. 31 Vgl. zum Folgenden Scott, Birth, 302–324; Schroeder, Transformation, 231–281; Raumer und Botzenhart, Deutschland, 139–160. 32 Kusber, »Russland«, 61 ff. 33 Oer, Friede, 198 f. 34 Ebd., 199–203. 35 Ebd., 190–211, 273–5. 36 Bernstein, Balance, 85. 37 Oer, Friede, 221 (mit weiteren Reaktionen auf S. 234–242); Raumer und Botzenhart, Deutschland, 160.
67. Letzte Reformversuche und die Auflösung des Reichs (1806)
I
n den Jahren 1801 bis 1805 wurde das Reich verwandelt, aber nicht in der Weise, wie sich das die Mehrheit jener, die über seine Reform schrieben, vorgestellt hatte. Alle wichtigen Fragen zur Zukunft des Reichs waren nach wie vor offen. Mehr als je zuvor war es in drei klar definierte Zonen geteilt: das besiegte Österreich, das geschwächte Preußen und das »dritte Deutschland«, dessen drei mächtigste Teile – Baden, Bayern und Württemberg – offiziell mit Frankreich verbündet waren und dessen andere Angehörige in unterschiedlicher Weise neutral oder in der Schwebe waren. Frankreichs süddeutsche Verbündete hatten Land und Souveränität gewonnen (wenngleich ihr Status nicht eindeutig war) und das Reich schien sich weiter in Richtung eines Föderalsystems bewegt zu haben. Die meisten Reichsgrafen und Reichsritter, Schlüsselelemente der traditionellen Feudalordnung des Reichs, blieben indes erhalten, ebenso der Deutsche Orden. Das Reichskammergericht arbeitete weiter, der Reichstag allerdings war mangels einer Einigung über die Stimmrechte der Fürsten paralysiert. Franz II. blieb heilig-römischer Kaiser, das Ausmaß seiner Macht war jedoch unklar. Das Hauptproblem des Friedens von Pressburg für das Reich war die mangelnde Klarheit über die Bedeutung des Begriffs plénitude de la souverainité. Wie verhielt er sich zu dem deutschen Begriff Landeshoheit, der für eine Macht stand, die durch die Gesetze des Reichs eingeschränkt war? Was Napoleon betraf, war das wohlüberlegt. Im März 1806 teilte er Talleyrand mit, er habe noch nicht entschieden, in welchen Verhältnis das Herzogtum Kleve und die Grafschaft Mark, die er soeben an Murat übergeben hatte, zum Reich stehen sollten. Er brauche Zeit, um zu beschließen, ob Berg ein Reichslehen oder Teil seines eigenen Imperiums werden solle. 1 Das ließ praktisch jede denkbare Interpretation zu. Der Kurfürst von Württemberg nahm unverzüglich den Titel Electeur-souverain du Saint-Empire an. Wie die Kurfürsten von Baden und Bayern hatte er bereits im November und Dezember 1805 die Länder der Reichsritter und andere kleine Territorien in seiner Region besetzt. Die Ritter selbst hatten erkannt, worauf die Sache hinauslief: Im Frühjahr 1805 entließen sie den Botschafter, der sie seit 1802 in Paris vertreten hatte; am 20. Januar 1806 lösten sie die seit dem 16. Jahrhundert bestehende Reichsritterschaft offiziell auf. 2 Trotz der offensichtlichen Überlegenheit der führenden Territorien mahnten die württembergischen und bayerischen Repräsentanten in Wetzlar ihre Regierun-
732
VI. · Krieg und Zerfall: Das Reich 1792–1806
gen, dass sie in mancher Hinsicht weiterhin der Rechtsprechung des Reichskammergerichts unterstanden. Im Reichstag wurde der österreichische Abgeordnete Egid von Fahnenberg nicht müde zu betonen, die neuen Souveräne seien nach wie vor Angehörige des Reichs und daher der Autorität des Kaisers unterworfen. Reichskammerrichter Heinrich Alois von Reigersberg vertrat eine verbreitete Ansicht, als er in einem anonymen Pamphlet schrieb: »Deutschlands Verfassung war bisher, und bleibt, so lange das alte Staatsgebäude nicht ganz umgeworfen wird, monarchisch.« Im Friedensvertrag von Pressburg stehe der Begriff souverainité nur deshalb, weil die Franzosen kein Wort für Landeshoheit hätten. 3 Wie üblich hatte Napoleon keinen genauen Plan, sondern strebte sein Ziel der Hegemonie Schritt für Schritt an. Sein Verhältnis zu den neuen süddeutschen Verbündeten wurde bald problematisch. Bayern war der verlässlichste Partner, schon aufgrund der Heirat von Napoleons Adoptivsohn Eugène de Beauharnais, dem Vizekönig von Italien, mit Prinzessin Auguste. Während einer Konferenz nach den Hochzeitsfeierlichkeiten in München im Januar 1806 versuchte Napoleon alle drei Territorien in eine ewige Allianz mit Frankreich und Italien einzubinden, der sich die Schweiz und andere anschließen würden. 4 Einen Austritt von Napoleons alliés à perpétuité aus dem Reich sah der Plan nicht vor; als états fédératifs sollten sie sich jedoch einverstanden erklären, ihre Klagen nicht länger vor den Reichstag zu bringen, sondern eine in Paris zu gründende commission de médiation anzuerkennen, mit Napoleon selbst als der obersten juristischen Autorität. Zudem sollten sie im Fall eines zukünftigen Reichskriegs keine Truppen mehr abstellen und stattdessen die französische Armee militärisch unterstützen. Bayern und Baden, dessen Thronfolger Stephanie de Beauharnais heiraten sollte, Eugènes Cousine zweiten Grades, waren im April 1806 gewillt, der Vertrag scheiterte jedoch, weil Württemberg die damit verbundene Schmälerung seiner Souveränität nicht hinnehmen wollte. So gut sie konnten, versuchten alle drei süddeutschen Territorien einen unabhängigen Kurs zu steuern, ohne Frankreich zu verprellen. Im Frühjahr 1806 entzogen sie sich schrittweise der Autorität des Reichskammergerichts, was die zahlreichen Klagen von Reichsrittern und anderen gegen sie betraf. Gleichzeitig kamen ihre Ministerpräsidenten seit April regelmäßig zusammen, um alle internen territorialen Probleme ohne Hinzuziehung Frankreichs zu klären. 5 Andererseits wurde zunehmend deutlich, dass Napoleon sich nicht damit zufrieden geben würde, die territoriale Neuorganisation in Süddeutschland seinen dortigen Verbündeten zu überlassen. Im Juni 1806 sahen sich zunächst Bayern, dann auch andere Territorien mit der Forderung konfrontiert, sich einer Confédération de la haute Allemagne (einem oberdeutschen Bund) anzuschließen und damit all ihren Titeln und Ämtern im Reich abzuschwören. Ein weiterer Bündnisvertrag mit Frankreich und Italien, in dem sämtliche Rechte und Besitzstände gegenseitig garantiert wurden, sollte diesen neuen Bund festigen. Bis Ende Juli unterschrieben die drei süd-
67. Letzte Reformversuche und die Auflösung des Reichs (1806)
deutschen Territorien und dreizehn andere unter massivem französischem Druck ein Statut zur Gründung der Confédération du Rhin (des Rheinbunds). Am 1. August teilten sie dem Reichstag ihren Beschluss mit, das Reich mit sofortiger Wirkung zu verlassen. Nur wenige Tage später löste Franz II. das Reich auf, womit der Rheinbund als einzige Union deutscher Territorien übrigblieb. Das neue Bündnis gründete auf Überlegungen, die bis 1804 zurückreichten, sowie auf früheren Vorbildern wie dem Rheinischen Bund, den Richelieu 1658 begründet hatte. 6 Mit der Forderung nach dem Austritt aller Mitglieder aus dem Reich ging er jedoch weit über alle früheren französischen Systeme in Deutschland hinaus. 7 Der wichtigste Gesichtspunkt für Napoleon war die Zusage von 630.000 Soldaten für seine Feldzüge.Wie schon in Pressburg wurden wichtige Mitglieder in ihrem Rang erhöht: Der Kurfürst von Baden, der Herzog von Berg und der Landgraf von Hessen-Darmstadt wurden zu Großherzögen mit königlichem Status, der Kopf des Hauses Nassau wurde Herzog, der Graf von der Leyen Fürst. Der Kurfürst von Mainz erhielt den Titel Fürstprimat, wenngleich ohne spezielle Rechte und Pflichten; Napoleon selbst wurde zum Protektor mit dem Recht, den nächsten Fürstprimaten zu ernennen. Alle Mitgliedsstaaten erhielten das Recht, sich die Ländereien von Reichsrittern innerhalb und an den Grenzen ihrer Territorien einzuverleiben, ebenso wie die Gebiete einiger weniger bedeutender Fürsten, Reichsgrafen und anderer Grundherren. Ein Parlament in Frankfurt, bestehend aus einer Kammer der Könige und einer der Fürsten, sollte die gemeinsamen Interessen der Mitglieder wahren und bei Streitigkeiten zwischen ihnen vermitteln. Zwar versicherte das Bündnisstatut allen Mitgliedern ihr plénitude de la souverainité (bezeichnenderweise als das Recht definiert, Soldaten auszuheben), es war jedoch klar, dass sie kein Recht auf eine unabhängige Außenpolitik hatten. Anfangs war nicht abzusehen, ob das Bündnis mehr werden konnte als ein Zusammenschluss deutscher Klientelstaaten, und das blieb auch während seines Bestehens bis 1813 umstritten. Unser Interesse indes gilt in erster Linie den Folgen seiner Gründung für das Weiterbestehen des Reichs. Die Ereignisse, die in der Gründung des Rheinbunds und der Auflösung des Reichs gipfelten, lösten, grob gesprochen, fünf Arten von parallelen Reaktionen aus, die jeweils ein enormes Ausmaß an Korrespondenzen, Verhandlungen, Spekulationen und Gerüchten nach sich zogen, was der letzten Phase des Reichs eine außerordentliche Intensität verlieh. Das Gefühl, dass die Situation in jeder Hinsicht offen war, verstärkte die Spannung. Niemand wusste, was passieren würde, und viele zögerten so lange wie möglich mit den diversen Plänen, die sie ausgearbeitet hatten, in der Hoffnung, die Ereignisse würden eine andere Wendung nehmen. Wer dem Rheinbund beitrat, tat dies aus verschiedenen Gründen und verfolgte unterschiedliche Ziele damit. Die großen süddeutschen Territorien hegten den Anspruch, ihre Souveränität über die vom Reich verliehene begrenzte »Landeshoheit«
733
734
VI. · Krieg und Zerfall: Das Reich 1792–1806
hinaus zu erweitern, aber auch Napoleon legte ihnen Schranken auf. Sie folgten seinen Plänen nicht nur aus Furcht vor seinen Armeen, sondern auch aus Sorge, er könne kleinere Territorien als Stacheln im Fleisch ihrer eigenen Länder erhalten und aus ihnen eine Art Union bilden, die als préfecture française in Süddeutschland dienen würde. 8 Durch Kooperation erzielten sie weitere beträchtliche Zugewinne und konnten den langfristigen Rahmen für ihre Entwicklung zu souveränen Staaten sichern. Die kleineren Territorien erhofften sich von dem Bund, was sie bereits im Reich angestrebt hatten: Schutz vor mächtigen Nachbarn. Daher waren sie an der Bildung der in den Klauseln des Vertrags erwähnten zentralen Institutionen interessiert. Viele Herrscher und Minister der Mitgliedsstaaten glaubten nicht an Napoleons Überleben und dachten daher in erster Linie an das, was sie sich selbst verschaffen konnten. Eine zweite Reaktion auf den Rheinbund war jedoch der echte Glaube an seine Zukunft als Ersatz oder Nachfolger des Reichs. Der prominenteste Vertreter dieser Sicht war wohl Fürstprimat Dalberg selbst. Seit in den 1790er Jahren erstmals von umfassenden Säkularisierungen und einer Reorganisation des Reichs die Rede war, warb er unermüdlich für die Erhaltung seines eigenen Erzfürstbistums und des Reichs, dessen Erzkanzler er war. Seine Neigung, sich mit buchstäblich jedem, der ihm über den Weg lief, auf Diskussionen einzulassen, und eine gewisse Gutgläubigkeit und Naivität untergruben seine Erfolgsaussichten; manche misstrauten ihm oder nahmen ihn ganz einfach nicht ernst. Er blieb nach dem Reichsdeputationshauptschluss Kurfürst, Erzbischof und Erzkanzler, schaffte es aber nicht, Rom zur Unterstützung der Wiederherstellung der Reichskirche zu bewegen und den Kaiser und die Fürsten dazu zu bringen, dass sie sich gemeinsam um eine umfassende Reform des Reichs bemühten. Ab 1803 wurde Dalberg zunehmend klar, dass Napoleon die einzige echte Macht im Reich war, und im Januar 1806 war er bereit, sich mit ihm zusammenzutun. Er konnte Napoleon nicht die deutsche Krone anbieten und verfügte nicht über militärische Mittel, die er den Franzosen zur Verfügung stellen konnte, aber er bot ihm eine Beteiligung am Reich an. Im Mai 1806 überraschte er das Reich mit der Verkündigung, er habe Napoleons Onkel, Kardinal Joseph Fesch, zu seinem eigenen Koadjutor mit Nachfolgerecht ernannt. 9 Insgeheim hatte er Napoleon auch vorgeschlagen, Murat, den Herzog von Berg, zum Kurfürsten zu machen. Beide Angebote machte er in der Hoffnung, Napoleon werde das Reich erhalten und dafür sorgen, dass es nicht zu einer simplen Föderation wurde. Dalbergs Geste kam jedoch zu einem Zeitpunkt, da Napoleon jegliches Interesse am Reich verloren hatte. Am 31. Mai schrieb Napoleon an Talleyrand, es werde bald keinen Reichstag mehr geben, da Regensburg Bayern einverleibt werde, und dann gebe es auch kein Deutsches Reich mehr, »und wir halten uns da raus« (»et nous nous en tiendrons là«). 10 Der stets flexible Dalberg kalkulierte, die einzige logische Vorgehensweise sei
67. Letzte Reformversuche und die Auflösung des Reichs (1806)
es, Napoleon dennoch weiter zu folgen. Er trat dem Bund bei und legte sein Amt als Reichserzkanzler am 31. Juli nieder. Als Fürstprimat versuchte er im Rheinbund zu erreichen, woran er im Reich gescheitert war. In der ersten Ausgabe seiner halboffiziösen Zeitschrift Der Rheinische Bund versuchte er die den Mitgliedern durch Artikel 4 des Bündnisvertrags verliehene plénitude de la souverainité zu begrenzen, indem er erklärte, die Mitgliedsstaaten des Bundes bildeten nur gemeinsam einen Staat. 11 Eine solche Beschränkung hätten die neuen Souveräne tatsächlich aber nie akzeptiert. Dalbergs wiederholte Versuche, ein Parlament des Bundes einzuberufen, scheiterten am Widerstand der süddeutschen Staaten und daran, dass Napoleon ständig wegen militärischer Unternehmungen verhindert war. Der Kaiser von Frankreich hatte sowieso nicht vor, Kaiser von Deutschland zu werden, nur um die Feindseligkeit und Obstruktion, die die Habsburger so lange ertragen hatten, selbst zu erleiden. Viel lieber hatte er verlässliche militärische Bündnispartner als verdrießliche Klienten. Man mag Dalberg für naiv halten, ein substanzieller Teil der eingeweihten zeitgenössischen öffentlichen Meinung teilte jedoch seine Leidenschaft für eine Reform des Reichs und deren Übertragung auf den Rheinbund. Erst mit dem Zusammenbruch des Bunds 1813 verflog diese wichtige Strömung des deutschen Patriotismus. 12 Preußen reagierte auf andere, dritte Weise auf Napoleons Politik in Deutschland. Obwohl es im Dezember den Vertrag von Schönbrunn unterschrieb und im Januar Hannover in Besitz nahm, versuchte es seine Neutralität zu wahren, indem es die offizielle Ratifikation des Vertrags so lange wie möglich hinauszögerte und derweil heimlich mit dem Zaren verhandelte. Napoleon begann an Preußens Treue zu zweifeln und beorderte Talleyrand zum Abschluss eines neuen Abkommens, um es fester an Frankreich zu binden. Am 15. Februar 1806 war Preußen gezwungen, den Pariser Vertrag zu unterzeichnen, der gegenseitige territoriale Unverletzlichkeit garantierte und Preußen verpflichtete, bei der Aneignung von Hannover auf die Übernahme der hannoverschen Kurwürde zu verzichten sowie alle Nord- und Ostseeflussmündungen und -häfen zu besetzen, darunter Lübeck, das der meistgenutzte Hafen für russische Schiffe war. 13 Zwar war Preußen somit von der antifranzösischen Koalition isoliert, die Kontrolle über die Häfen stärkte jedoch seine Stellung in Norddeutschland. Für manche in Berlin schien dies die ideale Gelegenheit, die nördliche Neutralitätszone in etwas Substanzielleres umzuwandeln. 14 Ideen dazu kursierten in Berlin seit 1800, hatten aber nie die Unterstützung des Königs gefunden. Im Februar 1806 schlug Hardenberg die Aufteilung Deutschlands in drei Föderationen vor, je eine unter österreichischer, bayerischer und preußischer Führung mit dem Kaiser als übergreifendem Staatsoberhaupt und Leiter der Reichsversammlung. 15 Dass auch Talleyrand Napoleon riet, das Reich in drei Föderationen aufzuteilen, schien
735
736
VI. · Krieg und Zerfall: Das Reich 1792–1806
die Aussichten eines solchen Plans zu erhöhen, allerdings plante Talleyrand das mitteldeutsche Reich nicht unter bayerischer, sondern unter französischer Kontrolle. Der Unterschied lag darin, dass Talleyrand eine zukünftige confédération du nord de l’Allemagne als integralen Teil des neuen französischen Kontinentalsystems vorsah, während Preußen in fataler Überschätzung seiner Macht und Möglichkeiten ein preußisches Norddeutschland als unabhängige Macht im Sinn hatte, die sich eine Stellung zwischen Frankreich und der antifranzösischen Koalition sichern konnte. Im Juni änderte sich die Lage erneut, als Napoleon Talleyrands Plan vom Tisch fegte und die Schaffung des Rheinbunds erzwang. Zugleich machte es die britische Kriegserklärung an Preußen am 11. Juni für Preußen unausweichlich, sich zwischen Frankreich und der Koalition zu entscheiden. In Reaktion auf die Nachricht von der Auflösung des Reichs Anfang August entwickelten der preußische Ministerpräsident Christian von Haugwitz und seine Minister einen neuen Plan, der darauf hinauslief, einen neuen Rahmen zu schaffen, der das Reich ersetzte. Er sah drei souveräne Reiche vor: ein süddeutsches Reich, beherrscht von Frankreich, und Österreich in den Grenzen von 1804. Der preußische König sollte Kaiser von Norddeutschland werden, einer Union aller großen und kleinen Territorien. Die Kurfürsten von Sachsen und Hessen-Kassel sollten Könige werden, der Herzog von Braunschweig und andere Erzherzoge. Preußen, Sachsen und Hessen-Kassel – mit dem König von Preußen als Kaiser – würden als gemeinsame Führer des neuen Reichs und seiner Streitkräfte agieren. Die vorgesehene Struktur des neuen Reichs war der des alten Reichs bemerkenswert ähnlich: oberster Gerichtshof, gemeinsame Armee und Kreise. 16 Hessen-Kassel war gegen signifikante territoriale Zugeständnisse bereit, sich dem preußischen Plan anzuschließen, aber Sachsen lehnte ab. Wieder einmal trat die traditionelle sächsische Loyalität zum Reich und den Habsburgern zutage; hinzu kam ein profunder Widerwille, sich preußischer Kontrolle zu unterwerfen. Napoleons anhaltendes Misstrauen gegenüber Preußen machte jedoch alle in Berlin formulierten Pläne zunichte. Berichte von englisch-französischen Gesprächen über die Rückgabe Hannovers an Großbritannien zwangen Friedrich Wilhelm III. in eine verhängnisvolle Sackgasse. Als er von der Auflösung des Reichs erfuhr, forderte er in einem Ultimatum den Rückzug französischer Truppen und die Auflösung des Rheinbunds. Am 1. Oktober erklärte er Frankreich den Krieg; zwei Wochen später wurde seine Armee in der Doppelschlacht von Jena und Auerstedt dezimiert. Preußens Anspruch, eine Großmacht zu sein, und alle Hoffnungen auf ein norddeutsches Reich waren dahin. Bis nach der offiziellen Auflösung des Reichs hielt sich Preußen mit allen Ideen von einem norddeutschen Reich zurück. In dieser Hinsicht überschnitt sich die preußische Reaktion auf Napoleon ab Herbst 1805 mit der vierten breiten Strö-
67. Letzte Reformversuche und die Auflösung des Reichs (1806)
mung von Reaktionen auf die französische Politik: die Versuche der Rettung des Reichs. Sie fokussierten auf Reichstag und Reichskammergericht und repräsentierten eine Fortsetzung der Reformdebatte zurückliegender Jahre. Das Reichskammergericht bestand bis zum Ende. Unermüdlich arbeiteten Richter und Beamte in Wetzlar an neuen Verfahren und verbreiteten ihre Argumente für die absolute Notwendigkeit der Erhaltung des Reichs und eines obersten Gerichtshofs für die deutschen Territorien. Der Reichstag hingegen war paralysiert. Er erfuhr erst im Februar 1806 vom Frieden von Pressburg und bekam keine Gelegenheit eingeräumt, darüber zu debattieren. Unterdessen waren die verbliebenen Angeordneten mit Gerüchten und Spekulationen über die Zukunft beschäftigt. Im März 1806 hoffte der österreichische Abgeordnete Egid von Fahnenberg, das Reich könne trotz allem in irgendeiner Form überleben, vielleicht durch eine Verbindung föderaler Elemente unter Anerkennung der neuen Souveränität einiger Territorien mit traditionellen hierarchischen Strukturen, die die Rechte der weniger bedeutenden Territorien bewahrten. 17 Selbst Mitte Juli 1806 arbeitete Fahrenberg noch an Plänen zur Erhaltung des Reichs. Und er war beileibe nicht der Einzige. Im April 1806 schlug ein bayerischer Plan zur Reform des Reichs etwas anderes vor: die Schaffung einer Reihe von Nationalstaaten auf Grundlage des Friedens von Pressburg, vereint in einem föderalen System. 18 Das Reich brauche keinen Kaiser mehr als Herrscher, man könne ihn jedoch als Primus inter pares behalten, als Gallionsfigur zur Repräsentation der Föderation bei bestimmten Anlässen. Die souveränen Staaten sollten ihn wählen und durch eine Wahlkapitulation auf Lebenszeit binden. Der Reichstag sollte in einen permanenten Kongress von Repräsentanten umgewandelt werden. Die Reichsgerichte sollten durch oberste Gerichte in jedem Staat ersetzt werden. Im Lauf der Zeit würden die souveränen Staaten ihre Territorialstände abschaffen, die Freiheit der Presse indes sollte in der gesamten Föderation grundlegend sein. Der Plan, der den Deutschen Bund von 1815 vorauszuahnen scheint, spiegelte nicht die Meinung der Mehrheit wider. Große Territorien wie das Kurfürstentum Sachsen, aber auch kleinere wie die Grafschaft Sachsen-Weimar, hofften bis zuletzt, das alte Reich werde überleben. 19 Selbst die neuen souveränen Staat in Süddeutschland waren gespalten, was sein Verschwinden anbelangte. Als der bayerische Minister Montgelas von der Abdankung des Kaisers erfuhr, schrieb er: »Dieses Ergebnis kam zu früh. Wir werden nie einen bequemeren Kaiser haben, als den in Wien.« 20 Es mag paradox erscheinen, die Haltung Wiens von jenen zu trennen, die das Reich erhalten wollen, und sie als eine fünfte Form der Reaktion auf die französische Politik zu bezeichnen. Aber die Meinungen in Wien entwickelten sich anders als Fahrenbergs Haltung als österreichischer Abgeordneter in Regensburg. Österreich verließ das Reich nicht, es wurde nun hinausgezwungen.
737
738
VI. · Krieg und Zerfall: Das Reich 1792–1806
Militärisch besiegt und finanziell ruiniert, musste Österreich schließlich akzeptieren, was Napoleon diktierte. Seit 1801 hatte Wien eine immer wieder andere, oft widersprüchliche Politik verfolgt, in dem verzweifelten Versuch, die habsburgischen Länder im Reich und die Kaiserkrone selbst zu retten. Nach dem Frieden von Pressburg gab es kaum noch Möglichkeiten außer der Hoffnung, das Schicksal werde sich gegen Napoleon wenden. Die Gedanken konzentrierten sich nun zwangsläufig auf die praktischen Folgen des Verlusts der Krone und auf Möglichkeiten, diesen Verlust zumindest teilweise wettzumachen. Im Mai 1806 kamen drei Gutachten zu dem gleichen schonungslosen Ergebnis. Das erste stammte von Joseph Haas (* 1771, † 1808), Leiter der Kanzlei des kaiserlichen Repräsentanten beim Reichstag in Regensburg. 21 Sein Urteil war trostlos. »Fremde Übermacht und Politik« habe nun erreicht, was dem widerspenstigen Geist der deutschen Fürsten und ihrem missverstandenen Freiheitssinn jahrhundertelang nicht gelungen war: Die Einheit des Deutschen Reichs war zerstört. »Das deutsche Volk«, schrieb er, »hat aufgehört ein Staat zu seyn, nicht um der Unabhängigkeit seiner Stände willen, sondern um denselben ein fremdes Joch desto schwerer aufzulegen.« So gut wie nichts sei übrig vom System des Reichs; der Kaiser besitze Autorität nur noch in den Ländern des Erzkanzlers, in Westpommern, Mecklenburg und den Hansestädten – »solange diese Länder noch ihre dermaligen Herren behalten«. Haas’ Vorgesetzter, Johann Aloys von Hügel (* 1753, † 1826), der Konkommissar des kaiserlichen Abgeordneten, pflichtete ihm bei, riet jedoch, Österreich solle jegliche Entscheidung aufschieben, bis Napoleon seine wahren Absichten enthüllt habe.22 Vor allem solle man die kaiserliche Krone, die Hügel selbst aus Nürnberg gerettet und nach Wien gebracht hatte, behalten, bis Österreichs Rechte gewahrt seien. 23 Das dritte Gutachten stimmte überein: Friedrich Lothar von Stadion, der böhmische Gesandte in Regensburg und Bruder des Außenministers Philip von Stadion, meinte zwar, die Krone zu behalten, werde den Kaiser lediglich kompromittieren und demütigen und ihn verpflichten, Taten Napoleons zu billigen, die dem Reichsrecht zuwiderliefen. Auch er riet jedoch dazu, abzuwarten, bis die Dinge klarer wurden, wenngleich er nicht glaubte, dass sich die Lage bessern würde. 24 Als Franz II. die Gutachten von Hügel und Stadion am 17. Juni erhielt, war auch er der Ansicht, er müsse die Krone zu dem Zeitpunkt niederlegen, zu dem dies am vorteilhaftesten für die österreichische Monarchie sei. 25 Wenn er das Reich nicht gemäß den Regeln regieren könne, auf die er seinen Krönungseid abgelegt habe, verzichte er lieber ganz darauf. Ein von Napoleon beherrschtes Reich sei ein Reich, das zu verlassen er sich verpflichtet fühle. Graf Metternich solle deshalb so schnell wie möglich nach Paris entsandt werden, um Napoleons wahre Pläne zu eruieren. Fast zwei Monate lang machten die Mächtigen in Wien Ausflüchte und spiel-
67. Letzte Reformversuche und die Auflösung des Reichs (1806)
ten auf Zeit. Metternich bekam in Paris nichts Brauchbares heraus. Im Gegenteil: Seine Nachfragen sorgten für Ungeduld und Zorn. Am 22. Juli erließ Napoleon ein Ultimatum: Franz II. müsse bis 10. August abdanken. Am 1. August verkündeten die Fürsten des Rheinbunds ihren Austritt aus dem Reich. Seit 1795, erklärten sie, sei ihre Position zunehmend unhaltbar geworden. Sie seien von beiden großen deutschen Mächten im Stich gelassen worden; »vergeblich suchte man Deutschland mitten im deutschen Reichskörper«. Diejenigen, deren Länder Frankreich am nächsten lagen, hätten keine andere Wahl gehabt, als sich um Frieden mit Frankreich zu bemühen; nun seien sie alle entschlossen, den Schutz des französischen Kaisers zu suchen. 26 Fünf Tage später fügte sich Franz II. ins Unvermeidliche. Es war mehr als eine simple Abdankung. Ohne das französische Ultimatum auch nur zu erwähnen, bekräftigte er, er habe seit dem Frieden von Pressburg sein Bestes getan, um seinen Pflichten als Kaiser nachzukommen. 27 Die Auslegung des Friedens durch viele Fürsten habe ihn jedoch überzeugt, dass er nicht länger gemäß seiner Wahlkapitulation regieren könne. Die Gründung des Rheinbunds mache dies unmöglich. Die Kaiserkrone, erklärte er, habe für ihn nur so lange von Wert sein können, »als Wir dem, von Kurfürsten, Fürsten und Ständen und übrigen Angehörigen des deutschen Reichs Uns bezeigten Zutrauen zu entsprechen und den übernommenen Obliegenheiten ein Genügen zu leisten im Stande waren«. Da dies nicht länger der Fall sei, fuhr er fort, »erklären [Wir] demnach durch Gegenwärtiges, dass Wir das Band, welches Uns bis jetzt an den Staatskörper des deutschen Reichs gebunden hat, als gelöst ansehen«. Er legte die Krone ab und entließ die Kurfürsten und alle übrigen, auch die Angehörigen der obersten Gerichtshöfe und sämtliche anderen Diener des Reichs, aus allen Verpflichtungen ihm gegenüber. Seine eigenen Länder stünden fortan unter seiner Herrschaft als Kaiser von Österreich. Die Auflösung des Reichs durch Franz II. war zweifellos ein Bruch imperialen Rechts. 28 Andererseits schloss sie ein Interregnum von vornherein aus und vermied, dass die Krone in die Hände Napoleons oder eines der Kurfürsten fiel. Der Rückzug der habsburgischen Länder aus dem Reich und ihre Vereinigung mit der österreichischen Monarchie waren ebenfalls absolut illegal, aber eine logische Konsequenz der Auflösung. Ob Franz nun legal handelte oder nicht, eines war in jedem Fall klar: Am 6. August 1806 hörte das Heilige Römische Reich Deutscher Nation auf zu existieren.
Anmerkungen 1 2 3
Oer, Friede, 211. Walther, »Treue«, 864 f.; Demel, Reich, 342 f. Mader, Priester, 121; Oer, Friede, 204–211.
739
740
VI. · Krieg und Zerfall: Das Reich 1792–1806
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
Wierichs, Napoleon, 46–50; Weis, »Napoleon«, 59–60. Mader, Priester, 134. Vgl. S. 24 f. Hofmann, Quellen, 374–392. Weis, »Napoleon«, 61. Aretin, Heiliges Römisches Reich I, 500 f. Kraus, Ende, 55 f. Schmidt, »Souveränität«, 49. Raumer und Borzenhart, Deutschland, 338–350; Pape, »Revolution«, 62–68; Schuck, Rheinbundpatriotismus. Bernstein, Balance, 82 ff. Vgl. zum Folgenden Grzeszick, Reich, 121 f.; Bernstein, Balance, 121–129; Kittstein, Politik, 293–354. Stamm-Kuhlmann, »Hardenberg«, 80 ff. Kittstein, Politik, 335 f. Härter, Reichstag, 636 ff. Mader, Priester, 129 ff. Petschel, Außenpolitik, 226–244; Schmidt, »Überleben«, 350–353. Aretin, Heiliges Römisches Reich I, 477. Abgedruckt in Walter, Zusammenbruch, 132–144. Raumer, »Gutachten«, 399–408. Vgl. zur Rettung der kaiserlichen Krone und Insignien durch Hügel Kubin, Reichskleinodien, 103–112, 133 f. Aretin, Heiliges Römisches Reich II, 334–344. Der Volltext der Notizen von Franz II. zur Vorlage der Gutachten von Hügel und Friedrich von Stadion durch Philip von Stadion findet sich bei Kleinheyer, »Abdankung«, 138, Anm. 54. Hofmann, Quellen, 392 ff.; Buschmann, Kaiser II, 376 ff. Ebd., 379 ff. Kleinheyer, »Abdankung«, 142 ff.; Walter, Zusammenbruch, 76–81.
Schluss »[D]as Factum ist so neu, so unerwartet, so hochwichtig, so durchgreifend – so alles was war, was seit ein Jahrtausend war, erschütternd, daß der Geist das Ganze noch nicht fassen kann. Der Geist kann die Frage: wie ist es jetzt? noch weniger fassen, als die Frage: wie wird es künftig seyn? was wird jetzt unsere Verfassung seyn?« Joseph Anton von Vahlkampf Gerichtsschreiber am Reichskammergericht, Wetzlar Sommer 1806 1 »Auch läßt sich das Gefühl, daß Deutschland ein Ganzes ausmacht, aus keiner deutschen Brust vertilgen, und es beruht nicht bloß auf Gemeinsamkeit der Sitten, Sprache und Literatur (da wir es nicht in gleichem Grade mit der Schweiz und dem eigentlichen Preußen teilen), sondern auf der Erinnerung an gemeinsam genossene Rechte und Freiheiten, gemeinsam erkämpften Ruhm und bestandene Gefahren, auf dem Andenken einer engeren Verbindung, welche die Väter verknüpfte und die nur noch in der Sehnsucht der Enkel lebt … Es liegt in der Art, wie die Natur Individuen in Nationen vereinigt und das Menschengeschlecht in Nationen absondert, ein überaus tiefes und geheimnisvolles Mittel, den einzelnen, der für sich nichts ist, und das Geschlecht, das nur in einzelnen gilt, in dem wahren Wege verhältnismäßiger und allmählicher Kraftentwicklung zu erhalten, und obgleich die Politik nie auf solche Ansichten einzugehen braucht, so darf sie sich doch nicht vermessen, der natürlichen Beschaffenheit der Dinge entgegen zu handeln. Nun aber wird Deutschland in seinen nach den Zeitumständen erweiterten oder verengerten Grenzen immer im Gefühle seiner Bewohner und vor den Augen der Fremden Eine Nation, Ein Volk, Ein Staat bleiben.« Wilhelm von Humboldt Denkschrift zur deutschen Verfassung (1813) 2
Zwischen der schockierten Reaktion von Joseph Anton von Vahlkampf auf die Auflösung des Reichs 1806 und Humboldts Gedanken über Deutschlands Zukunft 1813 erlebten die Länder des ehemaligen Reichs weitere Jahre des Kriegs und eine Vielzahl politischer und territorialer Veränderungen.Vahlkampfs Bestürzung wur-
742
Schluss
de von vielen geteilt, während sich die Kunde im August 1806 im Reich verbreitete. Zwar schloss sich nur ein deutscher Fürst, der Kurfürst von Hannover, dem Protest des Zaren gegen die Auflösung des Reichs durch Franz II. an, es herrschte jedoch verbreitete Fassungslosigkeit über ein in vieler Hinsicht unvermeidliches, aber dennoch unerwartetes Ereignis. 3 Im Angesicht der neuen Wirklichkeit wurden Einwände, das Reich bestehe weiter, weil der Kaiser gar kein Recht habe, es aufzulösen, bald irrelevant. 4 Wichtiger war es, mit der unmittelbaren Hinterlassenschaft des Reichs fertigzuwerden. Verbleibende Grenzstreitigkeiten mussten geklärt, die Entschädigung von Herrschern und Einzelnen nach Maßgabe der diversen Vereinbarungen seit 1801 organisiert und bezahlt werden. Kompensationen und Pensionen für Beamte und Diener des Reichs, insbesondere Richter und Angestellte am Reichskammergericht in Wetzlar, waren zu finanzieren und zu regeln. 5 Die komplexen Strukturen imperialer und territorialer Gesetzgebung mussten in einen neuen Rahmen überführt, gesetzliche Normen mit der Veränderung institutioneller Strukturen neu formuliert werden, oft mehr als einmal über die folgenden Jahre bis zur Gründung des Deutschen Bundes 1815. 6 Auch die Landkarte des ehemaligen Reichs veränderte sich mehrere Male, da manche Territorien sich weiter vergrößerten und Napoleon neue Territorien schuf, etwa das Königreich Westphalen und das Großherzogtum Frankfurt, die 1815 beide wieder verschwanden. Bis dahin verloren die meisten kleinen Territorien ihre Unabhängigkeit und wurden in größere Territorien integriert; am Ende blieben nur neununddreißig Staaten übrig, die dem Deutschen Bund beitraten. Mitten in all dem musste der einzelne Deutsche vor dem Hintergrund eines ständigen Wandels sein Leben führen: Reichsgrafen und mindere Fürsten, die Untertanen der neuen souveränen Staaten wurden, mit persönlichen Privilegien, die manche von ihnen bis zur Revolution 1918/19 behielten; ehemalige Würdenträger der Reichskirche und Angehörige des Reichskammergerichts mit Pensionsansprüchen, die zu Streitigkeiten bis in die 1840er Jahre führten; Experten des Reichsrechts, die nun die Gesetze des Rheinbunds und dann die des Deutschen Bunds studieren mussten; Millionen gewöhnlicher Deutscher, die sich mühten, ihre vom Krieg zerstörten Existenzen inmitten ständiger Konflikte und Veränderungen neu aufzubauen, oft als Untertanen mehrerer unterschiedlicher Herrscher, bis 1815 wieder territoriale Stabilität eintrat. In den meisten traditionellen Darstellungen zur deutschen Geschichte überschatten die Ereignisse nach 1806 – die Gründung von Nationalstaaten, Napoleons Reorganisation von Deutschland und der langwierige Kampf gegen seine Hegemonie, die Errichtung eines neuen Rahmens für Deutschland 1815 – das Ende des Reichs. Aber wie Humboldts Gedanken klarmachen, vergaßen Zeitgenossen das Reich nicht einfach so.
Schluss
Humboldts Gedanken über die Zukunft beruhten auf seinen Reflexionen über die Vergangenheit. Seiner Ansicht nach war das Reich oft gescheitert. Er erkannte, dass die gemeinsame Identität der Deutschen nicht nur auf Sprache und Kultur beruhte, die die Deutschen mit Schweizern und deutschen Gemeinschaften an der Ostseeküste teilten. Das königliche und herzogliche Preußen wiederum hatte lange der polnisch-litauischen Völkergemeinschaft angehört und nie dem Reich, und weiter östlich hatten auch Litauen, Lettland und Estland zu unterschiedlichen Zeiten zu Polen und Russland gehört. Es ist höchst bezeichnend, dass Humboldt, ein preußischer Adliger aus der brandenburgischen Neumark, Österreich und Brandenburg zu »Deutschland« zählte, das Herzogtum Preußen jedoch nicht. Humboldt sah ein, dass es nicht möglich sein würde, das Reich wiederherzustellen, was er bevorzugt hätte, und 1813 spiegelte seine Zukunftsvision die unter preußischen Staatsmännern allgemein verbreitete Ansicht wider, Deutschland müsse nun von Österreich und Preußen gemeinsam geführt werden. Wie viele seiner Zeitgenossen betrachtete er indes Österreich bis zu dessen erneuter Niederlage 1809 als natürlichen Führer von »Deutschland«. 7 Was die Deutschen als Gemeinschaft band, waren die Rechte und Freiheiten, die sie im Reich erlangt hatten, und die Kriege, in denen sie sich gegen Türken und Franzosen verteidigt hatten. Über drei Jahrhunderte hinweg war die Entwicklung des Reichs und seiner Territorien von der Reformation und ihren Folgen geprägt gewesen, von religiösen Bewegungen zwischen dem späten 16. und frühen 18. Jahrhundert sowie von den folgenden intellektuell-religiösen Erschütterungen der Aufklärung. Es war für Humboldt wie für die meisten seiner Zeitgenossen selbstverständlich, das Reich als Staat zu betrachten. Sicherlich war es ein höchst ungewöhnliches Gemeinwesen, das auf einer Vielzahl von Ebenen funktionierte. Die wichtigste Aufgabe des Reichs selbst war, Schutz gegen Angriffe von außen zu bieten und innere Stabilität und Sicherheit zu garantieren. Der Reichstag lieferte einen gesetzlichen Rahmen, der teilweise auf regionaler Ebene von den Kreisen umgesetzt wurde, größtenteils aber in die Gesetzgebung der Herrscher von Territorien und der Räte der Reichsstädte einfloss. Dieses komplexe System führte oft zu Verwirrung und Konflikten. Zwischen 1618 und 1648 explodierten Differenzen über das Ausmaß der Autorität des Kaisers in einem langen, vernichtenden Krieg. Im 18. Jahrhundert wehrten sich viele Herrscher großer Territorien zunehmend gegen ihre formelle Unterwerfung unter die höhere Autorität des Reichs. Aber die Kontinuitäten sind ebenso auffallend wie die Veränderungen. Dies war ein Gemeinwesen, dem es gelungen war, die tiefe religiöse Spaltung der Frühneuzeit einzuordnen und zu überwinden. Es entwickelte juristische Mechanismen zur Konfliktlösung, die die Probleme der Gesetzlosigkeit lösten, die die deutsche Gesellschaft des späten Mittelalters gezeichnet hatten,
743
744
Schluss
und sorgte in der Frühneuzeit für zunehmende Stabilität und Sicherheit. Im gesetzlichen und institutionellen Rahmen des Reichs hatten sich die deutschen Territorien angesichts von Rebellion, Krieg und wirtschaftlichen Umbrüchen erfolgreich angepasst. Im Rückblick aus dem Jahr 1800 forderte Humboldts Zeitgenosse Daniel Jenisch dazu auf, die krisengeplagte und turbulente Geschichte von England, Frankreich, Spanien und der Schweiz mit dem »festen, ruhigen und blutlosen Entwickelungsgange unserer Constitution« zu vergleichen. 8 Das Reich, glaubte Humboldt, hatte den grundlegenden Charakter der Deutschen perfekt widergespiegelt, ihre seltsame nationale Identität, die dem Gefühl der Zugehörigkeit zu einem bestimmten Territorium entsprang: »Der Deutsche ist sich nur bewußt, daß er ein Deutscher ist, indem er sich als Bewohner eines besonderen Landes in dem gemeinsamen Vaterlande fühlt.« In die Zukunft blickend, meint Humboldt daher, das Beste wäre eine Wiederherstellung des Heiligen Römischen Reichs, da ein zentralisierter Staat, der die »Provincial-Selbständigkeit« der Deutschen aufhebe, in Deutschland keine Zukunft habe. 9 Da er einsah, dass das alte Reich nicht einfach so wiederbelebt werden konnte, meinte er, der beste Weg nach vorn sei die Schaffung von etwas, was ihm so nahe wie möglich komme, die Errichtung eines neuen Rahmens, der seine Prinzipien verkörpere, auch ohne die dreihundert oder mehr Fürsten, die unabhängigen Städte, kirchlichen und klösterlichen Territorien und die Ländereien der Reichsritter auferstehen zu lassen. Humboldt war kein romantischer Naivling, sondern einer der führenden preußischen Reformer und herausragendes Mitglied einer großartigen Generation deutscher Intellektueller. Zudem entsprachen seine Gedanken zu Deutschlands Zukunft dem Konsens der gebildeten Öffentlichkeit seiner Zeit. Im Gegensatz zu den Darstellungen späterer Historiker gab es nach dem Ende des Reichs kein allgemeines Geschrei nach einem zentralisierten Staat. Jene, die das forderten, waren nicht mehr als eine kleine, radikale Avantgarde. Die Mehrheit, die in jenen Jahren vernünftig über die deutsche Zukunft nachdachte, war der Idee einer »föderativen Nation« verbunden. 10 Sie sahen ein, dass es keinen Weg zurück gab.Viele betrachteten die Reformen in den neuen, vergrößerten souveränen deutschen Staaten als positiven Fortschritt, der durch die Abschaffung der vom alten Reich auferlegten Hindernisse erst möglich geworden war. Sie waren jedoch entschlossen, die traditionelle Einheit der Deutschen nicht aufzugeben. Die Entschlossenheit, mit der die großen Territorien vor dem Hintergrund der napoleonischen Krise die Gelegenheit zur Expansion ergriffen, machte es unmöglich, das Reich wiederherzustellen, wie es im 18. Jahrhundert gewesen war. Ob es hätte bestehen bleiben können, wenn es Napoleon nie gegeben oder wenn er früher besiegt worden wäre, ist wohl keine realistische Frage. Es gab jedoch keinen inneren Grund, der das Reich unvermeidlich zum Scheitern gebracht hätte. Zweifellos herrschten zunehmende Spannungen zwischen den traditionellen hierar-
Schluss
chischen Strukturen und den föderalen Tendenzen, die zutage traten, als sich die größeren Territorien der kaiserlichen Kontrolle zu entziehen versuchten. 11 In der endgültigen Krise glaubten jedoch wenige dieser Territorien, wenn überhaupt, der Untergang des Reichs liege in ihrem Interesse. Die Reform des Reichs erwies sich als unmöglich, als sie am dringendsten nötig gewesen wäre. Aber keine Reform des Reichs zuvor war je schnell verlaufen; das System war in sich konservativ und Trägheit war seit dem späten Mittelalter ein politisches Kernprinzip. Es ist nicht auszuschließen, dass sich das Reich mit der Zeit angepasst hätte. Schließlich war das Reich von 1800 nicht mehr das von 1500, ganz zu schweigen von der Zeit seiner Gründung 800. Das teleologische Argument, dass sich die Ambitionen der großen Territorien unausweichlich durchsetzen mussten, scheint stichhaltig, es erklärt aber nicht den Fortbestand solcher Winzigkeiten wie Nassau, Hessen-Homburg, Sachsen-Weimar und Gotha, Waldeck-Pyrmont und der älteren und jüngeren Linie der Fürsten von Reuß nach 1815 – oder Luxemburg und Liechtenstein, die bis heute als souveräne Staaten existieren. Das Denken Humboldts und seiner Zeitgenossen schlug sich in der Gestalt des Deutschen Bunds nieder, der 1815 als Nachfolger des Reichs und des Rheinbunds entstand. Wie der Historiker Georg Waitz 1848 vor dem Frankfurter Parlament erklärte: »Der Deutsche Bund ist nur die Continuität des Reichs, und Keinem hat es freigestanden, ob er beitreten wollte, oder nicht; und Wir wieder sind die Continuität dessen, was war, und Keinem steht es frei, ob er zu uns gehören will, oder nicht.« 12 Mit Blick auf das Ansinnen des dänischen Königs, Schleswig-Holstein, zwei uralte Herzogtümer des Reichs, aus dem Bund zu entfernen und in sein Königreich einzuverleiben, erklärte Waitz, das Erbe des Reichs sei für die Deutschen »ein älteres und heiligeres Band«. Wenn man den Deutschen Bund als Fortsetzung des Reichs betrachtet, stehen zwei spätere Daten für die Loslösung von seinen Traditionen. Das erste, 1871, bezeichnet die Gründung des Reichs, von dem Österreich ausgeschlossen blieb. Dann, 1934, schaffte Hitler die Länder ab und versuchte, einen Zentralstaat einzuführen. Diese Wendepunkte hatten auch mit Auslegungen des Begriffs »Reich« zu tun, die sich Legitimation zu verschaffen versuchten, indem sie sich auf Traditionen des ersten Reichs beriefen, mit dem sie in Wirklichkeit aber wenig zu tun hatten. Das Reich, von dem Humboldt schrieb, war im Grunde das frühmoderne Reich, das Gemeinwesen, das ab 1500 langsam entstanden und grundlegend von der Reformation geprägt war, der Epoche, in der es zum Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation geworden war. Da hatte es bereits siebenhundert Jahre Geschichte hinter sich, auf die viele seiner Traditionen zurückgingen; wenn Humboldt und seine Zeitgenossen – wie viele ihrer Vorgänger im 18. Jahrhundert – vom Reich sprachen, dachten sie an das Gemeinwesen, das durch die Reformen unter der
745
746
Schluss
Herrschaft von Maximilian, die Wahlkapitulation Karls V. von 1519, den Augsburger Religionsfrieden von 1555 und den Westfälischen Frieden von 1648 neu definiert worden war. Zusammen mit der Goldenen Bulle von 1356 bildeten diese fundamentalen Gesetze die »Erinnerungsorte« des späteren Reichs. Die frühere Existenz des Reichs ab 800 war wichtig, weil sie den Deutschen den Glauben an seine inhärente Dauerhaftigkeit und Unzerstörbarkeit gab. Die tatsächliche Erinnerung an diese frühe Geschichte indes spielte eine untergeordnete Rolle. Das Gefühl, das Zentrum Europas zu sein, war selbstverständlich fundamental. Seit der Reformation war für die meisten jedoch immer weniger wichtig, was das Reich »heilig« machte, und die Idee, es sei jemals »römisch« gewesen, erschien im frühen 17. Jahrhundert absurd. Erinnerungen an ein universelles christliches Reich spielten Ende des 18. Jahrhunderts wiederum eine gewisse Rolle bei der Definition der Deutschen als universelles, postnationales Volk. 13 Nach dem Ende des Reichs gründeten die Gedanken des Freiherrn vom und zum Stein über die Zukunft des Reichs auf der Vorstellung von dem starken Reich, von dem er sich vorstellte, dass es im Mittelalter existiert hatte, wobei er allerdings zugleich um die persönlichen Freiheiten der Deutschen besorgt war, die der Westfälische Friede garantierte. 14 Nach 1815 wurden konstruierte Erinnerungen an das mittelalterliche Reich zunehmend von Historikern und Herrschern wie Ludwig I. von Bayern und Friedrich Wilhelm IV. von Preußen kultiviert. 15 Die größeren souveränen Staaten des Deutschen Bunds entwickelten ihre eigenen Geschichten, die das Reich und Österreich ausblendeten und insbesondere in Preußen die eigene angebliche Rolle bei der Befreiung Deutschlands nach 1813 betonten. Auch Österreich entwickelte eine zunehmend ausgeprägte neue Identität, in der die Frühmoderne als langes Vorspiel der Gründung des österreichischen Kaiserreichs 1804 dargestellt wurde. Österreich blieb noch viele Jahrzehnte lang mit »Deutschland« verbunden, wurde jedoch nach dem Kampf gegen Preußen 1871 endgültig aus dem Reich ausgeschlossen. Diese konstruierten Erinnerungen überlagerten bald jede Vorstellung vom Reich, wie es im 18. Jahrhundert tatsächlich gewesen war. In Verknüpfung mit neuen, modernen Vorstellungen von der Nation, geprägt von demokratischen Ideen der Mobilisierung des Volks, geronnen diese Erinnerungen zu Mythen, die als historisches Bühnenbild für das Reich von 1871 und das von 1933 dienten. Im zweiten und im dritten Reich entwickelte allein das Wort »Reich« Konnotationen, die schließlich, nach dem Holocaust und dem Zweiten Weltkrieg, dazu führten, dass es aus dem Wortschatz der Deutschen getilgt wurde. 16 Die Wiederentdeckung seiner Bedeutung vor 1806 verlief schleppend. Ein Kernthema aller Darstellungen der deutschen Geschichte aus dem 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war der Niedergang des ersten Reichs nach dem Mittelalter. Die Geschichte des Reichs ab dem 15. Jahrhundert war diesen
Schluss
Historikern zufolge eine Geschichte von Auflösung, Teilung, Unterwerfung von außen, Stagnation und Niedergang. Seit 1945 hat das wieder auflebende Interesse am alten Reich langsam ein anderes Bild des frühneuzeitlichen Reichs als faszinierendes, komplexes und bis zur abschließenden Krise funktionsfähiges Gemeinwesen enthüllt. Die Wiederentdeckung ist noch lange nicht abgeschlossen. Wie in früheren Generationen gab es zudem die Versuchung, die Vergangenheit in den Dienst des aktuellen Tagespolitik zu zwingen. 17 Manche gingen so weit, zu behaupten, das alte Reich könne als nützliches Modell für die neue Bundesrepublik nach 1945 oder die neue Berliner Republik seit 1990 oder für eine postnationale Zukunft der Europäischen Union dienen. Wie im Fall der preußisch-deutschen nationalistischen Historiker vor 1945 verzerren solche Darstellungen die Vergangenheit mehr, als sie die Zukunft erhellen. Vieles am Heiligen Römischen Reich, was manchen Historikern modern erschien, war in Wirklichkeit frühneuzeitlich. Fruchtbarer ist es, das Reich mit seinen Zeitgenossen zu vergleichen, etwa dem polnisch-litauischen Staat, der Schweizer Eidgenossenschaft, der Republik der Vereinigten Niederlande und den zusammengesetzten Monarchien Spanien und Großbritannien, als mit Europa im späten 20. und frühen 21. Jahrhundert. Allein das ist eine wichtige Erkenntnis: Das Reich war einzigartig, aber anderen europäischen Gemeinwesen seiner Zeit nicht unähnlich. Es entwickelte eine Kultur der Freiheit und der Achtung vor Gesetzen ebenso wie eine nationale Identität und föderale Mentalität. Das alte Reich – das wusste Humboldt – war 1806 unwiederbringlich dahin. Aber die Tatsache seiner Existenz prägt seither und weiterhin das Leben der deutschsprachigen Einwohner von Mitteleuropa. Die Geschichte des frühneuzeitlichen Reichs zu verstehen, kann uns nicht helfen, einen Plan für Europas Zukunft zu entwerfen. Es kann jedoch dazu beitragen, zu verstehen, wie Deutschland und Europa zu dem wurden, was sie sind.
Anmerkungen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mader, »Altes Reich«, 235. Humboldt, Werke IV, 304. Burgdorf, Weltbild, 98–172. Walter, Zusammenbruch, 76 f.; Mader, Priester, 180–194. Vgl. z. B. Burgdorf, »Untergang«; Mader, Priester, 195–306. Härter, »Reichsrecht«, 327–337. Press, Altes Reich; Whaley, »Thinking«, 69 f.; Burgdorf, Weltbild, 245 f. Jenisch, Geist II, 50. Humboldt, Werke, IV, 308. Langewiesche, »Reichsidee«, 229–234.
747
748
Schluss
11 12 13 14 15 16 17
Aretin, Altes Reich III, 528–531; ders., »Das Alte Reich, eine Föderation?«. Siemann, »Weiterleben«, 585. Vgl. S. 687 ff. Duchardt, Stein, 309. Burgdorf, Weltbild, 227–251, 283–290; Burgdorf, »Kampf«, 340–350. Stolleis, Transformation; Whaley, »Reich«, 442 f. Whaley, »Old Reich«; Schnettger, »Reichsverfassungsgeschichtsschreibung«.
Literatur Aaslestad, Katherine und Karen Hagemann, »1806 and its aftermath: Revisiting the period of the Napoleonic Wars in German Central European historiography«, Central European History, XXXIX (2006), 547–579. Abel, Wilhelm, Geschichte der deutschen Landwirtschaft »vom frühen Mittelalter bis zum 19. Jahrhundert, 2. Aufl. (Stuttgart, 1967). –, Massenarmut und Hungerkrisen im vorindustriellen Europa: Versuch einer Synopsis (Hamburg und Berlin, 1974). Achermann, Hansjakob, Die Katakombenheiligen und ihre Translationen in der schweizerischen Quart des Bistums Konstanz (Stans, 1979). Ackermann, Jürgen, Verschuldung, Reichsdebitverwaltung, Mediatisierung: Eine Studie zu den Finanzproblemen der mindermächtigen Stände im Alten Reich. Das Beispiel der Grafschaft Ysenburg-Büdingen, 1687–1806 (Marburg, 2002). Achilles, Walter, »Georg III. als königlicher Landwirt: Eine Bestätigung als Beitrag zur Personalunion.« Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte, LXXIII (2001), 351–408. Ahnert, Thomas, Religion and the origins of the German Enlightenment: Faith and the reform of learning in the thought of Christian Thomasius (Rochester, NY, 2006). Albrecht, Peter, Die Förderung des Landesausbaues im Herzogtum Braunschweig-Wolfenbüttel im Spiegel der Verwaltungsakten des 18. Jahrhunderts (1671–1806) (Brunswick, 1980). Albrecht, Wolfgang und Christoph Weiß, »Einleitende Bemerkungen zur Beantwortung der Frage: Was heißt Gegenaufklärung?«, in Christoph Weiß (Hg.), Von »Obscuranten« und »Eudämonisten«: Gegenaufklärerische, konservative und antirevolutionäre Publizisten im späten 18. Jahrhundert (St. Ingbert, 1997), 7–34. Allen, Robert C., »Was there a timber crisis in early modern Europe?«, in: Simonetta Cavaciocchi (Hg.), Economia e energia secc. XII–XVIII (Florenz, 2003), 469–482. Allgemeine Deutsche Biographie, 56 Bde. (München und Leipzig, 1875–1902). Alt, Peter-André, Schiller: Leben-Werk-Zeit. Eine Biographie, 2 Bde. (München, 2000). –, »Auf den Schultern der Aufklärung: Überlegungen zu Schillers ›nationalem‹ Kulturprogramm«, in Peter-André Alt und Alexander Košenina (Hgg.), Prägnanter Moment: Studien zur deutschen Literatur der Aufklärung und Klassik (Würzburg, 2002), 215–237. Altgeld, Wolfgang, Katholizismus, Protestantismus, Judentum: Über religiös begründete Gegensätze und nationalreligiöse Ideen in der Geschichte des deutschen Nationalismus (Mainz, 1992). Andermann, Kurt, »Leibeigenschaft im pfälzischen Oberrheingebiet während des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit«, Zeitschrift für historische Forschung, XVII (1990), 281– 303. –, »Die geistlichen Staaten am Ende des Alten Reiches«, Historische Zeitschrift, CCLXXI (2000), 593–619. –, »Leibeigenschaft am mittleren und nördlichen Oberrhein in der frühen Neuzeit«, in: Jan Klußmann (Hg.), Leibeigenschaft: Bäuerliche Unfreiheit in der frühen Neuzeit (Köln, 2003), 63–75.
750
Literatur
Anderson, M. S., Historians and eighteenth-century Europe 1715–1789 (Oxford, 1979). Anderson, Perry, Lineages of the absolutist state (London, 1974). Appold, Kenneth, Orthodoxie als Konsensbildung: Das theologische Disputationswesen an der Universität Wittenberg zwischen 1570 und 1710 (Tübingen, 2004). Arendt, Hans-Jürgen, »Der Friede zu Hubertusburg oder: Viele Hunde waren nicht des Hasen Tod«, in: Susanne Hahn (Hg.), Hubertusburger Frieden – ewiger Frieden?! (London, 2007), 33–50. Aretin, Karl Otmar von, Heiliges Römisches Reich 1776–1806: Reichsverfassung und Staatssouveränität, 2 Bde. (Wiesbaden, 1967). –, Bayerns Weg zum souveränen Staat: Landstände und konstitutionelle Monarchie 1714– 1818 (München, 1976). –, Vom Deutschen Reich zum Deutschen Bund (Göttingen, 1980). –, Das Reich: Friedensordnung und europäisches Gleichgewicht 1648–1806 (Stuttgart, 1986). –, Das Alte Reich 1648–1806, 4 Bde. (Stuttgart, 1993–2000). –, »Das Reich und die europäische Politik 1763–1806«, in: Ferenc Glatz (Hg.), Europa und »wir«: 10 Jahre Europa Institut Budapest (Budapest, 2000), 15–31. –, »Das Alte Reich, eine Föderation?«, in: Wolfgang E. J. Weber und Regina Dauser (Hgg.), Faszinierende Frühneuzeit: Reich, Frieden, Kultur und Kommunikation 1500–1800 (Berlin, 2008), 15–26. Aris, Reinhold, History of political thought in Germany from 1798 to 1815 (London, 1936). Arndt, Johannes, Das niederrheinisch-westfälische Reichsgrafenkollegium und seine Mitglieder (1653–1806) (Mainz, 1991). Asch, Ronald G., »Estates and princes after 1648: The consequences of the Thirty Years War«, German History, VI (1988), 113–132. Asche, Matthias, »›Peregrinatio academica‹ in Europa im Konfessionellen Zeitalter: Bestandsaufnahme eines unübersichtlichen Forschungsfeldes und der Versuch einer Interpretation unter migrationsgeschichtlichen Aspekten«, Jahrbuch für europäische Geschichte, VI, (2005), 3–33. Assmann, Jan, Religio duplex: Ägyptische Mysterien und europäische Aufklärung (Frankfurt am Main, 2010). Atorf, Lars, Der König und das Korn: Die Getreidehandelspolitik als Fundament des brandenburg-preußischen Aufstiegs zur europäischen Großmacht (Berlin, 1999). Aubin, Herman und Wolfgang Zorn (Hgg.), Handbuch der Deutschen Wirtschafts-und Sozialgeschichte, Band 1: Von der Frühzeit bis zum Ende des 18. Jahrhunderts (Stuttgart, 1978). Auer, Leopold, »Das Reich und der Vertrag von Sevilla 1729–31«, Mitteilungen aus dem Österreichischen Staatsarchiv, XXII (1969), 64–93. Aurenhammer, Hans, J. B. Fischer von Erlach (London, 1973). Bachmann, Hanns-Martin, Die naturrechtliche Staatslehre Christian Wolffs (Berlin, 1977). Bader, Karl Siegfried, »Dorf und Dorfgemeinde im Zeitalter von Naturrecht und Aufklärung«, in: Festschrift für Karl Gottfried Hugelmann zum 80. Geburtstag, 2 Bde. (Aalen, 1959), I, 1– 36. Baeumer, Max L., »Klassizität und republikanische Freiheit in der außerdeutschen Winckelmann-Rezeption des späten 18. Jahrhunderts«, in: Thomas W. Gaehtgens (Hg.), Johann Joachim Winckelmann 1717–1768 (Hamburg, 1986), 195–219. Bahlcke, Joachim, »Kollektive Freiheitsvorstellungen aus den Erfahrungen konfessioneller Migration: Das Beispiel Böhmen«, in: Georg Schmidt, Martin van Gelderen und Andreas
Literatur
Klinger (Hgg.), Kollektive Freiheitsvorstellungen im frühneuzeitlichen Europa, 1400–1850 (Frankfurt am Main, 2006). Bahlow, Hans, Unsere Vornamen im Wandel der Jahrhunderte (Limburg an der Lahn, 1965). Bahrdt, Frierich Carl, The edict of religion: A comedy and the story and diary of my imprisonment, übers. und hg. v. Johan Christian Laursen und Johan van der Zande (Lanham, MD, 2000). Balet, Leo und E. Gerhard (d. i. Eberhard Rebling), Die Verbürgerlichung der deutschen Kunst, Literatur und Musik im 18. Jahrhundert (Leipzig, 1936). Barkhausen, Max, »Der Aufstieg der rheinischen Industrie im 18. Jahrhundert und die Entstehung eines industriellen Großbürgertums«, Rheinische Vierteljahrsblätter, XIX (1954), 135–177. Barnard, F. M., »Christian Thomasius: Enlightenment and bureaucracy«, Amercian Political Science Review, LIX (1965), 430–438. –, »The ›practical philosophy‹ of Christian Thomasius«, Journal of the History of Ideas, XXII (1971), 221–246. Barnowski-Fecht, Sabine, Das Handwerk der Stadt Oldenburg zwischen Zunftbindung und Gewerbefreiheit (1731–1861): Die Auflösung der Sozialverfassung des »alten Handwerks« und ihre Transformation unter den Bedingungen von Stadtentwicklung und staatlicher Gewerbepolitik (Oldenburg, 2001). Battenberg, J. Friedrich, Das Europäische Zeitalter der Juden, 2 Bde. (Darmstadt, 1990). –, Die Juden in Deutschland vom 16. bis zum Ende des 18. Jahrhunderts (München, 2001). Bauer, Volker, Hofökonomie: Der Diskurs über den Fürstenhof in Zeremonialwissenschaft, Hausväterliteratur und Kameralismus (Wien, 1977). –, Die höfische Gesellschaft in Deutschland von der Mitte des 17. bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts: Versuch einer Typologie (Tübingen, 1993). Baumann, Anette und Eva Ortlieb, »Netzwerk Reichsgerichtsbarkeit«, in: Birgit Feldner (Hg.), Ad Fontes: Europäisches Forum junger Rechtshistorikerinnen und Rechtshistoriker (Wien, 2001), 23–36. Baumgart, Peter, »Joseph II. und Maria Theresia 1765–1790«, in: Anton Schindling und Walter Ziegler (Hgg.), Die Kaiser der Neuzeit 1519–1918 (München, 1990), 249–276. –, »Friedrich Wilhelm I. (1713–1740)«, in: Frank-Lothar Kroll (Hg.), Preußens Herrscher: Von den ersten Hohenzollern bis Wilhelm II., 2. Aufl. (München, 2000), 134–159. Baumgarten, Marita, Professoren und Universitäten im 19. Jahrhundert: Zur Sozialgeschichte deutscher Geistes- und Naturwissenschaftler (Göttingen, 1997). Bautz, Friedrich Wilhelm (Hg.), Biographisch-bibliographisches Kirchenlexikon (Hamm, 1970). Beales, Derek, Joseph II, 2 Bde. (Cambridge, 1987–2009). –, Prosperity and Plunder: European Catholic monasteries in the age of revolution, 1650–1815 (Cambridge, 2003). Beck, Lewis White, Early German philosophy: Kant and his predecessors (Bristol, 1996). Begert, Alexander, Böhmen, die böhmische Kur und das Reich vom Hochmittelalter bis zum Ende des Alten Reiches: Studien zur Kurwürde und zur staatsrechtlichen Stellung Böhmens (Husum, 2003). Behrens, C. B. A., Society, government and the Enlightenment: The experiences of eighteenthcentury France and Prussia (London, 1985). Behringer, Wolfgang, In Zeichen des Merkur: Reichspost und Kommunikationsrevolution in der Frühen Neuzeit (Göttingen, 2003).
751
752
Literatur
Beiser, Frederick C., The fate of reason: German philosophy from Kant to Fichte (Cambridge, MA, 1987). –, Enlightenment, revolution and romanticism: The genesis of modern German political thought 1790–1800 (Cambridge, MA, 1992). – (Hg.), The early political writings of the German Romantics (Cambridge, 1996). –, The Romantic imperative: The concept of early German Romanticism (Cambridge, MA, 2003). Benecke, Gerhard, Society and politics in Germany 1500–1750 (London, 1974). –, »The German Reichskirche«, in: W. J. Callaghan und D. Higgs (Hgg.), Church and society in Catholic Europe of the eighteenth century (Cambridge, 1979), 77–87. Benedik, Christian, »Die Architektur als Sinnbild der reichsstaatlichen Stellung«, in: Harm Klueting und Wolfgang Schmale (Hgg.), Das Reich und seine Territorialstaaten im 17. und 18. Jahrhundert: Aspekte des Mit-, Neben- und Gegeneinander (Münster, 2004), 97–112. Benedikt, Heinrich, Franz Anton Graf von Sporck (1662–1738): Zur Kultur der Barockzeit in Böhmen (Wien, 1923). Benna, Anna Hedwig, »Von der erzherzoglichen Durchlaucht zur kaiserlichen Hoheit: Eine Titelstudie«, Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs, XXIII (1970), 1–35. Benz, Stefan, Zwischen Tradition und Kritik: Katholische Geschichtsschreibung im barocken Heiligen Römischen Reich (Husum, 2003). Berbig, Hans Joachim, »Kaisertum und Reichsstadt: Eine Studie zum dynastischen Patriotismus der Reichsstädte nach dem Westfälischen Frieden bis zum Untergang des Reiches«, Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg, LVIII (1971), 211–286. –, »Der Krönungsritus im alten Reich (1648–1806)«, Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte, LXXXVIII (1975), 639–700. –, Das kaiserliche Hochstift Bamberg und das Heilige Römische Reich vom Westfälischen Frieden bis zur Säkularisation (Wiesbaden, 1976). Berg, Jan van den, »English Deism and Germany: The Thomas Morgan controversy«, Journal of Ecclesiastical History, LIX (2008), 48–61. Berg, Wieland und Benno Parthier, »Die ›kaiserliche‹ Leopoldina im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation«, in: Detlef Döring und Kurt Nowak (Hgg.), Gelehrte Gesellschaften im mitteldeutschen Raum (1650–1820) (Leipzig, 2000), 39–52. Berger, Joachim, Anna Amalia von Sachsen-Weimar-Eisenach, 1739–1807: Denk- und Handlungsräume einer »aufgeklärten« Herzogin (Heidelberg, 2003). Berghaus, Günter, Die Aufnahme der englischen Revolution in Deutschland 1640–1669 (Wiesbaden, 1989). Berkis, Alexander Valdonis, The history of the Duchy of Courland (1561–1795) (Towson, MD, 1969). Bernard, Paul W., Joseph II and Bavaria: Two eighteenth century attempts at German unification (Den Haag, 1965). Bernstein, Amir D., Von der Balance of Power zur Hegemonie: Ein Beitrag zur europäischen Diplomatiegeschichte zwischen Austerlitz und Jena/Auerstedt 1805–1806 (Berlin, 2006). Besterman, Theodore, Voltaire (London, 1969). Betz, Hans Dieter et al. (Hgg.), Die Religion in Geschichte und Gegenwart Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft, 9 Bde. (4. Aufl., München, 1998–2007). Beutel, Albrecht, Aufklärung in Deutschland (Göttingen, 2006). Bireley, Robert, Maximilian von Bayern, Adam Contzen, S.J., und die Gegenreformation in Deutschland, 1624–1635 (Göttingen, 1975).
Literatur
–,
The Counter-Reformation prince: Anti-Machiavellianism or Catholic statecraft in early modern Europe (Chapel Hill, NC, 1990). Biro, Sidney Seymour, The German policy of revolutionary France: A study in French diplomacy during the First War of Coalition 1792–1797, 2 Bde. (Cambridge, MA, 1957). Birtsch, Günter, »Der Idealtyp des aufgeklärten Herrschers: Friedrich der Große, Karl Friedrich von Baden und Joseph II. im Vergleich«, Aufklärung, II (1987), 9–47. –, »Aufgeklärter Absolutismus oder Reformabsolutismus«, Aufklärung, IX (1996), 101–109. –, »Reformabsolutismus und Gesetzesstaat: Rechtsauffassung und Justizpolitik Friedrichs des Großen«, in: Günter Birtsch (Hg.), Reformabsolutismus und ständische Gesellschaft: Zweihundert Jahre Preußisches Allgemeines Landrecht (Berlin, 1998), 47–62. –, »Die Berliner Mittwochsgesellschaft«, in: Peter Albrecht, Hans Erich Bödeker und Ernst Hinrichs (Hgg.), Formen der Geselligkeit in Nordwestdeutschland 1750–1820 (Tübingen, 2003), 423–439. Blackall, Eric A., »The observations of Father Dornblüth«, Modern Language Review, l (1955), 450–463. –, The emergence of German as a literary language 1770–1775, 2. Aufl. (Ithaca, 1978). Blackbourn, David, The conquest of nature: Water, landscape and the making of modern Germany (London, 2006). Blaich, Fritz, Die Wirtschaftspolitik des Reichstags im Heiligen Römischen Reich: Ein Beitrag zur Problemgeschichte wirtschaftlichen Gestaltens (Stuttgart, 1970). Blanning, T. C. W., Reform and revolution in Mainz 1743–1803 (Cambridge, 1974). –, »That horrid electorate or ›ma patrie germanique‹ ? George III, Hanover, and the Fürstenbund of 1785«, The Historical Journal, XX (1977), 311–344. –, »German Jacobins and the French Revolution«, The Historical Journal, XXIII (1980), 985– 1002. –, The French Revolution in Germany: Occupation and resistance in the Rhineland 1791–1802 (Oxford, 1983). –, »The death and transfiguration of Prussia«, The Historical Journal, XXIX (1986) 433–459. –, The origins of the French revolutionary wars (London, 1986). –, »The French Revolution and the modernization of Germany«, Central European History, XXII (1989), 109–129. –, »Frederick the Great and enlightened absolutism«, in: H. M. Scott (Hg.), Enlightened absolutism: Reform and reformers in later eighteenth-century Europe (Houndmills, 1990), 265–288. –, »Frederick the Great and German culture«, in: Robert Oresko (Hg.), Royal and republican sovereignty in early modern Europe: Essays in memory of Ragnhild Hatton (Cambridge, 1997), 527–550. –, The culture of power and the power of culture: Old Regime Europe 1660–1789 (Oxford, 2002). Blaschke, Karlheinz, Bevölkerungsgeschichte von Sachsen bis zur industriellen Revolution (Weimar, 1967). Blaufuß, Dietrich, »Hugenotteneinwanderung in Franken am Ende des 17. Jahrhunderts: Wirtschaftlicher Wandel und religiöser Kontext«, in: Hans Hopfinger und Horst Kopp (Hgg.), Wirkungen von Migration auf aufnehmende Gesellschaften (Neustadt an der Aisch, 1996) 11–23. Bleeck, Klaus, Adelserziehung auf deutschen Ritterakademien: Die Lüneburger Adelsschulen 1665–1850 (Frankfurt am Main, 1977).
753
754
Literatur
Bleek, Wilhelm, Von der Kameralausbildung zum Juristenprivileg: Studium, Prüfung und Ausbildung der höheren Beamten des allgemeinen Verwaltungsdienstes in Deutschland im 18. und 19. Jahrhundert (Berlin, 1972). Blickle, Peter, Landschaften im Alten Reich: Die staatliche Funktion des gemeinen Mannes in Oberdeutschland (München, 1973). –, »Politische Landschaften in Oberschwaben: Bäuerliche und bürgerliche Repräsentation im Rahmen des frühen europäischen Parlamentarismus«, in: ders. (Hg.), Landschaften und Landstände in Oberschwaben: Bäuerliche und bürgerliche Repräsentation im Rahmen des frühen europäischen Parlamentarismus (Tübingen, 2000), 11–32. –, Von der Leibeigenschaft zu den Menschenrechten: Eine Geschichte der Freiheit in Deutschland (München, 2003). –, Das Alte Europa: Vom Hochmittelalter bis zur Moderne (München, 2008). Blickle, Renate, »Agrarische Konflikte und Eigentumsordnung in Altbayern, 1400–1800«, in: Winfried Schulze (Hg.), Aufstände, Revolten, Prozesse: Beiträge zu bäuerlichen Widerstandsbewegungen im frühneuzeitlichen Europa (Stuttgart, 1983), 166–187. –, »Scharwerk in Bayern: Fronarbeit und Untertänigkeit in der frühen Neuzeit«, Geschichte und Gesellschaft, XVII (1991), 407–433. –, »Frei von fremder Willkür: Zu den gesellschaftlichen Ursprüngen der frühen Menschenrechte; Das Beispiel Altbayern«, in: Jan Klußmann (Hg.), Leibeigenschaft: Bäuerliche Unfreiheit in der frühen Neuzeit (Köln, 2003), 157–174. Bodi, Leslie, Tauwetter in Wien: Zur Prosa der österreichischen Aufklärung 1781–1795, 2. Aufl. (Köln, 1995). Boelcke, Willi A., »›Die Sanftmütige Accise‹ : Zur Bedeutung und Problematik der indirekten Verbrauchsbesteuerung in der Finanzwirtschaft der deutschen Territorialstaaten während der frühen Neuzeit«, Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands, XXI (1972), 93–139. Bog, Ingomar, Der Reichsmerkantilismus: Studien zur Wirtschaftspolitik des Heiligen Römischen Reiches im 17. und 18. Jahrhundert (Stuttgart, 1959). Böhme, Joachim, »Heinrich Julius Elers und die wirtschaftlichen Projekte des Hallischen Pietismus«, Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands, VIII (1959), 121–186. Bohnen, Klaus, »Von den Anfängen des ›Nationalsinns‹ : Zur literarischen Patriotismus-Debatte im Umfeld des Siebenjährigen Kriegs«, in: Helmut Scheuer (Hg.), Dichter und ihre Nation (Frankfurt am Main, 1993), 121–137. Bondeli, Martin, Kantianismus und Fichteanismus in Bern: Zur philosophischen Geistesgeschichte der Helvetik sowie zur Entstehung des nachkantischen Idealismus (Basel, 2001). Böning, Holger, Welteroberung durch ein neues Publikum: Die deutsche Presse und der Weg zur Aufklärung; Hamburg und Altona als Beispiel (Bremen, 2002). Boockmann, Hartmut, Der Deutsche Orden: Zwölf Kapitel aus seiner Geschichte (München, 1981). Borck, Heinz-Günther, Der Schwäbische Reichskreis im Zeitalter der französischen Revolutionskriege (1792–1806) (Stuttgart, 1970). Borgmann, Karl, Der deutsche Religionsstreit der Jahre 1719–20 (Berlin, 1937). Borgstedt, Angela, Das Zeitalter der Aufklärung (Darmstadt, 2004). Borst, Otto, »Zwischen Kuhschnappel und Florenz: Zum Geschichtsbild und zur Entwicklung der süddeutschen Reichsstadt von 1500 bis 1800«, Bodenseebuch, XL (1965), 160–192.
Literatur
–,
»Die Kulturbedeutung der oberdeutschen Reichsstadt am Ende des Alten Reiches«, in: Babel oder Jerusalem? Sechs Kapitel Stadtgeschichte, hg. v. Helmut Böhme, Eberhard Jäckel und Rainer Jooß (Stuttgart, 1984), 201–303. –, »Kulturfunktionen der deutschen Stadt im 18. Jahrhundert«, in: Babel oder Jerusalem? Sechs Kapitel Stadtgeschichte, hg. v. Helmut Böhme, Eberhard Jäckel und Rainer Jooß (Stuttgart, 1984), 355–392. –, »Zur Verfassung und Staatlichkeit oberdeutscher Reichsstädte am Ende der Alten Reiches«, in: Babel oder Jerusalem? Sechs Kapitel Stadtgeschichte, hg. v. Helmut Böhme, Eberhard Jäckel und Rainer Jooß (Stuttgart, 1984), 305–353. Bosbach, Erika, Die »Rêveries politiques« in Friedrichs des Grossen Politischem Testament von 1752: Historisch-politische Erläuterung (Köln und Graz, 1960). Bosl, Karl, Günther Franz und Hans Hubert Hofmann (Hgg.), Biographisches Wörterbuch zur deutschen Geschichte, 3 Bde. (2. Aufl., München, 1973–1974). Boyle, Nicholas, Goethe: The poet and the age, 2 Bde. (Oxford, 1991–1992). Braeuer, Walter, »Kameralismus und Merkantilismus: Ein kritischer Vergleich«, Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte (1990), 107–111. Brandes, Helga, »The literary marketplace and the journal, medium of the Enlightenment«, in: Barbara Becker-Cantarino (Hg.), German literature of the eighteenth century: The Enlightenment and sensibility (Rochester, NY, 2005), 79–102. Brandmüller, Walter (Hg.), Handbuch der bayerischen Kirchengeschichte, 3 Bde. in 4 (St. Ottilien, 1991–1998). Braubach, Max, Prinz Eugen von Savoyen: Eine Biographie, 5 Bde. (München, 1963–1965). Braun, Hans-Joachim, »Economic theory and policy in Germany, 1750–1800«, Journal of European Economic History, IV (1975), 301–322. Braunfels, Wolfgang, Die Kunst im Heiligen Römischen Reich, 6 Bde. (München, 1979–1989). Breger, Herbert, »Leibniz und Tschirnhaus«, in: Kurt Nowak (Hg.), Wissenschaft und Weltgestaltung: Internationales Symposion zum 350. Geburtstag von Gottfried Wilhelm Leibniz vom 9. bis 11. April 1996 in Leipzig (Hildesheim, 1999), 59–67. Brendle, Franz und Anton Schindling, »Reichskirche und Reich in der Frühen Neuzeit«, in: Volker Himmelein (Hg.), Alte Klöster, neue Herren: Die Säkularisation im deutschen Südwesten 1803, 2 Bde. in 3 (Ostfildern, 2003), II Teil 1, 3–22. Breuer, Dieter, Geschichte der literarischen Zensur in Deutschland (Heidelberg, 1982). Brockpähler, Renate, Handbuch zur Geschichte der Barockoper in Deutschland (Emsdetten in Westfalen, 1964). Brown, George Ingham, Scientist, soldier, statesman, spy: Count Rumford; The extraordinary life of a scientific genius (Stroud, 1999). Brown, Sanborn C., Benjamin Thompson, Count Rumford (Cambridge, MA, 1979). Bruckmüller, Ernst und Peter Claus Hartmann (Hgg.), Putzger: Historischer Weltatlas (103. Aufl., Berlin, 2001). Brückner, Jutta, Staatswissenschaften, Kameralismus und Naturrecht: Ein Beitrag zur Geschichte der politischen Wissenschaft in Deutschland des späten 17. und frühen 18. Jahrhunderts (München, 1977). Bruford, W. H., Germany in the eighteenth century: The social background of the literary revival (Cambridge, 1935). Brunner, Otto, Adeliges Landleben und europäischer Geist: Leben und Werk W. Helmhards von Hohberg, 1612–1688 (Salzburg, 1949).
755
756
Literatur
Buchholz, Werner, »Das Ende der Fühen Neuzeit im ›Dritten Deutschland‹ : Vergleichende Analyse und Synthese«, in: ders. (Hg.), Das Ende der Frühen Neuzeit im »Dritten Deutschland« (München, 2003), 167–184. Buchinger, Erich, Die »Ländler« in Siebenbürgen: Vorgeschichte, Durchführung und Ergebnis einer Zwangsumsiedlung im 18. Jahrhundert (München, 1980). Buddruss, Eckhard, Die französische Deutschlandpolitik 1756–1789 (Mainz, 1995). Burgdorf, Wolfgang, Reichskonstitution und Nation. Verfassungsreformprojekte für das Heilige Römische Reich Deutscher Nation im politischen Schrifttum von 1648 bis 1806 (Mainz, 1998). –, »›Reichsnationalismus‹ gegen ›Territorialnationalismus‹ : Phasen der Intensivierung des nationalen Bewußtseins in Deutschland seit dem Siebenjährigen Krieg«, in: Dieter Langewiesche und Georg Schmidt (Hgg.), Föderative Nation: Deutschlandkonzepte von der Reformation bis zum Ersten Weltkrieg (München, 2000), 157–189. –, »Der Untergang der Reichskirche und die Subdelegationskommission für das transrhenanische Sustentationswesen«, in: Bernhard Diestelkamp (Hg.), Das Reichskammergericht am Ende des Alten Reiches und sein Fortwirken im 19. Jahrhundert (Köln, 2002), 143–188. –, »Der ›sang- und klanglose‹ Untergang des Alten Reiches im August 1806«, Geschichte in Wissenschaft und Unterricht, LVII (2006), 564–573. –, Ein Weltbild verliert seine Welt: Der Untergang des Alten Reiches und die Generation 1806 (München, 2006). –, »Der Kampf um die Vergangenheit: Geschichtspolitik und Identität in Deutschland nach 1813«, in: Ute Planert (Hg.), Krieg und Umbruch in Mitteleuropa um 1800: Erfahrungsgeschichte(n) auf dem Weg in eine neue Zeit (Paderborn, 2009), 333–357. Burkhardt, Johannes, Der Dreißigjährige Krieg (Frankfurt am Main, 1992). –, »Verfassungsprofil und Leistungsbilanz des Immerwährenden Reichstags: Zur Evaluirung einer frühmodernen Institution«, in: Heinz Duchhardt und Matthias Schnettger (Hgg.), Reichsständische Libertät und Habsburgisches Kaisertum (Mainz, 1999). –, Vollendung und Neuorientierung des frühmodernen Reiches 1648–1763: Gebhardt Handbuch der deutschen Geschichte, Band 11 (Stuttgart, 2006). Burr, Wolfgang, »Die Reichssturmfahne und der Streit um die hannoversche Kurwürde«, Zeitschrift für Württembergische Landesgeschichte, XXVII (1968), 245–316. Büschel, Hubertus, Untertanenliebe: Der Kult um deutsche Monarchen 1770–1830 (Göttingen, 2006). Buschmann, Arno (Hg.), Kaiser und Reich: Verfassungsgeschichte des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation vom Beginn des 12. Jahrhunderts bis zum Jahre 1806 in Dokumenten, 2. Aufl. (Baden-Baden, 1994). Carl, Horst, »›Die Aufklärung unseres Jahrhunderts ist ein bloßes Nordlicht …‹ : Konfession und deutsche Nation im Zeitalter der Aufklärung«, in: Heinz-Gerhard Haupt (Hg.), Nation und Religion in der deutschen Geschichte (Frankfurt am Main, 2001), 105–141. Carpenter, Kenneth E., Dialogue in political economy: Translations from and into German in the eighteenth century (Boston, MA, 1977). Carsten, F. L., Princes and parliaments in Germany from the fifteenth to the eighteenth century (Oxford, 1959). Caspary, Hermann, Staat, Finanzen, Wirtschaft und Heerwesen im Hochstift Bamberg (1672– 1693) (Bamberg, 1976).
Literatur
Cegielski, Tadeusz, »Preussische ›Deutschland- und Polenpolitik‹ in dem Zeitraum 1740–1792«, in: Klaus Zernack (Hg.), Polen und die polnische Frage in der Geschichte der Hohenzollernmonarchie 1701–1871 (Berlin, 1982), 21–27. –, Das alte Reich und die erste Teilung Polens 1768–1774 (Stuttgart, 1988). Christ, Günther, »Fürst, Dynastie, Territorium und Konfession: Beobachtungen zu Fürstenkonversionen des ausgehenden 17. und beginnenden 18. Jahrhunderts«, Saeculum, XXIV (1973), 367–387. Christmann, Thomas, Das Bemühen von Kaiser und Reich um die Vereinheitlichung des Münzwesens: Zugleich ein Beitrag zum Rechtsetzungsverfahren im Heiligen Römischen Reich nach dem Westfälischen Frieden (Berlin, 1988). Chytry, Josef, The aesthetic state: A quest in modern German thought (Berkeley, CA, 1989). Clark, Christopher, Iron kingdom: The rise and downfall of Prussia, 1600–1947 (London, 2006). –, »When culture meets power: The Prussian coronation of 1701«, in: Hamish Scott und Brendan Simms (Hgg.), Cultures of power in Europe during the long eighteenth century (Cambridge, 2007), 14–35. Conrad, Hermann, Deutsche Rechtsgeschichte, 2 Bde. (Karlsruhe, 1962–1966). –, Recht und Verfassung des Heiligen Römischen Reiches in der Zeit Maria Theresas (Köln und Opladen, 1964). –, »Verfassung und politische Lage des Reiches in einer Denkschrift Josephs II. von 1767– 68«, in: Louis Carlen und Fritz Steinegger (Hgg.), Festschrift Nikolaus Grass zum 60. Geburtstag, 2 Bde. (Innsbruck und München, 1974), 161–185. Conrads, Norbert, Ritterakademien der frühen Neuzeit: Bildung als Standesprivileg im 16. und 17. Jahrhundert (Göttingen, 1982). –, »Schlesiens Frühe Neuzeit (1469–1740)«, in: ders. (Hg.), Schlesien: Deutsche Geschichte im Osten Europas, Band 4 (Berlin, 1994), 178–344. Coreth, Anna, Pietas Austriaca: Österreichische Frömmigkeit im Barock, 2. Aufl. (Wien, 1982). Cottebrune, Anne, »Deutsche Freiheitsfreunde« versus »deutsche Jakobiner«: Zur Entmythisierung des Forschungsgebietes »Deutscher Jakobinismus« (Bonn, 2002). Craig, Gordon A., The politics of the unpolitical: German writers and the problem of power, 1770– 1871 (Oxford, 1985). Czech, Vinzenz, »Brandenburg und seine kleinen Nachbarn«, in: Jürgen Luh (Hg.), Preussen, Deutschland und Europa 1701–2001 (Groningen, 2003), 79–89. DaCosta Kaufmann, Thomas, Court, cloister and city: The art and culture of central Europe 1450–1800 (London, 1995). Dammann, Günter, »Modernität durch hermetisches Denken: Alchemie und Ökonomie bei Johann Joachim Becher«, in: Barabara Mahlmann-Bauer (Hg.), Scientiae et artes: Die Vermittlung alten und neuen Wissens in Literatur, Kunst und Musik (Wiesbaden, 2004), 717– 732. Daniel, Ute, Hoftheater: Zur Geschichte des Theaters und der Höfe im 18. und 19. Jahrhundert (Stuttgart, 1995). –, »Höfe und Aufklärung in Deutschland: Plädoyer für eine Begegnung der dritten Art«, in: Marcus Ventzke (Hg.), Hofkultur und aufklärerische Reformen in Thüringen: Die Bedeutung des Hofes im späten 18. Jahrhundert (Köln, 2002), 11–31. Dann, Otto, »Herder und die Deutsche Bewegung«, in: Gerhard Sauder (Hg.), Johann Gottfried Herder 1744–1803 (Hamburg, 1987), 308–340. Deinhardt, Wilhelm, Der Jansenismus in deutschen Landen: Ein Beitrag zur Kirchengeschichte des 18. Jahrhunderts (München, 1929).
757
758
Literatur
Demel, Walter, Vom aufgeklärten Reformstaat zum bürokratischen Absolutismus (München, 1993). –, »Der aufgeklärte Absolutismus in mittleren und kleineren deutschen Territorien«, in: Helmut Reinalter (Hg.), Der aufgeklärte Absolutismus im europäischen Vergleich (Wien, 2002), 69–112. –, Reich, Reformen und sozialer Wandel 1763–1806: Gebhardt Handbuch der deutschen Geschichte, Band 12 (Stuttgart, 2005). Deventer, Jörg, »Konfrontation statt Frieden: Die Rekatholisierungspolitik der Habsburger in Schlesien im 17. Jahrhundert«, in: Klaus Garber (Hg.), Kulturgeschichte Schlesiens in der Frühen Neuzeit (Tübingen, 2005), 265–283. Dickel, Günther, Das kaiserliche Reservatrecht der Panisbriefe auf Laienherrenpfründen: Eine Untersuchung zur Verfassungsgeschichte des Alten Reichs und zur kirchlichen Rechtsgeschichte nach Wiener Akten (Aalen, 1985). Dickerhof, Harald, »Europäische Traditionen und ›Deutscher Universitätsraum‹ : Formen und Phasen akademischer Kommunikation«, in: Hans Pohl (Hg.), Die Bedeutung der Kommunikation für Wirtschaft und Gesellschaft (Stuttgart, 1989), 173–198. Dickson, Donald R., The tessera of Antilia: Utopian brotherhoods and secret societies in the early seventeenth century (Leiden, 1998). Dickson P. M. G., Finance and government under Maria Theresia 1740–1780, 2 Bde. (Oxford, 1987). Diestelkamp, B. (Hg.), Das Reichskammergericht in der deutschen Geschichte: Stand der Forschung, Forschungsperspektiven (Köln, 1990). Dietze, Anita und Walter Dietze, »Abriß einer Entwicklungsgeschichte der Friedensidee vom Mittelalter bis zur Französischen Revolution«, in: dies. (Hgg.), Ewiger Friede? Dokumente einer deutschen Diskussion um 1800 (Leipzig, 1989), 7–58. –, »Verlauf, Höhepunkte und Ergebnisse der deutschen Friedensdiskussion um 1800«, in: dies. (Hgg.), Ewiger Friede? Dokumente einer deutschen Diskussion um 1800 (Leipzig, 1989), 501–532. Diezinger, Sabine, Französische Emigranten und Flüchtlinge in der Markgraftschaft Baden (1789–1800) (Frankfurt am Main, 1991). Dingel, Irene, »Die Rezeption Pierre Bayles in Deutschland am Beispiel des Dictionnaire historique et critique«, in: Heinz Duchhardt (Hg.), Interdisziplinarität und Internationalität: Wege und Formen der Rezeption der französischen und der britischen Aufklärung in Deutschland und Rußland im 18. Jahrhundert (Mainz, 2004), 51–63. Dippel, Horst, Germany and the American Revolution 1770–1800: A sociohistorical investigation of late eighteenth-century political thinking (Wiesbaden, 1978). –, Die Anfänge des Konstitutionalismus in Deutschland: Texte deutscher Verfassungsentwürfe am Ende des 18. Jahrhunderts (Frankfurt am Main, 1991). Dipper, Christof, Die Bauernbefreiung in Deutschland (Stuttgart, 1980). –, Deutsche Geschichte 1648–1789 (Frankfurt am Main, 1991). Dittrich, Erhard, Die deutschen und österreichischen Kameralisten (Darmstadt, 1974). Dixon, C. Scott, »Faith and history on the eve of the Enlightenment: Ernst Salomon Cyprian, Gottfried Arnold and the history of heretics«, Journal of Ecclesiastical History, LVII (2006), 3–54. Dölemcyer, Barbara, »Kodifikationspläne in deutschen Territorien des 18. Jahrhunderts«, in: Diethelm Klippel und Barabra Dölemeyer (Hgg.), Gesetz und Gesetzgebung im Europa der Frühen Neuzeit (Berlin, 1998), 201–223.
Literatur
–, Die Hugenotten (Stuttgart, 2006). Dopsch, Heinz, »Legatenwürde und Primat der Erzbischöfe von Salzburg«, in: Lutz Fenske, Werner Rösener und Thomas Zotz (Hgg.), Institutionen, Kultur und Gesellschaft im Mittelalter (Sigmaringen, 1984), 265–284. Döring, Detlef, »Beiträge zur Geschichte der Gesellschaft der Alethophilen in Leipzig«, in: Detlef Döring und Kurt Nowak (Hgg.), Gelehrte Gesellschaften im mitteldeutschen Raum (1650–1820) (Stuttgart und Leipzig, 2000), 95–150. –, Die Geschichte der Deutschen Gesellschaft in Leipzig: Von der Gründung bis in die ersten Jahre des Seniorats Johann Christoph Gottscheds (Tübingen, 2002). Dotzauer, Winfried, »Der kurpfälzische Wildfangstreit und seine Auswirkungen im rheinhessisch-pfälzischen Raum«, in: Alois Gerlich (Hg.), Regionale Amts- und Verwaltungsstrukturen im rheinhessisch-pfälzischen Raum (14. bis 18. Jahrhundert) (Stuttgart, 1984), 81–105. –, Die deutschen Reichskreise (1383–1806): Geschichte und Aktenedition (Stuttgart, 1998). Dreitzel, Horst, »Herders politische Konzepte«, in: Gerhard Sauder (Hg.), Johann Gottfried Herder 1744–1803 (Hamburg, 1987), 267–307. –, »Justis Beitrag zur Politisierung der deutschen Aufklärung«, in: Hans Erich Bödeker und Ulrich Herrmann (Hgg.), Aufklärung als Politisierung – Politisierung der Aufklärung (Hamburg, 1987), 158–177. –, Monarchiebegriffe in der Fürstengesellschaft: Semantik und Theorie der Einherrschaft in Deutschland von der Reformation bis zum Vormärz, 2 Bde. (Köln, 1991). –, »Zur Entwicklung und Eigenart der ›eklektischen Philosophie‹«, Zeitschrift für historische Forschung, XVIII (1991), 281–343. –, Absolutismus und ständische Verfassung in Deutschland: Ein Beitrag zu Kontinuität und Diskontinuität der politischen Theorie in der frühen Neuzeit (Mainz, 1992). –, »Zehn Jahre Patria in der politischen Theorie in Deutschland: Prasch, Pufendorf, Leibniz, Becher 1662 bis 1672«, in: Robert von Friedeburg (Hg.), »Patria« und »Patrioten« vor dem Patriotismus: Pflichten, Rechte, Glauben und Rekonfigurierung europäischer Gemeinwesen im 17. Jahrhundert (Wiesbaden, 2005), 367–534. –, »Hobbes-Rezeptionen: Zur politischen Philosophie der frühen Aufklärung in Deutschland«, in: Hans Erich Bödeker (Hg.), Strukturen der deutsche Frühaufklärung 1680–1720 (Göttingen, 2008), 263–307. Duchhardt, Heinz, Protestantisches Kaisertum und Altes Reich: Die Diskussion über die Konfession des Kaisers in Politik, Publizistik und Staatsrecht (Wiesbaden, 1977). –, »Die preußische Königskrönung von 1701: Ein europäisches Modell?«, in ders. (Hg.), Herrscherweihe und Königskrönung im frühneuzeitlichen Europa (Wiesbaden, 1983), 82–95. –, »Karl VI., die Reichsritterschaft und der ›Opferpfennig‹ der Juden«, Zeitschrift für historische Forschung, X (1983), 149–167. –, »Afrika und die deutschen Kolonialprojekte der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts«, Archiv für Kulturgeschichte, LXVIII (1986), 119–133. –, Altes Reich und europäische Staatenwelt 1648–1806 (München, 1990). –, Deutsche Verfassungsgeschichte 1495–1806 (Stuttgart, 1991). –, »Glaubensflüchtlinge und Entwicklungshelfer: Niederländer, Hugenotten, Waldenser, Salzburger«, in: Klaus J. Bade (Hg.), Deutsche im Ausland – Fremde in Deutschland: Migration in Geschichte und Gegenwart (München, 1992), 278–287. –, »Friedrich Wilhelm, der Grosse Kurfürst 1640–1688)«, in: Frank-Lothar Kroll (Hg.), Preußens Herrscher: Von den ersten Hohenzollern bis Wilhelm II., 2. Aufl. (München, 2000), 95–112.
759
760
Literatur
–, Stein: Eine Biographie (Münster, 2007). Ducret, Siegfried, German porcelain and faience, with Wien, Zürich and Nyon (London, 1962). Duhamelle, Christophe, »Le prénom catholique masculin dans le Saint Empire à l’époque moderne«, Annales de l’est, Sér. 6, XLIX (1998), 159–178. –, »De la confession imposée à l’identité confessionnelle: Le cas de l’Eichsfeld, XVIe–XVIIIe siècles«, Études Germaniques, LV (2002), 513–527. –, »Frontière, territoire, confession: L’exemple de l’Eichsfeld«, in: Christine Lebeau (Hg.), L’espace du Saint-Empire, du moyen âge à l’époque moderne (Straßburg, 2004), 175–192. Duindam, Jeroen, Wien and Versailles: The courts of Europe’s dynastic rivals, 1550–1780 (Cambridge, 2003). Düwel, Swen, Die Diskussionen um eine Reform der Reichsverfassung in den Jahren von 1763 bis 1803: Eine Verfassungsstudie auf der Grundlage ausgewählter publizistischer Schriften der damaligen Zeit (Hamburg, 2008). Dwyer, Philip G., »The politics of Prussian neutrality 1795–1805«, German History, XII (1994), 351–373. Eberle, Friedrich und Theo Stammen (Hgg.), Die Französische Revolution in Deutschland: Zeitgenössische Texte deutscher Autoren (Stuttgart, 1989). Ebersold, Günther, Rokoko, Reform und Revolution: Ein politisches Lebensbild des Kurfürsten Karl Theodor (Frankfurt am Main, 1985). Eckardt, Hans Wilhelm, Herrschaftliche Jagd, bäuerliche Not und bürgerliche Kritik: Zur Geschichte der fürstlichen und adligen Jagdprivilegien, vornehmlich im südwestdeutschen Raum (Göttingen, 1976). Ehrenpreis, Stefan, »Wir sind mit blutigen Köpfen davongelaufen …«: Lokale Konfessionskonflikte im Herzogtum Berg 1550–1700 (Bochum, 1993). Eisenbach, Ulrich, Zuchthäuser, Armenanstalten und Waisenhäuser in Nassau: Fürsorgewesen und Arbeitserziehung vom 17. bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts (Wiesbaden, 1994). –, Die kaiserliche Aufsicht über Buchdruck, Buchhandel und Presse im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation (1496–1806): Ein Beitrag zur Geschichte der Bücher- und Pressezensur (Karlsruhe, 1970). –, Die kaiserlichen privilegia de non appellando: Mit einer Abhandlung eingeleitet und in Zusammenarbeit mit Elsbeth Markert regestiert (Köln, 1980). Emrich, Wilhelm, Deutsche Literatur der Barockzeit (Königstein im Taunus, 1981). Enders, Lieselott, »Von der Freiheit zur Leibeigenschaft: Pervertierung in der frühneuzeitlichen Mark Brandenburg«, in: Jan Klußmann (Hg.), Leibeigenschaft: Bäuerliche Unfreiheit in der frühen Neuzeit (Köln, 2003), 37–62. Endres, Rudolf, »Das Armenproblem im Zeitalter des Absolutismus«, in: Franklin Kopitzsch (Hg.), Aufklärung, Absolutismus und Bürgertum in Deutschland (München, 1976). –, »Wirtschafts- und sozialpolitische Ansätze im Fränkischen Reichskreis«, in: Wolfgang Wüst (Hg.), Reichskreis und Territorium: Die Herrschaft über die Herrschaft? Supraterritoriale Tendenzen in Politik, Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft: Ein Vergleich süddeutscher Reichskreise (Stuttgart, 2000), 279–294. –, »›Lieber Sauhirt in der Türkei als Standesherr in Württemberg …‹ : Die Mediatisierung des Adels in Südwestdeutschland«, in: Volker Himmelein (Hg.), Alte Klöster, neue Herren: Die Säkularisation im deutschen Südwesten 1803, 2 Bde. in 3 (Ostfildern, 2003), II Teil 2, 837– 856. Engel-Jánosi, Friedrich, »Josephs II. Tod im Urteil der Zeitgenossen«, Mitteilungen des Österreichischen Instituts für Geschichtsforschung, XLIV (1930), 324–346.
Literatur
Engelberg, Meinrad von, Renovatio Ecclesiae: Die »Barockisierung« mittelalterlicher Kirchen (Petersberg, 2005). –, »Wie deutsch ist der deutsche Barock? Vorüberlegungen zu einer neuen ›Geschichte der bildenden Kunst in Deutschland‹«, Zeitschrift für Kunstgeschichte, LXIX (2006), 508–530. –, »Reichsstil, Kaiserstil, ›Teutscher Gusto‹ ? Zur politischen Bedeutung des deutschen Barock«, in: Heinz Schilling (Hg.), Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation 962 bis 1806: Altes Reich und neue Staaten 1495 bis 1806 (Dresden, 2006), 288–300. Engelbrecht, Jörg, »Rheinische und westfälische Unternehmer des 18. und 19. Jahrhunderts im landesgeschichtlichen Vergleich«, in: Werner Buchholz (Hg.), Landesgeschichte in Deutschland: Bestandsaufnahme, Analyse, Perspektiven (Paderborn, 1998), 429–438. –, »Der Dreißigjährige Krieg und der Niederrhein: Überblick und Einordnung«, in: Stefan Ehrenpreis (Hg.), Der Dreißigjährige Krieg im Herzogtum Berg und in seinen Nachbarregionen (Neustadt an der Aisch, 2002), 10–25. Epstein, Klaus, The genesis of German conservatism (Princeton, NJ, 1966). Erbe, Michael, Revolutionäre Erschütterung und erneuertes Gleichgewicht: Internationale Beziehungen 1785–1830 (Paderborn, 2004). Erdmannsdörffer, Bernhard, Deutsche Geschichte vom Westfälischen Frieden bis zum Regierungsantritt Friedrichs des Großen: 1648–1740, 2 Bde. (Berlin, 1892–1893). Erichsen, Johannes, »Kaisersäle, Kaiserzimmer: Eine kritische Nahsicht«, in: Heinz Schilling (Hg.), Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation 962 bis 1806: Altes Reich und neue Staaten 1495 bis 1806 (Dresden, 2006), 272–287. Erler, Adalbert und Ekkehard Kaufmann (Hgg.), Handwörterbuch zur Deutschen Rechtsgeschichte (Berlin, 1961–). Ernst, Christoph, »Forstgesetze in der Frühen Neuzeit: Zielvorgaben und Normierungsinstrumente für die Waldentwicklung in Kurtrier, dem Kröver Reich und der Hinteren Grafschaft Sponheim (Hunsrück und Eifel)«, in: Karl Härter (Hg.), Policey und frühneuzeitliche Gesellschaft (Frankfurt am Main, 2000), 341–381. Eulenburg, Franz, Die Frequenz der Deutschen Universitäten von ihrer Gründung bis zur Gegenwart (Leipzig, 1904). Evans, Richard J., Rituals of retribution: Capital punishment in Germany 1600–1987 (Oxford, 1996). Evans, R. J. W., »Learned societies in Germany in the seventeenth century«, European Studies Review, VII (1977), 129–151. –, The making of the Habsburg monarchy 1550–1700: An interpretation (Oxford, 1979). –, »German universities after the Thirty Years War«, History of Universities, I (1981), 169– 190. –, »Culture and anarchy in the Empire, 1540–1680«, Central European History, XVIII (1985), 14–30. –, Austria, Hungary, and the Habsburgs: Essays on Central Europe, c. 1683–1867 (Oxford, 2006). Falke, Johannes, Die Geschichte des deutschen Zollwesens (Leipzig, 1869). Faulenbach, Bernd, Ideologie des deutschen Weges: Die deutsche Geschichte in der Historiographie zwischen Kaiserreich und Nationalsozialismus (München, 1980). Fehrenbach, Elisabeth, »Soziale Unruhen im Fürstentum Nassau-Saarbrücken 1789–1792/93«, in: Helmut Berding (Hg.), Soziale Unruhen in Deutschland während der Französischen Revolution (Göttingen, 1988), 28–44. –, Vom Ancien Régime zum Wiener Kongress, 5. Aufl. (München, 2008).
761
762
Literatur
Feine, Hans Erich, Die Besetzung der Reichsbistümer vom Westfälischen Frieden bis zur Säkularisation 1648–1803 (Stuttgart, 1921). –, »Papst, Erste Bitten und Regierungsantritt des Kaisers seit dem Ausgang des Mittelalters«, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgsechichte, II, Kanonistische Abteiling XX (1931), 1–101. –, »Die Verfassungsentwicklung des Heiligen Römischen Reiches seit dem Westfälischen Frieden«, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germanistische Abteilung, LII (1932), 65–132. Feiner, Shmuel, The Jewish Enlightenment, übers. v. Chaya Naor (Philadelphia, PA, 2002). Felix, Fred W., Die Ausweisung der Protestanten aus dem Fürstentum Orange 1703 und 1711–13 (Bad Karlshafen, 2000). Feller, Heinz Rudolf, Die Bedeutung des Reiches und seiner Verfassung für die mittelbaren Untertanen und die Landstände im Jahrhundert nach dem Westfälischen Frieden (Dissertation, Marburg, 1953). Fellner, Fritz, »Reichsgeschichte und Reichsidee als Problem der österreichischen Historiographie«, in: Wilhelm Brauneder und Lothar Höbelt (Hgg.), Sacrum Imperium: Das Reich und Österreich 996–1806 (Wien, 1996), 361–374. Fellner, Thomas und Heinrich Kretschmayr, Die österreichische Zentralverwaltung, Abt. I: Von Maximilian I. bis zur Vereinigung der österreichischen und böhmischen Hofkanzlei (1749). Band 1: Geschichtliche Übersicht (Wien, 1907). Fenske, Hans, »International migration: Germany in the eighteenth century«, Central European History, XIII (1980) 332–347. Fichtner, Paula Sutter, Protestantism and primogeniture in early modern Germany (New Haven und London, 1989). Finger, Otto, »Johann Heinrich Schulz, ein Prediger des Atheismus«, in: Gottfried Stiehler (Hg.), Beiträge zur Geschichte des vormarxistischen Materialismus (Berlin, 1961). Fink, Gonthier-Louis, »Von deutscher Art und Kunst: Le Sturm und Drang et le patriotisme culturel«, in: Marita Gilli (Hg.), Le Sturm und Drang: Une rupture? (Paris, 1996), 81–106. Fischer, Ernst, Wilhelm Haefs und York-Gothart Mix (Hgg.), Von Almanach bis Zeitung: Ein Handbuch der Medien in Deutschland 1700–1800 (München, 1999). Fischer, Wolfram, Das Fürstentum Hohenlohe im Zeitalter der Aufklärung (Tübingen, 1958). Flach, Willy, Goethes Amtliche Schriften, Weimar 1950. Fläschendräger, Werner, »Rezensenten und Autoren der Acta Eruditorum (1682–1731)«, in: Aleksander Gieysztor (Hg.), Universitates studiorum saec. XVIII et XIX: Études présentées par la Commission Internationale pour l’histoire des Universités en 1977 (Warsaw, 1982), 61–80. Florey, Gerhard, Geschichte der Salzburger Protestanten und ihrer Emigration 1731–32 (Wien, 1977). Forberger, Rudolf, »Johann Daniel Crafft: Notizen zu einer Biographie (1624–1697)«, Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte (1964), Teil III/IV, 63–79. Forst, Rainer, Toleranz im Konflikt: Geschichte, Gehalt und Gegenwart eines umstrittenen Begriffs (Frankfurt am Main, 2003). Forster, Marc R., Catholic revival in the age of the baroque: Religious identity in southwest Germany, 1550–1750 (Cambridge, 2001). –, Catholic Germany from the Reformation to the Enlightenment (Houndmills, 2007). François, Étienne, »The German urban network between the sixteenth and eighteenth centuries: Cultural and demographic indicators«, in: A. D. van der Woude, Akira Hayami und
Literatur
Jan de Vries (Hgg.), Urbanization in history: A process of dynamic interactions (Oxford, 1990), 84–100. –, Die unsichtbare Grenze: Protestanten und Katholiken in Augsburg 1648–1806 (Sigmaringen, 1991). –, »La frontière intériorisée: Identités et frontières confessionelles dans l’Allemagne de la seconde moitié du XVIIe siècle«, in: Alain Ducellier (Hg.), Les frontières religieuses en Europe du XVe au XVIIe siècle (Paris, 1992), 51–57. Franz, Günther, Quellen zur Geschichte des deutschen Bauernstandes in der Neuzeit (München, 1963). –, Geschichte des deutschen Bauernstandes: Vom frühen Mittelalter bis zum 19. Jahrhundert, 2. Aufl. (Stuttgart, 1976). Freist, Dagmar, »Zwischen Glaubensfreiheit und Gewissenszwang: Das Reichsrecht und der Umgang mit Mischehen nach 1648«, in: Klaus Garber (Hg.), Der Frieden: Rekonstruktion einer europäischen Vision (München, 2001), 293–322. –, »One body, two confessions: Mixed marriages in Germany«, in: Ulinka Rublack (Hg.), Gender in early modern German history (Cambridge, 2002), 275–304. –, »Der Fall von Albini: Rechtsstreitigkeiten um die väterliche Gewalt in konfessionell gemischten Ehen«, in: Siegrid Westphal (Hg.), In eigener Sache: Frauen vor den höchsten Gerichten des Alten Reiches (Köln, 2005) 245–270. Fricke, Thomas, Zigeuner im Zeitalter des Absolutismus: Bilanz einer einseitigen Überlieferung; Eine sozialgeschichtliche Untersuchung anhand südwestdeutscher Quellen (Pfaffenweiler, 1996). –, »The making of patriots: Love of fatherland and negotiating monarchy in seventeenthcentury Germany«, Journal of Modern History, LXXII (2005), 881–916. Friedrichs, Christopher R., »German town revolts and the seventeenth-century crisis«, Renaissance and Modern Studies, XXVI (1982), 27–51. –, »Jews in the Imperial Cities: A political perspective«, in: R. Po-chia Hsia und Hartmut Lehmann (Hgg.), In and out of the Ghetto: Jewish-gentile relations in late medieval and early modern Germany (New York, 1995), 275–288. Fritsch, Matthias J., Religiöse Toleranz im Zeitalter der Aufklärung: Naturrechtliche Begründung, konfessionelle Differenzen (Hamburg, 2004). Frost, Robert I., The northern wars: War, state and society in northeastern Europe, 1558–1721 (Harlow, 2000). Frühsorge, Gotthard und Gerhard F. Strasser (Hgg.), Johann Joachim Becher (1635–1682) (Wiesbaden, 1993). Frühwald, Wolfgang, »Ruhe und Ordnung«: Literatursprache – Sprache der politischen Werbung; Texte, Materialien, Kommentar (München, 1976). Fuchs, Erich, »Fichtes Briefentwurf ›An den Kaiser‹ Franz II. aus dem Jahre 1799«, in: Albert Mues (Hg.), Transzendentalphilosophie als System: Die Auseinandersetzung zwischen 1794 und 1806 (Hamburg, 1989), 313–330. Fuhrmann, Manfred, »Die Querelle des Anciens et des Modernes, der Nationalismus und die deutsche Klassik«, in: ders., Brechungen: Wirkungsgeschichtliche Studien zur antikeuropäischen Bildungstradition (Stuttgart, 1982), 129–149. –, »Winckelmann, ein deutsches Symbol«, in: ders., Brechungen: Wirkungsgeschichtliche Studien zur antik-europäischen Bildungstradition (Stuttgart, 1982), 150–170.
763
764
Literatur
Fuhrmann, Martin und Diethelm, Klippel, »Der Staat und die Staatstheorie des aufgeklärten Absolutismus«, in: Helmut Reinalter und Harm Klueting (Hgg.), Der aufgeklärte Absolutismus im europäischen Vergleich (Wien, 2002), 223–243. Fulbrook, Mary, Piety and politics: Religion and the rise of absolutism in England, Württemberg and Prussia (Cambridge, 1983). Fürnrohr, Walter, Der Immerwährende Reichstag zu Regensburg: Das Parlament des Alten Reiches (Regensburg, 1963). Gabel, Helmut, Widerstand und Kooperation: Studien zur politischen Kultur rheinischer und maasländischer Kleinterritorien (1648–1794) (Tübingen, 1995). – und Winfried Schulze, »Peasant resistance and politicization in Germany in the eighteenth century«, in: Eckhart Hellmuth (Hg.), The transformation of political culture: England and Germany in the late eighteenth century (Oxford, 1990). Gagliardo, John G., From pariah to patriot: The changing image of the German peasant 1770– 1840 (Lexington, KY, 1969). –, Reich and nation: The Holy Roman Empire as idea and reality, 1763–1806 (Bloomington, 1980). Gantet, Claire, La paix de Westphalie (1648): Une histoire sociale XVIIe-XVIIIe siècles (Paris, 2001). Garber, Jörn, »Vom ›ius connatum‹ zum ›Menschenrecht‹ : Deutsche Menschenrechtstheorien der Spätaufklärung«, in: Reinhardt Brandt (Hg.), Rechtsphilosophie der Aufklärung: Symposium Wolfenbüttel 1981 (Berlin, 1982), 107–147. Garnier, Guillaume, »La question douanière dans le discours économique en Allemagne (seconde moitié du XVIIIe siècle)«, Histoire, économie et société, XXIII (2004), 39–53. Gatz, Erwin, Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1648 bis 1803: Ein biographisches Lexikon (Berlin, 1990). –, Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1448 bis 1648: Ein biographisches Lexikon (Berlin, 1996). –, Clemens Brodkorb und Helmut Flachenecker (Hgg.), Die Bistümer des Heiligen Römischen Reiches von ihren Anfängen bis zur Säkularisation (Freiburg im Breisgau, 2003). –, Rainald Becker, Clemens Brodkorb, Helmut Flachenecker und Karsten Bremer (Hgg.), Atlas zur Kirche in Geschichte und Gegenwart: Heiliges Römisches Reich, deutschsprachige Länder (Regensburg, 2009). Gawlick, Günter, »Thomasius und die Denkfreiheit«, in: Werner Schneiders (Hg.), Christian Thomasius 1655–1728: Interpretationen zu Werk und Wirkung, mit einer Bibliographie der neueren Thomasius-Literatur (Hamburg, 1989), 256–273. Gawthrop, Richard L., Pietism and the making of eighteenth-century Prussia (Cambridge, 1993). Gerber, Georg, »Leibniz und seine Korrespondenz«, in: Wilhlem Totok und Carl Haase (Hgg.), Leibniz: Sein Leben – sein Wirken – seine Welt (Hanover, 1966), 141–148. Gerhard, Hans-Jürgen, »Merkantilpolitische Handelshemmnisse (im territorialen Vergleich) am Beispiel eines territorial relativ einheitlichen Gebietes«, in: Hans Pohl (Hg.), Die Auswirkungen von Zöllen und anderen Handelshemmnissen auf Wirtschaft und Gesellschaft vom Mittelalter bis zur Gegenwart (Stuttgart, 1987), 59–83. Gerteis, Klaus, Die deutschen Städte in der Frühen Neuzeit: Zur Vorgeschichte der »bürgerlichen Welt« (Darmstadt, 1986). –, »Vorrevolutionäres Konfliktpotential und Reaktion auf die Französische Revolution in west-und südwestdeutschen Städten«, in: Helmut Berding (Hg.), Soziale Unruhen in Deutschland während der Französischen Revolution (Göttingen, 1988), 67–76.
Literatur
Geschichte des Pietismus, hg. v. Martin Brecht et al., 4 Bde. (Göttingen, 1993–2004). Gierl, Martin, Pietismus und Aufklärung: Theologische Polemik und die Kommunikationsreform der Wissenschaft am Ende des 17. Jahrhunderts (Göttingen, 1997). –, »Korrespondenzen, Disputationen, Zeitschriften: Wissensorganisation und die Entwicklung der gelehrten Medienrepublik zwischen 1670 und 1730«, in: Richard van Dülmen und Sina Rauschenbach (Hgg.), Macht des Wissens: Die Entstehung der modernen Wissensgesellschaft (Köln, 2004), 417–438. Giersberg, Hans-Joachim, Friedrich als Bauherr: Studien zur Architektur des 18. Jahrhunderts in Berlin und Potsdam (Berlin, 1986). Gleeson, Janet, The arcanum: The extraordinary true story of the invention of European porcelain (London, 1998). Gmür, Rudolf, »Städte als Landesherren vom 16. bis zum 18. Jahrhundert«, in: Karl Kroeschell (Hg.), Festschrift für Hans Thieme zu seinem 80. Geburtstag (Sigmaringen, 1986), 177–197. Gnant, Christoph, »›Jede Diöces ist nichts anders als ein Teil des Landes …‹ : Ausgewählte Fragen der josephinischen Diözesanregulierung und ihrer Auswirkungen auf Reich und Reichskirche«, in: Helmut Reinalter (Hg.), Der aufgeklärte Absolutismus im europäischen Vergleich (Wien, 2002), 245–262. –, »Die ›Österreichische Reichsgeschichte‹ und ihre Sicht auf das Heilige Römische Reich«, in: Harm Klueting (Hg.), Das Reich und seine Territorialstaaten im 17. und 18. Jahrhundert: Aspekte des Mit-, Neben- und Gegeneinander (Münster, 2004), 11–22. –, »Franz Stephan von Lothringen als Kaiser«, Das Achtzehnte Jahrhundert und Österreich, XXIII (2009), 115–129. Godsey, William D., Nobles and nation in Central Europe: Free Imperial Knights in the age of revolution, 1750–1850 (Cambridge, 2004). Goertz, Hans-Jürgen, Religiöse Bewegungen in der frühen Neuzeit (München, 1993). Goffman, Daniel, The Ottoman empire and early modern Europe (Cambridge, 2002). Goldenbaum, Ursula, »Die öffentliche Debatte in der deutschen Aufklärung 1697–1796«, in: dies. et al., Appell an das Publikum: Die öffentliche Debatte in der deutschen Aufklärung (Berlin, 2004), 1–118. –, mit Frank Grunert, Peter Weber, Gerda Heinrich, Brigitte Erker und Winfried Siebers, Appell an das Publikum: Die öffentliche Debatte in der deutschen Aufklärung (Berlin, 2004). Goloubeva, Maria, The glorification of Emperor Leopold I in image, spectacle and text (Mainz, 2000). Gömmel, Rainer, Die Entwicklung der Wirtschaft im Zeitalter des Merkantilismus 1620–1800 (München, 1998). –, »Methodische Probleme im Zusammenhang mit der Ermittlung von Baukonjunkturen: Propädeutische Überlegungen aus wirtschafts- und sozialwissenschaftlicher Sicht«, in: Markwart Herzog (Hg.), Himmel auf Erden oder Teufelsbauwurm? Wirtschaftliche und soziale Grundlagen des süddeutschen Klosterbarock (Constance, 2002), 37–41. Gooch, G. P., Germany and the French Revolution (London, 1920). –, History and historians in the nineteenth century (London, 1928). Göse, Frank, »Nachbarn, Partner und Rivalen: Die kursächsische Sicht auf Preußen im ausgehenden 17. und 18. Jahrhundert«, in: Jürgen Luh (Hg.), Preussen, Deutschland und Europa 1701–2001 (Groningen, 2003), 45–78. Gotthard, Axel, Säulen des Reiches: Die Kurfürsten im frühneuzeitlichen Reichsverband, 2 Bde. (Husum, 1999).
765
766
Literatur
–,
»Zwischen Luthertum und Calvinismus (1598–1640)«, in: Frank-Lothar Kroll (Hg.), Preußens Herrscher: Von den ersten Hohenzollern bis Wilhelm II., 2. Aufl. (München, 2000), 74–94. –, »Friede und Recht: Johann Philipp-Lothar Franz; Die beiden Schönborn in Umriss und Vergleich«, in: Peter Claus Hartmann (Hg.), Die Mainzer Kurfürsten des Hauses Schönborn als Reichserzkanzler und Landesherren (Frankfurt am Main, 2002), 17–63. –, Das Alte Reich 1495–1806, 3. Aufl. (Darmstadt, 2006). Gotthardt, Elmar, Die Kaiserwahl Karls VII.: Ein Beitrag zur Reichsgeschichte während des Interregnums 1740–1742 (Frankfurt am Main, 1986). Göttmann, Frank, »Über Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsentwicklung geistlicher Staaten in Oberschwaben im 18. Jahrhundert: Ein Versuch zum Wirtschaftsstil geistlicher Staatswesen«, in: Wolfgang Wüst (Hg.), Geistliche Staaten in Oberdeutschland im Rahmen der Reichsverfassung: Kultur – Verfassung – Wirtschaft – Gesellschaft; Ansätze zu einer Neubewertung (Epfendorf, 2002), 331–376. Gottsched, Johann Christoph, Ausgewählte Werke, 12 Bde. in 25, hg. v. Joachim Birke und Phillip Marshall (Berlin, 1968–1995). Grab, Walter, Demokratische Strömungen in Hamburg und Schleswig-Holstein zur Zeit der ersten französischen Republik (Hamburg, 1966). –, Norddeutsche Jakobiner: Demokratische Bestrebungen zur Zeit der Französischen Revolution (Frankfurt am Main, 1967). Graetz, Michael, »The Jewish Enlightenment«, in: Michael A. Meyer und Michael Brenner (Hgg.), German-Jewish history in modern times, 4 Bde. (New York, 1996–1998), II, 261– 374. Grafton, Anthony, »The world of the polyhistors: Humanism and encyclopedism«, Central European History, XVIII (1985), 31–47. Greiling, Werner, »Ernst der ›Mild-Gerechte‹ : Zur Inszenierung eines aufgeklärten Herrschers«, in: Werner Greiling, Andreas Klinger und Christoph Köhler (Hgg.), Ernst II. von SachsenGotha-Altenburg: Ein Herrscher im Zeitalter der Aufklärung (Köln, 2005), 3–22. Gretz, Daniela, Die deutsche Bewegung: Der Mythos von der ästhetischen Erfindung der Nation (München, 2007). Greyerz, Kaspar von, Religion und Kultur: Europa 1500–1800 (Darmstadt, 2000). Grillmeyer, Siegfried, »Habsburgs langer Arm ins Reich: Briefspionage in der Frühen Neuzeit«, in: Klaus Beyrer (Hg.), Streng geheim: Die Welt der verschlüsselten Kommunikation (Heidelberg, 1999), 55–66. –, Habsburgs Diener in Post und Politik: Das »Haus« Thurn und Taxis zwischen 1745 und 1867 (Mainz, 2005). Grimm, Gunter E., Literatur und Gelehrtentum in Deutschland: Untersuchungen zum Wandel ihres Verhältnisses vom Humanismus bis zur Frühaufklärung (Tübingen, 1983). Groening, Monika, Karl Theodors stumme Revolution: Stephan Freiherr von Stengel (1750– 1822) und seine staats- und wirtschaftspolitischem Innovationen in Bayern 1778–1799 (Ubstadt-Weiher, 2001). Gross, Hanns, Empire and sovereignty: A history of the public law literature in the Holy Roman Empire, 1599–1804 (Chicago, 1973). Grossmann, Walter, Johann Christian Edelmann: From Orthodoxy to Enlightenment (Den Haag, 1976). –, »Neuwied-am-Rhein: town growth and religious toleration. A case study«, Diogenes, XXVIII (1980), 20–43.
Literatur
–,
»Religious toleration in Germany, 1648–1750«, Studies on Voltaire and the Eighteenth Century, CCI (1982), 115–141. –, »The European origins of the True Inspired of Amana«, Communal Societies. Journal of the National Historic Communal Societies Association, IV (1984), 133–149. –, »Gruber on the discernment of true and false inspiration«, Harvard Theological Review, LXXXI (1988), 363–387. Grotefend, Hermann, Taschenbuch der Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit, 12. Aufl. (Hannover, 1982). Grzeszick, Bernd, Vom Reich zur Bundesstaatsidee: Zur Herausbildung der Föderalismusidee als Element des modernen deutschen Staatsrechts (Berlin, 1996). Gschließer, Oswald von, Der Reichshofrat: Bedeutung und Verfassung, Schicksal und Besetzung einer obersten Reichsbehörde von 1559–1806 (Wien, 1942). Gundlach, Christoph von, »Die Einführung neuer Nahrungsmittel: Dargestellt am Beispiel der Kartoffel«, Zeitschrift für Agrargeschichte und Agrarsoziologie, XXX (1987), 44–56. Haase, Carl, »Leibniz als Politiker und Diplomat«, in: Wilhelm Totok und Carl Haase (Hgg.), Leibniz: Sein Leben – sein Wirken – seine Zeit (Hannover, 1966), 195–226. Haaß, Robert, Die geistige Haltung der katholischen Universitäten Deutschlands im 18. Jahrhundert: Ein Beitrag zur Geschichte der Aufklärung (Freiburg, 1952). Habel, Thomas, »Deutschsprachige Rezensionszeitschriften der Aufklärung: Zur Geschichte und Erschließung«, in: Peter Albrecht und Holger Böning (Hgg.), Historische Presse und ihre Leser: Studien zu Zeitungen und Zeitschriften, Intelligenzblättern und Kalendern in Nordwestdeutschland (Bremen 2005), 42–77. Haberkern, Ernst, Limitierte Aufklärung: Die protestantische Spätaufklärung in Preussen am Beispiel der Berliner Mittwochsgesellschaft (Marburg, 2005). Haberkern, Eugen und Joseph Friedrich Wallach, Hilfswörterbuch für Historiker, 8. Aufl., 2 Bde. (Tübingen, 1995). Häberlin, Carl Friedrich, Staats-Archiv, 16 Bde. in 15 (Helmstedt, Leipzig, Brunswick, 1796– 1807). Häberlein, Mark, »Konfessionelle Grenzen, religiöse Minderheiten und Herrschaftspraxis in süddeutschen Städten und Territorien in der Frühen Neuzeit«, in: Ronald G. Asch und Dagmar Freist (Hgg.), Staatsbildung als kultureller Prozess: Strukturwandel und Legitimation von Herrschaft in der Frühen Neuzeit (Köln, 2005), 151–190. Hagen, William W., »Seventeenth-century crisis in Brandenburg: The Thirty Years’ War, the destabilization of serfdom and the rise of absolutism«, American Historical Review, LXXXVI (1989), 302–335. –, Ordinary Prussians: Brandenburg Junkers and villagers, 1500–1840 (Cambridge, 2002). Hahn, Hans-Werner, Altständisches Bürgertum zwischen Beharrung und Wandel: Wetzlar 1689– 1870 (München, 1991). –, »Neue Staatenwelt und Altes Reich: Die einzelstaatliche Reformpolitik und die neue staatenbündische Ordnung, 1806–1815«, in: Heinz Schilling (Hg.), Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation 962 bis 1806: Altes Reich und neue Staaten 1495 bis 1806 (Dresden, 2006), 368–381. Hahn, Peter-Michael, Friedrich der Große und die deutsche Nation: Geschichte als politisches Argument (Stuttgart, 2007). Hall, Marie Boas, Henry Oldenburg: Shaping the Royal Society (Oxford, 2002). Hamann, Brigitte, Die Habsburger: Ein biographisches Lexikon (Wien, 2001).
767
768
Literatur
Hammermeister, Kai, »Enlightenment thought and natural law from Leibniz to Kant and its influence on German literature«, in: Barbara Becker-Cantarino (Hg.), German literature of the Eighteenth Century: The Enlightenment and sensibility (Rochester, NY, 2005), 33–52. Hammerstein, Notker, Jus und Historie: Ein Beitrag zur Geschichte des historischen Denkens an deutschen Universitäten im späten 17. und im 18. Jahrhundert (Göttingen, 1972). –, »Leibniz und das Heilige Römische Reich deutscher Nation«, Nassauische Annalen, LXXXV (1974), 87–102. –, Aufklärung und katholisches Reich: Untersuchungen zur Universitätsreform und Politik katholischer Territorien des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation im 18. Jahrhundert (Berlin, 1977). –, »Christian Wolff und die Universitäten: Zur Wirkungsgeschichte des Wolffianismus im 18. Jahrhundert«, in: Werner Schneiders (Hg.), Christian Wolff 1679–1754: Interpretationen zu seiner Philosophie und deren Wirkung. Mit einer Bibliographie der Wolff-Literatur (Hamburg, 1983), 266–277. –, »Samuel Pufendorf«, in: Michael Stolleis (Hg.), Staatsdenker im 17. und 18. Jahrhundert: Reichspublizistik, Politik, Naturrecht, 2. Aufl. (Frankfurt am Main, 1987), 172–197. – (Hg.), Handbuch der deutschen Bildungsgeschichte, Band 1: 15. bis 17. Jahrhundert (München, 1996). –, »Relations with authority«, in: Walter Rüegg und Hilde de Ridder-Symoens (Hgg.), A History of the University in Europe, 3 Bde. (Cambridge, 1992–2004), II, 114–153. –, »Universitäten und gelehrte Institutionen von der Aufklärung zum Neuhumanismus und Idealismus«, in: ders., Res publica litteraria: Ausgewählte Aufsätze zur frühneuzeitlichen Bildungs, Wissenschafts- und Universitätsgeschichte, hg. v. Ulrich Muhlack und Gerrit Walther (Berlin, 2000), 215–234. – und Ulrich Hermann (Hgg.), Handbuch der deutschen Bildungsgeschichte, Band 2: 18 Jahrhundert (München, 2005). Hanfstaengl, Ernst F. S., Amerika und Europe von Marlborough bis Mirabeau: Die weltpolitische Bedeutung des belgisch-bairischen Tauschprojekts im Rahmen der hydro-geographischen Donau-Rhein-Scheldepolitik und der osterreichisch-amerikanischen Handelspläne Kaiser Josephs II. und John Adams; Die Verknupfung des belgisch-bairischen Tauschprojekts mit der maritimen Expansionspolitik der Zarin Katharina II. und dem englisch-französischen Verherrschaltskampfe bis 1796 (München, 1930). Hanke, Peter, Ein Bürger von Adel: Leben und Werk des Julius von Soden 1754–1831 (Würzburg, 1988). Hantsch, Hugo, Reichsvizekanzler Friedrich Karl Graf von Schönborn (1674–1746): Einige Kapitel zur politischen Geschichte Kaiser Josefs I. und Karls VI. (Augsburg, 1929). Hantsche, Irmgard, Altas zur Geschichte des Niederrheins (Bottrop, 1999). Harding, Nick, Hanover and the British Empire 1700–1837 (Woodbridge, 2007). Hardtwig, Wolfgang, Genossenschaft, Sekte, Verein in Deutschland. Band 1: Vom Spätmittelalter bis zur Französischen Revolution (München, 1997). Härter, Karl, Reichstag und Revolution 1789–1806: Die Auseinandersetzung des Immerwährenden Reichstags zu Regensburg mit den Auswirkungen der Französischen Revolution auf das Alte Reich (Göttingen, 1992). –, »›… zum Besten und Sicherheit des gemeinen Weesens …‹ : Kurkölnische Policeygesetzgebung während der Regierung des Kurfürsten Clemens August«, in: Günter Frank (Hg.), Im Wechselspiel der Kräfte: Politische Entwicklungen des 17. und 18. Jahrhunderts in Kurköln (Köln, 1999), 203–235.
Literatur
–,
»Gesetzgebung, Verwaltung und Justiz in Kurmainz unter den Kurfürsten Johann Philipp und Lothar Franz von Schönborn«, in: Claus Peter Hartmann (Hg.), Die Mainzer Kurfürsten des Hauses Schönborn als Reichserzkanzler und Landesherren (Frankfurt am Main, 2002), 83–124. –, »Soziale Unruhen und Revolutionsabwehr: Auswirkungen der Französischen Revolution auf die Rechtsprechung des Reichskammergerichts«, in: Bernhard Diestelkamp (Hg.), Das Reichskammergericht am Ende des Alten Reiches und sein Fortwirken im 19. Jahrhundert (Köln, 2002), 43–104. –, »Der Hauptschluss der außerordentlichen Reichsdeputation vom 25. Februar 1803: Genese, Dynamik und Ambivalenz der legalen ›Revolutionierung‹ des Alten Reiches«, Geschichte in Wissenschaft und Unterricht, LIV (2003), 484–500. –, Policey und Strafjustiz in Kurmainz: Gesetzgebung, Normdurchsetzung und Sozialkontrolle im frühneuzeitlichen Territorialstaat, 2 Bde. (Frankfurt am Main, 2005). –, »Reichsrecht und Reichsverfassung in der Auflösungsphase des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation: Funktionsfähigkeit, Desintegration und Transfer«, Zeitschrift für neuere Rechtsgeschichte, XXVIII (2006), 316–337. –, »Zweihundert Jahre nach dem europäischen Umbruch von 1803: Neuerscheinungen zu Reichsdeputationshauptschluß, Säkularisationen und Endphase des Alten Reiches«, Zeitschrift für historische Forschung, XXXIII (2006), 89–115. – und Michael Stolleis (Hgg.), Repertorium der Policeyordnungen der frühen Neuzeit, 9 Bde. in 14 (Frankfurt am Main, 1996–). Hartmann, Peter Claus, Geld als Instrument europäischer Machtpolitik im Zeitalter des Merkantilismus: Studien zu den finanziellen und politischen Beziehungen der Wittelsbacher Territorien Kurbayern, Kurpfalz und Kurköln mit Frankreich und dem Kaiser von 1715 bis 1740 (München, 1978). –, Karl Albrecht – Karl VII.: Glücklicher Kurfürst – unglücklicher Kaiser (Regensburg, 1985). –, »Bevölkerungszahlen und Konfessionsverhältnisse des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation und der Reichskreise am Ende des 18. Jahrhunderts«, Zeitschrift für historische Forschung, XX (1995), 345–369. –, »Zur Bedeutung der Reichskreise für Kaiser und Reich im 18. Jahrhundert«, in: Winfried Dotzauer (Hg.), Landesgeschichte und Reichsgeschichte (Stuttgart, 1995), 305–319. –, Der Bayerische Reichskreis (1500 bis 1803): Strukturen, Geschichte und Bedeutung im Rahmen der Kreisverfassung und der allgemeinen institutionellen Entwicklung des Heiligen Römischen Reiches (Berlin, 1997). –, Kulturgeschichte des Heiligen Römischen Reiches 1648 bis 1806: Verfassung – Religion – Kultur (Wien, 2001). Hassinger, Herbert, Johann Joachim Becher, 1635–1682: Ein Beitrag zur Geschichte des Merkantilismus (Wien, 1951). –, »Der Außenhandel der Habsburgermonarchie in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts«, in: Friedrich Lütge (Hg.), Die wirtschaftliche Situation in Deutschland und Österreich um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert (Stuttgart, 1964), 61–98. –, »Der Stand der Manufakturen in den deutschen Erbländern der Habsburgermonarchie am Ende des 18. Jahrhunderts«, in: Friedrich Lütge (Hg.), Die wirtschaftliche Situation in Deutschland und Österreich um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert (Stuttgart, 1964), 110–176.
769
770
Literatur
Hattenhauer, Christian, Wahl und Krönung Franz II. AD 1792: Das Heilige Reich krönt seinen letzten Kaiser; das Tagebuch des Reichsquartiermeisters Hieronymus Gottfried on Müller und Anlagen (Frankfurt am Main, 1995). –, Schuldenregulierung nach dem Westfälischen Frieden: Der sog. § »de indaganda« und seine Umsetzung in den Jüngsten Reichsabschied (AD 1648 und 1654) (Frankfurt am Main, 1998). Hattenhauer, Hans, »Das ALR im Widerstreit der Politik«, in: Detlef Merten und Waldemar Schreckenberger (Hgg.), Kodifikation gestern und heute: Zum 200. Geburtstag des Allgemeinen Landrechts für die Preußischen Staaten (Berlin, 1995), 27–57. –, Das Heilige Römische Reich als Konkursverwalter (Münster, 1998). Hatton, Ragnhil, George I (2. Aufl. London, 2001) Hauer, Charlotte E., »Das Experiment des Königs: Europäische Migration und die Peuplierung Preußens am Beispiel der Salzburger Emigranten«, in: Matthias Beer und Dittmar Dahlmann (Hgg.), Über die trockene Grenze und über das offene Meer: Binnenpolitische und transnationale Migrationen im 18. und 19. Jahrhundert (Essen, 2004), 67–89. Haug-Moritz, Gabriele, »Die Krise des Reichsverbandes in kaiserlicher Perspektive (1750– 1790)«, in: Monika Hagenmaier (Hg.), Krisenbewußtsein und Krisenbewältigung in der frühen Neuzeit: Festschrift für Hans-Christoph Rublack (Frankfurt am Main, 1992), 73–80. –, »Kaisertum und Parität: Reichspolitik und Konfessionen nach dem Westfälischen Frieden«, Zeitschrift für historische Forschung, XIX (1992), 445–482. –, Württembergischer Ständekonflikt und deutscher Dualismus: Ein Beitrag zur Geschichte des Reichsverbands in der Mitte des 18. Jahrhunderts (Stuttgart, 1992). –, »Corpus Evangelicorum und deutscher Dualismus«, in: Volker Press (Hg.), Alternativen zur Reichsverfassung in der Frühen Neuzeit? (München, 1995), 189–207. –, »Friedrich der Große als ›Gegenkaiser‹ : Überlegungen zur preußischen Reichspolitik (1740–1786)«, in: Otto Heinrich Becker (Hg.), Vom Fels zum Meer: Preußen und Südwestdeutschland (Tübingen, 2002), 25–44. –, »Des ›Kaysers rechter Arm‹ : Der Reichshofrat und die Reichspolitik des Kaisers«, in: Harm Klueting (Hg.), Das Reich und seine Territorialstaaten im 17. und 18. Jahrhundert: Aspekte des Mit-, Neben- und Gegeneinander (Münster, 2004), 23–42. –, »Ritterschaftliche Organisation zwischen Westfälischem Frieden (1648) und Ende des Alten Reiches (1806)«, in: Kurt Andermann und Sönke Lorenz (Hgg.), Zwischen Stagnation und Innovation: Landsässiger Adel und Reichsritterschaft im 17. und 18. Jahrhundert (Ostfildern, 2005), 9–21. Hauser, Albert, »War Kleinjogg ein Musterbauer?«, Zeitschrift für Agrargeschichte und Agrarsoziologie, IX (1961), 211–217. Haushofer, Heinz, »Die Literatur der Hausväter«, Zeitschrift für Agrargeschichte und Agrarsoziologie, XXXIII (1985), 121–141. Hawlik-Van de Water, Magdalena, Die Kapuzinergruft: Begräbnisstätte der Habsburger in Wien, 2. Aufl. (Wien, 1993). Heckel, Martin, »Die Wiedervereinigung der Konfessionen als Ziel und Auftrag der Reichsverfassung im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation«, in: Hans Otte (Hg.), Die Reunionsgespräche im Niedersachsen des 17. Jahrhunderts: Rojas y Spinola, Molan, Leibniz (Göttingen, 1999), 15–38. Hegel, G. W. F., Political writings, hg. v. Laurence Dickey und H. B. Nisbet (Cambridge, 1999). Heiss, Hans, »Ökonomie und Österreichbewußtsein: Zur Rolle der Kameralisten des 17. Jahrhunderts«, in: Marco Bellabarba und Reinhard Stauber (Hgg.), Identità territoriali e cultura
Literatur
politica nella prima età moderna = Territoriale Identität und politische Kultur in der Frühen Neuzeit (Bologna und Berlin, 1998), 215–235. Heitz, Gerhard, »Die Folgen des Dreißigjährigen Krieges und der Wiederaufbau: Die Entstehung des territorialstaatlichen Absolutismus (1648 bis 1688)«, in: Adolf Laube und Günter Vogler (Hgg.), Deutsche Geschichte, Band 3: Die Epoche des Übergangs vom Feudalismus zum Kapitalismus von den siebziger Jahren des 15. Jahrhunderts bis 1789 (Berlin, 1983), 328–362. Hellmuth, Eckhart, »Die ›Wiedergeburt‹ Friedrichs des Großen und der ›Tod fürs Vaterland‹ : Zum patriotischen Selbstverständnis in Preußen in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts«, Aufklärung, X (1998), 23–54. Henderson, William Otto, Manufactories in Germany (Frankfurt am Main, 1985). Henning, Friedrich-Wilhelm, Handbuch der Wirtschafts- und Sozialgeschichte Deutschlands, Band 1 (Paderborn, 1991). Hennings, Fred, Und sitzet zur linken Hand: Franz Stephan von Lothringen (Wien, 1961). Henrich, Dieter, Die Grundlegung aus dem Ich: Untersuchungen zur Vorgeschichte des Idealismus; Tübingen–Jena (1790–1794) (Frankfurt am Main, 2004). Henshall, Nicholas, The myth of absolutism: Change and continuity in early modern European monarchy (London, 1992). –, »Early modern absolutism 1550–1700: Political reality or propaganda?«, in: Ronald G. Asch und Heinz Duchhardt (Hgg.), Der Absolutismus, ein Mythos? Strukturwandel monarchischer Herrschaft in West- und Mitteleuropa (ca. 1550–1700) (Köln, 1996), 25–53. Herbers, Klaus und Helmut Neuhaus, Das Heilige Römische Reich: Schauplätze einer tausendjährigen Geschichte (Köln, Weimar und Wien, 2005). Herdmann, Frank, Montesquieurezeption in Deutschland im 18. und 19. Jahrhundert (Hildesheim, 1990). Hermand, Jost, »Die erste deutsche Nationaloper: Günther von Schwarzburg (1777) von Anton Klein und Ignaz Holzbauer«, in: Jost Hermand und Michael Niedermeier, Revolutio germanica: Die Sehnsucht nach der ›alten Freiheit‹ der Germanen, 1750–1820 (Frankfurt am Main, 2002), 159–171. Hermkes, Wolfgang, Das Reichsvikariat in Deutschland: Reichsvikare nach dem Tode des Kaisers von der Goldenen Bulle bis zum Ende des Reiches (Karlsruhe, 1968). Herrlinger, Robert, »Das Collegium Naturae Curiosum von 1652 und Niels Stensens Beziehungen zu den deutschen Akademikern«, in: Gustav Scherz (Hg.), Steno and brain research in the seventeenth century (Oxford, 1968), 261–272. Herrmann, Hans Peter, »Individuum und Staatsmacht: Preußisch-deutscher Nationalismus in Texten zum Siebenjährigen Krieg«, in: ders. et al., Machtphantasie Deutschland: Nationalismus, Männlichkeit und Fremdenhaß im Vaterlandsdiskurs deutscher Schriftsteller des 18. Jahrhunderts (Frankfurt am Main, 1993), 66–79. Hersche, Peter, Der Spätjansenismus in Österreich (Wien, 1977). –, »Intendierte Rückständigkeit: Zur Charakteristik des geistlichen Staates im Alten Reich«, in: Georg Schmidt (Hg.), Stände und Gesellschaft im Alten Reich (Stuttgart, 1989), 133– 149. –, Muße und Verschwendung: Europäische Gesellschaft und Kultur im Barockzeitalter, 2 Bde. (Freiburg im Breisgau, 2006). Herzig, Arno, »Der Einfluß der Französischen Revolution auf den Unterschichtenprotest in Deutschland während der 1790er Jahre«, in: Helmut Berding (Hg.), Soziale Unruhen in Deutschland während der Französischen Revolution (Göttingen, 1988), 202–217.
771
772
Literatur
–,
Der Zwang zum wahren Glauben: Rekatholisierung vom 16. bis zum 18. Jahrhundert (Göttingen, 2000). –, Konfession und Heilsgewissheit: Schlesien und die Grafschaft Glatz in der Frühen Neuzeit (Bielefeld, 2002). Heuvel, Christine van den und Gerd van den Heuvel, »Begrenzte Politisierung während der Französischen Revolution: Der ›Gesmolder Bauerntumult‹ von 1794 im Hochstift Osnabrück«, in: Helmut Berding (Hg.), Soziale Unruhen in Deutschland während der Französischen Revolution (Göttingen, 1988), 111–129. High, Jeffrey L., Schillers Rebellionskonzept und die Französische Revolution (Lewiston, NY, 2004). Hildebrandt, Reinhard, »Rat contra Bürgerschaft: Die Verfassungskonflikte in den Reichsstädten des 17. und 18. Jahrhunderts«, Zeitschrift für Stadtgeschichte, Stadtsoziologie und Denkmalpflege, I (1974), 221–241. Hill, David (Hg.), Literature of the Sturm und Drang (Woodbridge, 2003). Himmelein, Volker, Alte Klöster, neue Herren: Die Säkularisation im deutschen Südwesten 1803, 2 Bde. in 3 (Ostfildern, 2003). Hinske, Norbert, Erhard Lange and Horst Schröpfer, Der Aufbruch in den Kantianismus: Der Frühkantianismus an der Universität Jena von 1785–1800 und seine Vorgeschichte (Stuttgart-Bad Cannstatt, 1995). –, »Kant im Auf und Ab der katholischen Kantrezeption: Zu den Anfängen des katholischen Frühkantianismus und seinen philosophischen Impulsen«, in: Norbert Fischer (Hg.), Kant und der Katholizismus: Stationen einer wechselhaften Geschichte (Freiburg, 2005), 189– 205. Hinz, Renate, Pestalozzi und Preußen: Zur Rezeption der Pestalozzischen Pädagogik in der preußischen Reformzeit (1806/07–1812/13) (Frankfurt am Main, 1991). Hippel, Wolfgang von, Armut, Unterschichten, Randgruppen in der frühen Neuzeit (München, 1995). Höbelt, Lothar, Ferdinand III. (1608–1657): Friedenskaiser wider Willen (Graz, 2008). Hochedlinger, Michael, Austria’s wars of emergence: War, state and society in the Habsburg monarchy, 1683–1797 (London, 2003). Hochstrasser, T. J., Natural law theories in the early Enlightenment (Cambridge, 2000). Hoffmann, Barbara, Radikalpietismus um 1700: Der Streit um das Recht auf eine neue Gesellschaft (Frankfurt am Main, 1996). Hoffmann, Christian Gottfried, Gründliche Vorstellung derer in dem Heil. Röm. Reiche Teutscher Nation obschwebenden Religions-Beschwerden (Leipzig, 1722). Hofmann, Hanns Hubert (Hg.), Quellen zum Verfassungsorganismus des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation 1494–1815 (Darmstadt, 1976). Holenstein, André, »Gute Policey« und lokale Gesellschaft im Staat des Ancien Régime: Das Fallbeispiel der Markgrafschaft Baden(-Durlach), 2 Bde. (Epfendorf, 2003). Holzem, Andreas, Der Konfessionsstaat (1555–1802): Geschichte des Bistums Münster, Band 4 (Münster, 1998). –, Religion und Lebensformen: Katholische Konfessionalisierung im Sendgericht des Fürstbistums Münster 1570–1800 (Paderborn, 2000). Hoppit, Julian (Hg.), Failed legislation, 1660–1800, extracted from the Commons and Lords Journals, eingel. v. ders. und Joanna Innes (London, 1987). Horn, D. B., »The origins of the proposed election of a King of the Romans«, English Historical Review, XII (1927), 361–370.
Literatur
Houtman-de Smet, Helma. »The ambitions of the Austrian empire with reference to East India during the last quarter of the eighteenth century«, in: Sushil Chaudhury und Michel Morineau (Hgg.), Merchants, companies and trade: Europe and Asia in the early modern era (Cambridge, 1999), 227–239. Hughes, Michael, Law and politics in eighteenth century Germany: The Imperial Aulic Council in the reign of Charles VI (Woodbridge, 1988). –, Early modern Germany, 1477–1806 (Houndmills, 1992). Hufeld, Ulrich (Hg.), Der Reichsdeputationshauptschluss von 1803 (Köln, 2003). Hugo, Ludolf, Zur Rechtsstellung der Gebietsherrschaften in Deutschland, eingel. v. Jörg-Detlef Kühne (Münster, 2005). Humboldt, Wilhelm von, Werke in fünf Bänden, hg. v. Andreas Flitner und Klaus Giel, 5 Bde. (Darmstadt 1960–1981). –, The limits of state action, hg. v. J. W. Burrow (Cambridge, 1969). Hunter, Ian, Rival Enlightenments: Civil and metaphysical philosophy in early modern Germany (Cambridge, 2001). –, »Multiple Enlightenments: Rival Aufklärer at the University of Halle, 1690–1730«, in: Martin Fitzpatrick, Peter Jones, Christa Knellwolf und Iain McCalman (Hgg.), The Enlightenment world (Abingdon, 2004), 576–595. –, The secularisation of the confessional state: The political thought of Christian Thomasius (Cambridge, 2007). Hurlebusch, Rose-Maria und Karl Ludwig Schneider, »Die Gelehrten und die Großen: Klopstock’s ›Wiener Plan‹«, in: Rudof Vierhaus und Fritz Hartmann (Hgg.), Der Akademiegedanke im 17. und 18. Jahrhundert (Wolfenbüttel, 1975), 63–87. Hüttl, Ludwig, »Der Beitrag deutscher Reichsstände zur Rückeroberung Ungarns von den Osmanen«, in: Josef Schröder (Hg.), Beiträge zu Kirche, Staat und Geistesleben (Stuttgart, 1994). Ingrao, Charles W., In quest and crisis: Emperor Joseph I and the Habsburg monarchy (West Lafayette, IN, 1979). –, The Hessian mercenary state: Ideas, institutions, and reform under Frederick II, 1760–1785 (Cambridge, 1987). –, The Habsburg monarchy 1618–1815 (Cambridge, 1994). –, »Introduction: A pre-revolutionary Sonderweg«, German History, XX (2002), 279–286. Israel, Jonathan I., »Germany and its Jews: A changing relationship (1300–1800)«, in: R. Pochia Hsia und Hartmut Lehmann (Hgg.), In and out of the Ghetto: Jewish-gentile relations in late medieval and early modern Germany (New York, 1995), 295–304. –, The Dutch Republic: Its rise, greatness and fall, 1476–1806 (Oxford, 1995). –, European Jewry in the age of mercantilism, 3. Aufl. (London, 1998). –, Radical Enlightenment: Philosophy and the making of modernity 1650–1750 (Oxford, 2001). –, Enlightenment contested: Philosophy, modernity, and the emancipation of man 1670–1752 (Oxford, 2006). Jedin, Hubert, Kenneth Scott Lackourette und Jochen Martin (Hgg.), Atlas zur Kirchengeschichte: Die Christlichen Kirchen in Geschichte und Gegenwart (3., rev. Aufl., Freiburg, 2004). Jenisch, Daniel, Geist und Charakter des achtzehnten Jahrhunderts, politisch, moralisch, ästhetisch und wissenschaftlich betrachtet, 3 Bde. (Berlin, 1800–1801).
773
774
Literatur
Jersch-Wenzel, Stefi, Juden und »Franzosen« in der Wirtschaft des Raumes Berlin/Brandenburg (Berlin, 1978). Jeserich, Kurt G. A., Hans Pohl und Georg Christoph von Unruh (Hgg.), Deutsche Verwaltungsgeschichte, Band 1: Vom Spätmittel alter bis zum Ende des Reiches (Stuttgart, 1983). Jessen, Peter, Der Einfluß von Reichshofrat und Reichskammergericht auf die Entstehung und Entwicklung des Oberappellationsgerichts Celle: Unter besonderer Berücksichtigung des Kampfes um das kurhannoversche Privilegium »De non appellando illimitatum« (Aalen, 1986). Johnson, Trevor, »Holy fabrications: The catacomb saints and the Counter-Reformation in Bavaria«, Journal of Ecclesiastical History, XLVII (1996), 274–297. Jorio, Marco (Hg.), Historisches Lexikon der Schweiz (Basel, 2002–). Jörn, Nils, »Beobachtungen zur Steuerzahlung der Territorien des südlichen Ostseeraumes in der Frühen Neuzeit«, in: ders. (Hg.), Die Integration des südlichen Ostseeraumes in das Alte Reich (Köln, 2000), 312–391. –, »Die Versuche von Kaiser und Reich zur Einbeziehung der Hanse in die Anstrengungen zur Abwehr der Türken im 16. und 17. Jahrhundert«, in: ders. (Hg.), Die Integration des südlichen Ostseeraumes in das Alte Reich (Köln, 2000), 393–423. Julku, Kyösti, Die revolutionäre Bewegung im Rheinland am Ende des achtzehnten Jahrhunderts (Helsinki, 1965). Jürgensmeier, Friedhelm, Johann Philipp von Schönborn (1605–1673) und die Römische Kurie: Ein Beitrag zur Kirchengeschichte des 17. Jahrhunderts (Mainz, 1977). Just, Leo, »Österreichs Westpolitik im 18. Jahrhundert«, Rheinische Vierteljahrsblätter, V (1935), 1–15. –, »Grenzsicherungspläne im Westen des Reiches zur Zeit des Prinzen Eugen (1663–1736)«, Rheinische Vierteljahrsblätter, VI (1936), 230–243. –, »Wie Lothringen dem Reich verloren ging«, Rheinische Vierteljahrsblätter, VII (1937), 215– 227. Jütte, Robert, »Poverty and poor relief«, in: Sheilagh Ogilvie (Hg.), Germany: A new social and economic history, Vol. 2: 1630–1800 (London, 1996), 377–404. Kaiser, Marianne, Mitternacht – Zeidler – Weise: Das protestantische Schultheater nach 1648 im Kampf gegen höfische Kultur und absolutistisches Regiment (Göttingen, 1972). Kampmann, Christoph, »Der Immerwährende Reichstag als ›erstes stehendes Parlament‹ ? Aktuelle Forschungsfragen und ein deutsch-englischer Vergleich«, Geschichte in Wissenschaft und Unterricht, LV (2004), 646–662. Kant, Immanuel, Political Writings, hg. v. Hans Reiss (Cambridge, 1970). –, Was ist Aufklärung? Aufsätze zur Geschichte und Philosophie, hg. v. Jürgen Zehbe, 2. Aufl. (Göttingen, 1975). Kappelhoff, Bernd, Absolutistisches Regiment oder Ständeherrschaft? Landesherr und Landstände in Ostfriesland im ersten Drittel des 18. Jahrhunderts (Hildesheim, 1982). Kapr, Albert, Fraktur: Form und Geschichte der gebrochenen Schriften (Mainz, 1993). Karge, Wolf, Ernst Münch und Hartmut Schmied, Die Geschichte Mecklenburgs (Rostock, 1993). Kaufhold, Karl Heinrich, »Gewerbelandschaften in der Frühen Neuzeit (1650–1800)«, in: Hans Pohl (Hg.), Gewerbe- und Industrielandschaften vom Spätmittelalter bis ins 20. Jahrhundert (Stuttgart, 1986), 112–202. Keeton, Kenneth, »The Berliner Montagsklub, a center of German Enlightenment«, Germanic Review, XXXVI (1961), 148–153.
Literatur
Kell, Eva, Das Fürstentum Leiningen: Umbruchserfahrungen einer Adelsherrschaft zur Zeit der Französischen Revolution (Kaiserslautern, 1993). Kemiläinen, Aira, Auffassungen über die Sendung des deutschen Volkes um die Wende des 18. und 19. Jahrhunderts (Helsinki, 1956). Kempe, Michael, Wissenschaft, Theologie, Aufklärung: Johann Jakob Scheuchzer (1672–1733) und die Sintfluttheorie (Epfendorf, 2003). – und Thomas Maissen, Die Collegia der Insulaner, Vertraulichen und Wohlgesinnten in Zürich, 1679–1709 (Zürich, 2002). Kennecke, Andreas, »Hame’assef: Die erste moderne Zeitschrift der Juden in Deutschland«, Das Achtzehnte Jahrhundert, XXIII (1999), 176–199. –, Isaac Abraham Euchel: Architekt der Haskala (Göttingen, 2007). Kerry, Paul E., Enlightenment thought in the writings of Goethe: A contribution to the history of ideas (Rochester, NY, 2001). Khevenhüller-Metsch, Johann Josef, Aus der Zeit Maria Theresias: Tagebuch des Fürsten J. J. Khevenhüller-Metsch, Kaiserlichen Oberhofmeisters 1742–1776, hg. v. Rudolf Graf Khevenhuller-Metsch, Hanns Schlitter, Maria Breunlich-Pawlik und Hans Wagner, 8 Bde. (Wien, 1907–1972). Kiesel, Helmut, »Problem und Begründung der Toleranz im 18. Jahrhundert«, in: Horst Rabe, Hansgeorg Molitor und Hans-Christoph Rublack (Hgg.), Festgabe für Ernst Walter Zeeden zum 60. Geburtstag am 14. Mai 1976 (Münster, 1976), 370–385. –, »Bei Hof, bei Höll«: Untersuchungen zur literarischen Hofkritik von Sebastian Brant bis Friedrich Schiller (Tübingen, 1979). – und Paul Münch, Gesellschaft und Literatur im 18. Jahrhundert: Voraussetzungen und Entstehung des literarischen Markts in Deutschland (München, 1977). Killy, Walther (Hg.), Literatur-Lexikon: Autoren und Werke deutscher Sprache, 15 Bde. (Gütersloh und München, 1988–1993). – und Rudolph Vierhaus (Hgg.), Deutsche Biographische Enzyklopädie, 13 Bde. in 15 (Darmstadt, 1995–2003). Kisch, Herbert, »Prussian mercantilism and the rise of the Krefeld silk industry: Variations on an eighteenth-century theme«, Transactions of the American Philosophical Society, N.S., LVIII, No. 7 (1968), 3–50. –, »From monopoly to laissez-faire: the early growth of the Wupper valley textile trades«, Journal of European Economic History, I (1972), 298–407. Kissling, Peter, »›Gute Policey‹ und Konfessionalisierung im Berchtesgadener Land«, in: Karl Härter (Hg.), Policey und frühneuzeitliche Gesellschaft (Frankfurt am Main, 2000), 71–105. –, »Policeyreformationen: Eine Skizze der Policey im Fürststift Kempten in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts«, in: Wolfgang Wüst (Hg.), Geistliche Staaten in Oberdeutschland im Rahmen der Reichsverfassung: Kultur – Verfassung – Wirtschaft – Gesellschaft; Ansätze zu einer Neubewertung (Epfendorf, 2002), 187–203. Kittstein, Lothar, Politik im Zeitalter der Revolution: Untersuchungen zur preußischen Staatlichkeit 1792–1806 (Stuttgart, 2003). Klein, Thomas, »Die Erhebungen in den weltlichen Reichsfürstenstand 1550–1806«, Blätter für deutsche Landesgeschichte, XCCII (1986), 261–335. Kleinheyer, Gerd, Die kaiserlichen Wahlkapitulationen: Geschichte, Wesen, Funktion (Karlsruhe, 1968). –, »Die Abdankung des Kaisers«, in: Gerhard Köbler (Hg.), Wege europäischer Rechtsgeschichte (Frankfurt am Main, 1987), 124–144.
775
776
Literatur
Klinger, Andreas, Der Gothaer Fürstenstaat: Herrschaft, Konfession und Dynastie unter Herzog Ernst dem Frommen (Husum, 2002). –, »Die ›deutsche Freiheit‹ im Revolutionsjahrzehnt 1789–1799«, in: Georg Schmidt, Martin van Gelderen und Christopher Snigula (Hgg.), Kollektive Freiheitsvorstellungen im frühneuzeitlichen Europa, 1400–1850 (Frankfurt am Main, 2006), 447–471. Klippel, Diethelm, Politische Freiheit und Freiheitsrechte im deutschen Naturrecht des 18. Jahrhunderts (Paderborn, 1976). –, »Politische Theorien im Deutschland des 18. Jahrhunderts«, Aufklärung, II (1988), 57–88. –, »The true concept of liberty. Political theory in Germany in the second half of the eighteenth century«, in: Eckhart Hellmuth (Hg.), The transformation of political culture: England and Germany in the late eighteenth century (Oxford, 1990), 447–466. –, »Von der Aufklärung der Herrscher zur Herrschaft der Aufklärung«, Zeitschrift für historische Forschung, XVII (1990), 193–210. Klueting, Harm, »›Bürokratischer Patriotismus‹ : Aspekte des Patriotismus im theresianischjosephinischen Österreich«, Aufklärung, IV (1991), 37–52. –, Das Reich und Österreich 1648–1740 (Münster 1999). –, »Grafschaft und Großmacht: Mindermächtige Reichsstände unter dem Schutz des Reiches oder Schachfiguren im Wechselspiel von Großmachtinteressen. Der Weg der Grafschaft Tecklenburg vom gräflichen Territorium zur preußischen Provinz«, in: Helmut Neuhaus (Hg.), Menschen und Strukturen in der Geschichte Alteuropas: Festschrift für Johannes Kunisch zur Vollendung seines 65. Lebensjahres, dargebracht von Schülern, Freunden und Kollegen (Berlin, 2002), 103–131. –, »Wiedervereinigung der getrennten Konfessionen oder episkopalische Nationalkirche? Nikolaus von Hontheim (1701–1790), der ›Febronius‹ (1763) und die Rückkehr der Protestanten zur katholischen Kirche«, in: ders. (Hg.), Irenik und Antikonfessionalismus im 17. und 18. Jahrhundert (Hildesheim, 2003) 258–277. – (Hg.), 200 Jahre Reichsdeputationshauptschluß: Säkularisation, Mediatisierung und Modernisierung zwischen Altem Reich und neuer Staatlichkeit (Münster, 2005). –, »Zweihundert Jahre Reichsdeputationshauptschluß: Säkularisation und Mediatisierung 1802/03 in der Literatur um das Gedenkjahr 2003«, Historische Zeitschrift, CCLXXXVI (2008), 403–417. Kluge, Arndt, Die Zünfte (Stuttgart, 2007). Klußmann, Jan, »Leibeigenschaft im frühneuzeitlichen Schleswig-Holstein: Rechtliche Entwicklung, öffentlicher Diskurs und bäuerliche Perspektive«, in: ders. (Hg.), Leibeigenschaft: Bäuerliche Unfreiheit in der frühen Neuzeit (Köln, 2003), 213–240. Knigge, Adolph Freiherr von, Über den Umgang mit Menschen, eingel. v. Max Rychner (Birsfelden-Basel, o. J.). Knoll, Martin, Umwelt, Herrschaft, Gesellschaft: Die landesherrliche Jagd Kurbayerns im 18. Jahrhundert (St. Katharinen, 2004). Knox, R. A., Enthusiasm: A chapter in the history of religion (Oxford, 1950). Knudsen, Jonathan, Justus Möser and the German Enlightenment (Cambridge, 1986). Köbler, Gerhard, Historisches Lexikon der deutschen Länder: Die deutschen Territorien vom Mittelalter bis zur Gegenwart, 7. Aufl. (München, 2007). Koch, Rainer, »Wahl und Krönung in Frankfurt am Main am Beispiel Karls VII.«, in: Bernd Heidenreich und Frank L. Kroll (Hgg.), Wahl und Krönung (Frankfurt am Main, 2006), 205–222.
Literatur
Kocka, Jürgen, »Asymmetrical historical comparison: The case of the German Sonderweg«, History and Theory, XXXVIII (1999), 40–50. Kohler, Alfred, »Das Reich im Spannungsfeld des preussisch-österreichischen Gegensatzes«, in: Friedrich Engel-Jánosi, Grete Klingenstein und Heinrich Lutz (Hgg.), Fürst, Bürger, Mensch: Untersuchungen zu politischen und soziokulturellen Wandlungsprozessen im vorrevolutionären Europa (Wien, 1975), 71–96. Kollmer, Gert, Die schwäbische Reichsritterschaft zwischen Westfälischem Frieden und Reichsdeputationshauptschluß: Untersuchungen zur wirtschaftlichen und sozialen Lage der Reichsritterschaft in den Ritterkantonen Necker-Schwarzwald und Kocher (Stuttgart, 1979). –, »Die wirtschaftliche und soziale Lage der Reichsritterschaft im Ritterkanton NeckarSchwarzwald 1648–1805«, in: Franz Quarthal (Hg.), Zwischen Schwarzwald und Schwäbischer Alb: Das Land am oberen Neckar (Sigmaringen, 1984), 285–301. Kopitzsch, Franklin, »Die Sozialgeschichte der deutschen Aufklärung als Forschungsaufgabe«, in: ders. (Hg.), Aufklärung, Absolutismus und Bürgertum in Deutschland (München, 1976), 11–169. –, Grundzüge einer Sozialgeschichte der Aufklärung in Hamburg und Altona (Hamburg, 1982). Koser, Reinhold, Geschichte Friedrichs des Großen.Vierte und fünfte vermehrte Auflage, 4 Bde., Stuttgart/Berlin 1912–1914. Kraus, Hans-Christof, »Gegenaufklärung, Spätromantik, Konservatismus. Zu einigen neueren Veröffentlichungen«, Historische Zeitschrift, CCLXVI (1999), 371–413. –, »Friedrich der Große als Philosoph von Sanssouci«, in: Bernd Heidenreich und Frank-Lothar Kroll (Hgg.), Macht- oder Kulturstaat? Preußen ohne Legende (Berlin, 2002), 111–124. –, Das Ende des alten Deutschland: Krise und Auflösung des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation 1806, 2. Aufl. (Berlin, 2007). Krause, Gerhard und Gerhard Müller (Hgg.), Theologische Realenzyklopädie, 38 Bde. (Berlin, 1977–2007). Krausen, Edgar, »Die Verehrung römischer Katakombenheiliger in Altbayern im Zeitalter des Barock«, Bayerisches Jahrbuch für Volkskunde (1966/67), 38–48. Krauß, Martin, Armenwesen und Gesundheitsfürsorge in Mannheim vor der Industrialisierung, 1750–1850/60 (Sigmaringen, 1993). Krauth, Wolf-Hagen, »Gemeinwohl als Interesse: Die Konstruktion einer territorialen Ökonomie am Beginn der Neuzeit«, in: Herfried Münkler (Hg.), Gemeinwohl und Gemeinsinn: Historische Semantiken politischer Leitbegriffe (Berlin, 2001), 191–212. Kremer, Bernd Mathias, Der Westfälische Friede in der Deutung der Aufklärung: Zur Entwicklung des Verfassungsverständnisses im Hl. Röm. Reich Deutscher Nation vom Konfessionellen Zeitalter bis ins späte 18. Jahrhundert (Tübingen. 1989). Kremer, Stephan, Herkunft und Werdegang geistlicher Führungsschichten in den Reichsbistümern zwischen Westfälischem Frieden und Säkularisation: Fürstbischöfe – Weihbischöfe – Generalvikare (Freiburg, 1992). Kretschmer, Konrad, Historische Geographie von Mitteleuropa (München und Berlin, 1904). Kriedte, Peter, »Trade«, in: Sheilagh Ogilvie (Hg.), Germany: A new social history, Vol. 2, 1630– 1800 (London, 1996), 100–133. –, »›Denen Holländern nach und nach … abgelernt und abgejagt‹ : Der Aufstieg des Krefelder Seidengewerbes im 18. Jahrhundert«, in: Dietrich Ebeling (Hg.), Aufbruch in eine neue Zeit: Gewerbe, Staat und Unternehmer in den Rheinlanden des 18. Jahrhunderts (Köln, 2000), 87–104.
777
778
Literatur
Krieger, Leonard, The German idea of freedom: History of a political tradition from the Reformation to 1871 (Chicago, 1957). Krieger, Martin, Patriotismus in Hamburg: Identitätsbildung im Zeitalter der Frühaufklärung (Köln, 2008). Krischner, André, Reichsstädte in der Fürstengesellschaft: Politischer Zeichengebrauch in der Frühen Neuzeit (Darmstadt, 2006). Krüger, Kersten, Die landständische Verfassung (München, 2003). –, »Die landschaftliche Verfassung Nordelbiens in der frühen Neuzeit: Ein besonderer Typ politischer Partizipation«, in: ders., Formung der frühen Moderne: Ausgewählte Aufsätze (Münster, 2005), 199–224. Kubin, Ernst, Die Reichskleinodien: Ihr tausendjähriger Weg (Wien und München, 1991). Kuhn, Axel und Jörg Schweigard, Freiheit oder Tod! Die deutsche Studentenbewegung zur Zeit der Französischen Revolution (Köln, 2005). Kulenkampff, Angela, Österreich und das Alte Reich: Die Reichspolitik des Staatskanzlers Kaunitz unter Maria Theresia und Joseph II. (Köln, 2005). Kunisch, Johannes, Staatsverfassung und Mächtepolitik: Zur Genese von Staatenkonflikten im Zeitalter des Absolutismus (Berlin, 1979). –, »Hausgesetzgebung und Mächtesystem: Zur Einbeziehung hausvertraglicher Erbfolgeregelungen in der Staatenpolitik des ancien régime«, in: ders. (Hg.), Der dynastische Fürstenstaat: Zur Bedeutung von Sukzessionsordnungen für die Entstehung des frühmodernen Staates (Berlin, 1982), 49–80. –, Absolutismus: Europäische Geschichte vom Westfälischen Frieden bis zur Krise des Ancien Régime (Göttingen, 1986). Kurowski, Franz, Der Deutsche Orden: 800 Jahre Geschichte einer ritterlichen Gesellschaft (München, 1997). Kusber, Jan, »Russland, Europa und der Untergang des Alten Reiches«, in: Michael North (Hg.), Das Ende des Alten Reiches im Ostseeraum: Wahrnehmungen und Transformationen (Köln, 2008), 55–69. Kutz, Martin, »Die Entwicklung des Außenhandels Mitteleuropas zwischen Französischer Revolution und Wiener Kongress«, Geschichte und Gesellschaft, VI (1980), 538–558. Lachenicht, Susanne, »Die Freiheitskonzession des Landgrafen von Hessen-Kassel, das Edikt von Potsdam und die Ansiedlung von Hugenotten in Brandenburg-Preussen und HessenKassel«, in: Guido Braun und Susanne Lachenicht (Hgg.), Hugenotten und deutsche Territorialstaaten: Immigrationspolitik und Integrationsprozesse (München, 2007), 71–83. Laeven, Augustinus Hubertus, De »Acta eruditorum« onder redactie van Otto Mencke (1644– 1707): De geschiedenis van een internationaal geleerdenperiodiek tussen 1682 en 1707 (Amsterdam, 1986). Lahrkamp, Helmut, Unter dem Krummstab: Münster und das Münsterland nach dem Westfälischen Frieden bis zum Sturz Napoleons (Münster, 1999). Lamport, Francis, »Lessing, bourgeois drama and the national theatre«, in: Barbara BeckerCantorino (Hg.), German literature of the eighteenth century: The Enlightenment and sensibility (Rochester, NY, 2005), 155–182. Lanczkowski, Johanna, Kleines Lexikon des Mönchtums und der Orden (Stuttgart, 1993). Lange, Peter, »Kleinstaatlichkeit und Wirtschaftsentwicklung in Thüringen«, in: Jürgen John (Hg.), Kleinstaaten und Kultur in Thüringen vom 16.–20. Jahrhundert (Weimar, 1994), 187– 203.
Literatur
Lange, Ulrich, »Der ständestaatliche Dualismus: Bemerkungen zu einem Problem der deutschen Verfassungsgeschichte«, Blätter für deutsche Landesgeschichte, CXVII (1981), 311– 334. Langewiesche, Dieter, »Das Alte Reich nach seinem Ende: Die Reichsidee in der deutschen Politk des 19. und frühen 20. Jahrhunderts; Versuch einer nationalgeschichtlichen Neubewertung in welthistorischer Perspektive«, in: ders., Reich, Nation, Föderation: Deutschland und Europa (München, 2008), 211–234. –, »Kleinstaat – Nationalstaat: Staatsbildungen des 19. Jahrhunderts in der frühneuzeitlichen Tradition des zusammengesetzten Staates«, in: ders., Reich, Nation, Föderation: Deutschland und Europa (München, 2008), 194–210. Lau, Theodor Ludwig, Meditationes philosophiae de Deo, Mundo, Homine (1717): Meditationes, Theses, Dubia philosophico-theologica (1719), hg. v. Martin Pott (Stuttgart-Bad Cannstadt, 1992). Lau, Thomas, »Die Reichsstädte und der Reichshofrat«, in: Wolfgang Sellert (Hg.), Reichshofrat und Reichskammergericht: Ein Konkurrenzverhältnis (Köln, 1999), 129–153. –, »Stiefbrüder«: Nation und Konfession in der Schweiz und in Europa (1656–1712) (Köln, 2008). Laursen, John Christian, »Publicity and cosmopolitanism in late eighteenth-century Germany«, History of European Ideas, XVI (1993), 117–122. La Vopa, Anthony J., »The revelatory moment: Fichte and the French Revolution«, Central European History, XXII (1989), 130–159. –, Fichte: The self and the calling of philosophy, 1762–1799 (Cambridge, 2001). Lederer, David, Madness, religion and the state in early modern Europe: A Bavarian beacon (Cambridge, 2006). Leeb, Rudolph, »Die große Salzburger Emigration von 1731/32 und ihre Vorgeschichte (Ausweisung der Deferegger 1684)«, in: Joachim Bahlcke (Hg.), Glaubensflüchtlinge: Ursachen, Formen und Auswirkungen frühneuzeitlicher Konfessionsmigration in Europa (Berlin, 2008), 277–305. Lehmann, Hannelore, »Die Herausbildung manufakturkapitalistischer Verhältnisse: Der brandenburgisch-preußischer Militärstaat (1688 bis 1740)«, in: Adolf Laube und Günter Vogler (Hgg.), Deutsche Geschichte, Band 3: DieEpochedes Übergangsvom Feudalismuszum Kapitalismsus von den siebziger Jahren des 15. Jahrhunderts bis 1789 (Berlin, 1983), 363–418. Lehmann, Hartmut, Pietismus und weltliche Ordnung in Württemberg vom 17. bis zum 20. Jahrhundert (Stuttgart, 1969). Lehner, Ulrich L., »Ecumenism and Enlightenment Catholicism: Beda Mayr O.S.B. (1742– 1794)«, in: Beda Mayr, Vertheidigung der katholischen Religion: Sammt einem Anhange von der Möglichkeit einer Vereinigung zwischen unserer, und der evangelischlutherischen Kirche (1789), hg. v. Ulrich L. Lehner (Leiden, 2009), IX–LXXIV. Leibniz, G. W., Unvorgreifliche Gedanken, betreffend die Ausübung und Verbesserung der deutschen Sprache: Zwei Aufsätze, hg. v. Uwe Pörksen (Stuttgart, 1983). Leppin, Volker, »›… das der Römische Antichrist offenbaret und das helle Liecht des Heiligen Evangelii wiederumb angezündet‹ : Memoria und Aggression im Reformationsjubiläum 1617«, in: Heinz Schilling (Hg.), Konfessioneller Fundamentalismus: Religion als politischer Faktor im europäischen Mächtesystem um 1600 (München, 2007), 115–131. Lexikon des Mittelalters, 10 Bde. (München, 1980–1999). Liberles, Robert, »From toleration to Verbesserung: German and English debates on the Jews in the eighteenth century«, Central European History, XXII (1989), 3–32.
779
780
Literatur
Liebel, Helen P., »Enlightened bureaucracy versus enlightened despotism in Baden, 1750– 1792«, Transactions of the American Philosophical Society, N.S., LV (1965), 1–132. –, »Enlightened despotism and the crisis of society in Germany«, Enlightenment Essays, I (1976), 151–168. –, »The election of Joseph II and the challenge to imperial unity in Germany, 1763–64«, Canadian Journal of History, XV (1980), 371–397. Lindemann, Mary, Patriots and paupers: Hamburg, 1712–1830 (Oxford, 1990). –, Health and healing in eighteenth-century Germany (Baltimore, MD, 1996). Lindenfeld, David E., The practical imagination: The German sciences of state in the nineteenth century (Chicago, 1997). Link, Christoph, Herrschaftsordnung und bürgerliche Freiheit: Grenzen der Staatsgewalt in der älteren deutschen Staatslehre (Wien, 1979). –, »Dietrich Reinkingk«, in: Michael Stolleis (Hg.), Staatsdenker im 17 und 18. Jahrhundert: Reichspublizistik, Politik, Naturrecht, 2. Aufl. (Frankfurt am Main, 1987), 78–99. –, »Johann Stephan Pütter«, in Michael Stolleis (Hg.), Staatsdenker im 17 und 18. Jahrhundert: Reichspublizistik, Politik, Naturrecht, 2. Aufl. (Frankfurt am Main, 1987), 310–331. Lorenz, Hellmut, »Der habsburgische Reichsstil – Mythos und Realität«, in: Thomas W. Gaethgens (Hg.), Künstlerische Austausch – Artistic exchange: Akten des XXVIII. Internationalen Kongresses für Kunstgeschichte (15.–20. Juli 1992) (Berlin, 1992), 163–176. Lorenz, Reinhold, Türkenjahr 1683: Das Reich im Kampfum den Ostraum, 3. Aufl. (Wien, 1933). Lorenzen-Schmidt, Klaus-J., »Die Kremper-Marsch-Commüne: Gemeindestrukturen in den holsteinischen Elbmarschen 1470–1890«, in: Ulrich Lange (Hg.), Landgemeinde und frühmoderner Staat: Beiträge zum Problem der gemeindlichen Selbstverwaltung in Dänemark, Schleswig-Holstein und Niedersachsen in der frühen Neuzeit (Sigmaringen, 1988), 115–128. Louthan, Howard, Converting Bohemia: Force and persuasion in the Catholic Reformation (Cambridge, 2009). Luebke, David Martin, His Majesty’s Rebels: Communities, factions and rural revolt in the Black Forest, 1725–45 (Ithaca, NY, und London, 1997). –, »Erfahrungen von Leibeigenschaft: Konturen eines Diskurses im Südschwarzwald 1660– 1745«, in: Jan Klußmann (Hg.), Leibeigenschaft: Bäuerliche Unfreiheit in der frühen Neuzeit (Köln, 2003), 175–197. –, »Signatures and political culture in eighteenth-century Germany«, Journal of Modern History, LXXVI (2004), 497–530. Luh, Jürgen, Unheiliges Römisches Reich: Der konfessionelle Gegensatz 1648 bis 1806 (Potsdam, 1995). Luig, Klaus, »Christian Thomasius«, in: Michael Stolleis (Hg.), Staatsdenker im 17. und 18. Jahrhundert: Reichspublizistik, Politik, Naturrecht, 2. Aufl. (Frankfurt am Main, 1987), 227– 256. Lütge, Friederich, Geschichte der deutschen Agrarverfassung vom frühen Mittelalter bis zum 19. Jahrhundert, 2. Aufl. (Stuttgart, 1967). Lutterbeck, Klaus-Gert, Staat und Gesellschaft bei Christian Thomasius und Christian Wolff: Eine historische Untersuchung in systematischer Absicht (Stuttgart-Bad Cannstadt, 2002). Lynn, John A., The wars of Louis XIV, 1667–1714 (London, 1999). McClelland, Charles E., State, society and university in Germany 1700–1914 (Cambridge, 1980). McKay, Derek und H. M. Scott, The rise of the great powers 1648–1815 (London, 1983).
Literatur
Mader, Eric-Oliver, »Das Alte Reich in neuem Licht: Perspektiven auf sein Ende und sein Nachwirken im frühen 19. Jahrhundert«, in: Arndt Brendecke und Wolfgang Burgdorf (Hgg.), Wege in die Frühe Neuzeit (Neuried, 2001), 235–257. –, »›Soldateske‹ des Reichskammergerichts: Das reichskammergerichtliche Botenwesen am Ende des Alten Reichs«, in: Anette Baumann, Peter Oestmann, Stephan Wendehorst und Siegrid Westphal (Hgg.), Reichspersonal: Funktionsträger für Kaiser und Reich (Köln, 2003), 265–290. –, Das Reichskammergericht, der Reichsdeputationshauptschluss und die Auflösung des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation (Wetzlar, 2005). –, Die letzten »Priester der Gerechtigkeit«: Die Auseinandersetzung der letzten Generation von Richtern des Reichskammergerichts mit der Auflösung des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation (Berlin, 2005). Magen, Ferdinand, Reichsexekutive und regionale Selbstverwaltung im späten 18. Jahrhundert: Zu Funktion und Bedeutung der süd- und westdeutschen Reichskreise bei der Handelsregulierung im Reich aus Anlaß der Hungerkrise von 1770/72 (Berlin, 1992). Mah, Harold, Enlightenment phantasies: Cultural identity in France and Germany, 1750–1914 (Ithaca, NY, 2003). Maier, Hans, Die ältere deutsche Staats- und Verwaltungslehre, 2. Aufl. (München, 1980). Maks, Herbert, »Preußen im Konzert der Mächte: Möglichkeiten einer nachfriderizianischen Außenpolitik, 1786–1792«, Forschungen zur brandenburgischen und preußischen Geschichte, N.F. IX (1999), 145–184. Malcolm, Noel, Aspects of Hobbes (Oxford, 2002). Marchand, Suzanne L., Down from Olympus: Archeology and philhellenism in Germany, 1750– 1970 (Princeton, 1996). Marquardt, Bernd, Das Römisch-Deutsche Reich als segmentäres Verfassungssystem (1348– 1806/48): Versuch zu einer neuen Verfassungstheorie auf der Grundlage der lokalen Herrschaften (Zürich, 1999). –, »Zur reichsgerichtlichen Aberkennung der Herrschergewalt wegen Missbrauchs: Tyrannenprozesse vor dem Reichshofrat am Beispiel des südöstlichen schwäbischen Reichskreises«, in: Anette Baumann, Peter Oestmann, Stephan Wendehorst und Siegrid Westphal (Hgg.), Prozesspraxis im Alten Reich: Annäherungen, Fallstudien, Statistiken (Köln, 2005), 53–89. Marri, Fabio, »Muratori und Deutschland: Ansätze zu einer Geschichte der Rezeption«, in: Frederica La Manna (Hg.), Commercium: Scambi culturali italo-tedeschi nel XVIII secolo – Deutsch-italienischer Kulturaustausch im 18. Jahrhundert (Florence, 2000), 43–64. Martino, Lauro, »Barockpoesie, Publikum und Verbürgerlichung der literarischen Intelligenz«, Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur, I (1976), 107–145. Marx, Hans Joachim, »Geschichte der Hamburger Barockoper: Ein Forschungsbericht«, Hamburger Jahrbuch für Musikwissenschaft, III (1978), 7–34. Matsche, Franz, Die Kunst im Dienste der Staatsidee Kaiser Karls VI.: Ikonographie, Ikonologie und Programmatik des »Kaiserstils«, 2 Bde. (Berlin, 1981). –, »Prachtbau und Prestigeanspruch in Festsälen süddeutscher Klöster im frühen 18. Jahrhundert: Zum Typus und zur Verbreitung des Kolonnadensaals und zur Frage des ›Reichsstils‹«, in: Markwart Herzog (Hg.), Himmel auf Erden oder Teufelsbauwurm? Wirtschaftliche und soziale Grundlagen des süddeutschen Klosterbarock (Konstanz, 2002), 81–118. Mattheier, Klaus J., »Gemeines Deutsch – Süddeutsche Reichssprache – Jesuitendeutsch: Bemerkungen über die Rolle Süddeutschlands in der Geschichte der nhd. Schriftsprache«, in:
781
782
Literatur
Erwin Koller, Werner Wegstein und Norbert Richard Wolf (Hgg.), Bayerisch-österreichische Dialektforschung (Würzburg, 1989), 160–166. Mattiesen, Otto Heinz, Die Kolonial- und Überseepolitik der kurländischen Herzöge im 17. und 18. Jahrhundert (Stuttgart, 1940). Matz, Klaus Jürgen, »Das Elsass als Teil der französischen Monarchie (1648–1789)«, in: Michael Erbe (Hg.), Das Elsass: Historische Landschaft im Wandel der Zeiten (Stuttgart, 2002), 85–101. Mauerer, Esteban, Südwestdeutscher Reichsadel im 17. und 18. Jahrhundert: Geld, Reputation, Karriere. Das Haus Fürstenberg (Göttingen, 2001). Maur, Eduard, Gutsherrschaft und »zweite Leibeigenschaft« in Böhmen: Studien zur Wirtschafts-, Sozial- und Bevölkerungsgeschichte (14.–18. Jahrhundert) (München, 2001). Maurer, Michael, Die Biographie des Bürgers: Lebensformen und Denkweisen in der formativen Phase des deutschen Bürgertums (1680–1815) (Göttingen, 1996). –, Kirche, Staat und Gesellschaft im 17. und 18. Jahrhundert (München, 1999). Mayes, David, Communal Christianity: The life and loss of a peasant vision in early modern Germany (Leiden, 2004). Mecenseffy, Grete, Geschichte des Protestantismus in Österreich (Graz, 1981). Meid, Volker, Die deutsche Literatur im Zeitalter des Barock: Vom Späthumanismus zur Frühaufklärung, 1570–1740 (München, 2009). Meisenburg, Friedrich, Der Deutsche Reichstag während des Österreichischen Erbfolgekrieges (1740–1748) (Dillingen, 1931). Melton, Edgar, »Population structure, the market economy and the transformation of Gutsherrschaft in East Central Europe: The cases of Brandenburg and Bohemia«, German History, XVI (1998), 297–327. Melton, James Van Horn, Absolutism and the eighteenth-century origins of compulsory schooling in Prussia and Austria (Cambridge, 1988). Menk, Gerhard, Georg Friedrich von Waldeck (1620–1692): Eine biographische Skizze (Arolsen, 1992). Merten, Detlef, »Allgemeines Landrecht«, in: Wilhelm Treue (Hg.), Preußens großer König: Leben und Werk Friedrichs des Großen (Freiburg und Würzburg, 1986), 56–69. Meyer, Enno (mit Ara J. Berkian), Zwischen Rhein und Arax: Neunhundert Jahre deutscharmenische Beziehungen (Oldenburg, 1988). Meyer, Michael und Michael Brenner (Hgg.), German-Jewish history in modern times, 4 Bde. (New York, 1996–1998). Midelfort, H. C. Erik, Exorcism and Enlightenment: Johann Joseph Gassner and the demons of eighteenth-century Germany (New Haven, CT, 2005). Mikoletzky, Hann Leo, »Franz Stephan von Lothringen als Wirtschaftspolitiker«, Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs, XIII (1960), 231–257. –, Kaiser Franz I. Stephan und der Ursprung des habsburgisch-lothringischen Familienvermögens (Wien, 1961). Mikoletzky, Lorenz, »Leopold II. 1790–1792«, in: Anton Schindling und Walter Ziegler (Hgg.), Die Kaiser der Neuzeit 1519–1918 (München, 1990), 277–287. Miller, Max und Gerhard Taddey, Handbuch der historischen Stätten Deutschlands: Baden Württemberg, 2. Aufl. (Stuttgart, 1980). Minder, Robert, Kultur und Literatur in Deutschland und Frankreich: Fünf Essays (Frankfurt am Main, 1962).
Literatur
Mitchell, Phillip Marshall, Johann Christoph Gottsched (1700–1766): Harbinger of German classicism (Columbia, SC, 1995). Mittenzwei, Ingrid, Friedrich II.Von Preußen: Eine Biographie (Berlin, 1980). –, »Die kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Preußen und Österreich und ihre Auswirkungen (1740 bis 1763)«, in: Adolf Laube und Günter Vogler (Hgg.), Deutsche Geschichte, Band 3. Die Epoche des Übergangs vom Feudalismus zum Kapitalismus von den siebziger Jahren des 15. Jahrhunderts bis 1789 (Berlin, 1983), 419–459. Molitor, Hansgeorg, »Die untridentinische Reform: Anfänge kirchlicher Erneuerung in der Reichskirche«, in: Walter Brandmüller, Herbert Immenkötter und Erwin Iserloh (Hgg.), Ecclesia militans: Studien zur Konzilien- und Reformationsgeschichte; Remigius Bäumler zum 70. Geburtstag gewidmet, 2 Bde. (Paderborn, 1982), I, 399–431. Möller, Helmut, Die kleinbürgerliche Famile im 18. Jahrhundert: Verhalten und Gruppenkultur (Berlin, 1969). Möller, Horst, Aufklärung in Preußen: Der Verleger, Publizist und Geschichtsschreiber Friedrich Nicolai (Berlin, 1974). –, Vernunft und Kritik: Deutsche Aufklärung im 17. und 18. Jahrhundert (Frankfurt am Main, 1986). –, Fürstenstaat oder Bürgernation: Deutschland 1763–1815 (Berlin, 1989). Moran, Bruce T., The alchemical world of the German court: Occult philosophy and chemical medicine in the circle of Moritz of Hessen (1572–1632) (Stuttgart, 1991). Morineau, Michel, Les grandes Compagnies des Indes orientales (xvie-xixe siècles), 2. Aufl. (Paris, 1994). Mörz, Stefan, Aufgeklärter Absolutismus in der Kurpfalz während der Mannheimer Regierungszeit des Kurfürsten Karl Theodor (1742–1777) (Stuttgart, 1991). –, »The Palatinate: The Elector and the mermaid«, German History, XX (2002), 332–353. Moser, Johann Jakob, Neues Teutsches Staatsrecht, 43 Bde. (Stuttgart, Frankfurt am Main und Leipzig, 1766–1782). Möser, Justus, Sämtliche Werke, 16 Bde. (Oldenburg, Berlin und Osnabrück, 1943–1990). Mühlberger, Kurt, »Absolventen der Universität Wien in der Frühen Neuzeit: Perspektiven, Tendenzen, Quellen und offene Fragen«, in: Rainer A. Müller (Hg.), Promotionen und Promotionswesen an deutschen Hochschulen der Frühmoderne (Köln, 2001), 169–186. Mühleisen, Hans-Otto, Theo Stammen und Philipp Michael (Hgg.), Fürstenspiegel der Frühen Neuzeit (Frankfurt am Main, 1997). Mühlen, Patrik von zur, »Die Reichstheorien in der deutschen Historiographie des frühen 18. Jahrhunderts«, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germanistische Abteilung, LXXXIX (1972), 118–146. Müller, Andreas, Der Regensburger Reichstag von 1653/54: Eine Studie zur Entwicklung des Alten Reiches nach dem Westfälischen Frieden (Frankfurt am Main, 1992). Müller, Gerhard, Vom Regieren zum Gestalten: Goethe und die Universität Jena (Heidelberg, 2006). –, »Kultur als Politik in Sachsen-Weimar-Eisenach«, in: Lothar Ehrlich und Georg Schmidt (Hgg.), Ereignis Weimar-Jena: Gesellschaft und Kultur um 1800 im internationalen Kontext (Köln, 2008), 67–83. – und Jonas Maatsch, »Das ›Ereignis‹ Weimar-Jena um 1800 und seine Vorgeschichte«, in: Ereignis Weimar: Anna Amalia, Carl August und das Entstehen der Klassik 1757–1807 (Weimar, 2007), 16–37.
783
784
Literatur
Müller, Klaus, Das kaiserliche Gesandtschaftswesen im Jahrhundert nach dem Westfälischen Frieden (1648–1740) (Bonn, 1976). –, »Kurfürst Johann Wilhelm und die europäische Politik seiner Zeit«, Düsseldorfer Jahrbuch, LX (1986), 1–23. –, »Das ›Reichscamerale‹ im 18. Jahrhundert: Beiträge zur kaiserlichen Finanzpolitik«, in: Elisabeth Springer und Leopold Kammerhofer (Hgg.), Archiv und Forschung: Das Haus-, Hof- u. Staatsarchiv in seiner Bedeutung für die Geschichte Österreichs und Europas (München und Wien, 1993), 152–177. –, »Düsseldorf im 18. Jahrhundert: Zur Geschichte einer verlassenen Residenzstadt«, in: Gotthard Frühsorge, Harm Klueting und Franklin Kopitzsch (Hgg.), Stadt und Bürger im 18. Jahrhundert (Marburg, 1993), 86–102. Müller, Markus, Gemeinden und Staat in der Reichsgrafschaft Sayn-Hachenburg 1652–1799 (Wiesbaden, 2005). Müller, Matthias, Das Schloß als Bild des Fürsten: Herrschaftliche Metaphorik in der Residenzarchitektur des Alten Reiches (1470–1618) (Göttingen, 2004). Müller, Michael, »Die Beziehungen zwischen dem Schwäbischen und den rheinischen Reichskreisen im 18. Jahrhundert: Ein historisches Modell des Föderalismus im deutschen Südwesten?«, Zeitschrift des Historischen Vereins für Schwaben, C (2008), 431–446. –, Die Entwicklung des Kurrheinischen Kreises in seiner Verbindung mit dem Oberrheinischen Kreis im 18. Jahrhundert (Frankfurt am Main, 2008). Müller, Rainer A., »Kaisersäle in oberschwäbischen Reichsabteien: Wettenhausen, Kaisheim, Salem und Ottobeuren«, in: Wolfgang Wüst (Hg.), Geistliche Staaten in Oberdeutschland im Rahmen der Reichsverfassung: Kultur, Verfassung, Wirtschaft, Gesellschaft; Ansätze einer Neubewertung (Tübingen, 2002), 305–327. –, Der Fürstenhof in der Frühen Neuzeit, 2. Aufl. (München, 2004). Müller, Winfried, Die Aufklärung (München, 2002). Mulsow, Martin, Moderne aus dem Untergrund: Radikale Frühaufklärung in Deutschland 1680–1720 (Hamburg, 2002). –, Die unanständige Gelehrtenrepublik: Wissen, Libertinage und Kommunikation in der Frühen Neuzeit (Stuttgart, 2007). –, Freigeister im Gottsched-Kreis; Wolffianismus, studentische Aktivitäten und Religionskritik in Leipzig 1740–1745 (Göttingen, 2007). Münch, Paul, Lebensformen in der frühen Neuzeit (Berlin, 1992). Murk, Karl, Vom Reichsterritorium zum Rheinbundstaat: Entstehung und Funktion der Reformen im Fürstentum Waldeck (1780–1814) (Arolsen, 1995). –, »Waldeck und die Hessenanleihe (1784–1814): Ein Kleinstaat zwischen Finanznot und Reformzwang«, Hessisches Jahrbuch für Landesgeschichte, XLVII (1997), 149–169. Mussinghoff, Heinrich, »Niels Stensen (1638–1686): Arzt und Forscher, Priester und Bischof«, in: Reimund Haas (Hg.), Kirche und Frömmigkeit in Westfalen: Gedenkschrift für Alois Schröer (Münster, 2002), 187–201. Nagel, Jürgen G., »Standortkonkurrenz und regionaler Arbeitsmarkt: Der frühindustrielle Gewerbestandort Stolberg zwischen Ancien Régime und freiem Markt«, in: Dietrich Ebeling (Hg.), Aufbruch in eine neue Zeit: Gewerbe, Staat und Unternehmer in den Rheinlanden des 18. Jahrhunderts (Köln, 2000), 165–196. –, Abenteuer Fernhandel: Die Ostindienkompanien (Darmstadt, 2007). Nauen, Franz Gabriel, Revolution, idealism and human freedom: Schelling, Hölderlin and Hegel and the crisis of early German Idealism (Den Haag, 1971).
Literatur
Neue Deutsche Biographie (Berlin, 1953–). Neugebauer, Manfred, Die Kreise des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation (Wolfenbüttel, 2008). Neugebauer, Wolfgang, Absolutistischer Staat und Schulwirklichkeit in Brandenburg-Preußen (Berlin, 1985). –, Politischer Wandel im Osten: Ost- und Westpreußen von den alten Ständen zum Konstitutionalismus (Stuttgart, 1992). –, »Die Schulreform des Junkers Marwitz: Reformbestrebungen im brandenburg-preußischen Landadel vor 1806«, in: Peter Albrecht und Ernst Hinrichs (Hgg.), Das niedere Schulwesen im Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert (Tübingen, 1995), 259–322. –, »Friedrich III./I. (1688–1713)«, in: Frank-Lothar Kroll (Hg.), Preußens Herrscher: Von den ersten Hohenzollern bis Wilhelm II., 2, Aufl. (München, 2000), 113–133. –, Zentralprovinz im Absolutismus: Brandenburg im 17. und 18. Jahrhundert (Berlin, 2001). –, »Das Alte Preußen: Aspekte der neuesten Forschung«, Historisches Jahrbuch, CXXII (2002), 463–482. –, »Aufgeklärter Absolutismus, Reformabsolutismus und struktureller Wandel im Deutschland des 18. Jahrhunderts«, in: Werner Greiling, Andreas Klinger und Christoph Köhler (Hgg.), Ernst II. von Sachsen-Gotha-Altenburg: Ein Herrscher im Zeitalter der Aufklärung (Köln, 2005), 23–39. Neugebauer-Wölk, Monika, »Preußen und die Revolution in Lüttich: Zur Politik des Christian Wilhelm von Dohm 1789/90«, in: Otto Büsch und dies. (Hgg.), Preußen und die revolutionäre Herausforderung seit 1789 (Berlin und New York, 1991), 59–76. –, »Verfassungsideen in praktischer Absicht? Entwürfe für eine deutsche Republik 1792– 1799«, Comparativ, IV (1992), 62–84. –, »Das Alte Reich und seine Institutionen im Zeichen der Aufklärung: Vergleichende Betrachtungen zum Reichskammergericht und zum Fränkischen Kreistag«, Jahrbuch für fränkische Landesforschung, LVIII (1998), 299–326. –, »Reich oder Republik? Pläne und Ansätze zur republikanischen Neugestaltung im Alten Reich 1790–1800«, in: Heinz Duchhardt (Hg.), Reich oder Nation? Mitteleuropa 1780–1815 (Mainz, 1998), 21–50. Neuhaus, Helmut, »Chronologie erb- und thronfolgerechtlicher Bestimmungen europäischer Fürstenhäuser und Staaten«, in: Johannes Kunisch (Hg.), Der dynastische Fürstenstaat: Zur Bedeutung von Sukzessionsordnungen für die Entstehung des frühmodernen Staates (Berlin, 1982), 385–390. –, »Das Problem der militärischen Exekutive in der Spätphase des Alten Reiches«, in: Barbara Stollberg-Rilinger (Hg.), Staatsverfassung und Heeresverfassung in der europäischen Geschichte der frühen Neuzeit (Berlin, 1986), 297–346. –, »Hie Österreichisch – hier Fritzisch: Die Wende der 1740er Jahre in der Geschichte des Alten Reiches«, in: ders. (Hg.), Aufbruch aus dem Ancien régime: Beiträge zur Geschichte des 18. Jahrhunderts (Köln und Weimar, 1993), 57–77. –, Das Reich in der frühen Neuzeit (München, 1997). Neumann, Christoph K., »Political and diplomatic developments«, in: Suraiya N. Faroqhi (Hg.), The Cambridge History of Turkey, Vol. 3: The later Ottoman Empire, 1603–1839 (Cambridge, 2006), 44–62. Neveux, Jean Baptiste, Vie spirituelle et vie sociale entre Rhin et Baltique au XVIIe siècle: De J. Arndt à P. J. Spencer (Paris, 1967).
785
786
Literatur
Nicolai, Friedrich, Beschreibung einer Reise durch Deutschland und die Schweiz im Jahre 1781, 12 Bde. in 6 (Nachdruck, Hildesheim, 1994). Niedermeier, Michael, »Germanen in den Gärten: ›Altdeutsche Heldengräber‹, ›gotische‹ Denkmäler und die patriotische Gedächtniskultur«, in: Jost Hermand und ders., Revolutio germanica: Die Sehnsucht nach der »alten Freiheit« der Germanen, 1750–1820 (Frankfurt am Main, 2002), 21–116. Nipperdey, Thomas, Deutsche Geschichte 1800–1866: Bürgerwelt und starker Staat (München, 1983). Nisbet, H. B., »›Was ist Aufklärung?‹ The concept of Enlightenment in eighteenth-century Germany«, Journal of European Studies, XII (1982), 77–95. Nisbet, Hugh Barr, Lessing: Eine Biographie (München, 2008). Noël, Jean-François, »Zur Geschichte der Reichsbelehnungen im 18. Jahrhundert«, Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs, XXI (1969), 106–122. –, »Der Reichshofrat und das Verfassungsleben der Reichsstädte zur Zeit Josefs II.«, Jahrbuch für Geschichte der oberdeutschen Reichsstädte, XVI (1970), 121–131. –, »La conscience d’Empire en milieu populaire dans l’Allemagne du XVIIIe siècle«, in: Rainer Babel (Hg.), Identité régionale et conscience nationale en France et en Allemagne du moyen âge à l’époque moderne (Sigmaringen 1997), 119–131. Noflatscher, Heinz, »Liechtenstein, Tirol und die Eidgenossen«, in: Volker Press und Dietmar Willoweit (Hgg.), Liechtenstein, fürstliches Haus und staatliche Ordnung: Geschichtliche Grundlagen und moderne Perspektiven (Vaduz und München, 1987), 129–162. North, Isabelle, Ekstatischer Pietismus: Die Inspirationsgemeinde und ihre Prophetin Ursula Meyer (1682–1743) (Göttingen, 2005). North, Michael, Von Aktie bis Zoll: Ein historisches Lexikon des Geldes (München, 1995). –, »Integration im Ostseeraum und im Heiligen Römischen Reich«, in: Nils Jörn (Hg.), Die Integration des südlichen Ostseeraumes in das Alte Reich (Köln, 2000), 1–11. –, Kommunikation, Handel und Banken in der frühen Neuzeit (München, 2000). –, Genuss und Glück des Lebens: Kulturkonsum im Zeitalter der Aufklärung (Köln, 2003). Nottarp, Hermann, »Zur communicatio in sacris cum haereticis: Deutsche Rechtszustände im 17. und 18. Jahrhundert«, in: ders., Aus Rechtsgeschichte und Kirchenrecht: Gesammelte Abhandlungen, hg. v. Friedrich Merzbacher (Köln, 1967), 424–446. Nummedal, Tara E., Alchemy and authority in the Holy Roman Empire (Chicago, 2007). Oberndorfer, Martina, Wiblingen: Vom Ende eines Klosters; Die vorderösterreichische Abtei Wiblingen und ihr Umland im Zeitalter des Barock und der Aufklärung (Ostfildern, 2006) Oelkers, Jürgen, »Der Pädagoge als Reformer: Pestalozzi in Deutschland 1800 bis 1830«, in: Jürgen Oelkers und Fritz Oesterwalder (Hgg.), Pestalozzi – Umfeld und Rezeption: Studien zur Historisierung einer Legende (Weinheim und Basel, 1995), 207–239. Oer, Rudolfine Freiin von, Der Friede von Pressburg: Ein Beitrag zur Diplomatiegeschichte des napoleonischen Zeitalters (Münster, 1965). Oergel, Maike, Culture and identity: Historicity in German literature and thought 1770–1815 (Berlin, 2006). Oestreich, Gerhard, Antiker Geist und moderner Staat bei Justus Lipsius (1547–1606): Der Neustoizismus als politische Bewegung, hg. v. Nicolette Mout (Göttingen, 1989). Ogilvie, Sheilagh, »The beginnings of industrialisation«, in: dies. (Hg.), Germany: A new social history, Vol. 2: 1630–1800 (London, 1996), 263–308. –, State corporatism and proto-industry: The Württemberg Black Forest, 1580–1797 (Cambridge, 1997).
Literatur
–,
»The state in Germany: a non-Prussian view«, in: John Brewer und Eckhart Hellmuth (Hgg.), Rethinking Leviathan: The eighteenth-century state in Britain and Germany (Oxford, 1999), 167–202. –, »›So that every subject knows how to behave‹ : Social disciplining in early modern Bohemia«, Comparative Studies in Society and History, XLVI (2006), 38–78. –, »›Whatever is, is right‹ ? Economic institutions in pre-industrial Europe«, Economic History Review, LX (2007), 649–684. Ohst, Martin, »Gerard Wolter Molan und seine Stellung zum Projekt einer kirchlichen Reunion«, in: Heinz Duchhardt (Hg.), Union, Konversion, Toleranz: Dimensionen der Annäherung zwischen den christlichen Konfessionen im 17. und 18. Jahrhundert (Mainz, 2000), 171–197. Opfermann, Ulrich Friedrich, »Seye Kein Ziegeuner, sondern Kayserlicher Cornet«: Sinti im 17. und 18. Jahrhundert. Eine Untersuchung anhand archivalischer Quellen (Berlin, 2007). O’Reilly, William, »Lost chances of the house of Habsburg«, Austrian History Yearbook, XL (2009), 53–70. Osterwalder, Fritz, Pestalozzi: Ein pädagogischer Kult; Pestalozzis Wirkungsgeschichte in der Herausbildung der modern Pädgogik (Weinheim, 1996). Otterness, Philip, Becoming German: The 1709 Palatine migration to New York (Ithaca, NY, und London, 2004). Pape, Matthias, »Der Karlskult an Wendepunkten der neueren deutschen Geschichte«, Historisches Jahrbuch, CXX (2000), 138–181. –, »Revolution und Reichsverfassung: Die Verfassungsdiskussion zwischen Fürstenbund und Rheinbund«, in: Elisabeth Weisser-Lohmann und Dietmar Köhler (Hgg.), Verfassung und Revolution: Hegels Verfassungskonzeption und die Revolutionen der Neuzeit (Hamburg, 2000), 40–84. Papke, Gerhard, Von der Miliz zum Stehenden Heer: Wehrwesen im Absolutismus. Handbuch zur deutschen Militärgeschichte, Band 1 (München, 1979). Parker, Geoffrey, The army of Flanders and the Spanish road 1567–1659: The logistics of Spanish victory and defeat in the Low Countries’ wars (Cambridge, 1972). Parry, Geraint, »Enlightened government and its critics in eighteenth-century Germany«, The Historical Journal, VI (1963), 178–192. Pečar, Andreas, Die Ökonomie der Ehre: Höfischer Adel am Kaiserhof Karls VI. (Darmstadt, 2003). –, »Symbolische Politik: Handlungsspielräume im politischen Umgang mit zeremoniellen Normen; Brandenburg-Preußen und der Kaiserhof im Vergleich (1700–1740)«, in: Jürgen Luh (Hg.), Preussen, Deutschland und Europa 1701–2001 (Groningen, 2003), 280–295. –, »Gab es eine höfische Gesellschaft des Reiches? Rang- und Statuskonkurrenz innerhalb des Reichsadels in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts«, in: Harm Kleuting und Wolfgang Schmale (Hgg.), Das Reich und seine Territorialstaaten im 17. und 18. Jahrhundert: Aspekte des Mit-, Neben- und Gegeneinander (Münster, 2004), 183–205. Pelizaeus, Ludolf, Der Aufstieg Württembergs und Hessens zur Kurwürde 1692–1803 (Frankfurt am Main, 2000). Pelzer, Erich, Die Wiederkehr des girondistischen Helden: Deutsche Intellektuelle als kulturelle Mittler zwischen Deutschland und Frankreich während der Französischen Revolution (Bonn, 1998). Penners, Theodor, »Zur Konfessionsbildung im Fürstbistum Osnabrück: Die ländliche Bevölkerung im Wechsel der Reformationen des 17. Jahrhunderts«, Jahrbuch der Gesellschaft für Niedersächsische Kirchengeschichte, LXXII (1974), 25–50.
787
788
Literatur
Peper, Ines, Konversionen im Umkreis des Wiener Hofes um 1700 (Wien, 2010). Peterse, Hans, »Johann Christian von Boineburg und die Mainzer Irenik des 17. Jahrhunderts«, in: Heinz Duchhardt (Hg.), Union, Konversion, Toleranz: Dimensionen der Annäherung zwischen den christlichen Konfessionen im 17. und 18. Jahrhundert (Mainz, 2000), 105– 118. Petersen, Christian, »Die Teutsch-übende Gesellschaft in Hamburg«, Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Geschichte, II (1847), 533–564. Petri, Franz, Georg Droege, Friedrich von Klocke und Johannes Bauermann (Hgg.), Handbuch der Historische Stätten Deutschlands: Nordrhein-Westfalen, 2. Aufl. (Stuttgart, 1970) Petschel, Dorit, Sächsische Außenpolitik unter Friedrich August I.: Zwischen Rétablissement, Rheinbund und Restauration (Köln, 2000). Petz, Wolfgang, »Ökonomie zwischen Krise und Reform: Das Fürststift Kempten zur Bauzeit von St. Lorenz und der Residenz«, in: Markwart Herzog (Hg.), Himmel auf Erden oder Teufelsbauwurm? Wirtschaftliche und soziale Grundlagen des süddeutschen Klosterbarock (Konstanz, 2002), 233–259. Pfeilschifter, Georg, Friedrich Nicolais Briefwechsel mit St Blasien: Ein Beitrag zu seiner Beurteilung des Katholizismus auf Grund seiner süddeutschen Reise von 1781 (München, 1935). Pfister, Christian, Bevölkerungsgeschichte und historische Demographie 1500–1800 (München, 1994). Philipp, Wolfgang, Das Werden der Aufklärung in theologiegeschichtlicher Sicht (Göttingen 1957). Pinkard, Terry, German philosophy 1760–1860: The legacy of Idealism (Cambridge, 2002). Planert, Ute, »Wann beginnt der ›moderne‹ deutsche Nationalismus? Plädoyer für eine nationale Sattelzeit«, in: Jörg Echternkamp (Hg.), Die Politik der Nation: Deutscher Nationalismus in Krieg und Krisen 1760–1960 (München, 2002), 25–59. –, Der Mythos vom Befreiungskrieg: Frankreichs Kriege und der deutsche Süden; Alltag – Wahrnehmung – Deutung, 1792–1841 (Paderborn, 2007). Plassmann, Max, Krieg und Defension am Oberrhein: Die Vorderen Reichskreise und Markgraf Ludwig Wilhelm von Baden (1693–1706) (Berlin, 2000). Pöggeler, Otto, »Hegels Option für Österreich: Die Konzeption korporativer Repräsentation«, Hegel-Studien, XII (1977), 83–128. Polenz, Peter von, Deutsche Sprachgeschichte vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart, 3 Bde., 2. Aufl. (Berlin, 1994–2000). Polley, Rainer, »Fuldische Dorftrauer um Kaiser Leopold II.: Zur ›Heiligkeit‹ des Alten Reiches und des römisch-deutschen Kaisers im späten 18. Jahrhundert«, Hessisches Jahrbuch für Landesgeschichte, XXXV (1985), 159–175. Pons, Rouven, »Wo der gekrönte Löw hat seinen Kayser-Sitz«: Herrschaftsrepräsentation am Wiener Kaiserhof zur Zeit Leopolds I. (Egelsbach, 2001). Porter, Roy, Enlightenment: Britain and the creation of the modern world (Harmondsworth, 2000). Pörtner, Regina, »Migration und Herrschaftsverdichtung: Ökonomische Voraussetzungen Konfessionell bedingter Untertanenmobilität in der Ländern der Habsburgermonarchie 1680– 1780«, in: Joachim Bahlcke (Hg.), Glaubensflüchtlinge: Ursachen, Formen und Auswirkungen Frühneuzeitlicher Konfessionsmigration in Europa (Berlin, 2008), 345–371. Preisendörfer, Bruno, Staatsbildung als Königskunst: Ästhetik und Herrschaft im preußischen Absolutismus (Berlin, 2000).
Literatur
Press, Volker, »Steuern, Kredit und Repräsentation: Zum Problem der Ständebildung ohne Adel«, Zeitschrift für historische Forschung, II (1975), 59–93. –, ›Bayern, Österreich und das Reich in der frühen Neuzeit‹, Verhandlungen des Historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg, cxx (1980), 493–519. –, »Das ›Droit d’Épaves‹ des Kaisers von Österreich: Finanzkrise und Stabilisierungspolitik zwischen Lunéviller und Preßburger Frieden«, Geschichte und Gesellschaft, VI (1980), 559–573. –, »Landtage im Alten Reich und im Deutschen Bund: Voraussetzungen ständischer und konstitutioneller Entwicklung 1750–1830«, Zeitschrift für Württembergische Landesgeschichte, XXXIX (1981), 100–140. –, »Bayern am Scheideweg: Die Reichspolitik Kaiser Josephs II. und der Bayerische Erbfolgekrieg 1777–1779«, in: Pankraz Fried und Walter Ziegler (Hgg.), Festschrift für Andreas Kraus zum 60. Geburtstag (Kallmünz, 1982), 277–307. –, »Schwaben zwischen Bayern, Österreich und dem Reich 1486–1805«, in: Pankraz Fried (Hg.), Probleme der Integration Ostschwabens in den bayerischen Staat: Bayern und Wittelsbach in Ostschwaben (Sigmaringen, 1982), 17–78. –, »Zwischen Versailles und Wien: Die Pfälzer Kurfürsten in der deutschen Geschichte der Barockzeit«, Zeitschrift für Geschichte des Oberrheins, N.F. XCI (1982), 207–262. –, »Formen des Ständewesens in den deutschen Territorialstaaten des 16. und 17. Jahrhunderts«, in: Peter Baumgart (Hg.), Ständetum und Staatsbildung in Brandenburg-Preußen (Berlin, 1983), 280–318. –, »Das wittelsbachische Kaisertum Karls VII.: Voraussetzungen von Entstehung und Scheitern«, in: Andreas Kraus (Hg.), Land und Reich: Stamm und Nation; Probleme und Perspektiven bayerischer Geschichte, 3 Bde. (München, 1984), II, 201–234. –, »Der württembergische Angriff auf die Reichsritterschaft, 1749–1754 (1770)«, in: Franz Quarthal (Hg.), Zwischen Schwarzwald und Schwäbischer Alb: Das Land am oberen Neckar (Sigmaringen, 1984), 329–348. –, »Die Oberrheinlande zwischen Westfälischem Frieden und Französischer Revolution«, in: ders., Eugen Reinhard und Hansmartin Schwarzmeier (Hgg.), Barock am Oberrhein (Karlsruhe, 1985), 3–18. –, »Friedrich der Große als Reichspolitiker«, in: Heinz Duchhardt (Hg.), Friedrich der Große, Franken und das Reich (Köln, 1986), 25–56. –, »Kurhannover im System des alten Reiches 1692–1803«, in: Adolf M. Birke und Kurt Kluxen (Hgg.), England und Hannover (München, 1986), 53–79. –, »Reichsstadt und Revolution«, in: Bernhard Kirchgässner und Eberhard Naujoks (Hgg.), Stadt und wirtschaftliche Selbstverwaltung (Sigmaringen, 1987), 9–59. –, »Josef I. (1705–1711): Kaiserpolitik zwischen Erblanden, Reich und Dynastie«, in: Ralph Melville (Hg.), Deutschland und Europa in der Neuzeit: Festschrift für Karl Otmar Fhrh. von Aretin zum 65. Geburtstag (Stuttgart, 1988), 277–297. –, »Die kaiserliche Stellung im Reich zwischen 1648 und 1740 – Versuch einer Neubewertung«, in: Georg Schmidt (Hg.), Stände und Gesellschaft im Alten Reich (Stuttgart, 1989), 51–80. –, »Vorderösterreich in der habsburgischen Reichspolitik des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit«, in: Hans Maier und Volker Press (Hgg.), Vorderösterreich in der frühen Neuzeit (Sigmaringen, 1989), 1–41.
789
790
Literatur
–,
»Österreichische Großmachtbildung und Reichsverfassung. Zur kaiserlichen Stellung nach 1648«, Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, XCVIII (1990), 131–154. –, »Kaiser und Reichsritterschaft«, in: Rudolf Endres (Hg.), Adel in der Frühneuzeit: Ein regionaler Vergleich (Köln, 1991), 163–194. –, Kriege und Krisen: Deutschland 1600–1715 (München, 1991). –, »Reformabsolutismus in Bayern und in der Pfalz«, in: Richard Bauer und Hans Schlosser (Hgg.), Wiguläus Xaver Aloys Freiherr von Kreittmayr 1705–1790: Ein Leben für Recht, Staat und Politik; Festschrift zum 200. Todestag (München, 1991), 239–265. –, »Bayern und die Französische Revolution«, in: Winfried Eberhard und Ferdinand Seibt (Hgg.), Westmitteleuropa – Ostmitteleuropa: Vergleich und Beziehungen (München, 1992), 197–207. –, »Der Reichshofrat im System des frühneuzeitlichen Reiches«, in: Friedrich Battenberg und Filippo Ranieri (Hgg.), Geschichte der Zentraljustiz in Mitteleuropa (Köln, 1994), 349–363. –, Altes Reich und Deutscher Bund: Kontinuität in der Diskontinuität (München, 1995). –, »Das Haus Fürstenberg in der deutschen Geschichte«, in: ders., Adel im Alten Reich: Gesammelte Vorträge und Aufsätze, hg. v. Franz Brendle und Anton Schindling (Tübingen, 1998), 139–166. –, »Reichsgrafenstand und Reich: Zur Sozial- und Verfassungsgeschichte des deutschen Hochadels in der Frühen Neuzeit«, in; ders., Adel im Alten Reich: Gesammelte Vorträge und Aufsätze, hg. v. Franz Brendle und Anton Schindling (Tübingen, 1998), 113–138. Printy, Michael O., »From barbarism to religion: Church history and the Enlightened narrative in Germany«, German History, XXIII (2005), 172–201. –, Enlightenment and the creation of German Catholicism (Cambridge, 2009). Prinz, Friedrich, »Geschichte, Kultur und Gesellschaft in der frühen Neuzeit«, in: ders. (Hg.), Böhmen und Mähren: Deutsche Geschichte im Osten Europas, Band 2 (Berlin, 1993), 179– 302. Pufendorf, Samuel, Die Verfassung des deutschen Reiches, übers. und hg. v. Horst Denzer (Stuttgart, 1976). Puschner, Uwe, Handwerk zwischen Tradition und Wandel: Das Münchener Handwerk an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert (Göttingen, 1988). Pütter, Johann Stephan, Litteratur des Teutschen Staatsrechts, 3 Bde. (Göttingen, 1776–1783). Pütz, Peter, Die deutsche Aufklärung, 4. Aufl. (Darmstadt, 1991). Pyta, Wolfram, »Von der Entente Cordiale zur Aufkündigung der Bündnispartnerschaft: Die preußisch-britischen Allianzbeziehungen im Siebenjährigen Krieg 1758–1762«, Forschungen zur Brandenburgischen und Preussischen Geschichte, N.F. X (2000), 1–48. Quarthal, Franz, »Unterm Krummstab ist’s gut leben: Prälaten, Mönche und Bauern im Zeitalter des Barock«, in: Peter Blickle (Hg.), Politische Kultur in Oberschwaben (Tübingen, 1993), 269–286. –, »Vorderösterreich in der Geschichte Südwestdeutschlands«, in: Irmgard Christa Necker (Hg.), Vorderösterreich: Nur die Schwanzfeder des Kaiseradlers? Die Habsburger im deutschen Südwesten (Ulm, 1999), 14–59. Quedenbaum, Gerd, Der Verleger und Buchhändler Johann Heinrich Zedler, 1706–1751: Ein Buchunternehmer in den Zwängen seiner Zeit. Ein Beitrag zur Geschichte des deutschen Buchhandels im 18. Jahrhundert (Hildesheim und New York, 1977). Quéval, Marie-Hélène, »Johann Christoph Gottsched und Pierre Bayle: Ein philosophischer Dialog; Gottscheds Anmerkungen zu Pierre Bayles Historisch-critischem Wörterbuch«,
Literatur
in: Gabrielle Ball (Hg.), Diskurse der Aufklärung: Luise Adelgunde Victorie und Johann Christoph Gottsched (Wiesbaden, 2006) 145–168. Raab, Heribert, Die Concordata nationis germanicae in der kanonistischen Diskussion des 17. bis 19. Jahrhunderts: Ein Beitrag zur Geschichte der episkopalistischen Theorie in Deutschland (Wiesbaden, 1956). –, »Der ›Discrete Catholische‹ des Landgrafen Ernst von Hessen-Rheinfels (1623–1693): Ein Beitrag zur Geschichte der Reunionsbemühungen und der Toleranzbestrebungen des 17. Jahrhunderts«, Archiv für mittelrheinische Kirchengeschichte, XII (1960), 175–198. –, »›Sincere et ingenue etsi cum discretione‹ : Landgraf Ernst von Hessen-Rheinfels (1623– 1693) über eine Reform von Papsttum, Römischer Kurie und Reichskirche«, in: Remigius Bäumer (Hg.), Reformatio ecclesiae: Beiträge zu kirchlichen Reformbemühungen von der Alten Kirche bis zur Neuzeit; Festgabe für Erwin Iserloh (Paderborn, 1980), 813–830. –, »Attempts at Church reunion«, in: Hubert Jedin (Hg.), The Church in the age of absolutism and Enlightenment, übers. v. Gunther J. Holst (London, 1981), 509–524. –, »Episcopalism in the Church of the Empire from the middle of the seventeenth century to the end of the eighteenth century«, in: Hubert Jedin (Hg.), The Church in the age of absolutism and Enlightenment, übers. v. Gunther J. Holst (London, 1981), 443–469. –, »The reconstruction and constitution of the Church of the Empire«, in: Hubert Jedin (Hg.), The Church in the age of absolutism and Enlightenment, übers. v. Gunther J. Holst (London, 1981), 135–160. –, »›Lutherisch-deutsch‹ : Ein Kapitel Sprach- und Kulturkampf in den katholischen Territorien des Reiches«, Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte, XLVII (1984), 15–42. Radkau, Joachim, »Zur angeblichen Energiekrise des 18. Jahrhunderts: Revisionistische Betrachtungen über die ›Holznot‹«, Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, LXXIII (1986), 1–37. Raeff, Marc, The well-ordered police state: Social and institutional change through law in the Germanies and Russia, 1600–1800 (New Haven, CT, und London, 1983). Ramcke, Rainer, Die Beziehungen zwischen Hamburg und Österreich im 18. Jahrhundert: Kaiserliches-reichsstädtisches Verhältnis im Zeichen von Handels- und Finanzinteressen (Hamburg, 1969). Raumer, Kurt von, »Hügels Gutachten zur Frage der Niederlegung der deutschen Kaiserkrone«, Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte, XXVII (1964), 390–408. – und Manfred Botzenhart, Deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert, Teil 1. Deutschland um 1800: Krise und Neugestaltung von 1789 bis 1815 (Wiesbaden, 1980). Rauscher, Peter, »Recht und Politik: Reichsjustiz und oberstrichterliches Amt des Kaisers im Spannungsfeld des preußisch-österreichischen Dualismus (1740–1785)«, Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs, XLVI (1998), 269–309. Reden-Dohna, Armgard von, »Die schwäbischen Reichsprälaten und der Kaiser: Das Beispiel der Laienpfründen«, in: Hermann Weber (Hg.), Politische Ordnungen und soziale Kräfte im Alten Reich (Wiesbaden, 1980), 155–167. –, Reichsstandschaft und Klosterherrschaft: Die schwäbischen Reichsprälaten im Zeitalter des Barock (Wiesbaden, 1982). –, »Problems of small estates of the empire: The example of the Swabian imperial prelates«, Journal of Modern History, LVIII (1986), Supplement, 76–87. –, »Zwischen Österreichischen Vorlanden und Reich: Die schwäbischen Reichsprälaten«, in: Hans Maier und Volker Press (Hgg.), Vorderösterreich in der frühen Neuzeit (Sigmaringen, 1989), 75–91.
791
792
Literatur
Redlich, Fritz, »Der deutsche fürstliche Unternehmer: Eine typische Erscheinung des 16. Jahrhunderts«, Tradition. Zeitschrift für Firmengeschichte und Unternehmerbiographie, III (1958), 17–32, 98–112. –, The German military enterpriser and his workforce: A study in European economic and social history, 2 Bde. (Wiesbaden, 1964–1965). Redlich, Oswald, »Die Tagebücher Kaiser Karls VI.«, in: Gesamtdeutsche Vergangenheit: Festgabe für Heinrich Ritter von Srbik zum 60. Geburtstag am 10. November 1938 (München, 1938), 141–151. Reed, T. J., The classical centre: Goethe and Weimar 1775–1832 (London, 1980). –, »Talking to tyrants: Dialogues with power in eighteenth-century Germany«, The Historical Journal, XXXIII (1990), 63–79. Reichardt, Rolf, »Deutsche Volksbewegungen im Zeichen des Pariser Bastillesturms: Ein Beitrag zum sozio-kulturellen Transfer der Französischen Revolution«, in: Helmut Berding (Hg.), Soziale Unruhen in Deutschland während der Französischen Revolution (Göttingen, 1988) 10–27. –, »Probleme des kulturellen Transfers der Französischen Revolution in der deutschen Publizistik 1789–1799«, in: Holger Böning (Hg.), Französische Revolution und deutsche Öffentlichkeit: Wandlungen in Presse und Alltagskultur am Ende des 18. Jahrhunderts (München, 1992), 91–146. Reingrabner, Gustav, Protestanten in Österreich: Geschichte und Dokumentation (Wien, 1981). Reinhardt, Rudolf, »Zur Reichskirchenpolitik der Pfalz-Neuburger Dynastie«, Historisches Jahrbuch, LXXXIV (1964), 118–128. –, »Die hochadeligen Dynastien in der Reichskirche des 17. und 18. Jahrhunderts«, Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte, LXXXIII (1988), 213– 235. Reininger, Robert, Kant: Seine Anhänger und seine Gegner (München, 1923). Reininghaus, Wilfried, Gewerbe in der Frühen Neuzeit (München, 1990). Reiß, Stefan, Fichtes »Reden and die deutsche Nation« oder: Vom Ich zum Wir (Berlin, 2006). Repgen, Konrad, »Der Westfälische Friede und die zeitgenössische Öffentlichkeit«, Historisches Jahrbuch, CXVII (1997), 38–83. Ries, Klaus, Obrigkeit und Untertanen: Stadt- und Landproteste in Nassau-Saarbrücken im Zeitalter des Reformabsolutismus (Saarbrücken, 1997). –, »Kultur als Politik: Das ›Ereignis Weimar-Jena‹ und die Möglichkeiten und Grenzen einer ›Kulturgeschichte des Politischen‹«, Historische Zeitschrift, CCLXXXV (2007), 303–354. Riethmüller, Jürgen, Die Anfänge der Demokratie in Deutschland (Erfurt, 2002). Rill, Bernd, Karl VI.: Habsburg als barocke Grossmacht (Graz, 1992). Ritter, Christian, »Immanuel Kant«, in: Michael Stolleis (Hg.), Staatsdenker im 17. und 18. Jahrhundert: Reichspublizistik, Politik, Naturrecht, 2. Aufl. (Frankfurt am Main, 1987), 332– 353. Roeck, Bernd, Reichssystem und Reichsherkommen: Die Diskussion über die Staatlichkeit des Reiches in der politischen Publizistik des 17. und 18. Jahrhunderts (Stuttgart, 1984). –, »Baukunst und Baukonjunktur als Thema historischer Forschung«, in: Markwart Herzog (Hg.), Himmel auf Erden oder Teufelsbauwurm? Wirtschaftliche und soziale Grundlagen des süddeutschen Klosterbarock (Konstanz, 2002), 27–35. Roider, Karl A., Baron Thugut and Austria’s response to the French Revolution (Princeton, NJ, 1987).
Literatur
Römer, Christof, »Der Kaiser und die welfischen Staaten 1679–1755: Abriß der Konstellationen und der Bedingungsfelder«, in: Harm Kleuting und Wolfgang Schmale (Hgg.), Das Reich und seine Territorialstaaten im 17. und 18. Jahrhundert: Aspekte des Mit-, Neben- und Gegeneinander (Münster, 2004), 43–66. Rosa di Simone, Maria, »Admission«, in: H. De Ridder-Symoens (Hg.), A History of the university in Europe, Vol. 2: Universities in early modern Europe (Cambridge, 1996), 285–325. Rosenhaft, Eve, »Secrecy and publicity in the emergence of modern business culture: Pension funds in Hamburg 1760–1780«, in: Anne Goldgar und Robert I. Frost (Hgg.), Institutional culture in early modern society (Leiden, 2004), 218–243. –, »›But the heart must speak for the widows‹ : The origins of life insurance in Germany and the gender implications of actuarial science«, in: Ulrike Gleixner (Hg.), Gender in transition: Discourse and practice in German-speaking Europe, 1750–1830 (Ann Arbor, MI, 2006), 90– 113. Rosseaux, Ulrich, Städte in der Frühen Neuzeit (Darmstadt, 2006). Rowe, Michael, From Reich to state: The Rhineland in the revolutionary age, 1780–1830 (Cambridge, 2003). Rowell, Geoffrey, »The Marquis de Marsay: A Quietist in ›Philadelphia‹«, Church History, CLI, 1972–61–77. Rückleben, Die Niederwerfung der hamburgischen Ratsgewalt: Kirchliche Bewegungen und bürgerliche Unruhen im ausgehenden 17. Jahrhundert (Hamburg, 1970). Rudersdorf, Manfred, »Das Glück der Bettler«: Justus Möser und die Welt der Armen; Mentalität und soziale Frage im Fürstbistum Osnabrück zwischen Aufklärung und Säkularisation (Münster, 1995). Rudert, Thomas, »Mecklenburg«, in: Werner Buchholz (Hg.), Das Ende der Frühen Neuzeit im »Dritten Deutschland« (München, 2003), 53–76. Rudolf, Hans Ulrich, »Aus den Niederlanden ins Oberland: Das Haus Oranien-Nassau und die Herrschaft Weingarten 1802–1806«, in: Volker Himmelein (Hg.), Alte Klöster, neue Herren: Die Säkularisation im deutschen Südwesten 1803, 2 Bde. in 3 (Ostfildern, 2003), II Teil 1, 463–476. Rudolph, Hartmut, »Bemerkungen zu Leibniz’ Reunionskonzept«, in: Heinz Duchhardt (Hg.), Union, Konversion, Toleranz: Dimensionen der Annäherung zwischen den christlichen Konfessionen im 17. und 18. Jahrhundert (Mainz, 2000), 227–242. Ruegg, Walter, »Die Antike als Begründung des deutschen Nationalbewußtseins«, in: Wolfgang Schuller (Hg.), Antike in der Moderne (Konstanz, 1985), 267–287. Rürup, Reinhard, Johann Jacob Moser: Pietismus und Reform (Wiesbaden, 1965). Rusam, Georg, Österreichische Exulanten in Franken und Schwaben (Neustadt an der Aisch, 1989). Safley, Thomas Max, Children of the labouring poor: Expectation and experience among the orphans of early modern Augsburg (Leiden, 2005). Sahlins, Peter, »Natural frontiers revisited: France’s boundaries since the seventeenth century«, American Historical Review, XCV (1990), 1423–1451. Sahmland, Irmtraud, Christoph Martin Wieland und die deutsche Nation: Zwischen Patriotismus, Kosmopolitismus und Griechentum (Tübingen, 1990). Sailer, Rita, Untertanenprozesse vor dem Reichskammergericht: Rechtsschutz gegen die Obrigkeit in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts (Köln, 1999). Saine, Thomas P., Black bread – white bread: German intellectuals and the French Revolution (Columbia, SC, 1988).
793
794
Literatur
–,
The problem of being modern or the German pursuit of Enlightenment from Leibniz to the French Revolution (Detroit, 1997). Sante, Georg Wilhelm (Hg.), Geschichte der Deutschen Länder: »Territorien-Ploetz«, Band 1: Die Territorien bis zum Ende des alten Reiches (Würzburg, 1964). –, (Hg.), Handbuch der historischen Stätten Deutschlands: Hessen, 3. Aufl. (Stuttgart, 1976). Sauter, Christina M., Wilhelm von Humboldt und die deutsche Aufklärung (Berlin, 1989). Schäfer, Christoph, Das Simultaneum: Ein staatskirchenrechtliches, politisches und theologisches Problem des Alten Reiches (Frankfurt am Main, 1995). Schaffer, Wolfgang, »Die rheinische Klosterlandschaft im Vorfeld der Säkularisation von 1802/ 03«, in: Georg Mölisch, Joachim Oepen und Wolfgang Rosen (Hgg.), Klosterkultur und Säkularisation im Rheinland (Essen, 2002), 35–70. Schaich, Michael, Staat und Öffentlichkeit im Kurfürstentum Bayern der Spätaufklärung (München, 2001). Schama, Simon, Patriots and liberators: Revolution in the Netherlands 1780–1813 (London, 1977). Scharf, Claus, Katharina II., Deutschland und die Deutschen (Mainz, 1996). Schattenhofer, Michael, »Die Kultur Münchens im 17. und 18. Jahrhundert«, in: Wilhelm Rausch (Hg.), Städtische Kultur in der Barockzeit (Linz, 1982), 195–216. Schauer, Maike, Johann Balthasar Schupp: Prediger in Hamburg 1649–1661 (Hamburg, 1973). Schäufele, Wolf-Friedrich, »Die Konsequenzen des Westfälischen Friedens für den Umgang mit religiösen Minderheiten in Deutschland«, in: Günter Frank, Jörg Haustein und Albert de Lange (Hgg.), Asyl, Toleranz und Religionsfreiheit. Historische Erfahrungen und aktuelle Herausforderungen (Göttingen 2000), 121–139. Scheel, Heinrich, Süddeutsche Jakobiner: Klassenkämpfe und republikanische Bestrebungen im deutschen Süden Ende des 18. Jahrhunderts (Berlin, 1962). –, »Die Französische Revolution und der Beginn der bürgerlichen Umwälzung (1789 bis 1830)«, in: Walter Schmidt (Hg.), Die bürgerliche Umwälzung von 1789 bis 1871: Deutsche Geschichte, Band 4 (Köln, 1984), 14–74. Scheibelreiter, Georg, »Ostarrichi: Das Werden einer historischen Landschaft«, in: Wilhelm Brauneder (Hg.), Sacrum imperium: Das Reich und Österreich 996–1806 (Wien 1996), 9–70. Schenk, Winfried, »Forest development types in Central Germany in pre-industrial times: A contribution by historical geography to the solution of a forest history research argument about the ›wood scarcity‹ in the 16th century«, in: Simonetta Cavaciocchi (Hg.), L’uomo e la foresta secc. XII–XVIII (Prato, 1996), 201–233. Scherf, Helmut und Jürgen Karpinski, Thüringer Porzellan unter besonderer Berücksichtigung der Erzeugnisse des 18. und frühen 19. Jahrhunderts, 2. Aufl. (Leipzig, 1985). Scheurmann, Ingrid (Hg.), Frieden durch Recht: Das Reichskammergericht von 1495 bis 1806 (Mainz, 1994). Schieder, Theodor, Friedrich der Große: Ein Königtum der Widersprüche (Berlin, 1983). Schiewe, Jürgen, Öffentlichkeit: Entstehung und Wandel in Deutschland (Paderborn, 2004). Schiller, Friedrich, On the aesthetic education of man, in a series of letters, hg. und übers., eingel. und komment. v. Elizabeth M. Wilkinson und L. A. Willoughby (Oxford, 1967). –, Sämtliche Werke, 5 Bde., 8. Aufl. (Darmstadt, 1987–1989). Schilling, Heinz, »Innovation through migration: The settlements of Calvinistic Netherlanders in sixteenth-and seventeenth-century Central and Western Europe«, Histoire sociale – Social History, XVI (1983), 7–33. –, Höfe und Allianzen: Deutschland 1648–1763 (Berlin, 1989).
Literatur
–, Die Stadt in der Frühen Neuzeit, 2nd edn (München, 2004). Schilling, Roger, ›Ansiedlung der Deutschen in Rumpfungarn‹, in Jakob Bleyer (Hg.), Das Deutschtum in Rumpfungarn (Budapest, 1928), 41–87. Schilling, Ruth, ›»Homagium« or Hospitality? The Struggle for Political Representation in Bremen around 1600‹, Eras, Edition 5 (2003). Schindling, Anton, »›Friderizianische Bischöfe‹ in Franken? Aufklärung und Reform im geistlichen Franken zwischen Habsburg und Preußen«, in: Heinz Duchhardt (Hg.), Friedrich der Große, Franken und das Reich (Köln und Wien, 1986), 157–171. –, »Osnabrück, Nordwestdeutschland und das Heilige Römische Reich zur Zeit Mösers«, in: Winfried Woesler, Möser-Forum (Münster, 1989), 211–222. –, »Leopold I. 1658–1705«, in: ders. und Walter Ziegler (Hgg.), Die Kaiser der Neuzeit 1519– 1918 (München, 1990), 169–185. –, Die Anfänge des Immerwährenden Reichstags zu Regensburg: Ständevertretung und Staatskunst nach dem Westfälischen Frieden (Mainz, 1991). –, »Wachstum und Wandel vom Konfessionellen Zeitalter bis zum Zeitalter Ludwigs XIV.: Frankfurt am Main 1555–1685«, in: Frankfurter Historische Kommission (Hg.), Frankfurt am Main: Die Geschichte der Stadt in neun Beiträgen (Sigmaringen, 1991), 205–260. –, »Bei Hofe und als Pomeranzenhändler: Italiener im Deutschland der Frühen Neuzeit«, in: Klaus J. Bade (Hg.), Deutsche im Ausland – Fremde in Deutschland: Migration in Geschichte und Gegenwart (München, 1992), 287–293. –, Bildung und Wissenschaft in der Frühen Neuzeit 1650–1800, 2. Aufl. (München, 1999). –, »Reichsinstitutionen und Friedenswahrung nach 1648«, in: Klaus Garber (Hg.), Der Frieden: Rekonstruktion einer europäischen Vision (München, 2001), 259–291. –, »Universität und Verfassung in der Frühen Neuzeit«, in: Hans-Jürgen Becker (Hg.), Interdependenzen zwischen Verfassung und Kultur (Berlin, 2003), 51–79. –, »Das Ende der Reichskirche: Verlust und Neuanfang«, in: Rolf Decot (Hg.), Kontinuität und Innovation um 1803: Säkularisation als Transformationsprozeß; Kirche, Theologie, Kultur, Staat (Mainz, 2005), 69–92. –, »War das Scheitern des Alten Reiches unausweichlich?«, in: Heinz Schilling (Hg.), Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation 962 bis 1806: Altes Reich und neue Staaten 1495 bis 1806 (Dresden, 2006), 302–317. –, und Walter Ziegler (Hgg.), Die Territorien des Reichs im Zeitalter der Reformation und Konfessionalisierung: Land und Konfession 1500–1650, 7 Bde. (Münster, 1989–1997). Schlip, Harry, »Die neuen Fürsten: Zur Erhebung in den Reichsfürstenstand und zur Aufnahme in den Reichsfürstenrat im 17. und 18. Jahrhundert«, in: Volker Press und Dietmar Willoweit (Hgg.), Liechtenstein, fürstliches Haus und staatliche Ordnung: Geschichtliche Grundlagen und moderne Perspektiven (München, 1987), 249–292. Schlösser, Susanne, Der Mainzer Erzkanzler im Streit der Häuser Habsburg und Wittelsbach um das Kaisertum 1740–1745 (Stuttgart, 1986). Schlott, Michael, »Politische Aufklärung durch wissenschaftliche Kopplungsmanöver: Germanistische Literaturwissenschaft und geschichtswissenschaftliche Jakobinerforschung zwischen 1965 und 1990«, in: Holger Dainat (Hg.), Aufklärungsforschung in Deutschland (Heidelberg, 1999), 79–97. Schlumbohm, Jürgen, »Gesetze, die nicht durchgesetzt werden – ein Strukturmerkmal des frühneuzeitlichen Staates?«, Geschichte und Gesellschaft, XXIII (1997), 647–663.
795
796
Literatur
Schmid, Alois, »Der geplante Friedenskongress zu Augsburg 1761«, in: Andreas Kraus (Hg.), Land und Reich, Stamm und Nation: Probleme und Perspektiven bayerischer Geschichte; Festgabe für Max Spindler zum 90. Geburtstag, 3 Bde. (München, 1984), II, 231–258. –, »Franz I. und Maria Theresia 1745–65«, in: Anton Schindling und Walter Ziegler (Hgg.), Die Kaiser der Neuzeit 1519–1918 (München, 1990), 233–248. –, »Karl VII. (1742–1745)«, in: Anton Schindling und Walter Ziegler (Hgg.), Die Kaiser der Neuzeit 1519–1918 (München, 1990), 215–231. –, »Die Vermittlungsbemühungen des Großherzogs Franz Stephan von Habsburg-Lothringen und des Fürstbischofs Friedrich Karl von Schönborn im Österreichischen Erbfolgekrieg 1741/1742«, Jahrbuch für fränkische Landesforschung, LV (1995), 171–191. –, »Kaiser Franz I. Stephan – Umrisse eines neuen Bildes«, in: Renate Zedinger (Hg.), Lothringens Erbe: Franz Stephan von Lothringen (1708–1765) und sein Wirken in Wirtschaft, Wissenschaft und Kunst der Habsburgermonarchie (St. Pölten, 2000), 95–109. Schmidt, Alexander, »Prestige, Kultur und Außendarstellung: Überlegungen zur Politik Sachsen-Weimar-Eisenachs im Rheinbund (1806–1813)«, Zeitschrift des Vereins für Thüringische Geschichte, LIX/LX (2005–2006), 153–192. –, Vaterlandsliebe und Religionskonflikt: Politische Diskurse im Alten Reich (1555–1648) (Leiden, 2007). –, »The liberty of the ancients? Friedrich Schiller and aesthetic republicanism«, History of Political Thought, XXX, 2009, 286–314. –, »Das Überleben der ›Kleinen‹ : Die Zäsur 1806 und die Politik Sachsen-Weimar-Eisenachs (1796–1813)«, in: Andreas Klinger, Hans-Werner Hahn und Georg Schmidt (Hgg.), Das Jahr 1806 im europäischen Kontext: Balance, Hegemonie und politische Kulturen (Köln, 2008), 349–380. Schmidt, Burghart, »Mappae Germaniae: Das Alte Reich in der kartographischen Überlieferung der Frühen Neuzeit«, in: Matthias Schnettger (Hg.), Imperium Romanum – Irregulare Corpus – Teutscher Reichs-Staat: Das Alte Reich im Verständnis der Zeitgenossen und der Historiographie (Mainz, 2002), 3–25. Schmidt, Georg, »Die frühneuzeitlichen Hungerrevolten: Soziale Konflikte und Wirtschaftspolitik im Alten Reich«, Zeitschrift für historische Forschung, XVIII (1991), 257–280. –, »Goethe: politisches Denken und regional orientierte Praxis im Alten Reich«, Goethe-Jahrbuch, CXII (1995), 197–212. –, »Städtehanse und Reich im 16. und 17. Jahrhundert«, in: Antjektrin Graßmann (Hg.), Niedergang oder Übergang? Zur Spätzeit der Hanse im 16. und 17. Jahrhundert (Köln, 1998), 25–46. –, Geschichte des Alten Reiches: Staat und Nation in der Frühen Neuzeit 1495–1806 (München, 1999). –, »Die ›deutsche Freiheit‹ und der Westfälische Friede«, in: Klaus Garber (Hg.), Der Frieden: Rekonstruktion einer europäischen Vision (München, 2001), 323–347. –, »Die frühneuzeitliche Idee ›deutsche Nation‹ : Mehrkonfessionalität und säkulare Werte«, in: Heinz-Gerhard Haupt und Dieter Langewiesche (Hgg.), Nation und Religion in der deutschen Geschichte (Frankfurt am Main, 2001), 33–67. –, »Luthertum, Aufklärung und religiöse Gleichgültigkeit am Weimarer Hof im späten 18. Jahrhundert«, in: Klaus Malettke (Hg.), Hofgesellschaft und Höflinge an europäischen Fürstenhöfen in der Frühen Neuzeit, 15.–18. Jahrhundert (Münster, 2001), 491–506.
Literatur
–,
»Das Jahr 1783: Goethe, Herder und die Zukunft Weimars«, in: Markus Ventzke (Hg.), Hofkultur und aufklärerische Reformen in Thüringen: Die Bedeutung des Hofes im späten 18. Jahrhundert (Köln, 2002), 138–168. –, »Friedrich Schillers ›deutsche Größe‹ und der nationale Universalismus«, in: Werner Greiling und Hans-Werner Hahn (Hgg.), Tradition und Umbruch: Geschichte zwischen Wissenschaft, Kultur und Politik (Rudolstadt, 2002), 11–32. –, »Kulturbedeutung, Musenhof und ›Land der Residenzen‹ : Wie erzählt man die frühneuzeitliche Geschichte Thüringens?«, in: Matthias Werner (Hg.), Im Spannungsfeld von Wissenschaft und Politik: 150 Jahre Landesgeschichtsforschung in Thüringen (Köln, 2005), 343–376. –, »Reichspatriotische Visionen: Ernst II. von Sachsen-Gotha, Carl August von Sachsen-Weimar und der Fürstenbund (1785–1788)«, in: Werner Greiling, Andreas Klinger und Christoph Köhler (Hgg.), Ernst II. von Sachsen-Gotha-Altenburg: Ein Herrscher im Zeitalter der Aufklärung (Köln, 2005), 57–84. –, »Adel und Reich: Publizistische Kritik und Perspektiven«, in: Mark Hengerer und Elmar L. Kuhn (Hgg.), Adel im Wandel: Oberschwaben von der frühen Neuzeit bis zur Gegenwart (Ostfildern, 2006), 85–98. –, »Friedrich Meineckes Kulturnation: Zum historischen Kontext nationaler Ideen in Weimar-Jena um 1800«, Historische Zeitschrift, CCLXXXIV (2007), 597–621. –, »Das Ereignis Weimar-Jena und das Alte Reich«, in: Lothar Ehrlich und Georg Schmidt (Hgg.), Ereignis Weimar-Jena: Gesellschaft und Kultur um 1800 in internationalen Kontext (Köln, 2008), 11–32. –, »Mäzene, Patrioten und Despoten: Drei mitteldeutsche Fürsten im späten Alten Reich«, in: Holger Zaunstöck (Hg.), Das Leben des Fürsten: Studien zur Biografie von Leopold III. Friedrich Franz von Anhalt-Dessau (1740–1817) (Halle, 2008), 30–45. –, »Von der ›Westfälischen Souveränität‹ zu den Rheinbundsouveränen: Deutsche Staatlichkeit, Mächtebalance und napoleonische Hegemonie«, in: Guntram Martin (Hg.), 200 Jahre Königreich Sachsen: Beiträge zur sächsischen Geschichte im napoleonischen Zeitalter (Beucha, 2008), 37–53. Schmidt, Hans, Kurfürst Karl Philipp von der Pfalz als Reichsfürst (Mannheim, 1963). –, »Konversion und Säkularisation als politische Waffe am Ausgang des konfessionellen Zeitalters: Neue Quellen zur Politik des Herzogs Ernst August von Hannover am Vorabend des Friedens von Nymwegen«, Francia, V (1977), 183–230. –, »Joseph I. (1705–1711)«, in: Anton Schindling und Walter Ziegler (Hgg.), Die Kaiser der Neuzeit 1519–1918 (München, 1990), 186–199. –, »Karl VI. 1711–1740«, in: Anton Schindling und Walter Ziegler (Hgg.), Die Kaiser der Neuzeit 1519–1918 (München, 1990), 200–214. Schmidt, James, »The question of Enlightenment: Kant, Mendelssohn, and the Mittwochsgesellschaft«, Journal of the History of Ideas, I (1989), 269–291. Schnabel, Franz, Deutsche Geschichte im neunzehnten Jahrhundert, eingel. v. Eberhard Weis, 4 Bde. (München, 1987). Schnabel, Werner Wilhelm, »Österreichische Glaubensflüchtlinge in Franken: Integration und Assimilation von Exulanten im 17. Jahrhundert«, in: Hans Hopfinger und Horst Kopp (Hgg.), Wirkungen von Migration auf aufnehmende Gesellschaften (Neustadt an der Aisch, 1996), 161–173.
797
798
Literatur
Schnee, Heinrich, Hoffinanz und der moderne Staat: Geschichte und System der Hoffaktoren an deutschen Fürstenhöfen im Zeitalter des Absolutismus. Nach archivalischen Quellen, 6 Bde. (Berlin, 1953–1967). Schneider, Berhnard Christian, Ius reformandi: Die Entwicklung eines Staatskirchenrechts von seinen Anfängen bis zum Ende des Alten Reiches (Tübingen, 2001) Schneider, Hannelore, »Herzog Georg I. von Sachsen-Meiningen – Biographisches«, in: Herzog Georg I. von Sachsen-Meiningen: Ein Präzedenzfall für den aufgeklärten Absolutismus? (Meiningen, 2004), 13–43. Schneider, Hans-Peter, »Gottfried Wilhelm Leibniz«, in: Michael Stolleis (Hg.), Staatsdenker im 17. und 18. Jahrhundert: Reichspublizistik, Politik, Naturrecht, 2. Aufl. (Frankfurt am Main, 1987), 197–226. Schneider, Konrad, Die Münz- und Währungspolitik des Oberrheinischen Reichskreises im 18. Jahrhundert (Koblenz, 1995). Schneiders, Werner, Die wahre Aufklärung: Zum Selbstverständnis der deutschen Aufklärung (München, 1974). –, »Aufklärungsphilosophien«, in: Siegfried Jüttner und Jochen Scholbach (Hgg.), Europäische Aufklärung(en): Einheit und nationale Vielfalt (Hamburg, 1992), 1–25. – (Hg.), Lexikon der Aufklärung: Deutschland und Europa (München, 1995). Schnettger, Matthias, Der Reichsdeputationstag 1655–1663: Kaiser und Stände zwischen Westfälischem Frieden und Immerwährendem Reichstag (Münster, 1996). –, »Kirchenadvokatie und Reichseinigungspläne: Kaiser Leopold I. und die Reunionsbestrebungen Rojas y Spinolas«, in: Heinz Duchhardt (Hg.), Union, Konversion, Toleranz: Dimensionen der Annäherung zwischen den christlichen Konfessionen im 17. und 18. Jahrhundert (Mainz, 2000), 139–169. –, »Kurpfalz und der Kaiser im 18. Jahrhundert: Dynastisches Interesse, Reichs- und Machtpolitik zwischen Düsseldorf/Heidelberg/Mannheim und Wien«, in: Harm Kleuting und Wolfgang Schmale (Hgg.), Das Reich und seine Territorialstaaten im 17. und 18. Jahrhundert: Aspekte des Mit-, Neben- und Gegeneinander (Münster, 2004), 67–95. –, »Von der ›Kleinstaaterei‹ zum ›komplementären Reichs-Staat‹ : Die Reichsverfassungsgeschichtsschreibung seit dem Zweiten Weltkrieg«, in: Hans-Christof Kraus (Hg.), Geschichte der Politik: Alte und neue Wege (München, 2007), 129–154. –, »Im Schatten der Mediatisierung: Zur Reform(un)fähigkeit deutscher und italienischer Kleinstaaten in der Frühen Neuzeit«, Historisches Jahrbuch, CXXVIII (2008), 25–53. –, »Kleinstaaten in der Frühen Neuzeit: Konturen eines Forschungsfeldes«, Historische Zeitschrift, CCLXXXVI (2008), 605–640. Schöler, Claudia, Deutsche Rechtseinheit: Partikulare und nationale Gesetzgebung (1780–1866) (Köln, 2004). Schraut, Sylvia, Das Haus Schönborn; Eine Familienbiographie; Katholischer Reichsadel 1640– 1840 (Paderborn, 2005). Schreiber, Georg, Franz I. Stephan: An der Seite einer großen Frau (Graz, 1986). Schröder, Claudia, »Siècle de Frédéric II« und »Zeitalter der Aufklärung«: Epochenbegriffe im geschichtlichen Selbstverständnis der Aufklärung (Berlin, 2002). Schröder, Jan, »Justus Möser«, in: Michael Stolleis (Hg.), Staatsdenker im 17. und 18. Jahrhundert: Reichspublizistik, Politk, Naturrecht, 2. Aufl. (Frankfurt am Main, 1987), 294–309. Schröder, Peter, »Thomas Hobbes, Christian Thomasius and the seventeenth century debate on the church and state«, History of European Ideas, XXIII (1997), 59–79. –, Christian Thomasius zur Einführung (Hamburg, 1999).
Literatur
Schröder, Winfried, Ursprünge des Atheismus: Untersuchungen zur Metaphysik- und Religionskritik des 17. und 18. Jahrhunderts (Stuttgart-Bad Cannstatt, 1998). Schroeder, Klaus-Peter, Das Alte Reich und seine Städte: Untergang und Neubeginn: Die Mediatisierung der oberdeutschen Reichsstädte im Gefolge des Reichsdeputationshauptschlusses, 1802/03 (München, 1991). –, »Notizen zur reichsstädtischen Finanzlage am Vorabend des Reichsdeputationshauptschlusses«, in: Gerhard Lingelbach (Hg.), Staatsfinanzen, Staatsverschuldung, Staatsbankrotte in der europäischen Staaten- und Rechtsgeschichte (Köln, 2000), 293–304. Schroeder, Paul W., The transformation of European politics 1763–1848 (Oxford, 1994). Schuck, Gerhard, Rheinbundpatriotismus und politische Öffentlichkeit zwischen Aufklärung und Frühliberalismus: Kontinuitätsdenken und Diskontinuitätserfahrung in den Staatsrechtsund Verfassungsdebatten der Rheinbundpublizistik (Stuttgart, 1994). Schui, Florian, »Prussia’s ›trans-oceanic moment‹ : The creation of the Prussian Asiatic Trade Company in 1750«, The Historical Journal, XLIX (2006), 143–160. –, »French figures of authority in the Prussian fiscal administration c. 1766–1786«, in: Peter Becker (Hg.), Figures of authority: Contribution towards a cultural history of governance from the seventeenth to the twentieth century (Brüssel, 2008), 153–176. Schulte Beerbühl, Margrit, »Frühneuzeitliche Flüchtlingshilfe in Großbritannien und das Schicksal der Pfälzer Auswanderer von 1709«, in: Matthias Beer und Dittmar Dahlmann (Hgg.), Über die trockene Grenze und über das offene Meer: Binnenpolitische und transnationale Migrationen im 18. und 19. Jahrhundert (Essen, 2004), 303–328. Schultz, Helga, Soziale und politische Auseinandersetzungen in Rostock im 18. Jahrhundert (Weimar, 1974). Schulze, Winfried, »Hausgesetzgebung und Verstaatlichung im Hause Österreich vom Tode Maximilians I. bis zur Pragmatischen Sanktion«, in: Johannes Kunisch (Hg.), Der dynastische Fürstenstaat: Zur Bedeutung von Sukzessionsordnungen für die Entstehung des frühmodernen Staates (Berlin, 1982), 253–271. –, Deutsche Geschichtswissenschaft nach 1945 (München, 1989). –, »Die Entwicklung des ›teutschen Bauernrechts‹ in der frühen Neuzeit«, Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte, XII (1990), 127–163. –, »Der bäuerliche Widerstand und die ›Rechte der Menschheit‹«, in: Oliver Volckart (Hg.), Frühneuzeitliche Obrigkeiten im Wettbewerb: Institutioneller und wirtschaftlicher Wandel zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert (Baden-Baden, 1997), 126–138. Schumann, Jutta, Die andere Sonne: Kaiserbild und Medienstrategien im Zeitalter Leopolds I. (Berlin, 2003). Schunka, Alexander, Soziales Wissen und dörfliche Welt: Herrschaft, Jagd und Naturwahrnehmung in Zeugenaussagen des Reichskammergerichts aus Nordschwaben, 16.–17. Jahrhundert (Frankfurt am Main, 2000). –, »Exulanten in Kursachsen im 17. Jahrhundert«, Herbergen der Christenheit, XXVII (2003), 17–36. –, »Glaubensflucht als Migrationsoption: Konfessionell motivierte Migrationen in der Frühen Neuzeit«, Geschichte in Wissenschaft und Unterricht, LVI (2005), 547–564. –, Gäste, die bleiben: Zuwanderer in Kursachsen und der Oberlausitz im 17. und frühen 18. Jahrhundert (Münster, 2006). Schütte, Ulrich, Das Schloß als Wehranlage: Befestigte Schloßbauten der frühen Neuzeit im alten Reich (Darmstadt, 1994).
799
800
Literatur
Schweikhart, Gunter, »Antikenrezeption«, in: Aufklärung und Klassizismus in Hessen-Kassel unter Landgraf Friedrich II. 1760–1785 (Kassel, 1979), 119–127. Schwennicke, Andreas, »Ohne Steuer kein Staat«: Zur Entwicklung und politischen Funktion des Steuerrechts in den Territorien des Heiligen Römischen Reichs (1500–1800) (Frankfurt am Main, 1996). Schwerdtfeger, J., »Eine Denkschrift des Grossherzogs (nachmaligen Kaisers) Franz Stephan von Lothringen-Toscana aus dem Jahre 1742«, Archiv für österreichische Geschichte, LXXXV (1898), 361–378. Schwering, Leo, »Die Auswanderung protestantischer Kaufleute aus Köln nach Mülheim am Rhein im Jahre 1714«, Westdeutsche Zeitschrift für Geschichte und Kunst, XXVI (1907), 194–250. –, »Die religiöse und wirtschaftliche Entwickelung des Protestantismus in Köln während des 17. Jahrhunderts«, Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein, LXXXV (1908), 1–42. Scott, H. M., »Reform in the Habsburg monarchy 1740–1790«, in: ders. (Hg.), Enlightened absolutism: Reform and reformers in later eighteenth-century Europe (Houndmills, 1990), 145–187. –, »Aping the great powers: Frederick the Great and the defence of Prussia’s international position 1763–86«, German History, XII (1994) 286–307. –, The birth of a great power system 1740–1815 (London, 2006). Sedlmayr, Hans, »Die politische Bedeutung des deutschen Barocks (Der ›Reichsstil‹)«, in: Gesamtdeutsche Vergangenheit: Festgabe für Heinrich Ritter von Srbik zum 60. Geburtstag am 10. November 1938 (München, 1938), 126–140. See, Klaus von, Freiheit und Gemeinschaft: Völkisch-nationales Denken in Deutschland zwischen Französischer Revolution und Erstem Weltkrieg (Heidelberg, 2001). Seehase, Hans, »Der Augsburger Religionsfrieden von 1555, die Bedeutung des Primas in Germanien und das Erzstift Magdeburg«, in: Gerhard Graf (Hg.), Der Augsburger Religionsfrieden: Seine Rezeption in den Territorien des Reiches (Leipzig, 2006), 131–146. Seibicke, Wilfried, Die Personennamen im Deutschen (Berlin, 1982). Seiderer, Georg, Formen der Aufklärung in fränkischen Städten: Ansbach, Bamberg und Nürnberg im Vergleich (München, 1997). Seifert, Siegfried, »›Genie und Lumpen‹ – Programmatische Entwürfe Bertuchs zur Reform des deutschen Verlagsbuchhandels vor 1800: Überlegungen zu einem Forschungsansatz«, in: Gerhard R. Kaiser und Siegfried Seifert (Hgg.), Friedrich Justin Bertuch (1747–1822): Verleger, Schriftseller und Unternehmer im klassischen Weimar (Tübingen, 2000), 291–299. Seils, Ernst-Albert, Die Staatslehre des Jesuiten Adam Contzen, Beichtvater Kurfürst Maximilian I. von Bayern (Lübeck, 1968). Sellert, Wolfgang, Über die Zuständigkeitsbegrenzung von Reichshofrat und Reichskammergericht insbesondere in Strafsachen und Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (Aalen, 1965). –, »Gewalt, Macht oder Recht? Die Reichsjustiz als Garant der Friedensordnung«, in: Peter Claus Hartmann (Hg.), Das Heilige Römische Reich und sein Ende 1806: Zäsur in der deutschen und europäischen Geschichte (Regensburg, 2006), 38–50. Shaw, Stanford J., History of the Ottoman empire and modern Turkey, 2 Bde. (Cambridge, 1976– 1977).
Literatur
Sheehan, James J., German history 1770–1866 (Oxford, 1989). –, »Paradigm lost? The ›Sonderweg‹ revisited«, in: Gunilla Budde (Hg.), Transnationale Geschichte: Themen, Tendenzen und Theorien; Jürgen Kocka zum 65. Geburtstag (Göttingen, 2006), 150–160. Sheehan, Jonathan, The Enlightenment Bible: Translation, scholarship, culture (Princeton, 2005). Sheldon, William F., The intellectual development of Justus Möser: The growth of a German patriot (Osnabrück, 1970). Sichtermann, Hellmut, »Winckelmann in Italien«, in: Thomas W. Gaehtgens (Hg.), Johann Joachim Winckelmann 1717–1768 (Hamburg, 1986), 121–160. Sicken, Bernhard, »Leitungsfunktionen des Fränkischen Reichskreises im Aufklärungszeitalter: Zwischen Standesvorzug und Sachkompetenz«, in: Wolfgang Wüst (Hg.), Reichskreis und Territorium: Die Herrschaft über die Herrschaft? Supraterritoriale Tendenzen in Politik, Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft: Ein Vergleich süddeutscher Reichskreise (Stuttgart, 2000), 251–279. Siebers, Winfried, »Bildung auf Reisen: Bemerkungen zur Peregrinatio academica, Gelehrtenund Gebildetenreise«, in: Michael Maurer (Hg.), Neue Impulse der Reiseforschung (Berlin, 1999), 177–188. Siemann, Wolfram, Vom Staatenbund zum Nationalstaat: Deutschland 1806–1871 (München, 1995). –, »›Der deutsche Bund ist nur die Continuität des Reichs …‹ : Über das Weiterleben des Alten Reiches nach seiner Totsagung im Jahre 1806«, Geschichte in Wissenschaft und Unterricht, LVII (2006), 585–593. Sikora, Michael, Disziplin und Desertion: Strukturprobleme militärischer Organisation im 18. Jahrhundert (Berlin, 1996). Simms, Brendan, The impact of Napoleon: Prussian high politics, foreign policy and the crisis of the executive, 1797–1806 (Cambridge, 1997). –, The struggle for mastery in Germany, 1779–1850 (London, 1998). –, Three victories and a defeat: The rise and fall of the first British Empire, 1714–1783 (London, 2007). Smend, Rudolf, Das Reichskammergericht (Weimar, 1911). Smith, Pamela H., The business of alchemy: Science and culture in the Holy Roman Empire (Princeton, NJ, 1994). Sobiech, Frank, Herz, Gott, Kreuz: Die Spiritualität des Anatomen, Geologen und Bischofs Dr. mHg. Nils Stensen, 1638–86 (Münster, 2004). Soliday, Gerald L., A community in conflict: Frankfurt society in the seventeenth and early eighteenth centuries (Hanover, NH, 1974). Sommer, Louise, Die österreichischen Kameralisten in dogmengeschichtlicher Darstellung, 2 Bde. in 1 (Wien, 1920, 1925, Nachdruck Aalen, 1967). Sorkin, David, The religious Enlightenment: Protestants, Jews, and Catholics from London to Wien (Princeton, 2008). Sosulski, Michael J., Theater and nation in eighteenth-century Germany (Aldershot, 2007). Spalding, Paul S., Seize the book, jail the author: Johann Lorenz Schmidt and censorship in eighteenth-century Germany (West Lafayette, IN, 1998). Speitkamp, Winfried, »Soziale Unruhe und ständische Reaktion in Hessen-Kassel zur Zeit der Französischen Revolution«, in: Helmut Berding (Hg.), Soziale Unruhen in Deutschland während der Französischen Revolution (Göttingen, 1988), 130–148. Spielmann, John P., Leopold I of Austria (London, 1977).
801
802
Literatur
–, The city and the crown: Wien and the imperial court 1600–1740 (West Lafayette, IN, 1993). Spindler, Max et al. (Hgg.), Handbuch der Bayerischen Geschichte, 4 Bde. in 6 (München, 1967– 1975). Spohnholz, Jesse, The tactics of toleration: A refugee community in the age of religious wars (Newark, DE, and Lanham, MD, 2011). Srbik, Heinrich von, Das Österreichische Kaisertum und das Ende des Heiligen Römischen Reiches 1804–1806 (Berlin, 1927). Stamm-Kuhlmann, Thomas, »›Für dessen Constitution ich keine drei Kreuzer mehr gebe‹ : Hardenberg, Preußen und das Alte Reich«, in: Michael North (Hg.), Das Ende des Alten Reiches im Ostseeraum: Wahrnehmungen und Transformationen (Köln, 2008), 71–85. Stammen, Theo und Friedrich Eberle (Hgg.), Deutschland und die Französische Revolution 1789–1806 (Darmstadt, 1988). Steinmetz, Horst (Hg.), Friedrich. II, König von Preußen, und die deutsche Literatur des 18. Jahrhunderts: Texte und Dokumente (Stuttgart, 1985). Sternhell, Zeev, The Anti-Enlightenment tradition, übers. v. David Maisel (New Haven, CT, 2010). Stier, Bernhard, Fürsorge und Disziplinierung im Zeitalter des Absolutismus: Das Pforzheimer Zucht- und Waisenhaus und die badische Sozialpolitik im 18. Jahrhundert (Sigmaringen, 1988). Stievermann, Dieter, »Politik und Konfession im 18. Jahrhundert«, Zeitschrift für historische Forschung, XVIII (1991), 177–199 –, »Der Fürstenbund von 1785 und das Reich«, in: Volker Press (Hg.), Alternativen zur Reichsverfassung in der Frühen Neuzeit? (München, 1995), 209–226. Stollberg-Rilinger, Des Kaisers alte Kleider: Verfassungsgeschichte und Symbolsprache des Alten Reiches (München, 2008). Stolleis, Michael, »Veit Ludwig von Seckendorff«, in: ders. (Hg.), Staatsdenker im 17. und 18. Jahrhundert: Reichspublizistik, Politik, Naturrecht, 2. Aufl. (Frankfurt am Main, 1987), 148–171. –, Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland, 3 Bde. (München, 1988–1999). –, Heiliges Römisches Reich deutscher Nation, Deutsches Reich, »Drittes Reich«: Transformation und Destruktion einer politischen Idee (Wetzlar, 2007). Stolz, Otto, »Zur Entwicklungsgeschichte des Zollwesens innerhalb des alten Deutschen Reiches«, Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, XLI (1954), 1–41. Stone, Daniel, The Polish-Lithuanian state, 1386–1795 (Seattle und London, 2001). Ströhmer, Michael, »Landstädtisches Reichsbewusstsein im nordwestdeutschen Bischofsstaat: Eine historische Denkschrift des Brakeler Stadrates zum zentralistischen Staatsausbau im Fürstbistum Paderborn aus dem Jahr 1755«, Westfälische Zeitschrift, CLVI (2006), 265– 299. Strom, Jonathan, Orthodoxy and reform: The clergy in seventeenth century Rostock (Tübingen, 1999). Stroup, John, »Protestant churchmen in the German Enlightenment: mere tools of temporal government?«, Lessing Yearbook, X (1978), 149–189. –, The struggle for identity in the clerical estate: Northwest German protestant opposition to absolutist policy in the eighteenth century (Leiden, 1984). Struve, Burkhard Gotthelf, Ausführliche Historie der Religions-Beschwerden zwischen denen Römisch-Catholischen und Evangelischen im Teutschen Reich: Von deren Anfang, Fortgang und wahren Beschaffenheit, wie sie von Zeit der Reformation an … bis auf ietzige Zeiten;
Literatur
Aus den actis publicis und zuverläßigen Nachrichten … in zweyen Theilen erläutert, 2 Bde. (Leipzig, 1722). Stürmer, Michael, Herbst des Alten Handwerks: Zur Sozialgeschichte des 18. Jahrhunderts (München, 1979). Stulz, Percy und Alfred Opitz, Volksbewegungen in Kursachsen zur Zeit der Französischen Revolution (Berlin, 1956). Sudhof, Siegfried, Von der Aufklärung zur Romantik: Die Geschichte des »Kreises von Münster« (Berlin, 1973). Sugenheim, Samuel, Geschichte der Aufhebung der Leibeigenschaft und Hoerigkeit in Europa bis um die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts (St. Petersburg, 1861). Sutter, Berthold, »Kaisertreue oder rationale Überlebensstrategie? Die Reichsritterschaft als habsburgische Klientel im Reich«, in: Heinz Duchhardt und Matthias Schnettger (Hgg.), Reichsständische Libertät und habsburgisches Kaisertum (Mainz, 1999) 257–307. Szabo, Franz A. J., The Seven Years War in Europe 1756–1763 (London, 2008). Taddey, Gerhard, Lexikon der deutschen Geschichte: Ereignisse – Insitutionen – Personen; Von den Anfängen bis zur Kapitulation 1945, 3. Aufl. (Stuttgart, 1998). Tantner, Anton, Ordnung der Häuser, Beschreibung der Seelen: Hausnumerierung und Seelenkonskription in der Habsburger Monarchie (Innsbruck, 2007). Teuteberg, Hans J., »Das Kanalwesen als Beitrag zur Entstehung der modernen Welt«, Scripta Mercaturae. Zeitschrift für Wirtschafts- und Sozialgeschichte (1984), 1–29. Thomann, Marcel, »Christian Wolff«, in: Michael Stolleis (Hg.), Staatsdenker im 17 und 18. Jahrhundert: Reichspublizistik, Politik, Naturrecht, 2. Aufl. (Frankfurt am Main, 1987), 257–283. Thompson, Andrew, Britain, Hanover and the Protestant interest, 1688–1756 (Woodbridge, 2006). Toellner, Richard, »Die Leopoldina – eine ›terra incognita‹ in der deutschen Akademiegeschichtsschreibung: Johann Laurentius Bausch zum 400. Geburtstag«, in: ders. (Hg.), Die Gründung der Leopoldina – »Academia Naturae Curiosorum« – im historischen Kontext: Johann Laurentius Bausch zum 400. Geburtstag; Leopoldina-Symposium vom 29. September bis 1. Oktober 2005 in Schweinfurt (Bibliothek Otto Schäfer) (Stuttgart, 2008), 177– 187. Totok, Wilhelm, »Leibniz als Wissenschaftsorganisator«, in: ders. und Carl Haase (Hgg.), Leibniz: Sein Leben – sein Wirken – seine Welt (Hannover, 1966), 293–320. Trapp, Wolfgang, Kleines Handbuch der Maße, Zahlen, Gewichte und der Zeitrechnung, 2. Aufl. (Stuttgart, 1996). Tribe, Keith, »Cameralism and the science of government«, Journal of Modern History, LVI (1984), 263–284. –, Governing economy: The reformation of German economic discourse 1750–1840 (Cambridge, 1988). –, Strategies of economic order: German economic discourse 1750–1950 (Cambridge, 1995). Troßbach, Werner, »Südwestdeutsche Leibeigenschaft in der Frühen Neuzeit – eine Bagatelle?«, Geschichte und Gesellschaft, VII (1981), 69–90. –, »Fürstenabsetzungen im 18. Jahrhundert«, Zeitschrift für historische Forschung, XIII (1986), 425–454. –, Bauern 1648–1806 (München, 1993). Trunz, Erich, »Der deutsche Späthumanismas um 1600 als Standeskultur«, in: Richard Alewyn (Hg.), Deutsche Barock forschung (Köln und Berlin, 1965), 147–181.
803
804
Literatur
Tschirch, Otto, Geschichte der öffentlichen Meinung in Preussen vom Baseler Frieden bis zum Zusammenbruch des Staates (1795–1806), 2 Bde. (Weimar, 1933–1934). Tümmler, Hans, Carl August von Weimar, Goethes Freund: Eine vorwiegend politische Biographie (Stuttgart, 1978). Ulbricht, Otto, Englische Landwirtschaft in Kurhannover in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts: Ansätze zu historischer Diffusionsforschung (Berlin, 1980). Ullmann, Sabine, Nachbarschaft und Konkurrenz: Juden und Christen in Dörfern der Markgrafschaft Burgau, 1650 bis 1750 (Göttingen, 1999). Umbach, Maiken, »The politics of sentimentality and the German Fürstenbund, 1779–1785«, The Historical Journal, XLI (1998), 679–704. –, »Visual culture, scientific images and German small-state politics in the late Enlightenment«, Past and Present, Nr. 158 (1998), 110–145. –, Federalism and Enlightenment in Germany, 1740–1806 (London, 2000). –, »Culture and Bürgerlichkeit in eighteenth-century Germany«, in: Hamish Scott und Brendan Simms (Hgg.), Cultures of power in Europe during the long eighteenth century (Cambridge, 2007), 180–199. Urbanitsch, Peter, »Landes-Bewußt-Sein«, in: Ernst Bruckmüller und Peter Urbanitsch (Hgg.), 996–1996. Ostarrichi – Österreich: Menschen – Mythen – Meilensteine (Horn, 1996), 131– 142. Valjavec, Fritz, Die Entstehung der politischen Strömungen in Deutschland 1770–1815, mit einem Nachwort v. Jörn Garber (Kronberg im Taunus, 1978). Van Dülmen, Richard, Propst Franziskus Töpsl (1711–1796) und das Augustiner-Chorherrenstift Polling: Ein Beitrag zur Geschichte der katholischen Aufklärung in Bayern (Kallmünz, 1967). –, The Society of the Enlightenment (Cambridge, 1992). Vann, James Allen, The Swabian Kreis: Institutional growth in the Holy Roman Empire, 1648– 1715 (Brüssel, 1975). –, The making of a state: Württemberg, 1593–1793 (Ithaca, NY, 1984). Vazsonyi, Nicholas, »Montesquieu, Friedrich Carl von Moser, and the ›national spirit debate‹ in Germany, 1765–1767«, German Studies Review, XX (1999), 225–246. Ventzke, Marcus, Das Herzogtum Sachsen-Weimar-Eisensach 1775–1783: Ein Modell aufgeklärter Herrschaft? (Köln, 2004). Verdenhalven, Fritz, Alte Maße, Münzen und Gewichte aus dem deutschen Sprachgebiet (Neustadt an der Aisch, 1968). Vetter, Roland, »Heidelberg und die französische Kampagne von 1693«, in: Gerhard Fritz und Roland Schurig (Hgg.), Der Franzoseneinfall 1693 in Südwestdeutschland: Ursachen – Folgen – Probleme (Remshalden-Buoch, 1993), 39–50. –, »Die ganze Stadt ist abgebrannt«: Heidelbergs zweite Zerstörung im Pfälzischen Erbfolgekrieg 1693, 3. Aufl. (Karlsruhe, 2009). Vierhaus, Rudolf, »Montesquieu in Deutschland«, in: Ernst-Wolfgang Böckenförde (Hg.), Collegium Philosophicum: Studien Joachim Ritter zum 60. Geburtstag (Basel und Stuttgart, 1965), 403–437. –, »Land, Staat und Reich in der politischen Vorstellungswelt deutscher Landstände im 18. Jahrhundert«, Historische Zeitschrift, CCXXIII (1975) 40–60. –, Deutschland im Zeitalter des Absolutismus (Göttingen, 1978). –, »›Patriotismus‹ : Begriff und Realität einer moralisch-politischen Haltung«, in: Ulrich Herrmann (Hg.), Die Bildung des Bürgers: Die Formierung der bürgerlichen Gesellschaft im 18. Jahrhundert (Weinheim und Basel, 1982), 119–131.
Literatur
–,
»The revolutionizing of consciousness: A German utopia?«, in: Eckhart Hellmuth (Hg.), The transformation of political culture: England and Germany in the late eighteenth century (Oxford, 1990), 561–577. Vleeschauwer, H.-J. de, The development of Kantian thought: The history of a doctrine, übers. v. A. R. C. Duncan (London 1962). Vocelka, Karl, Glanz und Untergang der höfischen Welt: Repräsentation, Reform und Reaktion im Habsburgischen Vielvölkerstaat (Wien, 2001). Vogler, Günter, Absolutistische Herrschaft und ständische Gesellschaft: Reich und Territorien von 1648 bis 1790 (Stuttgart, 1996). Volckart, Oliver, »Politische Zersplitterung und Wirtschaftswachstum im Alten Reich, ca. 1650–1800«, Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, LXXXVI (1999), 1– 38. –, Wettbewerb und Wettbewerbsbeschränkung im vormodernen Deutschland 1000–1800 (Tübingen, 2002). Voltelini, Hans, »Eine Denkschrift des Grafen Johann Anton Pergen über die Bedeutung der römischen Kaiserkrone für das Haus Österreich«, in: Gesamtdeutsche Vergangenheit: Festgabe für Heinrich Ritter von Srbik zum 60. Geburtstag am 10. November 1938 (München, 1938), 152–168. Volz, Gustav Berthold, »Friedrichs des Großen Plan einer Losreißung Preußens von Deutschland«, Historische Zeitschrift, LXXII (1920), 267–277. Voss, Jürgen, »Zur Aufklärungsdiskussion im späten 18. Jahrhundert«, in: Deutsch-französische Beziehungen im Spannungsfeld von Absolutismus, Aufklärung und Revolution: Ausgewählte Beiträge von Jürgen Voss (Bonn, 1992), 215–239. –, »Die Eudämonia (1795–1798): Ein Kampforgan reaktionär-konservativer Grundhaltung«, in: Pierre-André Bois (Hg.), Voix conservatrices et réactionnaires dans les périodiques allemands de la Révolution française à la Restauration (Bern, 1999), 271–298. Wagner, Fritz, Kaiser Karl VII. und die grossen Mächte 1740–1745 (Stuttgart, 1938). Wagner, Gabriel, Ausgewählte Schriften und Dokumente, hg. v. Siegfried Wollgast (StuttgartBad Cannstadt, 1997). Wagner, Georg, Das Türkenjahr 1664: Eine europäische Bewährung; Raimund Montecuccoli, die Schlacht von Gotthard-Mogersdorf und der Friede von Eisenburg (Vasvár) (Eisenstadt, 1964). Wagner, Michael, »Der sächsische Bauernaufstand und die Französische Revolution in der Perzeption der Zeitgenossen«, in: Helmut Berding (Hg.), Soziale Unruhen in Deutschland während der Französischen Revolution (Göttingen, 1988), 149–165. Wagner, Oskar, Mutterkirche vieler Länder: Geschichte der Evangelischen Kirche im Herzogtum Teschen 1545–1918/20 (Wien, 1978). Wagner, Walter, Die Geschichte der Akademie der Bildenden Künste in Wien (Wien, 1967). Wagner, Wolfgang (Hg.), Das Staatsrecht des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation: Eine Darstellung der Reichsverfassung gegen Ende des 18. Jahrhunderts nach einer Handschrift der Wiener Nationalbibliothek, mit einem Vorwort v. Hermann Conrad (Karlsruhe, 1968). Wakefield, Andre, The disorganised police state: German cameralism as science and practice (Chicago, MI, 2009). Walker, Mack, German home towns: Community, state and general estate 1648–1871 (Ithaca, NY, 1971), –, Johann Jakob Moser and the Holy Roman Empire of the German Nation (Chapel Hill, NC, 1981).
805
806
Literatur
–,
The Salzburg transaction: Expulsion and redemption in eighteenth-century Germany (Ithaca, NY, und London, 1992). Wallmann, Johannes, »Union, Reunion, Toleranz: Georg Calixts Einigungsbestrebungen und ihre Rezeption in der katholischen und protestantischen Theologie des 17. Jahrhunderts«, in: Heinz Duchhardt (Hg.), Union, Konversion, Toleranz: Dimensionen der Annäherung zwischen den christlichen Konfessionen im 17. und 18. Jahrhundert (Mainz, 2000), 21–37. –, Der Pietismus (Göttingen, 2005). Wallner, Emil, »Die kreissässigen Reichsterritorien am Vorabend des Lunéviller Friedens«, Mitteilungen des Österreichischen Instituts für Geschichtsforschung, XI, Ergänzungsband (1929), 681–716. Walter, Gero, Der Zusammenbruch des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation und die Problematik seiner Restauration in den Jahren 1814/15 (Mainz, 1980). Walter, Maximilian, Das Fürststift Kempten im Zeitalter des Merkantilismus: Wirtschaftspolitik und Realentwicklung (1648–1802/03) (Stuttgart, 1995). Walter, Rolf, »Merkantilpolitische Handelshemmnisse (im territorialen Vergleich) am Beispiel eines territorial relativ zersplitterten Gebietes«, in: Oliver Volckart (Hg.), Frühneuzeitliche Obrigkeiten im Wettbewerb: Institutioneller und wirtschaftlicher Wandel zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert (Baden-Baden, 1997), 212–243. Walther, Gerrit, »Treue und Globalisierung: Die Mediatisierung der Reichsritterschaft im deutschen Südwesten«, in: Volker Himmelein (Hg.), Alte Klöster, neue Herren: Die Säkularisation im deutschen Südwesten 1803, 2 Bde. in 3 (Ostfildern, 2003), II/2, 857–872. Wandruszka, Adam, Leopold II.: Erzherzog von Österreich, Grossherzog von Toskana, König von Ungarn und Böhmen, Römischer Kaiser, 2 Bde. (Wien, 1963–1965). Wangermann, Ernst, From Joseph II to the Jacobin trials: Government policy and public opinion in the Habsburg dominions in the period of the French Revolution (Oxford, 1959). –, »Deutscher Patriotismus und österreichischer Reformabsolutismus im Zeitalter Josephs II.«, in: Heinrich Lutz (Hg.), Österreich und die deutsche Frage im 19. und 20. Jahrhundert: Probleme der politisch-staatlichen und soziokulturellen Differenzierung im deutschen Mitteleuropa (München, 1982), 60–72. Waniek, Gustav, Gottsched und die deutsche Litteratur seiner Zeit (Leipzig, 1897). Wappmann, Volker, Durchbruch zur Toleranz: Die Religionspolitik des Pfalzgrafen Christian August von Sulzbach, 1622–1708 (Neustadt an der Aisch, 1995). Ward, W. R., The Protestant evangelical awakening (Cambridge, 1992). –, Christianity under the ancien régime, 1648–1789 (Cambridge, 1999). Warde, Paul, »Forests, energy and politics in the early modern German states«, in: Simonetta Cavaciocchi (Hg.), Economia e energia secc. XII–XVIII (Florenz, 2003), 585–597. Watanabe-O’Kelly, Helen, »The equestrian ballet in seventeenth-century Europe – origin, description, development«, German Life and Letters, N.S. XXXVI (1983), 198–212. –, Court culture in Dresden: From Renaissance to Baroque (Houndmills, 2002). Weber, Edwin Ernst, »Bäuerliche Landschaften in südwestdeutschen Reichstadt-Territorien der frühen Neuzeit«, in: Peter Blickle (Hg.), Landschaften und Landstände in Oberschwaben: Bäuerliche und bürgerliche Repräsentation im Rahmen des frühen europäischen Parlamentarismus (Tübingen, 2000), 207–222. Weber, Matthias, Das Verhältnis Schlesiens zum Alten Reich in der frühen Neuzeit (Köln, 1992). Weber, Wolfgang E. J., Prudentia gubernatoria: Studien zur Herrschaftslehre in der deutschen politischen Wissenschaft des 17. Jahrhunderts (Tübingen, 1992).
Literatur
–,
»›What a good ruler should not do‹ : Theoretical limits of royal power in European theories of absolutism, 1500–1700«, Sixteenth-Century Journal, XXVI (1995), 897–915. –, »Describere sine lacrumis vix liceat: Die Reichskreise in der Reichspublizistik des 17. und 18. Jahrhunderts«, in: Wolfgang Wüst (Hg.), Reichskreis und Territorium: Die Herrschaft über die Herrschaft? Supraterritoriale Tendenzen in Politik, Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft: Ein Vergleich süddeutscher Reichskreise (Stuttgart, 2000), 39–70. –, »›Aus altem orientalischen Schnitt und modernen Stoff zusammengesetzt‹ : Zur Wahrnehmung und Einschätzung der geistlichen Staaten in der politiktheoretisch-reichspublizistischen Debatte des 17. und 18. Jahrhunderts«, in: Wolfgang Wüst (Hg.), Geistliche Staaten in Oberdeutschland im Rahmen der Reichsverfassung: Kultur – Verfassung – Wirtschaft – Gesellschaft; Ansätze zu einer Neubewertung (Epfendorf, 2002), 67–83. Wegert, Karl H., »Patrimonial rule, popular self-interest, and Jacobinism in Germany, 1763– 1800«, Journal of Modern History, LIII (1981), 440–467. –, German radicals confront the common people: Revolutionary politics and popular politics 1789–1849 (Mainz, 1992). Wegner, Karl-Hermann, »Das Stadtbild Kassels im 18. Jahrhundert. Von der Festung zur Stadt in der Landschaft«, in: Heide Wunde, Christina Vanja und Karl-Hermann Wegner (Hgg.), Kassel im 18. Jahrhundert: Residenz und Stadt (Kassel, 2000), 143–159. Wehler, Hans-Ulrich, Deutsche Gesellschaftsgeschichte, 5 Bde. (München, 1987–2008). Weigl, Engelhard, Schauplätze der deutschen Aufklärung: Ein Städterundgang (Reinbek, 1997). Weis, Eberhard, »Napoleon und der Rheinbund«, in: Armgard von Reden-Dohna (Hg.), Deutschland und Italien im Zeitalter Napoleons (Wiesbaden, 1979), 57–80. Weitlauff, Manfred, Die Reichskirchenpolitik des Hauses Bayern unter Kurfürst Max Emanuel (1679–1701) (St. Ottilien, 1985). Weintraub, Wiktor, »Tolerance and intolerance in old Poland«, Canadian Slavonic Papers, XIII (1971), 21–43. Welke, Martin, »Gemeinsame Lektüre und frühe Formen von Gruppenbildungen im 17. und 18. Jahrhundert: Zeitungslesen in Deutschland«, in: Otto Dann (Hg.), Lesegesellschaften und bürgerliche Emanzipation (München, 1981), 29–54. Welker, Karl H. L., Rechtsgeschichte als Rechtspolitik: Justus Möser als Jurist und Staatsmann, 2 Bde. (Osnabrück, 1996). Wells, C. J., German: A linguistic history to 1945 (Oxford, 1985). Wende, Peter, Die geistlichen Staaten und ihre Auflösung im Urteil der zeitgenössischen Publizistik (Lübeck, 1966). Wendehorst, Alfred und Stefan Benz, Verzeichnis der Säkularkanonikerstifte der Reichskirche, 2. Aufl. (Neustadt an der Aisch, 1997). Wendehorst, Stephan und Siegrid Westphal, »Reichspersonal in der Frühen Neuzeit? Überlegungen zu Begrifflichkeit und Konturen einer auf Kaiser und Reich bezogenen Funktionselite«, in: Anette Baumann, Peter Oestmann, Stephan Wendehorst und Siegrid Westphal (Hgg.), Reichspersonal: Funktionsträger für Kaiser und Reich (Köln, 2003), 1–20. Westphal, Siegrid, Kaiserliche Rechtsprechung und herrschaftliche Stabilisierung: Reichsgerichtsbarkeit in den thüringischen Territorialstaaten 1648–1806 (Köln, 2002). Whaley, Joachim, »Symbolism for the survivors: The disposal of the dead in Hamburg in the late seventeenth and eighteenth centuries«, in: ders. (Hg.), Mirrors of mortality: Studies in the social history of death (London, 1981), 80–105. –, Religious toleration and social change in Hamburg 1529–1819 (Cambridge, 1985).
807
808
Literatur
–,
»Obedient Servants? Lutheran attitudes to authority and society in the first half of the seventeenth century: The case of Johann Balthasar Schupp«, The Historical Journal, XXXV (1992), 27–42. –, »Die Habsburgermonarchie und das Heilige Römische Reich im 18. Jahrhundert«, in: Wilhelm Brauneder und Lothar Höbelt (Hgg.), Sacrum imperium: Das Reich und Österreich 996–1806 (Wien, 1996), 288–318. –, »Thinking about Germany, 1750–1815: the birth of a nation?«, Publications of the English Goethe Society, N.S. LXVI (1996), 53–72. –, »A tolerant society? Religious toleration in the Holy Roman Empire«, in: Ole Peter Grell und Roy Porter (Hgg.), Toleration in Enlightenment Europe (Cambridge, 2000), 175–195. –, »The Old Reich in modern memory: Recent controversies concerning the ›relevance‹ of early modern German history«, in: Christian Emden und David Midgley (Hgg.), German literature, history and the nation (Frankfurt am Main, 2004), 25–49. –, »Reich, Nation, Volk: Early Modern Perspectives«, Modern Languages Review, CI (2006), 442–455. –, »Religiöse Toleranz als allgemeines Menschenrecht in der Frühen Neuzeit?«, in: Georg Schmidt, Martin van Gelderen und Christopher Snigula (Hgg.), Kollektive Freiheitsvorstellungen im frühneuzeitlichen Europa, 1400–1850 (Frankfurt am Main, 2006), 397–416. –, »The transformation of the Aufklärung: From the idea of power to the power of ideas«, in: Hamish Scott and Brendan Simms (Hgg.), Cultures of power in Europe during the long eighteenth century (Cambridge, 2007), 158–179. –, »Kulturelle Toleranz – die deutsche Nation im europäischen Vergleich«, in: Georg Schmidt (Hg.), Die deutsche Nation im frühneuzeitlichen Europa. Politische Ordnung und kulturelle Identität? (München, 2010), 201–224. –, »A German nation? National and confessional identities before the Thirty Years War«, in: R. J. W. Evans, Michael Schaich und Peter H. Wilson (Hgg.), The Holy Roman Empire 1495–1806 (Oxford, 2011) 303–321. Wiedemann, Conrad, »Römische Staatsnation und griechische Kulturnation: Zum Paradigmawechsel zwischen Gottsched und Winckelmann«, in: Albrecht Schöne, Franz Norbert Mennemeier und Conrad Wiedemann (Hgg.), Kontroversen, alte und neue: Deutsche Literatur in der Weltliteratur – Kulturnation statt politischer Nation? (Tübingen, 1986), 173– 178. –, »Über das Projekt ›Berliner Klassik‹«. Online: http://www.berliner-klassik.de (letzter Zugriff 1. April 2014). Wienand, Adam (Hg.), Der Johanniter-Orden. Der Malteser-Orden: Der ritterliche Orden des hl. Johannes vom Spital zu Jerusalem (Köln, 1970). Wierichs, Marion, Napoleon und das »Dritte Deutschland« 1805/06: Die Entstehung der Großherzogtümer Baden, Berg und Hessen (Frankfurt am Main, 1978). Wild, Reiner, »Freidenker in Deutschland«, Zeitschrift für historische Forschung, III (1979), 253– 285. Willoweit, Dietmar, Rechtsgrundlagen der Territorialgewalt: Landesobrigkeit, Herrschaftsrechte und Territorium in der Rechtswissenschaft der Neuzeit (Köln, 1975). –, »Hermann Conring«, in: Notker Hammerstein (Hg.), Staatsdenker im 17. und 18. Jahrhundert: Reichspublizistik, Politik, Naturrecht, 2. Aufl. (Frankfurt am Main, 1987), 129–147. –, Deutsche Verfassungsgeschichte: Vom Frankenreich bis zur Wiedervereiningung Deutschlands, 4. Aufl. (München, 2001).
Literatur
Wilson, Catherine, »The reception of Leibniz in the eighteenth century«, in: Nicholas Jolley (Hg.), The Cambridge companion to Leibniz (Cambridge, 1995), 442–474. Wilson, Peter H., War, state and society in Württemberg, 1677–1793 (Cambridge, 1995) –, »The German ›Soldier Trade‹ of the seventeenth and eighteenth centuries: A reassessment«, International History Review, XVIII (1996), 757–792. –, German armies: War and German politics 1648–1806 (London, 1998). –, The Holy Roman Empire 1495–1806 (Houndmills, 1999). –, Absolutism in Central Europe (London, 2000). –, »The politics of military recruitment in eighteenth-century Germany«, English Historical Review, CXVII (2002), 536–568. –, »Der Favorit als Sündenbock: Joseph Süß Oppenheimer, 1698–1738«, in: Michael Kaiser (Hg.), Der zweite Mann im Staat: Oberste Amtsträger und Favoriten im Umkreis der Reichsfürsten in der Frühen Neuzeit (Berlin, 2003), 155–176. –, »Prusso-German social militarisation reconsidered«, in: Jürgen Luh (Hg.), Preussen, Deutschland und Europa 1701–2001 (Groningen, 2003), 355–384. –, From Reich to Revolution: German history, 1558–1806 (Houndmills, 2004). –, »Still a monstrosity? Some reflections on early modern German statehood«, The Historical Journal, XLIX (2006), 565–576. –, »Prussia’s relations with the Holy Roman Empire, 1740–1786«, The Historical Journal, LI (2008), 337–371. Winau, Rolf, »Zur Frühgeschichte der Academia Naturae Curiosum«, in: Fritz Hartmann und Rudolf Vierhaus (Hgg.), Der Akademiegedanke im 17. und 18. Jahrhundert (Bremen und Wolfenbüttel, 1977), 117–139. Winckelmann, Johann Joachim, Gedanken über die Nachahmung der griechischsen Werke in der Malerei und Blidhauerkunst, Hrsg. Luwig Uhlig, Stuttgart, 1969. Wines, Roger, »The imperial circles, princely diplomacy, and imperial reform, 1681–1714«, Journal of Modern History, XXXIX (1967), 1–29. Winkelbauer, Thomas, Ständefreiheit und Fürstenmacht: Länder und Untertanen des Hauses Habsburg im konfessionllen Zeitalter, 2 Bde. (Wien, 2003). Winkler, Heinrich August, Der lange Weg nach Westen, 2 Bde. (München, 2000). Winter, Eduard, Die tschechische und slowakische Emigration in Deutschland im 17. und 18. Jahrhundert: Beiträge zur Geschichte der Hussitischen Tradition (Berlin, 1955). Winzen, Kristina, Handwerk – Städte – Reich: Die städtische Kurie des Immerwährenden Reichstags und die Anfänge der Reichshandwerksordnung (Stuttgart, 2002). Wolf, Erik, »Idee und Wirklichkeit des Reiches im deutschen Rechtsdenken des 16. und 17. Jahrhunderts«, in: Karl Larenz (Hg.), Reich und Recht in der Deutschen Philosophie, 2 Bde. (Stuttgart und Berlin, 1943), I, 33–168. Wolf, Hubert, Die Reichskirchenpolitik des Hauses Lothringen (1680–1715): Eine Habsburger Sekundogenitur im Reich? (Stuttgart, 1994). Wolff, Helmut Christian, »Die Hamburger Barockoper 1678–1738«, in: 300 Jahre Oper in Hamburg (Hamburg, 1977), 72–91. Wolfrum, Edgar, Krieg und Frieden in der Neuzeit: Vom Westfälischen Frieden bis zum Zweiten Weltkrieg (Darmstadt, 2003). Wolgast, Eike, »Die Sicht des Alten Reiches bei Treitschke und Erdmannsdörffer«, in: Matthias Schnettger (Hg.), Imperium Romanum – Irregulare Corpus – Teutscher Reichs-Staat: Das Alte Reich im Verständnis der Zeitgenossen und der Historiographie (Mainz, 2002), 169– 188.
809
810
Literatur
–,
»Säkularisationen und Säkularisationspläne im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation vom 16. bis zum 18. Jahrhundert«, Rottenburger Jahrbuch für Kirchengeschichte, XXIII (2004) 25–43. Wollgast, Siegfried, Ehrenfried Walther von Tschirnhaus und die deutsche Frühaufklärung (Berlin, 1988). –, Philosophie in Deutschland zwischen Reformation und Aufklärung 1550–1650 (Berlin, 1988). –, »Zur philosophischen Frühaufklärung in Deutschland: Quellen, Hauptlinien, Vertreter«, in: Karol Bal, Siegfried Wollgast und Petra Schellenberger (Hgg.), Frühaufklärung in Deutschland und Polen (Berlin, 1991), 21–59. Wolter, Stefan, »Bedenket das Armuth«: Das Armenwesen der Stadt Eisenach im ausgehenden 17. und im 18. Jahrhundert (Göttingen, 2003). Wrede, Martin, Das Reich und seine Feinde: Politische Feindbilder in der reichspatriotischen Publizistik zwischen Westfälischem Frieden und Siebenjährigem Krieg (Mainz, 2004). –, »Der Kaiser, das Reich, die deutsche Nation – und ihre ›Feinde‹ : Natiogenese, Reichsidee und der ›Durchbruch des Politischen‹ im Jahrhundert nach dem Westfälischen Frieden«, Historische Zeitschrift, CCLXXX (2005), 83–116. Wunder, Bernd, »Pfarrwitwenkassen und Beamtenwitwen-Anstalten vom 16–19. Jahrhundert: Die Entstehung der staatlichen Hinterbliebenenversorgung in Deutschland«, Zeitschrift für historische Forschung, XII (1985), 429–498. –, »Der Chausseebau in Württemberg während des 18. Jahrhunderts: Infrastrukturpolitik zwischen Regierung, Landschaft und Schwäbischer Landkreis«, in: Wolfgang Schmierer (Hg.), Aus südwestdeutscher Geschichte: Festschrift für Hans-Martin Maurer. Dem Archivar und Historiker zum 65. Geburtstag (Stuttgart, 1994), 526–538. –, »Der Kaiser, die Reichskreise und der Chausseebau im 18. Jahrhundert«, Zeitschrift für neuere Rechtsgeschichte, XVIII (1996), 1–22. –, »Das Chausseestraßennetz des schwäbischen Kreises im 18. Jahrhundert«, Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins, CXLVII (1999), 515–535. –, »Das kaiserliche Emigrationsedikt von 1768: Ein Beispiel der Reichsgesetzgebung durch Kaiser und Kreise am Ende des Alten Reiches«, in Wolfgang Wüst (Hg.), Reichskreis und Territorium: Die Herrschaft über die Herrschaft? Supraterritoriale Tendenzen in Politik, Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft: Ein Vergleich süddeutscher Reichskreise (Stuttgart, 2000), 111–122. Würgler, Andreas, Unruhen und Öffentlichkeit: Städtische und ländliche Protestbewegungen im 18. Jahrhundert (Tübingen, 1995). Wüst, Wolfgang, Das Fürstbistum Augsburg: Ein geistlicher Staat im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation (Augsburg, 1997). Yavetz, Zvi, »Why Rome? Zeitgeist and ancient historians in early 19th century Germany«, American Journal of Philology, LCVI (1976), 276–296. Zachlod, Christian M., Die Staatsfinanzen des Hochstifts Hildesheim vom Ende des Siebenjährigen Krieges bis zur Säkularisation (1763–1802/03) (Stuttgart, 2007). Zammito, John H., »›The most hidden conditions of men of the first rank‹ : The pantheist current in eighteenth-century Germany ›uncovered‹ by the Spinoza controversy«, Eighteenth-century Thought, I (2003), 335–368. Zande, Johan van der, Bürger und Beamter: Johann Georg Schlosser, 1739–1799 (Stuttgart, 1986).
–,
»Popular philosophy and absolute monarchy«, in: Hans Blom, John Christian Laursen und Luisa Simonutti (Hgg.), Monarchisms in the age of enlightenment: Liberty, patriotism, and the common good (Toronto, 2007), 194–216. –, Sozietätslandschaft und Mitgliederstrukturen: Die mitteldeutschen Aufklärungsgesellschaften im 18. Jahrhundert (Tübingen, 1999). –, »Das Leben des Fürsten: Konturen eines Forschungsfeldes«, in: Holger Zaunstöck (Hg.), Das Leben des Fürsten: Studien zur Biografie von Leopold III. Friedrich Franz von AnhaltDessau (1740–1817) (Halle, 2008), 11–29. Zedinger, Renate, Franz Stephan von Lothringen (1708–1765): Monarch, Manager, Mäzen (Wien, 2008). Zedler, Johann Heinrich, Grosses vollständiges Universal-Lexicon aller Wissenschafften und Künste welche biszhero durch menschlichen Verstand Witz erfunden and verbessert worden, 64 Bde. (Leipzig, 1733–1754). Online: http://www.zedler-lexikon.de/index.html (letzter Zugriff 1. April 2014). Zelle, Carsten, »Das Erhabene in der deutschen Frühaufklärung: Zum Einfluss der englischen Physikotheologie auf Barthold Heinrich Brockes’ Irdisches Vergnügen in Gott«, Arcadia. Zeitschrift fur Vergleichende Literaturwissenschaft, XXV (1990), 225–240. Ziegler, Walter, »Franz II. 1792–1806«, in: Anton Schindling und Walter Ziegler (Hgg.), Die Kaiser der Neuzeit 1519–1918 (München, 1990), 289–306. –, »Kaiser Franz II. (I.): Person und Wirkung«, in: Wilhelm Brauneder (Hg.), Heiliges Römisches Reich und moderne Staatlichkeit (Frankfurt am Main, 1993), 9–27. Ziekursch, Johannes, Hundert Jahre schlesischer Agrargeschichte: Vom Hubertusburger Frieden bis zum Abschluss der Bauernbefreiung (Breslau, 1915). Žmegač, Viktor, Geschichte der deutschen Literatur vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, 2 Bde. in 4 (Königstein im Taunus, 1978–1980). Zschunke, Peter, Konfession und Alltag in Oppenheim: Beiträge zur Geschichte von Bevölkerung und Gesellschaft einer gemischtkonfessionellen Kleinstadt in der frühen Neuzeit (Wiesbaden, 1984). Zückert, Hartmut, Die sozialen Grundlagen der Barockkultur in Süddeutschland (Stuttgart, 1988). –, »Barockbau-Erfahrungen von Bauherren und Untertanen«, in: Paul Münch (Hg.), »Erfahrung« als Kategorie der Frühneuzeitgeschichte (München, 2001), 451–469.
Register Aachen 327, 673 Aachen, Frieden von (1668) 47 Aachen, Frieden von (1748) 410, 443, 480 Abendroth, Amandus Augustus 587 Absolutismus 15–16, 19, 219–223, 290, 515, 520, 563 Academia Naturae Curiosorum 113 Ackermann, Konrad 606 Acta Eruditorum 112 Adolf Friedrich IV., Herzog von Mecklenburg-Strelitz (1752–1794) 633 Adorno, Theodor 518 Afsprung, Johann Michael 566 Ákos Barcsay, Fürst von Siebenbürgen (1658–1660) 43–44 Albrecht V., Herzog von Österreich (1404– 1439), heilig-römischer König (1438– 1439) 461 Albrecht von Sachsen-Teschen (1758–1763), Feldmarschall 658 Alchemie 114, 387 Alexander I., Zar von Russland (1801– 1825) 666, 709, 727 Alexander VIII., Papst (1689–1691) 108 Allgemeine Deutsche Bibliothek 535, 543– 544 Althann, Graf Michael Johann 158 Altranstädt, zweiter Friedensvertrag von (1707) 142 Amalie von Gallitzin, Fürstin 551, 614 amicabilis compositio 183, 201; siehe auch itio in partes Ämter (Distrikt) 299 Amtmann 299 Andreae, Johann Valentin 109–110, 113, 357 Anna Amalia von BraunschschweigWolfenbüttel (Herzogin von SachsenWeimar-Eisenach, 1758–1775) 617–619
Anne (Stuart), Königin von England (1702– 1707) 140 Ansbach 34, 237, 249, 254, 272–273, 306– 307, 309, 439, 441, 455, 458–462, 501, 579, 632, 653, 662, 729 Ansbach-Bayreuth siehe Ansbach Anselm II. Schwab, Abt von Salem (1746– 1778) 550 Anselm von Reichlin-Meldegg, Abt von Kempten (1727–1747) 285 Anton, Paul 357 Anton Ulrich, Herzog von BraunschweigWolfenbüttel (1685–1702, 1704–1714) 67, 95, 141, 203 Anton Viktor von Österreich, Erzherzog (1801–1835) 645 Apafy Mihály, Fürst von Siebenbürgen (1662–1690) 44–45 Architektur 115, 155, 160–162, 200, 260– 266, 334, 339, 608–611 Aretin, Johann Christoph von 717 Aretin, Karl Otmar von 451, 641, 644 Argenson, René Louis Marquis d’ 410, 432 Armenfürsorge 301, 583–587 Arnauld, Antoine 348–349 Arndt, Ernst Moritz 418 Arndt, Johann 357, 362, 382 Arnold, Gottfried 363 atlantisches Handelssystem 525–527 Aufklärung 12, 110, 112, 225–235, 267, 269, 355, 380–394, 403, 491, 506, 515–521, 528, 530–575, 584, 595–602, 606–607, 623–633, 680–681, 686–688, 743 Augsburger Assoziation (1686) 64 Augsburger Konfession (1530) 21, 442 Augsburger Religionsfriede (1555) 11 August II. (der Starke), König von Polen (1694–1733) 97, 195–196, 426, 435; siehe auch Friedrich August I., Kurfürst von Sachsen
Register
August III., König von Polen (1734–1763) 458, 470 August von Limburg-Stirum, Fürstbischof von Speyer 565, 649 Austerlitz, Schlacht bei (1805) 728–729 Auswanderung, Recht auf (ius emigrandi) 295
Bach, Johann Sebastian 356 Bacon, Francis 113, 382 Baden 283, 303, 307, 564, 570, 574–575, 579, 592, 632, 642, 650, 659, 663–666, 672, 677, 707, 712–714, 719–721, 728, 731–733 Baden, Frieden von (1714) 181–182 Bahrdt, Friedrich Karl 545 Bamberg, Bischof von 189, 260, 350, 484, 659 Banniza, Johann Peter 209 Barclay, John 268 Barclay, Robert 367 barocker Katholizismus 331–342 Barrierevertrag, dritter (1715) 145 Bartenstein, Johann Christoph 189, 209 Barthel, Johann Caspar 209–210, 350, 484– 485 Basedow, Johann Bernhard 598–599 Basel, Frieden von (1795) 644–645, 661– 662, 699 Batavische Republik 661, 666–667, 727 Bauernkrieg (1525) 12, 294, 577 Bauernrecht 295 Bauerntum 12, 141, 150, 176, 229, 241, 279, 283–296, 299–300, 303, 305, 307, 309, 333, 524, 570, 572–575, 579, 588, 659, 672–674, 677, 701 Baumgarten, Alexander Gottlieb 543, 610 Baumgarten, Siegmund Jakob 543 Bausch, Johann Lorenz 113 Bayerischer Kreis 150, 697, 713 Bayern 18, 21, 24, 38, 40, 45, 48, 54–55, 57, 61, 64, 67, 79, 86, 94, 96–98, 105, 134–135, 140–145, 149–150, 153, 159, 162, 164, 166, 173–174, 188, 191, 194, 196, 202, 220–221, 228–229, 236, 250, 259, 275– 276, 282–283, 289–292, 303–304, 314,
320, 323, 336–340, 346, 399, 405–409, 411, 413, 415, 421–432, 435, 438, 453, 456–466, 470, 472, 479, 481–487, 492– 493, 500, 523, 550, 573–574, 579, 582, 586, 592, 596, 599–600, 632, 639–644, 653–654, 659, 663–666, 677–678, 698, 708, 710–713, 716, 719–722, 724, 728– 729, 731–732, 734 Bayle, Pierre 350, 382, 387, 390, 531 Bayreuth 174, 249, 254, 307, 309, 439, 455, 458–462, 597, 632, 653, 662 Beauharnais, Eugène de 732 Becher, Johann Joachim 77, 102–104, 229– 230, 314, 324 Beck, Christian August 469 Becker, Rudolf Zacharias 535 Beckmann, Johann 572 Becmann, Johann Christoph 266 Befestigungen 19, 53, 115, 142, 260, 315, 613 Belgrad 164, 198, 315, 424 Belle-Isle, Charles Fouquet Marschall von 407, 426, 430 Belvedere, Wien 160 Benedikt XIV., Papst (1740–1758) 209 Bengel, Johann Albrecht 359 Berg 30, 175, 190, 198, 254, 261, 283, 325– 328, 353, 373–374, 423, 438, 461, 484, 642, 644, 652, 672, 729, 731, 733–734 Berg, Günther Heinrich von 563 Berlin 80, 97, 108, 158, 167, 169, 171, 174– 175, 190, 192, 212, 225, 253–254, 265, 276, 284, 305–309, 320, 322–325, 327, 329, 358–359, 381, 389, 391, 408–409, 414, 417, 459, 465–466, 473, 531, 535– 537, 544, 548, 552–554, 560, 581, 583, 585, 591, 596–597, 609–613, 620, 624, 629–630, 643–645, 649, 651–654, 656, 660–662, 666, 673, 681–682, 692, 704, 735–736, 747 Berlin, Friede von (1742) 408 Berlin, Saul 553 Berliner Akademie 114–115 Berliner Universität 600 Bernadotte, Graf Carl Johan 729 Bernhard, Herzog von Weimar 264 Bernhard Rosa, Abt von Grüssau 334
813
814
Register
Bernini, Gian Lorenzo 261 Bernstorff, Johann Hartwig Ernst von 471 Bertuch, Friedrich Justin 618–619 Bevölkerung 220, 384, 504, 523–524, 625 Bibra, Philipp Anton von 486, 550, 631 Biet, Jean 322 Bildung 595–602 Bildungsbürgertum 268, 394 Binnenhandel 78, 316, 525 Bocris, Georg Christian 494 Bodin, Jean 120, 225 Bodman siehe Rupert von Bodman Bodmer, Johann Jakob 214 Boehmer, Justus Henning 204 Böhme, Jakob 357, 361–362, 382, 537 Böhmen 34, 37, 48, 92, 96, 98, 104, 138, 153, 160, 220, 248, 262, 289, 303–304, 308, 332–334, 336, 365–366, 372, 399, 406–409, 411, 422, 424–425, 430–432, 438, 445, 456, 460–461, 525, 538, 576, 596, 640, 642, 652, 722 Böhmische Brüder 366 Bohse, August 268 Boineburg, Johann Christian 105–106 Bonner Universität 601 Borromeo, Carlo 549 Böttger, Johann Friedrich 324 Boyen, Hermann von 670 Boyne, Schlacht am (1690) 66 Brakel 502 Brandenburg 17–19, 21, 23–25, 27–30, 33– 38, 40, 45–54, 56, 59, 61, 64, 66, 72, 78–79, 93–98, 103, 124, 132, 140, 142, 148–149, 151, 154, 157, 167–170, 174–177, 179– 186, 190, 192, 198, 201, 204, 205, 220, 222, 231, 233, 240–243, 249–255, 261–263, 271, 274, 281, 289–290, 303–309, 313– 314, 317–318, 320, 322, 326–327, 333– 335, 337, 358–359, 363–368, 405–406, 411, 414, 426, 428, 435–441, 487, 526, 544–545, 573–574, 587, 598, 628, 743 Brandenburg-Ansbach, Markgraf von 34, 306 Brandenburg-Preußen siehe Preußen Braun, Heinrich 597, 599 Braunschweig 23, 32, 40, 50–52, 54, 59, 79,
95, 104, 168, 180, 272, 276, 324, 354, 523, 526, 531, 583, 597, 654, 673, 736 Braunschweig-Lüneburg 18–19, 24, 50, 94, 107, 124, 263, 307, 348 Braunschweig-Wolfenbüttel 18, 50, 67, 94, 141, 153, 176, 206, 254, 272, 289, 307, 317, 324, 545, 577, 599, 617, 652 Braunschweiger Union (1672) 50 Breisgau 88, 480, 574, 601, 713, 718–719, 728 Breitinger, Johann Jakob 214 Bremen 23–25, 27, 29–30, 37, 62, 80, 168– 169, 175, 244, 315, 353, 359, 368, 376, 525, 664, 673 Brenkenhoff, Franz Balthasar Schönberg von 573 Brenneysen, Enno Rudolph 177, 284 Breslau, Vertrag von (1741) 407 Bretzenheim, Fürst Karl August von (1790– 1804) 713, 718 britisch-russische Allianz (1805) 727 Brockes, Barthold Heinrich 388, 606 Broglie, Marshall Victor de 408, 413–414 Bruchsaler Residenz 265 Brühl, Graf Heinrich von 405–411 Brunnemann, Jakob 202 Buchau 631, 639 Buchheim, Graf Franz Anton von 108 Buddeus, Johann Franz 386, 390, 542 Bünau, Heinrich von 210 Bürgerlichkeit 530, 606 Bürgerschaft 152, 244, 279, 360–361, 563, 603, 611, 673 Bürgertum 16, 26, 380, 604; siehe auch Bildungsbürgertum, Bürgerschaft Burgund, Vertrag von (1548) 174 Büsch, Johann Georg 522 Buttlar, Eva von 364 Caesarini Fürstenerii (Leibniz) 124 Calenbergische Wittwen-VerpflegungsGesellschaft 586 Calixt, Georg 105, 107, 354–355 Calov, Abraham 355 Calvinismus 122, 249, 282, 327, 361, 387 Calwer Zeughandelscompagnie 325 Campe, Joachim Heinrich 599, 682
Register
Campo Formio, Vertrag von (1797) 663– 666, 688, 699, 710, 729 Carl Edzard, Fürst von Ostfriesland (1733– 1744) 177, 284, 436 Carmer, Johann Heinrich von 591 Carpzov, Johann Benedict 358 Cäsar Constantin Franz von Hoensbroech, Fürstbischof 464 Castiglione, Baldassare 268 Charlottenburger Schloss 263, 609 Charlottenburger Vertrag (1723) 185 Chemnitz, Bogislaus Philipp 119, 121–122, 205 Chotusitz, Schlacht bei (1742) 408 Christian Ernst, Markgraf von BrandenburgBayreuth 274 Christian Ludwig I., Herzog von Mecklenburg-Schwerin 176, 178, 284 Christian Ludwig II., Herzog von Mecklenburg-Schwerin 284 Christina, Königin von Schweden 25, 26, 33 christliche Vornamen 375 Christoph Bernhard von Galen, Fürstbischof von Münster 54, 87, 272, 347–348, 613 Christoph Franz von Hutten, Fürstbischof von Würzburg 172 Cirksena-Dynastie (Ostfriesland) 93, 176– 177, 436 Cisrhenanier 676 Clemens August, Kurfürst von Köln 86, 423, 439, 445, 447, 614 Clemens XI., Papst (1700–1721) 143, 154, 181 Clemens Wenzeslaus von Sachsen, Erzbischof von Trier 470, 614 Cobenzl, Graf Philipp von 653, 656–657 Cocceji, Heinrich von 204–205 Cocceji, Samuel von 591 Coehoorn, Menno van 262 Colloredo, Graf Rudolf Joseph von, Reichsvizekanzler 159, 435–436, 447, 471–472 Colloredo-Mansfeld, Fürst Franz Gundaker von, Reichsvizekanzler 494 Colloredo-Waldsee, Franz Karl Graf von 645 Condé, Louis Joseph de Bourbon, Prinz von 30
Conring, Hermann 105, 107, 119–120, 123 Contzen, Adam 228–229 Corpus Catholicorum 37, 201, 482, 542 Corpus Evangelicorum 37, 97, 180, 182, 184–185, 191, 197, 201, 208, 254, 335– 337, 353, 377, 413, 425, 439–441, 448, 455, 462, 469–470, 474, 482, 542 Custine, General Adam Phillipe, Comte de 655
Dalberg, Karl Theodor von, Reichserzkanzler 479, 487–488, 696–697, 709, 714, 716, 721, 734–735, Damian Hugo von Schönborn, Fürstbischof von Speyer 152, 168, 265, 346 Dänemark 27–28, 50–51, 54, 67, 132, 167, 169, 191, 282, 366, 390, 444, 446, 454, 474, 553 Daniel, Christian 706 Delbrück, Hans 400 Denain, Schlacht bei (1712) 143 Derham, William 382 Dernbach siehe Peter Philipp von Dernbach Descartes, René 382, 387 Dessauer Philanthropinum 520 Dettingen, Schalcht bei (1743) 408, 410 Deutsche Bewegung 517–519, 532, 680 deutsche Freiheit und Libertät 12, 21, 27, 46, 49, 159, 183, 202, 205, 208, 219, 295, 402–403, 416, 442, 470–472, 488–489, 563, 564, 688, 694, 701 Deutsche Gesellschaften 211–215, 392 deutsche Gotik 648, 717 deutsche nationale Identität 504–511 Deutscher Bund 630, 640, 720, 737, 742, 745–746 Deutscher Orden 86, 711, 728 deutsche Sprache 211–215, 530 Diderot, Denis 515, 531 Diez, Immanuel Carl 687 Diözesangrenzen, Reform der 483–485 Dippel, Johann Konrad 365 Dohm, Christian Wilhelm 552, 554 Dornblüth, Augustin 214, 394 Dorsch, Anton Joseph 675 Drama 536
815
816
Register
drei schwarze Adler, Entente cordiale (1732) 195 Dreierkoalition (1668) 47 Dreizehnjähriger Krieg (1654–1667) 26 Dresden 59, 69, 80, 97, 262–263, 317, 320, 324, 339, 357, 409, 414–415, 455, 531, 673–674 Dresden, Friede von (1745) 436 Dresdner Akkord (1621) 333 Droit d’épave 718, 724–725 Duisburger Universität 203, 367, 601 Dumont, Daniel 675 Dumouriez, Charles François 654–657 Düsseldorf, Vertrag von (1705) 181
Eberhard Ludwig, Herzog von Württemberg 284, 613 Eberstein, Josef Karl Theodor von 639 Edelmann, Johann Christian 365, 545 Edikt von Nantes, Widerruf (1685) 64, 108, 306 Edikt von Potsdam (1685) 64, 306–307 Eggersdorf, Joseph Pachner von 76 Ehrentitel 92 Eichstätt, Fürstbischöfe von 345 Eisenburg, Friede von (1664) 45, 59 Eklektizismus 383–384 Eleonore von Pfalz-Neuburg, Gattin von Leopold I. 86, 94 Elers, Heinrich Julius 358 Elisabeth, Zarin von Russland 414 Elisabeth Charlotte von Orléans 65, 69 Elisabeth Christine von BraunschweigWolfenbüttel 94, 188, 206 Ellwangen, Fürstpropstei 264, 344, 346–347 Elsass 53–54, 69–70, 143–144, 408–409, 427, 431, 493, 646–655, 672 Eltz siehe Philipp Carl von Eltz Emanuel, Prinz von Portugal 195 Emden 93, 177, 284, 314, 368, 436, 524–525 Emden, Jacob 552 Emden, Synode von (1571) 353 Emigranten, französische 648, 650–651, 654 Enghien, Louis Antoine Duc d’ 725, 727 England siehe Großbritannien
Eosander, Johann Friedrich von 263, 323 Erblande 16, 36, 48, 80, 88, 138, 145, 150, 165, 230, 248, 266, 334, 336, 592, 718 Erfurt 40, 272, 531, 547, 575, 696, 699, 707, Erlach, Johann Bernhard Fischer von 154– 155, 161, 265 Ernesti, Johann August 543 ernestinische Herzöge und Herzogtümer 83, 497, 506–507, 616, 619 Ernst, Herzog von Gotha 227, 264 Ernst, Landgraf von Hessen-Rheinfels 106 Ernst II., Herzog von Sachsen-GothaAltenburg 616 Ernst August, Herzog von Calenberg 94–96 Ernst August, Herzog von Hannover 61, 67, 108, 124, 153 Ernst August, Herzog von Weimar 162 Ernst August von Braunschweig-Lüneburg, Fürstbischof von Osnabrück 263 Ernst Casimir, Graf von YsenburgBüdingen 364 Ernst Ludwig, Landgraf von HessenDarmstadt 174, 323 Ernst von Thun, Erzbischof von Salzburg 336 erste Bitte 482 Erthal siehe Friedrich Karl Joseph von Erthal Espen, Zeger Bernard van 350 Estland 167, 169, 743 Euchel, Isaac 552–553 Eudämonia 532 Eugen, Prinz von Savoyen 43, 60–61, 114, 135, 137–138, 141, 143, 158, 160, 164, 168, 184, 189, 194, 196, 198, 255, 263 Eyseneck, Maria Juliana Baur von 362
Fahnenberg, Egid von 732, 737 Febronianismus 351–352, 485, 550, 702 Fehr, Johann Michael 113 Felbiger, Johann Ignaz von 596 Ferdinand, Herzog von Braunschweig, preußischer Feldmarschall 413 Ferdinand I., heilig-römischer Kaiser (1558– 1564) 16, 159, 189, 406 Ferdinand II., heilig-römischer Kaiser (1619– 1637) 81, 93, 228, 231, 332–333
Register
Ferdinand III., heilig-römischer Kaiser (1637–1657) 23–41, 81, 147–148, 162, 201, 231 Ferdinand IV., heilig-römischer König (1653– 1654) 33, 201 Ferdinand Maria, Kurfürst von Bayern (1651–1679) 38, 48, 282, 324, 422 Ferdinand von Fürstenberg, Fürstbischof von Münster 348 Fesch, Kardinal Joseph 734 Fichte, Johann Gottlieb 556, 599, 619, 687, 689–690 Firmian, Leopold Anton von siehe Leopold Anton von Firmian Firmian, Leopold Ernst von siehe Leopold Ernst von Firmian Fleury, Kardinal André-Hercule de 194, 198, 405, 407, 426 Folter 538, 544, 591, 593 Forster, Georg 675–676 Forstwirtschaft 258, 301, 316, 318, 321, 534, 673 Franche-Comté 47, 53, 134, 144–145 Francke, August Hermann 357–362, 362, 371, 381, 597 Frankfurt am Main 37, 48, 56, 72, 80, 108, 112, 166, 172, 209, 244–245, 303–304, 307, 315, 320, 328, 356–357, 360–361, 364, 390, 401, 408, 423, 427, 429, 436– 437, 469, 476, 525–526, 531, 603, 631, 639, 645, 653, 655, 662, 664, 699, 733, 742, 745 Frankfurt an der Oder 203–204, 233, 252, 266, 526, 630 Frankfurter Allianz 55, 57, 166 Frankfurter Deputation 37–38 Frankfurter Union (1744) 409 Frankfurter Universität 203–204 Fränkischer Kreis 53, 79–80, 174, 373, 465, 481, 500–501, 658, 667, 697, 714 Frankreich 12, 15, 20, 24–25, 28–30, 37–41, 45–57, 59, 61, 64–70, 72, 74, 78, 80, 86–87, 94–98, 103–105, 108, 110, 112–113, 123, 131–145, 149, 151, 157, 161–162, 165– 166, 173–174, 180–181, 185, 190–191, 194–198, 202, 219–221, 225, 229–230, 248, 250, 260, 262, 264, 266–267, 275–
276, 302, 306–308, 314, 322, 344, 361, 402–416, 421–422, 425–426, 428, 431, 435, 438, 441, 443–444, 451–456, 458, 462–466, 493–494, 500–501, 507, 509, 516–517, 522, 524–525, 531, 553, 555, 567, 571, 584, 595, 599–601, 608, 611, 630, 633, 642, 644–667, 670–699, 702– 703, 708–719, 722–732, 735–736, 739, 744 Franz I., heilig-römischer Kaiser (1745– 1765) 194, 196, 199, 214, 399–400, 409– 410, 419, 423, 425, 431, 435–448, 457, 470, 472, 499, 501, 625–626, 695 Franz II., heilig-römischer Kaiser (1792– 1806) 399, 494, 644–646, 652–653, 655, 658, 665, 677, 688, 694, 702, 710, 718– 719, 723–727, 731, 733, 738–739, 742 Franz II. Rákóczi, Fürst von Siebenbürgen (1704–1711) 70, 141–142 Franz Arnold von Wolff-Metternich, Fürstbischof von Paderborn und Münster 87, 154 Franz Egon von Fürstenberg, Fürstbischof von Straßburg 48, 54, 93 Franz Georg von Schönborn, Erzbischof von Trier (1729–1756) 198, 209, 614 Franz Ludwig von Pfalz-Neuburg, Erzbischof von Mainz 86, 158, 190–191, 423 Franz Stephan von Lothringen siehe Franz I., heilig-römischer Kaiser Franzensburg 645 Französische Revolution 465, 497, 548, 559, 563, 566, 583, 595, 611–612, 632, 663, 670–690 Frauen, Gewissensfreiheit 377–378 Freiberg, Schlacht bei (1762) 416 Freimaurer 536–537, 587, 599, 601, 616, 671 Fresenius, Johann Philipp 361 Friedberg 244, 304 Friedberg-Scheer 639 Friedensteiner Schloss, Gotha 264 Friedländer, David 552–553 Friedrich I., König von Preußen (1701–1713, zuvor Friedrich III. von Brandenburg) 17, 97–98, 181, 240, 250–251, 253, 282, 323, 373 Friedrich I., König von Württemberg 720
817
818
Register
Friedrich I., Landgraf von Hessen-Kassel 169 Friedrich II. (der Große), König von Preußen (1740–1786) 15, 17, 21, 98, 132, 149, 159, 176–177, 190, 219, 221–222, 250, 255, 276, 318, 323, 389, 400–401, 406– 418, 424–425, 428–432, 436, 438–446, 453–464, 470, 474, 477, 487, 501, 506, 520, 522, 533, 545, 560, 565–566, 572– 573, 588, 591, 593, 603, 609–610, 612– 613, 628–630, 643, 698 Friedrich II., Herzog von Sachsen-GothaAltenburg 275 Friedrich II., Landgraf von Hessen-Kassel 21 Friedrich III., Graf von Wied 364 Friedrich III. von Brandenburg siehe Friedrich I., König von Preußen Friedrich August I., Kurfürst von Sachsen 60–61, 96–97, 188, 194–196, 281; siehe auch August II., König von Polen Friedrich August II., Kurfürst von Sachsen 426, 435 Friedrich August III., Kurfürst von Sachsen 674 Friedrich Casimir, Graf von Hanau-Münzenberg 102, 314 Friedrich Christian, Kurfürst von Sachsen 415, 470 Friedrich Franz I., Herzog von MecklenburgSchwerin 633 Friedrich Josias, Herzog von SachsenCoburg 658 Friedrich Karl Joseph von Erthal, Erzbischof von Mainz 601 Friedrich Ludwig, Graf von HohenloheIngelfingen 623 Friedrich Magnus, Markgraf von BadenDurlach 265 Friedrich Wilhelm, Herzog von Mecklenburg-Schwerin 168, 284 Friedrich Wilhelm, Markgraf von Brandenburg (der Große Kurfürst) (1640–1688) 17, 26–27, 49, 169, 240, 250–251, 274, 304 Friedrich Wilhelm I., König von Preußen (1713–1740) 17, 144, 168, 170, 175, 179, 184, 190, 219, 222, 228, 250, 252–254,
276, 329, 358, 366, 388, 406, 440, 508, 591, 612 Friedrich Wilhelm II., König von Preußen (1786–1797) 400, 464–466, 493, 537, 592, 610, 629, 653, 656, 661, 674, 698 Friedrich Wilhelm III., König von Preußen (1797–1840) 400, 610, 724, 727–728, 736 Friedrich Wilhelm IV., König von Preußen (1840–1861) 746 Fürstbistümer 86, 344, 347, 584 Fürsten 279–286 Fürstenberg siehe auch Ferdinand von Fürstenberg und Franz Egon von Fürstenberg Fürstenberg (Grafen/Fürsten) 92–93, 240 Fürstenberg, Dietrich von, Fürstbischof von Paderborn 337 Fürstenberg, Franz Friedrich Wilhelm Freiherr von 551, 614 Fürstenberg, Wilhelm Egon von, Bischof von Straßburg 50, 65, 69, 87, 93 Fürstenbund 454, 464–465, 479, 485–486, 488, 493, 506, 616, 617–618, 659, 694, 706, 709 Fürstenkollegium 32, 76, 93, 429, 442, 639, 711, 722–723 Fürth, jüdische Gemeinde 306 Füssen, Vertrag von (1745) 409
Galen siehe Christoph Bernhard von Galen Garve, Christian 560–561 Gaspari, Adam Christian 707, 723 Gaßner, Johann Joseph 551 Gattschina, Vertrag von (1799) 665 Gedencke, daß du ein Teutscher bist! 27 Gegenaufklärung 532, 538 Geheimer Rat 189, 228, 258 Geheimräte 92 Geißler, Christian Benjamin 673–674 Gemmingen, Otto Heinrich von 632 Gentz, Friedrich von 641, 681–682, 686, 729 Georg, Fürst von Calenberg 94 Georg I., Herzog von Sachsen-Meiningen 616
Register
Georg I., König von England 96, 166, 168– 170, 175–176, 180, 184–185, 453 Georg II., König von England 263, 359, 408, 410, 413, 453 Georg II. Rákóczi, Fürst von Siebenbürgen (1648–1660) 26–27, 43–44 Georg III., König von England 413, 453– 454, 486–487, 572 Georg Albrecht, Graf von Ostfriesland 176– 177, 284 Georg Ludwig, Herzog von BraunschweigHannover 141; siehe auch Georg I., König von England Georg Wilhelm, Herzog von BraunschweigCelle 95, 141 Georg Wilhelm, Kurfürst von Brandenburg 249–250 Gerbert, Martin 550 Gerhard, Johann 354 Gerhardt, Paul 356 Gericht, Gerichtshöfe 36, 74, 81, 112, 152, 200, 207, 221, 222, 237, 241, 244, 252– 253, 258, 272, 275, 281, 283–286, 290– 295, 300, 317, 341, 372, 377, 403, 429, 441, 446, 448, 475, 481, 497–498, 507, 563, 583, 591, 694, 698–699, 706–707, 722, 725, 736–737 Gesetzeskodifizierung 590–593 Gesmolder Unruhen (1794) 672 Gichtel, Johann Georg 363 Gielsberg, Roman Giel von, Abt von Kempten (1636–1673) 285 Gilden 77, 103, 246, 299, 305–306, 317, 324–329, 360, 470, 476, 498, 500, 528, 579 Goebel, Johann Wilhelm von 205–206 Goethe, Johann Wolfgang von 213, 401, 418, 430, 475, 486, 517, 535, 537, 547– 548, 555, 564, 575, 601, 606, 609, 611, 617–620, 648, 654, 680–681 Goeze, Johann Melchior 544, 546 Goldenstedt, gemeinsam genutzte Kirche 376 Gold- und Rosenkreuzer, Orden der 537– 538 Gönner, Nikolaus Thaddäus 511, 707 Gontard, Carl Philipp Christian 609 Görres, Joseph 682, 703
Gotha 220, 264, 593, 599 Göttingen 203, 544, 566 Göttinger Universität 210, 386, 508, 531, 544, 585, 600–602 Gottsched, Johann Christoph 211–214, 381, 385, 389, 391–394, 532, 549, 601, 611 Gracián, Baltasar 211–212, 268–269 Gravamina 182, 210, 335, 349, 351 gregorianischer Kalender 376 Grimm, Melchior 520 Großbritannien 132, 134, 136, 139, 142– 143, 145, 157–158, 165–166, 169, 175, 180, 191, 194, 202, 214, 275–276, 302, 313–314, 365, 405–415, 443, 451–458, 466, 469, 487, 507, 509, 524–525, 542, 608, 617, 655, 657, 660–665, 719, 726– 727, 729, 736, 747 Großbritannien-Hannover/HannoverGroßbritannien 190–191, 405, 411, 430, 454–455 Großer Nordischer Krieg (1700–1721) 131– 132, 167–170, 252, 262, 273 Groß Friedrichsburg, Kolonie 97, 314 Grotius, Hugo 202–203 Grundbesitz(er) 92, 241, 252, 289, 295, 301, 520, 523, 570, 573–574, 595–596, 672– 674, 717 grundherrschaftliches System 288–293 Guericke, Otto von 33 Guevara, Fray Antonio de 268 Gujer, Jakob 575 Gundling, Nicolaus Hieronymus 204–205 Gustav IV., König von Schweden (1792– 1809) 726–727 Gustav Friedrich, Graf von YsenburgBüdingen 366 gutsherrschaftliches System 293–296 gutswirtschaftliches System 289–291 Gymnasien 597, 599–600
Haager Konzert (1659) 28 Haak, Theodor 110 Haas, Joseph 738 Häberlin, Karl Friedrich 511, 688, 692–695, 698–699 Habermas, Jürgen 518
819
820
Register
Habsburg-Lothringen 399, 423, 448, 482, 645, 695 Haiminsfeld, Melchior Goldast von 202, 507 Halberstadt, Grundherrschaft 289 Halle 358–359, 366, 371, 505, 544, 597, 606 Haller Universität 110–111, 203–212, 228, 231, 233, 252–253, 387–388, 507–509, 531, 600 Hallmann, Johann Christian 268 Hamann, Johann Georg 517, 610 Hamburg 62, 78, 80, 89, 110, 152, 168, 172, 184, 212, 244–245, 274, 304–305, 307, 313, 315, 317, 357, 360–361, 364, 375, 381, 384, 387–388, 390, 393, 446, 457, 522, 525–526, 531, 534, 544, 581, 585– 587, 593, 603–604, 606, 610, 631, 673, 677, 683, 697, 725 Hammerstein, Freiherr von 672 Hanau-Lichtenberg, Graf Friedrich Casimir von 102, 314 Handel 78, 103, 105, 111, 191, 227, 229, 301, 305, 309, 313–316, 318, 327–328, 340, 446, 470, 476, 500, 522, 524–527, 561, 564, 570–571, 577, 580, 625, 630– 631, 633, 661, 666, 699, 701 Hannover 21, 48, 55, 57, 59, 61, 66–67, 94– 96, 98, 107–108, 114, 123–124, 126, 131– 132, 140–143, 153, 157–158, 162, 167– 170, 174–176, 179–185, 192, 201, 209, 220, 225, 236, 250, 254, 262–263, 276, 282, 289, 305, 335, 359, 374, 400, 405, 410–411, 413, 416, 424–425, 436, 439– 441, 443, 453–456, 465, 470, 486–487, 493, 508, 531, 539, 545, 571, 574, 577, 592, 632, 653–655, 664, 702, 713, 722, 725, 727, 729, 735–736, 742 Hannover-Großbritannien siehe Großbritannien-Hannover Hardenberg, Karl August von 599, 724, 735 Hartlib, Samuel 110 Hauensteiner Bauern 291–294 Haugwitz, Christian Freiherr von 625–626, 736 Haugwitz, Graf Friedrich Wilhelm von 437 Hausmachtpolitik 458 Hebenstreit, Franz 677
Hecker, Johann Julius 597 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 362, 517, 680, 687, 708 Heidelberg 66–67, 94, 111, 240, 253, 261– 262, 615, 663 Heidelberger Katechismus 179, 184 Heidelberger Universität 120, 181 Heinrich Albert, Graf von Sayn-Wittgenstein-Hohenstein 364 Heinrich von Preußen, Prinz 414, 416, 460 Helvetische Gesellschaft 470 Henning, August 561 Herder, Johann Gottfried 211, 418, 476, 488, 507, 517, 537, 542, 545–548, 564, 601, 610, 618, 620, 627, 648, 680, 688–689 Hermann, Markgraf von Baden 103 Herrenhauser Allianz (1725) 166, 185 Herrenhauser Schloss 263 Hersche, Peter 320–321, 328 Hertzberg, Ewald Friedrich von 457, 464– 466 Hessen-Darmstadt 237, 241, 273, 276, 307, 359, 592, 662, 664, 712, 719–721, 733 Hessen-Kassel 21, 23–24, 32, 50, 66, 96, 179, 184, 220, 282–283, 307, 353, 359, 368, 389, 440–442, 454, 493, 592, 613, 630, 653, 659–661, 672, 710–712, 736 Hildebrandt, Johann Lucas von 265 Hildesheimer Allianz 23, 25 Hildesheimer Kongress (1796–1797) 698 Hirschel, Moshe 553 Hitler, Adolf 745 Hobbes, Thomas 120–121, 125, 225, 230– 231, 382 Hochstädt, Schlacht bei (1704) 141–142 Hoensbroech siehe Cäsar Constantin Franz von Hoensbroech Hofburg, Wien 160–161 Hoffmann, Daniel 676 Hofmann, Andreas Joseph 354 Hohenfriedberg, Schlacht bei (1745) 409 Hohenlohe-Ingelfingen, Graf Heinrich August von 658 Hohenzollern 174, 249, 253–255, 358, 406, 439, 455, 639, 653
Register
Holbach, Paul Henri Thiry, Baron d’ 545 Holstein (Herzogtum) 28, 282, 286, 288– 290, 292 Holstein, Herzog von (König von Dänemark) 390 Holstein-Gottorp (Herzogtum) 54, 87, 167, 169 Homanns Erben in Nürnberg 527 Hommel, Karl Ferdinand 604 Hontheim, Johann Nikolaus von 477, 484– 485 Horb, Johann Heinrich 360 Horkheimer, Max 518 Hörnigk, Philipp Wilhelm von 77, 102–104, 229–230 Höroldt, Johann Gregorius 324 Howard, John 593 Hoym, Graf Karl von 674 Hubertusburg, Friede von (1763) 415, 451 Hügel, Johann Aloys von 738 Hugenotten 180, 306–307, 313, 320, 322, 362, 365, 375 Hugo, Ludolf 120 Humboldt, Alexander von 682 Humboldt, Wilhelm von 110, 562, 599–600, 611, 619, 682, 685–687, 741–747 Hume, David 531–532 Hunold, Christian Friedrich 268 Hutten siehe Christoph Franz von Hutten
Ibrahim, osmanischer Sultan (1640–1648) 43 Ickstatt, Johann Adam von 209, 548–549, 597, 604 Illuminatenorden 532, 537, 599 Imperialstil (Architektur) 155, 161 Ingelheim, Graf Franz Adolf Dietrich von 152 Innozenz XI., Papst (1676–1689) 60 Innozenz XII., Papst (1691–1700) 108 Isabella von Parma 469 itio in partes 183, 417 Itzig, Isaac Daniel 552 ius emigrandi 295 ius reformandi 226 Ixnard, Michel d’ 614
Jacobi, Friedrich Heinrich 526, 546–548, 554 Jagdrechte 292, 318, 672 Jägerndorf 34, 406, 408 Jakob II., König von England (1685–1688) 65–66, 108 James Edward Stuart 136, 165 Jan III. Sobieski, König von Polen (1674– 1696) 45–46, 51, 59–60 Jansenismus 209 Jemappes, Schlacht bei (1792) 655 Jena 111, 212–213, 354, 535, 544 Jena und Auerstedt, Schlacht von (1806) 736 Jenaer Universität 203–204, 206, 221, 508, 600–602, 618–620, 686–687, 707 Jenisch, Daniel 744 Jerusalem, Johann Friedrich Wilhelm 543 Jesuitenorden, Auflösung (1773) 531, 596, 600–601 Johann Friedrich, Herzog von Braunschweig-Lüneburg 107–108, 124 Johann Friedrich Karl von Ostein, Bischof von Worms, Erzbischof von Mainz 425, 432 Johann Georg II., Kurfürst von Sachsen (1656–1680) 262 Johann Georg III., Kurfürst von Sachsen (1680–1691) 262 Johanniterorden 347 Johann Philipp von Lamberg, Fürstbischof von Passau 76 Johann Philipp von Schönborn, Erzbischof von Mainz (1647–1673) 24, 28, 32–33, 38, 40, 44, 48, 50, 101, 105, 349 Johann Wilhelm, Kurfürst von der Pfalz (1690–1716) 97, 148–150, 181 Joseph I., heilig-römischer Kaiser (1705– 1711) 17, 21, 40, 60, 67, 70, 94–95, 131– 132, 137–144, 147–159, 164, 167, 171– 172, 184, 188, 201, 335, 469, 625 Joseph II., heilig-römischer Kaiser (1765– 1790) 145, 150, 332, 336, 372, 399–400, 403, 408, 411–412, 415, 443–444, 448, 454–466, 469–489, 491, 493, 497, 502, 506, 538, 552, 555, 572–574, 584–585,
821
822
Register
592–593, 598, 601, 603–604, 612, 625, 627–630, 632, 643–645, 651, 702 Joseph Clemens, Erzbischof von Köln (1688– 1723) 65, 140, 149 Judentum 151, 172, 276–277, 302–306, 357, 376, 505, 519, 538, 541, 551–556, 583– 584, 602–603, 723 Jülich 30, 38, 49, 175, 181, 190–191, 198, 254, 283, 326–328, 353, 373–374, 423, 438, 461, 465, 484, 644, 652, 664 Jung, Johann Heinrich (Jung-Stilling) 544 Jungius, Joachim 109–110 Jüngster Reichsabschied (1653) 37, 56, 201, 281 Justi, Johann Heinrich Gottlob von 489, 561–562, 570, 576, 588
Kaiserliche Bücherkommission, Frankfurt 476 Kaiserstil siehe Imperialstil Kameralismus 227–233, 302, 329, 569–570, 602 Kamisardenaufstand (1702–1705) 180, 362 Kammer 258 Kanäle 527 Kant, Immanuel 381, 402, 506, 517–518, 533–535, 541, 547–548, 554, 560, 562, 566, 571, 598, 602, 619, 676, 680, 684– 687, 699–701 Kara Mustafa Pascha, Großwesir 42 Katharina I., Zarin von Russland (1725– 1727) 166 Katharina II. (die Große), Zarin von Russland (1762–1796) 96, 413–414, 454, 458, 462–463, 656, 661–662 Katholizismus siehe Reichskirche Karl, Erzherzog von Österreich 658, 663, 697, 727–728 Karl, Herzog von Parma-Piacenza siehe Karl VII. und V., König von Neapel und Sizilien Karl, Landgraf von Hessen-Kassel 282 Karl II., Herzog von Mecklenburg-Strelitz 633 Karl II., König von England 35, 39, 272
Karl II., König von Spanien (1665–1700) 134, 136 Karl III., Herzog von Lothringen (1625– 1634, 1659–1675) 30, 43, 48, 50, 53, 61, 66, 69 Karl V., heilig-römischer Kaiser (1519– 1558) 39, 132, 135, 143, 157, 708, 745 Karl VI., heilig-römischer Kaiser (1711– 1740) 17, 21, 93, 131–133, 144, 154–214, 230, 238, 249, 254, 273, 315–316, 399, 401, 405, 423–424, 436, 439, 443, 446, 448, 492, 625, 695 Karl VII. (zuvor Karl Albrecht von Bayern), heilig-römischer Kaiser (1742–1745) 174, 188, 194, 201, 210, 282, 399, 401– 402, 406, 408–409, 419, 421–432, 439, 444, 457, 484, 695 Karl VII. und V., Herzog von Parma-Piacenza, König von (VII.) Neapel und (V.) Sizilien, später Karl III. von Spanien (1759–1788) 139, 165–166, 409 Karl X. Gustav, König von Schweden (1654– 1660) 25–29, 38, 43, 96 Karl XII., König von Schweden (1697– 1718) 142, 167–168, 335 Karl Albrecht, Kurfürst von Bayern siehe Karl VII., heilig-römischer Kaiser Karl Alexander, Herzog von Württemberg 277, 284 Karl August, Herzog von Sachsen-WeimarEisenach (1758–1828) 486, 488, 542, 547, 575, 617–619, 659, 709 Karl August, Herzog von Zweibrücken 461, 463 Karl Emanuel, König von Sardinien 409 Karl Eugen, Herzog von Württemberg (1737–1793) 284, 447, 613, 634 Karl Friedrich, Markgraf von Baden 475, 486, 572, 574, 623, 650 Karl Friedrich von Schönborn, Erzbischof von Würzburg 421 Karl Gustav, Herzog von Pfalz-ZweibrückenKleeburg 30 Karl Joseph von Lothringen, Bischof von Osnabrück 87, 154 Karl Leopold, Herzog von MecklenburgSchwerin 168, 175–176, 230, 284
Register
Karl Philipp, Kurfürst der Pfalz 179, 190– 191, 194, 201, 261–262, 324, 423, 614 Karl Theodor, Kurfürst von Bayern-Pfalz (1742–1799) 190, 262, 324, 460–461, 463, 492, 583, 614–616, 650 Karl Thomas zu Löwenstein-WertheimRochefort, Fürst 390 Karl von Lothringen, Oberbefehlshaber 409 Karl Wilhelm Ferdinand, Herzog von Braunschweig-Wolfenbüttel (1780–1806) 652 Karl Wilhelm Friedrich, Markgraf von Brandenburg-Ansbach (1729–1757) 272 Karlowitz, Frieden von (1699) 60, 69 Karlskirche, Wien 160–161 Karlsruher Schloss 265 Kartoffelkrieg (1778) 461–462 Kassel 106, 282, 320, 597, 612–613, 659, 719 Kaunitz, Graf Wenzel Anton von 412–413, 437–438, 441, 444–445, 447, 456, 459– 462, 466, 471–473, 479, 481–482, 491, 494, 625, 644, 648, 651–653, 656 Kellermann, François Cristophe de 654 Kelpius, Johannes 371 Kemény, János 44 Kempten, Reichsabtei 321, 344, 373 Kesseldorf, Schlacht bei (1745) 409 Khevenhüller, Graf Ludwig von 408, 447 Kinsky, Graf Franz Ferdinand von 153 Kirchberg, Burggraf Georg Friedrich von 273 Kirchenbauten 339 Kirchenlieder, lutherische 355–356 kirchliche Territorien 20, 88, 151, 237–238, 274, 279, 299–300, 320–321, 323, 340, 344, 348, 454, 463, 486, 550, 579, 596, 600, 603, 642, 644, 661, 664, 666, 701–702, 711, 723, 744 Klein, Anton von 615, 623 Klein, Ernst Ferdinand 560, 563, 574, 591 Kleinstaaterei 219, 260, 267, 520 Kleist, Christian Ewald von 417–418 Kleve 175, 203, 249–250, 283, 326–327, 367–368, 374, 415, 465, 661, 729, 731 Klopstock, Friedrich Gottlob 476, 607, 683– 684
Klosterneuburg, Stift 160–161 Klüber, Johann Ludwig 492 Knesebeck, Karl Friedrich von dem 686 Knigge, Adolph Freiherr von 535–537 Knobelsdorff, Georg Wenzeslaus 609 Koblenz 485, 614, 650, 652, 664, 703 Kohen, Raphael 553 Köhler, Johann David 210 Köln 23–24, 30, 34, 50–51, 65–66, 69, 80, 86, 111, 140–141, 149, 152–153, 183, 191, 196, 201–202, 210, 220, 300–302, 307, 314, 317, 327, 337, 339–340, 348–349, 406, 422, 425, 427, 439, 444, 447, 463– 465, 482, 484–485, 489, 531, 576, 592, 614, 659, 664, 673, 714 Kölner Allianz 24 Kolonialhandel 313–315 Kommunikationsnetzwerk 430, 445 Konfessionalisierung und Westfälischer Frieden 371–377 Königliches Ungarn 44, 59 Königsberg 26, 111, 203, 251, 291, 531, 552, 602, 670 Königsberg, Vertrag von (1656) 26 Königsfeld, Johan Georg von 436 Konkordienformel 354, 363, 365 Konzil von Trient (1545) 107, 341, 345 Kopenhagen, Friede von (1660) 28 Köprülü, Ahmet, Großwesir 46, 59 Köprülü, Mehmet, Großwesir 43, 46 Kornelimünster, Abtei 294 Kreise 19, 23, 25, 45, 52–53, 55–56, 59, 61, 64, 66, 68, 73–74, 78–80, 91, 105, 123, 125, 154, 166, 173–174, 182, 195, 204, 206, 239–240, 254, 298, 316, 373, 403, 429, 439, 443, 455, 476, 497, 499–502, 506– 507, 510, 527, 579, 626, 658, 660, 697– 699, 707, 714, 721–722, 743; siehe auch Vordere Kreise Kreittmayr, Wiguläus Xaverius Aloysius von 592 Kronberg 182 Krug, Wilhelm Traugott 699–700 »Kuhkrieg« (1651) 30 Kulpis, Johann Georg 122–123 Kunersdorf, Schlacht bei (1759) 414, 417
823
824
Register
Kuriatstimme 34, 481, 507 Kurrheinischer Kreis 68, 373, 465, 499–500, 577, 658, 698, 714
La Hogue, Schlacht von (1692) 66 Lamberg, Graf Leopold Matthias von 150 Lampe, Friedrich Adolf 368 Landbesitz(er) 238, 240, 290, 439 Landeshoheit 221–222, 226, 243, 280, 299, 475, 731–734 Landkarten 506, 527 Landräte 251–252 Landschaftsparks 608, 617 Landshuter Erbfolgekrieg (1504–1505) 421 Landtag 280–284, 632, 634, 673, 677 Landwirtschaft 523–524, 570–576 Langhans, Karl Gotthard von 610 Lau, Theodor Ludwig 389 Lausitz 289–290, 334 Lavater, Johann Caspar 547, 553, 610 Laxenburger Allianz (1685) 57, 64 Leibeigenschaft 288–296, 336, 520, 538, 563, 573–574, 674 Leibniz, Gottfried Wilhelm von 48, 102, 106–108, 110, 114–115, 120, 123–126, 211, 263, 348, 381, 385–386, 388, 390–393 Leipziger Münzvertrag (1690) 79 Leipziger Universität 204–205, 600 Leopold I., heilig-römischer Kaiser (1658– 1705) 17, 20–21, 23–24, 27, 29–30, 37– 98, 102–110, 115, 119, 131–142, 147–154, 160, 162, 165, 171, 180, 188, 201, 211, 222, 238, 266, 271–272, 281, 285, 316–317, 334, 436, 445, 448, 625, 627, 639, 697 Leopold II., heilig-römischer Kaiser (1790– 1792) 399, 403, 465–466, 469, 491–495, 574, 627, 644–645, 648, 650–652, 656, 677, 694 Leopold III. Friedrich Franz, Herzog von Anhalt-Dessau 616 Leopold Anton von Firmian, Erzbischof von Salzburg 337 Leopold Ernst von Firmian, Fürstbischof von Passau 596, 599 Leopold Wilhelm, Erzherzog zu Österreich 30, 38
Lessing, Gotthold Ephraim 213, 418, 532, 536, 546, 553, 561, 606, 610, 615, 623, 629 Leszczyński, Stanislaus, König von Polen (1704–1709, 1733–1736) 142, 195–196, 453 Lettland 743 Leucht, Christian Leonhard 206 Leuthen, Schlacht bei (1757) 414 Lewenhaimb, Philipp Jacob Sachs von 113 Leyen, Adolf von der 327 Leyen, Friedrich und Heinrich von der 328 Liechtenstein 745 Liechtenstein, Fürst 91, 405 Liegnitz, Schlacht bei (1760) 414 Linzer Wollmanufaktur 580–581 Lippe (Westfalen) 62 Lippe-Detmold, Schulreform 599 Lipsius, Justus 225, 228, 382, 547 Litauen 26–27, 308, 337, 743 Livland 26, 28, 167, 169, 459 Lobkowicz, Fürst Wenzel 47, 50 Locke, John 382, 531, 560, 598 Loen, Johann Michael von 561 Loescher, Valentin Ernst 386 Lothar Franz von Schönborn, Erzbischof von Mainz 68, 139–140, 147, 154, 158, 260, 264 Lothringen 47, 69, 86, 144–145, 194–197, 303, 399, 408, 425, 453 Löwen, Johann Friedrich 606 Lübeck 62, 78, 80, 87, 307, 346, 525, 673, 697, 735 Ludewig, Johann Peter 202, 204–205, 252 Ludolf, Hiob 114 Ludwig I., König von Bayern (1825–1848) 746 Ludwig XIV., König von Frankreich 15, 25, 35, 38–39, 41, 45–51, 53–54, 57, 64–66, 68–69, 72, 91, 97, 109, 132, 134–136, 141– 143, 150, 219–220, 261, 349–350, 407, 627, 648–649, 651 Ludwig XV., König von Frankreich 195, 460 Ludwig XVI., König von Frankreich 494, 648–651, 655, 681, 684–685 Ludwig Rudolf, Herzog von BraunschweigWolfenbüttel 206
Register
Ludwig Wilhelm, Markgraf von BadenBaden 43, 61, 67–68, 96, 140–141, 265 Luise Henriette von Oranien 49 Lüneburg 94 Lunéville, Friede von (1801) 666, 688, 703, 706–711 Lünig, Johann Christian 206, 266 Lustheim, Gartenpalast 261 Luther, Martin 506 Luthertum 353–361 Lütticher Affäre (1789–91) 464–465, 489, 643, 671 Luxemburg 54, 57, 59, 67, 69, 144, 150, 174, 463, 584, 646, 652, 745
Mably, Gabriel Bonnot de 402, 452 Machiavelli, Niccolò 225 Mack, Alexander 365 Magdeburg, grundherrschaftliches System 289 Magdeburger Konzert 66–67 Mailand 66, 91, 135–138, 145, 676, 727 Maimon, Salomon 554–555 Mainz 23–24, 28, 30, 32, 38–40, 48, 50, 66, 68, 76, 80, 86–87, 93, 101, 105–107, 109, 114, 123, 139–140, 153, 158, 172, 182, 190–191, 201, 210, 220, 228–229, 237– 238, 243–244, 264, 272, 302, 314, 321, 324, 340, 345–349, 374, 424–425, 427, 429, 431, 444, 447, 465, 475, 479–480, 485, 487, 492–493, 526, 579, 597, 601, 603, 650, 653, 655, 657, 659–660, 662– 665, 672, 675–676, 695–696, 703, 711, 713–714, 719, 721, 733 Mainzer Plan religiöser Einigung (1660) 106 Malplaquet, Schlacht bei (1709) 143 Mann, Thomas 401 Mannheim 66, 162, 184, 194, 262, 305, 324, 327, 583, 614–616, 620, 623, 663 Manteuffel, Ernst Christoph von 389 Marburger Universität 389 Margarita Theresa, Kaiserin, Gattin von Leopold I. 40, 134 Maria Antonia, Erzherzogin von Bayern 40, 134
Maria Josepha von Bayern 472 Maria Theresia, Erzherzogin von Österreich, Königin von Ungarn, später Kaiserin des heiligen Römischen Reichs (1765– 1780) 159, 188–190, 194, 199, 214, 321, 399–400, 405, 407–408, 411, 414–415, 423–431, 437–438, 442–443, 456, 459, 462–463, 472, 479, 481, 592, 596, 601, 625–627 Maria Theresia von Spanien 39, 46, 134 Marie Antoinette, Königin von Frankreich und Navarra 494 Marienburg, Vertrag von (1656) 26 Marienburger Allianz (1671) 50 Marienkult 340–341, 548 Mark (Grafschaft) 249–250, 283, 731 Marlborough, John Churchill, Duke of 141– 143, 150, 244, 263 Marly, Vertrag von (1729) 423–424 Martinovics, Ignaz 677 Marx, Karl 680 Matsche, Franz 161 Matthias, heilig-römischer Kaiser (1612– 1619) 145 Max Heinrich, Kurfürst und Erzbischof von Köln 48, 65, 105, 348 Max(imilian) Franz, Kurfürst und Erzbischof von Köln 463, 481, 489, 592, 614 Maximilian I., heilig-römischer Kaiser (1508–1519) 11, 16, 132, 147, 214, 223, 745 Maximilian I., Herzog/Kurfürst von Bayern (1598/1623–1651) 228, 282, 303, 421– 422 Max(imilian) II. Emanuel, Kurfürst von Bayern (1679–1726) 40, 55, 201, 323 Maximilian III. Joseph, Kurfürst von Bayern (1745–1777) 409, 432, 435, 460, 592 Maximilian IV. Joseph, Herzog von Bayern (1799–1806), König Maximilian I. von Bayern (1806–1825) 677, 710 Maximilian Friedrich zu Königsegg-Rothenfels, Kurfürst und Erzbischof von Köln 614 Mayer, Johann Friedrich 360 Mazarin, Jules, Kardinal 24–25, 28, 38, 40
825
826
Register
Mecklenburg 25, 34, 168–169, 175–177, 230, 254, 284, 286, 289–290, 304, 460, 462, 526, 574, 592, 633, 738 Mecklenburg-Schwerin 220, 612–613, 632– 633, 712 Mecklenburg-Strelitz 202, 632–633 Mehmed IV., osmanischer Sultan 43 Meißen 324, 409, 581, 673 Mencke, Johann Burkhard 211–212 Mencke, Otto 112 Mendelssohn, Moses 546, 551–554 Mennoniten 326–329 Merkantilismus 102, 227, 570 Merlau, Johanna Eleonora von 362 Mesmer, Franz Anton 551 Metsch, Johann Adolf Graf von 158–159, 436 Metternich, Clemens Wenzel von 601, 648, 729, 738–739 Meusel, Johann Georg 535 Mevius, David 295 Meyer, Georg Conrad 677 Michaelis, Johann David 543, 554 Migration 301–309 Militärreform 55–56, 124, 697, 727 Minden, Schlacht bei (1759) 413 Mischehen 377 Missernten (1771–1772) 522 Molanus, Gerhard 107–108 Moll, Balthasar Ferdinand 399 Moll, Johann Nikolaus 399 Mollwitz, Schlacht bei (1741) 407 Mönchsorden 302 Monschau, Textilzentrum 327 Montecuccoli, Graf Raimondo 43–44, 50 Montesquieu, Charles-Louis de Secondat, Baron de 418, 471, 476, 510, 701 Montgelas, Graf Maxilimian 601, 721, 737 Moreau, Jean Victor 665 Morhof, Daniel Georg 111 Moser, Friedrich Karl von 173, 267, 470– 472, 476, 488, 561, 563, 565, 580, 631, 693–694 Moser, Johann Jacob 123, 203, 206–210, 222, 226, 279, 282, 293, 331–332, 359, 426, 432, 492, 508–510, 535, 548, 563– 564, 706
Möser, Justus 471, 524, 544–545, 563–564 Mosheim, Johann Lorenz von 543 Müller, Johannes von 488 München 59, 69, 80, 225, 262, 301, 320, 324, 348, 408, 422, 424, 427, 432, 435, 484–485, 493, 550, 556, 583, 610, 614, 616, 665, 673, 677–678, 719, 728, 732 Münchhausen, Gerlach Adolph von 209, 386, 424, 471, 508 Münster, Universität 601 Murad IV., osmanischer Sultan 43 Muratori, Ludovico Antonio 549 Musenhof, Konzept 606
Nahrungskrise (1770–1772) 500 Napoleon I., Kaiser von Frankreich (1804– 1815) 11, 451, 516, 566, 571, 633, 640, 663, 665–667, 677, 693, 709–710, 712, 716, 723, 725–739, 742, 744 Naumburger Handelsmesse 525 Neerwinden, Schlacht bei (1693) 240 Neerwinden, Schlacht bei (1793) 657 Neipergg, Graf Richard Wilhelm von 198 Neller, Georg Christoph 484 Neoklassizismus 608 Neologie 542–547 Neunjähriger Krieg siehe Pfälzischer Erbfolgekrieg Newton, Isaac 382, 391 Niederlande siehe Batavische Republik, Österreichische Niederlande, Spanische Niederlande Niederländische Republik 46–47, 87, 95, 121, 125, 154, 464, 566 Niederländische Westindienkompanie 102 Niederländischer Krieg (1672–1679) 273 Nicolai, Friedrich 504, 506, 535, 537, 543– 544, 549–550, 554, 556, 560, 580, 595, 624 Niebuhr, Barthold Georg 612 Niethammer, Friedrich Immanuel 600 Nimwegen, Friede von (1678–1679) 53, 75 Nimwegen, Friedensgespräche (1675– 1676) 51, 124 Nipperdey, Thomas 516 Normaljahrprinzip 374
Register
Nürnberg 30, 34, 80, 92, 111, 244–245, 309, 315, 360–361, 421, 446, 525, 527, 631, 673, 738 Nyborg, Schlacht bei (1659) 28 Nymphenburger Residenz 261, 424 Nystad, Friede von (1721) 169
Oberrheinkreis 57, 174, 373, 500, 658, 698 Obersächsischer Kreis 25, 61, 80, 254, 373, 439, 698 Oldenburg, Henry 110 Oliva, Friede von (1660) 39–40 Ompteda, Dietrich Heinrich Ludwig von 454 Oppenheim, multikonfessioneller Status 376–377 Oppenheimer, Joseph Süß 277 Oranien (Haus) 49, 144, 240, 308, 327, 662, 664, 710–711, 713 Orelly, Joseph 322 Orientkompanie 314–315 Osmanisches Reich siehe Türkenkriege Osnabrück 35, 48, 66, 338, 373–374, 377, 439, 672, 713 Osnabrück, Vertrag von (1648) 23, 25, 30, 105, 440, 648, 710; siehe auch Westfälischer Friede Ostein siehe Johann Friedrich Karl von Ostein Ostender Kompanie 165–167, 191, 315 Österreichische Niederlande 407–412, 422, 461, 463–466, 493, 499, 653, 657, 666, 671 Österreichischer Erbfolgekrieg (1740– 1748) 172, 189, 401 österreichisch-preußischer Dualismus 401– 402, 451 Österreich über alles, wann es nur will (Hörnigk) 104, 230 Ostfriesland 54, 93, 175–177, 284, 286, 353, 359, 368, 435, 445, 505 Ostpreußen 26–27, 192, 203, 220, 283, 289, 291, 323, 337, 527, 628 Ostpommern (Hinterpommern) 25, 33, 54, 283 Oudenaarde, Schlacht bei (1708) 143
Paläste 160–162, 219, 260–267, 322–323, 609, 613–615 Palladio, Andrea 608 Panin, Nikita 454, 462 Panisbriefe 482 Paris, Friede von (1783) 453 Paris, Vertrag von (1763) 415 Paris, Vertrag von (1806) 735 Pariser Académie des Arts et des Sciences 109, 382 Passarowitz, Friede von (1718) 164 Passau (Fürstbistum) 407, 431 Patriotische Gesellschaft (1724) 212, 388, 393, 571, 586–587, 703 Patriotismus (Reichs-) 20, 26, 391–394, 417–418, 504, 506, 688–689, 735 Penn, William 361, 367 Pergen, Graf Johann Anton von 470–473 Pestalozzi, Johann Heinrich 599 Peter I. (der Große), Zar von Russland (1682– 1725) 96, 114, 167–169, 176 Peter II., König von Portugal (1683–1706) 136 Peter III., Zar von Russland (1762) 96, 413– 414, 454 Peter Philipp von Dernbach, Fürstbischof von Bamberg 104 Petersdom, Rom 225 Petersen, Johann Wilhelm 362–363 Peyre, Antoine-François 614 Pfaff, Christoph Matthäus 206, 542 Pfalz 18, 21, 24, 34–35, 38, 40, 50–51, 54, 65, 69–70, 86, 94–95, 97, 108, 144, 148– 150, 153, 162, 166, 175, 179–185, 190– 192, 194, 196, 198, 206, 220–221, 231, 236–237, 249–250, 261, 272–273, 283, 291, 303–307, 324, 326, 328, 338, 346, 372–373, 376–377, 408–409, 413, 415, 421–425, 435–441, 444, 446, 453, 457, 460, 470, 476, 484, 493, 573, 579, 584, 593, 614–615, 632, 646, 651–652, 666, 672, 721 Pfalz-Bayern 465, 492, 659, 695, 703, 729 Pfalz-Neuburg 24, 30, 32, 38, 48–49, 55, 65, 86, 94, 96, 144, 174, 191, 261, 422–423 Pfälzischer Erbfolgekrieg (1688–97) 65–69, 123, 134, 136, 152 Pfeiffer, Christoph Ludwig 488
827
828
Register
Philadelphier 362, 366–367 philanthropische Schulen 598–599 Philipp II., König von Spanien (1556–98) 135 Philipp IV., König von Spanien (1621–65) 39, 46 Philipp V., König von Spanien (1700–24) 136, 138–139, 143, 158 Philipp Carl von Eltz, Erzbischof von Mainz 424–425 Philipp Wilhelm von Pfalz-Neuburg, Kurfürst von der Pfalz (1685–1690) 38, 55, 65, 86, 201, 261, 346 Physiokratismus 561, 564–565, 570–571 Pietismus 207, 243, 357–360, 367–368, 371, 393, 543, 563, 624 Pigage, Nicholas de 615 Pillnitzer Konvention (1791) 493 Pistorius, Gottfried Laurenz 613 Pius VI., Papst (1775–1799) 702 Plotho, Erich Christoph von 415, 457 Polen 26–29, 43–44, 46, 60, 97, 140, 142, 162, 167, 169, 188, 194–196, 202, 213– 214, 254, 262, 283, 334–335, 366, 405– 407, 412–413, 426, 454, 457–460, 464, 470, 523, 555, 577, 644–645, 653, 656– 657, 660–661, 674, 693, 695, 723–724 Polizei (Policey) 234, 300, 302, 498, 562, 575 Polizeiordnung 77, 257 Polnischer Erbfolgekrieg (1733–1738) 133, 194, 198, 423 Poltava, Schlacht bei (1709) 168 Pommern 37, 289, 304, 411, 414, 444, 474, 526, 573; siehe auch Ostpommern und Westpommern Pongauer Protestanten 337 Poniatowski, Stanislaus Augustus, König von Polen 458–459, 656 Pöppelmann, Matthäus Daniel 262 Porzellan 114, 263, 276, 305, 315, 324, 581, Post 80, 430, 445, 507, 527 Potsdam 325, 609, 729 Potsdam, Edikt von (1685) 64, 306 Pozzo, Andrea 265 Pragmatische Sanktion (1713) 159, 166, 175–176, 186, 188–192, 194, 196, 199,
205, 315, 405–407, 410, 423, 426, 461, 625, 627 Pressburg, Friede von (1805) 707–708, 728, 731–733, 737–739 Pressburger Landtag 43 Preußen 12, 15–18, 21, 26–29, 46, 49, 88, 97–98, 131–132, 140, 143–144, 151, 159, 161–162, 166–170, 174–179, 184, 190, 192, 195, 198, 201, 203–204, 219–220, 236, 248–255, 271–276, 283–286, 289, 307–309, 318, 322–329, 337, 340, 359, 367, 371, 373, 394, 400–419, 423, 430– 432, 435–440, 444, 446, 452–473, 476, 479, 482, 486–487, 493, 495, 499, 501, 516, 520–524, 527, 533, 537–538, 555, 566, 572–573, 577, 582, 590–595, 599– 600, 604, 609, 613, 625–629, 632, 641– 646, 649–667, 674, 684, 693, 696–700, 703, 706–714, 721–729, 731, 735–736, 741, 743, 746 Primogenitur 83, 95, 188, 221, 239, 241, 248 Prinzipalkommissar 73, 75, 76, 429, 445, 639 privilegium de non appellando 82 protestantische Flüchtlinge 303–309 Protestantismus 122, 166, 180, 182, 248, 331–337, 359, 371–372, 382, 386, 391, 439–440, 442, 548, 611–612, 614, 716 Protoindustrie 326 Pufendorf, Samuel 120–123, 126, 225, 231– 232, 253, 382, 392, 509 Puritanismus 357, 362 Pütter, Johann Stephan 120, 200, 222, 492, 508–510, 535, 548, 645, 693–694, 706 Pyrenäenfrieden (1659) 24, 28, 39–40, 46
Quäker 362 Quesnay, François
564, 571
Rákóczy-Fürsten (Siebenbürgen) 43 Ramillies, Schlacht bei (1706) 142 Rastatt, Friede von (1714) 144, 164, 171 Rastatter Friedenskonferenz (1797) 664– 665, 667, 677 Rastatter Kongress (1798) 688, 703, 708
Register
Ratke, Wolfgang 110 Rauscher, Peter 17 Ray, Thomas 315 Realschule 597 rechtspolitische Literatur 200–211 Reformen im Reich 11–12, 16–17, 21, 24, 32–33, 37, 43, 52–56, 73–78, 101–107, 110, 119–120, 124, 137, 152, 173, 199, 208, 210–211, 223, 252–253, 269, 271, 275, 401–403, 419, 424, 428, 447–448, 452, 456, 470, 473–476, 479–488, 493, 501, 505, 515–517, 520, 522, 569, 571, 591, 595, 606, 623–634, 658, 692–703, 724, 731, 734–735, 737, 745 reformierte Kirchen siehe Calvinismus Regalien 87, 275, 318–321 Regensburg, Friede von (1684) 57, 75 Régie 588, 590, 629 Reichardt, Christian 573 Reichenbacher Konvention (1790) 466, 643 Reichlin-Meldegg, Anselm von, Fürstabt von Kempten (1727–1747) 285 Reichsabschied 33, 37, 56, 201, 206, 281 Reichsabteien 321, 344, 373, 672, 711–713, 724 Reichsakademie 113–115 Reichsarmee 35, 44–45, 50, 52, 55–56, 66, 73–74, 92, 124, 195, 271–273, 277, 414– 417, 432, 443–444, 452, 658–660, 697 Reichsbarriere 144–145, 154 Reichsdeputation 34, 182, 712–723 Reichserzkanzler 24, 140, 147, 158, 210, 424–425, 427, 429, 714, 721, 735; siehe auch Dalberg, Karl Theodor von; Schönborn, Johann Philipp von Reichsgerichte 36, 74, 112, 200, 222, 272, 275, 281, 284, 286, 294–295, 372, 377, 429, 441, 722, 737 Reichsgesandte 80 Reichsgrafenkollegium 254 Reichshofrat 18, 35–36, 39, 81–83, 89, 91– 92, 95, 135, 138, 149, 151–152, 158, 162, 168, 171, 173–177, 179, 182, 184–185, 189, 198, 201, 206, 221, 237–238, 242, 244, 282, 284, 292, 424, 427, 429, 436, 440–441, 446–448, 470–476, 479, 481–
482, 497, 502, 565, 630, 632, 671, 698, 719, 725 Reichskammergericht 35, 81–83, 151–152, 175, 185, 209, 245, 283, 294, 424, 427, 447–448, 464–465, 470, 475, 477, 488, 497, 502, 537, 671, 693, 698, 704, 721– 722, 725, 731–732, 737, 741–742 Reichskirche 86–89, 93, 105–106, 173, 191, 239–240, 242–243, 344–351, 394, 431, 442, 447, 470, 477, 481–482, 484–486, 495, 501, 550, 702, 711, 716, 734, 742 Reichskrieg 405, 411, 413, 415, 655, 732 Reichskriegsdirektor 54 Reichsmatrikel 55–56, 247 Reichsprälaten 125, 243 Reichsritter 20, 36, 82, 86, 88, 125, 172, 208, 220, 236–243, 279, 295, 304–305, 346– 347, 374, 428–429, 446, 454, 476, 480, 507, 575, 631–632, 677, 710, 718–719, 723, 725, 731–733, 744 Reichsstädte 25, 34–35, 54, 76, 80, 82, 86, 88–89, 91, 104, 113, 125, 150, 172, 175, 183, 208, 220–221, 244–246, 265, 285, 295, 303–304, 307, 321, 327–328, 358– 361, 368, 373, 375, 393–394, 428, 431, 445–447, 474–475, 501–502, 567, 577, 582–583, 587, 603, 606, 631, 634, 648, 662, 708, 711–714, 716, 718, 722, 724, 728, 743 Reichstag 17–21, 25, 32–37, 41, 44, 51–56, 59, 61–66, 69, 72–83, 86, 88, 91, 97, 101, 103, 112, 122, 141, 144, 148–149, 151, 153, 164–165, 173, 182, 184–185, 189– 192, 195–197, 200, 206–208, 222, 237– 239, 243–245, 254, 272, 316, 331, 335, 344, 347, 349, 372–373, 403, 405–406, 411, 413, 415–417, 423–429, 432, 436, 438–448, 457, 460–462, 471, 476, 480– 483, 492, 494, 507, 510, 556, 577, 582, 639, 649, 655–667, 671, 693, 695, 697, 701– 702, 711–712, 714, 721–726, 731–734, 737–738, 743 Reichsvikare 38, 262, 273, 423–424, 426– 427, 435–436, 492, 694–695 Reichsvizekanzler 138–140, 147, 158, 166, 168, 171–172, 206, 208, 350, 428, 435– 437, 443, 471–472, 474, 480, 494, 645;
829
830
Register
siehe auch Colloredo-Mansfeld, Fürst Franz Gundaker von; Colloredo, Rudolf von; Schönborn, Graf Friedrich Karl von; Schönborn, Lothar Franz von Reigersberg, Heinrich Alois von 732 Reimarus, Hermann Samuel 545–546, 553 Reinhard, Karl Friedrich 684 Reinhold, Karl Leonhard 506, 547, 602 Reinkingk, Dietrich 119, 227, 331 Reiser, Anton 360 Reitemeier, Johann 707, 723 Reuß, Grafen von 239–240, 243, 365–367, 502 Reußisch-Schönburgische Konfession 242 Revolutionskriege 595, 648–667 Rheinbund (1658) 25, 28, 72 Rheinbund (1806) 639, 709–710, 733–736, 739, 742, 745 Rheinisches Reichsvikariat 423–424, 433, 435 Riedel, Andreas 677 Rijswijk, Friede von (1697) 53, 68–70, 144, 148–149, 180–185, 197, 251, 440, 648 Ritter, Gerhard 401 Ritterakademien 257 Ritteraufstand (1520er) 12 Rivière, Pierre-Paul Le Mercier de la 515 Robespierre, Maximilien 655, 678, 685, 701 Rochow, Friedrich Eberhard von 535, 598 Roentgen, Abraham 583 Rohr, Julius Bernhard von 267 Römermonate 34–35, 428 Römischer König 32–34, 37, 48, 67, 95, 153, 155, 411–412, 415, 443–444, 469 Ronsdorfer Sekte der Zionisten 367 Roßbach, Schlacht bei (1757) 414–415 Rossi, Domenico Egidio 265 Rousseau, Jean-Jacques 402, 452, 531, 546, 598, 707 Royal Society, London 109–110, 114, 382 Rudolf II., heilig-römischer Kaiser (1576– 1612) 73, 81, 135 Rumfordsuppe 584 Rumjancev, Graf Nikolaj 463 Rupert von Bodman, Fürstabt von Kempten (1678–1728) 92, 147, 152, 285, 373 Russland 26, 96, 131, 166–169, 195, 197,
254, 402, 407, 411–414, 452–466, 643– 644, 649, 656–657, 660–662, 664–666, 709, 712, 725–726, 728–729, 743
Sachsen 18, 21, 24–25, 34, 37–38, 45, 54–55, 57, 60–61, 66–67, 77, 79, 95–97, 104, 131, 140, 157, 161–162, 166–169, 175, 180, 184, 188, 190, 192, 194–195, 202, 220– 221, 228, 236, 240, 243, 249–250, 254, 262, 289–290, 293, 295, 304, 307, 309, 317–318, 320–321, 333, 335–336, 364– 366, 400, 405–416, 423, 425–426, 439, 454–455, 460–462, 465, 469–470, 486– 487, 492–494, 499, 523–524, 573, 576, 579–581, 587, 592, 600, 624, 632, 642, 654, 664, 673–674, 695, 702, 711, 719, 722, 736–737 Sachsen-Eisenach 57 Sachsen-Gotha 57, 441 Sack, August Friedrich Wilhelm 417 Sailer, Johann Michael 549 Saint-Pierre, Charles-Irénée Castel, Abbé de 402 Salem 550 Salzburg 32, 79, 220, 243, 291, 308–309, 321, 336–338, 345, 348, 366, 372, 463, 483, 485, 500, 579, 664, 713–714, 719, 722, 728 Salzburger Universität 550, 601–602 Salzmann, Christian Gotthilf 599 Sanssouci (Schloss) 609 Sardinien 97, 143–145, 165, 196, 405, 409–410 Savoyen 39, 65, 135–136, 138, 143–145, 165, 307, 410 Sayn-Altenkirchen 272 Sayn-Hachenburg 272 Sayn-Wittgenstein, Grafen von 272, 364 Schaitberger, Joseph 337 Scharnhorst, Gerhard von 597 Schaumburg-Lippe, Graf Wilhelm Friedrich Ernst von 597 Scheuchzer, Johann Jakob 387 Schierendorf, Christian Julius Schier von 151
Register
Schiller, Friedrich von 518, 535, 555, 561, 598, 611, 619–620, 642, 687, 689 Schilling, Heinz 15–16 Schilter, Johannes 305 Schimmelpenninck, Rutger Jan 727 Schinkel, Karl Friedrich 610 Schlaun, Johann Conrad 613 Schlegel, August Wilhelm 689 Schlegel, Friedrich 689, 708 Schlesien 88, 132, 142, 199, 220, 243, 248, 289, 304, 308, 317, 332–336, 362, 365, 372, 400–401, 405–419, 424–425, 431, 436, 438, 443–445, 448, 455–457, 459, 524, 584, 596, 603, 609, 625–626, 643, 674 Schlesische Kriege (1740–1763) 318, 405– 419, 448 Schleswig-Holstein 29, 54, 364, 573–574, 677, 745 Schlettwein, Johann August 564, 570 Schloss Weißenstein, Pommersfelden 264 Schlosser, Johann Georg 560, 564, 623 Schlözer, August Ludwig von 539, 565–566, 682–683 Schlüter, Andreas 263, 265, 323 Schmalz, Theodor von 707 Schmauss, Johann Jakob 206 Schmettau, Graf von 591 Schmidt, Benedikt 211 Schmidt, Georg 451 Schmidt, Johann Lorenz 390–391, 545 Schmidt, Michael Ignaz 211, 506, 645 Schmoller, Gustav 244 Schnaubert, Andreas Joseph 707 Schönborn, Graf Friedrich Karl von, Reichsvizekanzler 138–139, 147, 158, 171– 172, 198, 206, 208–209, 350, 421, 432, 482, 549 Schönborn (Bischöfe) siehe Damian Hugo, Franz Georg, Karl Friedrich und Lothar Franz von Schönborn Schönborn (Haus) 86, 162, 191, 197, 239, 264–265, 346 Schönbrunn, Vertrag von (1805) 729, 735 Schönbrunn (Schloss), Wien 154–155, 160, 261, 263, 265 Schröder, Wilhelm von 102–103, 229–230
Schubart, Christian Friedrich Daniel 534– 535, 538, 565, 598, 634 Schubart, Johann Christian (von Kleefeld) 573 Schulreform 599 Schulz, Johann Heinrich 545 Schulze, Winfried 17 Schupp, Johann Balthasar 355–356 Schütz, Heinrich 356 Schütz, Johann Jakob 362 Schwäbischer Kreis 36, 52–53, 64, 79–80, 150, 173–174, 437, 465, 480–481, 500, 630, 650, 658, 665, 697 Schwarzen Adler, Hoher Orden vom 253 Schweden 20, 24–30, 33, 37–38, 43, 47, 49, 51–52, 54, 64, 67, 80, 94–95, 131–132, 142, 167–169, 179, 214, 250, 254, 317, 333, 335, 359, 366, 373, 412–414, 444, 453– 454, 462, 474, 666, 712, 725–727 Schweder, Gabriel 123, 206 Schweidnitzer Friedenskirche 334 Schweizer Kantone 78 Schweizer Konföderation 727 Schwenningen-Höchstädt, Schlacht bei (1703) 141 Schwetzinger Schloss 615–616 Seckendorff, Karl Siegmund von 618 Seckendorff, Veit Ludwig von 227–229, 232 Sedlmayr, Hans 161 Semler, Christoph 597 Semler, Johann Salomo 543 Severinus de Monzambano Veronensis (Pufendorf) 120 Sevilla, Vertrag von (1729) 191 Siebenbürgen 43–45, 60, 142, 220, 337 Siebenjähriger Krieg (1756–1763) 241, 401, 419, 432, 440–441, 444, 448, 453–455, 469–470, 484, 506, 522, 555, 609, 613, 628, 673–674 Sieveking, Georg Heinrich 683 Sigismund, heilig-römischer Kaiser (1433– 1437) 461 Simultaneum 181–182, 338, 376, 440 Sinzendorf, Graf Philipp Ludwig von 154, 166
831
832
Register
Sizilien 47, 49, 97, 134–135, 143–145, 150, 165, 189, 195–196, 409 Smith, Adam 526, 562, 565, 571, 701 Soden, Graf Julius von 707 Solms-Laubach, Graf Friedrich Ernst von 152 Sonderweg 380, 401, 516, 518, 534, 540, 680 Sonnenfels, Joseph von 562, 570, 627 Spalding, Johann Joachim 543–546 Spangenberg, August Gottlieb 367 Spanien 24, 28, 37–41, 46–50, 55, 64–67, 70–95, 97, 110, 131–145, 157, 160–161, 165–166, 174–175, 188–189, 191, 195– 196, 276, 313, 405, 410–411, 509, 524, 607, 643, 662, 726–727, 744, 747 Spanische Niederlande 38, 41, 46–47, 50, 53, 66–68, 73, 97, 132, 134, 136–137, 141– 145, 154, 157, 165, 174–175, 220, 315, 340, 422, 436 Spanischer Erbfolgekrieg (1701–1714) 70– 94, 97, 109, 131, 134–148, 157, 161, 181, 264, 273, 276, 406–407, 422, 457 Spener, Philipp Jakob 356–358, 360–363, 368, 371 Spielmann, Anton Freiherr von 653, 656– 657 Spinola, Christoph de Royas y 77, 102–104, 106–109 Spinoza, Baruch 225, 348, 382, 387, 390, 545–547 Stadion, Graf Friedrich Lothar von 738 Städtekollegium 34, 76 St. Andrew’s Island, Gambia 313 St. Gotthard, Schlacht bei (1664) 45 St. Petersburg 114, 167–168, 583, 656 Starhemberg, Graf Guidobald von 139 Stein, Heinrich Friedrich Karl Freiherr vom und zum 746 Stein, Melchior 265 Stensen, Niels (Nicolaus Steno) 348–349 Steuern 17, 19, 34–35, 39, 44, 56, 62, 73–74, 83, 103–104, 135, 152, 168, 172, 176, 181, 222, 226, 228, 237–238, 246, 249, 251– 252, 258, 264, 271–273, 275–276, 279– 286, 288, 290, 292, 294–295, 303–304,
307, 323, 325, 329, 332, 446, 464, 480, 533, 570–571, 580, 587–590, 626, 630, 640, 673 Stockach 641 Strafrecht 592–93 Straßburg 54, 57, 69, 143–144, 361, 672, 675 Straßburger Universität 601, 648 Straßen 527–528 Strelin, Georg Gottfried 588 Struve, Burkhard Gotthelf 206 Stryk, Samuel 204 Stuart-Aufstand (1745) 410 Sturm-und-Drang-Bewegung 517, 532, 564 Stuttgart 597–598, 610, 613, 673 Suarez, Carl Gottlieb 591–592 Sulzbach, jüdische Gemeinde 306 Sulzer, Johann Georg 560 Superintendent 544, 618 Swieten, Gottfried van 601 Sybel, Heinrich von 645 Szatmár, Friede von (1711) 142
Talleyrand, Charles Maurice de 709, 712, 731, 734–736 Tecklenburg 175, 368 Teilungsvertrag, erster (1698) 134–135 Telemann, Georg Philipp 356 Tersteegen, Gerhard 368 Teschen, Vertrag von (1779) 454–455, 462, 481 Teschener Erweckungsprediger 308 Tessin der Jüngere, Nicodemus 261, 263 Thaer, Albrecht 572 Thököly, Emmerich 46, 59, 141 Thomasius, Christian 110–112, 204–206, 211–212, 225, 228, 231–233, 267–269, 295, 331, 358, 363, 381–388, 392–393, 518, 530–531, 552 Thompson, Benjamin 583–584 Thugut, Franz Maria von 644–646, 657– 658, 660, 662–663, 665–666, 711 Thüringen 524, 579–581, 616 Thurn und Taxis, Alexander Ferdinand von 639 Thurn und Taxis, Anton von 639 Thurn und Taxis (Haus) 429, 445, 639–640
Register
Tobago 313 Todesstrafe 544, 591, 593 Töllner, Johann Gottlieb 543 Torgau, Schlacht bei (1760) 414 Trafalgar, Schlacht von (1805) 728 Trauttmannsdorff, Graf Maximilian von 23 Treuer, Gottlieb Samuel 230–231 Triennial Act (1694) 75 Trier 23, 30, 50–51, 86, 190–191, 201, 209, 220, 264, 302–303, 321, 347, 349, 423, 425–426, 484–485, 603, 613–614, 650– 651, 659, 664, 672–673, 714 Tripelallianz (1717) 165 Tschirnhaus, Ehrenfried Walther von 324, 382 Tübingen 686–687 Türkenkriege 44, 54, 60–61, 68–70, 103, 197, 261, 424
Ulm 80, 244, 308, 317, 431, 631, 673 Ulm, Schlacht bei (1805) 728 Ulrika Eleonora, Königin von Schweden 169 Undereyck, Theodor 368 Unertl, Franz Xaver 406 Ungarn 18, 37, 43–50, 59–60, 64–66, 70, 92, 94, 104, 137–138, 141–143, 157, 164, 171, 189, 197, 220, 304, 399, 408, 428, 445, 464, 466, 493, 525, 576, 628, 652 ungarische Protestanten 107–108 ungarisch-kroatische Stände 60 Universitäten 101, 109–113, 200, 202–204, 212, 221, 226–227, 231, 233, 259, 279, 353–355, 383–386, 389, 472, 507, 531, 549, 598, 600–602, 608, 684, 716, 720; siehe auch die Universitäten unter der jeweiligen Stadt Utrecht, Vertrag von (1713) 143–144, 150, 308 Utzschneider, Joseph 678
Vagabunden 239, 301–302, 584 Vahlkampf, Joseph Anton von 741 Valmy, Schlacht bei (1792) 654–656 Vattel, Emer de 393
Venedig 43, 60, 96, 125, 164, 262, 577 Vergennes, Charles Gravier, Comte de 452, 463 Verhorst, Johannes Petrus 349 Versailles, erster Vertrag von (1756) 412 Versailles, zweiter Vertrag von (1757) 412– 413 Versicherungen 374, 585–586 Viktor Amadeus, Herzog von Savoyen (1630–1637) 138 Voltaire (François-Marie Arouet) 322–323, 476, 531, 543, 609, 615 Vorarlberg 303, 480, 728 Vordere Kreise 52, 68, 140, 173, 195, 197, 443, 499, 577, 650 Vorderösterreich 88, 139, 339, 373, 407, 431, 437, 461, 480, 538, 625, 652 Vorlande siehe Vorderösterreich Vossem, Friede von (1673) 49
Wachter, Johann Georg 389 Wagenfels, Hanns Jacob Wagner von 148, 155 Wagner, Gabriel 385, 393 Wahlkapitulation 32, 35, 39, 73, 153–154, 201, 222, 316, 345, 425–428, 444, 446, 465, 492, 694–695, 702, 737, 739, 745 Währung(sreform) 78–79, 102, 173, 241, 277, 298, 301, 448, 476, 500–501, 522 Waitz, Georg 745 Waldeck 243 Waldeck, Graf Georg Friedrich von 23, 34, 55, 57, Waldeck-Pyrmont 630, 745 Waldenser 307, 309 Walldürn, Wallfahrtsbasilika 264 Wallfahrten 340–341 Walpole, Horace 185, 617 Warschauer Allianz (1744) 409 Wehler, Hans-Ulrich 516 Weimar 264, 497, 547, 555, 606, 611–612, 618–620, 625, 687 Weise, Christian 268–269 Weishaupt, Adam 537 Weißen Berg, Schlacht am (1620) 248, 333
833
834
Register
Wekhrlin, Wilhelm Ludwig 487, 565 Welfen (Braunschweig) 18, 23, 25, 32, 93, 254 Wertheimer Bibel 390–391 Wessely, Hartwig 552 Westfälische Kreise 25, 68, 79, 174–175, 272, 373, 439, 465, 489, 499, 698 Westfälischer Friede (1648) 11, 15–17, 24, 29, 51, 95, 112, 119, 142, 145, 148, 153, 180–185, 192, 201, 206, 210, 221, 226, 234, 236, 242, 260, 271, 281, 295, 316, 331, 333, 335, 337–338, 345, 347, 349, 353, 355, 364, 368, 371, 376–378, 390, 402, 422, 440, 453, 455, 462, 473, 484, 486, 509–510, 541–542, 602–603, 649, 655, 701, 706, 746 Westpommern 25–26, 30, 167–169, 727, 738 Wetterauer Grafen 34, 57 Wetterauer Spiritualistengruppen 364–366 Wettin (Haus) 470, 695 Wiblinger Benediktinerkloster 243 Wied-Runkel, Graf von 440 Wieland, Christoph Martin 381, 476, 502, 553, 565, 618–620, 688 Wien 17–18, 20, 38–39, 43–46, 49–50, 54– 55, 59–60, 65, 69, 75–76, 80–84, 88–98, 101–115, 132, 135–142, 145, 148, 151– 161, 164–172, 177, 179–180, 184–198, 206–210, 214, 225, 237, 240, 242–244, 248–255, 261–267, 284, 301, 304–305, 308, 315, 320, 324–325, 336, 348–350, 355, 393, 406, 408, 412, 416, 423, 429, 432, 436–438, 444, 447, 456–457, 459, 461, 465–466, 471–473, 480–483, 488–489, 494–502, 525, 556, 585, 596, 601, 603, 607–612, 620, 640, 643–644, 651–653, 657, 660, 663–666, 677, 692–693, 698, 704, 710–711, 718–719, 723, 725–728, 737–738 Wien, Friede von (1731) 194 Wien, Vertrag von (1719) 169 Wien, Vorfriede von (1735) 196, 405, 453 Wiener Abkommen (1815) 640 Wiener Konkordat (1448) 349
Wilhelm III. von Oranien (1650–1702) 49–50, 57, 60, 65, 69, 70, 134, 136, 240, 307–308 Wilhelm V., Statthalter der Niederlande (1751–1806) 464, 671 Wilhelm VI., Landgraf von Hessen-Kassel 283 Wilhelm VIII., Landgraf von HessenKassel 282 Wilhelm IX./I., Landgraf (1785–1803) und Kurfürst (1803–1821) von HessenKassel 613, 710 Wilhelm Egon von Fürstenberg, Bischof von Straßburg 50, 54, 65, 69, 87, 93 Wilhelm Heinrich, Herzog von SachsenEisenach 272 Wilhelm Hyacinth, Graf von NassauSiegen 152 Wilhelmine Amalie von BraunschweigLüneberg 94 Wimpfen 631 Winckelmann, Johann Joachim 610–611, 629 Winckler, Johannes 360 Winkler, Heinrich August 516 Wirtschaftspolitik 77, 105, 227–228, 234, 252–253, 321, 570, 579–588, 629 Wismar 25, 169, 176 Witt, Johan de 49 Witte, Samuel Simon 562 Wittelsbacher 48, 55, 65, 86, 94, 105, 133, 140–141, 143–144, 149–150, 153, 162, 173, 191, 194, 261, 340, 346, 348, 401, 406, 411, 421–424, 427–428, 431, 435–436, 439, 444, 447, 470, 580, 695, 721 Wittenberger Disputationsregeln (1580) 385 Wittenberger Universität 204, 295, 354 Wolf, Friedrich August 608, 612 Wolfenbüttel, Truppenunterbringung 52 Wolff, Christian 211–213, 231–233, 280, 381, 388–389, 391–393, 508, 531–532, 549, 552, 560, 601–602 Wöllner, Johann Christoph von 537–538 Wörlitz, Park 617 Wurmbrand, Johann Wilhelm von 436
Register
Württemberg 32, 34, 48, 95, 174, 179, 208, 220, 237–238, 277, 284, 286, 292–293, 303–304, 307–308, 317, 325, 336, 359, 364–365, 421, 429, 440, 442, 446–447, 472, 475–476, 480, 523, 538, 576–577, 579, 584, 597, 600, 612–613, 632, 634, 639–640, 642, 650, 659, 663, 665–666, 677, 708, 711–714, 716, 718–721, 724, 728, 731–732 Würzburg, Bischofswahl 172–173 Würzburger Universität 549, 601–602
Ysenburg-Büdingen, Grafen von 241–242
Zachariae, Karl Salomo 707 Zedler, Johann Heinrich 381 zehn dunkle Jahre, Ungarn (1671–1681) 45
Zeiller, Franz von 645 Zeitungen 384, 504–505, 534–535 Zensur 301, 476, 538, 560, 566, 604, 671, 684, 696 Zimmermann, Johann Georg 417 Zinnaer Währungspakt (1667) 79 Zölle 35, 316–318 Zöllner, Johann Friedrich 533 Zsitvatorok, Friede von (1606) 43 Zucalli, Enrico 261 Zuchthäuser 302 Zürich 183, 303, 385, 387, 531, 571, 575, 665 Zweibrücken 283, 453, 460–461, 463, 487, 493, 672, 676, 721, Zweiter Nordischer Krieg (1655–1660) 26–29 zweiter Teilungsvertrag (1699) 135, 136 Zwinger, Dresden 262
835
Die wichtigsten Territorien des Heiligen Römischen Reiches um 1648
DÄNEMARK
Nordsee
REPUBLIK DER VEREINIGTEN NIEDERLANDE
FRANKREICH
SCHWEIZER EIDGENOSSENSCHAFT
Kirchliche Territorien Dänemark–Schleswig-Holstein Schwedische Eroberungen Reichsgrenze 0
50
100
150 km
OSMANISCHES REICH
SAVOYEN I TA L I E N I S C H E S TA AT E N
PREUSSEN
Ostsee
N
S
POLEN
BÖHMEN
OSMANISCHES REICH
Territorien der Hohenzollern Brandenburg Franken
Territorien der Wettiner Albertinisches Sachsen Ernestisches Sachsen ÖSTERREICH
Territorien der Wittelsbacher Bayern Pfalz
REPUBLIK VENEDIG
Habsburger Territorien österreichisch
Adria
spanisch
Die Kreise des Heiligen Römischen Reiches um 1700
DÄNEMARK
Nordsee
FRANKREICH
SCHWEIZER EIDGENOSSENSCHAFT
SAVOYEN 0
50
100
150 km
OSMANISCHES REICH
PREUSSEN
Ostsee
N
S
POLEN
BÖHMEN (kein Kreis)
Kreise Kurrheinischer Kreis Oberrheinischer Kreis Burgundischer Kreis Österreichischer Kreis Westfälischer Kreis UNGARN
Obersächsischer Kreis Niedersächsischer Kreis Fränkischer Kreis Schwäbischer Kreis
REPUBLIK VENEDIG
Adria
Bayrischer Kreis (in schraffierten Regionen gab es eine größere Anzahl von Reichsrittern)
Reichsgrenze
![Das Heilige Römische Reich deutscher Nation und seine Territorien: 1493-1648 [2 ed.]
3534270622, 9783534270620](https://ebin.pub/img/200x200/das-heilige-rmische-reich-deutscher-nation-und-seine-territorien-1493-1648-2nbsped-3534270622-9783534270620.jpg)



![Das Doberaner Seebad Der Heilige Damm, seine Curmittel [Kurmittel] und ihre Heilmittel](https://ebin.pub/img/200x200/das-doberaner-seebad-der-heilige-damm-seine-curmittel-kurmittel-und-ihre-heilmittel.jpg)